Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen: Eine Untersuchung der staatlichen Qualität unternehmerischer Entscheidungen [1 ed.] 9783428522149, 9783428122141
Die Beteiligung staatlicher Rechtssubjekte an privatrechtlich organisierten Gesellschaften mit privatem Anteilsbesitz is
124 100 1MB
German Pages 289 Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1045
Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen Eine Untersuchung der staatlichen Qualität unternehmerischer Entscheidungen
Von Ariane Berger
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
ARIANE BERGER
Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen
Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1045
Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen Eine Untersuchung der staatlichen Qualität unternehmerischer Entscheidungen
Von Ariane Berger
asdfghjk Duncker & Humblot · Berlin
Der Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin hat diese Arbeit im Jahre 2005 als Dissertation angenommen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten # 2006 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Fremddatenübernahme: Klaus-Dieter Voigt, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISSN 0582-0200 ISBN 3-428-12214-3 978-3-428-12214-1 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier ∞ entsprechend ISO 9706 *
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Vorwort Im Wintersemester 2005/2006 wurde die vorliegende Arbeit vom Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen. Das Manuskript wurde im August 2005 abgeschlossen. Rechtsänderungen sowie Abhandlungen und Entscheidungen konnten bis zum Frühjahr 2006 berücksichtigt werden. Meinem verehrten Lehrer Herrn Professor Dr. Walter Krebs danke ich für vielfältige Förderung und Unterstützung. Danken möchte ich weiterhin Herrn Professor Dr. Martin Schwab für die zügige Erstattung des Zweitgutachtens. Frau Professor Dr. Barbara Remmert und meinen Kollegen am Lehrstuhl bin ich für viele anregende Gespräche verbunden. Für ihre liebevolle Unterstützung möchte ich an dieser Stelle auch meiner Familie danken. Die Hanns-Seidel-Stiftung hat diese Arbeit mit einem Stipendium aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. Berlin, im Mai 2006
Ariane Berger
Inhaltsübersicht Einleitung und Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Erster Teil Gemischtwirtschaftliche Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
28
Erster Abschnitt: Staat als Entscheidungseinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Zweiter A. B. C.
Abschnitt: Entscheidungsherrschaft als Kriterium der Staatseigenschaft . . Beherrschungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steuerungsinstrumente des Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenzen des Kriteriums der staatlichen Entscheidungsherrschaft . . . . . . . .
31 31 36 63
Dritter Abschnitt: Rechtsform als Kriterium der Staatseigenschaft . . . . . . . . . . . . . . A. Organisationsrecht als Steuerungsinstrument und Entscheidungsprämisse B. Grenzen des Rechtsformkriteriums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 68 73
Vierter Abschnitt: Ingerenzpflicht des staatlichen Beteiligten . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Fünfter A. B. C.
Abschnitt: Öffentliche Aufgabe als Kriterium der Staatseigenschaft . . . . . . Öffentliche Aufgabe als staatlicher Entscheidungsbereich und -maßstab Fehlende Spezifizierbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verfassungs- und einfachrechtliche Konkretisierung öffentlicher Aufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81 82 85
Ergebnis zum Ersten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
92
Zweiter Teil Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte Erster Abschnitt: Staat als rechtliche Entscheidungseinheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96 96
Zweiter Abschnitt: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien der Staatseigenschaft . . 98 A. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtskomplexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 B. Relativität der Staatseigenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Dritter Abschnitt: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 A. Vertragliche Zuweisungen von Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 B. Auslegung der vertraglichen Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
8
Inhaltsübersicht C. Möglichkeit gesellschaftsrechtswidriger Auslegungsergebnisse . . . . . . . . . . 127
Vierter Abschnitt: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Typische gesellschaftsvertragliche Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128 130 133 141 166 167
Fünfter Abschnitt: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen über den Vertragsgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Typische vertragliche Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168 168 172 185 197 198
Sechster Abschnitt: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen . . . . . . . . . . A. Rechtssatzkonforme Auslegung von Verträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198 199 201 213
Ergebnis zum Zweiten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Dritter Teil Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
216
Erster Abschnitt: Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Abfallentsorgungsgesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216 218 232 233
Zweiter Abschnitt: Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Straßenreinigungsgesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG . . . B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233 234 243 245
Ergebnis zum Dritten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Vierter Teil Zusammenfassung
247
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Inhaltsverzeichnis Einleitung und Gang der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Erster Teil Gemischtwirtschaftliche Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
28
Erster Abschnitt Staat als Entscheidungseinheit
28
Zweiter Abschnitt Entscheidungsherrschaft als Kriterium der Staatseigenschaft
31
A. Beherrschungsansatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
B. Steuerungsinstrumente des Staates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Gesellschaftsrechtliche Steuerungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kapitalanteil als zentrales Steuerungsinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Unternehmensgegenstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Aktienkonzernrechtliche Steuerungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Sonstige Steuerungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kontrolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rechtliche Rahmenordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Einzelvertraglich vereinbarte Steuerungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . 4. Faktische Steuerungsinstrumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 37 37 45 51 51 53 53 57 58 59
C. Grenzen des Kriteriums der staatlichen Entscheidungsherrschaft . . . . . . . . . . . . I. Komplexität unternehmerischer Entscheidungsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . II. Vernachlässigung des privaten Entscheidungsanteils . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 63 66
Dritter Abschnitt Rechtsform als Kriterium der Staatseigenschaft A. Organisationsrecht als Steuerungsinstrument und Entscheidungsprämisse . . . . I. Dualismus der Rechtsformen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 68 69
10
Inhaltsverzeichnis II.
Privatautonomie als Freiheit Privater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
B. Grenzen des Rechtsformkriteriums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Indizielle Wirkung der Rechtsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Verwaltung in Privatrechtsform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 73 76
Vierter Abschnitt Ingerenzpflicht des staatlichen Beteiligten
77
Fünfter Abschnitt Öffentliche Aufgabe als Kriterium der Staatseigenschaft
81
A. Öffentliche Aufgabe als staatlicher Entscheidungsbereich und -maßstab . . . . .
82
B. Fehlende Spezifizierbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Positive Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Negative Begriffsbestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 85 87 91
C. Verfassungs- und einfachrechtliche Konkretisierung öffentlicher Aufgaben . . .
92
Ergebnis zum Ersten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
Zweiter Teil Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
96
Erster Abschnitt Staat als rechtliche Entscheidungseinheit
96
Zweiter Abschnitt Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien der Staatseigenschaft A. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtskomplexe . . . I. Eigenzuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Transitorische Wahrnehmungszuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Organwalter . . . . . . . . . . . . . . 1. Dienstrechtliche Zurechnung menschlichen Verhaltens . . . . . . . . . . . . 2. Organschaftliche und dienstrechtliche Zurechnung . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98 98 99 100 103 103 105 109
B. Relativität der Staatseigenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Inhaltsverzeichnis
11
Dritter Abschnitt Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten A. Vertragliche Zuweisungen von Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Staatliche Erklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rechtsfolge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115 117 118 120 122
B. Auslegung der vertraglichen Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 I. Keine Anwendbarkeit der §§ 133, 157 BGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 II. Objektive Auslegung von Rechtssätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 C. Möglichkeit gesellschaftsrechtswidriger Auslegungsergebnisse . . . . . . . . . . . . . . 127
Vierter Abschnitt Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand
128
A. Typische gesellschaftsvertragliche Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 B. Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Verpflichtung der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Verpflichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Verpflichtung der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) (Teil-)Identität der Entscheidungsbereiche von Verwaltungsträger und Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Ausrichtung des Unternehmensgegenstandes am Gemeinwohl . . . II. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Bedeutung von Rechtsbindungsanordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Bedeutung der staatlichen Anteilsmehrheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Wortlaut, Systematik und Telos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Bedeutung der staatlichen Anteilsmehrheit in anderen Rechtsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Kommunalrechtliche und haushaltsrechtliche Vorschriften . . . . . . b) Vergaberechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Vorschriften der Transparenzrichtlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Kommunalrechtliche Inkompatibilitätsregeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zustimmungs- und Weisungsrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133 133 133 133 135 137 137 139 140 141 141 144 145 147 147 151 153 156 160 160
12
Inhaltsverzeichnis IV. V.
Einrichtung von Koordinierungsgremien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
D. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 E. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Fünfter Abschnitt Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen über den Vertragsgegenstand
168
A. Typische vertragliche Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 B. Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Verpflichtung der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Verpflichtung der Gesellschaft als Organ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Erfüllungsgehilfen, Dritte und Stellvertreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Organschaftliche Zurechnung und andere Vertretungsformen . . . b) Verpflichtung zum Entscheiden in Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Verpflichtung der Gesellschaft als Zurechnungsendsubjekt . . . . . . . . . . . . IV. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172 173 173 174 177 179 182 183 184
C. Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Vergütungsanspruch der Gesellschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Bestimmungen über die Zurechnung von Haftungsfolgen . . . . . . . . . . . . . III. Widmung der Infrastruktur als öffentliche Einrichtung . . . . . . . . . . . . . . . IV. Bestimmungen über die Erhebung von Gebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Rechtsbindungsanordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Informations-, Kontroll- und Weisungsrechte zugunsten des Verwaltungsträgers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Recht zur Ersatzvornahme zugunsten des Verwaltungsträgers . . . . . . . . . VIII. Gestaltung der Vertragsbeendigung und ihrer Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Kooperationsverträge und Einrichtung eines Beirates . . . . . . . . . . . . . . . .
185 185 186 188 190 191 192 193 194 195
D. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 E. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Sechster Abschnitt Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
198
A. Rechtssatzkonforme Auslegung von Verträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 B. Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Inhaltsverzeichnis I.
13
Verpflichtung zur Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten . . . . . . 202 1. Verpflichtung zum Entscheiden in Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 2. Inhalt und Umfang der Verpflichtung zum Entscheiden in Person . . 202 a) Entscheidungszuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 b) Sachmaterienbezogene Zuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 aa) Erledigung einer Sachaufgabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 bb) Verantwortungsstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 (a) Erfüllungsverantwortung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
II.
(b) Sicherstellungs- und Gewährleistungsverantwortung . . . . 208 3. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Verpflichtung zur Zuweisung von Eigenzuständigkeiten . . . . . . . . . . . . . . 212
C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Ergebnis zum Zweiten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Dritter Teil Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
216
Erster Abschnitt Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Abfallentsorgungsgesellschaften
216
A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG . . . . . 218 I. Wortlaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 II. III.
Genetische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 1. §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG . . . 221 2. § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 a) „Dritter“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 b) „Mit der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen“ . . . . . . . . . . . . . . . 224
IV.
Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 1. Zuweisung eindeutiger Verantwortlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 2. Zweck optimaler Aufgabenerledigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 3. Abschließende gesetzliche Regelung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
V.
Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
14
Inhaltsverzeichnis Zweiter Abschnitt Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Straßenreinigungsgesellschaften
A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG . . . . . . . I. Wortlaut und Genese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Systematische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Teleologische Auslegung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Optimale Aufgabenerledigung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Grenzen der Nachvollziehbarkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233 234 234 235 236 236 237 243
B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 C. Ergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Ergebnis zum Dritten Teil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Vierter Teil Zusammenfassung
247
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256
Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
286
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen AbfSa Potsdam
AbfSa Rostock
BayAbfG
BayGKZ
BayGO
BayHO BayKreisO BayKWG
BayRDG
BayVerf BbgAbfG BbgGKG BbgGO
Satzung über die Abfallentsorgung der Landeshauptstadt Potsdam (Abfallentsorgungssatzung) v. 10.03.2004, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 8/2004, S. 3, zuletzt geändert durch Satzung v. 14.12.2005, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16/2005, S. 26. Satzung über die Abfallwirtschaft in der Hansestadt Rostock (Abfallsatzung) v. 17.12.2005, öffentlich bekanntgemacht unter http:// www.rostock.de/Internet/stadtverwaltung/download/abfallwirt.pdf, abgefragt am 08.05.2006. Gesetz zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in Bayern v. 09.08.1996, GVBl. S. 396, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.04.2006, GVBl. S. 178. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit für den Freistaat Bayern v. 20.06.1994, GVBl. S. 555, zuletzt geändert durch Gesetz v. 26.07.2004, GVBl. S. 272. Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern v. 22.08.1998, GVBl. S. 796, zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.12.2005, GVBl. S. 665. Haushaltsordnung des Freistaates Bayern, BayRS 630-1-F, zuletzt geändert am 24.03.2004, GVBl. S. 84. Landkreisordnung für den Freistaat Bayern v. 22.08.1998, GVBl. S. 826, zuletzt geändert am 24.12.2005, GVBl. S. 665. Gesetz über die Wahl der Gemeinderäte, der Bürgermeister, der Kreistage und der Landräte v. 05.04.2000, GVBl. S. 198, zuletzt geändert durch Gesetz v. 09.07.2003, GVBl S. 419. Bayerisches Gesetz zur Regelung von Notfallrettung, Krankentransport und Rettungsdienst (Bayerisches Rettungsdienstgesetz) v. 08.01.1998, GVBl. S. 9, zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.03.2004, GVBl. S. 84. Verfassung des Freistaates Bayern v. 15.12.1998, GVBl. S. 991, zuletzt geändert am 10.11.2003, GVBl. S. 817. Brandenburgisches Abfallgesetz v. 06.07.1997, GVBl. I S. 40, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.06.2005, GVBl. I S. 215. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit v. 28.05.1999, GVBl. I S. 194. Gemeindeordnung für das Land Brandenburg v. 10.10.2001, GVBl. I S. 154, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.06.2005, GVBl. I S. 210.
16 BbgHO
BbgKAG
BbgKreisO
BbgKWG
BbgStrG BbgVerf
BbgWassG BerlRDG
BerlWG
BHO BLG BWAbfG
BWGKZ BWGO BWHO
BWKWG
BWVerf DGO EG
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung v. 21.04.1999, GVBl. I S. 106, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.06.2005, GVBl. I S. 210, 211. Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg v. 31.03. 2004, GVBl. I S. 174, geändert durch Gesetz v. 26.04.2005, GVBl. I S. 170. Landkreisordnung für das Land Brandenburg v. 15.10.1993, GVBl. I S. 398, 433, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.06. 2005, GVBl. I S. 210. Gesetz über die Kommunalwahlen im Land Brandenburg v. 10.10.2001, GVBl. I S. 198, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.03.2004, GVBl. I S. 59, 66. Brandenburgisches Straßengesetz v. 31.03.2005, GVBl. I S. 218. Verfassung des Landes Brandenburg v. 20.08.1992, GVBl. I S. 298, zuletzt geändert durch Gesetz v. 16.06.2004, GVBl. I S. 254. Brandenburgisches Wassergesetz v. 08.12.2005, GVBl. I S. 50. Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin v. 08.07. 1993, GVBl. S. 313, zuletzt geändert durch Gesetz v. 24.06.2004, GVBl. S. 257. Gesetz über die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen v. 25.09.1987, GVBl. S. 2370, zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.10.2005, GVBl. S. 534. Bundeshaushaltsordnung v. 19.08.1969, BGBl. I S. 1284, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.09.2005, BGBl. I S. 2809. Bundesleistungsgesetz v. 19.10.1956, BGBl. I S. 815, zuletzt geändert durch Gesetz v. 12.08.2005, BGBl. I S. 2354. Gesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen in Baden-Württemberg v. 15.10.1996, GBl. S. 617, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.03.2005, GBl. S. 206. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit v. 16.09.1974, GBl. S. 408, zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.12.2004, GBl. S. 884. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg v. 24.07.2000, GBl. S. 582, zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.02.2006, GBl. S. 20. Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg v. 19.10.1971, GBl. S. 428, zuletzt geändert durch Gesetz v. 08.05.2003, GBl. S. 205. Kommunalwahlgesetz von Baden-Württemberg v. 01.09.1983, GBl. S. 429, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.07.2005, GBl. S. 578. Verfassung des Landes Baden-Württemberg v. 11.11.1953, GBl. S. 173, zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.05.2000, GBl. S. 449. Deutsche Gemeindeordnung vom 30.01.1935, RGBl. I S. 49. Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft v. 25.03. 1957, BGBl. II S. 766, in der Fassung des Vertrags von Amsterdam v. 02.10.1997, BGBl. 1998 II S. 386, ber. BGBl. 1999 II
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen
17
S. 416, zuletzt geändert durch EU-Beitrittsakte 2003 v. 16.04. 2003, ABl. Nr. L 236 S. 33. EnWG
Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung v. 07.07.2005, GVBl. I S. 1970, 3621.
ErbbauVO
Verordnung über das Erbbaurecht v. 15.01.1919, RGBl. S. 72, ber. S. 122, zuletzt geändert durch Gesetz v. 19.04.2006, BGBl. I S. 866.
GewO
Gewerbeordnung v. 22.02.1999, BGBl. I S. 202, zuletzt geändert durch Gesetz v. 06.09.2005, BGBl. I S. 2725.
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen v. 26.08.1998, BGBl. S. 2546, zuletzt geändert durch Gesetz v. 01.09.2005, BGBl. I S. 2676.
HeAbfG
Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz v. 20.07.2004, GVBl. I S. 252.
HeGKG
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit v. 16.12.1969, GVBl. I S. 307, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21.03.2005, GVBl. I S. 229.
HeGO
Hessische Gemeindeordnung v. 01.04.2005, GVBl. I S. 142, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21.03.2005, GVBl. I S. 229.
HeHO
Hessische Landeshaushaltsordnung v. 15.03.1999, GVBl. I S. 248, zuletzt geändert durch Gesetz v. 20.12.2004, GVBl. I S. 539, 543.
HeKWG
Hessisches Kommunalwahlgesetz v. 01.04.2005, GVBl. I S. 197.
HeVerf
Verfassung des Landes Hessen v. 01.12.1946, GVBl. I S. 229, zuletzt geändert durch Gesetz v. 18.10.2002, GVBl. I S. 628.
HGrG
Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (Haushaltsgrundsätzegesetz) v. 19.08.1969, BGBl. I S. 1273, zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.12.2003, BGBl. I S. 2848.
KrW-/AbfG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) v. 27.09.1994, BGBl. I S. 2705, zuletzt geändert durch Gesetz v. 01.09.2005, BGBl. I S. 2618.
MVAbfG
Abfallwirtschafts- und Altlastengesetz für Mecklenburg-Vorpommern v. 15.01.1997, GVBl. S. 43, zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.12.2003, GVBl. 2004 S. 2.
MVHO
Landeshaushaltsordnung Mecklenburg-Vorpommern v. 10.04.2000, GVBl. S. 159, zuletzt geändert durch Gesetz v. 19.12.2005, GVBl. S. 612.
MVKV
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern v. 08.06.2004, GVBl. S. 205, zuletzt geändert durch Gesetz v. 19.12.2005, GVBl. S. 640.
MVKWG
Kommunalwahlgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern v. 19.12.2005, GVBl. S. 640.
18 MVStrG
MVVerf
NdsAbfG NdsGKZ
NdsGO NdsHO
NdsKWG
NdsPressG NdsVerf NrWAbfG
NrWGKG
NrWGO
NrWHO
NrWKWG
NrWVerf
PBefG PostG
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern v. 13.01.1993, GVBl. S. 42, zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.03.2005, GVBl. S. 91. Verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern v. 23.05.1993, GVBl. S. 372, zuletzt geändert durch Gesetz v. 04.04.2000, GVBl. S. 158. Niedersächsisches Abfallgesetz v. 14.07.2003, GVBl. S. 273, zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.03.2006, GVBl. S. 175. Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit v. 19.02.2004, GVBl. S. 63, zuletzt geändert durch Gesetz v. 15.11.2005, GVBl. S. 342. Niedersächsische Gemeindeordnung v. 22.08.1996, GVBl. S. 382, zuletzt geändert durch Gesetz v. 15.11.2005, GVBl. S. 352. Niedersächsische Landeshaushaltsordnung v. 30.04.2001, GVBl. S. 276, zuletzt geändert durch Gesetz v. 17.12.2004, GVBl. S. 664. Niedersächsisches Gemeinde- und Kreiswahlgesetz v. 20.02.2001, GVBl. S. 83, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.11.2004, GVBl. S. 394. Niedersächsisches Pressegesetz v. 22.03.1965, GVBl. S. 9, zuletzt geändert durch Gesetz v. 20.11.2001, GVBl. S. 701. Niedersächsische Verfassung v. 19.05.1993, GVBl. S. 107, zuletzt geändert durch Gesetz v. 21.11.1997, GVBl. S. 480. Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen v. 21.06.1988, GV. NRW. S. 250, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.04.2005, GV. NRW. S. 306. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit v. 01.10.1979, GV. NRW. S. 621, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.04.2005, GV. NRW. S. 274. Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen v. 14.07. 1994, GV. NRW. S. 666, zuletzt geändert durch Gesetz v. 03.05. 2005, GV. NRW. S. 498. Landeshaushaltsordnung Nordrhein-Westfalen v. 26.04.1999, GV. NRW. S. 158, zuletzt geändert durch Gesetz v. 02.07.2002, GV. NRW. S. 284. Gesetz über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (Kommunalwahlgesetz) v. 30.06.1998, GV. NRW. S. 454, ber. S. 509, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.04.2005, GV. NRW. S. 332. Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen v. 28.06.1950, GV. NRW. S. 127, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.06.2004, GV. NRW. S. 360. Personenbeförderungsgesetz v. 08.08.1990, BGBl. I S. 1690, zuletzt geändert durch Gesetz v. 07.07.2005, BGBl. I S. 1954. Postgesetz v. 22.12.1997, BGBl. I S. 3294, zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.11.2003, BGBl. I S. 2304.
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen RegG
RPAbfG
RPGO RPHO
RPKWG
RPVerf RPZVG SAAbfG
SaarlAbfG SaarlGKG
SaarlHO
SaarlKSVG
SaarlKWG SaarlVerf SächsAbfG
SächsGKZ
SächsGO
19
Gesetz zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (Regionalisierungsgesetz) v. 27.12.1993, BGBl. I S. 2378, 2395, zuletzt geändert durch Gesetz v. 29.12.2003, BGBl. I S. 3076. Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz Rheinland-Pfalz v. 02.04.1998, GVBl. S. 97, zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.07. 2005, GVBl. S. 302. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz v. 31.01.1994, GVBl S. 153, zuletzt geändert durch Gesetz v. 02.03.2006, GVBl. S. 57. Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz v. 20.12.1971, GVBl. 1972 S. 2, zuletzt geändert durch Gesetz v. 06.02.2001, GVBl. S. 29. Landesgesetz über die Wahlen zu den kommunalen Vertretungsorganen v. 31.01.1994, GVBl. S. 137, zuletzt geändert durch Gesetz v. 02.03.2006, GVBl. S. 57. Verfassung für Rheinland-Pfalz v. 18.05.1947, GVBl. S. 209, zuletzt geändert durch Gesetz v. 16.12.2005, GVBl. 2006 S. 20. Zweckverbandsgesetz Rheinland-Pfalz v. 22.12.1982, GVBl. S. 476, zuletzt geändert durch Gesetz v. 02.03.2006, GVBl. S. 57. Abfallgesetz des Landes Sachsen-Anhalt v. 10.03.1998, GVBl. S. 112, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2004, GVBl. S. 852. Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz v. 26.11.1997, ABl. S. 1352, 1356, zuletzt geändert durch Gesetz v. 12.06.2002, ABl. S. 1414. Saarländisches Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit v. 27.06.1997, ABl. S. 723, zuletzt geändert durch Gesetz v. 08.10.2003, ABl. 2004 S. 594. Gesetz Nr. 938 betreffend die Haushaltsordnung des Saarlandes v. 03.11.1971, ABl. S. 733, in der Fassung der Bekanntmachung v. 05.11.1999, ABl. 2000 S. 194. Saarländisches Kommunalselbstverwaltungsgesetz v. 15.01.1964 in der Fassung der Bekanntmachung v. 27.06.1997, ABl. S. 682, zuletzt geändert durch Gesetz v. 13.12.2005, ABl. S. 2010. Kommunalwahlgesetz Saarland v. 13.12.1973, ABl. S. 841, zuletzt geändert durch Gesetz v. 31.03.2004, ABl. S. 1037. Verfassung des Saarlandes v. 15.12.1947, ABl. S. 1077, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.09.2001, ABl. S. 1630. Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz v. 31.05. 1999, GVBl. S. 261, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.05.2004, GVBl. S. 148. Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit für den Freistaat Sachsen v. 19.08.1993, GVBl. S. 815, ber. S. 1103, zuletzt geändert durch Gesetz v. 05.05.2004, GVBl. S. 148. Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen v. 18.03.2003, GVBl. S. 55, zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.05.2005, GVBl. S. 155.
20
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen
SächsHO
Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen v. 10.04.2001, GVBl. S. 153, geändert durch Gesetz v. 13.12.2002, GVBl. S. 333.
SächsKWG
Gesetz über die Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen v. 05.09. 2003, GVBl. S. 428, GVBl. 2004 S. 182, geändert durch Gesetz v. 28.05. 2004, GVBl. S. 196.
SächsÖPNVG
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Freistaat Sachsen v. 14.12.1995, GVBl. S. 412, 449, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.05.2004, GVBl. S. 196.
SächsVerf
Verfassung des Freistaates Sachsen v. 27.05.1992, GVBl. S. 243.
SAGKG
Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit für Sachsen-Anhalt v. 26.02.1998, GVBl. S. 81, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.03.2006, GVBl. S. 128.
SAGO
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt v. 05.10.1993, GVBl. S. 568, zuletzt geändert durch Gesetz v. 22.12.2004, GVBl. S. 852.
SAHO
Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt v. 30.04. 1991, GVBl. S. 35, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.04.2004, GVBl. S. 246.
SAKWG
Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt v. 27.02. 2004, GVBl. S. 92, geändert durch Gesetz v. 20.12.2005, GVBl. S. 807.
SAVerf
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt v. 16.07.1992, GVBl. S. 600, geändert durch Gesetz v. 27.01.2005, GVBl. S. 44.
SHAbfG
Abfallwirtschaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein v. 18.01. 1999, GVBl. S. 26, zuletzt geändert durch Gesetz v. 12.10.2005, GVBl. S. 487.
SHGKZ
Gesetz über kommunale Zusammenarbeit für Schleswig-Holstein v. 01.04.1996, GVBl. S. 382, zuletzt geändert durch Gesetz v. 01.02.2005, GVBl. S. 66.
SHGO
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein v. 28.02.2003, GVBl. S. 57, zuletzt geändert durch Gesetz v. 28.03.2006, GVBl. S. 28.
SHHO
Landeshaushaltsordnung für Schleswig-Holstein v. 29.06.1992, GVBl. S. 381, zuletzt geändert durch Gesetz v. 15.12.2005, GVBl. S. 568.
SHVerf
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein v. 13.06.1990, GVBl. S. 391, zuletzt geändert durch Gesetz v. 14.02.2004, GVBl. S. 54.
StrGebSa Potsdam Straßenreinigungsgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam v. 14.06.2004, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 14/ 2004, S. 3, zuletzt geändert durch Satzung v. 12.12.2005, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16/2005, S. 22. StrSa Potsdam
Straßenreinigungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam v. 15.12. 2004, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 24/2004, S. 12, zuletzt geändert durch Satzung v. 14.12.2005, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16/2005, S. 6.
Verzeichnis der verwendeten Gesetze und ihrer Abkürzungen ThürAbfG
ThürGKG ThürHO ThürKO
ThürKWG
ThürVerf TKG UWG VgV
WassSa Potsdam
WHG
21
Thüringer Gesetz über die Vermeidung, Verminderung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen v. 15.06.1999, GVBl. S. 385, zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.11.2004, GVBl. S. 853. Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit v. 10.10.2001, GVBl. S. 290. Thüringer Landeshaushaltsordnung v. 28.07.2000, GVBl. S. 282, geändert durch Gesetz v. 10.03.2005, GVBl. S. 58. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung v. 28.01.2003, GVBl. S. 41, zuletzt geändert durch Gesetz v. 23.12.2005, GVBl. S. 446. Thüringer Gesetz über die Wahlen in den Landkreisen und Gemeinden v. 16.08.1993, GVBl. S. 530, zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.11.2004, GVBl. S. 853. Verfassung des Freistaats Thüringen v. 25.10.1993, GVBl. S. 625, zuletzt geändert durch Gesetz v. 11.10.2004, GVBl. S. 745. Telekommunikationsgesetz v. 22.06.2004, BGBl. I S. 1190, geändert durch Gesetz v. 07.07.2005, BGBl. I S. 1970. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb v. 03.07.2004, BGBl. I S. 1414, geändert durch Gesetz v. 19.04.2006, BGBl. I S. 866. Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung) v. 09.01.2001, BGBl. I S. 110, neugefaßt durch Verordnung v. 11.02.2003, BGBl. I S. 169, zuletzt geändert durch Verordnung v. 01.09.2005, BGBl. I S. 2676. Satzung über die öffentliche Wasserversorgung der Landeshauptstadt Potsdam (Wasserversorgungs- und Gebührensatzung) v. 15.12.2005, Amtsblatt für die Landeshauptstadt Potsdam Nr. 16/ 2005, S. 28. Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) v. 19.08.2002, BGBl. I S. 3245, zuletzt geändert durch Gesetz v. 25.06.2005, BGBl. I S. 1746.
Einleitung und Gang der Untersuchung Gemischtwirtschaftliche Unternehmen1 sind Unternehmen in den Rechtsformen der Kapitalgesellschaften2, deren Kapitalanteile sowohl von staatlichen Einheiten3 als auch von Privaten4 gehalten werden.5 Der Begriff der Gemischtwirtschaftlichkeit kennzeichnet eine gemischt staatlich-private Kapitalverteilungsstruktur.
1 Einen Überblick über die historische Entwicklung staatlicher Wirtschaftsteilnahme geben z. B. Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 24 ff., 38 ff.; Poschmann, Grundrechtsschutz, S. 3 ff.; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 13 ff. Mann, Gesellschaft, S. 13, Fn. 38 verweist darauf, daß der Begriff „gemischtwirtschaftliches Unternehmen“ erstmals erwähnt wird von Friedrich Freund, Die „gemischte wirtschaftliche Unternehmung“, eine neue Gesellschaftsform, Deutsche Juristen-Zeitung, Nr. 18 v. 15.09.1911, Sp. 1113 ff. Abweichende Bezeichnungen treffen u. a. Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 39 u. Stober, NJW 1984, S. 339 (452) (jeweils „gemischt-private Unternehmen“). 2 Die allen landesrechtlichen Vorschriften bekannte Beteiligung Privater an (öffentlichrechtlich organisierten) Zweckverbänden (Art. 17 Abs. 2 S. 2 BayGKZ; § 2 Abs. 2 S. 2 BWGKZ; § 4 Abs. 2 S. 2 BbgGKG; § 3 Abs. 1 S. 2 HeGKG; § 150 Abs. 2 S. 3 MVKV; § 7 Abs. 3 NdsGKZ; § 4 Abs. 2 S. 2 NrWGKG; § 2 Abs. 2 RPZVG; § 2 Abs. 3 SaarlGKG; § 2 Abs. 2 S. 2 SAGKG; § 44 Abs. 2 S. 2 SächsGKZ; § 2 Abs. 2 S. 2 SHGKZ; § 4 Abs. 1 S. 2 ThürGKG) soll hier trotz ihrer gemischt staatlich-privaten Mitgliederstruktur außer Betracht bleiben. Vgl. dazu Hellermann, in: Hoppe/ Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 7, Rn. 142 ff., 167; Brüning, Erledigung, S. 74 ff.; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 62, 168. Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (140 f.) weist darauf hin, daß Private die Mitgliedschaft in einem Zweckverband in aller Regel nicht erwerben wollen, weil der Zweckverband vergleichbar einem kommunalen Regiebetrieb organisiert und deshalb auch vergleichbar unselbständig und unflexibel sei. Ebenso Hellermann, a. a. O., Rn. 167; Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 (275 f.). 3 Der Begriff der „Einheit“ wird in dieser Untersuchung als Oberbegriff für apersonale (Begriff nach Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 23) organisatorische Gefüge des öffentlichen Rechts und des Privatrechts verwendet. 4 Private werden in dieser Untersuchung verstanden als nichtstaatliche Juristische Personen des Privatrechts und natürliche Personen [vgl. ebenso Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (144)]. 5 Z. B. Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (215); Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 26; Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (1); Spannowsky, ZHR 169 (1996), S. 560 (562); Weiß, Privatisierung, S. 279. Einen Überblick über Begriffsvarianten geben z. B. R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (218 ff.); Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 38 ff.; Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 77 ff.
24
Einleitung und Gang der Untersuchung
Als Unternehmen nehmen sie fortgesetzt und planmäßig am Wirtschaftsverkehr teil.6 In verschiedenen Tätigkeitsbereichen bieten sie insbesondere Dienstleistungen gegenüber privaten und staatlichen Rechtssubjekten an und kooperieren7 mit diesen. Diese Teilnahme am Wirtschaftsprozeß bedingt notwendig das Eingehen vielfältiger rechtlicher Bindungen. Die Zuordnungssubjekte dieser rechtlichen Bindungen, die sogenannten Rechts- bzw. Unternehmensträger8, sind Kapitalgesellschaften, d. h. Juristische Personen des Privatrechts. Sie sollen hier gemischtwirtschaftliche Gesellschaften genannt werden. Diese gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften stehen in verschiedenen Rechtsbeziehungen zu staatlichen und privaten Rechtssubjekten. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Rechtsbindungen sie im Rahmen ihrer Unternehmenstätigkeit zu beachten haben, welche Rechtssätze also auf gemischtwirtschaftliche Gesellschaften anwendbar sind. Über die rechtlichen Vorgaben und Grenzen wirtschaftlicher Tätigkeit Staates besteht keine Einigkeit.9 Die vorliegende Arbeit untersucht, ob und ter welchen Voraussetzungen gemischtwirtschaftliche Gesellschaften an staatliche Einheiten als Adressaten voraussetzenden Rechtssätze, die hier so nannten Sonderbindungen des Staates10, gebunden sind.
des undie ge-
Wenn Sonderbindungen des Staates diejenigen Rechtssätze sind, die nur auf staatliche Einheiten anwendbar sind, dann bilden diese Sonderbindungen die Trennlinie zwischen Staat und Gesellschaft ab.11 Um zu verhindern, daß diese Trennlinie von der einen oder anderen Seite überschritten wird, muß bestimmt 6
Ronellenfitsch, in: HdBStR III, § 84, Rn. 1. Der Begriff der Kooperation meint hier jede Art von Zusammenarbeit von Staat und Privaten bei der Wahrnehmung von Aufgaben. Weitere Nachweise zum Begriff des „kooperativen Staates“ z. B. bei Schuppert, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel, S. 19 (36 ff.) m. Fn. 70; Weiß, Privatisierung, S. 135 f.; Gurlit, Verwaltungsvertrag, S. 1, Fn. 1. 8 Zum Begriff des Rechtsträgers als Zuordnungssubjekt von Rechten und Pflichten vgl. noch ausführlich unten Zweiter Teil, S. 98 ff. Zum Begriff des Unternehmensträgers vgl. nur K. Schmidt, Handelsrecht, § 5, S. 88 ff. 9 So z. B. Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 19, der z. B. die Anwendbarkeit wettbewerbsrechtlicher Vorschriften auf Unternehmen mit staatlicher Beteiligung untersucht. Vgl. ebenso Storr, Staat, S. 489 ff. In jüngerer Zeit wird auch die Bindung dieser Unternehmen an die Grundfreiheiten des EG-Vertrages diskutiert, vgl. nur Weiß, DVBl. 2003, S. 564 (567 ff.); Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 37 ff., 49, 50 ff. 10 In Anlehnung an die „Sonderrechts- bzw. Subjektstheorie“, wonach das öffentliche Recht das Sonderrecht des Staates sei. Vgl. dazu Hans J. Wolff, AöR 76 (1950/ 51), S. 205 ff.; ders., VerwR I8, § 22 II c, S. 99 f.; Menger, in: FS Hans J. Wolff, S. 149 (160 ff.); Pestalozza, Formenmißbrauch des Staates, S. 166 ff.; ders., DÖV 1974, S. 188 (189). Von „staatlichen Sonderbindungen“ spricht Gogos, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 7 ff., insbes. S. 130 ff. und versteht darunter am Beispiel der Grundrechte Rechtssätze, welche „ausschließlich an den Staat gerichtet“ seien (a. a. O., S. 130). 7
Einleitung und Gang der Untersuchung
25
werden können, auf welche Rechtssubjekte diese Sonderbindungen anwendbar sind.12 Die Sonderbindungen des Staates zwingen damit zu einer Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft im Einzelfall.13 Auch Abgrenzungsprobleme bei gemischt staatlich-privaten Organisationen dürfen nicht zu einem Außerachtlassen des rechtlichen Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft führen.14 Die Sonderbindungen des Staates sind neben einfachrechtlichen Vorschriften auch im Grundgesetz normiert. Neben verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsregelungen für Bund und Länder – z. B. Art. 30, 70 GG – sind z. B. Art. 1 Abs. 315, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG ausschließlich an staatliche Einheiten, die „Gesetzgebung, Rechtsprechung und vollziehende Gewalt“, adressiert. 11 Dies gilt auch dann, wenn man sich der Meinung anschließt, daß sich „Staat“ und „Gesellschaft“ real, d. h. als soziale Verbände, nicht von einander trennen lassen und der Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft in den veränderten sozialen Strukturen der Gegenwart nicht mehr zeitgemäß ist [vgl. zu dieser Frage Böckenförde, in: FG Hefermehl, S. 11 ff. und Isensee, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, S. 317 ff.]. Es handelt sich demnach „praktisch gesehen um denselben Verband“ [Ehmke, in: FG Smend, S. 23 (25)]. Vgl. zur Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft auch Bettermann, DVBl. 1977, S. 180 ff.; Böckenförde, Unterscheidung, S. 1 ff.; K. Hesse, DÖV 1975, S. 437 ff.; Koslowski, Gesellschaft und Staat, S. 1 ff.; H. H. Rupp, in: HdBStR I, § 28, Rn. 44 ff.; W. Schmidt, AöR 101 (1976), S. 24 ff. 12 Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (561). 13 Dürig, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. III, Rn. 45; Groß, Kollegialprinzip, S. 26; Hermes, Infrastrukturverantwortung, S. 147 ff.; Krebs, Die Verwaltung 29 (1996), S. 309 (317); ders., in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 339 (348); Möllers, Staat als Argument, S. 333 f.; ders., VerwArch 90 (1999), S. 187 (197); v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 147; Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (394); Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (88). Dementsprechend werden Ansichten, die von einer gestuften Grundrechtsschutzintensität je nach Umfang des staatlichen Anteilsbesitz ausgehen (vgl. nur Bull, Staatsaufgaben, S. 98; Bethge, Grundrechtskollisionen, S. 66, Fn. 142; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 91 ff.) und gemischtwirtschaftliche Gesellschaften auf einer „Skala“ oder „Abhängigkeitsstufe“ [F. Wagener, in: ders. (Hrsg.), Verselbständigung, S. 31 ff.] zwischen staatlich und privat verorten wollen (vgl. dazu kritisch Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 165 ff. m. w. N.), dem verfassungs- und einfachrechtlichen Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft nicht gerecht. 14 Dürig, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. III, Rn. 45 hält Unternehmen ab mindestens 50 Prozent staatlichen Anteilsbesitzes für grundrechtsgebunden, räumt aber schwierige Abgrenzungsfragen bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen ein. „. . . dieses Abgrenzungsproblem (dürfe man) nicht zum Anlaß (nehmen), die Unterscheidung insgesamt über Bord zu werfen . . .“. Vgl. auch Krebs, Die Verwaltung 29 (1996), S. 309 (317); Gogos, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 20; Groß, Kollegialprinzip, S. 26; Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 76 ff.; Isensee, in: HdBStR V, § 118, Rn. 26. 15 Für den Bereich der gemischtwirtschaftlichen Unternehmen wird insbesondere die Grundrechtsverpflichtung und bzw. oder -berechtigung derselben diskutiert. Über diese Frage konnte bislang keine Einigkeit erzielt werden [ebenso z. B. Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (568)]. Vgl. die zahlreichen Stellungnahmen zur Grundrechts-
26
Einleitung und Gang der Untersuchung
Die Untersuchung der Anwendbarkeit dieser Sonderbindungen setzt die Qualifizierung des jeweiligen staatlichen Adressaten voraus. Über die Kriterien zur Qualifizierung eines solchen staatlichen Verpflichtungssubjektes herrscht in Literatur und Rechtsprechung keine Einigkeit. Dies begründet sich jedenfalls auch damit, daß die Qualifizierung des staatlichen Verpflichtungsadressaten und seine Unterscheidung von privaten Rechtssubjekten nicht ohne Rekurs auf theoretische Vorstellungen vom Wesen staatlicher Organisation gelingen kann.16 Möglicherweise lassen sich jedoch einige Aussagen bereits aus dem Wortlaut der verfassungsrechtlichen Sonderbindungen des Staates ableiten. Dies soll zunächst im folgenden Abschnitt versucht werden. Im Anschluß daran sind verschiedene, auf diesen allgemeinen Überlegungen aufbauende Ansätze, der hier sogenannte Beherrschungs-, Rechtsform- und Aufgabenansatz, vorzustellen, welche die Qualifizierung eines staatlichen Verpflichtungsadressaten nach unterschiedlichen Kriterien vornehmen. Ob und inwieweit diesen Ansätzen eine zwingende Zuordnung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften zum Adressatenkreis von z. B. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG im Einzelfall gelingt, ist zu prüfen. Im Zweiten Teil soll ein alternatives Modell entwickelt werden, der hier sogenannte normative Ansatz. Dieser Ansatz wird im Dritten Teil anhand von Beispielen gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften praktisch erprobt. Seine Anwendung wird sich dabei auf einige ausgewählte Fallbeispiele beschränken. So treten in der Praxis gegenwärtig gerade im Bereich des Entsorgungsrechts neue gemischt privat-staatliche Organisationsformen in Erscheinung.17 Insbesondere verpflichtung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen, z. B. BVerfG, NJW 1990, S. 1783; BerlVerfGH, DÖV 2005, S. 515 ff.; Badura, DÖV 1990, S. 353 (353 f.); ders., Staatsrecht, S. 87; ders., in: FS Schlochauer, S. 3 (11, 20 ff.); Bethge, Grundrechtsberechtigung juristischer Personen, S. 100 ff.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 85; ders., JZ 1987, S. 218 ff.; ders., JZ 1990, S. 1089 ff.; ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV, Rn. 85; ders., Recht der öffentlichen Unternehmen, E 108 f., 149; Erichsen, Gemeinde und Private, S. 27 f.; Hermes, Infrastrukturverantwortung, S. 380 f., 481; Klein, Teilnahme des Staates, S. 90 ff.; Koch, Status, S. 94 ff., insbes. S. 190 ff.; Koppensteiner, NJW 1990, S. 3105 ff.; Kühne, Urteilsanmerkung, JZ 1990, S. 335 f.; Möllers, Staat als Argument, S. 305 ff.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 1 ff.; Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14, Rn. 213; Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 ff.; Poschmann, Grundrechtsschutz, S. 1 ff.; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 120 f.; Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 ff.; ders., in: FS Niederländer, S. 383 (392 ff.); R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 ff.; Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (568 ff.); Stern, Staatsrecht III/1, S. 1169 f.; Storr, Staat, S. 238 ff.; Weiß, Privatisierung, S. 279 ff.; Zimmermann, Schutzanspruch, S. 224 ff.; ders., JuS 1991, S. 294 (299 f.). Zur Bindung öffentlicher Unternehmen an die Grundfreiheiten vgl. z. B. Weiß, DVBl. 2003, S. 564 (567) m. w. N. 16 So auch Möllers, Staat als Argument, insbes. S. 230 ff., 297 ff. 17 Vgl. dazu nur Bauer, DÖV 1998, S. 89 ff.; Brüning, Erledigung, S. 256 ff.; ders., NWVBl. 1997, S. 286 ff.; Engel, Gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgung, S. 1 ff.; Klowait, Beteiligung Privater, S. 1 ff.; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 ff.; Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 ff.; Schoch, Privatisierung, S. 1 ff.;
Einleitung und Gang der Untersuchung
27
die Figur des „kommunalen Erfüllungsgehilfen“18 hat im Bereich des Entsorgungsrechts große Verbreitung gefunden. Hierauf soll im Rahmen der praktischen Erprobung des normativen Ansatzes ein besonderes Augenmerk gelegt werden. Neben dem Entsorgungsrecht sind einige weitere kommunale Tätigkeitsfelder vorzustellen, in denen die Einschaltung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen zunehmend an Bedeutung gewinnt.19
ders., DVBl. 1994, S. 1 ff.; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 ff. Ausführlich zur rechtlichen Einordnung von Abfallentsorgungsgesellschaften noch unten Dritter Teil, S. 216 ff. 18 Zum Begriff des kommunalen Erfüllungsgehilfen vgl. nur BGHZ 91, S. 84 (96); BGH, NVwZ-RR 1989, S. 388 (389 f.); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (90); Brüning, Erledigung, S. 27 f.; Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 124; Koch, Status, S. 218 ff.; Remmert, Dienstleistungen, S. 259, Fn. 39; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (454). 19 Vgl. dazu nur Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (566).
Erster Teil
Gemischtwirtschaftliche Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten Erster Abschnitt
Staat als Entscheidungseinheit Es stellt sich zunächst die Frage, welche Aussagen der Verfassung selbst zur Eigenschaft ihrer staatlichen Verpflichtungssubjekte zu entnehmen sind. Die vorstehend bereits erwähnten verfassungsrechtlichen Sonderbindungen des Staates (z. B. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG) sind neben der „Gesetzgebung“ und „Rechtsprechung“ auch an die „vollziehende Gewalt“ adressiert. Geht man davon aus, daß das Grundgesetz einer Verselbständigung staatlicher Organisationseinheiten in privatrechtlicher Organisationsform nicht entgegen steht,1 dann sind gemischtwirtschaftliche Gesellschaften Adressaten z. B. der Grundrechte, wenn und soweit sie Teil der „vollziehenden Gewalt“ sind. Fraglich ist, was diesen Adressatenkreis „vollziehende Gewalt“ kennzeichnet. Sprachlich erschöpft sich der Wortlaut von z. B. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG in der Beschreibung von Funktionsbereichen im Sinne von Handlungs- und Aufgabenbereichen.2 Zugleich statuieren diese Sonderbindungen des Staates verschiedene Verpflichtungen und Berechtigungen ihrer in diesem Sinn funktionsbezogen beschriebenen Adressaten. Geht man davon aus, daß Handlungs- und Aufgabenbereiche auch im Fall ihrer organisatorischen Verfasstheit3 selbst nicht Zuordnungssubjekte von Verpflichtungen und Berechtigungen sein können, letzteres vielmehr nur Rechtssubjekte sein können,4 dann müssen die Sonderbindungen des Staates notwen1 Vgl. nur Ehlers, Privatrechtsform, S. 113. Ausführlich zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit „öffentlicher Wirtschaftsteilnahme“ Mann, Gesellschaft, S. 16 ff. 2 Dürig, in: Maunz/ders., GG, Art. 1 III, Rn. 100 spricht von einer Aneinanderreihung von „Funktionen“ und „Tätigkeiten“. 3 Zum Begriff der Organisation vgl. nur Hans J. Wolff, VerwR II3, § 71 I, S. 2 f.; Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 2 m. w. N. in Fn. 1, 2. 4 Vgl. dazu nur Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 131 ff. Vgl. auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 8 II, S. 186 ff., insbes. S. 190, der darauf
1. Abschn.: Staat als Entscheidungseinheit
29
dig an Rechtssubjekte adressiert sein.5 Der Begriff der „vollziehenden Gewalt“ muß also neben Handlungs- und Funktionsbereichen auch Rechtssubjekte kennzeichnen. Der Begriff der vollziehenden Gewalt beschreibt deshalb sowohl einen organisatorischen Handlungsbereich als auch staatliche Rechtssubjekte. Staatliche Organisation läßt sich also sowohl real als Handlungsbereich als auch rechtlich als Rechtssubjekt beschreiben.6 Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist demnach Adressat von z. B. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG, wenn sie selbst Rechtssubjekt der vollziehenden Gewalt ist. Es stellt sich daher im weiteren die Frage, woran man erkennt, daß eine Juristische Person des Privatrechts Rechtssubjekt der vollziehenden Gewalt und deshalb Staat ist. Die Beantwortung dieser Frage setzt die nähere Qualifizierung staatlicher Rechtssubjekte voraus, wobei eine Auslegung der Verfassung über ihren Wortlaut hinaus hierbei an ihre Grenzen stößt. Die Funktionsbezogenheit der genannten verfassungsrechtlichen Bestimmungen legt es immerhin nahe, zur Qualifizierung staatlicher Rechtssubjekte an der Eigenart staatlicher Handlungs- und Aufgabenbereiche anzusetzen. Möglicherweise kennzeichnet also die Eigenart dieser Funktionsbereiche zugleich die Eigenschaft eines Rechtssubjektes, Zuordnungssubjekt der Sonderbindungen des Staates zu sein. Es ist also denkbar, daß die Kriterien zur Bestimmung staatlicher Funktionsbereiche zugleich die Kriterien zur Kennzeichnung staatlicher Rechtssubjekte bilden. Diese staatlichen Funktionsbereiche sollen deshalb im folgenden näher untersucht werden. Der Begriff der „vollziehenden Gewalt“ kennzeichnet ebenso wie die Begriffe der „Gesetzgebung“ und „Rechtsprechung“ einen bestimmten Bereich institutionell verfaßten staatlichen Handelns. Mit Wirkung für die staatlichen Organisationseinheiten handeln Menschen.7 Alles staatliche Handeln ist auf menschliches Verhalten rückführbar. Die Grundstruktur menschlichen Verhalhinweist, daß teilweise „die Organisation“ bzw. „der Verband“ selbst als Adressat von z. B. gesellschaftsrechtlichen Rechten und Pflichten angesehen wird. Vgl. zu letzterem und zur Gegenansicht, der „formale(n) Rechtstechnik“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 136), auch die Nachweise bei Hans J. Wolff, a. a. O., S. 131 ff. Vgl. auch die Nachweise bei Schnapp, Jura 1980, S. 68 (70) m. Fn. 22. 5 Zurückhaltender, aber i. E. ebenso, formuliert Schnapp, JuS 1989, S. 1 (2): „Schon rechtslogisch ist es schwer vorstellbar, wie Tätigkeiten (Funktionen) von Normimpulsen erreicht werden . . . sollen. Dazu bedarf es zumindest ausmachbarer Institutionen“. 6 Dies ist allgemein anerkannt. Vgl. nur G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, S. 50 ff.; Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 232; Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (292 ff.); H. H. Rupp, Grundfragen, S. 22 f.; Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (257); Möllers, Staat als Argument, S. 13 ff.; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I, Rn. 1; Fügemann, Zuständigkeit, S. 2. 7 Das Handeln der Menschen wird den Untereinheiten zugerechnet [vgl. nur Schnapp, Jura 1980, S. 68 (69)]. Diese Art der Zurechnung richtet sich nach den Re-
30
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
tens ist die Entscheidung.8 Infolgedessen bilden Entscheidungen auch die Grundstruktur staatlicher Tätigkeit.9 Staatliche Organisationseinheiten sind also Entscheidungseinheiten.10 Der Begriff der „vollziehenden Gewalt“ umschreibt damit staatliche Entscheidungseinheiten im Entscheidungsbereich „vollziehende Gewalt“.11 Diese staatlichen Entscheidungsbereiche gilt es im folgenden näher zu untersuchen, um weitere Kriterien für die Qualifizierung staatlicher Verpflichtungsadressaten zu finden. Hierfür ist zunächst am Begriff der Entscheidung anzusetzen. Der Begriff der Entscheidung kennzeichnet eine Wahl zwischen Handlungsalternativen.12 Sie ist „ein auf eine Alternativenwahl zulaufender Vorgang in der Zeit“.13 Eine Alternativenwahl besteht im Akzeptieren oder Verwerfen einer oder mehrerer Alternativen.14 Diese Entscheidung über eine oder zwischen mehreren Handlungsvarianten muß notwendig von einem Entscheidungsmaßstab begleitet sein. Eine Wahl kann rational nur getroffen werden, wenn Maßstäbe für die Wahl existieren.15 Staatliche Entscheidungen kennzeichnen sich deshalb gerade dadurch, daß sie an spezifisch staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausgerichtet sind. Eine staatliche Entscheidungseinheit kennzeichnet also die Gesamtheit all derjenigen Entscheidungen organisatorischer Untereinheiten, deren Alternativenwahl jeweils an spezifisch staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausgerichtet ist. Möglicherweise ist danach ein Rechtssubjekt der vollziehenden Gewalt gerade dadurch gekennzeichnet, daß es seine Entscheidungen an denjenigen Entgelungen des Dienstrechts. Vgl. dazu ausführlich Remmert, Dienstleistungen, S. 297 ff. und unten Zweiter Teil, S. 103 ff. 8 Krebs, Kontrolle, S. 28 m. Fn. 174 und w. N. 9 Hans J. Wolff, VerwR I8, § 2 II, S. 10; Krebs, Kontrolle, S. 27; Remmert, Dienstleistungen, S. 15 f. Zu Begriff und Bedeutung der Entscheidung seien hier aus der verwaltungswissenschaftlichen Literatur Lecheler, Verwaltungslehre, S. 285 ff.; Püttner, Verwaltungslehre, S. 327 ff.; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 740 ff.; ders., Staatswissenschaft, S. 370 ff.; Thieme, Entscheidungen, S. 1 ff. genannt. 10 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 71 II, S. 5: „Verwaltungsorganisationen . . . sind Organisationen zur Herstellung zweckbestimmter, verbindlicher Entscheidungen“. Von einer „Entscheidungseinheit“ gehen auch Böckenförde, Staat als sittlicher Staat, S. 13 f. u. Isensee, in: HdBStR I, § 13, Rn. 65 ff. aus. Vgl. auch Schmidt-Preuß, DÖV 2001, S. 45 (46). Von einer „Wirkeinheit“ sprechen z. B. Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (292 ff.) unter Bezugnahme auf Hermann Heller, Staatslehre, 1934 (3. Aufl. 1970), S. 89/90, 238 (a. a. O., S. 292, Fn. 81). Ebenso z. B. Möstl, Grundrechtsbindung, S. 106; Rittner, Juristische Person, S. 223 ff. 11 Der Begriff der vollziehenden Gewalt umschreibt zum einen den staatlichen Funktions- und Entscheidungsbereich „vollziehende Gewalt“, zum anderen notwendig einen Verpflichtungsadressaten (Dürig, in: Maunz/ders., GG, Art. 1 Abs. III, Rn. 100). 12 Krebs, Kontrolle, S. 32. 13 Krebs, Kontrolle, S. 32. 14 Vgl. Krebs, Kontrolle, S. 32, Fn. 199. 15 Krebs, Kontrolle, S. 32 ff.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
31
scheidungsmaßstäben ausrichtet, die für den Entscheidungsbereich der vollziehenden Gewalt Anwendung finden. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist demnach möglicherweise ein solches Rechtssubjekt, wenn sich die in ihrem Unternehmen getroffenen Entscheidungen tatsächlich an den Entscheidungsmaßstäben der vollziehenden Gewalt ausrichten. Es kommt deshalb darauf an, mit welchen Mitteln und unter welchen Voraussetzungen eine solche Ausrichtung unternehmerischer Entscheidungen an staatlichen Entscheidungsmaßstäben erreicht werden kann. Ebenso stellt sich die Frage, ob dieser Ansatz, der die Staatseigenschaft eines Rechtssubjektes von dem realen Kriterium der Ausrichtung der Entscheidungen an staatlichen Entscheidungsmaßstäben abhängig macht (reale Entscheidungseinheit), in jedem Fall zu zwingenden Zuordnungsergebnissen führt.
Zweiter Abschnitt
Entscheidungsherrschaft als Kriterium der Staatseigenschaft A. Beherrschungsansatz Die Entscheidungsmaßstäbe gemischtwirtschaftlicher Unternehmen sind möglicherweise dann an denen staatlicher Organisationseinheiten ausgerichtet, wenn eine zentrale staatliche Entscheidungsinstanz alle Entscheidungen „lenkt“.16 Verbreitet wird diese „organisierende, lenkende, aktualisierende Tätigkeit“17 auch so beschrieben, daß eine staatliche Einheit das jeweilige Unternehmen „steuert“18 bzw. „beherrscht“19, „eine Aufgabe tatsächlich an sich gezogen 16
Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293). Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293). 18 Zum „öffentlichen Unternehmen im Steuerungsstaat“ vgl. nur Storr, Staat, S. 60 ff. So auch Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 72 ff., insbes. S. 76 ff., der untersucht, wann eine „privatrechtliche Organisation . . . so stark mit dem Bereich staatlicher Verwaltung verknüpft ist, daß sie als Trabant oder Satellit des Systems der öffentlichen Verwaltung erscheint und damit neben Bundesoberbehörden, Körperschaften und Anstalten zu den verselbständigten Verwaltungseinheiten zu rechnen wäre“ (a. a. O., S. 76). Vgl. ebenso H. Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 296 ff.; Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften, S. 19 f. 19 Vgl. nur Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 I 3, Rn. 17: „Definitorisch handelt es sich demnach bei der privatrechtlich organisierten Verwaltung um von der öffentlichen Hand durch Innehabung, partielle Beteiligung oder externe Einflusssicherung beherrschte selbständige Rechtssubjekte, die unmittelbar oder mittelbar bestimmte öffentliche Verwaltungsaufgaben in privatrechtlichen Organisations- und Handlungsformen erledigen“. Vgl. ebenso H. Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 257; Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, insbes. S. 157 ff., insbes. S. 163 f.; 17
32
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
hat“20 oder einen „entscheidenden Einfluß“21 hat. Das Unternehmen werde in diesem Fall zum Zweck der staatlichen Aufgabenerfüllung „instrumentalisiert“.22 Es sei „Werkzeug“23 der jeweiligen steuernden staatlichen Einheit. Die Ipsen, VVDStRL 48 (1990), S. 177 (183); Janson, Rechtsformen, S. 24; Jarass, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 12, Rn. 2; Klein, Teilnahme des Staates, S. 90 ff., insbes. S. 93 f.; Koch, Status, S. 245 ff., insbes. S. 247 f.; Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14, Rn. 213; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 25 f.; Remmert, Dienstleistungen, S. 20, 190; Schallemacher, Bundesunternehmen, S. 160 ff.; R. Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S. 504; Stein/Weber, DÖV 2001, S. 278 (284); Stern, Staatsrecht III/1, S. 1421; Storr, Staat, S. 88 f.; Theobald/Siebeck, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 355 (360). Vgl. auch BGHZ 91, S. 84 (97), wonach öffentliche Rechtsbindungen auch dann auf privatrechtlich organisierte Rechtssubjekte anwendbar seien, wenn die Verwaltung nicht selbst . . . handele, sondern dem Bürger „in Gestalt eines von der Verwaltung beherrschten, privatrechtlich verfaßten Rechtssubjekts“ gegenübertrete. Vgl. auch BGHSt 49, S. 214 (219), wonach der Geschäftsführer einer GmbH, die sich in städtischem Alleinbesitz befindet und deren wesentliche Geschäftstätigkeit die Versorgung der Einwohner mit Fernwärme ist, Amtsträger gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB sei, „wenn die Stadt die Geschäftstätigkeit im öffentlichen Interesse steuert“. Dem folgend BGHSt 50, S. 299 (303 ff.). 20 Vgl. nur Möstl, Grundrechtsbindung, S. 111 ff. 21 BVerfG, NJW 1990, S. 1783. Auch der Bundesgerichtshof hat jüngst in seinem Urteil BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.) das Kriterium des staatlichen Mehrheitsbesitzes als Argument für die Anwendung von § 4 NdsPressG auf ein staatlich beherrschtes gemischtwirtschaftliches Unternehmen herangezogen. In seiner Entscheidung nimmt der Bundesgerichtshof allerdings ausdrücklich keine organisatorische Zurechnung des Unternehmens zur Organisation des staatlichen Mehrheitseigners vor, sondern legt vielmehr den Begriff der „Behörde“ im Sinne von § 4 NdsPressG „funktionell-teleologisch“ aus. Infolgedessen geht das Gericht von einer Anwendbarkeit dieser Norm auf das staatlich beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen aus. Über die Staatseigenschaft desselben wird gerade nicht entschieden. In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts spielt das Kriterium der organisatorischen Abhängigkeit bereits eine Rolle bei der Beurteilung der Grundrechtsberechtigung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts. So handele es sich bei den grundrechtsberechtigten Juristischen Personen des öffentlichen Rechts um solche, „die als eigenständige, vom Staat unabhängige oder jedenfalls distanzierte Einrichtungen bestehen“ [BVerfGE 45, S. 63 (79); 61, S. 82 (103); 68, S. 193 (207); 75, S. 192 (197)]. 22 Vgl. nur den Titel des Tagungsbandes von Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 1 ff. und die Referate von Engelhardt, a.a.O, S. 17 ff.; Himmelmann, a. a. O., S. 71 ff. und Schuppert, a. a. O., S. 139 ff. Ebenso ders., ZögU 8 (1985), S. 310 (311 f.); Mann, Gesellschaft, S. 14 ff.; Püttner, DÖV 1983, S. 697 ff.; Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (562); Storr, Staat, S. 60 ff.; v. Trott zu Solz, Aktiengesellschaft, S. 1 f. Die Instrumentalthese geht auf eine von den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften entwickelte Lehre zurück, wonach öffentliche Unternehmen als Teil der Politik und des politischen Prozesses begriffen werden. Vgl. dazu aus der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur die vorstehenden Nachweise und die Beiträge in Thiemeyer (Hrsg.), FS v. Eynern, S. 17 ff.; ders., a. a. O., S. 25 ff.; Himmelmann, a. a. O., S. 55 ff.; Eichhorn, a. a. O., S. 73 ff.; Püttner, a. a. O., S. 225 ff. Ebenso Siekmann, in: Stober/Vogel (Hrsg.), Wirtschaftsbetätigung der öffentlichen Hand, S. 103 (128). Der Begriff des Unternehmens als Instrument des Staates wurde von der rechtswissenschaftlichen Literatur übernommen. Vgl. nur Badura, in: FS Steindorff, S. 835 (841); Mann, Gesellschaft, S. 14 f.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 4; Püttner, Verwaltungs-
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
33
steuernde staatliche Einheit soll also Entscheidungsherrschaft besitzen. Als Folge dieser staatlichen Entscheidungsherrschaft sollen gemischtwirtschaftliche Unternehmen Teil des Staates und die Gesellschaft des Privatrechts an die Sonderbindungen des Staates gebunden sein.24 Als diese steuernden bzw. beherrschenden25 Organisationseinheiten werden in der Regel26 die an der Gesellschaft beteiligten staatlichen Rechtssubjekte angesehen. Hinter diesem Beherrschungsansatz steht die Vorstellung, staatliche Organisation lasse sich als Summe mehr oder weniger verselbständigter Verwaltungseinheiten27 beschreiben, die als Einheit aufgrund einer „organisierende(n), lenkende(n) . . . Tätigkeit“28 einer oder mehrerer zentraler Entscheidungsinstanzen zusammengefaßt werden.29 Die Entscheidungsherrschaft ist hierbei das Mittel, um die unternehmerischen Entscheidungen an den Entscheidungsmaßstäben der beherrschenden staatlichen Organisationseinheit auszurichten. Fraglich ist also, unter welchen Voraussetzungen von einer solchen organisierenden und lenkenden Entscheidungsherrschaft des an einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen beteiligten staatlichen Rechtssubjekts ausgegangen werden kann. Oben30 wurde bereits festgestellt, daß Entscheidungen von Menschen getroffen werden. Die entsprechenden natürlichen Personen werden verpflichtet, Entscheidungen mit Wirkung für die jeweilige Organisationseinheit zu treffen. Die natürlichen Personen sollen die Rechte und Pflichten der Organisation wahrnehmen. Dies setzt notwendig voraus, daß die menschlichen Entscheidungen der Organisation, d. h. in der Regel arbeitsteilig zunächst einer apersonalen Untereinheit derselben, als eigene zugerechnet werden.31 Die Entscheidungen der jelehre, S. 262 f.; Ronellenfitsch, DÖV 1999, S. 705 (707); Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (311 f.); Storr, Staat, S. 60 ff. 23 Loeser, Rechtsformen, S. 99; Badura, ZGR 26 (1997), S. 291 (293). 24 Verbreitet wird davon ausgegangen, daß die Gesellschaft aufgrund der staatlichen Steuerung zum Zurechnungsendsubjekt der Sonderbindungen des Staates werde, d. h. ihre Entscheidungen werden keinem anderen Rechtssubjekt mehr zugerechnet (so ist wohl BVerfG, NJW 1990, S. 1783 zu verstehen; ebenso Möstl, Grundrechtsbindung, S. 90 ff.). 25 Die Begriffe Steuerung und Beherrschung werden im folgenden synonym verwendet. 26 Zumindest theoretisch ist auch die Beherrschung eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens durch eine externe staatliche Einheit wie z. B. das Parlament denkbar. 27 Zum Begriff Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 21 ff. 28 Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293). 29 Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293) nennt diese Instanzen „leitende Organe (im sozialwissenschaftlichen Sinn)“ (Hervor. i. O.). Vgl. auch Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 72 ff. und sein Bild von verselbständigten Verwaltungseinheiten als „Trabanten“ bzw. „Satelliten“ des Systems der öffentlichen Verwaltung (a. a. O., S. 76). 30 Erster Teil, S. 29 f.
34
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
weiligen Untereinheit werden dann der Organisation zugerechnet.32 Es gibt also unzählige Einzelentscheidungen, die in einer Organisation getroffen und dieser zugerechnet werden. „Die Entscheidung“ eines Unternehmens ist lediglich Ergebnis einer Entscheidungs- und Zurechnungskette. Eine umfassende staatliche Entscheidungsherrschaft über „die Entscheidungen“ eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens würde deshalb eine Herrschaft über jede einzelne in dem jeweiligen Unternehmen getroffene Entscheidung voraussetzen. Eine in diesem Sinne umfassende Ersetzung der Alternativenwahl unternehmerischer Entscheider durch eine staatliche Entscheidung ist allerdings angesichts der organisationsrechtlichen Verselbständigung privatrechtlich organisierter Gesellschaften nicht umsetzbar und auch angesichts der in Folge einer „Privatisierung“33 erhofften Verselbständigungs- und Dezentralisierungseffekte34 unerwünscht. Die Entscheidungen in einer staatlichen Organisationseinheit können sich deshalb allenfalls durch ein Mindestmaß an Übereinstimmung auszeichnen. Ein Unternehmen ist daher staatliche Einheit, wenn seine Entscheidungen nach – notwendig wertender Betrachtung – dieses Mindestmaß an Übereinstimmung mit staatlichen Entscheidungen aufweisen. Dies wiederum ist dann der Fall, wenn ein entsprechendes Mindestmaß an staatlicher Einflußnahme auf den unternehmerischen Entscheidungsprozeß existiert. Der Beherrschungsansatz geht dementsprechend davon aus, daß es viele verschiedene mehr oder weniger organisatorisch verselbständigte staatliche Einheiten gibt, die sich alle durch ein Mindestmaß an staatlicher Einflußnahme auszeichnen, welche die Annahme einer staatlichen Entscheidungsherrschaft rechtfertigt. Bleiben die staatlichen Einwirkungshandlungen allerdings unter dieser Schwelle, finden sich also z. B. „kaum nennenswerte(n) Steuerungsimpulse(n)“35, liege lediglich eine staatliche Kapitalbeteiligung vor.36 Die Gesellschaft des Privatrechts soll in diesen Fällen privat sein. 31 Die rechtliche Konstruktion kann an dieser Stelle noch dahingestellt bleiben. Vgl. dazu ausführlich noch unten Zweiter Teil, S. 103 ff. 32 Zur organisationsinternen Zurechnung vgl. noch ausführlich m. w. N. unten Zweiter Teil, S. 98 ff. 33 Zum Begriff vgl. nur Remmert, Dienstleistungen, S. 189 ff.; Kämmerer, Privatisierung, S. 11. Privatisierung beschreibt einen Vorgang, der sich „in Richtung ,Privatheit‘ bewegt“ (Kämmerer, a. a. O., S. 11). 34 Engellandt, Einflußnahme der Kommunen, S. 85 weist darauf hin, daß die gewollte Flexibilisierung der kommunalen Wirtschaftseinheiten konterkariert werde, wenn der Geschäftsführung kein eigener Entscheidungsspielraum eingeräumt werde. Ebenso z. B. Ehlers, DÖV 1986, S. 897 (904); Haibt, Gestaltung, S. 87. Zu sonstigen Privatisierungsgründen und -zielen vgl. nur Bauer, VVDStRL 54 (1995), S. 243 (256); Lecheler, BayVBl. 1994, S. 555 ff.; Remmert, Dienstleistungen, S. 191 ff.; Schink, in: Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen, S. 5 (16 ff.). 35 Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 8. 36 Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 39, 43; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 92.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
35
Für die Annahme eines solchen Mindestmaßes staatlicher Entscheidungsherrschaft genügt es dementsprechend nach verbreiteter Ansicht, wenn auf die wesentlichen Entscheidungen des Unternehmens beherrschender staatlicher Einfluß ausgeübt werde.37 Dies seien insbesondere Entscheidungen der Gesellschafterbzw. Hauptversammlung, sowie die Entscheidungen der Leitungs- und Kontrollorgane der Gesellschaft. Es wird also nach verbreiteter Ansicht nur auf die Steuerung der Organentscheidungen von Leitungs- und Kontrollgremium der jeweiligen Kapitalgesellschaft abgestellt. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist also staatliches Rechtssubjekt, wenn ihre wesentlichen Organentscheidungen staatlich beherrscht sind. Zur Ermittlung einer staatlichen Entscheidungsherrschaft wird darüber hinaus auch hinsichtlich der Beherrschungsinstrumente nur eine summarische Prüfung vorgenommen. Entscheidend sei die „Effektivität“38 der Steuerungsinstrumente. Es muß eine „maßgebliche staatliche Bestimmungsmacht“ vorliegen.39 In Anlehnung an die zu § 17 AktG und §§ 36 ff. GWB entwickelten Grundsätze40 wird teilweise eine „Gesamtbetrachtung aller rechtlichen und tatsächlichen“41
37 Das Bundesverfassungsgericht spricht von einem „entscheidenden Einfluß“ (BVerfG, NJW 1990, S. 1783). Ebenso BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.) („maßgeblicher Einfluß“). So soll insbesondere die gesellschaftsrechtliche Einflußnahme auf die Entscheidungsorgane einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft Entscheidungsherrschaft vermitteln. Vgl. dazu sogleich unten Erster Teil, S. 37 ff. Teilweise wird zwischen der Einflußnahme und der Möglichkeit der Einflußnahme unterschieden (z. B. Möstl, Grundrechtsbindung, S. 15 m. w. N. in Fn. 82. Vgl. auch BGH, WUW/E, S. 2321 ff. zu § 37 GWB und Hüffer, AktG, § 17, Rn. 4, 6 ff. zu § 17 AktG). So genüge die Möglichkeit der Steuerung zur Annahme einer Entscheidungsherrschaft. Dahinter steht die Vermutung, Möglichkeiten würden auch genutzt. I. E. wird also ebenfalls auf eine tatsächlich ausgeübte Einflußnahme abgestellt. Die Differenzierung zwischen tatsächlicher Einflußnahme und der Möglichkeit der Einflußnahme kann hier also dahingestellt bleiben. 38 Storr, Staat, S. 63. 39 Puhl, Budgetflucht, S. 41 ff. 40 Vgl. z. B. Möstl, Grundrechtsbindung, S. 97. Kritisch gegenüber einer Heranziehung der Wertungen des Konzernrechts v. Arnauld, DÖV 1998, S. 437 (445), Fn. 85. 41 Vgl. z. B. Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 189. Nach BGHSt 49, S. 214 (219) seien Juristische Personen des Privatrechts „sonstige Stellen“ im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB, wenn bei ihnen Merkmale vorliegen, die eine Gleichstellung mit Behörden rechtfertigen. „Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sie bei ihrer Tätigkeit öffentliche Aufgaben wahrnehmen . . . und dabei derart staatlicher bzw. hier kommunaler Steuerung unterliegen, dass sie bei einer Gesamtbewertung der sie kennzeichnenden Merkmale als ,verlängerter Arm‘ des Staates erscheinen“ [unter Verweis auf BGHSt 43, S. 370 (377); 45, S. 16 (19); 46, S. 310 (312 f.); BGH, NJW 2001, S. 3062 (3063); dem folgend BGHSt 50, S. 299 (303)]. Auf eine solche Gesamtbewertung stellt schon RGZ 167, S. 40 (49) in bezug auf das Tatbestandsmerkmal der Abhängigkeit im Sinne von § 17 Abs. 1, 2 AktG ab; ebenso z. B. Hüffer, AktG, § 17, Rn. 9. Übereinstimmend BGHZ 62, S. 193 (199); K. Schmidt, ZGR 9 (1980), S. 277 (285). Vgl. auch § 37 Abs. 1 S. 2 GWB, wonach Kontrolle „unter Berücksichtigung aller tatsächlichen und rechtlichen Umstände“ begründet
36
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Einflußfaktoren gefordert. Es komme eine Kombination unterschiedlicher Steuerungsinstrumente in Betracht.42 Es stellt sich also im folgenden die Frage, ob es solche „effektiven“ Steuerungsinstrumente gibt, welche das jeweilige Unternehmen nach wertender Betrachtung als Instrument des Staates erscheinen lassen. Dies setzt zunächst einen Überblick über die verbreitet als zentral angesehenen staatlichen Steuerungsinstrumente voraus. Hierbei wird unterschieden zwischen sogenannten rechtlichen43 und faktischen bzw. tatsächlichen44 Steuerungsinstrumenten.
B. Steuerungsinstrumente des Staates Welche Steuerungsinstrumente für den staatlichen Anteilseigner in Betracht kommen, richtet sich in erster Linie nach der Organisationsform der jeweiligen gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft. Die Vorschriften des Haushaltsrechts45 und des kommunalen Wirtschaftsrechts46 machen die Zulässigkeit der Wahl einer privatrechtlichen Rechtsform von einer Beschränkung der Einzahlungs- und wird. Dazu Mestmäcker/Veelken, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), GWB, § 36, Rn. 49. 42 Greiling, ZögU 19 (1996), S. 286 ff. Vgl. auch Mestmäcker/Veelken, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), GWB, § 36, Rn. 58 zur Beurteilung von Zusammenschlüssen von Unternehmen nach § 36 GWB. 43 Vgl. dazu nur Schuppert, in: ders. (Hrsg.), Gesetz, S. 105 (123); Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293 f.). 44 Einen ausführlichen Überblick über die verschiedenen Steuerungsinstrumente eines an einem Unternehmen beteiligten Verwaltungsträgers geben z. B. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 267 ff.; Greiling, ZögU 19 (1996), S. 286 (287); HoffmannRiem, DÖV 1999, S. 221 (224); Mann, Gesellschaft, S. 173 ff. 45 § 65 Abs. 1 Nr. 2 BHO und die gleichlautenden Vorschriften in Art. 65 Abs. 1 Nr. 1 BayHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 BbgHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 BWHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 HeHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 MVHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 NrWHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 NdsHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 RPHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 SaarlHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 SAHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 SächsHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 SHHO; § 65 Abs. 1 Nr. 2 ThürHO. 46 Soweit im folgenden kommunalrechtliche Vorschriften genannt werden, beschränkt sich die Untersuchung aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Regelungen der Gemeindeordnungen. Die weitgehend gleichlautenden Vorschriften der Kreisordnungen sollen außer Betracht bleiben. Darüber hinaus vernachlässigt die Arbeit die landesrechtlichen Regelungen der Länder Berlin, Bremen und Hamburg. Die Gemeindeordnungen verpflichten die jeweils beteiligte Gemeinde dazu, eine Rechtsform zu wählen, welche die Haftung und Einzahlungsverpflichtung derselben auf einen „bestimmten“ (z. B. § 109 Abs. 1 Nr. 2 NdsGO; § 108 Abs. 1 Nr. 3 NrWGO; § 87 Abs. 1 Nr. 4 RPGO) bzw. „der Leistungsfähigkeit der Gemeinde angemessenen“ (z. B. § 103 Abs. 1 Nr. 4 BWGO; Art. 92 Abs. 1 Nr. 3 BayGO; § 102 Nr. 3 BbgGO; § 69 Abs. 1 Nr. 4 MVKV) Betrag begrenzt. In einigen Gemeindeordnungen findet sich die Vorgabe, daß sich die jeweilige Gemeinde nicht zu Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten darf (z. B. § 109 Abs. 1 Nr. 4 NdsGO; § 108 Abs. 1 Nr. 5 NrWGO; § 87 Abs. 1 Nr. 6 RPGO). Ausführlich zur
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
37
Haftungsverpflichtung des beteiligten staatlichen Rechtssubjektes abhängig. Daher kommen aus Sicht des staatlichen Beteiligten im wesentlichen nur Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaften als Organisationsformen für die Gründung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften in Betracht.47 Die folgende Untersuchung beschränkt sich daher auf diese beiden in der Praxis auch am meisten verbreiteten48 Kapitalgesellschaftsformen und die entsprechenden gesellschaftsrechtlichen Steuerungsinstrumente. I. Gesellschaftsrechtliche Steuerungsinstrumente 1. Kapitalanteil als zentrales Steuerungsinstrument Verbreitet wird der staatliche Kapitalanteilsbesitz als wichtigstes Mittel zur staatlichen Steuerung unternehmerischer Entscheidungen angesehen.49 So sei eine Aktiengesellschaft dann staatliche Entscheidungseinheit, wenn einem staatHaftung der Kommunen für ihre privatrechtlich organisierten Unternehmen Siekmann, in: Püttner (Hrsg.), Reform, S. 159 ff. 47 Daneben ergeben sich Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung bei eingetragenen Genossenschaften und Kommanditgesellschaften. Auch die Beteiligung als sogenannter stiller Gesellschafter kommt in Betracht. Vgl. dazu nur Mann, Gesellschaft, S. 173. In der Praxis dominieren die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft. Nachweise bei Koch, Status, S. 153; Loeser, System II, § 10, Rn. 160; Püttner, in: ders. (Hrsg.), Reform, S. 143 (143 f.). 48 Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (217 f.); Koch, Status, S. 153; Mann, Gesellschaft, S. 173; Püttner, in: ders. (Hrsg.), Reform, S. 143 (143 f.); Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (563). 49 Vgl. nur BVerfG, NJW 1990, S. 1783; BGHZ 91, S. 84 (97); BGH, NVwZ-RR 1989, S. 388 (200); Mann, Gesellschaft, S. 190 ff. Das Merkmal der Kapitalmehrheit ist ein in der Rechtsordnung vielfach verwendetes Kriterium, an das bestimmte Rechtsfolgen geknüpft werden. So z. B. in § 65 Abs. 3 S. 1 BHO oder § 53 Abs. 1 HGrG. § 17 Abs. 2 AktG trifft die Vermutung, wonach eine Anteilsmehrheit eines Unternehmens an einem anderen die Abhängigkeit des letzteren von dem mit Mehrheit beteiligten Unternehmen vermuten läßt. Vgl. auch Art. 2 Abs. 1b der Richtlinie 80/ 723/EWG der Kommission v. 25.06.1980, ABl. Nr. L 195 v. 29.07.1980, S. 35 ff., in der Fassung der Richtlinie 2000/52/EG der Kommission v. 26.07.2000 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, ABl. Nr. L 193 v. 29.07.2000, S. 75 ff., wonach eine „öffentliches Unternehmen“ definiert wird als „jedes Unternehmen, auf das die öffentliche Hand aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluß ausüben kann“ (vgl. dazu ausführlich unten Zweiter Teil, S. 153 ff.). Auch § 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GWB stellt auf die Kapitalmehrheit ab, ebenso § 98 S. 1 Nr. 2 GWB. Weitere Beispiele für eine Anknüpfung des Gesetzgebers an das Merkmal der Mehrheitsbeteiligung finden sich auch in kommunalrechtlichen Vorschriften (vgl. nur z. B. §§ 105 Abs. 1, 2, 106 Abs. 2 BbgGO). Weitere Beispiele finden sich bei Koch, Status, S. 147 f.; Schallemacher, Bundesunternehmen, S. 159 f. Zur Relevanz dieser Vorschriften für die Auslegung gesellschaftsvertraglicher Erklärungen vgl. ausführlich unten Zweiter Teil, S. 144 ff.
38
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
lichen Rechtssubjekt die Mehrheit der Anteile, also mindestens 50 plus x Prozent am Grundkapital gehöre.50 Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung soll nach dem Beherrschungsansatz Teil der vollziehenden Gewalt sein, wenn der jeweilige Verwaltungsträger die entsprechend größte Stammeinlage bei Gründung der Gesellschaft übernommen oder nachträglich die Mehrheit der Geschäftsanteile erworben habe.51 Ob und inwieweit ein mehrheitlicher Kapitalanteilsbesitz dazu geeignet ist, gemischtwirtschaftliche Unternehmen „effektiv“ staatlich zu steuern, soll im folgenden überblicksweise und für Aktiengesellschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung getrennt dargestellt werden. Es ist zu untersuchen, ob und inwiefern das Bestehen einer staatlichen Anteilsmehrheit geeignet ist, die Entscheidungen der Organe einer Kapitalgesellschaft derart zu steuern, daß eine staatliche Entscheidungsherrschaft angenommen werden kann. Die Untersuchung beginnt mit der Darstellung der Rechtslage im Fall einer Aktiengesellschaft. Zunächst sollen die Möglichkeiten zur Instrumentalisierung der Entscheidungen der Hauptversammlung aufgezeigt werden. Jeder Aktionär ist gemäß § 118 Abs. 1 S. 1 AktG Mitglied der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung beschließt gemäß §§ 119 Abs. 1 Nr. 1, 101 Abs. 1 S. 1 AktG über die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden gemäß § 133 Abs. 1 1. Hs. AktG grundsätzlich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.52 Gemäß 50 Differenzierende Ansätze finden sich demgegenüber z. B. bei v. Arnauld, DÖV 1998, S. 437 (442 ff., insbes. 445) u. Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften, S. 19 ff., die ein Unternehmen erst bei einem staatlichen Anteilsbesitz ab 75 Prozent als staatlich beherrscht ansehen. Ab einer solchen Anteilsmehrheit liege eine „qualifizierte“, d. h. zu einer Satzungsänderung ausreichende staatliche Mehrheitsbeteiligung vor. Vgl. auch BGHSt 50, S. 299 (303 ff.), wonach ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen bereits bei einer privaten Sperrminorität von 25,1 Prozent nicht mehr als „verlängerter Arm“ des mit einfacher Mehrheit beteiligten Verwaltungsträgers erscheine. Da in dem vom BGH entschiedenen Fall nach der gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung wesentliche Angelegenheiten der Gesellschaft nur mit Dreiviertel-Mehrheit beschlossen werden konnten, habe der private Minderheitsgesellschafter mit Hilfe seiner Sperrminorität entscheidenden Einfluß auf die wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen gehabt. Anders allerdings Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 51, Rn. 18, wonach es im Rahmen des Aktienkonzernrechts allgemein anerkannt sei, dass der Besitz einer Sperrminorität nicht genüge, um einen beherrschenden Einfluß auszuüben. Die Sperrminorität ermögliche es lediglich, bestimmte Entscheidungen zu blockieren, nicht jedoch, einen steuernden Einfluß auf das Unternehmen auszuüben. 51 Der Geschäftsanteil jedes Gesellschafters bestimmt sich gemäß § 14 GmbHG nach dem Betrag der von ihm übernommenen Stammeinlage. Bei Gründung kann jeder Gesellschafter nur eine Stammeinlage übernehmen, die aber für jeden verschieden groß sein kann. Gemäß § 15 Abs. 1 GmbHG ist ein späterer Hinzuerwerb weiterer Geschäftsanteile möglich. Vgl. dazu nur Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbHGesetz, § 3, Rn. 22, 23. 52 Zu den Ausnahmen vgl. nur § 133 Abs. 1 2. HS, Abs. 2 AktG.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
39
§§ 134 Abs. 1 S. 1, 12 Abs. 1 S. 1 AktG gewährt jede Aktie ein Stimmrecht. Soweit also eine Gebietskörperschaft die Mehrheit der Kapitalanteile auf sich vereinigt, verfügt sie zugleich grundsätzlich über die Mehrheit der Stimmrechte.53 In diesem Fall kann sie z. B. die Personalauswahlentscheidungen der Hauptversammlung steuern, d. h. die Entscheidungsmaßstäbe für die Alternativenwahl einseitig vorgeben. Entsprechendes gilt für die Beschlüsse zur Abberufung der gewählten Aufsichtsratsmitglieder, welche ebenfalls gemäß § 103 Abs. 1 AktG der Hauptversammlung obliegen. Auch die sonstigen Entscheidungen der Hauptversammlung wie z. B. die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates gemäß § 120 Abs. 1 S. 1 AktG kann ein staatlicher Mehrheitsaktionär nach seinen Entscheidungsvorgaben von seinen Vertretern54 in der Hauptversammlung beschließen lassen. Neben den Möglichkeiten der Steuerung der Personalwahlentscheidungen können dem staatlichen Anteilseigner gesellschaftsvertraglich Sonderrechte zur Entsendung einzelner Vertreter in den Aufsichtsrat eingeräumt werden. Diese Sonderrechte sind nicht an das Bestehen einer Anteilsmehrheit gekoppelt. § 103 Abs. 2 S. 1 AktG setzt ein solches im jeweiligen Gesellschaftsvertrag vereinbartes Entsendungsrecht einzelner Aktionäre voraus. Die Gemeindeordnungen verpflichten die beteiligten Gemeinden dazu, darauf hinzuwirken, daß entsprechende Rechte zur Entsendung von Amtswaltern in die Aufsichtsräte der kommunalen (Beteiligungs-)Unternehmen im Gesellschaftsvertrag statuiert werden55 oder setzen zumindest das Vorliegen einer solchen gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung im Einzelfall voraus.56 Die Gebietskörperschaft kann also als Mitglied der Hauptversammlung mit Stimmrechtsmehrheit die Personalentscheidungen der Hauptversammlung zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder steuern und aufgrund gesellschaftsvertraglich vereinbarter Entsendungsrechte selbst solche entsenden. Die Personalauswahl bestimmen zu können, wird verbreitet als zentrale Voraussetzung zur Instrumentalisierung der Unternehmensentscheidungen angesehen.57 53
Zu den Ausnahmen vgl. nur § 12 Abs. 1 S. 2 AktG. Ausführlich zu diesen Vertretern unten Zweiter Teil, S. 156 ff. 55 Vgl. Art. 93 Abs. 2 S. 1 BayGO: „Die Gemeinde soll bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung daraufhinwirken, daß ihr das Recht eingeräumt wird, Mitglieder in einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu entsenden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen Einflusses notwendig ist“. Ebenso § 111 Abs. 3 S. 1 NdsGO und § 113 Abs. 3 S. 1 NrWGO. 56 § 104 Abs. 2 BbgGO; § 104 Abs. 2, 3 BWGO; § 125 Abs. 2 S. 1 HeGO; § 71 Abs. 2 MVKV; § 88 Abs. 3 RPGO; § 114 Abs. 1 S. 2 SaarlKSVG; § 98 Abs. 2 S. 1 SächsGO; § 119 Abs. 2 S. 1 SAGO; § 104 Abs. 2 SHGO; § 74 Abs. 1 ThürKO. 57 Vgl. z. B. Möstl, Grundrechtsbindung, S. 15; Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 189; Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 (2562 ff.); R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (358 f.); Knemeyer, Der Städtetag 1992, S. 317 (320). Vgl. aus der gesellschaftsrechtlichen Literatur auch Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, 54
40
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Die Annahme staatlicher Entscheidungsherrschaft setzt allerdings neben der einmaligen staatlich gesteuerten Personalauswahl auch ein Mindestmaß an fortlaufender Einflußnahme auf die im Unternehmen getroffenen Entscheidungen voraus. Es stellt sich deshalb die Frage, ob und inwieweit der staatliche Mehrheitsaktionär auch die Entscheidungsherrschaft über die Entscheidungen von Aufsichtsrat und Vorstand erlangen kann. Dies soll zunächst für den Aufsichtsrat und im Anschluß daran für den Vorstand untersucht werden. Mit der Auswahl des entscheidenden Personals sind noch nicht notwendig die Entscheidungen des Aufsichtsrates selbst, d. h. die Überwachung der Geschäftsführung der Aktiengesellschaft (§ 111 Abs. 1 AktG) und die Bestellung der Vorstandsmitglieder gemäß § 84 Abs. 1 S. 1 AktG, staatlich gesteuert. Eine solche Steuerung wäre dann anzunehmen, wenn den Aufsichtsratsmitgliedern von der Gebietskörperschaft oder der Hauptversammlung Weisungen i. S. v. inhaltlichen Vorgaben für bestimmte Entscheidungen erteilt werden könnten. Die Gemeindeordnungen gehen verbreitet davon aus, daß die in den Aufsichtsrat entsandten Vertreter der Gemeinde den Weisungen derselben unterliegen: Entweder ermächtigen sie die Gemeinde unmittelbar zur Weisungserteilung,58 oder sie verpflichten die Gebietskörperschaft dazu, darauf hinzuwirken, daß solche Weisungsrechte im Gesellschaftsvertrag statuiert werden.59 Demgegenüber wird allerdings verbreitet davon ausgegangen, daß eine solche Weisungsbindung der entsandten Aufsichtsratsmitglieder gesellschaftsrechtlich unzulässig sei.60 Ein Aufsichtsratsmitglied sei lediglich an die inhaltlichen VorgaS. 36 f., 45 f. in bezug auf § 17 Abs. 2 AktG. Ebenso BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.); OLG Düsseldorf, AG 1994, S. 36 (37); OLG München, AG 1995, S. 383; Hüffer, AktG, § 17, Rn. 5. 58 § 104 Abs. 1 S. 4 BbgGO; § 104 Abs. 1 S. 3 BWGO; § 125 Abs. 2, Abs. 1, S. 3 HeGO; § 71 Abs. 2, Abs. 1 S. 5 MVKV; § 111 Abs. 3, Abs. 1 S. 2 NdsGO; § 113 Abs. 1 S. 2 NrWGO; § 114 Abs. 1 S. 2, 3 SaarlKSVG; § 119 Abs. 2, Abs. 1 S. 5 SAGO; §§ 104 Abs. 2, 25 Abs. 1 SHGO. § 74 Abs. 3 S. 3 ThürKO setzt das Bestehen eines solchen Weisungsrechts voraus. 59 Art. 93 Abs. 2 S. 3 BayGO. Abgeschwächt dagegen § 88 Abs. 4 RPGO: „Die Vertreter der Gemeinde im Aufsichtsrat oder einem entsprechenden Überwachungsorgan eines Unternehmens haben bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen der Gemeinde zu berücksichtigen“ (ebenso § 104 Abs. 3 BWGO). Anders auch § 98 Abs. 2 S. 4 SächsGO: „Die von der Gemeinde entsandten Mitglieder haben den Gemeinderat und, sofern dieser nicht dem Organ angehört, auch den Bürgermeister über alle Angelegenheiten des Unternehmens von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten“. Abgeschwächt auch § 65 Abs. 6 BHO und die entsprechenden LHOen, wonach das zuständige Ministerium darauf hinwirken soll, „daß die auf Veranlassung des Bundes gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichtsorgane der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Bundes berücksichtigen“. 60 So z. B. BGHZ 36, S. 296 (306) unter Verweis auf RGZ 165, S. 68 (79); Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 206; Raiser, Kapitalgesellschaften, § 15, Rn. 42; ders., ZGR 7 (1978), S. 391 (401); Ehlers, Privatrechtsform, S. 136; Koch, Status, S. 162; Leisner, WiVerw. 1983, S. 212 (216 f.); Säcker, in: FS Rebmann, S. 781 (792 f.); Schmidt-Aßmann/Ulmer, BB 1988, Beil. 13, S. 1 (15);
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
41
ben des Unternehmensgegenstandes und -zwecks, das sogenannte Unternehmensinteresse, gebunden.61 Dementsprechend stehen die Vorschriften der Gemeindeordnungen hinsichtlich der Konstituierung eines Weisungsrechts des kommunalen Entscheidungsorgans gegenüber dem in den Aufsichtsrat entsandten Gemeinderatsmitglied unter dem Vorbehalt der gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeit.62 Rechtliche Möglichkeiten der Gebietskörperschaften zur inhaltlichen Steuerung der Aufsichtsratsentscheidungen bestehen damit – schließt man sich der vorstehenden Ansicht zur gesellschaftsrechtlichen Unzulässigkeit an – nicht. Möglicherweise gibt es aber sogenannte faktische Möglichkeiten, auf die Entscheidungen des Aufsichtsrates Einfluß zu nehmen. Faktische Einflußnahme kann darin bestehen, daß die Aufsichtsratsmitglieder aufgrund von anderen, nichtrechtlichen Faktoren dazu veranlaßt werden, nach Vorgabe der Gebietskörperschaften zu entscheiden. So wird teilweise darauf hingewiesen, daß sich die gewählten oder entsandten Mitglieder der Gesellschaftsorgane „schon im Interesse ihrer Wiederwahl“63 im Zweifel nach den Vorstellungen des wählenden oder entsendenden Gesellschaftsmitglieds richten werden.64 Auch können die vom Verwaltungsträger entsandten Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 103 Abs. 2 S. 1 AktG von diesem jederzeit abberufen und ersetzt werden,65 was ebenfalls einen faktischen Entscheidungsdruck erzeugen kann. Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1074); Strobel, DVBl. 2005, S. 77 (79 ff.). Einen ausführlichen Überblick über die Diskussion geben Lieschke, Weisungsbindungen, insbes. S. 25 ff.; Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 (2562 ff.). Vgl. dazu auch Krebs, in: Ehlers/ders., Grundfragen, S. 41 (49 f.). 61 Für den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft wird dies insbesondere aus dem Sinn und Zweck der §§ 116, 93 Abs. 1 AktG abgeleitet. Nur eine unabhängige Stellung desselben könne die Erfüllung der geforderten Sorgfaltspflicht gewährleisten. Für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelte gemäß § 52 Abs. 1 GmbHG entsprechendes. Vgl. dazu Lieschke, Weisungsbindungen, S. 25 ff., 39 ff. jeweils m. w. N. Mann, Gesellschaft, S. 206 weist darauf hin, daß damit der Fixierung des öffentlichen Zwecks in der Satzung eine maßgebliche Bedeutung zukommt. Dazu sogleich unten S. 45 ff. 62 So Art. 93 Abs. 2 S. 3 BayGO; § 104 Abs. 2 BbgGO; § 71 Abs. 2 MVKV; § 88 Abs. 3 RPGO; § 119 Abs. 1 S. 5 SAGO. Demgegenüber enthalten § 104 BWGO; § 111 Abs. 3 NdsGO; § 113 Abs. 3 NrWGO; § 114 Abs. 1 S. 2 SaarlKSVG; § 98 Abs. 2 S. 4 SächsGO; § 74 Abs. 3 ThürKO keine entsprechenden Regelungen. Nach § 125 Abs. 2 S. 1 HeGO; § 104 Abs. 2 SHGO gelten die Regelungen über das Weisungsrecht lediglich „entsprechend“. Vgl. zu diesen kommunalrechtlichen Vorbehaltsregelungen auch Oebbecke, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 9, Rn. 39 ff. 63 Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 37; Koch, Status, S. 165; Hüffer, AktG, § 17, Rn. 5 f.; R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (359); Knemeyer, Der Städtetag 1992, S. 317 (320). Vgl. auch OLG Düsseldorf, AG 1994, S. 36 (37). 64 Auch z. B. Janson, Rechtsformen, S. 213 ff. weist auf die Bedeutung von „Personalpolitik“ als Mittel der Einflußnahme auf Unternehmensentscheidungen hin. 65 Ein Entsendungsrecht kann allerdings gemäß § 101 Abs. 2 S. 4 AktG für insgesamt höchstens ein Drittel der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder eingeräumt werden. Vgl. dazu nur Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 15, Rn. 45, die zugleich
42
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Daß die beteiligte Gebietskörperschaft diese faktischen Einflußmöglichkeiten ausüben kann, ermöglichen ihr vielfältige Informationsrechte. So sehen Vorschriften der Gemeindeordnungen verbreitet umfassende Informations- und Berichtspflichten der in die Gesellschaftsorgane entsandten Vertreter vor.66 Das Gesellschaftsrecht selbst stellt mit den §§ 394, 395 AktG punktuell Informationsmöglichkeiten zugunsten der staatlichen Anteilseigner zur Verfügung, indem die Aufsichtsratsmitglieder, die auf Veranlassung einer Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat gewählt oder entsandt worden sind, aufgrund dieser Vorschriften von der Verschwiegenheitspflicht der §§ 116, 93 Abs. 1 S. 2 AktG entbunden werden.67 Darüber hinaus ermöglicht auch die sogenannte Wirtschafts- und Finanzkontrolle den Zugang zu Informationen über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens für die jeweilige Gebietskörperschaft.68 Aufgrund dieser Informationsmöglichkeiten kann die jeweilige Gebietskörperschaft also möglicherweise im Rahmen ihrer rechtlichen Bindungen den vorstehend beschriebenen Entscheidungsdruck auf ihre Vertreter im Aufsichtsrat ausüben. Diese „informellen“ und „faktischen“69 Abhängigkeiten sollen im Einzelfall eine effektive Steuerung der Sachentscheidungen des Aufsichtsrates durch den staatlichen Anteilseigner begründen können.70 Die mitgliedschaftlichen Rechte des Mehrheitseigners bedürfen daher nach verbreiteter Ansicht einer Ergänzung durch sogenannte informelle bzw. faktische Einflußfaktoren, um die Entscheidungsherrschaft im Einzelfall bewirken zu können. Ob und inwieweit eine rechtlich gebundene Gebietskörperschaft verpflichtet und berechtigt ist, diese informellen bzw. faktischen Einflußmöglichkeiten zu nutzen, kann hier dahingestellt bleiben. Jedenfalls zeigt es sich, daß i. E. nach darauf hinweisen, daß die Vorschrift des § 101 Abs. 2 AktG auf die „besonderen Bedürfnisse der öffentlichen Hand“ zurückgehe. 66 Art. 93 Abs. 2 S. 2 BayGO; § 104 Abs. 4 S. 1 BbgGO; § 125 Abs. 1 S. 4 HeGO; § 71 Abs. 4 S. 1 MVKV; § 111 Abs. 4 S. 1 NdsGO; § 113 Abs. 5 S. 1 NrWGO; § 115 Abs. 1 S. 1 SaarlKSVG; § 98 Abs. 2 S. 4 SächsGO. Demgegenüber enthalten § 104 Abs. 3 BWGO, wonach „die von der Gemeinde entsandten oder auf ihren Vorschlag gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats oder eines entsprechenden Überwachungsorgans eines Unternehmens . . . bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen der Gemeinde zu berücksichtigen“ haben, und ebenso § 88 Abs. 4 RPGO; § 119 Abs. 1 SAGO, sowie die §§ 104 Abs. 2, 25 SHGO; § 74 Abs. 1, 3 ThürKO keine entsprechenden Regelungen. Vgl. zu diesen Informationspflichten nur Strobel, Verschwiegenheits- und Auskunftspflicht, S. 1 ff.; dies., DVBl. 2005, S. 77 ff. 67 Vgl. dazu z. B. Schmidt-Aßmann/Ulmer, BB 1988, Beil. 13, S. 1 ff.; Mann, Gesellschaft, S. 240 ff.; Will, VerwArch 94 (2003), S. 248 ff. 68 Dazu sogleich unten S. 53 ff. 69 Zu weiteren faktischen Steuerungsinstrumenten unten S. 59 ff. 70 Koch, Status, S. 165 weist darauf hin, daß in diesem Fall vielfach „ein nicht weiter auflösbares Nebeneinander von rechtlicher sowie rechtlich nicht fixierter . . . Einflußnahme“ vorliegt. Auch Püttner, Verwaltungslehre, S. 340 f. u. Janson, Rechtsformen, S. 213 f. heben die Bedeutung der „oft viel wirksameren informellen“ (Püttner, a. a. O., S. 340) Einwirkung auf bzw. Kontrolle von Personal hervor.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
43
verbreiteter Ansicht nicht das Kriterium der Anteilsmehrheit, sondern die tatsächlichen Herrschaftsverhältnisse in einem Unternehmen das zentrale Zuordnungskriterium für die Bestimmung der Staatseigenschaft einer Gesellschaft nach dem Beherrschungsansatz sind. Das Kriterium der Anteilsmehrheit ist lediglich ein Indiz für die tatsächliche Verteilung der Entscheidungsherrschaft in einem Unternehmen.71 Begründungsbedürftig ist es ebenfalls, die Entscheidungen des Vorstands als staatlich beherrscht anzusehen. Zwar werden die Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestellt, sie unterliegen allerdings keinen Weisungen weder durch den Aufsichtsrat noch durch die Hauptversammlung.72 Lediglich auf Verlangen des Vorstandes kann die Hauptversammlung gemäß § 119 Abs. 2 AktG über Fragen der Geschäftsführung entscheiden. Darüber hinaus kann dem Aufsichtsrat gemäß § 111 Abs. 4 S. 2 AktG ein Zustimmungsrecht für bestimmte Arten von Geschäften eingeräumt werden. Außerhalb dieser Zustimmungsvorbehalte bleibt der Aufsichtsrat allerdings ohne konkrete Einwirkungsmöglichkeiten auf die Geschäftsführung. Deshalb stehen zur inhaltlichen Steuerung der Entscheidungen des Vorstands durch den staatlichen Anteilseigner nur die bereits vorstehend erwähnten faktischen Einflußnahmemöglichkeiten zur Verfügung.73 Eine inhaltliche Steuerung der Unternehmensentscheidungen im Sinne einer aktiven und positiven Beeinflussung der Geschäftsführungstätigkeit durch den staatlichen Anteilseigner ist bis auf die Zustimmungsvorbehalte nicht möglich.74 Anders stellt sich dagegen die Rechtslage bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung dar. Die Steuerungsinstrumente der Anteilseigner sind im Fall der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung weitergehender Art.75 Im Gegensatz zum Recht der Aktiengesellschaft (§ 12 Abs. 2 AktG)76 ist es im Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung zulässig, gesellschaftsvertraglich77 Mehrfachstimmrechte der öffentlichen Hand vorzusehen.78 Umgekehrt 71 Ebenso Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (570), wonach die Kapitalanteile die „tatsächlichen Machtverhältnisse“ widerspiegeln sollen. 72 Dies wird verbreitet aus § 76 Abs. 1 AktG abgeleitet. Vgl. nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 28 II, S. 805; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 198 f.; Mertens, in: Kölner Kommentar, § 111, Rn. 32; § 76, Rn. 42. 73 Ebenso Mann, Gesellschaft, S. 210; Knemeyer, Der Städtetag 1992, S. 317 (320); R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (358 f.); Engel, Grenzen und Formen, S. 165 f. 74 Hüffer, AktG, § 76, Rn. 11. 75 Ausführlich dazu Mann, Gesellschaft, S. 189 ff. 76 Vgl. dazu nur Mann, Gesellschaft, S. 192 ff. m. w. N. 77 Die Begriffe Satzung und Gesellschaftsvertrag werden in dieser Untersuchung synonym verwendet. Grundlegend zu Gesellschaftsvertrag und Satzung „als Grundlagen gesellschaftsrechtlicher Rechtsverhältnisse“ K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I, S. 75 ff. 78 OLG Frankfurt, GmbHR 1990, S. 79 (80); Koppensteiner, in: Rowedder, GmbHG, § 47, Rn. 14; Hüffer, in: Hachenburg, GmbHG, § 47, Rn. 89; Lutter/Hommelhoff, in: dies., GmbH-Gesetz, § 47, Rn. 4; Schön, ZGR 25 (1996), S. 429 (446).
44
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
können beteiligten Privaten stimmrechtslose Geschäftsanteile eingeräumt werden.79 Derartige Regelungen finden sich allerdings in der Praxis nur selten.80 Im Unterschied zur Aktiengesellschaft können dem Geschäftsführer der Gesellschaft mit beschränkter Haftung Weisungen durch die Gesellschafterversammlung erteilt werden.81 Auch die Erteilung von Weisungen an Mitglieder eines fakultativen Aufsichtsrates (§ 52 GmbHG), der bei gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften mit kommunaler Beteiligung gesellschaftsvertraglich verbreitet vorgesehen ist,82 wird verbreitet für zulässig gehalten.83 Darüber hinaus sind gesellschaftsvertraglich vereinbarte Weisungsrechte zugunsten der jeweils beteiligten kommunalen Körperschaft gegenüber der Geschäftsführung gesellschaftsrechtlich zulässig.84 So kann nach verbreiteter Ansicht einem Gesellschafter ein Weisungsrecht als gesellschaftsvertragliches Sonderrecht entsprechend § 35 BGB eingeräumt werden.85 Intensivere Steuerungsrechte der kommunalen Gebietskörperschaft können auch darin bestehen, daß dieser gesellschaftsvertraglich ein Sonderrecht zur Bestellung des oder der Geschäftsführer eingeräumt wird.86 Soweit ersichtlich, wird von diesen Sonderrechten in der Praxis nur selten Gebrauch gemacht.87
79 BGHZ 14, S. 264 (269 f.); Hüffer, in: Hachenburg, GmbHG, § 47, Rn. 56. § 12 Abs. 1 S. 1 AktG ermöglicht die Ausgabe stimmrechtsloser Vorzugsaktien, allerdings gemäß § 139 Abs. 2 AktG nur bis zur Hälfte des Aktienkapitals. 80 Mann, Gesellschaft, S. 191 m. w. N. in Fn. 92. 81 Eine dem § 76 Abs. 1 AktG entsprechende Vorschrift fehlt. Vgl. dazu BGHZ 31, S. 258 (278); 89, S. 48 (57); Grunewald, Gesellschaftsrecht, S. 339 f.; Hueck/Windbichler, Gesellschaftsrecht, § 36, Rn. 5; Hommelhoff, ZGR 7 (1978), S. 119 (127 ff.); Schneider, in: Scholz, GmbHG, § 37, Rn. 30 ff. Verbreitet wird davon ausgegangen, daß ein solches Weisungsrecht auch ohne gesellschaftsvertragliche Vereinbarung zulässig ist. Anders aber z. B. Hommelhoff, ZGR 7 (1978), S. 119 (127 ff.), wonach der Gesellschafterversammlung bei einem Schweigen des Gesellschaftsvertrages nur eine Richtlinienkompetenz zukommen soll. 82 Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (144). 83 Raiser, in: Hachenburg, GmbHG, § 52, Rn. 143; Mann, Gesellschaft, S. 208; Ehlers, Privatrechtsform, S. 134; Engel, Grenzen und Formen, S. 162 f.; v. Danwitz, AöR 120 (1995), S. 595 (626). 84 Vgl. dazu bereits die Nachweise vorstehend Fn. 62. Entsprechende Weisungsrechte gegenüber der Geschäftsführung zugunsten der Gemeinde statuieren § 104 Abs. 2, Abs. 1 S. 4 BbgGO; § 71 Abs. 2, Abs. 1 S. 5 MVKV; § 88 Abs. 1 S. 6, Abs. 3 RPGO; § 119 Abs. 3 S. 1, Abs. 1 S. 5 SAGO; § 104 Abs. 2, 25 Abs. 1 SHGO; § 74 Abs. 3 S. 2, Abs. 1 S. 1 ThürKO. § 125 Abs. 2 S. 1 HeGO setzt ein solches gesellschaftsvertragliches Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführung voraus. Nach Art. 93 Abs. 2 S. 3 BayGO soll die Gemeinde auf die gesellschaftsvertragliche Vereinbarung eines solchen Weisungsrechts hinwirken. 85 Winter, in: Scholz, GmbHG, § 14, Rn. 19 ff.; Ulmer, in: Hachenburg, GmbHG, § 5, Rn. 177; Schneider, in: Scholz, GmbHG, § 37, Rn. 32; Mann, Gesellschaft, S. 214; Engellandt, DÖV 1996, S. 71 (73); Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (143). 86 Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (143); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 26 II, S. 1072; Ulmer, in: Hachenburg, GmbHG, § 6, Rn. 18.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
45
Diese fachlichen und personellen Weisungsrechte werden vielfach als ein besonderer Vorteil der Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihr Fehlen als Nachteil der Rechtsform der Aktiengesellschaft für den staatlichen Anteilseigner gewertet.88 Teilweise wird ein „Einflußknick“89 des Staates im Rahmen der Organisationsverfassung einer Aktiengesellschaft konstatiert.90 Dennoch dient das Kriterium der Anteilsmehrheit verbreitet als zentrales Argument zur Feststellung einer staatlichen Entscheidungsherrschaft sowohl in bezug auf Aktiengesellschaften als auch in bezug auf Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Die Überwachungs- und Informationsrechte des Aufsichtsrates, sowie eventuelle Zustimmungsvorbehalte vorstehend genannter Art und insbesondere die Personalentscheidungen der Aktionäre in der Hauptversammlung zur Wahl des Aufsichtsrates in Kombination mit den bereits erwähnten faktischen Abhängigkeiten der Aufsichtsratsmitglieder werden als so effektiv angesehen, daß nach wertender Gesamtbetrachtung ein „beherrschender Einfluß“ des beteiligten staatlichen Rechtssubjektes anzunehmen sei.91 2. Unternehmensgegenstand Im folgenden soll ein weiteres – rechtliches – Steuerungsinstrument staatlicher Anteilseigner in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen auf seine Effektivität hin untersucht werden.
87 Zurückhaltend auch Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (143); Mann, Gesellschaft, S. 214. Letzterer weist zugleich darauf hin, daß von solchen Zustimmungs- und Weisungsrechten „im Interesse der Selbständigkeit der Geschäftsführung nur restriktiv Gebrauch gemacht werden“ sollte. Vgl. ebenso Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (323 f.), wonach im Selbstverständnis öffentlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen das „Idealbild des privatwirtschaftlichen Managers“ vorherrsche. Ebenso Britz, NVwZ 2001, S. 380 (387). 88 Storr, Staat, S. 65 weist darauf hin, daß die fachliche Weisung „das ideale Steuerungsinstrument“ sei. Ebenso R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (358). Vgl. dazu auch § 103 Abs. 3 BWGO; § 108 Abs. 3 NrWGO; § 87 Abs. 2 RPGO und § 95 Abs. 2 SächsGO, die einen Nachrang der Aktiengesellschaft gegenüber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung statuieren, und Keller, in: Articus/Schneider, NrWGO, Erl. § 108 GO, Rn. 6. 89 Begriff nach F. Wagener, in: ders. (Hrsg.), Verselbständigung, S. 31 (41). 90 Vgl. nur R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (358); Koch, Status, S. 167, 188 f.; Mann, Gesellschaft, S. 265 ff.; Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (218). Nach Zimmermann, Schutzanspruch, S. 250 sei die GmbH aufgrund der stärkeren Einflußnahmemöglichkeiten „eher als die AG der staatlichen Verwaltung zurechenbar“. 91 Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 164; R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (358 ff.); Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften, S. 221 ff. Das Bundesverfassungsgericht geht ohne weitere Begründungen von einer staatlichen Entscheidungsherrschaft aus (BVerfG, NJW 1990, S. 1783).
46
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Eine Entscheidungssteuerung im Sinne einer Steuerung der Alternativenwahl kann auch dadurch erreicht werden, daß inhaltliche Zielvorgaben,92 die als Entscheidungsmaßstäbe fungieren, gesetzt werden.93 Die Instrumentalisierung eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens durch den staatlichen Anteilseigner erfolgt in diesem Fall nicht im Wege der Auswahl des in den Gesellschaftsorganen und für diese entscheidenden Personals, sondern durch die Verpflichtung der Gesellschaftsorgane, bestimmte, inhaltlich vorgegebene Entscheidungen zu treffen. Entscheidungsvorgabe für die in einem Unternehmen entscheidenden Rechtssubjekte ist die gesellschaftsvertragliche Regelung über den Gegenstand des Unternehmens i. S. v. § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG, § 3 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG. Der Unternehmensgegenstand ist der Wirtschaftsbereich, in dem die Gesellschaft nach der bei Abschluß des Gesellschaftsvertrages von den Gesellschaftern erzielten Übereinkunft ihre Tätigkeit entfalten soll.94 Fraglich ist, ob und inwieweit der Unternehmensgegenstand eine zwingende Entscheidungsvorgabe für die Gesellschaftsorgane ist. Zum einen dient die Angabe des Gesellschaftsgegenstandes nach verbreiteter Ansicht der Information der Teilnehmer am Rechtsverkehr. Die beteiligten Verkehrskreise sollen sich ein Bild vom Schwerpunkt der Tätigkeit des Unternehmens machen können.95 Der gesellschaftsvertraglich vereinbarte Gegenstand ist nach verbreiteter Ansicht darüber hinaus aber auch „eine verbindliche Vorgabe für die Organe“96 der Gesellschaft (vgl. § 82 Abs. 2 AktG u. § 37 Abs. 1 GmbHG). Der Gegenstand eines Unternehmens soll im Innenverhältnis die Geschäftsführungsbefugnis des Geschäftsführungsorgans beschränken.97 So ist der Unternehmensgegen92 Zielvorgaben enthalten Verpflichtungen der Gesellschaft, die Entscheidungen an dem jeweiligen Ziel zu orientieren. Rechtlich fixiert werden diese Zielvorgaben u. a. im Unternehmensgegenstand. Zur Bedeutung des Unternehmensgegenstandes für die Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen siehe noch unten Zweiter Teil, S. 130 ff. 93 Zur Steuerung öffentlicher Unternehmen durch Zielvorgaben vgl. nur Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 ff.; ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 ff.; Greiling, Trägerschaft, S. 122 ff.; dies., ZögU 19 (1996), S. 286 ff.; Engellandt, Einflußnahme der Kommunen, S. 28; Krönes, ZögU 21 (1998), S. 277 ff. Nach Krebs, Kontrolle, S. 32 ist „die Festlegung des mit der Entscheidung intendierten Zweckes (oder der Zwecke) notwendiges Element eines staatlichen Entscheidungsprozesses“ (Hervor. i. O.). 94 Vgl. nur BGHZ 127, S. 176 (179); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 4 II, S. 65 f.; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 10, Rn. 12, § 11, Rn. 8; Hüffer, Aktiengesetz, § 23, Rn. 21; Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, § 3, Rn. 5 f. 95 Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, § 3, Rn. 6; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 10, Rn. 12; Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 73 ff. 96 BGHZ 127, S. 176 (179 f.); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 4 II, S. 66 m. w. N. in Fn. 42; Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 80 ff. m. w. N. in Fn. 123. 97 BGHZ 127, S. 176 (180); Hommelhoff, ZHR 143 (1979), S. 288 (310 f.); Raiser/ Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 10, Rn. 12; Schön, ZGR 25 (1996), S. 429 (441 f.); Habersack, ZGR 25 (1996), S. 544 (551).
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
47
stand einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung Grenze der Geschäftsführungsbefugnis des Vorstands.98 Trifft z. B. der Vorstand einer Gesellschaft Entscheidungen, die von ihrem Entscheidungsbereich her außerhalb des Gegenstandes des Unternehmens liegen, dann liegt in diesem Überschreiten der gesellschaftsvertraglichen Entscheidungsvorgabe eine Pflichtverletzung des Organs, die Abwehr- und Schadensersatzansprüche auslösen kann.99 Diese Zielvorgaben im Gesellschaftsvertrag kann der staatliche Anteilseigner zur Steuerung unternehmerischer Entscheidungen nutzen. Bestimmt er den Tätigkeitsbereich der Gesellschaft, bestimmt er zugleich insoweit die Alternativenwahl der geschäftsführenden Organe. Diese inhaltliche Steuerung erfolgt auf die staatlichen Entscheidungsziele hin, die hier an dieser Stelle beschreibend „öffentliche Aufgaben“100 genannt werden sollen. Wird die „öffentliche Aufgabe“ als Unternehmensgegenstand in der Satzung fixiert, dann sind die Gesellschaftsorgane verpflichtet, ihre Entscheidungen an den Vorgaben des „öffentlichen“ Unternehmensgegenstandes auszurichten. Verbreitet wird allerdings darauf hingewiesen, daß eine solche Fixierung der öffentlichen Aufgabe im Unternehmensgegenstand in der Praxis zumeist nicht erfolge.101 Der Unternehmensgegenstand enthält vielmehr lediglich mehr oder weniger konkrete102 Beschreibungen von dem Gebiet, auf dem die Gesellschaft tätig werden soll, der Branche, und der Art der Tätigkeit (z. B. Handel oder Produktion),103 ohne auf eine besondere „öffentliche“ Zielsetzung abzustellen. Die Umschreibung des Unternehmensgegenstandes ist daher meist zweckneutral.104
98 Hüffer, Aktiengesetz, § 23, Rn. 21, § 82, Rn. 9; Lutter/Hommelhoff, in: dies., GmbH-Gesetz, § 37, Rn. 3; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 234 f.; Habersack, ZGR 25 (1996), S. 544 (552). 99 § 93 Abs. 2 AktG. Vgl. dazu nur Hommelhoff, ZHR 143 (1979), S. 288 (310 f.). Ausführlich auch Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 321 ff. 100 Zum Begriff der öffentlichen Aufgabe vgl. ausführlich unten S. 82 ff. 101 Greiling, Trägerschaft, S. 127 zu den Gründen dafür. Vgl. auch Mann, Gesellschaft, S. 187 ff. m. w. N.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 22. 102 § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG fordert nähere Angaben („. . . näher anzugeben“). Was nähere Angaben sind, bleibt allerdings offen. Vgl. hierzu nur Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 100 ff. Auch nach Püttner, Verwaltungslehre, S. 342 werden öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen „Ziele nur ungenau oder gar nicht vorgegeben, indem z. B. nur die Sachaufgabe . . . genannt und im übrigen an den Sachverstand der Verwalter appelliert wird. Verständlicher Weise entwickeln die zuständigen Amtsträger dann eigene Zielvorstellungen, deren Inhalt und deren Erreichung von Seiten der übergeordneten Verwaltung unkontrolliert bleibt“. 103 Vgl. dazu nur Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 99. 104 Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, § 1, Rn. 3; Emmerich, in: Scholz, GmbHG, § 1, Rn. 2, 2a; Dreher, ZHR 155 (1991), S. 349 (357); Leisner, WiVerw 1983, S. 212 (222); Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 268; Mann, Gesellschaft, S. 184.
48
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Teilweise wird daher gefordert, die „öffentliche Aufgabe“ als sogenannten Unternehmenszweck in der Satzung der jeweiligen Gesellschaft zu fixieren.105 Der Unternehmenszweck sei das einheitsbildende Merkmal, daß eine Summe von Entscheidern zu einer Einheit, zu einem Verband mache.106 Er sei die „Geschäftsgrundlage“ der Gesellschaft, die nur mit Zustimmung aller Gesellschafter zulässig geändert werden könne.107 Es ist die abstrakteste Zielsetzung der Gesellschaft. Der Begriff des Unternehmenszwecks wird weder vom AktG noch vom GmbHG definiert.108 § 1 AktG spricht vom „Zweck“, meint aber nach verbreiteter Ansicht auch den „Gegenstand“. Die gesetzliche Begriffsverwendung ist nicht einheitlich.109 Nach verbreiteter Ansicht unterscheiden sich Unternehmensgegenstand und Unternehmenszweck dadurch, daß der Gegenstand das Mittel zur Erreichung des Unternehmenszwecks sei.110 Es stellt sich die Frage, was ein „öffentlicher Zweck“ ist, und ob und inwieweit es staatliche Zielsetzungen gibt, die sich von privaten Zielsetzungen unterscheiden. Verbreitet werden diese staatlichen Zielsetzungen mit dem Begriff der Leistungsverwaltung umschrieben und in einen Gegensatz zur sogenannten Erwerbswirtschaft und gewinnorientiertem Entscheiden gesetzt.111 Zur Kennzeich105 Mann, Gesellschaft, S. 183 ff. Die Gemeindeordnungen verpflichten die beteiligten Kommunen in unterschiedlichen Formulierungen zu einer Ausrichtung ihrer unternehmerischen Entscheidungen am „öffentlichen Zweck“: Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayGO; § 102 Abs. 1 Nr. 1 BbgGO; § 102 Abs. 1 Nr. 1 BWGO; § 121 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HeGO; § 69 Abs. 1 Nr. 2 MVKV; § 109 Abs. 1 Nr. 5 NdsGO; § 108 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 NrWGO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 RPGO; § 108 Abs. 1 Nr. 1 SaarlKSVG; § 117 Abs. 1 Nr. 2 SAGO; § 101 Abs. 1 Nr. 1 SHGO; § 71 Abs. 1 Nr. 1 ThürKO. So auch § 65 Abs. 1 Nr. 1 BHO und die entsprechenden Vorschriften der LHOen. § 95 Abs. 1 Nr. 1 SächsGO fordert, daß „durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde sichergestellt ist“. 106 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 4 I, S. 60. 107 K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 4 I, S. 60. 108 § 1 GmbHG nennt den Begriff des Zwecks, meint hier aber wohl auch den Unternehmensgegenstand. Vgl. nur Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, § 1, Rn. 2. 109 Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 11 ff. 110 Emmerich, in: Scholz, GmbHG, § 1, Rn. 2a; Hueck, in: Baumbach/ders., GmbHG, § 1, Rn. 5; Mann, Gesellschaft, S. 184 m. w. N. in Fn. 51. Vgl. auch Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 90. 111 Diese Unterscheidung ist angelehnt an die Lehre vom Verwaltungsprivatrecht. Danach soll die Verwaltung je nach Tätigkeitsbereich drei unterschiedlichen Rechtsregimen unterworfen sein. So sei ein Träger öffentlicher Verwaltung, der „als Fiskus“ am wettbewerblichen Wirtschafts- und Erwerbsleben teilnimmt, an das allgemeine Privatrecht gebunden. Die unmittelbare Verfolgung genuiner Verwaltungsaufgaben in den Rechtsformen des Privatrechts, die sogenannte Leistungsverwaltung, sei dem Verwaltungsprivatrecht unterworfen. Vgl. dazu Hans J. Wolff, in: ders./Bachof, VerwR I9, § 23 II; ebenso Menger, in: FS Hans J. Wolff, S. 249 (163); Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 ff. Vgl. auch z. B. BGHZ 29, S. 76 (80, 81); 91, S. 84 (96). Diese Aufgabentypen wurden für die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft fruchtbar gemacht. Vgl. dazu nur Badura, DÖV 1966, S. 624 ff.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
49
nung der staatlichen Zielvorgaben finden sich auch die Begriffe der Daseinsvorsorge112 und der Gemeinwohlverwirklichung.113 Ob es einen solchen Dualismus zwischen staatlichen und privaten Zielvorgaben tatsächlich gibt, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben.114 Jedenfalls ist eine solche staatliche Zielsetzung im Unternehmensgegenstand notwendig abstrakt, um auf eine Vielzahl von Einzelentscheidungen Anwendung finden zu können und dem Geschäftsführungsorgan zugleich hinreichenden Spielraum für seine Entscheidungen zu gewähren.115 Darüber hinaus kann auch ein Interesse der Gesellschaft daran bestehen, Einzelheiten der beabsichtigten Tätigkeit geheim zu halten.116 Der Markterfolg von Unternehmen kann auf seinen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen beruhen.117 Neben diesen Aspekten sprechen möglicherweise auch rechtliche Gründe gegen eine Fixierung konkreter „öffentlicher“ Unternehmensziele im Gesellschaftsvertrag. So sei nach verbreiteter Ansicht eine solche Fixierung jedenfalls im Fall der Aktiengesellschaft gesellschaftswidrig. Zwar sei der Vorstand gemäß § 82 Abs. 2 AktG durch den Unternehmensgegenstand in seiner Geschäftsführungsautonomie beschränkt, diese aus § 76 Abs. 1 AktG abgeleitete Leitungsautonomie des Vorstandes stelle allerdings zugleich eine Grenze für die Hauptversammlung zur inhaltlichen Bindung des Vorstandes dar.118
112 Vgl. nur BGHZ 52, S. 325 (328 f.); 65, S. 284 (287); BVerfG, NJW 1990, S. 1783. Ausführlich dazu noch unten Erster Teil, S. 82 ff. 113 Vgl. Isensee, in: HdBStR III, § 57, Rn. 18, 134 und die Nachweise unten Erster Teil, S. 83, Fn. 299. 114 Vgl. dazu noch unten Erster Teil, S. 85 ff. 115 Vgl. dazu nur BGH, BB 1981, S. 450 (450), wonach im Hinblick auf ein zu respektierendes Interesse an der Erhaltung weitgehender Flexibilität und der Geheimhaltung der Einzelheiten der beabsichtigten Tätigkeit die Angabe des Kernbereichs der beabsichtigen Aktivitäten zur Befriedigung des Informationsbedürfnisses des Verkehrs genügen müsse. Vgl. auch Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 109 ff., insbes. S. 128; Raiser, ZHR 144 (1980), S. 206 (221 f.). 116 BGH, BB 1981, S. 450 (450). Zur Bedeutung von Geheimhaltungsinteressen hinsichtlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen „bei verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen um die Offenlegung von Geheimnissen regulierter Unternehmen“ jüngst v. Danwitz, DVBl. 2005, S. 597 (597 ff.). 117 So ausdrücklich v. Danwitz, DVBl. 2005, S. 597 (598, 600 f.) mit ausführlichen Rechtsprechungsnachweisen in Fn. 12 ff. 118 Einen ausführlichen Überblick über den Meinungsstand gibt Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 137 ff. m. w. N. Vgl. ebenso v. Trott zu Solz, Aktiengesellschaft, S. 40 ff., der die Ansicht vertritt, daß neben der Bestimmung des Unternehmensgegenstandes auch das Unternehmensziel umfassend zur Disposition der Gesellschafter stehe. Einschränkender Dreher, ZHR 155 (1991), S. 349 (357 ff.); Schön, ZGR 25 (1996), S. 429 (436 ff.); Habersack, ZGR 25 (1996), S. 544 (553). Vgl. aus der die öffentlichen und gemischtwirtschaftlichen Unternehmen betreffenden Literatur Kermel, Steuerungsmöglichkeiten, S. 108 ff.; Engellandt, Einflußnahme, S. 29.
50
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Anders stellt sich dagegen die Rechtslage im Fall der Gesellschaft mit beschränkter Haftung dar. Hier kann die Gesellschaftsversammlung sogar über Routinefragen der Geschäftsführung entscheiden.119 Doch auch in diesem Fall zwingen die erforderliche Flexibilität der Entscheider sowie mögliche Geheimhaltungsinteressen zu einer abstrakten Fassung des Unternehmenszwecks. Die inhaltlichen Vorgaben des Unternehmensgegenstandes können lediglich eine inhaltliche Mindeststeuerung durch den Staat bewirken. Eine Totalsteuerung würde sachangemessene Entscheidungen im Einzelfall unmöglich machen. Diese notwendige Abstraktheit gesellschaftsvertraglicher Regelungen über den Unternehmensgegenstand spricht gegen die Eignung öffentlicher Zielvorgaben als effektives Steuerungsinstrument des Staates. Je abstrakter eine Zielvorgabe ist, desto unbestimmter120 ist sie auch. Dies hat zur Folge, daß das notwendige Mindestmaß an inhaltlicher Steuerung nicht erreicht werden kann. Dementsprechend wird verbreitet konstatiert, daß in der Praxis in den allermeisten Fällen eine solche Fixierung eines öffentlichen Zwecks im Gesellschaftsvertrag nicht erfolgt.121 Die Regelungen beschränken sich vielmehr darauf, den Unternehmensgegenstand zu nennen.122 Es wird darauf hingewiesen, daß, soweit gesellschaftsvertragliche Regelungen tatsächlich einen öffentlichen Zweck statuieren, diese Klauseln in der Praxis nicht im erwünschten Umfang umgesetzt werden.123 So werde die Unternehmenstätigkeit trotz Fixierung einer Gemeinwohlklausel vorrangig am Erwerbsinteresse ausgerichtet.124 Als effekti119 Vgl. nur OLG Düsseldorf, ZIP 1984, S. 1476 (1478); Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG, § 37, Rn. 6; Mertens, in: Hachenburg, GmbHG, § 37, Rn. 19. 120 Kritisch deshalb Greiling, ZögU 19 (1996), S. 286 (293 ff.); Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (314); ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 (142); Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (142); Habersack, ZGR 25 (1996), S. 544 (553). 121 Kritisch deshalb Vitzthum, AöR 104 (1979), S. 580 (631); Janson, Rechtsformen, S. 202 f.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 273; Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1073); H. Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 259 f.; Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (478); Wahl, in: Hennecke (Hrsg.), Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung, S. 15 (23, 34); Engellandt, Einflußnahme, S. 29. 122 Püttner, in: ders. (Hrsg.), Reform, S. 143 (155); Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (314 ff.); Machura, Kontrolle, S. 65 f.; Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (142); Krönes, ZögU 21 (1998), S. 277 (287 ff.); Mann, Gesellschaft, S. 188 m. w. N.; Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (insbes. S. 330); ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 (144 f.); Janson, Rechtsformen, S. 46 ff. Beispiele aus den Satzungen großer Energieversorgungsunternehmen bei Kermel, Steuerungsmöglichkeiten, S. 105 ff. Storr, Staat, S. 64 weist darauf hin, daß eine übermäßig detaillierte Zielsetzung die Flexibilität des Unternehmens beeinträchtigt und deshalb in der Regel unerwünscht sei. Nach Janson, a. a. O., S. 48 sei „die Zielbestimmung für öffentliche Unternehmen ein dynamischer Prozeß“. 123 Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 52 f.; ders., Verwaltungslehre, S. 354 f.; Machura, Kontrolle, S. 75 f.; Krönes, ZögU 21 (1998), S. 277 (290). Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (315 ff.) weist auf „Zielverwässerungen“ und „Prozesse der Zielveränderung“ hin. 124 Vgl. auch Mann, Gesellschaft, S. 188 m. w. N.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
51
ves Beherrschungsinstrument scheidet die Fixierung eines „öffentlichen“ Unternehmensgegenstandes bzw. -zwecks im Gesellschaftsvertrag einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft damit aus. 3. Zwischenergebnis Nach verbreiteter Ansicht hat die staatliche Anteilsmehrheit zentrale Bedeutung für die Bewertung staatlicher Einflußnahmemöglichkeiten. Im Fall der Aktiengesellschaft ist es hierbei entscheidend, welche Bedeutung man der Steuerung der Personalpolitik durch den Mehrheitsaktionär in der Hauptversammlung zumißt. Es hat sich gezeigt, daß die Möglichkeiten rechtlicher Steuerung der von staatlichen Rechtsträgern gewählten oder entsandten Aufsichtsratsmitglieder begrenzt sind. Geht man allerdings davon aus, daß die Beeinflussung der Personalentscheidungen zumindest faktisch eine Entscheidungsherrschaft in der Sache nach sich zieht,125 dann spiegeln die Anteilsverhältnisse die bestehenden Machtverhältnisse in einem Unternehmen wider. Das Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung stellt dagegen umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten für den staatlichen Anteilseigner zur Verfügung. Insbesondere die Erteilung von Weisungen an den Aufsichtsrat und Vorstand ist hierbei zu erwähnen. Es zeigt sich also, daß das Kriterium des staatlichen Mehrheitsbesitzes ergänzt werden muß um sonstige Einflußfaktoren. Ob im Einzelfall tatsächlich eine staatliche Entscheidungsherrschaft vorliegt, kann erst beantwortet werden, wenn weitere Möglichkeiten der Einflußnahme auf unternehmerische Entscheidungen auf ihre „Effektivität“ hin untersucht worden sind. II. Aktienkonzernrechtliche Steuerungsinstrumente Das Aktienkonzernrecht eröffnet möglicherweise weitere Steuerungsinstrumente für den staatlichen Anteilseigner.126 Die an einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft beteiligte Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts ist als Inhaberin gesellschaftlicher Beteiligung „Unternehmen“ im Sinne von § 17 Abs. 1 AktG.127 Eine Gebietskörperschaft 125 So z. B. Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 36 ff., 41; Koch, Status, S. 165. Siehe oben S. 41 f. 126 Nach überwiegender Ansicht kann der Vertragskonzern auch eine GmbH als herrschendes und/oder abhängiges Unternehmen beherbergen. Vgl. dazu nur BGHZ 105, S. 324 (330 ff.); Habersack, in: Emmerich/ders., Konzernrecht, S. 6, 413 ff. 127 BGHZ 69, S. 334 (336 ff.) – VEBA/Gelsenberg; vgl. auch BGHZ 135, S. 107 (113 f.). Vgl. dazu Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 212 ff.; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 51, Rn. 4 ff.; Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (462 ff.); v. Mutius/Nesselmüller, NJW 1976, S. 1878; Ehlers, Pri-
52
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
kann damit auch „herrschendes Unternehmen“ im Sinne von §§ 17 Abs. 2, 291 Abs. 1, 308 AktG sein, Beherrschungsverträge im Sinne von § 291 Abs. 1 AktG mit einem abhängigen Unternehmen schließen und so den Vorstand einer Weisungsbindung unterwerfen (§ 308 AktG). In diesem Fall liegt ein sogenannter Vertragskonzern vor.128 Die daraus folgende Pflicht zur Verlustübernahme gemäß § 302 Abs. 1 AktG verstößt allerdings nach verbreiteter Ansicht gegen die Vorschriften des Haushalts- und Kommunalrechts.129 So sieht § 65 Abs. 1 Nr. 2 BHO eine Verpflichtung zur Haftungsbegrenzung vor ebenso wie die Vorschriften der Gemeindeordnungen.130 Dementsprechend sind die vorstehend genannten Beherrschungsverträge in der Praxis selten geblieben.131 Die konzernrechtlichen Möglichkeiten der staatlichen Einflußnahme auf die Sachentscheidungen eines Unternehmens sollen daher – selbst wenn man sie für kommunal- und haushaltsrechtlich zulässig hält132 – im folgenden vernachlässigt werden.133
vatrechtsform, S. 139 ff.; Mann, Gesellschaft, S. 215 ff.; Koch, Status, S. 169; ders., DVBl. 1994, S. 667 (668 ff.); Engellandt, Einflußnahme, S. 38 ff. 128 Vgl. nur Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 49. 129 Vgl. dazu nur Schallemacher, Bundesunternehmen, S. 578 ff.; Zimmermann, JuS 1991, S. 294 (299). Anders dagegen Koch, Status, S. 175 ff.; ders., DVBl. 1994, S. 667 (670 f.) und R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (360), die eine „teleologische Reduktion“ der haushalts- und kommunalrechtlichen Vorschriften vorschlagen. Differenzierend in bezug auf diejenigen Vorschriften der Gemeindeordnungen, nach denen sich die Gemeinde nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten darf (Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BayGO; § 102 Nr. 3 BbgGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BWGO; § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HeGO; § 69 Abs. 1 Nr. 4 MVKV; § 109 Abs. 1 Nr. 4 NdsGO; § 108 Abs. 1 Nr. 5 NrWGO; § 87 Abs. 1 Nr. 6 RPGO; § 110 Abs. 1 Nr. 2 SaarlKSVG; § 96 Abs. 1 Nr. 3 SächsGO; § 117 Abs. 1 Nr. 4 SAGO; § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 SHGO; § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 ThürKO), Mann, Gesellschaft, S. 221 f. 130 Vgl. dazu bereits vorstehend Fn. 129. 131 Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 236; Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (140); Mann, Gesellschaft, S. 219 m. w. N. in Fn. 234. Die zwischen kommunaler Gebietskörperschaft und Gesellschaft des Privatrechts verbreitet geschlossenen sogenannten Betriebsführungsverträge sind keine Beherrschungsverträge (ihre Einordnung ist umstritten, vgl. dazu nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 31 III, S. 949 f.). Zu diesen Betriebsführungsverträgen vgl. noch ausführlich unten Zweiter Teil, S. 168 ff. 132 Vgl. oben Fn. 127. 133 Liegt kein Beherrschungsvertrag im Sinne von § 291 Abs. 1 AktG trotz eines Abhängigkeitsverhältnisses im Sinne von § 17 Abs. 2 AktG vor (sogenannter faktischer Konzern), kommt § 311 Abs. 1 AktG zur Anwendung. Umstritten ist hierbei, ob § 311 AktG eine Befolgungspflicht des Vorstandes gegenüber Weisungen der Gebietskörperschaft zu entnehmen ist oder er zumindest eine solche ausnahmsweise toleriert. Dies wird verbreitet verneint. Vgl. nur Mertens, in: Kölner Kommentar, § 76, Rn. 56; Habersack, in: Emmerich/ders., Konzernrecht, S. 369; Hommelhoff, Konzernleitungspflicht, S. 113 ff.; Hommelhoff/Schmidt-Aßmann, ZHR 160 (1996), S. 521 (555 f.); Ehlers, Privatrechtsform, S. 143 f.; Mann, Gesellschaft, S. 224 f.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
53
III. Sonstige Steuerungsinstrumente Um das Vorliegen einer staatlichen Entscheidungsherrschaft, ihrerseits vermittelt durch eine staatliche Anteilsmehrheit, im Einzelfall feststellen zu können, muß ausgeschlossen sein, daß nicht andere Einflußlinien einer solchen staatlichen Herrschaftsstellung entgegenwirken. Eine wertende Betrachtung staatlicher Einflußfaktoren muß immer eine Gesamtbetrachtung aller Steuerungsinstrumente und Entscheidungsfaktoren sein. Es ist daher im folgenden ein kurzer Überblick über die sonstigen Steuerungsinstrumente staatlicher Organisationseinheiten gegenüber gemischtwirtschaftlichen Unternehmen zu geben. 1. Kontrolle Verbreitet wird die sogenannte Kontrolle öffentlicher und gemischtwirtschaftlicher Unternehmen als ein Mittel zu Instrumentalisierung derselben durch den Staat diskutiert.134 Kontrolle ist ein Vergleich von Entscheidungsalternativen – dem Ist-Wert – mit Entscheidungsmaßstäben – dem Soll-Wert.135 Es gibt verschiedene Kontrollinstanzen, die Entscheidungen gemischwirtschaftlicher Unternehmen und die Entscheidungen der beteiligten staatlichen Rechtssubjekte kontrollieren. Diese Kontrollinstanzen sind neben dem Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung insbesondere Abschlußprüfer i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG,136 §§ 316 ff. HGB und die Bundes- und Landesrechnungshöfe i. S. v. § 44 HGrG, § 92 Abs. 1 BHO und den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften.137 Die verschiedenen Kontrollinstanzen vergleichen die Entscheidungsalternativen des Unternehmens bzw. des staatlichen Beteiligten mit bestimmten Entscheidungsmaßstäben. Die Entscheidungsmaßstäbe des Unternehmens bilden also zugleich auch die Kontrollmaßstäbe der jeweiligen Kontrollinstanz. Kontrollmaßstäbe der Rechnungshöfe sind – so wird § 92 BHO verbreitet ausgelegt – 134 Vgl. nur Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 ff.; ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 ff.; Mann, Gesellschaft, S. 230 ff.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 166 ff.; Greiling, Trägerschaft, S. 150 ff.; Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (581 ff.). 135 Krebs, Kontrolle, S. 5, 34; Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (312). Dieser Begriff der Kontrolle ist nicht zu verwechseln mit dem Begriff der Kontrolle in § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB i. S. e. Ausübung „bestimmenden Einflusses“. 136 Ausführlich dazu Mann, Gesellschaft, S. 230 ff.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 166 ff.; Greiling, Trägerschaft, S. 150 ff.; Puhl, Budgetflucht, S. 374 ff. 137 Vgl. nur Art. 92 Abs. 1 BayHO; § 92 Abs. 1 BbgGO; § 92 Abs. 1 BWHO; § 92 Abs. 1 HeHO. Ausführlich zur sogenannten Betätigungsprüfung der Rechnungshöfe Mann, Gesellschaft, S. 235 ff.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 168 f.; Greiling, Trägerschaft, S. 159 ff.; Puhl, Budgetflucht, S. 386 ff.
54
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
z. B. die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung des jeweiligen staatlichen Rechtssubjekts an privatrechtlich organisierten Unternehmen.138 Kontrollmaßstab des Abschlußprüfers ist z. B. gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG die „Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung“. Letzteres beinhaltet die Prüfung, ob die Geschäftsführung des Unternehmens kaufmännischen Grundsätzen entsprach und ob sie in Übereinstimmung mit dem Gesetz und dem Gesellschaftsvertrag stand.139 Die Kontrolle durch die Abschlußprüfer und Rechnungshofbehörden soll also dazu dienen, insbesondere140 die Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung, also die Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit sicherzustellen. Deshalb flankiert die Kontrolle als Steuerungsinstrument die Steuerung der Unternehmensentscheidungen durch die Entscheidungsvorgaben „Wirtschaftlichkeit“ und „Rechtmäßigkeit“ unternehmerischer Tätigkeit. Die spezifische Steuerungsfunktion staatlicher Kontrolle besteht darin, „staatliche Sanktionsentscheidungen strafrechtlicher, haftungsrechtlicher oder politischer Art mitzubestimmen“.141 So werden die jeweiligen Kontrollergebnisse im Fall der Abschlußprüfung den Leitungs- und Aufsichtsorganen der Kapitalgesellschaft, gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 3 HGrG den Gebietskörperschaften und gemäß § 69 S. 1 Nr. 3 BHO sowie den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften den Rechnungshöfen übersandt.142 Kommunalrechtliche Vorschriften sehen teilweise auch, soweit der kommunalen Gebietskörperschaft mehr als 50 Prozent der Anteile an einem Unternehmen gehören, eine öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses vor.143 Gemäß § 85 Nr. 3 BHO und den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften ist der Jahresabschluß als Anlage zum Haushaltsplan des beteiligten staatlichen Rechtsträgers beizufügen.144 138 § 65 Abs. 1 BHO und die entsprechenden LHOen. Vgl. dazu Mann, Gesellschaft, S. 236; Ehlers, Privatrechtsform, S. 168 f.; Puhl, Budgetflucht, S. 386 ff. 139 Vgl. nur Ehlers, Privatrechtsform, S. 167; Puhl, Budgetflucht, S. 381 ff. 140 Zu den weiteren Kontrollmaßstäben vgl. nur § 53 Abs. 1 Nr. 2 und 3 HGrG. 141 Krebs, Kontrolle, S. 175 f. in bezug auf die Funktion einer nachträglichen Rechnungshofkontrolle. 142 Ausführlich zu den Adressaten der Prüfergebnisse Mann, Gesellschaft, S. 237 ff. 143 § 105 Abs. 1 Nr. 2b BWGO; § 73 Abs. 1 Nr. 1b MVKV; § 108 Abs. 2 Nr. 1c NrWGO; § 90 Abs. 1 S. 2 RPGO; § 118 Abs. 1 SAGO; § 43 Abs. 4 SHGO. § 75 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ThürKO ordnet an, daß „die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Jahresabschluss, in das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie in die beschlossene Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrags besteht und ortsüblich auf die Möglichkeit der Einsichtnahme hingewiesen wird“. Die sonstigen Gemeindeordnungen sehen lediglich die öffentliche Bekanntmachung oder die Möglichkeit der Einsichtnahme in den Beteiligungsbericht der Gemeinde vor. Dieser informiert über die Grundzüge der Geschäftsführungstätigkeit und z. B. über Kreditaufnahmen. So Art. 94 Abs. 3 S. 5 BayGO; § 105 Abs. 3 BbgGO; § 123a Abs. 1 S. 1 HeGO; § 116a S. 3 NdsGO; § 115 Abs. 2 SaarlKSVG; § 99 Abs. 3 S. 1 SächsGO.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
55
Die Prüfergebnisse der Rechnungshöfe werden gemäß § 96 Abs. 1 S. 1 BHO und den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften den zuständigen Dienststellen mitgeteilt. Über die Prüfergebnisse informieren zusammenfassend die Jahresberichte der Rechnungshofbehörden, die gemäß Art. 114 Abs. 1 GG und den entsprechenden landesverfassungsrechtlichen Vorschriften145 den Mitgliedern des Parlaments zugänglich gemacht werden. Findet sich keine Übereinstimmung der Alternativenwahl des Unternehmens bzw. des staatlichen Beteiligten mit der Alternativenwahl der Kontrollinstanz, kann bzw. muß der jeweilige Adressat des Prüfberichts rechtliche und/oder politische Konsequenzen ziehen, wobei der „Öffentlichkeitsdruck“ hierbei eine nicht unbedeutende Rolle spielen kann.146 Diese Steuerungsfunktion staatlicher Kontrolle im Wege der Mitbestimmung von Sanktionsentscheidungen wird ergänzt durch eine sogenannte „edukatorische Funktion“147 staatlicher Kontrollen. Die potentiellen rechtlichen oder politischen Sanktionsentscheidungen, die auf einen Verstoß des Entscheidenden gegen seine Entscheidungsmaßstäbe folgen, stellen schon im voraus sicher, daß der Entscheider sich an seinen Entscheidungsmaßstäben ausrichtet.148 Geht man davon aus, daß insbesondere die gesellschaftsvertragliche Statuierung eines Entscheidungsmaßstabes „öffentliche Aufgabe“ einer effektiven Steuerung unternehmerischer Entscheidungen dient,149 dann muß die Kontrolle gemischtwirtschaftlicher Unternehmen insbesondere in einem Vergleich unternehmerischer Entscheidungsalternativen mit dem Entscheidungsmaßstab der öffentlichen Aufgabe bestehen. Dementsprechend soll die Kontrolle gemischtwirtschaftlicher Unternehmen nach verbreiteter Ansicht dazu dienen, die Einhaltung der bereits oben150 erwähnten „öffentlichen Aufgabe“ bzw. „öffentlichen Zweckbindung“ durch das Unternehmen und den staatlichen Beteiligten zu gewährleisten.151 144
Vgl. dazu Mann, Gesellschaft, S. 237, Fn. 321. Art. 80 Abs. 1 S. 1 BayVerf; Art. 106 Abs. 2 S. 2 BbgVerf; Art. 83 Abs. 2 S. 4 BWVerf; Art. 144 S. 2 HeVerf; Art. 68 Abs. 5 MVVerf; Art. 86 Abs. 2 S. 2 NrWVerf; Art. 70 Abs. 1 S. 2 NdsVerf; Art. 120 Abs. 2 S. 4 RPVerf; Art. 106 Abs. 2 S. 4 SaarlVerf; Art. 100 Abs. 4 SächsVerf; Art. 97 Abs. 2 S. 2 SAVerf; Art. 56 Abs. 5 SHVerf; Art. 103 Abs. 3 S. 3 ThürVerf. 146 Vgl. dazu Mann, Gesellschaft, S. 239; Machura, Kontrolle, S. 295. 147 Krebs, Kontrolle, z. B. S. 177. 148 Krebs, Kontrolle, S. 177 m. w. N. in Fn. 55. 149 Vgl. nur Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 ff.; ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 ff. 150 Vgl. dazu bereits oben S. 46, Fn. 93. 151 Darsow, in: ders./Gentner/Glaser/Meyer (Hrsg.), Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, § 68, Rn. 2; Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 ff.; ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 ff.; Mann, Gesellschaft, S. 235 f., 240 ff.; Greiling, Trägerschaft, S. 150 ff. 145
56
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Die Effektivität der Kontrolle hängt also davon ab, ob und inwieweit die öffentliche Aufgabe im Einzelfall tatsächlich hinreichend bestimmter Entscheidungsmaßstab eines Unternehmens ist.152 Konkret formulierte Ziele sind Voraussetzung effektiver Kontrolle.153 Nur wenn der gesellschaftsvertragliche Entscheidungsmaßstab des Unternehmens der „öffentliche Zweck“ ist, kann die Kontrolle durch die Abschlußprüfer auch an diesem (Kontroll-)Maßstab ausgerichtet sein.154 Nur in diesem Fall kann die jeweilige Kontrollinstanz prüfen, ob der staatliche Beteiligte mit seinem unternehmerischen Engagement die öffentlichen Zwecke im Sinne der haushalts- und kommunalrechtlichen Vorschriften erreicht hat.155 Oben156 wurde allerdings festgestellt, daß eine gesellschaftsvertragliche oder gesetzliche Entscheidungsvorgabe „öffentlicher Zweck“ – soweit vorhanden – aufgrund seines abstrakten und unbestimmten Inhalts nicht dazu geeignet ist, unternehmerische und staatliche Entscheidungen zu determinieren. Deshalb ist auch die Kontrolle als Ergänzung der Steuerung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen durch staatliche Zielvorgaben zur Instrumentalisierung unternehmerischer Entscheidungen nur begrenzt geeignet. Kontrolle ist kein Steuerungsinstrument, das hinsichtlich seiner Effektivität über die Effektivität des Steuerungsinstruments der Zielvorgabe hinausgeht. Deshalb können sonstige Prüf- und Informationsverpflichtungen und -berechtigungen wie z. B. die Prüfung der privatrechtlichen Unternehmen durch die sogenannte Beteiligungsverwaltung157 oder sonstige Aufsichtsrechte wie z. B. die Banken- und Versicherungsaufsicht hier unerörtert bleiben ebenso wie die Beteiligungsberichte des Bundes und der Länder, in denen alle Unternehmensbeteiligungen den Abgeordneten und Ratsmitgliedern offen gelegt werden.158 Diese vorstehend genannten Prüf- und Informationsverpflichtungen und -berechtigungen sind also Instrumente zum Nachvollziehen der jeweiligen Entscheidungsvorgaben, eine Entscheidungsherrschaft staatlicher Rechtsträger über das jeweilige Unternehmen kann mit ihnen nicht erzeugt werden. 152
Vgl. dazu Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (311 ff.). Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (312); ders., in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 (141 f.); Püttner, Verwaltungslehre, S. 342. 154 Ehlers, Privatrechtsform, S. 167; zurückhaltender Mann, Gesellschaft, S. 233; Greiling, Trägerschaft, S. 157 ff. 155 Mann, Gesellschaft, S. 236; Ehlers, Privatrechtsform, S. 168 f.; Greiling, Trägerschaft, S. 162 f. 156 S. 50. 157 Vgl. dazu nur Ehlers, Privatrechtsform, S. 168; Puhl, Budgetflucht, S. 385 f.; Mann, Gesellschaft, S. 250 ff.; Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (589). 158 Siehe bereits die Nachweise oben S. 54, Fn. 143. Vgl. dazu z. B. Storr, Staat, S. 579 f. Einen Überblick über die verschiedenen sonstigen unternehmensexternen Prüfungen geben Greiling, Trägerschaft, S. 159 ff.; Mann, Gesellschaft, S. 240 ff.; Stober, NJW 1984, S. 449 (455 f.). 153
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
57
2. Rechtliche Rahmenordnung Neben den vorstehend genannten rechtlichen Steuerungsinstrumenten können auch sonstige Rechtssätze des öffentlichen Rechts wie z. B. rechtlich fixierte Genehmigungsvorbehalte Mittel zur Einflußnahme des Staates auf gemischtwirtschaftliche Unternehmensentscheidungen zur Verfügung stellen. Auch sind z. B. Auflagen in Zuwendungsbescheiden ein zusätzliches staatliches Steuerungsinstrument.159 So wird darauf hingewiesen, daß ein mehrheitlich oder sogar vollständig160 in privater Anteilshand liegendes Unternehmen in einem Maße staatlich subventioniert161 oder in sonstiger Weise finanziert werden kann, daß es seine Unternehmensentscheidungen aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder einer Auflage zum Subventionsbescheid an staatlichen Zielsetzungen orientiert.162 Darüber hinaus existieren allgemeine Maßnahmen der Steuer-, Sozial- oder Geldpolitik zur Steuerung unternehmerischer Entscheidungen.163 Auch die verschiedenen Maßnahmen der Wirtschaftlenkung164 und einfachgesetzliche Grenzen der Wettbewerbsfreiheit165 sind geeignet, unternehmerische Entscheidungsprozesse staatlich zu beeinflussen. Der Katalog verhaltensregelnder Rechtssätze ließe sich nahezu unbegrenzt erweitern.166 Diese Rechtssätze steuern unternehmerische Entscheidungen allerdings nur punktuell und lassen deshalb die (wertende) Annahme einer staatlichen Entscheidungsherrschaft nicht zu.
159
Beispiel nach Puhl, Budgetflucht, S. 43. In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne der in der Einleitung genannten Definition. 161 Diesen Aspekt betont R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (219 f.) mit Verweis auf Möller, Gemeindliche Subventionsverwaltung, S. 22 ff., 35 ff., 52 ff., 78 ff.; ders., Kommunale Wirtschaftsförderung, S. 32 ff., 89 ff., 116 ff., 167 ff. 162 Ehlers, Privatrechtsform, S. 11 ff. Schon in der Weimarer Republik hat der Staat durch Gewährung von Zuschüssen an private Unternehmen und durch an diese geknüpfte Bedingungen versucht, im öffentlichen Interesse liegende Zwecke zu erfüllen [Fleiner, Institutionen, S. 126 f. m. w. N.; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 30 ff.; R. Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S. 24 f.]. 163 Puhl, Budgetflucht, S. 42. 164 Vgl. dazu z. B. Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 44 f. Der Begriff umfaßt alle staatlichen Maßnahmen, die eine Einwirkung auf den wirtschaftlichen Prozeß hervorrufen sollen, um einen insbesondere wirtschafts- oder sozialpolitisch erwünschten Zustand des Wirtschaftslebens zu erreichen oder zu erhalten. Dies sind z. B. die Regelungen der Marktordnungen, aber auch die Vergabe von Subventionen. Ebenso BVerwGE 71, S. 183 (190); Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 30 I 1, S. 282. 165 So die Regelungen des UWG und des GWB. 166 Einen Überblick über „Zielerreichung durch öffentliche Bindung“ gibt Greiling, Trägerschaft, S. 304 ff. 160
58
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
3. Einzelvertraglich vereinbarte Steuerungsinstrumente Neben diesen vorstehend beschriebenen Informations- und Prüfrechten kann der Staat durch Abschluß einzelvertraglicher Abreden Einfluß auf Unternehmen – nicht notwendig gemischtwirtschaftliche – ausüben.167 Insbesondere auf kommunaler Ebene werden verbreitet einzelvertragliche Abreden zwischen kommunalen Gebietskörperschaften und Gesellschaften des Privatrechts geschlossen, die z. B. den Betrieb einer Entsorgungsanlage zum Inhalt haben können. In diesen Verträgen kann sich der jeweilige Verwaltungsträger u. a. einzelne Weisungs- oder Informationsrechte vorbehalten.168 Soweit solche Weisungsrechte gesellschaftsrechtlich zulässig sind,169 können sie – im Gegensatz zur staatlichen Anteilsmehrheit – sehr effektive Instrumente sein, um unternehmerische Entscheidungen inhaltlich zu steuern.170 In diesem Fall kann eine Entscheidungsherrschaft des jeweiligen staatlichen Vertragspartners vorliegen. Die unternehmerischen Entscheidungen sind in diesem Fall nicht durch einen staatlichen Anteilseigner, sondern durch eine externe staatliche Einheit gesteuert.171 Damit zeigt sich, daß die einseitige Betonung des staatlichen Anteilseigners und dessen Steuerungsinstrumente der tatsächlichen Einflußsituation nicht gerecht werden. Deshalb ist auch der Begriff des gemischtwirtschaftlichen Unternehmens, der gerade auf eine gemischt staatlich-private Kapitalbeteiligung abstellt, nicht geeignet, alle Fallgestaltungen staatlicher Entscheidungsherrschaft in sich aufzunehmen.172
167 Darauf weist Puhl, Budgetflucht, S. 43 hin. Ebenso z. B. Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (571); Huber/Ryll, ZögU 12 (1989), S. 287 (289); Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 ff. u. insbes. S. 277 ff. Ausführlich zu diesen einzelvertraglichen Abreden unten Zweiter Teil, S. 168 ff. 168 Vgl. dazu z. B. Dittmann, Bundesverwaltung, S. 136. Zu diesen einzelvertraglich vereinbarten Weisungsrechten ausführlich noch unten Zweiter Teil, S. 192 f. 169 Zur gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeit dieser schuldrechtlichen Weisungsvereinbarungen K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 17 III, S. 502; Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 201 f. m. w. N. 170 Vgl. nur Mann, Gesellschaft, S. 229; Klein, Teilnahme des Staates, S. 93. 171 Mann, Gesellschaft, S. 229. 172 Diese Fallgestaltungen werden mit dem Begriff „externer Einflußsicherung“ des Staates (Begriff nach Ehlers, Privatrechtsform, S. 11) beschrieben. Die entsprechenden Unternehmen werden als „privatrechtliche Verwaltungstrabanten“ [Köttgen, VVDStRL 16 (1958), S. 154 ff.; Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 72 ff.; ders., DÖV 1981, S. 153 ff.; Ehlers, Privatrechtsform, S. 155, Fn. 254], „Verwaltungsgesellschaften“ [Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 147, Fn. 36, S. 174], „öffentlich gebundene Unternehmen“ (Püttner, in: FS v. Eynern, S. 225 ff.) oder als „Quagos“ (quasi-governmental-organizations) bzw. als „Quangos“ (quasi-non-governmental-organizations; vgl. dazu Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 165 ff., 166; ders., DÖV 1981, S. 153 ff.) bezeichnet, ohne daß mit diesen Begriffen eine Zuordnung zum Bereich des Staatlichen oder Privaten bezweckt wäre.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
59
4. Faktische Steuerungsinstrumente Neben diesen vorstehend beschriebenen rechtlichen Einflußmöglichkeiten gibt es nach verbreiteter Ansicht auch sogenannte „faktische“ bzw. „informelle“173 Einflußmöglichkeiten der staatlichen und privaten Anteilseigner, die dem staatlichen Anteilseigner im Einzelfall sogar Entscheidungsherrschaft vermitteln können.174 Faktische Einflußmöglichkeiten sind solche Faktoren nichtrechtlicher Art, welche die unternehmensinterne Entscheidungsfindung unabhängig von rechtlichen Einflußfaktoren wie z. B. den Rechten der Mitglieder der Hauptversammlung beeinflussen können. Diese faktischen Einflußmöglichkeiten sollen daher im folgenden näher untersucht werden. Möglicherweise stellt sich heraus, daß gerade diese Entscheidungsfaktoren das Vorliegen einer staatlichen Entscheidungsherrschaft im Einzelfall begründen oder widerlegen können. Faktische Entscheidungsfaktoren sind insbesondere solche, die ihren Grund in der Person des jeweiligen Entscheiders haben. So können reale Einflußfaktoren z. B. aus persönlichen Abhängigkeiten von Entscheidungsträgern resultieren. Oben175 wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes im Zweifel trotz ihrer rechtlichen Unabhängigkeit im Sinne „ihrer“ Gesellschaftsmitglieder stimmen werden, um sich z. B. ihre Wiederwahl zu sichern. Diese persönlichen Abhängigkeiten können in allen Bereichen unternehmerischer Entscheidungstätigkeit existieren,176 und auch der beteiligte Verwaltungsträger kann sich diese persönlichen Abhängigkeiten zunutze machen. Dementsprechend kann trotz einer 173
Puhl, Budgetflucht, S. 44; Greiling, Trägerschaft, S. 173 f. Nach Koch, Status, S. 153 könne es demgegenüber für die Beurteilung eines „bestimmenden Einflusses“ nur auf die rechtlichen Einwirkungsmöglichkeiten ankommen. Dies wird verbreitet anders gesehen. Das Bild von der staatlichen Entscheidungsherrschaft soll umfassend alle rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten der Einflußnahme umschreiben. Vgl. nur Puhl, Budgetflucht, S. 44; Janson, Rechtsformen, S. 24. Schallemacher, Bundesunternehmen, S. 160 weist darauf hin, daß zur Bestimmung der Beherrschung „auf die §§ 16 und 17 AktG und die dazu entwickelte Rechtsprechung und Literatur“ zurückgegriffen werden könne. Ein „beherrschender Einfluß“ im Sinne von § 17 Abs. 1 AktG kann nach verbreiteter Ansicht auch aufgrund faktischer Einflußmöglichkeiten bestehen [z. B. BGHZ 62, S. 193 (199); 90, S. 381 (395) und die Nachweise oben Fn. 41]. 175 S. 41, Fn. 63. 176 Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 36 f. m. w. N. zur Rechtsprechung in Fn. 23 weist darauf hin, daß auf Seite der privaten Anteilseigner die Zugehörigkeit „zu derselben Familie“ eine Rolle für die Personalherrschaft eines Unternehmens über ein anderes spielen kann. Kritisch demgegenüber Hüffer, AktG, § 17, Rn. 6, 9; BGHZ 80, S. 69 (73). Es komme vielmehr darauf an, ob die Familie „in einem verfestigten Interessenverbund zu einer Einheit geworden ist“ [BGHZ 80, S. 69 (73); OLG Düsseldorf, AG 1994, S. 36 (37); dem folgend Hüffer, AktG, § 17, Rn. 9; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 51, Rn. 19]. 174
60
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
staatlichen Minderheitsbeteiligung eine staatliche Entscheidungsherrschaft vorliegen, wenn personelle Abhängigkeiten eine überlegende Stellung des Staates begründen.177 Besonders relevant für die Verteilung faktischer Entscheidungsmacht im Einzelfall wird der Entscheidungsfaktor der überlegenen Sachkunde sein.178 Grund für die Beteiligung von Verwaltungsträgern an gemischtwirtschaftlichen Unternehmen ist aus staatlicher Sicht zumeist die Beschaffung privaten Kapitals179 und privaten Know-Hows.180 Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es denkbar, daß die staatlichen Entscheidungsträger im Gegensatz zu den beteiligten Privaten nicht über die erforderliche Sachkunde verfügen, um die in ihrer Kapitalmehrheit angelegte Entscheidungsherrschaft auch tatsächlich umsetzen zu können.181 Aus diesem Grund ist es denkbar, daß ein privater Minderheitsbeteiligter aufgrund überlegenen Fachwissens faktisch Entscheidungsherrschaft besitzt. Die unternehmerische Erfahrung eines Minderheitsgesellschafters kann dessen Einfluß gegenüber den insoweit unerfahrenen übrigen Gesellschaftern verstärken.182 Eine solche faktische Entscheidungsherrschaft von einem der Beteiligten kann darüber hinaus auch aufgrund sonstiger externer Faktoren, die nicht in der Person des Entscheiders begründet sind, bestehen. So kann z. B. die Aussicht auf eine staatliche Subvention einen gewissen Entscheidungsdruck beim priva177 Zur Bedeutung dieser personellen Abhängigkeiten und Netzwerke vgl. nur Huber/Ryll, ZögU 1989, S. 291 ff. m. w. N.; Püttner, Verwaltungslehre, S. 340 f.; Janson, Rechtsformen, S. 213 f. 178 Nach Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 277 (291) handele es sich bei den Vertretern der öffentlichen Hand im Aufsichtsrat um Personen, „die hauptberuflich anderweitig tätig und stark engagiert sind . . .; sie werden in der Regel nicht imstande sein, ihre Aufsichtspflichten mit der nötigen Gründlichkeit wahrzunehmen. Obendrein fehlen den Repräsentanten der öffentlichen Hand vielfach die Fachkenntnisse, so daß ihr Wirken auch von dieser Seite her mit Schwierigkeiten verbunden ist“. 179 Darauf, daß ein zentrales Privatisierungsmotiv die Beschaffung privaten Kapitals ist, weisen auch das BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 28 f., sowie Brüning, Erledigung, S. 171; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1166); Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 (253) und Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1332) hin. 180 Schink, in: Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen, S. 5 (23 f.); ders., VerwArch 85 (1994), S. 251 (253); Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1333); Tettinger, DVBl. 1995, S. 213 (218). 181 Nach BGH, NJW-RR 2005, S. 474 (475) (trans-o-flex) sei der Deutschen Post AG als Minderheitsgesellschafter (24,8 Prozent) der trans-o-flex Schnelldienst AG „durch die ihr eingeräumte gesellschaftsrechtliche Position in Verbindung mit ihrer überlegenen Markt- und Branchenkenntnis und ihrer beherrschenden Position auf einem benachbarten Markt die Möglichkeit eines wettbewerblich erheblichen Einflusses“ im Sinne der § 37 Abs. 1 Nr. 4 GWB entsprechenden Vorschrift des § 23 Abs. 2 Nr. 6 GWB a. F. verschafft worden. Die unternehmerische Erfahrung des Minderheitsgesellschafters wurde also als Einfluß verstärkend bewertet. 182 Vgl. vorstehend Fn. 181.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
61
ten Mehrheitseigner erzeugen. Auch können Aspekte der Arbeitsplatzsicherung auf Seiten des staatlichen Anteilseigners bei der Ausübung seines beherrschenden Einflusses eine Rolle spielen.183 Ein nur mit Minderheit beteiligter Privater kann z. B. aufgrund der Drohung, in einem anderen rein privaten Unternehmen Arbeitsplätze abzubauen, Entscheidungsherrschaft besitzen. Insbesondere kommunale Gebietskörperschaften kann dies möglicherweise zu einem Entgegenkommen bewegen. Darüber führt es z. B. zu einer tatsächlichen Verstärkung einer gesellschaftsrechtlich begründeten Einflußstellung, wenn das Ausscheiden eines möglicherweise nur mit Minderheit beteiligten Gesellschafters aus dem Unternehmen eine Abfindungsforderung auslösen würde, die eine „Auszehrung der Finanzkraft der Gesellschaft zur Folge hätte“. In diesen Fällen kann dies die Mitgesellschafter veranlassen, zur Vermeidung dieser Folgen den Vorstellungen jenes Mitglieds möglichst weitgehend zu entsprechen.184 Gerade im Rahmen der zuletzt genannten Beispiele ist allerdings zu berücksichtigen, daß ein Verwaltungsträger im Einzelfall zwar einem faktischen Entscheidungsdruck ausgesetzt sein mag, er allerdings verpflichtet ist, rechtmäßig zu entscheiden. Er wird daher nur diejenigen Entscheidungen treffen, die seinen Rechtsbindungen entsprechen. Die Möglichkeit privater Einflußnahme mit Mitteln tatsächlicher bzw. informeller Art ist daher begrenzt. Umgekehrt stehen die faktischen Einflußinstrumente für den Staat nur im Rahmen der Rechtsordnung zur Verfügung. Neben den genannten tatsächlichen Entscheidungsfaktoren können auch sonstige Umstände des Entscheidungsprozesses im Einzelfall die Ausübung der Stimmrechte derart beeinflussen, daß sie die tatsächliche Anteilsmehrheit nicht widerspiegeln.185 So kann eine faktische Stimmrechtsmehrheit eines großen Minderheitsaktionärs bei einem ansonsten breit gestreuten Anteilsbesitz bestehen.186 Umgekehrt kann eine Beteiligung mehrerer Verwaltungsträger, die in 183
Loeser, Rechtsformen, S. 116 ff. So ausdrücklich BGH, BB 2001, S. 849 (851) (Werra-Rundschau). 185 Auf die nach § 12 Abs. 2 AktG jetzt unzulässigen Mehrfachstimmrechte soll hier nicht weiter eingegangen werden. Ausführliche Nachweise dazu bei Mann, Gesellschaft, S. 192 ff. 186 Vgl. dazu die Literatur und Rechtsprechung zu § 17 Abs. 2 AktG und der Möglichkeit beherrschenden Einflusses bei einer Minderheitsbeteiligung: BGHZ 69, S. 334 (347) – VEBA/Gelsenberg; 135, S. 107 (114 f.); 148, S. 123 (125 f.). So wird es in BGHZ 135, S. 107 (115) und in der Vorinstanz OLG Braunschweig, AG 1996, S. 271 (273) für die Annahme einer beherrschenden Stellung als ausreichend angesehen, daß das zur Entsendung von zwei Aufsichtsratsmitgliedern berechtigte Land Niedersachsen unmittelbar und mittelbar mit 20 Prozent an der VW-AG beteiligt gewesen ist und infolge einer Hauptversammlungspräsenz von unter 40 Prozent in fünf aufeinander folgenden Jahren über die Mehrheit der Stimmrechte der in der Hauptversammlung vertretenen Aktionäre verfügte. Anders dagegen AG Wolfsburg, AG 1995, S. 238 f. Eine vergleichbare Konstellation einer staatlichen Minderheitsbeteiligung bei regelmäßiger 184
62
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
ihrer Summe über eine Anteilsmehrheit verfügen, dazu führen, daß ein einheitliches staatliches Interesse jedenfalls nicht in jedem Fall formuliert werden kann, die Mehrheit der Stimmrechte aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen also nicht zugunsten des Staates genutzt wird.187 Entsprechendes gilt für den Fall konkurrierender Privatinteressen und privaten Streubesitzes. Es läßt sich daher feststellen, daß die privaten und staatlichen Anteilseigner sich nicht von vornherein als zwei monolithische Blöcke mit zwei verschiedenen Interessen gegenüberstehen. Je nach Entscheidung und Fallgestaltung können sich Interessengruppierungen quer durch die privaten und staatlichen Anteilseignerblöcke ergeben.188 Schließlich ist es im Einzelfall nicht ausgeschlossen, daß ein Unternehmen seine Entscheidungen freiwillig an den staatlichen Entscheidungsvorgaben ausrichtet.189 Es zeigt sich damit, daß sowohl dem staatlichen als auch dem privaten Anteilseigner unabhängig von der Verteilung der Stimmrechte vielfältige tatsächliche Einflußmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die im Einzelfall eine über-
Hauptversammlungspräsenz findet sich bereits in BGHZ 69, S. 334 (347) – VEBA/ Gelsenberg: Staatlicher Anteilsbesitz von 43,74 Prozent bei einer Anwesenheit in der Hauptversammlung in 80 Prozent der Fälle. Vgl. dazu auch Hüffer, AktG, § 17, Rn. 9; Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht, S. 40 f.; Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 51, Rn. 17 ff. Ebenso Mestmäcker/Veelken, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), GWB, § 37, Rn. 34 zur Frage, wann eine „bestimmender Einfluß“ i. S. v. § 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 2b GWB vorliegt. Vgl. auch die Gründe zur Richtlinie 80/723/EWG der Kommission v. 25.06.1980 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, ABl. Nr. L 195 v. 29.07.1980, S. 35, wonach „die öffentliche Hand . . . einen beherrschenden Einfluß auf das Verhalten der öffentlichen Unternehmen nicht nur dann ausüben (kann), wenn sie Eigentümer ist oder eine Mehrheitsbeteiligung besitzt, sondern auch wegen der Befugnisse, die sie in den Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen aufgrund der Satzung oder wegen der Streuung der Aktien besitzt“. 187 Kritisch deshalb Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (384) mit ausführlichen Nachweisen zu wirtschaftswissenschaftlicher Literatur und den Problemen in der staatlichen Willensbildung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen in Fn. 7. Ebenso R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (219); Koch, Status, S. 166. Eine entsprechende Fallgestaltung deutet auch Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (224) an. Ob die Schwierigkeiten staatlicher Entscheidungsfindung mit den vorstehend in Fn. 186 beschriebenen Effekten eines privaten Streubesitzes verglichen werden können, sei hier dahingestellt. 188 Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (224). Auch in diesem Fall ist zu bedenken, daß der staatliche Anteilseigner nur rechtmäßige Entscheidungen treffen darf. Er hat deshalb keine „Interessen“, sondern lediglich rechtliche Entscheidungsvorgaben. Vgl. zur Eigenart staatlicher Erklärungen noch ausführlich unten Zweiter Teil, S. 118 ff. 189 Ehlers, Privatrechtsform, S. 12 und Fn. 27, verweist darauf, es sei ebenfalls nicht ausgeschlossen, „daß eine privatrechtliche Vereinigung aus freien Stücken der öffentlichen Hand Einwirkungsrechte zugesteht.“ Dies komme „namentlich bei Stiftungen in Betracht.“
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
63
legene Herrschaftsstellung im Entscheidungsprozeß des Unternehmens begründen können.
C. Grenzen des Kriteriums der staatlichen Entscheidungsherrschaft I. Komplexität unternehmerischer Entscheidungsprozesse Insgesamt gibt es verschiedene rechtliche und tatsächliche Möglichkeiten, auf die Entscheidungen eines Unternehmens Einfluß zu nehmen. Diese Möglichkeiten stehen allen staatlichen und privaten Anteilseignern der jeweiligen Gesellschaften, aber auch externen staatlichen und privaten Akteuren zur Verfügung. Der Entscheidungsprozeß und die Möglichkeiten seiner Beeinflussung sind komplex.190 Es stellt sich damit die Frage, ob das Bild einer zentralen staatlichen Entscheidungsinstanz, die über effektive Steuerungsinstrumentarien zur Beherrschung des jeweiligen gemischtwirtschaftlichen Unternehmens – insbesondere über die Kapitalanteilsmehrheit – verfügt und mit Hilfe dieser Instrumentarien das Vorliegen einer staatlichen Entscheidungseinheit „bewirkt“191, der tatsächlichen Komplexität unternehmerischer Entscheidungsprozesse gerecht wird. So muß man möglicherweise davon ausgehen, daß das Bestehen staatlicher Entscheidungsherrschaft ausgeschlossen ist, und daß unternehmerische Entscheidungen vielmehr durch ein Netz unterschiedlicher Einflußfaktoren und Akteure gesteuert werden.192 Unternehmen sind einer Vielzahl von Einflüssen interner und externer Art ausgesetzt, die in ihrer Summe möglicherweise einer Beherrschung durch den staatlichen Anteilseigner entgegenstehen können.193 Deshalb 190 Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (259) m. w. N. in Fn. 87 weist darauf hin, daß die Wirklichkeit „hyperkomplex“ sei. Wirklichkeitsbezogene dogmatische Ansätze könnten daher „jeweils nur Aspekte eines Sachverhalts“ erfassen. Vgl. auch Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 8, der feststellt, daß die „Skala der staatlichen Einflußnahme auf privatrechtliche Vereinigungen . . . von kaum nennenswerten Steuerungsimpulsen zu ihrer vollständigen Beherrschung“ reicht. Ebenso Koch, Status, S. 166, der darauf hinweist, daß „das Vorhandensein eines ,bestimmenden‘ Einflusses letztlich von der im Einzelfall gegebenen rechtlichen und tatsächlichen Situation abhängt und sich einer sicheren Feststellung regelmäßig entziehen wird“. 191 I. S. v. Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (292 ff.). 192 Loeser, Rechtsformen, S. 116 ff. macht weit über 100 Steuerungssubjekte und Steuerungsmittel aus (z. B. Verfassungsorgane, Mitbestimmung, Öffentlichkeit, Haushaltsplan, Subventionen etc.). Zur Schwierigkeit, die verschiedenen Kapitalanteile mehrfach gestufter Beteiligungsverhältnisse bei gemischtwirtschaftlichen Unternehmen zu berechnen, Huber/Ryll, ZögU 12 (1989), S. 287 (291 ff.). 193 Storr, Staat, S. 61; Puhl, Budgetflucht, S. 42 f. In diesem Sinn ist auch der EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (368) in seiner vergaberechtlichen Entscheidung zu sogenannten In-house-Geschäften zu verstehen. Eine lediglich organisationsinterne Auf-
64
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
erscheint es sachangemessener, staatliche Organisation nicht als Entscheidungseinheit „leitender Organe“194, sondern staatliche und gesellschaftliche Organisation als Netz unterschiedlicher und wechselseitig steuernder Organisationseinheiten zu begreifen. Doch selbst wenn man davon ausgeht, daß eine zentrale staatliche Entscheidungsinstanz als Herrschaftsinstanz auch angesichts der Vielfalt sonstiger Faktoren im Einzelfall denkbar ist, stellt sich die Frage, ob die tatsächlichen Machtverhältnisse in einem Unternehmen nachvollzogen werden können. Standardfolgenkalküle und Pauschalurteile über Anteilsverhältnisse werden der Entscheidungswirklichkeit nicht gerecht. Sie sind zur Bestimmung der Herrschaftsverhältnisse in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen nicht geeignet.195 Die Bewertung der Staatseigenschaft eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens setzt vielmehr eine umfassende Auswertung all dieser Entscheidungsfaktoren unternehmensinterner und -externer Art voraus.196 Eine solche umfassende Auswertung stellt sich allerdings als ein nahezu unmögliches Unterfangen dar, zumal die rechtlichen und tatsächlichen Einflußfaktoren von Entscheidung zu Entscheidung unterschiedlich sein können. Sie setzt einen umfassenden Einblick in die unternehmensinternen Entscheidungsprozesse und in das Geschäftsumfeld des Unternehmens voraus. Auch ist das Ausmaß der Beteiligung in Fällen des Zusammentreffens unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen und Beteiligungen verschiedener staatlicher Rechtsträger und sonstiger vertraglicher Vereinbarungen nicht eindeutig bestimmbar.197 Schließlich können sich Beteiligungsquoten gerade bei Aktiengesellschaften kurzfristig verschieben.198
tragsvergabe liege danach nicht vor, wenn ein Verwaltungsträger eine Gesellschaft des Privatrechts, die ihrerseits im Mehrheitsbesitz des Verwaltungsträgers stehe, mit der Vornahme von Dienstleistungen beauftragt. Die – auch nur minderheitliche – Beteiligung eines Privaten am Kapital der Gesellschaft schließe „es auf jeden Fall aus, dass der öffentliche Auftraggeber über diese Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausübt wie über seine eigenen Dienststellen“. Organisationsinterne Beziehungen innerhalb eines öffentlichen Auftraggebers seien „durch Überlegungen und Erfordernisse bestimmt, die mit der Verfolgung öffentlicher Ziele zusammenhängen. Die Anlage von privatem Kapital in einem Unternehmen beruht dagegen auf Überlegungen, die mit privaten Interessen zusammenhängen, und verfolgt andersartige Ziele“. Ebenso Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (95): „Verfolgung komplementärer Ziele“. 194 Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (293). 195 v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 147; ders., Jura 1983, S. 30 (42). 196 Nach Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 160 sei es erforderlich, „hinter die Kulissen des Unternehmens zu schauen und der Frage nachzugehen, welche der beiden Seiten . . . im Konfliktfall das Machtwort sprechen kann“. Ebenso Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (571). 197 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (4); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (394); Huber/Ryll, ZögU 12 (1989), S. 287 (291).
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
65
Die einzelnen Beherrschungskriterien wie insbesondere die Anteilsmehrheit und die daran anknüpfende Möglichkeit der Beherrschung der Personalpolitik können damit lediglich Indizien199 für das Bestehen einer staatlichen Entscheidungsherrschaft sein.200 Zwar mag mit einer Steuerung der Personalpolitik typischerweise auch ein maßgeblicher Einfluß in der Sache einhergehen,201 die Vielfalt der Einflußfaktoren kann diese Vermutung allerdings im konkreten Fall widerlegen. Nachdem sich bereits oben202 gezeigt hat, daß sowohl das einfache Recht als auch das Verfassungsrecht von einem Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft ausgehen, setzt die Bestimmung der Staatseigenschaft Kriterien voraus, die eine möglichst eindeutige Zuordnung erlauben. Diese kann der Beherrschungsansatz nach dem vorstehend Gesagten nicht geben.203
198 v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 147; ders., Jura 1983, S. 30 (42); Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (4); Poschmann, Grundrechtsschutz, S. 137. 199 So ausdrücklich v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 147 m. Fn. 73; ders., Jura 1983, S. 30 (42). So wohl auch das BVerfG, NJW 1990, S. 1783, welches die Grundrechtsfähigkeit einer Aktiengesellschaft, die sich zu 72 Prozent in öffentlicher Hand befindet, mit dem Hinweis ablehnt, „bei diesem Beteiligungsverhältnis ist davon auszugehen, daß die Stadt H. die Möglichkeit hat, auf die Geschäftsführung entscheidenden Einfluß zu nehmen“. Vgl. auch § 17 Abs. 2 AktG, der an die Mehrheitsbeteiligung die Vermutung der konzernrechtlichen Abhängigkeit knüpft. 200 Aus diesen Unsicherheiten resultiert eine verbreitete Skepsis gegenüber der Verwendung der privatrechtlichen Organisationsformen. Als Konsequenz daraus wurde durch das Gesetz zur Änderung des kommunalen Wirtschaftsrechts v. 26.07.1995, GVBl. S. 376 in die Bayerische Gemeindeordnung der § 86 Nr. 2 BayGO als Ermächtigungsgrundlage zur Gründung und zum Betrieb von sogenannten Kommunalunternehmen, rechtsfähigen Anstalten des Öffentlichen Rechts, eingefügt. Weitere Regelungen enthalten die Art. 89 ff. BayGO. Grund für die Einführung dieser Organisationsform war die Annahme, nur mit Hilfe öffentlichrechtlicher Rechtsformen einen hinreichenden staatlichen Einfluß auf die Unternehmenstätigkeit sicherstellen zu können. Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben sich diesem Modell angeschlossen (vgl. dazu §§ 86a, 86b RPGO; §§ 113a ff. NdsGO; §§ 116 ff. SAGO; § 106a SHGO und § 114a NrWGO). Vgl. zur Notwendigkeit der Entwicklung einer „öffentlich-rechtlichen Gesellschaft“ Mann, Gesellschaft, S. 297 ff.; Ehlers, in: Henneke (Hrsg.), Kommunale Aufgabenerfüllung in Anstaltsform, S. 47 ff.; ders., NWVBl. 2000, S. 1 ff. Jüngst auch Storr, NordÖR 2005, S. 94 ff. 201 Siehe oben Erster Teil, S. 39, Fn. 57. 202 S. 25, Fn. 13. 203 Nach Puhl, Budgetflucht, S. 42 sei „ein Abstellen auf das Abhängigkeitsverhältnis gegenüber Gebietskörperschaften mit Unsicherheiten behaftet“. Ebenso Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (562); Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 I 2, Rn. 16.
66
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
II. Vernachlässigung des privaten Entscheidungsanteils Doch selbst wenn man von der Tauglichkeit des Anteilskriteriums jedenfalls als eine Vermutungsregel ausgeht, stellt sich die Frage, ob der Beherrschungsansatz als Modell die Entscheidungsrealität gemischtwirtschaftlicher Unternehmen hinreichend beschreiben kann. Der Beherrschungsansatz differenziert nicht zwischen Eigengesellschaften, privatrechtlich organisierten Kapitalgesellschaften in staatlichem Alleinbesitz, und beherrschten gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften. Diese Nivellierung der Unterschiede erstaunt, da ein in die staatliche Aufgabenwahrnehmung eingeschaltetes gemischtwirtschaftliches Unternehmen seiner Entscheidungsstruktur nach etwas anderes als eine staatliche Organisationseinheit ist.204 So unterscheiden sich die Entscheidungen gemischtwirtschaftlicher Unternehmen von den Entscheidungen staatlicher Eigengesellschaften und Juristischer Personen des öffentlichen Rechts: An der hinter einem Unternehmen stehenden gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft sind unterschiedliche Akteure beteiligt. Es gibt staatliche und private Anteilseigner. Diese staatlichen und privaten Rechtssubjekte üben ihre Mitgliedsrechte in der Hauptversammlung aus und wählen die Mitglieder des Aufsichtsrates, der wiederum den Vorstand bestellt. Die Entscheidungen des Vorstandes lassen sich deshalb mittelbar auch auf die Entscheidungen der privaten und staatlichen Anteilseigner zurückführen. Entscheidungen des Vorstandes und der Gesellschaft sind also immer sowohl durch die staatlichen als auch durch die privaten Anteilseigner vermittelte Entscheidungen und deshalb notwendig gemischt staatlich-privat. Diese gemischt staatlich-privaten Entscheidungen zeichnen sich dadurch aus, daß sie gerade nicht in einen staatlichen und einen privaten Entscheidungsanteil getrennt werden können. So sind die Entscheidungen des Vorstandes einer Aktiengesellschaft Ergebnis eines Entscheidungsprozesses, an dem sowohl staatliche als auch private Entscheider beteiligt sind.
204 So ist wohl auch der EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (368) = NVwZ 2005, S. 187 (190) zu verstehen, der darüber zu entscheiden hatte, ob das europäische Vergaberecht auf einen Dienstleistungsvertrag zwischen einem Verwaltungsträger und einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, an dem der Verwaltungsträger selbst mehrheitlich (75, 1 Prozent zu 24, 9 Prozent privaten Anteils) beteiligt ist, anwendbar ist. Dies ist dann nicht der Fall, wenn zwischen dem Verwaltungsträger und der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft aus Sicht des Vergaberechts Identität vorliegt (sog. „InHouse-Geschäft“). Letzteres hat der EuGH verneint. Die auch nur minderheitliche Beteiligung eines Unternehmens am Kapital einer Gesellschaft, an der auch der öffentliche Auftraggeber beteiligt ist, schließe „es auf jeden Fall aus, dass der öffentliche Auftraggeber über diese Gesellschaft eine ähnliche Kontrolle ausübt wie über seine eigenen Dienststellen“ (a. a. O., S. 368). Vgl. dazu bereits oben Fn. 90 und die Beiträge von Kersting/Siems, DVBl. 2005, S. 477 ff.; Hausmann/Bultmann, NVwZ 2005, S. 377 ff.
2. Abschn.: Entscheidungsherrschaft als Kriterium
67
Der Beherrschungsansatz rechnet nun für den Fall staatlicher Entscheidungsherrschaft die Juristische Person des Privatrechts vollständig dem staatlichen Bereich zu. Alle in diesem Unternehmen getroffenen Entscheidungen sind in diesem Fall staatliche Entscheidungen. Die Tatsache, daß sich ursprünglich staatliche und private Anteilseigner zu einer gemischt staatlich-privaten Entscheidungsfindung zusammengefunden haben, wird in diesem Modell nicht berücksichtigt. In diesem Sinn ist der vielfach zu findende Hinweis zu verstehen, der Beherrschungsansatz würde den Schutz und die Interessen privater Anteilseigner nicht berücksichtigen.205 Zwar ist die Beteiligung Privater an der staatlichen Entscheidungsfindung, also ein gemischt staatlich-privater Entscheidungsprozeß, von sich aus kein Grund, von der die Rechtsbindung einer staatlichen Organisationseinheit abhängig gemacht werden kann. Zumindest wäre dies ein für das Verwaltungsorganisationsrecht ungewöhnliches Vorgehen.206 Aber der gemischt staatlich-private Entscheidungsprozeß wird von dem Alternativmodell des Beherrschungsansatzes nicht hinreichend abgebildet.207 Umgekehrt wird in den Fällen, in denen staatliche Einheiten nur über eine Minderheitsbeteiligung verfügen, der staatliche Entscheidungsanteil an den Unternehmensentscheidungen negiert, wenn aus der Minderheitsbeteiligung die Konsequenz gezogen wird, die staatlichen Sonderbindungen würden nicht anwendbar sein. Dies wiederum hat zur Folge, daß die Sonderbindungen des Staates nicht anwendbar sind auf einen Entscheider, dessen Entscheidungen zumindest auch staatlich mitbewirkt sind. Der staatliche Entscheidungsteil wird damit von dem Anwendungsbereich der Sonderbindungen des Staates nicht umfaßt. Der Beherrschungsansatz kann deshalb als Modell die besondere Qualität gemischtwirtschaftlicher Entscheidungen nicht hinreichend abbilden.208 205 Vgl. so nur z. B. Ehlers, Privatrechtsform, S. 85; ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 4, Rn. 85 m. w. N. zur Kritik am Urteil BVerfG, NJW 1990, S. 1783 in Fn. 206; ders., Recht der öffentlichen Unternehmen, E 39 ff., 103: „Auch wenn gemischtwirtschaftliche Unternehmen wegen der privaten Mitträgerschaft nicht der Staatssphäre zugerechnet werden können und daher nicht an die öffentlich-rechtlichen Rechtskreisbestimmungen gebunden sind, . . .“ (a. a. O. E 103); ders., JZ 1990, S. 1089 (1096); Gogos, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 196; Jarass, in: ders./Pieroth, GG, Art. 19 Abs. 3, Rn. 15; Koppensteiner, NJW 1990, S. 3105 (3109 ff.); Möllers, VerwArch 90 (1999), S. 187 (193); Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (12 f., insbes. S. 13); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (396); R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (226 f.); Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (570 ff.); Stern, Staatsrecht III/1, S. 1170. Vgl. auch Puhl, Budgetflucht, S. 165, wonach der private Entscheidungsanteil eine „Strukturverschiebung in der Qualität dieser Privatrechtssubjekte“ begründe. 206 Groß, Kollegialprinzip, S. 42 weist darauf hin, „daß es sehr ungewöhnlich wäre, die Geltung des öffentlichen Rechts davon abhängig zu machen, daß dadurch keine privaten Interessen beeinträchtigt werden“. Nach Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (374 ff.) läßt sich aus der Verfassung keine Notwendigkeit einer Mitentscheidung Betroffener ableiten. 207 Krebs, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), Art. 19 Abs. 3 GG, Rn. 45. I. E. auch Koch, Status, S. 192.
68
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Dritter Abschnitt
Rechtsform als Kriterium der Staatseigenschaft A. Organisationsrecht als Steuerungsinstrument und Entscheidungsprämisse Möglicherweise gibt es andere Kriterien, die zum einen eine zwingende Zuordnung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen zum Bereich des Staatlichen oder Privaten im Einzelfall ermöglichen und zum anderen die gemischt staatlich-private Unternehmenswirklichkeit hinreichend abbilden können. Um eine „Vernachlässigung privater Rechtssubjekte“209 zu vermeiden, wird verbreitet davon ausgegangen, daß grundsätzlich nur öffentlichrechtlich organisierte Einheiten staatliche Einheiten seien, privatrechtlich organisierte Einheiten seien dagegen bereits aufgrund ihrer Rechtsform grundsätzlich private Einheiten.210 So sei eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft in Privatrechtsform bereits aufgrund ihrer privatrechtlichen Organisiertheit Teil der gesellschaftlichen Sphäre.211 Eine Zuordnung dieser gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften zum Bereich des Staatlichen wird bereits mit Verweis auf die privatrechtliche Rechtsform abgelehnt.212 Eine Ausnahme sei lediglich in denjenigen Fällen 208 Möllers, VerwArch 90 (1999), S. 187 (193) spricht von einem „Dilemma“. In diesem Sinn auch Krebs, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Art. 19, Rn. 45. 209 So ausdrücklich Stern, Staatsrecht III/1, S. 1170. 210 So Ehlers, Privatrechtsform, S. 85; ders., JZ 1990, S. 1089 (1096); ders., Recht der öffentlichen Unternehmen, E 39; ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 3, Rn. 85 f.; Jochum, Lizenzversagungsgrund, S. 48 f.; Klein, Teilnahme des Staates, S. 234 f.; Koppensteiner, NJW 1990, S. 3105 (3108 ff.); Kühne, JZ 1990, S. 335 f.; v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 146 f.; Pieroth, NWVBl 1992, S. 85 (88); Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 120 f.; Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil 34, S. 1 ff.; ders., in: FS Niederländer, S. 383 ff.; R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (225 ff.); Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (570 ff.); Stern, Staatsrecht III/1, S. 1169 ff.; Zimmermann, Schutzanspruch, S. 224 ff.; ders., JuS 1991, S. 294 (299 f.). 211 So Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (10). Anders dagegen ders. in Bezug auf den Begriff der „öffentlichen Gewalt“ im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG in: Maunz/Dürig, GG, Art. 19 Abs. IV, Rn. 58. Gemischwirtschaftliche Gesellschaften des Privatrechts seien danach Träger öffentlicher Gewalt im Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG, wenn sie staatlich beherrscht werden und „direkt der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen“. Dieser Ansatz sei bei Art. 19 Abs. 4 GG „geboten, weil auch hier die rechtsschutztypische Gefährdungssituation . . . besteht. Über das einschlägige Rechtsregime und den Rechtsweg ist damit freilich noch nichts gesagt.“ 212 So jeweils sehr knapp z. B. Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 39; v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 146 f.; Pieroth, NWVBl 1992, S. 85 (88); Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 120. Häufig wird auf die Praktikabilität des hier sogenannten Rechtsformansatzes verwiesen. Vgl. nur Schmidt-Aßmann, in: FS Nieder-
3. Abschn.: Rechtsform als Kriterium
69
denkbar, in denen die private Beteiligung „lediglich Alibifunktion hat und die Tätigkeit in Wahrheit auf öffentliche Verwaltung gerichtet ist“.213 I. Dualismus der Rechtsformen Möglicherweise beeinflußt das Privatorganisationsrecht Entscheidungen gemischtwirtschaftlicher Unternehmen in einem so intensiven Maße, daß deren Alternativenwahl im unternehmerischen Entscheidungsprozeß als an privaten Zielstellungen ausgerichtet erscheint, mit der Folge, daß die Entscheidungen als Entscheidungen Privater anzusehen sind. Dies setzt voraus, daß sich privatrechtliche und öffentlichrechtliche Organisationsrechtssätze hinsichtlich ihrer Entscheidungsmaßstäbe unterscheiden, und daß sie taugliche Mittel zur Ausrichtung unternehmerischer Entscheidungen an diesen – staatlichen oder privaten – Entscheidungsmaßstäben darstellen. Im Rahmen des vorstehend beschriebenen Beherrschungsansatzes wurde davon ausgegangen, daß das Privatorganisationsrecht Steuerungsinstrumente für staatliche Einheiten zur Konstituierung staatlicher Entscheidungsherrschaft im gemischt staatlich-privaten Entscheidungsprozeß bereithält.214 Sowohl das öffentlichrechtliche als auch das privatrechtliche Organisationsrecht statuieren Einwirkungsmöglichkeiten für die handelnden Akteure.215 Organisationsrecht ist damit „Entscheidungsprämisse“216 insoweit, als daß mit der Wahl der Organisationsrechtsform zugleich über die Instrumente zur inhaltlichen Steuerung von Entscheidungen und über die Auswahl des entscheidenden Personals zumindest mitentschieden wird.217 Ablauf und Ergebnis eines Entscheidungsprozesses unterscheiden sich je nachdem, ob eine organisatorische Einheit als unselbständige Verwaltungseinheit der unmittelbaren Staatsverwaltung218 mit den entsprechenländer, S. 383 (383, 392 ff.); ders., BB 1990, Beil. 34, S. 1 (10); Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 120 f.; Klein, Teilnahme des Staates, S. 234; v. Mutius, in: BK, Art. 19 Abs. 3, Rn. 147; R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (221); Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (88). 213 Stern, Staatsrecht III/1, S. 1170. 214 Vgl. oben Erster Teil, S. 37 ff. 215 Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 301 ff., insbes. S. 306. Vgl. auch Schmidt-Aßmann, in: ders./Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 9 ff.; Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 355 ff.; Groß, Kollegialprinzip, S. 19 ff.; R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (346 f.). 216 Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 301 (311 ff.). 217 So auch Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (383, 390); Schmidt-Preuß, DÖV 2001, S. 45 (47 ff.); Trute, in: SchmidtAßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, S. 293 (306 ff., 321). 218 Zum Begriff der Selbständigkeit Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 21 ff.
70
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
den Aufsichtsstrukturen und Verwaltungspersonal konstruiert ist oder als privatrechtlich verselbständigte Einheit, an deren Entscheidungen verschiedene auch private Akteure beteiligt sind. Die Ausgestaltung von Organisation und Verfahren kann also Entscheidungsprozesse beeinflussen.219 Organisationseinheiten des öffentlichen Rechts differieren hinsichtlich der Gründung220, Entscheidungsbildung und Kontrolle221 jedenfalls typischerweise von denen des Privatrechts.222 Es existiert ein Dualismus der Rechtsformen hinsichtlich ihrer Organisationsstrukturen.223 Deshalb bietet es sich an, von einem „formellen Dualismus“ zu sprechen. Aufbauend auf dieser Strukturverschiedenheit öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Rechtsformen wird vertreten, dem öffentlichen Recht und dem Privatrecht würden verschiedene „Regelungsprinzipien“224 und unterschiedliche „innere Formungsprinzipien“225 zugrunde liegen. Über die rein strukturelle Verschiedenheit unterschiedlicher Organisationsprozesse hinaus wird also verbreitet 219 So auch Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 301 (312); Trute, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, S. 293 (306 ff., 321); Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (383, 390); Schmidt-Preuß, DÖV 2001, S. 45 (47). 220 Verbreitet wird darauf hingewiesen, daß privatrechtlich organisierte Gesellschaften typischerweise auf einem „privatautonomen Gründungsakt“ bzw. „Kreationsakt“ beruhten, Organisationen des öffentlichen Rechts dagegen auf einer „kompetenziellen Zuweisung“. Vgl. dazu z. B. die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Grundrechtsberechtigung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts, BVerfGE 21, S. 362 (371); 61, S. 82 (101); 68, S. 193 (206); BVerfG, NJW 1987, S. 2501 (2502); BVerfGE 75, S. 192 (196). In diesem Sinne auch z. B. Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (346); ders., BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8); Stern, Staatsrecht III/1, S. 1082 ff., 1085 ff.; Puhl, Budgetflucht, S. 45. 221 Die Verwaltung in Privatrechtsrechtsform unterliegt nach verbreiteter Ansicht keiner allgemeinen Aufsicht durch staatliche Einheiten. Vgl. nur Püttner, DVBl. 1975, S. 353 (355); Ehlers, Privatrechtsform, S. 268; Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 45; H. Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 258. 222 Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (390); ders., BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8). 223 Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 167 (171 ff.). Das Verhältnis dieser Rechtsregime zu einander ist umstritten. So wird von einem „Vorrangverhältnis“ [z. B. R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (350) für einen Vorrang des Gesellschaftsrechts oder Stober, NJW 1984, S. 449 (455) für einen Vorrang des öffentlichen Rechts] oder einem „Auffangverhältnis“ [vgl. v. Danwitz, AöR 120 (1995), S. 595 ff. und die Beiträge von Schmidt-Aßmann, Trute, Bullinger und Hoffmann-Riem in Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 7 ff., S. 167 ff., S. 239 ff. und S. 261 ff.] ausgegangen. Einen Überblick über die Diskussion gibt Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 301 (327 ff.). 224 Vgl. nur Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 167 (171 ff.). 225 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8). Ossenbühl, ZGR 25 (1996), S. 504 (513) spricht bezogen auf das Verhältnis von Gesellschaftsrecht und öffentli-
3. Abschn.: Rechtsform als Kriterium
71
ein „materieller“ 226 Dualismus der öffentlichrechtlichen und privatrechtlichen Organisationsprinzipien angenommen.227 Das „Funktionsprinzip“ des Privatrechts sei die Privatautonomie.228 Das öffentliche (Organisations-)Recht soll demgegenüber zumindest typischerweise einen „hoheitlichen Herrschaftsanspruch verkörpern“.229 Es sei Instrument zur Konstituierung staatlicher Entscheidungen, das privatrechtliche Organisationsrecht Instrument zur Ermöglichung privatautonomen Entscheidens.230 Mit der Rechtsform werde zugleich die Eigenschaft, staatliche oder private Organisation zu sein, zugewiesen.231 Die öffentlichrechtliche und privatrechtliche Rechtsform sollen einen je eigenen „Zuweisungsgehalt“ besitzen.232 Fraglich ist, ob sich die auf der Feststellung des Formendualismus aufbauende These vom „materiellen Zuweisungsgehalt“233 der Teilrechtsordnungen als richtig erweist. Diese Prämisse vom Bestehen „konfligierender Regelungsintentionen“234 privatrechtlicher und öffentlichrechtlicher Rechtssätze kann in dieser Abstraktheit nicht widerlegt werden. Die Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft bedingt notwendig eine Unterscheidung von Rechtssatzbereichen.235 Unterscheiden sich Staat und Gesellschaft, dann muß es Rechtssätze geben, die entweder auf den Staat oder die Gesellschaft anwendbar sind. Die Anwendbarkeit von chem Recht von einer Kollision „zwischen den Wertungen des Zivilrechts und denen des öffentlichen Rechts“. 226 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8) spricht von einem „materiell gerechtfertigte(n) Dogma“. I. E. so auch Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 129. 227 Anders die Idee vom „Gemeinrecht“. Vgl. dazu nur Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht, S. 81 ff. 228 Ehlers, Privatrechtsform, S. 74 m. w. N. in Fn. 1. Anders dagegen Bullinger, in: FS Rittner, S. 69 (82), wonach „der Gedanke eines Privatrechts im Sinne der Ordnung einer prinzipiell privatautonomen, als staatsfrei gedachten Gesellschaft für das Wirtschaftsleben allenfalls noch begrenzte Aussagekraft besitzt“. Vgl. auch ders., Öffentliches Recht und Privatrecht, insbes. S. 80 ff. zur Entwicklung eines „Gemeinrechts“. Ebenso z. B. de Wall, Anwendbarkeit, S. 29 ff., 47. 229 Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (344 f.). 230 Bullinger, in: FS Rittner, S. 69 (74) spricht von einer „bis in die Gegenwart nicht völlig überwundene(n) Ideologie des Privatrechts als eines Bereichs gesicherter individueller und gesellschaftlicher Freiheit, dem das öffentliche Recht als der Bereich staatlichen Befehls und Zwangs“ gegenüberstehe (Hervor. i. O.). 231 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8 ff.); Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (87 ff.). 232 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8 ff.); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (387 ff.). 233 Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (8 ff.). 234 Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 255. 235 Möllers, Staat als Argument, S. 300, 309 f.; Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (386).
72
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Rechtssätzen muß das Alternativitätsverhältnis zwischen Staat und Gesellschaft widerspiegeln. Möglicherweise bilden gerade das öffentliche Recht und die Rechtssätze des Privatrechts dieses Alternativitätsverhältnis ab.236 II. Privatautonomie als Freiheit Privater Ein solcher Zuweisungsgehalt des Organisationsrechts im vorstehend genannten Sinn setzt voraus, daß dasselbe geeignet ist, Wahlentscheidungen in diesem Sinn zu steuern. Daran bestehen schon deshalb Zweifel, weil das Organisationsrecht im Gegensatz zu einzelnen Steuerungshandlungen abstrakt und generell ist. Es ist lediglich Voraussetzung für Steuerungsmöglichkeiten, kann aber nicht auf eine bestimmte Entscheidung Einfluß nehmen und sie in einer bestimmten Weise determinieren.237 Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob die These vom materiellen Zuweisungsgehalt jedenfalls hinsichtlich des Privatrechts richtig sein kann. Dies setzt die nähere Bestimmung der Eigenschaft Privater, der Privatautonomie, voraus.238 Verbreitet wird Privatautonomie definiert als Recht der einzelnen Person, „autonom“, i. e. selbstbestimmt zu entscheiden.239 In diesem Zusammenhang wird der Begriff verbreitet gleichgesetzt mit dem Begriff der Freiheit, insbesondere der Vertragsfreiheit.240 Geht man davon aus, daß diese Freiheit Privater von den Grundrechten und vom Privatrecht vorausgesetzt wird,241 dann kann diese Freiheit einem privaten Rechtssubjekt – ob natürlich oder juristisch242 – nicht zugewiesen werden. Privatautonomie ist in diesem Fall nicht eine durch das Privatrecht vermittelte 236 Ausführlich dazu und im Ergebnis anderer Ansicht Manssen, Privatrechtsgestaltung, S. 112 ff., 117 f. So werde die Trennung von öffentlichem Recht und privatem Recht „traditionell als Ausdruck der Trennung zwischen Staat und Gesellschaft verstanden“ (a. a. O., S. 112). Kritisch ebenfalls z. B. Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 (219): „Die Vorstellung, es müsse die Scheidung in öffentliches und privates Recht mit der Scheidung in öffentliche und private Sphäre parallel gehen, ist überholt“. 237 Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 301 (306). 238 Vgl. ausführlich dazu Busche, Privatautonomie, insbes. S. 13 ff. 239 Vgl. nur Flume, Bürgerliches Recht II, S. 1, 15; Busche, Privatautonomie, S. 13. Ebenso BVerfGE 72, S. 155 (170). 240 Vgl. nur Flume, Bürgerliches Recht II, S. 12 ff.; Bydlinski, Privatautonomie, S. 127; Manssen, Privatrechtsgestaltung, S. 132. 241 Vgl. nur Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen städtebaulicher Verträge, S. 120 (129); Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (212) [„. . . der Privatrechtsordnung vorausliegenden Bedingungen . . .“ (Hervor. i. O.)]. I. E. auch Busche, Privatautonomie, S. 20. Anders dagegen z. B. Badura, in: FS Rittner, S. 1 (1 ff.), der von einer „Zuständigkeit“ des einzelnen Privatrechtssubjekts spricht, die „durch die Rechtsordnung begründet werde (a. a. O., S. 1). Seiner Ansicht nach ist Privatautonomie also einfachrechtlich konstituiert.
3. Abschn.: Rechtsform als Kriterium
73
Freiheit, sondern die Freiheit Privater.243 Das Privatrecht setzt diese Freiheit möglicherweise voraus und gibt dem Privaten lediglich Instrumente zur Umsetzung seiner Freiheit in die Hand. In diesem Fall kann das Privatrecht auch keinen materiellen Zuweisungsgehalt besitzen, der eine privatrechtlich organisierte Einheit zu einer privaten Einheit werden läßt. Ob eine privatrechtlich organisierte Einheit staatlich oder privat ist, bestimmt sich dann vielmehr nach anderen Kriterien. Doch selbst wenn man davon ausgeht, daß das Privatrecht im Einzelfall zumindest auch privatautonome Gestaltungsmacht zuweist und insoweit einen materiellen Zuweisungsgehalt besitzt,244 stellt sich die Frage, ob der Rechtsformansatz in jedem Fall zu einer zwingenden Zuordnung von Rechtssubjekten zum Bereich des Staatlichen geeignet ist.
B. Grenzen des Rechtsformkriteriums I. Indizielle Wirkung der Rechtsform Daß im Einzelfall andere Kriterien als die Rechtsform die Staatseigenschaft eines Rechtssubjektes bestimmen, erkennen auch die Vertreter des Rechtsformansatzes an, die darauf hinweisen, daß vom Grundsatz des Rechtsformansatzes „ein größerer Kreis von Ausnahmen zu beachten“245 sei. So seien Stiftungen des privaten Rechts und rechtsfähige Vereine, mit denen der Staat Aufgaben z. B. der auswärtigen Kulturpolitik erfülle, dem Bereich des Staates zuzuordnen, weil „die Elemente der Staatlichkeit . . . sich hier regelmäßig im Gründungsvorgang und in der Herkunft der Finanzmittel ausmachen“246 lassen. Auch privatrechtlich organisierte Kapitalgesellschaften in staatlichem Alleinbesitz, die sogenannten Eigengesellschaften, seien Teil der Staatsorganisation, weil der Staat sich nicht durch einen reinen Wechsel der Rechtsform seiner Rechtsbindungen entziehen dürfe.247 Ein Betrieb, der „ganz der öffentlichen 242 Ob eine Juristische Person des Privatrechts Träger privater Freiheit ist, weil ein „Durchblick“ auf die hinter der Juristischen Person stehenden Menschen dies erfordert, oder weil Juristische Personen des Privatrechts selbst Träger privater Freiheit sind, kann hier dahingestellt bleiben. Von einem solchen „Durchblick“ geht das Bundesverfassungsgericht in ständiger Rechtsprechung zur Grundrechtsberechtigung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts aus [vgl. nur die Nachweise oben Fn. 220]. 243 Vgl. Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Städtebauliche Verträge, S. 120 (127 ff.). 244 So z. B. Badura, in: FS Rittner, S. 1 (1 ff.). Vgl. vorstehend Fn. 241. 245 Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (346). 246 Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (346). 247 Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (390); Ehlers, Privatrechtsform, S. 247 f. m. w. N.; R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 ff.; Stober, NJW 1984, S. 449 (450); Spannowsky, ZHR 160 (1996), S. 560 (568 ff.). Zur Gegenansicht Püttner, Öf-
74
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Aufgabe der gemeindlichen Daseinsvorsorge gewidmet ist und der sich in der Hand eines Trägers öffentlicher Verwaltung befindet, stellt daher nur eine besondere Erscheinungsform dar, in der öffentliche Verwaltung ausgeübt wird“.248 Eine weitere Ausnahme von der grundsätzlich fehlenden Staatseigenschaft privatrechtlich organisierter Einheiten soll – wie bereits vorstehend festgestellt – bei den privatrechtlich organisierten gemischtwirtschaftlichen Unternehmen dort zu machen sein, wo „die private Beteiligung lediglich Alibifunktionen hat und die Tätigkeit (des Unternehmens) in Wahrheit auf öffentliche Verwaltung gerichtet ist.“249 Verbreitet anerkannt ist es auch, daß private Rechtssubjekte und gemischt staatlich-privat organisierte Rechtssubjekte des Privatrechts dann Träger von Sonderbindungen des Staates seien, wenn und soweit ihnen durch einen „hoheitlichen Kompetenzentscheid“250 Staatsgewalt „übertragen“ wurde.251 Diese Fälle werden mit dem Begriff der „Beleihung“252 oder der „Aufgabendelegafentliche Unternehmen, S. 91 ff., insbes. S. 119 f.; Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 120 ff., 132 ff.; Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (88). 248 BVerfGE 45, S. 63 (80) zur Grundrechtsberechtigung einer Juristischen Person des Privatrechts, deren alleiniger Aktionär eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Das Bundesverfassungsgericht hat im Rahmen der Untersuchung der Grundrechtsberechtigung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß sich „die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch juristische Personen des öffentlichen Rechts . . . in aller Regel nicht in Wahrnehmung unabgeleiteter, ursprünglicher Freiheiten, sondern aufgrund von Kompetenzen, die vom positiven Recht zugeordnet und inhaltlich bemessen und begrenzt sind“, vollziehe. So ausdrücklich BVerfGE 68, S. 193 (206). Ebenso BVerfGE 21, S. 362 (369 ff.); 61, S. 82 (101); BVerfG, NJW 1987, S. 2502 (2502); BVerfGE 75, S. 192 (196). Diese Regelaussage stützt sich allerdings auf weitere Kriterien wie das Vorliegen einer „Widmung“ und der Erfüllung „öffentlicher Aufgaben“. Vgl. dazu Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (86). In BVerfGE 68, S. 193 (207) weist das Gericht ausdrücklich darauf hin, daß „Grund der Nicht-Anwendbarkeit der Grundrechte auf juristische Personen des öffentlichen Rechts . . . nicht die Rechtsform als solche“ sei. Es komme „namentlich auf die Funktion an, in der eine juristische Person des öffentlichen Rechts von dem beanstandeten Akt der öffentlichen Gewalt betroffen wird“ (a. a. O., S. 207). In BVerfG, NJW 1990, S. 1783 stellt das Bundesverfassungsgericht nicht mehr auf die Regelaussage der Rechtsform ab, sondern nur noch auf die „Funktion“, in der die Juristische Person des Privatrechts von dem beanstandeten Akt der öffentlichen Gewalt betroffen sei. Kritisch zu diesem „Wechsel“ Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (9 f.); ders., in: FS Niederländer, S. 383 (393). 249 Stern, Staatsrecht III/1, S. 1170. 250 R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (222). 251 Steiner, Öffentliche Verwaltung durch Private, S. 206 ff.; R. Scholz, in: FS Lorenz, S. 213 (223 f.); Ehlers, Privatrechtsform, S. 85; ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 1 I 1, Rn. 4, § 2 III 2, Rn. 27; Puhl, Budgetflucht, S. 57 ff.; Koch, Status, S. 194 ff., 205 ff.; v. Trott zu Solz, Aktiengesellschaft, insbes. S. 200, 207 f., 215, 246, 253 f.; Zimmermann, Schutzanspruch, S. 255 f. Kritisch dazu Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 151 ff. 252 Vgl. nur Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 1 I 1, Rn. 4, § 2 III 2, Rn. 27; Remmert, Dienstleistungen, S. 252 ff.
3. Abschn.: Rechtsform als Kriterium
75
tion“253 gekennzeichnet. Als Folge dieser Beleihung bzw. Aufgabendelegation sei das Privatrechtssubjekt selbst „Verwaltungsträger“.254 Von den Vertretern des Rechtsformansatzes wird also die Existenz einer Vielzahl von Erscheinungsformen staatlicher Organisationseinheiten in privatrechtlicher Organisationsform konzediert. Infolgedessen ist die Organisationsform zur Kennzeichnung der Trennlinie zwischen Staat und Gesellschaft nicht geeignet. Der privatrechtlichen Organisationsform kann damit lediglich indizielle Bedeutung für die Privatheit der jeweiligen Organisationseinheit zukommen.255 Oben256 wurde bereits festgestellt, daß die Verfassung zu einer Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft zwingt. Vermutungsregeln werden diesem verfassungsrechtlich statuierten Dualismus nicht gerecht. Der Rechtsformansatz ist damit kein Unterscheidungskriterium, das den Anforderungen der Verfassung gerecht wird. Aber auch die indizielle Wirkung der öffentlichrechtlichen Organisationsform wird dadurch geschwächt, daß die Voraussetzungen der Ausnahmetatbestände in vielen Fällen unklar bleiben. So bleibt zumeist offen, woran man im Einzelfall erkennt, daß eine solche Beleihung oder Aufgabendelegation vorliegt. Es herrscht keine Einigkeit über die Voraussetzungen der Beleihung und ihrer Abgrenzung z. B. gegenüber der Fallgruppe der sogenannten „Verwaltungshilfe“.257
253
Koch, Status, S. 194 ff. Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 1 II, Rn. 16; Koch, Status, S. 194 ff., 205 ff. Vgl. auch Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 41, wonach der Beliehene insoweit „eigentlich ein Stück juristische Person des öffentlichen Rechts“ sei. 255 Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer, S. 383 (388) spricht von einer Regelaussage, der diese Regelvermutung allerdings nicht zugunsten der Staatseigenschaft öffentlichrechtlich organisierter Einheiten ausweitet (a. a. O., S. 391). Von einer „indizielle(n) Bedeutung“ spricht das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in BVerfGE 68, S. 193 (212); BVerfG, NJW 1987, S. 2501 (2502); ebenso Krebs, in: v. Münch/ Kunig (Hrsg.), Art. 19, Rn. 40; Puhl, Budgetflucht, S. 45 ff.; Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 168 f.; Oebbecke, VerwArch 81 (1991), S. 349 (356 f.). Vgl. auch Remmert, Dienstleistungen, S. 19 f., die allerdings diese Vermutungsregel nicht auf Beteiligungsunternehmen anwenden will: „Eine derartige Regel würde bedeuten, daß der Staat durch die Wahl seiner Organisationsform über seine ,Staatlichkeit‘ und damit über seine Rechtsbindung disponieren könnte“ (a. a. O., S. 20, Fn. 36). 256 Einleitung, S. 25, Fn. 13. 257 Ausführlich zu den verschiedenen Auffassungen in bezug auf die Voraussetzungen der Beleihung Remmert, Dienstleistungen, S. 252 ff., insbes. S. 254 ff. m. w. N. Vgl. zu Abgrenzungsschwierigkeiten von Beleihung und Verwaltungshilfe am Beispiel des Rechtsstatus der am öffentlichen Rettungsdienst Beteiligten M. Schulte, Rettungsdienst, S. 84 ff. 254
76
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
II. Verwaltung in Privatrechtsform Darüber hinaus führt der Rechtsformansatz mit seiner nur partiellen Öffnung für das Vorliegen von Verwaltung in Privatrechtsform und seiner Beschränkung auf die Fälle der Beleihung von Privatrechtssubjekten zu einer Vernachlässigung der Komplexität moderner Verwaltungsorganisation.258 Der Staat hat andere Möglichkeiten, Private in die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben einzuschalten, als durch Übertragung von „rechtlicher Macht über ein Stück Verwaltung“.259 Eine derart einschränkende Sicht hat zur Folge, daß zahlreiche Erscheinungsformen der Verwaltung nicht erfaßbar und systematisierbar sind.260 Entsprechendes gilt für die Fälle außerhalb der Beleihung. Der Rechtsformansatz wird der gemischt staatlich-privaten Entscheidungssituation in einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, deren Entscheidungsprozesse notwendig staatlich (mit-)beeinflußt sind, nicht gerecht. Er vernachlässigt mit seinem alternativen Zuordnungsmodell den staatlichen Entscheidungsanteil an gemischtwirtschaftlichen Unternehmensentscheidungen, wenn er diese Unternehmen dem Bereich des Privaten zuordnet. Das geforderte Zur-Geltung-Bringen des privaten Entscheidungsanteils geht also notwendig zu Lasten des staatlichen Entscheidungsanteils und kann damit ebenso wie der Beherrschungsansatz die gemischt staatlich-private Entscheidungswirklichkeit nur unzureichend abbilden.261 Deshalb besteht die Gefahr einer „Flucht in das Privatrecht“262. Der Staat kann durch die Wahl seiner Organisationsform die Staatlichkeit derselben bestimmen und sich so seinen Rechtsbindungen entziehen.263
258 Kritisch deshalb Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 155 f.; Groß, Kollegialprinzip, S. 33; Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 I 2, Rn. 14; i. E. so auch Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 128. 259 So ausdrücklich Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (143) unter Verweis auf Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 1924, S. 243 (Ossenbühl, a. a. O., Fn. 16). Zu den „Erfüllungsmodalitäten“ Ossenbühl, a. a. O., S. 137 (145 ff.). 260 So ausdrücklich Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 I 2, Rn. 14; ebenso Möstl, Grundrechtsbindung, S. 142; Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 19 m. Fn. 72, Rn. 40. 261 Krebs, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Art. 19, Rn. 45. Vgl. dazu auch die Nachweise oben in Fn. 204. 262 Begriff nach Fleiner, Institutionen, S. 326: „Flucht von Staat und Gemeinde in das Privatrecht“. Kritisch zur diesem – eine Freiheit der Formenwahl voraussetzenden – Bild Pestalozza, Formenmißbrauch, S. 166; ders., DÖV 1974, S. 188 (188 ff.). 263 So auch z. B. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 98 f.; Groß, Kollegialprinzip, S. 39 ff.; Remmert, Dienstleistungen, S. 20, Fn. 36.
4. Abschn.: Ingerenzpflicht des staatlichen Beteiligten
77
Vierter Abschnitt
Ingerenzpflicht des staatlichen Beteiligten Möglicherweise gelangt man zu einem wirklichkeitsnaheren Zuordnungsmodell, wenn man – wie verbreitet – eine sogenannte Ingerenz264- oder Einwirkungspflicht265 des staatlichen Beteiligten an einer Gesellschaft des Privatrechts annimmt.266 Der private Mitentscheidungsanteil an den unternehmerischen Entscheidungen erfordere es nach verbreiteter Ansicht, das Unternehmen insgesamt dem Bereich der Gesellschaft zuzuordnen. Nur so könne man eine Vernachlässigung des privaten Entscheidungsanteils vermeiden.267 Lediglich der beteiligte Verwaltungsträger sei an die Sonderbindungen des Staates gebunden. Nur dessen Entscheidungen seien staatliche Entscheidungen.268 Oben269 wurde allerdings bereits festgestellt, daß die unternehmerischen Entscheidungen das Ergebnis eines gemischt staatlich-privaten Entscheidungsprozesses sind und sich nicht in einzelne Entscheidungsanteile zerlegen lassen. Ein staatlicher Mitentscheidungsanteil ist zwar theoretisch gegeben, er läßt sich allerdings in der den jeweiligen Entscheidungsprozeß abschließenden Entscheidung nur schwer separieren. Vielmehr sind die Entscheidungen des gemischtwirtschaftlichen Unternehmens von einer eigenen gemischt staatlich-privaten Qualität. Jede unternehmerische Entscheidung trägt damit notwendig einen staatlichen Mitentscheidungsanteil in sich. So ist z. B. eine Entscheidung des Aufsichtsrates mehr als die Summe der Entscheidungen der vom Verwaltungsträger entsandten und von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmit264 Die Begriffe „Ingerenz“ und „Einwirkung“ werden verbreitet synonym verwendet, vgl. nur Brüning, Erledigung, S. 107 ff., insbes. S. 113, 116 f.; Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (475 ff.); Spannowsky, ZGR 25 (1996), S. 400 (421 ff.). 265 So z. B. Püttner, DVBl. 1975, S. 353 (354), der diese Pflicht ursprünglich nur zur Sicherung des Zugangsrechts zu öffentlichen Einrichtungen in Privatrechtsform heranzog. 266 Vgl. zu dieser Einwirkungspflicht nur Ehlers, Privatrechtsform, S. 85; ders., Recht der öffentlichen Unternehmen, E 39 f.; ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 3, Rn. 84 f.; ders., JZ 1987, S. 218 (224 f., 227); ders., JZ 1990, S. 1089 (1096); Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge, S. 238 ff.; Janson, Rechtsformen, S. 50 f., 138 ff.; Kraft, Verwaltungsgesellschaftsrecht, S. 20 ff., 25 ff., 67 ff.; Püttner, DVBl. 1975, S. 353 ff.; ders., Öffentliche Unternehmen, S. 86, 120, 137; Puhl, Budgetflucht, S. 164 f.; Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 176; Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (346); Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (insbes. S. 1073 ff.). 267 Z. B. Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 3, Rn. 84 ff.; ders., JZ 1990, S. 1089 (1096); ders., Recht der öffentlichen Unternehmen, E 39 f.; Pieroth, NWVBl. 1992, S. 85 (86 f.). 268 Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 3, Rn. 85 ff. I. E. so auch Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge, S. 230, 238 ff. 269 Erster Teil, S. 66 ff.
78
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
glieder. Der staatliche Mitentscheidungsanteil erstreckt sich nicht lediglich auf die Stimmabgabe des staatlichen Personals. Auch die unter Mitwirkung der z. B. Gemeinderatsmitglieder zustande gekommene Entscheidung des Aufsichtsrates hat einen staatlichen Entscheidungsanteil. Ist nun der Aufsichtsrat nicht Teil einer staatlichen Organisationseinheit und als solcher nicht an die Sonderbindungen des Staates gebunden, dann besteht die Gefahr, daß der Staat seine Sonderbindungen umgeht. Um eine solche Umgehung der Sonderbindungen des Staates durch den jeweiligen beteiligten Verwaltungsträger zu verhindern, müsse nach verbreiteter Ansicht eine Verpflichtung desselben angenommen werden, auf das Unternehmen derart einzuwirken, „daß die Einhaltung der durch öffentliches Recht bestimmten besonderen rechtlichen Bindungen . . . jederzeit sichergestellt ist“.270 Diese Ingerenzpflicht ist keine konkrete Verpflichtung der an einer Gesellschaft des Privatrechts beteiligten Verwaltungsträger, bestimmte Entscheidungen nach bestimmten Entscheidungsvorgaben zu treffen. Sie ist vielmehr eine Verpflichtung der kommunalen Anteilseigner, von ihren Ingerenzmöglichkeiten Gebrauch zu machen.271 Die Erfüllung dieser Ingerenzpflicht soll dazu führen, daß private Entscheidungen an den staatlichen Entscheidungsvorgaben ausgerichtet werden, ohne daß die entscheidende Gesellschaft des Privatrechts dadurch zu einer staatlichen Verwaltungseinheit werde. Die Ingerenzpflicht stelle sicher, daß der Staat im Wege der Einschaltung Privater in die Erfüllung seiner Aufgaben keine „Flucht in das Privatrecht“272 begehe.273 Diese vorstehend beschriebene Ingerenzpflicht des an einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft beteiligten Verwaltungsträgers ist weitgehend274 recht270
Püttner, DVBl. 1975, S. 353 (356). Ehlers, Privatrechtsform, S. 250; ders., JZ 1987, S. 218 (224 f., 227); ders., JZ 1990, S. 1089 (1096); ders., in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 4, Rn. 85; Schachtschneider, Staatsunternehmen, S. 176 f.; Puhl, Budgetflucht, S. 164 f.; Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (346). 272 Vgl. oben Fn. 262. 273 Vgl. Püttner, DVBl. 1975, S. 353 (353). Zur Herleitung vgl. nur Spannowsky, ZGR 25 (1996), S. 400 (413 f.) m. w. N. Kritisiert wird verbreitet, das Gesellschaftsrecht stelle dem beteiligten Verwaltungsträger nicht in jedem Fall ausreichende Ingerenzmöglichkeiten zur Verfügung. Vgl. nur Möstl, Grundrechtsbindung, S. 102 f.; Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 237 ff., insbes. S. 267 ff. m. w. N. 274 Soweit keine Regelung existiert, wird die Ingerenzpflicht aus Art. 20 Abs. 2 S. 1 GG abgeleitet. Vgl. dazu nur Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 225 ff. Das Prinzip demokratischer Legitimation erfordere eine umfassende Steuerung der Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch ihre Träger- bzw. Beteiligungskörperschaften (Gersdorf, a. a. O., S. 225). Vgl. auch Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 86, 137; Schmidt-Aßmann/Ulmer, BB 1988, Beil. 13, S. 13; Puhl, Budgetflucht, S. 165; H. Dreier, Hierarchische Verwaltung, S. 258 ff.; Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1074); Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (476). Anders dagegen Janson, Rechtsformen, S. 137, der die Einwirkungspflicht aus dem „Rechtsstaatsprinzip“ ableitet. Offen bleibt nach all diesen Ansichten, ob und inwieweit diese Juristischen Personen des Privat271
4. Abschn.: Ingerenzpflicht des staatlichen Beteiligten
79
lich normiert. So finden sich Regelungen in den Gemeinde- und Kreisordnungen und den Haushaltsordnungen. Demnach sei durch die Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages sicherzustellen, daß der beteiligte Verwaltungsträger einen „angemessenen Einfluß“275 insbesondere in den Entscheidungsorganen der Gesellschaft erhalte. In den Gemeinde- und Kreisordnungen wird der Verwaltungsträger darüber hinaus verpflichtet, durch Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages sicherzustellen, „daß das Unternehmen den öffentlichen Zweck erfüllt“.276 Wie diese Ingerenzpflicht zu erfüllen ist, überlassen die kommunalrechtlichen Vorschriften den kommunalen Anteilseignern weitgehend selbst. Verbreitet existieren Vorschriften, wonach die beteiligten Gebietskörperschaften im Fall einer Mehrheitsbeteiligung sicherstellen sollen, daß – entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe – gesellschaftsvertraglich die jährliche Erstellung von Wirtschaftsplänen für die gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften vorgesehen wird.277 Darüber hinaus soll im Fall einer Mehrheitsbeteiligung verbreitet ein sogenannter Lagebericht erstellt werden.278 Sowohl § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO als auch § 65 Abs. 6 BHO und den entsprechenden Landeshaushaltsordnungen läßt sich entnehmen, daß das Haushaltsrecht den Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Überwachungsorgan als ein zentrales Einflußinstrument für den staatlichen Anteilseigner ansieht.279
rechts demokratisch legitimationsbedürftige Staatsgewalt ausüben oder ob nur der staatliche Entscheidungsanteil dem Gebot demokratischer Legitimation unterliege. Die Beantwortung dieser Frage ist erforderlich, um Inhalt und Umfang einer verfassungsrechtlichen Ingerenzpflicht des staatlichen Anteilseigners bestimmen zu können. 275 Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayGO; § 102 Nr. 2 BbgGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BWGO; § 122 Abs. 1 S. 1 HeGO; § 69 Abs. 1 Nr. 3 MVKV; § 109 Abs. 1 Nr. 6 NdsGO; § 108 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 NrWGO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 RPGO; § 110 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKSVG; § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO; § 117 Abs. 1 Nr. 3 SAGO; § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SHGO; § 73 Abs. 1 Nr. 3 ThürKO und § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO sowie die entsprechenden Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen. 276 Vgl. die Nachweise oben S. 48, Fn. 105. 277 Art. 94 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 5a, c BWGO; § 122 Abs. 4 Nr. 1a HeGO; § 73 Abs. 1 Nr. 1a MVKV; § 108 Abs. 2 Nr. 1a NrWGO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 7a RPGO; § 111 Abs. 1 Nr. 2 e SaarlKSVG; § 96 Abs. 2 Nr. 4 SächsGO; § 121 Abs. 1 Nr. 1a SAGO; § 102 Abs. 4 Nr. 1 SHGO. Die BbgGO, NdsGO und ThürKO enthalten keine entsprechenden Bestimmungen. 278 Art. 94 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 5b BWGO; § 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HeGO; § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1b MVKV; § 108 Abs. 2 S. 1 Nr. 1c NrWGO; § 89 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 RPGO; § 110 Abs. 1 Nr. 4 SaarlKSVG; § 96 Abs. 2 Nr. 6 SächsGO; § 118 Abs. 1 S. 1 SAGO; § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SHGO; § 75 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ThürKO. Keine entsprechenden Vorschriften enthalten die BbgGO und NdsGO. 279 Ehlers, Privatrechtsform, S. 166. Zur Bedeutung des Kriteriums der Anteilsmehrheit in sonstigen Rechtssätzen vgl. auch bereits oben S. 37, Fn. 49.
80
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Im übrigen bleibt es dem kommunalen Anteilseigner überlassen, die Ingerenzpflicht mit den Mitteln des Gesellschaftsrechts zu erfüllen. Unklar bleibt, wann ein „angemessener Einfluß“ im Einzelfall gegeben ist und zu welchen Entscheidungen die Rechtssätze den Verwaltungsträger im Einzelfall verpflichten.280 Es stellt sich damit die Frage, welche Reichweite die Ingerenzpflicht des staatlichen Anteilseigners im Einzelfall hat. Das Tatbestandsmerkmal „angemessen“ im Sinne der kommunalrechtlichen und haushaltsrechtlichen Vorschriften setzt eine Wertung im Einzelfall voraus. Die Kriterien für die Wertung bleiben allerdings verbreitet offen.281 Möglicherweise richtet sich die Intensität der Ingerenz nach der Summe der staatlichen Entscheidungsanteile.282 Die Intensität kann aber auch abhängig sein von der Art der Aufgabenerfüllung.283 Es wird vorgeschlagen, der staatliche Beteiligte müsse einen „effektiven Einfluß“ auf die Unternehmenstätigkeit haben und es müsse sichergestellt sein, daß alle für das Unternehmen wesentlichen Entscheidungen nicht gegen den Willen des Verwaltungsträgers getroffen werden dürfen.284 Es dürften keine „kontrollfreien Räume“285 entstehen. Die staatlichen Beteiligten müßten die Entscheidungen gemischtwirtschaftlicher Unternehmen „in ausreichendem Maße beeinflussen können“.286 Schließlich wird festgestellt, daß die Einwirkungspflichten „um so weiter reichen, . . . je mehr durch die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe die Wahrnehmung anderer grundrechtssichernder Aufgaben des Staates beeinträchtigt und freiheitsgefähr-
280
Kritisch deshalb Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (476). Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075) weist darauf hin, daß einer generellen Regelung der Reichweite der Ingerenzpflicht „angesichts der aufgabentypischen Unterschiede nur wenig Aussagekraft zukommen könnte“. Nach Strobel, DVBl. 2005, S. 77 (78) orientiere sich der Umfang der Ingerenzpflichten „an der Rechtsform, dem Beteiligungsgrad, der personellen Struktur und der Größe des Unternehmens sowie an seinem Aufgabengebiet“ und lasse „sich abstrakt nur schwer bestimmen“. 282 So wohl Puhl, Budgetflucht, S. 164. Nach Ehlers, Privatrechtsform, S. 166 ist der Einfluß des Bundes „angemessen“ i. S. v. § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO, wenn er dem mit der Beteiligung verfolgten Zweck sowie der Höhe und Bedeutung der Beteiligung gerecht werde. 283 So Ehlers, Privatrechtsform, S. 131 f., 166; Engellandt, Einflußnahme, S. 21 f., 26, 84; Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften, S. 13 ff. 284 Puhl, Budgetflucht, S. 164 in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Voraussetzungen demokratischer Legitimation [vgl. nur BVerfGE 83, S. 60 (70 f.)]. So auch Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075); Engellandt, Einflußnahme, S. 21 f., 26. Dazu, daß die Ingerenzpflicht aus Art. 20 Abs. 2 GG abgeleitet wird, soweit keine einfachrechtlichen Regelungen existieren, vgl. bereits oben S. 78, Fn. 274. Anders dagegen Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 237 ff., insbes. S. 242 ff., der aus dem Demokratieprinzip eine umfassende Verpflichtung zur Steuerung sämtlicher Entscheidungen der Beteiligungsgesellschaften ableitet. 285 Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075), der dieses Kriterium aus dem Rechtsstaatsprinzip ableiten will. 286 Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075). 281
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
81
dende Umstände geschaffen werden können“.287 Dies sei insbesondere der Fall, wenn gemischtwirtschaftlichen Unternehmen „die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern überlassen wird“.288 Diese Kriterien setzen ihrerseits eine Bewertung von Einflußintensitäten oder der Bedeutung unternehmerischer Aufgabenbereiche voraus. Dadurch entsteht die Gefahr, daß das Problem nur angesprochen, nicht gelöst wird. Es bleibt offen, welche Beherrschungsintensität im Einzelfall vorliegen muß, damit der Verwaltungsträger seine Ingerenzpflicht erfüllt und eine „Flucht in das Privatrecht“ gerade nicht vorliegt. Es wird also deutlich, daß die Frage nach der Staatseigenschaft im konkreten Fall lediglich verschoben wird auf die Frage, welche Intensität die staatliche Ingerenzpflicht im Einzelfall besitzen muß. Auch der Ansatz von der staatlichen Ingerenzpflicht vermag damit das Zuordnungsproblem gemischtwirtschaftlicher Unternehmen nicht zu lösen. Fünfter Abschnitt
Öffentliche Aufgabe als Kriterium der Staatseigenschaft Es stellt sich die Frage, auf welche sonstigen Kriterien zur Bestimmung der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen abgestellt werden kann. Zur Beantwortung dieser Frage sind zunächst die bisherigen Ergebnisse in Erinnerung zu rufen. Oben289 wurde bereits festgestellt, daß der Begriff der „vollziehenden Gewalt“ im Sinne von Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG eine staatliche Entscheidungseinheit kennzeichnet, die sich dadurch auszeichnet, daß ihre Entscheidungen an spezifisch staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausgerichtet sind. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften sind deshalb Adressaten dieser Sonderbindungen des Staates, wenn sich auch ihre Entscheidungen an jenen staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausrichten. Diese besondere Ausrichtung unternehmerischer Entscheidungen kann auf verschiedenen Gründen beruhen. Ein Unternehmen entscheidet z. B. – wie oben290 bereits erörtert – „staatlich“, wenn es staatlich beherrscht wird. Dies wiederum kann der Fall sein, wenn zumindest überwiegend staatliches Personal entscheidet. Aufgrund der Komplexität unternehmerischer Entscheidungspro287 288 289 290
Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075). Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 (1075). Erster Teil, S. 28 ff. S. 31 ff.
82
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
zesse und ihrer Entscheidungsfaktoren können staatliche Anteilsmehrheiten und eine daraus z. B. folgende Personalsteuerung allerdings lediglich Indiz für das Vorliegen einer staatlichen Entscheidungsherrschaft sein. Die öffentlichrechtliche Rechtsform ihrerseits ist zwar zur inhaltlichen Beeinflussung von Entscheidungen geeignet, kann jedoch ebenfalls nur Indiz für das Vorliegen einer staatlichen Entscheidungseinheit sein, will sie nicht die gesamte Verwaltung in Privatrechtsform aus dem Untersuchungsgegenstand ausblenden. Möglicherweise kann man aber von einer Ausrichtung der unternehmerischen Entscheidungen an staatlichen Entscheidungsmaßstäben in denjenigen Fällen ausgehen, in denen das Unternehmen in Sachbereichen tätig ist, auf denen zumindest typischerweise staatliche Zielsetzungen verfolgt werden. Denkbar ist es z. B., daß es bestimmte Entscheidungsbereiche und mit diesen einhergehende Entscheidungsmaßstäbe gibt, an denen sich ausschließlich staatliche Entscheider ausrichten. So läßt sich möglicherweise eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft dem Adressatenkreis der Sonderbindungen des Staates zuordnen, wenn sich nachweisen läßt, daß das Unternehmen in einem Bereich tätig wird, in dem staatliche Zielsetzungen verfolgt werden.291 Diese inhaltlichen Entscheidungsmaßstäbe des Staates sind nur dann zur Abgrenzung gegenüber privaten Entscheidungsmaßstäben geeignet, wenn sich solche staatlichen Entscheidungsbereiche und Entscheidungsziele ausmachen lassen und diese zugleich auch ausschließlich292 staatliche Entscheidungsbereiche und -maßstäbe sind.
A. Öffentliche Aufgabe als staatlicher Entscheidungsbereich und -maßstab Die staatlichen Entscheidungsbereiche und -maßstäbe werden verbreitet „öffentliche Aufgaben“ genannt.293 Die Eigenschaft als staatliche Entscheidungsbe291 Dementsprechend wird verbreitet davon ausgegangen, gemischtwirtschaftliche Unternehmen seien dem Bereich staatlicher Organisation zuzuordnen, wenn sie „öffentliche Aufgaben wahrnehmen“. Vgl. nur BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783). Auf das Kriterium der „Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ hat das Bundesverfassungsgericht bereits mehrfach zur Beurteilung der Grundrechtsberechtigung Juristischer Personen des öffentlichen Rechts abgestellt. So sollen die Grundrechte grundsätzlich nicht für Juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten, „soweit diese öffentliche Aufgaben wahrnehmen“ [z. B. BVerfGE 21, S. 362 (369 f.); 45, S. 63 (78); 61, S. 82 (101); 68, S. 193 (206); 75, S. 192 (196)]. Vgl. auch Klein, Teilnahme des Staates, S. 24 f., 87 ff. m. w. N., insbes. S. 91; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 103 ff.; insbes. S. 107, 137 ff., der zum einen auf die Art der wahrgenommen Aufgabe als „Verwaltungsaufgabe“ und zum anderen auf eine „staatliche Beherrschung“ abstellt. Zum Begriff der öffentlichen Aufgabe sogleich. 292 So wird diskutiert, ob es „genuine“, „zwingende“, „notwendige“, „unbedingte“, „unentbehrliche“, „unverzichtbare“, „geborene“ oder „originäre“ Staatsaufgaben gebe (Aufzählung nach Kämmerer, Privatisierung, S. 157).
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
83
reiche und -maßstäbe kennzeichnet der Begriff der „öffentlichen“ Aufgabe, „Staatsaufgabe“ bzw. „staatlichen Aufgabe“.294 Der Begriff der öffentlichen Aufgabe beschreibt also sowohl Sachbereiche, auf denen staatliche Entscheider tätig werden, als auch deren Ziel- bzw. Zwecksetzungen, die auf den jeweiligen Sachgebieten verwirklicht werden sollen.295 Nach diesem hier sogenannten Aufgabenansatz kennzeichnen sich die staatlichen Verpflichtungsrechtssubjekte gerade dadurch, daß ihre Entscheidungen eine besondere inhaltliche Qualität aufweisen. Sie werden in bestimmten staatlichen Sachbereichen mit bestimmten staatlichen Zielsetzungen getroffen. Ein solcher staatlicher Handlungszweck ist also nach dem Aufgabenansatz „als begriffsbildende und differenzierende Kategorie“296 Kriterium der Staatseigenschaft. Staatliche Einheiten sollen „Zweckeinheiten“ sein.297 Darüber hinaus wird vertreten, die staatliche Zielsetzung der „öffentlichen Aufgabe“ sei der legitimierende Grund staatlicher Tätigkeit.298 Der Begriff der öffentlichen Aufgabe weist damit über die reine Beschreibung eines staatlichen Entscheidungsbereiches und dessen Entscheidungsvorgaben hinaus und kennzeichnet ein bestimmtes staatstheoretisches Verständnis vom Wesen des Staates. Öffentliche Aufgaben können einen unterschiedlich abstrakten Inhalt aufweisen. Der abstrakteste Entscheidungsmaßstab staatlicher Einheiten ist nach verbreiteter Ansicht das Ziel aller staatlichen Entscheidungstätigkeit, gemeinnützige Entscheidungen zu treffen.299 Letztere seien Entscheidungen, die dem 293 Eine Trennung zwischen Entscheidungsbereich und -maßstab erfolgt in der Regel nicht. Beide hängen notwendig mit einander zusammen und bedingen einander. Dies geht auch aus der Formulierung von Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 14 hervor: „Ein Inbegriff von sachlich zusammenhängenden Kompetenzen (Kompetenzbereich), also ein Sachgebiet (Sachbereich), auf dem die Zwecke der organisatorischen Einheit (zB die Staatszwecke) verwirklicht werden sollen, ist eine Aufgabe iwS“. Vgl. ebenso Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 10, Rn. 1, wonach der Begriff der Aufgabe „einen bestimmten zielorientierten Tätigkeitsbereich“ beschreibe. 294 Vgl. nur Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (144 f.). 295 Der Begriff des Zwecks zeichnet sich im Gegensatz zum Begriff des Ziels durch eine besondere Bezogenheit auf die Realisierung der Zielvorstellungen aus. Ein Zweck kennzeichnet sowohl die Zielvorstellung, als auch das realisierte Ziel [vgl. ähnlich Link, VVDStRL 48 (1990), S. 7 (18)]. Diese Differenzierung soll für den vorliegenden Untersuchungsgegenstand nicht interessieren, die Begriffe „Aufgabe“, „Ziel“ und „Zweck“ werden deshalb im folgenden synonym verwendet. 296 Badura, DÖV 1966, S. 624 (626). 297 Vgl. dazu Kämmerer, Privatisierung, S. 158 ff. Zu Staatszwecklehren der Vergangenheit und Gegenwart vgl. nur Weiß, Privatisierung, S. 57 ff.; Link, VVDStRL 48 (1990), S. 7 (10 ff.). Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 44 weist darauf hin, daß dem Begriff der Staatsaufgabe „dogmatische Bedeutung“ zukomme. 298 Vgl. dazu nur in bezug auf das Gemeinwohl Sommermann, Staatsziele, S. 199 ff.; Link, VVDStRL 48 (1990), S. 7 (51 f.); Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204 (224); 299 Das Gemeinwohl soll die umfassendste und abstrakteste aller Zielvorgaben sein und kennzeichne alle staatlichen Entscheidungen. So z. B. BVerfGE 42, S. 312 (332);
84
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
„Gemeinwohl“ und nicht individuellen Interessen privater Rechtssubjekte dienen. Die Verwirklichung des Gemeinwohls sei oberster Staatszweck.300 Die Ausprägungen des Gemeinwohls werden mit dem Begriff der „Daseinsvorsorge“301 oder der „Leistungsverwaltung“302 umschrieben im Gegensatz zu erwerbswirtschaftlichen Zielsetzungen Privater.303 Es wird vertreten, der Staat habe die Pflicht, eine angemessene Bedürfnisbefriedigung der Bürger zu gewährleisten.304 Ziel staatlichen Entscheidens sei deshalb Gemeinwohlverwirklichung und die „Befriedigung kollektiver Bedürfnisse“.305 Dieser ausschließlich staatliche Entscheidungsmaßstab sei präpositiv,306 d. h. die Aufgaben der „Gemeinwohlverwirklichung“ bzw. „Daseinsvorsorge“ seien nicht verfassungsrechtlich oder einfachrechtlich normiert.
44, S. 124 (141 f.); Isensee, in: HdBStR III, § 57, Rn. 1 ff., 134; Klein, Teilnahme des Staates, S. 13, 26 m. w. N. in Fn. 26; Schuppert, Staatswissenschaft, S. 215 ff.; Fügemann, Zuständigkeit, S. 3; Link, VVDStRL 48 (1990), S. 7 (19 ff.). Vgl. auch EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (368), wonach innerstaatliche Beziehungen durch „Überlegungen und Erfordernisse bestimmt (werden), die mit der Verfolgung von im öffentlichen Interesse liegenden Zielen zusammenhängen“. 300 Bull, Staatsaufgaben, S. 29; Schuppert, Staatswissenschaft, S. 215 ff. 301 BGHZ 52, S. 325 (328); 65, S. 284 (287); 115, S. 311 (313); 119, S. 101 (105); 123, S. 157 (162); 132, S. 198 (205); Ronellenfitsch, in: HdBStR III, § 84, Rn. 48; Bachof, AöR 83 (1958), S. 208 (234); Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 (218). Der Begriff Daseinsvorsorge geht für die Rechtswissenschaft zurück auf Ernst Forsthoff, Die Verwaltung als Leistungsträger, 1938, unveränd. Wiederabdruck in ders., Rechtsfragen der leistenden Verwaltung, 1959, S. 22 (25 f.). Das Bundesverfassungsgericht verwendet ihn u. a. in seiner Entscheidung zur Grundrechtsbindung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783), wonach die Durchführung der Wasser- und Energieversorgung eine typische, die Daseinsvorsorge betreffende Aufgabe der kommunalen Gebietskörperschaft sei. 302 Zum Begriff der Leistungsverwaltung und der Daseinsvorsorge nur BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783) und BGHZ 91, S. 84 (95 ff.) mit Verweis auf Ernst Forsthoff, Verwaltungsrecht, Band 1, 10. Aufl. 1973, Vorb. § 20, S. 370. 303 Zurück geht diese Unterscheidung auf die Lehre vom Verwaltungsprivatrecht. Vgl. dazu bereits oben S. 48, Fn. 111. Klein, Teilnahme des Staates, S. 24 weist darauf hin, daß das Merkmal der „Konkurrenz“ Unterscheidungskriterium zwischen dem Begriff der Daseinsvorsorge und dem der Erwerbswirtschaft sei. 304 Klein, Teilnahme des Staates, S. 17, 26. 305 Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 154. In diesem Sinn z. B. auch Gramm, Privatisierung, S. 336, der z. B. die „Bereitstellung öffentlicher Güter“ als staatliche Kernaufgabe ansieht. 306 Isensee, in: HdBStR III, § 57, Rn. 37: „Seine Geltung geht jeder Positivierung voraus“.
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
85
B. Fehlende Spezifizierbarkeit Während auf dieser abstrakten Ebene noch Einigkeit über die Bestimmung des Begriffs der öffentlichen Aufgabe besteht, wird eine solche Zuordnung auf konkreter Ebene schwieriger. I. Positive Begriffsbestimmungen Begründungen für die Zuordnung bestimmter Sachgebiete zum Bereich des Staatlichen finden sich selten. Als einziges Zuordnungskriterium dient zumeist ein Verweis auf die traditionelle Zuordnung der jeweiligen Tätigkeit zum Bereich staatlicher Entscheidungstätigkeit.307 Dementsprechend finden sich Ansichten, wonach z. B. die Energie- und Wasserversorgung308 oder die Abwasserbeseitigung,309 die Abfallentsorgung,310 die Straßenreinigung,311 der öffentliche Personennahverkehr,312 der Betrieb von Krankenhäusern,313 die Bauplanung und Bausanierung,314 sowie die Polizei315 der Umsetzung des Entscheidungsmaßstabes der Daseinsvorsorge dienen sollen.316 Unternehmen, die in diesen
307 BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783), wonach „. . . die Durchführung der Wasserund Energieversorgung zu den typischen, die Daseinsvorsorge betreffenden Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften“ gehöre (Hervor. d. Verf.). Ebenso BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.) unter Verweis auf u. a. BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783); BGH, NJW 2004, S. 693 (693) = BGHSt 49, S. 214 (219); BGHZ 91, S. 84 (86); 132, S. 198 (205); Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 (229). Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 158 weist darauf hin, daß die amtliche Begründung zu § 67 Abs. 1 DGO zur näheren Konkretisierung des Begriffs „öffentlicher Zweck“ auf die geschichtliche Entwicklung und die herrschenden Anschauungen verwies. Umgekehrt für die traditionelle Zuordnung eines Tätigkeitsbereichs zum Bereich des „Fiskus“ Klein, Teilnahme des Staates, S. 26. 308 So BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783); BVerfGE 38, S. 258 (270 f.); 45, S. 63 (78); VGH Mannheim, NVwZ 1997, S. 90 (91); BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.); BGHSt 29, S. 214 (219); BGHZ 91, S. 84 (86). 309 BGHZ 115, S. 311 (313). 310 BVerfGE 38, S. 258 (270 f.); BVerwG, DVBl. 1990, S. 589 (589, 590 f.); BVerwGE 67, S. 321 (326). 311 BGH, NJW 1991, S. 33 (36). 312 BVerfGE 38, S. 258 (270 f.). 313 BVerfGE 38, S. 258 (270 f.). 314 BVerfGE 38, S. 258 (270 f.). 315 Z. B. Lecheler, ZBR 1980, S. 69 (69 f.); R. Scholz, NJW 1997, S. 14 ff.; Ronellenfitsch, DÖV 1999, S. 705 (708). 316 Die Ansicht, wonach es einen „Kernbestand“ ausschließlich dem Staat zugewiesener Aufgabe gebe, wird verbreitet „Aufgabentheorie“ genannt [vgl. nur Kämmerer, Privatisierung, S. 158]. Das Bestehen eines solchen Kernbestandes nehmen z. B. Kämmerer, Privatisierung, S. 179; Gramm, Privatisierung, S. 336; Lecheler, ZBR 1980, S. 69 (69 f.) u. Ronellenfitsch, DÖV 1994, S. 705 (708) an. Vgl. auch BVerfGE 17, S. 376 (377), einschränkend aber E 73, S. 280 (294).
86
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Entscheidungsbereichen tätig seien, würden zwingend gemeinnützige Entscheidungen treffen. Es stellt sich hier zum einen die Frage, warum z. B. die Lebensmittelversorgung nicht zu diesen gemeinwohlbezogenen Sachgebieten gezählt wird.317 So ist es auch in anderen Bereichen als den vorstehend genannten denkbar, daß eine entsprechende Entscheidungstätigkeit zu einer Umsetzung gemeinwohlorientierter Zielsetzungen führt.318 Zum anderen ist zu beachten, daß staatliche Entscheidungsbereiche durch den Gesetzgeber verändert werden können. Der Staat kann Aufgaben an sich ziehen, und er kann sich aus einer Aufgabenwahrnehmung auch wieder zurückziehen. Der Aufgabenbereich des Staates ist notwendig offen.319 Verschiedentlich wird zwar versucht, Kataloge ausschließlich staatlicher Aufgaben aufzustellen,320 eine einheitliche Staatsaufgabenlehre existiert allerdings bis heute nicht.321 Einen Regelsatz derart, daß bestimmte Entscheidungsbereiche die Erfüllung staatlicher Entscheidungsmaßstäbe nach sich ziehen, wird man in einer Zeit zunehmender Verschränkung zwischen Staat und Gesellschaft nicht aufstellen können.322 Auch in ehemals typisch staatlichen, da „hoheitlichen“ 323 Aufgabenbe-
317 So ist wohl Klein, Teilnahme des Staates, S. 17 zu verstehen. Einen ausführlichen Überblick über die Rechtsprechung zu Entscheidungsbereichen der Daseinsvorsorge gibt Storr, Staat, S. 109, Fn. 135 u. 136. Zur widersprüchlichen Verwendung des Begriffs ders., a. a. O., S. 112, Fn. 148. 318 In diesem Sinn auch Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 99: „Niemand kann mit Sicherheit sagen, welche Leistungen . . . lebenswichtig sind und welche nicht“. 319 Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (153 f.); Häberle, AöR 111 (1986), S. 595 (604); Schuppert, Staatswissenschaft, S. 221 ff. 320 Z. B. Bull, Staatsaufgaben, S. 149 ff., 224 ff. Vgl. auch Gramm, Privatisierung, S. 336, der z. B. die „Bereitstellung öffentlicher Güter“ als nicht privatisierungsfähige staatliche Kernaufgabe ansieht. Richtig allerdings Weiß, Privatisierung, S. 265, 267 f., der darauf verweist, daß es keine Kriterien zur Kennzeichnung staatlicher Kernaufgaben gibt. Auch Kämmerer, Privatisierung, S. 179 geht von einem „Kernbereich staatlicher Funktionserfüllung“ aus. Dieser Kernbereich unterliege allerdings stetem Wandel. Einen Überblick über Systematisierungsversuche gibt Schuppert, VerwArch 71 (1980), S. 309 (310 ff.); ders., Staatswissenschaft, S. 277 ff. 321 So Storr, Staat, S. 105; Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 155 f.; Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 41. Eine Staatsaufgabenlehre entwickeln u. a. Bull, Staatsaufgaben, S. 1 ff., 211 ff.; Weiß, Privatisierung, S. 97 ff.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 89 ff. m. w. N. 322 Vgl. auch Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (165) gegen die Anwendung materialer Kriterien zur Abgrenzung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Verträge: „Das ist angesichts der Verzahnung von Staat und Gesellschaft, die notwendig eine Grauzone gleitender Übergänge schafft, trennscharf nicht möglich“. 323 Der Begriff der „hoheitsrechtlichen Befugnisse“ in z. B. Art. 33 Abs. 4 GG meint herkömmlich die Befugnisse der „Eingriffsverwaltung überkommener Art, bei
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
87
reichen, wie z. B. dem Polizei- und Ordnungsrecht, finden sich Private z. B. in Form privater Sicherheitsdienste.324 II. Negative Begriffsbestimmungen Möglicherweise gelingt es aber, den Begriff der öffentlichen Aufgabe negativ zu definieren. So wird argumentiert, eine erwerbswirtschaftliche Zielsetzung sei gerade kein gemeinwohlorientierter Entscheidungsmaßstab.325 Dementsprechend enthalten auch die kommunalrechtlichen Vorschriften Regelungen, wonach sich die jeweilige Gebietskörperschaft zur Erfüllung ihrer Aufgaben nur wirtschaftlich betätigen darf, wenn ein öffentlicher Zweck diese Betätigung erfordere.326 Daß das Kriterium der erwerbswirtschaftlichen Zielsetzung zur Abgrenzung staatlicher und privater Entscheidungsmaßstäbe nicht geeignet ist, ergibt sich allerdings bereits aus den vorstehend genannten kommunalrechtlichen Vorschriften selbst. So gibt es Bestimmungen, in denen die (Beteiligungs-)Unternehmen der Gemeinde, deren Tätigkeit durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt sein muß, der Art ihrer Betätigung nach als solche angesehen werden, die mit Gewinn betrieben werden können.327 Auch finden sich Beteiligungen der der Staat mit Befehl und Zwang tätig wird“ [Maunz, in: ders./Dürig, GG, Art. 33, Rn. 33; ebenso Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 (218 ff.)]. 324 Vgl. dazu nur Jungk, in: Stober/Olschok (Hrsg.), Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, S. 571 ff.; Burgi, in: Stober/Olschok (Hrsg.), Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, S. 585 ff. 325 Die überkommene Fiskustheorie ging davon aus, daß erwerbwirtschaftliche Tätigkeit eines staatlichen Rechtssubjekts keine staatliche Tätigkeit darstelle. Der erwerbswirtschaftlich tätige Staat handele privat und sei infolge dessen nicht an die Sonderbindungen des Staates gebunden [Nachweise bei Papier, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 40 II 5, Rn. 19, Fn. 25; Erichsen, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, S. 112 f.]. Diese Unterscheidung zwischen zwei „Existenzen“ staatlichen Handelns wird so – soweit ersichtlich – nicht mehr nachvollzogen. Alles staatliche Handeln ist nach allgemeiner Ansicht umfassend an die Sonderbindungen des Staates gebunden [so z. B. Dürig, in: Maunz/ders., GG, Art. 1 Abs. III, Rn. 134 f. zur Grundrechtsbindung fiskalisch handelnder Verwaltungsträger; ebenso Kunig, in: v. Münch/ders. (Hrsg.), Art. 1, Rn. 50, 60; Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 2 IV 1, Rn. 71 ff.]. Die Trennung zwischen erwerbswirtschaftlichen Zielsetzungen und gemeinwohlbezogenen wird allerdings verbreitet in verschiedenen Erklärungsansätzen beibehalten (so Erichsen, a. a. O., S. 113). Zum Ansatz vom Verwaltungsprivatrecht vgl. bereits oben S. 48, Fn. 111. 326 Vgl. dazu bereits die Nachweise oben S. 48, Fn. 105. 327 Darauf weisen auch Weiß, Privatisierung, S. 24; Ehlers, Privatrechtsform, S. 139 f. und v. Mutius/Nesselmüller, NJW 1976, S. 1878 (1879) hin. So ausdrücklich z. B. in § 100 Abs. 1 BbgGO: „Wirtschaftliche Betätigung im Sinne dieses Gesetzes ist das Herstellen, Anbieten . . . von . . . Dienstleistungen . . ., die ihrer Art nach auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden könnten.“ Vgl. auch § 107 S. 2 BbgGO, wonach „der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen . . . so hoch sein (soll), dass außer den für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Ei-
88
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
von Verwaltungsträgern an Gesellschaften des Privatrechts, die nicht mit dem Ziel der Wahrnehmung einzelner der vorstehend genannten Sachbereiche erfolgen, sondern aus rein oder zumindest auch finanzwirtschaftlichen Gründen gehalten werden.328 Schließlich dient jede staatliche Wirtschaftstätigkeit durch die Erzielung von Einnahmen, die wiederum dem Staatshaushalt zufließen, jedenfalls mittelbar dem allgemeinen Wohl.329 Ein Kriterium, das zwischen einer nur mittelbaren und einer unmittelbaren Erfüllung gemeinwohlbezogener Aufgaben unterscheiden könnte, existiert nicht.330 Darüber hinaus ist zu bedenken, daß eine gemeinwohlbezogene Entscheidungstätigkeit „schon von der Sache her nicht daran vorbei(kommt), die Regeln einer am Markt orientierten Wettbewerbswirtschaft zumindest mit zu berücksichtigen und insoweit auch unternehmerisch zu handeln“.331 Ein Dualismus zwischen erwerbswirtschaftlicher Betätigung und der sogenannten gemeinwohlbezogenen Leistungsverwaltung existiert in dieser alternativen Form also weder rechtlich noch tatsächlich. Ein gewinnorientiertes Handeln und Tätigkeiten im Rahmen der Leistungsverwaltung widersprechen sich nicht.332
genkapitals erwirtschaftet wird, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird“. Gemäß § 108 Abs. 1 S. 2 NrWGO sollen Unternehmen „einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird“. Ähnlich § 114 Abs. 1 S. 1 NdsGO, wonach Unternehmen „einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen (sollen), soweit das mit ihrer Aufgabe der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist“. Ebenso § 75 Abs. 1 S. 2 MVKV. Gemäß § 85 Abs. 2 S. 1 2. HS RPGO „sollen (die Unternehmen) einen Überschuß für den Haushalt abwerfen, soweit dies mit der Erfüllung des öffentlichen Zwecks in Einklang zu bringen ist“. 328 Darauf weisen z. B. Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (215) und Leisner, WiVerw 1983, S. 212 (215) hin. Nach BGHZ 69, S. 334 (339) – VEBA/Gelsenberg – entspreche es „nicht der vollen Wirklichkeit, . . . öffentliches und privatwirtschaftliches Interesse als Triebkräfte wirtschaftlichen Handelns in einem strikten Gegensatz zu sehen“. Die öffentliche Hand sei z. B. „haushaltsrechtlich gehalten, bei der Verwaltung ihres Vermögens die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit zu beachten“. Vgl. dazu vorstehend Fn. 327. 329 In diesem Sinn auch Erichsen, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, S. 109, der zugleich darauf verweist, daß das Kriterium der „unmittelbaren“ Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben [vgl. dazu nur die Entscheidungen BGHZ 29, S. 76 (80, 81); 33, S. 230 (233); 36, S. 91 (91) zum Anwendungsbereich des Verwaltungsprivatrechts] ebenfalls nicht zur Konkretisierung des Begriffs der Daseinsvorsorge geeignet sei. Ebenso Badura, in: FS Schlochauer, S. 3 (7). 330 So auch Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 159 und vorstehend Fn. 329. 331 BGHZ 69, S. 334 (339) – VEBA/Gelsenberg unter Verweis auf u. a. Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 60 ff., 212 f. Ebenso BGH, NJW 2004, S. 693 (694), wonach „eine etwa zusätzlich zu Zwecken des Allgemeinwohls hinzutretende Gewinnerzielungsabsicht der Einstufung als öffentliche Aufgabe nicht entgegen“ stehe [unter Verweis auf BGH, NJW 2001, S. 3062 (3064)]. Dem folgend BGHSt 50, S. 299 ff. = NJW 2006, S. 925 (926).
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
89
Auch private Unternehmen zeichnen sich nicht notwendig durch ein gewinnbezogenes Handeln aus. So gibt es z. B. auf Verlust abzielende sogenannte Abschreibungsgesellschaften.333 Auch schließt es die Verpflichtung der Gesellschaftsorgane auf das im Unternehmensgegenstand und -zweck334 fixierte Unternehmensinteresse nicht aus, daß diese im Rahmen des Entscheidungsprozesses gesamtwirtschaftliche und damit gemeinwohlbezogene Gesichtspunkte mitberücksichtigen.335 Es ist also ebenso denkbar, daß Private gemeinwohlbezogene Zielsetzungen zumindest mitverfolgen können. Selbst das einfache Recht geht zuweilen davon aus, daß Private Entscheidungen in Sachgebieten treffen können, deren Zielsetzungen – wie vorstehend erwähnt – verbreitet dem Begriff der Daseinsvorsorge zugeordnet werden.336 So ist nach § 1 Abs. 1 EnWG „eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucher332 So auch Badura, in: FS Schlochauer, S. 3 (5); Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 215 (215); Klein, Teilnahme des Staates, S. 81; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 109; Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 51; Püttner, DÖV 1983, S. 697 (700). Auch das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 75, S. 192 (199) geht nicht von einer strikten Trennung aus: Die gemeinwohlbezogene Aufgabenstellung öffentlichrechtlicher Sparkassen sei ein Merkmal, das es rechtfertige, an ihrer Einordnung als Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge festzuhalten. Die Sparkassen arbeiteten „nach wie vor eher aufgaben- als gewinnorientiert, ein entscheidender Akzent ihrer Geschäftstätigkeit liegt in der Unterordnung des Gewinnstrebens unter ihre öffentliche Zwecksetzung, das heißt in dem Verbot, die Gewinnerzielung und -maximierung zum hauptsächlichen Ziel der Geschäftspolitik zu erklären“ (a. a. O., S. 199). Das Gericht bewertet also den Schwerpunkt staatlicher Unternehmenstätigkeit und muß damit angeben, wann ein solches Maß an gemeinwohlbezogener Tätigkeit vorliegt, daß diese als staatlich und nicht als privat angesehen werden muß. 333 Beispiel nach Raiser, ZHR 144 (1980), S. 206 (210), der zugleich darauf hinweist, daß auf das Merkmal des Gewinnstrebens in neueren – gesellschaftsrechtlichen – Definitionen des Unternehmensbegriffs verzichtet werde (a. a. O., S. 212 ff.). 334 Zur Unterscheidung vgl. oben Erster Teil, S. 45 ff. 335 So ausdrücklich BGHZ 69, S. 334 (339) – VEBA/Gelsenberg. Vgl. auch Hüffer, AktG, § 76, Rn. 12. Nach v. Mutius/Nesselmüller, NJW 1976, S. 1878 (1880) soll nach dem unternehmerischen Selbstverständnis vermehrt eine gesellschaftliche Mitverantwortung des Unternehmens bestehen. Zur Zulässigkeit politischer Zielsetzungen von Unternehmen vgl. auch ausführlich Dreher, ZHR 155 (1991), S. 349 ff. Zur Frage, ob die Unternehmensleitungen die Interessen der Allgemeinheit berücksichtigen müssen, vgl. Rittner, in: FS Geßler, S. 139 ff.; Raiser, ZHR 144 (1980), S. 206 ff. Das Aktiengesetz v. 1937 statuierte in § 70 Abs. 1 eine Gemeinwohlbindung: „Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl des Betriebs und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es erfordern“. Eine „allgemeine Richtlinienbestimmung ähnlichen Inhalts“ soll Art. 14 Abs. 2 GG enthalten [Rittner, in: FS Geßler, S. 139 (146 f.); zurückhaltender Dreher, ZHR 155 (1991), S. 349 (355 f.)]. Demgegenüber richtig z. B. Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 234 ff., 239 ff., der von einer Gemeinwohlbindung der Gesellschaftsorgane nur im Fall der gesellschaftsvertraglichen Fixierung eines „öffentlichen Zwecks“ ausgeht (a. a. O., S. 241). 336 Vgl. z. B. §§ 4 ff. KrW-/AbfG, die eine Aufgabenteilung zwischen staatlichen Entsorgungsträgern und privaten Erzeugern und Besitzern von Abfällen statuieren.
90
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
freundliche, effiziente und umweltverträgliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität und Gas“ Zweck des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz). Energieversorgungsunternehmen sind gemäß § 3 Nr. 2 bis 10 EnWG Organisationen, die bestimmte Versorgungsnetze oder Anlagen betreiben, d. h. auch private Unternehmen.337 Es läßt sich deshalb feststellen, daß sich staatliche und private Unternehmenszielsetzungen durchaus decken und überschneiden können.338 Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit können sowohl von staatlichen als auch privaten Rechtssubjekten erfüllt werden. Sowohl staatliche als auch private Akteure können Zielsetzungen verfolgen, die im weitesten Sinn dem „öffentlichen Interesse“ dienen.339 Soweit versucht wird, bestimmte gemeinwohlbezogene Schwerpunkte in der jeweiligen Unternehmenstätigkeit auszumachen und diese als Argument für die Staatseigenschaft des jeweiligen Unternehmens zu verwenden,340 müssen Wertungskriterien zur Gewichtung dieser gemeinwohlbezogenen Elemente in den jeweiligen unternehmerischen Entscheidungen gefunden werden. Als Wertungskriterien erlauben sie gerade keine zwingende Zuordnung der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften zum Adressatenkreis der Sonderbindungen des Staates und können auch atypische Fallgestaltungen einer reinen staatlichen Vermögensverwaltung ohne darüber hinausgehende gemeinwohlbezogene Zwecke bzw. privates Handeln im Interesse der Allgemeinheit nicht erfassen. 337 Darauf verweist z. B. auch VGH Mannheim, NVwZ 1997, S. 90 (91) (vgl. oben Fn. 308). 338 Ebenso BGHZ 69, S. 334 (339) – VEBA/Gelsenberg und v. Mutius/Nesselmüller, NJW 1976, S. 1878 (1879 f.). 339 Aufgrund dieser fehlenden Abgrenzbarkeit wird die öffentliche Aufgabe verbreitet lediglich als ein Entscheidungsbereich definiert, dessen Wahrnehmung öffentlichen Interessen diene. So z. B. BVerfGE 17, S. 371 (377); 30, S. 392 (311); 44, S. 103 (104); Badura, in: FS Schlochauer, S. 3 (8 f.); Peters, in: FS Nipperdey II, S. 877 (878); Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 252 f.; Tettinger/Mann, in: dies./Salzwedel, Wasserverbände, S. 1 (38); Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 43. Mit dieser Begriffsdefinition wird die öffentliche Aufgabe zu einem Entscheidungsgegenstand, der sowohl staatlich als auch privat sein kann. Es ist in diesem Fall kein Begriff mehr, der die staatliche von der privaten Sphäre trennt. „Staatsaufgaben“ dagegen sind nach verbreiteter Ansicht derjenige Teil der öffentlichen Aufgaben, der entweder vom Staat selbst erfüllt werden muß oder den der Staat nach freiem Entschluß und in rechtlich zulässiger Weise zur Erledigung an sich gezogen hat. In diesem Sinn z. B. BVerfGE 12, S. 205 (243); Peters, in: FS Nipperdey II, S. 877 (879); Isensee, in: HdBStR III, § 57, Rn. 159 f.; Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (153); Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204 (224 f.); Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 43 ff. Damit verweist der Begriff der Staatsaufgabe auf andere, weitere Kriterien der Staatseigenschaft („Erfüllen-Müssen“ bzw. „An-sich-Ziehen“). 340 Vgl. dazu den Nachweis oben Fn. 332 und z. B. BGHSt 49, S. 214 (219), wonach „die Stadt G. mit der Fernwärmeversorgung hier auch tatsächlich eine Aufgabe der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen und sich nicht etwa ausschließlich gewinnbringend betätigen wollte“.
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
91
Der Begriff der öffentlichen Aufgabe ist damit von vornherein nicht zu einer zwingenden Kennzeichnung des Dualismus von Staat und Gesellschaft geeignet, sondern umfaßt Zielsetzungen im öffentlichen Interesse, die sowohl staatliche als auch private Akteure verfolgen können.341 Es gibt keine Entscheidungsbereiche und mit diesen einhergehende Entscheidungsmaßstäbe, die ausschließlich staatliche Entscheider verfolgen. III. Zwischenergebnis Aus den vorstehend genannten Gründen wird der Versuch, den Begriff der öffentlichen Aufgabe im Sinne typisch staatlicher Entscheidungsbereiche und -maßstäbe inhaltlich zu bestimmen, verbreitet als gescheitert angesehen.342 Daß dies so ist, zeigen auch die nicht wenigen Versuche, das Kriterium der Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit dem Beherrschungskriterium zu kombinieren.343 Diese Kombination kann mit unterschiedlichen Akzentsetzungen erfolgen. So sollen beherrschte gemischtwirtschaftliche Gesellschaften des Privatrechts Teil der „öffentlichen Verwaltung“ sein, „soweit sie im Bereich der Daseinsvorsorge tätig sind“.344 In diesem Fall scheint das Kriterium der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dem Beherrschungskriterium logisch vorgeordnet sein. Darüber hinaus wird auch vorgeschlagen, funktionale und organisatorische Kriterien gleichberechtigt nebeneinander zu verwenden.345 Auf die Grenzen des 341 Nach Erichsen, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, S. 110 gibt es „keine spezifischen oder geborenen Verwaltungsaufgaben“. Ebenso Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 88 ff.; Krebs, VVDStRL 52 (1993), S. 248 (273 f.). 342 Vgl. nur m. w. N. Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 9; Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 154 ff.; Groß, Kollegialprinzip, S. 26 f.; Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204 (207); Schmidt-Aßmann, BB 1990, Beil. 34, S. 1 (14). Kämmerer, Privatisierung, S. 158 weist darauf hin, daß der Umfang des dem Staat vorbehaltenen Bereichs unterschiedlich weit gefaßt wird. Nach Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, S. 98 f. handele es sich bei dem Begriff der „Daseinsvorsorge“ um einen „soziologischen Begriff“, und es sei deshalb „verfehlt, aus ihm Rechtsfolgen herzuleiten“ (a. a. O., S. 99). 343 Man müsse funktionale Kriterien „kombinieren“ bzw. „ergänzen“ mit z. B. instrumentalen Kriterien. Vgl. nur Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 87; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 103 ff. Verbreitet werden funktionale und institutionelle Kriterien gleichberechtigt nebeneinander genannt, so z. B. in BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783); BGH, WM 2005, S. 810 (810 f.); BGHSt, 49, S. 214 (219); 50, S. 299 (303 ff.). 344 Klein, Teilnahme des Staates, S. 93 f. 345 So ist wohl BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783) zu verstehen. Für eine Kombination des Beherrschungsansatzes mit dem Aufgabenansatz auch Möstl, Grundrechtsbindung, S. 103 ff.: „Organisatorische und funktionale Aspekte sind gedanklich von einander kaum trennbar, . . .“. Vgl. ebenso den sogenannten formellen Aufgabenbegriff, wonach ein Entscheidungsbereich dem Staat zuzuordnen sei, mit der Folge der
92
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Beherrschungsansatzes wurde bereits oben346 hingewiesen. Eine solche Kombination verschiedener Wertungsansätze führt deshalb nicht zu zwingenderen Ergebnissen im Einzelfall. Schließlich werden sonstige Kriterien wie z. B. das Vorliegen einer „Beleihung“ oder „Widmung“ vorgeschlagen, die um das Aufgabenkriterium ergänzt werden sollen.347 Es zeigt sich damit, daß dem Begriff der öffentlichen Aufgabe keinerlei eigenständige zuordnende Bedeutung zukommen kann. Er dient lediglich zur Beschreibung typischer, da tradiert staatlicher Aufgabenbereiche und setzt die Bestimmung der Staatseigenschaft im konkreten Fall gerade voraus.
C. Verfassungs- und einfachrechtliche Konkretisierung öffentlicher Aufgaben Unabhängig von der Untauglichkeit des Begriffs der öffentlichen Aufgabe kann bereits der Prämisse des Aufgabenansatzes nicht gefolgt werden. Geht man davon aus, daß alle staatlichen Einheiten verfassungsrechtlich konstituiert sind,348 dann kann es keine präpositiven349 Zielvorgaben im Sinne einer öffentlichen Aufgabe der „Gemeinwohlverwirklichung“ geben.350 Vielmehr müssen auch die Entscheidungsvorgaben für staatliche Einheiten verfassungsrechtlich konstituiert sein. Es stellt sich in diesem Fall die Frage, inwieweit die Verfassung Aussagen über staatliche Zielvorgaben und ausschließlich staatliche EntscheidungsbereiGeltung von Sonderbindungen des Staates, wenn der jeweilige staatliche Rechtsträger diese Aufgabe „an sich gezogen“, „aufgegriffen“ oder „sich zu eigen gemacht“ habe. Vgl. dazu auch die Nachweise zum Begriff der Staatsaufgabe oben Fn. 90. Der Begriff der „öffentlichen Aufgabe“ umschreibt in diesem Fall keinen funktional bestimmbaren Entscheidungsbereich, sondern einen rein tatsächlichen, „faktisch staatlichen“ Entscheidungsbereich. 346 Erster Teil, S. 63 ff. 347 Vgl. dazu z. B. di Fabio, Ausstieg, S. 90 ff. Ebenso sieht Lang, NJW 2004, S. 3601 (3603 f.) die Grenze zwischen Staat und Gesellschaft „erst bei hoheitlicher Beleihung erreicht oder wenn Eigen- und Beteiligungsgesellschaften durch Gesetz ein Teil ihres Tätigkeitsbereichs als Monopol zugewiesen wird“. 348 Pietzcker, AöR 107 (1982), S. 61 (71); Erichsen, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, S. 114; Badura, in: FG BVerfG, Bd. 2, S. 1 (11); ders., in: FS Schlochauer, S. 3 (5 f.); Häberle, AöR 11 (1986), S. 595 (601); Schnapp, VVDStRL 43 (1985), S. 172 (185 f.); Krebs, in: Ehlers/ders., Grundfragen, S. 41 (46); ders., in: HdBStR III, § 69, Rn. 9; BVerfGE 42, S. 312 (331 f.). 349 So Isensee, in: HdBStR III, § 57, Rn. 37 für das Gemeinwohl. 350 Häberle, AöR 111 (1986), S. 595 (600 f.). I. E. ebenso Bull, Staatsaufgaben, S. 99 ff.; Däubler, Privatisierung als Rechtsproblem, S. 64 f., die sich gegen die Schaffung präpositiver Aufgabensätze wenden.
5. Abschn.: Öffentliche Aufgabe als Kriterium
93
che trifft. Den Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG sind keine besonderen staatlichen Aufgabenbezüge zu entnehmen.351 Die Verfassung enthält keine Definition der öffentlichen Aufgaben,352 sie weist lediglich einzelnen organisatorischen Einheiten Zuständigkeiten zu.353 Regelungsgegenstand der Verfassung ist also u. a. die Verpflichtung staatlicher Einheiten, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Nicht zum Regelungsgegenstand der Verfassung gehört die Zuordnung von Aufgabenbereichen zum Bereich des Staatlichen und Privaten. So verpflichtet zwar z. B. Art. 87 e Abs. 3 S. 1 GG den Bund zu einer Entscheidung darüber, ob er „Eisenbahnen“ in privatrechtlicher Form führen will oder nicht. Er schließt allerdings nicht das Betreiben von Eisenbahnen durch Private aus. Das Betreiben von Eisenbahnen ist also keine ausschließliche Staatsaufgabe.354 Auch in anderen staatlichen Entscheidungsbereichen, insbesondere im Rahmen der Landes- und Kommunalverwaltung setzt die Verfassung keine rein staatlichen Aufgabenbereiche voraus, deren Wahrnehmung für die Staatseigenschaft eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens sprechen könnte. Ob eine Aufgabe durch eine staatliche oder eine private Organisationseinheit wahrgenommen wird, bestimmt vielmehr das einfache Recht.355 Staatliche Einheiten können jeden Entscheidungsbereich an sich ziehen. Fast jeder Entscheidungsbereich kann also potentiell staatlich sein.356 Der Aufgabenbestand des Staates ist verfassungsrechtlich offen. Die Bestimmung der Aufgaben staatlicher Einheiten bleibt also – im verfassungsrechtlichen Rahmen357 – dem einfachen 351
Pietzcker, AöR 107 (1982), S. 61 (71). Groß, Kollegialprinzip, S. 26. 353 Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 62 ff. 354 Vgl. dazu ausführlich m. w. N. Homeister, Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindung, S. 13 ff.; Battis/Kersten, WuW 2005, S. 493 ff. 355 So z. B. v. Mutius/Nesselmüller, NJW 1976, S. 1878 (1879), wonach die Begriffe des öffentlichen und des privaten Interesses „als klassifikatorische Kategorien weitgehend unbrauchbar“ seien. „Was die maßgeblichen Allgemeininteressen zumindest in normativer Sicht sind, bestimmt sich nicht aus ihrer ,wahren Natur‘, sondern folgt im geltenden Verfassungssystem aus den Entscheidungen des demokratischen legitimierten Normgebers“ (Hervor. i. O.). Vgl. so auch Hans J. Wolff, VerwR I6, § 22 II a 6; Badura, in: FS Schlochauer, S. 3 (6); Menger, in: FS Hans J. Wolff, S. 149 (158 f.); Groß, Kollegialprinzip, S. 27; Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (153 ff.); Möllers, VerwArch 90 (1999), S. 187 (198); Link, VVDStRL 48 (1990), S. 7 (25 f.); F. Wagener, in: ders. (Hrsg.), Verselbständigung, S. 31 (40); Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge, S. 166 f. Ähnlich BGHZ 115, S. 311 (317), der ausgeht von der „Rechtsnatur der Abwasserbeseitigungspflicht als öffentliche Aufgabe, deren Charakter und Inhalt durch Normen des öffentlichen Rechts geprägt ist“. Zur sogenannten „wirtschaftspolitischen Neutralität“ des Grundgesetzes vgl. auch BVerfGE 4, 7 (17 f.); 50, 290 (336 ff.); Badura, in: FS Schlochauer, S. 3 (20); Franz, Gewinnerzielung, S. 53 ff.; Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 5 I 3, S. 50 ff. 356 Scholl, in: Püttner (Hrsg.), Reform, S. 85 (90) weist zudem auf einen „Wandel öffentlicher Aufgaben im Zeitablauf“ hin. 357 Z. B. der Art. 70 ff. GG. 352
94
1. Teil: Unternehmen als staatliche Entscheidungseinheiten
Recht vorbehalten. Das positive Recht muß dahingehend ausgelegt werden, ob es „staatliche Kompetenzzuweisungen“358 enthält. Dem Ansatz, der die Zuordnung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen zum Bereich des Staatlichen von der Ausrichtung der Unternehmenstätigkeit an einer abstrakt zu bestimmenden öffentlichen Aufgabe im Sinne von „Gemeinwohlverwirklichung“ und „Daseinsvorsorge“ abhängig macht, ist damit nicht zu folgen.
Ergebnis zum Ersten Teil Bislang wurde kein Modell gefunden, daß zum einen eine zwingende Zuordnung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften zum Bereich des Staatlichen oder Privaten im Einzelfall ermöglicht und zum anderen weder den staatlichen noch den privaten Entscheidungsanteil an gemischtwirtschaftlichen Entscheidungsprozessen durch Statuierung eines alternativen Zuordnungsmodells vernachlässigt. Dem Beherrschungsansatz ist entgegenzuhalten, daß seine Voraussetzungen eine wertende Beurteilung komplexer Entscheidungsprozesse im Unternehmen verlangen und daher nur schwer nachzuvollziehen sind. Der Ansatz verweist auf eine Einzelfallbewertung und ist damit untauglich. Darüber hinaus wird sein alternativer Ansatz, der ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen entweder vollständig dem staatlichen oder dem privaten Bereich zuordnet, der gemischt staatlich-privaten Entscheidungssituation im jeweiligen Unternehmen nicht gerecht. Die privatrechtliche Organisationsrechtsform ist lediglich Indiz für die Zuordnung einer privatrechtlich organisierten Einheit zum Bereich des Privaten. Ein solcher Vermutungssatz wird der verfassungsrechtlich geforderten zwingenden Unterscheidbarkeit von Staat und Gesellschaft nicht gerecht. Darüber hinaus liegt der Prämisse des Rechtsformansatzes wie dem Beherrschungsansatz ein Alternativmodell zugrunde, das die gemischt staatlich-private Entscheidungssituation in einem Unternehmen nur unzureichend abbilden kann. Auf diese Weise werden große Bereiche gemischt staatlich-privaten Entscheidens in Privatrechtsform von vornherein aus dem Bereich des Staatlichen herausgenommen. Die Komplexität staatlicher Organisationsvielfalt wird unzulässig reduziert. 358 Dies untersucht das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich in BVerfGE 68, S. 193 (210). Anders dagegen in BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783), wo ohne eine Auswertung des zugrundeliegenden „Normensystems“ abstrakt auf die wahrgenommene Funktion des Unternehmens abgestellt wird. Kritisch deshalb Bull, Staatsaufgaben, S. 49 m. w. N.: „Häufig soll die Formel von der ,öffentlichen Aufgabe‘ ganz offensichtlich nur dazu dienen, eine aus dem geltenden Recht nicht überzeugend ableitbare Befugnis oder auch Pflicht zu begründen.“
Ergebnis zum Ersten Teil
95
Diese Probleme vermag auch der Ansatz von der sogenannten Ingerenzpflicht des an einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen beteiligten staatlichen Rechtsträgers nicht zu lösen. Die Voraussetzungen für die Erfüllung dieser staatlichen Verpflichtung bleiben offen. Es besteht deshalb die Gefahr, daß der Ansatz von der Ingerenzpflicht lediglich der Problembeschreibung dient, ohne das Zuordnungsproblem lösen zu können. Der Aufgabenansatz schließlich ist nach dem vorstehend Gesagten ebenfalls nicht geeignet, die Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen zu bestimmen. Es gibt keine abstrakt zu bestimmenden öffentlichen Aufgaben, die ausschließlich staatliche Entscheidungsbereiche kennzeichnen. Staat und Gesellschaft zeichnen sich vielmehr durch eine Verschränkung ihrer Aufgabenbereiche aus. Ob eine Aufgabe staatlich oder privat ist, bestimmt das einfache Recht. Ein abstrakter Begriff der „öffentlichen Aufgabe“ bzw. der „Staatsaufgabe“ im Sinne von Gemeinwohlverwirklichung oder Daseinsvorsorge ist zur Unterscheidung staatlicher von privaten Rechtssubjekten nicht geeignet.
Zweiter Teil
Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte Erster Abschnitt
Staat als rechtliche Entscheidungseinheit Bislang wurde aufgrund des funktions- und tätigkeitsbezogenen Wortlauts der verfassungs- und einfachrechtlichen Sonderbindungen des Staates davon ausgegangen, daß zur Qualifizierung staatlicher Rechtssubjekte an der realen Qualität staatlicher Entscheidungen anzusetzen sei.1 Die Eigenschaft eines Rechtssubjektes, staatliches Rechtssubjekt zu sein, wurde infolgedessen im Laufe der bisherigen Untersuchung davon abhängig gemacht, ob seine Entscheidungen an besonderen, staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausgerichtet sind. Die Fähigkeit, Zuordnungssubjekt der Sonderbindungen des Staates zu sein, sollte von dem Vorliegen derjenigen Kriterien abhängig sein, die staatliche Entscheidungseinheiten in ihrer realen organisatorischen Existenz kennzeichnen. Solche Kriterien, die eine zwingende Zuordnung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften zum Bereich staatlicher Rechtssubjekte erlauben, wurden allerdings nicht gefunden. Dies legt die Vermutung nahe, daß die bisher zugrunde gelegte Prämisse nicht geeignet ist, Ausgangspunkt für die Suche nach Kriterien zur Qualifizierung staatlicher Verpflichtungsrechtssubjekte zu sein. Möglicherweise können diejenigen Kriterien, die reale staatliche Entscheidungseinheiten auszeichnen, nicht für die Bestimmung staatlicher Verpflichtungsrechtssubjekte fruchtbar gemacht werden. Es stellt sich damit die Frage, welcher andere Ansatz Ausgangspunkt für die Kennzeichnung staatlicher Verpflichtungsrechtssubjekte sein kann. Hierfür sind noch einmal diejenigen Erkenntnisse zum Wesen staatlicher Organisation in Erinnerung zu rufen, die sich bereits oben2 aus dem Wortlaut der verfassungsrechtlichen Sonderbindungen ergeben haben. Dort konnte festgestellt werden, daß sich die Adressaten der verfassungsrechtlichen Sonderbindungen des Staa1 2
Vgl. oben Erster Teil, S. 29. Vgl. oben Erster Teil, S. 29.
1. Abschn.: Staat als rechtliche Entscheidungseinheit
97
tes sowohl real als Entscheidungseinheit als auch rechtlich als Rechtssubjekte beschreiben lassen.3 Bereits der funktions- und tätigkeitsbezogene Wortlaut dieser Sonderbindungen zeigte, daß sich staatliche Einheiten durch eine rechtliche Existenz als Verpflichtungsrechtssubjekte ebenso auszeichnen wie durch eine reale Existenz als Entscheidungseinheiten.4 Dies legt die Vermutung nahe, daß Kriterien zur Kennzeichnung staatlicher Rechtssubjekte und staatlicher Organisation immer beide Bereiche staatlicher Existenz berücksichtigen müssen.5 Im folgenden soll deshalb das Verhältnis von realer und rechtlicher Existenz staatlicher Einheiten unter einem gegenüber der bisherigen Untersuchung modifizierten Blickwinkel betrachtet werden. Möglicherweise lassen sich staatliche Verpflichtungssubjekte zum Zweck ihrer Qualifizierung im Einzelfall auch rein rechtlich betrachten. Anknüpfungspunkt für diese rein normative Betrachtung staatlicher Verpflichtungssubjekte soll wiederum der Begriff der Entscheidung sein. Geht man davon aus, daß alle staatlichen Organisationseinheiten auch rein rechtlich beschrieben werden können,6 dann müssen auch die staatlichen Entscheidungsvorgaben rein rechtlich qualifiziert werden können. Oben7 wurde bereits festgestellt, daß die Verfassung die rechtliche Statuierung der staatlichen Entscheidungsbereiche und Entscheidungsmaßstäbe, der so3
Vgl. dazu die Nachweise oben Erster Teil, S. 29, Fn. 6 Dies gilt grundsätzlich für alle staatlichen Einheiten. Es ist allerdings zumindest theoretisch denkbar, daß staatliche Rechtssubjekte ausnahmsweise über keine zugrunde liegende Organisation verfügen (z. B. Gründung einer Juristischen Person „auf Vorrat“), und daß es nichtrechtsfähige staatliche Organisationseinheiten geben kann. 5 Darauf weist auch Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (257 f.) hin, hebt allerdings die Leistungsfähigkeit einer rein normativen Methode hervor (a. a. O., S. 259). 6 So Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 232 ff. unter Verweis auf Hans Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922, 1.–3. Kap. (a. a. O., S. 232, Fn. 1). Vgl. auch Hans J. Wolff, VerwR II3, § 71 I, S. 3, wonach staatliche Organisationen „normativ Inbegriffe von Rechtsnormen zur Regelung sozialtypischer Interessenkollisionen“ seien. Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (272, Fn. 9 u. 275 f.) weist darauf hin, daß sich die Wolffschen organisationsrechtlichen Begriffe in ihrer rein normativen Betrachtung und Isolierung der Rechtsphänomene auf Kelsen, Hauptprobleme, S. 162 ff. stützen können. Ebenso Rittner, Juristische Person, S. 199 ff. Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 232 ff. stellt mit Blick auf Hans Kelsen ausdrücklich klar, daß es dem normativen Begriff vom Staat nicht widerspricht, neben der rein rechtlichen Existenz auch eine faktische Realität des Staates anzunehmen. Ebenso Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (259) ebenfalls unter Hinweis auf Hans Kelsen in Fn. 92 und Bumke, in: Schmidt-Aßmann/HoffmannRiem (Hrsg.), Methoden, S. 73 (81) unter Verweis auf Kelsens sogenannte Zwei-Reiche-Lehre. Einen verfassungsrechtlichen Ansatz legt Pietzcker, AöR 107 (1982), S. 61 (71) zugrunde, der davon ausgeht, daß die Staatsgewalt „rechtlich – durch das GG geschaffen und verfaßt“ ist; ebenso Schnapp, VVDStRL 43 (1985), S. 172 (185 f.). Einen Überblick über normative staatstheoretische Ansätze geben z. B. Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 34 ff., 104 f.; Möllers, Staat als Argument, S. 36 ff.; Hoerster, NJW 1986, S. 2480 ff. Ausführlich zum Staatsverständnis Kelsens z. B. H. Dreier, Hans Kelsen, S. 1 ff.; Schnapp, Rechtstheorie 1984, Beiheft 8, S. 381 ff.; R. Walter, Hans Kelsen, S. 5 ff.; Möllers, a. a. O., S. 36 ff. 4
98
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
genannten öffentlichen Aufgaben, dem Gesetzgeber überläßt. Öffentliche Aufgaben sind deshalb in der Regel8 einfachrechtlich konstituiert, „präpositive“ Entscheidungsmaßstäbe des Staates gibt es nicht. Die Begriffe der „vollziehenden Gewalt“, „Rechtsprechung“ und „Gesetzgebung“ im Sinne von z. B. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 2 S. 2, Abs. 3 GG kennzeichnen also nach dem oben9 zum Aufgabenansatz Gesagten staatliche Rechtssubjekte, die verfassungs- und einfachrechtlich verpflichtet sind, ihre Entscheidungen an rechtlich normierten Entscheidungsbereichen und -maßstäben auszurichten. Staatliche Verpflichtungsrechtssubjekte sind rechtliche Entscheidungseinheiten. Im Rahmen des hier sogenannten normativen Ansatzes sollen nun diese Verpflichtungsrechtssätze, welche die staatlichen Entscheidungsbereiche und -maßstäbe konstituieren, näher untersucht werden. Gelingt es, diese rechtlich normierten Aufgaben näher zu spezifizieren, dann ist eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft Adressat der Sonderbindungen des Staates, wenn sie selbst Verpflichtungssubjekt eines solchen Verpflichtungsrechtssatzes ist. Die Eigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft, Adressat eines solchen Verpflichtungsrechtssatzes zu sein, ist in diesem Fall Kriterium der Staatseigenschaft derselben. Zweiter Abschnitt
Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien der Staatseigenschaft A. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtskomplexe Diejenigen verfassungs-10 und einfachrechtlichen Rechtssätze, die staatliche Rechtssubjekte verpflichten, bestimmte Entscheidungen nach bestimmten Entscheidungsvorgaben zu treffen, heißen Zuständigkeitsrechtssätze. Staatliche Verpflichtungsrechtssubjekte sind „Zuständigkeitskomplexe“.11
7
Vgl. dazu ausführlich oben Erster Teil, S. 92 ff. Auch die Verfassung statuiert teilweise staatliche Entscheidungsbereiche und -maßstäbe, vgl. z. B. Art. 87 e Abs. 3 GG. 9 Erster Teil, S. 92 ff. 10 Nach Schnapp, VVDStRL 43 (1985), S. 172 (185 ff.) konstituieren die „verfassungsrechtlichen Kompetenzzuweisungen“ den „Verfassungsstaat“ (a. a. O., S. 185). 11 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 236 ff. (zum Begriff des Organs); ebenso Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (219); H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24. 8
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
99
Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften sind dementsprechend staatliche Rechtssubjekte, wenn sie ihrerseits Zuweisungssubjekte von Zuständigkeitsrechtssätzen sind. Also kommt es darauf an, was diese Zuständigkeitsrechtssätze sind. I. Eigenzuständigkeiten Eine Zuständigkeit ist die rechtliche Verpflichtung und Berechtigung eines staatlichen Rechtssubjektes, bestimmte Aufgaben in einer in der Regel bestimmten Art und Weise wahrzunehmen.12 Zuständigkeiten verpflichten13 und berechtigen staatliche Rechtssubjekte also dazu, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Sie bestimmen das staatliche Handeln-Müssen.14 Der Begriff der Zuständigkeit beschreibt nach dieser Definition zugleich einen staatlichen Entscheidungsbereich, die Aufgabe, auf dem die Ziele staatlicher Rechtssubjekte verwirklicht werden.15 Die Aufgabe ist nach dem normativen Ansatz ein rechtlicher Entscheidungsmaßstab, der den mit der Entscheidung intendierten Zweck festlegt.16 Im Gegensatz zu dem vorstehend erörterten Aufgabenansatz17 kennzeichnet hier der Begriff der „Aufgabe“ den Verpflichtungsinhalt eines einfachrechtlichen Zuständigkeitsrechtssatzes und nicht eine präpositive staatliche Zielvorgabe. Die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe bedeutet 12 In diesem Sinn z. B. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 10, Rn. 2. Differenzierend dagegen Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 13 ff., wonach die materiellrechtliche Eigenzuständigkeit die „endgültige Zugehörigkeit einer Pflicht zu einem ,Rechtsträger‘ “ (a. a. O., S. 13) kennzeichne. Der Begriff der „Kompetenz“ kennzeichne dagegen den Gegenstand dieser Pflicht, d. h. die zugehörige Verpflichtung des Rechtsträgers (Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 237; ders., VerwR II3, § 72 I, S. 14). Die folgende Untersuchung verwendet die Begriffe „Zuständigkeit“ und „Kompetenz“ synonym. Zu den Gründen, die eine übergreifende Definition der Zuständigkeit im oben genannten Sinne rechtfertigen Remmert, Dienstleistungen, S. 199 m. Fn. 100 u. w. N. 13 Die Pflichtfähigkeit ist die primäre Erscheinung der Rechtsfähigkeit. So H. H. Rupp, Grundfragen, S. 83 unter Verweis auf Kelsen, Hauptprobleme, S. 312, 525 ff., 568, 666 ff. und Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 101 ff., Bd. 2, S. 254 (a. a. O., Fn. 180). 14 Vgl. nur Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 237, der darauf hinweist, daß unter dem Begriff der Zuständigkeit „vielfach auch das, was zusteht, also das zustehende Können, Dürfen und Sollen selbst“ verstanden wird. Hans J. Wolff kennzeichnet dies mit dem Begriff der „Kompetenz“. Zum Begriff der (Eigen-)Zuständigkeit im Sinne von Hans J. Wolff vgl. bereits oben Fn. 12. 15 Vgl. nur Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 14, wonach „ein Sachgebiet (Sachbereich), auf dem die Zwecke der organisatorischen Einheit (zB die Staatszwecke) verwirklicht werden sollen, . . . eine Aufgabe iwS“ sei. 16 Dazu, daß „die Festlegung des mit der Entscheidung intendierten Zweckes (oder der Zwecke) notwendiges Element eines staatlichen Entscheidungsprozesses ist“ (Hervor. i. O.), vgl. bereits Krebs oben S. 46, Fn. 93. 17 Vgl. oben Erster Teil, S. 81 ff.
100
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
also nach dem normativen Ansatz die Wahrnehmung einer rechtlich zugewiesenen Zuständigkeit. Die Wahrnehmung der jeweiligen Zuständigkeit erfüllt die rechtliche Verpflichtung und Berechtigung des staatlichen Adressaten mit der Folge, daß die getroffenen Entscheidungen und Realhandlungen diesem Rechtsträger zugerechnet werden. Die Entscheidungen gelten als eigene Entscheidungen des Rechtsträgers, dieser ist sogenanntes „Zurechnungsendsubjekt“.18 Die Entscheidungen, die in Ausübung dieser deshalb sogenannten Eigenzuständigkeit19 getroffen werden, werden keiner anderen Rechtsperson mehr zugerechnet.20 Es besteht also eine „endgültige Zugehörigkeit einer Pflicht (. . .) zu einem ,Rechtsträger‘“.21 Dieser Rechtsträger heißt Juristische Person bzw. Verwaltungsträger.22
II. Transitorische Wahrnehmungszuständigkeiten Aufgaben werden in einer Organisation arbeitsteilig durch Untereinheiten wahrgenommen, welche mit Wirkung für die Organisation und zugleich als Teil der Organisation Entscheidungen treffen. Der Begriff der Organisation beschreibt einen innerorganisatorischen Zurechnungszusammenhang von Untereinheiten hin zur Organisation als gedachter Einheit. Es kommt nun darauf an, wie dieser Zurechnungszusammenhang rein rechtlich dargestellt werden kann. Vorstehend wurde bereits festgestellt, daß sich staatliche Organisation aus normativer Sicht in verschiedene gedankliche Rechtssatzkomplexe gliedert. Es sind in erster Linie Verpflichtungsrechtssätze, die bestimmte rechtstechnische Zurechnungsendsubjekte zum Treffen bestimmter Entscheidungen verpflichten. Staatliche Organisation wird also in erster Linie durch Verpflichtungsrechtssätze rechtlich konstituiert. Diese Verpflichtungen staatlicher Rechtssubjekte werden durch Untereinheiten arbeitsteilig23 für die Organisation wahrgenommen. Die 18
Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, insbes. S. 151, 198 ff. Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 13. 20 So ausdrücklich zum Begriff der Juristischen Person Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 26. 21 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 13. Hans J. Wolff setzt den Begriff des Rechtsträgers in Anführungszeichen, weil derselbe erst durch die Zuordnung der Zuständigkeit rechtlich existent ist. Der Rechtsträger ist der personifizierte Zuständigkeitskomplex. So ausdrücklich zum Begriff des Organs Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 228 f., 236 ff. und ders., VerwR II3, § 74 I, S. 45, sowie ders., a. a. O., § 72 IV, S. 26 (zum Begriff des Amtes). 22 Vgl. nur Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 26. 23 Das organisatorische Prinzip der Arbeitsteilung wird immer wieder hervorgehoben. Vgl. nur Fügemann, Zuständigkeit, S. 1 ff.; Groß, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 139 (140 ff.); Hufeld, Vertretung, S. 9 ff.; Wahl, Stellvertretung, S. 21 ff.; Hans J. Wolff, 19
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
101
Verpflichtung des Zurechnungsendsubjektes wird zu diesem Zweck auf Untereinheiten verteilt, deren Entscheidungen ihrerseits dem Zurechnungsendsubjekt als eigene zugerechnet werden. Aus normativer Sicht sind auch diese Untereinheiten Verpflichtungsrechtsatzkomplexe. Die für eine Juristische Person des öffentlichen Rechts entscheidenden Untereinheiten sind ihrerseits konstituiert durch Zuständigkeitsrechtssätze. Ihre Zuständigkeit besteht im Gegensatz zur „materiellrechtlichen“ 24 Eigenzuständigkeit der Juristischen Person in der Verpflichtung zur „transitorischen Wahrnehmung von Eigenzuständigkeiten der Juristischen Person“.25 Diese Zuständigkeit heißt organisationsrechtliche Wahrnehmungszuständigkeit26 bzw. Organzuständigkeit27. Aus normativer Sicht ist also ein Organ „ein . . . eigenständiges, institutionelles Subjekt von Zuständigkeiten zur transitorischen Wahrnehmung von Eigenzuständigkeiten einer Juristischen Person“.28 „Transitorisch“29 heißt die Wahrnehmung von Eigenzuständigkeiten der Juristischen Person, weil die Wahrnehmung dieser Verpflichtungen und Berechtigungen aus der Wahrnehmungszuständigkeit die Verpflichtungen und Berechtigungen der Juristischen Person aus der Eigenzuständigkeit erfüllt oder deren Verpflichtung oder Berechtigung auslöst.30 Die Erfüllung der Verpflichtung aus der Wahrnehmungszuständigkeit ist eine „transitorische“, d. h. eine auf das Zurechnungsendsubjekt bezogene Erfüllung.31 Als Folge dieser transitorischen Wahrnehmung von Zuständigkeiten werden EntVerwR II3, § 72 I, S. 12. Aus verwaltungswissenschaftlicher Sicht z. B. Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 290 ff. 24 Vgl. Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 13. 25 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 74 I, S. 45. In der Folgeauflage (Hans J. Wolff, in: ders./Bachof, VerwR II4, § 74 I f, S. 48 f.) weist Hans J. Wolff auf Kritik von Bökkenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (277 ff., insbes. 282 ff.) darauf hin, daß es für die Definition des Organs auf die Vollrechtsfähigkeit der Organisation nicht ankomme. „In der Tat hat notwendigerweise jede (Hervor. i. O.), also auch eine nicht rechtsfähige Organisation Organe, die sie integrieren und handlungsfähig machen kann.“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 48 f.). Er definiert infolgedessen ein Organ als „ein durch organisierende Rechtssätze gebildetes, selbständiges institutionelles Subjekt von transitorischen Zuständigkeiten zur funktionsteiligen Wahrnehmung von Aufgaben einer (teil-)rechtsfähigen Organisation.“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 48). 26 Begriff nach Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 14 f. 27 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 15. 28 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 74 I, S. 45: „Organ im normativen Sinn“. Das Organ ist also ein personifizierter Komplex von Wahrnehmungszuständigkeiten. Ebenso Erichsen, in: FS Menger, S. 211 (215); Schnapp, Jura 1980, S. 68 (73). Dem folgend H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24. 29 Von lateinisch transire = (hin)übergehen. 30 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 15. 31 Die Zurechnung des Organhandelns ist „durchgehend“ bzw. „vorläufig“ (vgl. so Hans J. Wolff, VerwR II3, § 27 I, S. 15 f.). Dem folgend Kluth, in: Hans J. Wolff/ Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 27.
102
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
scheidungen der Organe in Ausübung dieser Wahrnehmungszuständigkeiten der Juristischen Person „rechtstechnisch endgültig“32 zugerechnet.33 Die Begriffe der organisationsrechtlichen Wahrnehmungszuständigkeit und der materiellrechtlichen Zuständigkeit bezeichnen zwei qualitativ nicht gleichwertige Zuständigkeitsbegriffe.34 Die organisationsrechtliche Wahrnehmungszuständigkeit ist im Gegensatz zur materiellrechtlichen Zuständigkeit, die eine Eigen- und Endzuständigkeit35 darstellt, innerorganisatorisches Mittel zur Herstellung eines Zurechnungszusammenhangs zwischen einem staatlichen Organ und dem jeweiligen staatlichen Zurechnungsendsubjekt. Diese Art der Zurechnung kann organisationsrechtliche 36 oder organschaftliche37 Zurechnung genannt werden. Die Entscheidungen des Organs werden der Juristischen Person organisationsrechtlich als eigene zugerechnet. Man kann also sagen, daß die Wahrnehmung der Zuständigkeit „als und für“38 die Juristische Person erfolgt. Diese organisationsrechtliche Zurechnung stellt eine besondere Art der Zurechnung dar und unterscheidet sich von anderen Vertretungsformen, der zivilrechtlichen Stellvertretung und der gesetzlichen Vertretung.39 Zugerechnet werden nicht nur Entscheidungen. Der Entscheider selbst, das VerpflichtungsrechtsHans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 16. Hans J. Wolff, VerwR I8, § 35 III, S. 237 mit dem Hinweis darauf, daß dies der „rechtstechnische Sinn“ der alten Organismustheorie sei, nach der eine Organisation handlungs- und willensfähig sei durch ihre Organe (als reale Untereinheiten der Organisation). So auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 252 f., der darauf hinweist, daß die Organismustheorie aus diesem Grund heutzutage „keineswegs erledigt“ sei. Die Organismustheorie wird insbesondere repräsentiert von Otto von Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die Deutsche Rechtsprechung, 1887 (Nachdruck 1963). 34 Dies stellt auch Fügemann, Zuständigkeit, S. 25 fest. 35 Begriff nach Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 13. 36 Vgl. nur Remmert, Dienstleistungen, S. 251 ff. 37 So z. B. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 247 ff.; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 33 ff. 38 So ausdrücklich Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274). Die Präposition „für“ steht in der Terminologie Hans J. Wolffs für den Begriff der „Wahrnehmungszuständigkeit“, der Partikel „als“ für den Begriff der „organisatorischen Wahrnehmungszuständigkeit“. Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 282 spricht von einer „Immanenz . . . der ,Organe‘ in der Juristischen Person“. Diese Immanenz meint lediglich eine gedankliche Einheit der Organe in der jeweiligen Juristischen Person. Organe sind ebenso wie eine Juristische Person aus normativer Sicht „nur gedachte Kompetenzkomplexe“ (Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 282), d. h. reine Zuständigkeitsrechtssubjekte. Die Organe gehören zur staatlichen Einheit „als gedachte Komponenten einer gedachten Einheit“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 282). 39 Vgl. zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen Organschaft und Stellvertretung Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 280 ff.; ebenso Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274). Vgl. auch K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 250 ff., insbes. S. 254. Dem folgend Kluth, in: Hans J. Wolff/ Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 33 ff., insbes. Rn. 36. Ausführlich dazu noch unten Zweiter Teil, S. 173 ff. 32 33
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
103
subjekt der Wahrnehmungszuständigkeit, gilt als Teil des Zurechnungsendsubjektes. Die jeweilige Entscheidung wird nicht nur mit Wirkung „für“, sondern auch „als“40 das jeweilige Zurechnungsendsubjekt getroffen. Das Verpflichtungsrechtssubjekt der Wahrnehmungszuständigkeit ist Teil des staatlichen Normenkomplexes. Daß das Organ „als und für“ die jeweilige Juristische Person entscheidet, hat zur Folge, daß das Organ seinerseits an alle für diese Juristische Person geltenden Rechtsätze gebunden ist. Zuständigkeitsrechtssätze, die ausdrücklich an die jeweilige Juristische Person adressiert sind, lassen sich dahingehend auslegen, daß sie auf alle als Organe des Zurechnungsendsubjekts eingeschalteten Rechtssubjekte ebenfalls anwendbar sind.41 Auch die sonstigen Entscheidungsvorgaben der Juristischen Person sind auf deren Organe anwendbar. Einer gesonderten Verpflichtung der Untereinheit zur Wahrnehmung dieser sonstigen Entscheidungsvorgaben des Zurechnungsendsubjektes bedarf es im Rahmen der organisationsrechtlichen Zurechnung also nicht. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist also ein staatliches Rechtssubjekt und als solches Adressat aller auf dieses Rechtssubjekt anwendbaren Sonderbindungen des Staates, wenn sie entweder Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit oder Träger einer transitorischen Wahrnehmungszuständigkeit und deshalb Organ ist. III. Gemischtwirtschaftliche Gesellschaften als Organwalter Die „rechtstechnische Juristische Person aber, die Titulär jener Berechtigungen und Verpflichtungen ist, ist unfähig diese Aufgaben irgendwie zu erfüllen“.42 Die Juristische Person ist ebenso wie ihre Organe lediglich gedankliches Rechtskonstrukt, ohne selbst entscheidungs- und handlungsfähig zu sein. 1. Dienstrechtliche Zurechnung menschlichen Verhaltens Entscheidungs- und handlungsfähig sind nur Menschen.43 Um ihre Verpflichtung aus der Eigenzuständigkeit erfüllen zu können, muß einer Juristischen Per40 Vgl. dazu Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, insbes. S. 297; Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274). I. E. ebenso Schnapp, Jura 1980, S. 68 (73). 41 Remmert, Dienstleistungen, S. 217 f. 42 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 297; ders., VerwR II3, § 74 III, S. 54. 43 Vgl. nur z. B. Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 242 f.; ders., VerwR II3, § 74 III, S. 54; H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24; Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (252 f.) m. w. N. in Fn. 56; Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 25.
104
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
son, dem gedanklichen, rechtstechnischen Zurechnungsendsubjekt,44 menschliches Verhalten als eigenes Verhalten zugerechnet werden. Diese Zurechnung erfolgt ebenso wie die innerorganisatorische Zurechnung von Entscheidungen aufgrund rechtlicher Anordnung. Die – vertraglichen oder gesetzlichen45 – Rechtssätze des Dienstrechts46 verpflichten die jeweilige natürliche Person als sogenannten Amtswalter zur Wahrnehmung der Wahrnehmungszuständigkeiten für das jeweilige rechtstechnische Wahrnehmungszuständigkeitssubjekt, das sogenannte Amt. Das Amt ist also aus normativer Sicht „ein auf einen Menschen bezogener, institutionalisierter Inbegriff von Wahrnehmungszuständigkeiten“.47 Die Verpflichtung des Amtswalters heißt Amtswahrnehmungspflicht.48 Wenn das Dienstrecht zur Wahrnehmung eines Amtes verpflichtet, müssen menschliche Entscheidungen und Handlungen in Erfüllung dieser Pflicht als Amtshandeln angesehen werden. Die Entscheidungen der Amtswalter in Ausübung dieser Amtswahrnehmungspflicht werden deshalb mit Wirkung für das staatliche Verpflichtungsrechtssubjekt der Wahrnehmungszuständigkeit getroffen.49 Die Amtswalter-Entscheidungen werden dem jeweiligen Amt und dem in der Regel aus verschiedenen Ämtern bestehenden Organ50 in Folge dessen als eigene zugerechnet. Die Entscheidungen des Amtes bzw. Organs gelten wiederum – wie vorstehend dargestellt – als Entscheidungen des staatlichen Zurechnungsendsubjektes der jeweiligen Eigenzuständigkeit.
44 So verschiedentlich Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 151, 187 ff., 198 ff., 207 ff., 437 f.: „Die Staatsperson dagegen ist die Staatsorganisation als ein durch das Völkerrecht einerseits und durch die Allgemeine Rechtsordnung andererseits begründetes konstruktiv annehmbares Zurechnungsendsubjekt“ (a. a. O., S. 437 f., Hervor. i. O.). Dem folgend z. B. Schnapp, Jura 1980, S. 68 (70 f.); H. H. Rupp, Grundfragen, S. 22 f., 24; Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 104 f. Kritisch dagegen Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (273 ff., insbes. S. 281). 45 Remmert, Dienstleistungen, S. 303. 46 Vgl. §§ 35 Abs. 1 S. 1, 36 S. 2 BRRG, die allerdings lediglich Rahmenvorschriften sind und keine konkrete Amtswahrnehmungspflicht eines Beamten begründen (vgl. Remmert, Dienstleistungen, S. 302). Konkrete Amtswahrnehmungspflichten enthalten z. B. arbeitsvertragliche Regelungen. Vgl. zum Begriff des Dienstrechts nur Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 25 m. w. N. in Fn. 93; Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (251); Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 (218). 47 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 73 I, S. 27 (Hervor. i. O.). Ebenso ders., Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 284; Remmert, Dienstleistungen, S. 272, 314; Schnapp, Jura 1980, S. 68 (74); ders., AöR 105 (1980), S. 243 (254). 48 Zum Begriff vgl. nur Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (251); Remmert, Dienstleistungen, S. 297 ff. 49 Schnapp, Amtsrecht und Beamtenrecht, S. 94; Remmert, Dienstleistungen, S. 297 f. 50 Zur Abgrenzung zwischen den Begriffen Amt, Behörde und Organ vgl. nur Loeser, System II, § 10, Rn. 41; Schnapp, Jura 1980, S. 68 (73 ff.).
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
105
2. Organschaftliche und dienstrechtliche Zurechnung Möglicherweise können neben natürlichen Personen auch gemischtwirtschaftliche Gesellschaften Adressaten einer Amtswahrnehmungspflicht sein mit der Folge, daß sie insoweit Amtswalter sind und ihre Entscheidungen als Entscheidungen des jeweiligen staatlichen Amtes gelten.51 So kann man möglicherweise davon ausgehen, daß auch Juristische Personen des Privatrechts als Amtswalter „mit der Ausübung eines Amtes betraut werden und Partei eines Amtswahrnehmungsvertrages sein“ können.52 Die für die Juristische Person entscheidenden und handelnden Menschen treffen ihre Entscheidungen insoweit mit rechtlicher Wirkung für die Gesellschaft, die ihrerseits Walter eines staatlichen Amtes ist.53 Im Unterschied zur Einschaltung natürlicher Personen als Verpflichtungsrechtssubjekte einer Amtswahrnehmungspflicht verlängert sich im Fall dieses mehrstufigen Zurechnungsmodells die Kette der Zurechnungen.54 Die menschlichen Entscheidungen werden zunächst einem apersonalen, rechtstechnischen Zurechnungsendsubjekt zugeordnet, das selbst nicht staatliches Rechtssubjekt ist. Es ist vielmehr ein – entscheidungs- und handlungsfähiges – privates Rechtssubjekt, das wiederum als Amtswalter zur Wahrnehmung eines Amtes verpflichtet wird. Dieses Amt ist – im Gegensatz zum vorstehend beschriebenen Modell – nicht auf den Entscheidungsbereich eines Menschen, sondern auf den Entscheidungsbereich eines Unternehmens zugeschnitten. Es ist deshalb „atypisch“.55 Die Entscheidungen dieses atypischen Amtes wiederum werden einem Organ und letztendlich dem staatlichen Zurechnungsendsubjekt der Eigenzuständigkeit organschaftlich als eigene zugerechnet. Ginge man von dieser Prämisse aus, dann würde sich in jedem Einzelfall die Frage stellen, ob eine einzelvertragliche Abrede zwischen einem Verwaltungsträger und einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft eine dienstrechtliche Amtswahrnehmungspflicht oder eine organisationsrechtliche Wahrnehmungszuständigkeit der Gesellschaft enthielte, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Es stellt sich daher die Frage, ob dienstrechtliche Zurechnungssätze neben natürlichen Personen auch auf Juristische Personen des Privatrechts anwendbar sind. 51 So Remmert, Dienstleistungen, S. 482 ff. in bezug auf nicht staatlich beherrschte Organisationseinheiten. In dieselbe Richtung weisende Ansichten finden sich in der Literatur zum sogenannten „kommunalen Erfüllungsgehilfen“ bzw. zur „Verwaltungshilfe“. Für diese Fälle einer einzelvertraglichen Beauftragung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften mit der Erbringung von Dienstleistungen oder Waren für einen Verwaltungsträger durch denselben wird die jeweilige Gesellschaft als „Amtshelfer“ bzw. „Verwaltungshelfer“ angesehen [vgl. dazu noch ausführlich mit weiteren Nachweisen unten Zweiter Teil, S. 173 ff.]. 52 Remmert, Dienstleistungen, S. 482 f. 53 Remmert, Dienstleistungen, S. 485. 54 Remmert, Dienstleistungen, S. 483. 55 Vgl. zur Möglichkeit eines „atypischen Zuschnitts“ von Ämtern Remmert, Dienstleistungen, S. 314 ff.
106
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Die Funktion des Dienstrechts, einer apersonalen Organisationseinheit menschliche Entscheidungen und Handlungen als eigene zuzurechnen, kann auch mit Hilfe der Einschaltung Juristischer Personen des Privatrechts erfüllt werden. Möglicherweise ist aber das Dienstrecht von seinem Wesen nach etwas anderes als das Organisationsrecht und in seiner spezifischen Eigenart nicht auf Juristische Personen anwendbar. Das „Amtswalterrecht“56 ist möglicherweise das Dienstrecht der entscheidenden natürlichen Personen.57 Die Trennung zwischen Organisations- und Amtswalter- bzw. Dienstrecht resultiert möglicherweise gerade aus der Unterscheidung zwischen dem institutionalisierten Zuständigkeitskomplex und den für diesen Zuständigkeitskomplex entscheidenden Menschen. Dafür spricht, daß sich die Zurechnung menschlichen Verhaltens zu einem apersonalen Zurechnungsendsubjekt von der organschaftlichen Zurechnung von Entscheidungen einer Juristischen Person unterscheidet. Geht man davon aus, daß Menschen nicht Teil der (apersonalen und entindividualisierten) staatlichen Organisation sein können,58 dann werden ihre Entscheidungen allenfalls „für“, aber nicht „als und für“ ein staatliches Zurechnungssubjekt getroffen. Natürliche Personen können daher nicht organisationsrechtlich verpflichtet werden, Entscheidungen als Teil eines staatlichen Zurechnungsendsubjektes zu treffen. Sie sind infolgedessen auch nicht ipso iure an alle für diese geltenden Rechtssätze gebunden.59
56
Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (270 f.). So ausdrücklich Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 265: „Es sind die Rechte und Pflichten, die eine – stets ,physische‘ – Person hat, weil und soweit sie Organwalter ist, also die Rechte und Pflichten aus dem Organwalterverhältnis“. Ebenso ders., VerwR II3, § 74 IV, S. 55, wonach Organwalter „die Menschen, welche die dem Organ zugewiesenen Kompetenzen rechtens unter dem Namen des Organs versehen“, seien. Nach Krebs, Jura 1981, S. 569 (570) ist ein Organwalter die zur Wahrnehmung der Organfunktionen berufene „natürliche Person“. Ebenso H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24, wonach der Organwalter eine „psychisch-physische Person“ ist. Vgl. auch Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (270 f.) und Erichsen, in: FS Menger, S. 211 (221), wobei letzterer darauf hinweist, daß sich die Existenz des Amtswalters „darin erschöpft, die Organisation willens- und handlungsfähig zu machen“. Ebenso H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24: „Der Organwalter dagegen ist diejenige psychisch-physische Person, die die Institution mit wirklichem Leben ausfüllt“. Nach Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 35 kann eine dienstrechtliche Verantwortlichkeit „nur einer natürlichen Person zukommen“. 58 Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 25; i. E. so auch Remmert, Dienstleistungen, S. 300 ff. Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 235 weist darauf hin, daß Menschen „nicht Teil eines Normensystems“ sein können. Geht man von der vorstehend genannten Prämisse einer apersonalen und entindividualisierten staatlichen Organisation nicht aus, dann ist es konstruktiv denkbar, daß die jeweilige natürliche Person als Rechtssubjekt Teil eines staatlichen „Normensystems“ ist. Ob allerdings „Art. 1 Abs. 1 GG einer derartigen Instrumentalisierung des Menschen entgegensteht“ (Remmert, a. a. O., S. 300), bleibt dann zu untersuchen. 57
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
107
Die Zurechnung menschlichen Verhaltens zu einem rechtstechnischen Zurechnungssubjekt ist deshalb von einer anderen Qualität als die innerorganisatorische, organschaftliche Zurechnung von Entscheidungen apersonaler Einheiten.60 Sie erfordert daher auch spezifisch menschenbezogene Regelungen, die gerade die Besonderheiten der Zurechnung menschlichen Verhaltens berücksichtigen. So müssen Bestimmungen existieren, die Anforderungen an die Zuverlässigkeit und Eignung des menschlichen Individuums stellen. Auch müssen sie der Tatsache Rechnung tragen, daß Menschen ihre Rechte und Pflichten im Einzelfall ändern oder aufheben wollen oder müssen. Die als Amtswalter handelnden natürlichen Personen müssen durch Rechtssatz zur Einhaltung der Rechtspflichten des Amtes, also aller anwendbaren Sonderbindungen des Staates, verpflichtet werden.61 Diesen menschenbezogenen Erfordernissen trägt das Dienstrecht Rechnung und bildet damit in seinem Verhältnis zum Organisationsrecht die Trennung zwischen Mensch und Organisation ab. Darüber hinaus sprechen auch Gründe der Praktikabilität und Plausibilität für eine solche Trennung zwischen dienstrechtlicher und organisationsrechtlicher Zurechnung. Das Modell der Juristischen Person des Privatrechts als Amtswalter eines atypisch zugeschnittenen Amtes geht von einer dreistufigen Zurechnung aus. So werden die Entscheidungen der für die Juristische Person des Privatrechts handelnden Menschen dieser in ihrer Funktion als Zurechnungsendsubjekt der zivilrechtlichen Verpflichtungen und Berechtigungen zugerechnet. Diese Entscheidungen der Juristischen Person wiederum werden als Entscheidungen eines (atypischen) Amtswalters einem gedanklichen, rechtstechnischen Amt zugerechnet. Das Amt seinerseits ist als Wahrnehmungszuständigkeitskomplex, der rechtlich nicht mit der Gesellschaft als Konstrukt des Gesellschaftsvertrages identisch ist, Teil staatlicher Organisation. Die Gesellschaft dagegen ist als Amtswalter nicht Teil derselben. Eine andere Konstruktion ergibt sich, wenn man davon ausgeht, daß Amtswalter nur natürliche Personen sein können, Juristische Personen als reine Rechtskonstrukte dagegen notwendig Ämter bzw. Organe einer staatlichen Juristischen Person oder selbst staatliche Juristische Person des öffentlichen Rechts sind. Geht man von dieser Trennung zwischen apersonalem Organisationsrecht und auf den Menschen bezogenem Dienstrecht aus, dann können gemischtwirtschaftliche Gesellschaften keine Amtswalter, sondern nur (atypisch zugeschnittene) Ämter sein. In diesem Fall sind die Entscheidungen der Gesellschaft inso59 Ebenso Remmert, Dienstleistungen, S. 303 unter Verweis auf Schnapp, Amtsrecht und Beamtenrecht, S. 172; ders., AöR 105 (1980), S. 243 (252 f.) u. w. N. in Fn. 237. 60 Die Organe sind als Teil staatlicher Organisation im Gegensatz zu den Organwaltern unverzichtbare Zurechnungsträger der Organisation und vom „Dasein, Wechsel und Wegfall“ [Schnapp, AöR 105 (1980), S. 243 (257) m. Verweis auf RGSt 32, S. 365 (366); Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 25] der Organwalter unabhängig. 61 Dazu ausführlich Remmert, Dienstleistungen, S. 303 f.
108
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
weit bereits Entscheidungen des Amtes und müssen nicht einem weiteren, rechtlich von der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft zu unterscheidenden Amt zugerechnet werden. Die Gesellschaft ist in diesem Fall als Wahrnehmungszuständigkeitskomplex ipso iure an alle auf den Verwaltungsträger anwendbaren Sonderbindungen des Staates gebunden. Darüber hinaus unterscheidet das vorstehend beschriebene dreistufige Zurechnungsmodell zwischen staatlich beherrschten und selbständigen Juristischen Personen des Privatrechts.62 Staatlich beherrschte Personen seien aufgrund ihrer organisatorischen Verflechtung apersonale staatliche Einheiten. Nur die selbständigen und deshalb privaten Juristischen Personen des Privatrechts seien taugliche Partner eines Amtswahrnehmungsvertrages.63 Während die Eigenschaft selbständiger Juristischer Personen des Privatrechts, Amtswalter zu sein, rechtskonstruktiv mit dem Vorliegen einer entsprechenden vertraglichen Bindung begründet wird, wird in bezug auf die beherrschten Juristischen Personen des Privatrechts und ihre Eigenschaft, Teil staatlicher Organisation zu sein, auf das reale Kriterium der Beherrschung abgestellt. Damit werden Juristische Personen des Privatrechts mal als staatliche Organisationseinheiten und mal als Amtswalter begriffen.64 Das Modell wechselt also die Betrachtungsebene von der organisationsrechtlichen im Fall der Beherrschung hin zu einer dienstrechtlichen für die sonstigen Fälle. Darüber hinaus wird die Staatseigenschaft beherrschter Organisationseinheiten mit einem realen Kriterium begründet, für die Eigenschaft selbständiger Juristischer Personen des Privatrechts, Amtswalter zu sein, dagegen auf das rechtliche Kriterium des Vorliegens eines Amtswahrnehmungsvertrages abgestellt. Auch insofern wechseln also die Betrachtungsebenen zwischen einem realen und einem normativen Ansatz. Nach dem vorstehend Gesagten soll deshalb im folgenden dem zweistufigen Zurechnungsmodell gefolgt werden, wonach Juristische Personen des Privatrechts im Fall einer Zuständigkeitszuweisung durchgehend als Amt bzw. Organ mit verschiedenen, zusammengefaßten Ämtern65 betrachtet werden. Nur natür62
Remmert, Dienstleistungen, S. 482 f. Remmert, Dienstleistungen, S. 482 f. m. Fn. 520 geht davon aus, daß staatlich beherrschte Organisationseinheiten in Privatrechtsform nicht privat seien und daher als Amtswalter von vornherein ausschieden. Eine staatlich beherrschte Organisationseinheit sei eine „eigene privatrechtsförmige Untereinheit“ (a. a. O., Fn. 520). „Die Zuständigkeitswahrnehmung durch eine eigene privatrechtsförmige Untereinheit einer Verwaltungseinheit ist regelmäßig keine Frage der Betrauung einer solchen Organisationseinheit mit der Wahrnehmung eines Amtes, sondern eine Frage der Wahrnehmung von Zuständigkeiten durch eigene, aber verselbständigte Untereinheiten“ (a. a. O., Fn. 520). 64 Remmert, Dienstleistungen, S. 303 m. w. N. zur Gegenansicht, S. 485 geht davon aus, daß der einzelne Amtswalter kein organisatorischer Bestandteil des Staates ist. 65 Je nachdem, ob die Gesellschaft ein auf einen oder mehrere Menschen bezogener Wahrnehmungszuständigkeitskomplex ist. In der Regel werden den Gesellschaften des Privatrechts gesellschafts- und einzelvertraglich verschiedene Aufgabenbereiche zuge63
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
109
liche Personen sollen als Adressaten einer Amtswahrnehmungspflicht in Betracht kommen.66 IV. Zwischenergebnis Staatliche Rechtssubjekte sind Zurechnungsendsubjekte von Eigenzuständigkeiten, deren Entscheidungen von Wahrnehmungszuständigkeitskomplexen, den Organen, getroffen werden. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist demnach Teil einer staatlichen Entscheidungseinheit, wenn sie entweder selbst Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit und damit Verwaltungsträger oder Träger einer transitorischen Wahrnehmungszuständigkeit und damit Organ ist. Die für die Gesellschaft handelnden und entscheidenden natürlichen Personen sind insoweit Walter eines staatlichen Amtes.
B. Relativität der Staatseigenschaft Nachdem festgestellt wurde, daß gemischtwirtschaftliche Gesellschaften des Privatrechts nach dem normativen Ansatz Adressat der Sonderbindungen des Staates sind, wenn sie Zuweisungssubjekt einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit sind, stellt sich im folgenden die Frage, ob ein Rechtssubjekt sowohl Zurechnungsendsubjekt privatrechtlicher Rechte und Pflichten als auch Zurechnungsendsubjekt einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit sein kann.67 Es ist im folgenden zu untersuchen, ob und inwieweit eine gemischwirtschaftliche Gesellschaft als Juristische Person des Privatrechts Organ oder Juristische Person des öffentlichen Rechts sein kann. Zur Beantwortung dieser Frage sind die Begriffe des Rechtssubjektes und der Juristischen Person noch einmal in Erinnerung zu rufen. Ein Rechtssubjekt bzw. eine Person68 ist ein Zurechnungsendsubjekt von Verpflichtungen und Berechtigungen.69 Als solches ist es der gedankliche wiesen, deren Wahrnehmung mehrerer Amtswalter bedarf (ausführlich dazu unten Zweiter Teil, S. 128 ff.). Die Gesellschaften werden also in der Regel Organe sein, die sich in verschiedene Ämter gliedern. Im folgenden soll daher von der Organeigenschaft der Gesellschaften des Privatrechts die Rede sein. 66 Vgl. dazu i. E. ebenso die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Amtsträgereigenschaft von Geschäftsführern einer staatlich beherrschten GmbH. Aufgrund der staatlichen Beherrschung sei die GmbH als staatliche Organisationseinheit zu betrachten und als „sonstige Stelle“ im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB den Behörden gleichzusetzen. Die für die GmbH entscheidenden Organmitglieder seien Amtsträger im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB: BGHSt 43, S. 370 (377); 45, S. 16 (19); 46, S. 310 (312 f.); BGH, NJW 2001, S. 3062 (3063); BGH, NJW 2004, S. 693 (694); BGHSt 49, S. 214 (219); BGHSt 50, S. 299 (303 ff.). 67 Diese Frage deutet Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 40 an. 68 Vgl. zum Verhältnis der Begriffe der Rechtspersönlichkeit und Rechtsfähigkeit nur H. H. Rupp, Grundfragen, S. 82 m. w. N. in Fn. 177, der es dahinstehen läßt, ob
110
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Punkt,70 dem Verpflichtungen und Berechtigungen zugerechnet werden. Diese Verpflichtungen und Berechtigungen knüpfen ihre Rechtsfolgen, das Zugewiesensein bzw. Bestehen einer Verpflichtung, an bestimmte Tatbestände. So wurde bereits zu Beginn der Untersuchung festgestellt, daß die Sonderbindungen des Staates ihre Rechtsfolgen an bestimmte staatliche Handlungs- und Funktionsbereiche knüpfen.71 Diese Tatbestände, z. B. „die Gemeinde“ oder „das Unternehmen“, werden durch individualisierte Einheiten, Menschen oder Organisationen, gesetzt. Dadurch werden die gedanklichen Zurechnungsendpunkte selbst individualisiert.72 Sie sind deshalb (natürliche oder Juristische) Person.73 Es gibt also einen individualisierten Endpunkt, die Person, der bestimmte Verpflichtungen und Berechtigungen als eigene zugerechnet werden. Dieser Endpunkt ist lediglich ein rechtstechnisches Konstrukt, ein „Konstruktionsmoment“,74 und zu trennen von der dieses Konstrukt individualisierenden realen Substanz. Er ist der gedankliche Zielpunkt von Normen.75 Wenn also nach dem üblichen Sprachgebrauch „der Gemeinde“ eine Zuständigkeit zugewiesen wird, dann heißt das, daß an den Tatbestand der kommunalen Organisation die Verpflichtung und Berechtigung aus der Zuständigkeit geknüpft wird. Rechtstechnische Person ist der durch die kommunale Organisation individualisierte Zurechnungsendpunkt der Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit, also die Juristische Person bzw. das Organ. Entsprechendes gilt für den sprachlichen Ausdruck, nach dem „einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen“ eine Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit zugewiesen wird. In diesem Fall wird an den Tatbestand der realen Unternehmensorganisation die Verpflichtung und Berechtigung aus der Zuständigkeit geknüpft. Rechtstechnische Person ist der durch die Unternehmensorganisation individualisierte Zurechnungsendpunkt der Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit. Staatliches Rechtssubjekt ist lediglich der rechtstechnische zwischen diesen beiden Begriffen „wirklich ein rechtlich relevanter Unterschied“ besteht (a. a. O., Fn. 177). Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 128 weist darauf hin, daß die Begriffe regelmäßig synonym gebraucht werden. 69 Vgl. nur Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 128, 142. 70 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 144 spricht auch von einem „Gedankending“. 71 Vgl. oben Erster Teil, S. 28 m. Fn. 2. 72 Nach Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 142 ist eine „Person“ ein „Komplex von Tatbeständen . . ., der dadurch, daß ein Individuum sie setzt, individualisiert wird“ (Hervor. i. O.). Ders., a. a. O., S. 207 weist darauf hin, daß eine natürliche Person durch einen Menschen, eine Juristische Person dagegen durch (in der Regel, nicht notwendig, Anm. d. Verf.) eine Organisation individualisiert wird. 73 Hans J. Wolff spricht an anderer Stelle auch von einer Juristischen Person als der „personifizierten Organisation“ (z. B. ders., VerwR II3, § 72 I, S. 16). 74 So ausdrücklich Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 144. 75 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 149 f.
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
111
Zurechnungsendpunkt, d. h. die Juristische Person oder das Organ. Das Unternehmen als Organisation ist lediglich ein Apparat76 mit gemischt staatlich-privater Entscheidungsstruktur. Die durch einen Wahrnehmungszuständigkeitsrechtssatz oder eine sonstige Sonderbindung des Staates an den Tatbestand staatlicher Organisation geknüpfte Rechtsfolge wird auch an den Tatbestand des Unternehmens geknüpft. Ebenfalls eine sprachliche Abbreviation liegt darin, von „der Gesellschaft des Privatrechts“ oder „der Juristischen Person des Privatrechts“ als Zurechnungsendsubjekt einer Zuständigkeit zu sprechen. Hinter dieser Ausdrucksweise steht vielmehr ein Sachverhalt, wonach an den Tatbestand einer unternehmerischen Organisationseinheit verschiedene Rechtsfolgen öffentlichrechtlicher und privatrechtlicher Verpflichtungsrechtssätze geknüpft werden. Der gedankliche Zurechnungsendpunkt der privatrechtlichen Verpflichtungsrechtssätze ist die Juristische Person des Privatrechts, der Zurechnungsendpunkt der Zuständigkeitsrechtssätze ist die Juristische Person des öffentlichen Rechts bzw. das Organ. Eine Juristische Person des Privatrechts ist also nicht zugleich Juristische Person des öffentlichen Rechts. Es handelt sich vielmehr um verschiedene Rechtssatzkomplexe, d. h. um einen Zuständigkeitskomplex und um einen oder mehrere Komplexe privatrechtlicher Verpflichtungen und Berechtigungen. Es liegen also verschiedene Juristische Personen vor, die durch dasselbe reale Substrat, d. h. durch das Unternehmen mit sachlicher und personeller Infrastruktur individualisiert werden. Soweit deshalb im folgenden davon gesprochen wird, eine Juristische Person des Privatrechts sei Organ oder Juristische Person des öffentlichen Rechts, ist dies eine verkürzende Ausdrucksweise dafür, daß zwei verschiedene Zurechnungsendsubjekte mit identischer Infrastruktur und organisatorischer Hülle vorliegen. Dieses reale Gebilde hat zwei „Rechtsträger“, eine Juristische Person des Privatrechts, den Unternehmensträger, und ein Organ bzw. eine Juristische Person des öffentlichen Rechts, den Verwaltungsträger.77 An den Tatbestand der Unternehmensorganisation knüpfen sich neben der Zuständigkeit auch Verpflichtungsrechtssätze z. B. des Gesellschaftsvertrages. So enthält ein Gesellschaftsvertrag Bestimmungen über die Organisation des unternehmensinternen Entscheidungsprozesses und die Verpflichtungen und Berechtigungen der für die Gesellschaft entscheidenden Organe und Organwalter. Er statuiert Bestimmungen, die das jeweilige staatliche Amt bzw. Organ „errichten“ und „einrichten“.78 Diese gesellschaftsvertraglichen Rechtssätze knüp76 Dieses Bild verwendet u. a. Groß, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 139 (141). 77 So ist wohl auch H. H. Rupp, Grundfragen, S. 101 zu verstehen, der von einer „Organschaft juristischer Personen“ spricht, aber zwischen der Rechtsstellung eines „Gebildes“ als Organ und „als eigener Rechtsträger“ differenziert. 78 Zu den Begriffen vgl. Hans J. Wolff, VerwR II3, § 74 III, S. 53 f., § 74 IV, S. 54 f. Die Errichtung ist die „Rechtsfolge organisatorischer Rechtssätze, die idR vor-
112
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
fen ihre Rechtsfolgen an den Tatbestand der jeweiligen unternehmerischen Organisation, ebenso wie möglicherweise ein Zuständigkeitsrechtssatz oder ein privatrechtlicher Verpflichtungsrechtssatz. Das „Rechtssatzmaterial“ eines Zuständigkeitssubjektes und einer Juristischen Person des Privatrechts kann also teilidentisch sein. Wird daher einem Rechtssubjekt, das durch die Verpflichtungsrechtssätze eines Gesellschaftsvertrages rechtlich konstituiert wird, eine Zuständigkeit zugewiesen, wird also an die Unternehmensorganisation, an die der Gesellschaftsvertrag Rechtsfolgen knüpft, auch die Rechtsfolge der Zuständigkeit geknüpft, kann man sagen, daß „die Gesellschaft“ als Konstrukt des Gesellschaftsvertrages Zuweisungssubjekt einer Zuständigkeit ist. Der Begriff der Gesellschaft meint in diesem Fall einen staatlichen Zuständigkeitskomplex, der gesellschaftsvertraglich und gesellschaftsrechtlich errichtet und eingerichtet ist. In diesem Sinne soll der Sprachgebrauch von der „Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften“ im folgenden verstanden werden. Aus dem vorstehend beschriebenen rein normativen Verständnis der Begriffe der Rechtsfähigkeit und Rechtspersönlichkeit folgt notwendig eine Relativität der Rechtsfähigkeit79 und damit auch der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften. Rechtlich existent sind die Gesellschaften des Privatrechts als Konstrukte des Gesellschaftsvertrages und mit Eintragung in das Handelsregister.80 Staatliches Rechtssubjekt sind sie insoweit, wie sie Zuordnungssubjekt einer Zuständigkeit sind. Je nach dem, ob eine Wahrnehmungszuständigkeit oder eine Eigenzuständigkeit zugewiesen wurde, sind sie dann insoweit Juristische Person des öffentlichen Rechts oder Organ. Die Eigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft, Träger von Eigenzuständigkeiten zu sein, reicht soweit, wie ein Rechtssatz die Gesellschaft verpflichtet, Entscheidungen schreiben, wie die Organwalter gewonnen werden, wie der Organwille zu bilden und durchzuführen ist (Verfahren des Organs) . . . und wo das Organ seinen Sitz hat“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 54). Sobald Menschen „bestimmt, ihre Aufgaben durch einen Organisations- und Geschäftsverteilungsplan festgelegt, ihre Besoldung durch Zuweisung von Planstellen gesichert und die von ihnen benötigten persönlichen und sachlichen Hilfsmittel bereitgestellt sind und sie ihre Tätigkeit aufgenommen haben, ist das Organ eingerichtet“ (Hans J. Wolff, a. a. O., S. 54 f.). 79 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 202, 203; Bd. 2, S. 249; Bachof, AöR 83 (1958), S. 208 (263 ff.), wonach die Rechtsfähigkeit als Teilrechtsfähigkeit notwendig auf den Umfang der Zuweisung begrenzt ist. Vgl. auch H. H. Rupp, Grundfragen, S. 15, 23, 82 ff., der wiederholt auf die Relativität der Rechtsfähigkeit hinweist unter Verweis auf Fritz Fabricius, Relativität der Rechtsfähigkeit. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des privaten Personenrechts, 1963 (a. a. O., S. 82, Fn. 176). Vgl. ebenso z. B. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 8 V, S. 212; Krebs, Jura 1981, S. 569 (573 f.); Schnapp, Rechtstheorie 1984, Beiheft 5, S. 381 (399 ff.). 80 Vgl. z. B. zur Entstehung einer Aktiengesellschaft bzw. einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ausdrücklich § 41 Abs. 1 S. 1 AktG bzw. § 11 Abs. 1 GmbHG. Ausführlich dazu z. B. Rittner, Juristische Person, S. 17 ff., 52 ff.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 11 IV, S. 298 ff.
2. Abschn.: Zuständigkeitsrechtssätze als Kriterien
113
als eigene zu treffen. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist lediglich insoweit als Organ konstituiert, wie es Zuständigkeitssubjekt einer Wahrnehmungszuständigkeit ist. Das Organ ist lediglich der „Kompetenzkomplex“81 bzw. der „Zuständigkeitskomplex“.82 Die Staatseigenschaft eines Rechtssubjektes ist also notwendig relativ83 und partiell.84 Gerade aus diesem Grund ist der normative Ansatz geeignet, die aus den oben85 beschriebenen realen Ansätzen resultierenden Fragestellungen zu beantworten. So führen der Beherrschungs-, Rechtsform- und Aufgabenansatz mit ihren jeweiligen Alternativlösungen, die ein Unternehmen im Ganzen entweder dem Staat oder dem privaten Bereich zuordnen, zu einer Vernachlässigung entweder des privaten oder des staatlichen Anteils an den Entscheidungen eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens.86 Sie können die gemischt staatlichprivate Entscheidungswirklichkeit nicht hinreichend abbilden. Der normative Ansatz dagegen kann dieses strenge Alternativitätsverhältnis auflösen in eine differenzierende Zuordnung: Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft kann Zuordnungssubjekt einer Zuständigkeit zur transitorischen Wahrnehmung einer Eigenzuständigkeit sein. Ihre Staatseigenschaft ist in diesem Fall relativ, soweit wie die Verpflichtung aus der Wahrnehmungszuständigkeit reicht. Als Wahrnehmungszuständigkeitskomplex ist sie Teil eines staatlichen Zurechnungsendsubjektes. Ihre Entscheidungen sind deshalb staatliche Entscheidungen. Die unternehmerische Organisation mit ihrer gemischt staatlich-privaten Entscheidungsstruktur ist lediglich Apparat und organisatorische Hülle. Entsprechendes gilt für die Fallgestaltung, in der eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft Träger einer Eigenzuständigkeit ist. Sie ist lediglich insoweit Juristische Person des öffentlichen Rechts, wie der Verpflichtungsgehalt der Eigenzuständigkeit reicht. Relativ, bezogen auf die Rechtssätze des Privatrechts, 81
H. H. Rupp, Grundfragen, S. 24. Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 236. 83 Schnapp, Rechtstheorie 1984, Beiheft 5, S. 381 (401 f.) spricht von der „Relativität der Organschaft“. 84 H. H. Rupp, Grundfragen, S. 22 m. w. N. in Fn. 10 weist daher auf folgendes hin: „Wer daher den Staat als nur juristische Person, als Rechtssubjekt zu begreifen vermag, muß sich also notwendig zu einem pluralistischen Staatsbegriff bekennen“. 85 Zweiter Teil, S. 63 ff. 86 Siehe dazu bereits oben Erster Teil, S. 66 ff. m. w. N. Eine möglicherweise relative und deshalb „partielle Grundrechtsbindung und -fähigkeit“ (Möstl, Grundrechtsbindung, S. 146) gemischtwirtschaftlicher Unternehmen wird nur vereinzelt angedeutet. So Möstl, a. a. O., S. 146 f., der darauf hinweist, daß nur „soweit der Unternehmensgegenstand also Verwaltungsaufgabe ist“, das Unternehmen den Grundrechtsschutz verliere. Ebenso Zimmermann, Schutzanspruch, S. 118, 123 f. Vgl. auch Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 41 in bezug auf den Beliehenen. Das Bundesverfassungsgericht läßt es in BVerfG, NJW 1990, S. 1783 (1783) für die Frage der Grundrechtsfähigkeit Juristischer Personen des Privatrechts dahingestellt, „ob die Leistungserbringung der Bf. in anderen Bereichen . . . einer anderen Beurteilung zugänglich wäre“. 82
114
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
bleibt die gemischtwirtschaftliche Gesellschaft Zurechnungsendsubjekt und Juristische Person des Privatrechts. Ihre Entscheidungen, die nicht in Ausübung einer Wahrnehmungszuständigkeit getroffen werden, werden der Juristischen Person des Privatrechts, also der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft als eigene, private Entscheidungen zugerechnet.87 Die Gesellschaft ist insoweit Privater. Die in dem Unternehmen entscheidenden Menschen entscheiden und handeln relativ mit Wirkung für ein privates Rechtssubjekt. Das Unternehmen selbst ist lediglich organisatorisches Substrat. Nach dem vorstehend Gesagten kann die zu Beginn der Untersuchung genannte Definition gemischtwirtschaftlicher Unternehmen als solche Unternehmen, auf deren Entscheidungen sowohl staatliche als auch private Rechtssubjekte Einfluß ausüben können, erweitert werden: Ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen ist eine organisatorische Einheit in Privatrechtsform, die in der Regel sowohl staatliche als auch private Entscheidungen trifft.88
C. Ergebnis Der normative Ansatz geht davon aus, daß staatliche Einheiten Rechtskonstrukte sind, welche durch die an sie adressierten Zuständigkeitsrechtssätze konstituiert werden. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist also insoweit Juristische Person des öffentlichen Rechts, wie sie Adressat einer Eigenzuständigkeit ist. Auch der innerorganisatorische Aufbau einer Juristischen Person des öffentlichen Rechts kann rein rechtlich konstruiert werden. Die Zuständigkeitskomplexe schalten andere Rechtssubjekte als Untereinheiten in die Aufgabenwahrnehmung ein. Diese Untereinheiten sind ihrerseits Adressaten der Zuständigkeitsrechtssätze, wenn und soweit sie als Organe „als und für“ das sogenannte Zurechnungsendsubjekt entscheiden. Eine Untereinheit ist Organ, wenn und soweit sie durch Zuweisung einer Zuständigkeit zur transitorischen Wahrnehmung einer Eigenzuständigkeit einer Juristischen Person verpflichtet ist. Als Organ des jeweiligen staatlichen Zurechnungsendsubjektes ist dieses Rechtssubjekt zugleich Adressat aller sonstigen für das Zurechnungsendsubjekt geltenden Rechtssätze. Verpflichtungsrechtssubjekt einer Wahrnehmungszuständigkeit ist eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft also dann, wenn und soweit sie zur Wahrneh87 Wie diese Zurechnung von privaten Rechten und Pflichten zur Juristischen Person privatrechtlich konstruiert wird, soll hier nicht untersucht werden. 88 Eine Ausnahme liegt lediglich dann vor, wenn die Gesellschaft ausschließlich als Zuständigkeitskomplex konstituiert wurde und außerhalb der Zuständigkeitsverpflichtung keinen weiteren (privaten) Verpflichtungen und Berechtigungen unterliegt. In diesem Fall trifft das Unternehmen lediglich staatliche Entscheidungen.
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
115
mung einer Aufgabe als und für89 eine staatliche Einheit verpflichtet wird. Relativ, d. h. soweit diese Wahrnehmungsverpflichtung reicht, sind die Entscheidungen des jeweiligen Unternehmens in Ausübung der Wahrnehmungszuständigkeit „staatliche“ Entscheidungen. Die Gesellschaft ist insoweit Organ und deshalb staatliches Zurechnungssubjekt. Insoweit kann man die Gesellschaft als „staatlich“ bezeichnen. Damit ergibt sich als Folge des normativen Ansatzes eine Erweiterung der Definition gemischtwirtschaftlicher Unternehmen: Gemischtwirtschaftliche Unternehmen sind Unternehmen, die in der Regel sowohl staatliche als auch private Entscheidungen treffen. Dritter Abschnitt
Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten Im folgenden ist zu untersuchen, ob und inwieweit im Einzelfall nachgewiesen werden kann, daß gemischtwirtschaftliche Gesellschaften Träger von materiellrechtlichen Eigen- oder organisationsrechtlichen Wahrnehmungszuständigkeiten sind. Eigen- und Wahrnehmungszuständigkeiten unterscheiden sich in ihrem Verpflichtungsgehalt. Eigenzuständigkeiten verpflichten ein Zurechnungsendsubjekt zum Treffen bestimmter Entscheidungen, Wahrnehmungszuständigkeiten verpflichten ein Organ zum Treffen von Entscheidungen „als und für“ ein Zurechnungsendsubjekt. Gemeinsam ist beiden Zuständigkeiten allerdings, daß sie ein Rechtssubjekt dazu verpflichten, Entscheidungen „als staatliches Rechtssubjekt“ zu treffen. Deshalb bietet es sich an, im folgenden zusammengefaßt zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen gemischtwirtschaftliche Gesellschaften Träger von Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeiten sind. Soweit im folgenden allgemein von „Zuständigkeiten“ die Rede ist, sind (materiellrechtliche) Eigen- und (organisationsrechtliche) Wahrnehmungszuständigkeiten gemeint. Zuständigkeiten werden durch Rechtssatz zugewiesen.90 Fraglich ist, welche Rechtssätze Zuweisungen von Zuständigkeiten an gemischtwirtschaftliche Gesellschaften enthalten können. Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 15. Nach Hans J. Wolff, VerwR II3, § 74 III, S. 53 f. entsteht ein Organ abstrakt durch Bildung. „Es ist dies die Rechtsfolge organisatorischer Rechtssätze, welche generell oder speziell bestimmten, begrifflich bezeichneten und benannten Funktionssubjekten die Wahrnehmungszuständigkeit für mehr oder minder genau bestimmte Kompetenzen zuordnen; m. a. W.: Bildung eines Organs ist die Anordnung, daß ein Funktionssubjekt bestimmter Art bestehen soll“. Diese Anordnung kann durch „typusbestimmende Modellgesetze“ (Hans J. Wolff, a. a. O., § 74 III, S. 54) oder in sonstiger Rechtsform erfolgen, soweit nicht andere Rechtssätze entgegen stehen. Vgl. dazu auch ders., VerwR II3, § 72 I, S. 13 ff. („organisatorische Rechtssätze“); Remmert, Dienstleistungen, S. 199 („organisationsrechtliche Rechtssätze“); Fügemann, Zustän89 90
116
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Oben91 wurde bereits festgestellt, daß gemischtwirtschaftliche Gesellschaften mit einem Verwaltungsträger in vielfältigen Rechtsbeziehungen stehen. Es bietet sich also an, auf der Suche nach rechtlich zugewiesenen Zuständigkeiten auf diese Rechtsbeziehungen abzustellen. So enthalten möglicherweise die zwischen Verwaltungsträgern und Privatrechtssubjekten vereinbarten Gesellschaftsverträge Zuständigkeitszuweisungen durch den jeweiligen Verwaltungsträger. Auch ist es denkbar, daß die bereits erwähnten einzelvertraglichen Abreden zwischen Verwaltungsträger und gemischtwirtschaftlicher Gesellschaft Zuständigkeitszuweisungen an ein staatliches Zurechnungsendsubjekt enthalten. Diese gesellschaftsvertraglichen und einzelvertraglichen Abreden zwischen staatlichen Rechtssubjekten und Gesellschaften des Privatrechts bzw. deren Anteilseignern sind also im folgenden dahingehend zu untersuchen, ob sie die Zuweisung von Zuständigkeiten an ein staatliches Zurechnungsendsubjekt enthalten, das hinsichtlich seiner Binnenorganisation rechtlich zumindest teilidentisch sein kann mit dem gesellschaftsvertraglichen Rechtskonstrukt. Möglicherweise ist also „die Gesellschaft“ Zurechnungssubjekt einer gesellschafts- oder einzelvertraglich zugewiesenen Zuständigkeit. Nicht ausgeschlossen ist es, daß einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft auch durch andere Rechtssätze als durch vertragliche Erklärungen materiellrechtliche oder organisationsrechtliche Zuständigkeiten zugewiesen werden können. Die Festlegung gegenseitiger Rechte und Pflichten zwischen Verwaltungsträger und Privatrechtssubjekt erfolgt allerdings in den beschriebenen Fällen in erster Linie und in der Praxis in zunehmendem Maß durch Vertrag.92 Es bietet sich also an, diese Vertragsbeziehungen auf Zuständigkeitszuweisungen hin zu untersuchen. Es stellt sich damit zunächst die Frage, ob vertragliche Abreden unabhängig von ihrer Ausgestaltung im Einzelfall Zuständigkeitszuweisungen enthalten können und wenn ja, wie das Vorliegen solcher Zuständigkeitszuweisungen im Einzelfall ermittelt werden kann. Die für diese Untersuchung interessierenden Verträge sind das Ergebnis einer Einigung zwischen einem oder mehreren staatlichen Rechtssubjekten und einem oder mehreren privaten Rechtssubjekten. Sie sollen im folgenden „Verwaltungsverträge“ genannt werden.93 Der folgenden digkeit, S. 10 („Zuweisungen durch Rechtssätze“); Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 110 („Organisationsakte“). Vgl. auch Erichsen, in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 15 I 2, Rn. 5 ff. 91 Einleitung, S. 24. 92 Vgl. dazu Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 339 (346 f.). 93 Diejenigen Verträge, an denen ein privatrechtliches und ein staatliches Rechtssubjekt beteiligt sind, werden verbreitet Verwaltungsverträge genannt [vgl. nur Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (137)]. Dies können sowohl privatrechtliche Verträge als auch öffentlich-rechtliche Verträge im Sinn von § 54 VwVfGe sein.
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
117
Untersuchung wird als ein vereinfachtes Modell ein Verwaltungsvertrag zwischen lediglich einem staatlichen und einem privaten Rechtssubjekt zugrunde gelegt.
A. Vertragliche Zuweisungen von Zuständigkeiten Wenn Zuständigkeiten durch Rechtssatz zugewiesen werden,94 dann enthalten Verträge Zuständigkeitszuweisungen, wenn und soweit sie entsprechende Rechtssätze enthalten und die Rechtsordnung einer solchen Zuständigkeitszuweisung durch Vertrag im Einzelfall nicht entgegen steht.95 Rechtssätze sind die sprachliche Form von Regelungen.96 Regelungen verknüpfen einen Tatbestand mit einer Rechtsfolge. Ein Rechtssatz ist also sprachlicher Ausdruck der Zuordnung einer Rechtsfolge zu einem Tatbestand.97 Ein Zuständigkeitsrechtssatz enthält die Regelung, wonach an den Sachverhalt eines bestimmten Rechtssubjekts die Verpflichtung geknüpft wird, bestimmte EntDie Abgrenzung ist nicht Gegenstand dieser Untersuchung [vgl. dazu nur Krebs, a. a. O., S. 163 ff., insbes. S. 167 m. Fn. 450; Eberhard, Verwaltungsrechtlicher Vertrag, S. 124 ff.; Schlette, Verwaltung als Vertragspartner, S. 110 ff.]. Die nachfolgenden Ausführungen gelten jedenfalls auch für den öffentlich-rechtlichen Vertrag. 94 s. oben S. 115, Fn. 90. 95 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 74 I, S. 45 weist an dieser Stelle darauf hin, daß ein Organ „ein durch organisatorische Rechtssätze (vgl. dazu oben Fn. 90, Anm. d. Verf.) oder ermächtigten Einzelakt gebildetes . . . Subjekt von Zuständigkeiten . . .“ sei. Es gibt also Rechtssätze, die im Einzelfall eine bestimmte rechtliche Form der organisatorischen Anordnung vorgeben. Dies ist insbesondere eine Frage der Abgrenzung der parlamentarischen von der exekutivischen Organisationsgewalt. So wird verbreitet davon ausgegangen, daß alle „wesentlichen“ Organisationsregelungen durch den Gesetzgeber zu treffen seien (sog. institutioneller Vorbehalt des Gesetzes). Vgl. dazu nur BVerfGE 33, S. 125 (158); 40, S. 237 (248 ff.); 49, S. 89 (126); Burmeister, Institutioneller Gesetzesvorbehalt, S. 1 ff.; Böckenförde, Organisationsgewalt, S. 95 ff.; Köttgen, VVDStRL 16 (1958), S. 154 (161 ff.); Loeser, System II, § 10, Rn. 24; ders., System I, § 7, Rn. 32 ff. So sollen z. B. Organisationsmaßnahmen, „die den Gesamtaufbau, die politisch-soziale Grundordnung des Gemeinwesens . . . betreffen“, und „jede Art der Ausgliederung von Selbstverwaltungs- und Autonomiebereichen aus der Verwaltungshierarchie“ (Böckenförde, a. a. O., S. 96), also auch die Übertragung von Eigenzuständigkeiten auf Privatrechtssubjekte, einer gesetzlichen Regelung bedürfen (zum Vorbehalt des Gesetzes im Fall der Beleihung vgl. nur Stober, in: Hans J. Wolff/ Bachof/ders., VerwR III5, § 90 VI 4, Rn. 44). Die Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten an ein Privatrechtssubjekt wird man daher nicht als eine die Grundstruktur der Verwaltungsorganisation betreffende Regelung ansehen können. Die Landesverfassungen statuieren – im Gegensatz zum Grundgesetz – verbreitet einen allgemeinen institutionellen Vorbehalt des Gesetzes, z. B. Art. 70 BWVerf.; Art. 77 NrWVerf.; Art. 77 BayVerf.; Art. 43 NdsVerf. Die Vorschriften des VIII. Abschnittes des Grundgesetzes normieren lediglich einzelne institutionelle Gesetzesvorbehalte (z. B. Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG). 96 Larenz, Methodenlehre, S. 250; Hans J. Wolff, VerwR I8, § 36 II, S. 242. 97 Larenz, Methodenlehre, S. 251; Engisch, Einführung, S. 18.
118
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
scheidungen nach in der Regel bestimmten Vorgaben zu treffen.98 Ein Vertrag zwischen einem Privatrechtssubjekt und einem Verwaltungsträger muß also einen entsprechenden Zuweisungs-Rechtssatz enthalten. Teilweise wird davon ausgegangen, daß Regelungen und Rechtssätze das Ergebnis eines staatlichen Rechtssetzungsaktes seien. Danach enthielten private Rechtsgeschäfte keine Rechtssätze, weil „dem privatautonomen Akt die materiale Qualifikation des Rechts“99 fehle. Privatautonome Gestaltung werde lediglich durch die Rechtsordnung anerkannt und gelte wie ein Rechtssatz.100 Diese Frage kann hier aber dahingestellt bleiben. Zuständigkeiten jedenfalls werden durch staatlichen Rechtssatz zugewiesen.101 Sie sind das Ergebnis einer innerstaatlichen Aufgabenverteilung.102 Das Zugewiesensein einer Zuständigkeit ist deshalb notwendig Folge einer staatlichen Erklärung. Eine vertragliche Erklärung muß daher eine staatliche Erklärung enthalten, an welche die Rechtsfolge des Bestehens einer Zuständigkeitsverpflichtung geknüpft ist. Zu untersuchen bleibt daher, wie man sich eine solche staatliche Regelung durch Verwaltungsvertrag zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privatrechtssubjekt rechtskonstruktiv vorzustellen hat. I. Staatliche Erklärung Eine staatliche Erklärung liegt zum einen jedenfalls in der Erklärung des jeweiligen Verwaltungsträgers zum Abschluß eines Gesellschaftsvertrages oder einer einzelvertraglichen Abrede. Zum anderen könnte eine solche staatliche Erklärung auch in der vertraglichen Einigung zwischen Verwaltungsträger und dem jeweiligen Privatrechtssubjekt, d. h. privaten Gesellschaftern oder einer Ge98 Ein Zuständigkeitsrechtssatz verpflichtet ein bestimmtes Rechtssubjekt. Die reale Organisation eines Rechtssubjektes ist demgegenüber kein Sachverhalt, an den die Zuständigkeit anknüpft. Der Begriff z. B. der „Gemeinde“ in einem Zuständigkeitsrechtssatz muß notwendig ein Rechtssubjekt meinen. Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 28 f. Tatbestandlicher Anknüpfungspunkt eines Zuständigkeitsrechtssatzes ist also jedenfalls dieses Rechtssubjekt. Das Rechtssubjekt selbst ist allerdings erst existent als rechtstechnischer, gedanklicher Zuständigkeitskomplex. Die Verpflichtung eines Rechtssubjektes und dessen rechtliche Existenz fallen deshalb – zumindest in der Regel – in eins. 99 Flume, Bürgerliches Recht II, S. 6. Vgl. auch Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (205). 100 Flume, Bürgerliches Recht II, S. 6. Larenz, Methodenlehre, S. 258 weist darauf hin, daß sich die schuldvertragstypischen Pflichten „aus dem Inhalt des konkreten Vertrages in Verbindung mit dem Rechtssatz, daß verpflichtende Verträge grundsätzlich rechtsverbindlich sind, ergeben“. 101 Davon gehen z. B. auch Fügemann, Zuständigkeit, S. 10 ff. und Zippelius, Allgemeine Staatslehre, S. 110 aus. Vgl. auch die Nachweise oben Zweiter Teil, S. 115, Fn. 90. 102 Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 I, S. 12 f.; Fügemann, Zuständigkeit, S. 5, 10.
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
119
sellschaft des Privatrechts mit privaten Anteilseignern zu sehen sein. Diese Einigung erfolgt durch Abgabe und Annahme der korrespondierenden Erklärungen des staatlichen und privatrechtlichen Rechtssubjektes.103 Die Einigung beinhaltet damit weder eine nur staatliche oder nur private Erklärung, sie beinhaltet vielmehr eine eigene, „dritte“ gemischt staatlich-private Erklärung. Es stellt sich damit die Frage, ob und inwiefern diese gemischt staatlich-private Entscheidung die Zuweisung einer Zuständigkeit durch Erklärung eines staatlichen Rechtssubjektes beinhalten kann. Möglicherweise kann eine vertragliche Einigung als eine staatliche Erklärung behandelt werden, wenn die Erklärung des jeweiligen Privatrechtssubjektes sich inhaltlich der Erklärung des staatlichen Rechtssubjektes unterordnet. Auch in diesem Fall ist die Einigung Ergebnis zweier gleichwertiger Erklärungen,104 sie ist allerdings inhaltlich identisch mit einer staatlichen Erklärung. Dies rechtfertigt es, eine solche vertragliche Erklärung als jedenfalls auch staatliche Erklärung anzusehen. Eine solche inhaltliche Übereinstimmung der Erklärungen des jeweiligen Verwaltungsträgers und des Privatrechtssubjektes setzt entsprechende Vertragsverhandlungen voraus, als deren Ergebnis die Erklärung des Privatrechtssubjekts als solche des staatlichen Rechtssubjektes erscheint und der Vertrag sich nur von der Rechtsform her von einer einseitigen staatlichen Erklärung unterscheidet. Auf das Vorliegen einer „überlegenen Verhandlungsposition“ des staatlichen Vertragspartners kommt es hierbei für die Beurteilung einer solchen inhaltlichen Übereinstimmung der vertraglichen Erklärungen allerdings nicht an.105 Als Zu103 Vgl. nur Schlette, Verwaltung als Vertragspartner, S. 441 zum Zustandekommen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages im Sinne von § 54 S. 1 VwVfGe; ebenso Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, S. 68; Krebs, VVDStRL 52 (1993), S. 248 (254). 104 Nach Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (185 f.) unterscheidet „die Besonderheit der vertraglichen Erklärung, die in der Gleichwertigkeit der sie konstituierenden Erklärung der Vertragspartner liegt, den Vertrag grundsätzlich vom einseitigen hoheitlichen Handeln“. 105 Verbreitet wird darauf hingewiesen, daß Vertragsverhandlungen zwischen Staat und Privatrechtssubjekten mit zumindest privater Beteiligung Folge wechselseitiger Interessen und zumeist auch Ausdruck verschiedener, nicht notwendig gleichberechtigter Machtpositionen seien. Vgl. dazu nur Schlette, Verwaltung als Vertragspartner, S. 36 ff. m. w. N. In diesem Sinne auch Storr, DÖV 2005, S. 101 (103). Daß es überlegene Verhandlungspositionen des staatlichen Vertragspartners geben kann, wird z. B. diskutiert im Rahmen der Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen der grundrechtliche Gesetzesvorbehalt auf den Abschluß eines öffentlich-rechtlichen Vertrages anwendbar ist. Vgl. dazu nur Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (188 f.); Gurlit, Verwaltungsvertrag und Gesetz, S. 294 f. Auch die Regelung des § 56 VwVfGe zum Koppelungsverbot soll „der regelmäßig dominierenden Vertragsposition“ des staatlichen Vertragspartners Rechnung tragen (Krebs, a. a. O., S. 225, der zugleich darauf hinweist, daß „das Machtgefälle zwischen den Vertragspartnern im Einzelfall auch umgekehrt verlaufen kann“). Differenzierend auch Kunig/Rublack, Jura 1980, S. 1 (4).
120
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
ständigkeitsrechtssubjekt ist der jeweilige Verwaltungsträger vielmehr auch als Vertragspartner verpflichtet, seine Zuständigkeiten zu erfüllen.106 Die vertragliche Einigung darf nur das enthalten, was der Verwaltungsträger erklären darf. Er ist verpflichtet, bestimmte Entscheidungen nach bestimmten Entscheidungsvorgaben zu treffen. Ein „ausgehandelter Vertrag“,107 dessen Inhalt gegen die Rechtsbindungen des Verwaltungsträgers verstößt, ist zuständigkeitswidrig.108 Eine gemeinsame Erarbeitung von Entscheidungen und eine konsensuale Entscheidungsfindung kommt aus Sicht des jeweiligen Verwaltungsträgers rechtlich nicht in Betracht.109 Der staatliche Vertragspartner muß vielmehr darauf hinwirken, daß die Einigung inhaltlich Ausdruck seiner Zuständigkeitsverpflichtung ist.110 Geht man davon aus, daß der staatliche Vertragspartner im Zweifel seine Zuständigkeit erfüllt,111 dann muß man auch davon ausgehen, daß er im Einzelfall eine Verhandlungsposition herbeigeführt hat, die eine entsprechend zuständigkeitsgemäße Einigung zur Folge hat. Eine vertragliche Einigung zwischen einem staatlichen Rechtssubjekt und einem Privatrechtssubjekt kann also auch als staatliche Erklärung behandelt werden. II. Rechtsfolge Die Rechtsfolge eines Zuständigkeitsrechtssatzes, die Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes, ist Folge einer staatlichen Erklärung. Es stellt sich 106 Vgl. nur Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (229); Gurlit, Verwaltungsvertrag und Gesetz, S. 248 ff., 377 ff.; Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 3, 108; Kunig/Rublack, Jura 1990, S. 1 (7); Krebs, VVDStRL 52 (1992), S. 248 (256); ders., in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (130 f., 196 f.). 107 Vgl. dazu nur Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (123 f.), der fragt, „wie sich eine vertraglich ,ausgehandelte‘ Regelung mit der strikten Rechtsbindung des Staates . . . verträgt“. 108 Burmeister, VVDStRL 52 (1993), S. 190 (211 f.); Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ ders., Rechtsfragen, S. 120 (203). Vgl. auch Schmidt-Aßmann, in: FS Gelzer, S. 117 ff. Ein „Aushandeln statt Entscheiden“ verstößt nach Kunig/Rublack, Jura 1990, S. 1 (9) auch gegen das Demokratieprinzip. 109 Nach Schuppert, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel, S. 19 (37 ff.) sei der verhandelnde Staat allerdings „Realität“ (a. a. O., S. 39); ders., Verwaltungswissenschaft, S. 120 f. 110 Vgl. zur „staatlichen Letztverantwortlichkeit“ der Exekutive bei kooperativem Verwaltungshandeln Kunig/Rublack, Jura 1990, S. 1 (9): „Um staatliche Letztverantwortlichkeit zu gewährleisten, muß sich die Verwaltung einen Konsens als inhaltliche Entscheidung zu eigen machen“. Schwächer demgegenüber wohl Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 176 f., wonach eine „verwaltungsrechtliche Systematik“ kooperativen Verwaltungshandelns „um dessen rechtsförmige Strukturierung“ und „die Einpassung der Verhandlungsergebnisse in größere Entscheidungszusammenhänge“ bemüht sein soll. 111 Ausführlich zu dieser Vermutungsregel noch unten Zweiter Teil, S. 198 ff.
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
121
deshalb die Frage, ob und inwiefern sich die Rechtsfolge einer vertraglichen Erklärung zwischen einem staatlichen und einem privaten Rechtssubjekt auf eine staatliche Erklärung zurückführen läßt. Ein Vertrag entfaltet Rechtsfolgen, wenn er wirksam zustandegekommen ist.112 Das Eintreten der Rechtsfolge ist damit abhängig von der vertraglichen Zustimmung des privatrechtlichen Vertragspartners. Das Vorliegen einer staatlichen Regelung ist gebunden an das Vorliegen einer entsprechenden zumindest privat mitbestimmten Entscheidung. Es stellt sich deshalb die Frage, ob die Rechtsfolge „Zuständigkeitszuweisung“ auch konsensual herbeigeführt werden kann. Zuständigkeiten werden organisatorischen Einheiten grundsätzlich einseitig zugewiesen. Auf eine Zustimmung eines Privaten oder eine vertragliche Einigung kommt es für das Herbeiführen von Rechtsfolgen grundsätzlich nicht an.113 In verschiedenen staatlichen Entscheidungsbereichen finden sich allerdings Ausnahmen von diesem Grundsatz. So geht z. B. § 54 S. 2 VwVfGe für den öffentlich-rechtlichen Vertrag davon aus, daß der Staat Rechtsfolgen auch durch Vertrag begründen kann.114 Im Fall des sogenannten mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsaktes wird das Vorliegen einer staatlichen Regelung ebenfalls von Mitwirkungshandlungen Privater abhängig gemacht.115 Dies spricht dafür, daß der Staat, soweit eine dementsprechende Zuständigkeit vorliegt und einfaches Recht oder Verfassungsrecht dem nicht entgegenstehen, jedenfalls116 Rechtsfolgen zusammen mit Privaten vertraglich setzen kann. Die Zuständigkeitszuweisung bleibt dabei tatbestandlich staatliche Erklärung. Nur die Rechtsfolge tritt nicht ipso iure, sondern erst mit dem wirksamen Vertragsschluß ein. Die staatliche Entscheidung wird erst im Zusammenwirken mit dem Privaten rechtsverbindlich.117 Das Einvernehmen mit dem Privaten bildet also den Geltungsgrund der vertraglichen Regelung.118 Nur insofern ist der Private „mitgestaltender Partner“.119 112
Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (204). Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (374 ff.), der darauf hinweist, daß sich aus der Verfassung die Notwendigkeit einer Mitentscheidung Betroffener nicht ableiten läßt; ders., DVBl. 1989, S. 533 (539). Ebenso Schmitt Glaeser, VVDStRL 31 (1973), S. 179 ff., 240 ff. Vgl. dazu auch schon oben S. 67, Fn. 206. 114 Vgl. dazu nur Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 1 f. 115 Vgl. dazu nur Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR II6, § 46 X 1, Rn. 31 ff. 116 Nicht dagegen den Tatbestand einer Regelung. Siehe dazu vorstehend S. 119 ff. 117 Krebs, VVDStRL 52 (1993), S. 248 (256 f.). 118 So ausdrücklich Schmidt-Aßmann, AöR 116 (1991), S. 329 (375). Vgl. auch Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 2. 119 So allgemein Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 2. 113
122
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Eine vertragliche Zuständigkeitszuweisung kann also z. B. in der Erklärung des Verwaltungsträgers liegen, daß eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft bestimmte Entscheidungen „als und für“ den Verwaltungsträger zu treffen hat. Die Rechtsfolge, also die Verpflichtung aus der Wahrnehmungszuständigkeit, tritt erst dann ein, wenn sich der Verwaltungsträger und das Privatrechtssubjekt über das Bestehen einer solchen Verpflichtung wirksam vertraglich geeinigt haben. Entsprechendes gilt für die Zuweisung einer Eigenzuständigkeit. Verweigert der Private die Abgabe seiner Willenserklärung zum Vertragsschluß, dann verweigert er nicht etwa eine Zustimmung zu einer Zuständigkeitszuweisung, sondern verhindert den Eintritt der Rechtsfolge einer staatlichen Erklärung.120 III. Zwischenergebnis Es läßt sich feststellen, daß Verträge zwischen staatlichen und privatrechtlichen Rechtssubjekten die Zuweisung einer Zuständigkeit an eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft enthalten können. Ein wirksamer Vertrag zwischen einem staatlichen und einem privatrechtlichen Rechtssubjekt kann eine staatliche Regelung enthalten.121 Die Rechtsfolge – die Verpflichtung – tritt erst dann ein, wenn sich der Verwaltungsträger und sein Vertragspartner über das Bestehen einer solchen Zuständigkeitszuweisung wirksam geeinigt haben. Daher kommt es darauf an, nach welchen Kriterien Gesellschaftsverträge gemischtwirtschaftlicher Unternehmen und einzelvertragliche Abreden zwischen einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft und einem Verwaltungsträger auf ihren Zuweisungsgehalt hin zu untersuchen sind.
B. Auslegung der vertraglichen Bestimmungen Eine ausdrückliche Zuweisung einer Eigenzuständigkeit an eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft kann z. B. folgendermaßen lauten: „Zuständig für die Entsorgung von Abfall im Kreis . . . ist die . . . GmbH. Sie entscheidet und handelt insoweit als Juristische Person des öffentlichen Rechts“.122 120 Die Abhängigkeit des Eintritts der Rechtsfolge von der Zustimmung eines Privaten ist kein Spezifikum des Vertrages. Auch der Eintritt der Rechtsfolgen von Verwaltungsakten kann von der Zustimmung eines Privaten abhängig gemacht werden. Zum sogenannten „mitwirkungsbedürftigen“ bzw. „zustimmungsbedürftigen“ Verwaltungsakt vgl. nur oben S. 121, Fn. 115. 121 Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 120 (204 f.) m. w. N. in Fn. 570: „Wirksame Verträge sind – wie Verwaltungsakte – rechtsverbindliche Einzelfallregelungen“ (a. a. O., S. 204). 122 Zur sprachlichen Abbreviation dieses Satzes vgl. oben S. 110 f. Die GmbH als Juristische Person des Privatrechts ist nicht „Träger“ einer Zuständigkeit. Durch die Zuständigkeitszuweisung an eine bereits bestehende Juristische Person des Privatrechts wird vielmehr ein Zuständigkeitskomplex konstituiert, der rechtlich von der bereits
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
123
Eine ausdrückliche Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung durch Vertrag kann folgendermaßen lauten: „Das Unternehmen entscheidet und handelt im Bereich der Abfallentsorgung als Organ der Gemeinde . . . / des Kreises . . .“.123 Denkbar ist auch folgende Formulierung: „Das Unternehmen entscheidet und handelt als und für die Gemeinde . . . / den Kreis . . .“.124 Eine solche Zuständigkeitszuweisung erfolgt – soweit ersichtlich125 – in den allermeisten Fällen nicht ausdrücklich. Eine ausdrückliche Zuordnung eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens in den Bereich des Staatlichen wird in der Regel von den Vertragsparteien vermieden werden.126 Diese erstreben als Folge einer „Privatisierung“ eine mehr oder weniger umfangreiche Ausgliederung des jeweiligen Entscheidungsbereiches aus dem Bereich staatlicher Verwaltung.127 Die privatrechtliche Organisationsform soll die als vorteilhaft eingeschätzte „privatrechtliche Handlungsrationalität“ 128 umsetzen und nutzen. Ausdrückliche Zuständigkeitszuweisungen könnten diesen erstrebten – möglicherweise nur psychologischen129 – Effekten zuwiderlaufen.130
existierenden Juristischen Person des Privatrechts zu unterscheiden ist. Beide verfügen allerdings über dieselbe Organisation, die Anknüpfungspunkt für z. B. gesellschaftsvertragliche Rechtsfolgen ist. 123 Auch dieser Satz soll verkürzt ausdrücken, daß das Unternehmen der Tatbestand ist, an den eine organisationsrechtliche Wahrnehmungszuständigkeit ihre Rechtsfolge knüpft. Organ im normativen Sinn ist nicht das Unternehmen, sondern das gedankliche rechtstechnische Zurechnungsendsubjekt der Wahrnehmungszuständigkeit. 124 In diesem Fall wird lediglich das Ergebnis der Begründung eines Wahrnehmungszuständigkeitskomplexes beschrieben. Als Folge dieser Zuständigkeitszuweisung sind die im Unternehmen getroffenen Entscheidungen solche des Zurechnungsendsubjektes, d. h. des vertragsschließenden Verwaltungsträgers. Das Unternehmen selbst ist lediglich organisatorischer Apparat. 125 Zu dem der Untersuchung zugrundegelegten Tatsachenmaterial vgl. sogleich unten S. 128, Fn. 157. 126 Darauf, daß eine gesellschaftsvertragliche Fixierung konkreter Zielvorgaben in der Regel von den Vertragsparteien vermieden wird, wurde bereits oben Erster Teil, S. 47 ff. hingewiesen. 127 Zu den Privatisierungsmotiven siehe oben Erster Teil, Fn. 34, 179, 180. 128 Dafür, daß die Einschaltung Privater in die staatliche Aufgabenwahrnehmung entsprechende Effekte besitzen kann, Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 339; ders., NVwZ 2001, S. 601 (602); ebenso z. B. Trute, DVBl. 1996, S. 950 (956); Storr, DÖV 2005, S. 201 (203). Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 108 nennt als Beispiel möglicher „Synergieeffekte“: „Ortskunde und Verwaltungskompetenz der Kommunen, Markterfahrung und Kapital Privater“. Nach Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 (187) lassen sich die „vielfach . . . beschworenen Synergien . . . nur selten quantitativ nachweisen“. 129 Darauf, daß „atmosphärische und psychologische Gründe maßgebend“ für eine Privatisierungsentscheidung sein können, weisen z. B. Schink, in: Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen, S. 5 (17); ders., VerwArch 85 (1994), S. 251 (267); Loeser, Rechtsformen, S. 25 f. hin. Loeser, a. a. O., S. 25 nennt „mit bestimmten Organisationsformen verbundene(n) Renommee-Defizit(e)“.
124
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Vertragliche Abreden müssen deshalb in der Mehrzahl der Fälle dahingehend auszulegen sein, ob und inwieweit sich die Vertragsparteien über die Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit an die jeweilige gemischtwirtschaftliche Gesellschaft geeinigt haben. Die Frage nach der Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft im Einzelfall läßt sich also nicht anders klären als durch Auslegung der die jeweilige privatrechtsförmige Organisationseinheit konstituierenden Rechtssätze.131 Es ist daher im folgenden zu prüfen, nach welchen Regeln diese vertraglichen Erklärungen auszulegen sind.132 I. Keine Anwendbarkeit der §§ 133, 157 BGB Ausdrückliche Regelungen über die Auslegung von Verträgen zwischen einem staatlichen Rechtssubjekt und einem Privaten existieren nicht.133 Für öffentlich-rechtliche Verträge zwischen staatlichen und privaten Einheiten im Sinne von § 54 VwVfGe enthalten die §§ 54 ff. VwVfGe ebenfalls keine ausdrücklichen Regelungen, § 62 S. 2 VwVfGe erklärt die Vorschriften des Bürgerlichen Rechts für entsprechend anwendbar. Auslegungsregeln für Verträge nach dem Bürgerlichen Recht finden sich in den §§ 133, 157 BGB. Möglicherweise sind die §§ 133, 157 BGB entsprechend anwendbar auf die Auslegung von Verwaltungsverträgen.134 Ob es sich bei den vertraglichen Ausgestaltungen zwischen Verwaltungsträger und Privatrechtssubjekt um öffentlich-rechtliche Verträge handelt, kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben, wenn die §§ 133, 157 BGB auf beide Vertragsformen gleichermaßen anwendbar bzw. unanwendbar sind. Gemäß § 133 ist bei der Auslegung einer Willenserklärung „der wirkliche Wille zu erforschen“.135 § 133 BGB knüpft also an den Tatbestand einer Wil130 Vgl. dazu Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (323 ff.), der auf ein „privatwirtschaftliches Selbstverständnis öffentlicher Unternehmer“ hinweist. Die öffentliche Hand verändere ihr Selbstverständnis als rechtlich gebundene Verwaltung hin zum „Idealbild des privatwirtschaftlichen Managers“. Ebenso Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968), S. 277 (277 f.). 131 Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (156) weist darauf hin, daß sich die Grenze zwischen „Verwaltungspflicht“ und „überbürdeter Verwaltungsobliegenheit“ „nicht anders als durch Auslegung des die Bürgerpflichten statuierenden Gesetzes abklären“ lasse. 132 Vgl. dazu ausführlich de Wall, Anwendbarkeit, S. 132 ff.; Kluth, NVwZ 1990, S. 609 ff.; Erichsen, in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 22, Rn. 13 f. 133 So auch Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (608). 134 Die Anwendbarkeit von § 133 BGB auf die Auslegung von staatlichen Erklärungen ist verbreitet anerkannt. So etwa Erichsen, in: ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 22, Rn. 12; BVerwGE 88, S. 286 (292); BVerwG, NJW 1993, S. 2193 f.; NVwZ 1999, S. 178 (182) jeweils ohne nähere Begründungen. Zur Anwendbarkeit auf öffentlich-rechtliche Verträge vgl. nur Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 34.
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
125
lenserklärung an.136 Eine Willenserklärung ist die Äußerung eines auf die Herbeiführung einer Rechtswirkung gerichteten Willens.137 Fähig, einen Willen zu bilden, sind nur Menschen. Allein dies steht der Anwendbarkeit des § 133 BGB auf staatliche Rechtssubjekte nicht entgegen. So ist eine staatliche apersonale Einheit handlungs- und möglicherweise auch willensfähig aufgrund der ihr zugerechneten Handlungen und des Willens ihrer Organwalter. Der Begriff des „Willens“ beinhaltet allerdings darüber hinaus ein Moment der Freiwilligkeit und Autonomie. Eine solche Freiheit, über das Eingehen von Verbindlichkeiten und die Abgabe von sonstigen Willenserklärungen grundsätzlich frei zu entscheiden, ist – dies wurde oben138 bereits festgestellt – lediglich die Freiheit Privater. Dem Staat kommt sie nicht zu. Der Staat ist nicht nur verfassungsrechtlich konstituiert,139 er ist nach der hier vertretenen Ansicht140 auch einfachrechtlich konstituiert. Er ist nur insoweit rechtlich existent, wie es Rechtssätze gibt, die staatliche Verpflichtungen und Berechtigungen konstituieren. Dementsprechend ist staatliches Handeln und Entscheiden notwendig zuständigkeitsgebundenes Entscheiden. Einen privatautonomen staatlichen Willensentschluß kann es deshalb nicht geben. Der Begriff der „Willenserklärung“ ist daher zur Kennzeichnung staatlicher Entscheidungen nicht geeignet.141 Es gibt keine staatlichen Willenserklärungen, sondern nur rechtlich gebundene staatliche „Erklärungen“.142 Jedenfalls auf die staatliche Erklärung durch Vertrag ist § 133 BGB damit nicht anwendbar. Verträge zwischen einem staatlichen Rechtssubjekt und einem Privatrechtssubjekt können damit nicht gemäß §§ 133, 157 BGB ausgelegt werden.
135 Zur Ermittlung des wirklichen Willens und zum Verhältnis von § 133 BGB zu § 157 BGB und der objektiven Erklärungsbedeutung vgl. nur Heinrichs, in: Palandt, BGB, § 133, Rn. 7 m. w. N. 136 Darauf weist auch de Wall, Anwendbarkeit, S. 133 hin. 137 Heinrichs, in: Palandt, BGB, Einf v § 116, Rn. 1. 138 Erster Teil, S. 73, Fn. 243. 139 Vgl. nur Pietzcker, AöR 107 (1982), S. 61 (71) und die Nachweise oben Erster Teil, S. 92, Fn. 348. 140 Vgl. oben Zweiter Teil, S. 97, Fn. 6. 141 So aber der verbreitete Sprachgebrauch. Vgl. nur Koch, Status, S. 89 ff.; Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, S. 289 f.; Schlette, Verwaltung als Vertragspartner, S. 441 ff. 142 So wohl auch de Wall, Anwendbarkeit, S. 132 ff. (in der Überschrift S. 132). Auch die Tatsache, daß ein Amtswalter als natürliche Person einen „Willen“ hat, führt nicht dazu, daß dieser Wille rechtlich der apersonalen Einheit als eigener zugerechnet wird. I. E. ähnlich Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (610), wonach „der vielleicht tatsächlich auf ein rechtswidriges Ziel gerichtete Wille der Organwalter durch den gesetzesdirigierten Willen des Organs korrigiert“ werde.
126
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
II. Objektive Auslegung von Rechtssätzen Es stellt sich deshalb die Frage, nach welchen sonstigen Regeln eine solche Auslegung zu erfolgen hat. Hierfür ist es zunächst erforderlich, das Wesen gemischt staatlich-privater Verträge in Erinnerung zu rufen. Oben143 wurde festgestellt, daß wirksame Verträge zwischen staatlichen und privaten Rechtssubjekten staatliche Regelungen sind. Als solche haben sie „Rechtsquellencharakter“. 144 Sie sind ebenso wie Verwaltungsakte „Einzelfall-Rechtssetzung“.145 Wenn wirksame gemischt staatlich-private Verträge also Rechtssätze sind, dann müssen sie auch wie Rechtssätze ausgelegt werden. Da Rechtssätze objektiv ausgelegt werden,146 müssen auch die Verträge objektiv mit Hilfe der objektiven Auslegungskriterien der grammatikalischen, historisch-genetischen, systematischen und teleologischen Auslegung147 ausgelegt werden.148 Die Erklärungen der Vertragsparteien sind auf ihren objektiven Erklärungsgehalt und ihren „normative(n) Sinn“149 hin zu untersuchen. Auch wenn z. B. der mit Wirkung für die staatliche Einheit erklärende Amtswalter subjektiv etwas anderes erklären wollte, kommt es für die Auslegung nur darauf an, was er objektiv mit Wirkung für die staatliche Einheit erklärt hat. Dies gilt sowohl für einzelvertragliche Abreden also auch für Gesellschaftsverträge. In der gesellschaftsrechtlichen Literatur150 und Rechtsprechung151 wird darüber hinaus verbreitet von einer objektiven Auslegung von Gesellschaftsverträ143
S. 122, Fn. 121. Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 205. Vgl. auch Eberhard, Verwaltungsrechtlicher Vertrag, S. 102 ff., 274 ff. zur österreichischen Vertragsdogmatik und der Ansicht, der verwaltungsrechtliche Vertrag sei „unselbständige Rechtsquelle“. 145 Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen, S. 205. 146 Vgl. dazu nur Larenz, Methodenlehre, S. 312 ff., insbes. S. 316 ff., der zugleich darauf hinweist, daß die Regelungsabsicht der Gesetzgebers zu berücksichtigen sei und insoweit ein subjektives Auslegungselement vorliege. 147 Ausführlich dazu z. B. Larenz, Methodenlehre, S. 320 ff. 148 Dazu scheinen auch die Rechtsprechung und Teile der Literatur zu tendieren. Vgl. dazu m. w. N. Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht, 10.50, S. 1 ff. So seien die §§ 133, 157 BGB zwar anwendbar, die „typische Funktion des öffentlichen Rechts“ sei jedoch zu berücksichtigen. Öffentlichrechtliche Verträge seien deshalb so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte und das öffentliche Wohl dies erfordern [Hillermeier, a. a. O., S. 1 (1); Bernsdorff, in: Obermayer, VwVfG, § 62, Rn. 20, 43]. Bei der Auslegung behördlicher Willenserklärungen sei ein erhöhter Maßstab hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit anzulegen [RGZ 134, S. 162 (166); Singer, in: Staudinger, BGB, §§ 133, Rn. 29]. 149 Larenz, Methodenlehre, S. 319. 150 Vgl. nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I, S. 77, 87 ff. m. w. N.; Emmerich, in: Scholz, GmbH-Gesetz, § 2, Rn. 33 ff.; Ulmer, in: Hachenburg, GmbHG, § 2, Rn. 138 ff.; Grunewald, Gesellschaftsrecht, S. 323 f. in bezug auf die Gesellschaftsverträge von Gesellschaften mit beschränkter Haftung. 144
3. Abschn.: Vertraglich zugewiesene Zuständigkeiten
127
gen ausgegangen. Dies wird mit dem Wesen des Gesellschaftsvertrages als Verbandsverfassung begründet. Diese Verbandsverfassung sei wie objektives Recht zu behandeln152 und dementsprechend auszulegen. Ein Gesellschaftsvertrag sei also, jedenfalls soweit er „körperschaftliche“, überindividuelle Regelungen enthalte,153 objektiv auszulegen. Nach dem vorstehend Gesagten sind deshalb Verwaltungsverträge wie Rechtssätze objektiv auszulegen.
C. Möglichkeit gesellschaftsrechtswidriger Auslegungsergebnisse Möglicherweise verstößt die Deutung gesellschafts- und einzelvertraglicher Bestimmungen als Regelungen über die Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit gegen Rechtssätze des Gesellschaftsrechts. So ist es zum einen denkbar, daß die Vorschriften des Gesellschaftsrechts nur auf privatautonom entscheidende Rechtssubjekte, nicht dagegen auf Zuständigkeitskomplexe im vorstehend erörterten Sinn anwendbar sind. Geht man demgegenüber davon aus, daß die Regelungen des Gesellschaftsrechts auf staatliche Rechtssubjekte jedenfalls nicht von vornherein unanwendbar sind,154 bleibt dennoch zu untersuchen, ob einzelne Rechtssätze des Gesellschaftsrechts im Einzelfall auf rechtlich gebundene staatliche Rechtssubjekte nicht angewendet werden können. Es ist z. B. fraglich, ob Gesellschaftsorgane aus Sicht des Gesellschaftsrechts im Fall einer Zuständigkeitszuweisung an die Gesellschaft (Unter-) Organe eines Verwaltungsträgers sein können oder ob das Gesellschaftsrecht einer solchen organschaftlichen Stellung z. B. des Vorstandes oder des Aufsichtsrates entgegensteht. Ebenso fraglich erscheint es aus Sicht des Gesellschaftsrechts, das in den Aufsichtsrat gewählte oder entsandte Aufsichtsratsmit151 St. Rspr. RGZ 159, S. 272 (278); 159, S. 321 (326); 164, S. 129 (140); 165, S. 68 (73); fortgeführt durch BGHZ 14, S. 25 (36 f.); BGH, NJW 1973, S. 1039 (1040); NJW 1983, S. 1910 (1911). 152 Sogenannte (modifizierte) Normentheorie. Vgl. dazu nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 I, S. 77 mit Verweis in Fn. 13 auf Otto v. Gierke, Deutsches Privatrecht I, 1895 (Nachdruck 1936), S. 142 ff. und w. N. in Fn. 14. Im Gegensatz dazu geht die sogenannte Vertragstheorie davon aus, daß ein Gesellschaftsvertrag nur eine Variante eines normalen, subjektiv auszulegenden Vertrages sei. Vgl. dazu K. Schmidt, a. a. O., m. w. N. in Fn. 12. 153 Vgl. dazu die Nachweise vorstehend Fn. 150. Ein Gegenbeispiel zu einer „individualrechtlichen Vereinbarung“ in einem Gesellschaftsvertrag findet sich in BGH, WM 1955, S. 65 (66 f.). 154 Davon wird ganz verbreitet ausgegangen. Vgl. nur z. B. die Nachweise zur Eignung gesellschaftsrechtlicher Steuerungsinstrumente zur Begründung einer staatlichen Entscheidungsherrschaft oben Zweiter Teil, S. 37 ff. Ginge man von der Unanwendbarkeit der gesellschaftsrechtlichen Regelungen aus, dann wäre die Prämisse beseitigt, daß es gemischtwirtschaftliche Unternehmen gibt.
128
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
glied als Amtswalter der jeweiligen Gebietskörperschaft anzusehen.155 Das Aufsichtsratsmitglied ist in diesem Fall möglicherweise Walter von zwei verschiedenen Ämtern, d. h. zum einen des Aufsichtsrates der Gesellschaft und zum anderen des kommunalrechtlich statuierten Amtes. Diese Fragen werden hier nur angedeutet und sollen in dem hier gesetzten Rahmen nicht untersucht werden. Die Beantwortung der Frage ist auch abhängig davon, ob man das Gesellschaftsrecht als lediglich „rechtstechnisches Organisationsrecht“ oder als Regelungen mit einem eigenen „materialen Gehalt“156 begreift. Ob eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft im Einzelfall Zuordnungssubjekt einer Zuständigkeit ist, bleibt von der gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer solchen Zuweisung unberührt. Vierter Abschnitt
Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand Nachfolgend sollen typische Vertragsklauseln in gesellschafts- und einzelvertraglichen Absprachen zwischen Verwaltungsträgern und Privatrechtssubjekten in der beschriebenen Weise ausgelegt werden.157 Die Untersuchung konzentriert sich hierbei auf die Auswertung von Gesellschaftsverträgen und schuldrechtlichen Nebenabreden der in der Praxis sehr verbreiteten gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften auf kommunaler Ebene.158 Insbesondere kommunale Gebietskör155
Darauf weist auch Krebs, in: Ehlers/ders., Grundfragen, S. 41 (49 f.) hin. Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 68 ff. So ist es z. B. in der gesellschaftsrechtlichen Literatur umstritten, ob das Aktienkonzernrecht der §§ 15 ff. AktG ein rechtstechnisches Organisationsrecht oder prinzipienbehaftetes Schutzrecht darstellt. Vgl. dazu z. B. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 17 II, S. 491 ff. m. w. N. Von dem Aktienkonzernrecht als „Organisationsrecht“ gehen z. B. Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften, § 50, Rn. 13 aus. 157 Beispiele finden sich in Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung I–IV; BMWA (Hrsg.), Public Private Partnership, insbes. S. 23 ff.; BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 1 ff.; Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht; Osthorst, De-Kommunalisierung, S. 7 ff.; UNI (Hrsg.), Staatliche Schuldenfalle, insbes. S. 14 ff.; Scheele, in: Blanke/Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung, S. 1 (insbes. 24 ff.); Schuppert, in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion, S. 141 ff.; ders., ZögU 8 (1985), S. 310 ff.; ders., Verwaltungskooperationsrecht, S. 1 ff.; Sterzel, in: Blanke/ Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung, S. 99 (insbes. 255 ff.); v. Trott zu Solz, Aktiengesellschaft, S. 37 ff. sowie zahlreiche Beispiele aus der Literatur zu speziellen Rechtsgebieten wie z. B. der Abfallentsorgung. Zu letzteren siehe unten Dritter Teil, S. 216 ff. 158 Vgl. dazu nur Ronellenfitsch, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 1, Rn. 17 ff., der darauf verweist, daß bereits in der Weimarer Republik eine ausufernde wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden konstatiert wurde (a. a. O., Rn. 18); ebenso Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, 156
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
129
perschaften lassen die traditionellen Sachbereiche der Leistungserbringung durch gemischtwirtschaftliche oder rein öffentliche Unternehmen erbringen. Dort finden sich insbesondere aufgrund der bereits oben159 erwähnten größeren Gestaltungsmöglichkeiten überwiegend Gesellschaften mit beschränkter Haftung.160 Dies rechtfertigt es, im folgenden aktienrechtliche Fallgestaltungen zu vernachlässigen. Eine rechtstatsächliche Auswertung einer Vielzahl von Verträgen bestimmter gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit kommunaler Beteiligung kann in dem hier gewählten Untersuchungsrahmen nicht vorgenommen werden.161 Die vorliegende Untersuchung wird daher nicht auf die Methoden einer empirischen Sozialforschung162 zurückgreifen, sondern lediglich exemplarisch die der Öffentlichkeit zugänglichen Vertragsmuster und Vertragsklauseln untersuchen, die in der kommunalen Praxis typischerweise verwendet werden.163 Darüber hinaus werden diejenigen praktischen Fallgestaltungen analysiert, die in den Sachverhaltsschilderungen von Rechtsprechung und Literatur erwähnt werden. Die Untersuchung dieser Vertragsklauseln und einzelner Sachverhaltsschilderungen läßt einen nur begrenzten Rückschluß auf die tatsächliche Praxis kommunaler Vertragsgestaltung zu. Ziel dieser Untersuchung kann deshalb keine Darstellung der Verwaltungspraxis gemischtwirtschaftlicher Unternehmen sein, sondern vielmehr das Aufzeigen typischer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Auslegung gesellschafts- und einzelvertraglicher Abreden. Dementsprechend kann auch eine Auslegung der Genese konkreter vertraglicher Bestimmungen in dem hier gewählten Rahmen nicht erfolgen. Die Untersuchung muß sich vielmehr auf die Auslegung nach dem Wortlaut, der Systematik und dem Sinn und Zweck typischer Formulierungen beschränken. Eine solche UntersuS. 30 ff.; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 14. Vgl. zur gegenwärtigen Bedeutung kommunaler Wirtschaftsteilnahme auch Ronellenfitsch, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 2, Rn. 12 f.; Schuppert, Verwaltungskooperationsrecht, S. 13 ff.; Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 17 ff.; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 15 f.; Storr, Staat, S. 28 ff. 159 Erster Teil, S. 45, Fn. 89, 90. 160 So z. B. Hellermann, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 7, Rn. 113 ff.; Püttner, in: ders. (Hrsg.), Reform, S. 143 (152). Auch aufgrund des aktienrechtlichen Mindestnennbetrages des Grundkapitals von fünfzigtausend Euro (§ 7 AktG) im Gegensatz zum Mindestbetrag des Stammkapitals von fünfundzwanzigtausend Euro (§ 5 Abs. 1 GmbHG) bietet sich die Rechtsform der GmbH für kleinere Gesellschaften auf kommunaler Ebene an. 161 Zu den praktischen Schwierigkeiten rechtstatsächlicher Forschungen und zu Methodenfragen vgl. nur Remmert, Dienstleistungen, S. 111 ff. 162 Vgl. zu deren Methoden z. B. Röhl, Rechtssoziologie, S. 105 ff. 163 Der Verf. liegen darüber hinaus Vertragsmuster einer auf die Beratung von Verwaltungsträgern im Rahmen von Privatisierungsprojekten spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei vor, die allerdings auf deren Wunsch hin in dieser Arbeit nicht zitiert werden.
130
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
chung kann in dem hier gewählten Rahmen nur exemplarisch erfolgen. Sie soll lediglich beispielhaft Auslegungsfragen aufzeigen und Lösungsansätze vorstellen. Zunächst sind typische Klauseln von Gesellschaftsverträgen gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften zu untersuchen. Die Auslegung der in der Praxis häufigen und bereits oben164 erwähnten einzelvertraglichen Absprachen erfolgt im Anschluß daran. Diese Reihenfolge ergibt sich nicht zuletzt daraus, daß in der Praxis häufig eine Kombination gesellschafts- und einzelvertraglicher Abreden im Rahmen des sogenannten Kooperationsmodells165 vorliegt. In diesem Fall wird zunächst zwischen einem oder mehreren Verwaltungsträgern und einem oder mehreren Privatrechtssubjekten ein Gesellschaftsvertrag über die Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft geschlossen. Diese Gesellschaft verpflichtet sich im Anschluß daran gegenüber dem Verwaltungsträger, bestimmte Leistungen zu erbringen. Der Suche nach Zuständigkeitszuweisungen sollen in diesen Fällen beide Vertragstypen zugrundegelegt werden. In der zeitlichen Reihenfolge der Vertragsabschlüsse im Rahmen des Kooperationsmodells sind zunächst typische gesellschaftsvertragliche Erklärungen auf ihren Zuweisungsgehalt hin zu untersuchen.
A. Typische gesellschaftsvertragliche Bestimmungen Typische gesellschaftsvertragliche Bestimmungen sind jedenfalls diejenigen, die das Gesetz als zwingende Bestimmungen voraussetzt. So enthalten Gesellschaftsverträge gemäß § 23 Abs. 3 AktG bzw. § 3 Abs. 1 GmbHG zwingend Bestimmungen z. B. über die Firma und den Sitz der Gesellschaft, den Gegenstand des Unternehmens und zum Betrag des Grund- bzw. Stammkapitals sowie der Zerlegung des Grundkapitals bzw. zum Betrag der Stammeinlage. Fraglich ist, welche dieser Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag die Zuweisung einer Zuständigkeit an ein gedankliches Zurechnungsendsubjekt enthalten können, dessen binnenorganisatorischer Aufbau sich zumindest auch nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen richtet. Es müssen vertragliche Bestimmungen sein, denen zumindest die Zuweisung einer Verpflichtung zu entnehmen ist. Oben166 wurde bereits festgestellt, daß der gesellschaftsvertraglich fixierte Unternehmensgegenstand nach verbreiteter Ansicht die Organe der Gesellschaft verpflichtet, bestimmte Entscheidungsmaßstäbe zu beachten. Den Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens wird also ein Verpflichtungsgehalt 164 165 166
Erster Teil, S. 58 f. Vgl. dazu ausführlich noch unten Zweiter Teil, S. 168, Fn. 335 u. 336. Zweiter Teil, S. 46, Fn. 96, 97, 98.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
131
entnommen.167 Insofern liegt es nahe, diese Bestimmungen im folgenden näher dahingehend zu untersuchen, ob sie im Einzelfall die Zuweisung einer Eigenoder Wahrnehmungszuständigkeit an die jeweilige gemischtwirtschaftliche Gesellschaft enthalten. Eine Eigenzuständigkeitszuweisung liegt vor, wenn die Gesellschaft durch die Regelung über den Unternehmensgegenstand verpflichtet wird, „als staatliches Zurechnungsendsubjekt“168 zu entscheiden. Eine Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung liegt demgegenüber vor, wenn die Gesellschaft verpflichtet wird, „als und für“169 einen Verwaltungsträger, in der Regel den beteiligten Verwaltungsträger, zu entscheiden. Fraglich ist, ob und unter welchen Voraussetzungen den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand eine solche Verpflichtung der Gesellschaft entnommen werden kann, Entscheidungen „als“ ein Verwaltungsträger oder „als und für“ einen Verwaltungsträger zu treffen. Oben170 wurde bereits festgestellt, daß der Wortlaut gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand typischerweise mehr oder weniger konkrete171 Beschreibungen von dem Gebiet, auf dem die Gesellschaft tätig werden soll, der Branche, und der Art der Tätigkeit (z. B. Handel oder Produktion)172 enthält, ohne auf eine besondere „öffentliche“ Zielsetzung abzustellen.173 So kann eine gesellschaftsvertragliche Regelung über den Gegenstand eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens z. B. folgendermaßen lauten: 167 Darauf, daß insbesondere den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand eine zentrale Bedeutung bei der Bestimmung der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen zukommt, weisen verschiedentlich Stimmen in der Literatur hin. So sehen z. B. Koch, Status, S. 217 und v. Trott zu Solz, Aktiengesellschaft, S. 256 in der gesellschaftsvertraglichen Regelung über den Unternehmensgegenstand den Anknüpfungspunkt für die Suche nach einer „Aufgabendelegation“, begrenzen die Fallgruppe der „Aufgabendelegation“ allerdings auf die Fälle der Übertragung einer Eigenzuständigkeit (vgl. z. B. Koch, a. a. O., insbes. S. 194 ff., 202, 210). Darauf, „daß der Unternehmensgegenstand eine staatliche Aufgabe“ beinhalten kann, stellt auch Weiß, Privatisierung, S. 281 ab, der allerdings die Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen mit dem Vorliegen einer – abstrakt zu bestimmenden – Staatsaufgabe begründen will (a. a. O., S. 280 ff.). 168 Vgl. zum Begriff oben Zweiter Teil, S. 100, Fn. 18. 169 Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274) und oben Zweiter Teil, S. 102, Fn. 38. 170 Erster Teil, S. 46 ff. 171 § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG fordert nähere Angaben („. . . näher anzugeben“). Was nähere Angaben sind, bleibt allerdings offen. Vgl. hierzu nur Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 100 ff. 172 Vgl. dazu nur Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 99. 173 Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz, § 1, Rn. 3; Emmerich, in: Scholz, GmbHG, § 1, Rn. 2a; Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (314 ff.) mit zahlreichen Beispielen aus der Vertragspraxis; Leisner, WiVerw. 1983, S. 212 (222); Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 268.
132
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
„Die Gesellschaft nimmt alle den Kreisen . . . aufgrund der Abfallgesetze obliegende Aufgaben, insbesondere die Abfallverwertung wahr, soweit sich die Kreise . . . zur Erfüllung dieser Aufgaben eines Dritten bedienen können“.174 Daneben finden sich Klauseln wie: „Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, der Bau und der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft, insbesondere der Abfallentsorgung, sowie die Beteiligung an Unternehmen der Entsorgungswirtschaft“.175 Auch finden sich Vertragsklauseln, wonach der Gegenstand des Unternehmens die „Zusammenarbeit mit den entsorgungspflichtigen Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw. mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben“176 ist. Verbreitet gibt es auch Vertragsklauseln mit weiten Formulierungen des Unternehmensgegenstandes,177 wie z. B.: „Gegenstand des Unternehmens ist die Abfallentsorgung“. Für den Bereich der Energieversorgung existiert ein Vertragsklauselbeispiel, wonach der Unternehmensgegenstand eine Öffnungsklausel zugunsten des beteiligten Verwaltungsträgers enthält: „Daneben kann die Gesellschaft andere ihr von der Stadt . . . zugewiesene Aufgaben wahrnehmen“.178 Auch finden sich Formulierungen wie z. B.: „Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen . . .“.179 174 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 270. Weitere, nur sehr allgemeine Nachweise zu verschiedenen Formulierungen gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen zum Unternehmensgegenstand finden sich teilweise in den verschiedenen Beteiligungsberichten des Bundes und der Länder, die vom Bundesministerium der Finanzen und von den meisten Landesministerien jährlich veröffentlicht werden (vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 54, Fn. 143 u. S. 56, Fn. 158). Vgl. z. B. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), Beteiligungsbericht 2005, abrufbar unter http://www.bundesfinanzministerium.de, abgefragt am 05.05.2006 und Bayerisches Staatsministerium der Finanzen (Hrsg.), Beteiligungsbericht des Freistaats Bayern 2005, abrufbar unter http://www2.stmf.bayern.de, abgefragt am 05.05.2006. 175 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 253. Vgl. auch die entsprechenden Beispiele bei Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (326 ff.) und § 2 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserversorgung, Musterverträge, S. 27. 176 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 258. 177 Darauf weist Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 273 hin. Vgl. ebenso Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (314 ff.), der ebenfalls auf vielfach unbestimmte Zielvorgaben verweist. Ebenso Greiling, Trägerschaft, S. 127 ff.; dies., ZögU 19 (1996), S. 286 (293 ff.). 178 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 274 mit Fn. 2. 179 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 258. Vgl. auch Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (322 f.), der auf den Unternehmensgegenstand der gemischtwirtschaftlichen Hamburger Stadtentwicklungsgesellschaft verweist. Danach sei „Gegenstand des Unternehmens . . . die Vorbereitung und Durchführung sowie die Betreuung von Bauvorhaben aller Art, insbesondere von Maßnahmen der Stadt-
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
133
Schließlich ist auf Bestimmungen des Unternehmensgegenstandes zu verweisen, die hinsichtlich des Gegenstandes des Unternehmens auf einen zwischen Verwaltungsträger und Gesellschaft geschlossenen Vertrag verweisen, z. B.: „Die Gesellschaft nimmt alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Rettungsdienstes wahr, mit denen sie durch öffentlich-rechtlichen Vertrag durch den Kreis . . . als Träger des Rettungsdienstes oder anderer Kreise betraut worden ist. Auf der Grundlage dieses Vertrages . . . führt die Gesellschaft den Rettungsdienst durch“.180
B. Wortlaut I. Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes Es kommt also darauf an, ob sich die vorstehend beschriebenen vertraglichen Bestimmungen über den Gegenstand eines Unternehmens als Zuständigkeitsrechtssätze deuten lassen. 1. Verpflichtung der Gesellschaft a) Verpflichtung Dann müssen diese Rechtssätze jedenfalls Verpflichtungsrechtssätze sein. Ein Verpflichtungsrechtssatz ist ein Rechtssatz, der ein bestimmtes Rechtssubjekt verpflichtet, bestimmte Entscheidungen zu treffen.181 Eine Verpflichtung ist ein „gebotene(s) Verhalten“182 bzw. ein „Handeln-Müssen“.183 erneuerung“. § 2 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 27 enthält eine Klausel, wonach die jeweilige Gesellschaft u. a. berechtigt sein soll, „alle den Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar fördernden Geschäfte zu tätigen“. 180 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 286. 181 Soweit ein Verpflichtungsrechtssatz als ein Rechtssatz definiert wird, der ein Rechtssubjekt zu einem Tun oder Unterlassen verpflichtet (so z. B. Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 40 III 1, Rn. 4), weichen diese Definitionen inhaltlich im Ergebnis nicht ab. Jeder Realhandlung, sei es Tun oder Unterlassen, geht notwendig eine Entscheidung voraus (Krebs, Kontrolle, S. 28). Die Verpflichtung zu einem Tun oder Unterlassen beinhaltet notwendig die Verpflichtung, bestimmte Entscheidungen zu treffen. 182 Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 40 III 1, Rn. 4. 183 Die Begriffe „Verpflichtung“ und „Pflicht“ werden verbreitet synonym verwendet. Darauf weist auch Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 40, Rn. 1 hin, der den Begriff „Pflicht“ „eher dann gebraucht“ sieht, „wenn es sich um einen Inbegriff von Rechtsbeziehungen“ handele, den Begriff „Verpflichtung“ dagegen zur Kennzeichnung „für die einzelne daraus hergeleitete und aktualisierte Beziehung“. Im folgenden soll der Begriff der „Verpflichtung“ und ebenso der „Berechtigung“ zur Kennzeichnung der Rechtsstellung eines Rechtssubjektes bzw. Pflichtsubjektes ver-
134
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Soweit sich Formulierungen wie z. B. „Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen . . .“184 finden, werden darin jedenfalls bestimmte Entscheidungsbereiche beschrieben, ohne ausdrücklich einen entsprechenden Verpflichtungssatz aufzustellen. Die Statuierung einer „Berechtigung“ schließt das Bestehen einer Verpflichtung aber möglicherweise nicht aus. Der Begriff der „Berechtigung“ wird verbreitet negativ definiert: Jedes Verhalten, das einer Verpflichtung nicht widerspreche, sei berechtigt.185 Dies folge aus der „allgemeinen Handlungsfreiheit“.186 Eine solche Berechtigung kann einem umfassend rechtlich gebundenen staatlichen Rechtssubjekt nicht zukommen. Die Berechtigung eines staatlichen Rechtssubjekts ist notwendig inhaltlich bestimmt und damit positiv zu benennen. Damit zeigt sich, daß der Begriff der Berechtigung nicht nur ein Alles-Dürfen, begrenzt durch die jeweilige Verpflichtung, meinen kann, sondern auch ein von vornherein inhaltlich umgrenztes Entscheiden-Dürfen. In einer solchen inhaltlich umgrenzten Berechtigung ist notwendig ein Verpflichtungselement enthalten. Die inhaltliche Bestimmung des Entscheidungsbereiches läßt sich zugleich als Verpflichtung deuten, diesen Bereich nicht zu überschreiten. Umgekehrt enthält jede Verpflichtung notwendig die Berechtigung, Entscheidungen entsprechend der Verpflichtung zu treffen.187 Anderenfalls wäre die Verpflichtung sinnwidrig. Damit zeigt sich also, daß der Begriff der Berechtigung das Vorliegen einer Verpflichtung nicht ausschließen muß, sondern auch voraussetzen kann. Auch die vom Wortlaut her neutraleren Formulierungen von Unternehmensgegenständen, die lediglich vom „Gegenstand des Unternehmens“ oder dem „Gegenstand der Gesellschaft“188 sprechen, stehen der Annahme einer Verpflichtung jedenfalls nicht entgegen. Es läßt sich also feststellen, daß die gesellschaftsvertraglichen Regelungen über den Gegenstand eines Unternehmens der
wendet werden, das „nur kraft der objektiven Rechtsordnung berechtigt oder verpflichtet ist“ (Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 105), also in bezug auf Juristische Personen. 184 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 258. Vgl. ebenso z. B. § 2 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 27. 185 Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 40 III 2, Rn. 6. 186 Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 40 III 2, Rn. 6. 187 H. H. Rupp, Grundfragen, S. 69 f. unter Verweis in Fn. 145 auf Kelsen, Hauptprobleme, S. 665. 188 So z. B. § 2 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 27. Verbreiteter ist die dem Wortlaut von § 3 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG entsprechende Formulierung vom Gegenstand des „Unternehmens“.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
135
Deutung als Verpflichtungsrechtssätze jedenfalls nicht von vornherein entgegenstehen. Der Wortlaut ist vielmehr in der Regel offen. Vorstehend189 wurde bereits darauf hingewiesen, daß die gesellschaftsvertraglichen Regelungen über den Unternehmensgegenstand auch einen Verweis auf die zwischen der Gesellschaft und dem beteiligten Verwaltungsträger geschlossenen einzelvertraglichen Abreden enthalten können. Danach nimmt die Gesellschaft alle Aufgaben wahr, „mit denen sie durch öffentlich-rechtlichen Vertrag durch den Kreis . . . betraut worden ist“.190 Der Begriff der „Betrauung durch den Kreis“ spricht für die Zuweisung einer Verpflichtung an die Gesellschaft durch einen Verwaltungsträger. Welchen Inhalt diese Verpflichtung hat, ob es sich insbesondere um eine Zuständigkeitszuweisung handelt, soll an dieser Stelle noch dahingestellt bleiben und ausführlich unten191 im Zusammenhang mit sonstigen einzelvertraglichen Bestimmungen untersucht werden. Die gesellschaftsvertraglichen Regelungen über den Unternehmensgegenstand bestehen im wesentlichen in einem Verweis auf die jeweilige einzelvertragliche Absprache. Insofern rechtfertigt sich eine einheitliche Untersuchung zusammen mit den sonstigen einzelvertraglichen Bestimmungen. b) Verpflichtung der Gesellschaft Zur Annahme der Staatseigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft muß weiterhin gerade eine entsprechende Verpflichtung der Gesellschaft vorliegen. Der Wortlaut der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand deutet – soweit er von einer „Berechtigung der Gesellschaft“ spricht oder den „Gegenstand des Unternehmens“ beschreibt – lediglich auf eine Berechtigung der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft hin, ohne zwingende Aussagen über eine entsprechende Verpflichtung der Gesellschaft zuzulassen. Möglicherweise geben aber die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften über den Gegenstand eines Unternehmens jedenfalls einen Hinweis auf den Bedeutungsgehalt der entsprechenden gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen. § 23 Abs. 3 Nr. 2 AktG und § 3 Abs. 1 Nr. 2 GmbHG sprechen lediglich vom „Gegenstand des Unternehmens“ und lassen deshalb ebenfalls keine weitergehenden Aussagen über den Verpflichtungsgehalt gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen zu. Gemäß § 82 Abs. 2 AktG und § 37 Abs. 1 GmbHG sind die Vorstandsmitglieder einer Aktiengesellschaft bzw. die Geschäftsführer einer Gesellschaft mit 189 190 191
Zweiter Teil, S. 133 m. Fn. 180. Vgl. oben Zweiter Teil, S. 133 m. Fn. 180. Zweiter Teil, S. 168 ff.
136
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
beschränkter Haftung im Verhältnis zur Gesellschaft verpflichtet, u. a. die Vorgaben des gesellschaftsvertraglich fixierten Unternehmensgegenstandes zu beachten. Diese Regelungen statuieren also Verpflichtungen nicht der Gesellschaft, sondern der für diese entscheidenden natürlichen Personen. Dementsprechend wird verbreitet davon ausgegangen, daß auch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen über den Unternehmensgegenstand insbesondere die Vorstandsmitglieder192 einer Aktiengesellschaft bzw. die Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung zur Beachtung der jeweiligen Entscheidungsvorgaben verpflichten.193 Die gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand sind also jedenfalls in erster Linie Vorschriften, die das Verhältnis der „Organmitglieder“194 zur Gesellschaft regeln. Die Organmitglieder handeln pflichtwidrig, wenn sie die Vorgaben des Unternehmensgegenstandes nicht beachten. Geht man weiterhin davon aus, daß private Gesellschaften des Privatrechts privatautonom entscheiden können, dann wird eine solche Gesellschaft durch die Rechtsordnung in ihrer Entscheidungsfreiheit lediglich beschränkt, nicht konstituiert. Die Annahme einer privatautonomen Rechtsstellung einer Gesellschaft des Privatrechts steht damit einem entsprechenden Verpflichtungsgehalt der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand entgegen. Dem Wortlaut der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist allerdings nicht zu entnehmen, daß die Gesellschaft des Privatrechts notwendig als privat und deshalb privatautonom anzusehen ist. Sowohl die Gesellschaftsverträge als auch die gesellschaftsrechtlichen Regelungen über die Verpflichtung der Organmitglieder weisen der Gesellschaft keine privatautonome Rechtsstellung zu, sondern setzen die Privatautonomie der Gesellschaft voraus.195 Geht man davon aus, daß die gesellschaftsvertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Regelungen über den Unternehmensgegenstand auch auf staatliche Rechtssubjekte anwendbar sind,196 dann bleibt es offen, ob und inwieweit eine Gesellschaft des Privat192 Sprachlich wird in gesellschaftsrechtlicher Literatur verbreitet nicht unterschieden zwischen dem apersonalen Organ einer Gesellschaft und dem für diese Organe entscheidenden Organwalter. So sei gemäß § 82 Abs. 2 AktG „der Vorstand im Verhältnis zur Gesellschaft verpflichtet“ (so ausdrücklich Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 83). Gemäß § 82 Abs. 2 AktG sind allerdings die „Vorstandsmitglieder“ verpflichtet, also die Organwalter, nicht das Organ selbst. Differenzierend zwischen „Organ“ und „Organmitgliedern“ für das Gesellschaftsrecht Hommelhoff, ZHR 143 (1979), S. 288 (insbes. S. 292 ff.), der darauf hinweist, daß das Aktiengesetz „deutlich das Organ von seinen einzelnen Organmitgliedern“ trenne (a. a. O., S. 292). 193 Vgl. dazu Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 80 ff. und oben S. 46 f. 194 Begriff nach Hommelhoff, ZHR 143 (1979), S. 288 (292 f.). 195 Zum Begriff der Privatautonomie als Entscheidungsautonomie Privater vgl. oben Erster Teil, S. 72 f. 196 Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 127 f.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
137
rechts im Einzelfall Adressat eines gesellschaftsvertraglich zugewiesenen Zuständigkeitsrechtssatzes ist. Der Wortlaut typischer gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen jedenfalls schließt eine solche Zuweisung einer Verpflichtung an die Gesellschaft nicht aus. 2. Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes Eine Zuständigkeit beinhaltet die Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes.197 Die gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand müssen also darüber hinaus gerade die Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes enthalten. Es muß in der vertraglichen Gestaltung objektiv zum Ausdruck kommen, daß das Unternehmen einem Zuständigkeitskomplex als dessen Träger zugeordnet wird. Es fragt sich also, woran man erkennt, daß die Verpflichtung der Gesellschaft, bestimmte Entscheidungen zu treffen, gerade eine Verpflichtung ist, „als“ bzw. „als und für“ ein staatliches Zurechnungsendsubjekt zu entscheiden. a) (Teil-)Identität der Entscheidungsbereiche von Verwaltungsträger und Gesellschaft Möglicherweise kann man dem Inhalt der Tätigkeitsbeschreibung selbst einen Hinweis auf das Vorliegen jedenfalls einer Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung entnehmen. Soweit ein Rechtssubjekt als Zuordnungssubjekt einer Wahrnehmungszuständigkeit verpflichtet ist, bestimmte Entscheidungen „als und für“ ein (staatliches) Zurechnungsendsubjekt zu treffen, ist sein Entscheidungsbereich notwendig zumindest teilidentisch mit dem Entscheidungsbereich des Verwaltungsträgers. Der Verwaltungsträger transportiert durch Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit zumindest einen Teil seiner Entscheidungsverpflichtung auf ein als ihn und für ihn entscheidendes Organ. Organe haben nur die Zuständigkeit, die Rechte und Pflichten der Juristischen Person wahrzunehmen.198 Die organisationsrechtliche Wahrnehmungskompetenz ist mit der materiellrechtlichen Kompetenz des Zurechnungsendsubjekts deshalb inhaltlich zumindest teilidentisch. Die Entscheidungsbereiche von materiellrechtlicher Zuständigkeit und organisationsrechtlicher Wahrnehmungszuständigkeit entsprechen sich, mit dem Unterschied lediglich, daß die Wahrnehmungszuständigkeit eine Verpflichtung zur transitorischen Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe enthält.199
197 198 199
Siehe oben Zweiter Teil, S. 99. Vgl. dazu Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274). Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 100 ff.
138
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Wenn also eine Gesellschaft gesellschaftsvertraglich verpflichtet ist, bestimmte Entscheidungen in einem Bereich zu treffen, der in die Zuständigkeit des beteiligten Verwaltungsträgers fällt, kann man möglicherweise aus dieser Teilidentität die Zuweisung einer Organzuständigkeit an das Unternehmen folgern. Wenn z. B. der Gegenstand einer Gesellschaft des Privatrechts die Entsorgung von Abfall in einem bestimmten Gebiet oder die Reinigung von Straßen ist und diese Entsorgungs- bzw. Reinigungsverpflichtung zugleich Gegenstand eines Zuständigkeitsrechtssatzes für den beteiligten Verwaltungsträger ist, dann könnte diese Ausrichtung des Unternehmensgegenstandes an der Zuständigkeit des beteiligten Verwaltungsträgers für eine Organpflicht des Unternehmens sprechen. Dies wäre allerdings nur dann der Fall, wenn allein im Fall der Organeigenschaft einer Gesellschaft eine Identität der Entscheidungsbereiche dieser Gesellschaft und des jeweiligen vertragsschließenden Verwaltungsträgers anzunehmen wäre. Eine Identität der Entscheidungsbereiche kann allerdings aus verschiedenen Gründen vorliegen. Die Verpflichtung, Entscheidungen zu treffen, die (auch) in den Entscheidungsbereich einer staatlicher Einheit fallen, ist ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für die Annahme der Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit im Einzelfall. Denkbar ist es vielmehr auch, daß ein privatrechtlich organisiertes Rechtssubjekt gerade als Privater verpflichtet ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen.200 So ist es denkbar, daß ein Privatrechtssubjekt zur Wahrnehmung bestimmter Aufgaben als Privater verpflichtet wird und insoweit „öffentliche Aufgaben“ im Sinne von im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben201 als eigene Angelegenheit erfüllt.202 In diesem Fall beinhalten die vertraglichen Abreden zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privatrechtssubjekt die Konstituierung eines privaten Verpflichtungsrechtssubjektes. An den Tatbestand der unternehmerischen Organisation wird die Verpflichtung eines privaten Zurechnungsendsubjektes geknüpft, bestimmte Aufgaben im öffentlichen Interesse zu erfüllen. Die Annahme einer Organeigenschaft allein aufgrund der Identität der staatlichen und privaten Entscheidungsbereiche im Einzelfall würde dem oben203 beschriebenen Aufgabenansatz gleichstehen, wonach die Staatseigenschaft eines Rechtssubjektes an einen bestimmten Inhalt der zugewiesenen Aufgaben geknüpft wird. Dort ließ sich feststellen, daß es in Entscheidungsbereichen, in de-
200
Vgl. Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (155 f.). Vgl. oben Erster Teil, S. 91. 202 Beispiele bei Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (149, 155 f.), der diese Pflichten eines Privaten „öffentlich-rechtliche Bürgerpflichten“ nennt und als Beispiel auf die Wegereinigungspflicht verweist. 203 Erster Teil, S. 81 ff. 201
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
139
nen sowohl staatliche als auch private Entscheider agieren, der Heranziehung zusätzlicher Kriterien zur Bestimmung der Staatseigenschaft bedurfte.204 Dementsprechend kann der Entscheidungsbereich auch an dieser Stelle nicht als ein Auslegungshinweis für die Annahme einer Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung herangezogen werden. Ob eine Zuständigkeitszuweisung vorliegt, ergibt sich auch in diesem Fall aus anderen (Auslegungs-)Kriterien. Die Eigenschaft einer Unternehmensaufgabe als typisch staatlich spricht also nicht für die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit. Der Wortlaut einer Regelung wie z. B. „Gegenstand des Unternehmens sind . . . der Betrieb von Einrichtungen der Entsorgungswirtschaft“205 ist vielmehr offen. b) Ausrichtung des Unternehmensgegenstandes am Gemeinwohl Möglicherweise spricht aber die ausdrückliche Ausrichtung des Unternehmensgegenstandes an der öffentlichen Aufgabe z. B. der Verwirklichung des Gemeinwohls für das Vorliegen einer Zuständigkeitszuweisung.206 So ist die ausdrückliche Statuierung des Gemeinwohls als Entscheidungsvorgabe des jeweiligen Unternehmens möglicherweise Hinweis auf die Staatseigenschaft desselben. Oben wurde allerdings bereits festgestellt, daß ausdrücklich gemeinwohlbezogene Aufgaben in der Satzung regelmäßig nicht statuiert werden.207 Doch selbst soweit im Einzelfall eine solche rechtliche Fixierung der Gemeinwohlverpflichtung vorliegt,208 stellt sich die Frage, welche Bedeutung eine solche Fixierung 204
Erster Teil, S. 87 ff. Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 253. 206 Lediglich i. E. so Lang, NJW 2004, S. 3601 (3603 f.), der die Staatseigenschaft einer Gesellschaft mit dem Vorliegen einer abstrakt zu bestimmenden öffentlichen Aufgabe begründet. Existiere keine ausdrückliche öffentliche Zweckbindung, sei der Unternehmensgegenstand darauf gerichtet, „Leistungen unter den für alle Rechtssubjekte des Privatrechts geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu erbringen“ (a. a. O., S. 3603). 207 Vgl. nur Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (326 ff.) und oben Erster Teil, S. 47 m. Fn. 101. 208 Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (326 f.) weist darauf hin, daß die Verpflichtung von Unternehmen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben in Errichtungsgesetzen oder Gesetzespräambeln statuiert sein kann, und verweist auf § 3 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank v. 26.07.1957, BGBl. I S. 745 und die Präambel zum Energiewirtschaftsgesetz v. 13.12.1935, RGBl. I S. 1451; jetzt aber anders § 1 EnWG, der den Begriff der „öffentlichen Aufgabe“ bzw. des „Gemeinwohls“ nicht mehr ausdrücklich nennt. Ders., in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (96) zitiert einen Gesellschaftsvertrag einer einzelvertraglich beauftragten Krankenhausgesellschaft, wonach „die Gewinnerzielung . . . nicht Zweck des Unternehmens“ sei. Haibt, Gestaltung, S. 199 verweist auf einen Gesellschaftsvertrag einer Nahverkehrseigengesellschaft: „Gegenstand des Unternehmens ist eine preiswerte und sichere Versorgung der Bevölkerung der Stadt . . . mit Leistungen des öffentlichen Personen205
140
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
für die vorliegende Aufgabe hat. So ist der Begriff des Gemeinwohls ebenso wie der Begriff der öffentlichen Aufgabe kein Begriff, der die Grenze zwischen Staat und Gesellschaft kennzeichnen kann.209 Ob ein entsprechender Unternehmensgegenstand möglicherweise in Verbindung mit einer gesetzlichen Regelung die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit enthält oder die Verpflichtung der Gesellschaft als privates Rechtssubjekt, läßt sich an der Art des Tätigkeitsbereiches nicht erkennen.210 Soweit gesetzliche Regelungen einen Gemeinwohlbezug bestimmter Entscheidungsbereiche statuieren, stellt sich lediglich die Frage, ob bereits diesen Regelungen Zuständigkeitszuweisungen zu entnehmen sind. Dies wird aufgrund ihres allgemeinen, nicht auf einen bestimmten Adressaten bezogenen Inhaltes in den meisten Fällen nicht der Fall sein.211 II. Zwischenergebnis Es zeigt sich also, daß der Wortlaut des gesellschaftsvertraglich konstituierten Unternehmensgegenstandes im Regelfall keinen eindeutigen Nachweis einer Zuständigkeitszuweisung zuläßt. Er ist vielmehr in der Regel offen. Zum einen läßt er die Deutung einer Verpflichtung der Gesellschaft als privates Rechtssubjekt zu. So ist es denkbar, daß die Gesellschaft aufgrund einer staatlichen Erklärung verpflichtet ist, bestimmte Entscheidungen als Privater zu treffen.212 Zum nahverkehrs. . . . Die Durchführung verlustbringender Geschäfte und Maßnahmen ist zur Förderung des Gemeinwohls zulässig, soweit die Rentabilität des Unternehmens insgesamt nicht entfällt . . .“. Auf dieses Beispiel verweist auch Oebbecke, in: Hoppe/ Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 8, Rn. 41. Haibt, Gestaltung, S. 174 f. weist zugleich darauf hin, daß in den meisten Fällen keine ausdrückliche Ausrichtung des Unternehmensgegenstandes an gemeinnützigen Zwecken erfolge. Auch § 2 des Mustervertrages für einen Gesellschaftsvertrag, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 27 – ein Gesellschaftsvertrag über eine gemischtwirtschaftliche Abwasserentsorgungsgesellschaft – enthält keine entsprechende Gemeinwohlklausel. Das Bundesverfassungsgericht verweist in einer Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit von § 26 Abs. 2 S. 1 BerlWG (vormals § 26 Abs. 1 Nr. 6 BerlWG) auf den Gegenstand der gemischtwirtschaftlichen „GEHAG Gemeinnützige Heimstätten-Aktiengesellschaft“, der in der „Errichtung, Bewirtschaftung und Betreuung von Wohnungen, die für breite Schichten der Bevölkerung geeignet sind“, besteht [BVerfGE 98, S. 145 (148)]. In diesem Fall lassen Firma und Gegenstand einen Gemeinwohlbezug erkennen. Ein Gesellschaftsvertrag einer gemischtwirtschaftlichen GmbH, deren Gegenstand eine „gemeinnützige Arbeitnehmerüberlassung“ ist, liegt der Entscheidung des Sozialgerichts Hamburg, HVBG-INFO 2003, S. 2935 ff. zugrunde. 209 Siehe dazu oben Erster Teil, S. 91 f. 210 Anders dagegen Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (157 f.), wonach die Indizien für das Vorliegen einer „überbürdeten Verwaltungsobliegenheit“ „aus dem Aufgabenzusammenhang geschöpft werden“ können. Kriterien zu Bestimmung eines „staatlichen“ Aufgabenzusammenhanges werden allerdings nicht genannt. 211 Der Verpflichtungsinhalt verschiedener gesetzlicher Zuständigkeitszuweisungen wird ausführlich unten Dritter Teil, S. 216 ff. untersucht. 212 Beispiele bei Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (155): Sogenannte „Verwaltungspflichten“.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
141
anderen ist es auch möglich, daß die staatliche Erklärung zum Unternehmensgegenstand die Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft enthält. Dieses offene Ergebnis wird dadurch bestätigt, daß es in der Regel politisch nicht erwünscht sein wird, die jeweilige Unternehmensleitung durch konkret ausformulierte staatliche Zielvorgaben zu verpflichten.213 Vielmehr wird es dieser im Regelfall überlassen bleiben, den jeweiligen Aufgabenbereich so gut wie möglich unter „Zukauf gesellschaftlicher Handlungsrationalität“ 214 zu erledigen.215 Dieser „Zukauf gesellschaftlicher Handlungsrationalität“ wird insbesondere in der Beschaffung privaten Kapitals bestehen.216 Dem privaten Kapitalgeber wird deshalb im Gegenzug an einem eigenen Handlungsspielraum im Unternehmen gelegen sein. Im folgenden ist daher zu prüfen, ob eine systematische oder teleologische Auslegung zu eindeutigen Auslegungsergebnissen führt und Aufschluß über die Art und den Umfang der organisatorischen Einschaltung privaten Kapitals in die Aufgabenerfüllung gibt.
C. Systematische Auslegung I. Bedeutung von Rechtsbindungsanordnungen Neben den Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens finden sich in derselben Vertragsklausel teilweise hier sogenannte Rechtsbindungsanordnungen. So gibt es Klauseln wie z. B. „Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere die abfallrechtlichen Bestimmungen, sind zu beachten“.217 Ein weiteres 213 Vgl. zum Privatisierungsmotiv einer Flexibilisierung verselbständigter Verwaltungseinheiten oben Erster Teil, S. 34 m. Fn. 34. 214 Burgi, NVwZ 2001, S. 601 (602) und die Nachweise oben Zweiter Teil, S. 123, Fn. 128. 215 So ausdrücklich Schuppert, ZögU 8 (1985), S. 310 (325). Zu den Privatisierungsmotiven bereits oben Erster Teil, S. 34 m. Fn. 34, insbesondere zum Motiv des Zukaufs privaten Kapitals und der Beschaffung privaten Know-hows oben Erster Teil, S. 60, Fn. 179, 180. 216 Darauf, daß zentrales Privatisierungsmotiv die Beschaffung privaten Kapitals ist, weisen auch das BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 28 f., sowie Brüning, Erledigung, S. 171; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1166); Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 (253) u. Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1332) hin. 217 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 253. Das BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 8 weist darauf hin, daß einer einzelvertraglichen Abrede im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung „in Form einer Präambel die Vertragsgrundlage vorangestellt werden“ sollte. In dieser „Präambel“ sollte u. a. folgende Klausel vereinbart werden: „Alle Maßnahmen des pri-
142
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Beispiel lautet: „Gegenstand des Unternehmens ist a) das Einsammeln . . . und Verwerten von Abfällen im Sinne der geltenden Abfallgesetze und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in der jeweils geltenden Fassung . . . unter Beachtung der gesetzlichen Ziele der Abfallwirtschaft bzw. der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft“.218 Auch soll z. B. die Abfallentsorgung „unter Beachtung der gesetzlichen Ziele der Abfallwirtschaft bzw. der Grundsätze der Kreislaufwirtschaft . . .“219 erfolgen. Ein weiteres Beispiel ist folgende gesellschaftsvertragliche Bestimmung für eine Rettungsdienst-Verbundgesellschaft: „Auf der Grundlage dieses Vertrages und unter Beachtung der Vorschriften des Rettungsdienstgesetzes (RDG) und der anderen zu beachtenden Rechtsvorschriften führt die Gesellschaft den Rettungsdienst durch.“220 Fraglich ist, welche Bedeutung die Verpflichtung einer Gesellschaft zur Beachtung von Rechtsvorschriften hat. Ein solcher Verpflichtungsrechtssatz kann einen deklaratorischen oder einen konstitutiven Gehalt besitzen. Einen deklaratorischen Gehalt besitzt er, wenn sich die Verpflichtung der Gesellschaft bereits aus den genannten Rechtssätzen selbst ergibt. Ob dies der Fall ist, ist abhängig vom Anwendungsbereich der jeweiligen Rechtssätze. Die vorstehend genannten Klauseln verweisen zumeist pauschal sowohl auf Sonderbindungen des Staates, als auch auf Rechtssätze, die sowohl auf staatliche als auch auf private Rechtssubjekte Anwendung finden. So sind die §§ 4 ff. KrW-/AbfG, die „abfallrechtlichen Bestimmungen“ im Sinne der vorstehend genannten Klausel,221 sowohl auf staatliche als auch auf private Rechtssubjekte anwendbar.222 § 15 KrW-/AbfG setzt dagegen ausdrücklich „öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger“ als Adressaten voraus. Auch die Vorschriften der Rettungsdienstgesetze der Länder223 enthalten sowohl Rechtssätze, die auf staatliche und private Rechtssubjekte anwendbar sind als auch Sonderbindungen des Staates wie z. B. Zuständigkeitsrechtssätze. Soweit die gesellschaftsvertraglichen Regelungen Verweise auf Rechtssätze enthalten, die sowohl auf staatliche als auch auf private Rechtssubjekte anwendbar sind, ergibt sich die Rechtsbindung der jeweiligen Gesellschaft – ob staatlich oder privat – bereits aus den gesetzlichen Regelungen selbst. Der gesellvaten Unternehmers erfolgen auf der Grundlage bzw. unter Berücksichtigung des Wasserver- und Abwasserentsorgungskonzepts der Gemeinde A und deren Investitionsplanes sowie aller einschlägigen rechtlichen Vorgaben“. 218 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 258. 219 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 258. 220 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 286. 221 Oben S. 141, Fn. 217. 222 Vgl. nur Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 4, Rn. 1 ff. 223 Vgl. nur das BayRDG und das BerlRDG.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
143
schaftsvertragliche Verweis auf diese Regelungen ist insofern ein lediglich deklaratorischer Hinweis. Als solcher kann er klarstellende Funktion und eine „Erinnerungs- und Mahnungswirkung“224 besitzen. Darüber hinaus hat eine gesellschaftsvertragliche Statuierung dieser Beachtenspflichten zur Folge, daß diese zum Gegenstand vertraglicher Informations-, Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten gemacht werden können.225 Ein Organ der Gesellschaft, das gegen diese Pflicht zu rechtmäßigem Entscheiden verstößt, entscheidet nicht nur rechtssatzwidrig, sondern auch gesellschaftsvertragswidrig. Für die Auslegung der Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand hinsichtlich ihres Zuweisungsgehaltes kann ein solcher deklaratorischer Verweis allerdings keine Auslegungshinweise ergeben. Es bleibt vielmehr offen, ob die Gesellschaft gerade als staatliches oder als privates Rechtssubjekt an die für beide geltenden Rechtssätze gebunden ist. Soweit ein Gesellschaftsvertrag einen Verweis auf Sonderbindungen des Staates enthält, kann dies zweierlei bedeuten: Zum einen können die Verweise als ein rein deklaratorischer Hinweis auf bereits bestehende Rechtsbindungen der jeweiligen Gesellschaft verstanden werden. Dies wiederum ist der Fall, wenn die Gesellschaft selbst staatliches Rechtssubjekt ist. Als Organ eines Verwaltungsträgers ist sie ipso iure an alle auf diesen Verwaltungsträger anwendbaren Rechtssätze gebunden.226 Als Adressat einer Eigenzuständigkeit ist die Gesellschaft an all diejenigen Rechtssätze gebunden, die Maßstäbe für die jeweilige Zuständigkeitswahrnehmung aufstellen, und an die sonstigen, auf alle staatlichen Rechtssubjekte anwendbaren Rechtssätze. Als deklaratorische Bestimmungen sind diese Rechtsbindungsanordnungen lediglich Hinweis auf eine bereits bestehende Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft. Zum anderen können diese Rechtsbindungsanordnungen konstitutiv eine neue Pflicht der Gesellschaft als private Juristische Person begründen, die lediglich inhaltlich mit dem Verpflichtungsgehalt der Sonderbindungen des Staates, in diesem Beispiel § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG, übereinstimmt. Diese Regelung würde also einen Privaten verpflichten, Abfall zu entsorgen unter Beachtung
224 So Henke, DÖV 1985, S. 41 (49) in bezug auf eine einzelvertraglich vereinbarte Rechtsbindungsklausel. Ebenso Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93). 225 Henke, DÖV 1985, S. 41 (49); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93). 226 Remmert, Dienstleistungen, S. 276 f. weist darauf hin, daß sich „die Normen, die Maßstäbe für die Wahrnehmung der Zuständigkeit einer übergeordneten Verwaltungseinheit enthalten und ausschließlich diese als Adressaten benennen, zwanglos dahingehend auslegen lassen, daß sie alle eigenen Untereinheiten der ausdrücklich benannten übergeordneten Verwaltungseinheit als Adressaten miterfassen“ (a. a. O., S. 277).
144
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
von Pflichten, die inhaltlich mit den Pflichten des Verwaltungsträgers übereinstimmen. Ob die jeweiligen Sonderbindungen des Staates der Statuierung einer solchen Verpflichtung eines Privatrechtssubjektes, die inhaltlich mit der jeweiligen Zuständigkeit des Verwaltungsträgers übereinstimmt, entgegen stehen, kann hier dahingestellt bleiben. Es bleibt jedenfalls nach dem Wortlaut der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über die Rechtsbindungsanordnungen offen, ob sie gerade ein privates oder ein staatliches Rechtssubjekt verpflichten. Einen Vermutungssatz dahingehend, daß ein Rechtssatz im Zweifel einen konstitutiven Gehalt besitzt, gibt es nicht. Auch den gesellschaftsvertraglichen Rechtsbindungsanordnungen läßt sich also kein Hinweis auf den Zuweisungsgehalt des jeweiligen Unternehmensgegenstandes entnehmen. II. Bedeutung der staatlichen Anteilsmehrheit In Gesellschaftsverträgen gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften mit beschränkter Haftung227 finden sich gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG zwingend Angaben über den Betrag der von jedem Gesellschafter auf das Stammkapital zu leistenden Einlage (Stammeinlage). Gemäß § 14 GmbHG bestimmt sich nach dem Betrag der von dem jeweiligen Gesellschafter übernommenen Stammeinlage der Geschäftsanteil. Gemäß § 47 Abs. 2 GmbHG gewähren jede fünfzig Euro eines Geschäftsanteils eine Stimme.228 Der Betrag der Stammeinlage bestimmt also (in der Regel) die Verteilung der Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung.229 Möglicherweise lassen sich den auf die einzelnen Gesellschafter entfallenden Beträgen der Stammeinlagen nach dem Gesellschaftsvertrag Hinweise auf die Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft entnehmen. Übernimmt der staatliche Gesellschafter die Mehrheit der Stammeinlagen, spricht dies möglicherweise auch aus Sicht des normativen Ansatzes230 für die Staatseigenschaft der 227 Darauf, daß in der kommunalen Praxis insbesondere Gesellschaften mit beschränkter Haftung weite Verbreitung gefunden haben, wurde bereits oben S. 128, Fn. 158, 160 hingewiesen. 228 Diese Klausel kann gemäß § 45 Abs. 2 GmbHG vertraglich modifiziert werden. Vgl. dazu z. B. Lutter/Hommelhoff, in: dies., GmbH-Gesetz, § 47, Rn. 4. Dementsprechend überläßt es § 6 Abs. 6 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 30 den Vertragsparteien, die Summe zu bestimmen. 229 Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 38 f. und zu den Ausnahmen von stimmrechtslosen Anteilen und Mehrstimmrechts-Anteilen ebd. S. 43. 230 Zum Beherrschungsansatz vgl. bereits oben Erster Teil, S. 31 ff.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
145
Gesellschaft. Zu prüfen ist also, ob in der gesellschaftsvertraglich geregelten staatlichen Einlagenmehrheit des beteiligten Verwaltungsträgers ein Auslegungshinweis für eine gesellschaftsvertragliche Zuweisung einer Wahrnehmungs- oder Eigenzuständigkeit zu sehen ist. 1. Wortlaut, Systematik und Telos Der Wortlaut der Regelungen über die Verteilung des Gesellschaftskapitals ergibt keinen näheren Aufschluß über ihre Bedeutung für die Auslegung der Regelungen über den Unternehmensgegenstand. Auch die systematische Stellung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen über das Stammkapital im Verhältnis zu den Regelungen über den Unternehmensgegenstand enthält keinen konkreteren Hinweis auf dessen Verpflichtungsgehalt. Fraglich ist, welchen Sinn und Zweck die Regelungen über den Betrag der Stammeinlage jedes Gesellschafters und die Übernahme eines Mehrheitsbetrages durch den beteiligten Verwaltungsträger haben. Möglicherweise spricht der Zweck der Statuierung einer staatlichen Einlagenmehrheit für die Zuweisung einer Zuständigkeit durch Gesellschaftsvertrag. Zweck einer Vereinbarung über das Bestehen einer staatlichen Einlagenmehrheit ist es jedenfalls, eine staatliche Geschäftsanteilsmehrheit zu erzielen und infolgedessen die Personalauswahl durch die Gesellschafterversammlung zu steuern. Auf diesem Wege soll ein „angemessener Einfluß“231 auf die Entscheidungen des Unternehmens sichergestellt werden.232 Fraglich ist allerdings, ob nach dem Sinn und Zweck dieser Regelungen das Unternehmen selbst staatliche Entscheidungseinheit sein soll. Denkbar ist es vielmehr auch, daß private Entscheidungen lediglich intensiver staatlich beeinflußt werden sollen. Das Herbeiführen staatlicher Entscheidungsherrschaft kann demnach auf zwei unterschiedlichen Zielsetzungen beruhen. Sie kann der Steuerung unternehmerischer Entscheidungen innerhalb der Verwaltungsorganisation dienen und insoweit Aufsicht ersetzen.233 In diesem Fall ist die gesellschaftsvertragliche Statuierung von Steuerungsinstrumenten Mittel des staatlichen An231 Im Sinne der Gemeinde- und Kreisordnungen, vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 79, Fn. 275. 232 Zu den durch die Anteilsmehrheit eröffneten mitgliedschaftlichen Rechten vgl. bereits oben Erster Teil, S. 38 ff. So wird verbreitet darauf hingewiesen, daß die Regelungen der Gemeinde- und Kreisordnungen, die die beteiligte Gebietskörperschaft verpflichten, einen angemessenen Einfluß auf die Aufsichtsorgane der Gesellschaft sicherzustellen, der Sicherung gemeindlicher Einwirkungsmöglichkeiten auf die Beteiligungsunternehmen dienen. Vgl. so nur Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 283. 233 Darauf, daß Verwaltung in Privatrechtsform nach verbreiteter Ansicht keiner allgemeinen Aufsicht unterliege, wurde bereits oben Erster Teil, S. 70, Fn. 221 hingewiesen.
146
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
teilseigners, die privatrechtlichen Organisationsformen lediglich als „Organisationshüllen“ zu nutzen.234 Das Herbeiführen staatlicher Entscheidungsherrschaft kann aber auch der „Überwachung privater Tätigkeit dienen“.235 Sinn und Zweck der gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist es dann, „die endogenen Potentiale der Gesellschaft für die Verfolgung öffentlicher Zwecke nutzbar zu machen“.236 Insofern dient die Statuierung einer staatlichen Einlagenmehrheit der Steuerung öffentlicher Aufgabenerfüllung (im oben237 genannten weiten Sinne des Begriffs) durch private Unternehmen.238 Es stellt sich daher die Frage, woran man erkennt, welche Variante der Einschaltung von Privatrechtssubjekten in die öffentliche Aufgabenwahrnehmung im Einzelfall vorliegt. Es gibt keinen Vermutungssatz, wonach die Überwachung privater Tätigkeit in der Regel weniger intensiv erfolgt, als die Steuerung verselbständigter Verwaltungseinheiten. Das Umgekehrte kann vielmehr auch der Fall sein. So können zivilrechtliche Bestimmungen die Entscheidungen eines Privatrechtssubjekts sehr viel mehr und intensiver beschränken,239 als dies bei Vorschriften des öffentlichen Rechts zur Konstituierung staatlicher Entscheidungen der Fall ist.240 Damit zeigt sich, daß von dem Bestehen einer gesellschaftsvertraglich statuierten staatlichen Einlagenmehrheit nicht zwingend auf die Zuweisung einer Zuständigkeit an die Gesellschaft geschlossen werden kann.
234 Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (158), Fn. 90 weist darauf hin, daß die Statuierung einer staatlichen Einlagenmehrheit in diesem Fall der aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten und weithin geforderten „Rückanbindung aller staatlichen Entscheidungen an das Volk“ diene. 235 So Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (158), Fn. 90 in bezug auf „Staatsaufsicht“ als Anhaltspunkt für das Vorliegen einer gesetzlich „überbürdeten Verwaltungsobliegenheit“. 236 Voßkuhle, VVDStRL 62 (2003), S. 266 (307). Vgl. ebenso z. B. Trute, DVBl. 1996, S. 950 ff. 237 Erster Teil, S. 90, Fn. 339. 238 Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (158), Fn. 90. 239 So wird z. B. verbreitet kritisiert, daß die mietrechtlichen Regelungen nach §§ 535 ff. BGB dem Vermieter nur wenig privatautonomen Entscheidungsspielraum lassen. Vgl. so z. B. Emmerich, Deutsche Wohnungswirtschaft 2000, S. 143 ff. = ders., Forum – Mietrechtsreform 2000, JuS 2000, S. 1051 ff. 240 So auch Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, S. 339 (350) mit weiteren Beispielen: „Autonomie und Fremddetermination sind keine exklusiven Begriffe des Staatlichen oder des Privaten“ (a. a. O., S. 350).
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
147
2. Bedeutung der staatlichen Anteilsmehrheit in anderen Rechtsvorschriften Möglicherweise ist aber eine gesellschaftsvertraglich statuierte staatliche Einlagenmehrheit zumindest ein Indiz für eine gesellschaftsvertragliche Zuweisung einer Zuständigkeit durch die Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand. Von einer solchen indiziellen Bedeutung kann ausgegangen werden, wenn auch in sonstigen Rechtsgebieten die Statuierung einer staatlichen Anteilsmehrheit241 mit der Eigenschaft der jeweiligen Gesellschaft, Zuordnungssubjekt von Zuständigkeiten zu sein, einhergeht. a) Kommunalrechtliche und haushaltsrechtliche Vorschriften Möglicherweise ist den Vorschriften der Gemeindeordnungen sowie der Haushaltsordnungen ein Hinweis darauf zu entnehmen, daß die Vereinbarung einer staatlichen Anteilsmehrheit die Staatseigenschaft der jeweiligen Beteiligungsgesellschaft bedingt. Wie bereits oben242 festgestellt, gehen die kommunal- und haushaltsrechtlichen Regelungen davon aus, daß der staatliche Anteilsbesitz ein Instrument zur Einflußnahme des staatlichen Anteilseigners auf die jeweilige Gesellschaft darstellt. So sehen diese kommunalrechtlichen Vorschriften vor, daß eine Gründung bzw. Beteiligung einer Gebietskörperschaft an einer Gesellschaft des Privatrechts nur zulässig ist, wenn „die Gemeinde einen angemessenen Einfluß, insbesondere in einem Überwachungsorgan, erhält und dieser durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder in anderer Weise gesichert wird“.243 Der angemessene Einfluß im Überwachungsorgan wird also gerade durch die Ausübung der Stimmrechte zur Wahl der Aufsichtsratsmitglieder umgesetzt. Auch den §§ 65 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 6 BHO und den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften läßt sich entnehmen, daß das Haushaltsrecht den Aufsichtsrat als ein zentrales Einflußinstrument ansieht.244 Der staatliche Anteilsbesitz gewährt Stimmrechte und ist damit Mittel zur Erzielung von Personalsteuerung. Damit läßt sich feststellen, daß die kommunal- und haushaltsrechtlichen Vorschriften den staatlichen Anteilsbesitz als Mittel zur Sicherung der Einflußnahmemöglichkeiten der Gebietskörperschaft auf die jeweilige Gesellschaft des Pri241 Im folgenden wird der Begriff des staatlichen Anteilsbesitzes und der staatlichen Anteilsmehrheit zur Kennzeichnung sowohl des Aktienbesitzes und der Aktienmehrheit als auch des Einlagenbesitzes und der Einlagenmehrheit verwendet. 242 Erster Teil, S. 78 f. 243 Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 79, Fn. 275. 244 Oben Erster Teil, S. 79, Fn. 279.
148
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
vatrechts ansehen.245 Möglicherweise geben diese Vorschriften auch Hinweise in bezug auf die Bedeutung des staatlichen Mehrheitsbesitzes für die Staatseigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft. Sowohl die Gemeinde- als auch die Kreisordnungen statuieren besondere Verpflichtungen der Gebietskörperschaften, soweit ihnen „mehr als 50 vom Hundert der Anteile an einem Unternehmen oder einer Einrichtung in Gesellschaftsform“ gehören.246 So sind diese Gebietskörperschaften z. B. verpflichtet, darauf hinzuwirken, daß jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt wird, die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ortsüblich bekanntgemacht werden und im Lagebericht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen wird.247 Darüber hinaus soll die jeweilige Gebietskörperschaft im Fall einer Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 Abs. 1 HGrG verbreitet die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG ausüben.248 So soll sie verlangen, daß im Rahmen der Abschlußprüfung auch die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung geprüft wird (§ 53 Abs. 1 Nr. 1 HGrG).249 Darüber hinaus soll sie verbreitet darauf hinwirken, daß ihr die in § 54 HGrG vorgesehenen Informations- und Prüfungsbefugnisse eingeräumt werden.250
245
So auch Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 282 f. Art. 94 Abs. 1 S. 1 BayGO; § 105 Abs. 1 BbgGO; § 105 Abs. 1 BWGO; § 123 Abs. 1 S. 1 HeGO; § 73 Abs. 1 S. 1 MVKV; § 124 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 NdsGO; § 112 Abs. 1 NrWGO; § 89 Abs. 6 S. 1 RPGO; § 111 Abs. 2, 1 SaarlKSVG; § 96 Abs. 2 SächsGO; § 121 Abs. 1 SAGO; § 102 Abs. 3–5 SHGO; § 75 Abs. 4 S. 1 ThürKO. Zu der Regelung der NrWGO vgl. auch Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 277 m. w. N. in Fn. 68. 247 Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 54, Fn. 143, 144. 248 Vgl. nur § 112 Abs. 1 NrWGO und die Nachweise oben Fn. 246. Das in § 53 Abs. 1 HGrG statuierte Ermessen wird landesrechtlich verbreitet als ein Regelermessen ausgeführt, tlw. wird auch eine gebundene Entscheidung statuiert. Ebenso Art. 94 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BayGO („hat“); § 105 Abs. 1 Nr. 1 BbgGO („soll“); § 105 Abs. 1 Nr. 1 BWGO („hat“); § 123 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HeGO („hat“); § 112 Abs. 1 Nr. 1 NrWGO („soll“); § 89 Abs. 6 S. 1 Nr. 3 RPGO („hat“); § 111 Abs. 2, 1 Nr. 4a SaarlKSVG („nur . . . wenn“); § 96 Abs. 2 Nr. 1 SächsGO („ist . . . festzulegen“); § 121 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 SAGO („soll“); § 75 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 ThürKO („hat“). Mann, Gesellschaft, S. 232, Fn. 294 weist darauf hin, daß diese Modifikation nicht gemäß Art. 31 GG nichtig ist. Vgl. ebenso Ehlers, Privatrechtsform, S. 167; Puhl, Budgetflucht, S. 381. Die § 73 Abs. 1 S. 1 MVKV; § 124 Abs. 3 S. 1 NdsGO u. § 102 Abs. 4 Nr. 1 SHGO verweisen nicht auf § 53 Abs. 1 HGrG, sondern auf die entsprechenden für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften. 249 Vgl. dazu schon oben Erster Teil, S. 54, Fn. 139. 250 Art. 94 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BayGO; § 105 Abs. 1 Nr. 2 BbgGO; § 123 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HeGO; § 124 Abs. 2 NdsGO; § 112 Abs. 1 Nr. 2 NrWGO; § 89 Abs. 6 S. 1 Nr. 2 RPGO; § 111 Abs. 2, 1 Nr. 4b SaarlKSVG; § 96 Abs. 2 Nr. 2 SächsGO; § 75 Abs. 4 S. 1 Nr. 4 ThürKO. In § 105 Abs. 1 BWGO; § 73 Abs. 1 S. 1 MVKV; § 121 Abs. 1, 3 SAGO u. § 102 Abs. 4 SHGO fehlen entsprechende Regelungen. 246
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
149
Die Gemeinde- und Kreisordnungen sehen also unter Verweis auf die entsprechenden haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Fall des Bestehens einer staatlichen Anteilsmehrheit besondere Vorgaben für die Wirtschaftsführung und -prüfung einer Gesellschaft vor. Möglichweise läßt sich diesen kommunal- und haushaltsrechtlichen Regelungen die Aussage entnehmen, daß staatlich beherrschte Gesellschaften rechtlich als Teil der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft gelten. Dies ist dann der Fall, wenn der Sinn und Zweck der kommunal- und haushaltsrechtlichen Vorschriften gerade darin besteht, staatliche Entscheidungen in der Rechtsform einer Gesellschaft des Privatrechts zu regulieren. Die kommunalrechtlichen Vorschriften enthalten verbreitet den Zusatz, daß „in sinngemäßer Anwendung der für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften“ besondere Vorgaben für die Wirtschaftsführung (Aufstellung eines Wirtschaftsplanes, fünfjährige Finanzplanung, ortsübliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses etc.) zu beachten sind.251 Die kommunalrechtlichen Vorschriften gehen also davon aus, daß Eigenbetriebe und staatlich beherrschte gemischtwirtschaftliche Gesellschaften vergleichbare Sachverhalte aufweisen, die auch vergleichbar zu regeln sind. Vergleichbar sind die Sachverhalte jedenfalls insofern, als daß ebenso wie bei den Eigenbetrieben die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft im Fall der Mehrheitsbeteiligung ein erhöhtes finanzielles Risiko eingeht. Gerade das verstärkte staatliche Engagement birgt ein größeres finanzielles Risiko in sich. Die kommunale Gebietskörperschaft ist verpflichtet, Bar- (vgl. § 23 Abs. 2 Nr. 3 AktG; §§ 3 Abs. 1 Nr. 4, 19 Abs. 1 GmbHG) oder Sacheinlagen (§ 27 Abs. 1 AktG; § 5 Abs. 4 S. 1 GmbHG) zu leisten. Dieses Kapital ist infolgedessen gebunden und steht für andere Verwendungszwecke nicht mehr zur Verfügung (sogenanntes Kapitalbindungsrisiko).252 Im Fall eines wirtschaftlichen Mißerfolges kann es verloren gehen (sogenanntes Kapitalverlustrisiko).253 Dieses auf251 Vgl. Art. 94 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BayGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 5a BWGO; § 122 Abs. 4 Nr. 1 HeGO; § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 MVKV; § 124 Abs. 1 S. 1 NdsGO; § 108 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 NrWGO; § 89 Abs. 6 S. 1 Nr. 1 RPGO; § 111 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKSVG; § 96 Abs. 2 Nr. 4 SächsGO; § 121 Abs. 1 Nr. 1 SAGO; § 102 Abs. 4 Nr. 1 SHGO. § 75 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ThürKO verweist auf die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs. Vgl. auch oben die Nachweise in Fn. 248. 252 So Oebbecke, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 8, Rn. 44. Ebenso die Anmerkung zu § 4 des Mustervertrages „für einen Gesellschaftsvertrag im Zuge des Kooperationsmodells“, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 27. 253 So Oebbecke, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 8, Rn. 44; Körner, NrWGO, § 88, Rn. 4; Keller, in: Articus/Schneider (Hrsg.), NrWGO, Erl. § 107 GO, Rn. 3; Erl. § 108 GO, Rn. 1, 3. Dieses wirtschaftliche Risiko ist dem Betrag nach begrenzt, da die Gemeindeordnungen bestimmen, daß die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen muß. Vgl. dazu nur die Nachweise oben S. 36, Fn. 46.
150
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
grund der gemeindlichen Anteilsmehrheit erhöhte wirtschaftliche Risiko der Gemeinde soll mit Hilfe der vorstehend genannten kommunal- und haushaltsrechtlichen Entscheidungs- und Kontrollvorgaben kalkulierbar bleiben.254 Darüber hinaus soll verhindert werden, daß die gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften „ein wirtschaftliches Eigenleben“ entfalten, das eine Kontrolle des Einsatzes öffentlicher Mittel durch Verwaltung, Rechnungshof und Parlament255 nicht mehr zuläßt.256 Sinn und Zweck der kommunal- und haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für den Fall kommunalen Mehrheitsbesitzes ist also eine intensivere Steuerung unternehmerischer Entscheidungen, um finanzielle Risiken der Gebietskörperschaften zu vermeiden oder zumindest zu minimieren.257 Die Sondervorschriften sind Folge eines verstärkten finanziellen Engagements der Gebietskörperschaften. Aus diesen zwischen der einfachen Anteilseignerschaft und dem Mehrheitsbesitz der kommunalen Gebietskörperschaft differenzierenden kommunalrechtlichen Regelungen lassen sich deshalb jedenfalls keine zwingenden Hinweise dahingehend ableiten, daß staatlich beherrschte Kapitalgesellschaften selbst Teil einer beherrschenden Einfluß ausübenden kommunalen Gebietskörperschaft sind. Sinn und Zweck der genannten Regelungen in den Gemeinde- und Kreisordnungen ist lediglich die Reduzierung des finanziellen Risikos der mehrheitlich beteiligten Gebietskörperschaften, das gerade aus ihrem verstärkten finanziellen Engagement resultiert.
So muß z. B. gemäß Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BayGO die Haftung der Gemeinde auf einen „bestimmten, ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt“ werden. Auch wird eine eventuell im Gesellschaftsvertrag vereinbarte Nachschußpflicht der Gesellschafter (§§ 26 Abs. 1, 53 Abs. 3 GmbHG; § 180 Abs. 1 AktG) kommunalrechtlich begrenzt. So bestimmt § 108 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 NrWGO, daß die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichten darf. Vgl. ebenso § 109 Abs. 1 Nr. 4 NdsGO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 RPGO; § 117 Abs. 1 Nr. 6 SAGO; § 73 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 ThürKO. Einen Überblick über gesellschaftsvertragliche Bestimmungen zu gemeindlichen Nachschußpflichten gibt Haibt, Gestaltung, S. 174. 254 Rehn/Cronauge, in: dies./v. Lennep, NrWGO, § 108, S. 14; Körner, NrWGO, § 88, Rn. 4. Ebenso Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 282; Mann, Gesellschaft, S. 220 f. mit Verweis auf die amtl. Begründung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, LT-Drs. 11/4938 (zu § 98 Abs. 1 Nr. 4 des Entwurfs des Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung v. 17.05.1994) (a. a. O., S. 221, Fn. 248); ders., Gemeinde und Private, S. 34 f. 255 Zum Parlament als Adressaten der Prüfberichte vgl. bereits oben Erster Teil, S. 53 ff. 256 So ausdrücklich Rehn/Cronauge, in: dies./v. Lennep, NrWGO, § 108, S. 14. Ebenso z. B. Puhl, Budgetflucht, S. 381 f. 257 So auch Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften, S. 136 f.; Koch, Status, S. 176 f.; ders., DVBl. 1994, S. 667 (671); R. Schmidt, ZGR 25 (1996), S. 345 (361); Raiser, ZGR 25 (1996), S. 458 (473 f.); Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (140).
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
151
b) Vergaberechtliche Vorschriften Möglicherweise lassen sich den Regelungen über die Vergabe öffentlicher Aufträge gemäß §§ 97 ff. GWB258 Hinweise auf die Staatseigenschaft staatlich beherrschter gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften entnehmen. Die §§ 98 Nr. 2 bis 6 GWB regeln, unter welchen Voraussetzungen Juristische Personen des Privatrechts „öffentliche Auftraggeber“ und als solche an die Regelungen der §§ 97 ff. GWB gebunden sind.259 Öffentliche Auftraggeber sind u. a. gemäß § 98 Nr. 1 GWB Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, also staatliche Rechtssubjekte. Gemäß § 98 Nr. 2 GWB sind Juristische Personen „des privaten Rechts“, die zu dem besonderen öffentlichen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art zu erfüllen, u. a. dann öffentliche Auftraggeber, wenn Stellen im Sinne von § 98 Nr. 1 GWB, also staatliche Rechtssubjekte, sie einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben.260 § 98 Nr. 2 GWB knüpft also die Eigenschaft einer Juristischen Person des Privatrechts, öffentlicher Auftraggeber zu sein, an die Kriterien, die bereits oben261 im Rahmen des Beherrschungsansatzes zur Kennzeichnung einer beherrschenden Stellung des staatlichen Anteilseigners verwendet wurden.
258 Die Vorschriften der §§ 97 ff. GWB sind das Ergebnis der Umsetzung verschiedener Vergaberichtlinien der EG, insbes. der Richtlinie 89/665/EWG des Rates v. 21.12.1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge in der Fassung der Richtlinie 92/50/EWG des Rates v. 18.06.1992 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge, diese in der Fassung der Richtlinie 97/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 13.10.1997. Die verschiedenen Vergaberichtlinien sind gesammelt und erläutert bei Prieß, Öffentliches Auftragswesen, S. 164 ff.; Rittner, NVwZ 1995, S. 313 ff. 259 Die §§ 97 ff. GWB sind sachlich anwendbar, wenn der in der Vergabeverordnung festgesetzte Schwellenwert von 200.000 A Auftragsvolumen erreicht ist (§ 100 Abs. 1 GWB i. V. m. § 2 Nr. 3 VgV). § 30 HGrG als Rahmenvorschrift und die entsprechenden landeshaushaltsrechtlichen Regelungen (vgl. nur Art. 55 BayHO) statuieren eine Ausschreibungspflicht für alle Verträge über Lieferungen und Leistungen mit einer Gebietskörperschaft als Auftraggeber. Zu den Rechtsbindungen kommunaler Auftraggeber unterhalb der Schwellenwerte des § 100 Abs. 1 GWB vgl. nur Otting/ Ohler, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 14, Rn. 14 ff. 260 Sogenannter funktionaler Auftraggeberbegriff [vgl. nur Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 (443); Stickler, in: Reidt/ders./Glahs (Hrsg.), Vergaberecht, § 98, Rn. 4; Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht, § 24 IV 3, S. 234 f.]. 261 Erster Teil, S. 37 ff.
152
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Auch § 98 Nr. 4 GWB stellt auf Juristische Personen des Privatrechts ab, auf die Auftraggeber im Sinne von § 98 Nr. 1 GWB „einzeln oder gemeinsam einen beherrschenden Einfluß ausüben können“. Möglicherweise sind diesen Vorschriften Hinweise dahingehend zu entnehmen, daß das Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit die Staatseigenschaft der jeweils beherrschten Gesellschaft des Privatrechts bestimmt. Dies ist dann der Fall, wenn der Begriff des „öffentlichen Auftraggebers“ im Sinne der §§ 97 ff. GWB staatliche Rechtssubjekte meint. Es wurde allerdings bereits festgestellt, daß der Begriff des Öffentlichen einen besonderen Bezug zum Staat kennzeichnet, ohne anzugeben, welcher Art dieser Bezug ist. Der Wortlaut und die systematische Stellung der §§ 98 Nr. 2 und 4 GWB lassen dies offen. Fraglich ist, was Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist. Die Regelungen der §§ 97 ff. GWB sollen die Chancengleichheit der Bieter ebenso wie einen preisgünstigen, wirtschaftlichen Einkauf des staatlichen Auftraggebers sichern.262 Öffentliche Aufträge sollen diskriminierungsfrei und nach einem transparenten Verfahren vergeben werden (vgl. § 97 Abs. 1 GWB).263 Zugleich soll sich der staatliche Auftraggeber im Wege des Ausschreibungsverfahrens Informationen und einen Marktüberblick verschaffen können.264 Die spezifischen Schwächen staatlicher Markteilnahme sollen so kompensiert werden.265 Öffentliche Aufträge haben ein insgesamt großes Auftragsvolumen und nehmen damit einen großen Teil des Auftragsmarktes ein. Insbesondere die Kommunen sind bedeutende öffentliche Auftraggeber.266 Die Vergabe von Aufträgen durch den Staat ist deshalb geeignet, wirtschaftliche Prozesse in nicht unerheblichem Maß zu beeinflussen. Diese Beeinflussung soll nicht nach willkürlichen Maßstäben, sondern nach den Maßstäben des § 97 Abs. 4 GWB (Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) erfolgen. Eine solche Beeinflussung wirtschaftlicher Prozesse kann der Staat unmittelbar oder mittelbar bewirken. Unmittelbar bewirkt er sie, wenn er selbst als Alleingesellschafter einer Juristischen Person oder als Gebietskörperschaft Auf262 Dreher, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), GWB, Vor §§ 97 ff., Rn. 1 f.; Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 (428, 430). 263 Vgl. dazu nur Otting/Ohler, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 14, Rn. 1. Vgl. ebenso EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (367), wonach das Hauptziel der sogenannten Dienstleistungs-Koordinierungsrichtlinie 92/50/EWG (oben Fn. 258) v. 18.06.1992 ein freier Dienstleistungsverkehr und die Öffnung für einen unverfälschten Wettbewerb in allen Mitgliedstaaten sei. Vgl. dazu Hausmann/Bultmann, NVwZ 2005, S. 377 (378). 264 Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 (433 f.); Stober, Kommunalrecht, § 19 III 2b, S. 285 f. 265 Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 (433 f., 442). 266 Vgl. dazu nur Otting/Ohler, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 14, Rn. 2.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
153
träge vergibt. Mittelbar bewirkt er sie, wenn er eine Juristische Person des Privatrechts im Wege der Beherrschung veranlaßt, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Die staatliche Beherrschung eines Unternehmens ist ebenso wie die unmittelbar staatliche Auftragsvergabe geeignet, Einfluß auf die wirtschaftlichen Prozesse auszuüben und Bieter zu benachteiligen.267 Darüber hinaus hat der staatliche Anteilseigner und Träger eines wirtschaftlichen Risikos auch als Gesellschafter eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens ein Interesse daran, daß eine Ausschreibung und im Anschluß daran ein preisgünstiger, wirtschaftlicher Zuschlag erfolgen kann. Dies rechtfertigt es, beherrschte Juristische Personen des Privatrechts mit staatlichen Auftraggebern gleichzusetzen. Diese Gleichsetzung erfolgt allerdings nur hinsichtlich des genannten spezifischen vergaberechtlichen Schutzzwecks, nicht aber hinsichtlich ihrer organisatorischen Einordnung in den Bereich des Staatlichen.268 Den §§ 97 ff. GWB und insbesondere §§ 98 Nr. 2 und 4 GWB sind also keine Hinweise auf die Staatseigenschaft staatlich beherrschter Gesellschaften zu entnehmen. c) Vorschriften der Transparenzrichtlinie Art. 2 Abs. 1b der Richtlinie über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, sowie über die finanzielle Transparenz innerhalb bestimmter Unternehmen (sogenannte Transparenzrichtlinie) 269 definiert ein öffentliches Unternehmen als „. . . jedes Unternehmen, auf das die öffentliche Hand auf Grund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Satzung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann“.270 Öffentliche Unternehmen im Sinn der Transparenzrichtlinie
267
Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 (446). Vgl. dazu auch die vergaberechtliche Beurteilung von Aufgabendelegationen zwischen Verwaltungsträgern durch Kersting/Siems, DVBl. 2005, S. 477 (480 f.), wonach das Vergaberecht nicht darauf abziele, „Vorgaben für die Organisation der staatlichen Aufgabenerfüllung zu geben“. Der wesentliche Zweck des Vergaberechts sei „die Förderung des Wettbewerbs auf den öffentlichen Beschaffungsmärkten“ (a. a. O., S. 480). 269 Richtlinie 80/723/EWG der Kommission v. 25.06.1980, ABl. Nr. L 195 v. 29.07.1980, S. 35 ff., in der Fassung der Richtlinie 2000/52/EG der Kommission v. 26.07.2000 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EWG über die Transparenz der finanziellen Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, ABl. Nr. L 193 v. 29.07.2000, S. 75 ff. 270 Zum Begriff des öffentlichen Unternehmens im Sinne der Transparenzrichtlinie vgl. nur Badura, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 3. Kap., Rn. 123; Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 23; ders., DÖV 1983, S. 697 f.; Storr, Staat, S. 270 ff.; Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 V 2, Rn. 66; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 4 f.; Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 23. 268
154
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
sind also auch gemischtwirtschaftliche Unternehmen, soweit die öffentliche Hand einen beherrschenden Einfluß ausüben kann.271 Gemäß Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie wird vermutet, „daß ein beherrschender Einfluß ausgeübt wird, wenn die öffentliche Hand unmittelbar oder mittelbar: a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens bestellen kann“. Das Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit ist also Indiz für die Ausübung eines beherrschenden Einflusses und damit der Eigenschaft, öffentliches Unternehmen zu sein. Zum Teil wird davon ausgegangen, diese Definition eines öffentlichen Unternehmens habe für den deutschen Rechtsraum „prägende Wirkung“.272 Es kommt darauf an, inwiefern dieser Regelung Hinweise dahingehend entnommen werden können, daß die staatliche Anteilsmehrheit Kriterium für das Vorliegen einer Zuständigkeitszuweisung durch Gesellschaftsvertrag ist. Möglicherweise meint der Begriff „öffentlich“ im Sinne von Art. 2 Abs. 1b der Richtlinie „staatlich“. Daß der Begriff des Öffentlichen einen Bezug zum Staatlichen kennzeichnet, wurde bereits oben273 festgestellt. Es stellt sich daher die Frage, ob dieser Bezug im vorliegenden Fall gerade ein organisationsrechtlicher ist. Die Transparenzrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Umsetzung verschiedener Maßnahmen zur Erzielung von Transparenz in den Finanzverhältnissen zwischen der öffentlichen Hand einerseits und öffentlichen Unternehmen oder „Unternehmen, die zu einer getrennten Buchführung verpflichtet sind“274 andererseits. Diese Maßnahmen bestehen insbesondere in weitreichenden Buchführungspflichten der genannten Unternehmen. So „sollen die Unterschiede zwischen den einzelnen Tätigkeiten, die mit jeder Tätigkeit verbundenen Kosten und Einnahmen, die Verfahren der Zuordnung und Zuweisung von Kosten und Einnahmen“ aus diesen Büchern hervorgehen.275 Zweck der Statuierung dieser umfangreichen Buchführungspflichten ist zum einen eine bessere Informationsmöglichkeit der öffentlichen Hand über ihre Finanzverhältnisse, nicht zuletzt um ihr die Einhaltung ihrer Verpflichtung aus Art. 86 Abs. 1 und 2 EG zu ermöglichen. Gemäß Art. 86 Abs. 1, 2 EG sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, keine die Wettbewerbsregeln der Art. 81 ff. EG 271
Püttner, DÖV 1983, S. 697 (697 f.); Möstl, Grundrechtsbindung, S. 4 f. So ausdrücklich Püttner, Öffentliche Unternehmen, S. 23; ders., DÖV 1983, S. 697 f.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 4. Kritisch dagegen Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 23. 273 Erster Teil, S. 82 ff. 274 Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie. 275 Abs. 7 der Gründe der Richtlinie. 272
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
155
verletzenden Maßnahmen zu treffen. Eine solche Verpflichtung kann nur erfüllt werden, wenn die Geschäftsführung des Unternehmens im einzelnen nachvollziehbar ist. Die Kommission geht davon aus, daß die Finanzbeziehungen zwischen der öffentlichen Hand und den genannten Unternehmen derart komplex seien, daß sie die Anwendung der Wettbewerbsregeln erschwerten.276 Zum anderen soll es der Kommission, die gemäß Art. 5 Abs. 2, 3 der Richtlinie entsprechende Informationsrechte hat, ermöglicht werden, ihrer Verpflichtung nach Art. 86 Abs. 3 EG nachzukommen.277 Gemäß Art. 86 Abs. 3 EG ist die Kommission verpflichtet, die Erfüllung der Verpflichtung der Art. 86 Abs. 1, 2 EG durch die Mitgliedstaaten zu kontrollieren. Nach dem Sinn und Zweck der Richtlinie unterscheiden sich also die Finanzbeziehungen zwischen einem staatlichen Rechtssubjekt und einem staatlich beherrschten Unternehmen von denen zwischen staatlichen Rechtssubjekten und sonstigen Unternehmen, sowie von den Rechtsbeziehungen zwischen sonstigen Unternehmen.278 Der Einfluß eines staatlichen Rechtssubjekts auf die Unternehmensentscheidungen aufgrund „finanzielle(r) Beziehungen eigener Art“279 macht aus Sicht der Kommission eine Sonderbehandlung hinsichtlich der Buchführungspflichten erforderlich.280 Die Definition „öffentlicher Unternehmen“ ist deshalb keine Definition, die Unternehmen benennen soll, die dem Bereich des Staatlichen zugerechnet werden sollen, sondern dient vielmehr der Festlegung von Kriterien, die erforderlich sind, um diejenige Gruppe von Unternehmen zu umschreiben, für deren finanzielle Beziehungen zu staatlichen Rechtsträgern die Buchführungs- und Informationspflichten der Transparenzrichtlinie gelten.281 Öffentliche Unternehmen sind also ebenso wie „Unternehmen, die zur Erstellung einer getrennten Buchführung verpflichtet sind“,282 nach dieser Richtlinie nicht notwendig staatliche Unternehmen.
276
Abs. 6 der Gründe der Richtlinie. Abs. 5 der Gründe der Richtlinie. 278 So auch EuGHE 1982, S. 2545 (2577 f.): „Entscheidungen der privaten Unternehmen legen jedoch im Rahmen der einschlägigen Rechtsvorschriften ihre Produktions- und Vertriebsstrategie insbesondere mit Rücksicht auf Rentabilitätsanforderungen fest. Die Entscheidungen der öffentlichen Unternehmen dagegen können im Zusammenhang mit der Verfolgung der Interessen des Allgemeinwohls durch die öffentlichen Stellen, die auf diese Entscheidungen einwirken können, dem Einfluß andersgearteter Faktoren ausgesetzt sein.“ 279 EuGHE 1982, S. 2545 (2577 f.). 280 Aus den Gründen zur Richtlinie 80/723/EWG der Kommission. 281 So EuGHE 1982, S. 2545 (2578) zur Frage, ob die Transparenzrichtlinie unzulässigerweise den Begriff des Unternehmens im Sinne von Art. 86 EG definiert. Vgl. dazu auch Storr, Staat, S. 270 f., Fn. 106. 282 Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie. 277
156
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Aufgrund dieses begrenzten Regelungszwecks der Richtlinie kann ihr kein Hinweis dahingehend entnommen werden, daß das Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit die Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft indiziert. d) Kommunalrechtliche Inkompatibilitätsregeln Im folgenden sollen einige landesrechtliche Regelungen untersucht werden, die in ihrem Tatbestand ebenfalls an das Bestehen einer staatlichen Anteilsmehrheit in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen anknüpfen. Es handelt sich hierbei um verschiedene kommunalrechtliche Inkompatibilitätsregeln.283 Oben284 wurde bereits erwähnt, daß die kommunalen Gebietskörperschaften Vertreter in die Organe einer Gesellschaft des Privatrechts entsenden oder wählen können. Die kommunalrechtlichen Vorschriften sehen verbreitet vor, daß der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte der Gebietskörperschaft, in der Regel der Bürgermeister, die Gebietskörperschaft in der Gesellschafterversammlung und – nach seiner Wahl durch die Gesellschafter – im Aufsichtsrat der jeweiligen Kapitalgesellschaft vertritt.285 Daneben wird verbreitet dem jeweiligen Gemeindevertretungsorgan das Recht eingeräumt, anstelle des Bürgermeisters einen anderen Vertreter für die Tätigkeit in der Gesellschafterversammlung oder im Aufsichtsrat der Kapitalgesellschaft zu benennen.286 Gesellschaftsvertraglich kann darüber hinaus ein Recht der Gemeinde zur Entsendung weiterer Vertreter in den Aufsichtsrat der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft vereinbart werden.287
283 Zu diesen Inkompatibilitätsregeln und ihrer Abgrenzung gegenüber Ineligibilitätsvorschriften vgl. nur BVerfG, DVBl. 1981, S. 865 ff. m. Anm. Bernhard, DVBl. 1981, S. 869 ff.; Bauer, NJW 1981, S. 2171 f. Ausführlich zur Regelung des § 18 BWGO Hager, VBlBW 1994, S. 263 ff. Zu § 29 Abs. 2 S. 1 Var. 2 BWGO und Interessenkollisionen zwischen familiär verbundenen Gemeinderatsmigliedern Stintzing, VBlBW 1998, S. 46 ff. Vgl. auch BVerfGE 93, S. 373 (376 ff.) zur Befangenheit von Ehegatten im Gemeinderat und BVerfGE 98, S. 145 (160 f.) zur Inkompatibilitätsregelung in § 26 Abs. 2 BerlWG. 284 Erster Teil, S. 40. 285 Art. 93 Abs. 1 S. 1 BayGO; § 104 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BbgGO; § 104 Abs. 1 S. 1 BWGO; § 125 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 HeGO; § 71 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 MVKV; § 111 Abs. 2 S. 1 NdsGO; § 113 Abs. 2 S. 2 NrWGO; § 88 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 RPGO; § 114 Abs. 1 S. 1, 2 SaarlKSVG; § 98 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 S. 1 SächsGO; § 119 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 SAGO; § 104 Abs. 1 SHGO. Vgl. auch ausführlich zu den verschiedenen Vertretern der Gemeinden in den Aufsichtsräten gemischtwirtschaftlicher Kapitalgesellschaften Lieschke, Weisungsbindungen, S. 10 ff. 286 Art. 93 Abs. 1 S. 2 BayGO; § 104 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 BbgGO; § 104 Abs. 1 S. 2 BWGO; § 71 Abs. 1 S. 4, Abs. 2 MVKV; § 111 Abs. 1 NdsGO; § 113 Abs. 2 S. 1 NrWGO; § 88 Abs. 1 S. 5, Abs. 3 RPGO; § 114 Abs. 2 S. 1, Abs. 3 SaarlKSVG; § 98 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 SächsGO; § 104 Abs. 1 SHGO. 287 Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 44, Fn. 86 und die Nachweise zu den entsprechenden Vorschriften der Gemeindeordnungen Erster Teil, S. 39, Fn. 55, 56.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
157
Nicht selten sind die in die Organe einer Kapitalgesellschaft gewählten oder entsendeten Personen daher solche, die bereits in einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienstverhältnis zur jeweiligen Gebietskörperschaft stehen.288 Es stellt sich daher die Frage, ob die Tätigkeit in den Organen der Kapitalgesellschaften mit der z. B. Tätigkeit als ehrenamtliches Mitglied in der jeweiligen Gemeindevertretung vereinbar ist oder ob in dieser Hinsicht Inkompatibilitäten bestehen. Für die vorliegende Untersuchung sollen diejenigen Vorschriften der Kommunalwahlgesetze und bzw. oder Gemeindeordnungen interessieren, welche die Unvereinbarkeit der Tätigkeit in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen mit der Tätigkeit als Mitglied des Vertretungsorgans der Gemeinde statuieren. Die landesrechtlichen Regelungen differieren hinsichtlich ihrer Regelungssystematik. So finden sich entsprechende Inkompatibilitätsvorschriften in verschiedenen Kommunalwahlgesetzen,289 aber auch in den jeweiligen Gemeindeund Kreisordnungen.290 Die folgende Untersuchung beschränkt sich hierbei auf die Regelungen der Kommunalwahlgesetze und die – mit den Kreisordnungen insoweit identischen – Gemeindeordnungen. Diese Inkompatibilitätsregelungen knüpfen die Unvereinbarkeit der Tätigkeit einer Person im Gemeinderat an eine Tätigkeit in einem von der jeweiligen Gebietskörperschaft beeinflußten Unternehmen. So dürfen verbreitet der Bürgermeister oder diejenigen Gemeinderatsmitglieder nicht leitende Beamte und leitende Angestellte von Juristischen Personen oder sonstigen Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts sein, an denen die Gemeinde mit mehr als fünfzig Prozent beteiligt ist.291 Die mehrheitliche Beteiligung erfaßt in einigen 288
Vgl. dazu Lieschke, Weisungsbindungen, S. 10 ff. § 12 Abs. 3 S. 1 BbgKWG; § 42 Abs. 1 S. 2 NrWGO i. V. m. § 13 Abs. 6 NrWKWG; § 5 Abs. 1 Nr. 4 RPKWG; § 17 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKWG. Vgl. auch die Vorschrift des § 26 Abs. 2 S. 1 BerlWG, welche die im Vergleich zu den anderen Inkompatibilitätsregelungen am meisten differenzierte Regelung enthält. Danach können Mitglieder und deren ständige Stellvertreter eines zur Geschäftsführung berufenen Organs eines privatrechtlichen Unternehmens, an dem das Land Berlin oder eine seiner Aufsicht unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts maßgeblich beteiligt ist, nicht zugleich dem Abgeordnetenhaus angehören. Eine „maßgebliche Beteiligung“ liegt gemäß § 26 Abs. 2 S. 2 BerlWG „bei einer Beteiligung von mehr als einem Viertel der Vermögensanteile oder einer sonstigen Absicherung eines bestimmenden Einflusses durch Vertrag, Satzung oder andere verbindliche Regelung“ vor. § 26 Abs. 1 Nr. 6 BerlWG v. 03.09.1990, GVBl. S. 1881, bezog sich lediglich – so wie die meisten anderen landesrechtlichen Regelungen auch – auf eine staatliche Beteiligung von mehr als 50 vom Hundert. 290 Vgl. nur Art. 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BayGO; § 18 Abs. 2 Nr. 2 BWGO; § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 HeGO; § 25 Abs. 1 Nr. 5 MVKV; § 3 NdsKWG i. V. m. § 35a NdsGO; § 32 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO; § 22 Abs. 2 Nr. 3 SHGO; § 23 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, 2a ThürKO. § 37 Abs. 3 SAGO i. V. m. SAKWG enthalten keine entsprechenden Vorschriften. Vgl. auch die Inkompatibilitätsregelung für Beteiligte in Verwaltungsverfahren nach § 20 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 VwVfGe. Ausführlich dazu z. B. Säcker, in: FS Rebmann, S. 781 (798 ff.). 289
158
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Vorschriften neben den Fällen einer Kapitalbeteiligung mit einem Anteil von mehr als fünfzig Prozent auch diejenigen Fälle, in denen die Gebietskörperschaft aufgrund ihrer Stimmenmehrheit in Aufsichts- und Kontrollorganen292 oder in sonstiger Weise „entscheidenden“ bzw. „maßgeblichen“ Einfluß auf die Unternehmensführung besitzt.293 Möglicherweise ist nach dem Sinn und Zweck dieser Vorschriften der privatrechtlich organisierte Rechtsträger eines vom Staat „entscheidend“ bzw. „maßgeblich“ beeinflußten Unternehmens ein staatlicher Rechtsträger. Nach dem Wortlaut und der Systematik der kommunalrechtlichen Regelungen ist Regelungsgegenstand dieser Vorschriften die Statuierung von Inkompatibilitätsregelungen für bestimmte Personenkreise, die in den entsprechenden Bestimmungen als Beamte oder Angestellte bezeichnet werden.294 Während die sonstigen Vorschriften der Inkompatibilitätsregelungen an Angehörige des öffentlichen Dienstes adressiert sind, richten sich die auf beherrschte gemischtwirtschaftliche Unternehmen bezogenen Vorschriften lediglich an die „Mitglieder“ oder „Angestellten“ eines Geschäftsführungsorgans eines beherrschten Unternehmens.295 Sie stellen diese also hinsichtlich ihrer Wählbarkeit den Angehörigen des öffentlichen Dienstes gleich. Diese Gleichsetzung ist punktuell, bedeutet allerdings nicht notwendig, daß diese Mitglieder oder Angestellten eines Gesellschaftsorgans selbst Angehörige des öffentlichen Dienstes sind. Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist lediglich
291 Art. 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BayGO; § 12 Abs. 3 S. 2 BbgKWG; § 25 Abs. 1 Nr. 5 MVKV; § 42 Abs. 1 S. 1, 2 NrWGO i. V. m. § 13 Abs. 6 S. 2 NrWKWG; § 5 Abs. 1 Nr. 4 RPKWG; § 17 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKWG; § 23 Abs. 4 S. 1 Nr. 2, 2a ThürKO. § 26 Abs. 2 S. 2 BerlWG stellt u. a. auf eine Beteiligung von lediglich mehr als einem Viertel der Vermögensanteile ab. Vgl. dazu auch die Nachweise vorstehend Fn. 289. § 32 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO spricht von einem „maßgeblichen Einfluß“. In § 3 NdsKWG i. V. m. § 35a NdsGO u. § 37 Abs. 3 SAGO i. V. m. SAKWG fehlt eine entsprechende Regelung. Nach § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 HeGO besteht Inkompatibilität bei einer Person, die bei einer Juristischen Person als Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig ist, „es sei denn, dass er diesem Organ als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört“. Ebenso § 18 Abs. 2 Nr. 2 BWGO u. § 22 Abs. 2 Nr. 3 SHGO. 292 Art. 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 2. Hs. BayGO; § 12 Abs. 3 S. 2 BbgKWG; § 26 Abs. 2 S. 1, 2 BerlWG; § 42 Abs. 1 S. 1, 2 NrWGO i. V. m. § 13 Abs. 6 S. 2 NrWKWG; § 5 Abs. 1 Nr. 4 RPKWG; § 32 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO; § 23 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 2. Hs. ThürKO. Zur Möglichkeit der gesellschaftsvertraglichen Vereinbarung von Mehrfachstimmrechten zugunsten des beteiligten Verwaltungsträgers oder stimmrechtslosen Geschäftsanteilen Privater vgl. bereits oben Erster Teil, S. 43, Fn. 78, 79, 80. 293 § 12 Abs. 3 S. 2 BbgKWG; § 26 Abs. 2 S. 1, 2 BerlWG; § 42 Abs. 1 S. 1, 2 NrWGO i. V. m. § 13 Abs. 6 S. 2 NrWKWG; § 32 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO. 294 Vgl. nur Art. 31 BayGO; § 12 BbgKWG; § 26 BerlWG. 295 Vgl. nur Art. 31 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BayGO; § 12 Abs. 3 S. 1 BbgKWG; § 26 Abs. 2 S. 1 BerlWG.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
159
die Anordnung von Inkompatibilität für Tätigkeiten verschiedener Personen, die in einem bestimmten Näheverhältnis zum Staat stehen und deshalb Interessenkollisionen ausgesetzt sein können.296 Diese Personen müssen nicht notwendig Amtswalter der Gemeinde sein. Die Gefahr solcher Interessenkollisionen besteht nach dem Sinn und Zweck der meisten kommunalrechtlichen Vorschriften297 auch bei sonstigen Organmitgliedern staatlich beeinflußter Unternehmen, die als Gemeinderatsmitglieder zugleich an der Ausübung der Finanz- und Wirtschaftlichkeitskontrolle über diese Unternehmen beteiligt sind.298 Als Organmitglieder unterliegen sie dem Einfluß der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft, die über den Einfluß auf das Gesellschaftsorgan möglicherweise zugleich die Amtswahrnehmung des Amtswalters in der Gemeindevertretung bestimmen kann.299 Auf diese Weise besteht die Gefahr, daß die innerorganisatorische Zuständigkeitsverteilung innerhalb einer Gebietskörperschaft umgangen wird. Die Gemeinde könnte sich aufgrund der personalen Verschränkung im Gemeinderat und Gesellschaftsorgan als Kontrolleur selbst kontrollieren.300 Es besteht in einem solchen Fall die Gefahr von „Interessenkonflikten und Verfilzungen“.301 Auf diese Weise werden die Grenzen zwischen der beruflichen Stellung im Unternehmen und der Mandatswahrnehmung verwischt. Diese Gefahr von Interessenkonflikten besteht bereits aufgrund der mehrheitlichen staatlichen Einflußnahme auf das Unternehmen, ohne daß die Kapitalgesellschaft selbst Träger von Zuständigkeiten sein muß. Sie besteht unabhängig von der organisationsrechtlichen Einordnung der gemischtwirtschaftlichen Kapitalgesellschaften. Die Inkompatibilitätsvorschriften begründen sich allein mit der besonderen gemischt staatlich-privaten Qualität des unternehmerischen Entscheidungsprozesses. Aussagen darüber, ob die Möglichkeit des staatlichen Anteilseigners, bestimmenden Einfluß auf die Geschäftsführungstätigkeit des Unternehmens auszuüben, zugleich die organisationsrechtliche Einordnung der jeweiligen Kapitalgesellschaft beeinflußt, sind den genannten kommunalrechtlichen Vorschriften daher nicht zu entnehmen.
296 So BVerfGE 98, S. 145 (160 f.) in bezug auf diejenigen Abgeordneten des Berliner Abgeordnetenhauses, die zugleich Mitglieder einer Gesellschaft des Privatrechts mit Beteiligung des Landes Berlin sind, anläßlich einer Entscheidung zur Vereinbarkeit des § 26 Abs. 2 BerlWG mit Art. 137 Abs. 1 GG. Ebenso Säcker, in: FS Rebmann, S. 781 (781 ff.). Vgl. zur Finanz- und Wirtschaftlichkeitskontrolle der Gemeinden über ihre Beteiligungsunternehmen oben Erster Teil, S. 53 ff. 297 Zu den Ausnahmen vgl. § 25 Abs. 1 S. 1 Nr. 5 HeGO, wonach eine Inkompatibilität nicht bei einer Person besteht, die dem jeweiligen Gesellschaftsorgan als Vertreter oder auf Vorschlag der Gemeinde angehört. Ebenso § 18 Abs. 2 Nr. 2 BWGO u. § 22 Abs. 2 Nr. 3 SHGO. Vgl. bereits oben Fn. 291. 298 BVerfGE 98, S. 145 (160 f.) zu § 26 Abs. 2 BerlWG. 299 Diese Gefahr sah BVerfGE 98, S. 145 (160 f.). 300 So in bezug auf die Rechtslage in Berlin auch BVerfGE 98, S. 145 (160). 301 BVerfGE 98, S. 145 (160). Entsprechend BVerfGE 93, S. 373 (377).
160
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
3. Zwischenergebnis Die Bedeutung der gesellschaftsvertraglichen Regelungen über den Betrag der Stammeinlage für die einzelnen Gesellschafter mit einer Einlagenmehrheit des staatlichen Gesellschafters bleibt offen. Die staatliche Einlagen- und damit Geschäftsanteilsmehrheit ist lediglich Hinweis auf das Vorliegen einer Entscheidungsherrschaft des beteiligten Verwaltungsträgers. Dieser hat die Möglichkeit, den unternehmerischen Entscheidungsprozeß zu bestimmen. Der Entscheidungsprozeß erhält dadurch eine besondere staatlich beeinflußte Qualität. An diese besondere Qualität des unternehmerischen Entscheidungsprozesses knüpfen deshalb unterschiedliche Rechtssätze unterschiedliche Rechtsfolgen. Die Rechtssätze verfolgen bestimmte Regelungsziele, so den Schutz der Bieter im Markt oder der Reduzierung des wirtschaftlichen Risikos des staatlichen Beteiligten, ohne daß Fragen der Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft Regelungsgegenstand dieser Rechtssätze wäre. Auch die Vorschriften der Transparenzrichtlinie lassen keinen Rückschluß vom Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit auf die Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts zu. Die teleologische Auslegung der vorstehend untersuchten Tatbestandsmerkmale der Einflußnahme und Anteilsmehrheit ergab, daß eine organisationsrechtliche Zurechnung der jeweiligen Organisationseinheiten gerade nicht Regelungszweck der jeweiligen Vorschriften ist. Es gibt keine Rechtssätze, die vom Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit auf die Staatseigenschaft der Gesellschaft schließen lassen und insofern Indiz für die Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen sein können. Aus diesen systematischen Erwägungen kann deshalb den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über die Verteilung der Stammeinlagen zugunsten des staatlichen Anteilseigners kein Hinweis darauf entnommen werden, daß die Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand die Konstituierung eines staatlichen Zuständigkeitskomplexes enthalten. III. Zustimmungs- und Weisungsrechte Oben302 wurde bereits festgestellt, daß nach dem Recht der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gesellschaftsvertraglich vereinbarte Weisungsrechte zugunsten der Gesellschafterversammlung gegenüber der Geschäftsführung zulässig sind. Darüber können gesellschaftsvertraglich Weisungsrechte zugunsten der jeweils beteiligten kommunalen Körperschaft gegenüber der Geschäftsführung vereinbart werden.303 Auch kann der kommunalen Gebietskörperschaft gesell302 303
Erster Teil, S. 44, Fn. 81. Vgl. Erster Teil, S. 44, Fn. 81.
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
161
schaftsvertraglich ein Sonderrecht zur Bestellung des oder der Geschäftsführer eingeräumt werden.304 Soweit ersichtlich, werden diese Sonderrechte zugunsten der jeweiligen Gebietskörperschaft in der Praxis nur selten gesellschaftsvertraglich fixiert.305 Verbreiteter ist es, der Gesellschafterversammlung die vorstehend genannten Weisungsrechte einzuräumen306 und die Durchführung bestimmter Geschäfte gesellschaftsvertraglich an die vorherige Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder eines fakultativen Aufsichtsrates im Sinne von § 52 GmbHG307 zu binden, wobei die Bezeichnungen für letzteren variieren können.308 Dementsprechend finden sich gesellschaftsvertragliche Bestimmungen, wonach „die Geschäftsführung . . . im Innenverhältnis zu allen über den normalen Geschäftsbetrieb hinausgehenden Geschäften der vorherigen Zustimmung des Gesellschafterrates“ bedarf.309 Denkbar sind auch Bestimmungen, wonach „die Geschäftsführung . . . den Weisungen der Gesellschafterversammlung unterworfen (ist). Für den Abschluß nachfolgender Rechtsgeschäfte und für die Ausübung folgender Handlungen bedarf die Geschäftsführung im Innenverhältnis der Zustimmung des Aufsichtsrates“.310 Möglicherweise sprechen für die gesellschaftsvertragliche Zuweisung einer Zuständigkeit an die jeweilige Gesellschaft die vorstehend genannten gesellschaftsvertraglichen Sonderrechte zugunsten der kommunalen Gebietskörperschaft – soweit vereinbart –, die gesellschaftsvertraglich statuierten Weisungs304 Ehlers, DVBl. 1997, S. 137 (143); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 36 II, S. 1072; Ulmer, in: Hachenburg, GmbHG, § 6, Rn. 18. 305 Vgl. oben Erster Teil, S. 45, Fn. 87. 306 So Haibt, Gestaltung, S. 139 ff., insbes. S. 151, 162 f., 170. 307 Vgl. zu diesen Zustimmungsvorbehalten bereits oben Erster Teil, S. 43; zum fakultativen Aufsichtsrat einer GmbH vgl. nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 36 IV, S. 1107 ff. 308 So Lutter/Hommelhoff, in: dies., GmbH-Gesetz, § 52, Rn. 4: Der Name sei unerheblich. Auch ein „Beirat“, „Verwaltungsrat“ oder „Gesellschafterausschuß“ könne funktional Aufsichtsrat sein. Näher zu entsprechenden gesellschaftsvertraglichen Regelungen Haibt, Gestaltung, S. 139 ff., insbes. S. 172; Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 (2563 ff.). Nach BGHSt 49, S. 214 (219 f.) eröffnen die im Gesellschaftsvertrag einer GmbH zugunsten des fakultativen Aufsichtsrats vereinbarten Zustimmungsrechte so weitreichende Einflußmöglichkeiten, daß es gerechtfertigt erscheine, eine GmbH im staatlichen Alleinbesitz als „sonstige Stelle“ im Sinne von § 11 Abs. 1 Nr. 2c StGB zu begreifen und mit einer „Behörde“ gleichzusetzen. Letzteres sei bei lediglich staatlichem Alleinbesitz ohne weitere Einflußfaktoren nicht möglich [ebenso BGHSt 43, S. 370 (378); 45, S. 16 (20); BGH, NJW 2001, S. 3062 (3064)]. Aufgrund der Zustimmungsrechte zugunsten des Aufsichtsrates konnte die Stadt als Alleingesellschafterin der städtischen Energieversorgungsgesellschaft (GmbH) die Geschäftstätigkeit in dem von ihr für richtig gehaltenen Umfang steuern. Vgl. dazu ausführlich Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 (2563 ff.). 309 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 254. 310 § 5 Abs. 5 S. 1, 2 des Mustervertrages für einen Gesellschaftsvertrag, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 28.
162
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
rechte zugunsten der Gesellschafterversammlung und die Vereinbarung von Zustimmungsvorbehalten zugunsten eines mehrheitlich mit kommunalen Vertretern besetzten (fakultativen) Aufsichtsrates im Einzelfall. Der Sinn und Zweck dieser Vorschriften ist ebenso offen wie der Sinn und Zweck der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über die Verteilung der Einlagenmehrheiten. 311 Zweck der Statuierung der vorstehend genannten kommunalen Steuerungsinstrumente kann zum einen eine intensive Steuerung privater Entscheidungen durch die Kommune, aber auch eine atypische Form der Aufsicht über die Entscheidungen einer verselbständigten Verwaltungseinheit sein. Zwar ermöglichen Zustimmungsvorbehalte sehr weitreichende Möglichkeiten des vom staatlichen Anteilseigner in den Aufsichtsrat entsandten staatlichen Personals, die Geschäftstätigkeit des Unternehmens nach ihren Vorstellungen zu lenken.312 Die Intensität staatlicher Steuerung ist allerdings kein zwingender Hinweis für eine organisationsrechtliche Zuordnung der Gesellschaft zum beteiligten Verwaltungsträger. Auch den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über Steuerungsinstrumente zugunsten des staatlichen Gesellschafters sind daher keine Hinweise auf eine gesellschaftsvertraglich zugewiesene Zuständigkeit zu entnehmen. IV. Einrichtung von Koordinierungsgremien Teilweise betreiben sowohl Verwaltungsträger als auch Private jeweils verschiedene Unternehmen in identischen Tätigkeitsbereichen. So finden sich sowohl Wertstoffbehandlungsanlagen, die von Verwaltungsträgern betrieben werden, als auch Anlagen zur Verwertung oder Beseitigung eigener Industrieabfälle, die von den Industrieunternehmen selbst betrieben werden.313 In diesen Fällen ist es denkbar, daß sich der Verwaltungsträger und der Private darüber einigen, z. B. aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Entsorgungsgesellschaft zu gründen, die eine gemeinsame Entsorgungsanlage betreibt. Für diese gemischtwirtschaftliche Gesellschaft wird die Einrichtung von Koordinierungsgremien als Abstimmungsorgane neben den gesetzlich vorgeschriebenen Gesellschaftsorganen von den Vertragsparteien auf freiwilliger Basis gesellschaftsvertraglich vereinbart.314 Diese Koordinierungsgremien werden verbreitet „Beirat“, 311
Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 144 ff. Vgl. auch BGHSt 49, S. 214 (219 f.); Altmeppen, NJW 2003, S. 2561 (2565). 313 Beispiel nach Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 261 f. 314 Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 262; Köhler, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 112 (116 f.). Ders., a. a. O., S. 117 weist darauf hin, daß der zuvor beschriebene Entsorgungsbeirat kein Organ der Gesellschaft sei. Zur gesellschaftsrechtlichen Zulässigkeit einer Konstituierung zusätzlicher, fakultativer Gesellschaftsorgane einer GmbH und den Grenzen der gesell312
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
163
„Strukturpolitischer Beirat“ oder „Entsorgungsbeirat“ genannt.315 Sie finden sich zunehmend auch in sonstigen Bereichen staatlich-privater Zusammenarbeit.316 Aufgabe des Beirates ist die Beratung der Entscheidungs- und Kontrollorgane der Gesellschaft.317 Er besteht aus in der Regel sachkundigen Gesellschaftsmitgliedern, denkbar ist allerdings auch die Mitgliedschaft von Nichtgesellschaftern,318 die von den verschiedenen Gesellschaftergruppen bestimmt werden. Sinn und Zweck der Einrichtung eines solchen Beirates ist es zum einen, Sachkunde zu beschaffen und diese in einem Organ zusammenzuführen,319 und zum anderen, verschiedene Interessen und Zielsetzungen320 im Entscheidungsprozeß zu koordinieren. Die gesellschaftsvertragliche Konstituierung eines solchen Koordinierungsgremiums spricht möglicherweise im Einzelfall gegen eine Zuständigkeitszuweisung an die Gesellschaft. Dies ist dann der Fall, wenn durch die Schaffung eines solchen Koordinierungsorgans objektiv zum Ausdruck kommt, daß Entscheidungen der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft gerade nicht „als und für“ den bzw. „als“ der Verwaltungsträger getroffen werden sollen. Möglicher-
schaftsvertraglichen Gestaltungsfreiheit vgl. nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 5 III, S. 109 ff.; Altmeppen, in: Roth/ders., GmbHG, § 52, Rn. 15 ff.; 48 ff. m. w. N.; ders., NJW 2003, S. 2561 (2563). 315 Haibt, Gestaltung, S. 162. Weitere Beispiele bei Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 255, 257, 260 f., 273. 316 Das Bundesumweltministerium empfiehlt ausdrücklich die Bildung von Beiräten, die mit Vertretern beider Parteien besetzt sein sollen: „Dieser sollte die Aufgabe haben, den Interessenausgleich zwischen den Parteien und die erleichterte Abstimmung . . . zu gewährleisten . . . Der Beirat ist ein wichtiges Instrument, um erweiterte Mitspracherechte der kommunalen Seite sicherzustellen. Die Gemeinden sollten auf ihn nicht verzichten.“ [Anmerkung zu § 16 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 22]. Auf die wachsende Bedeutung dieser Beiräte weist auch folgende Gesetzesänderung hin: Durch Art. I Nr. 6 des Änderungsgesetzes zum Berliner Rettungsdienstgesetz v. 24.06.2004, GVBl. S. 257 wurde der § 8a eingefügt, dessen Abs. 1 S. 1 die Bildung eines Beirates für den Rettungsdienst gesetzlich anordnet. Diesem Beirat sollen gemäß § 8a Abs. 1 S. 2 BerlRDG u. a. die zuständige Senatsverwaltung, Vertreter der Krankenkassen und private Rettungsdienstgesellschaften angehören. Gemäß § 8a Abs. 1 S. 4 BerlRDG können „weitere fachkundige Personen . . . zu den Sitzungen hinzugezogen werden“. 317 Haibt, Gestaltung, S. 162, 178. 318 Haibt, Gestaltung, S. 178 f., der darauf hinweist, daß in der kommunalen Praxis Beiräte nach dem jeweiligen Gesellschaftsvertrag verbreitet durch besonders sachkundige Personen besetzt werden sollen. 319 Haibt, Gestaltung, S. 178. 320 Der Begriff des Interesses deutet auf autonom gesetzte Zielvorstellungen hin, die – wie bereits mehrfach festgestellt – einem umfassend rechtlich gebundenen staatlichen Rechtsträger nicht eigen sind. Es ist daher besser, von staatlichen Zielsetzungen zu sprechen.
164
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
weise ist die Schaffung eines Koordinierungsgremiums vielmehr ein Hinweis auf die Bildung einer Gesellschaft, die jedenfalls nicht staatlich sein soll. Koordinierungsgremien dienen der Koordinierung und Effektivierung des organisationsinternen Entscheidungsprozesses. Die Vertragspartner einigen sich mit der Schaffung eines solchen Koordinierungsorgans darüber, als Gesellschafter der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft Entscheidungen in gegenseitiger Absprache zu treffen. Bereits im Vorfeld der den Entscheidungsprozeß abschließenden Entscheidung sollen z. B. entscheidungswichtige Informationen der sachkundigen Beiratsmitglieder zwischen den verschiedenen Akteuren ausgetauscht werden. Man könnte davon ausgehen, daß diese gegenseitigen Absprachen den Willen beider Vertragsparteien voraussetzen, zugunsten der anderen Kompromisse einzugehen. Die Entscheidungen der Gesellschaft könnten in Folge dessen das Ergebnis eines organisationsinternen Entscheidungsprozesses sein, der von vornherein offen und auf Kompromißbereitschaft angelegt ist. Oben321 wurde allerdings bereits festgestellt, daß ein Verwaltungsträger im Zweifel nur diejenigen Erklärungen abgibt und nur diejenigen Entscheidungen trifft, die er zuständigkeitsgemäß treffen darf. Der Begriff der „Kooperation“ kann daher aus Sicht des beteiligten staatlichen Rechtsträgers keinen Verzicht auf seine Rechtsbindungen beinhalten. Trotz der Statuierung von Koordinierungsgremien hat der Verwaltungsträger dafür zu sorgen, daß im Unternehmen diejenigen Entscheidungen getroffen werden, die er selbst aufgrund seiner Zuständigkeit treffen muß. Im Einzelfall kann es die jeweilige Zuständigkeit des Verwaltungsträgers möglicherweise sogar erfordern, einen solchen sachkundigen Beirat zu schaffen. Die gesellschaftsvertragliche Konstituierung eines Kooperationsorgans kann deshalb lediglich darauf hinweisen, daß den Vertragspartnern an einem intensiven und sachkundigen Austausch von Informationen im unternehmensinternen Entscheidungsprozeß gelegen ist. Ein solcher gesteigerter Informationsaustausch ist nicht zuletzt deshalb erforderlich, weil der Entscheidungsprozeß einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft notwendig ein Prozeß ist, an dem verschiedene, staatliche und private Akteure mit verschiedenen Interessen bzw. Zielsetzungen beteiligt sind.322 Innerhalb der Entscheidungsorgane finden also Entscheidungsprozesse statt, die bereits aufgrund ihrer gemischt staatlich-privaten Entscheidungsstruktur einer Koordinierung bedürfen. 321
Zweiter Teil, S. 118 ff. Ebenso EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (368) zu Fragen der sogenannten In-HouseGeschäfte (vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 63 ff., Fn. 193): Die Anlage von privatem Kapital in einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen beruhe auf Überlegungen, die mit privaten Interessen zusammenhängen, und verfolge andere als die im öffentlichen Interesse liegenden Ziele. 322
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
165
Auf Seiten des Verwaltungsträgers bedeutet dies lediglich, daß er in Wahrnehmung seiner Zuständigkeit dafür sorgen muß, daß sachangemessene Entscheidungen im Zusammenwirken mit den beteiligten Privatrechtssubjekten getroffen werden.323 Welcher Organisationsform er sich dabei bedient hat, ob er also der Gesellschaft eine Zuständigkeit zugewiesen hat oder nicht, läßt sich den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über die Einrichtung von Koordinierungsgremien nicht entnehmen. Es ist also denkbar, daß organisationsintern koordiniert getroffene Entscheidungen organisationsrechtlich dem beteiligten Verwaltungsträger als eigene zugerechnet werden. Der realen Organisation eines Entscheidungsprozesses können aus normativer Sicht keine Aussagen über die organisationsrechtliche Zurechnung der den Prozeß abschließenden Entscheidung entnommen werden. Die Betonung des kooperativen Charakters des unternehmerischen Entscheidungsprozesses kann lediglich als Hinweis dafür gewertet werden, daß eine koordinierte Absprache der Gesellschafter für den jeweiligen Aufgabenbereich von besonderem Interesse bzw. von der Zuständigkeit des Verwaltungsträgers gefordert ist. Als Indiz gegen die Staatseigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft kommt die Einrichtung von Koordinierungsgremien daher nicht in Betracht. V. Zwischenergebnis Die systematische Auslegung hat keinen näheren Aufschluß über den Regelungsgehalt der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Gegenstand des Unternehmens ergeben. Es läßt sich lediglich zeigen, daß die gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen in erster Linie die Modalitäten des arbeitsteiligen Entscheidungsprozesses zwischen staatlichen und privaten Rechtsträgern regeln, und daß die rechtlichen Möglichkeiten staatlicher Einflußnahme auf diesen Entscheidungsprozeß unterschiedlich umfangreich ausgestaltet sein können. Welche Bedeutung die Vereinbarung von „Beherrschungsrechten“ zugunsten des beteiligten Verwaltungsträgers wie z. B. einer staatlichen Anteilsmehrheit oder von Weisungsrechten hat, bleibt offen. Aus der Konstituierung realer Entscheidungsherrschaft des beteiligten Verwaltungsträgers kann nicht zwingend auf die Zuweisung einer Zuständigkeit geschlossen werden. Denkbar ist es vielmehr auch, eine private Gesellschaft mit staatlicher Beteiligung gerade aufgrund dieser Beteiligung einer verstärkten staatlichen Einflußnahme zu unterstellen. Das Organisationsrecht ist von der realen Qualität eines Entscheidungsprozesses als mehr oder weniger staatlich beeinflußt unabhängig. Die realen Gegebenheiten lassen keinen Rückschluß auf die organisationsrechtlichen Konstruktionen zu. Auch ein Regelsatz, wonach eine intensive staatliche Steuerung mit einer organisa323 Ausführlich zum Inhalt und Umfang von Zuständigkeitsrechtssätzen noch unten Dritter Teil, S. 201 ff.
166
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
tionsrechtlichen Einordnung der jeweiligen Gesellschaft in die Verwaltungsorganisation einhergeht, läßt sich nicht aufstellen. Die reale Organisation staatlicher Verwaltung zeichnet sich vielmehr durch das Vorhandensein verschiedener mehr oder weniger verselbständigter Verwaltungseinheiten aus.
D. Teleologische Auslegung Möglicherweise ergibt eine teleologische Auslegung näheren Aufschluß über den Inhalt der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand. Aus dem Wortlaut, der Genese und der Systematik des jeweiligen Rechtssatzes ist dessen objektiver Zweck324 zu ermitteln. Oben325 wurde bereits festgestellt, daß die Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand Entscheidungsvorgaben jedenfalls für die mit Wirkung für die jeweilige Gesellschaft entscheidenden Rechtssubjekte darstellen. Entscheidungsvorgaben sind Kriterien für die Wahl zwischen Handlungsalternativen und als solche notwendige Bestandteile eines Entscheidungsprozesses.326 Der Unternehmensgegenstand als einheitliche Entscheidungsvorgabe für alle entscheidenden Akteure in einem Unternehmen dient der Vereinheitlichung der mit Wirkung für die Gesellschaft getroffenen Entscheidungen. Das einheitliche Wahlkriterium führt dazu, daß die Entscheidungen der Gesellschaft ein Mindestmaß an Übereinstimmung aufweisen und nicht lediglich als Einzelentscheidungen verschiedener Akteure erscheinen. Die Statuierung des Unternehmensgegenstandes macht ein Unternehmen deshalb zu einer Entscheidungseinheit. Eine solche unternehmerische Entscheidungseinheit grenzt sich nach innen und außen ab. Die Einheitsbildung nach außen ist erforderlich, um zum einen den Rechtsverkehr über den Tätigkeitsbereich des Unternehmens zu informieren.327 Zum anderen ist der Gegenstand eines Unternehmens Anknüpfungspunkt verschiedener Rechtssätze.328 Unternehmensintern hat der Unternehmensgegenstand einheitsbildende Wirkung, um einen rationalen unternehmerischen Entscheidungsprozeß zu gewährleisten. Rational ist ein Entscheidungsprozeß, wenn
324
Larenz, Methodenlehre, S. 333. Erster Teil, S. 46 f. 326 Zur Definition der Entscheidung als Wahl zwischen Alternativen vgl. bereits oben Erster Teil, S. 30, Fn. 12. „Die Festlegung des mit der Entscheidung intendierten Zweckes (oder der Zwecke) (ist) notwendiges Element eines staatlichen Entscheidungsprozesses“ (Krebs, Kontrolle, S. 32, Hervor. i. O., vgl. oben Erster Teil, S. 46, Fn. 93). 327 Vgl. dazu bereits oben Erster Teil S. 46, Fn. 95. 328 Tieves, Unternehmensgegenstand, S. 68 ff. mit ausführlichen Nachweisen. So knüpft z. B. die GewO an bestimmte Tätigkeitsbereiche eine Erlaubnispflicht. Auch dürfen bestimmte Gegenstände wie z. B. die Vergabe von Krediten, nur in einer bestimmten Rechtsform verfolgt werden (Tieves, a. a. O., S. 68). 325
4. Abschn.: Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen
167
seine Entscheidungen nicht willkürlich, sondern nach objektiven Kriterien, in diesem Fall nach den Kriterien des Unternehmensgegenstandes, getroffen werden. Ein rationales Entscheiden wiederum ist erforderlich, um arbeitsteiliges Vorgehen innerhalb eines Unternehmens zu ermöglichen. Eine Abstimmung der einzelnen getroffenen Entscheidungen aufeinander ist nur möglich, wenn das gemeinsam verfolgte Ziel feststeht. Die Art des Tätigkeitsbereiches bestimmt darüber hinaus die unternehmensinterne Organisationsstruktur. Die Definition des Tätigkeitsbereiches ist erforderlich, um den Bedarf an personeller und sachlicher Infrastruktur festlegen zu können. Eine dem Unternehmensziel angemessene Organisation zur Erreichung dieses Ziels bzw. der Aufgabe329 kann nur errichtet werden, wenn das Ziel selbst definiert ist. Es läßt sich also feststellen, daß der Unternehmensgegenstand dazu dient, eine bestimmte Entscheidungsstruktur im Unternehmen zu schaffen. Er ist insofern auch Organisationsvorgabe für eine aufgabenangemessene Organisation. Offen bleibt allerdings in den vorstehend genannten Beispielsfällen der konkrete Inhalt der Organisationsvorgabe. Typischerweise kann dem Wortlaut und der Systematik der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen nicht entnommen werden, ob es sich bei der unternehmerischen Entscheidungseinheit um eine staatliche oder private Einheit handelt. Ob der Verwaltungsträger der Gesellschaft des Privatrechts im Einzelfall gerade keine Zuständigkeit zugewiesen hat, um sich so „gesellschaftliche Handlungsrationalität“ 330 zunutze zu machen, oder ob er eine Zuständigkeit zugewiesen hat, um das Unternehmen als privatrechtliche Organisationshülle in seine Aufgabenwahrnehmung einzuschalten,331 bleibt offen. Es läßt sich lediglich feststellen, daß es Zweck der gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist, inhaltliche und organisatorische Entscheidungsvorgaben für die Gesellschaft festzulegen, um aufgabenangemessene unternehmerische Entscheidungen zu gewährleisten. Welche Organisationsform – staatlicher Verwaltungsträger bzw. Organ oder private Gesellschaft – die Vertragsparteien zur Schaffung einer aufgabenangemessenen Organisationsform im Einzelfall gewählt haben, kann allerdings objektiv nicht nachvollzogen werden.
E. Ergebnis Die Auslegung typischer gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen über den Unternehmensgegenstand kommt damit hinsichtlich ihres Zuweisungsgehaltes zu keinen zwingenden Ergebnissen. Sowohl der Wortlaut, die Systematik und 329 330 331
Zu den Begriffen vgl. bereits oben Erster Teil, S. 83, Fn. 295. Burgi, NVwZ 2001, S. 601. Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 123, Fn. 128. Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 123, Fn. 128 u. S. 141, Fn. 216.
168
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
der Sinn und Zweck lassen offen, ob der Verwaltungsträger der Gesellschaft eine Zuständigkeit zugewiesen hat oder ob sich ein staatliches Rechtssubjekt und ein Privatrechtssubjekt über die Gründung einer nichtstaatlichen Gesellschaft geeinigt haben. Oben332 wurde bereits festgestellt, daß die verfassungs- und einfachrechtlichen Sonderbindungen des Staates zu einer Zuordnung gemischt staatlich-privater Organisationsstrukturen zum Bereich des Staatlichen oder Privaten zwingen. Wie eine solche Zuordnung im Einzelfall trotz der mehrdeutigen Auslegungsergebnisse gelingen kann, soll daher im folgenden untersucht werden. Zuvor sind allerdings einzelvertragliche Regelungen zwischen Verwaltungsträger und gemischtwirtschaftlicher Gesellschaft dahingehend zu untersuchen, ob sie Zuweisungen von Wahrnehmungszuständigkeiten enthalten können. Fünfter Abschnitt
Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen über den Vertragsgegenstand A. Typische vertragliche Bestimmungen Mehrfach333 wurde bereits erwähnt, daß der an einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft beteiligte Verwaltungsträger neben der Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft mit dieser Gesellschaft sogenannte „satzungsergänzende“ bzw. „schuldrechtliche Nebenabreden“ abschließen kann.334 Denkbar ist es darüber hinaus auch, daß ein Verwaltungsträger mit einer Gesellschaft des Privatrechts ohne staatlichen Entscheidungsanteil eine solche einzelvertragliche Abrede schließt. Die erste Variante wird mit dem Begriff des „Kooperationsmodells“335 ebenso wie mit dem Begriff „Public Private Partnership“336 oder den Begriffen der „echten“ oder „unechten funktionalen Privati332
Einleitung, S. 25, Fn. 13. Vgl. nur oben Erster Teil, S. 58, Zweiter Teil, S. 116, 128 ff. 334 Vgl. nur BGHZ 123, S. 15 (20); Hüffer, AktG, § 23, Rn. 45 ff.; Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbHG, § 3, Rn. 58 ff. m. w. N. 335 Vgl. nur Bauer, DÖV 1998, S. 89 (91); BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 33; BMWi (Hrsg.), Kreislaufwirtschaft, Leitfaden, S. 43 und Anhang 4; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1169); Bodanowitz, Organisationsformen, 157, 159 ff.; Brüning, Erledigung, S. 101; Michaels, in: Koenig/Kühling/ Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (396 ff.); Schoch, in: Ipsen (Hrsg.), Organisationsformen, S. 63 (89 f.); Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 32; Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (764 f.). 336 Vgl. zum Begriff nur Bauer, DÖV 1998, S. 89 (89 f.); Burgi, Die Verwaltung 33 (2000), S. 183 (185); Gottschalk, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 153 (153 ff.); Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1169) m. Fn. 33; 333
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
169
sierung“ umschrieben.337 Die Fallkonstellationen der zweiten Variante werden mit dem Begriff der „Verwaltungshilfe“338 oder ebenfalls mit dem Begriff der „funktionalen Privatisierung“ gekennzeichnet. Die Konstruktion der einzelvertraglichen Abreden gleicht sich, so daß es gerechtfertigt ist, beide Fallkonstellationen im folgenden gemeinsam zu untersuchen. Die einzelvertraglichen Abreden begründen Verpflichtungen und Berechtigungen zwischen dem jeweiligen Verwaltungsträger und der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts. Zentraler Gegenstand dieser Verpflichtungen und Berechtigungen ist die Dienstleistungsverpflichtung der Gesellschaft gegenüber dem Verwaltungsträger im Bereich der Ver- und Entsorgung von Wasser und Abfall und der Energieversorgung, aber auch vermehrt in anderen Bereichen kommunaler Tätigkeiten wie z. B. dem Fremdenverkehr, der städtebaulichen Sanierung und Entwicklung und bei kulturellen Einrichtungen.339 Darüber hinaus werden verschiedene weitere einzelvertragliche Abreden wie z. B. Kaufverträge, Erbbaurechtsverträge, Schiedsverträge und Personalübernahmeverträge geschlossen.340 Die schuldrechtlichen Nebenabreden bestehen in der Regel aus verschiedenen Einzelabreden, die zu einem Vertragswerk zusammengefaßt werden. Es lassen sich im wesentlichen zwei verschiedene Typen einzelvertraglicher Absprachen unterscheiden:341 Mehde, VerwArch 91 (2000), S. 540 (543); Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 f.; Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (764 f.); ders., in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 125 (125 f.); ders., NWVBl. 2005, S. 1 ff. 337 Vgl. nur Burgi, Funktionale Privatisierung, insbes. S. 145 ff. „Funktionale Privatisierung“ bestehe in der Veranlassung eines Privaten zur Aufgabenerfüllung mit funktionalem Bezug zur Staatsaufgabe. Eine „unechte funktionale Privatisierung“ sei bei Einschaltung staatlich beherrschter gemischtwirtschaftlicher Unternehmen gegeben, weil das Unternehmen aufgrund der Beherrschung nicht mehr Privater, sondern staatliche Einheit sei. Eine echte funktionale Privatisierung liege demgegenüber vor, wenn ein privates Privatrechtssubjekt eingeschaltet werde. 338 Z. B. Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (393 f.); Burgi, Funktionale Privatisierung, insbes. S. 145 ff. 339 Einen Überblick über die Bereiche kommunalen Entscheidens, die durch eine zunehmende Einschaltung Privater gekennzeichnet sind, geben z. B. Bauer, DÖV 1998, S. 89 ff.; Budäus/Grüning, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 25 (40 f.); Schoch, DVBl. 1994, S. 1 ff.; Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 6 f.; Spannowsky, DVBl. 1992, S. 1072 ff.; Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, Vor § 90 IV, Rn. 24; Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765). 340 BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 31; Brüning, Erledigung, S. 169, 174; Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht, 24.25, S. 8; Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (400); Gottschalk, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 153 (159 ff.); Kummer/ Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1172); Rudolph, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung, S. 175 (182); Tettinger, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S.125 (127 f.). 341 Einen Überblick geben z. B. Bauer, DÖV 1998, S. 89 (91 ff.); BMWi (Hrsg.), Kreislaufwirtschaft, Leitfaden, S. 41 ff.; Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald
170
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
So kann das gemischtwirtschaftliche Unternehmen von dem beteiligten Verwaltungsträger beauftragt werden, die vom Verwaltungsträger bereitgestellten (Entsorgungs-)Anlagen zu betreiben.342 Auch kann das Privatrechtssubjekt aufgrund einzelvertraglicher Abreden verpflichtet sein, eigene Anlagen für den Verwaltungsträger zu betreiben. Es finden sich darüber hinaus auch Fallgestaltungen, wonach eine Gesellschaft das Eigentum der entsprechenden Anlage verwaltet und eine andere Gesellschaft diese Anlagen betreibt („Besitzermodell“).343 So gibt es in der Praxis Konstruktionen gemischtwirtschaftlicher Besitzgesellschaften und gesonderter gemischtwirtschaftlicher Betriebsgesellschaften, die typischerweise mit einander einen Pachtvertrag schließen.344 Die Variation der einzelvertraglichen Regelungen ist groß. Verbreitet wird zur Grobgliederung dieser Fallgestaltungen zwischen einem sogenannten „Betreibermodell“ und einem „Betriebsführungsmodell“ unterschieden.345 Nach dem sogenannten „Betriebsführungsmodell“346 betreibt der Betriebsführer – das (gemischtwirtschaftliche) Unternehmen in Privatrechtsform – aufgrund vertraglicher Vereinbarung mit einem Verwaltungsträger gegen Entgelt Anlagen der staatlichen Einheit.347 „Betreibermodelle“ sehen die Planung und den Bau oder die Sanierung bestehender Anlagen durch einen privatrechtlichen Betreiber vor und im Anschluß daran die Übernahme des Betriebes durch diesen Betreiber, welche in der Regel die Wartung und Instandhaltung der Anlagen sowie
(Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 ff.; Rudolph, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung, S. 175 ff.; Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 ff.; Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); ders., in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 125 (126 ff.). Ebenso Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 162 ff., der diese Verträge „Veranlassungsverträge“ nennt. 342 Beispiel nach Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 248 ff. 343 BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 38; Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht, 24.25, S. 9; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1169); Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (766); Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (458). 344 Vgl. nur Rehm, in: Gedenkschrift Thiemeyer, S. 277 (284 ff.) mit Beispielen aus der kommunalen Praxis. 345 Vgl. nur Bodanowitz, Organisationsformen, S. 34 ff.; Brüning, Erledigung, S. 168 ff.; Dedy, NWVBl. 1993, S. 245 (250 f.); Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1169); Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 ff.; Schoch, in: Ipsen (Hrsg.), Privatisierung, S. 63 (86 ff.); ders., DVBl. 1994, S. 1 (10 ff.); Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765 f.); ders., NWVBl. 2005, S. 1 ff.; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (455 ff.). 346 Die Begriffe des Betriebsführungsvertrages und der Beherrschung sind Adaptionen der Begrifflichkeiten des Aktienkonzernrechts. Vgl. zum sogenannten Betriebsführungsvertrag nur Veelken, Betriebsführungsvertrag, S. 24 ff.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 17 III, S. 499 ff.; Hommelhoff, Konzernleitungspflicht, S. 284 ff.; Raiser, Kapitalgesellschaften, § 57, Rn. 17; BGH, NJW 1982, S. 1817 (1817 f.). 347 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (393); Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (455 ff.).
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
171
die technische und kaufmännische Verwaltung mitumfaßt.348 Der Betreiber wiederum erhält von dem jeweiligen Verwaltungsträger ein Entgelt, das in der Regel durch die Gebühren refinanziert wird, die der Verwaltungsträger von den Benutzern erhebt.349 Der wesentliche Unterschied zwischen dem Betriebsführungsmodell und dem Betreibermodell besteht darin, daß im ersten Fall die Anlage im Eigentum der Gemeinde steht, im zweiten Fall dagegen im Eigentum des Privatrechtssubjektes und von der Gemeinde lediglich als öffentliche Einrichtung gewidmet wird.350 Deshalb ist das wirtschaftliche Risiko351 im Rahmen des Betriebsführungsmodells für den privatrechtlichen Betreiber geringer als im Fall des Betreibermodells.352 Identisch ist die rechtliche Grundkonstruktion der beschriebenen einzelvertraglichen Abreden: Die jeweilige Gesellschaft des Privatrechts wird als „Dritter“, „Verwaltungshelfer“ oder „Erfüllungsgehilfe“ in die Aufgabenwahrnehmung des Verwaltungsträgers353 eingeschaltet. Die Gesellschaft soll die Aufgaben des Verwaltungsträgers als Erfüllungsgehilfe desselben durchführen, ohne daß sich im Außenverhältnis gegenüber den Benutzern die Vertragsbeziehungen zur kommunalen Gebietskörperschaft ändern.354 Im Außenverhältnis erbringen sowohl der Betreiber als auch der Betriebsführer typischerweise Leistungen des Verwaltungsträgers gegenüber den Benutzern der Anlagen „in dessen Namen“.355
348 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (91). Einen Überblick über typische Regelungsinhalte von Betreiberverträgen geben z. B. Bodanowitz, Organisationsformen, S. 34 ff.; Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 (188 f.); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93); Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (457 f.). 349 Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 (193); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (91); Henke, DÖV 1985, S. 41 (43); Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171). Ein Beispiel für eine solche Entgeltregelung nennen Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Kommunale Vertragsgestaltung III, S. 215 ff.; Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (97). 350 Schumacher, in: Bergmann/ders. (Hrsg.), Kommunale Vertragsgestaltung I, S. 50 f. Zur Bedeutung der Widmung sogleich unten S. 188 ff. 351 Zum Inhalt des wirtschaftlichen Risikos der kommunalen Gebietskörperschaften vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 149 m. Fn. 253. 352 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (393). 353 Einer kommunalen Gebietskörperschaft oder eines Zweckverbandes. Zu den Zweckverbänden vgl. bereits oben Einleitung, S. 23, Fn. 2. 354 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765); Gottschalk, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 153 (160); Brüning, Erledigung, S. 157, 172. 355 Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765). Ebenso Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (395); Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (455).
172
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
So finden sich in einzelvertraglichen Absprachen z. B. Klauseln wie „Die Stadt (. . .) bedient sich der (. . .) zur Erfüllung ihrer Hoheitsaufgaben im Bereich der Abfallbeseitigung als Dritter i. S. d. § 16 KrW-/AbfG. Zur Erfüllung ihrer Hoheitsaufgaben nach Straßenreinigungsgesetz NW zieht die Stadt (. . .) die (. . .) als Erfüllungsgehilfin hinzu“.356 Zugleich wird die Gesellschaft vertraglich an die für den jeweiligen Anlagenbetrieb geltenden Rechtsvorschriften gebunden.357 Dem Verwaltungsträger sind Informations- und Kontroll-, sowie Weisungsrechte eingeräumt.358 Darüber hinaus enthalten die Verträge regelmäßig Bestimmungen über die Vertragsbeendigung und Klauseln zur Regelung der Folgen der Vertragsbeendigung.359 Es stellt sich also im folgenden die Frage, ob diese einzelvertraglichen Bestimmungen im Einzelfall die Zuweisung von Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeiten an die jeweilige Gesellschaft des Privatrechts regeln. Ist dies der Fall, dann umfaßt der Begriff der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft als eines Rechtssubjekts in Privatrechtsform, das sowohl staatliche als auch private Entscheidungen trifft, also auch diejenigen Juristischen Personen des Privatrechts, die bislang mit dem Begriff des Verwaltungshelfers umschrieben wurden.
B. Wortlaut Möglicherweise lassen sich bereits dem Wortlaut typischer Vertragsklauseln über die Festlegung wechselseitiger Verpflichtungen und Berechtigungen Zuständigkeitszuweisungen entnehmen. Dies ist dann der Fall, wenn die Gesellschaft verpflichtet wird, bestimmte Entscheidungen „als“ oder „als und für“ ein staatliches Rechtssubjekt zu treffen.
356 Beispiel nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 208. Ein weiteres Beispiel für die einzelvertragliche Beauftragung einer gemischtwirtschaftlichen Abfallverwertungsgesellschaft als „Dritter“ nennt BGHSt 50, S. 299 (301 ff.). 357 Zu den Rechtsbindungsanordnungen vgl. nur Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93 f.). 358 Vgl. z. B. Henke, DÖV 1985, S. 41 (43); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93); Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 (188 f.). Beispiele nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Kommunale Vertragsgestaltung III, S. 223. 359 Beispiele nach Bauer, DÖV 1998, S. 89 (95 f.); Dahlen/Köhler, in: Bergmann/ Schumacher (Hrsg.), Kommunale Vertragsgestaltung III, S. 224 f. Zu weiteren typischen Klauseln in Betreiberverträgen vgl. Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 (189).
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
173
I. Verpflichtung der Gesellschaft Die vorstehend beschriebenen einzelvertraglichen Absprachen enthalten eine Beschreibung des Vertragsgegenstandes. Der Vertragsgegenstand legt die wechselseitigen Hauptpflichten und -rechte der Vertragsparteien fest. Diese betreffen die Erfüllung der Hauptaufgaben und etwaige finanzielle Leistungen des Verwaltungsträgers gegenüber dem Betreiber.360 Die Gesellschaft ist demnach verpflichtet, diejenigen Entscheidungen zu treffen und Realhandlungen vorzunehmen, die erforderlich sind, um die jeweilige Sachaufgabe, z. B. den Betrieb einer Ver- oder Entsorgungsanlage zu erledigen. So ist die Gesellschaft z. B. verpflichtet, den Betrieb zu organisieren und alle Arbeiten bzw. Lieferungen zu beschaffen bzw. zu veranlassen.361 Auch die Veranlassung von Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen kann zum Kreis der Verpflichtungen gehören ebenso wie z. B. kaufmännische Leistungen. Letztere können die Vorbereitung von Anträgen sowie die Erfüllung von Auflagen und Verpflichtungen umfassen, um Zuwendungen und Fördermittel der öffentlichen Hand zu erlangen, aber auch die Erstellung von Erfolgs-, Investitions- und Finanzplänen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft zur Beschaffung personeller Kapazitäten verpflichtet sein.362 Es stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen die Gesellschaft verpflichtet ist, die jeweils erforderlichen Entscheidungen „als“ oder „als und für“ den Verwaltungsträger zu treffen mit der Folge, daß die Entscheidungen und die im Anschluß daran erfolgenden Realhandlungen und Erklärungen als solche eines staatlichen Rechtssubjektes gelten. Es ist daher nach Zurechnungssätzen zu suchen, die bestimmen, daß die verschiedenen Entscheidungen mit Wirkung für ein staatliches Rechtssubjekt getroffen werden.
II. Verpflichtung der Gesellschaft als Organ Dafür, daß die jeweilige Gesellschaft Entscheidungen als Organ des Verwaltungsträgers trifft, sprechen möglicherweise die verschiedenen vertraglichen Bestimmungen, welche die jeweilige Gesellschaft als „Erfüllungsgehilfen“ oder „(Stell-)Vertreter“ des Verwaltungsträgers verpflichten, bestimmte Aufgaben für den Verwaltungsträger zu erfüllen, also z. B. eine Abfallentsorgungsanlage zu
360
Henke, DÖV 1985, S. 41 (49). BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 41. 362 Die Rechte und Pflichten des Personals und des Verwaltungsträgers werden zumeist in einem gesonderten Personalgestellungsvertrag vereinbart. Ein Beispiel für einen solchen Personalgestellungsvertrag findet sich bei Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 321 ff. 361
174
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
betreiben. Synonym für den Begriff des Erfüllungsgehilfen wird in den vertraglichen Abreden teilweise auch der Begriff des „Dritten“ verwendet.363 1. Erfüllungsgehilfen, Dritte und Stellvertreter Oben364 wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Bestimmungen über den Vertragsgegenstand z. B. folgende Klauseln enthalten können: „Die Stadt . . . bedient sich der . . . zur Erfüllung ihrer Hoheitsaufgaben im Bereich der Abfallbeseitigung als Dritter i. S. d. § 16 KrW-/AbfG. Zur Erfüllung ihrer Hoheitsaufgaben nach Straßenreinigungsgesetz NW zieht die Stadt . . . die . . . als Erfüllungsgehilfin hinzu“.365 Darüber hinaus finden sich Bestimmungen, wonach der Betriebsführer oder Betreiber die Anlagen „im Namen“ der kommunalen Gebietskörperschaft „auf deren Rechnung und Risiko“ betreibt.366 Er soll nach den vertraglichen Bestimmungen im Außenverhältnis Leistungen der Gebietskörperschaft erbringen. Daneben vereinbaren die Vertragspartner typischerweise Bestimmungen über die Abgabe von Erklärungen durch die Gesellschaft mit Wirkung für den jeweiligen Verwaltungsträger. So wird z. B. die Gesellschaft vom Verwaltungsträger beauftragt und bevollmächtigt, die im Rahmen der Erfüllung des jeweiligen Vertrages notwendigen rechtsgeschäftlichen oder sonstigen Erklärungen Dritten gegenüber „im Namen des Verwaltungsträgers“ abzugeben und entgegenzunehmen, Anträge bei Behörden zu stellen und Verfahren zu führen.367 Der umfassende Wortlaut dieser einzelvertraglichen Bestimmungen spricht dafür, daß der Geschäftsbesorgungsauftrag sich in der Regel auch auf die aktive und passive Führung von Rechtsstreitigkeiten und die Abgabe und Entgegennahme prozessualer Erklärungen erstrecken wird. Die Gesellschaft ist also nach verschiedenen vertraglichen Bestimmungen verpflichtet, Erklärungen „im Namen“ des Verwaltungsträgers abzugeben und Realhandlungen als „Erfüllungsgehilfe“ desselben vorzunehmen. Diesen Erklärungen und Realhandlungen gehen notwendig Entscheidungen voraus. Die genannten vertraglichen Bestimmungen verpflichten die Gesellschaft deshalb
363 Vgl. z. B. § 1 Abs. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 8. 364 Zweiter Teil, S. 168 ff. 365 Beispiel nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 208. 366 So z. B. BMWi (Hrsg.), Kreislaufwirtschaft, Leitfaden, S. 41; BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 41; Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765). Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 171 f. 367 Vgl. nur Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (765) und oben S. 171 f.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
175
durchweg dazu, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Dies rechtfertigt es, diese Verpflichtungsrechtssätze im folgenden gemeinsam zu untersuchen. Die vorstehend beschriebenen Bestimmungen enthalten die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft, wenn und soweit die Gesellschaft verpflichtet wird, Entscheidungen als Organ für den Verwaltungsträger zu treffen. Ausdrücklich erfolgt eine solche Zuweisung nach dem vorstehend Gesagten nicht. Die verschiedenen Vertragsbestimmungen lehnen sich vielmehr sprachlich an die entsprechenden zivilrechtlichen Vorschriften an. Soweit sie zum Treffen von Entscheidungen „im Namen“ des Verwaltungsträgers verpflichten, beziehen sie sich sprachlich auf die Konstellation der zivilrechtlichen Vertretung im Sinne von § 164 Abs. 1 S. 1 BGB, wonach eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, unmittelbar für und gegen den Vertretenen wirkt.368 Der Begriff des Vertreters kennzeichnet also einen Zurechnungszusammenhang. Die „Wirkungen“ der Stellvertretererklärungen sollen in der Person des Vertretenen eintreten. Die einzelvertraglichen Klauseln über das Handeln im Namen des Verwaltungsträgers statuieren die Zurechnung der Rechtsfolgen von Erklärungen der Gesellschaft zum Verwaltungsträger. Die Rechtsfolgen dieser Erklärungen sollen nicht in der Person der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft, sondern in der Person des vertretenen Verwaltungsträgers eintreten. Auch der Begriff des „Erfüllungsgehilfen“ ist dem Zivilrecht entlehnt.369 So wird z. B. gemäß § 278 S. 1 BGB dem Schuldner das schuldhafte Verhalten derjenigen Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient, wie ein eigenes Verhalten zugerechnet. Zugerechnet wird also das Verhalten des Erfüllungsgehilfen und dessen Verschulden.370 Der Begriff des Erfüllungsgehil368 Dementsprechend geht Brüning, Erledigung, S. 169 davon aus, die Gesellschaft trete im Außenverhältnis „als bevollmächtigter Vertreter der Gemeinde auf, so daß sich keine selbständige Rechtsbeziehung zwischen dem Betriebsführer und dem Anschlußnehmer ergibt“. 369 Der Begriff des „Erfüllungsgehilfen“ findet sich – neben § 278 S. 1 BGB, der den Begriff nicht als Substantiv verwendet – ausdrücklich in u. a. §§ 309 Nr. 7a, b; 434 Abs. 2 S. 1 BGB; § 28 Abs. 1 BLG; § 5 Abs. 2 Nr. 1 PostG und § 110 Abs. 2 Nr. 1a TKG. Der Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zu den Entwürfen eines Gesetzes zur Änderung des Abfallgesetzes von Bundesregierung und Bundesrat, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (18) nennt den „Dritten“ im Sinne von § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG-Entwurf „Erfüllungsgehilfen“. Ebenso die Begründung des Gesetzesentwurfs der Bundesregierung, BT-Drs. 12/5672, S. 1 (45). 370 Grundmann, in: Münchener Kommentar, BGB, Bd. 2a, § 278, Rn. 1, 49. Der Wortlaut des § 278 S. 1 BGB, der sich lediglich auf das Verschulden bezieht, ist insofern mißverständlich. Die §§ 276 Abs. 1 S. 1, 278 S. 1 BGB sind Zurechnungsregelungen, die bestimmen, unter welchen Umständen Entscheidungen und Realhandlungen des Schuldners selbst oder Dritter, die Pflichtverletzungen begründen, zugerechnet werden und Ansprüche begründen (vgl. Grundmann, a. a. O., § 276, Rn. 1, 2). Vgl. auch Heinrichs, in: Palandt, BGB, § 278, Rn. 1.
176
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
fen im Sinne von § 278 S. 1 BGB kennzeichnet damit einen Zurechnungszusammenhang von Entscheidungen und Realhandlungen sowie deren Rechtsfolgen zwischen zwei Personen, dem Erfüllungsgehilfen und dem Schuldner. Es läßt sich also feststellen, daß die vorstehend beschriebenen vertraglichen Bestimmungen die jeweilige Gesellschaft verpflichten, bestimmte Entscheidungen, Realhandlungen und Erklärungen mit Wirkung für den Verwaltungsträger zu treffen. Der sprachliche Bezug auf Zurechnungsvorschriften des Zivilrechts weist auf die Statuierung von Zurechnung hin, ohne damit notwendig eine Festlegung hinsichtlich einer bestimmten zivilrechtlichen Zurechnungsmodalität zu treffen. Insbesondere der Begriff des „Erfüllungsgehilfen“ wird in einem umfassenderen Sinn als in § 278 BGB verwendet und soll nicht (nur) die Zurechnung einzelner Verschuldenshandlungen, sondern die Zurechnung sämtlicher in einem Unternehmen getroffener Entscheidungen und vorgenommener Handlungen umfassen. Die Konstituierung eines Verwaltungsträgers als Zurechnungsendsubjekt verschiedener Handlungen und Entscheidungen einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft kann deshalb möglicherweise auch eine organschaftliche Zurechnung voraussetzen und lediglich die Begrifflichkeiten aus dem Zivilrecht entlehnen.371 Die Zuordnung der verschiedenen vertraglich vereinbarten Vertretungswirkungen zu einer der verschiedenen Zurechnungsmodalitäten setzt zunächst eine nähere Untersuchung der verschiedenen Vertretungsformen voraus. Es stellt sich deshalb die Frage, ob und inwieweit sich die organschaftliche Zurechnung von anderen Vertretungsformen372 unterscheidet373 und welche Vertretungsform in
371 Eine solche Begriffsentlehnung ist nicht unüblich und findet sich z. B. in der Diskussion um die organisationsrechtliche und gegebenenfalls auch haftungsrechtliche Zurechnung von Entscheidungen und Handlungen eines Verwaltungshelfers zum jeweiligen Verwaltungsträger. Hier wird der Begriff des Verwaltungshelfers häufig synonym mit dem Begriff des „Erfüllungsgehilfen“ bzw. des „technischen Erfüllungsgehilfen“ verwendet. Vgl. z. B. OVG Münster, NVwZ 1995, S. 1238 (1240); Ehlers, Privatrechtsform, S. 504 ff.; Steiner, Öffentliche Verwaltung, S. 106 f.; Brüning, Erledigung, S. 27, 141; Peine, DÖV 1997, S. 353 (357); Stober, Kommunalrecht, § 16 II 4, S. 236 f.; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (454). Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl anderer Begriffe, welche den Bereich der „Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private“ [so die Titel der Referate von Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 ff. u. Gallwas, VVDStRL 29 (1971), S. 211 ff.] kennzeichnen und eine bestimmte Vertretungsform voraussetzen, wie z. B. den Begriff der „Indienstnahme“, des „Verwaltungsmittlers“ oder des „Amtshelfers“. 372 Der Begriff der „Vertretung“ wird hier als Oberbegriff für alle Zurechnungsverhältnisse, in denen ein Rechtssubjekt Entscheidungen und Handlungen mit Wirkung für ein anderes Rechtssubjekt trifft, verwendet. Vgl. dazu auch Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, insbes. S. 1 ff., 91 ff., 107 ff., zu den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen organschaftlicher Vertretung und Stellvertretung insbes. S. 280 ff.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 II, S. 254 ff. Vgl. anders Beuthien, NJW 1999, S. 1142 ff., der sich gegen die Verwendung des Begriffs der „organschaftlichen Stellvertretung“ wendet, allerdings die Begriffe der „Stellvertretung“
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
177
den einzelvertraglichen Abreden zwischen Verwaltungsträger und Privatrechtssubjekt im Einzelfall statuiert wird. a) Organschaftliche Zurechnung und andere Vertretungsformen Gemeinsam ist sowohl den zivilrechtlichen Zurechnungsformen als auch der organschaftlichen Zurechnung, daß es sich um Fälle der Vertretung handelt. „Vertretung liegt vor, wenn kraft objektiven Rechts das Verhalten eines Rechtssubjekts (des Vertreters) einem anderen (dem Vertretenen) zugeordnet wird, so daß aus dem Verhalten des Vertreters der Vertretene verpflichtet und berechtigt wird“.374 Alle Vertretungsformen zeichnen sich dadurch aus, daß Entscheidungen eines Rechtssubjektes aufgrund rechtlicher Anordnung mit Wirkung für ein anderes Rechtssubjekt getroffen werden. Vertretung setzt also Zurechnung voraus. Der Gegenstand der Zurechnung kann im Einzelfall unterschiedlich ausgestaltet sein. So wird der Vertretene bereits durch das Vertreterverhalten verpflichtet und berechtigt, wenn ihm lediglich die Rechtsfolgen des Vertreterverhaltens „zugeordnet“ werden. Diese besondere Art der Zurechnung, die sogenannte „Zuordnung“375, hat zur Folge, daß die an ein bestimmtes Verhalten anknüpfenden Rechtsfolgen in der Person des Vertretenen eintreten. Die rechtsfolgenbedingenden Entscheidungen und Handlungen dagegen bleiben tatbestandlich solche des Vertreters.376 Die Zuordnung von Rechtsfolgen setzt also eine Trennung zwiund „Vertretung“ synonym im Sinne einer nicht organschaftlichen Zurechnung verwendet. 373 Daß ein solcher Unterschied existiert, wird verbreitet ausdrücklich festgestellt. So z. B. Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff, S. 269 (274 f.); K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 248; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 33 ff., insbes. Rn. 36. Auf die Gemeinsamkeiten der rechtlichen Grundkonstruktion der verschiedenen Vertretungsformen weisen insbesondere Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 280 ff.; ders., VerwR I8, § 35, S. 233 ff. und Kelsen, Hauptprobleme, S. 693 ff. hin. Hans J. Wolff begreift die Organschaft als einen Spezialfall juristischer Vertretung. Dem entspricht die Gliederung des zweiten Bandes von „Organschaft und Juristische Person“. Vgl. zu diesem Ansatzpunkt auch Wahl, Stellvertretung, S. 67 f. 374 Hans J. Wolff, VerwR I8, § 35 I, S. 233. Dem folgend Wahl, Stellvertretung, S. 66. Ähnlich Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 33. I. E. ebenso wohl auch Flume, Bürgerliches Recht I/2, S. 379. 375 Hans J. Wolff, VerwR I8, § 32 II, S. 194; § 35 I, S. 234; dem folgend Wahl, Stellvertretung, S. 67. So wohl auch Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 33 ff. In Bd. 2 seiner Untersuchung „Organschaft und Juristische Person“ unterscheidet Hans J. Wolff mehrere „spezifische Vertretungsfolgen“, die sich u. a. darin unterscheiden, „ob jeder vom Vertreter als solchem gesetzter Tatbestand oder nur das Ergebnis seiner Besorgung fremder Geschäfte“ zugerechnet wird (a. a. O., S. 205). 376 Hans J. Wolff, VerwR I8, § 35 I, S. 234; Wahl, Stellvertretung, S. 67.
178
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
schen den Entscheidungen und Handlungen des Vertreters und deren Rechtsfolgen voraus. Der Vertreter trifft seine Entscheidungen lediglich „für“ nicht „als und für“ das Zurechnungsendsubjekt der Verpflichtungen und Berechtigungen. Deshalb findet sich für diese Art der Zurechnung (i. w. S.) auch der Begriff der „Drittzurechnung“.377 Der Dritte, d. h. der Vertreter, steht nach verbreiteter Ansicht lediglich „neben“ dem Vertretenen.378 Der Dritte entscheide und handele nur mit Wirkung „für“, nicht „als und für“ die Juristische Person.379 Ein Beispiel für diese Art der Zurechnung ist die vorstehend erwähnte zivilrechtliche Stellvertretung. Die durch das Vertreterverhalten ausgelösten Verpflichtungen und Berechtigungen treten in der Person des Vertretenen als Zurechnungsendsubjekt auch dann ein, wenn aufgrund einer rechtlichen Anordnung bereits das Verhalten selbst tatbestandlich als ein solches des Vertretenen gilt.380 Der Vertreter trifft seine Entscheidungen dann „als und für“ den Vertretenen als Zurechnungsendsubjekt. Ein Beispiel für diese Art der Zurechnung (i. e. S.) ist die bereits oben381 erwähnte organschaftliche Zurechnung. Die Entscheidungen der Organe werden bereits „als“ solche der Juristischen Person getroffen, das Verhalten des Vertreters gilt also bereits als vom Vertretenen gesetzt.382
377 Z. B. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 247 ff., 254 ff., der diesen Begriff in einen Gegensatz zur organschaftlichen „Eigenzurechnung“ setzt. Ebenso ders., Handelsrecht, § 16 II, S. 454 ff. Von einer „Zurechnung von Drittverhalten“ spricht Hufeld, Vertretung, S. 14. 378 Das Zurechnungsverhältnis zwischen Organ und Juristischer Person unterscheidet sich deshalb von dem Zurechnungsverhältnis zwischen einem Bevollmächtigten, Besitzdiener oder Gehilfen und dem jeweiligen Geschäftsherrn. Vgl. dazu ausführlich Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 280 ff., 294 ff.; K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 248 ff., 254 ff.; ders., Handelsrecht, § 16 II, S. 454 ff. 379 So z. B. K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 10 I, S. 251. Die Diskussion um die Unterschiede zwischen der organschaftlichen Vertretung und der Stellvertretung leidet darunter, daß häufig hinsichtlich des Dritten nicht hinreichend deutlich zwischen den Entscheidungen einer natürlichen Person und denen eines rein rechtstechnischen Rechtssubjektes unterschieden wird. Ein reines Rechtskonstrukt kann rechtlich Teil eines anderen Rechtskonstruktes sein. Bei einer natürlichen Person geht die Rechtsordnung demgegenüber zumeist davon aus, daß sie rechtlich nicht Teil einer anderen natürlichen Person sein kann. Dies liegt nahe, da der hinter der jeweiligen Person stehende Mensch nicht Teil eines anderen Menschen sein kann. Soweit eine natürliche Person als Stellvertreter eine andere Person vertritt, werden deshalb dem Vertretenen nur die Rechtsfolgen der Vertretererklärungen, nicht dagegen die Erklärung selbst zugerechnet. Die Entscheidungen einer natürlichen Person gelten in diesem Fall rechtlich nicht als die einer anderen Person. Entsprechendes gilt nach nicht unumstrittener Ansicht für den Amtswalter. Vgl. so und m. N. zur Gegenansicht Remmert, Dienstleistungen, S. 299 ff. Anders z. B. Erichsen, in: FS Menger, S. 211 (217, 221). 380 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 284. 381 Zweiter Teil, S. 100 ff. 382 Vgl. so Hans J. Wolff, VerwR I8, § 35 I, S. 234; Wahl, Stellvertretung, S. 67.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
179
Gemeinsam ist diesen beiden Zurechnungsmodalitäten der Zuordnung und Zurechnung i. w. S. ihr „organisatorischer Charakter“.383 Die Rechtssätze, die einen Vertreter verpflichten, die Verpflichtung des Vertretenen wahrzunehmen, bilden aus normativer Sicht einen rechtstechnischen, gedanklichen „Zuständigkeits- bzw. Verpflichtungskomplex“.384 Dieser Zuständigkeitskomplex heißt als Wahrnehmungszuständigkeitskomplex „Organ“ bzw. „Amt“. Dementsprechend kann man den gedanklichen Zurechnungspunkt einer individualvertraglichen Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung für einen anderen auch als ein „Vertretungsamt“ bzw. „Stellvertretungsamt“385 und den rechtstechnischen Zurechnungspunkt einer Verpflichtung zur Vornahme bestimmter Handlungen als ein „Gehilfenamt“ bezeichnen.386 Diese „Vertretungsämter“ bestehen also rechtlich aus der Verpflichtung eines Vertretungssubjektes, die Verpflichtung des Vertretenen mit Wirkung für diesen wahrzunehmen. Soweit der Vertreter Juristische Person ist, müssen natürliche Personen zur Wahrnehmung des Vertretungsamtes als „Walter des Vertretungsamtes“387 verpflichtet werden. Vorstehend wurde bereits festgestellt, daß diese Vertretung, je nachdem ob eine Stellvertretung oder eine organschaftliche Vertretung vorliegt, eine solche lediglich „für“ oder aber auch „als und für“ sein kann. Es bleibt also in jedem Einzelfall zu untersuchen, welche Art der Vertretung vorliegt und welche Form der Zurechnung (i. w. S.) in der jeweiligen rechtlichen Zurechnungsanordnung vorausgesetzt wird. b) Verpflichtung zum Entscheiden in Person Nachdem oben388 bereits festgestellt wurde, daß nur natürliche Personen Walter eines Amtes sein können, kann eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft nicht als Walter eines Vertretungsamtes angesehen werden. Amtswalter
383 Wahl, Stellvertretung, S. 67. Ausführlich dazu Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 282 ff. 384 Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, S. 144 spricht auch von einem „Gedankending“. Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 110, Fn. 70. 385 So Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 283 ff. 386 Wahl, Stellvertretung, S. 73 f. weist darauf hin, daß der private Kompetenzbereich der einzelnen Rechtsperson keinen besonderen Namen hat, „da es im Privatrechtsverkehr um individuelle Personen geht und deshalb Rechte und Pflichten unmittelbar ihnen zugeordnet werden“. Ebenso Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 283. Eine arbeitsteilige organisatorische Gliederung von Verpflichtungsrechtssubjekten in verschiedene Organe und Ämter kommt lediglich bei Juristischen Personen vor. Dem steht allerdings nicht entgegen, daß es auch bei natürlichen Personen einen vom Menschen zu unterscheidenden Verpflichtungsrechtssatzkomplex, das Vertretungsamt, gibt. 387 So ausdrücklich Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, S. 283. 388 Zweiter Teil, S. 103 ff.
180
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
sind vielmehr die für die Gesellschaft entscheidenden natürlichen Personen. Die Wahrnehmungs- bzw. Geschäftsführungsverpflichtung ist an die Gesellschaft adressiert. Das Vertretungsamt ist also rechtlich konstituiert durch den Verpflichtungsrechtssatz und die sonstigen organisatorischen Rechtssätze des Gesellschaftsvertrages und Gesellschaftsrechts. Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft kann daher nach dem vorstehend Gesagten einzelvertraglich sowohl als Stellvertretungsamt als auch als ein organschaftliches Amt konstituiert sein. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Zurechnungsmodalität die vorliegenden einzelvertraglichen Abreden zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privatrechtssubjekt anordnen. Der Wortlaut der beschriebenen Bestimmungen läßt mit seinem zivilrechtlichen Bezug offen, ob und inwieweit die Zurechnungsregeln den zivilrechtlichen Zurechnungsmodellen der Stellvertretung oder Erfüllungshilfe entsprechen. Von einer einzelvertraglichen Zurechnungsanordnung i. e. S., also einer Anordnung, daß das Vertreterverhalten rechtlich als Verhalten des Vertretenen gilt, ist dann auszugehen, wenn Verpflichtungen und Berechtigungen einem staatlichen Rechtssubjekt notwendig organschaftlich und nicht im Wege einer Drittzurechnung bzw. Zuordnung zugerechnet werden. Zur Beantwortung dieser Frage ist es erforderlich, sich die besondere Qualität der Rechtsbindungen von Verwaltungsträgern in Erinnerung zu rufen. Verwaltungsträger sind nach dem normativen Ansatz als reine Rechtskonstrukte umfassend rechtlich gebunden.389 Sie sind sowohl Verpflichtungsrechtssubjekte von Eigenzuständigkeiten als auch umfassend an alle sonstigen Sonderbindungen des Staates gebunden. Diese Sonderbindungen des Staates verpflichten staatliche Rechtssubjekte möglicherweise dazu, in jedem Einzelfall einen rechtlichen Zurechnungszusammenhang zu konstruieren, in dessen Folge nicht nur die Rechtsfolgen des Vertreterverhaltens, sondern die Vertreterentscheidungen und -handlungen selbst dem jeweiligen Verwaltungsträger organschaftlich zugerechnet werden. Möglicherweise darf ein Verwaltungsträger nur durch Organe und Ämter (und deren Amtswalter), nicht aber durch „Dritte“ entscheiden, die rechtlich nicht selbst Teil der Verwaltungsorganisation sind. Zuständigkeiten weisen einem bestimmten staatlichen Rechtssubjekt eine Entscheidungsverpflichtung zu. Der Inhalt dieser Verpflichtung kann mit dem Begriff „Verantwortung“ umschrieben werden.390 Der staatliche Verpflichtungsadressat ist „verantwortlich“ für die Erfüllung der jeweiligen Verpflichtung.391 Diese Verantwortung wird einem staatlichen Verpflichtungsrechtssubjekt gerade deshalb zugewiesen, weil der Zuständigkeitsgeber davon ausgeht, daß gerade dieses Rechtssubjekt zur Erfüllung der Verpflichtung am besten geeignet ist.392 389
Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 96 ff. So ausdrücklich Pestalozza, JuS 1975, S. 366 (371). Vgl. auch Röhl, Die Verwaltung, Beiheft 2 (1999), S. 33 (39 ff.). 391 Vgl. nur Remmert, Dienstleistungen, S. 200 m. w. N. in Fn. 102. 390
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
181
Der in der jeweiligen Zuständigkeit genannte Verpflichtungsadressat ist deshalb nicht disponibel. Er muß seine Verpflichtung in Person erfüllen, d. h. die erforderlichen Entscheidungen entsprechend der Verpflichtung selbst treffen.393 Entsprechend dem Umfang der Verpflichtung muß der staatliche Verpflichtungsadressat also in Person entscheiden.394 Es läßt sich deshalb feststellen, daß die Erfüllung von Zuständigkeiten durch einen Verwaltungsträger gerade eine organschaftliche Zurechnung voraussetzt.395 Sobald sich ein Verwaltungsträger durch ein anderes Rechtssubjekt vertreten läßt, muß er dieses Rechtssubjekt als Organ bzw. Amt einschalten und (durch deren Amtswalter) als und für ihn entscheiden lassen. Der jeweilige staatliche Verpflichtungsadressat ist verpflichtet und berechtigt, in jedem Fall Organe zur arbeitsteiligen Wahrnehmung seiner Verpflichtung einzuschalten und natürliche Personen als Amtswalter zur Wahrnehmung der Wahrnehmungszuständigkeit der Organe zu verpflichten. Zuständigkeitsrechtssätze verpflichten und berechtigen den staatlichen Entscheider deshalb zur Herstellung eines Zurechnungszusammenhangs von der einzelnen menschlichen Entscheidung bis hin zur rechtstechnischen Juristischen Person. Das Organisationsprinzip der Verwaltungsorganisation ist deshalb die organschaftliche Vertretung.396 Dies hat 392
Remmert, Dienstleistungen, S. 217 ff. Pietzcker, in: Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit, S. 17 (55); Schenke, DÖV 1985, S. 452 (452); Remmert, Dienstleistungen, S. 217 ff. I. E. so wohl auch Hufeld, Vertretung, S. 14 f., der von einem Prinzip der „Selbstorganschaft“ spricht. Dieser Begriff ist der gesellschaftsrechtlichen Diskussion entlehnt und kennzeichnet dort das personengesellschaftsrechtliche Organisationsprinzip, wonach grundsätzlich nur persönlich haftende Gesellschafter Organwalter eines Gesellschaftsorganes einer Personengesellschaft sein dürfen (vgl. §§ 164, 170 HGB). Vgl. dazu nur K. Schmidt, Gesellschaftsrecht, § 14 II, S. 409 ff.; BGH, NJW 1982, S. 1817 (1817 f.). 394 Oben Erster Teil, S. 30, Fn. 8 wurde bereits festgestellt, daß staatliches Handeln in erster Linie darin besteht, Entscheidungen zu treffen. Jedem Realakt, im vorliegenden Beispiel einem solchen der Hausmüllentsorgung, geht notwendig eine Entscheidung des Handelnden voraus. Deshalb ist es gerechtfertigt, die jeweilige auf die Entscheidung folgende Realhandlung in dieser Betrachtung zu vernachlässigen. Das Prinzip organschaftlicher Zurechnung kann man auch auf die Fallgruppen des „Mandates“ [vgl. z. B. Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 10 Rn. 18 f.; BVerwGE 63, S. 258 (259 f.)] und der „Organleihe“ [vgl. z. B. Lerche, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 83, Rn. 26; BVerfGE 63, S. 1 (31)] übertragen. Soweit in diesen Fällen ein „fremdes“ Organ in die Aufgabenwahrnehmung eines Verwaltungsträgers eingeschaltet wird, kann man sich diese Einschaltung als die Konstituierung eines neuen, eigenen Organs im Sinne eines Komplexes von Wahrnehmungszuständigkeiten vorstellen, dessen Infrastruktur von dem jeweils anderen Organ zur Verfügung gestellt wurde. Es existieren also zwei verschiedene Organe mit identischer Infrastruktur, wobei das eine das Organ des Entleihers bzw. des Mandanten ist, das andere dagegen jenes des verleihenden Rechtsträgers bzw. des Mandatars. 395 Remmert, Dienstleistungen, S. 217 ff. Vgl. auch zu den Grenzen der Pflicht, zugewiesene Zuständigkeiten selbst wahrzunehmen, dies., a. a. O., S. 231 ff. 396 Eine andere Frage ist es, ob sich auf der Ebene des Dienstrechts ein Amtswalter durch einen anderen Amtswalter als seinen Stellvertreter vertreten lassen darf. Aus393
182
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
zur Folge, daß jeder in die Zuständigkeitswahrnehmung eingeschaltete Vertreter eines Verwaltungsträgers, der nicht natürliche Person, sondern reines Rechtskonstrukt ist, notwendig Organ ist und als solches ipso iure allen sonstigen Rechtsbindungen des Verwaltungsträgers unterliegt. Einer gesonderten Rechtsbindungsanordnung bedarf es nicht. Nach dem vorstehend Gesagten läßt sich also feststellen, daß staatliche Rechtsträger notwendig durch eigene Organe entscheiden.397 Es gibt keine andere Art der Zurechnung von rechtsfolgenbedingenden Entscheidungen zu Verwaltungsträgern als die organschaftliche Zurechnung. 2. Zwischenergebnis Wenn eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft einzelvertraglich verpflichtet wird, bestimmte Entscheidungen, Erklärungen und Realhandlungen als Erfüllungsgehilfe oder Stellvertreter mit Wirkung für den jeweiligen Verwaltungsträger zu treffen, dann sind diese Rechtssätze dahingehend auslegen, daß sie die Gesellschaft als Organ verpflichten, die Zuständigkeit des Verwaltungsträgers „als und für“ diesen wahrzunehmen. Die Gesellschaft ist insoweit, wie die Verpflichtung zur Geschäftsbesorgung reicht, staatliches Vertretungsorgan.398 Geht man darüber hinaus – wie bereits oben399 dargestellt – davon aus, daß Organwalter nur natürliche Personen sein können, dann kann eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft nie Walter eines Vertretungsamtes, sondern nur ein Vertretungsamt selbst sein. Die Verpflichtung einer Gesellschaft als Erfüllungsgehilfe oder als Stellvertreter eines Verwaltungsträgers kann ausgehend von dieser Prämisse nicht die Verpflichtung einer Gesellschaft als Organwalter kennzeichnen. Die z. B. als „Verwaltungshelfer“ oder als „Erfüllungsgehilfen“ in die Aufgabenwahrnehmung eingeschalteten Juristischen Personen des Privatrechts können deshalb nicht als „außerordentliche Organwalter“400 bezeichnet werden.
führlich zur Stellvertretung unter Amtswaltern Wahl, Stellvertretung, S. 11 ff., 33 ff.; Hufeld, Vertretung, S. 2 ff. 397 I. E. so wohl auch Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83 I 2, Rn. 35, wonach es nahe liege, „. . . die Dogmatik der Zurechnung im Verwaltungsorganisationsrecht auf der Grundlage der Organtheorie zu entwickeln und das Handeln der Organe den jeweiligen rechtsfähigen Funktionssubjekten als eigenes zuzurechnen“. Ders., a. a. O., Rn. 61 stellt allerdings demgegenüber ohne weitere Nachweise fest, daß es auch bei „öffentlich-rechtlich verfassten Funktionssubjekten“ Stellvertretung im Sinne einer Drittzurechnung geben könne. 398 I. E. so auch Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (457) in bezug auf die in die Aufgabe der Abwasserbeseitigung eingeschalteten Erfüllungsgehilfen, die allerdings auf das Beherrschungskriterium und nicht auf die vertraglichen Rechtsbeziehungen im Rahmen eines Kooperationsmodells abstellt. 399 Zweiter Teil, S. 103 ff.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
183
Sobald Entscheidungen eines apersonalen Rechtssubjekts einem Verwaltungsträger als eigene zugerechnet werden sollen, muß dies notwendig im Wege einer organisationsrechtlichen Zurechnung des Vertretungsamtes zum Bereich der staatlichen Organisation geschehen. Der in Gesellschaftsverträgen teilweise fixierte Begriff des Erfüllungsgehilfen, Dritten und Stellvertreters läßt sich deshalb ebenso wie der Begriff des Verwaltungshelfers dahingehend auslegen, daß er eine organisationsrechtliche Zurechnung von Entscheidungen der Gesellschaft zum Verwaltungsträger voraussetzt. III. Verpflichtung der Gesellschaft als Zurechnungsendsubjekt Es bleibt zu untersuchen, welche Bedeutung vertragliche Bestimmungen besitzen, nach denen die Gesellschaft „im eigenen Namen“ handelt. Die Klauseln statuieren jedenfalls die Zurechnung der Entscheidungen zur Gesellschaft selbst.401 So kann einzelvertraglich verabredet werden, daß die Gesellschaft Zurechnungsendsubjekt der Verpflichtungen und Berechtigungen ist, die sich aus Rechtsbeziehungen gegenüber z. B. in die Aufgabenerfüllung eingeschalteten Dritten ergeben.402 Auch finden sich Klauseln, nach denen die kommunale Gebietskörperschaft der Gesellschaft „für die Dauer dieses Vertrages die Ausübung sämtlicher Rechte und Pflichten ab dem Übergangsstichtag“ aus vertraglichen Bindungen der Körperschaft überträgt.403 Diese Zurechnungsendsubjektivität kann begrenzt sein. So kann z. B. vereinbart werden, daß „in der Vergangenheit entstandene Zahlungspflichten“ bei der Gemeinde verbleiben.404
400 So aber Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 90 a I 1, Rn. 1 („Werkzeugtheorie“); Brüning, Erledigung, z. B. S. 156. Weitere Nachweise bei Remmert, Dienstleistungen, S. 261, Fn. 54. 401 I. E. so auch M. Schulte, Rettungsdienst, S. 89, der einzelvertragliche Abreden zwischen kommunalen Gebietskörperschaften und Rettungsdienstgesellschaften untersucht. Eine Rettungsdienstgesellschaft soll Beliehener sein, wenn sie aufgrund vertraglicher und/oder gesetzlicher Bestimmungen gegenüber den Patienten „im eigenen Namen“ Verträge abschließe und/oder Gebühren erhebe. 402 Vgl. dazu z. B. § 2 Abs. 1 u. Abs. 2 S. 1, 2 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 10. Bei der Vergabe von Aufträgen an Dritte „hat die Firma X sicherzustellen, daß die der Gemeinde A aus diesem Vertrag gegenüber der Firma X zustehenden Rechte auch gegenüber dem eingeschalteten Dritten bestehen“ (§ 2 Abs. 2 S. 2 des Mustervertrages). 403 § 3 Abs. 3 S. 2 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserverund Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 11. 404 § 3 Abs. 3 S. 4 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserverund Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 11.
184
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Die Bestimmungen über das Handeln im eigenen Namen lehnen sich sprachlich an den Begriff des Handelns im eigenen Namen im Sinne von § 164 Abs. 2 BGB an, der die Zurechnung von Erklärungen zum Erklärenden selbst kennzeichnet. Auch die Klauseln über den Übergang von Verpflichtungen und Berechtigungen sprechen für eine Zurechnungsendsubjektivität der Gesellschaft. Offen bleibt allerdings in den vorstehend genannten Fällen, ob nach dem Gesellschaftsvertrag die Entscheidungen und Realhandlungen oder Verpflichtungen und Berechtigungen einem staatlichen oder einem privaten Rechtssubjekt als eigene zugerechnet werden. So ist es denkbar, daß der jeweilige Verpflichtungsrechtssatz an ein privates Zurechnungsendsubjekt adressiert ist und dieses verpflichtet, bestimmte Entscheidungen im eigenen Namen zu treffen. Der Wortlaut läßt allerdings auch eine Deutung zu, wonach eine Gesellschaft als Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit verpflichtet wird, diese Entscheidungen zu treffen. Diese zweite Konstellation kennzeichnet die Fallgruppe der Beleihung jedenfalls405 einer Juristischen Person des Privatrechts.406 IV. Zwischenergebnis Die vertraglichen Bestimmungen über die Gesellschaft als „Erfüllungsgehilfen“ des Verwaltungsträgers und das Auftreten derselben „im Namen“ des Verwaltungsträgers setzen einen Zurechnungszusammenhang voraus, ohne nähere Hinweise auf die rechtliche Konstruktion desselben zu geben. Jedenfalls läßt sich feststellen, daß die Zurechnung von Entscheidungen der Gesellschaft zum „Geschäftsherrn“, dem Verwaltungsträger, vorausgesetzt wird. Ob diese Zurechnung eine Zurechnung von Entscheidungen lediglich „für“ oder auch „als und für“ ist, bleibt nach dem Wortlaut dieser Bestimmungen offen. Geht man allerdings davon aus, daß sich Verwaltungsorganisation innerorganisatorisch in Wahrnehmungszuständigkeitsrechtssubjekte gliedert, die „als und für“ den jeweiligen Verwaltungsträger entscheiden und handeln, dann lassen sich diese Vertragsklauseln nur als organschaftliche Zurechnungssätze interpretieren, die ihrerseits die Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten voraussetzen. Lediglich soweit die Gesellschaft „im eigenen Namen“ entscheidet, bleibt offen, ob dies als privates oder staatliches Rechtssubjekt erfolgt. 405 Zur rechtlichen Konstruktion der Beleihung natürlicher Personen vgl. nur Remmert, Dienstleistungen, S. 350 ff. 406 Zum Begriff des Beliehenen als Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit vgl. nur Hans J. Wolff, VerwR II3, § 104 I, S. 387 f.; i. E. auch Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 41. Zurückhaltender Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 90 I, Rn. 1, 4, der lediglich eine „organisatorische Nähe“ der Beliehenen zu den Verwaltungsträgern konstatiert (a. a. O., Rn. 1).
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
185
In der Mehrzahl der Fallgestaltungen des Betreiber- und Betriebsführungsmodells tritt die Gesellschaft im Außenverhältnis jedenfalls gegenüber den Benutzern der Anlagen, die als öffentliche Einrichtungen gewidmet sind,407 nicht als Zurechnungsendsubjekt auf. In diesem Fall lassen sich die vertraglichen Bestimmungen zwischen Gesellschaft und Gebietskörperschaft dahingehend auslegen, daß sie insoweit die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft enthalten. Die Gesellschaft entscheidet insoweit als Organ.
C. Systematische Auslegung Im folgenden ist zu untersuchen, ob es weitere Vertragsklauseln gibt, die im Einzelfall für oder gegen die Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft aufgrund der beschriebenen einzelvertraglichen Klauseln sprechen. I. Vergütungsanspruch der Gesellschaft Typischerweise ist die Gesellschaft nach den Bestimmungen der Betreiberund Betriebsführungsverträge berechtigt, für die erbrachten Leistungen von dem Verwaltungsträger die Zahlung eines Entgeltes zu verlangen.408 Diese Vergütungsregeln enthalten zudem in der Regel eine Anpassungsklausel.409 Möglicherweise spricht eine solche Entgeltvereinbarung gegen die Staatseigenschaft der Gesellschaft, weil der Austausch von Leistungen zwischen staatlichen Rechtssubjekten in der Regel unentgeltlich erfolgt. Dies ist allerdings nicht notwendig so. Gerade im Bereich der Einschaltung von Privatrechtssubjekten in die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben finden sich Absprachen über die Vergütung des partiell in die staatliche Aufgabenwahrnehmung eingeschalteten Rechtssubjektes. So können z. B. dem Beliehenen finanzielle Ansprüche gegen den beleihenden Verwaltungsträger eingeräumt werden.410 Statt eines Entgeltes kann Verwaltungshelfern und Beliehenen auch 407 Vgl. dazu nur die Erläuterung zu § 4 Abs. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 12. Gemäß § 4 Abs. 1 dieses Vertrages sind „die von der Firma X nach diesem Vertrag übernommenen sowie in ihrem Auftrag künftig neu hergestellten, der Erfüllung der Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienenden Anlagen, Bauwerke und Gegenstände . . . öffentliche Einrichtungen“. Zur rechtlichen Bedeutung der Widmung sogleich unten Zweiter Teil, S. 188 ff. 408 Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 171 m. Fn. 349. 409 Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171); Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 449. 410 So z. B. Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 90 IX 1, Rn. 49.
186
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
das Recht zur Entgelterhebung gegenüber Dritten zugestanden werden.411 Die Zahlung eines Entgeltes an Privatrechtssubjekte, die relativ, d. h. bezogen auf ihre Zuständigkeit, staatliche Rechtssubjekte sind, ansonsten allerdings als Private entscheiden, ist keine Ausnahmeerscheinung des Verwaltungsorganisationsrechts. Einer Vereinbarung über die Zahlung eines Entgeltes durch den Verwaltungsträger an die jeweilige Gesellschaft des Privatrechts kann deshalb kein Hinweis gegen die Staatseigenschaft der Gesellschaft entnommen werden. Ob das Entgelt die Vergütung eines Privaten oder eine (Ausgleichs-)Zahlung an ein staatliches Rechtssubjekt darstellt, bleibt allerdings offen. II. Bestimmungen über die Zurechnung von Haftungsfolgen Neben den Bestimmungen über die Vergütung der jeweiligen Gesellschaft finden sich Vertragsklauseln, in denen zumeist pauschal auf die gesetzlichen Regelungen über die Haftung für auftretende Schäden verwiesen wird.412 So finden sich z. B. Bestimmungen, wonach eine Gesellschaft gegenüber „Dritten für jeden Schaden, der durch den Betrieb, die Unterhaltung der Anlagen, sowie die Durchführung der Tätigkeiten verursacht wird, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen“413 haftet. Es wird also einzelvertraglich auf diejenigen Rechtssätze verwiesen, die einen Schadensverursacher zum Ersatz von Schadensersatz verpflichten, also z. B. § 823 Abs. 1 BGB oder die zivilrechtlichen Regelungen über die Gefährdungshaftung. Die vertraglichen Bestimmungen regeln, daß Zurechnungsendsubjekt dieser Verpflichtungsrechtssätze und Schadensverursacher im Sinne des jeweiligen gesetzlichen Tatbestandes die gemischtwirtschaftliche Gesellschaft und nicht z. B. der beteiligte Verwaltungsträger ist. Es stellt sich daher die Frage, ob diesen Bestimmungen ein Hinweis gegen die Staatseigenschaft der Gesellschaft zu entnehmen ist. Möglicherweise soll die Gesellschaft für ein Verhalten haften, das ihr organisationsrechtlich als eigenes zugerechnet wird. 411 Vgl. z. B. § 21 Abs. 1 S. 1 BerlRDG (oben Fn. 316), wonach für die Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes, die nicht von der Berliner Feuerwehr, sondern von privatrechtlich organisierten Rettungsdienstgesellschaften wahrgenommen werden, Entgelte von den Patienten bzw. deren Krankenkassen erhoben werden. 412 Z. B. § 15 Abs. 2 S. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 21. Vgl. zu vertraglichen Bestimmungen über die Haftungsverteilung auch Haibt, Gestaltung, S. 122 ff., 174 ff.; Henke, DÖV 1985, S. 41 (50 ff.); Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171). 413 § 15 Abs. 2 S. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserverund Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 21.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
187
Dies setzt voraus, daß die Eigenschaft, Zurechnungsendsubjekt eines zum Schadensersatz verpflichtenden Rechtssatzes zu sein, zugleich die Eigenschaft eines Rechtssubjektes mitbestimmt, Zurechnungsendsubjekt von denjenigen Rechtssätzen zu sein, die dasselbe verpflichtet haben, die schadensverursachenden Entscheidungen zu treffen. Es ist also fraglich, ob die haftungsrechtliche Zurechnung von Entscheidungen auch deren organisationsrechtliche Zurechnung mitbestimmt.414 Am Vorliegen dieser Voraussetzung bestehen Zweifel. Aufgrund der oben erörterten Relativität der Rechtsfähigkeit415 reicht die Eigenschaft eines Rechtssubjektes, Zurechnungsendsubjekt eines Verpflichtungsrechtssatzes zu sein, nur soweit wie der Verpflichtungsinhalt und -umfang selbst. Die haftungsrechtliche Zurechnung von Entscheidungen ist also nicht notwendig an deren organisationsrechtliche Zurechnung gekoppelt. Es ist vielmehr denkbar, daß dem Rechtssubjekt seine Entscheidungen zwar haftungsrechtlich als eigene zugerechnet werden, daß es aber in bezug auf diejenigen Verpflichtungsrechtssätze, aufgrund derer es die schadensverursachenden Entscheidungen traf, lediglich rechtstechnisches Durchgangssubjekt ist. In diesem Fall gelten die Entscheidungen organisationsrechtlich als Entscheidungen eines anderen Rechtssubjektes. Schadenshaftung ist also keinesfalls in allen Fällen eine solche für eigenes Verhalten. Denkbar ist es vielmehr auch, daß ein Rechtssubjekt nicht für eigenes, sondern für fremdes Verhalten haftet.416 Die gemischtwirtschaftliche Gesellschaft kann also durchaus für ein Verhalten haftbar gemacht werden, daß organisationsrechtlich als ein solches des beteiligten Verwaltungsträgers gilt. In diesem Fall würde das Organ eines Verwaltungsträgers als Zurechnungsendsubjekt privatrechtlicher Haftungsrechtssätze für die im Unternehmen getroffenen schadensverursachenden Entscheidungen haften. Darüber hinaus ist es – je nach der gesellschafts- und einzelvertraglichen Ausgestaltung im Einzelfall – auch denkbar, daß die Gesellschaft Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit ist und zugleich als Zurechnungsendsubjekt von privatrechtlichen Verpflichtungsrechtssätzen Schadensersatz an Dritte leisten muß. Hinweise gegen die Staatseigenschaft der jeweiligen gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft sind den genannten Bestimmungen daher nicht zu entnehmen.
414 Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (157) weist darauf hin, daß der Ausgestaltung der eine „Bürgerpflicht“ statuierenden gesetzlichen Regelung u. a. hinsichtlich der Haftung „rückschließende Anhaltspunkte für die Zurechnung der Aufgabenerfüllung entnommen werden müssen“. 415 Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 109 ff. 416 Vgl. dazu nur Remmert, Dienstleistungen, S. 265 für den Fall der Haftung eines Verwaltungsträgers für ein fremdes, amtspflichtwidriges Verhalten seines Beamten gemäß Art. 34 GG i. V. m. § 839 BGB.
188
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
III. Widmung der Infrastruktur als öffentliche Einrichtung Betreiber- und Betriebsführungsverträge können Bestimmungen enthalten, wonach z. B. „die von der Firma X nach diesem Vertrag übernommenen sowie in ihrem Auftrag künftig neu hergestellten, der Erfüllung der Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung dienenden Anlagen, Bauwerke und Gegenstände . . . öffentliche Einrichtungen“ sind.417 Diese Bestimmungen werden ergänzt um Klauseln, welche die jeweilige Gesellschaft z. B. verpflichten, „nach Maßgabe dieses Vertrages zumindest alle dem gemeindlichen Anschluß- und Benutzungszwang . . . unterliegenden Abnehmer im Versorgungsgebiet mit Trinkwasser bzw. Brauchwasser zu versorgen“418 bzw. „alle dem gemeindlichen Anschluß- und Benutzungszwang . . . unterliegenden Benutzer im Entsorgungsgebiet von Abwasser zu entsorgen“.419 Möglicherweise lassen sich diesen Bestimmungen Hinweise dahingehend entnehmen, daß die Gesellschaft Organ der jeweiligen kommunalen Gebietskörperschaft ist. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn mit dem Begriff der „öffentlichen Einrichtung“ organschaftliche Zurechnung ausgedrückt werden soll. In diesem Fall enthalten die vorstehend genannten vertraglichen Verpflichtungsrechtssätze die Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten. Der Begriff der Einrichtung bezeichnet sachliche und personelle Vorkehrungen zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks.420 Eine „Einrichtung (ist) die auf die Erfüllung eines besonderen Verwaltungszwecks aus dem Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner (. . .) hin formierte Zusammenfassung von Mitteln, also von Sachen und/oder Personen“.421 Der Begriff der Einrichtung beschreibt also eine organisatorische Vorkehrung im Rahmen gemeindlicher Leistungserbringung. Ihre besondere Zwecksetzung wird mit dem Begriff „öffentlich“ beschrieben. Daß der Begriff „öffentlich“ eine bestimmte Beziehung zum Staat ausdrückt, wurde bereits oben festgestellt.422 Eine Einrichtung wird zur öffentlichen Einrichtung durch Widmung.423
417 § 4 Abs. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 12. 418 § 5 Abs. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 14. 419 § 6 Abs. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 14 f. 420 Hans J. Wolff, AfK 1963, S. 149 (149); Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 236; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 95 V 3, Rn. 180. 421 Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 236. 422 Siehe oben Erster Teil, S. 82 ff. 423 Entsprechende Widmungen enthalten kommunale Satzungen über den Betrieb einer öffentlichen Einrichtung. Vgl. z. B. § 2 Abs. 1 AbfSa Potsdam. Danach betreibt
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
189
„Die Widmung ist der Rechtsakt, der die Nutzung der Sache durch die kommunale Öffentlichkeit konstituiert“.424 An den Tatbestand der Widmung knüpfen verschiedene Rechtssätze verschiedene Rechtsfolgen, z. B. die Vorschriften über den Benutzungsanspruch gegenüber der Gemeinde425 und über die Erhebung von Gebühren.426 Als Folge der Widmung werden also Rechte und Pflichten der Einwohner gegenüber der Gebietskörperschaft und Verpflichtungen und Berechtigungen der Gebietskörperschaft gegenüber ihren Einwohnern begründet. Sie statuiert allerdings keine organisationsrechtliche Zurechnung der Betriebsgesellschaft zum Verwaltungsträger und setzt ihrerseits auch keine Zuständigkeitszuweisung voraus.427 Ob die jeweilige Gebietskörperschaft ihre Verpflichtung zur Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen zur Benutzung durch ihre Einwohner428 dadurch erfüllt, daß sie ein Privatrechtssubjekt verpflichtet, seine organisatorischen Vorkehrungen den Einwohnern zur Verfügung zu stellen, oder dadurch, daß sie selbst eine öffentliche Einrichtung durch organisationsrechtlich zurechenbare Rechtssubjekte betreibt, ergibt sich jedenfalls nicht aus der jeweiligen Widmung der Einrichtung. Den Bestimmungen über die Widmung der organisatorischen Unternehmensstruktur als öffentliche Einrichtung sind deshalb keine Hinweise auf die Organeigenschaft der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts zu entnehmen. die Landeshauptstadt Potsdam die Abfallentsorgung „als öffentliche Einrichtung“. Vgl. dazu noch unten Dritter Teil, S. 232. 424 Schmidt-Aßmann/Röhl, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 1. Kap, Rn. 107. 425 Verpflichtungssubjekt des Nutzungsanspruches (z. B. aus § 14 Abs. 1, 2 BbgGO) ist nach verbreiteter Ansicht die Gemeinde [vgl. nur Papier, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 41 I 3, Rn. 36; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 95 V 3, Rn. 200]. 426 Entsprechend den landesrechtlichen Kommunalabgabengesetzen und den jeweiligen Gebührensatzungen der kommunalen Gebietskörperschaften. Vgl. dazu sogleich unten S. 190 ff. 427 Nach Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 95 V 3, Rn. 184 ist die kommunale öffentliche Einrichtung „keine organisationsrechtliche Kategorie“. Ders., a. a. O., Rn. 196 ff. weist darauf hin, daß zwischen der Trägerschaft einer öffentlichen Einrichtung und ihrer tatsächlichen Unterhaltung und Bereitstellung zu trennen sei. Die jeweilige Gebietskörperschaft könne das organisatorische Substrat der kommunalen Einrichtung auch durch Private bereitstellen lassen. Der private Betreiber verpflichte sich privatrechtlich, die „Leistung nach den vertraglich konkretisierten inhaltlichen Vorgaben der Kommune den Nutzern gegenüber zu erbringen“. Die Gebietskörperschaft müsse sich zudem Ingerenzrechte vorbehalten, mit deren Hilfe sie die Benutzungsansprüche der Benutzer gegenüber dem Betreiber durchsetzen kann (a. a. O., Rn. 198). Püttner, DVBl. 1975, S. 353 ff. weist darauf hin, daß die im Ersten Teil beschriebene Einwirkungs- bzw. Ingerenzpflicht ursprünglich zur Durchsetzung der kommunalrechtlichen Benutzungsansprüche entwickelt wurde. 428 Eine solche Verpflichtung ergibt sich aus den Rechtssätzen, die einen entsprechenden Benutzungsanspruch der Einwohner gegenüber der Gebietskörperschaft statuieren, z. B. § 14 Abs. 1 BbgGO.
190
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
IV. Bestimmungen über die Erhebung von Gebühren Ergänzend zu den vorstehend beschriebenen Bestimmungen enthalten Betreiber- und Betriebsführungsverträge in der Regel Bestimmungen darüber, welcher der Vertragspartner verpflichtet und berechtigt sein soll, Gebühren oder privatrechtliche Entgelte429 für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen gegenüber den Benutzern zu erheben.430 Typischerweise soll nach den vertraglichen Bestimmungen die kommunale Gebietskörperschaft verpflichtet und berechtigt sein, die Gebühren von den Benutzern zu erheben.431 Möglicherweise sprechen diese Bestimmungen für die Organeigenschaft der Gesellschaft des Privatrechts. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Verpflichtung und Berechtigung der Gebietskörperschaft, Gebühren zu erheben, nach der organisationsrechtlichen Zuordnung der die jeweilige Anlage oder Einrichtung betreibenden Gesellschaft des Privatrechts richtet. Möglicherweise kann eine kommunale Gebietskörperschaft nur dann Gebühren für die Inanspruchnahme einer Einrichtung oder Anlage erheben, wenn der Betrieb der Anlage durch ein ihr organisationsrechtlich zurechenbares Rechtssubjekt vorgenommen wird. Es stellt sich damit die Frage, für welche Leistung die jeweiligen Gebietskörperschaften Benutzungsgebühren als Gegenleistung verlangen können. Dies richtet sich nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften der Kommunalabgabengesetze i. V. m. den entsprechenden Satzungen.432 Danach werden Benutzungsgebühren „für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben“.433 Der Begriff der Anlage dient ebenso wie der Begriff der Einrichtung zur Bezeichnung sachlicher und personeller Vorkehrungen zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks.434 429 Nach allgemeiner Ansicht kann die kommunale Gebietskörperschaft wählen, ob sie ein Benutzungsverhältnis privatrechtlich ausgestaltet und für die Benutzung ein privatrechtliches Entgelt erhebt, oder öffentlichrechtlich ausgestaltet und eine Gebühr erhebt. Vgl. nur Erichsen, in: ders./Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 29 IV, Rn. 33 m. w. N. in Fn. 163. 430 Vgl. nur Brüning, Erledigung, S. 157; BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 41; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 449. 431 Vgl. nur BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 21 f.; Brüning, Erledigung, S. 157. M. Schulte, Rettungsdienst, S. 56, 88 f., 92 f. verweist auf die gesetzlichen Regelungen der Rettungsdienstgesetze der Länder, welche das Recht zur Gebühren- und Entgelterhebung unterschiedlich regeln. So sollen verbreitet die beauftragten Rettungsdienstgesellschaften die Gebühren als „Zahlstellen“ des jeweiligen Verwaltungsträgers einziehen (M. Schulte, a. a. O., S. 93). Vgl. demgegenüber aber die §§ 20, 21 BerlRDG. 432 Vgl. nur Erichsen, in: ders./Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 29 IV, Rn. 36. So dürfen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 BbgKAG Abgaben nur aufgrund einer Satzung erhoben werden. 433 Z. B. § 4 Abs. 2 BbgKAG.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
191
Vorstehend wurde bereits festgestellt, daß die Widmung die Anwendbarkeit bestimmter öffentlichrechtlicher Rechtssätze auf die öffentliche Einrichtung und die widmende Gebietskörperschaft zur Folge hat. Eine organisationsrechtliche Zurechnung der Entscheidungen und Handlungen der jeweiligen Organisation zur Gebietskörperschaft wird nicht begründet. Die Gebührenpflicht der Benutzer, die Folge der Widmung einer Einrichtung bzw. Anlage als öffentlich ist, setzt die Staatseigenschaft der Betriebsgesellschaft deshalb nicht voraus. Ob die Betriebsgesellschaft organisationsrechtlich Teil der Gebietskörperschaft und daher zugleich Träger der aus der Widmung resultierenden Verpflichtungen und Berechtigungen ist, bleibt offen. Vertragliche Bestimmungen, wonach die Gebietskörperschaft berechtigt sein soll, die Gebühren für die Benutzung der Einrichtung zu erheben, lassen demnach keinen Rückschluß auf die Organeigenschaft der Betreibergesellschaft zu. V. Rechtsbindungsanordnungen Ebenso wie in gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen finden sich auch in einzelvertraglichen Bestimmungen hier sogenannte Rechtsbindungsanordnungen, nach denen die Gesellschaft verpflichtet wird, bestimmte Rechtssätze zu beachten.435 So gibt es z. B. folgende Klauselbeispiele: „Die Firma . . . hat ihre Aufgaben im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften, dem Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises und nach Maßgabe der jeweils verfügbaren Haushaltsmittel des Landkreises zu erfüllen“436 oder „Alle einschlägigen gesetzlichen und sonstigen rechtlichen Bestimmungen und Vorschriften sind stets vollumfänglich zu beachten“.437 Diese Bestimmungen sind je nachdem, ob die Gesellschaft des Privatrechts staatliches oder privates Rechtssubjekt ist, konstitutiver oder deklaratorischer Natur. Insofern kann auf die Ausführungen über die gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen verwiesen werden.438 Für die Auslegung der vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich ihres Zuweisungsgehaltes geben sie keine näheren Hinweise.
434
Hans J. Wolff, AfK 1963, S. 149 (149); Erichsen, Kommunalrecht NrW, S. 236; Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 95 V 3, Rn. 180. 435 Vgl. dazu Henke, DÖV 1985, S. 41 (49); Bauer, DÖV 1998, S. 89 (93); Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 203. 436 Beispiel nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 203. 437 § 1 Abs. 3 S. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserverund Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 9. 438 Vgl. oben Zweiter Teil, S. 141 ff.
192
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
VI. Informations-, Kontroll- und Weisungsrechte zugunsten des Verwaltungsträgers Verbreitet werden dem jeweiligen Verwaltungsträger Informations-, Kontrollund Weisungsrechte gegenüber der Gesellschaft eingeräumt.439 Möglicherweise sind diesen vertraglichen Bestimmungen Hinweise auf das Vorliegen einer Zuständigkeitszuweisung zu entnehmen. So kann sich der Verwaltungsträger über die rechtssatz- und vertragsgemäße Aufgabenerfüllung durch die Gesellschaft z. B. in Form der Einsichtnahme in betriebliche Unterlagen und Daten, mitunter auch gekoppelt an Betretungsrechte, informieren.440 Mit diesem Informationsrecht korrespondieren Mitteilungs- und Auskunftspflichten des privaten Vertragspartners z. B. über den Betriebsablauf, Betriebsstörungen, größere Revisionen und Optimierungsmaßnahmen.441 Darüber hinaus kann der Verwaltungsträger der Gesellschaft im Einzelfall Weisungen erteilen. So finden sich z. B. folgende Bestimmungen: „Die Firma X wird schriftlichen Weisungen der Gemeinde A nachkommen, welche diese in Erfüllung ihrer Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten erteilt“442 oder „Die Gemeinde A ist berechtigt, die Erfüllung der Verpflichtungen der Firma X zu überwachen und Weisungen zu erteilen . . .“.443 Diese vertraglichen Weisungsrechte eröffnen dem Verwaltungsträger die Möglichkeit, die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen bei der Aufgabenerfüllung durchzusetzen und die Geschäftsführung zu steuern.444 Der Umfang der Weisungsrechte kann sehr unterschiedlich ausgestaltet sein.445 Neben dieser einseitigen Fixierung von Informations- und Kontrollrechten finden sich auch Verträge, in denen gegenseitige Informationspflichten fixiert 439 Vgl. dazu z. B. Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94); Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 38 (47 ff.); Bodanowitz, Organisationsformen, S. 35 f.; Brüning, Erledigung, S. 163 f.; Henke, DÖV 1985, S. 41 (49); Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171); Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 449. Zahlreiche Vertragsbeispiele auch bei Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Kommunale Vertragsgestaltung III, S. 6 ff. 440 So ausdrücklich Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94). Vgl. dazu § 9 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 17 ff. 441 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94). 442 § 7 Abs. 2 S. 1 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserverund Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 16. 443 § 9 Abs. 6 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 18. 444 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94). 445 Vgl. dazu Henke, DÖV 1985, S. 41 (49).
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
193
sind.446 So werden sich z. B. „in allen Fällen einer Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen Privaten . . . die Firma X und die Gemeinde A . . . unverzüglich gegenseitig informieren“.447 Oben448 wurde bereits festgestellt, daß die Regelungen über Aufsichtsbefugnisse des Verwaltungsträgers gegenüber dem Entsorgungsunternehmen und die vertragliche Zuweisung von Weisungsrechten an den Verwaltungsträger keine Hinweise auf eine vertragliche Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten enthalten. Von der staatlichen Aufsicht über private Unternehmen kann nicht ohne weiteres auf die Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten an die Juristische Person geschlossen werden.449 Staatliche Aufsicht kann seinen Grund vielmehr in zwei verschiedenen Fallgestaltungen haben. Zum einen kann sie Ausdruck der Eingliederung eines privatrechtlich organisierten Unternehmens in die Verwaltungsorganisation sein und der Steuerung staatlicher Entscheidungen dienen. Zum anderen kann sie Instrument einer „staatlichen Regulierung gesellschaftlicher Selbstregulierung“450 sein und der Nutzbarmachung privater Handlungsrationalität dienen. Insofern kann auf die Ausführungen oben451 zur Auslegung gesellschaftsvertraglicher Bestimmungen verwiesen werden. VII. Recht zur Ersatzvornahme zugunsten des Verwaltungsträgers Teilweise wird einzelvertraglich zwischen dem staatlichen und privaten Vertragspartner ein Recht zur Ersatzvornahme zugunsten des jeweiligen Verwaltungsträgers vereinbart.452 Dieses Recht besteht, wenn und soweit das Verhalten des Privaten eine Gefährdung der Aufgabenerledigung wahrscheinlich werden läßt.453 Ergänzend zu diesem Recht der Ersatzvornahme können Informations446
Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94) m. w. N. in Fn. 57. § 7 Abs. 3 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 16. 448 Oben Zweiter Teil, S. 160 ff. 449 Vgl. dazu Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (157), Fn. 90. 450 Dazu nur Schmidt-Preuß, VVDStRL 56 (1997), S. 160 ff.; di Fabio, VVDStRL 56 (1997), S. 235 ff.; Trute, DVBl. 1996, S. 950 ff. 451 Zweiter Teil, S. 160 ff., 167. 452 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94). Vgl. auch die Fallbeispiele, in denen „die Erfüllung der Bürgerpflichten . . . außerdem durch die ,Reserve‘ der Staatsgewalt abgesichert“ wird, bei Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (157) mit Fn. 89 unter Verweis auf BVerfGE 10, S. 302 (324 ff., 327). Storr, DÖV 2001, S. 101 (109) fordert für den Fall der Einschaltung privater Sicherheitsunternehmen in die Wahrnehmung polizeilicher Aufgaben die gesetzliche Statuierung einer „Reservekompetenz“ der öffentlichen Hand für die Fälle einer verzögerten, anhaltend schlechten oder nicht erbrachten Leistung eines Privatrechtssubjekts. 453 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94) in bezug auf die Gefährdung der Abwasserentsorgung. 447
194
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
pflichten der Gesellschaft gegenüber dem Verwaltungsträger und den Benutzern vereinbart werden.454 Möglicherweise sprechen diese Bestimmungen für die Zuweisung einer Zuständigkeit an die jeweilige Kapitalgesellschaft. Sinn und Zweck dieser Klauseln ist die Gewährleistung einer umfassenden Ver- und Entsorgungssicherheit.455 Es soll sichergestellt werden, daß im Fall z. B. eines Betriebsausfalls keine Ver- und Entsorgungsengpässe auftreten.456 Feststellen läßt sich damit jedenfalls, daß der Gebietskörperschaft nach dem Vertrag eine besondere Verantwortung für die Aufgabenerfüllung durch das Privatrechtssubjekt zukommt. Welchen Inhalt und Umfang diese Verantwortung hat, ob es eine Verantwortung für eigenes oder fremdes Fehl- oder Nichtverhalten ist, bleibt allerdings offen. VIII. Gestaltung der Vertragsbeendigung und ihrer Folgen Teilweise finden sich in Verträgen zwischen staatlichen und privaten Vertragspartnern ausführliche Bestimmungen über die Gestaltung der Vertragsbeendigung und ihrer Folgen. So werden Kündigungsklauseln fixiert ebenso wie Klauseln zur Regelung der Folgen der Vertragsbeendigung, deren Inhalt abhängig ist von der Ausgestaltung des Vertragsgegenstandes.457 So finden sich, soweit die Gebietskörperschaft Eigentümer des Anlagengrundstücks bleibt und dem Betreiber ein Erbbaurecht im Sinne von § 1 Abs. 1 ErbbauVO eingeräumt hat, Regelungen über einen sogenannten „Heimfall“ der Anlage im Fall der Vertragsbeendigung. Dieser Heimfall setzt gemäß § 2 Nr. 4 ErbbauVO die Verpflichtung des Erbbauberechtigten voraus, das Erbbaurecht beim Eintreten bestimmter Voraussetzungen auf den Grundstückseigentümer zu übertragen. Den entsprechenden vertraglich vereinbarten Heimfallklauseln wird deshalb verbrei454 Vgl. dazu § 8 Abs. 2, 3 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 17. 455 Vgl. dazu §§ 8 Abs. 2 u. 3, 18 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 17, 23 f. Zu den vertraglichen Bestimmungen über die Folgen der Vertragbeendigung sogleich unten Zweiter Teil, S. 194 ff. 456 Vgl. dazu z. B. die Anmerkung zu § 18 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 23 f.: „Die entsorgungspflichtige Gemeinde muß sich dabei bewußt sein, daß Ver- und Entsorgungsengpässe – seien sie auch nur vorübergehend – keinesfalls auftreten dürfen . . . Dies bedeutet, im Extremfall muß die Gemeinde den möglichen Ausfall des privaten Unternehmers gegebenenfalls so gut wie ,von der einen auf die andere Stunde‘ übernehmen“. 457 Ausführlich dazu Bauer, DÖV 1998, S. 89 (95 f.). Vgl. ebenso Brüning, Erledigung, S. 175 m. w. N. in Fn. 626; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171). Vgl. auch Storr, DÖV 2005, S. 101 (102), der fordert, entsprechende Bestimmungen zum Gegenstand einer gesetzlichen Regelung für eine Kooperation des Staates mit privaten Sicherheitsunternehmen zu machen.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
195
tet eine große Bedeutung für die Durchsetzung der kommunalen Interessen und zur Wahrung kommunaler Handlungsfähigkeit beigemessen.458 Diese Heimfallklauseln sprechen für die vertragliche Zuweisung einer Zuständigkeit durch oben genannte einzelvertragliche Verpflichtungsrechtssätze, wenn ihnen ein Hinweis dahingehend zu entnehmen ist, daß eine organisatorische Durchsetzung der kommunalen Interessen gerade im Wege der Einschaltung eines staatlichen Rechtssubjektes in die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erfolgen soll. Zweck dieser Bestimmungen ist die durchgehende Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung auch für den Fall, „daß die Public Private Partnership scheitert“.459 Die Fälle des Scheiterns betreffen die Schlecht- oder Nichterfüllung sowie die Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz oder Betriebsaufgabe des Betreibers.460 Auch diese Bestimmungen sprechen für eine besondere Aufgabenverantwortung der Gebietskörperschaft, lassen allerdings keine näheren Rückschlüsse auf die Staatseigenschaft der Gesellschaft zu. Insofern kann auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen werden. IX. Kooperationsverträge und Einrichtung eines Beirates Neben den vorstehend beschriebenen Bestimmungen finden sich auch solche, in denen ausdrücklich von einer „Zusammenarbeit“ der Vertragspartner die Rede ist. So kann z. B. in der „Präambel“ eines entsprechenden Vertrages eine „freiwillige Zusammenarbeit“ zwischen den Vertragspartnern vereinbart werden.461 Die Vertragspartner nennen sich im Vertragstext „Kooperationspartner“.462 Der Gegenstand einer solchen Kooperationsvereinbarung kann u. a. folgende Klauseln enthalten: „Die Zusammenarbeit bewirkt keine Beschränkung der eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereiche beider Kooperationspartner; sie soll vielmehr durch eine effektive Nutzung der Kompetenz der Partner gekenn458 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (96); Anmerkung zu § 18 des Mustervertrages für einen Betreibervertrag zur Wasserver- und Abwasserentsorgung, in: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge, S. 23 f.; BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 29 ff.; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1172) m. Fn. 63; Rudolph, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung, S. 175 (183). 459 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (95) m. w. N. in Fn. 66. 460 Brüning, Erledigung, S. 175; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1171 f.). 461 Beispiel nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 18 ff. 462 Beispiele nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 42 ff.; Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (98 ff.); ders., Verwaltungswissenschaft, S. 291 ff. Vgl. auch Köhler, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 112 (116 f.) am Beispiel der Paderborner Abfallverwertung und -entsorgung GmbH PAVEG.
196
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
zeichnet sein“463 oder „Beide Vertragspartner . . . verpflichten sich, diesen Vertrag in partnerschaftlicher Weise durchzuführen und die damit verbundene Zielsetzung weiter zu entwickeln“.464 Darüber hinaus finden sich Bestimmungen über die Einrichtung eines Kooperationsgremiums, z. B. eines Beirates.465 Danach erfolgt die Bildung eines solchen Beirates z. B. zur „Erörterung und Klärung von Fragen und Problemen, die sich aus der Durchführung dieses Vertrages ergeben“.466 Er soll „den Interessenausgleich zwischen den Parteien und die erleichterte Abstimmung über die Ausübung und Weiterentwicklung vertraglicher Rechte“ fördern.467 Oben468 wurde in bezug auf entsprechende Bestimmungen in Gesellschaftsverträgen bereits darauf hingewiesen, daß diesen Bestimmungen lediglich eine besondere Betonung der gegenseitigen Informationspflichten und -rechte der beteiligten Akteure entnommen werden kann. Desweiteren ist die Einrichtung eines solchen Beirates ein Zeichen dafür, daß ein Austausch von privater Sachkunde, aber auch kommunaler Verfahrens- und Rechtskenntnisse in dem jeweiligen Entscheidungsbereich besonders wichtig ist. Die Einrichtung eines Beirates dient damit einer effektiven und rationalen Entscheidungsfindung.469 Die einzelvertraglichen Bestimmungen lassen allerdings keine Hinweise für oder insbesondere gegen eine organisationsrechtliche Zurechnung dieser in gegenseitiger Absprache getroffenen Entscheidungen zum jeweiligen Verwaltungsträger zu. Unabhängig von der Einrichtung eines Beirates ist davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger nur diejenigen Entscheidungen trifft, die er
463 Beispiel nach Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III, S. 42. 464 Beispiel nach Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (98 ff., 99). Vgl. ebenso das Beispiel a. a. O., S. 101. 465 Ausführlich dazu Bauer, DÖV 1998, S. 89 (94 f.). Vgl. ebenso Brüning, Erledigung, S. 175 m. w. N. in Fn. 628; Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (99). 466 Beispiel nach Bauer, DÖV 1998, S. 89 (95) m. w. N. in Fn. 62. Vgl. die entsprechende Klausel bei Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (98 ff.); ders., Verwaltungswissenschaft, S. 291 ff. 467 Bauer, DÖV 1998, S. 89 (95). 468 Zweiter Teil, S. 162 ff. 469 Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 93 (100); ders., Verwaltungswissenschaft, S. 291 ff. nennt ein Klauselbeispiel, wonach das Kooperationsgremium einer Wohlfahrtsgesellschaft folgende Aufgaben hat: „a) Beratung und Klärung von Zweifelsfragen bei der Auslegung und Anwendung des Zuwendungsvertrages. b) Erarbeitung von Vorschlägen zur Vereinfachung der Zuwendungspraxis . . . c) Erarbeitung eines Muster-Leistungsvertrages . . . und damit einhergehend von Leistungsstandards für die einzelnen Projektbereiche. d) Beratung über die Verwendung der Zuwendungsmittel.“ Das Kooperationsgremium macht also sehr konkrete Vorschläge für die Ausgestaltung des Entscheidungsprozesses der Gesellschaft.
5. Abschn.: Auslegung einzelvertraglicher Bestimmungen
197
treffen darf.470 Ob er diese Entscheidungen durch die Gesellschaft als Organ treffen läßt, bleibt offen.
D. Teleologische Auslegung Hinsichtlich der Ermittlung des jeweiligen Telos der vertraglichen Verpflichtungsrechtssätze gilt das oben471 zur Auslegung der Gesellschaftsverträge Gesagte. Zweck einer vertraglichen Regelung der Verpflichtungen und Berechtigungen zwischen einer Gesellschaft des Privatrechts und einem Verwaltungsträger ist eine zumindest472 sachangemessene Erledigung der jeweiligen Aufgabe.473 Mittel zur Erreichung dieses Ziels ist u. a. eine aufgabenangemessene Ausgestaltung der unternehmerischen Organisation. Hierfür stehen dem Verwaltungsträger und dem Privatrechtssubjekt verschiedene Organisationsformen zur Verfügung. Je nach Aufgabenbereich kann eine Nutzbarmachung „privater Handlungsrationalität“ 474 der Einschaltung einer Gesellschaft des Privatrechts als privatrechtliche „Organisationshülle“475 vorzuziehen sein oder umgekehrt aus Sicht des Verwaltungsträgers als nicht angemessene Organisationsform gelten. Welche Organisationsmodalität der jeweilige Verwaltungsträger für die einzelvertragliche Ausgestaltung gewählt hat, bleibt allerdings offen. Eine Ausnahme besteht für die Fälle, in denen den einzelvertraglichen Abreden zu entnehmen ist, daß die Entscheidungen der Gesellschaft dem Verwaltungsträger als eigene zugerechnet werden sollen. In diesem Fall soll die Gesellschaft als Organ des Verwaltungsträgers die jeweilige Aufgabe erledigen. Soweit sich nicht bereits aus dem Wortlaut oder der Systematik der Verträge ein Hinweis auf den verfolgten Zweck der Organisationsentscheidung ergibt, bleibt offen, welches organisatorische Mittel der jeweilige Verwaltungsträger zur Aufgabenerledigung gewählt hat. Die Intensität der Steuerung der Gesellschaft durch den Verwaltungsträger ist hierbei kein Indiz für eine organisationsrechtliche Zurechnung der Unternehmensentscheidungen.476 470
Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 118 ff., insbes. S. 120. Zweiter Teil, S. 166 ff. 472 Zu weitergehenden Entscheidungsvorgaben vgl. noch ausführlich unten Dritter Teil, S. 227 ff., 236 ff. 473 Das BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht, S. 28 f. weist darauf hin, daß das Betreibermodell entwickelt worden sei, um „eine ganzheitliche Optimierung aller ,Arbeitspakete‘, nämlich Planung, Finanzierung, Bau, Ausrüstung und Betrieb unter Einschaltung privaten Kapitals zu ermöglichen“. Dem folgend Brüning, Erledigung, S. 171; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (457). Zum Entscheidungsmaßstab der „optimalen“ Aufgabenerledigung vgl. ausführlich unten Dritter Teil, S. 227 ff., 236 ff. 474 Vgl. dazu die Nachweise oben Zweiter Teil, S. 123, Fn. 128. 475 Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 145 m. Fn. 234. 476 Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 144 ff.; 160 ff.; 192 ff. 471
198
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
E. Ergebnis Es läßt sich also feststellen, daß den einzelvertraglichen Abreden zwischen einem Verwaltungsträger und einer Gesellschaft des Privatrechts das Vorliegen einer Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung lediglich insoweit entnommen werden kann, als die Gesellschaft „als Erfüllungsgehilfe“ bzw. „im Namen“ des Verwaltungsträgers entscheiden soll. Nach dem normativen Ansatz setzen diese Klauseln notwendig eine organisationsrechtliche Zurechnung der Unternehmensentscheidungen zum Verwaltungsträger voraus. Soweit allerdings die Gesellschaft „im eigenen Namen“ entscheidet, bleibt offen, ob dies als Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit oder als privates Rechtssubjekt erfolgt. Die sonstigen typischerweise in Betriebsführungsund Betreiberverträgen zu findenden Vertragsklauseln lassen keine weitergehenden Rückschlüsse auf die Staatseigenschaft der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts zu. Zwar lassen sie eine besondere, teilweise auch gesteigerte staatliche Aufgabenverantwortung erkennen. Offen bleibt allerdings in all diesen Fällen, mit welchen organisatorischen Mitteln der jeweilige Verwaltungsträger dieser Verantwortung nachkommt. Der Wortlaut der vertraglichen Bestimmungen läßt – soweit nicht eine der vorstehend genannten eindeutigen Fallgestaltungen vorliegt – sowohl eine Einschaltung der Gesellschaft als staatliches Rechtssubjekt und privatrechtliche Organisationshülle als auch eine Verpflichtung eines Privaten zum Zweck der Nutzbarmachung privater Handlungsrationalität zu. Entsprechendes gilt für die untersuchten gesellschaftsvertraglichen Regelungen. Auch sie können typischerweise nicht zwingend dahingehend ausgelegt werden, daß sie die Zuweisung eine Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit enthalten. Die Regelungen über den Unternehmensgegenstand stehen einer solchen Regelung zwar nicht entgegen, sie können aber auch Verpflichtung einer privaten Gesellschaft sein. Ihr Wortlaut ebenso wie ihre Systematik und ihr Telos lassen verschiedene Auslegungsmöglichkeiten zu.
Sechster Abschnitt
Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen Es stellt sich deshalb für diejenigen Fälle, in denen eine Auslegung von Gesellschaftsverträgen und schuldrechtlichen Nebenabreden keine zwingenden Aussagen hinsichtlich ihres Zuweisungsgehaltes zuläßt, die Frage, woran man erkennt, daß ein solcher Vertrag im Einzelfall die Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit enthält.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
199
A. Rechtssatzkonforme Auslegung von Verträgen Geht man davon aus, daß alle staatlichen Einheiten rechtlich konstituiert sind,477 dann sind auch deren Entscheidungen notwendig rechtlich konstituiert. Zum einen verpflichtet der jeweilige Zuständigkeitsrechtssatz den Verpflichtungsadressaten dazu, bestimmte Entscheidungen nach in der Regel bestimmten Vorgaben zu treffen. Diese Verpflichtung bestimmt das „Handeln-Müssen“ des jeweiligen Adressaten. Zum anderen ist jeder staatliche Rechtsträger verpflichtet, im Rahmen seines Entscheidungsprozesses alle sonstigen Vorgaben der Rechtsordnung – das „Handeln-Dürfen“ – zu beachten. Aufgrund dieser umfassenden rechtlichen Konstituierung staatlicher Entscheidungen kommt den staatlichen Rechtssubjekten eine privatautonome Rechtsstellung nicht zu.478 Der Staat ist nicht „Subjekt autonomer Freiheit“.479 Diese besondere Rechtsstellung staatlicher Rechtssubjekte bestimmt auch die Auslegung vertraglicher Erklärungen derselben.480 Während das Ob und Wie der Entscheidungen von privatautonomen Privatrechtssubjekten durch deren Willen bestimmt wird, werden die Entscheidungen staatlicher Rechtssubjekte durch die Rechtsordnung umfassend vorgegeben.481 Man kann von einer „gesetzesdirigierten Vertragsgestaltung“482 sprechen. Die vertraglichen Erklärungen eines Verwaltungsträgers sind umfassend rechtlich gebunden und nicht Ausfluß eines „Willensentschlusses“. Geht man weiterhin davon aus, daß staatliche Rechtssubjekte im Zweifelsfall rechtmäßig entscheiden,483 dann können die Modalitäten der bereits oben484 477
Siehe oben Zweiter Teil, S. 96 ff. Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 72 ff. und Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ ders., Rechtsfragen, S. 120 (131); ders., in: Liber amicorum Erichsen, S. 63 (69) m. w. N. in Fn. 26; H. H. Rupp, in: FG BVerwG, S. 539 (541); Schnapp, VVDStRL 43 (1985), S. 172 (185). 479 H. H. Rupp, in: FG BVerwG, S. 539 (541). 480 Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 122 ff. 481 Nach de Wall, Anwendbarkeit, S. 134 gehe es der Verwaltung „nicht in erster Linie darum, diesen Willen, sondern das Gesetz durchzusetzen“. Ebenso Erichsen, in: ders./Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, § 22 III, Rn. 13 f.; ders., Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, S. 114. Vgl. auch Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (610). 482 Ausdrücklich Schmidt-Aßmann, in: FS Gelzer, S. 117 (122); ders., Ordnungsidee, S. 343. Vgl. auch Tettinger, DÖV 1996, S. 764 (769): „Gesetzliche Ausgestaltungsvorgaben“. 483 Koch, Status, S. 91 geht davon aus, daß „die Verwaltung ,im Zweifel‘ wird rechtmäßig handeln wollen“. Vgl. ebenso BayVGH, BayVBl. 1980, S. 501 (502). Vgl. dazu, daß es auf den Willen des mit Wirkung für eine Verwaltungseinheit handelnden Amtswalter nicht ankommen kann, oben Zweiter Teil, S. 125, Fn. 142. 484 Zweiter Teil, S. 126 ff. 478
200
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
dargestellten objektiven Auslegung ergänzt werden um eine hier sogenannte rechtssatzkonforme Auslegung.485 Im Rahmen einer solchen rechtssatzkonformen Auslegung ist ein Vertrag zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privatrechtssubjekt im Zweifel so auszulegen, daß die Erklärung des Verwaltungsträgers, so wie sie sich im Vertragstext findet,486 rechtmäßig ist.487 Eine rechtssatzkonforme Auslegung wählt also zwischen verschiedenen Auslegungsvarianten488 diejenige Variante, die rechtmäßiges Verwaltungshandeln darstellen würde.489 Eine rechtssatzkonforme Auslegung von Gesellschaftsverträgen oder schuldrechtlichen Nebenabreden setzt also zum einen das Bestehen von Auslegungsspielräumen und zum anderen die Existenz von Rechtssätzen voraus, gegen die eine der möglichen Auslegungsvarianten verstoßen würde. Daß Auslegungsspielräume490 bestehen, wurde vorstehend491 für die Mehrzahl der gesellschaftsund einzelvertraglichen Erklärungen festgestellt.492
485 Ebenso für eine „gesetzeskonforme“ bzw. „rechtssatzkonforme“ Auslegung BayVGH, DVBl. 1977, S. 394 (394, 395); BayVGH, BayVBl. 1980, S. 501 (502); OVG Münster, NVwZ 1992, S. 988 (988, 989); Bernsdorff, in: Obermayer, VwVfG, § 62, Rn. 44. Vgl. auch Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, S. 289 f., der auf die Möglichkeit einer „gesetzeskonforme(n) Auslegung“ (a. a. O., S. 289) hinweist. Damit könne „der Vorrang des Gesetzes stärker zur Geltung gebracht werden“ (a. a. O., S. 289 f.). Ebenso de Wall, Anwendbarkeit, S. 136 ff. m. w. N., der darauf verweist, daß eine gesetzeskonforme Auslegung auch im Privatrecht nicht unbekannt sei (a. a. O., S. 137 m. w. N. in Fn. 100); Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (610). Von einer „grundrechtskonformen Auslegung“ geht Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht, 10.50, S. 4a f. aus. 486 Vgl. zum Inhalt einer vertraglichen Erklärung eines Verwaltungsträgers bereits oben Zweiter Teil, S. 118 ff. 487 BayVGH, DVBl. 1977, S. 394 (395); BayVGH, BayVBl. 1980, S. 501 (502); OVG Münster, NVwZ 1992, S. 988 (988, 989); Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (610 f.); Bernsdorff, in: Obermayer, VwVfG, § 62, Rn. 44; Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs, VwVfG, § 54, Rn. 34. 488 Es müssen also mehrere Deutungsmöglichkeiten bestehen. Dies wurde in bezug auf die typischen einzel- und gesellschaftsvertraglichen Klauseln bereits festgestellt. Nach Koch, Status, S. 91 könne die Zweifelsregelung nur eingreifen, wenn „ein ,Wille‘ der Verwaltung nicht festgestellt werden kann“. 489 Nachweise bei de Wall, Anwendbarkeit, S. 134 ff. So auch Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns, S. 290: „. . . die Wahl derjenigen Auslegungsmöglichkeit, die den Vertrag am besten in Einklang mit dem Gesetz bringt“; ebenso Kluth, NVwZ 1990, S. 608 (610 f.). 490 Der BayVGH, DVBl. 1977, S. 394 (395) hat bei einem öffentlich-rechtlichen Vertrag derjenigen Auslegung den Vorrang gegeben, die nicht zur Nichtigkeit des Vertrages führt, „wenn sie dem objektiv erklärten Willen der Parteien beim Abschluß des Vertrages nicht ausdrücklich zuwiderläuft und sich innerhalb der Auslegungsschranke des § 157 BGB hält“. Ebenso OVG Münster, NVwZ 1992, S. 988 (989). 491 Zweiter Teil, S. 128 ff., 168 ff. 492 Eine Ausnahme besteht lediglich im Fall einzelvertraglicher Abreden, nach der die Gesellschaft „als Erfüllungsgehilfe“ bzw. „im Namen“ des Verwaltungsträgers ent-
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
201
In verschiedenen Rechtssatzbereichen wie z. B. dem Verfassungs-, Haushalts-, Kommunal- und sonstigen Verwaltungsrecht sowie – soweit anwendbar – auch in zivilrechtlichen Vorschriften finden sich Rechtssätze, die das Handeln-Dürfen staatlicher Rechtssubjekte begrenzen. So können z. B. die Vorschriften des Gesellschaftsrechts Organisationsvorgaben für staatliche Rechtssubjekte aufstellen.493 Darüber hinaus konstituiert auch das Europarecht Entscheidungsvorgaben für Verwaltungsträger. Die rechtlichen Vorgaben stellen ein sehr komplexes Normengefüge dar.494 Die Beurteilung der Frage, welche Organisationsentscheidung ein Verwaltungsträger im konkreten Fall rechtmäßig zu treffen hat, setzt die Untersuchung sämtlicher rechtlicher Entscheidungsvorgaben desselben voraus. Dies soll hier nicht weiter untersucht werden. Für die Prüfung des Zuweisungsgehaltes von Gesellschaftsverträgen und nebenvertraglichen Abreden kommt es gerade darauf an, ob es Rechtssätze gibt, die einen Verwaltungsträger zur Zuweisung von Zuständigkeiten an ein Privatrechtssubjekt verpflichten. Möglicherweise gibt es also Rechtssätze, die einen Verwaltungsträger zur Zuweisung von Zuständigkeiten an die in dessen Aufgabenwahrnehmung eingeschalteten Rechtssubjekte verpflichten. Gegen diese Rechtssätze verstößt der Verwaltungsträger, wenn er Privatrechtssubjekte als Private in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben einschaltet. Das Eingehen von Rechtsbeziehungen mit einem Privatrechtssubjekt ohne Zuweisung von Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeiten ist in diesem Fall rechtswidrig. Finden sich solche Rechtssätze, dann ist im Wege einer rechtssatzkonformen Auslegung davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger der arbeitsteilig in den Entscheidungsprozeß eingeschalteten gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft eine solche Zuständigkeit tatsächlich vertraglich zugewiesen hat.
B. Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen Oben495 wurde bereits festgestellt, daß staatliches Handeln in erster Linie darin besteht, Entscheidungen zu treffen, und staatliche Entscheidungen insbesondere durch Zuständigkeitsrechtssätze konstituiert werden. Möglicherweise verpflichten diese Zuständigkeitsrechtssätze den jeweiligen Verwaltungsträger seinerseits dazu, den in seinen Entscheidungsprozeß eingeschalteten Gesellschaften des Privatrechts Zuständigkeiten zuzuweisen, so daß im Rahmen einer scheidet. In diesen Fällen muß von der Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft ausgegangen werden. Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 174 ff. 493 Darauf wurde bereits oben Zweiter Teil, S. 127 f. hingewiesen. 494 Vgl. Bauer, DÖV 1998, S. 89 (92) zum „Rechtsregime für Privatisierungsvorgänge“. Einen Überblick gibt auch Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (413 ff.). 495 Erster Teil, S. 30, Fn. 8.
202
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
zuständigkeitskonformen Auslegung der Verträge vom Vorliegen einer solchen Zuweisung auszugehen ist. Bevor dies an einzelnen Fallbeispielen untersucht werden soll, soll vorab zunächst geprüft werden, welche allgemeinen Aussagen sich über den Verpflichtungsinhalt von Zuständigkeitsrechtssätzen treffen lassen.
I. Verpflichtung zur Zuweisung von Wahrnehmungszuständigkeiten 1. Verpflichtung zum Entscheiden in Person Es wurde bereits festgestellt, daß Zuständigkeitsrechtssätze im Einzelfall die Verpflichtung und Berechtigung des staatlichen Verpflichtungsadressaten enthalten können, einer in den Entscheidungsprozeß eingeschalteten Gesellschaft des Privatrechts eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen.496 Lassen sich in diesem Fall die vertraglichen Absprachen zwischen Verwaltungsträger und gemischtwirtschaftlicher Gesellschaft und/oder der jeweilige Gesellschaftsvertrag dahingehend deuten, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit enthalten können, ist also ein Auslegungsspielraum vorhanden, dann sind diese vertraglichen Absprachen zuständigkeitskonform dahingehend auszulegen, daß sich der Verwaltungsträger im Rahmen seines „Handeln-Müssens“ gehalten und der Gesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zugewiesen hat. 2. Inhalt und Umfang der Verpflichtung zum Entscheiden in Person Unbeantwortet blieb bislang die Frage, welche Entscheidungen im Einzelfall von dem jeweiligen staatlichen Zuständigkeitsrechtssubjekt in Person zu treffen sind. Dies bestimmt sich nach dem Inhalt und Umfang des jeweiligen Verpflichtungsrechtssatzes. Eine Verpflichtung, Juristische Personen des Privatrechts als staatliche Organe einzuschalten, besteht nur insoweit, wie auch die eigene Entscheidungsverpflichtung des Verwaltungsträgers reicht. Deshalb begrenzt der jeweilige Verpflichtungsumfang der Zuständigkeit die Pflicht des beteiligten Verwaltungsträgers, der eingeschalteten Gesellschaft des Privatrechts eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. Zuständigkeiten lassen sich in bezug auf ihren Verpflichtungsinhalt unterscheiden in sogenannte Entscheidungszuständigkeiten und sogenannte sachmaterienbezogene Zuständigkeiten.497 Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser
496 497
Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 179 ff. Differenzierung nach Remmert, Dienstleistungen, S. 219 ff.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
203
beiden Zuständigkeitstypen hinsichtlich ihres Verpflichtungsinhalts sollen im folgenden untersucht werden. Es wurde bereits festgestellt, daß alle Zuständigkeiten ein staatliches Rechtssubjekt verpflichten, bestimmte Entscheidungen nach in der Regel bestimmten Vorgaben zu treffen.498 Die Unterschiede der genannten Zuständigkeitstypen bestehen gerade in der Qualität der zu treffenden Entscheidungen. a) Entscheidungszuständigkeiten Entscheidungszuständigkeiten sind Zuständigkeiten, die eine staatliche Einheit verpflichten, eine ganz bestimmte, einen Entscheidungsprozeß abschließende Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidungszuständigkeiten finden sich in verschiedenen Sachbereichen staatlicher Tätigkeit, so z. B. im Bau- und Planungsrecht,499 aber auch im Recht des öffentlichen Personennahverkehrs. Aus Gründen der Anschaulichkeit soll daher im folgenden der Inhalt und Umfang von Entscheidungszuständigkeiten am Beispiel einer gemischtwirtschaftlichen Verkehrsgesellschaft in Dresden dargestellt werden. Gemäß § 5 Abs. 1 SächsÖPNVG haben die Aufgabenträger im Sinne von § 3 Abs. 1 SächsÖPNVG, d. h. die Landkreise und kreisfreien Städte, in Abstimmung untereinander für den Nahverkehrsraum einen verbindlichen Nahverkehrsplan zu erstellen, zu beschließen und fortzuschreiben.500 Die Stadt Dresden ist daher gemäß § 5 Abs. 1 SächsÖPNVG jedenfalls verpflichtet, einen Planungsprozeß in Gang zu setzen und diesen Entscheidungsprozeß mit einer verfahrensabschließenden Entscheidung zu beenden. In diesen Planungsprozeß schaltet sie verschiedene Privatrechtssubjekte ein, so z. B. die Dresdner Verkehrsbetriebe AG, welche aus dem VEB Verkehrsbetriebe der Stadt Dresden hervorging,501 und nun eine Eigengesellschaft der Stadt Dresden ist. Diese Eigengesellschaft war und ist an verschiedenen gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften beteiligt, u. a. bis Anfang 2005 auch an der VerkehrsConsult Dresden-Hamburg GmbH,502 einem Beratungsunternehmen 498
Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 99 m. Fn. 12. Ein Beispiel für eine Entscheidungszuständigkeit findet sich z. B. in § 2 Abs. 1 S. 1 BauGB, wonach die Gemeinden, Bauleitpläne „in eigener Verantwortung aufzustellen“ haben. Weitere Beispiele bei Remmert, Dienstleistungen, S. 224 ff. 500 Die §§ 8 Abs. 3, 13 Abs. 2 S. 2 Nr. 2c, 13 Abs. 2a, 13 Abs. 3, 16 Abs. 2 PBefG verweisen auf diese Nahverkehrspläne der Aufgabenträger. Entsprechende Vorschriften enthalten die ÖPNVGe der anderen Bundesländer. Einen Überblick über die Regelungen der ÖPNVGe gibt Jacob, LKV 1996, S. 262 ff. 501 Vgl. zur Chronik der Dresdner Verkehrsbetriebe AG die Nachweise auf www. dvbag.de, abgefragt am 05.05.2006. 499
204
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
für den Bereich des Verkehrswesens,503 das verschiedene Dienstleistungen für die Verkehrsplanung erbrachte und hierfür u. a. Verkehrskonzepte entwarf, das Verkehrsaufkommen und die optimalen Streckenführungen berechnete und den Einsatz von Verkehrstechnik prüfte.504 Die Stadt Dresden schaltete also in ihre Verkehrsplanung eine gemischtwirtschaftliche Planungsgesellschaft, die VerkehrsConsult Dresden-Hamburg GmbH, ein. Es stellt sich damit die Frage, ob und inwieweit die Stadt Dresden verpflichtet ist, Planungsentscheidungen einschließlich ihrer Vor- und Teilentscheidungen durch eigene Organe zu erbringen. Sollte die Stadt Dresden verpflichtet sein, alle Entscheidungen im Bereich der Verkehrsplanung in Person zu treffen, dann müßte zum einen der Gesellschaftsvertrag der Dresdner Verkehrsbetriebe AG zuständigkeitskonform dahingehend ausgelegt werden, daß er eine Wahrnehmungszuständigkeitszuweisung enthält. In diesem Fall wäre die Eigengesellschaft insoweit Organ der Stadt Dresden505 und als Organ der Stadt an den gemischtwirtschaftlichen Gesellschaften beteiligt. Die vertraglichen Absprachen zwischen der Eigengesellschaft und einer gemischtwirtschaftlichen Planungsgesellschaft wiederum müßten im Rahmen des Auslegungsspielraums zuständigkeitskonform dahingehend ausgelegt werden, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft enthalten.506 Dem jeweiligen Beschluß eines Nahverkehrsplanes, zu dessen Erstellung § 5 Abs. 1 SächsÖPNVG verpflichtet, geht ein Entscheidungsverfahren voraus, in dem verschiedene Entscheidungen im Vorfeld der verfahrensabschließenden Entscheidung zu treffen sind. Diese Entscheidungen sind notwendige Vor- und Teilentscheidungen für die abschließende Entscheidung. Die verfahrensabschließende Entscheidung kann ohne die Entscheidungen im vorhergehenden Ent502 Anfang 2005 zog sich der private Gesellschafter aus wirtschaftlichen Gründen aus seiner Gesellschafterstellung zurück, und an seine Stelle traten die Berliner Verkehrsbetriebe, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Die ab diesem Zeitpunkt gemischt-öffentliche Gesellschaft heißt nun VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH. Nähere Informationen unter www.vcdb.de, abgefragt am 05.05.2006. 503 Nachweise unter www.dvbag.de/partner/beteiligungen, abgefragt am 05.05.2006. Vgl. auch den Hinweis bei Muthesius, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 169 (181). 504 Vgl. § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, 3 u. 6 SächsÖPNVG. Zu den weitgehend inhaltsgleichen Regelungen des § 11 Abs. 3 S. 2 Nr. 1 bis 4 BWÖPNVG Kroh, ÖPNVG BadenWürttemberg, S. 55 ff. 505 Eigengesellschaften sind nicht notwendig Organe des staatlichen Alleingesellschafters. Denkbar ist es vielmehr auch, daß sie im Fall einer entsprechenden Zuweisung Träger einer Eigenzuständigkeit und als solche selbst Verwaltungsträger sind. 506 Entsprechendes gilt für eine gemischt-öffentliche Gesellschaft. In diesem Fall stellt sich allerdings die Frage, ob auch der andere beteiligte Verwaltungsträger verpflichtet ist, der Gesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. Dass infolge einer solchen Doppelzuweisung von Organzuständigkeiten möglicherweise ein (atypisches) Gemeinschaftsorgan zweier Verwaltungsträger entsteht, kann in diesem Zusammenhang nur angedeutet werden.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
205
scheidungsprozeß nicht getroffen werden. Sie ist vielmehr Ergebnis einer Alternativenwahl,507 die aufgrund der vorhergehenden Entscheidungen getroffen wird. Die Vor- und Teilentscheidungen bilden ihrerseits Entscheidungsmaßstäbe für die verfahrensabschließende Entscheidung. Eine Entscheidung und das ihr vorangehende Entscheidungsverfahren lassen sich also nicht von einander trennen.508 Eine verfahrensabschließende Entscheidung kann rational nur getroffen werden, wenn auch die vorhergehenden Teilentscheidungen selbst getroffen werden. Ist ein Verwaltungsträger verpflichtet, die verfahrensabschließende Entscheidung in Person zu treffen, muß er notwendig auch alle vorhergehenden Vor- und Teilentscheidungen selbst treffen.509 Daher lassen sich Entscheidungszuständigkeiten dahingehend auslegen, daß sie die Verpflichtung eines staatlichen Rechtssubjektes statuieren, alle Entscheidungen eines Entscheidungsprozesses bis hin zur verfahrensabschließenden Entscheidung in organisationsrechtlich zurechenbarer Weise selbst zu treffen.510 Soweit also z. B. die Stadt Dresden gemäß § 5 Abs. 1 SächsÖPNVG verpflichtet ist, einen Nahverkehrsplan zu erstellen, muß sie diesen Nahverkehrsplan vollumfänglich in Person erstellen. Alle in diesen Entscheidungsprozeß eingeschalteten Rechtssubjekte müssen als und für die Stadt Dresden entscheiden. Die Stadt ist damit gemäß § 5 Abs. 1 SächsÖPNVG verpflichtet, Beratungsgesellschaften, die Vorentscheidungen zum Nahverkehrsplan treffen, Wahrnehmungszuständigkeiten zuzuweisen. Die jeweiligen vertraglichen Absprachen müssen – einen Auslegungsspielraum vorausgesetzt – zuständigkeitskonform dahingehend ausgelegt werden, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft enthalten. Die zuständigkeitskonforme Auslegung gesellschafts- und einzelvertraglicher Absprachen ist also im Fall des Vorliegens sogenannter Entscheidungszuständigkeiten des beteiligten Verwaltungsträgers prinzipiell511 dahingehend vorzunehmen, daß der Verwaltungsträger verpflichtet ist, alle Entscheidungen in Person zu treffen. Die Bestimmung der Staatseigenschaft wird daher im Fall einer Eigenzuständigkeit des vertragschließenden Verwaltungsträgers im Regelfall unproblematisch möglich sein.
507 Zum Begriff der Entscheidung als Wahl zwischen Handlungsalternativen vgl. bereits oben Erster Teil, S. 30 m. Fn. 12. 508 Remmert, Dienstleistungen, S. 207 m. w. N. in Fn. 132. 509 Dies hat ausführlich Remmert, Dienstleistungen, S. 206 ff., 224 ff. aufgezeigt. 510 Remmert, Dienstleistungen, S. 224 f. 511 Ausführlich zu den Grenzen der Verpflichtung, alle Entscheidungen in Person zu treffen, Remmert, Dienstleistungen, S. 231 ff., die zugleich darauf hinweist, daß diese Grenzen „nur Ergebnisse von Bewertungen sein können“ (a. a. O., S. 231).
206
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
b) Sachmaterienbezogene Zuständigkeiten aa) Erledigung einer Sachaufgabe Sachmaterienbezogene Zuständigkeiten verpflichten staatliche Rechtssubjekte ebenfalls dazu, bestimmte Entscheidungen zu treffen, Ziel dieser Zuständigkeiten ist allerdings nicht die Herbeiführung einer verfahrensabschließenden Entscheidung, sondern die Erledigung bestimmter Sachaufgaben, also die Herbeiführung eines Zustandes in der Realität. Diese Sachzuständigkeiten finden sich in unterschiedlichen Sachbereichen, u. a. im Bereich der kommunalen Entsorgung und der Straßenreinigung. So verpflichtet z. B. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die kommunalen Entsorgungsträger zu einer Entsorgung von u. a. Hausmüll.512 Die Landesstraßengesetze und verbreitet auch die Landesstraßenreinigungsgesetze verpflichten die Gemeinden zur Reinigung von Straßen.513 Die Tatbestandsmerkmale der „Entsorgung“ bzw. der „Reinigung“ beschreiben verschiedene Handlungen. Jede Handlung setzt eine Entscheidung hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ der Ausführung dieser jeweiligen Handlung voraus.514 Auch sachmaterienbezogene Zuständigkeiten verpflichten den staatlichen Adressaten also dazu, bestimmte Entscheidungen zu treffen.515 Im Gegensatz zu den vorstehend erörterten Entscheidungszuständigkeiten wird der Entscheidungsprozeß allerdings nicht durch eine verfahrensbeendende Entscheidung abgeschlossen, sondern durch die Erledigung einer Sachaufgabe, also durch einen Realakt. Es muß ein Zustand in der Realität herbeigeführt werden.516 Der verpflichtete Verwaltungsträger hat all diejenigen Entscheidungen zu treffen, die erforderlich sind, damit die Sachaufgabe erledigt wird. Diese Erledigung von Sachaufgaben setzt im Gegensatz zu den vorstehend erwähnten Entscheidungszuständigkeiten nicht notwendig voraus, alle Entscheidungen in Person zu treffen.517 Eine Entscheidung im Rahmen eines Entsorgungsprozesses und die anschließende Realhandlung können, müssen aber nicht abhängig sein von einer vorhergehenden Teil- oder Vorentscheidung. Denkbar ist es vielmehr auch, daß sich der jeweilige Verwaltungsträger auf einige Entscheidungen beschränken kann, solange nur im Ergebnis die Sachaufgabe entsprechend den Vorgaben der Zuständigkeit von Dritten tatsächlich erledigt wird. 512 Ausführlich zum Inhalt und Umfang dieser Regelung unten Dritter Teil, S. 218 ff. 513 So z. B. § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG und § 50 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 S. 1 MVStrG. Ausführlich zum Inhalt und Umfang dieser Regelungen unten Dritter Teil, S. 234 ff. 514 Krebs, Kontrolle, S. 28; Remmert, Dienstleistungen, S. 15 m. Fn. 12. 515 So die These oben Zweiter Teil, S. 203. 516 Vgl. dazu Remmert, Dienstleistungen, S. 219 ff. 517 Remmert, Dienstleistungen, S. 223.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
207
Welche Entscheidungen der Verwaltungsträger treffen muß, richtet sich nach der Zuständigkeit im Einzelfall. Die Bestimmung des Verpflichtungsinhaltes und -umfangs hat durch Auslegung zu erfolgen.518 Im Wege der Auslegung ist zu ermitteln, welche Entscheidungen der jeweilige Verpflichtungsadressat zu treffen hat. Stellt man sich einen Entscheidungsprozeß mit entsprechenden auf die Entscheidungen folgenden Realhandlungen vor, dann kann eine Zuständigkeit zum Treffen aller Entscheidungen im Rahmen dieses Entscheidungsprozesses verpflichten, oder lediglich dazu, nur einzelne Entscheidungen zu treffen. Je nachdem ist der Verpflichtungsadressat unterschiedlich „verantwortlich“.519 bb) Verantwortungsstufen Verbreitet werden zum Zweck einer Grobeinteilung zwei verschiedene Verantwortungsstufen520 unterschieden. (a) Erfüllungsverantwortung Zum einen ist es denkbar, daß den Verpflichtungsadressaten eine sogenannte „Erfüllungsverantwortung“521 trifft. Dies bedeutet, daß der Verpflichtungsadressat alle im Rahmen eines Entscheidungsprozesses erforderlichen Entscheidungen treffen muß, an dessen Ende die Erledigung der Aufgabe steht. Es muß also ein Verpflichtungsrechtssatz vorliegen, der einen Verpflichtungsadressaten verpflichtet, umfassend selbst zu entscheiden. Diese Verpflichtung erfüllt der Verpflichtungsadressat nur dann, wenn er tatsächlich alle Entscheidungen in Person trifft. Dies bedeutet, daß alle in diesen Entscheidungsprozeß eingeschalteten organisatorischen Einheiten (durch ihre Walter) als organisationsrechtlich 518
Vgl. dazu Remmert, Dienstleistungen, S. 222. Zum Begriff der Verantwortung vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 180 m. Fn. 390. 520 Bereits Ossenbühl, VVDStRL 29 (1971), S. 137 (145 ff.) weist auf verschiedene „Erfüllungsmodalitäten“ staatlichen Handelns hin. Aus der jüngeren Zeit vgl. z. B. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 170, der von „Stufungen staatlicher Verantwortung“ spricht. Ebenso ders., in: Hoffmann-Riem/ders./Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 11 (43 f.). „Verantwortungsstufen“ erkennen z. B. Burgi, Funktionale Privatisierung, S. 63 ff., 86 f.; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 400 ff. Die „unterschiedliche Intensität staatlicher Verantwortung“ untersucht Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 171 (198 ff.); ders., DVBl. 1996, S. 950 ff. Vgl. ebenso z. B. Bauer, VVDStRL 54 (1995), S. 243 (277 ff.); Osterloh, VVDStRL 54 (1995), S. 204 (236); Schoch, DVBl. 1994, S. 962 (975 ff.); Schuppert, DÖV 1995, S. 761 (768 ff.); ders., in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel, S. 19 (24 ff.); Weiß, DVBl. 2002, S. 1167 (1173 ff.). 521 Vgl. dazu z. B. Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 171; Schuppert, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel, S. 19 (24 ff.); Weiß, DVBl. 2002, S. 1167 (1173 ff.). 519
208
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
zurechenbare Untereinheiten, d. h. als Organe des Verwaltungsträgers entscheiden müssen. Eine solche umfassende Erfüllungsverantwortung ist also Organisationsvorgabe für den Verwaltungsträger. Die jeweilige Zuständigkeit verpflichtet ihn dazu, Entscheidungen durch Einheiten zu treffen, die ihm organisationsrechtlich als eigene zugerechnet werden. Schaltet der jeweilige Verwaltungsträger in solchen Fällen eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft in seinen Entscheidungsprozeß ein, ist er verpflichtet, der Gesellschaft eine organisatorische Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. (b) Sicherstellungs- und Gewährleistungsverantwortung Zum anderen ist es auch denkbar, daß Zuständigkeitsrechtssätze ein staatliches Rechtssubjekt dazu verpflichten, die Erledigung einer Sachaufgabe durch private (oder staatliche) Dritte sicherzustellen. So verpflichtet z. B. § 3 Abs. 2 BbgGO die Gemeinden zur „Sicherung und Förderung eines breiten Angebotes an Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen“.522 § 1 Abs. 1, 2 RegG i. V. m. den entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften523 verpflichtet die nach Landesrecht zuständigen Stellen zur „Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr“. Gemäß Art. 18 Abs. 1 S. 1 BayRDG524 haben die Landkreise und kreisfreien Gemeinden die Aufgabe, „Notfallrettung und Krankentransport nach Maßgabe dieses Gesetzes flächendeckend sicherzustellen (Rettungsdienst)“. Der Inhalt einer solchen Sicherstellungsverpflichtung ist abhängig von der jeweiligen Sachaufgabe im Einzelfall und kann z. B. in der Auswahl und Steuerung des Dritten, aber auch in einer Subventionierung oder der Organisation und Förderung externer Angebote privater Anbieter525 bestehen. Eine Sicherstellungs- bzw. Gewährleistungsverpflichtung kann der Verwaltungsträger im Einzelfall darüber hinaus auch dadurch erfüllen, daß er sich an einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft beteiligt, ohne dieser eine Organzuständigkeit zuzuweisen, diese aber möglicherweise mit Hilfe der oben526 dargestellten Ingerenzinstrumente beherrscht. Staatliches Entscheiden besteht in den Fällen staatlicher Sicherstellungsverantwortung lediglich in dem begrenzt zugewiesenen Entscheidungsumfang. Dies kann zum einen die staatliche Beteiligung an sich sein, zum anderen auch die
522 523 524 525 526
Auf dieses Beispiel weist Remmert, Dienstleistungen, S. 218 ff. m. Fn. 167 hin. Zum SächsÖPNVG vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 203 ff. Vgl. ebenso z. B. § 2 Abs. 1 S. 1 BerlRDG. Remmert, Dienstleistungen, S. 219 f. Erster Teil, S. 36 ff.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
209
aus der Beteiligung und Anteilseignerschaft folgende Wahrnehmung von Ingerenzrechten.527 Die Verantwortung des staatlichen Rechtssubjekts beschränkt sich in diesem Fall auf die Sicherstellung oder Gewährleistung der Aufgabenerledigung.528 Das Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit oder das Bestehen eines „bestimmenden Einflusses“ des Verwaltungsträgers ist für die Beurteilung der Staatseigenschaft unerheblich, kann aber im konkreten Einzelfall Konsequenz einer entsprechenden Sicherstellungsverpflichtung des beteiligten Verwaltungsträgers sein. Die oben529 erörterte Ausübung von Ingerenz durch einen an einer Gesellschaft beteiligten Verwaltungsträger ist in diesem Fall Inhalt der Zuständigkeitsverpflichtung.530 Umgekehrt ist die Zuständigkeit zugleich Grenze der Wahrnehmung der kommunalrechtlichen Ingerenzpflicht.531 Eine Einflußnahme auf Entscheidungen einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft ist dann nicht „angemessen“ im Sinne der kommunalrechtlichen Vorschriften,532 wenn und soweit die Ausübung der Einflußnahme ihrerseits zuständigkeitswidrig ist. Eine „überwirkende Verantwortung“533 des Staates ist nicht zuständigkeitsgemäß. Indem die kommunal-
527 Dazu ausführlich unten Dritter Teil, S. 218 ff., 234 ff. am Beispiel des kommunalen Entsorgungs- und Straßenreinigungsrechts. 528 Dementsprechend wird verbreitet von einer „Sicherstellungsverantwortung“ oder einer „Gewährleistungsverantwortung“ gesprochen. Vgl. nur z. B. Britz, Die Verwaltung 37 (2004), S. 145 (148 ff.); Bumke, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, S. 73 (120 ff.); Hermes, Infrastrukturverantwortung, S. 337 ff.; Hoffmann-Riem, DÖV 1997, S. 433 (442); Schuppert, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel, S. 19 (24 ff.); ders., Verwaltungskooperationsrecht, S. 111 ff.; Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen, S. 167 (201 f.); Weiß, Privatisierung, S. 293, 297 ff.; ders., DVBl. 2002, S. 1167 (1174 ff.). Ausführlich zu den verschiedenen Modellen und Begrifflichkeiten einer sogenannten Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft Weiß, a. a. O., S. 298 f. m. w. N.; ders., DVBl. 2002, S. 1167 (1173 ff.). Vgl. auch Pitschas, DÖV 1998, S. 907 (911 f.). 529 Erster Teil, S. 77 ff. 530 I. E. ebenso v. Danwitz, AöR 120 (1996), S. 595 (604 f.), der „das Bestehen hoheitlicher Ingerenzen unmittelbar aus der Pflicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ ableitet (S. 604). Die oben Erster Teil, S. 79, Fn. 275 genannten kommunalrechtlichen Vorschriften über die Sicherung eines „angemessenen Einflusses“ statuieren demnach lediglich die Modalitäten der Einwirkung, nicht die Einwirkungspflicht selbst. Einer Ableitung der Ingerenzpflicht aus Art. 20 Abs. 2 S. 2 GG bedarf es nicht. Anders dagegen z. B. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 225 ff., der sich gegen eine Ableitung der Ingerenzpflicht aus Zuständigkeitsrechtssätzen wendet (a. a. O., S. 229 ff.). Eine Zuständigkeit sei lediglich „pflichtenbegrenzend“, nicht „pflichtenbegründend“. 531 Vgl. dazu ausführlich m. w. N. Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 229 ff. 532 Vgl. dazu die Nachweise oben Erster Teil, S. 79, Fn. 275. 533 Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 100 f. geht von einer „überwirkenden Legitimationsverantwortung“ des Staates aus. Aufgrund der Verflechtungen von Staat und Gesellschaft „im intermediären Bereich“ sei es „nicht sachgerecht“, die staatliche Legitimationsverantwortung auf den staatlichen Entscheidungsbeitrag zu beschränken (a. a. O., S. 100).
210
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
rechtlichen Vorschriften Regelungen für kommunale Organisationen in Privatrechtsform aufstellen, ergänzen sie die jeweiligen kommunalrechtlichen Zuständigkeitsvorschriften für die kommunale Gebietskörperschaft. Nach diesen Zuständigkeitsvorschriften richtet es sich, ob eine kommunale Gebietskörperschaft ein Unternehmen selbst betreiben muß, oder ob es genügt, sich mehrheitlich oder mit Minderheitsbeteiligung an einem solchen zu beteiligen. Deshalb sind die Regelungen über die kommunalrechtliche Ingerenzpflicht lediglich akzessorisch zur Zuständigkeit des Verwaltungsträgers. Sie stellen klar, daß die Zuständigkeitswahrnehmung auch im Wege der Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft durch Einflußnahme auf die unternehmerischen Entscheidungen erfolgen kann. Hinsichtlich der Modalität der Einflußnahme nennen sie beispielhaft die Mitgliedschaft in einem Überwachungsorgan und die Fixierung von Einflußnahmemöglichkeiten im Gesellschaftsvertrag. Auch „in anderer Weise“534 kann allerdings ein angemessener Einfluß gesichert werden. Es ist denkbar, daß im Einzelfall ein „angemessener Einfluß“ nur durch Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit hergestellt werden kann. Umgekehrt kann die sogenannte Gewährleistungsverantwortung im Einzelfall auch dadurch erfüllt sein, daß ein staatlicher Verwaltungsträger die Entscheidungen und Handlungen Privater rechtlich fördert oder finanziert, oder dadurch, daß der jeweilige Verwaltungsträger eine rechtliche Rahmenordnung für private Entscheidungen setzt oder für die Fälle der Nicht- oder Schlechterfüllung eine staatliche Einstandspflicht vorsieht.535 Welchen Inhalt und Umfang die jeweilige Sicherstellungsverantwortung des Staates hat, ob also der Gesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zugewiesen werden muß, oder ob z. B. eine staatliche Teilnahme am Entscheidungsprozeß der Gesellschaftsorgane genügt, richtet sich nach dem Inhalt und Umfang der jeweiligen Zuständigkeit des beteiligten Verwaltungsträgers. Das Verhältnis von Sicherstellungs- und Erfüllungsverantwortung kann ein Alternativ-, im Einzelfall aber auch ein Ergänzungsverhältnis sein. So ist es 534 So § 108 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 NrWGO. Auch die sonstigen kommunalrechtlichen Vorschriften regeln nicht abschließend, mit welchen Mitteln ein „angemessener“ Einfluß gesichert werden soll. Vgl. dazu Art. 92 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BayGO; § 102 Nr. 2 BbgGO; § 103 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BWGO; § 122 Abs. 1 S. 1 HeGO; § 69 Abs. 1 Nr. 3 MVKV; § 109 Abs. 1 Nr. 6 NdsGO; § 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 RPGO; § 110 Abs. 1 Nr. 3 SaarlKSVG; § 96 Abs. 1 Nr. 2 SächsGO; § 117 Abs. 1 Nr. 3 SAGO; § 102 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 SHGO; § 73 Abs. 1 Nr. 3 ThürKO und § 65 Abs. 1 Nr. 3 BHO sowie die entsprechenden Vorschriften der Landeshaushaltsordnungen. 535 Dementsprechend wird z. B. von einer staatlichen „Kontroll-, Privatisierungsfolgen- und Beobachtungsverantwortung“ [Bauer, VVDStRL 54 (1995), S. 243 (278 f.)] oder einer staatlichen „Beratungs-, Überwachungs-, Organisations- und Einstandsverantwortung bei gesellschaftlicher Schlechterfüllung“ [Schmidt-Aßmann, in: HoffmannRiem/ders./Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, S. 11 (43 f.); Britz, Die Verwaltung 37 (2004), S. 145 (148)] gesprochen. Weitere Beispiele bei Weiß, Privatisierung, S. 298 f.; ders., DVBl. 2002, S. 1167 (1173 ff.).
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
211
denkbar, daß ein Zuständigkeitsrechtssatz den jeweiligen staatlichen Adressaten ausschließlich zur Wahrnehmung einer Sicherstellungsverantwortung verpflichtet. Zum anderen ist es auch denkbar, daß Sachzuständigkeiten die Entscheidungsverpflichtung ihres Adressaten nicht ausdrücklich auf eine Sicherstellung begrenzen, sondern sprachlich umfassend formuliert sind. Eine Auslegung dieser Rechtssätze kann ergeben, daß die Verpflichtung des staatlichen Rechtssubjektes darin besteht, darüber zu entscheiden, ob es sich im konkreten Fall auf eine Sicherstellung und Gewährleistung beschränkt oder umfassend alle Entscheidungen in Person trifft.536 An welchen Entscheidungsmaßstäben eine solche Organisationsentscheidung auszurichten ist, richtet sich nach der Zuständigkeit im Einzelfall und kann an dieser Stelle dahingestellt bleiben.537 3. Zwischenergebnis Zuständigkeitsrechtssätze verpflichten ihre Adressaten dazu, Entscheidungen unterschiedlichen Inhalts und Umfangs zu treffen. Soweit wie die Verpflichtung des Verwaltungsträgers reicht, ist sie in Person zu erfüllen. Dies schließt die Einschaltung von Privatrechtssubjekten in den jeweiligen Entscheidungsprozeß nicht aus, der Verwaltungsträger ist allerdings verpflichtet, soweit wie seine Verpflichtung reicht, seine Entscheidungen durch organisationsrechtlich eigene Organisationseinheiten treffen zu lassen. Er muß der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts deshalb insoweit eine Wahrnehmungszuständigkeit zuweisen. Es stellt sich in jedem Einzelfall die Frage, welche Entscheidungen die jeweiligen Zuständigkeitsrechtssätze ihrem Adressaten aufgeben. Nicht jeder Zuständigkeitsrechtssatz verpflichtet wie im Fall der sogenannten Entscheidungszuständigkeiten dazu, alle Entscheidungen eines Entscheidungsprozesses selbst zu treffen. Denkbar ist es vielmehr auch, daß die Zuständigkeit lediglich die Verpflichtung zur Sicherstellung der Erledigung der jeweiligen Aufgabe beinhaltet oder den Entscheidungsträger verpflichtet, selbst darüber zu entscheiden, welche Organisationsentscheidung zu treffen ist. Welchen Inhalt und Umfang eine Zuständigkeitsverpflichtung hat, ist durch Auslegung zu ermitteln. Soweit den jeweiligen Verwaltungsträger lediglich eine Sicherstellungsverantwortung trifft, kann er diese Verpflichtung erfüllen, indem er dafür sorgt, daß ein Privater tatsächlich diese Aufgabe erledigt. In Person hat er lediglich die Sicherstellung der Aufgabenerledigung zu verantworten. Nur insoweit besteht die Verpflichtung, eigene Organe in die Aufgabenerfüllung einzuschalten.
536 537
Vgl. dazu Remmert, Dienstleistungen, S. 222. Vgl. dazu ausführlich unten Dritter Teil, S. 216 ff.
212
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
II. Verpflichtung zur Zuweisung von Eigenzuständigkeiten Rechtssätze, die einen Verwaltungsträger dazu ermächtigen, seine Eigenzuständigkeit auf ein Privatrechtssubjekt (oder einen anderen Verwaltungsträger) zu übertragen,538 werden verbreitet Delegationsermächtigungen genannt.539 Geht man davon aus, daß staatliche Entscheidungen umfassend rechtlich konstituiert sind, dann kann es keine autonome Entscheidung eines Verwaltungsträgers über die Übertragung einer Eigenzuständigkeit an ein anderes Rechtssubjekt geben. Der jeweilige Verpflichtungsrechtssatz verpflichtet den Verwaltungsträger vielmehr zum Treffen einer ganz bestimmten Entscheidung, die in der Übertragung bzw. Nicht-Übertragung einer solchen Eigenzuständigkeit liegen kann. Zu welcher Entscheidung der Verwaltungsträger im Einzelfall verpflichtet ist, ist durch Auslegung der jeweiligen Delegationsermächtigung zu ermitteln. Soweit eine solche Verpflichtung zur Zuweisung einer Eigenzuständigkeit im Einzelfall vorliegt, sind die vertraglichen Absprachen zwischen Verwaltungsträger und Privatrechtssubjekt – einen entsprechenden Auslegungsspielraum vorausgesetzt – dahingehend auszulegen, daß sie die Zuweisung einer Eigenzuständigkeit beinhalten.540 Diese Zuständigkeitsrechtssätze, die einen Verwaltungsträger unter bestimmten Voraussetzungen verpflichten, einem Privatrechtssubjekt eine Eigenzuständigkeit zu übertragen, sind zu unterscheiden von den Rechtssätzen, die unter bestimmten Voraussetzungen zu einer sogenannten „verantwortungsbefreienden Delegation“ berechtigen und verpflichten. Als Folge einer solchen verantwortungsbefreienden Delegation wird das Privatrechtssubjekt als Privater verpflichtet, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Der ursprünglich zuständige Verwal538 Vgl. z. B. § 16 Abs. 2 S. 1 KrW-/AbfG. Ebenso § 18a Abs. 2a S. 1 WHG i. V. m. den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen. Zum Inhalt dieser Vorschriften ausführlich unten Dritter Teil, S. 216 ff. Zum Erfordernis einer ausdrücklichen Delegationsermächtigung vgl. ausführlich Remmert, Dienstleistungen, S. 202 ff. 539 Zum Begriff der Delegation vgl. nur Bonk, in: Stelkens/ders./Sachs (Hrsg.), VwVfG, § 4, Rn. 41; Loeser, System II, § 10, Rn. 43; Remmert, Dienstleistungen, S. 202; Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht, § 10, Rn. 16 f.; Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 IV, S. 23 f. 540 Die Übertragung der jeweiligen Eigenzuständigkeit hat zur Folge, daß die ursprüngliche Zuständigkeit untergeht und eine neue Verpflichtung des Privatrechtssubjektes, dem Delegaten, begründet wird. Eine Zuständigkeit setzt notwendig einen Verpflichtungsadressaten voraus. Eine Verpflichtung ohne Verpflichtungssubjekt ist nicht denkbar. Wenn Delegation die Übertragung einer Zuständigkeit auf ein anderes Rechtssubjekt, also den Wechsel des Verpflichtungsadressaten bedeutet, dann hat Delegation notwendig den Untergang der ursprünglichen Zuständigkeit zur Folge. Delegation ist also die Begründung einer neuen Zuständigkeit des Delegaten (Barbey, Rechtsübertragung, S. 48 ff.; Lauscher, Delegation, S. 44 ff., insbes. S. 50). Vgl. dazu Remmert, Dienstleistungen, S. 202 m. w. N. in Fn. 107 auch zur Gegenansicht.
6. Abschn.: Zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen
213
tungsträger ist von seiner Verantwortung befreit.541 Ob und inwieweit ihn eine sogenannte „Folgenverantwortung“542 trifft, ist eine Frage der Auslegung der jeweiligen Zuständigkeit des Verwaltungsträgers. Ob ein Rechtssatz zu einer verantwortungsübertragenden oder einer verantwortungsbefreienden Delegation ermächtigt, ist durch Auslegung im Einzelfall zu ermitteln.543
C. Ergebnis Mit Hilfe einer zuständigkeitskonformen Auslegung von Gesellschaftsverträgen gemischtwirtschaftlicher Unternehmen und schuldrechtlichen Nebenabreden kann deren Zuweisungsgehalt ermittelt werden. Gibt es Rechtssätze, die einen Verwaltungsträger im Einzelfall zur Zuweisung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit verpflichten, ist – soweit ein entsprechender Auslegungsspielraum vorhanden ist – zuständigkeitskonform von dem Vorliegen einer entsprechenden staatlichen Erklärung auszugehen. Zuständigkeitsrechtssätze können ihren Verpflichtungsadressaten im Einzelfall zu einer solchen Zuweisung von Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeiten verpflichten. Entscheidungszuständigkeiten verpflichten den jeweiligen Verwaltungsträger dazu, alle Entscheidungen des Entscheidungsprozesses in Person zu treffen. Soweit dieser also eine Gesellschaft des Privatrechts in diesen Entscheidungsprozeß einschaltet, muß er dieser eine Wahrnehmungszuständigkeit zuweisen. Darüber hinaus ist es denkbar, daß auch sogenannte sachmaterienbezogene Zuständigkeiten die Verpflichtung des Verwaltungsträgers beinhalten, alle Entscheidungen durch organisationsrechtlich zurechenbare Untereinheiten zu treffen. Ob dem Verwaltungsträger eine solche umfassende Erfüllungsverantwortung zukommt, oder ob er lediglich verpflichtet ist, die Erledigung der jeweiligen Sachaufgabe – auch durch Private – sicherzustellen, ist im Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln. Die sogenannten Delegationsermächtigungen verpflichten die Verwaltungsträger unter bestimmten Voraussetzungen dazu, einem Privatrechtssubjekt eine Eigenzuständigkeit zuzuweisen. Unter welchen Voraussetzungen dies der Fall ist, muß ebenfalls durch Auslegung im Einzelfall ermittelt werden.
541
Remmert, Dienstleistungen, S. 201 f. So ausdrücklich Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 172. Trute, DVBl. 1996, S. 950 (951) spricht von einer „staatlichen Rahmenverantwortung für den gemeinwohlverträglichen Interessensausgleich unter Privaten“. 543 Vgl. dazu das Beispiel unten Dritter Teil, S. 221 f. 542
214
2. Teil: Gesellschaften als Zuständigkeitsrechtssubjekte
Ergebnis zum Zweiten Teil Nach dem hier sogenannten normativen Ansatz ist eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft Organ eines Verwaltungsträgers, wenn und soweit sie Adressat einer Wahrnehmungszuständigkeit ist. Sie ist Verwaltungsträger, wenn und soweit sie Zurechnungsendsubjekt einer Eigenzuständigkeit ist. Diese so verstandene Staatseigenschaft der Gesellschaft reicht soweit wie der Verpflichtungsgehalt der jeweils zugewiesenen Zuständigkeit. Sie ist damit relativ. Staatliche Entscheidungen liegen nur insoweit vor, wie sie durch die Gesellschaft in Ausübung ihrer Zuständigkeit getroffen werden. Ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen ist deshalb ein Unternehmen, das in der Regel sowohl staatliche als auch private Entscheidungen trifft. Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeiten können sowohl gesellschaftsvertraglich als auch einzelvertraglich zugewiesen werden. Im Regelfall stellt sich daher die Frage, woran man erkennt, daß vertragliche Verpflichtungsrechtssätze gerade die Verpflichtung der Gesellschaft enthalten, „als und für“ bzw. „als“ ein Verwaltungsträger zu entscheiden. Eine (objektive) Auslegung dieser Rechtssätze führt nicht in allen Fällen zu eindeutigen Ergebnissen. Insbesondere den Gesellschaftsverträgen lassen sich in der Regel keine Aussagen über ihren Zuweisungsgehalt entnehmen. Lediglich soweit einzelvertraglich vereinbart ist, daß die Gesellschaft „als Erfüllungsgehilfe“ bzw. „im Namen“ des Verwaltungsträgers Entscheidungen treffen soll, kann man von der einzelvertraglichen Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit ausgehen. Aufgrund der vielfach verbleibenden Unsicherheiten über den Zuweisungsgehalt der vertraglichen Absprachen kommt einer zuständigkeitskonformen Auslegung dieser vertraglichen Rechtssätze für die Bestimmung der Staatseigenschaft Juristischer Personen des Privatrechts eine zentrale Bedeutung zu. Soweit den gesellschafts- oder einzelvertraglichen Rechtssätzen zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privatrechtssubjekt keine ausdrücklichen Aussagen über die Zuweisung einer Wahrnehmungs- oder Eigenzuständigkeit an die jeweilige Gesellschaft des Privatrechts zu entnehmen sind, ist im Rahmen einer zuständigkeitskonformen Auslegung von Verträgen zu prüfen, ob der die Verträge abschließende Verwaltungsträger aufgrund seiner eigenen Zuständigkeit verpflichtet ist, der Gesellschaft eine Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. Ist dies der Fall, und verfügen die Verträge über einen entsprechenden Auslegungsspielraum, ist zuständigkeitskonform davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger seine Verpflichtung erfüllt und der Gesellschaft eine entsprechende Zuständigkeit zugewiesen hat. Ob und inwieweit die den Verwaltungsträger verpflichtenden Zuständigkeitsrechtssätze eine solche Verpflichtung enthalten, ist durch Auslegung zu ermitteln. Dies kann sich bei sachmaterienbezogenen Zuständigkeiten im Einzelfall als schwierig erweisen.
Ergebnis zum Zweiten Teil
215
Die Bestimmung der Staatseigenschaft einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft erfolgt also in der Regel zweistufig. Zunächst sind die vertraglichen Rechtssätze nach ihrem Wortlaut, ihrer Genese, ihrer Systematik und ihrem Telos dahingehend auszulegen, ob sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit enthalten. Ergibt diese Auslegung keine eindeutigen Ergebnisse, sind im Rahmen einer zuständigkeitskonformen Auslegung die an den Verwaltungsträger adressierten Zuständigkeitsrechtssätze auf ihren Verpflichtungsgehalt hin zu untersuchen. Wenn und soweit der Verwaltungsträger verpflichtet ist, bestimmte Entscheidungen und Realhandlungen in Person zu bringen, handelt er nur zuständigkeitsgemäß, wenn er ein Organ in diese Aufgabenwahrnehmung „als und für“ ihn einschaltet. Zuständigkeitskonform ist dann für die Auslegung der gesellschafts- und einzelvertraglichen Abreden von derjenigen Auslegungsvariante auszugehen, die ein zuständigkeitsgemäßes Verhalten des Verwaltungsträgers darstellt.
Dritter Teil
Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten Es wird daher nach dem vorstehend Gesagten für die Bestimmung der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften häufig darauf ankommen, zwingende Aussagen über den Inhalt und Umfang der Sachzuständigkeit des beteiligten Verwaltungsträgers zu treffen. Ob und inwieweit dies gelingt, soll deshalb im folgenden am Beispiel von zwei Sachzuständigkeiten kommunaler Gebietskörperschaften untersucht werden. Die Auswahl soll sich an denjenigen Arbeitsfeldern orientieren, die typischerweise als Gegenstand einer staatlich-privaten Zusammenarbeit in Betracht kommen. So werden insbesondere der Städtebau und die Stadtentwicklung, die Wirtschaftsförderung und Infrastrukturentwicklung, die Forschung und Entwicklung sowie die kommunale Ver- und Entsorgung, der Umweltschutz, das Kulturangebot, der Bildungsbereich und der Fremdenverkehr sowie die Sozialpolitik als Gegenstand staatlich-privater Zusammenarbeit genannt.1 Aus diesen Sachbereichen staatlich-privater Zusammenarbeit sollen wiederum die Abfallentsorgung2 und die Straßenreinigung3 als Beispiele für diejenigen Entscheidungsbereiche dienen, die bereits oben4 ihm Rahmen des Aufgabenansatzes als tradiert staatliche Aufgabenbereiche angesehen wurden. Erster Abschnitt
Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Abfallentsorgungsgesellschaften Verbreitet finden sich im Bereich der Abfallentsorgung5 bereits vor, aber vermehrt seit dem In-Kraft-Treten des KrW-/AbfG verschiedene Organisationsmo1 Schuppert, Verwaltungskooperationsrecht, S. 12 f. unter Verweis auf Roggencamp, Public Private Partnership, S. 39 f. 2 BVerfGE 38, S. 258 (270 f.); BVerwG, DVBl. 1990, S. 589 (589, 590 f.); BVerwGE 67, S. 321 (326). 3 BGH, NJW 1991, S. 33 (36). 4 Erster Teil, S. 85. 5 Auch im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung. Vgl. dazu ausführlich Brüning, Erledigung, S. 21 ff.
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
217
delle mit dem Zweck der (Teil-)Privatisierung kommunaler Entsorgungsanlagen.6 In den meisten Fällen gründen ein Landkreis, eine kreisfreie Stadt oder ein kommunaler Zweckverband zu diesem Zweck zusammen mit einem oder mehreren Privatrechtssubjekten eine gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgungsgesellschaft. In vielen Fällen wird neben einer gemischtwirtschaftlichen oder einer rein staatlichen Besitzgesellschaft in Form einer Eigengesellschaft eine gemischtwirtschaftliche oder ausschließlich in privater Anteilseignerschaft stehende Betriebsgesellschaft gegründet.7 Die Entsorgungspflichten dieser Betriebsgesellschaften sind typischerweise Gegenstand der bereits vorstehend beschriebenen Betreiber- und Betriebsführungsmodelle.8 Soweit die Abfallentsorgungsgesellschaften in die Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Gebietskörperschaften einzelvertraglich ausdrücklich als Vertreter und Erfüllungsgehilfen des kommunalen Verwaltungsträgers eingeschaltet werden, gilt das im Rahmen der Auslegung einzelvertraglicher Abreden Gesagte.9 Diese Vertragsklauseln müssen dahingehend ausgelegt werden, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft des Privatrechts enthalten. Die folgende Untersuchung konzentriert sich auf diejenigen Vertragsgestaltungen, in denen Auslegungszweifel bestehen. In diesen Fällen muß mit Hilfe einer rechtssatz- und insbesondere zuständigkeitskonformen Auslegung der Vertragsklauseln der Inhalt und Umfang der Zuständigkeit des Verwaltungsträgers ermittelt werden. Der Zuständigkeitsbereich der kommunalen Abfallentsorgung ist sowohl bundes- als auch landesrechtlich konstituiert. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung sollen beispielhaft die landesrechtlichen Entschei6 Vgl. dazu nur Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 38 ff.; Engel, Gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgung, S. 1 ff.; Klowait, Beteiligung Privater, insbes. S. 120 ff.; Kämmerer, Privatisierung, S. 378 ff.; Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 ff.; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 ff.; Osthorst, De-Kommunalisierung, S. 7 ff.; Stober, DVBl. 1994, S. 1 ff.; ders., Privatisierung der Abfallentsorgung, S. 1 ff.; Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 ff.; Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, S. 185 ff.; Tettinger (Hrsg.), Public Private Partnerships, S. 1 ff.; ders., DVBl. 1995, S. 213 ff.; Tomerius, NVwZ 2000, S. 727 ff.; Zacharias, DÖV 2001, S. 454 ff. Das Beispiel der gemischtwirtschaftlichen RPL Recyclingpark Lochau GmbH, an der die Stadtwerke Halle GmbH mit 75,1 Prozent beteiligt ist, wird jüngst erwähnt in einer vergaberechtlichen Entscheidung des EuGH, DVBl. 2005, S. 365 (365). Alleingesellschafterin der Stadtwerke Halle GmbH ist die Verwaltungsgesellschaft für Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Stadt Halle mbH, an der die Stadt Halle ihrerseits als Alleingesellschafterin beteiligt ist. Weitere Praxisbeispiele finden sich z. B. in BGHSt 50, S. 299 (301 ff.) (staatlich beherrschte Abfallverwertungsgesellschaft mit privater Sperrminorität) und bei Dewey, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 103 ff.; Köhler, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 112 ff. 7 So z. B. auch im vorstehend Fn. 6 genannten Beispiel der RPL Recyclingpark Lochau GmbH. 8 Vgl. oben Zweiter Teil, S. 168 ff. m. w. N. und das Vertragsbeispiel bei Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II, S. 248. 9 Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 173 ff.
218
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
dungsvorgaben gemischtwirtschaftlicher Entsorgungsgesellschaften in Rostock und Potsdam, der Stadtentsorgung Rostock GmbH und der Stadtentsorgung Potsdam GmbH untersucht werden. Die Kapitalanteile der Stadtentsorgung Rostock GmbH gehören zu 51 Prozent der Rostocker Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH, einer Eigengesellschaft der Stadt Rostock, und zu 49 Prozent der privaten Entsorgungsgesellschaft ALBA AG.10 Die Beteiligungsstruktur der Stadtentsorgung Potsdam GmbH besteht zu 51 Prozent aus dem Anteilsbesitz der Stadtwerke Potsdam GmbH, einer Eigengesellschaft der Stadt Potsdam, und zu 49 Prozent aus dem Anteilsbesitz der privaten REMONDIS AG & Co. KG.11
A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG Möglicherweise verpflichtet § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG i. V. m. den entsprechenden landesrechtlichen Regelungen (§ 3 Abs. 1 S. 1 MVAbfG, § 2 Abs. 1 S. 1 BbgAbfG) die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dazu, einer in die Aufgabenerfüllung eingeschalteten Abfallentsorgungsgesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle aus privaten Haushaltungen und Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen „zu verwerten oder . . . zu beseitigen“. Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger sind gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die nach Landesrecht zur Entsorgung verpflichteten Juristischen Personen, d. h. nach § 3 Abs. 1 S. 1 MVAbfG und § 2 Abs. 1 S. 1 BbgAbfG die Landkreise und kreisfreien Städte.12 § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG i. V. m. § 3 Abs. 1 S. 1 MVAbfG bzw. § 2 Abs. 1 S. 1 BbgAbfG verpflichten die jeweilige kommunale Gebietskörper10
Daten abgefragt am 05.05.2006 auf http://www.stadtentsorgung-rostock.com. Daten abgefragt am 05.05.2006 auf http://www.stadtwerke-potsdam.de. 12 Vgl. die – teilweise abweichenden – Regelungen der sonstigen Landesabfallgesetze in Art. 3 Abs. 1 S. 1 BayAbfG; § 6 Abs. 1 BWAbfG; § 4 Abs. 1 HeAbfG; § 6 Abs. 1 S. 1 NdsAbfG; § 5 Abs. 1 NrWAbfG; § 3 Abs. 1 S. 1 RPAbfG; § 5 Abs. 1 SaarlAbfG; § 3 Abs. 1 S. 1 SAAbfG; § 3 Abs. 1 SächsAbfG; § 3 Abs. 1 S. 1 SHAbfG; § 2 Abs. 1 S. 1 ThürAbfG. Daneben ist landesrechtlich teilweise die Bildung von Abfallentsorgungsverbänden als Körperschaften des öffentlichen Rechts im Rahmen kommunaler Zusammenarbeit zulässig, die dann Entsorgungsverpflichtete sind. Vgl. nur § 6 Abs. 1 S. 1, 2 NrWAbfG [vgl. dazu Schink, VerwArch 85 (1994), S. 251 (258)]. Diese Abfallentsorgungsverbände unterscheiden sich von den privatrechtlich organisierten Entsorgungsverbänden im Sinne von §§ 17, 18 KrW-/AbfG. Letztere sind nur im Fall der Aufgabenübertragung im Sinne von §§ 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG Entsorgungsträger. 11
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
219
schaft zur Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die in die Aufgabenerfüllung eingeschaltete gemischtwirtschaftliche Gesellschaft, wenn und soweit ihnen die Verpflichtung zu entnehmen ist, die Entscheidungen des Entscheidungsprozesses „Verwertung“ bzw. „Beseitigung“ selbst, d. h. durch organisationsrechtlich zurechenbare Organisationseinheiten zu treffen. I. Wortlaut Die von § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verwendeten Begriffe „verwerten“ und „beseitigen“ beschreiben verschiedene Realhandlungen, die in einem bestimmten Ergebnis, dem „Verwertet-Sein“ bzw. „Beseitigt-Sein“ münden. Da jede Realhandlung Folge einer Entscheidung ist,13 gehen diesen Entsorgungshandlungen notwendig Entscheidungen voraus. Die Begriffe „verwerten“ und „beseitigen“ beschreiben damit verschiedene Entscheidungen und ihnen folgende Realhandlungen, die ein bestimmtes Ziel verwirklichen. Sie beschreiben ein umfassendes finales Handlungsprogramm.14 Die organisatorischen Mittel zur Erreichung dieses Handlungsziels nennt § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG dagegen nicht. Der umfassend formulierte Wortlaut der Verben „verwerten“ und „beseitigen“ spricht für eine Verpflichtung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers, das Handlungsziel durch organisationsrechtlich zurechenbare Organe, also ausschließlich in Person zu erfüllen. II. Genetische Auslegung Möglicherweise ergeben sich aber aus der Genese der Vorschrift Hinweise dahingehend, daß der kommunale Entsorgungsträger nicht verpflichtet ist, alle Entscheidungen im Sinne einer umfassenden Erfüllungsverantwortung15 selbst zu treffen.16 Denkbar ist es möglicherweise auch, daß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG den Verwaltungsträger dazu verpflichtet, im Einzelfall darüber zu ent13
Vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 206, Fn. 514. Nach Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Methoden, S. 9 (29) werden Konditionalprogramme zunehmend ergänzt „um andersartige, relativ flexible Programmformen – Finalprogramme, Konzeptvorgaben, Planaufträge u. ä.“. Dies sei „ein Ausdruck des Bemühens, das Normprogramm anpassungsflexibel zu halten“. Vgl. auch Schultze-Fielitz, DVBl. 1994, S. 657 (658 f.). 15 Zu den Begriffen der Erfüllungs- und Gewährleistungs-/Sicherstellungsverantwortung vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 207 ff. 16 Vgl. zur Entstehungsgeschichte des KrW-/AbfG nur den Gesetzesentwurf des Bundesrates, BT-Drs. 12/631, S. 1 ff.; den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BTDrs. 12/5672, S. 1 ff.; die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7240, S. 1 ff. und den Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 ff. 14
220
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
scheiden, in welchem Umfang er seiner Erfüllungsverpflichtung nachkommt oder ob er sich auf eine Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch Private beschränkt.17 Der Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG korrespondieren verschiedene Pflichten privater (und staatlicher) Erzeuger und Besitzer von Abfällen gemäß §§ 4 ff. KrW-/ AbfG. Diese miteinander korrespondierenden Pflichten sind Folge der mit Inkrafttreten des KrW-/AbfG18 bezweckten neuen Aufgabenverteilung zwischen staatlichen und privaten Entsorgungsträgern.19 Während vor Inkrafttreten des KrW-/AbfG die nach Landesrecht zuständigen kommunalen Körperschaften umfassend entsorgungspflichtig waren und den Abfallbesitzer lediglich eine Pflicht zur Überlassung und nur ausnahmsweise zur Entsorgung der Abfälle traf,20 sollen nach der neuen Rechtslage im Regelfall die Erzeuger und Besitzer von Abfällen, die sogenannten Verursacher, beseitigungspflichtig sein (sogenanntes Prinzip der Eigen-/Selbstentsorgung).21 Der staatliche Pflichtenanteil soll sich lediglich auf diejenigen Bereiche der Abfallentsorgung erstrecken, in denen die Selbstentsorgung nicht gewährleistet ist. Die §§ 13 Abs. 1 S. 1, 15 Abs. 1 S. 1 Var. 1 KrW-/AbfG gehen davon aus, daß dies insbesondere im Bereich der Hausmüllentsorgung in der Regel der Fall sein wird.22 Zweck dieser neuen Aufgabenverteilung ist es also, staatliche Entscheidungsund Handlungspflichten soweit wie möglich und soviel wie nötig zu reduzieren. Das Ziel dieser Aufgabenverlagerung sei es, „das Denken vom Abfall her zu fördern und die Erzeuger von Abfall . . . zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen zu veranlassen“.23 17 Zu diesem alternativen Verhältnis von Erfüllungs- und Sicherstellungsverantwortung vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 207 ff. 18 Das KrW-/AbfG wurde als Art. 1 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen v. 27.09.1994, BGBl. I S. 2705 verkündet und trat im wesentlichen am 06.10.1996 in Kraft. 19 So Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 11, Rn. 2; Schink, NVwZ 1997, S. 435 (435 f.); Versteyl/Wendenburg, NVwZ 1994, S. 833 (838 f.); Breuer, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 5. Kap., Rn. 239, 253; Kloepfer, Umweltrecht, § 20, Rn. 39 f. Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1328 f.) spricht von einem „Paradigmenwechsel“. Vgl. dazu die Stellungnahme der Bundesregierung zum Gesetzesentwurf des Bundesrates, BT-Drs. 12/631, S. 10 (14) u. den Gesetzesentwurf der Bundesregierung, BT-Drs. 12/5672, S. 1 ff. 20 Vgl. zur alten Rechtslage nach § 3 AbfG nur Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 11, Rn. 2; Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 41 ff.; Mann, Abfallverwertung, S. 78 ff. 21 Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 11, Rn. 2; Tomerius, NVwZ 2000, S. 727 (727 f.); Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1328). 22 Vgl. ebenso die Begründung der Bundesregierung zum Gesetzesentwurf, BT-Drs. 12/5672, S. 1 (37). 23 So ausdrücklich die Zielsetzung und Begründung des Gesetzesentwurfes der Bundesregierung, BT-Drs. 12/5672, S. 1 (2, 35). Ebenso Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
221
Die Genese der Vorschriften der §§ 4 ff. KrW-/AbfG über die Aufgabenverteilung zwischen Staat und Privaten legt also eine Auslegung nahe, die zum einen die Notwendigkeit einer gesicherten Abfallentsorgung berücksichtigt, zum anderen aber auch dem Zweck, staatliche Verantwortung gegenüber privaten Entsorgungspflichten weitgehend zurückzudrängen (Verursacherprinzip)24, Rechnung trägt.25 Wenn also die staatliche Erfüllungsverantwortung bereits bei der Verteilung der Entsorgungspflichten nach dem Willen des Gesetzgebers beschränkt wurde, ist es denkbar, daß der jeweilige kommunale Entsorgungsträger auch im Bereich der Erfüllung eigener Verpflichtungen Entscheidungsbereiche Privaten zur Erledigung überlassen kann. Der Umfang der staatlichen Entscheidungsverpflichtung richtet sich danach, ob die Entsorgungssicherheit im Einzelfall gewährleistet ist oder nicht. Ob z. B. die Verpflichtung zur Hausmüllentsorgung gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG eine umfassende, alle Entscheidungen umfassende Verpflichtung ist, hängt davon ab, wie viel staatliches Eigenentscheiden zur Sicherstellung der Hausmüllentsorgung im konkreten Fall erforderlich ist. Es kommt also darauf an, wann die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit erforderlich ist im vorstehend genannten Sinn. III. Systematische Auslegung 1. §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG Gemäß § 15 Abs. 2 KrW-/AbfG sind die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger von ihren Pflichten zur Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen befreit, soweit ein Übertragungstatbestand der §§ 16, 17 oder 18 KrW-/AbfG vorliegt. Die §§ 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG verpflichten die zuständige Behörde, auf Antrag mit Zustimmung der kommunalen Entsorgungsträger darüber zu entscheiden, ob sie „deren Pflichten auf einen Dritten“ überträgt. „Deren“ Pflichten, also die Zu(Hrsg.), KrW-/AbfG, § 11, Rn. 2; Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1333 f.); Schink, NVwZ 1997, S. 435 (435). 24 Zum Verursacherprinzip im Umweltrecht und der Verantwortungsverteilung nach dem KrW-/AbfG vgl. nur Breuer, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 5. Kap., Rn. 12 ff., 239; Schink, NVwZ 1997, S. 435 (435 f.); Versteyl/ Wendenburg, NVwZ 1994, S. 833 (838 f.); Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1328 f., 1334). 25 In diesem Sinn auch die Begründung der Bundesregierung zum Gesetzesentwurf, BT-Drs. 12/5672, S. 1 (35): „Das Gesetz gewährt die notwendigen Handlungsspielräume, legt gleichzeitig die ökologischen Rahmenbedingungen fest und schafft die Voraussetzungen für die erforderliche Überwachung“. Ausdrücklich bezug auf das Verursacherprinzip nimmt die Bundesregierung a. a. O., S. 37; vgl. ebenso den Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (2). V. Lersner, in: ders./Wendenburg (Hrsg.), Recht der Abfallbeseitigung, § 16, Rn. 2 weist darauf hin, daß es „keine gesetzliche Priorität der Beauftragung privater Dritter“ gibt.
222
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
ständigkeiten der kommunalen Entsorgungsträger zur Verwertung und Beseitigung gewerblichen Abfalls,26 werden notwendig27 im Wege einer sogenannten verantwortungsübertragenden Delegation28 übertragen mit der Folge, daß der Dritte – soweit Juristische Person – insoweit neues Zurechnungsendsubjekt der ursprünglichen Zuständigkeit des kommunalen Entsorgungsträgers ist. Er ist insoweit Juristische Person des öffentlichen Rechts und Beliehener.29 Damit läßt sich zum einen feststellen, daß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG neben §§ 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG keine (konkludente)30 Ermächtigung des kommunalen Entsorgungsträger enthält, seine Zuständigkeit verantwortungsübertragend auf ein Privatrechtssubjekt zu delegieren. Die §§ 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG regeln die Möglichkeiten der Einschaltung von Privatrechtssubjekten als Zurechnungsendsubjekte von Zuständigkeiten in die staatliche Aufgabenwahrnehmung abschließend. Nicht entnehmen läßt sich allerdings aus der systematischen Stellung, ob § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG den staatlichen Entsorgungsträger über den Fall des § 15 Abs. 2 KrW-/AbfG hinaus dazu verpflichtet und berechtigt, darüber zu entscheiden, ob er die Verpflichtung aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG vollumfänglich in Person erfüllt oder sich im Einzelfall auf eine Sicherstellungsverantwortung beschränkt. 2. § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG Möglicherweise gibt die systematische Stellung des § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG zu § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG Aufschluß über den Inhalt und Umfang der Verpflichtung der kommunalen Entsorgungsträger. Gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG „können die zur Verwertung und Beseitigung Verpflichteten“, also auch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, „Dritte mit der Erfüllung ih26 Eine Übertragung der Verpflichtung zur Entsorgung von Hausmüll ist jedenfalls nach dem Wortlaut des § 15 Abs. 2 KrW-/AbfG nicht möglich: Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 15, Rn. 15 m. w. N. 27 Eine verantwortungsbefreiende Delegation dagegen würde die Übertragung einer privaten Pflicht auf ein Privatrechtssubjekt voraussetzen. „Deren Pflichten“ im Sinne von § 16 Abs. 2 S. 1 KrW-/AbfG sind dagegen die Pflichten des staatlichen Entsorgungsträgers. 28 Zum Begriff siehe oben Zweiter Teil, S. 212 f. 29 Kunig, in: ders./Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 16, Rn. 32 („Akt der Teilbeleihung“); Kämmerer, Privatisierung, S. 383 f. m. N. zur Gegenansicht in Fn. 440; Kummer/Giesberts, NVwZ 1996, S. 1166 (1168); Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1329 f.); v. Lersner, in: ders./Wendenburg (Hrsg.), Recht der Abfallbeseitigung, § 16, Rn. 29. 30 Verbreitet wird eine solche konkludente Ermächtigung zur Übertragung einer Eigenzuständigkeit auf ein Privatrechtssubjekt für unzulässig erklärt und das Vorliegen einer gesetzlichen Ermächtigung gefordert. Vgl. nur die Nachweise bei Remmert, Dienstleistungen, S. 202 ff.
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
223
rer Pflichten beauftragen“. Nachdem bereits oben31 festgestellt wurde, daß jeder Zuständigkeitsrechtssatz notwendig eine Verpflichtung enthält, verpflichtet § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die kommunalen Entsorgungsträger also dazu, darüber zu entscheiden, ob sie Dritte mit der Erfüllung ihrer Zuständigkeit beauftragen. Möglicherweise berechtigt § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die kommunalen Entsorgungsträger darüber hinaus gerade dazu, die Dritten, also z. B. eine Gesellschaft des Privatrechts, als Organe in die Erfüllung ihrer Zuständigkeiten einzuschalten. a) „Dritter“ Der Begriff des „Dritten“ umschreibt Rechtssubjekte, die rechtlich nicht identisch mit dem Beauftragenden im Sinne von § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG sind.32 Diese sprachliche Abgrenzung gegenüber dem jeweiligen Auftraggeber kann zum einen Ausdruck dafür sein, daß sich der Dritte sowohl in bezug auf seine organisatorische Verfaßtheit als auch in bezug auf seine Pflichtenstellung von dem staatlichen Auftraggeber unterscheidet. Die Unterschiede können sich allerdings auch lediglich auf einen Teilbereich der Rechtsstellung und die rechtliche Verselbständigung der Organisationsform gegenüber dem Verwaltungsträger beziehen. Der Begriff des Dritten kennzeichnet in diesem Fall auch ein Privatrechtssubjekt, das relativ – soweit wie die Verpflichtung aus der Wahrnehmungszuständigkeit reicht – staatliches Organ ist. Dritte können sowohl natürliche Personen als auch Juristische Personen des öffentlichen und des Privatrechts sein.33 § 16 Abs. 1 S. 3 KrW-/AbfG beschreibt zwar mit dem Begriff der „Zuverlässigkeit“ eine Eigenschaft, die typischerweise Menschen zukommt, aber auch Juristische Personen können aufgrund ihrer Entscheidungs- und Zurechnungsstrukturen Zuverlässigkeit im Sinne von Sachkenntnis und finanziellen Voraussetzungen, sowie von sonstigen persönlichen Eigenschaften34 vermitteln. Dies muß auch der Gesetzgeber gesehen haben, da in der Praxis gerade apersonale Kapitalgesellschaften mit der Abfallentsorgung beauftragt werden.35 Der Begriff des Dritten kennzeichnet deshalb sowohl private als auch staatliche Rechtssubjekte, deren rechtliche Verfaßtheit sich zumindest teilweise von dem jeweiligen Auftraggeber unterschei31
Zweiter Teil, S. 212 ff. zum Begriff der Delegationsermächtigung. Zum Begriff des „Dritten“ in den entsprechenden Klauseln einzelvertraglicher Abreden vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 174 ff. 33 Vgl. nur Versteyl, in: Kunig/Paetow/ders. (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 16, Rn. 9; Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1329); v. Lersner, in: ders./Wendenburg (Hrsg.), Recht der Abfallbeseitigung, § 16, Rn. 6. 34 Vgl. so die Konkretisierung des Begriffs der Zuverlässigkeit im Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (18). 35 Vgl. dazu die Nachweise oben Dritter Teil, S. 217, Fn. 6. 32
224
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
det. Ob eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft als Dritter gerade organschaftlich in die Erfüllung der Verpflichtung des kommunalen Entsorgungsträgers eingeschaltet werden muß, läßt der Begriff des Dritten offen. b) „Mit der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen“ Die kommunalen Entsorgungsträger können die Dritten gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG „mit der Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen“. Eine Beauftragung beinhaltet eine Verpflichtung des Beauftragten, ein ihm vom Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen zu besorgen (vgl. § 662 BGB).36 Die Beauftragung mit der Erfüllung von Pflichten beinhaltet die Verpflichtung des Beauftragten, bestimmte Entscheidungen nach den Entscheidungs- und Handlungsvorgaben der jeweils zu erfüllenden Pflicht zu treffen. Der Begriff der „Erfüllung“ im Sinne von § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG ist ein Synonym für die Begriffe der „Erledigung“ oder „Wahrnehmung“ von Aufgaben. Wird ein Dritter gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG mit der Erfüllung „ihrer Pflichten“, d. h. der Zuständigkeit des (kommunalen) Entsorgungsträgers beauftragt, dann wird ein anderes Rechtssubjekt verpflichtet, mit Wirkung für den Entsorgungsträger dessen Verpflichtung wahrzunehmen. Der Dritte kann seine Erfüllungsverpflichtung rechtlich nur dann erfüllen, wenn die Wirkungen seiner Erfüllung in der Person des Entsorgungsträgers eintreten. Diese Erfüllungsverpflichtung setzt deshalb notwendig die Zurechnung jedenfalls der Rechtsfolgen seiner Entscheidungen und Handlungen zum Entsorgungsträger voraus.37 Jedenfalls die durch die Entscheidungen und Handlungen 36 Verbreitet wird darauf hingewiesen, es liege ein typengemischter Vertrag mit werkvertraglichen Elementen vor [z. B. Versteyl, in: Kunig/Paetow/ders. (Hrsg.), KrW-/ AbfG, § 16, Rn. 11; Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 43]. Andere gehen davon aus, daß ein öffentlich-rechtlicher Vertrag im Sinne von § 54 ff. VwVfGe vorliege [vgl. so auch allgemein zu vergleichbaren Kooperationsverträgen im Bereich der Abfallbeseitigung vor dem Inkrafttreten des KrW-/AbfG Henke, DÖV 1985, S. 41 (44 ff.)] Dies kann hier dahingestellt bleiben. Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf alle Verwaltungsverträge. Zum Begriff des Verwaltungsvertrages vgl. bereits oben Zweiter Teil, S. 117 ff. 37 In diesem Sinn ist wohl auch der verbreitete Hinweis zu verstehen, der Dritte übernehme die Erfüllung der Pflicht, „nicht aber die Pflicht selbst“. Vgl. nur Versteyl, in: Kunig/Paetow/ders. (Hrsg.), KrW-/AbfG, § 16, Rn. 12; Beckmann, in: Bauer/ Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 44; Schoch, Privatisierung, S. 40; Kämmerer, Privatisierung, S. 381, 385. Nach Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1329) übernehme der Dritte „die technische Durchführung der Pflicht, nicht aber die Pflicht selbst“. In diesem Sinn auch Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (454), wonach „nicht die Aufgabe selbst, sondern nur die Aufgabenerledigung privatisiert“ werde. In diesem Sinn auch der Bericht des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (18), wonach durch § 16 Abs. 1 KrW-/AbfG klargestellt werde, „daß Pflichten des Auftraggebers durch das Auftragsverhältnis nicht berührt werden, insbesondere nicht auf den Dritten übergehen“.
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
225
des Dritten ausgelösten Verpflichtungen und Berechtigungen müssen in der Person des Entsorgungsträgers eintreten. Ob auch die Entscheidungen und Handlungen selbst nach § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG als von dem jeweiligen staatlichen Entsorgungsträger gesetzt gelten sollen, läßt der Wortlaut offen. Es stellt sich deshalb die Frage, welche Art der Zurechnung, d. h. welche Vertretungsform im oben38 genannten Sinn die §§ 15 Abs. 1 S. 1, 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG jedenfalls in bezug auf die Vertretung eines staatlichen Rechtssubjektes voraussetzen. Wer die Verpflichtung des kommunalen Entsorgungsträgers aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG zu erfüllen hat, bestimmt § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG selbst. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG ist an den landesrechtlich zu bestimmenden kommunalen Entsorgungsträger adressiert und geht deshalb davon aus, daß gerade diese kommunalen Entsorgungsträger z. B. aufgrund ihrer Sach- und Problemnähe am besten zur Aufgabenerledigung geeignet sind.39 Dies bedeutet, daß nur der kommunale Entsorgungsträger selbst seine Pflicht erfüllen kann. Soweit er durch § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG zum Entscheiden verpflichtet ist, muß er alle Entscheidungen in Person, d. h. durch ihm organschaftlich zurechenbare Untereinheiten treffen, für die wiederum Menschen entscheiden und handeln. Entscheidungen und Realhandlungen werden einem Verwaltungsträger deshalb ausschließlich organschaftlich zugerechnet.40 Geht man darüber hinaus davon aus, daß einem Verwaltungsträger nur eine organisationsrechtliche, nicht eine dienstrechtliche Einschaltung einer Juristischen Person des Privatrechts möglich ist,41 dann verpflichten die jeweiligen vertraglichen Abreden eine Entsorgungsgesellschaft nur als Organ, nicht als dessen Walter. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verpflichtet die Entsorgungsträger deshalb dazu, darüber zu entscheiden, ob sie gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgungsgesellschaften als Organe in die Erfüllung ihrer Entsorgungsverpflichtung einschalten. § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG erweitert also nach dem vorstehend Gesagten die organisatorischen Möglichkeiten der kommunalen Entsorgungsträger gegenüber § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG dahingehend, daß neben öffentlichrechtlich organisierten Organen auch apersonale Privatrechtssubjekte (oder andere Verwaltungsträger) als Organe in die Aufgabenwahrnehmung eingeschaltet werden können. Darüber hinaus können auch natürliche Personen, die nicht bereits zum Personal des kommunalen Entsorgungsträgers gehören und deshalb ebenfalls „Dritte“ sind, als (außerordentliche) Amtswalter mit einer Amtswahrnehmungspflicht gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG beauftragt werden. Während ge38 39 40 41
Zweiter Teil, S. 177 ff. Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 179 ff.; 202 ff. Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 179 ff. Vgl. oben Zweiter Teil, S. 105 ff.
226
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
mischtwirtschaftliche Abfallentsorgungsgesellschaften „als und für“ den kommunalen Entsorgungsträger entscheiden, handeln und entscheiden die entsprechenden Amtswalter lediglich mit Wirkung für denselben. Der Amtswalter übernimmt in diesem Fall als natürliche Person lediglich die Erfüllung einer Pflicht, nicht aber diese selbst.42 § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG ist also ein Rechtssatz, der sowohl organisationsrechtliche als auch dienstrechtliche Verpflichtungen und Berechtigungen für kommunale Entsorgungsträger aufstellt. Darüber hinaus ist er ein Rechtssatz, der im Einzelfall auch Private berechtigen und verpflichten kann. Die Verantwortlichkeit für die Erfüllung der Pflichten bleibt dabei gemäß § 16 Abs. 1 S. 2 KrW-/AbfG in allen Fällen unberührt. Der kommunale Entsorgungsträger muß also dafür sorgen, daß er all diejenigen rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen schafft, die erforderlich sind, damit sich die Vertretung durch Dritte in ihren rechtlichen und tatsächlichen Wirkungen nicht von der Eigenwahrnehmung unterscheidet. Es muß also zum einen ein rechtlicher Zurechnungszusammenhang von der einzelnen menschlichen Entscheidung bis hin zum staatlichen Verpflichtungsrechtssubjekt bestehen. Zum anderen hat der Entsorgungsträger dafür zu sorgen, daß die privatrechtlich organisierten Organe und Ämter sowie deren Amtswalter in den organisatorischen Entscheidungsprozeß, die staatliche Wirkeinheit, institutionell eingebunden sind und bleiben.43 IV. Teleologische Auslegung Nach dem vorstehend Gesagten läßt sich feststellen, daß die §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG und § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG die Einschaltung apersonaler Privatrechtssubjekte als Träger einer Eigenoder einer Wahrnehmungszuständigkeit in die Aufgabenwahrnehmung der Abfallentsorgung ermöglichen. Natürliche Personen, die nicht Beamte oder Angestellte des öffentlichen Dienstes sind, können als „Dritte“, d. h. als atypische Organwalter in die Wahrnehmung der Verpflichtung aus § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG eingeschaltet werden. Es kommt daher im folgenden darauf an, ob eine teleologische Auslegung näheren Aufschluß über weitere, neben den §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG und § 16 Abs. 1 S. 1
42
Vgl. dazu bereits oben die Nachweise in Fn. 37. § 5 S. 2 u. 3 BbgAbfG weist sprachlich auf eine solche kommunale Verantwortung in bezug auf das Bestehen einer realen Wirkeinheit hin. So bleiben die Entsorgungsträger „dafür verantwortlich, daß die Aufgaben ordnungsgemäß erfüllt werden. Dies haben sie durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, insbesondere durch den Vorbehalt ausreichender Überwachungs- und Weisungsbefugnisse im Zusammenhang mit der Drittbeauftragung und durch die Gewährleistung nachvollziehbarer Abrechnungen durch den beauftragten Dritten“. Das MVAbfG enthält keine entsprechenden Bestimmungen. 43
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
227
KrW-/AbfG bestehende organisatorische Möglichkeiten der kommunalen Entsorgungsträger gibt. 1. Zuweisung eindeutiger Verantwortlichkeiten Die Verpflichtung eines bestimmten Adressaten dient zum einen der Begründung eindeutiger Verantwortlichkeiten.44 Aufgabenbereiche verschiedener Verwaltungsträger sollen gegeneinander abgrenzbar sein.45 Dies spricht dafür, daß der jeweilige Verwaltungsträger auch verpflichtet ist, alle Entscheidungen in Person zu treffen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist. Enthielte jede Zuständigkeitsnorm zugleich die Ermächtigung des Verwaltungsträgers, sich aus der Wahrnehmung seiner Zuständigkeit zumindest teilweise zurückzuziehen und sich auf eine Sicherstellungsverantwortung zu beschränken, würde dies der von Zuständigkeiten gerade bezweckten Verantwortungsklarheit entgegenstehen. 2. Zweck optimaler Aufgabenerledigung Zum anderen weisen Zuständigkeitsrechtssätze einem staatlichen Verpflichtungsadressaten gerade deshalb Verantwortung zu, weil der Zuständigkeitsgeber davon ausging, daß gerade dieser Verpflichtungsadressat am besten zur Aufgabenerledigung geeignet ist.46 Sinn und Zweck jedes Zuständigkeitsrechtssatzes ist eine optimale Aufgabenerledigung gerade durch den Verpflichtungsadressaten.47 Der Adressat ist verpflichtet, eine Sachaufgabe zu erledigen, weil gerade 44 Vgl. nur Hans J. Wolff, VerwR II3, § 72 III, S. 22; Pietzcker, in: Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit, S. 17 (55); Fügemann, Zuständigkeit, S. 3. 45 Ein entsprechendes Gebot rationaler Organisation wird verbreitet aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleitet. Vgl. dazu nur Schultze-Fielitz, in: FS Vogel, S. 311 (326 ff.); Groß, Kollegialprinzip, S. 200 ff.; K. Hesse, in: FG Smend, S. 71 (83); Kahl, Staatsaufsicht, S. 540; Schmidt-Aßmann, Ordnungsidee, S. 84 ff.; ders., in: HdBStR II, § 26, Rn. 21 f.; Krebs, in: HdBStR III, § 69, Rn. 81. Dieses Rationalitätsgebot besagt u. a., daß Zuständigkeiten Organisationseinheiten vorhersehbar zugeordnet werden sollen. Zuständigkeiten sollen berechenbar und eindeutig zugewiesen werden. Vgl. dazu auch Remmert, Dienstleistungen, S. 204 f. 46 Vgl. dazu bereits oben Zweiter Teil, S. 202 ff. 47 Thieme, Verwaltungslehre, S. 30 ff.; Fügemann, Zuständigkeit, S. 3. In diesem Sinne auch Remmert, Dienstleistungen, S. 219. Vgl. auch Krebs, Kontrolle, S. 33, der darauf hinweist, daß die Wahl eines staatlichen Entscheiders zwischen Entscheidungsalternativen am „Maßstab optimaler Zweckerreichung“ erfolge. Anders Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 764 ff., der sich ausdrücklich gegen das Postulat optimaler Aufgabenerfüllung wendet und lediglich eine „praktikable Aufgabenerfüllung“ als Ziel von Verwaltungsentscheidungen für realitätsnah hält. Das Postulat optimaler Aufgabenerfüllung sei nicht praxisgerecht. Ebenso ders., Verselbständigte Verwaltungseinheiten, S. 323 f. unter Verweis auf Herbert A. Simon, Das Verwaltungshandeln. Eine Untersuchung der Entscheidungsvorgänge in Behörden und privaten Unternehmen,
228
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
er am besten dazu geeignet ist.48 Dieser Zweck der Zuständigkeitsrechtssätze, optimale Entscheidungen durch den jeweils am besten geeigneten Entscheider zu bewirken, bestimmt zugleich den Entscheidungsmaßstab jedes staatlichen Zuständigkeitsadressaten. Der Verpflichtungsadressat muß Entscheidungen treffen, deren Alternativenwahl sich an dem Ziel optimalen Entscheidens ausrichtet.49 Er muß also Entscheidungen treffen, welche die jeweilige Sachaufgabe optimal erledigen. Was eine optimale Aufgabenerledigung ist und welche Organisationsentscheidungen sie in personeller und sachlicher Hinsicht50 verlangt, bestimmt in erster Linie51 der Zuständigkeitsrechtssatz selbst. Welche Vorgaben § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG hinsichtlich der organisatorischen Mittel zur Optimierung der Aufgabenerledigung aufstellt, ist deshalb im folgenden zu untersuchen. Die Zielsetzung des § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG ergibt sich bereits aus § 1 KrW-/AbfG, wonach Zweck des Gesetzes „die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen ist“. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verpflichtet kommunale Gebietskörperschaften also dazu, all diejenigen Entscheidungen zu treffen, die erforderlich sind, damit die Aufgabe der Abfallentsorgung optimal erledigt wird. 1955; ebenso Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Methoden, S. 9 (28 f.), der davon ausgeht, daß es nicht eine richtige, sondern nur „relativ richtige“ Verwaltungsentscheidungen geben kann. 48 Remmert, Dienstleistungen, S. 199 ff., 217; Pietzcker, in: Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit, S. 17 (55); Fügemann, Zuständigkeit, S. 3; Schenke, DÖV 1985, S. 452 (452). 49 Vgl. dazu allgemeiner die nicht auf den Inhalt von Zuständigkeiten abstellenden Ansichten, wonach „Effektivität“ und „Effizienz“ als – teilweise verfassungsrechtliche – Entscheidungsmaßstäbe der Verwaltung im Sinne von „Optimierungsgeboten“ angesehen werden. Vgl. zur letzterem nur Kahl, Staatsaufsicht, S. 539 ff.; Pietzcker, VVDStRL 41 (1983), S. 193 (196 f.); Schmidt-Aßmann, in: HdBStR II, § 26, Rn. 20 zum Rechtsstaatsprinzip; Wahl, VVDStRL 41 (1983), S. 151 (162 ff. m. Fn. 32). Der hier vertretenen Annahme, Zuständigkeitsrechtssätze verpflichteten staatliche Entscheidungsträger zu einer optimalen Aufgabenerledigung, steht nicht entgegen, daß angesichts der Komplexität der Aufgabenfelder eine optimale Erfüllung in der Praxis schwer zu erreichen ist, und vielfach tatsächlich lediglich „praktikable“ Entscheidungen getroffen werden, die „nur eine begrenzte Rationalität aufweisen und durch die Suche nach befriedigenden (nicht nach optimalen) Lösungen gekennzeichnet sind“ (Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S. 765 f., 766). 50 Fügemann, Zuständigkeit, S. 3 weist darauf hin, daß die einfachrechtlich geforderte „Optimierung der Aufgabenerledigung durch Inanspruchnahme der jeweils am besten geeigneten personellen und sächlichen Mittel“ erfolgen müsse. Ders., a. a. O., S. 3 stellt zugleich fest, daß „die Breite des heutzutage vom Staat wahrzunehmenden Aufgabenspektrums den Einsatz von Spezialisten (verlange) . . . Diesen Vorgaben hat die Zuständigkeitsordnung zu folgen“. 51 Ausführlich zu weiteren rechtlichen Entscheidungsvorgaben unten Dritter Teil, S. 236 ff.
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
229
Dies allein ist allerdings kein zwingender Hinweis darauf, daß der jeweilige Zuständigkeitsrechtssatz den ausdrücklich genannten Adressaten auch vollumfänglich in Person verpflichtet. Ein Rückzug des Staates auf seine Sicherstellungsverantwortung kann im Einzelfall gerade eine optimale Aufgabenerledigung zur Folge haben. Eine solche optimale Aufgabenerledigung, die z. B. auch Aspekte der Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit mit einbezieht, kann deshalb im Einzelfall gerade darin bestehen, daß der jeweilige Verwaltungsträger Privatrechtssubjekte in die Aufgabenwahrnehmung einschaltet und sich auf die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung beschränkt: Vielfach wird man sachaufgabenbezogene Zuweisungen von Verwaltungszuständigkeiten so auszulegen haben, daß es ihnen vor allem darauf ankommt, die bestmögliche Erledigung der Sachaufgabe zu gewährleisten und der zuständigen Verwaltungseinheit insoweit die Verantwortung zuzuweisen, ohne zugleich starre Festlegungen zu treffen, welche Teilaufgaben in einer der zuständigen Verwaltungseinheit zurechenbaren Weise wahrzunehmen sind.52 Allein die Tatsache, daß der Wortlaut des § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger als Adressaten der Entsorgungsverpflichtung nennt, spricht also nicht zwingend dafür, daß diese Entsorgungsträger vollumfänglich in Person entscheiden müssen. Im Rahmen der genetischen Auslegung wurde bereits festgestellt, daß mit Inkrafttreten des KrW-/AbfG eine neue Aufgabenverteilung zwischen staatlichen Entsorgungsträgern und Privaten statuiert werden sollte mit dem Ziel, private Verantwortung zu stärken. In welchem Umfang die ursprünglich umfassende staatliche Verantwortung reduziert wird, bleibt nach dem Wortlaut und der Genese des § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG offen. 3. Abschließende gesetzliche Regelung Die systematische Stellung des § 15 Abs. 1 KrW-/AbfG zu §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG und § 16 Abs. 1 KrW-/AbfG ergibt demgegenüber Aufschluß darüber, wie eine optimale Aufgabenverteilung unter Nutzbarmachung privater Handlungsrationalität organisatorisch von den kommunalen Entsorgungsträgern umgesetzt werden soll. Die §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG und § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG sind Organisationsvorgaben für den kommunalen Entsorgungsträger bei der Einschaltung von Privatrechtssubjekten in die Aufgabenerfüllung. Im Bereich der Entsorgung gewerblichen Abfalls besteht nach §§ 5 Abs. 2, 11 Abs. 1 KrW-/AbfG grundsätzlich eine gesetzliche Entsorgungspflicht Privater. Soweit öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger zur Entsorgung gewerblichen Abfalls zuständig sind, darf vorhandene private Infrastruktur genutzt werden mit 52
So ausdrücklich Remmert, Dienstleistungen, S. 222 f.
230
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Hilfe einer organisatorischen Verselbständigung der Abfallentsorgung durch eine verantwortungsübertragende Delegation seitens der zuständigen Behörde (§ 15 Abs. 2 KrW-/AbfG). Der Zuständigkeitsgeber ergänzt also die Verpflichtung des kommunalen Entsorgungsträgers zur Entsorgung jedenfalls gewerblichen Abfalls mit der Verpflichtung der zuständigen Behörde, auf Antrag und mit Zustimmung der Entsorgungsträger darüber zu entscheiden, ob sie einem Dritten die Entsorgungsverpflichtungen (zur Entsorgung gewerblichen Abfalls) übertragen. Sie sind zu einer solchen verantwortungsübertragenden Delegation verpflichtet, wenn und soweit diese Delegation die optimale Organisationsform zur Entsorgung gewerblichen Abfalls darstellt. Im Bereich der Hausmüllentsorgung müssen die Entsorgungsträger eigene Organe in die Aufgabenerfüllung einschalten. § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verpflichtet sie, darüber zu entscheiden, ob sie apersonal organisierte Dritte als atypische, privatrechtlich organisierte Organe in die Entsorgung von Hausmüll (oder gewerblichen Abfalls) einschalten. Sie sind dazu verpflichtet, soweit diese Organisationsform im Einzelfall die optimale Aufgabenerledigung gewährleistet.53 § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG enthält darüber hinaus auch Regelungen dafür, daß ein kommunaler Entsorgungsträger eine natürliche Person als (außerordentlichen) Amtswalter in die Wahrnehmung der Entsorgungsverpflichtung einschaltet. Dieser Amtswalter muß nach § 16 Abs. 1 S. 3 KrW-/AbfG über die erforderliche Zuverlässigkeit verfügen. Diese differenzierende Regelungssystematik54 der §§ 15 Abs. 1 S. 1, Abs. 2, 16 Abs. 1, Abs. 2, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG spricht dafür, daß die Möglichkeiten zur Einschaltung von natürlichen oder apersonalen Privatrechtssubjekten in die staatliche Aufgabenwahrnehmung abschließend geregelt sind.55 Zwar ist ein Grund für die Schaffung einer neuen Verantwortungsverteilung zwischen den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern und den Abfallverursa53 I. E. ebenso Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 38 (45), wonach die jeweilige entsorgungspflichtige Gebietskörperschaft „die Vor- und Nachteile der Aufgabenübertragung gegeneinander in ihrer Entscheidung abwägen muß“. Sind alle staatlichen Entscheidungen umfassend rechtlich gebunden, dann beinhaltet ein „pflichtgemäßes Organisationsermessen“ [Beckmann, a. a. O., S. 38 (45)] die Verpflichtung zum Treffen der einen richtigen, da rechtmäßigen Entscheidung [vgl. ebenso Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, S. 209 (210); ders., Kontrolle, S. 74 ff.; Remmert, VerwArch 91 (2000), S. 209 (224 f.)]. 54 Kämmerer, Privatisierung, S. 386 spricht von einem „filigrane(n) Wechselspiel zwischen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen (einschließlich potenzieller organisationsprivater) Ausgestaltungsvarianten“. 55 Diese Frage wird in der Literatur – soweit ersichtlich – nicht thematisiert. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß die von § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG vorausgesetzte Vertretungsform verbreitet nicht untersucht wird. Der vom Regelungsgehalt des § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG nicht erfaßte Bereich der Einschaltung Privater bei verbleibender staatliche Sicherstellungsverantwortung wird daher gerade nicht erörtert.
1. Abschn.: Staatseigenschaft von Abfallentsorgungsgesellschaften
231
chern gewesen, gerade die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu entlasten.56 Dieser Grund allein spricht allerdings nicht für eine Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, sich auf eine reine Sicherstellungsverantwortung zurückzuziehen und die kostenintensive Abfallentsorgung Privaten zu überlassen. Vielmehr sollte durch die Reform des KrW-/AbfG eine effiziente, flächendeckende und umweltverträgliche Abfallentsorgung gewährleistet werden.57 Zwar ist die Zuordnung der Abfallentsorgung zum Bereich der „Daseinsvorsorge“58 im oben59 genannten Sinn kein Argument für die Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Entsorgungsgesellschaften.60 Das gemeinwohlbezogene Telos der Regelungen in den §§ 15 ff. KrW-/AbfG spricht aber für deren abschließenden Charakter. Die Regelungssystematik der §§ 15 ff. KrW-/ AbfG bietet das Instrument dafür, die Entlastung durch Einschaltung von Privatrechtssubjekten zu erreichen, ohne eine flächendeckende und umweltverträgliche Abfallentsorgung in Frage zu stellen. Die staatliche Erfüllungsverantwortung soll gerade eine Überakzentuierung ökonomischer Interessen61 verhindern. Deshalb kann § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG keine Ermächtigung des kommunalen Entsorgungsträgers zum Rückzug aus seiner Erfüllungsverantwortung entnommen werden. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG verpflichtet den kommunalen Entsorgungsträger vielmehr vollumfänglich zum Entscheiden in Person. Eine Einschaltung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften in die Wahrnehmung der kommunalen Entsorgungsverpflichtungen kommt lediglich in Form der Einschaltung als Organ (§ 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG) oder im Wege einer verantwortungsübertragenden Delegation (§§ 16 Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3 S. 1, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG) in Betracht.
56 Vgl. die Begründung des Berichtes des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (17): Beschränkung der Überlassungspflichten „auf den erforderlichen Bereich der notwendigen Daseinsvorsorge“. Dafür, daß eine Abfallbeseitigung durch Private regelmäßig kostengünstiger sei als eine staatliche z. B. Kloepfer, VerwArch 70 (1979), S. 195 (200 f.). 57 Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1333). 58 So ausdrücklich die Begründung des Berichtes des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, BT-Drs. 12/7284, S. 1 (17); BVerwG, JZ 1993, S. 409 (410) m. Anm. v. Kunig; Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen, S. 38 (41); Tomerius, NVwZ 2000, S. 727 (731). 59 Erster Teil, S. 82 ff., insbes. S. 84. 60 Ausführlich zur „Erfüllung öffentlicher Aufgaben“ als Kriterium der Staatseigenschaft oben Erster Teil, S. 81 ff. 61 Dazu, daß jede Privatisierung die Gefahr einer solchen den rechtlichen Determinanten entgegengesetzten Überakzentuierung birgt, Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1335) m. w. N. in Fn. 107, 108.
232
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
V. Zwischenergebnis Gemäß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG müssen kommunale Entsorgungsträger also all diejenigen Entscheidungen treffen, die erforderlich sind, um die Sachaufgabe Abfallentsorgung zu erledigen. Welche organisatorischen Möglichkeiten zur Einschaltung privatrechtlich organisierter Entsorgungsgesellschaften dem Entsorgungsträger zur Verfügung stehen, regeln die §§ 15 ff. KrW-/AbfG für die Hausmüllentsorgung und die Entsorgung gewerblichen Abfalls unterschiedlich. Für den Bereich gewerblichen Abfalls bestimmen die §§ 15 Abs. 2, 16 Abs. 2, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 und § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die organisatorischen Möglichkeiten abschließend. Für den Bereich der Hausmüllentsorgung verpflichten die §§ 15 Abs. 1 S. 1, 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG den jeweiligen Entsorgungsträger dazu, alle Entscheidungen in Person, d. h. durch eigene Organe zu treffen. Soweit nicht bereits die gesellschafts- und bzw. oder einzelvertraglichen Bestimmungen eindeutige Zuweisungen von Wahrnehmungszuständigkeiten enthalten, kann deshalb mit Hilfe des Auslegungskriteriums der zuständigkeitskonformen Auslegung festgestellt werden, daß der Entsorgungsträger einer gemischtwirtschaftlichen Entsorgungsgesellschaft im Einzelfall eine Wahrnehmungszuständigkeit zugewiesen hat.
B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften Die Abfallbeseitigung ist gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 24 GG ein Gegenstand der konkurrierenden Gesetzgebung im Sinne von Art. 72 Abs. 1, 2 GG. Der Bund hat nach dem vorstehend Gesagten von der Möglichkeit, die Einschaltung von Privatrechtssubjekten in die kommunale Aufgabenerfüllung zu regeln, abschließend Gebrauch gemacht. Die Länder sind deshalb nicht befugt, abweichende Regelungen zu erlassen. § 3 Abs. 1 S. 1 MVAbfG und § 2 Abs. 1 S. 1 BbgAbfG verweisen deshalb hinsichtlich der Entsorgungsverpflichtung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger auf die bundesrechtlichen Regelungen. Entsprechendes gilt für die von den Stadtverordnetenversammlungen der Städte Potsdam und Rostock beschlossenen Abfallsatzungen, die möglicherweise ebenfalls eine Verpflichtung der beiden Städte enthalten, den gemischtwirtschaftlichen Entsorgungsgesellschaften eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen: Gemäß § 2 Abs. 1 AbfSa Potsdam betreibt die Landeshauptstadt Potsdam die Abfallentsorgung im Rahmen ihrer Pflichten nach dem KrW-/AbfG und dem BbgAbfG als öffentliche Einrichtung. Gemäß § 2 Abs. 3 S. 1 AbfSa Potsdam kann sich die Stadt „zur Erfüllung dieser Pflicht Dritter bedienen“.
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
233
Gemäß § 1 Abs. 3 S. 1 AbfSa Rostock ist die Hansestadt Rostock öffentlichrechtlicher Entsorgungsträger. Gemäß § 1 Abs. 4 S. 1 u. 2 AbfSa Rostock betreibt die Stadt „die Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung. Sie bedient sich zur Erfüllung dieser Pflicht der Stadtentsorgung Rostock GmbH (. . .)“. Beide Vorschriften setzen einen Zurechnungszusammenhang voraus. Zurechnungsendsubjekt der aus den Entscheidungen und Handlungen der Abfallentsorgungsgesellschaften resultierenden Verpflichtungen und Berechtigungen ist die jeweilige Stadt. Auch die Abfallentsorgungssatzungen bringen damit zwingend zum Ausdruck, daß die jeweiligen Entsorgungsgesellschaften als Organ der jeweiligen Stadt entscheiden und handeln.
C. Ergebnis Es läßt sich also feststellen, daß § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG i. V. m. § 2 Abs. 1 S. 1 BbgAbfG/§ 3 Abs. 1 S. 1 MVAbfG i. V. m. § 2 Abs. 1, Abs. 3 S. 1 AbfSa Potsdam/§ 1 Abs. 3, Abs. 4 S. 1, 2 AbfSa Rostock die Städte Potsdam und Rostock verpflichtet, ihren gemischtwirtschaftlich organisierten Abfallentsorgungsgesellschaften Wahrnehmungszuständigkeiten zuzuweisen, wenn und soweit sie diese in die Erfüllung ihrer Abfallentsorgungsverpflichtungen einschalten. Die gesellschafts- und einzelvertraglichen Abreden zwischen den Städten und den Gesellschaften über den Gegenstand des Unternehmens lassen sich im Zweifel zuständigkeitskonform dahingehend auslegen, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit enthalten. Die Stadtentsorgung Rostock GmbH und die Stadtentsorgung Potsdam GmbH sind deshalb Organe der Städte Rostock bzw. Potsdam, soweit sie die Entsorgung von Hausmüll und gewerblicher Abfälle zur Beseitigung betreiben.
Zweiter Abschnitt
Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Straßenreinigungsgesellschaften Im Gegensatz zur bundesrechtlich zugewiesenen Pflichtaufgabe der Abfallentsorgung handelt es sich in den Fällen kommunaler Straßenreinigung um landesrechtlich statuierte sogenannte pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben. In der Praxis erbringen Straßenreinigungsgesellschaften auf kommunaler Ebene verbreitet zugleich Leistungen der Abfall- und Abwasserentsorgung. Deshalb kann auf die bereits vorstehend62 untersuchten Fallbeispiele der Stadtentsorgung Ro-
62
Vgl. oben Dritter Teil, S. 216 ff.
234
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
stock GmbH und der Stadtentsorgung Potsdam GmbH verwiesen werden, die auch Dienste der Straßenreinigung erbringen.63 § 49a BbgStrG, der die Gemeinden zur Straßenreinigung verpflichtet, ist weitgehend identisch mit § 50 MVStrG. Deshalb kann bezüglich des Inhalts und Umfangs von § 50 MVStrG auf die Ausführungen zum Brandenburger Landesrecht verwiesen werden.
A. Inhalt und Umfang der Zuständigkeit aus § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG Möglicherweise enthält § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG, wonach „die Gemeinden . . . alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu reinigen“ haben, die Verpflichtung der Gemeinde Potsdam, der Stadtentsorgung Potsdam GmbH eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. I. Wortlaut und Genese Einem umfassend formulierten Wortlaut ist kein zwingender Hinweis auf eine in jedem Fall umfassende Entscheidungsverpflichtung im Sinne einer Erfüllungsverantwortung zu entnehmen.64 Denkbar ist es vielmehr auch, daß die Gemeinde in jedem Einzelfall verpflichtet ist, darüber zu entscheiden, ob sie sich zur Erledigung der Sachaufgabe auf eine Sicherstellung beschränkt oder alle Entscheidungen in Person trifft. Möglicherweise verpflichtet § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG die jeweilige Gemeinde also im Einzelfall lediglich zur Vornahme von Maßnahmen zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung durch Private. Die Genese der Regelungen des BbgStrG spricht möglicherweise für die letzte Auslegungsvariante. Gegenstand und Ziel aktueller Änderungen des BbgStrG65 war u. a. eine Entlastung der Gemeinden und insbesondere auch der Landestraßenbaubehörden bei ihrer jeweiligen Aufgabenwahrnehmung. So wurden z. B. die Möglichkeiten der Übertragung von gemeindlichen Aufgaben auf die Straßenbaubehörden beschränkt.66 Darüber hinaus wurde die Landesstraßenbauverwaltung neu organisiert.67
63 Vgl. dazu oben Dritter Teil, S. 218, Fn. 10, 11. Das Muster einer Vereinbarung über die Durchführung der Straßenreinigung zwischen einer Gemeinde und einer Gesellschaft des Privatrechts findet sich bei Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht, 32.70, S. 1 ff. 64 Oben Dritter Teil, S. 229, Fn. 52 in bezug auf § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG. 65 Zuletzt geändert und neu bekanntgemacht durch Gesetz v. 31.03.2005, GVBl. I S. 218. 66 Dazu sogleich unten S. 235 f. – Systematische Auslegung.
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
235
Diese neue Aufgabenverteilung zur Entlastung einzelner Aufgabenträger findet sich auch im Bereich des hier interessierenden Entscheidungsbereichs der Straßenreinigung. Nach § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG n. F. werden die Gemeinden z. B. ermächtigt, neben den Straßenbauämtern auch „private Dritte durch öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Durchführung der Winterwartung der Fahrbahnen in der geschlossenen Ortslage (zu) beauftragen“.68 Die Genese des BbgStrG deutet daher darauf hin, daß zumindest in Teilbereichen der Straßenreinigung wie z. B. der Winterwartung die Möglichkeit einer z. B. den Kapazitäten der jeweiligen Gemeinde angemessenen Aufgabenverteilung besteht. Es stellt sich deshalb die Frage, welche organisatorischen Möglichkeiten der Gemeinde hierbei zur Verfügung stehen. II. Systematische Auslegung Der vorstehend bereits erwähnte § 49a Abs. 4 BbgStrG ermächtigt die Gemeinden in S. 1 dazu, „anderen Gemeinden oder Gemeindeverbänden durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung . . . die Winterwartung der Fahrbahnen in der geschlossenen Ortslage (zu) übertragen oder diese mit der Durchführung der Aufgabe (zu) beauftragen“. Eine „Übertragung“ der Winterwartung auf die Straßenbaubehörden ist im Gegensatz zur alten Rechtslage nicht mehr möglich, lediglich eine „Beauftragung“ mit der „Durchführung der Aufgabe“ ist gemäß § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG vorgesehen. Darüber hinaus werden die Gemeinden – wie bereits vorstehend erwähnt – gemäß § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG ermächtigt, „private Dritte“ durch „öffentlich-rechtlichen Vertrag mit der Durchführung der Winterwartung der Fahrbahnen in der geschlossenen Ortslage (zu) beauftragen“. Nähere Angaben hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltungsmöglichkeiten dieser Beauftragung enthält die Regelung nicht. Es soll sich allerdings lediglich um eine „Beauftragung“ mit der „Durchführung“ und nicht um eine „Übertragung“ im Sinne von § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG handeln. Die Gemeinden sind also insoweit weiterhin eigenzuständig. Nur der Inhalt und Umfang der Winterwartungsverpflichtung kann um die „Durchführung“ der Aufgabe reduziert werden. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, sich auf eine Sicherstellungsverantwortung zu beschränken und Teile des Entscheidungsprozesses Dritten zur Wahrnehmung zu überlassen. Ob diese Wahrnehmung durch Dritte eine solche lediglich „für“ oder auch „als und für“ die jeweilige Gemeinde ist, läßt der Wortlaut offen.
67 Vgl. nur die Gesetzesentwürfe der Landesregierung, LT-Drs. 2/5987, S. 1 (19, 20 ff.) und LT-Drs. 3/7214, S. 1 ff. und die Berichte des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr, LT-Drs. 2/6267, S. 1 ff. und LT-Drs. 2/6324, S. 1 ff. 68 GVBl. I 2005, S. 134 (154).
236
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Sprachlich lehnt sich § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG an den bereits untersuchten § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG an, allerdings mit dem Unterschied, daß der Dritte in Abgrenzung zu den Straßenbaubehörden und den Gemeinden und Gemeindeverbänden ausdrücklich als „privater Dritter“ bezeichnet wird. Ob dieser Dritte als Privater oder, soweit es sich um eine Juristische Person handelt, als Organ mit der Durchführung beauftragt wird, bleibt offen. Die Tatsache, daß der Dritte als „privat“ bezeichnet wird, bedeutet nicht, daß dieser nicht relativ auch Zuweisungssubjekt einer Wahrnehmungszuständigkeit oder Amtswahrnehmungsverpflichtung sein kann. Aufgrund der ausdrücklichen Delegationsermächtigung in § 49a Abs. 4 S. 1 BbgStrG ist zum einen davon auszugehen, daß § 49a Abs. 4 S. 1 BbgStrG die Möglichkeiten einer solchen verantwortungsübertragenden Delegation von Teilen der Zuständigkeit auf Dritte abschließend regelt. Eine konkludente Ermächtigung zur verantwortungsübertragenden Delegation auf Privatrechtssubjekte kann deshalb für § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG nicht angenommen werden. Nicht abschließend regelt § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG dagegen die Möglichkeiten einer organisatorischen Einschaltung von privaten Dritten in die Durchführung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung. Die Genese der Vorschrift spricht dafür, daß die ausdrückliche Nennung privater Dritter in § 49a Abs. 4 S. 2 BbgStrG auf dem Bestreben beruht, gerade bezüglich der Winterwartung eine zusätzliche Entlastung der Straßenbaubehörden herbeizuführen. Eine abschließende Regelung der Einschaltung Privater in die gemeindliche Aufgabe der Straßenreinigung ist damit allerdings nicht bezweckt. Deshalb ist davon auszugehen, daß § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG den Gemeinden die Verantwortung für die Aufgabenerledigung zuweist, ohne zugleich starre Festlegungen zu treffen, welche Teilaufgaben in einer der zuständigen Verwaltungseinheit zurechenbaren Weise wahrzunehmen sind.69 § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG verpflichtet die Stadt Potsdam vielmehr dazu, im konkreten Fall darüber zu entscheiden, ob sie die Stadtentsorgung Potsdam GmbH als Organ oder als Privater in die Straßenreinigung einschaltet. Es kommt deshalb darauf an, an welchem Entscheidungsmaßstab die Stadt Potsdam diese Entscheidung auszurichten hat. Nur wenn der Entscheidungsmaßstab feststeht, läßt sich nachweisen, welche Organisationsentscheidung die Stadt im konkreten Fall zu treffen hat. III. Teleologische Auslegung 1. Optimale Aufgabenerledigung Wenn Sinn und Zweck eines Zuständigkeitsrechtssatzes die Gewährleistung einer optimalen Aufgabenerledigung ist,70 dann ist der jeweilige Verwaltungs69
Oben Dritter Teil, S. 229, Fn. 52.
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
237
träger immer dann zur Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit verpflichtet, wenn die Aufgabenwahrnehmung durch Organe die im Einzelfall beste organisatorische Ausgestaltung darstellt. Es kommt daher wie bereits im Rahmen des § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG auf eine Konkretisierung des Begriffs der optimalen Aufgabenerledigung an, d. h. in bezug auf welche Teil- und Unterziele die jeweilige Aufgabenerledigung optimal sein soll. Im Gegensatz zu den §§ 15 ff. KrW-/AbfG enthält § 49a BbgStrG keine entsprechend differenzierte Regelungssystematik. Der staatliche Zuständigkeitsadressat hat vielmehr in bezug auf die Straßenreinigung im Allgemeinen ein umfassendes „Organisationsermessen“.71 Geht man davon aus, daß alle staatlichen Entscheidungen umfassend rechtlich gebunden sind, dann kann es kein Ermessen eines staatlichen Rechtssubjektes in dem Sinne geben, daß dieses staatliche Rechtssubjekt selbstgewählte, außerrechtliche Entscheidungsmaßstäbe heranziehen könnte.72 Auch wenn der Verwaltungsträger verpflichtet ist, eine optimale Organisationsentscheidung zu treffen, gibt es aus Sicht des Zuständigkeitsrechtssatzes nur eine rechtmäßige Organisationsentscheidung. Das dem Verwaltungsträger zukommende Organisationsermessen ist daher umfassend rechtlich gebunden.73 Je nachdem welche Organisationsentscheidung dies im Einzelfall ist, ist zuständigkeitskonform davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger genau diese eine, optimale Organisationsentscheidung getroffen hat. 2. Grenzen der Nachvollziehbarkeit Es kommt deshalb darauf an, wie man ermittelt, welche Organisationsentscheidung im Einzelfall diese eine rechtmäßige Organisationsentscheidung darstellt. Privatrechtssubjekte können zur Erreichung unterschiedlicher, teilweise sogar konträrer Teil-Ziele in die Aufgabenwahrnehmung eines Verwaltungsträgers eingeschaltet werden.74 Diese Ziele sind dem übergeordneten Ziel optimaler Aufgabenerfüllung nachgeordnet. Insoweit kann man von einer „Zweckstaffelung“ sprechen.
70
Dritter Teil, S. 227 ff. Zum Begriff vgl. nur Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5, § 91 VII 7, Rn. 112. 72 Ausführlich dazu Krebs, Kontrolle, S. 74 ff., insbes. S. 77 mit Verweis u. a. auf H. H. Rupp, Grundfragen, S. 210 f. (a. a. O., S. 78 f., Fn. 176). Darauf, daß es nach dem normativen Ansatz keine außerrechtlichen, „präpositiven“ Entscheidungsmaßstäbe staatlicher Rechtssubjekte geben kann, wurde bereits oben Erster Teil, S. 92 ff. hingewiesen. 73 So Krebs, Kontrolle, S. 78 f. zum Ermessen der Verwaltung. 74 Vgl. nur Voßkuhle, VVDStRL 62 (2003), S. 266 ff. Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht, S. 45 ff. untersucht z. B. die verschiedenen, zumeist nebeneinander existierenden Zielsetzungen staatlicher Wirtschaftsteilnahme. 71
238
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Geht man davon aus, daß alle Ziele staatlicher Rechtssubjekte notwendig rechtlich normierte Ziele sind,75 dann sind staatliche Entscheidungen auch hinsichtlich ihrer Ziele umfassend rechtlich gebunden.76 Welche Organisationsentscheidung angesichts der im Einzelfall relevanten unterschiedlichen Teil- und Nebenziele optimal ist, richtet sich nach den jeweils anwendbaren Rechtssätzen im Einzelfall. § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG sind neben dem Entscheidungsmaßstab der optimalen Aufgabenerledigung keine weiteren Zielvorgaben und Entscheidungsmaßstäbe zu entnehmen, die das übergeordnete Ziel der optimalen Erledigung der Straßenreinigung konkretisieren könnten. Nach § 100 Abs. 1, 2 BbgGO darf sich die jeweilige Gemeinde wirtschaftlich betätigen, also eine Tätigkeit im Sinne von § 100 Abs. 1 BbgGO verfolgen, die auch mit der Absicht der Gewinnerzielung erbracht werden kann.77 Die Beteiligung der Stadt Potsdam an einem Straßenreinigungsunternehmen ist damit wirtschaftliche Betätigung. Die Erzielung von Gewinn ist deshalb als Entscheidungsmaßstab für die Gebietskörperschaften zumindest nicht von vornherein ausgeschlossen. Nach § 107 S. 2 BbgGO müssen die wirtschaftlichen Unternehmen, welche die Gemeinde betreibt, oder an denen sie sich beteiligt, einen Jahresgewinn erbringen, der so hoch ist, daß eine technische und wirtschaftliche Fortentwicklung möglich ist und die notwendigen Rücklagen erwirtschaftet werden.78 Die Organisationsentscheidung der jeweiligen Gemeinde muß also immer auch den Entscheidungsmaßstab der Wirtschaftlichkeit beachten. Hierbei ist auf eine Vielzahl von Faktoren Rücksicht zu nehmen, z. B. auf den Kapitalbedarf, mögliche Verluste in der Anlaufphase, prognostizierte Gewinnerwartungen, die Vermeidung von Überkapazitäten und etwaige Veränderungen der Einwohnerzahlen und der Altersstruktur.79
75
Vgl. dazu bereits oben Erster Teil, S. 92 ff. Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden, S. 209 (209 f.) und oben Erster Teil, S. 92 ff. 77 Ausführlich zum Begriff der Wirtschaftlichkeit und dessen Bedeutungselementen vgl. nur Gersdorf, Öffentliche Unternehmen, S. 413 ff.; Möstl, Grundrechtsbindung, S. 3 ff. m. w. N.; Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg, § 100 BbgGO, Rn. 2. 78 Vgl. auch die entsprechenden Vorschriften in Art. 95 Abs. 1 S. 1 BayGO; § 102 Abs. 2 2. Hs. BWGO; § 121 Abs. 8 S. 1 HeGO; § 75 Abs. 1 S. 1 MVKV; § 114 Abs. 1 S. 1 NdsGO; § 109 Abs. 1 S. 2 NrWGO; § 85 Abs. 2 S. 1 2. HS RPGO; § 108 Abs. 3 S. 3 SaarlKSVG; § 97 Abs. 3 2. Hs. SächsGO; § 116 Abs. 1 S. 2 SAGO; § 107 S. 2 SHGO; § 75 Abs. 1 ThürKO. 79 Aufzählung nach Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg, § 100 BbgGO, Rn. 3.3. 76
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
239
Darüber hinaus verpflichtet § 100 Abs. 3 S. 1 BbgGO die kommunalen Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung im Sinne von § 100 Abs. 1 BbgGO zu einer sparsamen Unternehmensführung.80 Dazu gehört, daß die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft vor ihrer abschließenden Entscheidung über die Organisation der Aufgabenerfüllung einen Kostenvergleich vornimmt.81 Der Vergleichsmaßstab sind hierbei die Kosten, die bei der Wahrnehmung der Zuständigkeit in Eigenregie entstehen würden (sogenannter Regiekostenvergleich).82 Eine zur Erledigung der jeweiligen Sachaufgabe optimal geeignete Organisationsentscheidung ist also nach dem vorstehend Gesagten eine Entscheidung, die eine kostengünstige und wirtschaftliche Produktion der jeweiligen Ware oder im vorliegenden Beispiel eine für den Verwaltungsträger kostengünstige und wirtschaftliche Straßenreinigung ermöglicht.83 So stellt möglicherweise am Maßstab dieses Teil-Zieles die Einschaltung eines privaten Dritten die optimale Organisationsentscheidung dar, weil der Dritte infolge überregionaler Tätigkeitsfelder aufgabengerechtere Betriebsgrößen mit günstigerem Kosten-NutzenVerhältnis aufweisen kann.84 Darüber hinaus kann sich die Einschaltung eines privaten Dritten gegenüber der staatlichen Organisationslösung als wirtschaft-
80 Vgl. auch die entsprechenden Vorschriften in Art. 61 Abs. 2 S. 1, 95 Abs. 1, 106 Abs. 1 Nr. 3 BayGO; §§ 74 Abs. 2, 10 Abs. 3 S. 1, 116 Abs. 3 Nr. 3 BbgGO; § 77 Abs. 2 BWGO; § 92 Abs. 2 HeGO; § 43 Abs. 1 S. 2 MVKV; § 82 Abs. 2 NdsGO; § 75 Abs. 1 S. 2 NrWGO; §§ 93 Abs. 2, 122 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 RPGO; § 82 Abs. 2 SaarlKSVG; § 72 Abs. 2 SächsGO; § 90 Abs. 2 SAGO; §§ 8, 75 Abs. 2, 101 Abs. 4 S. 2 SHGO; §§ 53 Abs. 2, 84 Abs. 1 Nr. 3 ThürKO. Vgl. auch § 7 Abs. 1 S. 1 BHO und die entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften. 81 Vgl. nur Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (408 ff.). Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg, § 100 BbgGO, Rn. 5.1 weist darauf hin, daß sich die Erfüllung dieser Aufgabe „in der Praxis allerdings häufig schwierig (gestaltet), da in den Gemeinden oft eine hinreichende Leistungsbeschreibung und Kostenrechnung fehlt“. 82 Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (408). 83 Vgl. auch § 49a Abs. 4 BbgStrG a. F., wonach die Gemeinden „durch Vereinbarung die Winterwartung der Fahrbahnen . . . den unteren Straßenbaubehörden . . . übertragen (können), wenn sie technisch und personell nicht in der Lage sind, die Winterwartung selbst wahrzunehmen oder soweit die unteren Straßenbaubehörden . . . die Winterwartung kostengünstiger durchführen können“. Eine entsprechende ausdrückliche Regelung fehlt in § 49a Abs. 4 BbgStrG n. F. 84 Darauf weist Tettinger, in: Eichhorn/Engelhardt (Hrsg.), Standortbestimmung öffentlicher Unternehmen, S. 145 (147) hin. Ebenso Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (408), wonach dies allerdings „immer eine Frage des Einzelfalles“ sei. Vgl. auch z. B. § 100 Abs. 3 S. 1 BbgGO, wonach „die Gemeinde . . . im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung dafür zu sorgen (hat), dass Leistungen, die von privaten Anbietern in mindestens gleicher Qualität und Zuverlässigkeit bei gleichen oder geringeren Kosten erbracht werden können, diesen Anbietern übertragen werden, sofern dies mit dem öffentlichen Interesse vereinbar ist.“
240
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
licher erweisen, auch falls dies z. B. mit einem Gebührenanstieg für die Verbraucher verbunden ist, wenn die notwendige Modernisierung einer Anlage sonst unterbleiben würde.85 Möglicherweise ist also eine bestmögliche Erledigung von Sachaufgaben eine Erledigung durch Heranziehung privater Infrastruktur, um technische Neuerungen schneller und kostengünstiger einführen zu können.86 Auch die Beschaffung privaten Know-Hows kann hierbei ein Wahlkriterium darstellen.87 Der Entscheidungsmaßstab der wirtschaftlichen Betätigung steht nach § 100 Abs. 2 Nr. 2 BbgGO unter dem Vorbehalt, daß der „öffentliche Zweck dies rechtfertigt“.88 Gemäß § 107 S. 1 BbgGO sind Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, „dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird“. Ein öffentlicher Zweck ist eine Entscheidungsvorgabe des Staates, die einen bestimmten Gemeinwohlbezug aufweist.89 Konkretisiert wird diese Entscheidungsvorgabe nach dem normativen Ansatz durch die Rechtsordnung. Es stellt sich also die Frage, welche Rechtssätze den Entscheidungsmaßstab des öffentlichen Zwecks für den jeweiligen kommunalen Entscheider konkretisieren. Jedenfalls die rechtlich zugewiesenen Zuständigkeiten des jeweiligen Verwaltungsträgers geben nähere Hinweise, worin der Gemeinwohlbezug im Einzelfall bestehen kann.90 Der Begriff des „öffentlichen Zwecks“ kennzeichnet also u. a. denjenigen Entscheidungsmaßstab, den der jeweilige Zuständigkeitsrechtssatz aufstellt.
85 Beispiel nach Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung, S. 392 (410) als Argument für die Vereinbarung eines Betreibermodells. 86 Auf dieses „Privatisierungsziel“ weist auch Zacharias, DÖV 2001, S. 454 (461) hin. Infolge dessen könne „auch der Bürger . . . von der zu erwartenden Optimierung profitieren, wenn und soweit es infolge der Privatisierung gelingt, daß die Kosten der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung trotz steigender Anforderungen stabil bleiben oder gar sinken“. In diesem Sinn auch Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1334) zu den Privatisierungsmotiven in der Abfallwirtschaft; ebenso Tettinger, DVBl. 1995, S. 213 (215): „High-Tech-Entsorgung“. Vgl. auch BGHSt 50, S. 299 (301). 87 Schink, in: Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen, S. 5 (23 f.); ders., VerwArch 85 (1994), S. 251 (253); Kahl, DVBl. 1995, S. 1327 (1333); Rudolph, in: Fettig/ Späth (Hrsg.), Privatisierung, S. 175 (187); Tettinger, DVBl. 1995, S. 213 (218). Rudolph, a. a. O., S. 187 weist darauf hin, daß der „Einkauf von Spezial-Know-how“ zu „politischer und rechtlicher Absicherung der Verantwortlichen durch Einschaltung eines externen Experten“ führen kann. 88 Vgl. dazu auch die Nachweise oben Erster Teil, S. 48, Fn. 105. 89 Vgl. dazu schon oben Erster Teil, S. 82 ff. 90 Verbreitet finden sich lediglich allgemeine Hinweise auf den Inhalt dieses Entscheidungsmaßstabes. So sollen „Aufgaben der Daseinsvorsorge“ darunter zu fassen sein oder die „Förderung des allgemeinen Wohls.“ Vgl. so nur Darsow, in: ders./Gentner/Glaser/Meyer (Hrsg.), Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, § 68, Rn. 2. Zur fehlenden Spezifizierbarkeit sowie zur notwendigen verfassungs- und einfachrechtlichen Konkretisierung des Begriffs der öffentlichen Aufgabe vgl. bereits oben Erster Teil, S. 85 ff., 92 ff.
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
241
Der Zweck der Zuständigkeit nach § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG, eine umfassende Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen der Straßenreinigung, kann im Einzelfall daher aufgrund von §§ 100 Abs. 2 Nr. 1, 107 S. 1 BbgGO das Abweichen von Rentabilitätsaspekten erforderlich machen. Die Ziele der Kostenreduzierung und Gewinnerzielung können aber andererseits auch im Dienst der Aufgabenerfüllung stehen. Darauf, daß sich die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und erwerbswirtschaftliche Zielsetzungen nicht notwendig ausschließen, wurde bereits oben91 hingewiesen. Neben den Zuständigkeitsrechtssätzen können andere Rechtssätze den Entscheidungsmaßstab des öffentlichen Zwecks konkretisieren. So wird verbreitet darauf hingewiesen, die Organisationsentscheidung müsse im Einzelfall sicherstellen, daß die Erledigung einer Sachaufgabe z. B. dem Ausbau öffentlicher Infrastruktur, der Wirtschaftsförderung, der Wettbewerbssicherung, der Arbeitsplatzsicherung oder der Gewährleistung einer krisensicheren Versorgung der Bevölkerung92 diene. Welche verfassungs- oder einfachrechtlichen Regelungen entsprechende Entscheidungsvorgaben für die jeweilige kommunale Gebietskörperschaft statuieren, soll hier nicht weiter untersucht werden.93 Nach § 100 Abs. 3 S. 1 BbgGO haben die Gemeinden die jeweilige Aufgabe der Leistungserbringung Privaten zu übertragen, wenn diese dieselbe in mindestens gleicher Qualität und Zuverlässigkeit bei gleichen oder geringeren Kosten erbringen können, sofern dies mit dem öffentlichen Interesse vereinbar ist.94 Auch dieser Subsidiaritätsgrundsatz hat Einfluß auf die jeweils zu treffende richtige Organisationsentscheidung.
91
Erster Teil, S. 87 ff. Aufzählung nach Uechtritz/Otting, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 6, Rn. 50 m. w. N. in Fn. 101. Vgl. ähnlich Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg, § 100 BbgGO, Rn. 5.2; Darsow, in: ders./Gentner/Glaser/Meyer, Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, § 68, Rn. 3. 93 Darsow, in: ders./Gentner/Glaser/Meyer, Kommunalverfassung MecklenburgVorpommern, § 68, Rn. 3 weist z. B. darauf hin, daß Aufgaben der Arbeitsmarktpolitik nicht in den Zuständigkeitsbereich der Kommunen fallen. „Lediglich die sozialpolitische Bedeutung von Langzeitarbeitslosen oder arbeitslosen Jugendlichen vermag im Einzelfall einen . . . öffentlichen Zweck zu begründen“ (a. a. O., Rn. 3). Ebenso Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg, § 100 BbgGO, Rn. 5.2; Keller, in: Articus/Schneider (Hrsg.), NrWGO, Erl. § 107 GO, Rn. 3. 94 Vgl. die entsprechenden sogenannten Subsidiaritätsklauseln in Art. 87 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 BayGO; § 107 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 NrWGO; § 101 Abs. 1 SHGO; § 71 Abs. 1 Nr. 4 ThürKO. § 71 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 ThürKO sieht ein Markterkundungsverfahren vor. Teilweise wird versucht, das Subsidiaritätsprinzip aus der Verfassung abzuleiten. Einen Überblick über die Diskussion gibt z. B. Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S. 125 ff. 92
242
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Auf die Existenz sonstiger Entscheidungsvorgaben, die sich aus dem Europarecht, Vergaberecht, Wettbewerbsrecht und dem sonstigen Verwaltungsrecht ergeben, soll hier nur hingewiesen werden.95 Die rechtlichen Entscheidungsmaßstäbe eines Verwaltungsträgers sind also sehr komplex.96 Daher erscheint es nahezu unmöglich, die eine im konkreten Fall „optimale“ Organisationsentscheidung nachzuvollziehen. Darüber hinaus weisen unterschiedliche Organisationsformen auch unterschiedliche Vor- und Nachteile auf,97 so daß ein Vergleich verschiedener Organisationsformen zusätzlich erschwert wird. Diese Schwierigkeiten werden verbreitet zum Anlaß genommen, Zuständigkeitsrechtssätzen nur die Verpflichtung zu entnehmen, „sachangemessen“ oder „praktikabel“ zu entscheiden.98 Dies kann hier dahingestellt bleiben, da auch in diesem Fall offen bleibt, welche Organisationsentscheidung nach dem Sinn und Zweck des jeweiligen Zuständigkeitsrechtssatzes „sachangemessen“ bzw. „praktikabel“ ist. Der Begriff der Sachangemessenheit setzt eine Wertung voraus, deren Ergebnis ohne nähere rechtliche Anhaltspunkte zu den Wertungskriterien des Verwaltungsträgers nicht nachvollzogen werden kann. Das Kriterium der Sachangemessenheit als Element einer Zuständigkeitsverpflichtung ist deshalb für die zuständigkeitskonforme Auslegung von Verträgen nicht besser geeignet als das Kriterium der „optimalen Entscheidung“.
95 Vgl. z. B. zu europarechtlichen Vorgaben staatlicher Wirtschaftsteilnahme nur Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 37 f., 48 f., 50 ff.; Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR I11, § 17, Rn. 1 ff. Zu den Vorgaben des Wettbewerbsrechts vgl. z. B. Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge, S. 245 ff.; Emmerich, Unlauterer Wettbewerb, S. 46 ff.; R. Scholz, ZHR 132 (1969), S. 97 ff.; Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht, S. 1 ff.; Storr, Staat, S. 489 ff., 523 ff.; Lux, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 10, Rn. 1 ff. Zu den vergaberechtlichen Voraussetzungen staatlicher Wirtschaftstätigkeit z. B. Burgi, GewArch 2001, S. 217 ff.; Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen, E 57 ff.; Frenz/Kafka, GewArch 2000, S. 129 ff.; Gallwas, GewArch 2000, S. 401 ff.; Otting/Ohler, in: Hoppe/ Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 14, Rn. 1 ff.; Pietzcker, ZHR 162 (1998), S. 427 ff.; Tomerius, NVwZ 2000, S. 727 ff. 96 Vgl. auch Bauer, DÖV 1998, S. 89 (92): „Unter dem Hinweis auf das Gesetz als Rahmen und Richtlinie der Vertragsgestaltung verbirgt sich allerdings bisweilen ein sehr komplexes Regelwerk“. Ebenso Storr, DÖV 2005, S. 101 (105) der gerade aufgrund der Komplexität staatlicher Entscheidungsvorgaben die Entwicklung von „Konkretisierungshilfe(n)“ in Form von „Kooperationsvertragstypen“ und der gesetzlichen Vorgabe „bereichsspezifischer Vertragsinhalte“ fordert. 97 Ausführlich z. B. zu den möglichen Vorteilen eines Betreibermodells Bodanowitz, Organisationsformen, S. 109 ff.; Schoch, in: Ipsen (Hrsg.), Privatisierung, S. 63 (83 ff., 86 ff.). 98 Vgl. dazu bereits oben Dritter Teil, S. 227, Fn. 47. Krebs, Kontrolle, S. 76 weist darauf hin, daß „die mehr oder minder mangelnde ,Eindeutigkeit‘ von Rechtssätzen der rechtliche Regelbefund“ sei.
2. Abschn.: Staatseigenschaft von Straßenreinigungsgesellschaften
243
IV. Zwischenergebnis § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG verpflichtet den kommunalen Entsorgungsträger dazu, eine funktionierende Straßenreinigung sicherzustellen und die im Einzelfall zur Aufgabenerledigung beste organisatorische Ausgestaltung zu wählen. Konkretere Vorgaben lassen sich der Vorschrift nicht entnehmen. Im Gegensatz zu den §§ 15 ff. KrW-/AbfG überläßt das Gesetz dem Verwaltungsträger die Entscheidung über die Art der Organisation optimaler Aufgabenerfüllung. Geht man davon aus, daß alle staatlichen Entscheidungen umfassend rechtlich gebunden sind, dann kann es kein rechtlich ungebundenes Organisationsermessen des jeweiligen Zuständigkeitsadressaten geben. Ein Zuständigkeitsrechtssatz verpflichtet seinen Adressaten vielmehr umfassend. Es gibt aus Sicht des Zuständigkeitsrechtssatzes nur eine optimale Organisationsentscheidung. Nur diese Entscheidung ist zuständigkeitsgemäß. Neben dem jeweiligen Zuständigkeitsrechtssatz statuieren auch viele andere Rechtssätze Entscheidungsvorgaben für den jeweiligen Verwaltungsträger, die das übergeordnete Ziel optimaler Aufgabenerledigung ergänzen oder konkretisieren. Die Verwaltungsentscheidung muß daher umfassend rechtmäßig sein. Welche Organisationsentscheidung die Stadt Potsdam zu treffen hat, ob sie also der Stadtentsorgung Potsdam GmbH eine Wahrnehmungszuständigkeit zuweisen muß oder nicht, läßt sich an dieser Stelle ohne genaue Kenntnisse der vorstehend genannten Entscheidungsfaktoren sowie der wirtschaftlichen Lage und des Geschäftsumfeldes der Stadtentsorgung Potsdam GmbH nicht feststellen. Voraussetzung dafür, diese eine optimale Organisationsentscheidung nachzuvollziehen, ist eine umfassende Auswertung der gesamten unternehmensinternen sowie -externen Entscheidungssituation.99
B. Sonstige kommunal- und satzungsrechtliche Vorschriften Erleichtert werden würde eine solche Auswertung, wenn sonstige kommunalund satzungsrechtliche Bestimmungen für die Stadt Potsdam Konkretisierungen der Verpflichtung aus § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG enthielten. 99 Diese Schwierigkeiten ähneln insoweit denen des Beherrschungsansatzes. Wie oben Erster Teil, S. 63 ff. dargestellt, setzt die Feststellung des Vorliegens einer staatlichen Entscheidungsherrschaft ebenfalls eine umfassende Auswertung der unternehmensinternen und -externen Entscheidungssituation voraus. Die Auswertung erfolgt allerdings nach anderen Kriterien. Während der Beherrschungsansatz Hinweise auf das Bestehen einer rechtlichen und/oder tatsächlichen Entscheidungsherrschaft des staatlichen Anteilseigners sucht, ist im Rahmen der zuständigkeitskonformen Auslegung nach dem normativen Ansatz zu prüfen, welche Organisationsentscheidung der staatliche Anteilseigner aufgrund der rechtlichen Entscheidungsvorgaben im Einzelfall treffen muß.
244
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Potsdam hat auf Grund von § 5 Abs. 1 S. 1 BbgGO i. V. m. § 49a Abs. 5, 6 BbgStrG die StrSa Potsdam mit Regelungen über die Art und den Umfang der Reinigung sowie die Auferlegung der Reinigungspflicht gegenüber Grundstückseignern beschlossen. Darüber hinaus wurde aufgrund § 5 Abs. 1 S. 1 BbgGO i. V. m. § 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 S. 1 BbgKAG die StrGebSa Potsdam mit Regelungen über die Erhebung und Höhe von Benutzungsgebühren erlassen. Die organisationsrechtliche Zuordnung der Entsorgungsgesellschaften zur jeweiligen Gebietskörperschaft ist gerade nicht Gegenstand dieser Regelungen. Die in Ausführung der Ermächtigungsvorschriften beschlossene StrSa Potsdam enthält insoweit keine darüber hinausgehenden Regelungen. Auch die Bestimmung in § 1 Abs. 1 S. 2 StrSa Potsdam, wonach die Stadt Potsdam „die Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung betreibt“, läßt sich nicht als Hinweis auf die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Reinigungsgesellschaft verstehen.100 § 14 Abs. 1 BbgGO, wonach alle Einwohner der Gemeinde im Rahmen des geltenden Rechts berechtigt sind, die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen, läßt sich ebenfalls nicht dahingehend auslegen, daß er die Gemeinde in jedem Einzelfall verpflichtet, der die Einrichtung betreibenden Gesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zuzuweisen. § 14 Abs. 1 BbgGO verpflichtet die Gemeinde dazu, alle Entscheidungen zu treffen, die erforderlich sind, damit jeder Einwohner (im Rahmen der Kapazitäten) die öffentlichen Einrichtungen benutzen kann.101 Sie muß im Einzelfall diejenige organisatorische Vorkehrung treffen, die die Durchsetzung der Benutzungsansprüche optimal gewährleistet. Ob dies im Einzelfall der Betrieb der Anlage durch eigene, organisationsrechtlich zurechenbare Rechtssubjekte ist oder lediglich die Sicherstellung der Benutzung durch die vertragliche Sicherung von Einwirkungsrechten
100
Vgl. zur Bedeutung einer Widmung bereits oben Zweiter Teil, S. 188 ff. Demgegenüber finden sich auch Satzungsvorschriften wie z. B. § 1 Abs. 2 WassSa Potsdam, welche den jeweiligen Verwaltungsträger zur Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die jeweilige Anteilsgesellschaft verpflichten. So „bedient“ sich gemäß § 1 Abs. 2 WassSa Potsdam die Stadt Potsdam „zur Erfüllung dieser Aufgabe [d. h. der Wasserversorgung, Anm. d. Verf.] der Energie und Wasser Potsdam GmbH“. Das Wort „bedienen“ deutet hier darauf hin, daß die Entscheidungen und Handlungen der (gemischtwirtschaftlichen) Energie und Wasser Potsdam GmbH der Stadt Potsdam als eigene zugerechnet werden sollen. Wenn die organisationsrechtliche Zurechnung das Organisationsprinzip der Verwaltungsorganisation ist, dann muß dieser Zurechnungszusammenhang notwendig ein organschaftlicher sein [vgl. dazu ausführlich oben Zweiter Teil, S. 105 ff., 177 ff., insbes. S. 181]. 101 Zum sogenannten Benutzungs- und Verschaffungsanspruch vgl. nur Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 95 V 3, Rn. 196 ff. Nach verbreiteter Ansicht habe die Gebietskörperschaft insoweit ein „Organisationsermessen“. Zu diesem Begriff vgl. bereits oben Dritter Teil, S. 230, Fn. 53 u. S. 237, Fn. 71, 72, 73.
Ergebnis zum Dritten Teil
245
gegenüber einer privaten Betreibergesellschaft, kann an dieser Stelle aus den vorstehend genannten Gründen nicht nachvollzogen werden.
C. Ergebnis § 49a Abs. 1 S. 1 BbgStrG verpflichtet die jeweilige Gemeinde dazu, eine funktionierende Straßenreinigung sicherzustellen und die jeweils optimale Organisationsform zur Erledigung der Sachaufgabe Straßenreinigung zu wählen. Ob die Gemeinde alle Entscheidungen und Realhandlungen in Person treffen oder ob sie sich auf die Gewährleistung einer funktionierenden Straßenreinigung durch Private beschränken muß, richtet sich nach den sonstigen rechtlichen Entscheidungsvorgaben der Gemeinde und setzt daher eine umfassende Einzelfalluntersuchung voraus. Auch den anderen kommunal- und satzungsrechtlichen Vorschriften lassen sich keine näheren Aussagen über die konkrete Organisationsentscheidung im Einzelfall entnehmen. Welche Organisationsentscheidung damit die im konkreten Fall optimale Entscheidung ist, läßt sich jedenfalls in dem hier gewählten Untersuchungsrahmen nicht nachvollziehen.
Ergebnis zum Dritten Teil Die Auswertung der beiden vorstehend beschriebenen sachmaterienbezogenen Zuständigkeitsrechtssätze hat gezeigt, daß der Inhalt und Umfang von Zuständigkeiten staatlicher Rechtssubjekte sehr unterschiedlich ausgestaltet sein kann. Gemeinsam ist allen Sachzuständigkeiten lediglich, daß sie ein staatliches Rechtssubjekt verpflichten, bestimmte Entscheidungen nach mehr oder weniger konkret bestimmten Vorgaben zu treffen. Rechtssätze, die Pflichtaufgaben kommunaler Gebietskörperschaften statuieren, enthalten mehr oder weniger konkrete Vorgaben hinsichtlich des „Ob“ und „Wie“ staatlichen Entscheidens. In der Regel ist der jeweilige Verwaltungsträger dazu verpflichtet, darüber zu entscheiden, wie er, d. h. insbesondere in welcher Organisationsform er die zugewiesenen Aufgaben erledigt. Sein Entscheidungsmaßstab ist das Ziel einer optimalen Aufgabenerledigung. Die organisatorischen Mittel zur Erreichung dieses Ziels können von den jeweiligen Zuständigkeitsrechtssätzen unterschiedlich konkret vorgegeben sein. So verpflichtet z. B. § 15 Abs. 1 S. 1 KrW-/AbfG die nach Landesrecht zu bestimmenden öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dazu, darüber zu entscheiden, in welcher Organisationsform sie die Aufgabe der Abfallentsorgung erfüllen. Geht man davon aus, daß alle staatlichen Entscheidungen umfassend rechtlich gebunden sind, dann kann es nur eine richtige Entscheidung geben. Die kommunalen Entsorgungsträger sind verpflichtet, diese eine optimale und umfassend rechtmäßige Organisationsentscheidung zu treffen. Die §§ 15 Abs. 2, 16
246
3. Teil: Inhalt und Umfang kommunaler Sachzuständigkeiten
Abs. 2 S. 1, 17 Abs. 3, 18 Abs. 2 KrW-/AbfG und § 16 Abs. 1 S. 1 KrW-/ AbfG geben die Modalitäten einer optimalen Organisationsentscheidung vor. Dem jeweiligen kommunalen Entsorgungsträger verbleibt die Entscheidung darüber, welche Organisationsform – ein Regiebetrieb in öffentlichrechtlicher Form, eine Eigengesellschaft in privatrechtlicher Form oder eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft des Privatrechts als Organ des Verwaltungsträgers – im konkreten Einzelfall eine optimale Abfallentsorgung gewährleistet. Er ist verpflichtet diese eine optimale Organisationsentscheidung zu treffen. Soweit sich der jeweilige kommunale Entsorgungsträger zur Gründung einer gemischtwirtschaftlichen Entsorgungsgesellschaft und/oder zur vertraglichen Bindung derselben entschlossen hat, lassen sich diese vertraglichen Regelungen – einen entsprechenden Auslegungsspielraum vorausgesetzt – zuständigkeitskonform dahingehend auslegen, daß sie die Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die Gesellschaft enthalten. Die untersuchten landesrechtlichen Regelungen über die Verpflichtung der Gemeinden, alle öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu reinigen, ebenfalls eine sogenannte, in diesem Fall landesrechtlich normierte Pflichtaufgabe, enthielten im Gegensatz zur bundesrechtlichen Regelung der §§ 15 ff. KrW-/AbfG keine Vorgaben hinsichtlich der organisatorischen Ausgestaltung der Aufgabenerledigung. Die Gemeinden sind landesrechtlich lediglich verpflichtet, die optimale organisatorische Lösung zu wählen. Dies kann je nach Einzelfall eine eigenbetriebliche Lösung oder die Gründung und/oder vertragliche Bindung einer, möglicherweise gemischtwirtschaftlichen, Gesellschaft des Privatrechts sein. Es ist in diesem Fall möglich, die Gesellschaft als Organ in die Erfüllungsverantwortung der Gemeinde oder als Privaten in die Sicherstellungsverantwortung derselben einzuschalten. Die Beantwortung der Frage, welche Organisationsentscheidung im konkreten Einzelfall optimal zur Umsetzung der vielfältigen, auch in sonstigen Rechtssätzen statuierten, kommunalen Entscheidungsvorgaben geeignet ist, erfordert eine umfassende Auswertung der rechtlichen und tatsächlichen Entscheidungssituation der Gemeinde. Im Einzelfall sind insbesondere auch kommunale Satzungsvorschriften dahingehend zu untersuchen, ob sie den jeweiligen kommunalen Verwaltungsträger zur Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit an die jeweilige Gesellschaft verpflichten.
Vierter Teil
Zusammenfassung (1) Gemischtwirtschaftliche Unternehmen sind Unternehmen in den Rechtsformen der Kapitalgesellschaften, deren Kapitalanteile sowohl von staatlichen Einheiten als auch von Privaten gehalten werden.1 (2) Das Ziel dieser Untersuchung ist es, Kriterien zu finden, welche die Zuordnung dieser Kapitalgesellschaften zum Adressatenkreis der Sonderbindungen des Staates2 im Einzelfall erlauben. Diese verfassungs- und einfachrechtlichen Sonderbindungen zwingen zu einer Unterscheidung zwischen Staat und Gesellschaft. Ein Ansatz, der lediglich „Skalierungen“ oder „Verantwortungsstufen“3 staatlicher Tätigkeit beschreibt, wird diesem rechtlichen Dualismus zwischen Staat und Gesellschaft nicht gerecht.4 (3) Die Suche nach diesen Zuordnungskriterien setzt die Bestimmung des staatlichen Adressatenkreises der Sonderbindungen voraus.5 Deren Wortlaut beschreibt bestimmte organisatorisch verfaßte Aufgaben- und Handlungsbereiche. Geht man davon aus, daß Organisationen nicht Träger von Rechten und Pflichten sein können, sondern daß dies notwendig nur Rechtssubjekte sind, dann muß der Wortlaut der Sonderbindungen des Staates neben Handlungseinheiten zugleich staatliche Rechtssubjekte kennzeichnen. Möglicherweise zeichnen sich diese Rechtssubjekte gerade durch diejenigen Eigenschaften aus, die auch ihre Aufgaben- und Handlungsbereiche beschreiben. Möglicherweise sind also diejenigen Kriterien, die staatliches Handeln kennzeichnen, zugleich Kriterien zur Kennzeichnung staatlicher Rechtssubjekte. (4) Staatliches Handeln besteht im wesentlichen darin, Entscheidungen zu treffen.6 Die staatlichen Verpflichtungsrechtssubjekte zeichnen sich also gerade dadurch aus, daß sie Entscheidungen von einer besonderen Qualität treffen. Sie treffen spezifisch staatliche Entscheidungen. Diejenigen Kriterien, welche die Eigenschaft von Kapitalgesellschaften kennzeichnen, Zuordnungssubjekte der 1
Vgl. oben Einleitung, S. 23. Zum Begriff vgl. oben Einleitung, S. 24 m. Fn. 10. 3 Vgl. zu dem Gedanken der Verantwortungsteilung zwischen Staat und Gesellschaft ausführlich oben Zweiter Teil, S. 207 ff. 4 Vgl. dazu die Nachweise oben Einleitung, Fn. 13. 5 Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 28 ff. 6 Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 30 m. Fn. 9. 2
248
4. Teil: Zusammenfassung
Sonderbindungen des Staates zu sein, sind deshalb notwendig auch jene, welche staatliche Entscheidungen auszeichnen. Es kommt deshalb darauf an, ob und unter welchen Voraussetzungen gemischtwirtschaftliche Unternehmen staatliche Entscheidungen treffen. (5) Eine Entscheidung besteht in einer Wahl zwischen verschiedenen Handlungsalternativen.7 Diese Alternativenwahl setzt, um rational getroffen werden zu können, notwendig Kriterien der Wahl, sogenannte Entscheidungsmaßstäbe, voraus. Staatliche Entscheidungen zeichnen sich gerade dadurch aus, daß die jeweilige Alternativenwahl an spezifisch staatlichen Entscheidungsmaßstäben ausgerichtet ist. (6) Der in dieser Untersuchung sogenannte Beherrschungsansatz geht davon aus, daß staatliche Entscheidungsmaßstäbe insbesondere dadurch gekennzeichnet sind, daß sie von einer staatlichen Einheit gesetzt werden.8 Ein gemischtwirtschaftliches Unternehmen treffe daher staatliche Entscheidungen, wenn seine Alternativenwahl durch eine staatliche Organisationseinheit vorgegeben werde. Dies wiederum sei der Fall, wenn es von dem an dem Unternehmen beteiligten Verwaltungsträger „beherrscht“ werde. In diesem Fall sei das Unternehmen selbst als organisatorischer Bestandteil der herrschenden staatlichen Einheit zu bewerten. Das Unternehmen und seine Entscheidungen seien dann staatlich. (7) Voraussetzung dieser Beherrschung sei keine umfassende Ersetzung der unternehmerischen Entscheidungen durch die Entscheidungen des beteiligten Verwaltungsträgers, es genüge vielmehr ein bestimmtes Maß an staatlicher Einflußnahme auf den Entscheidungsprozeß des Unternehmens. Dieser Beherrschungsansatz setzt daher die Qualifizierung des für die Annahme staatlicher Entscheidungsherrschaft erforderlichen Mindestmaßes staatlicher Einflußnahme voraus. Als Kriterium für das Vorliegen staatlicher Entscheidungsherrschaft wird verbreitet der staatliche Mehrheitsbesitz an den Unternehmensanteilen genannt. Ein staatlicher Mehrheitsanteil von 50 Prozent plus x spreche für das Vorliegen einer beherrschenden Stellung des Verwaltungsträgers im Unternehmen. (8) Das Vorliegen einer staatlichen Anteilsmehrheit ist nicht in allen Fällen geeignet, eine staatliche Entscheidungsherrschaft zu bewirken. Das Anteilskriterium kann allenfalls eine entsprechende Vermutung begründen, die durch das Vorliegen sonstiger rechtlicher und insbesondere tatsächlicher Entscheidungsfaktoren im Einzelfall widerlegt werden kann.9 Es gibt atypische Konstellationen, in denen zwar eine staatliche Anteilsmehrheit besteht, diese aber aufgrund z. B. 7 8 9
Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 30 m. Fn. 12. Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 31 ff. Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 31 ff., 63 ff.
4. Teil: Zusammenfassung
249
überlegenen Know-Hows des privaten Anteilseigners im Einzelfall nicht zur Verwirklichung staatlicher Entscheidungsherrschaft führt. Diese Konstellationen bleiben auf der Grundlage des Anteilskriteriums unberücksichtigt. Aufgrund der Komplexität der unternehmerischen Entscheidungsprozesse ist zur Begründung staatlicher Entscheidungsherrschaft vielmehr in jedem Einzelfall eine Gesamtbetrachtung sämtlicher rechtlicher und tatsächlicher unternehmensinterner und -externer Entscheidungsfaktoren erforderlich. Der Begriff des gemischtwirtschaftlichen Unternehmens, der gerade auf eine gemischt staatlich-private Kapitalbeteiligung abstellt, ist nicht geeignet, alle Fallgestaltungen staatlicher Entscheidungsherrschaft in sich aufzunehmen. (9) Eine solche Gesamtbetrachtung kann notwendig nur wertend erfolgen. Sie ist zwar im Gegensatz zum genannten Anteilskriterium besser geeignet, den komplexen unternehmerischen Entscheidungsprozeß abzubilden, läßt aber ebenfalls keine zwingenden Aussagen über die Verteilung der Entscheidungsherrschaft in jedem konkreten Einzelfall zu.10 Es wurde demgegenüber zu Beginn der Untersuchung festgestellt, daß die verfassungs- und einfachrechtlichen Sonderbindungen des Staates zwingende Kriterien zur Kennzeichnung staatlicher Rechtssubjekte voraussetzen. Aus Sicht dieser Sonderbindungen kommen reine Vermutungskriterien zur Kennzeichnung der staatlichen Adressaten nicht in Betracht. (10) Doch selbst wenn man von der Tauglichkeit des Anteilskriteriums zumindest als Vermutungsregel ausgeht, stellt sich die Frage, ob der Beherrschungsansatz als Modell der Entscheidungswirklichkeit in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen gerecht wird.11 Der Beherrschungsansatz geht von einem Alternativmodell aus, welches das gemischtwirtschaftliche Unternehmen im Fall seiner „Beherrschung“ durch eine staatliche Organisationseinheit im Ganzen dem Bereich des Staatlichen zuordnen will. Liegt demgegenüber keine staatliche Entscheidungsherrschaft vor, soll dieses Unternehmen privat sein. Gemischtwirtschaftliche Unternehmen zeichnen sich allerdings gerade durch einen gemischt staatlich-privaten Entscheidungsprozeß aus. Wenn die jeweilige Kapitalgesellschaft dem Adressatenkreis der Sonderbindungen des Staates zugeordnet wird, wird der private Anteil an den unternehmerischen Entscheidungen vernachlässigt. Umgekehrt wird auch der staatliche Entscheidungsanteil im Fall privater Entscheidungsherrschaft und der Zuordnung des Unternehmens zum Bereich des Privaten nicht hinreichend berücksichtigt. (11) Der hier sogenannte Rechtsformansatz geht davon aus, daß nur öffentlichrechtlich organisierte Rechtssubjekte staatliche Entscheidungen treffen. Lediglich die öffentlichrechtlich organisierten Einheiten seien staatliche Einheiten.
10 11
Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 63 ff. Vgl. dazu oben Erster Teil, S. 66 ff.
250
4. Teil: Zusammenfassung
Eine Kennzeichnung staatlicher Organisationseinheiten und ihrer Entscheidungen gerade aufgrund der öffentlichrechtlichen Rechtsform des jeweiligen staatlichen Entscheiders kann zwar zu zwingenden Zuordnungsergebnissen im Einzelfall führen, wird allerdings der großen praktischen Bedeutung der sogenannten Verwaltung in Privatrechtsform nicht gerecht.12 Der Rechtsformansatz führt zu einer Verengung des Untersuchungsgegenstandes auf staatliche Einheiten in öffentlichrechtlicher Rechtsform. Darüber hinaus wird auch in diesem Fall ein Alternativmodell konstruiert, welches die gemischt staatlich-private Entscheidungswirklichkeit nicht hinreichend abbilden kann. Der staatliche Entscheidungsanteil an privatrechtlich organisierten gemischtwirtschaftlichen Unternehmen wird ebenso wie im Fall des Beherrschungsansatzes vernachlässigt. (12) Auch die Konstruktion einer sogenannten Ingerenzpflicht des staatlichen Anteilseigners, die denselben verpflichtet, einen angemessenen Einfluß auf die Unternehmensentscheidungen auszuüben und so den staatlichen Zielsetzungen in einem im übrigen privaten Unternehmen zur Geltung zu verhelfen, kann das Dilemma der genannten Alternativmodelle nur unzureichend lösen.13 Kriterien, die einen solchen angemessenen staatlichen Einfluß im konkreten Fall quantifizieren können, finden sich nicht. Die Frage nach der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen wird im konkreten Fall lediglich verschoben auf die Frage, welche Intensität die staatliche Ingerenzpflicht im Einzelfall besitzen muß. (13) Nach dem hier sogenannten Aufgabenansatz sind unternehmerische Entscheidungen staatliche Entscheidungen, wenn sie an dem ausschließlich staatlichen Entscheidungsmaßstab der öffentlichen Aufgabe ausgerichtet sind.14 Der Begriff der öffentlichen Aufgabe soll also staatliche Entscheidungsmaßstäbe inhaltlich kennzeichnen. Im Gegensatz zum Beherrschungsansatz wird die Ausrichtung unternehmerischer Entscheidungen an staatlichen Entscheidungsmaßstäben nicht mit dem Vorliegen einer staatlichen Entscheidungsherrschaft begründet. Es wird vielmehr von dem jeweiligen Entscheidungsbereich eines Unternehmens, dem Unternehmensgegenstand, auf das verfolgte – staatliche oder private – Entscheidungsziel geschlossen. Es wird vermutet, daß Tätigkeiten in bestimmten Entscheidungsbereichen bestimmte Entscheidungsmaßstäbe bedingen. Die Konkretisierung des Begriffs der öffentlichen Aufgabe setzt deshalb die Benennung ausschließlich staatlicher Entscheidungsbereiche voraus. Eine positive Konkretisierung oder eine negative Definition in Abgrenzung zu rein privaten Entscheidungsbereichen und den auf diesen Sachgebieten verfolgten Zielen ist allerdings bislang nicht gelungen.15 Sowohl Private als auch staat12 13 14 15
Vgl. Vgl. Vgl. Vgl.
dazu dazu dazu dazu
oben oben oben oben
Erster Erster Erster Erster
Teil, Teil, Teil, Teil,
S. S. S. S.
68 77 81 85
ff. ff. ff. ff.
4. Teil: Zusammenfassung
251
liche Einheiten können auf die Allgemeinheit bezogene, aber auch gewinnorientierte Entscheidungen treffen. Aufgrund einer zunehmenden tatsächlichen Verschränkung von Staat und Gesellschaft lassen sich private und staatliche Zielsetzungen nicht zwingend unterscheiden. Auch der Aufgabenansatz wird daher dem verfassungs- und einfachrechtlichen Dualismus von Staat und Gesellschaft nicht gerecht. (14) Diese Zuordnungsfragen führen zu der Überlegung, ob sich staatliche Organisation und die in dieser Organisation getroffenen Entscheidungen nicht auch anders als unter Rückgriff auf die vorstehend genannten Kriterien beschreiben lassen. Geht man davon aus, daß sich staatliche Organisation auch rein rechtlich als verfassungs- und einfachrechtliches Rechtskonstrukt beschreiben läßt, dann sind staatliche Entscheidungen aus Sicht dieses hier sogenannten normativen Ansatzes rechtlich konstituierte Entscheidungen.16 (15) Diejenigen Rechtssätze, die staatliche Entscheidungen konstituieren, heißen Zuständigkeitsrechtssätze. Zuständigkeiten sind rechtlich zugewiesene Entscheidungsbereiche und -maßstäbe. Sie verpflichten ein staatliches Rechtssubjekt dazu, bestimmte Entscheidungen nach in der Regel bestimmten Vorgaben zu treffen. Unterschieden werden kann hierbei zwischen den sogenannten materiellrechtlichen Eigenzuständigkeiten eines Verwaltungsträgers und den sogenannten organisationsrechtlichen Wahrnehmungszuständigkeiten der Organe und Ämter desselben.17 Während die Entscheidungen in Ausübung einer materiellrechtlichen Eigenzuständigkeit dem staatlichen Verpflichtungsrechtssubjekt als eigene Entscheidungen endgültig zugerechnet werden, werden die Entscheidungen in Ausübung einer organisationsrechtlichen Wahrnehmungszuständigkeit transitorisch, d. h. „als und für“ ein staatliches Zurechnungsendsubjekt getroffen. Als organisationsrechtlicher Teil des jeweiligen staatlichen Zurechnungsendsubjektes ist sowohl das Organ als auch das einzelne auf den Entscheidungsbereich eines Menschen zugeschnittene Amt Adressat all der auf dieses Zurechnungsendsubjekt anwendbaren Rechtssätze. (16) Eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft ist deshalb Adressat der Sonderbindungen des Staates, wenn und soweit sie Adressat einer solchen Eigenoder Wahrnehmungszuständigkeit ist. Entscheidungen, die in Ausübung einer Eigen- oder Wahrnehmungszuständigkeit getroffen werden, sind staatliche Entscheidungen. (17) Die Eigenschaft einer Gesellschaft, Zuordnungssubjekt von Zuständigkeiten zu sein, ist relativ18 und abhängig vom Inhalt und Umfang der jeweiligen Zuständigkeit. Soweit wie eine Gesellschaft Organ oder Verwaltungsträger 16 17 18
Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 96 ff. Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 99 ff. Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 109 ff.
252
4. Teil: Zusammenfassung
ist, sind die in dem Unternehmen getroffenen Entscheidungen staatliche Entscheidungen. Organ oder Verwaltungsträger ist die Gesellschaft nur insoweit, wie sie auch Adressat einer entsprechenden Zuständigkeit ist. Außerhalb dieser Verpflichtung ist sie privates Rechtssubjekt und trifft private Entscheidungen. Aufgrund dieser Relativität der Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften läßt sich die zu Beginn der Untersuchung genannte Definition gemischtwirtschaftlicher Unternehmen modifizieren: Gemischtwirtschaftliche Unternehmen sind Unternehmen, die sowohl staatliche als auch private Entscheidungen treffen.19 (18) Zuständigkeiten werden durch staatliche Erklärungen zugewiesen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Gesellschaftsverträge gemischtwirtschaftlicher Unternehmen oder etwaige schuldrechtliche Nebenabreden zwischen dem beteiligten Verwaltungsträger und der jeweiligen Kapitalgesellschaft eine solche staatliche Erklärung enthalten.20 Da eine Zuständigkeitszuweisung in der Regel nicht ausdrücklich erfolgt, müssen die jeweiligen vertraglichen Rechtssätze, die eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft verpflichten und berechtigen, auf ihren Zuweisungsgehalt hin ausgelegt werden.21 (19) Es kommt daher darauf an, nach welchen Kriterien eine solche Auslegung zu erfolgen hat. Ein Vertrag zwischen einem Verwaltungsträger und einem Privaten, ein sogenannter Verwaltungsvertrag, hat Rechtsquellencharakter. Er ist Rechtssatz.22 Die Auslegung dieser Verwaltungsverträge muß daher anhand der Kriterien einer objektiven Auslegung von Rechtssätzen erfolgen.23 Dies gilt sowohl für den jeweiligen Gesellschaftsvertrag einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft als auch für die schuldrechtlichen Nebenabreden zwischen der jeweiligen Gesellschaft und dem beteiligten Verwaltungsträger. (20) Eine Untersuchung typischer Vertragsklauseln in Gesellschaftsverträgen gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften und der jeweiligen schuldrechtlichen Nebenabreden zwischen dem beteiligten Verwaltungsträger und der gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft hat gezeigt, daß sich nicht in jedem Fall zwingende Aussagen treffen lassen. Ob eine Gesellschaft bestimmte Aufgaben als staatliches Zuständigkeitssubjekt oder als Privater erfüllen soll, läßt sich nicht immer eindeutig ermitteln. Lediglich soweit einzelvertraglich vereinbart ist, daß die Gesellschaft ihre Entscheidungen „als Erfüllungsgehilfe“ bzw. „im Namen“ des Verwaltungsträgers zu treffen hat, kann man von der einzelvertraglichen Zuweisung einer Wahrnehmungszuständigkeit ausgehen.24 19 20 21 22 23 24
Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl. Vgl.
dazu dazu dazu dazu dazu dazu
oben oben oben oben oben oben
Zweiter Zweiter Zweiter Zweiter Zweiter Zweiter
Teil, Teil, Teil, Teil, Teil, Teil,
S. S. S. S. S. S.
114. 117 ff. 122 ff. 117 ff. 122 ff. 174 ff.
4. Teil: Zusammenfassung
253
(21) Aufgrund der vielfach verbleibenden Unsicherheiten über den Zuweisungsgehalt der vertraglichen Absprachen kommt einer hier sogenannten zuständigkeitskonformen Auslegung dieser vertraglichen Rechtssätze für die Bestimmung der Staatseigenschaft eine zentrale Bedeutung zu.25 Im Rahmen einer solchen zuständigkeitskonformen Auslegung ist zu prüfen, ob und inwieweit der jeweilige Verwaltungsträger verpflichtet ist, alle Entscheidungen in Person, d. h. durch ihm organisationsrechtlich zurechenbare Organe zu erbringen. Soweit eine solche Verpflichtung zum Entscheiden in Person besteht, muß der staatliche Verpflichtungsadressat allen in seinen Entscheidungsprozeß eingeschalteten Rechtssubjekten eine Wahrnehmungszuständigkeit zuweisen. Im Einzelfall kann ein Verwaltungsträger darüber hinaus auch verpflichtet sein, einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft eine Eigenzuständigkeit zuzuweisen. Liegt eine solche Verpflichtung zur Zuweisung von Zuständigkeiten vor, und verfügen die Verträge über einen entsprechenden Auslegungsspielraum, ist davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger seine Verpflichtung zuständigkeitskonform erfüllt und der Gesellschaft eine entsprechende Zuständigkeit zugewiesen hat. (22) Entscheidungszuständigkeiten verpflichten einen Verwaltungsträger dazu, eine bestimmte verfahrensabschließende Entscheidung, z. B. eine Planungsentscheidung, zu treffen.26 Diese Entscheidungszuständigkeiten sind so auszulegen, daß sie die Verpflichtung beinhalten, alle Entscheidungen des Entscheidungsprozesses in Person, d. h. durch ihm organisationsrechtlich zurechenbare Untereinheiten zu treffen. Soweit dieser also eine Gesellschaft des Privatrechts in seinen Entscheidungsprozeß einschaltet, muß er der Gesellschaft eine Wahrnehmungszuständigkeit zuweisen. Zuständigkeitskonform ist also, einen entsprechenden Auslegungsspielraum vorausgesetzt, im Rahmen der Auslegung der vertraglichen Abreden davon ausgehen, daß eine z. B. in einen Planungsprozeß eingeschaltete Juristische Person des Privatrechts Zuweisungssubjekt einer Wahrnehmungszuständigkeit ist. (23) Sogenannte sachmaterienbezogene Zuständigkeiten beinhalten die Verpflichtung des Verwaltungsträgers, all diejenigen Entscheidungen zu treffen, die erforderlich sind, um die jeweilige Sachaufgabe optimal zu erledigen.27 Eine solche optimale Erledigung einer Sachaufgabe kann im Einzelfall in einer Aufgabenwahrnehmung durch eigene Organe des Verwaltungsträgers oder umgekehrt gerade in einer solchen durch Einschaltung von Privaten bestehen. Ob dem Verwaltungsträger eine umfassende sogenannte Erfüllungsverantwortung zukommt oder ob er lediglich verpflichtet ist, die Erledigung der Sachaufgabe
25 26 27
Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 198 ff. Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 203 ff. Vgl. dazu oben Zweiter Teil, S. 206 ff. und Dritter Teil, S. 227 ff., 236 ff.
254
4. Teil: Zusammenfassung
durch Private sicherzustellen, ist im Einzelfall durch Auslegung der jeweiligen Sachzuständigkeit zu ermitteln. (24) Der Inhalt und Umfang sachmaterienbezogener Zuständigkeiten kann im Gegensatz zu demjenigen von Entscheidungszuständigkeiten im Einzelfall schwierig zu bestimmen sein. Je konkreter die organisatorischen Vorgaben des Bundes- oder Landesgesetzgebers sind, desto leichter lassen sich Aussagen hinsichtlich des Verpflichtungsinhaltes der Zuständigkeiten treffen. Es konnte am Beispiel der Regelungen der §§ 15 ff. KrW-/AbfG gezeigt werden, daß die organisatorischen Vorgaben für die Wahrnehmung dieser Auftragsangelegenheit durch den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger bundesrechtlich weitgehend umfassend und abschließend geregelt sind.28 Im Bereich der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben wie z. B. der Straßenreinigung sind die rechtlichen Organisationsvorgaben demgegenüber in der Regel nur gering.29 In diesen Fällen kommt es insbesondere darauf an, ob und inwieweit satzungsrechtliche Bestimmungen weitere Hinweise auf die organisationsrechtliche Einordnung der jeweiligen Gesellschaft des Privatrechts enthalten. (25) Geht man davon aus, daß staatliche Verpflichtungsrechtssubjekte umfassend rechtlich gebunden sind, dann verpflichtet jeder Zuständigkeitsrechtssatz seinen staatlichen Adressaten dazu, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Welche Entscheidung dies ist, richtet sich nach den verschiedenen rechtlichen Entscheidungsmaßstäben im Einzelfall. Diese Entscheidungsmaßstäbe normieren die Unterziele zum übergeordneten Ziel der optimalen Aufgabenerledigung und ergänzen sich gegenseitig. Aufgrund dieser verschiedenen rechtlichen Entscheidungsmaßstäbe entsteht für den jeweiligen staatlichen Verpflichtungsadressaten eine komplexe Entscheidungssituation.30 Der Verwaltungsträger muß diejenige Entscheidung treffen, die alle rechtlich relevanten Entscheidungsmaßstäbe berücksichtigt. (26) Diese Komplexität staatlicher Entscheidungsmaßstäbe steht nicht der Annahme entgegen, es gebe in jedem Einzelfall genau eine richtige Entscheidung, die zu treffen der jeweilige Verwaltungsträger verpflichtet sei. Auch wenn Verpflichtungsrechtssätze zunehmend lediglich final die Erledigung einer bestimmten Sachaufgabe verlangen, ohne konkrete Wahrnehmungsbedingungen zu statuieren, gibt es doch immer nur eine Entscheidung, die ein umfassend rechtlich gebundener Verwaltungsträger im konkreten Fall treffen darf. Aufgrund der beschriebenen Vielfalt der staatlichen Entscheidungsmaßstäbe kann es sich jedoch im Einzelfall als schwierig erweisen, diese eine richtige (Organisations-)Entscheidung nachzuvollziehen.31 Voraussetzung hierfür ist eine um28 29 30 31
Vgl. Vgl. Vgl. Vgl.
dazu oben Dritter Teil, S. 218 ff. dazu die Beispiele im Dritten Teil, S. 233 ff. dazu oben Dritter Teil, S. 236 ff., insbes. S. 242, Fn. 96. oben Dritter Teil, S. 237 ff.
4. Teil: Zusammenfassung
255
fassende Auswertung aller rechtlichen und tatsächlichen Entscheidungsvorgaben des staatlichen Verpflichtungsadressaten. (27) Die Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften läßt sich in verschiedenen Fällen zwingend nachweisen: Wenn und soweit erstens einzelvertragliche Abreden eine gemischtwirtschaftliche Gesellschaft verpflichten, bestimmte Entscheidungen als „Erfüllungsgehilfe“ oder „im Namen“ des beteiligten Verwaltungsträgers zu treffen, entscheidet und handelt diese Gesellschaft als staatliches Organ. Die Unternehmensentscheidungen sind insoweit staatliche Entscheidungen. Sobald zweitens z. B. gemischtwirtschaftliche Planungsgesellschaften in die Wahrnehmung einer Entscheidungszuständigkeit eingeschaltet werden, ist der zuständige Verwaltungsträger verpflichtet, sowohl die verfahrensabschließende Entscheidung als auch alle Vor- und Teilentscheidungen im Rahmen des Entscheidungsprozesses in Person zu treffen. Er muß die Planungsgesellschaft deshalb als organisationsrechtlich zurechenbares Organ in die Aufgabenwahrnehmung einschalten. Entsprechendes gilt drittens für die Beauftragung gemischtwirtschaftlicher Gesellschaften mit der Erledigung sachmaterienbezogener Zuständigkeiten. Läßt sich nachvollziehen, welche Organisationsentscheidung der jeweilige Verwaltungsträger im konkreten Fall zum Zweck der optimalen Aufgabenerledigung zu treffen hat, dann ist im Rahmen einer zuständigkeitskonformen Auslegung davon auszugehen, daß der Verwaltungsträger eine solche Organisationsentscheidung auch tatsächlich getroffen hat.
Literaturverzeichnis Altmeppen, Holger: Kommentierung, in: Günther H. Roth/ders., Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Kommentar, 5. Aufl. 2005 (zit.: Altmeppen, in: Roth/ders., GmbHG). – Die Einflussrechte der Gemeindeorgane in einer kommunalen GmbH, NJW 2003, S. 2561 ff. Arnauld, Andreas von: Grundrechtsfragen im Bereich von Postwesen und Telekommunikation, DÖV 1998, S. 437 ff. Bachof, Otto: Teilrechtsfähige Verbände des öffentlichen Rechts, AöR 83 (1958), S. 208 (263 ff.). Badura, Peter: Die Daseinsvorsorge als Verwaltungszweck der Leistungsverwaltung und der soziale Rechtsstaat, DÖV 1966, S. 624 ff. – Verfassung, Staat und Gesellschaft in der Sicht des Bundesverfassungsgerichts, in: Christian Starck (Hrsg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bundesverfassungsgerichts, Zweiter Band, 1976, S. 1 ff. (zit.: Badura, in: FG BVerfG). – Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und die Unternehmenszwecke bei der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand, in: Ingo v. Münch (Hrsg.), Staatsrecht – Völkerrecht – Europarecht, Festschrift für Hans-Jürgen Schlochauer zum 75. Geburtstag, 1981, S. 3 ff. (zit.: Badura, in: FS Schlochauer). – Die Wirtschaftstätigkeit der öffentlichen Hand und die neue Sicht des Gesetzesvorbehalts, in: Jürgen F. Baur/Klaus J. Hopt/K. Peter Mailänder (Hrsg.), Festschrift für Ernst Steindorff zum 70. Geburtstag, 1990, S. 835 ff. (zit.: Badura, in: FS Steindorff). – Die Unternehmensfreiheit der Handelsgesellschaften. Ein Problem des Grundrechtsschutzes juristischer Personen des Privatrechts, DÖV 1990, S. 353 ff. – Mitbestimmung und Gesellschaftsrecht. Verfassungsrechtliches Korollarium zur Rolle des Privatrechts in der Rechtsordnung, in: Manfred Löwisch/Christian Schmidt-Leithoff/Burkhard Schmiedel (Hrsg.), Beiträge zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Festschrift für Fritz Rittner zum 70. Geburtstag, 1991, S. 1 ff. (zit.: Badura, in: FS Rittner). – Das öffentliche Unternehmen im europäischen Binnenmarkt, ZGR 26 (1997), S. 291 ff. – Wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zur Erfüllung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze, DÖV 1998, S. 818 ff.
Literaturverzeichnis
257
– Öffentliches Wirtschaftsrecht, in: Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2005, Drittes Kapitel, S. 277 ff. [zit.: Badura, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht]. – Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl. 2003 (zit.: Badura, Staatsrecht). Barbey, Günther: Rechtsübertragung und Delegation. Eine Auseinandersetzung mit der Delegationslehre Heinrich Triepels, 1962 (zit.: Barbey, Rechtsübertragung). Battis, Ulrich/Kersten, Jens: Die Deutsche Bahn AG als staatliches Wirtschaftsunternehmen zwischen Grundrechtsverpflichtung, Gemeinwohlauftrag und Wettbewerb, WuW 2005, S. 493 ff. Bauer, Hartmut: Zum personellen Anwendungsbereich der kommunalrechtlichen Vertretungsverbote, NJW 1981, S. 2171 f. – Verwaltungsrechtliche und verwaltungswissenschaftliche Aspekte der Gestaltung von Kooperationsverträgen bei Public Private Partnership, DÖV 1998, S. 89 ff. – Verwaltungsrechtslehre im Umbruch?, Die Verwaltung 25 (1992), S. 301 ff. – Privatisierungsimpulse und Privatisierungspraxis in der Abwasserentsorgung, VerwArch 90 (1999), S. 561 ff. – Zur notwendigen Entwicklung eines Verwaltungskooperationsrechts, in: Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung und schlankem Staat. Verantwortungsteilung als Schlüsselbegriff eines sich verändernden Verhältnisses von öffentlichem und privatem Sektor, 1999, S. 247 ff. [zit.: Bauer, in: Schuppert (Hrsg.), Jenseits von Privatisierung]. Becker, Florian: Perspektiven für eine organisatorische Verflechtung der Bankgesellschaft Berlin und der Norddeutschen Landesbank, NdsVBl. 2002, S. 57 ff. Becker, Ralph: Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch gemischtwirtschaftliche Unternehmen, 1997 (zit.: R. Becker, Erfüllung öffentlicher Aufgaben). Beckmann, Martin: Rechtsfragen bei der Gründung einer Entsorgungs GmbH – abfallrechtliche Aspekte, in: Joachim Bauer/Alexander Schink (Hrsg.), Organisationsformen in der öffentlichen Abfallwirtschaft, 1993, S. 38 ff. [zit.: Beckmann, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen]. Berg, Wilfried: Die wirtschaftliche Betätigung des Staates als Verfassungsproblem, GewArch 1990, S. 225 ff. Bernhard, Ralf: Urteilsanmerkung zu BVerfG, DVBl. 1981, S. 865 ff., DVBl. 1981, S. 869 ff. Bernsdorff, Norbert: Kommentierung, in: Roland Fritz (Hrsg.), Kommentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz, begr. von Klaus Obermayer, 3. Aufl. 1999 (zit.: Bernsdorff, in: Obermayer, VwVfG). Bethge, Herbert: Zur Problematik von Grundrechtskollisionen, 1977 (zit.: Bethge, Grundrechtskollisionen). – Die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen nach Art. 19 Abs. 3 Grundgesetz, 1985 (zit.: Bethge, Grundrechtsberechtigung juristischer Personen).
258
Literaturverzeichnis
Bettermann, Karl August: Zuständigkeit der Zivilgerichte bei Streit um die Rechtmäßigkeit hoheitlichen Verhaltens juristischer Personen des öffentlichen Rechts, DVBl. 1977, S. 180 ff. Beuthien, Volker: Gibt es eine organschaftliche Stellvertretung?, NJW 1999, S. 1142 ff. Bezzenberger, Gerold/Schuster, Detlev: Die öffentliche Anstalt als abhängiges Konzernunternehmen, ZGR 25 (1996), S. 481 ff. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Die Organisationsgewalt im Bereich der Regierung, 1964 (zit.: Böckenförde, Organisationsgewalt). – Die Bedeutung der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft im demokratischen Sozialstaat der Gegenwart, in: Rechtsfragen der Gegenwart. Festgabe für Wolfgang Hefermehl zum 65. Geburtstag, 1972, S. 11 ff. (zit.: Böckenförde, in: FG Hefermehl). – Die verfassungstheoretische Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als Beginn der individuellen Freiheit, 1973 (zit.: Böckenförde, Unterscheidung). – Organ, Organisation, Juristische Person. Kritische Überlegungen zu Grundbegriffen und Konstruktionsbasis des staatlichen Organisationsrechts, in: Christian-Friedrich Menger (Hrsg.), Fortschritte des Verwaltungsrechts. Festschrift für Hans J. Wolff zum 75. Geburtstag, 1973, S. 269 ff. (zit.: Böckenförde, in: FS Hans J. Wolff). – Der Staat als sittlicher Staat, 1978 (zit.: Böckenförde, Staat als sittlicher Staat). Bodanowitz, Jan: Organisationsformen für die kommunale Abwasserbeseitigung, 1993 (zit.: Bodanowitz, Organisationsformen). Bonk, Heinz Joachim: Kommentierung, in: Paul Stelkens/ders./Michael Sachs (Hrsg.), Verwaltungsverfahrensgesetz. Kommentar, 6. Aufl. 2001 [zit.: Bonk, in: Stelkens/ ders./Sachs (Hrsg.), VwVfG]. Breuer, Rüdiger: Umweltschutzrecht, in: Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2005, Fünftes Kapitel, S. 551 ff. [zit.: Breuer, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht]. Britz, Gabriele: Die Mitwirkung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, VerwArch 91 (2000), S. 418 ff. – Funktion und Funktionsweise öffentlicher Unternehmen im Wandel: Zu den jüngsten Entwicklungen im Recht der kommunalen Wirtschaftsunternehmen, NVwZ 2001, S. 380 ff. – „Kommunale Gewährleistungsverantwortung“ – Ein allgemeines Element des Regulierungsrechts in Europa?, Die Verwaltung 37 (2004), S. 145 ff. Brohm, Winfried: Die Dogmatik des Verwaltungsrechts vor den Gegenwartsaufgaben der Verwaltung, VVDStRL 30 (1972), S. 245 ff. Brüning, Christoph: Der Private bei der Erledigung kommunaler Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung, 1997 (zit.: Brüning, Erledigung). – Der Verwaltungsmittler – eine neue Figur bei der Privatisierung kommunaler Aufgaben, NWVBl. 1997, S. 286 ff.
Literaturverzeichnis
259
Budäus, Dietrich/Grüning, Gernod: Public Private Partnership – Konzeption und Probleme eines Instruments zur Verwaltungsreform aus Sicht der Public Choice-Theorie, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership – Neue Formen öffentlicher Aufgabenerfüllung, 1997, S. 25 ff. [zit.: Budäus/Grüning, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership]. Bull, Hans Peter: Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 1973 (zit.: Bull, Staatsaufgaben). Bullinger, Martin: Öffentliches Recht und Privatrecht, 1968 (zit.: Bullinger, Öffentliches Recht und Privatrecht). – Öffentliches Recht und Privatrecht in Geschichte und Gegenwart, in: Manfred Löwisch/Christian Schmidt-Leithoff/Burkhard Schmiedel (Hrsg.), Beiträge zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Festschrift für Fritz Rittner zum 70. Geburtstag, 1991, S. 69 ff. (zit.: Bullinger, in: FS Rittner). – Die funktionelle Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht als Beitrag zur Beweglichkeit von Verwaltung und Wirtschaft in Europa, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 239 ff. [zit.: Bullinger, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen]. Bumke, Christian: Die Entwicklung der verwaltungsrechtswissenschaftlichen Methodik in der Bundesrepublik Deutschland, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, S. 73 ff. [zit.: Bumke, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden]. Bumke, Ulrike: Die öffentliche Aufgabe der Landesmedienanstalten, 1995 (zit.: Bumke, Landesmedienanstalten). Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.): Public Private Partnership. Ein Leitfaden für öffentliche Verwaltung und Unternehmer, 2. Aufl. 2003 [zit.: BMWA (Hrsg.), Public Private Partnership]. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Hrsg.): Kreislaufwirtschaft. Ein Leitfaden zur Privatisierung der Abfallwirtschaft und zur Einbeziehung Privater in die kommunale Abfallentsorgung, 1998 [zit.: BMWi (Hrsg.), Kreislaufwirtschaft, Leitfaden]. Bundesumweltministerium (Hrsg.): Privatwirtschaftliche Realisierung der Abwasserentsorgung. Musterverträge, 1993 [zit.: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Musterverträge]. – Privatwirtschaftliche Realisierung der Abwasserentsorgung. Erfahrungsbericht, 1993 [zit.: BMU (Hrsg.), Abwasserentsorgung, Erfahrungsbericht]. Burgi, Martin: Funktionale Privatisierung und Verwaltungshilfe, 1999 (zit.: Burgi, Funktionale Privatisierung). – Privat vorbereitete Verwaltungsentscheidungen und staatliche Strukturschaffungspflicht – Verwaltungsverfassungsrecht im Kooperationsspektrum zwischen Staat und Gesellschaft, Die Verwaltung 33 (2000), S. 183 ff.
260
Literaturverzeichnis
– Vergaberechtliche Fragen bei Privatisierungsvorgängen: Das Beispiel Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsgewerbe, GewArch 2001, S. 217 ff. – Kommunales Privatisierungsfolgenrecht: Vergabe, Regulierung und Finanzierung, NVwZ 2001, S. 601 ff. Burmeister, Günter Cornelius: Herkunft, Inhalt und Stellung des institutionellen Gesetzesvorbehalts, 1991 (zit.: Burmeister, Institutioneller Gesetzesvorbehalt). Burmeister, Joachim: Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, VVDStRL 52 (1993), S. 190 ff. Bydlinski, Franz: Privatautonomie und objektive Grundlagen des verpflichtenden Rechtsgeschäfts, 1967 (zit.: Bydlinski, Privatautonomie). Dahlen, Hans-Josef: Bearbeitung, in: Karl Otto Bergmann/Hermann Schumacher, Handbuch der kommunalen Vertragsgestaltung, Band II, 2000 [zit.: Dahlen, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung II]. Dahlen, Hans-Josef/Köhler, Heinz: Bearbeitung, in: Karl Otto Bergmann/Hermann Schumacher, Handbuch der kommunalen Vertragsgestaltung, Band III, 2000 [zit.: Dahlen/Köhler, in: Bergmann/Schumacher (Hrsg.), Vertragsgestaltung III]. Damm, Reinhard: Risikosteuerung im Zivilrecht – Privatrecht und öffentliches Recht im Risikodiskurs, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 85 ff. [zit.: Damm, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen]. Danwitz, Thomas von: Vom Verwaltungsprivat- zum Verwaltungsgesellschaftsrecht – Zur Begründung und Reichweite öffentlich-rechtlicher Ingerenzen in der mittelbaren Kommunalverwaltung, AöR 120 (1995), S. 595 ff. – Der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen im Recht der Regulierungsverwaltung, DVBl. 2005, S. 597 ff. Darsow, Thomas: Kommentierung, in: ders./Sabine Gentner/Klaus-Michael Glaser/Hubert Meyer (Hrsg.), Schweriner Kommentierung der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, 2. Aufl. 1999 [zit.: Darsow, in: ders./Gentner/Glaser/Meyer, Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern]. Däubler, Wolfgang: Privatisierung als Rechtsproblem, 1980 (zit.: Däubler, Privatisierung als Rechtsproblem). Dedy, Helmut: Rechtliche Rahmenbedingungen der Organisation kommunaler Abwasserbeseitigung in Nordrhein-Westfalen, NWVBl. 1993, S. 245 ff. Dehnhard, Albrecht: Die Bankgesellschaft Berlin – eine fehlerhafte Konstruktion, LKV 2003, S. 121 ff. Denninger, Erhard: Rettungsdienst und Grundgesetz, DÖV 1987, S. 981 ff. Dewey, Wilhelm-Josef: Die Organisation der Abfallentsorgung in Dortmund, in: Joachim Bauer/Alexander Schink (Hrsg.), Organisationsformen in der öffentlichen Abfallwirtschaft, 1993, S. 103 ff. [zit.: Dewey, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen].
Literaturverzeichnis
261
Dittmann, Arnim: Die Bundesverwaltung. Verfassungsgeschichtliche Grundlagen, grundgesetzliche Vorgaben und Staatspraxis ihrer Organisation, 1983 (zit.: Dittmann, Bundesverwaltung). Dreher, Meinrad: Unternehmen und Politik. Die gesellschaftspolitische Kompetenz der Aktiengesellschaft, ZHR 155 (1991), S. 349 ff. – Kommentierung, in: Ulrich Immenga/Ernst-Joachim Mestmäcker (Hrsg.), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 3. Aufl. 2001 [zit.: Dreher, in: Immenga/ Mestmäcker (Hrsg.), GWB]. Dreier, Horst: Rechtslehre, Staatssoziologie und Demokratietheorie bei Hans Kelsen, 2. Aufl. 1990 (zit.: H. Dreier, Hans Kelsen). – Hierarchische Verwaltung im demokratischen Rechtsstaat. Genese, aktuelle Bedeutung und funktionelle Grenzen eines Bauprinzips der Exekutive, 1991 (zit.: H. Dreier, Hierarchische Verwaltung). Dreier, Ralf: Der Begriff des Rechts, NJW 1986, S. 890 ff. Dürig, Günter: Kommentierung, in: Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Bd. I, Loseblatt (Stand Februar 2004) (zit.: Dürig, in: Maunz/ders., GG). Eberhard, Harald: Der verwaltungsrechtliche Vertrag, 2005 (zit.: Eberhard, Verwaltungsrechtlicher Vertrag). Ehlers, Dirk: Verwaltung in Privatrechtsform, 1984 (zit.: Ehlers, Privatrechtsform). – Die Entscheidung der Kommunen für eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Organisation ihrer Einrichtungen und Unternehmen, DÖV 1986, S. 897 ff. – Die Grenzen der Mitbestimmung in öffentlichen Unternehmen, JZ 1987, S. 218 ff. – Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand in der Bundesrepublik Deutschland, JZ 1990, S. 1089 ff. – Interkommunale Zusammenarbeit in Gesellschaftsform, DVBl. 1997, S. 137 ff. – Das selbständige Kommunalunternehmen des öffentlichen Rechts, in: Hans-Günter Henneke (Hrsg.), Kommunale Aufgabenerfüllung in Anstaltsform, 2000, S. 47 ff. [zit.: Ehlers, in: Henneke (Hrsg.), Kommunale Aufgabenerfüllung]. – Verwaltung und Verwaltungsrecht im demokratischen und sozialen Rechtsstaat, in: Hans-Uwe Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2002, S. 1 ff. [zit.: Ehlers, in: Erichsen/ders. (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht]. – Empfiehlt es sich, das Recht der öffentlichen Unternehmen im Spannungsfeld von öffentlichem Auftrag und Wettbewerb national und gemeinschaftsrechtlich neu zu regeln?, NJW 2002, Beil. 23, S. 33 ff. – Empfiehlt es sich, das Recht der öffentlichen Unternehmen im Spannungsfeld von öffentlichem Auftrag und Wettbewerb national und gemeinschaftsrechtlich neu zu regeln?, Gutachten für den 64. Deutschen Juristentag, in: Verhandlungen des vierundsechzigsten Deutschen Juristentages, 2002, Band I, Teil E (zit.: Ehlers, Recht der öffentlichen Unternehmen).
262
Literaturverzeichnis
Ehmke, Horst: „Staat“ und „Gesellschaft“ als verfassungstheoretisches Problem, in: Konrad Hesse/Siegfried Reicke/Ulrich Scheuner (Hrsg.), Festgabe für Rudolf Smend, 1962, S. 23 ff. (zit.: Ehmke, in: FG Smend). Eichhorn, Peter: Wer bestimmt die Geschäftspolitik in gemischtwirtschaftlichen Unternehmen?, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 20. Jahrgang, 1968, S. 215 ff., 277 ff. [zit.: Eichhorn, Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis 20 (1968)]. – Zwölf Thesen über das öffentliche Interesse an und in Unternehmen, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Öffentliche Bindung von Unternehmen, Gert von Eynern zum 80. Geburtstag gewidmet, 1983, S. 73 ff. (zit.: Eichhorn, in: FS v. Eynern). Emde, Ernst Thomas: Die demokratische Legitimation der funktionalen Selbstverwaltung, 1991 (zit.: Emde, Demokratische Legitimation). Emmerich, Volker: Das Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen, 1969 (zit.: Emmerich, Wirtschaftsrecht der öffentlichen Unternehmen). – Kommentierung, in: Franz Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz mit Anhang Konzernrecht, Bd. 1, 9. Aufl. 2000 (zit.: Emmerich, in: Scholz, GmbHG). – Mietrechtsreform 2000, Deutsche Wohnungswirtschaft 2000, S. 143 ff. = Forum – Mietrechtsreform 2000, JuS 2000, S. 1051 ff. – Bearbeitung, in: ders./Mathias Habersack, Konzernrecht, 8. Aufl. 2005 (zit.: Emmerich, in: ders./Habersack, Konzernrecht). – Unlauterer Wettbewerb, 7. Aufl. 2004 (zit.: Emmerich, Unlauterer Wettbewerb). Engel, Christoph: Gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgung, 1995 (zit.: Engel, Gemischtwirtschaftliche Abfallentsorgung). Engel, Wolfgang: Grenzen und Formen der mittelbaren Kommunalverwaltung, 1981 (zit.: Engel, Grenzen und Formen). Engelhardt, Gunther: Die Instrumentalthese in der wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion. Ansätze einer institutionenökonomischen Reinterpretation, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion öffentlicher Unternehmen, 1. Aufl. 1990, S. 17 ff. [zit.: Engelhardt, in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion]. Engellandt, Frank: Die Einflußnahme der Kommunen auf ihre Kapitalgesellschaften über das Anteilseignerorgan, 1995 (zit.: Engellandt, Einflußnahme der Kommunen). – Zustimmungsvorbehalte zugunsten der Kommunalaufsicht und der Kommunalparlamente in Gesellschaftsverträgen kommunaler Unternehmen, DÖV 1996, S. 71 ff. Engisch, Karl: Einführung in das juristische Denken, 4. Aufl. 1956 (zit.: Engisch, Einführung). Erichsen, Hans-Uwe: Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I, 3. Aufl. 1982 (zit.: Erichsen, Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit I). – Der Innenrechtsstreit, in: ders./Werner Hoppe/Albert v. Mutius (Hrsg.), System des verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, Festschrift für Christian-Friedrich Menger zum 70. Geburtstag, 1985, S. 211 ff. (zit.: Erichsen, in: FS Menger).
Literaturverzeichnis
263
– Gemeinde und Private im wirtschaftlichen Wettbewerb, 1987 (zit.: Erichsen, Gemeinde und Private). – Kommunalrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl. 1997 (zit.: Erichsen, Kommunalrecht NrW). – Das Verwaltungshandeln, in: ders./Dirk Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2002, Dritter Abschnitt, S. 229 ff. [zit.: Erichsen, in: ders./Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht]. di Fabio, Udo: Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 235 ff. – Der Ausstieg aus der wirtschaftlichen Nutzung der Kernenergie, 1999 (zit.: di Fabio, Ausstieg). Fabricius, Fritz: Relativität der Rechtsfähigkeit. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis des privaten Personenrechts, 1963 (zit.: Fabricius, Relativität). Fett, Torsten: Öffentlich-rechtliche Anstalten als abhängige Konzernunternehmen, 2000 (zit.: Fett, Anstalten). Fleiner, Fritz: Institutionen des deutschen Verwaltungsrechts, 8. Aufl. 1928 (2. Nachdruck 1963) (zit.: Fleiner, Institutionen). Flume, Werner: Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Erster Band, Zweiter Teil, Die juristische Person, 1983 (zit.: Flume, Bürgerliches Recht I/2). – Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, Zweiter Band, Das Rechtsgeschäft, 4. Aufl. 1992 (zit.: Flume, Bürgerliches Recht II). Franz, Thorsten: Gewinnerzielung durch kommunale Daseinsvorsorge, 2005 (zit.: Franz, Gewinnerzielung). Frenz, Walter/Kafka, Axel: Vergaberechtliche Grenzen bei der Einbeziehung Privater in die Abfallentsorgung, GewArch 2000, S. 129 ff. Fügemann, Malte W.: Zuständigkeit als organisationsrechtliche Kategorie, 2004 (zit.: Fügemann, Zuständigkeit). Gallwas, Hans-Ullrich: Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 (1971), S. 211 ff. – Das Recht der Vergabe öffentlicher Aufträge – ein Überblick, GewArch 2000, S. 401 ff. Gersdorf, Hubertus: Öffentliche Unternehmen im Spannungsfeld zwischen Demokratie- und Wirtschaftlichkeitsprinzip. Eine Studie zur verfassungsrechtlichen Legitimation der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand, 2000 (zit.: Gersdorf, Öffentliche Unternehmen). Gogos, Konstantinos: Verselbständigte Verwaltungseinheiten als Adressaten von Sonderbindungen des Staates. Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel der Grundrechte, 1997 (zit.: Gogos, Verwaltungseinheiten). Gottschalk, Wolf: Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private Partnership (PPP) in der Versorgungswirtschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn
264
Literaturverzeichnis
(Hrsg.), Public Private Partnership, 1997, S. 153 ff. [zit.: Gottschalk, in: Budäus/ Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership]. Greiling, Dorothea: Aufgabenbezogene Eigentümerüberwachung in öffentlichen Unternehmen, in: Peter Eichhorn/Achim v. Loesch/Günter Püttner (Hrsg.), Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Bd. 19 (1996), S. 286 ff. [zit.: Greiling, ZögU 19 (1996)]. – Öffentliche Trägerschaft oder öffentliche Bindung von Unternehmen?, 1996 (zit.: Greiling, Trägerschaft). – Öffentliche und private Unternehmen im Dienste öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, in: Dietrich Budäus (Hrsg.), Organisationswandel öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, 1998, S. 235 ff. [zit.: Greiling, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel]. Groß, Thomas: Grundzüge der organisationswissenschaftlichen Diskussion, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 139 ff. [zit.: Groß, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Das Kollegialprinzip in der Verwaltungsorganisation, 1999 (zit.: Groß, Kollegialprinzip). Grundmann, Stefan: Kommentierung, in: Kurt Rebmann/Franz Jürgen Säcker/Roland Rixecker (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bd. 2a, Schuldrecht Allgemeiner Teil, §§ 241–432, 4. Aufl. 2003 (zit.: Grundmann, in: Münchener Kommentar, Bd. 2a). Grunewald, Barbara: Gesellschaftsrecht, 6. Aufl. 2005 (zit.: Grunewald, Gesellschaftsrecht). Gundlach, Ulf/Frenzel, Volkhard/Schmidt, Nikolaus: Das kommunale Aufsichtsratsmitglied im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Recht und Gesellschaftsrecht, LKV 2001, S. 246 ff. Gurlit, Elke: Verwaltungsvertrag und Gesetz, 2000 (zit.: Gurlit, Verwaltungsvertrag). Gusy, Christoph: Die Bindung privatrechtlichen Verwaltungshandelns an das öffentliche Recht, DÖV 1984, S. 872 ff. Häberle, Peter: Verfassungsstaatliche Staatsaufgabenlehre, AöR 111 (1986), S. 595 ff. Habersack, Mathias: Private public partnership: Gemeinschaftsunternehmen zwischen Privaten und der öffentlichen Hand, ZGR 25 (1996), S. 544 ff. – Bearbeitung, in: Volker Emmerich/ders., Konzernrecht, 8. Aufl. 2005 (zit.: Habersack, in: Emmerich/ders., Konzernrecht). Hager, Gerd: Grundfragen zur Befangenheit von Gemeinderäten, VBlBW 1994, S. 263 ff. Haibt, Alexander: Die Gestaltung von GmbH-Verträgen kommunaler Eigengesellschaften in Nordrhein-Westfalen, 1999 (zit.: Haibt, Gestaltung). Hausmann, Friedrich Ludwig/Bultmann, Peter Friedrich: Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Stadt Halle, NVwZ 2005, S. 377 ff.
Literaturverzeichnis
265
Hecker, Jan: Privatisierung unternehmenstragender Anstalten öffentlichen Rechts, VerwArchiv 92 (2001), S. 261 ff. Heinrichs, Helmut: Kommentierung, in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, 64. Aufl. 2005 (zit.: Heinrichs, in: Palandt, BGB). Heintzen, Markus: Rechtliche Grenzen und Vorgaben für eine wirtschaftliche Betätigung von Kommunen im Bereich der gewerblichen Gebäudereinigung, 1999. – Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62 (2003), S. 220 ff. Heller, Hermann: Staatslehre, 3. Aufl. 1963 (zit.: Heller, Staatslehre). Hellermann, Johannes: Örtliche Daseinsvorsorge und gemeindliche Selbstverwaltung, 2000 (zit.: Hellermann, Örtliche Daseinsvorsorge). – Handlungsformen und -instrumentarien wirtschaftlicher Betätigung, in: Werner Hoppe/Michael Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 7, S. 115 ff. [zit.: Hellermann, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen]. Henke, Wilhelm: Praktische Fragen des öffentlichen Vertragsrechts – Kooperationsverträge, DÖV 1985, S. 41 ff. Hermes, Georg: Staatliche Infrastrukturverantwortung, 1998 (zit.: Hermes, Infrastrukturverantwortung). Hesse, Konrad: Der Rechtsstaat im Verfassungssystem des Grundgesetzes, in: Staatsverfassung und Kirchenordnung. Festgabe für Rudolf Smend zum 80. Geburtstag, 1962, S. 71 ff. (zit.: K. Hesse, in: FG Smend). – Bemerkungen zur heutigen Problematik und Tragweite der Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, DÖV 1975, S. 437 ff. – Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20. Aufl. 1999 (zit.: K. Hesse, Grundzüge). Hillermeier, Heinz: Kommunales Vertragsrecht. Handbuch für die Vertragsgestaltung und Sammlung von Vertragsmustern mit Erläuterungen, Loseblatt (Stand 15.05. 2004) (zit.: Hillermeier, Kommunales Vertragsrecht). Himmelmann, Gerhard: Grenzen der Instrumentalisierung öffentlicher Unternehmen, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion öffentlicher Unternehmen, 1990, S. 73 ff. [zit.: Himmelmann, in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion]. – Öffentliche Bindung durch neokorporatistische Verhandlungssysteme, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Öffentliche Bindung von Unternehmen, Gert von Eynern zum 80. Geburtstag gewidmet, 1983, S. 55 ff. (zit.: Himmelmann, in: FS v. Eynern). Hoerster, Norbert: Zur Verteidigung des Rechtspositivismus, NJW 1986, S. 2480 ff. Hoffmann-Riem, Wolfgang: Ermöglichung von Flexibilität und Innovationsoffenheit im Verwaltungsrecht. Einleitende Problemskizze, in: ders./Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität des Verwaltungshandelns, 1994, S. 9 ff. [zit.: Hoffmann-Riem, in: ders./Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Innovation und Flexibilität].
266
Literaturverzeichnis
– Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen. Systematisierung und Entwicklungsperspektiven, in: ders./Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 261 ff. [zit.: Hoffmann-Riem, in: ders./Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen]. – Organisationsrecht als Steuerungsressource. Perspektiven der verwaltungsrechtlichen Systembildung, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 355 ff. [zit.: Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Finanzkontrolle als Steuerungsaufsicht im Gewährleistungsstaat, DÖV 1999, S. 221 ff. – Finanzkontrolle der Verwaltung durch Rechnungshof und Parlament, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 73 ff. [zit.: Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Verwaltungskontrolle]. – Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, S. 9 ff. [zit.: Hoffmann-Riem, in: Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Methoden]. Homeister, Joachim: Öffentliche Aufgabe, Organisationsform und Rechtsbindung, 2005. Hommelhoff, Peter: Unternehmensführung in der mitbestimmten GmbH, ZGR 7 (1978), S. 119 ff. – Der aktienrechtliche Organstreit, ZHR 143 (1979), S. 288 ff. – Die Konzernleitungspflicht, 1982 (zit.: Hommelhoff, Konzernleitungspflicht). Hommelhoff, Peter/Schmidt-Aßmann, Eberhard: Die Deutsche Bahn AG als Wirtschaftsunternehmen. Zur Interpretation des Art. 87 e Abs. 3 GG, ZHR 169 (1996), S. 321 ff. Huber, Gerhard/Ryll, Stefan: Kapitalbeteiligungen von Bund und Ländern. Eine Analyse auf Basis einer Verflechtungsrechnung, in: Peter Eichhorn/Achim v. Loesch/ Günter Püttner (Hrsg.), Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Bd. 12 (1989), S. 287 ff. [zit.: Huber/Ryll, ZögU 12 (1989)]. Hueck, Götz/Windbichler, Christine: Gesellschaftsrecht, 20. Aufl. 2003 (zit.: Hueck/ Windbichler, Gesellschaftsrecht). Hufeld, Ulrich: Die Vertretung der Behörde, 2003 (zit.: Hufeld, Vertretung). Hüffer, Uwe: Kommentierung, in: Peter Ulmer (Hrsg.), Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Großkommentar, Zweiter Band, 8. Aufl. 1997 (zit.: Hüffer, in: Hachenburg, GmbHG). – Aktiengesetz, 6. Aufl. 2004 (zit.: Hüffer, Aktiengesetz). Ipsen, Jörn: Die Bewältigung der wissenschaftlichen und technischen Entwicklungen durch das Verwaltungsrecht, VVDStRL 48 (1990), S. 177 ff.
Literaturverzeichnis
267
Isensee, Josef: Der Dualismus von Staat und Gesellschaft, in: Ernst-Wolfgang Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft, 1976, S. 317 ff. [zit.: Isensee, in: Böckenförde (Hrsg.), Staat und Gesellschaft]. – Staat und Verfassung, in: ders./Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 1987, § 13 (zit.: Isensee, in: HdBStR I, § 13). – Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat, in: ders./Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 1988, § 57 (zit.: Isensee, in: HdBStR III, § 57). – Anwendung der Grundrechte auf juristische Personen, in: ders./Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 5, 1992, § 118 (zit.: Isensee, in: HdBStR V, § 118). Jacob, Andre: Nahverkehrsgesetze der neuen Bundesländer im Vergleich, LKV 1996, S. 262 ff. Janson, Bernd: Rechtsformen öffentlicher Unternehmen in der Europäischen Gemeinschaft, 1980 (zit.: Janson, Rechtsformen). Jarass, Hans-Dieter: Verwaltungsrecht als Vorgabe für das Zivil- und Strafrecht, VVDStRL 50 (1991), S. 238 ff. – Wirtschaftsverwaltungsrecht mit Wirtschaftsverfassungsrecht, 3. Aufl. 1997 (zit.: Jarass, Wirtschaftsverwaltungsrecht). – Kommentierung, in: ders./Bodo Pieroth, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, 8. Aufl. 2006 (zit.: Jarass, in: ders./Pieroth, GG). Jellinek, Georg: Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl. 1913 (Neudruck 1976) (zit.: G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre). Jestaedt, Matthias: Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993 (zit.: Jestaedt, Kondominialverwaltung). Jochum, Heike: Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit des Lizenzversagungsgrundes § 6 Abs 3 Satz 1 Nr 3 PostG, 2001 (zit.: Jochum, Lizenzversagungsgrund). Jungk, Fabian: Police Private Partnership, in: Rolf Stober/Harald Olschok (Hrsg.), Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, 2004, S. 571 ff. [zit.: Jungk, in: Stober/ Olschok (Hrsg.), Sicherheitsgewerberecht]. Kahl, Wolfgang: Die Privatisierung der Entsorgungsordnung nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, DVBl. 1995, S. 1327 ff. – Die Staatsaufsicht, 2000 (zit.: Kahl, Staatsaufsicht). Kämmerer, Jörn Axel: Privatisierung. Typologie – Determinanten – Folgen, 2001 (zit.: Kämmerer, Privatisierung). Keller, Stephan: Kommentierung, in: Stephan Articus/Bernd Jürgen Schneider (Hrsg.), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Kommentar, 2. Aufl. 2004 [zit.: Keller, in: Articus/Schneider (Hrsg.), NrWGO]. Kelsen, Hans: Der soziologische und der juristische Staatsbegriff, 1922 (zit.: Kelsen, Staatsbegriff).
268
Literaturverzeichnis
– Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1923 (Nachdruck 1960) (zit.: Kelsen, Hauptprobleme). – Allgemeine Staatslehre, 1925 (Nachdruck 1966) (zit.: Kelsen, Allgemeine Staatslehre). – Reine Rechtslehre, 2. Aufl. 1960 (Nachdruck 1967) (zit.: Kelsen, Reine Rechtslehre). Kermel, Cornelia: Steuerungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand bei Beteiligung an Aktiengesellschaften der Energieversorgung, 1994 (zit.: Kermel, Steuerungsmöglichkeiten). Kersting, Andreas/Siems, Thomas: Ausschreibungspflicht für staatliche Kooperationen?, DVBl. 2005, S. 477 ff. Klein, Hans H.: Die Teilnahme des Staates am wirtschaftlichen Wettbewerb, 1968 (zit.: Klein, Teilnahme des Staates). – Zum Begriff der öffentlichen Aufgabe, DÖV 1965, S. 755 ff. Kloepfer, Michael: Gewerbemüllbeseitigung durch Private – Zulässigkeit und Grenzen der Beseitigung von Gewerbeabfällen durch private Unternehmen, VerwArch 70 (1979), S. 195 ff. – Umweltrecht, 3. Aufl. 2004 (zit.: Kloepfer, Umweltrecht). Klowait, Jürgen: Die Beteiligung Privater an der Abfallentsorgung, 1995 (zit.: Klowait, Beteiligung Privater). Kluth, Winfried: Rechtsfragen der verwaltungsrechtlichen Willenserklärung, NVwZ 1990, S. 608 ff. – Funktionssubjekte der Verwaltungsorganisation, in: Hans J. Wolff/Otto Bachof/Rolf Stober (Hrsg.), Verwaltungsrecht, Bd. 3, 5. Aufl. 2004, § 83 (zit.: Kluth, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR III5, § 83). Knemeyer, Franz-Ludwig: Kommunale Wirtschaftsunternehmen zwischen Eigenverantwortlichkeit und Kontrollen, Der Städtetag 1992, S. 317 ff. – Vom kommunalen Wirtschaftsrecht zum kommunalen Unternehmensrecht. Beispielhafte Fortentwicklung eines überalterten Rechtsbereichs, BayVBl. 1999, S. 1 ff. Koch, Thorsten: Der rechtliche Status kommunaler Unternehmen in Privatrechtsform, 1994 (zit.: Koch, Status). – Kommunale Unternehmen im Konzern, DVBl. 1994, S. 667 ff. Köhler, Heinz: Die Organisation der öffentlichen Abfallwirtschaft im Kreis Paderborn, in: Joachim Bauer/Alexander Schink (Hrsg.), Organisationsformen in der öffentlichen Abfallwirtschaft, 1993, S. 112 ff. [zit.: Köhler, in: Bauer/Schink (Hrsg.), Organisationsformen]. Koppensteiner, Hans-Georg: Zur Grundrechtsfähigkeit gemischtwirtschaftlicher Unternehmungen, NJW 1990, S. 3105 ff.
Literaturverzeichnis
269
– Kommentierung, in: Christian Schmidt-Leithoff (Hrsg.), Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG). Kommentar, begr. von Heinz Rowedder, 4. Aufl. 2002 (zit.: Koppensteiner, in: Rowedder, GmbHG). Körner, Hans: Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, 5. Aufl. 1990 (zit.: Körner, NrWGO). Koslowski, Peter: Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher Dualismus, 1982 (zit.: Koslowski, Gesellschaft und Staat). Köttgen, Arnold: Die Organisationsgewalt, VVDStRL 16 (1958), S. 154 ff. Kraft, Ernst-Theodor: Das Verwaltungsgesellschaftsrecht. Zur Verpflichtung kommunaler Körperschaften, auf ihre Privatrechtsgesellschaften einzuwirken, 1982 (zit.: Kraft, Verwaltungsgesellschaftsrecht). Krebs, Walter: Vorbehalt des Gesetzes und Grundrechte, 1975 (zit.: Krebs, Vorbehalt des Gesetzes). – Kontrolle in staatlichen Entscheidungsprozessen. Ein Beitrag zur rechtlichen Analyse von gerichtlichen, parlamentarischen und Rechnungshof-Kontrollen, 1984 (zit.: Krebs, Kontrolle). – Verwaltungsorganisation, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 1988, § 69 (zit.: Krebs, in: HdBStR III, § 69). – Freiheitsschutz durch Grundrechte, Jura 1988, S. 60 ff. – Der städtebauliche Vertrag im Gefüge der allgemeinen Vertragslehren des Verwaltungsrechts, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen städtebaulicher Verträge. Vertragstypen und Vertragsrechtslehren, 2. Aufl. 1992, S. 120 ff. (zit.: Krebs, in: Schmidt-Aßmann/ders., Rechtsfragen). – Verträge und Absprachen zwischen der Verwaltung und Privaten, VVDStRL 52 (1993), S. 248 ff. – Notwendigkeit und Struktur eines Verwaltungsgesellschaftsrechts, Die Verwaltung 29 (1996), S. 309 ff. – Neue Bauformen des Organisationsrechts und ihre Einbeziehung in das Allgemeine Verwaltungsrecht, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 339 ff. [zit.: Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Kommentierung, in: Ingo v. Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. I, 5. Aufl. 2000 [zit.: Krebs, in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG]. – Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Verwaltungsrecht – Zum Koppelungsverbot in der Verwaltungsvertragsdogmatik, in: ders. (Hrsg.), Liber amicorum HansUwe Erichsen. Zum 70. Geburtstag am 15. Oktober 2004, S. 63 ff. (zit.: Krebs, in: Liber amicorum Erichsen). – Die Juristische Methode im Verwaltungsrecht, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/ Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft,
270
Literaturverzeichnis
2004, S. 209 ff. [zit.: Krebs, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden]. Kroh, Ralph A.: Gesetz über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs – ÖPNVG Baden-Württemberg, 1996 (zit.: Kroh, ÖPNVG). Krönes, Gerhard: Operationalisierung von Zielen öffentlicher Unternehmen, in: Peter Eichhorn/Günter Püttner (Hrsg.), Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Bd. 21 (1998), S. 277 ff. [zit.: Krönes, ZögU 21 (1998)]. Kühne, Gunther: Zur Frage, ob und inwieweit juristische Personen grundrechtsfähig sind, JZ 1990, S. 335 f. Kummer, Heinz Joachim/Giesberts, Ludger: Rechtsfragen der Privatisierung kommunaler Abfallentsorgung, NVwZ 1996, S. 1166 ff. Kunig, Philip: Das Rechtsstaatsprinzip, 1986 (zit.: Kunig, Rechtsstaatsprinzip). – Urteilsanmerkung, JZ 1993, S. 409 ff. – Kommentierung, in: Ingo v. Münch/Philip Kunig (Hrsg.), Grundgesetz – Kommentar, Bd. I, 5. Aufl. 2000 [zit.: Kunig, in: v. Münch/ders. (Hrsg.), GG]. – Kommentierung, in: ders./Stefan Paetow/Ludger-Anselm Versteyl (Hrsg.), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2003 [zit.: Kunig, in: ders./ Paetow/Versteyl (Hrsg.), KrW-/AbfG]. Kunig, Philip/Rublack, Susanne: Aushandeln statt Entscheiden?, Jura 1990, S. 1 ff. Lang, Markus: Die Grundrechtsberechtigung der Nachfolgeunternehmen im Eisenbahn-, Post- und Telekommunikationswesen, NJW 2004, S. 3601 ff. Larenz, Karl: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Aufl. 1991 (zit.: Larenz, Methodenlehre). Larenz, Karl/Canaris, Claus-Wilhelm: Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 3. Aufl. 1995 (zit.: Larenz/Canaris, Methodenlehre). Lauscher, Carl Wilhelm: Die Delegation von Hoheitsrechten durch Gemeinden auf Gemeinden und Gemeindeverbände, 1968 (zit.: Lauscher, Delegation). Lecheler, Helmut: Öffentlicher Dienst und Arbeitsmarkt, ZBR 1980, S. 1 ff. – Verwaltungslehre, 1988 (zit.: Lecheler, Verwaltungslehre). – Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, BayVBl. 1994, S. 555 ff. Leisner, Walter: Der Vorrang des Gesellschaftsinteresses bei den Eigengesellschaften der öffentlichen Hand, WiVerw. 1983, S. 212 ff. Lersner, Heinrich Freiherr von: Kommentierung, in: ders./Helge Wendenburg (Hrsg.), Recht der Abfallbeseitigung des Bundes, der Länder und der Europäischen Union, Kommentar zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Nebengesetze und sonstige Vorschriften, Loseblatt (Stand Mai 2005) [zit.: v. Lersner, in: ders./Wendenburg (Hrsg.), Recht der Abfallbeseitigung]. Lieschke, Uwe: Die Weisungsbindungen der Gemeindevertreter in Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen, 2002 (zit.: Lieschke, Weisungsbindungen).
Literaturverzeichnis
271
Link, Heinz-Christoph: Staatszwecke im Verfassungsstaat – nach 40 Jahren Grundgesetz, VVDStRL 48 (1990), S. 7 ff. Loeser, Roman: Wahl und Bewertung von Rechtsformen für öffentliche Verwaltungsorganisationen, 1988 (zit.: Loeser, Rechtsformen). – System des Verwaltungsrechts, Bd. 1, 1994 (zit.: Loeser, System I). – System des Verwaltungsrechts, Bd. 2, 1994 (zit.: Loeser, System II). Löwer, Wolfgang: Die öffentliche Anstalt, DVBl. 1985, S. 929 ff. Lutter, Marcus/Bayer, Walter: Kommentierung, in: Marcus Lutter/Peter Hommelhoff, GmbH-Gesetz, Kommentar, 16. Aufl. 2004 (zit.: Lutter/Bayer, in: Lutter/Hommelhoff, GmbH-Gesetz). Lutter, Marcus/Hommelhoff, Peter: Kommentierung, in: Marcus Lutter/Peter Hommelhoff, GmbH-Gesetz, Kommentar, 16. Aufl. 2004 (zit.: Lutter/Hommelhoff, in: dies., GmbH-Gesetz). Lux, Herwig: Wettbewerbsrecht, in: Werner Hoppe/Michael Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 10 [zit.: Lux, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen]. Machura, Stefan: Die Kontrolle öffentlicher Unternehmen. Für eine mehrdimensionale Strategie zur Instrumentalisierung öffentlicher Unternehmen, 1993 (zit.: Machura, Kontrolle). Mann, Thomas: Abfallverwertung als Rechtspflicht. Zur Konkretisierung unbestimmter Rechtsbegriffe metajuristischen Ursprungs im Abfallverwertungsgebot des § 3 Abs. 2 Satz 3 AbfG, 1992 (zit.: Mann, Abfallverwertung). – Die öffentlich-rechtliche Gesellschaft, 2002 (zit.: Mann, Gesellschaft). Manssen, Gerrit: Privatrechtsgestaltung durch Hoheitsakt, 1994 (zit.: Manssen, Privatrechtsgestaltung). Maunz, Theodor: Kommentierung, in: ders./Günter Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Bd. IV, Loseblatt (Stand Februar 2004) (zit.: Maunz, in: ders./Dürig, GG). Maunz, Theodor/Scholz, Rupert: Kommentierung, in: ders./Günter Dürig, Grundgesetz. Kommentar, Bd. IV, Loseblatt (Stand Februar 2004) (zit.: Maunz/R. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG). Maurer, Hartmut: Allgemeines Verwaltungsrecht, 15. Aufl. 2004 (zit.: Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht). Mehde, Veith: Ausübung von Staatsgewalt und Public Private Partnership, VerwArch 91 (2000), S. 540 ff. Menger, Christian-Friedrich: Zum Stand der Meinungen über die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht, in: ders. (Hrsg.), Fortschritte des Verwaltungsrechts, Festschrift für Hans J. Wolff zum 75. Geburtstag, 1973, S. 149 ff. (zit.: Menger, in: FS Hans J. Wolff). Mertens, Hans-Joachim: Kommentierung, in: Wolfgang Zöllner (Hrsg.), Kölner Kommentar zum Aktiengesetz, Bd. 2, 2. Aufl. 1996 (zit.: Mertens, in: Kölner Kommentar).
272
Literaturverzeichnis
– Kommentierung, in: Peter Ulmer (Hrsg.), Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Großkommentar, Zweiter Band, 8. Aufl. 1997 (zit.: Mertens, in: Hachenburg, GmbHG). Mestmäcker, Ernst-Joachim/Veelken, Winfried: Kommentierung, in: Ulrich Immenga/ Ernst-Joachim Mestmäcker (Hrsg.), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 3. Aufl. 2001 [zit.: Mestmäcker/Veelken, in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), GWB]. Michaels, Sascha: Bearbeitung, in: Christian Koenig/Jürgen Kühling/Christian Theobald (Hrsg.), Recht der Infrastrukturförderung. Ein Leitfaden für die Praxis, 2004 [zit.: Michaels, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung]. Möller, Ferdinand: Gemeindliche Subventionsverwaltung, 1963 (zit.: Möller, Gemeindliche Subventionsverwaltung). – Kommunale Wirtschaftsförderung, 1963 (zit.: Möller, Kommunale Wirtschaftsförderung). Möllers, Christoph: Braucht das öffentliche Recht einen neuen Methoden- und Richtungsstreit?, VerwArch 90 (1999), S. 187 ff. – Staat als Argument, 2000 (zit.: Möllers, Staat als Argument). Möstl, Markus: Grundrechtsbindung öffentlicher Wirtschaftstätigkeit. Insbesondere die Bindung der Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost an Art. 10 GG nach der Postreform II, 1999 (zit.: Möstl, Grundrechtsbindung). – Engagement des Sicherheitsgewerbes in Ordnungs- und Sicherheitspartnerschaften, in: Rolf Stober/Harald Olschok (Hrsg.), Handbuch des Sicherheitsgewerberechts, 2004, S. 698 ff. [zit.: Möstl, in: Stober/Olschok (Hrsg.), Sicherheitsgewerberecht]. Muthesius, Thomas: Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private Partnership in der Verkehrswirtschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, 1997, S. 169 ff. [zit.: Muthesius, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership]. Mutius, Albert von: Kommentierung, in: Kommentar zum Bonner Grundgesetz, Loseblatt (Stand Juni 2002) (zit.: v. Mutius, in: BK). – Repetitorium: Öffentliches Recht. Grundrechtsfähigkeit, Jura 1983, S. 30 ff. Mutius, Albert von/Nesselmüller, Günter: Juristische Personen des öffentlichen Rechts als herrschende Unternehmen i. S. des Konzernrechts?, NJW 1976, S. 1878 ff. Noch, Rainer: Begriff des öffentlichen Auftraggebers, NVwZ 1999, S. 1083 ff. Oebbecke, Janbernd: Demokratische Legitimation nicht-kommunaler Selbstverwaltung, VerwArch 81 (1991), S. 349 ff. – Rechtliche Vorgaben für die Führung kommunaler Gesellschaften, in: Werner Hoppe/Michael Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 9 [zit.: Oebbecke, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 9]. Ossenbühl, Friedrich: Die Erfüllung von Verwaltungsaufgaben durch Private, VVDStRL 29 (1971), S. 137 ff.
Literaturverzeichnis
273
– Mitbestimmung in Eigengesellschaften der öffentlichen Hand, ZGR 25 (1996), S. 504 ff. Osterloh, Lerke: Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, VVDStRL 54 (1995), S. 204 ff. Osthorst, Winfried: Die De-Kommunalisierung der Abfallwirtschaft in den Städten. Sieben Fallstudien, 2001 (zit.: Osthorst, De-Kommunalisierung). Otting, Olaf/Ohler, Frank Peter: Vergaberecht, in: Werner Hoppe/Michael Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 14 [zit.: Otting/Ohler, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, § 14]. Papier, Hans-Jürgen: Recht der öffentlichen Sachen, in: Hans-Uwe Erichsen/Dirk Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 12. Aufl. 2002, S. 589 ff. [zit.: Papier, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht]. – Zur Selbstverwaltung der Dritten Gewalt, NJW 2002, S. 2585 ff. – Kommentierung, in: Theodor Maunz/Günter Dürig, Grundgesetz, Kommentar, Bd. II, Loseblatt (Stand Februar 2004) (zit.: Papier, in: Maunz/Dürig, GG). Peine, Franz-Joseph: Grenzen der Privatisierung – verwaltungsrechtliche Aspekte, DÖV 1997, S. 353 ff. Pestalozza, Christian Graf von: Formenmißbrauch des Staates, 1973 (zit.: Pestalozza, Formenmißbrauch). – Kollisionsrechtliche Aspekte der Unterscheidung von öffentlichem Recht und Privatrecht. Öffentliches Recht als zwingendes Sonderrecht für den Staat, DÖV 1974, S. 188 ff. Peters, Hans: Öffentliche und staatliche Aufgaben, in: Rolf Dietz/Heinz Hübner (Hrsg.), Festschrift für Hans Carl Nipperdey zum 70. Geburtstag, 21. Januar 1965, Bd. 2, 1965, S. 877 ff. (zit.: Peters, in: FS Nipperdey II). Pfeifer, Axel: Möglichkeiten und Grenzen der Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften durch ihre Gebietskörperschaften, 1991 (zit.: Pfeifer, Steuerung kommunaler Aktiengesellschaften). Pieroth, Bodo: Die Grundrechtsberechtigung gemischtwirtschaftlicher Unternehmen, NWVBl. 1992, S. 85 ff. Pietzcker, Jost: Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 193 ff. – Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bundesstaat. Landesbericht Bundesrepublik Deutschland, in: Christian Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit der Gliedstaaten im Bundesstaat, 1988, S. 17 ff. [zit.: Pietzcker, in: Starck (Hrsg.), Zusammenarbeit]. – Die neue Gestalt des Vergaberechts, ZHR 162 (1998), S. 427 ff. Pitschas, Rainer: Struktur- und Funktionswandel der Aufsicht im Neuen Verwaltungsmanagement, DÖV 1998, S. 907 ff. Plumbaum, Werner: Kommentierung, in: Michael Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg. Potsdamer Kommentar zur Gemeindeordnung, Amtsordnung und
274
Literaturverzeichnis
Landkreisordnung, Loseblatt (Stand August 2002) [zit.: Plumbaum, in: Muth (Hrsg.), Kommunalrecht in Brandenburg]. Poschmann, Thomas: Grundrechtsschutz gemischtwirtschaftlicher Unternehmen, 2000 (zit.: Poschmann, Grundrechtsschutz). Prieß, Hans-Joachim: Das öffentliche Auftragswesen in der Europäischen Union, 1994 (zit.: Prieß, Öffentliches Auftragswesen). Puhl, Thomas: Budgetflucht und Haushaltsverfassung, 1996 (zit.: Puhl, Budgetflucht). Püttner, Günter: Die Einwirkungspflicht. Zur Problematik öffentlicher Einrichtungen in Privatrechtsform, DVBl. 1975, S. 353 ff. – Öffentlich gebundene Unternehmen im geltenden Wirtschaftsrecht, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Öffentliche Bindung von Unternehmen. Gert von Eynern zum 80. Geburtstag gewidmet, 1983, S. 225 ff. (zit.: Püttner, in: FS v. Eynern). – Öffentliche Unternehmen als Instrument staatlicher Politik, DÖV 1983, S. 697 ff. – Die öffentlichen Unternehmen, 1984 (zit.: Püttner, Öffentliche Unternehmen). – Kommunale Energiepolitik?, NVwZ 1988, S. 121 ff. – Verwaltungslehre, 3. Aufl. 2000 (zit.: Püttner, Verwaltungslehre). – Die Wahl der Rechtsform für kommunale Unternehmen, in: ders. (Hrsg.), Zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts, 2002, S. 143 ff. [zit.: Püttner, in: ders. (Hrsg.), Reform]. Raiser, Thomas: Unternehmensziele und Unternehmensbegriff, ZHR 144 (1980), S. 206 ff. – Weisungen an Aufsichtsratsmitglieder?, ZGR 7 (1978), S. 391 ff. – Konzernverflechtungen unter Einschluß öffentlicher Unternehmen, ZGR 25 (1996), S. 458 ff. – Kommentierung, in: Peter Ulmer (Hrsg.), Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Großkommentar, Bd. 2, 8. Aufl. 1997 (zit.: Raiser, in: Hachenburg, GmbHG). Raiser, Thomas/Veil, Rüdiger: Recht der Kapitalgesellschaften, 4. Aufl. 2006 (zit.: Raiser/Veil, Recht der Kapitalgesellschaften). Rehm, Hannes: Aktuelle Probleme bei der Eigenfinanzierung öffentlicher Infrastruktur-Unternehmen, in: Peter Eichhorn/Werner Engelhardt (Hrsg.), Standortbestimmung öffentlicher Unternehmen in der Sozialen Marktwirtschaft, Gedenkschrift für Theo Thiemeyer, 1994, S. 277 ff. (zit.: Rehm, in: Gedenkschrift Thiemeyer). Rehn, Erich/Cronauge, Ulrich: Kommentierung, in: dies./Hans Gerd von Lennep, Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Bd. II, Loseblatt (Stand Oktober 2004) (zit.: Rehn/Cronauge, in: dies./v. Lennep, NrWGO). Remmert, Barbara: Private Dienstleistungen in staatlichen Verwaltungsverfahren, 2003 (zit.: Remmert, Dienstleistungen).
Literaturverzeichnis
275
Rittner, Fritz: Zur Verantwortung des Vorstandes nach § 76 Abs. 1 AktG 1965, in: Kurt Ballerstedt/Wolfgang Hefermehl (Hrsg.), Festschrift für Ernst Geßler zum 65. Geburtstag am 5. März 1970, 1971, S. 139 ff. (zit.: Rittner, in: FS Geßler). – Die werdende Juristische Person, 1973 (zit.: Rittner, Juristische Person). – Das deutsche öffentliche Auftragswesen im europäischen Kontext, NVwZ 1995, S. 313 ff. Roggencamp, Sibylle: Public private partnership, 1999 (zit.: Roggencamp, Public private partnership). Röhl, Hans Christian: Verwaltung und Privatrecht – Verwaltungsprivatrecht?, VerwArch 86 (1995), S. 531 ff. – Verwaltungsverantwortung als dogmatischer Begriff?, Die Verwaltung, Beiheft 2 (1999), S. 33 ff. Röhl, Klaus F.: Rechtssoziologie. Ein Lehrbuch, 1987 (zit.: Röhl, Rechtssoziologie). Ronellenfitsch, Michael: Wirtschaftliche Betätigung des Staates, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, Das Handeln des Staates, 1988, § 84 (zit.: Ronellenfitsch, in: HdBStR III, § 84). – Staat und Markt – Rechtliche Grenzen einer Privatisierung kommunaler Aufgaben, DÖV 1999, S. 705 ff. – Neuere Privatisierungsdiskussion, in: Werner Hoppe/Michael Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 2, S. 15 ff. [zit.: Ronellenfitsch, in: Hoppe/Uechtritz (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen]. Rudolph, Karl-U.: Erfahrungen mit Betreiber- und Kooperationsmodellen im Abwasserbereich, in: Wolfgang Fettig/Lothar Späth (Hrsg.), Privatisierung kommunaler Aufgaben, 1997, S. 175 ff. [zit.: Rudolph, in: Fettig/Späth (Hrsg.), Privatisierung]. Rupp, Hans Heinrich: Formenfreiheit der Verwaltung und Rechtsschutz, in: Otto Bachof (Hrsg.), Verwaltungsrecht zwischen Freiheit, Teilhabe und Bindung, Festgabe aus Anlaß des 25jährigen Bestehens des Bundesverwaltungsgerichts, 1978, S. 539 ff. (zit.: H. H. Rupp, in: FG BVerwG). – Die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, 1987, § 28 (zit.: H. H. Rupp, in: HdBStR I, § 28). – Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, 2. Aufl. 1991 (zit.: H. H. Rupp, Grundfragen). Säcker, Franz-Jürgen: Behördenvertreter im Aufsichtsrat, in: Heinz Eyrich/Walter Odersky/ders. (Hrsg.), Festschrift für Kurt Rebmann zum 65. Geburtstag, 1989, S. 781 ff. (zit.: Säcker, in: FS Rebmann). Säcker, Franz-Jürgen/Busche, Jan: Kommunale Eigenbetriebe im Spannungsfeld von Selbstverwaltungskompetenz und Kartellaufsicht, VerwArch 83 (1992), S. 1 ff. Schachtschneider, Karl Albrecht: Staatsunternehmen und Privatrecht, 1986 (zit.: Schachtschneider, Staatsunternehmen).
276
Literaturverzeichnis
Schallemacher, Rainer: Die industriellen Bundesunternehmen, 1990 (zit.: Schallemacher, Bundesunternehmen). Scheele, Ulrich: Privatisierung kommunaler Einrichtungen – Zielsetzungen, Stand und erste Ergebnisse, in: Thomas Blanke/Ralf Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung, 1998, S. 3 ff. [zit.: Scheele, in: Blanke/Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung]. Schenke, Wolf-Rüdiger: Anmerkung zum Beschluß des Bundesdisziplinargerichts, DÖV 1985, S. 450 ff., DÖV 1985, S. 452 ff. Schink, Alexander: Kommunalverfassungs- und kartellrechtliche Probleme bei der Organisation der öffentlichen Abfallwirtschaft, in: Joachim Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen in der kommunalen Abfallwirtschaft, 1993, S. 5 ff. (zit.: Schink, in: Bauer/ders. (Hrsg.), Organisationsformen). – Organisationsformen für die kommunale Abfallwirtschaft, VerwArch 85 (1994), S. 215 ff. – Öffentliche und private Entsorgung, NVwZ 1997, S. 435 ff. Schlette, Volker: Die Verwaltung als Vertragspartner, 2000 (zit.: Schlette, Verwaltung als Vertragspartner). Schliesky, Utz: Öffentliches Wettbewerbsrecht, 1997 (zit.: Schliesky, Öffentliches Wettbewerbsrecht). – Öffentliches Wirtschaftsrecht, 2. Aufl. 2003 (zit.: Schliesky, Öffentliches Wirtschaftsrecht). Schmidt, Karsten: „Unternehmen“ und „Abhängigkeit“ – Begriffseinheit und Begriffsvielfalt im Kartell- und Konzernrecht – Besprechung der Entscheidung BGHZ 74, 359, ZGR 9 (1980), S. 277 ff. – Handelsrecht, 5. Aufl. 1999 (zit.: K. Schmidt, Handelsrecht). – Gesellschaftsrecht, 4. Aufl. 2002 (zit.: K. Schmidt, Gesellschaftsrecht). Schmidt, Reiner: Öffentliches Wirtschaftsrecht, Allgemeiner Teil, 1990 (zit.: R. Schmidt, Öffentliches Wirtschaftsrecht). – Der Übergang öffentlicher Aufgabenerfüllung in private Rechtsform, ZGR 25 (1996), S. 345 ff. Schmidt, Walter: Die Entscheidungsfreiheit des einzelnen zwischen staatlicher Herrschaft und gesellschaftlicher Macht, AöR 101 (1976), S. 24 ff. Schmidt-Aßmann, Eberhard: Verwaltungsorganisationsrecht zwischen parlamentarischer Steuerung und exekutivischer Organisationsgewalt, in: Festschrift für H. P. Ipsen zum siebzigsten Geburtstag, 1977, S. 333 ff. (zit.: Schmidt-Aßmann, in: FS Ipsen). – Der Umweltschutz im Spannungsfeld zwischen Staat und Selbstverwaltung, NVwZ 1987, S. 265 ff. – Die Lehre von den Rechtsformen des Verwaltungshandelns, DVBl. 1989, S. 533 ff. – Der Grundrechtsschutz gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen nach Art. 19 Abs. 3 GG, BB 1990, Beil. 34, S. 1 ff.
Literaturverzeichnis
277
– Verwaltungsverträge im Städtebaurecht, in: Wolfgang Lenz (Hrsg.), Festschrift für Konrad Gelzer zum 75. Geburtstag, 1991, S. 117 ff. (zit.: Schmidt-Aßmann, in: FS Gelzer). – Zur Bedeutung der Privatrechtsform für den Grundrechtsstatus gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, in: Erik Jayme/Adolf Laufs/Gert Reinhart/Rolf Serick (Hrsg.), Festschrift für Hubert Niederländer zum 70. Geburtstag am 10. Februar 1991, 1991, S. 383 ff. (zit.: Schmidt-Aßmann, in: FS Niederländer). – Verwaltungslegitimation als Rechtsbegriff, AöR 116 (1991), S. 329 ff. – Zur Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Reformbedarf und Reformansätze, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/ders./Gunnar Folke Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 11 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/ders./Schuppert (Hrsg.), Reform des Allgemeinen Verwaltungsrechts]. – Öffentliches Recht und Privatrecht: Ihre Funktionen als wechselseitige Auffangordnungen. Einleitende Problemskizze, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/ders. (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 7 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann, in: Hoffmann-Riem/ders. (Hrsg.), Auffangordnungen]. – Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource. Einleitende Problemskizze, in: ders./Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 11 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann, in: ders./HoffmannRiem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungsrecht, in: Wolfgang HoffmannRiem/ders. (Hrsg.), Effizienz als Herausforderung des Verwaltungsrechts, 1998, S. 245 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/ders. (Hrsg.), Effizienz]. – Verwaltungskontrolle. Einleitende Problemskizze, in: ders./Wolfgang HoffmannRiem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 9 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann, in: ders./ Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle]. Schmidt-Aßmann, Eberhard/Röhl, Hans Christian: Kommunalrecht, in: Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 13. Aufl. 2005, Erstes Kapitel, S. 1 ff. [zit.: Schmidt-Aßmann/Röhl, in: Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht]. – Kommentierung, in: Theodor Maunz/Ernst Dürig, GG, Bd. III, Loseblatt (Stand Februar 2004) (zit.: Schmidt-Aßmann, in: Maunz/Dürig, GG). – Der Rechtsstaat, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 26 (zit.: Schmidt-Aßmann, in: HdBStR II, § 26). – Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004 (zit.: SchmidtAßmann, Ordnungsidee). Schmidt-Aßmann, Eberhard/Ulmer, Peter: Die Berichterstattung von Aufsichtsratsmitgliedern einer Gebietskörperschaft nach § 394 AktG, BB 1988, Beil. 13, S. 1 ff. Schmidt-Preuß, Matthias: Verwaltung und Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, VVDStRL 56 (1997), S. 160 ff.
278
Literaturverzeichnis
– Steuerung durch Organisation, DÖV 2001, S. 45 ff. Schmitt Glaeser, Walter: Partizipation an Verwaltungsentscheidungen, VVDStRL 31 (1973), S. 179 ff. Schnapp, Friedrich E.: Amtsrecht und Beamtenrecht. Eine Untersuchung über normative Strukturen des staatlichen Innenbereichs, 1977 (zit.: Schnapp, Amtsrecht und Beamtenrecht). – Grundbegriffe des öffentlichen Organisationsrechts, Jura 1980, S. 68 ff. – Ausgewählte Probleme des öffentlichen Organisationsrechts, Jura 1980, S. 293 ff. – Dogmatische Überlegungen zu einer Theorie des Organisationsrechts, AöR 105 (1980), S. 243 ff. – Der Verwaltungsvorbehalt, VVDStRL 43 (1985), S. 172 ff. – Hans Kelsen und die Einheit der Rechtsordnung, in: Werner Krawietz/Helmut Schelsky (Hrsg.), Rechtssystem und gesellschaftliche Basis bei Hans Kelsen, Rechtstheorie 1984, Beiheft 5, S. 381 ff. (zit.: Schnapp, Rechtstheorie 1984, Beiheft 5). – Die Grundrechtsbindung der Staatsgewalt, JuS 1989, S. 1 ff. Schneider, Uwe H.: Kommentierung, in: Franz Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz mit Anhang Konzernrecht, Bd. I, 9. Aufl. 2000 (zit.: Schneider, in: Scholz, GmbHG). Schoch, Friedrich: Privatisierung der Abfallentsorgung, 1992 (zit.: Schoch, Privatisierung). – Rechtsfragen der Privatisierung von Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, in: Jörn Ipsen (Hrsg.), Privatisierung öffentlicher Aufgaben. Private Finanzierung kommunaler Investitionen, 1994, S. 63 ff. [zit.: Schoch, in: Ipsen (Hrsg.), Privatisierung]. – Rechtsfragen der Privatisierung von Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, DVBl. 1994, S. 1 ff. – Privatisierung von Verwaltungsaufgaben, DVBl. 1994, S. 962 ff. Scholl, Mechthild: Was bedeutet der „öffentliche Zweck“ heute?, in: Günter Püttner (Hrsg.), Reform des Gemeindewirtschaftsrechts, 2002, S. 85 ff. [zit.: Scholl, in: Püttner (Hrsg.), Reform]. Scholz, Rupert: Wettbewerbsrecht und öffentliche Hand, ZHR 132 (1969), S. 97 ff. – Grundrechtsschutz gemischt-wirtschaftlicher Unternehmen, in: Bernhard Pfeiffer/ Michael Will (Hrsg.), Festschrift für Werner Lorenz zum 70. Geburtstag, 1991, S. 213 ff. (zit.: R. Scholz, in: FS Lorenz). – Verkehrsüberwachung durch Private?, NJW 1997, S. 14 ff. Schön, Wolfgang: Der Einfluß öffentlich-rechtlicher Zielsetzungen auf das Statut privatrechtlicher Eigengesellschaften der öffentlichen Hand. Gesellschaftsrechtliche Analyse, ZGR 25 (1996), S. 429 ff. Schröder, Claus: Zum Begriff des Amtsträgers, NJW 1984, S. 2510 f.
Literaturverzeichnis
279
Schröder, Holger: Vergaberechtliche Probleme bei der Public-Private-Partnership in Form der gemischtwirtschaftlichen Unternehmung, NJW 2002, S. 1831 ff. Schulte, Martin: Rettungsdienst durch Private, 1999 (zit.: M. Schulte, Rettungsdienst). Schulz, Norbert: Neue Entwicklungen im kommunalen Wirtschaftsrecht Bayerns, BayVBl. 1996, S. 97 ff., 129 ff. – Wirtschaftliche, nichtwirtschaftliche und nicht nichtwirtschaftliche Unternehmen, BayVBl. 1997, S. 518 ff. Schulze-Fielitz, Helmuth: Kooperatives Recht im Spannungsfeld von Rechtsstaatsprinzip und Verfahrensökonomie, DVBl. 1994, S. 657 ff. – Rationalität als rechtsstaatliches Prinzip für den Organisationsgesetzgeber, in: Paul Kirchhof/Moris Lehner/Arndt Raupach/Michael Rodi (Hrsg.), Staaten und Steuern. Festschrift für Klaus Vogel zum 70. Geburtstag, 2000 (zit.: Schulze-Fielitz, in: FS Vogel). Schuppert, Gunnar Folke: Die öffentliche Aufgabe als Schlüsselbegriff der Verwaltungswissenschaft, VerwArch 71 (1980), S. 309 ff. – Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch verselbständigte Verwaltungseinheiten, 1981 (zit.: Schuppert, Verselbständigte Verwaltungseinheiten). – Zur Kontrollierbarkeit öffentlicher Unternehmen. Normative Zielvorgaben und ihre praktische Erfüllung, in: Peter Eichhorn/Achim v. Loesch/Theo Thiemeyer (Hrsg.), Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, Bd. 8 (1985), S. 310 ff. [zit.: Schuppert, ZögU 8 (1985)]. – Probleme der Steuerung und Kontrolle öffentlicher Unternehmen, in: Theo Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion öffentlicher Unternehmen, 1990, S. 141 ff. [zit.: Schuppert, in: Thiemeyer (Hrsg.), Instrumentalfunktion]. – Verwaltungsrechtswissenschaft als Steuerungswissenschaft. Zur Steuerung des Verwaltungshandelns durch Verwaltungsrecht, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Reform des allgemeinen Verwaltungsrechts, 1993, S. 65 ff. [zit.: Schuppert, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/ders. (Hrsg.), Reform]. – Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch die öffentliche Hand, private Anbieter und Organisationen des Dritten Sektors, in: Jörn Ipsen (Hrsg.), Privatisierung öffentlicher Aufgaben. Private Finanzierung kommunaler Interessen, 1994, S. 17 ff. [zit.: Schuppert, in: Ipsen (Hrsg.), Privatisierung]. – Privatisierung und Regulierung – Vorüberlegungen zu einer Theorie der Regulierung im kooperativen Verwaltungsstaat, 1996 (zit.: Schuppert, Privatisierung und Regulierung). – Die öffentliche Verwaltung im Kooperationsspektrum staatlicher und privater Aufgabenerfüllung. Erscheinungsformen von Public Private Partnership als Herausforderung an Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, 1997, S. 93 ff. [zit.: Schuppert, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership].
280
Literaturverzeichnis
– Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument des Rechtsstaats, in: ders. (Hrsg.), Das Gesetz als zentrales Steuerungsinstrument des Rechtsstaats, 1998, S. 105 ff. [zit.: Schuppert, in: ders. (Hrsg.), Gesetz]. – Geändertes Staatsverständnis als Grundlage des Organisationswandels öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, in: Dietrich Budäus (Hrsg.), Organisationswandel öffentlicher Aufgabenwahrnehmung, 1998, S. 19 ff. [zit.: Schuppert, in: Budäus (Hrsg.), Organisationswandel]. – Verwaltungswissenschaft: Verwaltung, Verwaltungsrecht, Verwaltungslehre, 2000 (zit.: Schuppert, Verwaltungswissenschaft). – Staatswissenschaft, 2003 (zit.: Schuppert, Staatswissenschaft). Siebert, Wolfgang: Privatrecht im Bereich öffentlicher Verwaltung, in: Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät zu Göttingen (Hrsg.), Festschrift für Hans Niedermeyer zum 70. Geburtstag, 1953, S. 215 ff. (zit.: Siebert, in: FS Niedermeyer, S. 215 ff.). Siekmann, Helmut: Wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand und ökonomische Analyse des Rechts, in: Rolf Stober/Hanspeter Vogel (Hrsg.), Wirtschaftsbetätigung der öffentlichen Hand, 2000, S. 103 ff. [zit.: Siekmann, in: Stober/Vogel (Hrsg.), Wirtschaftsbetätigung der öffentlichen Hand]. – Haftung der Kommunen für ihre privatrechtlich organisierten Unternehmen, in: Günter Püttner (Hrsg.), Zur Reform des Gemeindewirtschaftsrechts, 2002, S. 159 ff. [zit.: Siekmann, in: Püttner (Hrsg.), Reform]. Singer, Reinhard: Kommentierung, in: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 1: Allgemeiner Teil, §§ 90–133, §§ 1–54 BeurKG, 2004 (zit.: Singer, in: Staudinger, BGB). Sinz, Klaus: Praktische Erfahrungen und Probleme mit Public Private Partnership in der Entsorgungswirtschaft, in: Dietrich Budäus/Peter Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, 1997, S. 185 ff. [zit.: Sinz, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership]. Sobota, Katharina: Das Prinzip Rechtsstaat, 1997 (zit.: Sobota, Rechtsstaat). Sommermann, Karl-Peter: Staatsziele und Staatszielbestimmungen, 1997 (zit.: Sommermann, Staatsziele). Spannowsky, Willy: Die Verantwortung der öffentlichen Hand für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben und die Reichweite ihrer Einwirkungspflicht auf Beteiligungsunternehmen, DVBl. 1992, S. 1072 ff. – Grenzen des Verwaltungshandelns durch Verträge und Absprachen, 1994 (zit.: Spannowsky, Grenzen des Verwaltungshandelns). – Der Einfluß öffentlich-rechtlicher Zielsetzungen auf das Statut privatrechtlicher Eigengesellschaften in öffentlicher Hand, ZGR 25 (1996), S. 400 ff. – Öffentlich-rechtliche Bindungen für gemischt-wirtschaftliche Unternehmen, ZHR 169 (1996), S. 560 ff. Stein, Jürgen vom/Weber, Markus: Vereinbarkeit von Richteramt und Mitwirkung in Gesellschaftsorganen kommunaler Unternehmen, DÖV 2003, S. 278 ff.
Literaturverzeichnis
281
Steiner, Udo: Öffentliche Verwaltung durch Private, 1975 (zit.: Steiner, Öffentliche Verwaltung durch Private). Stern, Klaus: Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, Allgemeine Lehren der Grundrechte, 1. Halbband, 1988 (zit.: Stern, Staatsrecht III/1). Sterzel, Dieter: Verfassungs-, europa- und kommunalrechtliche Rahmenbedingungen für eine Privatisierung kommunaler Aufgaben, in: Thomas Blanke/Ralf Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung, 1998, S. 101 ff. [zit.: Sterzel, in: Blanke/Trümmer (Hrsg.), Handbuch Privatisierung]. Stettner, Rupert: Grundfragen einer Kompetenzlehre, 1983 (zit.: Stettner, Grundfragen). Stickler, Thomas: Kommentierung, in: Olaf Reidt/ders./Heike Glahs (Hrsg.), Vergaberecht. Kommentierung, 2. Aufl. 2003 [zit.: Stickler, in: Reidt/ders./Glahs (Hrsg.), Vergaberecht]. Stintzing, Heike: Zu Beschränkungen der Wahlrechtsgrundsätze nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung, VBlBW 1998, S. 46 ff. Stober, Rolf: Die privatrechtlich organisierte öffentliche Verwaltung. Zur Problematik privatrechtlicher Gesellschaften und Beteiligungen der öffentlichen Hand, NJW 1984, S. 449 ff. – Möglichkeiten und Grenzen einer Privatisierung der kommunalen Abfallentsorgung, in: Peter J. Tettinger (Hrsg.), Rechtlicher Rahmen für Public-Private-Partnerships auf dem Gebiet der Entsorgung, 1994, S. 25 ff. [zit.: Stober, in: Tettinger (Hrsg.), Public-Private-Partnerships]. – Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, 3. Aufl. 1996 (zit.: Stober, Kommunalrecht). – Bearbeitung, in: Hans J. Wolff/Otto Bachof/ders., Verwaltungsrecht Bd. 1, 11. Aufl. 1999 (zit.: Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/Stober, VerwR I11). – Bearbeitung, in: Hans J. Wolff/Otto Bachof/ders., Verwaltungsrecht, Bd. 2, 6. Aufl. 2000 (zit.: Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR II6). – Neuregelung des Rechts der öffentlichen Unternehmen?, NJW 2002, S. 2357 ff. – Bearbeitung, in: Hans J. Wolff/Otto Bachof/ders., Verwaltungsrecht, Bd. 3, 5. Aufl. 2004 (zit.: Stober, in: Hans J. Wolff/Bachof/ders., VerwR III5). – Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht, 14. Aufl. 2004 (zit.: Stober, Wirtschaftsverwaltungsrecht). Storr, Stefan: Der Staat als Unternehmer, 2001 (zit.: Storr, Staat). – Zu einer gesetzlichen Regelung für eine Kooperation des Staates mit privaten Sicherheitsunternehmen im Bereich polizeilicher Aufgaben, DÖV 2005, S. 101 ff. – Das neue Kommunalunternehmen in Schleswig-Holstein, NordÖR 2005, S. 94 ff. Strobel, Brigitte: Verschwiegenheits- und Auskunftspflicht kommunaler Vertreter im Aufsichtsrat öffentlicher Unternehmen, 2002 (zit.: Strobel, Verschwiegenheits- und Auskunftspflicht).
282
Literaturverzeichnis
– Weisungsfreiheit oder Weisungsgebundenheit kommunaler Vertreter in Eigen- oder Beteiligungsgesellschaften?, DVBl. 2005, S. 77 ff. Tettinger, Peter J.: Der Adressatenkreis des Abfallverwertungsgebots, in: Peter Eichhorn/Werner Wilhelm Engelhardt (Hrsg.), Standortbestimmung öffentlicher Unternehmen in der sozialen Marktwirtschaft. Gedenkschrift für Theo Thiemeyer, 1994, S. 145 ff. (zit.: Tettinger, in: Eichhorn/Engelhardt (Hrsg.), Standortbestimmung öffentlicher Unternehmen). – Rechtliche Bausteine eines modernen Abfallwirtschaftsrechts, DVBl. 1995, S. 213 ff. – Die rechtliche Ausgestaltung von Public Private Partnership, in: Dietrich Budäus/ Peter Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership, 1997, S. 125 ff. [zit.: Tettinger, in: Budäus/Eichhorn (Hrsg.), Public Private Partnership]. – Public Private Partnership, Möglichkeiten und Grenzen – ein Sachstandsbericht, NWVBl. 2005, S. 1 ff. Theobald, Christian/Siebeck, Jana: Bearbeitung, in: Christian Koenig/Jürgen Kühling/ Christian Theobald (Hrsg.), Recht der Infrastrukturförderung. Ein Leitfaden für die Praxis, 2004 [zit.: Theobald/Siebeck, in: Koenig/Kühling/Theobald (Hrsg.), Infrastrukturförderung]. Thieme, Werner: Entscheidungen in der öffentlichen Verwaltung, 1981 (zit.: Thieme, Entscheidungen). – Verwaltungslehre, 4. Aufl. 1984 (zit.: Thieme, Verwaltungslehre). Thiemeyer, Theo: Öffentliche Bindung von Unternehmen, in: ders. (Hrsg.), Öffentliche Bindung von Unternehmen, Gert von Eynern zum 80. Geburtstag gewidmet, 1983, S. 25 ff. (zit.: Thiemeyer, in: FS v. Eynern). Thode, Bernd/Peres, Holger: Die Rechtsform Anstalt nach dem kommunalen Wirtschaftsrecht des Freistaates Bayern, BayVBl. 1999, S. 6 ff. Tieves, Johannes: Der Unternehmensgegenstand der Kapitalgesellschaft, 1998 (zit.: Tieves, Unternehmensgegenstand). Tomerius, Stephan: Kommunale Abfallwirtschaft und Vergaberecht, NVwZ 2000, S. 727 ff. Trott zu Solz, Jost von: Die staatlich beeinflußte Aktiengesellschaft als Instrument der öffentlichen Verwaltung, 1975 (zit.: von Trott zu Solz, Aktiengesellschaft). Trute, Hans-Heinrich: Wechselseitige Verzahnungen zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht, in: Wolfgang Hoffmann-Riem/Eberhard Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Öffentliches Recht und Privatrecht als wechselseitige Auffangordnungen, 1996, S. 167 ff. [zit.: Trute, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann (Hrsg.), Auffangordnungen]. – Die Verwaltung und das Verwaltungsrecht zwischen gesellschaftlicher Selbstregulierung und staatlicher Steuerung, DVBl. 1996, S. 950 ff. – Funktionen der Organisation und ihre Abbildung im Recht, in: Eberhard SchmidtAßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als
Literaturverzeichnis
283
Steuerungsressource, 1997, S. 249 ff. [zit.: Trute, in: Schmidt-Aßmann/HoffmannRiem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Methodik der Herstellung und Darstellung verwaltungsrechtlicher Entscheidungen, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenschaft, 2004, S. 293 ff. [zit.: Trute, in: Schmidt-Aßmann/ Hoffmann-Riem (Hrsg.), Methoden]. Uechtritz, Michael: Rechtsform kommunaler Unternehmen. Rechtliche Vorgaben und Entscheidungskriterien, in: Werner Hoppe/ders. (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen, 2004, § 15 [zit.: Uechtritz, in: Hoppe/ders. (Hrsg.), Handbuch Kommunale Unternehmen]. Ule, Carl Hermann/Laubinger, Hans-Werner: Verwaltungsverfahrensrecht, 4. Aufl. 1995 (zit.: Ule/Laubinger, Verwaltungsverfahrensrecht). Ulmer, Peter: Kommentierung, in: ders. (Hrsg.), Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Großkommentar, Bd. 1, 8. Aufl. 1992 (zit.: Hüffer, in: Hachenburg, GmbHG). – Kommentierung, in: ders. (Hrsg.), Hachenburg, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), Großkommentar, Bd. 2, 8. Aufl. 1997 (zit.: Ulmer, in: Hachenburg, GmbHG). UNI Unternehmerinstitut der ASU e.V. (Hrsg.): Der Weg aus der staatlichen Schuldenfalle. Konzepte und Beispiele für eine umfassende Privatisierung, 2003 [zit.: UNI (Hrsg.), Staatliche Schuldenfalle]. Veelken, Winfried: Der Betriebsführungsvertrag im deutschen und amerikanischen Aktien- und Konzernrecht, 1975 (zit.: Veelken, Betriebsführungsvertrag). Versteyl, Ludger-Anselm: Kommentierung, in: Philip Kunig/Stefan Paetow/ders. (Hrsg.), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Kommentar, 2. Aufl. 2003 [zit.: Versteyl, in: Kunig/Paetow/ders. (Hrsg.), KrW-/AbfG]. Versteyl, Ludger-Anselm/Wendenburg, Helge: Änderungen des Abfallrechts. Anmerkungen zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz sowie den Gesetzen zu dem Basler Übereinkommen, NVwZ 1994, S. 833 ff. Vitzthum, Wolfgang Graf: Gemeinderechtliche Grenzen der Privatisierung kommunaler Wirtschaftsunternehmen, AöR 104 (1979), S. 580 ff. Vosskuhle, Andreas: „Schlüsselbegriffe“ der Verwaltungsrechtsreform, VerwArch 92 (2001), S. 184 ff. – Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, VVDStRL 62 (2003), S. 266 ff. Wagener, Frido: Typen der verselbständigten Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in: ders. (Hrsg.), Verselbständigung von Verwaltungsträgern, 1976, S. 31 ff. [zit.: F. Wagener, in: ders. (Hrsg.), Verselbständigung]. Wahl, Rainer: Stellvertretung im Verfassungsrecht, 1971 (zit.: Wahl, Stellvertretung). – Verwaltungsverfahren zwischen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag, VVDStRL 41 (1983), S. 151 ff.
284
Literaturverzeichnis
– Privatorganisationsrecht als Steuerungsinstrument bei der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource, 1997, S. 301 ff. [zit.: Wahl, in: Schmidt-Aßmann/Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungsorganisationsrecht als Steuerungsressource]. – Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung im Spannungsfeld von Demokratie und Effizienz, in: Hans-Günter Hennecke (Hrsg.), Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung, 1998, S. 15 ff. [zit.: Wahl, in: Hennecke (Hrsg.), Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung]. Wall, Heinrich de: Die Anwendbarkeit privatrechtlicher Vorschriften im Verwaltungsrecht, 1999 (zit.: de Wall, Anwendbarkeit). Walter, Robert: Hans Kelsens Rechtslehre, 1999 (zit.: R. Walter, Hans Kelsen). Weiß, Wolfgang: Privatisierung und Staatsaufgaben, 2002 (zit.: Weiß, Privatisierung). – Beteiligung Privater an der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und staatliche Verantwortung, DVBl. 2002, S. 1167 ff. – Kommunale Energieversorger und EG-Recht: Fordert das EG-Recht die Beseitigung der Beschränkungen für die kommunale Wirtschaft?, DVBl. 2003, S. 564 ff. Wieland, Joachim: Neuere Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Finanzkontrollen, in: Eberhard Schmidt-Aßmann/Wolfgang Hoffmann-Riem (Hrsg.), Verwaltungskontrolle, 2001, S. 59 ff. Will, Martin: Informationszugriff auf AG-Aufsichtsratsmitglieder durch Gemeinden, VerwArch 94 (2003), S. 248 ff. Windthorst, Kay: Zur Grundrechtsfähigkeit der Deutschen Telekom AG, VerwArch 95 (2004), S. 377 ff. Winter, Heinz: Kommentierung, in: Franz Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz mit Anhang Konzernrecht, Bd. 1, 9. Aufl. 2000 (zit.: Winter, in: Scholz, GmbHG). Wolfers, Benedikt: Privatisierung unter Wahrung der öffentlich-rechtlichen Rechtsform. Der Modellfall Berliner Wasserbetriebe, NVwZ 2000, S. 765 ff. Wolfers, Benedikt/Kaufmann, Marcel: Private als Anstaltsträger, DVBl. 2002, S. 507 ff. Wolff, Hans Julius: Organschaft und Juristische Person, Bd. 1, Juristische Person und Staatsperson, 1933 (Berichtigter Neudruck 1968) (zit.: Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 1). – Organschaft und Juristische Person, Bd. 2, Theorie der Vertretung, 1934 (Berichtigter Neudruck 1968) (zit.: Hans J. Wolff, Organschaft und Juristische Person, Bd. 2). – Rechtsformen gemeindlicher Einrichtungen, Archiv für Kommunalwissenschaften 1963, S. 149 ff. (zit.: Hans J. Wolff, AfK 1963). – Verwaltungsrecht, Bd. 2, 3. Aufl. 1970 (zit.: Hans J. Wolff, VerwR II3). – Verwaltungsrecht, Bd. 1, 8. Aufl. 1971 (zit.: Hans J. Wolff, VerwR I8). Zacharias, Diana: Privatisierung der Abwasserbeseitigung, DÖV 2001, S. 454 ff.
Literaturverzeichnis
285
Zimmer, Gerhard: Funktion – Kompetenz – Legitimation. Gewaltenteilung in der Ordnung des Grundgesetzes, 1979 (zit.: Zimmer, Funktion). Zimmermann, Norbert: Zur Grundrechtssubjektivität kommunaler Energieversorgungsunternehmen, BVerfG, NJW 1990, 1783, JuS 1991, S. 294 ff. – Der grundrechtliche Schutzanspruch juristischer Personen des öffentlichen Rechts, 1993 (zit.: Zimmermann, Schutzanspruch). Zippelius, Reinhold: Allgemeine Staatslehre, 14. Aufl. 2003 (zit.: Zippelius, Allgemeine Staatslehre). Zöllner, Wolfgang/Noack, Ulrich: Kommentierung, in: Adolf Baumbach/Alfred Hueck, GmbH-Gesetz, 18. Aufl. 2006 (zit.: Zöllner/Noack, in: Baumbach/Hueck, GmbHG).
Sachwortverzeichnis Amt – atypisches 105 m. Fn. 55 – Begriff 104 m. Fn. 47 Amtswahrnehmungspflicht 104 m. Fn. 48 Amtswalter 104 ff. Aufgabe – Begriff 82, 83 m. Fn. 293 – öffentliche 47, 82 ff. – staatliche 83 – Staats- 83 Aufgabenansatz 81 ff. Aufgabendelegation Siehe Beleihung und Delegation Auftraggeber, öffentlicher 151 ff. Auslegung – objektive Auslegung von Rechtssätzen 126 f. – rechtssatzkonforme 199 ff. – von Gesellschaftsverträgen 126 f. m. Fn. 150, 151 – von Verwaltungsverträgen 124 ff. – zuständigkeitskonforme 201 ff. Beherrschung, Begriff 31 m. Fn. 19 Beherrschungsansatz 31 ff. Beherrschungsvertrag 52 Beirat 162 m. Fn. 315, 196 m. Fn. 465 Beleihung – Begriff 74 – einer Juristischen Person des Privatrechts 183 f. – und Aufgabenansatz 92 m. Fn. 347 Berechtigung, Begriff 134 Besitzermodell, Begriff 170 Besitzgesellschaft 217 Betreibermodell, Begriff 170 f.
Betriebsführungsmodell, Begriff 170 m. Fn. 346 Betriebsgesellschaft 217 Daseinsvorsorge 48 f., 84 m. Fn. 301 Delegation – Begriff 212, Fn. 539 – Delegationsermächtigung 212 – verantwortungsbefreiende 212 f. – verantwortungsübertragende 222, 229 f. Dualismus der Rechtsformen 69 ff. Eigengesellschaft, Begriff 73 Einflußknick 45 m. Fn. 89 Einrichtung – Begriff 188 m. Fn. 420, 421 – öffentliche 188 – und Widmung 188 f. Einwirkungspflicht Siehe Ingerenzpflicht einzelvertragliche Abreden 58, 168 ff. Entscheidung – Begriff 30 – Entscheidungsherrschaft 31 ff. – Entscheidungsmaßstab 30 – gemischt staatlich-private 66, 119 Entscheidungseinheit – Begriff 30 – reale 31 – rechtliche 98 – staatliche 30 Erwerbswirtschaft, Begriff 48 m. Fn. 111 externe Einflußsicherung 58, 63 ff. Fiskustheorie 87, Fn. 325 Flucht in das Privatrecht 76 m. Fn. 262, 78, 81
Sachwortverzeichnis Gebot rationaler Organisation 227, Fn. 45 Gemeinwohlverwirklichung 49, 84 gemischtwirtschaftliche Gesellschaft – als staatlicher Zuständigkeitskomplex 112 – Begriff 24 – und reale Entscheidungseinheit 31 gemischtwirtschaftliches Unternehmen – Begriff 23 – eigene Begriffsdefinition 114, 115 gesellschaftliche Handlungsrationalität Siehe privatrechtliche Handlungsrationalität gesetzesdirigierte Vertragsgestaltung 199 m. Fn. 482 Ingerenzpflicht – Begriff 77 f. – kommunalrechtliche 209 f. Instrumentalisierung Siehe Beherrschung kommunaler Erfüllungsgehilfe – Begriff 27, Fn. 18 – und einzelvertragliche Abreden 171 f., 173 ff. – zivilrechtlicher Begriff 175 m. Fn. 369 Kommunalunternehmen 65, Fn. 200 Kontrolle 53 ff. Kooperation 24, Fn. 7; 162 ff., 164 Kooperationsmodell 130, 168 Kooperationsvertrag 195 ff. Koordinierungsgremium 162 ff., 195 ff. Leistungsverwaltung, Begriff 48 m. Fn. 111, 84 m. Fn. 302 normativer Ansatz 98 ff. Organ, Begriff 101 m. Fn. 28 Organisation, Begriff 100 Organisationsermessen 237 Organismustheorie 102, Fn. 33 Person – Begriff 109
287
– Juristische Person 100 – natürliche Person 106 m. Fn. 57, 58 Prinzip der Eigenentsorgung 220 m. Fn. 21 Privatautonomie 71 ff. private und privatrechtliche Handlungsrationalität 123, 197 Privatisierung – Begriff 34, Fn. 33 – funktionale 168 f. m. Fn. 337 – Privatisierungsmotive 34, 60 m. Fn. 179, 180; 123 m. Fn. 128 Public Private Partnership, Begriff 168, Fn. 336 Rechtsbindungsanordnungen 141 ff., 191 Rechtsformansatz 68 ff. Rechtsträger – Begriff 100 – eines Unternehmens und Unternehmensträger 111 Relativität der Rechtsfähigkeit 112, 187 Relativität der Staatseigenschaft 109 ff. Sonderbindungen des Staates 24 m. Fn. 10 staatliche Regulierung gesellschaftlicher Selbstregulierung 193 m. Fn. 450 Staatsaufgabenlehre 86 m. Fn. 321 Steuerung Siehe Beherrschung Steuerungsinstrumente – aktienkonzernrechtliche 51 f. – des Staates 36 ff. – faktische 41, 59 ff. – gesellschaftsrechtliche 37 ff. – sonstige 53 ff. Transparenzrichtlinie 153 ff. m. Fn. 269 Unternehmensgegenstand – als Steuerungsinstrument 45 ff. – Auslegung 128 ff., 166 f. – Begriff 46 m. Fn. 94
288
Sachwortverzeichnis
Unternehmensinteresse 41, 89 Unternehmensträger Siehe Rechtsträger Unternehmenszweck 41, 48
Widmung Siehe auch Einrichtung Widmung, Begriff 188 Willenserklärung, staatliche 125
Verantwortung – Begriff 180 m. Fn. 390 – Erfüllungs- 207 f. – Folgen- 213 – Gewährleistungs- 208 ff. – Sicherstellungs- 208 ff. – Verantwortungsstufen 207 ff. Vertretung – Begriff 176, Fn. 372; 177 m. Fn. 374 – gesetzliche Vertretung 102 – organschaftliche 181 – zivilrechtliche Stellvertretung 102, 175, 177 ff. Verursacherprinzip 221, Fn. 24 Verwaltung in Privatrechtsform 76 Verwaltungshelfer Siehe Verwaltungshilfe Verwaltungshilfe – Abgrenzung zur Beleihung 75, Fn. 257 – und einzelvertragliche Abreden 171 – und funktionale Privatisierung 169 Verwaltungsprivatrecht 48, Fn. 111 Verwaltungsträger, Begriff 100 Verwaltungsvertrag, Begriff 116 m. Fn. 93
Zuordnung, Begriff 177 m. Fn. 375 Zurechnung – dienstrechtliche 105 ff. – Drittzurechnung 178 m. Fn. 377 – haftungsrechtliche 187 – organisationsrechtliche 102 – organschaftliche 102, 105 ff., 177 ff. – Unterscheidung von anderen Vertretungsformen 102, 176 ff. Zurechnungsendsubjekt 100 Zuständigkeit – Begriff 99 – Eigen- 99 ff. – Entscheidungs- 202 ff. – Organ- 101 – Sach- 206 – sachmaterienbezogene 202, 206 ff. – Wahrnehmungs- 101 f. Zuständigkeitskomplex 98 m. Fn. 11 Zuständigkeitsrechtssatz 98 Zuweisungsgehalt von Rechtsformen 73 ff. Zweck – Begriff 83, Fn. 295 – öffentlicher 48, 56, 240 – optimaler Aufgabenerledigung 227 ff., 236 f. – Zweckstaffelung 237
Weisungsrechte – als Steuerungsinstrument 44 – einzelvertraglich vereinbarte 58, 160 ff.
![Die Inhaltskontrolle unternehmerischer Entscheidungen von Verbandsorganen im Spannungsfeld zwischen Ermessensfreiheit und Gesetzesbindung: Eine rechtsvergleichende Untersuchung am Beispiel des deutschen und französischen Kapitalgesellschaftsrechts [1 ed.]
9783428519941, 9783428119943](https://dokumen.pub/img/200x200/die-inhaltskontrolle-unternehmerischer-entscheidungen-von-verbandsorganen-im-spannungsfeld-zwischen-ermessensfreiheit-und-gesetzesbindung-eine-rechtsvergleichende-untersuchung-am-beispiel-des-deutschen-und-franzsischen-kapitalgesellschaftsrechts-1nbsped-9783428519941-9783428119943.jpg)
![Amtsrecht und Beamtenrecht: Eine Untersuchung über normative Strukturen des staatlichen Innenbereichs [1 ed.]
9783428440245, 9783428040247](https://dokumen.pub/img/200x200/amtsrecht-und-beamtenrecht-eine-untersuchung-ber-normative-strukturen-des-staatlichen-innenbereichs-1nbsped-9783428440245-9783428040247.jpg)
![Diversifizierte Unternehmen: Eine Untersuchung über wettbewerbliche Wirkungen, Ursachen und Ausmaß der Diversifizierung [1 ed.]
9783428436873, 9783428036875](https://dokumen.pub/img/200x200/diversifizierte-unternehmen-eine-untersuchung-ber-wettbewerbliche-wirkungen-ursachen-und-ausma-der-diversifizierung-1nbsped-9783428436873-9783428036875.jpg)
![Gefahrenabwehr durch Private: Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zu den Grenzen der Übertragung von Aufgaben der Gefahrenabwehr auf Private und der staatlichen Zulassung privater Gefahrenabwehr [1 ed.]
9783428461912, 9783428061914](https://dokumen.pub/img/200x200/gefahrenabwehr-durch-private-eine-verfassungsrechtliche-untersuchung-zu-den-grenzen-der-bertragung-von-aufgaben-der-gefahrenabwehr-auf-private-und-der-staatlichen-zulassung-privater-gefahrenabwehr-1nbsped-9783428461912-9783428061914.jpg)
![Der Kreditvertrag in der Umwandlung: Eine Untersuchung der umwandlungsrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten kreditnehmender Unternehmen sowie des Gläubigerschutzsystems für Kreditinstitute [1 ed.]
9783428523160, 9783428123162](https://dokumen.pub/img/200x200/der-kreditvertrag-in-der-umwandlung-eine-untersuchung-der-umwandlungsrechtlichen-gestaltungsmglichkeiten-kreditnehmender-unternehmen-sowie-des-glubigerschutzsystems-fr-kreditinstitute-1nbsped-9783428523160-9783428123162.jpg)
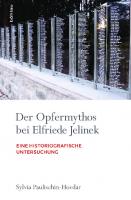




![Staatseigenschaft gemischtwirtschaftlicher Unternehmen: Eine Untersuchung der staatlichen Qualität unternehmerischer Entscheidungen [1 ed.]
9783428522149, 9783428122141](https://dokumen.pub/img/200x200/staatseigenschaft-gemischtwirtschaftlicher-unternehmen-eine-untersuchung-der-staatlichen-qualitt-unternehmerischer-entscheidungen-1nbsped-9783428522149-9783428122141.jpg)