Kleiner Mann in großen Zeiten: Reportagen eines Lebens [Reprint 2014 ed.] 9783110971996, 9783598213281
George Wronkow worked as a journalist with the Mosse publishing house in Berlin in the 1920s and 30s; in the Spring of 1
167 52 8MB
German Pages 349 [352] Year 2008
Polecaj historie
Table of contents :
Vorwort
Kleiner Mann in großen Zeiten. Reportagen eines Lebens
Exposé
Einer neuen Generation gewidmet
Erste große Zeit. Der Friedenskaiser
Zweite große Zeit. „Ich führe Euch herrlichen Zeiten entgegen.“
Dritte große Zeit. „Erwürgt die junge Freiheit nicht!“
Vierte große Zeit. „Meine Herren, seien Sie unbesorgt. Die Notenmaschinen laufen wieder in drei Schichten Tag und Nacht“
Fünfte große Zeit. „Denn einmal werden wir ja doch wieder zur Ruhe kommen müssen“
Sechste große Zeit. „Wenn ich das Wort Kultur höre, möchte ich meinen Revolver entsichern“
Siebente große Zeit. „’s ist leider Krieg - und ich begehre/ Nicht schuld daran zu sein!“
50 Jahre Journalist - Lebenslauf
George Wronkow und die WAZ
„Reportagen eines Lebens“ oder „Erinnerungen“? Ein Vergleich der Autobiographien zweier deutschjüdischer Berliner Journalisten: George Wronkow und Moritz Goldstein
Literaturverzeichnis
Bild- und Textnachweise
Text des Wahlplakats der Deutschen Demokratischen Partei (S. 106)
Text des Briefes von George Wronkow an seinen Bruder Ludwig (S. 246)
Namensregister
Zeitungsregister
Redaktionelle Hinweise
Citation preview
Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung
Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung Band 63 Herausgegeben von Hans Bohrmann und Gabriele Toepser-Ziegert Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund
George Wronkow
Kleiner Mann in großen Zeiten Reportagen eines Lebens
Bearbeitet von Karen Peter mit Beiträgen von Siegfried Maruhn und Irmtraud Ubbens
K G Saur München 2008
Mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Presse-Haus NRZ
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationaibibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind Im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Gedruckt auf säurefreiem Papier © 2008 by Κ. G Saur Verlag, München Ein Imprint der Walter de Gruyter GmbH & Co. KG Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten / All Rights Strictly Reserved Diese Werk - oder Teile daraus darf nicht vervielfältigt, in Datenbanken gespeichert oder in irgendeiner Form - elektronisch, photomechanisch, auf Tonträger oder sonstwie - übertragen werden ohne die schriftliche Genehmigung des Verlags. Druck/Binden: Strauss GmbH, Mörlenbach ISBN 979-3-598-21328-1
Inhalt
7
Gabriele Toepser-Ziegert Vorwort
11
George Wronkoiv Kleiner Mann in großen Zeiten. Reportagen eines Lebens
13
Exposé
15
Einer neuen Generation gewidmet
17
Erste große Zeit Der Friedenskaiser
29
Zweite große Zeit „Ich führe Euch herrlichen Zeiten entgegen."
51
Dritte große Zeit „Erwürgt die junge Freiheit nicht!"
69
Vierte große Zeit „Meine Herren, seien Sie unbesorgt. Die Notenmaschinen laufen wieder in drei Schichten Tag und Nacht."
85
Fünfte große Zeit „Denn einmal werden wir ja doch wieder zur Ruhe kommen müssen."
133
Sechste große Zeit „Wenn ich das Wort Kultur höre, möchte ich meinen Revolver entsichern."
247
Siebente große Zeit „'s ist leider Krieg - und ich begehre/ Nicht schuld daran zu sein!"
307
George Wronkow 50 Jahre Journalist - Lebenslauf
309
Siegfried Maruhn George Wronkow und die WAZ
313
Irmtraud Ubbens „Reportagen eines Lebens" oder „Erinnerungen"? Ein Vergleich der Autobiographien zweier deutschjüdischer Berliner Journalisten: George Wronkow und Moritz Goldstein
335
Literaturverzeichnis
338
Bild- und Textnachweise
340
Text des Wahlplakats der Deutschen Demokratischen Partei (S. 106)
341
Text des Briefes von George Wronkow an seinen Bruder Ludwig (S. 246)
343
Namensregister
348
Zeitungsregister
349
Redaktionelle Hinweise
Vorwort
„Immerzu Abschied nehmen - auch das ist ein Symbol der Emigration."1 Mit diesen Worten hätte George Wronkow seine Autobiographie ebenfalls überschreiben können, aber er nannte seine Reportagen eines Lebens letztlich Kleiner Mann in Großen Zeiten, vermutlich in Anlehnung an den Roman von Hans Fallada aus dem Jahr 1932 {Kleiner Mann - was nun?). Den Gedanken, eine Autobiographie zu verfassen, trug der Journalist schon länger mit sich herum, im Englischen wollte er sie The Learned Emigrant nennen.2 Beendet hat er sie im Jahre 1974, in dem Jahr, in dem er sein 50-jähriges Berufsjubiläum beging, das er auf einer Deutschlandreise feierte. Der mittlerweile 69-jährige Amerika-Korrespondent europäischer Zeitungen und Rundfunksender schrieb aus der zeitlichen Distanz von 33 Jahren über seine Emigration in die USA im Sommer 1941 und die davorliegenden Epochen seiner Kindheit, Jugend und der ersten journalistischen Erfahrungen. Es wurde eine Bilanz der „Abenteuer des kleinen Mannes", die im Frühjahr 1941 abbricht, als er sich nach der glücklichen Landung in New York nicht mehr als „unmittelbares Objekt großer Zeiten"3 sieht. Als neunjähriger Junge erlebte Wronkow den Ausbruch des Ersten Weltkrieges in Berlin und die damit verbundene Kriegsbe' George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten. Reportagen eines Lebens, in diesem Band S. 1 1 - 3 0 5 , hier S. 233. Walter O'Hearn, The Story of the Learned Immigrant, in: The Montreal Star v. 13.07.1963 (Lit.verz. Nr. 21). 2
3
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 14.
7
geisterung der Bevölkerung. Er schildert den Kriegsverlauf anhand der schulfreien Tage, mit der jeder militärische Sieg Deutschlands gewürdigt wurde. Anschaulich beschreibt er seine Kriegskindheit, die geprägt wird durch Mangelernährung, Hamstern in der Provinz, Tauschhandel von Stahl-Pfeil gegen Granatsplitter unter den Schulkameraden. Die Wirren der Novemberrevolution beeindrucken den nunmehr 14-Jährigen, während die Schulen geschlossen sind, auf der Straße und aus der Sicht des Erwachsenen reflektiert er die Informationsmittel und -wege, die der irritierten Bevölkerung zur Verfügung standen. Der junge Wronkow tritt eine kaufmännische Lehre im Eisenbahnbau an und bald zwingen Inflation und Krankheit der Mutter (der Vater war früh verstorben) den Lehrling, Nebentätigkeiten aufzunehmen, um der kleinen Familie den Lebensunterhalt zu sichern. Auf verschlungenen Wegen gerät er schließlich mit Hilfe des 5 Jahre älteren Bruders Ludwig, der als Pressezeichner tätig ist, ins Pressegeschäft und verkauft seine erste Reportage als 19-Jähriger. Er erlebt das Auftauchen der Nationalsozialisten im Straßenbild und der Gesellschaft Berlins und die gewalttätig geführten Wahlkämpfe mit Saal- und Straßenschlachten. Nach dem 30. Januar 1933 zweifelt die Verlagsleitung des Mosse-Verlags, bei dem er arbeitet, seine „Zuverlässigkeit zur neuen Staatsform" an und entlässt ihn.4 Hellsichtig sucht Wronkow nach Fluchtmöglichkeiten über die Grüne Grenze und schließlich gelangt er mit einem „Kraft-durch-Freude"-Ausflugsdampfer nach Kopenhagen. Mit kleinen schriftstellerischen Gelegenheitsarbeiten hält er sich dort finanziell über Wasser, bevor er im September 1933, auch wieder auf dem Seeweg, nach Frankreich und Paris gelangt. Georg Bernhard, der emigrierte ehemalige Chefredakteur der Vossischen Zeitung, hatte mit Freunden das Pariser Tageblatt gegründet und vermittelt Wronkow eine Beschäftigung. Auch beim berühmten Straßburger Sender Radio Strasbourg kommt er zum Einsatz, verfasst er anti-nationalsoziali4
Ebd., S. 136.
stische Propagandasendungen und beginnt eine neue Karriere als Rundfunkjournalist, der er letztendlich in seiner neuen Heimat New York hauptberuflich bleiben wird. Der Reportagestil von George Wronkow ist kurzweilig, humorvoll und amüsant. Der Leser kann leicht die Entwicklung vom kleinen Jungen in der Kaiserzeit zum erwachsenen ausgegrenzten jüdischen Emigranten nachvollziehen, und da Wronkow weiß, dass seine Lebensgeschichte gut ausgegangen ist, kann er den heiter-ironischen Ton trotz aller widrigen Lebensumstände beibehalten. Der Nachlass von George Wronkow kam nach seinem Tod 1989 durch die Vermittlung des Chefredakteurs des Auflaus, Will Schaber, ins Institut für Zeitungsforschung der Stadt Dortmund, in dem zahlreiche Nachlässe emigrierter Journalisten aufbewahrt werden. Unter den Sendemanuskripten, Zeitungsartikeln und anderen Dokumenten seines Lebens in den Vereinigten Staaten befand sich auch eine Kopie der maschinenschriftlich verfassten Autobiographie, das Original liegt in der Bibliothek der State University of New York at Albany/Emigré Collection. Die Herausgeber der Schriftenreihe Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung haben sich entschlossen, das Manuskript, angereichert durch einige Erläuterungen und Illustrationen, einer breiteren Leserschaft zugänglich zu machen, da sie der Überzeugung sind, dass diese Art der zeitgeschichtlichen Darstellung den Zugang zu den Ereignissen und Lebensumständen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts erleichtern und vertiefen kann. George Wronkow hat auch in schweren Zeiten seinen Humor behalten und wurde, wie die schriftlichen Zeugnisse in seinem Nachlass zeigen, nicht müde, diese gelassene Einstellung gegenüber den Anmutungen eines unfreiwilligen und beschwerlichen Lebensweges zu empfehlen. Ergänzt wird die Autobiographie durch Texte von Siegfried Maruhn, der sich mit dem Journalisten und Kollegen Wronkow befasst, und von Irmtraud Ubbens, die seine Erzählweise als Autobiograph im Vergleich mit den Erinnerungen des ebenfalls emi9
grierten Publizisten Moritz Goldstein5 beleuchtet. Beiden Autoren danke ich für ihre Beiträge, die das Bild von George Wronkow für die Nachwelt abrunden und vervollständigen. Besonderer Dank gebührt Frau Heike Geminiani, die die handschriftlich korrigierte Manuskriptfassung, die auf einer amerikanischen Schreibmaschine gefertigt wurde, elektronisch erfasst und übertragen hat. Frau Karen Peter hat mit großem Sachverstand, bewährter Akribie und unendlicher Ausdauer die redaktionelle Bearbeitung bis hin zum Layout durchgeführt. Frau Sigrid Huwer danke ich für die umsichtige und perfekte Digitalisierung zahlreicher Illustrationen. Finanziell wurde die Bearbeitung ermöglicht durch die Stiftung Pressehaus N R Z (Essen), wofür ich insbesondere Herrn Heinrich Meyer dankbar bin. Mit diesem 63. Band der Schriftenreihe greifen wir wieder ein historisches Thema auf, das zugleich einen Sammelschwerpunkt des Instituts für Zeitungsforschung über Jahrzehnte gebildet hat. Damit sollen die dunklen Kapitel deutscher Geschichte in Erinnerung behalten werden in einer Zeit, in der sich die Migrationsthematik zusehends verschärft. Schließlich sind wir alle Ausländer. Dortmund, im Dezember 2007
Gabriele Toepser-Ziegert
5
Moritz Goldstein, dessen Nachlass ebenfalls im Institut f ü r Zeitungsforschung liegt, schrieb seine Erinnerungen zwar im ähnlichen Alter (67 Jahre), aber aus der zeitlichen Distanz von nur 14 Jahren und mit einer gänzlich anderen, bitteren Bilanz.
10
George Wronkow
Kleiner Mann in großen Zeiten Reportagen eines Lebens
George Wronkow 1953
Exposé
Episoden aus stürmischem Weltgeschehen, widerwillig überlebt von einem kleinen Mann, der zwischen Kriegen, die er stets verlor, Revolutionen, Inflationen, Depressionen, Tausendjährigen Reichen, Emigrationen und anderen Katastrophen als Stehaufmännchen ohne Orden und Ehrenzeichen, ohne Staatsangehörigkeit aber mit heilen Knochen immer wieder davonkam. Als Journalist berichtet er in Reportageform über die Fülle der großen Zeiten, die er durchlebte, und wie es ihm gelang, aus grauen Wolken immer wieder ein Stück Blau herauszupolken. Die „Erste große Zeit: Der Friedenskaiser" beginnt im großen Jahr 1905, dem Geburtsjahr des kleinen Mannes. Sie ist das Vorwort, Kindheitserinnerungen an die „gute alte Zeit". Die „Zweite große Zeit: Ich werde Euch herrlichen Zeiten entgegenführen" schildert Episoden von der Heimatfront des Ersten Weltkrieges mit den Augen eines von der Sexta zur Tertia aufrückenden Gymnasiasten, der sich wundert, dass es allmählich immer weniger Siege und schulfrei gibt, dafür aber immer größeren Hunger. Die „Dritte große Zeit: Erwürgt die junge Freiheit nicht" wird von einem sehr jungen Revolutionär erlebt, der als Dachschütze den einzigen Schuss seines Lebens abgibt und dafür eine Tracht Prügel erntet. Die „Vierte große Zeit" unter dem Motto des Reichsbankpräsidenten Havenstein: „Meine Herren, seien Sie beruhigt, die Notenmaschinen laufen wieder" zeigt den kleinen Mann in Lehre und erster Liebe in wilder Inflation, die er durch das Wunder ererbter 13 Dollar siegreich überlebt. 13
Die „Fünfte große Zeit: Denn einmal werden wir ja doch wieder zur Ruhe kommen müssen" hat die kurze Blüte und den raschen Niedergang der Weimarer Republik zum Hintergrund. Als Journalist erlebt der kleine Mann den kurzen Traum und das nüchterne Erwachen im Zeitungsviertel Berlins. Die „Sechste große Zeit: Wenn ich das Wort Kultur höre ..." macht den kleinen Mann zum Staatsfeind, zum politischen Flüchtling, zum Staatenlosen; mit dem „Kraft durch Freude"-Dampfer Odin geht es zum Wochenendausflug nach Kopenhagen, ein Ausflug, der Jahrzehnte dauern wird. Schließlich wird Frankreich die neue Heimat. Er wird Redakteur am historisch gewordenen „Sender Strasbourg", dem ersten Sender, der in deutscher Sprache der Nazipropaganda entgegentritt. Dieser ungleiche Kampf im Aether ist Thema eines wichtigen Kapitels. Eine von der Gestapo gestörte Liebe findet vor einem Pariser Standesamt ihr Happy End. Die „Siebente große Zeit: 's ist leider Krieg, und ich begehre nicht schuld daran zu sein" beginnt mit der Wortschlacht des Sitzkrieges und endet mit der Emigration im Laderaum eines spanischen Schiffes nach Amerika. Dazwischen liegt eine Odyssee als „freiwilliger Ausländer" - Volontaire Étranger — und nach dem Zusammenbruch Wanderung als „Toter" durch die Weinfelder Südfrankreichs, durch Lager und den Maquis Marseilles1, durch das Spanien des siegreichen Franco nach Lissabon. Mit der Ankunft in einem noch Vorkriegs-Amerika im Frühjahr 1941 enden die Abenteuer des kleinen Mannes. Die großen Zeiten rissen zwar nicht ab, aber der Einwanderer war nicht mehr unmittelbares Objekt dieser großen Zeiten, sondern konnte sie als Normalbürger ungestört betrachten.
Maquis bezeichnet eine Buschwald-Landschaft in den Mittelmeerländern; da ein Teil der Résistance vom Maquis Marseille aus operierte, wurde Maquis auch als Synonym für den Widerstand verwendet. 1
14
Einer neuen Generation gewidmet Große Zeiten mögen in Geschichtsbüchern nachgelesen werden. Doch der Mensch, der sie durchlebt, sieht sie nicht als Sternstunden der Menschheit, sondern aus der Perspektive seines eigenen profanen Bauchnabels, den er für den Nabel der Welt hält. Nach fünfzig Jahren Journalismus blicke ich auf meinen Nabel, den Nabel eines kleinen Mannes in großen Zeiten. Es sind Reportagen wahrer Geschehnisse, die Mitmenschen, die sie mit mir durchlebten, sind echt. Doch die Namen vieler unangenehmer Weggenossen sind fiktiv. Der Grund: So viele von ihnen, die sich meist sehr wichtig nahmen, liegen vergessen in ihren Gräbern. Es lohnt sich nicht, ihre Vergessenheit zu stören.
15
Der Friedenskaiser
Erste große
Geboren mit einem Silberlöffel im Munde 2 , der bald seinen Weg in die Pfandleihe fand, Vi zu flotten Trommeln und Trompeten der am Geburtshaus vorbei zum Tempelhofer Feld trabenden Gardeulanen mit ihren schwarz-weiß bewimpelten Lanzen. Dies wurde, wie meine Mutter oft versicherte, als ein gutes Omen für einen neugeborenen Preußen betrachtet. Jahre später überlegte ich mir, wie diese Ulanen die Lanzen mit den Wimpeln in Feindesbrüste stoßen könnten, bis mein vier Jahre älterer Bruder 3 erklärte: „Dummkopf, die Wimpel werden vorher abgeknöpft, damit sie sauber bleiben." •
I
2
Die Redensart, „mit einem silbernen Löffel im Mund geboren" zu sein, besagt, dass jemand mit Reichtum und Glück gesegnet ist.
3
Ludwig Wronkow (1900-1982), Pressezeichner.
17
Natürlich wusste ich im friedlichen Berlin noch nicht, wie groß die Zeit war, in die ich hineingeboren worden war. Ich war kein Wunderkind, sondern nur ein Kind wie alle anderen Kinder, mit dem - wie sich in späteren großen Zeiten herausstellte - recht beachtlichen Unterschied, dass man mich rituell beschnitten hatte. *
Doch die Geschichtsbücher melden die historische Größe der Zeit. Es war anno 1905: In Sankt Petersburg wurde scharf auf eine friedlich demonstrierende Menge vor dem Winterpalast geschossen, eine Revolution brach aus und wurde niedergemetzelt. Die Japaner versenkten die russische Flotte und der Zar Nikolaus II. verlor seinen Krieg. Später traf er sich mit Kaiser Wilhelm II. zur See vor Finnland zu einem Gipfeltreffen, auf dem die beiden gekrönten Vettern von Gottesgnaden sich gegenseitige Waffenhilfe versprachen. Es war, wie der weitere Geschichtsverlauf zeigt, kein sehr erfolgreiches Gipfeltreffen. Dann dampfte der flottenfreudige Deutsche Kaiser und König von Preußen per Kriegsschiff nach Tanger, um den deutschen Einfluss in Afrika zu stärken, und löste eine schwere Marokkokrise aus. Am anderen Ende des Schwarzen Kontinentes, in Deutsch-Südwestafrika, bemühten sich die kaiserlichen Kolonialtruppen, die Hereros auszurotten, was ihnen zum guten Teile gelang. Das Wettrüsten blühte zu Wasser und zu Lande, und dankbare Untertanen nannten Seine Majestät den Friedenskaiser. *
Von dieser großen Zeit wurde mir nichts an meiner Wiege gesungen. Wohlbehütet wuchs ich in gutbürgerlichem Hause auf. Neben Köchin und Dienstmädchen sorgten sich Kinderfräulein und liebende Eltern um zwei zukunftsversprechende Söhne. Alles war gut 18
und gediegen. Über dem Sofa wuchtete ein gewaltiger Kupferstich der Menzelschen Tafelrunde Friedrich des Großen. Der Alte Fritz stand auch in Bronze dem Kaiser Napoleon als Pendant gegenüber. Ein Bild des 99-Tage-Kaisers Friedrich III. galt als Symbol des liberalen Geistes. Als Zeichen der Kultur stand Goethes Alabastergipsbüste auf einem Piedestal. Ihm fehlte eine Alabasterlocke, die trotz vieler Klebeversuche stets herunterfiel. In Buntdruck hing die Schlacht von Königgrätz im Erker des Berliner Zimmers - zur Erinnerung an den Großvater, der als preußischer Feldwebel in die Kriege von 1864, 1866 und 1870/71 gezogen war. Seine breite Ordensschnalle wurde in einem Samtkasten aufbewahrt. Eine kleine Kopie des Moses von Michelangelo auf dem Bücherschrank sollte an die jüdische Tradition der Familie mahnen. Im Bücherschrank standen die Gesamtausgaben aller deutschen Klassiker in Prachtbänden gebunden. Mein Bruder stampfte mit umgebundenem Kindersäbel durch die Wohnung, schlug mit ihm auf den Küchenkacheln Funken und spielte den Hauptmann von Köpenick.
*
[1909] Nach dem frühen Tode des Vaters folgte der große Berliner Häuserkrach. Die Gutbürgerlichkeit verflüchtete schnell, und statt dreifacher Hausbesitzer wurden wir zahlungsunfähige Hypothekenschuldner mit unverkäuflichen Häusern. Der Preußische Adler flog ins Heim. Er klebte weiß auf blauem Grunde unter Tisch und Stuhl, hinter Sofa und Anrichte und versteckte sich unter dem Teppich; es war der blaue Vogel des Gerichtsvollziehers, der Kuckuck, der zum ständigen Gast wurde. Ich tauschte die runden blauen Adlermarken gegen Reklamemarken ein, bis mir dies meine Mutter strengstens verbot. Schließlich holten eines Tages kräftige Ziehmänner den ganzen Salon in seinem wohlgeschwungenen Jugendstil nebst Menzelschem Kupfer19
stich ab. Auch der Alabaster-Goethe wurde mitgenommen. Die abgebrochene Locke steckte der Gerichtsvollzieher sorgsam in die Tasche. Ich hatte niemals im Salon spielen dürfen. Jetzt gehörte uns Kindern das riesige, bis auf eine verstaubte künstliche Palme leere Zimmer, das noch immer ehrfürchtig Salon genannt wurde.
*
Aus der königlichen Hofschatulle wurde mir als Halbwaisen das halbe Schulgeld gezahlt. Phantasievoll malte ich mir auf der Vorschule des Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums in der Kochstraße diese goldene Schatulle aus, in die der gute Kaiser hineingriff, um die Hälfte meines Schulgeldes zu zahlen. Während der ganzen drei Jahre dieser Vorschulzeit saß der dicke von Platen in seinem Matrosenanzug mit stramm gezogenem Scheitel auf dem ersten Platz. „Warum ist denn der Platen immer Erster?", fragte ich einen Schulkameraden, „der kann doch auch nicht mehr als wir - und dauernd bekommt er Lobe." „Na weißt du denn nicht? Das ist doch der Sohn des Hofschatullenbewahrers des Kaisers. So hoher Adel ist natürlich immer Erster." Von Platen hat niemals mit mir gesprochen, er saß viel zu weit oben; aber meine Achtung vor ihm war grenzenlos, sein Vater bewahrte ja die Hälfte meines Schulgeldes. Und dann erfuhr ich mit großer Enttäuschung, dass die Hofschatulle nur ein Rechnungsamt mit vielen Beamten war und gar nicht eine goldene Büchse. Ich begann Zeitungsüberschriften zu buchstabieren: „ChingDynastie gestürzt: Revolution in China." [10. Okt. 1911] „Wo ist China? Was ist eigentlich eine Revolution?" Mein Onkel Otto, der zuweilen Vaterstelle vertrat, überlegte lange: „Revolution ist, wenn Bürger Barrikaden bauen und aufeinander schießen und versuchen, ihren Kaiser vom Thron zu
20
stürzen." Dann nach einer Weile: „Aber China ist weit weg im Fernen Osten. Um die Revolution brauchen wir uns nicht viel zu kümmern." „Gibt es auch Revolutionäre in Deutschland?" „Aber nein. Wir lieben doch alle unseren Kaiser Wilhelm. Selbst die Sozialdemokraten sind bei uns nicht so rot wie ihre Fahnen." In meinem ersten Schulatlas lag ein loses Blatt - eine neue Balkankarte mit neu eingezeichneten Grenzen nach den Balkankriegen von 1912 und 1913. Der Lehrer sagte: „Klebt die Karte hinten in den Atlas. Die Balkanländer werden erst in der nächsten Klasse behandelt — und bis dahin gibt's sicher schon wieder neue Grenzen." *
Dreifach stürzten die Ereignisse einer wahrhaft großen Zeit im strahlenden Frühsommer 1913 auf die Kaiserstadt ein: 25. Regierungsjubiläum unseres Friedenskaisers - glanzvolle Vermählung der Hohenzollern Prinzessin Viktoria Luise mit Prinz Ernst von Cumberland 4 - das hundertste Jubiläum der Befreiungskriege. Es gab so viel schulfrei, dass ein Achtjähriger einfach Patriot werden musste. [März 1913] In Berlin waren die Straßen mit Guirlanden überzogen, die sich unter großen Königs- und Kaiserkronen aus Pappmaché zu Baldachinen wölbten. Schwarz-weiß-rote und schwarz-weiße Fähnchen kreuzten sich an den Laternenmasten. Am Abend flackerten Kerzen in den Fenstern. Massen spazierten im Sonntagsanzug und bestaunten die Schaufenster, die sich in patriotischen Auslagen und Kaiserbüsten überboten. Unser Kaufmann an der Ecke hatte aus getrockneten Pflaumen eine Silhouette des Jubilars auf ebenfalls getrockneten Apfelringen geschaf-
4
Ernst August III. Christian Georg von Hannover, Prinz von Großbritannien und Irland, Duke of Cumberland, ab 1913 Herzog von Braunschweig und Lüneburg
21
fen und verschenkte schwarz-weiß-rote Bonbons an die Kinder seiner Kunden. Unter den Linden ballte sich die Menge vor dem Fenster des Hofmalers Fischer. Auch ich konnte mich nicht losreißen: Hier prangte ein überlebensgroßes Gemälde Seiner Majestät in der weißen Uniform der Gardekürassiere vor einer in Silber gepanzerten hochbusigen Germania unter einer knorrigen Eiche, deren Wurzeln aus echtem Eichenholz geschnitzt aus dem Bilde heraussprangen und einen goldenen mit Reichsadler geschmückten Schild umklammerten. Über diese dreidimensionale Hohenzollernkunst schrieb ich einen begeisterten Aufsatz, der mit einem „Sehr gut" bewertet wurde. [Mai 1913] Zur Prinzessinnenhochzeit kamen König George V. von England und Zar Nikolaus II. von Russland nach Berlin. Als Vettern Wilhelms II. gehörten sie zur Familie. Durch die Beine eines Schutzmannspferdes sah ich Kaiser, König und Zaren. Vor dem Zeughaus standen offene Autos, Standarten flatterten von den Kühlern. Die Monarchen schritten in prächtigen Uniformen vorüber, die Wache präsentierte mit Trommelwirbel, Adjutanten halfen ihnen ins Auto, und von Gardekürassieren umringt gings unter melodiösem Tatü T a t a t a - „für unser Geld" sangen die Berliner - in Richtung Schloss davon. Soldaten standen Schulter an Schulter, das erste Glied strammgestanden den Ehrengästen zugewandt; das zweite Glied in völliger Kehrtwendung mit aufgepflanztem Bajonett das jubelnde Volk am Straßenrande scharf beäugend. „Warum stehen die denn verkehrt herum?", fragte ich den neben mir stehenden Onkel Otto. „Ja weißt du", antwortete er zögernd, „viele Russen haben ihren Zaren nicht so gerne wie wir unsern Kaiser. Da ist es schon besser aufzupassen, dass nicht so ein Anarchist eine Bombe wirft. Und da passen die Soldaten eben auf." „Was ist ein Anarchist?" „Das ist eben ein Mann, der Bomben wirft."
22
*
Kriegsveteranen von anno 70/71 in schwarzen Gehröcken marschierten mit klimpernden Ordensschnallen, ihre Stöcke wie Gewehre über den Schultern, zur mit frischem Gold angestrichenen Viktoria und dem Ehrenmal für die Befreiungskriege auf den Kreuzberg, vorneweg eine Kompanie Gardeinfanterie in den Uniformen des Landsturms von 1813. Wir hatten schulfrei. Zwei weitere Stunden schulfrei gab es für den Zeppelinbesuch, als das Luftschiff mit Wimpeln und der Kriegsflagge geschmückt über den Schlossplatz kreuzte und die kaiserliche Familie ihm vom Balkon zuwinkte. In der Fasanenstraße wurde die neue Hauptsynagoge eingeweiht. Sie war mit Kadiner Kacheln aus den Hohenzollern Werkstätten - einem königlichen Privatunternehmen - geschmückt, und der Kaiser kam zur Einweihung. Das war eine Sensation für die Berliner Juden und blieb lange das beherrschende Gesprächsthema meiner Großmutter. „Schließlich sind sie ja meine Kunden", soll der Kaiser auf die Kacheln zeigend gesagt haben. Bei der feierlichen Einsegnung hat er seinen Helm aufbehalten. Die Pickelhaube ragte aus einem Meer von Zylinderhüten. „Der Kaiser weiß, was sich schickt", verkündete die Großmutter stolz, „der ist kein Antisemit". 5 In der Kristallnacht einer anderen großen Zeit ging dieser Tempel in Flammen auf. Eine Säule mit einer einzigen geretteten Kadiner Kachel zeugt heute noch von vergangener Pracht. 6 Eingeweiht wurde die Synagoge am 26. Aug. 1912; Kaiser Wilhelm II. wurde dabei von seinem Generaladjutanten Generaloberst v. Kessel vertreten und besuchte selber die Synagoge am 31. Okt. 1912, wobei er dem Trausaal, der mit Kacheln aus seiner Majolika-Werkstatt in Kadinen (heute Kadyny) ausgeschmückt werden sollte, ein besonderes Interesse entgegenbrachte. 5
Aus Bestandteilen der alten Synagoge wurde eine Gedenksäule errichtet, die noch heute vor der Fassade des Gemeindehauses steht. 6
23
Der schönste Tag des schönen Jahres war die Kaiserparade am Sedantage [2. Sept. 1913] vom Tempelhofer Feld zum Schloss. Wir waren von unserem Turnplatz in der Hasenheide geschlossen zur Belle-Alliance-Straße 7 marschiert. Der Primus der Primaner mit der Schulstandarte, dem Preußenadler, an der Spitze, dann die Schulkapelle und dahinter wir Vorschüler als erste Kolonne. Lange standen wir in Front des Kaufhauses Jandorf und warteten erwartungsvoll. Ich fühlte meine fünf Pfennig wöchentliches Taschengeld in meiner Tasche und überlegte mir, ob ich mir zur Feier des Tages für diesen Sechser8 eine Eiswaffel, Bonbons, einen Rollmops oder Kuchenkrümel spendieren sollte. Kuchenkrümel schien der beste Kauf, da gab's am meisten. Eine sich näherwälzende Welle von Begeisterungslärm ließ mich dieses Problem vergessen. Dann übertönte Militärmusik den Beifallssturm. Zunächst kam eine Gruppe berittener Schutzleute, dann eine Reihe rundbäuchiger, zweifellos dienstältester Schutzleute zu Fuß, mit langen schleppenden Säbeln, alle geschmückt mit dem Apfelsinenorden. So genannt, weil die bronzene Gedenkmünze mit dem Bildnis Wilhelms I. so groß wie eine Apfelsine schien. Ein achtbarer Zwischenraum — unser Klassenlehrer hebt die Hand, aus voller Kehle schreien wir „Hurra, Hurra, Hurra". Der Kaiser trabt auf weißem Ross, in der blitzenden weißen Uniform seiner Leibkürassiere, mit silbernem Brustschild und goldenem preußischen Adler auf silbernem Helm auf dem rechten Flügel seiner neben ihm reitenden fünf Söhne, gefolgt von den buntuniformierten Bundesfürsten der deutschen Staaten an der Spitze seiner Garde leutselig an uns vorbei. Und dahinter paradiert die gesamte Berliner Garnison. Es war ein begeisterndes Schauspiel. Aber noch ein anderes Bild prägte sich mir ein. Unmittelbar vor dem kaiserlichen Schimmel schritten würdevoll zwei Straßenkehrer in weißer Extrauniform. 7
Seit 1929 Stresemannstraße.
8
Fünf-Pfennig-Stück.
24
Der eine schob einen grünglänzenden Schubkarren, der andere schüttete mit großer Schaufel und weit ausholender Armbewegung frischen Kies aus diesem Karren vor die Hufe des Rosses seiner Majestät. Mir schienen diese beiden Männer wahre Paladine zu sein, Männer, die dem Thron am nächsten standen - und damals beschloss ich, Straßenkehrer zu werden.
*
Onkel Zoll war eine Sagenfigur. Ein Großonkel, der als junger Mann wegen böser Streiche von der Familie nach Amerika abgeschoben worden und jetzt als angeblich reicher Onkel aus Amerika in die alte Heimat und verwitwet in den Schoss der liebenden Familie zurückgekehrt war. Ich sah ihn bei seltenen großen Familienfestlichkeiten. Eines Tages wollte er verreisen und ich wurde bestimmt, ihm beim KofFertragen zu helfen. Doch der Onkel machte es mir leicht, er winkte ein Automobil, das an der Ecke stand, herbei, wir verluden die Koffer und ich fuhr zum ersten Male in meinem Leben mit einem TöfF-TöfF. Während der Fahrt schaute ich erschreckt auf die Taxameteruhr, die eifrig um je zehn Pfennig weiterhüpfte und bei der Ankunft am Bahnhof ein Vermögen anzeigte. Onkel Zoll stieg aus, zahlte und gab mir einen blanken Jubiläumstaler mit dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal. Mit einem Schlage war ich ein Autofahrer und ein Talereigentümer - ein Doppelwunder, das für viele Jahre einmalig blieb. Den Taler musste ich meiner Mutter leihen, die damit die lange überfälligen Schulden beim Kaufmann bezahlte. Onkel Zoll war wahrlich der reiche Onkel aus Amerika.
*
25
An Sommersonntagen ging die Familie in den Zoo. Die Karawane setzte sich von Großmutters Wohnung aus am Nachmittag in Bewegung, doch wir kamen nie zeitig genug zur Fütterung der Raubtiere. Großmutter präsidierte auf der Kaffeehausterrasse und ließ die Promenade der Lästerallee vor dem Musikpavillon an sich vorüberziehen. „Lästerallee" wohl, weil die auf den Terrassen Sitzenden als ihr großes Vergnügen über die vorbeiwandernden Pärchen lästerten. Für uns Kinder wurde je eine halbe Portion Eis bestellt. Mein Traum, einmal eine ganze Portion Eis vor mir zu sehen, ist niemals in Erfüllung gegangen. Die Gardejägerkapelle in knallgrüner Uniform spielte. Sie hatte einen besonderen Akt auf ihrem Programm: Das Jägerlied mit Echo. Ein Trompeter marschierte, gefolgt von einer Kinderschar, rund um den See und blies vom anderen Ufer ein Echo über das Wasser. Erwartungsvoll stand ich an diesem Sonntag, den 28. Juni 1914 vor dem Pavillon, um mit meinem Trompeter um den See zu marschieren. Plötzlich bricht die Kapelle abrupt ab. Die Promenierenden bleiben erstaunt stehen. Der Kapellmeister tritt vor, er erhebt seinen Taktstock und räuspert sich: „Der Österreich-ungarische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand, und seine Gattin sind heute in Sarajewo ermordet worden." Ein Augenblick völliger Stille. Schon gehen Extrablätter von Hand zu Hand, Menschen stehen in Gruppen zusammen, ich sehe alle diese Menschen, die in ihrem Schock nicht recht wissen, was tun. Die Jäger packen ihre Instrumente ein und marschieren ab. Am Familientisch herrscht Schweigen. Dann schüttelt die Großmutter den Kopf: „Wie schrecklich für den armen, alten Franz Joseph - erst seine Gattin Opfer eines Attentates, dann der Selbstmord von Rudolf und der große Skandal, und jetzt wird der Franz Ferdinand erschossen." Ich weiß nicht recht, wer eigentlich der Franz Ferdinand sein mochte. Uber die Hohenzollern haben wir schon viel gelernt, aber die Habsburger haben wir noch nicht in der Schule gehabt. „Ein 26
Erzherzog in Österreich ist das Gleiche wie bei uns der Kronprinz", belehrt mich mein Bruder. In der Familie wurde das Attentat vor allem als eine persönliche Tragödie des Hauses Habsburg empfunden. Zunächst schien überhaupt kaum ein deutscher Bürger trotz aller aufregender Zeitungsberichte zu ahnen, wie tief ihn in Kürze das Drama persönlich berühren würde. Interessanter als die große Politik schien ein Photo mit den Särgen der Ermordeten; der Sarg Franz Ferdinands hoch auf einem Katafalk aufgebahrt, doch der Sarg seiner Gattin stand eine Stufe tiefer, auf halber Höhe - Symbol der morganatischen Ehe. „Für die Sofie Chotek aus Prag ist das gut genug", erklärte ein Hofberichterstatter aus Wien, „man hat sie zwar zur Gräfin von Hohenberg 9 gemacht, aber sie war ja doch nur eine Bürgerliche". Ich fragte, ob die Sofie auch eine Stufe tiefer begraben werde als der Franz Ferdinand. „Die werden gar nicht begraben, die kommen in die Kapuzinergruft", belehrte mich mein Bruder. Auf dem Königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymnasium wehte der Preußenadler auf Halbmast. Der Geschichtslehrer unterbrach sein Pensum der griechischen Geschichte für einen Schnellkurs über das Haus Habsburg. Aber die großen Ferien waren nur noch Tage entfernt, und schnell vergaß ich das Weltgeschehen in einem Schrebergarten hinter der Hasenheide. Doch dann knallten die Zeitungsüberschriften:
„Ultimatum Österreich-Ungarns an Serbien" „Kaiser Wilhelm bekräftigt seine Bündnistreue" „Russland droht mit Mobilisation". Aber Onkel Otto schien es aus bester Quelle zu wissen: „Kaiser Wilhelm und der Zar werden es zu keinem Kriege kommen lassen. Beide wollen ja den Frieden." 9
Zunächst Fürstin, ab 1909 Herzogin von Hohenberg.
27
Drei Tage später endete meine erste große Zeit in meinem neunten Lebensjahr. Sie wurde in späteren großen Zeiten oft sehnsuchtsvoll die „gute alte Zeit" genannt.
28
Ich führe Euch herrlichen Zeiten entgegen."10 (Kaiser Wilhelm II.)
Zweite große •
Schlossplatz und Lustgarten sind ein schwarzes Meer singender, Hurra schreiender Menschen. V Die steifen Kragen der Männer schmelzen in der Sonne des heißen Augusttages. Die Domglocken läuten. Vom Schloss weht die Hohenzollernstandarte. Mutter und ich haben uns zum vergitterten Schlosseingang vorgedrängt, vor den Schilderhäusern stehen Wachen in neuer feldgrauer Uniform. 1. August 1914. Die Menge ruft: „Wir wollen unseren Kaiser sehen!" Ich rufe begeistert mit und starre auf den einzigen Balkon der riesigen Schlossfassade. Plötzlich öffnet sich die große Balkontür. Ein Husch der Erwartung liegt über der
I
10 „... zu Großem sind wir noch bestimmt, und herrlichen Tagen führe Ich euch noch entgegen." Wilhelm II. am 24. Februar 1892 beim Festmahl des Brandenburgischen Provinziallandtages; siehe Lit.verz. Nr. 22.
29
Menge - der Kaiser tritt heraus, in der Uniform der Gardejäger, gefolgt von Kaiserin Auguste Viktoria in violettem Kleide. Fanatischer Jubel bricht aus. Schwarz-weiß-rote Fähnchen, von Straßenhändlern schnell an den M a n n gebracht, schwingen über den Köpfen. Seine Majestät wartet, bis sich die Menge schließlich ausgeschrieen hat, dann schallen kaiserliche Worte über die Schlossfreiheit: „Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche." Markige Worte bis zum Höhepunkt des Finales: Der Kaiser reißt sein Schwert aus der Scheide, schwingt es über das Balkongitter: „Nicht eher werde ich dieses Schwert wieder in die Scheide stecken, bis der letzte Feind geschlagen am Boden liegt." Grenzenlose Begeisterung. Die Wacht am Rhein schallt über die Schlossfreiheit. Oben auf dem Balkon steckt der Kaiser die blanke Klinge wieder in die Scheide, reicht der Kaiserin galant den Arm, und beide treten durch die Balkontür ab. „Mutter", frage ich erstaunt, „der Kaiser hat doch gesagt, er wolle sein Schwert nicht eher in die Scheide stecken, bis der letzte Feind am Boden liegt - und nun hat er es doch gleich wieder eingesteckt". „Aber Junge, das hat unser Kaiser doch nur symbolisch gemeint, er kann doch nicht dauernd mit gezücktem Säbel herumlaufen." „Warum denn nicht — schließlich haben wir doch Krieg."
*
Wir Jungens stehen vor den Kasernen. Die Soldaten werfen vieles, was nicht zur neuen feldgrauen Uniform passt, aus den Fenstern: Achselklappen, Uniformknöpfe, blinkende Koppelschlösser; vor allem bunte Kalender mit dem lockenden Spruch „Reserve hat Ruh". Die Tore öffnen sich — das Regiment rückt ins Feld. Begeisterte Mädchen in weißen Sommerkleidern stecken den Soldaten
30
Blumen in die Gewehrläufe und marschieren Arm in Arm mit ihnen zum Bahnhof. Brave Bürger stehen Spalier, schwenken die Hüte und rufen aufmunternd: „Nach Paris - nach Paris." „Auf Wiedersehen zu Weihnachten", rufen mütterlich aussehende Frauen, und „Auf Wiedersehen", klingt es aus den Rängen zurück. Im letzten Glied marschiert ein kleiner Soldat, weit unter Gardemaß. Keine Blume schmückt seinen Gewehrlauf, kein Mädchen ist an seiner Seite. Ich laufe ihm nach und rufe: „Auf Wiedersehn." Lächelnd dreht er sich um: „Ja, uff Wiedasehn im Himmel, mein Kleener ..." *
Die großen Ferien sind vorüber, aber die Lehrer scheinen für uns Sextaner kaum Zeit zu haben, sie sind mit Notabiturien für die beiden Primaklassen vollbeschäftigt. „Lüttich gefallen!" [17. Aug. 1914] Extrablätter verkünden die Waffentat. Neugekaufte schwarz-weiß-rote Fahnen werden auf die Fenster gesteckt. Die Klassen marschieren in die Aula. Erste Siegesfeier, mit vaterländischer Ansprache des Direktors — der erste schulfreie Siegestag. Wir jagen die Friedrichstraße hinauf Unter die Linden, vielleicht können wir sogar wieder den Kaiser sehen; aber der scheint etwas anderes zu tun zu haben, er kann ja schließlich nicht jeden Tag auf den Balkon treten. Krieg ist etwas so aufregend Neues, kaum ein Bürger scheint es zu Hause auszuhalten, in der wogenden Masse steigert sich sein Patriotismus, und heute wird der erste Sieg gefeiert. So ist Berlins Prachtstraße mit sich gegenseitig begeisternden Menschen und jubelnder schulfreier Jugend gefüllt. Jeder Tag bringt einen neuen Sieg: „U 9 versenkt drei britische Kreuzer" - „Jeder Tritt ein Britt'!" Gerüchte füllen die Luft. 31
Postkarte 1914
An der Wilhelmstraßen-Ecke ruft ein aufgeregter Mann von der Kranzlerterrasse11 „Japan hat England den Krieg erklärt". Ein zufällig vorüberkommender japanischer Student - vielleicht ist es auch nur ein Chinese - wird von einer jubelnden Menge gepackt und in die Luft geworfen. Doch ehe er weiß, wie ihm geschieht, wird an der Friedrichstraße die unangenehme Wahrheit bekannt: „Japan hat Deutschland den Krieg erklärt." [23. Aug. 1914] Die Stimmung der Menge schlägt zur Wut um, sie sucht den kleinen Japaner zu lynchen, und nur das Machtwort eines Schutzmannes rettet ihn — er flüchtet, so schnell ihn seine Beine tragen: „Jeder Klaps ein Japs!" *
Die Primaner haben ihr Notabiturium gemacht. Der Direktor schüttelt in der Aula jedem die Hand: „Ihr seid als Kinder in dieses Gymnasium gekommen, das euch heute als Helden entlässt." Die Abiturienten sammeln sich auf dem Schulhof zum gemeinsamen Abmarsch, um sich freiwillig zu den Fahnen zu melden. Sie singen „Es braust ein Ruf wie Donnerhall". Wir Jüngeren blicken neidisch zu ihnen auf. Eigentlich schäme ich mich, dass ich noch nicht einmal zehn Jahre alt bin. Für mich Sextaner wird es noch viele Jahre dauern, bis ich ein Held werden kann. Von den Primanern bleibt ein schmächtiger Bursche mit dikken Brillengläsern zurück, er ist völlig wehrdienstunfähig. Doch etwas entfernt steht ein zweiter Primaner, kräftig und gesund, aber mit niedergeschlagenem Gesicht. Sein Bruder in meiner Klasse gesteht mir: „Vater hat ihm nicht erlaubt, sich freiwillig zu melden. Er sagt, Rudolf solle mal schön zu Hause bleiben, bis er aufgerufen wird. Die werden ihn schon holen, wenn sie ihn brauchen, der Krieg kann auf ihn warten." 11 Das erste Café Kranzler war 1834 an der Ecke Unter den Linden/Friedrichstraße eröffnet worden.
33
Drei Monate später fielen die meisten unserer Primaner beim Sturm der völlig unausgebildeten Freiwilligenregimenter auf Langemarck in Westflandern [10. Nov. 1914] - „Jeder Stoß ein Franzos'!" Bruder Rudolf wurde erst ein Jahr später eingezogen.
*
Die Erste Kriegsanleihe überzeichnet: Das Gold dem Vaterland. Die Turnhalle wird zur Sammelstelle, der lange Turnlehrer zum Goldkassenwart. Meine Schulkameraden sammeln Zehn- und Zwanzigmarkstücke und bringen die goldenen Uhrketten ihrer Väter. Gold gab ich für Eisen. Nur ich finde niemanden, der mir Gold geben kann, ich lebe schon lange in einem goldlosen Haushalt. Ein Nachbar lächelt verschmitzt: „Junge, du hast noch viel zu lernen; in einem Kriege gibt man kein Gold weg, das hamstert man." Na so ein Miesmacher ... Ich laufe eifrig mit einer amtlich gestempelten Blechbüchse durch die Stadt und sammle fürs Rote Kreuz und verkaufe Kriegsbilderbogen. Viele Passanten lassen Sechser und Groschen in meine Büchse klimpern. Mein Schulfreund zeigt mir, wie man mit einem Taschenmesser Münzen aus der Büchse herausholen kann. So decken wir unseren Bonbonbedarf. In unserem einstigen Salon, der vor Jahren vom Gerichtsvollzieher ausgeräumt worden war, beherbergen wir Flüchtlinge aus Ostpreußen, der Staat zahlt die Miete. Hindenburg siegt bei Tannenberg [30. Aug. 1914] und treibt die Russen in die Masurischen Sümpfe. Hunderttausend Gefangene gemacht. Für diesen Doppelsieg gibt es gleich zwei schulfreie Tage: „Jeder Schuss ein Russ'!" Dann aber werden die schulfreien Tage seltener. Keine Siegesmeldungen mehr vom Westen, wo doch schon die Ulanenpatrouillen in Sicht des Eiffelturms gemeldet worden waren. Man munkelt von einem Rückzug von der Marne; General von Moltke, 34
der Generalstabschef, seines Postens enthoben [14. Sept. 1914], Aber nur Miesmacher wagen am Sieg zu zweifeln. Im Westen nichts Neues 1 2 ... Der Krieg wird zum Alltag. Es gab kein Wiedersehen zu Weihnachten. Die Reservisten singen: „Denn dieser Feldzug ist ja kein Schnellzug, es ist ein Bummelzug, der langsam fährt." Unser Lateinlehrer kommt in die Klasse: „Adieu Jungens, ich habe meinen Gestellungsbefehl erhalten." Er gibt jedem von uns die H a n d und verlässt schnell das Zimmer. Eine Stunde ohne Lehrer. Wir wissen nicht viel mit dieser Stunde unverhoffter Freiheit anzufangen. Am nächsten Tage schlurft ein alter Mann in die Klasse: „Ich bin euer neuer Lateinlehrer", murmelt der aus dem Ruhestand zurückberufene Professor mürrisch. Die jüngeren Lehrer verschwinden einer nach dem anderen. Neben den Alten taucht ein junger hochgeschossener ganz magerer Lehramtskandidat mit dicken Brillengläsern auf. Wir nennen ihn „Baidur, die Leiche". Autorität kann Baidur, die Leiche, nicht erringen, aber im Lärm der Klasse bleibt sein Federhalter erschreckendes Werkzeug der Obrigkeit. Es hagelt Tadel ins Klassenbuch. *
Auf dem Tempelhofer Feld wurde ein Musterschützengraben ausgehoben, bemannt mit feldgrauen Landsern, mit Sappen 13 und Stacheldraht, mit Horchposten und Maschinengewehren. Für zehn Pfennig Eintritt sehen wir, wie gemütlich der Grabenkrieg sein muss. In die Laufgräben sind Bretter gelegt, die Landser spielen Harmonika, die Gulaschkanone dampft, mit dicken Sandsäk-
12
Erich Maria Remarques Roman Im Westen nichts Neues (erschienen 1929) beschreibt den Kriegsalltag der Frontsoldaten. 13 Sappe: Laufgraben, der von der vordersten Linie gegen die feindliche Stellung vorgetrieben wird.
35
ken verschalt. In den Offiziersunterstand wurde sogar ein kleiner Teppich geschleppt. Der Schützengraben wird zum beliebten Ausflugsziel. Die Kinder dürfen mit dem Maschinengewehr spielen. Italien hat uns den Krieg erklärt. Der Dreibund 14 ist endgültig zerplatzt. Der Kaufmann an der Ecke tauft seinen Italienischen Salat in „Treubruch-Salat" um und erhöht den Preis. „Viel Feind viel Ehr'!" Vor der Siegessäule im Tiergarten steht der Eiserne Hindenburg. Er wird fleißig behämmert: Eine Mark für den eisernen Nagel, fünf Mark für den Silbernagel fürs Schwert und zehn Mark der goldene Nagel für den Schwertknauf. Die Nagelfreudigen stehen in langen Reihen vor dem riesigen Gerüst. Ich möchte gerne mitnageln, aber niemand hat eine Mark für mich übrig. Ich muss fast ein Jahr warten, bis die Menge allmählich des Nageins müde wird und weitere Flächen des Eisernen Hindenburgs unbenagelt bleiben. Der Preis sinkt, und an einem „Billigen Sonntag" darf ich für 25 Pfennig einen Eisernen Nagel ins linke Hosenbein Hindenburgs hämmern. „Willst du noch einen Nagel einschlagen?", fragt mich der Hammer- und Nagelbewahrer. „Ich hab' kein Geld mehr." - „Macht nichts, hier hast du einen Nagel als Prämie. Wir müssen das Ding ja voll kriegen."
*
Brotmarken werden eingeführt. Ich esse eine ganze Woche kein Brot, um die erste Brotkarte meiner Kriegssammlung einverleiben zu können. Die besteht zur Zeit aus meinem Soldatenkalender, 14 Verteidigungsbündnis, entstanden 1882 durch den Beitritt Italiens zu dem 1879 zwischen dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn geschlossenen Zweibund, nicht wirksam durch Italiens Neutralitätserklärung im August 1914, beendet 1915 mit dem Eintritt Italiens in den Ersten Weltkrieg auf der Seite der Entente.
36
einigen Granatsplittern, die wir während eines Schulausflugs auf einem Schießplatz aufgelesen hatten, einem russischen Uniformknopf, einer Germania-Drei-Pfennig-Marke mit dem Aufdruck „Russisch-Polen", einem Koppelschloss mit eingraviertem „Gott mit uns" und vor allem einem glänzenden, etwa 20 Zentimeter langem Stahlpfeil, den ich in der Schule gegen einen Granatsplitter eingetauscht hatte. Solche Stahlpfeile sollten in Bündeln von Flugzeugen abgeworfen werden, scheinen aber keinen großen Eindruck auf den Feind gemacht zu haben. Sie waren jedoch die erste von Flugzeugen abgeworfene Waffe, Urahnen der Atombombe einer späteren Generation.
*
Das zweite Kriegsjahr geht zu Ende. Meine Mutter arbeitet in einem Kriegsamt. Die Menschen beginnen, vor den Läden anzustehen. Arbeiten und Schlangestehen klappen nicht miteinander. Wir ziehen in eine bürgerliche Pension in der Lindenstraße. „Da bekommst du wenigstens dein regelmäßiges Essen." Mein Bruder wird in einem Lehrlingsheim untergebracht. Onkel Otto wird eingezogen. Zu Kriegsanfang war er kriegsuntauglich. Als ich ihn mit seinem Pappkarton zum Bahnhof bringe, wird nicht mehr gesungen. Die Kolonnen steigen schweigend in die mit Stroh ausgelegten Güterwagen. Der Sohn unseres Schusters ist vor Verdun gefallen. „Für mich ist der Krieg zu Ende", sagt der alte Mann mit trostlosen Augen und nagelt mir schweigend Holzsohlen unter meine Papierfaserschuhe. Diese Papierfaserschuhe lösen sich im eisigen Schlamm auf, als wir Quartaner mit einem Straßenkehrer als Truppführer zum Schneeschippen und Eishacken kommandiert werden, um die Kochstraße Ecke Friedrichstraße passierbar zu machen. Der von der Stadt ausgezahlte Arbeitslohn wird von der Schule für vaterländische Zwecke einbehalten.
37
Es ist der dritte Kriegswinter und die Kachelöfen bleiben kalt. Wir sind von reichen Verwandten zum Essen eingeladen. Das geschieht einmal im Jahr. Es gibt Schmorbraten und sogar Kuchen hinterher. Auf der Fahrt nach Hause sagt mein Bruder: „Weißt du, wenn man satt ist, friert man nicht so sehr." In der bürgerlichen Pension werden die Portionen streng zugeteilt. Ich bekomme ein halbes Ei und zwei Radieschen mit einer Pellkartoffel. Mein Nachbar hat vier Radieschen und ein ganzes hartes Ei auf dem Teller - die Eierration einer ganzen Woche. Ich frag das Servierfräulein: „Warum?" „Na, der zahlt doch mehr, aber ich will sehen, ob noch eine Kartoffel für dich übrig ist." Am langen Mittagstisch sitzen zwanzig Gäste. Sekretärinnen mittleren Alters mit spitzen Gesichtern, die sich angeregt mit zwei dienstuntauglichen Herren, der eine beinahe blind, der andere lahm, unterhalten. Ein Kriegsbeschädigter mit Beinschuss ist der Lieblingsgast der Wirtin, deren Gatte in Italien steht. Siebzehn Gäste haben ein halbes Ei auf dem Teller, drei schlemmen mit einem ganzen Ei. An diesem halben Ei scheiden sich die Klassen.
*
Deutschland erklärt den uneingeschränkten U-Bootkrieg [1. Febr. 1917]. Am 28. Februar 1917 [korrekt: 6. April 1917] erklärt Amerika den Krieg. „Die Amerikaner können weder fliegen noch schwimmen", prahlt Reichsminister Helfferich, und der königliche Schuldirektor wiederholt diese Voraussage, als er seinen immer noch vorhandenen Bauch auf das Rednerpult in der Aula schiebt. „Hat irgend einer von Euch schon einmal gehungert? Der stehe auf!" Niemand steht auf; obgleich ich großen Hunger habe, bleibe ich feige sitzen. Befriedigt fährt der Direktor fort: „Dieses Gymnasium bleibt von äußeren Einflüssen unberührt. Das Pensum bleibt das Gleiche, die Anforderungen bleiben die Gleichen. 38
Unser Schirmherr, Seine Majestät der Kaiser, erwartet von jedem Schüler äußerste Pflichterfüllung. Aufstehen zum Gebet!" Als ich, wenn auch als Vorletzter, in die Untertertia versetzt werde, gibt mir die Pensionswirtin als Anerkennung eine doppelte Portion Kohlrüben, und meine Mutter spendiert eine Schaumtorte beim Konditor. *
Eines Tages sieht mich der Ordinarius — wir nennen ihn Pipps — durchdringend an: „Sag deiner Mutter, sie soll morgen in der großen Pause zu mir kommen." Mich packt der Schrecken - was habe ich verbrochen? Dabei fühle ich mich im Augenblick wirklich unschuldig, keine Schlägerei, in jüngster Zeit kein Tadel, noch nicht einmal eine verhauene Klassenarbeit. Meine Mutter stellt die gleiche Frage: „Was hast du wieder verbrochen?", und geht am nächsten Tag aufgeregt zu Pipps. Von vornherein stammelt sie irgendeine Entschuldigung. „Nein, wir wollen nicht von der Schule sprechen", beruhigt Pipps. „In sechs Wochen sind Ferien. Wir haben einige Stellen für leichte Landarbeit im Sommer zu vergeben. Ich dachte an ihren Jungen, ich glaube, er hat's nötig, er braucht kräftiges Essen. Wollen Sie ihn verschicken?" *
Ich komme zu einem Bauern am Rande des Teutoburger Waldes. Am Bahnhof eines kleinen Städtchen erwartet eine pferdebespannte gelbe Postkutsche den Zug und rattert mich ins Dorf. Am Scheunentor steht eine stramme Bäuerin: „Du bist also unser Landarbeiter? Na kräftig siehst du ja nicht gerade aus. Mit der Arbeit wird's wohl nicht so schlimm werden, komm in die Küche und iss mal erst richtig."
39
Eine Satte15 dicke Milch steht auf dem Küchentisch, dann kommt ein riesiger Pfannekuchen mit Fettstücken, frisches Brot und ein Klumpen Butter, und sogar ein großes Eckstück Streuselkuchen. „Dir schmeckt's wohl? Haben alle Gymnasiasten solchen Appetit?" In der Nacht bekomme ich Bauchschmerzen. Am nächsten Morgen verzichte ich auf die dicke Milch und begnüge mich mit zwei Rühreiern. Dann esse ich zwei Tage lang nur dicke Mehlsuppen. Die Landarbeit besteht im Heuen und vor allem Kühehüten. Das Kühehüten ist nicht so einfach. Futter ist knapp, das Heu auf der Wiese wird für den Winter gebraucht. So muss ich zwei Kühe bei der Leine nehmen und sie das Gras entlang des Chausseegrabens abfressen lassen. Hinter dem mageren Gras des Grabens strecken sich üppige Weizenfelder und locken meine Kühe. Nicht immer gelingt es mir, die Tiere an der Leine zu halten. Sie brechen los, und eine wilde Jagd durch die reifenden Felder beginnt. Bauern kommen von den Nachbarfeldern, um die Kühe zurückzutreiben, sie fuchteln mit großen Stöcken, die sie wohl am liebsten auf mir zerschlagen würden. „Willst du mir heute Abend helfen?", fragt die Bäuerin. Nach dem Dunkelwerden ziehen wir mit einer Schubkarre los. Sie ist mit zwei Säcken beladen. Wir gehen nicht durchs Dorf, sondern auf Feldwegen um das Dorf herum. Es ist ein weiter Marsch zur Mühle, die völlig im Dunkel liegt. Die Bäuerin pfeift leise und ein lauter Pfiff ist die Antwort über das Klappern der Windmühlenflügel. Der Müller kommt aus der Tür, schleppt die zwei Säcke in die Mühle und lässt auf sich warten. Mit einem vollen Sack kommt er zurück; zwei große Säcke Weizen gegen einen viel kleineren Sack Weizenmehl. Dieser Handel ist nach den Kriegsgesetzen strengstens verboten. Der Müller mahlt während der Nacht „schwarzes Mehl". 15
Flache Schüssel zum Ansetzen von Dickmilch.
40
In tiefer Finsternis geht es zurück: „Morgen backe ich dir einen Streuselkuchen, wenn uns bis dahin kein Gendarm erwischt." Der Gendarm erwischte uns nicht. Aber am nächsten Tage ertappte er gerade an der Stelle, wo ich meine Kühe hüte, zwei dürre Frauen aus der Stadt, die aufs Land gekommen waren, um ein paar Lebensmittel zu ergattern. Er beschlagnahmt sieben Eier, eine Scheibe Speck. „Das Butterbrot, das ich gefressen habe, können Sie mir nicht mehr abnehmen", höhnt die eine Frau bitter. Zu Ende der großen Ferien packt mir die Bäuerin zwei Mandeln Eier16, ein kräftiges Stück Speck, eine Wurst und ein Bauernbrot in meinen Rucksack. Die Postkutsche bringt mich zum Bahnhof. Gendarmen stehen an der Sperre, aber sie haben zu meinem Glück einen Großhamsterer mit zwei ganzen Speckseiten erwischt, und da sie ein Protokoll aufnehmen, haben sie keine Zeit, einen Blick auf meinen kleinen Rucksack zu werfen.
*
Zar Nikolaus ist gestürzt [15. März 1917] - Kerenskij sucht sich an der Macht zu halten. Es gibt wieder schulfrei für die Siege der deutschen Ostoffensive tief in die Ukraine hinein. „Das bringt uns Getreide", frohlockt der Direktor bei der Siegesfeier. Revoltierende russische Matrosen beschießen Kronstadt - die Bolschewisten ergreifen die Macht — Waffenstillstand im Osten. „Der Ring ist gebrochen! Zeichnet Kriegsanleihe", verkünden Plakate an den Mauern. Sie zeigen einen deutschen Soldaten, der mit seinen Fäusten einen Eisenring gebrochen hat. Ich aber feiere meinen eigenen Sieg. Die Schwester unserer schönen Emma, Stubenmädchen in unserer gutbürgerlichen Pension, dient in einer Kneipe in Neukölln als Servierfräulein. ,Kommt heute Nacht auf den Hof, da geb ich Euch etwas", flü16
Mandel ist ein Mengenmaß; eine Mandel Eier = 15 oder 16 Eier.
41
stert sie Emma zu. Um elf Uhr abends schleichen wir uns auf den dunklen Hof - es ist bitter kalt. Ein Fenster im Hochparterre öffnet sich um eine Handbreite. Emma hebt mich auf den Fenstersims. Aus dem Fensterschlitz schiebt sich eine immer länger werdende Bockwurstkette und landet in vielen Windungen in meiner kunstwollenen Zipfelmütze. Ich gleite vom Sims, Emma fängt mich mit starken Armen auf, und eilends laufen wir auf Zehenspitzen auf die Straße. Der große Wurstraub von Neukölln hat drei Minuten gedauert. Wir rennen zur Straßenecke und springen auf eine langsam um die Ecke biegende Straßenbahn. Emma beginnt fröhlich zu wiehern, ich beiße herzhaft in eine eiskalte Pferdewurst. In der Klasse sitze ich auf der letzten Bank neben Kurt Knoll. Sein Vater ist als Offizier beim Sturm auf das Fort Douaumont gefallen. Knoll lebt in einem Waisenhaus für Offizierssöhne. Er ist ein kleiner schwacher Junge. In der ersten Stunde haben wir Geschichte. Mein Nachbar flüstert mir zu: „Die Großen haben mir heute früh wieder mein Frühstück fortgenommen, ich habe nichts zu essen." Unter der Bank liegt mein großer Schatz: zwei Pferdewürste. Ich stecke ihm eine zu, er sieht sie mit hungrigen Augen. „Nimm's", flüstere ich, und greife nach der zweiten Wurst. Verwegen schieben wir Wurststücke in den Mund. Der Herr Studienrat ruft mich auf: „Von wann bis wann regierte der Hohenstaufenkaiser Otto der Zweite?" Mit einem Wurststück im Munde muss ich schweigen, außerdem weiß ich das Datum sowieso nicht. „Du hast nicht aufgepasst, setz dich, eine Vier."
*
Mein Onkel Otto kommt auf kurzen Urlaub. Er hatte einige Goldstücke aufgetrieben, und für jedes Stück Gold gibt es einen Tag Urlaub. Er spricht nicht gern vom Krieg. „Du bist ja noch immer Gemeiner", sage ich. Die Antwort: „Sei froh, dass ich lebe." 42
„Aber ich habe dir etwas mitgebracht, für deine Kriegssammlung." Und er holt aus seinem Rucksack einen stark eingebeulten französischen Stahlhelm. „Heb' ihn mir bis nach dem Kriege auf. Ich habe einen armen Kerl, einen verwundeten Franzosen, aus dem Drahtverhau geschnitten und zur Verbandsstelle getragen. Der gab mir seinen Helm: „Merci, das ist das Einzige, was ich dir geben kann", hat er gesagt und mit einem Bleistiftstummel seine Pariser Adresse auf den Helm geschrieben: ,Viens après la guerre pour un petit verre' - Komm nach dem Kriege auf ein kleines Gläschen - rief er zum Abschied." Mein Onkel schenkte mir auch seinen alten Zivilanzug - „der passt doch nicht mehr". Der Schneider hat ihn für mich gewendet und zusammengeschnitten. Knöpfe und Knopflöcher sind zwar spiegelverkehrt, das Ganze reichlich für künftiges Wachstum geschneidert, aber ich stehe vor dem Spiegel und bewundere mich in meinem ersten neuen Anzug seit vielen Jahren.
*
Mein Bruder Ludwig ist 17 Jahre alt, dürr und schmächtig, Hosenbeine und Ärmel seines vielgeflickten Anzuges sitzen auf Halbmast, an den Ärmeln zupft er erfolglos im Versuch, sie lang zu ziehen. Er ist Lehrling in einer Firma, die nichts mehr zu verkaufen hat. In ein paar Monaten wird sein Jahrgang aufgerufen werden. Er teilt unserer Mutter seinen festen Entschluss mit: „Ich melde mich freiwillig." In diesem vierten Kriegsjahr meldet sich kaum noch jemand aus Patriotismus freiwillig zu den Fahnen. Die Gründe meines Bruders sind daher rein materialistisch: „Beim Kommiss bekomme ich jedenfalls mehr zu essen und eine warme Uniform — und vor der Front werde ich mich schon drücken." Die Gründe scheinen einleuchtend, Mutter gibt achselzuckend die Genehmigung: „Kinder werden sie nun doch nicht ins Feld schicken."
43
Sie haben Ludwig garnisonsdienstfähig geschrieben, und er erscheint, als Soldat verkleidet, versunken in einer Uniform, in die er erst in Jahren hineinwachsen mag, die Ohren retten die Mütze vor völligem Abrutsch über das Gesicht. Das Koppel bleibt leer, da ihm der Unteroffizier noch kein Seitengewehr anvertraut hat; die Kommissstiefel passen nach Einlegen mehrerer Schichten Fußlappen17 beinahe wie nach Maß. Er ist als Schreiber dem Minenwerferkommando zugeteilt und dient in einer zum Stabsquartier umgewandelten Wohnung in der Tauentzienstraße in Berlin. Dem Leutnant schien diese Karikatur eines preußischen Soldaten nicht recht zu gefallen. Er verkauft ihm seine alte blaue Friedensuniform: „Lassen Sie sich die ändern." Der Schneider liefert ein Prachtstück. Einen so guten Stoff hat er schon lange nicht unter der Schere gehabt. Und so stolziert unser Soldat nach dem Dienst aus der Schreibstube allabendlich auf die nicht gerade im besten Leumund stehende Tauentzienstraße. Ludwig vertraut mir seine Seligkeit an: „Hab' ich Glück bei den Weibern, die halten mich in meiner Extrauniform alle für einen Kadetten." Er ist Hahn im Korb im männerarmen Berlin. O welche Lust, Soldat zu sein. Das Glück dauert nicht sehr lange. Unseligerweise hat die puritanische Mutter ihren Sohn eines Abends an der Seite einer nicht mehr allzu jungen Dame gesehen. Am nächsten Morgen geht sie entschlossen zum Feldwebel: „Ich lasse nicht zu, dass mein minderjähriger Sohn beim Militär verkommt. Sie müssen etwas tun." Der von solcher Empörung verängstigte Feldwebel tut etwas. Der verlorene Sohn wird zur Stammkompanie nach Markendorf bei Jüterbog abkommandiert. Immerhin ist Markendorf sehr weit vom Kriegsschauplatz entfernt.
Vor der verbreiteten Verwendung von Strümpfen Tücher zur Bekleidung der Füße insbesondere beim Tragen von Stiefeln; noch bis z u m Zweiten Weltkrieg gebräuchlich. 17
44
Wieder bringe ich einen Soldaten zum Bahnhof. Es ist der wütendste Soldat, den ich je gesehen habe. Er hat keine Ahnung, wem er diese Strafversetzung zu verdanken hat, und meine Mutter gesteht mir erst viel später ihren Eingriff in die deutsche Kriegsmaschine. *
Viel Feind - viel Ehr. Die Russen sind wir zwar los geworden, aber nun haben wir seit Erklärung des uneingeschränkten U-Bootkrieges die Amerikaner auf dem Hals. Die können zwar, wie von höchster Stelle versichert wird, weder fliegen noch schwimmen, aber wir haben plötzlich einen feindlichen Ausländer in der Familie, den Großonkel Zoll. In seinem Alter wird er zwar behördlich ziemlich zufrieden gelassen, er muss sich nur zuweilen beim Polizeiamt melden. Aber seine Rentenzahlungen aus Amerika stoppen, oder was für Zahlungen es gewesen sein mögen, und im Familienrat kommt die erschreckende Erkenntnis zum Durchbruch, dass der reiche Onkel aus Amerika gar kein reicher Onkel ist, sondern zumindest zur Zeit ein armer Schlucker. „Es gibt Kartoffeln!" Wie ein Lauffeuer verbreitet sich der Ruf im Kriegswinter 1917. Die Menschen strömen in die Markthalle zwischen Linden- und Friedrichstraße. Die Schlange auf ihren Holzsohlen in der Kälte stapfender Menschen, in Viererreihen aufmarschiert, von Schutzleuten bewacht, reicht aus der Halle heraus weit auf die Straße. Fünf Pfund Kartoffeln pro Kopf, und ohne Marken, eine unverhoffte Sonderzuteilung. Nur langsam geht es voran, nach einer Stunde sind wir hundert Meter vorgerückt. In diesem Tempo wird es noch zwei Stunden bis zu unserer Reihe dauern. Die besorgte Frage der Hintenstehenden: „Wird's für uns noch reichen?" Kundschafter werden ausgeschickt; beruhigende Nachricht, zwei Lastwagen voll Kartoffeln sind gesichtet worden. „Wat 'ne Abwechslung nach all die Kohlrüben", seufzt die Nachbarin. „Wenn's noch Kohlrüben wären, ick hab seit Wochen nur Runkelrüben jesehn", schimpft die Frau neben ihr.
45
Meist stehen hier Frauen in ihren Umschlagtüchern und mit alten kunstledernen Markttaschen. Einige haben Babies auf dem Arm, die durch in den M u n d gesteckte Schnuller ruhig gehalten werden. Die größeren Kinder wurden mitgenommen, damit sie vielleicht eine Extraration schnappen können. Alte Männer in ausgebeulten, vielgeflickten Arbeitshosen und zerschlissenen Jakken warten geduldig neben einigen Soldaten, vermutlich Urlaubern, die hier Stunden ihrer kurzen Freiheit verbringen: „Besser nach Kartoffeln stehen als im Schützengraben liegen." Plötzlich hören wir Singen. Eine dicke Frau fing an, und schnell wird es zum Rundgesang:
Eins, zwei, drei, Ich singe frank und frei: Wenn Wilhelm im Zylinder geht Und Juste nach Kartojfeln steht, Dann ist der Krieg vorbei. Lachen, Händeklatschen: „Da Capo, da Capo." Immer mehr Stimmen fallen ein, bald singen Hunderte mit. Ein Schutzmann fasst sich an seine Pickelhaube und weiß nicht recht was tun. Schließlich dreht er sich um und kehrt uns den Rücken zu — er will nichts gehört haben. Nachbarlich gute Laune herrscht, das Singen scheint die Schlangestehenden aufgewärmt zu haben. Nach drei Stunden komme ich mit fünf Pfund Kartoffeln nach Haus. Eine Schüssel Pellkartoffeln ist die Belohnung. Natürlich vergaß ich die Schularbeiten. Am nächsten Morgen werde ich aufgerufen. Ich soll aus dem Julius Caesar übersetzen und beginne hilflos zu stottern. „Hast du denn nicht deine Schulaufgaben gemacht?" „Nein, ich hab den ganzen Nachmittag nach Kartoffeln angestanden." „Kartoffeln sind dir wichtiger als Lernen?" Ich zucke die Achseln.
46
.Antworte!" - „Ja." .Eine Stunde Nachbleiben wegen Frechheit!"
*
Ostern 1918. Ich habe das Ziel der Klasse nicht erreicht. Mit mir blieb mein ewig hungriger Nachbar Knoll sitzen. Der Klassenlehrer gab mir verachtungsvoll mein mit vielen „Mangelhaft" geziertes Zeugnis. Das einzige Fach, in dem ein „Gut" stand, war Turnen. Ein sehr schwacher Trost. Ein blauer Brief mit preußischem Dienstadler, portopflichtige Dienstsache, verkündet, dass die halbe Schulgeldfreiheit gestrichen worden ist. Es sind traurige Osterferien, die Mutter weint, ich schäme mich vor meinen Schulfreunden und fürchte mich vor der neuen Klasse. Der Osterbesuch zu den reichen Verwandten muss abgesagt werden. Sie wollen diese Familienschande nicht zu Gesicht bekommen. Mein Bruder, während der Ostertage auf Urlaub, sagt: „Musst du mir denn alles nachmachen?" Der war schon in der Quinta sitzengeblieben. Große Durchbruchschlacht im Westen. Deutschland hat seine an der Ostfront freigewordenen Kräfte an die Westfront geworfen. Schlacht an der Somme, an der Marne. Ludendorff: „Wir werden die Entscheidung erzwingen, bevor die Amerikaner kommen." Die Schande meiner NichtVersetzung ist bis an die Front gedrungen. Ein Feldpostbrief meines Onkels Otto: „Lieber Junge, nimm das Sitzenbleiben nicht zu schwer. Auch ich bin sitzengeblieben — hier im Schützengraben fragt keiner mehr danach."
*
In den großen Ferien geht's auf eine Hamsterfahrt. Mutter und ich marschieren durch pommersche Dörfer. Die erste Bäuerin
47
zuckt die Schultern: „Nein wir haben nichts" - dann zögernd: „Aber ich geb dem Jungen ein Glas Milch." Auf dem zweiten Bauernhof das gleiche Kopfschütteln und der gleiche Trost: „Hier ein Glas Milch für den Jungen." Nach langem Marsch auf dem dritten Hof: „Hier ein Glas Milch für den Jungen." Acht weitere Bauernhöfe werden abgeklappert - kein Ei, kein Speck, kein Brot - aber weitere vier Glas Milch für den armen Stadtjungen. Dann geschieht ein unglaubliches Wunder: ein Huhn flattert aufgeregt aus einem Roggenfeld, wir haben es aufgescheucht. Ich entdecke ein geheimes Nest, in das die Henne, aller Lebensmittelkontrolle zum Trotz, zwei markenfreie Eier gelegt hat. Die Kriegsbeute wird sorgsam in Zeitungspapier gewickelt. Wir schöpfen neuen Mut und werden zu Selbstversorgern. Vorsichtig nach allen Seiten spähend, reißen wir Roggen- und Weizenähren von den Feldern, eine ganze Tüte voll. Ein weiterer Versuch bei einem Bauern — diesmal ist es ein Glas Ziegenmilch. Das war zu viel, furchtbares Bauchweh ist das Ende dieser Hamsterfahrt. In geduldiger Arbeit trennen Mutter und ich am nächsten Abend die Spreu vom Weizen. Das Korn wird durch die Kaffeemühle gedreht, und wir ernten ein halbes Pfund Mehl. Auf dem Spirituskocher werden mit dem Mehl und den zwei Eiern dicke Eierkuchen gebacken. Der Heeresbericht meldet „Verkürzung der Front auf die Hindenburglinie 18 ".
*
Verteidigungslinie von Arras über St. Q u e n t i n nach Soisson, ausgebaut 1916 und zunächst „Siegfriedstellung" genannt, hierauf zogen sich die deutschen Truppen im Frühjahr 1917 zurück auf Befehl der Obersten Heeresleitung, deren C h e f Paul von H i n d e n b u r g war (vgl. Lit.verz. Nr. 17). 18
48
Weitere Frontverkürzungen. Die Amerikaner sind doch gekommen. Vor unserem Haus in der Lindenstraße steht ein Mann in abgerissener Uniform, die Knöpfe offen, ohne Koppel. Ein Hauptmann kommt vorüber, der Mann starrt ihn gelassen an. „Warum grüßen Sie nicht? Wie sehen Sie überhaupt aus, schließen Sie die Uniform!" „Ich kenne Sie ja gar nicht, warum soll ich Sie dann grüßen? Ich bin kein Soldat mehr - ich bin als Schwerverwundeter entlassen." „Das gibt's nicht. Solange Sie die Uniform tragen, sind Sie Soldat. Ich werde Sie melden, zeigen Sie mir Ihre Papiere." Arbeiter kommen aus der gegenüberliegenden Druckerei, eine Menge sammelt sich an. „Ich trage diese Scheißuniform, weil ich nichts anderes anzuziehen habe, lassen Sie mich zufrieden." Die Umstehenden nehmen Partei: „Du hast Recht!" „Lassen Sie den Mann zufrieden." Der Hauptmann sieht sich ängstlich um, er fühlt sich von Arbeitern umringt und zupft verlegen an seinem Kragen: „Ah, äh - ich will Ihnen ja nur helfen ...". „Scher dich fort", mahnt eine Stimme. Der Hauptmann lässt sich das nicht zweimal sagen. Im Laufschritt macht er sich dünn und stolpert über seinen eigenen Säbel. Höhnisches Gelächter schallt hinter ihm her. Der Mann in der zerlumpten Uniform humpelt davon.
*
Die Hindenburglinie durchbrochen [Oktober 1918] - amerikanische Truppen erreichen Sedan. Versammlung in der Aula. Der Direktor wettert gegen Miesmacher: „Wir müssen durchhalten - der Kaiser verlangt es von uns." Dann wird seine Stimme leiser: „Zwei Schulen mussten
49
zusammengelegt werden, ihr habt nur noch dreimal die Woche Schule." Freudiges Raunen geht durch die Aula, gesenkten Hauptes geht der Herr Direktor von der Kanzel. Der Schulchor singt: „Ein' feste Burg ist unser Gott." Deutschland stellt den uneingeschränkten U-Bootkrieg ein. Die Donaumonarchie zerfällt, Bulgarien und die Türkei bitten um Waffenstillstand. Um Lebensmittelunruhen zu vermeiden, verspricht die Regierung für die nächste Woche doppelte Rationen. Osterreich ergibt sich, Kaiser Karl flieht. Die Matrosen meutern in Kiel. Mein Bruder erscheint. „Hast du Urlaub?", fragt Mutter ängstlich. „Nein, die laufen ja alle davon." „Ich kenne dich nicht, ich will keinen Deserteur hier haben." In Bayern wird die Räterepublik ausgerufen. 8. November 1918: Ein üblicher Schultag, aber es hängt etwas in der Luft, die Lehrer vergessen, Hausarbeiten aufzugeben. Am Abend kommt Emma, das Mädchen, mit dem ich einst Pferdewürste stahl, heulend in unser Zimmer gestürzt. Berittene Polizei hat ihr mit der flachen Klinge auf den Rücken geschlagen, als sie eine demonstrierende Menge vor dem Schloss auseinandertrieb. Der Rücken ist blau geschwollen. Meine Mutter legt kühle Kompressen auf und bringt die arme Emma zu Bett. Sie ging unter der Monarchie schlafen und wachte am nächsten Morgen in einer Republik auf. Der Rücken tat ihr viel weniger weh. Kaiser Wilhelm II. hat uns herrlichen Zeiten entgegengeführt. Das ist das Ende meiner zweiten großen Zeit.
50
,Erwürgt die junge Freiheit nicht!" (Plakat aus der Revolutionszeit 1918/19)
D
u* iI I & I *>¿
·4"Ι"/"\ S &M»1 IbVM»
große
9. November 1918. Der Generalstreik ist ausgerufen. Rote Fahnen wehen vom Vorwärtsgebäude in der Lindenstraße, gegenüber unserer gutbürgerlichen Pension. Der Vorwärts ist die Sozialdemokratische Zeitung Berlins. Das Gebäude beherbergt die Redaktion, die Druckerei, den Buchverlag und ist Hauptquartier vieler Parteiorganisationen. Heute wird es zum Sternpunkt der von allen Seiten anrückenden Arbeiter und Soldatenkolonnen. Neugierig aufgeregte Massen füllen die Lindenstraße und den Belle-Alliance-Platz19. Ein Bataillon Gardejäger in nagelneuen Uniformen und Tschakos, mit frischgewichsten Stulpenstiefeln, geführt von seinen Offizieren, rückt im Marschschritt an. Die Gewehre geschultert. Die 19
Seit 1947: Mehringplatz.
51
Masse weicht zurück. Rufe erschallen: „Brüder nicht schießen kommt zu uns." Extrablätter werden in die Kolonnen geworfen: „Der Kaiser hat abgedankt- Flucht nach Holland." Die Jäger machen halt. Sie sind zunächst unschlüssig. Einer nimmt sein Gewehr von der Schulter, andere folgen. Ein Gewehr fliegt auf das Pflaster, ein zweites, ein drittes. Und plötzlich liegt ein großer Haufen von Gewehren mitten auf der Straße. Ungeheurer Jubel. Den Offizieren werden die Säbel abgenommen. Sie verschwinden. Minuten später laufen Jungens mit Bündeln von Extrablättern aus dem VfrwÄrögebäude. Auch ich renne auf den Hof und lasse mir ein großes Paket zuwerfen: „Extrablatt, Extrablatt — die Gardejäger gehen zum Volk über." Sofort bin ich meine Extrablätter los. Ich kämpfe mich durch die Massen zurück zum Druckereihof. Ein neues Paket, eine neue Überschrift: „Scheidemann ruft die Demokratische Republik aus." „Vorwärts - Extrablatt - Extrablatt". Diesmal dringe ich mit meiner Sensation bis zur Friedrichstraße vor und bin, von greifenden Händen umringt, der Held der Minute. Gruppen von Soldaten ziehen durch die Friedrichstraße. Von einem Lastwagen werden ihnen Gewehre zugeworfen, sie hängen sie um die Schulter, mit dem Lauf nach unten. Der Gewehrlauf nach unten scheint das Zeichen der Revolutionäre. Überraschten Offizieren werden Kokarden und Achselklappen abgerissen; ein wütender Oberst wirft seinen Säbel in einen Schacht der im Bau befindlichen Untergrundbahn. Der Bau war schon seit Jahren unterbrochen. Eine immer größer werdende Menschenmasse wälzt sich in Richtung Unter den Linden und Schloss. Vereinzelte Schüsse pfeifen von Häuserdächern - sie werden kaum beachtet. Rund um das Schloss stehen bewaffnete Matrosen; die Meuterer von Kiel, die nach Berlin marschierten. Massenverbrüderung mit den Blauen Jungens. Vom Balkon, von dem aus mein Kaiser im August 1914 — das ist 1773000 deutsche Heldentote her — seinen Säbel gezogen hatte, hängt ein roter Teppich. 52
Ein kleiner schwarzhaariger Mann mit einem Pincenez20 auf der Nase erscheint auf dem Balkon. „Liebknecht, Liebknecht", tönt es aus der Menge. Er ruft aus voller Lunge - der elektronische Lautverstärker ist noch nicht erfunden — „Niemals wieder wird ein Hohenzoller hier stehen ... Ich rufe die Freie Sozialistische Deutsche Republik aus - die Republik des Proletariates!" Dieser Balkon hängt noch heute als einziger Rest des Hohenzollernschlosses als Erinnerungsmal an Liebknecht am wiederaufgebauten Marstall in Ostberlin.21
*
Der Unterschied zwischen der Freien Sozialistischen Republik Liebknechts und der Demokratischen Republik, die Scheidemann vor einigen Stunden von einem Fenster des Reichstags ausgerufen hatte, ist mir nicht sehr klar, und wohl auch vielen andern nicht, die vor dem Reichstag und auf der Schlossfreiheit ihrer Begeisterung Laufließen. Ich habe heute genug revolutioniert, der Hunger treibt mich nach Hause. Revolution macht müde. Ich liege schon lange im Bett, als mein Bruder erscheint. Da steht er mit offener Bluse, Achselklappen und Kokarden abgerissen, mit einem roten Armband und schwingt eine lange Blutwurst, die er vom Soldatenrat gefasst hatte. Er wirft sie mir zu - mitten in der Nacht esse ich die ganze Wurst und fühle mich als Revolutionär satt und wohl. Am nächsten Morgen ist er verschwunden, die Revolution scheint ihn zu brauchen. Am Abend kommt er wieder, seine revolutionäre Ausrüstung durch zwei Karabiner bereichert, die er, na20
Altertümliche Brille ohne Bügel an den Seiten („Nasenkneifer").
Das Portal des Schlosses mit dem Balkon (zu großen Teilen rekonstruiert) wurde in die Fassade des 1964 errichteten Staatsratsgebäude der D D R integriert.
21
53
türlich mit dem Lauf nach unten, um die Schultern geworfen hat: „Hier ist einer für dich, nimm auch ein paar Patronen." Gestern hörte ich die ersten Schüsse in meinem Leben und heute habe ich bereits ein Gewehr in der Hand. Auch für meinen Bruder scheint es eine Premiere zu sein. In der Dunkelheit steigen wir mit unseren Waffen aufs Dach. Wir laden und schießen in die Luft, meine zweite Patrone bleibt im Lauf stecken. Menschen spähen ängstlich aus verschlossenen Hoffenstern. Unsere Mutter erscheint, wohl Böses ahnend, auf dem Dach, sieht ihre Söhne mit Gewehren und rast die Treppen wieder herunter. Nach wenigen Augenblicken kommt sie mit einem Nachbarn zurück, einem breitschultrigen Soldaten: „Macht keinen Unsinn Jungs, gebt die Schießknüppel her." Mein Bruder erhebt schüchtern Einspruch: „Aber ich bin doch auch Soldat." Der Nachbar sieht ihn mitleidig an: „Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben, wenn sie Kinder wie dich einzogen." Wir lassen uns widerstandslos entwaffnen - mir aber versetzt der Nachbar in Uniform wortlos eine schallende Ohrfeige. Mutter schüttelt traurig den Kopf: „Was man so mit seinen Jungs durchmachen muss."
*
11. November [1918]. Wieder verteile ich Extrablätter des Vorwärts: Waffenstillstand! Die Menschen machen lange Gesichter, als sie Bedingungen dieses Waffenstillstandes lesen: „Na da sitzen wir ja mit den 14 Punkten Wilsons schön in der Scheiße." — „Der Kaiser ist doch weg, wir machen Revolution, dafür müssten wir doch bessere Bedingungen bekommen." - „Ist ja alles egal, Hauptsache der Krieg ist aus." Ich komme mit meinen Vorwärts-Extrablättern in die Zimmerstraße. Die Spartakisten haben den kaisertreuen Lokal-Anzeiger besetzt und drucken hier ihre Rote Fahne. Wo noch vor drei Tagen Hofberichte gedruckt wurden, rollt aus den Rotationsmaschinen 54
das Blatt der von Liebknecht verkündeten Sozialistischen Republik. Auch die Rote Fahne wird als Extrablatt verteilt, mit einem Appell Liebknechts. Als zwei Spartakisten mich mit meinen Vorwärts-Blättern erspähen, kommen sie auf mich zu: „Gib den Dreck her." Ein kräftiger Stoß, und meine Extrablätter fliegen davon. Ich war von der Demokratischen Republik in die Sozialistische Republik geraten. Viele große Zeiten später steht an der gleichen Stelle ein Stück der Berliner Mauer. Hier endete meine Karriere als Zeitungsjunge.
*
Niemand weiß, wer nun eigentlich regiert. In der Wilhelmstraße sitzt die Regierung Ebert-Scheidemann. Im Reichstag tagen Soldatenräte, das Schloss halten revolutionäre Matrosen besetzt, viele Berufsoffiziere haben sich nach Potsdam und Lager Döberitz zurückgezogen. Der Schwarzmarkt wird zum offenen Markt und versorgt sich vor allem aus geplünderten Militärlagern. Die Schulen sind von rückflutenden Soldaten requiriert, wir Vierzehnjährigen ziehen durch die Straßen. Demonstranten marschieren hinter roten Fahnen, auf den Bürgersteigen stehen Bauchhändler mit Schokolade und Zigaretten und amerikanischem Kaugummi. Am dichtesten umlagert sind die Glücksspieler, die auf einem Papptisch mit drei Spielkarten jonglieren und mit ihrem Kümmelblättchen den Dummen das Geld abnehmen. An allen öffentlichen Gebäuden kleben Plakate „Schützt das Volkseigentum". Die Stadt wimmelt von Kriegsverletzten, die bisher in Lazaretten versteckt gehalten wurden. Uberall hocken die „Schüttler", Gasvergiftete, deren ganze Körper zittern. Viele Vorübergehende stecken ihnen Geld zu - Schütteln wird zum Beruf. Die blaue Polizei mit ihren Pikkelhauben und langen Säbeln ist völlig verschwunden, niemand scheint sie zu vermissen. 55
„Brot und Frieden" verspricht ein großes Banner, das vom Brandenburger Tor herunterhängt. Einzug rückkehrender Fronttruppen, begrüßt von Friedrich Ebert und einem großen Ehrenkomitee. Ebert hat endlich eine Armee, die die Gewehrläufe nach oben hält. „Ich grüße Euch, die Ihr unbesiegt vom Schlachtfeld kommt." Aber auch diese Armee will nicht mehr länger Soldaten spielen und löst sich schnell auf. Alle Parteien scheinen sich einig: Die herumstrolchenden Kinder müssen von der Straße. Die Schulen sollen wieder aufgemacht werden. Der gekrönte Preußenadler weht weiter vom FriedrichWilhelms-Gymnasium. Niemand hatte befohlen, die Flagge einzuziehen. Ich komme mit einem roten Knopf am Anzug. „Was hast du da", schreit mich ein Lehrer an. Ich blicke fragend. „Das rote Ding da, mach's sofort ab." Ich stecke den Knopf in die Tasche. „Komm mir nicht wieder mit solch rotem Zeug." Auf dem Schulhof gibt es dann eine Prügelei. „Du Spartakist", beschimpft mich ein Mitschüler, und zum ersten Male in meinem Leben höre ich einen fanatischen Schrei: „Du dreckiger Jude." Ich schlage zu und ernte für meinen Zorn ein tiefblaues Auge.
*
Weihnachten 1918. Ein buntgeschmückter Tannenbaum ohne Lichter, denn Kerzen sind kaum aufzutreiben, und die paar Stumpen müssen aufgehoben werden, falls wieder einmal die Elektrizität streiken sollte. Gestern haben Regierungstruppen auf die Matrosen im Schloss und Marstall geschossen, aber sie hörten schnell auf zu knallen, als sie von einer riesigen Menschenmenge umringt wurden, die sie zu entwaffnen drohte. Schließlich zogen die Truppen ab, und heute marschieren rote Matrosen an der Spitze einer riesigen Demonstration in die Lindenstraße und besetzen das Vorwärtsgebäude. Flugblätter mit dem Zeitungskopf 56
„Roter Vorwärts" werden verteilt: „Alle Macht den Arbeitern und Soldaten. Nieder mit der Ebert-Scheidemann-Regierung." Ich stehe am eisbeschlagenen Fenster des ungeheizten Zimmers und sehe mir das Getümmel um die vielen Straßenredner an, die die soziale Revolution verkünden. Das ist eine eigenartige Weihnachtsstimmung. Der Vorwärts bleibt besetzt, aber in den nächsten Tagen wird es ruhiger, die Demonstrationen werden weniger. Bewaffnete Spartakisten riegeln den Straßenblock ab. Außer einigen stämmigen Matrosen sind es meist junge Burschen in Phantasieuniformen mit roten Binden und Patronengurten um die Schultern. Die Anwohner der Lindenstraße gewöhnen sich an ihren seltsamen Belagerungszustand. Jedes Haus hat seinen Hausspartakisten, der frierend Wache steht, ohne recht zu wissen, wen oder was er eigentlich zu bewachen hat. Unser Portier bringt unserem Mann gelegentlich warmen Kaffee. Die Revolutionäre haben die Dächer besetzt, und Dachschützen melden sich gelegentlich durch Gewehrgeknatter. Hausfrauen mit ihren Einkaufstaschen gehen unbekümmert durch die Sperrketten in die nahe Markthalle, und brave Bürger gehen zur Arbeit, wenn überhaupt Arbeit zu finden ist.
*
Wieder einmal marschiert eine Demonstration mit roten Fahnen durch die Straße und begrüßt stürmisch die Genossen, die das Vorwärtsgebäude halten: „Berlin ist rot - es lebe die Revolution." Die Meldungen von der Außenwelt sind spärlich. Es gibt ja noch keinen Rundfunk, Zeitungen sind kaum zu haben, das Telephon funktioniert meist nicht. Aber wilde Gerüchte sickern aus der Außenwelt durch die Blockade unseres Straßenblocks: Gustav Noske ist Kriegsminister geworden und hat die Freikorps, die sich unter alten Offizieren bilden, um Hilfe angerufen. Die Freischärler sollen in Zossen, etwa 30 Kilometer vor Berlin stehen. 57
Am Silvesterabend gehen bunte Leuchtraketen hoch, Salutschüsse dröhnen, die Revolutionäre feiern. Ich sehe begeistert das erste Riesenfeuerwerk meines Lebens. Irgendwo strahlt ein Scheinwerfer in den Himmel. „Prost Neujahr 1919!" Die Schule sollte am 5. Januar [1919] wieder beginnen. Statt dessen gibt es kein Licht und keine Straßenbahn. „Das Revolutionskomitee hat den Generalstreik ausgerufen", verkündet unser Hausspartakist. Mein Bruder, der seit Tagen verschwunden war, taucht auf und teilt mir wichtig mit, dass er im Reichstag mit den Soldatenräten wohne. Irgendwo hat er Löhnung bezogen und schenkt mir ein paar Mark. Ich will ihn natürlich zu seinem Regierungssitz begleiten, aber er scheint keinen kleinen Bruder um sich haben zu wollen. Ich folge meinem Bruder ein paar Schritte, dann ist er in der Menge verloren. Die Straßen sind schwarz von Menschen, aber das ist nicht mehr die harmlose Revolution vom 9. November. Hier marschieren bewaffnete Kolonnen und versuchen, öffentliche Gebäude und vor allem die Zeitungen zu besetzen. Das Mossehaus, in dem das liberale Berliner Tageblatt und die noch liberalere Berliner Volks-Zeitung gedruckt werden, wird von regierungstreuen Soldaten und ein paar Redakteuren gegen die belagernden Spartakisten verteidigt, muss aber später kapitulieren. Auch Ullstein war besetzt. Mosses Fassade zeigt noch viele Jahre die Pockennarben von Gewehreinschüssen. Von der Höhe des Brandenburger Tores starren Maschinengewehre. Demonstrationen marschieren kreuz und quer, oft aneinander vorbei. Demonstranten und Gegendemonstranten sind Spartakisten und Sozialisten, Soldaten und Bürger. Dazwischen machen Bauchhändler gute Geschäfte, denn marschieren macht hungrig. „Kaninchenwurst", ruft ein Händler „parteilose Kaninchenwurst". Ich lege meinen Teil der Löhnung meines Bruders in Wurst an und habe noch Geld für eine Rippe Schokolade. Kauend ziehe ich durch die Wilhelmstraße. Vor den Regierungsgebäuden stehen Arbeiter und Soldaten anscheinend führerlos herum. Viele von ihnen sind bewaffnet. Die Regierung Ebert-Noske hat Berlin 58
verlassen. Es lohnt sich wohl nicht, leere Gebäude anzugreifen oder zu verteidigen. Das Vorwärtsgebäude ist inzwischen zu einem Heerlager geworden. Statt einiger Wachtposten ist die Straße plötzlich mit Barrikaden aus Zeitungspapierrollen abgeriegelt. Ich kann einen Posten überzeugen, dass ich tatsächlich in Nummer 105 wohne und schlüpfe durch einen Engpass. Meine Mutter: „Wo warst du denn? Ich habe solche Angst gehabt!" - „Ich kann doch nicht dauernd zu Hause sitzen, wenn draußen Revolution ist." - „Von nun ab lass ich dich nicht aus den Augen, die da draußen können ihre Revolution ohne dich machen." Es ist gut, dass wir unsere Kerzenstumpen nicht am Weihnachtsbaum vergeudet hatten. Bei trübem Kerzenschein sitzen wir und löffeln eine auf dem Spirituskocher gewärmte Suppe und essen schwarzes Brot. Auf die Straße kann ich in den nächsten Tagen tatsächlich nicht mehr, wir sind völlig abgeriegelt. Hin und wieder knallt ein Schuss, gelegentlich Maschinengewehrfeuer. Noske soll im Anmarsch sein. *
[11. Jan. 1919] Mit einem furchtbaren Donner werde ich aus dem Bett geworfen, ein Fenster ist zersplittert. Ich höre eine Kette dumpfer Explosionen und das Klirren weiterer Fensterscheiben. Das ist nicht mehr übliches Gewehrgeknatter — das sind schwere Kanonenschüsse. Noske marschiert gegen den Spartakusaufstand. Behutsam schleiche ich mich zu einem auf die Straße gehenden Fenster und luge aus mir sicher scheinender Deckung durch die Ritzen der herabgelassenen Jalousie. Die ganze Front des Vorwärtsgebäudes auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein riesiges Loch. Die als Barrikaden benutzten Zeitungspapierrollen vor dem Portal sind zu Fetzen zerschossen. Freischärler mit aufgepflanzten Bajonetten springen, Handgranaten werfend, über die Reste der Barrikaden. Aus einem hohlen 59
Fenster hängt eine weiße Fahne, aber das Schießen geht weiter, verstummt zuweilen und wiederholt sich in kurzen Salven. Drei junge Männer laufen aus den Trümmern, sie scheinen unbewaffnet. Zwei Soldaten mit weißen Armbinden reißen ihnen ihre roten Armbinden von den Armen: „Hände hoch." Die Soldaten führen ihre Gefangenen an die nächste Straßenecke. Da stehen sie, die Hände noch immer erhoben, an der Hauswand. Über den leeren Fahrdamm schreitet gelassen ein Offizier in schneidiger Gardeuniform auf sie zu, zieht seinen Revolver und schießt aus einem Meter Entfernung die erstarrt Stehenden nieder. Dann macht er eine Kehrtwendung und marschiert, ohne sich umzusehen ab. Er steckt die Waffe in die Revolvertasche zurück und zieht sich weiße Handschuhe an. Die drei Toten liegen den ganzen Tag, wie sie gefallen sind, auf der leeren, nassen Straße. Es hat an diesem Tage viele tausend Tote gegeben. Fast die gesamte Vorwärtsbesatzung, etwa 3 0 0 Mann, wurde standrechtlich erschossen. Die Freikorps erlitten kaum eigene Verluste, es war ein leichter Sieg gegen undisziplinierte, schlecht bewaffnete Massen. Auch unser Hausspartakist wurde Opfer. In dieser „Befreiungsschlacht um Berlin" habe ich nur diese drei Toten gesehen. Aber der dreifache Mord an der Straßenecke - der einzige Mord, dessen direkter Augenzeuge ich jemals wurde - bedeutet einen entscheidenden Einschnitt in meinem vierzehnjährigen Leben. Viel furchtbarer als der Anblick der armseligen Leichen war für mich das höhnische Gesicht des Mörders in seiner Paradeuniform mit silbernen Epauletten und seine weiß behandschuhten Hände. Ein Gesicht, das ich niemals vergessen kann. Es war kein Mord in der Leidenschaft des Kampfes, es war kein Mord aus glühendem Hass - es war der arrogante Mord berechneten kalten Terrors. *
60
Die Lindenstraße ist „befriedigt", wir gehen wieder in die Schule und sitzen in unsern Wintermänteln in den kalten Klassen. Manche Lehrer versuchen den Unterricht zu führen, als ob das, was draußen geschieht, uns gar nichts anginge. Der Geschichtslehrer sucht uns, fern jeder Zeitgeschichte, die Regierungsdaten der Hohenstaufenkaiser einzubläuen. Doch draußen gehen die Säuberungsaktionen weiter. Die von Noske gerufenen Freikorps haben in Hotels ihre Hauptquartiere aufgeschlagen und fühlen sich als Befreier. Die Leiche Karl Liebknechts wird aus dem Landwehrkanal gezogen, sein Kopf mit einem Gewehrkolben eingeschlagen. Rosa Luxemburg, mit Liebknecht die Führerin der niedergeschlagenen Spartakusbewegung, wird erschossen aufgefunden. 22 Noske hat den Kriegszustand erklärt. „Bluthund Noske" steht mit Riesenlettern an den Mauern. An unserer Hauswand klebt ein Plakat von Max Pechstein: ein kleiner nackter Junge hält eine rote Fahne eng in seinen Armen: „Erwürgt die junge Freiheit nicht." Ein Freischärler nimmt sein Seitengewehr und zerfetzt das Kind auf dem Plakat. Eine Kopie des Pechsteinplakates hing fast ein halbes Jahrhundert später in der Plakatausstellung des „Museum of Modern Art" in New York. *
Mein Bruder ist wieder einmal verschwunden. Seine Reichstagsperiode ist längst vergessen. Das Gebäude ist fest in der Hand der Reinhard-Brigade 23 . Es gibt keine Soldatenräte mehr. Das
22
A m 15. J a n u a r 1919 wurde Karl Liebknecht erschossen, Rosa Luxem-
burg mit Gewehrkolben zusammengeschlagen und anschließend ebenfalls erschossen; ihre Leiche wurde erst E n d e M a i 1919 im Landwehrkanal gefunden. 23
Freikorps, benannt nach seinem K o m m a n d e u r Wilhelm
(1869-1955), 1918/19 K o m m a n d a n t von Berlin.
61
Reinhard
Plakat von Max Pechstein 1919
Verschwinden besorgt diesmal ernsthaft. Ich frage bei seinen Freunden herum; niemand hat ihn seit über einer Woche gesehen. Unsere verzweifelte Mutter ruft Onkel Otto zu Hilfe. Der hat schon längst Schluss mit dem Soldatenleben gemacht, seine Uniform ausgezogen und Unterschlupf bei irgendeiner Regierungsbehörde gefunden. „Komm, wir wollen ihn suchen", sagt Otto zu mir, mehr um meine Mutter zu beruhigen als in wahrer Hoffnung auf Erfolg. Wir gehen zuerst, wie jeder gute deutsche Bürger, zur Polizei. Achselzucken: „Wir haben Tausende von Vermissten. Gehen Sie doch mal ins Leichenschauhaus." Wir fahren in die Chausseestraße und starren hinter Glas auf lange Reihen nackter Körper, ihre an ihnen gefundenen Habseligkeiten in einem kleinen Bündel auf den Bauch gelegt, eine Nummer über dem Kopf. Viele Körper zeigen Schusswunden, mancher Kopf ist eingeschlagen. Vor allem Frauen drängen sich vor den Fenstern. Ich weiß nicht, wo das Grauen größer ist - hinter dem Glas oder in den ängstlichen Gesichtern der Suchenden, die sich langsam an den Leichen vorbeischieben. Nein, wir haben meinen Bruder hier nicht gefunden. Aber Mutter fand ihn, sie hatte die Gefängnisse abgeklappert - er saß in Plötzensee. Sie brachte ihm ein paar Lebensmittel. Er war auf dem Potsdamer Platz verhaftet worden, als er eine Rede gegen den Belagerungszustand schwang. Jetzt biss er herzhaft ins Brot und sagte zu dem Gefängniswärter: „Passen Sie auf, da ist eine Feile drin." „Sei nicht so frech", mahnte ihn Mutter. Nach drei Wochen hatten sie vergessen, warum sie ihn eigentlich eingesperrt hatten und setzten ihn einfach vor die Tür. Das war sein letztes revolutionäres Abenteuer. Er zog in das Atelier eines Freundes, verliebte sich in Sonja, und da Revolution und Liebe nicht allzu gut zueinander passen, sucht er sich, wenn auch nicht einträgliche, so doch friedlichere Berufe. *
63
Friedensvertrag von Versailles. „Die Hand soll verdorren, die diesen Schandvertrag unterzeichnet", rief Reichskanzler Scheidemann und trat zurück [20. Juni 1919]. Diese „verdorrte Hand" schützte ihn später nicht vor einem Salzsäureattentat Rechtsradikaler.24 Die Militärs schlugen vor, dass „Bluthund" Noske mit ihrer Unterstützung eine Militärdiktatur errichten und den Vertrag ablehnen sollte. Hindenburg wurde angerufen, doch er sah bewaffneten Widerstand als Selbstmord an. Das „Diktat von Versailles" wurde vom Reichstag unter Protest angenommen, und der Zivilist Erzberger unterzeichnete ihn. Der Lohn war eine Mörderkugel.25 Doch Friede bedeutete für uns erst einmal, dass die Blockade aufgehoben wurde. Massen überschüssiger alliierter Lebensmittel, vor allem aus den Lagern der abziehenden Amerikaner, strömten in die Markthallen und fanden oft ihren Weg auf den immer noch blühenden schwarzen Markt. Wir kamen in den Besitz einer scharf gesalzenen, leicht anrüchigen amerikanischen Speckschwarte. Das gab einen Kübel ausgelassenes Fett und viele Grieben. Für uns, und wohl für jeden kleinen Mann, hieß Friede kaum abgetretene Gebiete und in Schmach verdorrte Hände, sondern Fressen - mag es auch nur ranziger Speck sein, den die Berliner „Affenfett" tauften. *
Es gab wieder regelmäßig Schule. Das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium wurde von „königlich" in „staatlich" umgetauft, aber die
24
A m 4. J u n i 1922; Scheidemann überlebte schwer verletzt.
Der Vertrag wurde von Reichsaußenminister H e r m a n n Müller (SPD) und Reichsverkehrsminister Johannes Bell (Zentrum) a m 28. Juni 1919 unterzeichnet. Matthias Erzberger hatte a m 11. Nov. 1918 den Waffenstillstand unterzeichnet. N a c h d e m er bei einem Attentat am 26. J a n u a r 1920 nur leicht verletzt worden war, wurde er a m 26. A u g u s t 1921 ermordet.
25
64
Gipsfigur des Kaisers schmückte noch immer die Aula neben den Büsten von Cicero und Caesar. Ich war Obertertianer und lernte jetzt in der Geschichtsstunde, dass Deutschland, im Felde unbesiegt, einen Dolchstoß in den Rücken erhalten habe. Die Dolchstoßlegende fand frühe Verbreitung. Der Erdkundelehrer verkündete: „Da Juden kein Vaterland haben, können sie auch keine Geographie." Als ich daraufhin die Urstromtäler der Deutschen Tiefebene in richtiger Reihenfolge herunterrasselte, behauptete er wütend, mir sei vorgesagt worden. Studienrat Wittekind begann seinen englischen Unterricht mit der Erklärung: „Wir müssen England ewig hassen." „Warum lernen wir dann Englisch?" - „Weil man die Sprache des Feindes kennen muss, um ihn besser hassen zu können." Derselbe Studienrat lehrte auf französisch: „Wir kommen zu dem unregelmäßigen Verb vouloir - wollen. Übersetzt: ,Ich will den Reichsfinanzminister töten'" - „Je veux tuer le ministre des Finances". Durch den Mord an Erzberger wurde sein Wunsch bald erfüllt. Und dann hatten wir den Lateinlehrer, der den alten Cato frei zitierte: „Ceterum censeo Galliam esse delendam." Cato hatte es auf Karthago abgesehen, unser Lateinlehrer wollte Frankreich zerstören. Die ersten Hakenkreuze tauchten auf den Rockaufschlägen älterer Schüler auf. Kein Lehrer hatte etwas dagegen einzuwenden, wie etwa damals bei meinem roten Knopfe. Einer der Hakenkreuzler schlug mir das Gesicht blutig. Als ich mit geschwollener Nase nach Hause kam, lief Mutter zum Studienrat Wittekind. Der schüttelte den Kopf: „Ich wusste gar nicht, dass Ihr Sohn so empfindlich ist." Die Umschulung in die Bertram-Realschule war eine Erlösung, ich war endlich gleichberechtigt. Viele der jüngeren Lehrer waren Frontschweine gewesen und hatten keine großen Rachegedanken, vor allem hatte keiner seinem königlichen Beamtentum nachzutrauern, die Schule war städtisch.
65
In der großen Pause gab es Quäkerspeisung. Zwar nur bis zum Alter von vierzehn Jahren. Aber auch wir Fünfzehnjährigen waren hungrig. Der Ausweg war schnell gefunden; wir wurden zum Kesselauswaschen abkommandiert, und die Mütter, die das Essen verteilten, sorgten dafür, dass genügend zum Auskratzen übrig blieb. *
Kapp-Putsch. März 1920. Gerüchte schwirren durch die Stadt: Die Brigade Ehrhardt ist im Anmarsch! Wir werden aus der Schule nach Hause geschickt, natürlich gehen wir nicht nach Hause, man will doch schließlich wissen, was los ist. Noch ehe wir die ersten Putschisten sehen, laufen Männer durch die Straßen und kleben noch vom Druck feuchte Plakate an die Häuserwände: „Arbeiter. Parteigenossen. Der Militärputsch ist da. Die Arbeit eines ganzen Jahres steht in Gefahr. Verlasst die Arbeitsstätten Generalstreik!" Inzwischen marschieren die Freischärler, schwarz-weiß-rote Fahnen schwingend, über die Heerstraße in den Tiergarten. Sie haben weiße Hakenkreuze auf die Stahlhelme gemalt und singen: „Hakenkreuze am Stahlhelm, schwarz-weiß-rotes Band— Die Brigade Ehrhardt werden wir genannt." Im Tiergarten beziehen sie Biwaks. Von hier marschieren einzelne Kompanien zur Wilhelmstraße, aber die Ebert-Regierung ist rechtzeitig in Richtung Stuttgart geflüchtet. Eine andere Kompanie besetzt das Vorwärtsgebäude, dessen Fassade nach der letzten Besetzung gerade ausgebessert worden war. Vorerst bleibt hier alles ruhig. Wir Jungens lungern herum, auf der anderen Seite, vor dem Vorwärts, tun einige Soldaten das
66
Gleiche. Ein Putschist mit seinem Hakenkreuz am Stahlhelm, den Gürtel voller Handgranaten, das Gewehr umgeschlungen, kommt auf mich zu: „Sag mal Junge, wo ist die nächste Synagoge?" Ich sehe ihn besorgt an — wollen die Hakenkreuzler die Synagoge besetzen? Der junge Soldat sieht dabei recht freundlich drein: „Heut ist Sonnabend, ich will beten." Viele Jahre später habe ich diesen Freischärler wieder getroffen, er war erfolgreicher Pressezeichner geworden, und ich kaufte ihm als Redakteur Zeichnungen ab. „Waren Sie nicht beim Kapp-Putsch dabei?" „Ja - ich hatte doch keine Ahnung, worum es ging. Ich war damals nach dem Kriege aus dem Baltikum zurückmarschiert, und wusste nicht wohin. Von Politik hatte ich keinen Dunst. Sie haben unsere Truppe nach Zossen geschickt, und da bin ich geblieben. Und eines Tages hieß es ,Marsch auf Berlin'." „Haben Sie nun gebetet?" „Natürlich, in der Synagoge in der Lindenstraße. Der Vorbeter hat mich in die erste Reihe gesetzt. Ich muss gestehen, alle waren etwas ängstlich, als sie mich so schwerbewaffnet beten sahen, den Helm mit dem Hakenkreuz auf dem Kopfe." In der Lindenstraße geht es wieder einmal hoch her. Die Straße ist schwarz von Menschen. Im Tor des Vorwärts knien drei Putschisten hinter einem Maschinengewehr. Die drehen den Lauf von einer Seite zur anderen, und wenn die Menge auf der einen Seite zurückweicht, drängt sie auf der anderen vor. Die Soldaten haben mehr Angst als die Unbewaffneten; sie wissen, dass ihr erster Schuss der letzte sein würde, denn kräftige Arbeiter haben ihnen den Rückweg abgeschnitten. Übrigens ist der Generalstreik total, und die derzeitigen Eroberer des Vorwärts haben noch nicht einmal Wasser. Plötzlich rennen Menschenmassen vom Belle-Alliance-Platz heute Mehringplatz— schreiend in die Nebenstraßen. Bajonettspitzen blinken auf, eine kleine Truppe Putschisten ist zum
67
Bajonettangriff vorgegangen — Richtung: ihre eingeschlossenen Kumpanen im Vorwärtsgebäude. Auch wir rennen davon, aber das Ganze sah gefährlicher aus, als es schließlich wirklich war. Hinter drei Sturmtrupplern schleppen vier Mann im Laufschritt zwei Säcke Brot an. Es ist die Durchbruchschlacht einer Proviantkolonne. Freischärler müssen essen, wenn sie auch schon längst nicht mehr singen. Am nächsten Tage zieht Ehrhardt mit seiner Brigade recht kleinlaut ab. Der Generalstreik hat den Putsch gebrochen. Diktator Wolfgang Kapp flieht nach Schweden. Der Kapp-Putsch wäre blutlos verlaufen, wenn nicht einige wütende Freischärler beim Abzug durchs Brandenburger Tor auf die höhnisch hinter ihnen her lachende Menge eine Maschinengewehrsalve abgegeben hätten. *
Wir hatten acht Tage schulfrei — die Abgangsexamen für die Obersekundareife mussten beschleunigt werden. Nach der mündlichen Prüfung erklärte der Examensleiter: „Dies ist die letzte Kriegsklasse, an der ist doch Hopfen und Malz verloren." Und er ließ keinen durchfallen.
68
„Meine Herren, seien Sie unbesorgt. Die Notenmaschinen laufen wieder
in drei Schichten Tag und Nacht."
(Rudolf Havenstein, Reichsbankdirektor)
Lehrling bei Orenstein & Koppel — Eisenbahnbau. Ich sitze vor dicken Büchern in der Kontrollbuchhaltung und sehe erstaunt, dass mir die Ziffern davonrennen. Eingetragen werden sollen mit schwarzer Tinte die Preise des Angebots, der Lieferungspreis und schließlich die Zahlung. Veränderungen in diesen Zahlen müssen mit roter Tinte verbessert werden. Aber die rote Tinte quillt schnell über, die Kontrollbuchhaltung gerät aus der Kontrolle, und der Angestellte, der meine Eintragungen kontrollieren soll, gibt diesen Versuch bald auf. Aber nicht nur die Ziffern in meinen dicken Büchern laufen davon, sondern auch die Preise in den Läden. Die Angestellten murren und sprechen von Streik. Das ist aufregend. Drei ganze Wochen stehe ich im deutschen Wirtschaftsleben, noch nicht einmal mein erstes Lehrlingsgehalt in Höhe von 50 Mark pro Monat ist fällig, und plötzlich gehen Handzettel
69
durch die Büros: Streikabstimmung! Dürfen Lehrlinge auch mit abstimmen? Der Betriebsrat entscheidet: Ja! Denn da die Firma, als Lehrlingsmühle verschrieen, genauso viele Lehrlinge wie Angestellte beschäftigt, bilden diese Lehrlinge einen wesentlichen Teil des kaufmännischen Betriebes. Nach Büroschluss versammeln wir uns im großen Saal eines Bierrestaurants, rund 1 5 0 0 M a n n stark. Der Betriebsrat hält feurige Reden, Wahlzettel werden verteilt, Wahlurnen stehen an den Türen. Natürlich stimme ich stolz für meinen ersten Streik, der dann auch mit überwältigender Mehrheit beschlossen wird. A m nächsten Morgen stehen Streikposten vor dem majestätischen Verwaltungsgebäude am Landwehrkanal. Die übrigen Streikenden bevölkern die Straßenecken und wissen nicht recht, was tun. Polizei erscheint und schiebt uns weiter vom Gebäude ab. Alles bleibt friedlich. Der Betriebsrat rät uns, nach Hause zu gehen. Dies soll ein disziplinierter Streik sein, schließlich sind wir doch Streikende mit weißem Stehkragen, wenn es auch in meinem Falle ein Papierstehkragen ist. Auch der geringste Zusammenstoß mit der Polizei muss vermieden werden. A m nächsten Morgen tröpfelt die Belegschaft pünktlich wieder in die Versammlungshalle und wartet. Ein Vertreter des Betriebsrates verkündet: „Wir verhandeln mit der Betriebsführung. Es steht gut." W i r warten, essen unser mitgebrachtes Frühstücksbrot, rund herum wird Skat gedroschen. Ich gestehe einem älteren Streikgenossen stolz, dass dies nach dreiwöchigem Berufsstand mein erster Streik ist. Er sieht mich erstaunt an: „Ich bin jetzt 25 Jahre bei Orenstein & Koppel, und das ist auch mein erster Streik. Wer hätte denn so etwas früher gewagt." Um die Mittagszeit erscheint der Betriebsrat und verkündet von der Bühne: „Wir bringen Euch 50 % Gehaltserhöhung. Die Gehälter werden nicht mehr monatlich, sondern wöchentlich ausgezahlt, die beiden Streiktage werden mitbezahlt." Beifallsklatschen. Der Beschluss zur Arbeitswiederaufnahme erfolgt durch Handerheben. Die Gegenprobe zeigt nur einige unverbesserlich Unzufriedene.
70
Um unsere Disziplin zu zeigen, treten wir vor dem Lokal geschlossen an. Im Marschschritt mit Gesang geht es zurück in den Betrieb, der Betriebsrat vorne weg. Das Haupttor steht offen, um uns aufzunehmen - an Alltagen dürfen nur Prokuristen diesen Eingang benutzen. Wir fühlen uns als Sieger. Aber in rauer Wirklichkeit war es kein Sieg. Die Geldentwertung schritt inzwischen viel weiter fort als unsere Gehaltserhöhung, und mit steigender Inflation kamen wir tiefer und tiefer ins Hintertreffen. Diese Inflation begann allmählich und fraß sich, von fast allen unverstanden, immer stärker in uns hinein. Zuerst waren viele Menschen sogar stolz, so viel Geld wie noch nie in der Tasche zu haben. Es war ein so ganz neues Erlebnis, einen richtigen blauen Tausendmarkschein von Vorkriegsqualität mit Kaiserkrone und dem bärtigen Kaiser Wilhelm I. als Wasserzeichen auf weißem Grund zu besitzen. Denn im ersten Stadium der Inflation wurden die alten Banknoten wacker weiter gedruckt. Als ich in meinen ersten Urlaub mit Freund Willy zur Wanderfahrt durch den Thüringer Wald aufbrach, kostete der Dollar 100 Mark: wir hatten genau abgezähltes Geld, 30 Mark pro Tag, in der Tasche. Die ersten Tage ging alles gut, wir wanderten froh gelaunt drauf los. Nach einer Woche glaubten wir in eine teure Gegend geraten zu sein, selbst das Brot war teurer als auf der anderen Seite der Berge. „Weißt du, hinter den Bergen war's vorgestern viel billiger, hier kostet allein eine Herberge 30 Mark. Unser Geld reicht ja nicht mehr, wir kehren besser um", meinte Willy. Wir machten kehrt, aber auf der anderen Seite war es auch nicht mehr billig, und den letzten Tag unseres Urlaubes mussten wir bargeldlos in einer dachlosen Burgruine schlafen. Glücklicherweise hatten wir Rückfahrkarten für den Bummelzug von Saalfeld an der Saale, vierter Klasse. Der Dollar war während unserer Wanderung auf 300 Mark gestiegen. *
71
Die gutbürgerliche Pension in der Lindenstraße schloss. Die Preise, die die Mieter zahlen konnten, hielten nicht mehr der Teuerung stand. Wir zogen in zwei möblierte Zimmer mit Küchenbenutzung nach Charlottenburg. Bald wurde Mutter krank: Schwindsucht, ausgelöst durch jahrelange Unterernährung. Sie brachte seitdem die meiste Zeit in Krankenhäusern und Lungensanatorien zu. Ich musste zu meinem Lehrlingsgehalt dazu verdienen. Da alles verkäuflich war, brachte ich Bücher, Briefmarkensammlung und einen von früherem Reichtum zufällig übriggebliebenen silbernen Suppenschöpflöffel an den Mann. Meine verarmte Tante Clara, die auf 500 000 Mark deutscher Kriegsanleihe festsaß, ließ Jumper im Hausbetrieb stricken, die ich dann an die zahllosen Sekretärinnen meiner Firma verkaufte. Außerdem hatte ich einen Bauchladen mit Zigaretten. *
„Knallt ab den Walther Rathenau, die gottverfluchte Judensau!" Sie haben ihn abgeknallt. 24. Juni 1922: Außenminister Rathenau ermordet! Wenige Stunden später Generalstreik. Mein zweiter Streik, aber diesmal war keine Abstimmung nötig. Mit Hunderttausenden marschiere ich inmitten der gesamten Belegschaft in wütendem Protest an einem Tage der Trauer durch die Straßen. Die Mörder werden nach wilder Jagd gefasst. Einer von ihnen heißt Techow— das ist ein Kind aus meiner Schule. Der Techow war zwei Klassen über mir, ich erinnere mich, ein großer Bulle im Friedrich-Wilhelms-Gymnasium, seine Lehrer werden eine Freude an ihm haben. Der Dollar springt von 500 auf 7 0 0 0 Mark. *
„Willst du Geld verdienen?" fragt Willy. „Ich habe zwei Ballen Herrenanzugstoff an der Hand. Einen Kunden habe ich auch
72
schon, aber ich habe noch nie solche Geschäfte gemacht und brauche moralischen Halt. Erstens musst du mir tragen helfen. Dann stelle ich dich als Besitzer vor, und wenn der Mann zu handeln anfangen sollte, sagst du einfach ,Ich habe kein Interesse an diesem Geschäft' und stehst auf — so etwas zieht immer." „Wo hast du denn den Stoff her?" „Von meinem Onkel." „Warum verkauft der ihn denn nicht selber?" „Für den ist das Objekt zu klein." Dann hat Willy noch einen Geistesblitz: „Du, ich habe einen guten künstlichen Schnurrbart, den kleb dir an, damit du älter aussiehst." Wir schleppen die zwei Ballen zu dem Mann, der den Stoff haben will. Er sieht noch jünger aus als wir und wohnt in einem möblierten Zimmer. Natürlich versucht er zu handeln. Da schreite ich ein, stehe gelangweilt auf und erkläre: „Ich habe kein Interesse an solchen Geschäften." Unser Kunde wird nervös. Im Ganzen stehe ich auf Stichwort dreimal auf und setze mich wieder, es ist schwer zu sagen, ob der Kunde oder Willy nervöser ist. Schließlich mische ich mich direkt ein: „Wollen Sie oder wollen Sie nicht?" Er will, zieht ein Bündel Tausendmarkscheine aus der Tasche und legt seine Hand auf die Stoffballen. Er wird den Stoff sehr bald im Kettenhandel mit gebührendem Aufschlag weiter verhandeln. Vor der Tür gibt mir Willy großzügig einen Schein ab, ich weiß nicht, fürs Tragenhelfen oder fürs Handeln. Ich gebe ihm den Schnurrbart zurück. Am Abend vertanzen wir unseren Gewinn. Er reicht für Fruchtschaumwein auf der Weinterrasse. Die Mädchen schweben uns zu. Am nächsten Tage kehre ich zum Eintopfgericht für Lehrlinge in die Kantine zurück. *
Deutschland kam mit seinen Kriegsreparationszahlungen ins Stocken, Reichskanzler Wirth stürzte. Januar 1923, die Franzosen marschierten ins Ruhrgebiet, um sich ihre Reparationen selber zu
73
holen - ein Dollar kostete 100000 Mark. Die neue Cuno-Regierung erklärte die Politik des passiven Widerstandes und verkündete Landestrauer. Jeder öffentliche Tanz wurde verboten. Es war eine sinnlose Verfügung. Wir waren jung und wollten tanzen, wir wollten nicht unsere Jugend um die Dummheiten anderer Generationen vertrauern. Es war Karneval, Berlin hatte die Saison der Künstlerfeste. Musiker würden das ungeheure Heer der Arbeitslosen noch vermehren, falls das Tanzverbot aufrecht erhalten bliebe. Eine Protestwelle rollte: Deutschland wollte tanzen, und Reichskanzler Cuno wurde zum Kompromiss gezwungen - bis zur Polizeistunde um ein Uhr nachts durfte getanzt werden. Der „Sturm-Ball" war das erste Kostümfest nach Aufgabe des totalen Tanzverbotes, veranstaltet von der Gruppe der Expressionisten, Futuristen und Kubisten, die sich nach der Zeitschrift Der Sturm nannten. Später würden der Ball der Kunstakademie, das Fest der Reimannschule und der Kunstgewerbeball folgen. Künstlerkarten waren heiß begehrt, und nur Auserwählte konnten ihrer habhaft werden. Begehrt nicht nur wegen des billigeren Preises, sondern sie gaben Prestige — wer eine Künstlerkarte eroberte, wusste, dass er dazugehört. Das große Geld wurde von den Bürgerlichen erhoben, die um jeden Preis dabei sein wollten. Sie mussten nicht nur den hohen Eintritt, sondern auch später die Zeche zahlen, denn kein anständiger Mensch konnte in dieser Inflation seinen Wein aus eigener Tasche zahlen. Und die „Raffkes" ließen sich gerne neppen. Zu den Inflationsgewinnlern gesellten sich die Valutastarken, die Berlin wie ein Magnet anzog, eine noch nie gesehene Gelegenheit, die Zeit ihres Lebens feiern zu können. Für den Preis einer Straßenbahnfahrt im eigenen Lande konnten die Ausländer hier eine Orgie haben. Der Preis der Eintrittskarten stieg am schwarzen Markt immer höher, denn die Bälle waren schnell ausverkauft. Viele junge Künstler und Studenten verkauften ihre eigenen Künstlerkarten für Hunderttausende von Mark, wollten aber keinesfalls das Fest 74
missen. Zu ihnen gesellten sich die Heerscharen derer, die gar kein Geld hatten und die selbstverständlich dabei sein wollten. So standen Hunderte Kostümierte vor den Toren der Philharmonie und waren entschlossen, den „Sturm-Ball" zu stürmen. Doch die Festleitung hatte ihre Vorsorge getroffen; eine Polizeikette war gebildet, nur für Eintrittkartenbesitzer blieb eine enge Lücke. Natürlich hatte ich keine Karte. Rasch erkenne ich, dass gewaltsamer Durchbruch unmöglich ist, obgleich viele Verzweifelte den Versuch wagen. Breitbeinig stehen die Polizisten, einander untergehakt in eiserner Kette. Während die Masse gegen diese Kette drängt und die Verteidiger beschäftigt, lasse ich mich fallen und krieche vorsichtig durch zwei besonders breit gespreizte Polizistenbeine. Der Ordnungshüter merkt nichts, aber sonst haben es wohl viele gesehen, denn als ich sicher auf der anderen Seite bin, erhalte ich eine fröhliche Ovation ehrlicher Kartenbesitzer. Mutig geworden krieche ich in die Kampfzone zurück und ziehe ein hübsches kartenloses Mädchen, das mit großen Augen auf mich blickt, durch dieselben Polizeibeine auf meine Seite. Diesmal ist die Ovation noch größer. „Wie heißt du?" - „Ulli." Der Sieg über die Polizei lohnt sich. Viele Kapellen, jede mit eigenem Rhythmus, spielen heiße Musik; Lichtkegel gleiten über riesige Banner, von Expressionisten, Kubisten, Futuristen, Dadaisten in starken Farben bemalt, und beleuchten ein buntes Kaleidoskop ausgelassen tanzender Kostüme. Lilli hat nicht gerade sehr viel an, der vergoldete Bauchnabel ist der Höhepunkt ihres Kostüms. Von Landestrauer ist hier wenig zu spüren. Meine Partnerin kennt ihre Pflichten. Sie springt in die Logen, gibt beglückten Raffkes einen fröhlichen Kuss und verschwindet mit dem vollen Weinglas, das sie mir strahlend überreicht: „Ich schulde dir ja den Eintrittspreis." Um ein Uhr, einer Stunde, zu der das Fest seinem Höhepunkt zurollt, erscheint ein Herr in schwarzem Anzug auf dem Podium und verkündet: „Polizeistunde." Wildes Gelächter ist die Antwort,
75
die Musik spielt lärmend weiter. Der Herr zieht ab, doch eine halbe Stunde später erscheint ein Dutzend Polizisten und versucht, die Musiker von ihren Stühlen zu treiben. Eine Welle wilder Mädchen umringt die Polizisten und verheddert sie in einen Schlangentanz. Dabei wird den Hütern von Gesetz und Ordnung Alkohol und Alkohol und Alkohol eingeflößt. Die Kapelle zieht ab, Amateure bemächtigen sich der Klaviere, und der Tanz geht über die betrunken zusammensinkenden Polizisten. Es ist drei Uhr geworden. Ein Polizeileutnant erscheint mit Verstärkung: „Ich befehle allen, den Saal sofort zu räumen!" Der scheint es ernst zu meinen. Er lässt die noch nüchternen Beamten eine Kette bilden, ihre Karabiner quer vor dem Bauch, zum Vorrücken bereit. Das Fest wird zur Protestversammlung; ein unwahrscheinliches Bild: Scheinwerfer umspielen die Phalanx der Staatsgewalt, die zum Einschreiten gegen ein Meer schreiender, tobender Kostümierter bereit ist. Die Festleitung sucht zu verhandeln: „Wir können hier nicht fort - seit Stunden fahren keine Straßen- und Untergrundbahnen mehr - draußen ist es hundekalt - wollen Sie, dass sich alle den Tod holen?" Der Leutnant grübelt. Tatsächlich gibt es um diese Stunde in ganz Berlin keinen öffentlichen Verkehr mehr. Autos sind eine Seltenheit, einige klapprige Taxis stehen vor der Tür nur für die wenigsten erschwingbar. Aber Befehl ist Befehl. Er muss das Fest beenden — schließlich haben wir Landestrauer. Der junge Polizeileutnant fasst ein salomonisches Urteil: „Polizisten besetzen die Klaviere - jeder Tanz hat aufzuhören. Die Anwesenden dürfen bis zur Aufnahme des allgemeinen Verkehrs in den Sälen verbleiben. Doch in zehn Minuten müssen alle Lichter gelöscht werden." Ein Jubelschrei aus tausend Kehlen: „Die Polizei soll leben!" Der Leutnant zieht seinen Tschako fester und marschiert ab, einige Polizisten bleiben als Wache zurück. In tiefer Dunkelheit betten sich die Pärchen auf die Tanzböden und in Logen zum fröhlichen Nachtlager.
76
Meine durch die Polizeibeine gezogene Lilli bleibt an meiner Seite und flüstert: „Darf ich mit dir landestrauern?" Am grauenden Morgen meine Frage: „Wann sehen wir uns wieder?" „Niemals, Süßer — ich bin verheiratet - und ich heiße gar nicht Lilli." Mit der ersten Straßenbahn fährt sie davon. Der Dollar kostet 200 000 Mark. Mein Gesamtvermögen in harter Valuta beträgt zehn Dollarcent. *
Meine kaufmännische Ausbildung machte Fortschritte. Ich kam in die Verkaufsabteilung für gebrauchtes Feldbahnmaterial. Die Zentrale verkaufte das Material an die Filialen in der ganzen Welt. Jeder Angestellte hatte einen Lehrling zur Seite. Mein Ressort waren gebrauchte Lokomotiven. Wir hatten ein knappes Dutzend an der Hand, jede von ihnen hatte einen Mädchennamen als Erkennungszeichen und stand auf dem Abstellgleis im Lager Teltow. Im Falle einer Bestellung wurde der Lehrling mit vielen ausgefüllten Formularen zur Lagerverwaltung geschickt; seine Hauptaufgabe war, persönlich nachzusehen, ob die Lokomotive wirklich auf den Gleisen stand. Alles verlief ordnungsgemäß bis zu dem Sommertage, an dem mein Chef, Herr Franzke, in einen vierzehntägigen Urlaub ging und mich allein zurückließ. Schließlich war Hochsommer und nicht jeden Tag wird eine Lokomotive verkauft. Doch kaum ist Herr Franzke fort und ich mache mich an seinem Schreibtisch breit, als ein Telegramm der Auslandsfiliale in Caracas, Venezuela, einläuft: „Lokomotive Τ 3 Elsa sofort versandfertig machen. Eilauftrag, versucht schnellsten Frachter zu erreichen." Ungläubig halte ich das Telegramm in der Hand - Hilfe! Ich habe eine Lokomotive verkauft! Lehrlinge haben nur zum Prokuristen Zutritt, wenn er nach einem Glase Wasser klingelt. Schüchtern klopfe ich an, zeige
77
ihm das Telegramm. Der freut sich: „Na, der Franzke ist nicht da, zeigen Sie mal, was Sie können. Machen Sie die notwendigen Papiere fertig, bestellen Sie das Verpackungsmaterial und machen Sie Dampf, damit alles schnell geht." „Wie bestellt man die Verpackung zum Seetransport einer Lokomotive?" Das kann ich den großen Chef nicht fragen, aber ein Angestellter in der Abteilung, die gebrauchte Kipploren verkauft, hilft: „Rufen Sie bei Schmulz und Hendke an, die liefern uns gewöhnlich die Holzverschalungen, aber ziehen Sie auch Konkurrenzangebote ein, zumindest der Form halber." Bei Schmulz und Hendke antwortet Herr Hendke, am Telephon scheint er ein sehr freundlicher Herr: „Selbstverständlich, wir werden die Lokomotive gleich auf ihrem Lagerplatz ausmessen lassen. Wir rechnen für Sie aus, wie viel Holz Sie brauchen, wir liefern erstklassige Balken ... Übrigens das Übliche ..." „Das Übliche?" frage ich. „Na, mehr geht nicht. Die Sache wird rund zweieinhalb Milliarden Mark kosten ... Sind Sie mit 250 Millionen zufrieden?" Vor Erstaunen kann ich nicht antworten. „Ach so, über die Kontrollangebote brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die ziehen wir für Sie bei befreundeten Firmen ein und schicken sie gleich mit unserem Angebot mit." Das Angebot trifft prompt ein, mit detaillierter Ausrechnung der benötigten Holzmengen, die beiliegenden Konkurrenzangebote sind um Milliarden teurer. Ich schreibe die Bestellung aus, aber ein Lehrling ist ja nicht zeichnungsberechtigt. Der Abteilungsleiter von den benachbarten Kipploren muss neben dem Prokuristen zeichnen. Der liest die Bestellung und fragt mit Augenzwinkern: „Wie viel zahlen Sie für die Unterschrift?" „25 Millionen!" „Na ja, dann werde ich das Ding unterschreiben, — aber vergessen Sie nicht den Chef von der Schienenabteilung. Da Franzke nicht da ist, hat der auch mitzureden." Der Chef von der Schienenabteilung schaut auf die Bestellung und dann lächelnd auf mich. Ich antworte auf die unausgesprochene Frage: „25 Millionen."
78
Der Rechnungschef fordert detaillierte Ausrechnung, wie viel Holz wir brauchen. Schmulz und Hendke geben mir telephonisch schwierige Formeln und Endergebnisse in Kubikmetern. Ich kritzle einige wilde Ziffern dazu, fülle einen großen Bogen mit Zahlen aller Art; der Rechnungschef kontrolliert mit scharfen Augen eines Fachmanns meine schöne Arbeit: „Scheint ja zu stimmen." Seine Initialen auf dem Bogen kosten weitere 25 Millionen. Schließlich bleibt der Lehrling, der mir gegenübersitzt und für sonstiges Feldbahnzubehör verantwortlich ist. Er hat scharfe Augen und Ohren, die sich für 25 Millionen schließen. Es ist ein Eilauftrag, in acht Tagen wird das Holz ins Lager geliefert; die Bezahlung hat sofort zu erfolgen, denn morgen kostet der Dollar bestimmt wieder mehr. Schmulz und Hendke schicken mir per Boten einen dicken Brief: 250 Millionen in Einmillionenscheinen. Ich gehe von einem Chef zum andern und lege still die ihm zustehenden Millionen auf den Tisch, es scheint wie ein gewöhnlicher Zahltag, die Transaktion ist ganz offen, jedes Mal höre ich ein höfliches „Danke". Einhundertundfünfzig Millionen bleiben für mich übrig, eine überlebensgroße Summe: ein dringend benötigter neuer Anzug und ein paar Schuhe, die Monatsmiete, eine kleine Urlaubsreise, und in der Kantine statt des üblichen täglichen Eintopfgerichtes das volle Menü für höhere Angestellte auf viele Wochen. Acht Tage später kommt Herr Franzke vom Urlaub. Ich begrüße ihn freudig: „Herr Franzke, ich habe die Lokomotive Elsa nach Venezuela verkauft, sie ist schon verpackt und versandfertig." Franzke läuft rot an: „Zeigen Sie mir das Aktenstück." Er blättert: „So, Sie haben die Verpackung bei Schmulz und Hendke bestellt. Mensch, können Sie denn nicht rechnen, das sind ja viel zu wenig Balken, die Lokomotive bricht uns ja auf dem Transport zusammen." Zornig ruft er bei Schmulz und Hendke an: „Hören Sie mal, mein Lehrling hat da alles falsch bestellt, das kommt davon, wenn man sich einmal Urlaub gönnt. Liefern Sie sofort 79
noch einmal das doppelte Quantum Balken ... Natürlich das Übliche, was denken Sie denn ...". Nach ein paar Tagen kommt der gleiche Bote von Schmulz und Hendke, er gibt Herrn Franzke einen dicken Brief. Dann winkt mich der Bote hinaus: „Herr Hendke schickt Ihnen hier auch einen Brief; ich soll Ihnen sagen, Sie hätten gar nichts falsch gemacht." Auf dem W.C. öffne ich den Umschlag - 25 Millionen Nachzahlung. Das sind nur noch zwei Dollar. Ein paar Tage später kommt auch Herr Franzke mit einem neuen Anzug. Franzke sprach nur noch dienstlich mit mir und sorgte dafür, dass ich schnellstens aus seinem Ressort versetzt wurde. Er sorgte, wie ich später erfuhr, auch dafür, dass meine Personalakten ein schwarzes Mal erhielten - wegen kaufmännischer Unfähigkeit. Das Resultat: Strafversetzung in eine Buchhaltung. Wenige Monate später flog auch Franzke. Er hatte versucht, die Lokomotive Τ 3 Frieda unter der Hand schwarz auf eigene Faust zu verkaufen. Das war dem Prokuristen nun doch zu viel gewesen. Elsa war die einzige Lokomotive, die ich in meinem Leben verkauft habe. Ich habe noch andere Dinge verkauft, die auf dem schwarzen Markt reißenden Absatz fanden; die von der Firma gelieferten Bleistifte und Radiergummis, die Ordensschnalle meines Großvaters, deren Erlös ich mit meinem Bruder teilte, die Messingstangen der Betten unseres sowieso bereits zusammengebrochenen Haushaltes. Ich machte Luftgeschäfte mit nicht vorhandenen Gütern. Aber Elsa war der Höhepunkt meiner korrupten kaufmännischen Tätigkeit. Ich hatte die beste Lehrlingsausbildung in der Kunst, wie in der großen Inflation Geschäfte gemacht wurden. *
Die Inflation rast weiter. Gehälter werden täglich ausgezahlt, und zwar am Vormittag, vor Bekanntgabe des letzten Dollarkurses. Das
80
Geld wird in Waschkörben zur Kasse getragen. Nach Geldempfang darf jeder Angestellte den Arbeitsplatz auf eine Stunde verlassen, um sein Geld schnellstens anzulegen, ehe die Preise am Nachmittag weiter in die Höhe schnellen. Es sieht wie ein Wettlauf aus, wenn 1 500 Menschen aus den Toren in alle Richtungen schießen, um alles nur Habhafte recht wahllos zusammenzukaufen. Doch eines Tages werden keine mit Geldscheinen gefüllte Waschkörbe unter Polizeibewachung angefahren, die Angestellten, die zur Kasse drängen, stoßen auf Achselzucken der Kassierer: „Wir haben kein Geld — die Reichsdruckerei streikt, und mit ihr alle übrigen Notenpressen." Denn schon längst wird Geld in Hilfsdruckereien hergestellt, von Falschmünzern ganz zu schweigen. Unser Geld kommt aus der Zeitungsdruckerei Ullstein. Die Reichsdruckerei muss den Druck auf Vorschuss zahlen, das heißt, sie zahlt den Kurs von gestern für das Papiergeld von morgen, das hier gedruckt wird und zur weiteren Entwertung beiträgt. Der Streik geht weiter, es gibt tagelang kein neues Geld, und ohne Notendruck kann die Inflation nicht weiter treiben. Es gibt genug Papiergeld mit alten Ziffern, aber mit einer Null zu wenig, so zahle ich dem Straßenbahnschaffner einen ganzen Bündel von Fünftausendmarkscheinen für einen Fahrschein. Die Firma zahlt uns unser tägliches Gehalt in Lebensmitteln aus. An einem Tage schleppe ich Margarine, am nächsten Nudeln und Reis nach Hause. Mit grünen Erbsen und Speck zahle ich die fällige Miete. Eine neue Regierungskrise droht. Die Situation ist grotesk; jeder versucht aus dem Geld zu fliehen und sich in Sachwerte zu retten. Aber man kann gar nicht aus dem Gelde fliehen, wenn keins vorhanden ist. Da erscheint Reichsbankdirektor Rudolf Havenstein vor dem verängstigten Reichstag und verkündet stolz: „Der Streik ist beendet. Meine Herren, seien Sie unbesorgt. Die Notenmaschinen laufen wieder in drei Schichten Tag und Nacht."
*
81
Onkel Zoll ist gestorben. Noch vor wenigen Tagen hatte er mir auf dem Krankenbett versprochen: „Well, du erbst alles." Nach dem Kriege hatte sich die Familie wieder recht eifrig des alten Onkels angenommen. Tante Clara wusste, dass er zuweilen Briefe aus Amerika bekam. Der Nimbus des reichen Onkels aus Amerika war wieder da; er war wohl nicht so reich, wie er einst vorgegeben hatte, aber jetzt schien jeder Dollar ein Vermögen. Onkel Zoll war ein Lebemann, im Glänze seines neuen Reichtums hatte er sich eine Mätresse zugelegt. Tante Clara fand dies für einen 86jährigen Mann ungehörig. Der Onkel hinterließ einen Koffer voll mit Testamenten, denn er hatte, um sich der Liebe der vielen Verwandten und der Mätresse zu versichern, immer neue Testamente geschrieben, in denen er jedem alles vermachte. Neben den natürlich ungültigen Testamenten und einigen Medaillen aus seiner Yankee-Militärzeit im amerikanischen Bürgerkrieg fanden sich auch in einem Umschlag große grüne amerikanische Dollarscheine — ein ganz schönes Bündel. Nach großem Tumult in der Familie und harten Worten zwischen Tante Clara und der Mätresse sprach Onkel Richard ein Machtwort, und man einigte sich auf gerechte Verteilung des Schatzes zwischen allen Trauernden auf der Basis der Gleichberechtigung. Mein Anteil waren 16 große grüne Dollarscheine. Onkel Richard nahm sie an sich. Da meine kranke Mutter wieder in einem Sanatorium war, zahlte er mir jede Woche einen Dollar aus: 100 Millionen - 200 M i l l i o n e n - 500 Millionen - Eine Milliarde - 10 Milliarden - 100 Milliarden - Eine Billion - und schließlich über 4 Billionen Mark. Bei Anbruch der Rentenmark, die durch „das gesamte deutsche Volksvermögen" gedeckt war, blieben noch zwei Dollar von meiner Erbschaft vom reichen Onkel aus Amerika übrig. *
82
9. November 1923 - das Berliner Tageblatt erscheint mit der Schlagzeile „Hitler-Ludendorff-Diktatur in München. Der bayrische Ministerpräsident von Kahr gefangen gesetzt." Der Bierhallen-Putsch in München macht keinen sehr großen Eindruck im fernen Berlin. Bayern tummelt von so vielen nationalistischen Terrorgruppen, dass es gar nicht darauf ankommt, wer auf wen schießt. Da ja die Funkberichterstattung noch sehr in den Kinderschuhen steckt, wissen im Lauf des Tages nur sehr wenige, dass Hitler sich vor der Feldherrnhalle auf den Bauch geworfen hat, anstatt mit Ludendorff, wie er es sich vorgenommen hatte, seinen Marsch direkt vom Bürgerbräu nach Berlin fortzusetzen. Übrigens kannte kaum ein Berliner damals einen Adolf Hitler. *
Einige Tage später wurde Hitler im Kleiderschrank einer Freundin in Uffing von der bayrischen Polizei aufgestöbert, während die Inflation über die Multimilliarden hinaus in die Billionen raste. Da die Eisenbahn mit ihren Preiserhöhungen nicht mit dem wilden Tanz der Billionen Schritt halten konnte, fanden wir einen neuen Zeitvertreib — wir fuhren Erster Klasse nach Hamburg, tranken Kaffee im Alsterpavillon, und dann gings nach Berlin zurück; das war billiger als eine Straßenbahnfahrt in Berlin, da hier der Fahrpreis wöchentlich festgesetzt wurde, während die Bahntarife für vier Wochen galten. In den letzten Zuckungen der Inflation kaufte Papiergeld überhaupt nichts mehr. Seit Onkel Zolls Erbschaft hatte sich mein Lebensstandard wertbeständig stabilisiert: wöchentliches Einkommen: ein Dollar; tägliches Gehalt: Gegenwert eines Brotes; mittags: Eintopfessen in der Kantine auf Kreditmarken, die später mit wertlosen Scheinen bezahlt werden konnten. Das reichte sogar, um tanzen zu gehen und einer Partnerin ein Gefrorenes zu bezahlen: „Mensch, du hast aber die Spendierhosen an", sagte sie bewundernd. 83
Ende November ging der Spuk zu Ende. Dollargutscheine, die Ähnlichkeit mit Bankschecks hatten, tauchten auf. Ich erhielt mein erstes stabilisiertes Wochengehalt in einem solchen Scheck Höhe 0,42 Dollar. Mit einem Vermögen von zwei restlichen ererbten Dollars und einem Gehaltsscheck von 0,42 Dollar trat ich in die neue Währung. Nein, ich hatte noch 11 Kupferpfennige aus der guten alten Zeit, und diese Kupferpfennige wurden in die neue Währung übernommen. Die Rentenmark war auch nichts weiter als bedrucktes Papier. Man hatte einfach der Inflationsmark 12 Nullen gestrichen. Aber die von Inflation erschöpften Menschen glaubten an das Wunder.
84
„Denn einmal werden wir ja doch wieder zur Ruhe kommen müssen." (Theodor Wolff, Chefredakteur des Berliner Tageblatts)
Fünfte große •
Von der Inflation in die Depression. Das Reich der Inflationskönige bricht zusammen. V Bei Orenstein & Koppel fliegt ein großer Teil der Angestellten auf die Straße. Mit der Vielzahl der Lehrlinge weiß man gar nichts anzufangen. Mir wird großzügig ein halbes Jahr Lehrzeit geschenkt. Ich darf mein eigenes Zeugnis schreiben, das die schwungvolle Unterschrift zweier Prokuristen erhält, und werde mit diesem besten Zeugnis vor die Tür in die beste aller Welten gesetzt. Da stehe ich jung, arm und arbeitslos. Wer braucht einen ausgelernten kaufmännischen Lehrling? Wer braucht überhaupt einen neuen Angestellten? Es scheint sinnlos, eine feste Stellung zu suchen, feste Stellungen sind einfach nicht zu haben. Jeder klammert sich an jede neue Mark, die er ergattern kann.
I
85
Theodor Wolff, gezeichnet von Β. F. Dolbin
Ein Versicherungsagent sagt großzügig: „Ich nehme Sie auf Kommission." Es ist ein jovialer kleiner, dicker Mann. Das Versicherungsgewerbe braucht Vertreter. In den letzten wilden Jahren wurden ja kaum noch Versicherungen abgeschlossen, und die alten Versicherungen sind völlig wertlos geworden. Um mir und einigen Mitangeworbenen Mut einzuflößen, lädt er uns ins Restaurant zum Mittagessen ein und würzt das Mahl mit anfeuernden Reden: „Alles ist Neuland - dabei brauchen Sie gar keine neuen Kunden zu suchen, wir geben Ihnen die Adressen von alten Kunden, mit denen wir im Geschäft stehen. Alle haben Lebensversicherungen, na viel sind die ja nach der Inflation nicht mehr wert, aber wenn Sie die Leute richtig anpacken, werden Sie gerne neue Versicherungen abschließen." Ich ziehe mit einer Handvoll von Adressen solcher alten Kunden, einem Merkbuch darüber, wie man Versicherungen abschließt, und vielen Erfolgswünschen des freundlichen, dicken Herrn los. Er erlaubt uns sogar, von seinem Telephon aus diese Kunden anzurufen, um Verabredungen zu treffen. Die meisten haben Ausflüchte, sie scheinen nicht mehr viel von Lebensversicherungen zu halten. Aber einer sagt: „Na kommen Sie mal rauf, reden kann man ja mal, so um sechs Uhr abends, nach dem Geschäft." Ich klettere vier Treppen in einem einst gutbürgerlichen, nach Jahren des Krieges und der Inflation recht verkommenen Hause hoch. Ein älterer dürrer Mann empfangt mich; wir setzen uns in die gute Stube, eine kleine verhärmte Frau setzt sich zu uns. Ich sage meinen säuberlich gelernten Spruch her: „Sie haben eine Lebensversicherung, Sie wissen ja — leider ist die heute nicht mehr viel wert. Aber unsere Firma will Sie als Kunden behalten und verzichtet auf die erste Prämie für eine neue Versicherung als Anerkennung Ihrer alten Kundschaft." „Was ist denn meine alte Versicherung wert, auf die ich zwanzig Jahre lang eingezahlt habe? Sie behaupten, dass wir die ganzen Prämien verloren haben?"
87
Ich blättere in meinem Merkbuch, suche nach entsprechenden Ziffern: „Sie sind heute 50 Jahre, da sind die Raten schon ziemlich hoch, 80 Rentenmark Prämie auf 1000 Mark Versicherung, aber wir lassen Ihnen eine Prämie nach." Der Mann starrt mich an: „Wenn ich 80 Mark hätte ..." Die kleine Frau in dem zerschlissenen Sessel neben mir schluchzt leise und stöhnt: „80 Mark." „Wie viel haben Sie denn bisher eingezahlt?" „Ich weiß nicht genau, mit den Inflationsjahren. Aber die ersten 15 Jahre war es ja gutes Geld, mindestens zusammen 5 000 Goldmark." „5 000 Goldmark?" Das ist in den ersten Tagen der Rentenmark ein unglaublicher Betrag: „Und dafür will Ihnen die Versicherung nichts weiter geben, als eine Prämie auf eine neue Versicherung?" Die Ziffern in meinem neuen Merkbuch scheinen mich anzugrinsen: „Das ist ja reiner Betrug", rufe ich, „die haben doch mit dem Geld gearbeitet, haben Grundstücke gekauft, sind in Sachwerte gestiegen ... da muss doch irgendetwas übrig geblieben sein." Der Mann schüttelt den Kopf: „Sicherlich für die Versicherungsgesellschaft, aber nichts für mich." Ich klappe mein Merkbuch zu: „Das ist doch alles ein Riesenschwindel, und da sollen Sie eine neue Versicherung abschließen tun Sie's nicht." Der Mann lächelt: „Sie sind mir ja ein schöner Versicherungsagent. Ich hätte sowieso nicht abgeschlossen, aber Danke für Ihren Rat. Aus Ihnen wird noch was, junger Mann aber nicht in diesem Geschäft." Er bietet mir einen Korn an und wir scheiden als gute Freunde. Als ich die Treppen heruntergehe, wird mir völlig klar - ja ich bin im falschen Geschäft, so findet man keine Kunden für Lebensversicherungen. Aber ein Mittagessen - Wiener Schnitzel und ein Helles - hatte ich doch aus diesem Geschäft herausgeholt. Jahre später wurden die Versicherungsgesellschaften durch Gesetze gezwungen, einen kleinen Prozentsatz des Wertes alter Policen anzuerkennen. 88
*
Ein anderes Kommissionsgeschäft: Eine Firma hat mich mit einer Musterkollektion von Zigaretten einer nicht populären Marke ausgestattet. Deshalb ist es wohl nicht weiter auffallend, dass die Leute mir keine Bestellungen geben wollten. Schließlich gibt mir der Besitzer meiner Kneipe an der Ecke aus Freundschaft einen Auftrag. Die erste Seite meines dicken Bestellblocks ist gefüllt, ich schicke sie stolz der Firma ein. Als Antwort erhalte ich eine vorgedruckte Postkarte: „Wegen Streiks können wir derzeit nicht liefern." Ich rauche eine Zigarette aus meiner Musterkollektion, das wird kaum auffallen. In einer Woche habe ich die gesamte Musterkollektion aufgeraucht. Das war das Ende dieses Kommissionsgeschäfts. Mein Auftrag wurde nie ausgeliefert.
*
Die Rentenmark entfacht den Unternehmungsgeist vieler, die sich von der Inflationspsychose und den leichten Verdiensten dieser Epoche nicht losreißen können. Eine kleine Inseratenagentur, Leunmund und Zickler, schickt mich auf Werbetour für eine neue Zeitschrift. Herr Leunmund und Herr Zickler, zwei ideenstrotzende junge Männer, sitzen an zwei Schreibtischen in einem sonst kahlen Büro und impfen mir ihre Zukunftsphantasien ein: „Das wird eine große Sache! Heute gehen Sie erst einmal die Frankfurter Allee hoch, von Laden zu Laden, und offerieren eine Anzeige - drei Mark bei Bestellung, die sind für Sie — drei Mark bei Vorlage des Korrekturbogens — drei Mark bei Erscheinen. Das ganze wird eine erstklassige Kundenzeitschrift." Die eifrigen Chefs drücken mir ein paar Seiten Probedruck der künftigen Zeitschrift in die Hand, alles Inseratenseiten mit schö89
nen, schön erfundenen Anzeigen. Ich ziehe los; Erfolg des Tages: ein Anzeigenauftrag einer Drogerie und drei Mark in der Tasche, neunundvierzig weitere Versuche blieben Nieten. Als ich am späten Nachmittag mit meinem einen Auftrag zu Leunmund und Zickler zurückkehre, höre ich lautes Schreien vom Korridor aus. Die Tür wird aufgerissen, und Herr Zickler - oder war es Herr Leunmund? - rast heraus. „Die Firma ist soeben aufgeflogen", teilt mir der zurückbleibende Leunmund - oder war es der Zickler? — mit. „Was mache ich mit meinem Inserat?" Er zuckt die Achseln: „Ich weiß nicht — oder wollen Sie mein Partner werden? Das wird bestimmt eine große Sache." Ich lehne erschreckt ab. Die drei Mark habe ich behalten.
*
Ich versuchte andere Berufe, sie dauerten im Durchschnitt einen Tag, aber ein Erfolg leuchtet aus dem Dschungel der Versager. In der Friedrichstraße wurde ein Mittagstisch eröffnet, die Mutter eines Freundes war die Köchin. „Haben Sie die nächsten Tage ein paar Stunden Zeit", fragt sie mich, „so etwa zwei Stunden um die Mittagszeit?" „Aber ja!" „Ich möchte ein paar Menschen an den Tischen haben, damit es zuerst nicht so leer aussieht. Sie setzen sich an einen Tisch und bekommen zu essen, zwar langsam, über die zwei Stunden verteilt. Sie versuchen, mit etwaigen Kunden ins Gespräch zu kommen - natürlich schwärmen Sie, wie gut Ihnen das Essen schmeckt." Eine ganze Woche lang war ich Probeesser; gute Wiener Küche, Nachtisch wurde sogar zwei-, dreimal serviert, die besten Marillenknödel in der ganzen Stadt. Leider war der Mittagstisch schnell ein Erfolg; ein so großer Erfolg, dass nach acht Tagen mein Stuhl für zahlende Gäste gebraucht wurde — er wurde mir buchstäblich unterm Hintern fortgezogen, es wurde kein Probeesser mehr gebraucht.
90
*
Glücklicherweise kann ich meinem Bruder auf der Tasche liegen. Er macht plötzlich Karriere als Pressezeichner. Illustration in Tageszeitungen wird modern. Wegen der schlechten Druckerschwärze und des schlechten Papiers können jedoch Photos nur undeutlich gedruckt werden. Mein Bruder hat eine Spezialität entwickelt. Porträts vor allem werden von Photos in starken Strichen auf Pauspapier übertragen und erscheinen dann silhouettenähnlich deutlich im Druck. Er rückt zum Hauszeichner der Berliner Volks-Zeitung auf, zu Köpfen gesellen sich Karikaturen und Witzzeichnungen. Er braucht Witze und Anekdoten zum Illustrieren. Jeder Witz wird mit zwei Rentenmark bezahlt, ich werde Witzmacher, aber die Einfälle bleiben beschränkt. Ich finde heraus, dass Witzefabrizieren ein sehr ernstes Gewerbe ist, und dass man sich am besten auf guten alten erprobten Humor stützt, der nur frisch erzählt werden muss. Alte Jahrgänge deutscher und ausländischer Zeitschriften sind Studienobjekte. Anekdoten sind noch begehrter, die werden mit drei Rentenmark bezahlt, am besten sind Gedankensplitter, die finden gleich halbdutzendweise Abnahme. Ein halbes Dutzend Witze und zwei, drei Anekdoten bringen einen einkömmlichen Wochenumsatz. Aber es häufen sich die ungedruckten Manuskripte zu Bergen: Feuilletons, die in eifriger Nachtarbeit aus meiner etwas klapprigen Schreibmaschine strömen. Zuweilen schmuggle ich ein Manuskript auf den Tisch des Feuilletonredakteurs. Aber da bleibt es ungelesen liegen, oder ich finde es mit vorgedrucktem Ablehnungszettel in meiner Post wieder. Nicht dass die Manuskripte ungelesen blieben. Unter den Fichten im Grunewald liege ich mit Edith und lese ihr meine ungedruckten Werke vor; ihre Liebe ist so groß, dass sie mir widerspruchslos zuhört, und vorgibt, überhaupt nicht zu verste91
hen, warum die arroganten Redakteure mir vorgedruckte Ablehnungen ins Haus schicken. *
Die kleinen Presse-Cafés in der Jerusalemer- und Kochstraße waren zwischen den Umbruchszeiten die eigentlichen Vorzimmer zu den Redaktionen der Berliner Presse. Hier saß ich, die Taschen mit Manuskripten vollgestopft, und hoffte auf den großen Tag, wo ich mehr als einen aufgewärmten Witz oder eine Anekdote von mir gedruckt sehen würde. Am Nebentisch unterhielt sich ein Redakteur, den ich vom Sehen kannte, mit einem Kollegen: „Wissen Sie, da schleppen die Mitarbeiter die unmöglichsten Manuskripte heran, aber niemand schreibt, was ich wirklich brauche. Keiner hat die Courage, in die Wilhelma zu gehen und mir eine Reportage zu bringen." Ich räuspere mich und beuge mich zu ihm: „Ich gehe, wenn Sie es wollen." Der Redakteur sieht mich an: „Gut, morgen Mittag das Manuskript." Die Wilhelma ist ein Musik-Café schräg gegenüber vom Romanischen Café, das nach der romanischen Fassade als Kulisse der Gedächtniskirche genannt wurde. Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche steht wie eine Feste zwischen den beiden feindlichen Welten; dem Literatencafe, dessen Gäste schwarzen Kaffee und zwei Eier im Glase konsumieren und sich als Emigranten aus der Bürgerlichkeit betrachten, und dem Kontrapunkt, wo das nationale Bürgertum bei Bier und Bockwurst dem Patriotismus ein ewiges Sängerfest bringt. Nachdem einmal Rollkommandos, die vor den Toren ihrer Welt Wache standen, einige harmlos vorbeiziehende Bohemiens verrollt hatten, kreuzt kaum ein Gast aus dem Romanischen mehr die Straßenbahnschienen rund um die Gedächtniskirche, die diese beiden Welten trennen. 92
Am Abend überquere ich das Niemandsland für die erste Reportage meiner neuen Karriere. Ja, da stehen gleich hinter der Eingangstür zwei - in meiner Phantasie jedenfalls - drohende Gestalten. Doch gute Bürger mit Jägerhütchen, wie sie George Grosz zu zeichnen pflegte, begleitet von ihren vollbusigen Gattinnen, schieben sich durch die Drehtür; ich schließe mich ihnen an, als ob ich dazu gehöre - niemand würdigt mich eines Blickes. Die beiden drohenden Gestalten hinter der Tür sehen gar nicht mehr so drohend aus. Laute Blechmusik schallt durch die blauverqualmte Luft, um die runden Tische sitzen deutsche Bürger und singen laut zur Blechmusik: „Stolz weht die Flagge schwarz-weiß-rot von unsres Schiffes Mast Dem Feinde weh, der sie bedroht, der diese Farben hasst. " Untermischt ist dieses biedere Bürgertum von Gruppen junger Männer in Räuberzivil, wohl zur Zeit arbeitslose Freischärler, die von Herren mit Schmissen und zuweilen Rauschebärten mit Freibier versorgt werden. Kein einziger freier Stuhl ist zu finden, und ruhig kann ich durch die riesige, langgestreckte Halle wandeln, mit suchendem Blick, als ob ich nach einem freien Platze spähte. Mehrere Tische sind zusammengerückt; zwei Dutzend Kommilitonen, Studentenmützen schräg auf den Köpfen, Knüppelstöcke zwischen den Knien, klopfen mit ihren Gläsern den Takt, als die Musik ihnen zu Ehren ein Gaudeamus igitur schmettert. Dann machen die Musikanten eine Bierpause. An einem Tisch steht ein strammer Mann auf und bringt ein Hoch auf das Erste Garderegiment zu Fuß aus. Die Antwort ist ein Chor: „Hoch soll er leben, dreimal hoch." Ich sehe mir den Mann mit seiner stolzen gewölbten Brust an - das ist doch mein freundlicher Kolonialwarenhändler an der Ecke. 93
Um bei meinem Spaziergang doch nicht aufzufallen, ziehe ich mich für ein Weilchen in die Herrentoilette zurück. Am Pissoir schwankt eine Gestalt in Stulpenstiefeln und Reithosen und pfeift den Hohenfriedberger Marsch. Der „letzte Mann" öffnet mir freundlich eine WC-Tür. Ich überlege mir die Reportage: Das also ist der Sammelpunkt der so gefürchteten Reaktion im Sommer 1924. Männer, die noch immer ihre eisernen Uhrketten („Gold gab ich für Eisen") über den Bauch gespannt tragen, korsettierte Germanias mit verklärten Augen vor ihren Bierkrügen, Talmistudenten, die Studentenprinzen spielen, Freischärler, die auf ihre vergangene Glorie trinken. Diese Masse der Wilhelmapatrioten in der Weimarer Republik hat Hugenbergs Deutschnationalen über hundert Sitze im Reichstag gegeben. Ein Viertel aller Deutschen will nichts von der Republik wissen. Sie glauben an die Dolchstoßlegende der von hinten gemeuchelten Front; sie leben in der Vergangenheit eines kaiserlichen „glücklicheren" Deutschlands. Sie haben in der Inflation ihre Gutbürgerlichkeit verloren und nehmen übel. Sie stecken sich ein Stahlhelmemblem ins Knopfloch und spielen Soldaten. Es sind Menschen, die zusammenkommen, um gemeinsam besser hassen zu können. Ich gebe dem „letzten Mann" ein Trinkgeld, er salutiert militärisch. In der Halle wird ein Tusch geblasen, alle Gäste haben sich erhoben, viele knallen die Hacken zusammen. Auf dem Podium steht eine Sängerin, umrahmt von zwei Stahlhelmern mit schwarz-weiß-roten Flaggen, die dank eines Ventilators im Winde wehen: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall, Wie Schwertgeklirr und Wogenprall..." Die Kapelle fällt ein, zwei Musikanten mit Posaunen treten vor, die ganze Wilhelma singt mit: „Zum Rhein, zum Rhein, zum Deutschen Rhein ..." 94
Es ist die große Apotheose - der gewaltige Sehnsuchtsschrei nach der guten alten Zeit. Drüben im Romanischen Café hat Edith auf mich gewartet. Sie sieht mich erleichtert an, als ich zurückkomme. „War's gefährlich?" — „Nein, nicht gefahrlich für mich — aber vielleicht gefahrlich für uns alle." Am übernächsten Tage erscheint meine erste Reportage in der Berliner Volks-Zeitung: „Posaunen in der Zitadelle der Reaktion." An der Kasse liegen 30 Mark Honorar. *
Mit einer Sammlung guter alter, auf neu frisierter Witze und mehrerer der Vergessenheit verstaubter Bände entrissener Anekdoten erscheine ich wieder auf der Redaktion. Auf dem Korridor sieht mich mein Redakteur: „Übrigens hat Ihr Artikel dem Chef gefallen! Er hat mich gefragt, wer ihn geschrieben hat. Gehen Sie mal rein und stellen Sie sich ihm vor." Ich klopfe an die Tür des großen Mannes; Chefredakteur der Berliner Volks-Zeitung und demokratischer Landtagsabgeordneter Otto Nuschke sitzt behäbig am Schreibtisch: „So, Sie haben den Posaunenartikel geschrieben? Netter Bericht - machen Sie mal so weiter junger Mann, wir brauchen frische Reportagen." Entdeckt — ich bin entdeckt von Otto Nuschke! In Ostberlin gibt es heute eine Otto-Nuschke-Straße.26 Er war stellvertretender Ministerpräsident der DDR und starb 1957, ein sehr umstrittener Mann. Doch ich erinnere mich an den dicken Nuschke der zwanziger Jahre, der mich unter seine Fittiche nahm: Frühjahr 1924, ich war 19 Jahre alt, und Otto Nuschke erschloss mir die journalistische Karriere. Die frühere Jägerstraße hieß von 1 9 5 8 - 1 9 9 1 danach wieder Jägerstraße. 26
95
Otto-Nuschke-Straße,
Otto Nuschke, gezeichnet von Emil Stumpp
Ich bin gedruckt, meine Taschen sind mit Belegexemplaren gestopft. Edith erhält eine vom Autor unterzeichnete Kopie der „Posaunen in der Zitadelle der Reaktion". Wir sitzen zusammen im Romanischen Café, ich fühle mich unter all den Literaten als Gleichberechtigter und lasse mir von einem der hochklassigen Schnorrer, die scharfe Augen für junge Talente haben, großzügig fünfzig Pfennig für einen Kaffee abknöpfen. Spät abends regnet es. Ich winke stolz einem Taxi, das erste Taxi meines Lebens, das ich mit eigenem Geld zahlen werde. „Na gib mal nicht so an, so dick hast du es nun doch nicht!" „Sieh mal, Geld für ein Taxi habe ich, aber Geld, um mir einen Regenmantel zu kaufen, werde ich noch ziemlich lange nicht haben." Edith scheint von dieser ökonomischen Logik beeindruckt. Doch bald fand sie einen neuen Freund, der wahrscheinlich Geld für Taxis und obendrein einen Regenmantel hatte. *
Die Deutschen glaubten an ihre neue Mark und überraschend fasste auch das Ausland Glauben. Die Franzosen hatten die Aussichtslosigkeit ihres Ruhrabenteuers erkannt und zogen ab. Ein neuer Reparationsvertrag wurde unterzeichnet, der ein paar Jahre später unter die Räder der Weltdepression geriet. Vor allem aber ließen die reichen Amerikaner, berauscht von ihrer eigenen goldenen Prosperität, zu hohen Zinssätzen ihr Geld in die Weimarer Republik strömen; Regierung und Großfirmen borgten sich reich, nachdem sie durch die völlige Entwertung der vergangenen Inflation sich ihrer alten Schulden entledigt hatten. Nun konnten sie soviel neue Schulden machen, wie sie wollten. Plötzlich war es leicht, Geld zu verdienen, gutes, wertbeständiges Geld. Die Berliner Volks-Zeitung war das Hinterhaus des Mosse-Verlages in der Jerusalemer Straße. Im Vorderhaus wohnte das Ber-
97
liner Tageblatt der feinen Leute, das anerkannte Weltblatt. Ja, ich schrieb für die Hinterhäuser: Frühling im Schrebergarten - mit dem Bolle-Milchwagen durch Berlin — Bockbierfest in der Hasenheide - Sechstagerennen - und Kritiken über die Volkstheater hinter dem Alexanderplatz. Ein junger Mann meldet sich bei der Redaktion und klagt über die Elendswohnung, in der er leben muss: „Hier gleich um die Ecke, sehen Sie sich das mal an." Ich sehe es mir an: dunkles verschmutztes Treppenhaus; in den Zimmern schälen sich Tapeten von den Wänden, der Verputz fällt von den Decken, der undichte Wasserhahn lässt seine Tropfen in ein verrostetes Becken fallen, die Dielen sind angefault. Alles riecht dumpf und feucht. Ich schreibe einen scharfen Artikel gegen die Slum-Hauswirte mit der Adresse des Hauses. Der Artikel erscheint im Morgenblatt. Als ich mittags in die Redaktion komme, sehe ich teils grimmige, teils grinsende Gesichter: „Na Sie haben ja was schönes angerichtet - wissen Sie denn, wem das Haus gehört? Wer Ihr Slum-Hauswirt ist?" „Keine Ahnung." „Unser eigener Verleger Lachmann-Mosse." „Hat er Krach gemacht?" „Na ja, wenn Sie es Krachmachen nennen wollen — von oben kamen deutliche Zeichen des Missvergnügens." „Werde ich hier rausgeworfen?" Otto Nuschke: „Nein, wenn Ihr Bericht den Tatsachen entspricht ... Wir lassen das recherchieren." Der Verleger ließ seine Slum-Häuser reparieren. *
Weil ihm die Meute seiner Feinde keine Zeit gelassen hatte, sich rechtzeitig operieren zu lassen, starb Reichspräsident Ebert an einer Bauchfellentzündung [28. Febr. 1925].27 Zehntausende TrauFriedrich Ebert starb an einer Bauchfellentzündung als Folge einer zu spät behandelten Blinddarmentzündung.
27
98
ernde marschierten mit schwarzen Armbändern hinter dem Sarg beim stattlichen Staatsbegräbnis. Zunächst hatte die Reichswehr ihre Teilnahme verweigern wollen, weil Ebert „nur ein Zivilist gewesen sei". Wir hatten eine „weiße Reichswehr" von hunderttausend Mann, wie es der Versailler Vertrag vorschrieb, und eine „schwarze Reichswehr" von unbekannter Stärke, die ihre Mannschaften vor allen in kleinen Orten im Osten in alten Militärbaracken stationierte. Diese „Schwarzen" bildeten keine stehende Armee, sondern wurden von Reichswehroffizieren ausgebildet, die ihrerseits oft als geheime Berater der Sowjetarmee in Russland gedient hatten. Nach Ausbildung und Manövern wurden die Männer dann als Reserve nach Hause geschickt. Die Bürger der Republik wählten sich den 77-jährigen Hindenburg als Vater des Vaterlandes zum Präsidenten. Die paar Nazis, die es damals gab, wollten zunächst ihren General Ludendorff aufstellen, aber als sie die völlige Aussichtslosigkeit dieses Kandidaten erkannten, schlössen sie sich der Hindenburg-Lawine an. „Die Deutsche Republik ist hoffähig geworden", jubilierten die guten Bürger nach ihrem Wahlsieg. Ich lebte inzwischen als „besserer möblierter Herr" in eigener sturmfreier Bude bei Witwe Schmidt. Die Berliner Zimmervermieterinnen waren zumeist Witwen. Sie vermieteten ihr gutes Zimmer, oder auch zwei Zimmer, und bestanden auf kleinen, im Hausflur ausgehängten Pappschildern darauf, nur „bessere Herrn" zu akzeptieren. Wo die nicht so besseren Herrn unterkamen, blieb stets ein Rätsel. Mein Nachbar, natürlich auch ein besserer Herr, lud mich zuweilen zum Bier auf sein Zimmer. Eines Abends entdeckte ich ein Photoalbum: „Wenn Sie die Schnauze halten, dürfen Sie sich ein paar Bilder ansehen, ich habe sie während meines letzten Manövers mit den ,Schwarzen' geknipst." Ja, es waren fröhliche Manöverbilder, irgendwo bei Königswusterhausen aufgenommen. Die Männer trugen reguläre Reichs-
99
wehruniformen, Stahlhelme und Handgranaten im Gürtel, und benahmen sich gar nicht irgendwie geheimnisvoll. „Hier sehen Sie mich", sagte mein Nachbar stolz. Da stand er lachend in einer Gruppe von Schwerbewaffneten - und hier wieder, in einem malerisch gruppierten Photo am Schießstand - und hier wieder, beim Essenfassen an der Gulaschkanone. „Die Photos sind eine schöne Erinnerung — wir bekommen ja keine Ausweis-Papiere, doch wer's wissen muss, der kennt uns schon. Natürlich bleibt alles ein dickes Geheimnis, aber jeder weiß ja, was los ist, und wer uns verpfeift, dem geht's an den Kragen." Am nächsten Tage spreche ich mit einem Redakteur: „Ich kann eine Sensation bringen ... Ich habe Bilder von der schwarzen Reichswehr gesehen. Bei Königswusterhausen liegen die Kerle und halten reguläre Manöver ab; übrigens kenne ich einen von ihnen." Der Redakteur sieht mich ernst an: „Vergessen Sie lieber, dass Sie je solche Bilder gesehen haben. Denken Sie, wir wissen nicht, was da gespielt wird? Reichs weh rgeneral von Seeckt hat sich persönlich diese schwarze Armee geschaffen, ,zur Ostverteidigung!', heißt es. Wenn einer muckt, wird ihm ein Spionageprozess oder einer wegen Landesverrats angehängt, oder vielleicht noch Schlimmeres. Sie sind noch sehr jung, man wird auch heute noch verdammt leicht auf der Flucht erschossen ..." Der bessere Herr im Nebenzimmer zog sehr bald aus und nahm seine Photoalben mit. Ich „vergaß" meine Sensation, tatsächlich lief gerade ein Spionageprozess in Berlin, natürlich hinter verschlossenen Türen. Spione hatten dem französischen Geheimdienst angeblich Listen der „schwarzen Reichswehr" verkauft. Es waren aber nichts weiter als Namen aus dem Telephonbuch gewesen. Alles entpuppte sich als Riesenschwindel. Aber es gab andere, die mutiger waren als ich, und wirklich der „schwarzen Reichswehr" nachstöberten.28 Keiner von ihnen hat das Dritte Reich überlebt. 28 In der Weltbühne wurden zahlreiche Beiträge über die „schwarze Reichswehr" veröffentlicht, u. a. - teils anonym - von Berthold Jacob, Fritz Küster
100
Diese Schwarzen wurden später die gut gedrillten Kader der Nazi-SS. *
[1. November] 1926 — keine Zeitung erwähnte das historische Nichtereignis des Jahres: Ein Adolf Hitler hatte einen Joseph Goebbels zum Gauleiter der Nationalsozialistischen Partei von Berlin ernannt. Andere Gauleiter, wie etwa die Brüder Strasser, versuchten ihm diesen Posten streitig zu machen, doch sie waren dem Führer zu radikal. Schließlich lebte Hitler um diese Zeit kleinbürgerlich von einer Pension von 400 Mark aus der Hofschatulle der Großherzogin von Sachsen-Anhalt. Das Parteihauptquartier war ein schmutziger Keller in einem Hinterhaus im Stadtzentrum, wo Burschen in braunen Hemden unbeschäftigt herumsaßen. In Berlin bestand die ganze Partei aus ein paar Haufen solcher Sturmtruppler unter dem Befehl sich oft befehdender Kriegsherren. Goebbels Versuche, Massenversammlungen zu organisieren, endeten in fast leeren Hallen ziemlich kläglich. Einmal gelang es ihm rund 600 Getreue um sich zu versammeln, dies schien seine ganze Armee. Bald wollten die Wirte keine Säle mehr zur Verfügung stellen, weil der armselige Bierumsatz sich nicht lohnte. Zunächst verprügelten sich die SA-Männer meist untereinander. Doch dann kam es bei einer Versammlung im Wedding, im kommunistisch roten Herzen Berlins, zur ersten Schlacht zwischen Nazis und Kommunisten - ausgefochten mit Bierseideln, Stöcken und Stuhl- und Tischbeinen. Die Nazis bekamen Prügel, bis die Polizei schließlich für Ruhe und Ordnung sorgte.
und Carl Mertens; besonders bekannt wurde der Aufsatz von Walter Kreiser (unter d e m Pseudonym H e i n z Jäger) „Windiges aus der deutschen L u f t f a h r t " (vgl. Lit.verz. Nr. 15), für den er und Carl von Ossietzky als Herausgeber im November 1931 zu jeweils 18 Monaten G e f ä n g n i s verurteilt wurden.
101
Goebbels konnte unter dem soliden Schutz der republikanischen Polizei seine Kanonade gegen Kommunisten und Juden loslassen und kam zum ersten Male in die Zeitung; er hatte seinen lange gesuchten Propagandaerfolg und baute seitdem seine Prominenz als Organisator unzähliger Straßenschlachten auf. Handzettel erschienen an Litfaßsäulen und Häusermauern: „Der Angriff beginnt!" Um welchen Angriff handelt es sich? Goebbels hatte schließlich etwas Geld aufgetrieben, um seine eigene Zeitung herauszubringen. Es blieb zunächst ein Wochenblättchen mit kaum mehr als 2000 Lesern. Der Titel: Der Angriff. Der aus München29 zugereiste Joseph Goebbels schien jedenfalls nicht die Sensation Berlins. Eine Sensation war viel eher die aus Paris zugereiste Josephine Baker. Traute und ich bestaunten sie in einem Kabarett, schlank und schwarz, nur in Bananen und Federn gehüllt, tanzte sie wilden Jazz in noch nie erlebter Vollendung vor in Ekstase rasenden Zuschauern. Ich hatte Traute auf dem Kostümfest der Kunstgewerbeschule in der Prinz-Albrecht-Straße gefunden. Das ganze Haus war für eine Nacht in ein Piratenschiff verwandelt, und ich fing ein Mädchen auf, das über eine Reling in die wilde See weicher Pfühle sprang. Wir durchtanzten die Nacht, doch als wir uns am grauen Morgen mit schwarzem Kaffee zu ernüchtern suchten, setzte meine Partnerin eine besorgte Miene auf: „Weißt du, ich soll einen Ballbericht schreiben, und ich weiß doch gar nicht, wie man so etwas anfängt." Traute war Redaktionssekretärin des Film-Kurier. Der Chefredakteur hatte ihr die Rezensionskarten gegeben, mit der freundlichen Mahnung: „Aber schreiben Sie mir ein paar Zeilen." Brav hatte sie auch Bleistift und Papier eingesteckt, aber jetzt schien sie von allem Mut verlassen. 29 Goebbels, geboren in Rheydt a m Niederrhein, war vor seinen Berliner Jahren vorwiegend im Rheinland und Westfalen tätig und im Büro des NSDAP-Gauleiters des Rhein-Ruhr-Distrikts in Elberfeld angestellt.
102
„Na gib mal her", suche ich sie zu trösten, „ich schreibe hin und wieder auch für Zeitungen; wollen wir mal losdichten." Ich schreibe einen Ballbericht mit aller guten Laune einer vergnügt durchtanzten Nacht. „ D u bist aber nett", sagte sie beim Durchlesen, „das klingt beinahe wie eine Liebeserklärung." Wir trafen uns wieder. Traute erklärte stolz: „Ich bin ein begabtes Mädchen - mein Chefredakteur hat's mir gesagt und hat meinen Bericht groß im Blatt aufgemacht, sogar mit meinem Namen darunter." „Freut mich, dass ich ein begabtes Mädchen bin." „Mein N a m e steht in der Zeitung, ich bin das begabte Mädchen, nicht du. Aber das Beste kommt noch - Mein Chef sagte, er wird mich jetzt immer auf Bälle schicken, aus mir könnte noch eine brauchbare Reporterin werden, ich hätte Stil. Ich habe schon Karten für nächsten Sonnabend - hast du Zeit?" „ D u meinst, wir beide sind ab nun auf Gedeih und Verderb verbunden. Natürlich hab ich Zeit." Traute gibt sich reserviert: „Also gut, wir gehen zusammen hin, aber ich denke gar nicht daran, die ganze Nacht mit dir zusammen zu bleiben. Und überhaupt, wenn wir weiter auf die Bälle gehen, würde es mit der Zeit verdammt langweilig werden, dauernd zusammen zu hocken. Ich bringe die Eintrittskarten, jeder tanzt seiner eigenen Wege, am Morgen treffen wir uns und schreiben die Kritik - natürlich kannst du mich anschließend nach Hause bringen - bis vor die Haustür." „Natürlich - also einverstanden - aber wie wäre es, wenn ich zuweilen ein anderes Mädchen nach Hause bringen würde?" „Das wäre schiere Untreue." Mein Freund und Kollege Hans Egon hört sich interessiert mein Avancement zum begabten Mädchen, das Stil hat, an. M a n sieht seiner Wohlbeleibtheit an, dass er noch zu Hause bei Mutter und deren Fleischtöpfen wohnt. Hinterlistig fragt er: „So, du gehst jetzt wohl jeden Sonnabend zum Ball?" 103
„Vielleicht - hoffentlich ..." „Das ist großartig - dann werde ich mit Gabriele sonnabends bei dir zuziehen - du brauchst ja dann deine Bude schließlich nicht. Bis du wiederkommst, sind wir garantiert verschwunden. Du musst mir nur einen Hausschlüssel machen lassen." Am nächsten Sonnabend erscheint Gabriele in einem bunten Kostüm neben Hans Egon bei mir. Traute fragt: „Ach Ihr kommt auch mit zum Kostümfest?" Gabriele errötet leicht: „Meine Eltern glauben es wohl." Hans Egon schüttelt den Kopf: „Nein, wir konnten keine Karten bekommen." Traute und ich haben eine volle Saison, kaum ein Fest wird ausgelassen, die Ballberichte des begabten Mädchens füllen den Film-Kurier. Jeder tanzt zwar zuweilen seiner Wege, aber wir hokken mehr und mehr zusammen, und es wird mit der Zeit gar nicht langweilig. Ich habe schon lange kein anderes Mädchen nach Hause gebracht. Viele Jahre später zog Joseph Goebbels in das Haus in der Prinz-Albert-Straße, wo die berühmten „Stakugemu'-Bälle abrollten — die Bälle der Schule des Staatlichen Kunstgewerbemuseums. Es wurde im Dritten Reich zum Hauptquartier der Gestapo, und meine den Nazis verdächtige Traute musste hier so manches peinliche Verhör überstehen.
*
Prosperität und eine gute Portion Freiheit strahlten über der Deutschen Republik, die Große Koalition regierte; der LocarnoPakt, von Briand und Stresemann geschaffen, hatte endlich eine freundschaftliche Annäherung zwischen alten Feinden gebracht. Die Republik war tolerant, und die Nazis durften im Jahre 1928 zum ersten Male eigene Kandidaten für die Reichstagswahlen aufstellen, bei der Fülle der Parteien schien es auf eine mehr oder weniger nicht mehr anzukommen. 104
Der Wahlkampf begann frisch und fröhlich. Otto Nuschke hatte mir einige Aufträge für Wahlpropaganda der Demokratischen Partei zugeschanzt. Die Demokraten, auf der Nationalversammlung nach dem Kriege die große Partei der Mitte, waren seit dieser Zeit arg geschrumpft, viele ihrer Wähler waren nach rechts zur Wirtschaftspartei und Volkspartei abmarschiert, aber die Parteigewaltigen hielten sich noch immer für das Zünglein an der Waage. Ich verfasste satirische Verse für bunte Flugblätter; mein Prachtwerk wurden Verse für einen farbenprächtigen Bilderbogen in der Form einer Moritat: Alle übrigen Parteien wurden verspottet und nur die Demokratische Partei, als Freiheitsgöttin symbolisiert, hielt die schwarz-rot-goldene Fahne hoch über den Parteiflaggen der andern. Die höchsten Parteistellen hielten diesen Bilderbogen für so zündend, dass sie ihn in Millionenauflage drucken ließen. In der Woche vor den Wahlen fuhren Lastautos durch die Stadt und Wahlhelfer warfen meinen Bilderbogen in hohem Bogen auf die promenierenden Bürger. Ich stand auf dem Kurfürstendamm und sah nicht ohne Stolz zu, wie meine Geisteskinder durch die Luft flogen. Doch als sich das Schauspiel dauernd wiederholte und ich allmählich durch Fluten dieser Flugblätter watete und traurig erkennen musste, dass sich kein einziger Mensch auch nur nach einem Flugblatt bückte, stellte sich wachsender Katzenjammer ein, denn die guten Wähler traten mein vielfarbig gedrucktes Werk buchstäblich mit Füßen - sie konnten bei der Fülle des Materials kaum etwas anderes tun — , bis es von den Kehrmaschinen der Straßenreinigung mitleidig zunächst besprengt und dann aufgesaugt wurde. Bei der Wahl am nächsten Sonntag hielten die Demokraten ihre Stärke; die Sozialdemokraten gewannen erheblich, sie waren die bei weitem stärkste Partei im Reichstag - und die Nazis zogen mit ganzen 12 Mann in das 500-köpfige Parlament ein. Sie waren zu schwach, um eine Fraktion bilden zu können. Joseph Goebbels 105
Wählt Liste
wählt Liste
6
6
Deutsche
Deutsche
Demokratische
Demokratische
Partei
Partei
Iii mi Liuti. Illtl. Util? Itteilflill lit Stillili!!I
Filiti Siimü-Milll »1 ¡ill filli ili II mili Iti Till filiti!. Filiteli, nulli»-lllflll UlIlt^tiMiii
ìeJLàtfL-
Wahlplakat der Deutschen Demokratischen Partei 1928 (Text siehe S. 340)
war einer dieser 12 Abgeordneten. Er hielt es für einen großen Sieg - denn ab nun konnte er im Schutze der Immunität weiterschimpfen, und für ihn vielleicht noch wichtiger: Er erhielt einen Freifahrschein auf den Eisenbahnen und konnte umsonst kreuz und quer auf Propagandafahrten durchs Land reisen. Er hat diese Privilegien ausgiebig ausgenutzt.
*
Die Presse, und vor allem die Boulevard-Presse änderte ihr Gesicht: Technische Entwicklungen im Zeitungsdruck und in der Photographie machten klare Illustrationen möglich und die Seiten wurden mit Photos vollgepackt. Überdies erschienen dauernd neue Wochen- und Monatszeitschriften. Der Bedarf stieg ständig und Pressephotographie wurde zum lukrativen Beruf. Seine Aristokraten wurden die Bildreporter, die Photohandwerk und Journalismus verbanden und mit Kamera und Schreibmaschine die illustrierte Reportage schufen. Bisher hatten die Pressephotographen riesige, schwerfällige Photoapparate mit sich herumschleppen müssen, mit Sondertaschen für die dicken Kassetten mit ihren Glasnegativen. Mehr als zwölf solcher Kassetten trug kaum ein Photograph mit sich herum, das war Proviant für 12 Aufnahmen. Dann ging es zurück in die Dunkelkammer zum Neuaufladen. Wenn nicht gerade strahlender Sonnenschein herrschte, war es schlecht um Momentaufnahmen bestellt. Am besten war es, den Apparat auf einen Dreifuß zu montieren, damit das Bild nicht verwackelte. Blitzlichtaufnahmen erforderten pyrotechnische Kenntnisse. Auf ein Blechgestell mit langem Handgriff wurde ein Magnesium-Pulver gehäuft; das Instrument musste hoch in die Luft gehalten werden, und während das offene Kameraauge auf sein Objekt starrte, wurde das Pulver entweder durch eine Lunte oder einen elektrischen Funken aus einer Taschenlampenbatterie entzündet. Knallend unter star-
107
ker Rauchentwicklung blitzte die Flamme auf und beleuchtete das Bild - diskret konnte man solche Photos nicht gerade aufnehmen. Jetzt gab es moderne Apparate mit scharfen Linsen und großer Lichtstärke. Leichte Filme ersetzten die schweren Glasplatten - es gab kein umständliches Laden mehr nach jeder Aufnahme. Die Filme waren um ein vielfaches empfindlicher, sodass Momentaufnahmen auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen möglich wurden. Die neuen Kameras waren klein und handlich und machten gute Vergrößerungen möglich. Elektrische Blitzlichtbirnen ersetzten das offene Pulver. Ich kaufte eine Kamera, „Makina 1" - noch heute, ein halbes Jahrhundert später, Urbild des modernen Photoapparates. Doch Pressephotographie mit ihren vielen Tricks musste gelernt werden. Otto wurde mein Lehrmeister. Er hatte sich als Kriminalphotograph spezialisiert, hatte gute Verbindungen mit Polizei und Redaktionen und vor allem eine Spürnase, er schien zu riechen, wo etwas los war. Schon oft hatte ich Texte zu seinen Bildern geschrieben, und die Idee einer Partnerschaft schien uns beiden gut. Sie fing an einem Tage mit zwei Morden an: „Ich nehm den in Treptow und Sie den in Zehlendorf- beeilen Sie sich, nehmen Sie Tatort, Leiche und was Sie sonst so aufs Bild bekommen, auf." Ich nehme ein Taxi nach Zehlendorf, wo ein Tankstellenwärter ermordet und beraubt worden ist. Als ich am Tatort eintreffe, fahren die Polizeiwagen gerade davon, die Menge verläuft sich, nichts bleibt übrig als eine verlassene Tankstelle. Ich nehme ein Bild dieser Tankstelle auf, das ist alles. Als ich zurückkomme, ist Otto bereits in der Dunkelkammer und entwickelt seinen Mord, er hat natürlich alles, Tatort und Opfer und weinende Hinterbliebene. „Na, was haben Sie?" „Eine verlassene Tankstelle." — „Was, keine Leiche?" — „Die war schon fortgeschafft." - „Noch nicht mal eine Blutlache? Ne leere Tankstelle kauft uns keiner ab. Da hätten Sie irgend jemandem einen Fünfziger geben müssen, der
108
hätte sich als Leiche hingelegt. Für fünfzig Pfennige macht das jeder." Zum Mord nach Pankow am nächsten Tage kam ich zur Zeit. Da stand ich neben einem Polizisten und zitterte vor Aufregung so stark, dass meine Photos völlig verwackelt wurden. Otto schüttelte nur den Kopf. Auf einer Verbrecherjagd als Gast im Polizeiauto versagte nicht ich, sondern die Polizei - sie fand keinen Verbrecher. Auf einer Streife der Bahnpolizei nach jugendlichen Ausreißern sahen wir keinen Ausreißer; ich beherzigte den Rat Ottos, gab einem Jungen eine Mark Honorar, dafür ließ er sich als verdächtigter Ausreißer durchsuchen. Leider war es der Sohn eines Gymnasialdirektors, der sich kräftig beschwerte; die Zeitung musste eine Berichtigung bringen, und die Polizei beschlagnahmte das Bild. Otto und ich verfolgen eine Kindesentführung. Ich knipse einen Polizeihund, der einen Mann beschnüffelt. Wir warten auf dem Polizeirevier auf weitere Entwicklungen. Derweilen dreschen wir Klabrias und ich verspiele meinen Anteil am Photo. Später wurde der Täter gefasst. Es war der Mann, der von meinem Polizeihund beschnüffelt worden war. Otto hat eine Sensation. Zum Trost spendiert er mir einen Schnaps. „Gehen Sie mal ins Lehrter Zellengefängnis 30 . Die Gefangenen geben ein Konzert, zum ersten Mal dürfen wir im Gefängnis photographieren. Sehen Sie mal zu, ob's hell genug ist, um ein paar Aufnahmen zu machen, blitzen darf man nicht." Als ich beim Gefängnis vorfahre und den Taxichauffeur zahle, ruft der mir nach: „Männeken, uff Ihnen brauch ick wohl ooch nich zu warten." Die Aufnahmen vom Stern des Gefängnisses auf die Bühne und die Galerien mit den Häftlingen im Hintergrund als Zuhörer werden Meisterschüsse. Otto ruft aus der Dunkelkammer: „Mensch - großartig." Es ist meine erste Bildgroßreportage. 30
Zellengefangnis Lehrter Straße.
109
Otto hatte eigentlich nur einen Konkurrenten für seine Kriminalbilder, das war Herr Klinke. Schon lange hatten es die beiden aufgegeben, Bilder von Mordopfern vor den Augen der trauernden Hinterbliebenen von den Wänden abzuhängen oder sie auf irgendeine andere Weise unter Amtsanmaßung zu „beschlagnahmen" und dann im Wettlauf zu den Redaktionen zu eilen. Otto und Klinke hatten zusammen das Archiv eines verstorbenen Porträtphotographen gekauft; sobald ein Mord gemeldet wurde und das Signalement der Polizei vorlag, suchten sie sich irgendein entfernt ähnliches Portrait aus dem Archiv, vervielfältigten das Bild, und jeder verkaufte es an seine Kunden. Das ging so lange gut, bis Otto und Klinke sich verkrachten. Beim nächsten Mord besorgte sich Otto ein wahres Gleichnis des Opfers, während Klinke sich eins aus dem Archiv holte. Die Kunden Ottos brachten einen jüngeren blonden, glattrasierten Mann, während Klinkes Zeitungen einen vollbärtigen Glatzkopf veröffentlichten. Das Seltsame ist, dass weder Leser noch Redakteure diesen Betriebsunfall bemerkt zu haben scheinen. Ich hatte schon lange meine völlige Nichteignung als Mordphotograph festgestellt und versuchte nie wieder echte oder gestellte Leichen zu knipsen.
*
Ich habe einen neuen Polizei-Presseausweis, unterschrieben vom Polizeipräsidenten Zörgiebel. Ich darf Polizeiketten durchschreiten und mir dabei wichtig vorkommen. 1. Mai 1929. Feiertag der Arbeit. Die Werktätigen rüsten sich wie üblich für ihre Umzüge mit Fahnen und Musik. Aber dieser 1. Mai sollte kein üblicher Feiertag werden. Polizeipräsident Zörgiebel nennt sich zwar Sozialdemokrat, aber er ist vor allem ein Ruhe-und-Ordnungsmann. Er hat es mit der Angst bekommen, dass zu viele Kommunisten demonstrieren würden, und hatte 110
kurzfristig jede Demonstration verboten. Die rosaroten Gewerkschaftsführer schienen sich dem Verbot zu beugen, aber nicht ihre Mitglieder und vor allem nicht die Kommunisten, für die das Verbot ein gefundenes Propagandafressen war. „Wir marschieren doch" ist die Parole, und Otto und ich setzen uns mit unseren Kameras auf den Autobus und fahren nach Neukölln. Der Hermannplatz soll Sammelpunkt der verbotenen Demonstration werden. Ein Kreis von Zehntausenden hat sich rund um den Platz geformt, dessen Kern von dreifachen Polizeiketten abgesperrt ist. Immer weitere Massen drängen auf den Zufahrtsstraßen nach. Es ist neun Uhr früh. Die Menge ist noch gut gelaunt, und die Polizisten müssen zwar saftige Witze über sich ergehen lassen, stoßen aber bei ihren Absperrmaßnahmen kaum auf Widerstand. Otto und ich schlängeln uns durch die Menge und erreichen die Polizeikette. Stolz zücken wir unsere Polizeiausweise, ein Polizeileutnant lässt uns passieren. Hinter mir ruft ein Arbeiter: „Junge, geh nicht darein, die verhauen dich." Wir gehen auf die Mitte des großen leeren Platzes. Hier stehen Polizeikommandos, Gruppen von zehn bis zwanzig Mann mit gezückten Gummiknüppeln. Mein Kollege sieht sich die Situation an: „Die Luft ist mir zu dick, ich nehme meinen großen Apparat nicht raus. Ihr kleiner Apparat fällt nicht so auf." Ich halte die Kamera schussbereit. Auf einmal setzen sich die Kommandos in Bewegung, stoßen in einer Phalanx über die eigene Polizeikette hinaus gegen die Massen vor und lassen ihre Gummiknüppel sausen. Es geht alles so schnell, ich stehe in einer kleinen Gruppe von Photographen und schieße ein Photo. Plötzlich machen die Schupos kehrt und rasen im Sturmschritt gegen unsere kleine Gruppe. Um mich herum splittert Glas von Photolinsen, Apparate fliegen im großen Bogen durch die Luft, Menschen fallen aufs Pflaster. Ein Knüppel schwingender Hüne läuft auf mich zu, ich stoße ihm die Kamera ins Gesicht, der Knüppel saust hart an mir vorbei harmlos durch die Luft. Ehe 111
der Mann zum zweiten Schlage ausholen kann, schrei ich ihn an: „Diese schöne Kamera wollen Sie zerschlagen." Er stutzt, lässt den Gummiknüppel sinken, besieht sich die Kamera und fragt: „Wie viel kostet denn das Ding?" Die Gefahr ist verflogen, er gibt sich damit zufrieden, dass ich den Film herausreiße und ihm übergebe: „Denken Sie vielleicht, ich will mein Gesicht in irgendeiner Zeitung wiedersehen?" Mir ist klar geworden, dass wir Photographen im Augenblick die großen Feinde der Kommandos zum besonderen Einsatz sind, denn jeder blind um sich Schlagende fürchtet, dass er auf einem Photo erkannt werden könnte. Ein Krankenwagen kommt klingelnd herbei - einem Journalisten, wie sich später herausstellt, einem australischen Korrespondenten, haben sie ein Auge ausgeschlagen. Otto hat nichts abbekommen, und zusammen suchen wir so ruhigen Schrittes wie möglich einen Weg aus dem Kessel. Doch nach ihrem Sieg über die Presse gibt es bei den Sonderkommandos kein Halten mehr, im totalen Sturmangriff wird vorgegangen - plötzlich hören wir Schüsse. Die eben noch von Massen gefüllte Hermannstraße ist leergefegt. Otto rennt über den Damm und nimmt Deckung hinter einer Litfaßsäule. Für mich ist es zu spät. Neben mir marschiert ein ständig schießender Schupo. Ich versuche, mit ihm auf gleicher Höhe zu bleiben. Würde ich zurückbleiben, mag er denken, ich will ihn von hinten überfallen; würde ich vorgehen, könnte ich leicht einen Schuss in den Rücken bekommen. So marschiere ich in etwa fünf Schritten Abstand von diesem idiotisch ins Leere Schießenden im Gleichschritt mit ihm daher. Ich drücke mich mehr und mehr zur Mauer, aber alle Haustüren sind verrammelt, alle Läden geschlossen. Nach etwa einem Straßenblock erspähe ich eine offene Tür, ich stürze in einen Gemüseladen, der schießende Polizist marschiert weiter. Hinter dem Ladentisch, unter dem er Deckung genommen hatte, kriecht der Gemüsehändler hervor. Mit hoher Stimme verlange ich eine Banane — der Mann grinst: 112
„Ausgerechnet Bananen verlangt er von mir .. .".31 Ich esse lachend meine Banane, das beruhigt. Otto kommt von der anderen Straßenseite: „Das hat ja gefährlich ausgesehen, von meiner Perspektive aus schoss Sie der Idiot dauernd in den Hintern." Dann geschieht ein Wunder: Durch die völlig leere Straße rattert ein leerer Autobus, hält an der Haltestelle, wir steigen ein. „Wie kommen Sie denn hierher?", fragen wir den Schaffner. „Ganz einfach, wir standen an der Endhaltestelle, als der Klamauk losging, und nun wollen wir schnell nach Hause." Wir geben dem Schaffner ein dankbares Trinkgeld. Die Polizeiketten öffnen sich vor dem Autobus, und wir fahren davon. Ein paar Straßenzüge weiter lebt ein friedliches Berlin, als ob es eben rund um den Hermannplatz keine Straßenschlacht gegeben hätte. Ich komme aufgeregt auf die Redaktion: „Die Polizei schießt in Neukölln auf unbewaffnete Menschen." „Sie sind wohl ein Kommunist?", antwortet der Lokalredakteur. „Ich habe hier den Polizeibericht, die Demonstranten haben zuerst geschossen, wir halten uns an den Polizeibericht." Erst viel später kamen die Verlustlisten: Polizeiverluste null, noch nicht einmal ein Verletzter; ein Korrespondent des Hugenbergschen Lokal-Anzeigers getötet - sicher kein Kommunist; viele Pressephotographen verletzt; unter den Demonstranten 31 Tote und viele Verwundete. Ich habe niemals mehr trotz schönster Presseausweise eine zum Kampfbereite Polizeikette durchschritten.
*
„Ausgerechnet Bananen, Bananen verlangt sie von mir ..." war der Refrain eines gleichnamigen Liedes, das in den Zwanziger Jahren zum Repertoire von Ciaire Waldoff gehörte. 31
113
[24. Okt. 1929] Börsenkrach in New York - doch Amerika ist fern überm Großen Teich, trotz Lindbergh bleibt der Achtstundenflug zwischen den Kontinenten noch ein ferner Zukunftstraum. Was machte es uns schon aus, wenn in Wallstreet ein paar ruinierte Kapitalisten aus Wolkenkratzerfenstern sprangen? Auch deutsche Börsen sausten in die Tiefe, aber in unsern Kreisen besaß wohl niemand eine Aktie, und zunächst schien unsere Welt noch nicht aus den Fugen zu gehen. Die Dreigroschenoper spielte noch immer vor mit liberalen Bürgern vollgestopften Häusern, während die Konservativen dem wiederauferstandenen Alten Fritzen zujubelten, der unter dem Pseudonym des Schauspielers Otto Gebühr als Fridericus Rex seit Jahren die Filmpaläste füllte. In Luxusrestaurants wurden weiter Schlemmeressen serviert. Traute und ich schlemmten bei Kempinski: Krebse in Dill, Châteaubriand mit Sauce Bernaise, geeiste Schwedenfrüchte und eine Flasche Burgunder kosteten zwanzig Mark — das war das halbe Honorar einer Reportage. Kabaretts und Nachtlokale blieben überfüllt; die neuen Tischtelephone in der Femina32 waren nach wie vor die Sensation fröhlicher Herren aus der Provinz, die sich ihren gewünschten Anschluss zum Sekt an den Tisch telephonierten. Und auch die gestiefelten Damen, die nächtlich über die Tauentzienstraße promenierten - sie hießen im Volksmund „Stiefelkatrinen" - fanden noch immer ihre kapitalkräftige Kundschaft. Doch plötzlich klappte die erborgte Prosperität der Weimarer Republik zusammen; es ging so schnell, dass die Opfer, die auf die Straße flogen, gar nicht begriffen, woher die Schläge kamen. Fabriken schlössen oder gingen auf halben Betrieb über, Bankrotte häuften sich, die Arbeitslosenziffer raste in die Millionen, Löhne und Gehälter derer, die sich noch an Posten klammern konnten, wurden gekürzt. Die Weltdepression furchte in Deutschland ihre tiefsten Kurven. 32
Femina: einer der beliebtesten Tanzsäle der 30er Jahre im 1928-1931 errichteten Tauentzienpalast in der Nürnberger Straße.
114
Nun zeigte sich auch, welche Korruption im künstlichen Klima der Wirtschaftsblüte gewuchert hatte. So gingen die Brüder Sklarek, die die Stadt Berlin mit nicht gelieferten Polizei- und Feuerwehruniformen um Millionen geschädigt hatten, krachend pleite; ein Pelzmantel, den die Sklareks der Frau Bürgermeister Böß geschenkt hatten, wurde zum höchsten Politikum. Die Nazis hängten einen zerfledderten Pelz auf die Fahnenstange des Rathauses, und Böß demissionierte schnellstens. Goebbels hatte seinen großen Fall für den Angriff, jüdische Verbrecher und einen bestochenen liberalen Bürgermeister. Ich war Mitarbeiter des Welt-Spiegels, der illustrierten Wochenbeilage des Berliner Tageblatts. Der Honorarchef rief mich: „Wir mussten soeben Ihren Redakteur hinauswerfen. Der hat sich seit Jahren Geld von den Photographen zurückzahlen lassen, nachdem er ihnen zu hohe Honorare angewiesen hatte; obendrein hat er noch Schulden auf Konto der Redaktion gemacht. Drüben bei Hugenberg im Scherl-Verlag hatten sie den gleichen Fall; die haben Strafantrag gestellt, und der dumme Hund hat sich das Leben genommen. Wir hier sind Gentlemen und werden das im Stillen abwickeln; wollen Sie mir helfen?" „Ja gerne, was soll ich denn tun?" „Ihre Kollegin Gusti Hecht wird die Redaktion übernehmen, wollen Sie mit ihr zusammenarbeiten? Gusti soll nichts mit dem alten Dreck zu tun haben - aber Sie werden für die Honorare verantwortlich sein. Wir müssen diese Schulden an die Photographen in aller Stille aus dem laufenden Etat decken. Ihr Vorgänger hat 2 000 Mark wöchentlich für Photos ausgegeben. Die guten Zeiten sind vorbei. Wenn Sie es mit 500 Mark schaffen, sind wir die Schulden in ein paar Monaten los. Je besser Sie wirtschaften, um so schneller kann ich Ihnen ein angemessenes Gehalt zahlen." Es war ein seltsames Stellungsangebot. Aber wir saßen tief in der Depression, überall wurde eingespart und abgebaut. Da schien es gut, einen - wenn auch noch wackligen — Stuhl unter dem Gesäß zu haben. Gusti Hecht und ich sparten kräftig, wir 115
wurden bald die Schulden los, der Honorarchef seufzte auf, und ich bekam mein Redakteursgehalt. Inzwischen wurden in vielen Zeitungen die Bilderredakteure der Wirtschaftsblüte hinausgeworfen. Kleine Bestechungen schienen in diesem Beruf zum guten Ton gehört zu haben.
*
Es ging schnell bergab, das einzige, was stieg, war die Arbeitslosigkeit: 1,5 Millionen — 2,5 Millionen — 4 Millionen - und zum Schluss 6 Millionen - ein Drittel der deutschen Arbeitskraft. Die Große Koalition zerfiel. Reichskanzler Brüning konnte nur ein Minderheitskabinett formen und regierte mit dem Ausnahmezustand und Hindenburgs Dekreten. Die Arbeitslosen standen auf den Straßen, oder sie marschierten. Jede Partei formierte ihre paramilitärischen Kolonnen. Die Kommunisten marschierten hinter Schalmeien blasenden Kapellen, das Reichsbanner, das vor allem von den Sozialdemokraten organisiert wurde, hatte sein Trommler- und Pfeifenkorps, die Deutschnationalen mobilisierten den Stahlhelm unter der Generalität des Selterswasserfabrikanten Seldte mit dem Tschängtara lauter Militärkapellen. Aber die Nazis eroberten jede Straße, sie marschierten Tag und Nacht; sie schlugen zu, wo immer sie in der Ubermacht waren, und das war meist der Fall. Nur die Kommunisten antworteten mit gleicher Münze, und täglich gab es Straßenschlachten. Seit jeher machte ich am Abend in meiner Kneipe an der Ecke für ein kleines Helles halt. Nachbarn standen friedlich an der Theke, und im Hinterzimmer saßen Männer am runden Stammtisch. Stammtische waren stets rund und gaben gemütlichen Platz für die Honoratioren der Kegel-, Gesang- und Skatvereine. Aber die Depression hatte den Bierumsatz erheblich gesenkt, es wurde immer leerer in meiner Kneipe. Plötzlich füllte sich zuerst das 116
Hinterzimmer und dann auch die Theke mit Männern in braunen Hemden; Nazisturmtruppler hatten meine Kneipe übernommen. Ich wollte mein kleines Helles in einer anderen Kneipe trinken, doch ich fand das gleiche Bild - sie war von Sturmtrupplern übernommen. Eine Kneipe nach der andern wurde so nazisiert. Es war ein ausgeklügelter strategischer Plan. Die Nazis hatten hierfür genügende Mittel, vor allem waren die Großindustriellen wie Thyssen, die plötzlich ihr Herz für die Bewegung entdeckt hatten, nicht kleinlich. Den oft vor der Pleite stehenden Kneipen wurde Miete für das sonst leerstehende Vereinszimmer gezahlt, die Sturmtruppler erhielten Biermarken und lungerten hier herum, bis ein Sturmführer auftauchte und ein Kommando zum Appell schrie. Und dann marschierten sie los, wohin war ganz egal, mit Knüppeln im Stiefelschacht und Schlagringen in der Tasche. Mit ihren Stützpunkten in den Kneipen hatten die Nazis tatsächlich ein Netz über Berlin geworfen und konnten Straßenschlachten entfesseln, wo sie wollten. Ich trank mein abendliches kleines Helles von nun ab still zu Hause. *
[18. Juli 1930] Hindenburg hatte den Reichstag aufgelöst, aber der Wahlkampf wurde zu einer einzigen Straßenschlacht, die schließlich fast immer von den Polizeikommandos zum besonderen Einsatz gewonnen wurde. Die Parteitruppen hatten den Wahlkampf übernommen. Nur unter ihrem starken Saalschutz konnte sich ein Redner überhaupt auf dem Podium einer Wahlversammlung halten. Die mit Flugblättern beladenen Lastwagen ratterten durch die Straßen. Die Nazis ließen ihre Hakenkreuzstandarten wehen, doch hinter den Autos wurden die von ihren Feinden eroberten Fahnen durch den Schmutz gezogen, meist schwarz-rot-goldene Fahnen, die sie den Reichsbannertruppen abgenommen hatten. Die Kommunisten hielten die Rote Fahne 117
hoch und schleiften eine Nazifahne durch den Dreck. Kreuzten sich die Wege zweier solcher Autos, so gab es unweigerlich eine Schlägerei, bis die Polizei anrückte und auf beide Seiten losschlug. [14. Sept. 1930] Wahlnacht auf der Redaktion. Wir hatten alle damit gerechnet, dass Nazis und Kommunisten stark gewinnen würden. Aber die Ergebnisse waren eine Katastrophe. Die Ziffern schienen so unwahrscheinlich, dass der Redakteur, der sie in Satz geben musste, sie noch einmal recherchieren ließ. Es gab ja noch keine Meinungsbefragungen, Stimmungspools oder Vorausberechnungen. Die Resultate kamen krass aus dem Radio und lösten Schockwirkungen aus. U m drei Uhr nachts wussten wir es: Die Nazis, die mit 12 Reichstagssitzen in den K a m p f gezogen waren, hatten 107 Mandate gewonnen - 6,5 Millionen Stimmen. Auch die Kommunisten hatten stark gewonnen. Ein schwacher Trost war, dass die Sozialdemokraten wenigstens die stärkste Partei geblieben waren. Aber die Demokraten waren so schwach geworden, dass es nicht einmal mehr zu einer Fraktion ausreichte. Auf der Redaktion herrschte dumpfe Stimmung. Wir fühlten, dass es hier um mehr ging als einen verlorenen Wahlkampf. Die Kollegen reagierten recht verschieden; die einen schienen bestürzt und prophezeiten, dass dies den Anfang vom Ende bedeute, wobei sie nicht wussten, welches Ende das wäre und wie es aussehen würde. Ein paar stellten sich sehr schnell auf den Boden der bestehenden Tatsachen. Erstaunt sah ich, dass einige sich bereits Miniaturen ihrer Kriegsauszeichnungen aus dem Weltkrieg - damals nummerierten wir Weltkriege noch nicht, wir hatten erst einen hinter uns gebracht - in die Knopflöcher gesteckt hatten. Diese Eisernen Kreuze und sonstigen Orden wurden im Straßenbild immer mehr sichtbar - auf vielen Brüsten wurden sie später mit Hakenkreuzknöpfen ergänzt. Für über ein Jahrzehnt waren Orden und Ehrenzeichen ziemlich aus der Mode gekommen, nur die unerbittlichen Stammtisch118
krieger hatten sich so geziert. Jetzt aber herrschte stärkste Nachfrage. Mancher jüdische einstige Frontkämpfer glaubte, sich durch Tragen seiner Kriegsauszeichnungen ein Schutzschild vor den Bauch binden zu können. Doch bisher war in liberalen Redaktionen eine solche Rückversicherung verpönt gewesen. Es gab in dieser Nacht auch durchaus freudige Gesichter auf der Zeitung; nicht gerade unter den politischen Redakteuren, aber bestimmt unter dem übrigen Personal. Manch einer schien zu wittern, dass es hier bald das geben würde, was später einmal die „Fünfte Kolonne" genannt wurde, und dass man vielleicht einmal in frei werdende Positionen aufrücken könnte. Draußen marschierten die Sturmtruppen durch die Nacht und betranken sich mit Freibier in ihren Kneipen.
*
[4. Dez. 1930] Am Theater am Nollendorfplatz ist Premiere des Films Im Westen nichts Neues. Traute und ich gehen zur Premiere. Vor dem Kino demonstrieren Tausende von Sturmtrupplern. Der Film läuft an, Nazis im Theater beginnen zu randalieren. Plötzlich stinkt es fürchterlich, die Nazis haben Stinkbomben geworfen; der Film läuft im erhellten Saal weiter. Frauen kreischen auf und springen auf die Sitze, weiße Mäuse wurden losgelassen. Polizei erscheint und der Film kann zu Ende gespielt werden. Traute erklärt heldenhaft, dass sie sich nicht vor weißen Mäusen fürchtet und erst recht nicht vor Nazis. Die Nazidemonstration erreicht zunächst das Gegenteil ihres Ziels. Während Nazis und Polizei den Nollendorfplatz tagelang besetzt halten, wird es für die Nazigegner zur politischen Pflicht, sich Im Westen nichts Neues33 anzusehen. Die einen stehen hinter Polizeireihen Schlange vor der Kasse, während die anderen die 33
Siehe S. 35, Anmerkung 12.
119
Kinogänger mit wildem Geschrei bedrohen. Nach einiger Zeit siegt, wie Hindenburg erklärte, „die Empörung der nationalen Jugend gegen den im Film gezeigten Defaitismus der deutschen Soldaten". Die weißen Mäuse haben gesiegt, die Filmzensur verbietet plötzlich den Film. Inzwischen wurde die zweite Hindenburg-Wahl mit völlig veränderten Vorzeichen geschlagen. Nachdem es im ersten Wahlgang [13. März 1932] dank der Stärke des kommunistischen Kandidaten Thälmann keine Mehrheit gegeben hatte, stand in der Stichwahl [10. April 1932] Präsident Hindenburg als Kandidat der Mitte im Rennen gegen Adolf Hitler und siegte. Unter der Parole „Wählt das kleinere Übel" stimmten auch die Sozialdemokraten, die ihn anno 1925 so bitter bekämpft hatten, für den Sieger von Tannenberg. Doch Hitler konnte 13 Millionen Stimmen einheimsen - die Dampfwalze rollte weiter. *
[13. Juli 1931] Meine Hauswirtin trifft mich auf dem Treppenflur und ruft zitternd: „Die Danat-Bank 34 hat geschlossen!" Sie weint: „Was soll daraus werden, das ist ja eine Revolution." Ich versuche die zitternde Frau zu beruhigen. Ich habe selber kein Bankkonto, verspüre aber gar keine Schadenfreude gegen die Kapitalisten. Sie lässt sich nicht trösten: „Erst hab ich fast alles in der Inflation verloren, und nun nehmen sie mir den Rest." Die Depression hat heute den Mittelbürger ins Herz getroffen. Vor den Filialen der viertgrößten deutschen Bank stehen die Einleger vor verschlossenen eisernen Gittern, die Stimmung ist nackte Angst, obgleich Schilder verkünden, dass die Regierung die Einlagen garantiere. Andere Banken an den nächsten Straßenecken halten ihre Schalter noch offen, aber die Kassen werden 34
Darmstädter und Nationalbank, entstanden 1922 durch Fusion der Darmstädter Bank für Handel und Industrie mit der Nationalbank
120
gestürmt, und auch sie lassen schnell die Rollläden herab. BankFeiertage, die sich überstürzende Börse bleibt auf Wochen hinaus geschlossen. Bisher hatten sich die braven Bürger nicht allzuviel darum gekümmert, was auf den Straßen vor sich ging. Straßenschlachten zwischen den Radikalen schienen sie nicht viel anzugehen. Ruhe und Ordnung waren ihre einzige Sehnsucht. Arbeitslosigkeit erschütterte nur, wenn sie im eigenen Haus einschlug. Aber jetzt standen sie selbst auf der Straße vor den verschlossenen Banken in einer Demonstration der Ohnmacht. Auf der Redaktion verkündet der Verlagsdirektor drakonische Sparmaßnahmen. Unser Etat wird völlig zerhackt, Mitarbeiter werden so gut wie abgeschafft, wir sollen alle Artikel selber schreiben und möglichst viele Gratisbilder verwenden. Aus der Not wird eine Tugend, verstaubte Archive werden geöffnet, eine Serie Herausgekramtaus alten Bildern erinnert an die guten alten Zeiten, kostet kein Honorar und hat obendrein großen Erfolg. Ein Gerücht macht die Runde: Der Verleger geht nächtlich mit einer Pipette durch die Räume und senkt den Spiegel in den Tintenfässern. Damals schrieb man noch mit Federhalter und Tinte. *
[30./31. Mai 1932] Wieder einmal wird der Reichstag aufgelöst. Reichskanzler Brüning wird von Hindenburg entlassen. Franz von Papen wird als Hindenburgs Musterschüler „Fränzchen" neuer Kanzler der deutschen Republik und regiert weiter mit Notstandsdekreten. Was von Brüning blieb, war das kupferne Vierpfennigstück, das er als Sparsamkeitsmaßnahme eingeführt hatte, um das Nickel-Fünfpfennigstück zu ersetzen. Alles sollte einfach um 20 % im Preis gesenkt werden, natürlich auch die Löhne. Dieser primitive Versuch einer Währungsreform blieb im bitteren Gelächter der Opfer stecken. 121
Ein Drittel der gesamten deutschen Arbeitskraft ist arbeitslos. Bei der nächsten Wahl [31. Juli 1932] nach von Papens Amtsantritt hatten die Nazis 230 Sitze gewonnen, waren die weitaus stärkste Partei und teilten sich mit den Kommunisten die starke Mehrheit des Reichstages, über den Hermann Göring präsidierte. Dieser Reichstag der Extremen war nicht mehr arbeitsfähig, und von Papen versuchte auch gar nicht, verfassungsgemäß zu regieren, die Notverordnung war alles, was von der Weimarer Verfassung übrigblieb. *
[20. Juli 1932] Es war ein warmer Morgen, als ich mit meinem klapprigen Auto zur Redaktion fahren wollte und von einem Panzerwagen aufgehalten wurde. Die Innenstadt war gesperrt. Ich parkte und wanderte durch verkehrsleere Straßen, auf denen Soldaten lässig an ihren Lastwagen lehnten und von Neugierigen umlagert wurden. Niemand wusste, was eigentlich los war, am wenigsten die Soldaten selber. D a waren keine Barrikaden errichtet, keine Bajonette aufgepflanzt. An einer Ecke stand eine Gruppe von Stabsoffizieren, die Monokel blinkten, Adjutanten flitzten eifrig umher und verschwanden zuweilen hinter den Toren der preußischen Ministerien in der Wilhelmstraße. Schließlich verließen schwarze Limousinen unter Militärbegleitung die Gebäude. Ein paar Straßenecken weiter nahm das Leben der Stadt seinen normalen Verlauf. Etwas später wurde über Lautsprecher verkündet, dass Franz von Papen die preußische Regierung und ihren Ministerpräsidenten Braun in blutlosem Putsch gestürzt hatte. Sein Kriegsminister General von Schleicher hatte ihm die hierzu notwendigen Truppen geliehen. Fränzchen hatte dann ein Ultimatum gestellt, und als die sozialdemokratischen Minister erklärten, dass sie nur der Gewalt weichen würden, hatte er je einen Offizier mit ein paar Mann in die Ministerien geschickt, worauf die preußischen Mini-
122
ster erklärten, dass sie nunmehr dieser Gewalt wichen. Das ganze Abenteuer sah mehr dem Hauptmann von Köpenick ähnlich als der gewaltsamen Übernahme des preußischen Staates durch die Reichsgewalten. Von Papen ernannte Kommissare, und einer der Papenschen Gehilfen, ein Dr. Bracht, übernahm als Reichskommissar ganz Preußen. Eins seiner ersten Dekrete gebot den Zwickel. Was war ein Zwickel? Man könnte ihn ein Feigenblatt nennen. Dr. Bracht hatte Anstoß an den eng anliegenden Badeanzügen für Damen und Herren genommen, die für seine Augen jedenfalls zu viel sehen oder auch nur ahnen ließen. Er verfügte, dass ab nun jeder Badeanzug mit einem dreieckigen Stück Stoff versehen sein müsse, der die intimen Körperteile gegen jede ahnende Sicht gebührlich abdecken sollte. Und dies war eben ein Zwickel. Die Preußen hatten endlich etwas zu lachen, aber über dieses Gelächter vergaßen sie, dass der düstere Dr. Bracht die gesamte preußische Polizei unter seine Fuchtel bekam. Wir lachten, nie war die Satire schärfer und bitterer als in den Tagen des Niederganges, Theater und politische Kabaretts waren überfüllt, und hier saßen wir und lachten über uns selbst. Das geschmolzene Häuflein der Liberalen lebte wie auf Inseln im Meer der Intrigen um Hindenburg und den wachsenden Wellen des Naziradikalismus. Diese Inseln waren geographisch sehr begrenzt, in Berlin reichten sie nicht viel weiter als das Zeitungsviertel mit seinen Kneipen und Konditoreien, der Kurfürstendamm mit ein paar Seitenstraßen und dem Romanischen Café als Hauptquartier. *
Die Auflage des Berliner Tageblatts schrumpfte täglich, vor allem blieben die Inserate aus oder wurden nicht bezahlt. Am Etat des Welt-Spiegels war nicht mehr viel zu sparen. Aber dann kamen die spärlichen Mitarbeiter und Photographen und beklagten sich,
123
Erich Mühsam, gezeichnet von Β. F. Dolbin
dass sie keine Honorare erhalten hätten. Ich hatte natürlich die Anweisungen ausgeschrieben und ging zum Rechnungschef. Der gestand mir: „Wir füllen die Postanweisungen aus, aber die werden oft nicht weitergeleitet. Ich gebe Ihnen einen Rat; sagen Sie Ihren Freunden, sie sollen sich das Geld bar an der Kasse abholen. Da kommt noch genügend tägliches Geld rein, es sind ja auch meist kleine Summen, die Sie anweisen. Das bleibt aber unter uns." So, die Gerüchte waren wahr, eins der größten Verlagshäuser Deutschlands stand vor der Pleite. Die Dresdner Bank hielt den Verlag noch über Wasser. Ich begleitete meine Mitarbeiter persönlich zur Kasse und achtete darauf, dass ihnen die Honorare ausgezahlt wurden. Mein besonderes Sorgenkind war Erich Mühsam, der alte ewige Revolutionär, der einst Mitglied der Münchner Räteregierung gewesen war. Er lebte zum guten Teil von einer geheimen Rente von dreißig Mark pro Woche, die wir ihm für eine Anekdotenrubrik zahlten. Die Anekdoten suchte ich mir meist selber zusammen, da Mühsam viel zu zerfahren war, um regelmäßig ein brauchbares Manuskript zu liefern. Dafür aber benutzte er mein Zimmer als sein Büro und führte vor allem revolutionäre Telephongespräche, die ich ihm leider untersagen musste, da er von meinem zweifellos überwachten Apparat dauernd irgendjemanden zum Generalstreik aufrief. „Ja, Sie haben recht", stöhnte er und gab seine Revolution endgültig auf, jedenfalls über mein Telephon. Erich Mühsam ist eins der frühen Opfer der Nazis geworden. In der Nacht des Reichstagsbrandes haben sie ihn abgeholt und später erschlagen.35
*
Wenn wir unsere Inseln verließen, mussten wir in feindliche Welten segeln. Schon Weekendfahrten wurden schwierig, immer mehr 35
Erich Mühsam wurde am 10. Juli 1934 im K Z Oranienburg ermordet.
125
Gasthöfe und Pensionen an den schönen märkischen Seen hängten das Hakenkreuzbanner oder in schwachem Kompromiss die schwarz-weiß-rote Fahne aus den Fenstern. Das übrige Deutschland schien völlig Nazi verpestet. So saßen die Patrioten am Ostseestrand in ihren Sandburgen, von denen auf hohen Masten das Hakenkreuz flatterte. Rabiate Gastwirte hängten Schilder an die Tür: „Juden und Hunden ist der Eintritt verboten." Für Urlaube lockte das Ausland, selbst wenn man schon eine Grenzsteuer zahlen musste und nur wenig Geld mitnehmen durfte. In Kopenhagen und Stockholm und Prag konnte man plötzlich unter normalen Menschen ein normales Leben führen oder jedenfalls so tun als ob - ehe man in den Wahnsinn zurück musste. Das Ideal war natürlich Paris.
*
Die Caféterrassen an der Place Saint-Paul sind voll besetzt. SaintPaul buchtet halben Wegs zwischen dem Hotel de Ville und der Bastille aus der Rue de Rivoli aus. Es ist der Mittelpunkt des Marais, des ältesten Paris. Uberall stehen angeregt debattierende Gruppen, meistens Männer. Das Stimmengewirr vereinigt sich zu einer seltsamen Melodie aus Fetzen von Polnisch, Jiddisch und gutturalem Französisch. Ich bin zu einem Wiedersehen mit Michael, der von einer Weltreise mit Zeichenstift und Federhalter zurück Paris als letzte Etappe vor seiner Rückkehr nach Deutschland wählte, für ein langes Wochenende in die Seinestadt gekommen. Unsere Freunde Eugène und E m m a führen uns zum Diner in das kleine Bistro der Mme. Dombrowska in der Rue Saint-Paul. Die Kneipe bildet das Erdgeschoss eines typischen schmalen Alt-Pariser Hauses; im zweiten Stock die gutbürgerliche Wohnung unserer neuen Bekannten, die enge Freunde Eugènes zu sein scheinen. Die Zimmer in der ersten Etage werden auf Stunden vermietet, niemand
126
spricht hier von polizeilicher Anmeldung. Eugène ist Pariser Korrespondent einer Straßburger Z e i t u n g - ein rosiger Mann mit zufriedenen Augen. Um Mitternacht hat er sein Pressetelegramm aufzugeben - wir haben also viel Zeit. Mme. Dombrowska umarmt uns in stürmischer Begrüßung. Monsieur Dombrowski steht lächelnd im Hintergrund. Ein Schild „Geschlossen" wird vor die Tür gehängt. Wir sollen nicht durch etwaige fremde Gäste gestört werden. Wir gruppieren uns auf zwei Polsterbänke entlang eines langen Tisches, der mit Hors d'oeuvres polnischer und französischer Herkunft beladen ist, die Zwischenräume bieten knappen Raum für eine Batterie verstaubter Weinflaschen. Z u m besseren Verdauen besonders gewürzter Delikatessen werden Wodkarunden eingelegt. Die wenigen Unterbrechungen zwischen Kauen und Schlucken werden von Michael mit Reiseerlebnissen aus fernen Weltteilen gefüllt. Mme. Dombrowska räumt endlich die Hors d'oeuvres ab und stellt eine riesige Terrine Coq au Vin auf den Tisch, Monsieur entkorkt Flaschen leuchtenden Bordeaux's. Emma bemerkt: „So eine Weltreise aus Spaß - obendrein von einem Verleger bezahlt - muss doch herrlich sein." „Weltreise aus Spaß - das klingt gut. Michael, das ist Buchtitel." Wir trinken zum Boeuf ά ία Bourguignon mit frisch aus Keller geholtem Burgunder auf den kommenden Bestseller reise aus Spaß. Zwischen Salat und Käse wird Eugène etwas tern - es ist eine Stunde vor Mitternacht.
dein dem Weltnüch-
„Ich muss ja mein Telegramm abschicken, kein Wort weiß ich, was zu schreiben. Georges, du musst mir ein Interview geben; du kommst doch aus Deutschland, vorige Woche waren da wieder einmal Wahlen [6. Nov. 1932], was hältst du vom neuen Reichstag?" Durch das Burgunderrot meines Glases sieht die Welt rosig aus: „Ach, vom Reichstag ... Na ja, die Nazis haben ja immer noch einen Haufen Sitze. Aber die Partei hat Risse; die Deutsch-
127
nationalen wissen nicht recht wohin ... der Hugenberg hat zwar einen Freundschaftspakt mit Hitler abgeschlossen, aber Hindenburg kann den Hitler nicht leiden, der General will nichts mit dem hergelaufenen Gefreiten zu tun haben. Wir sind in einem Übergangsstadium. Schließlich brauchen ja die Industriellen Ruhe, um wieder Geld verdienen zu können ... Allzu schön sieht's gerade nicht aus, der von Papen ist alles andere als populär, aber wir werden schon weiterwursteln." Eugène schreibt eifrig mit; er beginnt seinen Bericht „Von gut informierter deutscher Seite erfahre ich ..." Monsieur Dombrowski hat zu Früchten und Nachtisch einen Champagnerpfropfen knallen lassen. Eugène trinkt sein Glas auf unser aller Wohl: „Lasst Euch nicht stören, ich laufe schnell zum Telegraphenamt, ich bin bald zurück." Michael steckt gerade ein großes Stück Napoleonschnitte in den Mund, als Eugène leise die Tür öffnet; er ist völlig nüchtern, sein Gesicht ist bleich: „Ich will Euch nicht beunruhigen, bekommt keinen Schreck. Aber soeben wird aus Berlin gemeldet, dass die Nazi-SA in den Reichstag eingedrungen ist. Am Potsdamer Platz gibt es blutige Unruhen, in der Leipziger Straße werden jüdische Geschäfte geplündert. Die Polizei ist nicht Herr der Lage, Polizisten scheinen sich mit den Nazis zu verbrüdern. Weitere Einzelheiten stehen noch aus ..." Stille herrscht am Tisch, von der Kirche Saint-Paul schlägt es Mitternacht. Mme. Dombrowska steht auf: „Ich werde Kaffee machen." Emma sinnt vor sich hin: „Michael, du wolltest doch morgen nach Berlin zurückfahren ... In Eugènes Arbeitszimmer steht ein Sofa. Du bleibst natürlich hier in Paris bei uns, du darfst nicht zurück zu den Nazis." Eugène: „Natürlich bleibt Ihr vorläufig mal hier." Der schweigsame Monsieur Dombrowski spricht zum ersten Mal: „Georges, Sie wissen, ich vermiete Zimmer im ersten Stock. Ich weiß nicht, ob Ihnen die Nachbarschaft zusagt, aber wenn Sie nicht zurückkönnen, sollen Sie ein Zimmer haben, solange Sie wollen, natür-
128
lieh kostenlos ... das wäre ja noch schöner ... Ihr werdet immer ein Heim in Paris finden." Und dann trinken wir unseren Kaffe mit einem Kognak. „Komm ins Hotel", stöhnt ein blassgewordener Michael. Ein Taxi bringt uns schnell zum Hotel. Ich helfe ihm beim Ausziehen, er krümmt sich unter Magenschmerzen. Auf den zahlreichen Wegen zwischen Bett und W C stöhnt er: „Daran hat nur der Hitler Schuld." Ich versuche zu widersprechen: „Wir haben zu viel gegessen und viel zu viel getrunken. D u konntest ja nicht genug von den scharfen Hors d'oeuvres bekommen." Aber der Widerspruch klingt selbst in meinen eigenen Ohren nicht zu überzeugend. Wir schlafen lange in den Morgen eines regnerischen Novembertages 1932 hinein. Doch als wir aufwachen, sieht die Lage nicht mehr ganz so düster aus, die Bauchschmerzen haben nachgelassen, und die Nachrichten sind nicht mehr so alarmierend wie in der gestrigen Nacht. Die Nazis hatten nicht den Reichstag gestürmt, sondern nur Feuerwerkskörper in den Plenarsaal geworfen; am Potsdamer Platz waren nur Passanten verprügelt worden, die nicht die H a n d zum Hitlergruß erheben wollten; in der Leipziger Straße waren nur ein paar Dutzend Fensterscheiben eingeschlagen worden. Tatsächlich hatte von Papens Polizei keine Hand gerührt. Die Pariser Zeitungen erscheinen mit Riesenüberschriften: „Que ce passe-t-il en Allemagne?" Was ist in Deutschland los? Wir studieren die Meldungen und beschließen schließlich, doch nach Berlin zurückzufahren. Schließlich warten dort ein Buchverleger auf Michael und ein Redaktionsstuhl auf mich, und übrigens wollte Traute mich vom Bahnhof abholen. Eugène bringt uns zum Gare du Nord: „Diesmal war's nur ein Schreckschuss, aber nächstes Mal wird es ernst werden. Wenn es soweit ist, kommt her. Ich werde für Georges ein besseres Zimmer finden als in der Rue Saint-Paul — es ist doch keine empfehlenswerte Adresse." 129
*
Die Löhne sollen wieder einmal gesenkt werden, diesmal geht es vor allem um die Löhne der Verkehrsbeamten. Die Gewerkschaften versuchen leise zu treten, aber sie haben ihre Gefolgschaft nicht mehr in der Hand. Deren Antwort ist Ausrufung eines Generalstreiks sämtlicher Berliner Verkehrsmittel über die Köpfe der Gewerkschaft hinweg. Nazis und Kommunisten übernehmen in einem seltsamen Burgfrieden die Streikleitung. Die Extreme marschieren getrennt und schlagen vereint auf die Reste jeder Autorität. Ich stehe in der Mitte der Tauentzienstraße im völlig gelähmten Berlin wie im luftleeren Raum zwischen riesigen Demonstrationen. Auf dem linken Fahrdamm marschieren Zehntausende von Nazis, auf dem rechten Fahrdamm wälzen sich in entgegengesetzter Richtung unübersehbare kommunistische Kolonnen. Beide Armeen führen blutig rote Flaggen, nur die aufgehefteten Symbole sind verschieden — hier das schwarze Hakenkreuz auf weißem Grunde, dort die goldenen Hammer und Sichel. Auf den brachliegenden Straßenbahnschienen und dem Promenadenstreifen zwischen den Fahrdämmen stehen Tausende Polizisten in Frontrichtung nach beiden Seiten. Mir dämmert das Groteske dieser Situation zwischen den beiden Polen: So sieht Deutschland wirklich aus — die Staatsgewalt durch Polizeikordons abgesteckt, die machtlos wären einen Zusammenprall der beiden Fluten von links und rechts aufzuhalten, der heute nicht erfolgt, weil ein ungeschriebener Burgfriede die feindlichen Kolonnen auseinander hält. Inmitten dieses Polizeikordons wird mir hier auf der Tauentzienstraße erschreckend klar bewusst, dass die Tage der Weimarer Republik gezählt sind, dass Eugène in Paris recht hatte, weil man von der Ferne eine bessere Ubersicht über die Geschehnisse bekommt. Die Massen wälzen sich weiter, so geht es den ganzen 130
Tag. Die Geschäfte haben die Rollläden herabgelassen, kein Bürger wagt sich in der in Ohnmacht gefallenen Stadt auf die Straße. Doch äußerlich bleibt alles friedlich. Uber den Polizeikordon hinweg fliegen wütende Schimpfworte, Sprechchöre überschreien sich, aber die Führer von rechts und links haben ihre Kolonnen scharf am Zügel. Es ist gerade diese äußere Ruhe vor dem Unabwendbaren, die so furchterregend wirkt. Wie wird dieses Ende aussehen? Wird die Republik endgültig in Straßenkämpfen ihr schwaches Leben aushauchen? Welche Intrigen können Fränzchen von Papen, General von Schleicher und der korrupte Sohn des alten Hindenburg aushecken, wie viele Neuwahlen können noch ausgeschrieben werden? Wird das Ende durch einen Militärputsch besiegelt werden, ganz unblutig wie vor einigen Monaten, als Papen die Bastion Preußen stürmte? *
Der Streik ging zu Ende, die Verkehrsmittel fuhren wieder, und es gab eine weihnachtliche Atempause, in der jeder zu versuchen schien, Politik zu vergessen. Auf der Tauentzienstraße standen jetzt Hunderte von Bauchladenhändlern und Bettlern vor den Schaufenstern der Luxusgeschäfte, und die Nazis klapperten mit Sammelbüchsen für milde Spenden zum nächsten Wahlkampf. Am Silvester saßen wir im Romanischen Café und stießen mit Glühpunsch auf ein frohes Neues Jahr an — Prost Neujahr 1933. Als dann vier Wochen später das Dritte Reich anbrach, geschah dies auf ganz legalem Wege. Hindenburg warf seinen neuesten Kanzler, General von Schleicher, hinaus. Der Generalfeldmarschall berief den Gefreiten zu sich und übergab ihm das Kanzleramt einer nationalsozialistisch-deutschnationalen Koalitionsregierung, mit von Papen als Vizekanzler und Hugenberg und nur zwei Mann der Hitlerpartei im ganzen Kabinett. War das wirklich das gefürchtete Ende? 131
Eigentlich waren wir auf unseren isolierten Inseln am historischen 30. Januar 1933 weniger niedergeschlagen als in den letzten Tagen vor der Entscheidung. Bisher war alles in so guter deutscher Ordnung vor sich gegangen, und schließlich waren ja die alten Reaktionäre um Hugenberg keine so wilden Männer, Hindenburg würde auch noch ein Wort mitzureden haben. Wir klammerten uns an jeden Trugschluss, wir hielten das Geschehen um uns für einen unwirklichen Spuk und wollten einfach nicht sehen, wie unsere kleine Welt zu einem Nichts zusammenschrumpfte. Unsere Inseln waren zu jüdischen Ghettos geworden.
132
„Wenn ich das Wort Kultur höre, möchte ich meinen Revolver entsichern."36 (Hanns Johst, Präsident der Reichsschrifttumskammer im Dritten Reich)
S große / " \ /•» i
•—Jl Vea» •
I1 I
ι r * 4*
A
I Bi^«M» mmffi *Jß V
Zum großen Siegesfackelzug hatten die Nazis ihre Truppen aus ganz Brandenburg in Berlin zusammengezogen. Diese Sturmtruppler blieben und beherrschten die Stadt. Alle anderen paramilitärischen Verbände waren von den Straßen verschwunden. Uberall wehten die Hakenkreuzfahnen, es wurde unendlich viel marschiert und viele brave Bürger kramten ihre zuweilen rostig gewordenen Unteroffiziersstimmen hervor und benahmen sich so zackig sie nur konnten. Doch die ersten Tage vergingen überraschend friedlich. Das Berliner Tageblatt erschien unbehelligt, neue Wahlen waren ausgeschrieben, und wir widmeten uns naiv dem neuen Wahlkampf, 36
In Johsts Drama Schlageter (Lit.verz. Nr. 16) äußert die Figur Friedrich Thiemann: „Wenn ich Kultur höre ... entsichere ich meinen Browning!"
133
denn in Wahlkämpfen hatten wir ja nun Routine. In der Redaktionsmappe lag sogar ein Erinnerungsartikel an den 50. Todestag von Karl Marx mit kostenlosen Bildern. Meine Sekretärin gab mir zwar nicht mehr den gewohnten Morgenkuss, sondern trug verschämt ihr Hakenkreuz. Der Laufjunge, der stets meine getragenen Anzüge geerbt hatte, entpuppte sich als Fahnenträger des zuständigen Sturmtrupps. Sie alle waren vielleicht etwas herablassend, aber sonst sehr freundlich zu mir. Michael und ich gehen im acht Tage alten Tausendjährigen Reich spazieren. SA steht vor jüdischen Geschäften und ruft zum Boykott auf. Ein kleiner verwachsener Bursche in braunem H e m d schreit wütend zu dem großgewachsenen schlanken Michael herauf: „ D u Dreckjude." Wir gehen still weiter. D a n n sagt Michael ganz ruhig: „Das habe ich doch gar nicht nötig. Draußen habe ich eine normale Welt gesehen. Ich fahre hier fort." Michael reiste am nächsten Morgen nach Kopenhagen. Er ließ ein schönes Atelier und viele Aufträge zurück. Er war der erste politische Emigrant, den ich kannte. Er verließ das Dritte Reich nicht als politisch Gefährdeter, wie wir andern nur wenige Wochen später, sondern als ein Mensch, der sich in seiner Ehre gekränkt fühlte und einfach in dem Klima, das jetzt herrschte, nicht weiterleben wollte.
*
Japan hat den Staat Mandschukuo in Nordchina mit einem Puppenkaiser an der Spitze gegründet. Wenig kümmerte uns, was die Japaner in der Mandschurei anstellten. Noch saß ich am Redaktionstisch, zwei Photos flogen mir auf diesen Tisch, die mich faszinierten — zwei japanische Plakate aus Mandschukuo. Das eine zeigte, wie die Ubersetzung besagte, auf schwarzem Grunde die Untaten des alten Regimes, das andere auf weißem Grunde die 134
strahlenden Versprechen des neuen. Wir stellten den Welt-Spiegel für den Wahlsonntag im März zusammen, und ich brachte die beiden Photos auf eine Seite. Überschrift: „Die Untaten der alten die Versprechen der neuen Regierung!" und ganz klein darunter die Unterschrift: „in Mandschukuo". Der Welt-Spiegel lief im Vordruck durch die Maschinen, er sollte der Sonntagsausgabe des Berliner Tageblatts beigelegt werden - und der Reichstag brannte [27. Febr. 1933]. Der Verlagsdirektor sah das erste Exemplar und lief rot an: „Halten Sie die Maschinen an - wie viel Exemplare sind schon gedruckt?" Der Maschinenmeister: „Wir lassen hunderttausend laufen." - „Stoppen Sie sofort, vernichten Sie die ganze Auflage, kein Exemplar darf übrig bleiben - das ist ja eine verfluchte Provokation." Sogar das Andruckexemplar wurde mir von meinem Redaktionsboten-Fahnenträger aus dem Schubfach gerissen. Am Sonntag erschien eine kleine Notiz in der Zeitung: „Aus technischen Gründen fällt der Welt-Spiegel in dieser Woche aus."37 Es hat dem Verlagsdirektor nicht viel geholfen - am nächsten Tage wurde das ganze Berliner Tageblatt auch ohne die Mandschukuo-Photos verboten.38 Der jüdische Verleger setzte sich schnellstens nach Paris ab, der arische Verlagsdirektor rollte sich schnellstens auf die Naziseite und versprach ein geläutertes und gleichgeschaltetes Tageblatt. Die Zeitung durfte wieder erscheinen, doch die Abbestellungen kamen in Waschkörben. Der Redaktionsbote kam mit einem Pack Briefen ins Zimmer: „Hier ist auch einer für Sie!"
37
Vom 5. März 1933 ist kein Welt-Spiegel überliefert.
38
Am 10. März 1933 wurde das Erscheinen des Berliner Tageblatts bis zum 13. März verboten, die Zeitung konnte jedoch am 12. März wieder erscheinen. (Berliner Tageblatt, Einzelblatt v. 10. März 1933; Berliner Tageblatt, Nr. 118 v. 12. März 1933.)
135
„ Sehr geehrter Herr! Da wir Ihre Zuverlässigkeit zur neuen Staatsform bezweifeln müssen, kündigen wir Sie mit sofortiger Wirkung. Sollten Sie noch einmal das Verlagsgebäude betreten, so würden wir uns gezwungen sehen, die Polizei hiervon zu verständigen. Heil Hitler! Die Verlagsleitung." Ich falte das Schreiben sorgsam zusammen und will das Zimmer verlassen, als Herr Illmer hereinkommt und sich ohne weitere Umstände an meinen bisherigen Schreibtisch setzt. Er steckt sich eine Zigarette an und erklärt: „Ich bin Ihr Nachfolger." Dieser Illmer war doch noch vor vier Wochen ein freundlicher Mitarbeiter, zwar blond und blauäugig, aber ich hatte ihn sogar eigentlich linkstendierend eingeschätzt. Heute trägt er ein Hakenkreuz im Knopfloch. „Viel Glück", sage ich und will aus der Tür hinaus. „Halt", ruft der neue Redakteur energisch, „was ist das hier für eine Schweinerei, machen Sie erst einmal den Schreibtisch sauber." Als ich zögere: „Oder wollen Sie, dass ich jemanden hole?" Nein, das wollte ich nun ganz und gar nicht. Ich richte Photos und Manuskripte in Reih und Glied aus. Illmer scheint zufrieden: „Na sehen Sie, von nun ab herrscht Ordnung." Und dann: „Was haben Sie denn hier eigentlich verdient?" „550 Mark nach Abzug der Steuern." Illmer fährt auf: „550 Mark - da will mich ja das Schwein betrügen, er will mir nur 500 Mark zahlen." Und schon ist Illmer an mir vorbei, raus aus der Tür - ein frischgebackener Nazi auf dem Wege zu seinem frisch gebackenem Nazichef, wohl um mit ihm kantig zu reden. Ich winke meiner alten Kollegin Gusti im Nebenzimmer ein Lebewohl zu. Sie sitzt bedrückt vor einem Berg von Photos und stellt eine Seite Der Tag von Potsdam [21. März 1933] zusammen.
136
Sie ging viele Jahre später in die Emigration und starb in Südafrika. *
Auf dem Flur herrscht Aufregung. Spukartig tauchen neue Redakteure auf, die sich auf die noch warmen Sessel der Vorgänger setzen. Andere alte Kollegen haben sich ein neues Parteizeichen angesteckt und hocken dienstbeflissen vor ihren Schreibtischen. Eine Sekretärin gibt mir ein Zeichen: „Sie suche ich", und zieht mich in eine Ecke: „Ich habe eben eine Liste der Entlassenen getippt, die der Verlag zur Gestapo schickt. Ihr Name steht gleich hinter Chefredakteur Theodor Wolff - kein gutes Omen. Verschwinden Sie hier schnell." Erst einmal muss ich aus dem Haus hinaus. Den Fahrstuhl kann ich nicht benutzen, der Fahrstuhlführer trägt seit dem Reichstagsbrand eine braune Uniform mit den Insignien des Sturms 66. Ich gehe die runde Treppe herunter. Im zweiten Stock sieht mich der dicke Botenmeister: „Mensch gehen Sie nicht raus, der Sturm 66 ist angerückt und hat das Haus umstellt." Sturm 66 scheint für das Zeitungsviertel zuständig. Das Haus hat verschiedene Nebenausgänge: einen durch die Druckerei - nein, der führt auf den Hof, da sollen bereits SAWagen geparkt sein; einen an der Kasse vorbei - nein, an die Kasse werden die Nazis zuerst gedacht haben; einen durch das Nebenhaus, eine Feuertreppe - die Tür ist natürlich verschlossen. Von nun ab herrscht Ordnung — das hat doch Hitler versprochen. Natürlich, die Nazis werden Ordnung halten. Im Erdgeschoss ist ein Postamt, das Postamt ist Reichsbesitz. Man könnte das Amt vom Inneren des Hauses erreichen. Ich spähe mich vorsichtig die völlig ausgestorbene Haupttreppe hinunter ins Erdgeschoss, erreiche ungesehen die Tür zum Postamt; hier bin ich der einzige Kunde; am Schalter verlange ich fünf Briefmarken à zehn und gehe, die Briefmarken sichtbar in der Hand, hinaus auf die
137
Straße. Frische Frühlingsluft weht mir entgegen - kein einziger Sturmtruppler steht vor d e m Tor des Postamts. Alle übrigen Ausgänge des Mossehauses sind von J u n g e n s in braunen Uniformen besetzt, doch keinem S A - M a n n würde es einfallen, einen deutschen Bürger a m A n k a u f deutscher Briefmarken zu hindern. Ich gehe a u f die andere Straßenseite, noch immer mit meinen f ü n f Briefmarken in der H a n d , sage „ H e i l " zu einem Bräunling: „ N a was macht Ihr denn hier, J u n g e n s ? " D e r J u n g e grinst: „Wir holen gerade den roten Betriebsrat ab, vielleicht b e k o m m e n wir auch ein paar von den Mistschreibern da in die Finger." „ N a , d a n n macht's mal gut." Militärmusik erschallt, ein neuer Siegesmarsch stapft durch die Straßen - hinter einem Z u g Braunhemden marschiert das Volk. Ich schließe mich i h m an - wo k a n n m a n in Hitlers Reich geborgener sein als im Marschschritt hinter Militärmusik.
*
M e i n Hauptquartier ist eine B a n k im Tiergarten. Es ist noch etwas kühl, d a f ü r aber sind hier k a u m R o l l k o m m a n d o s zu erwarten. D i e ersten K n o s p e n zeigen sich, ich lese ein dickes Buch: Cervantes Don Quijote, aber ich will keineswegs gegen W i n d m ü h l e n anrennen. Beste Verbindung mit der Außenwelt ist meine Freundin Traute. Bisher ist sie noch den Nazis unverdächtig. In ihrer Tischzeit setzt sie sich zu mir auf die B a n k . Unsere Tafelrunde vieler amüsanter Abende ist über ganz E u r o p a versprengt. Der eine, Wolfgang, ist a m T a g e nach dem Reichstagsbrand per Ski über das Riesengebirge in die Tschechoslowakei geglitten; der andere, Michael, geht in K o p e n h a g e n spazieren. Der Dritte, H a n s , ist über die Grenze nach H o l l a n d geradelt. Der Vierte, K u r t , trauert bargeldlos in Zürich dem Gelde nach, das i h m ein N a z i beim Grenzübergang a b g e n o m m e n hat.
138
Der Kerl hätte ihn verhaften können, aber dann hätte er das Geld abliefern müssen - so grinste er nur: „Mach, dass du fortkommst", und steckte die paar tausend Mark in seine Tasche. Mein Bruder ist rechtzeitig auf Urlaub nach Paris gegangen. Unser Trotzkist, der Radikalste von allen, hat im Sturmtrupp 66 sein Heil gefunden - ein Märzgefallener39! Und ich sitze noch auf einer Tiergartenbank in Berlin. Die Grenzen sind gesperrt, die Nazis verlangen Ausreisevisen. Das ist mir ziemlich gleichgültig, denn ich hätte mich ja sowieso nicht über eine offizielle Grenzstelle gewagt. Ich muss schnellstens über die „grüne Grenze" — aber wie und wohin? „Angriff*' - „Angriffschreien die Zeitungsverkäufer. Uberschrift: „Verhaftung von roten Gewerkschaftsführern." Traute und ich spazieren, Butterbrote kauend, über die Siegesallee40, wir kaufen die Zeitung — eine große Anzeige auf der dritten Seite zieht meinen Blick auf sich: WOCHENENDFAHRT NACH KOPENHAGEN AN BORD DES VERGNÜGUNGSDAMPFERS ODIN. Für alle Parteigenossen und Leser des ANGRIFF Preis 18 Mark. Kein Pass, kein Ausreisevisum nötig. Musik und Tanz an Bord. Fahrkarten im Angriffreisebüro. 39 Eigentlich: Opfer der Märzrevolution von 1848. Nach der Machtübergabe an Hitler im Januar, dem „Tag von Potsdam" und dem Ermächtigungsgesetz im März 1933 kam es zu massenhaften Eintritten in die N S D A P insbesondere von Beamten und staatlichen Angestellten. Diese Neumitglieder aus Opportunismus wurden als Märzgefallene verspottet. 40
Die Siegesallee führte vom Kemperplatz zum Königsplatz (heute Platz der Republik), auf dem die Siegessäule stand.
139
Ich hole einen Zwanzigmarkschein aus dem um den Hals hängenden Lederbeutel, er birgt mein ganzes Vermögen. Auf zum Reisebüro. Traute weiß sofort, um was es geht. Wir gehen durchs mit riesigen Hakenkreuzbannern geschmückte Brandenburger Tor und biegen in die Wilhelmstraße ein. Vor dem Hindenburg-Palais bewundert eine Rundfahrtgesellschaft die Wachtablösung. Traute stellt sich vor dem Reiseschalter an, die Karten für die Wochenendfahrt finden guten Absatz. Schließlich kommt sie an die Reihe: „Ich möchte eine Karte für die Kopenhagenfahrt!" „Gerne - für Sie selbst?" - „Nein für meinen Chef." „Der Name bitte." - Traute zögert. „Ich muss Namen und Adresse wissen, die Karte gilt nämlich gleichzeitig als Pass und 24-stündige Aufenthaltsberechtigung in Kopenhagen." „Oh, der Name, natürlich brauchen Sie den Namen, schreiben Sie auf: Georg von Knorr." Der Mann schreibt die Identitätskarte aus, ein hakenkreuzgeschmückter Stempel macht sie offiziell. Lächelnd überreicht er Fahrschein und Identitätskarte, nimmt den Zwanzigmarkschein und gibt zwei Mark Rest: „Sie haben Glück gehabt, wir sind beinahe ausverkauft - Heil Hitler!" Der Zug vom Stettiner Bahnhof soll am Freitag um Mitternacht abgehen, in Stettin liegt der Dampfer Odin dann am Kai. Das heißt noch 36 Stunden Berlin. Der Schlachtplan ist einfach: für meine Wochenendfahrt ein kleiner Koffer, wichtigster Inhalt ein zum Teil aufgeblasener Handball und die grüne Schlafdecke. Traute folgt dann mit regulärem Pass und Auslandsvisum, das ihr als unverdächtiger Arierin anstandslos erteilt wird. Sie nimmt 14 Tage Urlaub und fährt per Eisenbahn, wo sie im Koffer ein paar Anzüge mitbringen kann.
*
140
Die letzten 36 Stunden. Hauptsache, so wenige Kontakt wie möglich - ich werde Traute nicht mehr vor Kopenhagen sehen. Am Tage ist der Zoologische Garten ein guter Zufluchtsort. Das Wetter ist prächtig und ich füttere die Bären mit ein paar Stück Zukker. Dann in ein Restaurant mit möglichst großer Hakenkreuzflagge - und schließlich ins Kino. Hier sitze ich, einen grauen Seidenschal lose um den Hals. Mitten während der Vorführung erhebt sich ein Mädchen zwei Sitze entfernt, zwängt sich an mir vorbei und zieht hierbei mit geübter Hand den Schal vom Hals. Die natürliche Reaktion wäre Schal und Diebinnenhand zu packen. Aber ich bleibe unbeweglich. Was geschähe, wenn die Diebin aufschreien würde und behauptete, ich hätte sie belästigt? Was geschähe, wenn ich hinter ihr herlaufen und Lärm schlagen würde? Was geschähe, wenn das Ganze in einem Polizeiprotokoll enden würde? All das genau 24 Stunden vor meiner geplanten Flucht aus dem Dritten Reich? Die ganze Groteske meiner Situation kommt zum Bewusstsein. Ich lasse mir den Schal einfach stehlen und starre weiter auf die Leinwand. Spät nachts wage ich mich für ein paar Stunden nach Hause. Am frühen Morgen verschwinde ich mit meinem kleinen Koffer und grüner Decke. Das wird als Handgepäck am Bahnhof abgestellt. Frühstück im Wartesaal, in 18 Stunden geht der Zug. Freitag, mein hoffentlich letzter Tag in Berlin. „Wenn ich das Wort Kultur höre, möchte ich meinen Revolver entsichern", hatte ein führender Nazi verkündet, der dann auch Präsident der Reichsschrifttumskammer im Dritten Reich wurde. Museen sind Kulturstätten, hier werde ich keinen Nazi treffen. Und so wandere ich durch das Kaiser-Friedrich-Museum 41 , um Abschied von ein paar Bildern zu nehmen. Das Kronprinzenpalais mit seinen modernen Bildern ist bereits von den Nazis wegen entarteter Kunst geschlossen, aber die Alten Meister werden geduldet. Seit 1956: Bodemuseum.
141
Die Hakenkreuzfahne flattert über dem Portal, doch das ist der einzige Schönheitsfehler. Meine Schritte hallen durch die leeren Museumssäle, der Vormittag vergeht in freundlicher Stille. Am Nachmittag schlendere ich durch die Straßen. Plötzlich ruft eine laute Stimme: „Mensch, wie geht's dir denn - ich kenne dich ja noch aus Zeiten, wo Juden auch Menschen waren!" Einige Vorübergehende drehen sich um; ein alter Kollege, der mir wohl seine Freundschaft zeigen will. Wenn der Kerl nur nicht so laut und gut gelaunt wäre. Er gibt mir überschwenglich die Hand: „Was hat du denn für Pläne?" - „Pläne? Ich habe keine Pläne." Mit einem fröhlichen „Auf Wiedersehen" zieht er schließlich weiter. Eine Stunde vor Abgang des Zuges bin ich am Stettiner Bahnhof mit meinem Köfferchen und Decke. Das Gepäck hat sich um eine halbe Flasche Kognak vermehrt. Jetzt weiß ich, was es heißt, sich Mut anzutrinken. Vor dem Bahnhof steht Oskar Stark, bisher noch Chef vom Dienst am Berliner Tageblatt. Er begrüßt mich wie selbstverständlich. „Woher wissen Sie ...?" „Traute hat sich mit mir in Verbindung gesetzt." Oskar weicht nicht von meiner Seite. Ich gestehe: „Ich bin leicht betrunken." - „Das ist gut so, gut gegen Seekrankheit", lacht er. An der Sperre ist ein kleiner Tisch aufgebaut. Ein Herr mit Hakenkreuzbinde bittet um meinen Passierschein, ein Bahnbeamter knipst mein Billet. „Von Knorr", ruft er einem zweiten Herrn mit Armbinde, der am Tisch sitzt, zu. „Von Knorr", bestätigt der und hakt den Namen von einer Liste ab. „Parteiangehörige können die Wagen erster und zweiter Klasse benutzen, die übrigen Fahrgäste steigen Dritter Klasse ein", schallt es aus dem Lautsprecher. „Da haben Sie aber Glück", bemerkt Oskar. Auf dem Bahnsteig laufe ich Margot in die Arme, eine alte Bekannte aus dem Romanischen Café. Meine erstaunte Frage: ,Bringst du jemanden zur Bahn?" — „Nein, ich fahre selbst. Es ist ja so billig, ich wollte immer einmal Kopenhagen kennenler142
nen!" - „Fein, dann können wir ja hier zusammen Dritter Klasse einsteigen. Oder bist du Parteimitglied?" Ein vernichtender Blick ist die Antwort. Oskar steht vor dem Fenster bis der Zug ins Rollen kommt. Er winkt noch einmal und ruft „Gute Fahrt". Oskar Stark war der letzte Freund, den ich in Deutschland gesehen habe. Er war der erste Deutsche, den ich nach dem Kriege in Freiburg aufsuchte, wo er die Badische Zeitung herausgab. „Wissen Sie", gestand er mir, „damals auf dem Stettiner Bahnhof; ich war gekommen, um zu sehen, dass Sie richtig fortkamen, ich wollte versuchen, Sie abzusichern, falls etwas passieren sollte. Ich habe damals mehr Angst gehabt als Sie, Sie waren ja glücklicherweise reichlich betrunken. Sie sind in die äußere Emigration gegangen und ich in die innere. Übrigens stehe ich noch immer links über den Parteien ..." *
Der Zug rollt durch die Nacht. Unsere Mitreisenden sind munter und vergnügt; einer zupft auf einer Klampfe und singt forsche Marschlieder. Nur zwei Burschen mit Stahlhelm im Knopfloch, vornehme Sturmtruppler der Deutschnationalen, sind grimmig: „Die SA darf erster Klasse fahren und wir sitzen hier in der schäbigen dritten. Dabei gehört doch unser Hugenberg auch der Regierung an." Margot neben mir ist schweigsam, wie eine Vergnügungsreisende sieht sie mir nicht aus. Stettin! Die Passagiere stürzen aus den Waggons, ein kühler Seewind weht von der Bucht herein. Wir stehen, etwa 500 Wochenendler, vor dem Bahnhof und werden gezählt. Zu Viererreihen geformt marschieren wir entlang der Quais zum Ankerplatz des Vergnügungsdampfers Odin. Unter fröhlichen Soldatenliedern geht es in Schritt und Tritt. Margot an meiner Seite marschiert sehr schwerfällig und singt nicht mit. Die Silhouette 143
des Schiffs hebt sich gegen den grauenden Himmel. Die Kolonne kommt zu einem Halt. Langsam geht es über das Fallreep. Ich verlasse den festen Boden des Dritten Reichs, doch die Odin ist ein deutsches Schiff. Vom Heck weht das schwarze Hakenkreuz in weißem Kreis auf rotem Grunde. Einige uniformierte SA-Leute sind an Bord gekommen. Sollte noch in letzter Stunde etwas schief gehen? Auch Margot schaut misstrauisch auf die Braunhemden. Das Fallreep geht hoch - Symbol sentimentalen Kitsches: die Brücken sind abgebrochen - aber noch trennt uns eine lange Schiffsreise inmitten von rund 500 Angriff-Lesern und einer Gruppe uniformierter SA-Männer von einer Brücke in die freie Welt. Margot und ich mieten zwei Liegestühle und rücken auf dem Vorderdeck eng zusammen. In den Aufenthaltsräumen schmettert Marsch- und Tanzmusik. Margot setzt sich auffallend umständlich: „Danke für die halbe Reisedecke. Ich möchte sie mir am liebsten über die Ohren ziehn, aber dazu reicht's nicht ... Eigentlich komisch, wir beide hier unter einer Decke zum Wochenendausflug - und dazu noch unter einer grünen." Die Odin gleitet durch das Stettiner Haff, ihre Sirenen heulen durch den Morgennebel, die Reisegenossen singen. Ein Zollbeamter in grüner Uniform steigt über die Liegestühle und fragt freundlich, weniger aus Uberzeugung als aus Routine: „Hat jemand etwas zu verzollen, hat einer der Herrschaften mehr als die erlaubten 50 Mark oder ausländische Devisen bei sich? Die Herrschaften kennen die Devisengesetze, nicht wahr?" Margot schien die Frage nicht zu hören, sie war überraschend schnell eingeschlafen. Ich schüttele den Kopf und lächele, der Beamte zieht weiter - so ein Wochenendausflug ist für ihn leichter Dienst. Ich stehe auf, um die Beine zu strecken - es ist noch dunkel an Deck. Ich schaue durch ein Bullauge in den hell erleuchteten Tanzsaal. Einige SA-Leute tanzen, andere sitzen laut singend vor ihren Biergläsern. Ich bin erleichtert, die Burschen scheinen nicht im Dienst. Ich krieche beruhigt unter meine Hälfte der grünen 144
Decke. Zwei Stunden dauert die Fahrt durchs H a f f bis zur offenen Ostsee. Der Himmel rötet sich im Osten. Leichte Wellen wirken einschläfernd. Plötzlich fahre ich auf, aus den leichten Wellen ist eine kochende See geworden und das Schiff schwankt in kurzen Schaukelbewegungen. Die gegen die Odin schlagenden Breitseiten bringen die letzten Sänger an Bord zum Schweigen. Margot fragt schläfrig: „Wie spät ist es eigentlich — sind wir bald da?" - „ Z u früh, viel zu früh; noch vier Stunden, vier planmäßige Stunden." Der Lautsprecher schmettert weiter, Grammophonplatten werden leider nicht seekrank. Nach einer mir dünkenden Ewigkeit hebe ich den Kopf. Die Reling entlang hängen unsere einst so fröhlichen Wochenendler, die Köpfe weit vorgebeugt. Der ganze Himmel scheint schief zu hängen und neigt sich plötzlich auf die andere Seite. 12 Uhr mittags sollte die fahrplanmäßige Ankunft in Kopenhagen erfolgen, doch um diese sehnsüchtig erwartete Stunde sehen wir nichts als wilde graue See. D a gibt es auch für uns kein Halten mehr, Margot und ich opfern gemeinsam, und die frisch gereinigte grüne Decke sieht gar nicht mehr so frisch gereinigt aus. Vier Männer in brauner Uniform erbrechen sich gegen den Wind, alles fliegt ihnen ins Gesicht zurück. Sie sehen erbärmlich aus — und das sind nun meine Feinde . . . Auf dem ganzen einst so vergnügungssüchtigen Schiff herrscht statt versprochener Kraft durch Freude nur Jammer durch Leid. Ein Volksgenosse erbricht sich vom Heck des Oberdecks auf die Hakenkreuzfahne. Drei Stunden später kommt die dänische Küste in Sicht. Die MS Odin legt an der Langelinie an, die Landungsbrücke wird an Bord geschoben, ein schmaler Streifen Wasser trennt mich noch von der freien Welt. Ich greife in die Tasche und lasse als symbolischen Akt meinen Berliner Hausschlüssel ins Meer fallen. A m Ufer eine kleine Demonstration, Flugblätter werden aufs Schiff geworfen: „Deutsche, lasst euch eure Hirne nicht gleichschalten!" Dänische Polizisten treiben die Demonstranten davon. 145
Die Braunhemden mit ihren leuchtenden Hakenkreuzbinden drängen sich als erste ans Land, doch wieder greift die dänische Polizei ein: „Uniformierte erhalten keine Landungserlaubnis!" Die Jungens brüllen die Polizisten an, brüllen sind sie aus der Heimat gewohnt. Die Dänen bleiben ganz ruhig. Schließlich ruft der Kapitän die Helden zurück — ihr Ausflug nach Kopenhagen endet bereits hier an Bord im Hafen. Margot und ich gehen mit leichter Schadenfreude von Bord. Ich geb ihr die Hand: „Auf der Rückreise wirst du ohne grüne Reisedecke auskommen müssen, ich lasse meine Rückfahrkarte verfallen." „Das war mir ja klar — aber ich muss zurück, ich hab hier nur schnell etwas zu erledigen; ich habe einige Tausendmarkscheine für meinen Freund herausgeschmuggelt, der ist schon mit dem vorigen Schiff getürmt." „Wo hast du denn die gehabt?" „In meiner Vagina, angenehm war's gerade nicht, und vor dem grünen Zollbeamten hatte ich ganz schöne Angst." Ein letzter Gruß: „Viel Glück für dich, viel Glück für mich, für uns alle; wir werden's verdammt nötig haben." Ich drehe mich noch einmal um, Margot läuft schnell davon. Auf der MS Odin steht ein Häuflein missgelaunter Braunhemden an der Reling.
*
Mein Freund Michael lungerte hinter einem dänischen Schilderhaus am Kai. Er ruft ein freudiges „Hallo", als er mich entdeckt. „Woher wusstest du, dass ich an Bord bin?" „Ach, ich bin zur Ankunft jedes deutschen Schiffes hier, man trifft zuweilen Bekannte. Ich habe einen neuen Beruf — ich verkomme im Hafen. Aber du siehst ja grüner aus als deine Reisedecke." „Weißt du, wo ich wohnen kann?" „Komm mit in meine Pension, Froken Christensen wird dich schon unterbringen." Und so ziehe ich in Froken Christensens 146
Pension in der Bredgade Ecke Tollhuusgade 42 für 20 Kronen pro Woche mit voller Pension. Sie verlangt zunächst 25 Kronen, doch als ich ihr sage, dass ich aus dem Dritten Reich geflohen bin, sieht sie mich mitleidsvoll an und lässt 5 Kronen nach. Hitlerflüchtlinge sind im Frühjahr 1933 noch eine Seltenheit im friedlichen Dänemark. In meinem Zimmer packe ich den kleinen Koffer aus, lasse die Luft aus dem Ball, knüpfe den Senkel der Außenhülle auf und hole meinen Pass und ein Bündel Geld heraus. Pass und Geld sind reichlich verrollt und müssen gebügelt werden. Michael bewundert meine Erfindungsgabe: „Komm zu Krogh am Fischmarkt, das muss gefeiert werden, da gibt's herrliche Hummer." „Lieber nicht, ich möchte nichts essen, was aus dem Meere kommt - heute wenigstens nicht - ich habe Bauchschmerzen." Froken Christensen kocht mir eine Semmelsuppe. Dann werfe ich mich ins Bett. Michael wünschte mir „Gute Nacht!" Ja, es wird eine gute Nacht werden, ohne Furcht vor den Nacht-undNebel-Kommandos — erster friedlicher Schlaf seit vielen Wochen. In Kopenhagen ist ein Herr von Knorr mit einem 24 Stunden gültigen Reisepapier eingetroffen. Dieser Herr von Knorr muss amtlich schnellstens verschwinden. Am frühen Morgen gehe ich zum Fährhafen. Die Fähre nach Malmö wartet. Ich habe meinen eigenen aus dem Gummiball geholten Pass in der Tasche, dem bisher ein wichtiges Mark fehlt, der dänische Einreisestempel. Da es für einen Erdbewohner nicht genügt, einfach vorhanden zu sein, so muss er dies beweisen: Ein Pass mit Einreisestempel ist ein solcher Beweis. Dem dänischen Grenzbeamten an der Fähre zeige ich das 24Stundenvisum des von Knorr; ich gehe auf die Fähre und mitten im 0resund, auf halber Strecke nach Schweden werfe ich das mit dem Nazistempel verzierte Dokument in kleine Fetzen zerrissen 42
Vermutlich: Tojhusgade, die aber (heute) keine Ecke mit der Bredgade bildet.
147
ins Meer. Auf der schwedischen Seite ziehe ich meinen Pass heraus, der schwedische Beamte gibt mir freundlich einen blauen schwedischen Einreisestempel. Bis zur Rückfahrt der Fähre gehe ich in Malmö spazieren, dann kehre ich zum Schiff zurück, erhalte einen schwedischen roten Ausreisestempel und segle meiner neuen provisorischen Heimat Dänemark entgegen. Der Däne empfängt mich mit einem ordnungsgemäßen grünen Einreisestempel. Drei Stempel innerhalb zweier Stunden - rot, blau und grün - ich habe mich ordnungsgemäß legalisiert. Jetzt kann ich bei der Fremdenpolizei amtlich gemeldet werden. Ein Dampfer tutet am Kai, es ist die Odin, zur Rückreise nach Stettin bereit — die 24 Stunden sind abgelaufen. Langsam löst sich das Schiff von der Hafenmauer, ein verzweifelter Zuspätkommender schafft noch gerade den Sprung vom Kai und hält sich an der Reling fest. Mitpassagiere ziehen ihn aufs Schiff - er hätte beinahe den Anschluss ans Dritte Reich versäumt. *
Mit dem Abendzug kommt Traute mit zwei Koffern und der Schreibmaschine. Ich stehe auf dem Bahnsteig — wir geben uns ein heimliches Zeichen wie vorher ausgemacht. Denn man kann ja nicht wissen, ob da irgendein Spitzel herumsteht und den direkten Berlin-Kopenhagen-D-Zug nebst seinen Passagieren beäugt. Ich fühle mich, als ob ich einen schlechten Detektivfilm durchlebe. Traute geht hinter dem Gepäckträger her, der die Koffer auf seinem Wägelchen zum Taxistand rollt. Ich folge in einiger Entfernung. Die Koffer werden eingeladen, sie steigt ein, ich stehe plötzlich auf der anderen Seite des Taxis, reiße die Tür auf und springe hinein. Der Taxifahrer dreht sich erstaunt um, sieht unsre lachenden Gesichter und fährt los, Adresse: Bredgade Ecke Tollhuusgade. Froken Christensen ist vorbereitet. Da es schon nach der Abendbrotzeit ist, hat sie mein kleines Zimmer mit einem gewal148
tigern Smorgasboard vollgestellt. Tisch und Bett sind mit Salaten und Aufschnitten beladen, Heringe in allen Formen, Krabben, Räucheraal, „gehackter Briefträger" - eine dänische Spezialität: rote Rüben und Hering, genannt nach den roten Uniformen der Briefträger. Und dann Fruchtgrütze mit Sahne - unter einer gehäkelten Haube noch warmer Kaffee. Meine Wirtin scheint zu glauben, dass Hitlerflüchtlinge besonders großen Hunger haben. Jetzt erst fällt mir Traute in die Arme: „Wie schön, dass du da bist, ich habe solche Angst gehabt!" Tränen tröpfeln. Ich gestehe, dass ich auch Angst hatte, eine gehörige Portion Angst - aber jetzt nur keine Trauerszenen. Wir haben herrliche vierzehn Tage vor uns. „Hast du Hunger nach der langen Fahrt?" - „Wolfshunger!" Es ist ein Festmahl. Am Morgen wartet Michael am Frühstückstisch, stürmische Begrüßung: „Heute gehen wir aber zu Krogh am Fischmarkt Hummer essen." Heute lehne ich nicht ab, die Seekrankheit ist längst vergessen. Traute versucht einen praktischen Einwand: „Jungens, Ihr müsst doch mit dem Geld sparen." Michael zuckt die Achseln: „Ich hab mir in den letzten Tagen meine Philosophie gezimmert: Pleite darfst du sein, aber niemals arm! Wir spielen reich, wenn wir es wollen, die übrige Zeit verkommen wir dann im Hafen. Heute ist unser reicher Tag!" Als noch Ungelernter frage ich: „Du hast mir schon gestern gesagt, du verkommst in Hafen, wie macht man denn das?" „Das wirst du noch schnell lernen. Du steckst dir eine Flasche Bier in die Tasche, besser zwei. Durch das goldene Bier gesehen ist der Hafen bunt und aufregend. Man schwätzt mit herumlungernden Matrosen in allen Sprachen, die man beherrscht oder nicht beherrscht, du wirst eingeladen an Bord von Frachtern zu kommen, du darfst mit herumlungern und ins Wasser spucken und von der weiten Welt träumen und dabei vergessen, dass du eigentlich arbeitslos bist und bald nicht einmal die 20 Kronen wöchentlich für Fraken Christensen haben magst." 149
Aber heute ist unser reicher Tag, und die nächsten vierzehn Tage werde ich dauernd reich sein, noch ist ja das Geld da aus dem aufgeblasenen Ball. Der Hummer bei Krogh ist ausgezeichnet. Traute und ich haben einen Pakt geschlossen. Wir wollen diesen kurzen Frühling genießen und in den Tag hineinleben. Wir wollen Tucholskys Rheinsberg spielen und kein Wort von unserer ungewissen Zukunft reden. „Ist das nicht ein bisschen zu romantischer Kitsch?", zweifelt sie. „Vielleicht - aber Kitsch ist das Opium der Völker." Kopenhagen im noch kühlen Frühling ist eine herrliche Stadt. Wir spazieren über den Rathausplatz mit seinen vielen Türmen, wir sehen die Wachablösung der kleinen Soldaten mit ihren riesigen Bärenmützen vor der Amalienborg. König Christian reitet, nur von einem Adjutanten begleitet, zu einem Morgenritt aus. Höflich ziehen vorbeikommende Bürger den Hut, freundlich grüßt König Christian zurück. Wir stehen vor der zauberhaften Meerjungfrau am 0resund und füttern Möwen. Wir gehen an einem stattlichen Amtsgebäude vorbei, mit breiter Freitreppe und dicken Säulen. Um die Ecke ist eine kleine Tür. Neben der Tür hängt ein altmodischer Klingelzug, darunter ein ovales Emailleschild: „Natklokke til Generalstaben!" Nachtglocke zum Generalstab. „Ob die Nazis an dieser Glocke ziehen werden, wenn sie eines Nachts in Dänemark einfallen sollten?", zweifelt Traute. Die Geschichte lehrt uns, dass sie nicht gezogen haben. An der Langelinie liegt ein großes weißes Schiff vor Anker, am Heck flattert das Sternenbanner. Ein Matrose winkt uns eifrig an Bord: „Welcome", ruft er uns erfreut zu, als wir das Fallreep hinaufsteigen, und wirft Traute eine Kusshand zu. Er scheint der einzige Mann an Bord und zeigt uns liebevoll das ganze Schiff, von Bug bis Heck. Auf der Brücke wollen wir uns endlich von ihm verabschieden: „Stay with me" - bleiben Sie doch noch ein bisschen! Und er erzählt uns seine traurige Geschichte: „Seit zehn Jahren fahre ich nun mit diesem Seekadettenschiff über alle Meere; alle 150
zwei Jahre laufen wir Kopenhagen an. Jedesmal besaufe ich mich zuvor in Southampton, und als Strafe darf ich daher niemals in Kopenhagen von Bord, und Kopenhagen soll doch so lustig sein und so nette Mädchen haben." Traute gibt ihm mitleidig einen Kuss auf die Wange. „Endlich hat mich ein dänisches Mädchen gekiisst", seufzt er beglückt. Ein Polizeiwagen hält vor dem Schiff — wie aus dem Nichts erscheinen amerikanische Militärpolizisten. Die dänischen Polizisten öffnen die vergitterte Tür ihres Wagens, die Militärpolizei holt mit starken Armen ein halbes Dutzend völlig betrunkener Amerikaner heraus und schleift sie an Bord. Unser Matrose blickt neidisch auf seine Kameraden: „Nur ein einziges Mal möchte ich mich in Kopenhagen betrinken!" Wir füttern im Tiergarten bei Springforbi die zahmen Rehe, wir sitzen in Tisvilde am Strand und spielen mit meinem einst so kostbaren Ball; wir wandeln in Helsingor auf Hamlets Spuren, folgen einem Schild zu seinem Grabe. Ein altes Eisengitter umrahmt einen Hügel unter dunklen Eichen. Hier liegt also nach der Legende Hamlet, auch wenn die neuere Forschung behauptet, dass er hier gar nicht begraben sei. Wir aber entdecken einen lebenden Hamlet am Marktplatz - ein Ladenschild verkündet: „Gustav Hamlet, Kinderwagen und Fahrräder." Ob der wohl verwandt ist? Vierzehn Tage Urlaub von der Wirklichkeit fliegen vorüber. Die langen nordischen Tage beginnen, wir sitzen am letzten hellen Abend beisammen und starren ins Abendrot, wir sind sehr still. Plötzlich fragt Traute: „Willst du mich heiraten?" Erst muss ich den Schock überwinden: „Damals, als ich glaubte einen guten Posten zu haben, sozusagen eine Lebensstellung - damals, als ich sogar Geld verdiente, - damals, als ich glaubte ziemlich erfolgreich zu sein, - damals als die Zukunft rosig aussah und wir einmal von Ehe sprachen, lachtest du: .Solche Jungens wie dich heiratet man nicht, du bist zuweilen reizend, aber unseriös.' Und heute willst du einen Unseriösen, Arbeitslosen, 151
Heimatlosen, Zukunftslosen mit einem Totalvermögen von 786 dänischen Kronen heiraten?" „JA!" Ich hatte beim Silber-Jensen einen Silberring gekauft, den wollte ich ihr zum Abschied morgen früh schenken. Ich hole ihn aus der Tasche: „Hier, mein Verlobungsring." Ich stecke ihn meiner Braut an den Finger. Dann kommt die Nüchternheit: „Du musst erst einmal zurück. Du hast deine Eltern, du hast deine Stellung. Ich muss irgendwo Fuß fassen, irgendwo auf dieser Erde. Ich hole dich, sobald ich kann. Ich hole dich ..." Am nächsten Morgen nehmen wir die Straßenbahn zum Bahnhof, man muss ja anfangen Geld zu sparen. Wir nehmen Abschied an der Haltestelle. Allein geht Traute langsam die Bahnhofstreppe hinauf und verschwindet in der Bahnhofshalle. In meinem leeren Zimmer hat Michael auf mich gewartet. Ich ruf ihm zu: „Los, lass uns im Hafen verkommen."
*
Werft Eure Herzen über alle Grenzen Und wo Ihr Anker fasst, da seid zu Haus! Mit diesen Zeilen ermutigte Walter Mehring seine über die Reichsgrenzen fliehenden Weggenossen im Frühjahr 1933. Doch wehe dem, der diese Aufforderung etwa wörtlich nahm. Erst einmal verbieten es die Zollgesetze sämtlicher Kulturstaaten, überhaupt irgendeinen Gegenstand über irgendeine Grenze zu werfen. Wer dem Zollbeamten entgehen sollte, stößt auf den Grenzschutz. Denn viele Grenzen sind aus militärischen Sicherheitsgründen für jeden Übergang gesperrt. Ein Werfen von lebenden Herzen würde hier gegen die Verteidigungssicherung verstoßen und militärische Gegenmaßnahmen wegen Verletzung der Hoheitsrechte des betref152
fenden Staates auslösen. Bewilligungen zum Ankern unterstehen den Hafenbehörden. Und ob man sich als zu Haus betrachten darf, entscheiden Ministerien und Polizei. Als ich mit Walter Mehring und seinem kleinen Hund viele Jahre später im New Yorker Central Park spazieren ging, erinnerte ich ihn an sein Gedicht aus den Frühlingsstürmen der Emigration. Mehring lächelte: „Ein Dichter gibt oft unpraktische Ratschläge." Vielleicht wäre ein anderes Dichterzitat passender gewesen: „Die Welt ist weggegeben ... Willst du im Himmel mit mir leben, er soll dir offen sein .. ,"43 Die dänische Polizei ließ mich schließlich provisorisch auf drei Monate Anker fassen. Doch unter der in den Pass gestempelten Aufenthaltsgenehmigung vermerkte ein blauer Gummistempel in großen Lettern: „Keine Arbeitserlaubnis!" Von diesem Gummistempel, den auf der Höhe der Depression jeder Staat in den Pass jedes Ausländers drückte, hatte Walter Mehring in seinem Gedicht nicht gesprochen. Wie lernt man mit einem bereits auf 771 dänische Kronen geschrumpften Vermögen zu leben, ohne arbeiten zu dürfen? Ein Redakteur des Socialdemokraten schien an meinen Erlebnissen interessiert: „Schreiben Sie ein paar Artikel, wie es im Dritten Reich aussieht - aber bitte keine Leitartikel, sondern interessante Reportagen. Wir können Sie leider nicht direkt bezahlen, da Sie ja keine Arbeitserlaubnis haben ... Warten Sie mal, wir werden es so machen: Wir honorieren unseren Ubersetzer, und der wird Ihnen das Ihnen zukommende Geld auszahlen." In Friedrich Schillers Gedicht Die Theilung der Erde, das von der Übergabe der Erde durch Zeus an die Menschen und ihre Verteilung unter den verschiedenen Berufsständen handelt, kommt der Poet zu spät, so dass für ihn nichts mehr übrig ist, woraufhin Zeus in den abschließenden Gedichtzeilen sagt: ,„Was thun?' spricht Zeus, ,die Welt ist weggegeben, / Der Herbst, die Jagd, der Markt ist nicht mehr mein. / Willst du in meinem Himmel mit mir leben, / So oft du kommst, er soll dir offen seyn.'" (Lit.verz. Nr. 24.) 43
153
Walter Mehring
Der Emigrantenchoral
Werft eure Herzen über alle Grenzen, Und wo ein Blick grüßt, werft die Anker aus! Zählt auf der Wandrung nicht nach Monden, Wintern, Lenzen, Starb eine Welt - ihr sollt sie nicht bekränzen! Schärft das euch ein und sagt: Wir sind zu Haus! Baut euch ein Nest! Vergeßt - vergeßt Was man euch aberkannt und euch gestohln! Kommt ihr von Isar, Spree und Waterkant: Was gibt's da heut zu holn? Die ganze Heimat Und das bißchen Vaterland Die trägt der Emigrant Von Mensch zu Mensch - von Ort zu Ort An seinen Sohl'n, in seinem Sacktuch mit sich fort.
Tarnt euch mit Scheuklappen - mit Mönchskapuzen: Ihr werdt euch doch die Schädel drunter beuln! Ihr seid gewarnt: das Schicksal läßt sich da nicht uzen Wir wolln uns lieber mit Hyänen duzen Als drüben mit den Volksgenossen heuin!
Wo ihr auch seid: Das gleiche Leid Auf'ner Wildwestfarm - einem Nest in Poln Die Stadt, der Strand, von denen ihr verbannt: Was gibt's da noch zu holn? Die ganze Heimat und das bißchen Vaterland Die trägt der Emigrant Von Mensch zu Mensch - von Ort zu Ort An seinen Sohl'n, in seinem Sacktuch mit sich fort.
Werft eure Hoffnung über neue Grenzen Reißt euch die alte aus wie'n hohlen Zahn! Es ist nicht alles Gold, wo Uniformen glänzen! Solln sie verleumden - sich vor Wut besprenzen Sie spucken Haß in einen Ozean! Laßt sie allein Beim Rachespein Bis sie erbrechen, was sie euch gestohln Das Haus, den Acker - Berg und Waterkant. Der Teufel mag sie holn! Die ganze Heimat und das bißchen Vaterland Die trägt der Emigrant Von Mensch zu Mensch - landauf landab Und wenn sein Lebensvisum abläuft mit ins Grab.
Der Übersetzer scheint ein netter Mensch: „Erik Nielsen", stellte er sich vor und ladet mich gleich zu einem Bier in der Lumske Bugten, anscheinend seinem Stammlokal, ein. Dann stürze ich an die Reiseschreibmaschine, auch ein Stück, das Traute mir gerettet hat, und schreibe und schreibe, an Material mangelt es nicht. Am nächsten Sonntag erscheint eine ganze Seite, reich illustriert - und mehrere Fortsetzungen folgen. Die Artikel sind mit einem Pseudonym gezeichnet. Erstens brauchen die Nazis nicht zu wissen, wer der Verfasser ist, und dass dieser Verfasser sich in Dänemark aufhält, und zweitens braucht die dänische Fremdenpolizei nicht zu wissen, dass ich gegen ihren Gummistempel verstoßen habe. Ich warte auf meinen neuen Freund, den Ubersetzer, und mein Geld. Wieder treffen wir uns in der Lumske Bugten am Hafen. Er kommt, spendiert wieder ein Bier und erklärt mit treuem blauäugigen Blick, dass die Zeitung noch nicht das Honorar gezahlt habe - aber er werde sofort hingehen und Krach schlagen. Dann höre ich viele Tage nichts von ihm. Ich suche ihn auf der Redaktion. Dort hat er sich auch nicht sehen lassen. Schließlich frage ich den Redakteur, der ruft bei der Kasse an: „Aber wir haben den Artikel schon lange an Herrn Nielsen bezahlt. Wo ist der Kerl eigentlich, ich hab ihn schon mehrere Tage nicht gesehen - hoffentlich ist er nicht wieder auf Touren ..." Schließlich taucht Nielsen auf, unrasiert und schluchzend und gesteht, dass er sein ganzes Gehalt und mein Honorar dazu versoffen habe. Jetzt hätten sie ihn noch obendrein aus der Zeitung hinausgeworfen. Er wisse, was für ein gemeiner, gewissenloser Mensch er sei, einen armen Hitlerflüchtling so sitzen zu lassen, und er werde mir bestimmt das Geld wiedergeben, doch zur Zeit habe er keine Krone und keinen Ore — und außerdem sei er arbeitslos. Ich treffe meinen Ubersetzer noch häufig in der Lumpenbucht, die auch meine Stammkneipe geworden ist. Stets verspricht er mir mit seinem Hundeblick, die Schuld abzustottern, und schüch156
tern fragt er, ob ich ihm nicht heute ein Bier und einen Aquavit vorlegen könne. Bei meinem ersten illegalen Arbeitsversuch im Königreiche Dänemark musste ich ausgerechnet auf einen Quartalssäufer stoßen, der in sein von mir bezahltes Bier hineinweint und immer wieder sich selbst bezichtigt, was für ein gemeiner Mensch er sei. *
Eine neue Arbeit! Mein reuiger Ubersetzer schickt mich zu einem Verleger, der Ubersetzungen ins Deutsche braucht. Der Mann erklärt mir, dass er eine Agentur zum Vertrieb Wahrer Geschichten aufmache, die außerhalb des Dritten Reichs in deutschen Sprachgebieten verkauft werden sollen. Denn mit dem Reich könne man wegen all der Zensur und der Devisenbestimmungen keine Geschäfte mehr machen: „Sie können sicher genug dänisch, um diese Geschichten zu übersetzen", fragt der Verleger, ohne auf meine verlogene Antwort zu warten, denn er braucht einen Mann, der unter Tarif Schwarzarbeit leistet. „Hier sind erst einmal drei Geschichten, etwa dreißig Seiten; wir zahlen eine Krone pro Seite Ubersetzung, wir brauchen das Manuskript sehr schnell." Eine Krone pro Seite ist krasse Unterbezahlung, aber der Verleger wird das Geld aus seiner Hosentasche zahlen, da braucht man keine Arbeitserlaubnis. Ich nehme die dreißig Seiten, ich habe wieder Arbeit. Die einzige Schwierigkeit ist, dass ich gar nicht Dänisch kann und bestimmt nicht in den paar Tagen bis zum Ablieferungstermin Dänisch lernen werde. Das Problem: Wie übersetzt man aus einer einem unbekannten Sprache? Am Mittagstisch in der Pension Christensen sitzt mir Fraken Etta gegenüber. Wir haben uns verschiedene Male zugelächelt, und sie spricht sogar ein ganz verständliches Deutsch. Mit einer Mischung dänischer Brocken in mein mit englischen Wörtern durchsetztem Deutsch lade ich Etta zu einem Sonntagspaziergang auf der Langelinie, der berühmten Kopenhagener Promenade, ein.
157
Sie nickt mit dem Kopf ein Ja, und im Laufe unseres Spazierganges fahren wir mit einer kleinen Fähre durch den Hafen zur Insel Trekroner, der alten Festung in der Hafeneinfahrt, und trinken im Schatten würdiger Geschütze, auf denen Kinder herumturnen, unsern sonntäglichen Kaffee. Schließlich spreche ich von meinem Manuskript und frage, ob sie mir bei der Ubersetzung helfen wolle. „Aber natürlich", lacht sie — „wovon handelt es denn?" „Das möchte ich gerne von Ihnen erfahren!" Wir gehen Arm in Arm zurück zur Fähre. Zu Hause hat Freken Christensen wunderbare sonntägliche Salate auf den Tisch gestellt, es wird ein Festessen. Eine kleine Liebelei, doch schließlich ist eine junge Dänin mit einem lachenden vollen Gesicht jedem trockenen Wörterbuch vorzuziehen. Wir sitzen am Abend im Gästezimmer bei Tee und Keksen im Pensionspreis einbegriffen - und studieren das Manuskript. Etta weiß genug Deutsch, um mir die Umrisse der Handlung zu erzählen: „Es handelt sich in der ersten Geschichte um einen armen Maler, der ein armes Mädchen liebt; sie hat kein Kleid, um ausgehen zu können, und er malt ihr heimlich große bunte Blumen auf ihr altes Kleid, und sie hat jetzt das schönste Kleid, und beide gehen glücklich auf den Ball...". Es ist eine furchtbar sentimentale Geschichte, und die beiden andern sind keinesfalls besser. Am nächsten Morgen sitze ich an meiner Schreibmaschine, und da ich die Einzelheiten schon vergessen habe, muss die Phantasie herhalten. Meine Geschichten sind zu Tränen rührend, können aber kaum noch Übersetzungen genannt werden. Mit leichter Beklemmung liefere ich die Manuskripte an den Verleger: „Ich will sie mir erst einmal durchlesen, ich kann ganz gut Deutsch. Kommen Sie morgen für Ihr Honorar." Ich stottere etwas von „freier Übersetzung, wobei aber doch die tieferen Gedanken des Verfassers wohl richtig erfasst seien." Es sind harte vierundzwanzig Stunden. Ich wage Etta nicht in die fragenden Augen zu schauen, als sie mir besonders freund158
lieh den „gehackten Briefträger" über den Mittagstisch reicht. Am nächsten Morgen steige ich etwas beklommen die Treppen zum Verleger empor. „Ach Sie sind's", sagt er unbefangen freundlich, „Sie kommen wegen der Ubersetzung. Meine Sekretärin wird Ihnen 31 Kronen auszahlen ... Ich kann Ihnen sagen, die Übersetzung ist ganz frisch, Sie kleben nicht so am Original, das gefällt mir. Sie haben mich ganz richtig verstanden, man kann nicht einfach wörtlich übersetzen, man muss die Gedanken des Schriftstellers in eine andere Sprache übertragen. Ich werde sicher bald wieder etwas haben, dann lasse ich von mir hören." Mit 31 Kronen in der Tasche gehe ich mit Etta ins Tivoli. Er ließ wirklich von sich hören, noch einmal tröpfelten 28 Kronen. Doch die Agentur schien nicht recht einzuschlagen. Das deutsche Sprachgebiet außerhalb des Dritten Reichs schien nicht kapitalkräftig genug, um viele Wahre Geschichten zu kaufen. Die kärgliche Einnahmequelle als Ubersetzer aus einer mir unbekannten Sprache versiegte schnell.
*
Michael hatte inzwischen eine Zeichnung ans Aßonbladet verkauft. Sie erschien am Abend, mit dem Namen des Zeichners in Fettdruck. Dem wahren Namen und keinem Pseudonym. Dies erwies sich als Fehler. Es war eine gute Zeichnung, sie wurde viel beachtet, vor allem von der zuständigen Behörde. Drei Tage später kam ein Brief, mit dem mein Freund höflich gebeten wurde, im Zimmer 78 des Justizministeriums vorzusprechen. „Arbeitsgenehmigungen für Ausländer", besagte ein Schild an der Tür des Zimmers 78. Ein dänischer Justizbeamter begrüßte den eintretenden Michael höflich. Der gab ihm die Vorladung, und der Beamte griff ein Aktenstück aus einem hohen Haufen heraus. Er öffnete es - obenauf lag die Zeichnung aus dem Afionb ladet. 159
„Ach, Sie sind der Zeichner." Der Beamte betrachtet die vor ihm liegende Zeichnung eines schönen Mädchens: „Recht nett, wirklich recht nett." Michael lächelt geehrt und verbindlich. „Ja", räuspert sich der Beamte, „leider haben Sie als Ausländer kein Recht, ohne Arbeitsgenehmigung in Dänemark zu arbeiten. Um eine solche Genehmigung müssen Sie erst einmal ansuchen. Das Gesuch muss auf Form 453 A in dreifacher Ausfertigung eingereicht werden. Warten Sie, ich gebe Ihnen die Formulare." „Sie sind äußerst freundlich", bemerkte Michael bei Empfangnahme der Papiere, „ich danke Ihnen sehr. Wie lange wird es wohl dauern, bis das Gesuch bewilligt wird?" Der Beamte schaut verlegen auf: „Bewilligt? - Bewilligt wird Ihr Gesuch wohl kaum werden. Wir erteilen bei unserer angespannten Arbeitslage zur Zeit überhaupt keine Arbeitsgenehmigung für Ausländer." Michael blickt den Herrn Justizbeamten verständnislos an: „Ja, dann hat es doch gar keinen Zweck, dass ich das Gesuch einreiche." Der Beamte, scharf und eindringlich: „Keinen Sinn? - Ich glaube doch. Sehen Sie Ihre Situation: Sie haben bereits illegal gearbeitet, die Zeichnung hier ist Beweis. In Ihrem Pass ist ein Stempel eingedruckt, der Ihnen deutlich sagt, dass Sie nicht ohne Genehmigung arbeiten dürfen. Sie haben gegen unsere Gesetze verstoßen und könnten sehr schnell ausgewiesen werden. Falls Sie aber ein Gesuch um Arbeitsbewilligung einreichen, können während der Laufzeit des Gesuches keine Maßnahmen gegen Sie ergriffen werden." Michael schien die juristischen Feinheiten nicht ganz zu verstehen. Der Beamte versucht, noch deutlicher zu werden: „Übrigens werde ich Ihr Gesuch persönlich bearbeiten, ich werde eingehende Recherchen anstellen, das kann wohl eine ganze Weile dauern, und bis zum Entscheid haben Sie nichts zu befürchten." Schließlich begriff Michael, dass dieser Däne hinter dem Schreibtisch auf seine Art helfen wollte und ihm eine Galgenfrist gab. Die Drohung mit Ausweisung brauchte nicht zu ernst genom160
men zu werden, kein Land wies anno 1933 die damals noch nicht so zahlreichen Hitlerflüchtlinge aus - aber das Arbeitsverbot war ernst zu nehmen. Nach Wochen des Nichtstuns und gar nicht unangenehmen Verkommens im Hafen im herrlichen skandinavischen Sommer und einer Mastkur in der Pension Christensen sitzen wir in der Lumpenbucht und studieren die Lage. Wir stellen fest, dass das freundliche Dänemark nur die erste Etappe auf einer langen Reise durch die Welt und ihrer Paragraphenwälder sein kann: „Solange du Geld hast und nicht zu arbeiten brauchst, bist du mehr oder minder freier Weltbürger. Doch wer versucht, für sein Leben zu arbeiten, wird schnell zum lästigen Ausländer", philosophiert Michael. Dann sein plötzlicher Entschluss: „Schließlich sind wir zu jung, um im Hafen zu verkommen. Ich fahre nach Schweden und vielleicht später nach England." „Glaubst du, dass es in Schweden kein Justizministerium gibt und in England kein Home Office, die dir die Arbeit verbieten werden?" „Doch ich weiß, die gibt es - aber diese beiden Behörden haben bisher noch kein Aktenstück über mich angelegt." „Na, dann gehe ich morgen aufs französische Konsulat; wenn die mir ein Visum geben, ziehe ich Paris vor, da droht mir nur die Préfecture. Außerdem sitzt dort mein Bruder im Café du Dôme am Montparnasse, und ich kenne ein paar französische Kollegen. Eugène und Monsieur Dombrowski hatten mich ja damals im November so herzlich eingeladen. Vor allem hat mir ein guter Freund mein Vermögen von tausend Mark nach Paris geschmuggelt - da bin ich wieder einmal reich." Dieses Schmuggeln war ein kompliziertes Geschäft gewesen. Ich hatte einem tschechoslowakischen Freunde, der den stolzen Titel Devisenausländer führte, vor meinem Verschwinden diese tausend Mark anvertraut. Hiermit wurde ich stiller Teilhaber eines Filmunternehmens, das einen deutschen Knüller nach Spanien exportierte. Der Exporteur brachte den Film persönlich nach 161
Madrid, kassierte seine Kommission und hatte wohl kaum die Absicht, das Geld zurück ins Dritte Reich zu bringen. Auf seinem Rückweg über Paris hatte er meinem Bruder einen Umschlag voller spanischer Peseten gegeben. Die warteten auf mich.
*
„Aber mein Herr, Sie haben einen in Berlin ausgestellten Pass, das französische Konsulat in Berlin ist für Ihr Visum zuständig", sagt mir der Beamte auf dem Konsulat in Kopenhagen. Ich erkläre ihm eindringlich, dass ich mir diesen Umweg ersparen will, dass Freunde in Paris auf mich warten, dass ich das nächste Schiff nehmen muss und dass er doch bitte eine Ausnahme machen soll. Er geht achselzuckend mit meinem Pass zum Konsul. Der kommt aus seinem Zimmer, blättert im Pass: „Hier steht als Beruf Redakteur. Wo sind Sie denn Redakteur?" Zögernde Antwort: „Ich arbeitete am Berliner Tageblatt." „Vor der Gleichschaltung?" - „Oui, Monsieur." Der Konsul sieht mich lange an. Er gibt dem Beamten den Pass zurück: „Bei Journalisten können wir eine Ausnahme machen — erteilen Sie ihm ein Dauervisum" - und verschwindet in seinem Büro. Beglückt zeige ich Michael mein Visum. Er liest es kritisch: „Dänisch kannst du nicht, aber du behauptest doch Französisch zu sprechen. Hast du gelesen, was unter dem Visum steht? ,Pas autorisé d'accepter un emploi salarié' - das heißt auf Deutsch: Kein Recht, eine bezahlte Stellung anzunehmen." Eine Kleinigkeit wie dieser Zusatzstempel kann mich nicht aus meiner gehobenen Stimmung bringen: „Jetzt weiß ich wenigstens, was Arbeitsverbot auf französisch heißt. Französisch ist doch eine schöne Sprache." Michaels Zug nach Stockholm ging am nächsten Morgen um sechs Uhr. Er weckte mich, den Koffer in der Hand: „Mach's gut, 162
seh dich irgendwo in der Welt mal wieder - es gibt überall Häfen, in denen man verkommen kann." Er stürzte aus dem Zimmer. Acht Jahre später begrüßte er mich am Kai in New York. Mit der Morgenpost kam zwei Stunden später die Ablehnung seines Arbeitsgesuches vom dänischen Innenministerium. In drei Tagen geht mein Schiff von Esbjerg nach Antwerpen. Froken Christensen gibt mir ein paar Kronen wieder, weil ich den vollen Monat bezahlt habe, aber einige Tage nicht abwohnen und abessen werde. Vor ein paar Monaten habe ich als in Berlin Untergetauchter auf den Abgang eines Dampfers nach Dänemark gewartet. Wieder warte ich auf ein Schiff. Doch das Warten im schönen, friedlichen Kopenhagen auf mein Schiff nach Frankreich ist angenehmer, angefüllt mit sentimentalen Spaziergängen durch liebgewonnene Straßen. Vor dem Tivoli steht eine Waage. In den letzten Wochen in Berlin hatte ich zehn Kilo verloren, der Anbruch des Dritten Reichs war eine gute Abmagerungskur. Ich werfe ein Zweiörestück in den Schlitz, der Zeiger schnellt nach oben. In Kopenhagen habe ich zwölf Kilo zugenommen. Auf dem Hauptbahnhof am Zuge nach Esbjerg steht Etta mit einem riesigen Fruchtkorb und ein paar Tränen, und plötzlich taucht mein Quartalssäufer auf. Er kam, um mir noch einmal zu versichern, was für ein gemeiner Mensch er sei, aber er kam auch diesmal ohne Geld. Er schwor, dass er seine Schuld bestimmt einmal abzahlen werde — natürlich blieb es ein Meineid. Ein langer Abschiedskuss Ettas ist der letzte Gruß Kopenhagens. Der Zug rollt aus der Halle zur Fahrt durch ein friedliches Land. Ich habe hier zwar keinen ständigen Ankerplatz für mein Herz finden können, aber der Sommer in Dänemark hatte aus einem gehetzten Staatsfeind einen braungebrannten, rundlichen und ziemlich glücklichen Erdbewohner gemacht.
*
163
Zu Schiff nach Frankreich. In Esbjerg liegt die SS GrafBernstorff und wartet auf den direkt am Kai haltenden Zug. Ich schleppe zwei Koffer, Schreibmaschine, meinen Fruchtkorb und eine dicke Tüte mit belegten Broten, die Fraken Christensen mir beim Abschied in die Hand gedrückt hatte, in die tief im Bauch des Schiffes liegende dritte Klasse - zwei große Schlafsäle, eine vielbettige Kabine für die Männer, eine für die Frauen. Wir sind im Männerraum vier Passagiere, bei den Frauen sind nur drei Betten belegt. Die Route im weiten Bogen um das Dritte Reich - später „die Emigrantenroute" genannt - wird noch wenig frequentiert. Die SS Graf Bernstorff hat vor allem Fracht geladen - der Emigrantenstrom wird erst später kommen. Die Fahrt über die Nordsee nach Antwerpen wird zwei Tage und eine Nacht dauern. Ich starre meinen Bettnachbarn an, und er starrt mich an. „Haben wir uns nicht schon einmal gesehen?" - „Ja, Sie kommen mir auch bekannt vor." Wir grübeln beide nach. Plötzlich steht mir eine Figur vor Augen, die bei der Abfahrt des Dampfers Odin einsam an der Langelinie herumgelungert hatte. Ein Mann, den Hut tief ins Gesicht gezogen, blickte, wie ich, dem Schiff mit der Hakenkreuzfahne nach. Unsere Augen trafen sich, wir beide dachten wohl das Gleiche: Auch so einer, der seine Rückfahrkarte verfallen ließ. Aber damals gingen wir misstrauisch in entgegengesetzter Richtung davon. „Ich glaube, wir waren schon einmal Reisegenossen. Sind Sie nicht mit der Odin zu einem Ausflug nach Kopenhagen gekommen?" Kopfnicken. „Haben Sie dann nicht am Kai gestanden, als der Kahn abfuhr?" „Mensch, Sie waren die verlorene Gestalt am andern Ende? Wissen Sie noch, wie der eine Volksgenosse beinahe die Rückfahrt versäumt hätte und verzweifelt über die Reling sprang?" Lachen — Händeschütteln „Helmut Jacoby" - „Georg Wronkow". Helmut fährt nach Amsterdam, will mal sehen, ob man dort besser Fuß fassen kann als in Dänemark. Ihm geht es nicht schlecht; er war in Deutschland Gewerkschaftler, und die dänischen Genossen
164
helfen großzügig. Wir tauschen Erlebnisse aus. Für ihn war die Odin der Retter vor dem Konzentrationslager. Wenn mein neuer Weggenosse nur nicht lügen würde, dass er auf der Fahrt über die Ostsee nicht seekrank gewesen sei. Unsere Gruppe von sieben Drittklasse-Passagieren klimmt an Deck. Freundliche Sonne über der Nordsee, ruhige leichte Wellen. Drei junge Däninnen, die als Dienstmädchen nach Paris gehen. Die einzige Arbeitserlaubnis für Ausländer wird für Hauspersonal erteilt. Aber alle drei haben weit größere Hoffnungen auf die Seinestadt, als sich auf die Dauer als Haustöchter verdingen zu müssen. Unsere zwei männlichen Mitreisenden: ein Japaner und ein dänischer Student. Dänische Schiffe sind für ihre gute Küche bekannt, und wir können durch die großen Fenster des Speisesaals einen hochgetürmten Smorgasboard betrachten. Doch das billige Billett dritter Klasse schließt keine Verpflegung ein. Wir sieben haben vorgesorgt, jeder kramt aus Rucksäcken und Kartons seine Delikatessen heraus. Wir hocken im Kreise an Deck und bauen unsere Vorräte gemeinsam rund um meinen Fruchtkorb zu einem eigenen Smergasboard auf. Die Dritte Klasse hat keinen Steward, aber ein Matrose bringt eine große Kanne Kaffee aus seiner Messe, und der Student zaubert eine Flasche Aquavit hervor. Die Lingua Franca ist ein Gemisch von Dänisch, Deutsch, Englisch und Französisch. Das Festmahl dauert bis in die tiefe Nacht hinein, die Mädchen singen, ein Paar beginnt zu tanzen, und plötzlich tanzen wir alle, ohne Musik - es gab noch keine Transistorradios - , das Stampfen des Dampfers gibt den Rhythmus. Helmut nachdenklich: „Damals auf der Odin haben die anderen getanzt, solange sie noch nicht seekrank waren - heute tanzen wir aus purer Lebensfreude." Wir beide sitzen fast die ganze warme helle Nacht an Deck. Lange Gespräche. Das Thema ist kaum die Vergangenheit. Helmut ist Optimist: „Nur nicht den Kampf aufgeben, nur nicht in der Emigration verkommen - allzu lange wird es ja nicht dau165
ern ..." Im Herbst 1933 glaubten wir noch, wie so viele, dass diese Emigration nur eine Episode sein würde, dass Hitler so schnell abwirtschaften würde wie seine vielen Vorgänger. Helmut ist voller praktischer Ratschläge: „Jeden Tag rasieren" der Vollbart war noch nicht Mode - „und immer ein sauberes Hemd." Und dann nach einem Schluck Aquavit: „Langweile die Leute nicht mit Erzählungen, was du für ein großer M a n n warst, die glauben es dir doch kaum. Und wenn du es wirklich warst, denk nicht dran." U m diese Zeit entstand der klassische Witz: Zwei emigrierte Hunde treffen sich, ein Pinscher und ein Dakkel. Sagt der Pinscher: „Ja damals, als ich noch ein Bernhardiner «
war. SS Graf Bernstorjf dampft in die Scheidemündung. Landung in Antwerpen. Nach einem Rundtanz am Kai zerstäubt die kleine Reisegesellschaft. Ich empfehle Helmut an einen guten Freund in Amsterdam. Ein Händedruck und ein „Auf Wiedersehen irgendwo in der Welt". Wir sind auf dieser Fahrt wirklich Freunde geworden. Unsere Lebenswege werden sich noch oft kreuzen, in Europa und in Amerika. Helmut kehrte nach Dänemark zurück, wo er seine Lotte heiratete. Beim Naziüberfall begann seine Weltreise wider Willen über Schweden, die Sowjetunion, China, die Philippinen, wo er von den Japanern in ein Konzentrationslager gesteckt und schließlich von den Amerikanern befreit wurde. Wir sahen uns nach dem Kriege in den Vereinten Nationen wieder. Heute ist er schwedischer Professor in Stockholm. Der Z u g fährt durch die Nacht. An der französischen Grenze drückt ein Zöllner einen schönen Einreisestempel unter mein frisches Visum in den Pass. *
Sieben Uhr früh an einem Septembermorgen [1933] Gare du Nord, Paris. A u f dem Bahnsteig stehen mein unausgeschlafener Bruder und ein guter alter Kollege, bis zum Dritten Reich Pariser
166
Korrespondent deutscher sozialistischer Blätter. Er hatte nicht erst emigrieren müssen, er hatte nur seinen Posten verloren, und da er zur Zeit nicht viel anderes zu tun hatte, begrüßte er seine emigrierenden Kollegen auf dem Gare du Nord und half ihnen bei ihren ersten Schritten an der Seine. Solchen feierlichen Empfang hatte ich zu solch früher Stunde kaum erwartet. Doch eine leicht neidische Begrüßung: „Du siehst ja braungebrannt und dick aus, so ganz unemigrantisch." Die gute dänische Küche und die Nordseesonne der SchifFsreise ließen mich krass von den bleichen Gesichtern der Pariser Flüchtlinge abstechen, die ihre Emigration in den Cafehäusern des Montparnasse verbrachten. Ein kleines Hotel, 207 Boulevard Raspail, am Bauchnabel der Rive Gauche, zehn Schritte vom Café du Dôme, dem Romanischen Café von Paris, wird mein neues Heim. 300 Francs für ein enges Zimmer pro Monat - das ist fast so viel, wie ich in Kopenhagen mit voller Pension bezahlt hatte - sechs Francs waren eine Mark. Viele bekannte Gesichter, ein Spaziergang am Montparnasse erinnert an das Berliner Presseviertel vergangener Zeiten, selbst die Schnorrer sind wieder da und erarbeiten sich ihre Tasse Kaffee auf den Caféhausterrassen. Sogar der Verkehrsschutzmann an der Kreuzung Montparnasse und Raspail trägt ein Schild „spreche Deutsch". Er war Kriegsgefangener gewesen und spricht ein fließendes Sächsisch mit französischem Akzent. Immer wieder gibt es freudige Begrüßungen. Als Neuankömmling bin ich zunächst Mittelpunkt, neuer Zuhörer für alte Geschichten. Herzliches Wiedersehen mit meinem elsässischen Freund Eugène und seiner Freundin Emma. Er hält sein Versprechen, dass er mir bei meinem letzten Paris Besuch wenige Wochen vor Ausbruch des Dritten Reiches gegeben hatte. Er verschafft mir und meinem Bruder Arbeit im Auslandsdienst einer Bilderagentur: 500 Francs pro Monat für einen halben Arbeitstag. Ich zeige ihm besorgt den Stempel in meinem Pass „Pas autorisé d'accepter un emploi salarié" - nicht berechtigt, bezahlte Stellung anzuneh167
men. „Georges, was macht das schon, du bist doch in Frankreich, on se débrouille." Z u m ersten Mal höre ich dieses Wort, das Leitmotiv aller Franzosen ist und selbstverständlich auch mein Motto wird. Es gibt hierfür kaum eine Ubersetzung, es heißt etwa sich durchschlängeln, sich aus der Klemme ziehen, auf die Beine fallen - aber „se débrouiller" hat einen viel umfassenderen Sinn, es ist eine Weltanschauung. Eugène hat eine schöne Überraschung für mich: „ D u weißt, ich bin auch Pariser Korrespondent der Straßburger Zeitung. Die erscheint in deutscher Sprache. Aber ich habe jetzt meine eigene Druckerei und wenig Zeit, am Abend noch ein Pressetelegramm zu schreiben. Mach dich erstmal mit den politischen Verhältnissen hier vertraut, dann kannst du mir manchmal die Arbeit abnehmen. Das geht natürlich unter meinem Namen, ich teile das Honorar mit dir, sagen wir 500 Francs." 500 Francs am Vormittag und 500 Francs am Abend - ich komme mir wie ein Großverdiener vor, 1 0 0 0 Francs reichen beinahe zum Leben. A m Vormittag bin ich Schwarzarbeiter und am Abend „Petit Nègre". „Petit Nègre" hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Ein „kleiner Neger" ist ein Schreiber, der seine Schreibmaschine für andere wetzt, die keine Zeit mehr zum Schreiben haben, weil sie bereits zu berühmt geworden sind, um selber zu schreiben, oder anderen lukrativen Beschäftigungen nachgehen. Eugènes „manchmal die Arbeit abnehmen" bedeutet sehr bald die volle Übernahme der Berichterstattung zum halben Preis. Er bekommt täglich die Belegexemplare und kann meine Artikel unter seinem fettgedruckten Namen lesen. Besonders beglückt scheint er, wenn er als Leitartikler auf der ersten Seite erscheint. „Ich vertraue dir ganz!", beteuert er, und sein Vertrauen ehrt mich, wenn er mir beinahe pünktlich allmonatlich meine 500 Francs auszahlt.
*
168
Die Präfektur ist ein freudloses graues Gebäude in der Cité und bildet eine krasse Kulisse zum bunten Blumenmarkt am Seineufer. Im Café du Dôme habe ich furchtbare Geschichten gehört. Niemand bekäme die Aufenthaltserlaubnis; einer zeigt mir seinen oft verlängerten blauen Ausweisungsbefehl als sein einzig gültiges Papier. Ein anderer behauptet, man müsse einen Fünfzigfrancsschein als Bestechungsgeld in den Pass legen. Glücklichere, wie mein Bruder, besitzen jedoch bereits provisorische Aufenthaltsgenehmigungen, weil sie mit gültigen Papieren ins Land kamen. Der riesige Saal der Präfektur mit seinen unzähligen Schaltern und harten Holzbänken ist die Wartehalle der Emigration. In langen Reihen warten Neuankömmlinge und alte Routiniers neben arbeitslos gewordenen Fremdarbeitern, die der französische Staat abzuschieben sucht, was ihm in den wenigsten Fällen gelingt. Vor mir wartet eine junge Frau. Sie reicht dem Beamten einen roten Schein durch das Schalterfenster. Blau ist die Farbe der Ausweisung, rot der endgültige Ausweisungsbefehl. Der Mann hinter dem Schalter fahrt sie an: „Sie hätten bereits vor acht Tagen das Land verlassen müssen. Ihre Ausweisung ist bereits dreimal aufgeschoben worden. Jetzt ist es endgültig. Sollen wir Sie mit der Polizei über die Grenze bringen?" Der Beamte blickt auf und sieht in ein völlig verzweifeltes Gesicht, die Augen von Tränen verquollen. Die Frau hat bisher kein Wort gesprochen. Er erstarrt vor dieser fassungslosen Tragik. Seine Stimme wird plötzlich ganz leise: „Und jetzt gehen Sie sofort mit diesem verheulten Gesicht hinauf ins Zimmer 48 und holen sich eine Verlängerung. Ich möchte den französischen Beamten sehen, der einen Menschen mit einem solchen Gesicht aus dem Lande wirft." „Der Nächste bitte." Ich gebe meinen Pass und den ausgefüllten Antrag auf Aufenthaltsbewilligung durch den Schalter. Der Beamte blättert im Pass, prüft das Visum: „Bitte zwanzig Francs Stempelgebühr und 3 Photos. Hier Ihr provisorisches Papier, holen Sie sich in vierzehn Tagen ihre Carte d'Identité ab." 169
Die grüne Carte d'Identité bedeutet Aufenthaltserlaubnis. Die ganze Prozedur hat knappe fünf Minuten gedauert. Nach all den Hiobserzählungen blicke ich erstaunt auf mein Papier mit dem tiefblauen echten Stempel der sitzenden Republik in weitem Faltenwurf, umrahmt von den Worten „Liberté, Egalité, Fraternité" - niemals habe ich mich freier, gleicher und brüderlicher gefühlt. Im Café werde ich wie ein Wunder betrachtet, alle wollen meinen Pass sehen. Das Wunder war eigentlich nicht auf der Pariser Präfektur geschehen, sondern auf dem Konsulat in Kopenhagen. Der Konsul dort war mein Schutzengel - er hatte mir ein Dauervisum gegeben, wie es dänische Bürger erhielten. Dauervisen geben ohne weiteres Aufenthaltsrecht. Die französischen Konsulate in Deutschland gaben längst nur noch höchstens Vierzehntagevisen, viele mussten mit einem dreitägigen Durchreisevisum zufrieden sein, oder schlimmer, besaßen überhaupt kein gültiges Papier, weil sie schwarz über die Grenze gekommen waren. Sie alle versuchten sich en règle zu bringen. En règle - in Ordnung zu kommen — wurde zum Hauptberuf jeder neuen Emigrantenwelle, und so mancher lebte jahrelang im Schwebezustand einer bürgerlichen Nichtexistenz. Wer genügend Geld und Kühnheit hatte, ging auf den schwarzen Markt für falsche Stempel und falsche Pässe. Ungarische Pässe waren die billigsten, doch ihre Häufigkeit erregte schnell das Misstrauen der Behörden. Es schien, dass die leeren Passformulare en gros eingeschmuggelt wurden. Die „echten" falschen Pässe mittelamerikanischer Bananenrepubliken waren die besten. Sie wurden von Konsulatbeamten der betreffenden Länder zu kräftigen Preisen abgegeben und von Mittelsmännern für noch kräftigeren Aufschlag vertrieben. Alles in solchen Pässen war echt, die Photos, die Stempel, die Unterschriften. Die ganze Welt stand den neuen Honduranern und Panamesen offen — nur in ihre neue Heimat durften diese Staatsbürger nicht reisen, denn ihre Passnummern waren nicht registriert und galten nicht in ihren Vaterländern. Aber wer wollte
170
lire du titulaire.
Französische Identitätskarte, ausgestellt 1939
schon nach Honduras. Hauptsache, dass sie mit diesen Papieren in der übrigen Welt en r è g l e kamen. Nur die wenigsten hatten das nötige Geld für solchen Luxus. Die Masse marschierte den ewigen Weg zwischen Präfektur und Innenministerium als letzter Instanz und schaffte es irgendwie, einen neuen Stempel auf irgendein provisorisches Papier gedrückt zu erhalten. Die Verzweifelten wurden zu Selbstversorgern, sie fälschten sich ihre eigenen Papiere. Das Rezept für falsche Stempel war vor Einführung der Prägestempel von genialer Einfachheit: Man nehme ein noch warmes hartgekochtes Ei, entferne Schale und dünne Haut. Das blütenweiße Ei rollt man langsam über einen nicht sehr alten Originalstempel. Der Stempel überträgt sich spiegelverkehrt auf das Ei. Vorsichtig wird dieser negative Stempelabdruck schnell vom Ei auf das gewünschte Papier gerollt und ziert die Fälschung mit einem völlig echten Stempel. Jeder frische Originalstempel ist gut für einen kräftigen Abdruck. Je älter der Stempel, umso schwächer die Wiedergabe. Das Ei kann anschließend gegessen werden. Einführung raffinierter Stempelfarben und Stahlstempel erschwerten das Fälschergewerbe. Aber die französischen Behörden drückten noch lange Jahre ihre guten alten Gummistempel, auf guten alten Stempelkissen eingefärbt, auf ihre Dokumente, von denen dann neue falsche Dokumente abgezogen wurden. Wen die Nazis am tiefsten hassten, den setzten sie auf ihre Ausbürgerungslisten, die länger und länger wurden. Ironischerweise taten sie den Betroffenen, soweit sie sich ins Ausland gerettet hatten, mit der Ausbürgerung oft den größten Gefallen. Jede neue Liste wurde von den vielen, die nicht en r è g l e waren, wie eine Lotterieliste hoffnungsvoll studiert. Denn Erscheinen seines Namens auf dieser amtlichen Liste galt als Beweis, dass der Betroffene wirklich ein politischer Flüchtling und nun staatenlos war. Anerkannten politischen Flüchtlingen wurde in der Regel Asylrecht zugesprochen. 172
Die grüne Identitätskarte, die ich mir abhole, hat zwei Jahre Laufzeit. Sie hat die Form einer Ziehharmonika und bietet Platz für unzählige künftige Stempel. Eine Seite ist bereits blau auf grün mit dem strikten Gebot gestempelt, dass ich keinerlei bezahlte Stellung annehmen darf. Mit diesem kleinen Schönheitsfehler werde ich eben leben müssen. Man wird sich in freier Mitarbeit debrouillieren. Das Wort „se débrouiller" wurde im Emigrantenjargon schnell verdeutscht. Einem Redakteur der Pariser Illustrierten VU hatte ich kurz vor Anbruch des Dritten Reichs bei einer Reportageserie in Berlin nützliche Winke gegeben. „Wenn Sie einmal in Paris etwas brauchen, will ich Ihnen gerne behilflich sein", hatte Monsieur Frédéric damals gesagt. Tatsächlich half er mir; er besorgte mir Arbeit, den Bilderumbruch eines Photobuches. Vier Wochen nach Ankunft an dem Gare du Nord bin ich vollbeschäftigt - vormittags in der Photoagentur, nachmittags mit der Arbeit am Buch und abends schreibe ich meinen Bericht für Straßburg. Niemand fragt nach einer Arbeitserlaubnis. Es sind natürlich alles nur provisorische Berufe, aber es gibt ein französisches Sprichwort: „Rien ne dure que le provisoire" - Nichts währt wie das Provisorium. Trotz zweier Kabinettsstürze lebe ich wie Gott in Frankreich und kümmere mich nicht viel um die lärmenden Umzüge der Croix de Feu und die Handstreiche der Jungen Patrioten der Action Française. Nach Polizeiziffern hatten die faschistischen Croix de Feu nicht mehr als 60000 aktivistische Anhänger - da waren wir von den Nazis her andere Ziffern gewohnt. Am Silvester vor einem Jahr saßen wir im Romanischen Café in Berlin und stießen auf ein frohes Neujahr 1933 an. Heute sitzen wir im Café du Dôme in Paris und stoßen mit einem Glas Champagner auf ein Prost Neujahr 1934 an. Was konnte uns noch geschehen? Wir hatten überlebt und glaubten weiter fest daran, dass die Emigration eine kurze Episode bleiben würde, die man schließlich in Paris ganz erträglich überdauern könnte. Ich beschäftigte
173
mich wegen meiner Berichterstatterpflichten für Straßburg zwar mehr mit der Innenpolitik des Gastlandes als die meisten meiner Weggenossen, aber die am Neujahrstage veröffentlichte Meldung, dass ein Haftbefehl gegen einen gewissen Serge Stavisky wegen Fälschung städtischer Obligationen der Stadt Bayonne erlassen worden sei, interessierte mich nicht sehr.
*
Doch die Schlagzeilen werden täglich größer, der Finanzskandal wächst über die selbst in Frankreich üblichen Normen. Minister, Abgeordnete, hohe Beamte, Zeitungsverleger werden kompromittiert. Das alles gibt gutes Material für meinen täglichen Bericht. Doch über die FinanzafFäre Stavisky werden nicht nur weitere Regierungen, sondern auch meine eigenen Finanzen nach kurzer Blüte zusammenbrechen. „Stavisky Selbstmord" - schreien die Zeitungsjungens über die Boulevards. Der Betrüger verübte Selbstmord, als die Polizei in seine Villa eindringt - heißt die offizielle Version, die natürlich niemand glaubt. Hier endet einer der glänzendsten Verbrecher der Dreißiger Jahre, das Abbild der Depressionsepoche mit ihrer korrupten Gesellschaft, der Politiker und Frauen in Spielsälen, Nachtlokalen und Palästen bezauberte, verführte und bestach, bis seine Welt in einer Betrugsaffäre von 250 Millionen Francs krachend zusammenbrach. „Nieder mit den Betrügern" - „Hängt die Mörder!", schallt es über die Boulevards. Les Camelots du roi der L'Action Française, die Königsknappen, die Croix de Feu, die Feuerkreuzler, die Cagoulards, die Vermummt e n - Geistesbrüder der Mussolinischen Faschisten und Hitlers Nazis, ziehen durch die Straßen. Zuerst in kleinen Gruppen nach dem Muster der Nazirollkommandos in den Tagen der Weimarer Republik, doch die Gruppen werden täglich größer, die nationa174
listischen Kriegerverbände machen mobil. Wir Emigranten rund um die Holzkohlenöfen auf den winterlichen Caféhausterrassen des Montparnasse bekommen ihren Zorn zu spüren, denn Fremdenfeindlichkeit gehört zum Handwerkszeug der Extremisten. Die zutiefst kompromittierte Regierung Chautemps bricht zusammen, viele Minister sind direkt in den Skandal verwickelt. Daladier bildet ein neues Kabinett, er will sich am 6. Februar [1934] von der Kammer bestätigen lassen. Die faschistischen Ligen mobilisieren zu einer Massendemonstration auf der Place de la Concorde. Die L'Humanité ihrerseits ruft die Kommunisten ebenfalls zur Demonstration an gleicher Stelle auf. Das ähnelt verdammt dem großen Verkehrsstreik in Berlin im Herbst 1932, wo Kommunisten und Nazis in Doppelformation gemeinsam gegen die Republik marschierten. Ich will für mein nächtliches Telegramm einen Augenzeugenbericht liefern und beziehe meinen Beobachterposten am Steingelände der Tuilerien, erster Rang, erste Reihe über einer schreienden, schnell wachsenden Menge. Von Anfang an wird deutlich, dass die Kommunisten von den Faschisten tausendfach überschrieen werden. Es ist später Nachmittag. Nur die breite Seinebrücke trennt den Platz vom Palais Bourbon, in dem die Kammer tagt, um die neue Daladier-Regierung zu bestätigen. Diese breite Brücke ist von Garde Mobile mit bereiten Karabinern, Feuerwehr mit gezückten Schläuchen, Polizeikolonnen mit ihren Knüppeln und berittener republikanischer Garde mit ihren Goldhelmen und breiten Säbeln abgeriegelt. Aller Verkehr ist längst abgeleitet, ein einzelner leerer Autobus mitten auf dem Platze steckt in der Masse fest. Plötzlich steht er in Flammen, die Polizei attackiert mit geschwungenen Knüppeln und wird zurückgeschlagen; berittene Polizei geht vor - Demonstranten haben Messer und Rasierklingen an Stöcke gebunden und suchen die Pferdebäuche aufzuschlitzen; Feuerwerkskörper explodieren unter Pferdehufen - Reiter stürzen, es gibt Verwundete auf beiden Seiten. 175
Die Masse setzt zum Sturm auf die Brücke an. Militärisch gedrillte Schocktrupps stoßen wellenweise vor. Die Feuerwehr richtet Strahlen eiskalten Seinewassers auf die Angreifer, doch die Feuerkreuzler lassen sich nicht abkühlen; sie formieren ständig ihre Reihen aufs Neue. Das ist keine Demonstration mehr, sondern offene, vorbereitete Revolte. Mit entrollten Trikoloren rennen die Faschisten gegen die Dritte Republik an, gegen das verhasste Parlament. Die berittene Garde treibt erneut, diesmal mit blanken Säbeln, die mit flacher Klinge geschlagen werden, Keile in die Phalanx wutverzerrter Menschen. Unter einem Steinhagel wird auch dieser Vorstoß zurückgeworfen, die Reiter suchen Schutz hinter den auf der Brücke errichteten Barrikaden aus Polizeiautos. Hinter mir in den Tuilerien sehe ich Männer die Schutzgitter von den Bäumen reißen, die zu Waffen werden, zu Schildern im Angriff auf die Polizei. „Tod den Deputierten" wird der Kampfschrei der Massen. Irgendwo in der Menge scheint eine Art Generalstab zu funktionieren. Die Schocktruppen, die sich immer wieder aus der Masse lösen, scheinen gut gedrillt, ihr Ziel ist klar: Erstürmung der Kammer, Auseinandertreibung des Parlamentes. Dunkelheit fällt früh an diesem Februartag. Die Demonstranten haben schnell alle Straßenlaternen mit Steinen ausgebombt. Ich sehe nur noch die Umrisse der Brücke, bis von der anderen Seite Polizeischeinwerfer aufleuchten und das Schlachtfeld grell bestrahlen. Plötzlich knallt ein Schuss, eine Füsillade folgt. Ohrenbetäubendes Schreien von allen Seiten, übertönt von weiteren Einzelschüssen. Dann Fetzen der Marseillaise. Verwundete werden an die Mauer direkt unter mir geschleppt, eine ErsteHilfe-Station entsteht. Ich gebe meinen Logenplatz über der Straßenschlacht auf und ziehe mich durch die Tuilerien zurück. Diese Tuilerien wurden einst, in der Geburtsstunde der Dritten Republik, von revoltierenden Massen in Brand gesteckt. Droht heute der Kammer im Palais Bourbon ein gleiches Schicksal?
176
Mein Ziel ist das Haupttelegraphenamt, um meinen Bericht zu schreiben. Doch in der Rue Saint-Honoré gerate ich in neuen Tumult: Garde Républicaine schlägt mit nackten Säbeln einen Angriff auf das Elysée zurück, die goldenen Helme leuchten in der Dunkelheit. Rettungswagen, mit Verwundeten vollgepackt, klingeln durch die Menschenwogen. Gitter schließen die Metrostationen, die Pariser Innenstadt ist ohne Verkehrsmöglichkeit. Doch einige Straßenecken vom Kriegsschauplatz sind die typischen Pariser Bistros weit offen, die Gäste stehen um die Lautsprecher: Kabinett Daladier bestätigt bei den Unruhen auf der Place de la Concorde bisher ein Dutzend toter Demonstranten - Hunderte Verwundete - die Polizei hat schwere Verluste. Ein letzter Großangriff der Demonstranten bricht an der letzten Polizeibarrikade vor dem Palais Bourbon zusammen - die Polizei geht zur Säuberung des Platzes vor. Die Schlacht um das französische Parlament wurde schließlich von der Polizei gewonnen. Mein Augenzeugenbericht erscheint in großer Aufmachung, Eugène kann mit mir zufrieden sein. Am nächsten Tag tritt das Kabinett Daladier zurück, es war noch nicht einmal vierundzwanzig Stunden im Amt gewesen. Eine Koalitionsregierung der Versöhnung wird gebildet, mit Pétain und Laval im Kabinett des alten konservativen Doumergue, einer Vaterfigur à la Hindenburg. Die große Depression kam später nach Frankreich als in die übrige Welt — aber der 6. Februar 1934 brachte dem Lande die tiefste Kurve. Denn bisher war die Depression hier milder verlaufen, der Stavisky-Skandal löste den schwersten Schock aus. Ich spüre schnell die volle Wucht. Zuerst sagt die Photoagentur, dass sie mich nicht mehr braucht, das Photobuch ist fertiggestellt. Und auch Eugène stottert mit der Honorarzahlung für seinen „Petit Nègre" - die Druckerei geht schlecht. Ich gehe zu meinem Gönner Frédéric in der VU. Er hatte mir von Zeit zu Zeit Photoideen abgekauft, doch heute ist er von meinen Ideen nicht begeistert.
177
*
Wir kommen ins Gespräch; ich sage ihm, was mir so alles schiefgegangen ist. „Um Sie mach ich mir keine Sorgen, Sie werden sich schon immer debrouillieren". Schon wieder dieses Wort. „Aber ich mach mir Sorgen um mich!" „Na seien Sie nicht gleich gekränkt. Wollen wir uns mal den Fall überlegen." Und er überlegt: „Also Arbeitserlaubnis haben Sie natürlich nicht." - Pause — „Die werden Sie auch nicht bekommen. Außerdem gibt's auch gar keine Stellungen." Nach neuer Pause: „Sie sind ja noch jung — da gibt's zuerst einmal eine Möglichkeit: Sie melden sich zur Fremdenlegion - ich würde Indochina vorschlagen - sehr interessantes Land, völlig französiert, sehr westlich, und vor allem keine kriegerischen Verwicklungen zu befürchten. Wenn es hier in Europa losgehen sollte, sind Sie weit vom Schuss im friedlichen Südostasien." (Welch schöne Illusion im Jahre 1934.) „Sie dienen Ihre fünf Jahre ab, kommen zurück und können dann französischer Staatsbürger werden." — Pause — „Die Idee gefällt Ihnen wohl nicht, ehrlich gestanden mir auch nicht. Und außerdem werden die Leute Sie auch gar nicht nehmen, Sie scheinen mir nicht stramm genug." „Ich könnte Ihnen vielleicht einen kleinen Posten im Deuxième Bureau besorgen, Sie wissen, das ist unser Spionagedienst. Hier in Paris laufen so viele Ausländer herum, Sie verkehren doch in den Kreisen. Man möchte wissen, was die Leutchen so treiben, ob sie ohne Aufenthaltsgenehmigung im Lande sind, ob sie ohne Erlaubnis arbeiten, ob es Anarchisten sind ... Nebenbei, es ist kein großer Posten, wird schlecht bezahlt, es geht auf Stückarbeit. Wir haben schon so viele, die es tun. Der Montparnasse ist voll von unsern Agenten. Sicherlich auch bestimmt voll von Nazispitzeln. Einige von denen kennen wir. Es ist das alte Lied, jede Emigration bespitzelt sich selbst. Ich rate Ihnen von dem Beruf ab." Frédéric scheint tatsächlich engere Beziehungen zum Deuxième Bureau gehabt zu haben. Ich sah ihn zum letzten Mal nach dem 178
Zusammenbruch Frankreichs im Sommer 1940 in Marseille. Er steckte mir eine Hundertfrancsnote zu und flüsterte: „Von nun an kennen Sie mich nicht mehr; es ist besser für Sie." Kurze Zeit später wurde sein von einer Maschinenpistole zerfetzter Körper gefunden. Ein Opfer der Naziagenten. „Aber vielleicht kann ich Ihnen wirklich helfen", fahrt Frédéric in unserem Gespräch fort. „Da ist dieser Refulier. Er nennt sich Verleger, hat eine Nachrichtenagentur und sucht ständig Reporter. Ich sage Ihnen gleich, der Refulier hat seine eigene Auffassung von Nachrichten; die von ihm vertriebenen Reportagen nehmen es oft mit der Wirklichkeit nicht zu genau, aber sie sind sensationell und werden von der Sensationspresse gefressen. Refulier sucht ständig Leute für diese Sensationen. Natürlich zahlt er nicht viel, ich glaube, er arbeitet auf prozentualer Basis. Versuchen Sie am besten, immer im Vorschuss zu sein." Mein Wohltäter greift zum Telephon: „Monsieur Refulier, Sie fragten mich neulich nach einem guten Mitarbeiter für Sie. Sie wissen, ich lasse Sie nicht im Stich. Ich schicke Ihnen einen Kollegen, er ist Spezialist für Deutschland, das ist doch heute sehr gefragt. - Ja, seine Arbeiten müssen übersetzt werden; aber bezahlen Sie ihn anständig, und Sie werden an ihm reich werden." Monsieur Refulier scheint sehr interessiert. Das Internationale Korrespondenzbüro hat seine Räume im Quartier Latin im Schatten des Panthéon. Der Chef begrüßt mich überraschend herzlich und erläutert leuchtend die weltweite Bedeutung seines Unternehmens. Er lehnt sich in seinen Sessel und kreuzt die Arme über einem wohlgenährten Bauch. An der Wand hängen eingerahmt Briefe und Photos bekannter ausländischer Autoren. „Meine Mitarbeiter", lächelt er stolz mit einer Handbewegung zur Wand. Ich bleibe dieser Kollektion gegenüber leicht misstrauisch. „Wir haben einen täglichen Dienst, der geht über die ganze Welt. Dafür habe ich meine Leute. Was ich brauche, sind pakkende Großreportagen. Ich kann Ihnen die notwendigen Unter-
179
lagen geben; wenn Sie die sensationell aufziehen, werden Sie bei mir Geld verdienen. Wir müssen natürlich Ihre Arbeiten in gutes Französisch bringen, aber trotzdem werde ich mit Ihnen fünfzigfünfzig abrechnen." Er holt seine Brieftasche heraus: „Hier haben Sie hundert Francs Vorschuss." Ich werde in die Redaktion geführt. Sie besteht aus einem dürren jungen Mann mit Hornbrille, er verkörpert die Gesamtredaktion für den Tagesdienst und ist gleichzeitig Übersetzer aus mehreren Sprachen. Eine dickliche Sekretärin vollendet den Stab. Die Unterlagen, aus denen ich meine Sensationsberichte schöpfen soll, sind vor allem einige englische und deutsche Zeitungsausschnitte. Monsieur Refulier ladet mich zum Aperitif in die Capoulade auf dem Boulevard Saint-Michel ein. Hier rückt er mit seinen großen Plänen heraus. Er macht dies alles sehr vertraulich, blickt sich um, ob auch niemand zuhört: „Sehen Sie mal, wir haben so viele Sensationsblätter als Kunden, die möchten ihrem Publikum am liebsten erzählen, was in Hitlers Schlafzimmer vorgeht, aber niemand schreibt es ihnen - das könnte Ihre Aufgabe sein." Ich sehe meinen neuen Verleger verdutzt an: „Wie soll ich denn das wissen?" Monsieur Refulier ahnte nichts von Eva Braun, und ich natürlich auch nicht. Aber er hatte andere Quellen: „Passen Sie auf, ich habe den deutschen Adelskalender. Sie sehen nach, welche deutsche Prinzessin in heiratsfähigem Alter in Frage kommt und schreiben mir den Artikel: ,Will Hitler die Prinzessin X heiraten?' Wenn der Artikel gut wird, kann ich ihn sogar nach Amerika verkaufen." Refulier träumt bereits von dicken amerikanischen Honoraren. „Sie wollen, dass ich Enten fabriziere, dazu soll ich meinen Namen hergeben?" „Um Gottes Willen nicht Ihren Namen. Dieser Artikel ist von der Kammerzofe Madame Y geschrieben. Auch in Zukunft wird kein Bericht unter Ihrem Namen erscheinen, meine Stärke sind 180
geheimnisvolle Pseudonyme" - er wirft sich in die Brust: „Der gute Name meines Verlages garantiert meinen Kunden eine gewisse Glaubwürdigkeit." Mein Verleger legt den deutschen Adelskalender auf den Marmortisch, schlürft seinen Aperitif und vertieft sich in den Paris Soir, während ich den Almanach studiere. Ich hatte mir eigentlich meine Arbeit anders vorgestellt, diese Art Journalismus kannte ich noch nicht. Aber schließlich ging es um die nackte Frage des nächsten Mittagessens. „Wie wäre es mit Prinzessin Augusta Cäcilia von SachsenCoburg Gotha? Unverheiratet, 27 Jahre alt, der Stammbaum lässt nichts zu wünschen übrig." „Klingt gut — geben Sie mir morgen die Reportage." „Hitler mit Prinzessin Augusta Cäcilia heimlich verlobt?", schreit einige Tage später die Überschrift eines Pariser Sonntagsblattes. Der Artikel stellt fest, dass der Führer zu verschiedenen Malen in Berchtesgaden die schöne Prinzessin zur Seite hatte; die Kammerzofe behauptet, gewisse Intimitäten beobachtet zu haben, und plaudert Gerüchte aus, die in hohen Kreisen in Umlauf sind. Sogar ein Photo der fraglichen Braut erscheint; es ist nicht sehr deutlich und verbirgt das Gesicht unter einem breiten Hutrand. Monsieur Refulier strahlt: „Ist das nicht eine Sensation? Wir haben schon drei Nachdrucke verkauft." Ein Vertreter der Associated Press kommt ins Büro. Er möchte die Geschichte nach Amerika melden und hat schon Recherchen in Deutschland begonnen. Eine Prinzessin Augusta Cäcilia habe sich vor kurzem mit einem Großindustriellen verheiratet, es müsse wohl noch eine andere gleichen Namens geben, aber er habe sie nicht ausfindig machen können. Ob Monsieur Refulier ihm nicht nähere Einzelheiten und Unterlagen geben könne. Der erwidert, dass er die Unterlagen zur Zeit nicht zur Hand habe, und dass er als Gentleman nicht aus vertraulichen Quellen plaudern dürfe. Der Vertreter der Associated Press verlässt das Büro sichtlich unbefriedigt. 181
„Sehen Sie" - schimpft Refulier - „deshalb kann man mit den Amerikanern keine Geschäfte machen. Sie sind zu gründlich, sie wollen immer die Quellen wissen, sie verstehen nichts von Sensationen ... Übrigens, hier haben Sie weitere hundert Francs Vorschuss, wir rechnen später ab." Weder diese Reportage noch spätere Berichte wurden jemals abgerechnet. Das Prozentabkommen arbeitete sichtbar zu Gunsten Refuliers. *
L'heure bleue auf der Terrasse des Café du Dôme. L'heure bleue — die Dämmerstunde, wenn an einem schönen Sommertage ein leichtes Blau über ganz Paris liegt. 30. Juni 1934. Die Abendzeitungen werden ausgeschrieen: „Que ce passe-t-il en Allemagne?" Was ist in Deutschland los? „Blutgemetzel im Dritten Reich! SS erschießt SA-Führer." Die KafFeetrinker springen von ihren Stühlen auf, die ruhige Dämmerstunde wird zum Tumult; in allen Sprachen, vornehmlich Deutsch, wird über die Tische hinweg diskutiert. Jeder Zeitungsjunge kommt mit einer neuen Extraausgabe: „SA-Führer Röhm tot — Sturmführer Heines erschossen - General Schleicher ermordet — von Papen verwundet — SA-Stabsführer von Berlin Karl Ernst erschossen. In München, in Berlin — überall in Deutschland eine Welle des Massenmordes." Menschen sammeln sich auf den Boulevards. Es ist, als ob die gesamte deutsche Emigration von Paris plötzlich zusammenströmt. Phantastische Gerüchte finden willige Gläubige. „Der Spuk ist aus", rufen die ewigen Optimisten, „das ist der Aufstand gegen Hitler." Es dauert noch lange, ehe klar wird, dass es die Revolte Hitlers gegen seine eigenen Braunhemden ist, deren unbequem gewordenen Centauren er barbarisch in der Nacht der langen Messer abschlachtete. Doch in dieser Nacht frohlockt die Emigration: 182
„In einer Woche sind wir wieder in Berlin." Der Katzenjammer kommt später, als klar wird, was wirklich geschehen ist. Monsieur Refulier eilbogt sich durch die Menge und stürzt auf mich zu: „Sie suche ich seit Stunden. Wissen Sie etwas über Stabsführer Ernst? Sehen Sie, alle anderen Ermordeten sind hier bekannt, aber den Ernst kennt keiner. Schreiben Sie mir sofort das Leben dieses Ernst." Er ist diesmal wirklich aufgeregt: „Kommen Sie gleich mit ins Büro, ich organisiere alles." Ich erinnere mich, dass dieser Ernst ein wilder Schläger auf den Straßen Berlins war, dass er gerne im offenen Auto mit dem Grafen Helldorf und anderen homosexuellen Freunden durch die Straßen raste. Aus dem mageren Archiv klaubte ich einige Fakten zusammen: Ernst war 22 Jahre alt, persönlicher Freund Röhms, hatte vor vier Wochen geheiratet, um sich vor dem sittenstrengen Hitler ein Alibi zu verschaffen. Adolf war damals Hochzeitsgast. Ich schreibe los, Refulier steht neben mir und reißt die einzelnen Seiten aus meinen Händen. Der herbeizitierte dürre junge Mann bringt sie in lesbares Französisch. Telephonisch verkauft Refulier den Artikel mit Exklusivrecht und verspricht, ihn noch in der Nacht, vor Redaktionsschluss, persönlich abzuliefern. Zwischendurch gibt er Anregungen: „Schreiben Sie, dass Hitler und Göring Trauzeugen waren, betonen Sie dass Röhm nicht die Braut, sondern den Bräutigam küsste. Fügen Sie hinzu, dass Hitler ein selbstgemaltes Bild geschenkt hat und Göring einen goldenen Dolch." Refuliers Phantasie reißt mich mit: Die Hochzeit war nach dem Wotanskult zelebriert worden, das Hochzeitspaar sprang über eine lodernde Flamme. „Lassen Sie Hitler mitspringen", ruft Refulier begeistert. Ich zögere ... „Geht das nicht nun doch ein bisschen zu weit?" „Wer trägt hier die Verantwortung? Sie oder ich?" - „Glücklicherweise Sie." Um Mitternacht ist der Augenzeugenbericht fertig. „Großartig, großartig — wissen Sie, wer ihn geschrieben hat? SA-Sturmführer Horst von K., der persönliche Adjutant dieses 183
Ernst, dem es heute als einzigem Überlebenden seines Stabes gelungen ist, im eigenen Flugzeug aus Berlin zu entkommen." „Das soll Ihnen einer glauben?" — „Meiner Weltagentur wird alles geglaubt." Eine große Zeitung bringt am nächsten Morgen in großer Aufmachung den Augenzeugenbericht des SA-Sturmführers Horst von K. und im Fettdruck die Zeile „Hitler sprang durch die lodernde Flamme". Der Rundfunk meldet, dass Sturmführer Heines während einer Orgie in seiner Villa von der SS überrascht und mit allen seinen Kumpanen niedergeschossen wurde. „Nicht mit allen Kumpanen", korrigiert Refulier die deutsche Meldung, „einer ist entkommen, und der liefert mir einen Augenzeugenbericht." Refulier scheint der Mann zu sein, zu dem alle einstigen Nazis vor der Rache Hitlers und Himmlers und ihrer SS flüchten, und obendrein während atemberaubender Flucht ihre Erlebnisse druckreif niederlegen. Er scheint der einzige, der die brennende Frage: „Que ce passe-t-il en Allemagne?" zu beantworten weiß. Sogar seine Vorschüsse werden großzügiger. Der dürre junge Mann mit der Hornbrille, Monsieur Consky, kommt an meinen Schreibtisch: „Ich möchte Sie gerne sprechen, privat, nicht hier." Im Café bricht er los: „Refulier betrügt Sie." „Das kann ich mir denken." - „Ich meine, er betrügt Sie groß. Glauben Sie wirklich, dass er seine Sensationen mit Exklusivrecht für 200 oder 300 Francs verkauft? Er steckt sich mehr als das Doppelte ein." „Was kann ich machen? Als ,Petit Nègre' kann ich kaum auftrumpfen. Übrigens habe ich die Nase voll." - „Suchen Sie sich einen andern Agenten." — „Wen?" — „Beispielsweise mich! Ich habe heute fristlos gekündigt und mache meine eigene Agentur auf." Das Geschäft mit den Sensationen des 30. Juni ist sowieso im Abflauen, Refulier ist auf der Jagd nach anderen Sensationen. Mit einem letzten Vorschuss scheide ich von ihm. „Wie ist es mit einer 184
Abrechnung?" - „Monsieur, die Vorschüsse, die ich Ihnen so großzügig gezahlt habe, übersteigen bereits alle Ihre Ansprüche." Übrigens fand Monsieur Refulier schnell einen neuen Mitarbeiter. Diese Zusammenarbeit endete nicht so friedlich, wie mit mir. Bald machte es in den Cafés die Runde, dass Refulier von seinem neuen Mann furchtbar verprügelt worden sei.
*
Auch mein Bruder hat inzwischen seine kleine Stellung bei der Photoagentur verloren; einige Zeichenaufträge halten ihn über Wasser. Er sieht pessimistisch in die Zukunft und sucht Luftveränderung. Freunde in Prag laden ihn ins Caféhaus auf dem Wenzelplatz ein. Vielleicht sind da die Chancen zum Uberleben besser, außerdem ist in Prag das Leben billiger als in Paris. Eine Emigrationsetappe für ihn und ein Abschied mehr. In einigen Jahren werde ich noch einmal von ihm Abschied nehmen, auf einem holländischen Schiff, das ihn nach dem Fall der Tschechoslowakei noch rechtzeitig vor dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika bringt. *
Ein paar alte Setzmaschinen müssen für drei Zeitungen den Satz liefern. Eine russische Emigrantenzeitung, eine jiddische Zeitung und das Pariser Tageblatt werden in einer kleinen Druckerei am Montmartre gedruckt. Das Pariser Tageblatt, vom einstigen Chefredakteur der Vossischen Zeitung, Georg Bernhard, ins Leben gerufen, ist die erste Zeitung der deutschen Emigration. Ihr Kopf wurde dem alten Berliner Tageblatt nachgeformt, das in den ersten Nazijahren, völlig gleichgeschaltet, von „Märzgefallenen"44 redi44
Siehe S. 139, Fußnote 39.
185
giert, ein Schattendasein führte, bis es schließlich seinen Ungeist aushauchte.45 Das Pariser Tageblatt hingegen ist quicklebendig und hat bei geringstem Etat einen Mitarbeiterstab, wie sie ihn sich eigentlich nur die größten Weltblätter leisten können. Allein die Leitartikel Georg Bernhards geben in den ersten Jahren dem Blatt ein politisches Gewicht, das in der ganzen Welt weit größer ist als die Auflageziffer. Noch nie hatten die bedeutenden Politiker, Publizisten und Schriftsteller einer aus der Heimat verjagten Kultur mehr zu sagen und weniger Raum gedruckt zu werden als in diesem armen sechs Seiten starken Emigrantenblatt. Es bestehen gute Geheimkanäle ins Dritte Reich. Die ersten Warnungen über Geheimaufrüstung, besonders der Luftwaffe, erscheinen im Pariser Tageblatt und werden natürlich von den einschlägigen Generalstäben nicht zur Kenntnis genommen. Kurt Caro, einst Chefredakteur der Berliner Volks-Zeitung nach dem Abgang Otto Nuschkes, sitzt mit zwei, drei Redakteuren in der winzigen Redaktion. Ich bin dieser dritte Mann, der einspringt, wenn besonderer Bedarf besteht, und vor allem, wenn die Finanzen ausreichen, mich zu bezahlen. Die Redaktion sitzt an drei Schreibtischen mit zwei Schreibmaschinen und einer Sekretärin in einer Hinterstube der größeren russischen Schwester, die von Poljakow, dem einstigen Mitarbeiter Kerenskijs, redigiert wird. Abends sitzen wir in einem Winkel der Druckerei. Jedes Blatt geht von der Schreibmaschine direkt zur Setzmaschine. Der Metteur, der auch die jiddische Zeitung zusammenstellt, nimmt den Maschinensatz in Empfang, setzt die Uberschriften im Handsatz und akzeptiert gnädig die Hilfe der Nachtredakteure beim Umbruch. Diese Einschätzung des Berliner Tageblatts kann heute aus wissenschaftlicher Sicht nicht bestätigt werden. Bei der Arbeit an der Edition NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit (Lit.verz. Nr. 20), in der bis 1936 auch die Umsetzung der Presseanweisungen in den Tageszeitungen untersucht wurde, ergab sich ein wesentlich differenzierteres Bild. 45
186
v*vV-r>tca kennt sica nun ¿aenr aus . D.uí eiÄsisö was icn sagen ¿cari» « ist » uíísí ait ¿»erven noch Halten» das» es für une keine üeoerrasohung ¿ae¿xr geœn kann una ich eauaogut • in acht Xageu ii-i Kitteliwffer werde i&nen Können oder in »er ¿»enei ss e sitzen » ni eòi t tiefer und Iii cht weniger t i ei' .J.1« ' S'r&naoßen. rifenxi ich -..αϊ aeu «orcpo¿ eitler; v,m-ue » v; "Ire es ¿can; interessant» aie Hntsickiung ...it .n^ueehen , f.·a ait Heskau una AnUko&int era » ««er mer .· ísacntfi nient so tìo.aen Spaße . /Anlie&eno ¿a-vche ion i/ir ein' Seaonenk J 43 Cent *n ungfeteispeitea üriofx^irken 'Seines L~naea , aie lei cat ange bufi t , aber «uia frankieren noca gut genug . Bas sind ikaaexhin aoht Auslands orí efe · yD si:. Im aie öeseftlcate ¿-it der «unùlung geschrieben aast » war air von ^ ^ Anfang an ici -r . Aber heute Lienen aieine tfitsciien ni cat ¿¿ehr »ioa darltt| wenigstens im hundfunk sagen » aase Herr Hitler ein Ver uree¿¿er ist · Has erleichtert das Herz . In diesen Tagen Haben wir Millionen Hörer f le epr one .,ie ein ¿leid (und bins doch ,icaum) Wir sind "La "Äisc ae la ¿ranee una erxA&ren , ϋαε; e e nient ìk*'éMMgkt gent » semer» u» aie -»re-theit —j^nd^dass υ ir ì"r aies< xrt.iha.kt ^ter.X'i. wìcìui. H . xat —--s s- leicnt -
1
• '.«"i-' gfì« gt , «Tu gettâwinxei ni'-i-a "gt¿leuen Einen Aui'eau-AusWwie a- α engiic.en ψ ίαδ jachst gat a-agesten u » *cuí¡ Jrieae οι ei ot onne^'-'nenen" , wrdeiiCii UeMBfeS'-c Haares cea fr ariaSsi echen 4 Y.rband aer nundiun&jeura listen bejtretflHpLs ißt »enigsene wa»..Μύ^ metes. p " ^ ^ Honig aogu von axb&uien ist ein Mägerer xiuigrant^aie wir , aer Hat wenigstens die JCaßöe iaitgena¿uaen une le ut Hier vergnügt x&m auf ¿olii® spera. Auch uer Huke of Windsor ist ein 1 fröhlicher Äiigrant « Am 51. August beginnt iaein Urionb -ich halte es für bittere Ironie . Ion abe ein hinter hoch auf den ¿orge» direkt über-dew Heer in aer itane von Cannes gemietet· Ich fürcüite , fs wird leer bleiben. Ich bin auf Hitler persönlich boeeliäne sags inw jenen "Xa^g·» Kacueter Vag : Teil nobilisierufi| ¿ üriaubssperre »sehr kritische SÜBBattng í'jki hörst von air in I f feg oder frieden gut Ättaa Hrinnere ilichaells daran J daes er eventuell fur ¿rante sorgen soll. ZmL Stunden später « , och ha®»,' wir ¿ïleaen , wir weraen ihn auca noch einige Tage haben -vielieieht sogar geecaieat ein .vunder Schreibe englisch , wenn Hu gehreibst , oder lase Hir von Hike französisch schreiben . ¿xa re-»© ir
Brief George an Ludwig Wronkow im August 1939 (Text siehe S. 341-342)
,'s ist leider Krieg - und ich begehre/ Nicht schuld daran zu sein!" (Matthias Claudius)
Siebente große
3. September 1939 - es ist Abend. Die Lichter von Paris sind erloschen, durch die dunklen Straßen geistern Menschen. Viele mit Päckchen beladene Männer, einrückende Reservisten, strömen zu Kasernen und Bahnhöfen; requirierte Pariser Autobusse mit blau abgedämpften Lichtern transportieren bereits Mobilisierte ab. Hitlers Blitzkrieg gegen Polen tobt schon seit drei Tagen. Heute hat Frankreich erklärt, „es sähe sich gezwungen, seine Verpflichtungen Polen gegenüber zu erfüllen." Das heißt, Frankreich ist im Krieg. Am 1. September sollte mein Urlaub beginnen. Doch ein bereits gemietetes Häuschen auf einem Berg über der Côte d Azur bleibt leer. Statt Urlaub wurde ich auf meinem Posten bei der Radiodiffusion Nationale am Arbeitsplatz mobilisiert, der Befehl lautet „mobilisé sur place". Unser Chef Pascal Copeau läuft in
I
247
einer Leutnantsuniform herum; wir übrigen bleiben in Zivil und stopfen unsere Taschen mit bunten Ausweisen voll. In dem Staatenlosen-Pass prangt ein frischer Stempel: „Wichtiger technischer Arbeiter." Auf ministeriellem Briefpapier wird meine Loyalität Frankreich gegenüber bestätigt. Ein roter Ausweis befiehlt, dass ich bei Luftalarm passieren soll. Ein grüner Ausweis berechtigt zum Betreten des Ministeriums. Ich tappe durch die dunklen Straßen der ersten Kriegsnacht zum Nachtdienst, eine Büchse mit meiner Gasmaske hängt von der Schulter. Am Boulevard des Invalides schwenke ich in eine Vespasienne53. Breitbeinig stehe ich in der Nische des Urinoirs, als plötzlich eine warme Flüssigkeit vom Gesäß aus an meinen Hosenbeinen herunterrinnt. Ich springe zurück und stoße gegen einen Körper. Eine Männerstimme schreit auf: „Mon Dieu" - Mein Gott! Und dann tönen verwirrte Worte aus der Dunkelheit: „Pardon, Pardon, ich kann überhaupt nicht sehen - wie konnte ich wissen, dass Sie vor mir standen?" Die unsichtbare Gestalt im Dunkel scheint die Achseln zu zucken: „C'est la guerre!" Das ist der Krieg denke auch ich. Er fängt für mich reichlich bepisst an. Mit feuchten Hosen eile ich an anderen dunklen Gestalten vorbei, die es ebenfalls eilig zu haben scheinen. Die Menschen sind stumm, keine Straßendebatten wie in den letzten Vorkriegstagen, keine Begeisterung, kein Protest. Dieser Krieg hat sich ins Land geschlichen wie eine Naturkatastrophe. In Redaktion und Funkstudios herrscht Hochbetrieb, niemand hat Zeit, sich um nasse Hosen zu kümmern. Sobald ein Mikrophon frei ist, gehen Sendungen in deutscher Sprache in den Äther. Die Studios sind in tiefe Luftschutzkeller verlegt, die Redaktionsräume bleiben hinter schwarzen Vorhängen im Dachgeschoss, daher ein dauerndes Auf und Ab in Expressfahrstühlen. Für diesen ersten Kriegstag und diese erste Kriegsnacht haben die Sendungen ein Leitmotiv, sie alle beginnen mit Matthias 53
Ö f f e n t l i c h e Toilette.
248
Matthias Claudius
Kriegslied 's ist Krieg! 's ist Krieg! 0 Gottes Engel wehre, Und rede du darein! 's ist leider Krieg - und ich begehre Nicht schuld daran zu sein! Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen Und blutig, bleich und blaß. Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen, Und vor mir weinten, was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, Verstümmelt und halb tot Im Staub sich vor mir wälzten, und mir fluchten In ihrer Todesnot? Wenn tausend tausend Väter, Mütter, Bräute, So glücklich vor dem Krieg, Nun alle elend, alle arme Leute, Wehklagten über mich? Wenn Hunger, böse Seuch' und ihre Nöten Freund, Freund und Feind ins Grab Versammelten, und mir zu Ehren krähten Von einer Leich herab? Was hülf mir Krön' und Land und Gold und Ehre? Die könnten mich nicht freun! 's ist leider Krieg - und ich begehre Nicht schuld daran zu sein! (1778)
Claudius: „'s ist leider Krieg - und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein." Die deutschsprachigen Sendungen werden über alle verfügbaren Stationen übertragen. Der Straßburger Sender ist von den Nazis sofort gestört, der viel stärkere Saarbrücker Sender übertönt ihn. Sie halten zwei Schallplatten bereit, die sie abwechselnd auflegen: die Quatschplatte und die Lachplatte. Während einmal lautes Lachen aus vielen Kehlen die Stimme des Ansagers zu übertonen sucht, stoßen wir das nächste Mal auf undurchdringliches Stimmgewirr von Rhabarber-Rhabarber-Rufen. Doch von anderen Sendetürmen, die nicht so unmittelbar an der Grenze liegen, dringen die Sendungen besser durch, da sie breiter ausgestrahlt werden können. „La drôle de guerre" - „the phony war" - der Sitzkrieg - ist jedenfalls an der Funkfront in voller Schärfe entbrannt, und noch viele Monate werden die Funkwellen über die Maginotlinie und die Siegfriedlinie hinaus lauter dröhnen als die Kanonen. Laut wird die französische „Saaroffensive" in den ersten Septembertagen 1939 zu einer großen Entlastungsoffensive für Polen aufgebläht. In Wahrheit rückten einige Bataillone in das Niemandsland zwischen Maginotlinie 54 und Siegfriedlinie 55 vor, besetzten kampflos ein paar deutsche Dörfer und zogen sich später ebenso kampflos wieder zurück. Während General Gamelin Kriegsberichte von einer großen Schlacht an der französischen Nordostfront ausgab, sprach ein Panzeroberst, der an dieser Schlacht teilgenommen hatte, später von einer reinen Demonstration, nichts weiter als einer Geste. Sein Name: Charles de Gaulle. Wir aber gaben dramatische Berichte von der großen Offensive in den Äther, denen bald peinliches Schweigen folgte. Uber Polen 54
Zwischen 1 9 3 0 und 1 9 3 6 erbaute französiche Verteidigungslinie, be-
nannt nach seinem Planer A n d r é Maginot. 55
So wurde der zwischen 1 9 3 8 und 1 9 4 0 von den Deutschen gebaute
,Westwall" von den Aliierten bezeichnet.
250
wird dann überhaupt nur wenig gesprochen. Schweigen herrscht auch über die Ende August abgegebene Prophezeiung des Generalissimus Gamelin, dass Hitler am ersten Kriegstage zusammenbrechen und dass die Alliierten durch Deutschland wie mit einem Buttermesser schneiden würden. Eine andere Schlacht wird von der Polizei in den Pariser Straßen geschlagen, und viele Gefangene werden hier eingebracht, es ist die Schlacht gegen Kommunisten und Ausländer. Jeder ist verdächtig, nach dem Hitler-Stalin-Pakt gibt es kein Pardon für die Roten, und die Sportarenen rund um Paris füllen sich als Sammellager. Während die einheimischen Kommunistenführer einzeln aus den Betten geholt werden müssen — mein Portier lässt sich nur unter lautem Protest abführen — marschieren Tausende deutscher Naziflüchtlinge mit gepacktem Rucksack und Koffer dem Befehl des Pariser Stadtkommandanten folgend via Polizeiwachen in die Lager. Und wer nicht freiwillig marschiert, wird in Polizeirazzien aufgegriffen. Die Cafés rund um den Montparnasse werden leer. Übrigens bleibt keine große Wahl, die große Mehrheit der Emigranten hat die kärglichen Existenzmöglichkeiten am Rande der französischen Wirtschaft über Nacht verloren. Theoretisch ist alles ganz schön ausgedacht. Die Ausländer, vor allem deutsche Flüchtlinge, können sich aus den Lagern zu Arbeitsbataillonen oder zur Fremdenlegion melden; die Polizei will sie erst einmal aus den Großstädten heraus haben. Die Kommunisten sollen nach Afrika abgeschoben werden, Frankreich hat ja ein großes Kolonialreich. Die für den Kriegseinsatz wichtigen ausländischen Spezialisten werden an ihren Arbeitsplätzen mobilisiert. Doch das Ganze bleibt in völliger Verwirrung stecken. Auch die Fülle unserer Ausweise hilft oft nicht viel, wenn wir auf den Patriotismus eines übereifrigen Polizisten stoßen. Denn die Behörden, die unsere bunten Ausweise ausfertigen, vergaßen die zuständigen Polizeireviere zu verständigen. Immer wieder erscheint der eine oder andere Mitarbeiter nicht zum Dienst, wird schließlich auf irgendeinem Polizeirevier entdeckt und dank 251
Intervention der vorgesetzten Behörde befreit. Man zuckt die Achseln: „C'est la pagaille" - totale Verwirrung. Besonders schwierig ist es mit dem Nachtdienst. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es nachts kaum noch, in den leeren, dunklen Straßen stehen Polizisten, die nichts weiter zu tun haben, als sich auf den einsamen Passanten zu stürzen: „Ihre Papiere." Da so mancher Polizist nichts mit unseren Papieren anzufangen weiß, landet der eine oder andere nach dem Dienst statt zuhause im Bett auf einer Wache. Schließlich hat unser Chef eine großartige Idee: Als am Arbeitsplatz Mobilisierte unterstehen wir den Militärbehörden, und die haben für unsere Sicherheit zu sorgen. Eine Demarche, und das Militär sorgt wirklich. Nach dem Dienst fahren ab nun elegante Limousinen vor dem Ministerium vor, Sergeanten reißen die Türen auf, grüßen stramm militärisch und fahren ihre, wie sie glauben, prominenten Gäste nach Hause. Hier wieder die gleiche Zeremonie: Türaufreißen, strammer Gruß und ein leutseliges „Merçi" des Fahrgastes. Sie ahnen nicht, dass diese wichtige Persönlichkeit sich in Wahrheit nicht über die Straße wagt. Wie war dies Wunder möglich? Unser Chef hatte den Autopark des Generalstabs aufgestöbert, und da die Generäle nachts kaum Dienst machten, blieben die stets in Bereitschaft stehenden Autos unbenutzt. Während der langen Monate des Sitzkrieges wurde ich so mit militärischen Ehren allnächtlich an den in der Dunkelheit lauernden Polizisten vorbei sicher nach Hause gebracht, während der Generalstab schlief. Der Sitzkrieg wird zur Routine, die Razzien werden wegen Mangels an noch frei herumlaufenden Verdächtigen allmählich weniger, denn die wahre Fünfte Kolonne ist viel zu gerissen und hat viel zu gute Beziehungen, um sich einfangen zu lassen. Paris gewöhnt sich an seinen seltsamen Sitzkrieg. Wir lassen die Gasmasken zu Hause, essen die in den ersten Kriegstagen gehamsterten Vorräte auf, denn es gibt auf den Märkten soviel zu kaufen wie je zuvor. Die Benzinrationierung wird aufgehoben, und in 252
Auteuil beginnen wieder die Pferderennen. Aus den Sandsäcken, mit denen die Denkmäler umringt wurden, sickert der Sand, mit dem Kinder spielen. *
Wir sind zur Hochzeit eingeladen, der Sohn unserer Hausmeisterin will die Tochter des benachbarten Autoschlossers heiraten. Die Schwierigkeit ist nur, dass der Vater der Braut als alter Kommunist in ein Lager gesperrt wurde, während der Schwiegersohn als Soldat nur kurzen Urlaub von der Maginotlinie hat. Die entschlossene Schwiegermutter unternimmt unzählige Demarchen bei Polizei, Lagerbehörde, militärischen Stellen, bis die Amtlichkeit vor diesem Totalangriff kapituliert; pünktlich erhält der Brautvater „drei Tage Zeit, bis er die Tochter dem Gatten gefreit"56 - drei Tage Urlaub aus dem Konzentrationslager. Es ist eine fröhliche Hochzeit mit vielem guten Speis' und Trank. Ich knipse ein Familienphoto: der kommunistische, kriegsfeindlicher Umtriebe verdächtige Schwiegervater umarmt lachend den Bräutigam in seiner Khakiuniform. Am nächsten Tage ruft beide die Pflicht zurück - den einen zur Maginotlinie, den anderen ins Konzentrationslager. *
Immer mehr Offiziere aus dem Informationsministerium, die behaupten, Deutsch zu sprechen, tauchen vor dem Mikrophonen auf und übernehmen ganze Sendungen, die weder von Freund noch Feind verstanden werden können; das scheinen begehrte Druck-
56
In Schillers Gedicht Damon und Pythias (vorher: Die Bürgschaft) bittet Damon, der den Tyrannen Dionys ermorden wollte, aber gefangen wurde, vor seiner Todesstrafe um drei Tage Zeit, „bis ich die Schwester dem Gatten gefreit" (Lit.verz. Nr. 23).
253
posten zu sein. Ein Teil der Sendungen wird den „unterdrückten Österreichern" eingeräumt. Mit dem Ruf „Osterreich wird wieder frei" propagieren einige königstreue Herren die Wiedergeburt des Habsburgreiches unter Kaiser Otto über den Rundfunk der französischen Republik. Da es über so wenige handfeste Ereignisse zu berichten gibt, wird auf allen Seiten immer mehr Wortschaum geschlagen. Die Offiziere halten Augenzeugenberichte vom herrlichen Leben in der Maginotlinie mit Beschreibung von Menüs, die der Grande Cuisine nahekommen, für besonders gute Propaganda. Frontberichte gibt es fast nur von der russisch-finnischen Front, propagandistisch werden die Finnen tönend unterstützt. In diesen Sendungen scheint die Sowjetunion allmählich die Nazis als wahren Feind zu überrunden. In ihren Zeitungen fordern die Chauvinisten Entsendung eines französischen Expeditionskorps nach Finnland. Uber die finnische Frage stürzt Daladier, und Paul Reynaud wird Ministerpräsident [20./21. März 1940]. Zur Belebung der Sendungen schreiben wir kurze Hörspiele, Satiren, die von bekannten Schauspielern der Emigration vorgetragen werden. Von mir stammt eine Glosse zu Ostern: „Warum legt das deutsche H u h n keine Eier?" Der Schauspieler Karlweis erklärt tönend in der Stimme Hitlers: „Das Oval des Gelbeis ist das runde Symbol jüdisch kabalistischer Tücke. Solange nicht Hühner quadratische Eier legen, muss das Deutsche Volk von jedem verräterischem Frischei abgeriegelt bleiben." Eine Glosse, deren Folgen keineswegs harmlos bleiben sollten. Pascal Copeau hatte mir ein Sonderhonorar angewiesen. Doch der Zusammenbruch kam schneller als das Geld, und die Anweisung auf 100 Francs unter dem Titel „Warum legt das deutsche H u h n keine Eier?" mit meinem Namen als Verfasser fiel in die Hände der Eroberer. Lange Zeit nach dem Kriege erfuhr ich, dass die Nazis über diese Sendung wegen Verhöhnung des Führers besonders böse waren und meinen Namen auf die Liste der Großverbrecher gesetzt hatten. Das einzige, was sie von mir fanden, war mein Gesamtver-
254
mögen, ein Konto über 1 500 kräftig entwertete Francs auf der Bankfiliale der Société Generale, Montparnasse Ecke Boulevard Raspail. Das Vermögen wurde beschlagnahmt.
*
„Heute ist ja ein stiller Tag, können Sie die Leitung des Nachtdienstes übernehmen? Ich habe etwas besseres vor", fragt mich Copeau, der schon längst wieder Zivil trägt. „Aber selbstverständlich." Und so sitze ich am Abend des 8. April 1940 mit zwei Mitarbeitern in dem großen Redaktionsraum. Die Nachrichten sind zunächst spärlich. Der amtliche Nachrichtenfernschreiber ist in einem Schrank im Korridor eingebaut. Ein Schloss versperrt ihn vor unbefugten Augen. Als Chef vom Dienst bin ich an diesem Abend Schlüsselbewahrer für die deutschsprachige Abteilung. Ich habe das Recht, eine Kopie vom Fernschreiber abzureißen und muss danach den Schrank wieder versperren. Eigentlich dürfen nur die französischen Chefs an diesen Geheimschrank. Die üblichen Meldungen werden uns von den Kollegen der französischen Sendung gebracht. Ich picke eine interessante Meldung heraus: Die Engländer haben Minen in norwegische Inlandsgewässer gelegt, um deutsche Erzzufuhren aus Narvik zu verhindern. Dann später eine Nachricht aus Kopenhagen: Deutsche Kriegsschiffe im Kattegat gesichtet. Der Apparat im Geheimschrank schweigt für lange Zeit. Schließlich eine Meldung der Reuter-Agentur. Starke deutsche Flottenbewegungen in Richtung Norwegen. Ich warte, den Schlüssel in der Hand, und stiere auf die Reutersmeldung. Keine weiteren Einzelheiten, der Fernschreiber bleibt stumm. Ich höre die Nazisendungen am Radio ab. Sie melden Versenkung eines britischen Zerstörers vor Trondheim. Aber auch hier kein weiteres Wort über Entwicklungen im Norden. Vielleicht wissen die Engländer mehr, ich schalte um, die Sendung aus London sagt auch 255
nicht viel, sie wiederholt die kurze Reutersmeldung. Unsere Sendezeit naht; die Sendung beginnt mit den dürftigen Meldungen, die vorliegen, und wird im übrigen mit unwichtigen Nachrichten vollgestopft. Vor der Tür wartet mein Generalsauto, ich fahre durch das dunkle Paris und habe ein dumpfes Gefühl, dass im Kattegat und Skagerrak Dinge geschehen, von denen der schlafende General, in dessen Auto ich sitze, nicht viel mehr wissen mag als ich. Später schrieb Ministerpräsident Reynaud in seinen Memoiren, dass die französische Regierung am Abend des 8. April 1940 durch eine Reutermeldung erfahren habe, dass eine deutsche Armada auf Norwegen zusteuerte. Er habe Generalissimus Gamelin angerufen, der nichts von alledem wusste. Wenige Stunden später aber wusste die Welt vom deutschen Uberfall auf Dänemark und Norwegen - es war das Ende des Sitzkrieges. Ich habe niemals mehr den Schlüssel zum Geheimschrank in die Hand bekommen.
*
Schluss mit der Gemütlichkeit des „drôle de guerre". Die Redaktion wird voll mobilisiert und arbeitet in Tag- und Nachtschichten. Doch das Gefühl herrscht vor, dass die Schlacht um Norwegen eigentlich eine britische Angelegenheit sei, in der nur ein paar französische Alpenjägerbataillone im hohen Norden unter englischem Kommando eingesetzt sind. Die Pariser lassen sich trotz alarmierender Schlagzeilen nicht aus ihrer Frühlingsstimmung bringen. Die wenigsten wissen, wo Narvik eigentlich liegt, und wenn sie es wissen, kümmert es sie wenig. Hinter mit Streifbändern als Vorkehrung gegen Luftangriffe verklebten Schaufenstern in der Rue Saint-Honoré werden die neuesten Frühjahrsmoden sichtbar. Von sonnigen Cafehausterrassen schauen wir auf Kastanienbäume, die die ersten Kerzen aufsetzen. Blumenmädchen verkaufen am 1. Mai [1940] die traditionellen Maiglöckchensträuße, 256
viele Urlauber aus der Maginotlinie promenieren über die Boulevards. Mit einem Funkwagen fahren wir in die Markthallen, um eine Reportage über die in allen Frühlingsfarben leuchtenden Frucht- und Gemüseberge im Bauch von Paris zu machen. Das soll zeigen, wie gut Frankreich im Kriege lebt. Inzwischen ist die Schlacht um Norwegen bereits verloren. Die letzten alliierten Truppen in Narvik machen sich zum Abzug bereit. Am Freitag, den 10. Mai [1940] verfliegt dieser unwirkliche Frühlingstraum unter dem Ansturm der deutschen Offensive auf Holland, Belgien, Luxemburg und Nordostfrankreich. In den Funkräumen herrscht Verwirrung; immer mehr Offiziere erscheinen in geheimer Mission. Wir erhalten scharf zensurierte Berichte zur Ubersetzung, aus denen sich aber doch Rückschlag um Rückschlag herauslesen lässt. Keiner von uns darf sich mehr dem Geheimschrank nähern, aber wir sehen aus den Gesichtern der Eingeweihten, dass sie vom Fernschreiber nichts Angenehmes erfahren. Neue Polizeirazzien - diesmal halfen die schönsten und buntesten Ausweise kaum noch. Einer nach dem anderen unserer Mitarbeiter verschwindet. Vor allem scheint die Gendarmerie den Flüchtlingsstrom von Ausländern vieler Nationalitäten nach Paris drosseln zu wollen. Uberall entstehen Auffanglager. Flüchtlinge vor dem deutschen Blitzkrieg, Flüchtlinge aus Belgien, spanische Republikaner, die als Arbeitssoldaten von der sich auflösenden Front zurückströmen, österreichische Flüchtlinge, deutsche Emigranten, Saarländer, die einst für Frankreich optiert hatten - die Gendarmerie greift jeden auf. Bisher waren Frauen von den Razzien verschont geblieben. Jetzt müssen auch sie sich in Lagern melden. Vel'd'Hiver, in friedlicheren Zeiten Schauplatz von Sechstagerennen, Boxkämpfen und anderen Sportereignissen, wird zur Schlafhalle von tausenden Ausländerinnen. Vel' d'Hiver ist eine gedeckte Halle, in der jetzt in langen Reihen Pritschen stehen; die Franzosen bleiben galant, sie wollen Frauen nicht unter freiem Himmel kampieren lassen. 257
Noch drei Tage schützt mich das Generalstabsauto vor den Straßenrazzien. Doch am 13. Mai [1940] versammelt Pascal Copeau uns noch verbliebene drei deutschsprachige Mitarbeiter: „Meine Herren, Sie müssen sich leider im Stade Buffalo melden, um Ihre Situation zu regulieren. Wir haben die notwendigen Papiere eingereicht, Sie werden sicherlich sofort wieder entlassen werden. Bitte bringen Sie Ihre Frauen ins Vel'd'Hiver. Wenn Sie dann en règle sind, können Sie die Damen wieder abholen. Die Kasse wird Ihnen inzwischen Ihr halbes Gehalt auszahlen." Zum letzten Male bringt mich das Generalstabsauto nach Hause, der Fahrer salutiert wie immer. Copeaus Versprechen der baldigen Entlassung ist natürlich eine Lüge, aber was konnte der arme Kerl tun? In der Nacht packen Traute und ich kleine Koffer, am Morgen treffen wir die Kollegen und ihre Frauen. Zunächst geht es ins Vel'd'Hiver. Gendarmen stehen vor dem vergitterten Eingang und lassen nur die Frauen passieren. Es ist ein bitterer Abschied, ein letztes „Auf baldiges Wiedersehen" klingt hohl. Am nächsten Tage werden unsere Frauen ins Lager Gurs in den Pyrenäen abtransportiert. Stade Buffalo ist eine riesige Sportarena vor der Porte de Versailles. Wir fahren im Taxi vor und stehen vor einer Phalanx von Gendarmen mit aufgepflanzten Bajonetten. Ein Sergeant lässt uns passieren und verweist uns in ein Vorfeld. Neue Gendarmenkette; wir zeigen unsere Ausweise, ein Offizier prüft sie, schüttelt den Kopf: „Meine Herren, mit diesen Papieren kann ich Sie nicht ins Lager lassen, Sie sind ja Staatsangestellte." „Wir wollen gar nicht ins Lager; geben Sie uns einen Stempel, dass wir uns hier gemeldet haben und lassen Sie uns gehen." „Nein, ich habe keinen Stempel, und gehen lassen kann ich Sie auch nicht. Sie sind ja gebürtige Deutsche." „Na, was wollen Sie denn mit uns machen?" Der Offizier zuckt die Achseln: „Gehen Sie in diese Halle dort und warten Sie, Sie werden von uns hören." 258
In der Halle unter den Tribünen liegen ein paar Dutzend Männer auf Strohhaufen: „Seid Ihr auch Legionäre?" — „Nein." Es sind ehemalige Fremdenlegionäre deutscher Herkunft, alle mit Ordensbändern, der eine hat das Croix de Guerre, die höchste französische Kriegsauszeichnung, aus dem Knopfloch hängen. Auch sie sollen warten und warten bereits zwei Tage. Wir warten mit ihnen zwei weitere Tage. Vorsorglich hatten wir ein paar Lebensmittel und eine Flasche Kognak eingepackt. Die Legionäre lehren uns aus Stroh Betten zu bauen, teilen mit uns ihren Wein und erlauben sogar, mit ihren reichlich abgenutzten Spielkarten Belotte zu spielen. Einmal gibt es eine Unterbrechung. Eine schreiende Frau wird von einem Gendarm hereingebracht. Tränen haben tiefe Rinnen in die gepuderten Wangen geschnitten. Wir sehen unter ihren blonden Locken ein Gesicht voller Bartstoppeln. Das ist ja gar keine Frau, sondern ein Mann in Frauenkleidern. Ein Gendarm nach dem anderen kommt herein und grinst den Unglücklichen an, der mit hoher Stimme fleht, hinausgelassen zu werden. Schließlich wälzt sich das Geschöpf in Schreikrämpfen auf dem Boden, bis es auf einer Tragbahre fortgeschafft wird. Ein Transvestit mit deutschem Pass. Dann wird es wieder still um uns. Nach 48 Stunden kommt ein anderer Offizier, sieht uns erstaunt an: „Was machen Sie denn hier?" Wir zeigen wieder einmal unsere Papiere: „Wir warten auf einen Entlassungsstempel." „Das werden wir später sehen", und mit einem Wink an einen Gendarmen: „Bringen Sie die Männer ins Lager." Zum ersten Male seit zwei Tagen sehen wir die Sonne, sie scheint über eine von tausenden Männern gefüllten Arena, aber nach dem Fegefeuer der Wartehalle kommt uns selbst das Lager wie ein Stückchen Freiheit vor. Ein Schreiber notiert Namen und Beruf. Er zögert: „Gehen Sie da hinüber, wo Ausgang 20 steht; da sammeln wir alle die, mit denen wir nicht recht wissen, was anzufangen." 259
Am Ausgang 20 stoßen wir auf ein seltsames Häuflein; eine Gruppe von einberufenen Saarländern, die für Frankreich optiert hatten und nun auf dem Wege zur Kaserne als Ausländer aufgefangen wurden. Ein einstiger österreichischer Generalkonsul mit dem Kreuz der Ehrenlegion, unsere Fremdenlegionäre und einen blinden Bettler, der angeblich deutscher Herkunft sein soll und hier weiter mit Münzen in seinem Blechtopf klingelt. Erster Appell. Wir stellen das Kreuz der Ehrenlegion, das Croix de Guerre und den Blinden in die erste Reihe. Ein Offizier kommt, sieht das Croix de Guerre, vor dem er vorschriftsmäßig salutieren muss, wirft einen Seitenblick auf die Ehrenlegion und verschwindet schnellstens. Nie mehr hat ein Offizier unsern Appell abgenommen. Ein Fremdenlegionär rät mir: „Mensch, melde dich als Essenverteiler, dann wirst du nie Kohldampf schieben." Ein Soldat steht an der Gulaschkanone, wir sehen uns an. Es ist der Barmann hinter der Theke aus meinem Bistro aus der Avenue du Maine. Wir lachen: „Wie kommen Sie denn hierher? Feindlicher Ausländer, he?" Er macht eine Handbewegung über das Menschenmeer: „Das sind nun die Gefangenen, die General Hering gemacht hat." General Pierre Hering war der Platzkommandant von Paris. Und dann zeigt mein Freund auf die schwer bewaffneten Gendarmen rund um uns: „Mensch, das da sind unsere Feinde." Sinnloses Warten auf das Nichts. Ich sitze in einer Loge auf der Tribüne, beim Fußballspiel wäre es der teuerste Platz. Irgendwo tobt der Krieg, keine Zeitung darf ins Lager, einmal haben wir Luftalarm und müssen uns alle auf den Boden werfen. Frisch Eingelieferte erzählen Schreckensgeschichten. Mein Name wird aufgerufen. Ein Sergeant gibt mir von einem dicken Pack eine Karte: zwei gekreuzte blau-weiß-rote Trikoloren — Einberufungsbefehl, Gestellungsort Nimes, 15. Artilleriedepot. Ich bin Armierungssoldat in der französischen Armee. 250 Mann haben hier im Lager den gleichen Appell sous les drapeaux, den Ruf zu den Fahnen, erhalten. Von Gendarmen
260
werden wir frischen Rekruten, Volontaires Étrangers - freiwilliger Ausländer - in Viererreihen gesammelt und zum Güterbahnhof hinter dem Gare de Lyon marschiert. Ein langer Zug wartet auf uns, „40 Mann oder 6 Pferde" steht auf dem Güterwagen, in den einige Bündel Stroh geworfen werden. Jeder Mann erhält seine Eiserne Ration, Kommissbrot, Ölsardinen, Käse, eine Büchse Leberpastete und eine Rippe Schokolade. Zehn Mann werden zum Weinfassen abkommandiert, aus einem Bistro nahe dem Bahnhof schleppen sie hunderte Flaschen Rotwein herbei. Der Offizier zahlt die Zeche, denn Wein gehört zur Ration eines französischen Soldaten. Am 25. Mai [1940] beginnt der Zug mit uns Freiwilligen in den Süden Frankreichs zu rollen. Es ist nicht ganz klar, als welche Fracht wir auf den einzelnen Bahnhöfen gemeldet wurden. Auf einer Station wird der Zug von schwer bewaffneten Kolonialtruppen umstellt, hier scheinen wir als deutsche Kriegsgefangene angesagt worden zu sein. Auf der nächsten umschwärmen uns freundliche Damen des Roten Kreuzes und bewirten uns Landesverteidiger mit Kaffee und Kuchen. Meist aber steht der Zug auf offener Strecke und wartet. Dann schleicht er wieder weiter. Aus langer Weile betrinken wir uns an der reichlichen Weinration. Drei Tage später werden wir vor einem kleinen Dorf im tiefen Süden ausgeladen. Das Schild auf der Bahnhofsrampe sagt: Langlade. *
Langlade, Departement du Gard. Wir klettern steifgliedrig aus den Viehwaggons, suchen unsere Habseligkeiten zusammen und gruppieren uns auf einem Feld vor dem Bahnhof. Im Hintergrund liegt das Dorf, von Rebenfeldern umgeben. „Das sieht ja ganz friedlich aus", sagt mein Nebenmann, „aber warte mal, hinter den Häusern gibt es bestimmt ein Lager mit Stacheldraht".
261
Vor uns steht eine kleine Gruppe französischer Offiziere, ein Hauptmann, drei Leutnants und f ü n f Sergeanten. Sie blicken ohne große Begeisterung auf diesen Haufen Staatenloser aus allen Ecken Mitteleuropas aller militärpflichtiger Jahrgänge. Doch wir haben es geschafft, unsere kleine Gruppe von Pariser Kollegen ist beinahe intakt geblieben, überdies trafen wir alte Freunde wieder; aus dem Nachbarwaggon sprang mir Walter Thormann in die Arme, einstiger Sekretär des Reichskanzlers Wirth, Freund langer Debatten, zuweilen mit gutem Wein gewürzt. Zunächst einmal werden braune Berets ausgegeben, 250 Mann in Räuberzivil erhalten einen militärisch egalisierten Kopf. Jeder Sergeant zählt fünfzig M a n n ab und marschiert sie durch das halb verlassene Dorf zu einer großen, frei im Felde stehenden Scheune. Nein, hier gibt es keinen Stacheldraht und keine Wachen. Der Sergeant macht eine weitausholende Handbewegung: „Das sind eure Quartiere." In einer Ecke sind Strohballen aufgehäuft. Jeder M a n n fasst einen Ballen und macht sich irgendwo sein Bett. Allmählich kommt etwas Ordnung in unseren Haufen. Erst einmal werden vier M a n n zum Essenfassen abkommandiert. Die bringen aus einer Gulaschkanone in großen Schüsseln eine dicke Suppe, in denen große Fleischstücke schwimmen; weingefüllte Feldflaschen werden auf Holzplanken gestellt, Brot wird verteilt, und jeder Mann erhält einen Löffel Marmelade. Nach all den Erfahrungen in Sammellagern, nach all den Polizeischikanen atmen wir hier beim alles gleichmachenden Militär etwas auf. Neugierig trotten Kamerad Walter und ich über die zwei Dorfstraßen. Ein typisch südfranzösisches Dorf, die Mehrzahl der verfallenen Häuser steht verlassen, ein paar misstrauische alte Männer und Frauen sehen uns nach. Schon seit langem haben wir keine direkten Nachrichten mehr gehört; nur wilde, unheilvolle Gerüchte sickerten durch. In der kleinen, fast leeren Dorfkneipe steht ein Radio und gibt verwirrende Meldungen von einer Schlacht um Frankreich, aus denen sich jedoch der völlige Verfall aller Fronten heraushören lässt.
262
Noch glauben wir uns hier im tiefen Süden in diesem halbverfallenen D o r f fern vom Schuss. Was macht man mit 250 Mann, mit denen man eigentlich nichts anzufangen weiß? Der unordentliche Haufen Männer soll zu einer Kompanie organisiert werden. Die Sergeanten machen ein Brachfeld zum Exerzierplatz und lassen uns marschieren, das stärkt die Disziplin. Aber zum Marschieren werden Militärstiefel gebraucht. Tatsächlich rollt ein Lastwagen voller Stiefel an. Bei der Stiefelverteilung kommt unsere Fünfzig-Mann-Gruppe etwas zu kurz. Die Schuhe liegen auf einem Haufen. Der Sergeant wirft jedem ein Paar zu; ein lebhafter Austausch beginnt, bis die meisten beinahe passende Schuhe an den Füßen haben. Ein Unglücklicher bleibt schuhlos, die fünfzig M a n n haben nur 49 Paar Schuhe gefasst. Die Folge ist, dass jeden Tag irgendeinem Opfer sein Paar Schuhe gestohlen wird, der Bestohlene stiehlt natürlich weiter, und täglich erscheint ein anderer M a n n mit völlig unmilitärischer Fußbekleidung zum Appell. Ich schlafe mit meinen Stiefeln als Kopfkissen. Allmählich tröpfeln weitere Uniformstücke ein, und wir beginnen in unserer uniformähnlichen Verkleidung beinahe wirklich wie eine Kompanie auszusehen. Wir erhalten sogar ein Soldbuch und Militärpapiere, die wir unseren Frauen zuschicken sollen, die auf Grund dieser Papiere als Kriegerfrauen aus den Lagern entlassen werden sollen. Aus den Papieren erfahre ich, dass ich Mitglied der 217. Kompanie des Artilleriedepots No. 15 in Nimes geworden bin. Wir sollen ausgebildet werden, um Artilleriestellungen auszubauen. A m 10. Juni [1940] erklärt Mussolini Frankreich den Krieg. Schnell verbreitet sich das Gerücht, dass wir zum Stellungsbau an die nahe Grenze geworfen werden sollen. Wir lernen, als Deckung gegen Luftangriffe in Indianerlinie, einer hinter dem anderen, am Straßengraben entlang zu schleichen und auf Befehl Deckung zu nehmen. Als wir die ersten Anweisungen zum Stellungsbau erhalten sollen, stellt sich heraus, dass für die ganze Kompanie nur zehn Spaten zur Verfügung stehen. Außerdem werden zwanzig Besen
263
entdeckt, und am nächsten Tage werde ich mit meinem Freunde Walter zum Kehren des Marktplatzes von Langlade kommandiert. Da es nur ein einziges Pferd im ganzen Dorf zu geben scheint, das seine Apfel üblicherweise auf den sonst leeren Marktplatz fallen lässt, so scheint dieser Dienst zu zweit nicht allzu anstrengend. Wir marschieren mit geschultertem Besen ab. Aus dem offenen Fenster des Bürgermeisters schallt das Radio: Deutsche Truppen marschieren in das zur offenen Stadt erklärte Paris ein! [14. Juni 1940] Wir beide setzen uns stumm auf den Brunnenrand und heulen. Aus dem Lautsprecher tönt die Marseillaise von einer kratzenden Platte. Als auch die endlich verstummt, herrscht unheimliche Stille. Lange Zeit vergeht, niemand spricht - es gibt Augenblicke, in denen auch die besten Freunde sich nichts mehr zu sagen haben. Da erscheint, vor eine Karre gespannt, unser Pferd und lässt seine Pferdeäpfel auf die Mitte des Platzes rollen. Ich erhebe mich und kehre den Mist befehlsgemäß fort. Um mich ist eine Welt zusammengebrochen, doch auf dem Exerzierplatz geht die leere Geschäftigkeit weiter, niemand spricht mehr vom Abrücken an die italienische Front. Es ist Löhnungsappell, ich bin bereits seit zehn Tagen Soldat: 50 Centimes pro Tag, vier Päckchen schwarze Zigaretten und eine Rasierklinge. Kriegsrat mit Hans Jacob und Walter Thormann auf nächtlichem Spaziergang: Nur nicht in die Hände der Deutschen fallen - die scheinen schon Lyon erreicht zu haben. Es besteht vielleicht die Möglichkeit, Marschbefehl nach Algerien zu erhalten, doch das ist sehr fraglich. Wir haben uns einen eisernen Bestand angelegt, wir sparen Brot, unsere Feldflaschen bleiben mit Kaffee gefüllt, wir haben eine Dauerwurst und harten Käse ergattert, einige Büchsen Olsardinen sind von unseren Rationen übrig geblieben. Die unmittelbare Gegend haben wir während unserer Märsche ganz gut kennengelernt; bis zur Mittelmeerküste erstreckt sich das Maquis, das später als Schlupfort der Resistance weitbe-
264
kannt werden sollte. Nicht weit im Westen liegen die Sevennen, in denen die Hugenotten einst Zuflucht fanden; unser eigenes Dorf ist ein Hugenottendorf geblieben. Wir haben auch einige Höhlen erforscht, die erstes Versteck bieten können. Wir haben uns Bauernhemden beschafft, wie sie hier in der Gegend getragen werden, von weitem könnte diese Tarnung vielleicht gelingen, wenn wir harmlos in den Weinfeldern zu arbeiten scheinen. Nur nicht kopflos abhauen, denn selbst wenn die ersten deutschen Truppen am Horizont erscheinen, können wir unbemerkt verschwinden. Die haben anderes zu tun, als nach uns zu fahnden; die Feldpolizei und Gestapo kommen erst hinterdrein. Andere Gruppen im Lager scheinen ähnliche Fluchtpläne auszuhecken. Die einen fassten einen völlig falschen Plan, sie suchten den Weg nach Nordwest, nach dem Golf von Biskaya, um von dort per Schiff irgendwohin zu entkommen. Aber die Deutschen waren in ihrem Vorstoß entlang dem Atlantischen Ozean schneller als sie; sie gerieten in ihnen entgegenwogende Flüchtlingsströme, wurden schließlich von französischen Gendarmen aufgegriffen und waren im Ende froh, wieder im Lager Langlade abgeliefert zu werden. Dann war der Weg in den Osten zur Schweizer Grenze vielleicht möglich, nicht entlang der engbesiedelten und sicherlich scharf überwachten Küste, sondern durch das menschenleere Hinterland der Provence und über die Voralpen. In unserem Kriegsrat tauchte ein letzter verzweifelter Gedanke auf: Wenn gar kein anderer Ausweg möglich wäre, könnte man sich von den Italienern gefangen nehmen lassen, in einem italienischen Kriegsgefangenenlager wäre es vielleicht am einfachsten unterzutauchen. Was würde mit unseren Frauen da oben in den Pyrenäen, im Lager Gurs geschehen? Ich schrieb täglich - funktionierte die Post überhaupt noch? Ja, es kam ein erster Brief - ein Kontakt war hergestellt, wir wussten zumindest unsere zeitweiligen Adressen, Traute hatte meine Militärpapiere erhalten und wartete täglich auf die Entlassung. Entlassung - aber wohin? 265
Trotz sich überstürzender Hiobsbotschaften geht der militärische Betrieb im Lager Langlade in seinen seltsamen Formen weiter. Die Sergeanten scheinen weder Radio zu hören noch Zeitung zu lesen; sie lassen uns unentwegt weitermarschieren und ernennen deutschsprechende Unteroffiziere aus dem Mannschaftsstand. Nach den Unteroffizieren kommen Gefreite. So werde ich in den hektischen Tagen des Zusammenbruchs „Soldat Première Classe" Gefreiter. Da diese Beförderung im Geschehen der nächsten Tage niemals bestätigt wurde, blieb der höchste Rang meines Lebens „amtierender Gefreiter" mit sehr beschränkter Befehlsgewalt. Während wir am Tage wacker exerzieren und marschieren, schmieden wir allnächtlich unsere vagen Fluchtpläne, die wir am nüchternen Morgen wieder verwerfen. Plötzlich Sonderappell — wir erwarten dramatische Befehle. Der Hauptmann tritt vor die Kompanie: „Ich habe heute früh menschliche Exkremente mitten auf der Dorfstraße vorgefunden. Es ist eine Schande für die ganze Kompanie, wenn wir die Gastfreundschaft dieses freundlichen Dorfes derart missbrauchen. Die Kompanie hat sofort Straßen und Plätze des Dorfes zu reinigen. Abtreten!" Und während in Bordeaux das Kabinett Reynaud stürzt und Marschall Pétain mit Pierre Laval die Regierung übernimmt [16./17. Juni 1940], während die deutschen Truppen im Rhônetal vorstoßen, säubern 250 Mann unter den erstaunten Augen der Gesamtbevölkerung die Ortschaft Langlade von einem menschlichen Exkrement. Zum Abendappell taucht der Hauptmann wieder auf: „Ich entschuldige mich bei Ihnen allen. Ich habe heute mit eigenen Augen gesehen, wie ein Bauer dieses Ortes am hellen Tage mitten auf die Straße schiss. Zweifellos war auch ein Ortseinwohner für den letzten Zwischenfall verantwortlich." Der Hauptmann grüßt militärisch und verschwindet.
*
266
Am nächsten Tage wird der Waffenstillstand verkündet [22. Juni 1940]. Eine Klausel, von wenigen Franzosen in ihrem eigenen Unglück beachtet, versetzt uns allen einen lähmenden Schock, das Lager ist einer Panik nah: Hitler verlangt die Auslieferung aller Antinazi-Flüchtlinge. Der Waffenstillstand hat zwar die Gefahr der unmittelbaren Gefangennahme durch deutsche Truppen gebannt, doch für uns gibt es keine Demarkationslinie. Die Tatsache, dass wir uns im unbesetzten Frankreich befinden, scheint nur eine Gnadenfrist zu bedeuten. Der Kommandant spricht mit den Meistgefährdeten und sucht sie zu beruhigen: „Ich versichere Ihnen, unter meinem Kommando wird niemand ausgeliefert. Bis zu meiner eigenen Demobilisierung kann ich Sie schützen. Solange Sie hier bleiben, sind Sie am sichersten, reißen Sie nur nicht kopflos aus." Zunächst einmal geben wir unsere Fluchtpläne als aussichtslos auf. Wir stehen vor der äußersten Belastungsprobe des se debrouiller - irgendwelche Auswege finden.
*
Es soll Löhnung geben — aber vom Zahlmeister, der gleichzeitig Proviantoffizier ist, fehlt jede Spur. Er hatte zwei Mann abkommandiert und alle Tabakvorräte und Säcke voll Lebensmittel der Kompanie in sein privates Auto laden lassen und hatte sich die Löhnung für die Kompanie in die Tasche gesteckt. Mit ein paar Stempeln aus der Schreibstube hatte er sich selber demobilisiert und blieb spurlos verschwunden. In unserer verzweifelten Stimmung merkten wir noch nicht einmal den Löhnungsausfall, Appetit hatten wir auch nicht viel, nur die Zigaretten fehlten einem. Traute und ich hatten uns am letzten Tage in Paris unsere Barmittel, bestehend aus 2 0 0 0 französischen Francs, 150 Schweizer Franken und 20 Dollar, geteilt. Vorläufig konnte ich den ausgefallenen Sold von 10 Francs noch verschmerzen. Für 15 Francs hatte ich eine Luftpostmarke für einen Brief an meinen Bruder nach
267
Amerika erstanden, und hatte die vage Hoffnung, dass dieser Brief vielleicht sogar befördert würde. Und das Wunder geschah. Ein Brief aus Amerika kam nach gar nicht langer Zeit an, und sogar ein zehn Dollar Scheck; erst später erfuhr ich, dass dies das halbe Wochengehalt meines Bruders war. Zur Einlösung dieses Schecks bekam ich Urlaub nach Nimes, wo ich ihn leider zum amtlichen Kurs hergeben musste, während es für den schwarzen Dollar bereits das Fünffache gab. Hier in Nimes spazierten die Offiziere unseres Artilleriedepots, von der Front zurück, in frischen Uniformen, die Brüste mit Orden beladen, über die breiten Boulevards. Doch ich sah kaum einen zurückgekehrten einfachen Soldaten. Es sprach sich schließlich herum, durch welche Heldentaten die Offiziere ihre Orden verdient hatten. Sie hatten auf höheren Befehl ihre Mannschaften unbewaffnet nach dem Nordwesten, in die Nähe von Bordeaux marschieren lassen, wo sie angeblich demobilisiert werden sollten, doch tatsächlich nach dem Waffenstillstand von den Deutschen gefangen genommen wurden. So entledigte sich das Pétain-Regime großer Teile der zurückflutenden Massen der eigenen Armee, vor denen man sich anscheinend mehr fürchtete als vor den Deutschen. Die Offiziere hatten ihre Geschütze willig den Siegern überlassen, nur das Divisionsauto mit den Orden und Ehrenzeichen hatten sie gerettet und sich stolz dekoriert.
*
Auch unsere Frauen strömten aus den Lagern. Sie waren als Frauen von Einberufenen schließlich entlassen worden und hatten sogar Anrecht auf Militärunterstützung, die sie hätten kassieren können, wenn sie einen Wohnort gehabt hätten. Mit einigen Weggenossinnen erschien Traute schließlich in Langlade. Sie war braungebrannt und schlank. Doch Braungebranntsein war in
268
diesen Sommertagen des Jahres 1940 gar nicht elegant, es war die Hautfarbe der fast völlig unter heißer südlicher Sonne im Freien lebenden Flüchtlinge. Wir organisieren uns in einer Stube eines längst verlassenen Hauses auf einer Strohmatratze und einem selbstgezimmerten Tisch. Kerzen werden in den kleinen Kirchen der umliegenden Dörfer aufgekauft und dienen profanen Zwekken. Ich fasse zuweilen doppelte Ration, bei den Bauern kann man noch hin und wieder Käse und ein paar Eier auftreiben; wir haben eine kräftige Delikatesse entdeckt: Geschlagenes Ei mit Traubenzucker in Rotwein. Die Sergeanten haben endlich das Marschieren aufgegeben und warten auf die Entlassung. Unser letzter Marsch führte am 14. Juli [1940] zum Kriegerdenkmal des Nachbardorfes, unser Ort war zu klein für ein solches Mal. Hier standen wir zur Ehrung der Kriegsgefallenen eine Minute stramm. Vor einem Jahr hatte das anders ausgesehen, als wir hoch vom Balkon des Hotels Majestic die Parade der mächtigen französischen Armee abnahmen. Hier standen wir nun, ein letzter kläglicher Rest der „Grande Armee". Traute und ich spazieren durch die reifen Weinfelder und versuchen, nicht viel an die Z u k u n f t zu denken. Wenn ich mich einmal am Tage zum Appell melde, lässt man mich zufrieden. Das Idyll dauerte eine ganze Woche. Inzwischen waren die Durchführungsbestimmungen zur Auslieferung politischer Flüchtlinge bekannt geworden. Deutsche Kommissionen sollten die Lager unter Militärverwaltung auskämmen, während die französische Polizei wichtige zivile Flüchtlinge aufspüren und ausliefern sollte. Die ersten bekannten Opfer sind die Sozialistenführer Breitscheid und Hilferding. In Nizza wird mein alter Chefredakteur vom Berliner Tageblatt, Theodor Wolff, ein kranker alter Mann, von der Vichypolizei verhaftet, von den Nazis nach Berlin geschleppt, wo er armselig stirbt. Für mich geht es darum, dem Griff der Kommission zu entgehen, die bald nach Langlade kommen soll. Doch eine noch unmittelbarere Gefahr droht unseren Frauen. Der Präfekt des
269
Departements hat den Befehl erteilt, alle ausländischen Flüchtlingsfrauen zu verhaften und in ein Frauenlager zu stecken. Der ersten Razzia sind wir entgangen, da wir weit in die Felder spaziert waren, aber die Gendarmen kommen wieder. Traute muss fort. Ich gebe ihr alle Lebensmittel, die wir auftreiben können. Wir knüpfen ein Bündel zusammen und marschieren bei Sonnenaufgang ab, durch Busch und Pinienwälder; wenn uns der Sinn danach stände, könnten wir das schöne Naturschauspiel bewundern. Wir marschieren etwa drei Stunden über Nebenwege, von Gendarmen ungesehen, zu einem Ort, von dem aus noch immer ein Autobus nach Montpellier im Nachbardepartement Hérault gehen soll. Hier will sich Traute ordnungsgemäß bei der Präfektur als „Kriegerfrau" melden, um irgendwo Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Wieder einmal ein Abschied auf irgendeiner Landstraße; die Abschiede fallen immer schwerer, weil sie immer sinnloser werden. Der Autobus kommt - ein letztes „Schreib schnell". Ich stehe allein auf der Chaussee. Der Rückmarsch ist einsam. Im Lager warten Gendarmen, die bereits einige Frauen zusammengetrieben haben: „Wo ist Ihre Frau?" - „Ich weiß es nicht!" — „Sie sind doch mit ihr zusammen gesehen worden, noch heute morgen." - „Das ist möglich, aber nun ist sie fort." Der Gendarm folgt mit zu meiner Bude — sie ist leer. „Wir bringen Sie zu Ihrem Kommandanten, dem werden Sie schon antworten müssen." Der Gendarm stellt vor dem Kommandanten die selbe Frage: „Wo ist Ihre Frau?" - „Sie brauchen nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen", bemerkt der Kommandant. Ich schweige. „Wenn Ihre Frau noch im Ort ist, werden wir sie schon finden!", bellt der Gendarm und marschiert ab. Drei Tage später bekomme ich einen Brief aus Lodève, einem Städtchen hoch in den Sevennen. Die Präfektur in Montpellier hatte ihr diesen Luftkurort als Zwangsaufenthalt zugeteilt. Da gab es keine Widerrede, aber schließlich war sie hier endlich wieder einmal so einigermaßen en règle und in bedingter Freiheit. 270
Die Bürgermeisterei wusste mit dieser staatenlosen „Kriegerfrau" nichts anzufangen, doch ein freundlicher Stadtschreiber fand eine Lösung: Eine Gruppe belgischer Flüchtlinge war vor Wochen hier gestrandet, und er fügte einfach ihrer Liste einen neuen Namen hinzu. Poetisch erklärte er: „Sie sind ein heimatloser Vogel, der von Ast zu Ast fliegt." Traute war zu einem belgischen Flüchtling geworden und erhielt sogar 90 Francs Militärunterstützung. Als die Belgier später zurückgeschickt wurden, blieb sie als einziger Flüchtling in der Stadt zurück. Sie hatte Quartier bei einer Köhlerfamilie gefunden. Lodève, ein von der Welt vergessener Ort hoch oben in den Bergen, wurde für sie zu einem Abstellgleis im Weltgeschehen. *
Die Demobilisierung brachte neue Verwirrung. Ausländer mit Wohnsitz im besetzten Gebiet durften nicht entlassen werden. Doch es gab Entlassungsämter für „Versprengte". Hier wurde nicht viel gefragt, viele verschafften sich so Entlassungsscheine aus der Armee, und wenn es ging, unter falschem Namen. Doch die Gendarmen waren hinter ihnen her, und in jeder Nacht wurden einige wie Verbrecher gefesselt ins Lager zurückgebracht. Der Kommandant musste geweckt werden, um den Erhalt des Gefangenen zu quittieren. „Warum kommen Sie immer in der Nacht?" Ein Gendarm gestand: „Wir warten gerne bis in die Nacht mit dem Abliefern, dann bekommen wir einen Extradienst bezahlt." Seitdem weigerte sich die Lagerleitung, nachts Gefangene entgegen zu nehmen. Sie wurden sowieso sofort ohne jede Strafe in die Arme der Kompanie zurückgenommen, denn das Lager hatte gar keine Haftzellen. Den Gendarmen war aber ein guter Nebenverdienst entgangen.
271
„Mais Monsieur, pour moi, vous êtes mort!" „Aber mein Herr, für mich sind Sie tot", ruft der französische Offizier und wendet sich ab, als ob ich nicht vorhanden wäre. Ich habe mich am frühen Morgen bei meinem Kompanieführer gemeldet und um einen Urlaubsschein für den Tag gebeten. So tief sitzt mir noch die militärische Ordnung in den Knochen, das muss meine preußische Seele sein. Dieser Hauptmann hatte die Nacht aufgesessen und persönlich eine gereinigte Kompanieliste aufgestellt, aus der die Namen von Flüchtlingen fortgelassen wurden, die besonders gefährdet schienen, darunter natürlich die früheren Redakteure des Straßburger Senders. Am Abend vorher hatte sich eine deutsche Waffenstillstandskommission zur Kontrolle des Militärlagers Langlade angesagt. Die Nazis gaben ihrer Forderung auf Auslieferung von prominenteren Hitlerflüchtlingen also den gebührenden Druck. Der französische Schutzpass, den mir die Dritte Republik ausgestellt hatte, war ein belastendes Dokument geworden, ich zerriss ihn in viele Fetzen. Der Kommandant hatte sein Wort gehalten, unter seinem Kommando würde niemand ausgeliefert werden. In der Kompanieliste fehlten an diesem Morgen fünf Namen — für uns fünf gab es an diesem Morgen nur eine Parole: „Verschwinden." Wir machten aus, dass jeder in eine andere Richtung marschieren müsse. Unsere Hauptsorge war im Augenblick weniger die deutsche Kommission, die das Lager durchkämmen sollte, als die französischen Gendarmen, die jeden Herumlaufenden, der nicht die rechten Papiere vorweisen konnte, aufgegriffen und in ein Konzentrationslager steckten. In unserem Falle hätte jeder Gendarm in der Umgebung uns an seine lange Stahlkette genommen und sofort zurück, das heißt in die Hände der deutschen Kommission geliefert, denn er erhielt zehn Francs Kopfgeld pro Gefangenem. Die breite Chaussee ist mir also versagt, ich wage auch nicht, den kleinen Bahnzug, der am Morgen vorbeirollt, zu benutzen, denn die Gendarmen lieben Bahnhöfe besonders. Der einzige
272
Weg geht durch die Rebenfelder, die sich kilometerweit erstrecken, und durch das Maquis, mit Stachelpflanzen übersätet Sandboden, das später dem Untergrund seinen Namen geben wird. Es ist ein schöner früher Herbsttag, die Weinreben färben sich schon blau, die Trauben sind noch sehr sauer, aber helfen gegen den Durst. Ich habe einen Kanten Brot und ein paar Francs in der Tasche und marschiere los über den lehmigen Boden der Weinfelder; das einzige Ziel: möglichst weit fort vom Lager. Die ersten Kilometer nimmt mich der Marsch voll in Anspruch, es ist schweres Vorwärtskommen im Lehm. Allmählich kommt mir der ganze Widersinn meiner Situation zum Bewusstsein: „Mais Monsieur, pour moi, vous êtes mort!" Ich bin aus den Listen der amtlichen Gesellschaft gestrichen und laufe als bürgerlich Toter durch eine fremde Welt. Oben in den nicht fernen Bergen der Sevennen sitzt meine Frau in Zwangsresidenz und lebt von den kläglichen Francs, die Soldatenfrauen ausgezahlt werden. Wie benimmt sich ein Toter, der Hunger hat und in seinen Brotkanten beißt? Ich setze mich auf einen breiten Stein, ein Markierungsstein, der die Felder abgrenzt, und spreche mit mir selbst: „Wenn du je wieder ins Leben zurückkehrst — nicht unter die Halbtoten im Lager, sondern unter die wirklich Lebenden, wenn du diesen Krieg überstehst, der ja erst richtig angefangen hat, was dann? Die Chancen sind nicht sehr groß. Heute wirst du wohl durchkommen - welcher Gendarm wird sich schon seine blanken Stiefel im weichen Lehmboden eines Rebenfeldes dreckig machen wollen? Aber wie oft wird noch ein französischer Offizier sich als Schutzengel hinsetzen und Kompanielisten korrigieren? Die Kompanie wird bald aufgelöst werden, dann kommt Arbeitslager oder Schlimmeres. .Etranger Superflu' - überflüssiger Ausländer lautet der neue schmeichelhafte Titel, den dir Petains Frankreich verliehen hat." In Gedanken versunken habe ich den ganzen Brotkanten aufgegessen, und es ist noch früh am Tag. Ich stehe auf und sehe mir
273
den Stein, auf dem ich saß, etwas genauer an. Römische Ziffern sind eingemeißelt und lateinische Worte; ein römischer Grabstein aus dem alten Gallien. Ich suche weiter - ein anderer Grabstein, und in gleicher Entfernung ein dritter und vierter. Das ganze Rebenfeld ist mit römischen Grabsteinen abgesteckt. Etwas weiter eine Art Schilderhaus aus Stein, wohl eine Regenhütte, als Fundament eine verwitterte Säule, das Ganze wohl aus den Resten eines Mausoleums gebaut. Ich verbringe interessante Stunden meines Todes mit der Suche nach neuen Funden, sehe aber nur noch gewöhnliche Feldsteine. So ein bisschen römische Historie bringt weitere Perspektiven. Ich marschiere und grübele weiter, alles wird etwas unwichtiger: Wenn du je aus diesem Dreck hinauskommen solltest, nimm nichts mehr so schrecklich wichtig. Nimm die Zukunft als neues geschenktes Leben - vielleicht landest du sogar auf der Siegerseite dieses Krieges - es sieht heute nicht so aus, aber vielleicht, vielleicht. In der Ferne taucht Calvisson auf, ein reiches Weinbauerndorf. Ich wage mich hinein, denn die Gendarmen sind vor allem auf den Landstraßen gefährlich. Ein größeres Dorf mit einer richtigen Stadtmauer, wie sie diese Hugenottendörfer häufig haben. Und in den Fundamenten der Mauer wieder römische Steine, die Inschriften nicht mehr zu entziffern, sogar ein eingravierter Kopf. Ich erstehe ein paar aus Traubenzucker gefertigte Bonbons und ein Stück kuchenähnliches Gebäck. Im Wirtshaus trinke ich eine Tasse „Nationalkaffee", der mit Hilfe eines Schnaps genießbar wird, und tausche ein Paket grauen Militärtabaks beim Wirt gegen zwei hartgekochte Eier ein. Der Friseur steht vor seiner Türe. Warum soll sich ein Toter nicht die Haare schneiden lassen? Der Friseur ist gesprächig. Vom Haarschneiden allein kann man hier nicht leben, er hat sein Rebenfeld: „Wir bauen hier nicht billigen Landwein, wir haben Tafeltrauben, die besten der Welt. Die gingen sogar an den Hof des Königs von England, na, das ist jetzt aus. Aber die Deutschen wissen ja auch, was gut schmeckt, die
274
nehmen uns die ganze Ernte ab. Wissen Sie, ich habe nie etwas gegen Hitler gehabt - der Léon Blum, der hat uns das alles eingebrockt." Auf dem Stuhl liegt eine bunte Zeitschrift, Le Signal, ein deutsches Propagandablatt in französischer Sprache, herausgegeben von der Wehrmacht. Plötzlich fesselt mich eine Überschrift: „Mit unsern blauen Jungens auf Jagd im Ärmelkanal", Autor Fritz Kelian. Fritz Kelian, das war doch mein Kollege in Berlin, ein alter Zechkumpan. Fritz Kelian, der laute Sozialist, der mir anno 1933 Mut machte, als ich ihm meinen Kündigungsbrief zeigte: „Mensch, Courage, der faule Zauber ist bald vorbei." Unter seinem Namen im Signal der Titel eines hohen Offizierranges. Und ich sitze als Toter auf dem Friseurstuhl eines französischen Petinisten und studiere römische Grabsteine. Wenn ich jetzt Kelian träfe, was geschähe dann? Würde er mich verhaften lassen? Ich trete kurz geschoren aus dem Friseurladen; gegenüber an der Theke des Wirtshauses steht ein Gendarm und trinkt einen Schnaps. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps — der Mann ist beim Schnaps, also keine unmittelbare Gefahr. Doch ich mache mich schnell dünn und verschwinde in meinen Rebenfeldern. Es ist auch Zeit für den Rückmarsch. Marschieren ist das Einzige, was ich beim französischen Kommiss gelernt habe. Heute kommt mir das Training zustatten. Leider begleitet mich zumindest ein Floh auf meinem Marsch. Trotz meines Antiflohpulvers scheint mein Begleiter unersättlich. Es ist heiß geworden, ich ziehe mein Hemd aus und schüttele es gründlich, ein halbes Dutzend Flöhe wirbeln durch die Luft. Ich streue etwas Pulver in die Hose, ich muss sparsam sein; wegen der Ungezieferverseuchung ist selbst Flohpulver in Pétains Frankreich knapp geworden. Ich habe Durst und esse saure Trauben. Aus dem Dickicht des Maquis taucht ein magerer Hund auf - ein Streunhund, wie sie jetzt in Massen durch Frankreich laufen. Ich gebe ihm einen Bonbon, er leckt meine Hand. Ich marschiere weiter, er folgt mir. Seltsame Weggenossen für einige Kilometer: ein überflüssiger Hund 275
und ein überflüssiger Mensch. Aber ich muss meinen traurigen Gefährten loswerden, es laufen schon genug herrenlose Hunde im Lager herum. Ich versuche ihn fortzuscheuchen, er weicht nicht. Da werfe ich einen Stein nach ihm, und noch einen Stein, er springt erschreckt zurück und sieht mir traurig aus braunen Hundeaugen nach. Plötzlich fühle ich mich sehr einsam. Sind die Deutschen noch im Lager? Haben sie die gereinigte Kompanieliste akzeptiert? Hat einer uns „Deserteure" verpfiffen? Ich verlangsame meine Schritte, es ist noch zu früh, um eine Rückkehr zu riskieren. Der Kirchenturm von Langlade taucht in der Ferne auf, das Lager liegt am Dorfrand. Als ich mich dem Dorf gegen frühen Abend nähere, kommt mir der Gemüsekrämer entgegen: „Du willst doch nicht darunter, die ,Boches' sind noch immer da." Kein Wort weiter und er verschwindet. Der Gemüsekrämer ist wohl der einzige Rote in Langlade. Er hat einen kleinen Garten und verkaufte außer seinem Gemüse zuweilen auch ein paar Eier oder selbstgemachten Käse. Früher hatte ihn das Dorf so weit wie möglich boykottiert, unsere Kompanie hatte ihn etwas in Brot gesetzt. Jetzt aber waren Lebensmittel knapp; die Bäuerinnen standen bei ihm Schlange, wenn er etwas zu verkaufen hatte, und die Dorfältesten hatten ihm jeden Verkauf von Lebensmitteln an die lästigen Ausländer, die da unten in Scheunen hausten, verboten. Zur Inkraftsetzung ihres Verbotes stellten sie den Feldhüter in seinen winzigen Laden. Zwei Franzosen haben mich „überflüssigen Ausländer" an diesem Tage meines Todes als Schutzengel begleitet: Mein Kompanieführer, der die Namen der politischen Flüchtlinge aus der Kompanieliste verschwinden ließ, und dieser kleine Mann, der Gemüsekrämer von Langlade. Beide kannten mich und meine Kameraden kaum, unser Schicksal konnte sie nicht viel angehen. Doch sie waren in diesen Tagen des militärischen und moralischen Zusammenbruchs Frankreichs Menschen geblieben. Ich klettere durch ein Pinienwäldchen einen Hügel herauf, zupfe ein paar Karotten aus dem Gemüsegarten und kaue
276
hungrig. Auf dieser Höhe hat mein Freund Wache gehalten. Er hatte uns wohl am frühen Morgen beobachtet, wie wir in verschiedenen Richtungen verschwanden. Von hier aus konnte ich das Lager völlig übersehen. Jetzt kann auch ich von halber Höhe aus die Situation studieren: Auf dem Exerzierplatz stehen noch immer die Stabswagen mit der Hakenkreuzstafette am Kühler. Auf zwei Lastwagen sitzen Männer mit Kisten und Koffern, es sind die freiwilligen Rückwanderer, die schon vorher eine besondere Gruppe gebildet hatten. Freiwillige Rückkehrer, das sind vor allem Menschen mit fragwürdiger Staatszugehörigkeit, Menschen aus Grenzgebieten, die sich französisch fühlten, solange es Frankreich gut ging, sie haben jetzt für das Nazireich optiert. Sie werden als „Volksdeutsche" mit offenen Armen aufgenommen und später in die deutsche Armee gesteckt werden. Unwahrscheinlich schöner Sonnenuntergang über rotblau schimmernden Rebenfeldern. Was tut ein Toter im wartenden Dämmerlicht eines unwirklichen Tages? Ich schaue auf das Lager der ausländischen Arbeitssoldaten mit einer Gruppe deutscher Offiziere im Zentrum, ich schaue auf das Hugenottendorf in einem verlorenen Winkel Frankreichs. Ich hole einen zerknitterten Papierbogen aus der Tasche und schreibe: Der Kriegsgott hat uns hergeweht und glaubt es noch als Gnade — Hier, wo ein Häuflein Häuser steht, das Häuflein heißt Langlade. Jahrtausendfältiges
Gestein,
geschichtsdurchfurcht und kantig. Was könnte dies wohl anders sein als glückliche Romantik. Oliven, Feigenbäume, Wein und südlich heiße Sonne. Was könnte dies wohl anders sein als Menschheitstraum von Wonne. 277
Nein, Wonne hab ich nicht im Sinn, besiegt muss ich hier dienen und hocke in der Scheiße drin in stinkenden Ruinen. Die Prosa sieht prosaisch aus, Romantik fehlt der Szene, Du siehst ein halbverfallnes Haus, spürst keinen Hauch Hygiene. Es greift der lange Naziarm in dieses Land der Reben; Im Hintergrund lugt der Gendarm — Ich muss als Toter leben. Doch glänzt im Baedeker der Stern so schön ist die Provence — Ach, lieber war ich meilenfern von dieser „Douce France". Es ist dunkel geworden. Die deutschen Stabsautos rollen aus dem Lager; hinter ihnen die Lastwagen mit den Rückwanderern. Ich steige vorsichtig ins Dorf hinunter, die Luft ist rein. Das Lagertor ist weit offen, ich schleiche in meine Scheune und werfe mich müde auf den Strohsack. „Alles nicht so schlimm gewesen", vertraut mir mein Kamerad vom nächsten Strohsack an. „Erst war allgemeiner Appell. Zwei deutsche Offiziere verfolgten die aufgerufenen Namen auf ihrer Suchliste. Natürlich wurde dein Name nicht genannt. Sie haben niemanden gefunden. Dann mussten die Juden vortreten: ,Um Euch kümmern wir uns nicht!', schnarrte der Offizier. Die Juden durften abtreten. Dann wurden die deutschgebürtigen Kaukasier vernommen. Das ging gründlich zu. Die meisten von ihnen sind mit der Kommission abgezogen, zurück ins Reich - die sind wir los. Übrigens war ein Mann vom schwedischen Roten Kreuz dabei und ein Franzose von der Waffenstillstandskommission. Mensch, war das alles korrekt." 278
Kameraden haben mir einen Topf mit kaltem Essen aufgehoben. Am Morgen werden die Kompanielisten wieder auf volle Höhe gebracht. Ich kehre unter die beinahe Lebenden zurück.
*
Die Stimmung in Langlade ist nach der Kontrolle durch die deutsche Waffenstillstandskommission ruhiger geworden, eine Art Narrensicherheit kommt auf, dass für die nächste Zukunft nicht viel zu fürchten sei - wir haben es hinter uns. Die allgemeine Demobilisierung ändert nicht viel an unserer Situation im Lager. Einige ältere Kameraden, die sich irgendwo im unbesetzten Frankreich Aufenthaltsrecht beschaffen konnten, werden entlassen. Aber alle unter 38 Jahren werden zurückbehalten. Jeder Mann erhält eine Bescheinigung, dass er die deutsche Kommission passiert hat. Für uns Verschwundene konstruiert der Kommandant ein fein ausgeklügeltes Stück Papier: „Es wird bescheinigt, dass der Bezeichnete am 28. Mai 1940, das heißt vor Passieren der deutschen Waffenstillstandskommission, in die 217. Kompanie, Standort Langlade (Gard) aufgenommen worden ist. Er ist heute noch Mitglied der Kompanie. Der Kommandant." Dieses Stück Papier sollte mir einige Monate später sehr wichtig werden. Denn eigentlich sollte ja kein deutscher Flüchtling ohne Genehmigung der Kommission das Land verlassen dürfen. Mein Papier genügte den Behörden für eine Ausreiseerlaubnis. Wir haben uns im Dorf einen Radioapparat besorgt. Abends stecken wir unsere Köpfe unter viele Decken und lauschen den natürlich verbotenen Sendungen aus London: „Frankreich hat eine Schlacht verloren - Frankreich hat nicht den Krieg verloren!" Wir lauschen der Stimme de Gaulles, eines bisher unbekannten Generals, der von England aus französischen Widerstand organisiert. Seine Stimme wird schnell vertraut. Es ist seltsam, wie
279
viel Hoffnung eine leise ferne Stimme einem heimlich Lauschenden unter seiner schalldämpfenden Decke geben kann. Vorsichtig geben wir unsere erlauschten Meldungen an vertraute Kameraden weiter. Bald merken wir, dass das ganze Dorf um die Stunde der französischen Sendung aus London ganz still wird und sich mit seinen Radios in Decken und Kissen zu hüllen scheint. Mit der Demobilisierung sind Offiziere und Sergeanten gegangen, andere kommen, sie tragen Zivil, das heißt Uniformen ohne Rangabzeichen. Wir unterstehen nicht mehr einer Militärbehörde, sondern als Kompanie ausländischer Arbeiter dem Arbeitsministerium; da aber Ausländern prinzipiell im neuen Vichy-Staat jede Arbeit verboten ist, ist es mit den Arbeitsleistungen der Arbeitskompanie nicht weit her. Inzwischen rotten die Trauben an den Reben, weil ja Millionen französischer Arbeitskräfte in deutscher Gefangenschaft sind. Schließlich erlaubt der Präfekt nach einem schweren Regensturm, der viele Weinstöcke niedergeschlagen hat, den Einsatz dieser überflüssigen Ausländer, um von der Weinernte zu retten, was zu retten ist. Nein, es ist kein fröhlicher Weinberg, wenn wir die oft am Boden liegenden Reben lesen und dabei tief im Lehm versinken. Niemand singt, wie wir es so oft in schönen Filmen gehört haben. Selbst die reichliche Weinration, die wir zu unserem Brotkanten beziehen, verhilft nicht zur Fröhlichkeit. Wir schleppen unsere mit Trauben schweren Körbe zu einem Ochsengespann und werfen die Ernte in große Kübel. Diese werden wiederum in einen riesigen offenen Holzkübel entladen. Hier stampfen vier Mann mit nackten Füßen im Kreise herum; schnell werden ihre Beine blutigrot, während aus einem Speihahn köstlicher roter Most in bereitstehende Fässer fließt. Stundenlang stampfen die Männer durch die Reben im Kübel, hier hat sich seit Jahrhunderten nichts am Einbringen der Ernte geändert. Die ungewohnte Arbeit nach Monaten sinnlosen Herumsitzens gibt der Moral etwas Auftrieb, der Bauer scheint zufrieden, er belohnt jeden mit einem fingerbreiten Stück Wurst.
280
Müde marschiere ich von den Weinfeldern zurück nach Langlade: „Ein Telegramm für dich!", rufen mir Kameraden aufgeregt entgegen. „Bitte erscheinen Sie mit Ihrer Gattin unverzüglich auf dem amerikanischen Konsulat in Marseille zwecks Visaerteilung." Ich starre auf das Telegramm, meine neugierigen Kameraden schauen mir über die Schulter und betrachten mich ungläubig wie ein Wunderkind. Amerika? Ist das möglich? Meine Freunde, mein Bruder da drüben, - sie haben wirklich an mich gedacht. Es ist eine so völlige Überraschung, dass ich noch nicht einmal zu hoffen wage, ein Schock, der mich aus meiner Passivität herausreißt. Ich hatte mich in diesen letzten Monaten an ein solches passives Leben gewöhnt, an ein Überwintern ohne aufzufallen. Traute hatte mit ihren Wirtsleuten gesprochen und mir in vor der Zensur klausulierten Worten ihren Plan mitgeteilt: Wenn es zu kritisch werden sollte, würde mich der Köhler in seiner Köhlerhütte in den Bergen unterbringen, da kämen sicher keine Gendarmen hin. Das klang recht abenteuerlich - doch da oben in den Sevennen bildeten sich später tatsächlich Widerstandsnester des französischen Untergrundes. Noch ist Amerika unendlich weit, zunächst sind Berge von Schwierigkeiten zu überwinden; die erste ist: Wie kommen Traute und ich schnell nach Marseille? Der neue Kommandant hilft sofort, gibt mir Marschbefehl nach Marseille und Urlaub, um meine Frau abzuholen. Lodève ist nur knappe hundert Kilometer entfernt. Ich schaffe es nach Fußmarsch, Fahrt in einem mit Holzkohlen angetriebenen Autobus und schließlich einer Schmalspur-Bergbahn in rund zehn Stunden, unterwegs gelingt es mir sogar, ein Huhn einzuhandeln. Trautes erste Reaktion nach heulender Umarmung: „Ist etwas passiert? - Bist du durchgebrannt? - Bist du freigekommen?" Ich strecke ihr das Telegramm entgegen: „Wir bekommen ein Visum nach Amerika!" 281
Erst sprachloses Staunen, dann ganz schüchtern: „Ich möchte aber gar nicht nach Amerika." - „Na weißt du, die Alternative, jahrelang in einer Köhlerhütte versteckt zu leben, ist nicht viel verlockender." Und dann kochen wir hungrig unser Huhn. Am nächsten Morgen geht es zur Gendarmerie, die jedes Verlassen des Zwangsaufenthaltes genehmigen muss. Da werden Papiere beschaut, mit spitzer Feder wird eine achttägige Reiseerlaubnis ausgestellt - Schreibmaschinen scheint es auf der Gendarmerie noch nicht zu geben. Strenge Anordnung, sich sofort nach Ankunft bei der Marseiller Polizei zu melden. Es ist eine lange Reise in überfüllten Zügen. Uberall entlassene Soldaten in zerschlissenen Uniformen, die anscheinend ziellos durch das Land fahren, jeder will irgendwohin, und es scheint gar nicht viel auszumachen, wohin eigentlich. Marseille! Auf den Bahnsteigen Ketten von Polizeikontrollen. Hinter Tischen Beamte mit Stempeln, die sie eifrig auf Stempelkissen drücken; in ihrer Stempelwut ist es ihnen gleichgültig, was sie eigentlich abstempeln, als ob jeder Stempeldruck ihr Machtbewusstsein stärkt. Bei mir ist es der Urlaubsschein, bei Traute das rote Gendarmeriepapier. Bewundernd schaut sie auf den neuen Stempel: „Großartig, jetzt brauche ich mich gar nicht mehr auf der Polizei zu melden. Die Polizei ist zu mir gekommen!" Wir finden nahe am Bahnhof ein kleines Hotel und schlendern dann ziellos über die Canebière in einem unübersehbaren Menschenstrom aller Zungen; plötzlich erkennen wir, dass wir zwei Tropfen sind in einem unendlichen Flüchtlingsstrom, der hier an der Küste sich staute und nun auf einer Wanderung ins Nichts wie Ebbe und Flut auf- und abwogt. Viele suchende Gesichter, denn hier ist ein Sammelpunkt, wo Menschen, die nach allen Windrichtungen zerstreut wurden, sich wiederfinden mögen, und zuweilen gibt es auch Freudenausrufe, wenn alte Bekannte überraschend aufeinanderstoßen. Natürlich treffen auch wir alte Freunde wieder und hören auf überfüllten Caféhaus-Terrassen spannende Erzählungen wilder Odysseen. 282
An Nebentischen hat sich ganz offen ein schwarzer Devisenmarkt etabliert, der Dollar steht hoch im Kurs, aber an Diamanten scheint Uberangebot zu herrschen, Flüchtlinge verkaufen ihre Ringe und goldenen Uhren. In dunkleren Ecken wird über Kauf von falschen Papieren und Visen verhandelt. Viele tragen eine Identität in der einen und eine andere in der anderen Hosentasche. Wovon alle diese Drift des verlorenen Krieges lebt, bleibt unklar, viele haben noch nicht einmal Lebensmittelmarken, die wenigsten sind mit den neuen Behörden en règle - noch hat Lavais Menschenjagd, der so viele von ihnen zum Opfer fallen werden, nicht so recht begonnen. Am nächsten Morgen zum amerikanischen Konsulat. Hunderte von Menschen belagern den Eingang, der von robusten Männern abgesperrt bleibt. Nur Besucher, die eine Aufforderung des Konsulats vorweisen können, werden mit einem freundlichen Stoß durch einen Türspalt in das Heiligtum eingelassen. Im Gegensatz zu dem Gedränge vor den Toren ist es still und beinahe leer, nur wenige Wartende sitzen auf Holzbänken. Die Dame am Empfangstisch nimmt unser Telegramm, studiert eine Liste - ja da steht unser Name. Die Liste ist nicht lang, Amerika scheint nicht viele Visa zu erteilen. Ein Konsul empfängt uns, holt ein Aktenstück hervor. Kühl und korrekt fragt er: „Können Sie sich ausweisen?" Dann: „Ich habe vom Weißen Haus in Washington den Auftrag erhalten, Ihnen ein Sondervisum zu erteilen. Das ist wohlgemerkt kein Einwandervisum, sondern hat begrenzte Gültigkeit." Ein Visum vom Weißen Haus? Visen werden üblicherweise vom State Department erteilt. Doch Präsident Roosevelt hatte persönlich die Ausgabe von etwa 2 000 Visen für politisch Gefährdete angeordnet. Ich hatte von diesen sagenhaften „Notstandsvisen" gehört - meine Freunde Hans Jacob und Walter Thormann waren, wie ich annahm, mit Hilfe solcher Visen entschwunden. Das Wichtigste war, dass diese Visen ohne viele bürokratische Klippen sofort ausgestellt wurden. 283
Der Konsul weiter kühl und korrekt: „Ich betone, dass dieses Reisepapier allein die Einreise erlaubt. Wir können weder für Transport noch irgendwelche Demarchen bei anderen Regierungen sorgen. Beschaffen Sie sich je vier Photos und den Gegenwert von vier Dollar pro Visum und kommen Sie schnellstens wieder her!" Traute und ich machen Kassensturz. Wir besitzen den offiziellen Gegenwert in Francs, und Photos hatten wir uns auch schon besorgt. Es ist ein tiefer Griff in die Kasse. Der Konsul übergibt uns einer Sekretärin, wir werden durch die Konsulatsmaschine geschleust: Personalien werden aufgenommen, Fingerabdrücke jedes Fingers und jeder Hand, Fragebogen sind auszufüllen. Ich schwöre, dass ich nicht gedenke, die amerikanische Verfassung gewaltsam zu ändern, dass ich kein Kommunist, Anarchist oder Mädchenhändler bin; Traute ihrerseits gibt den Schwur ab, kein Freudenmädchen zu sein. Viele Unterschriften werden geleistet, Bilder werden aufgeklebt, unsere vier Dollar pro Kopf kassiert. Schließlich erscheinen zwei imponierend aussehende Dokumente mit dem amerikanischen Adler am Kopf auf dickem Wasserzeichenpapier, das das Staatssiegel durchblicken lässt. Als Besitzer eines amerikanischen Reisepapiers verlassen wir das Konsulat. Es ist ein ermutigendes Gefühl, ein so schicksalhaftes Dokument in der Tasche zu haben. Aber wie soll es weitergehen? Wie kann man auf ein Schiff kommen, das nach Amerika geht? Der einzige Weg scheint über Spanien und Portugal. Da brauchen wir weitere Visen. Und woher soll das Fahrgeld kommen? „Gehen Sie zur HIAS", rieten uns Bekannte im Café auf der Canebière. HIAS 57 schien ein Zauberwort für alle die, die vage Hoffnungen auf Auswanderung hatten, die irgendeinen Verwandten in Amerika ausfindig gemacht hatten, von dem sie ein rettendes „Affidavit" erhofften; eine Versicherung, dass der Betreffende für den Neuankömmling gutsagt. Die HIAS ist eine weltweite 57
HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society.
284
jüdische Hilfsorganisation, die versucht, soviele Flüchtlinge wie möglich zu retten. Das Büro in Marseille steht vor einer übermenschlichen Aufgabe. Schon vor der Tür ballen sich nervöse, oft verzweifelte Menschen und verlangen Einlass. In einem überfüllten Empfangsraum müssen von Sachbearbeitern, die geduldig dramatischen Erzählungen lauschen, erste harte Entscheidungen getroffen werden — wem kann wirklich ernsthaft geholfen werden? Wer hat gute Bürgen drüben in Amerika? Wer hat echte Chancen auf ein Visum, auf welche Einwandererquote, die noch nicht erschöpft ist, kann er gesetzt werden? Für wen können Verwandte und Freunde Geld für die Uberfahrt aufbringen, oder zumindest einen Teil der Kosten? Es muss eine enge Auswahl getroffen werden - Jahre später werden die Todesziffern aus den Konzentrationslagern zeigen, wie wenigen Tausenden selbst hier im sogenannten freien Frankreich geholfen werden konnte. Als ich mein amerikanisches Visum vorzeige, komme ich mir als Privilegierter vor — ein klarer Fall, in dem Hilfe möglich ist. Ich werde in ein kleines Zimmer gerufen, ein Mann hinter dikken Brillengläsern schaut auf mein Visum: „Sie sind politischer Flüchtling — Sie haben ein Visum, die erste und schwerste Hürde ist also bereits genommen. Wir werden uns sofort mit Ihrem Bruder in New York in Verbindung setzen. Kann er Geld aufbringen? Uberfahrt für Sie beide kann 750 Dollar kosten." 750 Dollar sind für mich ein so sagenhafter Betrag, dass ich mit dem Kopf schüttele. Mein Bruder schrieb mir einmal, dass er zwanzig Dollar pro Woche verdiene. Hier in Marseille zahlt man hundert Francs für den Dollar auf dem Schwarzen Markt. „Nun, wir werden sehen — Sie haben die wichtigsten Papiere und kein Geld, dem kann abgeholfen werden, aber es dauert Zeit." „Sie sind eine jüdische Hilfsorganisation ... meine Frau ist keine Jüdin." Die Antwort ist ein Schulterzucken: „Das spielt überhaupt keine Rolle, Sie gehören doch zusammen." „Was sollen wir jetzt tun?" 285
„Das Beste ist, Sie gehen vorläufig in Ihr Lager zurück, und Ihre Frau wieder nach Lodève. Wir werden Sie nach Marseille kommen lassen, wenn wir Sie hier brauchen, dann müssen Sie sich auch noch das spanische und portugiesische Visum besorgen. Sie hören von uns so schnell wie möglich." Der Mann sieht mein misstrauisches Gesicht: „Nein, ich mache keine leeren Versprechungen, Sie sind ab nun mein Fall, ich kümmere mich um Sie, aber Geduld müssen Sie haben. Ich will nicht, dass Sie hier im überfüllten Marseille lange herumsitzen, das ist ein zu gefährliches Pflaster für Sie ... übrigens, Sie haben acht Dollar für Ihr Visum bezahlt, die Kasse wird sie Ihnen wiedergeben." Er entlässt mich mit einem Händedruck: „Das Warten wird hart sein, aber verlieren Sie nicht die Nerven, ich verspreche Ihnen, wir bringen Sie in Lissabon auf ein Schiff." Ich habe noch zwei Tage Urlaub. Wir fahren nach Lodève zurück. In Montpellier kaufen wir auf dem Markt ein, einen ganzen Rucksack Lebensmittel. Notschlachtungen haben begonnen, es gibt kein Viehfutter mehr. Wir ergattern ein ganzes Kilo Fleisch und Speck und Blutwurst und obendrein Stockfisch und Kartoffeln. In den Wäldern um Lodève sammeln wir Reisig und bringen einen ganzen Schubkarren voll nach Hause. Die Köhlersfrau lächelt: „Das ist gut zum Feueranmachen, dann aber brauchen Sie gutes Holz für den Kamin." Ein Mann verkauft uns frisches grünes Holz, das schlecht brennt und furchtbar qualmt. Und dann bringt der Köhler Holzkohle, das reicht für eine Weile, um im Kamin zu kochen. Diesmal ist der Abschied leichter, das Visum in der Tasche macht Mut. Unter dem Motto „Betreibung der Auswanderung" bekomme ich häufigen Tagesurlaub nach Nimes. Es tut gut, in einem Café bei einer Tasse Nationalkaffee (garantiert ohne Kaffeebohnen) zu sitzen, oder zuweilen in einem richtigen Bett in einem Hotel zu schlafen oder sich in einem Kino alte Filme anzusehen. Die Menschen versuchen, sich an die Niederlage zu gewöhnen. Hin und wieder tauchen V-Zeichen an den Mauern auf. Die Schlangen vor
286
den Läden werden länger, das kurze Schlemmen im Zeichen der Notschlachtungen ging schnell vorüber. Ein kurzer, aber harter Winter bringt auch den letzten Rest der Wirtschaft zum Stillstand, die Menschen hungern und frieren in Frankreichs „sonnigem Süden". Im Lager wird der Koch fast tot geschlagen. Misstrauische Kameraden hatten ihm in der Dunkelheit aufgelauert, als er mit der einzigen noch vorhandenen Speckseite unterm Mantel zu seiner Liebsten im Dorf schleichen wollte. Wir hören Fluchen und Schmerzensschreie, und dann wird die Speckseite im Triumph zurück in die Küche getragen. Am nächsten Tage kocht ein neuer Koch eine kräftige Specksuppe, während der zerschlagene Liebhaber mit verschiedenen Knochenbrüchen ins Lazarett geschafft wird. Es tauchen Gerüchte auf, dass Arbeiterkommandos der deutschen Armee übergeben werden sollen, um am Bau des Atlantikwalles mitzuarbeiten. Niemand weiß, was an diesen Gerüchten wahr ist. Inzwischen hält man sich, unter Militärdecken vergraben, im verflohten Stroh so warm wie möglich. Ich glaube nicht viel an alle diese Gerüchte. Doch zur Vorsicht habe ich einen undatierten Urlaubsschein nach Nimes in der Tasche, sollte etwas geschehen, so verschwinde ich schnellstens.
*
Nachricht aus Marseille. Von Bruder und Freunden wurden 160 Dollar als Anzahlung für die Schiffskarte aufgebracht - den Rest will die HIAS vorschießen. Jetzt sei es Zeit, nach Marseille zu kommen. Die Gendarmerie erlaubt Traute Abreise in den Mittelmeerhafen, wo das vertraute kleine Hotel sie wieder aufnimmt. Ich aber werde in ein neues, sogenanntes Auswandererlager in Les Milles bei Marseille überwiesen, nur von dort kann meine Entlassung aus dem Arbeitsdienst erfolgen.
287
Traute und ich treffen uns auf dem Marseiller Bahnhof, wo überraschenderweise ein Dritter angekommen ist - unser Koffer aus Paris. Wir hatten Kontakt mit unserer alten Concierge aufgenommen, und als der Güterverkehr zwischen den beiden Zonen Frankreichs wieder aufgenommen worden war, hatte die Hausverwalterin versprochen, uns einen Koffer mit Sachen zu schicken, Adresse bahnlagernd Marseille. Es bestanden nicht viele Hoffnungen, dass wir je diesen Koffer wiedersehen würden - aber hier stand er. Ich habe drei Tage Zeit, um mich in Les Milles zu melden. Im Hotel zahle ich mit meiner Militärdecke - glücklicherweise ist die Kältewelle gebrochen —, die Wirtin nimmt die Decke lieber als Geld. Erwartungsvoll wird der Koffer geöffnet; ein Füllhorn ergießt seine Gaben - die gute Concierge hat uns alles eingepackt, was sie in unserer Küche vorfand: Nudeln und Reis und Mehl und Kaffee — echten Friedenskaffee - und Büchsen voller Kostbarkeiten. Ein Schlemmerleben konnte beginnen. Meine Reiseschreibmaschine taucht auf und wird bereits am nächsten Tage zu viel Geld gemacht. Dann kommen Anzug und Kleider und Schuhe. Wir können aus unserem Räuberzivil aussteigen und bürgerlich aussehen. Das ist wichtig, denn bei den ständigen Razzien nimmt die Vichypolizei vor allem die aufs Korn, die noch in zerfetzten Uniformen herumlaufen oder auch sonst schon rein äußerlich nicht en règle scheinen. Marseille hat sich seit den hektischen Sommertagen des Zusammenbruchs sehr verändert. Die Straßen gehören der neuen Vichy-Polizei. Die Polizeistreifen bestehen aus einem biederen uniformierten Polizisten aus alten Zeiten und einem Petaingardisten, der an seiner Armbinde erkenntlich ist. Die Flüchtlingswelle ist abgeebbt, viele Heimatlose scheinen hinter Stacheldraht verschwunden. Unser erster Weg zur HIAS ist hoffnungsvoll, man verspricht uns Abreise in vier Wochen. Wir haben uns um das portugiesische und spanische Durchreisevisum zu kümmern. 288
Les Milles ist eine verlassene Ziegelbrennerei, gefüllt mit Menschheit aus allen Himmelsrichtungen. Auswandererlager ist eine reichlich euphemistische Bezeichnung. Natürlich wollen wohl alle aus dem Lande, aber die Chancen der großen Mehrheit sind gering. Es scheint, dass hier vor allem Menschen zusammengebracht wurden, die das Vichy-Regime so bald wie möglich los werden möchte. Da sitzen viele spanische Flüchtlinge mit der vagen Hoffnung einer Auswanderung nach Mexiko; Russen, die in der noch währenden Ägide der Stalin-Hitler-Freundschaft in die Sowjetunion abgeschoben werden sollen; die „Politischen" vieler Nationalitäten hocken zusammen, die, zu Kriegsbeginn als kommunistenverdächtig verhaftet, wieder aufgegriffen worden sind, darunter letzte Reste der Ausländerbrigaden aus dem spanischen Bürgerkrieg. Der hagere Spanier, der mir täglich Kaffe braut, hat kein Hemd unter seiner zerfetzten Jacke. Da es noch recht kalt ist, gebe ich ihm mein Militärhemd — ich habe ja andere Hemden in meinem Zauberkoffer. Er kann es nicht begreifen, dass es noch so reiche Männer gibt, die Hemden verschenken können — nie wieder nimmt er den einen Franc für seinen Topf Kaffee. Der Schwarzhandel blüht. Jeder scheint mit irgendetwas zu handeln, die Lagerwachen vor allem betreiben schwunghaften Handel mit allem Essbaren und Trinkbaren. Manche Insassen sind ständig betrunken und gröhlen durch die Nacht. Jeden Tag werden „zur Förderung der Auswanderung" Tagespässe nach Marseille ausgestellt, für viele wird das Lager nur zur Schlafstelle. Zunächst glaubte ich, dass der Lagerkommandant, der unsichtbar blieb, wirklich ein Menschenfreund sei — bis ein Küchenbulle mir die Wahrheit versetzte: „Wir haben die größten Schwindler in der Verwaltung; die schicken täglich das halbe Lager in die Stadt, weil sie dann kein Essen ausgeben müssen und die Lebensmittel für die ganze Bande verschieben können." Unser Koffer gibt die letzten Vorräte her, wir kochen sie bei Freunden, die einen Spirituskocher besitzen. Vor allem leben 289
wir vom Tauschhandel, die Wirtin übernimmt allmählich als Zimmermiete einen großen Teil des Kofferinhaltes. Ich erstehe schwarze Dollars im Café, und hoffnungsvoll wärmen wir uns in der ersten Sonne des südlichen Vorfrühlings 1941. Es ist so weit! Das spanische Konsulat teilt mit, dass es ein Durchreisevisum erteilen wird, falls ich ein portugiesisches Visum vorweise. Die Portugiesen teilen mit, dass aus Lissabon die Bewilligung für ein Durchreisevisum vorliegt, falls ich von der HIAS die Garantie für die Weiterreise beibringe. Die französischen Behörden erteilen Ausreiseerlaubnis, da ich ja angeblich die deutsche Kommission passiert habe. Die letzten Tage in Marseille sind hektisch. Lauf von einem Konsulat zum anderen. Vor dem spanischen Konsulat stehen rund hundert Menschen seit dem frühen Morgen an. Die Spanier öffnen nur für zwei Stunden und fertigen sehr langsam ab. Etwa 50 Mann werden heute das Glück haben, überhaupt eingelassen zu werden. Ich zähle sorgsam, wir sind bei den ersten Fünfzig. Auf der anderen Seite der Straße steht eine andere, weit größere Menschenschlange, da gibt es Eier. Traute sucht aus unserer Reihe auszubrechen und sich der Eierschlange anzuschließen: „Eier sind mir wichtiger als alle Visen!", behauptet sie und lässt sich nur schwer von ihrem Vorhaben abbringen. Gegen Mittag stehen wir vor einem Schalter. Der Konsulatsbeamte fordert alle meine Papiere und steckt sie in einen Umschlag: „Kommen Sie morgen wieder, dann bekommen Sie die Papiere zurück und Ihr Visum." Ohne jedes Papier in Marseille, selbst mein Urlaubsschein aus Les Milles ist abgelaufen, und ich kann gar nicht zurück, weil ich mich ja schon morgen früh um sechs Uhr wieder vorm Konsulat anstellen muss. Vierundzwanzig gefährliche Stunden in einer Stadt, in der eine Razzia die andere ablöst. Da die Polizeijagd meist nur auf Männer geht, stellt sich Traute ruhig nach Olsardinen an, ich jedoch will schnellstens ins Hotel. Auf dem Quai de la Joliette am Vieux Port passiert prompt das Gefürchtete. Ein 290
M a n n in dem seltsamen Zivil der Vichyagenten versperrt mir den Weg: „Vos papiers, Monsieur!" - Ihre Papier! Ich sehe ihn gelassen an: „Wer sind Sie, zeigen Sie mir zunächst einmal Ihre Papiere!" Der M a n n zuckt erstaunt zusammen, greift in die Tasche, holt seine Brieftasche heraus und zeigt mir tatsächlich seinen Polizeiausweis. Ich werfe einen Blick auf sein Papier, sage „in Ordnung" und gehe schnellen Schrittes weiter, ohne mich umzudrehen. Der Schatten einer engen Gasse im Straßengewirr der Altstadt hinter dem Vieux Port nimmt mich auf. Der Mann hinter mir ist völlig perplex stehen geblieben. Ich glaube nicht, dass er mir in dieses Gassengewirr folgen wird, in dem bereits so viele seiner Kumpanen spurlos verschwunden sind. Jedes Haus ist hier eine Feste gegen die Staatsautorität. Das ist schon immer so gewesen, als das Quartier nur ein von Zuhältern und Prostituierten bevölkerter Rotlicht-Bezirk war. Heute haben viele Verfolgte, vor allem Kommunisten, hier Asyl gefunden. In dem kleinen Restaurant im ersten Stock eines baufälligen Hauses, in dem ich in letzter Zeit oft mit Traute gegessen habe, sind Lebensmittelmarken unbekannt. Ich sage dem Wirt, dass draußen am Q u a i wieder einmal eine Razzia im Gange ist. Der pfeift kurz, mehrere Gestalten lösen sich von den Wänden und verschwinden, Vorsicht ist immer gut. Ich esse mein Mittagessen und gestehe dann, dass ich mich nicht über die Joliette nach Hause traue. „Warte, ich gebe dir jemanden mit." Ein Junge führt mich durch ein Gewirr von Kellern und unterirdischen Gängen bis fast in mein Hotel. Dort ist Traute gerade mit zwei Büchsen Olsardinen eingetroffen. Als die Nazis zwei Jahre später auch Vichy-Frankreich besetzten und nach Marseille kamen, haben sie das ganze Viertel in die Luft gesprengt - es war zu einem Hauptquartier der Maquis geworden. Mit dem leer gewordenen Koffer zahlen wir unserer Wirtin unseren letzten Tag im Hotel. Unseren Freunden hinterlassen wir die letzten Lebensmittel, Zucker, Reis und Mehl. Beide, Mann und Frau, haben später im Untergrund gekämpft und schließ291
lieh Auschwitz überlebt. Professor Sussmann lebt heute mit seiner Frau in Wien und ist als „Maler der Konzentrationslager" bekannt geworden. Mit allen Papieren versehen, verlassen wir am Abend Marseille.
*
Nach durchfahrener Nacht mehrere Stunden Aufenthalt in Lourdes. Wir wandern durch die Stadt der Wunder. Es ist leer vor dem Heiligen Schrein in der Grotte, die mit fortgeworfenen Stöcken und Krücken der Geheilten angefüllt ist. Es ist keine Zeit für Wallfahrten. Ich weiß nicht, welche Heilige hier Wunder vollbringt, aber ich werfe ein paar Francs in den Opferstock schließlich ist es doch ein Wunder, dass ich bisher mit gesunden Knochen davongekommen bin. Ein Bummelzug schleppt sich die Pyrenäen empor, er hält in jedem kleinen Weindorf. Wir beginnen, unseren Proviant anzunagen: eine Tüte getrockneter Pflaumen, ein langes Brot und acht Büchsen Olsardinen, die wir in langen Wochen gehamstert haben. Der Zug wird von Station zu Station leerer, französische Gendarmen steigen ein und prüfen noch einmal unsere Papiere. In Canfranc, schon auf spanischem Boden, auf dem Kamm der Pyrenäen klettern wir mit etwa zwei Dutzend Auswanderern aus dem Zuge. Drüben auf dem anderen Gleis wartet der spanische Zug auf breiterer Schienenspur. In der Mitte der Plattform stehen zwei Tische eng aneinander, vor denen die Reisenden passieren müssen. An einem Tisch sitzt der französische Beamte, am anderen der spanische. Hier wird eine seltsame Groteske gespielt, auf die wir bereits in Marseille vorbereitet worden waren, wir haben unsere Rolle in diesem Spiel gut gelernt. Frankreich verbietet die Ausfuhr jeglicher Devise. Spanien verlangt Vorweisung von Devisen im Mindestbetrage von 50 amerikanischen Dollars. Es akzeptiert
292
keine französischen Francs und verbietet die Einfuhr von Peseten. Der französische Beamte fragt: „Haben Sie ausländische Devisen?" Die Antwort ist ein promptes „Nein!" Daraufhin drückt der Franzose einen Ausreisestempel auf das Reisepapier, das er dem spanischen Kollegen überreicht. Der fragt: „Haben Sie ausländische Devisen?" Die Antwort ist ein promptes „Ja!" - „Bitte vorzeigen." Ich hole meine Dollars hervor. „Sie müssen zumindest dreißig Dollar für Fahrkarten einwechseln." Ein neben ihm sitzender Kassierer wechselt die Dollars in Peseten zum Zwangskurs. All dieses geschieht im Blickfeld des französischen Nachbarn, der den nächsten Ausreisenden fragt: „Haben Sie ausländische Devisen?" Die Antwort ist ein promptes „Nein!". Unter dem wachsamen Blick von zumindest einer Hundertschaft Francomiliz steigen die wenigen Fahrgäste in den Zug, in jedem Waggon pflanzt sich ein spanischer Gendarm, den Karabiner zwischen den Knien, auf eine Bank. Auf jeder Station steigen Bauern ein, meist haben sie kleine Körbe voller Eier, die sie nach Sarragossa auf den Markt bringen. Die Landschaft hat sich völlig geändert; statt des Grüns und der Weinberge auf französischer Seite rollt der Zug die braune, steinige Steppe der Westabhänge herab. In Sarragossa Umsteigen in den Fernzug nach Madrid. Uberfüllte Waggons; neben die Gendarmen postieren sich Soldaten in die vollgedrängten Waggons. Stunden um Stunden werden wir durcheinandergeschüttelt. Plötzlich kreischen die Bremsen, der Zug hält auf offener Strecke - nichts als Steppe und Steine rund um uns. Doch dann löst sich eine Armee von Zwergen vom braunen Boden und formiert sich zum Sturm auf die Wagen. Die Gleise sind mit Steinblöcken versperrt. Gendarmen und Soldaten gemeinsam mit dem Bahnpersonal suchen mit Gewehrkolben und Stöcken den unter einem Steinhagel konzentrierten Angriff eines halben Tausend zerlumpter Kinder abzuwehren. Eine Bande der unendlichen Armee der Kinder des Bürgerkrieges, deren Eltern verschollen, deren Dörfer niedergebrannt
293
sind, hat sich hier zusammengerottet. Ich sehe Kinder, die nicht älter als zehn Jahre sein mögen, mit wohlgezielten Steinwürfen die Francomilizen zurücktreiben. Jeder kämpft für sich, aber doch scheinen die Kinder Rottenführern zu gehorchen, denn der Angriff ist gut organisiert. Einzelkämpfe werden auf den Waggondächern ausgetragen, zwischen den Kuppelungen und auf den Gleisen, die Bahnbeamte von den Steinblöcken zu räumen suchen. Ziel aller dieser verwaisten und verwahrlosten Kinder ist Madrid, wo man sich durch Betteln und Stehlen durchschlagen kann. Einigen Angreifern gelingt es, in die Waggons einzudringen. Interessant ist die völlige Passivität der Reisenden, die ihr Gepäck um sich gesammelt und sich sorgsam darauf gesetzt haben. Den Krieg gegen die Kinder überlassen sie den Uniformierten. Schließlich scheint die Schlacht für die Kinder verloren. In Säuberungsaktionen unter den Waggons, in den Waggons und auf den Waggondächern werden die Kinder in die Steppe zurückgeschlagen. Der Gendarm in unserem Waggon nimmt selbstzufrieden seinen Platz wieder ein. Er schlägt sein weites Cape fest um sich, klemmt den Karabiner zwischen die Knie und scheint ins Leere zu stieren. Doch unter der Bank, von der Mantilla des stolzen Sergeanten verdeckt, hockt ein verdreckter Junge; nur seine nackten Zehen lugen hervor. Jeder Passagier hat ihn unter die Bank schlüpfen sehen, jeder Passagier lächelt seinen Nachbarn an. Der Z u g setzt sich in Bewegung — eine Münze rollt, von irgend woher kommend unter die Bank, weitere folgen, wir sehen eine schmutzige kleine H a n d eifrig die Münzen am Boden zusammenstreichen. Der stramm sitzende Gendarm wird zur komischen Figur, und Madrid wird bald einen Mitbürger mehr haben. Madrid. Horden zerlumpter Kinder hängen sich an die Aussteigenden und schreien: „Brot - Brot!" Sie lassen sich nicht abschütteln, aber niemand im siegreichen Francospanien scheint ein Stück Brot für diese armseligen Opfer des Bürgerkrieges übrig zu haben. Wir haben einen halben Tag Aufenthalt in Madrid, das
294
kurze Durchreisevisum gibt uns nicht mehr Zeit, und übrigens hätten wir kaum Geld für ein Hotel. Wir schleppen unser bisschen Gepäck zur Aufbewahrung und wandern durch eine Stadt, die den Eindruck macht, vom Feinde besetzt zu sein. In den breiten Prachtstraßen stehen unter jedem Laternenpfahl zwei Uniformierte Wache. Sie sind zum Schutz der Sieger postiert, die hier in ordenbepflasterten Uniformen flanieren und auf den Caféhausterrassen in Feiertagsstimmung ihre Siesta nehmen. Polizisten sorgen dafür, dass sich ihnen kein bettelndes Kind nahen und etwa das herrliche Gebäck, das in großen Körben auf den Tischen steht, stehlen kann. Die Kellner sammeln die Zigarettenstummel auf, die von den Offizieren fortgeworfen werden. Zigaretten sind kostbarste Mangelware. Ich besitze noch zwei Päckchen Gauloises Bleu, die ich mir sorgsam aufgespart hatte. Wir wandern weiter, aus den guten Vierteln in die volkreichen Straßen nahe der Plaza de Sol. Der Geruch aus einer Garküche bringt Traute zu dem Aufschrei: „Ich habe Hunger!" Winzige Fische sieden in heißem Fett. Ein Fisch für jeden, ein Löffel Bohnen und ein Glas Wein erschöpfen unsere Peseten fast völlig. Ich greife in die Tasche und biete dem Koch als Trinkgeld eine Zigarette an - die Bohnenportion auf unserem Teller vergrößert sich beachtlich. Wir stehen an hohen Tischen und essen unseren Fisch bis auf die nackten Gräten. Ein völlig abgemagerter Mann nähert sich schüchtern und fragt leise, auf den Teller zeigend: „Kann ich die Gräten haben?" Und schon steckt er diese Gräten in den M u n d und kaut auf ihnen herum. Wir kommen aus einem hungernden Frankreich - aber dieser absolute Hunger, den ich zuerst auf den Gesichtern der Kinder sah und der sich nun hier im Gesicht dieses Mannes spiegelt, ist so trostlos, dass ich in die Tasche greife und ihm eine Handvoll Zigaretten in die Hand drücke. Der Mann schaut sprachlos auf diesen für ihn unendlichen Schatz und läuft davon, als ob ich mich eines Besseren besinnen könnte. Zwei Nächte in überfüllten Zügen liegen hinter uns, die dritte Nacht steht bevor: von Madrid zur portugiesischen Grenze. Wir
295
sind früh auf dem Bahnhof, noch ist der wartende Zug nicht überfüllt. Sofort fallen wir in tiefen Schlaf. Als wir nach Stunden aufwachen, rattert der Zug schon lange durch die spanische Nacht. Ein Dutzend Menschen stehen in unserem Abteil; niemand hat uns geweckt, das ist spanische Höflichkeit. Beschämt rücken wir in unsere Ecken, ich versuche mit meinem letzten Pack Zigaretten unsere Schuld abzuzahlen. In tiefen Zügen rauchen die Männer ihre Zigaretten bis zur Hälfte und geben die andere Hälfte an sehnsüchtig wartende Freunde auf dem überfüllten Gang weiter. Im letzten ausgebombten Bahnhof vor der Grenze nehmen wir herzlichen Abschied von vielen Freunden dieser Nacht. Absoluter Hunger und Zigarettengeld wurden bald Alltagserscheinungen in ganz Europa, aber Spanien hatte das Schicksal, den übrigen Europäern in seiner Not einen guten Sprung voraus zu sein. *
Portugiesische Grenze — mit bunten Kacheln ausgelegter sauberer Bahnhof. Umsteigen von spanischer Breitspur auf Normalspur; hier steht der letzte Rest des einstigen internationalen Zuges, der vor dem Kriege durch ganz Europa fuhr. Zum ersten Male seit drei Nächten können wir unsere Glieder in der Polsterklasse eines Luxuszuges strecken. Nur noch eine Dame teilt unser Abteil. Als wir durch den frühen Morgen fahren, öffnen wir die achte und letzte Olsardinenbüchse unseres Proviantes. Wir sind wohl die einzigen Globetrotter, die je Olsardinen nach Portugal, dem klassischen Sardinenland, eingeführt haben. Die Dame in der anderen Ecke des Abteils öffnet eine Büchse mit Leberpastete und beginnt mit langen Bissen zu kauen. Wir blicken sehnsüchtig auf diese Delikatesse, und sie blickt anscheinend ebenso sehnsüchtig auf unsere Sardinenbüchse. „Darf ich Ihnen eine Sardine anbieten?" Dankbarer Ausruf: „Oh ja, gerne! Aber möchten Sie vielleicht etwas Leberpastete?" - „Mit größtem Vergnügen." - „Ich
296
komme nämlich aus Nizza, habe seit drei Tagen nur Leberpastete gegessen; das war das einzige, was ich für die Reise hamstern konnte." - „Wir haben uns in Marseille eingedeckt, und Olsardinen sind seitdem unsere Nahrung." Beglückt werden unsere Kostbarkeiten und dann Erlebnisse ausgetauscht. Sie ist englische Krankenschwester, war mit dem Expeditionskorps in Frankreich und wurde nach dem Zusammenbruch versprengt. Nach Irrfahrten durch Frankreich wurde sie schließlich per „geheime Untergrundbahn" nach Lissabon geschleust und will nach England zurück. Wir beschließen ein gemeinsames erstes gewaltiges Mittagsmahl in Lissabon und sitzen einige Stunden später auf dem Rossio, dem Hauptplatz der Stadt, und essen und essen. Ich lasse mich diese erste „Friedensmahlzeit" über einen Dollar meines Vermögens kosten. Traute isst zum Schluss alleine vier Stücke Kuchen. Nur die Olsardinen zum Vorgericht haben wir stehen lassen. Der plötzliche Sprung in die zumindest äußerliche Normalität eines neutralen Landes ist atemberaubend. Selbst gesättigt können wir uns nicht von den Schaufenstern der Lebensmittelgeschäfte losreißen, wir gehen durch die mit Früchten und Gemüsen und Fischen gefüllten Markthallen. Es herrscht ein Uberangebot von Ananas und Südfrüchten von den Azoren, da der Krieg die Ausfuhr hindert. Die HIAS-Organisation nimmt sich unserer sofort energisch an. Freundliche Menschen empfangen uns. Ein sauberes Zimmer in einer portugiesischen Familie erwartet uns, wir erhalten Taschengeld, in einer Kantine können wir essen, wann immer wir wollen. Wir sind für die Passage in etwa drei Wochen vorgesehen: „Betrachten Sie die Zeit als Urlaub, erholen Sie sich!" Der gewaltigste Eindruck packt uns bei Anbruch der Dämmerung, wenn die Lichter in dieser vom Flussufer des Tejo in die Hügel steigenden Stadt angehen und ganz Lissabon aufstrahlt. Seit dem 1. September 1939 habe ich keine leuchtende Stadt mehr gesehen, als ganz Europa in Dunkelheit versank. Wir sitzen auf einer Bank am Fluss, blicken auf diese Lichter der Stadt und füh-
297
len plötzlich, wie deprimierend die ewige Dunkelheit des Krieges ist - wie erlösend Licht sein kann. Allmählich fühlen wir die eigenartige Atmosphäre in diesem Fluchthafen Westeuropas. Die Versprengten eines Kontinentes sammeln sich hier zu einer Atempause. Die vielen Neugierigen vor den Zeitungskiosken, in denen nebeneinander die Zeitungen von Freund und Feind hängen, sind kaum Portugiesen; hier hören wir Französisch, Englisch, Deutsch, Holländisch, Tschechisch und Jiddisch. Viele wollen nach England, um weiterzukämpfen, viele waren Mitglieder der tschechoslowakischen und polnischen Legion in Frankreich. Lissabon ist in diesem Frühling 1941 ein Zentrum der Intrigen, die Neutralität Portugals neigt der englischen Seite zu, aber die Nazis haben ein weites Spionagenetz über das ganze Land geworfen, besonders die Transporte nach England müssen in Nacht und Nebel erfolgen, und die englische Flotte kreuzt hart vor der Küste. Aber auch zu Lande schrecken die Nazis nicht vor gelegentlichen Kidnappings zurück. Wir werden zur Vorsicht gemahnt, Gerüchte über Verschleppungen gehen um und haben, wie sich später zeigte, durchaus Berechtigung. Am Abend gehen wir niemals allein, stets in kleinen Gruppen. „Extra! Extra!", rufen die Zeitungsjungens, und die portugiesischen Überschriften zeigen in großen Lettern den Namen Rudolf Heß. Aufgeregt buchstabiere ich mir am Cafehaustisch mit Hilfe eines kleinen Lexikons die Sensation zusammen, dass der Führerstellvertreter nach England geflohen ist [10. Mai 1941], Das gibt Gesprächsstoff in dem Café, das in Lissabon sofort Sammelpunkt der Emigration wurde. Gesichter aus dem alten Romanischen Café in Berlin tauchen auf; Menschen, mit denen man im Café du Dôme in Paris zusammengesessen hat, Schicksalsgenossen, deren Bekanntschaft aus den Cafés der Canebière in Marseille stammt.Cafés sind auf dieser Weltreise wider Willen die Magneten, die die Heimatlosen anziehen und einsame Menschen vor völliger Einsamkeit bewahren. Ich treffe einige Kameraden aus der Arbeitskompanie in Langlade; ich erkenne Gesichter aus dem 298
Auswandererlager Les Milles; Menschen, mit denen man lange Stunden vor Konsulaten und auf den Wartebänken in Hilfsorganisationen zugebracht hat. Freudiges Wiedersehen mit lang verschollenen Freunden. Mein einstiger Chefredakteur Georg Bernhard freut sich so, uns unter den Lebenden wiederzufinden, dass er Traute zwei grüne Dollarnoten schenkt.
*
Wir werden geimpft, erhalten Schiffskarten zur Amerikafahrt auf der Ciudad de Sevilla. Da keine regulären Passagierdampfer nach Amerika zu finden waren und der Passagierluftverkehr noch in ferner Zukunft lag, hatten die Hilfsorganisationen ein eigenes spanisches Schiff gechartert, um rund 700 Emigranten auf einem Schwung auf den Weg zu bringen. Der große Tag: Einschiffung nach Amerika. Am Quai liegt ein recht kleines Schiff, die spanischen Farben rot-gelb-rot sind groß auf die Flanken gemalt. In friedlicheren Zeiten war die Ciudad de Sevilla ein Touristenschiff auf der Balearenroute gewesen. Sie hatte ein Dutzend Kabinen, die für die sagenhaft Reichen reserviert blieben, die für ihre eigene Uberfahrt erster Klasse zahlen konnten. Für uns andere waren die Frachtbunker zu Schlafräumen umgebaut worden. Mit unseren letzten Escudos kaufen wir uns Liegestühle am Quai, wir werden sie auf unserer dreiwöchigen Kreuzfahrt zur Neuen Welt dringend brauchen. Die HIAS hat uns mit dem amtlichen Impfschein einen Fünfdollarschein als Taschengeld auf die Reise gegeben. Wir gehen die Brücke hinauf zum Schiff, unsere Papiere werden geprüft und gestempelt — dann empfangen uns zwei Herrn in Zivil: „Gesundheitsdienst, bitte fünf Dollar für Impfung!" Wir protestieren, wir sind ja bereits geimpft, hier der amtliche Impfschein! Die Herren schütteln die Köpfe: „Fünf Dollar für Gesundheitskontrolle oder Sie kommen nicht aufs Schiff!" 299
Siebenhundert Passagiere geben ihren kostbaren Fünfdollarschein an die beiden Herren, die weder unseren Impfschein anschauen, noch einen Versuch einer Impfung noch sonstiger Gesundheitskontrolle unternehmen - keinerlei Stempel, keinerlei Quittung. 700 χ 5 - das sind 3 500 Dollar. Nachdem alle Passagiere an Bord sind, verschwinden die beiden Herren - und erst dann stellt es sich heraus, dass die zwei Ehrenmänner schlichte Betrüger waren, die irgendwoher erfahren hatten, dass jeder Passagier fünf Dollar in der Tasche hatte und sie siebenhundertfach abknöpften - es war für sie die reinste Form von Kriegsgewinn. 700-faches Fluchen in vielen Weltsprachen hilft nicht viel - unser Taschengeld ist verschwunden, und damit die kleinen Annehmlichkeiten wie spanischer Wein und amerikanische Zigaretten an Bord. Die SchifFssirene heult, die Ciudad de Sevilla gleitet den Tejo hinunter ins offene Meer. 7 0 0 Männer, Frauen und Kinder stehen an Bord, ihre paar Habseligkeiten und die Liegestühle u m sich geschart. Uber einen Lautsprecher werden Anweisungen gegeben: Frauen und Kinder in die Laderäume am Heck, Männer am Bug des Schiffes. Ich schleppe meinen Koffer die steile Leiter herunter in den Bauch des Schiffes. Hier sind in langen Reihen primitive Kojen gebaut mit einer dünnen Matratze und einer Decke pro Mann. In der Mitte stehen Holzbänke, das ist der Speisesaal. Ich werfe den Koffer in irgendeine Koje und eile zurück an Deck, u m einen guten Platz für die Liegestühle zu ergattern - wir schaffen es unter einem Sonnensegel am Bug. Ich kratze mit einem Messer unsern Namen ins Gestühl und sichere so den privilegierten Platz, den uns auf der ganzen Fahrt niemand streitig macht. Abend fällt, als die Ciudad de Sevilla das offene Meer erreicht. Die spanischen Farben zu beiden Seiten sind mit grellen Scheinwerfern angestrahlt, das Schiff liegt hell erleuchtet auf dunklem Meer, ein neutrales Schifft nimmt Kurs auf einen noch neutraleren Erdteil. Die britischen Patrouillen, deren schattenhafte Umrisse am Horizont verschwinden, und die deutschen U-Boote,
300
die nicht sehr weit sein mögen, sollen wissen, wer wir sind. Traute und ich sitzen am warmen Frühlingsabend an Deck in unseren Liegestühlen, die Küste weicht zurück. Europa und der bisher noch europäische Krieg verschwinden. Eine Weltreise wider Willen, die vor genau acht Jahren auf dem „Kraft durch Freude"-SchifF Odin begann, nimmt auf der Ciudad de Sevilla ihren Fortgang. Drei lange Wochen werden wir auf dem kleinen Schiff völlig isoliert sein, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 Knoten, mit seiner Menschenfracht an Bord für San Domingo, Kuba und New York. Schon die erste Mahlzeit, bestehend aus öligem Fisch, zeigt, dass die Fleischtöpfe Lissabons entschwunden sind. Es wird eine neue Abmagerungskur, die uns unsere in Lissabon gewonnenen zehn Kilo wieder kosten wird. Denn öliger Fisch bleibt unser tägliches Menü. Ein recht unwirkliches Leben organisiert sich auf diesem Emigrantenschiff. Gruppen alter Bekannter rücken ihre Stühle zu engen Kreisen zusammen. Es sind nicht die verhärmten Opfer späterer Jahre, die, in Konzentrationslagern gebrochen, Zuflucht in Amerika finden werden; nicht die Alten, die die Nazis gegen Lösegeld über die Grenzen hetzten. Die Menschen sind „gelernte Emigranten", die sich immer wieder durchgeschlagen haben, die dem immer länger werdenden Arm der Nazis stets eine kurze Meile voraus waren. Viele junge Menschen, die ein Jahr später in amerikanischer Uniform in Truppentransportern den Weg zurück nach Europa antreten werden. Während irgendwo neue Schlachten zur Luft und zur See geschlagen werden, Hitler zur Zeit den Balkan erobert und seinen Aufmarsch gegen die Sowjetunion plant, diskutieren hier Reichstagsabgeordnete der Weimarer Republik mit Politikern aus überrannten Ländern ihre alten politischen Schlachten, die sie sämtlich verloren haben. SchuschniggOsterreicher streiten sich mit österreichischen Sozialisten; eine Gruppe jüdischer Siedler hockt zusammen, die in San Domingo eine Farmkooperative gründen wollen; einige Familien chassidischer Juden, die sich auf rätselhafte Weise von Polen durch ein 301
feindliches Europa durchgeschlagen haben und hoffen, in Kuba eine neue Heimat zu finden, beten unaufhörlich. Seltsame Typen beleben das Deck: Der Mann, der immerzu Listen schreibt, unsere Kojen nummeriert, unsere Plätze an den Holztischen festzulegen sucht und einen Plan einer geregelten Reihenfolge zur Benutzung der viel zu knappen Toiletten ausarbeitet, der immerzu organisiert und verzweifelt ist, wie wenig Beachtung seine Listen finden. Da ist der Mann, der eine ganze Kiste Olsardinen an Bord gebracht hat, einsam in einer Ecke sitzt und ständig Olsardinen isst. Er weigert sich, auch nur eine Sardine abzugeben, und schaut misstrauisch in hungrige Augen, die ihn zu verfolgen scheinen. Als er in Kuba das Schiff verlässt, schleppt er noch eine halbe Kiste an Land. Ein Hysteriker läuft ohne Unterlass rund um das Deck, sieht hinter jeder Welle ein deutsches U-Boot und gerät in namenlose Panik, als eine Schule von Delphinen auftaucht, die er endgültig für von einem U-Boot abgeschossene Torpedos hält. Wir haben die junge schöne Frau, die sich durch das ganze Schiff weint, von den Tiefen des Frachtbunkers bis in die Kabine des Ersten Offiziers, und so der Reise etwas Sex gibt. Ein Professor sucht Zuhörer für seine Tiraden gegen Amerika, das er noch nie gesehen hat: „Alle Amerikaner sind Antisemiten, sehen Sie sich den Lindbergh an, der ist ein Busenfreund von Göring!" - „Es gibt doch außer Lindbergh noch andere Amerikaner, wer hat Ihnen denn Ihr Visum beschafft?" „Meine jüdischen Verwandten — aber glauben Sie mir, in Amerika sind selbst die Juden Antisemiten!" Wir sitzen in einem Kreis von Schauspielern zusammen mit dem Regisseur Aufricht, der Brechts Dreigroschenoper in Berlin auf die Bühne gebracht hatte, unter unserm Sonnendeck und hören zum unendlichsten Male die Geschichte seines großen Erfolges. Da das Schiff außer uns Passagieren auch noch portugiesischen Kork geladen hat, überrennen Armeen von Ameisen die Kojen tief in den Laderäumen, daher bleiben wir Tag und Nacht auf unseren Liegestühlen und haben nichts anderes zu tun, als
302
tage- und nächtelang über Theater der Dreißiger Jahre in Berlin und Wien zu reminiszieren, während zuweilen fliegende Fische aufs Deck fallen. Die Sensation ist die Geburt eines Kindes. Die Mutter hatte gehofft, das freudige Ereignis zurückhalten zu können, bis der Boden Amerikas erreicht wäre. Aber das Schiff fuhr zu langsam, nun hatte sie einen neuen Weltbürger ohne amerikanisches Visum. Der Kapitän aber strahlte, eine Geburt an Bord bedeutet ein glückhaft Schiff. Er stellte einen spanischen Pass aus, denn das Baby war unter spanischer Flagge geboren worden. Später ließen die Amerikaner den stolzen Spanier visumlos einreisen. Auf der Höhe von Bermuda stoppt ein Zerstörer unser Schiff und schickt ein Kommando an Bord. Unser Hysteriker sieht sich nun endgültig in der Hand von Nazipiraten - bis die britische Flagge am Heck des Kriegsschiffs sichtbar wird. Mit einem dröhnenden Hipphipp-Hurrah werden die Matrosen empfangen, letzte Zigaretten werden in ihre Hand gedrückt. Nach Prüfung der Schiffspapiere setzt die Ciudad de Sevilla ihren Kurs fort. 700 Hände, zum V-Zeichen erhoben, winken den Engländern zum Abschied. Wir fuhren die sonnige Südroute über den Atlantik, jetzt aber wird es subtropisch heiß, wir kreuzen im Golfstrom, und schließlich wird im Morgendunst die Küste Kubas sichtbar. Im Hafen von Havanna kommen Zeitungen an Bord: „Hitler ist in Russland eingefallen!" [22. Juni 1941] Ein amerikanischer Vergnügungsdampfer, auf Kreuzfahrt in den Antillen, liegt neben uns am Quai. Seine Sirene tönt ununterbrochen und ruft die Passagiere eilends an Bord. Die Kreuzfahrt wird abgebrochen, das Schiff wurde zurückgerufen. Drei Tage später fährt die Ciudad de Sevilla in die Bucht von New York ein. Ein Zollkutter bringt den Piloten, Zollbeamte und einen Schwärm von Journalisten, eine ganze Schiffsladung von Emigranten ist immerhin eine kleine Sensation. Plötzlich sehe ich meinen Bruder das Fallreep heraufkommen: „Na da seid Ihr 303
ja" - eine Bärenumarmung für mich und Traute. „Wie kommst du denn aufs Schiff?" - „Mit einer Journalistenkarte. Schließlich bist du mir damals auf der Reede von Calais zum Abschied entgegengefahren, da bin ich euch hier eine gebührende Begrüßung schuldig." Ein Reporter stellt, den Bleistift gezückt, aufgeregte Fragen: „Haben Sie U-Boote gesehen? Sind Sie aus einem Konzentrationslager ausgebrochen? Sind Sie schwarz über die Grenzen gekommen? Sie waren in der französischen Armee - in welchen Schlachten haben Sie gekämpft?" Ich muss den Mann enttäuschen. Nein ich habe kein U-Boot gesehen, bin aus keinem Konzentrationslager ausgebrochen, habe keine Schlachten geschlagen. Ich bin kein Held, meine Abenteuer sind die eines kleinen Mannes, der sich nicht ganz ohne Erfolg durch große Zeiten geschlängelt hat - dazu gehört vor allem eine gehörige Portion Glück. Zum Schluss fragt der Reporter: „How do you like America?" - „Ich kenne es doch noch gar nicht, hoffentlich werde ich es gut leiden können - schließlich soll es ja meine neue Heimat werden." Inzwischen sind wir weit draußen im Frachthafen gelandet. Hinter der Zollsperre stehen sie alle zum Empfang: Michael, dem ich in Kopenhagen „Auf Wiedersehen" gesagt hatte, Hans Jacob vom Straßburger Sender, Walter Thormann aus Langlade - wieder einmal haben wir Versprengten uns gesammelt — es scheint wie eine Heimkehr.
*
Die großen Zeiten rissen nicht ab. Bei unserer Ankunft war Amerika noch nicht im Kriege, Hitlers Armeen fielen gerade in Russland ein, der europäische Krieg begann sich zum Zweiten Weltkrieg auszuweiten. Doch die großen Zeiten, die nun folgten,
304
nahmen uns von jetzt ab nicht mehr als ausgesuchtes Ziel. Ich wurde zum Normalbürger, und daher mache ich nach dieser siebenten großen Zeit einen Punkt.
305
George Wronkow vor einem CBS-Mikrofon
George Wronkow
50 Jahre Journalist - Lebenslauf
Geboren im Jahre 1905 zu Berlin mit einem Silberlöffel im Munde, der bald seinen Weg in die Pfandleihe fand. Während des Ersten Weltkrieges königlich preußischer Gymnasiast, dessen Patriotismus schließlich von Hunger zernagt wurde. Uberlebt die Inflation dank der Erbschaft von einem reichen Onkel aus Amerika in Höhe von dreizehn Dollar. 1924 Mitarbeiter der im Verlag Rudolf Mosse, Berlin erschienenen Zeitungen und anderer deutscher Presseorgane. 1931 Redakteur am Berliner Tageblatt. März 1933 fristlose Entlassung wegen Staatsfeindlichkeit. Flucht über die „grüne Grenze" nach Kopenhagen und von dort zu Schiff nach Frankreich. Bis 1936 freier Schriftsteller, „Ghostwriter" und Mitarbeiter am Pariser Tageblatt. 1936 bis Mai 1940 Redakteur an der Radiodiffusion Nationale, Paris, für den Sender Strasbourg in deutscher Sprache. Dieser Dienst war durch den 1944 ermordeten Minister Georges Mandel ins Leben gerufen worden und suchte der ins Elsaß flutenden Nazipropaganda entgegenzutreten. 307
Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf diesem Posten mobilisiert. Frühjahr 1940 folgte Einberufung als Armierungssoldat und Rückzug nach Nimes, später unbesetztes Frankreich. Uber Militärlager, Auffanglager, Untertauchen und Wiederauftauchen schließlich via Spanien und Portugal mit einem „Emergency Visum" für politisch Bedrohte nach Amerika. Ankunft Frühjahr 1941. In Amerika: Bei Gründung der französischen Emigrantenzeitung Pour la Victoire (Chefredakteurin Mme Tabouis) in New York für Verlagsarbeit und Propaganda engagiert. (1942) 1943-47 Senior Editor im Auslandsdienst des Columbia Broadcasting Systems für Überseesendungen nach Europa. 1947-52 Vereinte-Nationen-Korrespondent für den Auslandsdienst der Canadian Broadcasting Corporation, Montreal. Herbst 1949: Sondersendungen für Vereinte Nationen Radio während der Berliner Blockade. Seit 1950: USA- und UN-Korrespondent für eine Gruppe Schweizer und Deutscher Zeitungen und Funkstationen, u. a.: Kölner Stadtanzeiger - Köln, Die TAT - Zürich, Weserkurier - Bremen, Westdeutsche Allgemeine Zeitung - Essen, UN-Berichte für Südwestfunk - Baden-Baden. Heiratete 1936 Claire Gertrude Wincenty nach deren Flucht vor der Gestapo in Paris. 1974: Fünfzig Jahre Journalist. George Wronkow verstarb am 15• Dezember 1989 in New York. 308
Siegfried Maruhn George Wronkow und die WAZ1
Die deutschen Zeitungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, durften zunächst keine eigenen Korrespondenten ins Ausland entsenden. Nach meiner Erinnerung war es eine junge deutsche Redakteurin der (noch amerikanisch kontrollierten) Nachrichtenagentur DENA 2 in Bad Nauheim, die 1948 als erste aus London über die Außenministerkonferenz berichten durfte. Die Entsendung löste bei den älteren (und männlichen) Kollegen viel Neid aus. Als die junge Frau in einem Rundfunkinterview darüber klagte, dass sie kein Abendkleid für die zu erwartenden festlichen Empfänge habe, war das Anlass zu manchem hämischen Kommentar. An ihren Berichten freilich gab es nichts zu kritteln. Für die Tageszeitungen hatte sich 1952, als ich zur WAZ kam, noch nichts geändert. Zwar konnten Deutsche, wenn auch unter Uberwindung beträchtlichen bürokratischen Widerstands, wieder kurzfristig ins Ausland reisen, doch eine dauerhafte Entsendung von Korrespondenten war noch nicht möglich. In dieser Situation behalfen sich die Zeitungen mit deutschsprachigen Journalisten, die vor dem Hitler-Regime ins Ausland
1
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, gegründet im April 1948.
2
Deutsche Nachrichtenagentur: Presseagentur der Amerikaner in ihrer Besatzungszone ab 1946 als Nachfolgerin der DANA (Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur, gegründet 1945); ging im August 1949 in die dpa (Deutsche Presse-Agentur) ein.
309
geflohen oder vertrieben worden waren. Manchmal war dies in der Tat ein Behelf, wenn also etwa der Kollege schon zu lange im Ausland war und sein Deutsch gelitten hatte oder wenn er die Verhältnisse in der ehemaligen Heimat nicht mehr beurteilen konnte. Im Allgemeinen aber handelte es sich um qualifizierte, erfahrene Journalisten, die ihr Handwerk beherrschten. Wenn sie den alten deutschen Zeitungsstil pflegten, also ausführlich und kommentierend berichteten, so war das nicht unbedingt ein Nachteil. Die aktuellen Nachrichten entnahmen wir zu jener Zeit den Agenturen. Vom Korrespondenten erwarteten wir eine ausführliche Hintergrundberichterstattung, eben jene Form, die bis heute als „Korrespondentenbericht" dieses Genre kennzeichnet. Zu den WAZ-Korrespondenten jener frühen Fünfziger Jahre zählte Reynolds in London, Hans B. Meyer in Washington und eben George Wronkow in New York. Schon lange in Paris tätig, aber meines Wissens erst später zur WAZ gestoßen war Rudolf Wolff, ein Sohn des bedeutenden ehemaligen Chefredakteurs des Berliner Tageblatts, Theodor Wolff, den die Italiener 1943 noch aus Nizza herausholten und an die Gestapo auslieferten. Auch Wronkow hatte zunächst in Frankreich Zuflucht gesucht, doch gelang es ihm, das Land noch rechtzeitig zu verlassen, bevor deutsche und französische Juden verhaftet und deportiert wurden. Wronkow hatte schon für die WAZ aus Amerika berichtet, bevor Hans B. Meyer seine Arbeit in Washington aufnahm. Meyer war Mitarbeiter der amerikanischen Militärregierung gewesen und hatte als stellvertretender Pressesprecher für OMGUS 3 gearbeitet. In dieser Funktion hatte er Erich Brost und der WAZ geholfen, als 1949 mit dem Ende der Lizenzpflicht die neuen Zeitungen sich gegen die wieder auf den Markt drängenden alten Verleger behaupten mussten.
Office of Military Government for G e r m a n y (U.S.): höchste Verwaltungseinrichtung der amerikanischen Besatzungszone von September 1945 bis Dezember 1949.
3
310
Die Aufteilung der Amerikaberichterstattung auf zwei Positionen in Washington und New York war für die damalige Zeit, in der es sowohl an Zeitungspapier und damit an Platz für Berichte als auch an Devisen mangelte, ungewöhnlich. Sie war gleichwohl sinnvoll. Meyer berichtete über Weißes Haus und Außenministerium, sowie aus den für Deutschland noch wichtigen Militärbehörden. Wronkow hatte die Vereinten Nationen und die Wall Street als Hauptarbeitsgebiet. Aber natürlich bot New York auch als Kulturmetropole genügend interessanten Stoff. Ein Nachteil der Lösung war, dass beide Korrespondenten, die ja jeweils nicht ausschließlich für die WAZ arbeiteten, sondern auch für andere Zeitungen, die sich nur einen Korrespondenten leisteten, sich in ihrem Angebot überschnitten. Meyer bemühte sich auch um eine Berichterstattung über die Vereinten Nationen, Wronkow berichtete auch über die hohe Politik in Washington. Meine Erinnerung ist, dass Wronkow die besser geschriebenen Berichte lieferte, während Meyer manchmal besser informiert war. Meine Kollegen in der Außenpolitik standen oft genug vor Gewissensentscheidungen, wen sie bevorzugen sollten. Nachdem Wronkow pensioniert war, setzten wir diese Doppellösung auch nicht fort. Erst später kamen zeitweilig auch Mitarbeiter aus anderen Zentren der USA, vor allem Kalifornien, hinzu. Dazu gehörte u. a. auch Anneliese Uhlig, ein früherer Ufa-Star 4 , die, mit einem amerikanischen Offizier verheiratet, von der Westküste berichtete. George Wronkow besuchte uns gelegentlich in der Redaktion in Essen. Er gab seine Berichte auch an andere deutsche und Schweizer Zeitungen, so auch an den Kölner Stadt-Anzeiger, mit dem wir viele Jahre lang ein weitgehend gemeinsames Korrespondentennetz betrieben, bis Zerwürfnisse der Verleger diese Zusammenarbeit beendeten. Öfter freilich kam ich mit Wronkow in New York zusammen. Dort lernte ich auch seine Frau kennen. Die Gespräche mit Wron4
Universal Film A G .
311
kow waren stets ein Genuss. Er war kenntnisreich, scharfsinnig und witzig. Bei ihm wurde mir stets bewusst, was die Nazis mit der Vertreibung der Juden angerichtet hatten, welcher intellektuellen Potenz sie uns beraubt hatten. Wronkow seinerseits hing an seiner alten Heimat, auch wenn er in New York mit seiner großen jüdischen Einwohnerschaft eine vertraute Umgebung um sich wusste. Er half auch dabei, den deutschsprachigen Auflau noch lange am Leben zu erhalten. Über die Zukunft des Blattes machte er sich keine Illusionen. Einmal zeigt er mir die Todesanzeigen, die das Abschmelzen des Abonnentenstammes verkündeten. Zum letzten Mal sahen meine Frau und ich George Wronkow 1989 bei einer Tagung der Bertelsmannstiftung auf Long Island. Er war 84, klein und hinfällig, aber wie früher schlagfertig und witzig. Erst ein Jahr später erfuhren wir, dass er schon 1989 gestorben war. Seine Witwe rief mich in Washington an, wo ich inzwischen als sein und Meyers Nachfolger arbeitete. Sie machte sich Vorwürfe, dass sie immer noch die kleine Rente von einigen hundert Dollar erhielt, die Erich Brost bei der Pensionierung ausgesetzt hatte. Sie wurde weiter gezahlt, wie es sich im Andenken an einen Mann der ersten Stunde gehörte. Siegfried Maruhn war WAZ-Redakteur seit 1952, Chefredakteur von 1970—1988, Korrespondentfür die WAZ und andere Zeitungen in Washington von 1989-1992.
312
Irmtraud Ubbens Reportagen eines Lebens" oder „Erinnerungen"? Ein Vergleich der Autobiographien zweier deutsch-jüdischer Berliner Journalisten: George Wronkow und Moritz Goldstein
Durch die unruhigen Zeiten der Flucht und Emigration - verursacht durch die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland - sind viele Lebenszeugnisse deutsch-jüdischer Journalisten verloren gegangen. Diese Journalisten, die während der Weimarer Republik in der Zeitungsstadt Berlin geschrieben und das Bild der Zeit mitgeprägt hatten, waren nach dem Machtantritt Hitlers gezwungen, Deutschland zu verlassen. Nur wenige verbliebene Nachlässe geben Aufschluss über ihre Schicksale und sind daher wichtige Quellen für die Exilforschung. Das „Institut für Zeitungsforschung" in Dortmund hat etwa zwei Dutzend solcher Exil-Nachlässe gesammelt, die zum großen Teil durch Findbücher erschlossen worden sind. Zu diesen Nachlässen gehören u. a. die der beiden deutsch-jüdischen Berliner Journalisten George Wronkow und Moritz Goldstein. Beide haben außer Briefen und diversen anderen Schriften - veröffentlichten und unveröffentlichten Manuskripten — auch ihre Autobiographien hinterlassen.1 Sowohl George Wronkow als auch Moritz Goldstein mussten 1933 das nationalsozialistische Deutschland verlassen; sie verbrachten ihr folgendes Leben im Ausland und kehrten nicht wie-
1 George Wronkow, Kleiner M a n n in großen Zeiten. Reportagen eines Lebens, in diesem Band S. 11-305. Moritz Goldstein, Berliner Jahre - Erinnerungen 1880-1933 (Lit.verz. Nr. 11).
313
der in ihre alte Heimat zurück. Beide starben als amerikanische Staatsbürger in den USA. Zunächst klingen diese Fakten nach ähnlichen Schicksalen, doch mehr als den historischen Rahmen teilen sie nicht, denn diese Schicksale wurden sehr verschieden erlebt. A m Beispiel der beiden Lebenserinnerungen soll auf verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem Schreiben autobiographischer Texte eingegangen werden, z.B.: Beschriebener Zeitraum und Zeitpunkt der Niederschrift; Schilderung zeitgeschichtlicher Ereignisse oder Darstellung des eigenen Ich; Motiv und Absicht der Niederschrift; Aufbau der Texte. Bei einem Vergleich der Erinnerungen von Wronkow und Goldstein stellt sich auch die Frage, ob und wieweit die beiden Autoren in der Reflexion ihr Leben im Exil als selbst gestaltet oder als erlitten empfanden. Beide haben durch das Aufschreiben ihrer Autobiographien das Erlebte verarbeitet, geordnet und gedeutet und damit in gewisser Weise neu erschaffen und konstruiert. 2 Es gibt nur wenig theoretische Erkenntnisse über den Zusammenhang von autobiographischem Gedächtnis und Zeitgeschichte, doch kann man anhand dieser beiden Lebensberichte aufzeigen, wie sehr die Erinnerungen sowohl vom Kontext der damaligen Gegenwart als auch vom Selbstverständnis der Erinnernden zur Zeit der Niederschrift bestimmt werden. 3 Wronkows und Goldsteins Wahrnehmungen und Erinnerungen lehren, dass Emigration und Exil kein Schicksal ist, das ohne weiteres verallgemeinert werden könnte, sondern dass das vielfach eher homogen gezeichnete Bild des Exils differenziert werden muss: Exil wird so unterschiedlich erlebt, wie es Emigranten gibt.
2
Vgl. Sylke B a r t m a n n , Biografíen von Emigranten im Nationalsozialis-
mus. Eine erzählstrukturelle Analyse (Lit.verz. Nr. 3), S. 31. 3 Vgl. Werner Bergmann/Juliane Wetzel: „ D e r Miterlebende weiß nichts". Alltagsantisemitismus als zeitgenössische E r f a h r u n g und spätere Erinnerung (1919-1933) (Lit.verz. Nr. 4), S. 175.
314
Ausschlaggebend für die Bewältigung und die Verarbeitung des Exils sind nicht nur Herkunft, Persönlichkeit, Alter, sozialer Status, Bildung und Gesundheit. Wichtiges Kriterium für den Umgang mit so stark belastenden Situationen, wie sie im Exil erlebt werden, ist vor allem die Prägung in Kindheit und Jugend, durch die sich das Selbst- und Weltverständnis der Betroffenen ausbildet. Das stark voneinander abweichende Exilerlebnis der beiden Journalisten Wronkow und Goldstein läßt sich u. a. mit dem großen Altersunterschied erklären, der sie voneinander trennte, und mit ihren sehr gegensätzlichen Charakteren. George Wronkow (geb. 1905) war bei seiner Emigration mit 28 Jahren ein noch junger Mann, dem es möglich war, ein neues Leben zu planen und aufzubauen. Moritz Goldstein (geb. 1880) stand dagegen zu Beginn seines Exils mit 53 Jahren schon in der zweiten Lebenshälfte. Neugier, Geistesgegenwart, Kontaktfreude und Anpassungsfähigkeit waren die Charaktereigenschaften, die Wronkow bei der Bewältigung des Exils halfen und die es ihm ermöglichten, „aus grauen Wolken immer wieder ein Stück Blau herauszupolken"4. In seiner Autobiographie bezeichnet er sich selbst als ein „Stehaufmännchen".5 Goldstein dagegen war eher kontaktarm, introvertiert und analysierend. Diese Eigenschaften waren weit weniger geeignet, ihm in den unsicheren Lebensbedingungen des Exils zu helfen. Er schreibt über sich: „Das Leben ist mir auch unter den so viel günstigeren Bedingungen meiner Heimat nicht leicht gefallen, sondern schwer. Wie konnte ich erwarten, Erfolg und Aufstieg würden mir in der kalten, harten, gleichgültigen Fremde besser glücken, zumal der Schwung und die Empfehlung der Jugend weit hinter mir liegen?"6
4
George Wronkow, Kleiner M a n n in großen Zeiten, S. 13.
5
Ebd.
6
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 10/11.
315
Beide Autoren beginnen ihre Aufzeichnungen mit der Schilderung ihrer Kindheit und Jugend in Berlin; es folgen ihre Berufsjahre, die sie beide ebenfalls in Berlin erlebten. Goldsteins Erinnerungen enden hier, während Wronkow die Jahre im Exil - vor allem die sieben Jahre in Frankreich - noch ausführlich thematisiert. Wronkows und Goldsteins Lebensbeschreibungen schließen jeweils an einem bestimmten, für die Autoren wichtigen Wendepunkt. Für Wronkow ist dieser Zeitpunkt gekommen, als er im Frühjahr 1941 in Amerika einwandert und hier eine neue Heimat findet. Er schließt seine Erinnerungen mit der Begründung: „Die großen Zeiten rissen zwar nicht ab, aber der Einwanderer war nicht mehr unmittelbares Objekt dieser großen Zeiten, sondern konnte sie als Normalbürger ungestört betrachten."7 Als Wronkow 1974, mit 69 Jahren, seine Lebenserinnerungen aus Anlass seines fünfzigjährigen Jubiläums als Journalist schrieb, lagen schon mehr als dreißig Jahre zwischen dem beschriebenen Zeitraum und der Zeit des Schreibens. Er war in Amerika zu Hause, die Schwierigkeiten der Emigration waren für ihn schon lange überstanden, und er führte das relativ ruhige „ungestörte" Leben eines „Normalbürgers". Goldsteins Autobiographie endet bereits mit dem Verlassen Deutschlands und dem Beginn seiner Emigration im Oktober 1933. Er ist in keinem seiner Exilländer Italien, England und den USA heimisch geworden und fühlte sich während der folgenden 44 Jahre im Ausland, bis zu seinem Tode, immer „aus seiner Sprache verbannt".8 Wie tief ihn die Unmöglichkeit, weiter als Journalist und Schriftsteller zu leben und zu arbeiten, getroffen hat, zeigt seine ablehnende Haltung zu Will Schabers9 Vorschlag 1966, seine Autobiographie um die Exiljahre zu erweitern. Gold7
George Wronkow, Kleiner M a n n in großen Zeiten, S. 14.
Inquit (d. i. Moritz Goldstein), A u f b r u c h , in: Pariser Tageszeitung Nr. 9 9 6 v. 14./15. M a i 1939, Sonntagsbeilage, S. 3. 8
9
Z u der Zeit Herausgeber des Aufôaus N e w York.
316
Stein begründete seine Ablehnung damit, dass sich „über Emigration jeder Emigrant äußern" könne.10 Es ist zu vermuten, dass er mit seiner Weigerung ausdrücken wollte, wie wenig diese Jahre mit seinem eigentlichen Lebensplan zu tun hatten. Wir erfahren jedoch durch das Vorwort zu seinen Erinnerungen, in dem er sehr eindringlich seine Erfahrungen mit dem Exil beschreibt, viel über die Unsicherheiten und Verletzungen, die diese Situation für ihn bedeutete. Als er 1947 mit 67 Jahren begonnen hatte, an seiner Autobiographie zu schreiben, waren vierzehn Jahre seit dem Verlassen Deutschlands vergangen. Nach zunächst sechs Exiljahren in Italien, lebte er seit 1939 mit seiner Frau unter wirtschaftlich und persönlich schwierigen Verhältnissen in England. Er beendete seine Autobiographie 1948 in den USA. Hier musste das Ehepaar sich zum dritten Mal eine neue Existenz aufbauen. Goldstein fand nach dem Verlassen Deutschlands nie wieder die Möglichkeit, das Leben eines „Normalbürgers" zu führen. Obwohl seit 1945 der Krieg beendet und die Hitlerherrschaft in Deutschland zerbrochen war, fühlte er sich auch jetzt noch im Exil. Eine Rückkehr nach Deutschland war zu diesem Zeitpunkt aus psychologischen, politischen und finanziellen Gründen noch immer problematisch.11 Sowohl George Wronkow als auch Moritz Goldstein waren an einer Veröffentlichung ihrer Lebensberichte interessiert, um den Lesern ein eigenes Bild von sich selbst und/oder von der erlebten Zeit zu vermitteln. Ihre Beweggründe und Absichten sind allerdings sehr unterschiedlich, wie sich aus den Texten erkennen lässt. Wronkow überschreibt seine Aufzeichnungen: „Kleiner Mann in großen Zeiten - Reportagen eines Lebens". Aus diesem Titel ist Moritz Goldstein an Will Schaber, Brief vom 21. April 1966 ( GoldsteinNachlass, Lit.verz. Nr. 10). 10
11 Vgl. Irmtraud Ubbens, „Aus meiner Sprache verbannt..." Nr. 26), S. 9 7 - 1 0 8 .
317
(Lit.verz.
für die Leser nicht unmittelbar zu erkennen, dass es sich hier um seine Autobiographie handelt, denn mit der Bezeichnung „kleiner M a n n " könnte ebenso gut eine andere Person gemeint sein, und mit den „großen Zeiten" wird kein realer Zeitraum bezeichnet. Auch der Zusatz „Reportagen eines Lebens" deutet nicht auf eine Autobiographie hin, da Wronkow ganz distanziert Reportagen „eines Lebens" und nicht „meines Lebens" formuliert. Außerdem wird mit dem Begriff „Reportage" die Erwartung der Leser in eine bestimmte Richtung gelenkt. Sie sollen den aus subjektiver Sicht aufbereiteten Tatsachenbericht eines Augenzeugen erwarten, der als Beobachter über ein oder mehrere Ereignisse berichtet. Wenn die Reportage auch eigene Empfindungen und persönliche Eindrücke enthalten kann, so ist doch das berichtete Ereignis wichtiger als die Person des Berichtenden. 12 Insofern spricht aus Wronkows Titel und auch aus seinem ebenfalls in der dritten Person geschriebenen Vorwort eine deutliche Distanzierung von sich selbst. Vielleicht liegt es an dem großen Zeitabstand zwischen den beschriebenen Erlebnissen und der Zeit des Schreibens, dass die Einführung in seinen Lebensbericht auf den ersten Blick einen so unpersönlichen Eindruck vermittelt. Sicher ist es Wronkows Absicht, durch diese rhetorischen Mittel anzudeuten, dass es ihm vor allem darum geht, historische und politische Ereignisse seiner Zeit und sein eigenes politisches Wirken als „Objekt dieser großen Zeiten" zu verbinden. Er will die von ihm — dem „kleinen M a n n " - erlebte Zeit zeigen „aus der Perspektive seines eigenen profanen Bauchnabels, den er für den Nabel der Welt hält". 13 Damit werden die mit dem Begriff „Reportage" geweckten Erwartungen der Leser erfüllt; sie können aus der subjektiven Sicht eines Augenzeugen und Zeitzeugen die vergangene Zeit am Beispiel eines realen Lebens nacherleben. Dass Wronkow seine
12
Vgl. Christian Siegel, Die Reportage (Lit.verz. Nr. 25).
13
George Wronkow, Kleiner M a n n in großen Zeiten, S. 15.
318
Lebensbeschreibung „einer neuen Generation" 14 widmet, lässt sein Motiv erkennen: Er will Zeitgeschichte vermitteln. Goldstein hat beim Schreiben ein ganz anderes Anliegen. Ihm geht es nicht um die politische und historische Aufklärung „einer neuen Generation", sondern um die Darstellung seiner eigenen Person. Dieses Vorhaben wird deutlich in seinem Wunsch - der aber aus verlegerischen Gründen nicht erfüllt wurde 15 - die Erinnerungen mit „Ein Mensch wie ich" zu überschreiben. Der Begriff „Rechtfertigung", den Goldstein seinem Vorwort voranstellt, spricht die Absicht aus, die er mit diesen Aufzeichnungen verfolgt. Er will mit seinen Erinnerungen auf sich aufmerksam machen, sich selbst und sein Werk erklären. Goldstein will die „Partei seiner geistigen Leistung ergreifen, ihre Sache führen, so wie man einen Prozess führt, zur Abwehr von Unrecht und in Verteidigung des Rechts".16 Denn er „lebt im Dunkeln, unbekannt, unerkannt, vereinzelt und vereinsamt".17 Goldstein ist ein Enttäuschter, der sich als „Schriftsteller gescheitert" fühlt, obwohl es immer sein Wunsch gewesen war, „für die Literatur zu leben". Stattdessen musste er sich im Exil zuerst als Schulleiter und Lehrer, später vor allem als Pensionswirt seinen Unterhalt verdienen. Nie wieder konnte er, der sich vor allem unter dem Pseudonym „Inquit" an der Vossischen Zeitung einen Namen gemacht hatte, an sein bisheriges Leben als Schriftsteller und bekannter Journalist anknüpfen. Daher sind seine Erinnerungen, wie er im Vorwort schreibt, auch „Ausdruck seiner Sehnsucht nicht nach einem fer-
14
Ebd.
15
Als das Buch 1977 erscheinen sollte, waren soeben Franz Beckenbauers Erinnerungen unter dem Titel „Einer wie ich" erschienen. Wegen der großen Ähnlichkeit der Überschriften wurde Goldsteins Autobiographie schließlich - auf Vorschlag des Herausgebers Kurt Koszyk - mit dem unpersönlicheren Titel „Berliner Jahre. Erinnerungen 1880-1933" versehen. 16
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 9.
17
Ebd.
319
nen und immer ferneren Lande, sondern nach einer entschwundenen Zeit".18 Wronkow gliedert seine Aufzeichnungen in sieben „große Zeiten". Schon durch die Uberschriften ist zu erkennen, dass es weniger um private Erlebnisse als um erlebte Zeitgeschichte geht. Auffallend ist es, dass Wronkow für seine Uberschriften Zitate verwendet, mit denen er das wesentliche Thema eines jeden Kapitels hervorhebt. Dadurch, dass es nicht seine eigenen Worte sind, die er für die Titel verwendet, distanziert er sich wieder von sich selbst und macht deutlich, dass er die beschriebene Zeit in den Vordergrund rücken will. Es ist bezeichnend für ihn, dass er auf diese Weise über sich selbst hinaus, auf einen größeren Zusammenhang verweist. Die einzelnen Kapitel sind überschrieben: Erste große Zeit: Der Friedenskaiser Zweite große Zeit: „Ich werde Euch herrlichen Zeiten entgegenführen" (Kaiser Wilhelm II.) Dritte große Zeit: „Erwürgt die junge Freiheit nicht" (Plakat aus der Revolutionszeit 1918/19) Vierte große Zeit: „Meine Herren, seien Sie beruhigt, die Notenmaschinen laufen wieder in drei Schichten Tag und Nacht." (Reichsbankdirektor Rudolf Havenstein) Fünfte große Zeit: „Denn einmal werden wir ja doch wieder zur Ruhe kommen müssen." (Theodor Wolff, Chefredakteur des Berliner Tageblatts) Sechste große Zeit: „Wenn ich das Wort Kultur höre, möchte ich meinen Revolver entsichern." (Hanns Johst, Präsident der Reichsschrifttumskammer im Dritten Reich) Siebente große Zeit: „'s ist leider Krieg, und ich begehre / Nicht schuld daran zu sein!" (Matthias Claudius) Im Gegensatz zu Wronkows aufwendig formulierten Titeln lassen Goldsteins Uberschriften sofort den privaten Charakter 18
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 13.
320
seiner Erinnerungen erkennen. Sie sind sehr kurz und lakonisch, und vor allem die ersten drei sagen etwas aus über Goldsteins eigene Befindlichkeiten und Bemühungen. Sie lauten: Der Einsame; Ratlosigkeit; Kampf um die Bühne; Presse; Aufbruch. Durch diese rhetorischen Unterschiede in den Kapitel-Uberschriften werden von vornherein die verschiedenen Absichten der beiden Autoren deutlich. Bei einem Blick auf ihre erinnerte Kindheit und Jugend lassen sich schon sehr früh unterschiedliche Wahrnehmungsmuster erkennen. Wronkow sieht sich als Teil der „großen Zeiten", die er erlebte. Von Anfang an wird klar, dass er schon als Kind wach und neugierig seine Umwelt beobachtete und sich rückblickend sehr früh als Zeitzeugen und Beobachter versteht. Er verbindet seine eigenen lebensgeschichtlichen und alltäglichen Erlebnisse mit politisch und historisch interessanten Ereignissen. In seinen Kinderjahren erlebte er mit Interesse das 25. Regierungsjubiläum des „Friedenskaisers", den Besuch des Zeppelins, die Einweihung der Synagoge in der Fasanenstraße, die Vermählung der Hohenzollernprinzessin Viktoria Luise und das hundertste Jubiläum der Befreiungskriege. „Durch die Beine eines Schutzmannspferdes" sah er den Kaiser, den Zaren Nikolaus II. und den englischen König Georg V. in Berlin. Als Schüler marschierte er mit seiner Klasse zur Belle-Alliance-Straße, um dort die Kaiserparade zum Sedantag zu erleben. Es gab Schulfrei, Militärmusik und viel Begeisterung. Außer auf selbst erlebte Begebenheiten weist er immer wieder auf Zeitereignisse der Weltgeschichte hin, die er nicht unmittelbar erlebte. Auf diese Weise bettet er die eigenen Erlebnisse in einen größeren Kontext ein. So schreibt er im ersten Kapitel von der beginnenden Revolution in Russland; von den Kämpfen der kaiserlichen Kolonialtruppen mit den Hereros in DeutschSüdwestafrika, bei denen die Hereros fast ausgerottet wurden, und vom „Wettrüsten zu Wasser und zu Lande". Zynisch merkt er aus der Sicht des Erwachsenen an: „dankbare Untertanen nann321
ten Seine Majestät den Friedenskaiser".19 Auf diese Weise wird der Begriff „Friedenskaiser" im Titel ad absurdum geführt und der Leser ahnt, dass es sich mit den „großen Zeiten" ähnlich verhält. Nach der Abdankung des Kaisers spielt er mit seinem Bruder „Revolution", indem sie mit einem Karabiner aufs Dach klettern und in die Luft schießen. Er verteilt Extra-Blätter vom Vorwärts, wird von Mitschülern als „Spartakist" beschimpft, streift durch die Straßen und beobachtet heimkehrende Soldaten, Kriegsverletzte und Demonstranten. Er erlebt, wie die ersten Hakenkreuze auftauchen, und er wird von einem Nationalsozialisten als Jude verprügelt. Doch auch Not und Hunger, unter denen die Familie leiden musste, werden beschrieben. Mit dem Schulabschluss in der Obersekunda endet für ihn die Kindheit. Goldsteins Kapitel, in dem er von seiner Kindheit und Schulzeit erzählt, ist überschrieben „Der Einsame". Dieser Titel verweist nicht auf erlebte „große Zeiten", sondern deutet Goldsteins charakteristische Befindlichkeit in diesen Jahren an und lässt erkennen, dass er sich in seiner Autobiographie hauptsächlich mit seelischen Erlebnissen und der Frage nach seiner eigenen Identität beschäftigen wird. Ein wesentliches Problem für Goldstein ist seine jüdische Herkunft, unter der er leidet. Der unterschiedliche Umgang Wronkows und Goldsteins mit ihrer jüdischen Herkunft zeigt auch in dieser Hinsicht zwei recht gegensätzliche Charaktere. Auch Wronkow erwähnt zwei antisemitische Vorfalle, die er während seiner Schulzeit erlebte. Doch scheint er - anders als Goldstein — seelisch kaum darunter gelitten zu haben, denn er ist extrovertiert und selbstbewusst; nie scheint er grüblerisch mit sich selbst und seinen inneren Vorgängen beschäftigt zu sein. Goldstein dagegen ist unsicher, zweifelnd, suchend und reflektierend. Er grübelt darüber nach, weshalb die Mitschüler, zu denen er in der Schule ein gutes und freundschaftliches Verhältnis hat, ihn nie zu Hause besuchen oder ihn zu sich einladen. Als Grund da19
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 18.
322
für vermutet er, dass die Eltern ihren Kindern den Umgang mit Juden verboten haben. In einer anderen Klasse empfindet er „heftigen und offenen Antisemitismus".20 Goldstein erkennt im Judentum einen wesentlichen Grund für seine Einsamkeit.21 Indem er über seine Empfindungen und Wahrnehmungen schreibt und darüber, wie er sich wegen seiner jüdischen Herkunft isoliert und diskriminiert fühlte, werden trotz der sehr persönlichen Sicht die Probleme und die Stimmung der erlebten Zeit spürbar. Schreibt Goldstein aber über das, was ihn in seiner Kindheit umgab, so ist der Rahmen enger gefasst als bei Wronkow, und er beschreibt nur das, was ihn direkt angeht. Da die Familie einige Zeit in unmittelbarer Nähe des Kurfürstendamms lebte, konnte er als Kind mit eigenen Augen dessen allmähliche Bebauung beobachten, ebenso den Bau der Gedächtniskirche. Oder er beschreibt das Leben in der damals berühmten Kaiser- oder Lindenpassage, deren kaufmännischer Direktor sein Vater wurde und in der die Familie mehrere Jahre eine Dienstwohnung bewohnte. Politische Ereignisse haben Goldstein in seiner frühen Jugend nicht interessiert. Nach der Schule begann Wronkow eine kaufmännische Lehre. Die Zeiten waren unruhig, die Arbeitslosigkeit groß, so dass er nach dem Ende der Lehrzeit über sich schreibt: „Da stehe ich jung, arm und arbeitslos".22 Er schlug sich als Versicherungsvertreter, Zigarettenverkäufer Zeitschriftenagent und mit anderen Gelegenheitsarbeiten durch. Mit Hilfe seines fünf Jahre älteren Bruders Ludwig, der Pressezeichner beim Mosse-Verlag war und vor allem für die Berliner Volks-Zeitung zeichnete, bekam auch 20
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 19.
Ausdruck dieses inneren Konfliktes, der ihn nicht nur als Kind beschäftigte, wurde sein Aufsatz „Deutsch-jüdischer Parnaß", der 1912 in der nationalkonservativen Zeitschrift „Der Kunstwart" erschien, und in dem er Zweifel an der endgültigen Integration und Assimilation der jüdischen Bevölkerung in Deutschland äußerte (Lit.verz. Nr. 12). Mit diesem Aufsatz erregte Goldstein „ungeheures" Aufsehen. 21
22
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 85.
323
George Wronkow Kontakt zu den verschiedenen Zeitungen des Verlags. Schließlich nahm ihn - wie er sich erinnert - der Chefredakteur der Berliner Volks-Zeitung, Otto Nuschke, „unter seine Fittiche".23 Er wurde als Journalist angestellt, bekam einen Polizei-Presseausweis und schreibt ironisch über sich: „Ich darf Polizeiketten durchschreiten und mir dabei wichtig vorkommen."24 Die Berliner Volks-Zeitung war, wie er sagt, das „Hinterhaus" des Mosse-Verlags, während das Berliner Tageblatt das Vorderhaus darstellte.25 Später schrieb Wronkow auch für das Berliner Tageblatt und versuchte sich als Pressefotograf. Goldstein hat nach Germanistikstudium und Promotion zunächst sieben Jahre lang als Herausgeber der „Die Goldenen Klassiker-Bibliothek" im Deutschen Verlagshaus Bong gearbeitet. Sein eigentlicher Wunsch war es allerdings immer, als Dramatiker literarischen Erfolg zu haben. Obwohl Goldstein nach Abschluss seines Studiums ausdrücklich den Entschluss gefasst hatte, nicht zur Presse zu gehen, wurde er im Alter von 38 Jahren doch Journalist. Georg Bernhard holte ihn - nachdem er von 1915 bis 1918 als Soldat in Frankreich gewesen war - noch vor Ende des Krieges als Redakteur an die Vossische Zeitung. Der Beruf des Journalisten war für Goldstein nur ein Brotberuf, doch bezeichnete er später in seiner Autobiographie die fünf Jahre von 1928 bis 1933, in denen er als bekannter Gerichtsreporter der Vossischen Zeitung im Ullstein-Verlag arbeitete, als die „fünf besten Jahre" seines Lebens.26 Im Frühjahr 1933 - sofort nach Beginn der Hitler-Diktatur in Deutschland — wurden Wronkow und Goldstein von ihren Verlagen entlassen. Sie verließen Deutschland und gingen ins Exil.
23
Ebd., S. 95.
24
Ebd., S. 110.
25
Ebd., S. 97f.
26
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 100.
324
Beide können als Vertreter jeweils einer der beiden Gruppen von Emigranten gelten, in die später oft die Gesamtheit des Exils eingeteilt wurde: die Menschen, die aus politischen Gründen emigrierten, und die Juden, die aus rassischen Gründen flohen. Wronkow ist jedoch ein Beispiel dafür, dass diese Einteilung zu einfach ist. In seinen Erinnerungen betont Wronkow, dass er als „politisch Gefährdeter" 27 aus Deutschland fort ging; seine jüdische Herkunft erwähnt er nicht als ausschlaggebend für diesen Entschluss. Beim Lesen der Erinnerungen stellt sich das Gefühl ein, als ob Wronkow im Nachhinein seine Flucht aus Deutschland im März 1933 als Abenteuer erlebt hat. Dänemark war sein erstes Ziel. Da er nicht wagte, Deutschland offiziell zu verlassen, kam er auf einen tollkühnen Gedanken. Er besorgte sich mit Hilfe seiner Freundin unter falschem Namen ein Wochenendticket für ein „Kraft-durch-Freude"-Schiff und begab sich mit wenig Gepäck auf die Fahrt nach Kopenhagen. An Bord befanden sich fast ausschließlich Nationalsozialisten. Im Gegensatz zu seinen Mitreisenden ließ er die Rückfahrt verfallen. Sarkastisch bemerkt er über einen Fahrgast, der noch in allerletzter Minute das Schiff erreichte: „Er hätte beinahe den Anschluss ans Dritte Reich versäumt." 28 Sich selbst bezeichnete er von diesem Zeitpunkt an als „politischen Flüchtling". 29 In Dänemark erhielt er nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung von drei Monaten; außerdem war unter der Genehmigung mit „großen Lettern" vermerkt, „keine Arbeitserlaubnis". Daher reiste Wronkow im Herbst nach Frankreich weiter. Der Sommer in Dänemark aber hatte aus ihm, dem „gehetzten Staatsfeind, einen braungebrannten, rundlichen und
27
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 134.
28
Ebd., S. 148.
29
Ebd., S. 14.
325
ziemlich glücklichen Erdbewohner gemacht".30 Während seines siebenjährigen Exils im demokratischen Frankreich konnte er wieder - zuerst illegal, später auch legal - als Journalist arbeiten. Hier hatte er die Möglichkeit mit publizistischen Mitteln auf die politischen Ereignisse zu reagieren und sich in das Zeitgeschehen einzumischen. Als Goldstein im April 1933 vom Ullstein-Verlag entlassen wurde, fasste er nicht sofort den Entschluss, aus Deutschland fort zu gehen. Er hoffte zunächst - wie viele andere - darauf, dass die Herrschaft der Nationalsozialisten nur von kurzer Dauer sein würde, und dass er in der Zwischenzeit eine Nische zum Uberleben finden würde. Obwohl Goldstein in der Vossischen Zeitung immer wieder eindeutig den Nationalsozialismus und dessen Führer und Anhänger kritisiert hatte, bezeichnet er sich in seinen Erinnerungen doch nicht als politisch Verfolgten; er erlebte, dass er aus rassischen Gründen bedroht war. Seine Frau - ebenfalls jüdischer Abstammung - war es, die darauf drängte, Deutschland zu verlassen und in Italien ein neues Leben zu beginnen, wohin schon Beziehungen bestanden. Zusammen mit einem Bekannten wurde geplant, ein Internat für jüdische Kinder in Florenz zu gründen. Die Wahl des faschistischen Italiens als Zufluchtsland deutet daraufhin, dass Goldstein nicht an eine politisch-journalistische Tätigkeit im Exil dachte, denn eine Mitarbeit an demokratischen Exil-Blättern war von Italien aus nicht möglich. Es waren pragmatische Gründe, die für Italien sprachen. Für jüdische Emigranten bestand ein ganz wesentlicher Grund in dem dort bis 1938 kaum vorhandenen Antisemitismus und in der liberalen und wenig bürokratischen Fremdengesetzgebung. Man brauchte ζ. B. für die Einreise kein Visum, und es gab, was besonders wichtig war, in begrenztem Umfang legale Arbeitsmöglichkeiten. Dazu kamen Umzugsgenehmigungen von deutscher Seite, Vorteile beim Devisentransfer und nicht zuletzt viel niedrigere Lebensko30
Ebd., S. 163.
326
sten als in den anderen Nachbarländern Deutschlands. Goldstein sprach nicht wie Wronkow von einer „Flucht" sondern von einer „Auswanderung", als er im Oktober 1933 - nach Auflösung seiner Wohnung in Berlin und nachdem der Umzug nach Italien geregelt war - Deutschland endgültig verließ.31 Doch 1939, als Italien alle Juden auswies, die nach 1919 eingewandert waren, wurden auch er und seine Frau zu „Flüchtlingen". Goldstein bedauerte seine Naivität gegenüber der italienischen Regierung und schrieb in der „Jüdischen Welt-Rundschau": „Daß es ein Land faschistischen Regimes war, schlug ich in den Wind. Es war falsch von mir wie von allen, die so handelten; heute wissen wir es, und es hat sich an uns gerächt. Wir hätten nicht daran vorbeisehen dürfen, denn wir waren keine Faschisten."32 So lassen sich in Wronkow und Goldstein nicht nur in ihrer Selbstwahrnehmung als politisch oder rassisch Verfolgte zwei gegensätzliche Typen von Emigranten erkennen, sondern auch in der Art und Weise wie sie ihre Emigration in die Wege leiteten. Wronkow bezeichnet sich als „Flüchtling" und spricht von seiner „Flucht aus dem Dritten Reich"; 33 Goldstein dagegen bezeichnet sich nach seinem legalen Umzug nach Italien als „Auswanderer".34 Ebenso verschieden wie in ihrer Selbsteinschätzung und in der Wahl ihrer Exilländer verhielten sich beide Emigranten auch bei der aktiven Gestaltung ihres Lebens im Exil. Wronkow beschreibt sich als offen für einen flexiblen Umgang mit den neuen, unvorhersehbaren Lebenssituationen. Goldstein dagegen vermittelt den Eindruck, dass er sich von seinem früheren Selbst- und Weltbild nur sehr schwer zu lösen vermochte.
31
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 1 3 4 .
32
Spiel mit Juden, in: Jüdische Welt-Rundschau vom 30. 6. 1939.
33
George W r o n k o w , Kleiner M a n n in großen Zeiten, S. 141.
34
Vgl. auch Sylke Bartmann, Biografíen von Emigranten, S. 38/39.
327
George Wronkow wird bei seiner Ankunft in Paris von seinem Bruder und von Freunden empfangen. Eine Aufenthaltsgenehmigung erhält er ohne Schwierigkeiten, da er vom dänischen Konsulat ein Dauervisum über zwei Jahre erhalten hat. Französische Freunde geben ihm Arbeit, so dass er das Arbeitsverbot umgehen kann. Vier Wochen nach seiner Ankunft ist er „vollbeschäftigt". Vormittags arbeitet er in einer Photoagentur, nachmittags am Bildumbruch für einen Bildband und abends schreibt er unter dem Namen eines französischen Freundes Artikel für eine rechtsbürgerliche Straßburger Zeitung. 35 Zwischendurch arbeitet er auch für das Pariser Tageblatt. Hier fühlt er sich wohl und bezeichnet die Redaktion als „eine herrliche Schwatzbude, Treffpunkt vieler Literaten", deren „geistige Früchte später die Zeitungsspalten" füllten. 36 Als Georges Mandel 37 1936 versuchte, von Paris aus mit einem Nachrichtensender in deutscher Sprache der Nazipropaganda im Elsass entgegenzutreten, und für diese Arbeit deutsche Ubersetzer brauchte, wurde George Wronkow einer von ihnen. In dieser Funktion erhielt er nun auch eine offizielle Arbeitserlaubnis. Durch seine Arbeiten für die Straßburger Zeitung und den Nachrichtensender „Radiodiffusion Nationale" war Wronkow gut über die politischen Vorgänge informiert. Doch trotz der immer bedrohlicher werdenden Verhältnisse in Europa und der besorgniserregenden Nachrichten, ζ. B. über den Einmarsch deutscher Truppen in Osterreich und bald darauf in die Tschechoslowakei, trotz der Berichte über die „Reichskristallnacht" in Deutschland und trotz der vielen neuen Flüchtlinge in Frankreich, gab es doch immer wieder Gelegenheiten, mit Freunden das Leben in Paris mit Spaziergängen, Picknicks und Cafehaus-Gesprächen zu
35
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 173.
36
Ebd., S. 190.
37
Georges Mandel, eigtl. Louis Rothschild, 5.6.1885 - 15.7.1944, frz. Politiker, widersetzt sich 1940 als Innenminister der Kapitulation vor der NSPolitik und wird 1944 ermordet.
328
genießen. Auch als sich Frankreich im Krieg befand, hatte Wronkow immer noch viel Glück. Wegen seiner Arbeit beim Nachrichtensender Radiodiffusion Nationale bekam er einen Stempel als „wichtiger technischer Arbeiter" in seinen Pass und wurde den Militärbehörden unterstellt. Während deutsche Emigranten von nun an verfolgt und interniert wurden, blieb er durch seine Arbeit geschützt, ja es kam zu der grotesken Situation, dass er und seine Kollegen nach dem Nachtdienst zu ihrem Schutz vor Verhaftungen mit den Dienstwagen der Generäle nach Hause gefahren wurden. Amüsiert schreibt Wronkow, dass die vor ihnen salutierenden Chauffeure nicht ahnten, dass die „wichtige Persönlichkeit", die sie nach Hause zu fahren hatten, staatenlos war, und „sich in Wahrheit nicht über die Straße wagte".38 Wronkow hatte das Glück, im Exil - ganz ähnlich wie vor 1933 in Deutschland - weiter als freier Journalist arbeiten zu können, so dass sein Leben eine berufliche Kontinuität behielt. Im Mai 1940 wurde auch Wronkow als feindlicher Ausländer interniert und kurze Zeit später zusammen mit 250 anderen Leidensgenossen als Armierungssoldat im Süden Frankreichs eingesetzt, um Artillerie-Stellungen auszubauen. Bei der Beschreibung dieser Ereignisse zeigt sich wieder Wronkows Stärke, neben dem Gefährlichen und Bedrohlichen gleichzeitig auch das Alltägliche und Banale wahrzunehmen. So erzählt er, wie er und sein Freund den Befehl erhalten, den Marktplatz des Ortes zu fegen. Zu ihrem großen Erschrecken hören sie aus einem Radio vom Einmarsch der Deutschen in Paris. „Wir setzen uns stumm auf den Brunnenrand und heulen. [...] Da erscheint, vor eine Karre gespannt, unser Pferd und lässt seine Pferdeäpfel auf die Mitte des Platzes rollen. Ich erhebe mich und kehre den Mist befehlsmäßig fort."39 Einige Zeit später hat er ein fast symbolisches Erlebnis. Da sich eine deutsche Kommission angesagt hatte, um das Lager, in 38
George Wronkow, Kleiner Mann in großen Zeiten, S. 252.
39
Ebd., S. 264.
329
dem er interniert war, zu kontrollieren, wurden Wronkow und vier andere „gefährliche" Deutsche vom Kommandanten für diesen Tag aus der Liste der Lagerinsassen gestrichen und zu ihrem eigenen Schutz für tot erklärt. Wronkow wanderte den ganzen Tag „als Toter" durch die Weinberge. Bei einer Rast entdeckte er, dass er sich auf einem römischen Grabstein ausgeruht hatte. Als er sich genauer umsah, erkannte er, dass das ganze Feld mit römischen Grabsteinen begrenzt war. Durch diesen Fund fühlte er sich ein wenig getröstet, denn: „So ein bisschen römische Historie bringt weitere Perspektiven. [...] Alles wird etwas unwichtiger".40 Schließlich, als er es schon gar nicht mehr zu hoffen wagte, erhielten er und seine Frau ein Visum für Amerika, um das sich sein dort lebender Bruder bemüht hatte. Uber Spanien reisten sie 1941 nach Lissabon und von dort mit einem ehemaligen TouristenschifF nach New York. So schließt sich für Wronkow der Kreis: Auf einem Touristenschiff verließ er Deutschland, seine ehemalige Heimat, und mit einem ehemaligen Touristenschiff erreicht er Amerika, seine neue Heimat. Goldsteins Stimmung beim Verlassen Deutschlands war zunächst zuversichtlich. Er schreibt über seinen Entschluss, in Italien ein neues Leben zu beginnen, dass er „weder Furcht noch Niedergeschlagenheit" empfand, sondern dass er in diesem neuen Leben eher ein „Abenteuer" sah.41 Doch hielten sein anfänglicher Mut und seine Neugier nicht lange an. Obwohl die mit seinem Kompagnon gegründete Schule in Florenz ein Erfolg wurde und sich mit ca. hundert Kindern und dreißig Lehrern zur größten von sechs ähnlichen Schulen in Italien entwickelte, kam es bald zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Schulleitern. Goldstein schied aus diesem Grund nach drei Jahren aus der Schule aus und eröffnete mit seiner Frau eine Pension. Als 1938 auch in Ita40
Ebd., S. 274.
41
Moritz Goldstein, Berliner Jahre, S. 134.
330
lien Rassegesetze eingeführt und die zugewanderten Juden 1939 aus Italien ausgewiesen wurden, war Goldstein verzweifelt, die mühsam in Italien aufgebaute Existenz war vernichtet. N u n mussten Goldstein und seine Frau, die sich anfangs als „Auswanderer" betrachtet hatten, fast mittellos als „Flüchtlinge" Italien verlassen. Sie gelangten über Frankreich nach Großbritannien, wo sie zuerst von der „Hospitality" leben mussten, d. h. sie waren auf fremde Hilfe angewiesen. Später verdienten sie wieder ihren Lebensunterhalt als Pensionswirte. Ähnlich verlief ihr Leben auch nach Kriegsende in den USA, nachdem ihnen ihr Sohn 1947 ein Visum vermittelt hatte. Für Goldstein wurde das Leben im Exil - wie er schrieb - „ein unermüdlicher K a m p f mit der kleinen Misere", so dass die Sorge um das alltägliche Leben die Verarbeitung der Situation durch Reflexion verhinderte. Er beklagte, dass „die Beschäftigung mit dem Wesentlichen nur nebenher und allenfalls zufällig geleistet wurde." 42 Hinzu kam die Fremdheit und die Unsicherheit in den verschiedenen Emigrationsländern. Für ihn, der schon weit mehr als ein halbes Leben hinter sich hatte, war es schwierig, den Schmerz um das Verlorene zu bewältigen und sich den neuen Anforderungen des Lebens zu stellen. Als Goldstein seine Erinnerungen aufschrieb, waren die „Umstände", unter denen er lebte „bis zur Unkenntlichkeit verschieden" von seinem früheren Leben. Für ihn war das Exil vor allem mit den Erfahrungen „Hilflosigkeit", „Vereinsamung" und „Unstetheit" verbunden. Er schreibt dazu: „Das andere Land, in dem man lebt, und obwohl man darin lebt und es täglich und stündlich um sich hat, bleibt verschlossen und fern. D u erreichst es nicht, allen Anstrengungen zum Trotz." 43 Er fühlte sich „aus allen Bindungen gerissen". Hinzu kam, dass Goldstein wie die meisten Emigranten im Exil weit unterhalb seiner Kenntnisse und Fähigkeiten lebte. „Und daher", so schreibt 42
Ebd., S. 12.
43
Ebd., S. 11. 331
er, „bedeutet Emigration vor allem den Verlust des angeborenen, mit dir gewachsenen, von dir erworbenen, des gewohnten und dir gebührenden Ansehens." 4 4 Unter diesem Zustand, den er als gesellschaftliche Deklassierung empfand und durch den seine eigene Identität und sein Selbstwertgefühl in Frage gestellt wurden, litt er a m meisten. Er, der seine Identität immer im Schreiben gefunden hatte, fand in Italien nie die Möglichkeit, sich journalistisch zu äußern; und auch nachdem er Italien verlassen hatte und Artikel von ihm in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften erschienen, gelang es ihm nie wieder, seinen Lebensunterhalt mit Schreiben zu verdienen. Deshalb empfand er seine Existenz nach dem Verlassen Deutschlands als einen Bruch und nicht als kontinuierliche Fortsetzung seines bisherigen Lebens. Er hatte im Exil die Gewissheit verloren, sein Leben selbst gestalten zu können, statt dessen fühlte er sich „den unbekannten Mächten ausgeliefert", „hin und her geweht", „in rasender Fahrt dicht a m Abgrund entlang". 45 Resigniert beendet er das Vorwort „Rechtfertigung" zu seiner Autobiographie: „ . . . der Weg alles Menschlichen führt in die Dunkelheit und in das Schweigen, und es ist auf tröstende und versöhnende Weise wunderbar gut so." 46 M i t den beiden Autobiographien von George Wronkow und Moritz Goldstein liegen uns zwei wichtige Dokumente zur Zeitgeschichte vor, die in der Gegensätzlichkeit ihrer Selbst- und Weltwahrnehmung die Zeit des Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der Emigration pointiert beleuchten. Geschichtsbücher können zwar eine vergangene Zeit darstellen und erklären, aber erst durch subjektive Lebensberichte lassen sich Wirkungen und Einflüsse vergangener Zeiten auf die einzelnen Menschen und das Erfassen der Wirklichkeit aus der Sicht dieser Personen überhaupt 44
Ebd., S. 11.
45
Ebd., S. 11/12.
46
Ebd., S. 14.
332
nachvollziehen. Denn die Wirklichkeit lässt sich nicht objektiv beschreiben, sondern wird jeweils interpretiert, und sie konstituiert sich erst in den Deutungen der Erlebenden. Diese Deutungen finden ihren Ausdruck in autobiographischen Texten.
Irmtraud Ubbens, Buchhändlerin, MA Germanistik und Kulturwissenschaften Universität Bremen, arbeitet derzeit an einer Promotion zum Dr. phil. an der Universität Bremen über Moritz Goldstein als Journalist und Gerichtsberichterstatter an der Vossischen Zeitung
1918-1933.
333
Literaturverzeichnis
ι. Alle Berliner Straßen und Plätze. Von der Gründung bis zur Gegenwart, hg. von Hans-Jürgen Mende, 4 Bände, Berlin 1998. 2.
Autorenkollektiv, Exilpublizistik in Frankreich, in: Presse im Exil. Beiträge zur Kommunikationsgeschichte des deutschen Exils 1933-1945, München u. a. 1979 (Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung, Bd. 30), S. 123-180. 3. Sylke Bartmann, Biografíen von Emigranten im Nationalsozialismus. Eine erzählstrukturelle Analyse, in: traverse, Zeitschrift für Geschichte, revue d'histoire, 13. Jahrgang, 2006, H. 2, S. 2 9 - 4 1 . 4. Werner Bergmann / Juliane Wetzel, „Der Miterlebende weiß nichts". Alltagsantisemitismus als zeitgenössische Erfahrung und spätere Erinnerung (1919-1933), in: Jüdisches Leben in der Weimarer Republik - Jews in the Weimar Republik, hg. v. Wolfgang Benz, Tübingen 1998, S. 173-196. 5. Berliner Tageblatt, Einzelblatt v. 10. März 1933
6. Berliner Tageblatt, Nr. 118 v. 12. März 1933 7. Matthias Claudius, Sämtliche Werke. Gedichte, Prosa, Briefe in Auswahl, hg. von Hansludwig Geiger, Berlin u. a. 1958, S. 2 3 9 - 2 4 0 . 8.
Marcel Déat, Mourir pour Dantzig? Point de vue et fancons de voir, in : L'Oeuvre, 2. ed. de Paris, No 8.614 vom 4. M a i 1939, S. 1+4. 9. Die deutsche Rechtschreibung. Duden, Band 1, 24. völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim u. a. 2006.
335
10. Moritz Goldstein an Will Schaber, Brief vom 21. April 1966, in: GoldsteinNachlass im Institut für Zeitungsforschung, II A K 85/103-1,3-, Nr.107. 11. Moritz Goldstein, Berliner Jahre - Erinnerungen 1880-1933, München 1977 (Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung, Bd. 25). 12. Moritz Goldstein, Deutsch-jüdischer Parnaß, in: Der Kunstwart, 25. Jg.(1912), 1. Märzheft, Heft 11, S. 281-294. 13. Moritz Goldstein, Spiel mit Juden, in: Jüdische Welt-Rundschau vom 30.6.1939, S. 5. 14. Inquit (d. i. Moritz Goldstein), Aufbruch, in: Pariser Tageszeitung Nr. 996 v. 14./15. Mai 1939, Sonntagsbeilage, S. 3. 15. Heinz Jäger (d. i. Walter Kreiser), Windiges aus der deutschen Luftfahrt, in: Die Weltbühne, 25. Jg. (1929), Nr. 11 v. 12. März 1929, S. 4 0 2 - 4 0 7 . 16. Hanns Johst, Schlageter. Schauspiel, München 1933, S. 26. 17. Lebendiges virtuelles Museum Online (LeMO, U R L : http://www.dhm.de/ lemo), eine Internetpräsentation des Deutschen Historischen Museums ( D H M ) in Berlin, des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (HdG) in Bonn und des Fraunhofer Instituts für Software- und Systemtechnik (ISST) in Berlin und Dortmund. Zur Hindenburglinie: http://www.dhm.de/lemo/html/wkl/kriegsverlauf/siegfried/ 18. Lieselotte Maas, Von der Dürftigkeit publizistischer Tagesgeschäfte, in: InnenLeben. Ansichten aus dem Exil. Ein Berliner Symposium, hrsg. von Hermann Haarmann, Berlin 1995, S. 91-106.
336
19. Walter Mehring, Der Emigrantenchoral, in: Ders., Staatenlos im Nirgendwo. Die Gedichte, Lieder und Chansons 1 9 3 3 - 1 9 7 4 , Düsseldorf 1981, S. 17-19. 20. NS-Presseanweisungen der Vorkriegszeit. Edition und Dokumentation, hrsg. von Hans Bohrmann und Gabriele Toepser-Ziegert, München u. a. 1 9 8 4 2001.
21. Walter O ' H e a r n , The Story o f the Learned Immigrant, in: The Montreal Star v. 13.07.1963 (Kopie im Nachlass George Wronkow, II Ak 2004/35-24).
22. Reden des Kaisers. Ansprachen, Predigten und Trinksprüche Wilhelms II., hg. von Ernst Johann, 2. Aufl., München 1977, S. 58. 23. Friedrich Schiller, Damon und Pythias, in: Schillers Werke. Nationalausgabe. Zweiter Band, Teil 1. Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens 1 7 9 9 - 1 8 0 5 in der geplanten Ausgabe letzter Hand, hrsg. von Norbert Oellers, Weimar 1983, S. 2 5 0 - 2 5 4 . 24. Friedrich Schiller, Die Theilung der Erde, in: Schillers Werke. Nationalausgabe. Zweiter Band, Teil 1. Gedichte in der Reihenfolge ihres Erscheinens 1 7 9 9 - 1 8 0 5 in der geplanten Ausgabe letzter Hand, hrsg. von Norbert Oellers, Weimar 1983, S. 4 0 6 - 4 0 7 . 25. Christian Siegel, Die Reportage, Stuttgart 1978 (Sammlung Metzler Bd. 164). 26. Irmtraud Ubbens, „Aus meiner Sprache verbannt . . . " Moritz Goldstein, ein deutsch-jüdischer Journalist und Schriftsteller im Exil, München 2 0 0 2 (Dortmunder Beiträge zur Zeitungsforschung, Bd. 59), S. 97-108. 27. Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 7., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage, Gütersloh 2 0 0 0 .
337
Bild- und Textnachweise
S. 12:
George Wronkow 1953 Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Wronkow (II AK 2004/35 -3.9(2))
S. 32:
Postkarte: Jeder Schuß ein Russ ... (1914) Original: Museum Europäischer Kulturen, Staatliche Museen zu Berlin; © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2007
S. 62:
Plakat von Max Pechstein (1919) © Pechstein Hamburg/Tökendorf und Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2007 / Kunstbibliothek, Staatliche Museen Berlin / Dietmar Katz (Fotograf)
S. 86:
Theodor Wolff Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Dolbin
S. 96:
Otto Nuschke Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inventarnr. Gr 64/407 © Michael Stumpp (Emil-Stumpp-Archiv, Gelnhausen)
S. 106:
Wahlplakat DDP 1928 Herausgeber: Deutsche Demokratische Partei, Werner Stephan; Grafiker: wigor Bundesarchiv, Plak 002-027-028
S. 124:
Erich Mühsam Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Dolbin
S. 154-155: Emigrantenchoral Walter Mehring: Staatenlos im Nirgendwo. Die Gedichte, Lieder und Chansons 1933-1974, Düsseldorf 1981, S. 17-19 (Erstveröffentlichung in: Und Euch zum Trotz, Paris 1934). © 1981 Ciaassen Verlag in der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
338
S. 171:
Certificat d'identité et de voyage pour les réfugiés provenant d'Allemagne, ausgestellt am 15.02.1939 Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Wronkow II AK 2004/35 - 3.1, S. 3
S. 187:
Georg Bernhard Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Dolblin
S. 188:
Alfred Kerr Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Dolbin
S. 196:
Pariser Emigrantenstammtisch Zeichnung von Eduard Thöny in: Simplicissimus, 38. Jg. (1933/34), Nr. 30 v. 22. Oktober 1933, S. 351 © Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin, 2007 (Die Rechtsnachfolge von Eduard Thöny konnte nicht ermittelt werden.)
S. 246:
Brief George Wronkow an seinen Bruder Ludwig im August 1939 Institut für Zeitungsforschung, Nachlass George Wronkow (II Ak 2004/35-1, S. 1)
S. 249:
Kriegslied Matthias Claudius, Sämtliche Werke. Gedichte, Prosa, Briefe in Auswahl, hg. von Hansludwig Geiger, Berlin u. a. 1958, S. 2 3 9 240.
S. 306:
George Wronkow vor CBS-Mikrophon Institut für Zeitungsforschung, Nachlass Will Schaber (II Ak 2003/75-105/Nr. 196)
S. 350:
George Wronkow 1985 beim Kölner Stadt-Anzeiger © F. W. Holubovsky, Köln; Erstveröffentlichung: Kölner StadtAnzeiger, Nr. 112 vom 15. Mai 1985, S. 4
339
Text des Wahlplakats der Deutschen Demokratischen Partei (S. 106)
Parteifahne oder Reichsflagge? Deutschvölkisches Blöckchen Hakenkreuz auf schwarz weiß rot Schlagt die Volksgenossen tot! Deutschnationale Volkspartei Schwarz weiß rot mit kleinen Krönchen Jedem Fürstensproß sein Thrönchen! Deutsche Volkspartei Fürs Geschäft göscht man ins Eckchen Selbst ein schwarz rot goldnes Fleckchen! Das Zentrum Republik und Monarchie Man pfeift jede Melodie! Sozialdemokratische Partei Schwarz rot gold, das geht zur Not Doch das Fahnentuch bleibt rot! Wirtschaftspartei Unser Banner schwankt im Wind Wenn wir wüßten, wer wir sind! Kommunisten Ueber uns der Sowjetstern, Moskau ruft, wir folgen gern! Demokraten Was soll Lärmen, Toben, Hetze? Ueberbrückt die Gegensätze! Führet Schwarz-Rot-Gold zum Sieg. Wählt nur die Partei der Tat! Einheit, Freiheit, Republik - Hierfür kämpft der Demokrat!
340
Text des Briefes von George Wronkow an seinen Bruder Ludwig (S. 246)
[Brief an Ludwig, August 1939]
Mein Lieber, Wir wollen so tun, als ob wir Frieden hätten. Wenn D u diesen Schreibebrief erhältst, wird sich aller Wahrscheinlichkeit schon alles entschieden haben. Kein Mensch kennt sich nun mehr aus. Das einzige, was ich sagen kann, ist, dass die Nerven noch halten, dass es für uns keine Ueberraschung mehr geben kann und ich ebensogut in acht Tagen im Mittelmeer werde baden können oder in der Scheisse sitzen, nicht tiefer und nicht weniger tief als alle Franzosen. Wenn ich auf dem Nordpol sitzen würde, wäre es ganz interessant, die Entwicklung mit anzusehen, so mit Moskau und Antikomintern, aber hier machts nicht so dollen Spass. Anliegend mache ich Dir ein Geschenk: 43 Cent in ungestempelten Briefmarken Deines Landes, alle leicht angebufft, aber zum Frankieren noch gut genug. Das sind immerhin acht Auslandsbriefe. Dass D u die Geschichte mit der Wandlung geschrieben hast, war mir von Anfang an klar. Aber heute ziehen kleine Witzchen nicht mehr, ich darf wenigstens im Rundfunk sagen, dass Herr Hitler ein Verbrecher ist. Das erleichtert das Herz. In diesen Tagen haben wir Millionen Hörer, ich spreche wie ein Held (und bins doch kaum). Wir sind „La Voix de la France" und erklären, dass es nicht um Danzig geht, sondern um die Freiheit und dass wir für diese Freiheit zu sterben wissen. Das ist alles so leicht gesagt ... Wie gesagt, Jugendwinkel hiess nicht „gefährlich leben". Einen Aufbau-Ausweis auf englisch, möglichst gut aufgemacht. Wenn Friede bleibt ohne „München", werde ich Ende des Jahres dem französischen Verband der Rundfunkjournalisten beitreten, das ist wenigstens was handfestes. König Zogu von Albanien ist ein klügerer Emigrant als wir, der hat wenigstens die Kasse mitgenommen und lebt hier vergnügt auf Schlössern. Auch der Duke of Windsor ist ein fröhlicher Emigrant.
341
Am 31. August beginnt mein Urlaub — ich halte es für bittere Ironie. Ich habe ein Zimmer hoch auf den Bergen direkt über dem Meer in der Nähe von Cannes gemietet. Ich fürchte, es wird leer bleiben. Ich bin auf Hitler persönlich böse und sags ihm jeden Tag. Nächster Tag: Teilmobilisierung, Urlaubssperre, sehr kritische Stimmung. Du hörst von mir in Krieg oder Frieden. Machs gut. Erinnere Michaelis daran, dass er eventuell für Traute sorgen soll. Zwei Stunden später: Noch haben wir Frieden, wir werden ihn auch noch einige Tage haben - vielleicht sogar geschieht ein Wunder. Schreibe englisch, wenn Du schreibst, oder lass Dir von Mike französisch schreiben. Au revoir
Handschriftlicher Text oben auf dem Blatt, vermutlich von George Wronkows Ehefrau Ciaire Gertrude, geb. Wincenty: Ich will Ihnen immer einen langen Brief schreiben und komme nicht dazu, weil ich jetzt einige kleine Sous für die Reise verdienen mußte. Und nun liegt diese schöne Reise evtl. auf dem Mond? Sie sind ein alter Stöhner, von Geburt an? Was macht Lise? Und vor allem Marguérile? Es grüßt Sie Ihre liebe belle-soeur.
342
Namensregister
A Alexander I. Karadordevic, König von Jugoslawien 194 Aufricht, Ernst Joseph 302-303 Augusta Cacilia von Sachsen-Coburg Gotha (fiktiv?) 181 Auguste Viktoria, Kaiserin des Deutschen Reiches 30 Β Baker, Josephine 102 Baldwin, Stanley 205, 207 Barthou, Louis 194, 199 Bäsch, Victor 203 Beck, Józef 195 Beckenbauer, Franz 319 Bell, Johannes 64 Benes, Eduard 232, 235 Bernhard, Georg 8, 185-187, 299, 324 Blum, Léon 203, 215, 216, 217, 220, 224, 228, 230, 231, 275 Böß (Frau von Gustav Böß) 115 Böß, Gustav 115 Bonnet, Georges 231, 235, 238 Bracht, Franz 123 Braun, Eva 180 Braun, Otto 122 Brecht, Bertolt 302 Breitscheid, Rudolf 269 Bretholz, Wolfgang 190 Briand, Aristide 104, 205, 206 Brossolette, Pierre 239 Brost, Erich 310, 312
Brüning, Heinrich 116, 121 C Cäsar, Julius 46, 65 Caro, Kurt 186, 191, 205, 207, 209 Cato 65 Cervantes y Saavedra, Miguel de 138 Chamberlain, Arthur Neville 233, 235, 236 Chautemps, Camille 175, 230 Christensen (Pensionswirtin in Kopenhagen) 146, 148, 149, 163, 164 Christian X., König von Dänemark 150 Churchill, Winston 189, 206 Cicero 65 Claudius, Matthias 247, 249, 250, 320 Clemenceau, Georges 206 Consky (Journalist) 184 Copeau, Pascal 232, 242, 247, 254, 255, 258 Cuno, Wilhelm Carl Josef 74
D Daladier, Édouard 175, 177, 203, 231, 234, 235, 254 Déat, Marcel 243 Dolbin, Benedikt Fred 86, 124, 187, 188 Dombrowska (Restaurantbesitzerin) 126, 127, 128
343
Dombrowski (Restaurantbesitzer)
George V., König von Großbritannien und Nordirland 22, 321 George VI., König von Großbritannien und Nordirland 232 Goebbels, Joseph 101, 102, 104, 105,
127, 128, 161 Doumergue, Gaston 177 Drach, Frédéric 173, 177, 179 E Ebert, Friedrich 55-58, 66, 98, 99 Eden, Anthony 205 Ehrhardt, Hermann 66, 68 Elisabeth Amalie Eugenie, Kaiserin
107, 115, 191, 201, 215, 232 Göring, Hermann 122, 183, 237, 302 Goethe, Johann Wolfgang v. 19, 20 Goldstein (Vater von Moritz) 323 Goldstein, Antonie Charlotte 317, 327, 331 Goldstein, Moritz 10, 313-333 Goldstein, Thomas 331 Grynszpan, Herschel 237
von Österreich 26 Elizabeth Bowes-Lyon, Königin von Großbritannien und Nordirland 232 Epstein (Metteur) 189, 191 Ernst, Karl 182, 183, 184 Ernst August, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg 21 Erzberger, Matthias 64, 65 F Fallada, Hans 7 Fischer (Hofmaler) 22 Flandin, Pierre-Etienne 207 Franco, Francisco 219, 230 Franz Ferdinand von Österreich-Este 26 Franz Joseph I., Kaiser von Österreich 26 Franzke (Angestellter bei Orenstein & Koppel) 7 7 - 8 0 Fratellinis (Clowns) 226 Friedrich II., König von Preußen 19, 20, 27, 56, 64, 72, 98, 114, 133, 141, 155, 337 Friedrich III., Kaiser des Deutschen Reiches 19 Fritsch, Werner v. 230 G Gamelin, Maurice 250, 256 Gaulle, Charles de 250, 279 Gebühr, Otto 114
H Habsburg, Otto von 254 Havenstein, Rudolf 69, 81, 320 Hecht, Auguste (Gusti) 115,136,137 Heine, Heinrich 193 Heines, Edmund 182, 184 HelfFerich, Karl 38 Helldorf, Wolf-Heinrich Graf von 183 Hendke (Inhaber der Fa. Schmulz und Hendke) 78, 80 Hering, Pierre 260 Heß, Rudolf 298 Hilferding, Rudolf 269 Himmler, Heinrich 184 Hindenburg, Oskar von Beneckendorff und von 131 Hindenburg, Paul von BeneckendorfFund von 34, 36, 48, 64, 99, 116, 117, 119, 120, 121, 128, 131, 132,177 Hitler, Adolf 83, 101, 120, 128, 129, 131, 137, 180, 181, 182, 184, 195, 199, 200, 204, 205, 214, 230, 233, 234, 235, 240, 241, 242, 244, 247, 251, 254, 267, 275, 289, 301, 303, 305, 313, 324
344
Luxemburg, Rosa 61
Hoffmann, Johannes 202 Hilgenberg, Alfred 94, 113, 115, 128, 131, 132
M
I Illmer (Mitarbeiter BT) 136
J Jacob, Berthold 100 Jacob, Hans 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 225, 226, 234, 242, 264, 283, 304 Jacoby, Helmut 164-166 Johst, Hanns 133, 141, 320 Κ Kahr, Gustav Ritter ν. 83 Karl I. (Österreich-Ungarn) 50 Karlweis, Oskar 254 Kelian, Fritz 275 Kerenskij, Aleksandr Fëdorovic 41, 186 Kerr, Alfred 188-190 Kessel, Gustav Emil Bernhard Bodo v. 23 Klinke (Pressephotograph) 110 Knoll, Kurt 42, 47 Koszyk, Kurt 319 Kreiser, Walter 101 Küster, Fritz 100 L Lachmann-Mosse, Hans 98, 121, 135 Laval, Pierre 177, 195, 199, 200, 204, 206, 266, 283 Lebrun, Albert 204, 229, 239 Leunmund (Werbeagentur) 89, 90 Levi (Übersetzer) 207, 209 Lewy (Übersetzer) 207, 209 Liebknecht, Karl 53, 55, 61 Lindbergh, Charles 114,302 Ludendorff, Erich 47, 83, 99
Maginot, André 250 Magne (Ehemann von Hotelwirtin) 194 Magne (Hotelwirtin in Paris) 194, 218 Mamlock, Günter siehe Mummick (Redakteur) Mandel, Georges 206-208,210,211, 214, 215, 231, 234, 238, 328 Marx, Karl 134 Masaryk, Tomás Garrigue 236 Maurras, Charles 215 Mehring, Walter 152-155 Menzel, Adolph v. 19 Mertens, Carl 101 Meyer, Hans B. 310,312 Michelangelo Buonarroti 19 Moltke, Helmuth Johannes Ludwig von 34 Mühsam, Erich 124, 125 Müller, Hermann 64 Mummick (Redakteur) 200-202 Mussolini, Benito 195, 199, 204, 235, 240, 242 Ν N.N. (Großmutter) 23, 26 N.N. (Großvater) 19 N.N., Clara (Tante) 72, 82 N.N., Edith (Freundin) 91, 95, 97 N.N., Emma (Freundin) 126, 127, 128, 167, 225, 226 N.N., Emma (Stubenmädchen) 41, 42, 50 N.N., Etta (Bekannte in Dänemark) 157, 158, 163 N.N., Eugène (Freund) 126, 127, 128, 129, 130, 161, 167, 168, 177, 202, 225, 226, 239 N.N., Hans (Freund) 138
345
N . N . , Hans Egon (Kollege) 103, 104
Refulier (Verleger in Paris) 179, 180,
N . N . , Kurt (Freund) 138 N . N . , Margot (Bekannte) 142, 143, 144, 145, 146 N . N . , Michael (Freund) 126, 127,
181, 182, 183, 184 Reinhard, Wilhelm 61 Remarque, Erich Maria 35 Reynaud, Paul 254, 256, 2 6 6 Reynolds (Korrespondent der WAZ in London) 310 Ribbentrop, Joachim v. 230, 238,
128, 129, 134, 138, 146, 147, 149, 152, 159, 160, 162, 304 N . N . , Otto (Onkel) 20, 22, 27, 37, 4 2 , 4 3 , 47, 63 N . N . , Otto (Pressephotograph) 108, 109, 110, 111, 112 N . N . , Richard (Onkel) 82 N . N . , Rolf (Kollege) 245 N . N . , Willy (Freund) 71, 72 N . N . , Wolfgang (Freund) 138 Napoleon I., Kaiser von Frankreich 19, 226 Nielsen, Erik 156, 163 Nikolaus II., Zar des Russischen Reiches 18, 22, 27, 41, 321 Noske, Gustav 57, 58, 59, 61, 64 Nuschke, Otto 95, 96, 105, 186, 324 O Ossietzky, Carl v. 101 Ρ Papen, Franz v. 121, 122, 123, 128, 129, 131, 182 Pechstein, Max 61, 62 Pétain, Philippe 177, 266, 268, 275 Picasso, Pablo 228 Platen ν. (Mitschüler) 20 Platen v. (Hofschatullenbewahrer) 20 Poljakow, Wladimir 186 Q Quisling, Vidkun 243
R Rathenau, Walther 72
239, 245 Röhm, Ernst 182, 183 Roosevelt, Franklin D. 283 Rosenberg, Sonja 63 Rudolf, Kronprinz von ÖsterreichUngarn 26 Runciman, Walter, Viscount of Doxford 233 S Salomon (Professor) 206, 207, 209 Sarraut, Albert 2 0 5 , 2 0 7 Schaber, Will 9 , 3 1 6 Scheidemann, Philipp 52, 53, 55, 57,64 Schiller, Friedrich 153, 253 Schleicher, Kurt v. 122, 131, 182 Schmidt (Vermieterin) 99 Seeckt, Hans v. 100 Seldte, Franz 116 Selier (Ubersetzer) 213 Sklarek, Leo 115 Sklarek, Willi 115 Sophie Maria Josephine Albina Gräfin Chotek von Chotkowa und Wognin, Herzogin von Hohenberg 26, 27 Stalin, Josef 245, 251, 289 Stark, Oskar 142, 143 Stavisky, Serge Alexandre 174, 177 Stern, Marie Louise 2 0 2 Stern, Peter August 2 0 0 - 2 0 2 Strasser, Gregor 101 Strasser, Otto 101 Stresemann, Gustav 104, 205
346
Stumpp, Emil 96 Sussmann, Anni 292 Sussmann, Heinrich 292
Wronkow, Berta (Forts.) 54, 59, 63, 65, 72, 82, 90, 103, 303 Wronkow, Claire Gertrude (Traute) siehe Wincenty (später: Wronkow), Ciaire Gertrude Wronkow, Hugo 8, 19 Wronkow, Ludwig 8, 17, 19, 27, 37, 38, 43, 44,47, 50, 53, 54, 58, 61, 63, 91, 139, 161, 162, 166, 167, 169, 185, 229, 233, 246, 267, 268, 281, 285, 287, 303, 323, 328, 330, 339, 341 Wronkow, Sonja siehe Rosenberg, Sonja
Τ Techow, Ernst Werner 72 Thälmann, Ernst 120 Thalheimer, Siegfried 202 Thöny, Eduard 196 Thorez, Maurice 203 Thormann, Walter 262, 264, 283, 304 Thyssen, Fritz 117 U Uhlig, Anneliese 311
Ζ Zickler (Werbeagentur) 89, 90 Zoll (Großonkel) 25, 45, 82, 83 Zörgiebel, Karl Friedrich 110
V Viktoria Luise von Preußen 21,321 W Waldoff, Ciaire 113 Wilhelm I., Kaiser des Deutschen Reiches 24, 71 Wilhelm II., Kaiser des Deutchen Reiches 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 38, 46, 49, 50, 52, 61, 65, 71, 92, 320, 321, 322 Wilson, Woodrow 54 Wincenty (Mutter von Ciaire Gertrude W.) 229 Wincenty (später: Wronkow), Ciaire Gertrude 102-104, 119, 138-141, 148-152, 192-194, 197-199, 217-222, 225, 243, 245, 258, 265, 267-271, 281-305, 311, 325, 330 Wirth, Joseph 73,262 Wittekind (Studienrat) 65 Wolff, Rudolf 310 Wolff, Theodor 85, 86, 137, 269, 310, 320 Wronkow, Berta 8, 17, 19, 25, 29, 30, 37, 39,43, 4 4 , 4 5 , 4 7 , 4 8 , 50,
347
Zeitungsregister einschließlich Agenturen und Radiosendern
Aftonbladet 159 Agence Havas 190 Der Angriff 102, 115, 139, 140, 144 Associated Press 181 Aufbau 312, 316 Badische Zeitung 143 Berliner Lokal-Anzeiger 54, 113 Berliner Tageblatt 58,83,85,97, 115, 123, 133, 135, 142, 162, 185, 190, 200, 269, 307, 324 Berliner Volks-Zeitung 58,91,95, 97, 186, 323 Canadian Broadcasting Corporation 308 Columbia Broadcasting System 308 DANA (Deutsche Allgemeine Nachrichtenagentur) 309 DENA (Deutsche Nachrichtenagentur) 309 dpa (Deutsche Presse-Agentur) 309 Film-Kurier 102, 104 Grenzland 201, 202 L'Humanité 175 Internationales Korrespondenzbüro 179 Kölner Stadt-Anzeiger 308 Pariser Tageblatt 8, 185-191, 197, 205, 307, 328 Pariser Tageszeitung 191 Paris Soir 181 Pour la Victoire 308 Prager Mittag 190
Radiodiffusion Nationale 205,211, 241, 247, 307, 329 Radio Strasbourg 8, 206, 210, 211, 216, 220, 230-232, 236, 238-242, 250, 272, 304 Reichssender Saarbrücken 205, 250 Reuters Ltd. (Nachr.) 255, 256 Rote Fahne 54, 55 Le Signal 275 Simplicissimus 196 Socialdemokrat 153 Straßburger Sender siehe Radio Strasbourg Der Sturm 74 Südwestfunk 308 Die TAT 308 Vereinte Nationen Radio 308 Völkischer Beobachter 238 Vorwärts 51, 52, 54, 55, 57, 59, 66, 67, 322 Vossische Zeitung 8, 185, 319, 324, 326 VU 177 Welt-Spiegel 115, 123, 135, 200 Die Weltbühne 100 Weserkurier 308 Westdeutsche Allgemeine Zeitung 308, 309-312 Westland 200-202
348
Redaktionelle Hinweise
George Wronkow hat seinen Namen von Georg (Deutschland) über Georges (Frankreich) zu George (USA) geändert. In der Autobiographie wird die jeweils von Wronkow verwendete Schreibweise benutzt, in den Beiträgen wird „George" als Verfasser der Autobiographie verwendt. Um eine zeitliche Orientierung zu erleichtern, wurden zu einigen Ereignissen die genauen Daten eruiert und in eckige Klammern gesetzt. Da durch die posthume Veröffentlichung sinnvoll erscheinende Veränderungen mit dem Autor nicht abgesprochen werden konnten, wurden nur ganz offensichtliche Fehler stillschweigend korrigiert, Ungenauigkeiten teilweise durch Fußnoten ergänzt oder richtiggestellt, nicht aufzuklärende Widersprüche, Wiederholungen und sprachliche Eigenarten aber belassen. Die Rechtschreibung wurde den heute gültigen Regeln angepasst. Ursprünglich war geplant, die Autobiographie zu ergänzen mit von Georg Wronkow verfassten Zeitungsartikeln; dies schien insofern naheliegend zu sein, als Wronkow selbst sehr konkret auf einzelne Artikel hinweist. Aufwendige Recherchen führten hier jedoch zu keiner eindeutigen Zuweisung von Artikeln zu dem Verfasser Georg Wronkow. Dies mag zum einen der Tatsache geschuldet sein, dass in der Berliner Volks-Zeitung Artikel nur selten mit Namen(skürzel) versehen sind, zum anderen dem Zeitpunkt der Abfassung der Autobiographie, der ein so konkretes Erinnern nach fünfzig Jahren doch nicht ermöglicht. Einzig konnten Beiträge im Welt-Spiegel, einer Beilage der Berliner Volks-Zeitung und des Berliner Tageblatts, Anfang der 30er Jahre gefunden werden, die mit dem Kürzel „greko", einem Pseudonym Wronkows, gekennzeichnet sind. Da diese aber weniger einzelne aussagekräftige Artikel darstellen als vielmehr feuilletonistisch gestaltete ganze Zeitungsseiten mit zahlreichen Zeichnungen, ist eine Wiedergabe dieser Seiten in dem vorliegenden Format wenig sinnvoll.
349
George Wronkow 1985

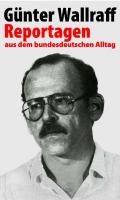

![Durch vergiftete Zeiten: Memoiren eines Nazibuben [1 ed.]
9783205216421, 9783205216407](https://dokumen.pub/img/200x200/durch-vergiftete-zeiten-memoiren-eines-nazibuben-1nbsped-9783205216421-9783205216407.jpg)


![Heinrich Mann: Dichter und Moralist [Reprint 2015 ed.]
3484150262, 9783484150263](https://dokumen.pub/img/200x200/heinrich-mann-dichter-und-moralist-reprint-2015-ed-3484150262-9783484150263.jpg)
![Napoleons Sohn: Biographie eines ungelebten Lebens [1. ed.]
9783806235005, 9783806234879, 9783806234992](https://dokumen.pub/img/200x200/napoleons-sohn-biographie-eines-ungelebten-lebens-1nbsped-9783806235005-9783806234879-9783806234992.jpg)


![Kleiner Mann in großen Zeiten: Reportagen eines Lebens [Reprint 2014 ed.]
9783110971996, 9783598213281](https://dokumen.pub/img/200x200/kleiner-mann-in-groen-zeiten-reportagen-eines-lebens-reprint-2014nbsped-9783110971996-9783598213281.jpg)