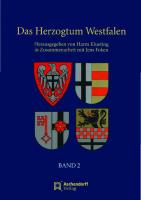Familie, verwandtschaftliche Netzwerke und Klassenbildung im ländlichen Westfalen (1750-1874) 9783828260047, 9783828205475
164 9 23MB
German Pages [300] Year 2012
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1: Einleitung
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
Kapitel 4: Untersuchungsorte, Datenerhebung, Methoden
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Lohne: Netzwerkkonstruktion und Klassengesellschaft
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf: Soziale Endogamie, lokale Welt und die Liebe zu den Verwandten
Kapitel 7: Familienstrategien und soziale Netzwerke: Die soziale Plazierung von Kindern
Kapitel 8: Soziale Beziehungen und soziale Ungleichheit
Tabellen- und Abbildungsanhang
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Citation preview
Familie, verwandtschaftliche Netzwerke und Klassenbildung im ländlichen Westfalen (1750-1874) Christine Fertig
Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte Herausgegeben von Stefan Brakensiek Erich Landsteiner Heinrich Richard Schmidt Clemens Zimmermann
Band 54
Christine Fertig
Familie, verwandtschaftliche Netzwerke und Klassenbildung im ländlichen Westfalen (1750-1874)
®
Lucius & Lucius • Stuttgart
Anschrift der Autorin: Christine Fertig Heerdestr. 35 48149 Münster [email protected]
Gedruckt mit Unterstützung des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
LWL
Für die Menschen. Für Westfalen-Lippe.
www.lwl.org sowie mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften in Ingelheim am Rhein.
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-8282-0547-5 ISSN 0481-3553 © Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft mbH • Stuttgart • 2012 Gerokstraße 51 • D-70184 Stuttgart • www.luciusverlag.com Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Druck und Einband: BELTZ Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza Printed in Germany
Inhalt Abbildungsverzeichnis
VIII
Tabellenverzeichnis
IX
Vorwort
XI
Kapitell: Einleitung
1
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Soziale Beziehungen in der ländlichen Gesellschaft Familienstrategien? - Eine Forschungsdiskussion Ehe und Heirat Transfers, Erbsystem und Bequest Motive Hofidee als handlungsleitendes Normensystem?
7 14 17 25 33
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
39
3.1 3.2 3.3 3.4
39 47 61 70
Soziale Netzwerke und Geschichte Verwandtschaft Patenschaft Bauern und Tagelöhner
Kapitel 4: Untersuchungsorte, Datenerhebung, Methoden
77
4.1 Untersuchungsorte 4.1.1 Löhne (Ostwestfalen) 4.1.2 Borgeln (Soester Börde) 4.2 Quellenkorpus und Datenerfassung 4.3 Methodischer Ansatz
79 79 83 87 91
VI
Inbat
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne: NtUwti kkonstruktion und Klassengesellschaft 5.1 Patenschaften in westfälischen Dörfern: ein relevantes Thema? 5.1.1 Fragestellung 5.1.2 Quellenlage und Möglichkeiten der Netzwerkkonstruktion 5.2 Topographie des Patennetzes 5.2.1 Räumliche Ausdehnung der Patennetze 5.2.2 Altersstruktur 5.2.3 Soziale Schichten 5.2.4 Zentralisierung der Netze 5.2.5 Zwischenfazit 5-3 Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft 5.3.1 Verwandtschaft und Patenschaft zwischen Bauern und ländlichen Unterschichten 5.3.2 Patenschaften und Klassengrenzen: Heuerlinge und Bauern in Löhne 5.3.3 Strategien von Bauern, Tagelöhnern und Heuerlingen: The strength of weak ties 5.4 Ländliche Klassengesellschaft? Schichtenübergreifende Integration durch soziale Netzwerke Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf: Soziale Endogamie, lokale Welt und die Liebe zu den Verwandten 6.1 Heirat als Option: Heiraten, Nicht-Heiraten und Besitztransfers 6.1.1 Besitztransfer in Löhne: Heiraten als Auslöser von Ressourcenflüssen 6.1.2 Heiraten in Borgeln: Übergabe, Aussteuer und Erbteil 6.1.3 Singles in Borgeln: Ein alternatives Lebensmodell 6.1.4 Familienwirtschaft, Einkommensgesellschaft und Erweckungsbewegung 6.2 Höfe und Häuser: Besitztransfers zwischen Heirat und Erbabfindung 6.2.1 Der Hof als Sozialgebilde 6.2.2 Heiratsmobilität zwischen Höfen und Häusern 6.2.3 Verdichtete Bereiche im Heiratsnetz und die Zirkulation der Güter 6.2.4 Heiratkreise und Ressourcenflüsse
99 99 99 101 107 107 111 112 116 121 121 122 130 135 140
143 143 145 149 153 164 167 168 171 176 189
Inhalt
6.3 Fkirat auf dem Dorfe: lokale, soziale oder verwandtschaftliche Endogamie? 63.1 PGraph: Ein formales Modell zur Analyse genealogischer Netzwerke 63.2 Verwandtschaftskerne im Heiratsnetz 63.3 Die Liebe zur Cousine? Verwandtenehen in Löhne und Borgeln 63.4 Im Kreise der Verwandten: Heirat und soziales Netzwerk 6.4 Egebnisse: Heirat, Besitztransfer und Klassenbildung
VII
190 192 195 199 205 206
Kapfei 7: Familenstrategien und soziale Netzwerke: Die soziale Plazierung TOO Kndern 7.1 S»ziale Mobilität und familiäre Unterstützung 71.1 Soziale Mobilität in modernen und vormodernen Gesellschaften 71.2 Soziale Plazierung in der ländlichen Gesellschaft: Heiratsund Familienstrategien 7.2 Ailage der Untersuchung 72.1 Individuelle Mobilität und Familie 72.2 Faktoren familiären Erfolgs 7.3 Stziale Netzwerke, Besitz und soziale Plazierung von Kindern 73.1 Soziale Plazierung I: Heirat und Haushaltsgründung 73.2 Soziale Plazierung II: Hoferwerb 73.3 Soziale Plazierung III: Statuserhalt bei Bauern und Tagelöhnern 7.4 Rmilien und soziale Mobilität
211 211 211 215 221 221 222 225 228 231 234 236
Kppiti 8: Sozial Beziehungen und soziale Ungleichheit
241
Tabden- und Abbildlingsanhang
247
Quelknverzeichnis 1 Ungedruckte Quellen 2 Gedruckte Quellen 3 Software
263 263 264 264
Ijtefsurverzeichnis
265
Abbildungsverzeichnis
Abb. 4.1: Abb. 4.2: Abb. 4.3: Abb. 5.1:
Die Untersuchungsorte Löhne und Borgeln in Westfalen Der Untersuchungsort Löhne (Kreis Herford) Der Untersuchungsort Borgeln (Kreis Soest) Anteil der identifizierten Paten, Borgeln (1766-1859) und Löhne (1800-56) Abb. 5.2: Anzahl der Geburten, Borgeln (1766-1859) und Löhne (1800-56) Abb. 5.3: Durchschnittliche Anzahl der Paten je Kind, Borgeln (1766-1859) und Löhne (1800- 56) Abb. 5.4: Lorenzkurven der Input Degnee-Verteilung, Löhne (1800-56) und Borgeln (1800-59) Abb. 5.5: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, Löhne (1800-56), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 5.6: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, Borgeln (1766-1859), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 5.7: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, ländliche Unterschichten in Löhne (1800-56), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 5.8: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, Bauern in Löhne (1800-56), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 5.9: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, ländliche Unterschichten in Borgeln (1766-1859), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 5.10: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, Bauern in Borgeln (1766-1859), 5jährig gleitende Durchschnitte Abb. 6.1: Anteil der jemals verheirateten Männer nach Lebensjahren, Löhne und Borgeln (1780-1819), in Prozent Abb. 6.2: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Borgeln (1750-1874), schwach verbundene Komponenten Abb. 6.3: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Löhne (1750-1874), schwach verbundene Komponenten Abb. 6.4: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Borgeln (1750-1874), stark verbundene Komponenten Abb. 6.5: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Löhne (1750-1874), stark verbundene Komponente Abb. 6.6: PGraph-Darstellung und Verwandtschaftsdiagramm im Kontrast Abb. AI: Anteil der jemals verheirateten Frauen nach Lebensjahren, Löhne und Borgeln (1780-1819), in Prozent
78 80 84 103 105 106 120 123 124 126 126 127 127 156 179 181 185 187 193 261
Tabellenverzeichnis
Tab. 5.1: Tab. 5.2: Tab. 5.3: Tab. 5.4: Tab. 5.5: Tab. 5.6: Tab. 5.7: Tab. 5.8: Tab. 5.9: Tab. 5.10: Tab. 5.11: Tab. 5-12: Tab. 5.13: Tab. 5.14: Tab. 5-15: Tab. 6.1: Tab. 6.2: Tab. 6.3: Tab. 6.4: Tab. 6.5: Tab. 6.6:
Patenidentifizicrung in Löhne (1800-56) und Borgeln (1766-1859) Wohnorte der Paten, Löhne (1820-1822) und Borgeln (1777-95) Patenschaften zwischen Hofbesitzern, Löhne (1800-56) und Borgeln (1766-1859) Alter der Paten, Löhne (1800-56) und Borgeln (1800-1859) Altersabstände zwischen Paten und Müttern, Löhne (1800-1856) und Borgeln (1800-1859) Berufliche Schichtung der Paten in Löhne (1800-56) Berufliche Schichtung der Paten in Borgeln (1766-1859) Zentralitätsmaße der Patennetze, Löhne (1800-56) und Borgeln (1800-59) Consanguinal und affinal verwandte Paten nach Geburtsrang, Löhne (1800-56) Consanguinal und afFinal verwandte Paten nach Geburtsrang, Borgeln (1766-1859) Verwandtschaftsbeziehungen zwischen bäuerlichen Paten und Heuerlingen als Kindseltern, Löhne (1800-56), N = 541 Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Heuerlingen als Paten und bäuerlichen Kindseltern, Löhne (1800-56), N = 165 Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten und Beziehungen zwischen den Schichten, in Prozent Patenbeziehungen von Bauern und Heuerlingen, nach Verwandtschaft und Schicht, Löhne (1800- 56) Patenbeziehungen von Bauern und Tagelöhnern, nach Verwandtschaft und Schicht, Borgeln (1800- 56) Hofubergabe und Heirat des Hoferben: Löhne (1794-1871) und Borgeln (1802-1884) Intergenerationelle Mobilität von Bauern und Hausbesitzern, Löhne 1750-1869 Intergenerationelle Mobilität von Bauern und Hausbesitzern, Borgeln 1750-1869 Herkunftsorte der Heiratspanner von Hofbesitzern, Löhne (1750-1874) Herkunftsorte der Heiratspartner von Hofbesitzern, Borgeln (1750-1874) Schwach verbundene Komponente und soziale Schichtung, Borgeln (1750-1874)
104 108 110 111 112 114 115 119 129 129 133 134 136 137 137 148 171 173 174 175 182
X
Tab. 6.7: Tab. 6.8: Tab. 6.9: Tab. 6.10: Tab. 6.11: Tab. 6.12: Tab. 6.13: Tab. 6.14: Tab. 6.15: Tab. 7.1: Tab. 7.2:
Tab. 7.3:
Tab. AI: Tab. A2: Tab. A3: Tab. A4: Tab. A5: Tab. A6: Tab. A7: Tab. A8:
TabtUtnvtr^tubnis
Schwach verbundene Komponente und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Stark verbundene Komponente und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Ehepaare im Heiratsnetz: Verwandtschaftskern und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Ehepaare im Heiratsnetz: Verwandtschaftskern und soziale Schichtung, Borgeln (1750-1874) Bauern und ländliche Unterschichten im Verwandtschaftskern in Löhne, Borgeln (1750-1874) und Feistritz (1860-1960) Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Löhne (1770-1870) Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Borgeln (1770-1870) Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Löhne, nach Schicht (1770-1870) Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Borgeln, nach Schicht (1770-1870) Determinanten von Heiraten der Kinder, Vater in Borgeln 1830-1866 (Negative Binomiale Regression) Abhängige Variable: Anzahl verheirateter Kinder Determinanten von Hoferwerb durch Kinder, Väter in Borgeln 1830-1866 (Negative Binomiale Regression) Abhängige Variable: Anzahl von Kindern, die einen anderen als den Elternhof besitzen Determinanten von Statuserhalt durch die Kinder, Väter in Borgeln 1830-1866 (Negative Binomiale Regression) - Abhängige Variable: Anzahl von Kindern, die einen anderen Hof als den Elternhof besitzen, der aber mindestens derselben Besitzklasse angehört Ledigenquoten und Verheiratetenanteile bei den Männern, Löhne und Borgeln (1780-1819) Ledigenquoten und Verheiratetenanteile bei den Frauen, Löhne und Borgeln (1780-1819) Alter der zwischen 1820-1849 Heiratenden in Löhne und Borgeln Heiratsmobilität bei Männern und Frauen, Löhne (1750-1874) Heiratsmobilität bei Männern und Frauen, Borgeln (1750-1874) Höfe und Häuser in Borgeln Höfe und Häuser in Löhne Deskriptive Statistiken der Variablen in den Regressionsmodellen
183 188 196 197 198 200 202 203 204 229
233
235 247 247 248 248 248 249 255 260
Vorwort Die vorliegende Studie wurde im Wintersemester 2010/11 von der Philosophischen Fakultät der Universität Münster unter dem Titel „Soziale Beziehungen in der ländlichen Gesellschaft: Integration und Klassenbildung in Westfalen (19. Jahrhundert)" als Dissertation angenommen. Sie entstand im Rahmen der „Forschungsgruppe ländliches Westfalen: Familien-, Wirtschafts- und Agrargeschichte im 18. und 19. Jahrhundert", deren Arbeit von der DFG in mehreren Projekten großzügig gefördert worden ist. Gemeinsames Nachdenken, kontroverses Diskutieren und beständige Unterstützung bilden neben der gemeinsam erarbeiteten Quellenbasis das Fundament, auf dem diese Arbeit steht. Dafür danke ich Georg Fertig, Johannes Bracht und Volker Lünnemann. Bedanken möchte ich mich bei Ulrich Pfister für viel faltige wissenschaftliche Anregungen, weiterführende Kritik, besonders aber für die Unterstützung und auch Geduld, ohne die sich wissenschaftliche Neugier und eine junge Familie nicht vereinbaren lassen. Stefan Brakensiek gebührt zweifacher Dank: für das Zweitgutachten und für die Aufnahme dieses Buches in die Reihe der „Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte", wofür auch den Herausgebern Erich Landsteiner, Heinrich Richard Schmidt und Clemens Zimmermann gedankt sei. Georg Fertig, Johannes Bracht, Lara Stupinski, Jost Wagner und Hanna Fertig haben das Manuskript gelesen und kommentiert, auch bei ihnen bedanke ich mich herzlich. Gedankt sei auch den Kommentatoren verschiedener Tagungen, die wertvolle Hinweise gaben: Annie Antoine, Maurice Aymard, David W. Sabean, Rui Santos, Jürgen Schlumbohm, Michael Schnegg und Hermann Zeitlhofer sind hier besonders zu nennen. Bedanken möchte ich mich auch bei den Archivaren und Mitarbeitern der Archive in Münster, Detmold, Bielefeld, Herford und Löhne. Ohne ihre freundliche Unterstützung und ihr Entgegenkommen, mit dem sie immer wieder große Mengen an Archivalien bereitstellten und für jedes Problem eine Lösung fanden, wäre diese Arbeit nicht zustande gekommen. Besonderer Dank gebührt Herrn Averbeck im Lesesaal des Staatsarchivs Münster (heute Landesarchiv NRW, Abteilung Westfalen) für seine immerzu freundliche und entgegenkommende Unterstützung und seine Sorge um ein angenehmes Arbeitsklima. Allen an der Datenerfassung beteiligten Mitarbeitern der Forschungsgruppe sei für ihre beharrliche und gründliche Arbeit wie für Kritik und Anregungen gedankt: Hakon Albers, Andreas Berger, Birgit Buthe, Nina Buthe, Anna Diercks, André Donk, Sylvia Dopheide, Felix Eichhorn, Stefan Evers, Silke Goslar, Insa Großkraumbach, Mathias Hanses, Thomas Hajduk, Malte Harth, Christian Hörnla, Robin Kiera, Georg Körte, Lara Stupinski, Markus Küpker, Katharina Lammerding, Markus Lampe, Eva-
XII
Vorwort
Maria Lerche, Bernhard Liemann, Thorsten Lübbers, Birgit Lüke, Susanne Muhle, Frank Peters, Theresa Potente, Carsten Rothaus, Miriam Schall, Christian Wilmsen und Ina Witte. Besonderer Dank gebührt meiner Familie. Meine Kinder zeigen mir Tag für Tag, dass das Leben mehr bereithält, als wir uns oftmals vorstellen; davon hat auch die Auseinandersetzung mit den Familien der Vergangenheit profitiert. Mein Mann hat stets an das Gelingen dieser Arbeit geglaubt und Familienarbeit nie für Frauenarbeit gehalten; ohne ihn gäbe es dieses Buch nicht.
Kapitel 1: Einleitung
Diese Arbeit untersucht die Entstehung ländlicher Klassengesellschaften; sie verfolgt dabei eine Netzwerkperspektive. Sie geht über klassische, gesellschaftliche Positionen untersuchende Schichtungsanalysen hinaus, indem sie soziale Beziehungen in den Blick nimmt und die relationale Struktur zweier westfälischer Gemeinden im 19. Jahrhundert analysiert. Es wird danach gefragt, ob man für eine Region, in der die Besitzverhältnisse eine klare Hierarchie mit Großbauern an der Spitze und Lohnarbeitern als breiter unterbäuerlicher Schicht aufwiesen, auf der Ebene der Netzwerkstruktur eine Segregation in soziale Klassen nachweisen kann. Die Arbeit ist als vergleichende Mikrostudie angelegt, in der eine ostwestfälische, durch Protoindustrie geprägte Gemeinde und eine rein agrarische, stark marktorientierte Gemeinde in der westfälischen Hellwegregion analysiert werden. Untersucht werden Verwandtschafts- und Patenschaftsbeziehungen zwischen sozialen Schichten, verwandtschafts- und schichtenendogames Heiratsverhalten, die Bedeutung sozialer Netzwerke für die soziale Plazierung von Kindern und die Aushandlung von Beziehungen und Ressourcenflüssen innerhalb von Familien. Ausgangspunkt der Arbeit ist die Frage nach der Entstehung der Klassengesellschaft im ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert. Eine .ländliche Klassengesellschaft' ist bisher im ländlichen Ostwestfalen verortet worden. Sie wurde geprägt durch die Existenz zweier Klassen, die durch Landbesitz einerseits und Landlosigkeit andererseits klar voneinander geschieden waren, wobei die landbesitzenden Bauern ihren Status auf Kosten der unterbäuerlichen Schichten ausbauten. Die nach unten abgeschlossenen Heiratskreise der Bauern und die strukturelle Abwärtsmobilität derjenigen Bauernkinder, die den elterlichen Hof nicht übernehmen konnten, reproduzierten in Josef Moosers Studie diese Struktur der massiven sozialen Ungleichheit.1 Ein ganz anderes Bild von ländlicher Klassengesellschaft ist für das württembergische Dorf Neckarhausen entworfen worden, in einer Region, in der Realteilung für weit verbreiteten Landbesitz, verbunden mit erheblichen Statusunterschieden, sorgte. Auch hier war die Heirat ein zentraler Steuerungsmechanismus der ländlichen Gesellschaft, allerdings mit im Zeitverlauf sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf deren Netzwerkstruktur. Partnerwahlen waren im 18. Jahrhundert ein Instrument schichtenübergreifender Vernetzung, dienten dann aber über Heiraten im sozialen Nahbereich der Etablierung einer Führungselite und der Exklusion der anwachsenden Unterschichten. David W. Sabean sieht Heiraten als Teil eines komplexen Austauschsystems, in dem auch andere Beziehungen wie Patenschaften, Vormundschaften, Kriegsvogtschaften 1
Josef MOOSER: Ländliche Klassengesellschaft 1770-1848. Bauern und Unterschichten, Landwirtschaft und Gewerbe im östlichen Westfalen, Göttingen 1984.
2
Kapittl 1: Einleitung
und Bürgschaften ihre je eigene Funktion hatten. Letztlich führten aber Änderungen im Netzwerkverhalten zur Entstehung einer Klassengesellschaft, die sozial wie ökonomisch segregiert war. 2 Die Bedeutung sozialer Beziehungen sind auch in einer nordwestdeutschen lokalen Gesellschaft (Belm im Osnabrücker Land) untersucht worden. Die Heirat, und damit die Möglichkeit, eine Familie zu gründen und legitimen Nachwuchs zu haben, war universell zugänglich und daher gemeinsame, schichtenübergreifende Erfahrung. Damit ist auf die Relevanz ländlicher Lohnarbeit, im agrarischen wie protoindustriellen Bereich, verwiesen, die es auch Menschen ohne Landbesitz ermöglichte, ihre eigene Familie zu ernähren. Die Organisation dieser Arbeitsverhältnisse konnte aber ganz unterschiedlich gestaltet sein. In Auseinandersetzung mit der These einer ländlichen Klassengesellschaft verweist Jürgen Schlumbohm auf die erhebliche Bedeutung der alltagspraktischen Beziehungen zwischen Bauern und ihren Heuerlingen. Letztere waren in die Hofwirtschaft eingebunden und hatten ganz individuelle, sich über Arbeitspflichten, Verpachtungen, aber auch Verwandtschaft und Patenschaft erstreckende persönliche Beziehungen zu den Bauern. Schlumbohm sieht keine Anzeichen dafür, dass sich in der von ihm untersuchten ländlichen Gesellschaft soziale Klassen gegenüberstanden; weder ist ein Bewusstsein für die gemeinsame sozio-ökonomische Lage zu erkennen, noch kam es zu gemeinsamen Aktionen. Die sozialen Netzwerke, in die Bauern und unterbäuerliche Haushalte eingebunden waren, bildeten dagegen das dominierende Element der sozialen Struktur.3 Allerdings war das Heuerlingssystem nicht überall in Nordwestdeutschland oder Westfalen verbreitet. So gibt es etwa in der Hellwegregion, in der auch das hier untersuchte Borgeln liegt, keine vergleichbare soziale Institution. Man kann also erwarten, dass sich die sozialen Beziehungen und damit auch die Klassenverhältnisse hier anders gestalteten. An diese Studien, die Heirat und soziale Ungleichheit ganz unterschiedlich bewerten, schließt die vorliegende Arbeit an, unter Anwendung neuerer, netzwerkanalytischer Methoden, die neben qualitativen und statistischen Auswertungen des Materials eingesetzt werden. Sie gliedert sich in einen theoretischen (Kapitel 2 und 3) und einen empirischen Teil (Kapitel 4 bis 7). Entstanden ist sie im Kontext der Forschungsgruppe ländliches Westfalen, in der umfangreiche Datenbanken zu drei westfälischen Gemeinden aufgebaut worden sind. Georg Fertig und Johannes Bracht haben zwei Studien vorgelegt, die sich mit dem ländlichen Bodenmarkt und Vermögensstrategien befassen; daneben haben Volker Lünnemann und Silke Goslar zu Erbschaft, Geschwisterbeziehungen und nichtehelichen Kindern gearbeitet.4 Diese Studien beruhen teil-
2 3
4
David W . SABEAN: Kinship in Neckarhausen, 1 7 0 0 - 1 8 7 0 , Cambridge 1 9 9 8 . Jürgen SCHLUMBOHM: Lebensläufe, Familien, Höfe: Die Bauern und Heuerleute des osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650-1860, 2. durchges. Aufl., Göttingen 1997. Johannes BRACHT: Geldlose Zeiten und überfüllte Kassen - Vermögensstrategien westfälischer Bauern auf frühen Kapitalmärkten, 1830-1866, unveröff. Dissertation, Münster 2009; Georg FERTIG: Äcker, Wirte, Gaben: Ländlicher Bodenmarkt und liberale Eigentumsordnung
Einleitung
3
weise auf denselben Datenbeständen, untersuchen jedoch andere Fragen. In den beiden folgenden Kapiteln werden die Grundfragen der Arbeit im Kontext der geschichtswissenschaftlichen, ethnologischen und soziologischen Forschung entfaltet. In Kapitel 2 stehen die Themenfelder Heirat und Ressourcentransfers im Vordergrund. Indem die Agrargeschichte sich zunehmend zu einer Geschichte der ländlichen Gesellschaft gewandelt hat, rücken Familienformen, Erbsysteme und soziale Reproduktion in den Fokus der Forschung. Zunächst wird diskutiert, welchen heuristischen Stellenwert das Konzept der Familienstrategie haben kann. Dann wird nach dem Heiratsverhalten in der ländlichen Gesellschaft vor dem Hintergrund von Heiratsbeschränkungen, der Frage nach einem typisch europäischen Heiratsmuster und dem konkreten Zustandekommen von Heiratsentscheidungen gefragt. Davon kaum zu trennen sind intergenerationelle Transfers, die in verschiedenen Erbsystemen unterschiedlich organisiert sein können. Die Auswirkungen dieser Erbsysteme auf die soziale Reproduktion stellen sich allerdings aus heutiger Sicht weniger gravierend dar, als die ältere Forschung angenommen hat. Im Gegenteil kann man danach fragen, warum in Westfalen diejenigen Kinder, die den Hof nicht übernahmen, hohe Erbabfindungen erhielten. Diese Zahlungen bedeuteten für den Hof eine erhebliche Belastung; vor diesem Hintergrund muss man auch fragen, wie weit das Konzept einer bäuerlichen .Hofidee' trägt. Im dritten Kapitel wird diskutiert, was das in den Nachbardisziplinen, besonders der Soziologie und der Ethnologie, inzwischen etablierte Verfahren der Netzwerkanalyse für das Verständnis einer ländlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts leisten kann. Zunächst werden die bislang noch wenigen historischen Netzwerkanalysen vorgestellt, um dann die Bedeutung der hier untersuchten sozialen Beziehungen zu erläutern. Dann wird der Stellenwert von Verwandtschaft in europäischen Gesellschaften seit der Christianisierung diskutiert. Die Einbettung von Individuen und Familien in verwandtschaftliche Netzwerke ist lange als vormodernes Phänomen verstanden und als solches kaum untersucht worden. Die neuere Forschung wendet sich nun gegen die Vorstellung, dass verwandtschaftliche Beziehungen nur in der Vormoderne relevant waren, und verweist auf die zunehmende Hinwendung zu Verwandten gerade im Kontext von Modernisierung. Patenbeziehungen gestalteten sich dagegen je nach gesellschaftlichem Kontext sehr unterschiedlich und können als Indikatoren für soziale Vernetzung herangezogen werden. Dabei kann diese relationale Struktur einer lokalen im Westfalen des 19. Jahrhunderts, Berlin 2007; Silke GOSLAR: Nichteheliche Kinder auf dem Land: eine vergleichende Analyse zweier westfälischer Kirchspiele im 19. Jahrhundert, unveröffentlichte Magisterarbeit, Münster 2 0 0 5 ; Volker LONNEMANN: Der Preis des Erbens. Besitztransfer und Altersversorgung in Westfalen, 1 8 2 0 - 1 9 0 0 , in: Stefan BRAKENSIEK / Michael STOLLEIS / Heide WUNDER (Hg.), Generationengerechtigkeit? Normen und Praxis im Erb- und Ehegüterrecht 1500-1850, Berlin 2006, S. 139-162; ders.: Familialer Besitztransfer und Geschwisterbeziehungen, in: Georg FERTIG (Hg.), Geschwister - Eltern - Großeltern. Beiträge der historischen, anthropologischen und demographischen Forschung, Köln 2005, S. 31-48; Siehe auch Markus KÜPKER: Weber, Hausierer, Hollandgänger. Demographischer und wirtschaftlicher Wandel im ländlichen Raum, Frankfurt a.M. 2008.
4
KapütH: Endtitung
Gesellschaft ganz anders aufgebaut sein als die anhand der Schichtung generierte positionale Struktur. Gerade ländliche Gesellschaften sind aber oft als bäuerliche Gemeinden verstanden worden, auch wenn (Voll-)Bauern im 18. und 19. Jahrhundert nur eine Minderheit der dörflichen Bevölkerung ausmachten.5 Die Beziehungen zwischen den ländlichen Schichten sind bislang kaum untersucht, besonders für rein agrarische Gebieten ohne Protoindustrie ist wenig über die breite Masse der landwirtschaftlichen Tagelöhner bekannt. Mit Kapitel 4 beginnt der empirische Teil der Studie. Es wird zunächst der politische, institutionelle und wirtschaftliche Kontext für die beiden untersuchten Gemeinden dargestellt. Die Arbeit leistet einen Strukturvergleich zweier ländlicher Gemeinden, Löhne (Kreis Herford) und Borgeln (Kreis Soest), in denen politische und rechtliche Rahmenbedingungen sehr ähnlich waren (beide gehörten zur preußischen Provinz Westfalen), deren sozio-ökonomische Verhältnisse sich aber deutlich unterschieden. Beide Gemeinden waren protestantisch, jedoch spielte im ostwestfälischen Löhne die pietistische Erweckungsbewegung eine wichtige Rolle, in Borgeln dagegen nicht. Die Arbeit untersucht Netzwerke von Bauern und einer breiten Schicht von ländlichen Arbeitern, von vornehmlich protoindustriell tätigen Heuerlingen in Löhne und ländlichen Handwerkern und Tagelöhnern in der agrarischen Marktproduktion in Borgeln. Die Gemeinden unterschieden sich massiv bezüglich der wirtschaftlichen Situation; während die Agrarproduktion in Borgeln (Hellwegregion) einen steigenden Absatz im nahe gelegenen, schnell anwachsenden Ruhrgebiet fand, geriet die protoindustrielle Produktion in Löhne (Ostwestfalen) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in eine massive Krise. Weiter wird in diesem Kapitel die Quellenbasis und die Erfassung der Daten in relationalen Datenbanken erläutert und das methodische Instrumentarium der Arbeit vorgestellt. In Kapitel 5 wird die Konstruktion von Patennetzen durch die historischen Akteure untersucht. Das Netz der Patenschaften wird als zentraler Bestandteil persönlicher Netzwerke in der ländlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verstanden. Die Analyse dieser Patenbeziehungen lässt Rückschlüsse auf die Beziehungsstruktur der Dorfgesellschaft zu. Es wird gezeigt, dass das ostwestfalische Löhne stärker von schichtübergreifenden Beziehungen geprägt, und damit stärker sozial inkludierend organisiert war als das Kirchspiel Borgeln. In beiden Gemeinden konstruierten die sozialen Schichten je eigene Netzwerkformationen: Tagelöhner weiteten ihre Netzwerke im Laufe des 19. Jahrhunderts aus und vergrößerten so ihren sozialen Raum, während Bauern sich zunehmend auf ihren sozialen Nahbereich beschränkten.
Zum Konzept der .peasant community' siehe etwa George M. FOSTER, Peasant Society and the Image of Limited Good, in: American Anthropologist 67 (1965), S. 293-315; Peter BUCKLE, Kommunalismus, Parlamentarismus, Republikanismus, in: Historische Zeitschrift 242 (1986), S. 529-556.
'Einleitung
5
In Kapitel 6 wird der Zusammenhang zwischen Heiratsverhalten und der Reproduktion von gesellschaftlicher Ungleichheit untersucht. Heiraten waren in Anerbengebieten neben dem Erbsystem der zentrale Steuerungsmechanismus sozialer Reproduktion. Im Gegensatz zu Patenschaften hatten Heiraten eine ganz erhebliche ökonomische Bedeutung: Zum einen konnten Kinder durch Heirat auf anderen Höfen plaziert werden, zum anderen löste aber fast jede Heirat Ressourcenflüsse von der älteren an die junge Generation aus. In diesem Kapitel werden zunächst Dokumente zu Besitztransfers und Familienverträgen vornehmlich auf qualitativem Wege untersucht. Die Übergabe- und Leibzuchtverträge, Eheverabredungen, Erbteilungen und Testamente lassen Schlussfolgerungen über den Stellenwert der Heirat im Lebenslauf der Individuen und der ländlichen Gesellschaft in ihrer je unterschiedlichen Ausprägung zu. Dann wird nach der Zirkulation von Personen und Ressourcen zwischen Höfen gefragt, wobei die unteilbaren und über einen langen Zeitraum stabilen Höfe als Sozialgebilde verstanden werden, deren Identität sich in den Lebenslauf der Personen einschrieb. Die Wege, die junge Menschen und mit ihnen ihre Erbabfindungen zwischen ihrem Elternhof und ihrer neuen Heimat zurücklegten, werden als Heiratsbeziehungen verstanden, die Höfe miteinander verbanden; das so definierte Netz wird mit netzwerkanalytischen Verfahren untersucht. Im letzten Abschnitt wird die Perspektive von den Besitzenden auf die gesamte Bevölkerung erweitert. Das genealogische Netzwerk aller Familien, die demographische Spuren in den Quellen hinterließen, wird mit Hilfe des in der ethnologischen Netzwerkanalyse entwickelten PGraph-Verfahrens untersucht. Hier wird auch danach gefragt, ob Sabeans These der zunehmenden Verwandtschaftsorientierung in Europa bestätigt werden kann. Es wird mithin die Bedeutung der Eheschließung in den Blick genommen - im Lebenslauf der Menschen, für die verwandtschaftlichen Netzwerke, und für die Integration der sozialen Schichten in der ländlichen Gesellschaft in Westfalen im 18. und 19. Jahrhundert. Kapitel 7 untersucht schließlich den Einfluss verschiedener Variablen auf den Erfolg familiärer Strategien. Es wird danach gefragt, welche Faktoren die Wahrscheinlichkeit einer Heirat bzw. eines Hoferwerbs erhöhen. Im Zentrum der Analyse stehen dabei die Eltern, deren Kinder nur zum Teil erfolgreich plaziert werden konnten. Neben der sozialen Schichtung werden Netzwerkpositionen von Eltern berücksichtigt, die Rückschlüsse auf das Prestige der Familie zulassen. Sozialer Status hing auch von Prestige ab, und dieses wurde wenigstens zum Teil in netzwerkorientierten Interaktionen akkumuliert und dargestellt. In Kapitel 8 wird in einer Schlussdiskussion die Bedeutung sozialer Beziehungen für ländliche Gesellschaften im 19. Jahrhundert erörtert und vor dem Hintergrund unterschiedlicher wirtschaftlicher und sozialer Verhältnisse diskutiert. Dabei wird herausgearbeitet, dass man eine ländliche Klassengesellschaft eher in der rein agrarischen Hellwegregion als im protoindustriellen Ostwestfalen findet, und dass Klassenbildung weniger durch Verwandtschaftsorientierung im Sinne eines interaktionistischen Klassenkonzepts als durch wachsende Arbeitsmärkte vorangetrieben wurde.
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
2.1 Soziale Beziehungen in der ländlichen Gesellschaft Die Geschichte der ländlichen Gesellschaft hat sich in den l e t 2 t e n Jahren zunehmend als Geschichte von Dörfern und damit von lokalen Gesellschaften etabliert.1 Damit ist erstmals auch die Untersuchung sozialer Beziehungen als fundamental für das Verständnis des ländlichen Raums erkannt worden. In der Agrargeschichte sind bis in die 1970er Jahre drei Perspektiven entwickelt worden. Wilhelm Abel hat auf stark aggregierter Ebene über Preise, Erträge und Einkommen geforscht.2 In den 1960er Jahren verlagerte sich das Interesse mit den Arbeiten Friedrich Lütges dann auf Fragen von Agrarverfassung und Rechtstypologien und mit Günther Franz auf eine „politische Sozialgeschichte" des Bauernstandes.3 Mit der Hinwendung zur Erforschung sozialer Proteste modernisierte Peter Blickle die alte Agrargeschichte. Hier rückten erstmals soziale Beziehungen in den Fokus der Agrargeschichte, die damit eigentlich erst zur Geschichte der ländlichen Gesellschaft wurde.4 Bei Abels Ansatz hatten soziale Beziehungen dagegen keine Rolle gespielt, bei Lütge nur in Bezug auf die Beziehungen zwischen Herren und Bauern, während es bei Franz um externe Beziehungen zur adeligen Herrschaft ging. Hier kommt die Distanz auch der deutschen Agrargeschichte zur Sozialgeschichte, insbesondere in ihrer französischen Variante, zum Tragen, erklärte Marc Bloch doch bereits 1940 in seinem klassischen Werk über die Feudalgesellschaft die Untersuchung sozialer Beziehungen zu einem fundamentalen Problem.5 Allerdings ist die Geschichtswissenschaft dieser Erkenntnis lange Zeit kaum gefolgt; erst die mi1
2
3
4
5
Werner TROBBACH und Clemens ZIMMERMANN: Die Geschichte des Dorfes. Von den Anfängen im Frankenreich zur bundesdeutschen Gegenwart, Stuttgart 2006. Wilhelm ABEL: Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter, 2. Aufl., Hamburg 1966. Friedrich LOTGE: Geschichte der deutschen Agrarverfassung vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1968; Günther FRANZ: Geschichte des deutschen Bauernstandes vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart 1970; Zitat bei Werner TROßBACH: Bauern 1648-1806, München 1993, S. 51. Peter BLICKLE: Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300-1800, München 1988; für eine Diskussion dieser Entwicklung siehe Werner TROßBACH: Historische Anthropologie und frühneuzeitliche Agrargeschichte, in: Historische Anthropologie 5 (1997), S. 187-211, hier S. 187ff. und S. 194ff. Marc BLOCH: Die Feudalgesellschaft, Frankfurt a.M. 1982; zitiert nach Jürgen SCHLUMBOHM: Quelques Problèmes de Micro-Histoire d'une Société locale. Construction de liens sociaux dans la paroisse de Belm (17e-19e siècles), in: Annales HSS 50 (1995), S. 775-802, hier S. 775.
8
Kapittl 2: Hängt, Erbschaft und ttqjak Ung/eübbeit in der Umdheben GtteUscbaft
krohistorischen Ansätze erklärten die Rekonstruktion „du réseau des rapports sociaux dans lequel l'individu est pris" zu einem zentralen Anliegen. 6 Die sozialen Beziehungen innerhalb ländlicher Gemeinden, und zwar besonders diejenigen zwischen landbesitzenden Bauern und den wachsenden unterbäuerlichen Schichten, werden seit den 1970er Jahren von einigen Vertretern der deutschsprachigen Sozialgeschichte thematisiert. Insbesondere die von Forschern des Göttinger Max Planck-Instituts für Geschichte vorangetriebene Protoindustrialisierungsforschung ist hier wichtig.7 Die Bedeutung der Protoindustrialisierung für die demographische Entwicklung stand von Beginn an im Zentrum der Debatte, Franklin Mendels setzte sich bereits 1972 mit dieser Frage auseinander.8 Das Anwachsen der Unterschichten wurde dabei als Folge einer Durchbrechung der ,Kette zwischen Fortpflanzung und Erbschaft' gesehen: Frühe Eheschließungen, und damit eine höhere Fertilität, waren in dieser Sicht möglich, da der Lebensunterhalt nicht durch ererbten Besitz, sondern über eigenes Einkommen erlangt werden konnte. Eine frühe Familiengründung konnte unter den wirtschaftlichen Bedingungen der protoindustriellen Produktion nicht nur nützlich, sondern sogar notwendig sein, jedenfalls wenn die Familie als Produktionseinheit gebraucht wurde. Es konnte in der Folge gezeigt werden, dass die Bevölkerungszahl in protoindustriellen Regionen besonders stark anwuchs, obgleich auch agrarische Intensivierung zu einem beträchtlichen Bevölkerungswachstum führen konnte und der Zusammenhang zwischen Stellenerwerb und Heiratsverhalten auch für agrarische Gesellschaften noch längst nicht geklärt ist. Von erheblicher Bedeutung für das demographische System war allerdings die Frage, wie sehr und in welcher Weise protoindustrielle Hausindustrie und Landwirtschaft miteinander verflochten waren. Besonders in Ostwestfalen, wo die Leinenherstellung im Rahmen des Heuerlingssystems erfolgte, in dem die landlosen Produzenten partiell in die Hofwirtschaft der Bauern eingebunden waren, fanden Familien- und Haushaltsgründung nicht gänzlich unabhängig von der agrarischen Umwelt statt. Die Grundthese, dass „Proto-Industrialisierung im regionalen Rahmen Möglichkeiten zu einem wesentlichen Bevölkerungswachstum bot", ist insgesamt aber weitgehend bestätigt worden.9 6 7
8
9
Carlo GINZBURG und Carlo PONI: La micro-histoire, in: Le Débat 17 (1981), S . 133-136. Peter KRIEDTE, Hans MEDICK und Jürgen SCHLUMBOHM: Industrialisierung vor der Industrialisierung. Gewerbliche Warenproduktion auf dem Land in der Formationsperiode des Kapitalismus, Göttingen 1977, insbesondere Kapitel 2 über die protoindustrielle Familienwirtschaft. Franklin MENDELS: Proto-Industrialization: The First Phase of the Industrialisation Process, in: Journal of Economic History 32 (1972), S. 241-261; ders.: Industrialization and Population Pressure in Eighteenth-Century Flanders, New York 1981. Peter KJUEDTE, Hans MEDICK und Jürgen SCHLUMBOHM: Sozialgeschichte in der Erweiterung Proto-Industrialisierung in der Verengung? Demographie, Sozialstruktur, moderne Hausindustrie: eine Zwischenbilanz der Proto-Industrialisierungs-Forschung, in: Geschichte und Gesellschaft 18 (1992), S. 7 0 - 8 7 und 2 3 1 - 2 5 5 , Zitat S. 8 6 ; Christoph REINDERS-DOSELDER: Ländliche Bevölkerung vor der Industrialisierung: Geburt, Heirat und Tod in Steinfeld, Damme und Neuenkirchen 1650 bis 1850, Cloppenburg 1995; für eine kritische Diskussion von theoreti-
Soziale Begebungen in der ¡ändlubtn Gesellschaft
9
Die seit den 1980er Jahren entstandenen mikrohistorischen Dorfstudien nehmen dagegen das soziale Beziehungsfundament der ländlichen Gesellschaft stärker in den Blick. So befasst sich Rainer Beck in seiner Arbeit über das oberbayerische Unterfinning intensiv mit der Ökonomie des Dorfes und kommt aus dieser Perspektive zu der Erkenntnis, dass eine Untersuchung der sozio-ökonomischen Beziehungen von Bauern, Handwerkern und Tagelöhnern für ein Verständnis dieser Ökonomie unerlässlich ist Beck setzt sich, dieser Erkenntnis folgend, auch intensiv mit der Stellung der unterbäuerlichen Tagelöhner in der ländlichen Gesellschaft auseinander.10 Auch Kurt Wagner thematisiert die Verflechtung von Grundbesitz, politischer Vormachtstellung und sozialen Beziehungen von Pferde-, Kuh- und Ziegenbauern einerseits und Arbeitsleuten andererseits vor dem Hintergrund der beginnenden Industrialisierung im hessischen Dorf Körle.11 Dagegen beschränkt sich die Untersuchung von Gunter Mahlerwein auf die .Herren im Dorf, ausgehend von der Annahme, dass es sich bei der bäuerlichen Oberschicht um die Träger der Wandlungsprozesse innerhalb der ländlichen Gesellschaft handele. Mit nur wenigen Schlaglichtern auf generatives Verhalten und materielle Lebensstile bleiben Kleinbauern wie Tagelöhner weitgehend außen vor.12 Carola Lipp und Wolfgang Kaschuba haben in einem gemeinsamen Forschungsprojekt das schwäbische Dorf Kiebingen in seiner Gesamtheit untersucht und Bauern, Wirte, Handwerker, Wanderarbeiter, Leineweber und andere Dorfbewohner in die Analyse einbezogen. Während Kaschuba sich mit dem Wandel der dörflichen Welt im Modernisierungsprozess auseinandersetzte, hat Lipp das familiäre wie verwandtschaftliche Beziehungsgeflecht mit Bezug auf die dörfliche Sozialordnung untersucht.13
10
11
12
13
sehen Erklärungsansätzen des Bevölkerungswachstums siehe Küpker, Weber, S. 27ff.; zum Heiratsverhalten unter protoindustriellen und agrarischen Bedingungen siehe Georg FERTIG: „Wenn zwey Menschen eine Stelle sehen": Heirat, Besitztransfer und Lebenslauf im ländlichen Westfalen des 19. Jahrhunderts, in: Christophe DuHAMELLE und Jürgen SCHLUMBOHM (Hg.): Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Göttingen 2003, S. 93-124. Gehrmann zeigt das breite Spektrum an Einkommensmöglichkeiten im Zuge einer wachsenden Bevölkerung in Norddeutschland auf, in dem Protoindustrie nur eine Variante war: Rolf GEHRMANN: Bevölkerungsgeschichte Norddeutschlands zwischen Aufklärung und Vormärz, Berlin 2000. Rainer BECK: Unterfinning. Ländliche Welt vor Anbruch der Moderne, München 1 9 9 3 , hier besonders S. 252f. Kurt WAGNER: Leben auf dem Lande im Wandel der Industrialisierung. „Das Dorf war früher auch keine heile Welt". Die Veränderung der dörflichen Lebensweise und der politischen Kultur vor dem Hintergrund der Industrialisierung am Beispiel des hessischen Dorfes Körle, Frankfurt a.M. 1986. Gunter MAHLERWEIN: Die Herren im Dorf. Bäuerliche Oberschicht und ländliche Elitenbildung in Rheinhessen 1700-1850, Mainz 2001, S. 3. Wolfgang KASCHUBA und Carola LIPP: Dörfliches Überleben. Zur Geschichte materieller und sozialer Reproduktion ländlicher Gesellschaft im 19. und 20. Jahrhundert, Tübingen 1982.
10
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und sortale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Erst die im Umfeld des Göttinger Max Planck-Instituts entstandenen großen Mikrostudien stellten die sozialen Beziehungen ins Zentrum ihrer Arbeit. Hier fanden Konzepte, Theorien und zum Teil auch Methoden der Kultur- und Sozialanthropologie ihre Anwendung. 14 Damit wurde die Ökonomie zu einem Teilsystem der lokalen Gesellschaften, anders als bei Mooser oder auch noch bei Beck wird ihr keine dominante Position mehr in der historiographischen Darstellung zugestanden. 15 Gleichzeitig rückte damit aber ein klassisches Thema der Historischen Sozialwissenschaft wieder in den Mittelpunkt: die Herausbildung von Klassen im 19. Jahrhundert. 16 Insbesondere David W. Sabean und Jürgen Schlumbohm haben sich mit der Frage nach den Klassen in der ländlichen Gesellschaft auseinandergesetzt. Während Sabean in einer interaktionistischen Wendung des Klassenbegriffs auf Verwandtschaftsorientierung und verwandtschaftliche Strategien als Instrument von Klassenbildung verweist, ist Schlumbohms Befund eher skeptisch. Nur auf den ersten Blick handelte es sich bei dem osnabrückischen Kirchspiel Belm um eine moderne Klassengesellschaft, noch weniger um eine traditionelle bäuerliche Gesellschaft (peasant soäety). Soziale Ungleichheit war ein basales Strukturelement, das „weitreichende Auswirkungen auf die Lebenslaufmuster" hatte, doch wiesen die Lebenswelten von Angehörigen der verschiedenen Schichten auch erhebliche Gemeinsamkeiten auf. Dass die lokale Gesellschaft nicht in zwei Klassen zerfiel - wie Josef Mooser in seiner .Ländlichen Klassengesellschaft' postuliert hat — ist der Verflechtung von Bauern und Heuerlingen zu verdanken. „Grundlegend ist, dass sich in der ökonomischen und sozialen Praxis fast nie Klassen oder Schichten als Aggregate gegenübertraten, ja nicht einmal eine größere Zahl von Angehörigen der einen Gruppe einem Vertreter der anderen gegenüberstand. Dominierend war vielmehr die Verflechtung der Eigentumslosen in die Vielzahl der kleinen Einheiten der Höfe."17 Verflechtungen, mit anderen Worten soziale Netzwerke, waren also
,s
Siehe v. a. die Einleitung zu Hans MEDICK: Weben und Überleben in Laichingen, 1650-1900. Lokalgeschichte als allgemeine Geschichte, Göttingen 1996: Entlegene Geschichte? Lokalgeschichte als mikro-historisch begründete Allgemeine Geschichte, S. 13-37; Hans MEDICK: „Missionare im Ruderboot?" Ethnologische Erkenntnisweisen als Herausforderung an die Sozialgeschichte, in: Alf LÜDTKE (Hg.), Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt a.M. 1989, S. 48-84; Sabean, Kinship, Kap. 1. Zum Verhältnis von Eigentum und sozialen Beziehungen kann der Sammelband von Hans MEDICK und David W. SABEAN (Hg.): Emotionen und materielle Interessen. Sozialanthropologische und historische Beiträge zur Familienforschung, Göttingen 1984, inzwischen als Klassiker gelten; insbesondere der Beitrag von Sabean diskutiert das Verhältnis dieser beiden Kategorien: David W. SABEAN:,Junge Immen im leeren Korb": Beziehungen zwischen Schwägern in einem schwäbischen Dorf, a.a.O., S. 231-250; ähnlich auch der Beitrag von Martine SEGALEN: „Sein Teil haben": Geschwisterbeziehungen in einem egalitären Vererbungssystem,
16
Jürgen KOCKA: Lohnarbeit und Klassenbildung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in Deutsch-
17
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 622f.
14
a . a . O . , S. 181-198. l a n d 1 8 0 0 - 1 8 7 5 , B o n n 1983.
Soziale Begebungen in der ländlichen Gesellschaft
11
das zentrale Strukturelement der lokalen Gesellschaft. Erst auf dieser desaggregierten Ebene wird deutlich, dass Menschen im 18. und 19. Jahrhundert „die Mikrostrukturen ihres Zusammenlebens [veränderten], statt (...) sich dem Druck der Verhältnisse zu beugen".18 Man kann also fragen, ob man statt von einer Klassengesellschaft nicht vielmehr von einer Netzwerkgesellschaft sprechen muss. Wolfram Pyta hält etwa den Begriff der Dorfgemeinschaft für besser geeignet, um das Geflecht der sozialen Beziehungen noch im frühen 20. Jahrhundert zu beschreiben.19 Es zeichne sich durch eine „unausweichliche Dichte unmittelbarer Sozialkontakte", ein gemeinsames Ethos und eine kollektive Identität aus. Allerdings werden auch hier keine Beziehungen untersucht, da die Quellenbasis sich auf Aufzeichnungen von Pfarrern und Lehrern beschränkt. 20 Aus der klassischen ethnologischen Forschung ist das Konzept der ,peasant communities' bekannt, dass allerdings gerade nicht auf Beziehungen, wie etwa Verwandtschaft, sondern auf territoriale Einheit abhebt.21 Die Sozialgeschichte der ländlichen Gesellschaft bewegt sich damit im Spannungsfeld der drei Themenfelder soziale Beziehungen, Wirtschaft und Herrschaft. Wie die Studien von Sabean und Schlumbohm eindrucksvoll demonstriert haben, greifen diese Bereiche aber in hohem Maße ineinander. Weder ökonomische noch herrschaftliche Strukturen in der ländlichen Gesellschaft sind zu verstehen, wenn die Struktur der sozialen Beziehungen außer Acht gelassen wird. 22 So sind ländliche Märkte, entgegen den Erwartungen etwa der preußischen Reformer des 19. Jahrhunderts, keine von sozialen Netzwerken abgekoppelten Systeme der Ressourcenallokation; vielmehr handelt es sich bei Marktnutzung, familialer Redistribution und Reziprozität im sozialen Nahbereich um funktionale Äquivalente. 23 Sie konnten so zur Flexibilisierung der ländlichen Wirtschaft und der kommerziellen Integration bäuerlicher Betriebe beitragen. 24 Selbst die öffentliche Versteigerung von Land in Neckarhausen war weitgehend in den
18 19
20
21
22
23 24
Ebd., S. 624. Wolfram PYTA: Dorfgemeinschaft und Parteipolitik 1918-1933. Die Verschränkung von Milieu und Parteien in den protestantischen Landgebieten Deutschlands in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1996, Zitat auf S. 41. Der Begriff der Gemeinschaft geht zurück auf Ferdinand TÖNNIES: Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 4. Aufl., Berlin 1922. Dass „den Aufzeichnungen der dörflichen Bildungselite" für die Erforschung des „sozialen Umganges auf dem Lande" ein „eminent hoher Quellenwert" (ebd., S. 44) zukomme, ist allerdings kaum nachvollziehbar. Eric R. WOLF: Closed Corporate Peasant Communities in Mesoamerica and Central Java, in: Southwestern Journal of Anthropology 13 (1957), S. 1-18, hier bes. S. 3. Schlumbohm Lebensläufe; David W. SABEAN: Property, production, and family in Neckarhausen, 1 7 0 0 - 1 8 7 0 , Cambridge 1990, und Sabean, Kinship. G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt. Markus CERMAN: Bodenmärkte und ländliche Wirtschaft in vergleichender Sicht: England und das östliche Mitteleuropa im Spätmittelalter, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2004/2, S. 125-148.
12
Kapitel 2: Hein/, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Bereich von Verwandtschaft und Familie eingebunden. 25 Gerade die Untersuchung von Märkten hat also stark von den mikrohistorischen Ansätzen profitiert und die Bedeutung der sozialen Einbettung betont. 26 Umgekehrt kann man auch die Frage nach den sozialen Strukturen ländlicher Gesellschaften nicht von den wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen trennen. Für das württembergische Neckarhausen hat Sabean herausgearbeitet, wie sehr Machtverhältnisse von sozialen — und dass heißt vor allem von familialen und verwandtschaftlichen - Beziehungen geprägt waren. 27 Die starken Landgemeinden des süddeutschen Raums findet man in Nordwestdeutschland allerdings nicht; hier war der preußische Staat die zentrale Herrschaftsinstanz, die weitgehend ohne die Vermittlung durch lokale Herrschaftsträger auskam. 28 Die Arbeiten zum nordwestdeutschen Raum stellen daher auch die wirtschafdichen Strukturen stark in den Vordergrund. Dieses gilt sowohl für Friedrich-Wilhelm Henning, der sich v. a. mit den wirtschaftlichen Problemen der Bauern auseinandersetzte, als auch für Mooser, der anhand der Besitzverhältnisse eine ,Zwei-Klassen-Gesellschaft' konstatiert. 29 Gerade die protoindustrielle Produktion war allerdings nicht den unterbäuerlichen Schichten vorbehalten; die Annahme, dass Landarmut und -losigkeit nicht nur eine Ursache für die Entstehung der Protoindustrie waren, sondern dass es auch zu einer 25 26
Sabean, Property, bes. Kap. 16. Siehe Überblick und Diskussion bei Stefan BRAKENSIEK: Grund und Boden - eine Ware? Ein Markt zwischen familialen Strategien und herrschaftlichen Kontrollen, in: Rainer PRASS, Jürgen SCHLUMBOHM, Gerard BFCAUR und Christophe DUHAMELLE (Hg.), Ländliche Gesellschaften in Deutschland und Frankreich, 18.-19. Jahrhundert, Göttingen 2003, S. 269-290; Johannes BRACHT:
Abschied von der hohen Kante? Zur Bedeutung der frühen Sparkasse für ländliche Kapitalmärkte und Wirtschaftsbeziehungen am Beispiel Westfalens (1830-1866), in: Ira SPIEKER, Elke SCHLENKRICH, Johannes MOSER und Martine SCHATTKOWSKY (Hg.), UnGleichzeitigkeiten. Transformationsprozesse in der ländlichen Gesellschaft der (Vor-)Moderne, Dresden 2008, S. 37-60; Christine FERTIG: Kreditmärkte und Kreditbeziehungen im ländlichen Westfalen (19. Jh.): Soziale Netzwerke und städtisches Kapital, in: Gabriele B. CLEMENS (Hg.), Schuldenlast und Schuldenwert. Kreditnetzwerke in der europäischen Geschichte 1300-1900, Trier 2008, S. 161-175. 27 28
29
Sabean, Property und Kinship; siehe auch Kaschuba / Lipp, Überleben. Für einen Überblick ländlicher Gemeindeverfassung siehe Peter BLICKLE (Hg.): Landgemeinde und Stadtgemeinde in Mitteleuropa. Ein struktureller Vergleich, München 1991; der westfälische Bereich ist hier allerdings nicht vertreten. Siehe auch Robert von FRIEDEBURG: Ländliche Gesellschaft und Obrigkeit. Gemeindeprotest und politische Mobilisierung im 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 1997; Josef MOOSER: Gleichheit und Ungleichheit in der ländlichen Gemeinde. Sozialstruktur und Kommunalverfassung im östlichen Westfalen vom späten 18. bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, in: Archiv für Sozialgeschichte 19 (1979), S. 231-262. Friedrich-Wilhelm HENNING: Die Verschuldung westfälischer Bauernhöfe in der zweiten Hälfte des 18. Jh., in: H.-G. SCHLOTTER (Hg.), Landwirtschaft und ländliche Gesellschaft in Geschichte und Gegenwart. Festschrift für W. Abel zum 60. Geburtstag, Hannover 1964, S. 11-25; ders.: Dienste und Abgaben der Bauern im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1969; ders.: Bauernwirtschaft und Bauerneinkommen im Fürstentum Paderborn im 18. Jahrhundert, Berlin 1970; Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 198.
Soziale Begebungen in der ländlichen Gesellschaft
13
umfassenden ,Proletarisierung' protoindustrieller Trägerschichten kam, hat sich als nicht haltbar erwiesen. 30 Wie Jürgen Schlumbohm hat auch Markus Küpker gezeigt, dass in Tecklenburg (Westfalen) nahezu alle sozialen Schichten an der Leinenproduktion beteiligt waren. Die Leinenproduktion war an den Zugang zu Land gebunden, da es in den Weberdörfern keinen Markt für Rohstoffe - Hanf und Flachs - und für Garn gab. Neben der starken Präsenz der Bauern, die aufgrund ihrer Verfügung über Land und Arbeitskräfte die Leinenproduktion dominierten, führte dies vor allem zu einem engen Beziehungsgeflecht zwischen Bauern und landlosen Heuerlingen. Daneben waren Bauern in der Lage, ledige Frauen als Würkemägde in der Leinenproduktion zu beschäftigen. 31 Auch Schlumbohm stellt heraus, dass im angrenzenden Osnabrücker Land kaum jemand ausschließlich von der Löwendherstellung lebte, die Produktion erfolgte größtenteils im Winterhalbjahr. Auch hier fanden alle Schritte des Produktionsprozesses vom Anbau der benötigten Rohstoffe bis zum Weben im selben Haushalt statt. Hierfür pachteten die Heuerlinge Land gegen Arbeitsleistungen und Pachtzahlungen von den Bauern. 32 Damit gibt es für den nordwestdeutschen Textilgürtel bereits Hinweise auf eine enge Verflechtung von Bauern und unterbäuerlichen Schichten. 33 Generell stellt die genaue Untersuchung der Sozial- und Besitzstrukturen in protoindustriell geprägten Gebieten immer noch ein wichtiges Forschungsdesiderat dar. 34 Dabei sollte aber nicht übersehen werden, dass protoindustrielle Regionen im Verhältnis zu jenen, in denen nahezu ausschließlich agrarische Produktion betrieben wird, noch relativ gut erforscht sind. Über die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der agrarischen Tagelöhner und ihre Beziehungen zu den bäuerlichen Schichten, wie man sie etwa in der Soester Börde findet, ist weit weniger bekannt. 35 Die historische Forschung hat sich bisher eher für die Entwicklung gewerblicher Regionen interessiert, weniger
30
31
32 33
34
35
Kriedte / Medick / Schlumbohm, Sozialgeschichtc, S. 234; Ulrich PFISTER: Protoindustrie und Landwirtschaft, in: Dietrich EßELING und Wolfgang M A G E R (Hg.), Protoindustrie in der Region. Europäische Gewerbelandschaften vom 16. bis zum 19. Jahrhundert, Bielefeld 1997, S. 57-84. Küpker, Weber, Kap. 3; die nicht als Mikrostudie angelegte Arbeit leistet allerdings keine eingehendere Untersuchung der Beziehungen zwischen den Schichten. Schlumbohm, Lebensläufe, S. 68-72. Siehe auch Wolfgang MAGER: Protoindustrialisierung und agrarisch-heimgewerbliche Verflechtung in Ravensberg während der frühen Neuzeit, in: Geschichte und Gesellschaft 8 (1982), S. 435-474. Kriedte / Medick / Schlumbohm, Sozialgeschichte, S. 231 und 243. Mitterauer hat auf die „Weberbauern" des oberen Waldviertels aufmerksam gemacht, wo die hausindustrielle Arbeit ebenfalls in den bäuerlichen Haushalt integriert wurde; Michael MITTERAUER: Formen ländlicher Familienwirtschaft: Historische Ökotypen und familiale Arbeitsorganisation im österreichischen Raum, in: ders. und Josef EHMER (Hg.), Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften, Wien 1980, S. 185-323; zu protoindustriellen Trägerschichten siehe aber Ulrich PFISTER: Die Zürcher Fabriques. Protoindustrielles Wachstum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, Zürich 1992. Siehe Kapitel 3.4.
14
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
aber für rein agrarische ländliche Gesellschaften, in denen die hohe Produktivität der Agrarwirtschaft alle verfügbare Arbeitskraft nutzen konnte. 36
2.2 Familienstrategien? - Eine Forschungsdiskussion In vormodernen, ländlichen Gesellschaften umfassten Familienstrategien in erster Linie die Bereiche von Besitzweitergabe, betrieblichen Strategien, Heiratspolitik und sozialer Plazierung von Kindern. Die historische Forschung zu Familienstrategien konzentriert sich im Wesentlichen auf die Themenfelder Armut und Überleben sowie Transfers von Status und Ressourcen, mit anderen Worten, Heirat und Erben. Diese Arbeit nimmt beide Ansatzpunkte für Familienstrategien in den Blick, einmal die bäuerlichen, auf Status- und Hoferhalt zielenden Strategien, und zum anderen die Strategien derjenigen, die sich von Lohneinkommen ernähren mussten, also Strategien der Risikominimierung von Tagelöhnern angesichts unsicherer Arbeitsmärkte und des Bedarfs an Unterstützungsleistungen. In den letzten Jahren ist das Konzept der Familienstrategien, das mit der breiten Rezeption von Pierre Bourdieus wegweisendem Aufsatz über Heiratsstrategien und seines Buches über die kabylische Gesellschaft in die Geschichtswissenschaft eingezogen ist, problematisiert worden. 37 Insbesondere Pier Paolo Viazzo, Katherine A. Lynch und Theo Engelen haben dafür plädiert, das Strategiekonzept aufzugeben oder doch zumindest auf solche Fälle zu begrenzen, in denen direkte empirische Evidenz oder zumindest sehr starke indirekte Evidenz eines intentionalen Handelns der historischen Subjekte vorliegt. 38 Viazzo und Lynch wollen damit die Erforschung von Familienstrategien auf Akteure beschränken, die qualitativ auswertbare Texte hinterlassen haben, in denen strategisches Denken nachweisbar ist. Fehlen solche Dokumente, müssten Strategien auf Verhaltensmuster zurückgeführt werden; dies sei aber ihrer Meinung nach unzulässig. 39 Sie gehen dabei von zwei grundsätzlichen Annahmen aus, die nicht unbedingt weit tragen:
36 37
38
39
Pfister, Protoindustrie. Pierre BOURDIEU: Les strategies matrimoniales dans le system de reproduction, Annales E.S.C. 37 (1972), S. 1105-1127; eine gründlich überarbeitete Version des Artikels ist in einer deutschen Übersetzung erschienen: Pierre BOURDIEU: Boden und Heiratsstrategien, in: ders., Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1999, S. 264-287; Pierre BOURDIEU: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1979. Per Paolo VLAZZO und Katherine LYNCH: Anthropology, Family History, and the Concept of Strategy, in: International Review of Social History 47 (2002), S. 423-452; Theo ENGELEN: Labour Strategies of Families: A Critical Assessment of an Appealing Concept, in: International Review of Social History 47 (2002), S. 453-464. Viazzo / Lynch, Strategy, S. 450f.
Familienstrattgien? — Eine Forscbungsdiskussion
15
(1) Zum einen legen sie einen rational-choice-Ansatz zugrunde, der jede willentliche Entscheidung auf einer sehr hohen Reflektionsebene ansiedelt. Strategische Entscheidungen müssen demnach bewusst, also bedacht sein; damit sie von Historikern untersucht werden können, müssen sie aber auch ausgesprochen und schriftlich festgehalten werden - eine Anforderung, die auf die wenigsten Entscheidungen eines Menschen zutreffen wird, in historischen Kontexten angesichts geringer Schriftlichkeit noch weniger als heute. Sie grenzen diesen Anspruch von Bourdieus Annahme ab, dass Strategien auch ,unbewusst' verfolgt werden können. Damit wird Bourdieus Ansatz am anderen Ende einer Linie angeordnet, auf der es viele Abstufungen gibt — zwischen schriftlichem Festhalten von Intentionen und unbewussten Verhaltensweisen gibt es viele Zwischenstufen, auf denen die meisten menschlichen Handlungen verortet werden können. Dabei übersehen sie auch, dass menschliches Verhalten aus Erfahrungen abgeleitet sein und dennoch die beste Strategie darstellen kann.40 Gewohnheitsmäßige Verhaltensweisen können dazu beitragen, Informationskosten reduzieren und die Ergebnisse von Handlungen besser vorhersehbar zu machen, sich also als strategisch optimales Verhalten erweisen. Dies ist umso wichtiger, da Akteure in aller Regel gleichzeitig verschiedene, und manchmal auch widersprüchliche, Interessen haben, so dass die Folgen von Entscheidungen oft kaum zu überschauen sind.41 (2) Zum anderen gehen Viazzo und Lynch davon aus, dass mit dem Begriff der .Familienstrategien' grundsätzlich die Vorstellung eines kollektiven Akteurs verbunden ist, die individuelle Interessen und auch Strategien ignoriert. Ihr Ansatz, nur Individuen strategisches Verhalten zuzusprechen, wurde aber bereits von Fontaine und Schlumbohm als untauglich zurückgewiesen.42 Jürgen Schlumbohm hat jüngst darauf hingewiesen, dass die Erklärungskraft kausaler Mechanismen zwischen Familiensystemen, demographischem Verhalten und ökonomischen Ressourcen zu bezweifeln ist. Vielmehr muss man, ausgehend von der Mikroebene einzelner Personen, Familien und Haushalte, Strategien des Überlebens und der Reproduktion analysieren.43
40
41 42
43
Jan KOK: The Challenge of Strategy: A Comment, in: International Review of Social History 47 (2002), S. 465-485, hier S. 468; wie Bourdieu sprechen etwa auch Claverie und Lamaison davon, dass "die Wahl des Ehepartners (...) niemals zufallig [ist], sondern mehr oder weniger bewusst durch Strategien bestimmt, deren interne Logik auf der Zirkulation der Aussteuer zwischen einzelnen Geschlechtern gleichen Ranges beruht." Siehe Elisabeth CLAVERIE und Pierre LAMAISON: Der Ousta als Produktions- und Wohneinheit im Haut-Gevaudan im 17., 18. und 19. Jahrhundert, in: Neithard BULST, Joseph GOY und Jochen HOOCK (Hg.), Familie zwischen Tradition und Moderne, Göttingen 1981, S. 202-213, hier S. 208. Frederik BARTH: Process and Form in Social Life, London u. a. 1981, S. 100. Laurence FONTAINE und Jürgen SCHLUMBOHM: Household Strategies for Survival: An Introduction, in: International Review of Social History 45 (2000), S. 1-17, hier S. 7. Jürgen SCHLUMBOHM: Familienformen und demographisches Verhalten. Politische Debatten und empirische Befunde zum vorindustriellen Deutschland, in: Karl-Heinz ZLESSOW, Christoph REINDERS-DCSELDER und Heinrich SCHMIDT (Hg.), Frühe Neuzeit. Festschrift für Ernst Hinrichs, Bielefeld 2004, S. 219-231.
16
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft tmd soziale Ungleichheit in der ländticben Gesellschaft
In dieselbe Richtung zielt Jan Koks Anregung, zwischen kollektiven, individuellen und den Strategien von Eltern zu unterscheiden.44 Dieser Ansatz wird der Realität von Familienverhältnissen besser gerecht, denn Familien waren in der Vergangenheit zumeist kollektive Akteure, die z.B. Einkommen gemeinsam erwirtschafteten. Ebenso war die Verteilung der familiären Ressourcen, etwa im Erbgang, eine Frage, die alle Familienmitglieder anging. Es handelte sich dabei um eine Schnittstelle individueller wie kollektiver Interessen, die miteinander in Einklang gebracht werden mussten. Tamara K. Hareven hat mit ihren Arbeiten zu den Schwierigkeiten, Phasen in Lebensläufen von Familien und Familienmitgliedern miteinander in Einklang zu bringen, diese Zusammenhänge untersucht.45 Familienstrategien können demnach als kollektive Entscheidungen verstanden werden, in denen individuelle Interessen einzelner Familienmitglieder unterschiedlich stark zum Ausdruck kommen. Die kollektiven Interessen von Familien können nicht auf individuelle Interessen einzelner Familienmitglieder reduziert werden, das würde dem komplexen System .Familie' nicht gerecht. Jan Kok spricht sich in seiner Replik auf Viazzo/Lynch und Engelen dafür aus, das Konzept der Familienstrategien im Zusammenhang mit methodisch innovativer empirischer Forschung weiter zu entwickeln. Beispiele hierfür sieht er in den Arbeiten von Hilde Bras und Martin Dribe. Beide arbeiten mit einem Lebenslaufansatz und setzen individuelle und familiäre Abläufe miteinander in Beziehung. Mithilfe der von beiden angewandten Event-History-Analyse können große Datensätze mit Lebenslaufdaten analysiert werden. 46 Sie demonstrieren, dass man mit anspruchsvollen statistischen Methoden, die eine Analyse großer Datenmengen auf individueller Ebene erlauben, in die Black Box der familiären Entscheidungsfindung blicken kann, auch wenn keine Absichtserklärungen der historischen Akteure vorliegen. Mit demselben methodischen Instrumentarium hat auch Georg Fertig gearbeitet und so die innere Logik von Hofübergaben und Familiengründungen beleuchtet.47
44 45
46
47
Kok, Strategy, S. 467. Tamara K. HAREVEN: Family Time and Historical Time, in: Michael MITTERAUER und Reinhard SIEDER (Hg.), Historische Familienforschung, Frankfurt a.M. 1982, S. 64-87; Tamara K. HAREVEN: Synchronizing individual time, family time, and historical time, in: John BENDER und David E. WELLBERRY (Hg.), Chronotypes: The Construction of Time, Stanford 1991, S. 821 6 7 ; Tamara K. HAREVEN und Kathleen A D A M S : Leaving Home: Individual or Family Strategies, in: James LEE, Michel ORIS und Frans VAN POPPEL (Hg.), The Road to Independence: Leavers and Stayers in the Household in Europe, Bern 2004, S. 339-365. Hilde BRAS: Zeeuwse meiden. Dienen in de levensloop von vrouwen, ca. 1 8 5 0 - 1 9 5 0 , Amsterdam 2 0 0 2 ; dies, und Jan K O K : „Naturally, Every Child Was Supposed to Work". Determinants of the Leaving Home Process in the Netherlands, 1 8 5 0 - 1 9 4 0 , in: James LEE, Michel O R I S und Frans VAN POPPEL (Hg.), The Road to Independence: Leavers and Stayers in the Household in Europe, Bern 2 0 0 4 , S. 4 0 3 - 4 5 0 ; Martin DRIBE: Leaving Home in a Peasant Society: Economic Fluctuations, Household Dynamics and Youth Migration in Southern Sweden, 1 8 2 9 - 1 8 6 6 , Södertalje 2 0 0 0 . G. Fertig, Lebenslauf.
Ehe und Heirat
17
2.3 Ehe und Heirat Die ökonomische Bedeutung der Heirat ist schon oft Gegenstand historischer Untersuchungen gewesen. Angeregt wurde das Interesse für Heiratsverhalten und Heiratsstrategien durch eine lange ethnologische Forschungstradition, die vor allem auf Arbeiten von Edmund Leach und Claude Lévi-Strauss zurückgeht, aber bereits eine ältere Tradition hat.48 Wichtig für die geschichtswissenschaftliche Forschung wurden die frühen, ethnographisch angelegten Arbeiten von Pierre Bourdieu, die allerdings erst mit der Durchsetzung des mikroanalytischen Blicks auf größere Resonanz stießen. Bourdieu stellte die Bedeutung von Heiratsstrategien heraus, die sich nicht in der Befolgung von Regeln erschöpfte.49 Vielmehr zielten die Heiratsentscheidungen darauf, materielles und symbolisches Kapital einer Familie zu bewahren oder zu vermehren.50 Gleichzeitig waren Familien in vielen ländlichen Gebieten darauf bedacht, dass die Partnerwahl das gesellschaftliche Gleichgewicht nicht gefährdete. In diese Richtung argumentieren etwa Elisabeth Claverie und Pierre Lamaison, die im Gévaudan (südliches Zentralmassiv) ein System von .Häusern' gefunden haben, das sich durch sorgfältige Vermeidung von Besitzkonzentration (etwa durch die Heirat von zwei Hauserben) auszeichnete und gleichzeitig durch Heirat vermittelte klientelartige Strukturen aufwies.51 Als Christophe Duhamelle, Pat Hudson und Jürgen Schlumbohm vor einigen Jahren zu einer Konferenz über .Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts' nach Göttingen einluden, ging es ihnen darum, eine Zwischenbilanz auf (nordwest-) europäischer Ebene zu ziehen.52 Dies erschien geboten, nachdem die These eines spezifisch europäischen Heiratsmusters durch neuere, vor allem empirisch orientierte Forschung und durch einen sich in der Forschung abzeichnenden Perspektivwandel in die Kritik geraten war. Der Mechanismus, der Eheschließung und ökonomische Ressourcen miteinander verknüpfen und die Heirat junger Menschen von der Existenz einer .Stelle' oder .Nische' abhängig machte, ist von verschiedenen Seiten 48
Siehe etwa Edmund LEACH: Political Systems of Highland Burma. A Study of Kachin Social Structure, London 1954; Claude LÉVI-STRAUSS: Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Frankfurt a.M. 1981; eine frühe Untersuchung, die Heirat, soziale Beziehungen und ökonomische Transaktionen analysiert, ist Franz BOAS: The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians, in: Report of the U.S. National Museum for 1895 (1897), S. 311-738; kritisch zu Theorien über die ökonomische Logik der Heirat in der ethnologischen Forschung: Laurel BOSSEN: Toward a Theory of Marriage: The Economic Anthropology of Marriage Transactions, in: Ethnology 27 (1988), S. 127-144.
49
Bourdieu, Heiratsstrategien, S. 264ff. Bourdieu, Entwurf, S. 273. Elisabeth CLAVERIE und Pierre LAMAISON: L'Impossible Marriage. Violence et parenté en Gévaudan XVII e , X V I i r et XIX C siécles, Paris 1982. Christophe DUHAMELLE und Jürgen SCHLUMBOHM: Einleitung: Vom europäischen Heiratsmuster* zu Strategien der Eheschließung?, in: dies. (Hg.), Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Göttingen 2003, S. 11-33.
50 51
52
18
Kapittl 2: Heim/, Erbschaft und ¡ondale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
her kritisiert worden. Die Vielfältigkeit der Heiratspraktiken, die in den historischen Studien herausgearbeitet worden sind, ließen das europäische Heiratsmuster eher als „Repertorium von anpassungsfähigen Systemen denn als ein einziges Muster" 53 erscheinen. Neuere Ansätze fragen jenseits von durch aggregativ-statistische Methoden ermittelten Durchschnitten und Trends nach konkreten Lebensläufen, die das Verhältnis von Heirat und Ressourcentransfers in einem neuen Licht erscheinen lassen. Die Fokussierung auf die Akteure, ihre Handlungsspielräume und Strategien, hat die Frage nach den Bedingungen der Eheschließung über das Feld der ökonomischen Zwänge hinaus erweitert. Der in Folge der Konferenz von Duhamelle und Schlumbohm herausgegebene Band fuhrt nicht nur die Vielfalt der Heiratsmuster und -Strategien vor, sondern auch die Vervielfältigung des wissenschaftlichen Instrumentariums. Im Anschluss an diese Arbeiten stellt sich die Frage, ob „bei der Analyse des Heiratsverhaltens in Europa die Vielfalt als Gegensatz zu jedem Muster begriffen werden muss oder ob die Vielfalt das eigentliche europäische Muster ausmachte." 54 Die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Heiratsstrategien an die jeweiligen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten würde in diesem Sinne eine Besonderheit des vormodernen Europas darstellen, die den Weg in die Moderne weist. In eine ähnliche Richtung argumentiert Josef Ehmer in seinem breit angelegten Überblick zur Heirat im langen 19. Jahrhundert. Schon im 18. Jahrhundert war eine Debatte über die Ehe entbrannt, deren Positionen die Vorstellungen von Heirat und Ehe z.T. bis heute prägen. In diesem Diskurs stand die Heirat in einem anhaltenden Spannungsfeld von individuellen Wünschen einerseits und familiären Bindungen und gesellschaftlichen Interessen andererseits. Die Ehe wurde (und wird bis heute) als gesellschaftliche Institution verstanden, auf die der Einzelne nur eingeschränkten Zugriff hat. 55 Dabei hat die nunmehr vier Jahrzehnte andauernde Erforschung von Heirat und Familie eine kaum zu überschauende Vielfalt der Muster und Praktiken hervortreten lassen, die sich kaum auf einheitliche und allgemeingültige Trends reduzieren lassen. Die gesellschaftlich stabilisierende Funktion der Ehe stand dabei im Zentrum der meisten Ehediskurse, etwa über die Möglichkeit der Ehescheidung oder den Vertragscharakter der Ehe. 56 Ihre stabilisierende Wirkung konnte die Ehe aber nur dort entfalten, wo sie gewissermaßen auf eigenen, festen Füßen stand, und nicht auf die materielle Unterstützung von außen angewiesen war. Groß war daher die Sorge der Eliten um das Heirats- und Reproduktionsverhalten der unteren Schichten. Diese Sorge ging so weit, dass es in einigen Regionen zu obrigkeitlichen Eingriffen in das Heiratsverhalten kam,
53
54 55
54
Ebd. S. 13; siehe auch Edward A. WRIGLEY: Marriage, fertility and population growth in 18thcentury England, in: Richard. B. OUTHWAITE (Hg.), Marriage and society. Studies in the social history of marriage, London 1981, S. 137-185. Duhamelle / Schlumbohm, Einleitung, S. 25. Josef EHMER: Marriage, in: David I. KERTZER und Marzio BARBAGLI (Hg.), Family Life in the Long Nineteenth Century 1789-1913, New Haven 2002, S. 282-321. Ebd., S. 287.
Ehe und Heirat
19
und Heirat zu einem Privileg der wohlhabenden Schichten wurde. Dabei war der Verweis auf die drohende Verarmung und Übervölkerung aber oft genug nur Legitimation einer restriktiven Heiratspolitik, die anderen Zwecken diente. So hat Elisabeth Mantl gezeigt, dass die Einführung des Heiratskonsenses eben nicht mit der Entwicklung eines .leichtsinnigen' und uneingeschränkten Heiratsverhaltens der Unterschichten zusammenhing. Vielmehr blieben die Paare, die im 19. Jahrhundert einer veränderten Heiratslogik folgten, auch weiterhin der Vorstellung verpflichtet, dass eine Eheschließung nur auf der Basis eines selbständigen und auskömmlichen Wirtschaftens möglich war. Was sich jedoch verändert hatte, waren die Wege der Überlebenssicherung. Mit den sich wandelnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verloren die herkömmlichen, an Besitz gekoppelten Ehevoraussetzungen an Bedeutung, während Einkommen aus unselbständiger Erwerbsarbeit wichtiger wurden. Die Heiratskontrolle diente also der Verstetigung einer an Besitz ausgerichteten sozialen und politischen Ordnung.57 Jüngst haben Jan Luiten van Zanden und Tine de Moor das Aufkommen des Europäischen Heiratsmusters in England und den Niederlanden im 17. Jahrhundert nicht nur auf wachsende Arbeitsmärkte, die auch Frauen ein relativ selbständiges Erwirtschaften eines eigenen Einkommens garantierte, und damit der Formation einer marktorientierten Wirtschaftsweise zurückgeführt, sondern umgekehrt den Schluss gezogen, dass dieses Heiratsverhalten überhaupt erst das europäische Wirtschaftswachstum ermöglicht hat. Insbesondere in England, wo weder das protestantische noch das neue katholische Eheverständnis wirksam wurde, blieb die Eheschließung einzig am Konsens der Partner ausgerichtet, ohne die in Kontinentaleuropa im Zuge der Konfessionalisierung verschärften Einflussmöglichkeiten von Eltern und Gemeinden. Die Autorität der Eltern wurde ebenso durch Erbsysteme geschwächt, die Töchtern zum einen gleiche Erbrechte zugestanden, und zum anderen die Herausgabe dieses Erbes nicht an eine Heirat banden. Vor diesem Hintergrund boten Arbeitsmärkte jungen Menschen die Gelegenheit, sich dauerhaft von ihren Eltern zu emanzipieren, und gleichzeitig dienten sie der Ausbildung von Männern wie Frauen. Das hatte wiederum massive Rückwirkungen auf intergenerationelle Transfers: Anders als etwa in China oder Indien waren junge Familien nicht in patriarchalische Haushalte eingebunden, in denen ein Großteil der erwirtschafteten Ressourcen den alten Eltern zukam, sondern sie konnten in die eigenen Nachkommen investiert werden. In dieser Argumentation führte das Europäische Heiratsmuster zu einem langfristigen wirtschaftlichen Aufschwung, der sowohl an demographische Faktoren wie auch an Bildungseffekte eines Arbeitsmarktes gebunden war. 58
57
58
Elisabeth MANTL: Heirat als Privileg. Obrigkeitliche Heiratsbeschränkungen in Tirol und Vorarlberg 1820 bis 1920, Wien 1997, S. 230ff. Jan Luiten VAN ZANDEN und Tine DE MOOR: Girlpower. The European Marriage Pattern (EMP) and Labour Markets in the North Sea Region in the Late Medieval Period, in: Jan Luiten VAN ZANDEN, The Lond Road to the Industrial Revolution. The European Economy in a Global Perspective, 1 0 0 0 - 1 8 0 0 , Leiden 2009, S. 101-141; auch Josef Ehmer setzt sich in seiner Habilitationsschrift mit dem Verhältnis von europäischem Heiratsverhalten in seiner erheb-
20
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und ¡oyjalt Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Die Frage, ob Menschen in der Vergangenheit wie auch in der Gegenwart überhaupt heiraten woll(t)en, wird in den meisten Studien gar nicht gestellt. Dass der Wunsch zu einer Eheschließung aber keineswegs so selbstverständlich war, wird im sechsten Kapitel diskutiert. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Heiratserlaubnis ist schnell beantwortet; es brauchte sie in Preußen nicht. Sobald junge Menschen volljährig wurden, stand es ihnen frei, sich zu verheiraten. Eine elterliche Einwilligung war dann nicht mehr nötig, und es gab weder auf gesetzlicher noch auf gemeindlicher Ebene Eheverbote oder -hindernisse. Damit unterscheiden sich die hier untersuchten Orte deutlich von anderen deutschsprachigen Gebieten, etwa von Südwestdeutschland und Österreich, aber auch vom Königreich Hannover, in dem 1827 - wie in vielen anderen deutschen Staaten — Ehebeschränkungen eingeführt wurden. So durfte in Belm kein Pfarrer eine Trauung vornehmen, ohne dass die Brautleute ihm eine Erlaubnis des Amtes vorlegten; diese konnte wiederum nur ausgestellt werden, wenn eine Gemeinde die Möglichkeit der Ansiedlung bestätigte. Schlumbohm kommt aber zu dem Schluss, dass diese Ehebeschränkungen keine große Wirkung entfalteten. 59 Für die württembergische Gemeinde Kiebingen ist Carola Lipp dagegen zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Hier versuchten die dörflichen Eliten schon vor dem Erlass von Gesetzen, die Eheschließungen beschränkten, und die Ansiedlung insbesondere von besitzlosen Paaren zu verhindern. Nachdem die Bürgerrechtsgesetze 1828/33 in Kraft traten, die die Erlaubnis einer Eheschließung von der Aufnahme in das Bürgerrecht abhängig machten, konnte der Gemeinderat seine restriktive Politik ausbauen. Tagelöhner und Lohnhandwerker waren hiervon besonders betroffen, zwischen 1828 und 1871 wurden 20 Heiratsgesuche abgelehnt. 60 Dass relativ viele Menschen dauerhaft unverheiratet blieben, wird auf diese restriktive Gemeindepolitik zurückgeführt. So kontrastieren hier zwei Gemeinden mit ähnlichen Ehegesetzen, in denen sich diese Beschränkungen jedoch sehr unterschiedlich stark auswirkten. Für Kiebingen führt Lipp die schwierige ökonomische Lage an, in der die besitzenden Schichten ihre Pfründe zu verteidigten suchten. Doch auch die im nordwestdeutschen Textilgürtel wichtige protoindustrielle Produktion befand sich in einer schweren Krise, ohne dass größere Auswirkungen auf das Heiratsverhalten der ärmeren Schichten festzustellen sind.
59
60
liehen Variabilität und der Durchsetzung des Kapitalismus auseinander; siehe Josef EHMER: Heiratsverhalten, Sozialstruktur, ökonomischer Wandel. England und Mitteleuropa in der Formationsperiode des Kapitalismus, Göttingen 1991. Schlumbohm, Lebensläufe, S. l l l f . ; Ehmer, Heiratsverhalten; Mantl, Heiratsbeschränkungen; Klaus-Jürgen MATZ: Pauperismus und Bevölkerung. Die gesetzlichen Ehebeschränkungen in den süddeutschen Staaten während des 19. Jahrhunderts, Stuttgart 1980; Margareth LANZINGER: Das gesicherte Erbe. Heirat in lokalen und familialen Kontexten: Innichen 1700 -1900, Wien u.a. 2003, S. 126ff. Kaschuba / Lipp, Überleben, S. 312ff, hier bes. S. 318.
Ehe und Heirat
21
Heiratsbeschränkungen waren also in Nordwestdeutschland generell nicht sehr restriktiv und in den hier untersuchten Gemeinden praktisch unbekannt.61 In Preußen galt das Prinzip unbeschränkter Verehelichungsfreiheit, das nur durch die erforderliche Einwilligung der Eltern bei Minderjährigen begrenzt war. Warnungen vor Übervölkerung und Pauperismus und politische Bestrebungen der Heiratsbeschränkungen in den 1850er Jahren führten nicht zum Ziel, so dass bis zur Gründung des Norddeutschen Bundes, und damit bis zur generellen Aufhebung der Heiratsbeschränkungen in Norddeutschland, keine restriktive Heiratspolitik durchgesetzt werden konnte.62 Ähnlich wie in den von Mantl untersuchten österreichischen Gebieten führte die wirtschaftliche Entwicklung auch hier zu erweiterten Einkommensmöglichkeiten, die von unmittelbarem Besitz etwa an Grund und Boden zunehmend abgekoppelt waren. Grundsätzlich konnte also Jeder und Jede heiraten, sofern er oder sie in der Lage war, ein Arbeitseinkommen zu erzielen und einen potentiellen Ehepartner für sich zu gewinnen. Das Heiratsverhalten der besitzenden Schichten blieb aber ein mächtiger Steuerungsmechanismus, der die Reproduktion der sozialen Ordnung — und damit insbesondere der ausgeprägten sozialen Ungleichheit - garantierte. Die weitgehend geschlossenen Heiratskreise der Bauern, gepaart mit einer ausgeprägten Abwärtsmobilität der Nebenerben, stabilisierten die sozialen Verhältnisse.63 Auch hier hatte die Konservierung der dörflichen Ordnung also einen Preis — nur dass er in dieser Perspektive eher von den Kindern der Bauern als den heiratswilligen, aber nicht ,konsensfähigen' Unterschichten bezahlt werden musste. Dass die überzähligen Bauernkinder allerdings nicht, wie in der zeitgenössischen Literatur angenommen, zu Ehelosigkeit oder selbstlosem Dienen auf dem Elternhof verdammt waren, ist seit langem bekannt. Im Wesentlichen standen den Bauernkindern, die den elterlichen Hof nicht übernehmen konnten, drei Optionen offen. Die Attraktivste war wohl die Heirat auf einen anderen Hof, wobei Statuserhalt oder gar -Verbesserung nicht immer realisiert werden konnte. Aber auch für diejenigen, die nicht auf einen Hof heiraten konnten, war Familien- und Haushaltsgründung zumindest im späten 18. und 19. Jahrhundert in der Regel möglich. In Westfalen gab es genügend, wenn auch regional unterschiedliche Möglichkeiten, eine Familie durchzubringen. Eine auf Arbeitseinkommen aufbauende 61
62 63
In den hier untersuchten Gemeinden gab es keine generellen Ehebeschrankungen, sondern nur eine Konsenspflicht für Hofbesitzer: Wenn ein Hofbesitzer oder -nachfolger heiraten wollte, musste er den Konsens des Grundherren einholen. Dieser durfte aber nicht ohne weiteres verweigert werden, etwa wenn der aufheiratende Partner kein Geld mitbrachte, aber als tüchtiger Landwirt bekannt war. Die Verweigerung des Konsenses war auch kein Heiratsverbot; der Hofbesitzer musste zwar damit rechnen, den Hof zu verlieren, die Ehe war aber nicht etwa ungültig. Zweck dieses Heiratskonsenses war, dass Höfe nicht qua Heirat an ungeeignete Personen gelangten. Dass die Eheschließung an sich nicht kontrolliert wurde, wird schon daran ersichtlich, dass ungesessene Eigenbehörige (ohne Hof) keinen Heiratskonsens benötigten. Siehe auch Klaus ScharpwinKEL: Die westfälischen Eigentumsordnungen des 17. und 18. Jahrhunderts, Göttingen 1965. Ehmer, Heiratsverhalten, S. 52f.; Matz, Pauperismus, S. 175. Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 194f.
22
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Existenz, die ein selbständiges Leben garantieren konnte, war also auch hier für alle erreichbar, und zwar sowohl für die Kinder von Bauern ebenso wie für Tagelöhner- oder Handwerkerkinder. Dass sich die Lebenschancen der Bauernkinder von denen der Kinder der Besitzlosen unterschieden, ergibt sich aber einerseits aus ihrer in Kapitel 5 beschriebenen besseren Einbindung in soziale Netzwerke, andererseits aus den ihnen durch Erbabfindung zur Verfügung stehenden Mitteln. Eine dritte Möglichkeit war die Abwanderung. Von regelrechter Auswanderung kann man nur für das ostwestfalische Kirchspiel Löhne sprechen. Aus dem Hellweggebiet wanderten kaum Menschen nach Übersee aus - die erheblichen Einkommensmöglichkeiten im ländlichen Bereich, aber auch im unmittelbar angrenzenden Ruhrgebiet dürften hier eine große Rolle gespielt haben.64 Daneben gab es aber auch regionale Mobilität, also das Verlassen des Kirchspiels, um sich in einem anderen Ort zu verheiraten. Diese Form der Abwanderung ist schlecht dokumentiert, so dass empirisch fundierte Aussagen hierüber schwer zu treffen sind. Man kann allerdings das andere Ende dieses Weges betrachten — die Heiratswanderung in einen Untersuchungsort (Kapitel 6). Die Wahl des Ehepartners fand in ländlichen Gemeinden in einem sozialen Umfeld statt, dem sich niemand entziehen konnte. Schon früh hat die mikrogeschichtlich angelegte Forschung darauf hingewiesen, dass der Einfluss der Eltern auf die Heiratswahl nicht überbewertet werden sollte. Die ,peergroup' der Gleichaltrigen war ganz erheblich an der Paarbildung beteiligt. Dabei spielten neben Festen und Feiern auch Geselligkeitsformen wie etwa das gemeinsame Spinnen eine wichtige Rolle.65 Marion Lischka hat aufgezeigt, wie sich das gesamte Umfeld eines jungen Paares mit der Legitimität seiner Beziehung befasste, angefangen bei der Frage, ob es sich überhaupt um eine Eheanbahnung handelt, bis hin zu der ökonomischen und sozialen Angemessenheit der angestrebten Konstellation. Neben der ,peergroup' und den Eltern waren auch Geschwister, Nachbarn und Verwandte an den Diskursen über junge Paare beteiligt. 66 Neben sozio-ökonomischen Faktoren war aber auch die Religiosität eine Frage, der in einigen Kontexten eine große Bedeutung zukam. Besonders in der auch in Ostwestfalen seit den 1760er Jahren wichtigen Erweckungsbewegung spielte die Frömmigkeit des zukünftigen Ehepartners eine zentrale Rolle.67 „Die führenden Theologen drän64
65
66
67
Siehe Walter P. KAMPHOEFNER: Westfalen in der Neuen Welt. Eine Sozialgeschichte der Auswanderung im 19. Jahrhundert, Göttingen 2006, Karte S. 46. Hans MEDICK: Spinnstuben auf dem Dorf: Jugendliche Sexualkultur und Feierabendbrauch in der ländlichen Gesellschaft der frühen Neuzeit, in: Gerhard HUCK (Hg.), Sozialgeschichte der Freizeit: Untersuchungen zum Wandel der Alltagskultur in Deutschland, Wuppertal 1980, S. 19-49; Rainer BECK: Illegitimität und voreheliche Sexualität auf dem Land. Unterfinning 1671 —1770, in: Richard VAN DÜLMEN (Hg.), Kultur der einfachen Leute, München 1983, S. 112-150. Marion LLSCHKA: Liebe als Ritual. Eheanbahnung und Brautwerbung in der frühneuzeitlichen Grafschaft Lippe, Paderborn 2006. Andreas GESTRICH: Partnerwahl und Familie im ländlichen Pietismus in Württemberg, in: Werner-Zeller-Stiftung (Hg.), Partnerwahl und Familie im ländlichen Pietismus in Württemberg, Göttingen 2008, S. 11-24.
Ehe und Heirat
23
gen auf eine strikte pietistische Endogamie; sie malen ein bedrohliches Inferno bei Missachtung dieser wichtigen Regel aus."68 Auch nach der Heirat konnte die Frage der Frömmigkeit zwischen Ehepartnern für Verwerfungen sorgen. Ein Beispiel aus Löhne ist das des Heuerlings Koch: Johann Jürgen Koch (*1744) war früh verwaist und zunächst von Verwandten, dann von einem wohlhabenden Bauern aufgezogen worden. Er heiratete bereits mit 19 Jahren eine 18jährige Bauerntochter. Nachdem er sich einige Jahre später der Erweckungsbewegung zugewandt hatte, bereitete es ihm großen Kummer, dass seine Frau „in der Finsternis blieb (...)". Erst mit ihrer .Erweckung' trat wieder Friede zwischen den Eheleuten ein.69 Im nordwestdeutschen Raum, wo Höfe ungeteilt, d.h. nach Anerbenrecht, übergeben wurden, spielte die Frage nach der ökonomischen Ausstattung der Brautleute eine große Rolle. Ein Hoferbe oder eine Hoferbin musste in der Lage sein, seine bzw. ihre Geschwister angemessen abzufinden; die Größe des Brautschatzes, der mit dem Ehepartner auf den Hof kam, war also für alle Beteiligten eine kritische Größe. Die Konzentration der bäuerlichen Heiratskreise auf Partner aus ähnlichen Verhältnissen findet hier ihre Ursache. Eine schichtenbezogene Endogamie der Eheschließung lässt sich also recht einfach erklären, auch wenn diese letztlich nur für die Hoferben der großbäuerlichen Schicht nachzuweisen ist, während es in den übrigen sozialen Schichten zu teilweise erheblicher Mobilität gekommen ist.70 Weniger intuitiv verständlich ist der in einigen Regionen zu beobachtende Trend zu Heiraten innerhalb der (näheren) Verwandtschaft; davon wird in Kapitel 3 die Rede sein. Heiratsstrategien betrafen aber nicht nur die Frage, wie ein passender Ehepartner für den Hofnachfolger zu finden sei. Umgekehrt stellte sich die Frage der sozialen Plazierung der übrigen Kinder, die aufgrund der Unteilbarkeit der westfälischen Höfe nicht mit Land ausgestattet werden konnten.71 Landbesitz war aber sowohl in der auf Agrarproduktion ausgerichteten Hellwegregion (mit dem Kirchspiel Borgeln) als auch im protoindustriellen Ostwestfalen (mit Löhne) für die Erwirtschaftung eines eigenständigen, nicht auf abhängiger Lohnarbeit basierenden Einkommens essentiell. Sollten die Kinder der Bauern also den Status ihrer Eltern erhalten, so musste man entweder versuchen, 68
69
70 71
Ulrike GLEIXNER: Zwischen göttlicher und weltlicher Ordnung. Die Ehe im lutherischen Pietismus, in: Pietismus und Neuzeit. Ein Jahrbuch zur Geschichte des neueren Protestantismus Bd. 28, Göttingen 2002, S. 147-184, hier S. 182. Johann Jürgen KOCH: Leben und Führung von Johann Jürgen Koch, einem armen Landmanne in Westfalen, Neu-Rüppin o. J., S. 12f.; in der Datenbank Löhne ist Koch unter der ID 15466 zu finden. Siehe hierzu Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 194f.; Schlumbohm, Lebensläufe, S. 419ff. Einschränkend muss hier darauf hingewiesen werden, dass in Borgeln Kinder einzelne Parzellen erhalten konnten. Es handelte sich um sogenannte Erbelande, die sich schon vor der Ablösung der grundherrlichen Rechte im ungeteilten Eigentum der Bauern befanden und über die sie deshalb frei disponieren konnten. Dabei handelt es sich aber immer nur um kleine Stücke Land, nicht um einen relevanten Teil des Hofes; eine Ansiedelung als Bauer war auf dieser Basis nicht möglich. Siehe G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 107ff.
24
Kapitel 2: Heim/, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
einen Hof zu erwerben — was aber aufgrund des wenig fluiden Bodenmarktes kaum möglich war 72 — oder man musste versuchen, eine gute Partie zu finden, die den sozialen Abstieg verhinderte. Dieser Prozess der sozialen Plazierung als Ergebnis familiärer Strategien ist zuerst von Bourdieu beschrieben worden.73 Eine besondere Schwierigkeit stellt die Identifizierung von innerfamiliären Vorgängen dar, die oftmals nur vom Ergebnis her, also hier v. a. anhand der intergenerationellen Mobilität, erkennbar sind.74 Hierbei kann es hilfreich sein, diese Ergebnisse und greifbare Variablen mit Hilfe von formalen Verfahren zu untersuchen, die genauere Aussagen über die Relevanz verschiedener Faktoren zulassen. 75 Neben den sozialen Beziehungen, deren Einfluss auf die soziale Plazierung in Kapitel 7 untersucht wird, stellt sich hier auch die Frage nach den intergenerationellen Transfers, also der Ausstattung der Kinder durch die Eltern. Heiratsentscheidungen hingen von verschiedenen Faktoren ab. Sie sind in der Regel auf drei Achsen anzusiedeln: (1) auf ökonomischer Ebene musste die Ernährung einer Familie möglich erscheinen, (2) auf emotionaler Ebene musste überhaupt ein passender Partner gefunden werden, und es musste (3) der richtige Zeitpunkt abgepasst werden. Die meisten Interpretationen von Heiratsverhalten zielen auf ökonomische Faktoren. Fundamental ist die Annahme, dass nur geheiratet wird, wenn die ökonomische Basis für eine eigenständige Unterhaltung einer Familie gegeben ist.76 Diese Basis konnte in ländlichen Gesellschaften grundsätzlich auf drei Wegen erreicht werden: Durch den Tod der Eltern konnte eine .Stelle' frei werden, etwa ein Hof, der im Erbgang an einen Nachkommen fiel. In gleicher Richtung konnte eine Hofübergabe wirken, also ein Ressourcentransfer noch zu Lebzeiten der Eltern. Ressourcentransfers gingen aber auch an diejenigen Bauernkinder, die nicht die Nachfolge auf dem Hof antraten. Sie erhielten in aller Regel eine Erbabfindung, zum Teil in Form einer regelrechten .Aussteuer', die bei der Etablierung eines eigenen Hausstandes hilfreich war. Damit hatten viele von ihnen bereits, was Kinder aus weniger wohlhabenden Häusern sich über die Zeit erarbeiten mussten: einen Heiratsfond. In zeitlicher Hinsicht ist also damit zu rechnen,
72 73 74
75
76
G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, Kap. 5. Bourdieu, Stratégies matrimoniales. Die damit verbundenen Schwierigkeiten diskutiert Heinz REIF: Theoretischer Kontext und Ziele, Methoden und Eingrenzung der Untersuchung, in: Jürgen KOCKA (Hg.), Familie und soziale Plazierung. Studien zum Verhältnis von Familie, sozialer Mobilität und Heiratsverhalten an westfälischen Beispielen im späten 18. und 19. Jahrhundert, Opladen 1980, S. 20-66. Siehe etwa zum Zusammenhang von Heirat, Hofübertragungen und vorehelicher Konzeption G. Fertig, Lebenslauf. Timothy Guinnane hat darauf hingewiesen, dass eine Erklärung allein über erwartbares Familieneinkommen, etwa gemessen in Reallöhnen, die ökonomischen Implikationen von Heiratsentscheidungen nicht adäquat reflektiert. Vielmehr müssen die Folgen dieser Entscheidung angesichts unterschiedlicher ökonomischer und institutioneller Rahmenbedingungen auch in ihren langfristigen Folgen, etwa für die Versorgung im Alter, bedacht werden. Timothy GUINNANE: Re-Thinking the Western European Marriage Pattern: The Décision to Marry in Ireland at the Turn of the Twentieth Century, in: Journal of Family History 16 (1991), S. 47-64.
Transfers, Erbsystem und Bequest Motive
25
dass Menschen nicht zu Beginn ihres Arbeitslebens heirateten, sondern zunächst eine ökonomische Basis für eine Familiengründung erarbeiteten. Hier können aber wiederum die Emotionen ihre eigene Logik zur Geltung bringen: Eine Schwangerschaft war in dem meisten Fällen Grund genug, bald zur Ehe zu schreiten. Im ländlichen Westfalen kam dem ,Stellenprinzip' keine regulierende Funktion zu; für eine Eheschließung war weder der Tod der Eltern noch die Übertragung eines Hofes nötig. Die meisten Ehen wurden ohne jede Aussicht auf einen Hofes geschlossen. Aber auch viele Hoferben gründeten schon vor der Übertragung der Eigentumsrechte eine eigene Familie, also ohne die durch den Hofbesitz gewährleistete Absicherung. Landbesitz war durchaus hilfreich — wenn jemand einen Hof bekommen oder auch gekauft hatte, wurde eine baldige Heirat deutlich wahrscheinlicher. Viel wichtiger war jedoch die Frage, ob es mit der Heirat noch Zeit hatte — war ein Kind unterwegs, beschleunigte dies die Eheschließung ganz erheblich, und auch Hofübertragungen gingen nun schneller vonstatten. Voreheliche Schwangerschaften dürfen aber nicht durchweg als .Unfälle' verstanden werden. In vielen Fällen folgten sie wie die Heiraten einer ökonomischen Logik, wurden also durch die Erlangung von Landbesitz und durch gute konjunkturelle Bedingungen wahrscheinlicher. Die detaillierte Analyse auf der Ebene einzelner Lebensläufe führt nicht überall zu dem gleichen Ergebnis: In Borgeln, der landschaftlich wie wirtschaftlich besonders privilegierten Gemeinde, heiratete man weitgehend unabhängig von der Konjunktur, und auch Schwangerschaften hatten keinen so stark beschleunigenden Einfluss wie in den anderen Gemeinden. Mehr als die Hälfte der Familiengründungen begannen hier jedoch mit einer Schwangerschaft, die Heirat kam - wenn überhaupt - erst danach. 77
2.4 Transfers, Erbsystem und Bequest Motive Intergenerationelle Transfers bilden in vormodernen Gesellschaften das Rückgrat der sozialen Reproduktion. Die für moderne Gesellschaften typische Statuszuweisung über Bildung und Erwerbseinkommen spielte in der ländlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts praktisch keine Rolle. Dazu hat beigetragen, dass Land als zentrale Ressource und Quelle von Einkommen in Westfalen auch mit den Agrarreformen des 19. Jahrhunderts kaum auf den Bodenmarkt gelangte. Land und in noch ausgeprägterem Maße Höfe wurden hier beinahe ausschließlich innerhalb von Familien weitergegeben, z.T. innerhalb derselben Generation, etwa über Wiederheiraten verwitweter Hofbesitzer, schließlich aber an die nachfolgende Generation, deren Zugang zu relativem Wohlstand und einem gehobenen sozialen Status in erheblichem Maße von diesen Transfers bestimmt wurde. 78 77 78
G. Fertig, Lebenslauf, S. 93-124. Zur Rolle familiärer Transfers auf dem Bodenmarkt siehe G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt; zu Wiederheiraten von Hofbesitzern siehe Schlumbohm, Lebensläufe.
26
Kapitel 2: Heirai, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
Für die ältere Generation waren mit der Regelung der Nachfolge und der Verteilung des Erbes aber einige Probleme verbunden. Die alten Bauern waren für die Gestaltung ihres Lebensabends auch weiterhin auf die Erträge des Hofes angewiesen; eine davon unabhängige Alterssicherung gab es im 19. Jahrhundert nicht.79 Wenn sie sich auf den Altenteil zurückziehen wollten, mussten nun also die intergenerationellen Beziehungen eine für alle Parteien annehmbare Regelung erfahren. Dem Transfer eines Hofes an die Hofnachfolger standen Transfers der jungen Bauernfamilie an die Altenteiler gegenüber. Daneben mussten aber auch Fragen nach den Formen des Zusammenlebens, nach Pflichten und Aufgaben, Zuständigkeiten, Verfügungs- und Anweisungsrechten geregelt werden; immerhin war es gar nicht so selbstverständlich, dass die Hofübernehmer überhaupt das Recht erhielten, den Hof nach eigenem Gutdünken zu bewirtschaften.80 Zum anderen stellte aber das Anerbenrecht bäuerliche Familien vor das Problem, eine gerechte Regelung für alle aufwachsenden Kinder zu finden. Der Hof konnte, solange die grundherrlichen Rechte noch nicht abgelöst waren, nicht unter den Kindern aufgeteilt werden. Dass Bauern dies aber auch gar nicht anstrebten, wird in den Jahren nach den Ablösungen deutlich, in denen sich an der Übergabepraxis kaum etwas änderte.81 Die Familien fanden also auch jenseits einer Realteilung Möglichkeiten, 79 80
81
Bracht, Vermögensstrategien, Kap. 6.3. Christine FERTIG: Hofübergabe im Westfalen des 19. Jahrhunderts: Wendepunkt des bäuerlichen Familienzyklus?, in: Christophe DUHAMELLE und Jürgen SCHLUMBOHM (Hg.), Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Göttingen 2003, S. 65-92; Christine FERTIG und Georg FERTIG: Bäuerliche Erbpraxis als Familienstrategie: Hofweitergabe im Westfalen des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Stefan BRAKENSIEK, Michael STOLLEIS und Heide WUNDER (Hg.), Generationengerechtigkeit? Normen und Praxis im Erbund Ehegüterrecht 1500-1850, Berlin 2006, S. 163-187; Schlumbohm, Lebensläufe, S. 444ff.; Gertrude LANGER-OSTRAWSKY: Generationenbeziehungen im Spiegel von Testamenten und Übergabeverträgen, in: Josef EHMER und Peter GUTSCHNER (Hg.), Das Alter im Spiel der Generationen, Wien u. a. 2000, S . 259-282; Dana STEFANOVA und Hermann ZEITLHOFER: Alter und Generationenbeziehungen in Böhmen. Zum Ausgedinge in nord- und südböhmischen Dörfern in der Frühen Neuzeit, in: Josef EHMER und Peter GUTSCHNER (Hg.), Das Alter im Spiel der Generationen, Wien u.a. 2000, S. 231-258; Erhard CHVOJKA: „Dank sei ihnen, den guten und braven Schwiegereltern." Leitbilder in ländlichen Milieus des 18. und 19. Jahrhunderts, in: Josef EHMER und Peter GUTSCHNER (Hg.), Das Alter im Spiel der Generationen, Wien u. a. 2000, S. 283-319; Lanzinger, Erbe, S. 259ff. Die Höhe der Abfindungen steigt in dieser Zeit an; ob dies durch die Wertsteigerung der Höfe nach der Ablösung der grundherrlichen Rechte bedingt war oder aber auf die gestiegene Einkommensmöglichkeiten der Bauern zurückzuführen ist, ist unklar; C. Fertig und G. Fertig, Bäuerliche Erbprais, S. 179f. Zur Ablösung der grundherrlichen Lasten siehe Johannes BRACHT: Reform auf Kredit: Grundlastenablösung in Westfalen und ihre Finanzierung durch Rentenbank, Sparkasse und privaten Kredit (1830—1866), in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 54, Heft 2 (2006), S. 55-78; Joseph Goy hat gezeigt, wie Bauern entgegen den staatlichen Bemühungen um volle Teilbarkeit im Zuge der Einführung des Code civil an ihren gewohnten Praktiken festhielten. Siehe Joseph GOY: Heiratsstrategien und Erbfolge angesichts
Transfers, Erbsystem und Bequest Motive
27
das Erbe gerecht aufzuteilen, indem die Geschwister, die den Hof nicht übernehmen konnten oder wollten, abgefunden wurden. Diese Abfindungen entwickelten sich über das 19. Jahrhundert hinweg von Natural- zu monetären Abfindungen. 82 Sie konnten einen erheblichen Umfang erreichen; gemessen an dem (allerdings nur schwer zu bestimmenden) Wert des Hofes standen sie - unter Berücksichtigung der Lasten und Risiken, die Hofnachfolger übernehmen mussten — einer Realteilung kaum nach. 83 Hier stellt sich allerdings die Frage, warum bäuerliche Familien ihre .überzähligen' Kinder nicht, wie die Rede vom .weichenden Erben' suggeriert, mittellos fortschickten oder sie als billige Arbeitskräfte nutzten. In der Logik der auf der ,/ife cycle bypothesis of consumptiori basierenden Vorstellung eines ,bequest motive' wäre genau dies zu erwarten. 84 Die in Aussicht stehende Erbschaft sollte einen Anreiz für die junge Generation darstellen, die Eltern zu versorgen; dabei handelt es sich also um eine Alternative zu einem Prozess des An- und Absparens, bei dem der Lebensabend durch Aufbrauchen der angesparten Reserven bestritten würde. So könnte man erklären, warum alternde Menschen wenig Neigung zeigen, ihre Ersparnisse aufzubrauchen, und es z. T. sogar zu Akkumulation weiteren Vermögens kommt. 85 Die Vorstellung eines an ,bequest motives' orientierten Verhaltens ist allerdings schon vor einiger Zeit entschieden zurückgewiesen worden. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass das Spar- und Transferverhalten sich nicht mit einem ,bequest motive' erklären lässt. Michael D. Hurd konnte nachweisen, dass Paare mit Kindern in den 1970er Jahren sogar weniger ansparten als kinderlose Paare, dass Eltern aber sub-
82
83
84
85
der revolutionären Gesetzgebung des Codes Civil in der Bäuerlichen Gesellschaft Südfrankreichs (1789-1804), in: Neithard BULST, Joseph G O Y und Jochen HOOCK (Hg.), Familie zwischen Tradition und Moderne, Göttingen 1981, S. 125-137. Sauermann hat darauf hingewiesen, dass im frühen 18. Jahrhundert Bargeld eine wichtige Rolle in den bäuerlichen Brautschätzen einnahm, neben Vieh und den anfallenden Abgaben an den Grundherren. Erst im frühen 19. Jahrhundert gewannen Brautwagen und Kleidung an Bedeutung. Siehe Dietmar SAUERMANN: Brautschatzverschreibungen als Quelle für die Veränderungen der bäuerlichen Kultur im 18. Jahrhundert. Das Beispiel Lienen, in: Westfälische Forschungen 29 (1978/79), S . 199-222, siehe auch meine Magisterarbeit: Christine GROßE [verh. Fertig]: Ländlicher Haushalt und Ressourcentransfer im 18. und 19. Jahrhunder. Eine Fallstudie: Löhne, Kreis Herford, unveröff. Magisterarbeit, Münster 2001, S. 92ff. Die erheblichen Lasten, die ein Hofnachfolger mit der von ihm allein zu leistenden Versorgung der Altenteiler und der Abfindung der Geschwister übernehmen musste, müssen dabei in Rechnung gestellt werden. In Borgeln erreichten die Abfindungen etwa zwei Drittel des Wertes, der bei Realteilung zu erwarten wäre; C. Fertig / G. Fertig, Bäuerliche Erbpraxis, S. 180. Franco MODIGLIANI: The Role of Intergenerational Transfers and Life Saving in the Accumulation of Wealth, in: Journal of Economic Perspectives 2 (1988), S. 15-40; B . Douglas BERNHEIM, Andrei SHLEIFER und Lawrence H. SUMMERS: The Strategic Bequest Motive, in: Journal of Political Economy 93 (1985), S. 1045-1076; kritisch Laurence J. KOTLIKOFF: Intergenerational Transfers and Savings, in: Journal of Economic Perspectives 2 (1988), S. 41-58. Paul L. MENCHIK und Martin DAVID: Income Distribution, Lifetime Savings, and Bequests, in: American Economic Review 73 (1993), S. 672-690.
28
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
stanzielle Transferleistungen in Form von Konsum und (Aus-)Bildung an ihre Kinder erbrachten. Dabei handelt es sich aber gerade nicht um auf Wohlverhalten der (erwachsenen) Kinder zielende Erbstrategien, da die Transfers in einer Zeit geleistet werden, in denen die Kinder noch keine Unterstützung gewähren konnten.86 Nigel Tomes konnte darüber hinausgehend für in den Jahren 1964/5 angefallene Erbschaften in Cleveland, Ohio zeigen, dass Eltern die Lebens- und Einkommenssituation ihrer Kinder berücksichtigten und Kinder mit niedrigem Einkommen kompensatorisch einen größeren Erbteil erhielten, unabhängig davon, ob sie sich um ihre Eltern kümmerten (sie z. B. pflegten) oder nicht.87 Dem liegt das von Gary S. Becker und Nigel Tomes entwickelte Modell altruistischer Transfers zugrunde.88 Auch Maria G. Perozek hat für die USA in den 1980er Jahren keine Hinweise darauf gefunden, dass die Aussichten auf eine Erbschaft Kinder dazu bewegte, ihren Eltern mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen; andere Faktoren, wie Geschlecht, Anzahl der Geschwister, räumliche Nähe sowie das Vorhandensein eigener Kinder spielten dagegen eine wichtige Rolle.89 Die meisten Untersuchungen zu Erbschaftsregeln kommen zu dem Ergebnis, dass eine gleichmäßige Aufteilung des Erbes auf alle vorhandenen Kinder das vorherrschende Modell darstellt, und dass damit weder die Vorstellung eines strategischen bequest motive noch die vollkommen altruistischer Eltern zu halten ist. So kann man mit Hendrik Jürges schließen, dass die ökonomische Theorie der Familie bislang kaum zum Verständnis von Erbregeln beigetragen hat.90 Damit rücken für die ländliche Gesellschaft in Westfalen zwei Probleme in den Blick. Zum einen ist danach zu fragen, wie die Kinder unter der Bedingung des ungleichen Erbes behandelt wurden, zum anderen danach, wie intergenerationelle Transfers im 19. Jahrhundert organisiert waren. Bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde innerhalb der westfälisch-preußischen Behörden eine intensive Debatte um Teilbarkeit der Höfe geführt, die in die Verabschiedung des Gesetzes über die bäuerliche Erbfolge
86
87
88
89
90
Michael D. HURD: Savings of the Elderly and Desired Bequests, in: American Economic Review 77 (1987), S. 298-312. Nigel TOMES: The Family, Inheritance, and the Intergenerational Transmission of Inequality, in: Journal of Political Economy 89 (1981), S. 928-958. Gary S. BECKER: A Theory of Social Interactions, in: Journal of Political Economy 82 (1974), S. 1063-1093; Gary S. BECKER und Nigel TOMES: Child Endowments and Quantity and Quality of Children, in: Journal of Political Economy 84 (1976), S. 143-162. Maria G. PEROZEK: A Reexamination of the Strategic Bequest Motive, in: Journal of Political Economy 106 (1998), S. 423-445. Perozeks Datengrundlage ist der us-amerikanische National Survey of Families und Households von 1987. Hendrik JORGES: Die ökonomische Theorie der Familie und die Erklärung von Erbschaftsregeln - ein problemorientierter Überblick, MEA Discussion Paper 070-05, Mannheimer Foschungsinstitut Ökonomie und Demographischer Wandel (www.mea.uni-mannheim.de/publications/ meadp_070-05.pdf, letzter Zugriff am 6.5.2010).
Transfers, Erbsystem und Bequest Motive
29
von 1836 mündete.91 Schon früh machten Kritiker darauf aufmerksam, dass die bäuerliche Bevölkerung sich durch das Gesetz in ihren althergebrachten Gewohnheiten eingeschränkt sah.92 Die Haltung der Bauern wird auch daran deutlich, dass ihnen im 19. Jahrhundert der Begriff eines .weichenden Erben' unbekannt ist. So ist in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts im Kirchspiel Löhne in vielen Verträgen die Rede vom ,Anerben', der einen Hof übertragen bekommt oder, aus Gründen der aktuellen Familiensituation, nicht übertragen bekommen kann und daher für sein ,Anerbenrecht' besonders abgefunden wird. .Weichende Erben' kommen dagegen im Verständnis der Bauern nicht vor, nur Kinder, die angemessen abgefunden werden sollen. Im 20. Jahrhundert hat diese Vorstellung dagegen in den allgemeinen Diskurs um die Vererbung von Höfen Eingang gefunden.93 Dies mag einerseits auf die weiteren Bemühungen des Gesetzgebers zurückzuführen sein, den allgemeinen gleichen Erbrechten ein bäuerliches Sondererbrecht entgegenzustellen, wie es in der Etablierung des Höfegesetzes von 1882 (in Westfalen) und im Reichserbhofgesetz von 1933 seinen Niederschlag findet.94 Andererseits können die massiven Veränderungen der wirtschaftlichen Situation von Bauern nach dem 2. Weltkrieg zu der Erkenntnis geführt haben, dass bäuerliche Familien tatsächlich nur noch wenig Spielraum für die Abfindung von Geschwistern der Hofübernehmer hatten. So hat die landwirtschaftliche Fachzeitschrift top agrar 2005 ein Sonderheft herausgebracht, das bäuerlichen Familien in Fragen der Erbabfindungen Hilfestellungen an die Hand geben soll, indem die Möglichkeiten einer gerechten Abfindung ausführlich dargelegt werden. Dabei muss davon ausgegangen werden, dass der Hof zwar ein erhebliches Vermögen darstellt, dass dieses aber von Hoferben nicht realisiert werden kann, da es sich hierbei um seinen Arbeitsplatz und seine Lebensgrundlage handelt. Es gilt also, das Spannungsverhältnis zwischen gerechter Abfindung der (hier so titulierten) weichenden Erben
91
92
93
94
Edikt über die bäuerliche Erbfolge in der Provinz Westfalen. Vom 13ten Juli 1836, in: GesetzSammlung für die Königlichen Preußischen Staaten Nr. 14 (1836), S. 209-215 (Nr. 1730 der Gesamtzählung). Eine ausführliche Diskussion bietet Susanne ROUETTE: Der traditionale Bauer. Zur Entstehung einer Sozialfigur im Blick westfälisch-preußischer Behörden im 19. Jahrhundert, in: Ruth DöRNER, Norbert F R A N Z und Christian M A Y R (Hg.), Lokale Gesellschaften im historischen Vergleich. Europäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert, Trier 2001, S. 109-138; siehe auch Josef SCHEEPERS: Über das bäuerliche Erbfolge-Gesetz für die Provinz Westphalen vom 13. Juli 1836, Münster 1836; Benedikt F. WALDECK: Über das bäuerliche Erbfolgegesetz für die Provinz Westphalen, Arnsberg 1841. Bernold BENDEL: Das Problem der weichenden Erben im Anerbenrecht, Berlin 1959; dort weitere Hinweise auf juristische Literatur der 1930er und 1940er Jahre; für ein aktuelles französisches Beispiel siehe Rolande BONNAIN-DULON: Une stratégie de survie pour les cadets pyrénéens, in: Bernard DEROUET, Luigi LORENZETTI und John MATHIEU (Hg.), Pratiques familiales et sociétés de montagne, XVIe-XXe siècles, Basel 2010, S. 37-51. Birgit FASTENMAYER: Hofübergabe als Altersversorgung. Generationswechsel in der Landwirtschaft 1870-1957, Frankfurt a.M. 2009, S. 22 und S. 139.
30
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
und der Belastungsgrenze des Hofes aufzulösen. Die Modellrechnungen zeigen, dass nur ein Viertel der analysierten Höfe überhaupt in der Lage wäre, Abfindungen zu zahlen. Dieses angesichts der im 19. Jahrhundert noch üblichen erheblichen Abfindungszahlungen erstaunliche Ergebnis ist offensichtlich darauf zurückzuführen, dass Bauern heute stärker auf die ständige Verfügbarkeit liquider Mittel angewiesen sind. Vor allem hat die Mechanisierung der bäuerlichen Betriebe zu immensen Investitionskosten für landwirtschaftliche Maschinen, Melk- und Fütterungsanlagen etc. geführt, die das betriebswirtschaftliche Ergebnis erheblich schmälern. 95 Im Untersuchungszeitraum fielen dagegen nur die jährlich falligen Steuerzahlungen an, daneben evtl. auch fällige Zinszahlungen. Die Abneigung der Bauern gegen eine hohe jährliche Belastung ist auch daran zu erkennen, dass sie etwa bei der Finanzierung der Grundlastenablösung in Borgeln weder auf das Kreditmodell der Rentenbank, noch auf den Amortisationskredit der Soester Sparkasse zurückgriffen, die beide mit relativ hohen jährlichen Belastungen einher gingen. Sie zogen eine niedrige jährliche Belastung vor und zahlten Kredite bei Gelegenheit zurück, auch wenn die Kreditkosten sich dadurch erhöhten. 96 Angesichts erheblicher Preis- und Ernteschwankungen, mit denen sich Agrarproduzenten konfrontiert sahen, erscheint diese Strategie trotz eventuell höherer Gesamtkosten für einen Kredit sinnvoll gewesen zu sein. 97 Damit war aber auch für die Auszahlung von Erbteilen ein größerer Spielraum vorhanden als heute, wo betriebswirtschaftliche Investitionen unumgänglich sind. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der Begriff des .weichenden Erben' heute in aller Munde ist, entspricht er doch der Erfahrungswelt der bäuerlichen Familien. Im 19. Jahrhundert war das noch nicht der Fall. Dennoch erscheint eine Aufteilung des Erbes und die Berücksichtigung der übrigen Kinder unter den Bedingungen der ungeteilten Hofübergabe erklärungsbedürftig: Der Altenteil musste aus dem übergebenen Hof finanziert werden, die Verpflichtung zur Versorgung der alten Bauern verblieb beim jeweiligen Hofbesitzer, selbst wenn es sich bei ihm etwa durch Todesfalle und Wiederheiraten oder auch durch einen möglichen Verkauf des Hofes gar nicht mehr um ein Kind der alten Leute handelte. 98 Von den Geschwistern des Hofnachfolgers wurde dagegen keine Unterstützung ihrer alten Eltern erwartet; dennoch erhielten sie einen ansehnlichen Teil der Erbschaft. Nur in wenigen Fällen gibt es Hinweise darauf, dass Eltern versuchten, sich mehrere Optionen offen zu halten. So kam es immer wieder vor, dass Witwen bei der Hofübergabe aushandel-
95
96 97
98
Anne SCHULZE VOHREN: top agrar extra. Das Magazin für moderne Landwirtschaft: Abfindung weichender Erben, Münster-Hiltrup 2005, mit Beiträgen von Josef Deuringer, Silvia Riehl, Hubertus Schmitte und Henning Wolter. Bracht, Reform; Bracht, Vermögensstrategien, S. 282ff. Michael KOPSIDIS: Marktintegration und Entwicklung der westfälischen Landwirtschaft 1780— 1880. Marktorientierte ökonomische Entwicklung eines bäuerlich strukturierten Agrarsektors, Münster 1996, S. 345ff. C. Fertig, Hofübergabe, S. 76.
Transfers, Erbsystem und Bequest Motive
31
ten, zwischen einem gemeinsamen Haushalt, einem eigenständigen Haushalt auf dem Hof (in einem Nebengebäude oder auch einfach in einigen Räumen des Haupthauses) und dem Weggang vom Hof, mit dem aber Zahlungsverpflichtungen der Hofbesitzer verbunden waren, wählen zu können." Es sind auch einzelne Fälle bekannt, in denen Eltern ein Kind aufgrund seiner .kindlichen' Fürsorge besonders berücksichtigten und es eine höhere Abfindung oder ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht im elterlichen Haus erhielt.100 Dabei handelt es sich aber um Ausnahmen; in der Regel erhielten alle Geschwister Abfindungen von ähnlichem Wert, und die Familien bemühten sich offensichtlich, eine gerechte und für alle akzeptable Lösung zu finden. Offensichtlich ließen Eltern sich also nicht nur von Fragen der Alterssicherung leiten, sondern hatten die Zukunft ihrer Kinder im Blick. Die Diskussion um ein strategisches bequest motive lässt den sozialen Kontext eines Elternpaares außen vor, das sich vielleicht weniger Sorgen um seine Altersversorgung als um den Erhalt des sozialen Status der Familie machen musste. Dieses Bemühen drückt sich sowohl in der Sicherung des Hofes als auch in der sozialen Plazierung der Geschwister aus. Es wird in Kapitel 7 darum gehen, den Prozess der sozialen Plazierung in der ländlichen Gesellschaft und die Rolle der familiären Verhältnisse genauer in den Blick zu nehmen.101 Wurde die Organisation des intergenerationellen Transfers lange Zeit zwei distinkten Erbsystemen zugeordnet, die neben der ungeteilten Hofweitergabe (nur) die gleichmäßige Aufteilung des Landes unter allen Erben kannte, so kann dieses duale Modell inzwischen als widerlegt gelten. Insbesondere die Arbeiten von Hermann Zeitlhofer haben deutlich gemacht, dass die geschlossene Weitergabe von Höfen mit wertmäßig vollkommen egalitärer Erbschaft vereinbar sein konnte. Für die südböhmische Pfarre Kaplicky konnte er zeigen, dass Übergaben mittels Kaufverträgen abgewickelt wurden, und dass die so erzielten Erlöse unter allen Familienmitgliedern zu gleichen Teilen aufgeteilt wurden. Gleichzeitig waren Verkäufe an Familienfremde, auch jenseits des Kreises der Verwandten, hier keine Ausnahme. Dieses Kaufsystem war in vielen Gebieten Ober- und Niederösterreichs und in Teilen Bayerns verbreitet, und weist erstaunliche Ähnlichkeiten mit einem von Segalen untersuchten Realteilungsgebiet in 99
100 101
Christine FERTIG, Volker LONNEMANN und Georg FERTIG: Inheritance, succession and familial transfer in rural Westphalia, 1 8 0 0 - 1 9 0 0 , in: The History of the Family 10 (2005), S. 309-326, hier S. 320. Siehe den Vertrag St AD, D 23 B, Nr. 50245, S. 8 in Kapitel 6, S. 621. Klassisch zu sozialer Plazierung: Jürgen K O C K A (Hg.): Familie und soziale Plazierung. Studien zum Verhältnis von Familie, sozialer Mobilität und Heiratsverhalten an westfälischen Beispielen im späten 18. und 19. Jahrhundert, Opladen 1980, darin insbesondere der Beitrag von Josef Mooser, der sich mit bäuerlichen Familien befasst, und die einleitende Diskussion des Konzepts von Heinz Reif; Josef MOOSER: Familie und soziale Plazierung in der ländlichen Gesellschaft am Beispiel des Kirchspiels Quernheim im 19. Jahrhundert, in: Kocka, Familie, S. 127-213; siehe auch Christine FERTIG: Rural Society and Social Networks in Nineteenth-Century Westphalia: The Role of Godparenting in social mobility, in: Journal of Interdisciplinary History 39 (2009), S. 497-522.
32
Kapitel 2: Heini, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
der Bretagne, aber auch mit dem von Medick untersuchten württembergischen Laichingen auf. 102 Auch die Annahme, dass es sich bei intergenerationellen Transfers im Zuge einer Realteilung um einen langfristigen Prozess handle, während die Weitergabe eines ungeteilten Hofes einen Wendepunkt für die bäuerliche Familie bedeutete, kann bei genauem Blick auf die Besitztransferpraxis nicht bestätigt werden. Die Auszahlung von Abfindungen an die Geschwister, Eheschließungen sowohl der Geschwister als auch des Hofnachfolgers bzw. der Hofnachfolgerin sowie der Rückzug der alten Bauern auf ein Altenteil unter Aufgabe der Bewirtschaftungsrechte fiel in vielen Fällen nicht mit dem Zeitpunkt der Hofübergabe zusammen. 103 In Südfrankreich kam es zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert zu einer Verlagerung von Realteilung zu Primogenitur; hier hing der soziale Status, vermittelt über die mit der Steuerklasse verbundenen Wahlrechte und dem Zugang zu öffentlichen Amtern, ganz erheblich von der Größe des Landbesitzes ab. Die Veränderungen im Erbsystem sind auf das Bevölkerungswachstum und die daraus resultierende Knappheit an unkultiviertem und erschwinglichem Land zurückzuführen. 104 In der französischen Familiengeschichte wird in Kontexten ungeteilter Erbschaft oft die Kontinuität des ,Hauses' ins Zentrum gestellt. Es geht hier weniger darum, ein Kind besonders zu bevorzugen, als vielmehr um die Gewährleistung dieser Kontinuität. 105 Diese Interpretation wird gestützt von Befunden, die soziale Ungleichheit in enger Beziehung mit der Bedeutung intergenerationeller Transfers sehen. Ein Vergleich über 21 historische wie zeitgenössische Gesellschaften hat gezeigt, dass beides typische Merkmale von Hirten- und Agrargesellschaften sind. 106 Das Kind, das als Nachfolger ausgewählt wird, kann dies auch durchaus eher als Belastung denn als besonderes Privileg erfahren. Auf dieses Problem hat schon Bourdieu hingewiesen, auch aus nordeuropäischen Kontexten sind Fälle bekannt, in denen sich das Gewinnen eines Nachfolgers als eher schwie102
103 104
Hermann ZEITLHOFER: Besitztransfer in frühneuzeitlichen ländlichen Gesellschaften: die südböhmische Pfarre Kaplicky (Herrschaft Vyssi Brod), 1640-1840, in: Markus CERMAN und Hermann ZEITLHOFER (Hg.), Soziale Strukturen in Böhmen: Ein regionaler Vergleich von Wirtschaft und Gesellschaft in Gutsherrschaften, 16.-19. Jahrhundert, Wien 2002, S. 240261; Martine SEGALEN: Fifteen Generations of Bretons. Kinship and society in Lower Brittany 1720-1980, New York 1991; Medick, Weben, S. 329f. Auch in Westfalen wurde ein Teil der innerfamiliären Transfers über den Bodenmarkt geregelt, vorherrschend waren hier allerdings die Ubergabeverträge inter vivos. C. Fertig, Hofübergabe. Bernard ÖEROUET: Political Power, Inheritance, and Kinship Relations: The Unique Features of Southern France (Sixteenth-Eighteenth Centuries), in: David W. SABEAN, Simon TEUSCHER und Jon MATHIEU (Hg.), Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development ( 1 3 0 0 - 1 9 0 0 ) , N e w Y o r k 2 0 0 7 , S. 1 0 5 - 1 2 4 .
105
106
Bourdieu, Heiratsstrategien; Claverie / Lamaison, Ousta; Bernard DEROUET: Les pratiques familiales, le droit et la construction des différences (15e-19c siècles), Annales HSS 52 (1997), S. 369-391, hier S. 375. Monique Borgerhoff MULDER u. a.: Intergenerational Wealth Transmisson and the Dynamics of Inequality in Small-Scale Societies, in: Science 326 (2009), S. 682-688.
Hofidee als handlungsleitendes Normensystem?
33
rig gestaltete.107 Im Japan des 19. Jahrhunderts wurde dabei auf das Instrument der Adoption zurückgegriffen, sowohl in der Variante, dass einheiratende Schwiegersöhne in die Familie aufgenommen wurden, als auch durch eine Adoption eines passenden ,Sohnes', dessen Braut gleich mit rekrutiert wurde.108 Diese Arbeiten haben deutlich gemacht, dass die geschlossene Vererbung bäuerlichen Besitzes keineswegs immer eine massive Privilegierung eines Kindes gegenüber den Geschwistern bedeutete.
2.5 Hofidee als handlungsleitendes Normensystem? Die Vorstellung einer Kontinuität des,Hauses' ist auch in der Geschichte der ländlichen Gesellschaft Westfalens nicht unbekannt. Bereits 1970 erschien ein Artikel von Dietmar Sauermann, in dem die Bewohner eines westfälischen Bauernhofes zwischen zwei miteinander konkurrierenden Normensystemen verortet werden: dem Leitbild der Familie und der ,Hofidee'.109 Das Spannungsgefüge dieser beiden sozialen Leitbilder ist diesem Verständnis nach für familiäre Konflikte sowohl zwischen den Generationen als auch zwischen Hoferben und Geschwistern verantwortlich. ,Der HoP verlangte demnach, dass die Elterngeneration auf Besitz und Herrschaft verzichteten, sobald ihre Leistungsfähigkeit durch Alter oder Gesundheitszustand beeinträchtigt war. Die ,Hofidee' zwang den jeweiligen Hofbesitzer, hart und unnachgiebig die Ansprüche der Familienmitglieder zu bekämpfen, sobald sie den Interessen ,des Hofes' zuwider liefen, ganz gleich ob es sich um Geschwister oder Eltern handelte. Insbesondere die alten Bauern seien demnach, aufgrund ihrer nachlassenden Leistungsfähigkeit, eine erhebliche Belastung für den Hof gewesen. Gegen die auf Sachzwängen beruhende Hartherzigkeit der jungen Bauern hätten sie sich aber durch „äußerst konkret[e] und auf den Einzelfall zugeschnitten[e]" rechtliche Regelungen in den Übergabeverträgen, die „stets die wichtigsten Lebensbereiche wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Herrschaft zu regeln suchten", geschützt.110 Dass „Vertragsbestimmungen (...) oft die kleinsten Details pedantisch vermerken" ist auch bei David Gaunt ein wichtiger Beleg
107
Bourdieu, Heiratsstrategien, S. 274f.; Palle O. CHRISTIANSEN: Die vertrackte Hofübergabe. Zur gutsherrlichen Rekrutierung von Bauern in der ländlichen Gesellschaft des östlichen Dänemark im 18 Jahrhundert, in: Historische Anthropologie 3 (1995), S. 144-164; der norwegische Schriftsteller Edvard Hoem beschreibt in der Lebensgeschichte seiner Eltern die verzweifelten - und vergeblichen - Bemühungen seines als Laienprediger der Inneren Mission reisenden Vaters, die Erbschaft des Hofes abzuwenden: Edvard HOEM: Eine Geschichte von Vater und Mutter, Frankfurt a.M. 2009, S. 118ff.
108
Satomi KUROSU und Emiko OCHIAI: Adoption as an Heirship Strategy under Demographic Constrains: A Case from Nineteenth-Century Japan, in: Journal of Family History 20 (1995), S. 261-288. Dietmar SAUERMANN: HoFidee und bäuerliche Familienverträge in Westfalen, in: RheinischWestfälische Zeitschrift für Volkskunde 17 (1970), S. 58-78. Ebd. S. 76.
109
110
34
Kapitel 2: Heina, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
für die Problemlage der bäuerlichen Familien. Höfe seien insbesondere durch einen möglichen Auszug der Altenteiler aus dem gemeinsamen Haushalt existentiell bedroht: „Diese gefährliche Lage konnte nur auf eine Art beseitigt werden - durch die Milderung der Auszugslasten, also durch den Tod der Eltern."111 Bei beiden Autoren ist die Quellenlage und damit die empirische Evidenz nicht unproblematisch. Sie stützen sich jeweils auf wenige ausgewählte Übergabeverträge, die sie zum größten Teil der älteren Literatur entnehmen. Die Neigung heimatkundlicher, rechtshistorischer wie auch volkskundlicher Arbeiten, sich auf besonders interessante und scheinbar ungewöhnlich aussagekräftige Quellen zu stützen, führt, das machen diese Beispiele deutlich, zu gravierenden Missverständnissen und Fehlinterpretationen. 112 Es war im Westfalen des 19. Jahrhunderts keineswegs die Regel, dass die Ansprüche der Altenteiler detailliert festgehalten wurden. In der Regel wurden nur Grundfragen wie die Einrichtung eines gemeinsamen oder zweier getrennter Haushalte, Nutzung bestimmter Parzellen durch die Altenteiler, oder auch ein regelmäßiges Taschengeld festgeschrieben; dass der Umfang der regelmäßigen Naturalleistungen genau beziffert wurde, kam nur sehr selten vor.113 Dass diese Verträge aber eher ihren Weg in die Veröffentlichung finden als die viel häufigeren, denkbar knapp gehaltenen Verträge, in denen das Altenteil in wenigen Worten abgehandelt wird und die Ansprüche der Eltern nicht detailliert aufgeführt werden, ist nicht weiter erstaunlich. Man darf aber nicht davon ausgehen, dass sie ein zuverlässiges oder auch nur halbwegs stimmiges Bild der Familienbeziehungen oder der bäuerlichen Altersversorgung hergeben. Auch an anderen Stellen findet das normativ aufgeladene Bild einer bäuerlichen ,Hofidee' keine Bestätigung in dem Verhalten bäuerlicher Familien, so wie es uns in den Quellen begegnet. In Sauermanns Verständnis geht es in den Verträgen vor allem um die Aushandlung der vornehmlich materiellen Rechte der Familienmitglieder; das Eheversprechen der jungen Leute sei nur eine Nebensache. Nicht durch die Heirat, sondern durch die mit einer Reihe von symbolischen Handlungen verbundene Aufnahme auf den Hof würden der einheiratenden Ehefrau Herrschafts-, Nutzungs- und Besitzrechte (in der Regel von ihren Schwiegereltern) übertragen. Diese Deutung über111
112
113
David GAUNT: Formen der Altersversorgung in Bauernfamilien Nord- und Mitteleuropas, in: Michael MITTERAUER und Reinhard SIEDER (Hg.), Historische Familienforschung, Frankfurt a.M. 1982, S. 156-196, hier S. 176f. Jüngstes Beispiel ist Fastenmayer, Hofübergabe, eine kürzlich erschienene rechtshistorisch ausgerichtete Arbeit zum selben Thema, in der im Ergebnis zwar von der zentralen Bedeutung des Ubergabevertrags die Rede ist, ohne dass jedoch Verträge systematisch analysiert werden; lediglich ein einzelner Vertrag wird hier und da zitiert. So ist für einen der größten Höfe in Löhne ein Fall aus dem Jahr 1885 bekannt, in dem das Altenteil des ehemaligen Hofbesitzers detailliert aufgeführt und so umfangreich ist, dass er die Bedürfnisse eines immerhin bereits 75jährigen Altbauern unverkennbar übersteigt. StAD, D 23 B, Nr. 50388, S. 187 (Hof Löhnebeck Nr. 2); für systematische Analysen von Übergabeverträgen siehe auch C. Fertig, Hofübergabe; C. Fertig und G. Fertig, Bäuerliche Erbpraxis; Lünnemann, Geschwisterbeziehungen; ders., Preis des Erbens.
Hofidee als bandlungsleilendts Normensystem?
35
sieht zum einen, dass in vielen Gebieten die eheliche Gütergemeinschaft galt, so dass der einheiratende Partner mit der Eheschließung Mitbesitzer wurde. Zum anderen wird übersehen, dass die Aufnahme des jungen Ehepaares auf den Hof kein Gnadenakt der alten Bauern war, sondern ein Versuch, ein junges Arbeitspaar als Unterstützung in der Hofwirtschaft und bei Pflegebedürftigkeit auf dem Hof zu halten. Es handelt sich also um die Neuordnung der familiären Beziehungen und der Rechte und Pflichten aller Beteiligten. Die,Hofidee' ist im Kern die Interessenlage der Hofbesitzer und der Grundherren, deren wirtschaftliche Rationalität den Hof schützt: „Der Gedanke der Rentabilität des Hofes führte beide Partner zu gemeinsamem Handeln zusammen. (...) durch die Autorität des Grundherrn aber, der die gleichen Interessen vertrat wie der Hofbesitzer, konnten im Sinne der Hofidee die Forderungen der .eigentumslosen' Familienmitglieder umso wirksamer eingedämmt werden."114 Auch die Ansprüche der Altenteiler wurden in diesem Verständnis von den umsichtigen Grundherren in Zaum gehalten. Nun hatten die Grundherren durchaus ein erhebliches Interesse an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Höfe; aber dies gilt ebenso für die bäuerlichen Familien insgesamt, die auch nach der Ablösung der grundherrlichen Rechte erfolgreich nach tragfähigen Lösungen suchten. An dieser Stelle ist das Argument der ,Hofidee' als eines spezifisch bäuerlichen Leitbildes durchbrochen: Nicht Normen bilden die Grundlage der Entscheidungsfindung, sondern die wirtschaftliche Vernunft. Die Frage nach der Rentabilität verband aber nicht nur Hofbesitzer und Grundherren, sondern auch die übrigen Familienmitglieder: Jeder, der auf dem Hof lebte, arbeitete ,für des Hauses Bestes'; ehemalige Hofbesitzer erhielten ihre Altersversorgung; jedes Kind konnte erwarten, bei Bedürftigkeit auf dem Hof, und aus den Erträgen des Hofes, versorgt zu werden; wer den Hof verließ, um eine eigene Familie zu gründen, wurde ausbezahlt.115 Die bäuerliche Familie hatte also insgesamt ein erhebliches Interesse an der dauerhaften Leistungsfähigkeit eines Hofes. Das Missverständnis, das Sauermanns Argumentation zugrundeliegt, ist aber nicht allein in der empirisch dünnen Basis des Textes begründet. Der Deutung dieses Materials liegt die Rezeption von zwei älteren volkskundlichen Arbeiten zugrunde, die sich bereits mit der Rolle des Hofes für die bäuerliche Familie auseinandergesetzt haben. Der Begriff der ,Hofidee' stammt von Helene Barthel, die 1931 eine Arbeit über den Emmentaler Bauern bei Jeremias Gotthelf veröffentlicht hat.116 Sie betont allerdings, dass die Hofidee kein autonomes Leitbild sei, sondern dass die Erhaltung des Hofes
114 115
116
Sauermann, Hofidee, S. 61. Die Wasserscheide war bei diesen Versorgungsrechten die Heirat bzw. die Auszahlung der Erbabfindung. Junge Menschen konnten bis dahin in der Regel bei Krankheit oder auch bei Arbeitslosigkeit auf den Hof zurückkehren. Nach der Heirat war diese Form der Unterstützung nicht mehr vorgesehen. Helene BARTHEL: Der Emmentaler Bauer bei Jeremias Gotthelf. Ein Beitrag zur bäuerlichen Ethik, Münster 1931.
36
Kapitel 2: Heirat, Erbschaft und soziale Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft
untrennbar mit der Existenz der Bauernfamilie verbunden sei und ihre materielle Grundlage bilde. „Es muss jedoch davor gewarnt werden, die Hofidee zu abstrakt zu verstehen, als käme es nur darauf an, den Hof an und für sich zu erhalten und zu fördern. Selbstverständlich bildet die Grundlage der Hofidee die Einheit von Bauernhof und Bauernfamilie. Die Familie soll eben unter allen Umständen im Besitze des Hofes bleiben, dem sie sich mit Leib und Seele verschrieben hat. Der Hof ist keine absolute Größe etwa wie ein Staat seiner Regierung gegenüber. Er ist vielmehr undenkbar ohne die seit Jahrhunderten auf ihm sitzende Bauernfamilie; er ist wesentlich auf sie bezogen. Der Familie aber gegenüber ist er unbedingt das Übergeordnete, d. h. die Existenz des Hofes ist die Grundlage für die Existenz der Familie". 117 Der Hof ist also den divergierenden Interessenlagen der Familienmitglieder übergeordnet, weil ihre soziale und wirtschaftliche Existenz von ihm abhängt, nicht weil es sich um ein konkurrierendes Leitbild handelt. 118 Der zweite Gewährstext für die .Hofidee' ist eine volkskundliche Arbeit von Martha Bringemeier, die ebenfalls 1931 erschienen ist. Ziel dieser Arbeit ist es, zu zeigen, „dass die Lebensform der .Gemeinschaft' Voraussetzung ist für die Entstehung und das Leben unseres gesamten Volksgutes". 119 In diesem Sinne ist das von Sauermann gebrachte Zitat zu verstehen, in dem die Bindungen der Menschen an den Hof essentiell für die zwischenmenschlichen Beziehungen sind. 120 Die Beziehungen zwischen den Menschen, die Bringemeier beschreibt, sind allerdings getragen von der durch den Hof gestifteten Gemeinschaft und nicht einem ,Hofinteresse' diametral entgegengesetzt. So wurden nicht nur Kinder mit einer Aussteuer bedacht, sondern auch Mägde und Knechte, die längere Zeit auf dem Hof gearbeitet hatten, konnten damit rechnen, eine „Abgangsgabe" oder „Mitgift" zu bekommen. 121 Der Dienst am Hof und der persönliche Verzicht wurde als „gottgewollte Lebensaufgabe, (...) Dienst Gottes" ver117 118
119
120
121
Ebd., S. 56. Zu diesem Schluss kommt auch Josef Mooser, wenn er zu dem Schluss kommt, dass Bauern zwei „hierarchisch geordnete Ziele" verfolgten: Zunächst musste der Familienbesitz erhalten werden, dann aber wurden alle Kinder, die den elterlichen Hof nicht übernehmen konnten, möglichst gut platziert; siehe Mooser, Soziale Plazierung, S. 211. Martha BRINGEMEIER: Gemeinschaft und Volkslied. Ein Beitrag zur Dorfkultur des Münsterlandes, Münster 1931, S. 5. Sauermann, Hofidee, S. 58f.: „Die primären Beziehungen in der bäuerlichen Hausgemeinschaft liefen nicht von Mensch zu Mensch, sondern strahlten sämtlich vom Hof aus. Jeder einzelne war zunächst an den Hof gebunden, und um dessentwillen fühlte er sich auch mit den andern verknüpft. Der Hof war das Bindeglied zwischen ihnen. Diesem Mittelpunkt zugewandt, übersah der einzelne die Individualität der Menschen, die mit ihm in die gleiche Art von Beziehungen eingespannt waren. Der Blick glitt über ihre individuelle Art und Wertigkeit und beurteilte sie nach ihrer Zuordnung zum Hof."; Original Bringemeier, S. 78; siehe auch weiter unten Kap. 6, S. 170ff., und die kritische Auseinandersetzung bei Friedrich WEBER: „Äs dai oine unnerchenk, was dai annere all wuier do." Menschen und Familien auf einem mittleren Hof in der Soester Niederbörde, Welver 1994, S. 239ff. Bringemeier, Gemeinschaft, S. 74f.
Hofidee als bandiungsleitendts Normensystem?
37
standen. „So war der ganze Bereich der Lebensgebiete von der Sphäre des Vitalen über die des Ökonomischen bis zu der des Religiösen aufs engste ineinander geschlossen, war völlig zu einer Einheit verschmolzen."122 Das Verhältnis des Hausherrn war auch nicht von einem Grundkonflikt zwischen familiären Ansprüchen und Hofinteresse gekennzeichnet, im Gegenteil: „Von Herrschaft konnte keine Rede sein. Gewöhnlich sagte der Vater beim ersten Frühstück: Wat wi gi maken vöndage? (Was wollt ihr tun heute), und jeder gab aus eigenem Wissen seine Tagesaufgabe an, die also mehr als Bericht gegeben, denn als Befehl empfangen wurde. Die Arbeitsverteilung hatte den Charakter der Überlegung, der gemeinsamen Beratung, bei der allerdings dem Bauern Entscheidung und Vorsitz als Selbstverständlichkeit zuerkannt wurde."123 Bringemeier stützt diesen Teil ihrer Studie auf Interviews nur einer Person, ihrer Großmutter; man kann sich also durchaus fragen, wie überzeugend diese Ausführungen sind. Entscheidend ist aber, dass beide Texte, die als Referenztexte für ein soziales Leitbild der ,Hofidee' herangezogen wurden, eine Interpretation im Sinne Sauermanns bei genauerer Lektüre nicht erlauben. Höfe hatten in der ländlichen Gesellschaft Westfalens im 18. und 19. Jahrhundert einen hohen Wert, nicht nur im materiellen, sondern auch im ideellen Sinne. Die materielle und soziale Existenz bäuerlicher Familien waren auf das Engste mit ihrem Hof verbunden, und folgerichtig gab es ein erhebliches Interesse, diese Existenzgrundlage zu erhalten. Die Ansprüche, die der oder die Einzelne an die Familie und den Hof stellen konnte, mussten vor dem Hintergrund konkurrierender Ansprüche anderer Familienmitglieder und der Tragfähigkeit des Hofes austariert werden. Die vielfältigen Lasten, die der Hof zugunsten der Familienmitglieder zu tragen hatte, gerade dann, wenn sie in Zeiten von Krankheit oder Alter nichts zur häuslichen Wirtschaft beitragen konnten, verweisen aber deutlich auf die funktionale Dimension der Beziehung zwischen Bauernfamilie und Hof. Spätestens dann, wenn junge Menschen einen Hof verließen und umfangreiche Abfindungsleistungen erhielten, werden der hohe Stellenwert intergenerationeller Transfers und die funktionale Bedeutung des Hofes als Basis der familiären Existenz deutlich. Diese familiären Strategien können aber nur auf einer breiten empirischen Basis, die es erlaubt, Besitzverhältnisse, demographische Faktoren, soziale Beziehungen und familiäre Entscheidungen in den Blick zu nehmen, untersucht werden.
122 123
Ebd., S. 77f. Ebd., S. 73.
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
3.1 Soziale Netzwerke und Geschichte In Kapitel 2 ist die Geschichte der ländlichen Gesellschaft unter zwei Perspektiven betrachtet worden: Zum einen ist die Familie als zentrale Instanz hervorgetreten; der Familienzyklus, von der Familiengründung bis hin zur Aufteilung des elterlichen Erbes, bestimmt die Allokation von Ressourcen in Zeit und Raum. Zum anderen ist deutlich geworden, dass Familien sozialen Schichten zuzuordnen sind, im Wesentlichen den landbesitzenden Bauern und den weitgehend landlosen ländlichen Unterschichten. Über diese in der Forschung gut etablierten Perspektiven der Analyse positionaler Strukturen geht diese Arbeit hinaus, indem sie soziale Netzwerke jenseits von Familie und Haushalt in den Blick nimmt und die Integration von Menschen und Familien in eine von sozialen Beziehungen gebildete, in verschiedenem Maße schichtenübergreifende relationale Struktur untersucht. Mit Hilfe der Netzwerkanalyse als einem neueren, in den Nachbardisziplinen bereits etablierten Forschungsparadigma kann soziale Ungleichheit - als relationales Phänomen - mit der klassischen, positionalen Schichtungsanalyse in Beziehung gesetzt werden. Die für Historiker wohl wichtigsten methodischen wie theoretischen Anregungen kommen aus zwei Nachbardisziplinen: der Soziologie und der Ethnologie. Innerhalb der Soziologie hat sich insbesondere die Wirtschaftssoziologie in Auseinandersetzung mit Neoklassik und neuerer Institutionenökonomie, aber auch mit Theorien Bourdieus, mit der Bedeutung sozialer Netzwerke befasst.1 Die wichtigsten soziologischen Netzwerktheoretiker werden heute dieser Teildisziplin zugerechnet. Die wohl bekanntesten Soziologen, deren Arbeiten die Verankerung des Netzwerkparadigmas bis heute stark beeinflusst haben, sind Harrison C. White, Mark S. Granovetter, Ronald S. Burt und Barry Wellman. White hat sich mit der Entstehung sozialer Strukturen, aber auch mit den sozialen Voraussetzungen von Märkten auseinandergesetzt und eine Theorie sozialer Formationen entwickelt.2 Einen über die Fachgrenzen hinaus größeren Bekanntheitsgrad haben die Arbeiten von Granovetter, der zum einen die Bedeutung
Jens BECKERT und Christoph DEUTSCHMANN: Neue Herausforderungen der Wirtschaftssoziologie, in: dies. (Hg.), Wirtschaftssoziologie, Wiesbaden 2009, S. 7-21; Sophie M0T7.EL: Strukturelle Netzwerkanalyse und Bourdieus Praxistheorie: Weiterführende Ideen für die neue Wirtschaftssoziologie, in: Michael FLORIAN und Frank HILLEBRANDT (Hg.), Pierre Bourdieu: Neue Perspektiven für die Soziologie der Wirtschaft, Wiesbaden 2006, S. 109-125. Harrison C. WHITE: Identity and Control. A structural theory of action, Princeton 1992; ders., Identity and Control. How social formations emerge, 2. Überarb. Aufl. Princeton 2008; ders., Markets from networks: Socioeconomic models of production, Princeton 2002.
40
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
schwacher Netzwerkbeziehungen herausgearbeitet, zum anderen auf die Einbettung von sozialem wie ökonomischem Handeln in soziale Kontexte hingewiesen hat. Mit seiner bereits 1974 erschienenen Studie zur Arbeitsplatzsuche hat er die Grundlage zu einer Theorie der Bedeutung schwacher Beziehungen {weak ties) gelegt. 3 Burt hat bereits in den frühen 1980er Jahren eine strukturelle Handlungstheorie entwickelt, bekannter sind allerdings seine Arbeiten zu sozialem Kapital, in denen er die Bedeutung von Brokern und strukturellen Löchern zeigt. 4 Auch Wellman gehört zu den Soziologen, die die Entwicklung des Netzwerkparadigmas entscheidend vorantrieben. 5 Er hat auf die Bedeutung persönlicher Netzwerke auch in modernen, Urbanen Lebenswelten hingewiesen, in denen auch Verwandte einen überraschend wichtigen Platz einnahmen. 6 Er war aber auch einer der Ersten, die mit Historikern zusammen arbeiteten und so die Erforschung historischer Gesellschaften anregten. In gemeinsamen Aufsätzen untersuchten Barry Wellman, Charles Wetherell und Andrejs Plakans eine osteuropäische Gemeinde. 7 Neben Wellman wiesen auch andere Soziologen darauf hin, dass man auch historische Quellenbestände aus einer Netzwerkperspektive heraus fruchtbar machen kann. Bonnie Erickson hat bereits 1997 aufgezeigt, wie mit historischem Material Netzwerkanalysen durchgeführt werden können. Hierfür hat sie einige Anregungen gegeben, wie die Erhebung von Daten durchgeführt werden sollte, um eine formale Analyse zu ermöglichen. Ähnlich haben Peter Bearman, James Moody und Robert Faris auf-
4
5
6
7
Mark S. GRANOVETTER: Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, in: American Journal of Sociology 91 (1985), S. 481-510; ders.: The Strength of Weak Ties, in: American Journal of Sociology 78 (1973), S. 1360-1380; ders.: The Strength of Weak Ties; A Network Theory Revisited, in: Peter V. MARSDEN und Nan LIN (Hg.), Social Structure and Network Analysis, Berverly Hills 1982, S. 105-130; zur Bedeutung schwacher Beziehungen auf Arbeitsmärkten ausführlich: Mark S. GRANOVETTER: Getting a Job. A Study of Contacts and Careers, Cambridge 1974. Ronald S. BURT: Towards a structural theory of action, New York 1982; ders.: Structural Holes. The Social Structure of Competition, Cambridge 1992; ders.: Structural Holes versus Network Closure as Social Capital, in: Nan L I N , Karen COOK und Ronald S. BURT (Hg.), Social capital. Theory and research, New York 2001, S. 31-56. Barry WELLMAN: Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, in: ders. und Stephen D. BERKOWITZ, Social Structures: a network approach, Cambridge 1988, S. 19-61. Barry WELLMAN: Studying Personal Communities, in: Peter MARSDEN und Nan LIN (Hg.), Social Structure and Network Analysis, Beverly Hills u. a. 1982, S. 61-80; ders.: The Place of Kinfolk in Personal Community Networks, in: Marriage and Family Review 15 (1990), S. 195-228. Charles WETHERELL, Andrejs PLAKANS und Barry WELLMAN: Social Networks, Kinship, and Community in Eastern Europe, in: Journal of Interdisciplinary History 24 (1994), S. 639-663; siehe auch Andrejs PLAKANS und Charles WETHERELL: Patrilines, surnames, and family identity: A Case Study From the Russian Baltic Provinces in the Nineteenth Century, in: The History of the Family 5 (2000), S. 199-214.
Sortale Netzwerke und Geschichte
41
gezeigt, wie mit historischen Daten gearbeitet werden kann. 8 Dabei hat Bearman in seiner Studie über lokale Eliten in Norfolk im 16. und 17. Jahrhundert eine der ersten historischen Netzwerkanalysen vorgelegt.9 Britische Soziologen haben sich auch mit historischen Netzwerken in Städten und Dörfern beschäftigt.10 Daneben gab es hier einzelne Untersuchungen von sozialen Netzwerken, die von Historikern durchgeführt wurden. 11 In Deutschland hat der Soziologe Paul Windolf die Verflechtung von Unternehmen in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts untersucht und hat dabei Netzwerkanalyse und Regressionsanalyse miteinander kombiniert.12 Stärker als für Unternehmen und ihr Führungspersonal ist allerdings die Bedeutung von Netzwerkstrukturen für soziale Bewegungen in den Blick genommen worden. 13 Soziale Bewegungen zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie nur wenig ausdifferenzierte Positionen und Rollen aufweisen und eher Netzwerk- als Organisationsstrukturen aufweisen. 14 Für die französische Arbeiterbewegung und die amerikanische Frauenbewegung im 19. Jahrhundert sind ebenfalls Netzwerkanalysen durchgeführt worden. 15 Carola Lipp hat, in enger Kooperation mit Lothar Krempel, die politische Mobilisierung und den sozialen Kontext von Petitionen in Esslingen während der Revolution
8
Bonnie H. ERICKSON: Social Networks and History, in: Historical Methods 30 (1997), S. 149157; Peter S. BEARMAN, James MOODY und Robert FARIS: Networks and History, in: Complexity 8 (2002), S. 61-71.
9
10
11
12
13
14
15
Peter S. BEARMAN: Relations into rethorics: Local elite social structure in Norfolk, England, 1540-1640, New Brunswick 1993. Jeremy BOULTON: Neighbourhood and Society. A London Suburb in the Seventeenth Century, Cambridge 1987; Keith WRIGHTSON and David LEVINE: Poverty and Piety in an English Village. Terling, 1525-1700, Oxford 1998. Ein frühes Beispiel ist Richard M. SMITH: Kin and neighbors in a thirteenth-century Suffolk community, in: Journal of Family History 4 (1979), S. 219-256; Jenny KERMODE: Sentiment and survival: Family and friends in late medieval english towns, in: Journal of Family History 24 (1999), S. 5-18. Paul WINDOLF: Sozialkapital und soziale Ungleichheit. Vergleichende Analysen zur Unternehmensverflechtung in Deutschland und in den USA (1896-1938), in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2007/2, S. 197-228. Siehe v. a. Mario DIANI und Doug MCADAM (Hg.): Social Movements and Networks. Relational Approaches to Collective Action, New York 2003. Dieter RUCHT und Friedhelm NEIDHARDT: Soziale Bewegungen und kollektive Aktionen, in: Hans JOAS (Hg.), Lehrbuch der Soziologie, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 2007, S. 627-651, hier S. 634f. Christopher K. ANSELL: Symbolic Networks: The Realignment of the French Working-Class 1 8 8 7 - 1 8 9 4 , in: A m e r i c a n J o u r n a l of S o c i o l o g y 103 (1997), S. 359-390; R o g e r V. GOULD: M u l -
tiple networks and mobilization in the Paris Commune 1871, in: American Sociological Rev i e w 56 (1991), S. 716-729; N a o m i ROSENTHAL, M e r y l FINGRUTD, M i c h e l e ETHIER, R o b e r t a
KARANT, and David MCDONALD: Social movements and network analysis: A case study of nineteenth-century women's reform in New York State, in: American Journal of Sociology 90 (1993), S. 1022-1054.
42
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormodtrnt
von 1848/49 untersucht. 16 Lipp ist es auch, die neben Sabean auf die systematisch unterschätzte Rolle verwandtschaftlicher Strukturen für die politische Kultur des 19. Jahrhunderts hingewiesen hat.17 Die vielleicht bekanntesten historischen Netzwerkanalysen stammen von dem amerikanischen Politologen John F. Padgett, der über viele Jahre eine umfangreiche Datenbank der politischen Eliten in Florenz (14./15. Jahrhundert) aufgebaut und ausgewertet hat. So konnte er in einem gemeinsamen mit Christopher Ansell geschriebenen Aufsatz zeigen, dass die Medici ihre Heirats- und Geschäftsbeziehungen in einer Weise organisierten, die ihnen eine größtmögliche strukturelle Unabhängigkeit garantierte. Sie legten ihre Netzwerke weitgehend uniplex, d. h. mit einfach belegten Beziehungen an, wobei insbesondere Heirats- und Geschäftsbeziehungen sorgfaltig auseinander gehalten wurden. 18 Es gibt also von soziologischer Seite Anregungen wie Beispiele für die Anwendung formaler Netzwerkanalyse auch auf historische Fragestellungen. Bisher sind diese Anregungen von Historikern allerdings nur selten aufgegriffen worden. Ebenso erstaunlich ist, dass in den letzten Jahren ethnologische Theorien und Methoden von Historikern vermehrt rezipiert worden sind, ohne dass die neueren methodischen Ansätze wahrgenommen wurden. Besonders das starke Interesse an verwandtschaftlichen Beziehungen wird aus der älteren ethnologischen Literatur hergeleitet.19 Dabei ist übersehen worden, dass die Erforschung von Verwandtschaft in der Ethnologie lange Zeit ein Schattendasein geführt hat und erst in den 1990er Jahren durch einen Perspektivwechsel und durch methodische Innovationen wieder an Bedeutung gewann. 20 Douglas R. White 16
17
18
19
20
Carola LIPP und Lothar KREMPEL: Petitions and the Social Context of Political Mobilization in the Revolution of 1848/ 49: A Microhistorical Actor-Centred Network Analysis, in: International Review of Social History 46 (2001), 151-169; Krempel ist Mitarbeiter am Max-PlanckInstitut für Gesellschaftforschung, der über die Visualisierung von Netzwerken gearbeitet hat: Siehe Lothar KREMPEL: Visualisierung komplexer Strukturen. Grundlagen der Darstellung mehrdimensionaler Netzwerke, Frankfurt a. M. 2005. Carola LIPP: Kinship Networks, Local Government, and Elections in a Town in Southwest Germany, 1800-1850, in: Journal of Family History 30 (2005), S. 347-365; Carola LIPP: Verwandtschaft - ein negiertes Element in der politischen Kultur des 19. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift 283 (2006), S. 31-77. John F. PADGETT und Christopher K . ANSELL: Robust action and the Rise of the Medici, 1 4 0 0 1 4 3 4 , in: American Journal of Sociology 9 0 ( 1 9 9 3 ) , S. 1 2 5 9 - 1 3 1 9 ; siehe auch John F. PADGETT: Open Elite? Social Mobility, Marriage, and Family in Florence, 1 2 8 2 - 1 4 9 4 , in: Renaissance Quarterly 6 3 ( 2 0 1 0 ) , S. 1 - 5 5 . Siehe die Diskussion in Sabean, Kinship, S. 7ff.; in der programmatisch angelegten Einleitung zu einem in jüngerer Zeit erschienenen Sammelband fehlt dieser Bezug auf ethnologische Forschung dagegen völlig. Siehe David W . SABEAN und Simon TEUSCHER: Kinship in Europe: A New Approach to Long-Term Development, in: dies, und Jon MATHIEU (Hg.), Kinship in Europe. Approaches to Long-Term Development, 1300-1900, New York/Oxford 2007, S. 1-32. Siehe James D. FAUBION: Kinship is Dead. Long Live Kinship. A Review Article, in: Comparative Studies in Society and History 38 (1996), S. 67-91 und Patrick HEADY: Introduction: Care, Kinship and Community - the view from below, in: ders. und Peter SCHWEITZER (Hg.), Family,
Soziale Netzwerke und Geschichte
43
und Thomas Schweizer haben diese Revitalisierung initiiert. Neben einem von beiden herausgegebenen Sammelband und mehreren Einführungswerken (von Schweizer) ist inzwischen eine ganze Reihe von methodischen Texten wie auch Computeranwendungen (von White) entstanden.21 White führte die Kooperationen mit deutschen Ethnologen fort, v. a. mit Ulla Johansen und Schweizers Schüler Michael Schnegg.22 Die von diesen Forschern entwickelten Konzepte und Methoden werden im empirischen Teil dieser Arbeit eine große Rolle spielen; sie werden in Kapitel 6 vorgestellt. Das Konzept der sozialen Netzwerke hat in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft schon mit der 1979 erschienenen Arbeit von Wolfgang Reinhard Anklang gefunden. 23 Auch in einem jüngst erschienen Buch über Papst Paul V. Borghese (1605-1621) betont er die heuristische Relevanz der Netzwerkperspektive, die ausführlich entfaltet wird; von einem Instrumentarium formaler Methoden, wie es der „strengen Wissenschaft" zur Verfügung stehe, will er jedoch Abstand nehmen. „Doch für den Historiker genügt (...) in der Regel die elementare Version ohne viel rechnerischen Aufwand, weil seine Datenbasis dafür meistens viel zu fragmentarisch ist. (...) Aus guten Gründen müssen wir uns also versagen, die Dichte eines historischen Netzwerkes genau zu berechnen (.. .)".24 Auch wenn Reinhard der erste Historiker in der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft war, der den Begriff des sozialen Netz-
21
22
23
24
Kinship and State in Contemporary Europe, Vol. 2. The View from Below: Nineteen Localities, Frankfurt a.M. 2010, S. 13-59. Thomas SCHWEIZER: Netzwerkanalyse. Ethnologische Perspektiven (Berlin 1988); Thomas SCHWEIZER: Muster sozialer Ordnung. Netzwerkanalyse als Fundament der Sozialethnologie, Berlin 1996; Thomas SCHWEIZER und Douglas R. WHITE (ed.): Kinship, Networks, and Exchange, Cambridge 1998; Douglas R. WHITE: Structural endogamy and the network ,graphe de parenté', in: Mathématiques et sciences humaines 137 (1997), S. 101-125; Douglas R. WHITE, Vladimir BATAGELJ und Andrej MRVAR: Anthropology. Analyzing Large Kinship and Marriage Networks with PGraph and Pajek, in: Social Science Computer Review 17 (1999), S. 245-274; Douglas R. WHITE and Paul JORION: Representing and Analyzing Kinship: A Network Approach, in: Current Anthropology 33 (1992), S. 454-462. Michael SCHNEGG und Douglas R. WHITE: Getting Connected: Kinship and Compadrazgo in Rural Tlaxcala, Mexiko, in: Clemens GREINER und Waltraud K O K O T (Hg.), Networks, Resources and Economic Action, Berlin 2009, S . 37-52; Douglas R. WHITE und Ulla JOHANSEN: Network Analysis and Ethnographic Problems. Process Models of a Turkish Nomad Clan, Lanham u.a. 2005. Wolfgang REINHARD: Freunde und Kreaturen, „Verflechtung" als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen: Römische Oligarchie um 1600, München 1979; siehe auch die Diskussion bei Stefan GoRißEN: Netzwerkanalyse im Personenstandsarchiv? Probleme und Perspektiven einer historischen Verflechtungsanalyse, in: Bettina JOERGENS und Christian REINICKE (Hg.), Archive, Familienforschung und Geschichtswissenschaft. Annäherungen und Aufgaben, Norderstedt 2006, S. 159-174; Morten REITMAYER und Christian M A R X : Netzwerkansätze in der Geschichtswissenschaft, in: Christian STEGBAUER und ROGER HAUÖLING (Hg.), Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2010, S. 869-880. Wolfgang REINHARD: Paul V. Borghese (1605-1621). Mikropolitische Papstgeschichte, Stuttgart 2009, S. 10.
44
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
werkcs, oder besser gesagt der .Verflechtung', einführte, so hat dieser Versuch doch recht wenig Wirkung entfaltet. 25 Dass die beständig wachsenden Möglichkeiten, historische Daten zu generieren, ebenso ignoriert werden wie die fortschreitende Entwicklung verfugbarer und leicht zugänglicher Netzwerkprogramme, mag dabei eine Rolle spielen. Der Ethnologe Alan Macfarlane hatte schon 1977 darauf hingewiesen, dass gerade Historiker oftmals über vielversprechende Daten verfügen: „Here is a challenge in which several disciplines could combine; sociologists and social anthropologists have some indices and concepts, historians have large banks of data, and mathematicans are needed to help in the analysis." 26 Um soziale Netzwerke zu untersuchen, ist die Generierung geeigneter Daten also nötig und für viele historische Fragestellung auch durchaus möglich. Man sollte allerdings darauf achten, dass es sich hierbei tatsächlich um Netzwerkdaten handelt. Wenn etwa Zünfte, Gemeinden oder andere Institutionen als Netzwerke bezeichnet werden, ohne dass die konkrete Beziehungsstruktur überhaupt untersucht wird, sind Aussagen zur Bedeutung sozialer Netzwerke in historischen Gesellschaften schwierig zu treffen. So zieht etwa Sheilagh Ogilvie den Schluss, dass es im frühneuzeitlichen Württemberg zwei Typen von sozialen Netzwerken gegeben habe, Zünfte und lokale Gemeinden, die Frauen den Zugang zu sozialem Kapital verwehrt hätten. 27 Ogilvie leitet ihre Begriffe von James Colemans Konzept von sozialer Geschlossenheit (closurt) ab. Coleman versteht darunter die Geschlossenheit eines Netzwerks (oder eines Teilbereichs), in dem jeder mit jedem anderen in Kontakt steht; netzwerkanalytisch geht es also um die Existenz von Cliquen in Netzwerken. Diese Struktur enthält keine strukturellen Löcher und damit auch keine Broker; niemand kann einen Teil des Netzes oder einzelne Akteure beeinflussen, ohne dass die anderen davon Kenntnis erlangen oder eingreifen können. Diese Struktur führt zu hoher sozialer Kontrolle und erschwert defektives Verhalten. Er zieht daraus den Schluss, dass ,closurt' Vertrauenswürdigkeit erhöht, Informationsdurchlässigkeit garantiert und dass deshalb Normenverstöße unmittelbar sanktioniert werden können. 28 Ob Zünfte oder südwestdeutsche Gemeinden überhaupt eine solch hohe relationale Kohäsion aufweisen, ist allerdings fraglich. In beiden Institutionen können sich Faktionen bilden, oder auch hierarchische Strukturen, wo eben nicht jeder mit jedem anderen in engem Kontakt steht. Ogilvie zeigt, dass Frauen
25
26
27
28
Reinhard urteilt selbst, dass der Versuch, für .network' den Begriff .Verflechtung' einzuführen, gescheitert ist: ebd., S. 8, Fußnote 21. Alan MACFARLANE: History, anthropology and the study of communities, in: Social History 5 (1977), S. 631-652, hier S. 638. Sheilagh OGILVIE: A Bitter Living. Women, Markets, and Social Capital in Early Modern Germany, Oxford 2003, besonders S. 21 und S. 138f. James S. COLEMAN: Social capital in the creation of human capital, in: American Journal of Sociology 94 (1988), S. 95-120, hier S. 105ff.
Sortait Netzwerke und Geschichte
45
der Zugang zu bestimmten Institutionen verschlossen war; die sozialen Netzwerke sind nicht Gegenstand der Untersuchung.29 Dabei hat in den letzen Jahren eine ganze Reihe von Historikern, vornehmlich aus dem französischen und dem nordwesteuropäischen Raum, gezeigt, dass historische Netzwerkanalysen zu interessanten Ergebnissen führen können. So sind etwa von französischen Historikern Trauzeugeneinträge ausgewertet worden, um die Reichweite sozialer Netzwerke zu untersuchen.30 Cristina Munno hat die sozialen Beziehungen einer venezianischen Gemeinde in den mittleren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts untersucht. Indem sie neben Landverkäufen und -Versteigerungen auch verwandtschaftliche und Patenschaftsbeziehungen mit einem mikrogeschichtlichen Ansat2 untersuchte, konnte sie eine fortschreitende Tendenz zu weniger hierarchisch und stärker egalitär organisierten Beziehungen zwischen 1834 und 1888 aufzeigen.31 Nordwesteuropäische Historiker können oftmals über hervorragende vitalstatistische Daten verfugen. So werden in den Niederlanden große, ganze Regionen umfassende demographische und
29
30
31
Die Annahme, dass (italienische) Zünfte und vorindustrielle lokale Gemeinden sich durch einen hohen Grad an Kohäsion und sozialem Kapital auszeichnen würden, stammt von dem amerikanischen Politologen Robert D. PUTNAM: Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, Princeton 1993. Für eine ausführliche Kritik der Ansätze von Coleman und Putnam siehe Alejandro PORTES und Julia SENSENBRENNER: Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, in: American Journal of Sociology 98 (1993), 13201 3 5 0 und Alejandro PORTES: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, in: Annual Review of Sociology 24 (1998), 1-24; siehe auch Marina HENNIG: Soziales Kapital und seine Funktionsweise, in: Christian STEGBAUER und Roger HAUßLING (Hg.), Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2010, S. 177-189. Scarlett BEAUVALET und Vincent GOURDON: Les Liens Sociaux à Paris au XVIIe Siècle: Une Analyse des Contrats de Marriage de 1660, 1665 et 1670, in: Histoire, Économie et Société 17 (1998), S. 583-612.; Vincent GOURDON: AUX coeurs de la sociabilité villageoise: une analyse de réseaux à partir du choix des conjoints et des témoins au marriage dans un village d'Ilede-France au XIXe siècle, in: Annales de démographies historique 2 (2005), S. 61-94; Vincent GOURDON: Réseaux des femmes, réseaux de femmes. Le cas du témoignage au mariage civil au XIXe siècle dans les pays héritiers du Code Napoléon (France, Pays-Bas, Belgique), in: Annales de démographie historique 2 (2006), S. 33-55; Cyril GRANGE: The choice of matrimonial witnesses by Parisian Jews: Integration into greater society and socio-professional cohesion (1875-1914), in: The History of the Family 10 (2005), S. 21-44. Cristina MUNNO: L'echeveau des párenteles au villages. Dynamiques démographiques, mobilisations réticulaires et parcours individuels dans une communauté de Vénétie au XIXe siècle, unveröff. Dissertation, Paris 2010. In der Arbeit werden netzwerkanalytische wie statistische Verfahren (Regressionsanalyse) angewendet. Neben Netzwerkstrukturen wird der Einfluss sozialer Netzwerke auf Migration und Demographie untersucht. Siehe auch Cristina MUNNO: Land at Risk: Distribution of common land between networks and elites in 19th century Veneto, in: Georg FERTIG (Hg.), Social Networks, Political Institutions and Rural Societies, Turnhout, in Vorbereitung; und dies.: Prestige, intégration, parentèle: Les réseaux de parrainage dans une communauté de vénétie (1834-1854), in: Annales de démographie historique 1 (2005), S. 95-130.
46
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
netzwerkanalytische Studien durchgeführt, in denen v.a. die Netzwerke der nahen und entfernten Verwandtschaft thematisiert werden. 32 Auch in den skandinavischen Ländern sind in den letzten Jahren einige historische Netzwerkstudien zu sozialen Beziehungen und sozialen Klassen entstanden. Hier sind es oftmals die über Trauzeugen und Patenschaften erkennbaren sozialen Netzwerke, deren Verortung in der lokalen Sozialstruktur untersucht wird. 33 Historiker, Soziologen und Ethnologen haben gezeigt, dass die Netzwerkanalyse auch erfolgreich auf historische Daten angewandt werden kann. Damit kann der oben angesprochene Paradigmenwechsel der Nachbardisziplinen auch für die Untersuchung historischer Gesellschaften fruchtbar gemacht werden. Im Folgenden wird der Untersuchungsansatz dieser Arbeit mit Blick auf den Forschungsstand zu zentralen Netzwerkbeziehungen entwickelt. Neben den im vorhergehenden Kapitel angesprochenen innerfamiliären Beziehungen waren in der ländlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts fünf Beziehungsformen von Bedeutung: Verwandtschaft, Patenschaften, Nachbarschaft, Arbeitsbeziehungen und Cliquen oder Freundschaftsgruppen ( p e e r g r v u p s ) . Letztere bleiben in dieser Arbeit ausgespart. Das ist nicht ihrer Relevanz geschuldet, sondern der Quellenlage im ländlichen Westfalen; in den verfügbaren, auf Familien- und Besitzverhältnisse bezogenen Quellen kommen Freundschaften nicht vor. 34 Auch über Arbeitsbeziehungen weiß man wenig, Anschreibe- oder Tagebücher von Bauern stehen hier nicht zur Verfügung. 35 Das in Ostwestfalen wie im Osnabrücker Land etablierte Heuerlings-
32
Siehe etwa Hilde BRAS und Theo VAN TILBURG: Kinship and Social Networks: A Regional Analysis of Siblings Relations in Twentieth-Century Netherlands, in: Journal of Family History 32 (2007), S. 296-322; Hilde BRAS, Frans VAN POPPEL und Kees MANDEMAKERS: Relatives as
Spouses: Preferences and Opportunities for Kin Marriage in a Western Society, in: American Journal of Human Biology 21 (2009), S. 793-804; Maarten DUIJVENDAK und M a r i k e PETER-
ZON: Relations, friends and relatives. Comparing elite-networks on structural properties in the Dutch provinces Groningen and North-Brabant, 1830-1910, in: Onno BOONSTRA, Geurt COLLENTEUR, Bart VON ELDEREN (Hg.), Structures and contigencies in Computerized Historical Research, Hilversum 1995, S. 87-97; Wendy POST, Frans VAN POPPEL, Evert VAN IMHOFF und Ellen KRUSE: Reconstructing the extended kin-network in the Netherlands with genealogical data: Methods, problems, and results, in: Population Studies 51 (1997), S. 263-278. 33
Gisli Agüst GUNNLAUGSSON und Loftur GUTTORMSSON: Cementing alliances? Witnesses to marriage and baptism in early nineteenth-century iceland, in: The History of the Family 5 (2000), S. 259-272; Robert C. OSTERGREN: Kinship Networks and Migration. A NineteenthCentury Swedish Example, in: Social Science History 6 (1982), 293-320; Tom ERICSSON: Godparents, Witnesses and Social Class in Mid-Nineteenth Century Sweden, in: The History of the
34
Marion Lischka (Liebe als Ritual) hat mit Prozessakten gearbeitet, die für die hier untersuchten Kirchspiele nicht erhalten sind. Siehe auch Medick, Spinnstuben, und Beck, Illegitimität. Schlumbohm, Lebensläufe, hat mit einem Bestand zu einem einzelnen Hof gearbeitet, S. 543ff.; Thijs LAMBRECHT: Reciprocal exchange, credit and cash: agricultural labour markets and local economies in the southern Low Countries during the eighteenth century, in: Continuity and Change 18 (2003), S. 237-261.
F a m i l y 5 ( 2 0 0 0 ) , S. 2 7 3 - 2 8 6 .
35
Verwandtschaft
47
system ist von Mager und v. a. von Schlumbohm untersucht worden, dagegen ist über die anders organisierten Wohn- und Arbeitsverhältnisse der unterbäuerlichen Schichten in weiten Teilen Westfalens, so auch in der Soester Börde, bislang wenig bekannt. 36 Angesichts der hohen Bedeutung des Produktionsfaktors Arbeit für die Produktivitätsentwicklung der westfälischen Landwirtschaft handelt es sich hier um ein erhebliches Forschungsdesiderat. Die Nachbarschaften sind vornehmlich in volkskundlichen Studien thematisiert worden. Sie waren durch einen hohen Grad an normativen Handlungserwartungen gekennzeichnet, vor allem mit Bezug auf die Nothilfe; daneben haben aber in vielen Regionen arbeitsorganisatorische Fragen eine wichtige Rolle gespielt.37 Eine wenig untersuchte Frage ist jedoch der Stellenwert der Nachbarn in den persönlichen Netzwerken. Wenn aus Nachbarn Paten werden, so gehen die Beziehungen über rein funktionale Nothilfegemeinschaften hinaus. In den folgenden Abschnitten wird nun die Forschungslage zu verwandtschaftlichen und Patenschaftsbeziehungen sowie Beziehungen zwischen Bauern und ländlichen Arbeitern vorgestellt.
3.2 Verwandtschaft Verwandtschaft war für lange Zeit kein Thema, für das sich diejenigen Wissenschaften, die sich mit modernen Gesellschaften beschäftigen, allzu sehr interessiert hätten. In der Familiensoziologie ist dies seit einiger Zeit als Defizit erkannt. Zwei Faktoren werden für das weitgehende Ausblenden verwandtschaftlicher Beziehungen verantwort-
36
Mager, Protoindustrialisierung; Wolfgang MAGER: Haushalt und Familie in protoindustrieller Gesellschaft: Spenge (Ravensberg) während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Neithard BULST, Joseph GOY und Jochen HOOCK (Hg.), Familie zwischen Tradition und Moderne, Göttingen 1981, S. 141-181; Jürgen SCHLUMBOHM: Agrarische Besitzklassen und gewerbliche Produktionsverhältnisse: Großbauern, Kleinbesitzer und Landlose als Leinenproduzenten im Umland von Osnabrück und Bielefeld während des frühen 19. Jahrhunderts, in: Mentalitäten und Lebensverhältnisse. Beispiele aus der Sozialgeschichte der Neuzeit. Rudolf Vierhaus zum 60. Geburtstag, Göttingen 1982, S. 315-334; Jürgen SCHLUMBOHM: From peasant society to class society: some aspects of family and class in a northwest german protoindustrial parish, t h _ t h centuries, in: Journal of Family History 17 (1992), 1 8 3 - 1 9 9 ; Schlumbohm, Lebensläufe; Hans-Jürgen SERAPHIM: Das Heuerlingswesen in Nordwestdeutschland, Münster 1947. Zum Normensystem der Nachbarschaft siehe Rudolf HEBERLE: Das normative Element in der Nachbarschaft, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 11 (1959), S. 181197; Teresa DOBROWOLSKA: Nachbarschaft und Zusammenarbeit in den Karpathen-Dörfern, in: Ethnologia Europaea XV (1985), S. 165-178; Hubert HONVEHLMANN: Nachbarschaften auf dem Lande. Gegenwärtige Formen im nordwestlichen Münsterland, Münster 1990; Winfried SCHMITZ: Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft im archaischen und klassischen Griechenland, in: Historische Zeitschrift 268 (1999), S. 561-597; siehe auch den Tagungsbericht: Nachbarschaft und der Sinn für Gemeinschaft, Dresden 25.06.2010-26.06.2010, erschienen in H-Sozu-Kult 14.08.2010. (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=3245, letzter Abruf am 26.08.2010). 17
37
19
48
Kapitel 3: Stnjalt Netzwerke in der Vormoderne
lieh gemacht. Erstens war im 20. Jahrhundert die Vorstellung der gattenzentrierten (bürgerlichen) Familie als Keimzelle der modernen Gesellschaft dominierend, die weitgehend isoliert von ihrer sozialen Umgebung existieren konnte. 38 Hinzu kam die Betonung der Mutterrolle, mit einer starken Betonung der Mutter-Kind-Beziehung, die für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes zentral sei. Zweitens erschwert aber der uneindeutige Status der Verwandtschaft eine soziologische Untersuchung. Verwandtschaftliche Beziehungen nehmen eine Zwitterstellung ein, einerseits sind sie wie innerfamiliäre Beziehungen zugeschrieben {ascribed), andererseits unterliegt aber die Aktivierung dieser Beziehungen zumindest in den meisten modernen Gesellschaften keinen starken gesellschaftlichen Normen, sondern wird in der Regel frei gewählt und ähnelt damit der (besser untersuchten) Freundschaft. Gravierend ist hier aber auch das Datenproblem: Die amtliche Statistik, schon immer auf den Haushalt konzentriert, liefert keine Informationen zu verwandtschaftlichen Verhältnissen, und auch in der Netzwerkforschung ist oft nicht nach der verwandtschaftlichen Dimension persönlicher Netzwerke gefragt worden. Die familiensoziologische Forschung sieht sich also mit erheblichen Datenproblemen konfrontiert. 39 Inzwischen ist erkannt worden, dass sowohl die Vorstellungen über die Bedeutung der Verwandtschaft in der Vergangenheit als auch die über ihren Bedeutungsverlust in der Gegenwart relativiert werden müssen. Weder lebte die Mehrzahl der Menschen in der Vormoderne in Großfamilien, die aus Familienmitgliedern, Gesinde und Verwandten gebildet wurden, noch war im Dorf ,jeder mit jedem' verwandt. Aber auch für die Gegenwart muss man eher von einem Bedeutungswandel als von einem Bedeutungsverlust der verwandtschaftlichen Beziehungen sprechen. Insbesondere für ältere Menschen ist nachgewiesen worden, dass Verwandte eine wichtige Quelle sozialer Sicherheit sind. Anders als Freunde oder Nachbarn stellen Verwandte langfristige Kontakte von erheblicher Konsistenz zur Verfügung. Dem entspricht die Beobachtung einer intergenerationellen Verlagerung von Verwandtschaftsbeziehungen, die sich aus einer höheren Lebenserwartung bei reduzierten Bruttoreproduktionsraten ergeben, mit anderen Worten: Die Bedeutung der Großeltern (oder Enkel) nimmt zu, die der kollateralen Verwandten wie Cousinen oder Schwäger nimmt schon deshalb ab, weil
38
39
Talcott PARSONS: Das Verwandtschaftssystem in den Vereinigten Staaten, in: ders., Beiträge zur soziologischen Theorie, Neuwied 1964, S. 84-108; Emile DÜRKHEIM: La famille conjugale, in: Revue Philosophique de la France et de l'etranger 91 (1921), S. 1-14. Yvonne SCHÜTZE und Michael WAGNER: Verwandtschaft - Begriff und Tendenzen der Forschung, in: Yvonne SCHÜTZE und Michael WAGNER (Hg.), Verwandtschaft. Sozialwissenschaftliche Beiträge zu einem vernachlässigten Thema, Stuttgart 1998, S. 7-16; eine ausführliche Diskussion bietet Nina JAKOBY: (Wahl-)Verwandtschaft - Zur Erklärung verwandtschaftlichen Handelns, Wiesbaden 2008; siehe auch Johannes F. K. SCHMIDT: Soziologie der Verwandtschaft: Forschung und Begriff, in: Johannes F. K. SCHMIDT, Martine GUICHARD, Peter SCHUSTER und Fritz TRILLMICH (Hg.), Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Verflechtung zweier Beziehungssysteme, Konstanz 2007, S. 15-43.
Verwandtschaft
49
es sie, zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht mehr in großer Anzahl gibt. Insgesamt ist aber die Erforschung des modernen Verwandtschaftssystems als wichtiges Desiderat soziologischer Forschung erkannt. Auch hier wird, wie in der Geschichtswissenschaft, auf Anregungen aus ethnologischen Verwandtschaftsanalysen zurückgegriffen.40 In der Ethnologie ist Verwandtschaft lange ein beherrschendes Thema gewesen. Vor allem Claude Lévi-Strauss' „Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft" gilt als das wichtigste Werk zur ethnologischen Verwandtschaftsforschung. Lévi-Strauss baute auf der Verwandtschaftstheorie von Lewis H. Morgan auf, der bereits das auf Austausch beruhende Prinzip der Exogamie thematisierte.41 Diese Vorstellung von Verwandtschaft als Besitz- und Austauschsystem ist in der Geschichtswissenschaft insbesondere von Sabean aufgegriffen worden.42 Neuere Ansätze der ethnologischen Verwandtschaftsforschung bedienen sich netzwerkanalytischer Methoden; davon wird in Kapitel 4 die Rede sein. Die Geschichtswissenschaft folgte lange der Vorstellung eines vormodernen, geradezu archaischen Charakters verwandtschaftlicher Beziehungen, denen in der modernen Welt keine Bedeutung mehr zukäme.43 Gerade die vor allem an Modernisierungsprozessen interessierte Historische Sozialwissenschaft war demzufolge wenig geneigt, die Rolle der Verwandtschaft etwa für die Akkumulation von Kapital oder die Rekrutierung von Führungskräften zu untersuchen. Kocka hat auf die Rolle der Familie und von Familiennetzwerken (und somit der weiteren Verwandtschaft) in der frühen Industrialisierung hingewiesen, ist allerdings von einem weitgehenden Funktionsverlust der Familien nach dem späten 19. Jahrhundert ausgegangen.44 Familien wurden eher als Störfaktoren unternehmerischer Entwicklung denn als treibende Kraft gesehen. Erst in jüngerer Zeit ist mit dem Interesse an kleinen und mittleren Unternehmen, denen ein „besonders hohes Maß an Flexibilität, Kreativität und Innovationsbereitschaft zugeschrieben" wird, auch das Familienunternehmen wieder als Forschungs-
40
41
42 43
44
Günther LOSCHEN: Verwandtschaft, Freundschaft, Nachbarschaft, in: Rosemarie N A V E - H E R Z und Manfred M A R K E F K A (Hg.), Handbuch der Familien- und Jugendforschung, Bd. 1: Familienforschung, Neuwied 1989, S. 435-452; Ulla BJÖRNBERG und Hans E K B R A N D : Configurations of Family Commitments: Patterns of Support Within Kin, in: Eric D. W I D M E R und Riitta JALLINOJA (Hg.), Beyond the Nuclear Family: Families in a Configurational Perspective, Bern 2008, S. 13-36; Blanche L E BIHAN und Claude MARTIN: Caring for Dependent Elderly Parents and Family Configurations, in: ebd., S . 59-76; Bernhard N A U C K und Otto G. SCHWENK: Did Societal Transformation Destroy the Social Networks of Families in Eastern Germany?, in: American Behavioral Scientist 44 (2001), S. 1864-1878. 1981; Lewis H. MORGAN: Systems of Consanguinity and Affinity in the Human Family, Washington D. C. 1870. Sabean, Social background, S. 115; Sabean, Kinship, S. 8ff. Für einen Überblick siehe David I. KERTZER: Living with Kin, in: David I. K E R T Z E R und Marzio BARBAGLI (Hg.), Family Life in the Long Nineteenth Century, New Haven 2003, S. 40-72. Jürgen KOCKA: Familie, Unternehmer und Kapitalismus: An Beispielen aus der frühen Industrialisierung, in: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte 24 (1979), S. 99-135. LÉVI-STRAUSS
50
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
gegenständ entdeckt worden.45 So ist Michael Schäfer in seiner Untersuchung sächsischer Familienunternehmen zwischen 1850 und 1940 zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Beziehungen zwischen Familie und Unternehmen im Laufe der Zeit sogar intensivierten. Gründe hierfür sieht er im steigenden Kapitalbedarf sowohl für Unternehmensgründungen als auch für die Überbrückung von Notlagen. Daneben dürfte die Schwierigkeit, das in Investitionskapital angelegte Vermögen für die Auszahlung von Erben aus dem Unternehmen zu ziehen, ein wichtiges Motiv für die Etablierung dauerhafter Unternehmerfamilien gewesen sein.46 Hier findet ein Übergang statt von familiären Beziehungen, also denen zwischen Eltern und Kindern, zu solchen, die man der Verwandtschaft zurechnet: Die gemeinsame Präsenz von Brüdern, Schwägern oder auch weiteren Verwandten wie Onkel und Neffen oder Cousins in einem Unternehmen weitet den Begriff des Familienunternehmens auf die nähere Verwandtschaft aus. Das europäische Verwandtschaftssystem hat erst spät Aufmerksamkeit erfahren. Zwar gibt es bereits seit den 1950er Jahren ethnologische Studien, die sich sowohl mit der Bedeutung verwandtschaftlicher Strukturen in den ländlichen als auch städtischen Regionen Europas beschäftigen, aber erst in jüngster Zeit wird die Rolle von Verwandten für soziale Unterstützung systematisch untersucht47 Die Entstehung eines spezifisch europäischen Verwandtschaftssystems, das sich durch das weitgehende Fehlen
45
Michael SCHAFER: Unternehmen und Familie. Zur Genese von Familienunternehmen im Industriezeitalter: Sachsen 1 8 5 0 - 1 9 4 0 , in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 2 0 0 8 / 2 , S. 197-214,
Zitat S. 198; siehe auch David LANDES: Die Macht der Familie. Wirtschaftsdynastien in der Weltgeschichte, München 2008; Harold JAMES: Familienunternehmen in Europa. Haniel, Wendel und Falck, München 2005; Hervé JOLY: Ende des Familienkapitalismus? Das Überleben der Unternehmerfamilien in den deutschen Wirtschaftseliten des 20. Jahrhunderts, in: Volker R. BERGHAHN, Stefan UNGER und Dieter ZIEGLER (Hg.), Die deutsche Wirtschaftselite im 20. Jahrhundert. Kontinuität und Mentalität, Essen 2003, S. 75-92; Richard GRASSBY: Kinship and Capitalism. Marriage, Family, and Business in the English-speaking World, 1580-1740, Cambridge 2001; Andrea COLLI: The History of Family Business, 1850-2000, Cambridge 2003, bietet einen ausführlichen Literaturüberblick. 46 47
Schäfer, Unternehmen, S. 213. Raymond J. FIRTH (Hg.): Two Studies of Kinship in London, London 1956; Raymond J. FIRTH, Jane HUBERT und Anthony FORGE: Families and their Relatives: Kinship in a Middle-Class Sector of London, London 1968; Elisabeth BOTT: Family and social networks, London 1957; Michael YOUNG und Peter WILMOTT: Family and Kinship in East London, London 1957; Julian PITT-RIVERS: The people of the Sierra, London 1954; John K. CAMPBELL: Honour, family and patronage: a study of institutions and moral values in a Greek mountain community, Oxford 1964; Sandra HOFFERTH und John ICELAND: Social capital in Rural and Urban Communities, in: Rural Sociology 63 (1998), S. 574-598; Heidi ROSENBAUM und Elisabeth TIMM: Private Netzwerke im Wohlfahrtsstaat. Familie, Verwandtschaft und soziale Sicherheit im Deutschland des 20. Jahrhunderts, Konstanz 2008; Hannes GRANDITS (Hg.): Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Vol. 1: The Century of Welfare: Eight Countries, Frankfurt a.M. 2010; Patrick HEADY und Peter SCHWEITZER (Hg.): Family, Kinship and State in Contemporary Europe,
Verwandtschaft
51
klar abzugrenzender Verwandtengruppen und durch eine geringe Bedeutung der Abstammungsgruppe auszeichnet, ist zuerst von einem Ethnologen thematisiert worden. Jack Goody führt es auf die Etablierung von Heiratsverboten durch die Kirche in der Spätphase des römischen Reiches zurück. Damit sei dann ein weitgehend exogames Heiratsverhalten durchgesetzt worden, das die Herausbildung starker Verwandtschaftsverbände verhindert hätte.48 Es ist allerdings strittig, inwieweit diese Vorschriften von der Masse der Bevölkerung überhaupt befolgt worden sind.49 Mitterauer hat auf die massive Bedeutung der Christianisierung für Verwandtschaft, Familie und Haushaltsbildung hingewiesen.50 Das Konsensprinzip der Heirat, die Zurückdrängung des Ahnenkults, die neolokale Haushaltsbildung sind die wichtigsten damit verbundenen Veränderungen des europäischen Familiensystems, die zum Teil genuin christliche Wurzeln hatten, zum Teil auch auf ältere Ursprünge zurückgehen, sich aber erst mit dem Christentum durchsetzten. An die Stelle der Abstammungsgruppe trat die christliche Gemeinde als zentrale Integrationsinstanz; mit dem „Mitbruder" trat auch der „Pate" in den sozialen Nahbereich der Menschen. Die auf dem Konsens der Brautleute beruhende christliche Ehe schwächte den Einfluss der Herkunftsfamilie und flexibilisierte das Heiratsverhalten. Das Prinzip der neolokalen Haushaltsgründung löste den Zwang zur Patrilokalität ab; von nun an war die Neugründung eines Haushalts dem Verbleib bei den Eltern des Mannes oder aber der Frau zumindest nebengeordnet.51 Daneben boten spirituelle Gemeinschaften Alternativen zur Eheschließung; erst mit dem christlichen Zölibat erlangte die Entscheidung zur Ehelosigkeit soziale Legitimität. Nach Michael Mitterauer liegen dem fundamentalen Wandel des europäischen Verwandt-
48 49
50
51
Vol. 2: The View from Below: Nineteen Localities, Frankfurt a. M. 2010; Patrick H E A D Y und M. KOHLI (Hg.): Family, Kinship and State in Contemporary Europe, Vol. 3: Perspectives on Theory and Politics, Frankfurt a. M. 2010. Jack GOODY: Die Entwicklung von Ehe und Familie in Europa, Berlin 1986. Heidi ROSENBAUM: Verwandtschaft in historischer Perspektive, in: Michael WAGNER und Yvonne SCHÜTZE (Hg.), Verwandtschaft. Sozialwissenschaftliche Beiträge zu einem vernachlässigten Thema, Stuttgart 1998, S. 17-33; hier S. 19. Michael MITTERAUER: European Kinship Systems and Household Structures: Medieval Origins, in: Hannes G R A N D I T S und Patrick H E A D Y (Hg.), Distinct Inheritances. Property, Family and Community in a Changing Europe, Münster 2003, S. 35-51. Für England hat Laslett von einem regelrechten Zwang zur Neolokalität gesprochen; siehe Peter LASLETT: Family, Kinship and Collectivity as Systems of Support in Pre-industrial Europe: a consideration of the nuclear-hardship hypothesis, in: Continuity and Change 3 (1988), S. 153175; siehe auch Daniel Scott SMITH: The Curious History of Theorizing about the History of the Western Nuclear Family, in: Social Science History 17 (1993), S. 325-353. In den meisten Regionen Europas gab es aber ein Nebeneinander verschiedener Systeme, die je nach Familiensituation, ökonomischen Erfordernissen oder auch kulturellen Vorstellungen auch Formen von erweiterten Haushalten kannten. In Nordwestdeutschland war es etwa üblich, dass designierte Hoferben im Haushalt ihrer Eltern blieben, und auch Altenteiler blieben oft im Haushalt ihres Nachfolgers. In Kapitel 6 wird gezeigt, dass es daneben eine Vielzahl möglicher, individuell vereinbarter Arrangements gab.
52
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der X/ormoderne
schaftssystems also, anders als bei Jack Goody, weniger institutionelle Veränderungen zugrunde als vielmehr ein tiefgreifender religiöser Wandel, der die Grundpfeiler der patriarchalischen Gesellschaft erschütterte. Die christliche Gesellschaft des Mittelalters und der frühen Neuzeit kannte keine Abstammungsgruppen mehr, denen die Individuen eindeutig zugeordnet waren.52 Das europäische Verwandtschaftssystem ist kognatisch organisiert, d.h. die Verwandten von Vater und Mutter werden gleichermaßen als verwandt anerkannt. Das bedeutet aber, dass das Feld der Verwandten diffus ist; nur Vollgeschwister haben dieselben Verwandten, während ihre Eltern jeweils eigene ,kindreis' haben. „Da es keine strukturellen Vorgaben für die Bevorzugung bestimmter Verwandtschaftsbeziehungen gibt, hat die Kernfamilie zentrale Bedeutung. Dieses System ist in hohem Maße offen, flexibel und anpassungsfähig. Jenseits seiner Kernfamilie kann Ego unter der Vielzahl vorhandener Verwandter auswählen, und je nach Bedarf bestimmte Beziehungen betonen, andere vernachlässigen."53 Verwandtschaft in Europa ist somit ein potentielles Feld von Beziehungen, die nur durch die Praxis der Individuen realisiert und aktiviert werden können; verwandtschaftliche Beziehungen sind in diesem Sinne eine Ressource, nicht a priori eine Realität.54 Damit ist die starke Rolle der Kernfamilie und ihre eher lose Einbindung in Verwandtschaftsgruppen gerade nicht ein Produkt der europäischen Moderne, sondern ein weit zurückreichendes mittel- und westeuropäisches Muster.55 In der Neuzeit scheint die Bedeutung der Verwandtschaft nicht ab-, sondern im Gegenteil sogar zuzunehmen. Neben den oben angesprochenen Funktionen von Familie und Verwandtschaft für das Wirtschaftsbürgertum sind auch für ländliche wie städtische Unterschichten und für Bauern verwandtschaftliche Unterstützungsleistungen in erheblichem Umfang aufgezeigt worden. So konnten Tamara Hareven und Heidi Rosenbaum zeigen, wie Verwandte bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen
52
Zur mediävistischen Verwandtschaftsforschung siehe auch Kerstin SEIDEL und Peter SCHUSTER: Freundschaft und Verwandtschaft in historischer Perspektive, in: Johannes F. K. SCHMIDT, Martine GUICHARD, Peter SCHUSTER und Fritz TRILLMICH (Hg.), Freundschaft und Verwandtschaft. Zur Unterscheidung und Verflechtung zweier Beziehungssysteme, Konstanz 2007, S. 145-156. Für die mittelalterlichen Städte Bern und Köln ist gezeigt worden, dass Verwandtschaft eine fundamentale Beziehungsform und das wichtigste Bauprizip der mittelalterlichen Stadtgesellschaft war, siehe Simon TEUSCHER: Bekannte - Klienten - Verwandte. Soziabilität und Politik in der Stadt Bern um 1500, Köln 1998, und Kerstin SEIDEL: Freunde und Verwandte. Soziale Beziehungen in einer spätmittelalterlichen Stadt, Frankfurt a.M. 2009.
53
Rosenbaum, Verwandtschaft, S. 20. Josef EHMER: Alter und Generationenbeziehungen im Spannungsfeld von öffentlichem und privatem Leben, in: Josef EHMER und Peter GUTSCHNER (Hg.), Das Alter im Spiel der Generationen, Wien 2000, S. 15-48, hier S. 26; Martine SEGALEN: Die Familie, Frankfurt a.M. 1990; S . 93. Rosenbaum, Verwandtschaft, S. 21.
54
55
Verwandtschaft
53
halfen. 56 Margareth Lanzinger hat gezeigt, dass unverheiratete Frauen in den Haushalt ihrer Schwester gingen, um bei der Versorgung der Kinder zu helfen; einem solchen Arrangement konnte nach dem frühen Tod der Mutter dann eine Eheschließung zwischen dem Vater der Kinder und der Schwägerin erfolgen. 57 In Neckarhausen sorgten Verwandtennetzwerke dafür, dass angehende Schuldner als kreditwürdig eingestuft wurden. 58 Die Untersuchung von Unterstützungsleistungen zwischen solchen Verwandten, die nicht demselben Haushalt angehörten, durchbricht die zum Teil auch der Überlieferung geschuldete Konzentration auf die Einheit von Familie und Haushalt.59 Die Struktur des lokal verfügbaren, über den Haushalt hinaus reichenden Verwandtennetzes konnte erhebliche Auswirkungen auf die Lebensläufe von Individuen und Familien haben. Für eine toskanische Gemeinde ist gezeigt worden, dass die Größe des jenseits des eigenen Haushalts verfügbaren Netzwerks von Verwandten im 19. Jahrhundert als Barriere gegen Emigration gewirkt hat. 60 Auch außerhalb des europäischen Kontextes ist die Bedeutung der Verwandtschaft jenseits des eigenen Haushaltes jüngst nachgewiesen worden: Cameron Campbell und James Lee haben für die Provinz Liaoning im Nordosten Chinas (19. Jahrhundert) die Auswirkungen der Präsenz Verwandter im eigenen und jenseits des eigenen Haushalts untersucht. Für die Erlangung eines Amtes war dabei sowohl die Position des eigenen Vaters, die von Verwandten jenseits des Haushaltes
56
57
58 59
60
Tamara K. HAREVEN: Family time and industrial time. The relationship between the family and work in a New England industrial community, Cambridge 1982; Tamara K. HAREVEN: Verwandtschaftsdynamiken in einer amerikanischen Industriestadt, in: dies., Familiengeschichte, Lebenslauf und sozialer Wandel, Frankfurt a.M. 1999, S. 87-129; Heidi ROSENBAUM: Proletarische Familien, Frankfurt a. M. 1992; auch Schlumbohm weist darauf hin, dass Geschwister Arbeitsplätze vermittelten: Schlumbohm, Lebensläufe, S. 360. Margareth LANZINGER: Schwestern-Beziehungen und Schwager-Ehen. Formen familialer Krisenbewältigung im 19. Jahrhundert, in: Eva LABOUVIE (Hg.), Familienbande - Familienschande. Geschlechterverhältnisse in Familie und Verwandtschaft, Köln 2007, S. 263-282; zur Rolle von Geschwistern in sozialen Netzwerken siehe auch Bras / van Tilburg, Kinship; zur Problematik der Beziehungen zwischen Schwägern, die im 17. Jahrhundert im Zentrum des Inzestdiskurses standen, siehe David W. SABEAN: Inzestdiskurse vom Barock bis zur Romantik, in: L'Homme. Zeitschrift für Geschichte 13 (2002), S. 7-28. Sabean, Kinship, S. 7. Für einen kurzen Überblick der italienischen Forschung siehe Giovanni LEVI: Family and Kin - A few thoughts, in: Journal of Family History 15 (1990), S. 567-578, hier S. 570f.; Tamis FARAGÔ: Kinship in rural Hungary during the eighteenth century: The Findings of a Case Study, in: The History of the Family 3 (1998), S. 315-331; Fontaine / Schlumbohm, Household Strategies, S. 14. Matteo MANFREDINI und Marco BRESCHI: Coresident and Non-Coresident Kin in a NineteenthCentury Italian Rural Community, in: Annales de démographie historique 1 (2005), S. 157-172; zu Verwandtschaftsnetzen und Migration siehe auch Laurence FONTAINE: Migration and work in the Alps (17th-18th centuries): Family Strategies, Kinship, and Clientelism, in: The History of the Family 3 (1998), S. 351-369; Ostergren, Kinship Networks.
54
Kapitel 3: Stnjoit Netzwerke in der Vormoderne
als auch die absolute Anzahl von lokal verfügbaren Verwandten wichtig. 61 In einem Überblick über intergenerationelle Beziehungen zwischen alternden Eltern und ihren erwachsenen Kindern in England seit dem 17. Jahrhundert hat Pat Thane gezeigt, dass die meisten Menschen getrennte Haushalte bei gleichzeitig intensiven reziproken Unterstützungsleistungen bevorzugten. 62 Auch Barry Reay widerspricht einem in der englischen Forschung gängigen Bild, dass hier die Kernfamilie und deren Einbindung in die Gemeinde zentral sei, erweiterte Familien und Verwandtschaftsnetze aber keine große Rolle spielten. In den drei von ihm untersuchten Gemeinden in der Grafschaft Kent durchliefen viele Haushalte eine erweiterte Phase, und auch Kernfamilien waren zum großen Teil in lokale Verwandtschaftsnetze eingebunden. 63 Peter Laslett hatte dagegen die Auffassung vertreten, dass das Verwandtennetz schon aufgrund der im späten 18. Jahrhundert noch hohen Sterblichkeit keine relevante Ressource darstellen konnte. An der Allgemeinheit als zentraler Quelle sozialer Unterstützung sei somit kein Weg vorbeigegangen. 64 Hier übersah Laslett allerdings die erhebliche Flexibilität der europäischen Familienformen, die auch dort, wo Haushalte in der Regel Kernfamilien umfassten, die Versorgung alter und hilfsbedürftiger Verwandter in erweiterten Haushalten kannten. Kulturelle Normen der Neolokalität schlössen solche Normen, die eine Unterstützung hilfsbedürftiger Eltern und Verwandter forderten, keineswegs aus. 65 Martine Segalen hat daraufhingewiesen, dass die Norm, unabhängige Haushalte zu bilden, möglichst sogar ein eigenes Haus zu bauen, kaum Rückschlüsse über das Ausmaß an Kooperation zwischen Verwandten zulässt. Im 19. wie 20. Jahrhundert verband ein dichtes Netz wechselseitiger Beziehungen verwandte Haushalte. Der eigene Haushalt ermöglichte allen Beteiligten Unabhängigkeit; die meisten Menschen im Süd-Bigouden wählten auf dieser Basis aber die Aufrechterhaltung und Reproduktion eines dichten sozialen Netzes für das alltägliche, die Haushaltsgrenzen überschreitende Zusammenleben. 66
61
62
63
64 65 66
Cameron CAMPBELL und James L E E : Kin Networks, Marriage, and Social Mobility in Late Imperial China, in: Social Science History 32 (2008), S. 175-214. Pat T H A N E : „ E S ist gut, in der Nähe zu sein — aber nicht zu nah". Ältere Menschen und ihre Familien in England seit dem 17. Jahrhundert, in: Margareth LANZINGER und Edith SAURER (Hg.), Politiken der Verwandtschaft. Beziehungsnetze, Geschlecht und Recht, Wien 2007, S. 73-98. Barry REAY: Kinship and the neighbourhood in nineteenth century rural England: the myth of the autonomous nuclear family, in: Journal of Family History 21 (1996), S. 87-104. Laslett, Family, S. 161 ff. Kertzer, Kin, S. 52f. Martine SEGALEN: Nuclear is Not Independent. Organization of the Household in the Pays Bigouden Sud in the Nineteenth and Twentieth Centuries, in: Robert McC. NETTING, Richard R. WLLK, Eric J. ARNOULD (Hg.), Households. Comparative and Historical Studies of the Domestic Group, Berkeley u.a. 1984, S. 163-186.
Verwandtschaft
55
Auf politischer Ebene ist für verschiedene schwäbische Dörfer gezeigt worden, dass verwandtschaftliche Netzwerke den Prozess der politischen und sozialen Klassenbildung stützten.67 Für Kiebingen hat Carola Lipp gezeigt, dass Familie und Verwandtschaft die Basisorganisation bei der Verteilung der politischen Macht waren; dass jemand ohne verwandtschaftlichen Rückhalt in die Gemeindevertretung kam, war sehr selten der Fall. Verwandtschaftliche Netzwerke waren die stabilisierende Substruktur der politischen Herrschaft.68 Während die Verwandtschaft gegen Ende des 19. Jahrhunderts aus den theoretischen Konzepten der bürgerlichen Philosophie und Soziologie verdrängt wurde, war sie in der politischen Praxis omnipräsent. In Lipps Einschätzung bildeten Verwandtschaftsnetze ein unsichtbares Fundament der bürgerlichen Gesellschaft, weshalb die klassischen Vorstellungen von der Autonomie des Individuums in der frühen bürgerlichen Gesellschaft und die Idee der Auflösung traditionaler Ordnungen überdacht werden müssten.69 Sandro Guzzi-Heeb hat für ein alpines Tal (Val de Bagnes, Schweiz) gezeigt, dass Familien ihre sozialen Netzwerke ausbauten; zum einen erweiterten sie ihre verwandtschaftlichen Netzwerke durch Heirat, zum anderen dehnten sie ihre Patenbeziehungen aus. So wurden spezifische Milieus geschaffen, in denen horizontale, nicht klientelistische Beziehungen für politische Mobilisierung genutzt werden konnten.70 Hier wird also im Vergleich zu Sabeans Thesen eine gänzlich anders gelagerte Organisation von verwandtschaftlichen Strukturen gezeigt, die sich eher durch Diversifizierung sozialer Beziehungen (weak ties)11 und gerade nicht durch exklusive Verwandtschaftskreise auszeichnet. Demographische Arbeiten, die sich mit der Rolle der Verwandtschaft beschäftigen, kommen mit Bezug auf den Reproduktionserfolg endogamer Ehen zu ambivalenten Ergebnissen.72 Für die Niederlande ist nachgewiesen worden, dass Cousins im 19. Jahrhundert gar nicht sehr häufig waren, und dass ihre durchschnittliche Anzahl bis etwa 1950 anstieg.73 Demgegenüber nahm die Zahl der Ehen mit Cousins ersten Grades, und auch mit den Geschwistern verstorbener Ehepartner zwischen 1840 und 1922 ab. Dabei gab es durchaus Unterschiede in Bezug auf Schichtenzugehörigkeit, Konfession 67
68 69 70
71
72
73
Rosenbaum, Verwandtschaft, S. 24; Beispiele hierfür sind Utz JEGGLE: Kiebingen - eine Heimatgeschichte, Tübingen 1977; Kaschuba / Lipp, Überleben; Sabean, Kinship; Heide WUNDER: Schwäbische Schultheißenfamilien, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 9 (1961), S. 203-210. Kaschuba / Lipp, Überleben, S. 572, S. 582, S. 588. Lipp, Verwandtschaft. Sandro GUZZI-HEEB: Kinship, ritual kinship and political milieus in an alpine Valley in 19th century, in: The History of the Family 14 (2009), S. 107-123. Weak ties sind eher schwache Beziehungen, die sich gerade nicht durch häufige Kontakte, große persönliche Nähe oder Multiplexität auszeichnen. Die Bedeutung solcher Beziehungen ist zuerst von Granovetter identifiziert worden; siehe Fußnote 3 in diesem Kapitel. Siehe auch den Sammelband Tommy BENGTSSON und Geraldine P. MINEAU (Hg.): Kinship and Demographic Behaviour in the Past, London 2008. Post / van Poppel / van Imhoff / Kruse, Reconstructing.
56
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
und Regionalität. In isolierten Gebieten wurden verhältnismäßig mehr Verwandte geheiratet, und orthodoxe Protestanten im „Bibelgürtel" wählten relativ häufig Cousins zu Ehepartnern. Dass in den oberen Schichten und bei den Bauern Verwandtenheiraten häufiger waren, deutet auf die Rolle der Verwandtschaft in der Klassenbildung des späten 19. Jahrhunderts hin.74 Den positiven Auswirkungen der Verwandtschaftsorientierung auf die soziale Reproduktion konnten jedoch gravierende Nachteile gegenüberstehen. So sind für Nordschweden die Auswirkungen von Heiraten zwischen Blutsverwandten auf Fertilität und Sterblichkeit zwischen 1720 und 1899 untersucht worden, mit ernüchternden Ergebnissen: Ehepaare, die zugleich Cousins ersten Grades waren, waren signifikant stärker von Totgeburten und Kindersterblichkeit betroffen.75 Die von David Sabean entwickelte These geht über den politischen Rahmen hinaus. Seine ähnlich einer ethnographischen Feldstudie angelegte Untersuchung zieht das gesamte zu dem württembergischen Dorf Neckarhausen verfügbare Quellenmaterial heran. So wird es möglich, wie in einer klassischen ethnographischen Monographie „alle Bereiche dieses dörflichen Mikrokosmos [zu entfalten]: Produktionsweise, Landbesitz, Sozialstruktur, Einkommen, Haushaltsausstattung, Bevölkerung, Familie und Verwandtschaft, Lokalverwaltung, dörfliche Politik und soziale Kontrolle, Streitfälle und Bildung" in den Blick zu nehmen.76 Den verwandtschaftlichen Beziehungen kommt in dieser Studie ein besonderer Stellenwert zu. Verwandtschaft wird hier als ein System von Allianzen verstanden, das sich im Laufe des 18. und frühen 19. Jahrhundert zu einem stark integrierten, flexiblen Austauschsystem entwickelte, in dem Heiratspartner, Patenschaften, Vormundschaft, politisches Wohlwollen, Arbeitskontakte und finanzielle Garantien zirkulierten. Verwandtschaftliche Beziehungen erfuhren hier also keinen Bedeutungsverlust, sondern wurden in der entstehenden Moderne erst zu einer zentralen Kategorie des sozialen Raums. Die lokale Gesellschaft in Neckarhausen entwickelte sich zu einer ,kinship bot society'. Diese Entwicklung eines umfassenden, in alle Lebensbereiche ausstrahlenden verwandtschaftlichen Allianzsystems führt er auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse zurück, die mit einem starken Bevölkerungsanstieg, Zersplitterung von Landbesitz, einem anwachsenden Bodenmarkt und dem Zugang zu öffentlichen Ressourcen über die dörfliche Verwaltung einher gingen. 77 Diese Ergebnisse führten zu der zentralen Frage des zweiten Neckarhausenbandes, 74 75
76
77
Bras / van Poppel / Mandemakers, Relatives. Inez EGERBLADH und Alan BITTLES: The Influence of Consanguineous Marriage on Reproductive Behavior and Early Mortality in Northern Coastal Sweden, 1780-1899, in: Tommy BENGTSSON und Geraldine P. MINEAU (Hg.), Kinship and Demographic Behaviour in the Past, London 2008, S. 205-224. Thomas SOKOLL: Kulturanthropologie und Historische Sozialwissenschaft, in: Thomas MERGEL und Thomas WELSKOPP (Hg.), Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte, München 1997, S. 233-272, hier S. 258. David W. SABEAN: Social background to Vetterleswirtschaft: Kinship in Neckarhausen, in: Rudolf VIERHAUS (Hg.), Frühe Neuzeit - Frühe Moderne? Forschungen zur Vielschichtigkeit von Übergangsprozessen, Göttingen 1992, S. 113-132.
Verwandtschaft
57
der sich mit dem Zusammenhang zwischen dem hier eben nicht nachweisbaren Niedergang der Verwandtschaft und der Herausbildung sozialer Klassen auseinandersetzt. Hier stehen also die Beziehungen zwischen Haushalten und Individuen jenseits der Kernfamilie im Zentrum.78 In Neckarhausen kam es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einem Wandel der sozialen Struktur. Die sozialen Beziehungen waren immer weniger vertikal, an Patronage, Abstammung und Patrimonialbesitz ausgerichtet, sondern erfuhren eine horizontale Orientierung: Allianzen, ökonomische Kooperationen zwischen Schwägern und Vettern, im Verwandtschaftskreis erprobte Fokussierung auf Menschen in ähnlichen Lebenslagen standen nun im Zentrum sozialen Handelns. In diesem Sinne sieht Sabean hier die Entstehung eines neuen Verwandtschaftssystems als treibende Kraft im Prozess der Klassenbildung, die das 19. Jahrhundert charakterisiert. Der Vergleich mit Arbeiten französischer Historiker lässt diese Entwicklung in Sabeans Lesart zu einem gesamteuropäischen Prozess werden. Auch Gérard Delille hat ähnliche Veränderungen im Königreich Neapel beobachtet, eine Zunahme von Ehen mit Verwandten, die zeitlich mit Problemen der Ressourcenallokation einhergehen.79 Martine Segalen hat für das bretonische Süd-Bigouden horizontale Netzwerke beobachtet, die auf ,relinking, der Bevorzugung naher afflnaler Verwandter beruhten.80 Blutsverwandte wurden dagegen regelrecht gemieden, als Heiratspartner kamen sie nur in Frage, wenn sie als ,gar nicht verwandt' deklariert werden konnten. In den durch affinale Beziehungen gebildeten, horizontal ausgerichteten sozialen Netzwerken zirkulierten Tauschgüter verschiedenster Art und auch Informationen. Segalen kontrastiert zwei Verwandtschaftsbereiche: den ,kühlen* der affinalen Netzwerke und den .heißen' der Blutsverwandtschaft, in dem emotionale Anbindung, Rivalität um das Erbe, aber auch enge Kooperation eine wichtige Rolle spielte. Genau deshalb spricht Sabean für Neckarhausen, wo Blutsverwandte sehr wichtig wurden, von einer ,kinsbip bot society'. Sabean interpretierte das ,re/inktng' im Süd-Bigouden ebenfalls als verwandtschaftsendogames Heiratsverhalten, in einer Phase, in der sich die Gesellschaft ausdifferenzierte und soziale Klassen sich formierten.81 Etwas schwieriger ist die Einordnung der Befunde von Elisabeth Claverie und Pierre Lamaison, die ein an Häusern (justa1) orientiertes System im Gévaudan (südliches Zentralmassiv) untersucht haben. Hier wurden ebenfalls Blutsverwandte als Interaktionspartner gemieden, gerade die Erben der .Häuser' gingen keine solchen Beziehungen ein. Zwischen den auf Autonomie bedachten Häusern waren die Beziehungen eher angespannt; unter diesen Umständen war es relativ schwierig, einen Ehepartner zu finden, der statusgemäß, bekannt (also aus der näheren Umgebung) und 78 79
80 81
Sabean, Kinship, S. 3ff. Gérard DELILLE: Famille et Propriété dans le Royaume de Naples, X V - X I X siècles, Rom 1985; Diskussion bei Sabean, Kinship, S. 399ff. Segalen, Fifteen Generations. Sabean, Kinship, S. 419ff.
58
Kapitel 3: Sortait Netzwerke in der Vormoderne
gleichzeitig aber nicht verwandt sein sollte. Auch hier bildete sich ein nur über eine langfristige Beobachtung erkennbares System von Allianzen heraus, die als „generalisierter Tausch" beschrieben werden. 82 Sabean sieht in diesem an Häusern orientierten System dasselbe Prinzip am Werk wie in Neckarhausen: Während in Neckarhausen Patrilinien Allianzen miteinander eingingen, waren es im zentralfranzösischen Gevaudan Häuser, Patrimonien, die nach vorteilhaften Allianzen suchten. 83 Obgleich Claverie und Lamaison darauf hinweisen, dass Heiraten mit Blutsverwandten im 17., 18. und 19. Jahrhundert sehr selten waren, sieht Sabean auch hier eine Hinwendung zu Verwandten. Es ist etwas unklar, ob Lamaisons Analyse bis 1830 oder bis in die 1870er Jahre reicht. 84 Sabean verweist aber auf einen älteren Aufsatz, in dem Statistiken aus dem frühen 20. Jahrhundert ausgewertet werden, und kommt so zu dem Schluss, dass sich auch im Gevaudan des 19. Jahrhunderts die Eheschließung mit Blutsverwandten durchsetzte. Ein Blick in diesen Aufsatz fällt jedoch ernüchternd aus. Wo Sabean darauf verweist, dass in dieser Region mehr als 50% der Ehen mit Blutsverwandten solche mit Cousins zweiten Grades waren, wurden bei näherem Hinsehen insgesamt nur sehr wenige Ehen zwischen Blutsverwandten geschlossen: gut 1% bei den zivilen Ehen und gut 3% bei den katholischen Ehen (1926-30). 85 Da Lamaison für den Zeitraum 1650-1830 nur bei 35 der 1900 untersuchten Eheschließungen eine Blutsverwandtschaft zwischen den Partnern festgestellt hat (= 1,9%), ist nicht ganz klar, wie Sabean zu dem Schluss kommt, dass „that regon did develop considerable endogamy in the course of nineteenth centu/y".86 Überzeugender erscheint der Schluss, dass in einer Gesellschaft, die vornehmlich auf die Erhaltung von „Häusern" oder, wie man in Westfalen sagt, „Höfen" ausgerichtet ist, eine besondere Orientierung an Verwandtschaft nicht zu erwarten ist. Sabeans These wird in dem von ihm gemeinsam mit Simon Teuscher und Jon Mathieu herausgegebenen Sammelband weiter entwickelt. Auch hier geht es um die Entstehung einer ,kinship bot society' im 19. Jahrhundert, in der Familien viel Energie darin investierten, umfassende, verlässliche und genau umrissene Verwandtschaftsbeziehungen zu etablieren und zu erhalten. 87 Während ab dem Hochmittelalter bis zur 82 83 84
85
86 87
Claverie / Lamaison, Ousta; Claverie / Lamaison, L'Impossible Mariage, Kap. 14, bes. S. 283. Sabean, Kinship, S. 407ff. Siehe vor allem Pierre LAMAISON: Les stratégies matrimonial dans une système complexe de parenté: Ribennes en Gévaudan (1650-1830), in: Annales ESC 34 (1979), S. 721-743, hier S. 730. Lamaison weist daraufhin, es auch da kaum zu Ehen zwischen Blutsverwandten kam, wo diese aufgrund der Entfernung der Beziehung erlaubt gewesen wären: Es gab nur 13 Ehen im 4. kanonischen Grad (= 0,7% der untersuchten Eheschließungen). Siehe auch Fußnote 9 bei Sabean, Kinship, S. 408, wo er auf eine mündliche Auskunft Lamaisons verweist, dass dieser die zivilen Ehestandsregister bis 1872/73 untersucht habe. Jean SUTTER und Léon TABAH: Fréquences et répartition des mariages consanguins en France, in: Population 3 (1948), S. 607-630, hier S. 616. Sabean, Kinship, S. 408. Sabean / Teuscher, Kinship, S. 3.
Verwandtschaft
59
Mitte des 18. Jahrhunderts patrilineare Strukturen, zentriert um Abstammungslinien oder Häuser, etabliert worden seien, entstanden nun beinahe überall Verwandtschaftsnetzwerke, die auf Allianzen, Gefühlen, sozialer und familialer Endogamie beruhten und vor allem horizontal, innerhalb derselben Generation, orientiert waren.88 Damit reagierten Familien auf sozio-ökonomische und politische Prozesse, wie ein sich beschleunigendes Bevölkerungswachstum, sich ausweitende Märkte für Produktionsfaktoren wie Boden, aber auch Kapital, und zunehmend in die lokale Welt hineinreichende staatliche Herrschaft. Dieses Gefüge von Allianzen wurde durch ein neues Heiratsverhalten etabliert, das sich mehr und mehr auf Verbindungen mit näheren Verwandten konzentrierte. Zentral waren dafür Heiraten unter Cousins, die damit zugleich zu Ehepartnern und Schwägern wurden, aber auch zunehmend wiederholte Heiraten zwischen denselben Familien, in Form von Heiraten zwischen Geschwisterpaaren oder solchen etwa mit der Schwester der verstorbenen Ehefrau.89 Die von Sabean und anderen vorangetriebene Umorientierung der sozialgeschichtlichen Forschung, die sich weniger an soziologischen Konzepten und Methoden als vielmehr an älteren Traditionen der Ethnologie ausrichtet, weist den Weg zu neueren, innovativen Ansätzen in der ethnologischen Verwandtschaftsforschung. Zu nennen sind hier insbesondere Douglas R. White und Thomas Schweizer. Beide haben die Etablierung formaler netzwerkanalytischer Verfahren vorangetrieben, White hat darüber hinaus ein neues Verfahren der Verwandtschaftsnotation und -analyse entwickelt (PGraph), das die Untersuchung auch großer Datensätze mit entsprechenden Programmpaketen erlaubt.90 Exemplarisch hat White dieses Verfahren gemeinsam mit 88 89
90
Ebd., S. 16. Ebd., S. 19ff. Die Zunahme von Ehen zwischen nahen Verwandten, v. a. Cousins, ist von einigen Historikern anhand von Heiratsdispensen für verschiedene Regionen Europas nachgewiesen worden, siehe André BURGUIERE: „Cher Cousin": Les usages matrimoniaux de la parenté proche dans la France du 18e siècle, in: Annales HSS 52 (1997), S. 1339-1360; Gérard DELILLE: Consanguinité proche en Italie du XVIe au XIXe siècle, in: Pierre BONTÉ (Hg.), Épouser au plus proche. Inceste, prohibitions et stratégies matrimoniales autour de la Méditerranée, Paris 1994, S. 323-340; ders. 1985; Jon MATHIEU: Verwandtschaft als historischer Faktor. Schweizer Fallstudien und Trends, 1500-1900, in: Historische Anthropolgie 10 (2002), S. 225-244, hier bes. S. 238ff.; Marion TRÉVISI: Le mariage entre parents à La Roche-Guyon (Vexin français) au XVIIIe siècle: une étude de la perception du lien de parenté dans le cas des mariages avec dispense, in: Christophe DUHAMELLE und Jürgen SCHLUMBOHM (Hg.), Eheschließungen im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts: Muster und Strategien, Göttingen 2003, S. 65-92; siehe auch die Diskussion über Verwandtenheirat in Realteilungs- und Anerbengebieten bei Schlumbohm, Lebensläufe, S. 430ff. Siehe die Einführung in den gemeinsam herausgegebenen Sammelband: Thomas SCHWEIZER und Douglas R. WHITE: Revitalizing the study of kinship and exchange with network approaches, in: Thomas SCHWEIZER und Douglas R. W H I T E (Hg.), Kinship, Networks, and Exchange, Cambridge 1998), S. 1-9; zum PGraph-Verfahren siehe White, Structural Endogamy; White / Batagelj / Mrvar, Anthropology; White /Jorion, Representing und Schweizer, Muster, S. 220ff.
60
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
Lilyan Brudner anhand einer Reanalyse der von ihr viele Jahre zuvor untersuchten Kärntner Gemeinde Feistriz eingesetzt Die Daten, insbesondere zu Heirat und Besitz zwischen 1860 und 1960, wurden u. a. auf schichtenspezifische und verwandtschaftliche Endogamie hin analysiert. Während es sich bei schichtenbezogenen Merkmalen um einfache kategoriale Daten handelt (die die Zugehörigkeit zu einer wie auch immer eingeteilten Gruppe betreffen), ist verwandtschaftliche Endogamie ein relationales Merkmal, das sich allein auf die Etablierung und Verdoppelung verwandtschaftlicher Beziehungen bezieht.91 Brudner und White konnten die Existenz eines verwandtschaftlichen Zentrums, eines Netzwerkkerns nachweisen, von dem die unterbäuerlichen Schichten rigoros ausgeschlossen blieben. 92 Das Ergebnis deutet also in eine ähnliche Richtung wie Sabeans Interpretationen, methodisch ist ihr Ansatz dagegen um einiges interessanter: Während Sabean sich auf die händische Auszählung von relativ wenigen Fällen stützt, kann man mit diesem Ansatz die Bevölkerung einer Gemeinde umfassend untersuchen. Dies betrifft vor allem die landarmen und -losen Schichten, deren Untersuchung aufgrund der schlechteren Quellenlage generell schwierig ist. Unterbäuerliche Einwohner wie Tagelöhner und Handwerker werden in einer formalen, die Daten für die gesamte Bevölkerung umfassenden Untersuchungsanlage genauso berücksichtigt wie die landbesitzende Bauernschicht - der Umfang (oder das Fehlen) von Besitz geht lediglich als Variable in die Analyse ein. Für das österreichische Feistriz konnte so gezeigt werden, dass die verwandtschaftlichen Beziehungen der Gemeinde eine Zentrum-Peripherie-Struktur aufwiesen, mit einem fast ausschließlich von Landbesitzern gebildeten Zentrum und einer Peripherie, in der beinahe alle Menschen ohne Besitz zu finden waren. Mit einem ähnlichen Ansatz hat White gemeinsam mit Michael Schnegg die sozialen Netzwerke der verwandtschaftlichen und Patenschaftsbeziehungen in Belén, einer mexikanischen Gemeinde, untersucht. Das Zentrum des verwandtschaftlichen Netzwerkes setzt sich hier fast ausschließlich aus eingesessenen Familien zusammen; über das Patenschaftsnetz werden jedoch auch die übrigen Familien in das Gesamtnetz der Gemeinde integriert. 93 Schnegg hat auch gezeigt, dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in zunehmenden Maße Verwandte um die Übernahme einer Patenschaft gebeten werden. Diese Entwicklung führt er auf zwei Motive zurück. Die Eltern (oder, je nach Anlass, Hausbauer oder Autokäufer) können den finanziellen Aufwand der jeweiligen Feste reduzieren, da Verwandte nicht als .richtige' Paten galten. Darüber hinaus versuchen aber gerade diejenigen, die als Kleinunternehmer von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren, ihre sozialen Netzwerke klein zu halten. Die Hinwendung zu Verwandten reduziert die Größe der Netzwerke und verringert den Druck, den neu erworbenen Wohlstand teilen zu müssen. 94 Auf methodischer wie
91 92
93 94
Für eine ausführliche Erläuterung des Ansatzes siehe unten Kapitel 6, S. 193ff. Lilyan A . BRUDNER und Douglas R. WHITE: Class, property, and structural endogamy: Visualizing networked histories, in: Theory and Society 26 (1997), S. 161-208. Schnegg/White, Getting Connected; siehe auch die ausführlichere Diskussion unten, S. 62f. Schnegg, Compadres.
Patenschaft
61
konzeptioneller Ebene schließt die vorliegende Arbeit an diese neueren ethnologische Arbeiten an, insbesondere bei der Untersuchung der Löhner und Borgeler Heiratskreise. Für ein Verständnis der ländlichen Sozialstruktur ist es aber unerlässlich, auch die Konstruktion von Patenschaftsnetzen in den Blick zu nehmen.
3.3 Patenschaft Seit dem Ende des 2. Jahrhunderts ist das christliche Europa dazu übergegangen, nicht mehr nur Erwachsene, sondern auch Kinder zu taufen. Die Institution der Patenschaft erhielt dadurch eine neue Bedeutung. Hatten die Paten bei der Erwachsenentaufe noch eher die Rolle eines Bürgen, der für den in die christliche Gemeinde Aufgenommenen einstand, so wurde bei der Taufe eines Kindes die Verantwortung der Paten für die geistige Erziehung betont. 95 Mit der Übernahme der Patenschaft galten die Paten nun als mit ihren Patenkindern verwandt, allerdings mit kulturell bedingt unterschiedlicher Akzentuierung. Zum Teil galten die Paten nun als „neue Eltern" der Kinder, wobei sich moralische wie physische Eigenschaften auf sie übertrügen. Dabei spielte besonders das Verhalten der Paten am Tag der Taufe eine entscheidende Rolle. Dies entspricht der Vorstellung, dass die Haltung der Eltern bei der Zeugung eines Kindes Auswirkungen auf sein Wesen habe.96 Dieses Verständnis war aber nicht universell, oftmals galten Paten eher als Verwandte denn als Eltern.97 Die Frage nach dem Verhältnis zwischen Verwandtschaft und Patenschaft ist unterschiedlich beantwortet worden. Zum Teil gilt die Patenschaft als ,rituelle', .fiktive' oder irgendwie .künstliche' Verwandtschaft. Mit einer Fiktion im Sinne einer Rechtsfiktion haben Patenschaften jedoch wenig zu tun; in diese Kategorie fallt dagegen die Adoption, die jemandem den Status einer leiblichen Abstammung überträgt. Mit irgendeiner Art von Ritual ist dagegen jede Form von Verwandtschaft verbunden, man denke nur an die Heirat als wichtigen, Verwandtschaft stiftenden Ritus. Einer .künstlichen' Verwandtschaft durch Patenbeziehungen steht eine .natürliche' Verwandtschaft gegenüber, gestiftet durch Geburt und Heirat. Solchen Vorstellungen stehen insbesondere Mediävisten jedoch sehr kritisch gegenüber. Auch die durch Abstammung gestif-
95
96
97
Agnès FINE: Godparents, in: Paula FASS (Hg.), Encyclopedia of Children and Childhood (2003), S. 392-393; Bernhard JUSSEN: Patenschaft und Adoption im frühen Mittelalter. Künstliche Verwandtschaft als soziale Praxis, Göttingen 1991, S. 138ff. Agnès FINE: Les parentés parallèles, in: Collection Ethnologie de la France Cahier 7 — Vers une ethnologie du present, Paris 1992, S. 195-210, hier S. 202f; Agnès FINE: Parrains, marraines. La parenté spirituelle en Europe, Paris 1994, S. 68ff. John BOSSY: Blood and Baptism: Kinship, Community and Christianity in Western Europe from the Fourteenth to the Seventeenth Centuries, in: Studies in Church History 10 (1973), S. 129-143, hier S. 133; siehe auch Michael MITTERAUER: Geistliche Verwandtschaft im Kontext mittelalterlicher Verwandtschaftssysteme, in: Karl-Heinz SPIEß, Die Familie in der Gesellschaft des Mittelalters, Ostfildern 2009, S. 171-194.
62
Kapitel 3: Soziale Netzwerke in der Vormoderne
tete Verwandtschaft bedarf der sozio-kulturellen Unterfütterung, dies zeigt das Beispiel der außerehelichen Kinder, die z.T. als nicht verwandt mit ihren Vätern galten. Verwandtschaft war im Mittelalter ein begriffliches Ordnungssystem, mit dem soziale Beziehungen aller Art definiert werden konnten. Allerdings gab es zwei Konzeptionen von Verwandtschaft, geistliche und fleischliche, die gleichzeitig benutzt wurden. Sie hatten unterschiedliche Akzentuierungen: Während fleischliche Verwandtschaft exklusiv war, eine klare Trennung in Außen und Innen vornahm, umfasste die geistliche Verwandtschaft im Prinzip alle Christen; „ein Außen gab es nur als illegitimen Ort". „Spezifische Formen dieser geistlichen Verwandtschaften (durch Patenschaft, Profess, Weihe, Mitgliedschaft in einer Pfarrei usw.) bedeuteten nur eine Statusmodifikation, deren Spannweite variierte von einer engen Verwandtschaft wie der Patenschaft zu Verwandtschaftsbeziehungen, die kaum mehr wert waren als eine Redekonvention." 98 Die christliche Gemeinde trat an die Stelle der Abstammungsgemeinschaft, die Verbreitung des Christentum als auf der Gemeinde der Gläubigen basierende Religion führte zu einem markanten Bedeutungsverlust von Abstammung und Verwandtschaft, und die zentrale Rolle der Taufe als „geistiger Geburt" betont den Vorrang der geistigen Verwandtschaft." Historiker, die sich mit der Bedeutung der Patenschaftsbeziehungen in der Neuzeit beschäftigt haben, sind in der Regel von anthropologischen Ansätzen inspiriert worden. 100 Wenig bekannt, aber dennoch wegweisend ist ein früher Aufsatz von George Foster, der die Konstruktion von Netzwerken in Mexiko untersucht hat. Dabei hat er Faktoren wie die geographische und schichtenmäßige Herkunft von Eltern und Paten, die vorhergehende Beziehung (wie Verwandtschaft oder Freundschaft), die Beziehungen der Paten untereinander, den Geburtsrang des getauften Kindes und den 98
Siehe insbesondere die Diskussion bei Bernhard JussEN: Künstliche und natürliche Verwandte? Biologismen in den kulturwissenschaftlichen Konzepten von Verwandtschaft, in: Juri L. BESMERTNY und Otto Gerhard O E X L E (Hg.), Das Individuum und die Seinen. Individualität in der okzidentalen und der russischen Kultur in Mittelalter und Früher Neuzeit, Göttingen 2 0 0 1 , S. 3 9 - 5 8 , Zitate auf S. 5 6 ; siehe auch Mitterauer: Geistliche Verwandtschaft, S. 172f.; Anita GUERREAU-JALABERT. Spiritus et Caritas. Le baptême dans la société médiévale, in: Françoise HÉRITIER-AUGE und Elisabeth COPET-ROGIER (Hg.), La parenté spirituelle, Paris 1 9 9 5 , S. 1 3 3 2 0 3 ; Joseph MORSEL: Ehe und Herrschaftsproduktion zwischen Geschlecht und Adel (Franken, 1 4 . - 1 5 . Jahrhundert). Zugleich ein Beitrag zur Frage nach der Bedeutung der Verwandtschaft in der mittelalterlichen Gesellschaft, in: Andreas HOLZEM und Ines WEBER (Hg.), Ehe - Familie — Verwandtschaft. Vergesellschaftung in Religion und sozialer Lebenswelt, Paderborn 2 0 0 8 , S. 1 9 1 - 2 2 4 ; John BOSSY: Godparenthood: the Fortunes of a Social Institution in Early Modern Christianity, in: Kaspar VON GREYERZ (Hg.), Religion and Society in Early Modern Europe 1 5 0 0 - 1 8 0 0 , London 1 9 8 4 , S. 1 9 4 - 2 0 1 .
99
Mitterauer, Kinship Systems, S. 42f. Siehe u. a. den kürzlich erschienenen Sammelband: Guido ALFANI, Philippe CASTAGNETTI und Vincent GOURDON (Hg.): Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale, XVIe-XXe siècles, Saint-Etienne 2 0 0 9 , und Guido ALFANI: Fathers and Godfathers. Spiritual Kinship in EarlyModern Italy, Farnham 2 0 0 9 .
100
Patenschaft
63
Wohnort der Kindseltern (neolokal oder bei den Eltern) in den Blick genommen. Die so gewonnenen Erkenntnisse entsprachen weitgehend der Selbstauskunft der Befragten: Paten sollten möglichst ein befreundetes verheiratetes Paar aus dem eigenen Dorf sein, mit ähnlichem sozio-ökonomischen Status, jedoch eher nicht verwandt. Bei den ersten Kindern eines Paares wurden tatsächlich Freunde deutlich bevorzugt, die Kindseltern sorgten also für eine schnelle Expansion ihres persönlichen Netzwerkes. Erst später, nachdem das Paar auch einen eigenen Haushalt gegründet hat, kommen Verwandte hinzu. In der ersten, in aller Regel patrilokalen Phase erschienen Patenbeziehungen mit Angehörigen der Herkunftsfamilie als riskant; waren die bei engem Zusammenleben zu erwartenden Spannungen und Konflikte doch innerhalb von Patenschaftsbeziehungen stark verpönt.101 Sidney Mintz und Eric Wolf haben darauf hingewiesen, dass Patenschaften einerseits die soziale Umgebung stabilisieren, andererseits aber Beziehungen in andere soziale Bereiche ermöglichen. Dabei sind sie leichter zu erlangen als über Heirat etablierte Verwandtschaftsbeziehungen. Insbesondere mit Blick auf schichtenübergreifende Beziehungen können sie für gesellschaftliche Integration sorgen.102 Hier wird ein Aspekt deutlich, der auch für europäische Kontexte betont worden ist: Patenschaften konnten auch dazu dienen, Konflikte beizulegen und die jeweiligen Partner auf kooperatives, von gegenseitigem Respekt getragenes Verhalten zu verpflichten. In jüngerer Zeit ist dieses Verständnis auch auf ökonomische Zusammenhänge übertragen worden. In Mittel- und Südamerika werden compadrazgo-Beziehungen oft zu vielen verschiedenen Anlässen gestiftet, etwa beim ersten Haarschnitt eines Kindes mit 3 oder 4 Jahren, bei der Konfirmation, bei der Anschaffung eines Autos oder eines Hauses etc. So werden weitreichende Netzwerke geschaffen, die zu wechselseitiger Hilfe, Fairness in geschäftlichen Belangen und der Weitergabe von Informationen verpflichten. Solche Netzwerke dienen mithin der Reduktion von Informations- und Transaktionskosten und der sozialen Kontrolle in ökonomischen Beziehungen.103 Auch in der neuzeitlichen Geschichtswissenschaft wird nach der Konstruktion von Patennetzen gefragt Nur wenige Punkte der Auswahl von Paten weiden von kirchlicher Seite vorgeschrieben, wie das Verbot, eigene Kinder aus der Taufe zu heben, oder die Reduzierung der Paten auf zwei Personen beiderlei Geschlechts durch das Konzil von Trient104 101
102
103
104
George M. FOSTER: Godparents and Social Networks in Tzintzuntzan, in: Southwestern Journal of Anthropology 25 (1969), S. 261-278. Sidney W. MINTZ und Eric R. WOLF: An analysis of ritual Co-Parenthood (Compadrazgo), in: Steffen W . SCHMIDT, Laura GUASTI, Carl H. LANDE und James SCOTT (Hg.), Friends, Followers and Factions: A Reader in Political Clientelism, Berkeley 1977, S. 1-15. Barbara GÖBEL: Risk, Uncertainty, and Economic Exchange in a Pastoral Community of the Andean Highlands (Huancar, N . W . Argentina), in: Thomas SCHWEIZER und Douglas R. WHITE (Hg.), Kinship, Networks, and Exchange, Cambridge 1998, S. 158-177. Siehe Guido ALFANI: Geistige Allianzen: Patenschaft als Instrument sozialer Beziehungen in Italien und Europa (15. bis 20. Jahrhundert), in: Margareth LANZINGER und Edith SAURER (Hg.), Politiken der Verwandtschaft. Beziehungsnetze, Geschlecht und Recht, Wien 2007, S. 25-54.
64
Kapitel 3: Soijaii Netzwerke in der Vormoderne
Die Konstruktion von Patennetzen ist spirituelle und soziale Praxis zugleich, beide Aspekte sind untrennbar miteinander verbunden. Die Regeln, nach denen Paten ausgewählt werden, wurden einerseits aus kirchlichen Bestimmungen hergeleitet; andererseits hat aber die Kirche Regeln eingeführt, die auf der Praxis des Volkes beruhten. 105 Diese Praxis geht auch auf ältere Formen der institutionalisierten Freundschaft zurück, wie etwa der Blutsbrüderschaft. 106 Die Muster, nach denen Paten ausgesucht werden, variieren aber zwischen verschiedenen Gesellschaften ganz beträchtlich, und auch innerhalb dieser können sie unter Angehörigen der verschiedenen sozialen Schichten ganz unterschiedlich sein.107 Dies beginnt schon bei einfachen Fragen, etwa ob jedes Kind eigene Paten bekommt oder aber die Paten des ersten Kindes zu jeder neuen Taufe gebeten werden, ob die Paten entsprechend dem Geschlecht des Kindes ausgewählt werden oder wie viele Paten jedes Kind erhält. Darüber hinaus kann man nach der Netzwerkposition der Paten fragen, also ihrer vorgängigen Beziehung zu den Kindseltern. Verschiedene Ethnologen und Historiker haben die Bedeutung des Patennetzes in europäischen Gesellschaften untersucht. Insbesondere für Angehörige der unteren Schichten war die Existenz eines verlässlichen Unterstützungsnetzwerks unerlässlich. Neben Verwandten, Nachbarn und Kollegen spielten Patenbeziehungen hier eine wichtige Rolle. Der qualitative Inhalt von Patenbeziehungen ist zwar nur schwer einzuschätzen, da hierzu systematisch auswertbare Quellen fehlen. Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass diese Beziehungen auch im neuzeitlichen Europa von gegenseitigem Vertrauen und der Verpflichtung zu Beistand gekennzeichnet waren. 108 Daher erklärt sich, warum Eltern sich in ihrer Patenwahl etwa an wichtige Menschen in ihrer Heimatgemeinde hielten.109 Segalen hat für das Süd-Bigouden (Bretagne) festgestellt, dass oftmals Verwandte zu Paten gewählt wurden; hier sollten die neuen Bande den zentrifugalen Kräften des europäischen Verwandtschaftssystems entgegen wirken. Gleichzeitig fragten auch hier Tagelöhner ihre Bauern nach der Übernahme einer Patenschaft, um sich ihrer Unterstützung in Krisenzeiten zu versichern. 110 Guzzi-Heeb hat die Funktion der Patenbeziehungen für die politische Mobilisierung im schweizerischen Val de Bagnes untersucht. Hier vermieden die meisten Familien klientelartige Abhängigkeitsverhältnisse zu einzelnen Patronen und diversifizierten ihre sozialen Beziehungen, verblieben aber zumeist innerhalb spezifischer Milieus. 111 105
106 107
108
109 110 111
Stephen GUDEMAN: Spiritual Relationships and Selecting a Godparent, in: Man 10 (1975), S. 221-237, bes. S. 222. Fine, Parentés parallèles. Gudeman, Spiritual, S. 221; Jacques DUPÀQUIER: Naming-Practices, Godparenthood, and Kinship in the Vexin, 1540-1900, in: Journal of Family History 6 (1981), S. 135-155. Robert JÜTTE: Arme, Bettler, Beutelschneider. Eine Sozialgeschichte der Armut in der frühen Neuzeit, Weimar 2000, S. 109 und S. 118. Gunnlaugsson / Guttormsson, Alliances. Segalen, Fifteen Generations, S. 266f. Guzzi-Heeb, Kinship.
Patenschaft
65
Im Zentrum vieler Arbeiten steht die Frage nach der Vernetzung der sozialen Schichten. In diesem Kontext werden v. a. von französischen Historikern auch Trauzeugen untersucht.112 So hat Vincent Gourdon gezeigt, dass Zeugenschaften in einem südöstlich von Paris gelegenen Dorf dazu dienten, vertikale Beziehungen über Schichtengrenzen hinweg zu etablieren.113 Cyril Grange hat die berufliche Kohäsion der Netzwerke von Juden in Paris untersucht und ihre sich verstärkende Integration in die lokale Gesellschaft aufgezeigt.114 Solveigh Fagerlund hat für das frühneuzeitliche Heisingborg (Südschweden) festgestellt, dass Paten ausschließlich innerhalb derselben Schicht oder aber in einer höheren gesellschaftlichen Schicht gesucht wurden, jedoch niemals in einer niedrigeren. Je höher der soziale Status der Familien war, desto dichter und kleiner war das Patennetz, während Familien mit relativ niedrigem sozialem Status ihre Beziehungen streuten und die Patennetze in alle Bereiche der Gesellschaft hinein reichten.115 Die florentinische Kaufmannselite des 15. Jahrhunderts knüpfte dagegen ganz bewusst Kontakte auch mit niedrigeren Schichten. In ihren Patennetzen zirkulierten Namen, Geschenke, Hilfeleistungen, Freundschaft und Informationen.116 Tom Ericsson hinterfragt dagegen die in der Sozialgeschichte gängige Schichteneinteilung aufgrund ökonomischer Daten, wie Grundbesitz oder, in diesem Fall, Berufsbezeichnungen. Für die nordschwedische Stadt Umei kommt er zu dem Schluss, dass alle Schichten mit Ausnahme der Oberschicht und der untersten sozialen Schicht gut miteinander vernetzt waren. Aus relationaler Perspektive bildeten Handwerker, einfache Angestellte und Kleinunternehmer eine dicht vernetzte, homogene Substruktur zwischen den beiden anderen. Dieser Befund lässt die übliche Unterteilung dieser Berufsgruppen in zwei oder drei separate Schichten fraglich werden.117 Die Untersuchung der Konstruktion von Patennetzen lässt also Schlüsse auf das Verhältnis der sozialen Schichten zu. Verschiedene Historiker haben sich mit der Frage auseinandergesetzt, inwieweit sich insbesondere für das 18. und 19. Jahrhundert Klassenbildungsprozesse aus dem Aufbau sozialer Netzwerke erkennen lassen.118 Hartmut Zwahr hat sich bereits in den 1970er Jahren mit der sozialen Basis der Entstehung des Leipziger Proletariats befasst. Dabei hat er sich nicht allein auf ökonomische Kriterien gestützt, sondern den inneren sozialen Zusammenhang, die sozialen Kontakte und das daraus erwachsende Zusammengehörigkeitsgefühl für zentral erachtet. Dass er auch
112 113 114 115
116
117 118
Beauvalet / Gourdon, Liens Sociaux; Gourdon, Réseaux. Gourdon, Sociabilité villageoise. Grange, Choice. Solveig FAGERLUND: Women and men as godparents in an early modem swedish town, in: The History of the Family 5 (2000), S. 347-357. Louis HAAS: Mi buno compadre: choosing godparents and the use of baptismal kinship in renaissance Florence, in: Journal of Social History (1995), S. 341-356. Ericsson, Godparents. Zu Klassenbildung im 19. Jahrhundert siehe Kocka, Klassenbildung.
Kapitel 5: Soziale Netzwerke in der Vormodtrne
66
ländliche Lohnarbeiter zum Proletariat rechnet, ist von Kocka kritisiert worden. 119 Innovativ ist dagegen seine Untersuchung von Patenschaftsbeziehungen zwischen verschiedenen Berufsgruppen, wie Buchdruckern, Schriftsetzern, Schlossern, Schmieden, Handarbeitern, Fabrikarbeitern etc. Während für die Zeit um 1830 eine ausgeprägte soziale Distanz zwischen verschiedenen Berufsgruppen, insbesondere zwischen ungelernten und gelernten Arbeitern, vorherrschte, nahmen die Beziehungen zwischen diesen Gruppen bis 1875 zu. Gleichzeitig nahm der Anteil der Paten, die selbst keine Arbeiter waren, tendenziell ab. Generell blieb aber die Fragmentierung der Arbeiterschaft ein wichtiges Strukturelement. 120 Ähnlich hat Peter Franke versucht, für das 19. Jahrhundert Klassenbildung durch zunehmende Verflechtung bei märkischen Glasarbeitern aufzuzeigen. Empirisch ließ sich jedoch keine Klassenbildung nachweisen, lediglich die Stammarbeiterschaft der Glashütten bildete dichte Netzwerke aus. 121 Cristina Munno konnte für die venetische Gemeinde Foligno einen langsamen Prozess abnehmender Hierarchisierung und eine Zunahme horizontaler Beziehungen im Patennetz zwischen 1834 und 1888 nachweisen. Gleichzeitig nahm der Anteil an verwandten Paten über diesen Zeitraum stetig zu. 122 Den bekanntesten Versuch, Klassenbildung auf die Intensivierung sozialer Beziehungen innerhalb sozialer Schichten zurückzuführen, stellt Sabeans NeckarhausenStudie dar. Auch Sabean hat, trotz intensiven Quellenstudiums, nicht viel Evidenz darüber gefunden, was Paten für ihre Patenkinder oder deren Eltern taten. Sie wurden als Bürgen bezeichnet und repräsentierten die Kindseltern gegenüber der Dorfgemeinschaft. Umgekehrt waren es aber die Kindseltern, die hin und wieder Bürgschaften für die Paten ihrer Kinder unterzeichneten; die Paten erscheinen in dieser Perspektive eher als Klienten denn als Patrone. 123 Im frühen 18. Jahrhundert scheinen Paten als Vermittler von Landverkäufen aufgetreten zu sein, später war dies nicht mehr nachweisbar. 124 Sabean identifiziert die Patenschaft neben der Verwandtschaft als zweite fundamentale Institution, die langfristige Verbindungen zwischen Menschen in Neckarhausen stiftete. 125
119
120
121
Jürgen KOCKA: Sozialstruktur und Arbeiterbewegung: die Entstehung des Leipziger Proletariats, in: Archiv für Sozialgeschichte 20 (1980), S. 584-592, hier S. 589. Hartmut ZWAHR: Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Strukturuntersuchung über das Leipziger Proletariat während der industriellen Revolution, Berlin 1978, S. 167ff. Peter FRANKE: Märkische Glasarbeiter im 19. Jh., in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte ( 1 9 8 8 ) , S. 69-92.
122
123 124 125
Munno, L'echeveau des párenteles, S. 127ff.; Cristina MUNNO: Bricoler des fragments de vie ancienne: entre outils historiographiques et exploration micro-analytique. Un exemple italien au XIXe siècle, in: Guido ALFANI, Philippe CASTAGNETTI und Vincent GOURDON (Hg.), Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale, XVIe-XXe siècles, Saint-Etienne 2009, S. 317-340, hier S. 326. Sabean, Kinship, S. 23ff. Sabean, Property, S. 383. Sabean, Kinship, S. 289f.
Patenschaft
67
Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren Eltern und Paten nur selten miteinander verwandt. Nahe Verwandte wurden konsequent gemieden, und von über hundert Paten war nur eine Frau mit den Eltern ihres Patenkindes blutsverwandt, eine Cousine zweiten Grades. Obwohl es in Neckarhausen üblich war, immer dasselbe Patenpaar für alle Kinder zu nehmen, und man so auf die gerade bei Patenschaften gegebene Möglichkeit, große soziale Netzwerke aufzubauen, verzichtete, erscheint dieses Verhalten als Versuch, die persönlichen Netzwerke zu erweitern und nach neuen Beziehungen zu suchen.126 Patenschaftsbeziehungen dienten im 18. Jahrhunderts dazu, Verbindungen zwischen Reichen und Armen, Jungen und Alten, Mächtigen und Schwachen herzustellen, während Heiratsbeziehungen diese Funktion schon immer weniger erfüllten. Im 19. Jahrhundert waren dann fast 90% der Paten verwandt, die Paten waren nun in der Regel aus derselben Generation wie die Eltern, und sie gehörten derselben sozialen Schicht an. Aus einem schichtenübergreifenden, klientelistischen Patennetz war ein horizontal orientiertes geworden, das in Verbindung mit anderen Verhaltensänderungen zur Klassenbildung in Neckarhausen beitrug.127 Sabean beobachtet für Neckarhausen also zunächst ein ähnliches Phänomen wie Ericsson in Umel: Die anhand ökonomischer Kenndaten zu unterscheidenden sozialen Schichten bilden eine gut integriertes soziales Netzwerk, von sozialen Klassen im Sinne Kockas kann man hier noch nicht sprechen. Im 19. Jahrhundert ändert sich die soziale Struktur allerdings massiv, auch in relationaler Perspektive kann man nun weitgehend abgegrenzte Bereiche im Netzwerk der lokalen Beziehungen identifizieren, so dass man hier mit Recht von Klassenbildung sprechen kann. In der .ländlichen Klassengesellschaft', die Josef Mooser für Ostwestfalen gezeichnet hat, kommen Patenschaftsbeziehungen nicht vor. Unter sozialer Verflechtung werden lediglich Heiratskreise einerseits und Arbeits- und Pachtbeziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen andererseits verstanden.128 Daneben gibt es Hinweise darauf, dass die Kinder von Heuerlingen und Bauern sich gemeinsam in Spinnstuben trafen, allerdings ist der Umfang dieser allgemeinen Geselligkeit schwer abzuschätzen.129 Da Verwandtschaft zwar kurz thematisiert, aber nicht untersucht wird, und auf das System der Patenschaften nicht eingegangen wird, bleiben soziale Netzwerke bei der Untersuchung weitgehend außen vor. Klassen werden hier an Bodenbesitz und Berufsangaben festgemacht. Dass diese Perspektive unzureichend ist und den sozialen Verhältnissen im nordwestdeutschen Textilgürtel nicht gerecht wird, hat schon Jürgen Schlumbohm deutlich gemacht. Anhand von zwei jeweils gut 70 Paten umfassenden Stichproben für die Zeiträume 1767-77 und 1850-60 hat er nach Mustern der Patenwahl gesucht. In Belm waren v. a. Bauern mit größeren Höfen begehrte Paten, während es in der Regel vermieden wurde, Paten aus einer niedrigeren Schicht zu wählen. Oftmals baten Heuerlinge 126 127 128 129
Ebd., S. 147f. Ebd., S. 238ff. Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 194ff. Ebd., S. 260ff.
68
Kapittl 3: Sortait Netzwerke in der Vormodernt
diejenigen Bauern, bei denen sie lebten und arbeiteten, um die Übernahme einer Patenschaft; in beiden Zeiträumen stellte die Familie des Hofbesitzers etwa ein Fünftel der Paten bei Heuerlingskindern. Während die Bauern bei der Patenwahl unter sich blieben, etablierten Heuerlinge möglichst viele Beziehungen mit der landbesitzenden Schicht. Bemerkenswert ist allerdings weniger die Präferenz der Heuerlinge als die Bereitschaft der Bauern, solche Patenschaften auch zu übernehmen, und damit in dauerhafte und verpflichtende Beziehungen mit Angehörigen der Unterschicht einzutreten.130 Die Bereitschaft zur Übernahme einer Patenschaft ist aber keinesfalls selbstverständlich: Wie die autobiographischen Aufzeichnungen eines münsterländischen Großbauern zeigen, wägten die Bauern durchaus ab, wen sie in den Kreis der geistlichen Verwandtschaft aufnahmen. Ein mittelloses, zugezogenes Ehepaar konnte auch auf Ablehnung stoßen. Dass dieses mit der Gefahr, das Patenkind im Notfall versorgen zu müssen, und dem Verweis auf die geringen „haushälterischen Mittel" begründet wurde, kann nicht überzeugen: Philipp Richter besaß nicht nur einen der ältesten Höfe in Altenroxel bei Münster, sondern auch mit über 64 Hektar den bei weitem größten Hof. Die mögliche Versorgung eines Kindes fallt da wohl kaum ins Gewicht, aber die Verpflichtung den Eltern gegenüber mochte Richter ebenso wenig eingehen wie seine Nachbarin, die die Übernahme der Patenschaft ebenfalls ablehnte.131 Bei Patenschaften handelt es sich also um durch soziale Normen geprägte Beziehungen, deren alltagspraktischer Wert in erster Linie in ihrem Appellcharakter zu sehen ist. Anders als bei Eheschließungen werden hier nicht Ressourcen in größerem Umfang redistributiert, weder unmittelbar bei der Kindstaufe noch später, etwa bei wichtigen Übergängen wie Erstkommunion oder Firmung. Die sozio-ökonomische Bedeutung der Patenschaft liegt zum einen in ihrem Netzwerkeffekt, der zur Integration beitragen oder, wie im Neckarhausen des 19. Jahrhunderts, ausschließend wirken kann. Zum anderen lassen Menschen sich auf Beziehungen ein, die denen der Verwandtschaft zumindest insoweit ähneln, dass man einander nur schwerlich Hilfe, Unterstützung und auch Respekt verweigern kann. Besonders herausgearbeitet worden ist dies für mittelund südamerikanische Gesellschaften, in denen compadrazgo ein wichtiges Element der Sozialstruktur war und zum Teil auch heute noch ist. Michael Schnegg hat das Netzwerk der Patenschaften im mexikanischen Belén untersucht, einem Ort, der auch in den 1970er Jahren schon von Hugo Nutini, Jean Forbes, Douglas R. White und Lilyan Brudner untersucht worden ist; es handelt sich also um eine Wiederholungsstudie, die auch auf ältere Daten zugreifen konnte.132 Schnegg konnte zeigen, dass Patenschaften
130 131
132
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 595ff.; Schlumbohm, Problèmes, S. 790ff. Philipp RICHTER: Ein Bauernleben. Aus den autobiographischen Aufzeichungen eines westfälischen Bauern 1 8 1 5 - 1 8 9 0 , 2. erw. Aufl., Rheda-Wiedenbrück 1991, besonders S. 10 u. S. 94. Michael SCHNEGG: Das Fiesta Netzwerk. Soziale Organisation in einer mexikanischen Gemeinde 1 6 7 9 - 2 0 0 1 , Münster 2005, hier S. 235ff.; Hugo V. NUTINI und Betty BELL: Ritual Kinship: The Structure and Historical Development of the Compadrazgo System in Rural Tlaxcala, Bd. 1, Princeton 1980.
Patenschaft
69
schon seit dem späten 18. Jahrhundert vor allem dazu dienten, verlässliche Beziehungen in die unmittelbare benachbarte Umgebung zu etablieren. Im späten 20. Jahrhundert lässt sich zudem beobachten, dass die noch in den 1970er Jahren getrennten Bereiche der Verwandtschaft und der Patenschaft zunehmend aufeinander bezogen werden. In den zwischen 1975 und 1979 gesammelten Daten sind zwei auf den ersten Blick weitgehend voneinander getrennte soziale Netzwerke erkennbar, vor allem hinsichtlich ihrer Netzwerkkerne: Das Zentrum des Verwandtschaftsnetzes wurde von ganz anderen Familien und Personen gebildet wie dasjenige des Patennetzes; beide schienen wenig miteinander zu tun haben. Das betrifft auch die Orientierung der Netzwerkkonstruktion: Während über endogame Heiraten ein Verwandtschaftsnetz geschaffen wurde, das vornehmlich innerhalb der Gemeinde für verdichtete Beziehungen sorgte, so diente das exogam angelegte compadrazgo-Netz der Integration von Außenstehenden sowie zugezogenen Gemeindemitgliedern. Der doppelt integrierende Effekt der beiden Netzwerke wird erst deutlich, wenn man beide zusammen betrachtet: Mittels des weiter oben bereits erwähnten PGraph-Verfahrens konnten White und Schnegg zeigen, dass beide Netze zusammengenommen 98% der Paare in Belén umfassten, nur zwei Familien waren durch keine der beiden Beziehungsformen in das Gesamtnetz der Gemeinde integriert.133 Eine Analyse der Patenschaftsbeziehungen ist unerlässlich, will man die soziale Struktur einer lokalen Gesellschaft erfassen. Die bislang für historische Gesellschaften vorliegenden Studien deuten einerseits darauf hin, dass Patenschaften oftmals dazu genutzt wurden, sich an die Wohlhabenden, Mächtigen, sozial höher Stehenden zu binden. Andererseits muss dieser generelle Trend aber relativiert werden: Der soziokulturelle Kontext hatte einen erheblichen Einfluss auf die Netzwerkkonstruktion und konnte, wie etwa in Neckarhausen im 19. Jahrhundert, ganz anderen Orientierungen folgen. Für eine Gemeinde mit nordwestdeutschem Heuerlingssystem hat Schlumbohm bereits darauf hingewiesen, dass die Integration der sozialen Schichten mittels solcher Beziehungen ein wichtiges Element war, das das Bild einer ländlichen Klassengesellschaft empfindlich stört. Dagegen steht eine solche Untersuchung von sozialen Netzwerken und Klassenbeziehungen in rein agrarischen Gesellschaften wie dem hier untersuchten, in der Hellwegregion gelegenen Borgeln noch aus.
133
Michael SCHNEGG: Compadres familiares: Das Verhältnis von compadrazgo und Verwandtschaft in Tlaxcala, Mexiko, in: Zeitschrift für Ethnologie 131 (2006), S. 91-109; ders.: Blurred Edges, Open Boundaries. The Long-Term Development of a Peasant Community in Rural Mexico, in: Journal of Anthropological Research 63 (2007), S. 5-31; SCHNEGG /WHITE 2009.
70
Kapitel 3: Sortait Netzwerke in der Vormoderne
3.4 Bauern und Tagelöhner Die sozio-ökonomischen Beziehungen zwischen Bauern und Tagelöhnern sind generell wenig erforscht. Dass es sich hierbei um ein wichtiges Forschungsdesiderat handelt, wird aus der längst erkannten Bedeutung des Faktors Arbeit für die erhebliche Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion im späten 18. und 19. Jahrhundert ersichtlich. Michael Kopsidis hat gezeigt, dass der Mehreinsatz dieses Faktors - in Verbindung mit verbesserten Bewirtschaftungsmethoden — eine wichtige Rolle für die steigende Produktion im 19. Jahrhundert gespielt hat. 134 Während das Wachstum der Agrarproduktion im späten 19. Jahrhundert stärker kapitalintensiv war, müsse man für die frühere Zeit von einem arbeitsintensiven Wachstum ausgehen. In Westfalen erfolgte der intensivierte Anbau des Marktgetreides Weizen auf Kosten des traditionellen Brotgetreides Roggen. Insgesamt war die Steigerung der Erträge je Flächeneinheit wichtiger als eine Ausdehnung der Anbauflächen, und dies konnte - ohne technologischen Wandel — nur über erhöhten Arbeitseinsatz realisiert werden. 135 In Regionen wie der Soester Börde, in denen sich die Produktion von ,cash crops' lohnte, konnte so die gesamte vorhandene Arbeitskraft für die Agrarproduktion genutzt werden, so dass Protoindustrie sich hier nicht etablieren konnte. 136 Für die Niederlande ist die Bedeutung der Lohnarbeit schon für das 16. Jahrhundert nachgewiesen worden. Bas van Bavel hat drei Regionen - Holland, Geldern und das innere Flandern — verglichen. Die von ihm beobachtete starke regionale Differenzierung bzgl. des Einsatzes von Lohnarbeit lässt sich weder auf die sektorale Struktur der ländlichen Ökonomie noch auf den Grad der Verstädterung der Region zurückführen. So wiesen sowohl Holland als auch Geldern einen hohen Anteil an Lohnarbeit auf, Flandern jedoch nicht. Allerdings zeichneten sich sowohl Geldern als auch Flandern durch einen deutlich geringeren Grad an Verstädterung aus als Holland, und Holland war ebenso wie Flandern durch einen stark wachsenden protoindustriellen Sektor und eine steigende Marktorientierung gekennzeichnet. Die unterschiedlich starke Bedeutung der Lohnarbeit führt van Bavel dagegen auf die Qualität der sozio-ökonomischen Beziehungen zurück. Während in Holland und Geldern Arbeitsverträge in aller Regel formell und kurzfristig angelegt waren, waren sie in Flandern in persönliche Beziehungen eingebettet. Bauern und Arbeiter kannten sich meistens gut, gingen mehrfache, reziproke Austauschbeziehungen miteinander ein, in denen Dienstleistungen
134
135
136
Kopsidis, Marktintegration, S. 243; Michael KOPSIDIS und Heinrich HOCKMANN: Technical change in Westphalian peasant agriculture and the rise of the Ruhr, circa 1830-1880, in: European Review of Economic History 14 (2010), S. 209-237. Michael KOPSIDIS: Die regionale Entwicklung der Produktion und der Wertschöpfung im westfälischen Agrarsektor zwischen 1822 / 35 und 1878 / 82. Ein komparativ-statistischer Vergleich, in: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte 1 (1995), S. 131-169. Pfister, Protoindustrie.
Bauern und Tagelöhner
71
und Kapitalgüter getauscht wurden. Dazu passt, dass hier, anders als in Holland und Geldern, Arbeitsmigration kaum eine Rolle spielte.137 Auf die wachsende Bedeutung arbeitsintensiver Produktion im Agrarsektor hat auch Sabean hingewiesen.138 Die Arbeitsorganisation ist ein zentraler Punkt in seiner Argumentation. Im württembergischen Neckarhausen ist es jedoch vornehmlich die Kooperation von Landbesitzern, die über familiäre Strategien und sehr bewusst orientierte soziale Netzwerke gewährleistet wurde. In diesem Realteilungsgebiet gab es offensichtlich nur wenige Familien, die ohne jeden Landbesitz waren und damit eindeutig der unterbäuerlichen Schicht zuzurechnen sind. Viele Tagelöhner waren hier Kleinstbesitzer, der Umfang ihres Landbesitzes war etwa ein Fünftel dessen, was ein durchschnittlicher Bauer besaß.139 Die Zuordnung zu einer sozialen Schicht gestaltet sich in Neckarhausen allerdings als etwas schwierig. So wurden manche Landarme in den Quellen als „Bauern" bezeichnet, was möglicherweise auf — nicht steuerpflichtige — Zupachtung zurückzuführen ist. Andere wurden wiederum als Tagelöhner bezeichnet, obwohl sie in einer der oberen Steuerklassen veranschlagt wurden und nicht zum ärmeren Teil der Bevölkerung gehörten.140 Sabean stellt zwischen dem frühen 18. und dem mittleren 19. Jahrhundert eine Entflechtung der sozialen Schichten fest, und führt dies u. a. auf die veränderten Produktionsbedingungen unter den Bedingungen wachsender Bevölkerung und fortschreitender Besitzzersplitterung zurück.141 Konkrete Untersuchungen der in soziale Netzwerke eingebetteten Beziehungen sind allerdings rar. Eine der von van Bavel verglichenen Regionen, das innere Flandern, ist von Thijs Lambrecht für das 18. Jahrhundert untersucht worden. Hier steht der Arbeitsmarkt in dem kleinen Dorf Markegem im Mittelpunkt. Lambrecht wertet zwei Anschreibebücher des größten Bauern aus, in dem die mannigfachen Beziehungen, Pflichten und Forderungen zwischen ihm und seinen Arbeitern festgehalten wurden. Alle Güter und Dienstleistungen wurden dort in monetären Größen vermerkt, aber nur selten auch ausgezahlt. Vielmehr war es üblich, nur ein- oder zweimal im Jahr abzurechnen. Bei dieser Gelegenheit kam der Bauer in die Häuser seiner Arbeiter, ein soziales Ereignis, dass eindrucksvoll die Verbundenheit des Bauern mit den Arbeitern demonstriert. Die Arbeitsleistungen der Arbeiter wurden zu einem großen Teil mit dem Ausleihen von Pferd, Pflug und Wagen vergolten. Der Bauer lieferte auch Ge137
138 139
140
141
Bas VAN BAVEL: Rural wage labour in the sixteenth-century Low Countries: an assessment of the importance and nature of wage labour in the countryside of Holland, Guelders and Flanders, in: Continuity and Change 21 (2006), S. 37-72. Sabean, Property, Kap. 5. Ebd., S. 61 f. Sabean diskutiert hier die soziale Schichtung des Dorfes, ohne genaue Zahlen anzugeben. Sabean, Kinship, S. 242 und 272. Auf die von den Dörflern selbst entwickelten Kategorien beruft sich auch Wagner (1986), der einem auf simplen ökonomischen Daten beruhenden Klassenbegriff skeptisch gegenüber steht. Hier stimmen diese Kategorien - Pferdebauern, Kuhbauern und Ziegenbauern - allerdings mit klar zu benennenden Größenkategorien überein. Sabean, Social Background, S. 125f.
72
Kapitel 3: Sortait Netzwerke in der Vormoderne
treide in knappen Zeiten und Flachs für die protoindustrielle Produktion, die Arbeiter .bezahlten' mit dem Versprechen, die (zu aktuellen Marktpreisen erworbenen) vorgestreckten Güter abzuarbeiten. Diese Austauschbeziehungen beschränkten sich aber nicht nur auf die relativ fest an den Hof gebundenen Arbeiter, sondern erstreckten sich etwa auch auf die lokalen Handwerker. Von den Reziprozitätsbeziehungen zwischen dem Bauern und den Arbeitern profitierten letztlich beide Parteien. Der Bauer hatte stets eine Basis zuverlässiger Arbeitskräfte, auf die er bei Bedarf zurückgreifen konnte, und konnte gleichzeitig kostspielige Kapitalgüter optimal auslasten. Beide Seiten kamen mit wenig Bargeld aus, so dass der Bauer sich selten gezwungen sah, zu wenig günstigen Konditionen verkaufen zu müssen, während der Arbeiter auch in schlechten Zeiten nicht um sein tägliches Brot fürchten musste. Für die Arbeiter war die Möglichkeit, ihre Felder durch den Großknecht des Bauern pflügen zu lassen, von erheblichem Vorteil: Um einen Hektar pflügen zu lassen, musste ein Mann 19 Tage lang für den Bauern arbeiten. Gleichzeitig hätte er etwa 60 Tage mit dem Spaten auf dem Feld verbringen müssen, um dasselbe Stück Land von Hand umzugraben; er gewann also ungefähr 40 Tage, die er für andere Arbeiten einsetzen konnte. Über 90% des Lohns wurde durch das Verleihen von Pflug und Wagen abgegolten. Zusätzlich wurde den Erntearbeitern oft das Recht gewährt, die Felder unmittelbar nach der Ernte abzusuchen und Reste aufzusammeln. Das so gesammelte Getreide konnte eine Familie für zwei bis drei Monate ernähren. Informelle, auf persönlichen Beziehungen gegründete Arbeitsbeziehungen konnten also für beide Seiten höchst effizient sein.142 Auch für den nordwestdeutschen Raum sind sozio-ökonomische Beziehungen im Rahmen des protoindustriellen Heuerlingssystems untersucht worden, während man über den rein landwirtschaftlichen Produktionssektor sehr wenig weiß. 143 Die wichtigsten Beiträge zur protoindustriellen Unterschicht stammen zweifellos von Josef Mooser und Jürgen Schlumbohm. Die Ergebnisse beider unterscheiden sich jedoch mit Blick auf die soziale Einbettung der Arbeitsbeziehungen stark voneinander. Während Mooser zwei ökonomisch wie sozial strikt voneinander geschiedene Klassen sieht, betont Schlumbohm, wie oben ausgeführt, die soziale Verflechtung der Heuerlinge mit ihrem Bauern. Mooser hat die sozialen Beziehungen kaum untersucht; lediglich die Frage der sozialen Endogamie der Heiratskreise wird näher thematisiert. Schon aufgrund der genaueren empirischen Analyse ist Schlumbohms Interpretation 142
143
Lambrecht, Labour markets, S. 237-261; Thijs LAMBRECHT.: Peasant Labour Strategies and the Logic of Family Labour in the Southern Low Countries during the 18 th Century, in: Simonetta CAVACIOCCHI (Hg.), La Famiglia Nell'Economia Europae Secc XIII- XVIII. The Economic Role of the Family in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries, Florenz 2009, S. 637-649. Siehe u. a. den älteren Forschungsstand zur Protoindustrialisierung in Ostwestfalen bei Mager, Haushalt; Mager, Protoindustrialisierung; zu Tagelöhnern im Paderborner Land siehe die neuere Arbeit von Claudia RICHARTZ-SASSE: Ländliche Tagelöhner im östlichen Paderborner Land. Eine mikroanalytische Studie über das Bauen und Wohnen zwischen 1830 und 1930, Frankfurt a. M. 2000, die allerdings weitgehend auf den Hausbau fokussiert ist.
Bauern und Tagflöbner
73
überzeugender. Entscheidend ist aber, dass Schlumbohm nach dem relationalen und praktischen Gehalt der Kategorie Klasse fragt, und diese nicht allein an ökonomischer Ungleichheit festmacht. Wenn die sozialen Beziehungen sich quer zu Klasseneinteilungen vollziehen, und sich kein Klassenbewusstsein im Sinne eines gemeinsamen Handelns feststellen lässt, wird die Interpretation kategorialer Einteilungen im Sinne eine Klassengesellschaft obsolet.144 Schlumbohms Ansatz fuhrt zu überzeugenden Ergebnissen, allerdings beruhen sie auf einer recht schmalen empirischen Basis. Ähnlich wie Lambrecht wertet Schlumbohm schriftliche Unterlagen des größten Hofes in Belm aus, in denen sich Notizen über acht Heuerlingsverträge befinden. Daneben werden auch Verwandtschaftsverhältnisse und Patenschaften zwischen Bauern und ihren Heuerlingen untersucht, letztere allerdings auf der Basis zweier kleiner Stichproben. Hier wäre also zu überprüfen, ob Schlumbohms Befunde einer durch starke Vernetzung geprägten ländlichen Gesellschaft auch anhand einer die gesamte Bevölkerung eines Dorfes umfassenden Analyse und auch über einen längeren Zeitraum hinweg bestätigt werden können. Während es also zum Heuerlingssystem interessante Forschungsarbeiten gibt, fehlen solche für die landwirtschaftlichen Tagelöhner. Auch für die ökonomisch äußerst erfolgreiche Hellwegregion im Herzen Westfalens, die zunächst das landschaftlich wenig begünstigte Sauerland und dann das schnell wachsende Ruhrgebiet mit Nahrungsmitteln versorgte, weiß man nur wenig über die Arbeitsbeziehungen. Die in dieser Region ausgesprochen großen Höfe konnten aber nur mit einer großen Anzahl an Lohnarbeitern bewirtschaftet werden. Neben dem Gesinde waren das die zahlreichen ansässigen Tagelöhnerfamilien. Mit der Quellenlage steht es hier nicht zum Besten: Über den Arbeitsmarkt gibt es praktisch keine überlieferten schriftlichen Quellen. Anders als im nordwestdeutschen Textilgürtel, der vom Tecklenburger Land bis Ostwestfalen reichte, waren die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen hier nur schwach institutionalisiert. Viele, aber längst nicht alle, Tagelöhner besaßen hier eigene, kleine Häuser in den Dörfern. Da Landbesitz quellenmäßig gut zu fassen ist, kann man so einiges über Besitzverhältnisse, Erbangelegenheiten, Transfers und Kredite in Erfahrung bringen. Auf der anderen Seite sind aber die sozio-ökonomischen Beziehungen zwischen Bauern und Tagelöhnern schwerer zu fassen. Die Mehrheit der Tagelöhner war ohne Eigentum an Haus und Land. Sie mieteten sich bei den Bauern ein, ohne dass sich diese Mietverhältnisse etwa in den Kirchenbüchern niederschlugen.145
144 145
Siehe hierzu das Klassenbildungsmodell bei Kocka, Klassenbildung, S. 23ff. Löhner Heuerlinge werden mit der genauen Adresse des Hofes, zu dem sie gehören, im Kirchenbuch eingetragen, etwa bei den Geburten der Kinder oder anderen demographischen Ereignissen. In den Kirchenbüchern der Pfarrgemeinde Borgeln sind dagegen immer nur Dörfer oder Flecken als Wohnorte vermerkt, eine Zuordnung zu einem bestimmten Bauern findet hier nicht statt. Eine Rekonstruktion der Beziehungen ist also im Forschungsprozess nicht möglich.
74
Kapitel 3: Sortait Netzwerke in der Vormoderne
Man kann also davon ausgehen, dass die Beziehungen zwischen Bauern und Tagelöhnern in dieser Region weniger eng waren als in denen mit Heuerlingssystem. Aber auch wenn es sich hier um eher schwach institutionalisierte Beziehungen handelte, gibt es doch verschiedene Hinweise darauf, dass Bauern Wohnungen in ihren Nebengebäuden zu ähnlichen Bedingungen an Tagelöhner vermieteten, wie das auch für Heuerlinge bekannt ist. Gerhard Schildt hat für braunschweigische Dörfer zwischen freien und festen Tagelöhnern unterschieden. Beide mieteten sich bei den Bauern ein, allerdings zu unterschiedlichen Konditionen. Die festen Tagelöhner leisteten Miet- und Pachtzahlungen in Arbeitsleistungen ab. Da aber auch die freien Tagelöhner zumindest gelegentlich für ihre Vermieter arbeiteten, waren die Grenzen zwischen beiden Formen fließend. 146 Etwa die Hälfte der erwachsenen männlichen Bevölkerung war als Tagelöhner von Lohnarbeit abhängig. Lässt man die Knechte als lebenszyklisch unselbständig Beschäftigte außen vor, so stellten die Tagelöhner zwei Drittel der ansässigen Familien. 147 Auch im Paderborner Land bildeten die lohnabhängig Beschäftigten den Hauptteil der ländlichen Bevölkerung, etwa jedes vierte Wohnhaus gehörte einem Tagelöhner; damit waren aber viele Tagelöhner wiederum darauf angewiesen, sich einzumieten. 148 Die breite Schicht der eigentumslosen Landarbeiter ist eher ein Charakteristikum derjenigen Regionen, in denen Höfe ungeteilt vererbt wurden. In Neckarhausen hatte dagegen fast jeder verheiratete erwachsene Mann wenigstens etwas Landbesitz. 149 Auch für den Hunsrück hat Alfred Bauer gezeigt, dass über 90% der Landbesitzer zur unterbäuerlichen Schicht gehörten, also Kleinstbesitzer waren, die nicht von den auf ihrem Land erwirtschafteten Produkten leben konnten. Grundbesitz war hier wesentlich breiter verteilt. 150 Für den westfälischen Raum gibt es bislang nur wenig Evidenz für die Beziehungen zwischen Tagelöhner und Bauern. Bislang sind v. a. Fragen der Wohnverhältnisse und des Hausbaus gestellt worden, etwa in volkskundlichen Befragungen oder auch in ambitionierteren Heimatgeschichten. In vielen Gegenden Westfalens wurden Zimmer oder Wohnungen in Backhäusern oder anderen Nebengebäuden an Familien vermietet. So wird etwa aus der Kirchengemeinde Oberkirchen im Hochsauerland berichtet, dass die Nebenräume der Backhäuser als Wohnraum vermietet oder auch als Werkstatt für die von einem Hof zum anderen wandernden Handwerker genutzt wurde. Hier ist der Familienname Backes noch heute üblich.151 Auch aus dem Kreis Bersenbrück ist
146
147 148 149 150
151
Gerhard SCHILDT: Tagelöhner, Gesellen, Arbeiter. Sozialgeschichte der vorindustriellen und industriellen Arbeiter in Braunschweig 1830-1880, Stuttgart 1986, S. 33. Ebd., S. 152. Richartz-Sasse, Tagelöhner, S. 179. Sabean, Property, S. 39. Alfred BAUER: Ländliche Gesellschaft und Agrarwirtschaft im Hunsrück, zwischen Tradition und Innovation, Trier 2009, S. 139. Martha BRINGEMEIER: Bäuerliches Brotbacken in Westfalen, Münster 1980, Bericht von Heinrich Schauerte, Nordenau, Kreis Meschede, S. 30.
Bauern und Tagelöhner
75
von Vermietungen an Tagelöhner berichtet worden.152 Für das sauerländische Dorf Fleckenberg sind eine ganze Reihe von „Hausgeschichten" der Beilieger seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts rekonstruiert worden. Hier wurden Backhäuser und Wohnungen in Speichern vermietet, Schafställe und andere Nebengebäude wurden in Wohnhäuser umgebaut. Es kam auch vor, dass Backhäuser als Wohnhäuser an abzufindende Erben weitergegeben wurden.153 Im Jahr 1808 lebten in Seidfeld (Sauerland) sieben bäuerliche und vierzehn Tagelöhnerfamilien. Dort waren Wohnungen im Haus und im Backhaus an Familien vermietet.154 Das Bewohnen von Backhäusern war im 19. Jahrhundert nicht mehr überall in Westfalen üblich, so waren etwa in Siegen-Wittgenstein und auch in Ostwestfalen die Gebäude sehr klein und wurden nur zum Backen genutzt.155 Hier waren bereits im 16. Jahrhundert Altenteilswohnungen, Speicher und Backhäuser vermietet worden, später wurden dann größere Häuser, oftmals in Form von Doppelhäusern, gebaut und vermietet.156 In der Soester Börde, in der auch das hier untersuchte Borgeln liegt, sind ebenfalls stetige Beziehungen zwischen Tagelöhnern und einzelnen Bauern bezeugt. Dort konnten Tagelöhner Brot bei ihren Bauern backen lassen und sich ggf. bis zum nächsten Backtag Brot leihen.157 Backhäuser sind hier bereits im Bördekataster von 1685 nachgewiesen. 158 Nur wenige dieser alten Backse sind heute noch erhalten. Auf dem Hof Aßhoff in Oberense (ebenfalls Kreis Soest) steht heute noch ein solches Haus, das 1810 gemeinsam mit dem neuen Haupthaus errichtet wurde. Dieser Backs hat eine Grundfläche von 7 x 8 m, mit einem Backraum von etwa 4,5 m Höhe, und dazu jeweils drei übereinanderliegende Räume von ca. 2 m Höhe. Diese Nebenräume sind laut mündlicher Überlieferung auch im 19. Jahrhundert bewohnt gewesen, nach dem 2. Weltkrieg haben sie dann als Wohnraum für Kriegsflüchtlinge gedient.159 Man kann also davon ausgehen, dass Tagelöhner sich bei den Bauern einmieten konnten und dass mit diesen Mietverhältnissen zumindest zum Teil auch Arbeitsverpflichtungen einhergingen. Wenn auch über die Ausgestaltung der Arbeitsbeziehungen oder auch -Verträge zwischen Bauern und Tagelöhnern im ländlichen Westfalen wenig bekannt und aufgrund der schwierigen Quellenlage auch kaum in Erfahrung zu bringen ist, so können doch die sozialen Beziehungen zwischen den bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten auf schichtenübergreifende Integration oder aber ausgeprägte Klassengrenzen hin untersucht werden. Im folgenden Kapitel werden zunächst 152 153
154 155
156 157 158 159
Ebd., Bericht von Gretchcn Velmelage, Artland, S. 125. Bruno ERMECKE: Beisitzer, Beilieger, Beiwohner, in: Unser Dorf Fleckenberg. Fleckenberg, Jagdhaus und Wulwesort in Vergangenheit und Gegenwart, Schmallenberg 1996, S. 321-340. Katharina HOFF: Seidfeld. Ein Dorf im Sauerland, Seidfeld 2 0 0 0 , S. 21 und 61. Marita GALKA: Alte Backhäuser im Kreis Siegen-Wittgenstein, Paderborn 1991; Gerhard SEIB: Backhäuser im Stadtgebiet von Bad Oeynhausen, Löhne 1996. Wolf-Dieter KÖNENKAMP: Heuerlinge in Westfalen, Münster 1984. BRINGEMEIER 1980, Bericht von Heinrich Tiemann, Ehringhausen, Kreis Lippstadt, S. 58f. Marga KOSKE: Das Bördekataster von 1685, Soest 1960. Persönliche Auskunft von Christian Aßhoff, Oberense (8.3.2010).
76
Kfpittl 3: Soziale Netzwerke in der Vormodernt
die beiden Untersuchungsorte beschrieben. Danach wird die Quellenbasis und die Erfassung der Daten in relationalen Datenbanken erläutert. Daran schließt sich eine kurze methodische Einführung an. Die empirischen Ergebnisse werden dann in den folgenden Kapiteln vorgestellt.
Kapitel 4: Untersuchungsorte, Datenerhebung, Methoden
Die Arbeit ist als Vergleich von zwei westfälischen Gemeinden angelegt. Schon die Quellenlage legt die Begrenzung auf Kirchspiele nahe, in Löhne umfasst dies ein Dorf, umgeben von Streusiedlung, in Borgeln mehrere Dörfer beziehungsweise Flecken. Es handelt sich hier also nicht um eine Dorfgeschichte, sondern um einen analytisch-verstehenden Vergleich von zwei Untersuchungsorten.1 In diesem Sinne wird hier nicht der Versuch unternommen eine doppelte Mikrogeschichte, nämlich zu zwei Untersuchungsorten, zu entwerfen. Es handelt sich vielmehr um eine vergleichende Mikrostudie.2 Die beiden Kirchspiele werden mit Blick auf ihre relationale Struktur, der Formation der sozialen Beziehungen von Bauern, Handwerkern und Landarbeitern, untersucht. Dafür wird Löhne (Kreis Herford), ein ostwestfalisches, protoindustrielles Kirchspiel als relativ gut erforschtes Sozialwesen einem rein agrarischen Kirchspiel der westfälischen Hellwegregion (Borgeln, Kreis Soest) gegenüber gestellt. Über die soziale Struktur von nicht durch Protoindustrie geprägten Gebieten ist wenig bekannt, was teilweise thematisch begründet ist - Agrarwirtschaft erschien weniger spannend als die in den 1970er Jahren entdeckte Protoindustrie — , zum Teil aber auch auf die weniger günstige Quellenlage gerade in Bezug auf unterbäuerliche Schichten zurückzuführen ist. Für die beiden untersuchten Kirchspiele kann auf umfangreiche Datenbestände zurückgegriffen werden, die in mehreren DFG-Projekten erfasst wurden.3 Ähnliche Daten liegen auch für ein weiteres Kirchspiel im ländlichen Westfalen vor, Oberkirchen bei Schmallenberg (Hochsauerland), allerdings ohne die eigens für diese Arbeit erfassten Informationen zu Patenschaften - Oberkirchen wird daher hier nicht untersucht.
Zum historischen Vergleich siehe Hartmut KAELBLE: Der historische Vergleich. Eine Einführung zum 19. und 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M. 1999. Diesen Ausdruck hat auch Georg Fertig in seiner Studie zum westfälischen Bodenmarkt benutzt (siehe G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 39). Er hat die drei Untersuchungsorte (Löhne und Borgeln, dazu das Kirchspiel Oberkirchen im Hochsauerland) jedoch weniger verglichen, als vielmehr als kleinräumige Untersuchungseinheiten genutzt, um auf der Mikroebene zu Aussagen über die Region Westfalen zu kommen. DFG-Projekt PF 351/3: „Ländliche Faktormärkte, institutioneller Wandel und Familienstrategien im Westfalen des 19. Jahrhunderts"; DFG-Projekt PF 351/4 „Transfers von bäuerlichem Besitz: Westfalen im 19. Jahrhundert"; DFG-Projekt PF 351/6 „Beziehungen und Ressourcenflüsse in der ländlichen Gesellschaft: Soziale Netzwerke in Westfalen im 19. Jahrhundert".
78
Kapitel 4: Untenvcbwtgsorte, Datenerbebung, Metboden
Abbildung 4.1: Die Untersuchungsorte Löhne und Borgeln in Westfalen
Karte erstellt von Johannes Bracht.
Die Existenz eines verfügbaren Quellenkorpus, der z.T. bereits von Genealogen erschlossen worden ist, war in den Vorgängerprojekten ausschlaggebend für die Auswahl der Kirchspiele. Darüber hinaus bieten sie sich aber aufgrund ihrer politischen, institutionellen und sozio-ökonomischen Gegebenheiten für eine vergleichende Untersuchung an. Beide liegen in der preußischen Provinz Westfalen, politisch wie institutionell unterscheiden sie sich kaum. Die Gemeinden spielte hier keine wichtige Rolle, anders als etwa im süddeutschen Raum. 4 Die wirtschaftlichen Bedingungen waren dagegen sehr verschieden — einerseits die nahe an umsatzstarken Absatzgebieten gelegene, mit besten Böden ausgestattete Soester Börde, andererseits das ostwestfälische Hinterland, dessen zu einem guten Teil protoindustrielle Wirtschaft unter dem Niedergang des Heimgewerbes zu leiden hatte — und auch die sozialen Strukturen unterschieden sich in einigen Punkten. Auf den folgenden Seiten werden zunächst die beiden Untersuchungsorte genauer vorgestellt, dann werden Quellenkorpus und die Erhebung der Daten beschrieben. Im letzten Teil werden die methodischen Ansätze der Arbeit erläutert, bevor sich dann in den nächsten Kapiteln die empirischen Analysen anschließen.
Mooser, Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft.
Untersuchungsorte
79
4.1 Untersuchungsorte 4.1.1 Löhne (Ostwestfalen) Löhne liegt in einer Region, die relativ gut erforscht ist.5 Das hat auch mit der räumlichen Nähe zur Universität Bielefeld zu tun, an der die Erforschung sozialer Strukturen lange Zeit ein wichtiges Thema war. Die für Ostwestfalen typische Form der Beziehung zwischen bäuerlichen und unterbäuerlichen Schichten, die als Heuerlingssystem bezeichnet wird, ist schon früh auf das Interesse der Historiker gestoßen.6 Ein großer Teil der wachsenden Bevölkerung Ostwestfalens und auch Lohnes wurde so in die bäuerliche Struktur integriert. Bereits seit dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts ist zu beobachten, wie die Anzahl der Häuser stetig anwuchs. Im Katasterprotokoll der Hoheit Beck von 1681 werden 27 Bauern genannt, daneben vier Neubauern. Das Feldregister von 1745 führt dagegen bereits 36 zu Beck gehörige Höfe auf, offensichtlich sind bis 1759 dann nochmals sieben bäuerliche Stätten ergänzt worden. Hinzu kommen 40 weitere, zu anderen Grundherren behörige oder leibfreie Höfe. In den Grundkatastern von 1830 und 1866 werden dann 122 bzw. 165 Wohnstätten genannt.7 Neben diesem kontinuierlichen Anwachsen der eigenständigen, mit Grund und Boden ausgestatteten Häuser wurden im Laufe der Zeit auch immer mehr Nebengebäude mit Heuerlingsfamilien besetzt. Diese mussten für ihren Bauern auf Abruf arbeiten, ernährten sich hier aber zu einem guten Teil durch Garnspinnerei.8 Zwischen 1818 und 1871 wuchs die Bevölkerung in Löhne um 59%, von 855 auf 1.356 Einwohner.9 Mehr als jede zweite Familie lebte hier in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Tagelohn bzw. von Garnspinnerei. Nur etwa 40% der verheirateten Männer wurden als Colone (Bauern) bezeichnet, zum Teil handelte es sich dabei aber bereits um Landwirtschaft im Nebenerwerb. Gesinde kam hier dagegen kaum vor.10
5
Mager Haushalt und Familie; Mager Protoindustrialisierung; Mooser, Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft; Mooser, Ländliche Klassengesellschaft.
6
Mager, Haushalt und Familie; Mager, Protoindustrialisierung, Mooser, Ländliche Klassengesellschaft; Schlumbohm, Agrarische Besitzklassen; Schlumbohm, Peasant society; Schlumbohm 1997; Seraphim 1947.
7
Gerhard RÖSCHE, O t t o STEFFEN und Erik STEFFEN: „Das Katasterprotokoll der Hoheit Beck von 1681 mit den Bauerschaften Mennighüffen, Obernbeck und Löhne-Beck", Beiträge zur Heimatkunde der Städte Löhne und Bad Oeynhausen 2 0 (2006), S. 67-102, Bauerschaft LöhneBeck S. 97-102; G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 46f.
8
Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 155.
9
Bracht, Vermögensstrategien westfälischer Bauern, S. 20.
10
Die verschiedenen Quellen (Kirchenbücher, Wertschätzungsverhandlungen), die für eine E r stellung einer Schichtungstabelle herangezogen werden können, lassen sich nicht gut zu einer stimmigen Gesamtrechnung zusammenbringen; ein ungefähres Bild der Sozialstruktur bietet aber Tabelle 2 . 5 in G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 62.
80
Kapitel 4: UntemubungsorU, Datenerbebung, Metboden
Abbildung 4.2: Der Untersuchungsort Löhne (Kreis Herford)
Im 19. Jahrhundert war die Kirchengemeinde Löhne geprägt von einer wirtschaftlich eher schwierigen Situation, einem für westfälische Verhältnisse recht lebhaften Bodenmarkt, Auswanderung nach Übersee (ab 1838) und in das rasant anwachsende Ruhrgebiet,11 und durch die in diesem Raum ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wichtige pietistische Erweckungsbewegung. In Löhne wurden im Durchschnitt 1,5% der Bodenfläche pro Jahr an Familienfremde verkauft, mehr als doppelt so viel wie in Borgeln. Gleichzeitig stieg hier die Zahl kleiner Höfe am stärksten an, während der Anteil der Vollbauern und der Familien ohne Landbesitz an der lokalen Bevölkerung abnahm. Hier betrieben immer mehr Menschen Landwirtschaft im Nebenerwerb auf eigenem Grund und Boden, sie kombinierten verschiedene monetäre Einkom-
Zur westfälischen Auswanderung in die USA siehe v. a. Kamphoefner, Westfalen in der Neuen Welt; daneben auch Timothy G. ANDERSON: Proto-Industrialization, Sharecropping, and Outmigration in Nineteenth-Century Rural Westphalia, in: The Journal of Peasant Studies 29 (2001), S. 1-30; Anderson argumentiert, dass v. a. Kleinbauern auswanderten, um ihrer Proletarisierung zu entgehen, während besitzlose Heuerlinge sich dies nicht leisten konnten und sich in der Krise der protoindustriellen Textilproduktion eher verstärkt agrarischen Tätigkeiten zuwandten oder aber in das industrialisierte Ruhrgebiet abwanderten. Zu Wanderung in das Ruhrgebiet siehe Liebetraut ROTHERT: Zur Herkunft westfälischer Bergleute auf Bochumer Schachtanlagen im 19. Jahrhundert, in: Westfälische Forschungen 31 (1981), S. 73-117; zu Auswanderung aus Löhne siehe Friedrich SCHÜTTE: „Auf den Spuren von Amerikaauswanderern des 19. Jahrhunderts", in: Beiträge zur Heimatkunde der Städte Löhne und Bad Oeynhausen, Sonderheft 4 (1985), S. 53-81.
UntersMcbungsorte
81
mensquellen mit Subsistenzwirtschaft. Die Bedeutung der Eigenwirtschaft für die Einkommenssituation ländlicher Haushalte wird oft übersehen. Wie eine soziologische Feldstudie in Ostwestfalen unlängst gezeigt hat, unterschätzen selbst die meisten Familien im ländlichen Raum die Relevanz ihrer Eigenwirtschaft und der darauf basierenden Tauschnetzwerke, obwohl die Bilanz der meisten Haushalte hiervon ganz erheblich entlastet wird.12 Die Möglichkeit vieler Kleinstbesitzer, einen großen Teil ihres täglichen Bedarfs selbst herzustellen, muss für das 19. Jahrhundert noch höher eingeschätzt werden. Man kann hier also eine ganz erhebliche soziale Mobilität beobachten, die es zumindest einem Teil der unterbäuerlichen Bevölkerung ermöglichte, ihre Lebenssituation markant zu verbessern. Wir haben es in Löhne demnach mit einer sozialen Struktur zu tun, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts deutlich veränderte. Die in dieser Arbeit verwendete Einteilung in Besitzklassen folgt den Vorgaben der 1828 erstellten Wertschätzungsverhandlungen. Die dort genannten Flächengrenzen für kleine, mittlere und große Höfe wurden umgerechnet in die entsprechenden Werte für den steuerlichen Reinertrag, der die ökonomische Leistungsfähigkeit eines Hofes weit besser darstellt. Der Reinertrag ergibt sich aus der Größe einer Fläche und ihrer Güteklasse, so dass gute von schlechteren Böden unterschieden werden. Nach den Wertschätzungsverhandlungen haben große Höfe in Löhne 55 bis 130 Morgen, das entspricht einem steuerlichen Reinertrag von 83 bis 160 Talern; mittelgroße Höfe waren 30 bis 55 Morgen groß (= 45-83 Taler Reinertrag), und kleine Höfe haben etwa 11 bis 30 Morgen (= 17-45 Taler Reinertrag). Häuser mit weniger als 17 Talern Reinertrag werden also nicht als bäuerliche, sondern als unterbäuerliche Anwesen gezählt, ihre Besitzer demnach als Tagelöhner, die höchstens Landwirtschaft im Nebenerwerb betrieben. Der Anteil der Colone (= Bauern mit Höfen über 10 Taler Reinertrag13) ging zwischen 1830 und 1866 von 52% auf nur noch 40% zurück; dieser Rückgang ist v. a. über den Bevölkerungsanstieg zu erklären. Gleichzeitig sank aber auch der Anteil der landlosen Paare von 37% auf 28%. Gesinde gab es hier kaum, so dass der Anteil der Kleinbesitzer sich in diesen 36 Jahren etwa verdoppelte; in absoluten Zahlen wird der Anstieg aber noch größer gewesen sein.14 In Löhne gab es also schon aus struktureller Perspektive eine erhebliche soziale Mobilität. Wie weit dieses Phänomen zum inzwischen gängigen Bild einer ostwestfälischen .ländlichen Klassengesellschaft' passt, wird zu ergründen sein.
12
13
14
Andrea BAIER, Veronika BENNHOLDT-THOMSEN und Brigitte HOLZER: Ohne Menschen keine Wirtschaft. Oder: Wie gesellschaftlicher Reichtum entsteht. Bericht aus einer ländlichen Region in Ostwestfalen, München 2005. Georg Fertig hat für Löhne die Grenze zwischen kleinbäuerlichen Höfen und unterbäuerlichen Tagelöhnerhäusern bei 10 Talern Reinertrag angesetzt. G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 62, auch S. 48. Auch Schlumbohm beobachtet in Belm einen Rückgang des Anteils landloser Haushalte, während der Anteil der Kleinbesitzer zunahm; siehe Schlumbohm, Lebensläufe, S. 55, Abbildung 2.03.
82
Kapitel 4: Untenucbtmgsorte, Datenerbebung, Methoden
Dieses Bevölkerungswachstum wurde im 18. und frühen 19. Jahrhundert von relativ guten Einkommensmöglichkeiten durch die Produktion protoindustrieller Güter begleitet, an denen wahrscheinlich auch die Bauern partizipierten.15 Im Laufe der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verfielen die Preise für Garn und Leinen jedoch massiv.16 Obwohl die Situation der ländlichen Unterschichten in den 1830er und 1840er Jahren als dramatisch beschrieben wird, blieben größere Proteste aus. Möglicherweise nahmen die zeitgenössischen Beobachter, deren Perspektive die Überlieferung bestimmt, die Lebenssituation der Menschen als dramatischer wahr als diese selbst. Nach 1850 zogen die Preise für protoindustrielle Produkte wieder leicht an, daneben etablierte sich auch bald die Zigarrenmacherei.17 Als 1846/47 die Köln-Mindener Eisenbahn gebaut wurde, fanden hier viele Heuerlinge Arbeit. Die Konkurrenz um die gut bezahlte Arbeit beim Bahnbau war jedoch hart; es kam zu Auseinandersetzungen über die Beschäftigung ortsfremder Arbeiter. Auf der Baustelle konnte mit 12 bis 15 Silbergroschen pro Tag deutlich mehr verdient werden als in der Landwirtschaft (9-10 Sgr.), jedoch war die Arbeit sehr viel härter, so dass viele Tagelöhner und Garnspinner den hohen körperlichen Anforderungen nicht gewachsen waren. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten im April 1848 wurden jedoch beinahe alle Bahnarbeiter entlassen, so dass es sich hierbei nur um eine kurzfristige Episode gehandelt hat.18 Immer wichtiger wurde dagegen der landwirtschaftliche Sektor, erkennbar an der Saisonalität der Heiraten, die auf agrarische Arbeitsrhythmen hindeutet.19 Die vor Ort produzierten Nahrungsmittel reichten jedoch nicht aus, um die wachsende Bevölkerung zu ernähren, beinahe die Hälfte des Bedarfs an Roggen und Weizen musste importiert werden - auch daran erkennt man, dass die Produktion von Garn für überregionale Märkte weiter eine gewichtige Rolle spielte.20 Die infrastrukturelle Anbindung, die der frühe Bau eines Bahnhofs in Löhne (1847) bewirkte, konnte hier nicht für den Vertrieb land15
16 17
18
19
20
Schlumbohm, Lebensläufe und Küpker, Weber, haben für den osnabrücker und tecldenburgischen Raum gezeigt, dass auch die Bauern Garne und Stoffe produzierten bzw. durch ihr Gesinde produzieren ließen. Es ist also gut möglich, dass dies in Ostwestfalen ebenso der Fall war, Belege hierfür fehlen allerdings. Allerdings herrschte in dieser Gegend Garnspinnerei vor, eine Produktion, die wenig Kapitaleinsatz erforderte und deshalb in der Regel auch von unterbäuerlichen Haushalten geleistet werden konnte; siehe Pfister, Protoindustrie und Landwirtschaft, S. 59. G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 44 und 46. Klaus TLEKE: Wirtschaftliche und soziele Strukturen im Raum Löhne (1850-1918), in: H E I MATVEREIN LÖHNE UND DIE STADT LÖHNE (Hg.), 1000 Jahre Löhne. Beiträge zur Orts- und Stadtgeschichte, Löhne 1993, S. 165-219. Joachim KUSCHKE: Unruhen beim Bau der Cöln-Mindener-Eisenbahn 1846/47, in: Beiträge zur Heimatkunde der Städte Löhne und Bad Oeynhausen 13/14 (1991), S. 70-78; Tieke Wirtschaftliche und soziale Strukturen, S. 177ff. Georg FERTIG: Gemeinheitsteilungen in Löhne: Eine Fallstudie zur Sozial- und Umweltgeschichte Westfalens im 19. Jahrhundert, in: Karl DITT, Rita GUDERMANN, Norwich RüßE (Hg.), Landwirtschaft und Umwelt in Westfalen vom 18. bis 20. Jahrhundert, Paderborn 2001, S. 393426, hier S. 399f. G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 42.
Untersuchungsorte
83
wirtschaftlicher Produkte genutzt werden, die agrarische Produktion konnte ja nicht einmal genügend Nahrungsmittel für den lokalen Markt bereitstellen.
4.1.2 Borgeln (Soester Börde) Die Kirchengemeinde Borgeln liegt nordwestlich der Stadt Soest in der mit besten Böden ausgestatteten Soester Börde.21 Wie Löhne war auch Borgeln eine protestantische Gemeinde, jedoch spielte der Pietismus hier keine Rolle. Das hier deutlich häufigere Vorkommen unehelicher Geburten in Verbindung mit einer geringeren Verheiratungsquote mag darauf zurückgehen, zumal von Ehehindernissen weder auf rechtlicher noch sozio-ökonomischer Ebene die Rede sein kann. 22 In der Soester Börde waren die Löhne im westfälischen Vergleich außergewöhnlich hoch, mit zunehmender Tendenz; zeitgenössische Beobachter beklagten, dass es Gesinde und Bauern allesamt zu gut ging, dass Mägde gar ihre unehelichen Kinder mit auf den Hof brachten.23 Bereits im 18. Jahrhundert waren die Dörfer der Börde in Märkte für Agrarprodukte eingebunden, traditionelles Absatzgebiet war das nördliche Sauerland. 24 Im 19. Jahrhundert wurde dann das schnell wachsende Ruhrgebiet zum zentralen Nachfragezentrum, ab 1850 auch über die Eisenbahn in kurzer Zeit erreichbar. Die Kombination von landschaftlicher Begünstigung und der Verfügbarkeit einer kontinuierlichen und steigenden Nachfrage nach Agrargütern bot beste Voraussetzungen für eine erfolgreich betriebene, stark marktorientierte Landwirtschaft. Daneben konnte sich mit der Einführung der Hypothekenbücher ein lebhafter Kreditmarkt etablieren, auf dem sich die bäuerlichen Betriebe mit nötigem Kapital versorgen konnten. Von nah und fern strömte Kapital in den Ort, das über die hypothekarische Belastung des wertvollen Bodens abgesichert werden konnte. Dass die Landbesitzer in Borgeln ihre Kredite fast ausschließlich außerhalb ihres sozialen Nahbereichs und v. a. auch außerhalb des Kirchspiels aufnahmen, deutet auf die geringe Bedeutung sozialer Netzwerke für ökonomisches Handeln hin. In Löhne war dies anders: Hier gab es viele Kreditbeziehungen zwischen den Menschen im Kirchspiel, der Kapitalbedarf konnte nur zum Teil über auswärtigen Kredit abgedeckt werden. 25 Allerdings wurden in Borgeln viele und 21
22 23
24
25
Die Datenbank Borgeln enthält nur Daten zu den politischen Gemeinden Borgeln, Hattropholsen, Stocklarn und Blumroth, jedoch nicht zum ebenfalls zur Kirchengemeinde gehörenden Dorf Berwicke. Siehe hierzu auch G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 55. Goslar, Nichteheliche Kinder; Mooser, Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft, S. 261. StAMS, Katasterbücher Arnsberg, Nr. 92, Landwirtschaftliche Beschreibung, Abschnitt 12; siehe auch G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 57f. Noch heute findet man an größeren Straßen im Hochsauerland Verkaufsstände, in denen Nahrungsmittel „aus der Soester Börde" angeboten werden. Christine FERTIG: Urban capital and agrarian reforms: rural credit market in nineteenth-century Westphalia, in: Phillipp R. SCHOFIELD und Thijs LAMBRECHT (Hg.), Credit and the rural economy in North-western Europe, c. 1200 - c. 1850, Turnhout 2009, S. 169-196; Bracht, Abschied von der hohen Kante; Bracht, Vermögensstrategien westfälischer Bauern, Kap 3.
84
Kapitel 4: Unternubungiorte, Datenerbebung, Metboden
Abbildung 4.3: Der Untersuchungsort Borgeln (Kreis Soest)
•
Siedlungsplatz
•
Dorf
© Kirchdorf • Stadt —
Grcn/.on des Unlcrsuchungsgebiots Kirchspiel Borgeln
Flüsse und Bäclc
N t
Eisenbahn (Hamin-Padcrbom) ab 1850
0
1
2
3
4
5 km
Karte erstellt von Johannes Bracht.
auch umfangreiche Kredite über persönliche, jedoch nicht im sozialen Nahbereich anzusiedelnde Beziehungen vermittelt, etwa von in Soest ansässigen Rentiers. Dagegen hatte die Sparkasse, die hier schon früh als institutioneller Kreditgeber zur Verfügung stand, Probleme, als Kreditgeber Marktanteile zu gewinnen. Das ist zum einen auf die mangelnde Attraktivität der von der Sparkasse angebotenen Konditionen zurückzuführen, zum anderen aber auf den in dieser Gegend ungewöhnlich leistungsfähigen Kreditmarkt. Landbesitzer in Borgeln hatten wenig Schwierigkeiten, an Kapital zu gelangen, ihre Sicherheiten und ihre wirtschaftliche Situation wurden von Geldgebern geschätzt. 26 In Borgeln waren soziale Beziehungen weniger eng mit wirtschaftlichen Beziehungen verflochten als im ostwestfälischen Raum. Heuerlinge waren hier unbekannt, obwohl auch hier ein großer Teil der Familien für die Bauern arbeitete. Bauern im landwirtschaftlichen Vollerwerb machten hier nur etwa ein Fünftel der Familien aus, unterbäuerliche Familien, die zum größten Teil von landwirtschaftlichem Tagelohn oder auch von einem Handwerk lebten, beinahe vier Fünftel der Familien. Große Höfe haben hier Land im Wert von über 350 Taler jährlichen steuerlichen Reinertrag. Der größte Hof des Kirchspiel, die Jünglings Colonie in Blumroth, hatte 1866 einen Umfang von 72 Hektar und einen steuerlichen Reinertrag von 431 Talern; die Schulzen Colonie zu Borgeln (B 1) war allerdings mit über 500 Talern Reinertrag nur 47 Hektar groß. Mittelgroße Höfe haben in Borgeln 160 bis 350 Taler Reinertrag (etwa 12 bis zu
26
Bracht, Vermögensstrategien westfälischer Bauern, Kap. 3.5.
Untersuchungsortc
85
47 Hektar), kleine Höfe 18 bis 160 Taler Reinertrag (etwa 2 bis 23 Hektar). Zum Vergleich: der größte Löhner Hof, Elstermeyers Bauerngut (Löhnebeck Nr. 1), hatte zum selben Zeitpunkt nur 130 Morgen Land bei einem steuerlichen Reinertrag von 159 Talern. Im Vergleich mit der Klasseneinteilung der Löhner Höfe wird also deutlich, dass es einerseits in Borgeln größere Höfe gab, andererseits aber Höfe derselben Größe hier viel leistungsfähiger waren, daneben konnten aber Höfe derselben Größe aufgrund der unterschiedlichen Bodenqualität auch sehr verschiedenen bewertet werden. Der enorme Arbeitskräftebedarf auf den großen Borgeler Höfen wurde zu einem guten Teil durch Gesinde abgedeckt. Der Gesindeanteil lag bei einem Drittel der erwachsenen Bevölkerung. 27 Zum Teil war das Gesinde hier verheiratet, es gab also Ackerknechte, die selbständig mit ihrer Familie lebten, aber eine feste Anstellung bei einem Bauern hatten. Knapp ein Fünftel der Familienväter wurden als Handwerker bezeichnet, sie betrieben wahrscheinlich sowohl ein Handwerk als auch landwirtschaftlichen Tagelohn. 28 Etwa jeder vierte Tagelöhner (bzw. Handwerker) besaß ein Haus und ein wenig Land, ähnlich wie in Löhne. Alle anderen Tagelöhnerfamilien wohnten offensichtlich zur Miete, allerdings waren diese Mietverhältnisse weit weniger institutionalisiert als in Gebieten, in denen diese Mieter in einem Heuerlingsverhältnis zu ihrem Bauern standen. So findet man hier in den Quellen, wie etwa in den Kirchenbüchern, keine Hinweise darauf, auf welchem Hof Menschen ohne eigenen Landbesitz lebten. Mindestens zwei Drittel der Bevölkerung Borgelns lebte also ganz oder teilweise von landwirtschaftlicher Lohnarbeit, möglicherweise ergänzt durch ein Handwerk, aber ohne institutionalisierte Bindung an die bäuerliche Schicht. Es fehlte die Möglichkeit zu eigenständiger, heimgewerblicher Warenproduktion, die in Ostwestfalen für Einkommenschancen jenseits der agrarischen Lohnarbeit sorgte. Mehr als ein protoindustrieller Sektor als alternative Einkommensquelle fehlte den unterbäuerlichen Schichten in Borgeln allerdings ein liquider Bodenmarkt. Land wurde hier fast ausschließlich innerhalb der Familie weitergegeben, mit einer jährlichen Umsatzrate von 0,6% pro Jahr nur sehr selten außerhalb der Kernfamilie verkauft. Es war aber nicht unüblich, denjenigen Kindern, die den Hof nicht übernehmen konnten, einzelne Parzellen, die sogenannten Erbelande, mitzugeben. Diese standen schon im 18. Jahrhundert im alleinigen Eigentum der Bauern, gehörten nicht zum Hofland und konnten frei unter den Kindern verteilt werden. Zum Teil dienten diese Landstücke auch als Bestandteil des Altenteils, bevor sie an ein Kind übergingen; ein Verkauf außerhalb der Familie kam jedoch nur selten vor. Es gab also für Tagelöhner nur wenig Chancen, an Land zu kommen und sich eigenen Besitz aufzubauen. Dies wurde manchmal aber auch von den Bauern aktiv verhindert, indem sie Anträge auf einen Hausbau in der Gemeinde ablehnten. Die soziale Schichtung scheint also in Borgeln deutlich von weniger Mobilität gekennzeichnet gewesen zu sein als in Löhne. 29 Aller27 28 29
G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 62. Siehe unten S. 106, Tabelle 5.7. Bracht, Vermögensstrategien westfälischer Bauern, S. 319ff. und 419.
86
Kapitel 4: UnttmubungsorU, Datenerbebung, Metboden
dings ist auch hier der Anteil der Familien ohne Landbesitz an der Gesamtbevölkerung zwischen 1830 und 1866 von 42% auf 31% zurückgegangen. 30 Anders als in Löhne stieg hier die Bevölkerung im Kirchspiel Borgeln nur leicht an, von 853 Einwohnern 1818 auf 1.038 im Jahr 1871.31 Die unterbäuerliche Schicht in dieser Region ist quellenmäßig weniger gut dokumentiert, und so ist auch bislang kaum über sie geforscht worden. Diese Forschungslage steht in seltsamer Opposition zu ihrer Bedeutung: Gerade hier, wo die deutlichen Steigerungen der Agrarproduktivität auf vermehrten Arbeitseinsatz zurückgehen, war der agrarische Arbeitsmarkt unabdingbare Voraussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg der Bauern mit ihren in dieser Gegend sehr großen Höfen. Die Verdienstmöglichkeiten in der Soester Börde waren so gut, dass junge Menschen und auch Familienväter aus der Stadt in den ländlichen Raum gingen, während die Auswanderung hier kaum eine Rolle spielte. 32 Die sozio-ökonomischen Beziehungen zwischen Bauern und ihren Arbeitern sind ein zentraler Gegenstand dieser Arbeit. Nach Mooser zerfiel das ländliche Westfalen in zwei Klassen: „auf dem Lande standen sich Bauer und Nichtbauer gegenüber, weniger Bauer und Handwerker, Weber usw.".33 Diese dichotomische Perspektive übersieht die Zwischenstufen der ländlichen Gesellschaft: Einerseits gab es in der Soester Börde tatsächlich überraschend viele Handwerker, die auf den Dörfern lebten, andererseits lebten auch Tagelöhner und Garnspinner in sehr unterschiedlichen Verhältnissen. 34 Etwa ein Viertel der Tagelöhner- und Garnspinnerfamilien besaßen ein Haus und etwas Land, und zumindest in Löhne erfuhren manche Menschen erhebliche Mobilität im Lebenslauf, indem sie vom einfachen Heuerling zum Landbesitzer wurden. Dennoch ist es nicht ganz verkehrt, den fundamentalen Gegensatz von Bauern und Nicht-Bauern zu betonen. Die Bauern bildeten die grundbesitzende Elite des Dorfes, sie fragten Arbeit nach und konnten Hilfe gewähren. Für die unterbäuerlichen Schichten, die auf Erwerbseinkommen und zumeist auch auf die Miete einer Wohnung angewiesen waren, ganz zu schweigen
30 31
32
33 34
G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 62. Bracht (2009, S. 20) berücksichtigt nur die Einwohner der Orte Borgeln, Hattropholsen, Stocklarn und Blumroth, da das Dorf Berwicke zwar zur Kirchengemeinde gehört, aber in unseren Datenbanken nicht berücksichtigt wird. Siehe hierzu auch G. FERTIG 2007, S. 55. Volker JARREN und Norbert WEX: Die Soester Stadtgesellschaft im Jahr 1768 - Familien, Haushalte und Erwerbstätigkeit, in: Soester Zeitschrift 114 (2002), S. 109-174, hier S. 123 und 128; dies.: Die Soester Stadtgesellschaft im Jahr 1807 - Familien, Haushalte und Erwerbstätigkeit, in: Soester Zeitschrift 117 (2005), S. 99-154, hier S. 112; Johannes-Josef JOEST: Wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Soester Raumes im 19. Jahrhundert und ihre Berücksichtigung in den Lokalzeitungen der Stadt, Soest 1978, S. 146ff. Kamphoefner, Westfalen in der Neuen Welt, Karte auf S. 46. Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 199. Johannes Bracht (Vermögensstrategien westfälischer Bauern, S. 18) verweist auf die Banngesetze der Soester Börde, die in den ländlichen Gemeinden nur die unmittelbaren Landhandwerke erlaubten; offenbar entfalteten sie aber keine große Wirkung.
jQutlknkorpus und Datenerfassung
87
von Unterstützungsleistungen in Notzeiten, waren gute Beziehungen zur bäuerlichen Schicht wichtig. Über die Arbeitsbeziehungen wissen wir aufgrund der schlechten Quellenlage wenig, die Wohnverhältnisse können wir nur da nachvollziehen, wo Heuerlinge an einzelne Höfe gebunden waren. Durch die mikroanalytische Anlage der Untersuchung ist es aber möglich, die sozialen Netzwerke von Bauern, Heuerlingen, Tagelöhnern und Handwerkern, ihre verwandtschaftlichen Beziehungen, das Netz der Patenschaften und die Integration der sozialen Klassen in beiden Gemeinden vergleichend zu untersuchen. Dies geschieht hier in netzwerkanalytischer Perspektive; die Quellengrundlage und die methodischen Ansätze werden nun kurz erläutert, bevor in Kapitel 5 die Patenschaftsbeziehungen untersucht werden.
4.2 Quellenkorpus und Datenerfassung Die vorliegende Arbeit ist im Kontext einer Forschungsgruppe hervorgegangen, die 1996 am Historischen Seminar der Universität Münster etabliert wurde. Mit finanzieller Unterstützung der DFG wurden Quellenbestände erhoben und in Datenbanken zusammengeführt, deren Erfassung für einzelne Forscher nur mit erheblichem Zeitaufwand zu realisieren wäre. Dieser institutionelle Hintergrund ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam. Zum einen kann auf Arbeiten und Forschungsergebnisse verwiesen werden, die in den letzten Jahren erarbeitet wurden: Georg Fertig, Johannes Bracht, Volker Lünnemann, Silke Goslar und Bernd Liemann haben hier wichtige Beiträge geleistet.35 Zum anderen kann auf einen umfangreichen Datenbestand zurückgegriffen werden, der bislang nur zum Teil ausgewertet ist. Die in dieser Arbeit verwendeten Quellen lassen sich im Wesentlichen vier Quellengattungen zuordnen. (1) Da sind zunächst Kirchenbücher, die vitalstatistische Daten und Informationen zu Patenschaften enthalten. (2) Der zweite Quellenbestand besteht aus Hypothekenbüchern (heute als Grundbücher bezeichnet). In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts eingeführt, enthalten sie Informationen über Besitzwechsel von Höfen, eingeschränkt auch über Bewegungen einzelner Parzellen, über Grundlasten zugunsten der Grundherren und über hypothekarische Belastungen des Landes. (3) Vermessungsdaten, Informationen über Landkultur und über Transaktionen von Land stellen dagegen die Katasterunterlagen bereit, die parallel zu den Hypothekenbüchern geführt wurden. Hier gibt es flächendeckende Verzeichnisse, Güterverzeichnisse von 1829 (in Borgeln) bzw. 1833 (in Löhne), und Güterauszüge von 1866,
35
Bracht, Reform auf Kredit; ders., Abschied von der hohen Kante; ders., Vermögensstrategien westfälischer Bauern; G. Fertig Gemeinheitsteilungen in Löhne; ders., „Wenn zwey Menschen eine Stelle sehen"; Ländlicher Bodenmarkt; Goslar, Nichteheliche Kinder; Bernhard LIEMANN: Zwischen den Generationen. Die Gestaltung des bäuerlichen Besitztransfers in der Soester Börde im 19. Jahrhundert, in: Soester Zeitschrift 120 (2008), 55-77; Lünnemann, Familialer Besitztransfer und Geschwisterbeziehungen; ders., Preis des Erbens.
88
Kapitel 4: Unterstubnngorte, Datenerbebung, Methoden
aber auch jährlich erstellte Fortschreibungsverhandlungen, in denen die im laufenden Jahr erfolgten Veränderungen, wie Erbschaften oder Verkäufe, erfasst wurden. (4) Zu den Hypothekenbüchern wurden in den Gerichten Grundakten geführt, die Dokumente zu den dort eingetragenen Vorgängen beinhalten. Hier sind vor allem die Familienverträge wie Hofübergabeverträge und Erbauseinandersetzungen von Interesse. Wichtigste Grundlage für die hier interessierenden Fragen sind die Kirchenbücher der untersuchten Orte. Für beide Kirchspiele lagen zu Beginn der Datenerfassung bereits Familienrekonstitutionen vor, für Löhne in maschinenlesbarer Form, für Borgeln als Verkartung. 36 Anhand der Originalkirchenbücher (die als Mikrofiche verfügbar sind) konnten diese durch die Paten der Kinder ergänzt werden. Die Familienrekonstitutionen wurden in relationale Datenbanken (MS Access) überführt, so dass die Verknüpfung weiterer Datenbestände, wie etwa die Identifikation der Paten, problemlos möglich war. Die in den Kirchenbüchern aufgeführten Personen bilden gewissermaßen das Fundament der Studie, denn ihre Lebenswelt, ihre Beziehungen und sozialen Strategien werden im Folgenden untersucht. Allerdings enthalten die Datenbanken zu den beiden Orten mehr als nur „Kirchenbuchpopulationen", da alle greifbaren Personen, die Spuren in den verschiedenen Quellen zum Kirchspiel hinterlassen haben, mit aufgenommen worden sind, z.B. Kreditgeber, Grundherren, zugezogene Hauskäufer oder auch Paten, die nicht eindeutig identifiziert werden konnten oder von außerhalb des Kirchspiels stammen. Damit wurde der Versuch unternommen, der gesamten Population der lokalen Gesellschaft so nah wie möglich zu kommen, auch wenn dies immer nur annäherungsweise gelingen kann. 37 Die Patenschaften sind eigens für diese Arbeit erfasst worden. Aufgrund des erheblichen Aufwandes ist dies nur für zwei Kirchspiele geschehen. Die Identifizierung von Paten ist nicht ganz einfach, da es sich hier um recht spärliche Einträge handelt.
36
37
Dabei waren die Ausgangsdaten von sehr unterschiedlicher Qualität. Während für Löhne eine maschinenlesbare Version des von Manfred Schlien erarbeiteten Ortsfamilienbuchs existierte, musste für Borgeln auf publizierte Höfebücher und eine Verkartung der Kirchenbücher zurückgegriffen werden. Beide wurden von Adolf Ciarenbach, dem Borgeler Pfarrer, erstellt, um Ansprüche des nationalsozialistischen Staates an die evangelische Kirche zu erfüllen. Siehe die Diskussion der beiden Datenbestände bei G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt. Troßbach, Anthropologie und Agrargeschichte, S. 209f. Um eine „Kirchenbuchpopulation" handelt es sich dennoch nicht. Die Erweiterung der Datenbasis auf Personen, deren vitalstatistische Informationen sich nicht oder nur für einzelne Ereignisse (wie z. B. die Geburt eines Kindes) in den Kirchenbüchern der Untersuchungsorte befinden, erfolgt aber um den Preis, dass es relativ viele Personen gibt, über die man sehr wenig weiß. Dabei handelt es sich v. a. um Leute, die Käufer von Land oder Häusern oder aber als Geldgeber aufgetreten sind. Diese Personen müssen bei statistischen Analysen wegen des Mangels an Informationen oft ausgeschlossen werden. Auf einer eher qualitativen Ebene können solche informationsarmen Datensätze aber wiederum zu interessanten Erkenntnissen führen, etwa wenn man aus Texten etwas über die Lebensläufe abgewanderter Kinder erfährt, oder ein Berufs- oder Herkunftsprofil von auswärtigen Kreditgebern erstellen kann. Siehe dazu auch C. Fertig, Urban capital.
Quellenkorpus und Datenerfassung
89
Allerdings unterscheiden sich die Kirchenbücher der beiden Untersuchungsorte ganz erheblich. In Löhne werden in aller Regel einfach die Namen der Paten aufgeführt, während in Borgeln oftmals sowohl der Stand (z. Bsp. Colon), der Familienstand (z. Bsp. uxor = Ehefrau) und der Wohnort genannt werden. Eine ,Anna Maria Elisabeth Rickert, uxor J. H. Beuckmann' oder ein .Colon Peter Blomenroth* in Borgeln sind leichter zu identifizieren als eine ,Anna Maria Elisabeth Stricker' in Löhne, zumal hier bei den meisten Frauen ,Anna Maria' im Vornamen vorkam. Bei Frauen kommt hinzu, dass sie meistens mit ihrem eigenen Nachnamen, manchmal aber auch unter dem des Ehemannes aufgeführt wurden. Während sich die aus den Vorgängerprojekten übernommene Praxis, die Personen gleich der der Datenaufnahme zu identifizieren, für die Borgeler Patenschaften bewährte, mussten die Löhner Daten nach genauerer Überprüfung nochmals erfasst werden, in einem der schlechteren Datenqualität angepassten Verfahren.38 Für beide Untersuchungsorte gilt, dass die Pateneinträge in den 1850er Jahren zunehmend knapper wurden, so dass die Identifikation der Paten immer schwieriger wurde. In Löhne wurden daher die Patenschaften nur bis 1856, in Borgeln bis 1859 erfasst.39 Neben diesen personenbezogenen Daten sind weitere Quellen zu Land und Landbesitz, familialen Vereinbarungen und Eigentumsrechten erfasst worden, die in unterschiedlichem Grad in die Untersuchung eingeflossen sind.40 Von besonderer Bedeutung sind die über Kataster und Hypothekenbücher zu fassenden Informationen zum Landbesitz, die recht detaillierte Informationen zu Größe und Beschaffenheit des Landes liefern. Aus den Katasterverzeichnissen wurden die genauen Größen der Parzellen und ihr Ertragswert erfasst; letzterer diente der Besteuerung des Bodens und ergibt sich aus Größe und Güte der Parzelle. Anhand dieses Ertragswertes („steuerlicher Reinertrag") kann die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Höfen besser dargestellt werden als über ihre Fläche. Die in den empirischen Kapiteln angewandte Einteilung in Besitzklassen wurde an die Größenangaben in den 1828 erstellten Wertschätzungsverhandlungen angelehnt, allerdings wurden die dort verwandten Flächenangaben in Ertragswerte umgerechnet.41 Ein Nachteil der Katasterquelle ist, dass man dort in der Regel zu wenig Informationen zu den Landbesitzern findet, um diese zuverlässig identifizieren zu können, auch wenn die Quelle auf den ersten Blick einen ordentlichen, tabellarischen Aufbau aufweist. Hier stellen die Hypothekenbücher gewissermaßen Verbindungsglieder zwischen Informatio38
39 40
41
Siehe auch die Diskussion zur Datenerfassung bei G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 229ff. Die Löhner Patenschaften wurden in einem zweiten Durchgang zunächst komplett aus der Quelle abgeschrieben, dann erst wurden für den gesamten Untersuchungszeitraum die in Frage kommenden Personen aus der Datenbank herausgesucht. So konnten Namensvarianten bei den Pateneinträgen zuverlässiger bestimmten Personen zugeordnet werden. Aus Gründen des Arbeitsaufwandes sind diese Daten jedoch nur für das 19. Jahrhundert erfasst worden. Für eine genauere Beschreibung der Daten siehe Kapitel 5, S. 102ff. Für eine ausführliche Diskussion der Quellenbasis unserer Datenbanken und Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Datenverknüpfung siehe G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 229ff. StAMS, Katasterbücher Arnsberg, Nr. 92.
90
Kapitel 4: Untenucbmigsorte, Datenerbebung, Metboden
nen über Personen und solchen über Land dar. Hier werden Eigentumstransaktionen in Textform beschrieben, wodurch die personenbezogenen Informationen breiter werden und die Identifikation der Beteiligten sich einfacher gestaltet. Die Verknüpfung dieser das Land und die Personen betreffenden Informationen erlaubt vor allem aber auch zeitpunktbezogene Aussagen über den Besitz einzelner Personen. Die auf dieser Basis erstellte Besitzstruktur der Löhner und Borgeler Einwohner konnte ergänzt werden durch Angaben zu Berufen, die vor allem im Kirchenbuch bei Kindsgeburten verzeichnet wurden und ein nochmals differenzierteres Bild der sozio-ökonomischen Struktur erlauben. Auf diesem Weg wird einerseits die z.T. erhebliche soziale Mobilität von Angehörigen der unterbäuerlichen Schicht deutlich, andererseits aber auch der überraschend hohe Anteil ländlicher Handwerker in einem der Untersuchungsorte.42 Ein weiterer hier genutzter Quellenbestand sind die Dokumente zu intergenerationellen Transfers, namentlich Übergabeverträge, Erbvereinbarungen und (nur wenige) Testamente. Diese umfangreichen und ergiebigen Quellen sind ursprünglich für ein anderes Projekt erfasst worden und können im Rahmen dieser Arbeit nur für begrenzte Fragestellungen ausgewertet werden.43 Sie enthalten im Wesentlichen Regelungen, die den Übergang der Eigentums- und Bewirtschaftungsrechte, die Altersversorgung der Altbauern und die Rechte und Pflichten der Kinder betreffen. In Kapitel 6 wird der Stellenwert der Heirat in der ländlichen, bäuerlichen wie auch unterbäuerlichen Gesellschaft anhand dieser .sprechenden' Quellen diskutiert. 44 Die Erfassung der aus den Quellen stammenden Informationen in relationalen Datenbanken ermöglicht die Generation komplexer Daten zu Personen, Höfen, sozialen Netzwerken, etc. Einige Beispiele von in dieser Arbeit verwendeten Daten können den Nutzen dieser Datenverarbeitung demonstrieren: (1) Über die Erfassung der jährlichen Besitzveränderungen, der Vermessungsdaten jeder einzelnen Parzelle und der Verknüpfung von Personen, Parzellen und Höfen können für jede Person, für jeden Zeitpunkt die genaue Größe und der Ertragswert des Hofes ermittelt werden. So kann man Hofbesitzer nicht nur Größenklassen zuteilen, sondern man kann auch feststellen, wie sich ihr Besitz über den Lebenslauf hinweg verändert hat.45 (2) Die Größe des Hofes, den eine Familie irgendwann besessen hat, ist nur eine sehr grobe Kategorie für die Erfassung des gesellschaftlichen Status. Sie übersieht für gewöhnlich, dass Menschen unterschiedliche Mobilitätsprozesse erfahren. Für die
42 43
44
45
So etwa in den Tabellen 5.6, S. 114 und 5.7, S. 115. Diese Dokumente werden in Kapitel 6 nut qualitativ ausgewertet. Diese Entscheidung beruht vor allem auf der Erkenntnis, dass diese komplexen Quellen sich nur schwer in einer MS Access Datenbank verwalten lassen. Die Erschließung der umfangreichen und sehr heterogenen Informationen aus diesen Dokumenten würde erhebliche Vorarbeiten erfordern, die im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden können. Einer ausführlicheren Analyse ist ein Teil der Übergabeverträge aus Löhne unterzogen werden; siehe Große (verh. Fertig), Ländlicher Haushalt und Ressourcentransfer und C. Fertig, Hofubergabe. So etwa die Variable „Vergrößerung des Hofes" in den Regressionen, Kapitel 7.
Methodischer Ansät^
91
meisten Hofbesitzer war die Hofübergabe oder Heirat die entscheidende Passage im Lebenslauf — Höfe wurden an die jüngere Generation übertragen oder durch Heirat erworben, und zumeist blieb der damit erlangte Status dann ein Leben lang erhalten. Dies galt jedoch nicht unbedingt für Menschen, die in die unterbäuerliche Schicht hinein geboren wurden, oder als Nebenerben den elterlichen Hof nicht übernehmen konnten. Hier kann man oft verfolgen, dass sich der Status über den Lebenslauf hinweg veränderte, etwa indem ein Heuerling zum Neubauern oder gar Colon avancierte. Solche Statusveränderungen kann man gut über Berufsangaben in den Kirchenbüchern verfolgen, etwa bei Heirat und den Geburten von Kindern, wo die Berufe der Väter eingetragen wurden. 46 In Löhne kann man hier auch die Wohnorte, also die Höfe, auf denen die Familien als Bauern oder Heuerlinge lebten, erfassen. Auch hier können also über die Erfassung und Verknüpfung verschiedener Datenbestände Lebenslaufdaten generiert werden. (3) Ein weiteres Beispiel ist die Erstellung von Netzwerkdaten. Über die Kirchenbuchinformationen können Patenschaftsbeziehungen zwischen Eltern und Paten ermittelt und mit anderen Informationen, etwa über Schichtzugehörigkeit oder verwandtschaftlicher Einbettung, in Beziehung gesetzt werden. Dabei werden zum einen über Abfragen Daten in der Datenbank selbst generiert, zum anderen aber auf Programmpakete für Statistik (SAS) und spezielle Netzwerksoftware (PAJEK) zurückgegriffen. Nicht immer ist die Verwendung von Netzwerkprogrammen die beste Lösung; darauf wird im Folgenden einzugehen sein.
4.3 Methodischer Ansatz Carola Lipp hat die „Netzwerkanalyse eine Methode [genannt], deren theoretische und verfahrenstechnische Wurzeln in der Strukturanalyse gründen, die zugleich aber auch die Mikroperspektive individuellen Verhaltens und Interaktion einbezieht und insofern geeignet ist, das Problem der Komplexität gesellschaftlicher Beziehungen analytisch zu bearbeiten."47 Zunächst als eher vages Konzept in verschiedenen Wissenschaften - der Sozialpsychologie, der britischen Sozialanthropologie und der amerikanischen Gemeinde- und Industriesoziologie — entwickelt, trat in den 1970er Jahren e i n e Forschungsgruppe um Harrison White (Harvard) mit dem Anspruch auf, die
46
Die Berufsangaben wurden etwa genutzt, um die Schichtzugehörigkeit von Eltern und Paten zu klassifizieren; Kapitel 5, S. 113ff. Insbesondere die Neubauern, also aus der unterbäuerlichen Schicht aufgestiegene Kleinbesitzer, können nur so zuverlässig erfasst werden.
47
Carola LIPP: Struktur, Interaktion, räumliche Muster. Netzwerkanalyse als analytische Methode und Darstellungsmittel sozialer Komplexität, in: Silke GÖTTSCH und Christel KÖHLE-HEZINGER (Hg.), Komplexe Welt. Kulturelle Ordnungssysteme als Orientierung, Münster 2 0 0 3 , S. 4963, hier S. 49; der Text bietet sich auch als (sehr) kurze Einführung in Theorie und Methode der Netzwerkanalyse an.
92
Kapittl 4: Untemubungsorte, Datenerbebung, Metboden
neuen netzwerkanalytische Ansätze nicht nur als Instrumentarium von Methoden, sondern als zentralen theoretischen Ansatz einer Theorie der sozialen Strukturen zu etablieren. Die Harvard-Strukturalisten entwickelten die Blockmodellanalyse, die es erlaubt, aus den individuellen Beziehungsdaten auf gesamtgesellschaftliche Positionsund Rollenstrukturen zu schließen. Damit war der Grundstein gelegt für die Entwicklung netzwerkanalytischer Verfahren, die eine Analyse großer Datensätze erlaubte, ohne dass man auf statistische Verfahren ausweichen musste. 48 Bekanntestes Beispiel für eine historische Blockmodell- oder Positionenanalyse ist wohl die bereits erwähnte Florenz-Studie von John Padgett und Christopher Ansell. Das Netzwerk von Cosimo de Medici zerfiel im mehrere Blöcke, in dem Heirats- und ökonomische Beziehungen strikt voneinander getrennt blieben. Ein besonderer Vorteil war, dass die meisten Alteri untereinander unverbunden waren, wodurch Cosimo in einer sehr günstigen, mächtigen Netzwerkposition war. 49 Ein soziales Netzwerk ist definiert als eine begrenzte Anzahl von Akteuren und den zwischen ihnen bestehenden Relationen. Akteure können sowohl Personen sein, aber auch korporative Akteure wie Unternehmen oder Staaten. Daneben gibt es TwoMode-Netzwerke, in denen neben Akteuren auch Ereignisse dargestellt werden, z. B. Personen einerseits und Veranstaltungen, an denen sie teilgenommen haben, andererseits. 50 Two-Mode-Networks spielen im Verlauf dieser Untersuchung keine Rolle mehr; jedoch ist unlängst auf einer Tagung empfohlen worden, dass Historiker die Möglichkeiten, die eine Transformation ihrer Daten in solche Netzwerke bietet, nutzen sollten.51 In dieser Arbeit werden zwei Kirchspiele untersucht; die jeweiligen Netzwerke umfassen jedoch nicht die gesamte Bevölkerung, sondern sind jeweils klar umrissen. So enthalten die Patennetze alle identifizierbaren Personen, die entweder Kinder taufen ließen oder eine Patenschaft übernommen haben (Kapitel 5). Ein anderes Netzwerk ist das der Höfe und Häuser; hier sind korporative Akteure, die mehr oder weniger aus Familien bestehen, durch Heiratsbeziehungen miteinander verbunden (Kapitel 6.2). An anderen Stellen sind alle im Kirchspiel geborenen Menschen, die
48
49 50
51
Dorothea JANSEN: Einführung in die Netzwerkanalyse: Grundlagen, Methoden, Anwendungen, Opladen, 2. Aufl. 2003, S. 37ff., Zitate S. 47. Inzwischen ist es üblich, dass netzwerkanalytische und statistische Verfahren kombiniert werden. Padgett / Ansell, Robust action. Für ein Beispiel siehe Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 45; für eine ausführliche Definition siehe Stanley WASSERMAN und Katherine FAUST: Social Network Analysis: Methods and Applications, Cambridge 1994, S. 39ff. Tagung „Network Analysis and History. Approaches, tools, problems", organisiert von Thomas David, Sandro Guzzi-Heeb, Stéphanie Ginalski und Frédéric Rebmann, Lausanne 25.2. 27.2.2010. Sowohl Martin Everett, einer der Entwickler des inzwischen weit verbreiteten Programmpakets UCINET, als auch Vladimir Batagelj und Andrej Mrvar, die das hier benutzte PAJEK programmieren, haben in ihren Vorträgen auf die erweiterten Analysemöglichkeiten hingewiesen. Für diese Arbeit konnten diese Anregungen allerdings nicht mehr berücksichtigt werden.
Methodischer Ansatz^
93
das Erwachsenenalter erreicht haben, berücksichtigt worden. Dort ist das Ziel aber nicht eine Netzwerkanalyse, sondern die Ermittlung von Ledigen- und Heiratsquote (Kapitel 6.1.3). Diese Beispiele machen deutlich, dass Netzwerke immer durch klare Definitionen umgrenzt werden. Darin unterscheiden sich von Historikern untersuchte Netzwerke nicht von denjenigen, die für soziologische oder ethnologische Studien gesammelt werden.52 Die Beispiele verdeutlichen auch, dass es sich jeweils um Gesamtnetzwerke handelt. Damit ist wiederum nicht die gesamte Bevölkerung des Kirchspiels gemeint, sondern ein Netzwerk, das eine über Kriterien wie die Zugehörigkeit zu einem Kirchspiel definierte Gesamtheit von Akteuren und die zwischen ihnen existierenden Beziehungen umfasst. Dagegen zeichnen sich persönliche, ego-zentrierte Netzwerke dadurch aus, dass sie ausschließlich Akteure umfassen, die mit einer zentralen Person Ego verbunden sind. Solche ego-zentrierten Netzwerke sind relativ einfach zu generieren, etwa durch Interviews oder, für historische Untersuchungen, indem man z. B. überlieferte Korrespondenzen auswertet. Allerdings sind auf diese Weise gewonnene Daten mit Bezug auf ihre Gültigkeit problematisch, da sie nur auf der Perspektive von Ego beruhen. Selbst wenn Forscher ihre Informationen über Interviews sammeln — sie ihre untersuchten Subjekte also fragen können - , sind die Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit weder vollständig noch immer korrekt: „Dass Ego behauptet, die beiden Alteri A und B seien auch untereinander befreundet, muss ja nicht richtig sein."53 Mit der Frage nach der Güte der zur Verfügung stehenden Daten müssen Historiker sich also genauso auseinander setzen wie Forscher anderer Fachrichtungen. Dabei gilt immer, dass ein untersuchtes Netzwerk möglichst vollständig in den Daten repräsentiert sein sollte; eine Anforderung, die Datensätze aber kaum jemals erfüllen. Über Wege, wie soziale Netzwerke analysiert werden können, geben verschiedene Standardwerke Auskunft. Das wichtigste methodische Handbuch ist immer noch das bereits 1994 erschienene Buch von Stanley Wasserman und Katherine Faust; auf Deutsch liegt seit 1999 eine gut lesbare, 2003 in einer erweiterten Ausgabe erschienenen Einführung in die Netzwerkanalyse von Dorothea Jansen vor.54 Zur Einführung sehr zu empfehlen ist nach wie vor das grundlegende Buch von Thomas Schweizer.55 Einen guten Überblick über Konzepte, Theorien, Methoden und Anwendungsfelder bietet das von Christian Stegbauer und Roger Häußling herausgegebene Handbuch Netzwerkforschung.56 Ein 52
Mit dem vielbeklagten Problem der unvollständigen Daten müssen sich auch Forscher auseinandersetzen, die ihre Datengrundlage durch Befragungen oder Beobachtungen ermitteln.
53
Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 65; siehe auch S. 79f. Dabei gilt die Vollständigkeit der Daten, also auch der Beziehungen der Alteri untereinander, als wichtiges Gütekriterium.
54
Wasserman / Faust, Social Network Analysis; Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse. Siehe auch John SCOTT: Social Network Analysis: A Handbook, Newbury Park, 2. Aufl. 2000.
55
Thomas SCHWEIZER: Muster sozialer Ordnung. Netzwerkanalyse als Fundament der Sozialethnologie, Berlin 1996.
56
Christian STEGBAUER und Roger HAUBLING (Hg.): Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2010.
94
Kapitel 4: Untenucbungsorti, Datenerbtbung, Metboden
sehr guter Überblick über Geschichte, Theorien und Methoden der Netzwerkanalyse befindet sich auch in der Studie von Anna Kim über Familien und soziale Netzwerke in Deutschland und Südkorea.57 Zu einem der gängigsten Programmpakete (Pajek) ist inzwischen ein Einführungstext erschienen, die neben einer praktischen Einführung in die Benutzung der Software auch eine ausführliche Theorie- und Methodendiskussion bietet.58 Im Folgenden werden verschiedene Analysewege vorgestellt, soweit sie für diese Arbeit von Belang sind. Darüber hinaus wird auch auf das Verfahren der Blockmodellanalyse eingegangen, da es nicht nur eines der bekanntesten und wichtigsten Analyseverfahren ist, sondern auch von Historikern erfolgreich eingesetzt wurde. Die Diskussion wird sich weitgehend an dem Einführungstext von Jansen orientieren, allerdings an einigen Stellen darüber hinaus gehen. Der Gang der Darstellung folgt weitgehend dem Aufbau der folgenden empirischen Kapitel. (1) Zunächst einmal kann man mit relativ einfachen, deskriptiven statistischen Verfahren eine ganze Reihe von Erkenntnissen über soziale Netzwerke gewinnen. Die geographische Reichweite des Patennetzes, die Altersprofile der Paten, ihre Schichtenzugehörigkeit oder die soziale Mobilität von jungen Ehepaaren sind einfache kategoriale Variablen, die sich mit Hilfe von Datenbankabfragen und eines Tabellenkalkulationsprogramms darstellen lassen. Man kann also soziale Netzwerke bis zu einem gewissen Punkt auch mit gängigen Programmen, ohne Einsatz spezieller Software untersuchen.59 Kategoriale Merkmale von Akteuren sind dabei für die Untersuchung sozialer Netzwerke interessant, stellen aber keine größere Herausforderung dar. Anders verhält es sich mit relationalen Merkmalen, die sich aus den Beziehungen der Akteure untereinander ergeben.60 (2) Zentralitätsmaße erlauben es, Aussagen über die Zentralisierung (und damit auch Hierarchisierung) sozialer Netzwerke sowie über die Zentralität einzelner Akteure im Netzwerk zu treffen. Zentralität und Prestige fragen nach der Wichtigkeit, öffentlichen Sichtbarkeit oder .Prominenz' von Akteuren. Diese Konzepte gehen davon aus, dass Akteure besonders prominent im Netzwerk sind, die an vielen Beziehungen im Netzwerk beteiligt und deshalb besonders sichtbar sind.61 Wichtige Kennziffern sind etwa degree-basierte Zentralität, die nach den direkten Beziehungen von Akteuren fragt, nähebasierte Zentralität, die auch indirekte Beziehungen berücksichtigen, und 57
58
59
60
61
Anna KLM: Familie und soziale Netzwerke. Eine komparative Analyse persönlicher Beziehungen in Deutschland und Südkorea, Opladen 2001. Andrej MRVAR und Vladimir BATAGELJ: Pajek 1.26; Wouter DE NOOY, Andrej MRVAR und Vladimir BATAGELJ: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, Cambridge 2005. Das hier benutzte Tabellenkalkulationsprogramm ist Microsoft Excel, die meisten Tabellen und Abbildungen beruhen auf Pivottabellen. Zur Unterscheidung von verschiedenen Merkmalen siehe Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 53ff.; Jansen unterscheidet bei kategorialen Merkmalen genauer zwischen absoluten Merkmalen (z.B. Alter), komparativen Daten (z.B. Schichtzugehörigkeit) und kontextuellen Merkmalen (z. B. Gruppenzugehörigkeit). Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 127.
Methodischer Ansatz
95
betweenness-basierte Zentralität, die die Präsenz von Akteuren auf den Verbindungspfaden anderer Akteure misst. Man kann also z. B. danach fragen, wie stark sich prominente und weniger beliebte Paten unterscheiden, und wie groß die auf Prestige, nicht auf Landbesitz, bezogene soziale Ungleichheit in den Kirchspielen Löhne und Borgeln war. (3) Der Aufbau von Patennetzen durch junge Familien bietet eine gute Gelegenheit, um Netzwerkkonstruktion zu beobachten. Die Konstruktion sozialer Netzwerke kann grundsätzlich in zwei verschiedene Richtungen erfolgen: Sie können durch neue Beziehungen erweitert oder verdichtet werden. Netzwerke werden verdichtet, indem neue Beziehungen, wie Patenschaft, auf bereits bestehenden Beziehungen, wie Verwandtschaft, aufbauen. Die Beziehungen werden somit multiplex angelegt, d. h. mit mehreren Bedeutungen belegt. Die sozialen Netzwerke bleiben dadurch relativ klein, gleichzeitig wird die Bindung zwischen den Akteuren aber enger, z. B. wenn Heiratsbeziehungen sich auf ältere Verwandtschaftsbeziehungen auflagern, wie bei der Heirat mit der Cousine. Uniplexe Beziehungen sind dagegen nur einfach belegt, so werden etwa Verwandtschaft und Patenschaft getrennt gehalten, indem man keine Verwandten zu Paten bittet. Dies führt zu größeren, weniger engen Netzwerken, die zudem mehr Verbindungen in die soziale Umwelt stiften. Solche persönlichen Netzwerke eröffnen im Allgemeinen mehr Handlungsoptionen, Akteure können so eher Gruppenzugehörigkeit und strukturelle Grenzen überschreiten.62 (4) Gesamtnetze weisen nur selten eine gleichmäßige, einheitliche Struktur auf. Zumeist gibt Bereiche, die eher lose gestrickt, und andere, die stärker verdichtet sind. Verdichtete Bereiche können als Subgruppen untersucht und durch eine mehr oder weniger enge Gruppendefinition gekennzeichnet werden. Eine relativ strikte Definition ist die der Clique, in der alle Akteure in direktem Kontakt zueinander stehen. Solche Subgruppen kommen nur selten und in aller Regel auch nur in Netzwerken mit generell dichter Beziehungsstruktur vor. Daher sind weitere Definitionen von Gruppen entwickelt worden, um Subgruppen in Netzwerken identifizieren zu können, z.B. die Anforderung, dass jedes Mitglied der Gruppe jedes andere Mitglied auf einem relativ kurzen Pfad (z. B. in 2 oder 3 Schritten) erreichen kann.63 Für Netzwerke mit wenigen Beziehungen, also einer sehr geringen Dichte, wie sie z. B. das Netzwerk der Heiratsbeziehungen zwischen Löhner bzw. Borgeler Höfen aufweist, sind diese Verfahren nicht geeignet. Ein solches, wenig dichtes Netzwerk kann man aber auf Komponenten hin untersuchen. Eine Komponente ist eine Subgruppe, in der alle Akteure mit den anderen Akteuren verbunden sind, zumeist auf indirektem Wege und über beliebig lange Pfade. Daneben 62
63
Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 163ff.; Lipp, Netzwerkanalyse als analytische Methode, S. 56; Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 117ff.; Burt, Structural holes; Jessica H A A S und Thomas M A L A N G : Beziehungen und Kanten, in: Christian STEGBAUER and Roger HAußLiNG (Hg.), Handbuch Netzwerkanalyse, Wiesbaden 2010, S. 89-98, hier S. 94f. Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 193ff., dort auch weitere Verfahren der Cliquenanalyse.
96
Kapitel 4: Unternubiingsorte, Datenerbebung, Methoden
gibt es im Netzwerk andere Bereiche, z. B. weitere Komponenten oder auch gänzlich isolierte Akteure, die keine Verbindung zur ersten Komponente haben. Ein Netzwerk mit geringer Dichte kann also in mehrere unverbundene Komponenten oder eine einzelne Komponente und weitere isolierte Akteure zerfallen; ein Beispiel hierfür sind die Heiratsnetze in den beiden Untersuchungsorten. Hier kann man dann danach fragen, wie gut die sozialen Schichten über Heiratsbeziehungen integriert sind.64 (5) Ein spezielles Verfahren, das auf die besonderen Eigenschaften genealogischer Netzwerke eingeht, ist der von Douglas R. White entwickelte PGraph.65 White entwickelte einen neuen Weg, um genealogische Beziehungen zu repräsentieren und diese Netzwerke auf Strukturmerkmale hin zu analysieren. Ein wichtiger Begriff in diesem Zusammenhang ist strukturelle Endogamie. Endogamie wird hier rein relational bestimmt, über Heiraten, die in das Netz der Verwandtschaft zurückfuhren; im Gegensatz dazu stützen sich die meisten Untersuchungen auf kategoriale Daten, wie etwa Heirat innerhalb derselben Schicht oder innerhalb eines Ortes. Auf diesem Wege kann man einen Netzwerkbereich identifizieren, der „aus denjenigen Punkten gebildet wird, die über mehrere Abstammungs- oder Heiratsbeziehungen miteinander verknüpft sind und damit Tendenzen zur Endogamie des Verwandtschaftsnetzes aufweisen." Weiter kann danach gefragt werden, wer zum lokalen Kern des Verwandtennetzwerks gehört und wer nicht, und welche Rolle Schichtenzugehörigkeit in diesem Zusammenhang spielt.66 (6) Netzwerkanalytisch gewonnene Daten können als Variablen in multivariate Verfahren eingehen. So können die Einflüsse dieser Variablen in Abgrenzung zu anderen Variablen getestet werden. Hierfür sind umfassende Datenbanken, die Informationen auf verschiedenen Ebenen liefern können, eine wichtige Voraussetzung. So können etwa Daten zu Netzwerkpositionen, Besitzverhältnisse und vitalstatistische Daten für Fragestellungen wie die soziale Reproduktion von Familien operationalisiert werden.67 Es stehen also eine ganze Reihe von Analysewegen zur Verfügung, um aus historischen Quellen gewonnene Daten zu analysieren. Carola Lipp schreibt: „Im Unterschied zu Bourdieus Konzept, das immer eher katechismusartig in Vorworten zitiert wird, aber nachher in den Untersuchungen selten praktisch operationalisiert wird, bietet die Netzwerkanalyse ein erlernbares Instrumentarium, das auch Volkskundlerinnen und Kul64 65
66
67
Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 97ff.; siehe unten Kapitel 6, S. 170ff. Genealogische Netzwerke zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr spärlich sind. In aller Regel haben Akteure hier nur zwei Beziehungen: eine zu ihren Eltern, eine weitere zu ihrem Ehepartner. Die Beziehungen zu Kindern gehen dagegen von beiden Ehepartnern gemeinsam aus und können deshalb kaum einem der Partner zugeordnet werden. Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 218ff., Zitat auf S. 220; White / Jorion, Representing and Analyzing Kinship; White, Structural endogamy; Brudner/White, Class, property, and structural endogamy. Beispiele hierfür sind Padgett, Open Elite; Munno, L'echeveau des párenteles au villages; Fertig, Rural Society and Social Networks.
Methodischer Ansat^
97
turanthropologlnnen beherrschen können."68 Dasselbe gilt für Historiker und Historikerinnen. In den folgenden Kapiteln werden die sozialen Netzwerke in Löhne und Borgeln auf verschiedenen Wegen untersucht, die sich ergänzen; um eine erschöpfende Beschreibung der beiden untersuchten Orte handelt es sich gleichwohl nicht. Neben den beschriebenen Verfahren werden Familienverträge aus beiden Kirchspielen ausgewertet, in denen die Rede von Heirat und Erbteilen, Lebensplänen und familiären Verpflichtungen ist. Da solche Dokumente sich nur schwer in tabellenförmige Daten überführen lassen, und dies bislang in den Datenbanken nur in Ansätzen geschehen ist, wird der Frage nach der Bedeutung von Erbabfindung und Heirat im Lebenslauf auf der Grundlage einer ausführlichen Lektüre des Textkorpus — etwa 340 Dokumente in Löhne, 610 in Borgeln - unter Bezugnahme auf die zur Verfügung stehenden Kontextdaten nachgegangen. Neben den sozialen Netzwerken zwischen Familien stehen so Heirat und Transfers innerhalb von Familien im Zentrum der Arbeit; im letzten empirischen Kapitel werden diese Leitthemen in der Frage nach den Faktoren, die Familien die erfolgreiche soziale Plazierung ihrer Kinder ermöglichten, zusammengeführt.
68
Lipp, Netzwerkanalyse als analytische Methode, S. 62f.
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Lohne: Netzwerkkonstruktion und Klassengesellschaft
5.1 Patenschaften in westfälischen Dörfern: ein relevantes Thema? 5.1.1 Fragestellung Dieses Kapitel untersucht die Konstruktion von Patennetzen durch die historischen Akteure. Das Netz der Patenschaften wird dabei als zentraler Bestandteil persönlicher Netzwerke in der ländlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts verstanden. Die Analyse dieser Patenbeziehungen lässt Rückschlüsse auf die Sozialstruktur der Dorfgesellschaft und auf die sozio-ökonomischen Beziehungen von Bauern und anderen Dorfbewohnern zu. In diesem Kapitel wird nach der Konstruktion sozialer Netzwerke durch die ländliche Bevölkerung gefragt. Soziale Netzwerke werden als Ergebnisse menschlichen Handelns verstanden, zugleich aber als vorgängige soziale Struktur, die verändert, angepasst, gestaltet wird. Die Patenschaften, die von jungen Familien initiiert und aufgebaut wurden, erstreckten sich über einen sozialen Raum, in dem sie auf Beziehungen anderer Art trafen. Verwandtschaftliche, nachbarschaftliche, klientelartige Relationen konnten auf diesem Wege erneuert, verstärkt, aber auch vernachlässigt oder überschritten werden. Die Makro-Ebene der sozialen Struktur trifft so auf die Präferenzen und Strategien der handelnden Akteure, ihr Tun und Unterlassen. Es wird gezeigt werden, dass Heuerlinge und Tagelöhner andere soziale Netzwerke aufbauten als ihre Bauern. Mark S. Granovetter hat in seiner klassischen Studie zur Jobsuche amerikanischer Männer die Grundlage zu einer Theorie der ,Strength of weak ties' gelegt.1 Dabei geht es im Kern um die Frage, wie nützlich soziale Beziehungen sind, und zwar nicht nur die intensiven, engen, stark positiv aufgeladenen Beziehungen. Auch die schwachen Beziehungen, zu Menschen, die man nicht so häufig sieht, wo weniger starke Gefühle im Spiel sind, wo gegenseitige Unterstützung nicht unbedingt im Vordergrund steht, können, wie Granovetter nachgewiesen hat, in bestimmten Bereichen von erheblichem Nutzen sein. Auch im 19. Jahrhundert wurden die Lebenschancen von Menschen von sozialen Netzwerken mitbestimmt. In seinen Arbeiten zu dem württembergischen Dorf Neckarhausen hat David Sabean gezeigt, wie die Bedeutung sozialer Beziehungen im 18. und 19. Jahrhundert stetig zunahm, wie der Zugang zu Macht und Ressourcen immer stärker durch die Kooperation von eng miteinander verflochtenen Gruppen kontrolliert wurde und wie die Konstruktion sozialer Netzwerke vermittels PatenGranovetter, The Strength of Weak Ties.
100
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
Schäften und Heiratspolitik zur Exklusion der ländlichen Unterschichten führte. 2 Jürgen Schlumbohm hat in seiner mikroanalytischen Studie des Osnabücker Kirchspiels Belm u. a. auch die komplexe Struktur des Heuerlingssystems untersucht. Dabei wurde deutlich, dass die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen eine je individuelle Prägung aufwiesen, so dass jeder Vertrag eine andere Gestalt, unterschiedliche Rechte und Pflichten zum Inhalt haben konnte. Ein wichtiges Ergebnis dieser Arbeit war, dass diese Verflechtungen zwischen Bauern und Heuerlingen, zwischen Besitzenden und Besitzlosen das entscheidende Element der Belmer Sozialstruktur waren, nicht die Beziehungen der Heuerlinge untereinander, oder gar eine Art Klassenbewusstsein oder Klassensolidarität. Anzeichen für letzteres hat Schlumbohm selbst in Konflikten zwischen Bauern und ländlichen Unterschichten nicht gefunden. Dagegen waren die Heuerlinge stets bemüht, über die Etablierung etwa von Patenschaften stabile, personale Beziehungen zu den Bauern zu konstruieren, und zwar sowohl zu den Bauern, bei denen sie lebten, als auch zu anderen Angehörigen der bäuerlichen Schicht. Integration über Schichtengrenzen hinweg war also ein wichtiger Impuls bei der Konstruktion der sozialen Netzwerke. 3 Es geht also darum, diese Beziehungen zwischen den Schichten, die Strategien von Kooperation und Exklusion, und die Rolle sozialer Netzwerke in den Blick zu nehmen. Im Unterschied zu den vorgenannten Arbeiten wird hier eine vergleichende Analyse von zwei ländlichen Gesellschaften angestrebt. In den folgenden Abschnitten wird eine vergleichende Analyse der Patennetze der beiden Orte sich auf die Frage der sozialen Verhältnisse, der Beziehungen zwischen den sozialen Schichten und die nach den Strategien der historischen Akteure konzentrieren. Was kann man durch eine Netzwerkanalyse der Patenschaften lernen? Zunächst scheint es sich ja um eine wenig bedeutsame Form menschlicher Beziehungen zu handeln. Patennetze zu analysieren ist interessant, weil es sich um .gemachte' soziale Netze handelt, hier also das aktive Handeln der Menschen sichtbar wird. Dieses unterscheidet es vom Netz der Verwandten, das in aller Regel, bis auf wenige Ausnahmen, ein vorgefundenes Netz ist. Blutsverwandte erhält man nun einmal nicht durch eigene Wahl, sondern durch Geburt; bei affinalen Verwandten spielen Heiratsentscheidungen mit hinein, aber nicht unbedingt die eigenen Entscheidungen. Die Wahl der Paten bot den historischen Akteuren mehr Möglichkeiten, soziale Beziehungen zu gestalten, während Männer und Frauen den Heiratspartner nur einmal oder vielleicht zweimal im Leben aussuchten. Im Vergleich zu den weitreichenden, den weiteren Lebenslauf weitgehend determinierenden Folgen einer solchen Gattenwahl waren die ökonomischen Folgen einer Patenschaft recht überschaubar: Die Verpflichtungen gegenüber einem Patenkind beschränkten sich wahrscheinlich meist auf kleinere Geschenke, der Appellcharakter
Sabean, Property, production, and family; ders., Social background to Vetterleswirtschaft; ders., Kinship in Neckarhausen. Schlumbohm, Lebensläufe, Kap. 7 und Schlussdiskussion.
Patenschaften in westfälischen Dörfern: ein relevantes Thema?
101
der Beziehung zwischen Eltern und Paten stand eher im Vordergrund. Patenschaften hatten also zum einen religiöse Funktionen, waren aber auch ganz wesentlich Ausdruck von Soziabilitätsnetzwerken. Neben Erkenntnissen zur Strukturierung des sozialen Raums lässt der Aufbau der Netze aber auch Rückschlüsse auf den Stellenwert verschiedener sozialer Beziehungen zu. Popularität im Patennetz hat mit sozio-ökonomischen Merkmalen zu tun, aber auch mit verwandtschaftlichen, Nachbarschafts- und Arbeitsbeziehungen. Man kann über die Frage, welche sozialen Gruppen wie stark vertreten waren, hinausgehen, indem man die Veränderungen der Netze über die Zeit anschaut, indem man untersucht, welche Personen zuerst (d.h. bei den ersten Geburten) zu Paten gebeten werden. Soziale Beziehungen können auch in geographischer Hinsicht weite Entfernungen überbrücken, insbesondere dann, wenn alltägliche Kontakte nicht zwingend erforderlich sind. Lokalität ist also nicht unbedingt eine Voraussetzung für die Konstruktion des Patennetzes. Patenschaften werden, anders als etwa Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde oder Nachbarschaft, nicht durch räumliche Nähe getragen, sondern können relativ unabhängig von ihr existieren. In einer vormodernen ländlichen Gesellschaft war Patenschaft eines der wenigen Mittel, mit deren Hilfe man den lokalen Kontext überwinden und ein Stück Unabhängigkeit von einer dörflichen Gesellschaft gewinnen konnte. Die Gestaltung der persönlichen Netzwerke kann so in ganz verschiedene Richtungen gehen. Beziehungen können erweitert oder verdichtet werden; man kann möglichst viele Menschen aus möglichst unterschiedlichen Bereichen bitten, Paten der Kinder zu werden; oder man orientiert sich eher an bereits bestehenden Beziehungen, indem man etwa die eigene Schwester um die Übernahme der Patenschaft bittet und diese Beziehung so verstärkt und aufwertet, so dass es sich dann um eine verdoppelte, in der Sprache der Netzwerkanalyse multiplexe Beziehung handelt. Die Orientierung der Wahlen in der sozialen Ungleichheitsstruktur kann unterschiedlich ausfallen: Man kann eher horizontale Beziehungen anstreben, etwa indem man gleichaltrige Paten wählt, oder solche aus derselben Schicht. Eine eher vertikale, an Hierarchie ausgerichtete Wahl der Paten kann sich dagegen in einer stärkeren Zentralisierung des Netzes ausdrücken, oder indem die Eltern mehr Wert auf Paten von hohem sozio-ökonomischem Status legen. 5.1.2 Quellenlage und Möglichkeiten der Netzwerkkonstruktion Die Handlungsspielräume bei der Gestaltung der eigenen sozialen Netzwerke hingen ganz erheblich von der Größe der Patennetze ab. Letztere war abhängig von der Anzahl der Geburten, aber auch von der Begrenzung der Patenzahl. Besonders deutlich hat dies Sabean herausgestellt: In Neckarhausen wurden nur zwei Paten zur ersten Kindstaufe gebeten, und diese beiden Paten standen dann für alle folgenden Kinder eines Paares Pate. Diese Beziehungen hatten selbst über den Tod hinaus bestand: Starb ein Elternteil, so erhielten die Kinder der zweiten Ehe weiterhin dieselben Paten; nach dem Tod eines Paten wurde die Beziehungen von einem Kind des Verstorbenen oder einem anderen nahen Verwandten fortgesetzt. In Neckarhausen umfassten die Paten-
102
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
netze von Elternpaaren also in der Regel nur zwei Beziehungen. In Westfalen waren Patennetze viel größer: Jedes Kind erhielt eigene Paten, und die durchschnittliche Zahl der Paten lag bei etwa drei Paten in Löhne und bis zu fünf Paten in Borgeln. 4 Man muss aber dennoch davon ausgehen, dass Patenbeziehungen eine begrenzte Ressource waren - zwar konnte man mehr Paten- als Heiratsbeziehungen haben, aber es wird gezeigt werden, dass die Größe des Netzes von den Kindseltern nicht beliebig ausgedehnt werden konnte. Die Paten oder Taufzeugen wurden von den Pfarrern der beiden Kirchspiele in der letzten Spalte des Taufregisters erfasst. Diese Spalte war recht schmal; anders als bei den Kindseltern, für die systematisch Angaben etwa zu Wohnort und Beruf abgefragt wurden, war für die Taufzeugen die Nennung des Namens ausreichend. Die Pfarrer handhabten die Eintragungen jedoch sehr unterschiedlich. In den Borgeler Kirchbüchern gibt es oft zumindest Angaben zu Beruf oder Stand der Paten, im 18. Jahrhundert war auch die Nennung des Wohnortes üblich. Diese relativ gute Quellenlage ermöglichte die Identifizierung etwa der Hälfte der Paten in der Familienrekonstitution, vor 1800 sogar um 60%. In Löhne dagegen sind die Angaben zu den Paten in den Kirchenbüchern zumeist spärlich. In der Regel wurden von den Pfarrern bei der Taufe Vor- und Nachnamen notiert, nur in wenigen Fällen ergänzt um Angaben zu Beruf (oder Stand) oder Wohnort. 5 Für die Jahre 1816 bis 1822 ist die Quellenlage jedoch wesentlich besser. Offenbar liegt dieser veränderten Praxis ein Wechsel auf der Pfarrstelle zugrunde. 1815 wurde Friedrich Rudolf Adam Schmidt Pfarrer in Löhne, er blieb bis 1821.6 Zum Jahreswechsel 1815/16 hatte er die neue Konvention eingeführt, ab Januar 1820 dann bei beinahe jedem Eintrag angewandt, bis zu seinem Weggang im Jahr 1821. Der neue Pfarrer, Heinrich Philipp Christian Potthoff, behielt diese Praxis im ersten Jahr seiner Amtszeit noch bei, wenn auch schon mit erkennbar nachlassender Konsequenz, bevor er ab Januar 1823 dann auf diese Angaben verzichtete. Dieser doch im Vergleich schlechteren Quellenlage ist die niedrige Rate identifizierter Paten in Löhne geschuldet.
5 6
In der Rheinisch-Westphälischen Kirchenordnung von 1835 wurde die Anwesenheit von mindestens zwei Taufzeugen vorgeschrieben, eine Obergrenze wurde allerdings nicht angegeben; siehe Walter G ö B E L : Die Rheinisch-Westfälische Kirchenordnung vom 5. März 1835. Urkunden-Sammlung zur Rechtsgeschichte der Rheinisch-Westfälischen Kirchenordnung, Düsseldorf 1954, § 91. Die Jahrgänge 1812 bis 1814 fehlen in den Kirchenbüchern, die Daten der Patenschaften weisen daher eine Lücke von drei Jahren auf. Heimatverein Löhne, 1000 Jahre Löhne, S. 417.
Patenschaften in westfälischen Dörfern: ein relevantes Thema?
103
Abbildung 5.1: Anteil der identifizierten Paten, Borgeln (1766-1859) und Löhne (1800-56) 100 i
0 II I I I I II I II II I II II I i I II II I II 1 Ii I I I I II I I II I I I I I I II I II I I I I I I i i i i i l i i i l i i i i i i i ^
#
^y
^T
J?
«^C
Quelle: Datenbank Löhne.
^D
&
4>
«^D
^D
^C
^D
J?
^O
ai»» ^D
^o
ob*
^D
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
Abbildung 5.9: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, ländliche Unterschichten in Borgeln (1766-1859), 5jährig gleitende Durchschnitte
Quelle: Datenbank Borgeln.
Abbildung 5.10: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten, Bauern in Borgeln (1766-1859), 5jährig gleitende Durchschnitte
Quelle: Datenbank Borgeln.
127
128
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
In Borgeln kann man ebenfalls beobachten, wie vor allem die entfernten affinalen Verwandten für die ländlichen Unterschichten an Bedeutung hinzu gewannen. Auch hier gibt es einen klaren Unterschied zwischen bäuerlicher und unterbäuerlicher Bevölkerung: Die Hinwendung zu Verwandten drückte sich bei den Unterschichten (Abb. 5.9) vor allem in einer Verdreifachung des Anteils der entfernten affinalen Verwandten aus. Gleichzeitig blieben die Nicht-Verwandten für die Tagelöhner wichtig, auch wenn die Verwandtschaft über die Zeit an Bedeutung gewann. In der Mitte des 19. Jahrhunderts glichen die Patennetze der Borgeler Tagelöhner denjenigen der Löhner Heuerlinge: Etwa zwei Drittel der Paten waren nicht oder nur sehr entfernt (und nicht bluts-) verwandt. Die Bauern (Abb. 5.10) wandten sich dagegen verstärkt den Blutsverwandten und Schwägern zu: Waren im 18. Jahrhundert die Nicht-Verwandten noch in der Mehrzahl gewesen, so fiel ihr Anteil bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf etwa ein Viertel aller Paten. Damit hatten die Patennetze der Borgeler Bauern einen ähnlichen Aufbau wie die der Löhner Bauern, unterschieden sich aber in beiden Orten deutlich von denen ihrer Arbeiter und Mieter. Die bäuerliche Oberschicht orientierte sich in ihrer Patenwahl stärker an gemeinsamer Abstammung, während die Unterschichten eher dazu neigten, ,kindreds' aufzubauen, die auch affinale Verwandte umfassten, aber nur eine geringe Generationentiefe aufwiesen. 36 Vor allem waren aber Beziehungen jenseits des Verwandtschaftsbereichs für die ländlichen Unterschichten von Bedeutung. Unter den Verwandten spielten die nächsten Blutsverwandten, also Eltern und - mehr noch — Geschwister, bei den Patenschaften eine herausragende Rolle. Im folgenden Abschnitt werden die Anteile der Verwandten an den Patennetzen mit der Geburtenreihenfolge der Patenkinder in Beziehung gesetzt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass junge Eltern angesichts der demographischen Unsicherheit weiterer Geburten sich zunächst die Paten suchten, die ihnen besonders wichtig waren, und ihre Patennetze dann bei späteren Geburten in andere Richtungen ausbauten. Tabelle 5.9 und 5.10 führen auf, wie viele der identifizierten Paten bei den ersten bis dritten, vierten bis sechsten und den später geborenen Kindern jeder Familie 37 aus der in den Spalten angegebenen Verwandtengruppe stammte (Zeilenprozente). Bei den ältesten Kindern in Löhne (Tabelle 5.9) kamen 19,5% der Paten aus einer der beiden Herkunftsfamilien der Kindseltern, 21,4% der Paten waren dagegen nicht mit der Familie verwandt. In Borgeln wurden ebenso zunächst die nächsten Verwandten in das Patennetz eingebunden, mit 17,3% war die Herkunftsfamilie hier nur wenig schwächer vertreten. Die Verwandten aus den Herkunftsfamilien, also Eltern und Geschwister, wurden also gleich bei den ersten Kindern um die Übernahme einer Patenschaft gebeten; danach nahm ihr Anteil an den neu etablierten Patenschaften ab. Nun wurden auch schon bei eher geborenen Kindern andere Verwandte zu Paten gebeten; es ist aber 36 37
Zum Begriff der ,kindreds' siehe auch Segalen, Fifteen Generations of Bretons. Frauen, die zweimal verheiratet waren (und in beiden Ehen Kinder hatten) oder die vor ihrer Heirat ein uneheliches Kind hatten, können so zwei .Erstgeborene' haben; Basis der Zählung ist also die Familie, nicht der Lebensweg der Frau.
129
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
Tabelle 5.9: Consanguinal und affinal verwandte Paten nach Geburtsrang. Löhne (1800-56) Consanguinale Verwandte (Entfernung in Schritten) Geburtsrang 1.-3. Kind
1
2
3
4+
1-2
3
4
5+
248
65
89
119
108
51
63
259
(Zeilen-%)
19,5
4.-6. Kind
96
(Zeilen-%)
7.-14. Kind (Zeilen-%)
Summe (Zeilen-%)
Affinale Verwandte (Entfernung in Schritten)
5,1
35
13,0
4,8
26
6 2,1
9,1
370
106 4,6
16,1
7,0
52 7,1
20 7,0
161 7,0
9,3
86 11,7
34 11,8
239 10,4
8,5
42 5,7
29 10,1
179 7,8
4,0
27 3,7
12 4,2
90 3,9
4,9
63 8,6
19 6,6
145 6,3
20,3
207 28,1
77 26,8
543 23,6
Nicht verwandt 272 21,4
128 17,4
1274 100,0
736 100,0
64
287
22,3
100,0
464 20,2
2297 100,0
Quelle: Datenbank Löhne.
erkennbar, dass die jungen Eltern in beiden Orten zunächst eine Verstärkung ihrer Beziehungen zu ihren Herkunftsfamilien anstrebten, und sich erst in einem zweiten Schritt diejenigen zu ihren Cousins und anderen Verwandten ausbauten. Auch bei den affinalen Verwandten kann man einen Trend feststellen. Bei den vierten, fünften etc. Kindern holte man vielleicht noch eine angeheiratete Cousine oder einen Schwager der Schwägerin dazu, während die nächsten affinalen Verwandten schon bei den ersten Kindern in das Patennetz eingebunden wurden. Auffallend sind für beide Orte der über die Phase der Familiengründung hinweg konstante Anteil derjenigen Patenschaften, die nicht auf Verwandtschaft aufbauten, und der ebenfalls hohe Anteil der entfernt affinalen Verwandten. Offensichtlich waren den jungen Eltern diese über die nähere Verwandtschaft hinausreichenden Beziehungen von Beginn an wichtig; noch wichtiger waren ihnen aber enge Beziehungen ihren nächsten Verwandten. Tabelle 5.10: Consanguinal und affinal verwandte Paten nach Geburtsrang, Borgeln (1766-1859) Consanguinale Verwandte (Entfernung in Schritten) Geburtsrang 1.-3. Kind (Zeilen-%
4.-6. Kind
1
2
3
4+
745
167
153
97
17,3
232
(Zeilen-%)
11,2
7.-15. Kind
41
(Zeilen-%)
Summe (Zeilen-%)
6,1
1018 14,4
3,9
91 4,4
30 4,4
288 4,1
Quelle: Datenbank Borgeln.
3,6
95 4,6
32 4,7
280 4,0
Affinale Verwandte (Entfernung in Schritten) 1-2 351 8,2
63 3,0
17 2,5
177 2,5
167 8,0
46 6,8
564 8,0
3
4
5+
170
135
515
4,0
73 3,5
30
3,1
90 4,3
37
4,4
273 3,9
12,0
291 14,0
126 18,7
262 3,7
932 13,2
Nicht verwandt 1962 45,7
975 46,9
316 46,8
3253 46,2
4295 100,0
2077 100,0
675 100,0
7047 100,0
130
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
5.3.2 Patenschaften und Klassengrenzen: Heuerlinge und Bauern in Löhne
Löhne: handliche Klassengesellschaft von Bauern und Heuerlingen? Die folgenden Abschnitte beschäftigen sich mit dem Kern dieses Kapitels: Was trägt eine Analyse der Patennetze zu unserem Bild der sozialen Ungleichheit in der ländlichen Gesellschaft bei? Die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen sind in der neueren Literatur vor allem von Jürgen Schlumbohm thematisiert worden.38 Die Fragen, die Schlumbohm in seinem Buch stellt, werden auch hier im Zentrum stehen; seine Untersuchungen basieren aber auf anderen Quellen bzw. auf einer anderen Herangehensweise an ähnliche Quellen. Konnte Schlumbohm auf mehrere Quellen zu Haushaltquerschnitten zurückgreifen, so ist die Quellenlage für Löhne hier nicht so glücklich. Die Steuerliste von 1865 enthält nur wenig brauchbare Angaben zu Haushalten und Personen. Andererseits stehen inzwischen andere Instrumente zur Verfügung, die eine Auswertung insbesondere von umfangreichen Quellenbeständen leichter machen. Dies betrifft in einem ersten Schritt die Erfassung größerer Datensätze; wichtiger ist aber noch, dass die Auswertung von Daten einfacher wird. So ist es nicht mehr unbedingt nötig, mit Stichproben zu arbeiten; es bietet sich an, die Gesamtheit aller verfügbaren Daten auszuwerten. Für die folgenden Analysen sind alle Löhner Taufeinträge von 1800 bis 1856 berücksichtigt worden. Weiter oben ist diskutiert worden, dass die Paten nur zum Teil identifiziert wurden. In diesem Sinne ist die Auswertung also nur zum Teil vollständig. Es wurden aber keine Datensätze ausgespart - etwa weil die Eltern nicht aus dem Kirchspiel stammten, oder es bald verließen, oder weil ein Kind außerhalb der Ehe geboren war. Es wurden also alle Taufbucheinträge gleich behandelt, ohne die bei Stichproben nötigen Vorentscheidungen. Die Einträge der Pfarrer sind bei den hier wichtigen Wohnortangaben nicht immer zuverlässig, oft wird der Wohnort nur vage beschrieben. Ein Beispiel: Friedrich Wilhelm Steffen (ID 18499) und seine Frau Catharina Markmann (ID 5743) bekamen zwischen 1818 und 1839 acht Kinder: Louise Engel (ID 18174), 6.1.1818, Löhne königlich 5 Friedrich Wilhelm (ID 18509), 22.12.1820, Löhne 5 Carl Heinrich (ID 18510), 12.9.1823, Löhne 16 Louise Engel (ID 18072), 15.7.1826, Löhne königlich 16 Wilhelmine Engel (ID 18511), 27.8.1829, Löhnebeck 14 Friedrich Wilhelm (ID 18512), 19.8.1832, Löhnebeck 16 Carl Friedrich (ID 18513), 19.3.1835, Löhnebeck 16 Louise Ilsabein (ID 18514), 30.3.1839, Löhne königlich 7 In mindestens zwei Fällen ist der Eintrag nicht korrekt (es gab zwei parallel laufende Hofnummerierungen: Löhne königlich und Löhnebeck, aber nicht einfach Löhne), 38
Schlumbohm, Lebensläufe, Kapitel 7.
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
131
und bei anderen stellt sich die Frage, ob die Familie wirklich außergewöhnlich mobil war oder ob die Einträge nur wenig sorgfaltig gefuhrt wurden. Es kommt nicht selten vor, dass Löhne königlich und Löhnebeck verwechselt wurden, selbst bei Hofbesitzern findet man sowohl richtige als auch falsche Angaben. Einträge wie ,auf dem Geisebrinke' oder .Löhne 23' sind zu dürftig für eine Zuordnung zu einem Hof. Darüber hinaus sind diese Angaben oft fehlerhaft. Da Heuerlinge recht mobil waren und ihre Wohnung von Jahr zu Jahr wechseln konnten, muss man sich bei der Auswertung der Quelle im Wesentlichen an die Jahre halten, für die es Einträge in den Kirchenbüchern gibt. Man kann hier keine Zeitreihen bilden, in denen man den Familien auch für die Zeit zwischen zwei Einträgen oder die Jahre nach der letzten Kindsgeburt Wohnorte zuweist. Die Daten sind aber trotz dieser Schwierigkeiten interessant, bieten sie doch einen Einblick in das Verhältnis zwischen Bauern und Heuerlingen auf breiter Basis. Zunächst wird die Untersuchung auf die Patenbeziehungen zwischen Bauern und ihren Heuerlingen ausgedehnt, und zwar in beide Richtungen. Im zweiten Schritt werden dann alle bekannten Patenbeziehungen zwischen Angehörigen der bäuerlichen und der unterbäuerlichen Schichten untersucht, unabhängig vom Wohnort der Heuerlinge. Zwischen 1800 bis 1856 wurden in Löhne 945 Bauernkinder geboren. Bei diesen Kindern konnten 165 Heuerlinge als Paten identifiziert werden. Von diesen sind 14 (8,5%) mindestens einmal als auf dem Hof der Kindseltern wohnhaft im Kirchenbuch eingetragen. Für sieben Paten kann man davon ausgehen, dass sie zum Zeitpunkt der Taufe auf dem Hof der Kindseltern lebten. 39 In einem Fall war die Patin die jüngere Schwester des Bauern, die selbst erst sieben Jahre später heiratete, dann aber mit ihrem Mann für einige Jahre auf dem Hof des Bruders lebte. Nicht nur in diesem letzten Fall baute die Patenschaft, die den Heuerlingen von ihren Bauern angetragen wurde, auf einer bereits existierenden Verwandtschaftsbeziehung auf. Alle 14 Heuerlinge, die Paten bei ,ihren' Bauern wurden, waren mit diesen auch verwandt: vier Schwestern, zwei Brüder, der Sohn eines Bruders, einmal auch die Mutter der Kindsmutter. Letztere wurde allerdings erst bei der vorletzten Enkelin, 15 Jahre nach der Heirat geboren, Patentante. Daneben kamen zweimal Ehemänner der Schwester vor, eine Tante des Ehemannes der Schwester, ein Stiefvetter der Mutter, der Ehemann einer Cousine zweiten Grades und der Sohn einer Frau, die am Ende einer Geschwister-Heiratskette über fünf Schritte stand. Auch wenn nicht alle Paten identifiziert werden konnten und Heuerlinge wegen der grundsätzlich schlechteren Quellenlage bei Besitzlosen schwieriger zu identifizieren sind als Bauern, kann man festhalten, dass Bauern nicht dazu neigten, ihre eigenen Heuerlinge zu Paten ihrer Kinder zu machen. Sie nahmen aber Verwandte als Heuerlinge auf den Hof, und dann kam es auch vor, dass diese verwandten Heuerlinge Paten bei den Bauernkindem wurden.
39
Bei vier Paten gibt es keine Wohnortangaben in den Quellen für diesen Zeitpunkt (inklusive der Jahre vor und nach der Taufe), zwei Paten ziehen erst später auf den Hof.
132
Kapitel 5: Patenschaften in Borge/n und höhne
Umgekehrt standen auch Bauern bei den Kindern ihrer Heuerlinge Paten. Bei 1025 Heuerlingskindern kann man den Eltern zum Zeitpunkt der Geburt einen eindeutigen Wohnort zuordnen. Von diesen hatten 55 den Bauern oder die Bäuerin des Hofes zu Paten, auf dem die Eltern wohnten. Das sind nur 4% der Kinder von Heuerlingen. Da aber nicht alle Paten identifiziert werden konnten, ist damit zu rechnen, dass der Anteil höher lag. Auch diese Patenschaften bauten mit nur wenigen Ausnahmen auf Verwandtschaftsbeziehungen auf. Fast ein Drittel der Paten waren nächste Verwandte aus der Herkunftsfamilie, ein weiteres Viertel kam aus dem Bereich der nahen Verwandten (bis zu den Cousins der Eltern und den Ehepartnern der eigenen Cousins), nur 7 Paten (12,7%) waren nicht mit den Eltern des Patenkindes verwandt. Waren Heuerlinge generell mit ihren Bauern verwandt? Josef Mooser lehnt es ab, „die Verwandtschaft als Gestaltungsmoment des patriarchalischen Heuerlingssystems in den Mittelpunkt zu rücken"; dies verbiete sich aufgrund der großen Zahl der Heuerlinge und der Selbstrekrutierung der Heuerlingsschicht. 40 Dieser Eindruck verliert jedoch seine Aussagekraft, wenn man die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen genauer untersucht; die Analyse sozialer Netzwerke führt zu anderen Ergebnissen als eine Untersuchung auf aggregativer Ebene. Heuerlinge waren zwar aus der Perspektive der (ökonomischen) Klassenzugehörigkeit eine relativ homogene Gruppe, ihre Stellung in der dörflichen Gesellschaft und damit auch ihre Chancen auf soziale und ökonomische Teilhabe hingen aber ganz erheblich von ihrer Zugehörigkeit zu verwandtschaftlichen Netzwerken ab. Im 19. Jahrhundert waren Heuerlingsstellen, insbesondere solche mit etwas Pachtland, ein knappes Gut, zu dem nicht jeder Zugang hatte. 41 Wie die folgenden Beispiele zeigen, konnte die soziale Nähe zu Hofbesitzern helfen, eine solche Stelle zu bekommen 42 Es kam immer wieder vor, dass junge Heuerlingsfamilien sich zunächst auf einem Hof niederließen, von dem einer der Ehepartner stammte, und dass dort auch die ersten Kinder zur Welt kamen. Oft verließen die jungen Familien danach den Hof. Manche blieben aber auch lange Jahre auf dem Hof der Eltern bzw. Schwiegereltern. So etwa Elisabeth Richter (ID 14898) und ihr Mann Carl Heinrich Heidsiek (ID 14897), letzterer gebürtig aus dem benachbarten Kirchspiel Mennighüffen. Kurz nach der Heirat im Januar 1840 wurde der erste Sohn geboren, die junge Familie wohnte auf dem Hof Löhnebeck 25. Schon ein Jahr später, im April 1841, kam der zweite Sohn zur Welt, und die Familie lebte nun auf dem Hof der Eltern von Elisabeth Richter. Dort lebten sie auch noch 1860, als das elfte und letzte Kind kam. In dieser Zeit erwarben sie dann auch ein kleines Haus. 1868 gaben sie ihr Testament zu Protokoll, in dem sie das Haus ihrem drittältesten Sohn vermachen wollten. Im Gegenzug musste der Sohn 40
41 42
Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 255; Mooser weist gleichzeitig darauf hin, dass die Rolle der Verwandtschaft für die Heuerlinge genauer untersucht werden müsse. Mager, Haushalt und Familie, S. 143. Aufgrund der Quellenlage ist es nicht möglich, die Anzahl der Heuerlingsstellen im Kirchspiel und auf den einzelnen Höfen genau zu beziffern.
Soziale Netzwerke und KltusengtseUscbafl
133
beim Neubau des Hauses helfen, seine Eltern (auch finanziell) unterstützen und fiir die jüngsten Geschwister sorgen. Die Eltern erläutern, dass sie beide kein Vermögen in die Ehe gebracht hätten und dass sie aufgrund der vielen Kinder, für die sie hätten sorgen müssen, nicht in der Lage gewesen wären, das Haus in Stand zu halten. Ähnlich ist die Geschichte von Engel Stuke (ID 16020). 1825 heiratete sie Carl Heinrich Kruse (ID 15985), bei der Geburt des letzten Kindes 1839 lebten die Eheleute noch immer auf dem Hof der Eltern von Engel Stuke. Danach ist nichts mehr über die Familie bekannt, möglicherweise haben sie Löhne verlassen. Ganz anders erging es dagegen Ernst Caspar Kuhlmann (ID 16128) und Friederike Rottmann (ID 17714). Die Eheleute bekamen mehrere Kinder auf dem Hof Löhnebeck 32, bevor sie vor der Geburt der letzten Tochter 1834 eine Heuerlingswohnung auf dem Hof von Kuhlmanns Eltern bezogen. Friederike Rottmann war Anerbin des Hofes Löhnebeck 32 gewesen, hatte das Anerbenrecht aber schon 1823 aufgegeben, nachdem es Konflikte zwischen ihrem Ehemann und dem Stiefvater gegeben hatte. Die jungen Leute verließen den Hof aber erst, nachdem der Halbbruder den Hof übertragen bekommen hatte, und gingen dann auf den Hof der Eltern des Ehemannes. Man kann die Frage nach dem Einfluss von Verwandtschaft auf die Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen aber auch auf die gesamten bekannten Patenschaften ausdehnen. In Anlehnung an das oben Beschriebene stellt sich die Frage, ob Heuerlinge und Bauern nur dann Patenschaften miteinander eingingen, wenn sie miteinander verwandt waren, und zwar auch dann, wenn sie nicht auf demselben Hof lebten. Tabelle 5.11: Verwandtschaftsbeziehungen zwischen bäuerlichen Paten und Heuerlingen als Kindseltern, Löhne (1800-56), N = 541 Verwandt
Nah N
Consanguinal Affinal
134 92
Entfernt % 24,8 17,0
N 39 142
Niebt %
N
%
7,2 26,2
134
24,8
Quelle: Datenbank Löhne.
Bei den 541 Patenschaften, die Bauern bei Heuerlings- bzw. Aufsteigerkindern übernahmen, basierte die Hälfte auf naher Verwandtschaft beider Art oder entfernter Blutsverwandtschaft, je ein Viertel der Paten war nur entfernt affinal oder gar nicht verwandt. Jede zweite Patenschaft baute demnach auf bewussten, aktiven verwandtschaftlichen Beziehungen auf. Wenn man bedenkt, dass die meisten Heuerlinge schon als Heuerlingskinder geboren wurden, wird deutlich, wie stark die Beziehungen zwischen den Schichten von Verwandtschaft geprägt waren. Mooser hat für das ebenfalls in MindenRavensberg liegende Kirchspiel Quernheim in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für die Schicht der Heuerlinge eine Selbstrekrutierungsrate von über 80% ermittelt. 43 43
Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, Tabelle 27 im Anhang, S. 486.
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
134
Tabelle 5.12: Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Heuerlingen als Paten und bäuerlichen Kindseltern, Löhne (1800-56), N = 165 Verwandt
Entfernt
Nah
Nicht
N
%
N
%
N
%
Consanguinai
56
22
Affinal
26
33,9 15,8
13,3 23,6
22
13,3
39
Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln.
Zu ähnlichen Ergebnissen ist auch Schlumbohm gekommen, allerdings mit noch höheren Werten. In Belm stammte gegen Ende des 18. Jahrhunderts noch gut ein Fünftel der Heuerlinge aus Bauernfamilien, in der Mitte des 19. Jahrhunderts aber nur noch ein Zehntel. 44 Wenn ein Großteil der Patenschaften zwischen nahen Verwandten zustande kam, so blieb ein erheblicher Anteil dieser .geborenen' Heuerlinge außen vor. Bei etwa jedem sechsten Bauernkind konnte ein Heuerling als Pate identifiziert werden. Von diesen 165 Heuerlingen waren die Hälfte mit den Eltern ihres Patenkindes nah verwandt — Geschwister, Tanten, Neffen, Cousins, Schwäger und Ehepartner von Cousins (ersten Grades), und weitere 13,3% entfernt blutsverwandt. Nur ein gutes Drittel der Paten war nicht oder nur entfernt affinal verwandt. Hier wird noch einmal deutlich, wie die Einbindung der Heuerlinge in das Patennetz der Bauern von verwandtschaftlichen Beziehungen bestimmt wurde. Insgesamt muss Moosers strikte Ablehnung, Verwandtschaft als zentrales Element der ländlichen Gesellschaft Ostwestfalens zu betrachten, zurückgewiesen werden. Für die .absteigenden' Kinder von Bauern, die ihren Lebensunterhalt als Heuerlinge verdienen mussten, war die Möglichkeit, bei ihren Eltern, Geschwistern oder anderen Verwandten unterzukommen, gewiss nicht belanglos. Im Gegenteil: Die Konstanz, die manches Verhältnis hier auszeichnete, ebenso wie der Umstand, dass Familien von einem Elternhof auf den anderen wechselten, unterstreicht eher die Bedeutung dieser Beziehungen. Man darf sich hier .Verwandtschaft' aber nicht als durchgängig positives Strukturelement der Heuerlingsexistenz vorstellen: Die oben beschriebenen Streitereien um den Hof Löhnebeck 32 (Rottmann) zeigen, dass selbst mehrfach belegte Verbindungen (Verwandtschaft, Nachbarschaft und Arbeitsbeziehungen) nicht unbedingt von warmherzigem Miteinander geprägt sein mussten. Umgekehrt gilt natürlich auch, dass die Bindung der Bauernkinder an ihre Verwandten den Heuerlingen, die keine solchen Beziehungen hatten, das Leben nicht eben leichter machte; auch Heuerlingsstellen waren nur in begrenztem Ausmaß vorhanden. Die Bauern und ihre Kinder gestalteten ihre Beziehungen nach einem Muster, das erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts (wieder-)entdeckt wurde: „Es ist gut, in der Nähe zu sein — aber nicht zu nah". Erwachsene Kinder und ihre Eltern scheinen unter ganz unterschiedlichen
44
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 370ff.
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
135
Bedingungen Formen des Zusammenlebens zu suchen, die getrennte Haushalte mit räumlicher Nähe verbinden. So kann man sich bei den alltäglichen Problemen helfen, und gleichzeitig Konflikte quasi an der Haustür abfangen.45 Großeltern in der Nähe zu haben hilft in der schwierigen Phase der Familiengründung — auch wenn man nur zur Miete wohnt. Man kann also davon ausgehen, dass das Heuerlingssystem von Verwandtschaft überformt war; gerade für .absteigende' Bauernkinder bildete sie ein wichtiges soziales Netz, das durch weitere Beziehungen wie Patenschaft und Vermietung von Wohnungen verstärkt wurde und das sicherlich manche Unsicherheit der Heuerlingsexistenz aufzufangen vermochte. Es ist Mooser aber in seiner Kritik der Literatur um 1900 zuzustimmen, in der die durch Blutsverwandtschaft gestärkte „feste Wirtschafts- und Interessengemeinschaft" von Bauern und Heuerlingen angepriesen wurde. 46 Zu Recht weist Mooser darauf hin, dass aufgrund der hohen Selbstrekrutierung der ländlichen Unterschicht viele Heuerlinge und Tagelöhner ohne Verwandtschaftsbeziehungen zu Bauern waren. Dass eine Einheirat in die bäuerlichen Schichten schwierig war, ergibt sich schon aus der wirtschaftlichen Notwendigkeit, Ressourcen für die Auszahlung von Geschwistern zu .erheiraten'.47 Nimmt man dazu die Patenschaftsbeziehungen in den Blick, so wird aber deutlich, dass es keinen rigiden Ausschluss der abgestiegenen Geschwister gab. Die Bereitschaft, diesen Kindern bzw. Geschwistern Ressourcen zukommen zu lassen, drückte sich nicht nur in erheblichen Abfindungszahlungen aus. Sie waren auch oft in den Heuerlingswohnungen untergebracht, in der Nähe der Eltern, die in der schwierigen Phase der Familiengründung mit zur Hand gehen konnten. Sie wurden aber auch in das Netz der Patenschaften eingebunden, im Gegensatz zu den Heuerlingen ohne verwandtschaftliche Bindung an die bäuerlichen Haushalte. Für letztere bedeutete diese Vervielfachung an Beziehungen zwischen Bauern und .Absteigern' allerdings einen Ausschluss, ein Abschneiden von Zugang zu Formen von Unterstützung verschiedenster Art. Verwandtschaft zwischen Bauern und Heuerlingen gestaltete das Heuerlingssystem sehr wohl - nur nicht für alle Beteiligten in gleicher Art und Weise. 5.3-3 Strategien von Bauern, Tagelöhnern und Heuerlingen: The strength of weak ties Das Löhner Beispiel hat gezeigt, dass die Patenbeziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen von verwandtschaftlichen Beziehungen überformt waren. Nachdem oben die Entwicklung der Einbindung Verwandter in die schichtenspezifischen Patennetze untersucht wurde, wird im folgenden Abschnitt der Zusammenhang zwischen Verwandtschaft und Patenschaft für die Beziehungen zwischen den Schichten untersucht. 45 46 47
Thane, „Es ist gut, in der Nähe zu sein". Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 255. Siehe dazu auch Schlumbohm, Lebensläufe, S. 370ff. und 418ff.
136
Kapitel 5: Patenschaften in Borge/n und Löhne
Tabelle 5.13: Anteil Verwandter an allen identifizierten Paten und Beziehungen zwischen den Schichten, in Prozent a) in Löhne (1800-56)
b) in Borgeln (1800-59) Eitern
Eltern
Paten
Bauern
Heuerlinge
Paten
Bauern
Tagelöhner
Bauern
88,5%
75,7%
Bauern
83,6%
52,4%
Heuerlinge
85,9%
74,0%
Tagelöhner
85,5%
55,8%
Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln.
Der Vergleich der sozialen Verhältnisse in den beiden Untersuchungsorten wird weitere Rückschlüsse auf schichtenspezifische Verhaltensweisen westfälischer Bauern und ländlicher Unterschichten zulassen. Um den Vergleich zwischen den beiden Untersuchungsorten und den Beziehungen zwischen den Schichten zu erleichtern, wird die Heterogenität der ländlichen Sozialstruktur auf die beiden zentralen Kategorien der Bauern und der ländlichen Unterschichten - also Heuerlinge und Tagelöhner - reduziert. In Tabelle 5.13 ist aufgeführt, wie groß der Anteil der Verwandten bei Patenschaften zwischen den Schichten war. In den Spalten steht die Schichtzugehörigkeit der Kindseltern, in den Zeilen die der Paten, in den einzelnen Zellen der Anteil der Verwandten an den Beziehungen zwischen der Schicht der Eltern und der Schicht der Paten. Bauern legten wenig Wert darauf, Patenbeziehungen außerhalb ihrer näheren sozialen Umgebung, außerhalb des Feldes der Verwandten aufzubauen. Das gilt für beide Kirchspiele, und zwar sowohl für die Beziehungen zu Bauern als auch für die zu Heuerlingen bzw. Tagelöhnern. Die Paten und Eltern der Kinder in den ländlichen Unterschichten sind im Vergleich seltener verwandt: In Löhne ist etwa ein Viertel der Paten dieser Kinder nicht mit den Eltern verwandt, in Borgeln beinahe die Hälfte. 48 Die Patenwahlen der Bauern unterschieden sich also deutlich von denen der ländlichen Unterschichten: Bauern hielten sich eher an den sozialen Nahbereich, schlössen ihre Kreise nach außen ab, während Tagelöhner und Heuerlinge stärker über diesen Bereich hinausgingen. Man kann auch erkennen, dass es sich hierbei nicht ausdrücklich um eine Strategie handelte, die die Unterschichten aus den bäuerlichen Kreisen fernhalten sollte: Die Wahrscheinlichkeit, eine Patenschaft für ein Bauernkind übernehmen zu können, war viel größer, wenn man mit den Eltern des Kindes verwandt war — egal ob man selbst zur bäuerlichen oder zur Unterschicht gehörte. Andererseits wird aber auch deutlich, dass Verwandtschaftsbeziehungen zur bäuerlichen Schicht für
48
Dem großen Unterschied zwischen den beiden Gemeinden liegen die sehr unterschiedliche Dichte verwandtschaftlicher Beziehungen zugrunde. So waren in Löhne knapp drei Viertel der potentiellen Heiratskandidaten mit E G O verwandt, in Borgeln aber nur ein Viertel; siehe Tabellen 6.12 und 6.13, S. 200ff.
137
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
Angehörige der Unterschichten von entscheidender Bedeutung waren, wenn es darum ging, dauerhafte, formalisierte Beziehungen zu einer bäuerlichen Familie aufzubauen. Tabelle 5.14: Patenbeziehungen von Bauern und Heuerlingen, nach Verwandtschaft und Schicht, Löhne (1800-56) Eltern
Bauern
Paten
Bauern
Heuerlinge
Heuerlinge
Bauern
Heuerlinge
N
%
N
%
N
%
N
%
Nahe Verwandte
255
62,2
72
50,7
137
38,3
97
46,6
Entfernte Verwandte
108
26,3
50
35,2
134
37,4
57
27,4
Nicht Verwandte
Summe
AI
11,5
20
14,1
87
24,3
54
26,0
410
100,0
142
100,0
358
100,0
208
100,0
Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln.
Dieser Exklusionseffekt der Verwandtschaftspräferenz von Bauern wird deutlicher, wenn man zwischen nahen und entfernten Verwandten unterscheidet. Zunächst in Löhne: Die bäuerlichen Kindseltern zeigten eine deutliche Präferenz für nahe Verwandte, sowohl aus der eigenen Schicht, als auch bei Heuerlingen. Diskriminiert wurden, wie schon oben angesprochen, die Nicht-Verwandten. Die Heuerlinge wählten dagegen mehr Nicht-Verwandte, legten weniger Wert auf nahe Verwandtschaft zu den Paten ihrer Kinder. Hier erkennt man aber auch, dass Bauern in Löhne nicht gezielt nicht-verwandte Heuerlinge ausschlössen: Der Anteil der nahen Verwandten war bei den Paten aus der eigenen Schicht sogar größer als bei denen aus der Unterschicht. Tabelle 5.15: Patenbeziehungen von Bauern und Tagelöhnern, nach Verwandtschaft und Schicht, Borgeln (1800-56) Eltern
Bauern
Paten
Bauern
Tagelöhner
Tagelöhner
Bauern
Tagelöhner
N
%
N
%
N
%
N
%
Nahe Verwandte
721
63,0
98
74,8
286
30,7
157
48,9
Entfernte Verwandte
235
20,5
14
10,7
203
21,8
22
6,9
188
16,4
19
14,5
444
47,6
142
44,2
1.144
100,0
131
100,0
933
100,0
321
100,0
Nicht Verwandte
Summe
Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln.
In Borgeln war dieser Exklusionseffekt noch stärker: Auch hier zeigten die Bauern eine ausgeprägte Neigung, ihre Patennetze auf Verwandtschaft aufzubauen. Sie bauten aber insbesondere die Beziehungen zur Schicht der Tagelöhner auf nahen Verwandtschafts-
138
Kapitel 5: Patenschaften in Borg/in und Uibne
beziehungen auf, auf Kosten der entfernten Verwandtschaftsbeziehungen. Hier wird also die Diskriminierung der unteren Schichten recht deutlich. Wie wir eben schon gesehen haben, legten die Tagelöhner in Borgeln viel weniger Wert auf Verwandtschaft und zogen es vor, Beziehungen jenseits des sozialen Nahbereichs zu etablieren, ihre persönlichen Netzwerke in andere Bereiche der ländlichen Gesellschaft hineinreichen zu lassen und ihre Beziehungen so zu diversifizieren. 49 Die ländlichen Unterschichten verhielten sich also in beiden Kirchspielen ganz anders als die Bauern: Sie bemühten sich darum, ihre persönlichen Netzwerke auszuweiten; sie schlössen sich nicht durch die Bevorzugung des sozialen Nahbereichs gegen Außenstehende ab, sondern sie diversifizierten ihre Beziehungen. Man kann davon ausgehen, dass dieses Verhalten für die auf Lohnarbeit und die Erträge aus protoindustrieller Arbeit angewiesenen Unterschichten dazu beitrug, Risiken zu minimieren. Tagelöhner waren, wie schon der Name sagt, praktisch immer auf der Suche nach Arbeit; wie Granovetter in seiner Studie zur Arbeitsplatzsuche gezeigt hat, kommt in diesem Zusammenhang die Relevanz der weak ties, der schwachen Beziehungen, zum Tragen. Streng ties, starke Beziehungen, zeichnen sich durch starke Verbundenheit der Partner aus, etwa durch häufigen Kontakt, Intimität, oder durch Multiplexität, also z. Bsp. die Vervielfachung der Beziehung durch Verstärkung einer verwandtschaftlichen Beziehung durch eine Patenschaft. Ihr Vorteil liegt in der dadurch geschaffenen Nähe der Partner, die relativ resistent gegenüber Belastungen ist und in der Regel Unterstützungsleistungen in ihren verschiedenen Formen nach sich zieht. Diese Nähe birgt aber auch Nachteile, und zwar vor allem bzgl. der Chancen, an neue Informationen zu kommen. Wer viel Zeit in enge Beziehungen investiert - und Häufigkeit des Kontakts ist ein Hauptcharakteristikum naher Beziehungen — der läuft Gefahr, mit den immer gleichen Partnern über die immer gleichen Dinge zu sprechen. Um Neuigkeiten zu erfahren, sind weniger starke Bindungen viel nützlicher — sie kosten weniger Zeit und Aufwand, bringen aber Nachrichten von außen. Netzwerkanalytisch erlangen weak ties dadurch Bedeutung, dass sie eine Brücke zu anderen Bereichen der sozialen Struktur darstellt, über die man eher an neue Informationen kommt als über die Leute, mit denen man sich ohnehin ständig austauscht. Sie erlauben, die alltäglichen, durch starke Verpflichtung gekennzeichneten, sozialen Kreisen zu überschreiten und zusätzliche Strategien zu erkunden. 50 Es geht also auch darum, dass Märkte, auch Arbeitsmärkte, nicht perfekt sind; soziale Beziehungen können dazu beitragen, dass einzelne Akteure Informationen erlangen, die sonst nicht verfügbar sind.51 An
49
50
51
Für die Heiratspartner und die möglichen -kandidaten konnte gezeigt werden, dass Borgeler Tagelöhner allerdings nur relativ wenige Verwandte in der Gemeinde hatten; siehe Kap. 6, S. 202. Granovetter, The Strength of Weak Ties; Christine B. AVENARIUS: Starke und Schwache Beziehungen, in: Christian STEGBAUER und Roger HAußLlNG (Hg.), Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2 0 1 0 , S. 99-111; siehe auch Jansen, E i n f ü h r u n g in die Netzwerkanalyse, S. 2 4 3 f f . Nan LIN: Building a Network Theory o f Social Capital, in: Nan LIN, K a r e n COOK and Ronald S. BURT (Hg.), Social Capital. T h e o r y and Research, N e w York 2 0 0 1 , S. 3-29, hier S. 19f.
Soziale Netzwerke und Klassengesellschaft
139
dieser Stelle setzt auch Burts Hypothese der strukturellen Löcher an: Akteure, die in der Nähe solcher Löcher (also Netzwerkstellen mit geringer Dichte) positioniert sind, haben besseren Zugang zu Informationen und Ideen. Durch Selektion und Synthese sind solche Akteure gegenüber anderen im Vorteil.52 Breit angelegte, in nahe und ferne Bereiche reichende persönliche Netzwerke helfen also, Informationen darüber zu erlangen, wo es Arbeit gibt und wie gut sie entlohnt wird.53 Dass gerade Patennetze bewusst aufgebaut wurden, um Risiken zu minimieren und Transaktionskosten zu reduzieren, hat Barbara Göbel in ihrer Studie zu argentinischen Viehzüchtern gezeigt.54 Während der Aufbau weitreichender Patennetze für die ländlichen Unterschichten eine schlüssige Strategie zur Verringerung der eigenen Lebensrisiken war, beschränkten die Bauern ihre Netze auf den sozialen Nahbereich. Ihnen musste es eher darum gehen, Ressourcen zu erhalten und wirtschaftlich eigenständig zu bleiben. Das drückt sich auch darin aus, dass sie etwa wenig Neigung zeigten, Land abzugeben; besonders im ökonomisch erfolgreichen Borgeln kam es kaum vor, dass Familien sich von dieser kostbaren Ressource trennten.55 Auch das Verhalten der westfälischen Bauern ist also als zielgerichtet und sinnvoll zu verstehen: Ressourcen mussten eher gehalten als erlangt werden, Informationen etwa zur Verfügbarkeit von Kredit fand man auch im Soester Wochenblatt.56 Gleichzeitig konnten sie aufgrund der negativen Effekte sozialen Kapitals - etwa das Abschöpfen von ökonomischen Ressourcen durch Netzwerkmitglieder aufgrund der Verpflichtung, Unterstützung zu gewähren oder Konformitätserwartungen, die wirtschaftliches Verhalten beschränken - nur wenig Interesse daran haben, weitreichende Netze in die dörfliche Gemeinde auszubauen. Diese negativen Effekte sind bislang wenig untersucht, können aber vor allem dort beobachtet werden, wo sich die wirtschaftlich Erfolgreichen aus traditionellen Gemeinschaften zurückziehen, um ihren neu erworbenen Wohlstand nicht in umfangreichen sozialen Netzwerken, die von Reziprozitätsbeziehungen geprägt sind, verteilen zu müssen.57
52
53
54 55 5u 57
Ronald S. BURT: Structural holes and good ideas, in: American Journal of Sociology 1 1 0 ( 2 0 0 4 ) , S. 349-399, hier S. 349f. Zur Bedeutung sozialer Netzwerke für Informationen auf dem Arbeitsmarkt siehe auch Segalen, Fifteen Generations of Bretons, S. 273f. Göbel, Risk, uncertainty, and economic exchange. G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt. Marga K O S K E : AUS der Geschichte der Stadtsparkasse Soest, Soest 1 9 5 9 , S. 2 3 . Alejandro PORTES: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, in: Annual review of Sociology 24 (1998), S. 1-24; Alejandro PORTES und Julia SENSENBRENNER: Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, in: American Journal of Sociology 98 (1993), S. 1320-1350, hier S. 1339f.
140
Kapitel 5: Patenschaften in Borgeln und Löhne
5.4 Ländliche Klassengesellschaft? Schichtenübergreifende Integration durch soziale Netzwerke Auf der historiographischen Landkarte ist die .ländliche Klassengesellschaft' bislang in Ostwestfalen verortet. Die durch protoindustrielle Wirtschaftsweise geprägte Region zeichne sich durch das Auseinanderfallen der Sozialstruktur in zwei Klassen aus, eine mit, die andere ohne Besitz. Dieser Befund passte zu dem, was die frühe Protoindustrialisierungs-Theorie angenommen hat. Dort waren Kriedte et al. davon ausgegangen, dass die dörfliche Sozialstruktur ab dem 18. Jahrhundert eine .völlige Umkehr' erfahren hatte, so dass die landarmen und landlosen Unterschichten die Bevölkerungsmehrheit stellten. Das anhaltende Bevölkerungswachstum habe jedoch in Verbindung mit anhaltend hohen Getreidepreisen zu einer ausgeprägten Polarisierung der ländlichen Gesellschaft geführt, da die guten Preise nur den größeren Bauern zugutegekommen seien, kleinere Bauern und Unterschichten jedoch belastet hätten. Mittelfristig entwickelten sich demnach zwei Klassen, Großbauern mit umfangreichem Besitz auf der einen Seite, landarme und landlose Unterschichten auf der anderen Seite. 58 In einem einige Jahre später erschienenen Aufsatz haben die Autoren darauf hingewiesen, dass der Grad der Verflechtung zwischen den sozialen Trägergruppen der protoindustriellen Gewerbe und dem landwirtschaftlichen Bereich zu wenig untersucht ist. Untersuchungen der Sozial- und Besitzstrukturen protoindustrieller Gewerbelandschaften seien ein dringendes Desiderat der Forschung. 59 In den beiden untersuchten Kirchspielen hatte die Konstruktion sozialer Netzwerke unterschiedliche Schwerpunkte: Während die Patenbeziehungen in Löhne bevorzugt zu Menschen der gleichen Generation etabliert wurden und die bäuerliche und unterbäuerliche Schicht verhältnismäßig stark integrierten, achteten Borgeler Kindseltern stärker auf die soziale Hierarchie und bevorzugten Beziehungen zu älteren oder sozial höherrangigen Menschen; gleichzeitig schlössen sich die bäuerliche Mittel- und Oberschicht stärker gegen die Tagelöhner ab. Im Vergleich einer protoindustriellen Heuerlingsgesellschaft und einer agrarischen, marktorientierten Tagelöhnergesellschaft kann die .ländliche Klassengesellschaft' also gerade nicht in Ostwestfalen verortet werden, sondern in der Soester Börde. Wie Schlumbohm bereits gezeigt hat, waren die Beziehungen zwischen Bauern und ihren Heuerlingen ein zentrales Strukturelement der dörflichen Gesellschaft. Besonders Patenbeziehungen dienten dazu, den personalen Charakter dieser Beziehungen zu bestätigen und zu verstärken. Auch Clemens Zimmermann hat daraufhingewiesen, dass der Begriff der .ländlichen Klassengesellschaft' die über Schichtengrenzen hinweg integrierenden Kräfte der vormodernen ländlichen Gesellschaft vernachlässigt: etwa die für alle ähnlichen Bildungschancen, die von al-
58
59
Mooser, Ländliche Klassengesellschaft; Kriedte / Medick / Schlumbohm, Industrialisierung vor der Industrialisierung, S. 43 Kriedte / Medick / Schlumbohm, Sozialgeschichte in der Erweiterung, S. 231 und 243.
Ländliche Klassengesellschaft?
141
len verrichtete körperliche Arbeit, die sozial-moralische Kontrolle, der auch der Reiche unterlag. Von einer regelrechten Klassengesellschaft im Sinne verfestigter sozialer Fronten und unterschiedlichen Wertsphären könne schon aufgrund von Mobilität und Überkreuzungen mit anderen Kriterien wie Nachbarschaft, Verwandtschaft und arbeitswirtschaftlicher Verflechtungen nicht die Rede sein. 60 Die hier vorgestellten Ergebnisse untermauern diesen Einwand. Es konnte nachgewiesen werden, dass in Löhne, also gerade dort, wo die Theorien von .ländlicher Klassengesellschaft' und gesellschaftlicher Polarisierung im Zusammenhang mit Protoindustrialisierung ein Auseinanderfallen der Gesellschaft postuliert haben, soziale Beziehungen als integrierende Kräfte wirkten. Dies zeigte sich zum einen bei der Analyse der schichtenübergreifenden Beziehungen, zum anderen aber in der Struktur des Patennetzes selbst, das hier relativ wenig hierarchisiert und durch die Einbeziehung von Menschen mit eher geringem Status geprägt ist. Eine Klassengesellschaft findet man eher dort, wo sie bisher nicht gesucht wurde: in der marktorientierten, agrarischen Hellwegregion im Herzen Westfalens. Die breite unterbäuerliche Schicht der Tagelöhner, die dort den Großteil der Bevölkerung ausmachte, stand einer Schicht von Bauern gegenüber, die möglichst unter sich blieb. Klassengrenzen waren in dieser sozialen Struktur von erheblich größerer Bedeutung, ihre Überwindung für die ländlichen Unterschichten ungleich schwieriger als in Löhne. Das heißt nun aber nicht, dass soziale Netzwerke in Borgeln keine Funktion hatten. Wenn man vergleicht, wie Bauern und ländliche Unterschichten ihre jeweiligen sozialen Netzwerke konstruierten, kommt man für beide Kirchspiele zu ähnlichen Ergebnissen. In beiden Kirchspielen treten im Verhalten von Bauern und Unterschichten unterschiedliche Strategien hervor, die auch ihre ökonomischen Interessen spiegeln. Während die Bauern ihre Kreise schlössen und ihre sozialen Netzwerke im wesentlichen auf ihren sozialen Nahbereich beschränkten, diversifizierten Tagelöhner und Heuerlinge ihre sozialen Beziehungen und verschafften sich so eher Zugang zu auf dem Arbeitsmarkt wichtigen Informationen. Man kann hier also erkennen, wie diejenigen, die ganz unten auf der sozialen Leiter standen, ihr Leben und ihre sozialen Umwelt gestalteten und auf diesem Wege ihre persönliche Situation zu bessern suchten. Die Untersuchung sozialer Netzwerke erlaubt es, soziale Ungleichheit als ein beinahe aus der Mode gekommenes Thema wieder in den Blick zu nehmen. Soziale Ungleichheit, als relationale Struktur verstanden, kann so mit der klassischen Analyse von sozialer Schichtung und von gesellschaftlichen Positionen in Beziehung gesetzt werden. Auf diesem Wege werden Strategien historischer Akteure angesichts unterschiedlicher Möglichkeiten und Lebenschancen erkennbar, und so die Makroebene der sozialen Verhältnisse mit dem Handeln der historischen Akteure analytisch verbunden.
60
Troßbach / Zimmermann, Geschichte des Dorfes, S. 193f.
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf: Soziale Endogamie, lokale Welt und die Liebe zu den Verwandten
6.1 Heirat als Option: Heiraten, Nicht-Heiraten und Besitztransfers Die Heirat bildete in vorindustriellen Gesellschaften den Kristallisationskern sozialer Beziehungen. Durch Heiraten wurden — einerseits — Familien und in vielen Regionen Europas auch neue Haushalte etabliert, die zentralen Orte der Allokation von Ressourcen. Heiraten legten die Grundlage für innerfamiliäre Transferbeziehungen, für die Aufzucht, Ausbildung und Ausstattung von Kindern wie für die Versorgung alternder Eltern. Damit geht es hierbei um ein zentrales Movens menschlichen Handelns: Menschen sind ebenso durch ihre altruistischen Ziele in Transfersystemen wie durch egoistische Ziele in Marktsystemen geprägt. Die Verträge, die westfälische Familien im 19. Jahrhundert über die Verteilung des Erbes abschlössen, zeigen die Bedeutung sowohl von Emotionen als auch von Interessen für die Gestaltung von Erbschaft, Versorgung und sozialen Beziehungen. Daneben waren Heiraten aber - andererseits - ein zentrales Gestaltungsmittel der sozialen Struktur, also der sozialen Netzwerke, die über Familien hinauswiesen. Anders als Patenschaften waren Heiraten mit erheblichen Ressourcenflüssen verbunden; im westfälischen Anerbengebiet bedeutete dies, dass mit den Heiratspartnern auch die Erbabfindungen von Hof zu Hof wanderten. Die Analyse von Familienverträgen und die Untersuchung von Heiratsnetzwerken können daher zum Verständnis dieses zentralen lebenszyklischen Übergangs und der Herausbildung sozialer Gruppen beitragen. Traditionell gilt die Übergabe des elterlichen Hofes an den ältesten oder jüngsten Sohn in Gebieten mit Anerbenrecht als Wendepunkt der bäuerlichen Familie, im Gegensatz zum eher fließenden Generationenübergang in Realteilungsgebieten.1 Die Untersuchung einiger Übergabeverträge aus der Lohner Überlieferung hat dagegen gezeigt, dass auch unter den Bedingungen der ungeteilten Übergabe der Besitztransfer zwischen den Generationen ein eher langfristiger Prozess war, insbesondere dann, wenn Eltern sich den Nießbrauch des übertragenen Vermögens vorbehielten. Er begann zumeist mit der ersten Heirat eines Kindes, bei der in der Regel zumindest ein Teil der Abfindung gezahlt wurde, und endete oft erst Jahre nach der Übergabe, wenn auch das letzte Kind alle ausstehenden Forderungen erhalten hatte. Dabei konnte deutlich gemacht werden, dass Heirat kaum an den (vorherigen) Erwerb einer ,Stelle'
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 444; Josef EHMER: The Life Stairs: Aging, Generational Relations, and Small Commodity Production in Central Europe, in: Tamara K. HAREVEN (Hg.), Aging and Generational Relations Over the Life Course. A Historical and Cross-Cultural Perspective, Berlin 1996, S. 53-74, hier S. 63.
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
144
gebunden war. Im Gegenteil, die gängige Praxis, Heiratende mit Ressourcen auszustatten, zeigt, dass die Kausalität zwischen Heirat und Besitztransfer genau anders herum verstanden werden kann: Heirat war nicht an Stellenerwerb gebunden, löste aber intergenerationelle Ressourcenflüsse aus. So hatte noch kein unverheiratetes Kind bis zum Zeitpunkt der Übergabe eine Abfindung vom elterlichen Vermögen erhalten; umgekehrt hatten aber knapp 90% der verheirateten Kinder zumindest einen Teil der Abfindung bei der Heirat erhalten. 2 Dabei hatte das ,Stellen'-Prinzip durchaus seinen Platz im Lebenslauf: Wie Georg Fertig anhand von Lebenslauf-Daten gezeigt hat, erhöhte das Erben eines Hofes die Heiratswahrscheinlichkeit in Borgeln um das Dreifache. Stellen waren also nützlich, hatten aber keine kontrollierende Funktion; von der Ehe ausgeschlossen waren auch besitzlose Menschen nicht. 3 In den letzten Jahren sind in der Forschungsgruppe .Ländliches Westfalen' mehrere Aufsätze zu Heirat und Besitztransfers entstanden. Dabei wurden verschiedene Themenfelder angesprochen, etwa zum Einfluss wirtschaftlicher Faktoren auf Heiratsentscheidungen, 4 auf die Beziehungen der Geschwister, 5 Familienstrategien, 6 räumliche Heiratsmobilität 7 und die Bedeutung der Eheschließung im Lebenslauf. 8 Damit sind die in den Projektdatenbanken gesammelten Quellen aber noch nicht erschöpfend ausgewertet. Auf den folgenden Seiten wird nun eine vornehmlich qualitative Auswertung der bäuerlichen Familienverträge vorgenommen, bei der es vor allem um den Stellenwert der Eheschließung in der ländlichen Gesellschaft geht. Eine vergleichende Lektüre der Übergabe- und Leibzuchtsverträge, aber auch anderer Dokumente für die beiden Kirchspiele deutet darauf hin, dass die Heirat in Löhne eine größere Bedeutung für den Lebenslauf der Individuen hatte als in Borgeln. 2 3
4
5
6
7
C. Fertig, Hofübergabe, S. 82. G. Fertig, Lebenslauf; siehe zur Diskussion des Zusammenhanges von Familienstruktur, demographischem Verhalten und Ressourcentransfers auch G. Fertig, Invisible chain, und Rolf GEHRMANN: Das Verhältnis von Bevölkerung und Ressourcen als Problem der demographischen Theorie und historischen Forschung, in: Karl DITT, Rita GUDERMANN, Norwich ROßE (Hg.), Landwirtschaft und Umwelt in Westfalen vom 18. bis 20. Jahrhundert, Paderborn 2001, S. 23-45; Schlumbohm, Familienformen. Georg FERTIG: Marriage and economy in rural Westphalia, 1750-1870: A time series and cross sectional analysis, in: Isabelle DEVOS und Liam KENNEDY (Hg.), Marriage and Rural Economy: Western Europe Since 1400, Turnhout 1999, S. 243-271. Volker LÜNNEMANN: Familialer Besitztransfer und Geschwisterbeziehungen, in: Georg FERTIG (Hg.), Geschwister — Eltern — Großeltern. Beiträge der historischen, anthropologischen und demographischen Forschung, Köln 2005, S. 31-48. C. Fertig/Lünnemann/G. Fertig, Inheritance, succession and familial transfer; C. Fertig/G. Fertig, Bäuerliche Erbpraxis. Volker LÜNNEMANN: Kleinräumige Wanderungsbewegungen in Westfalen 1670-1870. Eine Untersuchung anhand von Familienrekonstitutionsdaten, in: Hannelore OBERPENNING und Annemarie STEIDL (Hg.), Kleinräumige Wanderungen in historischer Perspektive, Osnabrück 2001, S. 33-50.
8
C. Fertig, Hofübergabe; G. Fertig, Lebenslauf.
Heirat als Option
145
6.1.1 Beshztransfer in Löhne: Heiraten als Auslöser von Ressourcenflüssen Wenn man Löhner Übergabeverträge liest, so begegnet man dort nicht nur den alten Bauern und ihren Kindern, sondern oftmals auch bereits den zukünftigen Ehepartnern der Hofübernehmer. So brachte etwa Friedrich Steinsiek (ID 18626) im Oktober 1841 seine Braut Catharina Kollmeyer (ID 18628) und ihren Vater, den Colon Caspar Kollmeyer (ID 55912) mit nach Herford ans Gericht, als er dort mit seiner Mutter einen Übergabevertrag abschloss. Obwohl die jungen Leute noch nicht verheiratet waren, hatte die Übergabe des Hofes bereits stattgefunden; die Heirat war aber ausdrücklich Bedingung für die Übertragung der Eigentumsrechte. Der Vater der Braut verpflichtete sich gleichzeitig, einen Brautschatz von 800 Talern zu zahlen und außerdem einen Brautwagen nebst Kuh mitzugeben, und den größten Teil davon innerhalb eines halben Jahres zu liefern.9 Auch Charlotte Hartmann (ID 14738) stand kurz vor der Heirat mit Heinrich Osterholz (ID 55508), als sie den Hof von ihrem Vater und dessen zweiter Frau übertragen bekam. Sie sollte den Besitz des Hofes auch erst „sofort nach ihrer Verheirathuttg mit ihrem Ehemann" antreten.10 Auch bei Johann Philipp Dreckmeyer (ID 13674) scheint die Verlobung, zu der sein Vater ausdrücklich seine Zustimmung erklärte, die Übergabe zumindest erleichtert zu haben. Der Vater erklärte, dass er schon alt und schwächlich sei und deshalb die Großjährigkeit des 16jährigen Anerben Bernhard nicht abwarten könne. Er war aber erst 51 Jahre alt, zeugte nach dem Rückzug auf die Leibzucht noch 3 Kinder mit seiner zweiten Ehefrau und verstarb erst 15 Jahre später.11 Die wirtschaftliche Situation auf dem Kolonat war allerdings offenbar schwierig; schon bald nahm der neue Eigentümer, der sowohl alle auf dem Hof lastenden als auch die persönlichen Schulden des Vaters übernommen hatte, einen neuen Hypothekarkredit auf. Dass er den Hof nur vier Jahre nach der Übernahme verkaufen musste, kann mit der hohen Bürgschaft zu tun haben, die er inzwischen für einen Verwandten seiner Frau übernommen hatte; der Käufer übernahm mit dem Hof
9
StAD, D 23 B, Nr. 50107, S. 40. Ein voller Brautwagen sollte im 19. Jahrhundert etwa 80 Taler wert sein, eine Kuh 15 Taler, und eine milchgebende Kuh 20 Taler. Diese Angaben sind aus den Borgeler Verträgen und Inventaren ermittelt worden. Für Gohfeld, einem Nachbarkirchspiel von Löhne, gibt es eine aus dem Jahr 1841 stammende Auflistung der dort in einem Brautwagen enthaltenen Gegenstände, zu denen u. a. Schränke, Betten, weitere Möbel und Küchengerätschaften, aber auch „eine Seite geräucherten Speck" gehörten. Auch dieser Brautwagen sollte knapp 80 Taler wert sein, siehe Heinrich OTTENSMEIER: Der Mensch in unserer Heimat bei Fest und Feier - Sitten und Gebräuche im Jahreslauf und in der Familie, in: Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Löhne 2 (1970), S. 35-80, hier S. 58. Zu Brautschätzen und den üblicherweise enthalten Gegenständen siehe auch Dietmar SAUERMANN: Brautschatzverschreibungen als Quelle für die Veränderungen der bäuerlichen Kultur im 18. Jahrhundert. Das Beispiel Lienen, i n : W e s t f ä l i s c h e F o r s c h u n g e n 2 9 (1978/79), S. 1 9 9 - 2 2 2 .
10 11
StAD, D 23 B, Nr. 50113, S. 48. StAD, D 23 B, Nr. 50124, S. 28.
146
Kjipittl 6: Heiraten auf dem Dorf
die Schulden, so dass Dreckmeyer nur noch 100 Taler als Kaufsumme bekam.12 Als nach nunmehr fünfjähriger Ehe sein einziges Kind geboren wurde, war er nur noch Heuerling; nach seinem Tod verließ die Witwe mit der wenige Monate alten Tochter den Ort. Die Übergabe des Hofes an einen heiratenden Sohn war also nicht immer eine erfolgreiche Strategie. Höfe wurden in Löhne in vielen Fällen explizit an zukünftige Ehepaare übergeben, wobei die Eltern deutlich machten, dass die Überlassung der Eigentumsrechte untrennbar mit der Verheiratung verknüpft war. Diese Regelungen betrafen sowohl Söhne wie Töchter, wie Louisa Brinkmann (ID 13172) und ihren Verlobten Carl Imort (ID 18111),13 Engel Frensemeyer (ID 14341) und Heinrich Elstermeyer (ID 14022), die als Kaufpreis die Schulden des Vaters übernehmen mussten,14 aber auch Heinrich Darre (ID 13620) und seine Braut Friederike Speckenbrink (ID 13621),15 oder Friedrich Usling (ID 19493), der mit seiner Frau Christine Thielker (ID 19516) auf dem Hof unter der Autorität des Vaters leben und arbeiten musste, solange dieser das Recht zur Bewirtschaftung des Hofes behalten wollte.16 Die Reservierung der Nutzungsrechte betraf viele junge Bauern, in Löhne etwa ein Drittel der Hofübernehmer. Allerdings mussten vor allem Töchter und Schwiegersöhne den Nießbrauch gewähren, seltener Söhne und deren Frauen. Es wurden also vor allem die Rechte der aufheiratenden Männer eingeschränkt, während gleichzeitig dafür gesorgt wurde, dass ein junges Paar auf dem Hof war.17 Familienverträge wurden auch abgeschlossen, um etwa Töchter auf dem Hof zu behalten, die die Rolle der Hausmutter und Wirtschafterin ausfüllen konnten — auch wenn der Schwiegersohn noch nicht Herr auf dem Hof werden sollte.18 Aus der Perspektive der Hofwirtschaft war neben belastenden Schulden und der Notwendigkeit, junge Arbeitskräfte auf dem Hof zu behalten, auch die zu erwartende Mitgift des aufheiratenden Partners von Gewicht. So wurde etwa der Hof Löhnebeck Nr. 7 an den ältesten Sohn Bernhard Take (ID 19151) übergeben, weil die „dringenden Schulden'1 getilgt werden mussten, „ihr gegenwärtiger ältester Sohn aber Gelegenheit habe sich vortheilhaft verheirathen". Das Anerbenrecht des jüngsten Sohnes musste dabei durch eine besondere Abfindung von 100 Talern abgegolten werden.19 Auch die erst 16jährige Catharina Rahe (ID 17362) bekam den Hof der Eltern übertragen, da sie „Hoffnung habe, sich vortheilhaft und gut verheirathen". Die Ehe und die endgültige Übertragung kamen tatsächlich aber erst vier Jahre später zustande.20 12
13 14 15 16 17 18 19 20
Grundbuch Löhne Bd. 1, folio 35, S. 237. Bürgschaften werden nur dann fällig, wenn der ursprüngliche Schuldner ausfällt; ob dies hier der Fall war, ist indes nicht bekannt. StAD, D 23 B, Nr. 50183, S. 134. StAD, D 23 B, Nr. 50165, S. 22. StAD, D 23 B, Nr. 50110, S. 16. StAD, D 23 B, Nr. 50178, S. 17. C. Fertig, Hofübergabe, S. 79f. C. Fertig / Lünnemann / G. Fertig, Inheritance, succession and familial transfer, S. 321ff. StAD, D 23 B, Nr.50397, S. 20. StAD, D 23 B, Nr. 50339, S. 12 und S. 40.
Heirat als Option
147
In Löhne kam es recht selten vor, dass ein unverheirateter Sohn oder eine unverheiratete Tochter einen Hof übernahm, ohne dass eine Heirat zumindest in absehbarer Zeit bevorstand (Tabelle 6.1). Bei den Bauernkindern war nur jeder achte Hoferbe ohne Partner, bei den Angehörigen der Unterschichten etwas mehr.21 Die hier erkennbare Verknüpfung von Heirat und Besitzübertragung betraf aber nicht nur die Hofübernehmer, sondern auch die Nebenerben, die bei der Heirat mit Ressourcen ausgestattet wurden. Manchmal ging die Sorge um die Kinder aber auch über die Zahlung der Abfindung heraus, wie bei Johann Lindemeyer (ID 16268) und Louise Meyer (ID 16273), die im September 1836 heirateten. Ihre Eltern unterstützten die jungen Leute, „damit sie ihren eignen Ha[ussta]nd etablieren können", indem die Mutter der Braut ihnen neben diversen Haushaltsgegenständen einen Kamp übertrug, auf dem ein halb fertig gebautes Haus stand. Dieses Haus war aber von den Eltern des Bräutigams gebaut worden, die „ den Verlobten auch als Mitgift einen Ofen, eine Kuh, einen Ochsen und alles übrige was etwa einer bäuerlichen Haushaltung noch dürftig erforderlich ist*' dazu gaben.22 Franz Bührmann (ID 13334) und Engel Johannsmeyer (ID 11718) übertrugen ihren Hof 1826 an die Tochter Charlotte (ID 13348) und Schwiegersohn Dietrich Reitmeyer (ID 13353). Die jungen Leute mussten die im Vertrag detailliert aufgeführten Schulden der Eltern in Höhe von 58 Talern übernehmen. Darüber hinaus erließen sie den Eltern diejenigen 82 Taler, die sie an Lohn, für Flachslieferung und für geliehenes Geld zu fordern hatten, und sie mussten für die Altersversorgung der alten Leute sorgen, die mit etwa 250 Taler angerechnet wurde. Daneben mussten sie aber im nächsten Sommer einen Kotten auf dem Hof bauen, in welchem eine andere Tochter, Maria (ID 13347) mit ihrer Familie für die nächsten 10 Jahre mietfrei, allerdings unter der Bedingung, dass „derselbe, so wie seine Ehefrau, wenn sie bestellt werden, undgegen Erlegung des observan^mäßigtn Tagelohns und Kost, die gewöhnliche (.. .)hilfe auf dem Colonate leisten müsse". Allerdings musste der Schwiegersohn, Friedrich Schröder (ID 18276), den gegen die alten Leute laufenden Prozess über 72 Taler sofort aufgeben. In der Summe wurden die von Charlotte und Dietrich Reitemeyer übernommenen Verpflichtungen auf 491 Taler beziffert. 23 So wurde für beide Töchter gesorgt, allerdings ging diesen Vereinbarungen offenbar eine heftige Auseinandersetzung voraus, in dem die Eltern wohl erst nachgaben, nachdem erheblicher Druck seitens der Kinder ausgeübt worden war. Offenbar haben aber Maria und ihr Mann Friedrich Schröder den elterlichen Hof bald verlassen, außer einer Totgeburt im September desselben Jahres gibt es keine weiteren Daten zu dieser Familie.
21
22 23
In beiden untersuchten Gemeinden gab es Kleinstbesitzungen, deren Eigentümer sich durch landwirtschaftliche Lohnarbeit, Handwerk oder durch die Herstellung protoindustrieller Produkte ernährten. Die Familienstrategien dieser Hausbesitzer werden hier ebenfalls untersucht. StAD, D 23 B, Nr. 50180, S. 13. StAD, D 23 B, Nr. 50114, S. 20.
148
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Tabelle 6.1: Hofübergabe und Heirat des Hoferben: Löhne (1794-1871) und Borgeln (1802-1884) Bauern Löhne: Vor der Übergabe Bis zu 3 Monate nach Übergabe Später als 3 Monate nach Übergabe Summe Borgeln: Vor der Übergabe Bis zu 3 Monate nach Übergabe Später als 3 Monate nach Übergabe Summe
%
Kleinstbesitzer N % 14 41,2 13 38,2
N 58 45
45,3 35,2
25
19,5
7
128
100,0
47 19
Summe %
N 72 58
44,4 35,8
20,6
32
19,8
34
100,0
162
100,0
38,8 15,7
67
61,5
8
7,3
114 27
49,6 11,7
55
45,5
34
31,2
89
38,7
121
100,0
109
100,0
230
100,0
Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln.
Wenn man den zeitlichen Zusammenhang zwischen Heirat und Übergabe betrachtet (Tabelle 6.1), so unterscheiden sich die untersuchten Kirchspiele in zwei Punkten: (1) In Löhne waren Hofübernehmer entweder längst verheiratet, oder ihre Hochzeit stand unmittelbar bevor. In der Regel (80% der Fälle) wurden Höfe an Ehepaare oder Verlobte kurz vor der Hochzeit übergeben, oft wurde die Eheschließung zur Bedingung für die Übergabe gemacht. Umgekehrt findet man aber keine Hinweise darauf, dass junge Menschen erst heiraten konnten, nachdem die .Stelle' auf dem elterlichen Hof frei wurde. In Borgeln fehlte der enge zeitliche Zusammenhang zwischen Heirat und Übergabe. Auch hier waren viele Paare bei der Übergabe bereits verheiratet, nur wenige Hochzeiten waren aber bei der Hofübergabe in Vorbereitung; in den Übergabeverträgen findet man auch kaum Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorgängen. Über ein Drittel der Übergaben ging aber an eine ledige Person, bei den Bauern wurde beinahe die Hälfte der Höfe an unverheiratete Erben weitergegeben, die zumeist erst deutlich später heirateten. Dieser Befund ist umso erstaunlicher, als dass in Borgeln Primogenitur üblich war, in Löhne dagegen Ultimogenitur. Man würde also gerade in Borgeln eher mit verheirateten Übernehmern rechnen. In Borgeln wurde spät geheiratet — auch dann, wenn es nicht an den nötigen Ressourcen mangelte. (2) Während sich das Heiratsverhalten der (wenigen) unterbäuerlichen Kleinstbesitzer in Löhne nicht von dem der Bauern unterschied, kann man in Borgeln einen, wenn auch schwachen, Zusammenhang zwischen Besitzstatus und Zusammenfall von Hei-
Heirat als Option
149
rat und Hofubergabe ausmachen.24 Kam eine Heirat im Umfeld der Übergabe bei den Bauern schon nur in einem Sechstel der Fälle vor, so handelte es sich bei den Tagelöhnern beinahe schon um Ausnahmen (7%); mehr als die Hälfte der neuen Hausbesitzer waren längst verheiratet. Heiraten und in den Besitz eines Hauses zu gelangen waren voneinander unabhängige Schritte im Lebenslauf der unterbäuerlichen Schichten in Borgeln. 6.1.2 Heiraten in Borgeln: Übergabe, Aussteuer und Erbteil In Borgeln war die Regelung der Erbangelegenheiten aufgrund des anders gestalteten Eherechts oft aufwendiger. Während in Löhne das eheliche Vermögen nach dem Grundsatz „längst Leib, längst Gut, ein Leib, ein Gut"25 dem überlebenden Ehepartner zunächst verblieb und nur in Fall einer Wiederverheiratung eine Vermögensauseinandersetzung mit den Kindern erfolgen musste, erbten Kinder und verwitwete Elternteile in Borgeln gemeinsam. In der Regel wurde hier eine Gütergemeinschaft bis zu einer eventuellen Wiederheirat oder bis zur Übertragung an einen Hoferben eingerichtet. Viele Höfe und Häuser wurden aber auch hier bereits zu Lebzeiten der Eltern übertragen. Für das 19. und beginnende 20. Jahrhundert sind hier etwas mehr als 200 Übergabeverträge zwischen Eltern und Kindern überliefert. Nur in wenigen Fällen kamen Verlobte gemeinsam zur Vertragsausfertigung, wie etwa die erst 18jährige Angelika Remmert und ihr Bräutigam, der Verwalter des Guts Schwackhausen, Wilhelm Stahl.26 Auch der Colon Anton Risse übergab 1814 den Hof an seine Tochter, und sie brachte den Verlobten gleich mit: „Weil die Elisabeth Risse sich mit ihres Vaters Bewilligung mit dem Andreas Hilgenkamp ehelich verlobt hat, der Anton Risse auch nicht im Stande ist, seiner Colonie weiter vorzustehen, weil er schon über acht undfönfitfg Jahr alt, seitfünf Jahren Wittwer ist, und seit dem letzten Frühjahr her eine steife Schulter hat daher er seine Geschiffte nicht mehr wahrnehmen kann, so übergibt und überträgt er seine unterhabende %ur Domaine gehörige Rissen Colonie borgein, mit allen Partinen^ien, Rechten und Gerechtigkeiten, Pflichten und Lasten seiner Tochter und deren Verlobten Andreas Hilgenkamp dergestalt, daß diese von Stunde an Besitzer dieser Colonie sind, und die Rechte und Lasten auf eigene Rechnung ausüben und leisten."21 Hier ist gut zu erkennen, dass es dem übergebenden Vater darum gehen musste, ein arbeitsfähiges junges Paar auf dem Hof zu haben, das der Hofwirtschaft besser vorstehen konnte als ein Versehrter Witwer. Auch Margaretha Lips (ID 1958), Witwe des Tagelöhners Stephan Bähner, sieht in der Übertragung ihres kleinen Hauses an die älteste Tochter (ID 2343) und den zukünftigen Schwiegersohn eine Lösung ihrer ökonomischen Probleme: „Die
24
25 26 27
Zwischen Besitzstatus und Heirat zum Zeitpunkt der Übergabe (bis 3 Monate danach) gibt es in Löhne keinen signifikanten Zusammenhang. In Borgeln ist der Zusammenhang signifikant, aber nur schwach ausgeprägt (Pearsons Chi 2 12,353*, Cramer's V 0,232*). StAD, D 23 B, Nr. 50110, S. 16. St AM, Grundakten Soest, Nr. 1708/3, S. 157. StAM Grundakten Soest, Nr. 8904, S. 2.
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
150
Witwe Bahner erklärte zuvörderst, daß sie bereits alt und schwach sei, und dieserbaJh nicht mehr im Stande sei, der Wirtschaft gehörig vorzustehen, auch nicht so eine in Vermögen habe, um die höchstnötige Reparation ihres Wohnhauses vornehmen können. Sie habe sich deshalb mit Genehmigung des Vormundes ihrer Kinder entschlossen, ihr sämtliches Vermögen, ihrer mitanwesenden ältesten Tochter und deren Bräutigam %u übertragen " 28 In diesen beiden Fällen wird die Übergabe nicht mit der Möglichkeit zu einer .vorteilhaften Heirat' begründet, sondern eher als Ausweg aus einer schwierigen Lage beschrieben. Auch „die Eheleute Hoparte [waren] jetzt so altersschwach, daß sie ihrer Wirtschaft nichtgehörig mehr vorstehen könnten, sie wollten deswegen ihrer Tochter Sophia ihr Vermögen übertragen, damit sie sich ihnen auf ihrem Hof verheirathe" P Einen Bräutigam brachte die Tochter aber noch nicht mit; die erhoffte Eheschließung fand auch erst im November 1826 statt, mehr als zwei Jahre nach der Hofübergabe. Die in Löhner Verträgen nicht unübliche Klausel, dass eine Heirat Bedingung für die Übertragung des Vermögens sei, findet man in Borgeln kaum. Nur Heinrich Westermann (ID 10523) machte die Vermögensübertragung von der bevorstehenden Heirat des Übernehmers abhängig. Allerdings handelte es sich bei seinem Nachfolger um seinen Bruder Dietrich (ID 167), der dem unverheirateten 67jährigen im Gegenzug eine Leibzucht einräumen musste.30 Auch Dietrich war bereits 50 Jahre alt, heiratete aber wenig später die wesentlich jüngere Sophie Buschhoff (ID 169). So wurde eine junge Schneiderstochter auf den Hof geholt, und zwei Jahre später gab es auch einen Erben. Eine Heirat konnte eine Hofübertragung aber auch verhindern, wenn die Eltern mit dem zukünftigen Partner nicht einverstanden waren. So bekam Caspar Multermann den elterlichen Hof, obwohl er nur der jüngere Sohn war: „Die Eheleute Multermann haben aus ihrer gegenwärtigen Ehe noch ein Kind mit Namen Anton, der zwar der ältere Sohn [und Anerbe] ist. Da derselbe aber gegen ihren Willen heiraten will, wo%u sie nur unwillig ihren Consens erteilen, so soll derselbe als Abfindung von dem übertragenen elterlichen Vermögen aus einer (...) Summe von 200 Thlr. erhalten, welche sein Bruder Caspar verpflichtet ist, ihm nach dem Absterben beider Eltern auszuzahlend Die Familiensituation war allerdings auch dadurch erschwert, dass „die Ehefrau Multermann (...) 2 Vorkinder mit Namen Christoph und Luise [hat], von denen der erstere (...) und die letztere taubstumm ist. Dieselben sind zwar schon früher abgefunden, sollen aber wegen ihrer unglücklichen Lage von den übertragenden Eltern resp. Stiefeltern noch besonders bedacht werden. Es verpflichtet sich der Caspar Multermann diese seine beiden Halbgeschwister auf dem übernommenen Hofe lebenslänglich zu ernähren und zu verpflegen, mit Wohnung, Licht und Wärme Zu versehen und ihnen namentlich eine liebevolle Behandlung zu Theil werden zu lassen, die sie wegen ihrer unglücklichen Lage verdienen."31 Unter diesen Umständen war eine Verheiratung mit einer unliebsamen Person wohl besonders inakzeptabel. Auch andere Eltern machten sich eher Sorgen wegen einer möglichen Heirat, als dass sie sie verlangten. Friedrich Windhüvel (ID 52) musste 1822 versprechen, „sich ohne [der elterlichen] Einwilligung 28 29 30 31
StAM StAM StAM StAM
Grundakten Grundakten Grundakten Grundakten
Soest, Nr. Soest, Nr. Soest, Nr. Soest, Nr.
6585, S. 3. 1880/5, S. 17. 8930, S. 66. 8884, S. 71.
Heirat als Option
151
nicht verheiraten, und in der ihnen vorbehaltenen lebenslänglichen Herrschaft nicht hinderlich [zu] sein"?2 Tatsächlich heiratete er erst drei Jahre später, brachte mit der Tochter des Colons Schulze zu Westen (ID 53) aber wohl auch eine gute Partie auf den Hof. Auch Abfindungen wurden in Borgeln nicht unbedingt zum Zeitpunkt der Heirat ausgezahlt. Während Heiratende in Löhne in der Regel von dem elterlichen Vermögen abgefunden wurden, oder zumindest einen Teil der Abfindung erhielten, kamen die Geschwister von Borgeler Hofübernehmern oft erst lange nach der Übergabe in den Genuss ihres Erbteils. Hier waren zum Zeitpunkt der Hofübergabe bei 95% der verheirateten Geschwister die Erbansprüche noch gar nicht befriedigt, während in Löhne knapp 90% der verheirateten Geschwister zumindest schon einen Teil ihres Erbteils erhalten hatte.33 In Löhne riefen Heiraten also Ressourcenflüsse hervor, in Borgeln eher nicht. Allerdings muss man diesen Befund einschränken: Zum einen war der Hoferbe oft das älteste Kind, so dass viele Geschwister noch nicht verheiratet waren, zum anderen gibt es in Borgeler Dokumenten verstreute Hinweise darauf, dass zur Heirat eine Aussteuer bereit gestellt wurde. So musste etwa Georg Carrie (ID 1789) jedem seiner acht Geschwister eine Abfindung von 100 Talern auszahlen, so wie sie die älteste Schwester auch bei der Heirat erhalten hatte. Diese Zahlungen waren zu bestimmten Terminen fällig, zunächst bekam der Älteste seine Abfindung, dann immer im Abstand von 2 Jahren das nächst jüngere Kind. Bei der Heirat eines Kindes musste jedoch sofort eine Ausstattung, bestehend aus „/ Bett nebst Bettstelle, 1 Kleiderschrank, 1 Tisch, 6 Stühle, 1 Kuh, ferner die nöthige Kleidung", herausgegeben werden; alternativ konnte Georg Carrie aber auch die Summe von 24 Taler zahlen.34 Auch Friedrich Vieth sollte seiner Schwester neben ihrer Abfindung „wenn dieselbe heiratet, eine Ausstattung in Naturalien, den sog. Brautwagen in derselben Art und Weise %uteil werden lassen, wie solche seinen anderen Schwestern ^u Zeit der Heirat von den Eltern gegeben ist."35 Diese Trennung von Abfindung vom elterlichen Vermögen und bei der Heirat zu zahlender Aussteuer findet sich in verschiedenen Borgeler Verträgen.36 Man kann also davon ausgehen, dass viele Kinder bei ihrer Heirat von den Eltern ausgestattet worden sind, ohne dass dies in den Übergabeverträgen immer erwähnt worden ist. Hierbei handelte es sich in der Regel aber wohl um eine Grundausstattung, wie sie ein junger Haushalt benötigte; der Löwenanteil des Erbteils kam erst später, unabhängig von der Heirat der jungen Leute. Bei der Heirat wurden die Kinder also unterstützt, der Zusammenhang zwischen dem Zeitpunkt der Heirat und dem Ressourcenfluss war in Borgeln aber weniger eng als in Löhne.
32 33 34 35 36
StAM Grundakten Soest, Nr. 8905, S. 16. Datenbank Borgeln; C. Fertig, Hofübergabe, S. 82. StAM Grundakten Soest, Nr. 8869, S. 31. StAM Grundakten Soest, Nr. 4727, S. 87. So auch in StAM Grundakten Soest, Nr. 8951, S. 163: Die älteste Tochter Lisette sollte die Ausssteuer direkt vom Vater erhalten, die anderen Kinder bei ihrer Verheiratung. Die Abfindung war dagegen zu festgelegten Terminen fallig. Weitere Beispiele in StAM Grundakten Soest, Nr. 6639, S. 91, Nr. 8584, S. 14; Nr. 8893, S. 109; Nr. 8904, S. 40.
152
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Die Höhe der Erbabfindungen war aber gerade in Borgeln ganz erheblich. Da in Übergabeverträgen in den meisten Fällen zwar die Abfindungen spezifiziert, die Höhe des gesamten Vermögens jedoch nicht genannt ist, ist die Bewertung der relativen Höhe der Abfindungen schwierig. Nur für wenige Fälle konnte eine Beziehung zwischen Vermögen und Abfindungen hergestellt werden; die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder in Borgeln etwa zwei Drittel desjenigen erhielten, was ihnen bei Realteilung zustehen würde. Dabei muss man allerdings beachten, dass mit dem Hof auch die Versorgung der alten Bauern an den Hoferben überging, von der die Geschwister befreit waren. 37 Die Abfindungen der den Hof verlassenden Kinder waren also von beachtlicher Höhe. Zu derselben Einschätzung kommt Friedrich Weber, der die Geschichte seines großelterlichen Hofes, der Colonie Maaß, und des Ortes Blumroth in der Gemeinde Borgeln erforscht hat. Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Heimatgeschichte, deren methodischer Ansatz einer Mikrogeschichte gleichkommt. Der Autor führt eine ganze Reihe von Quellen zusammen, die über die hier genutzten Quellen hinausgeht: Zum einen hatte er Zugang zu privaten Hofarchiven, zum anderen konnte er auch auf mündliche Überlieferung zurückgreifen. Auf diesem Wege ist es ihm u. a. gelungen, die Investitionen der bäuerlichen Paare in ihre Höfe, etwa in Hofgebäude, der Auszahlung von Erbanfindungen gegenüberzustellen. Im Ergebnis übertrafen die Abfindungen die Investitionen ganz erheblich. Die Eheleute Peter Jacob gen. Maaß (ID 1582) und Josefine Maaß geb. Cumberg (ID 1583) heirateten im Dezember 1819 und hatten sieben Kinder, fünf Söhne und zwei Töchter. Nach ihrer Heirat baute das junge Paar zunächst eine Scheune, die spätestens 1826 vollendet war. Danach fingen sie an, Erbelande für die Abfindung ihrer Kinder zu kaufen: 1828 0,5 Hektar, 1832 0,125 Hektar, 1841 einen Hektar, zwischen 1846 und 1854 nochmal 2,4 Hektar. Im 1854 geschlossenen Übergabevertrag wurden 5,5 Hektar auf die sechs Geschwister des Hoferben aufgeteilt, bei einem Verkaufswert von etwa 3.200 Talern. Die Investitionen in Hofgebäude, wie der Bau der Scheune, beliefen sich auf nur 700 Taler. Zusätzlich wurden jedem der sechs Kinder 500 Taler Bargeld und eine Kuh zugesprochen. Nicht einmal zwei Jahre zuvor, im September 1852, waren die grundherrlichen Rechte an der Maaßschen Colonie abgelöst worden, die Abfindungssumme betrug 1.732 Taler. Damit überstieg die beinahe zeitgleich gewährte Barabfindung der Kinder die Ablösungsverpflichtungen um den Faktor 1,7, der Wert der ihnen zugedachten Erbelande den Wert der Investitionen in die Substanz des Hofes um den Faktor 4,6, und dazu erhielten sie jeweils eine Kuh, deren monetärer Wert sich auf etwa 15 bis 20 Taler belaufen haben wird. 38
37
38
In Oberkirchen, einem in der sauerländischen Mittelgebirgsregion gelegenen Kirchspiel, erhielten die abgefundenen Kinder nur etwa ein Drittel des Realteilungswertes. Siehe C. Fertig/ G. Fertig, Bäuerliche Erbpraxis, S. 180. Weber, Menschen und Familien, S. 178f., 181 f.
Heirat als Option
153
Die Erbelande, von denen hier die Rede ist, dienten in dieser Region der Abfindung der Kinder. Die Abgrenzung zum eigentlichen Hofland wird bereits darin deutlich, dass sie auf gesonderten Grundbuchblättern geführt wurden. 39 Dass diese Ländereien nicht zum Hofland gerechnet wurden, sondern den Altbauern als Altenteil dienten und dann an die weichenden Kinder vererbt wurden, war offenbar schon im 18. Jahrhundert üblich. Diese Praxis verschwand aber im Laufe des 19. Jahrhunderts, so wie auch Naturalleistungen unüblich wurden. Der älteste Sohn von Peter und Josephine, Heinrich Maaß (ID 1584), hatte mit seiner Frau Henriette (ID 1585) zwei Kinder. Die im Mai 1887 heiratende Tochter Josephine (ID 7098) bekam eine Abfindung in Geld, die wieder die Investitionen in Haus und Hof übertraf. „Heinrich und Henriette investierten eine größere Kapitalsumme in die Wirtschaftskraft des Hofes, als dies durch ihre Eltern Peter und Josefine sowie durch ihre Großeltern Anton und Anna Engel geschehen war. Sie kauften für etwa 6.500 Mark Land und errichteten bzw. renovierten für etwa 8.000 Mark Hofgebäude. (...) Dem investierten Kapital ist noch etwa V* der Ablösungssumme zuzurechnen: 1.300 Thaler = 3.900 Mark (vgl. Dok. 8). Damit war die Abfindungssumme für die Miterbin aber immer noch größer als das investierte Kapital. Die finanzielle Abfindung der Miterben aus dem erwirtschafteten Gewinn war offenbar noch ebenso wichtig wie die Hebung der Wirtschaftskraft des Hofes (.. .)."40 Die Abfindung der Tochter Josefine betrug 20.000 Mark, während sich die Investitionen auf 18.400 Mark summierten; ihr Pflichtteil wäre nur etwa halb so groß gewesen. Hier diente das zugekaufte Land nicht mehr der Ausstattung der Tochter, sondern der Vergrößerung der Produktionsfläche des Hofes. Die hohe Abfindung wurde zusätzlich zu den Landkäufen ausgelobt, das Land kam nun dem Hoferben zugute. Ihr Bruder, der den Hof übernommen hatte, wollte ebenso für jedes seiner Kinder 20.000 Mark als Abfindung ansparen.41 Deutlich wird an diesen Beispielen noch einmal, dass Bauern erhebliche Anstrengungen unternahmen, um ihre Kinder gut auszustatten, auch dann, wenn diese den Familienbesitz verließen.
6.1.3 Singles in Borgeln: Ein alternatives Lebensmodell Auch wenn Heirat im ländlichen Westfalen des 18. und 19. Jahrhunderts nicht an den Besit2 von Grund und Boden oder die Verfügbarkeit einer .Stelle' gebunden war, so gelangte doch nicht jeder in den Ehestand. Manche fanden keinen Partner, wie der oben erwähnte Borgeler Colon Heinrich Westermann, der den Hof schließlich an seinen Bruder übergab. Andere waren nicht in der Lage, selbstständig zu leben, etwa weil sie körperlich versehrt waren. So musste Louise Engelbrecht (ID 32372), die in Löhne 39
40 41
Dir Höfe der Gemeinde Borgeln sind in den Grundbüchern 1, 7 und 10 verzeichnet. Die Erbeläcder findet man in den Grundbüchern 2-6, 8, 9, 11-13. St AM, Grafschaft Mark, Gerichte, Gioßgericht Soest, Nr. 20,1: Hypothekenbuch der Soester Börde, Borgeln. Weber, Menschen und Familien, S. 190. Ebd., S. 239.
154
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
1871 im Beisein ihres Bräutigams von ihren Eltern Hof und Mühle übernahm, ihre 16jährige „körperschwäcbliche" Schwester Hanna lebenslänglich bei sich wohnen lassen, sie versorgen und ihr auch ein monatliches Taschengeld von einem Taler zahlen.42 Auch dem Löhner Colon Carl Bartling (ID 12596) und seiner Frau lag das Wohlergehen ihrer beiden kranken Kinder am Herzen. Die 28jährige Christine (ID 12607) und der 36jährige Carl (ID 12604) waren von klein auf taubstumm und auf Hilfe angewiesen. Der Vater wollte deshalb den Hof nicht inter vivos übergeben, sondern seine Tochter Charlotte (ID 12606) und ihren Ehemann durch einen Erbvertrag auch weiterhin auf dem Hof halten. Sie sollten den Hof erben, mussten aber die kranken Kinder „ihrem Stand und ihren Gewohnheiten gemäß" unterhalten, pflegen und ihnen ein Taschengeld geben.43 Auch im Kirchspiel Borgeln wurden Versehrte Kinder auf diese Weise abgesichert; so der „verwachsene"Albert Göbel (ID 15657),44 die erblindete Maria Wilms (ID 15649),45 der fast beständig kränkliche Georg Grotejohann (ID 2418)46 oder Heinrich Hilgenkamp (ID 5748), „welcher Fehler an einem Arme hat" und der deshalb „wenn er arbeitsunfähig werden möchte, berechtigt [ist], auf Hilgenkamps Hofe zurückzukehren und muß daselbst von seiner Schwester Wilhelmine unterhalten werden".*1 In Borgeln, aber nicht in Löhne, gab es aber auch eine ganze Reihe junger Menschen, die zu Hause bleiben wollten — nicht weil sie einer besonderen Betreuung bedurften, sondern sie ihr Leben so gestalten wollten, als Alternative zu einer Familiengründung. Die beiden Gemeinden unterschieden sich bzgl. des Heiratsverhaltens recht deutlich voneinander. (1) In Löhne heirateten Männer im Durchschnitt mit knapp 26 Jahren, in Borgeln erst mit 30 Jahren. Bei den Frauen ist der Unterschied nicht ganz so groß, das mittlere Heiratsalter lag in Borgeln bei gut 27 Jahren, in Löhne bei knapp 25 Jahren. In beiden Gemeinden hatten Bauern ein etwas niedrigeres Heiratsalter, insbesondere die Bräute waren 2 bis 3 Jahre jünger, wenn sie auf einem Hof heirateten.48 (2) In Borgeln waren die meisten 25 bis 29jährigen Männer ledig, mit im Zeitverlauf steigender Tendenz. Bei den Männern der Geburtskohorte 1800-1819 waren nur 40,5%
42 43 44 45 46 47 48
StAD, D 23 B, Nr. 59437, S. 62. StAD, D 23 B, Nr. 50104, S. 111. StAM Grundakten Soest, Nr. 8614, S. 106. StAM Grundakten Soest, Nr. 4282, S. 155. StAM Grundakten Soest, Nr. 3226, S. 8. StAM Grundakten Soest, Nr. 8929, S. 44. Siehe Tabelle A3 im Anhang. Diese Tendenz der späteren Verheiratung in den unteren Schichten ist auch in anderen Studien gefunden worden, etwa von Schlumbohm (Lebensläufe, S. 105) und Mahlerwein (Herren im Dorf, S. 107f.). Bei Schlumbohm waren die Bauern bei ihrer Verheiratung zwar etwas älter als die Heuerlinge, ihre Frauen waren allerdings deutlich jünger als die Heuerlings-frauen, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Geburtenrate. Vergl. auch G. Fertig, Lebenslauf, der für einen etwas späteren Zeitraum zu niedrigeren Werten kommt: S. 102f.
Heirat als Option
155
in diesem Alter verheiratet, während der Anteil der Verheirateten in Löhne mit 79,7% doppelt so hoch war. In Löhne heiratete also die Mehrheit der Männer in ihren Zwanzigern, in Borgeln aber erst in ihren Dreißigern.49 (3) Der Anteil der lebenslang Ledigen war in Borgeln in derselben Geburtskohorte deutlich höher als in Löhne. 27,5% der Männer, die das Erwachsenenalter50 erreichten, heirateten niemals; schränkt man die Grundgesamtheit auf diejenigen ein, die mindestens 45 Jahre alt wurden, so beträgt die Ledigenquote 16,2%. In Löhne blieben viel weniger Männer dauerhaft ledig, bei den über 45jährigen betrug der Anteil nur 5,9%.S1 In Abbildung 6.1 ist der Anteil der verheirateten Männer je Lebensjahr in den beiden Gemeinden für die Geburtskohorten 1780-1799 und 1800-1819 dargestellt. Die Alterskurve der heiratenden Männer verläuft für Borgeln erkennbar flacher und bleibt insgesamt auf einem niedrigeren Niveau. Das Heiratsalter verschob sich nach hinten, in der zweiten, späteren Kohorte blieben mehr Männer ledig. Bei den Frauen sind die Unterschiede im Heiratsalter geringer, so dass sich die Kurven nicht so stark unterscheiden, in der Tendenz bestätigen sie aber die Beobachtung, dass in der Gesindegesellschaft in Borgeln später geheiratet wurde und ein größerer Anteil der Menschen niemals heiratete.52
49
50 51
52
Siehe Tabelle AI im Anhang. Vergleiche auch die Verheiratetenanteile für Frauen in Tabelle A2: In Borgeln waren etwa 60% der 25 bis 29jährigen Frauen verheiratet, in Löhne wiederum 80%. Zur altersspezifischen Ledigenquote als Indikator des Heiratsverhaltens siehe Ehmer, Heiratsverhalten, S. 83. Als Erwachsene gelten alle, die mindestens 20 Jahre alt wurden. Siehe Tabelle AI im Anhang. Die Familienrekonstitutionsdaten für Löhne reichen nur bis 1874, für Borgeln dagegen bis 1900. Durch die Zensurierung sind Berechnungen für die spätere Löhner Geburtskohorte etwas schwierig, da durch die fehlenden Sterbedaten ein erheblicher Anteil der ansässigen Einwohner ausgeschlossen werden musste (geschätzt knapp 40% der verheirateten Erwachsenen). Im Gesamtbild ergeben sich aber klare Unterschiede zwischen den beiden Gemeinden. Siehe Abbildung AI im Anhang, die die Anteile für Frauen zeigt.
156
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Abbildung 6.1: Anteil der jemals verheirateten Männer nach Lebensjahren, Löhne und Borgeln (1780-1819), in Prozent
Alter
Anm.: Es sind alle Männer berücksichtigt, die im angegebenen Zeitraum geboren und im Kirchspiel verstorben sind, sofern sie das Erwachsenenalter erreichten, also mindestens 20 Jahre alt wurden. Drei Eheschließungen sind ausgeschlossen worden, da die Bräutigame älter als 45 Jahre waren. Quelle: Datenbanken Löhne und Borgeln. Der Ledigenanteil war also in Borgeln etwa doppelt so hoch wie in Löhne und lag für deutsche Regionen im oberen Bereich. Die Löhner Daten passen dagegen gut zu den von Schlumbohm für Belm gefundenen Werten. Die Ergebnisse bestätigen auch die von Knodel und Maynes bereits 1976 ermittelten Werte. 5 3 Man kann das hohe Heiratsalter und die hohen Ledigenquoten in Borgeln als typische Phänomene f ü r eine Gesindegesellschaft deuten. Damit könnte man allerdings nur das Verhalten der jungen Männer ohne Hofbesitz erklären; das Heiratsalter der Jungbauern lag jedoch kaum niedriger, und auch die jungen Bäuerinnen waren — zumindest im Vergleich mit den Löhner Daten — relativ alt. Ehmer hat bereits darauf hingewiesen, dass sich das 53
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 138f. Die Werte für das mittlere Heiratsalter der Belmer Bevölkerung entsprechen für den hier untersuchten Zeitraum ebenfalls den Löhner Werten: 25,7 Jahre für Frauen, 27,5 Jahre für die Männer (Tabelle 3.01, S. 100, eigene Berechnung). Siehe auch Josef EHMER: Bevölkerungsgeschichte und Historische Demographie 1800—2000, München 2004, S. 47f.; Ehmer, Heiratsverhalten, S. 103ff.; John KNODEL und Mary Jo MAYNES: Urban and Rural Marriage Patterns in Imperial Germany, in: Journal of Family History 1 (1976), S. 129-168, besonders S. 136f..
Heirat als Option
157
Heiratsverhalten nicht direkt aus Faktoren wie Erbrecht und Besitzverhältnissen ableiten lässt lassen. Auch Gebiete mit Realteilung und nur wenig Gesindeanteil weisen hohe Ledigenquoten auf.54 Im württembergischen Kiebingen hat Carola Lipp ähnlich hohe Anteile dauerhaft lediger Erwachsener gefunden, wie sie hier für Borgeln herausgearbeitet worden sind: Von allen Kindern, die das Erwachsenenalter erreichten, blieben 24 Prozent zeitlebens ledig. Dabei waren die unteren Schichten überproportional vertreten und wiesen auch ein höheres Heiratsalter auf als die Bauern.55 Das Heiratsverhalten im württembergischen Realteilungsgebiet und der westfälischen Gesindegesellschaft ähnelt sich also frappierend. Für Löhne hat dagegen Georg Fertig bereits darauf hingewiesen, dass gerade die Heuerlinge relativ spät heiraten. Das insgesamt eher niedrige Heiratsalter ist hier weniger auf die protoindustrielle Hausindustrie als auf die Praxis der Hofweitergabe an den jüngsten Sohn zurück zu führen: Im Vergleich der untersuchten Gemeinden liegt das Alter der Hofübergeber auf demselben Niveau, die Hofübernehmer sind aber jünger — eben die jüngsten Söhne, nicht die ältesten. Ein typisch protoindustrielles Heiratsverhalten von Garnspinnern und Webern, wie es etwa für sächsische und Schweizer Gemeinden nachgewiesen und mit der Möglichkeit und auch Notwendigkeit zur frühen Heirat erklärt wurde, ist für das ostwestfälische Löhne also zumindest fraglich.56 In beiden Gemeinden heirateten mittellose Menschen etwas später als die Bauern, aber die Unterschiede zwischen den Gemeinden waren deutlich größer als die zwischen den Schichten. Das Heiratsverhalten der Löhner und Borgeler Bevölkerung im 19. Jahrhundert trug also stärker lokalspezifische als schichtenspezifische Züge. Unverheiratete Erwachsene waren im Alltagsleben der Dörfer in der Gemeinde Borgeln sehr präsent, während junge Erwachsene in Löhne recht schnell heirateten. Die relativ große Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder die andere niemals heiraten würde, war den Borgelern bewusst. In vielen Familienverträgen wird dieser Möglichkeit Rechnung getragen, indem Regelungen für unverheiratet bleibende Kinder getroffen wurden. In aller Regel wurden solche Bestimmungen für ein ganz bestimmtes Kind getroffen, bei dem sich ein solcher alternativer Lebenslauf wohl bereits abzeichnete; nur in wenigen Ausnahmefällen war das Zuhause bleiben eine Option, die mehreren oder allen Kindern zustand. Man kann zwei Gruppen von Begünstigten unterscheiden. Zum einen wurde bei der Übergabe an den Hoferben bestimmt, dass eine Schwester oder ein Bruder zwischen der Auszahlung der Abfindung und einem lebenslangen Wohn- und Versorgungsrecht auf dem elterlichen Besitz wählen konnte. Junge Menschen ließen sich also auf diesem Wege einen Platz zum Leben zusichern, sofern sie nicht heiraten oder abwandern wollten (oder konnten). Der Status eines unverheirateten Einwohners mit Familienanschluss wird hier als alternativer Lebensweg entworfen, den sich eine ganze Reihe von jungen Menschen bewusst offenhielt. 54 55 56
Ehmer, Heiratsverhalten, S. 112f. Kaschuba / Lipp, Dörfliches Überleben, S. 342ff. G. Fertig, Lebenslauf, S. 102; Ehmer, Heiratsverhalten, S. 118.
158
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Daneben gibt es aber auch Beispiele, die von einer Neuausrichtung der Lebenspläne zeugen. Wenn Menschen in fortgeschrittenem Alter ihr Eigentum gegen eine (Alters-) Versorgung eintauschten, so erinnert dieser Vorgang an die Altenteilsregelungen, die alte Bauern und Tagelöhner mit ihren Kindern trafen. Es handelte sich hierbei aber um unverheiratete Personen, die in ihren 40er oder 50er Jahren eine Vereinbarung mit ihren Verwandten (nicht Kindern) trafen. Beide Varianten werden im Folgenden anhand einiger Beispiele vorgestellt, die für viele andere, ähnliche Vereinbarungen stehen. (1) Die Geschwister Ebbert, deren Eltern vor längerer Zeit verstorben waren, schlössen im September 1842 einen Vertrag miteinander. Die beiden Brüder, der 42jährige Zimmermann Christoph (ID 4351) und der 40jährige Schneider Wilhelm (ID 10250) wollten jeweils ein Stück Erbeland behalten, während die unverehelichte, erst 33jährige Schwester Margaretha (ID 876) das Haus mit Hofraum bekam. Sie verpflichtete sich dazu, die Schulden der Eltern zu übernehmen, und außerdem dem Wilhelm ,fur dessen Lebenszeit freie Wohnung in dem ihr übertragenen Wohnhaus Nr. 32, Essen und Trinken von ihrem Tische, wie sie es selbst genießt, Ucht und Wärme z? gewähren, für die Reinigung seiner Wäsche zu sorgen, und ihm jährlich ein neues Hemd, ein Stück Zwirn von 20 Gebind geben, auch ihm die oberhalb der Stube befindlichen Räume nebst einem vollständigen Bette zum freien Gebrauch einzuräumen." Daneben musste sie alle sechs Jahre das kleine Stück Land düngen und erhielt dafür Kaff und Stroh. Nach seinem Tod sollte diese Parzelle der Schwester oder ihren Erben zufallen.57 Zwei Jahre später heiratete sie, etwa im 6. Monat schwanger, den Tagelöhner Wilhelm Klauke (ID 875). Ihr Bruder Wilhelm blieb unverheiratet, während Christoph schon zehn Jahre vor dieser Erbteilung eine Familie gegründet hatte. (2) Der unverheiratete Schuster Friedrich Remmert (ID 7964) entschied sich 1867 im Alter von 25 Jahren, Haus und Land an seinen jüngeren Bruder Wilhelm (ID 894) abzutreten. Er hatte den Besitz erst 3 Jahre zuvor, kurz vor dem Tod der Mutter, übertragen erhalten. Vielleicht war diese Besitzübertragung etwas hastig und der Krankheit der Mutter geschuldet. Jedenfalls waren sich Eltern und Sohn noch nicht ganz einig, als sie im Oktober 1864 vor dem Soester Notar Hennecke standen: Behielten sich die Eltern im ersten Paragraphen noch den unbeschränkten Nießbrauch am übertragenen Vermögen vor, so konnte der Vertrag erst unterschrieben werden, nachdem diese Vereinbarung rückgängig gemacht wurde: „§4. Die Eheleute Christoph Remmertfinden sich bei näherer Überlegung veranlaßt, hiermit schon jetzt auf den nach Paragraph eins vorbehaltenen Nießbrauch zu verzichten, indem Friedrich Remmert den Besitz des elterlichen Vermögens bereits übernommen hat. Es wird daher hiermit vereinigt, daß Friedrich Remmert mit dem heutigen Tage Besitz und Verwaltung des ihm übergegebenen elterlichen Vermögenfür eigene Rechnung behält undfortsetzt, also seit dem heutigen Tage die im Paragraph 2 verschriebene Eeibzuchtgewähren muß." Friedrich blieb bis zu seinem Tod im Januar 1905 unverheiratet und ließ sich von seinem Bruder ein lebenslanges Wohnrecht und einen Versorgungsanspruch für den Fall, dass er nicht ar-
57
StAM Grundakten Soest, Nr. 5539, S. 33.
Heirat als Option
159
beiten könne, zusichern: Wilhelm „verpflichtet sich dagegen, seinem Bruder Friedrich Remmert, solang derselbe unverheiratet bleibt, freie Wohnung im Hause gewähren und denselben insomit er außer Stande sein möchte, sich selbst ernähren, für dessen Lebenszeit mit allen Lebensbedürfnissen versehen, insbesondere auch in Krankheiten für seine Wartung und Pflege sorgen. Dem Friedrich Remmert verbleibt, solange er nicht heirathet, der ausschließliche Gebrauch zweier Zimmer des Hauses, nämlich der Werkstätte und der darüber befindlichen Bühne. Derselbe erhält wenn er im Hause das Schusterhandwerk betreibt, Essen und Trinken bei seinem Bruder und %ahlt dafür täglich eine Vergütung von drei Silbergroschen. Dieses Kostgeld fällt aber weg, wenn er wegen Krankheit oder aus andern Ursachen verhindert sei %u arbeiten. An Sonn- und Festtagen bezieht Friedrich Remmert ebenfalls Essen und Trinken bei seinem Bruder gegen Entrichtung des bestimmten Kostgeldes von 3 Silbergroschen." Wilhelm musste auch den alten Vater versorgen, dem es gestattet wurde, „in der Werkstätte seines Sohnes soweit der Raum es gestattet, das Schusterhandwerk %u betreiben, mit der Maßgabe, dass der Vater von dieser Vergönnung nur in soweit Gebrauch machen kann und darf, dass Friedrich beim Betriebe des Handwerks in keiner Hinsicht durch den Vater beschränkt oder gestört werden darf.1,58 Wilhelm nahm die Übertragung an, heiratete kurz darauf, und neun Monate später wurde der erste Sohn des Paares geboren. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Schneider, und wurde bei den Geburten seiner jüngeren Kinder ab 1876 als Schneidermeister bezeichnet. Offensichtlich war die Übergabe an den ältesten, aber erst 22jährigen Sohn Friedrich die falsche Strategie gewesen. Er hatte zwar das Handwerk des Vaters erlernt, aber bereits bei der Vertragsaufnahme liefen die Dinge nicht wie (wohl von den Eltern) geplant. Nach wenigen Jahren zeichnete sich eine bessere Lösung ab, indem der jüngere Sohn, der nun ebenfalls knapp 23jährige Wilhelm, gemeinsam mit seiner Braut den elterlichen Besitz und die damit verbundenen Pflichten übernahm. Friedrich aber tauschte sein Eigentums- und Nutzungsrecht gegen ein lebenslanges Wohnrecht bei der Familie des Bruders ein, ergänzt durch unentgeltliche Versorgung in Nodagen. (4) Auch Friedrich Weber hat im Hofarchiv der Colonie Maas in Blumroth einen solche Vereinbarung gefunden, die diese Praxis bereits für das späte 18. Jahrhundert belegt. Der 54jährige Knecht Johann Jacob (ID 6249) war im Sommer 1788 aufgrund einer Erkrankung nicht mehr in der Lage, für seinen Lebensunterhalt als Knecht zu sorgen. Seine beiden Brüder waren beide Hofbesitzer - der Zweitälteste, Albert (ID 306), hatte den elterlichen Hof übernommen, der älteste, Anton (ID 1579), hatte die Witwe des Colons Georg Maas geheiratet. Schon früh hatte der unverheiratete Johann Jacob eine Vereinbarung mit seinem Bruder Albert getroffen: Er überschrieb ihm 0,25 Hektar Erbeland, den Albert bebauen musste; Johann erhielt das Korn, Albert Kaff und Stroh. Außerdem ließ Johann seine Erbabfindung, die aus einem Pferd, einer Kuh und 40 Talern bestand, bei seinem Bruder. Inzwischen war aber Anton, der älteste Bruder, verstorben, und hatte seine zweite Frau hinterlassen. Dieser Witwe eilte nun ein Neffe, der älteste Sohn von Albert Jacob, zu Hilfe, zunächst als Knecht, aber schon
58
StAM Grundakten Soest, Nr. 9018, S. 89.
160
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
bald als Nachfolger seines Onkels. Kaum ein Jahr nach dessen Tod kam der erste Sohn des neuen Paares zur Welt, die Heirat erfolgte gerade noch rechtzeitig vor der Geburt im September 1787. Nun traf der erkrankte Johann eine Vereinbarung mit seinem Neffen Anton Jacob gen. Maas (ID 1581), dem neuen Bauern auf der Colonie Maas. Er überließ ihm ein kleines Stück Erbeland, das ihm verblieben war, und vermachte ihm außerdem die Hälfte seiner noch ausstehenden Erbabfindung; die andere Hälfte schenkte er dem zweiten Sohn Alberts, der als Nachfolger auf dem Hof Jacob blieb. Der junge Anton Jacob gen. Maas verpflichtete sich nun, seinen kranken Onkel Johann aufzunehmen und ihn mit allem Lebensnotwendigen zu versorgen. Dieser Fall zeigt, dass die Versorgung der Geschwister von Hoferben ihnen nicht nur die Etablierung eines eigenen Haushaltes erleichtern, sondern ebenso als Altersabsicherung dienen konnte. Es wird auch deutlich, wie Familien ihre verfügbaren Ressourcen nutzen, um alle Familienmitglieder zu versorgen.59 (3) Die Geschwister Westermann fanden 1878 eine Erbregelung, die für Anna Maria (ID 10525) und Wilhelm (ID 10524) ein lebenslanges Wohn- und Verpflegungsrecht im Haus ihres Bruders Heinrich (ID 10523) beinhaltete. Die bereits 55jährige, unverheiratete Anna Maria übertrug ihren Grundbesitz an Heinrich und verzichtete auf ihre Abfindung, und bat sich neben dem üblichen, standesgemäßen Unterhalt „eine liebreiche, gütige Behandlung' aus. Ihr Bruder Wilhelm war bereits 58 Jahre alt und ebenfalls unverheiratet; er hatte seine Abfindung aber bereits erhalten. „Heinrich Westermann räumt ihm das Recht ein so lange er unverheiratet bleibt auf dem Hofe bleiben und verpflichtet sich, ihn dort Lebensunterhalt seinem Alter und Stande angemessen gewähren. Dagegen verpflichtet sich Wilhelm Westermann so lange und so weit es seine Kräfte gestatten, in der Haus- und Feldwirtschaft mitzuarbeiten und des Hauses Beste befördern,"60 Fünf Jahre später gab der nunmehr 67jährige Heinrich den Hof allerdings ab, und zwar an den jüngsten Bruder Diedrich (ID 167). Der 51jährige Diedrich kam mit seiner 27jährigen Braut Sophie Buschhoff (ID 169) und ihrem Vater zur Vertragsaufnahme. Es handelt sich hier um einen der ganz wenigen Fälle, in denen die Heirat des Übernehmers ausdrücklich Bedingung für die Eigentumsübertragung war.61 Die ursprüngliche Übertragung an den ältesten Sohn Heinrich war bereits 1844 erfolgt. In dieser elterlichen Übertragung waren auch Bestimmungen für einen weiteren Sohn getroffen worden, den Zweitältesten Christoph (ID 10526). Christoph wurde allerdings enterbt, da er den elterlichen Hof angezündet hatte und sich deshalb in Untersuchungshaft befand. Jedoch wurde auch für Christoph gesorgt: „Möchte Christoph Westermann dereinst von der Strafanstalt entlassen werden, so muß Heinrich Westermann denselben bei sich aufnehmen und ihn unterhalten, solange sich keine Gelegenheit %um Unterhalt für den Christoph Westermann anderwärts darbietet. Es versteht sich von selbst, daß Christoph Westermann dagegenfür seinen Bruder %u arbeiten gegen üblichen Lohn verpflichtet ist."62 Offenbar nahm 59 60 61 62
Weber, Menschen und Familien, S. 255f.; Datenbank Borgeln. StAM Grundakten Soest, Nr. 4339, S. 34. StAM Grundakten Soest, Nr. 8930, S. 66; siehe auch oben, S. 152f. StAM Grundakten Soest, Nr. 2077, S. 66.
Heirat als Option
161
Christoph dieses Recht in Anspruch, denn in dem Vertrag von 1883 ist von vier auf den Hof lebenden Geschwistern die Rede: „Für den Fall der Unverträglichkeit sollen die vier zur Begebung einer Leibzucht und resp. des Unterhalts berechtigten Geschwister des Übertragsnehmers Diedrich Westermanns berechtigt sein, vom Hofe abzuziehen und statt der Leibzucht resp. Unterhalt eine Geldrente verlangen, welche einerseits ihnen deren dem Alter und Stande angemessenen Unterhalt sichert, andererseits aber auch so bemessen wird, daß sie die Kräfte der Übertragmehmer nicht übersteigt, sondern ihnen angemessenen und standesgemäßen Unterhaltfür sich und ihre Familie vorab freiläßt." Christoph starb im März 1890, 64 Jahre alt und unverheiratet, die drei anderen Geschwister lebten bis 1892 (Wilhelm) bzw. 1905 (Heinrich und Anna Maria). In diesem letzten Beispiel waren Eltern bemüht, eine besondere Regelung für eines ihrer Kinder zu treffen, auch wenn der Sohn ihnen wohl viel Kummer bereitete. Auch andere Eltern sorgten dafür, dass ihren Kindern ein Platz zum Leben im elterlichen Haus erhalten blieb. Die folgenden Beispiele, die ebenfalls für viele andere stehen, illustrieren diese Familienstrategie. (5) Der Glaser und Schreiner Heinrich Römling (ID 1212) und Clara Frensis (ID 1211) übergaben am 3.11.1854 ihr Wohnhaus und einige Parzellen ihrem Sohn Wilhelm (ID 8448) unter der Bedingung, dass zwei ihrer vier übrigen Kinder im Haus bleiben dürften: „Dem Franz Höfling soll solange er unverheiratet ist, freie Wohnung und eine Kammer im Hause zum ausschließlichen Gebrauche verbleiben. Auch Florenz Römling, welcher kränklich ist, soll solange er unverheiratet bleibt, freie Wohnung bei seinem Bruder Wilhelm im Hause behalten." Franz Römling (ID 1213) erhielt auch eine Abfindung, die doppelt so hoch war wie die der übrigen Kinder, weil er seine Eltern unterstützt hatte. Er sollte auch „nach beider Eltern Tode die sämmfliehen zur Glaser-Profession gehörigen Handwerksgeräthe mit Einschluss der Blei(...) und des Diamants an Franz erhalten, während „alle übrigen zur Schreiner-Profession gehörigen väterlichen Handwerksgeräthschaften an beide Brüder Franz und Florenz *n Gemeinschaft" gehen sollten.63 Einen Tag nach der Aufnahme des Vertrags beantragte die Familie eine erneute Entsendung einer Gerichtsdeputation nach Borgeln, da sie den Vertrag abändern wollten. Dazu kam es jedoch nicht mehr, da am Folgetag die Mutter verstarb. Der alte Vater und die Brüder ließen später ihre Leibzucht bzw. ihr Wohnrecht im Hypothekenbuch eintragen, da Wilhelm das übertragene Haus verkaufen wollte. Tatsächlich verkaufte er am 28.1.1858 seinen Besitz für die Kaufsumme von 650 Talern. Am 1.2.1858 ließ Franz sein Wohnrecht im Hypothekenbuch eintragen, bald darauf, am 14.4.1858 auch der inzwischen in Düsseldorf lebende Florenz. Franz heiratete ein Jahr später, so dass sein Wohnrecht endete, und lebte bis zu seinem Tod im September 1912 als Glaser in Borgeln. Florenz kehrte aus dem Rheinland zurück und heiratete im Oktober 1860; er verstarb 1894 im Nachbardorf Klotingen.64
63 64
StAM Grundakten Soest, Nr. 8999, S. 56. StAM, Grafschaft Mark, Gerichte, Großgericht Soest, Nr. 20,1: Hypothekenbuch der Soester Börde, Borgeln, Nr. 2, Blatt 48 (S. 139); zugehörige Grundakte: StAM Grundakten Soest, Nr. 8999.
162
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
(6) „Die Sophie Tiümann [ID 10278] soll ihrt Abfindung nicht ausbezahlt erhalten, soll vielmehr in dem elterlichen Hause wohnen bleiben und in demselben Essen und Trinken sowie ihren Unterhalt erhalten, auch die jetzt inne gehabten Räume zur Benutzung für sich behalten. Wilhelm Tillmann [ID 1198] darf die Sophie nicht aus dem Hause weisen, sollte dieselbe jedoch ausstehen wollen, so hat sie sich an der ihr auszuzahlenden Abfindung einen Abzug von 10 Thlr. für jedes Jahr, wo sie in dem Hause gelebt hat, machen lassen." Die Abfindung, die der Zimmergeselle Wilhelm Tillmann den übrigen fünf Geschwistern zahlen musste, betrug je 100 Taler, so dass der Abzug je Jahr, in dem das Wohnrecht genutzt wurde, einem Zehntel der Abfindungssumme entsprach.65 (7) Der Tagelöhner Wilhelm Hövel junior (ID 6099) und seine Frau Elisabeth Stasius (ID 6101) erhielten im Oktober 1857, drei Tage nach ihrer Heirat, das Borgeler Wohnhaus seiner Eltern übertragen, allerdings mit der Auflage, „der Anna Catharina Hövel geschiedene Ehefrau Beiklas aus Hörde und ihren jetzigen Kindern, solange sie nicht wieder Zur anderen Ehe schreitet und einen ehrbaren Lebenswandel führt, namentlich, solange sie nicht mit einem unehelichen Kinde niederkommt, die an der Ostseite des abgetretenen Wohnhauses befindlichen Zimmer, nämlich unten eine Stube und oben eine Kammer, z**r unentgeltlichen Bewohnung einzuräumen." Zum Zeitpunkt der Heirat und der Übergabe war Elisabeth Stasius offenbar hochschwanger, jedenfalls erlitt sie nach knapp einem Monat eine Totgeburt. Die Schwägerin konnte (oder wollte) die von den Eltern bestimmten Auflagen jedoch nicht erfüllen; im Mai 1862 wurde sie nochmals Mutter eines kleinen Mädchens, über dessen Vater nichts bekannt ist. Nach den Bestimmungen des Vertrags hatte sie ihr Wohnrecht damit verwirkt. Sie blieb im Kirchspiel, starb 1895 aber im Nachbardorf Berwicke. Offensichtlich war die Option, als alleinstehendes Familienmitglied im Haushalt zu verbleiben, durchaus mit einem eingeschränkten Handlungsspielraum und hier auch mit sozialer Disziplinierung verbunden, so dass man nicht unbedingt von einer äquivalenten Alternative zur Gründung einer eigenen Familie sprechen kann. 66 (8) Auch Anna Maria Göbel (ID 5022) bekam 1819 anlässlich der Übertragung des Hofes an ihren Bruder ein Wohn- und Unterhaltsrecht auf dem elterlichen Hof eingeräumt. Der Vater war bereits 81 Jahre alt und verstarb drei Tage nach der Hofübertragung. Der einzige auf dem Hof verbliebene Sohn Johann Dietrich (ID 1707), der die Nachfolge nun antreten konnte, war bereits 48 Jahre alt, aber immer noch unverheiratet; er heiratete erst zehn Jahre später die 29jährige Anna Catharina Dahlhoff (ID 1708). Die Schwester Anna Maria blieb auf dem Hof: „MußDiedrich auch seine älteste Schwester, solange sie unverheiratet bleibt, bei sich auf dem Hofe behalten, ihr Essen, Trinken, lacht, Wärme verschaffen, auch ihr eine Stube und eine Kammer zum Gebrauche einzuräumen, auf ihr Verlangen ihr ihre Brautkuh aussuchen lassen, und zum Melken halten, ferner ihr ihr Erbeland gegen Kaff und Stroh zu cultivieren. Möchte die Anna Maria Goebel unverheirathet versterben, sofällt ihr Brautschatz und ihr ganzes sonstiges Vermögen dem Goebeln Hofesbesitzer zu, wogegen derselbe verpflichtet 65
66
StAM Grundakten Soest, Nr. 8880, S. 99. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das Wohnrecht mit Ablauf dieser zehn Jahre endete, es galt offenbar unbegrenzt. StAM Grundakten Soest, Nr. 3128, S. 48.
Heirat als Option
163
ist, sie in Alter und Krankheit aufzuwarten, sie hegen und verpflegen, auch ihr angemessenes Essen und Trinken zukommen lassen, ihrerseits verspricht sie dagegen, das Hofes Beste nach ihren Kräften befirdern %u helfen, ohne sichjedoch dabei befehlen oder Dienste anweisen lassen. Möchte die Anna Maria sich verheirathen, so erhält sie von Goebeln Hofe: (1) die obgedachte Brautkuh nächst der Besten, (2) ein Pferd nächst dem Besten, (3) 100 Thlr. Gemeingeld und (4) 5 Ruthen Erbelandes als den dritten Theil des vorhandenen Erbelandes."61 Die Bestimmungen dieses Vertrages machen deutlich, dass Anna Maria keinesfalls als unbezahlte Dienstmagd auf dem Hof verblieb: Sie konnte eine milchgebende Kuh auswählen, die sie zur alleinigen Nutzung überlassen erhielt, und sie schuldete ihrem Bruder keinen Gehorsam. Offenbar bildeten Bruder und Schwester hier ein Arbeitspaar, das den Hof längst bewirtschaftete; die Mutter war schon einige Jahre zuvor verstorben. Erst als die beiden Geschwister weit in ihren fünfziger Jahren waren, wurde mit Diedrichs Braut eine junge Frau, und damit eine junge Arbeitskraft, auf dem Hof geholt. Nachdem Diedrich im August 1844 verstorben war, blieb seine Witwe Anna Catharina unverheiratet, und bewirtschaftete den Hof offensichtlich mit Hilfe ihrer Schwägerin und dem gerade 14jährigen ältesten Sohn Franz (ID 1709) weiter. Die Schwägerin Anna Maria starb im Februar 1850; zwei Jahre später übergab Anna Catharina den Hof an ihren Sohn Franz.68 In der Blumrother Familien- und Dorfgeschichte sind auch für das 20. Jahrhundert noch solche Regelungen beschrieben. Heinrich (ID 1586) und Julie Maaß (ID 1587) sorgten 1933 dafür, dass ihre Töchter auf dem Hof bleiben oder auch auf ihn zurückkehren konnten, falls sie keine eigene Familie gründen sollten: „In einem gemeinsamen Testament setzen Heinrich und Julie am 4. Juli 1933 ihren Sohn Wilhelm als Nacherben ein (MA). Am 28. September 1933 überträgt Heinrich durch notariellen Vertrag den Hof an Wilhelm, behält sich aber den vollständigen Nießbrauch bis zum Lebensende vor; für die Töchter wird eine finanzielle Abfindung von je 7.500 RM festgesetzt (MA). Sorgfältig wird die Möglichkeit geregelt, daß sich eine der Töchter nicht verheiraten sollte: Für diesen Fall wird das lebenslange Recht eingeräumt, auf dem Hof wie ein „Hauskind" zu leben. ,Die Tochter hat allerdings die Pflicht, in standesgemäßer Weise und nach Kräften %u des Hofes Besten nach Anweisung des Übertragsnehmers mitzuarbeiten."'69 In vielen Borgeler Familienverträgen finden sich solche Regelungen, mit denen Menschen sich einen Platz zum Leben ohne die Gründung einer Familie und eines eigenständigen Hausstandes sicherten oder von ihren Eltern zugesichert bekamen. Dabei ging es nicht darum, kranke oder lebensuntüchtige Menschen zu versorgen, sondern um alternative Lebensentwürfe. Von einiger Bedeutung war dabei sicherlich das Erbrecht, das Vermögen schon beim Tod eines Elternteils zu Gemeinschaftsbesitz werden ließ — eine gute Ausgangsposition für die Verhandlungen um familiäre Ressourcen. Dennoch ist es erstaunlich, dass solche Regelungen in Löhne nicht vorkommen. Kranke Kinder wurden wohl versorgt, aber dass jemand seine Abfindung einsetzte, 67 68 69
StAM Grundakten Soest, Nr. 5457, S. 21. StAM Grundakten Soest, Nr. 5457, S. 36. Weber, Menschen und Familien, S. 206.
164
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
um im Elternhaus zu bleiben und dort selbständig, aber nicht allein zu leben, war kein alternativer Lebensentwurf. Die einzige überlieferte Ausnahme waren die Löhner Eheleute Carl Brackmann (ID 12975), ein Schmied, und seine Frau Louise Tiemann (ID 12995), die im Jahr 1885 ein Testament aufsetzten. Darin vermachten sie ihrem Sohn Friedrich, der ebenfalls das Schmiedehandwerk gelernt hatte, ihr Vermögen. Ihre Töchter behandelten sie aber höchst ungleich. „Unser Erbe ist verpflichtet: 1.) unserer Tochter llsabein die uns treulich gepflegt hat 2400 Mark in bar, ferner ein vollständiges Bett nebst Bettstelle, 2 Stühle, 1 Tisch, 1 Koffer und das vorhandene Webegestell mit sämtlichem Zubehör herauszugeben. Auch soll unsere genannte Tochter solange sie unverheiratet bleibt die an der rechten Seite des Hauses belegene kleine Stube nebst Kammer ohnejede Mietsentschädigung als Wohnung behalten. 2.) unserer jüngsten Tochter Anna Maria hat unser Erbe mit Rücksicht darauf, dass dieselbe seit ihrer Konfirmation auswärts dient, ihr Auskommen dadurch erwirbt und von uns noch unterstütz wird 600 Mark heraus^u^ahlen" Gottlieb, der jüngere Sohn, sollte 1800 Mark und einen Koffer erhalten.70 llsabein Brackmann hat von ihren Eltern ein unbegrenztes Wohnrecht in ihrem Haus zugesichert bekommen, auch über den Tod der Eltern hinaus. Dies geschah aus Dankbarkeit und als Lohn für ihre Pflege; immerhin war sie zu diesem Zeitpunkt mit 36 Jahren schon weit aus dem in Löhne üblichen Heiratsalter heraus. Die ihr zugesicherten Rechte waren in Löhne eine Ausnahme, und sie enthielten nicht einmal den in Borgeln üblichen Anspruch auf Unterhalt. Kinder durften nach Hause kommen, wenn sie krank oder für kurze Zeit ohne Arbeit waren — als Lebensmodell war diese Option nicht vorgesehen. Einen Platz zum Leben fand man in der Ehe, ob mit eigenem Besitz oder in einem Heuerlingshaus. In Borgeln war dagegen ein erheblicher Anteil der erwachsenen Bevölkerung ledig; viele blieben es ihr Leben lang und fanden Wege, die daraus in Not und Alter entstehenden Probleme zu lösen.71 6.1.4 Familienwirtschaft, Einkommensgesellschaft und Erweckungsbewegung In der historischen Familienforschung werden Ledigenanteile und Verheiratetenquoten in aller Regel unter dem Aspekt der Heiratshemmnisse gesehen. Im württembergischen Kiebingen hat Carola Lipp die restriktive Heiratspolitik der lokalen Elite als Ursache für ein steigendes Heiratsalter und höhere Ledigenquoten ausgemacht. Dem lag in dieser Perspektive ein Interessenkonflikt zugrunde: Junge Menschen auch aus der dörflichen Unterschicht wollten heiraten, oftmals mit begrenzten Mitteln; die wohlhabende Oberschicht nutzte dagegen die Ehegesetze, um die Zahl der mittellosen Familien möglichst gering zu halten. Das relativ hohe Heiratsalter führt Lipp auf die Schwierigkeit zurück, einen ausreichend großen Heiratsfond zusammen zu bekommen, um eine Heiratserlaubnis zu erhalten; die steigende Ledigenquote zeugt demnach von gescheiterten Hei70 71
StAD, D 23 B, Nr. 50245, S. 8. Zu den Mitteln der Alterssicherung siehe auch Bracht, Vermögensstrategien westfälischer Bauern, Kap. 6. Dort wird gezeigt, dass sogar Sparguthaben eingesetzt wurden, um eine Leibzucht (ursprünglich ein Altenteil für ehemalige Hofbesitzer) zu erlangen.
Heirai als Option
165
ratsambitionen. Dieser Interpretation liegt die Vorstellung zugrunde, dass Menschen im 19. Jahrhundert in aller Regel eine Familiengründung anstrebten; sie wurde jedoch manchen verwehrt.72 Ehmer hat darauf hingewiesen, dass Gesindedienst oftmals mit einem hohen Heiratsalter einherging; auch hier spielte das Ansparen eines Heiratsfonds eine wichtige Rolle. Nur selten kam es allerdings zu so extrem hohen Anteilen dauerhaft Lediger, wie sie in den österreichischen Zentralalpen üblich waren — zum Teil blieben hier weit über die Hälfte der über 45 Jahre alten Männer lebenslang unverheiratet.73 Für diese Bereiche kann man daher nicht mehr von ,life-cycle-servants' sprechen, es handelt sich um ,tife-time-servants'. Diese Extremform einer zentraleuropäischen Gesindegesellschaft zeigt aber, dass Heiratsmuster nicht ausschließlich ökonomisch begründet sind. Der Gesindestatus hatte in diesen inneralpinen Regionen eine spezifische soziale Qualität und war eben keine der Familiengründung vorgelagerte Phase im Lebenszyklus. Insbesondere für Gesinde ohne familiäre oder verwandtschaftliche Bindungen an den Dienstherren ist daher von Zwangszölibat gesprochen worden.74 Auch andere Autoren, wie John W. Cole und Eric R. Wolf oder Tamäs Färago, haben daraufhingewiesen, dass kulturelle Vorstellungen das Heiratsverhalten ganz entscheidend mitbestimmten, über ökonomische, ethnische und erbrechtliche Grenzen hinweg.75 Der Vergleich des Heiratsverhaltens in den beiden westfälischen Gemeinden hat gezeigt, dass in den unterbäuerlichen Schichten zwar später geheiratet wurde, insbesondere die Bräute der Bauern waren etwa zwei Jahre jünger als die Heuerlingsfrauen und Tagelöhnerinnen. Deutlich stärker als der schichtenspezifische Unterschied war jedoch der zwischen den untersuchten Orten. Das durchschnittliche Heiratsalter der Bauern und Nicht-Bauern lag in Löhne nur etwa ein Jahr auseinander, in Borgeln nicht einmal ein halbes Jahr; die Löhner heirateten aber bereits in ihren mittleren Zwanzigern, die Borgeler erst mit etwa 30 Jahren. Bei den Frauen sind die Unterschiede zwischen den Schichten jeweils etwas größer, die zwischen den beiden Gemeinden nicht ganz so ausgeprägt, aber auch hier gilt, dass man eher von einem lokalspezifischen als einem schichtenspezifischen Heiratsverhalten sprechen kann.76 Erklären kann man diesen Unterschied zwischen einer Gesellschaft mit alternativem Lebensmodell und einer, in der Ledige zwar vorhanden, aber ohne ,Platz' waren, auf zwei Wegen. Zum einen ist die ostwestfalische Region bis lange ins 19. Jahrhundert hinein tief geprägt von der Sozialstruktur des protoindustriellen Heuerlingswesens. Diese
72 73 74 75
76
Kaschuba / Lipp, Dörfliches Überleben, S. 312ff. Ehmer, Heiratsverhalten, S. 127ff. Ehmer, Heiratsverhalten, S. 129. John W. COLE und Eric R. WOLF: Die unsichtbare Grenze. Ethnizität und Ökologie in einem Alpental, Wien 1995, Kapitel 10; Tamäs FARAGO: Formen bäuerlicher Haushalts- und Arbeitsorganisationen in Ungarn um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in: Josef EHMER und Michael MITTERAUER (Hg.), Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften, Wien 1985, S. 103-184. Siehe Tabelle A 3 im Anhang.
166
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
nur bedingt traditionelle, im 18. Jahrhundert zur vollen Ausprägung gekommene Sozialform verband Familien auf Höfen, zwar in unterschiedlichen Rollen, aber in funktionaler Ergänzung zueinander.77 Die Heuerlingshäuser wurden an Familien vermietet, die gemeinsam protoindustrielle Produkte (hier vor allem Garn) herstellten, bei Bedarf aber ihre Arbeitskraft dem Bauern zur Verfügung stellen mussten. Bauern vermieteten an Familien und nahmen die Leistungen der verschiedenen Familienmitglieder in Anspruch, für Frauen- und Männerarbeit und für das, was halbwüchsige Kinder leisten konnten. In Borgeln gab es dagegen zwei Formen von landwirtschaftlicher Lohnarbeit, und bei beiden spielten Familien keine Rolle. Neben dem in der Regel unverheirateten Gesinde verrichteten Tagelöhner die anfallenden Arbeiten, und betrieben oftmals nebenher noch ein Handwerk. Die wirtschaftliche Prosperität der Agrarproduktion und die ausgeprägte Bedeutung des Arbeitsmarktes ließ die Hellwegregion schon früh Züge einer Einkommensgesellschaft annehmen, in der jeder — auch ohne Familie — sein Auskommen finden konnte. In einer solchen Gesellschaft war auch Platz für Ledige, zumal wenn sie sich über ihre Erbabfindung einen ,Platz' in einem Haus sichern konnten. Zum anderen muss man aber auf den hohen Stellenwert hinweisen, den die Ehe in der ostwestfalischen, durch die pietistische Erweckungsbewegung geprägten Region sicherlich hatte.78 Minden-Ravensberg war im 18. und 19. Jahrhundert ein Kerngebiet des Pietismus.79 Wichtige Protagonisten der Erweckungsbewegung wie Friedrich August Weihe (1721-1771) in Gohfeld und Theodor Schmalenbach (1821-1901) in Mennighüffen wirkten in unmittelbarer Nähe des Kirchspiels Löhne; letzterer allerdings erst nach 1863.80 Im benachbarten Kirchspiel Gohfeld hatte 1751 Friedrich August Weihe die Pfarrstelle angenommen. Im Laufe der nächsten Jahre erwarb er einen Ruf als bedeutender Prediger, unter anderem durch seine erfolgreichen Kollektenreisen nach Holland und Hamburg, und auch aus Löhne kamen Gläubige, um Weihe predigen zu hören.81 Pastor Gottreich Hartog, der 1763 nach Löhne kam, bemerkte die Anziehungskraft
77 78
79
80
81
Zu den Beziehungen zwischen Bauern und Heuerlingen siehe Schlumbohm, Lebensläufe. Zum pietistischen Eheverständnis siehe Andreas GESTRICH: Ehe, Familie, Kinder im Pietismus. Der „gezähmte Teufel", in: Hartmut LEHMANN (Hg.), Geschichte des Pietismus, Bd. 4. Glaubenswelt und Lebenswelten, Göttingen 2004, S. 498-521; zu Ostwestfalen Veronika JOTTEMANN: Im Glauben vereint. Männer und Frauen im protestantischen Milieu Ostwestfalens 1845-1918, Köln u.a. 2008. Gustav Adolf BENRATH: Die Erweckung innerhalb der deutschen Landeskirchen 1815-1888. Ein Überblick, in: Ulrich GABLER (Hg.) Geschichte des Pietismus. Bd. 3 : Der Pietismus im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert, Göttingen 2000, S. 150-271, hier S. 196. Benrath, Landeskirchen, S. 196; Christian PETERS: Pietismus in Westfalen, in: Martin BRECHT und Klaus DEPPERMANN (Hg.), Geschichte des Pietismus, Bd. 2 . Der Pietismus im 18. Jahrhundert, Göttingen 1995, S. 358-371, hier S. 360. Martin BRECHT: Friedrich August Weihe (1721-1771). Pietistischer Pfarrer, Liederdichter und Vorläufer der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung, in: Christian PETERS (Hg.), Zwischen Spener und Volkening. Pietismus in Minden-Ravensberg im 18. und frühen 19. Jahrhundert, Bielefeld 2002, S. 129-200.
Höfe und Häuser
167
des Gohfelder Pastors auf seine Löhner. Er griff zu einer ungewöhnlichen Maßnahme, indem er seine eigenen Gottesdienstzeiten so legte, dass er am Löhner Sonntagsausflug in die Gohfelder Pfarrkirche teilnehmen konnte.82 Generell waren aber gerade die ärmeren Schichten in den pietistischen Konventikeln vertreten, Kleinbauern und Heuerlinge.83 Über die religiöse Praxis der ostwestfalischen Gläubigen ist nicht viel bekannt; in der Regel wird eher das Wirken der Pastoren als die Wirkving auf die Gläubigen thematisiert.84 Dennoch liegt der Schluss nahe, dass das niedrige Heiratsalter und die ebenfalls niedrige Rate an nichtehelichen Geburten auf die Verbreitung der pietistischen Erweckungsbewegung zurückzuführen ist, zumal bei vorehelichen Schwangerschaften in der Regel versucht wurde, noch rechtzeitig zu heiraten.85 Die moralische Aufwertung der Ehe mag dazu beigetragen haben, dass in Löhne ein eigenständiges Leben jenseits der Familiengründung auf der Ebene formaler familiärer Vereinbarungen nicht vorgesehen war, und der Anteil dauerhaft Lediger hier verhältnismäßig niedrig war.
6.2 Höfe und Häuser: Besitztransfers zwischen Heirat und Erbabfindung In den beiden folgenden Teilkapiteln werden zwei Verfahren der Netzwerkanalyse zur Anwendung kommen, mit deren Hilfe man verdichtete Bereiche im Heiratsnetz finden kann. Zunächst (Kap. 6.2) werden die Heiratsbeziehungen zwischen den Löhner und Borgeler Höfen untersucht. Hierfür wurde die Komponentensuche gewählt, die sich für die Untersuchung mittelgroßer Netzwerke mit wenig dichten Beziehungen eignet. Hier werden Höfe als Akteure definiert, zwischen denen Menschen und Ressourcen zirkulieren; damit stellt sich auch die Frage nach Formen der Reziprozität innerhalb der landbesitzenden Schichten. Um genealogische Netzwerke zu untersuchen (Kap. 6.3), braucht es dagegen ein spezielles Verfahren. Ein solches Netzwerk zeichnet sich dadurch aus, dass Akteure sich mit Bezug auf ihre Beziehungen zunächst einmal kaum unterscheiden: Jeder Akteur entstammt einer Herkunftsfamilie, heiratet wahrscheinlich etwa einmal und hat eine überschaubare Anzahl von Nachkommen. Mit dem von Douglas R. White entwickelten PGraph-Verfahren kann man solche Netzwerke aber so umformen, dass man Kernbereiche verdichteter Verwandtschaftsbeziehungen fin82
Christof WlNDHORST: Kirchengeschichte in Löhne, in: HEIMATVEREIN LÖHNE UND DIE STADT LÖHNE (Hg.), 1000 Jahre Löhne. Beiträge zur Orts- und Stadtgeschichte, Löhne 1993, S. 323346, hier S. 333.
83
Josef MOOSER: Konventikel, Unterschichten und Pastoren. Entstehung, Träger und Leistungen der Erweckungsbewegung in Minden-Ravensberg, in: Josef MOOSER, Bernd HEY, Regine KRULL, Roland GLEßELMANN (Hg.), Frommes Volk und Patrioten: Erweckungsbewegung und soziale Frage in Ostwestfalen 1800-1900, Bielefeld 1989, S. 15-52.
84
Siehe aber Medick, Weben und Überleben in Laichingen, S. 447ff. Siehe Goslar, Nichteheliche Kinder; hier wird das Löhner Heirats- und Geburtenverhalten mit demjenigen in Borgeln kontrastiert.
85
168
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
den kann. Bei dieser Analyse von Abstämmlings- und Heiratsbeziehungen geht es also nicht um Reziprozitätsbeziehungen, sondern um verwandtschaftliche Endogamie. Ein Vorteil dieses Ansatzes ist, dass die unterbäuerlichen Schichten ohne Landeigentum, die immerhin den Großteil der Bevölkerung in den untersuchten Kirchspielen stellten, in diese Untersuchung einbezogen werden können.
6.2.1 Der Hof als Sozialgebilde Dietmar Sauermann identifiziert in seinem klassischen Artikel über die bäuerliche ,Hofidee' zwei Normensysteme, die in der (westfälischen) ländlichen Gesellschaft das Zusammenleben der Menschen bestimmten, und die sich aus den beiden Sozialordnungen Familie und Hof herleiteten.86 Der Vermittlung zwischen diesen oftmals konkurrierenden Normsystemen dienten die bäuerlichen Verträge, wie sie im vorhergehenden Abschnitt untersucht wurden. In diesen Übergabe- und Altenteilsverträgen wurden zwischen den konkurrierenden Autoritätsansprüchen des alten Vaters als Familienoberhaupt und des jungen Bauern als Hofeigentümer vermittelt, und die Rechte und Pflichten der einzelnen Familienmitglieder festgeschrieben.87 Die besondere Bedeutung, die der Beziehung der Individuen zum ,HoP zukommt, ist für das Löhner Kirchspiel bereits untersucht worden. Die Bestimmungen in den bäuerlichen Familienverträgen bezogen sich nämlich nur zum Teil auf innerfamiliäre Angelegenheiten, daneben wurden oftmals Ansprüche, Rechte und Pflichten erläutert, die eine besondere Beziehung zwischen Mensch und Hof erkennen lassen. So war zur Verpflegung der Altenteiler zwar zunächst das Kind verpflichtet, das den Hof übernahm. Letztlich richteten sich die Rechte der ehemaligen Bauern aber gegen den Hof selbst, etwa wenn der Übernehmer oder die Übernehmerin vor den Eltern verstarb und der Hof über eine erneute Eheschließung in fremde Hände kam. Die Ansprüche der ehemaligen Eigentümer konnten dann als Belastung auf dem Grundbuchblatt des Hofes verzeichnet werden und waren vom jeweiligen Eigentümer zu leisten. Ähnliches gilt auch für diejenigen Kinder der alten Bauern, die in der älteren Literatur oft als .weichende Erben' bezeichnet werden. Diese Nebenerben konnten zwar nicht die Nachfolge auf dem Hof antreten, wurden aber im Zuge von Erbregelungen abgefunden. Auch die Geschwister konnten ihre Rechte auf dem Grundbuchblatt des Hofes eingetragen lassen, so dass etwaige neue Eigentümer diese Last mit dem Hof erwerben würden. Umgekehrt verpflichteten sich Familienmitglieder oftmals, ,zu des Hauses Besten' zu wirken, und zwar sowohl die jungen Leute als auch die Altenteiler.88 Man kann also festhalten, dass der ,HoP ein Sozialgebilde besonderer Qualität war, das in einem vielfältigen Beziehungsgeflecht zu den ihn umgebenden Menschen stand. 86
87 88
Für eine ausführliche Diskussion der Herkunft einer ,Hofidee' und der Problematik dieses Ansatzes siehe Kap. 2, S. 34ff. Sauermann, Hofidee, S. 59f. C. Fertig, Hofübergabe, S. 75ff.
Höfe und Häuser
169
Allerdings darf man sich die Rolle des Hofes als handlungssteuerndes .Normensystem' nicht zu dominant vorstellen. Die mit der Vorstellung von einer,Hofidee' oft einhergehende Annahme, dass „die Individualität des einzelnen (...) übersehen" wurde und der Hof das eigentliche „Bindeglied zwischen ihnen" war, greift zu weit.89 Wie an einem Datensatz zu den Kirchspielen Borgeln und Oberkirchen (Kreis Schmallenberg, Sauerland) gezeigt werden konnte, lagen die Abfindungen für die Geschwister der Hofübernehmer etwa zwischen einem Drittel (für Oberkirchen) und zwei Dritteln (für Borgeln) der Summe, die bei Realteilung zu erwarten wäre. 90 Dass Hofbesitzer sich als „Treuhänder des Hofes" verstanden, die „im Sinne der Hofidee die Forderungen der ,eigentumslosen' Familienmitglieder (...) eingedämmt" haben, so dass auch die alten Bauern sich „nicht gegen die Willkür des Erben (...) sondern gegen die Forderungen, die der Hof durch den Jungbauern an sie stellte" absichern mussten, ist wohl eher den Ideen der zeitgenössischen bürgerlichen Beobachter geschuldet als dem bäuerlichen Verhalten.91 Die angemessene Versorgung aller Kinder war ein wichtiges Anliegen der bäuerlichen Familien, auch unter der Prämisse der ungeteilten Hofübergaben. Dass die Höfe in der ländlichen Gesellschaft als eigenständiges Sozialgebilde wahrgenommen wurden, kann man gut an der Praxis der Hofnamen festmachen. In der Regel behielten Männer bei der Heirat ihren Familiennamen, während Frauen in den Quellen sowohl unter ihrem Geburtsnamen als auch unter dem Familiennamen ihres Mannes erscheinen. Heiratete ein Mann auf einen Hof, also eine Erbin oder eine verwitwete Bäuerin, so wurde er in der Regel bald mit dem Hofnamen gerufen, und die Kinder wurden bei der Taufe unter diesem Namen eingetragen. Die Weitergabe des Namens an einen neuen Hofbesitzer hing aber nicht von den familiären Verbindungen ab; sie fand bei einem Verkauf an einen Familienfremden genauso Anwendung wie bei einer Vererbung. Diese Praxis war in allen untersuchten westfälischen Kirchspielen üblich.92 Tatsächlich wurde also der neue Besitzer dem Hof zugeordnet, indem seine Identität von nun an unter den Hof subsumiert wurde. So traten Männer wie Frauen bei der Heirat auf einen Hof in einen Sozialverband ein, mit dem ihre soziale Existenz von da an untrennbar verbunden war. Solche Bräuche sind auch für andere Regionen überliefert, etwa für das osnabrückische Belm oder auch für Dörfer im Westen Bulgariens. 93 89 90 91 92
93
Bringemeier, Gemeinschaft. C. Fertig/G. Fertig, Bäuerliche Erbpraxis, S. 180. Sauermann, Hofidee, S. 61 und 76; siehe auch Rouette, Bauer. Siehe hierzu auch Heinz-Günther BORCK: Die Verwendung von Hofnamen als Familiennamen im Regierungsbezirk Osnabrück seit 1815, in: Osnabrücker Mitteilungen 78 (1971), S. 117-130; Roland LINDE: Familienname conta Hofname. Konkurrierende Formen bäuerlicher Namensvererbung in Wittgenstein und Lippe, in: Uta HALLE (Hg.), Dörfliche Gesellschaft und ländliche Siedlung. Lippe und das Hochstift Paderborn in überregionaler Perspektive, Bielefeld 2001, S. 121-145. Ana LULEVA: Dimensionen der Verwandtschaft in der westbulgarischen Alltagskultur, in: Ulf BRUNNBAUER und Karl K Ä S E R (Hg.), Vom Nutzen der Verwandten. Soziale Netzwerke in Bulgarien (19. und 20. Jahrhundert), Wien 2001, S. 138-162, hier S. 154; Schlumbohm, Lebensläufe,
170
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Diese Kontinuität des Hofes, die sich in der einheitlichen Benennung der Hofbesitzer ausdrückt, darf aber nicht mit einer Kontinuität der Besitzerfamilie im Sinne einer Abstammungsfamilie verwechselt werden; dies hat Schlumbohm für Belm klar gezeigt. Höfe wurden nicht selten an andere als die eigenen Kinder vererbt oder weitergegeben. Dabei war besonders die Praxis der Wiederheirat von Bedeutung.94 Aber auch die relativ häufige Weitergabe eines Hofes an eine Tochter verdeutlicht, dass man die Vater-Sohn-Erbfolge nicht als Norm, sondern als eine von mehreren Optionen verstehen muss.95 Damit ist aber auch deutlich geworden, dass man in Nordwestdeutschland vergeblich nach patrilinearen Abstammungsgruppen, nach generationenübergreifenden Familien oder anderen stabilen Verwandtschaftsgruppen suchen wird. Stabil über Jahrzehnte hinweg waren die Höfe, die Familien waren es nicht. Für die Untersuchung der Heiratsbeziehungen bietet es sich daher an, die Höfe und Häuser der beiden Kirchspiele zum Ausgangspunkt der Analyse zu machen. Diese Perspektive nimmt zugleich einen Aspekt in den Blick, der für Gebiete mit ungeteilter Hofübergabe als zentral galt: Der Fluss der Abfindungen zwischen den Höfen.96 Dass der einheiratende Ehepartner eine substantielle Geld- oder Naturalabfindung mit auf den Hof brachte, gilt als unumgängliche ökonomische Notwendigkeit. Da die Erhaltung des Hofes ein zentraler Faktor bei der Heiratsentscheidung gewesen sei, hätten die Hoferben ,standesgleiche' Heiratspartner finden müssen.97 Im folgenden Abschnitt werden neben Höfen auch Klein- und Kleinstbesitzungen untersucht. Diese Häuser, oftmals ausgestattet mit einem Garten, aber kaum Ackerland, gehörten in der Regel Tagelöhnern und kleinen Handwerkern. Die Grenze zwischen diesen beiden Gruppen ist aber nicht sehr klar; es gibt vereinzelte Hinweise darauf, dass die meisten Handwerker bei Gelegenheit auch landwirtschaftliche Lohnarbeit ausführten, etwa in den Spitzenzeiten der Ernte. Deshalb kann man die Landbesitzer in dieser Region grob in zwei Kategorien einteilen, in (Vollerwerbs)Bauern und alle anderen, die ihr Einkommen durch Lohnarbeit generierten und hier im Folgenden
94 95
96
97
S. 506; Lanzinger, Das gesicherte Erbe, beobachtet dagegen eine Dualität von Hof- und Familienname; demnach wäre für Innichen (Tirol) „sowohl von einer Kontinuität des Hauses oder Hofes als auch Kontinuität der Familie" (S. 231) auszugehen. Schlumbohm, Lebensläufe, S. 451ff. In Belm gingen etwa ein Viertel der intergenerationellen Hofübergaben an Töchter, knapp drei Viertel an Söhne (sonstige u. unbekannte Fälle nicht berücksichtigt): Schlumbohm, Lebensläufe, S. 383f. Für Löhne waren bei einer früheren Untersuchung ein Drittel Hofübernehmerinnen gefunden worden (C. Fertig, Hofübergabe, S. 73), ebenso für Borgeln; für Westfeld im Kirchspiel Oberkirchen immer noch 29,2%: Siehe Volker LÜNNEMANN: Der Preis des Erbens. Besitztransfer und Altersversorgung in Westfalen, 1820-1900, in: Stefan BRAKENSIEK, Michael STOLLEIS und Heide WUNDER (Hg.): Generationengerechtigkeit? Normen und Praxis im Erb- und Ehegüterrecht 1500-1850, Berlin 2006, S. 139-162, hier S. 146ff. Claverie / Lamaison, Ousta, S. 271 ff.; Lamaison, Stratégies matrimonial; Bourdieu, Heiratsstrategien, S. 274ff.; Schlumbohm, Lebensläufe, S. 418f.. Siehe die ausführliche Diskussion bei Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, S. 190ff.
Höfe und Häuser
171
unter dem Begriff der Tagelöhner summiert werden. Die günstige Quellenlage ermöglicht also auch eine Untersuchung der unterbäuerlichen Schichten. Da es im Deutschen keinen gängigen Oberbegriff für Höfe und Häuser gibt, wird im nächsten Abschnitt an einigen Stellten von ,HoF gesprochen, auch wenn Kleinstbesitzungen ebenfalls gemeint sind. Nur wenn ausdrücklich die soziale Schicht genannt wird, bezieht sich der Ausdruck nur auf ein Segment der bäuerlichen Hof- und unterbäuerlichen Kleinstbesitzer.
6.2.2 Heiratsmobilität zwischen Höfen und Häusern Im diesem Abschnitt werden Heiraten untersucht, bei denen der Hoferbe bzw. die Hoferbin einen Partner auf einem anderen Hof in Löhne oder Borgeln gefunden hat. Ausgeklammert werden Heiraten, bei denen über die Herkunft des Partners wenig bekannt ist - weil ihre Eltern keinen Hof besaßen oder weil der Besitz der Eltern außerhalb des Kirchspiels lag. Damit werden auch die Heiraten der den Hof verlassenden Geschwister nicht vollständig erfasst. Viele von ihnen verließen das Kirchspiel, um sich anderswo zu verheiraten, oder sie ließen sich als einfache Tagelöhner oder Heuerlinge ohne Grundbesitz nieder. Tabelle 6.2: Intergenerationelle Mobilität von Bauern und Hausbesitzern, Löhne 1750-1869 Heiratskohorten
1750-1789
1790-1829
1830-1869
N = 53
N = 57
N = 48
% aufwärtsmobil
15,1
15,8
14,6
% abwärtsmobil
34,0
40,4
41,7
% mobil
49,1
56,1
56,3
% strukturell mobil
13,2
29,8
27,1
% zirkulär mobil
35,8
26,3
29,2
4,1 4,3
4,4
8,2 +
L2
5,1
10,9*
Gamma
0,375 +
0,070
0,453*
Kendall's Tau-b
0,216 +
0,037
0,292*
Somer's d1^
0,231 +
0,040
0,297*
Pearsons chi 2
Anm.: Die Besitzungen wurden in große Höfe (ab 7,5 Hektar/45 Taler Reinertrag), kleine Höfe (zwischen 2,75 und 7,5 Hektar / 17 und 45 Taler Reinertrag) und Kleinstbesitzungen (unter 2,75 Hektar /17 Taler Reinertrag) unterteilt; siehe Tabelle A4 im Anhang. a)
abhängige Variable: Eigene Schicht. Signifikanzniveau: + 10%, * 5 % , ** 1 %.
Quelle: Datenbank Löhne.
172
Kapitel 6: Heiraten auf dtnt Dorf
In Löhne waren Heiraten zwischen den Höfen durch eine recht hohe Mobilität der Bauernkinder geprägt. 98 In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts konnte die Hälfte der Geschwister von Hoferben, die selbst wiederum auf einen Löhner Hof heirateten, den Status der Eltern erhalten. Sozialer Aufstieg war durchaus möglich, immerhin gelang durchschnittlich 15% dieser Gruppe die Heirat in eine Familie aus einer höheren Schicht. Allerdings beziehen sich diese Anteile auf nur auf diejenigen Geschwister, denen eine Einheirat in einen andern Hof im Kirchspiel gelang. Abwärtsmobilität, die als charakteristisch für die ostwestfalische Klassengesellschaft gilt, betraf etwa ein Drittel der auf einen Hof heiratenden Geschwister — hinzu kamen noch diejenigen, die nicht auf einen Hof geheiratet haben, sondern besitzlose Heuerlinge, Tagelöhner oder Handwerker wurden. Ihr Anteil an allen Geschwistern lag im Zeitraum 1830-1869 bei etwa 46%, weitere 15% konnten einen kleinen Hof gründen oder erwerben und galten als Neubauern." Von denen, die im Kirchspiel blieben, konnte also insgesamt gerade mal ein Fünftel der Geschwister den Status des Hoferben und der Eltern halten. Dabei muss man aber in Rechnung stellen, dass Kinder ihre Heimat verließen, um sich in der Umgebung niederzulassen, so wie auch Heiratspartner in die hier untersuchten Kirchspiele kamen (siehe Tabelle 6.5). In Löhne kam etwa ein Drittel der Heiratspartner aus der näheren Umgebung des Kirchspiels - dort wird es auch Gelegenheiten für .vorteilhafte' Heiraten der Bauernkinder gegeben haben. Die Abwärtsmobilität der Geschwister wird wohl eher überschätzt, wenn man nur auf die im Kirchspiel verbleibende Bevölkerung schaut. Dennoch war die Mobilität in Löhne recht hoch, mit einem hohen Anteil an struktureller Mobilität. Letztere geht zu einem guten Teil auf die Dominanz der Großbauernkinder als Heiratspartner für die Erben von kleineren Höfen zurück. 100 Die starke Abwärtsmobilität insbesondere der Großbauernkinder war so für 98
99
100
Neben den kaum erklärungsbedürftigen Perspektiven der Richtung von sozialer Mobilität - also dem Auf- oder Abstieg auf der sozialen Leiter - kann man auch zwischen struktureller und zirkulärer oder auch individueller Mobilität unterscheiden. Strukturelle Mobilität ergibt sich aus der Veränderung der Sozialstruktur zwischen zwei Zeitpunkten, also etwa dem Anwachsen der Bevölkerung bei gleichzeitiger Konstanz bäuerlicher Stellen. Ein Teil der in einem solchen Fall zu beobachtenden Abwärtsmobilität ist demnach strukturell bedingt. Zirkuläre bzw. individuelle Mobilität meint demgegenüber die Differenz zwischen Gesamtmobilität und struktureller Mobilität, also die Neuverteilung über Positionen, die hier nicht der gesellschaftlichen Veränderung geschuldet ist. Siehe Hartmut ESSER, Soziologie. Spezielle Grundlagen, Band 2: Die Konstruktion der Gesellschaft, Frankfurt a.M. 2000, S. 181f., auch Pfister, Geburtenbeschränkung, S. 138f. Für den Zeitraum 1830-69 konnte der soziale Status eines großen Teils der Bevölkerung aus den Berufsangaben in den Kirchenbüchern ermittelt werden. Die in diesen Jahren heiratenden Hoferben hatten 87 in Löhne verbleibende Geschwister, die das Erwachsenenalter erreichten (d. h. sie wurden mindestens 20 Jahre alt), von denen 76 heirateten. Im bäuerlichen Stand verblieben 25 (33%), 27 sind der Schicht der Heuerlinge und Tagelöhner zuzuordnen (36%), weitere 11 kamen früher oder später in den Besitz einer Neubauerei (14%) und 8 wurden als Handwerker bezeichnet (11%). Siehe Tabelle A4 im Anhang. Zu struktureller und individueller Mobilität siehe Esser, Soziologie, S. 181 f.
Höfe und Häuser
173
Tabelle 6.3: Intergenerationelle Mobilität von Bauern und Hausbesitzern, Borgeln 1750-1869 Heiratskohorten % aufwärtsmobil % abwärtsmobil % mobil % strukturell mobil
1750-1789
1790-1829
1830-1869
N = 53
N = 57
N = 48
6,7
6,4
11,7
6,7
31,9
29,9
13,3
38,3
41,2
0
19,1
11,7
% zirkulär mobil
13,3
19,1
29,9
Pearsons chi 2
19,6**
20,7**
29,5**
19,0**
22,0**
32,6**
L
2
Gamma
1,000**
0,611**
0,704**
Kendall's Tau-b
0,844**
0,434**
0,513**
Somer's d*'
0,903**
0,428**
0,509**
Anm.: Die Besitzungen wurden in große Höfe (ab 5,5 Hektar / 1 0 0 Taler Reinertrag), kleine Höfe (zwischen einem und 5,5 Hektar/ 17 und 100 Taler Reinertrag) und Kleinstbesitzungen (unter einem Hektar / 17 Taler Reinertrag) unterteilt; siehe Tabelle A5 im Anhang. a)
abhängige Variable: Eigene Schicht. Signifikanzniveau: + 10%, * 5%, ** 1 %.
Quelle: Datenbank Borgeln.
einen großen Teil der intergenerationellen Mobilität verantwortlich. Allerdings waren in Löhne die Chancen für einen sozialen Aufstieg auch relativ gut, in Borgeln war sie deutlich geringer. In Borgeln war der Zusammenhang zwischen dem Status der Eltern und dem eigenen Status deutlich stabiler. Die meisten jungen Leute kamen aus derselben Schicht wie der Erbe, mit dem sie die Ehe eingingen, nur ein Drittel heiratete über Schichtengrenzen hinweg. Auch hier gab es den sozialen Aufstieg von Kleinbauern- und Tagelöhnerkindern und soziale Absteiger, beides allerdings in geringerem Ausmaß.101 Dieser engere Zusammenhang zwischen der Schicht der Eltern und der eigenen, durch
101
Die hier genutzten Quellen lassen nur begrenzt Aussagen zu den Lebenswegen der Geschwister zu, die das Kirchspiel verließen. Hierfür müsste ein anderer, weiter greifender Quellenkorpus herangezogen werden, wie das etwa Friedrich Weber für die Blumrother Colonie Maas durchgeführt hat. Weber hat die Schicksale aller Kinder nachverfolgt, die auf dem Hof Maas in Blumroth zwischen 1700 und 1950 geboren worden sind: Sieben waren Hoferben, 13 haben in einen anderen Hof eingeheiratet, eine Tochter hat in eine Bäckerei mit Landwirtschaft eingeheiratet, ein Sohn auf eine Hausstelle, die aber mit Hilfe des elterlichen Erbes bald zu einem Kotten wurde. Ein Sohn ist in Soest eingebürgert worden, ein anderer hat studiert; ebenso hat eine Tochter einen Lehrer geheiratet. Nur das Schicksal eines Sohnes ist unbekannt (Weber, Menschen und
174
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Tabelle 6.4: Herkunftsorte der Heiratspartner von Hofbesitzern, Löhne (1750-1874)
Kirchspiel Land Städte* >20 km Summe
Großbauern N % 50,7 70 30,4 42 23 16,7 3 2,2 138 100,0
Kleinbauern N % 96 55 32,9 16 9,6 -
167
-
100,0
Kleinstbesitzer N % 50 56,2 28 31,5 11 12,4 -
89
-
100,0
Summe N % 216 54,8 125 31,7 50 12,7 3 0,8 394 100,0
Anm.: * Herford und Bünde. Quelle: Datenbank Löhne.
Heirat erworbenen Schichtzugehörigkeit wird auch durch die in Tabellen 6.2 und 6.3 angeführten Zusammenhangsmaße bestätigt. Der Borgeler Heiratsmarkt wurde weniger stark von den Großbauernkindern dominiert, wodurch die Chancen der Kinder von kleinen Höfen besser waren, ihren Status über die Heirat mit einem Erben eines kleinen Hofes halten zu können.102 Insbesondere die strukturelle Mobilität war hier deutlich geringer als in Löhne; in den mittleren Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts war die Mobilität auf 41,2% angestiegen, strukturell mobil waren aber nur 11,7%. In Löhne wurde der Heiratsmarkt klar von den Kindern der größeren Bauern dominiert: 58% der Heiratspartner kamen in Löhne von einem großen Hof; in Borgeln waren es nur 39%.103 Die Chancen der Kinder aus den mittleren und auch unteren Schichten auf eine vorteilhafte Heirat waren in Borgeln also besser. Dies hatte aber auch Konsequenzen für die finanzielle Lage der Hoferben, besonders auf den kleineren Höfen: Wenn weniger Großbauernkinder auf die Höfe der Kleinbauern heirateten, blieben diese größeren Vermögen der lokalen Mittelschicht vorenthalten. Die Dominanz der Großbauernkinder auf dem Löhner Heiratsmarkt führte dagegen in jeder Generation zu einem Ressourcenfluss von den reicheren zu den weniger wohlhabenden Bauern.
102
103
Familien, S. 246f.). Umgekehrt kamen zwischen 1777 und 1930 drei der fünf Ehepartner von Hofbesitzern aus benachbarten Kirchspielen, die Mobilität über Kirchspielsgrenzen hinweg war also beträchtlich (ebd., S. 250). Siehe auch Tabellen A4 und A5 im Anhang: In Löhne kam nur jeder dritte Ehepartner auf einem kleinen Hof selbst aus dieser sozialen Schicht, während jeder zweite Partner von einem großen Hof kam. In Borgeln kamen dagegen jeweils knapp die Hälfte der Partner von großen bzw. kleinen Höfen. Andererseits stiegen Kindern von Kleinbauern in Borgeln häufiger in die Schicht der Kleinstbesitzer ab (37%, in Löhne nur 21%), die Aufstiegschancen waren hier ausgesprochen gering. Siehe Tabellen A4 und A5 im Anhang.
Höfe und Häuser
175
Tabelle 6.5: Herkunftsorte der Heiratspartner von Hofbesitzern, Borgeln (1750-1874) Großbauern Kirchspiel Land Städte* > 2 0 km Summe
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
Summe
N
%
N
%
N
%
N
%
60
72,3 19,3 6,0
88 13 8
80,7
114 17
78,6 11,7
262
77,7
7,6
46 24
13,6
11 3
2,1
5
7,1 1,5
145
100,0
337
100,0
16 5 2 101
2,4 100,0
11,9 7,3 -
109
-
100,1
Anm.: * Soest. Quelle: Datenbank Borgeln. Hinsichtlich der geographischen Herkunft der Heiratspartner unterschieden sich die beiden Untersuchungsorte nur wenig. In Löhne war nur etwa die Hälfte der Heiratspartner bereits im Kirchspiel geboren, in Borgeln immerhin mehr als drei Viertel. Viele Heiratspartner kamen aus der näheren ländlichen Umgebung nach Löhne und Borgeln, ein gewisser Anteil auch aus nahe gelegenen Städten. 104 Allerdings — darauf wurde schon in Kapitel 3 hingewiesen - mussten Löhner ihr Kirchspiel verlassen, um in den nächsten Ort zu gelangen, während es im Kirchspiel Borgeln mehrere kleine Dörfer gab. Die Siedlungsform mag also einigen Einfluss auf Mobilität über Kirchspielgrenzen hinweg gehabt haben. 105 Zum Teil waren diese jungen Leute auch schon mit ihren Eltern nach Löhne gekommen und nicht erst bei ihrer Heirat zugewandert. Die in dieser Region übliche Vermietung von Häusern und Wohnungen an Heuerlinge führte zu einer hohen Mobilität, so dass die Grenzen der Kirchspiele von Menschen jeden Alters überschritten wurden.
104
105
Städtische Kirchspiele umfassen z.T. allerdings ländliche Bereiche und Dörfer. So sind in der Soester Petri-Pauli-Gemeinde bis heute zehn Dörfer der Soester Börde eingepfarrt, u. a. die unmittelbar an die Gemeinde Borgeln angrenzenden Orte Katrop, Meckingsen und Hattrop. Die Bewohner gingen in die im Stadtkern gelegene Kirche St. Petri und wurden auf dem Soester Friedhof begraben. Siehe Marga KOSKE: Hattrop bis um 1900, in: dies, und Heinz BRINKMANN, Aus 800 Jahren Hattroper Geschichte, Soest 1986, S. 9-85, und die Website der Kirchengemeinde http://www.petri-pauli.de/, Menüpunkt Geschichte (Zugriff vom 23.09.2009). Volker Lünnemann kommt für den Zeitraum 1670-1870 auf einen Anteil lokal endogamer Heiraten von knapp 90%. Allerdings dürften Datenprobleme das Ergebnis erheblich beeinflusst haben, da nur die Einträge in der Familienrekonstitution berücksichtigt wurden, für Borgeln aber nur selten auswärtige Geburtsorte verzeichnet sind. Hier sind auch Informationen aus anderen Quellen berücksichtigt worden, so dass der Anteil lokal endogamer Ehen geringer ist. Siehe Lünnemann, Wanderungsbewegungen.
176
Kapitel 6: Heiraten turf dem Dorf
Auch das Heiratsverhalten von Bauern und Taglöhnern unterschied sich nur wenig. Bauern mit größeren Höfen orientierten sich bei ihrer Partnersuche eher über die Grenzen der Kirchspiele hinaus; in beiden Gemeinden kam ein geringerer Anteil der Heiratspartner vom lokalen Heiratsmarkt, der für Kleinbauern und auch Tagelöhner wichtiger war. Einige wenige Großbauern holten Partner auf den Hof, die aus größerer Entfernung kamen. So heiratete Philipp Brinkmann (ID 13192) aus dem heute zu Bad Salzuflen gehörenden Schötmar im Juli 1853 Friederike Pahmeyer (ID 13193); die Eheleute bekamen 1862 den Hof Löhne königlich Nr. 24 übertragen. Der Colon auf Löhnebeck Nr. 8, Hermann Rahe (ID 17343), heiratete 1778 Catharina Hepermann (ID 17354) aus Biemke im Wiehengebirge (bei Minden), und Heinrich Stricker (ID18804), Colon auf Löhnebeck Nr. 19, brachte im April 1789 Elisabeth Overdiek (ID 18826) aus Spenge auf seinen Hof, einen Monat vor der Geburt der ersten Tochter. In Borgeln heiratete Heinrich Bimberg (ID 1473), Colon in Blumroth, die Friederike Wiemann (ID 1474) aus Lünern bei Unna. 106 Die Bauern auf den größeren Höfen hatten also Beziehungen, die über das lokale Umfeld hinausreichten, und sie sahen sich eher als die Kleinbauern auch dort nach adäquaten Heiratspartnern um.
6.2.3 Verdichtete Bereiche im Heiratsnetz und die Zirkulation der Güter Nachdem die Heiratsbeziehungen zwischen den Löhner und Borgeler Höfen und Häusern zunächst mit Hilfe von Mobilitätstabellen beschrieben worden sind, werden die beiden Heiratsnetze nun netzwerkanalytisch untersucht. Viele Höfe und Häuser der beiden Untersuchungsorte sind durch Heiratsbeziehungen verbunden. Sie werden als korporative Akteure verstanden, ähnlich den in der Netzwerkanalyse bereits oft untersuchten Unternehmen oder Verbänden. Dass es Individuen sind, die innerhalb dieser korporativen Akteure handeln und Entscheidungen fällen, bleibt davon unberührt. 107 Die Heiratsbeziehungen, die hier untersucht werden, sind gerichtete Beziehungen; ein
106
Bimbergs Vater (ID 1472) war seinerseits aus Unna gekommen, um eine ursprünglich aus Schwefe stammende Witwe auf dem Hof zu heiraten (siehe auch unten, S. 185). Der verstorbene Mann dieser Witwe (die seine dritte Ehefrau war), Friedrich Gösslinghoff (ID 245), war wiederum bei seiner zweiten Eheschließung auf den Hof gekommen, den seine zweite Ehefrau von ihrem ersten Ehemann geerbt hatte. Bevor Heinrich Bimberg den Hof geerbt hat, war dieser also viermal an überlebende Witwer bzw. Witwen gegangen, von denen mehrere nicht aus dem Ort kamen. Vielleicht liegt darin die Wurzel des langjährigen Nachbarkeitsstreites zwischen den Familien Bimberg und Maas. Die Witwe Friderike Wiemann führte nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1844 den Hof bis in die 1870er Jahre eigenständig und stellte für die Bewirtschaftung Verwalter ein (belegt in Prozessakten im Hofarchiv Maas, Blumroth). Ihr einziger Sohn schrieb seine Lebenserinnerungen auf, die 1911 unter dem Titel „Es war einmal" in Soest erschienen: Emil BIMBERG: Es war einmal. Lebensweise, Sitten und Gebräuche im Amt und Kirchspiel Borgeln und der Soester Börde; Lebens-Erinnerungen eines Landwirts der Niederbörde, Soest 1911. Siehe auch Weber, Menschen und Familien, S. 184f.
107
Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, Kap. 4.
Höfe und Häuser
177
Partner verlässt den elterlichen Hof, heiratet auf einen anderen und bringt dabei seine Erbabfindung mit. Dabei ist es unerheblich, ob eine Frau auf einen Hof einheiratete oder ein Mann; in beiden Fällen bewegen sich Person und Ressourcen entlang dieser Linie vom elterlichen Hof zu dem des Ehepartners. Für beide Kirchspiele wurde jeweils ein Netzwerk erstellt, in dem alle zwischen 1750 und 1866 nachweisbaren Höfe und Häuser erfasst sind.108 Für Borgeln enthält das Netz 160, für Löhne 161 Höfe bzw. Häuser. Lässt man die Besitzungen ohne Informationen zum Grundbesitz (und damit zur sozialen Schicht) außen vor, so umfasst das Löhner Heiratsnetz für den Zeitraum 1750 bis 1874 insgesamt 156 Heiratsbeziehungen zwischen 152 Höfen und Häusern, das Borgeler Netz mit 123 etwas weniger Heiratsbeziehungen zwischen 156 Höfen und Häusern. Die Netze unterscheiden sich also hinsichtlich ihrer Größe und Dichte nur wenig, was die vergleichende Betrachtung erleichtert. Beide Netze sind nicht besonders dicht; wenn man das übliche Dichtemaß anwendet, das die realisierten zu allen potentiellen Relationen in Beziehung setzt, so erreicht das Löhner Netz einen Wert von 0,68%, das Borgeler Netz 0,51%. Die zugrunde liegende Annahme ist dabei, dass jeder Akteur mit jedem anderen eine Beziehung haben könnte. Nun ist diese Annahme für ein Heiratsnetz nicht realistisch; man kann nur dann mit einer Heirat rechnen, wenn ein Generationenwechsel stattfindet, also alle 25 oder 30 Jahre; bei einer Wiederheirat nach dem Tod eines Ehegatten verkürzt sich dieser Abstand. Man könnte also für jede Besitzung mit mindestens drei Eheschließungen für diesen Zeitraum rechnen. Dass die in den Quellen vorgefundene Zahl an Heiratsbeziehungen deutlich geringer ist, deutet zum einen darauf hin, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Heiratspartner nicht von einem Hof desselben Kirchspiels kam. Es gab auch durchaus sozialen Aufstieg, so dass auch die Heirat eines Tagelöhnerkindes auf einen Hof nicht prinzipiell ausgeschlossen war. Von größerer Bedeutung war hier aber der überlokale Heiratsmarkt, der die Grenzen des Kirchspiels überwand und Heiratspartner jenseits der lokalen Gesellschaft bereitstellte (siehe Tabellen 6.5 und 6.6). Die Netze, die hier untersucht werden, umfassen jeweils alle Höfe und Häuser der beiden Kirchspiele; außerhalb des Kirchspiels liegende Besitzungen wurden nicht einbezogen. Es wird danach gefragt, welche Struktur das lokale Heiratsnetz aufwies, und wie sich diese relationale Struktur zur sozio-ökonomischen Schichtung der Kirchspiele verhielt. Zwei Fragen liegen der Analyse zugrunde: (1) Welche Grundstruktur wies das Heiratsnetz in den beiden Gemeinden auf? In ethnologisch-strukturalistischer Perspektive ist nach den durch Heirat etablierten Austauschbeziehungen zu fragen, also nach Formen von restringierter und generalisierter Reziprozität. (2) Wie gut waren die sozio-ökonomischen Schichten integriert?
108
Mit dem Katasterquerschnitt von 1866 endet die Datenerfassung mit Bezug auf Landbesitz für alle Datenbanken. Die Kirchenbücher sind dagegen bis 1874 komplett erfasst, zum Teil auch darüber hinaus.
178
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Ziel der folgenden Analysen ist es, Kernbereiche im Netzwerk zu finden. Dafür muss man ein Verfahren wählen, das der Güte der untersuchten Daten angemessen ist.109 Bei Netzwerken, in denen es viele Beziehungen zwischen den Akteuren gibt, kann man etwa nach Cliquen suchen; eine Clique besteht aus mindestens drei Akteuren, die alle direkt miteinander verbunden sind. Empirisch sind solche Cliquen, etwa in Freundschaftsnetzwerken, selten größer als drei oder vier Akteure.110 Das Verfahren eignet sich nicht, um Heiratsbeziehungen (die in einem überschaubaren Zeitraum relativ selten geschlossen wurden) zwischen einer größeren Anzahl von Höfen zu untersuchen. Da das hier untersuchte Netzwerk der Heiratsbeziehungen zwischen Höfen eine relativ geringe Dichte aufweist, wurde das Verfahren der Komponentensuche gewählt.111 Dabei wird im Netz nach Komponenten (=Bereichen) gesucht, innerhalb derer alle Akteure miteinander verbunden sind. Die meisten Akteure sind dabei nur indirekt verbunden, die Anzahl der direkten Beziehungen muss nicht groß sein. Bedingung ist aber, dass von jedem einzelnen Akteur ein Pfad zu jedem anderen führt, alle Akteure einander also über mehr oder weniger lange Ketten von Zwischengliedern erreichen können. Ein Netz mit geringer Dichte, also relativ wenigen Beziehungen, kann dabei in mehrere kleine Komponenten zerfallen, die nicht miteinander verbunden sind. Nur wenn man in einem Netz eine große maximal verbundene Komponente112 findet, kann man so einen Bereich verdichteter Beziehungen, einen Netzwerkkern identifizieren.
109
110 111
1,2
Für einen Überblick siehe Volker G. TÄUBE: Cliquen und andere Teilgruppen sozialer Netzwerke, in: Christian STEGBAUER und Roger HAußLING (Hg.), Handbuch Netzwerkforschung, Wiesbaden 2010, S. 397-406. Siehe Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 195ff. Siehe zu theoretischem Konzept und zum Verfahren Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 91-99, hier besonders S. 97ff. Eine Blockmodellanalyse ist zwar für beide Heiratsnetze (und Patennetze) durchgeführt worden, die Ergebnisse waren allerdings sehr instabil und kaum zu interpretieren. Das ist zum einen darauf zurückzuführen, dass diese Methode sich v. a. für relative kleine Netzwerke mit dichten Beziehungen eignet. Zum anderen gibt es aber offensichtlich in den Heiratsnetzwerken der beiden untersuchten Orte keine entsprechende Rollenstruktur, die über eine Blockmodellanalyse zu identifizieren wäre. Maximal heißt, dass alle Punkte, die die Suchbedingungen erfüllen, in die Komponente gelangen; siehe Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 179.
Höfe und Häuser
179
180
Kapitel 6: Heiruten auf dem Dorf
In den Abbildungen 6.2 und 6.3 sind die Höfe in Löhne und Borgeln und die zwischen ihnen bestehenden Heiratsbeziehungen abgebildet. Sie sind mit ihren im frühen 19. Jahrhundert geltenden Adressen bezeichnet, soweit diese bekannt sind. 113 Die Höfe und Häuser sind nach ihren Größenklassen gekennzeichnet: Dunkle Punkte bezeichnen große Höfe und mittelgraue Punkte kleine Höfe, während hellgraue Punkte für unterbäuerliche Kleinstbesitzungen im Eigentum von Tagelöhnern und Handwerkern stehen. In beiden Kirchspielen sind etwa die Hälfte der Höfe durch Heiratsbeziehungen in einer großen Komponente miteinander verbunden, wobei manche Höfe nur eine direkte Beziehung zu einem anderen Hof haben, andere dagegen mit mehreren Höfen verbunden sind. Daneben gibt es in Borgeln kleine Komponenten, in denen nur zwei oder drei und in einem Fall sechs Höfe miteinander verbunden sind. Verbundenheit beruht hier in den meisten Fällen nicht auf direkten Beziehungen, sondern auf der Existenz von Pfaden, über die Höfe indirekt miteinander verbunden sind. Neben diesen lose miteinander verbundenen Höfen gibt es aber eine ganze Reihe anderer Höfe, die im Heiratsnetz isoliert sind. In Löhne ist das Netzwerk ähnlich strukturiert. Auch hier gibt es eine große, schwach verbundene Komponente, die den Kern des Heiratsnetzes ausmacht. Neben zwei kleinen, nur aus zwei Höfen bestehenden Komponenten, gibt es eine große Anzahl von isolierten Akteuren. Bereits mit bloßem Auge ist zu erkennen, dass die Höfe in Löhne stärker miteinander vernetzt sind als die Borgeler Höfe.
113
Siehe die Tabellen A6 und A7 im Anhang, in der Höfe mit Namen, Adressen und Größen aufgelistet sind.
182
Kapitel 6: Heiraten turf dem Dorf
Tabelle 6.6: Schwach verbundene Komponente und soziale Schichtung, Borgeln (1750-1874) Großbauern
Im Kernbereich
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
Summe
J»
25
25
33
(Zeikn-%)
(30,1)
(30,1)
(39,8)
(100,0)
(75,8)
(3^,9)
(51,9)
(Spoiten-%)
(80,6)
nein
6
(Zeilen-%)
83
8
59
73
(8,2)
(11,0)
(80,8)
(100,0)
(Spalten-%)
(19,4)
(24,2)
(64,1)
(48,1)
Summe
31
33
92
(Zeilen-%)
(19,9)
(21,2)
(59,0)
(Spalten-%)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
156 (100,0) (100,0)
Chi 2 : 27,2***; Cramér's V: 0,42. Quelle: Datenbank Borgeln.
Für Borgeln konnte eine große schwach verbundene Komponente identifiziert werden. Sie umfasst mit 81 Akteuren etwa die Hälfte der Höfe und Häuser; allerdings enthält sie vier Fünftel der großen und kleinen Höfe, aber nur ein Drittel der Häuser ohne nennenswerten Landbesitz. Die Borgeler Bauern waren also in der Regel über Heiratsbeziehungen miteinander verbunden, die hausbesitzenden Tagelöhner waren aber nur zum Teil in dieses Netz integriert. Allerdings gibt es eine Reihe von Höfen, die während dieser mehr als ein Jahrhundert umfassenden Periode keine Heiratspartner von einem anderen Borgeler Hof gewählt und auch kein Kind auf einen anderen Hof verheiratet haben. Diese Bauern hielten sich also vom lokalen Heiratsmarkt fern und suchten ihre Partner außerhalb der lokalen Gesellschaft. Es gab im Kirchspiel auch Gutshöfe, deren adelige oder auch bürgerliche Bewohner wenig mit der lokalen Dorfgesellschaft zu tun hatten: Gut Fahnen, Gut Broel im Besitz der Familie von Werthern und Gut Palmberg, dessen Besitzer ab 1821 der Kaufmann Friedrich Simons zu Soest war. Auf dem Hof Blumroth Nr. 1, der im Jahr 1825 bei seiner Aufnahme ins Grundbuch mit 47 Hektar und 376 Talern steuerlichem Reinertrag der drittgrößte Hof im Kirchspiel war, hat es im 19. Jahrhundert eine ganze Reihe von Ehen mit auswärtigen Heiratspartnern gegeben.114 1807 heiratete Stephan Gösslinghoff gt. Blumroth (ID 245) die aus dem angrenzenden Kirchspiel Schwefe stammende Wilhelmine Hohoff (ID 258). Nach seinem Tod heiratete die Witwe einen Bauernsohn aus Unna, Thomas Bimberg (ID 1472). Der 1812 geborene älteste Sohn der beiden, Heinrich Bimberg gt. Blumroth (ID 1473), brachte 1836 ein Jahr nach der Übernahme des elterlichen Hofes 114
Siehe Abbildung 6.2; der Hof mit der Bezeichnung B1 1 befindet sich im linken oberen Viertel des abgebildeten Netzwerkes.
Höfe und Häuser
183
Tabelle 6.7: Schwach verbundene Komponente und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Im Kernbereich
Großbauern
Ja (Zeilen-%) (Spalten-%) Nein
(Zeilen-%) (Spalten-%) Summe
(Zeilen-%) (Spalten-%)
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
29
35
21
(34,1) (93,5) 2 ßß)
(41,2) (89,7)
(24,7) (25,6)
4
61
(6,5)
(6,0) (10,3)
31
39
82
(25,7) (100,0)
(53,9) (100,0)
(20,4) (100,0)
(91,0) (74,4)
Summe 85
(100,0) (55,9) 67
(100,0) (44,1) 152
(100,0) (100,0)
Chi 2 : 66,47***; Cramer's V: 0,66. Quelle: Datenbank Löhne.
die 37jährige Friederike Wiemann aus Lünern als Braut auf den Hof. Allerdings kann es sich bei Heiratspartnern, die nicht aus dem Kirchspiel kamen, auch um Menschen aus dem nächsten Dorf handeln, wie etwa auf der Schulzen Colonie zur Nehlerheide (mit 362 Talern Reinertrag und 32 Hektar Land der fünftgrößte Hof im Kirchspiel):115 Georg Schulze zur Heide (ID 8063), heiratete etwa 1846 Sophia Crüsemann aus Klotingen (ID 8064). Auch seine Mutter Clara Schulze zur Heide (ID 8061) hatte einen Mann von außerhalb geheiratet, Ludwig Brauckhoff aus Recklingsen (ID 8062). Beide Partner kamen damit aus Dörfern, die nicht im Kirchspiel Borgeln lagen, aber nur gut 2 km entfernt waren. Ida Wiethaus (ID 8066), die Braut seines Sohnes Wilhelm Schulze zur Heide (ID 8065), kam dagegen aus Unna, also aus einer gut 30 km entfernten Stadt. Die Besitzer dieser beiden Höfe orientierten sich also auf einen überlokalen Heiratsmarkt, und beteiligten sich nicht an der Zirkulation von Personen und Gütern im Kirchspiel. Auch die Elisabeth Hape (ID 5468), Erbin des mit 7,3 Hektar und 113 Talern Reinertrag (für Borgeler Verhältnisse) eher kleineren Hofes ,Hapen Colonie zu Stocklarn', heiratete zunächst 1829 Heinrich Pannerich (ID 5461) aus Schmehausen (13 km entfernt), nach dessen Tod Franz Teimann (ID 5459) aus Nateln (5 km entfernt). Sechs Jahre vor ihrer ersten Heirat hatte sie eine Tochter geboren, deren Vater, ein Korbmacher aus Einecke „nachher meuchelmörderischer Weise nicht weit vom Hofe des Colon Windhüvelerschossen u>orden"n(> war.
1.5
1.6
Siehe Abbildung 6.2 ganz oben rechts; da die Adresse des Hofes nicht bekannt ist, ist er als „Schulze Nehlen" bezeichnet. Eintrag im Taufregister.
184
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Wenn man das Hof-Heiratsnetz für Löhne betrachtet, scheinen die Ergebnisse zunächst ähnlich zu sein. Auch hier haben einige Hofbesitzer sich nicht am lokalen Heiratsmarkt beteiligt, während die meisten Höfe in einer schwach verbundenen Komponente integriert waren (Tabelle 6.7). Der Anteil der Höfe außerhalb der Komponente ist zwar kleiner als in Borgeln (zusammen 8,6% der großen und kleinen Höfe, in Borgeln 21,9%), allerdings gab es im Kirchspiel selbst auch keine adeligen oder ehemals adeligen Güter. Unterbäuerliche Kleinstbesitzer waren in Löhne etwas schwächer mit dem Heiratsnetz der Bauern verbunden als in Borgeln (25,6%, in Borgeln 35,9%), was aber auf die weniger stark institutionalisierten Beziehungen zwischen Bauern und Tagelöhnern zurückzufuhren ist. In Löhne gab es bis ins 20. Jahrhundert hinein das Heuerlingssystem, in dem Bauern Häuser (ganz oder teilweise, mit oder ohne Landstücken) gegen Arbeitsleistung und Mietzahlung vermieteten. Hausbesitz im Sinne von Kleinstbesitz kam zwar bereits im 18. Jahrhunderts auf, aber die meisten Häuser entstanden erst im 19. Jahrhundert. 117 Wenn bäuerliche Familien ihre besitzlosen Verwandten unterstützen wollten, so nahmen sie sie als Heuerlinge auf den Hof — damit tauchen sie aber nicht als Hauseigentümer in den entsprechenden Quellen auf. In Borgeln gab es dagegen eine breite unterbäuerliche Schicht von Tagelöhnern, die zum Teil eigene Häuser besaßen. Es kam vor, dass Bauern ihre Kinder und Geschwister in dem Bestreben, zu einem eigenen Haus zu kommen, unterstützten. So hat Caspar Holtmann (ID 1237) etwa 1826/27 das Wohnhaus Borgeln Nr. 72 gebaut. Er hatte zwei Jahre zuvor im Testament seines Vaters 150 Taler, eine Kuh, ein Rind, einen halben Morgen (0,125 Hektar) Erbeland „an Holtmanns Garten" und ein weiteres, kleineres Stück Erbeland erhalten. Sein Bruder Heinrich Holtmann hatte ihm diesen Erbteil schon vor dem Tod des Vaters, der erst 1829 verstarb, ausgezahlt, damit er das Haus bauen konnte.118 Die relativ gute Integration der unterbäuerlichen Kleinstbesitzer in Borgeln beruhte wohl also auch auf dem Bestreben der bäuerlichen Eltern, ihre Kinder mit einem Haus auszustatten. Bei einem Netz mit gerichteten Beziehungen, in dem jede Beziehung einen Ausgangs- und einen Zielpunkt hat (also etwa einen Herkunfts- und einen eigenen Hof), kann man zusätzlich zwischen verschiedenen Graden an Verbundenheit unterscheiden. Schwach verbunden sind Komponenten, in denen alle Akteure verbunden sind (vor allem über indirekte Beziehungen), sofern man die Richtung der Beziehung nicht beachtet. Diese Verbindungen sind eher schwach ausgeprägt, da viele Akteure nur als Anfangs- oder Endpunkt eines Beziehungspfeils verbunden sind. So sind Höfe in einer schwach verbunden Komponente oft nur ,Geber' oder ,Nehmer' im Heiratsnetzwerk, um Reziprozitätsbeziehungen handelt es sich hierbei aber nicht. Stark verbunden sind dagegen Komponenten, in denen ein in eine Richtung durchgehender Pfad von jedem Akteur zu jedem anderen verläuft. In einer solchen Komponente gibt es keine 117
118
Leider ist die Gebäudemutterrolle für Löhne nicht überliefert, so dass es nur wenige und verstreute Informationen zum Hausbau gibt. StAM, Grundakten Soest Nr. 8962, S. 56 und Nr. 8895, S. 28.
Hofe und Häuser
185
Abbildung 6.4: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Borgeln (1750-1874), stark verbundene Komponenten
Anm.: Siehe Abbildung 6.2. Quelle: Datenbank Borgeln.
Sackgassen; jeder Akteur ist sowohl Ausgangspunkt als auch Ziel mindestens eines Pfeils. Auf die empirischen Heiratsnetze übertragen heißt das, dass jeder Hof in einer solchen starken Komponente sowohl Geber als auch Empfanger von Heiratspartnern und Ressourcen war.119 In Abbildung 6.4 sind nur diejenigen Borgeler Höfe dargestellt, die Teil einer solchen stark verbundenen Komponente sind. Hier gibt es nur zwei sehr kleine stark verbundene Komponenten. Zum einen gab es einen Heiratsring, der einen großen Hof, vier kleine Höfe und zwei (Tagelöhner-)Häuser miteinander verband:,Strumanns Colonie' in Stocklarn (St 11, 200 Taler jährlicher steuerlicher Reinertrag),,Berteis Hof in Borgeln (B 21, 56 Taler Reinertrag),,Schillers Colonie' in Hattropholsen (HH 7, 83 Taler Reinertrag), ,Clüseners Stelle' in Borgeln (B 14, 83 Taler Reinertrag), ,Keunings Colonie' in Borgeln (B 24, 94 Taler Reinertrag), und die Häuser Borgeln Nr. 31 (3 Taler Reinertrag) und Borgeln Nr. 38 (0,2 Taler Reinertrag). Eine weitere starke Komponente bildeten vier große Höfe:,Rüssen Colonie zu Fahnen' (B 3,338 Taler jährlicher steuerlicher Reinertrag), ,Windhüvels Colonie, Borgeler Linde' (B 6, 299 Taler Reinertrag), 1,9
Diese Terminologie folgt der in Pajek definierten Bezeichnung (de Nooy / Mrvar / Batagelj, Exploratory Social Network Analysis, S. 66ff.); ebenso Scott, Social Network Analysis, S. 103f. Jansen spricht dagegen für Komponenten, bei denen alle Akteure durch einen gerichteten Pfeil verbunden sind, von einseitig verbundenen Graphen. Stark verbunden sind demnach nur Graphen, die Pfeile in beide Richtungen zwischen jedem Paar aufweisen. Jansen folgt damit der Definition von Wasserman / Faust, Social Network Analysis, S. 275.
186
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
.Goesslinghoffsche Colonie' in Borgeln (B 7, 240 Taler Reinertrag) und die .Schulzen Colonie zu Witteborg' (B1 6, 319 Taler Reinertrag). Diese vier bildeten allerdings keinen Ring, sondern sie sind jeweils paarweise über direkte (mit Lévi-Strauss' Worten restringierte) reziproke Heiraten miteinander verbunden. In dieser reduzierten Abbildung ist gut zu erkennen, dass jeder dieser hier beteiligten Höfe jeweils mindestens einmal als Geber und als Nehmer an einem System zirkulierender Ressourcen beteiligt war. Darüber hinaus können diese Höfe durchaus auch Heiratsbeziehungen zu anderen Höfen gehabt haben, also etwa ein Kind dorthin verheiratet haben, ohne dass aus dieser Richtung jedoch etwas zurück gekommen wäre. Eine solche Verbindung ist in Abbildung 6.4 gut zu erkennen: Im Mai 1873 heiratete Wilhelmine Windhüvel (ID 1821), eine Tochter von der .Windhüvels Colonie' in Borgeln (B 6), auf den Hof .Schillers Colonie zu Hattropholsen' (HH 7). Der 36jährige Friedrich Schiller hatte den etwa 17 Hektar großen Hof (123 Taler Reinertrag) bereits 1864 von seinen Eltern übertragen erhalten.120 Er musste den Eltern allerdings den Nießbrauch und die Führung des Hofes überlassen und heiratete erst, nachdem die Mutter im Februar 1871 verstorben war. Bei dieser Heiratsbeziehung zwischen den beiden Höfen handelt es sich allerdings um eine Einbahnstraße; Heiratspartner und Ressourcen wandern nur von einem Hof zum anderen, aber der ,gebende' Hof erhält nichts aus diesem Bereich des Netzwerkes zurück. Die Höfe der beiden starken Komponenten in Abbildung 6.4 sind zwar über eine Heiratsbeziehung miteinander verbunden, aber es handelt sich nur um eine schwache, einseitige Verbindung. Das Borgeler Heiratsnetzwerk ist insgesamt nur schwach verbunden, es enthält keinen großen, stark verbunden Netzwerkkern, sondern nur einzelne Höfe, zwischen denen reziproke Heiraten stattfanden.
120
StAM, Grundakten Soest, Nr. 8951, S. 97.
Höfe und Häuser
187
Abbildung 6.5: Heiratsbeziehungen zwischen Höfen in Löhne (1750-1874), stark verbundene Komponente
Anm.: Siehe Abbildung 6.3. Quelle: Datenbank Löhne.
In Löhne waren dagegen ein Drittel der Höfe in in einer stark verbundenen Komponente miteinander vernetzt. Es gab einen Netzwerkkern mit 37 Höfen, zwischen denen 68 Heiratsbeziehungen bestanden. Der Kern war damit dichter als das Gesamtnetzwerk; die Dichte war hier mit 5,1% deutlich höher als im Gesamtnetz (0,68%). Diese Höfe waren zugleich Geber und Nehmer im Fluss der Personen und Ressourcen, hatten einen Heiratspartner und damit auch eine Abfindung von einem anderen Hof empfangen, und selbst ein Kind auf einem andern Hof untergebracht. Nur in dieser Gemeinde gab es also einen Netzwerkkern, in dem Beziehungen generalisierter Reziprozität zwischen Höfen zu beobachten sind, und in dem Heiratspartner und Ressourcen zwischen allen beteiligten Höfen zirkulierten. Hier war knapp die Hälfte der großen und kleinen Höfe so miteinander verbunden, dass jeder Hof sowohl Anfangs- als auch Endpunkt eines Pfeiles war. Jeder Hof hat also mindestens einmal ein Kind auf einen anderen Hof verheiratet, und ebenfalls mindestens einmal einen Ehepartner und dessen Erbabfindung von einem anderen Hof erhalten. Es gab in Löhne also ein System generalisierter Reziprozität, in das viele Höfe, aber nur wenige Kleinstbesitzungen eingebunden waren. Generalisierte Reziprozität und Eheschließungen von Partnern mit unterschiedlichem Status sind nach Lévi-Strauss nicht voneinander zu trennen.121 Eine ähnliche Struktur,
121
Siehe die Diskussion bei Edmund LEACH: Claude Lévi-Strauss zur Einführung, Hamburg 1991, S. 123.
Kapitel 6: Heiraten a*f dem Dorf
188
Tabelle 6.8: Stark verbundene Komponente und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Im Kernbereich
Großbauern
Ja (Zeilen-%) (Spalten-%)
15
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
17
5
37
( m
(100,0)
(40,5)
(45,9)
(48,4)
(43,6)
(6,1)
Summe
(24,3)
Nein
16
22
77
(Zeilen-%) (Spalten-%)
(119)
(19,1)
(67,0)
(100,0)
(51,6)
(56,4)
(93,9)
(75,7)
Summe
(Zeilen-%) (Spalten-%) Chi 2 :
115
39
82
(20,4)
(25,7)
(53,9)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
31
152
32,4***; Cramer's V: 0,46.
Quelle: Datenbank Löhne.
allerdings unter sehr anderen sozio-ökonomischen Bedingungen, hat schon Segalen beschrieben. 122 Die Chancen der Kinder auf eine gute Partie waren aber nicht nur vom Vermögen der Eltern bestimmt, sondern es spielte auch der soziale Status eine wichtige Rolle. Wie in Abbildung 6.5 zu erkennen ist, kamen auch Heiraten zwischen Kindern aus der unteren Besitzklasse und kleineren oder sogar größeren Höfen zustande. Zwei Beispiele: Unten links ist die Heirat von Heinrich Lindemeyer (ID 15439) mit Catharina Knoop (ID 13906) zu erkennen. Lindemeyer stammt vom Colonat Lindemeyer (LB 33), das zum Zeitpunkt der Heirat (1841) allerdings mit knapp zwei Hektar Grund nur einen steuerlichen Reinertrag von 10 Talern hatte; erst seinem Bruder gelang es später, den Hof auf etwa 8 Hektar (44 Taler Reinertrag) zu erweitern. Wie die Bezeichnung ,Colonat' zeigt, stammte Heinrich Lindemeyer von einem Hof, der zwar der Größe, aber nicht der sozialen Wahrnehmung nach zur unterbäuerlichen Schicht gehörte. Catharina Knoop hatte den Hof ihres Vater (LK 38) mit erheblichen Schulden (500 Talern) und den ausstehenden Abfindungsforderungen der Geschwister, die zum Teil aber erst viele Jahre später fallig werden sollten, bereits 1840 übernommen. Lindemeyer erhielt eine Abfindung vom elterlichen Hof von 300 Talern, verstarb allerdings bereits ein gutes Jahr nach der Hochzeit. Seine Witwe gab den Hof kurz nach seinem
122
Segalen hat .kindreds' gefunden, über affinale Beziehungen verbundene Gruppen, die über die Zeit Personen und Ressourcen zirkulieren ließen. Der Austausch von Männern, Frauen und Ressourcen zwischen einer begrenzten Zahl von Abstammungslinien führte auch unter den Bedingungen der Zeitpacht und der Realteilung des mobilen Familienvermögens dazu, dass Ressourcen innerhalb der Gruppe blieben. Siehe Segalen, Fifteen Generations of Bretons, S. 122.
Höfe und Häuser
189
Tod an ihren Vater zurück und lebte bis zum Tod des Vaters bei ihm. 123 Ein weiteres markantes Beispiel ist die Heirat von Louise Imort (ID 15181) von der - der Größe nach ebenfalls unterbäuerlichen - Imorts Stätte (LK 45, Reinertrag: 13 Taler) auf den in den 1860er Jahren mit 12 Hektar und einem Reinertrag von 115 Talern relativ großen (und v. a. leistungsfähigen) Hof ,Colonat Kuhlmann' (LB 9). Die Braut war das einzige Kind, das von ihrem Bruder abgefunden werden musste; möglicherweise war ihre Erbabfindung daher höher, als von einer unterbäuerlichen Besitzung unter normalen Umständen zu erwarten gewesen wäre. Ihre Heiratschancen mögen aber auch durch ihre verwandtschaftliche Einbindung verbessert worden sein. Ihr Onkel Carl Henrich Imort (ID 15167) war zwar 1826 von der Imorts Stätte abgefunden worden, es war ihm aber gelungen, über die Jahre einen eigenen Hof aufzubauen (LK 49).124 Er war v. a. aber sehr erfolgreich in der Versorgung bzw. Plazierung seiner Kinder: fünf der sieben Kinder heirateten auf größere Höfe, und für einen weiteren Sohn kaufte Imort einen Hof.125 Louise Imort war demnach vielleicht nicht besonders vermögend, aber mit einer .reichen Verwandtschaft' gesegnet. Die bäuerlichen Schichten waren in Löhne eng miteinander verbunden, während die unterbäuerlichen Besitzer weitgehen außen vor blieben. Chancen auf eine Heirat mit einem Hoferben hatten Kinder von sehr kleinen Besitzungen eher dann, wenn die Höfe ihrer Eltern zwar der Größe nach zur unterbäuerlichen Besitzklasse zählten, sie aber vom lokalen Umfeld immer noch als .Bauern' wahrgenommen wurden.
6.2.4 Heiratkreise und Ressourcenflüsse Die Heiratsbeziehungen zwischen den Löhner und Borgeler Höfen unterschieden sich in zwei zentralen Punkten. (1) Der Löhner Heiratsmarkt, soweit er auf die Einheirat in einen Hof bezogen war, war stärker von den Kindern der größeren Bauern dominiert als der in Borgeln. Das bedeutet, dass es mehr Abwärtsmobilität gab, sowohl bei den Großbauernkindern, die auf kleine Höfe heirateten, als auch bei den Kleinbauernkindern, die dadurch schlechtere Chancen hatten, über eine Heirat den Status ihrer Eltern zu halten. In Borgeln war der Heiratsmarkt dagegen stärker segregiert, auch Kindern von kleinen Bauern gelang es eher, einen nach Herkunft gleichrangigen Hoferben zu heiraten. Die Suche nach passenden Heiratspartnern orientierte sich hier offenbar eher an sozialer als an lokaler Endogamie: Der Heiratsmarkt für die Großbauern etwa reicht deutlich über die Kirchspielgrenzen hinaus. Die besseren Heiratschancen ihrer Kinder hatten aber auch ökonomische Folgen für die Kleinbauern: Während die Löhner Kleinbauern mit den Kindern der Großbauern auch deren Abfindungen erheirateten, im Wege der intergenerationellen Transfers und der Heiraten also ein steter Ressourcenfluss von den ( l ä n d l i chen zu den weniger wohlhabenden Bauern stattfand, kamen die Borgeler Kleinbauern 123 124 125
Siehe StAD, D 23 B, Nr. 50127, S. 38 und 52; StAD, D 23 B, Nr. 50426, S. 111. Siehe StAD, D 23 B, Nr. 50134, S. 57. Zu Carl Henrich Imort siehe aber G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 129ff.
190
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
wesentlich seltener in den Genuss dieser Transfers. Die stärkere Segregation verringerte also auch die Ressourcenflüsse zwischen den sozialen Schichten. (2) Gleichzeitig war aber das Löhner Hof-Heiratsnetz stärker verbunden. Nur in diesem ostwestfälischen Ort gab es einen dichten Heiratskern, in dem die Heiratspartner und die sie begleitenden Ressourcen nachweisbar zirkulierten, so dass jeder beteiligte Hof sowohl Geber als auch Nehmer von Personen und Ressourcen war. Diese Form von generalisierter Reziprozität gab es in Borgeln nicht; hier bildeten einzelne Höfe lediglich kleine .Heiratskreise'. Auch hier ist also die stärkere Integration der Löhner Dorfgesellschaft gut zu erkennen, die zum einen Personen und Abfindungen zirkulieren ließ, zum anderen aber über eine ausgeprägte Abwärtsmobilität stetig nach unten umverteilte. In Borgeln blieben die jungen Menschen bei ihrer Heirat dagegen eher .unter sich', innerhalb der Schicht der Eltern. Das restriktive Heiratsverhalten verhinderte damit eine Zirkulation von Ressourcen über Schichtengrenzen hinweg.
6.3 Heirat auf dem Dorfe: lokale, soziale oder verwandtschaftliche Endogamie? In den Lebensentwürfen der Menschen in Borgeln war Heiraten eine Option, die nicht immer eintraf; mancher rechnete schon in jungen Jahren damit, ledig zu bleiben. In Löhne, aber nicht nur dort, war dagegen der enge Zusammenhang zwischen Heirat und sozialer Stellung entscheidend für den weiteren Lebenslauf. Auch Hermann Zeitlhofer hat für die südböhmische Pfarre Kaplicky aufgezeigt, dass mit der Heirat in der Regel die soziale Position weitgehend bestimmt war: Wer im späten 18. Jahrhundert nicht erbte oder einen Hoferben heiratete, verblieb lebenslang im Inwohner- und damit im abhängigen Status. Der hohe Einfluss der Heirat auf den Lebenslauf hing mit dem zunehmenden land-family-bond in Kaplicky zusammen, der den Markt für Höfe und Häuser schrumpfen ließ. 126 Die Entscheidung für einen bestimmten Ehepartner mag also von Gefühlen und Neigungen (mitbestimmt sein, sie hat dennoch weitreichende soziale und wirtschaftliche Folgen. Zu den sozialen Folgen der Heirat gehört die Einbindung in ein verwandtschaftliches Netz. Den affinalen, durch Heirat gestifteten Verwandtschaftsbeziehungen ist in der jüngeren Forschung zu Familie und ländlicher Gesellschaft große Bedeutung zugemessen worden, etwa in Martine Segalens Studie zu einer bretonischen Region. 127 Das vielleicht bekannteste Beispiel ist die Neckarhausen-Studie von David Sabean, der einen gravierenden Strukturwandel verwandtschaftlicher Beziehungen zwischen dem frühen 18. und dem mittleren 19. Jahrhundert ausgemacht hat. Führten die zahlreichen Hei126
127
Hermann ZEITLHOFER: Besitztransfer und sozialer Wandel in einer ländlichen Gesellschaft der Frühen Neuzeit. Das Beispiel der südböhmischen Pfarre Kaplicky, 1640-1840, unveröff. Dissertation, Wien 2001, S. 258f. Segalen, Fifteen Generations of Bretons.
Heirat auf dem Dorfe
191
raten zwischen Kindern aus wohlhabenden und ärmeren Familien in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts noch zu einer intensiven Vernetzung der sozialen Schichten, so hatte sich im 19. Jahrhundert ein weitgehend schichtenendogames Heiratsverhalten entwickelt. Mit dem Austausch von Personen und Ressourcen zwischen den Schichten wurden auch dicht gewebte Verwandtschaftsnetze zwischen ihnen geknüpft, die den Ärmeren Zugang zu den Kreisen der wohlhabenden Bauern garantierten. Diese überlappenden Verkehrskreise der dörflichen Schichten findet man auch in anderen sozialen Beziehungen, etwa bei Patenschaften und Vormundschaften für verwaiste Kinder. Im 19. Jahrhundert hatten sich die Heiratskreise der sozialen Schichten getrennt: Die Kinder der reichen Bauern heirateten untereinander, oft auch innerhalb ihrer consanguinalen Verwandtschaft. Dieses doppelt endogame Heiratsverhalten bewirkte einen massiven Ausschluss der mittleren und unteren Schichten aus dem sozialen Nahbereich der lokalen Oberschicht. Die Segregation der sozio-ökonomischen Schichten schnitt die Ärmeren von den Ressourcen der wohlhabenden Bauern ab; direkt, indem die Erbteile der Bauernkinder nicht mehr in gemeinsame Haushalte mit den Kindern der Armen eingingen; indirekt, indem die Hochzeiten, Taufen und alle anderen Formen der Soziabilität auf den größeren Höfen nun ohne die .armen Verwandten' stattfanden. 128 Das Neckarhausener Beispiel veranschaulicht die Bedeutung der Heiratskreise und der durch Heirat gestifteten Verwandtschaftsbeziehungen. Für die nordwestdeutschen Anerbengebiete ist jedoch der Mangel an solchen Vernetzungen herausgestellt worden. So hat Mooser zu Recht darauf hingewiesen, dass soziale Ungleichheit zwar durch verwandtschaftliche Beziehungen gemildert werden konnte, der weitaus größte Teil der Heuerlinge und Tagelöhner aber gerade keine Verwandtschaftsbeziehungen zu Bauern hatte. Verwandtschaft wurde durch die - oben beschriebene - Abwärtsmobilität der Bauernkinder im Zuge ihrer Verheiratung etabliert. Allerdings blieben weite Teile der unterbäuerlichen Bevölkerung dabei außen vor — etwa 80% der Heuerlinge waren bereits in Heuerlingsfamilien geboren, und auch die Heirat mit einem Bauernkind konnte nur einer Minderheit gelingen.129 Im osnabrückschen Belm waren die Verhältnisse sehr ähnlich, hier war die Selbstrekrutierungsrate der Heuerlinge noch etwas höher und demzufolge Verwandtschaftsbeziehungen mit Bauern ebenfalls nur für eine Minderheit der unterbäuerlichen Bevölkerung verfügbar. Die Selbstrekrutierungsrate der Heuerlingsschicht nahm im Verlauf des 19. Jahrhunderts noch deutlich zu — kam Ende des 18. Jahrhunderts noch gut ein Fünftel der Heuerlinge aus der Schicht der Bauern, so reduzierte sich dieser Anteil bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf ein Zehntel.130 Ein vergleichbares Besitztransfersystem hat die Ethnologin Lilyan A. Brudner in dem im österreichischen Kärnten gelegenen Feistritz vorgefunden. Ihre in den 1960er Jahren erhobenen Daten zu Heirat und Verwandtschaft sind in einem 1997 erschienenen, gemeinsam mit Douglas
128 129 130
Sabean, Social background to Vetterleswirtschaft; Sabean, Kinship in Neckarhausen. Mooser, Ländliche Klassengesellschaft,, S. 197. Schlumbohm, Lebensläufe, S. 374.
192
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
R. White verfassten Artikel erneut ausgewertet worden.131 White hat einen neuen Ansatz der Netzwerkanalyse entwickelt, der eine Analyse genealogische Netzwerke erlaubt. In Feistritz haben die Autoren mit Hilfe eines neu entwickelten Verfahrens einen klaren Zusammenhang zwischen struktureller Endogamie und sozialer Schichtung gefunden. 6.3.1 PGraph: Ein formales Modell zur Analyse genealogischer Netzwerke Nachdem in Kapitel 6.2 der Zusammenhang zwischen Heirat und sozialer Ungleichheit untersucht worden ist, geht es nun um die Frage nach Bereichen verdichteter Verwandtschaftsbeziehungen in den genealogischen Netzwerken der beiden untersuchten Kirchspiele. Genealogische Netzwerke haben aber bestimmte Eigenschaften, die eine Untersuchung mit den gängigen Verfahren der Netzwerkanalyse — wie etwa die Suche nach Komponenten oder Cliquen — erschweren. Sie zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie sehr spärlich sind. Durchschnittlich heiratet jeder Akteur nur etwa einmal, jedenfalls wenn man Wiederverheiratung und Ledigenquoten miteinander aufrechnet; auch die Abstammung ordnet jede Person nur einem Elternpaar zu. Es ist also kaum möglich, die Akteure in einem solchen Netz etwa nach der Anzahl ihrer Beziehungen zu unterscheiden. Ähnlich wie im Abschnitt 6.2.3 wird auch hier zunächst die relationale Struktur des gesamten Netzwerkes ermittelt, und in einem zweiten Schritt die Einbindung von Paaren aus den unterschiedlichen Schichten in verdichtete Bereiche verwandtschaftlicher Beziehungen untersucht. Damit werden auch die besitzlosen Tagelöhner und Heuerlinge in die Analyse mit einbezogen. In methodischer Hinsicht erfordert eine solche Ausweitung auf die besitzlosen Einwohner aber einen anderen Ansatz, da man hier nicht mit der Zuordnung von Personen und Heiraten zu Höfen arbeiten kann. Eine Lösung für dieses Problem hat Douglas R. White in dem von ihm gemeinsam mit Paul Jorion entwickelten PGraph (Parerttage graph) gefunden.132 Es handelt sich hierbei um ein formalisiertes Modell von Verwandtschaftsbeziehungen, das „unmittelbar bei den empirischen Ausgangsdaten über Heirats- und Abstammungsbeziehungen ansetzt, daraus Visualisierungen erzeugt und graphentheoretische Zerlegungen des Netzes erlaubt".133 Eine gewisse Schwierigkeit besteht darin, dass man gegenüber den üblichen Verwandtschaftsdiagrammen umdenken muss. Im PGraph werden Ehen oder Paare als Punkte und Individuen als Pfeile dargestellt. Jede als Pfeil repräsentierte Person verbindet zwei Paare miteinander, ausgehend von der Fortpflanzungsfamilie. Ein Pfeil muss also gelesen werden als .stammt ab von' und zeigt mit seiner Spitze auf die Herkunftsfamilie, auf die Ehe (oder auch nichteheliche Beziehung) der Eltern. Indem man die Pfeile nach Geschlecht unterscheidet, kann man zwischen Frauen und Männern bzw. männlicher und weiblicher Abstammung differenzieren. Ledige Personen 131 132
133
Brudnet / White, Class, property, and structural endogamy. White /Jorion, Representing and Analyzing Kinship; White / Johansen, Network Analysis and Ethnographic Problems. Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 220.
Heirat auf dem Dorfe
193
Abbildung 6.6: PGraph-Darstellung und Verwandtschaftsdiagramm im Kontrast Verwandtschaftsdiagramm:
PGraph:
Nach: Thomas SCHWEIZER, Muster sozialer Ordnung. Netzwerkanalyse als Fundament der Sozialethnologie, Berlin 1996, S. 222.
können ebenfalls durch einen Punkt bezeichnet werden, von dem dann nur ein einzelner, zu einem Elternpaar zeigender Pfeil ausgeht (was aber auch dann der Fall ist, wenn die Abstammung eines Ehepartners unbekannt ist). In einem PGraph ist also die doppelte Einbindung von Personen in zwei Familien gut zu erkennen. Im PGraph stehen also Paare (die von verheirateten oder unverheirateten Paaren gebildet werden können, oder auch von alleinstehenden Eltern) stärker im Mittelpunkt als in einem herkömmlichen Verwandtschaftsdiagramm, das in seiner Darstellung letztlich egozentriert ist. Diese Repräsentation verwandtschaftlicher Beziehungen im PGraph wird deren Netzwerk-Charakter besser gerecht, und sie erlaubt die systematische Suche nach verdichteten Bereichen im Netzwerk. In einem solchen Bereich befinden sich zum einen Paare, bei denen verwandte Partner eine Ehe eingegangen sind, zum anderen aber auch diejenigen Paare, die auf den Verwandtschaftspfaden der verwandten Ehepartner zu finden sind. Bei letzteren handelt es sich also nicht um Verwandtenehen, sondern um .Verbindungsstücke' auf dem Beziehungspfad eines anderen, möglicherweise erst deutlich später heiratenden Paares. Da jeder Pfeil eine Abstammungsbeziehung repräsentiert, stellt jeder Kreis, der in einem PGraph vorkommt, eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen zwei Ehepartnern dar; viele Ehepaare auf diesem Kreis sind aber nicht miteinander verwandt. 134 Ein Beispiel ist in Abbildung 6.6 gut zu erkennen: Die im Verwandtschaftsdiagramm unten eingezeich134
White /Johansen, Network Analysis and Ethnographie Problems, S. 72f. Im konventionellen Verwandtschaftsdiagramm stellen schon die Beziehungen zwischen Eltern und einem Kind ein kreisförmiges Gebilde dar: A ist Kind von B; A ist Kind von C; C ist verheiratet mit B. Im PGraph sind die Eltern dagegen zu einer Einheit, einem Punkt zusammengefasst.
194
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
nete Ehe zwischen Cousins ersten Grades (die über ihre Mütter verwandt sind) wird im PGraph durch einen einfachen, alle beteiligten Paare umfassenden Heiratskreis dargestellt: Das junge Paar (4); die Mütter, die zugleich Schwestern sind, mit ihren Ehemännern (2 und 3); und die Großeltern als Herkunftsfamilie der Mütter (1). Dieses Grundprinzip lässt sich erweitern: Immer wenn eine Ehe zwischen consanguinal oder affinal Verwandten geschlossen wird, schließt sich im PGraph ein solcher Kreis. Beim PGraph-Verfahren werden die Paare 1 bis 4 in Abbildung 6.6 dem Bereich verdichteter verwandtschaftlicher Beziehungen zugeordnet, auch diejenigen, die selbst zwar keine Verwandtenehen waren, aber Teil des Verwandtschaftspfades waren. Im PGraph-Verfahren werden also Bereiche verdichteter verwandtschaftlicher Beziehungen gesucht. In Abschnitt 6.2.3 sind Komponenten gesucht worden, die als maximal verbundene Subgraphen definiert sind. Diese Komponenten mussten verbunden sein, allerdings war dort die Existenz einer einzelnen Verbindung ausreichend. Hier werden nun Subgraphen gesucht, die nur Akteure enthalten, die doppelt miteinander verbunden sind (= Bi-Komponenten). Jeder Akteur ist also mit jedem anderen Akteur durch zwei verschiedene, voneinander unabhängige Pfade verbunden. Ein solcher Subgraph enthält weder Brücken noch Cutpoints, also weder Beziehungen, die zwei ansonsten unverbundene Bereiche im Netzwerk verbinden (= Brücken), noch Akteure, die über solche Brückenverbindungen verfügen (= Cutpoints oder Broker). Die Bedeutung der Cutpoints für diese Art der Analyse liegt aber nicht in ihren Chancen, Brokergewinne zu erzielen, sondern in ihrer Eigenschaft, lose verbundene Bereiche im Netz zusammenzuhalten: Entfernt man einen Cutpoint, zerfallt der Subgraph in mindestens zwei Teile.135 Bei dem oben abgebildeten Heiratskreis (Abbildung 6.6), der durch die Heirat zweier Cousins entsteht, könnte dies nicht passieren; entfernt man eines der beteiligten Paare, so sind die anderen drei immer noch verbunden. Was in Abbildung 2 an einem kleinen Netzwerk veranschaulicht ist, kann man über diese graphentheoretischen Formalisierungen auf große Netzwerke mit vielen Paaren und Abstammungsbeziehungen anwenden. So kann man nach Bereichen suchen lassen, in denen alle Paare — früher oder später — über mehrere Heirats- und Abstammungsbeziehungen miteinander verbunden sind, die also eine deutliche Tendenz zur strukturellen Endogamie aufweisen. Auf diesem Wege können Verwandtschaftskerne in genealogischen Netzwerken identifiziert werden.136 135
136
Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 182f. bezeichnet diese Subgraphen als Blöcke. Dieses Konzept des Blocks ist nicht zu verwechseln mit dem in der Blockmodellanalyse gebrauchten; zu Blockmodellen siehe Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 212ff. Jansen geht nicht auf Bi-Komponenten ein, eine gute Definition ist zu finden bei de Nooy/Mrvar/Batagelj, Exploratory Social Network Analysis, S. 140ff. und 237 und bei White/Johansen, Network Analysis and Ethnographie Problems, S. 196. Schweizer, Muster sozialer Ordnung, S. 223f.; White / Johansen, Network Analysis and Ethnographie Problems, S. 154f. und S. 194ff. Zu beachten ist hierbei, dass nicht alle Familien in einer Bi-Komponente selbst aus Verwandtenheiraten hervorgegangen sind. Im Gegenteil, die meisten befinden sich an anderer Stelle auf einem solchen Heiratskreis. Das kann auch bedeu-
Heirat auf dem Dorfe
195
6.3.2 Verwandtschaftskerne im Heiratsnetz Für die beiden Untersuchungsorte sind PGraphen erstellt worden, die alle in den Familienrekonstitutionen greifbaren Paare umfassen. Enthalten sind Ehepaare aus den Kirchspielen, aber auch alleinstehende Mütter und zugewanderte Familien. Der PGraph für Löhne enthält 1345 Paare, von denen die Hälfte Tagelöhner oder Heuerlinge ohne Landbesitz waren. 17,8% der Paare waren Kleinstbesitzer, und die bäuerliche Schicht machte 31,5% der Elternpaare aus. Für Borgeln enthält der PGraph 1773 Paare mit einem Besitzlosen-Anteil von 62,3%, weitere 19,3% waren Tagelöhner mit Kleinstbesitz, und die Bauern bildeten die schmale Oberschicht von 18,4% (siehe Tabellen 6.9 und 6.10). Der Analyseweg, der hier beschritten wird, weitet den Blick auf die ländliche Gesellschaft also ganz erheblich über die Gruppe der landbesitzenden Schichten hinaus.137 Für beide Kirchspiele ist nun untersucht worden, wie gut die Paare der verschiedenen Schichten in den verwandtschaftlichen Kernbereich der Gemeinde integriert waren. Das hier verwendete netzwerkanalytische Verfahren unterscheidet sich nun in einem wichtigen Punkt von den herkömmlichen Verfahren der Suche nach endogamem Heiratsverhalten. Wenn man empirische Daten etwa auf soziale Endogamie hin untersucht, wie oben in den Tabellen 6.3 und 6.4 (zu Heiratsmobiliät) geschehen, so muss man Personen und Paare zunächst nach sozialer Schichtung kategorisieren, um dann Wanderungsbewegungen zwischen den Kategorien festzustellen. Man geht also von kategorialen Merkmalen der Untersuchungseinheiten aus, nach denen sie einer bestimmten Gruppe zugeordnet werden.138 Die im Folgenden vorgestellten Ergebnisse sind aber erst im zweiten Schritt einer Schichtungseinteilung unterzogen worden. Zunächst wurde das Gesamtnetz mit allen Paaren, ohne Ansehen der Besitzverhältnisse, auf strukturelle Endogamie hin untersucht. Strukturelle Endogamie ist ein rein relationales Konzept, das nach Heiraten sucht, die in eine Verwandtschaftsgruppe zurückführen — unabhängig von anderen, wie etwa ökonomischen Kriterien.139 Im Ergebnis kann man unterscheiden zwischen Paaren, die im verwandtschaftlichen Kernbereich des genealogischen Netzwerkes angesiedelt sind, und den Paaren an der Peripherie.
137
138
139
ten, dass ein Heiratskreis erst geschlossen wurde, nachdem die betreffenden Ehepartner längst verstorben waren, etwa wenn es erst in der übernächsten Generation zu einer Heirat zwischen Verwandten kam. Hinzu kommt, dass Borgeln eine Gesindegesellschaft mit einem Gesindeanteil von etwa 30% an den erwachsenen Einwohnern war. Da Gesinde zumeist unverheiratet war, war der oberste Streifen der Groß- und Kleinbauern noch schmaler, als hier angegeben. Siehe auch die Beschreibung der Sozialstruktur in Kap. 4, S. 85. Zu beachten ist allerdings, dass es sich hier um Daten zu dem gesamten Zeitraum von 1750 bis 1874 handelt, und nicht um einen auf ein einzelnes Jahr bezogenen Querschnitt. White / Johansen, Network Analysis and Ethnographie Problems, S. 70. Für eine Typologie von Merkmalen in der Netzwerkanalyse siehe Jansen, Einführung in die Netzwerkanalyse, S. 53ff., die hier allerdings von komparativen Merkmalen sprechen würde. Brudner/White, Class, property, and structural endogamy, S. 166 und 190.
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
196
Tabelle 6.9: Ehepaare im Heiratsnetz: Verwandtschaftskern und soziale Schichtung, Löhne (1750-1874) Im Kernbereich
Großbauern
J» (Zeilen-%) (Spalten-%)
87
124
120
(15,2) (46,0)
(21,7) (53,0)
(21,0) (50,2)
Nein
102
110
119
(Zeilen-%) (Spalten-%)
(13,2) (54,0)
(14,2) (47,0)
(49,8)
Summe
189
(Zeilen-%) (Spalten-%)
(14,1) (100,0)
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
Besitzlose Tagelöhner
Summe
241
572
(42,1) ß5,3) 442
(100,0) (42,5) 773
(57,2) (64,7)
(100,0) (57,5)
234
239
683
1345
(1Z4) (100,0)
(17,8) (100,0)
(50,8) (100,0)
(100,0) (100,0)
Chi 2 : 31,86***; Cramer's V: 0,15. Quelle: Datenbank Löhne.
Diese Struktur kann man dann mit der üblichen Schichtungseinteilung vergleichen, und so zu Aussagen darüber kommen, wie gut auch die unteren Schichten in die Verwandtschaftsbeziehungen der lokalen Gesellschaft integriert waren. Der verwandtschaftliche Kern des genealogischen Netzwerks in Löhne, also der Bereich, in dem alle Paare über mindestens zwei Beziehungen mit den anderen Paaren verbunden sind, umfasst mit 42,5% etwas weniger als die Hälfte der Paare (Tabelle 6.9). Hofbesitzer sind überdurchschnittlich oft im Kernbereich vertreten, während landlose Tagelöhner (bzw. Heuerlinge) mit nur einem Drittel unterrepräsentiert sind. Insgesamt ist der Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit zum Verwandtschaftskern und sozialer Schichtung aber nur schwach ausgeprägt. Dazu mag beigetragen haben, dass mehr großbäuerliche Paare außerhalb als innerhalb des Kerns anzusiedeln sind. Das muss nicht heißen, dass diese wohlhabenden Bauern Beziehungen zu ihren Verwandten vermieden. Möglicherweise reichten die Verwandtschaftsbeziehungen aber über den lokalen Kontext hinaus; wie oben in Abschnitt 6.2.2 (Tabellen 6.5 und 6.6) gezeigt wurde, kamen relativ viele Heiratspartner der Großbauern nicht aus dem Kirchspiel. Bei den Tagelöhnern macht es einen erheblichen Unterschied, ob die Familie zu den Kleinstbesitzern oder zu den eigentumslosen Mietern gehörte. Die Kausalität dieses Zusammenhangs ist jedoch unklar: Einerseits kann der Besitz eines Hauses den sozialen (und ökonomischen) Status verbessert haben, so dass die Attraktivität der Kinder stieg; andererseits können aber auch die verwandtschaftlichen Beziehungen geholfen haben, ein Haus zu erwerben.
Heirat auf dem Dorfe
197
Tabelle 6.10: Ehepaare im Heiratsnetz: Verwandtschaftskern und soziale Schichtung, Borgeln (1750-1874) Im Kernbereich
Großbauern 84
Ja
Kleinbauern
Kleinstbesitzer
104
172
Besitzlose Tagelöhner 256
(Zeilen-%)
(13,6)
(16,9)
(27,9)
(41,6)
(Spalten-%)
(54,9)
(60,1)
(50,1)
(23,2)
Nein
69
69
171
(Zeiltn-%)
848
Summe 616
(100,0) ß4,7) 1157
(6,0)
(6,0)
(14,8)
(73,3)
(100,0)
(Spalten-%)
(45,1)
(39,9)
(49,9)
(76,8)
(65,3)
Summe
153
173
(Zeiltn-%) (Spalten-%) Chi 2 :
(8,6) (100,0)
(9,8) (100,0)
343
1104
1773
(19,3)
(62,3)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
(100,0)
177,45***; Cramer's V: 0,32.
Quelle: Datenbank Borgeln.
Der verdichtete Bereich war in Borgeln (Tabelle 6.10) mit einem Drittel der Paare erheblich kleiner, der Zusammenhang zwischen Zugehörigkeit zum Verwandtschaftskern und sozialer Schicht dagegen stärker.140 Auch hier waren ein großer Teil der landlosen Tagelöhner (76,8%) nicht im Kern, während die Kleinstbesitzer recht gut integriert waren. Insgesamt machten die Tagelöhner zwar mehr als zwei Drittel des Kernbereichs aus, aber die Chancen der Bauern, im verdichteten Bereich zu sein, waren mit jeweils mehr als 50% wesentlich größer. Damit waren die unterbäuerlichen Schichten hier stärker ausgeschlossen als in Löhne, wo mehr als ein Drittel der besitzlosen Tagelöhner im Kernbereich zu finden sind. Die Kleinbauern waren dagegen im Borgeler Kernbereich relativ am besten vertreten, mit 60,1% der kleinbäuerlichen Paare lag ihr Anteil deutlich über dem Gesamtschnitt von 34,7%. In der folgenden Tabelle (6.11) wird die Verteilung der Paare auf die beiden Hauptgruppen der ländlichen Gesellschaft - Bauern und unterbäuerliche Schicht — und die Zugehörigkeit zum Kernbereich mit den von Brudner und White vorgestellten Ergebnissen zu Feistritz (Kärnten) verglichen. Dabei wird deutlich, dass die sozialen Schichten in Löhne recht gut integriert waren, während die Klassengrenzen in Borgeln höher waren: In Löhne war jeder zweite Bauer im Kernbereich, aber auch 40% der Tagelöhner; in Borgeln waren dagegen fast 60% der Bauern integriert, aber nur 30% der Tagelöhner. In beiden westfälischen Orten war aber strukturelle Endogamie weniger mit sozialer Schichtung korreliert als im österreichischen Feistritz, wo besitzlose Einwohner radikal vom Verwandtschaftsnetz ausgeschlossen waren. Allerdings decken die 140
Darauf verweisen auch die Zusammenhangsmaße in Tabelle 6.9 und 6.10 (Löhne: chi 2 31,86*** und Cramer's V 0,15; Borgeln chi 2 177,45*** und Cramer's V 0,32).
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
198
Tabelle 6.11: Bauern und ländliche Unterschichten im Verwandtschaftskern in Löhne, Borgeln (1750-1874) und Feistritz (1860-1960) Im Kernbereich
Löhne
Borgeln
Ja
211 212 423
Ja
188 138 326
Nein Summe Nein Summe
Ja Feistritz 1 2
Bauern 1 N %
Nein Summe
182 137 319
49,9 50,1 100,0 57,7 42,3 100,0 57,1 42,9 100,0
Tagelöhner 2 N % 361 561 922 428 1019 1.447 25 281 306
39,2 60,8 100,0 29,6 70,4 100,0 8,2 91,8 100,0
Summe N % 572 773 1.345 616 1157 1.773 207 418 625
42,5 57,5 100,0 34,7 65,3 100,0 33,1 66,9 100,0
in Feistritz: Heirs / Buyer in Feistritz: Residents; in Löhne und Borgeln besitzlose Tagelöhner und Kleinstbesitzer (siehe
Tabellen 6.9 und 6.10).
Löhne: Pearson's r = 0,16; Borgeln: Pearson's r = 0,23; Feistritz: Pearson's r = 0,54 Quellen: Datenbanken Löhne und Borgeln; BRUDNER und WHITE 1997, S. 193 (Table 2).
Daten für das österreichische Dorf einen späteren Zeitraum ab; sie setzten erst 1860 ein und gehen bis in die 1960er Jahre, während die Daten für die westfälischen Dörfer bereits 1874 enden. Man könnte mit Sabean — etwas kühn — die drei Orte als Etappen einer paradoxen Modernisierung deuten und die These formulieren, dass Klassenbildung durch sozial und verwandtschaftlich endogames Heiraten ein Phänomen der Moderne ist, das sich erst im 19. Jahrhundert durchsetzt. Die ausgeprägte doppelte Endogamie in Feistritz würde dann einen Endpunkt auf einem Weg markieren, auf dem eine sich früh modernisierende ländliche Gesellschaft wie Borgeln schon deutlich weiter vorangeschritten war als das noch in der traditionellen Ökonomie des 17./18. Jahrhunderts verhaftete Löhne. Gegen eine solche Deutung spricht allerdings, dass soziale Exklusion in den inneralpinen Bereichen Österreichs eine lange Tradition hat. In einigen inneralpinen Bezirken der Obersteiermark, Kärntens und Salzburgs blieben im 19. Jahrhundert mehr als die Hälfte der heiratsfähigen Männer ihr Leben lang ledig. Hier ging Gesindedienst also nicht einfach mit einem hohen Heiratsalter einher, wie in vielen Regionen Europas, sondern es gab eine „spezifische soziale Qualität des lebenslangen Gesindes".141 Der Ausschluss eines erheblichen Anteils der Bevölkerung in Kärnten von sozialer Reproduktion, von Familiengründung und Zugang zu Besitz ist also gerade kein modernes Phänomen.
141
Ehmer, Heiratsverhalten, S. 17 und S. 127ff., Zitat auf S. 129.
Heirat auf dem Dorfe
199
6.3.3 Die Liebe zur Cousine? Verwandteneben in Löhne und Borgeln David Sabean hat eines der vier Schlusskapitel seiner zweiten großen NeckarhausenStudie der Bedeutung von Heiraten zwischen Blutsverwandten in Europa gewidmet. Dort führt er eine ganze Reihe von Arbeiten zusammen, die eine auffallige Zunahme verwandtschaftsendogamer Heiraten im modernen Europa ausgemacht haben. In Neckarhausen wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts jede zweite Ehe zwischen Verwandten geschlossen, jede dritte zwischen Blutsverwandten. Affinale Beziehungen spielten dagegen eine deutlich geringere Rolle. 142 Sabean vergleicht eine Reihe von Studien zu ganz unterschiedlichen Orten in Europa und kommt zu dem Ergebnis, dass die Zunahme von Heiraten mit Blutsverwandten ein Phänomen ist, das man in ganz Europa beobachten kann.143 Etwas schwierig ist allerdings die Interpretation von Sabeans empirischen Ergebnissen. Heiraten mit Cousins ersten Grades kommen z. B. nur sehr selten vor, in keinem seiner Samples mehr als zweimal (je nach Größe des Samples also zwischen 1,6 und 2,4% der Fälle). Auch wenn man etwa für das vorletzte Sample (Kohorte IV, frühes 19. Jahrhundert) alle Arten von Cousinheiraten zusammen nimmt, machen die insgesamt 8 Heiraten mit Cousins ersten, zweiten und dritten Grades nur 6,6% aller Heiraten aus. Erst für die letzte Kohorte steigen die Anteile der Cousinheiraten merklich an, hier hat Sabean 18 Heiraten mit nahen und entfernteren Cousins gefunden. Es gibt also in der Mitte des 19. Jahrhunderts mehr Heiraten mit Cousins als zuvor; aber sind es wirklich ,viele'? Um diese Frage zu beantworten, braucht es eine Vergleichsgröße; diese fehlt in Sabeans Arbeit wie auch in den von ihm referierten Studien. Um von der Häufigkeit der Verwandtenheirat auf eine tatsächliche Bevorzugung von Verwandten als Heiratspartnern zu schließen, muss man die Dichte der vorgefundenen verwandtschaftlichen Beziehungen im Netzwerk der untersuchten Gemeinde kennen. Mit anderen Worten: Werden bestimmte Verwandte überhaupt häufiger geheiratet, als bei verwandtschaftsblinder Auswahl der Heiratspartner zu erwarten wäre? Erst bei Kenntnis dieses Verhältnisses kann man darüber nachdenken, ob man die Partnerwahl als strategisches Verhalten verstehen kann — als Hinwendung zu bestimmten verwandtschaftlichen Bereichen oder, im Gegenteil, als bewusstes Überschreiten des sozialen Nahbereichs. Im Folgenden werden die tatsächlich nachweisbaren verwandtschaftlichen Eheschließungen mit einer zufalligen, bei verwandtschaftsblindem Verhalten erwartbaren Häufigkeit solcher Eheschließungen verglichen.144 Die empirisch beobachteten Heiraten werden für einen Zeitraum von 100 Jahren (1771 —1870) mit einer Kontrollgruppe verglichen. Die Kontrollgruppe setzt sich für jedes Jahr aus einer zufällig ausgewählten 142 143 144
Sabean, Kinship in Neckarhausen, S.430f. Sabean, Kinship in Neckarhausen, Kapitel 21. Siehe auch Georg FERTIG: The making of kinship: marriage in 18th to 19th century Westphalia, Paper presented at the IUSSP Seminar „New History of Kinship", Paris, France, 30. September - 2. Oktober, 2004.
Kapitel 6: Heiraten aufdem Dorf
200
Tabelle 6.12: Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Löhne ( 1 7 7 0 - 1 8 7 0 ) Löhne
Blutsverwandt Nah
Entfernt
Nicht verwandt
Affinal verwandt Horizontal'
Nah
Summe
Entfernt
Anzahl 1770-1795 1796-1820 1821-1845 1846-1870 Summe
3 2 5
8 12 12 4 36
2 2 2 3 9
3 3 6
21 31 27 24 103
7 13 14 13 47
38 61 58 49 206
18.4 21,3 24,1 26.5 22,8
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Anteile (%) 1770-1795 1796-1820 1821-1845 1846-1870 Summe
4,9 4,1 2,4
21,1 19,7 20,7 8,2 17,5
5,3 3.3 3.4 6,1 4,4
5,2 6,1 2,9
55,3 50,8 46,6 49,0 50,0
Index 1770-1795 1796-1820 1821-1845 1846-1870 Summe
2,8 0,0 0,9 1,1
1,5 1,2 1,2 0,5 1,1
0,0 0,0 9,6 3,2 2,2
X 2 (Yates) b
3,8 0,9 0,6 3,2 1,2
1,1 1,0 1,3 1,0 1,1
0,6 0,8 0,7 1,0 0,8
4,93 3,07 19,47** 6,45 6,98
Anm.: Nur beiderseitige Erstehen und nur Personen, die im Kirchspiel geboren sind und deren Sterbezeitpunkt bekannt ist. Signifikanzniveau: + 10 %, * 5%, ** 1 %. *: Verwandtschaftsbeziehungen, die ausschließlich innerhalb derselben Generation verlaufen (Ketten von Geschwistern und Schwägern). b: Siehe Frank YATES: „Contingency Tables involving small numbers and the x 2 Test", Supplement to the Journal of the Royal Statistical Society, Vol. 1, No. 2 (1934), S. 217-235. Quelle: Datenbank Löhne. Gruppe von potentiellen Heiratspartnern zusammen, deren Altersverteilung derjenigen der tatsächlich Heiratenden entspricht. So haben etwa im Jahr 1828 in Borgeln 3 Paare geheiratet, zwei 21- und 31jährige Männer waren Bauern, der Dritte ein 23jähriger Tagelöhner; die Bräute waren 20, 25 und 28 Jahre alt. Entsprechend wurden aus der Familienrekonstitution drei Männer und drei Frauen gezogen, die dasselbe Altersprofil aufwiesen, und alle möglichen Paarkonstellationen zwischen diesen sechs Personen ermittelt. In diesem Fall wären alle neun möglichen Paarkonstellationen ohne Verwandtschaftsbeziehungen, bei den tatsächlich Heiratenden gab es dagegen eine Heirat mit der Tochter eines Vetters (MBSD). Auf diesem Wege wurden für jede
Heirat auf dem Dorfe
201
Gemeinde zwei Datensätze erstellt, anhand derer die Häufigkeit von Verwandtenheiraten mit einer auch bei verwandtschaftsblindem Verhalten erwartbaren Verteilung verglichen werden konnte. Dazu wurden Index-Werte gebildet: Wenn die beobachtete Häufigkeit der erwarteten entspricht, beträgt der Index-Wert 1, ist sie doppelt so hoch, liegt der Wert bei 2, bei halb so hoher Häufigkeit entsprechend bei 0,5 (siehe Tabellen 6.12 bis 6.15). Die Ergebnisse werden im Folgenden in zwei Schritten erläutert. Zunächst werden die Heiraten mit Verwandten und Nicht-Verwandten in den beiden Gemeinden über die Zeit hinweg verglichen und es wird danach gefragt, ob Tendenzen erkennbar sind. Die empirischen Ergebnisse werden mit den erwartbaren Häufigkeiten verglichen, um der Frage nachzugehen, ob man von einer Bevorzugung Verwandter sprechen kann. Im zweiten Schritt wird zwischen den beiden großen Bevölkerungsgruppen unterschieden und untersucht, ob Bauern und Heuerlinge bzw. Taglöhner sich bei der Partnerwahl unterschiedlich verhielten. Die Zahl der Verwandtenehen unterschied sich in den beiden Gemeinden erheblich. In Löhne waren mehr als drei Viertel der angehenden Ehepartner miteinander verwandt, in Borgeln dagegen nicht einmal ein Drittel. Über die Zeit entwickelten sich die Anteile der Verwandten gegenläufig: In Löhne nahm der Anteil der verwandten Ehepartner ab, derjenige der nicht-verwandten Ehepartner nahmen von 18,4% auf 26,5% zu. In Borgeln nahm der Anteil der Verwandten etwas zu, von zunächst einem Viertel auf ein Drittel in der Mitte des 19. Jahrhunderts, derjenige der Nicht-Verwandten sank dagegen von 73,9% auf 66,7%. In Borgeln wurden über die Zeit entferntere Verwandte - consanguinal und affinal - etwas häufiger geheiratet, man kann also, mit etwas gutem Willen, von einer Hinwendung zu den entfernten Verwandten sprechen. Alle anderen Verwandtschaftskategorien zeigen — zumindest in Bezug auf die Prozentanteile - keine eindeutigen Trends und sind nur jeweils mit sehr wenigen Fällen vertreten. Für Löhne kann man, wiederum bei sehr wenigen Fällen, eine steigende Popularität naher affinaler Verwandter ausmachen, sowohl derjenigen Beziehungen, die über horizontale Geschwister-Schwäger-Ketten laufen (die erst nach 1820 vorkommen), als auch der sonstigen nahen angeheirateten Verwandtschaft. Diese in den Fallzahlen und Anteilen angedeuteten Entwicklungen verblassen jedoch weitgehend, wenn man sie gegen einen Hintergrund von vorgefundener Verwandtschaftsdichte, also die Präsenz verwandter Heiratskandidaten, absetzt. Für Löhne kann man gelten lassen, dass (erst) im 19. Jahrhundert nahe affinale Verwandte beliebter werden, immerhin werden sie deutlich öfter geheiratet als zu erwarten wäre. In Borgeln nimmt zwar der Anteil der entfernten affinalen Verwandten zu, sie werden aber im 19. Jahrhundert eher gemieden; im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts waren sie noch überrepräsentiert.
202
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
Tabelle 6.13: Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Borgeln (1770-1870) Borgeln
Blutsverwandt Nah
Entfernt
Nicht verwandt
Affinal verwandt Horizontal"
Nah
Entfernt
2
4
5 6
3 4
9 11
4 17
11
Summe
Anzahl 1770-1795 1796-1820 1821-1845 1846-1870 Summe
3 2 1 1 7
2 6 9 17
15 24 59
51 76 74 76 277
69 99 106 114 388
Anteile (%) 1770-1795 1796-1820 1821-1845
4,3
1846-1870 Summe
2,9
5,8
13,0
73,9
100,0
5,1
3,0
11,1
76,8
100,0
5,7
3,8
2,0
2,0
0,9
5,7
0,9
7,9
3,5
1,8
4,4
4,4
2,8
14,2
69,8
100,0
21,1
66,7
100,0
15,2
71,4
100,0
Index 1770-1795 1796-1820 1821-1845 1846-1870 Summe
4,6
0,0
4,7 2,8 1,0 2,9
1,9 2,6
1,3 5,8 6,8
2,1 2,0
4,8 4,2
^(Yates)1» 4,6 2,3
1,3 0,7
5,7 0,0 2,2
0,8 0,9 0,9
0,9 0,9 0,9 1,0 0,9
14,28* 20,35** 41,07** 14,41* 61,85**
Anm.: Siehe Tabelle 6.12. Signifikanzniveau: + 10%, * 5%, ** 1 %. Verwandtschaftsbeziehungen, die ausschließlich innerhalb derselben Generation verlaufen (Ketten von Geschwistern und Schwägern). b: Siehe YATES, X2 Test. Quelle: Datenbank Borgeln.
Die Aussagekraft von einfachen Häufigkeiten ist also begrenzt, wenn sie nicht mit der Dichte des Verwandtschaftsnetzes in Beziehung gesetzt werden. In Löhne wurden sehr oft Verwandte geheiratet, weil die meisten in Frage kommenden Kandidaten eben verwandt waren. Außer einer leichten Benachteiligung von Nicht-Verwandten, die mit der Zeit aber abnahm und in der Mitte des 19. Jahrhunderts verschwunden war, und einer gewissen Beliebtheit von über horizontale Relationen Verwandten nach 1820 (die sich allerdings auf gerade einmal 6 Eheschließungen bezieht), kann man kaum von präferenziellem Heiratsverhalten sprechen. In Borgeln war die Situation dagegen ganz anders: Die meisten potentiellen Heiratspartner im Kirchspiel waren nicht mit dem Heiratswilligen verwandt, aber hier gab es eine ausgeprägte (allerdings über die Zeit abnehmende) Vorliebe für nahe Blutsverwandte, also Cousins ersten Grades,
Heirat auf dem Dorfe
203
Tabelle 6.14: Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Löhne, nach Schicht (1770-1870) Löhne
Blutsverwandt Nah
Entfernt
Nicht verwandt
Affinal verwandt Horizontal
Nah
Summe
Entfernt
Anzahl Bauern Heuerlinge
3 1
10 22
3 4
1 1
32 64
22 31
71 123
45,1 50,6
31,0 27,0
100,0 100,0
Anteile in % Bauern Heuerlinge
4,2 1,1
14,1 19,1
4,2 1,1
1,4 1,1 Index
Bauern Heuerlinge
2,3 0,4
0,6 1,1
3,5 2,5
^(Yates) 0,3 0,5
1,1 1,1
1,1 0,8
6,57 4,30
Anm.: Siehe Tabelle 6.12. In dieser Tabelle sind Neubauern als Heuerlinge aufgeführt, da sie zum Zeitpunkt der Heirat in der Regel noch Heuerlinge waren und erst später Neubauern wurden. Quelle: Datenbank Löhne.
und für Partner, die über Beziehungen innerhalb derselben Generation (Geschwister und Schwäger) verwandt waren. Daneben wurden auch entfernte Blutsverwandte, wie etwa Cousins 2. oder 3. Grades, und nahe affinale Verwandte jenseits der erwähnten horizontalen Beziehungen bevorzugt. Cousins wurden häufiger geheiratet, als dies zu erwarten wäre: Über den ganzen Zeitraum gab es sieben Ehen mit Cousins 1. Grades, ebenfalls sieben mit Cousins 2. Grades und acht Ehen mit Cousins 3. Grades; zu erwarten wären 1,2 Ehen im ersten Grad, 4,1 im zweiten und 2,2 Ehen im dritten Grad. In Löhne gab es mehr Cousinheiraten: fünf Ehen mit Cousins 1. Grades, 15 mit Cousins zweiten Grades und 21 mit Cousins dritten Grades, aber aufgrund der höheren verwandtschaftlichen Dichte würde man auch 4,3,10,2 bzw. 16,7 Ehen erwarten. Nachdem die Unterschiede zwischen den beiden Gemeinden deutlich wurden, soll abschließend danach gefragt werden, ob sich das Heiratsverhalten von Bauern und ländlichen Unterschichten unterschied. In Löhne gab es kaum Unterschiede zwischen den relativen Anteilen der Verwandtschaftskategorien bei beiden Gruppen. Vielleicht neigten Bauern etwas mehr als Heuerlinge dazu, sich an nahe Verwandte zu halten; der Unterschied zwischen den sozialen Gruppen ist aber gering. Hohe Index-Werte gehen hier meist mit sehr niedrigen Fallzahlen einher, bei Kategorien mit mehr Fällen unterscheiden sich die beobachteten kaum von den erwarteten Werten. Von einer bewussten Bevorzugung verwandter Heiratskandidaten kann hier also keine Rede sein. Zu diesem Schluss war auch Schlumbohm in seiner Studie gekommen: Lediglich für Großbauern hat er einige wenige ,Allianz-Heiraten' gefunden, während Ehen mit Verwandten in
204
Kapitel 6: Heiraten trnf dem Dorf
Tabelle 6.15: Verwandtenehen und Verwandtschaftsdichte in Borgeln, nach Schicht (1770-1870) Borgeln
Blutsverwandt Nah
Entfernt
Nicht verwandt
Affinal verwandt Horizontal
Nah
Summe
Entfernt
Anzahl Bauern
4
11
11
Tagelöhner
1
1
3
8
24
82
140
8
90
103
17,1
58,6
100,0
7,8
87,4
100,0
Anteile in % Bauern Tagelöhner
2,9
7,9
7,9
1,0
1,0
2,9
5,7 Index
^(Yates)
Bauern
4,6
2,4
4,6
3,4
0,7
0,9
59,14**
Tagelöhner
3,2
0,9
3,9
0,0
0,6
1,0
5,57
Anm.: Siehe Tabelle 6.12. Signifikanzniveau: + 10%, * 5%, ** 1 %. Quelle: Datenbank Borgeln.
allen anderen Schichten nur sehr selten vorkamen. Wo es solche „Kreuz-Heiraten" zwischen zwei Höfen gab, handelte es sich aber vor allem um „annähernd gleichzeitig vorbereitete Doppelhochzeiten", die sich innerhalb weniger Monate vollzogen.145 Auch wenn in Schlumbohms Belm-Studie die Häufigkeiten solcher Heiraten nicht mit der Dichte der verwandtschaftlichen Beziehungen verglichen werden, deutet dieser Befund darauf hin, dass unter sehr ähnlichen sozio-ökonomischen Bedingungen auch das Heiratsverhalten ähnlich dem der Löhner Bauern und Heuerlinge war. Ganz anders ist das Bild in Borgeln. Hier bevorzugen die Bauern ihre näheren oder zumindest Blutsverwandten klar als Heiratspartner, während die entfernte verschwägerte Verwandtschaft wie die große Gruppe der Nicht-Verwandten schlechtere Chancen hat, angesprochen zu werden. Das bedeutet hier aber nicht, dass nur Verwandte geheiratet werden: Die Mehrheit der lokal verfügbaren Heiratskandidaten war nicht verwandt, und so waren dann auch mehr als die Hälfte der Ehepartner Nicht-Verwandte. Bei verwandtschaftsblinder Partnerwahl hätten aber gut zwei Drittel der Ehepartner nicht verwandt sein dürfen. Ähnlich klar, aber in eine ganz andere Richtung weisend, ist das Heiratsverhalten der Tagelöhner. Die (lokalen) sozialen Netze der Borgeler Tagelöhner enthielten viel weniger Verwandte, von den potentiellen Heiratspartnern waren — möglicherweise auch aufgrund des hohen Ledigenanteils — nur etwa 12% verwandt. Genauso groß war der Anteil der Verwandten unter den Heiratspartnern.
145
Schlumbohm, Lebensläufe, S. 438; zu Eheschließungen der unterbäuerlichen Schichten siehe S. 530ff.
Heirat auf dem Dorfe
205
Von einer Meidung oder Bevorzugung bestimmter Verwandter, wie die Index-Werte andeuten, kann man aber aufgrund der geringen Fallzahlen kaum sprechen. Tagelöhner hatten nur wenige Verwandte im Kirchspiel, und sie sahen offenbar wenig Sinn darin, sie aktiv zu suchen.146
6.3.4 Im Kreise der Verwandten: Heirat und soziales Netzwerk Im ländlichen Westfalen des 18. und 19. Jahrhunderts waren Heiraten eingebettet in ein Netz von Beziehungen, in dem die Heirat neue Verbindungen herstellte. Die sozialen Netze unterschieden sich aber massiv: Zum einen war die Dichte verwandtschaftlicher Beziehungen in Löhne und Borgeln sehr unterschiedlich, zum anderen konnten Bauern und ländliche Unterschichten durchaus in verschiedenen sozialen Welten leben. In Löhne war dies nicht der Fall; die PGraphanalyse (Kap. 6.3.2) hat gezeigt, dass sich Bauern und Heuerlinge im Verwandtschaftskern der lokalen Gesellschaft befanden, und dass die Diskriminierung der Unterschichten hier nur schwach ausgeprägt war. Von Exklusion kann man deshalb kaum sprechen. Dies war in Borgeln anders. Die Tagelöhner der Soester Börde waren, besonders wenn sie keinen eigenen Besitz hatten, vom verwandtschaftlichen Kern der Gemeinde weitgehend ausgeschlossen. Allerdings war die Dichte der Verwandtschaftsbeziehungen in Borgeln auch gering: Unter allen potentiellen Heiratspartnern waren - ungeachtet der Schichtzugehörigkeit — nur 20% verwandt. Hier gab es aber auch große Unterschiede zwischen Bauern und Tagelöhnern. Tagelöhner trafen auf dem lokalen Heiratsmarkt kaum Verwandte an; Bauern waren dagegen mit etwa einem Drittel der Heiratskandidaten verwandt. Bauern hielten sich auch bei der Wahl der Heiratspartner an ihren sozialen Nahbereich und bevorzugten Cousins und Schwäger; für die ländlichen Unterschichten waren Verwandtschaftsbeziehungen dagegen kein Kriterium bei der Partnerwahl. Letzteres galt auch für Löhner Heuerlinge, aber ebenso für Bauern: Von einer besonderen Vorliebe für Verwandte kann in beiden Fällen nicht die Rede sein. Verwandte wurden nicht öfter geheiratet als auch unter verwandtschaftsblinder Partnerwahl zu erwarten gewesen wäre; gemieden wurden sie allerdings ebenso wenig. Der Vergleich der beiden Gemeinden führt vor Augen, wie sehr die Interpretation von Fallzahlen oder auch Anteilen in die Irre führen kann. Die scheinbar hohe Popularität Verwandter in Löhne ist gerade nicht auf eine Bevorzugung verwandter Heiratskandidaten zurückzuführen, während man dies für die Borgeler Bauern trotz moderater Fallzahlen durchaus nachweisen kann. Nur wenn man diesen Hintergrund der vorgefundenen Beziehungen kennt, kann man danach fragen, ob Verwandte gesucht und bevorzugt geheiratet wurden. Davon zu trennen ist die Frage, wie diese Dichte verwandtschaftlicher Beziehungen zustande gekommen ist. Zum einen kann ein deutlich geringerer Anteil dauerhaft Lediger, wie in Löhne beobachtet, die verwandtschaftlichen Vernetzungen begünstigen. Zum
146
Siehe die chi2(Yates)-Werte, die nur für die Borgeler Bauern signifikant sind.
206
Kapitel 6: Heiraten auf dem Dorf
anderen kann aber die Migrationsrate von Bedeutung sein, wie etwa die in einigen Gebieten Westfalens traditionellen Formen des Hollandgangs und des Wanderhandels als klassischer Arbeitsmigration, oder auch die Heiratswanderung, die in vorindustrieller Zeit vielleicht häufigste Art der Migration. 147 Verwandte, die eine Kirchengemeinde verlassen, werden aber für den Historiker zu fehlenden Gliedern in den Verwandtschaftsketten. Besonders das Heiratsverhalten der besitzenden Schichten kann eine wichtige Rolle für die Vernetzung lokaler Gesellschaften spielen. Wenn Bauernkinder sich eher statusorientiert verheiraten, dafür aber längere Distanzen in Kauf nehmen, sind die verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb einer Gemeinde eher schwach ausgeprägt. Umgekehrt führt ein lokal orientiertes, aber in Bezug auf Verwandtschaftsbeziehungen eher exogames Heiratsverhalten zu einer breiten Integration der sozialen Schichten. Mit anderen Worten: Netzwerkerweiterung durch exogame Heiratspraktiken führt zu breit aufgefächerten verwandtschafdichen Netzwerken, während endogame Verwandtenheiraten eher zu stellenweise verdichteten, aber insgesamt wenig weit reichenden Verwandtennetzen führt. Mit diesen Ansätzen könnte man versuchen, die unterschiedliche Dichte der Verwandtschaftsnetze in den beiden untersuchten Orten zu deuten. Entscheidend ist aber, wie die Menschen im 19. Jahrhundert mit den vorgefundenen Beziehungen umgingen, und hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Bauern und ländlichen Unterschichten in Löhne und Borgeln. Ohne Kenntnis der Netzwerkdichte stehen Aussagen über Bevorzugung oder Vermeidung bestimmter Beziehungsformen auf einer wenig tragfähigen Grundlage.
6.4 Ergebnisse: Heirat, Besitztransfer und Klassenbildung Die Heirat war und ist ein einschneidendes Ereignis im Leben vieler Menschen. Die Bedeutung der Eheschließung hat sich im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Im 21. Jahrhundert scheint sie trotz hoher Scheidungsquoten zuzunehmen; darauf deutet zumindest die hohe Bereitschaft zum Eingehen einer zweiten oder dritten Ehe hin. Neuere Forschungen zur Eheschließung in Europa im 18. und 19. Jahrhundert zeigen, dass das .europäische Heiratsmuster' sich vor allem durch eine erstaunliche Flexibilität und Anpassungsbereitschaft an kulturelle und wirtschaftliche Kontexte auszeichnete. In diesem Kapitel ist nun untersucht worden, welche Bedeutung die Heirat für die individuellen Lebensläufe einerseits und für die Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen andererseits hatte. Für ländliche Gesellschaften, in denen Höfe ungeteilt nach Anerbenrecht weitergegeben wurden, kann man generell davon ausgehen, dass Erb- und Heiratschancen ungleich verteilt waren. Die Vorstellung aber, dass die Geschwister von Hoferben weit147
Markus K ü P K E R : Migration im vorindustriellen Westfalen: Das Beispiel von Hausierhandel, Hollandgang und Auswanderung in Tecklenburg 1750-1850, in: Westfälische Forschungen 59 (2009), S. 45-78.
Ergebnisse
207
gehend mittellos vom Hof .weichen' oder sich gar unter einem Regime des Zwangszölibats in den (unentgeltlichen) Dienst des elterlichen Hofes stellen mussten, ist durch die Forschung der letzten Jahrzehnte zurückgewiesen worden. Dabei wurde deutlich, dass mit der Heirat der Geschwister oft eine Abwärtsmobilität verbunden war, die meistens irreversibel war. Mit anderen Worten: Heiraten konnte (fast) jeder und jede, viele junge Menschen mussten aber soziale Abwärtsmobilität in Kauf nehmen. Das System der ungeteilten Hofübergabe reproduzierte also eine gesellschaftliche Sozialstruktur, die von Mooser als .Ländliche Klassengesellschaft' bezeichnet worden ist. Im Anschluss an diese Charakterisierung ist hier nach der Relevanz der Heirat für die soziale Struktur der untersuchten Kirchspiele gefragt worden, insbesondere mit Blick auf die Integration der Tagelöhner und Heuerlinge, die überall den größeren Anteil an der dörflichen Bevölkerung ausmachten, in die lokalen Heirats- und Verwandtennetzwerke. Abwärtsmobilität im Sinne von Statusverlust war tatsächlich eine Erfahrung, die viele Kinder von Bauern machen mussten. Besonders im ostwestfalischen Löhne gingen viele bei ihrer Heirat auf kleinere Höfe oder in den Heuerlingsstand. Sie nahmen also einen Statusverlust in Kauf, zu dem Kinder von Großbauern in Borgeln eher nicht bereit waren. Dieses Verhalten hatte positive Auswirkungen auf die Heiratschancen der Kinder kleinerer Bauern in Borgeln: Es gelang ihnen öfter, innerhalb der Schicht ihrer Eltern zu heiraten. Das im Vergleich geringere Statusbewusstsein der Löhner Bauernkinder mag auf den Einfluss der pietistischen Erweckungsbewegung zurückzuführen sein, die in dieser Region seit dem späten 18. Jahrhundert von einiger Bedeutung war. Zugleich bewirkte die Abwärtsmobilität der Großbauernkinder, dass die Erben auf den kleinen Höfen mit ihren Ehepartnern auch deren Erbabfindungen erheirateten; es gab also einen stetigen Ressourcenfluss von oben nach unten. Die Zirkulation von Personen und Ressourcen zwischen Löhner Höfen bildete ein System generalisierter Reziprozität, das viele Höfe, aber nur wenige Tagelöhnerhäuser einschloss. Innerhalb dieses Kernbereichs gaben und erhielten alle Höfe mindestens einmal ein .bemitteltes' Kind an einen bzw. von einem anderen Hof im Kirchspiel. Die Löhner Höfe bildeten also ein Netz, durch das Personen und Ressourcen zirkulierten. In Borgeln gab es eine solche Struktur dagegen nicht: Ausgeprägte Klassenschranken hielten die Ressourcen der Großbauern in der eigenen Schicht und führten zu einer wesentlich schwächeren Integration der Gemeinde. Die bessere schichtenübergreifende Integration der Löhner Dorfgesellschaft wird noch deutlicher, wenn man die Verwandtschaftsnetzwerke von Personen untersucht und die besitzlosen Tagelöhner und Heuerlinge mit in den Blick nimmt. Die Analyse von genealogischen Netzwerken ist aufgrund der geringen Dichte der Netzwerke nicht trivial. Der PGraph-Ansatz ermöglicht aber auch hier die Suche nach verdichteten Bereichen im genealogischen Netz. In Löhne umfasste dieser Verwandtschaftskern beinahe die Hälfte der in den Quellen greifbaren Paare. Die Unterschiede zwischen den sozialen Schichten waren dabei eher gering. Die gänzlich besitzlosen Heuerlinge waren etwas schlechter integriert als Bauern und Kleinstbesitzer, insgesamt war der Unterschied zwischen Bauern und Heuerlingen aber nicht sehr groß. Dies war in Borgeln
208
Kapitel 6: Heiraten turf dem Dorf
anders, insbesondere besitzlose Tagelöhner blieben hier deudich außen vor. Der Besitz eines Wohnhauses hing also eng mit gesellschaftlicher Integration zusammen; ob allerdings die besseren Verwandtschaftsbeziehungen beim Erwerb eines Hauses halfen oder aber der höhere Status von Hausbesitzern die Chancen erhöhten, in wohlhabende Kreise zu heiraten, ist nur eine von vielen offenen Fragen zu den Lebensbedingungen von ländlichen Tagelöhnern, die auf detaillierte Untersuchungen warten. Es gibt in den Borgeler Quellen Hinweise darauf, dass Bauern sich bemühten, in den Besitz von zusätzlichen Wohnhäusern zu gelangen, um Kindern neben der hier üblichen Vererbung von Erbeland auch Häuser zu überlassen. In Löhne ließ man absteigende Kinder eher in Heuerlingshäusern wohnen, band sie also in den Sozial- und Wirtschaftsverband des Hofes mit ein; zu eigenem Besitz kamen sie aber auf diesem Wege nicht, und auch das Vererben von Parzellen an Nebenerben war hier gänzlich unbekannt. Die Erbpraxis in Borgeln war hingegen darauf angelegt, auch Kindern ohne Hofbesitz eine Existenzgrundlage zu geben, allerdings auf anderem Wege: Heuerlinge gab es hier in der aus Ostwestfalen oder auch dem Osnabrücker Land bekannten Form nicht, eine (zeitlich befristete) formelle Einbindung von Familien in die Hofwirtschaft war daher kein gangbarer Weg. Die Erbelande ermöglichten es den Nebenerben jedoch, zumindest einen Teil ihres alltäglichen Bedarfs auf eigenem Grund zu erwirtschaften, und sie boten eine gewisse Sicherung gegen Notlagen. Lenkt man den Blick von den großen Netzwerken weg und fragt nach der Bedeutung der Heirat für die Individuen, so tritt der Unterschied der Lebenswelten von Bauern und Tagelöhnern in den beiden Gemeinden noch stärker zutage. In Löhne waren Heirat und Besitztransfers eng miteinander verknüpft. Höfe wurden in der Regel an Paare übergeben, entweder an Ehepaare oder Verlobte, die allerdings die Eigentumsrechte nur unter der Bedingung der Heirat übertragen erhielten. Auch bei den Nebenerben waren Heirat und Ressourcenflüsse eng miteinander verknüpft, die Abfindung von elterlichen Vermögen wurde in den meisten Fällen zumindest zum Teil bei der Heirat ausgezahlt. Heiraten veranlassten Ressourcenflüsse, waren aber nicht von ihnen abhängig; die hohe Verheiratetenquote auch unter Besitzlosen und die große Zahl der Hoferben, die längst vor der Übernahme des elterlichen Hofes geheiratet hatten, belegen dies. Im reichen Borgeln hatte die Ehe dagegen einen weitaus geringeren Stellenwert im Lebenslauf der Menschen. Übergaben fanden meistens unabhängig von der Heirat des Hoferben statt, auch wenn Transfers Eheschließungen der Erben beschleunigten.148 Ein enger zeitlicher Zusammenhang bestand nur in einer Minderheit der Fälle, nur sehr selten brachten Übernehmer ihre zukünftigen Ehepartner mit, und dass Eltern ihren Kindern eine Heirat zur Bedingung für die Übergabe machten, kam nicht vor. Noch deutlicher wird die geringe Verknüpfung von Heirat und Ressourcentransfer bei den Geschwistern der Hofübernehmer. Sie wurden wohl von den Eltern bei der Haushaltgründung oder bei der Heirat auf einen anderen Hof unterstützt, al-
148
G. Fertig, Lebenslauf, S. 116.
Ergebnisse
209
lerdings erhielten sie bei der Heirat oft eine Aussteuer, nicht ihre Abfindung. Letztere war, soweit die Übergabeverträge darüber Auskunft geben, deutlich höher, wurde aber meistens einige Jahre nach der Übergabe gezahlt, und zwar zu genau festgelegten Terminen. Die Terminierung der Auszahlung von Abfindungen richtete sich also weniger nach den Bedürfnissen der Geschwister als nach der Ökonomie des Hofes, der in der Regel nur in Abständen von etwa zwei Jahren eine Abfindung aufbringen musste. Heiraten wurden also durch Bereitstellen von Ausstattungsgegenständen unterstützt, Ressourcentransfers fanden jedoch weitgehend unabhängig hiervon statt. Die Ehe hatte aber generell in Borgeln nicht den zentralen Stellenwert, den sie im ostwestfälischen, vom Pietismus geprägten Kirchspiel hatte. Menschen setzten ihre Abfindungsansprüche ein, um sich einen Platz zum Leben zu sichern - im elterlichen Haus, das zwar einem anderen Kind übergeben wurde, in dem aber für manchen Bruder und manche Schwester eine Kammer freigehalten werden musste. Auch Hofübernehmer, die partnerlos geblieben waren, etablierten solche Arrangements mit ihren Geschwistern, die ihnen im Gegenzug einen Platz im Haus bei ihrer Familie und lebenslänglichen Unterhalt zusicherten. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Untersuchungsorten liegt darin, dass in Löhne nur kranke und behinderte Kinder auf diese Weise versorgt wurden. In Borgeln war ein Leben als Single mit Familienanschluss eine Alternative zur Gründung einer eigenen Familie, die offenbar weithin akzeptiert und von manchem gewünscht war — ein eigenes Lebensmodell, keine Notlösung, allerdings mit möglicherweise gravierenden Folgen für die Dichte der verwandtschaftlichen Beziehungen. Die religiöse Aufwertung der Ehe in der pietistischen Erweckungsbewegung ist eine mögliche Erklärung für dieses unterschiedliche Heiratsbzw. Nicht-Heiratsverhalten, allerdings kann man den Zusammenhang schwer belegen. Daneben bieten sich aber die unterschiedlichen sozio-ökonomischen Verhältnisse in den beiden Orten als Erklärung an, die mit den Schlagwörtern Heuerlingssystem in Ostwestfalen, Tagelöhner- und Gesindegesellschaft in der Hellwegregion umrissen werden können. Das Heuerlingssystem zeichnet sich durch eine hierarchisierte Koexistenz mehrerer Familien auf Höfen aus. Das Agrarprodukte exportierende Borgeln hatte dagegen eine andere Sozialstruktur: eng, aber nur auf Zeit an die Höfe gebundenes Gesinde auf der einen Seite, selbständige Taglöhner auf der anderen Seite. Beide traten als Individuen in Arbeitsbeziehungen zu den Bauern, Gesinde als in der Regel unverheiratetes Personal, Taglöhner, indem sie ihre Familien zu Hause ließen. Die Arbeitsbeziehungen waren also weitgehend individualisiert, die Tagelöhner tauschten ihre Arbeitskraft gegen Lohn ein und begaben sich nicht unbedingt in langfristige und umfassende Beziehungen zu ,ihren' Bauern. In Löhne lebten Heuerlingsfamilien in einem Sozialsystem, dass man als traditionell bezeichnen kann; allerdings reicht diese Tradition wohl nicht weit über das 18. Jahrhundert hinaus. In Borgeln waren dagegen schon im 18. Jahrhundert Marktbeziehungen von erheblicher Bedeutung, sowohl für die Agrarproduzenten als auch für ihre Arbeitskräfte. Eine Einkommensgesellschaft entstand, in der alternative Lebensmodelle ihren Platz hatten.
210
Kapital 6: Heiraten turf dem Dorf
Gleichzeitig war die Borgeler Dorfgesellschaft wesentlich stärker durch Klassengrenzen bestimmt. Dies war schon in Kapitel 5 herausgearbeitet worden, und findet im Heiratsverhalten von Bauern und ländlichen Unterschichten seine Bestätigung. Bauern blieben auch bei der Suche nach einem passenden Ehepartner in ihrem sozialen Nahbereich, sie heirateten nicht nur innerhalb ihrer sozio-ökonomischen Schicht, sondern sie bevorzugten auch Heiraten mit näheren Verwandten. Tagelöhner waren dagegen aus den Heirats- und Verwandtschaftskreisen der Etablierten weitgehend ausgeschlossen. Ihre soziale Welt war eine andere als die der Bauern: Sie waren nicht nur von den sozialen Netzen der Bauern und dem verwandtschaftlichen Kern des dörflichen Netzwerkes ausgeschlossen, sondern sie waren überhaupt in der Gemeinde nur schlecht vernetzt, waren nur mit einem sehr kleinen Teil ihrer sozialen Umgebung durch Verwandtschaft verbunden. In Löhne waren die ländlichen Unterschichten dagegen viel besser mit der bäuerlichen Schicht vernetzt. In dieser Gesellschaft, in der beinahe .jeder mit jedem' verwandt war, waren auch die Unterschichten in die verwandtschaftlichen Netzwerke der Bauern integriert. Dies war auch ein Ergebnis der oft beschriebenen Abwärtsmobilität von Bauernkindern, die eben nicht nur Ressourcenflüsse in die klein- oder unterbäuerlichen Schichten auslöste, sondern auch vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen stiftete. Eine besondere Vorliebe für Verwandte gab es bei der Suche nach Heiratspartnern aber nicht — auch wenn die hohe Anzahl solcher Eheschließungen diesen Schluss auf den ersten Blick nahe legt. Gerade im Vergleich dieser beiden westfälischen Gemeinden wird deutlich, wie wichtig die Berücksichtigung der Dichte vorgefundener Verwandtschaftsbeziehungen ist. Die Untersuchung der sozialen Netzwerke und des Heiratsverhaltens im ostwestfalischen Löhne zeigt, dass es hier weder eine ausgeprägte Klassengesellschaft noch eine besondere Tendenz zu verwandtschaftsendogamem Heiraten gegeben hat. Die Charakterisierung als Klassengesellschaft trifft dagegen viel eher auf Borgeln in der Soester Börde zu, wo sich die sozialen Netzwerke der Bauern und der Unterschichten kaum überschnitten. Die Vorliebe der Borgeler Bauern für ihre Verwandten trug zur Reproduktion der ländlichen Klassengesellschaft bei.
Kapitel 7: Familienstrategien und soziale Netzwerke: Die soziale Plazierung von Kindern
7.1 Soziale Mobiiitat und familiäre Unterstützung 7.1.1 Soziale Mobilität in modernen und vormodernen Gesellschaften In Kapitel 6 wurden im ersten Teil die innerfamiliären Beziehungen und ihre Neuausrichtung in den Prozessen von Heirat und Hofübergabe untersucht. Im zweiten und dritten Teil ging es dann um die beständig ablaufende Neustrukturierung der sozialen Netzwerke durch Heiratsentscheidungen, zunächst bezogen auf soziale Schichten und die Ressourcenflüsse zwischen Höfen, dann auf die Integration von Bauern wie landlosen Unterschichten in einen Netzwerkkern verdichteter Verwandtschaftsbeziehungen. In diesem Kapitel geht es nun um die soziale Plazierung von Kindern, ihrer Etablierung in eigenen Familien bzw. Haushalten und die Chancen derjenigen Kinder, die nicht den elterlichen Hof übernehmen konnten, auf einen anderen Hof zu gelangen. Untersucht wird der Übergang der Kinder von der Herkunfts- in die eigene Familie, und zwar aus der Perspektive der Eltern, die ihre Kinder in diesem Prozess unterstützten. Dabei wird über die Feststellung, dass wohlhabende Bauern relativ homogene Heiratskreise bildeten, hinausgegangen, indem nach der Bedeutung sozialer Netzwerke der Familien und ihrer Stellung in der Gesamtnetzwerk der Patenschaften gefragt wird. Für vorindustrielle Gesellschaften gelten Statusvererbung und Wahl des Heiratspartners als die entscheidenden Faktoren bei der Plazierung der Kinder; hier spielte die Bildung eine sehr untergeordnete Rolle. Es waren die Familien und die von ihnen zur Verfügung gestellten Ressourcen, die die Lebenschancen ihrer Kinder massiv beeinflussten. Ressourcen kann man hier im Sinne von Bourdieu als unterschiedliche Arten von Kapital verstehen: ökonomisches Kapital in Form materieller Ressourcen, soziales Kapital und, wenn auch in geringerem Maße, Bildungskapital. Letzteres konnte in der Regel nur durch eine von den Eltern finanzierte Ausbildung erlangt werden. Ökonomisches Kapital wurde ebenfalls von Eltern an Kinder weitergegeben, zumeist in Form unentgeltlicher Transfers wie etwa der Kinderaufzucht und den verschiedenen Formen von Erbschaft. Daneben kann aber auch soziales Kapital eine wichtige Rolle spielen; soziale Beziehungen und das in ihnen vermittelte gesellschaftliche Prestige konnten Heiratschancen zumindest verbessern. Heiratskreise und Berufswahl sind in der historischen Forschung zu sozialer Plazierung die zentralen Indikatoren eben dieser sozialen Plazierung. Dieser Ansatz, der v. a. von einer Forschungsgruppe um Jürgen Kocka verfolgt wurde, hat jedoch metho-
212
Kapitel 7: Famitienstraiepen und so^iak Netyverke
(tische Schwächen.1 Zum einen bilden die Indikatoren (wie der Beruf des Bräutigams) eher die Ergebnisse sozialer Plazierung ab, als dass sie Einblicke in den Vorgang der Plazierung gewähren.2 Zum anderen wird zwar die Bedeutung der Familien für diesen Vorgang betont, die Strategien der Familien und ihre internen wie externen Beziehungen wurden in diesem Zusammenhang aber kaum untersucht. Die empirische Basis dieser Arbeiten ist eher dünn und wird kaum genutzt, um Einblick in die Lebenswege der Personen oder in familiäre Situationen zu gewinnen.3 Da die Daten nur aus Heiratsregistern gewonnen und nicht mit weiteren Informationen über persönliche Beziehungen und ökonomische Verhältnisse verknüpft wurden, ist die Relevanz familiärer Faktoren zwar postuliert, aber nicht untersucht worden. Aus Heiratsregistern generierte Datensätze umfassen in der Regel nur die Beziehungen zwischen Brautleuten und den Eltern bzw. Schwiegereltern. Zu einer Familie gehören aber selbst in ihrer engsten Definition mindestens alle Kinder eines Ehepaares. Um die Rolle von Familien bei der sozialen Plazierung von Kindern zu untersuchen, ist also ein anderer Ansatz nötig; Familien müssen im Forschungsdesign erst einmal erfasst werden. Auch die in den meisten Publikationen präsentierten Mobilitätstabellen spiegeln dieses Problem wider: Wo nur von Vater und Sohn die Rede ist, fehlen sowohl die weiblichen Familienmitglieder als auch die übrigen Söhne. Kinder wurden im ländlichen Westfalen von ihren Familien auf dem Weg in ein eigenständiges, erwachsenes Leben unterstützt. Sie wurden weder mittellos in die Fremde geschickt, noch erwartete man von ihnen, sich selbsdos für den Elternhof aufzuopfern. Diese Vorstellung hat sich aber—insbesondere für bäuerliche Familien - bis in die jüngere
Siehe v. a. die Beiträge in dem Band von Kocka, Familie und soziale Plazierung. Dabei wird etwa die soziale Stellung des Sohnes zum Zeitpunkt der Heirat mit der des Vaters zum gleichen Zeitpunkt verglichen. Allerdings wird die soziale Mobilität innerhalb des Lebenslaufs nicht berücksichtigt, obwohl gerade in Ostwestfalen im 19. Jahrhundert viele Neuansiedlungen stattfanden. Erkennbar wird dies an der großen Zahl der Menschen, die über den Lebenslaufhinweg zunächst als .Heuerlinge', dann aber als .Neubauern' bezeichnet werden. Diese Gruppe macht immerhin ein Viertel der unterbäuerlichen Schicht aus (siehe S. 114, besonders Tabelle 5.6). Berücksichtigt man die Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Lebenslaufs nicht, wird die Abwärtsmobilität also deutlich überschätzt. Siehe hierzu Mooser, Familie und soziale Plazierung, S. 139ff. Die Autoren betonen selbst, dass sie die Familie eher in ihrer .passiven Gelenkfunktion' in den Blick nehmen und die aktive Seite weniger untersuchen. (Reif, Theoretischer Kontext und Ziele, S. 25 und 28) Die begrenzte Aussagekraft von Heiratsregistern ist von den Autoren selbst gesehen worden (S. 64); in der Dissertation von Josef Mooser wird auf das Thema der sozialen Plazierung, obschon es für die Klassenbildung von hoher Relevanz ist, kaum mehr eingegangen (Mooser, Ländliche Klassengesellschaft). Siehe auch die kritische Rezension von Barbara FRANZOI: Rezension zu Jürgen KOCKA (Hg.): Familie und soziale Plazierung. Studien zum Verhältnis von Familie, sozialer Mobilität und Heiratsverhalten an westfälischen Beispielen im späten 18. und 19. Jahrhundert (Opladen 1980), in: Journal of Social History 16 (1983), S. 163-164.
Soziale Mobilität undfamiliäre Unterstützung
213
Zeit hartnäckig gehalten.4 Für andere Kontexte, etwa der französischen Provinz Bearn, die von Bourdieu in seinem für die Geschichte der Familienstrategien wegweisenden Aufsatz untersuchtet wurde, mag dies zutreffen, im ländlichen Westfalen gehen diese Vorstellungen jedoch fehl.5 Die umfangreichen Unterstützungsleistungen, die junge Erwachsene von ihren Eltern und auch den hoferbenden Geschwistern — von letzteren vielleicht nicht immer gerne — erhielten, belegen eindrucksvoll, dass Familien das Wohlergehen aller Familienmitglieder im Blick hatten. Sie schöpften dafür gegebenenfalls auch einen erheblichen Anteil der Wirtschaftskraft ihrer Höfe ab. Diese innerfamiliären Strategien können über Quellen wie Hofübergabeverträge in Verbindung mit Daten zu Personen und ihrem Besitz gut nachvollzogen werden. Es ist demgegenüber schwieriger, die über diesen inneren Bereich hinausgehenden sozialen Beziehungen in den Blick zu nehmen. Hier setzt die Untersuchung im folgenden Kapitel an. Im Mittelpunkt wird die soziale Plazierung derjenigen Kinder stehen, die den Elternhof verließen. Es wird zu klären sein, welchen Nutzen soziale Netzwerke in diesem Zusammenhang für Familien hatten und wie Eltern solche möglicherweise hilfreichen Netzwerke aufbauten. Unter sozialer Mobilität wird allgemein die Veränderung in der Besetzung von sozialen Positionen durch Akteure zwischen Generationen (intergenerationelle Mobilität) oder auch im Lebenslauf (intragenerationelle Mobilität) verstanden, bei der es zu einer Neuverteilung über die jeweiligen Kategorien kommt; gemessen werden diese sozialen Positionen in aller Regel über Informationen zum Berufsstand. Die Neubesetzung von Positionen im Generationenlauf kann ein neues Bild abgeben, manche Kinder verlassen die Position ihrer Eltern und steigen im sozialen Raum auf oder ab. Dementsprechend werden die Ergebnisse von Mobilitätsanalysen zumeist in Form von Mobilitätstabellen präsentiert, die Zu- und Abfluss sowie Persistenz zeigen. Ein zentraler Nutzen dieses Ansatzes ist, dass zwischen struktureller und individueller Mobilität unterschieden werden kann.6 Die Grenzen dieser Untersuchungsanlage sind jedoch darin zu sehen, dass individuelle Mobilitätsprozesse, also individuelle Leistungen und Faktoren für Erfolgs- oder Misserfolg, kaum in die Analyse einbezogen werden können. Pfadanalysen untersuchen dagegen die Bedeutung individueller Faktoren für die Statuseinnahme der Akteure, wie die Einflüsse von Familie, Schulerfolg, Berufsausbildung etc. Hier bleiben allerdings die strukturellen Beschränkungen von Mobilität unbeachtet, Mobilitätsprozesse werden — zumindest implizit — als Wahlentscheidungen oder als Frage von Bemühungen durch die Akteure modelliert.7
4
5
6
7
Über den Diskurs der preußischen Verwaltung über die Bauern, insbesondere über die Frage des bäuerlichen Erbrechts siehe Rouette, Der traditionale Bauer. Bourdieu bezeichnet diese Kinder, die als billige Arbeitskraft im Elternhaus blieben, als „strukturelle Opfer", da ihnen alternative Lebenswege verwehrt blieben; siehe Bourdieu, Boden und Heiratsstrategien, S. 283. Dieser Ansatz wurde in Kapitel 6 verfolgt; die Tabellen 6.2 und 6.3 (S. 171 und 173) präsentieren die intergenerationelle Heiratsmobilität von Bauern- und Häuslerkindern. Esser, Soziologie, S. 175ff.
214
Kapitel 7: Familienitrategien und soziale Netzwerke
Die soziale Plazierung 8 junger Menschen wird in modernen Gesellschaften stark durch das Bildungssystem beeinflusst, das über Leistungsauslese, aber auch über soziale Auslese für die Verteilung der nachwachsenden Generationen auf die sozialen Positionen sorgt. Dem Bildungssystem kommt so eine Allokationsfunktion zu, das Bildungsniveau entscheidet über den Zugang zu beruflichen Positionen. Nach Bourdieu ist Bildung heute die zentrale Ressource für Lebenschancen. 9 Dabei darf aber der Einfluss familiärer Faktoren nicht unterschätzt werden. Bereits in den 1960er Jahren wurde von Peter M. Blau und Otis D. Duncan nachgewiesen, dass Statusvererbung von Eltern — insbesondere Vätern — auf die Kinder auch im modernen Amerika noch eine große Rolle spielt. Das Blau-Duncan-Modell erfasst mittels einer Pfadanalyse den Einfluss von Bildungsvariablen und familiärem Hintergrund. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass das Elternhaus einen erheblichen direkten Einfluss auf die berufliche Position hat, und zwar nicht nur auf die berufliche Ausbildung, sondern auch auf die weiteren Etappen des Berufsweges. 10 Auch für die Bundesrepublik Deutschland sind ähnliche Vererbungseffekte auf die beruflichen Karrieren von Kindern nachgewiesen worden. 11 Donald J. Treiman und Kam-Bor Yip haben gezeigt, dass industrialisierte Staaten in Bezug auf soziale Mobilität offener sind als weniger entwickelte Staaten, Statuszuweisung also weniger vom sozialen Hintergrund bestimmt wird. Neben dem Bildungssystem ist die in solchen Staaten weiter fortgeschrittene Statusangleichung ein wichtiger Faktor hierfür. 12 Neuere Forschungen zu sozialer Reproduktion und sozialer Mobilität im 19. Jahrhundert kamen allerdings zu dem Schluss, dass sich vormoderne Gesellschaften weniger stark von modernen unterscheiden als gemeinhin angenommen wird. Der Einfluss der Familie auf die Mobilität ging in Großbritannien und Irland im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts zwar etwas zurück, blieb aber weiterhin von zentraler Bedeutung. 13 Für europäische Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ließ sich keine eindeutige Tendenz zur Öffnung, also zu vermehrten
9
10 11
12
13
Unter sozialer Plazierung wird hier die Verteilung junger Menschen auf soziale Positionen verstanden; der Begriff hat sich in der Geschichtswissenschaft durch die Arbeiten einer Forschungsgruppe um Jürgen Kocka etabliert. Siehe Reif, Theoretischer Kontext und Ziele, besonders S. 20. Bildungskapital wird von Bourdieu auch als inkorporiertes Kulturkapital bezeichnet; siehe hierzu Pierre BOURDIEU: Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Reinhard KRECKEL (Hg.), Soziale Ungleichheiten, Göttingen 1983, S. 183-198, hier S. 186ff. Peter M. BLAU und Otis D. DUNCAN: The American Occupational Structure, New York 1967. Walter MÜLLER: Bildung und Mobilitätsprozeß: Eine Anwendung der Pfadanalyse, in: Zeitschrift für Soziologie 1 (1972), S. 65-84, hier S. 73f. Donald J. TREIMAN und Kam-Bor YLP: Educational and Occupational Attainment in 21 Countries, in: Melvin L. KOHN (Hg.), Cross-National Research in Sociology, Newbury Park 1989, S. 373-394. Kenneth PRANDY und Wendy BOTTERO: Social Reproduction and Mobility in Britain and Ireland in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries, in: Sociology 34 (2000), S. 265-281.
Soziale Mobilität undfamiliäre Unterstützung
215
Möglichkeiten zu sozialem Aufstieg, nachweisen. Auch die US-amerikanische Gesellschaft scheint entgegen früherer Annahmen keine besseren Aufstiegschancen zu bieten.14 Die Erforschung von Statuserwerbsvorgängen mittels Pfadanalysen hat interessante Ergebnisse zu den individuellen Vorgängen des Statuserwerbs erbracht.15 Den Autoren dieser Studien ist aber zu recht vorgeworfen worden, sie würden zumindest implizit davon ausgehen, dass Statuserwerb nur auf der Basis von Bemühungen erfolge, es somit keine strukturellen Begrenzungen bei der Einnahme von Positionen gebe. Statuserwerb ist eben nicht nur eine Frage der ,Wahl' oder des .Bemühens', sondern auch von strukturellen Möglichkeiten. Diese wurden wiederum in der Analyse von Mobilitätsmustern und -regimes zwar systematisch berücksichtigt, individuelle Prozesse wurden hier aber nicht einbezogen. Neuere Arbeiten leisten dagegen eine Berücksichtigung von sowohl strukturellen Begrenzungen, wie auch individuellen Bemühungen, etwa durch multivariate Analyseverfahren.16 So konnte Per Kropp in seiner Studie über Gewinner und Verlierer der Wende 1989/90 in Ostdeutschland nachweisen, dass Erfolgschancen auf dem Arbeitsmarkt ganz erheblich von Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen beeinflusst werden. Dennoch war ein gutes Ausbildungsniveau wichtig für die Beschäftigungschancen, während große persönliche Netzwerke einen eher negativen Effekt hatten.17
7.1.2 Soziale Plazierung in der ländlichen Gesellschaft: Heirats- und Familienstrategien Soziale Abwärtsmobilität ist für das 19. Jahrhundert als prägende Erfahrung der kleinbäuerlichen Schichten, aber auch der .überzähligen' Kinder von Großbauern identifiziert worden.18 Wie bereits in Kapitel 6 gezeigt wurde, waren Bauern stark motiviert, alle Kinder standesgemäß zu versorgen, und ihre Bemühungen waren oft von Erfolg gekrönt. Soziale Plazierung erfolgte im ländlichen Westfalen beinahe ausschließlich über Heiratsstrategien; nur wenige Kinder wurden zum Studium fortgeschickt. Innerhalb der ländlichen Gesellschaft ist über Bildungskapital kein sozialer Aufstieg möglich, der Bodenbesitz blieb der einzige Zugang zu einer gehobenen Stellung und einer standesgemäßen Lebensführung. Das Land wurde aber von den Bauern in der Familie ge14
15
16 17
18
Hartmut KAELBLE: Sozialgeschichte Europas. 1945 bis zur Gegenwart, München 2007, S. 229ff; siehe auch Robert ERIKSON und John H. GOLDTHORPE: The Constant Flux. A Study of Class Mobility, Oxford 1992; dies.: Are the American rates of social mobility exceptionally high? New evidence on an old issue, in: European Sociological Review 1 (1985), S. 1-22. Siehe den Forschungsüberblick bei Harold R. KERBO: Social Stratification and Inequality. Class Conflict in Historical, Comparative, and Global Perspective, 6. Aufl., New York u. a. 2006. Esser, Soziologie, S. 210f. Per B. KROPP: Berufserfolg im Transformationsprozess. Eine theoretisch-empirische Studie über die Gewinner und Verlierer der Wende in Ostdeutschland, Amsterdam 1998, hier S. 147ff. So etwa von Mooser, Ländliche Klassengesellschaft, und Schlumbohm, Lebensläufe.
216
Kapitel 7: Familienstrattgien und sortait Netzwerke
halten, deshalb gab es im 19. Jahrhundert kaum sozialen Aufstieg über Landerwerb auf dem Bodenmarkt. 19 Dieser Befund bildet den Ausgangspunkt der folgenden Analyse: In einer ländlichen Gesellschaft, in der ein hoher sozialer Status beinahe ausschließlich durch die Übernahme des elterlichen Hofes oder die Heirat mit einem Hoferben erworben wurde, bildeten Heiratsentscheidungen das Fundament der sozialen Plazierung. Diese Entscheidungen wurden jedoch in den meisten Fällen weder allein von den Heiratswilligen, noch von deren Eltern getroffen. Sie entstanden in einem lokalen Rahmen, in dem es verschiedene Wege der Beziehungsanbahnung gab: Zwischen Vereinbarungen zwischen den Familien und relativ autonomer Paarbildung im Rahmen von ,peer groups' lag ein umfassendes Spektrum von Handlungsmöglichkeiten, das als legitim und sozial akzeptabel galt. 20 In der Studie von Marion Lischka, die Akten von Matrimonialprozessen am lippischen Konsistorium ausgewertet hat, ist deutlich geworden, dass jede Eheanbahnung in einem sozialen Zusammenhang stand, der Heiratspläne auch vereiteln konnte. So konnten Eltern keine Heiraten arrangieren, mit denen die Kinder nicht einverstanden waren; letztlich kam es auf deren Einwilligung und Absichtserklärung an, ohne die keine christliche Ehe Gültigkeit erlangte. Umgekehrt konnten Kinder aber auch im Rahmen jugendlicher Werbebräuche nicht vollkommen autonom entscheiden. Die Missbilligung einer Verbindung durch die Eltern wurde im lokalen Kontext nicht nur wahrgenommen, sondern auch als Ehehindernis angesehen. In Konfliktfällen konnte dies zu einem Scheitern des ,Eheprojektes' führen. Nicht nur Familien, auch Verwandte und nicht-verwandte Personen hatten ein reges Interesse an Eheplänen und Heiratsstrategien, so dass es einen „permanente [n] Diskurs über bestehende Ehemöglichkeiten" gab. 21 Martha Bringemeier berichtet in ihrer Arbeit über die Dorfkultur des Münsterlandes, dass ihre Gewährsfrau in den späten 1920er Jahren über hundert Verwandte nennen konnte, mit denen sie in den letzten beiden Jahren noch gesprochen hatte; dabei waren die Verwandten ihres Mannes noch gar nicht inbegriffen. Die näheren Verwandten wurden jährlich eingeladen, zumeist im Frühsommer, wenn zwischen Aussaat und Ernte die .müßige Zeit' war. „Dabei besichtigte man hauptsächlich die Aussaat, das Vieh auf der Weide und das Leinen, das man im Winter gesponnen hatte. Diese alljährlichen Visiten bedeuteten mehr als nur gemeinsame Plauderstunden. Man setzte sich dabei der Kritik derjenigen aus, die in die Verhältnisse des Hofes eingeweiht waren, man beratschlagte auf diesen .Tagungen' 19 20
21
G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 131ff. Zu Kontrollmechanismen von Eheanbahnung im Rahmen vormoderner Jugendkultur siehe Norbert SCHINDLER: Die Hüter der Unordnung. Rituale der Jugendkultur in der frühen Neuzeit, in: Giovanni LEVI und Jean-Claude SCHMITT (Hg.), Geschichte der Jugend, Band 1: Von der Antike bis zum Absolutismus, Frankfurt a.M. 1996, S. 319-382, besonders S. 329ff.; Medick, Spinnstuben auf dem Dorf; Beck, Illegitimität; Michael MITTERAUER: Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt a. M. 1992; Andreas GESTRICH: Traditionelle Jugendkultur und Industrialisierung. Sozialgeschichte der Jugend in einer ländlichen Arbeitergemeinde Württembergs, 1800-1920, Göttingen 1986. Lischka, Liebe als Ritual, S. 376f.
Soziale Mobilität undfamiliäre Unterstützung
217
sowohl über laufende Fragen der Wirtschaftsführung als auch über außergewöhnliche Unternehmungen wie Käufe, Neubauten und Berufswahl der Kinder; vor allem wurden Heiratsmöglichkeiten erwogen." 22 In diesem Kapitel werden die Plazierungserfolge von ländlichen Familien in Borgeln untersucht.23 Die Einschränkung auf einen Untersuchungsort beruht auf der Verfügbarkeit geeigneter Daten. Nur für diesen Ort reichen die in der Familienrekonstitution erfassten Daten bis 1914, während die Löhner Familienrekonstitution mit dem Jahr 1874 endet, so dass über die Lebenswege der Kinder zu wenig Informationen für diese Art der Analyse vorliegen. Man kann aber auch in Löhne beobachten, wie Familien sich um die möglichst vorteilhafte Plazierung ihres Nachwuchses bemühten, so wie Familien Krömker und Kröger: (1) Hermann Heinrich Krömker (ID 15734) war der Sohn von Hermann Heinrich Kröger (ID 158) und Anna Catharina Hamelmann (ID 14539). Der Vater stammte aus dem benachbarten Kirchspiel Gohfeld und heiratete 1800 die junge Witwe des Löhner Colons Bernhard Heinrich Krömker (ID 15731). Er führte den zu dieser Zeit 12,5 Hektar großen Hof (LB 25, Reinertrag: 86 Taler) und zog die junge Tochter seiner Frau auf. Das Paar bekam nur einen Sohn und verheiratete die Tochter bereits im Alter von 20 Jahren an den Colon Carl Heinrich Brackmann (ID 12973), der zuvor den elterlichen Hof (LK 27) von seinem Stiefvater übergeben bekommen hatte. So blieb Hermann Heinrich Krömker als Alleinerbe auf dem Hof seiner Eltern, heiratete aber 1826 mit Erreichen der Volljährigkeit Anna Ilsabein Kartelmeyer (ID 18372), die selbst Erbin des Hofes .Schwarzen Stätte' (LK 3) war. Hermann Heinrich Krömker verkaufte seinem Vater 1844 den erheirateten Hof, allerdings wurde die Kaufsumme nicht ausgezahlt: Sie wurde zunächst als Forderung des Sohnes gegen den Vater als neuen Hofbesitzer eingetragen, später dann auf die Kinder des Krömker übertragen. Nach dem Tod der Eltern im Januar 1846 fielen beide Höfe an Hermann Heinrich Krömker. Kurz vor dem Verkauf an den Vater hatte er sich zum zweiten Mal verheiratet. Seine Braut Anna Cläre Kröger (ID 15823) war wiederum zuvor mit einem Colon verheiratet gewesen und brachte den Hof Löhnebeck Nr. 7 mit in die neue Ehe. Nach dem Tod von Krömkers Eltern besaß die Familie nun drei recht große Höfe, auf denen sie ihre Kinder plazierte. Der jüngste Sohn von Krömker, Bernhard Heinrich (ID 18378) erhielt den Hof Löhnebeck Nr. 25, auf den sein Großvater einst geheiratet hatte. Auf die .Schwarzen Stätte' (LK 3) wurde ein junges Paar gesetzt: Hermann Heinrich Schwarze (ID 18373), der älteste Sohn, und Catharina Engel Tacke (ID 18379), Tochter von Anna Cläre Kröger. Die Eltern verheirateten also ihre Kinder, die ja nicht blutsverwandt waren, so dass beide in den Genuss des Hofbesitzes kamen. Der dritte Hof Löhnebeck Nr. 7, den die Witwe Kröger mit in die Ehe gebracht hatte, ging zunächst an ihren Sohn Carl Friedrich Tacke (ID 19179) und dessen Frau Catharina Cläre Kröger (ID 15828), die zugleich eine Tochter von Anna Cläre Krögers älterem 22 23
Bringemeier, Gemeinschaft, S. 82. Zu den folgenden Analysen siehe auch C. Fertig, Rural Society and Social Networks.
218
Kapitel 7: FamMenstrategien und soqalt Netzwerke
Bruder war; Carl Friedrich Tacke war also mit seiner Cousine (MBD) verheiratet. Er starb jedoch noch bevor die Übertragung der Eigentumsrechte vollzogen werden konnte. Die junge Witwe blieb auf dem Hof, den sie schon mit ihrem Mann bewirtschaftet hatte, und willigte in eine Heirat mit Carl Gottlieb Schwarze (ID 18377), dem zweitjüngsten Sohn von Hermann Heinrich Krömker ein. So gelang es dem Ehepaar Krömker / Kröger, zusammen fünf Kinder und eine Nichte auf den drei Höfen unterzubringen. Aber auch für die anderen Kinder wurde gesorgt: Johann Heinrich Schwarze (ID 18376) wurde Colon in Bischofshagen, einem benachbarten Kirchspiel, und Carl Friedrich Schwarze (ID 18374) heiratete auf den Hof Löhne königlich Nr. 40. Peter Friedrich Tacke (ID 19177), der älteste Sohn der Anna Cläre Kröger, wanderte 1845 in die USA aus. (2) Cläre Kröger kam ihrerseits aus einer Familie, die ihre Kinder gut zu plazieren verstand. Ihre Mutter, Anna Catharina Meyer (ID 15818), war als Besitzerin des Hofes Löhne königlich Nr. 33 (13 Hektar, 83 Taler Reinertrag) schon sehr erfolgreich gewesen. Maria Ilsabein (ID 15821), die älteste Tochter, heiratete Carl Friedrich Remmert (ID 17508); das .Remmertsche Colonat' (LK 1) zählte zu den größten Höfen in Löhne. Catharina Charlotte (ID 14549) heiratete auf die .Hamelmannsche Stätte' (LK 5), Catharina Engel (ID 15429) auf das .Knoopsche Colonat' (LK 38), 24 Maria Elisabeth (ID 14038) auf den Hof Elstermeyer (LB 1), einen der beiden ältesten Höfe in Löhne, und Anna Cläres (ID 15823) Lebensweg ist gerade schon beschrieben worden — sie war zunächst mit Bernhard Heinrich Tacke, dann mit Hermann Heinrich Krömer verheiratet. Auch der älteste Sohn Carl Friedrich (ID 15820) heiratete auf einen Hof, den seine Frau Margarethe Ilsabein Rübemeyer (ID 17796) von ihren Eltern geerbt hatte. Er war kein sehr treuer Ehegatte: Bereits einige Monate vor dem Tod seiner Frau im März 1824 wurde seine uneheliche Tochter Maria Engel (ID 20397) geboren, der noch ein kleiner Sohn im August 1827 folgte, die Mutter der Kinder zog danach offensichtlich fort. Inzwischen hatte er aber wieder geheiratet: Schon im März 1826 brachte seine zweite Ehefrau eine Tochter zur Welt, der noch sechs weitere Kinder folgten. Der Lebenslauf seines jüngeren Bruders Ernst Friedrich (ID 15822), der Hoferbe werden sollte, war ebenfalls außergewöhnlich, wenn auch in ganz andere Richtung. Er blieb bis Juni 1828 bei seiner Mutter, die bereits 1812 verwitwet war, und führte ihren Hof. Erst jetzt, mit nunmehr 79 Jahren, konnte die Witwe sich entschließen, den Hof an ihren jüngsten Sohn abzugeben, der mit inzwischen 46 Jahren auch schon im fortgeschrittenen Alter war. Er heiratete erst im Mai 1829, sein erster Sohn kam im Juli desselben Jahres zur Welt. Friedrich war ein wenig aus der Art geschlagen — seine Braut kam aus Exter, Verwandtschaft in Löhne hatte er wohl durch die Plazierungsambitionen seiner Mutter schon genug.
24
Catharina Engel Kröger war die Mutter der oben erwähnten Catharina Knoop (ID 13906), die den Hof nach dem Tod der Mutter (f25.8.1839) zunächst übernommen, dann aber zurück gegeben hatte.
Soziale Mobilität undfamiliärt Unterstützung
219
Unter erfolgreicher sozialer Plazierung wird im Folgenden die Heirat und der Hoferwerb derjenigen Kinder verstanden, die nicht die Nachfolge des elterlichen Hofes antreten konnten. In die Analysen werden nur Geschwister der Hoferben einbezogen, nicht die Hoferben selbst. Dass diese den Status ihrer Eltern halten konnten, ist in einer Region mit ungeteilter Hofübertragung nicht weiter erklärungsbedürftig. Wie die Entscheidung, einen Hof an ein bestimmtes Kind zu übertragen, innerhalb der Familie zustande kam, entzieht sich allerdings weitgehend der Beobachtung, da die Übergabeverträge zumeist nur das Ergebnis abbilden und nur selten Einblick in Aushandlungsprozesse gewähren. Die Auswahl eines Sohnes oder einer Tochter kann sowohl auf seine bzw. ihre besondere Eignung zurückzuführen sein wie auch auf traditionsbewusstes Verhalten der Eltern, oder aber auf eine besondere Situation in der Familie, wie etwa den frühen Tod der Bäuerin, deren Rolle wieder besetzt werden musste.25 Für das ostwestfälische Löhne konnte gezeigt werden, dass es in den ersten Dekaden des 19. Jahrhunderts ein besonderes Bewusstsein für die Erbrechte des .geborenen' Anerben gab, das sich in erhöhten Abfindungsleistungen niederschlug.26 Die familiären Verträge thematisieren in dieser Zeit jede ,,[Über]gehung des geborenen [...] Anerben".27 Familien sorgten in diesen Fällen über höhere Abfindungszahlungen oder aber durch den Bau eines Hauses o. ä. für einen angemessenen Ausgleich. Ein anschauliches Beispiel ist der Fall des minderjährigen Bernhard Heinrich Elstermeyer (*1801, ID 14009), der 1814 bei der Übergabe des Hofes an den älteren Bruder Johann Friedrich (*1785, ID 14005) erst 13 Jahre alt war. Der Vater war verstorben und die Mutter mit 54 Jahren in einem Alter, in dem Frauen nur noch selten heirateten. Der älteste Bruder Carl Heinrich (*1782, ID 14003) hatte längst auf einen anderen Hof in Löhne geheiratet, der Zweitälteste wollte nun auch heiraten. Vor dem Gang zum Gericht hatte der Familienrat getagt und die Pläne von Mutter und Sohn genehmigt. Nun kam mit der Heirat also eine neue Bäuerin auf den Hof, deren Mutter beim Vertragsabschluss zugegen war und einen ansehnlichen Brautschatz zusagte. Der jüngste Sohn erhielt nicht nur den üblichen Brautschatz, sondern darüber hinaus auch eine ausdrückliche Entschädigung für das Anerbenrecht, die er wahlweise in Form einer zusätzlichen Abfindung oder aber als Neubauerei, also ein neu zu erbauendes Haus mit einigen Stücken Land, in Anspruch nehmen konnte.
25
26 27
Zum Zusammenhang von Hofübergaberegelungen und Familiensituationen siehe C. Fertig/ Lünnemann / G. Fertig, Inheritance, succession and familial transfer; zur Rollenergänzung siehe Josef EHMER und Michael MITTERAUER: Zur Einführung: Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften, in: Dies. (Hg.), Familienstruktur und Arbeitsorganisation in ländlichen Gesellschaften, Wien u. a. 1986, S. 7-30; Michael MITTERAUER Familiengröße - Familientyp - Familienzyklus, in: Geschichte und Gesellschaft 1 (1975), S. 226-255. C. Fertig, Hofübergabe. Zu Erbsystem und Erbpraxis siehe auch Kap. 2, S. 26ff. und Kap. 6, S. 152ff. Zitat und folgendes Beispiel aus: Grundakten des Hofes Löhnebeck 1, StAD, D 23 B, Nr. 50386, S. 12.
220
Kapitel 7: Familietistmiepen und soziale Netzwerke
Im Laufe des 19. Jahrhunderts verschwanden diese Sonderregelungen für .geborene Anerben'; von einem besonderen Anspruch des Anerben war auch nicht mehr die Rede. Die gesetzliche Situation war, zumindest was die Wahrnehmung der preußischen Verwaltung angeht, unbefriedigend. Im Allgemeinen Landrecht gab es keine Bestimmungen, die auf die besonderen Bedürfnisse der bäuerlichen Bevölkerung ausgerichtet waren; im Erbrecht galt generell das Prinzip der gleichberechtigten Erbteilung. Ein im Juli 1836 erlassenes Gesetz, mit dem das alte Anerbenrecht in eine neue Gesetzgebung übernommen werden sollte, fand wenig Akzeptanz und musste schon bald außer Kraft gesetzt werden. Das Gesetz privilegierte die Hofübernehmer gegenüber den Geschwistern, aber auch gegenüber der Elterngeneration massiv. Insbesondere der Zwang, Höfe vor einer Wiederheirat an den Anerben zu übertragen, selbst wenn dieser noch sehr jung war, und die deutliche Reduzierung der Erbabfindungen für die Geschwister stießen in der bäuerlichen Bevölkerung auf erheblichen Widerstand. Bereits 1841 suspendierte der Provinziallandtag das Gesetz, im Dezember 1848 wurde es aufgehoben. 28 In den folgenden Jahrzehnten wurden die besonderen Rechte der jüngsten Söhne in Löhne immer weniger thematisiert, eine gesetzliche Bevorzugung von den Bauern abgelehnt; gleichzeitig wurden die Höfe aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts (und darüber hinaus) zu einem beständig wachsenden Anteil an die jüngsten Söhne übergeben. 29 Obwohl es den Bauern grundsätzlich freistand, ihren Besitz spätestens mit der Ablösung der grundherrlichen Rechte, die in der Regel bis in die 1850er Jahre erfolgt war, unter allen Kindern aufzuteilen, zogen sie eine solche Realteilung nicht in Erwägung. Die Höfe blieben auch unter den veränderten rechtlichen Bedingungen des 19. Jahrhunderts beisammen, die Abfindungen für die Geschwister erfolgten zunehmend nicht mehr in Realien, sondern in Bargeld. In Borgeln gab es daneben die Tradition, den Kindern kleinere Stücke Land mitzugeben. Diese Erbelande standen schon vor der Ablösung der Grundherrschaft im alleinigen Eigentum der Bauern und konnten frei gehandelt, vererbt und verschenkt werden. Sie wurden als Altenteil genutzt, daneben aber den Geschwistern auch als Mitgift mitgegeben. Diese mindestens schon im 18. Jahrhundert gebräuchliche Tradition hatte auch im 19. Jahrhundert noch Bestand, erst gegen Ende des Jahrhunderts ging man dazu über, Erbansprüche ausschließlich monetär abzugelten. 30
28
29 30
Rouette, Der traditionale Bauer, S. 122ff.; Scheepers, Erbfolge-Gesetz, S. 40ff.; Frank TYKWER: Hofnachfolge in Westfalen / Lippe. Eine rechtsvergleichende und rechtstatsächliche Darstellung der Erbgewohnheiten in der westfälischen Landwirtschaft, Köln u.a. 1997, S. 45ff.; Werner REINEKE: Die Entwicklung des bäuerlichen Erbrechts in der Provinz Westfalen von 1815 bis heute, in: Engelbert Fhr. VON KERCKERINCK ZUR BORG (Hg.), Beiträge zur Geschichte des westfälischen Bauernstandes, Berlin 1912, S. 117-163, hier S. 109ff. C. Fertig, Hofübergabe, S. 73f. Siehe hierzu Kapitel 4, S. 86f., sowie Weber, Menschen und Familien, S. 182.
Anlage der Untersuchung
221
7.2 Anlage der Untersuchung 7.2.1 Individuelle Mobilität und Familie Im Fokus der folgenden Untersuchungen stehen also nur die Geschwister der Hoferben, deren Statuserhalt nicht über eine Hofubergabe gesichert werden konnte. Ihnen blieb in der Regel nur die Möglichkeit, über eine Heirat in den (Mit-)Besitz eines Hofes zu gelangen.31 Statuserhalt konnte also nur über eine ,gute Partie' gelingen. In Löhne, nicht aber in Borgeln, gab es eine Ausnahme von dieser Regel: Carl Henrich Imort (ID 15167) plazierte fünf seiner sieben Kinder, die das Erwachsenenalter erreichten, über Heiraten mit Erben größerer Höfe. Es gelang ihm aber auch, einen mittelgroßen Hof für seinen ältesten Sohn Friedrich Carl (ID 15187) anzukaufen, den dieser dann später über den Erwerb eines weiteren Hofes vergrößerte.32 Plazierungserfolg kann also definiert werden als Erwerb eines Hofes durch ein Kind, dessen wirtschaftliche Kraft und sozialer Status dem des Elternhofes etwa entsprach oder diesen sogar übertraf. Da Höfe und auch Häuser kaum über den Markt erworben werden konnten, erfolgte der Erwerb in aller Regel über eine Heirat; durch das Heranziehen verschiedener Quellenbestände sind die folgenden Analysen allerdings nicht auf Heiraten beschränkt.33 Die zweite, vielleicht wichtigere methodische Entscheidung besteht darin, nicht individuelle Lebenswege der Kinder- (oder Söhne-)generation in den Blick zu nehmen, sondern den Plazierungserfolg der Eltern.34 Dieser eher ungewöhnlichen Perspektive liegt die Überlegung zugrunde, dass soziale Plazierung zum einen ganz wesentlich von den Eltern mitgestaltet wurde, also nicht unbedingt als individuelle Leistung des Kindes gelten kann, und dass sich westfälische Bauern zum anderen sehr deutlich bemühten, alle Kinder gleich zu behandeln und auch gleich auszustatten. Dieser Befund
31 32
33
34
G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 131f.. Es handelt sich um die Höfe Löhnebeck Nr. 8, den Carl Imort 1833, zwei Jahre vor der Heirat des ältesten Sohnes, für 1000 Taler erwarb (mit 6,5 Hektar und 57 Taler Reinertrag) und den Hof Löhnebeck Nr. 6 (5,75 Hektar und 33 Taler Reinertrag), den Johann Imort 1845 im Zuge einer Subhastation für 1565 Taler erwerben konnte. Johann Imort zog mit seiner Familie auf den neu angekauften Hof und fügte einige Landstücke des Hofes Löhnebeck Nr. 8 dem neuen Hof hinzu, andere Parzellen verkaufte er. Siehe hierzu auch G. Fertig, Ländlicher Bodenmarkt, S. 128ff. Angesichts des knappen Angebots an Heiratsgelegenheiten auf Höfen kann ein Statuserhalt bereits klar als Erfolg gewertet werden; eine Heirat auf einen kleineren Hof wird hier als Abwärtsmobilität gewertet, obwohl sie im Verständnis der bäuerlichen Gesellschaft möglicherweise noch als sehr akzeptable Wahl galt; über die Bewertung eines solchen .kleinen Abstiegs' sagen die hier zur Verfügung stehenden Quellen jedoch nichts aus. Zur Modellierung der abhängigen Variable siehe weiter unten, S. 226. Es sind zur Kontrolle Analysen mit Individualdaten der Kinder durchgeführt worden, mit den Kindern als Egos und unter Hinzuziehung weiterer Variablen wie Geschlecht und Rangfolge der Geburten. Diese erbrachten aber keine zusätzlichen Ergebnisse.
222
Kapitel 7: Yamilienstrattpen und soziale Netzwerke
ist wichtig und unterscheidet das ländliche Westfalen von anderen, etwa französischen Beispielen 35 : Es sind keinerlei Bemühungen erkennbar, einzelne Kinder besonders gut auszustatten, sie zu bevorzugen oder alle Ambitionen auf ein Kind zu konzentrieren. Im Gegenteil wird in vielen Familienverträgen betont und auch explizit vorgerechnet, dass Jeder und Jede seinen bzw. ihren gerechten Anteil erhalten solle. 36 Dass Kinder zugunsten des Hofnachfolgers auf ein eigenständiges Leben verzichten mussten, ist ein Mythos, der seit dem 19. Jahrhundert immer wieder in der Literatur auftaucht. 37 Bauern bemühten sich dagegen, jenseits der traditionellen geschlossenen Hofübergabe alle Kinder gleich zu behandeln. Dass sie sich auch bemühten, den Erbteil der Geschwister im Vergleich zu dem des Hofübernehmers gerecht zu gestalten, ist im sechsten Kapitel bereits diskutiert worden. 7.2.2 Faktoren familiären Erfolgs Wie konnte nun unter diesen Bedingungen soziale Plazierung gestaltet werden? Es ist nicht ganz trivial, das alltägliche Handeln historischer Akteure zu beobachten. Gut geeignet hierfür wären Prozessakten, wie sie etwa von Marion Lischka für gescheiterte Eheanbahnungen ausgewertet wurden. Solche Quellen stehen für die untersuchten Orte nicht zur Verfügung. Familiäre Verträge, wie Übergabeverträge, Eheverträge oder Erbauseinandersetzungen, lassen auf Interessen und Interessenausgleich schließen, liefern aber relativ wenige Informationen darüber, wie etwa Heiraten oder auch Hofübergaben zustande kamen. Die hier ausgewerteten Quellen können allerdings herangezogen werden, um die soziale Umwelt von Familien und ihre soziale und wirtschaftliche Stellung zu beleuchten. Die Untersuchung von Plazierungserfolg nimmt daher die folgenden Faktoren in den Blick: (1) Die Größe des Besitzes erlaubt Rückschlüsse über die wirtschaftliche, aber auch die soziale Stellung eines Hofes in der bäuerlichen Gesellschaft. Die in den 1820er Jahren von der preußischen Verwaltung erstellten Kataster erlauben, zusätzlich zu der absoluten Größe auch die Qualität des Bodens in die Untersuchung einzubeziehen. 35
36
37
Siehe etwa Claverie / Lamaison, Ousta, S. 208ff. Bourdieu betont dagegen, dass die den Hof verlassenden Kinder gleichwertig ausgestattet wurden, mit der Einschränkung, dass die Abfindung der Töchter etwas höher war als die der Söhne. Er führt dies darauf zurück, dass man die .jüngeren', also nicht erbenden Söhne, gerne auf dem Hof behielt, anstatt sie in eine möglicherweise untergeordnete Stellung in einer anderen Familie zu verheiraten: Bourdieu, Boden und Heiratsstrategien, S. 270 und 282ff.; siehe auch Antoinette F A U V E - C H A M O U X : The Stern Family and the Picardy-Wallonia Model, in: dies, und Emiko O C H I A I (Hg.), The Stem Family in Eurasian Perspective: Revisiting House Societies, 17,h-19th centuries, Bern u.a. 2009, S. 202-252. Töchter erhielten dieselbe Abfindung wie Söhne, es gab also auch keine geschlechtliche Benachteiligung. So meint Riehl, dass „der echte Bauer (..) das weichherzige moderne Erbrecht nicht begreifen [kann], welches allen Kindern alles gibt, damit keines was Rechtes besitze." Wilhelm Heinrich R I E H L : Die bürgerliche Gesellschaft, Stuttgart/Berlin 10. Aufl. 1907, S. 54.
Anlage der Untersuchung
223
Für jede Parzelle ist neben den exakten Ausmaßen auch die Klasse, die die Güte des Bodens bewertet, festgestellt worden. Aus der Größe und der Klasse wurde dann der steuerliche Reinertrag, also die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer, ermittelt. Addiert man die Reinertragswerte für die Parzellen eines Hofes, so kennt man damit auch die Leistungsfähigkeit des Hofes, die bei Höfen gleicher Größe durchaus sehr unterschiedlich sein konnte. (2) Soziale Mobilität kann sich in zwei Formen realisieren: Einerseits über Heiratsmobilität, wenn also der Hof, auf den ein Elternteil geheiratet hat, größer oder kleiner war als der Hof der Großeltern. Andererseits kam es trotz geringer Bodenmobilität vor, dass Höfe durch den Zukauf von Parzellen erweitert wurden, im Lebenslauf der Eltern also anwuchsen. Beide Ausprägungen kann man über einen Vergleich der maximalen Hofgröße im Lebenslauf von Eltern und Großeltern greifen.38 Auf diesem Weg kann man der Frage nachgehen, ob sich Aufwärts- oder Abwärtsmobilität der Eltern auf die Plazierung ihrer Kinder auswirkte. (3) Soziale Netzwerke von Elternpaaren umfassten in der vormodernen Gesellschaft neben Nachbarn vor allem Verwandte und Patenschaften. Die Relevanz nachbarschaftlicher und verwandtschaftlicher Beziehungen für die Etablierung von Patenschaften ist in Kapitel 5 untersucht worden. Hier werden soziale Netzwerke nun unter drei Perspektiven in die Analyse eingehen. Erstens wird nach der Relevanz lokal verfügbarer Verwandtschaftsbeziehungen für die soziale Plazierung gefragt. Wie in Kapitel 6 gezeigt wurde, unterscheiden sich Bauern und ländliche Unterschichten in Borgeln nicht nur in Bezug auf ihre Vorliebe für Verwandte, sondern auch hinsichtlich der Existenz von verwandtschaftlichen Beziehungen. Spielte die Verfügbarkeit von Verwandten in der dörflichen Gesellschaft eine Rolle für erfolgreiches Agieren auf dem Heiratsmarkt?39 Zweitens wird untersucht, inwieweit sich die Bemühungen junger Eltern um den Aufbau eines umfangreichen sozialen Netzes auszahlten. Wie in Kapitel 5 ausgeführt, waren die Patennetze westfälischer Familien im Vergleich etwa zu Neckarhausen recht groß. Zahlte es sich aus, wenn Eltern sich um möglichst große Patennetze bemühten?40 Drittens wird der Status der Eltern als Paten in den Blick genommen. Auch hier ist in Kapitel 5 gezeigt worden, dass es erhebliche Unterschiede zwischen populären und weniger populären Paten gegeben hat, dass Einzelne für mehrere Dutzend Kinder Paten standen, viele andere aber nie um die Übernahme einer Patenschaft gebeten wurden. In dieser Popularität drückt sich zum einen soziales Prestige aus, zum anderen wurde aber auch ein umfassendes soziales Netzwerk in alle Bereiche der lokalen Gesellschaft etabliert, das mit erheblichen Informationsvorteilen
38 39
40
Es wurde jeweils der größere der beiden großelterlichen Höfe herangezogen. Die Operationalisierung der Verwandtschaftsvariablen erfolgt über die Anzahl verfügbarer Verwandter verschiedener Kategorien, etwa Schwäger, Cousins, etc. In einigen Modellen wurden verschiedene Verwandtschaftsvariablen einbezogen, in anderen nur diejenige mit den signifikantesten Werten (Kinder von Cousins ersten Grades). Variable .Durchschnittliche Patenzahl je Kind'.
224
Kapitel 7: FamilUnstrategien und s