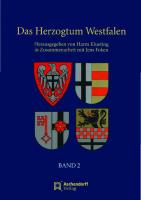Das Herzogtum Westfalen 02: Das ehemalige kurkölnische Herzogtum Westfalen im Bereich der heutigen Kreise Hochsauerland, Olpe, Soest und Märkischer Kreis. Band 2.1 und 2.2 9783402128626, 3402128624
7,434 75
German Pages [1183] Year 2012
Polecaj historie
Table of contents :
Title
Vorwort des Sauerländer Heimatbundes
Vorwort
Inhalt des ersten Teilbandes
Inhalt des zweiten Teilbandes
Harm Klueting: Kurkölnisches Herzogtum Westfalen oder (kur-) kölnisches Sauerland. Zur Einleitung
Hans-Joachim Behr: Staat und Politik im 19. Jahrhundert
Jürgen Schulte-Hobein: Staat und Politik im kölnischen Sauerland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
Harm Klueting: Kommunalverfassung – Gemeindeordnung – Kommunale Selbstverwaltung
Günter Cronau: Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im 19. und 20. Jahrhundert
Harm Klueting: Gebietsreform – Kommunale Neuordnung – Eingemeindungen
Patrick Ernst Sensburg: Gerichtswesen und Justiz
Harm Klueting: Bevölkerungsentwicklung
Wilfried Reininghaus: Gewerbe und Handel im ehemaligen Herzogtum Westfalen im 19. Jahrhundert (1800–1914)
Josef Schulte: Zur Geschichte der Industrie und ihrer Unternehmen im ehemaligen Herzogtum Westfalen in der Zeit der Weltkriege (1914–1945)
Markus Beek: Verkehrsgeschichte
Jens Hahnwald: Tagelöhner, Arbeiter und Arbeiterbewegung im kölnischen Sauerland des 19. und 20. Jahrhunderts
Bernward Selter: Land- und Forstwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert
Stefan Prott:Gewässer, Wasserwirtschaft und Elektrifi zierungim ehemaligen Herzogtum Westfalen (1800–2000)
Dieter Wurm: „Im Dienste der Kultur und des Tourismus“
Susanne Falk: Das kulturelle Leben in den Städten und Dörfern des kölnischen Sauerlandes im 19. und 20. Jahrhundert
Jens Foken: Schulwesen und Lehrerbildung (1803–1945)
Erika Richter: Die Entwicklung des Schulwesens seit 1945
Reimund Haas: Katholisches Leben und Pfarreien im Raum des alten Herzogtums Westfalen von der Reorganisation im 19. Jahrhundert bis zur Reorganisation im 21. Jahrhundert
Harm Klueting: Klöster – Mönche und Nonnen – Orden und Kongregationen
Jürgen Kampmann: Genese und Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinden im ehemaligen Herzogtum Westfalen
Georg Glade: Die Juden im ehemaligen Herzogtum Westfalen seit 1803
Ahmet Arslan: Muslimische Gemeinden im kölnischen Sauerland
Abbildungen
Register
Abbildungsnachweis
Corrigenda und Ergänzungen zum ersten Band
Kurzbiographien der Mitarbeiter
Autoren und Autorinnen des Gesamtwerkes
Citation preview
Klueting Das Herzogtum Westfalen Band 2
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 1
06.11.2012 16:07:46
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 2
06.11.2012 16:07:47
Das Herzogtum Westfalen Band 2 Das ehemalige kurkölnische Herzogtum Westfalen im Bereich der heutigen Kreise Hochsauerland, Olpe, Soest und Märkischer Kreis (19. und 20. Jahrhundert) Teilband 1
Herausgegeben von Harm Klueting unter Mitarbeit von Jens Foken
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 3
06.11.2012 16:07:47
L
ER HE I
-
M
-
WE
U AT B N D
STFÄ
CH
M
IS
Ü N S TER
Impressum © 2012 Aschendorff Verlag GmbH & Co. KG Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Die Vergütungsansprüche des § 54 Abs. 2 UrhG werden durch die Verwertungsgesellschaft Wort wahrgenommen. Gesamtherstellung: Aschendorff Druck und Dienstleistungen GmbH & Co. KG Druckhaus Aschendorff Münster, 2012 ISBN 978–3–402–12862–6
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 4
06.11.2012 16:07:51
Vorwort des Sauerländer Heimatbundes Das kurkölnische Sauerland als historische und lebendige Region wissenschaftlich zu erforschen und in einer zweibändigen, umfangreichen Publikation vorzustellen, das war Idee und Anspruch des Buchprojektes, dem wir nun auch diesen zweiten Band zu verdanken haben. Wie geplant behandelt der vorliegende Band den Zeitraum von der Säkularisation (1803) bis in die Gegenwart mit den Themenschwerpunkten Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr, Kultur, Schulwesen, Kirche und Religion. Wir teilen die Auffassung des Herausgebers Prof. Dr. Dr. Harm Klueting, mit diesem Werk einen bedeutenden Beitrag zur landesgeschichtlichen und landeskundlichen Forschung präsentieren zu können. Das ambitionierte Vorhaben, in dieser breitgefächerten Themenstellung ein Gesamtwerk „Das Herzogtum Westfalen“ zu erstellen, ist nun vollendet. Der Sauerländer Heimatbund dankt Herrn Prof. Dr. Dr. Klueting und dem verantwortlichen Redaktionsassistenten Dr. Jens Foken sowie allen Autoren für ihre Beiträge zu diesem Werk. Wir erinnern – nach wie vor – mit Dankbarkeit daran, dass dies nur gelingen konnte, weil wir von den Sparkassen, der Nordrhein-Westfalen-Stiftung, der LWL-Kulturstiftung, dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Westfälischen Heimatbund sowie von den Kommunen in der Region finanzielle Unterstützung erfahren haben. Der Dank des Vorstandes im Sauerländer Heimatbund gebührt aber auch meinem Vorgänger im Amt des Vorsitzenden Dieter Wurm, der in seiner Amtszeit dieses Projekt seit 2003 in vielen Gesprächen und Verhandlungen vorangetrieben und bis zum Erscheinen dieses Bandes verantwortet hat. So bleibt mir zum guten Schluss nur noch der Wunsch, dass auch dieser zweite Band lebhaftes Interesse und eine zufriedene Leserschaft finden wird. Elmar Reuter Vorsitzender des Sauerländer Heimatbundes
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 5
06.11.2012 16:07:52
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 6
06.11.2012 16:07:53
Vorwort Im Jahre 2009 erschien der 927 Druckseiten umfassende erste Band dieses Werkes „Das Herzogtum Westfalen“ über das kurkölnische Herzogtum Westfalen von den Anfängen der kölnischen Herrschaft bis zur Säkularisation 1803. Bei der Buchvorstellung am 29. September 2009 war nicht absehbar, dass der zweite Band über das ehemalige kurkölnische Herzogtum Westfalen im Bereich der heutigen Kreise Hochsauerland, Olpe, Soest und Märkischer Kreis im 19. und 20. Jahrhundert so lange auf sich warten lassen würde. Das Konzept war fertig, qualifizierte Autoren und Autorinnen waren gewonnen und teilweise schon an der Arbeit und die Verträge geschlossen. Erscheinen sollte der Band 2011. Vorgesehen waren neben den anderen Beiträgen, die sich jetzt in dem nunmehr fertiggestellten Werk finden, zwei große Blöcke, von denen der eine dem gesamten Kommunalwesen gelten sollte, der andere Wirtschaft und Gesellschaft. 2010 zogen sich die beiden dafür vorgesehenen Bearbeiter jedoch von dem Projekt zurück. Danach erwies es sich als überaus schwierig, andere Autoren für diese beiden großen und unverzichtbaren Teile zu gewinnen. Dadurch schien der zweite Band zeitweise gefährdet und nicht mehr realisierbar zu sein. Eine Lösung wurde durch die Aufteilung dieser beiden Teile auf mehrere Autoren gefunden. Was das Kommunalwesen betraf, so konnte mit dem am 7. September 2012 gestorbenen Dr. Günter Cronau der ehemalige Stadtdirektor von Arnsberg für einen Beitrag über die Bürgermeister im 19. und 20. Jahrhundert gewonnen werden, während ich die Themen Kommunalverfassung, Gemeindeordnung und kommunale Selbstverwaltung sowie Gebietsreform und Kommunale Neugliederung übernahm. Zwar konnte ich damit an eigene ältere Arbeiten anknüpfen, doch war das nur unter Zurückstellung anderer Aufgaben möglich. In ähnlicher Weise wurde der Teil Wirtschaft und Gesellschaft auf mehrere Autoren aufgeteilt. Der Präsident des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Wilfried Reininghaus, der zum ersten Band schon die Darstellung „Salinen, Berg- und Hüttenwerke, Gewerbe und Handel“ beigetragen hatte, übernahm bereitwillig die Darstellung des Gewerbes und des Handels im 19. Jahrhundert (bis 1914), während Josef Schulte als Abteilungsleiter beim Verband „Arbeitgeber Südwestfalen e.V.“ bereit war, die Industrie und ihre Unternehmen im 20. Jahrhundert zu behandeln. Für die Verkehrsgeschichte stellte sich der durch seine Dissertation „Straßen statt Schienen. Streckenstilllegungen der Bahnstrecken bei der Deutschen Bundesbahn in den Bundesbahndirektionen Köln und Wuppertal im Zeitraum 1949 bis 1976“ als Verkehrshistoriker ausgewiesene Dr. Markus Beek zur Verfügung, für die Sozialgeschichte der Tagelöhner und Arbeiter und die Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert Jens Hahnwald M. A. Die Bevölkerungsgeschichte übernahm ich selbst. Durch diese konzeptionellen Änderungen, durch die Suche nach neuen Autoren und durch deren notwendige Einarbeitung ergaben sich Verzögerungen von mehr als einem Jahr, zumal nach dem altersbedingten
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 7
06.11.2012 16:07:53
8
Vorwort
Ausscheiden des ursprünglich für das Thema Gewässer, Wasserwirtschaft und Elektrifizierung vorgesehenen Autors ebenfalls ein neuer Bearbeiter gesucht werden musste, der sich mit Dipl.-Geograph Stefan Prott fand. Leider erfüllt der Band auch in der jetzt realisierten Gestalt nicht alle meine Erwartungen. So sah sich Josef Schulte gezwungen, seine Darstellung auf die Zeit bis 1945 zu beschränken, was mir erst kurz vor der Drucklegung bekannt wurde. Da das zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu ändern war und hingenommen werden musste, bedeutet das, dass die gesamte Wirtschaftsentwicklung während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und damit für die Region außerordentlich wichtige Veränderungen in diesem Werk nicht vorkommen. Ein ähnliches Desiderat stellt das Fehlen eines Beitrags über die Bildende Kunst im 19. und 20. Jahrhundert dar, die im ersten Band mit einem Beitrag zum Spätmittelalter und zur Frühen Neuzeit der jungen Kunsthistorikerin Marina Cremer M. A. vertreten ist. Zwar konnte auch für den zweiten Band eine qualifizierte Kunsthistorikerin gewonnen werden, doch scheiterte deren weitere Mitarbeit an der nachträglich geltend gemachten völlig überhöhten Honorarforderung, die die respektable Honorierung aller Autoren um ein Vielfaches überschritt. Schließlich musste ich als Herausgeber entscheiden, den bereits fertig gesetzten Beitrag „Literatur und Literaten im kölnischen Sauerland des 19. und 20. Jahrhunderts“ unmittelbar vor dem Ausdruck aus dem Werk herauszunehmen, weil die Verfasserin nicht bereit war, die von mir und von Dr. Jens Foken für notwendig gehaltenen Änderungen zu akzeptieren und uns stattdessen mit einem Gerichtsverfahren drohte. Angesichts der zeitweise unüberwindbar scheinenden Schwierigkeiten erfüllen mich Freude und Dank, dass mit dem zweiten Band das Gesamtwerk „Das Herzogtum Westfalen“ nunmehr im Umfang von mehr als 2.000 Druckseiten – trotz der aufgezeigten Lücken – vollständig vorliegt. Der Dank gilt allen Autoren und Autorinnen, dem Vorstand des Sauerländer Heimatbundes, seinem Vorsitzenden Ehrenbürgermeister Elmar Reuter und seinem früheren Vorsitzenden – und Mitautor – Studiendirektor i.R. Dieter Wurm, dem Verlag Aschendorff in Münster und hier vor allem Dr. Dirk Paßmann und Dr. Burkhard Beyer, allen voran aber – wie schon im ersten Band – meinem ehemaligen akademischen Schüler und langjährig bewährten Mitarbeiter Dr. Jens Foken, dessen unermüdliche Arbeit diesem Band und dem Gesamtwerk über Jahre hin gegolten hat. Köln und Fribourg (Schweiz) am 3. November 2012 Prof. Dr. Dr. Harm Klueting
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 8
06.11.2012 16:07:53
Inhalt des ersten Teilbandes Harm Klueting Kurkölnisches Herzogtum Westfalen oder (kur-)kölnisches Sauerland – Zur Einleitung ..............................................
13
Hans-Joachim Behr Staat und Politik im 19. Jahrhundert ...........................................................
21
Jürgen Schulte-Hobein Staat und Politik im kölnischen Sauerland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ...................................................
83
Harm Klueting Kommunalverfassung – Gemeindeordnung – Kommunale Selbstverwaltung ...................................................................... 141 Günter Cronau † Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden im 19. und 20. Jahrhundert ......................................................................... 187 Harm Klueting Gebietsreform – Kommunale Neuordnung – Eingemeindungen ............ 247 Patrick Ernst Sensburg Gerichtswesen und Justiz ............................................................................. 323 Harm Klueting Bevölkerungsentwicklung ............................................................................ 355 Wilfried Reininghaus Gewerbe und Handel im ehemaligen Herzogtum Westfalen im 19. Jahrhundert (1800–1914) ................................................................. 415 Josef Schulte Zur Geschichte der Industrie und ihrer Unternehmen im ehemaligen Herzogtum Westfalen in der Zeit der Weltkriege (1914–1945) ................. 461 Markus Beek Verkehrsgeschichte ....................................................................................... 507 Jens Hahnwald Tagelöhner, Arbeiter und Arbeiterbewegung im kölnischen Sauerland des 19. und 20. Jahrhunderts ..................................................... 539
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 9
06.11.2012 16:07:53
10
Inhalt
Inhalt des zweiten Teilbandes Bernward Selter Land- und Forstwirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert ............................. 591 Stefan Prott Gewässer, Wasserwirtschaft und Elektrifizierung im ehemaligen Herzogtum Westfalen (1800 –2000) .................................. 643 Dieter Wurm „Im Dienste der Kultur und des Tourismus“: Überregionale und kreisgrenzenübergreifende Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen im kölnischen Sauerland Mit einem Exkurs „Mundart und Sauerlandidentität“ von Manfred Raffenberg ............................................................................... 691 Susanne Falk Das kulturelle Leben in den Städten und Dörfern des kölnischen Sauerlandes im 19. und 20. Jahrhundert .......................... 749 Jens Foken Schulwesen und Lehrerbildung (1803 –1945) ............................................ 781 Erika Richter Die Entwicklung des Schulwesens seit 1945 ................................................ 855 Reimund Haas Katholisches Leben und Pfarreien im Raum des alten Herzogtums Westfalen von der Reorganisation im 19. Jahrhundert bis zur Reorganisation im 21. Jahrhundert ................................................. 879 Harm Klueting Klöster – Mönche und Nonnen – Orden und Kongregationen ................ 949 Jürgen Kampmann Genese und Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinden im ehemaligen Herzogtum Westfalen ......................................................... 1009 Georg Glade Die Juden im ehemaligen Herzogtum Westfalen seit 1803 ....................... 1041 Ahmet Arslan Die muslimischen Gemeinden im kölnischen Sauerland .......................... 1083
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 10
06.11.2012 16:07:53
Inhalt
11
Abbildungen ................................................................................................. 1099
Register .......................................................................................................... 1117 Abbildungsnachweis ..................................................................................... 1155 Corrigenda und Ergänzungen zum ersten Band ........................................ 1157 Kurzbiographien der Mitarbeiter ................................................................ 1159 Autoren und Autorinnen des Gesamtwerkes .............................................. 1169
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 11
06.11.2012 16:07:53
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - 00 vorspann - seiten0001-0012.indd 12
06.11.2012 16:07:53
13
Harm Klueting
Kurkölnisches Herzogtum Westfalen oder (kur-) kölnisches Sauerland Zur Einleitung I. Johann Gustav Droysen, geboren 1808 in Treptow in Pommern und gestorben 1884 in Berlin, wo er seit 1859 an der damaligen Friedrich Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität, Professor der Geschichte war, hielt 1857, damals an der Universität Jena, eine Vorlesung über „Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte“, die er später in Berlin regelmäßig vortrug. Eine gedruckte Fassung erschien 1858 unter dem Titel „Grundriß der Historik“, ebenso 1862. Die letzte gedruckte Fassung liegt als dritte, umgearbeitete Auflage aus dem Jahre 1882 vor.1 In dieser letzten zu Droysens Lebzeiten gedruckten Fassung umfasst die Schrift – ohne die „Beilagen“ – nicht mehr als 44 Druckseiten, doch gehören diese zum Wichtigsten, was über Theorie der Geschichtswissenschaft je publiziert wurde.2 Vollständig ediert wurde die Vorlesung erst 1937 von Rudolf Hübner.3 Eine historisch-kritische Ausgabe von Peter Leyh begann 1977 zu erscheinen.4 Droysen lehrte die Historiker, dass der Gegenstand der Geschichtswissenschaft – anders als die Dinge und Erscheinungen, um die es in den Naturwissenschaften geht – nicht mehr vorhanden ist, nicht mehr existiert, sondern nur fortlebt im Wissen – oder in der Erinnerung – an das Nichtmehrvorhandene, an das Vergangene oder die Vergangenheiten, wie er im Plural sagt: „Alle empirische Forschung regelt sich nach den Gegebenheiten, auf die sie gerichtet ist. Und sie kann sich nur auf solche richten, die ihr unmittelbar zu sinnlicher Wahrnehmung gegenwärtig sind. Das Gegebene für die historische Forschung sind nicht die Vergangenheiten, denn die1 2
3
4
Johann Gustav Droysen, Grundriß der Historik, 3. Aufl. Leipzig 1882. Ich habe 1992 als Gastprofessor an der Emory University in Atlanta, Georgia (USA) in englischer Sprache Vorlesungen und Seminarübungen über „Nineteenth-Century German Historiography“ gehalten und dabei – anhand der englischen Ausgabe Johann Gustav Droysen, Outline of the Principles of History, Boston, Mass. 1893 – ausführlich Droysens „Historik“ behandelt und widme diese Überlegungen der Erinnerung an meine amerikanischen Kollegen und Studenten der Zeit vor 20 Jahren. Johann Gustav Droysen, Historik. Vorlesungen über Enzyklopädie und Methodologie der Geschichte, München 1937, 8. Aufl. 1977. Johann Gustav Droysen, Historik. Textausgabe von Peter Leyh. Bd. 1: Rekonstruktion der ersten vollständigen Fassung der Vorlesungen (1857). Grundriß der Historik in der ersten handschriftlichen (1857/58) und in der letzten gedruckten Fassung (1882), Stuttgart-Bad Cannstatt 1977; Bd. 2: Texte im Umkreis der Historik (1826–1882). Hrsg. von Horst Walter Blanke, Stuttgart-Bad Cannstatt 2007; Suppl.-Bd.: Droysen-Bibliographie. Hrsg. von Horst Walter Blanke, Stuttgart-Bad Cannstatt 2008.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 13
07.11.2012 13:36:23
14
Harm Klueting
se sind vergangen, sondern das von ihnen in dem Jetzt und Hier noch Unvergangene, mögen es Erinnerungen von dem, was war und geschah, oder Ueberreste des Gewesenen und Geschehenen sein.“5 Das unterscheidet die Geschichtswissenschaft aber nicht nur von den Naturwissenschaften, sondern ebenso von ihr an sich nahe verwandten Geisteswissenschaften wie der Kunstgeschichte, der ihre Objekte – Werke der Malerei, der Plastik, der Architektur usw. – ja „unmittelbar zu sinnlicher Wahrnehmung gegenwärtig“ sind. Nur die Geschichtswissenschaft hat es mit einem Gegenstand oder mit Gegenständen zu tun, die nicht (mehr) existieren, sondern nur durch Relikte – schriftliche Quellen und materielle Überreste wie Bodenfunde oder Bauwerke oder immaterielle Überreste wie Ortsnamen oder Institutionen – repräsentiert werden. Atheisten mögen einwenden, das sei mit dem Gegenstand der Theologie als Wissenschaft – Gott – auch so. Aber das steht erstens auf einem anderen Blatt und entspricht zweitens nicht meiner Position, die weit davon entfernt ist, eine atheistische zu sein. Somit bleibt das Nicht(mehr)vorhandensein ihres Gegenstandes die Besonderheit der Geschichtswissenschaft. Daraus folgt – mit Droysen gedacht –, dass der Historiker gar nicht die Vergangenheit erhellen kann – diese ist vergangen –, sondern nur das Wissen um die Vergangenheit oder die Erinnerung an die Vergangenheit.
II. Das wird deutlich bei der Beschäftigung mit der Geschichte des kurkölnischen Herzogtums Westfalen. Das Herzogtum Westfalen ist vergangen; es ist nicht mehr vorhanden. Es lebt nirgendwo institutionell fort. Seine Grenzen sind verwischt. Das kurkölnische Herzogtum Westfalen – das neben dem von ihm räumlich getrennten und nie institutionell mit ihm verbundenen kurkölnischen „Vest“ Recklinghausen andere und größere westfälische Nebenland des Erzstiftes und geistlichen Kurfürstentums Köln6 – hatte keine natürlichen Grenzen, allenfalls abschnittsweise die Lippe im Norden und den Kamm des Rothaargebirges im Süden.7 Es bildete weder ethnisch noch – durch einen gemeinsamen und nur dieser Landschaft eigenen Dialekt, wie ihn signifikant das Siegerland aufweist – linguistisch einen von den Nachbarterritorien abgrenzbaren Raum. Das Herzogtum Westfalen war ein Zufallsprodukt von Entwicklungen der Kirchen- und der Politikgeschichte seit der Missionierungs- und Christianisierungszeit bzw. der Karolingerzeit, in der die Diözese (seit 794/95 Erzdiözese) Köln sich auf der rechten Rheinseite über Westfalen südlich der Lippe 5 6
7
Zitiert nach der Ausgabe von 1882, dort S. 8, § 5. Monika Storm, Das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und das rheinische Erzstift Köln, in: Harm Klueting/Jens Foken (Hrsg.), Das Herzogtum Westfalen. Bd. 1: Das kurkölnische Herzogtum Westfalen von den Anfängen der kölnischen Herrschaft im südlichen Westfalen bis zur Säkularisation 1803, Münster 2009, S. 343–362. Günther Becker, Das Herzogtum Westfalen – der geographische Raum, ebd., S. 15–35.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 14
06.11.2012 14:42:42
Zur Einleitung
15
ausdehnte und neben ihrem rheinischen Diözesangebiet auch ein westfälisches Bistum wurde.8 Hier kam es seit der Zeit Karls des Großen zu reichen Grundbesitzerwerbungen der Kölner Kirche, die zur ersten Grundlage der späteren kölnischen Herrschaft und des kurkölnischen Herzogtums Westfalen wurden. Kölnische Schwerpunkte bildeten sich früh um Soest und Medebach, Hachen und Werl. Dadurch wurden die Erzbischöfe von Köln schon in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts zur wichtigsten politischen Größe dieser Region. Aber auch Attendorn befand sich durch die kirchliche Bindung an Köln und an das Kölner Stift St. Severin schon früh unter kölnischer Herrschaft. So konnte der Kölner Erzbischof Anno II. 1072 die Kirche und den Haupthof in Attandarra – so die alte Namensform – an das von ihm gegründete Kloster Grafschaft übertragen. 1102 eroberte der Kölner Erzbischof Friedrich I. zum ersten Mal die Burg Arnsberg der Grafen von Werl und gewann damit die Hälfte der Grafenrechte der Grafen von Werl im südlichen Westfalen. Die neue Burg – die heutige Ruine auf dem Arnsberger Schlossberg – wurde 1166 von den Kölnern erstürmt – Erzbischof war zu dieser Zeit Rainald von Dassel – und der Graf dadurch gezwungen, den Rest der Grafschaft Arnsberg von Köln als Lehen zu empfangen. Daher brachte nach dem Sturz Heinrichs des Löwen, des Herzogs von Sachsen und Bayern, die Übertragung des Dukates, der sächsischen Herzogswürde in Westfalen, 1180 auf Erzbischof Philipp von Heinsberg nur noch eine Art Bestätigung bereits bestehender Machtverhältnisse. Doch bezog sich die Herzogswürde nicht auf das spätere kölnische Territorium, sondern auf ganz Westfalen und blieb als solche ein theoretischer Anspruch, der gegenüber den anderen westfälischen Bischöfen – Münster, Paderborn, Osnabrück und Minden – und gegenüber den aufsteigenden weltlichen Dynasten nicht durchsetzbar war. Aber die Herzogswürde lieferte den Titel für das „Herzogtum Westfalen“. 1248 erwarb der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden durch Kauf die Burg Waldenburg bei Attendorn und die zugehörige Grundherrschaft von den Grafen von Sayn. Dadurch erfuhr der Ausbau der kölnischen Herrschaft im Bereich des heutigen Kreises Olpe eine wesentliche Stärkung, nachdem die kölnische Stadt Attendorn schon 1222 befestigt worden war. 1368 übertrug der letzte Graf von Arnsberg, der als einziger Nichtkleriker im Hohen Dom zu Köln bestattete Graf Gottfried IV. von Arnsberg, die Grafschaft Arnsberg an das Kölner Erzbistum, wodurch das spätere Herzogtum Westfalen weitgehend abgerundet wurde. Die letzte Etappe kam mit der Soester Fehde der Jahre 1444 bis 1449, in der Erzbischof Dietrich von Moers die alte Hauptstadt des kölnischen Westfalen, Soest, und die Soester Börde verlor, während er gleichzeitig die Herrschaft Bilstein und Fredeburg gewann. Damit nahm das Herzogtum Westfalen die räumliche Gestalt an, die es bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts behielt, wobei sich der Name „Herzogtum Westfalen“ aber erst später für das
8
Edeltraud Klueting, Die karolingischen Bistumsgründungen und Bistumsgrenzen in Sachsen, in: dies./Harm Klueting/Hans-Joachim Schmidt (Hrsg.), Bistümer und Bistumsgrenzen vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart, Rom 2006, S. 64–80.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 15
06.11.2012 14:42:42
16
Harm Klueting
erst seit dem 17. Jahrhundert als Einheit empfundene Land durchsetzte. Über das alles berichten die einschlägigen Beiträge im ersten Band des Werkes.9 Das Ende des Herzogtums Westfalen als geistliches Territorium – bzw. das Ende des kurkölnischen Herzogtums Westfalen – kam mit der Säkularisation von 1803 und mit der durch den Reichsdeputationshauptschluss vom 25. Februar 1803 ermöglichten Annexion durch den Landgrafen von Hessen-Darmstadt.10 Zwar bestand das Herzogtum Westfalen unter diesem Namen als Provinz der Landgrafschaft Hessen-Darmstadt (seit 1806 des Großherzogtums Hessen) fort, jedoch ohne Volkmarsen, das – räumlich nie mit dem übrigen Herzogtum Westfalen verbunden und durch waldeckisches Gebiet davon getrennt – 1803 zwar ebenfalls an Hessen-Darmstadt gefallen war, aber 1806 an Nassau-Oranien und 1807 an das Königreich Westphalen gelangte und heute zum hessischen Kreis Waldeck-Frankenberg gehört. Nach dem Übergang des ehemaligen Herzogtums Westfalen vom Großherzogtum Hessen an Preußen, 1816, verschwand der Name „Herzogtum Westfalen“ nach 1825 als amtliche Bezeichnung aus der Sprache von Politik und Verwaltung. 1817 wurden die alte kölnische Stadt Menden und die ehemals dem Herzogtum Westfalen angehörenden Orte Böingsen, Halingen, Holzen (Bösperde), Oesbern, Schwitten, Sümmern und Wimbern dem neuen Landkreis Iserlohn zugeschlagen, womit der Gebietsbestand des ehemaligen Herzogtums Westfalen bereits empfindlich gestört wurde. Doch blieben die Außengrenzen des ehemaligen Herzogtums Westfalen in den Gemeindegrenzen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts erkennbar. Die Kommunale Neuordnung der Jahre 1966 bis 1974 führte jedoch zu grundlegenden Veränderungen. Dem neuen Märkischen Kreis wurden die um ehemalige Gemeinden des Altkreises Arnsberg vergrößerte, ehemals kölnische Stadt Balve und die ebenfalls um ehemalige Gemeinden des Altkreises Arnsberg erweiterte alte märkische Stadt Neuenrade zugeordnet. Auch andernorts nahm die Kommunale Neugliederung oft keine Rücksicht mehr auf historische Grenzen. So bilden ehemals kölnische Ortschaften heute Ortsteile von Iserlohn, Lippstadt, Meinerzhagen oder Neuenrade oder gehören dem Kunstgebilde der Gemeinde Lippetal an, die mit ihrem Gemeindegebiet auf die nördliche Seite der Lippe in den Bereich des ehemaligen Hochstifts Münster reicht.11 Die kirchliche Zugehörigkeit des Gebietes des ehemaligen Herzogtums Westfalen zur Erzdiözese Köln, womit es sich von den zur Diözese Münster gehörenden Gebieten nördlich der Lippe und von dem das Kerngebiet der Diözese (seit 1930 Erzdiözese) Paderborn bildenden Hochstift Paderborn östlich der alten, heute nicht mehr erkennbaren Kulturgrenze östlich von Geseke 9
10
11
An erster Stelle zu nennen ist Wilhelm Janssen, Marschallamt Westfalen – Amt Waldenburg – Grafschaft Arnsberg – Herrschaft Bilstein-Fredeburg. Die Entstehung des Territoriums „Herzogtum Westfalen“, in: Klueting/Foken, Das Herzogtum Westfalen, Bd. 1 (wie Anm. 6), S. 235–265. Siehe auch Harm Klueting, Das kurkölnische Herzogtum Westfalen als geistliches Territorium im 16.-18. Jahrhundert, ebd., S. 443–518. Dazu Harm Klueting. Die Säkularisation und das Ende des kurkölnischen Herzogtums Westfalen, ebd., S. 851–861. Dazu in diesem Band Harm Klueting, Gebietsreform – Kommunale Neugliederung – Eingemeindungen, S. 247–322.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 16
06.11.2012 14:42:42
Zur Einleitung
17
(Grenze Westfalen / Engern) unterschied, endete 1821 mit dem Übergang des Gebietes des ehemaligen Herzogtums Westfalen an das Bistum Paderborn.12 Der politisch, kulturell und sozial bedeutsame Gegensatz zu den preußischen Gebieten – man denke nur an das preußische Militär- und Steuerwesen – mit der ehemaligen, seit 1609/14 brandenburgischen bzw. später preußischen Grafschaft Mark, dem preußischen märkischen Sauerland als Teil der Grafschaft Mark und der preußischen Garnisons- und Verwaltungsstadt Hamm ebnete sich allmählich ein, seit das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen seit 1816 selbst preußisch und Teil der preußischen Provinz Westfalen und seit seine alte Landeshauptstadt Arnsberg, ebenfalls seit 1816, Sitz eines preußischen Regierungspräsidenten und der Behörden des preußischen Regierungsbezirks Arnsberg war, der weit über das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen hinaus reichte und das altpreußische Gebiet der – bevölkerungsreicheren und mit dem Ostteil des Ruhrgebietes wirtschaftlich weit gewichtigeren – ehemaligen Grafschaft Mark einbezog.13 Was bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus blieb, war der nahezu geschlossen katholische Charakter des Gebietes des ehemaligen Herzogtums Westfalen,14 der es vom Siegerland, vom Wittgensteiner Land, von Hessen und vom Waldecker Land im Süden und Osten ebenso unterschied wie vom Oberbergischen Land und vom märkischen Sauerland im Westen, es aber zugleich mit dem ehemaligen Hochstift Paderborn im Nordosten und mit dem Münsterland im Norden verband und ihm im Übrigen – in der Wahrnehmung vieler Beobachter – neben wirtschaftlich peripherer Lage den Geruch der Rückständigkeit verlieh.15 Aber auch damit ist es längst vorbei, seit die großen Bevölkerungsverschiebungen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges16 in großer Zahl evangelische Christen in das ehemalige Herzogtum Westfalen kommen ließen,17 in dem heute der Katholizismus, wie vielerorts in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Jahre 1962 bis 1965, von wachsender Profillosigkeit 12
13
14
15
16 17
Volkmarsen und Marsberg (Ober- und Niedermarsberg) im Osten des Herzogtums Westfalen gehörten kirchlich immer zur Diözese Paderborn und nur politisch zu Kurköln, während die Pfarreien Alme und Thülen mit den Orten Hoppecke, Rösenbeck, Nehden, Messinghausen, Radlinghausen, Bontkirchen und Bredelar 1733 kirchlich aus der Diözese Paderborn ausschieden und seitdem auch kirchlich zu Köln gehörten. Siehe dazu Hans Jürgen Brandt/Karl Hengst, Geschichte des Erzbistums Paderborn. Bd. 2: Das Bistum Paderborn von der Reformation bis zur Säkularisation 1532–1802/21, Paderborn 2007, S. 22, 26. Dazu in diesem Band vor allem Hans-Joachim Behr, Staat und Politik im 19. Jahrhundert, S. 21– 82. Zu den wenigen evangelischen Christen vor der Mitte des 20. Jahrhunderts und zu den Juden vor Emigration und Holocaust in diesem Band Jürgen Kampmann, Genese und Entwicklung der evangelischen Kirchengemeinden im ehemaligen Herzogtum Westfalen, S. 1009–1040; Georg Glade, Die Juden im ehemaligen Herzogtum Westfalen seit 1802, S. 1041–1081. Zum Katholizismus im Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen im 19. und 20. Jahrhundert in diesem Band Reimund Haas, Katholisches Leben und Pfarreien im Raum des alten Herzogtums Westfalen von der Reorganisation im 19. Jahrhundert bis zur Reorganisation im 21. Jahrhundert, S. 879–947; Harm Klueting, Klöster – Mönche und Nonnen – Orden und Kongregationen, S. 949–1008. Dazu in diesem Band Harm Klueting, Bevölkerungsentwicklung, S. 355–414. Dazu in diesem Band Kampmann, Genese und Entwicklung (wie Anm. 14).
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 17
06.11.2012 14:42:42
18
Harm Klueting
und Selbstsäkularisierung – verbunden mit zunehmenden Kirchenaustritten, zurückgehenden Priesterzahlen und sich leerenden oder bereits aufgegebenen Klöstern – geprägt ist und seine kulturelle Prägekraft allmählich verliert, und in dem jetzt neben Katholiken in beträchtlicher Zahl Muslime18 und landeskirchliche sowie freikirchliche Protestanten und in geringerer Zahl Angehörige anderer Religionen, aber auch Religions- und Glaubenslose leben. Eine Erinnerung an das Kurkölnische ist somit kaum noch zu erwarten, am ehesten in bildungsbürgerlichen oder in heimatlich interessierten Kreisen, wie sie der Sauerländer Heimatbund integriert,19 der aber bezeichnenderweise seine Klientel außer im Hochsauerlandkreis und im Kreis Olpe allenfalls noch in dem heute zum Kreis Soest gehörenden Warstein findet, das mit seinen vor der Kommunalen Neuordnung selbständige Gemeinden bildenden Stadtteilen Allagen, Belecke, Hirschberg, Mülheim, Sichtigvor und Waldhausen bis zur Jahreswende 1974/75 dem Kreis Arnsberg angehörte, nicht aber in dem historisch ebenfalls kurkölnischen Hellweg- und Lippegebiet.
III. Dieses Nichtmehrvorhandensein des Herzogtums Westfalen hat Auswirkungen auf die Konzeption und Realisation eines mit beiden Bänden mehr als 2.000 Druckseiten umfassenden Werkes, das den Titel „Das Herzogtum Westfalen“ trägt. Mehrere Dutzend Historiker und Vertreter von Nachbardisziplinen – darunter Theologen, Philologen, Juristen, Kunsthistoriker und Ökonomen – behandeln gemeinsam in Abschnitten die Geschichte eines seit rund 200 Jahren nicht mehr bestehenden und auch vorher in seiner Einheit als „Herzogtum Westfalen“ relativ ephemeren Gebildes, das in der heutigen Wirklichkeit kaum Spuren hinterlassen hat und für die allermeisten Bewohner der Region keinerlei Realität mehr besitzt. Ursprünglich war ein umfangreiches einbändiges Werk „Das kurkölnische Herzogtum von den Anfängen der kölnischen Herrschaft im südlichen Westfalen bis zur Säkularisation 1803“ vorgesehen,20 wie es mit Band 1 des Gesamtwerkes „Das Herzogtum Westfalen“ seit 2009 vorliegt. Gegenstand dieses Bandes ist im Sinne Droysens unser Wissen von der Vergangenheit im Bereich des kurkölnischen Herzogtums Westfalen in der Zeit seiner Entstehung und seines Bestehens. Mit der Ausweitung des Projektes auf ein zweibändiges Werk, dessen zweiter Band dem ehemaligen kurkölnischen Herzogtum Westfalen im Bereich der heutigen Kreise Hochsauerland, Olpe, Soest und Märkischer Kreis 18
19
20
Dazu in diesem Band Ahmet Arslan, Muslimische Gemeinden im kölnischen Sauerland, S. 1083– 1097. Dazu in diesem Band Dieter Wurm, „Im Dienste der Kultur und des Tourismus“. Überregionale und kreisübergreifende Vereine, Verbände, Organisationen und Institutionen im kölnischen Sauerland, S. 691–748. Dazu Harm Klueting, Vorwort, in: Klueting/Foken, Das Herzogtum Westfalen, Bd. 1 (wie Anm. 6), S. 7–9, hier S. 8.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 18
06.11.2012 14:42:42
Zur Einleitung
19
im 19. und 20. Jahrhundert gelten sollte, standen Herausgeber und Autoren nicht nur vor der Droysenschen Frage, nicht über die Vergangenheit schreiben zu können, sondern nur über unser Wissen von der Vergangenheit. Sie hatten es darüber hinaus mit einem Gegenstand zu tun, der seit 1816 und somit während des größten Teils des 19. Jahrhunderts und im gesamten 20. Jahrhundert keinerlei Realität mehr besaß. Einige Autoren lösten das Problem, indem sie sich mehr oder weniger ganz auf den 1975 unter Veränderung ihres Gebietsstandes aus den Landkreisen Arnsberg, Brilon und Meschede hervorgegangenen Hochsauerlandkreis und auf den Kreis Olpe – bzw. auf den Kreis Olpe und die Altkreise Arnsberg, Brilon und Meschede – und somit auf das Gebiet des Sauerländer Heimatbundes konzentrierten und lediglich das kölnische Sauerland im 19. und 20. Jahrhundert in den Blick nahmen. Andere hingegen waren bemüht, das Gesamtgebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen und also auch den Hellweg- und Lipperaum einzubeziehen – wobei manche unter dem Titel „kölnisches Sauerland“ auch das Hellweg- und Lippegebiet behandelten. Sie standen vor dem Dilemma, über Werl und Geseke schreiben und über Soest und Lippstadt schweigen zu sollen. Bisweilen entsteht der Eindruck, dass die Autoren, die im Hochsauerlandkreis oder im Kreis Olpe leben oder arbeiten, eher der Binnensicht auf das kölnische Sauerland verpflichtet sind, während Autoren, die außerhalb dieser beiden heutigen Kreise leben oder arbeiten, eher den Blick auf das Gesamtgebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen richten. Ich habe als Herausgeber den Autoren bewusst Freiheit gelassen. Gewiss hat Werl heute – nicht nur wirtschaftlich – mehr Gemeinsamkeiten mit Hamm, Soest und Unna als mit Meschede, Brilon oder Attendorn, Menden mehr Verbindungen mit Iserlohn als mit Schmallenberg, Medebach oder Olpe. Die gesamte dem kölnischen Sauerland „vorgelagerte mittlere Hellwegzone“ muss schon für das 19. Jahrhundert wirtschaftlich als Einheit betrachtet „und der kombinierte Wirtschaftsraum mittlerer Hellweg/kölnisches Sauerland in langfristiger Perspektive vergleichend behandelt werden“.21 Im 20. Jahrhundert „wurde diese Verbundenheit dann auch in dem neuen räumlichen Zuschnitt der Industrie- und Handelskammer für das Südöstliche Westfalen in Arnsberg deutlich. So kamen 1916 der Altkreis Soest und 1943 der Altkreis Lippstadt zum Kammerbezirk hinzu.“22 Aber dennoch wäre es nicht sinnvoll gewesen, für den zweiten Band den gesamten mittleren Hellwegraum von Unna bis Geseke unter Einschluss der altpreußischen bzw. der historisch nicht 21
22
Beide Zitate in diesem Band bei Wilfried Reininghaus, Gewerbe und Handel im ehemaligen Herzogtum Westfalen im 19. Jahrhundert (1800–1914), S. 415–460, hier S. 416, der für das 19. Jahrhundert u.a. auf die Bedeutung der Bahnhöfe in Soest und Lippstadt für das Sauerland und auf den „Sog“ hinweist, der von der Artilleriewerkstatt in Lippstadt auf Arbeitskräfte aus dem oberen Sauerland ausging. Zur Verkehrsgeschichte im Übrigen in diesem Band Markus Beek, Verkehrsgeschichte, S. 507–538; zur Arbeitermigration aus dem Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen ins Ruhrgebiet Klueting, Bevölkerungsentwicklung (wie Anm. 16), hier S. 406–408. Josef Schulte, Zur Geschichte der Industrie und ihrer Unternehmen im ehemaligen Herzogtum Westfalen in der Zeit der Weltkriege (1914–1945), in diesem Band S. 461–506, zit. S. 463.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 19
06.11.2012 14:42:42
20
Harm Klueting
kurkölnischen Gebiete einzubeziehen, weil mit demselben Recht dann auch das gesamte märkische Sauerland hätte integriert werden können,23 zumal das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen von 1817 bis 1975 Orte an die früheren Landkreise Altena und Iserlohn bzw. an den heutigen Märkischen Kreis verloren hat. Außerdem hätte eine solche Ausweitung des Darstellungsgebietes über die historischen Grenzen des Herzogtums Westfalen hinaus nicht nur den Zusammenhang zwischen dem zweiten und dem ersten Band des Gesamtwerkes empfindlich gestört. Vielmehr wäre der zweite Band dann zu einer Darstellung der Geschichte Westfalens südlich der Lippe im 19. und 20. Jahrhundert mutiert – nicht nur zu einer Darstellung der Geschichte der 2007 konstituierten „Region Südwestfalen“ –,24 weil sich dann auch die Frage nach dem Ruhrgebiet und nach der kreisfreien Stadt Hagen sowie nach dem Ennepe-Ruhr-Kreis, aber auch die Frage nach dem heutigen Kreis Paderborn sowie – wegen der vor allem wirtschaftlich engen Verbindungen mit dem märkischen Sauerland und dem Kreis Olpe – die Frage nach dem Bergischen Land gestellt hätte. Diese Fragen positiv zu beantworten und diese Teile des heutigen Landes Nordrhein-Westfalen einzubeziehen, hätte bedeutet, ein völlig anderes Werk entstehen zu lassen,25 in dem das Gebiet des ehemaligen Herzogtums Westfalen nur noch die vergleichsweise periphere Rolle gespielt hätte, die es tatsächlich spielte und spielt – trotz des immer noch bestehenden Sitzes der auch für das östliche Ruhrgebiet und für Städte wie Dortmund, Bochum, Hagen und Herne zuständigen Bezirksregierung in Arnsberg.
23
24
25
Schulte (ebd., S. 463f.) hält „im Interesse einer sauberen räumlichen Abgrenzung den Verzicht auf die Einbeziehung von Lippstadt und Soest zumindest für die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges für vertretbar.“ Dazu Schulte, ebd., S. 464: „Bekanntlich haben sich der Hochsauerlandkreis, der Märkische Kreis und die Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest im Jahre 2007 zur Region Südwestfalen zusammengeschlossen. Nur kurze Zeit später wurden die fünf Kreise vom Land NordrheinWestfalen für die Ausrichtung der ,Regionale 2013‘ gewählt. Durch den Zusammenschluss ist eine neue Region entstanden.“ In diesem Zusammenhang ist auf die Rezension von Matthias Kordes zu „Das Herzogtum Westfalen, Bd. 1“, in: Vestische Zeitschrift 103 (2010/11), S. 361–364, hinzuweisen, der die Nichteinbeziehung des Vestes Recklinghausen in Band 1 – zustimmend – erörtert, das zwar „den westfälischen Dukat der Kölner Erzbischöfe nach Norden“ abgeschirmt habe und wohl im 13. und 14. Jahrhundert „zunächst zum erzbischöflichen Herzogtum Westfalen“ zu zählen gewesen sei, wofür es urkundlich allerdings keine Belege gebe, das sich aber seit dem beginnenden 16. Jahrhundert „als eigenständiger dritter Teil des Länderkomplexes“ des Kölner Kurstaates „eindeutig nach Westen“ orientiert habe, sichtbar vor allem an der Teilnahme der Stadt Recklinghausen an der Städtekurie des Landtags des rheinischen Erzstiftes und an dem 1515 erfolgten Beitritt der vestischen Landstände zur rheinischen Erblandesvereinigung von 1463, nicht zu den westfälischen Erblandesvereinigungen von 1437 oder 1463.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag00 einleitung - seiten0013-0020.indd 20
06.11.2012 14:42:42
21
Hans-Joachim Behr
Staat und Politik im 19. Jahrhundert Die Hessenzeit Die Französische Revolution mit ihren Folgen hat die politische Landkarte Deutschlands grundlegend verändert. Die schon lange als Anachronismus empfundenen geistlichen Staaten verschwanden und damit endete auch die kurkölnische Herrschaft in Westfalen. Seit den ersten Jahren des Krieges gegen die Revolution gab es Gerüchte, dass die großen Mächte sich für ihre Kriegsausgaben an geistlichen Fürstentümern schadlos halten wollten. Sie bestätigten sich, als Preußen am 5. April 1795 in Basel einen Sonderfrieden schloss und Frankreich bis zum allgemeinen Frieden die Besetzung seiner linksrheinischen Gebiete zugestand. Während der Verhandlungen hatte der Abbé Sieyès einen Plan für die Neugestaltung Deutschlands vorgelegt. Er verlangte für Frankreich die Rheingrenze. Die geistlichen Staaten sollten säkularisiert werden. Preußen sollte für den Verlust seiner linksrheinischen Territorien durch das Herzogtum Berg sowie die rechtsrheinischen Besitzungen der Kurfürstentümer Trier und Köln, also auch das Herzogtum Westfalen, entschädigt werden. Diese französischen Forderungen wurden 1798 von der Reichsfriedensdeputation angenommen und damit zur Grundlage für den am 9. Februar 1801 in Lunéville geschlossenen Frieden. Im Juni nahm Preußen den größten Teil der Fürstbistümer Münster und Paderborn ein. Das Herzogtum Westfalen gehörte zum Interessengebiet der hessischen Häuser. Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel sandte deshalb seinen Minister Waitz nach Paris, um den Erwerb zu betreiben. Dort aber hatte man bereits anderweitig entschieden. Landgraf Ludewig X. in Darmstadt unterhielt durch seinen Vertreter in Paris, August Wilhelm von Pappenheim, gute Verbindungen zu Talleyrand und anderen einflussreichen französischen Politikern. Pappenheim hatte zwar auf die konkreten Objekte keinen Einfluss, erreichte aber durch sein Verhandlungsgeschick, dass Hessen-Darmstadt das Dreifache seiner linksrheinisch erlittenen Gebietsverluste als Entschädigung erhielt. Seine Wünsche gingen zunächst auf die Bildung eines großhessischen Staates zwischen Rhein, Main, Neckar und Tauber. Von französischer Seite wurde er im April 1802 dann auf das von den landgräflichen Kernlanden weit entfernte Herzogtum Westfalen hingewiesen. Preußen erklärte sich damit einverstanden, obwohl es dieses Gebiet zunächst dem mit den Hohenzollern verwandten Prinzen Wilhelm VI. von Oranien zugedacht hatte. Pappenheim war enttäuscht, riet dem Landgrafen aber doch, auf die Vorschläge einzugehen und das Beste daraus zu machen. Eine vorgeschlagene Entschädigung des Fürsten Friedrich II. von Wittgenstein durch Teile des Herzogtums Westfalen wurde durch eine Ren-
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 21
07.11.2012 13:35:23
22
Hans-Joachim Behr
te abgelöst. Versuche des Landgrafen von Hessen-Kassel, sich wenigstens die Stadt Volkmarsen zu sichern, wurden gleichfalls vereitelt. Trotz Abratens des Berliner Vertreters und Warnungen von russischer Seite trat Pappenheim in einem Schreiben vom 4. September 1802 energisch für die sofortige Okkupation ein: „Wir haben alles schlechterdings dem französischen Gouvernement zu verdanken; sonst möchte wohl nichts zu okkupieren für uns da sein, und da dieses uns vorzugsweise und einer der ersten die Okkupation angeraten hat, so glaube ich, daß selbst aus Deferenz für selbiges die Sache nicht zu verschieben ist.“1 Landgraf Ludewig X. ließ das Entschädigungsland durch eine eindrucksvolle Militärmacht provisorisch in Besitz nehmen. Am 6. September 1802 überschritten hessische Truppen in Stärke von 2.400 Mann unter Oberst Johannes von Schaeffer-Bernstein die Grenze. Die ersten Eindrücke waren nach dem Bericht des Kommandeurs wenig ermutigend. Die „Höflichkeit und Unterwürfigkeit“, mit der die Truppen von einer Deputation, bestehend aus den beiden Beamten von Olpe, dem Bürgermeister, einem Prokurator und Sekretarius empfangen wurde, aber weckten Hoffnungen. Schaeffer-Bernstein war überzeugt, dass „der nützlichste und schätzenswerteste Teil der Einwohner“ die neue Herrschaft gerne sah, von der man sich „die Abschaffung drückender Missbräuche“ versprach.2 Anders als die Preußen in Münster wurden die neuen Herren hier „mit offenen Armen empfangen“. Mit dem 12. Oktober 1802 stellten das Offizialat in Arnsberg, die Hofkammer in Brilon und die anderen kurkölnischen Zentralbehörden ihre Tätigkeit ein. Gleichzeitig nahm unter Oberleitung der in Darmstadt eingerichteten Generalkommission für die Entschädigungslande in Arnsberg eine zunächst provisorische hessische Organisationskommission mit dem Geheimen Rat Freiherr von Grolmann als Zivilkommissar und nunmehrigem Chef der Interimsbehörde ihre Geschäfte auf.3 Widerstand leisteten nur das nach Arnsberg geflohene Kölner Domkapitel und die 409 Infanteristen und Reiter unter dem Befehl des Oberstleutnants 1
2
3
Max Braubach/Eduard Schulte, Die politische Neugestaltung Westfalens 1795–1815, in: Der Raum Westfalen, Bd. 2/2, Berlin 1934, S. 73–158, zit. S. 103, Anm. 114. Zu den Entschädigungsverhandlungen neuerdings Peter Fleck, Säkularisation und Rheinbundreformen im hessen-darmstädtischen Herzogtum Westfalen (1802–1816), in: Westfalen 79 (2001), S. 207–250, hier S. 213– 216. Manfred Schöne, Das Herzogtum Westfalen unter hessen-darmstädtischer Herrschaft 1802–1816, Olpe 1966, S. 19–27; ders., Die Besetzung des heutigen Kreises Olpe durch hessisch-darmstädtische Truppen im Spätsommer 1802, in: Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe 50 (1963), S. 124– 127, hier S. 126. Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 37; Wilhelm Kohl/Helmut Richtering (Bearb.), Behörden der Übergangszeit. Das Staatsarchiv Münster und seine Bestände, Bd. 1, Münster 1964, S. 38; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen [früher: Staatsarchiv Münster], Großherzogtum Hessen II A 4, Bl. 107–135 (Kurze statistische Darstellung des Herzogtums Westphalen); für das Amt Werl siehe die Untersuchung von Paul Leidinger, Die Zivilbesitzergreifung des kurkölnischen Amtes Werl durch Hessen-Darmstadt 1802, in: Westfälische Zeitschrift 117 (1967), Abt. 2, S. 329–342; zu Rüthen siehe Friedhelm Sommer, Die hessische Zeit 1802–1816, in: Wolfgang Bockhorst/Wolfgang Maron (Hrsg.), Geschichte der Stadt Rüthen, Paderborn 2000, S. 643–658.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 22
06.11.2012 14:42:14
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 23
Olpe
Balve
Bilstein
Belecke
Geseke
Fredeburg
Rüthen
Erwitte
Meschede
Eslohe
Arnsberg
Attendorn
Menden
Werl
Östinghausen
Medebach
Brilon
10 km
20 km
Entwurf und ©: Hans-Jürgen Behr und Theo Bönemann, 2012
0 km
Verwaltungssitz eines Amtes Grenze des Herzogtums Westfalen Amtsgrenzen
Marsberg
Die hessische Ämtereinteilung Herzogtum Westfalen 1807 - 1816
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
23
06.11.2012 14:42:14
24
Hans-Joachim Behr
Ledebur.4 In Anbetracht der fehlenden Rechtsgrundlage für die Okkupation sandte das Domkapitel einen Protest zum Reichstag nach Regensburg. Es sah sich weiterhin als legitimer Befehlshaber der kurkölnischen Truppen, nahm Beförderungen vor und suchte mit Hilfe der Soldaten Dokumente und Wertsachen außer Landes zu schaffen. Erst als Oberst Schaeffer-Bernstein mit öffentlicher Entwaffnung drohte, kam es zu einer Absprache mit Ledebur, der die Garnison aus Arnsberg abzog. Kriegskassen und Militärdepots wurden beschlagnahmt und die Waffen eingesammelt. Die Lage der Soldaten blieb jedoch ungewiss. Nachdem das Domkapitel verzichtet hatte, fühlte sich niemand für sie zuständig. Erst mit erheblicher Verzögerung erfolgte die Übernahme in die hessen-darmstädtische Armee. Die Kavallerie lehnte diesen Schritt ab und löste sich auf. Um die Enklave Volkmarsen drohte es fast zu einem Konflikt mit Hessen-Kassel zu kommen. Truppen beider Seiten standen sich hier einige Wochen lang gegenüber, bis Darmstadt sie Ende Oktober endgültig in Besitz nehmen konnte. Der Reichsdeputationshauptschluss zu Regensburg vom 25. Februar 1803 sanktionierte die bereits vollzogene Besitzergreifung. Mit Paragraph 7 wurde das Herzogtum Westfalen dem Landgrafen Ludewig X. von Hessen-Darmstadt zugesprochen. Einige Monate später, am 16. August 1803, erfolgte in Arnsberg die offizielle Huldigung. Zu Huldigungs- und anschließenden Landtagskommissaren waren Regierungspräsident Ludwig Samson, Freiherr von Rathsamhausen zu Ehenweyer und Regierungsrat Ludwig Minnigerode bestellt, dazu der Geheime Rat Kaspar Joseph von Biegeleben und der Kanzlist Rabenau. Nach einem feierlichen Hochamt in der Abteikirche Wedinghausen wurde die provisorische Regierung im Klostersaal vereidigt. Bedenken der Stände wurden durch die Erklärung behoben, dass sie ihrer wohlbegründeten Rechte nicht verlustig gehen sollten. Eine wohl nach badischem Muster im Herbst 1803 durchgeführte Verwaltungsreform sollte dem Zusammenwachsen des neuen Staatsgebildes dienen, von dessen 214,3 Quadratmeilen nicht einmal die Hälfte althessischer Besitz war. Das Organisationsedikt vom 12. Oktober 1803 teilte die Landgrafschaft in drei Provinzen ein: das Oberfürstentum Hessen, das Herzogtum Westfalen und das Fürstentum Starkenburg. Als Zentralbehörden für sämtliche Landesteile standen unter dem Fürsten ein Geheimes Ratskolleg oder Ministerium mit drei Departements für Auswärtiges, Inneres und Finanzen, das Oberappellationsgericht und – unter Leitung des Ministeriums des Innern – eine Gesetzgebungskommission, das Oberforstkolleg, das Oberkriegskolleg und das Oberbaukolleg. Für jede der drei Provinzen wurden eine Regierung, ein Hofgericht, eine Rentkammer (seit 12. Januar 1809 Hofkammer) und ein Kirchen- und Schulrat angeordnet, dazu für das Herzogtum Westfalen vorübergehend ein Forstkol-
4
Ernst Müller, Die Begründung der Provinz Westfalen 1813–1816 und ihr Zustand im Jahre 1817, in: Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine 72 (1924), Sp. 65–72, hier Sp. 54.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 24
06.11.2012 14:42:15
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
25
leg. Das neu organisierte Ministerium nahm am 1. November 1803 seine Tätigkeit auf. Am 1. Januar 1804 folgten die Provinzialbehörden. Durch die räumliche Trennung vom Zentrum des Erzstifts waren die Stände im Herzogtum zu einem bedeutsamen Organ in der Landespolitik geworden. Die Erblandesvereinigungen von 1463 bzw. 1560, der zwischen Ritterschaft und Städten geschlossene „Recessus perpetuae concordiae“ von 1654 und das Indigenatsprivileg von 1662 bildeten die Rechtsbasis für das Verhältnis zwischen Landesherrschaft, Domkapitel und weltlichen Ständen. Das Gesetzgebungsrecht lag formal zwar beim Landesherrn, doch hatten sich die Stände ein gewisses Mitspracherecht erworben. Die Exekutive war durch das Indigenatsrecht eingeschränkt, und der Verfassungseid, den jeder neue Regent zu leisten hatte, verpflichtete ihn auf alle ordentlichen Landtagsbeschlüsse. Mit der neuen hessischen Landesherrschaft kam es alsbald zu Konflikten, als der Landgraf den Landtag für Mitte August zu einer ordentlichen Sitzung nach Arnsberg einberief. Der Regierungsrat Peter Joseph von Gruben hatte in einer Relation darauf hingewiesen, dass den Ständen nichts näher zu liegen scheine als der Abschluss eines neuen Erbvertrages, der an die Stelle der bisherigen Erblandesvereinigung treten solle. Er hatte eindringlich gewarnt, dass „durch einen solchen Erbvertrag die Gränzen der landesherrlichen Befugnisse im Verhältniß zu den Ständen wohl eher eingeschränkt als erweitert werden dürften, wenigstens nach dem Geiste, welcher bisher die Stände leitete“.5 Vor der Eröffnung am 17. August 1804 legte Gruben die Haltung der neuen Regierung dar. Die Stände seien als Untertanen der Oberaufsicht des Landesherrn unterworfen, der Beschlüsse des Landtags jederzeit ablehnen könne. Der „Recessus perpetuae concordiae“ übertrage die Steuerlast weitgehend den Bauern. Deshalb müsse in nächster Zeit eine Steuerreform durchgeführt werden, die alle Untertanen nach Vermögen gleichmäßig belaste. Der Landtag bewilligte 134.000 fl. für Verwaltungskosten, den Bau von Kasernen und Behörden und zur freien Verfügung des Landesherrn.6 Danach ging er auseinander, ohne dass seine Privilegien bestätigt worden waren. Eine landesherrliche Erklärung vom 30. August hob den „Recessus perpetuae concordiae“ auf, welcher der Ritterschaft mit der Steuerfreiheit und den Städten mit einer Minderung ihrer Steuern erhebliche einseitige Vorteile zum Nachteil des platten Landes gebracht hatte. Als Ritterschaft und Städte um Informationen über die künftige Landesorganisation und besonders die Besetzung der höheren Stellen baten, wurde ihnen versichert, der Landesherr werde, falls nötig, ihre gutachtliche Meinung verlangen. „Wenn aber löbliche Stände aus diesem landesväterlichen Verfahren die Schluß-Folge machen wollten, daß Ihro Durchlaucht, bey allen solchen Landes Angelegenheiten an ihren Beirath gebunden seyen, und daß die 5
6
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Großherzogtum Hessen II A 45 u. II A 3; ebd., I A 11; Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 24. Ebd., S. 29f.; Johann Joseph Scotti (Hrsg.), Provinzial-Gesetze. Dritte Sammlung: Churkölnische, Westphälische und Recklinghausen’sche Landes-Verordnungen. Abt. 2/2, Düsseldorf 1831, S. 127.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 25
06.11.2012 14:42:15
26
Hans-Joachim Behr
Konkurrenz der Stände ehierbey necessitatis wäre, so würden Höchst Sie zu ihrem aufrichtigsten Schmerze sich in die Nothwenigkeit gesetzt sehen, löbliche Stände mit ihrer gutachtlichen Meynung über solche Gegenstände ganz auszuschließen, und dadurch auf einmal alle Konsequenzen abzuschneiden, welche etwa dahin gemacht werden wollten, daß den Ständen ein Antheil an der legislativen Gewalt zustehe.“7 Es folgte ein mehrjähriger Streit zwischen Landesherr und Ständen. Der „Recessus perpetuae concordiae“ war aufgehoben, das Indigenatsrecht als überholt angesehen. Da es an genügend brauchbaren einheimischen Staatsdienern fehle, könne man den althessischen Beamten den Zugang nicht verwehren, wurde argumentiert. Franz Wilhelm von Spiegel polemisierte 1805 im „Westfälischen Anzeiger“ gegen das Anwachsen von Beamtenstellen. Ein Gutachten der Göttinger Juristenfakultät, von Professor Justus Runde verfasst, bestätigte die Stände in ihrer Rechtsauffassung. Danach war die alte Verfassung nicht aufgehoben. Der Paragraph 60 des Reichsdeputationshauptschlusses, hieß es, gebe dem Landesherrn nur Handlungsfreiheit in der Zivil- und Militäradministration, mithin in rein technischen Dingen. Schließlich richteten die Stände am 14. Februar 1805 auch noch eine Beschwerde an den Reichshofrat. Das Verfahren blieb in der Beweisaufnahme stecken. Das Alte Reich und mit ihm seine Organe hatten aufgehört zu bestehen. Nach der Gründung des Rheinbundes nahm der Landgraf den Titel eines Großherzogs an und erhob die landgräflichen Lande durch Edikt vom 13. August 1806 zum souveränen Großherzogtum. Mit dem Hinweis auf die veränderten politischen Verhältnisse in Deutschland verkündete Großherzog Ludwig I. am 1. Oktober 1806 seine Absicht, im Interesse der nationalen Wohlfahrt in allen Territorien des Großherzogtums eine einheitliche Verfassung einzuführen. Die ständische Repräsentation sei ein Hemmnis, verschlinge große Summen und habe oftmals beabsichtigte Reformen der Verwaltungsorgane behindert. Die Landstände wurden aufgelöst und übergaben ihre Geschäfte den Provinzialbehörden. Die Grafschaften Wittgenstein-Wittgenstein und WittgensteinBerleburg wurden der Provinz Oberhessen angeschlossen. Der Geheime Rat Friedrich Arndts hatte in einem statistischen Bericht die politische, wirtschaftliche und soziale Situation erläutert und die Frage gestellt, „woran es doch liegen möge, daß das Herzogthum Westphalen vor manchen Teutschen Landen so weit zurücksteht?“ Ursachen dafür sah er in der Unfähigkeit und schlechten Besoldung der Beamten, der unverhältnismäßigen Größe der Amtsbezirke und dem Mangel eines geregelten Geschäftsgangs.8 Die Eingliederung in einen modernen zentralistischen Verwaltungsstaat brachte grundlegende Neuerungen. Das alte Steuersystem wurde 1806 durch eine allgemeine Vermögenssteuer ersetzt. Dazu kam 1808 eine Gewerbe- und 7 8
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Großherzogtum Hessen I A 29 u. I A 32. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Msc. VII, Nr. 5407: Kurze statistische Darstellung des Herzogtums Westfalen (1802), Teilabdruck in: Friedrich Keinemann (Hrsg.), Westfalen um 1800. Ausgewählte Quellen zur gesellschaftlichen Struktur, zu Kultur und alltäglichem Leben sowie zur Entwicklung des politischen Bewußtseins, Tl. 1, Hamm 1978, S. 257–261.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 26
06.11.2012 14:42:15
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
27
Verbrauchssteuer. Bei der Vermögenssteuer gab es allerdings so viele Ungleichheiten, dass die Arnsberger Regierung sich genötigt sah, schon am 6. Januar 1807 eine vorläufige Berichtigung der Grundsteuerverhältnisse und die Erstellung eines Katasters anzuordnen. Zum ersten Mal gab es Landvermessungen in großem Stil. 223 Taxationsbezirke wurden eingerichtet. Im April 1809 war die Steuerrektifikation so weit fortgeschritten, dass Steuerkapitalien errechnet und Steuerbücher eingeführt werden konnten. Ende 1811 war die Kommission mit der Errichtung des neuen provisorischen Grundsteuerkatasters fertig, so dass an Stelle der bisherigen Schatzung eine Grundsteuer erhoben und ausgeschrieben werden konnte. Die am 19. August 1810 in jedem Amt für den Ausgleich der Steuern angestellten „Peräquatoren“ (Vergleichsstifter) hatten die Flur-, Lasten- und Steuerbücher durch Ab- und Zuschreiben in Ordnung zu halten und Steuerrepartitions- bzw. Verteilungslisten anzulegen. Für kurze Zeit galt das seit 1790 in Frankreich übliche metrische System mit der Grundeinheit des „Meter“. Nach der Steuerfreiheit des Adels verschwand auch die Selbstverwaltung der Städte und Freiheiten mit Magistrat und eigener Gerichtsbarkeit. Der zunftmäßige Gewerbebetrieb hörte auf. Die Trennung von Stadt und Land wurde beseitigt und 1808 zunächst in den Landgemeinden, dann 1811 auch in den Städten die Schultheißen-Ordnung eingeführt. Der Schultheiß wurde als Staatsbeamter vom Landesherrn direkt ernannt. Als Ersatz für die alte Selbstverwaltung war den Schultheißen ein dreiköpfiger Gemeinderat beigegeben, der aber lediglich beratende Funktion hatte. Die Schultheißen unterstanden der Jurisdiktion der Amtmänner, diese dem Hofgericht in Arnsberg. Oberstes Gericht war das Oberappellationsgericht in Darmstadt. Eine Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen erging über das Land.9 Die Bauern wurden zu Eigentümern, ihre Güter unbeschränkt teilbar und nach gemeinem Recht vererbbar. Mit der Flurbereinigung wurde begonnen. Durch den Erlass einer Forstordnung wurde der Versuch gemacht, eine langfristig gesicherte Nutzholzwirtschaft aufzubauen. Die Einrichtung von Beschälstationen sollte die Pferdezucht verbessern, eine 1809 durch Staatsbeamte in Arnsberg gegründete Landeskulturgesellschaft die Landeskultur allgemein fördern. Nicht nur auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft und der Landesvermessung, auch im Gesundheitswesen, im Kirchen- und Schulwesen, der Bildung, wo kurkölnische Reformpläne aufgenommen wurden, und im Wegebau brachte die hessische Zeit bemerkenswerte Verbesserungen. Auf der anderen Seite standen die großen Kosten für Verwaltung und Militär. Im Jahre 1806 gab es im ehemaligen Herzogtum Westfalen folgende Behörden: die Regierung, das Hofgericht, die Rentkammer, die Rechnungsjustifikatur, die Kammerkasse und den Kirchen- und Schulrat mit insgesamt 66 9
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Großherzogtum Hessen II A 3: Großherzogtum Hessen – Edikte; Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 69. Zu den Reformen siehe auch Harm Klueting, Nachholung des Absolutismus. Die rheinbündischen Reformen im Herzogtum Westfalen in hessen-darmstädtischer Zeit (1802–1816), in: Westfälische Zeitschrift 137 (1987), S. 227–244.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 27
06.11.2012 14:42:15
28
Hans-Joachim Behr
Beamten. Dazu kamen noch vier Mann Forstpersonal. 1812 standen auf dem Ziviletat allein in Arnsberg 16 Advokaten und Prokuratoren, vier HofgerichtsProkuratoren, außerhalb Arnsbergs 32 Advokaten und 38 Notarien. Auf etwa 130.000 Einwohner kamen 400 Beamte in den Provinzialbehörden, Ämtern und Gemeinden.10 Die Teilnahme an den Kriegen Napoleons belastete die Untertanen durch wachsende Steuern und viele Einquartierungen. Als ganz besonderes Übel wurde die Einführung der bisher nicht üblichen Wehrpflicht am 1. Februar 1804 aufgenommen. Wehrpflichtig waren alle Männer vom 17. bis zum 25. Lebensjahr, ausgenommen einzige Söhne. Theologen und Schulamtskandidaten konnten befreit werden, ebenso beim Tod der Eltern ein wehrpflichtiger Sohn, wenn er für seine Geschwister zu sorgen hatte. Wandernde Handwerksgesellen durften das Land nicht ohne Erlaubnis verlassen. Die Zivilbehörden waren dafür verantwortlich, dass die Konskribierten zur Musterung erschienen. Unter Umständen wurden sie zwangsweise vorgeführt. Falls das nicht möglich war, wurde das Vermögen konfisziert. Ein verschärfter Musterungserlass des Oberkriegskollegiums vom 14. Juli 1809 tadelte die bisher nur ungenügend erfüllten Verpflichtungen im ehemals kölnischen Landesteil, wodurch die anderen Provinzen überlastet seien. Ein besonderer Regierungskommissar sollte mit einem Militärkommando nach Arnsberg gesandt werden. Allen Beamten wurde unbedingter Gehorsam angeraten, damit sie ihre früheren Fehler im Musterungsgeschäft wieder gut machen konnten. Falls ganze Gemeinden Widerstand leisteten, sollten sie nach den Bestimmungen des Kollegiums „mit Waffengewalt zu Paaren getrieben“ werden. Einzelne Einwohner, die „mit Waffen oder lebensgefährlichen Instrumenten in der Hand der Konskription“ entgegentraten, sollten ergriffen, sofort als Rebellen vor ein Kriegsgericht gestellt und erschossen werden. Die Entweichung einzelner Konskriptionspflichtiger hatte nicht nur die gesetzliche Vermögenskonfiskation zur Folge. Es sollten außerdem noch „die älteren, wenn auch schon etablierten Brüder ausgehoben, und in Ermangelung derselben, die Väter oder Mütter der Pflichtvergessenen bis zur Sistierung der letzteren verhaftet werden“. Alle möglichen Mittel wurden angewandt, um die hohe Zahl der Desertionen einzudämmen. Die Pfarrer durften Trauungen nur noch vornehmen, wenn ein Dispens aus Darmstadt vorlag. Ein wichtiger Zweck der Pfarrstatistik war die Erfassung der Wehrpflichtigen. Das Oberkriegskollegium beschwerte sich am 1. März 1811 beim Kirchen- und Schulrat in Arnsberg darüber, dass die Pfarrer ihrer Aufgabe nur sehr nachlässig nachkämen, die zu musternden jungen Männer in die Statistik einzutragen. Sie müssten zur „ungesäumten Beendigung“ dieser Arbeit angehalten werden. Die Deserteure konnten sich allerdings in den angrenzen10
Das Gehalt belief sich für den Präsidenten Weichs auf 700 fl. bar und 1.558 fl. Naturalien, für den Geheimen Rat Minnigerode auf 2.900 fl., für die adeligen Räte auf 100 bis 800 fl. Der Regierungsrat Haberkorn erhielt 1.300 fl., der Botenmeister 495 fl., der Regierungskanzlist 200 fl. Siehe dazu Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 45, Anm. 25 u. S. 170; Heinrich Kochendörffer, Der Übergang des Herzogtums Westfalen und der Grafschaften Wittgenstein an Preußen, in: Westfälisches Adelsblatt 5 (1928), S. 161–209, hier S. 196.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 28
06.11.2012 14:42:15
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
29
den Ländern kaum sicher fühlen, da zwischen den Rheinbundstaaten Auslieferungsabkommen bestanden. Viermal wurde in den Jahren 1806, 1809 und 1813 eine Amnestie verkündet. An allen großen Feldzügen Napoleons waren hessen-darmstädtische Truppen beteiligt und erlitten schwere Verluste. In Spanien verloren sie rund 1.300 Mann, und von den 5.046 Soldaten, die 1812 mit nach Russland zogen, lebten am 6. Januar 1813 noch 30 Offiziere und 340 Mann. Allein aus dem Raum Olpe waren 23 Männer gefallen. In der Schlacht bei Leipzig kämpften die Hessen noch für Napoleon. Zehn Tage später, am 28. Oktober 1813, durchzog Napoleons Bruder Jérôme, König von Westphalen, mit den Resten seiner Armee auf dem Rückzug zum Rhein, das Herzogtum und übernachtete in Arnsberg. Am 2. November 1813 schloss sich der Großherzog als letzter der süddeutschen Fürsten dem Bündnis gegen Frankreich an. Am 11. November trafen Kosaken und preußische Ulanen nunmehr als Verbündete in Arnsberg ein. Wenn das Herzogtum auch nicht an den großen Marschstraßen lag, brachte die Versorgung durchziehender alliierter Truppen doch jahrelang nachwirkende Belastungen. Nach dem Übertritt des Landgrafen zu den Alliierten wurde nach preußischem Vorbild auch im Herzogtum Westfalen eine „Freiwillige Jägerkompanie“ unter einem Enkel des letzten Landdrosten Klemens Maria von Weichs zur Wenne ins Leben gerufen. Beim Übergang an Preußen standen im Herzogtum Westfalen immer noch 2.500 Mann reguläres hessisches Militär und 30.000 Mann Landwehr.11
Preußische Besitznahme und Verwaltungsorganisation Der Frontwechsel des Großherzogs sicherte ihm keineswegs seinen territorialen Besitzstand. Am 23. November 1813 musste er sich in Frankfurt in einem Akzessionsvertrag zu Änderungen bereiterklären. Artikel 24 der Wiener Kongressakte vom 9. Juni 1815 bestimmte dann die Abtretung des Herzogtums Westfalen und der Wittgensteiner Länder an Preußen. Es folgten noch schwierige Verhandlungen, bis der Herrschaftswechsel wirklich vollzogen werden konnte. Zur Betroffenheit der hessischen Beamten stattete der preußische Zivilkommissar Ludwig Freiherr Vincke „dem hoffentlich bald vereinigten Herzogtum Westfalen“ bereits Ende Oktober 1814 einen kurzen Besuch ab. Möglicherwei11
Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 136–143; Scotti, Provinzial-Gesetze (wie Anm. 6), S. 75, 158, 264, 344, 395; Norbert Scheele, Die Beteiligung heimischer Soldaten an den Feldzügen in den Jahren 1806–1815, in: Heimatblätter des Kreises [Olpe] 6 (1929), S. 50–54, 65–69, 81–84, 98–102, 114–117, 129–132, 145–147, 170–174, 178–182 u. ebd., 7 (1930), S. 110f., 113–116; Manfred Schöne, Hessenherrschaft von 1802 bis 1816, in: Josef Wermert (Hrsg.), Olpe. Geschichte von Stadt und Land. Bd. 1: Von den Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, Olpe 2002, S. 263–274, hier S. 271; Karl Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs, Arnsberg 1895, S. 518f.; Scotti, Provinzial-Gesetze (wie Anm. 6), S. 566; Kochendörffer, Übergang (wie Anm. 10), S. 163.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 29
06.11.2012 14:42:15
30
Hans-Joachim Behr
se lag darin auch eine Warnung, nichts mehr gegen die Interessen des Landes zu unternehmen.12 Die Bevölkerung, die sich trotz aller Unbequemlichkeiten mit der hessischen Herrschaft eingelebt hatte, musste sich nun an den Gedanken einer Vereinigung mit Preußen gewöhnen, dessen Gebiet das Land von drei Seiten umschloss. Das ganze Herzogtum hatte Ende 1814 139.900 Einwohner, davon 136.547 Katholiken, 1.344 Lutheraner, 163 Reformierte, 21 Mennoniten und 1.825 Juden. Die Stadt Arnsberg zählte 1817 300 Häuser mit 2.400 Einwohnern.13 Obwohl angesichts der kurkölnischen Tradition unter der katholischen Bevölkerung erhebliche Vorbehalte gegen das protestantische Preußen zu erwarten waren, gab es kaum Anzeichen einer antipreußischen Gesinnung, zumal man sich von dem Übergang des Landes an einen größeren Staat wirtschaftliche Verbesserungen erhoffte. Der frühere Landdrost Franz Wilhelm von Spiegel brachte dieses wiederholt zum Ausdruck, und Joseph Sommer äußerte sich ähnlich.14 Gleichwohl mag eine gute Portion Wunschdenken dabei gewesen sein, wenn Vincke am 29. Februar 1816 nach Berlin berichtete, die Einwohner des Herzogtums Westfalen könnten „den Augenblick ersehnter Vereinigung“ nicht erwarten; die hessische Regierung setze „das Erpressungssystem […] mit rücksichtsloser Härte“ fort. Angeblich beabsichtigte sie, „unter der Hand, durch eine besondere Kommission“, die Domänen zu verkaufen. Berlin ließ die Einwohner des Herzogtums darauf vor jeglichem Ankauf warnen. Am 30. Juni 1816 schlossen Preußen, Österreich und Hessen-Darmstadt auf Grund des Frankfurter Vertrages vom 23. November 1813, des Wiener Traktats vom 10. Juni 1815 und der Wiener Kongressakte einen Staatsvertrag, mit dem der Großherzog das Herzogtum Westfalen und Wittgenstein an den König von Preußen abtrat.15 Nach der symbolischen Abtretung am 7. Juli 1816 in Frankfurt erfolgte am 15. Juli die wirkliche Übernahme des Landes im Rathaus zu Arnsberg, wo sich das Personal sämtlicher Gerichts- und Landesbehörden, die Arnsberger Lokaldienerschaft und der Vorstand der Stadt versammelt hatten. Nach Auswechslung der Vollmachten hielt Hofkammerdirektor Wilhelm von Kopp eine Rede, verlas das Entlassungspatent des Großherzogs und verwies Untertanen, Lehnsleute und Staatsdiener an den preußischen Kommissar, den Oberpräsidenten Ludwig Freiherr Vincke. Dieser nahm die Beamtenschaft in vorläufige Pflicht. Am Rathaus wurde an Stelle des hessischen Wappens das Besitzergreifungspatent angeheftet. Das hessische Militär wurde auf dem Marktplatz durch Gene12
13 14
15
Ludger Graf von Westphalen (Bearb.), Die Tagebücher des Oberpräsidenten Ludwig Freiherrn Vincke 1813–1818, Münster 1980, S. 103–105. Müller, Begründung (wie Anm. 4), Sp. 7–28. Friedrich Keinemann, Von den Freiheitskriegen zur Julirevolution. Westfalen im frühen 19. Jahrhundert, Norden 2006, S. 58–65. Hans-Joachim Behr/Jürgen Kloosterhuis (Hrsg.), Ludwig Freiherr Vincke. Ein westfälisches Profil zwischen Reform und Restauration in Preußen, Münster 1994, S. 617; Schöne, Herzogtum Westfalen (wie Anm. 2), S. 146 u. 152, Anm. 4; Heinrich Kochendörffer, Die Berichte des Militär- und Civilgouverneurs in den Provinzen zwischen Weser und Rhein, in: Westfälisches Adelsblatt 7 (1930), S. 38–106, hier S. 99f.; Müller, Begründung (wie Anm. 4), Sp. 15.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 30
06.11.2012 14:42:15
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
31
ralleutnant Schaeffer-Bernstein übergeben. Am 18./19. Juli wurde auch in den Grafschaften Wittgenstein die preußische Besitzergreifung vollzogen. Die Arnsberger Provinzialbehörden stellten bis auf das Hofgericht zum 31. Juli 1816 ihre Tätigkeit ein. Die Geschäfte des Oberkriegskollegiums in Darmstadt wurden der königlichen Regierung, die des Oberforstkollegiums der neuen Hofkammer in Arnsberg übertragen, Berg-, Hütten- und Salzwesen im Landesteil rechts der Lenne dem Bergamt in Dortmund, links der Lenne dem Oberbergamt in Bonn unterstellt. Bei den übrigen Provinzialbehörden gab es bis zur endgültigen Organisation der Verwaltung keine Veränderungen. Wie überall in den neuen Provinzen ging die preußische Verwaltung bei der Neugestaltung der Verhältnisse selbstbewusst und mit viel gutem Willen ans Werk, wenn auch nicht immer mit dem nötigen Takt und Geschick. Für Westfalen war es ein großes Glück, dass mit Vincke ein Mann an die Spitze trat, der die regionalen Verhältnisse kannte und viel Verständnis für die Probleme der neuen Staatsbürger aufbrachte. Am 9. Mai 1817 erstattete er dem Staatskanzler Fürst Hardenberg einen ersten Bericht über den Zustand des Landes. Vincke gab zu, dass die hessische Herrschaft einige Verbesserungen gebracht hatte, kam jedoch insgesamt zu keinem guten Urteil. Die hohen und ungerechtfertigten Steuern hätten das Land in einem Maße erschöpft, heißt es in dem Schreiben, dass die wegen rückständiger Steuern eingezogenen Pfänder keine Käufer mehr fänden, „selbst die Eltern über den Tod ihrer Kinder, für die sie kein Brot mehr hatten, sich freuen konnten, und eine stumpfe Gleichgültigkeit sich der großen Masse bemächtigen mußte“. Eine Revision des Steuersystems sei nötig. Die Einkünfte aus den Domänen, die sich noch steigern ließen, würden größtenteils von den Kosten für Militär und Verwaltung aufgezehrt. Die Zahl der Behörden und Beamten sei viel zu groß, der herrschende Geist schlecht. In den oberen Behörden säßen Landfremde, die sich um die größtenteils schlechten und die Untertanen willkürlich tyrannisierenden Unterbehörden nicht kümmerten. Es sei ein „recht dringendes Bedürfnis, durch Organisation der Justiz, durch eine zweckmäßige Gemeindeordnung, durch tüchtige Landräte […] und energisches Eingreifen der Regierungsbehörden den Stall des Augias zu säubern und eine bessere Ordnung der Dinge herzustellen“.16 Im Jahre 1808 waren in Preußen im Zuge der Verwaltungsreform Bezirksregierungen eingerichtet worden, deren Bezirke sich im Wesentlichen mit denen der aufgehobenen Kriegs- und Domänenkammern deckten. Diese Organisation wurde nun auf die westlichen Provinzen übertragen. Eine am 30. April 1815 noch in Wien erlassene Verordnung „wegen verbesserter Einrichtung der Provinzial-Behörden“ gliederte den preußischen Staat in fünf Militärbezirke, zehn Provinzen und 25 Regierungsbezirke.17 Der Regierungspräsident war die zentrale staatliche Verwaltungsbehörde, kollegialisch organisiert mit den drei 16
17
Kochendörffer, Übergang (wie Anm. 10), S. 165–167, 188–201; Westphalen, Tagebücher Vincke (wie Anm. 12), S. 274–277. Über den Ausgleich finanzieller Forderungen aus rückständigen Domänengefällen und Steuern wurde noch weiter verhandelt. Erst am 15. März 1817 wurden durch einen Vertrag die gegenseitigen Forderungen pauschal abgegolten. Siehe ebd., S. 308, Anm. 763. Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, Jg. 1815, S. 86, 96f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 31
06.11.2012 14:42:15
32
Hans-Joachim Behr
Abteilungen für Inneres, Domänen und Forsten, Kirchen und Schulen. Ihm unterstand der Landrat als Staatsbeamter. Regierungsbezirk und Kreis waren staatliche Verwaltungsbezirke. Dem Oberpräsidenten war lediglich die Rolle eines Kommissars der Staatsregierung zugewiesen, der die Aufsicht über die Verwaltungsbehörden führte. Die neue Provinz Westfalen sollte in drei Regierungsbezirke untergliedert sein. Einer mit Sitz in Hamm sollte die Grafschaft Mark, die mediatisierte Reichsstadt Dortmund, die Grafschaft Limburg und das Herzogtum Westfalen umfassen. Dazu kamen später noch die Grafschaften Wittgenstein-Berleburg und Wittgenstein-Wittgenstein sowie Siegen. Als Amtssitze der drei Regierungen waren ursprünglich die Sitze der bisherigen Kriegsund Domänenkammern in Minden, Hamm und Münster vorgesehen. Vincke sprach sich für Arnsberg und Paderborn aus, um die Integration der neuen Landesteile mit Preußen zu erleichtern, „teils, weil diese Städte geographisch weit besser situirt seien, teils, weil die neu erworbenen Länder der Aufsicht mehr bedürften, und durch Etablirung der Centralbehörde in ihrer Mitte sich eher mit Preußen assimiliren würden“.18 Neben Hamm erwog die Organisationskommission auch Soest, Dortmund und Arnsberg als möglichen Sitz der Bezirksregierung. Der Hofrat Ludwig Albert Koester machte sich zum leidenschaftlichen Anwalt für Arnsberg. In seinen „Freimütigen Gedanken zur Territorial-Einteilung von Mark und Westfalen“ zeichnete er von Dortmund und Soest ein trauriges Bild. Dort herrschten, „Mangel an Wohnungen, innere Unreinlichkeit, eingeschränkte Luft, beständig herrschende Krankheiten“. Nach seiner Ansicht gab es eine echte Wahl nur zwischen Hamm und Arnsberg. Er wies darauf hin, dass Arnsberg schon bisher Sitz der Oberbehörden im Herzogtum Westfalen gewesen sei, hob die Mittelpunktlage der Stadt im neuen Verwaltungsbezirk hervor und pries die Schönheit der Landschaft. Brot, Bier und Branntwein seien „oft sehr gut“, viele Zeitungen und Zeitschriften würden gehalten und lägen in den Gesellschaftszimmern offen. Der „rechtschaffene grade Mann“ werde geehrt. Schließlich sei „die Luft in und um die Stadt herum“ so gesund, dass viele Menschen „ein hohes Alter von 80, 90 und mehr Jahren“ erreichten.19 Vincke hatte andere praktische Gründe für die Wahl Arnsbergs. Sein Vorschlag war ein Wagnis, weil die unbedeutende und verkehrsmäßig ungünstig gelegene Kleinstadt Arnsberg keine Entfaltungsmöglichkeiten bot und nur mit Mühe für die Aufnahme des Behördenapparats hergerichtet werden konnte. Trotzdem gelang es ihm, sich gegen die Bedenken des Staatsministeriums durchzusetzen. „Vom Staatskanzler die Beglückung Arnsbergs zu meiner großen Freude“, notierte er am 15. November 1815 in seinem Tagebuch, und am 13. Mai 1816 konnte er über eine Konferenz in Berlin schreiben: „Es ward erst über die Regierungssitze de18
19
Braubach/Schulte, Die politische Neugestaltung Westfalens (wie Anm. 1), S. 150; Müller, Begründung (wie Anm. 4), Sp. 7. Köster, Freimütige Gedanken zur Territorial-Einteilung von Mark und Westfalen, Druck in: Karl Wurm, Zur Arnsberger Gerichtsgeschichte, Hamm 1971, S. 21f.; auch bei: Willi K. Erdmann, Gerichtsbarkeit in Arnsberg, in: 750 Jahre Arnsberg. Zur Geschichte der Stadt und ihrer Bürger. Hrsg. vom Arnsberger Heimatbund, Arnsberg 1989, S. 401–410, hier S. 405.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 32
06.11.2012 14:42:15
Bochum
Hagen
Iserlohn
Altena
Dortmund
Hamm
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 33
Siegen
Bilstein
Arnsberg
Soest
Wittgenstein
Berleburg
10 km
20 km
Entwurf und ©: Hans-Jürgen Behr und Theo Bönemann, 2012
0 km
Verwaltungssitz eines Kreises Grenze des Regierungsbezirks Arnsberg Kreisgrenzen Verwaltungsgliederungs im Hochsauerland Kondominat
Medebach
Brilon
Lippstadt
Verwaltungsgliederung des Regierungsbezirks Arnsberg, 1. Juli 1817
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
33
06.11.2012 14:42:16
34
Hans-Joachim Behr
battiert, und ich rettete Arnsberg“, während er mit der Verlegung von Minden nach Paderborn kein Glück hatte.20 Am 1. August 1816 nahm die preußische Regierung in Arnsberg ihre Tätigkeit auf. Ihr erster Präsident wurde der frühere Kammerpräsident in Aurich und Landesdirektor von Ostfriesland Friedrich Wilhelm von Bernuth. Er gehörte zwar zum näheren Bekanntenkreis Vinckes, doch entsprach die Ernennung des Protestanten Bernuth wohl nicht den personalpolitischen Grundsätzen des Oberpräsidenten. Dieser hatte sich während der vorbereitenden Konferenzen um die Ernennung eines katholischen Regierungspräsidenten in Westfalen bemüht und dabei sicherlich an Arnsberg gedacht.21 Nur ein kurzes Zwischenspiel blieben die verfassungspolitischen Aktivitäten des niederrheinischen und westfälischen Adels, an denen sich auch Standesgenossen aus dem Sauerland beteiligten. Das sogenannte Verfassungsversprechen des Königs vom 22. Mai 1815 und die Besitzergreifungspatente mit der Zusage ständischer oder provinzieller Verfassung hatten in Preußen Erwartungen geweckt. Während im Rheinland bürgerlich-liberale Bestrebungen überwogen, war die vom Freiherrn vom Stein unterstützte Bewegung in Westfalen fast ausschließlich auf den Adel beschränkt. Verfassungshistorische Materialien wurden zusammengetragen und zu Papier gebracht. Eine auf den 19. Februar 1818 datierte Petition des rheinisch-westfälischen Adels an den Staatskanzler enthält 22 Namen aus dem Herzogtum Westfalen.22 Als Freiherr Friedrich Wilhelm von Schorlemer-Herringhausen und Joseph Sommer ihre Arbeiten zur Verfassung im Herzogtum Westfalen vorlegten, waren die Bestrebungen, die letzten Endes auf eine Wiederherstellung der alten feudalen Verhältnisse abzielten, bereits gescheitert.23 Was später als Provinzialverfassung veröffentlicht wurde, war von den Vorstellungen der Petenten weit entfernt. Für die Entwicklung der Stadt Arnsberg hatte die Einrichtung der Bezirksregierung weitreichende Folgen. Etwa 60 Beamte und Justizangehörige zogen mit ihren Familien in die neue Regierungshauptstadt. Es fehlte an ausreichenden und geeigneten Wohnungen, und auch die Gasthöfe boten nur begrenzte und bescheidene Unterbringungsmöglichkeiten.
20
21
22
23
Westphalen, Tagebücher Vincke (wie Anm. 12), S. 205, 250. Als Vincke im Mai 1816 wegen der Organisation des Oberpräsidentenamtes mit Hardenberg Differenzen bekam und dem Staatskanzler seinen Rücktritt anbot, erbat er sich von diesem den Posten eines Regierungspräsidenten in Arnsberg. Ebd., S. 256, 258. Friedrich Wilhelm von Bernuth war seit 1813 Landesdirektor von Ostfriesland, bevor er 1816 zum Regierungspräsidenten in Arnsberg ernannt wurde. Er bekleidete dieses Amt bis zu seinem Ruhestand 1825. Siehe Dietrich Wegmann, Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der Provinz Westfalen 1815–1918, Münster 1969, S. 129, 244. Reinhold K. Weitz, Der niederrheinische und westfälische Adel im ersten preußischen Verfassungskampf 1815–1823/24, Phil. Diss. Bonn 1970, S. 131–133. Johann Friedrich Joseph Sommer, Von deutscher Verfassung im germanischen Preußen und im Herzogthum Westphalen, mit Urkunden, Münster 1819; Friedrich Wilhelm Frhr. von Schorlemer, Zur Verfassung, besonders für den landsässigen Adel des Herzogthums Westphalen, Lippstadt 1818; Alfred Hartlieb von Wallthor, Die landschaftliche Selbstverwaltung Westfalens in ihrer Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert, Tl. 1, Münster 1965, S. 94.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 34
06.11.2012 14:42:16
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
35
Oben links: Ludwig I., Großherzog von Hessen, Kupferstich von J.C. Ulmer; oben rechts: Friedrich Wilhelm III., König von Preußen, Lithographie von E. Kraft; unten: Königsstraße in Arnsberg um 1830, kolorierte Lithographie von C. Tangermann.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 35
06.11.2012 14:42:16
36
Hans-Joachim Behr
Als Regierungsgebäude wurde das Gefängnis, „nachdem seine unfreiwilligen Bewohner anders untergebracht waren“, mit „Bureau und Sessionszimmern“ eingerichtet. Um die Beamten unterzubringen, wurden beim Klostergebäude Bauplätze ausgewiesen. Die Einwohnerschaft wurde ermuntert, Häuser zu bauen. Ein Drittel der Baukosten wurde ihnen geschenkt und eine Prämie für diejenigen ausgesetzt, die besonders schnell und zweckmäßig bauten. Neben den Ersatzbauten für alte abbruchreife Häuser wurden mit Hilfe des Staates in Arnsberg bis 1830 76 neue Häuser gebaut. „So entstand“, wie der Regierungspräsident Keßler voll Anerkennung schrieb, „nach wenig Jahren zwischen der Ruine mit dem alten Städtchen und der Kirche mit den Klostergebäuden eine neue kleine Stadt von lauter bunter ‚Häuserchen‘, in deren Mitte ein freundlicher Marktplatz abgesteckt, an demselben eine evangelische Kirche und ein Postgebäude vom Staate erbaut, und durch einen Richtigspeculierenden ein großer Gasthof errichtet wurde. Straßen wurden nach allen Richtungen hin angelegt, um den im Gebirge vergrabenen Regierungssitz zugänglich zu machen, und Herrn v. Vincke’s Belebungsideen konnten nun beginnen ins Leben zu treten.“ Um ein gewisses gesellschaftliches Leben zu pflegen, schlossen sich zwei Jahre nach der Einrichtung der Bezirksregierung 84 Personen, vor allem höhere Beamte, zur exklusiven Kasinogesellschaft zusammen.24 Lange Zeit wurde eine Versetzung nach Arnsberg von den preußischen Staatsdienern als Strafe empfunden. Der Regierungspräsident Keßler, der von 1836 bis 1845 amtierte, betrachtete sie im Jahr seiner Ernennung gar als „eine Art Grablegung“ und glaubte sich in seinen Befürchtungen bestätigt: „So roh und ungeschlacht das Treiben der Menge hier ist, in Garten und Feld, in jedem Gewerbe alles höheren Strebens ermangelnd, so absolut unfruchtbar ist auch dieser Boden für allen edlern geselligen Verkehr.“ Selbst nach zwei Jahrzehnten preußischer Regierung konnte Keßler „noch wenig von Leben und Cultur“ bemerken. Das Beamtenwesen wirke „gerade nicht belebend auf das Volk“, für Handel und Fabriken gebe es jedoch „weder Raum noch Mittel“. Arnsberg sei noch nach 35 Jahren eine Beamtenkolonie und werde es auch wohl bleiben. „Das anfangs widerspenstige Volk, was nichts von der neuen belebenden Regierung wissen und mit ihr zu tun haben wollte, zehrt nun von und an den Beamten, wie es vordem seine Existenz von der Klostergeistlichkeit hatte. Wer von den zuerst dahin gesandten Regierungsmitgliedern nicht einiges Vermögen mitbrachte und unter den vom Staate gebotenen Vergünstigungen sich selbst anbaute und mit Haus, Garten und Feld sich festbürgerte, suchte sobald als möglich wieder fortzukommen aus der romantischen Gegend, dabei aber dürftigen Existenz, so vom Präsidenten an bis herunter auf den Calculator.“ Keßler war durch Intrigen aus seinem Amt als Direktor der Domänenverwaltung im Finanzministerium verdrängt worden und zweifellos verbittert und 24
Ernst Ludwig Heim, Leben des königlich preußischen Wirklichen Geheimen Rathes Georg Wilhelm Kessler, Leipzig 1853, S. 322; Hermann Herbold, Arnsbergs Bürgerschaft im Wandel der Zeit, in: 750 Jahre Arnsberg (wie Anm. 18), S. 246–269, hier S. 251.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 36
06.11.2012 14:42:17
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
37
nicht unvoreingenommen in seinem Urteil. Bald aber war auch er von der „überaus großen Güte“ der Einheimischen angetan und gab zu, dass die Natur „über jede Beschreibung schön“ sei. Doch oftmals wurde die Zeit in Arnsberg nur als Durchgangsperiode zu einer anderweitigen Beförderung angesehen.25 Mehr Schwierigkeiten als bei der Organisation der Mittelinstanz gab es bei der unteren Verwaltungsebene. Die Verordnung vom 30. April 1815 stellte für die östlichen Provinzen die kurmärkische Landrats- und Kreisverfassung wieder her und forderte von der Kreiseinteilung in den neuen Provinzen möglichste Berücksichtigung der historischen Grenzen. So wurde die Kreisbildung zwar 1817 provisorisch abgeschlossen, doch gab es bis 1832 noch zahlreiche Korrekturen.26 Die Ämter überlebten, wurden aber in ihrer Zuständigkeit auf die Rechtspflege beschränkt. Auch die 1815 umschriebenen Grenzen des Regierungsbezirks erfuhren nachträglich noch einige Änderungen durch den Übergang der Stadt Lippstadt 1816 und des Kreises Siegen 1817 an Arnsberg. Die großen Grenzverschiebungen der zweiten Hälfte des Jahrhunderts im Industrierevier haben das kölnische Sauerland nicht berührt. Der Regierungsbezirk war Rekrutierungsbezirk für Teile des 10. Westfälischen Landwehrregiments. Garnison des 2. Bataillons war Meschede. Stationierungsorte waren für die 1. Kompanie Hüsten, für die 2. Brilon, die 3. Winterberg und für die 4. Berleburg. Von dem in Soest garnisonierten 1. Bataillon stand die 4. Kompanie in Anröchte und Rüthen.27 Bei der definitiven Gliederung des stehenden Heeres 1818/20 wurde der Regierungsbezirk Arnsberg dem VII. Armeekorps mit Sitz in Münster zugeordnet. Nach der Annexion Kurhessens 1866 wurde dann aber der größte Teil des Regierungsbezirks dem XI. Korps in Kassel und 1899 schließlich dem XVIII. Korps in Frankfurt zugewiesen. Teile des 8. Husarenregiments lagen bis 1855 in Lippstadt. Tief eingreifende Veränderungen gab es in der Rechtspflege und Justizorganisation. Nach der Verordnung vom 30. April 1815 war für den Regierungsbezirk ein eigenes Oberlandesgericht vorgesehen. Zunächst aber wurde die Oberleitung der Justizverwaltung im Herzogtum Westfalen und den Grafschaften Wittgenstein dem mit der Organisation der Justiz in den Rheinprovinzen beauftragten Oberlandesgerichtspräsidenten Sethe in Düsseldorf übertragen. 1820 wurde als Entschädigung für den Sitz der Bezirksregierung das Oberlandesgericht nach Hamm verlegt. Gleichzeitig wurde entschieden, dass die beabsichtigte Vereinigung des Hofgerichts in Arnsberg mit dem Oberlandesgericht in Hamm nicht vollzogen werden sollte. Das Hofgericht in Arnsberg blieb also bestehen und wurde zunächst dem Oberlandesgericht in Kleve un25 26
27
Heim, Leben des Georg Wilhelm Kessler (wie Anm. 24), S. 322–327. Zur Berücksichtigung der alten Territorialgrenzen, wirtschaftlicher Zusammenhänge und Kulturräume bei der Kreisbildung siehe Stephanie Reekers, Die Gebietsentwicklung der Kreise und Gemeinden Westfalens 1817–1967, Münster 1977, S. 3–10, 17f. Zur Geschichte der Verwaltung neuerdings auch Jürgen Schulte-Hobein (Red.), Werden – Wachsen – Wirken. Vom Wandel der Zeit – Kreisverwaltung im Hochsauerland von 1817 bis 2007, Arnsberg 2008. Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg 1817, S. 371.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 37
06.11.2012 14:42:17
38
Hans-Joachim Behr
terstellt. Seine Zuständigkeit erstreckte sich über den Bereich des Regierungsbezirks, in dem das gemeine Recht galt, das Herzogtum Westfalen, Siegen mit Burbach und Neuenkirchen, Wittgenstein-Wittgenstein und WittgensteinBerleburg. Die Mängel der Organisation waren unverkennbar. Klagen über die teure und langsame Rechtspflege nahmen kein Ende. Der Umstand, dass man mit großem Kostenaufwand und viel Zeitverlust richterliche Hilfe im entfernten Kleve und im Tal Ehrenbreitstein mit zum Teil abweichenden Gesetzen suchen musste, veranlasste ebenso laute wie berechtigte Beschwerden und erschwerte zudem die Arbeit der Verwaltungsbehörden. Der Wunsch nach einer baldigen neuen Organisation der Justiz wurde im Herzogtum Westfalen und im Kreis Siegen „täglich lebhafter und lauter“ geäußert.28 Nach Einführung des Allgemeinen Landrechts und der Allgemeinen Gerichtsordnung im Herzogtum Westfalen zum 1. Dezember 1825 bestand das Hofgericht in Arnsberg gleichberechtigt neben dem Oberlandesgericht in Hamm. Seine Zuständigkeit wurde 1831 auch auf das standesherrliche Obergericht des Fürsten zu Wied ausgeweitet. Durch Kabinettsorder vom 31. August 1835 erhielt das Hofgericht die Bezeichnung Oberlandesgericht. Ihm unterstanden 1839 16 Land- und Stadtgerichte mit zwei Gerichtskommissionen.29 Bis zur Reform von 1879 bestanden damit im Regierungsbezirk Arnsberg zwei Obergerichte mit gleichem Status. Keßler meinte als Begründung, Streitsucht liege nun einmal in der „Natur des Westfalen“, der einen „Genuß im Prozessieren“ finde „wie andere Menschen im Spiele, der Engländer im Wetten“.30 Eine wichtige Aufgabe für die neue Herrschaft war die mentale und ökonomische Verschmelzung der Regionen. Es galt, einen Ausgleich zu schaffen zwischen den Traditionen der ehemaligen weltlichen und geistlichen Territorien mit ihren unterschiedlichen Rechts- und Verwaltungssystemen, ihren verschiedenen Wirtschaftsstrukturen, ihrer konfessionellen Spaltung in der Provinz und den Interessen des Gesamtstaates. Dem dienten Verwaltungs- und Gerichtsorganisation ebenso wie die Städteordnungen von 1808 und 1831, die Steuergesetzgebung von 1817/20 und die Gewerbeordnung von 1845, die das Nebeneinander von Gewerbefreiheit und Zunftverfassung beseitigte, sowie die Trennung von Justiz und Verwaltung. Dass dabei regionale Besonderheiten und Traditionen nicht unberücksichtigt bleiben sollten, zeigen die Sammlungen der Provinzialgesetze durch den Regierungssekretär Johann Joseph Scotti und der Gewohnheitsrechte des ehemaligen Herzogtums Westfalen durch den preußischen Justizamtmann in Brilon Johann Suibert Seibertz im Auftrag des Ministeriums in den dreißiger Jahren. Zu einem Provinzialgesetzbuch, wie es der Assessor Paul Wigand entworfen hatte, kam es jedoch nicht. Der Provin-
28
29
30
Amts-Blatt der Königlichen Regierung zu Arnsberg 1820, S. 257; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/1, Bl. 75, 81, 106. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/3, Bl. 9; Wurm, Zur Arnsberger Gerichtsgeschichte (wie Anm. 19), S. 22, 25; Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1825, S. 153 u. Jg. 1835, S. 197f. Heim, Leben des Georg Wilhelm Kessler (wie Anm. 24), S. 323.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 38
06.11.2012 14:42:17
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
39
ziallandtag verhandelte aber noch 1843 über die Rechte der Regionen in Westfalen.31
Vormärz Der Übergang war nicht leicht für die Bevölkerung. Obwohl auch die hessische Regierung schon vieles geändert hatte, war die Situation doch überschaubar geblieben. Nun wurde sie einem Großstaat eingefügt, dessen weltlicher Herrscher in Berlin saß, wie schon sein Vorgänger anderer Konfession war und durch Militär, Polizei und Verwaltung ein strammes Regiment führte. Oberpräsident Vincke hat sich nach Kräften bemüht, die Gegensätze auszugleichen, so dass die widerstrebenden Bewohner allmählich in die neuen Verhältnisse hineinwuchsen. Doch gab es noch lange mancherlei Vorbehalte. Der Freiherr vom Stein brachte das in einer Denkschrift für Prinz Wilhelm Friedrich von Preußen vom 29. Dezember 1830 zum Ausdruck, wenn er schrieb: „Die Provinz Westfalen ist ein Verein altpreußischer Länder und solcher, die in den Jahren 1803 und 1815 mit der Monarchie vereinigt worden. In den ersten herrscht die alte Treue und Biederkeit, die sich seit Jahrhunderten bewährt, in den letzteren ist die Neuheit des Bandes noch fühlbar, die Erinnerungen an einen älteren, bequemeren, weniger Abgaben und Anstrengungen fordernden Zustand sind bei der gegenwärtigen Generation noch lebhaft, sie werden aber bei dem jüngeren Geschlecht allmählich verschwinden, und in ihm werden sich Anhänglichkeit entwickeln.“32 Dankbar wurden in den neuen Landesteilen die Besuche von Mitgliedern des Königlichen Hauses aufgenommen. Im Sommer 1817 besuchte der Kronprinz, der spätere König Friedrich Wilhelm IV., die Stadt Arnsberg, übernachtete im Landsberger Hof, besichtigte Klosterberg, Schlossberg und Oberfreistuhl. Zwei Jahre später kam sein Bruder Wilhelm, der spätere Kaiser.33 Selbst an den Militärdienst gewöhnte man sich allmählich. Offenbar trugen dazu nicht wenig die Berichte der zurückkehrenden Mannschaften bei, dass die Behandlung keineswegs so arg sei, wie man es befürchtete. Dennoch versuchten junge Leute immer wieder, sich der Aushebung zu entziehen, wurden aber in den meisten Fällen aufgespürt und ausgeliefert, wie 1818 einige aus dem Kreis Brilon in Sachsenhausen. Es gab sogar Fälle von Selbstverstümmelung. Gelegentlich fehlte es den aus altpreußischen Provinzen nach Westfalen versetzten, zumeist protestantischen Offizieren und Beamten allerdings an Ver31
32
33
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 833, Bl. 62, 193; Protokolle des 7ten Westfälischen Provinziallandtages, Münster 1843. Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften, Bd. 6 u. 7, bearb. von Manfred Botzenhart, neu bearb. von Alfred Hartlieb von Wallthor, hrsg. von Walther Hubatsch, Stuttgart 1965/69, hier Bd. 7, S. 1013. Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 541f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 39
06.11.2012 14:42:17
40
Hans-Joachim Behr
ständnis für die Mentalität der Einheimischen. So musste der Regierungspräsident im März 1823 daran erinnern, dass es Pflicht der Behörden sei, „jedes Hinderniß zur guten Stimmung“ auszuräumen. Die Militärbehörden möchten deshalb die Marschtage der Ersatzmannschaften künftig nicht wieder an hohen Feiertagen ansetzen. „Denn so willig und freudig die junge Mannschaft ihrer Bestimmung entgegen geht und so sehr die Abneigung zum Militär Dienste sich vermindert und in guten Willen umgeändert hat, so hat es in den meisten Kreisen doch Anlaß zum Aergerniß gegeben, und bösen Eindruck auf die öffentliche Stimmung gemacht, daß die Ersatz-Mannschaften statt dem höchsten Herrn zu dienen an dem heiligen Charfreitage und den Ostertagen auf der Landstraße zubringen mußten.“34 Auch im Sauerland war die Zeit des Vormärz keine Idylle. In vielen Jahren war die wirtschaftliche Lage bedrückend, konnten die öffentlichen Abgaben nur mit Hilfe der Gendarmen eingetrieben werden. Grundstücke und Zugvieh wurden gepfändet. Wohl gewährte die Regierung bei schlechter Ernte Zuschüsse und lieferte Getreide aus ihren Magazinen. Diese Leistungen mussten aber später erstattet werden. Feldfrevel und Diebstähle machten der Polizei zu schaffen, und für die „beweisliche Entdeckung“ eines Wilddiebes wurde eine Prämie von 20 Talern ausgesetzt. Als im Winter 1827/28 in Medebach 220 Erwachsene und Kinder am Nervenfieber erkrankten und 20 davon starben, hatte das nach dem Urteil der Ärzte seinen Grund in der „elenden Nahrung“, vor allem dem Mangel an Salz. Ihre „Dürftigkeit und die Teuerung dieses Genußmittels“ nötige die Menschen nämlich, das Quantum, welches sie auf Grund des staatlichen Salzmonopols zwangsweise abnehmen und bezahlen müssten, wieder zu verkaufen und sich mit ungesalzenen Nahrungsmitteln zu begnügen. Die Armenkasse wies auf die Unzulänglichkeit ihres Fonds in dieser Lage hin, worauf ihr schließlich aus staatlichen Mitteln 100 Taler überwiesen wurden. Hunger und Armut ließen die Zahl der Selbstmorde steigen. Das Vagabundieren von einheimischen und auswärtigen arbeitslosen Menschen nahm auffallend zu. Im Juni 1830 wurde ein Steueraufseher in der Nähe von Arnsberg auf öffentlichem Wege überfallen und misshandelt.35 Wie stets in Notzeiten wurde die Vergangenheit verklärt, selbst die Franzosenherrschaft. Bis in die vierziger Jahre soll man in manchen Häusern des kölnischen Sauerlandes noch Bilder Napoleons vorgefunden haben. Trotzdem fand die französische Julirevolution in Westfalen keinen Widerhall. Oberpräsident Vincke wies die Behörden an, alles zu vermeiden, was „gerechte Unzufriedenheit und Verstimmung“ hervorrufen könne. Im Oktober konnte ihm der Regierungspräsident denn auch melden, „der aufrührerische Geist, welcher durch die Revolution in Frankreich und den Aufstand in Belgien angefacht, leider auch auf deutschem Boden an mehreren Orten auf die betrübendste Wei34
35
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/1, Bl. 109; 350/2, Bl. 60, 108. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/1, Bl. 23, 34, 37, 67, 78, 96, 106, 283; ebd., 350/2, Bl. 5f., 28, 85, 153f., 162; ebd., 350/4, 42.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 40
06.11.2012 14:42:17
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
41
se sich gezeigt“ habe, finde in Westfalen „keinen Anhalt“. Es seien bisher „nirgend Unordnungen vorgekommen, welche zu einer ernsten Besorgniß der Art Grund geben“ könnten. Die Regierung müsse alle Anlässe zur Unzufriedenheit beheben und „etwaigen öffentlichen Äußerungen derselben oder böswilligen Ruhestörungen“ begegnen, „welche in Folge der allgemeinen Aufregung auf gesetzwidrige und gefährliche Weise hervortreten möchten“. Bei dem in Olpe gefundenen aufrührerischen Plakat handelte es sich offenbar um einen Einzelfall. Als im Herbst in Hessen und Waldeck Unruhen ausbrachen, wurden vorsorglich Sicherheitsmaßnahmen in den Grenzgebieten getroffen. Nach der Meldung vom Aufruhr im hessischen Frankenberg erhielt der Kommandeur des Landwehr-Bataillons zu Arnsberg Order, ein oder zwei Kompanien zum Schutz der Grenze aufzubieten. In der Bereitwilligkeit, mit der die Einberufenen zum Dienst erschienen, sah man einen Beweis dafür „wie wenig von einer übeln Stimmung der Eingesessenen zu besorgen“ und „mit welcher Sicherheit auf sie zu zählen“ sei. Die Maßnahmen erwiesen sich bald als unnötig, und die in Meschede versammelte Landwehr konnte wieder entlassen werden. An der „guten Gesinnung“ der Einwohner gab es nach den amtlichen Berichten im Spätherbst und Winter 1830/31 keinen Zweifel. Prinz Wilhelm Friedrich und der Kronprinz wurden bei ihren Besuchen 1831 und 1832 in Arnsberg von der Bevölkerung geradezu enthusiastisch gefeiert.36 Die Unruhen außerhalb Preußens im Jahre 1832 haben Westfalen nicht berührt. Oberpräsident, Regierung und Landräte waren seit langem nach Kräften mit allerdings nur mäßigem Erfolg bemüht, die Wirtschaft durch Verbesserung der Infrastruktur und vor allem der Nahrungsmittelproduktion zu fördern. Vincke drängte die Landräte, auf die Bildung von landwirtschaftlichen Vereinen hinzuwirken. Oftmals übernahmen Regierungsbeamte und Landräte den Vorsitz oder wurden wenigstens Mitglieder im Vorstand. So war Florens von Bockum-Dolffs Vorsitzender des landwirtschaftlichen Kreisvereins Soest, Friedrich Boese in Meschede Direktor des dortigen landwirtschaftlichen und Gewerbevereins, der Oberregierungsrat und spätere Regierungsvizepräsident in Münster, Eduard Delius, wurde 1848 Präsident der Landeskulturgesellschaft für den Regierungsbezirk Arnsberg, die Regierungsräte Franz Droege und Reinhard Hymmen stellvertretende Vorsitzende und der Regierungspräsident Graf Heinrich von Itzenplitz ihr Präsident. Die Maßnahmen der Regierung zur Förderung der landwirtschaftlichen Produktion griffen jedoch nur langsam. Aus dem im Jahre 1833 zu diesem Zweck für die Provinz eingerichteten Fonds von 1.800 Talern, konnten im ersten Jahr für den Regierungsbezirk Arnsberg
36
Wilhelm Schulte, Volk und Staat. Westfalen im Vormärz und in der Revolution 1848/49, Münster 1954, S. 89, 470; Friedrich Keinemann, Zu den Auswirkungen der Julirevolution in Westfalen, in: Westfälische Zeitschrift 121 (1971), S. 351–364, hier S. 352–354, 362; ders., Westfalen im Zeitalter der Restauration und der Julirevolution 1815–1833, Münster 1967, S. 394f.; ders., Von den Freiheitskriegen zur Julirevolution (wie Anm. 14), S. 264f.; Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 542–546; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/4, Bl. 67f., 77f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 41
06.11.2012 14:42:17
42
Hans-Joachim Behr
nur 100 Taler angewiesen werden. Auch künftig wurden bis zur Auflösung 1845 nur 65 bis 75 Prozent in Anspruch genommen.37 Die Zeitungsberichte der Regierung Arnsberg melden auch in den folgenden Jahren immer wieder Missernten und abnehmenden Wohlstand. Mitte der vierziger Jahre kam es zu förmlichen Hungerkrisen. Im Herbst 1845 musste der Regierungspräsident die Städte zur Bildung von Vereinen zur Beschaffung von Lebensmitteln für die ärmere Bevölkerungsklasse aufrufen. Die zur Behebung der Not angeordneten öffentlichen Bauten an der Köln-Mindener Eisenbahn, im Straßen-, Wege- und Brückenbau brachten keine dauernde Besserung. Die Gemeinden suchten durch eigene Arbeitsmaßnahmen zu helfen. Wo sie dafür nicht die nötigen Mittel aufbringen konnten, halfen für diese Zwecke geschaffene Fonds mit zinsfreien Darlehen. Im Laufe des Jahres 1847 stieg der Preis für ein Pfund Schwarzbrot fast um das Dreifache. Die Regierung gab Darlehen, damit Suppenküchen eingerichtet werden konnten. Da man auch für das nächste Jahr Teuerung und Mangel an Nahrungsmitteln befürchtete, wurden mit Unterstützung der Lokal-Hilfsvereine ungewöhnlich große Mengen Kartoffeln angebaut.38 Mit Besorgnis vermerkten die Behörden, dass dem Land durch eine zunehmende „Sucht zur Auswanderung nach Amerika“ in den Kreisen Siegen, Wittgenstein, Olpe und Meschede Arbeitskräfte und bares Geld entzogen wurden.39 Zur materiellen Not kam der politische Druck, der auf dem Lande aber wohl kaum so empfunden wurde wie in den größeren Städten. Nach den Karlsbader Beschlüssen von 1819 wurden Universitäten, Akademien und Gymnasien, auch das Gymnasium Laurentianum in Arnsberg, auf revolutionäre Umtriebe überwacht. Im ehemaligen Herzogtum Westfalen selber sind keine politischen Vorfälle bekannt. Doch wurden einige auswärts Studierende in polizeiliche Untersuchungen verwickelt. Bei einem Prozess gegen 30 Studenten im Jahre 1835 fanden sich unter den Angeklagten zwei Mitglieder der Beamtenfamilie Freusberg aus Arnsberg und Olpe, Gierse aus Gellinghausen sowie die Namen d’Alquen aus Brilon und Dham. Die von der Zentralbehörde des Deutschen Bundes veranlasste Sammlung aller Urteile der Jahre 1838 bis 1842, das sogenannte „Schwarze Buch“, nennt Hermann Graßhoff und Franz Gustav von Stockhausen aus Brilon sowie Ferdinand Würzer und Karl Koch aus Arnsberg. Ludwig Arndts aus Arnsberg gehörte zu den Studenten, die trotz Verbots die Bonner Burschenschaft „Germania“ am Leben hielten. Carl Johann Dham, 37
38
39
Hans-Joachim Behr, Staatliche Hilfen für die Landwirtschaft im Vormärz, in: Westfalens Wirtschaft am Beginn des „Maschinenzeitalters“, Dortmund 1988, S. 75–93, hier S. 83–86; ders., Das landwirtschaftliche Vereinswesen Westfalens im 19. Jahrhundert, in: Westfälische Forschungen 39 (1989), S. 180–211; Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 105–107, 150–153, 231– 235, 246, 249, 259, 263, 290f. Friedrich Keinemann (Hrsg.), Quellen zur politischen und sozialen Geschichte Westfalens im 19. Jahrhundert, 2 Bde., Hamm 1975/76, hier Bd. 1, S. 10–13; Christian Leitzbach, Märzrevolution, in: Wermert, Olpe (wie Anm. 11), S. 531–535, hier S. 533; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/7, Bl. 399f., 458, 473. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/7, Bl. 34.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 42
06.11.2012 14:42:18
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
43
Sohn des Arztes Clemens Ludwig Dham aus Schmallenberg, wurde 1833 als Burschenschafter wegen Hochverrats verurteilt. Er verbüßte bis 1840 eine Festungshaft in Magdeburg. Der Auskultator Johann Matthias Gierse, Sohn des Bürgermeisters zu Gellinghausen im Kreis Meschede, war mit Fritz Reuter unter den 204 Burschenschaftern, die am 4. August 1836 durch den Kriminalsenat des Berliner Kammergerichts verurteilt wurden. Er wurde, obwohl er sich nie politisch betätigt hatte, zu zwölf Jahren Haft, Amtsentsetzung und Amtsunfähigkeit verurteilt. Da die Festungen überfüllt waren, durfte Gierse seine Strafe im Inquisitorialgebäude zu Paderborn verbüßen. Der Rest der Strafe wurde ihm nach zwei Jahren erlassen. Koch wurde vom Gericht freigesprochen. 40 Unmutsäußerungen über die politischen Verhältnisse blieben im Sauerland die Ausnahme. Die öffentliche Stimmung wird in den amtlichen Berichten durchweg als „sehr gut“, „gut“ oder „fortwährend befriedigend“ bezeichnet. Im Verhältnis der Konfessionen gab es zweifellos Irritationen, doch scheint lange Zeit, wenigstens nach außen hin, ein bemerkenswerter Geist religiöser Toleranz geherrscht zu haben. 1820 berichtete der Regierungspräsident nach Berlin, „das Verhältnis der christlichen Religions-Parteien gegen einander“ trage im Allgemeinen den „Charakter friedlicher Duldsamkeit und echten christlichen Sinnes“.41 Das Misstrauen, mit dem die katholische Bevölkerungsmehrheit auf die evangelischen preußischen Staatsdiener sah, wich jedoch nur sehr allmählich. Die preußische Regierung hat die politischen Probleme, die sich aus den Konfessionsverhältnissen ergaben, lange nicht gesehen. Vincke hatte früh in einem Bericht an Hardenberg vom 19. Juni 1816 darauf hingewiesen, und der Kultusminister Karl von Stein zum Altenstein hatte in einer ausführlichen Denkschrift vom 30. März 1818 die Bedeutung herausgestellt, welche die Katholiken inzwischen für den preußischen Staat besaßen. Infolge der umfangreichen Gebietserweiterung sei nunmehr fast ein Drittel der Untertanen in Preußen katholisch. Wenn man nicht für die höchst mögliche Förderung und Sicherung ihrer Religion Sorge trage, müsse man sie „als Untertanen im eigentlichen Sinne des Wortes“ aufgeben. Der westfälische „Bauernadvokat“ Joseph Sommer hatte 1819 in seiner Schrift „Von der Kirche in dieser Zeit“ argumentiert, die preußische Regierung werde in den katholischen Teilen Westfalens nur dann Glück haben, wenn die evangelische Kirche vom Staat getrennt, der König also nicht mehr „summus episcopus“ sei, sondern ein paritätischer Landesherr und somit beide Konfessionen von der Staatsregierung unabhängig seien. Erst dann würden die Katholiken das Gefühl los, nur Untertanen zweiter Klasse zu sein.
40
41
Karl Hüser, Die Lebenserinnerungen des Johann Matthias Gierse 1807–1881, in: Westfälische Zeitschrift 121 (1971), S. 71–95; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 66–68, 447–449. Friedrich Keinemann, Das Kölner Ereignis und die Kölner Wirren (1837–41). Ein Nachtrag zu: Das Kölner Ereignis. Sein Widerhall in der Rheinprovinz und in Westfalen, Hamm 1986, S. 222; ders., Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 10–21 u.a.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 43
06.11.2012 14:42:18
44
Hans-Joachim Behr
Vincke, obwohl tiefgläubiger Protestant, trat wiederholt für die Gleichbehandlung der Konfessionen ein und kritisierte die mangelnde Berücksichtigung der Katholiken bei der Besetzung der höheren Stellen in der Verwaltung. Der bürokratische Verwaltungsstaat aber handelte nach dem Grundsatz, möglichst keinen in der Provinz beheimateten Beamten dort in höheren Positionen zu ernennen. Noch 1830 nannte der Freiherr vom Stein unter den „Hauptbeschwerden“ der Rheinländer und Westfalen neben „Mißgriffe[n] und Untätigkeit in Kirchen- und Schulsachen“ das „Verdrängen der gebildeten, mit den innern Verhältnissen bekannten Einländern durch ein Heer von mittelmäßigen Subjekten aus den östlichen Provinzen“.42 Für Arnsberg kann dieses Urteil nur bedingt gelten. So wurde in der neuen Regierung zwar die Präsidentenstelle mit dem Protestanten Bernuth, die Direktorenstelle der zweiten Abteilung mit dem ebenfalls evangelischen Heinrich Eberhard Krug von Nidda, bisher Regierungsrat in Liegnitz, besetzt. Fünf der 13 Ratsstellen aber erhielten Beamte, die schon früher in Arnsberg tätig gewesen waren. Auch das neue Oberlandesgericht wurde weitgehend mit „vorhandenen Räten“ besetzt. Es darf nicht verkannt werden, dass der einheimische Adel dem neuen System mit Reserve begegnete. Der auf die erste Direktorenstelle bei der Regierung berufene vormals hessische Regierungsrat Freiherr Max von Weichs verzichtete wohl aus gesundheitlichen Gründen.43 Von zwölf Arnsberger Regierungspräsidenten zwischen 1815 und 1901 stammten nur vier aus Westfalen, drei aus dem Regierungsbezirk und zwei, Carl und Ernst von Bodelschwingh, aus dem Kreis Meschede im Herzogtum Westfalen. Von den ersten sechs Landräten waren vier Gutsbesitzer in ihrem Kreis, einer immerhin in einem Nachbarkreis des Regierungsbezirks. Nur Adolf von Pilgrim in Medebach, dessen Familie aus dem Waldeckschen stammte, verfügte über keinen nennenswerten Landbesitz, war aber durch seine Heirat mit einer Freiin von Plettenberg-Heeren mit dem westfälischen Adel verbunden. Als Bernuth nach fast zehnjähriger Amtszeit in den Ruhestand treten wollte, versuchte Stein vergeblich, den Freiherrn Gisbert von Romberg-Brüninghausen zur Übernahme des Amtes zu bewegen. Stein klagte, er habe gehofft, „diesen würden die Liebe zu seinem Geburtsland, zu dem König und die flehentlichen Bitten seiner Freunde zu einer willfährigen Erklärung bestimmen. Was soll aus unserm guten Vaterlande werden, wenn alle Männer von Bedeutung zurücktreten und alles den Händen eigenthumsloser, interessenloser Büralisten […] überlassen bleibt.“44 Zum Nachfolger Bernuths im Amt wurde im Februar 1825 der Regierungsdirektor in Koblenz Karl Graf von Flemming, ein 42
43 44
Behr/Kloosterhuis, Ludwig Freiherr Vincke (wie Anm. 15), S. 615; Keinemann, Das Kölner Ereignis. Nachtrag (wie Anm. 41), S. 57; Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1: Reform und Restauration 1789 bis 1830, 2. Aufl. Stuttgart u.a. 1957, S. 193f.; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 83; Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften (wie Anm. 32), Bd. 7, S. 929. Keinemann, Von den Freiheitskriegen zur Julirevolution (wie Anm. 14), S. 104–106. Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften (wie Anm. 32), Bd. 6, S. 783–789, 794, 803; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 35), S. 469f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 44
06.11.2012 14:42:18
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
45
pommerscher Adeliger, bestimmt.45 Er geriet bald in Gegensatz zum Oberpräsidenten Vincke. Schon 1826 betrieb Vincke die Versetzung Flemmings, die aber erst 1831 mit dessen Ernennung zum Präsidenten der Regierung Marienwerder erfolgte. Gegen den Willen des Innenministers Schuckmann, der sich für den auch von Stein empfohlenen Tecklenburger Landrat Ernst von Bodelschwingh verwandte, setzte der Finanzminister Maaßen die Berufung des Direktors im preußischen Finanzministerium Philipp Ludwig Wolfart durch. Wolfart fand die Stelle in Arnsberg für sich nicht angemessen und bemühte sich schon im Frühjahr 1835 um seine Pensionierung.46 Wolfart wie Flemming waren nach Steins Urteil „achtenswerte“, „brave“, „unermüdet“, „in Akten tätige“ Männer. Flemming jedoch verlasse seine Amtsstube nicht, und daher fehle es ihm „durchaus an der einem Regierungspräsidenten unerläßlichen Kenntnis der Personen, der Sachen, der Öffentlichkeit, also an einem lebendigen, kräftigen Eingreifen in die Provinzialverwaltung, deren Gang stockend und geistlos“ sei. Während Schuckmann und Vincke Flemmings Arbeit kritisierten, bemerkte der Finanzminister, dass sich unter Flemmings Leitung die Verwaltung in Arnsberg wesentlich gebessert habe, „Ordnung und Regelmäßigkeit“ in der Verwaltung „Lob und Beifall“ verdienten.47 Wolfart wurde im Februar 1836 durch den Geheimen Oberfinanzrat im Finanzministerium Georg Keßler abgelöst. Auch für Keßler war der Posten des Regierungspräsidenten in Arnsberg nicht unbedingt wünschenswert. Er hatte als aufgeklärter Liberaler das Missfallen des Kronprinzen erregt. Zunehmende Schwierigkeiten im Amt veranlassten ihn schließlich das Angebot anzunehmen.48 Keßlers Nachfolger wurde im Mai 1845 Graf Heinrich von Itzenplitz aus pommerschem Adel, bisher Regierungsvizepräsident in Posen, der das Amt bis zum August 1848 bekleidete. Von einzelnen Ausnahmen abgesehen, war das Zusammenleben zwischen den Konfessionen friedlich. Böses Blut erregte der Erlass über die Militärseelsorge von 1832, der katholische Soldaten zum Besuch des evangelischen Gottesdienstes zwang. Die Vertreibung der Klosterbrüder und ungeschickter Umgang mit dem verehrten Gnadenbild führten 1836 in Werl zu Tumulten und Übergriffen gegen Evangelische. Im März 1837 klagte der Paderborner Bischof Friedrich Clemens von Ledebur über seit Jahren anhaltende Reibungen mit der Bezirksregierung, welche auf die Verwaltung nur nachhaltig wirken könnten und diese mannigfach erschwerten. Mit den Regierungen zu Minden, Magdeburg, Erfurt und Merseburg stehe er im besten Einvernehmen. Die Bitte um Ablösung des Konsistorialrats Sauer wurde aber abgelehnt.49 Ernstere Differen45 46 47
48 49
Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 268. Ebd., S. 143f., 348f. Keinemann, Von den Freiheitskriegen zur Julirevolution (wie Anm. 14), S. 410f.; Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 20), S. 143, Anm. 89. Ebd., S. 145. Friedrich Keinemann, Das Kölner Ereignis. Sein Widerhall in der Rheinprovinz und in Westfalen. Tl 1: Darstellung, Tl. 2: Quellen, Münster 1974, hier Tl. 2, S. 4; ders., Das Kölner Ereignis. Nachtrag (wie Anm. 41), S. 78; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/4, Bl. 63 (1830). Zum Konflikt um das Simultaneum in Werl: Horst Conrad, Bürger und Verwaltung. Die Stadt im 19. Jahrhundert bis zum Ende des Kulturkampfes, in: Amalie Rohrer/
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 45
06.11.2012 14:42:18
46
Hans-Joachim Behr
zen zwischen den Staatsbehörden und der Amtskirche scheint es nicht gegeben zu haben. Der Mischehenstreit hat dann aber das Misstrauen gegen den preußischen Staat gesteigert. Zunächst wurde der Konflikt der Staatsregierung mit dem Kölner Erzbischof Clemens August Droste zu Vischering und dessen Amtsenthebung allerdings ziemlich ruhig hingenommen. Der Bischof von Paderborn ermahnte die Geistlichen seiner Diözese ausdrücklich zur Zurückhaltung. Er untersagte ihnen, die Ereignisse öffentlich zu erörtern und forderte sie auf, in Fällen, „wo eine in ihrer Gemeinde sich kundgebende bedenkliche Stimmung dazu Veranlassung darbieten möchte, als Prediger des Friedens ihre Stimme zu erheben und zum christlichen Gehorsam gegen die Obrigkeit zu ermahnen“. Mit der Dauer der Wirren zeigten sich schließlich auch unter der katholischen Bevölkerung des Sauerlandes Unzufriedenheit und Empörung. Regierungspräsident Keßler erhielt anonyme Drohbriefe und Warnungen. Im Juni 1839 musste er dem Oberpräsidenten berichten, dass das Verhältnis der Konfessionen „nicht so friedlich als früher“ sei. Wenngleich die Entfernung des Erzbischofs von Köln keine öffentlichen Aufstände verursacht habe, so sei doch das gegenseitige Zutrauen geschwunden, und Reibungen zwischen den Konfessionen seien nicht auszuschließen. 1840 heißt es, das Verhältnis sei seit den Kölner Ereignissen gespannt, man hoffe aber auf Milderung. Beim Abschluss gemischter Ehen gebe es fortwährend Konflikte zwischen den Geistlichen und Klagen. Noch 1843 hatten sich die Spannungen zwischen den Konfessionen nicht ganz gelegt.50 Im Großen und Ganzen aber entwickelte sich die Stimmung dann doch zeitweise wieder ganz im Sinne der Staatsregierung. Nach dem Thronwechsel richteten sich viele Hoffnungen auf den neuen König. Die Huldigungsfeier wurde mancherorts mit Begeisterung begangen. Als Friedrich Wilhelm IV. der katholischen Kirche Zugeständnisse machte und 1841 beim Kultusministerium eine katholische Abteilung einrichtete, sahen ihn viele Menschen als Versöhner von Kirche und Staat. Dankbar wurden Steuernachlässe für die untere Volksklasse und Maßnahmen zur Linderung der Not durch Getreidezufuhr, finanzielle Unterstützung und Ausfuhrverbote anerkannt. Im Juli 1843 besuchte der König Arnsberg und übernachtete beim Grafen Franz Egon von Fürstenberg-Herdringen, dem er bei dieser Gelegenheit den antiquierten Titel eines Erbmarschalls im Herzogtum Westfalen verlieh.51 Die Verfassungsfrage blieb offen. In der Verordnung vom 22. Mai 1815 hatte König Friedrich Wilhelm III. neben der Wiederherstellung und Neueinrichtung von Provinzialständen „der preußischen Nation“ eine schriftliche Verfassungsurkunde und eine Gesamtrepräsentation in Aussicht gestellt. 1817 war eine Verfassungskommission eingesetzt worden. Der Arnsberger Re-
50
51
Hans-Jürgen Zacher (Hrsg.), Werl. Geschichte einer Stadt, Bd. 1, Paderborn 1994, S. 667–757, hier S. 706–709; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 365. Heim, Leben des Georg Wilhelm Kessler (wie Anm. 24), S. 341f., Keinemann, Das Kölner Ereignis. Nachtrag (wie Anm. 40), S. 105, 109, 133, 143. Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 547–550.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 46
06.11.2012 14:42:18
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
47
gierungspräsident Bernuth schrieb damals, man müsse sich damit abfinden, dass die künftige Verfassung in der Regel nicht von Geburt und Stand abhängig gemacht werden könne. Es bleibe aber wünschenswert, dass der Adelsstand „möglichst beruhigt und zufrieden gestellt“ werde.52 Der König hatte sein Versprechen 1820 noch einmal erneuert und die Aufnahme neuer Schulden von der Zustimmung der allgemeinen Stände abhängig gemacht, deren Einrichtung aber schon bald auf unbestimmte Zeit verschoben. Stattdessen ordnete ein Gesetz vom 5. Juni 1823 Provinzialstände „im Geiste der älteren deutschen Verfassungen“ an. Gesetze für die einzelnen Provinzen folgten, unter dem 17. März 1824 das „Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände für die Provinz Westphalen“.53 Eine Wiederherstellung der territorialen Landtage und der alten Geburtsstände wurde nicht ernsthaft versucht, die Abgeordnetenzahl lediglich nach „Landesteilen“ aufgeschlüsselt. Das frühere Herzogtum Westfalen mit Siegen, Wittgenstein und märkischen Gebieten in den Kreisen Soest und Lippstadt bildete den dritten von sechs Wahlkreisen. Vertreten waren auf dem Landtag der Provinz die Standesherren mit elf, der zweite Stand der Rittergutsbesitzer ohne Rücksicht auf adelige oder unadelige Herkunft mit 20, sowie mit jeweils 20 Deputierten die Städte und die Bauern. Die beiden Standesherren im Bereich des dritten Wahlkreises, der Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg und der Fürst zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein (Wittgenstein-Wittgenstein), gehörten dem Provinziallandtag als geborene Mitglieder an. Von den 20 Abgeordneten der Ritterschaft konnte das ehemalige Herzogtum Westfalen drei stellen. Voraussetzung für das aktive Wahlrecht war ein früher landtagsfähiges Gut mit einem Grundsteuersatz von mindestens 75 Talern. Nur 32 der 57 Güter im Wahlbezirk erfüllten diese Voraussetzung. Nach Abzug minderjähriger und weiblicher Besitzer blieben noch 28, von denen zwölf an der Wahl teilnahmen. Gewählt wurden für den zweiten Stand Freiherr Friedrich Wilhelm von Schorlemer-Herringhausen, Graf Dietrich von Bocholtz-Niessen und Freiherr Friedrich von Wrede-Melschede. Für den dritten Stand der Städte stellte der dritte Kreis drei Abgeordnete. Siegen hatte eine Virilstimme, Hamm und Arnsberg wechselten sich ab. In die Wahl des dritten Abgeordneten teilten sich 16 Städte. Voraussetzung für die Wahl waren Bürgerrecht und Steuerquote. Der vierte Stand der Landgemeinden stellte drei Abgeordnete, je einer aus den Kreisen Arnsberg und Eslohe (Meschede), Brilon und Lippstadt sowie Olpe, Wittgenstein und Siegen. Auch hier entschied eine bestimmte Steuerqualität über das Wahlrecht. Gewählt wurde indirekt. Das Wahlgesetz brachte besonders für den vierten Stand einen äußerst scharfen Wahlmodus, während sich der adelige Grundbesitz einer bedeutenden Bevorzugung erfreute. Der Freiherr vom Stein, der als erster Landtagsmarschall der Versammlung vorstand, kritisierte, dass nicht immer die tüchtigsten Männer in den Provinziallandtag gewählt würden. Die Städte, darunter auch Arnsberg, hätten sich hier am meisten vorzuwerfen. Die Wahlen des platten Landes blieben „immer bedenklich“. 52 53
Keinemann, Von den Freiheitskriegen zur Julirevolution (wie Anm. 14), S. 297–299. Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1824, S. 109–115.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 47
06.11.2012 14:42:18
48
Hans-Joachim Behr
Der Bauer werde den Landtag „als einen Karneval ansehen, für dessen Genuß er durch Müßiggang und Diäten noch obendrein belohnt“ werde. Die Mitglieder der vier Stände verhandelten gemeinsam. Der Provinziallandtag war in erster Linie eine beratende Versammlung. Ihm wurden die Beratung der Gesetze, die allein die Provinz betrafen, das Recht, in Angelegenheiten der Provinz Bitten und Beschwerden an den König zu richten, und die Verwaltung der Kommunalangelegenheiten übertragen. Das Recht der Steuerbewilligung, das die alten Territorialstände behauptet hatten, blieb ihnen vorenthalten. Die Beschäftigung mit politischen Fragen suchte die Regierung möglichst zu unterdrücken. So behandelte der Provinziallandtag in den ersten Jahrzehnten vorwiegend Fragen der Ablösung bäuerlicher Lasten, Kataster, Städte- und Landgemeindeordnung, Verkehrswesen und Steuerangelegenheiten. Zweimal, 1830/31 und 1845, wurden jedoch Anträge gestellt, den König um Zusammenberufung von Reichsständen, also um eine preußische Gesamtstaatsvertretung zu bitten. Sie erhielten jedoch nicht die erforderliche Stimmenmehrheit.54 Die Masse der ländlichen Bevölkerung berührten solche Fragen wenig. Im April 1843 berichtete der Landrat in Brilon auf eine entsprechende Anfrage an den Regierungspräsidenten in Arnsberg, die Bevölkerung des Kreises, unter der „die gebildetere Classe nur einen verhältnißmäßig sehr kleinen Theil“ ausmache, sei „wenig geeignet zur Theilnahme an den politischen Ereignissen“. Sie würden die Aufmerksamkeit nur dann in Anspruch nehmen, wenn sie die materiellen Interessen oder die kirchlichen Verhältnisse unmittelbar“ berührten.55 Im Bürgertum jedoch wurden Erwartungen auf Erfüllung des Verfassungsversprechens geweckt, als Friedrich Wilhelm IV. am 3. Februar 1847 die Landtage der acht preußischen Provinzen für den 11. April zu einem Vereinigten Landtag nach Berlin einberief. Obwohl es die Verordnung von 1815 mit keinem Wort erwähnte und weder eine jährliche noch überhaupt eine regelmäßige Einberufung in Aussicht stellte, erregte das Patent des Königs „allgemeine freudige Sensation“. Die Verhandlungen, in denen sich Georg von Vincke, der älteste Sohn des Oberpräsidenten, mit der Forderung nach weiteren Rechten und Periodizität der Versammlung hervortat, wurden „von dem gebildeten Theile des Publikums mit der gespanntesten Theilnahme und dem lebhaftesten Interesse gelesen und verfolgt“. Unter den 21 Rittern der Provinz befanden sich aus dem Herzogtum Westfalen Graf Diederich von Bocholtz-Asseburg, Graf Dietrich von Bocholtz-Alme, Freiherr Felix von Lilien, Landrat zu Echthausen, Freiherr Clemens von Lilien-Borg zu Werl, aus dem Stand der Städte 54
55
Hartlieb von Wallthor, Die landschaftliche Selbstverwaltung (wie Anm. 23), S. 104–120; Josef Häming/Alfred Bruns, Die Abgeordneten des Westfalenparlaments 1826–1978, Münster 1978, S. 15–41; Manfred Wolf, Die Wahlen zum 1. und 2. Westfälischen Provinziallandtag im Jahre 1826 mit besonderer Berücksichtigung des Kreises Olpe, in: Heimatstimmen aus dem Kreise Olpe 49 (1978), S. 4–11; Freiherr vom Stein, Briefe und amtliche Schriften (wie Anm. 33), Bd. 7, S. 479. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 234, Bl. 9; ähnlich der Landrat in Olpe, ebd., Bl. 22.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 48
06.11.2012 14:42:18
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 49
Balve
Hellefeld
Serkenrode Fredeburg
Brilon
Thülen
Hallenberg
Nieder-
0 km 10 km 20 km Entwurf und ©: Hans-Jürgen Behr und Theo Bönemann, 2012
Landeskreisgrenzen Amtsgrenzen Grenzen der amtsfreien Gemeinden
sonstige amtsfreie Orte Amtsangehörige Kreishauptorte, die zugleich Amtsorte sind Amtshauptorte
Amtsfreie Kreishauptorte
Obermarsberg
Winterberg Medebach Liesen
Niedersfeld
Bigge
Schmallenberg
Bödefeld
Eversberg Meschede
Warstein
Eslohe
Freienohl Arnsberg
Allendorf
Neheim Hüsten
Amtsgrenzen in den Kreisen Arnsberg, Meschede und Brilon 1843
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
49
06.11.2012 14:42:18
50
Hans-Joachim Behr
lediglich Justizkommissar Theodor Plange aus Attendorn und der Kaufmann Leopold Epping zu Lippstadt, aus den Landgemeinden der Gemeindevorsteher August Deimel zu Elleringhausen und der Amtmann Theodor SchulzeDellwig. Vinckes Rechtsverwahrung, in der die Einhaltung des Verfassungsversprechens gefordert wurde, hat allein Epping mit unterzeichnet. Wenn man allerdings gehofft hatte, damit werde der Weg zum Verfassungsstaat beschritten, sah man sich bald getäuscht. Die Versammlung wurde, zumal sie nicht allen Propositionen des Königs zustimmte, mit ungnädigen Worten nach Hause geschickt, ohne dass eine baldige Wiedereinberufung in Aussicht gestellt wurde.56
1848 – Revolutionäre Bewegungen Trotz der sozialen Nöte und der politischen Unzufriedenheit rechnete in Westfalen niemand mit größeren Unruhen. Im April 1847 hatte der Arnsberger Bürgermeister Wulff dem Regierungspräsidenten Graf von Itzenplitz auf eine entsprechende Anfrage versichert, dass in der Stadt keinerlei ernstliche Versuche unternommen würden, um kommunistische Tendenzen zu fördern, noch Arnsberg überhaupt der geeignete Ort sei, kommunistischen Theorien Eingang zu verschaffen. „Eine klare Auffassung des vieldeutigen Begriffs ‚Communismus‘ setzt ohne Zweifel ein gewisses Maaß von Intelligenz voraus; die Intelligenz in hiesiger Stadt ist vorzugsweise im Beamtenstande concentrirt.“ Vielleicht diene „ein verkehrter Liberalismus“ […] einzelnen jüngeren Individuen gedachten Standes zum theoretischen Spielwerk“, doch verbiete ihnen schon die Rücksicht auf ihre Stellung, solchen Ideen „practischen Eingang zu verschaffen“. Die „Lokalität“ der Stadt sei „dem consequenten heimlichen Verfolgen solchen Treibens ganz und gar ungeeignet“. Ein Jahr später, im April 1848, aber war „ein Umschwung der Dinge“ eingetreten, wie ihn noch vor Wochen niemand hatte ahnen können. Die Stimmung sei überall sehr aufgeregt, heißt es in einem Bericht des Regierungspräsidenten, in der Grafschaft Mark bei Bürgern und Bauern noch sehr gut, bei den Fabrikarbeitern jedoch bedenklich. In vielen Orten sei es zu „Straßenunfug und Gewaltthätigkeit“ gekommen. Namentlich im Herzogtum Westfalen hätten die Bauern die adeligen Rittergutsbesitzer „terrorisirt“. An vielen Orten hätten rasch aufgestellte Bürgerwehren die Ruhe wieder hergestellt. Auf die Dauer lasse sich aber nicht dafür bürgen, dass dieses ausreichen werde. Itzenplitz beton-
56
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/7, Bl. 476 (April/Mai 1847); Der Erste Vereinigte Landtag in Berlin 1847. Hrsg. unter Aufsicht des Vorstehers des Central-Bureaus im Ministerium des Innern und des Bureaus des Vereinigten Landtages Königlichen Kanzlei-Raths Eduard Bleich, 4 Theile, Berlin 1847, hier Tl. 1, S. 733–746; Hans-Joachim Behr, Westfalen auf dem Vereinigten Landtag 1847, in: Franz Bölsker/Joachim Kuropka (Hrsg.), Westfälisches aus acht Jahrhunderten. Zwischen Siegen und Friesoythe – Meppen und Reval. Festschrift für Alwin Hanschmidt zum 70. Geburtstag, Münster 2007, S. 13–31.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 50
06.11.2012 14:42:18
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
51
te, dass es indes keine „eigentlich politische Erregung“ gebe, dass die Gefahr in der sozialen Frage liege.57 Die Ereignisse in Berlin, wo bei den Barrikadenkämpfen am 18. März auch ein Gardegrenadier aus Meggen fiel, konnten nicht spurlos an der Provinz vorübergehen. Die Patente vom 18. und 20. März, die Verkündung der Pressefreiheit und der Amnestie für alle politischen Vergehen, die Berufung einer preußischen Nationalversammlung und das Bekenntnis des Königs zur deutschen Einheit wurden allgemein begrüßt. Man schöpfte Hoffnung auf Besserung der Zustände. In vielen Orten wurden schwarz-rot-goldene Fahnen aufgezogen, trugen die Menschen die dreifarbige Kokarde. In Arnsberg, Lippstadt und anderen Städten kam es zu Aufläufen. Man zog vor die Häuser preußischer Beamter, der Magistrate und anderer unbeliebter Personen und warf ihnen die Fenster ein. Staatssymbole wurden angegriffen, in Werl wurde das Hoheitszeichen an der Post zertrümmert und in Allendorf der preußische Adler im Misthaufen vergraben. In Arnsberg zwangen die Bäcker einen Mann zur Umkehr, der mit einem Karren Brot von auswärts in die Stadt bringen wollte.58 In Werl beschlossen die Stadtverordneten eine Kollekte für die Berliner Märzgefallenen. Ein feierliches Requiem sollte abgehalten werden für die Opfer, deren „Heldenmuth“ allein die „Wiedergeburt Deutschlands“ zu verdanken sei. In Meschede sprach Hermann Graßhoff zu einer Volksversammlung. Unter dem Druck der Einwohnerschaft richteten die dortigen Stadtverordneten ein Gesuch an den Regierungspräsidenten, in dem sie um Rückverlegung des Kreisbüros in ihre Stadt baten. In Arnsberg trugen die anhaltenden Volksversammlungen nach dem Urteil des Bürgermeisters Wulff jedoch einen „durchaus friedlichen Charakter“. Er versicherte dem Regierungspräsidenten, der in der Stadt herrschende „Sinn für Gesetzlichkeit und Ordnung, auch unter der Classe der Tagelöhner“, lasse keine „Excesse und Unruhen“ befürchten. Der Magistrat habe „die feste Ueberzeugung“, dass auch jeder Angriff von außen „in der Gesammtheit der Einwohnerschaft nicht nur keine Unterstützung, sondern den kräftigsten Widerstand finden würde“. Die Bauart des Gefängnisses lasse einen Ausbruch der Gefangenen wohl nicht zu und ein Angriff auf das Gebäude durch „die Complicen und Verbündeten der Inhaftierten“ sei sehr unwahrscheinlich. Militärische Hilfe hielt der Bürgermeister noch nicht für erforderlich. Vorsorglich wies er darauf hin, dass wegen der noch nicht behobenen Schäden des großen Stadtbrandes „eine bleibende Einquartierung von auch nur 50 Mann neben den jetzt häufig vorkommenden vorübergehen-
57
58
Keinemann, Quellen (wie Anm. 37), Bd. 1, S. 25; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 235, Bl. 14f.; ebd., Oberpräsident 350/7, Bl. 530–532. Fritz Schumacher, Arnsberg im Vormärz, in: 750 Jahre Arnsberg (wie Anm. 19), S. 162–166; Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 567; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 238, Bl. 50; ebd., 236, Bl. 13–28, 50, 152, 199–201, 213–218; ebd., 237, Bl. 102; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 172.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 51
06.11.2012 14:42:19
52
Hans-Joachim Behr
den Einquartierungen“ für die Einwohnerschaft nur „viele Unbequemlichkeit“ bringen werde.59 Heftiger als in den Städten entluden sich Not und soziale Spannungen auf dem Lande. Zahlreiche Dörfer wurden davon erfasst. Der Regierungspräsident beurteilte die Situation ganz zutreffend, wenn er betonte, dass diese Unruhen unter der Landbevölkerung keine politischen Hintergründe hätten. Itzenplitz empfahl aber ausdrücklich, bei der herrschenden Stimmung eine Mobilmachung der Landwehr nur dann anzuordnen, wenn der Feind die Grenzen überschreite, und die Leute sofort in den Kampf zu führen. „Ein Abmarsch, um noch lange zwischen Krieg und Frieden zu schwanken, würde die Landwehr und ihre Angehörigen unzufrieden machen, und vielleicht gefährlich sein.“ Da die Kräfte der Polizei im Ernstfall nicht ausreichten, bat der Regierungspräsident um eine mobile Militärkolonne. Ulanen und Infanteristen wurden daraufhin in Marsch gesetzt.60 Die Agrarreformen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts hatten zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. Die Ablösungsfrage war nicht gelöst, und die Aufteilung der Marken hatte die Nahrungsgrundlage einer wachsenden unterbäuerlichen Schicht weiter eingeengt. Westfalen wurde nach Schlesien zur preußischen Provinz mit den meisten Bauernunruhen. In den Tagen vom 22. bis 27. März 1848 kam die lange aufgestaute Missstimmung gegen die Gutsherren zum Ausbruch. Die Eigenbehörigen verweigerten Dienste und Abgaben und verlangten Holz, Weideland und Streu für ihr Vieh. Die Vorsteher der zur Herrschaft Alme gehörenden Ortschaften trafen sich am 22. März zu einer Aussprache mit ihrem Amtmann. Sie versicherten dem König und der Obrigkeit den schuldigen Respekt und Gehorsam. Sie hätten allen Grund zur Zufriedenheit, wenn nicht der Gutsherr Graf von Bocholtz „gar zu bedeutende Abgaben“ verlangte und mit „großer Strenge eintreibe“. Seine Gegenleistung aber falle von Jahr zu Jahr „kümmerlicher“ aus. Eine große Erbitterung habe sich der Gemüter bemächtigt. Allein das werde nicht dazu führen, Person oder Eigentum des Grafen anzugreifen. Dennoch floh Graf Dietrich von Bocholtz aus Furcht vor seinen Bauern am 23. März von Alme nach Arnsberg und bat den Oberpräsidenten dringend, „die geeigneten Mittel zum Schutze des Eigentums zu veranlassen“. In den Kreisen Brilon und Büren herrsche „vollständige Anarchie“. Der Regierungspräsident forderte auch umgehend 50 Mann Infanterie aus Berleburg an, doch lehnte das Generalkommando in Münster die Abordnung von Truppen zum Schutz einzelner Gutsbesitzer ab. Graf Clemens Au59
60
Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 709. Landräten mit Grundbesitz im Kreis war es gestattet, ihren Wohnsitz auf ihrem Gut zu nehmen und auch das Kreisbüro dahin zu verlegen. Landrat Friedrich Boese war Besitzer des Ritterguts Berge und führte von da aus die Geschäfte. Um die Gemüter zu beschwichtigen, erklärte er sich bereit, das Büro nach Meschede zu verlegen, bat aber darum, seiner großen Familie wegen das Gehalt nicht zu kürzen. Siehe Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 125–131, 148–150; ebd., 237, Bl. 80, 195f.; Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 164. Hans-Joachim Behr, Revolution auf dem Lande. Bauern und ländliche Unterschichten 1848/49, in: Westfälische Zeitschrift 150 (2000), S. 43–147, hier S. 64; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 693, Bl. 13–15; ebd., 350/7, Bl. 540–544.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 52
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
53
gust von Westphalen floh vor dem Volkszorn aus seinem Schloss Fürstenberg, das zerstört und geplündert wurde, auf sein Gut Laer bei Meschede. Auch Freiherr Friedrich von Wrede in Melschede bat um Hilfe für die „bedrängten Gutsbesitzer“.61 In der Gemeinde Holzen wurden die zahlreichen dort wohnenden Lumpensammler, Topfbinder und Kiepenträger mit Frau und Kind vertrieben, ein Haus wurde niedergerissen. Unruhen gab es auch in Balve. Eine Deputation an den Grafen Johann Ignaz von Landsberg-Velen in Wocklum forderte die Rücknahme der Jagdteilung. Nach Melschede zum Freiherrn von Wrede zogen 300 Mann und verlangten die Auslieferung konfiszierter Gewehre und das Recht zum Sammeln von Kaff, Leseholz und Laub in seinen Wäldern. In Suttrop wurde die Wohnung des Gutspächters zerstört. Auch die Güter Schwarzenraben und Herdringen wurden bedroht. In Freienohl fanden Versammlungen und Umzüge statt. 120 bis 130 Männer zogen mit Fahne und Trommel zum Gut Bockum und verlangten die sofortige Abdankung des Amtmanns Devivere. Man wollte keinen Amtmann mit mehreren hundert Talern Besoldung mehr, sondern einen Schultheißen, der sich mit 20 Talern begnügte. Der Regierungspräsident beauftragte den Vorsteher Raulf-Oeventrop mit der Stellvertretung. Er tadelte die ungesetzliche Art des Vorgehens, auch wenn die Mehrheit der Eingesessenen die Entlassung des Amtmanns wünschte. Devivere bat wegen der gegen ihn herrschenden Stimmung um „vorläufige“ Entbindung von seinem Amt. Auch der Beigeordnete Wiethoff wollte seine Funktion erst dann wieder ausüben, wenn er sich in Freienohl sicher bewegen könne. Der Landrat bemerkte dazu, seines Erachtens seien diese Beamten „besorgter für ihre Personen, wie nöthig“. Devivere wurde sofort angewiesen, sein Amt wieder anzutreten. Der Landrat des Kreises Brilon wollte den Einsatz militärischer Macht wohl wegen der damit verbundenen Kosten vermeiden. Wie er der Regierung am 25. März schrieb, komme ihm die Nachricht von der Verlegung eines Truppenkommandos nach Brilon auf Veranlassung des Grafen von Bocholtz um so unerwarteter, als nach der Verfügung des Regierungspräsidenten zu diesem letzten Mittel erst gegriffen werden sollte, wenn die Notwendigkeit „unabweisbar“ und zugleich den Wünschen der Mehrheit der Kreisstände entspreche. Unzufriedenheit herrsche vielerorts, aber ernsthafte Unruhen würden kaum erwartet. In Brilon sei eine Bürgerschutz-Kompanie von 350 ansässigen Bürgern organisiert. Die Gemeindevorsteher der Herrschaft Alme hätten erklärt, für die Erhaltung der Ruhe einzustehen und versicherten ausdrücklich, dass der Graf von den Einwohnern keinerlei Gewalttätigkeiten zu befürchten habe. Aus Marsberg schrieb der Amtmann, die Verlegung eines Militärkommandos von etwa 100 Mann in den Kreis Brilon könne beim Ausbruch von Unruhen „wenig und 61
Behr, Revolution auf dem Lande (wie Anm. 60), S. 43–147; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 693, Bl. 285; Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 30; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 22–29, 37–42, 44, 80–82, 108–110, 117f., 224; ebd., 237, Bl. 140; Rainer Decker, Die Revolution von 1848/49 im Hochstift Paderborn, Paderborn 1983, S. 17.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 53
06.11.2012 14:42:19
54
Hans-Joachim Behr
nur an einzelnen Orten“ nützen, auf jeden Fall aber „die Aufregung der Gemüther, wo solche vorhanden ist, vermehren und an anderen Orten hervorrufen“. Der Landrat bat dem Kommando Gegenbefehl zu geben. Auch Magistrat und Stadtverordnete zu Brilon verwahrten sich gegen die Heranziehung von Militär. Dennoch wurden im Kreis Brilon zeitweilig 50 Infanteristen stationiert. In Bruchhausen forderten unzufriedene Landleute vom Freiherrn von Gaugreben freies Holz, freie Weide und freies Streu. Am 27. März überfielen sie das Renteigebäude, nahmen Dokumente und Akten und verbrannten sie. Dann zogen sie über die zum Herrenhaus führende Brücke und versuchten auch hier einzudringen, scheiterten aber an der starken Tür. Darauf wurden Fenster eingeworfen und eingeschlagen, bis andere Einwohner die Angreifer zurücktrieben. Der Schaden wurde mit jeweils 2.000 Talern angegeben, wobei nicht in Anschlag gebracht war, dass durch die Vernichtung der Rentamtsbücher die Nachweise über die gutsherrlichen Forderungen verloren waren. Der in den Kreis Brilon entsandte Regierungskommissar Saint Pierre und der Rentmeister Joly baten um Entsendung einer Untersuchungskommission. Es sei „dringend erforderlich“, dass dieser erste Fall von Gewaltsamkeiten der Prästationspflichtigen gegen den Gutsherrn „auf das Strengste und Schleunigste gegen die Frevler gerügt werde“. Im nördlichen Teil des Kreises, wo die Rittergüter lägen, werde die Ruhestörung durchweg zur Gewalttätigkeit. Die Anordnung von Schutzwachen sei unausführbar, weil die Pläne auf „Erpressung von Vorteilen“ gerade von denjenigen verfolgt würden, welche die Schutzwache bilden sollten. Nur Hilfe von außen könne die Ordnung erhalten, Person und Eigentum der Gutsherren schützen. Im Einverständnis mit dem Landrat Droste wurde gebeten, „so schleunig wie möglich“ das Militärkommando von 50 Mann im Kreis um 100 Mann Infanterie zu verstärken, da jeder Tag „die bedenklichsten Folgen“ bringen könne.62 Weithin herrschte die Meinung, Gesetz und Obrigkeit gewährten keinen Schutz mehr, weil die exekutive Gewalt fehle. Aus Rüthen meldete der Amtmann, man habe Sicherheits-Vereine gebildet und stelle nachts Bürgerwachen auf. Allein die Gärung nehme zu und die „ärgsten Ausbrüche der wildesten Rohheit“ seien „umso mehr mit Grauen zu befürchten […], als namentlich die Fabrikarbeiter in Suttrop und Warstein durch ihre fortwährenden Demonstrationen und ihre Persönlichkeiten dazu Veranlassung geben“ würden. Einziges Mittel sei die Einquartierung einer Abteilung, möglichst einer Schwadron, Kavallerie in Suttrop. Dort liege der Mittelpunkt allen Unheils, dort befänden sich „die verwegensten, unruhigsten und frechsten Subjekte“. In Brilon führte die von den örtlichen Behörden beschlossene Aufhebung der Schafhude zur Aufregung. Ratsherren wurden angegriffen und die Fenster ihrer Wohnungen eingeworfen. Auch in Warstein spaltete ein Prozess um die Schafhude, den der Fabrikant Wilhelm Bergenthal in zweiter Instanz gewonnen hatte, die Einwohnerschaft. Es kam fast zu Mord und Totschlag, als am 30. März über 100 Arbei62
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 46, 132–135, 159–178, 213–219; ebd., 237, Bl. 16–18, 23–25, 99, 309–316.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 54
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
55
ter von der Pudlingsfabrik Bergenthals für ihren Arbeitgeber demonstrierten. In das Rathaus zu Neheim wurde eingebrochen, offenbar ohne größeren Schaden. In Werl versuchte die katholische Bevölkerung, die evangelische Gemeinde aus der bisherigen Simultankirche zu verdrängen. Da der evangelische Gottesdienst an diesem Tage ausgesetzt worden war, mussten sich die Ruhestörer darauf beschränken, die gottesdienstlichen Gerätschaften aus der Kirche wegzuschaffen und damit triumphierend durch die Stadt zu ziehen. In Neuenrade führten die Fastnachtslustbarkeiten zu einigem „Straßenunfug“. Im Oktober ersuchte der Landrat zu Olpe wegen eines Aufruhrs in Saalhausen um militärische Hilfe. Die Bitte wurde als ungerechtfertigt abgelehnt.63 Nach Verkündigung der Jagdfreiheit rächten sich die Bauern für den über lange Zeit an ihren Früchten erlittenen Wildschaden. Förster wurden gezwungen, Strafzettel über Forstvergehen herauszugeben. Der Regierungspräsident bat das Oberlandesgericht, Forstgerichtstage für einige Zeit auszusetzen. Die Bauern drohten offen, das Hochwild in Masse abzuschießen, sobald das Wildbret nur etwas besser sei. Für die Jagdbehörde war es unmöglich, solchen Vorhaben ein Hindernis in den Weg zu legen. Nur den Förstern des Grafen von Fürstenberg-Herdringen sowie der Oberförsterei Obereimer war es zu verdanken, dass im Arnsberger Wald das Wild nicht völlig ausgerottet wurde.64 Der Oberpräsident Heinrich Eduard von Flottwell hatte am 22. März in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten den Vorwurf erhoben, die Bürgerschaft habe „die zur Wiederherstellung der Ordnung und Ruhe erforderliche Mitwirkung nicht in dem Maaße geleistet […], welche man von ihr mit Recht erwarten konnte“, und die Landräte verpflichtet, für die Bildung städtischer Sicherheits-Vereine Sorge zu tragen. Eine Bewaffnung sei aber möglichst zu vermeiden, weil „der unzweckmäßige und übereilte Gebrauch der Waffen, bei der vorhandnen Aufregung leicht zu traurigen Folgen führen“ könne. Zwei Tage später aber bat er schon darum, Landräten und Magistraten auf Verlangen aus den Landwehrzeughäusern Seitengewehre und disponible Schusswaffen auszuhändigen.65 In Arnsberg folgten 460 Bürger der Einladung zu einem Schutzverein. In Lippstadt wurden die Bürgerschützen mobilisiert. In Brilon, Winterberg, Medebach und Hallenberg stellten die Bürger Schutzwachen auf, um Ruhestörungen zu begegnen. Zur Verstärkung der Sicherheitsbeamten genehmigte die Regierung im Mai die Einrichtung einer besoldeten Kreisschutzmannschaft auf Zeit. Auch die Schützengesellschaften durften zur Unterstützung der Stadtverwaltung herangezogen werden. Zwar lieh das Militär Geweh-
63
64
65
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 166–172; Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 710; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 237, Bl. 90f., 224–237, 246, 250; ebd., 241, Bl. 167–186. Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 121; Behr, Revolution auf dem Lande (wie Anm. 60), S. 77–80; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 199. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 53f., 140.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 55
06.11.2012 14:42:19
56
Hans-Joachim Behr
re, doch oft blieb die Bewaffnung mangelhaft und beschränkte sich wie in Geseke auf Knüppel.66 Vielerorts glaubte man sich ohne Soldaten nicht mehr sicher. Nicht nur in Alme, auch in Hüsten, Meschede, Werl, Freienohl und Rüthen wurde nach Militärhilfe gerufen. Eine kleine Garnison blieb an der Landesgrenze im Wittgensteinschen. Einige bescheidene Einheiten zogen im Land umher und machten an verschiedenen Orten und Gütern Halt, um Präsenz zu zeigen. Der Kommandeur des 15. Infanterieregiments in Paderborn wusste angesichts vielfach „widersprüchlicher Wünsche“ nicht mehr, wohin er Soldaten senden sollte. Er bat, Anforderungen um militärische Unterstützung nur an ihn direkt zu richten und das auch nur in wirklich dringenden Fällen.67 Regierungspräsident Graf von Itzenplitz war den Schwierigkeiten nicht mehr gewachsen und gab im August 1848 das Amt auf. Er hatte Georg von Vincke, den ältesten Sohn des Oberpräsidenten, gebeten, die Vertretung zu übernehmen. Der aber hatte abgelehnt. So wurde mit der kommissarischen Verwaltung Heinrich Moritz von Bardeleben beauftragt, der sich als Polizeipräsident in Berlin politisch bewährt hatte. In Arnsberg entsprach er nicht den Erwartungen und wurde bereits im Juni 1849 wieder abgelöst, weil er es „an der erforderlichen Kraft und Konsequenz“ habe fehlen lassen.68 Im Herbst begannen die Untersuchungen der Unruhen in Suttrop, auf Gut Amecke und in Balve. Verhandlungen wegen der Vorkommnisse in Wocklum und Melschede lehnte das Oberlandesgericht zunächst mit dem Bemerken ab, dass eine Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit nicht vorliege, mithin die Absendung einer Untersuchungskommission nicht begründet sei. Der Assessor Schirmeister sollte in Balve nach Beweismaterial suchen. Militärischer Schutz wurde vorerst als nicht erforderlich angesehen. Das Gericht stellte der Regierung aber anheim, im Hinblick auf die bei einer gerichtlichen Untersuchung vielleicht zunehmende Aufregung in Balve ein entsprechendes Militärkommando zu belassen.69 Die Angelegenheit verzögerte sich, und Ende September 1849 stellte der Landrat fest, da bisher noch keine gerichtliche Untersuchung der Vorfälle erfolgt sei, könne „die davon erwartete heilsame Einwirkung auf die Exendenten als vereitelt angesehen“ werden. Auch sei von einer Untersuchung kaum noch ein Erfolg zu erwarten, wenn es sich bestätigen sollte, dass mehrere der Schuldigen den Ort bereits verlassen hätten, um in fernen Gegenden ihre Handels-
66
67
68
69
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 53–56, 80–82, 91–93, 96–107, 135, 142f, 156; ebd., 237, Bl. 11, 18, 115, 136, 204, 331; ebd., 242, Bl. 3; ebd., 236, Bl. 12, 50; zu den Kreisschutzmannschaften ebd., 236, Bl. 5–353. Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 164; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 236, Bl. 104–107, 158, 213–218, 230–240; ebd., 237, Bl. 2–8, 17–21, 46, 51–54, 65, 70, 99–101, 115, 130, 143, 159f. 164, 187–191, 220, 224, 236, 264–267¸ u.a. Staatsarchiv Osnabrück, Dep. 45b, Nr. 59; Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 145, 241, 291. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 237, Bl. 159, 187f., 305– 316, 338.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 56
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
57
geschäfte zu betreiben und üblicherweise erst im nächsten Jahre zurückkehren würden. Nach den Unruhen wegen der Schafhude in Brilon wurden 1851 15 Personen zu Strafen zwischen drei Jahren Zuchthaus und sechs Wochen Gefängnis verurteilt, teilweise aber später begnadigt. In Lippstadt wurden der Vikar Blömke und neun andere „wegen angestifteten Zusammenlaufs von Volk“ zu Gefängnisstrafen verurteilt. Der Bürgermeister sollte zur Rechenschaft gezogen werden, weil er unter dem Druck der Straße zwei Gefängnisinsassen freigegeben hatte. Als der wegen seiner Rolle beim Iserlohner Aufstand im Mai 1849 angeklagte Arzt Bering freigesprochen wurde, warnte der Regierungspräsident den Mendener Landrat Holtzbrinck eindringlich, irgendwelche Sympathiekundgebungen zu dulden.70 Da sich die wirtschaftliche Lage nicht grundlegend besserte, waren weitere Unruhen zu befürchten. Der Bürgermeister von Arnsberg wies den Regierungspräsidenten im September auf die Notwendigkeit hin, vor Anbruch des Winters für Beschäftigung der Arbeiter zu sorgen. Im Juli 1849 meldete der Rentmeister aus Bruchhausen, dass die Tumulte des vergangenen Jahres erneut begonnen hätten. Ausgewiesene Schonungen würden nicht respektiert. Die Gemeinde beharre auf ihrem Huderecht. Der Ziegenhirt Stahlschmidt treibe das Vieh unter dem Schutz von 30 bis 40 Einwohnern in die Fichten- und Lärchenpflanzungen. Der Rentmeister war besorgt und bat um Gendarmen zu seiner Unterstützung. Es kam zwar zu keinen Gewalttätigkeiten, aber die Hütungen auch von Rindvieh in den Schonungen wurden noch im August fortgesetzt. Als dann die amtlichen Untersuchungen begannen, die Hude in den Waldungen des Gutes Bruchhausen unterbunden wurde und die Waldbesitzer ihre Schonungen noch ausweiteten, wiederholten sich die Vorgänge im Sommer 1850.71 Inzwischen hatte sich die politische Situation in Deutschland grundlegend geändert. Die Revolution hatte den Weg zum Verfassungsstaat geebnet. Der Bundestag und der preußische Zweite Vereinigte Landtag hatten Wahlgesetze für die verfassunggebenden Nationalversammlungen in Frankfurt und Berlin verabschiedet, worauf am 1. Mai 1848 die Urwahlen für die beiden Parlamente stattfanden. Dem Regierungspräsidenten erschien es „charakteristisch“, dass das Herzogtum Westfalen mit seiner überwiegend katholischen Bevölkerung bei den politischen Ereignissen „fast völlig teilnahmslos“ blieb, während sich in der Grafschaft Mark allseitig „eine tiefe Aufregung der Gemüter in Verbindung mit einem gewissen Gefühle getäuschter Hoffnungen“ zeigte.72
70
71
72
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 241, Bl. 142, 152, 340, 346–376; ebd., 234, Bl. 106–109; ebd., 236, Bl. 199–201. Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 164; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 241, Bl. 2, 60, 76f., 151–156, 241, 257f., 280–290, 309–311, 317–326. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 49.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 57
06.11.2012 14:42:19
58
Hans-Joachim Behr
Er unterschätzte allerdings die Bedeutung der religiösen Einstellung für Wähler und Abgeordnete. Sie hatte überall in der Provinz erhebliches Gewicht. War es in Minden-Ravensberg die evangelische Erweckungsbewegung, so in Münster und im kölnischen Sauerland die katholische Konfession. Noch war der Kölner Kirchenstreit nicht vergessen. Er hatte die Katholiken Westfalens aufgerüttelt und ihr Selbstbewusstsein wieder zu voller Geltung gebracht. Im „Westfälischen Merkur“ erschien ein Aufruf, die Rechte der katholischen Kirche zu wahren. Diesem Appell an das katholische Gewissen waren die Statuten des katholischen Vereins zu Münster beigefügt. Der Paderborner Bischof Johann Franz Drepper erließ einen Hirtenbrief. Wie sehr das konfessionelle Moment im Vordergrund des Wahlkampfes stand, zeigt auch ein Artikel im „Westfälischen Merkur“. Darin wurde beklagt, dass die vorwiegend katholischen Kreise Wiedenbrück, Olpe, Arnsberg, Steinfurt und Warendorf so mit anderen Kreisen zu Wahlbezirken verbunden seien, dass die überwiegend katholische Bevölkerung in der evangelischen untergehe. Gewählt wurden für die Frankfurter Nationalversammlung im Wahlkreis 7 (Kreis Lippstadt und einige Ämter der Kreise Arnsberg und Büren) der Generalmajor Joseph Maria von Radowitz und zu seinem Vertreter Professor Eduard Baltzer, beide aus Berlin, im Wahlkreis 8 (Kreise Meschede und Brilon sowie Ämter des Kreises Arnsberg) Oberlandesgerichtsassessor Carl Dham aus Brilon, zum Stellvertreter Land- und Stadtgerichts-Direktor Lohmann aus Brilon, im Wahlkreis 9 (Wittgenstein und Siegen sowie das Amt Kirchhundem des Kreises Olpe) der Unternehmer Gustav Mevissen aus Dülken und zum Stellvertreter Schulinspektor Pfarrer Vogel aus Dillingen, und im Wahlkreis 10 (Kreis Olpe ohne Amt Kirchhundem, Kreis Altena und Teile der Kreise Arnsberg und Iserlohn) Pfarrer Stephan Friedrich Evertsbusch aus Altena und zum Stellvertreter der Kaufmann Friedrich Wilhelm Grünental aus Nachrodt im Kreis Altena. Sämtliche Gewählten schlossen sich in Frankfurt den Fraktionen Milani, Kasino, Württemberger Hof, und damit der politischen Mitte oder rechten Mitte an. Für die Berliner Nationalversammlung wurde im Wahlkreis 24 (Kreis Arnsberg) Kaplan Friedrich Anton Gelshorn und als Vertreter Bürgermeister Wulff aus Arnsberg gewählt, im Wahlkreis 27 (Kreis Brilon) Justizrat Joseph Sommer aus Arnsberg, als Stellvertreter der Geheime Obertribunalrat Ulrich aus Berlin, dann in einer Nachwahl Pfarrer Lefarth aus Bigge, im Wahlkreis 34 (Kreis Meschede) Pfarrer Bigge aus Velmede und als Stellvertreter Oberlandesgerichtsassessor Dham, in einer Nachwahl dann der Geheime Obertribunalrat Wilhelm Rintelen aus Berlin. Im Wahlkreis 35 (Kreis Olpe) wurde Amtmann Carl Stachelscheid aus Drolshagen und zum Stellvertreter der Progymnasialrektor Wiedmann aus Attendorn gewählt.73 73
Wilhelm Hüttermann, Parteipolitisches Leben in Westfalen vom Beginn der Märzbewegung im Jahre 1848 bis zum Einsetzen der Reaktion im Jahre 1849, in: Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde [Westfälische Zeitschrift] 68 (1910), S. 7–230, hier S. 118f., 129 (Anm. 1), 201, 204–207; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 35), S. 165, 184–189, 194, 564.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 58
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
59
Politische Vereine aller Richtungen entstanden. In Meschede wurde ein Volks-Club für Freiheit und Pflicht, in Werl ein Constitutioneller Verein ins Leben gerufen. Fast 100 konstitutionelle Vereine schlossen sich zu einem Central-Verein für Rheinland und Westfalen zusammen und verständigten sich am 7. Juli 1848 in Dortmund auf ein gemeinsames Programm, das die konstitutionelle Monarchie unterstützte und demokratische Entwicklungen wie das allgemeine Wahlrecht ablehnte.74 Linksliberale fanden sich in Werl zum Bürgerverein zusammen. Er beschloss, den Jahrestag der Revolution würdig zu begehen, forderte in einer Adresse eine Amnestie für die politischen Gefangenen und entsandte auch eine Deputation zum linksliberalen Kongress für die Sache und die Rechte der preußischen Nationalversammlung und des preußischen Volkes am 18./19. November 1848 nach Münster.75 Seine Mitglieder traten jedoch nicht dem Zentralverein bei, anders die Bürgergesellschaft zu Meschede mit dem Kaufmann Johann Meschede und dem Fabrikanten August Martin, die Politische Gesellschaft zu Olpe, die Volksversammlungen zu Attendorn und zu Arnsberg. Die wichtigste Vereinsgründung der Zeit aber war der katholische Piusverein, benannt nach Papst Pius IX. Er trat im Rahmen der durch die Verfassung erstmals garantierten Gleichberechtigung der christlichen Konfessionen für die Interessen der Katholiken ein. Der Piusverein hatte viel Zulauf. So zählte z.B. der im Mai 1849 in Werl entstandene Zweigverein schon bald 100 Mitglieder.76 Die Aufhebung der Zensur brachte eine Wende in der Publizistik. Neben den überregionalen liberalen, radikalen und konservativen Zeitungen erschienen auch in der Provinz politische Blätter. In Attendorn ließen Demokraten die erste Nummer der „Attendorner Blätter“ drucken. Als sie zum Steuerstreik aufriefen, nahmen Gendarmen den Redakteur Schmitz fest. In Lippstadt erschien im Oktober 1848 der „Patriot“, ein katholisches Blatt.77 Mit Sorge sahen die Konstitutionellen, dass die preußische Nationalversammlung zunehmend radikaler wurde. Sie wollten die von ihnen unterstützten Abgeordneten deshalb auf ein imperatives Mandat festlegen. Der Werler Constitutionelle Verein wandte sich am 6. September 1848 mit einer Klage über die Berliner Versammlung an den König und regte an, sie an einen anderen Ort zu verlegen. Die Vertagung der preußischen Nationalversammlung und ihre Wiedereinberufung nach Potsdam am 9. November 1848 sowie der 74
75
76 77
Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 165; Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 713f. Der Regierungspräsident sah die Gründung der konstitutionell-monarchischen Vereine als einen Beweis für die „allgemein jetzt wieder herrschende gute Stimmung“. Man wolle, wie er am 5. Juni 1848 schrieb, „keinen Rückschritt, aber auch keine Anarchie, sondern eine ruhige und besonnene Entwicklung der verheißenen freisinnigen Institutionen auf dem verfassungsmäßigen Wege.“ Siehe Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 31, 33. Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 716f.; Karl Hüser, Der westfälische Kongreß für die Sache und die Rechte der preußischen Nationalversammlung und des preußischen Volkes am 18./19. November 1848 in Münster, in: Westfälische Zeitschrift 119 (1969), S. 121–155. Ebd., S. 137f.; Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 693f., 713, 717. Wolfgang Maron, Das preußische Rüthen von 1816–1918, in: Bockhorst/Maron, Geschichte der Stadt Rüthen (wie Anm. 3), S. 659–740, hier S. 702.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 59
06.11.2012 14:42:19
60
Hans-Joachim Behr
folgende Kampf zwischen einem Teil des Parlaments, der sich widersetzte, in Berlin verharrte und zum Steuerboykott aufrief, stellte vielen Abgeordneten eine Gewissensfrage. Die Mehrzahl der westfälischen Abgeordneten stand zur Regierung. So erklärte der Abgeordnete Rintelen aus dem Kreis Meschede ausdrücklich, die Verlegung der Nationalversammlung sei nicht ungesetzlich. Die Abgeordneten Bigge aus Meschede, Gellern und Gelshorn aus Arnsberg sowie Lohmann und Lensing aus Brilon unterzeichneten zusammen mit anderen ein Bekenntnis zur konstitutionellen Monarchie. Der Constitutionelle Verein in Werl wollte eine Zustimmungsadresse zu den Maßnahmen der Regierung abgeben, wurde aber nicht beschlussfähig. Im Kreis Meschede hatte der Steuerverweigerungsbeschluss der Berliner Versammlung zunächst viel Anklang gefunden. Der Amtmann in Rüthen erwartete zwar „keine erheblichen Folgen“, meinte aber, „einzelne in schlechten Vermögensverhältnissen befindliche Personen“ könnten „zu einer Verweigerung der Steuern wohl Neigung haben“. Sollte es dazu kommen, so werde „ein energisches Einschreiten den Widerstand bald brechen“. Es scheint, dass gerade dieser Beschluss des Parlaments die Stimmung zugunsten der Regierung beeinflusst hat. Die Regierung berichtete sogar von „zahlreichen Anerbietungen auf Vorauszahlung der Steuer pro 1849“.78 Andere hielten zu den Abgeordneten in Berlin. Eine Adresse mit mehreren hundert Unterschriften aus dem Kreis Olpe erklärte allen in Berlin verbliebenen Abgeordneten: „Für Euch schlägt unser Herz, Euch versprechen wir Gehorsam, Euer ist unsere Waffe!“ Eine andere mit 1.006 Unterschriften aus Arnsberg bekundete, man werde sich „auf den ersten Ruf der Nationalversammlung erheben und diese mit Gut und Blut in ihren Rechten schützen“. Auch der Werler Handwerkerverein bezeugte dem Parlament seine Sympathie. Eine Adresse mit 1.200 Unterschriften aus Neheim forderte den der Regierung gefügigen Abgeordneten Gelshorn zum Rücktritt auf. Proteste und Misstrauensbezeugungen gegen die regierungstreuen Abgeordneten kamen auch aus Bilstein und Arnsberg. In Olpe und Attendorn wollten Vereine Misstrauensanträge gegen ihren Abgeordneten Stachelscheid stellen. Hier beteiligten sich die Bürger auch am Steuerboykott, bis der Landrat Freusberg sie mit der Warnung vor möglichen wirtschaftlichen Folgen davon abbringen konnte.79 Die Justiz geriet zunehmend unter politischen Druck. Dies zeigt der Fall des wegen Majestätsbeleidigung angeklagten Tierarztes Börner aus Rüthen. Ihm wurde vorgeworfen, er habe zur Verlegung des Parlaments nach Brandenburg erklärt, „der König hat einen schlechten und ruchlosen Streich gemacht, er wird noch das ganze Land in Flammen bringen“. Außerdem sollte er in einem Wirtshaus geäußert haben, „unser Fritz kann sich nur in Acht nehmen, sonst muss er nach London, wo er mit dem vormaligen Könige von Frankreich 78
79
Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 673; Hüttermann, Parteipolitisches Leben (wie Anm. 73), S. 152, Anm. 1; Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 714; Keinemann, Quellen (wie Anm. 37), Bd. 1, S. 37f. Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 716; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 272f.; Leitzbach, Märzrevolution (wie Anm. 38), S. 534f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 60
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
61
Whist spielen kann“. Die Vorwürfe wurden jedoch in der Voruntersuchung nur unvollständig bewiesen, worauf das Kreisgericht in Lippstadt dem Antrag des Staatsanwalts Liste folgte und das Verfahren einstellte. Die Regierung in Arnsberg aber wandte sich darauf mit einer Beschwerde über Liste an den Oberstaatsanwalt und beantragte eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Der interimistische Oberstaatsanwalt Mengershausen lehnte das im August 1849 mit der Begründung ab, eine schwurgerichtliche Untersuchung, die mit „überwiegender Wahrscheinlichkeit“ einen Freispruch erwarten lasse, könne „leicht dem öffentlichen Interesse mehr schaden als nützen“. Einer Berechtigung der Regierung, die Schritte der Staatsanwaltschaft zu überwachen und von deren Beamten in einzelnen Fällen – wie es hier geschehen – Rechenschaft über das von ihnen eingeschlagene Verfahren zu fordern, trat Mengershausen „auf das Entschiedenste“ entgegen.80 Die Aufregung ging nach dem Verfassungsoktroy sichtlich zurück. Allgemein wurde der Erlass der Verfassungsurkunde vom 5. Dezember 1848 begrüßt.81 Sie schuf Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen und Geschworenengerichte, verbot Ausnahmegerichte, garantierte Presse- und Religionsfreiheit, regelte die Zusammensetzung der beiden Kammern des Landtags und das Wahlrecht. Ferner wurden die Grundzüge einer neuen Gerichtsordnung festgelegt. Im Absatz über die Finanzverwaltung bestimmten die Artikel 98 bis 103 die jährliche Genehmigung des Staatshaushalts und die Aufnahme von Anleihen für die Staatskasse durch Gesetz. Artikel 105 regelte die Vertretung und Verfassung der Gemeinden, Kreise und Provinzen in ihren Grundzügen. Über deren „innere und besondere Angelegenheiten“ sollten gewählte Vertreter beschließen, ihre Beschlüsse durch „die Vorsteher der Provinzen, Bezirke, Kreise und Gemeinden“ ausgeführt werden.82 Die Verfassung enthielt allerdings den Vorbehalt, dass sie sogleich nach dem Zusammentritt der neu geschaffenen Kammern einer Revision unterzogen werden sollte. Im Januar/Februar 1849 fanden die Wahlen für die beiden Kammern statt. Die Wahl der 180 Mitglieder der Ersten Kammer sollte nach der Verfassung den Provinzial-, Bezirksund Kreisvertretern zustehen. Da es die Bezirks- und Kreisvertretungen noch nicht gab, schrieb das Wahlgesetz ein Zensuswahlrecht vor. Der Kreis Arnsberg (Meschede, Brilon, Olpe, Lippstadt, Soest, Siegen, Wittgenstein, Iserlohn, Stadt Menden, Ämter Menden und Hemer) wählte den Landrat Florens von Bockum-Dolffs aus Soest, den Geheimen Justizrat August von Bernuth aus Berlin und den Oberbergrat Heinrich Boecking aus Trier. Boecking, gleichzeitig in Düsseldorf-Duisburg gewählt, lehnte ab, ebenfalls der bei einer Nachwahl gewählte Justizminister Rintelen. Gewählt wurde schließlich Landgerichtsdirektor Friedrich von Diergardt. Für die Zweite Kammer wurden nach allgemeinem Wahlrecht in Arnsberg indirekt gewählt der Gutsbesitzer Johann Wilhelm Plassmann (Partei Auerswald), Justizkommissar Johann Matthias Gierse 80 81 82
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 241, Bl. 94–96. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 37, 39ff.; ebd., Bd. 2, S. VIIIf. Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1848, S. 373–394.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 61
06.11.2012 14:42:19
62
Hans-Joachim Behr
(äußerste Linke) und der Advokat Joseph Dane (linkes Zentrum).83 Schon im April löste der König die Zweite Kammer wieder auf und vertagte die Erste. Für Juli wurden Neuwahlen ausgeschrieben. Das nach der Revolution für die Zweite Kammer eingeführte allgemeine, gleiche und geheime Wahlrecht wurde durch das Dreiklassenwahlrecht ersetzt, das die Wähler nach ihrer Steuerleistung in drei Gruppen einteilte, die Besitzenden bevorrechtigte und die Demokraten weitgehend ausschaltete. Die so baldige Auflösung des Landtags und die Richtung, die Preußen in der deutschen Frage einschlug, fanden in Arnsberg bei „einem großen Teile des gebildeten Publikums keine Billigung“.84 Dieses wie auch die Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV. und die Abberufung der preußischen Abgeordneten aus Frankfurt wurden in den öffentlichen Blättern kontrovers diskutiert. Die Führer der demokratischen Clubs sahen darin mit Recht einen Staatsstreich des Ministeriums. In Menden wurde deshalb eine Protest-Adresse beschlossen. Der demokratische Abgeordnete Gierse kam nach Arnsberg, um dort seinen Wählern einen Rechenschaftsbericht über seine parlamentarische Tätigkeit zu geben. Zum Jahrestag der Revolution am 18. März 1849 gab es nur wenige Feiern. Soweit der Jahrestag der „glorreichen Revolution“ wie in Meschede gefeiert wurde, verliefen diese Feiern ruhig. Im Gegensatz zur Grafschaft Mark war die Stimmung im Herzogtum Westfalen also „fortdauernd eine äußerlich ruhige“.85 Die Meuterei der Landwehr und die Auflehnung in Iserlohn und Elberfeld im Mai 1849 fand nur wenig Unterstützung. Es gab allerdings auch im kölnischen Sauerland namhafte Demokraten, die ihr Betätigungsfeld aber andernorts suchten. So war der in Eslohe als Sohn eines katholischen Försters geborene Karl Wilhelm Tölcke, der „Vater der westfälischen Sozialdemokratie“, 1848 Kopf der revolutionären Bewegung in Altena.86 Der Arnsberger Lohgerber Wilhelm Hasenclever war einer der führenden Sozialdemokraten in Berlin.87 In Iserlohn hat allerdings eine Rede des Mendener Arztes Bering auf dem Marktplatz wesentlich zum Ausbruch des offenen Aufruhrs beigetragen. In Arnsberg versammelten sich etwa 50 Personen, „meist Männer der geringsten Volksklasse“ und ließen die Republik hochleben. Einige junge Leute aus Balve wollten mit Flinten und Säbeln bewaffnet den Iserlohnern zu Hilfe ziehen, kehrten aber wieder um, ohne ihr Ziel erreicht zu haben. Der Iserlohner Schuster Welte wollte die Regierungskasse in Arnsberg zur Besoldung seiner Truppen 83
84
85
86
87
Hüttermann, Parteipolitisches Leben (wie Anm. 76), S. 230. Zu den einzelnen Abgeordneten im preußischen Abgeordnetenhaus siehe Bernd Haunfelder, Biographisches Handbuch für das Preussische Abgeordnetenhaus 1849–1867, Düsseldorf 1994. Bericht des Bürgermeisters Wulff (Arnsberg, 16. Mai 1849) bei Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 588. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 50f.; Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S, 165; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 711f. Karl Wilhelm Tölcke betrieb 1874/75 den Zusammenschluss des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins Lassalles mit den Marxisten. Siehe Wilhelm Schulte, Westfälische Köpfe. 300 Lebensbilder bedeutender Westfalen, Münster 1965, S. 339f. Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 164.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 62
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
63
beschlagnahmen. Einer Legende nach wurde er betrunken gemacht und so von seinem Vorhaben abgehalten. Um den Ereignissen näher zu sein, verlegte der kommissarische Regierungspräsident Heinrich von Bardeleben seinen Sitz vorübergehend nach Sudweg. Zum Schutz der öffentlichen Kassen und der Behörden wurde ein Detachement des 13. Infanterieregiments nach Arnsberg verlegt, das im Juli, als die Lage sich beruhigt hatte, durch eine Kompanie des 22. Landwehrregiments abgelöst wurde.88 Im August 1849 war die öffentliche Stimmung nach den amtlichen Berichten wieder „fortwährend befriedigend“. Die Wahlen zur Zweiten Kammer wurden mit „Ruhe und Ordnung“ vorgenommen. Da die Demokraten zur Wahlenthaltung aufgerufen hatten, gingen nur knapp 20 Prozent der Wähler zur Wahl.89 In Vollzug der Verfassung erschien unter dem 2. Januar 1849 eine Verordnung über die Aufhebung der Privatgerichtsbarkeit und des eximierten Gerichtsstandes sowie über eine Reform der Gerichtsorganisation. Fortan wurde die Gerichtsbarkeit überall nur noch durch vom Staat bestellte Gerichtsbehörden ausgeübt, in erster Instanz durch kollegialisch eingerichtete Kreis- und Stadtgerichte, in zweiter durch Appellationsgerichte und in letzter Instanz durch das Obertribunal zu Berlin. Nach der Neuordnung unterstanden dem Appellationsgericht Arnsberg fünf Kreisgerichte in Arnsberg, Brilon, Lippstadt, Olpe und Siegen. Dazu kam 1850 nach dem Verzicht der Fürsten von Hohenzollern-Hechingen das 400 Kilometer entfernte Kreisgericht Hechingen, das 1879 aber zweckmäßigerweise dem Oberlandesgericht in Frankfurt unterstellt wurde. Eine Reform der Gerichtsbezirke wurde in Aussicht gestellt. Dabei war auch an eine Aufhebung des Obergerichts in Hamm und seine Vereinigung mit dem in Arnsberg gedacht. Bei den Etatberatungen für das Jahr 1850 herrschte im Staatsministerium darüber Übereinstimmung. Man rechnete aber mit erheblichem Widerspruch in der Öffentlichkeit und im Landtag. So wurde die Angelegenheit schließlich doch nicht weiter verfolgt.90 Eine längst fällige Revision der Agrargesetzgebung wurde in Angriff genommen. Die Jagdrechte auf fremdem Grund und Boden wurden aufgehoben, Ablösung und Gemeinheitsteilung geregelt. Die wirtschaftliche Lage im Sauerland aber blieb weiterhin misslich.91
88
89 90
91
Arno Herzig, Die Entwicklung der Sozialdemokratie in Westfalen bis 1894, in: Westfälische Zeitschrift 121 (1971), S. 97–172, hier S. 119f.; Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 53f.; Schumacher, Arnsberg im Vormärz (wie Anm. 58), S. 163f.; Féaux de Lacroix, Geschichte Arnsbergs (wie Anm. 11), S. 588. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 62–65. Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1829, S. 8; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 1308, Bl. 2. In Bruchhausen im Amt Bigge kam es im Juni 1850 erneut zu Unruhen aus Mangel an Weide. Der Hirte weigerte sich wieder, die Kühe auszutreiben. Der Rentmeister des Rittergutes erklärte sich schließlich bereit, noch sehr beträchtliche Distrikte zur Hude frei zu geben. Siehe Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 241, Bl. 280–287.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 63
06.11.2012 14:42:19
64
Hans-Joachim Behr
Das Amt des Regierungspräsidenten wurde im Juli 1849 mit Carl von Bodelschwingh besetzt,92 der sich nach dem Urteil der Minister in Münster als Vizepräsident und während der Vakanz des Oberpräsidiums als Oberpräsidialrat bewährt hatte. Mit ihm trat zum ersten Mal ein zwar nicht im kölnischen Sauerland doch im Regierungsbezirk gebürtiger und ansässiger Beamter an die Spitze des Kollegiums. Als Bodelschwingh 1851 Innenminister wurde, folgte ihm sein Bruder Ernst. Er hat die Arnsberger Regierung nur zweieinhalb Jahre geleitet und ist 1854 im Dienst gestorben.93
Jahre der Reaktion, „Neue Ära“ und Konfliktzeit An den Wahlen für das deutsche Volkshaus in Erfurt im März 1850 beteiligten sich nur wenige der Berechtigten. „Zweck und Mittel“ der Beratungen über die Verfassung einer deutschen Union unter preußischer Führung lagen nach der Ansicht des Regierungspräsidenten „für die Begriffsfähigkeit des überwiegenden Teil der Bevölkerung zu fern“.94 Die preußische Verfassung in ihrer endgültigen Gestalt vom 31. Januar 1850 ließ Preußen zwar als konstitutionellen Staat bestehen.95 Mit der Ernennung des bisherigen Innenministers Otto von Manteuffel zum Ministerpräsidenten im Dezember 1850 begann jedoch eine entschieden anti-liberale und antidemokratische Politik mit dem Ziel, die Ergebnisse des Jahres 1848 wieder rückgängig zu machen. Zwischen 1852 und 1857 ergingen nicht weniger als neun verfassungsändernde Gesetze. Einfache Verwaltungserlasse stellten schon 1851 die alten Kreistage und Provinzialstände wieder her. Ein Gesetz vom 24. Mai 1853 hob schließlich die nach Artikel 105 der Verfassung noch im März 1850 erlassene Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnung mit gestärkter Selbstverwaltung wieder auf. Das Interesse an den Wahlen ging merklich zurück. Wie der Regierungspräsident in Arnsberg es ausdrückte, war „die Teilnahme an den politischen Tagesbegebenheiten der Sorge für die materiellen Interessen gewichen“. Für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wurden die Wahlkreise und Wahlorte willkürlich so festgesetzt, dass die Wahl regierungskonformer Abgeordneter gesichert blieb. Die Wahlorte wurden möglichst in den Teil des Kreises gelegt, wo die Regierung die meisten Anhänger fand, und nebenbei so, dass weite Entfernungen und schlechte Wege die Wähler der Opposition fernhielten. Es wurde ein Wahltermin ausgesucht, zu dem viele Wähler durch ihren Dienst oder Beruf am Erscheinen gehindert waren. Landrat und Gendarmen wirkten
92 93 94
95
Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 246f. Ebd., S. 246. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/8, Bl. 10 (Dezember 1849/Januar 1850). Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1850, S. 17–35.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 64
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
65
mehr oder weniger massiv auf die Wähler ein, im Sinne der Regierung zu wählen. So wurde der 1849 aus den Kreisen Hamm, Soest und Lippstadt, Stadt und Amt Menden des Kreises Iserlohn und dem Amt Aplerbeck des Kreises Dortmund gebildete Wahlkreis 1855 geteilt. Der katholische Kreis Arnsberg wurde mit den beiden halbkatholischen Kreisen Soest und Lippstadt zusammengelegt. Der Erfolg war, dass mit dem Gutsbesitzer Plassmann und Justizrat Seißenschmidt regierungstreue Katholiken gewählt wurden. Die Wahlbeteiligung ging zurück und lag z.B. in Werl bis 1858 ständig unter 10 Prozent. Auch die Wahlen zum Provinziallandtag fanden im dritten und vierten Stand „sehr geringe Theilnahme“ und erbrachten an einigen Orten erst nach mehrfacher Wiederholung ein Ergebnis.96 Die politische Polizei wurde ausgebaut, das Versammlungsrecht eingeschränkt. Presserecht mit Kautionspflicht, Impressumzwang und Zeitungssteuer wurden Mittel der Reaktion. Eine „Zentralstelle für Preßangelegenheiten“ sollte die Presse überwachen und regierungstreue Blätter durch Informationen und Subventionen unterstützen. Die aktiven Teilnehmer an den Unruhen der Jahre 1848/49 wurden, soweit sie nicht fliehen konnten, vor Gericht gezogen. Unter den gesuchten politischen Flüchtlingen befanden sich auch der Lehrer Anton Eickhoff aus Lippstadt, der Ökonom Dietrich Schladör aus Marsberg und der Mediziner Franz Gustav von Stockhausen aus Brilon. Eduard Jordan aus Büren, Sohn eines Kanzleirats, wurde als Demokrat verdächtigt. Als Teilnehmer am badischen Aufstand wurden u.a. der Steinmetz Gottlieb Blümlein aus Soest und der Tagelöhner Heinrich Wilhelm aus Kirchhundem dem preußischen Kreisgericht überstellt und wegen Landes- bzw. Kriegsverrats zu einem Jahr und vier Monaten bzw. sechs Jahren Zuchthaus verurteilt.97 Im März 1850 meldeten die meisten Landräte dem Regierungspräsidenten keine besonderen Vorkommnisse. Der Mescheder Landrat Friedrich Boese schrieb, von einer „Organisation der Demokraten“ könne in seinem Amtsbereich keine Rede sein. Zwar seien „einige Schreier“ aufgetreten, hätten Regierung und Behörden kritisiert und Reformen verlangt. Demokraten seien das aber nicht gewesen, aus dem einfachen Grunde, weil sie nicht wüssten, was unter Demokratie eigentlich zu verstehen sei. „Eine Umsturz-Parthei wird unter den meistentheils verständigen und angesessenen Landleuten hiesiger Gegend meiner Meinung nach nie Platz greifen.“ Die demokratischen Clubs in Olpe, Attendorn und Brilon hatten sich aufgelöst. Bockum-Dolffs schrieb aus Soest, es herrsche solche „Liebe zur bestehenden staatlichen Ordnung“, dass es der „Umsturzpartei“ nicht gelingen werde, Fuß zu fassen. Es sei denn die 96
97
Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 69f., 76–78; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 339, Anm.; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 380/8, Bl. 121; Conrad, Bürger und Verwaltung (wie Anm. 49), S. 726; Günther Grünthal, Der Parlamentarismus in Preußen 1848/49–1857/58. Preußischer Konstitutionalismus, Parlament und Regierung in der Reaktionsära, Düsseldorf 1982, S. 334, 436. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 244; ebd., 258, Bl. 127, 131, 272; ebd., 241, Bl. 126–131; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 737.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 65
06.11.2012 14:42:19
66
Hans-Joachim Behr
Geistlichkeit, die sich bisher ferngehalten habe, werde „entschieden“ Partei ergreifen. Nur in Menden hatte eine Sammlung von Beiträgen für die Flüchtlinge in der Schweiz stattgefunden, bei der angeblich auch „höher gestellte Personen im Spiel gewesen“ waren.98 Alle Vereine wurden streng überwacht. Aus Lippstadt hieß es, über die „sozial-politische Tendenz der Cigarren-Arbeiter-Assoziation“ könne es keinen Zweifel geben. Bei dem Handwerkerverein in Rüthen wurde wegen der Teilnahme von Nicht-Handwerkern der „republikanischen und communistischen Partei“ auf politische Bestrebungen geschlossen. Dem Verein stand der Buchbinder Petrasch vor, der in den Jahren 1848/49 „eine ungemeine wühlerische Thätigkeit in republikanisch-comunistischer Tendenz“ an den Tag gelegt habe. Von den beiden Arnsberger Gesangvereinen wurde die „Liedertafel“ als politisch zuverlässig eingestuft, der Gesangverein im Wirtshaus des Schankwirts Hohoff dagegen misstrauisch betrachtet und überwacht. Ihm gehörten mehrere Mitglieder an, wie der Kreisgerichtsaktuar Carl Padberg und der Schreiner Anton Kleine, die 1848/49 wegen ihrer Beteiligung an den „demokratischen Umtrieben“ bekannt geworden waren. 1852 untersagte der Bürgermeister in Attendorn dem dortigen Bürger-Gesangverein die Beteiligung an öffentlichen Aufzügen. Eine Beschwerde blieb erfolglos. Landrat wie Regierungspräsident hielten „die sorgfältigste Ueberwachung“ des Vereins, dem hauptsächlich Mitglieder des früheren demokratischen Clubs angehörten, für nötig. Beim Piusverein und den anderen katholischen Vereinen sollte besonders darauf geachtet werden, dass sie mit ihren Aktivitäten nicht den konfessionellen Frieden störten. Die Staatsdienerschaft bot in dieser Hinsicht wenig Anlass zu Besorgnis. Nur bei der Lehrerschaft wollte man „eine nachteilige Einwirkung des regierenden Zeitgeistes“ bemerkt haben.99 Mitte des Jahrhunderts wurde auch der Sitz der Regierung in Arnsberg wieder in Frage gestellt. Die wirtschaftliche Entwicklung des Ruhrgebietes hatte Hamm gestärkt und Arnsberg weiter an den Rand gerückt. Im Innen- und Finanzministerium entstand 1853 der Plan, das Appellationsgericht in Hamm aufzuheben und die Regierung von Arnsberg nach Hamm zu verlegen. Die Aufhebung des Obergerichts Hamm biete sich an, weil es ungefähr im Mittelpunkt der Provinz liege und eine Aufteilung am leichtesten sei. Gegen andere Lösungen sprächen unangemessene Entfernung und schlechtere Verkehrsverbindungen. Damit würden jährlich 10.710 Taler eingespart. Im Übrigen beherberge die kleine Stadt Arnsberg schon jetzt „verhältnismäßig zu viele zahlreich besetzte Behörden“.100 98
99
100
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 234, Bl. 58–65, 80, 84– 86, 97. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 258, Bl. 49, 73–82, 89; ebd., Kreis Arnsberg 11/1; ebd., Regierung Arnsberg 258, Bl. 46; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 601. Am 1. Januar 1850 hatte Arnsberg mit der Oberpostdirektion eine weitere Behörde bekommen, die aber 1895 nach Dortmund verlegt wurde. Siehe Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 1308, Bl. 2–6.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 66
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
67
Während der Oberpräsident Franz von Duesberg den Plan befürwortete,101 sogar eine Vereinigung der fünf Obergerichte in Münster, Hamm, Paderborn, Arnsberg und Ehrenbreitstein zu einem einzigen Appellationsgericht in Münster für wünschenswert hielt, war der Arnsberger Regierungspräsident Ernst von Bodelschwingh grundsätzlich gegen eine Veränderung. Wenn überhaupt eines der Obergerichte in Westfalen aufgelöst werden solle, so spreche die Verkehrslage mehr für die Aufhebung des Appellationsgerichts in Paderborn. In einer Denkschrift vom 21. November 1853 erklärte Bodelschwingh es für besser, „von der ganzen Maaßregel zu abstrahiren“. Veränderungen, wie die Verlegung von Behörden, die seit einer langen Reihe von Jahren in einem Ort bestanden hätten, seien „immer mit bedeutenden Unbequemlichkeiten, mit großen Verlusten Einzelner und der Gemeinden verknüpft“, und brächten daher Unzufriedenheit, deren Nachteil höher anzuschlagen sei, als ein geringer Gewinn für die Staatskasse. Die Rechtsprechung werde nicht dadurch teurer, weil die Gerichte klein seien. Es könne im Gegenteil leicht nachgewiesen werden, dass zwei Gerichte von je zehn Mitgliedern mehr leisten könnten, als eines von zwanzig. Sollte aber dennoch ein Gericht eingehen, so müsse der Verlust auf Hamm und Arnsberg möglichst gleichmäßig verteilt werden und die eine Stadt ein Regierungskollegium, die andere ein Obergericht behalten. Eine Verlegung der Regierung vom Mittelpunkt des Bezirks an seinen Rand müsse wohlbedacht werden. Hamm liege am Knotenpunkt zweier Eisenbahnlinien, Arnsberg dagegen drei Meilen entfernt. Weitere Eisenbahnbauten würden aber eine neue Situation schaffen. Vorerst sei Arnsberg der geographisch besser geeignete Sitz der Regierung. Hamm biete zwar durch seine Verkehrslage eine bessere Verbindung zu den Zentralbehörden. Dies falle aber wenig ins Gewicht, da man von Arnsberg für wenige tausend Taler eine Telegraphenlinie einrichten könne. In Arnsberg befürchtete man den wirtschaftlichen Untergang der Stadt. Eine Deputation wurde nach Berlin gesandt, um auf die Folgen für die reine Beamtenstadt hinzuweisen. Handel und Gewerbe könnten keinen Ersatz bieten, hieß es in einer Denkschrift. Da die Oberpostdirektion sicher der Regierung folge, würden 107 Beamte mit ihren Familien mit einem jährlichen Diensteinkommen von 65.929 Talern die Stadt verlassen. Von 375 Häusern würden 53 leer stehen. Die zur Deckung des Kommunaldefizits bisher erforderliche Umlage von 5.000 Talern müsste nach der Halbierung der Steuerkraft die Bewohner „mit doppelter Wucht drücken“. 13 Beamte des Appellationsgerichts könnten diesen Verlust nicht ausgleichen. Hamm sei durch die Lippeschifffahrt und die Linienführung der Köln-Mindener Eisenbahn für seine Behördenverluste reichlich entschädigt worden. Schließlich wurden auch die konfessionellen Verhältnisse ins Spiel gebracht. Die evangelische Gemeinde zähle 756 Seelen. Durch die Verlegung der Regierung würde sie nicht weniger als 158 Mitglieder, „unter diesen mit die ansehnlichsten“ verlieren und „einer Verkümmerung entgegen gehen“. Mehrere Einwohner der Stadt, der Gemeinderat von Olpe 101
Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 265.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 67
06.11.2012 14:42:19
68
Hans-Joachim Behr
sowie die Magistrate von Olpe und Attendorn reichten ähnliche Eingaben ein. Auch Magistrat und Gemeinderat der Stadt Hamm wandten sich gegen die Reformen. Die Minister des Innern und für Finanzen teilten den Standpunkt des Regierungspräsidenten nicht. Die Verhältnisse hätten sich grundlegend geändert. Während sich Hamm zum Eisenbahnknotenpunkt entwickelt habe, sei Arnsberg in eine isolierte Lage geraten. Daher halte man zum Sitz der Regierung die Stadt Hamm trotz ihrer Lage hart an der nördlichen Grenze des Regierungsbezirks doch für besser geeignet. Im Mai 1854 entschied man in Berlin, die Frage nicht mehr weiter zu verfolgen.102 Die mit der Regentschaft des Prinzen Wilhelm 1858 verkündete „Neue Ära“ beendete die Zeit der Reaktion. Die sie tragende Partei verlor die staatliche Unterstützung, als der Prinzregent das Ministerium Manteuffel entließ. Die Wahlkreise und Wahlorte wurden der Beliebigkeit entzogen und festgeschrieben. Die ersten von größeren behördlichen Eingriffen freien Wahlen im November 1858 brachten denn auch eine liberale Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Im Wahlkreis Arnsberg 1 (Arnsberg, Soest, Lippstadt) wurde der Gutsbesitzer Johann Wilhelm Plassmann zu Allehof bei Neuenrade, in Arnsberg 2 (Brilon, Meschede, Wittgenstein) der Kreisrichter August Anton Bender aus Berleburg und Rittergutsbesitzer Julius Franz von Stockhausen, in Arnsberg 3 (Siegen, Olpe, Altena) Kreisgerichtsdirektor Ludwig von Beughem aus Neuwied und Hüttenbesitzer Heinrich Kreutz aus Olperhütte bei Olpe gewählt. Stockhausen, Beughem und Kreutz schlossen sich der gemäßigt liberalen Fraktion Georg von Vinckes an. Bender und Plassmann zählten zur katholischen Fraktion, dem späteren Zentrum. Doch die mit so vielen Hoffnungen begleitete neue Politik in Preußen währte nur kurze Zeit. Schon nach wenigen Jahren spaltete der Streit um die Heeresvermehrung, der sich rasch zum Verfassungsstreit ausweitete, das Land. Im Frühjahr 1862 sahen die Behörden den Wahlen zum Abgeordnetenhaus noch „im Ganzen ohne Aufregung entgegen“.103 Umso größer war die Überraschung, als sie dem oppositionellen liberalen Fortschritt den größten Sieg, den Konservativen die größte Niederlage brachte. Im kölnischen Sauerland allerdings wurde die katholische Fraktion und das linke Centrum gewählt, im Wahlkreis 2 (Olpe, Meschede) Kreisrichter Bender und in Wahlkreis 7 (Lippstadt, Arnsberg, Brilon) der Gewerke Friedrich Kropff aus Olsberg sowie Staatsanwalt Ernst Plassmann aus Arnsberg. Neuerliche Pressionen waren die Folge. Vor den nächsten Wahlen im Oktober 1863 bereisten die Landräte wiederum ihre Kreise und wirkten auf die Wahlmänner ein. Lehrer wurden angewiesen, durch entsprechende Agitation die Wahl unbequemer Wahlmänner zu vereiteln. Nachdem der Oberpräsident und der Bischof von Paderborn sich über geeignete Kandidaten verständigt 102
103
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 1308, Bl. 15, 20–24, 33–56; Heinz Pardun, Aus der Geschichte der Bezirksregierung Arnsberg – von den Anfängen bis zur Gegenwart, in: 750 Jahre Arnsberg (wie Anm. 19), S. 421–448, hier S. 434f. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 91, 93.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 68
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
69
hatten, wurden die Pfarrer entsprechend informiert. Der Innenminister gab den ihm unterstellten Behörden Order, bevorzugt Landräte zu Wahlkommissaren zu ernennen und bemerkte, wer als Beamter geschworen habe, „dem Könige seinem Allerhöchsten Herren unterthänig zu sein“, sei dieses Eides weder als Wähler noch als Gewählter entbunden. Noch 1873 wurde der Landrat Wilhelm von Schorlemer in Lippstadt zum Bericht aufgefordert, weil er sich an der Urwahl nicht beteiligt hatte.104 Die Wahlbeteiligung war gering. Von 137.398 Urwählern im Regierungsbezirk Arnsberg gingen nur 26.649 zur Wahl. Davon wählten lediglich 4.602 konservativ, aber 17.640 in demokratisch-liberalem Sinne. Zwischen Stadt und Land gab es kaum einen Unterschied. Aus dem Regierungsbezirk kamen somit im Oktober 1863 nur noch Anhänger des linken Centrums und der Fortschrittspartei ins Abgeordnetenhaus. Die beiden katholischen Abgeordneten Bender und Plassmann verloren ihre Sitze an den liberalen Olper Kaufmann Robert Bonzel und den Gutsbesitzer Heinrich Schulte-Westhoff vom linken Centrum. Schon 1861 hatten Meschede, Lippstadt und Brilon mehrheitlich fortschrittlich gewählt. 1862 entfielen in Arnsberg 69 von 128, in Olpe 62 von 103 Stimmen auf die Konservativen. Lippstadt, Meschede und Brilon hatten wieder für die Fortschrittspartei gestimmt.105 Die zur Berichterstattung aufgeforderten Landräte waren irritiert. Schmerzlich und unbegreiflich erschien es dem Landrat Droste zu Vischering-Padberg in Brilon, dass die Wahlmänner seines Bezirks die seit 1848 „ununterbrochen bewährte“ konservative Tradition verlassen hatten. Bürgermeister Hermann August Schuto war es gelungen, sie für die Kandidaten des Fortschrittes zu gewinnen. Landrat Devivere in Meschede schloss seinen Bericht etwas ratlos mit dem Ausdruck der Überzeugung, dass die Mehrheit der Einwohner seines Kreises „konservative Gesinnungen“ hege, aber durch den demokratisch gesonnenen „intelligenten“ Teil „irregeleitet“ und auch „terrorisiert“ werde.106 Als der Pfarrer Hundt sowie die Kapläne Nager und Hesse den Regierungspräsidenten um Verständnis dafür baten, dass sie sich wegen der Agitation des Bürgermeisters Schuto für die Fortschrittspartei nicht an der Wahl beteiligt hätten, erhielten sie eine Rüge. Gerade darum hätten sie sich an den Urwahlen beteiligen müssen, als Erfüllung der „jedem Staatsbürger obliegenden Wahlpflicht“.107 Listen der Lehrer, Kommunalbeamten, Kreisphysici, Steuerbeamten, Gymnasiallehrer und Geistlichen beider Konfessionen, die bei den Urwahlen gefehlt oder für die Opposition gestimmt hatten, wurden aufgestellt. In ihr finden sich auch der Vikar Metting aus Heggen im Kreis Olpe und der Pfarrer
104
105 106 107
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 92, Bl. 3, 10, 200f., 306– 311, 420–423. Ebd., Bl. 248–263, 280–286. Ebd., Bl. 179–183, 187–206. Ebd., Bl. 42–45.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 69
06.11.2012 14:42:19
70
Hans-Joachim Behr
Scheffer aus Liesen im Kreis Brilon. Einflussreiche Bürger wurden observiert. Die Amtmänner mussten berichten, wieweit sie selber und die Honoratioren ihres Bezirks das konservative Interesse gefördert hatten. Der Amtmann Thüsing in Allendorf wurde beschuldigt, gedruckte Wahlerlasse der Fortschrittspartei weitergegeben zu haben.108 Regierungspräsident Friedrich Wilhelm von Spankeren entsprach in seiner politischen Haltung nicht dem konservativen Kurs und wurde nach zehnjähriger Amtstätigkeit im Juni 1863 in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Er galt als Haupt einer liberal-demokratischen Richtung im Regierungskollegium und hatte sich zudem die Abneigung des einheimischen Adels und des katholischen Klerus zugezogen.109 Sein Nachfolger Heinrich Wilhelm von Holtzbrinck unterhielt enge Verbindungen zum konservativen Adel und kannte aus früheren Tätigkeiten auch die Arnsberger Verhältnisse, erschien somit für das Amt besonders geeignet.110 Bei günstigen Erwerbsverhältnissen war die öffentliche Stimmung im Winter 1864/65 im Allgemeinen gut und nach den militärischen Erfolgen gegen Dänemark sichtlich patriotisch geworden. Eine in versöhnlichem Ton gehaltene Thronrede des Königs machte überall den besten Eindruck. Man hoffte auf ein Ende des Konfliktes zwischen Regierung und Abgeordnetenhaus. Zum Geburtstagsfest des Königs bewilligte der Kreistag in Meschede einen Unterstützungsfonds von 100 Talern für „würdige u. bedürftige Veteranen des Kreises“. 1865 wurde das fünfzigjährige Bestehen der Provinz feierlich begangen. Am 18. Oktober fand in Münster in Gegenwart des Königspaares eine Huldigungsjubelfeier statt, zu der die einzelnen Landesteile Deputierte entsandten. An den Kosten in Höhe von 12.000 Talern mussten sich die Kreise Arnsberg mit 240 Talern, Brilon mit 208, Meschede mit 175 und Olpe mit 142 Talern beteiligen. Als Gnadengeschenk kamen 150 Taler Unterstützung für Arme zur Verteilung, zehn bis zwölf Taler je Kreis, ein bis vier Taler pro Person. Im kölnischen Sauerland wurde der Übergang des gleichnamigen Herzogtums an Preußen in allen Kreisen, in allen Pfarrkirchen und Schulen sowie von Privatvereinen „festlich und freudig unter Kundgebung ächt patriotischer, die Gefühle der Verehrung, Liebe und Dankbarkeit ausdrückender Gesinnung“ gefeiert.111 Je länger der Konflikt zwischen König und Landtag anhielt, umso weniger Aufmerksamkeit schenkte ihm die Bevölkerung. Der drohende Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland drückte auf die Stimmung. Die Katholiken waren durchweg gegen einen Krieg mit Österreich. Doch gab es bei der Einberufung der Landwehr keine Schwierigkeiten. Seit den ersten Julitagen 1866 wurden erhebliche Geldbeträge und bedeutende Mengen an Lebensmitteln und 108
109 110 111
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 92, Bl. 89–158, 187–193, 205, 208–220, 427–458. Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 147f., Anm. 112 u. S. 333. Ebd., S. 287. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 106, Bl. 3, 11v, 14–16, 19, 22, 25, 32–58; ebd., Oberpräsidium 350/10, Bl. 44.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 70
06.11.2012 14:42:19
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
71
Lazarettbedarf freiwillig von selbst in den kleinsten Orten gebildeten Männer- und Frauenvereinen für die Armee und besonders für die Lazarette gesammelt. Hilfsbedürftige Familien der einberufenen Reservisten und Wehrleute erhielten neben den Kreisunterstützungen Zuwendungen aus Gemeindeund Privatmitteln. An vielen Orten wurden Hilfslazarette eingerichtet, nahmen Bürger Verwundete in ihre Wohnungen auf, um sie zu pflegen. Bald hoben die militärischen Erfolge die Stimmung, mochten sich in den katholischen Landesteilen auch hier und dort Sympathiekundgebungen für das katholische Österreich in den allgemeinen Siegesjubel mischen. Doch das Vertrauen in die Regierung, „von deren Weisheit und Kraft eine glückliche Zukunft für das Vaterland zuversichtlich erwartet“ wurde, wuchs. Nachdem der Verfassungsstreit durch die Annahme der Indemnitätsvorlage im Landtag beendet und mit dem Norddeutschen Bund der Weg zur deutschen Einheit ein gutes Stück vorangekommen war, konnte man unbeschwert den Jahrestag der Schlacht von Königgrätz feiern.112
Politik und Gesellschaft in der Kaiserzeit Ende der 1860er Jahre wird über das gewerbliche Leben überwiegend von günstigen Entwicklungen berichtet. Die Nachfrage nach Arbeitern wuchs. Steigende Einnahmen der Sparkassen waren Zeichen des Wohlstandes. Nur vorübergehend sorgten Presseberichte über drohende Kriegsgefahr für Unruhe. Der Kreis Brilon litt jedoch unter den gesunkenen Holzpreisen. Auch gab es wieder Missernten und Schäden durch Mäusefraß.113 Der Überfall der Freischaren Garibaldis auf den Kirchenstaat weckte unter der katholischen Bevölkerung Besorgnis wegen des Fortbestandes der weltlichen Macht des Papstes. Wie in anderen Diözesen fand auch in Paderborn im Dezember 1867 eine Versammlung statt, bei der Führer der katholischen Vereine und Geistliche über eine Adresse an den König berieten, in der Dank für den der katholischen Kirche gewährten Schutz wie auch die Bitte, diesen auf die bedrohte Stellung des Papstes auszudehnen, ausgesprochen wurden. Ähnliche Adressen wurden in einzelnen Städten und Gemeinden entworfen und unter Mitwirkung der Geistlichkeit Unterschriften gesammelt.114 Seit dem Sommer 1870 beherrschte der deutsch-französische Krieg die Gedanken. Wieder wurden Hilfsvereine gegründet, Lazarette eingerichtet. Die Kreise brachten bis April 1871 mehr als 700.000 Taler zur Unterstützung der Frauen und Kinder der Einberufenen auf. Die Summe der „Ergebnisse privater, freiwilliger Thätigkeit“ ließ sich, wie der Regierungspräsident meldete, „kaum feststellen“. Die Landräte berichteten von einem zunehmenden Nationalgefühl und Wunsch nach deutscher Einheit. Die Proklamation König Wil112
113 114
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/10, Bl. 43, 68, 76, 84, 130; Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 1, S. 113. Ebd., Bd. 2, S. 108–112. Ebd., Bd. 1, S. 120; ebd., Bd. 2, S. 1.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 71
06.11.2012 14:42:19
72
Hans-Joachim Behr
helms I. von Preußen zum „Deutschen Kaiser“ erregte deshalb lebhafte Freude. Überall zeigte sich beim Sieges- und Dankfest am 18. Juni 1871 eine „patriotisch festliche Stimmung“.115 Dann brachte ein Jahrzehnt des Kulturkampfes Unruhe, tiefes Misstrauen gegen den Staat und lange nachwirkende Bitterkeit in der katholischen Bevölkerung.116 Ursächlich für den von Reichskanzler Otto von Bismarck mit Unterstützung der liberalen Landtagsmehrheit geführten Kampf gegen die katholische Kirche war das im Sommer 1870 durch das Erste Vatikanische Konzil definierte Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit bei Lehraussagen ex cathedra und die kirchliche Ablehnung jeder Form von Liberalismus. Ziel des Kanzlers war es, kirchlichen Einfluss auf die Politik in jeder Form auszuschalten. In Westfalen handhabte Friedrich Kühlwetter, der am 2. Juni 1871 das Amt des Oberpräsidenten der Provinz übernahm, die kirchenfeindlichen Gesetze mit besonderer Schärfe. Zuerst wurde im Juli 1871 die katholische Abteilung im preußischen Kultusministerium aufgelöst. Eine Ergänzung des Strafgesetzbuches im Dezember gab die Möglichkeit, Geistliche zu bestrafen, wenn sie durch Äußerungen den öffentlichen Frieden gefährdeten. Das Schulaufsichtsgesetz schloss die Ordensgeistlichen von der Lehrtätigkeit an öffentlichen Schulen aus. Die ersten Reaktionen in der katholischen Bevölkerung beschränkten sich auf öffentliche Diskussionen, Petitionen und einige Presseartikel. Es gab Sympathieadressen an den Abgeordneten Reichensperger und einige stark besuchte Versammlungen. Die Behörden wurden „zur höchsten Vorsicht und unausgesetzten Aufmerksamkeit“ ermahnt. Es sei ihre Aufgabe, heißt es in einem Erlass des Oberpräsidenten vom 21. Februar 1873, „alles zu vermeiden, was die Gereiztheit mehren und die irre geleitete Menge in Irrthümern bestärken könnte“. Dagegen müsse „nicht nur wirklicher Gesetzesverletzung […] mit allem Ernst des Strafgesetzes entgegengetreten, sondern auch selbst den Versuchen die Bande der gesetzlichen Ordnung und Ruhe zu lockern, mit allen der Staatsgewalt zu Gebote stehenden Mitteln energisch vorgebeugt werden“.117 Gesetze über die Vorbildung und Anstellung der Geistlichen, die kirchliche Disziplinargewalt und die Errichtung eines Gerichtshofes für geistliche Angelegenheiten sowie die Einstellung aller Zahlungen aus Staatsmitteln an Bistümer, kirchliche Institute und Geistliche verstärkten den Druck auf die Kirche. In Berlin war man der Ansicht, dass die Arbeitskraft des Regierungspräsidenten Holtzbrinck für die Bewältigung der mit dem Kulturkampf wachsenden Aufgaben nicht mehr ausreichte und wirkte über den Oberpräsidenten auf ihn ein, um seine Pensionierung nachzusuchen. Sein Nachfolger wurde im 115
116
117
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 350/10, Bl. 245–248, 257, 262f. Zum Kulturkampf auch in diesem Band Reimund Haas, Katholisches Leben und Pfarreien im Raum des alten Herzogtums Westfalen von der Reorganisation des 19. Jahrhunderts bis zur Reorganisation des 21. Jahrhunderts, S. 879–947, bes. S. 915–919. Keinemann, Quellen (wie Anm. 38), Bd. 2, S. 34–44; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 368, Bl. 140–180.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 72
06.11.2012 14:42:20
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
73
Oktober 1874 Georg Steinmann, Vortragender Rat im Innenministerium und Regierungsvizepräsident in Posen.118 Steinmann erwies sich als unbedingt zuverlässig im Sinne der Staatsregierung, bewahrte sich aber Selbständigkeit in Urteil und Handlung auch gegenüber seinen Vorgesetzten. Als er die Landräte ermahnte, die „bedenklichen oder unzuverlässigen geistlichen Elemente“ von der Aufsicht über die Schulen des „schleunigsten“ zu entbinden, sprach sich der Landrat in Brilon dafür aus, gleich alle katholischen Geistlichen von der Schulaufsicht zu entfernen, um nicht „durch Bevorzugung des Einen vor dem Andern zu verletzen“. Selbstverständlich müssten auch den „in der Regel durch kirchlichen Fanatismus sich auszeichnenden“ Kaplänen, Vikaren und Kooperatoren jede Einwirkung auf die Schule genommen werden.119 Der Landrat in Arnsberg berichtete, wenn bei den kirchenpolitischen Wirren auch alle Pfarrer des Kreises auf Seite des Bischofs ständen, diese doch mit wenigen Ausnahmen auf die Lehrer und den Geist der Schüler keinen regierungs- oder gar staatsfeindlichen Einfluss ausübten. Dazu seien sie „zu gewissenhafte und zugleich zu besonnene Männer“. Ähnlich meldete der Landrat in Soest, dass nach seinen Beobachtungen die Geistlichen durchgängig bemüht seien, „sich von allen offenen oder nachweisbaren Uebertretungen der bestehenden Vorschriften thunlichst fern zu halten“. Im März 1875 erinnerte der Innenminister die ihm unterstellten Behörden an ihre Pflicht, bei Ernennung und Bestätigung der „irgendwie zu einer Thätigkeit in kirchenpolitischer Beziehung“ Berufenen und ebenso bei den im Dienst befindlichen Beamten auf unbedingte Loyalität zu achten. Andernfalls seien sie, soweit das Gesetz es gestatte, „ohne Ansehen der Person und ohne Verzug“ zu entfernen. Da sich angeblich an vielen Orten „Postbeamte aller Kategorien in bemerkenswerter Weise“ an den regierungsfeindlichen Bestrebungen der „ultramontanen“ Partei beteiligten, ersuchte der Oberpräsident die Regierungspräsidenten um Bericht, um sich mit der Oberpostdirektion wegen disziplinarischer Maßnahmen zu beraten. Die Landräte hatten allerdings wenig Nachteiliges zu berichten. Aus Lippstadt schrieb Schorlemer, dass die Nachricht über eine „ultramontane“ Wahl des Postsekretärs Sommerkamp auf einem Irrtum beruhe, dagegen sei der Postbote Stratmann zu Oestereiden ein „stiller eifriger Anhänger der ultramontanen Sache“. Wenn der Postbote Leising in Geseke klerikal gestimmt habe, so sei dieses „seines beschränkten Verstandes und seiner ungenügenden Selbständigkeit wegen geschehen“. Dass der evangelische Postmeister Klemann in Brilon 1873 „ultramontan“ gewählt hatte, war dem Landrat, bei dessen sonst politisch tadellosem Verhalten unerklärlich. In Arnsberg wurden einige Postbeamte verdächtigt, Mitglieder des Mainzer Katholikenvereins zu sein. Hier hatten 17 von ihnen bei der letzten Wahl klerikal gestimmt. Im Kreis Meschede wurde der Briefträger Johann Willmer beschuldigt, dass er den Bauern regierungsfeindliche Blätter mitteile und so zur Ver118 119
Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 148, 337. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 377, Bl. 18–22.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 73
06.11.2012 14:42:20
74
Hans-Joachim Behr
breitung des Arnsberger „Central-Volksblattes“ beitrage. Gegen den Postgehilfen Pott zu Werdohl wurde 1878 eine Untersuchung eingeleitet, weil er sich über das Attentat auf den König in „strafbarer Weise“ geäußert haben sollte. Der Postsekretär Hunold wurde von Olpe nach Stade versetzt, weil er sich nach Ansicht des Landrats „wiederholt als eine im ultramontanen Sinne besonders tätige Persönlichkeit gezeigt“ hatte. Der Kreisrichter Boner in Meinerzhagen wurde nach einem Disziplinarverfahren als Gerichtskommissar nach Rahden versetzt. Disziplinarmaßnahmen wurden auch gegen den Kreisrichter Kleinsorgen zu Meschede ergriffen. Über die Haltung der Landräte im Regierungsbezirk berichtete der Regierungspräsident 1875, dass es nach seiner „pflichtgemäßen Ueberzeugung“ keinem von ihnen an dem guten Willen mangele, in dem Kampf gegen die Klerikalen in einer „der Staatsdienerpflicht und dem Ernst der Lage entsprechenden Weise wirksam zu sein“. Lediglich gegen den Landrat von Lippstadt, Wilhelm von Schorlemer, gebe es Bedenken, doch der scheide am 1. Juni aus dem Amt. Wenn er allen Landräten wegen ihrer Loyalität im Kirchenkonflikt durchaus günstige Zeugnisse ausstellen könne, so sei er zu seinem Bedauern nicht in der Lage, ein gleiches Urteil über ihre Befähigung und Aktivität auszusprechen. In ersterer Beziehung gäben die Landräte Droste-Padberg in Brilon und Devivere in Meschede, in letzterer der Landrat Lilien in Arnsberg zu ernsten Bedenken Anlass. Der siebzigjährige Lilien habe jede Fühlung mit den Kreiseingesessenen verloren. Seine Tätigkeit bleibe im Wesentlichen formal und daher auch in den kirchenpolitischen Angelegenheiten ohne jede Bedeutung. Droste-Padberg und Devivere seien „wohlgesinnt und selbst energisch“, allein beruflich „so wenig qualifiziert und in Auffassung und Urtheil so wenig klar, dass ihre Wirksamkeit ebenfalls eine ganz bedeutungslose“ sei. Wäre es nicht „von einer gewissen Bedeutung, katholische dem Landesadel angehörige Beamte von so unzweifelhafter Loyalität und so großem Eifer dem Staatsdienste zu erhalten“, so hätte er bereits den Versuch gemacht, beide zur Niederlegung des Amtes zu bewegen.120 Im Jahre 1883, als Staatsregierung und Kurie miteinander verhandelten und der Kampf dem Ende zuging, waren im kölnischen Sauerland 46 der 109 Pfarrstellen unbesetzt. Nur in seltenen Fällen konnte, wie im Kreis Meschede, die Stimmung der Bevölkerung in kirchenpolitischer Hinsicht als „eine ruhige und friedliche“ bezeichnet werden.121 Sorgenvoll und kritisch schrieb in jenen Tagen der kommissarische Landrat von Brilon, Hans Karl Federath, er könne „die Bemerkung nicht unterdrücken“, wie es ihn erschüttert habe zu sehen, „welche Lücken in die bestandene Gesellschaftsordnung gerissen, wie hart viele Existenzen getroffen, wie sonst harmlosen Persönlichkeiten und einer sonst gut gesinnten Bevölkerung gegenüber die äussersten Maßregeln des außerordentlichen Gendarmerie- ja des Mi120
121
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 248, Bl. 1, 4–6, 11f., 21f., 47, 50–52, 63, 67, 73; ebd., 368, Bl. 469. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 380, Bl. 3, 9, 28.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 74
06.11.2012 14:42:20
75
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
X6nigl.
p"~ief(mgsgebäuiJe
fims6er9
Oben: Sitz des Regierungspräsidenten in Arnsberg, Photographie vom Ende des 19. Jahrhunderts; unten: Landratsamt Arnsberg, Photographie von 1902.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 75
06.11.2012 14:42:20
76
Hans-Joachim Behr
litair-Aufgebots in Frage gekommen“ seien, ohne dass man damit etwas anderes erreicht habe, als „eine tiefe Verbitterung einer durch und durch conservativen Bevölkerung“.122 Der Konflikt hat die Menschen im Sauerland tief erregt und wirkte noch lange nach. Der Kampf gegen die katholische Kirche und dann seit 1878 gegen die Sozialdemokratie brachte wieder massive Eingriffe in die Pressefreiheit. In Medebach weist die Zensurliste von 1845 bis 1854 insgesamt lediglich 46 verbotene Titel auf, bis 1881 allein 416.123 Die Lokalpresse wurde scharf kontrolliert, damit nicht, wie es in einem Bericht aus Meschede heißt „die niederigen, keinem eigenen Urtheile fähigen Volksklassen“ größtenteils und auch einige „dem gebildeten Stande angehörenden Eingesessenen“ durch „die schändlichen clerikalen Blätter“ irregeleitet würden. Sogar ein Exemplar der in St. Louis erscheinenden Zeitung „America“, die der Gastwirt Kramer in Drolshagen von seinem Bruder erhalten hatte, wurde 1879 vom Amtmann polizeilich angehalten. Das Blatt hatte in einem Leitartikel „Immer mehr Freiheit“ die Politik Bismarcks allgemein und den Kampf gegen die Kirche kritisiert.124 Die als „ultramontan“ eingestuften Blätter erhielten keine amtlichen Nachrichten mehr zur Veröffentlichung. Dem Arnsberger „Central-Volksblatt“ war nach zweimaliger gerichtlicher Beschlagnahme schon 1873 der amtliche Charakter entzogen worden. Das „Olper-Kreisblatt“ folgte im November 1874, nachdem dort Berichte über die Verhaftung des Kaplans Schneider in Trier erschienen waren. Als „Olper Intelligenzblatt“ und ab 1876 als „Sauerländisches Volksblatt“ vertrat die Zeitung unter dem Redakteur Ruegenberg fortan entschieden kämpferisch römisch-katholische Interessen. Erst 1895 wurde der Zeitung unter dem Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs wieder der „Charakter eines amtlichen Kreisblattes für den Kreis Olpe“ verliehen, nachdem die Herausgeber sich verpflichtet hatten, für eine loyale, reichs- und preußenfreundliche Haltung des Blattes Sorge zu tragen. 1886 wurde auch dem „Mendener Telegraph“ die Eigenschaft als amtliches Kreisblatt entzogen. Das seit 1841 im Verlag des Buchdruckers Haarmann erscheinende „Mescheder Kreisblatt“ hatte nach dem Urteil des Landrats Boese 1848 politisch zu den „schlechtesten und verderblichsten“ Blättern des Regierungsbezirks gehört, später eine „ultramontane“ Richtung eingeschlagen, sei inzwischen aber politisch indifferent. Als das Blatt den Anfang einer am 5. Dezember 1873 in der „Kölnischen Zeitung“ veröffentlichten päpstlichen Enzyklika abdruckte und eine Fortsetzung ankündigte, sah der Landrat darin Aufwiegelung gegen die Staatsgewalt und wollte die nächste Nummer konfiszieren. Der Regierungspräsident lehnte ab, forderte aber von Haarmann Garantien für eine künftige regierungsfreundliche Haltung. Nachdem es über die Rückkehr des Pfarrers 122
123
124
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 380, Bl. 17–25 (1. Dezember 1883). Christian F. Trippe, Politik und Verwaltung. Stadt und Amt Medebach im Wandel der Staatsformen (1844–1970), in: Harm Klueting (Hrsg.), Geschichte von Stadt und Amt Medebach (Hochsauerland), Medebach 1994, S. 371–418, hier S. 375. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 368, Bl. 146, 194.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 76
06.11.2012 14:42:21
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
77
Schönlau von Wenholthausen nach siebentägiger Festungshaft und den feierlichen Empfang berichtet hatte, erhielt auch das „Mescheder Kreisblatt“ ab 1875 keine amtlichen Bekanntmachungen mehr zur Veröffentlichung. Dies übernahm der „Westfälische Telegraph“ in Meschede. Haarmann ließ sein Blatt unter dem Titel „Mescheder Zeitung“ weiterhin zweimal wöchentlich erscheinen. Nach seinem Tod wurde Friedrich Drees neuer Eigentümer. Auf Antrag des Landrats konnten vom September 1881 an amtliche Bekanntmachungen wieder in der „Mescheder Zeitung“ als amtliches Kreisblatt erscheinen. Noch einmal erhielt der Herausgeber 1883 eine Ermahnung wegen eines Artikels über die Branntweinbrennerei Bismarcks auf seinen Gütern, den er aus dem von Eugen Richter herausgegebenen „Reichsfreund“, übernommen hatte. Katholische Interessen vertraten nach einem Bericht der Regierung aus dem Jahre 1890 das „Sauerländer Volksblatt“ in Olpe und das „Central-Volksblatt“ in Arnsberg. Sie richteten angeblich auch Angriffe gegen die evangelische Kirche. Besonders das „Central-Volksblatt“ sei geeignet, „außerordentlich nachtheilig auf den confessionellen Frieden und auf die vaterländische Gesinnung der Leser zu wirken“, heißt es in einem Bericht aus dem Jahre 1888. Zugänglich waren der Bevölkerung neben diesen beiden Blättern jederzeit auch die „Mescheder Zeitung“, die „Briloner Zeitung“ und der „Diemelbote“, die sämtlich katholische Interessen vertraten. Besonderer Kontrolle unterlagen neben dem „Central-Volksblatt“, die „Rheinisch-Westfälische Zeitung“, die „Lüdenscheider Reform“, die „Emscher Zeitung“, die „Ruhr-Zeitung“, „Tremonia“, „Westfälische Volkszeitung“, „Zeitung der deutschen Bergleute“, „Volksstimme“, „Freie Presse“ und „Vorwärts“. Viele kleine Zeitungen lebten von Annoncen und folgten darum in politischer Hinsicht gewohnheitsmäßig den örtlichen und persönlichen Beziehungen. Die Mehrheit folgte Oppositionsparteien. 125 Um der „ultramontanen Einwirkung der kleinen Lokalblätter ein Gegengewicht zu schaffen“, wurde 1874 eine „Westfälische Provinzialzeitung“ ins Leben gerufen. Demselben Zweck diente seit 1882 die Pressorganisation. Im Sauerland waren ihr der „Sauerländische Anzeiger“, amtliches Kreisblatt für die Kreise Brilon und Büren, das „Lippstädter Kreisblatt“, amtlicher Anzeiger für den Kreis Lippstadt, und die „Arnsberger Zeitung“ angeschlossen. Diese Blätter brachten wöchentlich als Feuilletonbeilage „Neueste Mittheilungen“ der Regierung. Ganz reibungslos verlief diese Zusammenarbeit aber nicht. Es wurden deshalb Überlegungen angestellt, die „Neueste[n] Mittheilungen“ durch ein Blatt nach Art der 1884 eingegangenen „Provinzial-Korrespondenz“ zu ersetzen. Dazu ist es aber nicht mehr gekommen.126 Je länger der Kampf dauerte, umso mehr führte er zu einer politischen Aktivierung der deutschen Katholiken, die den Druck auf die Kirche vielfach 125
126
Günther Becker, Olper Zeitungen, in: Wermert, Olpe (wie Anm. 11), S. 543–570; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 270, Bl. 133f., 145–155, 178; ebd., 248, Bl. 67f.; ebd., 273, Bl. 2, 20, 25–33, 37f., 68–72; ebd., 369, Bl. 128–191. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 269, Bl. 28ff., 171f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 77
06.11.2012 14:42:21
78
Hans-Joachim Behr
zugleich als Druck auf den Glauben empfanden. Die seit 1871 im Reichstag vertretene Zentrumspartei wuchs, und auch der Ende der 1850er Jahre erloschene Piusverein lebte wieder auf. Er fand im Sauerland „guten Boden“. Die Beteiligung der Beamten wurde kontrolliert, doch bemerkte Landrat Wilhelm von Schorlemer aus Lippstadt schon im Herbst 1872, dass es schwer halten werde „überall zu constatiren“, inwiefern Beamte sich in dem Verein betätigten.127 Echter oder auch nur scheinbarer Missbrauch des Vereins- und Versammlungsrechts wurde scharf geahndet. Bezeichnend für das Klima ist es, dass vor einer Versammlung des Westfälischen Bauernvereins in Drüggelte am 20. Juli 1878 der Vorsitzende Burghard von Schorlemer-Alst als Redner darauf hinwies, dass keine auf Religion oder Politik bezüglichen Reden oder Auseinandersetzungen zu erwarten seien.128 Auf der anderen Seite wurden Ungeschick sowie echte oder vermeintliche Taktlosigkeiten von Vertretern der Staatsgewalt mit Erregung zur Kenntnis genommen. So berichtete der Redakteur Theodor Stein im „Central-Volksblatt für den Regierungsbezirk Arnsberg“ am 11. Juni 1887 unter „Verschiedenes“ von einem Vorfall bei der Fronleichnamsprozession. Ein Herr, welcher „nicht zur Klasse der sog. Knoten“ gehöre, sondern sich „der Stellung eines Königlichen Regierungs-Assessors erfreuen“ dürfe, sei „in anscheinend demonstrativer Weise bedeckten Hauptes und mit brennender Cigarre scharf an dem Sanctissimum“ vorbeigegangen. Es handelte sich dabei um den Regierungsassessor Dittmer, der, zum Bericht aufgefordert, den Vorgang herunterzuspielen suchte. Im Beleidigungsprozess vor dem Schöffengericht verteidigte Stein die scharfen Formulierungen, bestritt aber die Absicht einer persönlichen Beleidigung Dittmers. Das Urteil lautete auf 50 Mark oder fünf Tage Haft für Stein. Das „Central-Volksblatt“ schrieb in seinem Kommentar, das Gericht habe deutlich ausgesprochen, dass das Verhalten des Assessors Dittmer „ein wenig rücksichtsvolles gewesen sei, das selbst einem Manne aus dem Volke nicht wohl anstehe“. Es erregte damit höchstes Missfallen sowohl bei Behörden und Gericht und musste mehrere Berichtigungen bringen. Regierungspräsident Alfred von Rosen sah in den Formulierungen eine offenbar beabsichtigte Verbindung der Angelegenheit mit der Dienststelle.129 Der Staatsanwalt beim Landgericht in Arnsberg konnte jedoch eine Amtsbeleidigung nicht erkennen und sah keine Veranlassung, Anklage wegen Beleidigung der Behörde zu erheben. Der Regierungspräsident wandte sich nun an den Oberstaatsanwalt in Hamm mit der Begründung, „das Ansehen der Staatsdiener würde schwer leiden, wenn Fälle der vorliegenden Art im Sinne des Herrn Ersten Staatsanwalts beurteilt und wenn Beamte, Religionsdiener oder Mitglieder der bewaffneten Macht, welche durch den Vorwurf, dass sie sich eigentlich der von ihnen bekleideten Berufsstellung nicht sollten erfreuen können, auf das Empfindlichste beleidigt werden, auf den Weg der Privatklage verwiesen 127 128 129
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 368, Bl. 182f., 192–194. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 262, Bl. 66–68. Zu Alfred von Rosen siehe Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 322.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 78
06.11.2012 14:42:21
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
79
werden müssten“. Vom Oberstaatsanwalt in Hamm erging eine Anweisung, den Fall wieder aufzunehmen. Der Staatsanwalt in Arnsberg legte Revision ein, zog diese aber bald zurück, weil er zu geringe Aussicht auf einen Erfolg sah.130 Beim Massenstreik im Ruhrgebiet 1889 zeigte sich die Regierung der Lage nicht gewachsen. Etwa 100.000 Arbeiter befanden sich zeitweilig im Ausstand. Regierungspräsident Rosen gab zu früh den Großindustriellen nach, die eine Verhängung des Belagerungszustandes und den Einsatz von Militär verlangten. Er soll auch für eine irreführende Depesche des Oberpräsidenten Hagemeister über die Unruhen an den Kaiser verantwortlich gewesen sein. Obwohl er den harten Einsatz von Militär gegen die Streikenden mitzuverantworten hatte, wurde ihm Unentschlossenheit bei der Niederschlagung des Aufstandes vorgeworfen. Er wurde auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt. Im Revier entstanden völlig neue Umwelt-, Lebens- und Arbeitszusammenhänge. Die Verwaltung reagierte darauf nur zögernd durch Korrekturen der Gemeinde-, Amts- und Kreisgrenzen. Im letzten Jahrzehnt setzte eine Diskussion über die Grenzen des Regierungsbezirks ein. Nachdem der Abgeordnete Berger 1890 angeregt hatte, aus den Kreisen des Reviers einschließlich Düsseldorf eine neue Provinz zu bilden, mehrten sich Pressemeldungen über eine mögliche Teilung des Regierungsbezirks Arnsberg. In einem Artikel der „Rheinisch-Westfälischen Zeitung“ wurden im Herbst 1891 ausführlich Möglichkeiten einer Teilung erörtert. Ein Leserbrief erschien mit der Forderung, „eine Teilung muß stattfinden und zwar unverzüglich“. Für die gewachsene Bevölkerung des Industriereviers sei eine Verwaltung von dem entlegenen Arnsberg aus „völlig unmöglich“ geworden. „Auf eine einzelne Stadt Rücksicht zu nehmen, wo das Wohl von Tausenden in Frage steht, kann wohl nicht ernst gemeint sein.“ Der Magistrat der Stadt Dortmund richtete die Bitte an den Innenminister, die Kreise Gelsenkirchen Stadt und Land, Hattingen, Bochum Stadt und Land, Witten, Dortmund Stadt und Land, Hoerde und Hamm vom Regierungsbezirk Arnsberg zu trennen und zu einem eigenen Regierungsbezirk mit Sitz in Dortmund zusammenzufassen Um die Jahrhundertwende mehrten sich dann Stimmen in der Öffentlichkeit, den Regierungsbezirk vorerst nicht zu teilen, sondern lediglich den Sitz nach Dortmund, dem „natürlichen Centrum der Geschäfte“, zu verlegen. Als Entschädigung für Arnsberg wurde u.a. eine Universität vorgeschlagen. Der Innenminister stimmte jedoch dem Plan zu, aus dem Industriegebiet einen neuen Regierungsbezirk Dortmund zu bilden.131 In Arnsberg war die Zahl der Bediensteten in den Jahren 1888 bis 1900 von 120 auf 219 angewachsen. Es herrschte Raumnot. Regierungspräsident Wilhelm Reinhold Winzer aber erhob Einwände.132 Die ohnehin schon schwere Bereisung der ländlichen Kreise werde durch eine völlige Verlegung der Bezirksregierung in das Industriegebiet noch erschwert. Außerdem bedürfe die 130 131 132
Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 270, Bl. 92–96, 101–132. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 6900, Bl. 6, 11–16. Zu Wilhelm Reinhold Winzer siehe Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 348.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 79
06.11.2012 14:42:21
80
Hans-Joachim Behr
„eigenartig veranlagte sauerländische Bevölkerung“ mehr der Aufsicht und werde sich durch Etablierung der Zentralbehörde in ihrer Mitte eher mit Preußen assimilieren.133 Sein Amtsnachfolger Ludwig Renvers trat wieder entschieden für „Änderung der bestehenden Verhältnisse“ ein,134 weniger für eine Teilung als für eine Verlegung des Regierungssitzes nach Dortmund oder Hagen. Sie liege im staatlichen Interesse. Zwei Drittel der Dienstreisen führten ins Industrierevier. Im Falle von Arbeiterunruhen müssten der Präsident und die entsprechenden Dezernenten dort Wohnung nehmen. Die „weltabgeschiedene Lage des Landstädtchens Arnsberg“ habe auch insofern einen ungünstigen Einfluss, als die Beamten „von jeder geistigen Anregung“ abgeschnitten seien. Die einzige Anregung biete die „landschaftlich schöne Lage“. Als Beweis diene „das unausgesetzte Bestreben der Regierungs-Mitglieder, nach einige Zeit wieder in geistig angeregtere Verhältnisse zu kommen“. In Dortmund wurde von den Stadtverordneten 1900 schon der Ankauf eines Grundstücks für 126.000 Mark beschlossen. Auch Witten bemühte sich um den Sitz der neuen Bezirksregierung.135 Obwohl das Thema auch später noch mehrmals aufgegriffen wurde, blieb die Bezirksregierung doch bis in die Gegenwart in Arnsberg. Während im märkischen Revier Liberale und später Sozialdemokraten gewählt wurden, bestimmte im katholischen Sauerland weiterhin die Konfession die Wahlen. Von den 16 Westfalen, welche die Satzung der 1852 neu gegründeten Katholischen Fraktion im preußischen Landtag unterschrieben, kamen drei aus dem kölnischen Sauerland, der Kreisgerichtsdirektor Lohmann aus Brilon, der Kaufmann Cosack und Gutsbesitzer Johann Wilhelm Plassmann aus Arnsberg.136 Die Entwicklung der Arbeiterbewegung und Sozialdemokratie im märkischen Industrierevier hat kaum auf das Sauerland gewirkt. Nach der gesetzlichen Festlegung der Wahlkreise zum preußischen Abgeordnetenhaus im Jahre 1860 entfielen auf das ehemalige Herzogtum Westfalen die Wahlkreise Arnsberg 2 (Olpe-Meschede) und Arnsberg 7 (LippstadtArnsberg-Brilon). Gewählt wurden hier Anhänger der Rechten, des linken Zentrums, der katholischen Fraktion und dann der Zentrumspartei. Das Wahlverhalten der Staatsdiener wurde weiterhin scharf kontrolliert. Ein Verzeichnis der Beamten aus dem Jahre 1873, die bei den Urwahlen gefehlt, und derjenigen, welche die klerikale Partei unterstützt hatten, enthält in der zweiten Liste aus dem Wahlbezirk Olpe-Meschede die Namen von fünf, aus dem Wahlbezirk Hamm-Soest von vier und aus dem Wahlbezirk Arnsberg-Lippstadt-Brilon von 19 Wahlmännern.137 133
134 135
136
137
Pardun, Geschichte der Bezirksregierung (wie Anm. 102), S. 434f. (21. April 1900). Das Original fehlt. Zu Ludwig Renvers siehe Wegmann, Verwaltungsbeamten (wie Anm. 21), S. 319f. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Oberpräsidium 6900, Bl. 10–16, 127–142, 162–167, 182–187. Zu Olpe siehe Christian Leitzbach, Politische Parteien, Vereine, Gewerkschaften, in: Wermert, Olpe (wie Anm. 11), S. 537–542; Schulte, Volk und Staat (wie Anm. 36), S. 336, 757. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 92, Bl. 427–458.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 80
06.11.2012 14:42:21
Staat und Politik im 19. Jahrhundert
81
Wie sehr die Konfession das Wahlverhalten beeinflusste, zeigten die Wahlen zur verfassungsgebenden Versammlung und zum Reichstag des Norddeutschen Bundes, die nach dem allgemeinen und gleichen Männerwahlrecht durchgeführt wurden. Im Wahlkreis Arnsberg 8 (Lippstadt-Brilon) wurde 1867 in den Konstituierenden Reichstag des Norddeutschen Bundes Ferdinand Graf von Galen, Geheimer Rat und Kammerherr aus Münster, in der engeren Wahl dann der Kaufmann Ferdinand Ohm aus Lippstadt gewählt, im Wahlkreis 2 (Olpe, Meschede, Arnsberg) Hermann von Mallinckrodt. Beide Wahlkreise blieben lange Zeit in der Hand der Zentrumspartei. Der aus einer rheinischen Juristenfamilie stammende Peter Reichensperger, mit seinem Bruder August 1852 Mitbegründer der Katholischen Fraktion im preußischen Landtag und 1870/71 des Zentrums, hielt von 1871 bis zu seinem Tode am 31. Dezember 1892 den Wahlkreis 2 mit 15.325 von 15.768 (1884) und 15.716 von 17.358 (1890) Stimmen bei einer Wahlbeteiligung zwischen 71,8 und 85,6 Prozent. Vergeblich bemühte sich die Regierung Gegenkandidaten, wie 1870 den Amtmann Koper zu Schmallenberg, durchzubringen. Bei der Ersatzwahl nach dem Tode Reichenspergers wurde der Chefredakteur der „Westfälischen Volkszeitung“ Johannes Fusangel gewählt. Ähnliche Ergebnisse erreichten im Wahlkreis 8 als Kandidaten der Zentrumspartei von 1867 bis 1884 Theodor Schröder aus Lippstadt, danach Freiherr Fritz von Ketteler zu Harkotten und Schwarzenraben 1884 mit 8.927 von 9.603, Ferdinand Kersting, Gutsbesitzer zu Böckenförde, 1887 mit 11.250 von 12.356 abgegebenen Stimmen.138 Das Dreiklassenwahlrecht zum Landtag schränkte sowohl die Auswahl der Kandidaten wie auch das Gewicht der Stimmen ein. Doch wurden die Wahlkreise Arnsberg 2 (Olpe-Meschede) und Arnsberg 7 (Lippstadt-Arnsberg-Brilon), abgesehen von einigen der Rechten zugerechneten Beamten, wie dem Minister Ernst von Bodelschwingh und dem Landrat Heinrich Wilhelm von Holtzbrinck, zumeist von Mitgliedern der katholischen Fraktion oder des linken Zentrums, d.h. gemäßigt Liberalen, vertreten, wie August Anton Bender, Kreisrichter in Berleburg, Robert Bonzel, Kaufmann in Olpe, Maximilian Droste zu Padberg, Landrat in Brilon, Wilhelm Elven, Advokat in Köln, Ernst Plassmann, Staatsanwalt in Arnsberg, Friedrich Kropff, Gewerke in Olsberg und Heinrich Schulte-Westhoff, Gutsbesitzer in Westhof bei Lippstadt. Die Sozialdemokratie konnte auf Grund der starken konfessionellen Bindungen im kölnischen Sauerland nur langsam Fuß fassen. Wenn Ferdinand Lassalles Allgemeiner deutscher Arbeiterverein seinen Stimmenanteil bei den Reichstagswahlen im Regierungsbezirk Arnsberg von 1,96 Prozent im Jahre 1871 auf 3,87 Prozent im Jahre 1874 und 5,91 Prozent im Jahre 1877 steigerte, die Sozialistische Arbeiterpartei bei den letzten Wahlen unter dem Sozialistengesetz hier 14,24 Prozent der Stimmen gewann und der Stimmenanteil der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) zwischen 1898 und 1912 von
138
Fritz Specht (Bearb.), Die Reichstags-Wahlen von 1867 bis 1897, Berlin 1898, S. 220, 225; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen, Regierung Arnsberg 92, Bl. 395.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 81
06.11.2012 14:42:21
82
Hans-Joachim Behr
22,4 auf 26,8 Prozent anwuchs, so hatten die Kreise des vormals kölnischen Gebietes daran wenig Anteil.139 Eine Reichsjustizreform ordnete die Gerichtsorganisation neu. Durch das Gesetz vom 4. März 1878 wurden in Hamm ein Oberlandesgericht, in Arnsberg ein diesem zugeteiltes Landgericht errichtet, dessen Bezirk die Kreise Arnsberg, Meschede, Brilon, Siegen, Olpe und Wittgenstein bildeten. Nach der Verordnung über die Einrichtung der Amtsgerichte vom 26. Juli 1878 wurden im Bezirk des Landgerichts zu Arnsberg Amtsgerichte in Arnsberg, Attendorn, Balve, Berleburg, Bigge, Brilon, Burbach, Fredeburg, Grevenbrück, Hilchenbach, Kirchhundem, Laasphe, Marsberg, Medebach, Meschede, Neheim, Olpe, Siegen und in Warstein errichtet. Bei dieser Ordnung blieb es bis 1933.140 Auf Initiative der Nationalliberalen und Freikonservativen wurde in den siebziger und achtziger Jahren unter dem Innenminister Botho Wend Graf zu Eulenburg in Preußen eine durchgreifende Reform der Verwaltung durchgeführt.141 Ihr Höhepunkt war das „Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung“ vom 30. Juli 1883. Der Oberpräsident erlangte eine selbständigere Position und größere Kompetenzen. Fortan war er nicht mehr zugleich Regierungspräsident an seinem Sitz. In bestimmten Fällen war er letzte Beschwerdeinstanz. Ungeachtet dessen blieben die Regierungen die eigentlichen Träger der Verwaltung in der Mittelinstanz. Ihre innere Organisation aber wurde wesentlich verändert. Der Regierungspräsident war nicht mehr nur Vorsitzender eines Kollegiums, sondern Chef einer Behörde. Die Abteilungen des Innern wurden aufgelöst und ihre Aufgaben, zu denen vor allem alle polizeilichen Angelegenheiten, Land- und Wasserstraßen sowie die Kommunalaufsicht gehörten, dem Regierungspräsidenten direkt unterstellt. Im Rahmen dieser Reform hatten in den Jahren 1873 und 1875 neue Kreisund Provinzialordnungen zunächst für die alten Provinzen eine erhebliche Erweiterung der Selbstverwaltung gebracht. Wegen des Kulturkampfes wurde die Einführung in Westfalen hinausgeschoben. Erst das Gesetz vom 1. August 1886 setzte auch hier an die Stelle der bisherigen Provinzialstände den Provinzialverband als öffentlich rechtliche Körperschaft mit einem auf den Kreistagen gewählten Provinziallandtag. Seine Aufgaben, die in das Gebiet der staatlichen Verwaltung übergriffen, waren nicht fest umschrieben und hingen von der Leistungsfähigkeit ab. Die Finanzierung erfolgte durch einen Staatsfonds und Umlagen.142 Damit war ein Dualismus von Staat und Selbstverwaltung geschaffen, der sich bis heute bewährt hat. 139 140
141
142
Herzig, Entwicklung der Sozialdemokratie (wie Anm. 88), S. 97–172. Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1878, S. 109–120, S. 275–281; Wurm, Zur Arnsberger Gerichtsgeschichte (wie Anm. 19), S. 55. Hans-Joachim Behr, Die preußischen Provinzialverbände. Verfassung, Aufgaben, Leistung, in: Selbstverwaltungsprinzip und Herrschaftsordnung. Bilanz und Perspektiven landschaftlicher Selbstverwaltung in Westfalen, Münster 1987, S. 11–44, hier S. 13–20. Gesetz-Sammlung (wie Anm. 17), Jg. 1883, S. 195–236 u. Jg. 1886, S. 217–235, 254–277. Siehe auch Harm Klueting, Landschaftsverband Westfalen-Lippe und Provinzialverband Westfalen. Geschichtliche Entwicklung und rechtliche Grundlagen, in: Thomas Vormbaum (Hrsg.), Themen juristischer Zeitgeschichte, Bd. 4, Baden-Baden 2000, S. 71–131.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag01 behr - seiten0021-0082.indd 82
06.11.2012 14:42:21
83
Jürgen Schulte-Hobein
Staat und Politik im kölnischen Sauerland in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Erster Weltkrieg Das Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Herzogin von Hohenberg in Sarajevo am 28. Juni 1914 durch den bosnisch-serbischen Studenten Gavrilo Princip löste eine Kettenreaktion aus, die nach einem Monat in den Ersten Weltkrieg mündete. Ein Krieg zwischen den beiden Bündnissystemen – der Triple Entente mit Russland, Frankreich und England auf der einen und dem Zweibund mit dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn auf der anderen Seite – war lange vorhergesagt worden. Immer schneller hatte sich in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts das Krisenkarussell gedreht, begleitet von einem gigantischen Rüstungswettlauf. Besonders der Balkan glich einem Pulverfass, das jederzeit in die Luft fliegen konnte. Im Juli 1914 war es soweit. Im Bewusstsein der deutschen Rückendeckung erklärte Österreich-Ungarn am 28. Juli Serbien den Krieg. Mit dem Bekanntwerden der russischen Mobilmachung zwei Tage später waren die Würfel gefallen. Am Nachmittag des 1. August ordnete Kaiser Wilhelm II. im Deutschen Reich die Mobilmachung an, die unter den damaligen Umständen gleichbedeutend mit dem Beginn des Krieges war. Jahrzehntelang galt als gesichert, dass die Volksmassen frohlockten, als der Krieg ausbrach, und die europäische Bevölkerung den Krieg förmlich herbeigesehnt hat.1 Glockengeläut, Choräle, wildfremde Menschen, die sich in die Arme fallen, siegesgewisse und übermütige Soldaten in Wagons mit kriegerischen Kreideparolen und Blumen in den Gewehrläufen – diese Bilder vom Kriegsbeginn prägten lange die kollektive Erinnerung und waren besonders in populärwissenschaftlichen Abhandlungen unbestritten. Neuesten Forschungen zufolge war der Jubel jedoch keineswegs so verbreitet wie lange angenommen und publiziert. Die Auswertung von Feldpostbriefen und Tagebüchern hat das vorherrschende Bild vom Kriegsbeginn relativiert. Der Historiker Wolfgang Mommsen urteilt, dass die Verkündung der Mobilmachung am 1. August 1914 von der deutschen Öffentlichkeit überwiegend „mit schweigendem Ernst“, zugleich aber mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen worden sei, als „Befreiung von dem lähmenden Druck“ der vorangegangenen Tage und Wochen.2 Gleichwohl sei ein Großteil der Be1
2
Jochen Bölsche, „Ein Hammerschlag auf Herz und Hirn“. Der Mythos von der Kriegsbegeisterung der Volksmassen im Herbst 1914, in: Stephan Burgdorff/Klaus Wiegrefe (Hrsg.), Der Erste Weltkrieg. Die Ur-Katastrophe des 20. Jahrhunderts, München 2008, S. 54–153, hier S. 54. Wolfgang J. Mommsen, Die Urkatastrophe Deutschlands. Der Erste Weltkrieg 1914–1918, Stuttgart 2004, S. 35.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 83
07.11.2012 13:37:24
84
Jürgen Schulte-Hobein
völkerung von einer Flutwelle nationaler Gesinnung erfasst worden. Das Empfinden nationaler Solidarität habe alle jene Gruppen, die in den vorangegangenen Monaten gegen den Krieg agitiert hätten, zunächst verstummen lassen. Die Begeisterung der Augusttage sei echt und keine Fiktion gewesen. Aber sie sei einhergegangen mit depressiven Stimmungen und tiefer Sorge vor dem, was kommen würde. Die Aufbruchstimmung sei in erster Linie von den bürgerlichen Schichten und der Intelligenz in den städtischen Zentren getragen worden. In der Provinz und mehr noch auf dem flachen Land habe die Mobilmachung, die dazu führte, dass mitten in der Ernte die arbeitsfähigen Männer eingezogen und die Pferde requiriert wurden, weithin Schrecken und Irritation ausgelöst. Dennoch sei in der Bevölkerung das Bewusstsein verbreitet gewesen, dass man sich in dem nun ausbrechenden Krieg loyal hinter die Regierung zu stellen habe.3 Im ehemaligen Herzogtum Westfalen dachten nach dem Attentat auf das österreichisch-ungarische Thronfolgerpaar die wenigsten Menschen an Krieg. Immerhin hatte Deutschland 43 Jahre Frieden gehabt, so dass man vom „Friedenskaiser“ sprach.4 Stattdessen wurden wie in jedem Jahr die Schützenfeste und andere Veranstaltungen geplant, worüber die lokale Presse ausführlich berichtete.5 In Meschede lud die Feuerwehr zu ihrem Fest ein, der katholische Gesellenverein feierte am 17. Juli sein 50. Stiftungsfest mit einem prächtigen Umzug.6 In Arnsberg tagte zur gleichen Zeit ein Komitee zur Errichtung eines „Kaiser-Wilhelm-Turmes“ auf dem Lüsenberg unter Vorsitz von Regierungspräsident Alfred von Bake und dem kommissarischen Landrat des Kreises Arnsberg, Heinrich Haslinde.7 Anlässlich der im Jahre 1916 anstehenden 100. Wiederkehr des Tages, an dem das Herzogtum Westfalen zu Preußen kam, wurden außerdem Pläne diskutiert, das 1762 im Siebenjährigen Krieg zerstörte Residenzschloss der Kölner Erzbischöfe wieder aufzubauen.8 Als sich in den letzten Julitagen die politische Lage zuspitzte, verfolgten immer mehr Menschen die neuesten Nachrichten. Vor den Zeitungslokalen gab es laufend neue Depeschen, die von Jugendlichen und Schülern verteilt wurden. In Arnsberg zogen am letzten Juliwochenende mehrere Trupps durch die Straßen, um ihre Sympathie für das verbündete Österreich-Ungarn auszudrücken. Aus den gefüllten Lokalen drangen laute Kundgebungen der Begeisterung.9 Das damals in weiten Teilen des Sauerlandes verbreitete „Central3 4
5
6
7
8 9
Mommsen, Urkatastrophe (wie Anm. 2), S. 36. Fritz Schumacher, Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, in: 750 Jahre Arnsberg. Zur Geschichte der Stadt und ihrer Bürger. Hrsg. vom Arnsberger Heimatbund, Arnsberg 1989, S. 166–180, hier S. 167. Im kölnischen Sauerland weit verbreitet war das „Central-Volksblatt“. Im Kreis Olpe erschien das „Sauerländische Volksblatt“. Erika Richter, Die Welt Meschedes ab 1850, in: Mescheder Geschichte, Bd. 1. Hrsg. vom Heimatbund der Stadt Meschede, Meschede 2007, S. 279–346, hier S. 308. Haslinde wurde 1922 Regierungspräsident in Münster und 1926 Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Schumacher, Erster Weltkrieg (wie Anm. 4), S. 168. Ebd. S. 168.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 84
06.11.2012 14:47:10
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
85
Kriegsfreiwillige auf dem Arnsberger Neumarkt im August 1914. Volksblatt“ berichtete dagegen, die Situation sei „furchtbar ernst geworden“. Mit banger Sorge müsse die zivilisierte Welt den nächsten Stunden entgegensehen.10 Am 3. August meldete das Blatt ohne jede Euphorie die deutsche Mobilmachung.11 Wie reagierten die Menschen im Sauerland auf den Ausbruch des Krieges? In Olpe waren die meisten Menschen begeistert, als sie wenige Tage nach ihrem Schützenfest von der Mobilmachung erfuhren. Kaum jemand ahnte, dass es sechs Jahre dauern würde, ehe das nächste Schützenfest gefeiert werden konnte. Jugendliche stimmten nationale Lieder an, die Einrückenden eilten von ihren Arbeitsplätzen nach Hause, um die notwendigen Sachen zu packen. An den nächsten Tagen war der Bahnhof von Menschen belagert, die sich von den Einrückenden verabschiedeten.12 In Werl läuteten die Kirchenglocken der Propsteikirche, als die Reservisten, von Straßenmusikanten begleitet, durch die Stadt zum Kriegerdenkmal zogen. Der städtische Ausschuss für Jugendpflege mit dem katholischen Propst und Vikar, dem evangelischen Pfarrer, dem Direktor des Lehrerseminars und verschiedenen Schuldirektoren rief die Jugend auf, in den „heiligen Krieg“ zu ziehen. 600 Schüler traten freiwillig einer Jugendwehr bei, die Ursulinen wid-
10 11 12
Central-Volksblatt vom 28. Juli 1914. Central-Volksblatt vom 3. August 1914. Manfred Schöne, Erster Weltkrieg, in: Josef Wermert (Hrsg.), Olpe. Geschichte von Stadt und Land, Bd. 1, Olpe 2002, S. 571–580, hier S. 572.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 85
06.11.2012 14:47:10
86
Jürgen Schulte-Hobein
meten den von Lehrern und ehemaligen Unteroffizieren befehligten SchülerKompanien ein Lied.13 In Rüthen konnte das für den 2./3. August geplante Schützenfest nicht mehr in gewohnter Form gefeiert werden.14 Stattdessen begleiteten unter Führung des Kriegervereins und einer Militärkapelle mehrere hundert Menschen die eingezogenen Soldaten zu den Eisenbahnzügen.15 In Menden hatten sich am Abend des 31. Juli viele Bürger vor dem Rathaus versammelt, um eine patriotische Rede ihres Bürgermeisters zu hören. Dieser sprach zwar von einer ernsten Lage, vertrat aber die Überzeugung, dass Deutschland diesen Krieg gewinnen werde.16 Nicht anders war die Situation in Sundern. Am Abend des 1. August zogen viele Menschen singend durch die Straßen und ließen den Kaiser und das Vaterland „hochleben“. Mit einer Musikkapelle des Turnvereins marschierte man zum illuminierten Kriegerdenkmal, wo patriotische Reden gehalten wurden. Viele Soldaten folgten der Aufforderung der Geistlichkeit und eilten zur Kirche, um die Kommunion zu empfangen.17 Als am nächsten Tag der Zug der ausrückenden Soldaten mit der Fahne des Kriegervereins voran den Bahnhof erreichte, forderte der Vikar die Ausrückenden von der Plattform eines Eisenbahnwagons auf, „recht energisch gegen unsere Feinde vorzugehen, damit sie es nicht wieder wagen, uns anzugreifen“. Anschließend setzte sich der Zug unter Hochrufen und Hüteschwenken in Bewegung.18 Zahlreiche Landwehrmänner und Reservisten wurden in Meschede uniformiert, da sich hier das Bezirkskommando für die Kreise Arnsberg, Meschede, Brilon und Wittgenstein befand. Bis zum 10. August war das Bataillon des 81. Regiments feldmarschmäßig ausgerüstet. Anschließend wurde es an die Westfront transportiert.19 Die Mobilmachung fiel in die Haupterntezeit, so dass im landwirtschaftlich geprägten Sauerland in vielen Dörfern plötzlich die notwendigen Arbeitskräfte fehlten. Die Landräte und Bürgermeister riefen in der Presse vorwiegend Schüler zum Ernteeinsatz auf, die dadurch fast den ganzen August vom Unterricht befreit waren.20
13
14
15
16
17
18 19 20
Winfried Sträter, Arbeiterschaft, Bürgertum und das katholische Milieu. Werl im Kaiserreich, in: Amalie Rohrer/Hans-Jürgen Zacher (Hrsg.), Werl. Geschichte einer westfälischen Stadt, Bd. 2, Paderborn/Werl 1994, S. 759–780, hier S. 769. Wolfgang Maron, Das preußische Rüthen von 1816 bis 1918, in: Wolfgang Bockhorst/Wolfgang Maron (Hrsg.), Geschichte der Stadt Rüthen, Paderborn 2000, S. 659–740, hier S. 729. Der Patriot vom 15. August 1914. Die Zeitschrift „Der Patriot“, gegründet 1848, erscheint bis heute im ehemaligen Kreis Lippstadt. Paul Koch, Vom 1. Weltkrieg bis zum Ende der Weimarer Zeit, in: Menden (Sauerland). Eine Stadt in ihrem Raum, Menden 1973, S. 165–178, hier S. 165. Werner Neuhaus, Sundern im Ersten Weltkrieg, in: Sunderner Heimatblätter 17 (2009), S. 10– 18, hier S. 10. Ebd., S. 10. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 309. Alfred Bruns, Zur weltlichen Geschichte des Esloher Raumes, in: Rudolf Franzen (Hrsg.), Politik und Verwaltung im Esloher Raum, Eslohe 2002, S. 11–50, hier S. 44.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 86
06.11.2012 14:47:10
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
87
Erste Siegesnachrichten feierten die Menschen mit Glockengeläut und patriotischen Liedern. Häuser wurden beflaggt, Fackelzüge veranstaltet, die Kinder erhielten nicht selten schulfrei.21 In Meschede internierte man die ersten Kriegsgefangenen. Hierzu wurde auf dem sogenannten „Galiläafeld“ eine Barackenstadt mit einem hohen Stacheldrahtzaun errichtet. Im Verlauf des Krieges stieg die Zahl der Gefangenen aus immer mehr Nationen ständig an: Belgier, Franzosen, Engländer, Schotten, Italiener, Russen, Sibiriaken, Rumänen, sogar Araber und schwarze Kolonialsoldaten aus dem französischen Senegal füllten die Baracken, die jeweils 250 Männer beherbergten. Viele von ihnen mussten sich bei den Bauern oder auch in den Fabriken zum Arbeitseinsatz melden. Im Lager arbeiteten die meisten als Handwerker. Die Sonntagsmesse in der Lagerkapelle fand in französischer Sprache statt. Für die gestorbenen Gefangenen wurde ein eigener Friedhof angelegt, auf dem 935 Männer ihre letzte Ruhestätte fanden. Der Volksmund bezeichnet ihn bis heute als „Franzosenfriedhof“.22 Die anfängliche Kriegsbegeisterung schwand, als die ersten Todesmeldungen von der Front eintrafen und Verwundete in die Krankenhäuser und Lazarette der Städte transportiert wurden.23 Mit dem unglücklichen Ausgang der Marneschlacht war der Mythos der Unbesiegbarkeit der deutschen Armeen dahin, die Front erstarrte zum Stellungskrieg. Man glaubte bald nicht mehr, dass der Krieg bis Weihnachten zu Ende sei. Allein in Rüthen waren von den 120 eingezogenen jungen Männern zwei Monate nach Kriegsbeginn bereits sieben gefallen, Ende November waren es schon zwölf. Bis zum Kriegsende sollte diese Zahl auf 78 Tote ansteigen.24 Da der Krieg die Mobilisierung aller menschlichen und materiellen Ressourcen verlangte, entstand neben der militärischen Front die sogenannte „Heimatfront“. Um die Belange der Rüstungswirtschaft erfüllen zu können, griff der Staat massiv in die Abläufe der Wirtschaft und Arbeitsbeziehungen ein. Die Kriegskosten wurden im Wesentlichen über Kredite und Anleihen finanziert, wodurch die Inflationsrate anstieg.25 In Medebach fanden zahlreiche Sammlungen auf freiwilliger Basis statt. Der Flottenverein trug am 9. September 1914 insgesamt 449,86 Mark an Spenden zusammen, zwei Jahre später erzielte der „Marine-Opfertag“ 295,60 Mark. Zahlreiche Fabriken stellten ihre Produktion auf die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft um, erhielten Lieferaufträge von der Militärverwaltung und profitierten hiervon nicht unerheblich. In Sundern stellte die Lampenfabrik Josef Brumberg jetzt Feldflaschen her, die Metallwarenfabrik Schulte-Ufer baute
21 22
23 24 25
Koch, Weltkrieg (wie Anm. 16), S. 173. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 309f. Nach dem Krieg holten die meisten Nationen mit Ausnahme der Russen ihre Toten nach Hause. Schöne, Erster Weltkrieg (wie Anm. 12), S. 572. Maron, Das preußische Rüthen (wie Anm. 14), S. 730. Volker Ullrich, Heimatfront und Schützengräben. Der Zivilisationsbruch des Ersten Weltkrieges, in: Praxis Geschichte 1995, Heft 3, S. 4–9, hier S. 8.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 87
06.11.2012 14:47:10
88
Jürgen Schulte-Hobein
Zünder für Geschosse. Daneben wurden Kochtöpfe, Hängelampen, Trinkbecher und Papier-Verbandwatte produziert.26 Der Krieg verursachte in vielen Betrieben einen zunehmenden Arbeitskräftemangel. Allein die Papierfabrik Sundern verlor durch die Mobilmachung schlagartig 60 Arbeiter, denen in den nächsten Wochen noch 20 weitere folgten. Ersatzweise übernahmen zunehmend Frauen und Kriegsgefangene die Tätigkeiten. Letztere „vermietete“ die Lagerverwaltung in Meschede gegen Unterkunft und Verpflegung. Ab 1915 kamen die Gefangenen, vornehmlich Russen und Franzosen, auch in den landwirtschaftlichen Betrieben der Dörfer zum Arbeitseinsatz.27 In Rüthen waren ab Mai 1915 gefangene Franzosen, Belgier und Engländer in der Schützenhalle interniert, zeitweise mussten sie sogar ins Rathaus verlegt werden. Sie wurden zur Kultivierung des Kallenhardter Berges eingesetzt. Hier machten sie rund 300 Morgen Ödland urbar. Bereits ein Jahr später konnten auf diesen Flächen erhebliche Mengen an Kartoffeln, Hafer und Mohn geerntet werden.28 Den Schreckensmeldungen von der Front folgten Versorgungsmängel und Hungersnöte in der Heimat, verursacht durch die alliierte Wirtschaftsblockade, die Deutschland von den dringend benötigten Lebensmittelzufuhren abschnitt. Die Reichsleitung reagierte, indem sie die Behörden anwies, streng planwirtschaftlich zu arbeiten, um die immer knapper werdenden Nahrungsmittel und Konsumgüter zu verteilen. Vordringliche Aufgabe der Kriegswirtschaft war die Versorgung der Truppen. Auch wenn ein vorwiegend agrarisch geprägter Raum wie das Sauerland anders als die großen Städte vom Mangel an elementaren Lebensmitteln und damit vor Hunger weitgehend verschont blieb, so griff die Kriegsökonomie dennoch tief in das wirtschaftliche und politische Gefüge ein.29 Die Bauern erhielten strenge Auflagen zur Ablieferung von Getreide, Kartoffeln, Milch und Butter. Auch Leder wurde knapp, und man trug wieder Holzschuhe.30 Mit der fortschreitenden Kriegsdauer und der alliierten Seeblockade verschlechterte sich die Ernährungslage immer mehr. Der Landrat des Kreises Arnsberg verkündete in einem Aufruf: „Wer jetzt im Gemüsegarten seine Pflicht tut, hilft ebenfalls dem Vaterlande.“ Die im Roten Kreuz vereinigten Frauenvereine der Stadt Arnsberg riefen zur Hilfsaktion für die „Feldgrauen und tapferen Vaterlandsverteidiger“ auf und sorgten am Bahnhof für die Verpflegung der durchfahrenden Truppen. Zum Versand von „Liebesgaben“ ins Feld richteten sie Sammelstellen ein und veranstalteten Abende, an denen gestrickt und gehäkelt wurde.31
26 27 28 29
30 31
Neuhaus, Sundern im Ersten Weltkrieg (wie Anm. 17), S. 11. Ebd., S. 12. Maron, Das preußische Rüthen (wie Anm. 14), S. 731. Christian F. Trippe, Politik und Verwaltung. Stadt und Amt Medebach im Wandel der Staatsformen, in: Harm Klueting (Hrsg.), Geschichte von Stadt und Amt Medebach (Hochsauerland), Medebach 1994, S. 371–418, hier S. 386. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 310f. Schumacher, Erster Weltkrieg (wie Anm. 8), S. 169.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 88
06.11.2012 14:47:10
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
89
Unmittelbar nach Kriegsbeginn trafen die sauerländischen Städte und Gemeinden erste Maßnahmen, um die Versorgung der Bevölkerung sicher zu stellen. Die Gemeinde Sundern kaufte 600 Sack Roggen, verteilte das Mehl an die Sunderner Bäcker und gab diesen den Preis und das Gewicht für die Brote vor. Die Stadt Arnsberg bezog 5.000 Dosen Fleischkonserven und 600 Zentner Speck, richtete im Rathaus am Alten Markt in zwei Räumen ein Versorgungslager ein und gab zweimal in der Woche Konserven und Speck aus. In Attendorn hatte der Bürgermeister einen „Notstandsausschuß“ zur Behebung der allgemeinen Not ins Leben gerufen. Die Stadt wurde in Bezirke eingeteilt, für die bestimmte Bürger verantwortlich waren. Einzelpersonen, Vereine und die Industrie zeichneten Kriegsanleihen und sammelten zugunsten der Kriegswohlfahrtspflege. Die Stadt selbst hatte durch Beziehungen umfangreiche Lebensmitteleinkäufe in Dänemark durchgeführt, die jeder Bürger nach Anzahl der Familienmitglieder erhielt. Sie wurden in der Schule an der Ennester Straße verkauft, die in dieser Zeit den Namen „Speckschule“ trug.32 Trotz dieser Maßnahmen traten ab dem Jahr 1915 ernstzunehmende Versorgungsschwierigkeiten auf, die sich durch Hamsterkäufe und Zurückhalten von Lebensmitteln noch verschärften. Viele Städte führten Brotmarken ein; 1916 folgten Fleisch-, Eier-, Milch- und Fettkarten sowie Bezugsscheine für Stoff, Wäsche und Schuhe. Mit der Einrichtung großer Lagerräume erfolgte schließlich auch die Kontingentierung von Kartoffeln. Der schlimme „Steckrübenwinter“ 1916/17, mit dem die eigentliche Hungerzeit einsetzte, blieb der Bevölkerung lange in Erinnerung. An zahlreichen Stellen wurden Volksküchen eingerichtet, viele Menschen zogen mit der Eisenbahn oder dem Fahrrad aufs Land, um auf den Bauernhöfen zu kaufen oder zu tauschen. Bereits im zweiten Kriegsjahr beschlagnahmten die Verwaltungen zwangsweise Fahrräder und kauften Kautschuk und Fahrradreifen für einen symbolischen Preis auf. Auf dem Höhepunkt der alliierten Seeblockade konfiszierten die Behörden immer häufiger Kirchenglocken und Orgelpfeifen, wie z.B. in Medebach oder Olpe.33 Die Stadt- und Gemeindeverwaltungen empfahlen den Anbau ölhaltiger Früchte – wie Sonnenblumen und Mohn – sowie das Sammeln der fetthaltigen Pflaumenkerne, Kirschkerne und Bucheckern. In Sundern sammelten Schüler auch Weißdornfrüchte als Kaffeeersatz und Brennnesseln zur Gewinnung von Nesselstoff. Im letzten Kriegsjahr wurde fast alles gesucht, was in irgendeiner Form wieder verwertbar war: Futterreisig, Konservendosen, Knochen, Laubheu, Bucheckern oder Eicheln.34 Bezeichnend für die allgemeine Versorgungslage war, dass die Stadt Rüthen gegen Ende des Krieges nicht mehr in der Lage war, ihre in einem Lager untergebrachten 50 Kriegsgefangenen zu ernähren und um Aufhebung des Lagers bat.35 Einige Städte konnten mit Hilfe von Holz-
32
33 34 35
Josef Brunabend, Attendorn, Schnellenberg, Waldenburg und Ewig. Ein Beitrag zur Geschichte Westfalens, Münster 1937, S. 137. Trippe, Politik und Verwaltung (wie Anm. 29), S. 386. Neuhaus, Sundern im Ersten Weltkrieg (wie Anm. 17), S. 13f. Maron, Das preußische Rüthen (wie Anm. 14), S. 731.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 89
06.11.2012 14:47:10
90
Jürgen Schulte-Hobein
lieferungen aus ihrem Stadtwald ebenfalls etwas für ihre Bürger tun. So ging Holz aus Arnsberg im Tausch gegen Kartoffeln bis nach Ostpreußen.36 Die Stadt Olpe nahm während der Sommerferien 1916 etwa 60 Kinder aus bedürftigen Familien des Ruhrgebietes auf, die in Gastfamilien untergebracht und verpflegt wurden. Für die im Haus der Strickfabrik Pape an der Martinstraße eingerichtete Küche spendeten Olper Industrieunternehmen namhafte Beträge. Die unvorhergesehen lange Dauer des Krieges, die immer größer werdenden Verluste infolge des Stellungskrieges vor allem durch die monatelange Schlacht von Verdun zwischen Februar und Juli 1916, die Arbeitsverpflichtung für alle nicht zum Militär eingezogenen Männer durch das „Vaterländische Hilfsdienstgesetz“ vom Dezember 1916 und die wachsenden Schwierigkeiten der Lebensmittelversorgung durch die britische Blockade der deutschen Nordseeküste brachten das endgültige Ende der Kriegsbegeisterung in Deutschland.37 Behörden und vaterländische Verbände forderten trotz der ständig wachsenden Not immer lauter zum „Durchhalten“ auf.38 Im Kreis Arnsberg hielt die politische Aufklärung im letzten Kriegsjahr überall Vorträge mit dem einheitlichen Thema: „Wir können durchhalten, wir müssen und wir werden durchhalten.“39 Doch die militärische Niederlage war nicht aufzuhalten. Obwohl Russland nach der Revolution 1917 als Kriegsgegner ausgeschieden war, führte die deutsche Offensive im Frühjahr 1918 mit der Anspannung aller Kräfte nicht zum Ziel. Vor allem das Eingreifen der Vereinigten Staaten brachte die Entscheidung zugunsten der Alliierten. Die an der „Heimatfront“ überall sichtbaren Auflösungserscheinungen griffen nun auch auf das Heer und die Marine über. Demonstrationen, Arbeitsniederlegungen oder Aktivitäten von Kommunisten sind im kölnischen Sauerland nicht bekannt. Lediglich in Arnsberg kam es gegen Kriegsende zu einigen Unruhen und Geschäftsplünderungen.40 Die Oberste Heeresleitung hatte am 14. August 1918 die Fortführung des Krieges für aussichtslos erklärt und verlangte einen Monat später die Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen. Aus Meutereien bei der Hochseeflotte entwickelte sich die Novemberrevolution mit der Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten, die sich politisch radikalisierten. Am 9. November überschlugen sich in Berlin die Ereignisse. Am Mittag gab der letzte Reichskanzler der Kaiserzeit, Prinz Max von Baden, eigenmächtig den Thronverzicht Kaiser Wilhelms II. bekannt, trat selbst zurück und übergab das Amt des Reichskanzlers dem Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Friedrich Ebert. Um 14 Uhr rief Philipp Scheidemann die Deutsche Republik aus.41 36 37
38 39 40 41
Schumacher, Erster Weltkrieg (wie Anm. 4), S. 170f. Harm Klueting, Geschichte Westfalens. Das Land zwischen Rhein und Weser vom 8. bis zum 20. Jahrhundert, Paderborn 1998, S. 319f. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 311. Schumacher, Erster Weltkrieg (wie Anm. 4), S. 17. Ebd., S. 171. Wilhelm II. selbst begab sich am 10. November 1918 ins niederländische Exil.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 90
06.11.2012 14:47:10
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
91
Etwa zwei Stunden danach proklamierte Karl Liebknecht die „Freie Sozialistische Republik Deutschland“. Am folgenden Tag übernahm ein Rat der Volksbeauftragten, eine provisorische Regierung bestehend aus je drei Mitgliedern der SPD und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD), die Regierungsgeschäfte. Am 11. November 1918 unterzeichnete die deutsche Delegation unter Führung des Zentrumspolitikers Matthias Erzberger im Wald von Compiègne den Waffenstillstand. Der Erste Weltkrieg forderte fast zehn Millionen Todesopfer und etwa 20 Millionen verwundete Soldaten. Die Zahl der zivilen Opfer wird auf weitere sieben Millionen geschätzt. Im Deutschen Reich leisteten im Verlauf des Krieges 13,25 Millionen Männer Militärdienst, davon starben etwa zwei Millionen. Der Kreis Olpe hatte 1.388 Gefallene zu beklagen, darunter 137 aus Olpe und 114 aus Attendorn.42 97 Marsberger starben auf den Schlachtfeldern und 43 weitere gerieten in Gefangenschaft.43 Aus Sundern waren über 80 und aus Menden 441 Soldaten gefallen.44 Unter den 240 Gefallenen der Stadt Arnsberg war mit Leutnant Max Löcke auch der Sohn des Bürgermeisters.45 Die Vereine hielten die Namen der Gefallenen und Kriegsopfer auf Ehrentafeln fest.
Weimarer Republik In allen Bundesstaaten des Deutschen Reiches verschwand die Monarchie, ohne dass sie irgendwo entschieden verteidigt worden wäre. Das alte Regime wurde nicht durch eine planmäßig vorbereitete Volkserhebung gestürzt. Es brach in sich zusammen, als die Matrosen meuterten und ihre Revolte in dem kriegsmüden Land auf die Garnisonen des Heimatheeres und auf die Arbeiterschaft übersprang.46 Der Rat der Volksbeauftragten geriet in einen inneren Konflikt über die künftige Staatsform. Während die SPD rasche Neuwahlen zu einer verfassungsgebenden Nationalversammlung anstrebte und einer Revolution eine klare Absage erteilte, lehnte die radikalere und in sich gespaltene USPD unter dem Einfluss Liebknechts demokratische Verfassungsprinzipien der Gewaltenteilung und der Volkssouveränität ab und forderte stattdessen die Diktatur des Proletariats. Auf seiner Tagung vom 16. bis zum 20. Dezember 1918 in Berlin entschied sich der von zahlreichen Arbeiter- und Soldatenräten beschickte Deutsche Rätekongress jedoch gegen eine sozialistische Räterepublik und beschloss mit der überwältigenden Mehrheit von 400 gegen 50 Stimmen die Abhaltung von Wahlen für eine Nationalversammlung. Daraufhin traten am 29. Dezember 1918 die drei Vertreter der USPD aus dem Rat der Volksbeauftragten aus. Einen Tag später trennten sich die Mitglieder des radikalen Spartakusbundes 42 43 44 45 46
Albert K. Hömberg, Heimatchronik des Kreises Olpe, Köln 1958, S. 162. Ludwig Hagemann, Aus Marsbergs Geschichte, 2. Aufl. Niedermarsberg 1938, S. 91. Koch, Weltkrieg (wie Anm. 16), S. 169. Schumacher, Erster Weltkrieg (wie Anm. 4), S. 171. Karl Dietrich Erdmann, Die Weimarer Republik, München 1980, S. 28f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 91
06.11.2012 14:47:10
92
Jürgen Schulte-Hobein
von der USPD und gründeten die Revolutionäre Kommunistische Arbeiterpartei, die spätere Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).47 Truppen der Reichswehr und des Freikorps schlugen den sogenannten Spartakusaufstand vom 5. bis 12. Januar 1919 blutig nieder, Angehörige des Freikorps ermordeten am 15. Januar Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht.48 Auch in den Städten und Gemeinden des Sauerlandes war es zur Gründung von Arbeiter- und Soldatenräten gekommen. Diese Räte waren aber weder radikal, noch versuchten sie, eine politische Umgestaltung nach russischem Muster durchzusetzen. Sie orientierten sich vielmehr an rein praktischen Aufgaben, die sich aus der militärischen Niederlage und dem Zusammenbruch des monarchischen Obrigkeitsstaates ergaben. In Arnsberg veröffentlichte der Arbeiter- und Soldatenrat am 12. November 1918 folgende Anordnungen: „An die Bevölkerung und die Soldaten Arnsbergs! Mit dem heutigen Tage hat der Arbeiter- und Soldatenrat den größten Teil der politischen Macht in die Hand genommen. Große Aufgaben stehen uns bevor, und damit sie erfüllt werden können, ist die Einigkeit und Geschlossenheit der Bewegung notwendig. Folgende Punkte sind einmütig beschlossen worden: 1. Freilassung sämtlicher inhaftierter politischer Gefangener 2. Vollständige Rede- und Pressefreiheit 3. Abgabe sämtlicher Waffen und Munition 4. Jegliche Maßnahmen durch Blutvergießen sind zu unterlassen 5. Jeder Angehörige des Soldatenrats ist von jeglichem Dienst zu befreien 6. Plünderungen werden durch standrechtliches Erschießen bestraft Die Arbeiterschaft wird gebeten, unsere Interessen zu wahren und den Anordnungen des Arbeiter- und Soldatenrats Folge zu leisten. Der Arbeiter- und Soldatenrat Für den Arbeiterrat: Hubert Müller Für den Soldatenrat: Josef Lemärie“49 Arnsbergs Bürgermeister Max Löcke und Landrat Heinrich Haslinde unterstützten diese Beschlüsse. Sie forderten die Bürgerschaft auf, den Anweisungen des Arbeiter- und Soldatenrats Folge zu leisten und bei der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung mitzuwirken. Zur Bewältigung seiner Aufgaben unterstanden dem Arnsberger Arbeiter- und Soldatenrat sämtliche Behörden und Dienststellen einschließlich des gesamten Polizeiapparats sowie aller Militärpersonen der Stadt. Zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung wurde vom 27. November an allen Jugendlichen unter 17 Jahren der Aufenthalt in 47 48
49
Klueting, Geschichte Westfalens (wie Anm. 37), S. 321. Rosa Luxemburg trat zwar vehement für die Errichtung einer Diktatur ein, war aber keine blinde Nacheiferin des Bolschewismus. Sie hatte sich bereits vor dem Ersten Weltkrieg mit dem elitären Parteibegriff Lenins auseinandergesetzt und analysierte im Herbst 1918 in einer im Gefängnis verfassten und erst nach ihrem Tod veröffentlichten Schrift bewundernd und kritisch zugleich die Ereignisse der Russischen Revolution. Central-Volksblatt vom 12. und 13. November 1919.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 92
06.11.2012 14:47:10
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
93
den Straßen nach 20 Uhr vorerst nicht mehr gestattet. Wie sehr sich der Arbeiter- und Soldatenrat von dem vieler Großstädte unterschied, geht aus den Ergebnissen einer Versammlung vom 5. Dezember 1918 hervor, in der ausdrücklich die Unterstützung der Regierung Ebert beschlossen und gleichzeitig allen bolschewistischen Bestrebungen eine Absage erteilt wurde. Darüber hinaus forderte die Versammlung die baldige Einberufung einer Nationalversammlung aufgrund des allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Wahlrechts.50 Ähnlich war die Lage in anderen Gemeinden des Sauerlandes. In Sundern kümmerte sich der Arbeiter- und Soldatenrat mit Zustimmung der Gemeindevertretung in erster Linie um die Zuteilung von Lebensmitteln und die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung.51 In Meschede hatte sich ein 22-köpfiger Soldatenrat gebildet, der aus allgemeinen Wahlen in den Truppenteilen hervorgegangen war. Er arbeitete ohne jeden revolutionären Antrieb eng mit dem Mescheder Landrat Meinulf von Mallinckrodt an der Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung zusammen. Am 10. November erschien in der „Mescheder Zeitung“ ein Artikel, in dem der Landrat die Bürger des Kreises aufforderte, ihre Berufe in Ruhe auszuüben. Er appellierte besonders an die Landwirte, durch vermehrte Anstrengungen die Ernährung der Menschen sicher zu stellen. Sollte es bei der Verteilung von Lebensmitteln zu Ausschreitungen kommen, werde der Soldatenrat die Verursacher streng bestrafen.52 Im Kreis Olpe hatten sich ebenfalls vielerorts Arbeiter- und Soldatenräte gebildet. In Attendorn übernahm der Arbeiter- und Soldatenrat die komplette Leitung der Stadt- und Polizeiverwaltung. Seine Anordnungen, die vom Bürgermeister Laymann unterschrieben wurden, mussten unbedingt befolgt werden.53 Nicht so sehr die Kontrolle der Behörden als vielmehr die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung machte der Arbeiter- und Soldatenrat in Werl zu seiner zentralen Aufgabe. Dazu gehörte die Aufstellung von Sicherheitswachen, die durch die Stadt patrouillierten, das Gefängnis bewachten und den Bahnhof kontrollierten, um die Verschiebung von Lebensmitteln zu verhindern.54 Der Landrat des Kreises Soest, Freiherr von Werthern-Michels, lehnte eine Unterstellung der Kreisverwaltung unter die Kontrolle des Arbeiterrates in Übereinstimmung mit dem Kreistag ab und befürwortete stattdessen die Aufstellung von Bürgerwehren nach dem Beispiel der Stadt Rüthen. Mitgliedern der USPD sollte allerdings der Zugang in die Bürgerwehren versperrt werden.55
50
51 52 53 54
55
Jürgen Schulte-Hobein, „Und eines Tages war das Hakenkreuz auf dem Glockenturm.“ Der Aufstieg des Nationalsozialismus in der Stadt Arnsberg (1918–1934), Siegen 2000, S. 36. Neuhaus, Sundern im Ersten Weltkrieg (wie Anm. 18), S. 16. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 312. Brunabend, Attendorn (wie Anm. 32), S. 158. Johannes Dröge, Anmerkungen zur politischen Entwicklung in der Weimarer Zeit, in: Rohrer/ Zacher, Werl (wie Anm. 13), S. 781–794, hier S. 784. Hans Weller, Die Selbstverwaltung im Kreis Soest 1817 bis 1974, Paderborn 1988, S. 259.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 93
06.11.2012 14:47:11
94
Jürgen Schulte-Hobein
In Rüthen hatte sich im November 1918 ein aus 39 Mitgliedern aller Konfessionen und Berufsständen bestehender Volksrat konstituiert. Er sorgte für die Aufstellung einer Bürgerwehr, da man das Erscheinen von Spartakisten aus dem Ruhrgebiet fürchtete. Die Bürgerwehr gliederte sich in sechs Abteilungen und erhielt eine Handsirene, 30 Gewehre und 300 Patronen. Im März 1921 wurden alle Waffen und die ausgegebene Munition eingesammelt und die Bürgerwehr aufgelöst.56 Weniger geordnet ging es in Menden zu. Hier tyrannisierten in den ersten Tagen nach Kriegsende radikale auswärtige Gruppierungen die Bürgerschaft und setzten den am 10. November 1918 gebildeten Arbeiter- und Soldatenrat ab. Dieser rief die Bürger zu einer Protestversammlung auf, die unter Leitung des Bürgermeisters Overhues einen neuen Rat wählte. Er bestand aus fünf Soldaten, acht Arbeitern und zwei Bürgern, arbeitete in enger Abstimmung mit dem Bürgermeister und sorgte für die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung, so dass die radikalen Gruppen die Stadt verließen.57 Eine am 14. Februar 1919 in Finnentrop im Kreis Meschede abgehaltene Sitzung zeigte die praktischen Probleme auf. Die Bauern waren trotz empfindlicher Strafen nicht bereit, ihre Produkte abzuliefern, da sie für ihre Erzeugnisse keinen dem sinkenden Geldwert entsprechenden Preis erhielten. Auf der Tagesordnung standen Schwarzschlachtungen, geheime Viehverkäufe oder ungenügende Ablieferung von Butter und Milch, während weite Teile der Bevölkerung vornehmlich in den Städten des Ruhrgebietes hungern mussten. Alle Bemühungen blieben zunächst erfolglos, bis am 18. Juni 1919 die Vertreter der Arbeiterräte eine Preisvereinbarung vorschlugen, welche auch die Landwirte akzeptierten. Auch über Wohnungsnot wurde geklagt. Die Versorgung der Haushaltungen mit Brennholz konnte nur durch die enormen Waldbestände des Kreises gesichert werden.58 Die Erklärung der militärischen Niederlage seitens der Obersten Heeresleitung hatte nicht nur viele Soldaten an der Front, sondern auch große Teile der Bevölkerung völlig unvorbereitet getroffen. Das deutsche Heer galt allgemein als im Felde unbesiegt. Hieraus entstand schon bald nach dem Zusammenbruch des Kaiserreiches die „Dolchstoßlegende“, in der die traditionellen Führungsschichten nicht nur die Verantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges ablehnten, sondern gleichzeitig den demokratischen Parteien die Schuld für die militärische Niederlage gaben. Diese Auffassung vertraten auch Teile der Öffentlichkeit im kölnischen Sauerland. Viele Städte empfingen feierlich ihre zurückkehrenden Soldaten. In Arnsberg erfolgte der Einmarsch mit einer Musikkapelle und den Fahnenabordnungen der Vereine an der Spitze. Das „Central-Volksblatt“ berichtete, die Stadt sei „zur Rückkehr der tapferen und unbesiegten Krieger festlich ge56
57 58
Hans-Günther Bracht, Rüthen in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, in: Bockhorst/Maron, Geschichte der Stadt Rüthen (wie Anm. 14), S. 763–869, hier S. 765f. Koch, Weltkrieg (wie Anm. 16), S. 169. Hömberg, Heimatchronik (wie Anm. 43), S. 163.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 94
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
95
schmückt“. Für alle Kriegsteilnehmer wurde ein „Vaterländischer Abend“ veranstaltet und ein Gottesdienst in der Propsteikirche abgehalten.59 Gleichzeitig brachte die Demobilisierung logistische Probleme mit sich. Durch Menden zogen zwischen dem 23. November und dem 16. Dezember 1918 etwa 300.000 Soldaten, von denen sich viele vorübergehend in der Stadt einquartierten. Im Kreis Olpe bezogen Ende November 125 Offiziere und 3.300 Mannschaften mit 2.773 Pferden Quartier. In Attendorn mussten das Gymnasium, die Schützenhalle und sämtliche Säle der Stadt zu Notunterkünften hergerichtet werden. Auf dem Klosterplatz versteigerte man erschöpfte und kranke Militärpferde.60 In den Dörfern Deifeld und Medelon bei Medebach richtete ein Artillerieregiment bei der Rückführung erhebliche Flurschäden an, in Medelon wurde außerdem der Altar der Kirche beschädigt und das Schützenzelt zerstört.61 Am 19. Januar 1919 erfolgte die Wahl zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Erstmals waren Frauen stimmberechtigt, das Wahlalter hatte man von 25 auf 20 Jahre herabgesetzt und zum ersten Mal fand das Verhältniswahlrecht Anwendung. Im Reichsdurchschnitt wurde die SPD mit 37,9 Prozent stärkste Partei. Eine Mehrheitsbildung mit der USPD (7,6%), die Friedrich Ebert ohnehin nicht anstrebte, war allerdings nicht möglich. Stattdessen ergab sich eine Zusammenarbeit mit den demokratischen Parteien der Mitte, dem katholischen Zentrum (19,7%) und der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei (DDP, 18,6%) zur sogenannten Weimarer Koalition. Die nationalliberale Deutsche Volkspartei (DVP) hatte 4,4 Prozent und die Deutschnationale Volkspartei (DNVP) 10,3 Prozent der Stimmen erhalten. Die konstituierende Sitzung der Nationalversammlung fand am 6. Februar 1919 in Weimar statt, weil man sich in Berlin vor weiteren Unruhen nicht mehr sicher fühlte. Einen ganz anderen Ausgang nahm die Wahl in den Städten und Gemeinden des kölnischen Sauerlandes. Die katholisch konservativen Mentalitätsstrukturen, die sich durch die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Erzstift Köln herausgebildet hatten, kamen in der überdurchschnittlichen Dominanz der Zentrumspartei deutlich zum Ausdruck. Das Zentrum erreichte in Arnsberg 56,7 Prozent, in der Nachbarstadt Neheim 73,0 Prozent, in Menden 64,5 Prozent, in Olpe 87,3 Prozent und in Rüthen 90,1 Prozent. Mit großem Abstand folgte in den meisten Orten die SPD als zweitstärkste Partei. Die USPD erhielt im kölnischen Sauerland – wie etwa in Arnsberg, Olpe und Sundern – häufig keine einzige Stimme. Diese politischen Kräfteverhältnisse blieben in den kommenden Jahren bis zum Ausbruch der Wirtschaftskrise im Wesentlichen konstant. Auffallend sind neben der starken Position des Zentrums die geringen Stimmenanteile für radikale Gruppierungen. 59 60 61
Central-Volksblatt vom 19. Dezember 1918. Brunabend, Attendorn, Schnellenberg, Waldenburg und Ewig (wie Anm. 33), S. 388. Trippe, Politik und Verwaltung (wie Anm. 30), S. 388.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 95
06.11.2012 14:47:11
96
Jürgen Schulte-Hobein
Am 7. Mai 1919 wurden der deutschen Delegation in Versailles die unter den Siegern ausgehandelten und formulierten Friedensbedingungen ohne die Möglichkeit einer Verhandlung übergeben. Neben den Reparationszahlungen und Gebietsabtretungen hat keine Bestimmung des Versailler Vertrages die Atmosphäre so vergiftet wie der Kriegsschuldartikel 231, der Deutschland und seine Verbündeten mit der alleinigen Verantwortung für den Ausbruch des Krieges belastete und den Vertrag in den Augen aller Deutschen zu einem „Diktatfrieden“ stempelte.62 Dies empfanden auch die Menschen im Sauerland und protestierten gegen den „Scharfmacherfrieden“ durch öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen. In Arnsberg zeigte eine Ausstellung die wichtigsten Vertragsbestimmungen. Das „Central-Volksblatt“ schrieb: „Wird dieser ‚Scharfmacherfrieden‘ zur Tatsache, so bedroht er nicht nur unser Deutsches Reich mit der völligen Vernichtung, sondern auch jeden einzelnen von uns mit dem Hungertode.“63 Neben dem Kriegsschuldartikel rief die Teilung Oberschlesiens besondere Empörung hervor, da sich 60 Prozent der Oberschlesier für den Verbleib bei Deutschland ausgesprochen hatten. Für den Tag der Übergabe der oberschlesischen Gebiete an Polen ordnete das Land Preußen für alle Schulen die Abhaltung einer Trauerfeier in der dritten Stunde an, „um in würdiger Weise der Zerreißung Oberschlesiens zu gedenken“.64 Gerade aus der Agitation gegen den Versailler Vertrag, gegen „Erfüllungspolitiker und Novemberverbrecher“ bezogen die Rechtsparteien ihre politische Kraft. Am 13. März 1920 kam es in Berlin zum Kapp-Putsch. Militante Kräfte der radikalen Rechten unter Führung des hohen Verwaltungsbeamten Wolfgang Kapp versuchten die Regierungsgewalt in ihre Hand zu bekommen und den parlamentarisch-demokratischen Staat zu beseitigen. Trotz des Scheiterns des Putsches infolge der Ausrufung des Generalstreiks durch Sozialdemokraten und Gewerkschaften erfolgte keine Stabilisierung der demokratischen Ordnung.65 Die demokratischen Parteien im kölnischen Sauerland verurteilten das Vorgehen der Putschisten. Die Arnsberger Stadtverordnetenversammlung forderte einstimmig die strenge Bestrafung der Schuldigen. Die Zentrumsfraktion machte die „konservativen Junker“ für den Putschversuch verantwortlich. Hierdurch sei die gesamte positive Entwicklung in Deutschland wieder zurückgeworfen worden. Die Putschisten hätten geglaubt, im deutschen Volke sei ein starker Ruck nach rechts vor sich gegangen. Damit hätten sie sich jedoch verrechnet.66 Ähnlich reagierten die Stadtverordnetenversammlungen in Menden und Werl. Sie stellten sich demonstrativ hinter die legitime Regierung unter Reichs62 63 64 65
66
Erdmann, Die Weimarer Republik (wie Anm. 46), S. 107. Central-Volksblatt vom 16. Mai 1919. Central-Volksblatt vom 21. November 1921. Schulte-Hobein, „Und eines Tages war das Hakenkreuz auf dem Glockenturm“ (wie Anm. 50), S. 48. Central-Volksblatt vom 13. April 1920.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 96
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
97
kanzler Gustav Bauer und lehnten jede Diktatur von rechts oder links entschieden ab. In Menden folgten zahlreiche Angestellte und Arbeiter dem Aufruf der Gewerkschaften und legten die Arbeit nieder. Der Kapp-Putsch brach zusammen und der Generalstreik wurde aufgelöst. Im Ruhrgebiet ging der Generalstreik jedoch in einen Aufstand über. Es bildete sich eine bewaffnete Macht, von Anhängern und Gegnern als „Rote Armee“ bezeichnet. Ihr gelang es, innerhalb weniger Tage das gesamte Revier unter Kontrolle zu bringen. Carl Severing, der Kommissar für das Ruhrgebiet, versuchte die Anwendung militärischer Gewalt zu vermeiden und schloss am 24. März 1920 in Bielefeld ein Abkommen mit Vertretern der Gewerkschaften, Parteien und dem Chef des Stabes der „Roten Armee“. Als ein Teil der „Roten Armee“ das Abkommen nicht annahm, ließ die Regierung neue Truppen in das Revier einmarschieren, wobei es zu schweren Kämpfen und Ausschreitungen kam.67 Aufgrund ihrer räumlichen Nähe wurden die im nordwestlichen Grenzgebiet liegenden Städte des kölnischen Sauerlandes in den Aufstand hineingezogen. Ende März 1920 trafen Lastwagen mit bewaffneten kommunistischen Aufständischen in Menden ein, besetzten das Rathaus und verlangten die Anerkennung eines revolutionären Vollzugsrates. Diese Forderung wies der Bürgermeister mit Nachdruck zurück und erklärte, dass Stadtverordnete und Verwaltung auf dem Boden der Verfassung stünden. Für den Fall, dass die Forderung mit Gewalt erzwungen werde, würden alle Beamten und Angestellten der Stadt ihre Arbeit niederlegen. In der Stadt herrschte große Unruhe; Lastwagen mit Bewaffneten fuhren hin und her. Der Bürgermeister ließ eine Versammlung einberufen und verhängte eine nächtliche Ausgangssperre.68 Ähnlich war die Lage in Werl, wo die Kommunisten bis in den Stadtwald vordrangen und sich sogar Gefechte mit Soldaten des Freikorps lieferten.69 Nach erfolglosen Einigungsversuchen marschierten am 3. April Reichswehrtruppen ins Ruhrgebiet ein und schlugen den Aufstand innerhalb weniger Tage brutal nieder.70 Die Mordanschläge gegen den Zentrumspolitiker Matthias Erzberger am 26. August 1921 und Außenminister Walther Rathenau am 24. Juni 1922 durch Rechtsextremisten lösten im kölnischen Sauerland heftige Proteste aus. Die Arnsberger Zentrumspartei ließ für Erzberger ein Seelenamt lesen, anschließend erfolgte eine Versammlung mit einer Gedächtnisrede. Zentrum, SPD, DDP und Gewerkschaften zogen mit den schwarz-rot-goldenen Fahnen der Republik in einem Demonstrationszug durch die Stadt, um gegen die Ermordung Rathenaus zu protestieren. Auch Landrat Haslinde und der gesamte Kreistag verurteilten in scharfer Form das Attentat auf den Außenminister. In ganz Preußen fand am Tag der Beisetzung in allen Schulen eine kurze würdige Trauerfeier zu Ehren Rathenaus statt.71
67 68 69 70 71
Erdmann, Die Weimarer Republik (wie Anm. 46), S. 139. Koch, Weltkrieg (wie Anm. 16), S. 171. Dröge, Anmerkungen zur politischen Entwicklung in der Weimarer Zeit (wie Anm. 55), S. 782. Peter Longerich, Deutschland 1918–1933. Die Weimarer Republik, Hannover 1995, S. 111. Central-Volksblatt vom 28. Juni 1922.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 97
06.11.2012 14:47:11
98
Jürgen Schulte-Hobein
Mitten in die schwierigen Anfangsjahre der jungen Republik fiel das 700-jährige Jubiläum der Stadt Attendorn. Unter Anwesenheit des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Johannes Gronowski, und des Olper Landrats Freusberg feierten die Attendorner vom 10. bis 12. Juni 1922 die Verleihung der Stadtrechte im Jahre 1222 durch den Kölner Erzbischof Engelbert I. von Berg.72 Zu den Höhepunkten der Feierlichkeiten zählten ein großer historischer Umzug und die Einweihung des Kriegerehrenmals auf dem Klosterplatz für die 116 Gefallenen der Stadt.73 Unter dem Vorwand, Deutschland sei schuldhaft mit einigen Sachlieferungen im Rückstand geblieben, besetzten am 11. Januar 1923 französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet. Die Reichsregierung rief die Bevölkerung des besetzten Gebietes zum passiven Widerstand gegen alle Anordnungen und Maßnahmen der Besatzungsmacht auf. Im deutschen Volk kam es in der Verurteilung der Ruhrbesetzung und der Unterstützung der okkupierten Gebiete zu einer Einigkeit, die an den Kriegsausbruch im Sommer 1914 erinnerte. Im gesamten Preußen wurden alle Karnevalsveranstaltungen abgesagt, in vielen Orten des ehemaligen Herzogtums Westfalen – z.B. in Arnsberg und Werl – sogar die Schützenfeste. Viele Kinder aus dem Ruhrgebiet sowie ausgewiesene Erwachsene – hierzu gehörte vielfach die Schutzpolizei der Ruhrgebietsstädte – fanden vorübergehend eine neue Heimat im Sauerland.74 In Arnsberg verabschiedeten die politischen Parteien gemeinsam eine Resolution, in der sie schärfsten Widerspruch gegen den Einmarsch ins Ruhrgebiet erhoben. Der sozialdemokratische Regierungspräsident Max König rief zur tatkräftigen Unterstützung der Ruhrbevölkerung, die „aus tausend Wunden blutet“, auf. Deutschland habe „unter ungeheurem Zwang zur Erfüllung des Versailler Vertrages alles geleistet“.75 Zahlreiche Behörden, Betriebe, Schulen und Vereine unterstützten in breiter Solidarität durch Geld- und Sachsammlungen die notleidende Bevölkerung des besetzten Gebietes. In Rüthen wurden Spenden in Höhe von einer Million Mark gesammelt. Die Schützenbruderschaft stellte die Schützenhalle für alle Veranstaltungen der „Ruhrhilfe“ unentgeltlich zur Verfügung.76 In Werl beschlossen die Arbeiter der Firmen Drees und Wulf, jede Woche eine Stunde für die „Ruhrhilfe“ zu arbeiten. Die christlichen und freien Gewerkschaften unterstützten diese Aktion. Die Einwohnerzahl der Stadt wuchs sprunghaft an, da der Soester Landrat die Unterbringung von Kindern, Ausgewiesenen und Flüchtlingen angeordnet hatte.77 In Medebach sammelte man „Liebesgaben“ für das Ruhrgebiet: Öl, Roggen, Kartoffeln 72 73
74
75
76 77
Brunabend, Attendorn (wie Anm. 32), S. 159. Durch eine Munitionsexplosion wurde es im Juni 1945 stark beschädigt und später ganz entfernt. Schulte-Hobein, „Und eines Tages war das Hakenkreuz auf dem Glockenturm“ (wie Anm. 50), S. 49. Central-Volksblatt vom 28. März 1923. König bezeichnete in diesem Zusammenhang den Versailler Vertrag als „Schmachfrieden“. Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 776. Insgesamt wurden zwischen 140.000 und 150.000 Personen aus dem Ruhrgebiet ausgewiesen.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 98
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
99
und Erbsen. Über 300.000 Mark wurden als „Ruhrspende“ zusammengetragen und überwiesen.78 Die Besatzer trennten das gesamte Ruhrgebiet durch eine Zollgrenze vom übrigen Deutschland ab. Es kam von deutscher Seite zu zahlreichen Sabotageaktionen. Schiffe wurden versenkt, Kanäle blockiert und Schienen gesprengt, um den Abtransport der Kohle zu verhindern. Terrormaßnahmen der Franzosen gegen die Bevölkerung schufen Hass und Verbitterung. Die Besatzungsmacht wies Beamte aus, verhängte hohe Gefängnisstrafen und ließ Personen hinrichten, die besonderen Anteil an den aktiven Sabotagemaßnahmen hatten. Am 26. Oktober 1923 erklärte Reichskanzler Gustav Stresemann den passiven Widerstand für beendet. Die Folgen des Ruhrkampfes, ausgedrückt in den industriellen Produktionsausfällen und den enormen Kosten der Widerstandsaktionen, stürzten die deutsche Wirtschaft in eine katastrophale Lage. Die ohnehin schon hohe Inflation als Folge der Kriegsverschuldung beschleunigte sich und geriet nun ganz außer Kontrolle. Die meisten Städte reagierten auf die Inflation durch die Herausgabe von zusätzlichem „Notgeld“. Dem allgemeinen Beispiel folgend, beschloss die Mescheder Stadtverordnetenversammlung am 19. August 1923 den Druck von Notgeld in Höhe von 20 Milliarden Mark in Stücken von 100.000, 500.000, einer und fünf Millionen.79 Der Wert der deutschen Währung sank ins Bodenlose. Einem US-Dollar entsprachen im Januar 1923 noch 1.800 Mark; im November, als die Reichsregierung zur Stabilisierung die Rentenmark einführte, jedoch 4,2 Billionen Mark.80 Der Abbruch des Ruhrkampfes bedeutete für viele Rechtsextremisten das Signal zum Losschlagen gegen die verhasste Republik. Als nur zwei Wochen später, am 9. November 1923, eine kleine Partei mit dem Namen Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) um ihren Parteiführer Adolf Hitler von München aus „die Regierung der Novemberverbrecher“ in Berlin für abgesetzt erklärte und eine provisorische deutsche Nationalversammlung mit Hitler und dem Weltkriegsveteranen Erich Ludendorff an der Spitze proklamierte, nahm man im kölnischen Sauerland nur wenig Notiz von diesen Ereignissen. Stefan Zweig bemerkte später: „In diesem Jahr 1923 verschwanden die Hakenkreuze, die Sturmtrupps, und der Name Adolf Hitler fiel beinahe in Vergessenheit zurück. Niemand dachte mehr an ihn als einen möglichen Machtfaktor.“81 Die im Gefolge des Dawes-Plans, der die deutschen Reparationsleistungen im August 1924 neu festgesetzt hatte, ins Land fließenden amerikanischen Kredite und die Wiedereinbeziehung Deutschlands in die internationale Ordnung durch die Annäherungspolitik Stresemanns – er war am 23. November als Reichskanzler zurückgetreten, übernahm aber anschließend das Amt des Au78
79 80 81
Trippe, Politik und Verwaltung (wie Anm. 29), S. 392. Das Geld hatte allerdings zu dieser Zeit bereits erheblich an Wert verloren. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 315. Erdmann, Die Weimarer Republik (wie Anm. 46), S. 167f. Ian Kershaw, Hitler 1889–1936, Stuttgart 1998, S. 267.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 99
06.11.2012 14:47:11
100
Jürgen Schulte-Hobein
ßenministers – leiteten eine Phase scheinbarer wirtschaftlicher und politischer Stabilisierung ein. Scheinbar deshalb, weil Deutschland durch diese Entwicklung in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von ausländischen Krediten geriet.82 Dennoch erholte sich im Verlauf des Jahres 1924 die Konjunktur, womit ein Anstieg der Reallöhne verbunden war. Für den Kreis Olpe von besonderer Bedeutung war die in diesen Jahren erfolgte Gründung der Ferngas-AG, wodurch Arbeitplätze geschaffen und den Städten wie der Wirtschaft neue Impulse verliehen wurden.83 Zwischen 1920 und 1933 fanden allein acht Reichstagswahlen statt. Die Wahlergebnisse im kölnischen Sauerland hoben sich bei allen Wahlen durch die dominante Position des Zentrums vom Reichsdurchschnitt ab. Besonders stark war das Zentrum im Kreis Olpe mit einem katholischen Bevölkerungsanteil von 94,3 Prozent vertreten.84 In der Regierungsstadt Arnsberg lag der Anteil der Protestanten damals mit 17,4 Prozent im Vergleich zu den anderen Städten im kölnischen Sauerland relativ hoch, was hier die geringeren Werte des Zentrums erklärt.85 Bei der Reichstagswahl vom 6. Juni 1920 erhielt das Zentrum in Arnsberg 57,8 Prozent, gefolgt von der SPD mit 12,9 Prozent und der DVP mit 11,3 Prozent. Die USPD errang 8,4 Prozent, die DDP 4,4 Prozent, die DNVP 4,0 Prozent und die KPD lediglich 1,1 Prozent. In der Stadt Olpe gewann das Zentrum dagegen 80,5 Prozent, die SPD 8,6 Prozent, die Christliche Volkspartei 5,2 Prozent, DVP 4,1 Prozent, DNVP 0,7 Prozent, USPD 0,6 Prozent und DDP 0,3 Prozent.86 Einen absoluten Spitzenwert erreichte das Zentrum mit 93,4 Prozent in Medebach. Alle anderen Parteien hatten den Status von Splitterparteien. Niemand hatte für die KPD und die USPD gestimmt.87 Die Reichstagswahl vom 4. Mai 1924 bestätigte das Wahlverhalten. Das Zentrum wurde trotz Verlusten erneut mit deutlichem Abstand die stärkste Kraft. Die Partei erhielt in Arnsberg 51,6 Prozent und in Olpe 76,3 Prozent. Die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse des Krisenjahres 1923 hatten diese Wahl nicht unerheblich beeinflusst. Die Zerstörung der kleinen Vermögen durch die Inflation bedeutete eine schwere politische Belastung der Republik und machte die kleinbürgerlichen Schichten für radikale Parolen empfänglicher.88 Zusätzlich war am 9. April 1924, mitten im Wahlkampf, der Dawes-Plan der Öffentlichkeit bekannt geworden. Hierbei handelte es sich um ein Gutachten des amerikanischen Bankiers Charles Dawes, das die deutschen Reparationszahlungen von der Leistungsfähigkeit abhängig machte, ohne die Höhe der Gesamtzahlungen festzulegen. Deutschland sollte seiner wirtschaftlichen 82 83 84
85
86 87 88
Longerich, Deutschland 1918–1933 (wie Anm. 70), S. 145. Hömberg, Heimatchronik (wie Anm. 42), S. 165. Arnold Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus. Der Kreis Olpe 1933–1939, Siegen 1994, S. 84. Seit Arnsberg im Jahre 1816 Sitz der Bezirksregierung geworden war, versetzte der preußische Staat viele protestantische Verwaltungsbeamte in die Stadt. Sauerländisches Volksblatt vom 7. Juni 1920. Trippe, Politik und Verfassung (wie Anm. 29), S. 394. Erdmann, Die Weimarer Republik (wie Anm. 46), S. 217.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 100
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
101
Entwicklung entsprechend die Jahresraten von einer Milliarde Mark innerhalb von fünf Jahren auf zweieinhalb Milliarden steigern. Während die demokratischen Parteien grundsätzlich positiv auf den Dawes-Plan reagierten, lieferte er der politischen Rechten, aber auch den Kommunisten, Munition für ihre gegen die finanzielle „Versklavung“ gerichtete Propaganda. „Erfüllungspolitik“ wurde zum Unwort des Jahres.89 Die Reichstagswahl setzte die rückläufige Tendenz der demokratischen Parteien fort und stärkte die Position radikaler Parteien. Die Kommunisten erhielten in Arnsberg 12,8 Prozent. Erstmals hatte an dieser Wahl auch die NSDAP teilgenommen. Das Verbot der Partei sowie die Inhaftierung Hitlers in Landsberg am Lech für die Dauer vom 11. November 1923 bis zum 20. Dezember 1924 hatte einerseits zur Tarnung der rechtsradikalen Anhänger, andererseits aber auch zur Spaltung der NSDAP-Nachfolgeorganisationen in mehrere miteinander rivalisierende Gruppen geführt.90 Im kölnischen Sauerland kandidierte neben dem Völkischen Block auch der Völkisch-Soziale Block, der in Olpe nur 15, in Arnsberg aber immerhin 197 Stimmen (3,4%) erhielt.91 Die Regierungs- und Kreisstadt Arnsberg mit ihren Behörden hatte für die Nationalsozialisten eine besondere Bedeutung. Ansätze des Nationalsozialismus lassen sich hier bereits im Jahre 1921 nachweisen, als die ersten Flugblätter und Propagandaschriften aus München verteilt wurden. Der städtische Schlachthofdirektor Heinrich Teipel, ein „Alter Kämpfer“ reinsten Wassers, den die Partei 1933 zum Landrat des Kreises Arnsberg machte, gründete am 24. März 1924 eine Ortsgruppe des VölkischSozialen Blocks. Nach seiner Strategie sollte „die Idee des Nationalsozialismus von Arnsberg aus in das flache Land getrieben werden“.92 Aus diesem Grund traten mehrfach bekannte Redner der NSDAP, darunter Joseph Goebbels und Wilhelm Frick, in Arnsberg auf.93 Teipel baute die „nationalsozialistische Bewegung“ in den drei Kreisen Arnsberg, Meschede und Brilon systematisch auf. Zwischen 1924 und 1927 entstanden unter seiner Regie u.a. Ortsgruppen der NSDAP in Brilon, Meschede, Neheim, Hüsten, Werl, Wenholthausen und Wickede. Da die Verhandlungen nach der Wahl vom Mai des Jahres keine ausreichend gesicherte Regierungsbasis geschaffen hatten und Reichskanzler Wilhelm Marx eine Minderheitsregierung bilden musste, fand am 7. Dezember 1924 erneut eine Reichstagswahl statt. Die Erholung der Konjunktur im Laufe des Jahres mit einem Anstieg der Reallöhne entzog dem politischen Radikalismus den Boden. In Arnsberg lag das Abschneiden der KPD mit 9,0 Prozent jetzt wieder deutlich hinter dem der SPD mit 14,5 Prozent, während das Zentrum mit 50,1 Prozent weiter die absolute Mehrheit hielt. Die Nationalsozia89
90 91 92
93
Schulte-Hobein, „Und eines Tages war das Hakenkreuz auf dem Glockenturm“ (wie Anm. 50), S. 79. Nach Hitlers Haftentlassung wurde die NSDAP am 27. Februar 1925 neu gegründet. Central-Volksblatt und Sauerländisches Volksblatt vom 5. Mai 1924. Diese Strategie nannte Teipel rückblickend zum zehnjährigen Bestehen der Ortsgruppe in der „Westfälischen Landeszeitung Rote Erde“ vom 24. März 1934. Central-Volksblatt vom 2. Oktober 1925.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 101
06.11.2012 14:47:11
102
Jürgen Schulte-Hobein
listische Freiheitspartei, eine weitere Tarnbezeichnung der NSDAP, blieb mit 3,0 Prozent unbedeutend. Im Durchschnitt des Kreises Meschede erhielt sie nur 0,5 Prozent, während das Zentrum hier 81,1 Prozent erreichte. Im Kreis Olpe wählten nur 0,2 Prozent der Wähler die Nationalsozialisten, aber 75,9 Prozent die Zentrumspartei.94 Bemerkenswert war auch der Ausgang der Reichspräsidentenwahl von 1925, die nach dem überraschenden Tod von Friedrich Ebert erforderlich geworden war. Nach der Weimarer Reichsverfassung musste der neue Präsident in direkter Volkswahl gewählt werden. Da im ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten hatte, wurde ein zweiter Wahlgang erforderlich, bei dem die relative Mehrheit der Stimmen ausreichte. Die „Weimarer Koalition“ aus SPD, Zentrum und DDP einigte sich auf den Zentrumspolitiker Wilhelm Marx als gemeinsamen Kandidaten, die politische Rechte stellte den 77-jährigen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg auf. Die Kommunisten waren nicht bereit, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten und nominierten wie schon im ersten Wahlgang ihren Parteiführer Ernst Thälmann. Am 26. April 1925 wurde Hindenburg mit 48,3 Prozent zum Reichspräsidenten gewählt, Marx unterlag mit 45,3 Prozent nur knapp. Im kölnischen Sauerland hatte die Wahl jedoch einen ganz anderen Ausgang. Obwohl Hindenburg parteiübergreifend Autorität verkörperte und sein Feldherrenruhm ihm gleichsam die Rolle und Reputation eines Ersatzkaisers verlieh, votierten die Wahlberechtigten hier für den Katholiken Marx. Deutlich zeigt sich darin die Tendenz, politische Entscheidungen in einem traditionell-konservativen Orientierungsrahmen einzuordnen. Marx siegte in Arnsberg mit 71,3 Prozent vor Hindenburg mit 25,0 Prozent.95 Noch klarer entschieden sich die Olper und Werler für den Zentrumspolitiker, der hier jeweils rund 86 Prozent erreichte. Die Rüthener wollten mit einer Mehrheit von 89,0 Prozent Wilhelm Marx als Reichspräsident haben, nur 8,8 Prozent gaben Hindenburg ihre Stimme.96 In der im Kreis Olpe liegenden Gemeinde Wenden stimmten 93,8 Prozent für Marx und nur 5,7 Prozent für den Feldmarschall.97 In den Jahren 1924 bis 1929 beruhigte sich die innenpolitische Lage in Deutschland. Diese fünf Jahre brachten Erleichterungen und Fortschritte in gesellschafts- und sozialpolitischer Hinsicht. Währungsreform, Dawes-Plan und ausländische Kredite verliehen der deutschen Wirtschaft starke Impulse, Kunst und Kultur erlebten eine Blütezeit. Nach dem Eintritt in den Völkerbund nahm das internationale Ansehen der ersten deutschen Republik weiter zu. Mochte auch die Aussicht auf Reparationszahlungen bis zum Jahre 1988 in Höhe von 34,5 Milliarden Goldmark auf den ersten Blick erschrecken, so konnte doch kein Zweifel darin bestehen, dass auch der Young-Plan gegenüber 94 95 96 97
Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus (wie Anm. 84), S. 72f. Central-Volksblatt vom 27. April 1925. Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 794. Sauerländisches Volksblatt vom 27. April 1925.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 102
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
103
allen bisherigen Regelungen eine weitere deutliche Verbesserung darstellte.98 Er setzte nach Plänen des amerikanischen Industriellen Owen Young die deutschen Zahlungsverpflichtungen auf Grundlage des Versailler Vertrages mit einer Annuität von rund zwei Milliarden Reichsmark neu fest. Unter diesen Vorzeichen fand am 20. Mai 1928 die nächste Reichstagswahl statt. Gewinner dieser Wahl waren die Sozialdemokraten, denen ihre Oppositionszeit zugute gekommen war. Sie stellten fast ein Drittel aller Reichstagssitze und waren wieder zur stärksten politischen Kraft geworden. Ihr Vorsitzender Hermann Müller wurde Reichskanzler einer Großen Koalition, bestehend aus Vertretern seiner eigenen Partei, des Zentrums und der Bayerischen Volkspartei, der DDP sowie der DVP. Im kölnischen Sauerland blieb auch bei dieser Wahl das Zentrum mit großem Abstand die stärkste Kraft, musste aber bedingt durch die niedrige Wahlbeteiligung zum Teil deutliche Verluste hinnehmen. In Arnsberg erreichte die Partei noch 46,6 Prozent und in Olpe 74,9 Prozent.99 Während die NSDAP in Olpe lediglich sieben Stimmen erhielt,100 stimmten in Arnsberg 292 Wähler (5,3%) für die Partei Adolf Hitlers. Die systematische Aufbauarbeit Heinrich Teipels hatte erste Früchte getragen. Auffallend ist das Abschneiden der NSDAP in der heute zur Gemeinde Eslohe gehörenden Ortschaft Wenholthausen, wo Teipel selbst für die Gründung einer eigenen Ortsgruppe gesorgt hatte. 16,7 Prozent stimmten hier für die Nationalsozialisten.101 Am 24. Oktober 1929 setzte ein dramatischer Verfall der Aktienkurse an der New Yorker Börse ein, der eine Wirtschaftskrise einleitete, die sich weltumspannend ausweitete und alle wichtigen marktwirtschaftlich orientierten Industrieländer erfasste. Die Weltwirtschaftskrise ergriff Deutschland in besonderer Weise, weil in der Nachkriegszeit und in den Jahren der Stabilisierung hohe ausländische Kredite ins Land geholt worden waren. Von der gesamten Auslandsverschuldung des Jahres 1930 in Höhe von ungefähr 225,5 Milliarden Goldmark bestand etwa die Hälfte aus kurzfristigen Anleihen, die nun von den Gläubigerbanken zurückgerufen wurden. Daraufhin brach die deutsche Wirtschaft ein, die ohnehin schon unter geringer internationaler Wettbewerbsfähigkeit und einem dadurch hervorgerufenen hohen Handelsbilanzdefizit zu leiden hatte. Darüber hinaus musste die Republik nach wie vor hohe Reparationslasten tragen. Es entstand ein Teufelskreis aus sich verringernder Kaufkraft, zurückgehender Nachfrage, sinkender Produktion und Entlassungen von Arbeitskräften, der auch die Dauerkrise in der Landwirtschaft verschärfte.102 Zur wirtschaftlichen Situation schrieb die Industrie- und Handelskammer Arnsberg für den Bereich des südöstlichen Westfalen: „Das Jahr 1930 muß als schwarzes Jahr in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands bezeichnet werden. Es ist charakterisiert durch eine nie 98 99 100 101 102
Reinhard Sturm, Weimarer Republik, Bonn 1998, S. 32f. Central-Volksblatt und Sauerländisches Volksblatt vom 21. Mai 1928. Sauerländisches Volksblatt vom 21. Mai 1928. Bruns, Zur weltlichen Geschichte des Esloher Raumes (wie Anm. 20). Erdmann, Die Weimarer Republik (wie Anm. 46), S. 237f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 103
06.11.2012 14:47:11
104
Jürgen Schulte-Hobein
gekannte, immer größer werdende Arbeitslosigkeit, durch andauernden Rückgang des Verbrauchs, verbunden mit einem erheblichen Absinken der Preise auf fast allen Gebieten durch Zahlungseinstellungen in erheblichem Umfange. Die Konjunkturkurve ging ständig abwärts und es ist noch nicht zu übersehen, ob und wann die in die Tiefe stürzende Lawine der deutschen Wirtschaft aufgehalten werden kann. Einer der wesentlichen Gründe für den Verfall unserer Wirtschaft liegt in der Unkostenüberlastung, wobei auch die verschärfte Wirtschaftskrise mitgewirkt hat.“103 Die einsetzende Massenarbeitslosigkeit, die bis 1932 auf etwa sechs Millionen Arbeitssuchende anstieg, übertraf bei weitem die finanziellen Möglichkeiten der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung. Sie geriet in Zahlungsschwierigkeiten, so dass entweder die Beiträge erhöht oder die Leistungen gesenkt werden mussten. Über dieser vergleichsweise geringfügigen Streitfrage zerbrach im März 1930 die Regierung der Großen Koalition. Daraufhin ernannte Reichspräsident Hindenburg den Zentrumspolitiker Heinrich Brüning zum Kanzler eines Präsidialkabinetts ohne parlamentarische Mehrheit, das nur auf das Vertrauen des Präsidenten und dessen Notstandsvollmachten nach Artikel 48 der Reichsverfassung gestützt war. Brüning senkte die Ausgaben des Staates radikal. Durch Notverordnungen ließ er Steuern erhöhen und Gehälter wie Pensionen kürzen. Mit dieser Deflationspolitik bewirkte er zwar eine Sanierung des Reichshaushalts, eine Gesundung der deutschen Wirtschaft gelang jedoch nicht. Der Export ging weiter zurück, der Binnenmarkt bot durch die fehlende Kaufkraft ebenfalls keine Absatzmöglichkeiten mehr, so dass die Produktionsziffern in allen Bereichen stetig abnahmen und die Arbeitslosigkeit dramatisch anstieg.104 Die Arbeitslosenstatistiken unterschieden zwischen Arbeitslosenunterstützungsempfängern, Krisenunterstützungsempfängern und sogenannten Wohlfahrtserwerbslosen, für deren Versorgung die Gemeinden zuständig waren. Das wachsende Defizit in der Arbeitslosenversicherung sowie den übrigen Unterstützungskassen veranlasste die Regierung durch Notverordnungen mehrfach die Unterstützungssätze in der Arbeitslosenversicherung und in der Krisenfürsorge zu senken, wodurch die Zahl der Wohlfahrtserwerbslosen allein zwischen 1930 und 1932 um das Vierfache anstieg. Diese mussten von äußerst niedrigen Sätzen leben, die erst nach zum Teil peinlichen Bedürfnisprüfungen bewilligt wurden und zudem prinzipiell rückzahlbar waren. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise waren auch im Sauerland gravierend. Die Anträge auf Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung explodierten geradezu, während gleichzeitig die Einnahmen aus der Gewerbesteuer einbrachen. Hierdurch gerieten die Städte und Gemeinden in immer größer werdende Zahlungsschwierigkeiten. In Arnsberg kam es zu Demonstrationen von 103
104
Bericht der Industrie- und Handelskammer (IHK) für das südöstliche Westfalen/Arnsberg für das Jahr 1930. Longerich, Deutschland 1918–1933 (wie Anm. 70), S. 303.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 104
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
105
Arbeitslosen, die zur Bezirksregierung und zur Kreisverwaltung zogen, wo sie auf ihre prekäre Situation aufmerksam machten und höhere Unterstützungen forderten. Ende August 1930 schilderte der Sprecher der Kommunisten, Josef Surwald, in der Stadtverordnetenversammlung die Situation der beschäftigungslosen Arbeiter und forderte die Stadt auf, im kommenden Winter für die Lieferung von Kartoffeln, Brennstoff und die notwendigste Kleidung zu sorgen sowie die Kosten von Mieten und Strom zu übernehmen.105 Hierzu war die Stadt finanziell jedoch nicht in der Lage; stattdessen führte sie neue kommunale Steuern wie die Bier- und Bürgersteuer ein.106 In vielen Orten konnten die Menschen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und baten um Ermäßigung, Streichung oder Stundung von allen anfallenden Steuern, Mieten, Schulgeld, Kosten für Energie, Krankenhauspflegekosten und anderen Ausgaben. Durch ausbleibende Steuereinnahmen und Abgaben, ständige Mehrausgaben für die Wohlfahrtserwerbslosen und eine wiederholte Erhöhung der Kreisumlage vergrößerte sich kontinuierlich der Fehlbetrag in den städtischen Haushalten. In der Arnsberger Stadtverordnetenversammlung vom 20. Februar 1932 erklärte die Fraktion der NSDAP den „finanziellen Bankrott“ der Stadt und stellte gemeinsam mit der KPD einen Antrag auf Verabschiedung einer Resolution,107 in der es hieß, die Stadt Arnsberg sei infolge der ungeheuren gesetzlichen Lasten zahlungsunfähig geworden und stehe praktisch vor dem Bankrott.108 Die Zusammenarbeit zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten funktionierte trotz vieler Gegensätze und Anfeindungen auch auf lokaler Ebene, wenn es darum ging, die staatstragenden Parteien anzugreifen oder die Kommunen handlungsunfähig zu machen. Beide Fraktionen ließen keine Gelegenheit aus, politischen Nutzen aus der allgemeinen Notlage zu ziehen. Hier zeigen sich deutliche Parallelen zum Reichstag. Landrat Haslinde wies in der Kreistagssitzung vom 27. Mai 1932 auf „die große deutsche Not“ hin, von der „auch der Kreis Arnsberg aufs schwerste betroffen“ sei. Die Not der kreisangehörigen Gemeinden und deren Einwohner 105 106
107
108
Central-Volksblatt vom 1. September 1930. Die Biersteuer wurde direkt beim jeweiligen Wirt erhoben. Zum 1. Juni 1931 führte die Stadt auch eine neue Getränkesteuer ein. In allen Gast- und Schankwirtschaften sowie sonstigen Verkaufstätten wurde auf Wein, Sekt, Branntwein, Mineralwasser, Kakao, Tee, Kaffee und Limonade eine Steuer von 10 Prozent auf den Preis des jeweiligen Getränks erhoben. Die Bürgersteuer wurde 1931 auf 200 Prozent des ursprünglichen Hebesatzes erhöht und 1932 auf 350 Prozent. Sie wurde von allen Personen mit festem Einkommen erhoben. Ein Lediger zahlte 27 Reichsmark monatlich, die direkt vom Lohn einbehalten wurden. Verheiratete wurden gemeinsam veranschlagt und zahlten das Anderthalbfache. Nach der Wahl vom 1. März 1931 saßen sechs Nationalsozialisten und zwei Kommunisten in der Arnsberger Stadtverordnetenversammlung. Das Zentrum verfügte über zehn, die SPD und die Bürgerliche Arbeitsgemeinschaft über je drei Sitze. Protokoll der Stadtverordnetenversammlung vom 20. Februar 1932. Auf Vorschlag des Zentrums und mit Zustimmung der SPD wurde der Antrag geändert. Der Bürgermeister erhielt den Auftrag, der Regierung zu verdeutlichen, dass die Stadt auf Grund der ungeheuren gesetzlichen Lasten zahlungsunfähig geworden sei und ein finanzieller Zusammenbruch nur abgewendet werden könne, wenn die Regierung schnell ausreichend Zuschüsse zahle.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 105
06.11.2012 14:47:11
106
Jürgen Schulte-Hobein
wachse ins „Ungeheuerliche“.109 Während es anderen europäischen Ländern gelang, die Krise allmählich zu überwinden, weitete sie sich in Deutschland zu einer Staatskrise mit einer dramatischen Radikalisierung im linken und rechten Parteispektrum aus. Die Führung der NSDAP begriff nicht sofort die Tragweite des New Yorker Börsenkrachs. Der „Völkische Beobachter“ erwähnte den „Schwarzen Freitag“ an der Wall Street mit keinem Wort. Aber in Deutschland führte die wirtschaftliche Krise schon bald zu politischem Protest. Viele Menschen interpretierten die Weltwirtschaftskrise als Indikator für fehlende Problemlösungskompetenzen der Demokratie, so dass die radikale Kritik am Weimarer Demokratiemodell rasch zunahm. Vor der Weltwirtschaftskrise war die NSDAP nicht über den Status einer Splitterpartei hinausgekommen und hatte bei der Reichstagswahl 1928 lediglich 2,6 Prozent der Stimmen erhalten. Die ersten Erfolge der Nationalsozialisten bei Landtags- und Kommunalwahlen waren jedoch ein Indiz für die wachsende Radikalisierung der Wählerschaft. Das Volksbegehren gegen den Young-Plan hatte der Partei die dringend benötigte Publizität in der weit verbreiteten Presse des Medienunternehmers Alfred Hugenberg verschafft.110 Die extreme Aufwärtsentwicklung der NSDAP im Reich seit Ende 1929 setzte parallel auch im kölnischen Sauerland ein, allerdings hier wesentlich abgeschwächt. Bei der Kreistagswahl am 17. November 1929 trat die NSDAP im Kreis Arnsberg erstmals mit einer eigenen Liste an. Nach der Wahl zog Heinrich Teipel in den Kreistag ein. Einige Monate später zog sich Teipel jedoch vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurück und trat zum Schein aus der NSDAP aus. Hintergrund war eine Verfügung des preußischen Innenministers Carl Severing, die mit Wirkung vom 11. Juni 1930 das öffentliche Tragen der Parteiuniformen der NSDAP einschließlich ihrer Unterorganisationen in ganz Preußen verboten hatte. Am 4. Juli 1930 untersagte ein weiterer Erlass allen Beamten die Mitgliedschaft und Betätigung in der NSDAP und in der KPD mit der Begründung, beide Parteien würden als Organisationen eingeschätzt, deren Ziel der gewaltsame Umsturz der bestehenden Staatsordnung sei. Als Reichskanzler Franz von Papen zwei Jahre später beide Verfügungen wieder aufhob, trat Teipel offiziell als „Führer“ der sauerländischen Nationalsozialisten erneut und verstärkt in Erscheinung. Wegen erhöhter Mitgliederzahlen wurde die Struktur der NSDAP neu organisiert. Der Bezirk Sauerland wurde 1932 aufgelöst und in die Kreisleitungen Arnsberg, Meschede und Brilon unterteilt. Die Leitung des Kreises Arnsberg übernahm Teipel selbst, die des Kreises Meschede Ludwig Runte aus Marsberg und die des Kreises Brilon der Olsberger Alwin Schmidt.111
109 110 111
Central-Volksblatt vom 28. Mai 1932. Kershaw, Hitler (wie Anm. 81), S. 405. Jürgen Schulte-Hobein, Zwischen Demokratie und Diktatur – der Aufstieg des Nationalsozialismus in den Kreisverwaltungen des Hochsauerlandes, in: ders. (Red.), Werden – Wachsen – Wirken. Vom Wandel der Zeit – Kreisverwaltungen im Hochsauerland von 1817 bis 2007, Arnsberg 2007, S. 172–196, hier S. 179.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 106
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
107
Besonders schwierig gestaltete sich für die Nationalsozialisten der Aufbau der Partei in den Kreisen Brilon und Olpe. Über die Entwicklung im Kreis Brilon berichtet die Gauchronik, dass es in diesem Kreis bis ins Jahr 1930 nicht möglich gewesen sei, irgendeine nationalsozialistische Organisation aufzubauen. Die Bevölkerung sei zu 100 Prozent in den katholischen Einrichtungen und in der kirchlichen Gewerkschaft organisiert gewesen.112 So wurde in Medebach erst im Sommer 1932 eine Ortsgruppe der NSDAP gegründet, die dortige SA bestand zu diesem Zeitpunkt lediglich aus acht Personen.113 Im Kreis Olpe lösten Anfang August 1931 eine Großveranstaltung des Stahlhelms in Olpe und eine andere der Nationalsozialisten in Grevenbrück große Empörung aus. Das „Sauerländische Volksblatt“ berichtete über diese Veranstaltungen und kritisierte das Auftreten der Nationalsozialisten in Grevenbrück. Unter der Überschrift „Nazis ohne Maske“ griff das Blatt besonders das ungehörige Auftreten des Versammlungsleiters Herbert Evers an, der 1933 zum Landrat des Kreises Olpe ernannt wurde.114 Im Kreis Olpe mit über 94 Prozent Katholiken erreichte die NSDAP seit 1930 regelmäßig ihr schlechtestes Wahlergebnis im ganzen Wahlkreis Westfalen-Süd, der räumlich dem Regierungsbezirk Arnsberg entsprach. Wie gering die Verwaltung im Olper Land die Aktivitäten der NSDAP am Ende der Weimarer Republik einschätzte und registrierte, beweist auch die negative Antwort des Olper Bürgermeisters im Januar 1934 auf die Anfrage der NSDAP-Gauleitung Westfalen-Süd. Sie hatte angefragt, ob „Material für ein geschichtliches Archiv der Bewegung beim NSDAP-Reichsschulungsamt vorhanden“ sei „und zur Verfügung gestellt werden“ könne.115 Ungeachtet der innenpolitischen Konsequenzen hielt Reichskanzler Brüning an seiner Politik der „rücksichtslosen Sanierung der Finanzen“ fest. Als der Reichstag eine von ihm vorgelegte Notverordnung ablehnte, die u.a. eine Kürzung der Löhne und Gehälter des öffentlichen Dienstes sowie eine verstärkte Besteuerung der Einkommen über 8.000 Reichsmark vorsah, löste er am 18. Juli 1930 mit der Vollmacht des Reichspräsidenten den Reichstag auf, obwohl dieser noch zwei Jahre hätte im Amt bleiben können. Die Neuwahl des Reichstags am 14. September löste ein politisches Erdbeben aus und veränderte die politische Landschaft über Nacht dramatisch. Der NSDAP gelang im Reich ein Sprung von 2,6 Prozent auf 18,7 Prozent und von zwölf auf 107 Mandate. Fast sechseinhalb Millionen Deutsche hatten für Hitler und die Nationalsozialisten gestimmt und die NSDAP hinter der SPD
112 113 114
115
Schulte-Hobein, Zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 111), S. 399. Trippe, Politik und Verwaltung (wie Anm. 29), S. 394. Nach seiner Ausbildung zum Juristen war Evers an den Amtsgerichten in Grevenbrück, Siegen und Lüdenscheid tätig, schied jedoch wegen seiner Mitgliedschaft in der NSDAP aus dem Justizdienst aus und ließ sich 1931 als Rechtsanwalt in Altena nieder. Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus (wie Anm. 84), S. 65.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 107
06.11.2012 14:47:11
108
Jürgen Schulte-Hobein
zur zweitstärksten Kraft gemacht. Das Ergebnis der „Erbitterungswahlen“, wie sie die „Frankfurter Zeitung“ nannte, war eine Sensation.116 Auch im kölnischen Sauerland konnte die Partei gegenüber der Wahl von 1928 deutliche Gewinne verbuchen, die jedoch wesentlich geringer ausfielen als im Reichsdurchschnitt. Im Kreis Arnsberg wählten 8,9 Prozent die NSDAP und 61,5 Prozent die Zentrumspartei. Im Kreis Meschede erreichte die NSDAP 7,8 Prozent (Zentrum 67,4%) und im Kreis Olpe nur 5,4 Prozent (Zentrum 68,6%). Für die SPD stimmten im vergleichsweise stärker industriell geprägten Kreis Arnsberg 12,2 Prozent, im Kreis Meschede 5,8 Prozent und im Kreis Olpe 5,5 Prozent. Von geringer Bedeutung blieben in allen drei Kreisen auch die Kommunisten, die im Kreis Arnsberg 5,0 Prozent, im Kreis Meschede 3,7 Prozent und im Kreis Olpe 5,1 Prozent erhielten. Alle übrigen Parteien waren Splitterparteien. In Arnsberg gewann die NSDAP mit 17,7 Prozent fast viermal so viel Stimmen wie 1928 und stieg hinter dem Zentrum mit 43 Prozent zur zweitstärksten Partei auf. In Brilon erhielten die Nationalsozialisten nur 7,2 Prozent und damit über 10 Prozent weniger als in Arnsberg.117 Das Zentrum erreichte hier 54,2 Prozent. In Rüthen stimmten nur 6,3 Prozent für die NSDAP, aber 66,4 Prozent für das Zentrum.118 Ähnlich lagen die Verhältnisse in Medebach, wo die NSDAP mit 7,4 Prozent ebenfalls unterdurchschnittlich abschnitt.119 „Der Radikalismus hat gesiegt“ überschrieb das „Central-Volksblatt“ den Ausgang der Wahl und kommentierte: „Man darf annehmen, dass die NSDAP von den etwa fünf Millionen Neuwählern am meisten profitiert hat. Diese fünf Millionen sind neben jugendlichen Elementen vor allem verängstigte und durch den hohen Steuerdruck verbitterte Wähler und Wählerinnen aus den Mittelschichten, die in den Verheißungen der Hakenkreuzler einen Ausweg aus ihrer gedrückten Lage zu sehen glauben.“120 Im Klima des wirtschaftlichen Niedergangs, der sozialen Verelendung und der politischen Polarisierung endete im Frühjahr 1932 die siebenjährige Amtszeit des Reichspräsidenten. Wie weit der politische Schwerpunkt inzwischen nach rechts gedriftet war, zeigten die im Vergleich zu 1925 nun vertauschten Wahlbündnisse. Die demokratischen Parteien SPD, Zentrum und die DDP, ebenso das gemäßigte nationale Bürgertum, traten jetzt für Hindenburg ein, der 1925 als Kandidat der Rechtsparteien gewählt worden war. Eine zweite Amtszeit des inzwischen 84-jährigen Reichspräsidenten schien die einzige Möglichkeit zu sein, eine Präsidentschaft Hitlers zu verhindern. Im entscheidenden zweiten Wahlgang am 10. April 1932 siegte Hindenburg mit 53,0 Prozent über Hitler (36,8%) und den Kommunisten Thälmann (10,2%). Deutlich schlechter war das Ergebnis für Hitler im kölnischen Sauerland. Wäh116
117 118 119 120
Karl-Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik. Eine Studie zum Problem des Machtverfalls in der Demokratie, 5. Aufl. Villingen 1971, S. 368. Sauerländer Zeitung vom 16. September 1930. Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 797. Trippe, Politik und Verfassung (wie Anm. 29), S. 394. Central-Volksblatt vom 15. September 1930.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 108
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
109
rend in Arnsberg 69,2 Prozent für Hindenburg, 25,1 Prozent für Hitler und 5,7 Prozent für Thälmann stimmten, erhielt der greise Amtsinhaber in Brilon 75,3 Prozent. Hitler (12,7%) und Thälmann (12,0%) lagen hier nahezu gleichauf.121 In Olpe wählten 90 Prozent Hindenburg, lediglich 8,2 Prozent entschieden sich für Hitler und nur 1,2 Prozent gaben Thälmann ihre Stimme. Auch in Menden gewann Hindenburg mit 75,7 Prozent deutlich vor Hitler (18,7%) und Thälmann (5,6%).122 Hindenburg war trotz seines Wahlsieges tief enttäuscht darüber, dass sich so viele konservative Wähler von ihm abgewandt hatten und dass er seine zweite Amtszeit den Sozialdemokraten und Katholiken zu verdanken hatte. Hierfür machte er vor allem Brüning verantwortlich. Die ostpreußischen Grundbesitzer – zu denen auch Hindenburg selbst gehörte – kritisierten besonders das Osthilfe-Programm Brünings, wonach u.a. nicht mehr entschuldungsfähige Grundstücke zwangsweise für Siedlungszwecke veräußert werden sollten. Als Hindenburg ihm das Vertrauen entzog, musste Brüning am 30. Mai 1932 zurücktreten. Sein Nachfolger wurde der aus Werl stammende Franz von Papen, der bei Hindenburg unmittelbar die Auflösung des Reichstags bewirkte. Mit dieser von den Nationalsozialisten geforderten Auflösung, der Aufhebung des noch von Brüning durchgesetzten SA- und SS-Verbots und der Absetzung der demokratisch gewählten preußischen Regierung unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Otto Braun durch den sogenannten „Preußenschlag“ vom 20. Juli 1932 ebnete Papen bereits in dieser Phase Hitler und seinen Anhängern entscheidend den Weg.123 Im kölnischen Sauerland waren die meisten Menschen mit dieser Entwicklung nicht einverstanden. Am 7. Juni 1932 formulierte das Zentrum des Kreises Arnsberg auf seiner Delegiertenkonferenz unter Vorsitz des Kreisvorsitzenden, Propst Joseph Bömer, eine Entschließung, in der es hieß, dass „die Zentrumspartei des Kreises Arnsberg mit Überraschung, tiefem Bedauern und Entrüstung von dem erzwungenen Rücktritt des Kabinetts Brünings Kenntnis“ genommen habe. Sie glaube, dass mit Schleicher und Papen die Gefahr einer politischen und sozialen Reaktion“ heraufziehe. Sie fürchte „mit tiefer Sorge eine schwere Schädigung lebenswichtiger innen- und außenpolitischer Interessen“.124 Im Vorfeld der Reichstagswahl bestimmten blutige Auseinandersetzungen und Straßenkämpfe den politischen Alltag. Landrat Heinrich Haslinde rief öffentlich zur Mäßigung auf und beklagte, der Wahlkampf, in dem auch der „Brudermord“ immer häufiger vorkomme, nehme zunehmend schärfere Formen an.125 Wenige Tage vor der Reichstagswahl sprach am 25. Juli 1932 auf einer Wahlveranstaltung des Zentrums der ehemalige Reichskanzler Heinrich 121 122 123 124 125
Sauerländisches Volksblatt vom 11. April 1932. Koch, Weltkrieg (wie Anm. 16), S. 177. Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik (wie Anm. 116), S. 510–526. Central-Volksblatt vom 7. Juni 1932. Central-Volksblatt vom 19. Juli 1932.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 109
06.11.2012 14:47:11
110
Jürgen Schulte-Hobein
Brüning in Arnsberg vor Tausenden von Menschen, die aus der näheren und weiteren Umgebung gekommen waren. Das Ergebnis der Reichstagswahl vom 31. Juli 1932 erwies sich für die Republik als noch katastrophaler und ließ die NSDAP reichsweit mit 37,3 Prozent und weitem Abstand vor der SPD (21,6%) und dem Zentrum (12,5%) zur stärksten Partei werden. Mit 230 Sitzen war ihr mehr als eine Verdoppelung der Reichstagsmandate gelungen. Das Wahlergebnis im kölnischen Sauerland sah wiederum anders aus. Das Zentrum blieb die stärkste Partei und erreichte in Arnsberg 51,1 Prozent, gefolgt von der NSDAP (24,2%), SPD (10,1%) und KPD (7,1%).126 In der industriell, aber stärker katholisch geprägten Nachbarstadt Neheim gewann das Zentrum 58,9 Prozent, die NSDAP 13,8 Prozent, die SPD 11,7 Prozent und die KPD 10,9 Prozent. Fast gleichauf lagen die Nationalsozialisten in Medebach (18,8%) und Rüthen (18,4%). Auch die Werte des Zentrums waren in beiden Städten mit 67,3 Prozent bzw. 66,4 Prozent nahezu identisch.127 In Brilon wählten 62,2 Prozent die Zentrumspartei und 12,4 Prozent die NSDAP.128 In Olpe verbuchte das Zentrum 75,6 Prozent, während 9,1 Prozent den Nationalsozialisten und nur 2,4 Prozent den Kommunisten ihre Stimme gaben.129 Einen Spitzenwert erreichte das Zentrum mit 80,5 Prozent in Hallenberg. Noch höher war der Anteil in einigen Dörfern im kölnischen Sauerland. In Altenbüren erreichte das Zentrum 87,6 Prozent, nur zwei Wähler (0,6%) gaben der NSDAP ihre Stimme.130 Für den 6. November 1932 wurde abermals eine Neuwahl des Reichstags angesetzt. Da es sich bei dieser Wahl um den fünften Gang zur Urne innerhalb eines Jahres handelte, war das Ergebnis durch eine allgemeine Wahlmüdigkeit gekennzeichnet. Die NSDAP verlor etwa zwei Millionen Stimmen und 34 Reichstagsmandate. Sie kam reichsweit nur noch auf 33,1 Prozent, gefolgt von der SPD mit 20,4 Prozent. Am meisten profitierten die Kommunisten vom Stimmenrückgang der Nationalsozialisten. Sie verbesserten sich auf 16,0 Prozent und stiegen mit 100 Abgeordneten zur drittstärksten Reichstagsfraktion auf. Auch im kölnischen Sauerland verlor die NSDAP und erreichte in Arnsberg noch 21,8 Prozent, in Rüthen 18,4 Prozent, in Medebach 14,1 Prozent, in Brilon 10,4 Prozent und in Olpe 7,1 Prozent. Der Mythos des unaufhaltsamen Aufstiegs des Nationalsozialismus hatte einen schweren Rückschlag erlitten. Mit der Schlagzeile „Starker Stimmenrückgang der NSDAP“ überschrieb das „Central-Volksblatt“ den Wahlausgang und analysierte: „Der Rückgang der nationalsozialistischen Stimmen ist nicht zuletzt den Methoden des Nationalsozialismus zuzuschreiben. Inzwischen ist man bedeutend manierlicher und bescheidener geworden. Daß die Nationalsozialisten ihren schon bei der letzten Reichstagswahl begonnenen Rück126 127 128 129 130
Central-Volksblatt vom 1. August 1932. Trippe, Politik und Verfassung (wie Anm. 29), S. 394; Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 797. Sauerländisches Volksblatt vom 1. August 1932. Ebd. Ebd.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 110
06.11.2012 14:47:11
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
111
zug fortsetzen würden, war von vornherein so klar wie das Anwachsen der Kommunisten, die die Nutznießer der derzeitigen Notlage sind. Die erwartete Wahlmüdigkeit beim fünften Gang zur Wahlurne in diesem Jahr trat auch prompt ein.“131 Während das Zentrum reichsweit bei 15,0 Prozent lag, blieb es auch diesmal im kölnischen Sauerland mit großem Abstand die dominierende Kraft und erreichte in Arnsberg 47,7 Prozent, in Brilon 60,3 Prozent und in Olpe 71,3 Prozent. Die Kommunisten gewannen in Arnsberg 3,1 Prozent hinzu und waren in der Regierungsstadt jetzt mit 10,2 Prozent nahezu gleichauf mit der SPD. In Brilon wurden sie mit 18,5 Prozent die zweitstärkste Kraft.132 In Olpe verbesserten sie gegenüber der Wahl vom Juli ihr Ergebnis nur um drei Stimmen und kamen auf 2,6 Prozent.133 Alle Wahlen seit 1930 zeigen in den Städten und Gemeinden des kölnischen Sauerlandes im Vergleich zu anderen Regionen eine große Resistenz gegenüber den Parolen des Nationalsozialismus. Trotz der unübersehbaren Schädigungen durch die Weltwirtschaftskrise blieb das in sich differenzierte Kartell des katholischen Milieus intakt. Dennoch stand es der kommenden Diktatur schutzlos gegenüber.134 Der Ausgang der Reichstagswahl vom 6. November 1932 hatte an der politischen Gesamtsituation nichts geändert. Die Lage der Regierung war aussichtslos, da ihr auch der neue Reichstag das Misstrauen aussprechen oder ihre Notverordnung aufheben konnte. Im Kabinett wurde ein „Kampfplan“ erwogen: Auflösung des Reichstags ohne Neuwahl, Ausschaltung der Parteien mit Hilfe der Polizei und Reichswehr, autoritärer Umbau der Verfassung und spätere Billigung dieser Maßnahme durch eine Volksabstimmung oder eine Nationalversammlung. Als General Kurt von Schleicher die Hilfe der Reichswehr für diesen Staatsstreich mit der Begründung ablehnte, die Armee sei nicht imstande, in einem Bürgerkrieg Nationalsozialisten und Kommunisten zugleich niederzuwerfen, trat Reichskanzler Franz von Papen am 2. Dezember 1932 zurück, blieb allerdings ein enger Vertrauter des Reichspräsidenten. Einen Tag später ernannte Hindenburg Schleicher zum neuen Reichskanzler. Im Gegensatz zu Papen war die Regierung Schleicher weniger am Unternehmerinteresse orientiert, suchte die Unterstützung der Gewerkschaften und steuerte auf eine verstärkte staatliche Arbeitsbeschaffung zu, was allerdings zu heftigen Protesten der Industrie führte. Für weiteren Konfliktstoff, vor allem mit dem Landbund und den Deutschnationalen, sorgte die Siedlungspolitik, die auf die bereits von Brüning verfolgte Idee zurückgriff, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Siedlungen auf dem Boden unrentabler ostdeutscher Güter anzulegen.135 Schleichers Versuch, den „linken Flügel“ der NSDAP um Gregor Strasser für eine Regierungsbeteiligung zu gewinnen und damit die NSDAP zu spalten, wuss131 132 133 134 135
Central-Volksblatt vom 8. November 1932. Sauerländisches Volksblatt vom 7. November 1932. Ebd. Dröge, Anmerkungen zur politischen Entwicklung in der Weimarer Zeit (wie Anm. 55), S. 792. Longerich, Deutschland 1918–1933 (wie Anm. 70), S. 224.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 111
06.11.2012 14:47:11
112
Jürgen Schulte-Hobein
te Hitler erfolgreich zu verhindern. Am 28. Januar 1933 musste auch Schleicher zurücktreten. Besonders Papen gelang es, die Bedenken des greisen Reichspräsidenten, der sich lange gegen eine Kanzlerschaft des „böhmischen Gefreiten“ gesträubt hatte, zu zerstreuen. Er sicherte zu, sich um den Eintritt des Zentrums in die neue Koalition zu bemühen, um damit eine parlamentarische Mehrheitsbildung anzustreben, die ohne den Artikel 48 auskam. Außerdem beruhigte er Hindenburg mit dem Hinweis, dass ein von einer konservativen Kabinettsmehrheit „eingerahmter“ NSDAP-Führer keine Gefahr bedeute. Daraufhin ernannte der Reichspräsident am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler einer Regierung, in der außer Hitler zunächst nur noch zwei weitere Nationalsozialisten saßen: Wilhelm Frick als Innenminister und Hermann Göring als Minister ohne Geschäftsbereich.
Das „Dritte Reich“ Während in Berlin und anderswo die nationalsozialistischen Kampfverbände in großen Fackelzügen die „Machtergreifung“ feierten, waren die meisten Menschen im kölnischen Sauerland von der plötzlichen Wende der politischen Lage eher überrascht. Große Teile der Öffentlichkeit erfuhren erst am folgenden Tag aus der Presse von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. „Die Harzburger Front am Ziel. Hitler auf dem Stuhle Bismarcks“, titulierte das „Central-Volksblatt“ die von den Nationalsozialisten bezeichnete so „Machtergreifung“.136 In der Kommentierung dieses Ereignisses betonte die Redaktion, Hitler sei zwar Reichskanzler, aber keineswegs der allein maßgebende Mann im Reichskabinett, welches im Reichstag ohnehin über keine Mehrheit verfüge. Außerdem habe er einen Eid auf die früher von ihm selbst geschmähte Reichsverfassung geleistet. Kritisiert wurde ausdrücklich Franz von Papen, der als Initiator der Kabinettsbildung das Zentrum vollkommen übergangen habe. Dementsprechend, so der Kommentar weiter, könne es das Zentrum mit seiner Parteiehre nicht vereinbaren, sich an einem Kabinett zu beteiligen, das ein Spiegelbild der Harzburger Front sei.137 Noch vor der Vereidigung des Kabinetts hatte Hitler die Forderung nach sofortiger Reichtagsauflösung und damit Neuwahlen für den Fall durchgesetzt, dass die Verhandlungen mit dem Zentrum wegen der Beteiligung an der Regierung zu keinem Ergebnis führen würden. Diese Verhandlungen ließ Hitler absichtlich scheitern, so dass Hindenburg auf Papens Rat den Reichstag auflöste und die Neuwahl für den 5. März festsetzte. Damit war das Parlament für sieben entscheidende Wochen ausgeschaltet und der Herrschaft durch Notverordnungen Raum gegeben. Drei Tage nach Auflösung des Reichstags verfügte Papen als Reichskommissar für Preußen auch die Auflösung sämtlicher Kom136 137
Central-Volksblatt vom 31. Januar 1933. Ebd.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 112
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
113
munalparlamente und setzte deren Neuwahl auf den 12. März fest. Am 6. Februar 1933 hatte eine neue präsidiale „Notverordnung zur Herstellung geordneter Regierungsverhältnisse in Preußen“ alle der Regierung Braun-Severing verbliebenen Befugnisse, die dieser durch das Urteil des Staatsgerichtshofes vom 25. Oktober 1932 ausdrücklich zuerkannt worden waren, der Staatskommissariatsregierung unter Papen und Göring übertragen. Papen verfügte noch am selben Tag zusammen mit dem nationalsozialistischen Landtagspräsidenten Hanns Kerrl und unter Protest des Staatsratspräsidenten Konrad Adenauer die Auflösung des Landtags und setzte dessen Neuwahl in Anlehnung an die Reichstagswahl auf den 5. März fest. Die ersten Tage nach Bildung der neuen Regierung waren in vielen Orten des kölnischen Sauerlandes geprägt durch zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Angehörigen der NSDAP und Mitgliedern anderer Parteien, besonders der KPD. Vor allem in Arnsberg kam es in den ersten Februartagen zu mehreren Krawallen, in deren Verlauf ein Sozialdemokrat, der auch Mitglied des Reichsbanners war, durch zwei Revolverschüsse eines SA-Mannes schwer verletzt wurde.138 Das „Central-Volksblatt“ protestierte entschieden gegen die Gewalttätigkeiten und schrieb: „Es muß ganz dringend verlangt werden, obwohl Hitler Reichskanzler ist, daß bei Demonstrationen und sonstigem uniformierten Auftreten alle Teilnehmer nach Waffen durchsucht werden, und dass gegen alle, die das Leben ihrer Mitmenschen gefährden, ganz gleich welcher Partei sie angehören, die ganze Strenge des Gesetzes angewandt wird.“ Die Zeitung kritisierte die NSDAP, weil deren Reichsleitung früher selbst behauptet habe, jeder werde aus der Partei ausgeschlossen, der sich derartigen Gesetzesverletzungen schuldig mache.139 Der Prozess der Gleichschaltung und Machtübernahme vollzog sich auch im kölnischen Sauerland radikal und schnell. Nach dem „zweiten Staatsstreich“ in Preußen erfolgte auf Anweisung Görings eine systematische Entfernung nichtgenehmer Personen aus dem öffentlichen Dienst. Hiervon betroffen war auch der sozialdemokratische Arnsberger Regierungspräsident Max König, dessen Wirken in seiner nahezu vierzehnjährigen Amtszeit so gut wie einhellig vorbehaltlose Anerkennung gefunden hatte. Zum Nachfolger wurde der Schwiegersohn Papens, Max von Stockhausen ernannt, der wie sein Schwiegervater aus dem Zentrum ausgetreten war und sich den Deutschnationalen angeschlossen hatte.140 Schwer wog auch die am 22. Februar 1933 vollzogene Ablösung des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Johannes Gronowski, eines energischen Anhängers der Weimarer Demokratie, durch den deutschnationalen Ferdinand Freiherr von Lüninck, der sich später dem Widerstand gegen Hitler anschließen sollte. 138 139 140
Central-Volksblatt vom 6. Februar 1933. Central-Volksblatt vom 7. Februar 1933. Schulte-Hobein, „Und eines Tages war das Hakenkreuz auf dem Glockenturm“ (wie Anm. 50), S. 203f. Stockhausen wurde seinerseits 1935 entlassen und durch den Nationalsozialisten Ludwig Runte ersetzt.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 113
06.11.2012 14:47:12
114
Jürgen Schulte-Hobein
Nachdem Göring am 22. Februar für ganz Preußen die Aufstellung einer Hilfspolizei angeordnet hatte, wurden auch im kölnischen Sauerland sogenannte „Hilfspolizeikräfte“ verpflichtet. Allein im Kreis Arnsberg waren es 76 Personen, davon 29 SS- und 27 SA-Leute, zwölf Stahlhelmer und acht Mitglieder des deutschnationalen Kampfrings.141 Eine weiße Armbinde, Gummiknüppel und Pistole legitimierten künftig wilde Verhaftungen und Übergriffe der Parteiarmee als gesetzliche Vorgaben im Dienst des Staates. Am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Als Alleintäter wurde der holländische Kommunist Marinus van der Lubbe ermittelt. Die nationalsozialistische Propaganda legte die Brandstiftung den Kommunisten zur Last und nutzte sie zu einem verschärften Vorgehen gegen die Gegner des Regimes. Bereits am nächsten Tag wurde eine eilig vom Kabinett beschlossene „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ von Hindenburg unterzeichnet. Diese „Reichstagsbrandverordnung“ hob sämtliche in der Verfassung garantierten Grundrechte auf, beseitigte den Schutz des Einzelnen vor staatlichen Übergriffen, legalisierte die Verfolgung sowie Terrorisierung politischer Gegner und liquidierte die rechtsstaatliche Ordnung der Verfassung zugunsten eines permanenten Ausnahmezustandes. Vor dem Hintergrund dieses Ausnahmezustandes, einer massiven nationalsozialistischen Propaganda und einer Behinderung der Opposition fand am 5. März die Wahl zum Reichstag statt. Reichsweit erreichte die Regierung aus NSDAP und Kampffront Schwarz-Weiß-Rot mit 51,8 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit, die NSDAP allein kam auf 43,9 Prozent. Auch bei dieser letzten Wahl erteilten die Menschen im kölnischen Sauerland den Nationalsozialisten wiederum eine deutliche Absage. Im Kreis Arnsberg erhielt die NSDAP lediglich 20,9 Prozent, im Kreis Meschede 23,1 Prozent, im Kreis Brilon 22,6 Prozent und im Kreis Olpe sogar nur 14,3 Prozent. Bessere Ergebnisse erreichte sie in Medebach (36,3%), Rüthen (30,2%) und vor allem in Wenholthausen, wo die Nationalsozialisten mit 48,0 Prozent sogar vor dem Zentrum (39,1%) lagen. In der Stadt Arnsberg gewannen die Nationalsozialisten 28,4 Prozent, in Brilon 24,4 Prozent, in Meschede 23,1 Prozent, in Geseke 20,3 Prozent und in Olpe 11,1 Prozent. Auffallend ist der Wahlausgang in der im Kreis Lippstadt liegenden Gemeinde Suttrop. Die KPD erhielt hier mit 25,3 Prozent mehr als doppelt so viele Stimmenanteile wie die NSDAP (11,1%).142 Besonders erwähnenswert ist das Abschneiden der NSDAP in der im Kreis Olpe liegenden Gemeinde Wenden. Mit 5,0 Prozent hatte die NSDAP hier den Status einer unbedeutenden Splitterpartei, während das Zentrum 85,9 Prozent der Stimmen verbuchen konnte. Im ganzen Kreis Olpe erzielte das Zentrum 69,1 Prozent, im Kreis Brilon 64,2 Prozent, im Kreis Meschede 61,0 Prozent und im Kreis Arnsberg 54,6 Prozent. Während die große Mehrheit der katholischen Bevölkerung im kölnischen Sauerland nach wie vor fest 141 142
Central-Volksblatt vom 7. März 1933. Karl Dietrich Bracher, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34. Bd. 1: Stufen der Machtergreifung, Ulm 1983, S. 161.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 114
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
115
hinter dem Zentrum stand, fiel das Wahlergebnis des im märkischen Sauerland gelegenen überwiegend protestantischen Kreises Altena völlig anders aus. Die NSDAP lag hier mit 46,6 Prozent sogar noch über dem Reichsdurchschnitt, während nur 8,5 Prozent für das Zentrum gestimmt hatten. Auch bei der eine Woche später stattfindenden Kommunalwahl wurde den Nationalsozialisten eine Absage erteilt. Wie deutlich diese Absage war, verdeutlicht der Ausgang der Kreistagswahl im Gebiet des heutigen Hochsauerlandkreises. Die NSDAP wurde in keinem der drei Kreistage die stärkste politische Kraft und verfehlte die gewünschte Legitimation. Bei der Kreistagswahl im Kreis Arnsberg erreichte die Partei 24,0 Prozent der Stimmen und stellte mit sieben von 27 Mitgliedern nur rund ein Viertel der Kreistagsvertreter, während das Zentrum 15 Mandate erhielt. In den Kreisen Meschede und Brilon gewann die NSDAP jeweils nur vier der 24 Kreistagssitze.143 Im Jahre 1939 räumte der Mescheder Kreisleiter der NSDAP, Franz Quadflieg, ein, „1933 habe der Bevölkerung im Kreis Meschede noch die innere Bereitschaft und Begeisterung gefehlt, denn der von Natur aus konservative Sauerländer habe eine gesunde Zurückhaltung gegenüber neuen Gedanken und Strömungen gezeigt“.144 Trotz dieser klaren Entscheidungen zugunsten des Zentrums erhöhte sich nach den Wahlen im März auch im kölnischen Sauerland allmählich die Zahl derer, die schon immer zur NSDAP gehört haben oder aber jetzt dabei sein wollten. In Werl hatte zum Zeitpunkt des Machtwechsels im Reich die Ortsgruppe der NSDAP unter Führung des Ingenieurs Hans Lücke nur über 22 Mitglieder verfügt. Bis Anfang Mai stieg diese Zahl auf 48 an.145 In Rüthen sind für den 1. Mai mindestens 45 Eintritte in die NSDAP nachweisbar.146 Die Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes spielte insbesondere nach der Verabschiedung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 eine entscheidende Rolle bei den Überlegungen vieler Menschen, in die NSDAP einzutreten. Die „Alten Kämpfer“ sahen sich als die Helden und sprachen vielfach verächtlich von den „Märzgefallenen“. Eine Erklärung des Arnsberger Kreisleiters Teipel, die im „Central-Volksblatt“ veröffentlicht wurde, belegt die Diskrepanz zwischen den alten und neuen Parteimitgliedern: „Von allen Seiten treten Leute an die NSDAP heran, denen der Umbau des Staates nicht schnell genug geht, die Namen von an Behörden Beschäftigten abgeben, die noch aus politischen Gründen abgebaut werden müssen. Andere lassen sich als besonders geeignet für bestimmte Posten beschreiben oder versichern, daß sie schon immer der NSDAP 143
144 145
146
Schulte-Hobein, Zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 111), S. 182–184. Zu den Wahlergebnissen der Kommunalwahlen auch in diesem Band Harm Klueting, Kommunalverfassung – Gemeindeordnung – Kommunale Selbstverwaltung, S. 141–185, bes. S. 161–164. Richter, Die Welt Meschedes (wie Anm. 6), S. 321. Ludger Grevelhörster, Kommunalpolitik in der Zeit des Nationalsozialismus, in: Rohrer/Zacher, Werl (wie Anm. 13), S. 795–812, hier S. 795. Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 810.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 115
06.11.2012 14:47:12
116
Jürgen Schulte-Hobein
nahe gestanden haben, aber das aus bestimmten Gründen nicht zeigen konnten. All diesen sei gesagt: Wir sind in einem vierzehnjährigen Kampf ohne die Ratschläge Fremder fertig geworden und brauchen sie heute, wo wir die Macht im Staate als Ausgangspunkt unserer weiteren Aufbauarbeit erlangt haben, erst recht nicht. Außerdem sind wir seit Jahren darüber unterrichtet, wo bei den einzelnen Behörden jene Elemente sitzen, die dank ihrer dunklen Vergangenheit, ihrer moralischen Minderwertigkeit oder ihrer Faulheit und Unfähigkeit im Dritten Reich nicht würdig sind, ein Amt zu bekleiden.“147 Diese Äußerungen Teipels zeigen auch, wie weit die Nationalsozialisten inzwischen ihre Macht konsolidiert hatten und mit atemberaubender Geschwindigkeit ohne nennenswerten Widerstand dabei waren, die Demokratie zu zerschlagen. Ein entscheidender Meilenstein war die Verabschiedung des sogenannten „Ermächtigungsgesetzes“ am 23. März 1933. Nur die SPD stimmte gegen die Selbstausschaltung des Reichstags. Die Erwartung des Zentrums, sich durch die Zustimmung den Fortbestand der Partei zu sichern und Möglichkeiten zur Mitarbeit im Staate zu erhalten, erwiesen sich schnell als Fehleinschätzung. Denn unmittelbar nach der Zustimmung zum „Ermächtigungsgesetz“ gingen die neuen Machthaber dazu über, die absoluten Mehrheiten des Zentrums in den kommunalen Körperschaften zu zerschlagen. Die teils willkürlichen, teils planmäßigen Säuberungswellen wurden verstärkt fortgesetzt und richteten sich jetzt vornehmlich gegen die Bürgermeister und Landräte, die im kölnischen Sauerland nahezu ausschließlich Mitglieder des Zentrums waren.148 Zur ersten Sitzung des neugewählten Arnsberger Kreistags am 7. April 1933 waren die drei SPD-Kreistagsmitglieder nicht erschienen, da sie von der NSDAP massiv unter Druck gesetzt worden waren. Die NSDAP verlangte vom Zentrum, sich voll hinter die „nationale Regierung“ zu stellen. Streitpunkt war die Beibehaltung des bisherigen Landrats Haslinde. Heinrich Teipel, der selbst den Stuhl des Amtsinhabers beanspruchte, erklärte als Sprecher der nationalsozialistischen Fraktion: „Die Person des derzeitigen Landrats ist für uns aus politischen und sachlichen Gründen nicht tragbar, da dieser sich jahrelang mit Schärfe gegen den Nationalsozialismus eingestellt hat und nun nicht ein Freund der nationalsozialistischen Erhebung sein kann. Daher kann und will die NSDAP auch nicht mit Dr. Haslinde zusammenarbeiten. Der Nationalsozialismus hat nach vierzehnjährigem Kampf die Macht ergriffen und wird den Staat nach seinen eigenen Vorstellungen aufbauen und formen.“149 Fünf Tage später forderte Teipel in einem Schreiben an den Arnsberger Regierungspräsidenten erneut und unmissverständlich die Ablösung Haslindes und legte dar, dass seine Partei aufgrund jahrelanger Beobachtungen zu der Über147 148 149
Central-Volksblatt vom 23. März 1933. Der Arnsberger Bürgermeister Rudolf Isphording blieb bis 1945 im Amt. Schulte-Hobein, Zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 111), S. 186.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 116
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
117
zeugung gekommen sei, dass Haslinde in einem nationalsozialistischen Staat nicht tätig sein könne. Zwei Tage später trat Haslinde „schweren Herzens“ zurück, verließ „seine Kreisstadt Arnsberg“ und siedelte in die oberbayerische Gemeinde Marquartstein über.150 Damit entzog er sich weiteren Nachfragen oder Repressalien staatlicher Stellen. Wie nicht anders zu erwarten war, trat Teipel durch Erlass des preußischen Innenministers Göring die Nachfolge als Landrat des Kreises Arnsberg an. Ähnlich rabiat erfolgte die Ablösung des Landrats im Kreis Meschede. Hier stand der Amtsinhaber Otto Werra als überzeugtes Zentrumsmitglied und entschiedener Gegner des Nationalsozialismus zur Disposition. Mitglieder der Mescheder NSDAP erschienen im Dienstzimmer des Regierungspräsidenten, forderten massiv die Ablösung Werras und die Ernennung eines nationalsozialistischen Landrats in der Person Ludwig Runtes.151 Werra wurde am 11. April aus dem Amt gedrängt und als politisch verdächtig mit gekürzter Pension entlassen.152 Einen Tag später übernahm Runte als kommissarischer Landrat die Leitung des Kreises Meschede. Im Kreis Olpe wurde Ende April der zentrumstreue Landrat Bernhard Wening, dem man allseits große Verdienste bescheinigte, auf Anweisung des preußischen Innenministeriums seines Amtes enthoben und beurlaubt.153 Auch die Eingaben des Schützenbundes des kölnischen Sauerlandes, der Bürger seines Geburtsortes Dülmen und des Erzbischofs von Paderborn konnten die Amtsenthebung des beliebten Olper Landrats nicht verhindern. Zum Nachfolger ernannte die Partei kommissarisch Oberregierungsrat Sträter vom Polizeipräsidium Bochum. Er wurde jedoch bereits im September auf Initiative des nationalsozialistischen Kreisleiters wie auch des Gauleiters wieder abgelöst, da er nach deren Ansicht „keine Resonanz bei der Bevölkerung erzielt und die Sache des Nationalsozialismus auf dem schwierigen Terrain des katholischen Milieus nicht im geringsten hatte vorantreiben können“. Zum neuen Landrat bestimmte die Partei den aus Grevenbrück stammenden und in Altena als Rechtsanwalt tätigen Herbert Evers, der das Amt ebenfalls zunächst kommissarisch ausübte.154 Evers war im Kreis Olpe kein Unbekannter, da er in den zwanziger Jahren die Gründung des Sauerländer Heimatbundes mitinitiiert hatte. Gleichzeitig war er „Alter Kämpfer“ der NSDAP und hatte im Kreis Olpe schon früh na150
151 152
153
154
Ein „Revolutionsgesetz“ gegen die ehemaligen Reichsminister nahm ihm unter Verletzung seiner erworbenen Rechte dazu noch den größten Teil seines Ministerruhegehaltes und reduzierte seine Einkünfte auf ein Drittel seiner bisherigen Bezüge. In seinen Lebenserinnerungen betont Haslinde, dass ihn zuviel von der neuen „Bewegung“ getrennt habe. Insbesondere habe ihn als tief gläubigen Katholiken der offene Kampf vornehmlich gegen die katholische Kirche, aber auch gegen die evangelische Kirche und das Judentum abgestoßen. Schulte-Hobein, Zwischen Demokratie und Diktatur (wie Anm. 111), S. 187. Nach dem Krieg wurde Werra zum Leiter des Landeselektrizitätsverbandes Oldenburg ernannt. Beim Wiedergutmachungsverfahren wurde er als politisch Verfolgter anerkannt. Nach seiner Pensionierung im Jahre 1955 kehrte Werra in seine Heimatstadt Münster zurück, wo er sich vornehmlich sozialen Aufgaben widmete. Wening wurde der Regierung in Schleswig als außerplanmäßiger Beamter und später der Regierung in Münster zugewiesen. Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus (wie Anm. 84), S. 111f.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 117
06.11.2012 14:47:12
118
Jürgen Schulte-Hobein
tionalsozialistisches Gedankengut verbreitet. Offiziell war er seit 1930 Mitglied der NSDAP und hatte in diesem Jahr die Ortsgruppe Grevenbrück gegründet. Im folgenden Jahr trat er in die Grevenbrücker SA ein, deren Aufbau er kontinuierlich vorantrieb.155 Seine feierliche Amtseinführung fand am 15. November 1933 auf dem „Adolf-Hitler-Platz“ in Olpe statt. Am 27. Mai 1935 wurde Evers endgültig zum Landrat des Kreises Olpe ernannt.156 Im Kreis Brilon blieben Mitglieder der Zentrumspartei noch bis 1936 in kommunalen Spitzenpositionen. Nach Meinung der nationalsozialistischen Parteiinstanzen hatte sich hier die „Machtergreifung“ vom 30. Januar 1933 überhaupt noch nicht ausgewirkt. Besonders verbittert war man, dass der seit 1909 amtierende Landrat Heinrich Jansen nach wie vor im Amt geblieben war, obwohl ihm auf Betreiben der örtlichen Parteileitung der NSDAP seine jährliche Aufwandsentschädigung von 3.600 auf 2.000 Reichsmark zusammengestrichen worden war. Im Jahre 1935 nahmen die Eingaben des Briloner Kreisleiters Everken, in denen er eine Absetzung des Landrats Jansen forderte, an Schärfe zu. In einem Brief an die Gauleitung in Bochum betonte er die maßlose Erbitterung der alten Parteigenossen im Kreis Brilon darüber, dass der „schwarze Landrat Jansen“, der früher Provinzialabgeordneter des Zentrums gewesen sei, immer noch als Landrat amtiere. Jansen biete in keinerlei Weise die Gewähr dafür, dass die nationalsozialistische Weltanschauung im Kreis Brilon gefördert würde. Mit Nachdruck argumentierte er: „Immer wieder habe ich die alten Parteigenossen vertröstet, dass Jansen als Landrat bald verschwinden werde. Ich habe hier im ganzen Kreis Brilon nur einen Stamm von 130 Parteigenossen. Ich kann als Kreisleiter nicht mehr vor meine Unterführer hintreten und sie wieder vertrösten, dass demnächst mal durchgegriffen würde. In den letzten Monaten ist mir eine Flut von Beschwerden von den 52 Ortsgruppen, Stützpunkten und Zellen des Kreises Brilon zugegangen. Ich halte es für dringend erforderlich, dass einer Umbesetzung näher getreten wird.“157 In einem Schreiben an den preußischen Innenminister regte der Arnsberger Regierungspräsident an, Jansen mit Erreichen seines 60. Geburtstags im April 1936 in den Ruhestand zu verabschieden. Die Partei wolle in Brilon endgültig einen nationalsozialistischen Landrat haben. Dieser Maßnahme kam Jansen zuvor und wurde auf sein Gesuch hin am 12. März 1936 in den Ruhestand versetzt.158 Die Nachfolge übernahm der aus Bochum stammende Peter Schramm, der seit dem 1. März 1932 Mitglied der NSDAP war.159 155
156 157 158
159
Hans-Bodo Thieme, Herbert Evers. Landrat des Kreises Olpe von 1933 bis 1945, Olpe 2001, S. 22. Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus (wie Anm. 84), S. 112. Kreisarchiv des Hochsauerlandkreises, Akte Heinrich Jansen. Da man ihm als „Persönlichkeit von nationalem Empfinden“ noch eine gewisse Brauchbarkeit einräumte, wurde Jansen angesichts der personellen Engpässe bei Kriegsausbruch 1939 vertretungsweise zunächst in Siegen und Berleburg, dann als Landrat in Meschede eingesetzt. Nach dem Zusammenbruch wurde Schramm 1945 als Landrat des Kreises Brilon entlassen. Später war er zwischen 1952 und 1956 für die Freie Demokratische Partei (FDP) im Kreistag des Kreises Brilon.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 118
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
119
Ähnlich wie die Landräte wurden auch die meisten Amts- und Gemeindebürgermeister durch Nationalsozialisten ersetzt. Wie die neuen Machthaber dabei mit ungeliebten Amtsinhabern umgingen, zeigen die Beispiele des Amtsbürgermeisters von Hüsten, Rudolf Gunst, und des Bürgermeisters der Stadt Werl, Fritz Nachtsheim. Gunst hatte als Reserveoffizier vor Verdun die Schrecken des Ersten Weltkrieges kennengelernt, so dass er sich dem Friedensbund der deutschen Katholiken angeschlossen hatte. Als Vorsitzender der deutschen Sektion gehörte er mit zu den Einladenden zu dem heute durch die Teilnahme Franz Stocks sehr bekannten Friedenstreffen vom 12. September 1931 auf dem Borberg bei Brilon. In dieser Position zog er sich naturgemäß den Groll der Nationalsozialisten auf sich, die ihm u.a Demokratiefreundlichkeit sowie Völkerverständigung vorwarfen und ihn als „Judenschützling“ bezeichneten. In der nationalsozialistischen Tagespresse hieß es: „Im neuen Deutschland haben Männer vom Schlage des Dr. Gunst keinen Platz mehr – sie werden ausgemerzt, wo immer sie festgestellt werden. Es kann niemand verlangen, dass wir unsere eigenen Verderber füttern.“160 Am 30. Juni 1933 wurde Gunst vorzeitig in den Ruhestand versetzt und zur Zahlung von 5.000 Reichsmark Entschädigung an das Amt Hüsten verurteilt.161 In Werl war Bürgermeister Fritz Nachtsheim, Mitglied der Zentrumspartei, seit 1922 im Amt. Auf Druck der Kreis- und Gauleitung der NSDAP wurde er durch den Arnsberger Regierungspräsidenten am 28. März 1933 beurlaubt und durch Richard Klewer ersetzt.162 Noch am gleichen Tag hissten Werler SA- und SS-Truppen sowie die örtliche Hitler-Jugend auf dem Rathaus Hakenkreuzfahnen, um mit diesem symbolischen Akt „die Übernahme der Stadt durch die NSDAP“ zu demonstrieren.163 Zwei Monate später lag der abgesetzte Bürgermeister mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. In der Nacht vom 5. auf den 6. Juli hatten ihn SA-Männer in seiner Wohnung überfallen und schwer misshandelt. Danach nahm ihn die Polizei in „Schutzhaft“, ehe man ihn ins Krankenhaus einlieferte. In der ersten Sitzung der neugewählten Stadtverordnetenversammlung verlieh die Stadt Werl neben Hindenburg und Hitler auch dem „Sohn der Stadt“ Franz von Papen den Ehrenbürgerbrief. Bemerkenswert dabei ist, dass Papen die Ehrenbürgerschaft erst übertragen wurde, nachdem er Hitler an die Macht verholfen hatte und Vizekanzler in dessen Kabinett war. Bei einem Besuch als Reichskanzler in seiner Heimatstadt im Jahre 1932 war ihm diese Ehre nicht zuteil geworden.164 160
161
162
163 164
Karl Föster, Dr. Rudolf Gunst – Amtmann und Bürgermeister in Hüsten 1919–1933, in: Hüsten – 1200 Jahre, Arnsberg 2002, S. 73–78, hier S. 75. Günter Cronau, Das Amt – eine ausgediente Institution, in: Schulte-Hobein, Werden – Wachsen – Wirken (wie Anm. 111), S. 119–144, hier S. 131. Klewer trat sein Amt am 20. April 1933 an. 1942 wurde er durch den „Alten Kämpfer“ Walter Riedel ersetzt. Grevelhörster, Kommunalpolitik (wie Anm. 145), S. 798. Hans-Jürgen Zacher, „Im Geiste Adolf Hitlers wollen wir zusammenarbeiten“. Der Weg in den Nationalsozialismus, in: Rohrer/Zacher, Werl (wie Anm. 13), S. 813–866, hier S. 828.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 119
06.11.2012 14:47:12
120
Jürgen Schulte-Hobein
In Ausnahmefällen blieben Bürgermeister bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft im Amt. Hierzu zählte Arnsbergs Bürgermeister Rudolf Isphording, der sich als ehemaliges Zentrumsmitglied seit Beginn des Jahres 1932 an der Spitze der Regierungsstadt befand. Er passte sich nach dem 30. Januar 1933 schnell der veränderten politischen Lage an, schmeichelte sich bei Kreisleiter Teipel ein, trat aus der Zentrumspartei aus und der NSDAP bei. Bereits in der Endphase der Weimarer Republik waren die Kreistage und Stadtverordnetenversammlungen aufgrund einer Notverordnung des Kabinetts Brüning nur noch selten zusammengetreten, um Kosten zu sparen. Nach der nationalsozialistischen Machtübertragung und den Kommunalwahlen vom 12. März 1933 wurde umgehend das Ende der Kommunalparlamente eingeläutet. Die Nationalsozialisten mit ihrer betont antiparlamentarischen Haltung wünschten derartige Vertretungskörperschaften nicht länger. Die Gemeindeverwaltung in ganz Preußen erhielt durch das Gemeindeverfassungsgesetz vom 15. Dezember 1933 eine völlig neue Regelung. Das Gesetz lehnte Einrichtungen parlamentarisch-demokratischer Art kategorisch ab und übertrug nach dem nationalsozialistischen „Führerprinzip“ die alleinige und volle Verantwortung in den Städten den Bürgermeistern und in den Kreisen den Landräten. Diese wurden jetzt auch nicht mehr gewählt, sondern vom Staat ernannt. Beschlüsse einer Vertretungskörperschaft gab es nicht mehr. Es folgte die „Gleichschaltung“ aller Vereine und des gesamten Kulturlebens. Überall führte man das „Führerprinzip“ ein. Entsprechend erhielten die Vereinsvorsitzenden jetzt die Bezeichnung „Vereinsführer“. Auch sie wurden ernannt und nicht mehr gewählt.165 War der zentrumsnahen Presse im kölnischen Sauerland wie dem „CentralVolksblatt“, dem „Sauerländischen Volksblatt“, dem „Attendorner Volksblatt“ oder der „Sauerländischen Zeitung“ nach der „Machtergreifung“ trotz Behinderungen zunächst noch einiger Spielraum geblieben, erfolgte nach den Wahlen vom März 1933 eine schnelle Angleichung und Vereinheitlichung auf die Nahziele des Regimes. Im Juli 1933 wurde der verantwortliche Redakteur der nationalsozialistischen Zeitung „Rote Erde“ zum Leiter des neuerrichteten Pressedezernats bei der Bezirksregierung in Arnsberg ernannt. Ihm unterstand fortan die Presseaufsicht im ganzen Regierungsbezirk. Die Presse war nicht mehr Instrument einer sich frei bildenden und bewegenden öffentlichen Meinung, sondern entartete zum Organ der politischen Führung, für dessen Kontrolle neben Goebbels insbesondere Otto Dietrich als Reichspressechef sowie Max Amann als Reichsleiter für die Presse verantwortlich waren. Die Auflösung der Gewerkschaften und die Formierung der Deutschen Arbeitsfront Anfang Mai 1933 waren weitere entscheidende Vorgänge im Prozess der Gleichschaltung zur nationalsozialistischen Gesellschaft.166 Zu dieser Zeit war die KPD längst zerschlagen, ihre Funktionäre befanden sich in Haft oder 165 166
Central-Volksblatt vom 19. Juli 1933. Bei der „Gleichschaltung“ handelt es sich wie bei der „Machtergreifung“ um einen nationalsozialistischen Begriff.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 120
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
121
waren ins Ausland geflohen. Die polizeiliche Beschlagnahme des Parteieigentums schon im Anschluss an den Reichstagsbrand und die endgültige Liquidierung des kommunistischen Vermögens am 26. Mai 1933 hatten illegale Tätigkeiten der KPD weitgehend unwirksam gemacht.167 Danach galten die Schikanen und Terrormaßnahmen der SA vor allem der SPD. Ihre Presse wurde völlig lahmgelegt und ihre Beamten in den Staats- und Kommunalverwaltungen entlassen. Am 10. Mai erfolgte die Beschlagnahme aller Parteihäuser, der Zeitungen, Geschäftsräume und des gesamten Vermögens der SPD und des Reichsbanners. Am 22. Juni 1933 wurde die SPD endgültig verboten. Auch die anderen Parteien mit Ausnahme der NSDAP mussten sich auflösen, zuletzt am 5. Juli das Zentrum. Am 14. Juli 1933 konnte der Einparteienstaat offiziell erklärt werden. Ein „Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat“ vom 1. Dezember 1933 sollte der Monopolstellung des Nationalsozialismus eine Scheinlegalität verleihen und erklärte die NSDAP zum einzigen politischen Willensträger im Reich. Endgültig abgeschlossen war die nationalsozialistische Machtkonsolidierung durch den Tod des greisen Reichspräsidenten Hindenburg am 2. August 1934 und die Übernahme des Amtes sowie die Vereidigung der Reichswehr auf den „Führer und Reichskanzler“ Adolf Hitler. Schon bald nach dem 30. Januar 1933 änderten sich für die jüdische Bevölkerung in Deutschland die Lebensumstände einschneidend.168 Die nationalsozialistische Basis und Führung schritten in wechselseitiger Radikalisierung zur Verwirklichung der antisemitischen Ideen. Der Kampf gegen die Juden wurde nicht nur propagandistisch auf jede Weise gefördert und jetzt auch unter Zuhilfenahme des Staatsapparates systematisch organisiert, sondern zugleich auch zu einem bestimmenden Prinzip der gesamten deutschen Innenpolitik, der Personalpolitik wie besonders auch der Kulturpolitik erhoben. Die erste organisierte Maßnahme größeren Stils gegen die Juden war der reichsweite Aufruf zum Boykott aller jüdischen Geschäfte, Rechtsanwalts- und Arztpraxen. Das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 ermöglichte die Entlassung aller jüdischen Beamten, lediglich die jüdischen Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges blieben vorerst noch ausgenommen. Die „Nürnberger Gesetze“ vom 15. September 1935 degradierten die deutschen Juden endgültig zu Bürgern minderen Rechts. Das NSRegime machte die Verleihung politischer Rechte und Ämter fortan von „Ariernachweisen“ abhängig, hielt den Juden den Reichsbürgerstatus vor und verbot die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden. Am 9. November 1938 folgte die Pogromnacht, in der überall in Deutschland zumeist Angehörige der SA Synagogen zerstörten und jüdische Geschäfte und Wohnungen plünderten, wobei es auch zu Todesfällen kam. Mehr als 30.000 Juden wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht. Mit der Verschärfung der seit April 1938 167 168
Bracher, Die nationalsozialistische Machtergreifung (wie Anm. 142), S. 269. Zur Verfolgung der Juden auch in diesem Band Georg Glade, Die Juden im ehemaligen Herzogtum Westfalen seit 1803, S. 1041–1081, hier S. 1066–1080.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 121
06.11.2012 14:47:12
122
Jürgen Schulte-Hobein
forcierten „Arisierungspolitik“ zur Kennzeichnung und Konfiskation jüdischer Vermögen sowie zahlreicher Erlasse begann die vollständige Entrechtung der Juden. Noch aber sollten die Juden nach Enteignung nur massiv aus Deutschland vertrieben werden. 1933 lebten im Regierungsbezirk Arnsberg 10.326 Juden. Bis 1939 ging ihre Zahl durch Auswanderung auf 3.638 zurück, ehe die Machthaber am 23. Oktober 1941 die Emigration verboten.169 Bereits im Sommer 1941 wurden die Maßnahmen zur „Endlösung der europäischen Judenfrage“ vorbereitet und am 19. September 1941 zur öffentlichen Kennzeichnung der gelbe Judenstern eingeführt. Die Wannseekonferenz vom 20. Januar 1942 legte letzte Einzelheiten zur systematischen Deportation der europäischen Juden und deren anschließende umfassende physische Vernichtung fest. Nachdem das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli 1933 die Sterilisierung erbkranker Personen erlaubt hatte, lief im Herbst 1939 das Euthanasieprogramm zur „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ an, dem vor allem Patienten zum Opfer fielen, die an Schizophrenie, Epilepsie oder Schwachsinn litten. Solche Patienten ließ man überall in Deutschland aus den Pflege- und Heilanstalten holen und in Tötungsanstalten umbringen. In diesem Zusammenhang erfolgte in Niedermarsberg die Tötung geistig behinderter Kinder.170 Neben überzeugten Nationalsozialisten und Mitläufern gab es auch im kölnischen Sauerland Widerstand gegen die NS-Herrschaft in verschiedenen Formen und Graden. Ein Bericht der Gestapostelle Dortmund vom Juli 1934 verdeutlicht, dass viele Sauerländer dem Regime weiterhin ablehnend gegenüberstanden: „Es muss erreicht werden, dass auch in der kleinsten Führerstelle Menschen stehen, welche durch ihr tägliches Vorbild die Überzeugung von der Reinheit nationalsozialistischen Wollens mit unbeirrbarem Fanatismus vermitteln. Das gilt ganz besonders für die Gebiete, wo – wie im streng katholischen Sauerland – die Bewegung sich heute noch im schweren Kampf befindet und sich nur dann durchsetzen und behaupten kann, wenn sie wirkliche Führer herausstellt.“171 Widerstand war vielgestaltig und reichte über ein weites Spektrum von Gesten am Rande der Öffentlichkeit bis zu extremen Gegenhandlungen. Er begann mit der Verweigerung des sogenannten deutschen Grußes („Heil Hitler“), geschah weiterhin in Form illegaler Flugblattaktionen, als Fluchthilfe für Verfolgte, in Form defätistischer Reden oder in der Entwicklung konspirativer Organisationsformen. Das Regime war von Anfang an gezwungen, Maßnahmen in der durchaus zutreffenden Erkenntnis zu ergreifen, dass das Volk keineswegs „geschlossen hinter dem Führer“ stand, wie die offizielle Propaganda behauptete. Die von Göring am 26. April 1933 gegründete Geheime Staatspolizei (Gestapo) 169 170 171
Klueting, Geschichte Westfalens (wie Anm. 37), S. 409. Ebd., S. 411. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Westfalen [früher: Staatsarchiv Münster], Politische Polizei, III. Reich, Nr. 410.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 122
06.11.2012 14:47:12
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
123
entwickelte sich zum Organ eines bürokratisch organisierten Terrors gegen alle staatsgefährdenden politischen Bestrebungen. Die Anfänge des politischen Widerstandes sind vor allem von der linksgerichteten Arbeiterschaft getragen worden. Ein massiver Widerstand scheiterte aber sowohl an der Unterschätzung des Nationalsozialismus durch die KPD und SPD als auch an der Spaltung in zwei verschiedene Arbeiterlager, die sich gemeinsam schwer mobilisieren ließen. Im kölnischen Sauerland kam außerdem hinzu, dass beide Parteien durch die Dominanz des politischen Katholizismus nur schwach vertreten waren. Dennoch nahmen Mitglieder der SPD Verbot und Verfolgung nicht passiv hin, sondern beteiligten sich an Widerstandsaktionen. Die KPD war bereits im April 1933 weitgehend aufgelöst und viele ihrer Anführer – wie die Arnsberger Franz Klatecki und Josef Surwald – inhaftiert worden. Im Amt Altenrüthen sind Verfolgungen von Kommunisten schon seit Mitte März 1933 nachweisbar. Bis zum Sommer wurden allein 18 Arbeiter aus Suttrop – der Ort im Kreis Lippstadt galt nicht zuletzt wegen des Wahlergebnisses vom 5. März 1933 in den Augen der Nazis als „kommunistisch total verseucht“ – verhaftet.172 Auch die SPD war Mitte 1933 zerschlagen. Den SPD-Vertretern unter den Stadtverordneten teilte man in der Regel unter Androhung von Gewalt mit, dass sie an kommunalpolitischen Sitzungen nicht mehr teilnehmen durften. In Meschede drohte Landrat Runte dem SPD-Vorsitzenden Ewald Buß Schutzhaft für den Fall an, dass er sich weiter politisch betätige.173 An vielen Orten hielten kleine und mittlere Partei-, Reichsbanner- und Gewerkschaftsfunktionäre Kontakt und bewahrten so einen lockeren organisatorischen Zusammenschluss. In Arnsberg und Brilon gelang es, die Reichsbannerfahnen bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft zu verstecken. Für einige ging der Widerstand unter schwierigsten Bedingungen weiter. Absprachen zu geheimen Zusammenkünften wurden grundsätzlich mündlich getroffen. In Arnsberg fanden diese in der sogenannten „Edelbroich-Scheune“ in der Altstadt statt. Die Frauen der Mitglieder hatten bis zur Durchführung der letzten Reichstagswahl noch Flugblätter verteilt, die meist aus dem Raum Dortmund/Unna bis nach Neheim und von dort mit dem Fahrrad nach Arnsberg gelangten. Aus dem Kreis Meschede ist überliefert, dass u.a. in Finnentrop,174 Remblinghausen und Meschede mehrere Sozialdemokraten zeitweise inhaftiert waren, weil sie sich abfällig gegen das Regime geäußert hatten.175 Die katholische Kirche in Deutschland hatte in den Jahren vor 1933 in verschiedenen bischöflichen Einzelerklärungen scharf gegen den Nationalsozialismus Stellung bezogen und eine intensive Aufklärungsarbeit betrieben, um den Gegensatz zwischen Nationalsozialismus und Christentum herauszustel172 173
174 175
Bracht, Rüthen (wie Anm. 56), S. 808. Ottilie Knepper-Babilon/Hannelie Kaiser-Löffler, Widerstand gegen die Nationalsozialisten im Sauerland, Meschede 2003, S. 54. Finnentrop gehörte bis zur kommunalen Neugliederung von 1969 zum Kreis Meschede. Knepper-Babilon/Kaiser-Löffler, Widerstand (wie Anm. 173), S. 55.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 123
06.11.2012 14:47:12
124
Jürgen Schulte-Hobein
len. Nach dem 30. Januar 1933 bemühte sich die Kirche um eine Abgrenzung von Imperium und Sacerdotium auf neuer Grundlage. Vor diesem Hintergrund ist die Zustimmung zum „Ermächtigungsgesetz“ von Zentrum und Bayerischer Volkspartei sowie der Abschluss des Reichskonkordats am 20. Juli 1933 zu sehen, um sich nach der vollzogenen Anerkennung der Hitlerregierung durch eine frühzeitig bindende Rechtsvereinbarung ihren Wirkungsraum zu sichern. Hitler selbst erhoffte sich durch das Konkordat u.a. das Ende des politischen Katholizismus in Deutschland. Trotz dieses Abkommens hielt sich das nationalsozialistische Regime von Anfang an nicht an die Abmachungen und drängte katholische Schulen, Vereine und Jugendbünde immer stärker zurück. Der Gegensatz zwischen Nationalsozialismus und Kirche erwies sich schließlich als unüberbrückbar. Papst Pius XI. zog mit seiner Enzyklika „Mit brennender Sorge“ im Jahre 1937 einen offiziellen Trennungsstrich. Im kölnischen Sauerland traf der Nationalsozialismus auf ein katholisches Milieu, das auch nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ noch relativ geschlossen wirkte. Mehr als 90 Prozent der Menschen gehörten der katholischen Konfession an, deren Leben in ein Netz von katholisch bestimmten kirchlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Organisationen eingebunden war. Die bis 1933 unangetastet gebliebene Rolle des Pfarrers als Meinungsführer in allen Lebenslagen musste nach Auffassung lokaler Nationalsozialisten rigoros auf rein kirchlich-religiöse Belange zurückgeführt werden. Seine fast immer anerkannte „Richtlinienkompetenz“ besonders in politischen Fragen sollte nach dem 30. Januar 1933 nicht mehr gelten. Die Nationalsozialisten hatten den Lehrern diese Rolle zugedacht. Sie sollten im kommunalen Rahmen gegen den kirchlichen Einfluss NS-Indoktrination betreiben.176 Daher lassen sich hier weltanschauliche Abwehrmaßnahmen des Klerus und der Widerstand einzelner Priester vielfach und überzeugend nachweisen. „Ich habe den Eindruck“, schrieb der Arnsberger Regierungspräsident in seinem Lagebericht für die Monate August/September 1934 an das preußische Innenministerium, „als wenn gewisse Teile der Geistlichkeit, die früher stark politisch in führenden Stellen der Zentrumspartei tätig waren, immer noch um ihre alte politische Machtstellung kämpfen. Diese ‚politisch Eingestellten‘ sind überall herauszufinden. Sie werden auch schwer zu bessern sein. Die Beseitigung der ‚politischen Pastöre‘ muß durch konsequenten langsamen Druck erfolgen.“177 Besonders entschiedenen Widerstand gegen das Regime leistete von Anfang an der Arnsberger Propst Joseph Bömer, der bis zur deren Auflösung auch Vorsitzender der Zentrumspartei des Kreises Arnsberg war.178 Er scheute dabei auch keine Auseinandersetzungen mit Bürgermeister Isphording und Landrat Teipel. Wegen „permanenter Hetze“ gegen den nationalsozialistischen Staat wurde Bömer 1936 zu 150 Reichsmark Geldstrafe und neun Monaten Zucht176 177 178
Klein, Katholisches Milieu und Nationalsozialismus (wie Anm. 85), S. 249. Knepper-Babilon/Kaiser-Löffler, Widerstand (wie Anm. 173), S. 35. Bömer war seit 1930 Propst der Laurentiusgemeinde. Er hat seine Auseinandersetzungen mit der Arnsberger NSDAP in der Chronik der Propsteigemeinde niedergeschrieben.
herzogtum westfalen bd2 teilbd1 - beitrag02 schulte-hobeln - seiten0083-0140.indd 124
06.11.2012 14:47:12
125
Staat und Politik im 20. Jahrhundert
DQ6 ,.ßQt~nt~~u~ Quf b~m
![Das Kloster Hude im Herzogthum [Herzogtum] Oldenburg](https://dokumen.pub/img/200x200/das-kloster-hude-im-herzogthum-herzogtum-oldenburg.jpg)


![Entwicklungsprobleme einer Region: Das Beispiel Rheinland und Westfalen im 19. Jahrhundert [1 ed.]
9783428449590, 9783428049592](https://dokumen.pub/img/200x200/entwicklungsprobleme-einer-region-das-beispiel-rheinland-und-westfalen-im-19-jahrhundert-1nbsped-9783428449590-9783428049592.jpg)


![Das Wasserentnahmeentgeltgesetz Nordrhein-Westfalen: Bestandsaufnahme und Evaluierung [1 ed.]
9783428543649, 9783428143641](https://dokumen.pub/img/200x200/das-wasserentnahmeentgeltgesetz-nordrhein-westfalen-bestandsaufnahme-und-evaluierung-1nbsped-9783428543649-9783428143641.jpg)


![Die deutschen Königspfalzen. Band 6: Nordrhein-Westfalen: Teilband 3: Westfalen [1 ed.]
9783666352256, 9783525352250](https://dokumen.pub/img/200x200/die-deutschen-knigspfalzen-band-6-nordrhein-westfalen-teilband-3-westfalen-1nbsped-9783666352256-9783525352250.jpg)