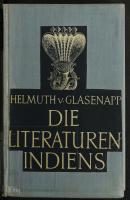Die koloniale Karibik: Transferprozesse in hispanophonen und frankophonen Literaturen 9783110281163, 9783110281590
This analysis of the kaleidoscopic world of the 19th-century Caribbean and the literary and cultural transfers that took
242 81 1MB
German Pages 293 [296] Year 2012
Polecaj historie
Table of contents :
I. Einleitung
I.1 Schlaglichter
I.2. Drei Thesen
I.3. Voraussetzungen
I.3.1. Gegenstand der Untersuchung
I.3.2. Vergleich von Zirkulations- und Transferprozessen
I.3.3 Textkorpus
I.3.4. Zum Aufbau
I.3.5. Kontexte der Forschung
I.4. Die Karibik als Kaleidoskop kolonialer Dynamiken (1789-1886)
I.4.1. Die hispanophone Karibik
I.4.2. Die frankophone Karibik
I.4.3. Pro Sklaverei
I.4.4. Contra Sklaverei
I.4.5. Haiti: zur Dialektik der Imitation
I.5. Debatten um Abolition in Frankreich und Spanien
I.5.1. Debatten um Abolition in Frankreich (1789-1848)
I.5.2. Debatten um Abolition in Spanien (1810-1886)
I.6. Fragen des Zusammenlebens
I.6.1. Wer ist Mensch?
II. Literatur und koloniale Frage
II.1. Vorstellungen von citoyenneté/ciudadanía am Vorabend der Unabhängigkeit
II.1.1. Rousseaus Überlegungen zum citoyen und deren Folgen für die Französische Revolution
II.1.2. Zwischen «edlem Wilden» und citoyen: Rousseaus Fallbeispiel der Kariben
II.1.3. Citoyenneté und ihre Rezeption in der Karibik
II.1.3.1. José María Heredia: ein Leser Rousseaus
II.1.3.2. J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles (1835)
II.2. Zwischen Frankophilie und Autonomiebestrebungen: Postkoloniale Theoriebildung und das 19. Jahrhundert
II.2.1. Gómez de Avellaneda: Sab (1841)
II.2.2. Louis de Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835)
II.2.3. Literarische Inszenierungen des spanischen und französischen Kolonialismus
II.3. Raumdynamiken und koloniale Positionierung
II.3.1. Émeric Bergeaud: Stella (1859)
II.3.2. Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835). Oder: kreolische Lianen
II.3.3. Eugenio María de Hostos: La peregrinación de Bayoán (1863). Oder: ein Pilger in den Mangroven
II.3.4 Fazit
III. Literarische Momentaufnahmen des Dazwischen
III.1. Die kreolische Oberschicht
III.2. Begriffliche Unzulänglichkeit von patrie/Nation/Exil
III.2.1. «Una cubana escritora no es siempre una escritora cubana»: die Condesa de Merlín
III.3. Haiti als Zwischen-Kultur
III.3.1. Der haitianische turn
III.3.2. Die Haiti-Rezeption in den karibischen Literaturen
III.4. Ideentransfers: Zentrum-Kolonie
III.4.1. Philanthropie im Zentrum: gescheiterte Ideentransfers
III.4.2. Erfolgreiche Ideentransfers
III.5. Dazwischen und die Figur des Mulatten
III.6. Inselfunktion oder zwischen Natur und Kultur
III.7. Zwischen transtropischen Dimensionen: Xavier Eyma und die Philippinen
III.8. Zwischen Literatur und Naturwissenschaft
IV. Ethnologische Zirkulationsprozesse
IV.1. Labeling People: «Rasse»-Diskurse in Frankreich und Spanien
IV.1.1. Die Phrenologie
IV.1.2. Geographie und Imperialismus
IV.1.3. Ethnologie, Anthropologie und Zivilisierung der «Rassen»
IV.1.4. Konstruktionen des Anderen: erste sozialwissenschaftliche Versuche
IV.1.5. Entstehung der Anthropologie in Spanien
IV.2. Die Revue des Colonies als Transfermedium innerhalb einer kolonialen frankophonen Diaspora
IV.2.1. Sklavereikritik und mission civilisatrice
IV.2.2. Weiß-Sein im Dazwischen: colon, homme du bien und mœurs créoles
IV.2.3. Weiß-Sein auf Haiti
IV.2.4. Transkoloniale Dimension
IV.2.5. Innerkaribische Dimension
IV.2.6. Ideentransfer
IV.2.6.1. Die Rezeption der haitianischen Revolution
IV.2.6.2. Ideentransfer Metropole-Kolonie
IV.2.7. Verschmelzung als Programm
IV.3. Haiti und die Revue encyclopédique
IV.3.1. Die Revue encyclopédique und koloniale Fragen
IV.3.2. Kolonialismus und panafrikanische Ideen
IV.4. Literarische Transferprozesse in der Revue des deux mondes
IV.4.1. Gustave d’Alaux: erste Versuche haitianischer Literaturgeschichtsschreibung
IV.4.1.1. Die littérature jaune: zwischen Frankophilie und Plagiat
IV.4.1.2. Haitianische Herrscher als Despoten
IV.4.1.3. Voraussetzungen intellektueller Arbeit auf Haiti
IV.4.1.4. Essentialistische Zuschreibungen als Inspirationsquelle
IV.4.2. Charles de Mazade: «La société et la littérature à Cuba»
IV.4.3. Die Condesa de Merlín: «Les esclaves dans les colonies espagnoles»
IV.4.4. Lerminier: «Les rapports de la France avec le monde»
V. Die imperiale Dimension der französischen Romantik: Asymmetrische Relationalitäten
V.1. Richtung Madrid oder Paris?
V.2. Dominante Rezeption der französischen Romantik
V.3. Rezeptionsvarianten
V.4. Das Modell Hugo
V.5. Das Modell Chateaubriand
V.6. Die Rezeption der französischen Romantik und ihre kulturhegemonialen Folgen
VI. Transkaribische Dimensionen: New Orleans als Zentrum frankophoner Zirkulationsprozesse
VI.1. Frankreich und Spanien als Kolonialmächte in Louisiana
VI.2. Karibisches Louisiana
VI.2.1. Victor Séjour: «Le mulâtre» (1837)
VI.2.2. Die Rückkehr nach Haiti. Joanni Questy: «Monsieur Paul» (1867)
VI.2.3. Joseph Colastin Rousseau: «nos frères d’outre-golf»
VI.3. Les Cenelles: Schreiben im Dazwischen
VI.3.1. Imitation der französischen Romantik
VI.3.2. Dazwischen: Zerrissenheit und Produktivität
VII. Exkurs: Paradigmenwechsel in der historischen Karibikforschung und ihre narrative Inszenierung
VII.1. Gomez de Avellaneda mit Maryse Condé lesen
VII.1.1. Mangroven und die Inszenierung einer identité relationnelle
VII.2. Raphaël Confiant
VII.2.1. Adèle et la pacotilleuse
VII.2.2. Von Insularität zu Archipelisierung
VII.2.3. Vom statischen Exilbegriff über den Black Atlantic zum Dazwischen
VII.2.4. Von Identitätskonzepten zu Fragen des Zusammenlebens
VII.2.5. Topoi der Karibikforschung oder von der Créolité zum Tout-monde
VIII. ZusammenLebensWissen oder von der Relevanz einer Karibikforschung zum 19. Jahrhundert
VIII.1. Wissensnormen von Zusammenleben: Utopien von Caribeanidad
VIII.2. Wissensformen von Zusammenleben. Ein ethnographisches Suchen oder die Frage der Distanz und des Abstands zum Anderen
VIII.3. Absage an essentialistische Identitätsmodelle
IX. Fazit
X. Literaturverzeichnis
X.1. Primärliteratur
X.2. Weitere Primärquellen
X.3. Ethnologische Zeitschriften
X.4. Sekundärliteratur
X.5. Internetquellen
Citation preview
mimesis Romanische Literaturen der Welt Band 53 herausgegeben von Ottmar Ette
Gesine Müller
Die koloniale Karibik Transferprozesse in hispanophonen und frankophonen Literaturen
De Gruyter
Gedruckt mit freundlicher Untersützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
ISBN 978-3-11-028116-3 e-ISBN 978-3-11-028159-0 ISSN 0178-7489
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2012 Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin/Boston Gesamtherstellung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen ∞ Gedruckt auf säurefreiem Papier Printed in Germany www.degruyter.com
Inhaltsverzeichnis
I.
II.
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.1 Schlaglichter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.2. Drei Thesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3. Voraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.1. Gegenstand der Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.2. Vergleich von Zirkulations- und Transferprozessen . . I.3.3. Textkorpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.4. Zum Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.3.5. Kontexte der Forschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4. Die Karibik als Kaleidoskop kolonialer Dynamiken (1789–1886) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.1. Die hispanophone Karibik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.2. Die frankophone Karibik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.3. Pro Sklaverei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.4. Contra Sklaverei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.4.5. Haiti: zur Dialektik der Imitation . . . . . . . . . . . . . . . . . I.5. Debatten um Abolition in Frankreich und Spanien. . . . . . . . . . I.5.1. Debatten um Abolition in Frankreich (1789–1848). . . I.5.2. Debatten um Abolition in Spanien (1810–1886) . . . . . I.6. Fragen des Zusammenlebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I.6.1. Wer ist Mensch? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatur und koloniale Frage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1. Vorstellungen von citoyenneté/ciudadanía am Vorabend der Unabhängigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.1.1. Rousseaus Überlegungen zum citoyen und deren Folgen für die Französische Revolution . . . . . . II.1.2. Zwischen «edlem Wilden» und citoyen: Rousseaus Fallbeispiel der Kariben . . . . . . . . . . . . . . . II.1.3. Citoyenneté und ihre Rezeption in der Karibik . . . . . . II.1.3.1. José María Heredia: ein Leser Rousseaus . . II.1.3.2. J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles (1835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.2. Zwischen Frankophilie und Autonomiebestrebungen: Postkoloniale Theoriebildung und das 19. Jahrhundert . . . . . . II.2.1. Gómez de Avellaneda: Sab (1841) . . . . . . . . . . . . . . . . II.2.2. Louis de Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835) . . . . II.2.3. Literarische Inszenierungen des spanischen und französischen Kolonialismus . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 1 4 5 5 9 15 17 19 23 24 26 28 30 34 36 36 44 49 52 55 55 56 57 58 59 62 64 66 69 72 V
II.3.
III.
IV.
VI
Raumdynamiken und koloniale Positionierung . . . . . . . . . . . . II.3.1. Émeric Bergeaud: Stella (1859) . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3.2. Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835). Oder: kreolische Lianen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3.3. Eugenio María de Hostos: La peregrinación de Bayoán (1863). Oder: ein Pilger in den Mangroven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II.3.4 Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 78
Literarische Momentaufnahmen des Dazwischen . . . . . . . . . . . . . . . . . III.1. Die kreolische Oberschicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.2. Begriffliche Unzulänglichkeit von patrie/Nation/Exil . . . . . . . III.2.1. «Una cubana escritora no es siempre una escritora cubana»: die Condesa de Merlín . . . . . . . . . III.3. Haiti als Zwischen-Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3.1. Der haitianische turn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.3.2. Die Haiti-Rezeption in den karibischen Literaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4. Ideentransfers: Zentrum–Kolonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4.1. Philanthropie im Zentrum: gescheiterte Ideentransfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.4.2. Erfolgreiche Ideentransfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.5. Dazwischen und die Figur des Mulatten . . . . . . . . . . . . . . . . . III.6. Inselfunktion oder zwischen Natur und Kultur . . . . . . . . . . . . III.7. Zwischen transtropischen Dimensionen: Xavier Eyma und die Philippinen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III.8. Zwischen Literatur und Naturwissenschaft . . . . . . . . . . . . . . .
87 89 93
Ethnologische Zirkulationsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1. Labeling People: «Rasse»-Diskurse in Frankreich und Spanien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.1. Die Phrenologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.2. Geographie und Imperialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.3. Ethnologie, Anthropologie und Zivilisierung der «Rassen» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.1.4. Konstruktionen des Anderen: erste sozialwissenschaftliche Versuche . . . . . . . . . . . . IV.1.5. Entstehung der Anthropologie in Spanien . . . . . . . . IV.2. Die Revue des Colonies als Transfermedium innerhalb einer kolonialen frankophonen Diaspora . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.1. Sklavereikritik und mission civilisatrice . . . . . . . . . . IV.2.2. Weiß-Sein im Dazwischen: colon, homme du bien und mœurs créoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.3. Weiß-Sein auf Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.4. Transkoloniale Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
82 85
96 101 101 104 107 107 109 112 114 116 119 123 125 129 131 133 135 136 139 144 150 154 156
IV.3.
IV.4.
V.
VI.
IV.2.5. Innerkaribische Dimension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.6. Ideentransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.6.1. Die Rezeption der haitianischen Revolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.2.6.2. Ideentransfer Metropole–Kolonie. . . . . . . . IV.2.7. Verschmelzung als Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haiti und die Revue encyclopédique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.3.1. Die Revue encyclopédique und koloniale Fragen . . . IV.3.2. Kolonialismus und panafrikanische Ideen . . . . . . . . . Literarische Transferprozesse in der Revue des deux mondes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1. Gustave d’Alaux: erste Versuche haitianischer Literaturgeschichtsschreibung . . . . . . . . IV.4.1.1. Die littérature jaune: zwischen Frankophilie und Plagiat . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1.2. Haitianische Herrscher als Despoten . . . . IV.4.1.3. Voraussetzungen intellektueller Arbeit auf Haiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.1.4. Essentialistische Zuschreibungen als Inspirationsquelle . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.2. Charles de Mazade: «La société et la littérature à Cuba» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.3. Die Condesa de Merlín: «Les esclaves dans les colonies espagnoles» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV.4.4. Lerminier: «Les rapports de la France avec le monde» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die imperiale Dimension der französischen Romantik: Asymmetrische Relationalitäten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.1. Richtung Madrid oder Paris? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.2. Dominante Rezeption der französischen Romantik . . . . . . . . V.3. Rezeptionsvarianten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.4. Das Modell Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.5. Das Modell Chateaubriand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.6. Die Rezeption der französischen Romantik und ihre kulturhegemonialen Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transkaribische Dimensionen: New Orleans als Zentrum frankophoner Zirkulationsprozesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.1. Frankreich und Spanien als Kolonialmächte in Louisiana . . . VI.2. Karibisches Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2.1. Victor Séjour: «Le mulâtre» (1837) . . . . . . . . . . . . . . VI.2.2. Die Rückkehr nach Haiti. Joanni Questy: «Monsieur Paul» (1867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI.2.3. Joseph Colastin Rousseau: «nos frères d’outre-golf» . .
159 162 162 164 165 171 171 173 176 177 178 182 188 190 194 197 200
205 205 207 209 211 213 219
223 223 225 226 229 232 VII
VI.3.
Les Cenelles: Schreiben im Dazwischen . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 VI.3.1. Imitation der französischen Romantik . . . . . . . . . . . . 235 VI.3.2. Dazwischen: Zerrissenheit und Produktivität . . . . . . . 237
VII. Exkurs: Paradigmenwechsel in der historischen Karibikforschung und ihre narrative Inszenierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.1. Gómez de Avellaneda mit Maryse Condé lesen . . . . . . . . . . . VII.1.1. Mangroven und die Inszenierung einer identité relationnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2. Raphaël Confiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.1. Adèle et la pacotilleuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.2. Von Insularität zu Archipelisierung . . . . . . . . . . . . . . VII.2.3. Vom statischen Exilbegriff über den Black Atlantic zum Dazwischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.4. Von Identitätskonzepten zu Fragen des Zusammenlebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII.2.5. Topoi der Karibikforschung oder von der Créolité zum Tout-monde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. ZusammenLebensWissen oder von der Relevanz einer Karibikforschung zum 19. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.1. Wissensnormen von Zusammenleben: Utopien von Caribeanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.2. Wissensformen von Zusammenleben. Ein ethnographisches Suchen oder die Frage der Distanz und des Abstands zum Anderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII.3. Absage an essentialistische Identitätsmodelle . . . . . . . . . . . . .
239 239 240 244 245 246 248 250 252
255 255
259 262
IX.
Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
X.
Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.1. Primärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.2. Weitere Primärquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.3. Ethnologische Zeitschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.4. Sekundärliteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X.5. Internetquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
273 273 274 275 275 284
I.
Einleitung
I.1
Schlaglichter
1) «Das Neue und Besondere unserer Zeit besteht in der Vieldimensionalität ihrer Beziehungen, in der Schnelligkeit ihrer elektronischen Kommunikationsmedien, was dazu führt, dass wir kontinuierlich erfahren, was momentan in anderen Breitengraden passiert.»1 Globale Vernetzung der Welt. Man hat den Eindruck, es ist von heute. Aber das schreibt ein Franzose 1850 in einem Artikel zu Gesellschaft und Literatur auf Kuba. Das Ganze in der Pariser Revue des deux mondes, Zeitschrift der zwei Welten. 2) Szenenwechsel, Väter und Söhne auf Guadeloupe. Eine Gardinenpredigt in Levilloux’ Les créoles ou la Vie aux Antilles von 1835: «Mein Sohn, ich habe Deinen Briefen entnehmen müssen, dass Du von einem neuen Geist besessen bist. Lass Dich nicht von den Ideen anderer Weißer täuschen […]. Sie könnten in Wirklichkeit Mulatten sein.»2 Der Sohn ist zum Studium von Guadeloupe nach Paris ausgezogen. Dort ist er von «diesen Ideen» angesteckt worden. «Die Ideen» sind philanthropisch, revolutionär und stellen die Sklaverei in Frage. Grund genug für den Vater, den Sohn zur Raison zu bringen. Und am Ende, nach seiner Rückkehr, überzeugt sich der Sohn schließlich selbst davon, dass die Sklaverei in Wirklichkeit die menschenfreundlichste Erfindung ist – für die Schwarzen. 3) In Gómez de Avellanedas abolitionistischem Roman kommt mit Sab ein Sklave selbst zu Wort: «Ich habe keine Heimat zu verteidigen, denn Sklaven haben keine Heimat.»3 Heimatlosigkeit in der Hochphase des Nationalismus. 4) 1835: Der Dichter Maynard de Queilhe reist vom französischen Festland ab, zurück nach Hause. Martinique. Victor Hugo beneidet seinen Dichterkollegen beim Abschied, zumindest zeit- beziehungsweise stundenweise: «Es gibt Stunden, in denen ich Sie beneide. Ein Dichter, exiliert in der Sonne, in einem Exil, das Ovid geliebt hätte. Auf Martinique, das Sie so wunderbar beschrieben haben.»4 In dem Roman Outre-mer des Beneideten klingt das ganz anders.
1
2 3 4
Charles de Mazade: La société et la littérature à Cuba. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, Bd. XII (1851), S. 1017–1035, hier S. 1018 (Übersetzung GM). Für ein intensives Lektorat der gesamten Studie sowie unzählige konstruktive Anregungen danke ich Marion Schotsch. J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles. Gefolgt von: Thérèse Bentzon: Yette. Morne-Rouge: Éd. des Horizons Caraïbes (1835) 1977, S. 23 (Übersetzung GM). Gertrudis Gómez de Avellaneda: Sab. Hg. von José Servera. Madrid: Cátedra (1841) 1997, S. 36 (Übersetzung GM). Victor Hugo: Bug-Jargal ou la Révolution haitienne. Les deux versions du roman 1818 et 1826. Hg. von Roger Toumson. Fort-de-France: Désormeaux 1979, S. 69 (Übersetzung GM).
1
5)
6)
7)
8)
5 6
7
8 9
2
Der Protagonist beschwert sich: «Aber ich, weshalb muss ich mein Vaterland [d. h. Festland-Frankreich] verlassen? Warum gibt es diese verfluchte Insel namens Martinique?»5 Louisiana, New Orleans um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Free People of Color. Sie sind Flüchtlinge der haitianischen Revolution, meist via Kuba. Die Nachkommen haben die heimatliche Erde noch nicht gesehen. Aber sie wollen «zurück», und die Literatur hält sie bei der Stange. So Monsieur Paul in einer Erzählung des louisianischen Autors Joanni Questy von 1867: «Mein Freund, Sie werden Georges nach Haiti zurückschicken. Schließlich ist er klug, jung und begabt. Er wird seinen Weg in diesem Land gehen. Georges hat einen Sinn für Freiheit. Vergessen Sie das nicht.»6 An Bord der Lara kommen am 25. Juli 1860 wirklich 250 Emigranten nach Port-au-Prince zurück. Le Progrès, die damals wichtigste haitianische Tageszeitung, jubelt: «Wir beglückwünschen die Ankunft unserer neuen Brüder. Wir alle werden Freiheit und Gleichheit erleben unter den haitianischen Palmen, in Port-auPrince, der Hauptstadt der schwarzen Rasse in der zivilisierten Welt»7. Transatlantische Solidarität wird selbst auf Straßenschildern bekundet, so in der Calle O’Reilly in Alt-Havanna: «Irland und Kuba: zwei Inseln, die dasselbe Meer von Sorgen und Hoffnung teilen»8. Irische Emigranten zog es zwar vor allem auf die britischen Kolonialbesitzungen Barbados und Jamaika, aber viele landeten auch auf Kuba. Die sklavereikritische Revue des Colonies aus Paris, die überall in den französischen Kolonien gelesen wurde, träumt zu Beginn der 1840er (also noch vor der Abschaffung der Sklaverei) von einem Rassenmix der Zukunft. Ideen, die man ein paar Jahre später auch bei den fortschrittlichen Intellektuellen auf Kuba wiederfinden wird: «Aus diesen Weißen, den Schwarzen, den Roten wird sich eine neue Mischrasse aus Europäern, Afrikanern und Amerikanern ergeben. Diese werden in einigen Generationen und nach verschiedenen Überkreuzungen neue Farben schaffen: über erdfarben, rehbraun, nougat, hin zu Orangetönen und einem blassen Kupfergelb.»9 1870 kommt der aus Puerto Rico stammende Eugenio María de Hostos auf den neuralgischen Punkt zu sprechen, der das ganze 19. Jahrhundert um-
Louis de Maynard de Queilhe: Outre-mer. 2 Bände. Paris: Renduel 1835, Bd. I, S. 43 (Übersetzung GM). Joanni Questy: Monsieur Paul. In: La Tribune de la Nouvelle-Orléans (25. Oktober–3. November 1867) (Übersetzung GM). Online verfügbar unter: http://www.centenary.edu/french/textes/paul.html [05.02.2011] Le Progrès. Journal Politique [Port-au-Prince] (8. September 1860), zit. nach Jean-Marc Allard Duplantier: «Nos frères d’outre-golf». Spiritualism, Vodou and the Mimetic Literatures of Haiti and Louisiana. Dissertation Louisiana State University 2006. Online verfügbar unter: http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11152006-152550/unrestricted/Duplantier_dis.pdf, S. 163 [15.12.2010] (Übersetzung GM). Gerry Adams: Cuba and Ireland. Two Islands in the Same Sea of Struggle. Online verfügbar unter: http://www.seeingred.com/Copy/5.0_cuba_ireland.html [22.02.2011]. Revue des Colonies (Juli 1836), S. 20f. (Übersetzung GM).
treibt. In einer Rede stellt er die Frage: «Was sind die Antillen?» So wie man anderswo fragt, was ist Deutschland, was ist Frankreich... Geht es ihm um einen pan-antillanischen Nationalismus, à la Bolívar? Seine Antwort belehrt uns eines Besseren. Schon wieder fühlt man sich ins 21. Jahrhundert versetzt: Die Antillen sind «die Verbindung, die Fusion verschiedener Ideen aus Europa und den Amerikas. Die Fusion der Rassen. Die natürliche geographische Verbindung zwischen Nord- und Südamerika. Letztlich eine transzendentale Fusion.»10 9) Vor diesem Hintergrund nimmt sich Édouard Glissants Antwort in seinem Discours antillais, über 100 Jahre später geschrieben, wenig spektakulär aus: «Was ist die Karibik in Wirklichkeit? Eine vielfältige Serie von Relationalitäten.»11 Werden nicht in der Karibik des 19. Jahrhunderts Phänomene und Prozesse vorweggenommen, die heute erst ins Bewusstsein gelangen? Der Blick auf die kaleidoskopartige Welt der Karibik in jener Epoche erlaubt völlig neue Einsichten in die frühen Prozesse der kulturellen Globalisierung. Rassistische Diskurse, etablierte Modelle «weißer» Abolitionisten, Erinnerungspolitiken und die bisher kaum wahrgenommene Rolle der haitianischen Revolution verbinden sich zu einem Amalgam, das unser gängiges Konzept einer genuin westlichen Moderne in Frage stellt. Migration, Zirkulation und Vernetzung zwischen verschiedensten geographischen Räumen, aber auch Orientierungs- und Heimatlosigkeit gelten als charakteristisch für unsere heutigen Gesellschaften. Diese Phänomene der Deterritorialisierung lassen sich in der karibischen Inselwelt schon für das 19. Jahrhundert beobachten, wo beispielsweise Piraten und Sklavenhändler zwischen Imperien und Kontinenten hin- und hersegeln, Schriftsteller von einem Exil ins nächste fliehen, oder auch analphabetische Kleinkrämerinnen als Nachrichtenüberbringer zwischen den Welten fungieren. Gerade das macht die Karibik des 19. Jahrhunderts zu einem faszinierenden Ausgangspunkt für die Untersuchung der (kulturellen) Bruchstellen kolonialer Systeme, die letztlich in kulturelle (und politische) Emanzipation münden. Die Inselwelt oder auch Insel-Welt12 der Karibik im 19. Jahrhundert kann als Kaleidoskop kolonialer Strukturen und Dynamiken gelesen werden.13 In diesem
10
11 12 13
Eugenio María de Hostos: Diario. Eintrag vom 28. März 1870, S. 284f., zit. nach Antonio Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo en el Caribe del siglo XIX. In: Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe 4, 8 (2007), S. 41–74, hier S. 48. Online verfügbar unter: http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/ memorias/memorias_8/articulos/gaztambide.pdf [10.12.2010] (Übersetzung GM). Édouard Glissant: Le discours antillais. Paris: Gallimard 1997, S. 426. Ottmar Ette: ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2005, S. 123. Diese Inselwelten haben ihre stets eigene Logik. Vgl. dazu auch Ottmar Ette: Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009, S. 32. Vgl. auch Gesine Müller: El Caribe como caleidoscopio de dinámicas coloniales (1789–1886). In: Liliana Gómez, Gesine Müller (Hg.): Relaciones caribeñas. Entre-
3
karibischen Kaleidoskop verdichten sich koloniale Erfahrungen im Wirkungskreis unterschiedlichster hegemonialer und peripherer Systeme und geben Anlass zu Anlehnung und Abgrenzung, zu Austausch und Konfrontation. Die vorliegende Studie möchte die kulturellen Transferprozesse, die sich innerhalb der Karibik abspielen, zur ihr hin gerichtet sind oder von ihr ausgehen, in einer besonders spannenden und zugleich noch wenig bearbeiteten Phase der kolonialen Schwellensituation (1789–1886) in den Fokus nehmen: von der Französischen Revolution, mit der Ausrufung der Menschenrechte und ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die revolutionären Ereignisse Haitis, bis hin zur Abschaffung der Sklaverei auf Kuba (1880/1886). In dieser Zeitspanne kondensiert sich die Erfahrung zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit.
I.2.
Drei Thesen
Anliegen dieser Untersuchung ist es, kulturelle Wirkungsweisen verschiedenartiger kolonialer Herrschaftssysteme aufzuzeigen. Es geht um den Vergleich von Transferprozessen auf der Zentrum-Peripherie-Achse, innerperipher, zentrumsquerend und transareal, bei dem sich alle Seiten in dynamischer Interaktion engagieren. Literarische Repräsentationsformen werden dabei im breiteren Kontext von Kultur- und Wissenszirkulation verortet. Der Vergleich zwischen frankophoner und hispanophoner Karibik zeigt die unterschiedliche Rezeption, Aneignung und Transkulturation mutterländischer Diskurse sowie deren Rückwirkungen auf die Fremdbilder in der Metropole. Drei Thesen leiten die Untersuchung: 1) Die starke Strahlungs- und Bindungskraft Frankreichs ist auf seine Kapazität zurückzuführen, das koloniale Andere zu integrieren beziehungsweise sich im Angesicht des Anderen selbst zu transformieren. Symptomatisch dafür sind die Neuordnung des Wissens und ihre Institutionalisierung zu Beginn des 19. Jahrhunderts (vor allem mit der Entstehung der Ethnologie als wissenschaftlicher Disziplin). 2) Der Verlust eines kulturell bindenden Zentrums im Falle der spanischen Kolonien wirkt sich insofern produktiv auf die koloniale Literatur aus, als er die Suche nach neuen Anknüpfungspunkten und Vernetzungen fördert und damit Anlass gibt zu einer (die karibische Literatur in zunehmendem Maße prägenden) Multirelationalität. Das «Zwischen-Welten-Schreiben» bringt damit literarische Entwürfe hervor, die zwar als foundational fictions (Doris Sommer) treffend beschrieben werden, deren Einordnung in die Kategorie der Nationalliteraturen jedoch problematisch ist. 3) Die Erforschung der Karibik im 19. Jahrhundert kann über diesen zeitlichen Rahmen hinaus aktuelle Diskussionen um Identitätsfragen in der vierten Phase beschleunigter Globalisierung perspektivieren: Als weit fruchtbarer als der Identitätsbegriff erweist sich die Frage nach einem Wissen vom Zusammen-
cruzamientos de dos siglos = Relations caribéennes. Frankfurt am Main: Lang 2011, S. 13–36.
4
leben, die nicht nur einen neuen Blick auf die Texte des 19. Jahrhunderts ermöglicht, sondern auch geeignet ist, zeitgenössische literarische Inszenierungen sowie kulturwissenschaftliche Debatten aus einem alten Zusammenhang heraus neu zu betrachten. Diese Studie versteht sich auch als Rehabilitierung karibischer Literaturen. Die Vorstellung, dass die frankophone und hispanophone Karibik im 19. Jahrhundert nur als Außenposten der europäischen Metropolen Madrid und Paris verstanden werden kann, wird sich im Folgenden in mehrfacher Hinsicht als problematisch erweisen.14
I.3.
Voraussetzungen
I.3.1. Gegenstand der Untersuchung Gegenstand der Untersuchung sind literarische und außerliterarische Repräsentationsformen, wie auch ihre stetig anwachsenden Überschneidungen, die in einer Zeit des kolonialen Umbruchs entstanden. Um der Frage nachzugehen, wie sich diverse Varianten von Kolonialismus in verschiedenen Textmedien reflektieren und ausformen, richtet sich der Blick auf parallel ablaufende Transferprozesse zwischen Mutterländern und kolonialen Einflusssphären, unter Berücksichtigung auch des interkolonialen Austauschs, selbst wenn er von der asymmetrischen Zentrum-Peripherie-Relation überlagert wird. Raum- und Zeitdimensionen sind folgende: Die Inselwelt der Karibik wird als ein zusammenhängender und zugleich heterogener und disparater Bewegungsraum behandelt, innerhalb dessen der spanische und französische Herrschaftsraum im Vordergrund stehen, sowie auch die einstige Insel Hispaniola mit dem bereits 1804 unabhängig gewordenen Haiti und der späteren Dominikanischen Republik mit ihrer bewegten Geschichte wechselnder Abhängigkeiten. Damit sind die Extreme erfasst, die ein Feld abstecken, innerhalb dessen vielfältige Zirkulationsprozesse ablaufen, ein Feld, das sich erstreckt von der frühsten Separation im Falle Haitis bis hin zu einer fortdauernden Zugehörigkeit zum (französischen) Mutterland im Fall von Guadeloupe und Martinique; von der sozialen Revolution, Abolition und Emanzipation der schwarzen Unterschichten (Haiti) bis hin zur späten Abschaffung der Sklaverei auf Kuba (1880/1886). Dieses Feld ist aber nicht hermetisch, sondern immer dynamisch und weltweit offen. Zudem geht die Arbeit von einem Karibik-Verständnis aus, das immer auch die zirkumkaribischen Regionen miteinschließt. Unter Gran Caribe werden die tropischen und subtropischen Küstenfassaden des Atlantiks von Charleston
14
Vgl. hierzu auch Tim Watson in seiner Einführung: «My book works against the idea that the Caribbean was a nineteenth-century ‚outpost‘ easily relegated to the mode of historical romance while the real story took place at the imagined centre, with the history of England.» Tim Watson: Caribbean Culture and British Fiction in the Atlantic World, 1780–1870. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2008, S. 2.
5
bis Rio verstanden, das heißt die Küsten und Flussmündungen Brasiliens (bis Bahia und Rio), Venezuelas, Neu-Granadas/Kolumbiens, Floridas und Louisianas (sofern es die Sklavereiforschung betrifft, auch die Küsten der Carolinas und Virginias) sowie die großen Antillen Kuba, Saint-Domingue/Haiti/Santo Domingo, Puerto Rico und die Vielfalt der Bahamas, der Kleinen Antillen sowie weiterer Archipele in der Karibik; unter bestimmten Gesichtspunkten werden auch die karibischen Küsten Mittelamerikas und Mexikos mit einbezogen sowie die pazifischen Küsten Kolumbiens und Ecuadors (das Übergangsgebiet des Darién sowie der Chocó).15 Zeuske betont, dass die Forschungen zur Geschichte der «großen» Karibik international und transdisziplinär exponentiell anwachsen, nachdem alle Staaten der Region nach Jahrhunderten «nationaler» Orientierung nach innen auch die Ressourcen ihrer karibischen Peripherien und die Verbindungspotenz des Konzepts entdeckt haben. Alle Gebiete der «großen» Karibik haben Gemeinsamkeiten, aber auch Individualitäten. In allen brachen unter dem Druck der Conquista, des ungewohnten Arbeitszwangs (Sklaverei, encomienda) und der von Europäern eingeschleppten Krankheiten die Indiopopulationen zusammen, was zu der demographischen Katastrophe des 15. und 16. Jahrhunderts führte. Es entstanden die großen «menschenleeren» Räume, die es den Kolonialeliten und der kreolischen Oberschicht16 ermöglichten, die Kolonialsklaverei als wichtige Exportwirtschaft und den Sklavenhandel mit Afrikanern sowie ihren Nachkommen als Akkumulationsquelle zu etablieren. In der «großen» Karibik spielte die Konkurrenz der großen Kolonialimperien des Westens (Spanien, Frankreich, England/ Großbritannien, Niederlande, Dänemark, später auch die Vereinigten Staaten) eine übermächtige Rolle – mit Auswirkungen auf Festungsbau, Schiffbau, Militär und Urbanisierung –, ebenso wie Piraterie und Schmuggel, von dem manche Historiker als einer «karibischen» Wirtschaftsweise sprechen.17 Der Untersuchungszeitraum 1789–1886 bezieht sich auf die Erfahrung einer kolonialen Schwellensituation zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Die Eckdaten sind ideen-, politik- und sozialgeschichtlich gewählt: von der Französischen Revolution mit der Ausrufung der Menschenrechte und ihren unmittelbaren Auswirkungen auf die haitianischen Ereignisse bis zur Abschaffung der Sklaverei auf der letzten (größten und bedeutendsten) Insel der Karibik, auf Kuba, 1886. Es wird also ein großer Bogen gespannt von der Lancierung des Gleichheitsgedankens in Europa bis hin zu seiner endgültigen Umsetzung in dem zentralen Punkt, der die Kolonien in dieser Zeit letztlich viel stärker umtreibt als die Frage nach der Unabhängigkeit, die meist erst zu einem Zeitpunkt akut wird, an dem die Abolition bereits erreicht worden ist. Als ehemalige Kolonie bieten die Vereinigten Staaten hier ein mögliches Vorbild für beide Seiten – sowohl für die Abolitionis-
15 16 17
6
Vgl. Michael Zeuske: Gran Caribe. Online unter: http://www.ihila.uni-koeln.de/5593. html [05.12.2010]. Eine ausführliche Beschäftigung mit dem komplexen Begriff «kreolische Oberschicht» findet sich in in Kap. IV dieser Arbeit. Vgl. http://www.ihila.uni-koeln.de/5593.html [05.12.2010].
ten wie für die Verfechter der Sklaverei –, wenn man die heftigen Spannungen zwischen Nord- und Südstaaten bedenkt. Der chronologische Rahmen der Studie verweist also auf den grundlegenden Wandel des Menschen- und Gesellschaftsbildes, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts vollzieht und umformend in die kolonialen Räume hinein übersetzt. Literaturhistorisch betrachtet, liegt der Schwerpunkt auf der Romantik, die als überregionales Epochenphänomen vom (nach)revolutionären Europa ausgeht, um dann – mit größerer Verspätung als die politischen Ideen der Revolution – in ganz Lateinamerika und im karibischen Raum rezipiert und umgesetzt zu werden (ca. 1830–1870). Allerdings lassen sich in der karibischen Umsetzung Aufklärung und Romantik nicht ohne weiteres voneinander trennen, weder hinsichtlich der chronologischen Überschneidungen noch im Hinblick auf den Eklektizismus, den viele karibische Autorinnen und Autoren18, trotz ihrer Übernahme der europäischen Epochenbegriffe, an den Tag legen. Wie bereits in der dritten These angedeutet, wird der zeitliche Rahmen insofern gesprengt, als nach einer Anschlussfähigkeit aktueller literarischer, aber auch literatur- und kulturwissenschaftlicher Lesarten kultureller Repräsentationsformen der Karibik im 19. Jahrhundert gefragt wird. Die Karibik des 19. Jahrhunderts soll so in ihrem kulturellen und politischen Austausch transareal19 mit einem besonderen Fokus auf drei unterschiedliche geographisch-politische Räume in den Blick genommen werden: 1) den hegemonialen Bereich des kolonisierenden Europa, 2) die externe Peripherie in Gestalt Afrikas und der beiden Amerikas sowie 3) die Dynamik ihres internen sprachenund kulturenübergreifenden Austauschs zwischen den Inseln. Was das hegemoniale kolonisierende Europa angeht, liegen die Beziehungen und Einflüsse besonders deutlich auf der Hand: jede Kolonie stand in enger Verbindung mit ihrem Mutterland. Allerdings verkompliziert sich dies im Falle der hispanophonen Karibik, für die das koloniale Zentrum Spanien aufgrund seiner
18
19
Für die folgenden Ausführungen möchte ich betonen, dass ich bei Verwendung der männlichen Form immer auch Autorinnen, wie beispielsweise Gertrudis Gómez de Avellaneda und die Condesa de Merlín, mit einbeziehe. Die Arbeit rekurriert auf das Instrumentarium der TransArea Studies, insofern gerade jene Austausch- und Transformationsprozesse im Zentrum stehen, die im globalen Maßstab direkt zwischen unterschiedlichen kulturellen Areas und ohne unmittelbare Zentrierung durch Europa verlaufen. Vgl. Ottmar Ette: ZusammenLebensWissen. List, Last und Lust literarischer Konvivenz im globalen Maßstab. Berlin: Kadmos 2010, S. 11f. Es versteht sich von selbst, dass diese Methode nicht historische Realitäten des 19. Jahrhunderts unberücksichtigt lässt: ein Zeitpunkt, zu dem auf Grund kolonialer Konstellationen Europas zentraler Charakter außer Frage steht. Zur transarealen Dimension karibischen Schreibens vgl. auch Torres Saillant, auch wenn der puertoricanische Kulturtheoretiker im Gegensatz zu Ette nicht konkret den Begriff benutzt, indirekt aber damit arbeitet: «The world consists of culture areas and distinct regions whose interconnectedness does not preclude their discreteness. As a chronicle of Caribbean though, this work enacts a postulation of the need to subdivide the intellectual history of humanity into manageable chunks, namely, countries, regions cultures areas, and the like.» Silvio Torres Saillant: An Intellectual History of the Caribbean. New York: Palgrave Macmillan 2006, S. 1.
7
kulturellen Schwäche erheblich an Strahlungskraft einbüßte. Daraus ergibt sich eine Offenheit für vielfältige andere kulturelle Einflüsse und Vorbilder, die in den spanischen Kolonien nicht nur Desorientierung auslösten, sondern die kulturelle Produktion zugleich auch in erheblichem Maße stimulierten. Gerade an diese «produktive Multirelationalität» knüpft sich die Frage nach den Rückwirkungen dieser kulturellen Manifestationen auf die europäischen Mutterländer.20 Zum Austausch mit der externen Peripherie gehören die noch kaum untersuchten Transferprozesse mit den jungen Vereinigten Staaten. Natürlich spielen die USA gegen Ende des Jahrhunderts in zunehmendem Maße die Rolle eines Kolonisators, wirtschaftlich wie auch militärisch und politisch. Doch zunächst handelt es sich bei den nördlichen Nachbarn um Kolonien, die sich aus der Abhängigkeit befreit haben und die daher durchaus als Modell in Frage kommen, zumindest wo für die Akteure die Frage der Unabhängigkeit am Horizont erscheint. Dazu kommt die für die Vereinigten Staaten so zentrale Sklavenfrage, die in den Bürgerkrieg mündet und die für Ober- und Unterschichten der Karibik gegenläufige Perspektiven mit jeweils gruppenspezifisch hohem Attraktivitätswert aufzeigt. Bietet die amerikanische Revolution ein Vorbild für die Inseln der Karibik? Wenn ja, welche Bedeutung hat die Sklavenfrage, ihre Ausblendung in der Revolution und ihre Rolle im schwelenden Konflikt zwischen Nord- und Südstaaten? Ist die nordamerikanische (als postkoloniale) Literatur in ihrer Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten und einer eigenen Identität sowie in ihrem Bemühen, sich vom literarischen England abzugrenzen, eine Inspirationsquelle für karibische Autoren? Ähnlich wie zu den Vereinigten Staaten gestalten sich die Transferprozesse zu den lateinamerikanischen Anrainern in Mittel- und Südamerika, wenn auch in abgeschwächter und weniger ambivalenter Form. Hier bedurften die hispanokaribischen Autoren keiner Übersetzung (oder interlingualen Rezeption). Sogar unmittelbarer Austausch mit den dortigen Kulturschaffenden war möglich, zumal eine ganze Reihe karibischer Autoren auf dem Festland ihren Exilort fand. Schiebt sich der gleichsprachige kulturelle Austausch mit dem Subkontinent möglicherweise sogar in die Leerstelle, die das Mutterland hinterlassen hat? Während in diesen Fällen bei aller Asymmetrie21 anzunehmen ist, dass Transferprozesse in beide Richtungen stattfanden, dürfte der Austausch mit Afrika und Asien im wesentlichen unidirektional gewesen sein, wobei die wohl größte kulturelle Bedeutung der von Afrika versklavten und in die Karibik verfrachteten schwarzen Bevölkerung zukam, die später von indischen Fremdarbeitern abgelöst wurde. Trotz dieses einseitigen Transfers spielt natürlich der Einfluss afrikanischer und auch asiatischer Kulturen eine große Rolle. Diese Kulturen
20 21
8
Ebda., S. 108. Lüsebrink unterscheidet in Bezug auf Michael Werner zwischen folgenden Arten von Asymmetrie: Zeitliche Asymmetrie, räumlich-geographische Asymmetrie und mehrdimensionale Asymmetrien. Vgl. Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, Weimar: Metzler ²2008, S. 131.
und ihre Träger machen ihrerseits in dem neuen heterogenen Umfeld komplexe Transferprozesse durch, deren Beitrag zur kulturellen Höhenkammliteratur im 19. Jahrhundert zu klären ist. Bei den Transferprozessen innerhalb der Karibik wird man davon ausgehen können, dass sie – so schwierig sie sich ob der begrenzten Verkehrsnetze auch gestalten mochten – den höchsten Grad an Symmetrie aufwiesen. Wie gestaltete sich der innerkaribische Austausch, erstens zwischen den zum Teil gleich-, zum Teil verschiedensprachigen Inseln des Archipels, zweitens zwischen den beiden kolonial, politisch und kulturell so unterschiedlich profilierten Teilen des einstigen Saint-Domingue, zwischen Haiti und der von ihm 22 Jahre lang (1822–1844) besetzten Dominikanischen Republik? Erst bei diesem karibikinternen Austausch, der eng in das Netz der externen kolonialen und kollateralen Beziehungen eingebunden ist, kommt die kaleidoskopische Multidimensionalität kolonialer Dynamiken in vollem Maße zum Tragen. I.3.2. Vergleich von Zirkulations- und Transferprozessen Mit der kulturellen Produktion der ehemaligen karibischen Kolonien Frankreichs und Spaniens werden nicht statische Gebilde miteinander verglichen, sondern nebeneinander ablaufende und in sehr unterschiedlichen Dynamiken befindliche Transfer- und Zirkulationsprozesse zwischen Zentrum und Peripherie in einer kolonialen Schwellensituation, Prozesse, die zudem stellenweise ineinander verwoben sind und sich gegenseitig beeinflussen22. So gab es im 19. Jahrhundert kaum karibische Autoren, die sich nicht über Jahre im außerkaribischen Raum aufgehalten hätten oder zwischen ihren Herkunfts- beziehungsweise Heimatinseln und den jeweiligen Mutterländern oder anderen Exilorten mehrfach sogar gependelt wären. Die meisten waren in Europa (vornehmlich in Paris), doch einige gingen auch in bereits unabhängige Kolonien Amerikas, in die Vereinigten Staaten oder nach Mexiko. Dazu kam, dass praktisch alle politisch aktiv waren, also über ihr Schreiben hinaus im Licht der Öffentlichkeit standen – einige hatten sogar Staatsämter inne –, was sie als Knotenpunkte von spartenübergreifenden Begegnungen für die transkontinentalen Transferprozesse besonders interessant macht. Seit dem späten 18. Jahrhundert machten sich auch vermehrt europäische Gelehrte unterschiedlichster Couleur in die entlegenen transatlantischen Gebiete auf, die ihre Eindrücke und Erfahrungen in der einen oder anderen Form zu Papier brachten und publizierten.23 Die durch den fundamentalen Paradigmenwechsel der Französischen Revolution ausgelöste Neuordnung der Wissenssysteme schlug
22
23
Das geschieht im Sinne einer Histoire croisée, wie sie Bénédicte Zimmermann und Michael Werner gefordert haben. Vgl. Michael Werner, Bénédicte Zimmermann: Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der «Histoire croisée» und die Herausforderung des Transnationalen. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft 28 (2002), S. 607–636. Vgl. Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 129. Vgl. Hans-Jürgen Lüsebrink: Das Europa der Aufklärung und die außereuropäische koloniale Welt. Göttingen: Wallstein Verl. 2006, S. 11f.
9
sich in der napoleonischen Modernisierung der Institutionen nieder und wurde von ihr wiederum nachhaltig befördert, wobei gerade die Entstehung und institutionelle Verankerung der Ethnologie den Blick der Neue-Welt-Reisenden nachhaltig veränderte. Als Wissenschaftler, Schriftsteller, Politiker und Interessensvertreter, oder mehreres in einem – wie beispielsweise besonders prominent Alexander von Humboldt –, ließen sie sich von völlig anderen (Erkenntnis)Interessen leiten als die Missionare und Kolonialbeamten der vorangegangenen Epochen, mit denen die Insulaner zuvor (zu Hause) in Berührung gekommen waren. Dadurch verändert sich auch in den Zentren die Wahrnehmung der überseeischen Kolonien, die die (proto)romantisch-exotischen Vorstellungen eines Rousseau vom bon sauvage, vom Menschen im guten Naturzustand, Fleisch werden lässt – und auf diese Vorstellung wiederum nachhaltig zurückwirkt. Die Kontakte zwischen den Kultureliten von Zentrum und Peripherie sowohl hüben wie drüben gewannen eine neue Intensität, man bereiste und rezipierte sich gegenseitig; literarische Darstellung, Reisebericht, Ethnographie und politische Stellungnahme lassen sich bisweilen nicht mehr genau auseinanderhalten. Erst in dieser Konstellation intensivierter Begegnung und gegenseitigen Austauschs sind die ersten großen Gründungsfiktionen entstanden, und interessanterweise gerade dort, wo sich diese Begegnungen nicht auf die einfache Bipolarität von Kolonisator und Kolonisiertem beschränkten, sondern die Akteure sich auch für multilaterale Transkulturationsprozesse öffneten. Daher kommt der Suche nach innerkaribischen Kontakten und Mittlerfiguren eine besondere Bedeutung zu.24 Denn nicht nur der starke kulturelle Frankreichbezug, der die frankophone wie auch die hispanophone Karibik prägt, hat gegenläufige Auswirkungen auf die Emanzipationsbestrebungen, bedeutet er doch für die französischen Kolonien eine enge Anlehnung ans Mutterland und tendenziell Interesse an der Beibehaltung des Status quo, für die spanischen Kolonien hingegen eine kulturelle Anlehnung an ein fremdes und damit Abgrenzung vom eigenen Mutterland; auch die Vielfalt der relationalen Bezüge hat Einfluss auf die Produktivität und Originalität der Kulturproduktion, was mittelbar wiederum zur politischen Affirmation eines Eigenen beiträgt. Daraus resultierend wirkt sich die bipolare Orientierung der französischen Kolonien mimetisch und damit stabilisierend auf den Status quo aus. Obwohl die karibischen Autoren größtenteils den Eliten zuzurechnen sind, driften Fülle und Stichhaltigkeit der verfügbaren Informationen über ihr Leben und Wirken außerhalb ihrer Texte sehr weit auseinander: Im Falle der kanonisierten
24
10
In Gestalt der pacotilleuse hat Raphaël Confiant einer solchen Mittlerfigur in der karibischen Inselwelt, oder besser gesagt zwischen den Insel-Welten des 19. Jahrhunderts, mit seinem Roman Adèle et la pacotilleuse ein Denkmal gesetzt. Diese schwarze Kleinhändlerin, Transporteurin und Pendlerin zwischen den Karibikinseln nimmt sich der verstörten Tochter Victor Hugos an, die auf ihrer Suche nach dem mysteriösen Geliebten in der Karibik gelandet ist, um sie nach St.-Pierre, der Hauptstadt Martiniques, zu bringen, von wo sie sich schließlich gemeinsam aufmachen ins «Mutter»-Land und zum berühmten Vater der Weißen. Vgl. Raphaël Confiant: Adèle ou la pacotilleuse. Paris: Mercure de France 2005. Vgl. auch Kap. VII.2 dieser Arbeit.
Autoren der spanischen Karibik ist vieles bekannt, gerade auch durch die breit geführten literarischen und politischen Debatten, während zu den frankophonen Autoren oft nur sehr spärliches Material vorliegt. Daher muss die methodologische Herangehensweise notwendigerweise heterogen sein. Begegnungen und Kontakte zwischen den Autoren lassen sich nicht immer biographisch nachweisen, doch geht es primär um die textuelle Repräsentation selbst, die – im Unterschied zu den persönlichen Treffen und Begegnungen, die zweifellos vielfach Anlass und Inspiration zu kultureller Tätigkeit gaben – mit ihrer Veröffentlichung zugleich auch eine Breitenwirkung entfalten konnte. Damit stehen intertextuelle Bezüge, Motive, gattungsspezifische Bezugnahmen im Vordergrund, kurz Relationalitäten, die sich aus einer differenzierten Gegenüberstellung der verschiedenen kulturellen Produktionen selbst erschließen lassen. Zum besonders wertvollen Material gehören Zeitschriften, die sich vorwiegend ethnologischen und literarischen Fragestellungen widmen, wobei klare fachliche Zuordnungen noch ausbleiben. Was die Untersuchung von innerkaribischen Über-Kreuz-Rezeptionen und Kommunikationsformen zwischen den Inseln betrifft, so hat Janett Reinstädler in ihrer Pionierstudie zum karibischen Theater darauf hingewiesen, dass die Theatergruppen auch zwischen den Inseln zirkulierten, dass es also nicht nur direkten Austausch gab, sondern dieser auch in unmittelbarer Tuchfühlung und Interaktion mit einem breiten, die Unterschichten und sogar Sklaven mit umfassenden Publikum stattfand. Diese bis dato völlig unerforschten Kontakte können Aufschluss geben über gegenseitige Rezeption und Einflüsse. Wenn diese Arbeit den Schwerpunkt auf die Betrachtung von Transferprozessen legt, bedient sie sich dabei verschiedener Methoden, die im Zuge eines sogenannten transnationalen Turns besondere Aufmerksamkeit erfahren haben. Einen wichtigen Pfeiler bildet die von Michael Werner und Bénédicte Zimmermann entwickelte Histoire croisée.25 Die vorliegende Studie schreibt sich ein in das Grundanliegen, nationalgeschichtliche Sichtweisen zu überwinden. Die Histoire croisée nun versucht die spezifische Verbindung von Beobachterposition, Blickwinkel und Objekt zu konstruieren. Es geht nicht mehr um die Verflechtung als neues Forschungsobjekt, sondern um die Produktion neuer Erkenntnisse aus einer Konstellation heraus, die selbst schon in sich verflochten ist. Die Histoire croisée ist in Frankreich entstanden, unter anderem auch als Versuch, die Leitdisziplin des Komparatismus als zu statisch zu entlarven und ihr ein alternatives Modell entgegenzuhalten. Hinsichtlich der zentralen Fragestellung dieser Arbeit, eines Vergleichs des französischen und spanischen Kolonialismus, ist es bedenkenswert, inwiefern eine vergleichende Betrachtungsweise kompatibel ist mit Methoden der Histoire croisée. Komparatistische Fragestellungen bringen das grundlegende Problem mit sich, dass sie als kognitive Operationen Synchronie voraussetzen, als Geschichte aber immer mit Diachronie zu tun haben. Demgegenüber schreibt sich die Transferge-
25
Werner, Zimmermann: Vergleich, Transfer, Verflechtung. Für wertvolle Hinweise und Diskussionen zur Histoire croisée danke ich Johanna Abel und Leonie Meyer-Krentler.
11
schichte von vornherein in einen diachronen Zusammenhang ein. Im Gegensatz zum Vergleich hat die Transfergeschichte per definitionem ausschließlich Prozesse zum Gegenstand. Sie beschreibt Veränderungen, Vorgänge von Akkulturation, Sozialisation und Aneignung. Sie möchte kognitive Aporien des historischen Vergleichs umgehen, indem sie versucht, keine abstrakten Konstruktionen vorauszusetzen, die das Ergebnis vorstrukturieren. Sie richtet ihr Augenmerk auf Interaktionen und darauf, wie diese Interaktionen historisch konstruierte Einheiten verändern. Dabei ist ein wichtiges Anliegen, die Mechanismen der Rezeption und Umdeutung zu untersuchen und Vorgänge kultureller Übersetzung in den Blick zu nehmen.26 Diese Übersetzungsarbeit lässt sich sowohl unter dem Gesichtspunkt der Aneignung und Anverwandlung von Fremdem, aber auch als Öffnung und Bereicherung beurteilen, welche die Rezeptionskultur verändert. Die Transfergeschichte möchte national verfestigte Paradigmen überwinden, indem sie den Prozesscharakter von Kultur und Nation, die Fluidität der Grenzziehungen und die permanente Neudefinition der Inhalte betont. Bei der Frage nach Kontakten, Transfers und Beziehungen geht es nicht mehr nur um Verbindungen oder Gemeinsamkeiten von verschiedenen Ensembles, sondern um eine Form von Vernetzung, welche die Ensembles selbst umformt und ihre Identitäten neu schreibt.27 Worin bestehen die Grenzen der Transfergeschichte? Die Analyse von Interaktionen kommt auch nicht ohne die Hypostasierung von Anfangs- und Endstufen aus, die national ausgezeichnet sind. Die Schwierigkeit von nationalen Beschreibungs- und Analysekategorien liegt darin, dass sie die Transferanalyse in den jeweiligen Systemen, kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Modellen verorten – deshalb impliziert die Transferstudie immer eine komparative Dimension, ob diese nun explizit namhaft gemacht oder nur indirekt konstruiert wird. Vergleich und Transfergeschichte haben ein und dieselbe komparatistische Dimension in ihren nationalen Analysekategorien. Problematisch wird es, wenn das implizite Vergleichsgerüst nicht offengelegt oder die Perspektive des Transfers gegen die des Vergleichs ausgespielt wird.28 Eine Gegenüberstellung von Vergleich und Transfergeschichte ist in polarisierter Form nicht aufrechtzuerhalten: Daraus ergibt sich, dass die Untersuchung von transnationalen Transfers vielfach zur Folge hat, dass der nationale Bezugsrahmen einerseits relativiert, andererseits aber auch konsolidiert wird. Analysen von kulturellen Austauschbeziehungen zwischen Nationen eröffnen ein reicheres, subtileres Bild vor allem auf die importierende Rezeptionskultur. Zwar wird das ideologische Konstrukt der Nationalkultur hinterfragt, zwar wird auf die Fremdanteile verwiesen, die es enthält, wird die Durchlässigkeit der Grenzen betont. Doch das in dieser Weise differenzierte Bild der nationalen Rezeptionskultur wird als solches nicht in Frage gestellt. Eher, so möchte man meinen, wird es gestärkt und gesichert.29
26 27 28 29
12
Ebda., Ebda., Ebda., Ebda.,
S. S. S. S.
613f. 614f. 615. 615.
Entscheidend ist gerade die Verbindung einer vergleichenden Perspektive mit Transfer- und Zirkulationsprozessen. Für die zweite Phase beschleunigter Globalisierung hat Ottmar Ette in Bezug auf Alexander von Humboldt darauf hingewiesen, dass durch Vergleiche zwischen unterschiedlichen Räumen allein dem Phänomen weltweiter Verflechtung nicht epistemologisch beizukommen war. «Alexander von Humboldt begriff, daß statische Vergleiche auf die Ebene mobiler Relationalitäten gehoben werden mussten.» Es ging darum, «durch Vergleich in Beziehung (und in Bewegung) zu setzen».30 Ob es vielmehr heutige Methodendiskussionen sind, die die Vereinbarkeit von Schulen verhandeln, sei dahingestellt. Jedenfalls mag dieser Humboldtsche Anspruch ein Leitgedanke für die Vorgehensweise dieser Arbeit sein. Anna Brickhouse hat in ihrer Studie zu Transamerican Literary Relations herausgearbeitet, wie sich eine transkulturelle Strömung namens Transamerican Renaissance formte. Sie markiert die Zeitspanne zwischen dem im Jahre 1826 anonym erschienenen, Félix Varela zugeschriebenen historischen Roman Jicoténcal und dem haitianischen Drama von Faubert mit dem Titel Ogé ou Le préjugé de couleur aus dem Jahre 1856.31 Wenn Ottmar Ette bereits seit langem für einen Paradigmenwechsel von einer Raum- zu einer Bewegungsgeschichte plädiert, so schreibt sich auch Anna Brickhouse ein in diese sich, wenn auch nur langsam, etablierende Bewegungsgeschichte, deren Anliegen es ist, gegen ein historiographisches Modell anzugehen, das Zentrum und Peripherie als feste Punkte auf einer analytischen Karte beibehält und die Vereinigten Staaten als Angelpunkt einem homogenisierten und erwartungsgemäß nebensächlichen Lateinamerika und einer noch nebensächlicheren Karibik gegenüberstellt.32 Sie streicht heraus, dass sich der dominante öffentliche Bereich der Vereinigten Staaten und seiner Rivalen – frankophone und hispanophone, abolitionistische und antikolonialistische – oft kreuzen. Zugleich geht es ihr um einen Zusammenhang der Phänomene des literarischen Transnationalismus einerseits und des Imperialismus andererseits,
30
31
32
Ette: Alexander von Humboldt, S. 116. Ette betont auch, dass der Vergleich eine gedankliche Bewegung provoziere, solange er nicht darauf abziele, durch Vergleichen gleichzumachen. Vgl. ebda., S. 152. Vgl. zu einer ähnlichen Verbindung, und zwar von «Vergleichen und Verstehen – Komparatistik und interkulturelle Kommunikation», die zentralen Ausführungen Lüsebrinks. Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 33. Anna Brickhouse: Transamerican Literary Relations and the Nineteenth-Century Public Sphere. Cambridge: Cambridge University Press 2004, S. 27. Félix Varela y Morales (Kuba 1788–USA 1853), Priester, Lehrer, Schriftsteller, Philosoph und Politiker, war eine wichtige Figur im intellektuellen Leben Kubas in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er gilt als Wegbereiter der kubanischen Nation und war der Lehrer einiger der herausragenden Köpfe dieser Epoche, wie beispielsweise José Antonio Saco, Domingo del Monte und José de la Luz y Caballero. Pierre Faubert (Haiti 1806–Frankreich 1868), ein haitianischer Dichter und Dramaturg, war als Diplomat für sein Land in Europa tätig. Für wichtige Hinweise bei der Beschäftigung mit den Studien von Brickhouse danke ich Stephan Eberhard. Ette: ZusammenLebensWissen, S. 16. Vgl. Brickhouse: Transamerican Literary Relations, S. 28.
13
die Hand in Hand gehen können. Um ein besonders deutliches Beispiel aus der North American Review zu nehmen: Ein Artikel aus dem Jahre 1849 über die Lyrik des «Spanischen Amerika» beauftragt seine US-amerikanischen Leser mit «einer patriotischen Pflicht», lateinamerikanische Literaturtraditionen zu lernen, angesichts «der undefinierten Grenzen unseres Landes» und all «der mysteriösen tropischen Nationen, mit denen zusammen es [unser] ‚offenkundiges Schicksal‘ ist […] enger und enger verbunden zu sein.»33 Brickhouse geht es um eine neue Betrachtung der US-amerikanischen Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts aus Blickpunkten innerhalb der größeren Americas, aus Kenntnissen, die jenseits der territorialen Grenzen der Vereinigten Staaten entwickelt wurden. Diese Kenntnisse teilen wichtige Merkmale mit dem, was Walter Mignolo als «Grenzkenntnis» bezeichnet, als Kenntnisproduktion aus sowohl den inneren Grenzen des modernen/kolonialen Weltsystems (imperiale Konflikte, hegemoniale Sprachen, Richtungsabhängigkeit von Übersetzungen, etc.) als auch den äußeren Grenzen (imperiale Konflikte mit Kulturen, die kolonisiert werden, genauso wie die folgenden Stufen von Unabhängigkeit oder Dekolonisierung) heraus.34
Genauer benannt als «Zentren, Peripherien und Semiperipherien», betont das moderne/koloniale Weltsystem, das von Mignolo theoretisiert wurde, die «inneren und äußeren Grenzen», die ein «Kontinuum in der kolonialen Expansion und in den Veränderungen von nationalen imperialen Hegemonien» darstellen.35 Die Americas des 19. Jahrhunderts spielen eine Achsenrolle im Bewegungsablauf der Grenzkenntnisse, wie Mignolo es definiert, in einem Zeitraum, in dem die imperialen Großmächte Spanien, Frankreich, England und zunehmend die Vereinigten Staaten um Territorien und Inseln in der Hemisphäre kämpften, sprachliche und kulturelle Reinheit auferlegten und dennoch unfähig blieben, das Tempo der Dekolonisierung und Revolution oder die Mobilität der intellektuellen Arbeit und Übersetzung innerhalb der in Wettbewerb stehenden öffentlichen Bereiche zu kontrollieren.36 Vom del Monte-Kreis in Matanzas auf Kuba zu den subversiven spanischsprachigen Verlagszentren in Philadelphia und New York, vom sich kreuzenden kulturellen Austausch der berühmten Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística bis zum umstrittenen Texas Territory, wo US-Soldaten als Vorbereitung für den Krieg Prescott lasen, von den exilierten Intellektuellen Haitis und Martiniques, die die Société des Hommes de Couleur aufbauten, zur frankophonen Kreolkultur Louisianas erstreckt sich die Zeitspanne der «transamerikanischen Renaissance».37
33 34
35 36 37
14
Ebda., S. 29 (Übersetzung GM). Walter D. Mignolo: Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press 2000, S. 31 (Übersetzung GM). Brickhouse: Transamerican Literary Relations, S. 30. Ebda., S. 30. Ebda., S. 30.
Die Wendung «transamerikanische Renaissance» beabsichtigt also nicht nur, auf die verschmolzenen transnationalen Kontexte einer klar definierten Zeitspanne der US-amerikanischen Literaturgeschichte hinzuweisen, sondern auch an einen großen Komplex von Beziehungen zwischen dem öffentlichen literarischen Bereich Neuenglands und einigen der anderen kulturellen Momente über die Americas hinweg zu erinnern: Von den hispanophonen Exilliteraturgemeinschaften im Philadelphia und New York der 1820er-Jahre, über das «goldene Zeitalter» der reformistischen Literatur auf Kuba während der 1830er- und 1840er-Jahre und den Le Républicain- und L’Union-Autorenzirkeln eines Ignace Nau, Gründer des Cénacle auf Haiti, in den 1830er-Jahren, zum Album littéraire und Les Cenelles-Kreis der farbigen Kreolautoren in New Orleans in den 1840er-Jahren und zur Meilensteinveröffentlichung der monatlich erscheinenden literarischen und historischen Zeitschrift El Museo Yucateco in der Mitte des Jahrhunderts in Campeche, Mexiko.38 I.3.3. Textkorpus Der genannte Untersuchungszeitraum ermöglicht es, literarische Akteure aus den französischen und spanischen Kolonialsphären der Karibik zu Wort kommen zu lassen, die zum Teil aus noch intakten Kolonien, zum Teil aus bereits unabhängigen Staaten stammen (Haiti, Dominikanische Republik). Für das Textkorpus wurden die profiliertesten Autoren ausgewählt, die für unterschiedliche Etappen der Romantik stehen und zu ihrer Zeit offenbar eine vergleichsweise breite Rezeption erfahren haben.39 Die literarischen Texte entstammen der Feder einer schreibenden euro-kreolischen Oberschicht. Es handelt sich also bis auf wenige Ausnahmen um eine littérature blanche. Besonders für die Autoren der frankophonen Karibik gilt: Ihre Literatur ist der Versuch, die Geschichte der französischen Kolonien aus Sicht der Pflanzerklasse zu erzählen. Es wird sich zeigen, dass eine biographische Gemeinsamkeit der hier behandelten Autorinnen und Autoren darin besteht, dass alle zwischen den Welten unterwegs waren. Anders gewendet: Es war unmöglich, sich als karibischer Autor Gehör zu verschaffen, wenn man seine Herkunftsinsel nie verlassen hatte. Politisch hat dies zur Folge, dass kreolische Fiktion immer eine «vacilation between loyality and opposition»40 ist. Tendenziell schreibt die kreolische Oberschicht der Karibik einen kolonialen Diskurs gegen die Metropolen. Sie befinden sich in einer Opposition zu den Metropolen, die sich jedoch nicht in der Infragestellung des kolonialen Status quo äußert. Die Karibik meint nicht nur die karibische Inselwelt, sondern auch den zirkumkaribischen Raum, wobei hier ein besonderer Schwerpunkt auf Louisiana liegen wird. Ein Nachdenken über karibische Transferprozesse kommt vor allem in der
38 39 40
Ebda., S. 32. Die Lebensdaten fehlen in den Fällen, wo keine biographischen Informationen verfügbar waren. Watson: Caribbean Culture, S. 18.
15
frankophonen Sphäre nicht ohne das Zentrum New Orleans aus. Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass ein Schreiben in nationalliterarischen Maßstäben problematisch ist. Dies schließt aber nicht aus, dass das Kriterium «Herkunftsinsel» die entscheidende Rolle spielt. Folgende literarische Texte wurden daher ausgewählt: (Post)kolonialer Raum Spaniens Condesa de Merlín, Maria de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo (Kuba 1789– 1852): La Havane [1844]. Galván, Manuel de Jesús (Santo Domingo 1834–1910): Enriquillo [1879]. Gómez de Avellaneda, Gertrudis (Kuba 1814–1873): Sab [1841]. Heredia, José María (Kuba 1803–1895): «Himno del desterrado» [1825], «A Bolívar» [1825]. Hostos, Eugenio María de (Puerto Rico 1839–1903): La peregrinación de Bayoán [1863]. Manzano, Francisco (Kuba 1797–1853): Autobiografía [1835].41 Tapia y Rivera, Alejandro (Puerto Rico 1826–1882): La palma del cazique [1852]. (Post)kolonialer Raum Frankreichs Bergeaud, Émeric (Haiti 1818–1858): Stella [1859]. Coicou, Massillon (Haiti 1867–1908): Poésies nationales [1892]. Coussin, J. H. J. (Guadeloupe 1773–1836): Eugène de Cerceil ou le dernier Caraïbe [1824]. Eyma, Xavier (Martinique 1816–1876): La Vie aux États-Unis [1876]. Lanusse, Armand (New Orleans 1812–1867) (Hg.): Les Cenelles [1845]. Levilloux, J. (Martinique): Les Créoles ou la Vie aux Antilles [1835]. Lespinasse, Bauvais (Haiti 1811–1863): Le Chevalier de Mauduit [1836]. Maynard de Queilhe, Louis de (Martinique 1811–1836): Outre-mer [1835]. Nau, Ignace (Haiti 1808–1845): Isalina ou une scène créole [1836]. Prévost de Sansac, Auguste Jean: Les amours de Zémedare et Carina et description de l’île de Martinique [1840]. Questy, Joanni (New Orleans 1817–1869): «Monsieur Paul» [1867]. Séjour, Victor (New Orleans 1817–1874): «Le mulâtre» [1837]. Dazu kommen noch Klassiker der französischen Romantik wie Chateaubriand und Victor Hugo. Neben den literarischen Zeugnissen werden zudem zeitgenössische Zeitschriften untersucht, die sich mit ethnologischen, literarischen und literaturgeschichtlichen Fragen auseinandersetzen: die Revue des Colonies, die Revue encyclopédique und die Revue des deux mondes. Und schließlich werden zum Vergleich mit den Werken des 19. Jahrhunderts noch zwei aktuelle Romane
41
16
Es gibt widersprüchliche Angaben zu den Lebensdaten Manzanos und zur Entstehungszeit der Autobiografía. Ich stütze mich hier auf das wissenschaftliche Vorwort von William Louis zu der 2007er Vervuert-Ausgabe.
herangezogen, Traversée de la Mangrove von Maryse Condé (1989) und Adèle et la pacotilleuse von Raphaël Confiant (2005). I.3.4. Zum Aufbau Der Arbeit wurden drei zentrale Thesen vorangestellt, die in den einzelnen Unterkapiteln in unterschiedlicher Form tangiert werden. Sie betreffen den Vergleich der Kolonialmächte Frankreich und Spanien anhand literarischer und kultureller Ausdrucksformen sowie die sich aus der ersten These ableitende zweite Frage nach den Folgen der stärkeren Inklusionskraft des französischen Kolonialismus. Die dritte These hat die Funktion eines Exkurses und öffnet den Untersuchungszeitraum des 19. Jahrhunderts, insofern sie sich mit Paradigmen der Karibikforschung und einem kritischen Rückblick auf Identitätskonstruktionen beschäftigt. Nachdem der Gegenstand bereits räumlich und zeitlich eingegrenzt und das Textkorpus vorgestellt wurde, folgt als Nächstes die Präsentation des Forschungsstandes. Methodisch orientiert sich die Arbeit an den Studien der Transfer- und Verflechtungsgeschichte, dies jedoch ohne sich explizit gegen komparatistische Fragen auszusprechen (siehe These 1). Zu den Voraussetzungen dieser Arbeit zählen auch Skizzierungen der historiographisch relativ schwach beleuchteten politischen Gemengelage der spanischen und französischen Karibik im Untersuchungszeitraum. Diese Skizzierungen historischer Sachverhalte beinhalten immer auch eine Darstellung literarischer Konstellationen. Zentrale inhaltliche Säulen sind dabei stets die Positionierung zur Sklaverei sowie zum kolonialen Status quo. Ein gesondertes Teilkapitel gibt einen Überblick über die Debatten um Abolition in Frankreich und Spanien. An die dritte These anschließend, folgen eine Hinführung zum Begriff Zusammenleben und seine Verortung innerhalb aktueller kulturtheoretischer Debatten, sowie Überlegungen zu deren Übertragbarkeit auf das 19. Jahrhundert. Dabei erweist es sich als zentral, zunächst die anthropologische Grunddimension zu klären. Das zweite Kapitel führt die angedeuteten literarischen Positionierungen zum kolonialen Status quo konkret vor Augen. Gewählt werden zentrale Aspekte, anhand derer eine politische Dimension der Romane aufgezeigt wird: die Citoyenneté, Pro und Contra Unabhängigkeit sowie Raumdynamiken. Zur Illustrierung dieser Themen werden vergleichend jeweils ein literarischer Repräsentant der französischen und der spanischen Kolonialsphäre einander gegenübergestellt. Diese eventuell statisch anmutende Vorgehensweise soll die vieldiskutierten politischen Stellungnahmen über die Literatur beleuchten. Insofern untermauert dieses Kapitel eine Feststellung des Ob und ist weniger eine Darstellung des Wie. Dass eine solche Erarbeitung vonnöten ist, hängt mit den grundsätzlich wenig erforschten Literaturen der frankophonen Karibik zusammen. Während das Kapitel zu «Literatur und kolonialer Frage» anstrebt, den Wert der Literatur auf der Ebene einer vergleichenden Kolonialismusforschung zu rehabilitieren, geschieht mit dem dritten Kapitel «Literarische Momentaufnahmen des Dazwischen» ein Perspektivenwechsel. Das Kapitel befindet sich hinsichtlich der Herangehensweise im scheinbaren Widerspruch zu den ihm vorausgehen17
den Ausführungen. Das, was als Tendenzen kolonialer Positionierungen herausgearbeitet wurde, wird nun hinterfragt. Eine klare koloniale Positionerung der Autorinnen und Autoren erweist sich auf den zweiten Blick als unmöglich, denn die des Schreibens mächtige kreolische Oberschicht befand sich in einem dauerhaften Dazwischen. Das dritte Kapitel versucht, unterschiedliche Dimensionen dieses nicht eindeutig definierbaren Dazwischen einzufangen: Etablierte Kategorien wie Patrie/Nation/Exil erweisen sich als unzulänglich, Haiti ist nur als Zwischenkultur fassbar, Ideentransfers aus dem Zentrum sind schwer in die Kolonien übertragbar etc. Mit dem vierten Kapitel wird ein erneuter Perspektivwechsel eingeläutet, der mit der zweiten These dieser Arbeit zu tun hat. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstehen in Frankreich über 30 ethnologische Zeitschriften. Sie stehen symptomatisch für die vielzitierte epistemische Wende und die Neuordnung des Wissens im Zuge von Französischer Revolution und napoleonischen Ausgriffen in den außereuropäischen Raum. Neue Lehr- und Forschungsinstitutionen unterteilen die Wissenschaften in Sparten, und an die Stelle des Universalgelehrten tritt der Spezialist, so auch der Ethnologe. Die Vorstellung und Sichtung der Revue des Colonies, der Revue des deux mondes und der Revue encyclopédique bieten Aufschluss über die Behandlung des karibischen Raums in diesen Zeitschriften. Quellen, Methoden und vermittelte Bilder werden untersucht, um anhand dessen die Netzwerke der Forscher, ihre Reisetätigkeit und ihre Kontakte mit Akteuren des Untersuchungsfeldes selbst in den Blick zu nehmen. Direkte oder indirekte Positionierungen und Eingriffe der Wissenschaftler in die kolonialpolitischen Debatten der Zeit, in erster Linie in die Abolitionismusdebatte, sowie ihre (wissenschaftliche Autorität beanspruchenden) Argumente sind von besonderem Interesse. In solchen politischen Debatten waren Literaten des Mutterlandes überproportional engagiert. Sie haben teilweise auch selbst die kolonialen Gebiete bereist und ihre Erfahrungen literarisch verarbeitet (beispielsweise Chateaubriand). Die Literatur in Frankreich scheint sich mit besonderer Raffinesse auch der fachwissenschaftlichen Diskurse zu bedienen und somit zumindest eine wichtige Rolle in der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse über das kolonial Andere gespielt zu haben. Das fünfte Kapitel fragt entsprechend nach der kolonialen Dimension der französischen Romantik und beschäftigt sich mit der Frage, inwiefern sich in der karibischen Rezeption gerade Diskurse der französischen Romantik durchgesetzt und damit eine Macht stabilisierende Funktion erfüllt haben. Um der Gefahr zu entgehen, die These von der Multirelationalität der hispanophonen Karibik zu kategorisch zu behandeln, sollen in einem sechsten Kapitel transkaribische Dimensionen in den Blick genommen werden, die die Inselwelt verlassen und den zirkumkaribischen Raum miteinschließen. Für die kolonialen Achsen im französischen Kolonialreich spielt New Orleans, obgleich es bereits im 18. Jahrhundert seinen Kolonialherren wechseln musste, eine zentrale Rolle. Es wird sich zeigen, inwiefern kolonial-kulturelle Bindungen gerade nach einer politischen Emanzipation, ähnlich wie im Falle Haitis, weiterhin Struktur bildend sind. 18
Das siebente Kapitel schließlich illustriert die dritte These und wagt einen Exkurs, in dem es den Untersuchungszeitraum verlässt und zwei zeitgenössische Romane der frankophonen Karibik ins Zentrum rückt. Zum einen wird gefragt, wie sich Gómez de Avellaneda mit Maryse Condé neu lesen lässt. Zum andern soll mit Raphaël Confiants Roman Adèle ou la pacotilleuse gezeigt werden, welche Inszenierungen die karibische Inselwelt des 19. Jahrhunderts in Gegenwartsliteraturen erfahren kann. Dabei werden Paradigmenwechsel in der Karibikforschung literarisch umgesetzt, was wiederum die Annahme untermauert, dass die Region ein privilegierter Ort von Theorieproduktion ist. An diese Hypothese knüpfen die Schlussbetrachtungen an, die eine Absage an essentialistische Identitätskonzepte beinhalten und diese veralteten Konzepte mit einer neuen Fokussierung auf die vielversprechende Frage nach einem Zusammenleben ablösen. I.3.5. Kontexte der Forschung Auf der Suche nach Kristallisationspunkten von Phasen beschleunigter Globalisierung42 kann die Karibik, ein Umschlagplatz unterschiedlichster Einflüsse, als ein Laboratorium der Moderne verstanden werden, das in zunehmendem Maße nicht mehr nur Material zur europäischen (postkolonialen) Theoriebildung liefert, sondern sich selbst zum Theorieproduzenten aufschwingt, eine euro-zentrifugale Entwicklung, die – wenn man an die Herkunft führender Vertreter postkolonialer Theorien denkt – weltweit symptomatisch zu sein scheint43. Ottmar Ette, der in den letzten Jahren in der internationalen literatur- und kulturwissenschaftlich ausgerichteten Karibikforschung wichtige Akzente gesetzt hat, führt diese Entwicklung unter anderem zurück auf die ständige Bewegung und Heimatlosigkeit der dortigen Intellektuellen beziehungsweise auf ihre Vernetzungen in den mannigfaltigen geographischen Räumen, auf ein Phänomen der Deterritorialisierung, das sich nicht im bloßen Migrationshintergrund der Akteure erschöpft und damit nicht aufgeht in der Kategorie der Migrationsliteratur.
42
43
Ottmar Ette: Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne. Göttingen: Velbrück Wissenschaft 2002, S. 26. Ottmar Ette unterscheidet vier Phasen beschleunigter Globalisierung: eine erste, die mit der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus 1492 begann; eine zweite, die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit den Entdeckungsfahrten verschiedener europäischer Seefahrer wichtige Leitlinien der europäischen Kolonialismen vorgab; eine dritte Phase, die sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts ebenso in Europa wie vor allem auf dem amerikanischen Doppelkontinent bemerkbar machte; und schließlich eine vierte Phase, die im Verlauf des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts auf der Grundlage der sprunghaften Entwicklung und Verbreitung elektronischer Medien und Speichersysteme eine weltweite Vernetzung sowie globale Kommunikationsmöglichkeiten ohne störende Zeitverzögerung entstehen ließ. Vgl. Ottmar Ette: Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und Amerika. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2001; Ette: ZwischenWeltenSchreiben.
19
Ubiquitäre Vernetzung, wie sie, wenn auch nicht zeitgleich, für die dislozierte intellektuelle Welt der Karibik im 20. Jahrhundert charakteristisch sein mag, lässt sich freilich nicht direkt auf das 19. Jahrhundert übertragen, denn die kolonialen Bindungen geben noch eine mehr oder weniger klare Richtung für die Vernetzungen vor, wenngleich dieser Rahmen immer wieder gesprengt wird. Gerade das macht jedoch die Karibik des 19. Jahrhunderts zu einem faszinierenden Ausgangspunkt für die Untersuchung der (kulturellen) Bruchstellen kolonialer Systeme, die längerfristig in kulturelle (und politische) Emanzipation münden. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichen in der Entwicklung der kolonialen Bezugssysteme (nicht im Sinne einer «Phasenverschiebung», wie sie eine monistische Fortschrittstheorie behaupten würde) ermöglicht es darüber hinaus, mit dem Vernetzungsansatz, der vergleichend nach Transfer- und Zirkulationsprozessen fragt, einen originären Beitrag zur Postkolonialismusdebatte zu leisten, ohne sich dieser Richtung konsequent zu verschreiben. Eine solche asymmetrische Herangehensweise ist neu und verknüpft auch analytisch hochgradig heterogene Räume, die in sehr unterschiedlichem Maße bearbeitet worden sind, meist situiert als Studien zu einer Regional-, Nationaloder auch Kolonial- beziehungsweise Postkolonial-Literatur, oder zentrumsfixiert auf einen kolonialen oder imperialen Herrschaftsbereich. Räumlich relevant sind, neben der frankophonen und hispanophonen Karibik und Frankreich, auch die Kolonialmacht Spanien, die karibischen Nachbarinseln und das amerikanische Festland. Am dünnsten ist die Forschungsdecke für die Literatur der französischen Karibik und die frühe französische Ethnologie. Dies gilt in noch extremerem Maße für die frühe spanische Ethnologie. Die frankophone Literatur der Karibik des 19. Jahrhunderts ist bislang noch fast unbearbeitet und selbst die Primärtexte sind nur schwer zugänglich. Zur hispanokaribischen Literatur des 19. Jahrhunderts liegen zwar vergleichsweise zahlreiche Arbeiten vor, doch die Frage nach ihren Relationalitäten ist bislang kaum behandelt worden. Da es unmöglich ist, in diesem Rahmen einen umfassenden Überblick über die Literatur zu geben, verweise ich auf die Anmerkungen im Text und konzentriere mich auf einige wenige jüngere Werke, die für mein Vorhaben von besonderem Wert sind. In der deutschsprachigen Romanistik sind zwei Studien verfasst worden, die hispanophone und frankophone Literatur der Karibik des 19. Jahrhunderts zusammen in den Blick nehmen und damit für diese Arbeit relevant sind: die Studien von Janett Reinstädler44 und von Gudrun Wogatzke45.
44
45
20
Janett Reinstädler: Die Theatralisierung der Karibik. Postkoloniale Inszenierungen auf den spanisch- und französischsprachigen Antillen im 19. Jahrhundert. Habilitation. Berlin. Humboldt-Universität. Vgl. auch: Janett Reinstädler: La répetition interrompue. Representando la descentralización del caribe durante la Revolución Francesa. In: Ottmar Ette (Hg.): Caribbean(s) on the move – archipiélagos literarios del Caribe. A TransArea Symposium. Frankfurt am Main: Lang 2008, S. 23–38. Gudrun Wogatzke: Identitätsentwürfe. Selbst- und Fremdbilder in der spanisch- und französischsprachigen Prosa der Antillen im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vervuert 2006.
Reinstädlers (unveröffentlichte) Habilitationsschrift untersucht das Theater in der Karibik des 19. Jahrhunderts und tangiert dabei durchaus Fragen des Transfers und Austauschs, vor allem wenn es um die Rezeption der hegemonialen Kulturen geht. So zeigt sie, unter anderem anhand von Spielplänen und Rezensionen, was wo aufgeführt wurde, und geht auch darauf ein, wie Publikum und Öffentlichkeit die Stücke aufnahmen. Demnach standen hauptsächlich Werke aus den jeweiligen Mutterländern auf dem Programm. Im Theater, wo die Unterschichten im Publikum saßen, kamen also die Sprachbarrieren sehr viel stärker zum Tragen als bei der interlingualen Prosa- und Lyrikrezeption durch die Intellektuellen, wie man sie in den hier untersuchten Texten findet. Die Multirelationalität erscheint in diesem Licht zunächst als ein Elitenphänomen und kann erst durch die einheimische literarische Verarbeitung und Umformung «ins Volk» getragen werden. Eine bedeutendere einheimische Dramenproduktion gab es vor allem in den spanischen Kolonien, während sie auf den französischen Antillen kaum ins Gewicht fällt. Das führt Reinstädler, konsequent ihrem symmetrischen Ansatz folgend, in erster Linie auf die geringere Bevölkerungszahl in der französischen Karibik (sowie auf die Sonderrolle und ökonomische Misere Haitis) zurück, während aus meiner Perspektive die tiefere Ursache in der ungleichen kulturellen Strahlungskraft der jeweiligen Mutterländer liegt, zumal die demographische Dichte auf Inseln wie Martinique sehr viel höher war als auf Kuba. Wogatzkes Studie erschließt ein äußerst umfangreiches Textkorpus (Lyrik und Prosa) zur spanischen und französischen Karibik des 19. Jahrhunderts. Es handelt sich damit um eine wichtige Vorarbeit. Mit ihrer imagologischen Orientierung setzt sie interessante Akzente, die zum Teil im Rahmen dieser Studie weitergeführt werden können, auch wenn ihr Ansatz eher statisch ist. Hinzu kommen einige wenige Einzelmonographien zur insgesamt kaum bearbeiteten Literatur der frankophonen Karibik, die sich (meist leider nur in Unterkapiteln) auch dem 19. Jahrhundert widmen.46 Demgegenüber ist die hispanophone Karibik im 19. Jahrhundert deutlich besser erforscht: So hat Doris Sommer gleich drei Romane47 der spanischen Karibik zu foundational fictions erklärt. Dennoch
46
47
Besonders erwähnenswert für Guadeloupe/Martinique sind Chantal Maignan-Claverie: Le métissage dans la littérature des Antilles françaises. Le complexe d’Ariel. Paris: Karthala 2005; Jack Corzani: La littérature des Antilles-Guyane Françaises. 6 Bände. Fort-de-France: Desormeaux 1987; Roger Toumson: La transgression des couleurs. Littérature et langage des Antilles, XVIIIe, XIXe, XXe siècles. Paris: Éd. Caribéennes 1989; Régis Antoine: La littérature franco-antillaise. Paris: Éd. Karthala 1992; sowie für den Sonderfall Haiti die Arbeiten von Léon-François Hoffmann: Littérature d’Haïti. Vanves: Edicef 1995; Carl Hermann Middelanis: Imperiale Gegenwelten. Haiti in den französischen Text- und Bildmedien 1848–1870. Frankfurt am Main: Vervuert 1996; und vor allem Sibylle Fischer: Modernity Disavowed. Haiti and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution. Durham, NC: Duke University Press 2004. Sab von Gómez de Avellaneda, Cecilia Valdés von Villaverde und Enriquillo von Galván. Vgl. Doris Sommer: Foundational Fictions. The National Romances of Latin America. Berkeley: University of California Press 1991.
21
gibt es relativ wenige Einzelmonographien und keine Überblicksdarstellung zum literarischen Feld der hispanophonen Karibik im 19. Jahrhundert insgesamt.48 Fremdbilder in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts sind häufig untersucht worden. Eine für die vorliegende Arbeit herausragende Rolle spielen dabei die Studien zum Reisebericht im 19. Jahrhundert,49 steht dieses Genre, dessen Popularität damals einen Höhepunkt erreichte, doch an der Schwelle zwischen dem (proto)wissenschaftlichen Gelehrteninteresse und einem breiten exotischen Publikumsgeschmack: Denn das Interesse der Öffentlichkeit bildete für die Legitimierung kolonialer und imperialer Herrschaft eine wesentliche Voraussetzung,50 während die reisenden Gelehrten eine Brücke zu der von der Forschung bisher so vernachlässigten frühen Ethnologie schlagen, möglicherweise sogar als deren Informanten dienten, ob direkt oder über das Medium der Berichte selbst. Aus diesem Grund verdienen auch die Studien zum Exotismus große Aufmerksamkeit, auch wenn sie sich mehrheitlich mit Orientalismus beschäftigen. Meine Frage nach der Durchsetzungskraft bestimmter literarischer Modelle des Mutterlandes und der darin aufscheinenden imperialen Kartographie betrifft die französischen Primärtexte, vor allem die französische Romantik, zu der es unzählige Arbeiten gibt.51 Explizit mit der Repräsentation der Antillen in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich nur die Thèse d’État von Romuald Fonkoua, die eine enorme Materialfülle liefert, im Ganzen jedoch vergleichsweise deskriptiv ausfällt. Für die Vermittlung europäischer Konstruktionen Außereuropas sind die Studien von Hans-Jürgen Lüsebrink52 (vor allem für das 18. Jahrhundert) von Be-
48
49
50 51
52
22
Wichtig sind die Arbeiten von Gewecke, unter anderen Frauke Gewecke: Der Wille zur Nation. Nationsbildung und Entwürfe nationaler Identität in der Dominikanischen Republik. Frankfurt am Main: Vervuert 1996; Frauke Gewecke: Die Karibik. Zur Geschichte, Politik und Kultur einer Region. Frankfurt am Main: Vervuert ³2007; sowie Ulrich Fleischmann: Ideologie und Wirklichkeit in der Literatur Haitis. Berlin: ColloquiumVerlag 1969; Thomas Bremer: Haiti als Paradigma. Karibische Sklavenemanzipation und europäische Literatur. In: Hanns-Albert Steger, Jürgen Schneider (Hg.): Karibik. Wirtschaft, Gesellschaft und Geschichte. München: Fink 1982, S. 319–340. Vgl. v.a. Friedrich Wolfzettel: Ce désir de vagabondage cosmopolite. Wege und Entwicklung des französischen Reiseberichts im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 1986; Barbara Korte: Der englische Reisebericht. Von der Pilgerfahrt bis zur Postmoderne. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1996; Karl Hölz: Zigeuner, Wilde und Exoten. Fremdbilder in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Berlin: Schmidt 2002. Vgl. für England die Ausführungen von Korte: Der englische Reisebericht, S. 120. Vgl. beispielsweise die Arbeiten von Wolfgang Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft. Zur Affektmodellierung im französischen Roman von Rousseau bis Balzac. Tübingen: Narr 1990; Joachim Küpper: Ästhetik der Wirklichkeitsdarstellung und Evolution des Romans von der französischen Spätaufklärung bis zu Robbe-Grillet. Ausgewählte Probleme zum Verhältnis von Poetologie und literarischer Praxis. Stuttgart: Steiner 1987; Rainer Warning: Romantische Tiefenperspektivik und moderner Perspektivismus. Chateaubriand/Flaubert/Proust. In: Karl Maurer, Winfried Wehle (Hg.): Romantik. Aufbruch zur Moderne. München: Fink 1991, S. 295–324. Lüsebrink: Das Europa der Aufklärung.
deutung. Die Neuordnung der Wissenssysteme und die Transformation kultureller Ordnungsvorstellungen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert haben seit den Überlegungen Foucaults viele Romanisten beschäftigt. Als wichtige Basis nicht zu vergessen sind die Forschungen zur literarischen Anthropologie53 sowie Ottmar Ettes Arbeiten zu Humboldt54.
I.4.
Die Karibik als Kaleidoskop kolonialer Dynamiken (1789–1886)
Wie in vielen lateinamerikanischen Ländern am Ende des 18. Jahrhunderts, verloren auch in der Karibik die überkommenen politischen und kulturellen Orientierungsmuster ihre vormalige Verbindlichkeit, so dass sich ein verstärktes Bedürfnis nach neuer kollektiver Verortung und Identität einstellte.55 Viele der Inseln hatten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zum Wiener Kongress einen fliegenden Wechsel der Kolonialherren erlebt, dazu kamen die politische Neuordnung Europas und die Impulse, die von den großen Revolutionen in Nordamerika und Frankreich ausgingen. In diesem Kontext permanenter Bedrohung und unter dem Eindruck ständiger Fluktuation und Veränderung ging die Selbstverortung einher mit einer Suche nach Anknüpfungspunkten außerhalb der Inseln, nicht nur in politischer, sondern auch in kultureller Hinsicht. Der Bezug zum Mutterland war fragwürdig geworden und musste in der einen oder anderen Weise neu definiert werden. Darin lag ein Potential, das Identitätsvorstellungen zu deterritorialisieren imstande war, eine ex-zentrische Entwicklung, die sich in der hispanophonen Literatur der Karibik am frühesten ankündigt und sie bereits im 19. Jahrhundert sichtlich prägt, während sich dieses Phänomen im Verlauf des 20. Jahrhunderts immer mehr auf die Gesamtheit der kulturellen Produktion der Inselwelt ausbreiten sollte und bisweilen schon als modellhaft prognostiziert wird für die Literatur weltweit im Zeichen der durch Digitalisierung auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Globalisierung der Kommunikationswege. Für das unmittelbar von kolonialpolitischen Herrschaftsstrukturen geprägte 19. Jahrhundert wäre es jedoch sicherlich verfehlt, würde man der Relation Zentrum-Peripherie einen analytisch privilegierten Platz aberkennen. Andererseits darf man auch die sie umgebende (potentielle und vielfach reale) Multirelationa-
53
54 55
Vgl. dazu überblickshaft und aus germanistischer Sicht, aber durchaus mit Verweis auf romanistische Tendenzen: Wolfgang Riedel: Anthropologie und die Literatur in der deutschen Spätaufklärung. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 6. Sonderheft (1994), S. 93–157. Vgl. auch Heinz Thoma: Von der Geschichte des esprit humain zum esprit français. Anthropologie, kulturelle Ordnungsvorstellungen und Literaturgeschichtsschreibung in Frankreich 1790–1840. In: Hansjörg Bay, Kai Merten (Hg.): Die Ordnung der Kulturen. Zur Konstruktion ethnischer, nationaler und zivilisatorischer Differenzen 1750–1850. Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, S. 99–120; Jörn Garber, Heinz Thoma: Zwischen Empirisierung und Konstruktionsleistung. Anthropologie im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 2004. Vgl. dazu unter anderem Ette: Weltbewußtsein sowie Alexander von Humboldt. Für entscheidende Anregungen und Diskussionen in diesem Kapitel, und weit darüber hinaus, danke ich Malte Griesse.
23
lität nicht aus den Augen verlieren, tangierte doch die bolivarianische Unabhängigkeits- und Vereinigungsbewegung mit dem sie begleitenden kulturellen und literarischen Aufbruch den karibischen Raum politisch in vergleichbarer Weise wie es die haitianische Revolution tat, nur dass Haiti weniger als Vorbild denn als abschreckendes Beispiel angesehen wurde. Das lag nicht nur an der Brutalität der dortigen Auseinandersetzung und dem beispiellosen ökonomischen Niedergang, der aus der Perle des französischen Kolonialreichs langfristig ein Armenhaus machte, sondern auch am kulturellen Stillstand, den die Vertreibung und Vernichtung der weißen Elite über viele Jahrzehnte nach sich zog: Der erste haitianische Roman nach der Revolution, Stella von Émeric Bergeaud (1818–1858), kam erst 1859 heraus. Bezeichnend für die Hierarchie der Relationalitäten ist hierbei, dass es offenbar erst einer literarischen Vermittlung durch Hugo (in seinem Erstlingswerk Bug-Jargal, 1818/26) und Lamartine (in seinem erst nach der 1848er Revolution und nach Abschaffung der Sklaverei uraufgeführten Theaterstück Toussaint Louverture, 1850) bedurfte, um die haitianische Revolution in der Karibik überhaupt diskussionswürdig zu machen, wobei sich die spanischen Autoren für die damit verbundene sozialrevolutionäre Romantik sehr viel rezeptiver erwiesen als die französischen; sogar in Haiti selbst bedurfte es des festlandsfranzösischen Modells, um die eigene Revolution gegen die politische Herrschaft dieses Modells zum Gegenstand von Prosadarstellungen zu machen. I.4.1. Die hispanophone Karibik Während die Kulturschaffenden der französischen Peripherie sich offenbar weitgehend darauf beschränkten, ihre Beziehung zum Zentrum neu zu definieren und den veränderten Rahmenbedingungen anzupassen, gewinnt man bei den hispanophonen Intellektuellen den Eindruck, dass das eigene kulturelle Zentrum in ihren Augen jegliche Strahlungskraft verloren hatte. Das wird freilich nicht immer in so drastische Worte gefasst wie bei Félix Tanco56, der als Schriftsteller und Kritiker auf Kuba dem del Monte-Kreis57 angehörte. Dieser scharfzüngige Polemiker und Verfechter der Abolition geizte nicht mit Schmähtiraden über die «Epigonenhaftigkeit» der zeitgenössischen spanischen Literatur: so machte er beispielsweise 1837 die Neoklassizisten herunter, um ein paar Jahre später die Romantiker um
56
57
24
1796 in Kolumbien geboren, flüchtete Félix Tanco y Bosmeniel 1812 mit seinen Eltern nach Kuba. Nach dem Conspiración de la Escalera genannten Aufstand musste der Sklavereigegner erneut fliehen, zunächst in die USA und dann weiter nach Spanien. Er konnte um 1850 nach Kuba zurückkehren, verbrachte aber seine letzten beiden Lebensjahre in New York, wo er 1871 verstarb. Der gebürtige Venezolaner Domingo del Monte (*1804) lebte seit seinem fünften Lebensjahr auf Kuba, wo er als Literaturkritiker bekannt wurde. Er scharte einen Zirkel von Intellektuellen und Literaten um sich, die zum Teil regelmäßig zu den berühmten tertulias zusammenkamen, zum Teil aus dem Exil heraus mit del Monte in regem Austausch standen. Der Beteiligung an der Conspiración de la Escalera verdächtig, musste del Monte Kuba verlassen und starb in Madrid im November 1853.
Zorrilla, Espronceda, Bréton de los Herreros aufs Korn zu nehmen, die, «wie die gesamte spanische Literatur», nichts Originelles mehr hervorbrächten.58 So extrem dieses Urteil auch sein mag, spiegelt es doch die Auswirkung der kulturellen (Selbst)Marginalisierung Spaniens auf den kolonialen Herrschaftsraum. In dem Maße, wie Spanien sich zu einer Art europäischer Peripherie wandelte, sollte man meinen, dass die Kolonien sozusagen zur Peripherie der Peripherie wurden, oder in die Polemik Tancos übersetzt: zu den Epigonen der Epigonen. Gerade das lässt sich aber mitnichten von der spanischsprachigen karibischen Literatur sagen, die vielmehr dazu neigt, ihr Zentrum als primären kulturellen Bezugspunkt aufzugeben. Damit schwebt sie quasi frei im Kräftefeld der verschiedenen kulturellen Gravitationszentren der Zeit, für die sie sich grundsätzlich öffnet. Dass dabei die französische Literatur eine herausragende Rolle spielt, ist kein Geheimnis. Sie ist in Europa ohnehin in aller Munde, denn alle, die etwas auf sich halten, sprechen und lesen Französisch; dazu kommt, dass sich die französische Romantik in der Folge Rousseaus auch explizit mit der Neuen Welt und ihren Menschen beschäftigt. Auch wenn die meisten hispanokaribischen Autoren Französisch gelesen haben dürften, spielen auch Übersetzungen eine wichtige Rolle, was die französisch-spanische Übersetzungstätigkeit59 als wichtigen Mittler für diese primäre Rezeption ausweist. Doch wenn die These von der Multirelationalität einer aus der kolonialen Einbahnstraße geratenden Literatur haltbar sein soll, dann geht es darüber hinaus auch um die Einflüsse und den Austausch mit anderen Kulturen. Heredia gibt in einigen Artikeln nicht nur Leseempfehlungen für die französische Literatur seiner Zeit,60 sondern auch für die englische und US-amerikanische. Die Vereinigten Staaten, das Exilland Villaverdes61, hat er sogar bereist und neben Briefen und Reisenotizen auch Artikel geschrieben, in denen er seiner Bewunderung für Washington und das amerikanische Volk, das sich in der Revolution mutig die Unabhängigkeit erkämpft habe, Ausdruck verleiht, um es den Kubanern (und möglicherweise auch anderen Bewohnern der Karibik) zumindest implizit als Vorbild hinzustellen.62 Autoren wie Lord Byron stehen bei Heredia besonders hoch im Kurs. Ist es das romantische Reisemotiv, und im Falle des englischen Satirikers gerade auch sein endgültiges Verlassen der Heimat (nach Italien), das die hispanokaribischen Autoren besonders anspricht, eine Entwurzelung, die bei
58 59 60
61
62
Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 100. Vgl. zum Phänomen der Übersetzung innerhalb von Kulturtransfers Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 143f. José María Heredia: Prosas. Hg. von Romualdo Santos. Havanna: Ed. Letras Cubanas 1980. José María Heredia (Kuba 1803–Mexiko 1839) war ein prä-romantischer Poet und Literat, dessen kurzes Leben zwischen Kuba, Santo Domingo, Venezuela, Mexiko und den USA verlief. Cirilo Villaverde (Kuba 1812–New York 1894), kubanischer Dichter, Journalist und Freiheitskämpfer, Autor des Romans Cecilia Valdés, musste wegen seines Engagements für die Unabhängigkeit Kubas 1849 in die USA fliehen, wo er mehrere Exil-Zeitschriften herausbrachte. Heredia: Prosas, 192f.
25
Byron zwar in einem anderen Kontext steht, die sein Schicksal aber mit der biographischen Erfahrung des Zwischen-Welten-Schreibens vieler spanischsprachiger Autoren der Karibik vergleichbar zu machen scheint?63 Auch einer der bekanntesten Romane Kubas, Cecilia Valdés von Cirilo Villaverde, legt Lesarten nahe, die eine Unterwanderung der kolonialen Kontrolle durch den kreolischen Autor zeigen. Villaverde eignete sich bewusst europäische Literaturmodelle des 19. Jahrhunderts an, um sie jedoch nach eingehender Ankündigung nicht einzuhalten.64 Die spanischsprachigen Literaturen des lateinamerikanischen Festlands wiederum bedurften nicht einmal der Übersetzung, und gerade Heredia hat sich lange im mexikanischen Exil aufgehalten. Was wurde gelesen und welchen Austausch gab es mit dem südamerikanischen Kontinent und dortigen Autoren vom Schlage eines Bello, Fernandez de Lizardi, Sarmiento, Altamirano oder Echeverría? Füllt der gleichsprachige kulturelle Austausch mit dem Subkontinent möglicherweise sogar das Vakuum, das das Mutterland hinterlassen hat, nachdem es aufs Abstellgleis geschoben wurde? I.4.2. Die frankophone Karibik Im Unterschied zu den spanischen Kolonien leidet die kulturelle Produktion der französischen Karibik, so paradox es klingt, in erster Linie an der außerordentlich starken kulturellen Strahlungskraft des Mutterlandes, die eine Bewegung auslöst, die man heute als brain drain bezeichnen würde. Frankreich, und insbesondere
63
64
26
Bezeichnenderweise verweist Heredia besonders auf Byrons berühmtes episches Gedicht Childe Harold’s Pilgrimage, das im Grunde genommen das poetische Reisetagebuch des Schriftstellers ist. Dort wird unter anderem der Freiheitskampf (der Spanier gegen Napoleon) romantisch stilisiert und die türkische Fremdherrschaft über Griechenland pathetisch beklagt. Naturerleben und -beschreibungen tragen Züge von Rousseaus Nouvelle Héloise und seiner Rêveries du promeneur solitaire, die in der lateinamerikanischen und karibischen Rezeption der Zeit eine herausragende Rolle spielen. In dem sich aus alten Bindungen lösenden Freiheitspathos war Byrons stark autobiographischer Protagonist als Weltenwanderer Identifikationsfigur für die romantische Jugend in ganz Europa. Zum problematischen Begriff der Entwurzelung vgl. auch Gesine Müller: Exil als Heimat – Heimat als Exil? Zur romantischen Inszenierung von Entwurzelung bei Literaturen der karibischen Kolonien Frankreichs und Spaniens (1838–1844). In: Frank Estelmann, Olaf Müller (Hg.): Exildiskurse der Romantik in der europäischen und lateinamerikanischen Literatur. Tübingen: Narr 2011, S. 227–242. Vgl. Ana Mateos: Dialéctica para una voz propia en Cecilia Valdés. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux : transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 103–120. Mateos betont, inwiefern Villaverdes «Strategie der anscheinenden Inkompetenz» als Spiel mit kolonialen Erwartungen entlarvt werden kann, die so ihrer karibischen Eigenständigkeit Ausdruck verleiht. Vgl. Abel: Tagungsbericht zur Konferenz «Koloniales Kaleidoskop Karibik. Eine Inselwelt im Fokus kultureller Transferprozesse im 19. Jahrhundert» (09.–11. Juli 2009 in Berlin). In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, hg. von Henning Krauss, Heidelberg 2009, S. 471–479, hier S. 474.
die französische Hauptstadt, bietet hervorragende Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, so dass die fortschrittlichsten Köpfe dort hängenbleiben, anstatt auf ihre Heimatinseln zurückzukehren. Ein Zeitzeuge bemerkte 1842, «presque toute la jeunesse de nos colonies est élevée en France, les jeunes gens dans les Collèges de Paris ; les jeunes personnes à Saint-Denis et au Sacré-Cœur.»65 Figuren wie die Kreolen Estève und Edmond, die in Levilloux’ Roman Les créoles ou la Vie aux Antilles nach genossener Ausbildung en métropole wieder zurück in ihre Heimat Guadeloupe fahren, verlassen das Mutterland nur mit Wehmut: Les yeux tournés vers cette terre qui s’abaissait à l’horizon, ils comptaient tous les bienfaits qu’ils en avaient reçus ; science, élévation de l’âme, nouvelle existence morale. […], et tout occupés de la France, de sa gloire, leurs âmes pures soupiraient d’un hymne d’amour et de reconnaissance66.
Für viele Autoren scheint ihr Herkunftsland sogar kaum noch eine Rolle zu spielen.67 Ein anderes Motiv für die starke Parisorientierung der Elite ist eine panische Angst der weißen Oberschichten (Békés) vor Rebellionen und Sklavenaufständen, ein Gefühl der Bedrohung, das sicherlich nicht ganz unbegründet war und stark vom haitianischen Beispiel geschürt wurde. So gab es wenige Versuche, die Spannungen durch Konzessionen an die Unterschichten und Sklaven, oder sogar durch die Abschaffung der Sklaverei abzubauen. Vergleicht man die nackten Zahlen, wird das Bedrohungsszenario deutlicher: Während um 1820 der Sklavenanteil auf Kuba mit 36 % für die spanische Karibik hoch lag (vgl. in Puerto Rico 9 %), bestand die sehr viel dichtere Gesamtbevölkerung auf Guadeloupe und Martinique zu 78 beziehungsweise 79 % aus Sklaven. Auf Saint-Domingue (Haiti) hatte der Sklavenanteil zu Kolonialzeiten (1760) nur wenig höher gelegen als auf den beiden kleineren französischen Karibikinseln, so dass die demographische Struktur dort ein ähnliches Gefahrenpotential zu bergen schien. Tatsächlich hatte es in der Folge der Revolution nicht nur in Saint-Domingue, sondern auch auf Martinique erhebliche Auseinandersetzungen zwischen Royalisten und Republikanern gegeben, die von Unruhen der Sklaven und freien Mulatten68 begleitet wurden. In einem Brief des martinikanischen Autors Maynard de Queilhe, den er seinem Roman Outre-mer voranstellt und der an seinen Vater gerichtet ist, kommt deutlich zum Ausdruck, dass sich die Antillen in einer derart angespann-
65
66 67
68
Adolphe Granier de Cassagnac: Voyage aux Antilles françaises, anglaises, danoises, espagnoles, à St-Domingue et aux États-Unis d’Amérique. 2 Bände. Paris: Dauvin et Fontaine 1842–1844, S. 102f.; Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 56. Levilloux: Les créoles, S. 32, vgl. auch S. 28; vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 301. Reinstädler (Die Theatralisierung der Karibik) zählt eine Reihe von Dramaturgen auf, die aus Martinique und Guadeloupe stammen, die jedoch in ihren Theaterstücken so gut wie keine karibischen Themen und Motive aufgreifen. Mit dem Begriff «Mulatte» sind sowohl freie als auch unfreie Mulatten gemeint, also Menschen mit afrikanischen und europäischen Vorfahren. Ich verwende den Begriff «Mulatte» in Anlehnung an den historischen Umgang in literarischen wie kulturellen Repräsentationsformen und nicht als Denomination der Hautfarbe aus heutiger Sicht.
27
ten politischen Situation befinden, dass ihre literarische Betrachtung als Quelle exotischer Projektionen längst überholt ist: Il ne me reste plus, mon père, qu’à souhaiter que ce livre vous attache. S’il est tout sanglant, vous ne vous en plaindrez pas, vous qui avez vu vingt fois la flamme courir sur vos terres et la révolte amonceler des cadavres à la Grosse-Roche, ce Clamart du Paris des Antilles. Les colons de toutes les colonies savent bien qu’il n’est plus possible aujourd’hui de composer sur les faits de leur société de jolis volumes qui soient à l’eau de rose ou à la fleur d’oranger. Naissent des choses riantes ! c’est ce que j’appelle de tous mes vœux. Mon Dieu ! vous qui avez prodigué à ces climats toutes vos magnifices, vos magnificences les plus rares, faites-leur un don plus beau et plus précieux, mon Dieu ! donnez-leur la paix.69
Nach der rechtlichen Gleichstellung der freien Mulatten (1792) kam es nicht mehr zur Abschaffung der Sklaverei, da die Royalisten und die große Mehrheit der weißen Plantagenbesitzer – bereit, ihre Privilegien um jeden Preis zu verteidigen – der britischen Invasionsarmee sekundierten, die letztlich den Status quo ante wiederherstellte. Nachdem erst 1815 die Inseln endgültig wieder unter die französische Flagge zurückgekehrt waren, verteidigen Autoren wie Prévost de Sansac70 sich und ihresgleichen gegen den impliziten Vorwurf des Verrats und der «Anglomanie». Um das Bündnis mit den Engländern zu rechtfertigen, braucht er nur Napoleon zu paraphrasieren, der bei einer Sitzung des Staatsrats 1803 erklärt hatte, dass er, hätte er sich 1794 auf Martinique aufgehalten, für die Engländer gewesen wäre, da man an erster Stelle sein Leben retten müsse. Sansac betont dazu noch die natürliche Treue der Martinikaner zu Frankreich und die vielfältigen «starken und zugleich weichen» (d. h. kulturellen) Bindungen zum Mutterland: Dans cette colonie […] l’on n’oubliera jamais que c’est à la généreuse protection [des Anglais] que l’on doit la conservation des hommes et celle des propriétés […] mais en conclure que les habitants de la Martinique, tous vrais Français, naturellement fidèles, bons et aimants, puissent désirer devenir anglais et briser les liens multiples, si forts et si doux, qui les attachent à la France, c’est la plus odieuse calomnie.71
I.4.3. Pro Sklaverei Die weißen Béké-Autoren der französischen Karibik der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheinen weitgehend darum bemüht, ein harmonisches, geradezu paradiesisches Bild von den kleinen Plantagen zu zeichnen, in denen der Herr väterlich für
69 70
71
28
Maynard de Queilhe: Outre-mer, Vorwort. Über Auguste Jean Prévost de Sansac, comte de Traversay, sind nur spärliche Lebensdaten überliefert. Seine Familie ließ sich wohl im 18. Jahrhundert auf Martinique nieder. 1806 veröffentlichte er Les amours de Zémédare et Carina. Auguste Jean Prévost de Sansac: Les amours de Zémédare et Carina et description de l’île de Martinique. Gefolgt von: Louis-Xavier Eyma: Emmanuel. Hg. von Auguste Joyau. Morne-Rouge: Éd. des Horizons Caraïbes (1840) 1977, S. 250–252 (Hervorhebungen GM).
seine Sklaven sorgt. Umstürzlerische Ideen werden, ähnlich wie die Konfrontation von 1794 mit den Engländern, als europäische Importware abgetan, die nur daher rührten, dass man in Frankreich nicht mit der tatsächlichen Lage in den Kolonien vertraut sei. Hier lässt sich eine erstaunliche Überschneidung von literarischer Repräsentation und politischen Stellungnahmen verzeichnen. In Outre-mer von Maynard de Queilhe kehrt der Protagonist Marius, überzeugt von der Unmenschlichkeit der Sklaverei und durchdrungen von europäischen sozialrevolutionären (abolitionistischen) Vorstellungen, in die Karibik zurück, um schließlich seinen grundlegenden Irrtum über das Leben der Sklaven auf den Plantagen einzusehen: On lui avait dit qu’on les exposait aux intempéries des saisons, sans défense, sans vêtements ; et il apprenait que ces hommes recevaient par an deux casaques et deux caleçons, les femmes deux casaques et deux jupes : que si parfois on les voyait à moitié nus c’est que cela leur était plus agréable. […] A ces travaux ne se joignaient ni douleurs ni peines.72
Die Einschätzung, die die Delegierten der Kolonien 1838 im Zentrum präsentieren, klingt geradezu wie ein Echo solcher literarischer Darstellungen: Si on les considère [les colonies] en elles-mêmes, dans leur état intérieur […] il n’y a rien qui rende urgente ni nécessaire l’abolition de l’esclavage. Le régime des habitations est doux et progressif, et aucune passion, aucune opinion indigène n’en demande la transformation radicale ; mais en présence de l’opinion publique d’Europe, sous l’influence des mesures qu’elle a déjà commandées, des discussions graves qu’elle provoque et multiplie, des effets mêmes que ces causes produisent sur l’état moral et économique des colonies, le maintien intégral et durable de l’esclavage n’est plus possible.73
Es wird zu untersuchen sein, wie sich die ungebrochene Begeisterung und Verehrung Frankreichs als Hort der Kultur und die starke Anlehnung, ja sogar Imitation französischer Kultur allgemein (und französischer Literatur im Besonderen) mit dieser einseitigen Verortung schädlicher Ideen im Mutterland vereinbaren lässt. Wie konstituiert sich das Frankreichbild und an welchen literarischen Modellen orientiert man sich sowohl inhaltlich als auch in formaler Hinsicht? Welche philosophischen Ideen werden wie aufgenommen und umgeformt? Ferner geht es um die Frage, inwieweit und auf welche Weise spartenübergreifend, in den literarischen und außerliterarischen Repräsentationsformen, ein Mythos über die Sklaverei verbreitet wird. Oder anders formuliert: Wie hat das von den Béké-Autoren
72
73
Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I., S. 105f. Vgl. zu einem völlig analogen Bild auch Louis Xavier Eyma: Les Borgias Noirs. In: Louis Xavier Eyma: Les Peaux Noires, Paris: M. Lévy 1857, S. 118: «Afin de rectifier […] ses jugements et de l’initier, […] aux splendeurs de cette végétation qui n’a pas sa pareille dans le monde, au spectacle de l’activité d’une habitation, de l’entendue des propriétés, du côté curieux et original des rapports entre le maître et l’esclave, je résolus de le conduire, […] sur une des sucreries les plus considérables de l’île.» Avis des Conseils coloniaux, zit. nach Antoine Gisler: L’esclavage aux Antilles françaises XVIIe–XIXe siècle. Reprint der Ausgabe Fribourg, Schweiz, 1965. Paris: Karthala 1981, S. 129.
29
gezeichnete Bild die französischen Vorstellungen von den sozialen Verhältnissen und den Beziehungen zwischen den Rassen in Übersee, möglicherweise bis in die Historiographie hinein, geprägt? Ohne Zweifel, den Darstellungen von Maynard de Queilhe und den Delegierten steht eine Realität von mehrfachen Sklavenaufständen entgegen (1822, 1830, 1833, 1848), die von einer, wenn auch schwachen, abolitionistischen Bewegung von Intellektuellen um Cyrille Bissette74 flankiert wurden. Die Sklaven waren also nicht nur von fremden und unqualifizierten europäischen Ideen angestiftet, wie es Maynard de Queilhe und andere suggerieren, sondern es gab gebildete Vordenker vor Ort – Philosophen, wie sie abschätzig von den Befürwortern der Sklaverei genannt wurden –, die sich der Sache der Sklaven annahmen und mit der wirklichen Situation bestens vertraut waren. Der Mythos umfasst auch die Abolition von 1848, die in der offiziellen Darstellung immer einseitig auf die Bestätigung von Victor Schœlchers Emanzipationsakte durch die Pariser Revolutionsregierung 1848 zurückgeführt, das heißt als ein Geschenk des Mutterlandes dargestellt wird, wo jedoch tatsächlich die Sklaven durch ihre Rebellion bereits vor Eintreffen der Nachricht über die Gesetzesänderung eine Verkündung ihrer Befreiung erzwungen hatten. Mit Bezugnahme auf diesen Mythos beklagt Édouard Glissant «die diskursive Negierung afrokaribischer Beiträge» zur Entwicklung des Landes: «L’absence de mémoire historique favorise la projection de ces pseudo-histoires d’ordre élitaire sur la conscience populaire»75. Das hartnäckige Überdauern des Schœlcherisme beruhe auf der repressiven politischen Strategie, die Ausbildung eines eigenen Geschichtsbewusstseins auf Martinique zu unterbinden; diese Abwesenheit der mémoire historique wiederum schaffe die Voraussetzung für eine auf die Metropole ausgerichtete Interpretation der Vergangenheit.76 Man wird auch hier der Frage nachgehen müssen, welchen Beitrag Literatur und Kultur zur diskursiven Konstruktion dieser zutiefst problematischen Erinnerungspolitiken oder vielmehr Wissensformationen geleistet haben. I.4.4. Contra Sklaverei Nicht alle Autoren reden die Plantagen jedoch in vergleichbarer Weise schön wie es die weißen Békés Prévost de Sansac, Eyma77, Maynard de Queilhe und
74
75
76 77
30
Cyrille Bissette (Martinique 1795–Paris 1858) war einer der engagiertesten karibischen Abolitionisten, der seinen Einsatz beinahe mit einer lebenslänglichen Galeerenstrafe gebüßt hätte, historiographisch jedoch – zu Unrecht – in den Schatten von Victor Schœlcher geriet und fast vergessen ist. Glissant: Le discours antillais, S. 646. Vgl. auch Édouard Glissant: Mémoires des esclavages. La fondation d’un centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions. Paris: Gallimard 2007. Vgl. auch Reinstädler: Die Theatralisierung der Karibik, S. 19. Glissant: Le discours antillais, S. 646. Der martinikanische Schriftsteller Louis-Xavier Eyma (1816–1876) verbrachte sein Leben zwischen den Antillen, Louisiana und Frankreich. Die auf seinen Reisen gewonnenen
Rosemond de Beauvallon78 tun. Levilloux, Chapus, Bonneville und Agricole79 gelten als sklavenfreundlich, auch wenn es sicherlich verfehlt wäre, ihre Romane als (militant) abolitionistisch zu bezeichnen. Es wird ein problematisches und zerklüftetes Bild der insularen Gesellschaften vermittelt: Konfrontationen zwischen Angehörigen der Rassen spielen eine zentrale Rolle, wobei Eigenschaften und Komplexität der Charaktere keineswegs an ihre Hautfarbe gebunden sind. Bei diesen Autoren nehmen geschichtliche Ereignisse einen wichtigen Platz ein und werden – anders als bei den «Hardlinern» unter den weißen Béké-Autoren mit ihrer Naturromantik – explizit thematisiert. Bei Levilloux sind dies vor allem die revolutionären Ereignisse auf Martinique und Guadeloupe, wobei verhalten ein Gegennarrativ zur offiziellen Darstellung anklingt, auch was die Interpretation der haitianischen Revolution und den Separatismus der schwarzen Rebellen angeht. So äußert sich General Dugommier in Levilloux’ Roman Les créoles ou la Vie aux Antilles dahingehend, dass die weißen Oligarchen auf Martinique, genauso wie auf Saint-Domingue, nur die revolutionären Wirren in Frankreich und den Krieg in Europa ausnützen wollten, um ihre Position zu stärken und sich vom Mutterland unabhängig zu machen («se constituer indépendants de la France en profitant des embarras de la lutte européenne»80). Hier wird der Vorwurf der Illoyalität gegenüber dem Mutterland explizit, auf den Sansac reagiert, wenn er das Verhalten der weißen Plantagenbesitzer zum Zeitpunkt der britischen Invasion rechtfertigt. Dem separatistischen Opportunismus der weißen Gutsbesitzer steht im Roman der Patriotismus des Mulatten-Protagonisten Estève entgegen, der die Ideale der französischen Aufklärung verinnerlicht hat und am Ende mit Dugommier zusammen in der Schlacht gegen die Spanier in der Selva negra (Katalonien) für die revolutionäre Sache Frankreichs stirbt. Deutlich zeichnet sich hier ein Konflikt der literarischen Diskurse um die geschichtliche Darstellung der Ereignisse selbst ab. Welche Interaktionen gab es zwischen Literatur und Geschichtsschreibung? Wie formierten sich die Geschichtsbilder an den Schnittstellen von literarischer und außerliterarischer Repräsentation? Gab es offene Diskussionen zwischen den wenigen französischsprachigen Literaten, die auf den französischen Antillen wirkten und das historische Geschehen zum Thema machten? Welche Rolle spielte die Zensur für die relative Zurückhaltung bei der literarischen Formulierung (oder eher: Insinuierung) von
78
79
80
Eindrücke flossen in die literarischen Beschreibungen der karibischen und amerikanischen Sklavenhaltergesellschaften ein. Der Journalist Jean-Baptiste Rosemond de Beauvallon (1819–1903) aus Guadeloupe versuchte mit seinen Beschreibungen der karibischen Gesellschaften die Festlandfranzosen von den Vorzügen der Sklaverei zu überzeugen. Levilloux und Chapus sind beide offenbar selbst Mulatten, vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 451, die dafür allerdings keinen Beleg gibt. Maignan-Claverie: Le métissage, S. 320 scheint Levilloux dagegen implizit zur Béké-Literatur zu rechnen. Bonneville ist mit einer Mulattin verheiratet und der auf Guadeloupe geborene Politiker Eugène Agricole (1834–1901) gilt als der erste schwarze Autor auf Martinique, der jedoch erst gegen 1870 in Erscheinung tritt. Levilloux: Les créoles, S. 249.
31
Kritik an der Sklaverei? Wie wurden die Romane rezipiert und von wem? Welche Verbindungen hatten die Autoren zur explizit abolitionistischen Bewegung auf den Antillen, über die noch kaum Konkretes bekannt ist und die bezeichnenderweise von Zeitgenossen mit den Freimaurern assoziiert wurde?81 Die Romane von Levilloux und Chapus, in denen die sozialrevolutionäre Dimension der europäischen Romantik besonders stark akzentuiert ist (auch wenn sie sich bisweilen nach innen, ins Philosophisch-Kontemplative, wenden mag82), sind durchaus vergleichbar mit Texten der spanischen Karibik. Allerdings sind bei diesen beiden Autoren nicht die geringsten Anzeichen von Unabhängigkeitsbestrebungen zu finden, ganz im Gegenteil. Die Abolitionsfrage indes hat hier wie dort einen hohen Stellenwert, ohne dass sie sich zu einer direkten Forderung nach Abschaffung der Sklaverei verdichtet, was wohl auch in beiden Fällen nicht durch die Zensur gegangen wäre. Mehr als die Frage nach der Befreiung der schwarzen Sklaven wird so die Figur des Mulatten in den Mittelpunkt gestellt: es geht primär um seine Emanzipation und gesellschaftlichen Aufstiegschancen; seine inneren Identitäts- und Zugehörigkeitskonflikte, geschürt durch das rassisch diskriminierende Umfeld, werden intensiv, teilweise auch introspektiv, beleuchtet. So kann sich der Mulatte in beiden Literaturen nur sehr schwer von den essentialistischen Zuschreibungen lösen, die schließlich seine Rechtsposition definieren, und er fällt, bei aller Forderung nach prinzipieller Gleichberechtigung, immer wieder zurück in die Gleichsetzung von schwarzer Abstammung mit Naturhaftigkeit und Unkultur, die nur mit viel Arbeit an sich selbst überwunden werden kann – und überwunden wird. Während Autoren wie Maynard de Queilhe oder Eyma im freien Mulatten (affranchi) die seditiöse Bedrohung par excellence sehen – denn durch seinen Aufstieg und Zugang zu Bildung und Kultur kann er sich revolutionäre Ideen aneignen und die «zufriedenen Sklaven» damit aufwiegeln –, setzen Autoren wie Villaverde, die kubanisch-spanische Schriftstellerin Gómez de Avellaneda, aber auch Levilloux letztlich alle Hoffnung in die Figur des Mulatten als Mittler, die allein die antagonistischen Positionen in den streng segregierten Gesellschaften aufzuweichen imstande ist. So verschwimmen essentialistische (rassische und gender-mäßige) Zuweisungen in der Figur des Sklaven Sab aus Gómez de Avellanedas gleichnamigem Roman, der gerade deshalb zur Integrations- und Kohäsionsfigur werden kann. In ähnlicher Weise lässt sich auch die rassische Identität von Levilloux’ Protagonisten Estève kaum von seinem Äußeren her bestimmen. Liest man diese Romanfiguren und die Bilder, die sie von der Gesellschaft und ihren Konflikten transportieren, zusammen mit den literarischen und politischen Diskussionen über die Sklaverei, beispielsweise im illustren Kreis des ursprünglich aus Venezuela stammenden Wahlkubaners del Monte, so wird klar, welche (in unseren heutigen Augen haarsträubenden) Utopien sich mit der
81 82
32
So Léon-François Hoffmann: Le Nègre romantique. Personnage littéraire et obsession collective. Paris: Payot 1973, S. 136; Maignan-Claverie: Le métissage, S. 259. Ebda., S. 259.
Figur des Mulatten verbinden, Utopien, die wegen ihrer Distanz zu heutigen Paradigmen von Multi-, Inter- oder Transkulturalität jedoch nicht als absurd abgetan werden dürfen, wenn man die Vorstellungswelt und Kategorien nachvollziehen will, in denen die karibischen Akteure dachten, kommunizierten, handelten und schrieben, und die durchaus Rückwirkungen auf den europäischen Raum hatten. Selbst in fortschrittlichen literarischen Zirkeln wurde Integration in Kategorien von Homogenisierung gedacht, die der Gefahr der Afrikanisierung vorbeugen sollte: «limpiar» (säubern), «blanquear» («weißen») und «controlar» (kontrollieren) waren die Schlagworte.83 So geht es für del Monte darum, «Kuba von der afrikanischen Rasse zu säubern» («limpiar Cuba de la raza africana»84), wobei «limpiar» hier freilich nicht «umbringen» heißt. Wie diese «Säuberung» aussehen soll, die uns aus heutiger Perspektive fast unwillkürlich an die brutalen «ethnischen Säuberungen» des 20. Jahrhunderts gemahnt, erklärt der bekannte kubanische Philosoph und Politiker José Antonio Saco in einem Brief aus den 1840er-Jahren an seinen Landsmann José de la Luz y Caballero: Er empfiehlt die gezielte Einwanderung weißer gebildeter Europäer und die aktive Förderung von Mischehen, um das afrikanische Element «wegzuzüchten» oder zu domestizieren85, also ein proto-eugenisches Projekt, mit dem auf menschliche Weise Gleichheit und Kultur geschaffen werden solle. Wurden in den französischen Kolonien der Karibik ähnliche Diskurse geführt? Und wie wirkt sich der weitaus höhere Sklavenanteil dort auf die (auch außerliterarischen) Überlegungen zum Mulattentum und dessen Gefahren und Potentiale aus? Welche Diskussionen wurden zeitgleich von Ethnologen in Paris zu diesen Fragen geführt und in welchem Wechselverhältnis standen sie zu den karibischen Debatten, sowohl in den spanischen, als auch in den eigenen Kolonien? Ist der hohe Stellenwert der Unabhängigkeitsfrage in den spanischen Texten nicht letztlich «nur» die Folge der politischen Unbeweglichkeit des Mutterlandes, das sich auf eine ernsthafte Diskussion der Abolitionsfrage einzulassen nicht bereit war, wohingegen die Mulatten-Romanfiguren aus der französischen Karibik in der Zugehörigkeit zum französischen Mutterland und der dortigen Virulenz egalitärer Prinzipien – zu Recht – die einzig realistische Aussicht auf ihre Emanzipation sahen? Hat es vor dem Hintergrund, dass den ethnischen Differenzen und dem Problem ihrer (wie auch immer gearteten) Überwindung eine solche Priorität zukam, möglicherweise doch direkten Austausch zwischen Intellektuellen der spanischen und französischen Karibik gegeben? Wie wirkt sich die Abolition von 1848 in der französischen Karibik auf Literatur (und Debatten) danach aus, angesichts der Tatsache, dass die Sklaverei (nicht ohne flankierende politisch-repressive Maßnahmen) durch eine (Hunger)Lohnarbeit ersetzt wurde,
83 84 85
Michael Zeuske: Kleine Geschichte Kubas. München: Beck 2000, S. 119f. Zit. nach Reinstädler: Die Theatralisierung der Karibik, S. 42. Zit. nach Irma Llorens: Nacionalismo y literatura. Constitución e institucionalización de la «República de las Letras Cubanas». Lérida: Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos 1998, S. 90f.
33
deren Hauptleidtragende sowohl Schwarze als auch die in immer stärkeren Wellen immigrierenden Asiaten waren, die als Reservearmee effektiv zum Lohndumping ausgenutzt werden konnten? I.4.5. Haiti: zur Dialektik der Imitation Schließlich bleibt zu fragen, wie sich innerkaribische Transferprozesse dort gestalteten, wo sich spanisch- und französischsprachige Akteure unmittelbar, ohne das scheidende Meer überwinden zu müssen, begegnen konnten, zumindest theoretisch, wo jedoch zugleich ein tiefer Graben zwischen ihnen bestand: auf Hispaniola, geteilt in Haiti und Santo Domingo und über 20 Jahre gewaltsam vereint durch die haitianische Besatzung (1822–1844). Nicht nur für Haiti auf französischer, sondern auch für Santo Domingo auf spanischer Seite gilt, dass es die einzige karibische Besitzung des jeweiligen Einflussbereichs war, die innerhalb des Untersuchungszeitraums (wenn auch nur zeitweise: im Falle Santo Domingos in den 1840er- bis 60er-Jahren) ihre Unabhängigkeit behaupten konnte.86 Der Sozialromantik eines Galván87, dessen Held Enrique sich auf «el gran Hugo» beruft und die Menschlichkeit gegenüber den spanischen Kriegsgefangenen großschreibt, steht in Haiti paradoxerweise die engste Anlehnung an die französische Kultur gegenüber, wie sie im Roman Stella von Bergeaud paradigmatisch zum Ausdruck kommt. Auch die haitianische Lyrikproduktion bietet in dieser Hinsicht einiges: Oui, France, nous t’aimons, comme plusieurs, sans doute, De tes propres enfants ne t’aimeront jamais ; Et partout où ton doigt nous indique la route C’est là que nous cherchons l’harmonie et la paix.88
86
87
88
34
Vgl. dazu den Beitrag von Frauke Gewecke: Saint-Domingue/Haití – Santo Domingo. Proyectos de una isla/nación une et indivisible. In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 253–281. Gewecke beschäftigt sich darin mit den haitianischen Besetzungen Santo Domingos im Zeitraum von 1795 bis 1865, die nach der Revolution wiederholt zur zeitweiligen Wiedervereinigung der Insel führten. Sie stellt dar, wie die Chancen, einen transkulturellen Staat aus revolutionärem Westen und spanisch/dominikanischem Osten nach Toussaints Ideal einer île une et indivisible zu gründen, in den hegemonialen Interessenskonflikten der kolonialen Mächte Frankreich, Spanien und England verspielt wurden. Die Transfers zwischen dem frankophonen und dem hispanophonen Teil der Insel würden angesichts eines ausgeprägten dominikanischen Antihaitianismus, der im 19. Jahrhundert zwischen europäischem Protektionismus und US-amerikanischem Anexionismus schwankte, in der Geschichtsschreibung als höchst konfliktiv und aggressiv bewertet. Dabei werde häufig das dynamische Potential anderer Möglichkeiten unterschlagen, die historisch mehrfach die Realität der gesamten Insel ausgemacht haben. Der Dominikaner Manuel de Jesús Galván (Santo Domingo 1834–Puerto Rico 1910) war ein spanientreuer Diplomat und Journalist, der durch seinen historischen Roman Enriquillo (1879/1882) bekannt wurde. Vgl. zu Galván auch Torres Saillant: An Intellectual History, S. 206. Massillon Coicou: Poésies nationales. Paris: Goupy et Jourdan 1892, S. 113f. Vgl. Hoffmann: Littérature d’Haïti, S. 92.
Diese Lobeshymne von Massillon Coicou (1867–1908) lässt den haitianischen Autor sogar im Vergleich zu den Franzosen als den besseren Patrioten erscheinen. Die konsequent das Mutterland glorifizierende Frankophilie ist eine besonders häufig anzutreffende Tendenz auf Haiti. Die unterschiedlichen Versuche einer Definition des eigenen Selbstverständnisses als erster unabhängiger schwarzer Staat Lateinamerikas führten bald dazu, dass dem einstigen Mutterland Frankreich erneut eine Orientierungsfunktion konzediert wurde. Französische Kultur, die als alleiniges Modell favorisiert wurde, fungierte einerseits als Garant für eine Sonderstellung im eigenen Land, mit der man sich den Aufstieg sichern konnte, und sollte andererseits die Rassendiskriminierung durch die Franzosen (und alle Weißen) als Unrecht ausweisen. Die Akzeptanz Haitis durch die Länder der westlichen Kultur zu erlangen, war die Intention der meisten kulturellen Bestrebungen, bei denen dann konsequent alle in Haiti noch bedeutsamen afrikanischen Kulturmanifestationen als rückständig angeprangert wurden, während man dazu neigte, die Parallelen zu Frankreich apotheotisch zu verklären: Es galt, die Ebenbürtigkeit des Schwarzen mit dem Weißen unter Beweis zu stellen. Unter dem Titel «Transfers culturels et légitimation postcoloniale du pouvoir – l’émergence de la presse et de la littérature haïtienne pendant le règne du Roi Christophe en Haïti» zeigt Hans-Jürgen Lüsebrink, wie präsent diese Bestrebungen in Presse und Literaturbetrieb im haitianischen Königreich Henri Christophes waren. An Textbeispielen von Abbé Henri Grégoire, Antoine Métral und Baron de Vastey aus den Jahren 1800 bis 1820 arbeitet er überzeugend heraus, welch zentrale Rolle die Printmedien für die Legitimation der Unabhängigkeit Haitis spielten. Indem die haitianischen Autoren den Stil der Hofberichterstattung des französischen Ancien Régime imitierten, leisteten sie einen entscheidenden Beitrag zur internationalen Anerkennung der intellektuellen Fähigkeiten, des «Zivilisationsgrads» und der Selbstverwaltung des neuen Staates. Nicht zuletzt durch diese kreative Aneignung okzidentaler Repräsentationsmedien gelang es dem postkolonialen Staat, seine Machtposition zu behaupten.89 Entscheidend für den weiteren Verlauf der haitianischen Geschichte ist, dass Idee und Sprache der Revolution weiß waren. Die schwarzen Sklaven machten die Revolution nicht aus eigener und selbstständiger Initiative, sondern als Mimikry
89
«La littérature haïtienne se voulait représenter, de par son existence même, une sorte de ,pièce à conviction‘ […] pour reprendre la métaphorique judiciaire utilisée par Grégoire) essentielle visant à ,prouver‘, aux yeux de l’opinion publique occidentale, mais aussi de son propre peuple, la capacité d’évolution intellectuelle de la jeune nation haïtienne ; c’est-à-dire sa faculté de réussir même dans les genres poétiques considérés comme les genres sublimes par l’art poétique de l’époque et d’atteindre rapidement, à travers des ,progrès‘ jugés étonnants par des observateurs externes comme Grégoire, Sismondi et Métral, des stades avancés de la ,civilisation‘. Hans-Jürgen Lüsebrink: Transfers culturels et légitimation postcoloniale du pouvoir. L’émergence de la presse et de la littérature haïtienne pendant le règne du Roi Christophe en Haïti. In: Ette, Müller: Caleidoscopios coloniales, S. 305–325, hier S. 321. Vgl. Abel: Tagungsbericht.
35
der Rhetoriken ihrer weißen Herren.90 Michael Zeuske verweist in diesem Zusammenhang auf eine der ersten Revolutionserzählungen im hispanischen Imperium, die Juan López Cancelada aus dem Französischen ins Spanische übersetzt hatte. Diese Erzählung setzt an den Beginn der Sklavenrevolution auf Saint-Domingue einen Demiurgen, einen geheimnisvollen Führer als Mentor der Schwarzen, der vor der Revolution Haussklave und Friseur eines französischen Rechtsanwaltes gewesen sei und die Rede- und Denkweise seines Herrn übernommen habe.91 Diese Sicht der Dinge kommt auch besonders deutlich zum Ausdruck in dem 1859 veröffentlichten Roman des haitianischen Autors Émeric Bergeaud, in dem die haitianischen Revolutionsführer die weiße Protagonistin Stella lieben. Sie ist eine Allegorie auf das revolutionäre Frankreich, das ihnen die Idee der Freiheit suggerierte und den Mut gab, dafür zu streiten und sich gegen das kolonialistische Frankreich zu erheben. Welche Bedeutung hat die Frankophilie in diesem für die Karibik einzigartigen, ausschließlich schwarzen Kontext? Kann man trotz aller Mimikry von einer Kulturalisierung der auf den anderen Inseln üblichen rassischen und essentialistischen Unterscheidungskriterien sprechen? Tritt französische Kultur an die Stelle von (weißer) Hautfarbe?
I.5.
Debatten um Abolition in Frankreich und Spanien
I.5.1. Debatten um Abolition in Frankreich (1789–1848) Im Falle Frankreichs kann von der einen abolitionistischen Bewegung kaum die Rede sein, da die Motivationen verschiedener gesellschaftlicher Gruppen wie auch einzelner Persönlichkeiten für abolitionistische Forderungen sehr vielfältig waren – ein Umstand, der dazu führte, dass sich die Abolitionisten in Frankreich bis zur realen Abschaffung der Sklaverei nie effektiv zu organisieren vermochten. Die Bewegung hin zu einer dauerhaften Abolition ist in Frankreich nicht linear verlaufen, sondern als komplexes Feld unterschiedlicher Kräfte zu verstehen. Die erste Gesellschaft, die sich in Frankreich für die Abolition einsetzte, war die 1788 ins Leben gerufene Société des amis des Noirs. Martin Klein beschreibt, dass diese erste Gesellschaft, im Vergleich zu Großbritannien oder den Vereinigten Staaten, relativ spät gegründet wurde und viel elitärer war als ihre Schwestern in der angelsächsischen Welt. Sie zählte nur wenige, wenn auch einflussreiche Mitglieder. Ihre Wurzeln lagen nicht in der Kirche, und es gehörte auch nicht zu ihren erklärten Zielen, die Öffentlichkeit zu erreichen.92 Ihre Arbeit beschränkte sich vielmehr auf eine lobbyistische Tätigkeit, die darin bestand, 1789 der Assemblée Klagen und Beschwerden einzureichen. Zweifelsohne hatte die Aufklärung
90 91 92
36
Michael Zeuske: Schwarze Karibik. Sklaven, Sklavereikultur und Emanzipation. Zürich: Rotpunkt 2004, S. 169. Ebda., S. 169. Martin A. Klein: Historical Dictionary of Slavery and Abolition. Lanham: Scarecrow Press 2002, S. 28. Für wichtige Hinweise in diesem Kapitel danke ich Hafid Derbal.
zu einem Klima geführt, das gegenüber den Rechten der Schwarzen und der Sklavereiabschaffung positiv eingestellt war, doch dass die Frage der Abolition während der gesamten Revolutionszeit eine Rolle spielte, ist zu einem großen Teil auf die Arbeit dieser ersten Société zurückzuführen. Laut Klein hat sie auch die Unzufriedenheit und den Aufruhr in den Kolonien angestachelt. Viele ihrer Mitglieder, wie der Marquis de Condorcet, waren Teil der republikanischen Girondisten und wurden während der Revolution hingerichtet.93 1791 übertrug die Assemblée karibischen Farbigen die Staatsbürgerschaft und verschärfte so die Spannungen in Saint-Domingue. Wenig später, im Jahr 1794, schaffte sie die Sklaverei im französischen Kolonialreich ab und verbot Sklavenhaltern, ihre Sklaven nach Frankreich mitzubringen. Abbé Grégoire (1750–1831), eines der schillernden Mitglieder der Société des amis des Noirs und zu dieser Zeit die führende Persönlichkeit der Abolitionsbefürworter, veröffentlichte ein Pamphlet mit dem Titel Lettre aux Citoyens de couleur, in dem er sich für ein Wahlrecht der Mulatten einsetzte. Er unterhielt auch Briefwechsel mit dem haitianischen Führer Toussaint Louverture und wurde zu einem Sprachrohr der Haitianer in Frankreich.94 Dieses Engagement von Grégoire, sowie die Arbeit vieler anderer, konnten zwar zu einem solch frühen Zeitpunkt keineswegs die Abolition erreichen, weil man weder in Frankreich selbst noch in den Kolonien darauf vorbereitet war. Sein Engagement war jedoch für die Abolition immens wichtig, da auf diese Weise die Abolitionismusfrage kontinuierlich diskutiert wurde und Teil der politischen und wirtschaftlichen Agenda blieb. Grégoire war auch einer der bekanntesten Kritiker der Wiedereinführung der Sklaverei unter Napoleon Bonaparte im Jahr 1802. Als die revolutionären Kräfte versuchten, die Kirche neu zu organisieren, gehörte Grégoire zu den wenigen Priestern, die die Reform akzeptierten. Das machte ihn zu einer kontroversen Persönlichkeit und schadete letztlich langfristig der Abolitionsbewegung, denn sein Engagement machte es schwierig, bei der Kirche Unterstützung für die Sache der Abolition zu suchen. Die katholische Kirche, deren Rolle von Seymour Drescher beschrieben wird,95 befand sich in einem Dilemma. Sie stand der Aufklärung und der Revolution feindlich gegenüber und sah die Abolition oder Kräfte wie die Société des amis des Noirs in diesem Zusammenhang.96 Aufklärung und Revolution hatten die Machtstellung der Kirche stark erschüttert, und ihr Hauptanliegen war es, im postrevolutionären Frankreich überhaupt zu überleben. Das Bestreben der Kirche ging folglich dahin, Frieden mit den neuen Regierenden zu schaffen, die die
93 94 95
96
Ebda., S. 273f. Ebda., S. 160f. Vgl. Seymour Drescher: Two variants of Anti-Slavery. Religious Organization and Social Mobilization in Britain and France, 1780–1870. In: Seymour Drescher (Hg.): From Slavery to Freedom. Comparative Studies in the Rise and Fall of Atlantic Slavery. Basingstoke: Macmillan 1999, Kap. 2, S. 35–56. Klein: Historical Dictionary, S. 84.
37
Sklaverei wiedereingeführt hatten. Zusätzlich verpflichtete sie sich durch ihre vereinbarte staatstragende Rolle dazu, den kolonialen Status quo nicht anzutasten.97 Jean-Marcel Champion bemerkt, dass das Gesetz zur Wiedereinführung der Sklaverei von 1802 nur das offiziell machte, was sich de facto ohnehin nie geändert hatte.98 Die Sklaverei war praktisch nirgends abgeschafft worden. Bonapartes Einstellung zur Sklaverei beruhte auf drei Säulen: Erstens strebte er an, die Ordnung und Autorität Frankreichs in allen Kolonien wiederherzustellen, und zweitens, sie wieder zu wirtschaftlichem Reichtum zu führen. Drittens beabsichtigte er, die Antillen, und besonders Saint-Domingue, als Plattform für eine aktive Politik auf dem amerikanischen Kontinent zu nutzen. Champion bemerkt, dass Bonapartes pragmatische Politik sich je nach Lage verhärten konnte: Sein Hauptziel bestand darin, den kolonialen Status quo zu erhalten.99 Bonaparte machte aber auch deutlich, dass die Abolition in Regionen, wo sie bestand, nicht angetastet werden würde. Guadeloupe, wo die Abolition kurzzeitig durchgesetzt worden war, stellt eine Ausnahme dar, denn dort wurde die Sklaverei tatsächlich 1802 von Antoine Richepanse wiedereingeführt.100 Paul Michael Kielstra kommt zu dem Schluss, dass die französische Abolitionsbewegung bis 1814 zersplittert und kaum organisiert war.101 Es gab protestantische Intellektuelle wie Madame de Staël und den Duc de Broglie, deren Haltung sowohl religiöse als auch politische Gründe hatte und der Restauration entgegenstand. Hinzu kamen aber auch konservative Adelige, die sich aus verschiedenen Gründen gegen den Sklavenhandel aussprachen. Auch wenn sie die Debatten am Leben hielten, konnten sie kaum etwas bewegen, weil die Zeichen der Zeit noch von Kräften gesetzt wurden, die den Handel und den kolonialen Status quo brauchten, um die Reichtümer wiederherzustellen, die ein Vierteljahrhundert Krieg verschlungen hatten.102 Die Reaktionen der politischen Kräfte der Restauration, der liberalen eingeschlossen, fielen noch deutlich pro Sklaverei aus. Francis Arzalier gibt zu bedenken, dass diese Kräfte sicher den zunehmenden britischen Druck und die Sklavenaufstände wahrgenommen hatten. Das bewegte sie zu der Einsicht, dass die Sklaverei auf lange Sicht zu einem Ende kommen würde, machte sie jedoch keineswegs zu Abolitionisten. Dafür war die Verbindung mit dem alten Kolonialsystem noch zu stark.103
97 98
99 100 101
102 103
38
Drescher: Two variants of Anti-Slavery, S. 42. Jean-Marcel Champion: 30 Floréal Year X. The Restoration of Slavery by Bonaparte. In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 229–236, hier S. 230. Ebda., S. 230. Ebda., S. 232f. Paul Michael Kielstra: The Politics of Slave Trade Suppression in Britain and France, 1814–48. Diplomacy, Morality and Economics. Basingstoke, Hampshire: Macmillan u.a. 2000, S. 21. Ebda., S. 21. Francis Arzalier: Changes in Colonial Ideology in France before 1848. From Slavery to Abolitionism. In: Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery, S. 261–271, hier S. 261.
Die pragmatische Politik, die die Zeit der Restauration bestimmte und darauf abzielte, das postrevolutionäre Frankreich und sein Kolonialreich zu stabilisieren, war geprägt von einer Generation, die noch die Zeit vor 1789 erlebt hatte und teilweise zurückwünschte. Gaspard Théodore Mollien beispielsweise hatte geholfen, die Unabhängigkeit und Schuldenfrage Haitis zu verhandeln. Er schrieb zwischen 1827 und 1831 Hunderte von Manuskriptseiten über den Verlust der Kolonien und ihren Zustand, die eine deutliche Nostalgie für die vorrevolutionäre Zeit verraten. Mollien akzeptierte zwar, dass die Sklaverei keine Zukunft hatte, fand dies jedoch bedauerlich.104 Wie stark die französische Wirtschaft unter der Revolution gelitten hatte, wird anhand von Zahlen deutlich, die in verschiedenen Parlamentsdebatten während der Restauration aufgeführt wurden. Der Handel des französischen Kolonialreichs war von 100.000 Gütertonnen vor der Revolution auf knapp 7.000 Tonnen im Jahr 1813 gefallen. Das führte die neuen Regierungen ab 1814 zu der Einschätzung, Frankreich könne sich nicht von den Krisen erholen und eine Wiederherstellung des kolonialen Wohlstands sei unmöglich.105 Der herausgehobene Stellenwert Saint-Domingues in diesen Debatten wird darin ersichtlich, dass am Vorabend der Revolution von den etwa 165 Millionen Francs, die die kolonialen Erzeugnisse abwarfen, rund 120 allein aus Saint-Domingue kamen.106 Eine Reihe Schiffseigner und -händler spielten in den ersten Restaurationsjahren eine Schlüsselrolle, unter ihnen Admiral Dufort de la Rochelle und Lezurier de la Martel. Sie wurden von Armeeangehörigen unterstützt, die im Parlament Gehör fanden, und hatten sowohl aus politischen wie strategischen Gründen ein Interesse daran, wieder zur alten Kolonialordnung zurückzukehren.107 Die wirtschaftlichen Interessen rund um die Frage der Sklaverei sind, wie bei Francis Démier ganz deutlich wird, keineswegs als Randproblem im ökonomischen Denken der Industrialisierungszeit zu sehen. Gerade die Interessen der Zuckerindustrie beeinflussten zunehmend die Abolitionsdebatten. Wirtschaftskrisen hatten in den 1820er-Jahren die Weltmarktpreise für Zucker stark erschüttert und den Preis für Rohrzucker auf die Hälfte fallen lassen. Das hatte verheerende Konsequenzen für die französischen Kolonien und führte zu erheblichen Einbußen. Gleichzeitig stiegen die Sklavenpreise um 1816 rasant an. Diese ökonomischen Rahmenbedingungen bewegten viele, sowohl in Paris als auch in den Kolonien, langsam über alternative Anbaumethoden, vor allem aber über alternative Arbeitskräfte nachzudenken.108 Die Mehrheit der Plantagenbesitzer jedoch wehrte sich gegen einen Wandel und organisierte und finanzierte die Lobbyarbeit für ihre Interessen in Paris. So schickte sie eine Delegation von 52 Personen in das
104 105
106 107 108
Ebda., S. 262. Francis Démier: Slavery, Colonial Economy and French Development Choices during the First Industrialization (1802–1840). In: Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery, S. 237–247, hier S. 237. Ebda., S. 238. Ebda., S. 239. Ebda., S. 241.
39
für atlantische Belange wichtige Bordeaux, die über mehrere Monate mit großen finanziellen Ressourcen die Interessen der Großgrundbesitzer auf den Antillen repräsentierte. Die politischen Führer und direkten Sprecher im Parlament waren der Herzog de Fitzjames, der Marquis de Lally Tollendal, der Comte de Sesmaisons, Révillière und verschiedene Abgeordnete und Soldaten, die direkt mit kolonialen Zirkeln in Beziehung standen, wie beispielsweise Generalleutnant Ambert. Diese Bewegung war der Ultrarechten nahe, und ihre Interessen waren eng mit denen der Marine und des Militärs verbunden. Kolonialbesitzungen brachten immer die Notwendigkeit einer starken Flotte mit sich.109 Philippe Vigier erwähnt in diesem Zusammenhang den Conseil des délégués des colonies und dessen Einfluss auf die beiden Kammern.110 Gleichzeitig erlebte die Restaurationszeit ein langsames, aber stetes Erstarken von verschiedenen und diffusen Einstellungen, die zur Abschaffung des Sklavereisystems tendierten. Diese waren vor allem bei Persönlichkeiten zu erkennen, die sich als Erben der Aufklärung und Revolution sahen. Sie waren auch ein Indiz dafür, dass eine neue Generation von Schriftstellern und Politikern heranwuchs, eine Generation, die die vorrevolutionäre Zeit nicht selbst erlebt hatte und dadurch beispielsweise die haitianische Revolution anders wahrnahm. Sie waren laut Arzalier eher treue Monarchisten, die ihre Ablehnung der Sklaverei auf der Grundlage eines religiös angehauchten Humanitarismus aufbauten – moderate Persönlichkeiten wie der Herzog de Broglie und sein Freund Benjamin Constant, Guizot, d’Argout und Auguste de Staël.111 Während der Restaurationszeit wurden auch liberale Stimmen lauter, die eine Abschaffung der Sklaverei aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus befürworteten und zunehmend die Kolonialfrage zu einer zentralen ökonomischen Frage machten. Sich auf die Kolonien zu beschränken und am alten Kolonialsystem festzuhalten hieße, so meinte man, den Handel mit den jungen, unabhängigen Staaten Lateinamerikas zu verhindern. Derart eingestellte Liberale kamen mit anderen Abolitionisten in der Société de la morale chrétienne zusammen, die 1822 ein Comité pour l’abolition de la traite des Noirs ins Leben rief. Sie wurden von Leuten wie Benjamin Constant112 and Jacques Antoine Manuel unterstützt und konnten zudem ihre Gedanken in verschiedenen Presseorganen wie Commerce, Producteur und Le Constitutionnel drucken lassen.113 Obwohl die pro-abolitionistische Haltung der Liberalen weniger einer Sympathie für die Schwarzen als handfesten Wirtschaftsinteressen geschuldet war, muss festgehalten werden, dass sie wesentlich dazu beitrugen, diese Fragen, die die Sklavereifrage einschlossen,
109 110 111 112
113
40
Ebda., S. 242. Philippe Vigier: The Reconstruction of the French Abolitionist Movement under the July Monarchy. In: Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery, S. 248–254, hier S. 251. Arzalier: Changes in Colonial Ideology, S. 262. Die Frage der Abolition taucht immer wieder in Constants Reden auf, wenn er argumentiert, dass Frankreich sich in einem progressiven Europa zunehmend isoliere. Démier: Slavery, Colonial Economy, S. 244. Ebda., S. 243.
in den Mittelpunkt der politischen Debatten zu rücken. Die meisten Stellungnahmen der Zeit sprachen sich eher für eine Transition aus und sahen Reformen als notwendige Maßnahmen, um schrittweise das alte Sklavensystem abzuschaffen oder zumindest zu ändern. Radikale Stimmen, die eine sofortige Abschaffung forderten, bildeten zu diesem Zeitpunkt noch die Ausnahme, waren aber durchaus vorhanden: Der zu der Zeit recht bekannte Philanthrop P.-A. Dufau versuchte in einem Pamphlet von 1830 die Plantagenbesitzer davon zu überzeugen, dass es in ihrem Interesse sei, eine Sklavereireform einzuleiten, die die Bedingung für eine Modernisierung ihrer Plantagen sei.114 Wer auch immer sich für die Abolition aussprach, musste sich den Vorwurf gefallen lassen, der Sache Englands dienen zu wollen, denn das Klima der Zeit war von einer allgemeinen Anglophobie gekennzeichnet.115 Dass die Zeit ab der Julirevolution insgesamt zunehmend von einem abolitionistischen Charakter geprägt war, lag nicht nur an dem Generationswechsel, der sich vollzog, sondern gewiss auch an einem neuen internationalen geopolitischen Kontext und an den beschriebenen, sich wandelnden ökonomischen Gegebenheiten. Bereits zu Beginn der 1820er-Jahre war dieser Wandel zu spüren, wie eine Bemerkung des Comte Molé, Marine- und Kolonienminister, von 1822 zeigt: Nichts könne das auf Sklaverei basierte Kolonialsystem vor seinem Zusammenbruch retten, meinte er.116 So war es nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die französische Regierung dem allgemeinen Trend folgte und – auch auf den starken britischen Druck hin – 1827 den Sklavenhandel verbot. Das Gesetz dazu wurde von den Abgeordneten mit 220 zu 64 Stimmen gebilligt. Auch wenn Frankreich zunächst wenig unternahm, um den noch bestehenden illegalen Sklavenhandel zu bekämpfen, zeigt die Billigung dieses Gesetzes einen deutlichen Meinungswechsel der politischen und sozialen Elite Frankreichs bezüglich des Sklavereisystems. Arzalier betont, dass sich diese Wende auch in der literarischen Produktion der Zeit manifestiert und sowohl den Geisteswandel der Autoren als auch den der Leser widerspiegelt.117 Eine Parallele findet diese Entwicklung in der Einstellung Frankreichs gegenüber dem schwächer werdenden und verfallenden Osmanischen Reich: Die Société de la morale chrétienne lancierte eine Kampagne, um die Griechen von der türkischen «Sklaverei» zu befreien. Einige ihrer Mitglieder, wie d’Argout, Guizoit und der Bankier Lafitte konnten nach der Julirevolution hohe politische Ämter erringen. Trotzdem musste die völlige Abschaffung der Sklaverei in den französischen Kolonien noch bis 1848 warten. Frankreich nutzte die propagandistischen Möglichkeiten, die in der Forderung nach Abschaffung der Sklaverei
114 115 116 117
Ebda., S. 244. Vigier: The Reconstruction, S. 252. Arzalier: Changes in Colonial Ideology, S. 262. Ebda., S. 262. Der Artikel von Francis Arzalier ist besonders erwähnenswert, da er bekannte und auch weniger bekannte literarische Werke sowie politische und historische Diskurse der Zeit analysiert, um die (sich wandelnde) Geisteshaltung zu veranschaulichen.
41
im Osmanischen Reich lagen, und versuchte deshalb auch die Eroberung Nordalgeriens ab 1830 mit abolitionistischen Argumenten zu begründen. Auch wenn es in Algerien zum Zeitpunkt der französischen Eroberung faktisch keine Sklaven mehr gab, rechtfertigte Frankreich seine Expedition und Eroberung damit, dass es die Piraterie und die Versklavung der Christen dort beendet sehen wolle.118 Diese Geisteshaltung findet sich in verschiedenen Werken wieder: Die Mehrheit der Romantiker, unter ihnen auch Alexandre Dumas, kombinierten ihre Ablehnung der Sklaverei mit einer Verurteilung des Islams, der als Träger der Sklaverei gesehen wurde.119 Diesen Zusammenhang kann man auch bei Schœlcher erkennen, dessen Reise nach Ägypten im Jahr 1845 ihn dazu veranlasste, die Person Mohammed Alis und den Islam als Rechtfertiger der Sklaverei zu brandmarken. Er lancierte im Jahr 1846 eine Petition, die dazu aufrief, die Sklaven in Algerien zu befreien.120 Die Abolition wurde also zunehmend dazu genutzt, die Kolonisierung neuer Gebiete zu rechtfertigen, und etablierte sich im Diskurs der neuen politischen und sozialen Kräfte Frankreichs. Das Erstarken neuer Kräfte bedeutete aber keineswegs das Verschwinden der alten. Noch Anfang der 1830erJahre erschienen verschiedene Werke, die deutlich den Erhalt der alten Strukturen forderten und ein positives Bild des Sklavensystems zeichneten.121 Insgesamt ermöglichte «1830» in Frankreich die Reorganisation von Bestrebungen hin zu einer Abolition, wobei abolitionistische Forderungen laut Philippe Vigier keinesfalls eine Randerscheinung einzelner Persönlichkeiten und ihrer Interessensvertreter im Parlament blieben.122 So wurde 1833 die Société française pour l’abolition de l’esclavage gegründet, die Victor Schœlcher, zweifelsfrei die bekannteste Persönlichkeit dieser Bewegung, zu ihren Gründungsmitgliedern zählte. Sie sah sich als Gruppe, die die öffentliche Meinung zu beeinflussen suchte und Druck auf die beiden Kammern und verschiedene aufeinanderfolgende Regierungen ausübte.123 Die Abolitionsbewegung ist indes nicht in klar definierten Zirkeln und Gesellschaften zu fassen; sie brachte auch Persönlichkeiten aus verschiedenen politischen Lagern und Konfessionen zusammen. Linke Größen wie Ledru-Rollin und Béranger trafen hier auf Zentralisten wie Lamartine und Tocqueville124, auf moderate Orleanisten wie Barrot, La Fayette, Molé und Achille de Broglie oder
118 119 120
121 122 123 124
42
Ebda., S. 264. Ebda., S. 267. Die politische Forderung, die Sklaverei in Algerien aktiv zu bekämpfen, muss natürlich einer Diskursanalyse unterzogen werden. Drescher zeigt, dass sie letzten Endes aus realpolitischen Gründen nicht umgesetzt wurde. Seymour Drescher: British Way, French Way. Opinion Building and Revolution in the Second French Slave Emancipation. In: Drescher (Hg.): From Slavery to Freedom, Kap. 6, S. 158–195, hier S. 167. Arzalier: Changes in Colonial Ideology, S. 264f. Vigier: The Reconstruction, S. 248. Ebda., S. 248. Alexis de Tocqueville gehörte zu jenen, die eine Kompromisslösung in der Sklavereifrage anstrebten. Er setzte sich für die Abolition ein, diese sollte jedoch mit Entschädigungszahlungen einhergehen. Ebda., S. 249.
auch auf Liberale wie den religiös motivierten Reformer und Journalisten F.R. de Lamennais und Montalembert, der ab 1831 deutlich die Sklaverei verurteilte, von der das Römische Reich durch das Christentum befreit worden sei.125 Arzalier erklärt sich die Zusammenführung solch verschiedener Kräfte dadurch, dass die Abolition vielmehr eine moralische als eine politische Forderung war.126 Dagegen müssen aber auch, wie Démiers Artikel zeigt, wirtschaftliche Interessen gehalten werden.127 Klein gibt zu bedenken, dass etwa 70% von Frankreichs Überseehandel mit karibischen Import- und Exportgütern zusammenhing, ohne jedoch klarzustellen, welche Zeit genau gemeint ist.128 Die Zuckerfrage, die noch einen Großteil der 1820er-Jahre geprägt hatte und eng mit der Sklavereifrage zusammenhing, schien Anfang der 1830er an Bedeutung verloren zu haben. In den 1840er-Jahren jedoch kam es zum Konflikt zwischen Zuckerrüben- und Rohrzuckerproduzenten. Rohrzucker war zum wichtigsten Produkt der Kolonialwirtschaft geworden und wurde von einem billigeren, «moralischeren» und moderneren Rübenzucker bedrängt. Dies hatte auch Konsequenzen für die Frage der Sklaverei.129 Am 18. Juli 1845 wurde ein Gesetz verabschiedet, das freien Sklaven eine kleine Summe Geld sicherte und ihnen erlaubte, Eigentum zu besitzen. Dies wurde als entscheidender Schritt in die Richtung einer definitiven Abolition angesehen.130 Nicht zuletzt spielte die republikanische Presse in diesen Debatten eine wichtige Rolle. Hier sind Buchez’ und Roux’ L’Atelier, Ledru-Rollins La Réforme und Le Siècle, aber auch zentralistische Kräfte wie Lamartine erwähnenswert. Philippe Vigier nennt noch weitere Zeitschriften, in denen sich die Abolitionsdebatte abspielte. Das Journal des débats, das er als halboffizielles Blatt der Orleanisten ansieht, verurteilte, obwohl deutlich rechts einzuordnen, die Kolonisten für den Versuch, das Sklavereisystem beizubehalten. Die Démocratie pacifique von Victor Considérant war ebenfalls abolitionistisch eingestellt, jedoch wesentlich radikaler und politisch links anzusiedeln. Vigier erwähnt auch Cyrille Bissette, den Herausgeber der Revue des Colonies, der als Mulatte von den Antillen immigriert war und zu einem entschlossenen Kämpfer für die Sache der Schwarzen gegenüber den Kreolen wurde.131 1824 war Bissette vom Tribunal Royal auf Martinique zusammen mit Fabien und Volny für schuldig befunden worden, die zivile und politische Ordnung in den französischen Kolonien stürzen zu wollen, weil er ein Pamphlet verfasst hatte, in dem er die unfaire Behandlung der freien Mulatten auf der Insel kritisierte und gleiche Rechte für sie forderte. Führende
125 126 127 128 129 130 131
Arzalier: Changes in Colonial Ideology, S. 265. Ebda., S. 120. Démier: Slavery, Colonial Economy, S. 242. Klein: Historical Dictionary, S. 82. Démier: Slavery, Colonial Economy, S. 246. Vigier: The Reconstruction, S. 252; Drescher: British Way, French Way, S. 166. Vigier: The Reconstruction, S. 250. Vigier bezieht sich hier auf die Arbeit von Stella Pâme, die er lobt. In ihrer thèse de troisième cycle beschreibt sie das Leben und Werk von Cyrille Bissette.
43
Anwälte und Liberale in Frankreich starteten deshalb 1827 eine Kampagne und erreichten die Aufhebung des Urteils. Bissette wurde jedoch verbannt und ging nach Paris.132 Seine Ankunft dort belebte das Interesse für koloniale Fragen neu und rief in der Öffentlichkeit Sympathien für die farbigen Menschen hervor.133 Drescher beschreibt Bissette als einen der fleißigsten Petitionssammler in Paris in den 1840er-Jahren.134 Abschließend kann festgehalten werden, dass die Abolitionsdebatten, die Frankreich geprägt haben, von moralischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren beeinflusst wurden, die alle in einem sich wandelnden nationalen und internationalen Kontext einzuordnen sind. Auch wenn die verschiedenen Regimes (1789–1802, 1802–1815, 1815–1830, 1830–1848) zweifelsohne einen hilfreichen Rahmen bieten, darf nicht der Eindruck einer linearen und schematischen Entwicklung entstehen. Die Einflüsse sind also vielmehr als multidirektional zu sehen. Wenn neue Faktoren und Kräfte erschienen, bedeutete das noch lange nicht, dass die alten verschwanden. Und dass manche von ihnen zeitweise schwächer wurden, konnte sich durch einen neuen nationalen oder internationalen Kontext schnell ändern. Wenn es die eine abolitionistische Bewegung nicht gab, und es sich in Frankreich zudem nicht um eine lineare Entwicklung hin zu einer Abolition handelte, bleibt als Leitfrage stehen: Welchen Zusammenhang gibt es zwischen einer Parteinahme für die Abolition und einer Positionierung zum kolonialen Status quo? Es mag erstaunen, dass in einem Klima solch dichter Debatten und eines solchen gesellschaftskritischen Potentials Fragen zum kolonialen Status quo in der Karibik – mit Ausnahme Haitis – keine vergleichbare Rolle spielten wie bei den spanischen Nachbarn. I.5.2. Debatten um Abolition in Spanien (1810–1886) Fragen der Sklaverei und des Abolitionismus im 19. Jahrhundert in Spanien müssen immer in einer transatlantischen Dimension gesehen werden, die den Einfluss der auf ihren Machterhalt bedachten kubanischen «Zuckerbarone» ebenso umfasst wie die abolitionistischen Bemühungen der puertoricanischen Reformer. Genauso gilt es, die Interessen in Spanien zu berücksichtigen, speziell jener Kreise, die mit einem moderaten Liberalismus verbunden waren. Diese Interessen richteten sich auf wirtschaftlichen Protektionismus und den Erhalt des Sklavenhandels als Ursprung großer und vieler Reichtümer. Enriqueta und Luisa Vila Vilar haben betont, dass die Entwicklung der Abolitionismus-Debatten in Spanien paradoxal verläuft: «es en España donde se dan manifestaciones abolicionistas absolutamente pioneras […] y al mismo tiempo es en España – si exceptuamos Brasil – donde la rémora de la esclavitud per-
132 133 134
44
Éric Mesnard: Resistance Movements in the French Colonies. The Bissette Affair (1823– 1827). In: Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery, S. 255–260, hier S. 255. Ebda., S. 257. Drescher: British Way, French Way, S. 169.
manece por más tiempo».135 Diese Autorinnen sprechen auch von einem unguten Schweigen, das dieses Thema in Wissenschaft und Literatur umgibt: Salvo algunas notables excepciones es raro encontrar escritores que tomen postura o que se refieran abiertamente al tema esclavista fuera del ámbito propagandístico de La Sociedad Abolicionista […] por otra parte hay que tener en cuenta que los derechos de expresión estuvieron cercenados durante casi toda la centuria.136
In Bezug auf dieses Schweigen über die Sklaverei und den Sklavenhandel heben die Artikel von Maluquer de Motes und Durnerin hervor, dass el silencio como política y el creciente desprestigio entre la opinión publica internacional incluidos los propios esclavistas antillanos […] esta aspiración a cerrar el debate abierto por las propuestas de Turnbull queda bien reflejada en las formulaciones de un anónimo esclavista español: «suplicamos al gobierno que, volviendo por su honor y por el de la nación decrete un día (…) De la esclavitud no se hable mas». Es decir, la ley del silencio.137
Vila Vilar und Hernández Sánchez-Barba haben drei Etappen ausgemacht, in denen über das Thema der Sklaverei debattiert wurde: Die Periode von 1810–1814, von 1835–1845 und von 1869–1886. Einen Vorläufer der Debatten um Sklaverei und Abolitionismus stößt der liberale Denker Arango y Parreño mit seinem Werk Discurso sobre la agricultura y medios para fomentarla von 1792 an, das er König Carlos IV. vorstellte und in dem er den Sklavenhandel verteidigte. Wenige Jahre danach wandte er sich von dieser Position ab, als er die politischen Folgen einer derartigen Haltung erkannte. Als wichtiger Vordenker abolitionistischer Positionen in Spanien ist auch Isidoro de Antillón (1778–1814) zu nennen, der im Jahr 1811 eine Disertación sobre el origen de la esclavitud de los negros, motivos que la han perpetuado ventajas que se le atribuye y medios que podrían adoptarse para hacer prosperar sin ellos a nuestras colonias veröffentlichte. In dieser Schrift nahm er eine Rede auf, die er 1802 gehalten hatte.138 Antillón kämpfte gegen die französische Besetzung und war in den Cortes von Cádiz aktiv. Spanien wurde von 1808 bis 1814 von napoleonischen Truppen besetzt. Als Zeichen, dass sie die Einsetzung von Napoleons Bruder, José I., zum König ablehnten, gründeten sich 1810 einige erste Cortes in San Fernando und später in Cádiz. Zu diesen Cortes wurden Abgeordnete der amerikanischen Territorien, Kuba eingeschlossen, eingeladen, und es wurde geplant, die gleichen Rechte auf sie alle auszuweiten. Dieses Unternehmen scheiterte jedoch, und es folgten
135
136 137 138
Enriqueta Vila Vilar, Luisa Vila Vilar (Hg.): Los abolicionistas españoles. Siglo XIX. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica 1996, S. 12. Für wichtige Hinweise in diesem Kapitel danke ich Ana Mateos. Ebda., S. 12. Jordi Maluquer de Motes: Abolicionismo y resistencia a la abolición en la España del siglo XIX. In: Anuario de Estudios Americanos 53 (1986), S. 311–331, hier S. 311. Vila Vilar, Vila Vilar: Los abolicionistas españoles, S. 33.
45
Befreiungsbewegungen in den verschiedenen Königreichen.139 Im Rahmen der Diskussionen über die «Gleichheit der Rechte und die repräsentative Gleichheit» wurde auch über die Abolition nachgedacht.140 Es ist interessant, dass in diesem Kontext von der Sklavensituation Spaniens gegenüber Frankreich die Rede ist. Eine wichtige Frage war, wie das Wahlrecht zu den spanischen Cortes gestaltet, das heißt auf welche Personen das Zensuswahlrecht ausgedehnt werden sollte. 1811 schlug der galizische Abgeordnete die Abschaffung der Sklaverei vor und trat dafür ein, auch den Schwarzen das Wahlrecht einzuräumen. Genauso äußerten sich Antillón und der mexikanische Abgeordnete Jose María Guridi. Die Abgeordneten Venezuelas, Esteban Morales, und Kolumbiens, Mejía Lequerica, stellten sich vehement dagegen, und ein Repräsentant Perus wies darauf hin, dass die Schwarzen kein Anrecht auf Repräsentation hätten, weil ihre Ursprünge nicht in Amerika sondern in Afrika seien.141 Der Abgeordnete Asturiens, Agustín Arguelles, entwarf das Verbot des Sklavenhandels und schlug vor, das Thema der Abolition vorerst zu verschieben. Sogleich schickten die kubanischen Großgrundbesitzer einen von Arango y Parreño verfassten und unterschriebenen Brief als Representación de la ciudad de la Habana en las Cortes, en la que se oponían a la abolición con motivo de las proposiciones hechas por Jose María Guridi y Agustín Arguelles.142 Am Ende war keiner der abolitionistischen Vorschläge erfolgreich und die Verfassung von Cádiz im Jahr 1812 erkannte die schwarze Bevölkerung insofern nicht an, als sie bei der Berechnung der Zahl der Repräsentanten übergangen wurde. Ein anderer starker Befürworter der Abolition in diesen Jahren war der vor allem für die spanische Romantik bekannte José María Blanco White (oder Blanco y Crespo) (1775–1841), ein katholischer Geistlicher mit irischen Ursprüngen, der zum Protestantismus konvertierte. Blanco White, der angelsächsisch-liberale Positionen vertrat, kämpfte gegen die napoleonischen Truppen, nahm an den Cortes von Cádiz teil und wanderte anschließend nach Großbritannien aus, als mit Fernando VII. der Absolutismus einzog. Er vertrat seine abolitionistischen Auffassungen im Kontext der britischen Sklavereiabschaffung und veröffentlichte 1814 die Schrift Boquexo sobre el comercio de esclavos auf der Basis einer Übersetzungspetition des berühmten Abolitionsbriefs von William Wilberforce im Jahr 1811.
139
140
141 142
46
Für eine Zusammenfassung der möglichen Gründe, warum diese Dialoge scheiterten, siehe Roberto Breña: El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808–1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. México, D.F.: El Colegio de México 2006. Mario Hernández Sánchez-Barba: Las cortes españolas ante la abolición de la esclavitud en las Antillas. Opinión institucional ante un tema de política social. In: Quinto Centenario 8 (1985), S. 15–36, hier S. 25. Ebda., S. 26f. André Pons: Blanco White Abolicionista. In: Cuadernos Hispanoamericanos 559 (1997), S. 63–76, hier S. 67.
Trotz der Cortes von Cádiz kehrte Fernando VII. nach Spanien zurück, schaffte die Verfassung von 1812 ab und etablierte ein konservatives absolutistisches Regime, das mit der Heiligen Allianz in Einklang stand. Fernando VII. unterschrieb 1817 einen Vertrag mit England, in dem er sich im Austausch gegen 400.000 Pesos verpflichtete, auf den Sklavenhandel zu verzichten. Dieser Vertrag wurde jedoch nicht umgesetzt.143 Tatsächlich musste er von der Königin María Cristina erst 1835 ratifiziert werden. Die zweite abolitionistische Phase begann mit der Herrschaft der Königin María Cristina, der Mutter von Fernando VII. und der zukünftigen Königin Isabel. Sie sah sich gezwungen, den Vertrag gegen den Handel zu ratifizieren, damit die Liberalen Großbritanniens die Thronbesteigung ihrer Tochter gegen die konservativen Carlisten unterstützten, die sich dafür einsetzten, Carlos, den Bruder Fernandos, auf den Thron zu setzen. In der Verfassung von 1837 wurde die Sklaverei auf der iberischen Halbinsel und den angrenzenden Inseln, jedoch nicht in den überseeischen Provinzen verboten.144 Vila Vilar haben das doppeldeutige Gesetz der Sklavereiabschaffung vom 5. März 1837 transkribiert, das sich zwischen Anerkennung einerseits der Abolition und andererseits der Ineffizienz des Gesetzes in den Überseegebieten bewegt: Guiada la comisión por estos principios y deseos quisiera que de hoy mismo para siempre quedara abolida la esclavitud, no sólo en el continente español sino también en sus posesiones ultramarinas que la condición de siervo no tuviese valor ni existencia al lado de españoles libres. Pero la comisión cree que esta reforma, exigida por la razón, la humanidad y por la religión misma, si es de fácil y expedita ejecución en la Península e islas adyacentes, no así en las provincias de Ultramar.145
Dieses Gesetz brachte auch eine Reihe von wirtschaftlichen Fragen auf. Der im Aufschwung befindliche kubanische Zucker war ein zu schmackhafter Leckerbissen, um wegen philanthropischer Ideen verschmäht zu werden.146 In diesem Sinn zeigen Vila Vilar, dass es bezüglich der Sklavereiabschaffung einen Rückschritt gegenüber den Debatten der vorigen Epoche in den Cortes von Cádiz gegeben hat. Für die Ausarbeitung der Verfassung wurden antillanische Abgeordnete dazugebeten, unter denen sich José Antonio Saco befand. Kaum waren sie anwesend, stimmten die iberischen Abgeordneten für ihren Ausschluss, indem sie mit der Ausnahmesituation der Inseln argumentierten, deren Kennzeichen das Sklavereisystem war. Der Vorschlag, den Antillen einige «Sondergesetze» zu geben, die außerhalb des konstitutionellen Rahmens standen, fand Zustimmung. Die Gesetze wurden nie umgesetzt, was die absolute Autorität des Capitán General bestätigte.
143
144 145 146
Über den britischen Druck gegen Sklavenhandel und Sklaverei, siehe Inés de Roldán: La diplomacia Británica y la abolición del trafico de esclavos cubanos. Una nueva aportación. In: Quinto Centenario 2 (1981), S. 219–225. Hernández Sánchez-Barba: Las cortes españolas, S. 28 und 29; Vila Vilar, Vila Vilar: Los abolicionistas españoles, S. 18. Ebda., S. 18. Ebda., S. 19.
47
José Antonio Saco argumentierte gegen den Ausschluss, indem er anführte, die liberalen europäischen Verfassungen seien ja selbst weit davon entfernt, eine Gleichheit ihrer Einwohner herzustellen.147 Piqueras bietet einen Überblick über die wirtschaftlichen Gewinne, die Königin María Cristina und einer ihrer treusten Gefolgsleute, O’Donnell, Kubas Capitán General und Gründer der Unión liberal in Spanien, mit dem Sklavenhandel erzielt hatten.148 Für die dritte Periode der spanischen Abolition markiert die Gründung der Sociedad Abolicionista durch den Puertoricaner Julio Vizcarrondo und den Spanisch-Kubaner (er wurde auf Kuba geboren, wuchs jedoch in Spanien auf) Rafael María Labra im Jahre 1864 einen wichtigen Moment.149 Letzterer verteidigte nicht nur die Abolition, sondern auch die Autonomie Kubas und das Ende der Kolonisierung. Die Sociedad veröffentlichte Zeitschriften wie El Abolicionista und unterstützte Wettbewerbe von abolitionistischen Werken150. Schmidt-Nowara beschreibt die Kontakte dieser Gruppe mit der Sociedad Libre de Economía Política, mit Mitgliedern wie Moret und Figuerola (Minister in der Regierung Prim). Er erwähnt, dass der Abolitionismus in dieser Epoche von drei Strömungen angetrieben wurde: eine von ihnen ist die wirtschaftlich-liberale Fragestellung der Sociedad Libre de Economía Política, die zweite der Krausismo und die dritte der Partido Democrático Republicano.151 Diese dritte Abolitionismusdebatte fand ihren Höhepunkt mit der Revolution von 1868. Schon in dieser Zeit hatte es in Spanien dank der Geschäfte mit den Antillen und speziell mit Kuba, was den Sklavenhandel einschloss, große Akkumulationen von Reichtümern gegeben. Tatsächlich haben Historiker wie Piqueras und Fontana argumentiert, die Revolution habe mit dem Einzug der bourbonischen Restauration im Jahr 1874 die Macht der kubanischen Lobby in Spanien gefestigt. Die zeitgenössische Parteienlandschaft war vielgestaltig, zu nennen sind unter anderem der Partido Progresista (Prim), die Unión Liberal (Serrano) und der Partido Demócrata Republicano (Castelar, Pi Margall). Nach den Wahlen schafften es mehrere Abolitionisten, einen Sitz in der Abgeordnetenkammer zu erlangen. Castelar hielt 1870 eine berühmt gewordene Rede mit dem Titel «La abolición de la esclavitud». 1870 wurde auch das Moret-Gesetz erlassen, das die Kinder von versklavten Müttern für frei erklärte. In Puerto Rico
147 148
149 150
151
48
Josep Fradera: Colonias para después de un Imperio. Barcelona: Ed. Bellaterra 2005, S. 153–166. José Antonio Piqueras Arenas: La revolución democrática (1868–1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1992, S. 277, 284. Maluquer de Motes (Abolicionismo y resistencia) spricht von der möglichen Existenz einer Sociedad Abolicionista im Jahr 1835. Vila Vilar erwähnen folgende andere Zeitschriften aus Madrid, die sich offen für die Sklavereiabschaffung aussprachen: La Discusión, La Propaganda, zu denen sich später El liberal und La Tribuna gesellten. Vila Vilar, Vila Vilar: Los abolicionistas españoles, S. 14. Christopher Schmidt-Nowara: Empire and Antislavery. Spain, Cuba, and Puerto Rico, 1833–1874. Pittsburgh: Univ. of Pittsburgh Press 1999, S. 74.
wurde die Sklaverei 1873 abgeschafft. Der Partido Republicano stellte 1873 einen Verfassungsentwurf vor, der niemals gebilligt wurde, in dem jedoch die Sklavereiabschaffung auf Kuba erklärt wurde. Die Volksrevolten, die vom Partido Republicano gedeckt wurden, der Krieg auf Kuba, der kein Ende fand, und die institutionelle Unordnung begünstigten die restaurative Wende unter Cánovas del Castillo und die Konsolidierung der kolonialen Lobby in Spanien.152 1880 wurde der Patronato gebilligt und 1886 die endgültige Abolition. Die Schwierigkeiten der Transition zwischen dem Patronato und der Abolition betreffend, hat Durnerín einerseits die heftigen Debatten in den Cortes und die stürmische Kampagne der abolitionistischen Gesellschaft ausgemacht, andererseits ihr Fehlen in den spanischen Zeitungen (mit Ausnahme von El liberal und El Imparcial) und in der öffentlichen Meinung bemängelt. Ohne Zweifel hat die Sociedad Abolicionista eine tragende Rolle im Meinungswechsel der spanischen Politiker gespielt.
I.6.
Fragen des Zusammenlebens
Verlassen wir nun die Ebene des konkreten Forschungsgegenstandes und nehmen mit zeitgenössischen kulturtheoretischen Debatten eine übergeordnete Dimension in den Blick, die zwar universalen Charakter hat, die jedoch ohne einen Rückbezug zur Karibik im 19. Jahrhundert eines ihres bedeutsamsten, um nicht zu sagen existentiellen, Anschauungsmaterials beraubt würde. Im Folgenden geht es um aktuelle kulturtheoretische Versuche, ein Zusammenleben in Frieden und Differenz programmatisch zu fassen, die vor allem im begonnenen 21. Jahrhundert eine Rolle spielen.153 Sie werden entwickelt als Antwort auf eine missglückte Etikettierung von Multikulturalismus154 oder als Absage an einen essentialistischen Identitätsbegriff. Dass aktuelle Debatten zu diesem Thema auch intensiv von Intellektuellen der Karibik und ihrer Diaspora geführt werden, liegt aus verschiedenen Gründen nahe. Die literarisch sehr reiche Region155 hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich zu einem der privilegierten Orte für Theorieproduktion emporgeschwungen: Négritude, Créolité, Relationalité – in dieser chronologischen Abfolge wird versucht, das Zusammenleben in der Karibik und ihrer Diaspora konkret in den Blick zu nehmen, beziehungsweise von dort aus universale Kategorien zu entwickeln, wie es vor allem Édouard Glissant156 und
152 153
154
155
156
Vgl. Piqueras Arenas: La revolución democrática. Vgl. zu den besonders großen Herausforderungen bezüglich Grundlagen und Bedingungen des weltweiten Zusammenlebens in der vierten Phase beschleunigter Globalisierung Ette: ZusammenLebensWissen, S. 169f., 183. Vgl. zum Begriff des Multikulturalismus die grundlegenden Ausführungen von Lüsebrink. «Unter Multikulturalität wird im Allgemeinen das Nebeneinander verschiedener Kulturen (im anthropologischen Sinn) innerhalb eines sozialen Systems (meistens einer Nation) verstanden». Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 16f. Die Karibik hat sich in besonderer Weise als privilegierte Region von «Literaturen ohne festen Wohnsitz» einen Namen gemacht. Vgl. Ette: ZwischenWeltenSchreiben, S. 123–156. Vgl. Édouard Glissant: Poétique de la relation. Paris: Gallimard 1990.
49
Benítez Rojo157 unternommen haben. Dabei stellt sich bis heute immer wieder die Frage, wie ethnische Differenz zu fassen ist, ohne in Essentialismen zurückzufallen. Ähnlich wie die Kritik am Multikulturalismus durch führende Intellektuelle in der angelsächsischen Tradition, wie Arjun Appadurai158 oder Paul Gilroy159, bemerkt Walter Mignolo rückblickend recht kritisch über die Creolité-Diskurse: Criollos, caribeanidad y criollidad son todavía categorías que se soplan pero que pertenecen a diferentes niveles. Ser o definirse a uno mismo como criollo significa identificarse con un grupo de gente y diferenciarse de otro. Así, decir que «ni europeos, ni africanos, nos proclamamos criollos»160 es identificarse en relación con un territorio y con los procesos históricos que crearon ese territorio.161
Was aber wird dieser Kritik entgegengehalten? Glissant nennt sein alternatives Modell Kreolisierung: Sie ist eine Mischung, insbesondere eine Mischung der Kulturen, die Unvorhersehbares herstellt. Die Kreolisierung, die in der Karibik stattfindet und die auf die anderen Anteile Amerikas übergreift, wirkt auch überall auf der ganzen Welt. Ich behaupte also, dass die Welt sich kreolisiert. Schlagartig und dabei in vollem Bewusstsein werden die Kulturen der Welt miteinander in Kontakt gebracht, verändern sich in ihrem Austausch, was häufig zu unabwendbaren Zusammenstößen, erbarmungslosen Kriegen führt, aber es sind auch Vorposten des Bewusstseins und der Hoffnung erkennbar.162
Da die heutige, spezifisch postkoloniale Situation karibischer Gesellschaften nicht ohne eine Auseinandersetzung mit ihren kolonialen Dimensionen möglich ist – bereits Benítez Rojo sprach in La isla que se repite von einer gegenseitigen Bedingtheit von heutigen Creolité/Criollidad-Diskursen und historischer Plantagenwirtschaft163 –, wenden wir uns nun wieder dem 19. Jahrhundert zu.
157 158 159 160
161 162 163
50
Vgl. Benítez Rojo: La isla. Arjun Appadurai: Die Geographie des Zorns. Aus dem Engl. von Bettina Engels. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. Paul Gilroy: After Empire. Melancholia or Convivial Culture? London: Routledge 2004. Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant: Éloge de la Créolité. Paris: Gallimard (1989) 2002, S. 75, zit. nach Walter D. Mignolo: Historias Locales/Diseños Globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Aus dem Amerikanischen übers. von Juan María Madariaga und Cristina Vega Solis. Madrid: Akal 2003, S. 197. Ebda., S. 197. Édouard Glissant: Kultur und Identität. Ansätze zu einer Poetik der Vielheit. Aus dem Französischen von Beate Thill. Heidelberg: Wunderhorn 2005, S. 81. Der kubanische Kulturtheoretiker Antonio Benítez Rojo hat in seinem zum Klassiker avancierten Essay La isla que se repite dargestellt, dass zu jedem Verständnis von Kreolität eine Auseinandersetzung mit dem System der Plantagengesellschaft notwendigerweise gehört: «Bien, entonces, ¿qué relaciones veo entre plantación y criollización? Naturalmente, en primer término, una relación de causa y efecto; sin una no tendríamos la otra. Pero también veo otras relaciones.» Benítez Rojo: La isla, S. 396. Zur Frage der Anwendbarkeit postkolonialer Theorien auf die Karibik des 19. Jahrhunderts vgl. Gesine Müller: Entre la francofilia y las aspiraciones de autonomía. Una mirada desde el Caribe sobre las diferentes constelaciones postcoloniales. In: Robert Folger, Stephan Leopold
Worin liegt der spezifische Gehalt eines literarischen Potentials von ZusammenLebensWissen karibischer Literaturen im 19. Jahrhundert?164 Dabei sind zwei Ebenen zu unterscheiden: 1) Wissensnormen von Zusammenleben. Darunter verstehe ich die explizite Vermittlung eines Programms vom guten oder idealen Zusammenleben. 2) Wissensformen von Zusammenleben. Darunter verstehe ich die Vermittlung eines literarischen Gehalts von Zusammenleben165, eine Ebene, die explizit oder implizit lesbar sein kann.166 Dass im 19. Jahrhundert mit der Etablierung von Rassismusdiskursen die Frage des Zusammenlebens besonders dicht verhandelt wird, liegt auf der Hand, war ja das Konzept «Rasse» in der Ausgestaltung der politischen Anatomie des 19. Jahrhunderts entscheidend. Indem dieses Konzept wissenschaftlich wurde, blieb es ein wichtiger Aspekt der europäischen Geopolitik auf dem Weg zu einer globalen Vorherrschaft, die durch die Anwendung von Darwins Erkenntnissen unterstützt und legitimiert wurde.167 Angesichts der epochalen Dominanz dieser allgegenwärtigen Ausprägung ethnischer Differenz, soll nun Zusammenleben durch die Linse eines ethnographischen Blicks eingefangen werden.168 Während aktuelle Versuche, wie die von Mignolo oder Glissant, darum bemüht sind, frühere Identitätskonzepte als essentialistisch zu entlarven, stellt sich für das 19. Jahrhundert bereits im Vorfeld die herausfordernde Frage, inwiefern es möglich ist, Konstruktionen von Essentialismen kritisch zu hinterfragen in einer Epoche, die gerade als Blütezeit des Rassismus in die Geschichte einging. Kann ein geschärfter Blick auf Repräsentationen von Zusammenleben dazu führen, kanonisierte Referenzrahmen im 19. Jahrhundert wie Rasse und Nation zu relativieren? Denn die Frage nach dem Zusammenleben sucht differenziertere Antworten, als beispielsweise die ethische
164 165
166 167 168
(Hg.): Escribiendo la Independencia. Perspectivas postcoloniales sobre la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert, Iberoamericana 2010, S. 125–139. Vgl. Ette: ZusammenLebensWissen, S. 80. Es geht also um ein Wissen, «das stets im Kontakt mit der außerliterarischen Lebenswelt steht, [das] aus der spezifischen Eigengesetzlichkeit und dem Eigen-Sinn der Literatur heraus verstanden […] werden kann.» Ebda., S. 114. Vgl. Ottmar Ette: Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft. In: Lendemains 125 (2007), S. 7–32, hier S. 27. Gilroy: After Empire, S. 6. Benítez Rojo wies darauf hin, dass es ab dem Zeitpunkt, da man die Plantage betrat, um die Demarkationslinie der Hautfarbe ging: «Así, en el Caribe el color de la piel no representa ni una ,minoría‘ ni una ,mayoría‘; representa mucho más: el color impuesto por la violencia de la conquista y la colonización, y en particular por el régimen de la Plantación. Sea cual fuere el color de la piel, se trata de un color no institucionalizado, no legitimado por la estirpe; un color en conflicto consigo mismo y con los demás, irritado por su propia inestabilidad y resentido por su desarraigo; un color que no es el del Yo ni tampoco el del Otro, sino una suerte de tierra de nadie donde se lleva a cabo la batalla permanente por la fragmentada identidad del Ser caribeño». Benítez Rojo: La isla, S. 241.
51
Dimension des abolitionistischen Romans und seinen Beitrag zur Abschaffung der Sklaverei zu betonen. Genauso wenig kann es global darum gehen, etwa die Beschwörung eines transkulturellen Kuba durch einen Gründungsroman wie Cecilia Valdés zu betonen. Kurz, es geht um mehr als um engagierte Literatur. I.6.1. Wer ist Mensch? Begeben wir uns in die Hochphase der karibischen Plantagenwirtschaft, den Vorabend der Französischen Revolution. Entscheidend für die Problematik des Zusammenlebens der Menschen war nicht so sehr das Wie, sondern die Frage, wer sich überhaupt Mensch nennen darf. Hans Blumenberg hat gerade im Bezug auf die Französische Revolution die Unfassbarkeit des Begriffs Leben anschaulich dargestellt. Von seinem Sekretär Jean Martet auf die Französische Revolution und ihre Blutigkeit angesprochen, habe Clemenceau geantwortet: «Was wollen Sie? Die Revolution… Die Prinzipien sind ausgezeichnet, aber die Menschen, die Menschen!»169 Wenn die Definition des Menschen bereits eine solche Herausforderung darstellt, verkompliziert sich der dem Mensch-Sein zugrunde liegende Lebensbegriff und führt direkt zu der Frage nach dem Zusammenleben. Hier hat Michel-Rolph Trouillot auf ein entscheidendes Ereignis hingewiesen und die anthropologische Dimension kolonialpolitischer Konstellationen in Paris zu jenem Zeitpunkt auf den Punkt gebracht.170 Er beschreibt, wie im Juli 1789, wenige Tage vor der Erstürmung der Bastille, Pflanzer aus Saint-Domingue in Paris zusammenkamen, um die neue französische Nationalversammlung dazu aufzufordern, zwanzig Deputierte aus der Karibik in ihren Reihen aufzunehmen.171 Die Pflanzer hatten diese Zahl genau mit denjenigen Methoden errechnet, die auch in Frankreich zur Zuteilung der Deputierten benutzt wurden, nur dass sie ganz bewusst die schwarzen Sklaven und die gens de couleur zur Inselbevölkerung hinzugezählt hatten, obwohl sie natürlich niemals daran dachten, den Nichtweißen das Wahlrecht einzuräumen. Honoré Gabriel Riquetti, Comte de Mirabeau, ergriff in der Sitzung vom 3. Juli 1789 das Wort, um die aberwitzigen Berechnungen der Pflanzer zu entlarven: Zählen die Kolonien ihre Neger und ihre gens de couleur zur Klasse der Menschen oder zu derjenigen der Lasttiere? Wenn die Kolonien die Neger und die gens de couleur als Menschen gezählt wissen möchten, sollten sie ihnen zuerst das Wahlrecht geben, so dass alle wählen und alle gewählt werden können. Falls nicht, bitten wir sie zu beachten, dass
169 170
171
52
Hans Blumenberg: Theorie der Lebenswelt. Hg. von Manfred Sommer. Berlin: Suhrkamp 2010, S. 14. Ich orientiere mich für diesen Teilaspekt direkt an den grundlegenden Ausführungen von Michel-Rolph Trouillot. Vgl. Michel-Rolph Trouillot: Zur Bagatellisierung der haitianischen Revolution. In: Sebastian Conrad, Shalini Randeria (Hg.): Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichts- und Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main: Campus-Verl. 2002, S. 84–115. Vgl. Trouillot: Bagatellisierung der haitianischen Revolution, S. 90.
wir bei der Verteilung der Anzahl der Deputierten auf die Bevölkerung Frankreichs weder die Anzahl unserer Pferde noch diejenige unserer Maultiere in Betracht gezogen haben.172
Es ging Mirabeau darum, die französische Nationalversammlung davon zu überzeugen, die philosophische Position der Menschenrechtserklärung mit ihrer politischen Haltung gegenüber den Kolonien in Einklang zu bringen. Allerdings sprach die Erklärung von den «Rechten des Menschen und Bürgers», ein Titel, der bereits widersprüchlich ist. Trouillot stellt heraus, wie im vorliegenden Fall der Bürger den Sieg über den Menschen davontrug, zumindest über den nichtweißen Menschen. Die Nationalversammlung erlaubte den Zuckerkolonien der Karibik nur sechs Abgeordnete. Dies war mehr, als man ihnen aufgrund der Anzahl an weißen Bewohnern zugestanden hätte, aber deutlich weniger, als herausgekommen wäre, hätte die Versammlung die vollen politischen Rechte von Schwarzen und gens de couleur anerkannt. Nach den Rechenmaßstäben der Realpolitik brachte eine halbe Million Sklaven auf Saint-Domingue/Haiti und mehrere Hunderttausend in den anderen Kolonien genau drei Deputierte, die natürlich weiß waren.173 Vor dem Hintergrund einer hochgradigen Verunsicherung bezüglich der Frage, wer überhaupt Mensch sei, verwundert es nicht, dass die Autoren der folgenden Textbeispiele heftig um ethnische Zuordnungen ringen.
172 173
Archives Parlementaires 1789, Bd. 8, S. 186, zit. nach Trouillot: Bagatellisierung der haitianischen Revolution, S. 90. Vgl. ebda., S. 91.
53
II.
Literatur und koloniale Frage
II.1.
Vorstellungen von citoyenneté/ciudadanía am Vorabend der Unabhängigkeit Impuls: Bolívar – «un héroe ciudadano» ¡Bolívar inmortal! ¿Que voz humana Enumerar y celebrar podría Tus victorias sin fin, tu eterno aliento? Colombia independiente y soberana Es de tu gloria noble monumento. Del vil polvo a tu voz, robusta, fiera, De majestad ornada, Ella se alzó, como Minerva armada Del cerebro de Júpiter saliera. [...] Jamás impunemente Al pueblo soberano Pudo imponer un héroe ciudadano El sello del baldón sobre la frente. El pueblo se alza, y su voraz encono Sacrifica al tirano, Que halla infamia y sepulcro en vez de trono Así desvanecerse vio la tierra De Napoleón y de Austria la gloria, Y prematura tumba los encierra Y la baña con llanto de la Victoria.
Diese Verse entstammen dem 1825 verfassten Gedicht «A Bolívar»1 des kubanischen Schriftstellers José María Heredia.2 Der Lobgesang auf den «héroe ciudadano» Bolívar führt uns den Zusammenhang vor Augen, der zwischen den Ideen der Französischen Revolution und den Unabhängigkeitskriegen in Lateinamerika besteht.
1 2
José María Heredia: Niagara y otros textos. Poesia y prosa selectas. Hg. von Angel Augier. Caracas: Biblioteca Ayacucho 1990, S. 84. Vgl. zu diesen Ausführungen Gesine Müller: Conceptos de ciudadanía en vísperas de la independencia. Los literatos caribeños y su contribución al nation-building. In: Barbara Potthast, Juliana Ströbele-Gregor u.a. (Hg.): Ciudadanía vivida, (in)seguridades e interculturalidad. ADLAF Congreso Anual 2006. Buenos Aires: Fundación Foro Nueva Sociedad 2008, S. 122–131.
55
II.1.1. Rousseaus Überlegungen zum citoyen und deren Folgen für die Französische Revolution Wenn als unmittelbarer Auslöser für den politischen Wandel von Kolonien in souveräne Republiken von der Forschung allgemein die Besetzung Spaniens durch französische Truppen im Jahre 1807 betrachtet wird, so ist die kulturelle Tragweite der Französischen Revolution selbst als indirekter Faktor durchaus ausschlaggebend für die Inspiration zum Kampf um die Unabhängigkeit. Insbesondere die Erklärung der Menschenrechte vom 26. August 1789, die Verkündigung der Verfassung vom 3. September 1791 und die Erlassung des Code civil beziehungsweise Code Napoléon im Jahre 1804 entfalteten viel revolutionäres Potential. Diese Ideen wurden in den europäischen Staaten und mit etwas Verspätung auch in Lateinamerika, letztlich aber flächendeckend als Vorbild einer politischen, ökonomischen und juristischen Modernisierung übernommen. In diesen Gesetzestexten, die einen Epochenumbruch einläuten, wird sehr häufig das Wort «citoyen» mit einer neuen Selbstverständlichkeit verwendet. Was verbirgt sich hinter diesem Leitbegriff der Französischen Revolution? Bekanntlich dürfen die kulturellen Hintergründe der Französischen Revolution nicht unterschätzt werden, bereiteten die Ideen der Aufklärungsphilosophen ja erst den Boden für die späteren Ereignisse. Für das neue Verständnis vom Bürger waren vor allem die Gedanken Jean-Jacques Rousseaus leitend: Im Contrat social erklärt der Genfer, was er unter citoyen versteht: «Le vrai sens de ce mot s’est presque entièrement effacé chez les modernes ; la plupart prennent une ville pour une Cité & un bourgeois pour un Citoyen. Ils ne savent pas que les maisons font la ville mais que les Citoyens font la Cité.»3 Der ursprüngliche Sinn des Wortes, der für Rousseau eng mit der cité, der selbstverwalteten Siedlung, verbunden ist und also auf das Gemeinwesen zielt, ging verloren. Dies formuliert Rousseau besonders deutlich in einem Zitat aus Émile: «L’institution publique n’existe plus, et ne peut plus exister, parce qu’où il n’y a plus de patrie, il ne peut plus y avoir de citoyens. Ces deux mots patrie et citoyen doivent être effacés des langues modernes.»4 Nachdem Rousseau zunächst auf die Antinomie zwischen Mensch und citoyen hinweist, kommt er zu folgender Hierarchisierung: «Nous concevons la société générale d’après nos sociétés particulières, l’établissement des petites républiques nous fait songer à la grande, et nous ne commençons proprement à devenir hommes qu’après avoir été citoyens.»5 Diese neue Bedeutsamkeit der citoyenneté tangiert notwendigerweise den Bezugrahmen patrie:
3 4 5
56
Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social. Écrits politiques. Œuvres complètes. Bd. III. Hg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond. Paris: Gallimard 1996, S. 361. Jean-Jacques Rousseau: Émile. Éducation. Morale. Botanique. Œuvres complètes. Bd. IV. Hg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond. Paris: Gallimard 1999, S. 250. Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social ou Essai sur la forme de la République. Manuscrit de Genève. 1. Buch, 2. Kapitel. [o.J.]. Online verfügbar unter: http://philo. record.pagesperso-orange.fr/contrat/geneve.htm [05.10.2010].
Si je te parlais des devoirs du citoyen, tu me demanderais peut-être où est la patrie, et tu croirais m’avoir confondu. Tu te tromperais pourtant, cher Émile ; car qui n’a pas une patrie a du moins un pays. Il y a toujours un gouvernement et des simulacres de lois sous lesquels il a vécu tranquille.6
Rousseaus Überlegungen bildeten eine wichtige Grundlage für das Verständnis von citoyenneté in der Französischen Revolution. Irene Castells zeigt, inwiefern das revolutionäre Konzept von citoyenneté drei Ebenen berührt: zum einen die rechtliche Ebene, die alle Bürger vor dem Gesetz gleichstellt, zum anderen die politische Ebene, die sich auf die aktive Teilhabe an den öffentlichen Angelegenheiten bezieht, und schließlich die nationale Ebene, auf der die Zugehörigkeit zur Nation die alten ständischen Strukturen ablöst.7 Die Emanzipation des citoyen, so Castells, wurde in die Tat umgesetzt, indem sich einfache Menschen im Rahmen der revolutionären Institutionen am öffentlichen Leben beteiligten, und sie führte zu einem tiefgreifenden Wandel und einer nachhaltigen Demokratisierung des politischen Raumes, der von da an nicht mehr nur die Sphäre von Regierungen und Interessensgruppen war, sondern eine Angelegenheit des täglichen Lebens.8 Das citoyenneté-Konzept der Französischen Revolution fußt also auf einer Identifizierung von Revolution, patrie und Nation, und es liegt in der Natur der Sache, dass dieses neue (Selbst)Verständnis Folgen hatte für die Konstruktion nationaler Identität. Die Nation definierte sich über die Integration aller citoyens, die ihre persönlichen Interessen aufgaben, um in die cité einzutreten, und zwar nicht um eines Gesetzes willen, sondern auf Grund eines kollektiven Enthusiasmus.9 II.1.2. Zwischen «edlem Wilden» und citoyen: Rousseaus Fallbeispiel der Kariben Im Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755) entfaltet Rousseau seine spekulative Evolutionstheorie, aus der sein politisches Hauptwerk, der Contrat social (1762) hervorgeht.10 Trotz der ihm häufig (fälschlicherweise) zugeschriebenen Formel «Zurück zur Natur» wollte er nicht das Naturparadies, sondern den Gesellschaftsvertrag. Sein Hauptbeispiel ist die in egalitären, reziproken und solidarischen Sozialbeziehungen lebende und gegen die Kolonialgewalt erbittert Widerstand leistende Gesellschaft der Kariben. Der Zustand der Kariben wird zum Zeitpunkt des ersten Zusammentreffens mit
6 7
8 9 10
Rousseau: Émile, S. 858. Irene Castells: La ciudadanía revolucionaria, 2002, S. 2. Online verfügbar unter: http:// www.casataule.org/cast/docs/la_ciudadania_revolucionaria.doc [05.10.2010]. Pierre Rétat: Citoyen-Sujet, Civisme. In: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820 9 (1988) (Titel des Bandes: Rolf Reichardt: Bastille – Pierre Rétat: CitoyenSujet, Civisme). München: Oldenbourg, S. 75–105. Castells: La ciudadanía revolucionaria, S. 5. Ebda., S. 8. Hinrich Fink-Eitel: Die Philosophie und die Wilden. Über die Bedeutung des Fremden für die europäische Geistesgeschichte. Hamburg: Junius 1994, S. 17.
57
den Kolonialmächten als recht positiv beschrieben. Diese Zeit sei vielleicht die glücklichste und dauerhafteste für die Menschen gewesen, weil sie zwischen der Faulheit des ursprünglichen Zustandes und der törichten Wirksamkeit der Eigenliebe die wahre Mitte hielt.11 Daher urteilt Rousseau, dass dieser Zustand den Revolutionen am wenigsten unterworfen sei und dem Menschen am besten anstünde. In den Wilden, die man meist an diesem Punkte angetroffen habe, sieht er die beispielhafte Bestätigung, dass dem Menschengeschlecht bestimmt sei, in diesem Zustande zu verbleiben.12 Rousseau geht allerdings einen Schritt weiter: Diese Menschen sind weder wild noch edel. Ihr Zustand ist zwar vorbildlich, aber nicht konfliktfrei, weder unter ihresgleichen noch innerhalb des kolonialen Systems. Sie bedürfen des Gesellschaftsvertrags, um menschenwürdig zu leben und als citoyens miteinander umgehen zu können. Der für die lateinamerikanische Unabhängigkeitsbewegung wichtige ciudadano-Begriff ist ein französischer Revolutionsimport, der wiederum maßgeblich von Rousseau anhand seiner Überlegungen zu der karibischen Gesellschaft entwickelt wurde. Wir haben es mit einem komplexen Transferprozess zwischen Zentrum–Peripherie–Zentrum zu tun, der durch weitere Rezeptionsmechanismen zu einem komplexen Zirkulationsprozess werden wird. II.1.3. Citoyenneté und ihre Rezeption in der Karibik Wie wurden die Ideen der Französischen Revolution in Lateinamerika und der Karibik rezipiert? Rousseau jedenfalls war im beginnenden 19. Jahrhundert eine verbreitete Lektüre: Sein Contrat social kam im Jahre 1811 in 400 Exemplaren in Chile an.13 Fray Melchor Martínez, der königliche Chronist der Unabhängigkeitskriege Chiles, beschrieb im Jahre 1815 die rasante Ausbreitung der aufklärerischen Ideen im Gefolge der Französischen Revolution. Diese Philosophie, die zu Unrecht modern genannt werde, da sie schon mehrere Jahrhunderte lang im Verborgenen schlummerte, habe durch die Revolution einen unwägbaren Einfluss auf die Vernunft der Menschen erlangt und könne seither als einzig gültige Wissenschaft betrachtet werden.14 Von Frankreich aus habe sie sich über den gesamten Erdball verbreitet, und Lateinamerika habe sich für die – aus Sicht des Chronisten
11 12 13
14
58
Vgl. ebda., S. 173. Vgl. ebda., S. 173. Cristián Gazmuri Riveros: Libros e ideas políticas francesas en la gestación de la independencia de Chile. In: María del Carmen Borrego Plá, Leopoldo Zea (Hg.): América Latina ante la Revolución Francesa. México, D.F.: Univ. Nacional Autónoma de México 1993, S. 81–108, hier S. 98. Vgl. Melchor Martínez: Memoria histórica sobre la Revolución de Chile. Desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814. Hg. von Guillermo Feliú Cruz. 2 Bände. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional 1964, zit. nach Gazmuri Riveros: Libros e ideas políticas, S. 81.
verderblichen – revolutionären Ideen besonders empfänglich gezeigt, da diese seinem Wunsch nach Abnabelung und Eigenständigkeit entsprochen hätten.15 Entsprechend schlägt sich der Einfluss der Französischen Revolutionsmaximen auch in den lateinamerikanischen Nationengründungen nieder. So war beispielsweise für die erste Verfassung in Mexiko das neue Verständnis von ciudadano durchaus leitend, wie Borrego Plá erläutert: Die cuidadanía umfasste alle in Mexiko geborenen Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe, aber auch hier lebende Ausländer, vorausgesetzt, sie waren dem Patriotismus zugeneigt und hingen dem römisch-apostolischen Katholizismus an.16 Der Status als Bürger, den auch nicht ortsansässige Mexikaner katholischen Glaubens innehatten, konnte auch wieder verwirkt werden, wenn sich jemand der Häresie, der Apostasie oder der Beleidigung der Nation schuldig machte. Alle cuidadanos genossen die gleichen Rechte, die denen in Frankreich 1789 proklamierten entsprachen und als «Menschenrechte» in die Geschichte eingingen.17 Borrego Plá führt aus, dass die Verfassungsväter, die in Apatzingán zusammenkamen, nach französischem Vorbild die Prinzipien Freiheit, Gleichheit, Sicherheit und Besitz obenan stellten, dass es dabei aber nicht um abstrakte Konzepte ging, sondern um die konkrete gesellschaftliche Umsetzung, mittels derer die feudalen Strukturen demokratisiert werden sollten.18 Sie betont besonders die Vordenkerrolle Rousseaus hinsichtlich der Überzeugung, alle Menschen würden gleich geboren und kein cuidadano könne sich mittels ererbter Rechte und Privilegien über die anderen stellen.19 Im Gegensatz zum lateinamerikanischen Festland hatten die Intellektuellen der Karibik «mehr Zeit», sich mit den genannten theoretischen Errungenschaften der Französischen Revolution innerhalb der kolonialen Strukturen auseinanderzusetzen. Im Folgenden sollen mit José María Heredia und J. Levilloux jeweils unterschiedliche Rezeptionsvarianten des citoyenneté-Konzepts für die französische und spanische koloniale Karibik vorgestellt werden. II.1.3.1. José María Heredia: ein Leser Rousseaus José María Heredia wurde 1803 in Santiago de Cuba geboren und starb 1839 in Mexiko. Sein Leben verlief sehr bewegt: Insgesamt lebte er nur sechs Jahre auf Kuba, fünfeinhalb in Venezuela, vier in den USA und 19 in Mexiko, wo er aktiv am literarischen und politischen Leben teilnahm und wo er auch meist für einen Mexikaner gehalten wurde. Dennoch identifizierte er sich selbst zeitlebens
15 16
17 18 19
Vgl. ebda., S. 81. María del Carmen Borrego Plá: La influencia de la Francia revolucionaria en México. El texto constitucional de Apatzingán. In: Borrego Plá, Zea (Hg.): América Latina, S. 9–30, hier S. 22. Ebda., S. 22. Ebda., S. 23. Ebda., S. 23.
59
überzeugt als Kubaner20 und war eng mit Saco, Varela und del Monte befreundet.21 Er genoss vor allem als Lyriker einen Ruf, obwohl er zudem Übersetzer französischer Dramen, englischer Romane und italienischer Lyrik war. Er studierte Jura und arbeitete zunächst als Rechtsanwalt in Matanzas, später hatte er verschiedene juristische Ämter in Mexiko inne. Die Unabhängigkeitskämpfe auf dem Kontinent (vor allem in Venezuela und Mexiko) hatten ihn stark beeinflusst. Auf Grund seiner konspirativen Aktivitäten für eine Unabhängigkeit Kubas, die er als Mitglied des Geheimbundes Soles y Rayos de Bolívar von Mexiko aus unternahm, wurde er in Kuba 1831 zum Tode verurteilt. Heredia war aktiv in verschiedene politische Debatten verwickelt. Er verstand sich als ciudadano und kämpfte für die Rechte der anderen ciudadanos, eine Haltung, die auch in seinen Gedichten deutlich zu Tage tritt, beispielsweise in «A los griegos en 1821» und «Oda a los habitantes de Anáhuac» (1821–22).22 Das bekannteste Beispiel für einen poetisch verarbeiteten Kampf um die Unabhängigkeit ist «Himno del desterrado»: ¡Cuba! Al fin te verás libre y pura como el aire de luz que respiras, cual las ondas hirvientes que miras de tus playas la arena besar. Aunque viles traidores te sirvan, Del tirano es inútil la saña, que no es vano entre Cuba y España tiende inmenso sus olas el mar.23
Heredias «poesía de caracter cívico» beinhaltet das aufklärerische Ideal von Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit. Sein Selbstverständnis als engagierter Schriftsteller zeigt sich auch in den Zeilen, in denen er sich sehr positiv über Ferdinand VII. äußert, der (vorübergehend) die Sklaverei abgeschafft hatte: Aquí una voz: «¡Oh negros desdichados Ya vuestros males término han tenido Ya no seréis del África arrancados Fernando libertarlos ha querido!»24
Heredias Sympathie für Ferdinand VII. sollte selbstverständlich nicht lange andauern. In seiner Übersetzung des Romans Tibère von Joseph-Marie Chénier (1819) sah er in Ferdinand VII. einen geistigen Nachfahren des römischen Tyrannen.25 Er übersetzte auch Sylla von Victor-Joseph-Étienne de Jouy (1821), was eine heftige Auseinandersetzung zwischen ihm und del Monte verursachte. Del Monte
20 21 22 23 24 25
60
Leonardo Padura Fuentes: José María Heredia. La patria y la vida. La Habana: Eds. Unión 2003, S. 9. María Poumier: José María Heredia et la révolution française (Cuba 1803–Mexico 1839). In: Cahiers des Amériques Latines 10 (1990), S. 262–274, hier S. 266. Padura Fuentes: José María Heredia, S. 31. Heredia: Niagara, S. 68. José María Heredia: Obra poética. Hg. von Ángel Augier. Havanna: Letras Cubanas 2003, S. 157. Poumier: José María Heredia, S. 264.
schien die Rolle des Diktators sehr positiv dargestellt, während Heredia gerade die Abdankung des Diktators darin sah. Del Monte äußerte sich folgendermaßen: ¿Y el Sila? Con qué se representó en el teatro de México; y las voces de Prieto y de Garay [die besten Schauspieler Mexikos, Spanier] hicieron resonar en sus republicanos artesones el Je me fis dictateur : je sauvais la patrie ? ¿A qué invitas, oh amigo imprudente de la libertad, a imitar en Tenoxtitlán el ejemplo del dictador romano ? Iturbide también pudo decirlo y todos los usurpadores lo mismo. No son esos los cuadros que deben presentarse a un recién nacido pueblo.26
Während es del Monte auf Kuba «nur» um die Erreichung der Unabhängigkeit ging, problematisierte Heredia im bereits unabhängigen Mexiko die Führungselite, konkret die Vereinigung der politischen Macht in einer Person.27 Auf kultureller Ebene jedoch ging del Monte weiter: Er kritisierte Heredia dafür, dass er ausländische Elitekulturen importierte. Heredia wiederum strebte eine Symbiose an: Er wollte die Helden der abendländischen Literatur in die amerikanische Mythologie verpflanzen. Heredia war ein großer Kenner der französischen Literatur. Er übersetzte nicht nur Florian, Millevoye und Lamartine ins Spanische, sondern übernahm auch in Mexiko die Regie der Theateradaptationen von Voltaire, Chénier und d’Alfieri, alle engagierte Schriftsteller der kulturellen Französischen Revolution.28 In der mexikanischen Presse veröffentlichte er Artikel über Rousseau und Victor Hugo. Auf den Einfluss Rousseaus auf Heredia hatte schon recht früh Menéndez Pelayo hingewiesen: […] no se ha de creer que Heredia […] deba ser tenido por poeta romántico. Su puesto está en otra escuela que fue como vago preludio, como aurora tenue del romanticismo [...] su verdadera filiación está evidentemente en aquella escuela sentimental, descriptiva, filantrópica y afilosofada que, derivada principalmente de la prosa de J. Jacobo Rousseau, tenía a fines del siglo XVIII insignes afiliados en todas las literaturas europeas.29
Neben seinen politischen und literarischen Betätigungen, interessierte Heredia sich auch für die Geschichte der Neuen Welt. Eine prominente Position innerhalb seiner historischen Untersuchungen nimmt Kolumbus ein: Kolumbus hat für ihn den Europäern ihre Unschuld zurückgegeben, er hat ihnen den Weg zu Revolutionen und zu mehr Demokratie geöffnet. Diese Gedanken haben ihre Wurzeln in Rousseau und seinen Überlegungen zum Naturzustand: Indem Kolumbus den Europäern zur Entdeckung der «edlen Wilden» verhalf, habe er die Reinigung der politischen Sitten angestoßen. Heredia zeigte sich überzeugt von dem Weg, den Rousseau vorgeschlagen hatte, um zu einem Idealzustand der Gesellschaft
26 27 28 29
Centón epistolario de Domingo del Monte. Brief vom 12. August 1826. Bd. 1. Havanna 1929, S. 23, zit. nach Poumier: José María Heredia, S. 267. Ebda., S. 267. Ebda., S. 263. Vgl. Felipe B. Pedraza Jiménez, Eugenio Alonso Martín: Manual de literatura hispanoamericana. Berriozar, Navarra: Cénlit Ed. 1991, S. 104.
61
zu gelangen, in dem Freiheit und Gleichheit herrschen, d. h. in dem allein der Allgemeinwille und die Einsicht in das Gemeinwohl das Handeln bestimmen. Auf diesem Weg schützt Rousseau vor Rechtsungleichheit, vor den verderblichen zivilisatorischen, geschichtlich gewordenen Vorrechten Einzelner und einzelner Schichten, aber er schützt nicht vor Demagogie und Tyrannis solcher Einzelner und solcher Gruppen, die den allgemeinen Willen zu vertreten glauben. Diese Prämissen kommen deutlich in Heredias Problematisierung der Tyrannis in Sylla und seiner Auseinandersetzung mit del Monte zum Ausdruck. Denn in Rousseaus Vorstellung war nur frei, war nur zum Volke gehörig, wer moralisch gut war und Tugend (vertu) besaß. Der politische Gegner ist dementsprechend automatisch moralisch korrupt – denn nur so ist seine Gegnerschaft zu erklären, d. h. die Gegnerschaft gegen das allgemein Beste. Ist sogar die Mehrheit korrupt – wie im Fall der spanischen kreolischen Oberschicht Kubas – so kann die tugendhafte Minderheit alle Gewalt anwenden, um der Tugend zum Sieg zu verhelfen. Der Zwang, den sie ausübt, ist nur das Mittel, dem unfreien Egoisten zu seinem wahren eigenen Willen zu verhelfen, den Bürger (citoyen) in ihm zu wecken.30 Diese Überzeugung Heredias kommt in seinem jahrelangen Kampf im Kreise der Konspiranten von Rayos y Soles de Bolívar zum Ausdruck. II.1.3.2. J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles (1835) Über J. Levilloux gibt es keine biographischen Angaben. «J. Levilloux de la Martinique» ist das einzige, was über ihn bekannt ist. Bei Les créoles ou la Vie aux Antilles handelt es sich um einen historischen Roman, um eine Neuinterpretation der revolutionären Ereignisse von 1789 auf den französischen Antillen. Der Mulatte Estève befreundet sich mit Edmond Briolan, da beide – aus Guadeloupe stammend – eine prestigeträchtige französische Schule, das Collège de Navarre, besuchen. Nach einer gewissen Zeit offenbart Estève Edmond sein Geheimnis, nicht «reinrassig weiß» zu sein. Daraus entsteht ein Dilemma um ein Akzeptieren oder Aufbrechen des ethnischen Kastensystems in den Kolonien. Dass die beiden Protagonisten ihre Bildung im selben Etablissement in der Metropole erhalten, ist ein zentrales Moment im Roman. Über neue Zugangsmöglichkeiten zur Bildung und ihre Auswirkung auf die Kolonialgesellschaften äußert sich Levilloux in seinem Vorwort: L’action constante de la presse et de la tribune des métropoles a conquis légalement dans les Petits Antilles ce que la révolution avait entrepris avec violence. Depuis dix-sept ans, de nombreuses générations de créoles visitant les collèges et les universités d’Europe ont perdu par le frottement les aspérités sauvages qui distinguaient leur caractère. Elles sont devenues, au contact des frères de la mère-patrie, plus pénétrables aux idées de progrès, plus flexibles aux mains du législateur. L’œuvre émancipation politique de la race de couleur est accomplie ; celle-ci ayant atteint le but de son ambition dépose
30
62
Ernst Schulin: Die Französische Revolution. München: Beck ²1989, S. 182.
cette aigreur passionnée qu’explique tout état de lutte, et chez elle aussi ont circulé les vivifiantes lumières de l’instruction.31
Levilloux verschreibt sich dem Anspruch, ein möglichst detailgetreues Bild seiner Zeit zu zeichnen. Er wendet sich ganz explizit an den europäischen Leser, dem er eine Beschreibung der Zustände auf der Insel vermitteln will, nachdem die Auswirkungen der Französischen Revolution wie ein Unwetter darüber hinweggezogen seien: «Les principes de la Révolution passèrent comme un ouragan sur ces terres de privilèges et d’esclavage, semant quelques idées fécondes pour l’avenir, et laissant une grande ruine, monument de leur invasion.»32 Levilloux insistiert darauf, sich von den Vorurteilen bezüglich der Rasse etc. zu befreien, die trotz des veränderten politischen Klimas hartnäckig weiterleben: «Les mœurs, créations laborieuses du temps […], résistent encore dans les usages et dans les rapports sociaux, quand les principes politiques qui doivent les transformer règnent déjà dans les esprit.»33 Dennoch gibt es im Roman einige rassistische Vorurteile, was sich im Gespräch des Mestizen Estève mit dessen Rivalen, dem jungen weißen Kreolen Thélesfore, zeigt: «Ah! que ne puis-je vous aimer comme un frère, confondre mes destinés avec les vôtres, marcher toujours avec vous en quête du bonheur que nous partagerions comme des enfants du même sang.»34 Auch die Beschreibung der verschiedenen insularen Bevölkerungsgruppen ist von essentialistischen Zuschreibungen und wertenden rassischen Stereotypen geprägt. Dies zeigt sich in der Charakterisierung der Kolonen: «intelligences légères, en général incultes, mais vives, pénétrantes, enthousiastes du merveilleux, dédaigneux des connaissances philosophiques de l’Europe […]. Ils se prévalent de la noblesse de la couleur blanche.»35 Und die freien Mulatten werden als ambitionierte Nutznießer der neuen Verhältnisse beschrieben: Nés du commerce des blancs et des négresses : affranchis ambitieux des droits politiques et de l’égalité sociales ; hommes aux passions fortes, d’une nature hardie, participant, à la fois des qualités intellectuelles des Blancs et de la vigueur corporelle des Noirs, ils aspirent à fonder pour leur compte, sur les ruines des privilèges du Créole.36
Demgegenüber heißt es über die schwarzen Sklaven: Ils sont les plus nombreux ; mais ignorants, superstitieux, rusés par nécessité, susceptibles de dévouements sublimes et d’atroces cruautés, doués d’une imagination poétique et affectant souvent l’esclavage à côté de plusieurs vertus qu’on est surpris de rencontrer dans cet état de dégradation.37
31 32 33 34 35 36 37
Levilloux: Les créoles, Vorwort. Ebda., S. 6, zit. nach Toumson: La transgression des couleurs, S. 190. Levilloux: Les créoles, Vorwort. Ebda., S. 64. Ebda., Vorwort. Ebda., Vorwort. Ebda., Vorwort.
63
Wenn der Handlungsstrang zunächst einen recht systemkritischen Autor erahnen lässt, offenbart sich beim genauen Hinsehen, dass Levilloux die bestehenden Verhältnisse der Sklaverei explizit bestätigt: […] quels qui soient les préjugés, vices de son éducation et de l’état social où se moule son enfance, le colon est un homme d’élite, qui peut attirer la haine, mais jamais le mépris […]. La domination [des colons] sur la race africaine se conçoit, s’explique, se justifie même jusqu’à nos jours.38
Das Hauptinteresse des martinikanischen Autors besteht darin, die Klasse der Mulatten zu rehabilitieren, jedoch nicht die der Schwarzen. Eine mit Heredia vergleichbare konzeptionelle Auseinandersetzung um die Idee des citoyen findet bei Levilloux nicht statt. Bezeichnenderweise fällt das Wort aus dem Munde des kreolischen Protagonisten Estève kaum. Er bedauert, das französische Mutterland nicht als perfekter citoyen besser unterstützt zu haben: Il y a en moi un besoin impérieux de me sacrifier à une sainte cause, de consacrer toutes les ressources de ma jeunesse et de mon savoir au service de quelques êtres chéris et à la réalisation de quelque sentiment pur et généreux. Telle est la vie morale du jeune homme de notre époque. Heureux ceux qui peuvent la reproduire au dehors ! Ainsi, n’ayant pu me rendre citoyen utile dans la révolution de notre chère France ; je sens du moins que même dans ce pays, il y a large place pour le dévouement à la cause de l’humanité.39
In einem anderen Kontext fragt er: «Nous acceptez-vous pour concitoyens, pour frères ?»40, was aber keine programmatische Inszenierung folgen lässt. Vergleicht man, wie präsent die Ideen der Französischen Revolution, konkret das Konzept des citoyen, bei José María Heredia und J. Levilloux ist, so zeigt sich, dass es bei Ersterem einen breiten Raum einnimmt, während es vom Zweiten überhaupt nicht rezipiert wird. Dieses Ergebnis ist durchaus symptomatisch. Die Wahl der beiden Autoren mag willkürlich erscheinen, doch sind ihre politischen Positionierungen repräsentativ für die beiden Kolonialsphären Frankreich und Spanien. Trotz der jedem Autor der französischen Kolonialsphäre immer naheliegenden Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution werden die staatsphilosophischen Ideen nicht zum Anlass genommen, kritisch über koloniale Rechtsfragen zu reflektieren.
II.2.
Zwischen Frankophilie und Autonomiebestrebungen: Postkoloniale Theoriebildung und das 19. Jahrhundert
Wenden wir uns nun einer weiteren Gegenüberstellung von zwei literarischen Vertretern der spanischen und französischen Kolonialsphäre zu und nehmen deren Positionierung zum kolonialen Status quo in den Blick. Gertrudis Gómez de Avellaneda und Louis de Maynard de Queilhe – was verbindet diese beiden Literaten?
38 39 40
64
Ebda., Vorwort. Ebda., S. 48. Ebda., S. 183.
Was bringt ein Vergleich ihrer zentralen Romane, Sab (1841) und Outre-mer (1835)? Beide Romane sind fast zeitgleich im karibischen Raum erschienen. Sie sind repräsentative Beispiele für die schreibende kreolische Oberschicht ihrer jeweiligen Herkunftsinsel, die im Unterschied zum lateinamerikanischen Festland beide weiterhin unter kolonialer Herrschaft stehen: Maynard de Queilhe stammt aus Martinique, Gómez de Avellaneda aus Kuba. Beide schreiben sie vom Mutterland aus: die Kubanerin in Madrid, der Martinikaner in Paris. Während Kuba 1898 unabhängig wird, bekommt Martinique 1946 den Status eines Département d’outre-mer. Dass sich die französischen Antillen bis heute in einer (post)kolonialen Problematik befinden, zeigen die aktuellen Debatten, entfacht durch einen Gesetzesentwurf der Assemblée nationale im Februar 2005, der die positive Rolle des Kolonialismus im französischen Schulunterricht betonen sollte.41 Doch inwiefern bietet die Arbeit mit den Konzepten der postkolonialen Theoriebildung eine fruchtbare Auseinandersetzung mit lateinamerikanischen Literaturen im 19. Jahrhundert? Während auf dem lateinamerikanischen Festland bis Ende der 1820er-Jahre die faktische Staatenbildung abgeschlossen war, dauerten die Unabhängigkeitsprozesse im karibischen Raum (abgesehen von Haiti: 1804) weiter an. Geht man von einem rein chronologischen Verständnis von post-kolonial aus, wäre eine Arbeit mit dem Begriff innerhalb einer literaturbeziehungsweise kulturtheoretischen Untersuchung des karibischen Raums im 19. Jahrhundert wohl problematisch. Eine Orientierung am Instrumentarium der postkolonialen Theorie kann sich dennoch anbieten. Ich stütze mich hier auf die Untersuchungen von Bill Ashcroft und Walter Mignolo. Bekanntlich plädiert Ashcroft (1999) dafür, das Postkoloniale nicht als einen (historischen) Moment danach zu fassen, sondern als einen Prozess der Auseinandersetzung mit Strukturen, die durch neue abgelöst werden, und bezieht folglich Lateinamerika in seine postkolonialen Analysen ein.42 Zunächst sollen beide Romane vorgestellt werden, wobei sofort ins Auge fällt, dass die zentrale Frage um das Verhältnis zwischen Kolonisator und Kolonisiertem kreist. Das heißt, im Fall der Karibik wird dieses Verhältnis auf eine sozial-ethnische Herr-Sklave-Ebene verlagert, da die indigene Urbevölkerung um 1492 vorwiegend ausgelöscht wurde. Bei dem Vergleich von Sab und Outre-mer stehen dann folgende Leitfragen im Zentrum: 1) Walter Mignolo schlägt vor, den Begriff des «Postkolonialen» terminologisch zu differenzieren. Er plädiert für eine Trennung von historischer Postkolonialität und epistemologischer Postkolonialität. Letztere ist an eine razón postcolonial gebunden, eine Geisteshaltung, die den kritischen (Rück)Blick auf das Koloniale (Erbe) erlaubt.43 Demnach können Romane bereits vor der
41
42 43
Vgl. dazu den Protestbrief von Édouard Glissant und Patrick Chamoiseau an den französischen Innenminister (damals Nicolas Sarkozy) vom Januar 2005. Online verfügbar unter: http://www.potomitan.info/articles/deloin.php [20.02.2011]. Vgl. Reinstädler: Die Theatralisierung der Karibik. Vgl. ebda.; Walter D. Mignolo: La razón postcolonial. Herencias coloniales y teorías postcoloniales. In: Alfonso de Toro (Hg.): Postmodernidad y postcolonialidad. Breves
65
2)
3)
4)
5) 6) 7)
politischen Unabhängigkeit postkoloniale Diskurse enthalten, etwa wenn sie dichotome Hierarchisierungen unterlaufen und die Pluralität von Wertigkeiten postulieren. Kann dieses Verständnis von Mignolo fruchtbar sein für eine Gegenüberstellung von Romanen, die sich eventuell höchst unterschiedlich zur kolonialen Situation positionieren? Welche europäischen Diskurse eignen sich die Autoren an? Behaupten sie dabei die eigene kulturelle Identität ihrer Herkunftsinseln? Auf welche Weise reflektieren sie den potentiellen Widerspruch von Emanzipation und an Europa ausgerichteter geistesgeschichtlicher Verpflichtung? Haben sich bestimmte Texte besonders durchgesetzt? Inwiefern trägt eine intensive Rezeption dazu bei, kulturhegemoniale Konstellationen aufzusprengen oder zu zementieren? Beruht die Darstellung der kolonialen Strukturen auf einem binären Oppositionssystem? Falls ja, wird dadurch die Teilung zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren forciert und stabilisiert?44 Trägt die Literatur der Antillen dazu bei, die These Edward Saids zu illustrieren, dass Kolonialismus immer eine Konsequenz des Imperialismus (und nicht umgekehrt) ist?45 Inwiefern antizipiert die Literatur politische Entwicklungen? Inwiefern werden Stereotypen, wie zum Beispiel das Bild des «edlen Wilden», in ihre Herkunftsregion zurückverpflanzt? Haben die beiden Texte gründungsfiktionalen Charakter? Das heißt, können sie im Sinne von Doris Sommer als foundational fictions gelesen werden? Beide Autoren sind auf den Antillen geboren, schreiben aber von den Metropolen ihrer jeweiligen Mutterländer aus, Gómez de Avellaneda in Madrid, Maynard de Queilhe in Paris. Führt diese Situation zu einem Fortschreiben kolonialer Diskurse? Inwiefern beeinflusst dieses Schreiben die Perspektive?
II.2.1. Gómez de Avellaneda: Sab (1841) In der Wahl ihres Sujets orientiert sich Gómez de Avellaneda an Victor Hugos Jugendwerk Bug-Jargal (1826): Der Sklave Sab verliebt sich in seine Herrin Carlota, doch wird er nicht zum romantischen Helden eines Sklavenaufstands, wodurch die sozialen und ethnischen Barrieren, die ihn von der Geliebten trennen, eingerissen würden, sondern er wählt den Weg des Selbstopfers und der Passion um seiner Liebe willen, einer Liebe, die schon aufgrund der stabilen gesellschaftlichen Ordnung von Carlota gar nicht wirklich erwidert wird und die sich – wie Avellaneda in ihrer Abgrenzung von Hugo zu suggerieren scheint – in dieser Gesellschaft wohl auch noch gar nicht wirklich denken, geschweige denn realisieren ließe. Während Hugo über die Befreiungskriege in Saint-Domingue post factum schreibt, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Sab, der
44 45
66
reflexiones sobre Latinoamérica. Madrid: Vervuert, Iberoamericana 1997, S. 51–70. Vgl. María do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: Transcript 2005, S. 85. Ebda., S. 13f.
selbst in seiner scheinbar «weichen» Kritik der krassen sozialen Wirklichkeit sofort der kolonialen Zensur zum Opfer fiel, Kuba mehr als ein weiteres halbes Jahrhundert Kolonialherrschaft bevor. Liest man Sabs Verhalten vor dem Hintergrund der Befreiungskämpfe im bereits unabhängigen lateinamerikanischen Umfeld, dann wird man seine Selbstaufgabe auch als Opfer auf dem Altar der herbeigesehnten nationalen Unabhängigkeit deuten können, da er um der inneren (nationalen) Einigung willen auf eine Eskalation der sozial-ethnischen Konflikte verzichtet, eine Eskalation, die aber durchaus als Option angedacht wird und für die sich in den solidarischen Beziehungen zwischen den Sklaven auch eine gewisse Grundlage erahnen lässt. He pensado también en armar contra nuestros opresores, los brazos encadenados de sus víctimas; arrojar en medio de ellos el terrible grito de libertad y venganza; bañarme en sangre de blancos; hollar con mis pies cadáveres y sus leyes y perecer yo mismo entre sus ruinas.46
Indem jedoch Gómez de Avellaneda die Liebesgeschichte außerordentlich ernst nimmt (sie selbst blieb etwa zeitgleich und unter umgekehrten GeschlechterVorzeichen in ihrer eigenen Liebe ungehört), verweist sie neben der ethnischen auf die geschlechtliche Dimension sozialer Unterdrückung. Die asymmetrischen Machtverhältnisse sind nicht ein rein Äußerliches, sie sind tief in das Bewusstsein der Menschen eingeschrieben, gerade auch der Unterdrückten selbst. Dabei wird von der gender-orientierten Forschungsliteratur gerne übersehen, dass Carlota nicht nur Sabs stille Liebe nicht erwidert, sondern dass für sie die Liebe zu einem Sklaven schlicht undenkbar ist. Als sie an ihrem Hochzeitstag durch ihre zutiefst erschütterte Verwandte Teresa von Sabs Tod erfährt, weist sie die Vermutung ihres Bräutigams, Teresa habe Sab geliebt, mit den Worten zurück: «¡Amarle! –repitió Carlota– ¡A el! ¡A un esclavo! […] sé que su corazón es noble, bueno, capaz de los más grandes sentimientos; pero el amor, Enrique, el amor es para los corazones tiernos, apasionados… como el tuyo, como el mío.»47 Anders als Bug-Jargal und seine Kampfgenossen, die sich herzlich wenig um die Gefühle und den Willen der begehrten weißen Frauen scheren und für die diese Frauen letztlich genau wie für die weißen Männer Objekte bleiben, erreicht Sab eine unvergleichlich bedeutendere moralische und reflexive Tiefe. Die traditionellen romantischen Bilder des impulsiv handelnden «edlen Wilden» und bon nègre werden revolutioniert, wenn Sab in seinem Verzicht Carlota als Subjekt ernst nimmt, ohne jedoch dabei zu verkennen, wie sehr die Geliebte gerade in ihren Empfindungen von den gesellschaftlich dominanten Denkmustern beherrscht bleibt, durch die sie ihre eigene Objekthaftigkeit subjektiv interiorisiert. So vergleicht Sab seine Rolle als Sklave mit dem Los der Frau: «¡Oh! ¡las mujeres! ¡Pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos, ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de las leyes humanas. Sin otra
46 47
Gómez de Avellaneda: Sab, hg. v. Servera, S. 157. Ebda., S. 251.
67
guía que su corazón ignorante y crédulo, eligen un dueño para toda la vida.»48 Man achte auf den Gebrauch des Aktivs: Die Frauen wählen, sie lassen sich von ihrem eigenen unwissenden und leichtgläubigen Herzen leiten, oder, um es in der Sprache der Aufklärung auszudrücken: ihre Unmündigkeit ist durchaus selbstverschuldet! «El esclavo, al menos, puede cambiar de amo, puede esperar que, juntando oro, comprará algún día su libertad, pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita: ,En la tumba.‘»49 Sabs Dilemma liegt in der Situation selbst begründet: die Feinfühligkeit seiner Wahrnehmung, die Tiefe seiner Reflexion und Selbstreflexion über die gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die er durchaus nicht als rein äußerliche Kraft versteht, sowie der unglaublich hohe moralische Anspruch an sich selbst treiben ihn in die eigene Selbstaufgabe. Er sieht sehr wohl die Charakterschwäche von Carlotas Verlobtem Otway, der unter dem Einfluss seines geldgierigen Vaters die bereits geplante Hochzeit absagen will, als er erfährt, dass es um die materiellen Verhältnisse der Familie Carlotas schlechter bestellt ist als erwartet. Nach zermürbendem innerem Kampf steckt Sab trotz seiner Voraussicht einer unglücklichen Ehe Carlota seinen Lottogewinn zu und ermöglicht ihr so eine freie Entscheidung. Erst nach mehreren ernüchternden Ehejahren, als ihre Verwandte Teresa im Kloster stirbt, bekommt Carlota Sabs Abschiedsbrief zu Gesicht, der ihr nicht nur die Geschichte des Sklaven offenbart, sondern ihr auch erstmals ihre eigene Geschichte gibt. Die verspätete Einsicht in die moralische Überlegenheit des Sklaven, der sich zu weitaus mehr als nur zu liebender Leidenschaft in der Lage erwies, lässt die unglücklich Verheiratete schließlich die Absurdität ihrer ethnischen und sozialen Vorurteile erkennen. Mehr als ein Aufruf zum Kampf gegen äußere Unterdrückung, zielt der Roman auf eine Überwindung der inneren Machtverhältnisse, die den strukturellen sozialen, ethnischen und geschlechtlichen Ungleichheiten erst ihre Stabilität verleihen. Sab spaltet die Gesellschaft nicht im Zeichen des Klassenkampfes, sondern wird zur Integrationsfigur für eine neue, geeinte kubanische Identität. Bezeichnenderweise entzieht er sich eindeutigen essentialistischen Zuschreibungen: obwohl Mulatte, haben die Leute Schwierigkeiten, seine Hautfarbe eindeutig zu bestimmen; und obwohl männlich, wird er mit durchaus femininen Zügen gezeichnet, vor allem wählt er freiwillig den Weg des Leidens, den er als Los der Frau in einer zu überwindenden patriarchalischen Gesellschaft ausmacht. Die Wahl dieses Leidensweges scheint mir stark an der biblischen Passionsgeschichte orientiert: wie Jesus von Nazareth durch die Zurückweisung des bewaffneten Widerstands der Zeloten gegen die römische Fremdherrschaft zum Kristallisationspunkt einer religiösen Neugründung wird, so soll Sab zur Integrationsfigur für eine nationale Neugründung werden. Sabs Identitätsprojekt entwirft damit die Perspektive eines neuen, in die Zukunft gerichteten nationalen Konsenses, dem keine exklusiven ethnischen oder
48 49
68
Ebda., S. 270 (Hervorhebung GM). Ebda., S. 271.
Geschlechterkriterien zugrunde gelegt werden und bei dem nur die Otways als männliche Vertreter einer kolonialen Spekulantenmoral – letztlich freiwillig – außen vor bleiben: denn für sie ist Kuba nur eine Durchgangsstation bei ihrer Jagd nach immer neuen Reichtümern in aller Welt, und sie haben gar kein Interesse, sich dort wirklich und dauerhaft zu integrieren. II.2.2. Louis de Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835) Outre-mer wurde 1835 geschrieben. Wir befinden uns in einem Klima, in dem die Ideen der Julirevolution von 1830 nach und nach in die entlegenen Winkel des französischen Kolonialreiches gelangen. Mit den Ideen der Revolution bestimmen auch Fragen um die Abschaffung der Sklaverei intensiv die philosophischen und politischen Debatten in Paris. Das Vorbild ist England, wo es bereits 1833 zur Abolition kam, in Frankreich werden Vorbereitungen für die Commission de Broglie (1840) getroffen, deren Gespräche dann 1848 in die definitive Abolition münden. Maynard de Queilhe ist ein Béké, ein Repräsentant der weißen kreolischen Oberschicht Martiniques, deren Hauptsorge um 1835 darin besteht, die alte Ordnung zu wahren. Ihr Reichtum basiert vor allem darauf, dass die Plantagenwirtschaft dank Sklaverei erfolgreich funktioniert. Revolutionäres Gedankengut aus Europa wird von den Békés als große Gefahr gesehen. Für sie scheint sich der Alptraum von 1789 nun zu wiederholen. In seinem Vorwort erklärt Maynard die Gründe für sein literarisches Zeugnis: [Mon livre présent a] deux faces, l’une qui est littéraire, l’autre qui est politique ou plutôt sociale. […] Je me suis efforcé d’être impartial… J’ai raconté… Je ne prétends pas nier qu’une leçon ou plutôt qu’un avis ne soit caché dans la fable et dans son dénouement.50
Der Roman spielt im Jahr 1830, und im Zentrum steht die Leidenschaft des Mulatten Marius für eine weiße Kreolin, Julie de Longuefort. Diese Verbindung kann nach Maynard de Queilhe nur wider die Natur sein und einzig mit schlechter Erziehung erklärt werden: Julie ist in der französischen Metropole aufgewachsen und war dort dem verderblichen Einfluss romantischer Plädoyers ausgesetzt. Ihrem Charakter fehlt folglich die Klarheit und Konsequenz junger Kreolen der «guten alten Zeit». Marius ist seinerseits erst kürzlich nach Martinique zurückgekommen. Die schlechte Erziehung erhielt er von seinem Adoptivvater, Sir William Blackchester, der Philanthrop und obendrein noch Engländer ist. (In den Augen der weißen Martinikaner waren die Engländer noch unbeliebter als die französischen Liberalen, da dort die Sklaverei bereits 1833 abgeschafft worden war.) Anfangs wird in Marius ein politisches Feuer entfacht, er ist stark beeinflusst von der europäischen Philosophie der Aufklärung und ruft zur Revolte auf. Die Sklaven lassen sich seiner Meinung nach zu viel gefallen: «Je n’y comprends rien. On les insulte, ils baissent la tête ; on les bat, ils s’agenouillent ; on les tue, ils remercient. Qu’est-ce que cela, bon Dieu ? Mais je viens d’un pays où
50
Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. II.
69
les bêtes pourraient vous enseigner votre devoir d’hommes…»51 Seine Worte nehmen fast spätere Positionen der Négritude vorweg, was so weit geht, dass er eine schwarze Frau kauft und befreit, um sie zu heiraten. Doch schnell landet er auf dem Boden der Tatsachen und ihm wird klar, dass sie Welten trennen. Marius lernt, dass er nur eine «echte Frau» lieben kann: eine Weiße. Damit steht er im vollen Widerspruch zu seinen politischen Überzeugungen. Zerrissen zwischen seinem Weißenhass und seiner Liebe für Julie, schließt Marius sich einer Gruppe aufständischer marrons (entlaufener Sklaven) an und beteiligt sich an einigen Revolten. Die Erfahrungen nach seiner Rückkehr auf Martinique führen dazu, sein Urteil über die Sklaverei zu revidieren. Der weiße M. de Longuefort erklärt dem Mulatten, dass die Vorurteile gegenüber den Schwarzen durchaus ihre Berechtigung haben.52 Und in der Tat, Marius gerät in Verzückung, als er eine habitation besichtigt, ein Modell der alten Aristokratie. Hier zeigt sich, wie gut die Sklaven in Wirklichkeit behandelt werden: ja, so gut, dass sie selbst fast auch zu Herren und Meistern geworden sind. Sie erhalten vom Kolonen sogar ein Stückchen Erde. Nach der Habitation-Besichtigung verwirft Marius seine revolutionären Ideen aus Europa. Par intervalles certes le fouet retentissait, mais en l’air et non sur le dos de l’esclave et c’était uniquement pour exciter l’ardeur des endormis ou pour se faire entendre des plus éloignés. La terre n’était point arrosée de leurs sueurs mais peut-être du sirop qu’on ne leur refuse en aucun temps, et qu’ils ont l’habitude de boire délayé dans l’eau […] On lui avait annoncé beaucoup de cris et de gémissements, et il ne les entendait que rire et jaser.53
Die Plantage ist nicht Gegenentwurf zum Paradies, sondern dessen Verlängerung, die Erntezeit eine Zeit positiver Aktivität und freudiger Lieder. Der französische Pflanzer wird meist als großzügiger Patriarch dargestellt, der von seinen Sklaven wie ein Vater angenommen wird und sie seinerseits liebevoll umsorgt. Er baut für sie durchaus ansehnliche Unterkünfte im Grünen. Die Sklaven bestellen ihre eigenen Gärten und werden im Krankenhaus der Plantage medizinisch versorgt.54 Soviel zur Darstellung der Schwarzen in Outre-mer. Wichtiger aber noch ist die Charakterisierung der Mulatten im Roman, repräsentiert durch den zentralen Protagonisten Marius. Der Autor verleiht Marius eine gewisse Intelligenz, die ihn fast den Weißen gleichstellt; doch bei der kleinsten Gelegenheit wird seine schwarze Herkunft betont, beispielsweise in Form seiner leidenschaftlichen Gewaltbereitschaft, seiner latent vorhandenen Barbarei etc. So eliminiert Marius im weiteren Verlauf des Romans alle Prätendenten Julies, und nachdem er den Sohn des Marquis de Longuefort getötet hat, nutzt er die Großzügigkeit des blinden Vaters aus und wird dessen Vertrauensmann. Dass Marius in eine weiße Frau verliebt ist, ist nichts Außergewöhnliches. Umgekehrt ist aber eine Gefühlsäu-
51 52 53 54
70
Ebda., S. 41. Ebda., S. 86; vgl. Corzani: La littérature des Antilles, Bd. II, S. 338. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. 105f. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 164.
ßerung einer weißen Frau für einen Mulatten ein Skandal. Julie gesteht ihm, als er sie zu Tode schlägt: «Mon Marius, je t’aimais!»55. In dem Moment, in dem M. de Longuefort sich darum bemüht, Gerechtigkeit walten zu lassen und den Mörder seiner Tochter zu enthaupten, das heißt in dem Moment, als Marius seinen Nacken entblößt, bemerkt eine schwarze Greisin eine Narbe und erkennt in ihm den Sohn, den sie einst mit demselben Marquis zusammen bekam. Die Tugenden der weißen Rasse finden so auf einer weiteren Ebene Bestätigung: Was Julie als leidenschaftliche Liebe ansah, entpuppt sich als die Zuneigung einer Schwester für ihren Halbbruder. Der Mulatte Marius hingegen ist am Ende des Romans in vielerlei Hinsicht stigmatisiert: Mörder seines Bruders, Vergifter seiner Schwäger, Geliebter und Mörder seiner Schwester. Er ist der große Schuldige, der es gewagt hat, auf seine Heimatinsel zurückzukehren, ohne deren Regeln zu respektieren. Ihm bleibt nichts als die melodramatische Inszenierung eines Selbstmords. Marius’ Schicksal lässt sich auf folgenden Satz aus seinem Munde reduzieren: «[…] dans un pays de privilèges, une brillante éducation est pour l’homme de la caste inférieure le présent le plus funeste»56: Die sozial aufgestiegenen Mulatten, die mit revolutionärem Gedankengut infiziert von ihren Pariser Studienaufenthalten zurückkehren, werden als die wahren Feinde der aristokratischen Ordnung dargestellt.57 Der konservative Adressat des Romans findet Bestätigung in der Beschreibung von Julies Seelenzustand, da sie sehr schockiert ist über die Mediokrität der Mulatten von Saint-Pierre. Cette découverte, en effet, c’était la flétrissure de tout ce passé où elle avait aimé Marius contre la règle et les usages de son pays : qu’elle, pauvre enfant ! avait eu la faiblesse de blâmer sur la foi des autres ! Maintenant elle voyait de ses propres yeux quelle erreur elle avait commise. Qui voudrait jamais croire que Marius fût une exception ! Et d’ailleurs, pour une exception, qui oserait abolir la règle ! 58
Der Roman zeigt eine kreolische Oberschicht, die von der Metropole vernachlässigt, von der Julimonarchie verraten ist. Wie es in einem Dekret des Conseil des colonies heißt, wäre die Abschaffung der Sklaverei aus kolonialer Sicht eigentlich nicht notwendig, das Problem sei nur der «philanthropische Druck», der von Europa ausgeübt werde: Die habitations würden mit sanfter Hand und durchaus fortschrittlich geführt, und die Einheimischen wünschten und forderten von sich aus keineswegs radikale Veränderungen. Doch angesichts der öffentlichen Meinung in Europa, unter dem Eindruck der dadurch bereits angestoßenen Maßnahmen und der stets neu entfachten ernsthaften Diskussionen samt ihrer negativen moralischen und ökonomischen Auswirkungen für die Kolonien, sei eine umfassende und dauerhafte Beibehaltung der Sklaverei nicht mehr möglich.59
55 56 57 58 59
Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 376. Vgl. ebda., S. 163. Corzani: La littérature des Antilles, Bd. II, S. 341. Maynard de Queilhe 1835, Bd. II, S. 163. Vgl. Gisler: L’esclavage aux Antilles, S. 129.
71
Das Anliegen von Outre-mer ist hochpolitischer Natur: Die Philanthropen sollen überzeugt werden, auf jede Form der Abolition zu verzichten. Gleichzeitig sollen die Kolonen vor jeder Verleumdung reingewaschen werden. Ihre Stilisierung als paternalistische Herren soll dem Ruf des Sklavenschinders entgegenwirken:60 «[I]ls seraient les premiers à seconder toute tentative louable qu’on ferait en faveur des esclaves et des affranchis, pourvu toutefois qu’on ne profitât point de leur bonne volonté pour saccager leurs propriétés et livrer leur vie au coutelas des Nègres…»61 II.2.3. Literarische Inszenierungen des spanischen und französischen Kolonialismus Die beiden Autoren Maynard de Queilhe und Gómez de Avellaneda stehen beispielhaft für die Literaten ihrer Herkunftsinseln. Ihre Gegenüberstellung wirft ein Licht auf die unterschiedliche Positionierung der Intellektuellen der französischen und der spanischen Karibik bezüglich der kolonialen Problematik. Gómez de Avellaneda stand dem Kreis von del Monte nahe, und Sab reiht sich ein in den conjunto abolitionistischer Romane aus Kuba, zu denen auch die Werke von Anselmo Suárez y Romero (1818–1878), Cirilo Villaverde (1812–1894) und Francisco Manzano (1797–1853) gehören. Bezeichnenderweise gab es auf Martinique keinen vergleichbaren intellektuellen Zirkel. Die wenigen anderen Autoren aus der französischen Kolonialsphäre in der Karibik (abgesehen von dem seit 1804 unabhängigen Haiti) haben eine ähnliche Haltung wie Maynard de Queilhe und sprechen sich für eine Bewahrung der bestehenden Verhältnisse aus. Für den untersuchten Zeitraum wären zu nennen: der bereits vorgestellte J. Levilloux sowie Poirié Saint-Aurèle62 und J. H. J. Coussin63. Während Outre-mer die bestehenden kolonialen Diskurse affirmiert, findet sich in Sab durchaus eine antikoloniale Haltung, die man auch mit dem eingangs erwähnten Begriff der epistemologischen Postkolonialität fassen kann. Wenn sich die Romane von Gómez de Avellaneda und Maynard de Queilhe hinsichtlich ihrer gesellschaftspolitischen Tendenz deutlich unterscheiden, so liegen sie wieder ganz eng beieinander, was ihre literarische Ausrichtung betrifft: Beide orientieren sich vor allem an der französischen Romantik. Der romantische Held Marius befindet sich in einer existentiellen Dualität, was auf den Einfluss von Victor Hugo zurückzuführen ist, mit dem Maynard de Queilhe befreundet war. In seinem
60 61 62
63
72
Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 214. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 168f. Jean Pierre Aurèle Poirié, genannt Poirié Saint-Aurèle, war ein Plantagenbesitzer und Dichter aus Guadeloupe. Er wurde 1795 während eines kurzen Exils seiner Familie im britischen Antigua geboren und starb 1855 auf Guadeloupe. Über den Autor J.H.J. Coussin (Guadeloupe 1773–1836) ist nur bekannt, dass er Schreiber am königlichen Gerichtshof in Guadeloupe war.
berühmten Vorwort zu Cromwell tangiert Victor Hugo die genuine Ambivalenz der menschlichen Natur: Tu es double, tu es composé de deux êtres, l’un périssable, l’autre immortel, l’un charnel, l’autre éthéré, l’un enchaîné par les appétits, les besoins et les passions, l’autre emporté sur les ailes de l’enthousiasme et de la rêverie, celui-ci enfin toujours courbé vers la terre, sa mère, celui-là sans cesse élancé vers le ciel, sa patrie.64
Diese doppelte Natur überträgt Longuefort aus Outre-mer in rassistischer Manier auf den Mulatten Marius: Le mulâtre, il ne faut pas l’oublier, ce n’était pas un homme comme un autre. C’était une image de ces fortes natures où les précipices, les plantes vénéneuses et les animaux malfaisants abondent, mais où néanmoins on doit aller chercher les merveilles les plus estimées de cet univers.65
In gewisser Hinsicht entspricht Marius dem von Homi Bhabha geprägten Bild des Mimikry-Man, da er immer nur eine partielle Repräsentation des Kolonialherren sein kann. Die Figur des edlen Wilden sucht man vergeblich bei Maynard de Queilhe. Alles Edle ist auf die Schönheit der weißen Frauen, die natürlich nicht «wild» sind, beschränkt. Die Darstellungen der Natur fallen sehr positiv aus, dennoch äußert der Autor im Vorwort, die antillanische Literatur könne angesichts der angespannten politischen Situation nicht mehr exotische Naturbilder als Zufluchtsort bieten. Sab indes hat einige Züge eines edlen Wilden. Als Archetyp des romantischen Helden entspricht auch er der Rezeption von Victor Hugo, allerdings in einer sozialromantischen Dimension. Die Orientierung an französischen Vorbildern bedeutet im Fall von Gómez de Avellaneda eine Abwendung von der literarischen Produktion ihres Mutterlandes Spanien und hat damit schon emanzipatorische Züge, was natürlich auch mit der damals omnipräsenten Rolle der französischen Romantik zusammenhängt. Marius und Sab verkörpern Grundzüge der romantischen Mythologie. Während Sab der positive Überheld ist, ist Marius der «Satan révolté», die «Frucht der Liebe zwischen Himmel und Erde»66. Die Rezeption desselben französischen Literaturmodells – der Romantik – entfaltet also völlig unterschiedliche Wirkungen: Bei Outre-mer werden kulturhegemoniale Konstellationen zementiert, bei Sab werden sie aufgesprengt. Im Fall von Outre-mer beruht die Darstellung der kolonialen Strukturen auf einem binären Oppositionssystem. Gearbeitet wird mit essentialistischen Identitätszuschreibungen, die die Welt unterteilen in gute Weiße und schlechte Schwarze. Die Mulatten als gefährliche Zwischengröße bilden die problematische Instanz zwischen den beiden Polen. Dies trägt dazu bei, die Segregation zu vertiefen und
64 65 66
Victor Hugo: Préface de Cromwell, zit. nach Maignan-Claverie: Le métissage, S. 250. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I., S. 350, zit. nach Maignan-Claverie: Le métissage, S. 251. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. 53, zit. nach Maignan-Claverie: Le métissage, S. 251.
73
koloniale Strukturen zu verfestigen. Binäre Strukturen (vor allem in Bezug auf die ethnische Herkunft) gibt es auch im Fall von Sab. Dort sind die Identitätszuweisungen zwar auch essentialistischer Natur, doch hat die durchaus positiv besetzte Figur des Sklaven Sab eine derartige Kohäsionskraft, dass, ähnlich wie bei Cecilia Valdés von Cirilo Villaverde, dank eines Transkulturationsprozesses (Fernando Ortiz) etwas wirklich Neues entstehen kann.67 Mit dieser Funktion Sabs hängt zusammen, dass der Roman als foundational fiction (im Sinne von Doris Sommer) gelesen wird. Nicht umsonst ist er Teil des konstitutiven Kanons der kubanischen Nationalliteratur. Unabhängig davon, dass Martinique nie eine eigene Nation geworden ist, könnten die Romane der französischen Antillen im 19. Jahrhundert keine solche Funktion übernehmen. Sowohl Outre-mer als auch Sab antizipieren die politischen Entwicklungen. Sab hat mit seinem emotionalen Appell und dem Schock, den sein Selbstopfer beim Leser auslöst, eine große historische Wirkung gehabt. Immerhin ist der Roman nach 30 Jahren Verbot auf Kuba endlich 1871 in einer revolutionären Zeitschrift publiziert worden und damit unmittelbar in den Kampf um Unabhängigkeit und Abschaffung der Sklaverei eingegangen. Wie anfangs bereits betont, besteht eine zentrale Gemeinsamkeit der Autoren darin, dass beide auf den Antillen geboren sind, jedoch von den Metropolen ihrer jeweiligen Mutterländer aus schreiben. Damit befinden sie sich in einem Dazwischen. Im Fall von Outre-mer wurde auf einer innerliterarischen Ebene deutlich, dass die «Übersetzung» (translation) partikularer Ideen und Theorien der Metropolen in die Kolonien bei ihrer Reartikulation innerhalb der imperialen Herrschaftsverwaltung Hybridisierungsprozessen unterworfen sind:68 Die revolutionären Ideen des Protagonisten Marius entstehen im Zentrum der französischen Kolonialmacht Paris und sind in der Kolonie selbst nicht durchführbar. Diese Problematik zeigt sich bei Gómez de Avellaneda nicht auf einer textinternen Handlungsebene, sondern in der Orientierung an literarischen Modellen. Für die kubanische Autorin gestaltet sich die Situation dieses Dazwischen weitaus komplexer: Sie schreibt sich und ihre Literatur von außen, aus der Distanz, in den Kampf für eine politische und zum Teil auch kulturelle Emanzipation ein. Bei ihr zeigt sich folgendes: Der Versuch, eine außereuropäische Identität zu begründen, schafft – wenn die Identitätskategorien, -modelle und -diskurse gerade aus den
67
68
74
Vgl. zu Cecilia Valdés Ottmar Ette: Cirilo Villaverde: Cecilia Valdés o La Loma del Angel. In: Volker Roloff, Harald Wentzlaff-Eggebert (Hg.): Der hispanoamerikanische Roman. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1992, Bd. I, S. 30–43; 313f.; Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. [Havanna] Dir. de publicaciones, Univ. central de Las Villas 1963. Vgl. zum bereits mehrfach in dieser Arbeit erwähnten Begriff der Transkulturalität besonders die Ausführungen von Lüsebrink, der auch explizit auf Fernando Ortiz verweist. Sehr aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang Lüsebrinks Pointierung des Verflechtungsansatzes: «Der Begriff Transkulturalität […] dient zur Bezeichnung pluraler kultureller Identitäten, die durch die hochgradige Vernetzung und Verflechtung vieler Kulturen der Gegenwart entstanden sind.» Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 17. Castro Varela, Dhawan: Postkoloniale Theorie, S. 89.
Zentren69 stammen, von denen man sich abzugrenzen sucht – häufig eine Spannung, die sich nicht immer einfach in einer dialektischen Synthese aufheben lässt. Für beide Autoren gilt: Egal, was die Motivation für ein Exil im Mutterland ist, und unabhängig davon, wie stark man sich mit der (ehemaligen) Kolonialmacht identifiziert, ein konzeptioneller Spagat ist aufgrund der diskursiven Herrschaft des Mutterlandes über die Kolonien jeder postkolonialen Positions- und Selbstbestimmung zu eigen. Wenngleich das Verhältnis zur jeweiligen Kolonialmacht Frankreich oder Spanien sehr unterschiedlich problematisiert wird, offenbaren sich aufschlussreiche Gemeinsamkeiten in den kolonialen Beziehungen: Die Wiederholung von Modellen/Ideen aus dem Mutterland in der Kolonie kann niemals mit dem sogenannten Original identisch sein. Der Prozess der Übersetzung – die Wiederholung innerhalb eines anderen Kontexts – schlägt gezwungenermaßen eine Lücke in das angenommene Original, womit der Kolonialismus selbst die Identität und Autorität der Kolonisatoren fragmentiert. Der Kolonisator verlangt, dass der Kolonisierte die äußerlichen Formen der beherrschenden Macht annimmt und ihre Werte und Normen internalisiert. In diesem Sinne ist der von Bhabha geprägte Begriff der Mimikry auch Ausdruck der europäischen Zivilisierungsmission70, die sich zur Aufgabe gemacht hatte, die kolonisierte Kultur nach ihrer Vorstellung zu transformieren, wobei Frankreich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein erfolgreicheres Modell zu bieten hatte als Spanien. Nach diesen konkreten Erkenntnissen sei noch ein Blick auf die wissenschaftstheoretische Metaebene erlaubt: Das Instrumentarium postkolonialer Theoriebildung liefert einen wichtigen Beitrag zur Eruierung politischer Positionierungen zum kolonialen Status quo über die Literatur. Für eine erste Zwischenbilanz sind die gewonnenen Erkenntnisse durchaus von Bedeutung. Allerdings wird sich zeigen, dass das postkoloniale Vokabular auch Gefahr läuft, Schematismen zu produzieren. Gerade das entscheidende Charakteristikum karibischer Literaturen, um das es in Kapitel III. gehen wird, lässt sich weder mit bipolaren Zentrums-Peripherie-Dimensionen greifen, noch ermöglicht der Fokus auf einen sogenannten dritten Raum die Erfassung eines komplexen Dazwischen, das sich nicht einfach in einer weiteren dritten Dimension auflösen lässt.
69 70
Dies gilt im Fall unseres Textkorpus für den in Kapitel II.3.3 vorgestellten Eugenio María de Hostos und für Gómez de Avellaneda. Jürgen Osterhammel hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Begriff Zivilisation nur in unauflöslicher Spannung mit seinem Gegenbegriff Sinn gewinnen kann: Zivilisation herrscht dort, wo Barbarei oder Wildheit besiegt sind. Zivilisation braucht ihr Gegenteil, um als solche kenntlich zu bleiben. Wäre «Barbarei» aus der Welt verschwunden, dann fehlte ein Maßstab für das offensiv selbstzufriedene oder defensiv sorgenvolle Wertungsbedürfnis der Zivilisierten. Minderzivilisierte sind als Zuschauer des großen Schauspiels der Zivilisierung notwendig. Vgl. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: Beck 52010, S. 1172.
75
II.3.
Raumdynamiken und koloniale Positionierung
Connaissez-vous le pays du cèdre et de la vigne, où sont des fleurs toujours nouvelles, un ciel toujours brillant ; où les ailes légères du zéphyr, au milieu des jardins de roses, s’affaissent sous le poids des parfums ; où le citronnier et l’olivier portent des fruits si beaux ; où la voix du rossignol n’est jamais muette ; où les teintes de la terre et les nuances du ciel, quoique différentes, rivalisent en beauté ?71
Diese romantische Lobpreisung der Natur steht am Anfang des 1859 erschienenen Romans Stella des haitianischen Schriftstellers Émeric Bergeaud. Es handelt sich dabei um ein Zitat des bereits erwähnten und zeitgenössisch bereits stark kanonisierten Lord Byron, der sich wiederum – zumindest in seiner ersten Zeile – wortwörtlich an Goethes «Mignon» orientiert. Warum werden die Beschreibungen italienischer Naturräume durch deutsche oder englische Dichter in die Karibik, konkret nach Haiti, transferiert, um dort wiederum das sogenannte «Eigene» zu besingen? Die räumliche Spannung, die damit in diesem ersten Roman des noch jungen Staates Haiti – also in einer post-kolonialen Situation per se – erzeugt wird, evoziert direkt die zentrale Fragestellung der folgenden Ausführungen: Welche Raumdynamiken unterliegen Texten des 19. Jahrhunderts, die in einer spezifisch kolonialen beziehungsweise postkolonialen Situation entstanden sind? Oder konkreter: Inwiefern kann ein Blick auf die Inszenierung von Raumdynamiken in literarischen Texten aus unterschiedlichen Kolonialsphären einen besonderen Beitrag leisten zu einer vergleichenden Kolonialismusforschung? Mit dem Fokus auf dieser Betrachtungsweise zeichnet sich bereits ein Paradigmenwechsel von einer Raumgeschichte zu einer Bewegungsgeschichte ab.72 Um dem Anspruch einer möglichst repräsentativen Untersuchung zu genügen, sollen hier drei literarische Vertreter unterschiedlicher Kolonialräume der Karibik zu Wort kommen. Im Vordergrund steht der eingangs zitierte Roman Stella (1859) des haitianischen Schriftstellers Émeric Bergeaud. Skizziert werden zudem der bereits vorgestellte, 1835 veröffentlichte Roman Outre-mer von Louis de Maynard de Queilhe und La peregrinación de Bayoán des Puertoricaners Eugenio María de Hostos aus dem Jahr 1863. Damit haben wir drei Stimmen aus höchst unterschiedlichen Kolonialsphären: Bergeaud aus dem von Frankreich unabhängigen Haiti steht mit Maynard de Queilhe ein Schriftsteller der französischen Kolonie Martinique gegenüber, die nie unabhängig geworden ist. Hostos als Vertreter der spanischen Kolonialsphäre befindet sich allein schon sprachlich gesehen in einem Umfeld, in dem das Streben nach Unabhängigkeit ein Thema von ganz anderer
71
72
76
Émeric Bergeaud: Stella. Hg. von Beaubrun Ardouin. Paris: E. Dentu 1859, S. 1. Eine erste Veröffentlichung der folgenden Ausführungen findet sich in Gesine Müller: «Une misérable petite île! moins qu’une île…». Raumdynamiken und koloniale Positionierung in der Literatur der spanischen und französischen Karibik im 19. Jahrhundert. In: Gesine Müller, Susanne Stemmler (Hg.): Raum–Bewegung–Passage. Postkoloniale frankophone Literaturen. Tübingen: Narr 2009, S. 87–100. Vgl. Ette: ZusammenLebensWissen, S. 16.
Bedeutung war als im französischen Kolonialreich, waren doch die karibischen Inseln die letzten abhängigen amerikanischen Enklaven der Madre Patria España. Rein historisch betrachtet, ist daher nur der Roman Stella einer postkolonialen Situation zuzuordnen. Es wird auch hier zu untersuchen sein, ob und inwiefern die beiden anderen Romane, die bereits vor Erreichung der Unabhängigkeit entstanden sind, gemäß Bill Ashcrofts (1999) prozessualem Verständnis des Postkolonialen eine solche Lesart nahelegen. Die folgenden Romananalysen konzentrieren sich: 1) auf die jeweiligen Raumkonzeptionen und ihre Dynamiken unter der Berücksichtigung, dass Räume kulturell konstituiert oder schlichtweg produziert sind (im Sinne eines kulturpragmatischen Raumbegriffs); 2) auf die Positionierungen zum kolonialen Status quo; 3) auf eine Wechselwirkung dieser beiden Phänomene. Neben diesen zentralen Fragen richtet sich mein Blick noch auf eine übergeordnete Dimension: Auch wenn die Rede vom spatial turn nicht neu ist, nehmen die folgenden Ausführungen diese in den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts konstatierte Wende der Geschichtswissenschaften, oder auch den topographical turn der Kulturwissenschaften, zum Anlass, der Inszenierung von Raumdynamiken in Texten des 19. Jahrhunderts nachzugehen.73 Mit einem geschärften Blick auf die Inszenierung von Raumdynamiken wird auch versucht, die Annahme, das 19. Jahrhundert sei ein Jahrhundert der Zeit, neu zu prüfen. Dies geschieht unter der längst etablierten Voraussetzung, dass die Vorherrschaft der Raumperspektive spätestens seit dem Entwicklungs- und Fortschrittsparadigma der Aufklärung des 18. Jahrhunderts zunehmend durch eine Zeitperspektive verdrängt worden ist; zugespitzt noch durch die kolonialistischen Entwicklungsvorstellungen im Zusammenwirken mit den fortschrittsbezogenen Geschichtsauffassungen des 19. Jahrhunderts.74 Der topographical turn beruht auf der Erfahrung eines Bruchs mit der etablierten Gleichung von kultureller Identität und nationalem Territorium, das heißt im Sinne Benedict Andersons: Imaginierung von territorialen Räumen als homogene Räume. Eine solche Erfahrung des Bruchs verdichtet sich in der Figur des displacements, die an die Stelle konventioneller Migrationskonzepte wie Exil und Diaspora getreten ist.75 Auch wenn das Projekt «kulturelle Identität» bereits im 19. Jahrhundert Konstruktcharakter hat, ist es dennoch bei damaligen Texten naheliegend, eine literarische Inszenierung zu erwarten, die gerade diese besagte Gleichung von kultureller Identität und nationalem Territorium vermittelt. In diesem Sinne wird auch von Vertretern des spatial turn eingeräumt, dass ein Zeitalter des Imperia-
73 74 75
Damit geht es also nicht um eine konsequente Anwendung neuer Kategorien im Sinne eines Kuhnschen Paradigmenwechsels. Doris Bachmann-Medick: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. 2006, S. 286. Sigrid Weigel: Zum «topographical turn». Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. In: KulturPoetik 2, 2 (2002), S. 151–165, hier S. 156.
77
lismus per se für eine Auseinandersetzung mit der Raumthematik stehe. Dennoch wird ihrer Ansicht nach damit nicht einem Raumverständnis im Sinne des spatial turn Rechnung getragen, da es in erster Linie um statische Gebilde und Raum als physikalische Masse gehe. Die Privilegierung der Zeit im 19. Jahrhundert scheint ganz besonders bei literarischen Texten aus Lateinamerika und der Karibik virulent, hatte doch bei den dortigen Autoren gerade solch ein Klassiker wie Chateaubriand Hochkonjunktur. Symptomatisch für sein omnipräsentes historisch-chronologisches Fundament ist sein berühmter Satz aus Mémoires d’outre-tombe: «Je me suis rencontré entre deux siècles comme au confluent de deux fleuves ; j’ai plongé dans leurs eaux troublées, m’éloignant avec regret du vieux rivage où je suis né nageant avec espérance vers une rive inconnue.»76 Eine intensive Zeiterfahrung äußert sich hier, konkret: das vorherrschende Gefühl eines Niedergangs des guten Ancien Régime. Bevor ich mich den Romanen zuwende, sei festgehalten: In erster Linie geht es bei den Lesarten der drei für die jeweilige Kolonialsphäre repräsentativen literarischen Texte um Raumdynamiken und um eine Positionierung zum kolonialen Status quo, wie auch um eine Wechselwirkung beider Phänomene. Erst in einer weiterführenden Schlussbetrachtung soll die übergeordnete wissenschaftsparadigmatische Frage unter Berücksichtigung ihrer Anwendbarkeit anskizziert werden. II.3.1. Émeric Bergeaud: Stella (1859) Mit Stella schrieb Émeric Bergeaud (1818–1858) den ersten Roman des unabhängigen Haiti. Die Handlung spielt im Zeitraum von 1789 bis 1804, einer Zeit der politischen Umwälzung, die die einstige Insel Hispaniola mit der Französischen Revolution und der Aufhebung der Sklaverei extrem verändert und das Land in einen langen Kampf um Freiheit als eigenständige Nation geführt hatte.77 In Form einer fiktionalisierten Historiographie, durchsetzt mit Elementen einer allegorischen Dichtungstradition, beschreibt Bergeaud die Zeit der Unabhängigkeitskriege am Beispiel des Brüderpaares Romulus und Rémus sowie der Figur Stella, einer Personifikation der Freiheit, um Haiti dann in einer glorifizierenden Schlussszene als einheitliche Nation zu besingen.78 Aus der Retrospektive berichtet die Mutter Marie im Schutz ihrer kleinen Hütte ihren beiden Söhnen unterschiedlicher Hautfarbe deren ursprüngliche Herkunft: Romulus ist der Sohn eines afrikanischen Stammesführers, der in Afrika im Kampf gefallen war und sein Dorf nicht mehr vor den Sklavenhändlern schützen konnte, so dass die anderen Stammesangehörigen als Sklaven nach Übersee verkauft wurden. Romulus, der in
76 77
78
78
René de Chateaubriand: Mémoires d’outre-tombe. Hg. von Maurice Levaillant. Paris: Gallimard (1848) 1958, S. 1047. In den Ausführungen zu Stella orientiere ich mich an den Ausführungen von Annegreth Thiem. Vgl. Annegreth Thiem: Rauminszenierungen. Literarischer Raum in der karibischen Prosaliteratur des 19. Jahrhunderts. Berlin, Münster: Lit 2010, S. 61ff. Ebda., S. 57.
Afrika gezeugt, aber in der Kolonie Saint-Domingue geboren wurde, symbolisiert somit den afrikanischen Ursprung der haitianischen Bevölkerung. Rémus ist das Resultat einer Vergewaltigung Maries durch den colon. Demzufolge ist seine Hautfarbe heller als die seines Bruders, und er gilt als Symbol für die Mulatten.79 Die Behandlung des Raums im Roman fällt sofort als strukturgebendes Moment ins Auge. Durch die Zugehörigkeit bestimmter inhaltlicher Aspekte zu einem bestimmten Bereich entstehen unterschiedliche Räume, die sich jeweils durch semantische Geschlossenheit und damit Abgegrenztheit charakterisieren. Diese Räume sind in erster Linie Orte im Sinne von geographischen Gebieten, die sowohl konkrete Orte mit einer außerliterarischen Referenz wie Haiti, Paris und Afrika sein können als auch begehbare Orte, die keine direkte außerliterarische Referenz haben. So gelten Berge, Städte oder Wälder zwar durchaus als in unserem Erfahrungsbereich begehbare Orte, aber sie stellen im Text eine Mischung aus möglichen und fiktionalen Orten dar, wodurch ihre Referenz nicht über den Text hinausweist und sich die räumliche Ausdehnung über unsere Vorstellung rein innerliterarisch manifestiert. Nach Annegreth Thiem lässt sich der Gesamttext mit Hilfe graphischer Felder in fünf Räume gliedern, die es ermöglichen, den Handlungsverlauf der Geschichte in räumlicher Struktur nachzuvollziehen: 1) Saint-Domingue/Haiti: patrie; 2) Europa/Frankreich/Paris: mèrepatrie; 3) Kriegsschauplatz: villes, fort, fortification; 4) Naturraum: montagne, bois, grotte, rivière; 5) Afrika. Die Relationen zwischen den einzelnen Räumen sind höchst unterschiedlich: Eine grundlegende räumliche Opposition stellen die Felder Saint-Domingue/Haiti und Europa dar, die sich gegenseitig beeinflussen, auf Außerliterarisches referieren sowie Grenzüberschreitungen durch Figuren ermöglichen. Demgegenüber vermischt sich in den Feldern Saint-Domingue/Haiti und montagne, bois, grotte, rivière die außerliterarische mit der innerliterarischen Ebene, wobei auch diese Beziehung der Räume als wechselseitig zu bezeichnen ist.80 Ein unmittelbarer Kontakt beider Räume ist aber unmöglich.81 Das Feld Afrika hat zwar weitreichende Folgen für andere Räume, weist aber bis auf die ursprüngliche Grenzüberschreitung durch Marie l’Africaine keine weitere Bewegung auf, sondern ist durch Statik gekennzeichnet. Das erste Feld SaintDomingue/Haiti hat eine doppelte Dimension: Fungiert es im größten Teil des Romans noch als Raum des kolonialen Saint-Domingue, wird es erst in den letzten beiden Kapiteln als unabhängige Nation Haiti realisiert. Im letzten Kapitel werden die Grenzen der einzelnen Räume durchlässig, die sich so miteinander verbinden. Sie bilden als Synthese einen neuen gemeinsamen Raum, die haitianische Nation. Die Raumstruktur des Romans dient somit als textuelle Stütze für
79 80 81
Ebda., S. 61. Ebda., S. 72. Thiem spricht in Bezug auf den Kriegsschauplatz von einem «dritten Raum» (ebda., S. 64). Angesichts des durch Homi Bhabha geprägten Begriffs würde ich nur von «Zwischenraum» sprechen, ohne auch dabei das postkoloniale in-between zu meinen.
79
den Mythos der Nationengründung, zudem antizipiert sie gleichsam den hybriden und synkretistischen Charakter dieser Nation.82 Ausschlaggebend für die kulturelle Verortung ist die territoriale Schönheit des späteren Nationenraumes. Bergeaud zitiert bei der Beschreibung der Kolonie Saint-Domingue daher paradiesische Bilder Byrons und Goethes, was den Anspruch auf den zu gründenden Orientierungsraum betonen soll.83 Der Lobgesang auf die Natur wird mit romantischen Märchenstrukturelementen eingeleitet: «Sur une terre fortunée, au sein d’une nature séduisante et prodigue de ses dons les plus précieux.»84 Der Adressatenkreis wird direkt aufgerufen, diese Insel zu besuchen und sich von der Schönheit der Natur beeindrucken zu lassen.85 Entscheidend ist jedoch die Omnipräsenz des Wissens über die abendländische Kultur, wonach diese wunderschöne Natur noch gezähmt und zivilisiert werden muss. Auch dies gelingt schließlich im letzten Kapitel, in dem das Fundament der Zivilisation die Grundlage für die Nation bildet.86 Ils savent qu’on n’est réellement heureux que par l’âme, fort que par l’intelligence, et que ces facultés sublimes ne se développent qu’au contact de la civilisation. La civilisation n’est pas exclusive ; elle attire au lieu de repousser. C’est par elle que doit s’opérer l’alliance du genre humain. Grâce à sa toute-puissante influence, il n’y aura bientôt sur la terre ni noirs, ni blancs, ni jaunes, ni Africains, ni Européens, ni Asiatiques, ni Américains: il y aura des frères. Elle poursuit de ses lumières la barbarie qui se cache. Partout où celle-ci, de sa voix mourante, conseille la guerre, la civilisation prêche la paix ; et quand retentit le mot haine, elle répond amour.87
Die strenge Ausrichtung an europäischen Werten hat zur Folge, dass der Raum Afrika nur ein Erinnerungsort bleibt:88 Thiem betont in diesem Zusammenhang zu Recht, dass die eigentlichen zivilisatorischen Werte zur Begründung einer kulturellen Identität auf das europäische Wertesystem bezogen sind und der afrikanische Raum damit vom Status eines dynamischen Wirkungsfeldes auf den rein ideellen Status einer statisch gewordenen Erinnerung reduziert werde. Diese Erinnerung ist eindimensional und vermittelt keine Bewegung. Der Autor versucht mit diesem Nationenmythos, Haiti aus der Position des Anderen herauszuführen und in den Reigen der westlichen Nationen zu integrieren. Nationsbildung findet in Stella als allegorische Verräumlichung der historischen Zeit und Ereignisse statt.89 Der allegorische Charakter äußert sich vor allem auch in den abstrakten Figuren und verstärkt noch das statisch reduzierte Bild der Raumkonfigurationen.
82 83 84 85 86 87 88 89
80
Ebda., S. 64. Ebda., S. 68. Bergeaud: Stella, S. 1. Thiem: Rauminszenierungen, S. 68. Ebda., S. 69. Bergeaud: Stella, S. 324. Vgl. Thiem: Rauminszenierungen, S. 76. Dies aber nicht in der Funktion Pierre Noras. Ebda., S. 76.
II.3.2. Maynard de Queilhe: Outre-mer (1835). Oder: kreolische Lianen Wir kommen nun zu dem Repräsentanten aus der französischen Kolonialsphäre, zu Maynard de Queilhe aus Martinique. Über ihn, genauso wenig wie über die meisten anderen Autoren der französischen Antillen, sind kaum genaue biographische Daten bekannt. Sicher ist, dass er zeitweise in Paris gelebt und dort auch seinen Roman Outre-mer90 geschrieben hat, und dass er mit Victor Hugo befreundet war. Es gibt einige Andeutungen, die darauf hinweisen, dass seine Familie im Zuge der Französischen Revolution von 1789 politisches Exil auf Martinique gesucht hatte. Aufschlussreich ist das lange Vorwort von Outre-mer, das eine Art ethnographische Einführung beinhaltet. Es wird deutlich, dass die kreolische Oberschicht bestens in der Lage ist, ihre Raumzugehörigkeit zuzuordnen. Maynard de Queilhe drückt das so aus: «Les colons ne se considèrent que comme des passagers sur une terre d’exil ; ils ont toujours les ailes entrouvertes, pour regagner leur ancienne patrie.»91 Eine räumliche Unentschiedenheit lässt sich höchstens hinsichtlich des Adressatenkreises ausmachen: «Il est ensuite beaucoup de choses de ce livre qui paraîtront étranges, tantôt aux personnes du pays où je suis, tantôt aux personnes du pays où vous êtes.»92 Fremdheit auf beiden Seiten des Atlantiks? Nicht wirklich, denn angesprochen ist jeweils die französische beziehungsweise kreolische Oberschicht. Innerhalb der Fiktion von Outre-mer ist es die Klasse der freien Mulatten, deren räumliche Positionierung thematisiert wird. Der Protagonist Marius erscheint als Heimatloser, genauer gesagt, er betrachtet England, das Land seines philanthropischen Adoptivvaters, als geistige patrie: Mais, moi, abandonner ma patrie [Angleterre], non celle où j’ai reçu le jour [Martinique], jour affreux, que je maudis et que je suis prêt à rendre ; mais celle de mon âme, où j’ai grandi, où j’ai été heureux et libre, où mon intelligence s’est enrichi et développée ; pour ma damnation éternelle, je le reconnais à cette heure. Pourquoi existe-t-il une île appelée Martinique ? pourquoi suis-je ici plutôt qu’autrepart ?93
Ohne dass England ein Schauplatz im Roman ist, durchzieht das Spannungsdreieck England–Frankreich–Martinique den gesamten Roman, wobei Marius ganz im Sinne des klassischen Bildungsromanhelden einen Läuterungsprozess durchläuft: vom philosophisch und revolutionär inspirierten jugendlichen Helden des nachrevolutionären Paris zum abgeklärten Befürworter des aristokratischen, vorrevolutionären Systems von Sklaverei und Plantagenwirtschaft. Der Roman hat drei geographische Schauplätze: Martinique als Kolonie, Frankreich als mère-patrie und das Schiff, mit klarer Fahrtrichtung ins französische Mutterland. Die Zielgerichtetheit des Schiffes, die lineare Reiseroute
90 91 92 93
Für eine kurze Zusammenfassung des Inhalts vgl. Kap. II.2.2. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. 13. Ebda., S. 12. Ebda., S. 43.
81
unterstreichen allerdings nur eine Bipolarität zwischen Mutterland und Kolonie. Entscheidend ist, dass diese räumliche Bipolarität ihre Entsprechung auch im Textraum findet: Erstens auf der Ebene der Protagonistenkonstellationen – gute Kreolen, böse Schwarze, und der vermeintlich edle Mulatte entpuppt sich letztlich als revoltierender Satan. Und zweitens auf der Ebene der literarischen Vorbilder, denn die Orientierung des Autors an Bernardin de Saint-Pierre, Victor Hugo und George Sand ist omnipräsent, und zwar ganz im Sinne René Girards mimetischer Theorie, oder mit dem Vokabular postkolonialer Theoriebildung: als Mimikry94. Nicht von ungefähr wurde das mimetische Verfahren eines Maynard de Queilhe verglichen mit der in den Tropen beheimateten Kletterpflanze der Liane.95 Lianen schießen in die Höhe, ohne sich zu verzweigen, die kolonialen Ableger ranken sich um die Mutterpflanze. Die bipolare Raumstruktur in Outre-mer wird außerdem unterstrichen durch die Inselfunktion Martiniques.96 Auch dies geschieht in Orientierung an einer Modeströmung zeitgenössischer Inselmotive: Ebenso wie die Île de Bourbon (eigentlich La Réunion) in Indiana von George Sand oder die Île de France (also Mauritius) bei Paul et Virginie von Bernardin de Saint-Pierre ist Martinique von einer Inselsemantik der Isolation und des Exils gekennzeichnet.97 II.3.3. Eugenio María de Hostos: La peregrinación de Bayoán (1863). Oder: ein Pilger in den Mangroven […] ir a Cuba, al Darién, del Darién al Perú; del Perú al Méjico; de Méjico a La Habana […] y en Nuevitas quedarme para ir a Cat Island (San Salvador de Colón, indiana Guanahaní) y al volver, visitar a los amigos […], que en tanto empeño tiene en que me prepare, para mi peregrinación a Europa […].98
Dieses Zitat aus dem Munde des heimatlosen Protagonisten in La peregrinación de Bayoán hat programmatischen Charakter. Bezeichnenderweise wurde der Roman von den spanischen Behörden kurz nach seinem Erscheinen konfisziert.99
94
95 96 97
98
99
82
Die mangelnde Originalität der Literatur der französischen Antillen im 19. Jahrhundert – von Patrick Chamoiseau und Raphaël Confiant als littérature doudouiste bezeichnet – ist schon beinahe Klischee frankokaribischer Literaturwissenschaft. Diese Feststellung tut aber dem kulturgeschichtlichen Reichtum, der sich durch eine feine Analyse der Kopierverfahren vermittelt, keinen Abbruch. Chris Bongie: Islands and Exiles. The Creole Identities of Post/Colonial Literature. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press 1998, S. 319. Zur Inselfunktion vgl. auch III.6. Ottmar Ette: Von Inseln, Grenzen und Vektoren. Versuch über die fraktale Inselwelt der Karibik. In: Marianne Braig, Ottmar Ette u.a. (Hg.): Grenzen der Macht – Macht der Grenzen. Lateinamerika im globalen Kontext. Frankfurt am Main: Vervuert 2005, S. 135–180, hier S. 143. Eugenio María de Hostos: La peregrinación de Bayoán. Obras completas. Bd. I: Literatura. Hg. von Julio César López. [Rio Piedras]: Editorial de la Universidad de Puerto Rico (1863) 1988, Teil 1, S. 108. Thiem: Rauminszenierungen, S. 184.
Dies mag der antispanischen Intention des Textes und der Auflehnung der Antillen gegen die sie unterdrückende Nation Spanien geschuldet sein, die Hostos in seinem Roman deutlich werden lässt. Die politische Dimension wird als Utopie einer Suche nach einer gesamtkaribischen Identität verstanden.100 ¡Partir! ¿Para encontrar los medios de hacer feliz a mi infeliz Boriquen, para dar el ejemplo, y preparar el advenimiento de una patria que hoy no tengo? […] ¡Partir…! ¿adónde? ¿A viajar por la América continental, a pensar en su porvenir y a provocarlo? ¿A Europa, a convencerla de que América es el lugar predestinado de una civilización futura? […] Partiré.101
In offenkundiger Anlehnung an die Reisebücher des Christoph Kolumbus beginnt der in Tagebuchform geschriebene Roman seine Aufzeichnungen mit dem 12. Oktober, dem Tag der Entdeckung Amerikas.102 Der junge Puertoricaner Bayoán, dessen Name «del primer indígena de Boriquen que dudó de la inmortalidad de los españoles» entlehnt ist – so die Erklärung Hostos’ im Namensschlüssel des Romans –, verlässt seine Herkunftsinsel per Schiff mit dem zunächst noch vage formulierten Ziel, die karibischen Inseln und das lateinamerikanische Festland zu besuchen.103 Einige Aufzeichnungen schreibt Bayoán an Bord. Das Schiff stellt hier – anders als bei Outre-mer – eine Art Schwellenraum dar. Es kann gleichsam als Vehikel betrachtet werden, das die Grenzen der Zeitebenen passiert, den Protagonisten von einer Ebene in die andere befördert und so ein Pendeln zwischen Zeitebenen und Räumen ermöglicht: «El viento empujaba a la fragata, y la fragata andaba como ando yo, empujado por un viento que aún no sé si lleva a puerto.»104 Hin- und hergerissen zwischen den Antillen und Spanien, dem er seine Stärke beweisen will, zeigt sich der innere Kampf Bayoáns um die zukünftige Richtung, die sein Leben nehmen soll.105 Die stets gegenwärtige Auseinandersetzung im Sinne eines Initiationsprozesses führt zur Bewusstseinsbildung des Protagonisten, die ihn, den Heimatlosen, erst am Ende deutlich erkennen lässt, wohin seine Reise
100 101 102
103 104 105
Ebda., S. 184. Hostos: La peregrinación de Bayoán, S. 149. Die Tatsache, dass die Reise Bayoáns nicht von einem Ursprungspunkt aus beginnt, sondern als Basis das Entdeckungsdokument des Kolumbus hat, kommt nicht von ungefähr. Die Figur des Kolumbus erfährt in Hostos’ Inszenierung einen dauerhaften Schwebezustand: auf der einen Seite betont er die Wichtigkeit von Kolumbus – dies gerade angesichts seines Anliegens, eine zivilisatorische Mission zu erfüllen, Amerika für die Europäer zu öffnen und den Kontinent aus dem Dunkel beziehungsweise aus der Unzivilisiertheit zu retten. Auf der anderen Seite problematisiert Hostos durchaus die negative Seite der Ankunft der Europäer. Richard Rosa betont, dass Bayoán weder Partei für noch gegen die Figur des Kolumbus ergreifen kann.Vgl. Richard Rosa: Los fantasmas de la razón. Una lectura material de Hostos. San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, Rep. Dom.: Ed. Isla Negra 2003. Thiem: Rauminszenierungen, S. 186. Hostos: La peregrinación de Bayoán, S. 192. Thiem: Rauminszenierungen, S. 199.
83
führen wird: «América es mi patria.»106 Die Pilgerfahrt des Bayoán strukturiert den literarischen Raum: «Yo soy un hombre errante en un desierto, y mi único oasis eres tú [se está dirigiendo a su patria]. Yo soy un peregrino… ¿Necesito peregrinar? Pues, ¡adelante!»107. Seine Reise erscheint als vieldimensionale Suche, als Ausdruck von Offenheit, aber auch von Fremdheit; das Motiv des Pilgerns beinhaltet Zielgerichtetheit, aber auch die Vorstellung vom Weg als Ziel. So ergibt sich eine Kreisstruktur, die vielfach gebrochen ist. Für eine Übernahme der Pilgerfahrt als raumstrukturierendes literarisches Element bleibt ihr offener Status konstitutiv: Konstruktion, Institutionalisierung und Funktionalisierung des Systems Pilgerfahrt unterliegen evolutionären Dynamiken, die unterschiedlich lose und strikt an die Entwicklungen des übergeordneten Funktionssystems der Religion gekoppelt sind.108 In der Übertragung des mittelalterlichen Pilgermotivs überwiegt sicherlich der Opfergedanke, der sich bei Bayoán auf einer politischen Ebene widerspiegelt. Auch wenn nicht behauptet werden kann, Hostos habe die Werke Hegels oder Nietzsches gelesen, entstand der Roman doch im religionskritischen Klima der neuzeitlichen Opferkritik, in der die Satisfaktionslehre Anselm von Canterburys, die die christliche Opferlehre begründet hatte, eine politische Dimension gewann.109 In diesem Sinne ist auch Bayoáns Pilgerfahrt zu interpretieren, denn er muss für die Freiheit der spanischen Kolonien ein Opfer bringen und den mühsamen Weg durch den karibischen Archipel, Lateinamerika und Europa auf sich nehmen. Und es ist nicht umsonst die Kreisstruktur, die mit dem Pilgermotiv ins Zentrum rückt, bezieht sich doch Hostos ganz zentral auf Kolumbus’ Bordbuch. Gerade die Rückkehr zum Ausgangspunkt Europa (und die dortige Ehrung durch die Katholischen Könige) gab Kolumbus Sinn und Legitimation für seine Entdeckungsreise mit erstem Halt auf den Antillen. Als literarisches Motiv ist die Pilgerschaft im 19. Jahrhundert grundsätzlich sehr präsent: Der damalige Bestseller war Child Harold’s Pilgrimage. A Romaunt des, wie bereits im Zusammenhang mit Bergeaud und Heredia erwähnten, stark rezipierten Lord Byron, mit dessen Veröffentlichung (1812, 1816, 1818) Byron über Nacht Berühmtheit erlangte. Ihn lesen Protagonisten solch kanonischer Romane wie María von Jorge Isaacs oder Amalia von José Mármol. Wie ist diese Modeströmung zu erklären? Ist es das per se romantische Symbol einer entfesselten Freiheitssehnsucht? Das erhabene Bild der unbegrenzten, zeitlosen, dem Menschen nicht unterworfenen See? Im Sinne einer (post)kolonialen Rezeptionsinterpretation bietet sich folgende Lesart an: Byron begründet Irlands «orientalen Status» erstens mit der Unterjochung durch England und zweitens, indem er
106 107 108 109
84
Hostos: La peregrinación de Bayoán, S. 355; vgl. Thiem: Rauminszenierungen, S. 199. Hostos: La peregrinación de Bayoán, S. 18. Friederike Hassauer: Santiago. Schrift, Körper, Raum, Reise. Eine medienhistorische Rekonstruktion. München: Fink 1993, S. 19. Nach dem Motto des Psalms 40,7: «Die Umkehr bringt Opfer, nicht um Gottes willen, der ihrer nicht bedarf, sondern um des Lebens, um der Gottesherrschaft willen, in die man anders nicht eingehen kann.»
Irland die Attribute «[w]ildness, tenderness and originality» zuschreibt.110 Diese Kombination mag gerade bei lateinamerikanischen und karibischen Autoren eine intensive Byron-Rezeption gefördert haben – Hostos selbst bekennt sich deutlich zu einer tiefen Bewunderung. Letztlich ging es ihm weniger um die ausschließlich Puerto Rico betreffende Freiheit als vielmehr darum, ein gesamtes spanisch-amerikanisches Projekt zu zeichnen, das den Ansatz einer antillanischen Konföderation birgt. Wenn auch die klare politische Dimension, vermittelt ganz besonders durch die Opferoption, in einem früheren Jahrhundert zu Hause ist, ist das Pilgermotiv durchaus als Vorform des Nomadentums à la Vilém Flusser oder des rhizomatischen Migranten à la Deleuze/Guattari zu lesen. Am überzeugendsten ist sicher Hostos’ Vorwegnahme der Gedanken Édouard Glissants, konkret dessen Konzepts der Antillanité, dem keine eindimensional nationalistische Perspektive zugrunde liegt, sondern die Mangrovenstruktur. II.3.4 Fazit Alle drei Texte suggerieren eine Lesart, die von einer Gleichung von kultureller Identität und nationalem Territorium ausgeht. Insofern kann nicht davon die Rede sein, dass sich in den hier skizzierten Romanen des 19. Jahrhunderts ein eindeutiger Paradigmenwechsel zum Topographischen manifestiert. Dennoch hat die Untersuchung der Raumdynamiken in den drei Werken wichtige neue Erkenntnisse im Rahmen einer vergleichenden Postkolonialismusforschung geleistet. Es ist unbestritten, dass sich die Literatur des 19. Jahrhunderts durch physikalisch wahrnehmbare Raumvorstellungen auszeichnet. Die allgemein vertretene These, das 19. Jahrhundert sei ein Jahrhundert der Zeit, konnte sich hier aber nicht bestätigen, und zwar keineswegs deshalb, weil die Kategorie der Zeit geflissentlich übergangen worden wäre. Im Gegenteil, insofern Zeit als konstitutiver Faktor von Dynamik und Bewegung fungiert, war es geradezu die Gegenüberstellung der beiden Schiffsmetaphern, die unterschiedliche Raumdynamiken fruchtbar machen konnte. Nicht für alle drei Romane kann gleichermaßen beansprucht werden, dass – mit den Worten Sigrid Weigels – die Figur des displacement an die Stelle konventioneller Migrationskonzepte wie Exil oder Diaspora getreten ist. Dennoch liefert das raumtheoretische Instrumentarium wichtige Schlüssel zum zentralen Verständnis postkolonialer Positionierung. Guadeloupe und Martinique haben mit der départementalisation ihren Kolonialstatus bis heute nicht verloren. Die politische und kulturelle Gravitationskraft des französischen Kolonialismus war weit prägender und effektvoller als das spanische Modell. Dementsprechend funktioniert in Outre-mer das Konzept «Exil» hervorragend. Die binäre Opposition zwischen Metropole und Kolonie wird dort nicht gebrochen. Der Roman kann als Modellfall eines «Mapping of Empire» im Sinne Edward Saids gelesen werden.111
110 111
Daryl Ogden: Byron, Italy, and the Poetics of Liberal Imperialism. In: Keats Shelley Journal 49 (2000), S. 114–137, hier S. 117. Bachmann-Medick: Cultural turns, S. 293.
85
Die weit komplexere Raumstruktur von Stella deutet darauf hin, dass die Multirelationalität der jungen haitianischen Gesellschaft weitreichende räumliche Dimensionen impliziert. Stella steht für koloniale Unabhängigkeit, da der Roman zeigt, inwiefern der junge Staat Haiti die Verbindung von externer und interner Relationalität verdichtet. Allerdings zeigen sich die einzelnen Räume bei Stella sehr statisch. Dies hängt mit dem unauflöslichen Widerspruch des haitianischen Selbstverständnisses zusammen, politische Unabhängigkeit bei gleichzeitiger Affirmierung der kulturellen Abhängigkeit zu proklamieren.112 Während Haiti in jeder Hinsicht einen Sonderfall nicht nur in der Karibik, sondern in der westlichen Hemisphäre überhaupt darstellt, vermitteln die beiden anderen Romane davon abweichende Raumperspektiven, was sich direkt in den Titeln spiegelt: Outre-mer von Maynard de Queilhe als Affirmierung des kolonialen Status quo steht für den eindimensionalen kolonialen Blick, La peregrinación de Bayoán basiert auf dem Moment der Bewegung. Das Verständnis des karibischen Archipels in La peregrinación de Bayoán projiziert eine insulare Logik und betont dessen interne Relationalität.113 Die Karibik symbolisiert in diesem Roman die Konzeption eines third space im Sinne Bhabhas, der sich jenseits der «Hypnosen Europa und Afrika» anbot.114 Outre-mer als dem kolonialen, an Europa ausgerichteten und Stella als dem antikolonialen, sich an Afrika orientierenden Diskurs folgt mit La peregrinación de Bayoán ein anderer postkolonialer Diskurs, der eine neue Raumkonzeption ermöglicht. Bayoán ist ein amerikanischer Diskurs mit independistischen Traditionen und referiert auf die gesamtamerikanischen Verbindungen. Auch wenn Texte des 19. Jahrhunderts nicht die Radikalität der Bewegungsstruktur von Texten aus dem 20. und 21. Jahrhundert aufweisen, nehmen La peregrinación de Bayoán und in gewisser Weise auch Stella den Glissantschen Anspruch einer relationalen Raumkonzeption vorweg. Der spatial turn schreibt sich auf die Fahnen, weder den Raum der Physik noch den Raum der Natur, sondern den gesellschaftlich produzierten Raum im Sinne eines dynamischen Prozesses zu meinen. Es kann nicht geleugnet werden, dass Physik und Natur wichtige Kategorien im 19. Jahrhundert sind, die aus einer postkolonialen Lesart nicht wegzudenken sind. Dennoch sensibilisieren die neuen Theorien von Vernetzung, relationalité und Bewegung für Dimensionen, die auch schon vor der postmodernen Wende präsenter waren als angenommen. Die drei Romane vermitteln die Überschneidungen durch die Gleichzeitigkeit von ungleichen Räumen und Territorien, die Aufladung von Räumen mit imperialen Einschreibungen, versteckten Hierarchien, deplazierten Erfahrungen und Kontinuitätsbrüchen.
112
113 114
86
Symptomatisch dafür ist der berühmte Satz von Masillon Coicou aus dem Jahre 1892: «Oui, France, nous t’aimons beaucoup, comme plusieurs de tes propres enfants ne t’aimerons jamais.» Coicou: Poésies nationales, S. 113. Ette: ZwischenWeltenSchreiben, S. 148. Ette: Literatur in Bewegung, S. 463.
III.
Literarische Momentaufnahmen des Dazwischen
«¡Quién sabe cuantos esclavos deberán un día su libertad a los poetas!» formuliert der Kubaner Félix Tanco enthusiastisch in einem Brief an Domingo del Monte. Die folgenden Überlegungen stützen die mit Tancos Ausspruch bestens illustrierte These, dass die Literatur im Sinne Edward Saids politische Entwicklungen antizipiert und dass kulturelle Dimensionen die Tiefenwirkung des Imperialismus ausmachen, wenn nicht gar dem politischen Imperialismus vorausgehen. Angesichts dieser Voraussetzungen seien der Untersuchung zwei Leitfragen vorangestellt: 1) Die nach wie vor boomende Kolonialismusforschung neigt meines Erachtens sehr dazu, ihren Gegenstandsbereich in sprachlich-kulturelle Einheiten zu unterteilen, wohingegen die Theoriebildung ihrerseits auf Verallgemeinerungen zielt. Die Kolonialgeschichte eines Cultural and Literary Entanglement im Sinne einer kolonialen Histoire croisée (Geschichte kolonialer Verflechtungen) kommt dagegen eher zu kurz. Und gerade dafür birgt die Karibik ein enormes Potential, lassen sich hier doch – dank der unmittelbaren Nachbarschaft unterschiedlicher Kolonialkulturen – neben der hegemonialen Achse auch interkoloniale Transfers in den Blick nehmen. Dass das Modell des französischen Kolonialismus im 19. Jahrhundert weitaus erfolgreicher war als das spanische, ist bekannt. Spanien befindet sich schon lange vor dem Verlust seiner letzten Kolonien 1898 in einem kontinuierlichen Niedergang, während das französische Konzept der mission civilisatrice im 19. Jahrhundert erst zu seiner Blüte gelangt – ungeachtet des schmerzhaften Verlusts Haitis, dessen gewaltsame Emanzipation weit über die französische Kolonialsphäre hinaus als ein Alarmsignal wahrgenommen wird. Die kulturelle Gravitationskraft Frankreichs bestätigt sich längerfristig auf politischer Ebene: die französischen Antillen bleiben beim Mutterland und werden 1946 zu Départements d’outre-mer. Ausgehend von diesem groben Befund, soll gefragt werden, auf welche Weise literarische Texte der spanischen und französischen Karibik die politischen Entwicklungen antizipieren. Welchen Beitrag leisten sie im Rahmen der Untersuchung einer kolonialen Histoire croisée? Konkret: bietet die literarische Produktion der französischen und spanischen Karibik Anhaltspunkte für die Perpetuierung des französischen und den Niedergang des spanischen Modells? Im inhaltlichen Fokus steht die koloniale Positionierung der Literatur. Das bezieht sich zuvorderst auf die beiden Hauptthemen der Karibik im 19. Jahrhundert: die Frage nach Unabhängigkeit und die nach Abolition. 2) Der Blick soll sich vor allem auf bisher wenig beachtete literarische Transferprozesse innerhalb beziehungsweise in und aus der Karibik richten. Dabei geht es um eine sowohl außer- wie innerliterarische Dimension. Welche Transfers werden wie inszeniert? Oder: welche Rezeptions-, Aneignungs- und Umformungsvarianten haben welche Wege zurückgelegt? 87
Die beiden Fragenkomplexe sollen keineswegs losgelöst voneinander betrachtet werden, es geht mir gerade auch um die Verknüpfungen von Umfang, Charakter und Reichweite der Transfers einerseits und politisch-kultureller Positionierung andererseits. Transferprozesse sind vieldimensional: ob nun im Rahmen von Untersuchungen des Festes als anthropologischer Grundkonstante und Ort der Transkulturation oder im Sinne einer Geschichte der Häfen, die als Begegnungsorte per se gelesen werden. Wichtige Transfers passieren natürlich auch bei der Zirkulation von Ideen, hier besonders häufig bezogen auf die Vermittlungsvarianten der haitianischen Revolution. Weitere Beispiele wären das Umherziehen von Theatergruppen,1 weiße Einwanderungspolitiken aus Angst vor der Afrikanisierung,2 Träger subversiven Wissens, wie Piraten, als Protagonisten einer frühen Globalisierung von unten3 etc. All diesen meines Erachtens sehr wertvollen Untersuchungen ist gemein, dass sie den Blick weg von komparatistischen, statischen Modellen auf bisher unterschätzte Formen des Austauschs und neue Formen von Bewegung richten. In den folgenden Ausführungen geht es um literarische Momentaufnahmen eines Dazwischen, die bewusst nicht typologisiert sind, sondern viele Wahrnehmungsfacetten festhalten wollen. Der Untersuchungszeitraum (1789–1886) verdichtet gerade für die Karibik in besonderer Weise die Folgen der zweiten Phase beschleunigter Globalisierung4; auf literarischer Ebene sind alle vorgestellten
1 2
3
4
88
Vgl. Reinstädler: Die Theatralisierung der Karibik. Vgl. Consuelo Naranjo Orovio: Los rostros del miedo. El rumor de Haití en Cuba (siglo XIX). In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 283–304. Naranjo Orovio zeigt, welche Angstreaktionen die haitianische Revolution und ihre Umwälzungen auf der Nachbarinsel Kuba auslösten. Sie geht auf das «Gespenst der Barbarei» ein, das die spanischen Kolonialbehörden und lokalen Eliten als Angst-Mythos nährten und instrumentalisierten, um bis zum Ende des 19. Jahrhunderts die koloniale Vormachtstellung Spaniens auf Kuba und Puerto Rico zu sichern. Dabei spielen die etablierten Konzepte Zivilisation und Barbarei und deren Umkehrung im Falle Haitis eine bedeutende Rolle. Vgl. Abel: Tagungsbericht, S. 476. Vgl. Albert James Arnold: Corsaires, Aventuriers, Flibustier et Pirates. Identité Régionale à la Frontière de l’Empire Espagnol dans la Caraïbe. In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 213–227. Globalisierungsdynamiken finden im 19. Jahrhundert eine besondere Zuspitzung auf der Ebene eines Zusammenhangs zwischen Globalisierung und Zivilisierungsmission. In der frühen Neuzeit fehlte noch die Überzeugung, es gebe auf der Welt nur eine einzige maßstäbliche Zivilisation: die europäische. Diese Globalisierung zivilisatorischer Normen war etwas Neues im langen 19. Jahrhundert. Sie setzte voraus, dass ältere militärische, wirtschaftliche und kulturelle Gleichgewichte zwischen Europa und den anderen Kontinenten aus dem Lot geraten waren. Die Erfolge der Zivilisierungsmissionen im 19. Jahrhundert beruhten auf zwei weiteren Voraussetzungen: erstens der Überzeugung – nicht nur von Vertretern europäischer Machteliten, sondern auch von privaten Globalisierungsagenten der unterschiedlichsten Art –, dass die Welt ein besserer Ort würde, wenn möglichst viele Nichteuropäer die Errungenschaften der überlegenen Zivilisation übernähmen, und zweitens dem Auftreten von gesellschaftlichen Kräften an den zahlreichen Peripherien, die eben diese Auffassung teilten. Vgl. Osterhammel: Die Verwandlung der Welt, S. 1174.
Autoren dem Ideal romantischen Schreibens verpflichtet. Insofern Zeit und Raum in ihrer Kombination als Bewegungsgeschichte zusammengedacht werden und der Blick vor allem auf den Transfer und die Translation von Wissen gerichtet ist, geht es, um in den Worten Ottmar Ettes über Alexander von Humboldt zu sprechen, um «Denken der Globalität als Archäologie ihrer Mobilität»5. Es handelt sich in beiden Kolonialreichen um eine Zeit von Überlappungen, die – was die Frage kolonialer Abhängigkeit betrifft – mit Ausnahme der einstigen Insel Hispaniola den kolonialen Status quo aufrechterhält. Eine zentrale Scheidelinie bildet das Jahr 1848 mit der Abschaffung der Sklaverei im französischen Kolonialreich. Damit gruppieren sich die Texte um ein Ereignis, das die Gesellschaften radikal veränderte beziehungsweise – im Falle der spanischen Kolonien – durch die unmittelbare Nachbarschaft die Frage der Abolition nochmals präsenter machte. Fast alle Textbeispiele sind literarische Zeugnisse einer schreibenden kreolischen Oberschicht, die zwar nicht annährend den «ganzheitlichen Zustand» einer Gesellschaft spiegelt, die aber allein entscheidend verantwortlich war für die Etablierung herrschender Diskurse, also im Sinne einer écriture blanche schreibt.6 Dies heißt trotzdem nicht, dass es sich um den Blick «imperialer Augen» handelt.7
III.1. Die kreolische Oberschicht Kreolisches Schreiben war Ausdruck eines permanenten Dazwischen, einer Zerrissenheit, die einerseits sehr zerstörerisch, starr gefangen in konservativen Denkstrukturen, aber andererseits auch hochproduktiv wirken konnte.8 Bereits die Bezeichnung «Kreole» bietet größte Definitionsschwierigkeiten. Die folgenden Beispiele stammen aus der Feder von Euro-Kreolen, das heißt von Vertretern der auf den Antillen geborenen weißen Oberschicht, die in kontinuierlichem Kontakt mit den Metropolen der jeweiligen Mutterländer steht. Häufig zeigt sich die Schwierigkeit einer klaren Verortung im besonders bemühten Ringen um eine Selbstvergewisserung, an die Eliten des Zentrums anschlussfähig zu sein. So wird in Les amours de Zémédare et Carina von Prévost de Sansac de Traversay9 das seinerzeit blühende Theaterleben in Saint-Pierre, der damaligen Hauptstadt Martiniques, wie folgt beschrieben:
5 6 7 8
9
Ette: Alexander von Humboldt, S. 92. Vgl. hierzu Bremer: Haiti als Paradigma, S. 336. Vgl. Mary Louise Pratt: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London: Routledge 1992. Eine Geschichte der Kreolen ließ sich noch nie, auch nicht vor dem 19. Jahrhundert oder in anderen Weltteilen als der Karibik, aus einer einzigen zentralen Perspektive her erfassen und gewiss nicht in das europäische Muster einer die «Totale panoramatisch ausleuchtenden Zentralperspektive» überführen. Vgl. Ette: ZusammenLebensWissen, S. 17. Corzani beschreibt Les amours de Zémédare et Carina als ersten Roman eines Martinikaners über Martinique. Vgl. Corzani: La littérature des Antilles, Bd. II, S. 301.
89
Saint-Pierre était la seule ville de la Martinique à posséder un théâtre. Des troupes venaient, chaque année, de Paris, y donner des spectacles. Et ces spectacles étaient généralement de qualité, car le public était connaisseur, et il se montrait parfois exigeant, surtout quand il s’agissait de chant ou de musique.10
Und ähnlich äußert sich Prévost de Sansac zur Beschreibung der Bewohner der – in seinen Worten – reichsten französischen Kolonie der Zeit: La Martinique, une des îles du vent de l’archipel américain, est aujourd’hui la colonie la plus florissante et la plus précieuse de celles que la France possède. La richesse de son sol, la beauté de son climat et sa salubrité, la rendent bien digne d’être habitée par les plus généreux, les plus affables et les meilleurs des hommes. Les Martiniquais, naturellement spirituels, fidèles, aimants, en général bien faits, sont tous braves. Il est peu de pays où l’on voie, proportion gardée, un plus grand nombre de jolies femmes.11
M. Saimprale, eine der Hauptfiguren aus Les amours de Zémédare et Carina, war noch nie in Europa. Dieses «Manko» versucht der Erzähler aber sofort mit Hinweis auf seine ausgezeichnete Bildung zu entkräften: «M. Saimprale n’avait jamais été en Europe ; cependant le soin que son père avait pris de son éducation le mettait de pair avec les hommes réputés pour être de la meilleure société. Ses mœurs étaient douces, sa figure agréable […].»12 Hinter solchen Beschreibungen verbirgt sich die Idee, die kreolische Oberschicht solle durch und durch positiv dargestellt werden. Les amours de Zémédare et Carina ist ein kolonialer Pro-Sklaverei-Roman. Er entwirft das Bild eines kreolischen Sklavenbesitzers, der in erster Linie eine Beschützerfunktion erfüllt: Le maître juste est toujours bien servi par ses esclaves, estimé de ses compatriotes et protégé par le gouvernement. Le maître inhumain […] il n’en existe point parmi les hommes blancs, à la Martinique, vu avec horreur par tous, on le forcerait bientôt à sortir de l’île. Sans vouloir chercher à justifier ici l’esclavage, j’observai seulement que les premiers annales du monde parlent de son existence : on l’a vue se maintenir dans tous les siècles, et même à Sparte, le plus républicain de tous les gouvernements. La culture des terres, entre les tropiques, n’a jamais pu être confiée, avec succès, à des hommes blancs ; ils n’y peuvent résister à ce travail pénible. Les nègres, dans toutes la vaste étendue de la côte d’Afrique, n’usent de leur liberté que pour assouvir leur stupide férocité, se faire la guerre, se détruire et se dévorer entr’eux. Dans nos colonies, au contraire, voyez leur gaîté, leurs plaisirs et la modération de leur travail ; ils sont sans souci sur l’avenir ; ils connaissent l’amour, et jouissent librement du bonheur d’être pères […] Journaliers d’Europe […], et vous surtout, serfs attachés à la glèbe en Pologne et en Russie ; vous que l’on voit si souvent inquiets sur votre existence et sur celle de votre famille, dites-nous si les nègres, dans les colonies, sont les êtres les plus malheureux sur la terre.13
10 11 12 13
90
Prévost de Sansac: Les amours, S. 8. Ebda., S. 21. Ebda., S. 25. Ebda., S. 61.
Bezeichnend für die Frankreichorientierung der kreolischen Oberschicht ist die Haltung, immer mit einem Fuß im Mutterland zu bleiben: «Nous n’y transporterons point notre fortune, parce qu’il est possible que quelques-uns de nos enfants et peut-être nous-mêmes, nous soyons très aises un jour de la retrouver en France.»14 In Les créoles ou la Vie aux Antilles, dem Roman J. Levilloux’15, wird Frankreich als Kolonialmacht und Bildungsstandort durchgehend verherrlicht. Der Grund, weshalb Estève nach Frankreich geschickt wurde, wird klar ausgesprochen: «[…] son père, planteur à la Guadeloupe, avait envoyé son fils, jeune, en France, y puiser ces belles connaissances qui, a cette époque, se rencontraient rarement aux colonies.»16 Kurz vor der Rückkehr der beiden Protagonisten von Paris nach Guadeloupe beruhigt Edmond Briolan Estève und meint, es sei noch zu früh, sich über den Fortbestand ihrer Freundschaft Sorgen zu machen: «Nous sommes encore en France, profitons de l’égalité dont on a le bonheur d’y jouir. Au-delà de l’Océan notre amitié puisera dans sa gêne même les moyens de s’entretenir sans exciter le scandale des préjugés de couleur.»17 Währenddessen freut sich die Schwester Lea ganz besonders auf die Rückkehr ihres Bruders Edmond, da er ihr Neuigkeiten aus der Metropole übermitteln wird: Elle attendait avec impatience le retour de son frère Edmond qui lui apportait de séduisans récits sur les merveilles de Paris, et dont la science agrandie dans sa naïve imagination lui révélait une foule de secrets que pouvait seul connaître un jeune homme élevé en Europe.18
Der Orientierung an den Bildungsstätten in Paris wird in Les amours de Zémédare et Carina mit dem Verweis auf zwei Collèges auf Martinique zwar keine gleichberechtigte Alternative entgegengehalten, aber immerhin eine Ersatzlösung auf der Insel angeboten: Si cette pension et le collège de Saint-Victor, qui ont déjà rendu les plus grands services à cette colonie, cessaient d’y exister, ce serait une perte inappréciable pour tous les habitants de la Martinique et ceux des îles voisines, qui n’ont pas assez de fortune pour envoyer leurs enfants en France pour y être élevés, ou qui ne veulent les y envoyer qu’à un certain âge et pour y perfectionner leur première éducation. Il est j’ose le dire, de l’intérêt et du devoir du gouvernement d’apporter tous ses soins à la conservation de ces deux établissements importants.19
Bei aller Glorifizierung der Metropole erfüllen die Kolonien selbst jedoch auch die Funktion von Zukunftsmodellen oder erscheinen gar als Orte für Utopien: «Les hommes sentaient le vieux monde s’abîmer sous leur pieds et se jetaient déjà
14 15 16 17 18 19
Ebda., S. 183. Für ein kurzes Resumé vgl. Kap. II.1.3.2. Levilloux: Les créoles, S. 20. Levilloux: Les créoles, S. 32. Levilloux: Les créoles, S. 38. Prévost de Sansac: Les amours, S. 142.
91
vers cet avenir si prochain où devait se reconstruire une nouvelle société.»20 Das politische Klima der Julimonarchie wirkte begünstigend für eine bevorstehende Abolition der Sklaverei, was bei der Pflanzeroligarchie drängende Verlustängste mit sich brachte. In den 1830er-Jahren fühlte man sich an den Vorabend von 1789 erinnert. Der Verlust des Ancien Régime saß der schreibenden kreolischen Oberschicht noch in den Knochen. Auch in Les amours de Zémédare et Carina werden die vorrevolutionären Zeiten verherrlicht. Zémédare ist Waise und hat einen Vormund, der wohl kaum zufällig den Namen des Autors, M. de Sansac, trägt und auf eine ehrenvolle Genealogie zurückblicken kann: M. de Sansac, son tuteur, officier de la marine militaire, homme du plus grand mérite. […] C’est un descendant de Prévost de Sansac, si estimé et si aimé d’Henri II, et des mêmes que l’archevêque de Bordeaux, Sansac, dont on voyait le tombeau dans la cathédrale de cette ville, avant la révolution.21
Ebenso vermittelt die Lektüre von Maynard de Queilhes Roman Outre-mer eine blockierte Gesellschaft, eine kreolische Kaste, die getrieben ist von der Angst, die alten Privilegien zu verlieren. Bezeichnenderweise haben zwei Protagonisten die besondere Sympathie des Autors: Mme de Château, die die Nachricht der Trois Glorieuses22 bringt, trägt ein schwarzes Kleid, das sie nie mehr auszieht. Der zweite besonders positiv gezeichnete Protagonist ist der Marquis de Longuefort, der sagt: «C’est un affreux peuple que ce peuple de France.»23 In einen Diskurs der Zerrissenheit scheinen sich die Äußerungen des Mulatten Marius einzuschreiben. Nach seinem Studium in Frankreich verflucht er Martinique, die Insel seiner Herkunft: Une misérable petite île ! moins qu’une île, une espèce d’îlet ; des fièvres, des serpents et des êtres qui se donnent des coups de fouet, parce qu’ils ne sont pas tous également jaunes, ou parce que les uns le sont trop et les autre pas assez ; ou parce qu’il y en a qui ne le sont pas du tout. Misère ! misères !24
Allerdings werden die Frankreich-Fixiertheit und die Ablehnung der kolonialen Heimat bei den Mulatten-Protagonisten der beiden Romane Outre-mer und Les créoles von den Erzählern völlig unterschiedlich bewertet. Marius reproduziert die im Mutterland aufgeschnappten Gleichheitsparolen und echauffiert sich über den Rassenwahn in seinem Herkunftsland, nur um nach seiner Rückkehr nach und nach festzustellen, wie unrealistisch die egalitären Ideen der Französischen Revolution sind und wie sehr sie vorbeigehen an der kolonialen Wirklichkeit und an der tatsächlichen Ungleichheit und Ungleichwertigkeit der Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Abstammung. In einem Läuterungsprozess im
20 21 22 23 24
92
Levilloux: Les créoles, S. 21. Prévost de Sansac: Les amours, S. 32 f. 26.–28. Juli 1830. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 178, 183. Ebda., Bd. I, S. 42.
Sinne des klassischen Bildungsromans erfährt er mühsam, dass die philanthropischen Ideen aus bestimmten Zirkeln in Paris und London das wohletablierte Plantagensystem zu Unrecht diskreditieren. Dagegen ist das Schicksal von Levilloux’ Mulatten-Protagonisten Estève tragisch, nicht nur weil er die Liebe zur Schwester seines weißen Freundes aufgrund der gesellschaftlichen Barrieren nicht ausleben kann, sondern weil er sich in seinem (vergeblichen) Bemühen um Anerkennung in der weißen kreolischen Gesellschaft auch dem Kampf mit den aufständischen schwarzen Sklaven verschreibt. Um weißer zu sein als die Weißen, lässt er sich einspannen in die aktive Ausgrenzung derer, die rassisch noch unter ihm stehen, anstatt die Solidarität mit ihnen zu suchen: er beteiligt sich an der Unterdrückung eines der zahlreichen Aufstände der schwarzen Sklaven. Während Estèves Liebeshymnus an das Mutterland von Dauer ist und auch gegen die widrige und anti-egalitäre koloniale Wirklichkeit Bestand haben kann, erweisen sich die «Errungenschaften» des Mutterlandes für Marius als bloße Luftblasen. Hier hinkt nicht die Kolonie vergeblich dem Mutterland hinterher, sondern die Ideen des Mutterlandes «hinter» der Wirklichkeit und den spezifischen Erfahrungen im Zusammenleben unterschiedlicher Rassen in der Kolonie. Die letztlich törichten Luftschlösser der Revolution gefährden massiv den als paradiesisch dargestellten Status quo. Bei der kreolischen Oberschicht handelt es sich um eine Bevölkerungsgruppe, die sich genuin in einem Zwischenraum befindet, auch wenn sich diese Zerrissenheit höchst unterschiedlich artikuliert.
III.2. Begriffliche Unzulänglichkeit von patrie/Nation/Exil Den literarischen Texten der französischen und spanischen Karibik ist gemein, dass Zuschreibungen von Nation, patrie und Exil nicht immer eindeutig funktionieren können. Die schreibende kreolische Oberschicht war in einer Dauersituation des Dazwischen. In seinem paratextuell wertvollen Vorwort zu Outre-mer beschreibt Maynard de Queilhe das Selbstverständnis der Kreolen als Exilfranzosen, allzeit bereit, wieder in die «ancienne patrie» zurückzukehren:25 Die Kolonien als Durchgangsstation. Der Roman selbst trägt eine eindeutige Handschrift, er ist unterschrieben von einem «Franzosen aus Amerika». Maynard de Queilhe lebt selbst eine Exilerfahrung auf den Antillen, die von Sehnsucht nach dem Mutterland gekennzeichnet ist. Auf einer innerliterarischen Ebene ist für unsere Fragestellung aufschlussreich, dass Maynard de Queilhe in seinen Protagonisten, den Mulatten Marius, eine spezielle Art von Exilerfahrung transferiert, die symptomatisch ist für die neuen Konkurrenten der Béké: die Klasse der freien Farbigen, die erst 1830 sozial aufgestiegen sind und fast mit den Weißen vergleichbare Rechte haben. Diese neue Klasse ist heimatlos, das heißt, sie kann gerade dank der Heimatlosigkeit eine neue geistige Heimat frei wählen. Sie hat sich nicht Frankreich, sondern England
25
Ebda., S. 13.
93
als patrie erkoren. Kein Wunder, zumal im britischen Kolonialreich die Sklaverei längst abgeschafft war und auch die Mulatten bereits andere Rechte hatten.26 Bei Levilloux gilt Frankreich immer als eindeutiger Referenzpunkt, so beispielsweise, wenn der Rektor Briolan als neuen Schüler vorstellt. Die Kolonie ist «le pays»: «,Mes enfants, dit le recteur, je vous présente un nouveau camarade. Son pays est éloigné, et bientôt seul en France, il aura besoin de votre amitié.‘»27 Die Rückkehr auf die Insel Guadeloupe bedeutet jedoch die Rückkehr in die patrie: «Nous retournons dans notre patrie, mais nous connaissons du moins les obstacles que notre affection aura à surmonter.»28 Andererseits sind Briolan und Estève in dem Moment, als sie das französische Festland verlassen, «exilés». Mehr noch: sie wirken wie Reisende, die sich in die Wüste aufmachen: Ainsi nos jeunes exilés emportaient dans leur cœur toute une France d’émotions, de souvenirs et de consolantes pensées pour les heures d’amertume. En cela, semblables aux voyageurs partant pour le désert, et qui mettent leurs espérances de salut dans l’abondance de provisions. Mais les feux du soleil dessècheront leurs outres, les insectes impurs corrompront leurs fruits et leurs viandes ; et les malheureux, au lieu d’y puiser la vie trouveront que dégoût et surcroît de regres.29
Während zum einen die Abwesenheit aus Paris als Exil bezeichnet wird, erscheint zum anderen auch die Karibik als Sehnsuchtsort, und der Gedanke eines Exils ist immer präsent, wenn von der Heimatinsel Edmonds und Estèves die Rede ist: La Martinique dessine ses fertiles rivages devant mes yeux… mais au milieu de mes émotions une amère pensée traverse mon âme, et je détourne les regards pour les porter sur cette terre de l’exil […].30 Fatigué de la terre de l’exil, ne sachant où reposer sa tête qui ne dormait plus […]. Je ne peux mourir dans l’exil […].31
Interessant ist auch die Verwendung des Begriffes «Nation». So wird in Les créoles ou la Vie aux Antilles bezüglich der Schwarzen-Bevölkerungsgruppen von Nationen gesprochen: «A peine avait-il prononcé les premiers mots que des Bambaras, nation ennemie de la sienne […].»32 Eine analoge Bedeutung hat der Begriff auch in Les amours de Zémédare et Carina: Die unterschiedliche Physiognomie der Schwarzen wird auf die Herkunft von unterschiedlichen afrikanischen Ethnien zurückgeführt, die der Erzähler als Nationen bezeichnet: L’Européen sait à peine distinguer un nègre d’un autre, tous lui paraissent également noirs ; il ne voit que des nez plats, de grosses lèvres et des cheveux crépus. Mais le créole, habitué à vivre avec eux, distingue non seulement les individus entr’eux, il vous dira même, à la première vue, à quelle nation il appartient. Les Mocos ont les dents
26 27 28 29 30 31 32
94
Ebda., S. 43. Levilloux: Les créoles, S. 20. Ebda., S. 21. Ebda., S. 32. Ebda., S. 201. Ebda., S. 208. Ebda., S. 116.
séparées en feston. […] Le nègre Calvaire se distingue parmi tous les autres par la noirceur parfaite de sa peau, ainsi que par la beauté de ses formes ; c’est parmi ceux de cette nation, que le sculpteur et le peintre doivent choisir leurs modèles. Les dimanches, et les jours de fête, la gaîté la plus vraie régnait dans tout l’atelier : les nègres et les négresses des habitations voisines venaient, par leur présence, ajouter aux plaisirs. Ils se divisaient par nations, et formaient autant de groupes différents, et chacun avait sa danse particulière.33
Ein Blick auf ein repräsentatives Beispiel aus der spanischen Karibik hingegen zeigt, dass dort Fragen des Exils anders verhandelt werden. So spielen sie im Roman Sab keine explizite Rolle. Sie werden jedoch in einem weiteren Sinne auf den Sklaven selbst übertragen: No tengo tampoco una patria que defender, porque los esclavos no tienen patria; no tengo deberes que cumplir, porque los deberes del esclavo son los deberes de la bestia de carga que anda mientras puede y se echa cuando ya no puede más. Si al menos los hombres blancos, que desechan de sus sociedades al que nació teñida la tez de un color diferente, le dejasen tranquilo en sus bosques, allá tendrán patria y amores.34
Aufschlussreich für die Frage nach Artikulationsmöglichkeiten aus dem Exil ist bei Gómez de Avellaneda auch, dass sie ihre Autorschaft in gewisser Weise zurücknimmt, wenn sie den Schreibprozess selbst in den Roman integriert und ihrem männlichen Protagonisten zuschreibt. Die gesamte Erzählung erweist sich gegen Ende des Romans als Abschiedsbrief des Sklaven und Titelhelden Sab. Dadurch geschieht zweierlei: Einerseits wird dem ethnisch und sozial mehr oder weniger ausgegrenzten Romanhelden eine autoritative (auktoriale) Stimme verliehen, die ihn vom kolonialen Objekt nicht nur zum Subjekt der eigenen Geschichte, sondern auch zum Subjekt eines eigenen Diskurses erhebt, andererseits wird das erzählende Wort aus der Ferne (Madrid) in den Schauplatz des Romans verfrachtet, so dass sich die gefühlte Illegitimität einer Stellungnahme von außen (das heißt aus dem Land der Kolonisatoren) relativiert. Bleiben wir bei dieser Autorin und wenden wir den Blick auf eine außernarrative Dimension: 1859 kehrt sie nach 23 Jahren Aufenthalt in Spanien erstmals nach Kuba «zurück» und wird von den kubanischen Intellektuellen in zwiespältiger Weise empfangen. In den literarischen Kreisen löst die Frage ihrer nationalen Zugehörigkeit eine heftige Debatte aus, die mit «La cuestión Avellaneda» betitelt wurde. So ist einem Zeitungsartikel aus der Aurora del Yumurí vom 27. August 1867 zu entnehmen: El Areópago literario reunido en la Habana para escojer las composiciones dignas de figurar en el libro, «La Lira Cubana», ha determinado escluir a la poetisa Sra. Da Gertrudis Gómez de Avellaneda, por no considerarla cubana sino madrileña. En cambio, parece que los Sres. D. Saturnino Martínez y D. Antonio Enrique de Zafra serán mirados en lo adelante como escritores cubanos.35
33 34 35
Prévost de Sansac: Les amours, S. 62. Gómez de Avellaneda: Sab, hg. von Servera, S. 36. Aurora de Yumurí, 27. August 1867, zit. nach Gertrudis Gómez de Avellaneda: Cartas
95
Wenige Monate später erscheint in der gleichen Zeitung eine völlig andere Meinung: Junta – La Sección de Literatura de nuestro Liceo celebró anoche, á petición de uno de sus miembros, para ocuparse de la cuestión Avellaneda. No pudimos asistir á esa reunión, pero nos informan que en ella quedó acordado que la Sección literaria considera á Da Gertrudis Gómez de Avellaneda como una de las glorias literarias de que puede Cuba enorgullecerse, y se convino igualmente estender una acta certificada de esa resolución para los fines oportunos.36
Die Zugehörigkeit der Autorin zu Kuba oder Spanien wird willkürlich je nach Situation strategisch entschieden. Für die Texte der französischen wie spanischen Kolonialsphäre gilt: die Zuschreibungen Nation, Exil und Patria funktionieren nicht nach klaren Kriterien, sondern passen sich an die jeweiligen Situationen an. Damit zeichnet sich eine Brüchigkeit des Nationsbegriffs ab, die gerade zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet werden konnte. III.2.1. «Una cubana escritora no es siempre una escritora cubana»: die Condesa de Merlín «Una cubana escritora no es siempre una escritora cubana».37 Diese einführenden Worte Roberto Ignacio Díaz’ zur Condesa de Merlín, die im übrigen auch für die bereits vorgestellte Gómez de Avellaneda gelten, verweisen auf die zentrale Problematik, der jede Beschäftigung mit der 1789 auf Kuba geborenen und 1852 in Paris verstorbenen Schriftstellerin und Musikerin sich stellen muss. Bereits die Entscheidung für eine Aussprachevariante ihres Namens bereitet Schwierigkeiten: María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo ist besser bekannt als Condesa de Merlín oder aber Comtesse Merlin.38 Sie schreibt auf Französisch, zudem ist
36
37 38
96
inéditas y documentos. 1859 a 1864. Colección ilustrada por José Augusto Escoto. Matanzas: Imprenta La Pluma de Oro 1912, S. 62. Aurora del Yumurí, 15. Januar 1868, zit. nach ebda., S. 62f. Zu einem Briefwechsel von 1859 bemerkt der spanische Literaturkritiker Bravo Villasante: «Su situación en Cuba es grata e ingrata a la vez, al homenaje se une el reproche, y su doble aspecto de cubana y española es equívoco. Su llegada como consorte de un representante del Gobierno Central puede resultar molesto a los ojos de los revolucionarios, que intentan la independencia de Cuba, aunque sea prematura. Ella, inteligente, se da cuenta de todo, y se debate en las alternativas que se le presentan. Políticamente ama al pueblo, y al mismo tiempo reverencia a su majestad; se siente hija de Cuba y de España a la vez y cuando intentan de dejarla fuera de una antología de poetas cubanos se siente ofendida, aunque no renuncia tampoco a su gloria de pertenecer a la literatura española.» Zit. nach José Servera: Introducción. In: Gómez de Avellaneda: Sab, hg. von Servera, S. 9–93, hier S. 38. Roberto Ignacio Díaz: Merlin’s Foreign House. The Genres of La Havane. In: Cuban Studies 24 (1994), S. 57–82, hier S. 58. Ebda., S. 58. Zur Condesa de Merlín vgl. auch Johanna Abel: Viajes corporales al Caribe. Autoras del siglo XIX y sus saberes corporizados sobre las culturas. In: Gómez, Müller (Hg.): Relaciones caribeñas, S. 61–68.
sie eine Frau. Dies mag ihr Fehlen im offiziellen Literaturkanon der kubanischen Literatur des 19. Jahrhunderts erklären. Kurz nach ihrer Geburt emigrierte die Familie nach Madrid, sie verbrachte jedoch die ersten zwölf Jahre ihres Lebens bei ihrer Großmutter auf Kuba. Im Jahre 180239, während der französischen Besetzung Madrids, verheiratete ihre vorausschauende Mutter die Tochter mit dem Grafen Antoine Christophe Merlin (1771–1839), einem General der Armee Bonapartes.40 Als Franzosen waren die Merlins dann 1812 gezwungen, nach der Niederlage Bonapartes Spanien zu verlassen. Während der Zeit von 1813 bis 1839 wurde die Kreolin Santa Cruz y Montalvo zu einer der führenden Bellesdames des kulturellen Pariser Establishments. Ihr Salon in der Rue de Bondy Nr. 40 zog wichtige Musiker und Literaten der Zeit an. Nach 38 Jahren in Frankreich und genau ein Jahr nach dem Tod ihres Ehemannes kehrte sie 1840 für sieben Wochen nach Kuba zurück. Als Resultat dieser Reise erschien 1844 La Havane, ein Reisebericht (in drei Bänden auf 1000 Seiten), der sich romantischen Idealen verschreibt.41 Die Grenzen der Gattung werden jedoch ständig überschritten. Der Text besteht aus 36 Briefen, die zum größten Teil an die Tochter der Autorin, Madame Gentien de Dissay, adressiert sind, daneben aber auch an eine Reihe wichtiger europäischer Persönlichkeiten: René de Chateaubriand, Prinz Friedrich von Preußen, George Sand und den Baron Rothschild. Die ersten Stationen nach der Atlantiküberquerung sind New York und andere Städte der US-amerikanischen Ostküste. Bezeichnend für die Ausführungen der Condesa de Merlín zu den Vereinigten Staaten ist ihre klare Selbstdarstellung als Fremde: die Nicht-Involviertheit in die Welt, die sie beschreibt, ist deutlich. Von dem Moment an, in dem sie in New York von Bord geht, beschreibt sie sich als «étrangère à tous ce qui m’entoure»42. Ihre scheinbar neutrale Außenperspektive wird unterstrichen durch Äußerungen wie «Il faut voir cette nation pour se faire une idée de ses mœurs»43. Diese Haltung ändert sich mit der Ankunft auf Kuba schlagartig: Nun möchte sie sich dem Leser als Kubanerin präsentieren, die ihr eigenes, vertrautes Land beschreibt. In ihrem Vorwort an den Capitán General schreibt sie: «Permettez, general, que je place sous votre protectrice cette œuvre conçue par le sentiment patriotique d’une femme, le désir ardent de voir mon pays heureux, l’a seul inspirée»44. Gewidmet ist das Buch: «À mes compatriots»45. Dieses fast pene-
39
40 41 42 43 44 45
Adriana Méndez Rodenas: A Journey to the (Literary) Source. The Invention of Origins in Merlin’s Viaje a La Habana. In: New Literary History 21, 3 (1990), S. 707–731, hier S. 708. Ebda., S. 708. Vgl. Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 57. Maria de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlín: La Havane. 3 Bände. Paris: Amyot 1844, Bd. I, S. 65. Ebda., S. 118. Ebda., S. 5. Ebda., S. 7.
97
trante Ringen um eine Anerkennung als Kubanerin durchzieht den Text wie ein roter Faden. Woran lässt sich dies festmachen? In den Beschreibungen der Insel ist die Orientierung der Autorin an den «Crónicas de las Indias» nicht nur unterschwellig omnipräsent. Sie erwähnt die Chronisten und in erster Linie Kolumbus recht häufig als direkte Quelle.46 Bereits am Anfang paraphrasiert sie das Diario de a bordo des Entdeckers, der – wie sie selbst – bei seiner Ankunft auf Kuba glaubte, nun das schönste Land der Welt angetroffen zu haben. An mehreren Stellen greift sie seine loci amoeni auf. Diese Orientierung zeigt sich auch in ihrer Stilisierung der auf Kuba faktisch gar nicht mehr existierenden indigenen Bevölkerung, die eine sehr exaltierte Darstellung erfährt:47 À quelque distance, et plus prêt de la côte, je découvre le village de Puerto Escondido ; à ces chaumières de forme conique, couvertes jusqu’à terre de branches de palmiers ; aux buissons touffus de bananiers qui, de leurs larges feuilles, protègent les maisons contre les ardeurs du soleil ; à ces pirogues amarrées sur le rivage, et à la quiétude silencieuse de l’heure de midi, vous diriez que ces plages sont encore habitées par des Indiens.48
Überhaupt sind Entdeckung und Eroberung zentrale Themen der Condesa de Merlín. In ihren Naturbeschreibungen zeigt sich eine Lesart der Karibik als prädestinierter Ort der symptomatischen Trias «Finden–Erfinden–Erleben» in besonders eindrücklicher Weise.49 Lorsque j’aperçois ces palmiers séculaires, qui courbent leur orgueilleux feuillage jusqu’au bord de la mer, je crois voir les ombres de ces grands guerriers, de ces hommes de résolution et de volonté, compagnons de Colomb et de Vélazquez ; je les vis, fiers de leurs plus belles découvertes, s’incliner dans leurs reconnaissance devant l’Océan, pour le remercier d’un si magnifique présent.50
46
47 48 49 50
98
Zu ihrer kontinuierlichen Orientierung an Quellen – in einem Fall sogar als Plagiat entlarvt – schreibt Silvia Molloy: «Rediscovery came from her less from what she saw on that trip than from what she read, remembered and imagined.» Sylvia Molloy: At Face Value. Autobiographical Writing in Spanish America. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1991, S. 93. Vgl. auch Raúl Ianes: La esfericidad del papel. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la condesa de Merlín y la literatura de viajes. In: Revista Iberoamericana LXIII, 178–179 (Januar bis Juni 1997), S. 209–218, hier S. 214. Vgl. Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 62. Condesa de Merlín: La Havane, Bd. I, S. 276. Vgl. Ette: ZusammenLebensWissen, S. 32. Condesa de Merlín: La Havane, Bd. I, S. 269; vgl. Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 64. Ein Verweis auf eine neue Lesart von La Havane auf der Grundlage dieser Trias soll nicht der Gefahr erliegen, das Konzept Ettes zu reduzieren auf Interpretationsmöglichkeiten einzelner Passagen. Im Gegenteil, der Verweis versteht sich als anschauliches Beispiel, das einen literarischen Text als solchen wertfrei aufwertet, der vor allem ironische Lesarten nahelegen würde. Denn die konzeptionelle Ausrichtung der Trias Finden–Erfinden– Erleben schreibt sich ein in die grundlegende Neubestimmung des Literaturbegriffs, der umfassenderen Charakter hat, als Interpretationen einzelner Textpassagen zu bereichern: In der «Öffnung auf eine terminologische Dreiecksbeziehung könnte der Schlüssel zur Lösung einer Problemstellung liegen, die darauf abzielt, aus der simplistischen Gegenüberstellung von ‚Realität‘ und ‚Fiktion‘, von ‚Faktizität‘ und ‚Fiktionalität‘ auszubrechen und eine komplexere (und zugleich dynamischere) Einsicht in ebenso historische
Genauso wie die spanischen Eroberer sieht sie Kubas Größe und Schönheit als Naturgeschenk für die gerade angekommenen Europäer an. Natur ist für die Autorin ein literarisches Königreich, eine Quelle für exotistische Darstellungen. Was die kubanischen Städte betrifft, so betrachtet sie sie als Orte, deren Geschichtslosigkeit eben durch beeindruckende Naturwunder auf der Insel kompensiert wird: Nos édifices n’ont pas d’histoire ni de tradition: le Havanais est tout au présent et à l’avenir. Son imagination n’est frappé, son âme n’est émue, que par la vue de la nature qui l’environne ; ses châteaux sont les nuages gigantesques traversés par le soleil couchant ; ses arcs de triomphe, la voûte du ciel ; au lieu d’obélisques, il a ses palmiers ; pour girouettes seigneuriales, le plumage éclatant du guacamayo ; et en place d’un tableau de Murillo ou de Raphaël, il a les yeux noirs d’une jeune fille, éclairés par un rayon de la lune à travers la grille de sa fenêtre.51
Problematisch ist der Umgang der Condesa de Merlín mit Possessivpronomina, die oft nur schwer zugeordnet werden können. Wer sind beispielsweise «unsere Dichter»? Sind es Franzosen, Spanier oder Kubaner? Dies geht aus dem Text nicht klar hervor, denn «nos» und «notre» bezieht sich immer wieder auf beides: «nos plus riches hôtels de Paris»52, «notre monde européen»53, «nos élégants salons»54, aber auch: «nos guajiros»55. Wenn die hartnäckige Selbstinszenierung als Kubanerin auf den ersten Blick auffällt, so schwingt an einigen Stellen jedoch auch eine brüchige Identitätserfahrung mit.56 Wer bin ich? Jetzt und hier in den Tropen? Gräfin oder Kreolin? Santa Cruz y Montalvo oder Comtesse de Merlin?57 Diese Ambivalenz steht in engem Zusammenhang mit ihren politischen Überzeugungen: Sie sieht sich nicht als Ausländerin, sondern als Kolonisatorin, die aber in ihrer Verwurzelung mit der Insel eine besondere Legitimation zur Stellungnahme sieht. Die nationalen Projekte eines Heredia oder Villaverde lehnt sie rigoros ab. Was die politische Unabhängigkeit betrifft, ist ihre Loyalität Spanien gegenüber klar: «Quant à nous, je le répète, nous sommes profondément, exclusivement
51 52 53 54 55 56 57
wie kulturelle oder literarische Prozesse zu gewinnen, wie sie gerade auch im Bereich der Karibik […] zu einer Untersuchung der Relationalität zwischen Gefundenem, Erfundenem und Erlebtem förmlich zwingen.» Ette: ZusammenLebensWissen, S. 32. Condesa de Merlín: La Havane, Bd. II, S. 210f.; vgl. Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 65. Condesa de Merlín: La Havane, Bd. I, S. 74. Ebda., Bd. II, S. 49. Ebda., S. 54. Ebda., S. 51; vgl. Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 63. Vgl. Méndez Rodenas: A Journey to the (Literary) Source, S. 709. Diese Zerrissenheit kommt auch besonders deutlich zum Ausdruck in ihren 1836 veröffentlichten Memoiren: «Existen en mi dos ‚yo‘ que luchan constantemente, pero estimulo siempre al ‚fuerte‘, no por ser el ‚más fuerte‘ sino por que es el más desgraciado, el que nada consigue.» Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin, publiés par elle-même. Paris 1836, S. 246, zit. nach Adriana Méndez Rodenas: Voyage to La Havane. The Countess of Merlín’s Preview of National Identity. In: Cuban Studies 16 (1986), S. 71–99, hier S. 80.
99
Espagnols. […] L’intérêt de l’Espagne est le nôtre ; notre prospérité servirait la prospérité espagnole».58 Ähnlich radikal sind ihre Ansichten zu den aktuellen Debatten über die Abschaffung der Sklaverei. In ihren Augen ist die Versklavung der Schwarzen sogar ein zivilisatorischer Fortschritt für Afrika, da die vormals barbarischen Sitten im Umgang mit Gefangenen dadurch abgemildert würden: Lorsqu’une tribu faisait des prisonniers sur une tribu ennemie, si elle était anthropophage, elle mangeait ces captifs ; si elle ne l’était pas, elle les immolait à ses dieux. La naissance de la traite détermina un changement dans cette horrible coutume : les captifs furent vendus.59
Unter Berücksichtigung dieser radikal konservativen Haltung in einem Klima, das von solch politisch liberalen Debatten wie dem del Monte-Kreis bestimmt war, nimmt es nicht wunder, dass die Condesa de Merlín viel zeitgenössische Kritik erfahren hat. Diese richtete sich allerdings nicht nur gegen ihre extrem konservativen Positionen. Bezeichnenderweise gründet die Hauptkritik auf ihrem Anspruch, als Kubanerin zu sprechen, wozu es ihr nach Meinung der einheimischen Schriftstellerkollegen jeder Grundlage entbehrte. Félix Tanco verfasste mehrere Artikel im Diario de la Habana, in denen er das Schreiben über Kuba aus europäischer Perspektive aufs Korn nahm. «La señora de Merlín, por decirlo una vez, ha visto la isla de Cuba con ojos parisienses y no ha querido comprender que La Habana no es París».60 Das Gesamtwerk der Condesa de Merlín vermittelt den Eindruck einer Exterritorialität, um den Terminus von George Steiner61 zu verwenden. La Havane ist ein wichtiges Beispiel von «unhousedness», das so charakteristisch ist für die kubanische Literatur. Der Text ist ein hybrides Gebilde, das auf einer Reihe von Gegensatzpaaren fußt: Kuba–Frankreich, spanisch–französisch, lokaler costumbrismo–europäischer Exotismus, Erinnerung–Gegenwart. Sie schreibt in einem Dazwischen, einem Zwischen-Raum. Ihrem angestrengten Bemühen um die Inszenierung kubanischer Identität kann im Zusammenhang mit ihrem Anliegen, den spanischen Kolonialismus zu zementieren, nur die Inszenierung eines gebrochenen identitären Selbstverständnisses folgen. Anscheinend hat die Erfahrung des französischen Kolonialismus und seiner wirksameren Gravitationskraft sie dazu gebracht, kolonisatorisch aufzutreten – wenn auch nicht im Dienste von Paris, sondern im Sinne der Madre Patria España. Der Dienst an Frankreich kam insofern nicht zu kurz, als La Havane, gerichtet an ein französisches Publikum,
58 59
60 61
Condesa de Merlín: La Havane, Bd. II, S. 285. Ebda., S. 89f.; vgl. auch Díaz: Merlin’s Foreign House, S. 68. Vgl. hierzu auch den Artikel der Condesa: Maria de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo Condesa de Merlín: Les esclaves dans les colonies espagnoles. In: Revue des deux mondes 2 (1841), S. 380–405. Méndez Rodenas: A Journey to the (Literary) Source, S. 711. Vgl. George Steiner: Exterritorial. Schriften zur Literatur und Sprachrevolution. Aus dem Amerikanischen von Michael Harro Siegel. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974.
100
durchaus exotische Erwartungshaltungen erfüllt haben dürfte. Ein modellhaftes Beispiel für transkolonialen Wissenstransfer.
III.3. Haiti als Zwischen-Kultur III.3.1. Der haitianische turn Mit ihrem Buch Modernity Disawoved (2004) hat Sibylle Fischer, in Orientierung an Michel Trouillot, ein neues Paradigma in die Karibikforschung gebracht. Fischer konstatiert die fehlende Erwähnung der haitianischen Revolution in der abendländischen Philosophie, obwohl es die einzige Revolution mit dem zentralen Anliegen der Rassengleichheit war. Durch den kolonialen Sklavenhandel entstand in einer ganzen Hemisphäre ein heterogenes, transnationales kulturelles Netzwerk. Fischer beschreibt dieses kulturelle Netzwerk als eine interstitial culture: eine Zwischenkultur, eine Landschaft aus heterogenen Fakten, Praktiken und Ideen, die bis heute durch disziplinäre Grenzen fragmentiert sei. Haiti und die haitianische Revolution sind eine zentrale Koordinate dieser Landschaft, denn gerade um das Rätsel der haitianischen Revolution entstand ein Zusammenfluss politischer Vorstellungen und Emanzipationsbestrebungen – obwohl es oft nur als das Unaussprechliche, als Trauma, Utopie oder flüchtiger Traum fassbar ist.62 Entscheidend an Fischers Ansatz ist, dass ihr zufolge die wahren Schlachten auf imaginären Schauplätzen ausgefochten wurden: «Imaginary scenarios became the real battleground».63 Die radikale Anti-Sklavereibewegung hinterließ einen tiefen Abdruck in der Psyche der Sklavenhandels- und Plantagengesellschaft: Phantasie, Paranoia, Identifikationswünsche und Verleugnung waren immer Teil dieser Formation. Fischer bemüht sich darum, ein Panorama zu konstruieren, eine Landschaft, die das Ungesagte, Verborgene und Verschwiegene der historischen Belege bloßlegt. Kuba und Santo Domingo waren am direktesten von den Ereignissen in Haiti betroffen: Kuba nahm mit der Zeit den Platz des ehemaligen Saint-Domingue als
62
63
Für wichtige Diskussionen in diesem Kapitel danke ich Johanna Abel und Leonie MeyerKrentler. Ein aufschlussreiches Beispiel für Haiti als Zwischenkultur ist der Beitrag von Anja Bandau: Configuraciones atlánticas y modalidades de la circulación de saberes sobre la rebelión de Saint-Domingue entre 1791 y 1810. El caso de «Mon Odyssée». In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 399–419. Anhand eines eindrucksvollen Textbeispiels von Testimonialliteratur eines weißen Flüchtlings über die Ereignisse der haitianischen Revolution untersucht sie die transkulturelle Wissenszirkulation zu Haiti im zirkumkaribischen und hemisphärischen Raum zwischen Saint-Domingue, New Orleans, Frankreich und New York. Dabei geht es ihr um die Verhandlung und Repräsentation der revolutionären Ereignisse von 1791–1804 in den Medien und inwiefern das Genre des Augenzeugenberichts eine Übersetzbarkeit der Ereignisse gewährleistet beziehungsweise ihre Darstellung reguliert. Vgl. Abel: Tagungsbericht, S. 476. Zur haitianischen Revolution von Bedeutung: C.L.R. James: The black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo revolution. London u.a.: Penguin books [1938] 2001. Fischer: Modernity Disavowed, S. 2.
101
Hauptzuckerproduzent der Karibik ein. Die territoriale Sonderlage Kubas brachte naturgemäß mit sich, dass Haiti gleichermaßen weit genug entfernt und gefährlich nah war. Bezeichnenderweise kam es zwischen 1791 und 1805 zu keiner einzigen Erwähnung der haitianischen Revolution im Papel periódico von Havanna. Diese Verschweigungspolitik brachte mit sich, dass in Zeitzeugenberichten wie Briefen oder Artikeln die Revolution nie eine politische oder diplomatische Angelegenheit war.64 Um dieses Phänomen zu fassen, um die unterschätzte Rolle Haitis in der offiziellen Geschichtsschreibung begrifflich zu bestimmen, schlägt Fischer das Konzept der Verleugnung der Moderne vor – dies sowohl im herkömmlichen Sinne (Weigerung der Anerkennung) als auch im psychoanalytischen Sinne (Verdrängung einer traumatischen Erfahrung). Ähnlich wie bei Paul Gilroys Gegenkultur handelt es sich bei der Verleugnungsthese eher um eine Haltung zur oder Perspektive auf die Vergangenheit, und nicht um den vermeintlichen Charakter eines bestimmten historischen Moments. Das Konzept Verleugnung funktioniert nur, wenn es etwas gibt, von dem man weiß, dass es verleugnet wird. Es gilt, das Verdrängte zu identifizieren und zu fragen, von wem es verdrängt/verleugnet wird und aus welchem Grund. Unlike the notion of trauma, which becomes politically inert when it cannot properly distinguish between, for instance, a traumatized slave and a traumatized slaveholder, disavowal does not foreclose the political by rushing to assign victim status to all who find it difficult to deal with reality.65
Chris Bongie wiederum konstatiert seit 2008 eine wissenschaftliche Hinwendung zur haitianischen Revolution, die er als haitian turn bezeichnet.66 Er markiert für den 11. September 2001 eine politische Wende des ganzen Feldes der Postcolonial Studies, deren Folge in der inflationären Deutung karibischer Kulturproduktion
64
65 66
In wichtigen Lexikonartikeln fehlen bis heute Einträge zu Kolonialismus und Sklaverei. Auch in der politischen Theorie ist der Fall Haiti problematisch. Hannah Arendt lässt Haiti in ihrer Revolutionsgeschichte weg (On Revolution, 1936). Sie schließt die Sklaverei aus der sozialen Frage aus. Über Sklaverei kann bei Hannah Arendt nicht gesprochen werden, da sie aus ihrem Rahmen von sozial versus politisch fällt. Sklaverei verschwindet in der Unsichtbarkeit: buchstäblich, da die Institutionen sie verschweigen, und dann auch konzeptuell im Abgrund zwischen dem Sozialen und dem Politischen. Haiti wird undenkbar. Das gleiche gilt auch aus der Perspektive der Ökonomie: von Adam Smith, Karl Marx und Max Weber wird die Sklaverei als präkapitalistisch eingestuft und damit aus der Diskussion geschoben, obwohl die Plantagenwirtschaft die ökonomische Grundlage der europäischen Industrialisierung war und nur in einem kapitalistischen Weltmarkt funktioniert. Das Fazit dieser Geistesgeschichte lautet: Kolonialismus und Sklaverei sind nur Störfaktoren am Rande der Geschichte, Anomalien, mehr oder weniger besorgniserregende Unregelmäßigkeiten im Siegeszug des Fortschritts und der Entfaltung der individuellen Freiheiten. Fischer: Modernity Disavowed, S. 38. Chris Bongie: Friends and Enemies. The Scribal Politics of Post/Colonial Literature. Liverpool: Liverpool University Press 2008.
102
als politisch und revolutionär besteht. Sein Eingangsbeispiel ist Nick Nesbitts kulturalistische Interpretation der antillanischen Bewegung des 20. Jahrhunderts (Négritude) als politische Revolution. Laut Bongie entspricht diese Sichtweise einem Vorurteil der gesamten Disziplin, die auf einer Verwechslung des Kulturellen mit dem Politischen beruhe. Bongies Contra fußt auf Peter Hallward, der den kulturalistischen Ansatz als unsinnige «disastrous confusion of spheres»67 bezeichnet, die von der Annahme ausgehe, dass Kultur sich wie auch immer direkt in progressive Politik übersetzen müsse. Die Quintessenz von Bongies Buch Friends and Enemies ist eine Kritik an der Kulturpolitik und damit unausgesprochen auch an Sibylle Fischer, weil sie den politischen Einfluss von Kultur hoch bewertet. Die politische Wende der Postcolonial Studies vollzieht sich als Bewegung weg von der Hybriditätsbegeisterung der 1990er-Jahre hin (zurück) zum politischen Engagement: diesen Pol bezeichnet Bongie als das «eigentlich (porperly) oder substantiell (substantively) Politische»68, im Gegensatz zu den gängigen kulturalistischen Postkolonialismus-Studien. Es geht um eine Abkehr vom konsentischen, postpolitischen Ethos, das die Postcolonial Studies im ausklingenden 20. Jahrhundert prägte, hin zum Willen für Grenzziehungen, die Politik erst ermöglichen – so wie die Feindschaft der Haitianer gegenüber den Franzosen eine Bedingung für ihren revolutionären Sieg war. Damit rückt die Spaltungslogik des Politischen wieder in den Blick, die Peter Hallward in dem Konzept der Divisive Universality69, der spaltenden Universalität, fasst und die Chantal Mouffe wie folgt definiert: «[…] there is no consensus without exclusion, no ,we‘ without a ,they‘ and no politics is possible without the drawing of a frontier».70 Diese militantere Form der Postcolonial Studies bietet, so Bongie, ein dringend nötiges Gegengewicht zu den immergleichen kulturalistischen Exzessen des postkolonialen Einerleis, sie eröffnet aber auch den Horizont von (Ausschluss-) Gewalt und Terror, der den «skeptischen Humanisten» in uns allen die Tyrannei der haitianischen Revolution verurteilen lässt. Die Schwierigkeit dieser Wende formuliert Bongie wie folgt: «Il n’est pas facile, en un mot, d’englober la logique fractionniste du politique – l’exclusion violente avec laquelle les distinctions entre amis et ennemis se révèlent – dans un milieu critique comme le nôtre où les impératifs d’un pluralisme intégrationniste relèvent du sens commun.»71 Mit direktem Bezug zu Haiti vermerkt Bongie, die übliche Postkolonialismusforschung beschäftige sich ausschließlich mit zwei Arten von frankokaribischer Revolution: eine politische 1791–1804 (Politics) und eine literarisch-kulturelle im 20. Jahrhundert (Literature). Indes verzeichnet er ein auffallendes Vergessen des
67 68 69 70 71
Peter Hallward: Absolutely Postcolonial. Writing Between the Singular and the Specific. Manchester: Manchester Univ. Press 2001, S. XIX. Bongie: Friends and Enemies, S. 328. Hallward: Absolutely Postcolonial. Chantal Mouffe: On the Political. London: Routledge 2005, S. 73. Chris Bongie: Politique, Mémoire, Littérature. L’«Universalité fractionniste» d’Haïti au XIXe siècle. In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 231–252, hier S. 234.
103
langen Interregnums der post- und prärevolutionären Zeit von 1804–1920 (Memory). In einer fünfseitigen starken Kritik an seinem Lieblingsfeind Nick Nesbitt und dessen jüngstem, auf den Zug des Haiti-Mainstreams aufspringenden Buch Universal Emancipation: The Haitian Revolution and Radical Enlightenment (2008) betont er, dass Nesbitt gerade die Nachwehen der haitianischen Revolution aus seinen Betrachtungen ausblende, weil die Chronologie der Ereignisse die These widerlege, die haitianische Revolution sei ein weltgeschichtliches Ereignis gewesen. In der aktuellen Haiti-Forschung werde die Existenz zweier rivalisierender Haitis ignoriert und es werde fein säuberlich getrennt zwischen der «guten Erinnerung» (an den erfolgreichen antikolonialen Kampf und die «Idee von 1804» zur radikalen Rassengleichheit) und der «schlechten Erinnerung» (an die rassistisch geteilte(n) Nation(en) Haitis in der unmittelbaren Folgezeit der Revolution 1804–1820): die von Mulatten geführte Südrepublik Alexandre Pétions und das «schwarze» Königreich Henri Christophes im Norden replizieren nach Bongie vor allem die binäre Spaltung in «Freunde und Feinde», die allem Politischen inhärent ist. Dass der weltgeschichtliche Triumph der haitianischen Revolution in Rassismus und Absolutismus versank und somit letztlich scheiterte, wird in der haitianischen Wende der Postcolonial Studies konsequent ausgeblendet. III.3.2. Die Haiti-Rezeption in den karibischen Literaturen Wie nun artikulieren sich literarische Repräsentationen zu Haiti? Die Angst vor Saint-Domingue ist ein häufiges Thema karibischer Literaturen, vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Bei Maynard de Queilhe geht es beispielsweise darum, dass die Sklaven mit Härte und Gerechtigkeit behandelt werden müssen, um ein zweites Saint-Domingue zu vermeiden – so die Haltung der Protagonisten-Sklavenbesitzer im Roman Outre-mer, wobei der Begriff Gerechtigkeit mit kolonialer Rechtsprechung gleichzusetzen ist, also mit dem Recht des Sklavenbesitzers, so zu verfahren, wie er es für richtig hält.72 Bei Maynard verkörpern die freien Schwarzen und Mulatten opportunistische Egoisten, die ihrer privaten Gelüste wegen haitianische Zustände auf Guadeloupe und Martinique herbeiführen wollen.73 «[L]a Martinique, le 29 décembre 1830, sera devenue une seconde Saint-Domingue, une France des Antilles ! Je suis pour qu’on me nomme député immédiatement après»74, erklärt einer der Rädelsführer, während ein anderer die Massen mit der Aufforderung aufwiegelt, sich zu nehmen, was die Weißen nicht freiwillig geben: «Mais, ils ne donnent rien, prenons tout. Saint-Domingue doit attirer et fixer vos yeux et vos esprits. Saint-Domingue est l’étoile de tout ce que nous allons faire.»75 Nur dank der Dummheit der Sklaven
72 73 74 75
Für genauere Informationen siehe Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 505. Ebda., S. 506. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 182, zit. nach Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 506. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 160, zit. nach Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 506.
104
und des Weitblicks der Herren kann bei Maynard ein zweites Saint-Domingue erfolgreich verhindert werden.76 Haiti findet in Les créoles von Levilloux kaum Erwähnung. Dies ist um so erstaunlicher, als der Roman zu Zeiten der haitianischen Aufstände spielt und Sklavenunruhen auf Martinique und Guadeloupe eine zentrale Thematik im Roman bilden. Gerade weil der Roman retrospektiv – also 45 Jahre später – die revolutionäre Hochphase, die 1790er-Jahre, in den Blick nimmt, zu einer Zeit also, da auf dem französischen Festland alle Diskussionen um eine Anerkennung Haitis (definitiv 1825) bereits stattgefunden hatten, scheint diese Ausblendung Haitis besonders auffällig. Die wenigen Stellen, an denen Haiti zur Sprache kommt, seien im Folgenden zusammengefasst. Eine besondere Episode stellt die erste Übermittlung der haitianischen Ereignisse durch Thélesfore dar, die unmittelbar mit der Französischen Revolution in Verbindung gebracht werden: –«De grandes nouvelles, messieurs, s’écria Thélesfore en entrant, des nouvelles de Saint-Domingue ! –Saint Domingue ! Quelles sont-elles ? Quelles sont-elles !» Ces exclamations partent de tous les coins de l’appartement. Thélesfore, avec l’importance de tout possesseur d’un secret intéressant, commence par s’étendre dans un fauteuil après avoir jeté son chapeau et sa canne à pomme d’or à son jeune esclave. «Enfin, qu’y a t-il ? Les nouvelles ! Lui crie-t-on à la fois avec un redoublement de curiosité et d’anxiété. –Il ne s’agit de rien moins que de l’infernal traînée de poudre dont la tête est à Paris et la queue ici ; elle commence à prendre feu. –Quoi ! dit Desvallon, les principes qui se forgent dans les clubs sont été poussés par l’ouragan révolutionnaire jusque dans la grande colonie ?77
Die Debatten in den Pariser Klubs scheinen ihren Widerhall selbst in der großen Kolonie gefunden zu haben, der Perle des französischen Kolonialreiches. Aufschlussreich für den Roman ist die unmittelbare Reaktion Estèves, der sofort aufhorcht, als er erfährt, dass mit Vincent Ogé ein Mulatte der Hauptdrahtzieher der haitianischen Ereignisse war. Und weiter: –C’est cela, continue Thélesfore, on nous apprend du Port-au-Prince la conjuration du mulâtre Vincent Ogé, récemment arrivé de France. –Conjuration ! Répètent avec effroi plusieurs des assistants. –Vincent Ogé, mulâtre ! Murmure sourdement, Estève.78
Die Pflanzer reagieren sehr kritisch darauf, dass der Aufstand von einem Mulatten ausging. Auf die Frage, was die Motivation der Rebellen sei: «Ogé réclamait l’égalité civile et politique au nom de je ne sais quelle folie, répond Thélesfore en affectant un air dédaigneux.»79
76 77 78 79
Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 507. Levilloux: Les créoles, S. 70. Ebda., S. 70. Ebda., S. 71.
105
Bezeichnend bei Levilloux ist, dass die Überlieferung der revolutionären Ereignisse auf Haiti über die französische Literatur stattgefunden haben muss. So kommt es nicht von ungefähr, dass er auf Adonis als wichtigen Befreier eingeht und damit die gleichnamige erste Erzählung eines französischen Schriftstellerkollegen über die haitianische Revolution aufnimmt: Adonis ou le bon nègre von Picquenard.80 Wie aber artikuliert sich das Verhältnis zur haitianischen Revolution in der literarischen Produktion Haitis selbst? Ein Blick auf den 1859 publizierten Roman Stella von Émeric Bergeaud zeigt, dass die Revolution zwar präsent ist, sich jedoch nur als Erbe des einstigen Mutterlandes Frankreich legitimiert. Vor der Folie von Stella kommt man zu dem Eindruck, die Haitianer hätten staatsrechtlich betrachtet nichts anderes getan, als die Ideen der rechtmäßigen französischen Regierung Haitis, des revolutionären Frankreichs, gegen den Willen der üblen weißen Kreolen durchzusetzen.81 Auf Haiti waren es Schwarze und Mulatten, die gemeinsam die hohen Ideale der Französischen Revolution retteten, die den niederen Interessen der Pflanzer diametral gegenüberstanden. Das revolutionäre Frankreich, die Freiheit, die in der Gestalt der Stella auftritt, partizipiert zunächst aktiv bei der Erkämpfung der Menschenrechte für alle Bevölkerungsteile Haitis, zieht sich aber anschließend in die Berge zurück und überlässt es den Brüdern Romulus und Rémus, den Kampf für die Freiheit selbst auszufechten.82 Es gereicht den Mulatten und den Schwarzen Haitis zur Ehre, dass sie sich ihre Freiheit schließlich allein erstritten. Dennoch wird Stella, oder auch das revolutionäre Frankreich, als «Initiatorin der Revolte», als «Ratgeberin und moralische Unterstützung» betrachtet. Angesichts ihrer «Unerfahrenheit» waren die Haitianer auf die Hilfe derer, die politisch und strategisch versierter waren als sie, angewiesen.83 Anders als bei Bergeaud, der die afrikanischen Wurzeln der Haitianer würdigt, gestaltet sich bei seinem haitianischen Schriftstellerkollegen Ignace Nau der Bezug zu Afrika. In Isalina ou une scène creole (1836) wird die Physiognomie von Galba, einem Freund des Protagonisten Paul, wie folgt beschrieben: «Sa tête large et velue ne ressemble nullement au vrai type africain qui s’améliore considérablement dans notre pays».84 Bemerkenswert in Isalina ist auch eine Darstellung der Plantagenwirtschaft, die an das idyllische Bild in Maynard de Queilhes Outre-mer erinnert. Die Erzählung ist im Plantagenarbeitermilieu angesiedelt, die Atmosphäre zunächst geprägt vom Alltagsleben und seinen Geräuschen: Der Lärm der Zuckermühle, das Kommen und Gehen der Arbeiter, ihre Gesänge vermitteln eine sehr eigene Stimmung. «En effet, est-il rien de plus
80 81 82 83 84
Jean-Baptiste Picquenard: Adonis suivi de Zoflora et de documents inedits. Hg. von Chris Bongie. [Paris]: L’Harmattan 2006. Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 508. Vgl. ebda., S. 508; Bergeaud: Stella, S. 91–97. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 509. Ignace Nau: Isalina, ou une scène créole. Récit. Port-au-Prince: Choucoune (1836) 2000, S. 46.
106
animé, rien de plus varié et de plus pittoresque que la roulaison !»85 Dieser kritischen Haltung zu Afrika und der Befürwortung des Plantagensystems, die sich in Haiti bereits unmittelbar nach der Revolution mit frankophilen Tendenzen unter einen Hut bringen lassen, steht gleichzeitig die positive Inszenierung eines Voodoo-Kults gegenüber: So hat Galba eine Natter, mit der er spricht, damit sie die Reisenden nicht angreift. Er lässt sich das Problem schildern, das Paul zu ihm führt. Dieser stellt drei Fragen: Ob es die Verletzung sei, die Isalina ins Delirium gestürzt habe, wer ihr die Verletzung zugefügt habe und, falls sie verzaubert sei, wer den Zauber über sie verhängt habe. Galba fragt nach den Namen, die sie im Delirium nennt. In der folgenden Voodoo-Zeremonie hat Paul Gelegenheit, auf zwei Karten sowie in einem Wasserkrug die Antworten auf seine Fragen zu sehen, und er bekommt ein Gegengift gegen den Zauber. Isalina ist gerettet. Aus Dankbarkeit bietet Paul Galba an, sein Adoptivsohn zu werden. Diese Ambivalenz in der bewussten Bejahung von Relationalitäten, die in okzidentaler Logik in sich widersprüchlich sind, entspricht der im ersten Kapitel erläuterten, spezifisch dialektischen Grundsituation eines Schreibens auf Haiti im 19. Jahrhundert.
III.4. Ideentransfers: Zentrum–Kolonie III.4.1. Philanthropie im Zentrum: gescheiterte Ideentransfers Die weißen Béké-Autoren Guadeloupes und Martiniques machten nie den Versuch, eine andere als die französische Identität zu behaupten.86 Wie der in der Einleitung zur frankophonen Karibik zitierte Zeitzeuge bemerkte, gab es einen regelrechten brain drain Richtung Paris.87 Die Békés verhielten sich so, als sei Kultur für sie gleichbedeutend mit französischer Kultur, die der Metropole Paris vorbehalten blieb, während die kreolische Kultur mit der Zuckerkultur identifiziert wurde.88 Der kulturbeflissene Überseefranzose fand ein ihm genehmes Ambiente nur in der Metropole: L’univers créole ne privilégiait guère le travail et le désintéressement intellectuel et artistique. La seule culture qui lui importait était celle de la canne à sucre. Les rares écrivains d’origine antillaise à s’illustrer […] en littérature resteront en métropole où ils oublieront à peu près totalement leur pays natal.89
Die Spaltung in ein in Frankreich liegendes Kulturzentrum und ein auf den Inseln befindliches Wirtschaftszentrum bewirkte, dass die Schriftkultur der französischen Antillen vor allem aus historischen und wirtschaftlichen Texten bestand, in denen
85 86 87 88 89
Ebda., S. 27. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 56. Granier de Cassagnac: Voyage aux Antilles, Bd. I, S. 102f.; Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 56. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 56. Corzani: La littérature des Antilles, Bd. II, S. 24.
107
zum Teil auf das Fehlen einer eigenen historiographischen und literarischen Tradition aufmerksam gemacht, das Desinteresse der Metropole beklagt, aber auch das Phlegma einer Bevölkerung moniert wird, die sich im eigenen Land gebärde, als sei sie nur auf der Durchreise. Die Schwierigkeit des Ideentransfers von der Metropole in die Kolonie ist eines der zentralen Themen der frankophonen Karibik im 19. Jahrhundert. Bei Levilloux wird der Kreole Edmond Briolan in Paris von dem revolutionären Klima erfasst, er entwickelt dort philanthropische Ideen, die sich in den Kolonien nicht umsetzen lassen. Là, sa vigoureuse mémoire lui retraçait ses premiers impressions trop vivaces pour s’effacer d’une âme sensible. Il sentait l’incompatibilité des ses convictions philosophiques avec les réalités sociales au sein desquelles il était destiné à vivre. Né créole, membre d’une caste privilégiée dont le prestige de supériorité pouvait seul entretenir la domination, il s’était nourri des doctrines les plus indépendantes et rêvait avec enthousiasme leur application politique.90
In einem Brief warnt Edmonds Vater seinen Sohn vor einer Übertragung der Ideen, die diesen im Paris der Französischen Revolution inspiriert haben könnten: Gleichheit kann es in den Kolonien nicht geben.91 Im Gespräch zwischen Edmonds Mutter und seiner Schwester Lea wird dessen Ankunft vorbereitet. Lea geht selbstverständlich von seinem Assimilationserfolg in der Hauptstadt und folglich von seiner Zugehörigkeit zum Pariser Establishment aus. Sie stellt sich vor, in welchen Kreisen ihr Bruder in Paris verkehrt haben musste, woraufhin sie von ihrer Mutter eines Besseren belehrt wird. Maman, il a dû aller à la cour, car un jeune créole n’est déplacé nulle part. Nous qui sommes les premiers ici, nous ne pouvons pas en France descendre de notre rang. La cour ! ma fille. Tu oublies donc le mépris et les accens de colère qu’elle inspire à Edmond ? Ses lettres ne sont pleines que des principes nouveaux qui, en France, tourmentent tous les esprits. Je tremble que ses sentimens et son caractère enthousiaste ne soient menacés de bien rudes épreuves dans ce pays.92
Nach seiner Ankunft dankt Briolan den Sklaven für ihre Arbeit, der er seine Bildungsmöglichkeiten schulde: «Et vous, mes bons esclaves, dont le travail a nourri ma jeunesse, a payé mon éducation, m’a fait naître à la vie de l’intelligence ; pour vous je continuerai le soins de ma mère, la douceur de mon père. Venez dans mon sein, il est assez vaste pour vous contenir tous.»93 Das Problem der Nicht-Übertragbarkeit antirassistischer Ideen ist omnipräsent. In Paris spielt die Hautfarbe, anders als in der Kolonie, kaum eine Rolle: «Le voilà donc ce créole de pure race, l’incarnation vivante d’un odieux privilège qui, en France, marcherait mon égal, et ici me repousse du pied dans le cercle
90 91 92 93
Levilloux: Les créoles, S. 21. Ebda., S. 23. Ebda., S. 38. Ebda., S. 48.
108
infranchissable des préjugés».94 Rassismus wird in der Metropole aufgehoben zugunsten eines Lobes auf Frankreich: «[…] les braves de toutes les peaux s’unir pour le triomphe de la France».95 III.4.2. Erfolgreiche Ideentransfers In der spanischen Karibik sucht man vergeblich nach den philanthropischen Diskursen eines Zentrums Madrid, die in die Karibik transferiert werden. Im Gegenteil, hier blickt man konsequent nach Europa, häufig um dortige Moden zu kopieren. Bei Sab von Gómez de Avellaneda sind es vor allem literarische Vorbilder der französischen und spanischen Romantik, die durch vorangestellte Zitate in den einzelnen Kapiteln einen Europabezug explizit machen. Weitere wichtige Transfers spielen sich vor allem auf einer ökonomischen Ebene ab: die Spekulantenmoral der Engländer in der Person Otways, die Funktion der Lotterie etc. spielen eine exponierte Rolle. In Manzanos Autobiografía96 sind die französischen Aufklärer als Antichristen präsent: Manzanos Zukunft, «schlimmer als Rousseau und Voltaire», wird von seiner Herrin antizipiert und als Rechtfertigung für ihre rigorose Unterdrückung seiner geistigen Fähigkeiten genutzt. Weitere Beziehungen bestehen zur französischen Oper, zu den Gutsherren der iberischen Halbinsel (Galizien), zu dem englischen Zeichenlehrer Mr. Godfria, aber auch transkaribisch zur Emigration aus Santo Domingo. Trotz der kritischen Darstellung der Sklavenbehandlung bleibt das bereits im Fall von Haiti gezeichnete Bild einer dialektischen Beziehung zum Herrn nicht aus. So faszinierte Manzano mit 16 die goldene, neuproduzierte Münze, auf der ein Bildnis des spanischen Königs Fernando VII. eingeprägt war, so sehr, dass er sie für sich behielt und sie hegte und pflegte.97
94 95 96
97
Ebda., S. 63. Ebda., S. 251. Juan Francisco Manzano (Kuba 1797–1853) war Sklave und Schriftsteller. Die meisten seiner Werke schrieb er als unfreier Mann, seine Autobiographie verfasste er wohl 1835, ermuntert von Domingo del Monte, auf dessen Initiative hin er von liberalen Intellektuellen 1837 freigekauft wurde. Vgl. dazu den Artikel von Thomas Bremer: Juan Francisco Manzano y su Autobiografía de un esclavo (Cuba, 1835/1840). La repercusión en Europa. In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 439–448. Bremer untersucht die Rezeptionsgeschichte dieser einzigen bekannten Autobiographie eines ehemaligen Sklaven der hispanischen Karibik. Dabei beleuchtet er die Transferprozesse der Rezeption zwischen Kuba, Spanien, England, Frankreich, Irland und Haiti. Zentral ist bei ihm die Frage, inwiefern die kubanische Literatur eine Initialmotivation von britischen Abolitionisten wie Richard Madden erfuhr, die als Augenzeugen und Agitatoren gegen die Sklaverei die literarischen Diskurse der karibischen Inseln politisierten. Nachdem die Berichte englischer Reisender die Sklavereiabschaffungsdiskussionen zwischen spanischer und englischer Krone bereits erheblich verschärft hatten, folgte 1840, als der Abolitionist Victor Schœlcher die Manzano-Biographie ins Französische übersetzte, eine weitere Internationalisierung der Rezeption. Für die Ausführungen zu Manzano, Enriquillo und Tapia y Rivera danke ich Johanna
109
Komplexer als bei Gómez de Avellaneda und Manzano gestalten sich für die spanische Karibik die Transferprozesse im Fall von Galváns98 Enriquillo: «Koloniale Schönheitstransfers»99 werden dort zwischen Italien, Spanien und den Amerikas inszeniert. Galván erwähnt des Öfteren die Art, sich nach Mailänder Mode zu kleiden:100 ein Fall von umgekehrtem Exotismus. Ein weiteres Transferthema sind die Kommunikationsschwierigkeiten durch Missverständnisse und Hürden auf den Datenwegen, also die langsamen Mühlen der transatlantischen Bürokratie.101 Die Transfers von egalitären Ideen finden demgegenüber vielmehr auf einer transkaribischen Dimension statt: So bildet der transkaribische Widerstand der Taínos eine zentrale Achse in Enriquillo: Hatuey (aus Haiti) flüchtet nach Kuba und organisiert von dort, indem er zwischen den Inseln spioniert, den Kampf gegen die Eroberung Kubas.102 Auch auf einer subversiven Ebene kommt die multirelationale Ausrichtung der spanischen Karibik zum Tragen: die Piraten nutzen den Kolonialherren zur Verschleppung von Indio-Sklaven zwischen den karibischen Inseln.103 Grundsätzlich zeigt der Roman ein tiefes Verständnis für den espíritu de la época der spanischen Eroberungen. Galván zeichnet ein eindringliches Gemälde der kastilischen Hofkultur und des Sendungsbewusstseins der Konquistadoren. Eine latente Sympathie für die Weltmacht Spanien mit ihren großen Geistern Kolumbus und Las Casas ist omnipräsent.104 Dies schließt aber, im Gegensatz zu den literarischen Beispielen aus der französischen Karibik, nicht aus, dass es zu einer Rebellion Enriquillos als Antizipation der Freiheitsbestrebungen und der Unabhängigkeitskriege mit der Kolonialmacht Spanien kommen kann: «El alzamiento del Bahoruco aparece como reacción; como el preludio de todas las reacciones que en menos de cuatro siglos han de aniquilar en el Nuevo Mundo el derecho de conquista.»105 In einer Zeitkritik Galváns findet sich ein Hinweis auf die politische Dekadenz Spaniens:
98
99
100 101 102 103 104 105
Abel. Vgl. Johanna Abel: Transatlantisches KörperDenken. Reisende Autorinnen in der spanischen Karibik des 19. Jahrhunderts. (Forthcoming). Manuel de Jesús Galván (1834–1910), Diplomat und politischer Funktionär, genoss eine klassische akademische, humanistische Bildung. Sein Leben ist eng mit der Unabhängigkeitsgeschichte der Dominikanischen Republik verflochten: zunächst (1861) überzeugter Anexionist, dann in seinen Dreißigern Anhänger des Partido Azul unter Luperón (ab 1868). Als Diplomat war er unter anderem auch in Frankreich tätig. In Paris, in der Bibliothèque Nationale, konzipierte er seinen einzigen Roman Enriquillo (Erstveröffentlichung 1879, erste vollständige Ausgabe 1892). Johanna Abel: «Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.» Paradoxien in den kolonialen Schönheitsdiskursen der hispano-karibischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Romanistik, 17, 33 (2010) (Titel des Heftes: Die Maskeraden der Schönheit), S. 15–32. Manuel de Jesús Galván: Enriquillo. Leyenda histórica dominicana (1503–1533). Notas del autor. Santo Domingo: Corripio (1879) 1990, S. 135. Ebda., S. 372. Ebda., S. 294f. Ebda., S. 410. Abel: Transatlantisches KörperDenken. Galván: Enriquillo (1990), S. 534.
110
El Consejo Real de Indias, contra las protervas esperanzas del Rey Fernando, inspirándose en la dignidad e independencia que tanto enaltecieron en aquel siglo las instituciones españolas, falló unánimemente en favor de los derechos reclamados por Don Diego, reintegrando en todo su puro brillo el mérito de Colón. Sin embargo de este glorioso triunfo del derecho sobre el poder [...].106
In Tapia y Riveras La palma del cacique107 bildet die Beziehung zur zeitgenössischen kastilischen Literatur eine wichtige Achse; dies beispielsweise in einem intertextuellen Verweis auf Cervantes und die imaginäre Folie des Ritterromans – der Protagonist Sotomayor will vor der Hochzeit Heldentaten in der Neuen Welt vollbringen. Estas ideas, por otra parte, eran muy naturales y propias en la juventud distinguida de su época, pues aún estaba en pie el caballeresco edificio que levantó Enrique I de Alemania, y que aún no había derribado con su implacable pluma, el más grande y singular de los satíricos. Libre la península ibérica del dominio musulmán con la toma del baluarte granadino, el espíritu aventurero y belicoso de los españoles, encontraba un nuevo terreno más vasto a su ejercicio, que el que podía ofrecerles la Flandes y la Italia; así que no era de extrañar que la juventud ardorosa, acudiese en tropel a las tierras nuevamente halladas, en donde mil empresas quiméricas se hacían lugar en las imaginaciones novelescas, con la relación de extrañas aventuras, de grandes proezas, y de doradas regiones, en que los prodigios se mezclaban a lo vasto y desconocido de aquellos países.108
Unter den europäischen Einflüssen dominieren bei Tapia y Rivera exotisierte Bilder der fremden Frau: Sultanin und arabische Paradiesschönheit, aber auch der transkulturierte Körper der exotischen Andalusierin, griechisches Körperideal der Nymphe. Daneben finden sich herkulische Krieger (Taínos) und kastilische Helden (Cid-Salazar). Weiter von Bedeutung sind imaginäre Transfers der indigenen Protagonisten nach Europa und die Spiegelung an europäischen Rollenäquivalenten, zum Beispiel Guarionex als Ritter: «Guarionex trasladado a Europa y educado a usanza feudal, habría sido, obedeciendo a su corazón apasionado y valiente, todo un noble y cumplido caballero.»109 Den gleichen Transfer erfahren auch die weiblichen Gestalten, wenn Tapia y Rivera Loarina als Europäerin imaginiert und die «wilde Frau» an der «kultivierten Dame» spiegelt, die mit ihren Gefühlen strategisch haushaltet: «Natural era una lucha semejante en el corazón de Loarina, que [...] sentía rubor al conocer que su veleidad la impulsaba a amar a otro; porque la hermosa salvaje no era la culta dama de nuestros tiempos.»110
106 107
108 109 110
Ebda., S. 115 (Hervorhebung GM). Alejandro Tapia y Rivera: La palma del cacique. Leyenda histórica de Puerto Rico y poesías. La leyenda de los veinte años. A orillas del Rhin. Mexiko: Editorial Orion (1852) 1977. Alejandro Tapia y Rivera (Puerto Rico 1826–1882) war ein in vielen Genres produktiver Autor und Essayist, der als «Vater der puertoricanischen Literatur» gilt. Darüber hinaus machte er sich für Abolition und Frauenrechte stark. Galván: Enriquillo (1990), S. 47 (Hervorhebung GM). Ebda., S. 40 (Hervorhebung GM). Ebda., S. 42 (Hervorhebung GM). Ich danke Johanna Abel für diesen Hinweis.
111
Die Transfers von philosophischen Ideen werden somit vor allem in der frankophonen Karibik als gescheitert inszeniert, während solche in der hispanophonen Karibik auf fruchtbaren Boden fallen, wie der Fall Heredia im vorigen Kapitel gezeigt hat. Auch literarisch-ästhetische Modelle werden dort, häufig exotisierend, als geglückte Übertragungen dargestellt. Doch bei aller unterschiedlicher Rezeption in den beiden Kolonialsphären gilt: Ob gescheitert oder erfolgreich, eine Eins-zu-Eins-Übertragung ist nie möglich, und jedwelches Produkt aus dem Zentrum wird in den karibischen Texten als Amalgam inszeniert.
III.5. Dazwischen und die Figur des Mulatten Du haut du privilège les blancs laissent tomber le mépris sur les mulâtres, hommes pétris de leur sang. Ceux-ci humiliés de leur infériorité, lacent à leurs pères la haine de l’envie et se vengent sur les noirs de la nuance dégradante d’épiderme dont ils sont héritiers. De leur côté les nègres reconnaissant la supériorité des blancs, repoussant le prétentions de la classe de couleur, conspirent contre les uns parce qu’ils sont maîtres, et haïssent les autres parce qu’ils aspirent à le devenir.111
Bei Levilloux zeigt sich ein ständiges Ringen um ethnische Identitätszuschreibungen. Keine Konversation ohne Bestimmung der Hautfarbe. Der Mulatte Estève betont, dass sowohl er als auch der weiße Kreole Edmond beide Amerikaner sind: «[…] nous sommes deux arbustes américains sur le sol de l’Europe, loin de notre beau ciel.»112 Trotz des streng definitorischen Bemühens um klare Zuschreibungen bleibt jedoch eine gewisse latente Unsicherheit bestehen. So werden an einer Stelle die freien Mulatten und die unfreien als zwei unterschiedliche Gruppen beschrieben. Estève als Mulatte beobachtet: «A son départ il était assez âgé, il avait assez de raison pour avoir observé et gardé souvenir de la supériorité que les mulâtres et les métis libres affaictaient sur les noirs surtout.»113 Aus Sicht der Schwarzen werden die Mulatten mitunter bedauert und als im Dazwischen befindlich wahrgenommen: So hat die Kräuterheilerin Iviane Mitleid mit Estève. Interessanterweise spielt hier der Nationsbegriff eine Rolle: «Moi possédée de Dieu seul, répliqua la vielle. Vous mulâtre, moi negresse. Nation à moi est grande dans un grand pays. Vous pas avoir une nation, vous.»114 Dem Stigma des Wortes Mulatte kann man nur durch Flucht nach Frankreich oder dem amerikanischen Kontinent entkommen. «Ensuite, partons, quittons les Antilles, fuyons en Frances ou sur le continent américain. Alors plus de terreurs, nous sommes libres, libres de la tyrannie d’un mot mulâtre.»115 In beide Richtungen fühlt sich Estève zerrissen. Aus Paris schreibt er an seinen Vater zurück:
111
112 113 114 115
Levilloux: Les créoles, S. 14. Vgl. zu diesem Aspekt bei Levilloux auch: Leonie MeyerKrentler: El Bois-Caïman y la mitificación de la figura negra en Les Créoles ou la Vie aux Antilles de J. Levilloux. In: Gómez, Müller (Hg.): Relaciones caribeñas, S. 69–88. Levilloux: Les créoles, S. 25. Ebda., S. 27. Ebda., S. 104. Ebda., S. 110.
112
Mon père […] pourquoi m’as-tu éloigné de mon pays ? Pourquoi ne me suis-je pas développé sur le sol qui m’a vu naître ? Pourquoi cette vaine et fatale éducation qui doit faire ma misère ? C’est en vain que mon savoir, mes connaissances élèveront mon ambition ; les blancs me repousseront ; mes semblables, blessés de ma supériorité, m’envieront. Ce sera une lumière enfermée en moi et qui ne sait que mieux éclairer l’horreur de mon isolement.116
Maynard de Queilhe zeichnet die Mulatten sehr kritisch. Sie sind es, die die Regeln des Code Noir brechen. Nachdem die hommes de couleur libres 1831 politische und zivile Rechte erhalten haben, geht von ihnen aus seiner Sicht die größte umstürzlerische Gefahr aus. Sie werden immer respektloser: Ils étaient la plupart du temps ridicules ou odieux. Pour prix de leurs insolences, ils se faisaient rompre de coups de canne […]. A la faveur de la nuit, ils couvraient les murs de placards infâmes, où ils ne rougissaient pas d’insulter et de menacer les existences les plus honorables du pays […]. Ils ne saluaient plus les femmes et les filles de leurs maîtres ou de leurs anciens maîtres. Leurs chansons retentissaient du mot de liberté, ce qui n’a jamais été bon signe […].117
Was die Zeichnung des Mulatten Dérima in Les amours de Zémédare et Carina betrifft, so positioniert er sich für die Sklaverei. Dies ist deshalb nicht verwunderlich, da ein großer Teil der Mulatten selbst Sklaven hatten. L’homme de couleur libre serait certainement le plus maltraité, s’il osait se déclarer contre les hommes blancs. Les esclaves, ayant secoué le joug de leurs maîtres, seraient proprement subjugués par les forces immenses qu’on enverrait facilement d’Europe.118 […] Après la victoire, les hommes de couleur libres ne pouvant être utiles et s’étant rendus dangereux, seraient tous massacrés et ils le seraient, je le dis, avec justice. – Supposera-t-on d’ailleurs que l’esclave, qui ne veut pas être soumis à des hommes blancs, dont il reconnaît cependant la supériorité, lui préférait des hommes de couleur, sortis des Blancs, jalouses et haïs par les Nègres ?119
Dieser Mulatte spricht wie ein Freier und verteidigt dabei aber alle Werte der Kolonialgesellschaft. Im Gegensatz zu diesen Beispielen aus der frankophonen Karibik, werden Mulatten in Texten der hispanophonen Karibik, wie Sab oder Cecilia Valdés, viel häufiger als positive Figuren inszeniert, die eine integrierende Kohäsionskraft haben. Es zeichnet die Texte aus, dass die konkrete Farbdenomination bereits ein Dazwischen vermittelt, welches im sozialen Gefüge keinen klar bestimmbaren Platz hat. Eine unsichere beziehungsweise unmögliche Verortung des Mulatten ist allen Texten gemein.
116 117 118 119
Ebda., S. 28. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. 161. Hier bezieht er sich auf die Exkursion von Leclerc nach Saint-Domingue. Prévost de Sansac: Les amours, S. 170f., zit. nach Corzani Bd. II, S. 306
113
III.6. Inselfunktion oder zwischen Natur und Kultur «Il y a des heures où je vous envie, vous poète exilé sous le soleil, exil qu’Ovid eût aimé, dans cette Martinique que vous avez si admirablement peinte.»120 Diese Worte entstammen einem Brief Victor Hugos aus dem Jahre 1835 an seinen Schriftstellerkollegen Louis de Maynard de Queilhe, der kurz zuvor von Paris zu seiner Herkunftsinsel Martinique aufgebrochen war. «Mais, moi, abandonner ma patrie. […] Pourquoi exist-t-il une île appelée Martinique? pourquoi suis-je ici plutôt qu’autrepart?»121, so Marius, der Protagonist aus Maynard de Queilhes Outre-mer, als er aus England wieder auf seine Geburtsinsel zurückkehren muss. Der Roman ist nur wenige Jahre nach dem erwähnten Briefwechsel entstanden. So unterschiedliche Wertungen können offenbar problemlos auf die koloniale Karibikinsel projiziert werden. In dem Roman Eugène de Cerceil ou les Caraïbes (1824) von J. H. J. Coussin122 wird eine Inselmetapher aquiriert, die sich stark an Isolation und Exil orientiert. Man fühlt sich in die Ferne verbannt, fernab jeglicher Zivilisation und kultureller Möglichkeiten. Der Autor schreibt über sich selbst im Vorwort: Vivant loin du monde littéraire, dans une île de l’Archipel Américain, et au milieu des sites sauvages qu’il a essayé de décrire, il n’a pas eu la ressource de recourir aux conseils d’amis éclairés et francs qui lui auroient peut-être appris à penser encore plus désavantageusement qu’il n’est porté à le faire de ces élucubrations de son esprit.123
Bezeichnenderweise verortet sich die Insel in einem amerikanischen Archipel. Und Coussin fügt in einer Fußnote hinzu: Quoique le savoir et les connoissances littéraires soient assez rares dans le pays où cet ouvrage a été composé, l’auteur manqueroit à la reconnaissance, s’il ne déclaroit ici que quelques personnes, auxquelles (long-temps après avoir écrit cette Préface) il a communiqué son manuscrit, lui ont donné de bons conseils dont il a profité.124
Auch bei Thérèse Bentzons125 Yette. Histoire d’une jeune créole (1880) zeigt sich bereits zu Beginn, dass die thematische Hinführung zum Plot nur funktionieren kann über den Weg exotistischer Inselbilder. Die friktionalen Züge des Romans treten besonders deutlich zutage, wenn er, wie einige literarische Karibiktexte, auch eine deutliche ethnographische Lesart nahelegt:
120 121 122 123 124 125
Hugo: Bug-Jargal, S. 69. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. I, S. 43. Guadeloupe 1773–1836. J.H.J. Coussin: Eugène de Cerceil ou les Caraïbes. 3 Bde. Paris: Igonette 1824, Bd. I, S. xxiii. Ebda., S. xxiii. Thérèse Bentzon (eigentlich Marie Thérèse Blanc, Frankreich 1840–1907) war eine französische Journalistin, Schriftstellerin und langjährige Mitarbeiterin der Revue des deux mondes. Sie bereiste die Karibik und schrieb neben ihren Romanen auch Artikel über die dortige Literatur und die sozialen Zustände.
114
Tous les voyageurs qui ont visité les Antilles et longé le littoral escarpé d’une de nos plus belles colonies, la Martinique, se rappellent l’aspect pittoresque des habitations sucrières dont on aperçoit, entre le double azur du ciel et de la mer, la cheminée d’usine, le bâtiments d’exploitations et les cases à nègres couvertes en paille qu’abrite contre le soleil tropical le feuillage échevelé des cocotiers.126
Im Gegensatz zu späteren Karibikentwürfen ist den Inselkonzepten des 19. Jahrhunderts die Idee des Exils und der Isolation gemein. Positive Inselimaginarien orientieren sich allenfalls an exotistischen Vorstellungen. Dadurch dass die Insel meist nur als Durchgangsstation «ertragen» wird, ist auch sie Teil eines Dazwischen, das symptomatisch ist für ein Schreiben in und über die Karibik im 19. Jahrhundert. Diese Inselmetaphorik von Isolation und Exil lässt sich besonders in der französischen Karibik finden. In Enriquillo von Galván weicht eine explizite Auseinandersetzung mit Insularität vielmehr vereinzelten Landschaftsbeschreibungen als idyllische und von der Natur perfekt geplante Ansichten. Die Beschreibungen der Natureuphorie des europäischen Reisenden finden ihr Gegenstück im Enthusiasmus von Fray Bartolomé de las Casas. Sie schreiben sich ein in die zeitgenössisch etablierte europäische, quasireligiöse Blicktradition der Bewunderung der Natur als ästhetisches Kunstwerk. Las Casas ist hier ein intellektueller Reisender, der mit Ekstase die exotische Landschaft verschlingt.127 Las Casas, dotado de sensibilidad exquisita, ferviente admirador de lo bello, sentía transportada su mente en alas del más puro y religioso entusiasmo, contemplando la rica variedad de esmaltes y matices con que la próvida Naturaleza ha decorado el fértil y accidentado suelo de La Española. Deteníase como un niño haciendo demostraciones de pasmo y alegría, ora al aspecto majestuoso de la lejana cordillera, ora a vista de la dilatada llanura, o al pie del erguido monte que llevaba hasta las nubes su tupio penacho de pinos y baitoas. [Nota: Árbol indígena]. [...] todo era motivo de éxtasis para el impresionable viajero, que expresaba elocuentemente su admiración, deseoso de compartirla con sus compañeros; los cuales, no tan ricos de sentimiento artístico, o más pobres de imaginación y lirismo, permanecían con estoica frialdad ante los soberbios espectáculos que electrizaban al Licenciado [...].128
Insofern übernimmt die Natur der Inseln die Rolle eines Pars pro toto für eine Funktionalisierung von Insel als Metapher. Dies deutet gleichzeitig auf eine Abkopplung vom Zentrum und einen Bruch mit der kolonial etablierten bipolaren Achse hin. In Juan Francisco Manzanos Autobiografía wird die Natur als natürliche Umgebung nicht romantisch geschildert. Sie taucht lediglich als medizinisches Mittel auf, um seinen depressiven Gemütszustand aufzuhellen, wenn ihm Spaziergänge verordnet werden oder er zur Erholung mit einem Arzt auf den Besitztümern
126
127 128
Thérèse Bentzon: Yette. Histoire d’une jeune Créole. Reprint der Ausgabe Paris: J. Hetzel 1880. In einem Band mit: J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles. Morne-Rouge: Éd. des Horizons Caraïbes 1977, S. 273–409. Abel: Transatlantisches KörperDenken. Galván: Enriquillo (1990), S. 249f.
115
seiner Herren jagen und fischen gehen soll. Es ist jedoch immer domestizierte Natur, die ihm zum Beispiel im Fall der Geranie zum Verhängnis wird. Die Kultur taucht unter anderem im Zeichnen und Schreiben auf. Manzano nimmt früh Zeichenunterricht mit den Kindern der Herrschaften und entpuppt sich als sehr begabt, bis es ihm verboten wird, weil er eine mit dem Teufel kopulierende Hexe gemalt hat. Daraufhin wirft sein Vater die Malsachen in den Fluss. Sein Vater spielt Harfe und ist ein Vertreter der schwarzen Musikerkultur der Zeit, die auf den Taufen und Festen der Herrschaften im klassischen Ensemble musizieren. Seine Mutter ist Kulturträgerin, insofern sie von ihrer Herrin als ausgewählte Zofe zu besonderen zivilisierten Fähigkeiten erzogen wurde und höfische Umgangsformen etc. internalisiert hat. Manzano stammt also aus einem «kulturnahen» Elternhaus, das darauf achtet, dass er sich nicht mit den schwarzen Sklavenkindern gemein macht, die nicht zum Haushalt gehören. Da ihm der Zugang zur «(Schrift)Kultur» jedoch verwehrt wird (Schreibverbot, Zeichenverbot, Sprechverbot), verlegt er seine Fähigkeiten in die Mündlichkeit und rezitiert unaufhörlich Gedichte, Sprüche, Gebete, Verse, Psalmen und tritt sogar in imaginierte Dialoge mit Gegenständen wie Tischen und Stühlen. Manzano spricht von seinem «cuaderno en la imaginación», in dem er seine Gedichte aufhob und sie bei Improvisationsbedarf abrief. Aufgrund seiner Sprachbegabung wird er parlero und pico de oro genannt.129 Bei Alejandro Tapia y Riveras La palma del cacique fungiert die Inselnatur als Spiegel des Gemütszustands der Protagonisten, sie illustriert etwa deren Melancholie und Verzweiflung. Die «wilde» Kultur der Kaziken korrespondiert mit einer «Intelligenz» des Regenwaldes: «la inteligencia, aunque inculta, amena y gigante, como las selvas siempre verdes»130. Indigenes Denken wird im Roman aus Sicht der Eurokreolen literarisch inszeniert.131 Die Antithese Natur–Kultur erfährt in den Literaturen der französischen Karibik eine deutlichere Polarisierung als in den spanischen Texten. Dies korrespondiert mit einer unterschiedlichen Inselfunktion in beiden Kolonialreichen: die auf den französischen Antillen häufig anzutreffende Inselmetaphorik von Exil und Isolation – und dies aus dem Munde einer Pflanzeroligarchie, die sich freiwillig dort niedergelassen hat –, findet man in der spanischen Karibik kaum. III.7.
Zwischen transtropischen Dimensionen: Xavier Eyma und die Philippinen
Als Befürworter der Sklaverei ging es dem martinikanischen Schriftsteller Xavier Eyma, der vor allem zwischen Saint-Pierre auf Martinique, Paris und New Orleans unterwegs war, darum, die Debatten in New Orleans dahingehend zu beeinflussen, dass die Südstaaten der Vereinigten Staaten nicht auch die Sklaverei abschafften – wie es im französischen Kolonialreich bereits 1848 geschehen war. Seine Beschreibungen des Ideen- und Erfahrungs-Transfers, die über ein
129 130 131
Abel: Transatlantisches KörperDenken. Tapia y Rivera: La palma del cacique, S. 54. Abel: Transatlantisches KörperDenken.
116
immenses narratives wie essayistisches Werk vermittelt werden, bewegen sich entlang vielfältiger kolonialer Achsen im Bereich des gesamten französischen, aber auch spanischen Kolonialreichs. So vergleicht er in seinem Essay La vie aux États Unis den Hahnenkampf auf Kuba mit dem Hahnenkampf in Mexiko und in Manila.132 Die Linie Kuba, Mexiko, Philippinen wird bei ihm ganz selbstverständlich vorausgesetzt. «Les combats de coqs sont aussi populaires à Cuba qu’au Mexique et à Manille. C’est l’après-midi du dimanche qu’ils se donnent dans les villages de l’intérieur de l’île.»133 Ebenso selbstverständlich vergleicht Eyma Pflanzer auf Kuba mit Pflanzern in Louisiana: Je dois dire que les planteurs de l’île de Cuba sont incontestablement les plus nobles cœurs du monde. Les planteurs du Sud, aux Etats-Unis, forment une population charmante. Beaucoup sont riches, tous sont hospitaliers, plusieurs sont intelligents, éclairés et délicats ; mais ils ne surpassent point les planteurs cubains en raffinement, en intelligence et en richesse. Quant à la fortune, il est douteux qu’on puisse rencontrer au monde des hommes plus opulents que les plus opulents des planteurs cubains.134
Bemerkenswert ist seine Offenheit für den spanischen Kolonialismus, den er dafür lobt, dass er in der Lage ist, Kuba zu halten, La siempre fiel, ja, den er sogar dem französischen Kolonialreich als Vorbild hinzuhalten scheint.135 Eyma denkt in kolonialen Systemen, deren Kulturen er aber durchaus miteinander vergleicht – die politischen Kulturen eingeschlossen. Die französische kreolische Oberschicht ist in seiner Sichtweise durch ein enges Band in den verschiedensten Weltregionen miteinander verbunden. So lobt er die Louisiana-Kreolen und stellt außerdem die französische «kreolische Rasse» weltweit der angelsächsischen gegenüber. In Bezug auf die fast geteilte Stadt New Orleans schreibt er: «Il y a plus que de l’antipathie politique aujourd’hui, il y a absence de sympathie sociale entre la race créole et la race anglo-saxonne.»136 Ähnlich globale Vorstellungen regionaler Zusammenhänge legt Eyma seinem Roman Le roi des tropiques zugrunde. Hier wird weder inner- noch zirkumkaribisch unterschieden: die Tropen bilden eine Zone. Ette hat darauf hingewiesen, dass die Tropen einen Mittelpunkt und Übergangsraum, Zentrum des Erdballs (oder Erdapfels) und Schwelle zum Anderen einer den Europäern vertrauten Welt zugleich bilden: eine Kippfigur, die in der abendländischen Bildtradition immer wieder neu gestaltet und ebenso künstlerisch wie kartographisch ausgemalt wurde.137
132 133 134 135 136 137
Xavier Eyma: La Vie aux Etats-Unis. Notes de voyage. Paris: Plon 1876, S. 280. Ebda., S. 274. Ebda., S. 267. Ebda., S. 266. Ebda., S. 47. Vgl. Ottmar Ette: Diskurse der Tropen – Tropen der Diskurse: Transarealer Raum und literarische Bewegungen zwischen den Wendekreisen. In: Wolfgang Hallet, Birgit Neumann (Hg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld: Transcript 2009, S. 139–165, hier S. 142.
117
Während die Beispiele von Levilloux und Maynard de Queilhe darauf hindeuten, dass sich Transfers auf einer eindimensionalen bipolaren Achse zwischen Mutterland und Kolonie abspielen, haben die Transfers bei Eyma durchaus mehrdimensionalen Charakter. Er hat als Referenzrahmen nicht nur den zirkumkaribischen Raum, sondern geht mit den Philippinen auch weit über ihn hinaus. Dass Manila mehrere Jahrhunderte unter spanischer Fremdherrschaft und Einfluss stand, liegt an der strategischen Lage auf dem Seeweg vom amerikanischen Kontinent nach Asien und vor allem China. Die Silberroute, die insbesondere vor dem 19. Jahrhundert florierte, brachte immer wieder spanische Handelsgaleeren in die Philippinen, die neben dem Edelmetall und Luxuswaren aus Asien auch Kulturgüter brachten. So entstand eine enge Beziehung zwischen Philippinen und Mexiko, die sich auch in der Literaturproduktion niederschlug und dazu beitrug, dass die Typographie der Philippinen eng mit der des spanischen Vizekönigreichs verbunden war. Viele, die ihre literarische Karriere auf den Philippinen begonnen hatten, erhielten die Möglichkeit, ihre intellektuelle Arbeit in Mexiko zu präsentieren. Unter ihnen waren beispielsweise der Vater der Buchdruckerei Manilas, der Dominikaner Francisco Blancas de San José; Doktor Don Antonio de Morga, Gouverneur der Philippinen, Richter der Real Audiencia de México und Präsident der Audiencia en San Francisco de Quito; Don Diego de Camacho y Ávila, erst Erzbischof von Manila und dann Bischof von Guadalajara; der in Puebla geborene Ordensbruder und spätere Bischof von Nueva Segovia (Philippinen), Diego de Gorozpe.138 Die Öffnung auf die Philippinen führt bei Eyma allerdings nicht zu einer Infragestellung des kolonialen Status quo. Im Gegenteil, er affirmiert Frankreich als Kolonialmacht, wo er nur kann. Ganz im Sinne der Idee der mission civilisatrice hat Frankreich erfolgreich seine koloniale und kulturelle Strahlungskraft umgesetzt, auch wenn Eyma die Abschaffung der Sklaverei als einen schwerwiegenden Fehler bedauert und am liebsten das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen scheint. Was bei Eyma auf einer literarischen Ebene stattfindet, erfährt eine aktuelle wissenschaftsparadigmatische Ausrichtung in den jüngeren Publikationen von Ottmar Ette, in denen er programmatisch für eine weitere konzeptuelle Öffnung der Karibikforschung über den Atlantik hinaus und für eine Integration des pazifischen Archipels in die Untersuchung der hemisphärischen Transferprozesse des 19. Jahrhunderts plädiert. Die Wahrnehmung der karibischen Inseln nahm von Beginn an ihren Lauf als transarchipelische Inselfiktion, indem Kolumbus, ausgehend von Marco Polo, Amerika als Asien erfand. Erst der Kubaner José Martí und der Philippine José Rizal hatten zum ausgehenden 19. Jahrhundert die seit Marco Polo herrschende Fiktion des kolonialen Kaleidoskops zerstört und ihre Archipele als translokale Welten begriffen, in deren Wirbelstürmen die kolonialen Systeme verschwinden würden. Ette beschreibt den karibischen Archi-
138
Pablo Laslo (Hg.): Breve antología de la poesía filipina. Poetas habla española. Vorwort von Luis G. Miranda. México, D. F: B. Costa-Amic 1966, S. 9.
118
pel als fraktale Welt, der eine «translokalisierte, lokale Diversität» mit anderen Archipelzonen tropischer Konsumprodukte teilt. In letzter Konsequenz würde dieser Ansatz dazu führen, die Karibik im globalen Kontext noch radikaler zu dynamisieren und in vektorialen Modellen zu verstehen.139
III.8. Zwischen Literatur und Naturwissenschaft Die Inselnatur der Karibik erfährt im 19. Jahrhundert großes Interesse, und zwar von zwei Seiten: zum einen als wildromantische oder paradiesische Kulisse literarischer Werke, zum anderen als Untersuchungsobjekt Forschungsreisender.140 Die Literatur begeisterte sich im Gefolge Rousseaus allgemein für Landschaftsbeschreibungen; dazu kam die zeitgenössische Modeströmung des literarischen Exotismus, die sich unter anderem in der Schilderung der üppigen Tropenvegetation und anderer fremdartiger Naturschauspiele äußerte. Auf der anderen Seite war der karibische Archipel das Ziel geographisch-naturwissenschaftlicher Expeditionen, die Flora, Fauna, geologische Beschaffenheit etc. erforschten. Ein genauerer Blick offenbart jedoch, dass diese beiden Bereiche keineswegs so isoliert voneinander betrachtet werden können, wie es vielleicht den Anschein hat. Zwischen Literatur und wissenschaftlichen Naturbeschreibungen gab es zahlreiche wechselseitige Befruchtungen und Übertragungen. Diese Transferprozesse prägen im 19. Jahrhundert beide Genres entscheidend. Im Vorwort zu seinem Roman Eugène de Cerceil ou les Caraïbes verweist J. H. J. Coussin auf den ästhetischen Wert der Landschaftsbeschreibungen in naturwissenschaftlichen Werken der Forschungsreisenden, die die Entwicklung hin zu einem schwärmerischen Genuss und einer literarischen Verarbeitung der Natur mit angestoßen haben: La passion de l’histoire naturelle qui se développa avec force en France vers la fin du 18e siècle, servit aussi à augmenter le goût du pittoresque. Les botanistes, les géologues surtout visitèrent des déserts ignorés de tout le monde […]. L’imagination de ces voyageurs, amis des sciences, sut apercevoir dans ces sites jusqu’alors inexplorés, un charme que plusieurs d’entre’eux réussirent à faire passer dans leurs écrits. Les hommes véritablement sensibles se passionnèrent pour ce genre de beautés si longtemps négligées ; les autres firent semblant de les aimer parce que c’étoit la mode ; et depuis lors, ce fut l’usage de presque tous les voyageurs, qui aspiroient à la réputation d’hommes de goût, de se détourner de leur chemin, pour aller admirer des précipices, des cascades, des grottes, des scènes de désert enfin, auxquelles personne ne s’avisoit de songer autrefois.141
Die Kontamination zwischen literarischer und wissenschaftlicher Naturbetrachtung fand genauso auch in umgekehrter Richtung statt. Immer wieder finden sich in den zeitgenössischen Romanen lange Passagen, die Bezug auf die Natur-
139 140 141
Vgl. Ottmar Ette: Le monde transarchipélien de la Caraïbe coloniale. In: Ette, Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales, S. 23–64. Ich danke Marion Schotsch für konzeptionell entscheidende Hinweise und Recherche in diesem Teilkapitel. Coussin: Eugène de Cerceil, Bd. I, S. iv–v.
119
forschung nehmen und bisweilen den Charakter von Abhandlungen aufweisen. Prévost de Sansac nimmt in seinem Roman Les amours de Zémédare et Carina den Besuch eines Naturforschers zum Anlass für einen Exkurs über die geologische Beschaffenheit der Insel Martinique: De chez M. le J***, nos voyageurs furent visiter la montagne Pelée ; cette montagne, ses environs et même toute l’île entière, offre des vestiges irrécusables d’éruptions de volcans. On ne voit nulle part, à la Martinique, de montagne primitive, elles ne datent leur formation, si on en juge par les matières qui les composent, que de l’époque de violentes convulsions de la nature, très postérieures à la création du monde. «J’établis cette opinion, dit M. Tamony, sur la très petite quantité de terre végétale qui les recouvre, et que leur intérieur ne contient aucun de ces blocs immenses de pierre dure et autres, qu’on retrouve dans presque toutes celles des autres parties de la terre. Le granit ne se trouve qu’en très petits morceaux roulés, et sur le bord de la mer seulement, ce qui pourrait faire croire qu’il y a été apporté.» Ces naturalistes avaient observé que dans quelques endroits, la couche de terre végétale n’avait guère plus de six pouces d’épaisseur, qu’elle est suivie d’une couche de pierre-ponce épaisse d’un pied environ ; qu’après celle-ci, vient une autre couche de terre végétale, haute de huit à dix pouces, dénuée de toute faculté végétative, qui lui a sans doute été enlevée par l’action des pierres-ponces embrasées qui la couvrirent tout à coup lors de la dernière éruption. Une seconde couche de pierres-ponces venait encore après, et elle était suivie par un lit de terre argileuse teinte par l’oxide rouge de fer ; au-dessous on trouvait de la vraie pruzzolane, que les habitants de Saint-Pierre emploient utilement pour bâtir. M. Tamony se plaignit de n’avoir ramassé que très peu de minéraux importants ; des trapps, des cornéennes calcinées qui contenaient des morceaux de feld-spath, quelques grenats de volcans, des pyroxènes et les substances que l’on trouve le plus fréquemment dans les pays de volcans. Il avait des pierres-ponces extrêmement légères, dont tous les interstices étaient remplis par des paillettes de mica de la plus belle couleur d’or. Il fit voir à Mme Sainprale des sables ferrugineux de diverses qualités qui contenaient de très jolis cristaux microscopiques ; mais le plus pur et le plus fin se trouve, dit-il, en abondance sur le rivage de la mer, au bourg de la case des navires. Il avait aussi de très beaux morceaux docre de toutes les couleurs, […].142
Die in aller Ausführlichkeit zitierte Passage zeigt, dass hier die Elemente der wissenschaftlichen Naturbeschreibung und der fiktionalen Romanhandlung kaum mehr auseinanderzudividieren sind. Die Beschreibung der Realität reibt sich an dem fiktionalen Entwurf, es kommt zu einem Effekt, den Ottmar Ette als Friktion beschrieben hat143 und der besonders häufig in Reiseberichten und Biographien anzutreffen ist. Im Kontext der Karibik sind aber nicht nur Naturbeschreibungen vom Phänomen der Friktion betroffen, es erstreckt sich auch auf andere Bereiche der wissenschaftlichen Welterfassung, beispielsweise die frühen ethnologischen Studien, die im nächsten Kapitel anhand ausgewählter Zeitschriften genauer unter die
142 143
Prévost de Sansac: Les amours, S. 91f. Ottmar Ette: Eine Literatur ohne festen Wohnsitz. Fiktionen und Friktionen der kubanischen Literatur im 20. Jahrhundert. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes (Heidelberg) XXVIII, 3–4 (2004), S. 457–481.
120
Lupe genommen werden. An dieser Stelle sei als Beispiel eine weitere Passage aus Prévost de Sansacs Roman zitiert, die mit «Observations du curé de GrosMorne sur les moyens de reconnaître le caractère par l’étude des physionomies» überschrieben ist und in der eingehend auf Physiognomik und Temperamentlehre eingegangen wird. Viele zeitgenössische Geographen und Ethnologen gingen davon aus, dass von der Gesichts- und Kopfform Rückschlüsse auf den Charakter der Menschen möglich seien: Le siège de la physionomie se trouve fréquemment dans les yeux ; on voit rarement quelqu’un avec des yeux noirs être indolent et paresseux par habitude, ceux qui le sont ont les yeux bleus ; chez les yeux bleus la tendresse est plus énergique ; des yeux bien nets manquent rarement d’ordre et de netteté dans l’esprit ; les yeux certains n’aiment rien, quoi qu’ils puissent dire ; les yeux humides aiment beaucoup, et les yeux fort ouverts aiment tout – Les yeux dont les liqueurs sont brouillées inspirent de ta défiance ; les yeux bridés promettent peu d’esprit ; des yeux bien fendus et brillants me disent qu’ils sont animés par une âme saine ; ceux qui sortent de la tête font craindre la bêtise et la méchanceté ; les yeux enfoncés appartiennent quelquefois à un homme envieux et perfide ; s’ils sont trop rapprochés l’un de l’autre, s’ils rendent le regard farouche, on doit s’attendre à de la cruauté ; les yeux de l’homme distrait vous fixent et ne vous voient pas, ils imitent la préoccupation de l’homme studieux, tandis que l’esprit ne songe à rien.144
144
Prévost de Sansac: Les amours, S. 101.
121
IV.
Ethnologische Zirkulationsprozesse
Noch für die Aufklärung, die das Prinzip der Kritik und Selbstkritik begründete, war Europa nicht bloß der Mittelpunkt der Welt, sondern der Inbegriff der ganzen Menschheit. Erst mit der europäischen Romantik wendete sich das Blatt: Der viel zitierte Epochenumbruch hängt damit zusammen, dass mit Beginn des 19. Jahrhunderts die im Repräsentationskonzept begründete klassische Episteme durch eine andere Organisationsform des Wissens abgelöst wird.1 Ein Ausdruck davon ist die Entstehung der Ethnologie, für die die kolonisatorische Situation
1
Vgl. Michel Foucault: Les mots et les choses. Paris: Gallimard 1966, S. 229. Vgl. auch Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 86; Küpper: Ästhetik der Wirklichkeitsdarstellung, S. 64–82. Für wichtige Hinweise in diesem Kapitel zur Ethnologie und den drei ethnologischen Zeitschriften danke ich Hafid Derbal. Wenngleich die außereuropäische Romantik besonders hervorgehoben wird, sei hinzugefügt, dass auch die Aufklärung nur unter Einbezug ihrer außereuropäischen Dimensionen zu verstehen ist. Wichtige Arbeiten über den sich herausbildenden ethnographischen Diskurs im Frankreich der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und der Wende um 1800 sind u.a. die Studien: Jean-Luc Chappey: La Société des Observateurs de l’Homme (1799–1804) des anthropologues au temps de Bonaparte. Paris: Soc. des Études Robespierristes 2002; Jean Copans: Aux origines de l’anthropologie française. Les mémoires de la Soc. des Observateurs de l’Homme en l’An VIII. Vorwort von Jean-Paul Faivre. Paris: Le Sycomore 1978; Michèle Duchet: Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris: Maspero 1971; Michèle Duchet: Le partage des savoirs. Discours historique et discours ethnologique. Paris: Éd. la Découverte 1985; Ottmar Ette: Réflexions européennes sur deux phases de mondialisation accélérée chez Cornelius de Pauw, Georg Forster, Guillaume-Thomas Raynal et Alexandre de Humboldt. In: HiN. Alexander von Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien (Potsdam–Berlin) 11, 21 (2010), S. 1–28. Online verfügbar unter: http://www.hin-online. de [15.03.2011]; Lüsebrink: Das Europa der Aufklärung, S. 10f. Von großer Bedeutung ist auch der Beitrag der (Exil)Jesuiten zur Herausbildung ethnographischen Wissens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, für Südamerika wie für den transkulturellen Raum der Karibik. Vgl. Hans-Jürgen Lüsebrink: Missionarische Fremdheitserfahrung und anthropologischer Diskurs. Zu den Nachrichten von der Amerikanischen Halbinsel Californien (1772) des elsässischen Jesuitenmissionars Johann Jakob Baegert. In: Sabine Hofmann, Monika Wehrheim (Hg.): Lateinamerika. Orte und Ordnungen des Wissens. Festschrift für Birgit Scharlau. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2004, S. 69–82; Manfred Tietz, Dietrich Briesemeister (Hg.). Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII (Actas del coloquio internacional de Berlín, 07.–10.04.1999). Frankfurt am Main u.a.: Vervuert 2001.
123
unerlässlich ist.2 Die Begegnung mit dem Fremden verweist immer auf die vermittelnde Subjektivität des Beobachters zurück.3 Der Einfluss der Wissenschaften und ihrer neuen Infrastruktur trug nicht nur seinerseits dazu bei, die imperialen Diskurse Frankreichs zu festigen, er verlieh dem napoleonischen Intermezzo in Übersee eine kulturelle Dimension, die sich viel nachhaltiger auswirkte als die eigentliche politische Herrschaft. Eine Neuorganisation der Erkenntnisgrundlagen wie in Frankreich hat es in Spanien nicht gegeben. Die (von Napoleon eingeführten) großen Pariser Lehr- und Forschungsinstitute tragen bei zur Entwicklung von Archäologie, Linguistik, Historiographie, Orientstudien und Experimentalbiologie. Häufig zitieren die Romanautoren den akademisch gelenkten Diskurs über die überseeischen Besitzungen.4 Durch die Etablierung der Ethnologie als neuer Wissensform entstand ein geistiges Klima, das die unterschiedlichsten Diskursformationen über den Andern legitimierte und – im Gegensatz zu früheren Vermittlungen des bon sauvage aus dem 18. Jahrhundert – besonders forcierte. Wissenschaft ist zu diesem Zeitpunkt in Europa in ihrer verselbstständigten Eigenlogik «Impulsgeber und Mittel europäischer Expansionspolitik zugleich»5. Als Folie für die folgenden Betrachtungen der Rezeption ethnologischen Wissens aus der Karibik soll zunächst ein Panorama der zeitgenössischen Rasse-Diskurse in Frankreich und Spanien skizziert werden. Mit den Pariser Zeitschriften Revue des Colonies, Revue des deux mondes und Revue encyclopédique stehen drei französische Publikationsorgane im Mittelpunkt, die repräsentativ sind für das Verhandeln kolonialer Fragen innerhalb spezifisch karibischer Diskurse zu einem Zeitpunkt, in dem Paris als privilegiertes Zentrum von Wissenszirkulationen fungierte. Alle drei entstanden zwischen 1820 und 1830. Während die Revue des Colonies und die Revue encyclopédique nur eine kurze Hochphase hatten, sehr spezialisiert waren, für ein begrenztes Publikum schrieben und recht schnell eingestellt wurden, besteht die mehr am Establishment orientierte Revue des deux mondes bis heute. Inhaltlich präsentieren alle drei Zeitschriften kulturwissenschaftliche Fragestellungen, die auf Grund der gerade erst beginnenden Spartentrennung keine eindeutige Zuordnung erfahren. Das Themenfeld umfasst Ethnologie, Kolonialismus, Literatur, Literaturgeschichte und Kultur. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehen in Frankreich viele Zeitschriften, die von nur kurzer Lebensdauer sind.
2
3 4
5
Vgl. Fink-Eitel: Die Philosophie und die Wilden, S. 211. Fink-Eitel bezieht sich hier auf Foucaults Les mots et les choses. Von Bedeutung für die neuen Repräsentationsformen des Anderen sind auch Abbé Raynal und Cornelius de Pauw. Vgl. Ette: Alexander von Humboldt, S. 74f. So Hölz mit Bezug auf Wolfzettel. Vgl. Hölz: Zigeuner, Wilde und Exoten, S. 11. Vgl. Wolfzettel: Entwicklung des französischen Reiseberichts. Dies natürlich nicht nur in Bezug auf die Karibik, sondern auch Afrika, östliche Besitzungen etc., wie beispielsweise Balzac in La Peau de Chagrin oder La cousine Bette. Vgl. auch das Teilkapitel III.8 zur Friktionalität. Ette: Alexander von Humboldt, S. 49.
124
Die Wahl der genannten drei hängt ausschließlich damit zusammen, dass sie vor allem karibische Transferprozesse vermitteln. Da die Forschungsdecke recht dünn ist, erfolgte die Auswahl der einzelnen Gesichtspunkte induktiv. Im Fall der Revue des Colonies und der Revue encyclopédique bilden koloniale Fragen das zentrale Anliegen, daher werden dort Themen herausgefiltert, die für die Beleuchtung kolonialer Transfer- und Zirkulationsprozesse und Fragen vom Zusammenleben besonders relevant scheinen. Demgegenüber werden im Falle der Revue des deux mondes ganze Artikel vorgestellt, die als Zeugnisse früher karibischer Literaturgeschichtsschreibung fungieren. Das Augenmerk soll sich in allen drei Fällen auf die Inszenierung der für diese Studie relevanten Fragen richten und weniger auf eine Beleuchtung der Publikationsorgane als solche. Es spricht für sich, dass Spanien zu diesem Zeitpunkt auf keine vergleichbare Zeitschriftenlandschaft verweisen kann. Über eine Auffächerung unterschiedlicher Themenschwerpunkte soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern die für Frankreich postulierte Kapazität einer Integration6 des Anderen ihren Ausdruck fand. Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass diese Integrationskraft gerade auch über kolonialkritische Medien Verbreitung fand. Ebenso wichtig ist die Frage nach einer Verortung zwischen Bipolarität und Multirelationalität. Und schließlich bleibt zu klären, ob und wie diese Zeitschriften Fragen des Zusammenlebens verhandeln.
IV.1. Labeling People: «Rasse»-Diskurse in Frankreich und Spanien Wolf Lepenies hat mit seiner Untersuchung über Das Ende der Naturgeschichte (1976) gezeigt, wie im Zuge der Aufklärung eine allmähliche Verzeitlichung in den Wissenschaften einsetzt, aus der sich das historische Denken entwickelt. Er macht deutlich, dass die Entdeckung der Zeitperspektive in den heute als naturwissenschaftlich geltenden Disziplinen stattfand. Besonders brisant zeigt sich dies im Übergang von der klassischen Naturgeschichte zur modernen Biologie: durch die rasante Zunahme bekannter Tiere und Pflanzen wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine neue Ordnung des Wissens notwendig, mit der die unüberschaubare Vielfalt der Kataloge und Tableaus, die zumeist alphabetisch geordnet waren, neu strukturiert wurde. Erst die Entwicklung eines historischen Verständnisses der Natur, einer Geschichte der Natur, welche die einzelnen Arten über ihre zeitliche Entwicklung miteinander verknüpfte, erlaubte eine übersichtliche Ordnung der biologischen Erkenntnisse. Lange vor Darwin setzte damit eine Verzeitlichung der Natur ein, bei der die Geschichte des wis-
6
Vgl. zum Begriff der Integration gerade für diesen Aspekt folgenden Hinweis von Lüsebrink: «Mit Integration sind Formen kultureller und sozialer Anpassung an eine dominante Kultur gemeint, bei der jedoch zumindest in einer Übergangsphase wichtige Identitätselemente der Ausgangs- und Herkunftskultur erhalten bleiben, wie Sprache, Rituale und Kleidungscodes.» Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 130.
125
senschaftlichen Objekts erstmals seine Klassifikation bestimmte.7 Das Ende der Naturgeschichte lässt sich indes ohne eine außereuropäische Dimension nicht denken.8 Debatten um diese Dimension wurden in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nirgendwo intensiver geführt als in Paris, dem privilegierten Zentrum von Wissenszirkulationen.9 Hier wurde im Jahr 1839 die Société ethnologique gegründet. Ihr erklärtes Ziel war es, Material zu sammeln, zu koordinieren und zu veröffentlichen, um die unterschiedlichen Menschenrassen, die auf der Erde verbreitet sind oder waren, bekannt zu machen.10 Zu diesem Zweck stellte die Société den Belesenen und Reisenden eine Reihe von Fragen über die physische Beschaffenheit, die Sprache, die Religionen, die Sitten und Bräuche, die Traditionen, den Einfluss von Boden und Klima bei verschiedenen Völkern. In Anlehnung an die Pariser Société ethnologique entstanden weitere Gesellschaften gleichen Namens in London und New York.11 Was war nun aber die Vorgeschichte dieser Ethnologischen Gesellschaft? Die vor allem seit 1789 zunehmenden abolitionistischen Debatten tangierten notwendigerweise eine Reihe von ethnologischen Fragestellungen. Wie Michel Foucault in Les mots et les choses erklärt, beruhte der gesamte klassische Wissensmodus im 17. und 18. Jahrhundert auf Klassifizierung von Spezies. Das Vordringen der Europäer in den Pazifik und das afrikanische Inland, selbst wenn es mehr der Gründung von Handelsposten denn einer Kolonialisierung galt, schuf neue Kontakte und neue Subjekte zum Klassifizieren. Die Studie von Martin Staum12, auf deren Ergebnisse ich mich in den folgenden Ausführungen beziehen werde, zeigt, dass es zeitweise eine Tendenz gab, die neuen Subjekte mehr durch den Raster eines biologischen Determinismus zu betrachten, als sie nach dem Grad ihres kulturellen «Rückstands» oder ihrer «Wildheit» einzuordnen. Diese Sichtweise diente durchaus auch dazu, die Sklaverei «wissenschaftlich» zu rechtfertigen: Fully developed classification of humans by skin and colour emerged only among the naturalists of the late eighteenth century. Ordering «races» by superiority could serve to assuage guilt about slavery, although even anti-slavery authors generally believed in racial hierarchy and African inferiority.13
7 8
9 10 11
12 13
Vgl. www.erzwiss.uni-hamburg.de/inst05/abs.../Kapitel03.pdf [09.02.2011]. Vgl. Ottmar Ette: Europäische Literatur(en) im globalen Kontext. Literaturen für Europa. In: Özkan Ezli, Dorothee Kimmich u.a. (Hg.): Wider den Kulturenzwang. Migration, Kulturalisierung und Weltliteratur. Bielefeld: Transcript 2009, S. 257–296, hier S. 262. Vgl. Ette: Alexander von Humboldt, S. 115. Ich verwende den Rasse-Begriff in den folgenden Ausführungen in Anlehnung an die zeitgenössischen Diskurse. Vgl. den ersten, Paris gewidmeten Teil des Artikels von Charles Louandre: De l’association littéraire et scientifique en France. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, Bd. XVI (1846), S. 512–537. Martin S. Staum: Labeling People. French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815–1848. Montreal u.a.: McGill-Queens Univ. Press 2003. Ebda., S. 8.
126
Zwischen 1800 und 1850 setzte sich das strikte physische Kriterium endgültig durch. Und mit der nunmehr unausweichlichen Natur der «Rasse» führte kein Weg mehr vorbei an der Kennzeichnung (labeling). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dann führte die Evolutionstheorie sowohl in der Biologie als auch in der Soziologie zu einer Wiederbelebung des Rückstandsmodells.14 Die Klassifizierungen bedeuteten nicht unbedingt, dass die Eigenschaften und Fähigkeiten der einzelnen Völker als festgelegt und unabänderlich betrachtet wurden. Viele europäische Philosophen (Smith, Turgot) des 18. Jahrhunderts wandten sich vom Mythos des «edlen Wilden» ab, der als Kontrast für die europäische Unvollkommenheit diente. Sie nahmen an, dass alle Völker den gleichen Lebenszyklus durchlaufen, um höhere Entwicklungsstufen zu erklimmen. Die Klassifizierung der Menschen nach ihren äußeren Merkmalen im 18. Jahrhundert kann auch in einem spezifischen sozialen Kontext Frankreichs gesehen werden. In dieser Zeit waren Kleidungsvorschriften und Konsumvorlieben im Wandel. Dies machte die Unterscheidung der sozialen Herkunft und Schicht schwierig. Die reiche Bourgeoisie konnte nun die Aristokratie nachahmen und ehemals sichtbare Grenzen wurden verwischt. Die Revolution hob endgültig alle Verzierungsverbote und Kleiderordnungen auf und verschärfte damit die bereits vorhandenen Tendenzen noch.15 Um so entscheidender war in dieser Situation beispielsweise das Deuten der menschlichen Kopfform, um geeignete Angestellte oder gar passende Heiratskandidaten zu finden.16 In einer Ära der sozialen Umwälzungen, der wirtschaftlichen Rivalitäten auf globaler Skala und der wachsenden Neigung, Menschen zu kennzeichnen, stieg das Interesse an den aufkommenden Humanwissenschaften.17 Man war interessiert daran, Gesetzmäßigkeiten im menschlichen Verhalten aufzustellen. Vor diesem Hintergrund ist die Gründung diverser wissenschaftlicher Gesellschaften zu sehen: Den Anfang machte im Jahr 1821 die Société de Géographie de Paris (SGP), die sich aus aktiven Forschungsreisenden, Geographie-Theoretikern und Linguisten zusammensetzte.18 Sie artikulierten das Ziel, mittels französischer Wirtschaftsintervention die gesamte übrige Welt zu dominieren. Die SGP trug dazu bei, Theorien zur Hierarchisierung der Völker zu entwickeln, auch mit dem Ziel, die französische Herrschaft über sie zu legitimieren. Nach 1830 etablierte sich eine viel kleinere Gruppe, die Société phrénologique de Paris (SPP), die sich mit einer Schädellehre befasste. Sie behauptete, Intelligenz und Charakter allein anhand der Kopfform deuten zu können. Diese Gruppe fand nur beschränkte Anerkennung bei den wissenschaftlichen, medizinischen
14 15
16 17 18
Vgl. ebda., S. 8. Vgl. zu Mode-Transfers die Studien von Gertrud Lehnert, z. B. Gertrud Lehnert: Des «robes à la turque» et autres orientalismes à la mode. In: Anja Bandau, Marcel Dorigny u.a. (Hg.): Paris Croisé, ou comment le monde extra-européen est venu dans la capitale française (1760–1800). Paris: Karthala 2010, S. 183–200. Vgl. Staum: Labeling People, S. 9. Vgl. ebda., S. 10. Zur Naturgeographie vgl. auch Lüsebrink: Das Europa der Aufklärung, S. 11.
127
und intellektuellen Größen dieser Zeit. Deshalb konnte sich die Phrenologie nie zu einer experimentellen Psychologie wandeln. 1839 versammelte der Physiker William Frédéric Edwards eine Gruppe von Geographen und Linguisten, um die Société ethnologique de Paris (SEP) zu gründen. Dies geschah aus dem expliziten Beweggrund, die humane Vielfalt zu studieren und die Verbesserungsfähigkeit der verschiedenen Rassen zu bewerten. Sie untergruben die in Frankreich traditionelle Theorie, die besagt, dass alle unterworfenen Völker als genauso erziehbar wie die französischen Bürger zu betrachten seien. Das gemeinsame Thema dieser drei Gesellschaften (SGP, SPP, SEP) war die Frage nach den Entwicklungsmöglichkeiten der Individuen und Rassen; keine dieser Gesellschaften war jedoch monolithisch. Sie haben dazu beigetragen, dass das Deuten der Schädelformen zu einem wesentlichen Forschungsgegenstand der Anthropologen wurde. Zwar ließ der Schock der Revolution von 1848 sowohl die SPP als auch die SEP auseinanderbrechen, aber die Diskurse der Ethnologen lieferten den Entwurf für die physische Anthropologie, die in der 1859 gegründeten Société d’anthropologie de Paris (SAP) angesiedelt war und von Paul Broca angeführt wurde.19 Die Arbeiten des Schweden Carl von Linné (Linnaeus 1707–1778) lieferten zweifellos das Vorbild für jene quasi-hierarchische Aufteilung menschlicher Vielfalt, die später mittels geometrischer Bestimmung der «Gesichtswinkel» und der Kunst der Profilphysiognomik fortgesetzt wurde. Der holländische Anatom, Künstler und Wundarzt Petrus Camper (1722–1789) führte die neue Methode der Gesichtsform-Messung ein, um die Einheit der Menschen zu demonstrieren und sie von der Tierwelt abzugrenzen. Er widersprach Auffassungen, wonach Afrikaner (Winkel von etwa 70 %) dem Orang-Utan (58 %) näher seien als den Europäern (80 %). Auch wenn er keine rassistischen Ansichten vertrat, bildete seine Arbeit den Grundstein für spätere hierarchische Rasseneinteilungen, die den Winkelabstand von Affen und Afrikanern als einander viel näher berechneten als denjenigen von Afrikanern und Europäern. So auch Georges Cuvier und Etienne Geoffroy Saint-Hilaire.20 Eine weitere einflussreiche Arbeit aus dieser Zeit waren die physiognomischen Illustrationen des Schweizer Pastors Johann Caspar Lavater (1741–1801), die große Auflagen erzielten. Für ihn spiegelte die Schönheit des Gesichts die Schönheit der Seele. Er hoffte, aus der Physiognomik eine echte Wissenschaft zu machen, die aufgrund verschiedener Merkmale des Kopfes und Gesichts Rückschlüsse auf Intellekt und Charakter zuließe. Anders als die Phrenologie, wurde die Physiognomik von konservativen Eliten geduldet, weil sie nicht den Glauben an die Existenz einer menschlichen Seele in Frage stellte. Zu den führenden Rassentheoretikern gehörte, neben anderen, auch der Pharmazeut Julien-Joseph Virey (1775–1846), der großen Einfluss auf die Polyge-
19 20
Vgl. Staum: Labeling People, S. 12. Vgl. ebda., S. 26f.
128
nismus-Vertreter wie Bory de Saint-Vincent und Honoré Jacquinot hatte. Er war besonders in den 1830er-Jahren politisch aktiv und für seine ausgeprägten Hetzreden gegen Schwarze bekannt, die teils durch seine Erfahrungen der haitianischen Revolution erklärt werden konnten. Zwar vertrat auch er die Auffassung, dass kein Mensch dem Affen glich, er betonte jedoch, dass manche dem Affen näher seien als andere. Die vollen Konsequenzen dieses Denkens artikulieren sich in seinen Arbeiten ab 1824, als er die menschliche Spezies in zwei Unterarten unterteilte und sie durch den «Gesichtswinkel» über und unter 80° festmachte. Laut Virey schloss die Rasse unter 80° die Menschen ein, die dem Orang-Utan am nächsten seien. Die universale Entwicklung der «Wilden» hin zur Zivilisation war nun aus der Diskussion verschwunden, und Virey wiederholte bei mehreren Vorträgen, dass die «Neger sich nicht selbst zivilisieren können»21. Er lieferte somit den Sklavereibefürwortern Argumente, war jedoch selbst nicht unbedingt für die Sklaverei. Zwar ging er in seinem Artikel «Nègres» von 1803 davon aus, dass die Schwarzen ewig versklavt sein würden, doch später behauptete er sogar, Teile seiner Arbeit prangerten die Missstände und Missbräuche des Sklavereisystems an und höben die Notwendigkeit hervor, den emanzipierten Sklaven bei dem Aufstieg zur Zivilisation zu helfen. Staum schreibt: «Virey in this manner endorsed a position that would echo through anthropologists’ manifestoes of the late 19th century. Inequality was assumed, but Europeans could assist inferior races to reach their full, if limited, potential.»22 IV.1.1. Die Phrenologie Die Phrenologie geht auf die Schädellehre oder «Organologie» von Franz-Joseph Gall (1758–1828) und Johann Caspar Spurzheim (1776–1832) zurück, die mit ihren komparativen Schädelmessungen die Klassifizierungsmodelle bis weit in die 1840er-Jahre beeinflusst haben.23 Die größten Bemühungen, die Phrenologie institutionell als Wissenschaft zu etablieren, kamen durch eine Kooperation von Physikern und liberalen Philanthropen im Jahr 1830 zustande und führten zur Gründung der Société phrénologique de Paris (SPP). Die Mitglieder verpflichteten sich, die Doktrin von Gall zu verbreiten und den Fortschritt der Aufklärung zu unterstützen, und sie weiteten ihre Arbeit auf mehrere französische Großstädte aus. Politisch waren sie im Mitte-Links-Lager bei den Orléanisten einzuordnen. Gall unterstellt in seiner «Organologie» einen Zusammenhang zwischen Schädel- und Gehirnform einerseits und Charakter und Geistesgaben andererseits. Eigentlich hätte man erwarten können, dass die Phrenologie die Grundlage für eine rassische Gleichheit entwickelt, jedoch schrieben schon Gall und Spurzheim einigen Völkern bestimmte Eigenschaften zu. Später folgten Phrenologen, die zwischen erziehbaren Europäern und nicht zu erlösenden Wilden unterschieden
21 22 23
Vgl. ebda., S. 40ff., hier S. 43. Vgl. ebda., S. 43. Vgl. ebda., S. 48.
129
– so beispielsweise auch im Phrenological Journal aus Edinburgh.24 Andere entwickelten ihre Theorien auf Auslandsreisen: Ab den 1830ern spielten vor allem die neu erschlossenen nordafrikanischen Gebiete eine große Rolle, daneben der Pazifik und andere Teile Afrikas, wobei durchaus auch innergesellschaftliche Einstufungen vorgenommen wurden – Bauern, Häftlinge, etc. Stets spielte die Frage nach der Erziehbarkeit eine große Rolle, also inwiefern die menschlichen Dispositionen durch Erziehung zu verbessern wären. Grundsätzlich sind sich die meisten Phrenologen einig, dass die verschiedenen «Spezies» erziehbar sind, oft jedoch werden Auffassungen deutlich, die manchen Ethnien klare, durch ihr Gehirn und ihre Schädelform vorgegebene Grenzen setzen. Dabei werden bei fast allen die Afrikaner beziehungsweise «Neger» hierarchisch an die unterste Stelle gestellt. In diese Richtung argumentiert auch Joseph Vimont (1795–1857), der vor dem Hintergrund der Informationen über Haiti und Sierra Leone meinte, die Emanzipation der Sklaven sei nicht wünschenswert, weil Schwarze nicht in der Lage seien, ein Staatswesen zu organisieren. Andere, wie Victor Courtet im Jahr 1838, waren der Ansicht, nur eine Vermischung der Rassen könne Ungleichheiten aufheben. Ähnlich äußerte sich der Journalist Julien Le Rousseau, nur dass er für diese Vermischung eine Kolonialisierung als wünschenswert erachtete.25 Spurzheim glaubte nur bedingt an Erziehung als Mittel, das einzelne Individuum zu verbessern. Er war strikt gegen eine Rassenvermischung – auch innerhalb der französischen Gesellschaft – und befürwortete Heiratsgesetze, die eine solche verhindern sollten. Die meisten Phrenologen, wie auch Spurzheim, teilten den funktionalistischen Gesellschaftsentwurf eines Saint-Simon26, hatten jedoch nicht die gleichen Ansprüche an Egalitarismus und soziale Gerechtigkeit.27 Aber es gab durchaus auch Vertreter, die Phrenologie und Sozialismus zusammenführten, so beispielsweise Le Rousseau oder Jean-Baptiste Mège. In diesen ganzen Debatten wird deutlich, wie stark die Diskussionen und die Forschungslinien geprägt wurden von den wichtigsten Themen der Zeit: Demokratie, Revolution, Kolonialismus, soziale Ordnung, zudem Verbesserung der Lebensbedingungen etwa für Häftlinge oder die Bauernschicht. Die Wissenschaft musste sich legitimieren und Erklärungsansätze schaffen. Dabei spielte es keine Rolle, dass diese Erklärungsansätze nicht selten von wirtschaftlichen und machtpolitischen Impulsen motiviert oder zumindest beeinflusst waren, wichtig blieb, dass es eine empirische Deutung gab. Sowohl Phrenologie als Physiognomik lieferten Deutungsmuster und Legitimation für bestimmte politische Positionen
24 25 26
27
Vgl. ebda., S. 57. Vgl. ebda., S. 62f. Henri de Saint-Simon (1760–1825) entstammte dem französischen Hochadel und vertrat liberale und egalitäre Positionen. Während der Restauration verfasste er vielbeachtete soziologische und philosophische Schriften, auf die sich der frühsozialistische SaintSimonismus berief. Vgl. Staum: Labeling People, S. 66f.
130
in nationalen und internationalen Fragen, gerade vor dem Hintergrund, dass sie um ihre Institutionalisierung rangen. Staum fragt sich, warum die Phrenologie schließlich nicht zu einer Art Muster für eine wissenschaftliche physiologische Psychologie geworden ist, und mutmaßt, die Gründe könnten zum einen in der weltanschaulichen Gegnerschaft der bekanntesten französischen Wissenschaftler liegen (Cuvier, der Sekretär der Académie des Sciences, nannte Gall einen Scharlatan), zum anderen aber auch in den empirischen Defiziten der jungen Disziplin. Die Phrenologen konnten sich untereinander nicht über die genaue Lage und Wichtigkeit von Gehirnorganen einigen.28 Staum sieht aber trotzdem eine «Wissensproduktion» in der Phrenologie: «Certainly, phrenology called for a kind of Foucauldian exercise in authority and power – an arena in which to build and solidify its knowledge.»29 Obwohl in den 1840ern führende Physiker und Physiologen die Phrenologie angriffen, blieb sie bis Ende des 19. Jahrhunderts «aktiv» und war Teil von regelrechten Langzeitexperimenten seitens der SAP. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Phrenologie eine säkulare und naturalistische Sicht der Selbstverbesserung verbreitete, was antiklerikale Kräfte auf den Plan rief, aber auch – wenngleich deutlich seltener – Kleriker wie Abbé Frère und Abbé Besnard.30 IV.1.2. Geographie und Imperialismus Phrenologen untersuchten Völker ursprünglich auf rein individueller Ebene, die geographischen und ethnologischen Gesellschaften hingegen sahen es als ihre vordringliche Aufgabe an, menschliche Gruppen weltweit als Ganzes zu studieren. Sie unterstützten die Idee einer europäischen Führung, die dringend gebraucht würde, um die diversen Völker zu zivilisieren.31 Es besteht Konsens darüber, dass die geographischen Gesellschaften des späten 19. Jahrhunderts bedeutende Lobbyisten des französischen Imperialismus waren. So haben Mitglieder der 1821 gegründeten Société de Géographie de Paris (SGP) mit den verbündeten Kollegen auf ihren Expeditionen dazu beigetragen, vermeintlich wissenschaftliche rassische Hierarchien aufzubauen, die für die imperialistische Unternehmung überaus nützlich waren.32 In diesem Kontext ist von Bedeutung, dass zahlreiche Geographen schon vor Gründung der SGP zunehmend in expansive Regierungsprojekte eingebunden waren. Einer der wichtigsten Gründer der SGP, Edme-François Jomard (1777–1862), hatte beispielsweise als Geographieingenieur bei den napoleonischen Feldzügen in Ägypten gearbeitet und pries noch 1859 die französische mission civilisatrice.
28 29 30 31 32
Ebda., S. 76–79. Ebda., S. 76. Vgl. ebda., S. 81. Vgl. ebda., S. 84. Vgl. ebda., S. 86.
131
In seinen Studien zu Arabien bemerkt er im Jahr 1839: «[…] ethnology is the science of geography itself seen as a whole and in its highest generality. [It was] urgent to know thoroughly the degree of civilization of all races to have relations between them and us which are more certain and advantageous».33 Dabei wurden manche Völker als kulturell und sozial «zurückgeblieben» oder organisch defizitär beschrieben. Bereits ab dem 18. Jahrhundert entwickelten Geographen und Forschungsreisende auf dieser Basis «Zurückgebliebenheitsmodelle» (retardation models) und eine unumgängliche Abfolge von Entwicklungsschritten auf dem Weg von der Wildheit hin zur Zivilisierung. Europäer sollten den kindlichen Spezies beistehen und beim Erwachsenwerden helfen: Such argument foreshadowed the ideology of assimilationism prominent throughout the 19th century in French imperial theory. The French mission was to lead non-Europeans to civilization. By means of the French language, Christianity, its associated morality, and superior science and technology, the French would develop the intellectual and moral faculties of the colonized.34
Zu dieser dominanten Theorie der Zivilisierung und Assimilierung der Kolonisierten boten die aufkommenden soziologischen Studien ein konkurrierendes Modell. Vor 1848 unterschieden die Mitglieder der SGP und der SEP aufgrund rassischer Unterschiede – oft mit Hilfe der Gesichtswinkelmessung – mehrheitlich zwischen entwicklungsfähigen und nicht entwicklungsfähigen Völkern.35 Sie gehen entweder von mehreren menschlichen Spezies mit unterschiedlichem Verbesserungspotential oder von einer Spezies mit schwer zu überwindenden Rassencharakteristika aus. Die meisten hielten eine Verbesserung der Rassentypen folglich für unwahrscheinlich und standen einer Assimilierungspolitik daher skeptischer gegenüber.36 Je mehr erkundet und klassifiziert wurde, desto größer wurde die Tendenz zu behaupten, manche Rassen seien entweder «unzivilisierbar» oder nur mit europäischer Hilfe «zivilisierbar»: The alleged disparities within the human species, combined with commercial or strategic motivations, provided a synergy between theories of race and projects of empire. In this fashion scientific studies of ethno-geographers gave aid and comfort to French expansion even before the heyday of imperialism and the distinctive Third Republic version of the civilizing mission.37
Schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts artikulierten die Franzosen eine Art mission civilisatrice, und ab der Mitte des Jahrhunderts ließen ein streng hierarchisch
33 34 35 36
37
Edme François Jomard: Études géographiques et historiques sur l’Arabie. Paris: Firmin Didot Frères 1839, zit. nach Staum: Labeling People, S. 91. Staum: Labeling People, S. 86f. Vgl. ebda., S. 87ff. Ebda., S. 100. Es gab jedoch auch immer Stimmen, die eine starre Festlegung durch Rassenmerkmale nicht akzeptierten. Beachtenswert ist hier die Position Alexander von Humboldts, der von 1844 bis 1845 Präsident der SGP war. Er lehnte jegliche Form von hierarchischer Rassentrennung ab. Ebda., S. 120.
132
gedachter Monogenismus oder alternativ ein rigider Polygenismus die brutalen Formen der imperialen Politik erahnen, die gegen Ende des Jahrhunderts die Assimilation der Kolonisierten verwarf und sie zu Menschen zweiter Klasse degradierte. Michael Heffernan argumentiert in seinem Buch The Science of Empire, dass die verschiedenen ethnographischen Gesellschaften wünschten, Frankreich möge seine kulturelle Vitalität demonstrieren und kolonisierte Gebiete unterwerfen oder assimilieren. Er kommt zu dem Schluss, die Geographie sei – ungeachtet der diversen Spielarten des Imperialismus – größtenteils eine imperiale Wissenschaft (science of empire): «Geographers provided practical knowledge for those planning colonial ventures, and scholars helped justify and advance government objectives.»38 IV.1.3. Ethnologie, Anthropologie und Zivilisierung der «Rassen» Die Ethnologie machte es sich ganz allgemein zur Aufgabe, die Eigenarten des Menschen herauszuarbeiten. Die Beziehungen zwischen Geographie und Ethnologie waren dabei recht eng: zahlreiche Geographen beteiligten sich 1839 an der Gründung der Société ethnologique de Paris (SEP) und viele Mitglieder der SGP waren an den Völkerbeschreibungen durch die Forscher der SEP interessiert. Die SEP war somit Teil eines allgemeinen Interesses für die Vielfalt der Nichteuropäer, das sich quer durch Europa und Nordamerika zog. Durch die anhaltende Debatte über die Zivilisationsfähigkeit der verschiedenen Völker wurden allerdings Zweifel laut, ob diese überhaupt zu einer einzigen Menschheit gehören. An dieser Frage schieden sich die Geister, so dass sich die frühen Ethnologen grob in drei Gruppen unterteilen lassen: die Polygenisten, die Vertreter eines hierarchischen Monogenismus und die Verfechter des Egalitarismus. Großen Einfluss auf die SEP hatten die bereits genannten Rassentheoretiker Joseph Virey und Bory de Saint-Vincent, die beide mehr an verschiedene Spezies als an verschiedene Varietäten innerhalb der Menschheit glaubten und die sich beide in den 1820er-Jahren gegen die Sklaverei aussprachen, wobei Virey 1803 noch die Sklaverei als «das ewige Schicksal der Neger» beschworen hatte.39 Als die SEP gegründet wurde, sahen die Mitglieder ihre Arbeit vorrangig als eine wissenschaftliche Mission und nicht so sehr als eine philanthropische oder humanitäre. Sie wollten die «physische Organisation, den intellektuellen und moralischen Charakter, die Sprachen und geschichtlichen Traditionen der verschiedenen menschlichen Rassen»40 erforschen. Artikel 6 ihrer Satzung besagte jedoch, dass die Gesellschaft neben ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit nicht
38 39 40
Ebda., S. 120. Ebda., S. 128f. Zit. nach ebda., S. 131 (Übersetzung GM).
133
verabsäumen möchte, zur Verbesserung des Schicksals der Eingeborenen (so weit als möglich) beizutragen.41 Die meisten Mitglieder der SEP akzeptierten Galls und Spurzheims Doktrinen nicht, sahen aber dennoch einen Zusammenhang zwischen organischen und kulturellen Defiziten. Die zentrale Frage war, unter welchen Einflüssen und zu welchem Grad bestimmte Rassen spontan Zivilisierung erreichen könnten. Dabei gab es keine klare Verbindung zwischen den politischen Einstellungen der SEPMitglieder und ihren Ansichten über hierarchische Rassenordnungen. Ultrakonservative Pro-Bourbonen wie d’Eckstein konnten diese Klassifizierungen genauso gutheißen wie progressive Kräfte wie Courtet. Naturalisten wie Milne-Edwards, Quatrefages und Dumoutier akzeptierten die Einheit aller Menschenspezies, nicht jedoch die Gleichheit.42 In welchen Presseorganen wurde über all das berichtet? Quatrefages schrieb auch für die Revue des deux mondes, die in kleiner Auflage von etwa 2.000 Exemplaren erschien und relativ wenig Leser – Staum spricht von opinion leaders – erreichte. Schœlcher dagegen publizierte in La Réforme, die auch nur eine beschränkte Auflage hatte. Man muss aber bedenken, dass es in Frankreich vor 1880 so etwas wie ein Massenpublikum nicht gab.43 Der Einfluss der Zeitschriften kann entsprechend nicht in absoluten Zahlen gemessen werden, die Frage lautet vielmehr, in welchen Kreisen sie gelesen wurden. Und hier zeigt sich: Die Theorien der SEP waren wichtige Gesprächsthemen bei der kulturellen Elite. Noch wichtiger: Die SEP verlieh späteren Gesellschaften eine entscheidende Basis, so zum Beispiel der Société d’anthropologie de Paris (SAP).44 Bereits kurz nach der Gründung der SEP (1839) benutzt Edwards, der führende Kopf, den Terminus «Anthropologie» und bekräftigt, die Anthropologie sei erstens die grundlegende Studie der menschlichen Natur und zweitens die Studie der menschlichen Vielfalt. Der Ideologe Cabanis sprach schon im Jahr 1804 von «Anthropologie» als Synonym für eine Wissenschaft, die physikalisch-mentale Beziehungen beschrieb, aber auch Ethik, Ideenanalyse und Physiologie miteinbezog.45 Zu den verwendeten Begrifflichkeiten schreibt Staum: Early uses of words such as anthropology and ethnology raise the common question of whether a field of study can exist before the terminology that names it. From our retrospective and anachronistic viewpoint, any systematic traveler’s report describing the appearance and customs of peoples, any philosophical reflection of human capacity, any comparative natural history relating humans and animals could qualify as potential anthropology of the 18th century.46
41 42 43 44 45 46
Vgl. ebda., S. 131. Ebda., S. 154f. Ebda., S. 154. Ebda., S. 156. Ebda., S. 123. Vgl. ebda., S. 122f.
134
«Anthropologie» war eng mit der Ethnologie verwandt und bezog sich sowohl auf «anatomische» als auch «psychologische» Studien. Das Musée Nationale d’Histoire Naturelle (MNHN) lieferte die andere große institutionelle Basis für die anthropologischen Studien und spielt bei der akademischen Etablierung der französischen Anthropologie eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch wenn verschiedene Akademiker sich mit Fragen der Rassentheorie beschäftigten, dauerte es bis 1855, bis es einen offiziell benannten Lehrstuhl für Anthropologie gab.47 1859 wurde dann schließlich von Paul Broca die SAP gegründet. Verglichen mit dieser anthropologischen Gesellschaft scheint die SEP weniger intellektuelle Kohärenz gehabt zu haben. Abolitionistisch motivierte Spekulationen trübten aus zeitgenössischer Sicht die wissenschaftliche Objektivität: «politization harmed science.»48 IV.1.4. Konstruktionen des Anderen: erste sozialwissenschaftliche Versuche Wenn wir heute die Phrenologie als absurd, lachhaft und unbeweisbar abtun, dürfen wir nicht den kulturellen Kontext vergessen, dem sie entstammt. Die geographische Gesellschaft war weit mehr das Reservat von Amateuren und Hobbyforschern, als es die phrenologische Gesellschaft war. Zudem: In Westafrika, Ostafrika und dem Pazifik bildete strategische Gegnerschaft zu Britannien oft das Hauptmotiv, um passende Territorien für die französische Expansion zu suchen. Für dieses Ziel waren sowohl Reiseliteratur als auch systematisches geographisches Wissen unabdingbare Voraussetzungen.49 Und was die Anthropologie angeht, so hinderten Broca weder seine linken, republikanischen Ansichten (zumindest vor 1848) noch seine Haltung gegen die Sklaverei an der «wissenschaftlichen» Hinterfragung der Rassengleichheit. Die Phrenologie identifizierte anhand verschiedener Messungen entwickelte sowie unterentwickelte Gehirnareale. Eine Folge war, dass die soziale Bewegungsfreiheit mancher Individuen beschränkt und manchen Rassen gar pauschal nur begrenzte intellektuelle Fähigkeiten attestiert wurden. Die Saint-Simonsche Bewegung ihrerseits konnte in der Ambivalenz der Phrenologie vor allem das positive Potential der Selbstentwicklung und Bevollmächtigung von Individuen ausmachen. Wie die Genetik heutzutage, gab die Erforschung von Gesichtswinkel, Kopf- und Schädelform Anlass zu begeistertem Optimismus, hatte aber auch dramatische Folgen für die als niederer Klassifizierten. Solch eine Diagnostik konnte manipuliert werden und zur Rechtfertigung von harten Strafen dienen oder gar die Fähigkeit ganzer Völker in Frage stellen. Geographiehistoriker haben die Phrenologie als die koloniale Wissenschaft par excellence bezeichnet, weil Forscher und Kartographen damit die konzeptionelle Basis für das Imperium lieferten. Demgegenüber erwiesen sich weder
47 48 49
Ebda., S. 125f. Ebda., S. 127. Ebda., S. 169.
135
Ethnologen noch Anthropologen als bedingungslose Befürworter der Eroberung und der imperialen Herrschaft. Staum macht drei grobe Strömungen in Frankreich aus. Erstens gab es diejenigen, die gewillt waren, den Nichteuropäern die europäische Zivilisation zu bringen und sie zu französischen Bürgern zu assimilieren. Zweitens gab es diejenigen, die eine europäische Führung befürworteten, aufgrund der «Rassenungleichheit» jedoch eine Annäherung und niemals eine Assimilierung oder Gleichheit für möglich erachteten. Drittens gab es diejenigen, die eine europäische Rasse für weit überlegen und die anderen Rassen und Völker für keineswegs lern- oder verbesserungsfähig hielten, und die auch keinerlei Bedenken gegen europäische Herrschaft und Ausbeutung hatten.50 Nicht vergessen sollte man schließlich, dass die Phrenologie, die für die Erkenntnisse ihrer Schädelmessungen wissenschaftliche Geltung beanspruchte, Wegbereiter anderer Theoretiker wie Arthur Graf von Gobineau oder Houston Stewart Chamberlain wurde, die einen pseudowissenschaftlichen Rassismus für weite bürgerliche und intellektuelle Kreise salonfähig machten. Dass die Karibik bei der Etablierung phrenologischer Erkenntnisse keinen zentralen Untersuchungsraum bildet, mag überraschen. Vereinzelt spielen die Beziehungen dorthin durchaus eine Rolle. So wurde beispielsweise D’Eichthal, von 1841 bis 1846 stellvertretender Sekretär der SEP und von 1846 bis 1852 deren Sekretär, durch die Bekanntschaft mit dem Saint-Simonisten Ismaïl Urbain, einem zum Islam konvertierten Mulatten aus Guyana, dahingehend beeinflusst, dass er die Rassenvermischung nicht ablehnte. Er idealisierte vielmehr die Mulatten, die in seinen Augen die besten Qualitäten beider Rassen in sich vereinten.51 Zu dem extremen Polygenisten-Flügel gehörten außerdem zwei SEP-Mitglieder aus Übersee – de Reiset aus Guadeloupe und Dejean de la Bâtie aus Réunion. Wenig überraschend argumentierten sie, afrikanische Landwirtschaft sei unterentwickelt, die Hirtenvölker seien unzivilisiert und nur die Rassenmischung beziehungsweise die europäische Führung wie in den Kolonien könne den Schwarzen helfen, sich zu verbessern.52 Der Physiker Etienne Rufz de Lavison aus Martinique hatte Quatrefages unterstützt und behauptet, keine Rasse sei widerständig gegen Zivilisierung. Wieviel aber letztlich an neuem ethnologischen Wissen aus der Karibik kam, soll im nächsten Kapitel ein Blick auf eine recht intensive französische Zeitschriftenproduktion zeigen. Doch zunächst wenden wir uns dem südlichen Nachbarn zu und schauen, ob und welchen Einfluss die Karibik auf die Entstehung der Anthropologie in Spanien hatte. IV.1.5. Entstehung der Anthropologie in Spanien Über die Entstehungsgeschichte der Anthropologie in Spanien ist nur wenig bekannt, und die Forschungen dazu sind spärlich. Konstatiert wird allgemein
50 51 52
Ebda., S. 188. Ebda., S. 139. Ebda., S. 148.
136
das späte Auftreten einer naturalistischen Anthropologie im französischen Stil. Zwar wurden bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ethnographische und anthropologische Untersuchungen durchgeführt, jedoch nicht im Namen und im Rahmen einer institutionalisierten Anthropologie. Alles, was in Spanien in Richtung Anthropologie unternommen wurde, beruhte auf Impulsen aus dem nördlichen Nachbarland und muss in Verbindung mit französischen Forschern gesehen werden. Die explizit rassisch-biologisch ausgerichtete Anthropologie, die gerade in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts fundamental war, tritt wohl in dieser ersten Periode zum erstenmal in Erscheinung. Einen Hinweis bietet hier der kurze Artikel von Francisco Antonio Beavides mit dem Titel «Historia física del hombre». Ein Veröffentlichungsdatum ist nicht aufgeführt, aber laut Elena Ronzón kann man ihn in die späten 1840er einordnen. In diesem Artikel nimmt der Autor Bezug auf taxonomische Probleme. Gleichzeitig konzentriert sich «der Rest seiner Arbeit auf die Frage der menschlichen Rassen, deren Klassifizierung und Eigenschaften.»53 Ronzón betont den grundlegenden Charakter dieser Studie, die spätere darwinistische Entwicklungen forciert habe. Betrachtet man die inhaltliche Schwerpunktsetzung der anthropologischen Untersuchungen spanischer Provenienz, so fällt das Fehlen jeglicher Beiträge aus und zu der Karibik im 19. Jahrhundert ins Auge, bei einer starken Präsenz Afrikas, vor allem des Nordwestens mit Marokko und Algerien. Von den Vertretern der spanischen Anthropologie hebt Ronzón drei besonders hervor: Vicente Adam, Francisco Fabra Soldevilla und José Varela de Montes.54 Bei den Lecciones de Antropología (1833) von Vicente Adam handelt es sich um ein Werk der Philosophie, und Moralphilosophie im Besonderen. Es verschreibt sich der empirischen Linie Lockes, aber auch dem sensualistischen Empirismus von Cordillac und den idéologues. Man kann jedoch keinerlei ethnographische Informationen finden. Francisco Fabra Soldevilla (1778–1839) schrieb La filosofía de la legislación natural fundada en la antropología (1838). Fabra Soldevilla studierte Medizin in Montpellier und war für die Geschäftsordnung der 1835 zugelassenen Akademie der Naturwissenschaften verantwortlich. Obgleich er den Menschen den Naturwissenschaften zuordnete und ihn als deren Studienobjekt betrachtete, blieb er ein Anti-Darwinist55 und war besonders daran interessiert, die Grenzen der naturwissenschaftlichen Erforschung des Menschen aufzuzeigen. José Varela de Montes (1796–1868) schrieb den Ensayo de Antropología (1844) aus medizinischer Sicht. Seine Idee einer «Einheit des Menschen» beinhaltet eine Kritik an der naturalistisch-zoologischen Perspektive der Arten.56
53
54 55 56
Elena Ronzón: Antropología y antropologías. Ideas para una historia crítica de la antropología española. Oviedo: Pentalfa 1991, S. 174. Für wichtige Hinweise zur Anthropologie in Spanien danke ich Ana Mateos. Ebda., S. 173 (Übersetzung GM). Ebda., S. 220. Ebda., S. 251.
137
Im Jahr 1864 gründete Dr. Velasco, der von der positivistisch-naturalistischen Schule beeinflusst war, in Madrid die Sociedad Antropológica.57 Das erklärte Ziel der Gesellschaft, die ihre eigene Zeitschrift für Ethnologie veröffentlichte, war die Klassifizierung der menschlichen Spezies und Vielfalt, für die sie Daten aus diversen Quellen verwendete, einschließlich der verschiedenen Völker Spaniens und der Karibik. Dafür baten sie die jeweiligen Provinzgouverneure um die Sammlung von Schädeln und Knochen. In diesen Analysen dominierte in erster Linie der biologische Ansatz.58 In Sevilla entstand im Jahr 1871 eine weitere Sociedad de Antropología, ins Leben gerufen von Antonio Machado Nuñez, einem Professor für Naturgeschichte. Sie hatte jedoch nur bis 1875 Bestand.59 Wie bereits erwähnt, war der afrikanische Kontinent das bevorzugte Gebiet spanischer anthropologischer Untersuchungen, so dass in diesem Zusammenhang ein Blick auf den spanischen Kolonialismus in Afrika angeraten scheint: Im Jahre 1436 erkundete der Portugiese Alfonso Goncalves die Küste der Sahara und kaufte Sklaven von den Stämmen der Sahraouis ab.60 Um diese Region zu befrieden, verboten jedoch im Jahre 1497 die Katholischen Könige den Sklavenhandel an der Küste der Sahara.61 Die Haltung der Bourbonen gegenüber den afrikanischen Besitzungen grenzte an Gleichgültigkeit, bis es zu einem Politikwechsel kam unter der Herrschaft von Fernando VI. und Carlos III., die mit dem marokkanischen König Mohamed Ben Adballa (1757–1790) den Versuch unternahmen, die Beziehung zwischen den beiden Monarchien durch verschiedene Vereinbarungen zu stärken.62 Mit dem Vertrag von Pardo im Jahr 1778 trat Portugal die volle Souveränität über die Inseln Fernando Poo – im 19. Jahrhundert für die Deportation von politischen Gefangenen aus Kuba bekannt geworden – und Annobón an Spanien ab. Im gleichen Jahr 1778 startete die erste spanische Expedition in den Golf von Guinea mit dem Ziel, Stützpunkte auf den Inseln zu bilden und sowohl dort wie auf dem afrikanischen Festland eine kommerzielle Basis für die Verschiffung von Sklaven nach Amerika zu schaffen. Unter ethnographischen Gesichtspunkten ist die Gruppe der Reisenden bei diesen Expeditionen nach Afrika im 19. Jahrhundert interessant, weil sie Daten und Dokumente sammelten und das Leben der anderen Völker beschrieben. Dazu gehörten Domingo Badía alias Ali Bey aus Barcelona (1767–1818), der im Jahre 1801 Godoy seine Pläne für eine Reise nach Afrika präsentierte, die sowohl politische als auch wissenschaftliche Ziele hatte. Hervorzuheben ist auch José María de Murga, besser bekannt als Moro vizcaíno. Er machte anthropologische Studien in Nordafrika, vor allem in Marokko. Seine Beiträge zum Wissen über
57 58 59 60 61 62
Ebda., S. 267. Ebda., S. 273. Ebda., S. 296. Azucena Pedraz Marcos: Quimeras de África. La sociedad Española de Africanistas y Colonialistas. Madrid: Ed. Polifemo 2000, S. 28. Ebda., S. 19. Ebda., S. 34.
138
die Welt der maghrebinischen Berber und Juden sind von wesentlicher Bedeutung, insbesondere sein Reisebericht Recuerdos marroquíes von 1868.63 Sowohl Badía als auch Murga gaben sich als Marokkaner und Angehörige entfernter arabischer Ethnien aus, um den Kontakt mit lokalen Völkern zu erleichtern. Im Jahre 1874 näherte sich ein weiterer Spanier, Manuel Iradier Bulfi (1854– 1911), mit seiner 1868 gegründeten Gesellschaft La viajera, die später La exploradora genannt wurde, den Küsten des Golfs von Guinea, wo die Spanier einige Inseln besaßen, die ihnen das Eindringen ins Landesinnere ermöglichten.64 Während seiner Expedition machte er Aufzeichnungen in der fragmentarischen Form eines Tagebuchs, wobei er nicht nur die geographischen, sondern auch ethnographische Daten kommentierte. Er war überzeugt, seine Beobachtungen könnten für spätere Forscher als Leitfaden dienen. Im Jahr 1876 gründete sich die Sociedad geográfica und ein Jahr darauf die Asociación Española para la exploración del África. Noch in ihrem Gründungsjahr 1877 beauftragte letztere den ebenfalls erwähnenswerten Katalanen Joaquín Gatell (1826–1879), der Kontakte mit der französischen Geographischen Gesellschaft pflegte, mit der Erforschung Afrikas, um die inneren Küstengebiete Westsaharas zu erkunden. Dabei schrieb er das Manual del viajero explorador en África. Angesichts der prekären Forschungssituation zur frühen Ethnologie in Spanien und der spärlichen Auseinandersetzung mit der Karibik als Forschungsgegenstand, nimmt es nicht wunder, wenn innerhalb der vergleichenden Perspektive zwischen dem französischen und spanischen Kolonialismus Frankreich in den folgenden Ausführungen eine ungleich größere Aufmerksamkeit erfahren wird.
IV.2. Die Revue des Colonies als Transfermedium innerhalb einer kolonialen frankophonen Diaspora «Die Kolonien kennen die großen Grundsätze der Philanthropie bisweilen generell nur in der Theorie; von Freiheit in Aktion wissen sie nichts. Die leidenden und unterdrückten Klassen stellen Forderungen und kämpfen ohne Unterlass, immer ohne Erfolg.» Auf diese Eröffnungssätze macht Kelly Duke Bryant in ihrer beachtenswerten Auseinandersetzung mit der Revue des Colonies und deren früher frankophoner Diaspora-Funktion aufmerksam.65 Dieser Tenor der ersten Ausgabe der Revue des Colonies, im Juli 1834 in Paris gedruckt, gibt den Ton an für die Berichte und Debatten, die in dieser außergewöhnlichen Zeitschrift während der acht Jahre ihres Bestehens erschienen. Eines ihrer obersten Ziele war,
63 64 65
Ebda., S. 83. Ebda., S. 88. Vgl. Kelly Duke Bryant: Black but not African. Francophone Black Diaspora and the Revue des Colonies, 1834–1842. In: International Journal of African Historical Studies 40, 2 (2007), S. 251–282, hier S. 251 (Übersetzung GM). Für wichtige Hinweise bei der Beschäftigung mit den Studien von Duke Bryant und Bongie danke ich Stephan Eberhard.
139
«zusammenzuführen» und den Problemen und Ungerechtigkeiten, denen farbige Menschen mit Wohnsitz in der französischen Kolonialwelt ausgesetzt waren, die «größte Aufmerksamkeit» zukommen zu lassen.66 Geführt von Cyrille Bissette, einem Mulatten aus Martinique, der in Paris als halboffizieller Repräsentant der freien nichtweißen Bevölkerung (hommes de couleur)67 in den Kolonien fungierte, stellte die Publikation die erste französische Reihe dar, die von einem homme de couleur für farbige Menschen produziert wurde. Mit dem Anliegen, nichts zu übersehen, «was die französischen Kolonien betreffe», beschäftigte sich die Zeitschrift mit Themen wie Sklaverei, Rassenvorurteilen und sozialen Ungleichheiten in den französischen Kolonien.68 Durch die Konzentration auf diese Themengebiete machte die Zeitschrift die Konturen einer speziellen Art von schwarzer Diaspora sichtbar.69 Die Redaktion beabsichtigte jedoch keine Publikation für ein ausschließlich schwarzes und mulattisches Publikum; tatsächlich kündigte die erste Ausgabe an, dass die Zeitschrift, zusätzlich zu ethnisch-sozialen Themen, «politische, intellektuelle, moralische und industrielle Interessen von Kolonisten der einen und der anderen Farbe» ansprechen würde.70 Auch wenn die Revue des Colonies mit Bissette von einem in Paris ansässigen freien Mulatten geleitet wurde, waren weder Adressaten noch Themen auf Belange der Mulatten konzentriert.71 Während sie an die Menschlichkeit und den Gerechtigkeitssinn der weißen Leser appellierte, funktionierte die Zeitschrift für farbige Leser anders.72 Der Diskurs der Revue des Colonies stärkte und erweiterte die Verbindungen einer frankophonen schwarzen Diaspora, indem sie Artikel über politische und Rechtsangelegenheiten, die farbige Menschen im französischen Kolonialreich und
66
67
68 69 70 71
72
Revue des Colonies (Juli 1834), zit. nach Duke Bryant: Black but not African, S. 251 (Übersetzung GM). Diese Studie von Duke Bryant bot wichtige Voraussetzungen, vor allem zum Diaspora-Verständnis der Revue des Colonies. Mit dem Begriff «Farbige» sind sowohl freie als auch unfreie Mulatten gemeint, also Menschen mit afrikanischen und europäischen Vorfahren. Im Kontext der ethnologischen Zeitschriften jedoch ist die Bezeichnung hommes de couleur (farbige Menschen) ein in erster Linie bürgerrechtlicher Begriff und bezeichnet freie Menschen mit mindestens einem afrikanischen Vorfahren. Die Kategorie schließt frei geborene Personen und ehemalige Sklaven ein und kann sowohl schwarze als auch mischrassige Individuen meinen. Mit «Freie Farbige» können somit auch freie Personen schwarzer Hautfarbe gemeint sein. Das zeitgenössische veröffentlichte Material macht Gebrauch von einer Mischung von Begriffen – meistens hommes de couleur (libres), aber auch gens de couleur (libres), nègres, noirs, mulâtres. Ich benutze Farbige/Mulatten oder – vor allem im Kontext der ethnologischen Zeitschriften – hommes de couleur (das Adjektiv libres [frei] voraussetzend), da diese Begriffe am häufigsten in der zeitgenössischen Literatur auftauchen. Vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 251. Vgl. ebda., S. 251. Revue des Colonies (Juli 1834), S. 4; vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 252. Vgl. Chris Bongie: «C’est du papier ou de l’Histoire en Marche?». The Revolutionary Compromises of a Martiniquan Homme de Couleur, Cyrille-Charles-August Bissette. In: Nineteenth Century Contexts 23 (2002), S. 439–473, hier S. 443. Vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 252.
140
in der Metropole betrafen, einschloss und die hommes de couleur dazu ermutigte, sich selbst und besonders ihren Kindern Bildung zukommen zu lassen, um den sozialen Aufstieg zu sichern. Neben der Forderung nach Gleichberechtigung der ethnischen Gruppen war das zweite wichtige Anliegen, der Verbindung zum Mutterland Frankreich treu zu bleiben. Die Revue des Colonies unterstützte entscheidend den Gleichheitsstatus der hommes de couleur innerhalb des französischen Gemeinwesens. Ein wichtiger Aspekt hierbei war die Einbeziehung afrikanischer Themen in die Berichterstattung. Weil er für die volle Anerkennung der hommes de couleur als Mitglieder der französischen Nation warb, versuchte Bissette, die Leser durch die Revue des Colonies über Ereignisse in Afrika zu informieren und den Kontinent somit zu einem Ort von politischem Belang zu erklären.73 Ebenso bot er den Lesern mit einem Ensemble von afrikanischen historischen Persönlichkeiten den Beweis, dass Menschen ihrer Rasse Großes erreichen konnten, und stärkte so die Verbindung zu Afrika als Ursprungsort. Kelly Duke Bryant spricht davon, dass die Revue die Vorstellung einer Diaspora mit zwei homelands forcierte – Afrika, der Ort der Herkunft ohne die logische Konsequenz der Rückkehr, und Frankreich, eine Nation, die den hommes de couleur ein Exil bot –, was die Vergangenheit und Zukunft von farbigen Menschen im französischen Kolonialreich miteinander verband. Die Revue des Colonies bot einen Raum mit identitätsstiftender Funktion für farbige Menschen innerhalb der frankophonen Welt. Folgende Ziele waren vorherrschend: umfassende französische politische und bürgerliche Rechte, die Sklavenbefreiung sowie der Versuch einer Geschichtsschreibung mit schwarzen, oft afrikanischen Helden in der Hauptrolle, um für die Befreiung der unterdrückten Rassen zu werben. Die Behandlung Afrikas in der Revue des Colonies wirft neue Fragen über den Gebrauch des Diasporakonzepts auf und liefert ein Beispiel von intellektueller Verbindung zwischen den Antillen und Afrika, welches der Négritude-Bewegung fast einhundert Jahre vorausging.74 Die Sekundärliteratur über Bissette und die Revue des Colonies, deren Großteil Bissettes politischen Aktivismus als Einblick in die kolonialen Rassenbeziehungen vor der Abschaffung der Sklaverei behandelt und die Revue ausschließlich als eine Abolitionisten-Zeitschrift betrachtet, untersucht die Frage der Diaspora nicht adäquat.75 Chris Bongie, der einige der
73 74 75
Vgl. ebda., S. 253. Vgl. ebda., S. 253. Vgl. ebda., S. 253. Duke Bryant verweist auf Mereer Cook: Five French Negro Authors. Washington, D.C. 1943, S. 38–71; Melvin D. Kennedy: The Bissette Affair and the French Colonial Question. In: The Journal of Negro History 45, 1 (1960), S. 1–10; Camille Darsières: Des origines de la nation martiniquaise. Pointe-à-Pitre 1974, S. 41–50; Stella Pâme: La Revue des Colonies. In: Jacques Adelaïde (Hg.): L’Historial Antillais 3. Fort-de-France 1981, S. 530–536; Stella Pâme: L’Affaire Bissette (1823–1830). In: Jacques Adelaïde (Hg.): L’Historial Antillais 3. Fort-de-France 1981, S. 222–239; François Manchuelle: Le rôle des Antillais dans l’apparition du nationalisme culturel en Afrique noire francophone. In: Cahiers d’Études africaines 32, 127 (1992), S. 375–408, hier S. 380f.; Éric Mesnard: Les Mouvements de Résistence dans les colonies françaises.
141
analytisch reichsten und herausforderndsten Diskussionen über Bissette als Individuum, Schriftsteller und Politiker lieferte, betont die Ambivalenz Bissettes als Autor und historische Persönlichkeit.76 Mit Verweis auf Paul Gilroys Black Atlantic bemerkt Bongie, dass solch eine «,afro-diasporische Pionier‘-Schilderung» von Bissettes Leben unvollständig wäre, da weder dieses noch irgendein anderes solch unmissverständliches Modell die unbequeme Mischung aus Widerstand, Kompromiss und Kapitulation, auf die diese Geschichte uns zubewegt, erklären kann.77 Indem er das Konzept der Diaspora ablehnt, da ihm seines Erachtens die Komplexität als analytischer Rahmen fehlt, liest Bongie Bissettes Werk statt dessen als «moderne» Dokumente, die in vielerlei Hinsicht postkoloniale Lesarten nahelegen.78 Seine Argumentationslinie beruht auf einer Vorstellung Bissettes als zutiefst ambivalentem Schauspieler, welche er wiederum aus einer Reihe gegensätzlicher Eigenschaften gewinnt, die in Bissettes Arbeit zum Vorschein kommen: Bissette zeige eine «Mischung aus Widerstand und Mittäterschaft»79, er operiere «zwischen Konformismus und Meinungsverschiedenheit» und er betreibe kulturellen «Revisionismus», indem er bedeutende schwarze historische Persönlichkeiten in die Revue des Colonies mit einbeziehe. Gleichzeitig trete er oft mit höchst konservativen Ideen in Erscheinung.80 Auch wenn die Abonnentenzahl dieses Periodikums nie besonders hoch war, wurde die Revue des Colonies intensiv wahrgenommen. Die Zeitschrift zirkulierte in vier Kolonien der British West Indies, drei französischen Kolonien, BritischMauritius, Französisch-Mauritius (ehemalige Île Bourbon), Französisch-Senegal und Haiti. Während die Themen der Journalisten aus dem französischen Kolonialreich sehr stark variierten, beschäftigten sich die Beiträge aus den britischen
76 77 78 79 80
L’affaire Bissette (1823–1827). In: Marcel Dorigny (Hg.): Les Abolitions de l’Esclavage de L.F. Sonthonax à V. Schœlcher 1793, 1794, 1848. Saint-Denis: Presses Univ. de Vincennes 1995, S. 293–297; Jennings, Lawrence C.: Cyrille Bissette, Radical Black Abolitionist. In: French History 9, 1 (1995), S. 48–66; Françoise Thésée: Le général Donzelot à la Martinique. Vers la fin de l’Ancien Régime colonial (1818–1826). Paris: Éditions Karthala 1997, Kap. 5; Chris Bongie: 1835, or «Le troisième siècle». The Creole Afterlives of Cyrille-Charles-Auguste Bissette, Louis de Maynard de Queilhe, and Victor Schœlcher. In: Bongie: Islands and Exiles, S. 264–287, 323–340; Stella Pâme: Cyrille Bissette. Un Martyr de la Liberté. Fort-de-France 1999; Lawrence C. Jennings: French Anti-Slavery. The Movement for the Abolition of Slavery in France, 1802–1848. Cambridge 2000, S. 29–37, 49–50, 71–73, 241–44, 266–69, 279, 288; Chris Bongie: A Street Named Bissette. Nostalgia, Memory, and the Cent-Cinquantenaire of the Abolition of Slavery in Martinique (1848–1898). In: South Atlantic Quarterly 100, 1 (2001), S. 215–257; Bongie: The Revolutionary Compromises. Vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 254. Duke Bryant verweist hier auf Bongie: A Street Named Bissette, S. 230; Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 467. Vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 254. Vgl. ebda., S. 254. Vgl. ebda., S. 254. Vgl. Bongie: The Creole Afterlives, S. 269–271; A Street Named Bissette, S. 229–232; The Revolutionary Compromises, S. 442–447.
142
Kolonien vor allem mit den Folgen der Abolition von 1834. Damit trugen sie wiederum bei zu Emanzipationsbewegungen in den französischen Kolonien. Die ausdrückliche Zielsetzung der Revue des Colonies ist gleichermaßen patriotisch und humanistisch. Anliegen ist es, die soziale Ordnung der Kolonien zu ändern und dabei jedoch die materiellen Interessen und die persönliche Sicherheit der Besitzer sicherzustellen. Das Band zwischen Kolonien und Mutterland sollte gefestigt werden:81 Das mangelnde Wissen des Mutterlandes über die Bevölkerung der Karibik führe zu der «fälschlichen» Überlegung, Frankreich könne die Kolonien nicht halten. Dieses verfälschte Bild wird dadurch erklärt, dass man bis dahin diese Bevölkerung lediglich durch die Beschreibungen der Sklavenhalter wahrgenommen hatte – hier wird die sogenannte Zucker-Aristokratie kritisiert: Les débris de l’aristocratie coloniale venaient encore parader en France et y consommer dans de stériles dépenses les produits d’un travail qu’on appréciait mal à deux mille lieues de distance. On ne connaissait des colonies que trois choses ; le sucre, le café et les créoles blancs. Les deux premières fesaient supporter la troisième.82
Bezeichnend ist dabei vor allem, dass das Wissen über die Kolonien als unzureichend bewertet wird. Die Autoren der Revue des Colonies beanspruchen für sich einen «neutralen Blick» auf die Kolonien. Sie sind stolz darauf, die Emanzipation nach Kräften befördert zu haben: Pour nous, qui avons poussé de tous nos efforts au char de l’émancipation, qui avons incessamment porté un regard scrutateur et impartial sur la société coloniale, d’autres devoirs nous restent à remplir. Le premier de tous, c’est de faire connaître plus intimement les colonies à la France […].83
Besonders beleuchtet werden die Leistungen und Fähigkeiten, die man «der schwarzen und der farbigen Rasse» zutraut. In diesem Zusammenhang wird speziell auf Haiti aufmerksam gemacht. Man müsse Frankreich endlich in die Geschichte dieses Landes einführen, von dem falsche Bilder vorherrschten. En voyant le pas immense qu’a fait une société d’esclaves abandonnée à elle-même, en proie à la guerre civile et à la guerre étrangère pendant 25 ans, on concevra que, sous la protection éclairée de la France, les colonies peuvent arriver pacifiquement à une révolution sociale, qu’elles possèdent tous les élémens de la société la plus forte et la plus intelligente, si ces éléments sont combinés avec justice et avec mesure.84
Als erste Zwischenbilanz sei festgehalten: Insofern die Revue des Colonies ein Transfermedium per se ist, verdient sie besondere Beachtung. Für unsere Fragen von Bedeutung ist, dass das erklärte Ziel von Gleichheit nur innerhalb des französischen Gemeinwesens funktionieren kann. Hier wird auch deutlich, was bereits im Eingangskapitel in Bezug auf die Literatur festgestellt wurde: eine
81 82 83 84
Revue des Colonies (Juli 1836), S. 3. Ebda., S. 4. Ebda., S. 6. Ebda., S. 6.
143
abolitionistische Haltung geht nicht notwendigerweise einher mit einer Infragestellung des kolonialen Status quo. In Anlehnung an aktuelle Debatten um Inklusion und Exklusion steht für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts fest: Die Gravitationskraft des französischen Kolonialismus kommt nicht nur inkluierend, sondern durchaus integrierend zur Geltung. Paris war der Knotenpunkt der Revue des Colonies, wobei im Vergleich zu den literarischen Texten nun ein Richtungswechsel zu verzeichnen ist. Wissen aus den Kolonien traf in Paris zusammen und wurde von der Revue neu geordnet und zudem neu distribuiert. So konnten beispielsweise Leser aus Guyana von kulturellen Praktiken im Senegal erfahren. Die kulturwissenschaftlich bisher unhinterfragte Interpretation der Négritude als erste schwarze Bewegung, die sich aus dem gemeinsamen kolonialen Zentrum Paris heraus der eigenen kollektiven Geschichte bewusst wird, verdient definitiv eine Revision. IV.2.1. Sklavereikritik und mission civilisatrice Ogé-Barbaroux, Staatsanwalt auf der Île Bourbon und einer der Redakteure der Revue, betont die Bedeutung der Zeitschrift für Sklavenaufstände auf weit entfernten Kolonialbesitzungen südlich von Afrika, so wie Bourbon, der heutigen Insel La Reunion: «Als die Revue des Colonies unter den Einwohnern zirkulierte, wurden alle Klassen der Gesellschaft aufgewiegelt.»85 Der Staatsanwalt streicht ihr stark abolitionistisches Programm heraus, beginnend mit dem Bild des in Ketten liegenden schwarzen Mannes, der das Titelblatt zierte (und unter welchem der Satz «Bin ich nicht auch ein Mensch und euer Bruder?» geschrieben stand), und fährt fort, dass die Lektüre den Eindruck erweckte, als sollten die erforderlichen Maßnahmen sofort – ohne Verzögerung, ohne Vorkehrung, ohne Vorbereitungen, ohne Entschädigung – umgesetzt werden, nämlich dem kolonialen Eigentum ein Ende zu bereiten und eine plötzliche und vollständige Restrukturierung der sozialen Ordnung herbeizuführen.86 Obwohl Ogé-Barbaroux’ Meinung, die Doktrinen der Revue seien subversiv zu der bestehenden Ordnung, nicht notwendigerweise von seinen Mitredakteuren geteilt wurde, mag der Effekt auf bestimmte Leser durchaus subversiv gewesen sein. So weisen beispielsweise Reaktionen auf Sklavenaufstände auf die Verbreitung und Rezeption der Revue in den Kolonien selbst hin, auch wenn ihr größter Einfluss in Paris lag, wo sie, ungeachtet ihrer sehr begrenzten Leserschaft, eine Reihe von Polemiken und Klagen hervorrief.87
85
86 87
Revue des Colonies, III.x, S. 400, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 447. Leider waren mir diese früheren Ausgaben der Revue des Colonies nicht zugänglich, so dass ich mich im folgenden auf die ausführlichen Zitate bei Bongie (The Revolutionary Compromises) stütze. Die von Bongie englisch angeführten Revue-Zitate habe ich ins Deutsche übersetzt. Vgl. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 447. Vgl. ebda., S. 447.
144
In einem Artikel aus dem Jahre 1837, der auch die Rede Ogé-Barbaroux’ protokolliert, leugnet Bissette die Anschuldigung, er und seine Mitarbeiter hätten zur Rebellion aufgerufen und seien bemüht gewesen, «die Kolonien vollkommen auf den Kopf zu stellen»: solche Anschuldigungen seien haltlos und in den drei Bänden der Revue fänden sich von der ersten bis zur letzten Zeile keinerlei Anzeichen für solche Umtriebe.88 Wie Bissettes Kommentare nahelegen, sollte die in der Revue propagierte «gesellschaftliche Revolution» in den Kolonien auf der Basis eines Aushandelns geschehen, und die ständigen Aufrufe dazu gründeten auf dem unerschütterlichen Glauben an die Wirksamkeit einer legalen Reform und moralischen Umerziehung. Diese Auffassung von Revolution erwuchs aus der Aufwertung vergangener revolutionärer Gewalt zum Fundament einer Gesellschaft, in der nun ein friedliches Zusammenleben möglich war. Die Französische Revolution sei die Quelle der Revue, da die Déclaration des droits de l’homme en société zu Anfang der ersten Ausgabe niedergeschrieben stehe. Neben der Kommentierung dieser Déclaration merkt Bissette an, dass, «was auch immer passiert, in diesen Grundsätzen – die ausgesät sind über ganz Europa durch die Französische Revolution, durch ihre republikanischen und imperialen Armeen und über die ganze Welt durch ihre Bücher – eine Kraft liege, die niemals jemand erfolgreich zunichte machen wird»89. Die Französische Revolution brachte «virtuelle» Dynamiken von wahrhaft globaler Dimension mit sich – wie die haitianische Revolution über den Atlantik hinweg bestätigte. Auf diese Tatsache weist Bissette in seiner Retrospektive im Jahre 1836 über die Errungenschaften der Revue während ihrer ersten beiden Erscheinungsjahre hin: «Die haitianische Revolution, trotz der Massaker am haitianischen Kap, genau wie die Französische Revolution, trotz der Septembermassaker, schuf ein neues Volk und ließ die Grundsätze von Gerechtigkeit und Menschlichkeit hohl werden.»90 Bissette führt die haitianische Revolution an als ein revolutionäres Modell, von dem man in einem postrevolutionären Zeitalter lernen kann. Durch die entschiedene Zurückweisung des in seinen Augen lächerlichen Projekts einer kolonialen Unabhängigkeit, welches er mit den Interessen der weißen Oligarchie in Verbindung setzte, verkündete Bissette nachdrücklich seine Präferenz «einer friedlichen Verschmelzung, im Unterschied zu jedweden aufrührerischen Bewegungen»91 und bewahrte eine Vorstellung vom Mutterland Frankreich als «der Schlichterin aller kolonialen Probleme»92, während er wiederholt seiner Enttäuschung über den Mangel an gesellschaftlichem Fortschritt in den Kolonien Ausdruck verlieh.93 Er betonte nicht nur die Notwendigkeit der Bildung in den
88 89 90 91 92 93
Vgl. ebda., S. 447. Revue des Colonies, III., S. 8, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 448. Revue des Colonies, III., S. 4, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 448. Revue des Colonies, I.iv, S. 33, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 448. Revue des Colonies, III.x, S. 397, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 448. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 448.
145
Kolonien, sondern ging auch auf mulattische Führungspersönlichkeiten der Neuen Welt ein, wie Bolívar, Pétion und Boyer, die sich «die edlen und großzügigen Ideen zueigen machen konnten, für die sie mit solcher Tapferkeit und Erfolg kämpfen würden», und fügte hinzu, dass [w]ir, Kinder Frankreichs, uns keinen Bolívar wünschen müssen, der uns vom fremden Joch erlösen wird. Frankreich ist uns zu teuer, sein nützlicher Einfluss zu wertvoll und sein Schutz zu nötig, als dass wir uns Ideen hingeben sollten, die ihm feindlich gesinnt sind. In der Dominanz jener, die über uns herrschen und die Wünsche Frankreichs falsch interpretieren, sehen wir lediglich isolierte Unternehmungen und nicht den treuen Ausdruck der Absichten der mère-patrie.94
Solche Glaubensbekenntnisse sind auf den Seiten der Revue sehr zahlreich vertreten: Revolution ist notwendig, aber Gewalt kann und muss verhindert werden; dies wird am besten – ja, sollte ausschließlich – durch gute Behörden des kolonialen «Elternteils» erreicht werden. Bissettes (post- und anti-)revolutionäre Vorstellung der Assimilation, sein Glaube an die allmächtige Kraft der métropole ist bekannt im Kontext der frankokaribischen Politik des 20. Jahrhunderts und kann mehr oder weniger wörtlich aus dem Enthusiasmus herausgehört werden, mit dem später Aimé Césaire für die départementalisation der Inseln Martinique und Guadeloupe im Jahre 1946 warb.95 Die Abolition galt von Anfang an als das dringlichste Anliegen der Revue des Colonies. Die Abschaffung der Sklaverei aus dem Geiste der Revolution ist eine Gründungsfigur der Zeitschrift. So war die Revue des Colonies sehr inspiriert von der Abolition im britischen Kolonialreich: Disons aussi que si les Français n’arrivent pas toujours les premiers en fait de révolution, ils vont plus droit et plus loin quand on leur a montré le chemin. L’activité des esprits se tourna vers les questions d’outre-mer. On étudia ce monde si différent du monde européen. De ce jour de surprise, l’abolition de l’esclavage fut prononcée. C’est à ce moment que la Revue des Colonies publia son premier numéro. Le bill de l’émancipation des noirs allait être mis à exécution.96
Immer wieder finden sich deutliche Stellungnahmen für die Abschaffung der Sklaverei: Il s’était formé une association respectable par les hommes qui la composaient et par son but. Cette association était celle de l’abolition de l’esclavage ; et il nous sera permis ici de rappeler avec bonheur que cette association, annoncée par la Revue des Colonies, se constitua peu de temps après la publication de notre premier numéro.97
Bissette wurde häufig als erster Befürworter einer vollständigen und sofortigen Gleichberechtigung in der französischen Julimonarchie beschrieben. Sogar ohne
94 95 96 97
Revue des Colonies, I.ii, S. 6, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 449. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 449. Revue des Colonies (Juli 1838), S. 5. Ebda., S. 5.
146
Berücksichtigung der hochproblematischen – «reaktionären», «rechten», «populistischen» – Positionen, die Bissette später, während der Zweiten Republik, vertrat, beinhalteten seine Selbstidentifikation als ein (mulattischer) homme de couleur libre und seine starke Loyalität zum französischen Mutterland, das diese Identität im Jahre 1833 legitimierte, jedoch einen Vorbehalt, der als gewisse Identifikation mit dem «Schwarzsein» bezeichnet werden kann.98 Häufig wird in den Beiträgen der Revue die koloniale Aristokratie kritisiert, gewarnt wird konkret vor dem Erhalt des Sklavensystems, da sich dadurch soziale Spannungen nur erhöhen würden. Die viel zu lange hingenommene Sklaverei sei dabei, die Kolonien gründlich zu zerstören: «La France comprit que les discours endormeurs des aristocrates colons lui avaient caché un danger immense, inévitable et prochain ; inévitable si l’on ne changeait les rapports sociaux des colonies.»99 Die Revue des Colonies geht bisweilen sehr ironisch um mit politischen Positionen aus dem «anderen Lager». So wird beispielsweise ironische Kritik am Marineminister Charles Dupin geübt, der die Sklaven nur darum weiterhin züchtigen lassen wolle, weil er sie so sehr liebe: Hier c’était M. Charles Dupin, le marin ; aujourd’hui c’était M. Charles Dupin le délégué des colons ; demain ce sera, M. Charles Dupin le professeur des arts et métiers ; après-demain ce sera, M. Charles Dupin de l’Institut ; […] Ces pauvres esclaves ! M. Charles Dupin les aime, et s’il veut que l’on continue à leur caresser les reins à coups de bambou, c’est qu’il les aime !!!100
Belustigt wird festgestellt, dass die Befürworter der Sklaverei, das heißt die politischen Kontrahenten der Autoren der Revue des Colonies, unter konstant wechselnden Pseudonymen schrieben: Sie seien zwar nicht zahlreich, aber sie hätten auf diese Weise eine hervorragende Möglichkeit gefunden, sich zu vermehren und den (falschen) Eindruck zu vermitteln, die Elite der französischen Schriftsteller spreche sich gegen die Emanzipation der Schwarzen aus. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Revue du XIXe siècle aufs Korn genommen, die sich nach Meinung der Autoren besser Revue du XIVe siècle nennen sollte: Les partisans de l’esclavage ne sont pas nombreux ; mais ils ont trouvé un excellent moyen de se multiplier. Nos lecteurs se souviennent des ingénieuses métamorphoses de M. Granier, natif de Cassagnac. Ce grand écrivain signait ses articles tantôt Granier, tantôt de Cassagnac, puis Mr. P.L.M., puis M. trois étoiles ; et les aristocrates des colonies disaient : Vous voyez que l’élite des écrivains français se prononce contre l’émancipation des noirs ! Aujourd’hui M. le comte de Mauny, qui a trouvé ces mascarades de son goût, commence un nouveau chapitre de métamorphoses. Après avoir écrit au journal le Temps, sous son nom, M. de Mauny prend un déguisement à la Cassagnac et se métamorphose en un abonné de la Revue du XIXe siècle, laquelle Revue ferait mieux de s’appeler Revue du XIVe siècle.101
98 99 100 101
Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 443. Revue des Colonies (Juli 1838), S. 5. Revue des Colonies (Juli 1836), S. 44f. Revue des Colonies (November 1836), S. 263.
147
M. de Mauny war ein bekannter konservativer Aristokrat, der mit den Ministerialzeitungen und der Regierung stritt, die mit aller vorstellbaren Vorsicht versuchten, die soziale Ordnung in den Kolonien zu ändern. Es seien also nicht die Kolonialregierungen, sondern vielmehr einzelne Plantagenbesitzer, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Interessen eine Pro-Sklaverei-Haltung durchsetzen wollten. An einer anderen Stelle wird die aristotelische Sklavereirechtfertigung ironisch unter die Lupe genommen und mit der polemischen Kritik einer «weißen» christlichen Heilslehre verknüpft. L’esclavage est divin ; Dieu à créé lès hommes pour servir et pour être vendus au marché ; Dieu à créé lès noirs pour cultiver la canne à sucré à coups de bâton ; Dieu a crée lés femmes pour les souiller éternellement ! par le concubinage ; Dieu a créé des maîtres et Jésus Christ est mort du supplice des esclaves pour nous, possesseurs d’hommes. Jésus Christ est venu enseigner au genre humain le plus grand de tous les crimes !102
Rechtfertigungsdiskurse für die Sklaverei oder deren Abschaffung werden in apologetische Diskurse und Gegendiskurse integriert. Eine andere Argumentationslinie lautet: Der Mensch ist durch seinen (Sünden)Fall zur Arbeit genötigt und die Sklaverei zwingt die Arbeit nur auf, damit sich die Menschheit weiterentwickeln kann. Das Christentum jedoch könne die Sklaverei ersetzen. Seine Mission sei es, die Sklaverei zu beenden und den Weg der Menschheit fortzusetzen. Zu dem Verhältnis, das zwischen Herr und Sklave bestand, sei ein neues hinzugekommen: das von Christ zu Christ. Daraus ergebe sich, dass die Sklaverei und das Christentum die zwei größten Errungenschaften darstellen, die die Menschheitsgeschichte kenne. Die eine unterstelle den Menschen dem Willen des Menschen, die andere unterstelle den Sklavenhalter dem Willen Gottes. Die eine führe vom wilden Zustand zum barbarischen Zustand, die andere von der Barbarei zur Zivilisation. Die Aufgabe der einen war es, die Arbeit in der Welt einzuführen, die Aufgabe der anderen ist es, die Sklaverei abzuschaffen.103 In unserer Zeit, in der die Einhaltung der Menschenrechte weltweit zum Maßstab gesellschaftlichen Fortschritts gemacht wurde, mag diese Argumentation überzeugen. Ob aber das christliche Argument damals in einer nach der Französischen Revolution säkularisierten Gesellschaft Wirkung entfaltete, ist eine offene Frage. Nell Irvin Painter hat darauf aufmerksam gemacht, dass es oft darum ging, entweder zu beweisen oder zu widerlegen, dass die Vorherrschaft der Weißen etwas Gottgewolltes sei. Einen solchen religiösen Diskurs findet man in den Schriften des US-amerikanischen schwarzen Abolitionisten David Walker (1785–1830). Painter beschreibt ihn und sein Werk,104 ein achtzigseitiger Traktat mit dem etwas langen Titel «David Walker’s Appeal: in four articles, together with a preamble, to the coloured citizens of the world, but in particular, and very expressly, to
102 103 104
Ebda., S. 263. Revue des Colonies (Januar 1837), S. 305. Nell Irvin Painter: The History of White People. New York: Norton 2010, S. 118–121.
148
those of the United States of America»105, das 1829 publiziert wurde. Walker veröffentlichte ebenfalls die erste schwarze Zeitung der Vereinigten Staaten, das Freedom’s Journal, in der er über die haitianische Revolution berichtete. Er war unter der schwarzen Bevölkerung Bostons, wo er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, sehr anerkannt. In seinem Traktat verurteilt er einerseits die Heuchelei der christlichen Weißen und beschreibt andererseits die Geschichte der Schwarzen von Ägypten bis Haiti, wobei er die Haitianer als Brüder bezeichnet («our brethren Haytians»). Der sehr engagierte Walker missbilligte afrikanische Naturreligionen und berief sich auf die christliche Lehre. Er argumentierte, dass Mord zum Wesen des Weißen gehöre, und prophezeite den weißen Christen göttliche Strafe für ihre Behandlung der Schwarzen. Obwohl er schon ein Jahr nach Veröffentlichung seines Textes an Tuberkulose verstarb, blieb sein Wirken bis zum Ende des US-Bürgerkrieges präsent – man kann also davon ausgehen, dass sein Diskurs nicht nur in den USA, sondern auch darüber hinaus in abolitionistischen Kreisen Verbreitung fand. Genau diese religiöse Ebene von Walker findet sich auch bei der Revue des Colonies, in der fortlaufend Berichte abgedruckt werden, in denen Schwarze als gute Christen beschrieben werden. Die Fähigkeit, zum Christentum zu konvertieren, wird gleichgesetzt mit der, sich zu zivilisieren. Neben dem grundsätzlich sklavereikritischen Tenor der Revue des Colonies ist der Gedanke einer mission civilisatrice sehr präsent. Sklavereikritik und Zivilisierungsgedanke scheinen sich also nicht auszuschließen. So wird beispielsweise die Arbeit der Ordensschwestern Sœurs de Saint-Joseph vorgestellt, die in Guyana Krankenhäuser, Schulen und andere soziale Einrichtungen unterhalten. Auch hier ist die Abolitionismusdebatte latent Thema: 600 Afrikaner, die von französischen Kampfschiffen aus der Hand von Sklavenschmugglern «befreit» wurden,106 sind in die Obhut der Ordensschwestern gegeben worden. In einem Artikel wird beschrieben, wie «gewissenhaft» sie in Cayenne integriert werden. Les six cents noirs confiés à la soeur Javouhey [Leiterin der Ordensschwestern] et à ses dames sont ceux que le commet ce interpole avait été chercher dans le golfe de Bénin, et que nos bâtimens de guerre en croisière contre la traite, ont enlevés aux négriers. Ces noirs ont donc été réunis en ateliers du gouvernement, ils se sont apprivoisés, assainis. On les a employés aux chemins de la colonie, à quelques desséchemens locaux, au balayage des rues de Cayenne, à divers travaux publics, et surtout à la culture des vivres. On a tiré de ces ateliers quelques jeunes gens qui montraient plus de dispositions que les autres, et ils sont beaucoup plus utiles qu’on ne pouvait l’espérer.107
Es geht auch um die Christianisierung dieser Sklaven und die Darstellung der Schwestern als «weiße» Mütter von schwarzen Sprösslingen, die sie in morali-
105 106 107
Auszüge finden sich unter: http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h2931t.html, die volle Version unter: http://docsouth.unc.edu/nc/walker/walker.html [31.01.2011]. Häufig gab es die Konstellation, dass Sklavenhandel verboten war, die Sklaverei selbst aber erlaubt. Revue des Colonies (Juli 1836), S. 19.
149
schen und sozialen Fragen unterweisen und zur civilisation führen. Die Schwestern würden schöne, junge schwarze Männer heranziehen, gebildet für die Errungenschaften von Zivilisation und Kultur. Vor dem Licht des Zivilisierungsanspruchs Frankreichs wird die Arbeit der Ordensschwestern gelobt als Beitrag zum Fortschritt, zur Weiterentwicklung von Zivilisation und Kultur sowie zum Zusammenwachsen der Rassen. Dieser Beitrag erfolge über religiöse Wege und das Evangelium. Die Verbindung von christlichem Missionsgedanken und kulturellem Zivilisierungsanspruch wird deutlich artikuliert: «Nous verrons […] sous l’étendard de la croix, des tribus de Caraïbes, recevoir de la main de la soeur Javouhey et de celles des soeurs de Saint-Joseph, les bienfaits de la civilisation.»108 Dadurch, dass die Schwarzen zu ordentlicher und sinnvoller Arbeit angehalten und mit dem Christentum vertraut gemacht werden, scheint die Integration in die französische Gesellschaft gelungen zu sein. Es ist aber bezeichnend, dass sie Objekte der Schwestern bleiben, ihre politische Gleichberechtigung scheint nicht deren Anliegen zu sein. Auch für die wichtigste Frage der Zeit, die Frage nach Pro und Contra Abolition, gilt bei der Revue des Colonies, was bereits hinsichtlich der literarischen Vermittlung festgestellt wurde: philanthropische Diskurse entstehen im Zentrum und werden von der aristokratischen Pflanzerklasse auf den Inseln zu dementieren versucht. Im Gegensatz zur Literatur potenziert sich der Transfer im Medium der Revue mehrfach und wird zu einer Zirkulation, einer Kreisstruktur, die vielfach gebrochen ist. Denn viele Redakteure kommen aus den Kolonien, artikulieren sich jedoch, angeregt durch sklavereikritische Diskurse des Zentrums, von dort aus, um ihre Ideen weltweit zirkulieren zu lassen. Hier mag auch durchaus der sozial andere Hintergrund der Redakteure im Vergleich zu einer weißen PflanzerDichter-Schicht eine entscheidende Rolle spielen. Während ein Protagonist wie Marius aus Outre-mer in einer unidirektionalen Bewegung inszeniert wird, findet die Revue eine multirelationale Verbreitung. Da ihr Zentrum mit seiner mission civilisatrice aber im Gegensatz zur Situation in den spanischen Kolonien eine enorme Kraft hat, erfährt es eine weltweite Affirmation; auf kolonialer Ebene setzt sich weiterhin eine bipolare Struktur durch. Dass Affirmierung des kolonialen Status quo bei gleichzeitiger Sklavereikritik miteinander einhergehen kann, deutet darauf hin, dass auch für die Artikulierung politischer Positionen die Kategorie eines Dazwischen nötig zu sein scheint, die sich als so charakteristisch für karibische Verortungsbemühungen auf literarischer Ebene gezeigt hat. IV.2.2. Weiß-Sein im Dazwischen: colon, homme du bien und mœurs créoles Was sagt uns die Revue des Colonies jedoch über die Repräsentationsformen der weißen Bevölkerung in den Kolonien? Da die Literatur der Zeit – wie bereits besprochen – Ausdrucksweise einer weißen kreolischen Oberschicht ist und gerade in deren Beschreibungen anderer ethnischer Gruppen einiges über Weiß-Sein
108
Ebda., S. 20.
150
aussagt, ist nun besonders spannend, wie Weiß-Sein aus mulattischer Perspektive wahrgenommen wird. Im Folgenden werden einige Momentaufnahmen der Revue kaleidoskopartig vorgestellt, um im Anschluss an dieses induktive Vorgehen eine übergeordnete Repräsentationsform DES Weißen herauszufiltern. Ein wichtiges Thema ist die Klage über die Pressezensur. Explizit artikuliert wird eine Kritik an der kolonialen Aristokratie und an der Zeitung Courrier de la Guadeloupe, darin dann konkret an den Herren Cicéron, Comte de Mauny und Louis de Maynard de Queilhe. Letzterer spielt vor allem dank seines kolonialistischen Romans Outre-mer eine Rolle. Ironisch wird bemerkt: S’il fallait analyser en détail l’éloquence de Messieurs des conseils coloniaux, notre Revue elle-même, ne suffirait pas d’ici à plusieurs années. Force nous est de restreindre notre admiration, au dernier chef-d’oeuvre qui nous vient d’arriver du conseil général de la Guadeloupe : placé à l’éloquence guadeloupéenne !109
In der gleichen Ausgabe wird auch ein Brief des Conseil Colonial an den Gouverneur Arnous stellenweise ironisch und sarkastisch kommentiert, genauer gesagt wird die Selbstdarstellung der colons als hommes de bien relativiert. An einer Stelle heißt es seitens der colons: «Le Gouvernement veut le respect de tous les intérêts, l’ordre ; le travail et la sécurité : c’est aussi ce que veulent LES HOMMES DE BIEN DE LA MÉTROPOLE ET LES COLONS EUX-MÊMES.»110 Die Autoren der Revue erklären in einem strategischen rhetorischen Schachzug, gerade weil sich die colons mit den hommes de bien vergleichen, dürften diese die Bezeichnung gar nicht für sich selbst beanspruchen. Spöttisch werden sie als «ausgezeichnete Übersee-Franzosen» beschrieben, deren Zuckerrohr ihnen wichtiger sei als Frankreich: Ces excellens Français d’outre-mer, ces Français de la Guadeloupe, qui vous disent périsse là France plutôt que nos cannes à sucre ; ces excellens Français n’ont laissé place à aucun doute. Ils ont dit : Les hommes de bien et nous-mêmes. Plus de discussion possible. A moins que ces Messieurs ne prétendent que leur adresse à M. le gouverneur Arnous, dit tout le contraire de ce qu’ils pensent. C’est encore là une explication qui peut séduire quelques lecteurs du Courrier de la Guadeloupe, mais le plus grand nombre dira : Oui, c’est bien cela ; LES HOMMES DE BIEN ET LES COLONS EUX-MÊMES.111
Während die beiden Gruppen, die colons als herrschende weiße Schicht in den Kolonien und die hommes de bien als Ideal aus vorrevolutionärer Zeit, für eine ironische Darstellung überholter aristokratischer Selbstinszenierungen stehen, erfährt ein anderer Typenentwurf eine Aufwertung, und zwar jene des progressiven Weißen, der durchaus sensibel und sklavereikritisch gezeichnet wird, aber trotzdem den französischen Kolonialismus verteidigt: So beteuert Cicéron in seiner im Courrier de la Guadeloupe besprochenen Rede, wie sehr er um das Wohl von rund 20 schwarzen Männern aus Dominica, die Zuflucht auf Guadeloupe
109 110 111
Ebda., S. 42. Ebda., S. 42. Ebda., S. 43.
151
gesucht hatten, besorgt sei. Dabei geht es offensichtlich auch um eine Kopfpauschale von 1.485 F, die man für diese entlaufenen Sklaven bekommen würde. Er erklärt auch, dass die auf Guadeloupe angekommenen Sklaven auf Dominica so schlecht behandelt würden, dass sie sich bald wieder ihre Versklavung in den französischen Kolonien wünschten. Auf der Insel Antigua habe sich ein tragisches Ereignis abgespielt: Geflohene Sklaven aus Guadeloupe seien verhaftet, in Ketten gelegt und zum Straßenbau eingeteilt worden. Unter der eigentlich befreiten Bevölkerung herrsche vollkommenes Elend, und die schwarzen Franzosen litten noch mehr darunter als die indigene Bevölkerung. Einige der Flüchtlinge hätten darum gebeten, nach Guadeloupe zurückzukehren, da ein Leben in der französischen Sklaverei allemal besser sei als die Freiheit in den britischen Kolonien. An diese Frage schließt sich eine Präzisierung der instrumentarischen Handhabung an: In dem Artikel «De la peine du fouet» wird Kritik an den Weißen als Gegner der Abolition und am Gebrauch der Peitsche geübt.112 Dabei geht es auch um die Frage, ob man die Schwarzen überhaupt «zivilisieren» könne, eine Frage, die die Befürworter der Sklaverei vehement verneinen; allerdings seien die Herren gerne bereit, es gegen Zahlung einer horrenden Summe auf einen Versuch ankommen zu lassen: Lorsque M. Mauguin, M. Dupin, Charles le baron, M. Granier, natif de Cassagnac, viennent nous endormir de leurs pesantes homélies, quelle est la conclusion de ces grands hommes d’état ? que les noirs sont esclaves parce qu’ils n’ont ni intelligence, ni moralité, ni amour du travail, et qu’ils sont incapables d’acquérir ces qualités. Ce n’est qu’après avoir démontré qu’il y a impossibilité de moraliser les noirs, que tous les défenseurs de l’esclavage en viennent à dire : essayez, pourtant ; mais surtout ne faites rien sans nous avoir préalablement donné 250 millions.113
Der Andere wird existentiell zur Selbst-Versicherung benötigt. So wird kritisiert, dass jeder von der Moralisierung der Sklaven spreche, die aber in Frage stehe, solange die Peitsche immer noch in Gebrauch sei. Gewährsmann ist hier der französische Abgeordnete François Mauguin, der 1834 einen Gegner der Abolition attackiert, und zwar eine der damaligen Hauptfiguren der Sklavereiverteidiger im französischen Parlament. Die Emanzipation werde nur dann Wirklichkeit, wenn man die Peitsche aus der Hand der Sklavenhalter nehme. Nous ne désespérons pas de voir M. Mauguin venir demander à la tribune une loi qui nomme les maîtres instituteurs de leurs esclaves ; et M. Mauguin qui est d’un naturel très vif sera bien capable de demander cette loi, le fouet à la main ! Quant à nous, nous demandons une loi, un décret, une ordonnance (peu nous importe !) qui fasse disparaître des lois coloniales un horrible supplice. L’émancipation ne commencera à être une vérité, que lorsqu’on aura ôté le fouet des mains d’un possesseur d’esclave.114
112 113 114
Revue des Colonies (Oktober 1836), S. 145f. Ebda., S. 145f. Ebda., S. 146.
152
Manguin ist ein typischer Vertreter der Aufklärung, der davon überzeugt ist, dass man – schafft man vernünftige Bedingungen – die Schwarzen auch bilden kann. Zu allen Zeiten behaupteten die Vertreter der gegnerischen Position, die Schwarzen seien auf Grund genetischer Defizite nicht bildbar. Eine wieder andere Repräsentationsform zeigt sich in dem Artikel «Esquisses de moeurs créoles – par un créole de Cayenne». Es handelt sich um Reiseliteratur eines in Guyana geborenen und aufgewachsenen jungen Kreolen aus Frankreich, der sein Herkunftsland nach langer Zeit wieder besucht.115 Er macht sich auf den Weg zu den Plantagen, wo er früher gelebt hat, und schildert seine Eindrücke. Die Erzählung ist ursprünglich in einer anderen Zeitung (Temps) erschienen, und es ist interessant festzustellen, dass es Abweichungen zu den üblichen Schwerpunkten in der Revue des Colonies gibt. So beschreibt der Autor Rituale der Sklaven und ihre spirituelle Verbundenheit mit der Natur, insbesondere mit den Gestirnen, während die Artikel in der Revue sonst eher die Missionierungserfolge bei den Sklaven hervorheben: […] les chants deviennent de plus en plus distincts ; el lorsqu’apparaît le soleil, avec cette éclatante majesté dont il s’environne toujours dans les régions de l’équateur, chaque nègre frappe l’onde de sa large pagaie, et, levant les yeux au ciel, pousse un hourra long et bruyant, comme pour saluer l’astre du jour. Tous ces malheureux esclaves, que l’on baptise par force, conservent le souvenir de l’idolâtrie qu’ils pratiquaient en Afrique, et aiment encore le soleil comme une divinité bienfaisante.116
Er schildert die Arbeit der Sklaven und erinnert sich, wie brutal sie behandelt wurden. Die Vorzüge der Dampfmaschinen werden gepriesen, die dazu führten, dass nun wenige Frauen reichten, um die Arbeit zu vollziehen. Auch das (Privat) Leben der Schwarzen wird thematisiert: Les colons de Cayenne accordent à leurs esclaves ce qu’ils appellent le samedi nègre. L’esclave travaille depuis le lundi malin jusqu’au vendredi soir pour le compte du maître ; mais il peut disposer du samedi pour cultiver le petit jardin qu’on lui a donné et où croissent quelques bananiers et des patates […]. A la ville, les esclaves ouvrière travaillent pour leur propre compte le samedi et le dimanche ; ils emploient tout l’argent qu’ils gagnent à s’acheter des vêtemens et des chapeaux en cuir vernissé […]. Dans les habitations, les économies des nègres sont moins considérables et plus rares ; aussi ne partagent-ils pas la passion de ceux de la ville pour la parure.117
Das Eigeninteresse der Sklaven wird geweckt, da sie ein eigenes Stück Land bearbeiten. In der Wahrnehmung des Autors scheint es ihnen besser zu gehen als früher, während seiner Kindheit. Die häufig schablonenhafte Wahrnehmung einer Repräsentation von Weiß-Sein erfährt über einen kaleidoskopischen Blick auf verschiedene Teilartikel der Revue eine Relativierung. Eine klare Zuschreibung scheint allein auf Grund komplexer
115 116 117
Revue des Colonies (November 1836), S. 253–261. Ebda., S. 254. Ebda., S. 256.
153
geographischer Zirkulationsprozesse nicht mehr kenntlich. So erweist sich eine eindeutige Grenzziehung zwischen colon (als Plantagenbesitzer) und homme du bien (als Pariser Aristokrat) als unmöglich. Genauso wenig funktioniert die Zuordnung eines Kreolen aus Guyana, der nach langem Parisaufenthalt nach Cayenne zurückkehrt und sich selbstverständlich als Kreole sieht, dort aber nicht als solcher wahrgenommen wird. Wie auf literarischer Ebene im Zusammenhang mit den Begrifflichkeiten Nation/Patrie/Exil bei Gómez de Avellaneda und der Condesa de Merlín bereits gezeigt, erfahren die weißen Denominationspraktiken, die gesellschaftlich als unhinterfragbar galten, eine Relativierung. Auch hier scheinen karibische Inszenierungen nicht ohne die Kategorie des Dazwischen auszukommen – dass dies unter Beibehaltung eines klaren kolonialen Zentrums stattfindet, überrascht nicht weiter. IV.2.3. Weiß-Sein auf Haiti Wenig überraschend, waren die haitianische Revolution und vor allem ihre Folgen ein wichtiges Thema der Revue: zu dem Artikel «Haiti. Principe de sa constitution» wird lediglich «un haïtien» als Autor angegeben.118 Es geht darin um die Rechtfertigung der haitianischen Verfassung, speziell eines Gesetzes, das zu der Zeit für viel Polemik sorgte. Dieses Gesetz beinhaltet, dass kein Weißer, egal welcher Nation, Haiti jemals als Herr (maître) oder Eigentümer (proprietaire) betreten dürfe.119 Der Artikel wirbt um Verständnis für ein solches Ausschließen von Weißen: Rassenvorurteile würden nur dann überwunden, wenn Europa sehen könne, dass die schwarze Rasse aus eigener Kraft den Ausweg aus der härtesten Sklaverei gefunden habe und sich allein durch die eigene Wesensart formieren konnte. On se tromperait fort si on ne voyait dans cette loi fondamentale qu’une expression de haine envers les blancs. Il y a quelque chose de plus élevé qu’un sentiment de vengeance ou de colère : il y a la foi dans l’avenir d’un pays et la ferme volonté d’en établir les bases sur un principe nouveau, du moins pour les Européens. Les législateurs d’Haïti ont voulu montrer que la nation était aussi bien capable de conserver que de conquérir. Si cette démonstration était devenue nécessaire, ce n’est pas à eux qu’il faut en imputer la faute. Le préjugé de race ne sera totalement aboli que lorsque l’Europe verra la race noire, sortie par ses seules forces du plus dur esclavage ; s’organiser par son seul génie, édifier après avoir détruit […].120
Der Autor versucht, dieses Gesetz als alternativlos zu erklären und die Reichweite eines solchen Gesetzes zu schildern. Er setzt bei dem Dogma der colons an, die Schwarzen seien Sklaven und verdienten dieses Los. Sie gehörten einer niederen Rasse an und seien deshalb nicht in der Lage, jemals eine zivilisierte Gesellschaft zu gründen. Aber da die Welt nun mit Haiti ein Land gesehen ha-
118 119 120
Revue des Colonies (September 1836), S. 97–100. Ebda., S. 98. Ebda., S. 98.
154
be, das sich ohne fremde Hilfe formt und zivilisiert, werde dieser Syllogismus, weitaus bedeutender als alle Theorien für oder gegen die Sklaverei, eine neue Ära in den menschlichen Gesellschaften einläuten. Das Beispiel Haitis sei weit über die Grenzen des Landes bedeutsam: Les législateurs d’Haïti ont été guidés par l’intérêt de toute la race noire. Haïti a stipulé pour l’Afrique tout entière. L’exemple que ses législateurs ont voulu donner au monde, est d’une si grande portée, qu’ils ne devaient point être retenus par la crainte de proclamer une loi, injuste peut-être dans son principe, mais nécessaire et commandée par toutes les considérations qui servent de mobile à la société.121
Die hehren Motive des Ausschlusses von Weißen seien also keinesfalls zu verwechseln mit Hass oder Rachsucht, man möge nachsichtig sein mit der jungen Nation, die sich gegen die geistige und materielle Übermacht Europas erst durchsetzen musste; schließlich sei das Prinzip des Ausschlusses in Frankreich selbst gerade erst durch die Französische Revolution (also weniger als ein halbes Jahrhundert zuvor) verschwunden. Resümierend erklärt der Autor: «Le peuple français qui a tant fait pour la cause de l’humanité doit avoir assez d’expérience pour reconnaître qu’il faut quelquefois séparer le but des moyens et que la nécessité n’impose pas toujours la loi la plus juste.»122 Aus dem Fundus der Revue des Colonies ist des weiteren ein satirisches Theaterstück zu Haiti mit dem wenig aussagekräftigen Titel Proverbe dramatique erwähnenswert, dessen Schauplatz das Marineministerium ist und das mit allen fünf Szenen abgedruckt wird. Folgende fünf Personen spielen mit: 1) M. Saintileurre, oberster Direktor aller Kolonien. Sein Name wird im Stück andauernd verfälscht, um seine opportune und «lächerliche» Art zu veranschaulichen. 2) Ein Schwarzer; sein Name wird erst im Stück bekannt. 3) Ein Mulatte, dessen Name gar nicht genannt wird. 4) Ein Herr namens Thé(-au-d’or) Baboule; er wird ironisch als humanitärer Weltverbesserer beschrieben. 5) Ein Baron. Das Ganze spielt im Büro von Saintileurre, wo Portraitgemälde vieler colons und ihrer Interessensvertreter hängen, die namentlich genannt werden. Dabei wird ein Bild beschrieben, das die colons schlafend im Conseil zeigt: On voit même à la figure des divers personnages que ce sommeil est d’une nature prodigieuse, et tellement concentré qu’on serait tenté de croire que chacun des honorables dormeurs porte dans sa poche un exemplaire d’outre-mer, par M. Louis de Maynard de Queilhe, gentilhomme de Quercy.123
121 122 123
Ebda., S. 98f. Ebda., S. 100. Revue des Colonies (August 1836), S. 137.
155
Thema des Stücks ist Haiti, wobei sich Thé Baboule bei Saintileurre als neuer Gouverneur bewirbt, um das bankrotte Haiti zu retten. Zudem geht es vielfach um die Schwierigkeit, wie jetzt mit den befreiten Sklaven und den Mulatten umzugehen sei. Saintileurre weiß überhaupt nicht mehr, wie er sie nennen soll. Schwarze sind sie nicht mehr, Weiße aber auch nicht. Der Baron wird gerufen, um Klarheit zu bringen, die jedoch durch sein Stottern nicht aufkommen mag. Der Mulatte und der Schwarze müssen mehr oder weniger hilflos wieder verschwinden. Die Pointe besteht darin, dass diesmal Saintileurre dem Baron voller Ironie und stotternd sagt, ihm bleibe nichts anderes übrig, als auf eine ironische Ebene zu rekurrieren. Klare Hautfarbzuschreibungen scheinen nicht mehr zu funktionieren, und doch gilt nach wie vor die Hautfarbe als staatsrechtliche Funktion. Es mag nicht von ungefähr kommen, dass es sich bei diesem Beispiel um eine literarische, konkret dramatische Repräsentationsform handelt, die für Nicht-Sagbarkeit über ein anderes Repertoire verfügt als journalistische Texte. IV.2.4. Transkoloniale Dimension Der Beitrag «L’Espagne, sa révolution, son influence sur l’abolition de l’esclavage colonial»124 erörtert die spanische Revolution und ihren Einfluss auf die Sklavereiabschaffung. Betont wird die Rolle einer großen spanischen Nation, wo der Fortschritt sich nicht aufhalten lasse. Die politischen Entwicklungen in Spanien, die die Macht der Aristokratie in Frage stellen, könnten nicht ohne Auswirkungen auf die spanischen Kolonien bleiben. Wenn Spanien es nicht vermöge, geschickt und gerecht zu agieren, werde es seine verbleibenden Kolonien nicht halten können und die karibischen Inseln würden dem Beispiel der bereits unabhängigen Nationen folgen: Les efforts réunis de quelques philantropes et de quelques ambitieux, appelant aux armes, les maîtres et les esclaves sans distinction, secouèrent le joug de la métropole, et l’Africain et l’Indien, jusqu’alors tenus en servitude, devinrent citoyens libres et prouvèrent depuis, sur les champs de bataille et dans les conseils, que la gloire et la liberté étaient pour eux des biens inappréciables, comme pour tous les êtres humains. Certes, les gouvernans actuels [...] ne s’exposeront pas à perdre encore la Havane et Porto-Rico. Par une politique habile et juste, ils s’occuperont [...] de conserver à leur patrie ces débris assez importans de leur immense empire d’Amérique, et qu’ils sont menacés de perdre s’ils sont inhabiles et injustes.125
Es fällt auf, dass die Revue des Colonies, ein kolonialkritisches Organ, das Beispiel Spaniens als Vorbild für Frankreich präsentiert. Diese Stelle ist rhetorisch besonders interessant, da sie sich vordergründig an Spanien wendet und es ermutigt, Frankreich in punkto Kolonialpolitik hinter sich zu lassen; der eigentliche Adressat ist aber Frankreich. Spanien wird ein politischer Vorsprung attestiert,
124 125
Ebda., S. 49–54. Ebda., S. 52.
156
und es wird aufgerufen, sich auch hinsichtlich des sozialen Fortschritts um eine Vorreiterrolle zu bemühen: Nous le répétons, il n’y a qu’une politique habile et juste de la part du gouvernement espagnol qui peut préserver la perte des îles de Cuba et Porto-Rico, [...]. Il faut suivre l’exemple de l’Angleterre et proclamer comme elle le principe de l’abolition de l’esclavage, conséquence de l’abolition de la traite ; il faut par ce grand acte de justice rattacher par la reconnaissance à la métropole cette masse d’ilotes qui ne cessaient d’avoir les yeux tournés vers la Jamaïque et vers Haïti d’où ils attendaient leur délivrance. Leur reconnaissance et les productions de la liberté vous récompenseront largement des imprécations de quelques planteurs. N’imitez pas la France, et puisque vous la devancez dans la carrière politique, devancez-la aussi dans le progrès social et laissez-la honteusement en arrière, subissant les injures el les outrages d’une poignée de colons qui veulent lui imposer la liberté du commerce, et auxquels elle n’a pas le courage et la dignité d’imposer la liberté de l’homme !126
Anstatt Frankreich solle Spanien lieber dem Vorbild Englands nacheifern und die Sklaverei abschaffen. Hier spielt die innerkaribische Dimension eine wichtige Rolle: wenn dann auch die spanischen Karibikinseln die Abolition umgesetzt hätten, so die Hoffnung der Autoren, würde die Isolation der beiden verbleibenden Sklavenhaltergesellschaften, Guadeloupe und Martinique, auch hier zu einer Veränderung der Verhältnisse führen: Encore une fois, suivez l’exemple de l’Angleterre, et n’imitez pas la France ; et lorsque dans le golfe mexicain, la Martinique et la Guadeloupe seules renfermeront une poignée de maîtres et une population d’esclaves, les temps seront bien près d’arriver et les destinées bien près de s’accomplir pour ces deux îles.127
In «Sur les derniers évènemens de l’île de Cuba et sur l’importance politique de cette colonie»128 wird die Wichtigkeit der Insel Kuba für die Kontrolle der gesamten Karibik betont. In einem «rassistischen» Satz am Ende wird gewarnt, England hege, wie alle großen Mächte, ein Interesse an dieser strategischen Position. Es gelte, um jeden Preis zu verhindern, dass England mehr Spielraum bekomme: «L’existence de la race espagnole dans l’Amérique du Nord est pour nous une garantie nécessaire ; nous devons donc, de tous nos efforts, empêcher les envahissemens de la race anglaise.»129 Zur Bestätigung einer solchen Ansicht werden als Beispiel die britischen Kolonien angeführt, wo die Abschaffung der Sklaverei lediglich negative Auswirkungen gehabt habe. Landwirtschaft, Industrie und Handel seien fast völlig zum Erliegen gekommen, und es drohe der komplette Ruin der britischen colons. Auch die britischen Handelsbilanzen werden negativ dargestellt, was in einem starken Kontrast zum positiven Bericht von Gouverneur Smith über die Produktionszahlen
126 127 128 129
Ebda., S. 53. Ebda., S. 54. Revue des Colonies (Februar 1837), S. 334–337. Ebda., S. 337.
157
steht.130 Folglich müsse man aus den Folgen der Abolition in anderen Kolonien lernen und Geduld haben, denn die Vorbereitung der Befreiung benötige viel Zeit und keinesfalls eine vorschnelle Gesetzgebung: «la civilisation des peuples est l’oeuvre des tems bien plus encore que celle des législateurs.»131 Es ist bemerkenswert, dass eine Zeitschrift, die so eindeutig für die Abolition eintritt, auch Stimmen zu Wort kommen lässt, die die Nachteile der Sklavenbefreiung beim Namen nennen. In einer weiteren Ausgabe wird die Biographie von Thomas Clarkson abgedruckt. Der Kampf des Engländers für die Abolition wird erzählt, auch wie er versucht hat, sich außerhalb seines Landes für die Abolition einzusetzen – so auch in Deutschland: L’abolition de la traite par le parlement anglais en 1807 fut la récompense de tant d’efforts. Mais ce résultat obtenu, Clarkson fut loin de considérer son oeuvre comme accomplie. Il désirait que toutes les nations du monde missent fin à la traite, et pour les y amener, il se rendit en 1818 au congrès d’Aix-la-Chapelle, où les souverains dé l’Europe étaient réunis.132
Aber es gibt auch durchaus andere Stimmen aus dem britischen Kolonialreich: in einer anderen Ausgabe werden die bereits umgesetzten Abolitionen auf Jamaika, Saint-Christopher und Tobago als Erfolgsgeschichte erzählt. Ein Brief der Herrnhuter Brüdergemeine (frères moraves) lobt die positiven Auswirkungen der Sklavenabschaffung, allerdings bezogen auf den Kirchenzulauf. In verschiedenen Orten auf Jamaika sei der Andrang der ehemaligen Sklaven in der Kirche so hoch, dass man viele von ihnen (leider) heimschicken müsse. Zudem werde der dringende Wunsch nach Alphabetisierung ausgedrückt: «Partout on voit se manifester un vif désir d’entendre la parole de Dieu et d’apprendre à lire.»133 Diese positive Schilderung der Abolitionsfolgen steht der großen Skepsis der Plantagenbesitzer entgegen, die beispielsweise auch bezüglich der Ernteergebnisse manche Bedenken hegten: «[…] on a aussi manifesté quelques doutes sur les résultats de là récolte, mais ces doutes venaient tout autant, et même bien plus, des craintes vagues dés planteurs que d’aucune mauvaise volonté de la part des noirs […].»134 Um die Vorbehalte der Plantagenbesitzer zu zerstreuen, werden englischsprachige Berichte übersetzt, die illustrieren, dass die Sklavereiabschaffung (wie sie in den britischen Kolonien bereits stattgefunden hatte) großen Nutzen bringt. Die Inszenierung der vergleichenden Fragestellung zum spanischen, französischen und englischen Kolonialismus bringt zwar keine spannenden Erkenntnisse auf der Ebene einer differenzierten Betrachtung unterschiedlicher Kolonialismen, dennoch illustriert sie auf wieder andere Weise Frankreichs unhinterfragbare
130 131 132 133 134
Revue des Colonies Revue des Colonies Revue des Colonies Revue des Colonies Ebda., S. 29.
158
(Juli 1836), S. 21–25. (August 1836), S. 67. (Oktober 1836), S. 160. (Juli 1836), S. 27.
Selbstbezüglichkeit, deren Affirmation durch einen Außenblick noch Bestätigung finden soll. IV.2.5. Innerkaribische Dimension Welche Wissenstransfers fanden nun zwischen den Inseln statt? Inwiefern diente die Revue des Colonies als innerkaribisches Kommunikationsmedium? Dadurch, dass Druckerpresse und andere offizielle Medien über die kolonialen Zentren gesteuert waren, sind die innerkaribischen Zirkulationsprozesse bis heute historiographisch unterbeleuchtet und werden vor allem subversiven Akteuren zugestanden, die wenig Schriftzeugnisse hinterlassen haben. Inwiefern die Revue des Colonies eine Mittlerinstanz einnimmt, sollen die folgenden Teilartikel zeigen. Zunächst Guyana und die Frage nach einer möglichen Emanzipation der schwarzen Bevölkerung: Im August 1836 bringt die Revue des Colonies eine Rede des Gouverneurs von Guyana, M. de Choisy, vor dem Conseil colonial, die sich speziell an die Plantagenbesitzer richtet.135 Man merkt den auf dieses Auditorium abgestimmten Ton: De Choisy zeigt Verständnis für die abwehrende Haltung der colons, die die «Dinge» nicht überstürzt ändern wollten, betont aber gleichzeitig, dass die Zeit der Zugeständnisse gekommen sei, denn ganz Frankreich wünsche die Emanzipation und es sei an ihnen einzulenken, um ihre Interessen zu wahren. Diese «Zeit der Zugeständnisse» unterstreicht er denn auch mit dem Hinweis, der König sei sehr gewillt, den Kolonien mit Investitionen entgegenzukommen: Cependant, Messieurs, nous ne le dissimulons pas, le tems des concessions est arrivé. La grande question de l’émancipation, terreur des colons, chimère caressée par la Métropole, est à l’ordre du jour ; la France entière la désire et l’appelle de tous ses voeux, sans en calculer probablement tous les résultats. Les noirs, travaillés par des idées d’indépendance, [...] viennent réclamer à leur loin des droits fondés en principe sur la liberté du genre humain, [...]. Dans cet état de choses, placés entre les idéalités philosophiques de la mère-patrie et les réclamations bien plus pressantes des esclaves, les colons sentiront qu’il est tems de prendre un paru et de calmer les irritations par des concessions sages, graduées, qui puissent concilier et les intérêts presens des propriétaires et l’avenir des noirs.136
Unter dem Titel «Adresse du conseil en réponse au discours du gouverneur»137 ist die Antwort des Conseil abgedruckt. Die colons (kein Autor wird genannt) machen deutlich, dass sie nicht gedenken, sich den aus ihrer Sicht gefährlichen Utopien der Emanzipation hinzugeben. Sie betonen, stets offen zu sein für Verbesserungsvorschläge, sofern diese wünschenswert und machbar sind, aber die Zeit sei nicht reif für Innovationen und die Sklaven seien noch nicht bereit für die Freiheit.
135 136 137
Revue des Colonies (August 1836), S. 60–64. Der Titel lautet: «Guiane – Conseil Colonial – Discours de M. de Choisy, gouverneur, à l’ouverture de la session de 1836». Ebda., S. 62. Ebda., S. 64–68.
159
Nous avons marché, nous marcherons encore à toutes les améliorations désirables et possibles. Mais, ainsi que vous le reconnaissez vous-même, monsieur le gouverneur, le temps n’est pas venu pour nous de nous lancer dans la carrière des innovations. Nous pouvons le dire avec assurance, malgré les assertions de nos détracteurs, les hommes dont quelques novateurs s’occupent sans les connaître ne sont pas à la hauteur des bienfaits dont on voudrait les faire jouir.138
Nach Guyana rückt in der gleichen Ausgabe schließlich Kuba in den Blick und damit die Frage, ob es nicht dem Beispiel Haitis folgen und sich unabhängig erklären könnte. Zwei mögliche Modi kommen zur Sprache, wie die Unabhängigkeit zu erreichen wäre: entweder durch ein Abkommen zwischen colons und Schwarzen, so – der Vergleich hinkt allerdings ein wenig – wie es der Fall war in Peru, Mexiko und Chile; oder durch gewaltsame und «glückliche» Aufstände der Schwarzen – sehr zum Schrecken der Sklavenhalter, die sich Besitzrechte über andere Menschen anmaßen –, wie es der Fall war in Saint-Domingue.139 Für die englische Karibik wird besonders häufig die Insel Barbados einer Betrachtung unterzogen, und dies meist unter dem Blickwinkel von Missionierungsfragen. So wird in «Barbados: Mission des frères moraves» über das Missionswerk der Herrnhuter Brüdergemeine berichtet, wobei die positiven Ergebnisse der Emanzipation besondere Erwähnung finden: «L’émancipation des nègres n’y a produit jusqu’à présent que d’heureux effets.»140 Nochmals zurück zu Guyana, dem auf Grund der Kontinentallage und der Brücke zu einer transtropischen Zone in der Revue des Colonies traditionell eine prominente Position zukommt. Auch hier darf das Hauptthema der Karibik, die Abolition, nicht fehlen. An einer Stelle rügt Bissette M. Ursleur, ein Mulatten-Mitglied des Kolonialrats in Cayenne, er sei der «einzige farbige Mann» in Cayenne, der gegen den «gesunden Menschenverstand» handle, indem er sich weigere, die Abolition zu unterstützen.141 Er behauptet, beweisen zu können, dass die nichtweiße Bevölkerung in Cayenne kategorisch protestiere gegen einen derartigen Verrat durch einen Mann, der so sehr jede Moral und Bescheidenheit vergesse, dass er sich gegen seine eigene Rasse und seine eigene Familie verschwöre, um sich der elendsten aller Aristokratien, jener der Hautfarbe, anzudienen.142 Hier wird deutlich, dass Bissette nicht nur nach der Abschaffung der Sklaverei strebte, sondern das Thema der Abolition so eng mit dem der Identitätskonstruktion der hommes de couleur verbunden hatte, dass eine Unterstützung des Status quo ungeheuerlich und undenkbar wurde. Bissette unterschied hier auch zwischen Rasse und Hautfarbe, er hielt Schwarze und Mulatten für ein und dieselbe Rasse, trotz der Unterschiedlichkeit ihrer Hautfarbe.143
138 139 140 141 142 143
Ebda., S. 65. Ebda., S. 52f. Ebda., S. 71. Vgl. Duke Bryant: Black but not African, S. 261. Zit. nach Revue des Colonies (September 1836), S. 117. Vgl. auch Duke Bryant: Black but not African, S. 261. Duke Bryant: Black but not African, S. 261.
160
Die «Notice sur la Guyane»144 enthält einen aufschlussreichen Plan darüber, wie Guyana zu kolonisieren sei. Sie nimmt Bezug zum Kommissionsbericht von 1822, der davon abrät, Guyana zu kolonisieren. Der Autor Catineau-La-Roche, königlicher Kommissar und verantwortlich für die Erschließung Guyanas, argumentiert, man könne Guyana sehr wohl kolonisieren, man müsse nur «richtig» vorgehen. Pour réussir dans une affaire aussi compliquée que l’est une colonisation, quel que soit le climat sous lequel, on l’entreprenne, il faut beaucoup de soins et de prévoyance : les soins donnés aux détails sont les principaux moyens de succès, et c’est pour les avoir négligés que la France compte autant de revers que de colonisations entreprises. […] Je suppose que la colonisation soit entreprise et conduite par le gouvernement seul : quelle population pourra-t-il envoyer à la Guyane ? Ses agens, quelques recommandations qu’il leur fasse, regarderont la nouvelle colonie comme un égout dans lequel ils se hâteront d’envoyer la population la moins pure, et la Guyane ne recevra que des rebuts. J’admets au contraire qu’une association de cent familles propriétaires, par exemple, ait un intérêt particulier à envoyer dans la nouvelle colonie des hommes honnêtes et laborieux î les meilleurs choix seront faits, et il sera facile de les faire tels, car chaque famille n’aura qu’un petit nombre de personnes à choisir.145
Der Leitgedanke einer mission civilisatrice ist hinsichtlich des «unzivilisierten» Guyana besonders pointiert dargestellt. Die Betonung der überlegenen Arbeitskraft rundet die etablierten Rassenvorurteile ab: «En supposant que chaque ouvrier blanc ne fasse que la dixième partie du travail d’un nègre, qui ne travaille guère, c’est-à-dire, qu’il ne travaille qu’une heure par jour, si le nègre en travaille dix.»146 Die innerkaribische Dimension bezieht sich auf Wissenstransfers zwischen den Inseln, die die Hauptthemen der Karibik zu diesem Zeitpunkt verhandeln: Abolition, kolonialer Status quo, Rassediskurse, Missionierung. Der teilweise unterschiedliche Umgang mit diesen Themen wird vermittelt, wobei auffällt, dass weniger ein solidarisches Netz zwischen den Inseln gespannt wird, als dass man kritisch beäugt, wie andere mit Diskursen aus den kolonialen Zentren umgehen. Die Wahrnehmung des Anderen wird gefiltert und wirkt dank dieses Publikationsorgans wieder unmittelbar auf die Metropole zurück. Die Kapazität der Integration, um nicht zu sagen: Inklusion, geht so weit, dass selbst naheliegende Themen nicht in unmittelbarer Nachbarschaft verhandelt werden, sondern immer über das Zentrum.
144
145 146
Pierre-Marie Catineau-La-Roche: Notice sur la Guyane française, suivie des motifs qui font désirer que la colonisation projetée sur la Mana soit dirigée par une association en concurrence avec le gouvernement. Paris: Imprimerie de Fain 1822. Ebda., S. 7f. Ebda., S. 15.
161
IV.2.6.
Ideentransfer
IV.2.6.1. Die Rezeption der haitianischen Revolution Le Chevalier de Mauduit In dem vollständig abgedruckten Theaterstück Le Chevalier de Mauduit von Bauvais Lespinasse147 wird in einem ersten Teil die Vorgeschichte der Sklavenaufstände von Haiti wiedergegeben, genauer gesagt die Machtkämpfe, die am 30. Oktober 1790 stattgefunden und beinahe zum Bürgerkrieg geführt haben. Es wird von zwei Regierungen berichtet, die sich zu der Zeit in Saint-Domingue gegenüberstehen: einerseits der Gouverneur général, Comte de Peynier, und seine Anhänger, die mit weißen Hüten bekleidet sind, sprich: in der königlichen Farbe; andererseits die rotbehuteten Anhänger der Assemblée nationale samt colons, die die Fortschritte der Revolution mit Begeisterung erwarten und sich einer Gleichsetzung und Emanzipation der mulattischen (übrigens gebraucht Lespinasse den Ausdruck «jaune») und schwarzen Bevölkerung vehement widersetzen: «L’assemblée provinciale de l’ouest et tous les propriétaires blancs partageaient les vues de l’assemblée générale ; car ils craignaient, qu’une portion de la race africaine arrivant à l’émancipation, n’entraînât l’autre avec elle, et de là, la perte de leurs biens immenses.»148 Deswegen schließen sich die freien Schwarzen und Mulatten de Peynier und seinem Colonel Mauduit an. Der Machtkampf verschärft sich und die Assemblée verschanzt sich, um zu tagen. Als ihre Anhänger versuchen, den (Schieß)Pulverladen einzunehmen und sich dem gemeuterten Schiff Léopard anzuschließen, greift de Peynier ein und schickt Colonel Mauduit, um die Versammlung aufzulösen, gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen zu kämpfen und das Besitztum des Königs zu wahren. De Peynier und Mauduit werden bis zu diesem Zeitpunkt positiv und «fair» beschrieben, die Assemblée jedoch als «hinterhältig». Mauduit stürmt die Assemblée und siegt. Als die Assemblée bemerkt, welch große Gefahr Colonel Mauduit und de Peynier darstellen, versucht sie, die freien Schwarzen und Mulatten für ihre Sache zu bewaffnen. Doch diese halten ihrem König die Treue, da sie sich von der Auflösung der Assemblée ihre Emanzipation erhoffen.149 Die freien Schwarzen und Mulatten merken indes schnell, dass sie auch von Mauduit und de Peynier keine wirkliche Emanzipation zu erwarten haben. Es kommt zum Bruch, als sie ihre Hüte bekommen – diese sind nicht, wie erwartet, weiß, sondern weiß-gelb. Die Hüte werden als Affront abgelehnt, was wiederum Mauduit erbost. Er zerreißt das Dekret vom 28. Mai, das allen
147
148 149
Bauvais Lespinasse: Le Chevalier de Mauduit. In: Revue des Colonies. Teil 1: «30 octobre 1790 – Le comité de l’ouest» (Oktober 1836), S. 166–170. Teil 2: «Madame Martin et Schelec» (November 1836), S. 206–211. Teil 3: «4 mars 1791» (Dezember 1836), S. 245–248. Revue des Colonies (Oktober 1836), S. 166. Ebda., S. 169.
162
Eigentümern ab 25 Jahren die Möglichkeit garantierte, Teil der kolonialen Assemblées zu sein, vor ihren Augen mit den Worten: «[…] et nous verrons maintenant, […], qui vous protègera, bande de g…. !»150 Der Konflikt endet glimpflich, als die Mitglieder der Assemblée die Flucht auf dem Schiff Léopard ergreifen und Saint-Domingue knapp einem Bürgerkrieg entgeht. Es bleiben aber anarchische Zustände, keine Autorität wird mehr dort anerkannt. Sieben Monate nach der Flucht der Mitglieder der Assemblée landen zwei Schiffe mit Soldaten in Port-au-Prince, die eigentlich den «weißen Hüten» von Mauduit (de Peynier ist durch Rouxel Blanchelande ersetzt worden) helfen sollen, wieder Ordnung zu schaffen.151 Diese Soldaten werden jedoch schon auf dem Weg überzeugt, sich den «roten Hüten» anzuschließen. Besonders bemerkenswert ist hier die Figur der Madame Martin, eine als männlich und stark beschriebene Frau, die die weißen Soldaten Mauduits nun auch zum Seitenwechsel bewegen möchte. Sie überzeugt Schelec, einen jungen Soldaten Mauduits, seine Truppenkameraden auch für die Roten zu gewinnen. Dies gelingt ihm. Er soll nun zu Mauduit gehen und ihm einen roten Hut anbieten. Mauduit erfährt davon und sieht sein Ende nahen. Er stirbt den «Heldentod», weil er sich bewusst in eine Falle begibt. Detailliert wird seine Schönheit beschrieben.152 Er macht sich ruhig vor dem Spiegel fertig in dem Wissen, dass er bald ermordet wird. Einige Soldaten und Offiziere stehen ihm bei. Sein Mut wird sehr pathetisch dargestellt. Schelec versetzt ihm den ersten Stoß, und er wird von den anderen Säbeln «in tausend Stücke» gerissen. Sehr makabre und harte Szenen werden beschrieben, unter anderem wie Madame Martin die Nachricht vom Tod Mauduits durch Port-au-Prince trägt. Der Verlust Mauduits wird im Text als der eines großen Mannes beklagt: Le gouvernement colonial perdait en Mauduit le plus ferme soutien de son autorité qui, dorénavant promenée de ville en ville, ne devait plus être qu’une nullité. Quant à la colonie, elle perdait un homme d’ordre, de grand talent, d’une activité persévérante, qui eût pu dans la circonstance lui rendre de véritables services, s’il avait été de meilleure foi.153
Schelec findet nur drei Monate danach auch den Tod in den USA: «Trois mois après la mort de Mauduit on sut au Port-au-Prince que Schelec avait été pendu aux Etats-Unis : ,pour s’être vanté de ses belles actions‘ ajoutait le peuple.»154 Im Gegensatz zu dem vorherigen literarischen Haiti-Beispiel, das sich mit Fragen um die Demarkationslinie der Hautfarbe beschäftigte, reiht sich der Chevalier Mauduit in die literarischen Haiti-Texte (vgl. Kap. III) ein, für die bezeichnend ist, dass sich die Darstellung der haitianischen Revolution hauptsächlich auf eine Schilderung der chaotischen Umstände der Revolution beschränkt. Die Tatsache, dass das Augenmerk vor allem auf das Wie der Revolution gelenkt wird, ist von Bedeutung für die Wertung der haitianischen Revolution im globalen Maßstab.
150 151 152 153 154
Ebda., S. 170. Revue des Colonies (November 1836), S. 206–211. Revue des Colonies (Dezember 1836), S. 245–248. Ebda., S. 248. Ebda., S. 248.
163
Das Ereignis als solches erfährt – ähnlich wie in den literarischen Texten – keine universale revolutionäre Bewertung. IV.2.6.2. Ideentransfer Metropole–Kolonie Der Theorietransfer Metropole–Kolonie, der an sich als DIE koloniale Richtung etabliert ist, wird von den weißen Kreolen für höchst problematisch erachtet, wie aus einer abgedruckten Rede von M. Cicéron vor dem Conseil colonial Guadeloupes hervorgeht:155 Frankreich habe sich in dieser Hinsicht zu Unrecht an ausländischen Vorbildern, genauer gesagt an England, orientiert und so die Zukunft der weißen Pflanzer aufs Spiel gesetzt. Die neuen Kolonialgesetze von 1833 kritisiert Cicéron gegenüber denjenigen von 1790 als zu einengend. Damals sei der Assemblée nationale der Sonderstatus der Kolonien bewusst gewesen. Sie habe berücksichtigt, dass in Ländern, die so weit von der Metropole entfernt sind, andere Sitten und Bräuche herrschten als in Frankreich: L’assemblée nationale, en 1790, par des considérations de justice et d’équité, avait doté les colonies d’une représentation plus large que celle du 24 avril 1833. Elle n’ignorait pas que des pays, situés à 2,000 lieues de la métropole, avaient des moeurs et des habitudes différentes de celles de la France ; en raison de leur exceptionnalité, elles avaient le droit, dans leurs assemblées, de voter les lois et réglemens en harmonie avec leur situation, lois et réglemens qui étaient soumis à la sanction royale.156
Aufschlussreich für den Austausch Metropole–Kolonie ist auch ein Briefduell zwischen dem Comte de Mauny und dem Courrier Français.157 Der Courrier Français scheint in Frankreich selbst etabliert und den colons gegenüber negativ eingestellt zu sein, wie aus dem Wechsel hervorgeht. Diese Polemik besteht aus drei Teilen. Sie beginnt mit einem Artikel, der im Courrier Français erschien. Daraufhin schreibt der Comte de Mauny eine Art Beschwerdebrief, der ebenfalls abgedruckt wird. Schließlich nimmt der Courrier Français Stellung zum Schreiben de Maunys. Der Autor des Artikels im Courrier Français wirft den Plantagenbesitzern vor, sie verschleierten die wahren Zustände in den Kolonien, und ihre Motive für eine Ablehnung der emanzipatorischen Ideen aus dem Mutterland seien rein ökonomischer Natur: La division des colonies a toujours cherché à détourner l’attention publique de ces possessions qu’elle régit arbitrairement, […], de manière que les questions importantes qui les concernent échappent à la connaissance de la métropole. Au surplus les discussions des conseils coloniaux sur la question des sucres, et le langage des journaux de l’île Bourbon et de la Guadeloupe, sur les intentions de la métropole, relativement à
155 156 157
Revue des Colonies (Oktober 1836), S. 151–154. Ebda., S. 154. Ebda., S. 171–177. Der Titel lautet: «Polémique de Journaux».
164
l’esclavage, laissent assez soupçonner, par quels argumens on repousse l’intervention de la législature et du gouvernement sur ce point.158
Daraufhin antwortet der Comte de Mauny am 14. Oktober 1836, dass die Pressefreiheit auf Martinique gewährleistet sei und ein aktives Interesse des Conseil colonial darin bestehe, Werbung zu machen. Zur Sklavereifrage und zur Handelsfreiheit äußert er sich folgendermaßen: La question ne semble pas mériter un si superbe dédain, lorsqu’on propose de faire perdre au commerce maritime de la métropole, pour la Martinique seulement, de 80 à 100 millions, et qu’en invoquant les noms sonores de liberté et d’humanité, on excite à l’insurrection, à l’incendie et à l’assassinat ; il est assez naturel que dans une question où les colons défendent la civilisation contre l’état sauvage, on sache qui la décidera.159
Damit fasst de Mauny nochmals die Argumente der anti-abolitionistischen colons gegen die Reformbestrebungen der Metropole zusammen: Die Emanzipation der Schwarzen führe zu beträchtlichen wirtschaftlichen Einbußen, zu Umstürzen (sprich: zum Verlust der Privilegien der weißen Besitzerklasse) sowie zum Untergang der (französischen) Zivilisation. Nach dem Brief des Comte de Mauny folgt nochmals eine Stellungnahme des Courrier Français, die klar ausdrückt, wie heuchlerisch und verlogen man die Worte von de Mauny findet. Zu erklären ist diese kritische Einschätzung dadurch, dass der Comte de Mauny zwar die Ideen von 1789 bejaht, aber in der konkreten Umsetzung in den Kolonien Probleme sieht. Das in den literarischen Texten häufig inszenierte Scheitern der Transfers vom Zentrum in die Kolonie findet seine Entsprechung in einigen Artikeln der Revue des Colonies. IV.2.7. Verschmelzung als Programm Das Wort, das am besten das revolutionäre Vorhaben der Revue zusammenfasst, ist «Verschmelzung»: wie im Vorwort geäußert, wurde die Revue gegründet mit dem Ziel, die öffentliche Meinung zu beeinflussen durch «eine jederzeit angemessene und aufrichtige, aber energische und niemals zaghafte Diskussion der Ursachen, was auch immer diese sein mögen, die die erstrebenswerte Verschmelzung der verschiedenen Völker der Kolonien behindern».160 Die Rassensegregation, die die koloniale Gesellschaft strukturiert, soll aufgebrochen werden. Dies zeigt besonders anschaulich Bissettes Artikel zu den englischen Kolonien: «De l’émancipation des esclaves, considérée comme premier élément du progrès social aux colonies»161. Darin stellt er fest, dass «Produktion und materieller Wohlstand dort vorankommen und die Verschmelzung der schwar-
158 159 160 161
Ebda., S. 171f. Ebda., S. 175. Revue des Colonies, I.i, S. 3, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 449. Revue des Colonies, I.vii, S. 3–14.
165
zen und weißen Rassen schnell voranschreitet».162 Obwohl mit dem Vorhaben der assimilation in der mère-patrie in Verbindung gebracht, ist das Ideal der Verschmelzung nicht deckungsgleich mit der in Pariser Kreisen zirkulierenden Idee der Assimilation. Im Gegenteil: Die Betonung liegt in erster Linie auf der Bildung einer karibischen Gesellschaft, die ihre eigenen Bräuche hat.163 Im beispielhaften Artikel «De la fusion des deux races aux colonies et des causes qui la retardent»164, höchstwahrscheinlich von Bissette verfasst, wird gleichfalls die Schaffung eines postrassischen «geteilten Heimatlandes» propagiert, das sowohl Teil Frankreichs als auch von ihm verschieden wäre: Eigentlich ist es unmöglich, dass, sobald rechtmäßige Klagen einmal erfüllt, Groll beschwichtigt, gleiche Ausgangsbedingungen geschaffen, die Unterdrücker entwaffnet und bestraft, in einem Wort, gleiche Rechte ausgerufen und angemessen von öffentlichen Behörden beschützt worden sind, ist es unmöglich, sagen wir, dass die weiße und schwarze Bevölkerung in den Kolonien sich nicht verbrüdern sollten und sich zusammentun, in jedermanns bestem Interesse, das Land gemeinsam zu bewirtschaften, ihr heutiges gemeinsames Heimatland, in dem eine bessere Organisation von Arbeit und die Entwicklung eines außerordentlichen Gemeinschaftsgefühls der Brüderlichkeit der Männer, es für sie in ein Heimatland wandeln wird, das so sehr geliebt wird, wie es frei, fleißig und wohlhabend ist.165
Bongie macht darauf aufmerksam, dass eine Forderung wie diese nur unzulänglich erscheinen könne, dennoch habe sie in ihrer anspornenden Rhetorik einen Weg zu einer anderen Zukunft eröffnet und dabei eine ähnliche Funktion erfüllt wie die vielen Appelle für Kreolisierung und Hybridität heutzutage.166 Gewiss mag das Konzept der «Verschmelzung» unvertretbar vereinfachend erscheinen und möglicherweise liegt es nahe, es in (con)fusion umzuschreiben, einer chaotischeren Art, mit Anderen zu sein, eine komplexere und beunruhigende Weise dessen, was Glissant als Relationalität aufgewertet hat.167 Eine solche postkoloniale Umschreibung bewirkt aber keinesfalls die Löschung dieses sichtlich unangemessenen kolonialen Präzedenzfalls aus dem 19. Jahrhundert, vielmehr wird man gezwungen, seine fortwährende Präsenz in der Form einer Spur anzuerkennen, die, sobald sie einmal gelesen wurde, die Aufmerksamkeit auf die konzeptuellen Grenzen dieser zeitgenössischen Vorstellungen von interkultureller Vermischung – métissage, Kreolisierung und so weiter – lenkt, mit der sie genealogisch verbunden ist.
162 163
164 165 166 167
Revue des Colonies, I.vii, S. 3f., zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 450. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 450. Die Entstehung einer solchen karibischen Gesellschaft wird der barbadische Dichter und Kulturhistoriker Kamau Brathwaite über ein Jahrhundert später in seiner wegweisenden Studie des Kreolisierungsprozesses, The Development of Creole Society in Jamaica, 1770–1820 (1971), analysieren. Vgl. ebda., S. 450. Revue des Colonies, I.vi, S. 3–7, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 449. Revue des Colonies, I.vi, S. 3, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 449. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 450. Ebda., S. 450.
166
Wer die Vorstellung der Verschmelzung vertritt, muss sich auch Fragen betreffend der Identitätskonstruktionen stellen: Wie werden sich die alten Identitäten unterscheiden, wenn sie einmal miteinander verschmolzen sind? Für Bissette ist eine idealerweise verschmolzene martinikanische Identität nicht durch das Verschwinden der alten Rassenidentitäten («weiß/braun/schwarz») charakterisiert, sondern durch eine produktive Restrukturierung der Beziehungen zwischen den drei «Klassen». Der Mulatte, das Paradebeispiel für ein vollständiges Aufgehen alter («weiß/schwarz») Identitäten in eine neue, wird somit eher als eine Möglichkeit innerhalb der «vielfältigen Bevölkerungen» der Kolonie gesehen, obwohl «braun» deutlich privilegiert wird als mittlere Kategorie, durch die «la fusion désirable des populations diverses des colonies» erleichtert werden kann.168 Durch die Neudefinition dieses Zwischenraums169 als Kanal zwischen «weiß» und «schwarz», im Gegensatz zu der Vorstellung einer Barriere, die diese beiden Kategorien voneinander trennt, stellt Bissette das «Teilen und Erobern»-Strategem des kolonialen Diskurses in Frage, das auf unzählige Arten den Unterschied des «mulattischen Subjektes» beteuert, um seine eigene Macht effektiver auszuführen und aufrechtzuerhalten. Wenn der Mulatte auch als eine (rassische, gesellschaftliche) Kategorie in der Revue unangefochten besteht, so zeigt Bissette nichtsdestotrotz häufig sein scharfes Bewusstsein für die bedingte Natur kolonialer Identitäten und für die Sprache, mit der der koloniale Diskurs versucht, diese historisch geschaffenen Identitäten zu «naturalisieren», beispielsweise spricht er von «diesem magischen Wort, hommes de couleur, ein Wort mit dessen Hilfe sie an den Rand der Zivilisation verbannt wurden»170. Solche Identitäten sind Erfindungen, erkennt Bissette – eine Tatsache, die im Falle «dieses magischen Wortes» immer offensichtlicher wird, da, wie er zeigt, das Gesetz von 1833 den homme de couleur als rechtliche Kategorie eigentlich «abgeschafft» hatte und all jene, die vorher in dieser Wendung vereint waren, in farblose Bürger der mère-patrie umwandelte. Nach Bongie ist die Revue folglich, ebenso wie sie von sogenannten hommes de couleur produziert wird, ein posthumes Unternehmen, das in eine Sprache eingeschrieben ist, die Identitätszuschreibungen entmystifiziert. Bongie hat darauf hingewiesen, dass nichts die Fragwürdigkeit einer Identitätspolitik besser verdeutliche, als das Paradoxon der Literatur jener hommes de couleur im Jahre 1834. Bissette kann natürlich nicht unter dieser einen posthumen Identität zusammengefasst werden; das «wir», durch das er in der Revue spricht, konzipiert nicht nur einen homme de couleur, sondern auch, abhängig vom Kontext, einen Franzosen, einen Martinikaner, einen Mulatten, eine Person afrikanischer Abstammung. Seine Reflexionen über «dieses magische Wort», die ein Verständnis für die Grundlosigkeit insbesondere des kolonialen Diskurses (wenn nicht der Spra-
168 169 170
Vgl. ebda., S. 451. Bongie spricht hier von «Drittem Raum». Ich bevorzuge den Begriff Zwischenraum. Revue des Colonies, I.iii, S. 10, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 451.
167
che allgemein) verdeutlichen, gehen ein in die vielleicht entscheidende Strategie seines Werkes in der Revue, die gleichermaßen wesentlich für den postkolonialen Revisionismus ist: nämlich eine entmystifizierte – und man könnte sogar sagen: dekonstruktivistische – Kritik der kolonialen (Falsch)Darstellung, eine Kritik, die den kolonialen Diskurs, wie er in Regierungsdokumenten, gerichtlichen Entscheidungen, literarischen Texten, Zeitungsartikeln und so weiter geschrieben steht, als eine systematische Art dessen identifiziert, auf was die Revue häufig als «Denaturierung» der Realität verweist.171 Diese Kritik beinhaltet ein heilsames, vielleicht auch vorhersehbares Interesse am Problem der Stereotypisierung und an der Art und Weise, wie Literaturkonventionen in Darstellungen historischer Tatsachen münden, aber es äußert sich auf höchst interessante Art, so wie in der Diskussion der Wendung hommes de couleur dargelegt. Bongie zeigt, inwiefern sich Bissette, durch das wiederholte Aufdecken der Lücke zwischen kolonialem Diskurs und Realität, eine rhetorische Praxis zu eigen macht, die unter vielen Vertretern dieser Generation verbreitet ist, und zwar die romantische Ironie, die «an die Doppelnatur von Sprache (Leben) erinnert, die nicht bedeuten oder sein kann, was sie sagt».172 Diese Problematisierung (kolonialer) Sprache – um kurz ein historisches Ereignis zu betrachten, mit dem sich die ersten Ausgaben der Revue stark beschäftigten – steht im Zentrum von Bissettes Bericht über ein Vorkommnis, auf das er sich ironisch mit «große Revolution von Grand’anse» bezieht, ein vermutlich von Mulatten geführter Aufstand, der in Martinique im Dezember 1833 stattfand und der damit endete, dass Dutzende von Menschen zum Tode verurteilt wurden (obwohl dieses Urteil schließlich einige Jahre später gemildert werden sollte).173 Wie Bissette wiederholt argumentiert, verwandelte die weiße kreolische Elite, um Empörung und moralische Panik hervorzurufen, eine einfache démonstration in eine mulattische Verschwörung mit dem Ziel, die weiße Bevölkerung der Insel niederzumetzeln und sich deren Besitztümer zu bemächtigen. Durch die Andeutung der Wege, auf denen «das Amt des öffentlichen Staatsanwaltes in Martinique mühevoll jenes schafft, was es den Aufstand in Grand‘anse nennt»174, liefert er auch detaillierte Berichte über die gewalttätige Unterdrückung (Ermordung von Bürgerwehrmitgliedern und dergleichen), die auf diesen «Aufstand» folgten, und kritisiert heftig die mangelnde Bereitschaft der Regierung, die Autoren oder Täter [les auteurs ou fauteurs] dieser blutigen und willkürlichen Saturnalien zu verfolgen, sowie ihre Bereitwilligkeit, «unumstößliche Tatsachen» zu ignorieren, die zum hundertsten Mal der métropole die systematischen Unterdrückungen der «farbigen» Klasse, die täglich gegen sie gerichteten Provokationen, das beharrliche Leugnen all ihrer Rechte, den Gesetzen zum Trotz, die ihnen diese Rechte einräumen, beweisen – all diese
171 172 173 174
Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 452. Ebda., S. 452. Vgl. ebda., S. 452. Zit. nach ebda., S. 453.
168
Tatsachen, die, kurz gesagt, die Vorkommnisse in Grand’anse ins rechte Licht rücken [qui donnent aux événemens de la Grand’anse une véritable couleur].175
Solche Tatsachen würden von den Medien der Regierung «ausgelassen, verborgen, wenn nötig verleugnet und in allen Fällen ausgelöscht»176. Die Kolonien präsentierten Frankreich offiziell einhundertsiebzehn Verschwörer, belastet durch eine 300-seitige Anklageschrift, doch bei näherer Betrachtung würden banale Vergehen zu einem Komplott aufgebauscht: Ce qu’on montrera aux colonies, à la France, dans les relations officielles et authentiques, comme on sait, du Moniteur, ce sera cent dix-sept conspirateurs comparaissant sous le poids d’une accusation de 300 pages, accusés tous de complot, car il en faut bien un au gouvernement de la Martinique ; puis prévenus chacun en particulier d’avoir pillé deux pots de taffia et deux pots de rhum chez Seguinol ; ou chez Desmadrelles, du savon, de la chandelle, une étrille de cheval ; ou chez Lereynerie, une bouteille de genièvre (pages 85 et 86 d’arrêt de renvoi). Et tout cela imprimé par le gouvernement de la colonie à 200 pages, intitulé pompeusement, par le plus ignorant des magistrats, Insurrection de la Grand’anse.177
In dieser exemplarischen Passage zeigt Bissette, wie Kolonialgeschichte sozusagen «fehlerhaft geschrieben» (auteur/fauteur) wird und ihre trügerische Erscheinung von «Gewichtigkeit» erlangt. Das angeblich «authentische» und «offizielle» Wissen, um das es sich bei einem Regierungsorgan wie dem Moniteur handelt, wird zum Gegenstand eines ironischen Wissens («comme on sait»), das auf die fragliche Existenz der einhundertsiebzehn «Verschwörer» und ihren Akt der «Plünderung» eingestellt ist. Dass solche Worte nur die leeren Zeichen von Macht darstellen, denen ein realer Referent fehlt, die aber dennoch brutal Realität konstruieren, wird durch ihre Unterstreichung betont. Diese Unterstreichung, die durch ein erneutes Zitieren der Vorlage ein Wort wie «Verschwörer» seiner Bedeutung entleert, erfüllt (durch metonymische Assoziationen) eine ähnliche Funktion in Bezug auf koloniale Namen (Seguinot, Desmadrelles, Lereynerie), deren Einrichtungen «ausgeraubt» wurden: Könnten diese unterstrichenen Patronyme und die Autorität, auf die sie hindeuten, so unbegründet sein, wie die anderen unterstrichenen Wörter im Text? Könnte ihre Berechtigung nicht ebenso leer an Substanz sein wie der «geschraubte» und irrige Titel Insurrection de la Grand’anse? Derart sind die Fragen, die Bissettes ironisches Verhör individueller Wörter aufwirft. Indem er die Autorität des kolonialen Diskurses wiederholt untergräbt und ihn in seinen wahren (das heißt falschen) «Farben» zeigt, ergänzt er diese ironische Kritik durch einen umgekehrten Diskurs, wenn er ein paar Zeilen später auf «die dauerhafte Verschwörung gegen die Rechte und die persönliche
175 176 177
Revue des Colonies, I.i, S. 15, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 453. Revue des Colonies, I.i, S. 15, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 453. Revue des Colonies, I.i, S. 15f., zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 453.
169
Sicherheit der ‚farbigen‘ Bevölkerung, den permanenten Aufstand der Weißen gegen die Gesetze der métropole» verweist.178 Diese dekonstruktive Ironie, die auf den Seiten der Revue sehr reichlich vorhanden ist, und Bissettes weitreichende Demaskierung der «Auslassungen, Verheimlichungen, Verleugnungen und Rechtfertigungen» (einer speziellen Variante) des kolonialen Diskurses verdienen gewiss einen viel größeren Raum im Rahmen der frankokaribischen Literaturgeschichte und Kulturkritik, als sie bisher erhalten haben. Dass Bissettes Arbeit für die Revue nicht genauer betrachtet wurde, trotz ihrer offenkundigen Leistungen, die ihr sicherlich einen Platz im afroamerikanischen Kanon eingebracht hätten, hängt zum Teil natürlich mit seiner uneindeutigen Positionierung zusammen, auf die ich als seine (Nicht)Identifizierung mit dem Schwarzsein verwiesen habe – etwas, das allerdings kein Mulatte in den französischen Kolonien zu dieser Zeit hätte umgehen können. Zum Teil mag es auch an der zunehmend religiösen und konservativen Rhetorik liegen, die Bissette in den Jahren, die dem Niedergang der Revue folgten, an den Tag legte – Jahre, die von seinen «übermenschlichen Bemühungen»179 im Auftrag der abolitionistischen Sache gekennzeichnet waren. Indes könnte man argumentieren, dass solche «Anomalien» aus ihm in entscheidender Hinsicht eine nicht weniger wertvolle, sondern wertvollere Persönlichkeit für ein Verständnis der Komplexität einer afrofranzösischen Identität im 19. Jahrhundert machen und dass er in seiner abwechselnd bissigen und versöhnlichen Verhandlung der Beziehungen zwischen Martinique und der mère-patrie jemand ist, der sehr gut in Paul Gilroys (The Black Atlantic) Beschreibung jener schwarzen Schreiber passt, deren Wanderleben und regimekritische politische Beobachtungen ein verabsolutierendes Verständnis rassischer Kulturformen nur enttäuschen und frustrieren können. In der Tat ist der Zwischenraum des homme de couleur, der «offiziell» von einem mulattischen Schreiber wie Bissette besetzt ist, nicht lediglich ein koloniales Erzeugnis, sondern greift auf die eigene Welt globaler interkultureller Verstrickungen voraus, auf eine Welt, die sich, wie Gilroy es ausdrückt, der «gnadenlosen Einfachheit undifferenzierter Rassenwesen als eine Lösung der wachsenden Grenzen innerhalb schwarzer Gemeinschaften»180 entzieht. Zwischen Konformismus und Regimekritik angesiedelt, erinnern die Schriften Bissettes an eine doppelte Identität – gleichzeitig kolonial und postkolonial, weiß und schwarz, französisch und martinikanisch –, die verlangt, weder in erster Linie positiv noch negativ gelesen zu werden, sondern ausschließlich mit höchster Ambivalenz. Nirgends ist die Notwendigkeit dieser ambivalenten Lektüre evidenter, als wenn man die bitteren Rivalitäten untersucht, die sich in den frühen 1840er-Jahren zwischen Bissette und seinem Mitstreiter Victor Schœlcher entwickelten, dem Mann, der schließlich als der Bezwinger der Sklaverei in den französischen Kolonien verherrlicht werden wird – eine ‚Apotheose’, die höchst gewiss die Hauptursache für
178 179 180
Revue des Colonies, I.i, S. 16, zit. nach Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 454. Bongie: The Revolutionary Compromises, S. 454. Ebda., S. 455.
170
die fortwährende Vernachlässigung Bissettes in einem revisionistischen Zeitalter wie dem aktuellen ist, das sich damit rühmt, marginalisierte Persönlichkeiten der Vergangenheit zu rehabilitieren.181
IV.3. Haiti und die Revue encyclopédique IV.3.1. Die Revue encyclopédique und koloniale Fragen «Mais ces progrès si étonnans, conquis dans l’espace d’un quart de siècle, ces espérances si belles données par la nation haitienne au monde entier, faudrat-il y renoncer?182 Die prestigeträchtige Revue encyclopédique, die im Januar 1819 erstmalig in Paris erschien und bis in die ersten Monate des Jahres 1835 Bestand hatte, war eine Monatsschrift, die jedes Trimester in Bänden archiviert wurde. Unter ihrem Dach fand sich eine Gruppe Oppositioneller zusammen, die sich gegen die Restauration wandten und hier ihre Diskussionen führten.183 Die Zeitung wurde von Marc-Antoine Jullien geleitet, der im Jahre II nach der Französischen Revolution im Alter von 17 Jahren Sondergesandter des Comité de Salut Public im Osten Frankreichs und in Bordeaux gewesen war; mittlerweile hatten sich jedoch die Überzeugungen des jakobinischen Robbespierristen aus der Hochphase der Revolution etwas abgemildert.184 Seine neue Revue encyclopédique reihte sich in vielerlei Hinsicht in die Reihe der Décade oder Revue philosophique, littéraire et politique (1794–1807) ein, deren einer Begründer, Jean-Baptiste Say, in der neuen Gruppe mitarbeitete, genauso wie der Gelehrte Langlès.185 Ebenfalls beteiligt waren ein gewisser Guadet, ein Neffe des Abgeordneten Coquerel aus der Gironde, und der Neffe von Miss Helen Williams, die während der Revolution einen Salon führte.186 Erwähnenswert sind unter den zahlreichen Mitarbeitern der Revue encyclopédique auch eine Frau Louise Swanton Belloc, der Geograph Jomard, Adolphe Blanqui, der Ökonom Moreau de Jonnès und, als besonders häufiger Autor, Sismondi.187 Die meisten Artikel stammen von den beiden sehr bekannten Intellektuellen Abbé Grégoire,
181 182
183 184 185 186 187
Ebda., S. 455. Revue encyclopédique 25 (Janvier 1825), S. 113. Zur Quelle der Revue encyclopédique vgl. Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les plus remarquables dans la politique, les sciences, l’industrie et les beaux-arts. Paris: Bureau de la Revue Encyclopédique, 1 (1819)–61 (1835). Ich orientiere mich für die Ausführungen zur Revue encyclopédique an dem grundlegenden, posthum erschienenen Artikel von Yves Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique». In: Leon-François Hoffmann, Frauke Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804. Lumières et ténèbres. Impact et résonances d’une révolution. Madrid: Iberoamericana u.a. 2008, S. 99–112. Vgl. zu dieser Revue auch Lüsebrinks wichtige Analyse zu Antoine Métral (Lüsebrink: Transfers culturels). Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 99. Vgl. ebda., S. 99. Vgl. ebda., S. 99. Vgl. ebda., S. 99. Vgl. ebda., S. 99.
171
ehemaliger Bischof von Blois,188 und Lanjuinais. Sie publizieren in der Revue enyclopédique erst ab 1822, seit dem Zeitpunkt also, als ihr eigenes Organ, die Revue religieuse, nicht mehr erscheinen durfte. Zumindest was Grégoire betrifft, war er seit Beginn des Unternehmens so oft er konnte mit Jullien in Kontakt.189 Die Präsenz Grégoires in dieser Gruppe ist ein Zeichen dafür, dass die Fragen rund um Sklaverei und Sklavenhandel sowie, für die Zeit kennzeichnend, um das unabhängig gewordene Haiti einen zentralen Stellenwert innehatten. Die Gruppe hielt ihre Treffen in Form von monatlichen Abendessen ab, worüber 1827 in der Revue encyclopédique berichtet wird. Zu diesen Treffen wurden oft Freunde eingeladen, die gerade zu Besuch in Paris waren, wie beispielsweise haitianische Parlamentarier oder Osage-Indianer aus den USA.190 Die meisten der Autoren der Revue encyclopédique befürworten ein parlamentarisches System; auch wenn manche, wie Grégoire, noch immer zutiefst überzeugte Republikaner sind, wären sie mit einer konstitutionellen Monarchie nach englischem Muster zufrieden.191 Zwar sind sie alle der Meinung, dass ein Parlament gewählt werden sollte, aber das heißt noch lange nicht, dass das allgemeine Wahlrecht zu ihren Hauptforderungen gehörte. Sie beharren auf der Freiheit der Presse, sofern diese nicht zur Revolte und zu politischer Gewalt aufruft. Sie glauben an die Wirksamkeit der öffentlichen Erziehung. Sie bewundern das (US-) amerikanische konstitutionelle Modell. Als Sismondi in der Revue encyclopédique eine lebhafte Attacke gegen die Sklaverei beginnt, muss er viele Gegenargumente seiner Gegner lesen, häufig mit stark rassistischer Tendenz. Liberal sind die Autoren in politischer Hinsicht, nicht wenige sind ebenfalls Anhänger des Wirtschaftsliberalismus. Jean-Baptiste Say gibt den Ton an, auch wenn es einige Versuche Sismondis gibt, ihm zu widersprechen. Der Glaube an einen Fortschritt, der durch die Reduzierung der Staatsrolle auf ein Minimum gesichert sein sollte, zeigt sich auf allen Ebenen.192 Die Gruppe ist am Fortschritt des Wissens und der Weiterentwicklung der Technik interessiert. Die Revue encyclopédique gibt Informationen über den Zustand der Presse, der Bildung, der Wissenschaft und Technik in den verschiedenen Regionen der Welt, die sie durch ihre Korrespondenten erreichen kann. Der Hauptteil der Veröffentlichungen be-
188
189 190 191 192
Zumindest bis 1827 ist seine Mitarbeit durch etwa 50 Notizen belegt, die mit «G.» unterschrieben sind. Vgl. zu Grégoire Hans-Jürgen Lüsebrink: «Negrophilie» und Paternalismus: Die Beziehungen Henri Grégoires zu Haiti (1790–1831). In: Reinhard Sander (Hg.): Der karibische Raum zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Zur karibischen Literatur, Kultur und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 1984, S. 99–108. Vgl. auch Hans-Jürgen Lüsebrink: Aufklärerisches Erkenntnispotential versus institutionelle Erkenntnisschranken. Zur Geschichtsschreibung Henri Grégoires (1751–1831). In: Horst-Walter Blanke, Jörn Rüsen (Hg.): Von der Aufklärung zum Historismus. Zum Strukturwandel des historischen Denkens. Paderborn: Schöningh 1985, S. 203–218. Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 99. Vgl. ebda., S. 100. Vgl. ebda., S. 100. Dies gilt nicht für Sismondi, der eine lebhafte Polemik auslösen wird, die indes aus dieser Studie ausgeschlossen wird.
172
steht aus Buchrezensionen inklusive Stellungnahmen der Autoren.193 Wie einst bei der Décade, ist die ablehnende Haltung gegenüber der Sklaverei die Regel, genauso wie die ständige Brandmarkung des Sklavenhandels. Nichtsdestotrotz wird die Abolition nur stufenweise gedacht, es gilt, revolutionäre Aufstände zu vermeiden. Der Kampf für eine effektive Umsetzung des Sklavenhandelverbots nimmt den höchsten Stellenwert ein, für die Revue encyclopédique genauso wie für die Société de la Morale Chrétienne, deren Vorsitzender kein anderer ist als Coquerel, Mitarbeiter der Revue encyclopédique.194 Jullien ist ebenfalls Mitglied dieser Gesellschaft. Was Haiti angeht, ist der koloniale Status eines der Schlüsselprobleme der französischen Innen- wie Außenpolitik.195 Auch wenn es ein erklärtes Anliegen der Revue encyclopédique ist, sich nicht in die Tagespolitik einzumischen, konzentriert sich die Beschäftigung mit Haiti auf eine politische sowie eine ideologische Ebene. IV.3.2. Kolonialismus und panafrikanische Ideen Die Revue encyclopédique informiert ihre Leser196 über Ersuche Boyers an die USA, eine Emigration freier Schwarzer von dort aus nach Haiti zu organisieren. Er kritisiert gleichzeitig die Aktionen der amerikanischen Société de Colonisation, die dabei ist, die Grundlagen eines Staates zu schaffen, der später den Namen Liberia tragen sollte. Boyer beobachtet zu Recht, dass der gewählte afrikanische Küstenabschnitt keine Wüste ist, dass es dort afrikanische Völker gibt, die seit langem etabliert sind. Er hält sie für «Barbaren» und ist der Ansicht, es sei im Interesse der «bereits zivilisierten» (US-)amerikanischen Schwarzen, sich eher in einem entwickelten Land wie Haiti niederzulassen. Granville, ein alter Kämpfer der napoleonischen Armeen, der nach 1815 nach Haiti zurückkehrte, berichtet für die Revue encyclopédique sehr ausführlich über die Bemühungen Boyers. Was aber die konkrete Positionierung der Revue encyclopédique selbst angeht, so gilt ihr Interesse den Kolonien Liberia und Sierra Leone, die gerade in Afrika gegründet wurden; dort ist nach ihrer Einschätzung die Avantgarde der Zivilisation. Die generelle Linie der Revue encyclopédique kann man in einem einleitenden Artikel von Sismondi aus dem Jahre 1825 nachlesen: «Nous ne parlerons point des colonies destinées à répandre la civilisation sur le vaste continent de l’Afrique et qui, du cap de Bonne Espérance et de Sierra Leone, porteront peu à peu dans l’intérieur la lumière et la vertu pour réparer le longs forfaits de l’Europe […].»197 Die Revue encyclopédique ist nicht antikolonial; selbst wenn
193 194 195 196 197
Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 100. Vgl. ebda., S. 101. Vgl. ebda., S. 101. In ihren Ausgaben vom Oktober 1820 sowie Oktober und November 1824. Revue encyclopédique 25 (Janvier 1825), S. 37, zit. nach Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 107.
173
manchmal die Kolonisierung kritisiert wird, dann geschieht das meist, weil sie als zu teuer eingeschätzt wird.198 Haiti ist nicht nur eine Herausforderung für das politische Gefüge Frankreichs und der Welt. Es ist für die Revue encyclopédique ein gelungenes Modell, um all jenen zu widersprechen, die generell alles herabsetzen, was schwarz ist. Die Argumente der Sklavereibefürworter wurden damals immer noch lautstark und undifferenziert hervorgebracht. Die Revue encyclopédique entgegnet ihnen 1822, die haitianische Regierung könne als Modell für das alte Europa dienen.199 Haiti ist der lebende Beweis, dass alle menschlichen Wesen, Schwarze und Mulatten eingeschlossen, die gleichen intellektuellen Fähigkeiten haben, so dass sie sich weiterentwickeln und vervollkommnen können, was für die Aufklärer und später für die idéologues ein Wesensbestandteil des menschlichen Daseins war. Neben Haiti trägt auch Sierra Leone zu einer optimistischen Sicht auf die Situation und die Zukunft der Schwarzen bei. Bezüglich des afrikanischen Staates stellt sich Coquerel in seinem Artikel vom Juli 1822 gegen diejenigen, die in «den Abhandlungen zu Physiologie» oder «in einigen politischen Veröffentlichungen» eine «intellektuelle Minderwertigkeit» der Schwarzen oder die «Vorherrschaft der Sinne über die Gedanken» unterstellen. Denn «immer wenn die unglücklichen Sklaven die Freiheit erlangten, folgten die Qualitäten der Intelligenz»; und in einer Fußnote zitiert er Grégoires Buch De la littérature des nègres: «Partout où on les affranchit, ils ont montré un goût très prononcé pour une ingénieuse industrie. Ils ont cultivé avec un succès non douteux les arts et la littérature ; […] leur cœur s’est ouvert tout comme le nôtre aux sublimes impressions du beau et du juste. Voilà les faits.»200 In der «Revue des progrès des peuples dans les 25 dernières années», die die Ausgabe vom Januar 1825 eröffnet und deren Autor Sismondi ist, erscheint das Lob Haitis wie eine Provokation an die Adresse der Sklavereibefürworter, aber auch der gelehrten «Physiologisten», die die Rassenlehre mit scheinbar wissenschaftlichen Theorien stützen. Zum besseren Verständnis soll hier eine Passage etwas ausgedehnter zitiert werden: La carrière parcourue par la nouvelle nation haïtienne, à Saint-Domingue, dans ce quart de siècle, est pour l’humanité entière, un plus beau sujet de triomphe. C’est là que les fils de l’Afrique ont prouvé qu’ils sont des hommes, qu’ils méritaient d’êtres libres, qu’ils savaient apprécier la lumière et la vertu. Un crime effroyable des Européens transporta les Africains dans les îles de l’Amérique ; une suite de crimes les y maintint dans l’esclavage et les rendit féroces ; s’ils commirent aussi des crimes en brisant leurs chaînes, la responsabilité en pèse tout entière sur ceux qui les avaient forgées. Tant que l’esclavage dura à Saint-Domingue, l’immoralité et l’ignorance furent proportionnelles à la privation absolue de liberté […] Depuis qu’Haïti est libre et que les nègres sont leurs propres maîtres, leur ardeur pour s’instruire l’a emporté encore sur leur ardeur pour s’affranchir. Un quart de siècle a suffi pour transformer ceux qu’on regardait comme
198 199 200
Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 108. Vgl. ebda., S. 108. Revue encyclopédique 15 (Juillet 1822), S. 24.
174
un bétail à figure humaine en une nation civilisée, chez laquelle des écoles s’ouvrent de toutes parts, où la pensée fait des progrès rapides, où chaque année apporte dans les mœurs, en dépit du climat, une amélioration notable, où les crimes sont rares, où la justice est rendue avec promptitude et impartialité, où l’agriculture, l’industrie, le commerce prospèrent, où la population a doublé au milieu même des guerres terribles qui ont accompli et suivi l’émancipation. Voilà ce que des nègres ont su faire en vingt cinq ans.201
Man erkennt unschwer, dass die Revue encyclopédique mit Sismondi ihren ideologischen Vorgaben treu geblieben ist: Sie glaubt an die Entfaltungsmöglichkeiten aller Menschen, gerade auch der Schwarzen, wenn historisch bedingte Barrieren aufgehoben sind. Dieser Aufklärungsoptimismus war typisch für den Liberalismus des frühen 19. Jahrhunderts. Freilich konnte Sismondi die sozioökonomischen Bedingungen, unter denen die Entwicklung Haitis bis heute zu leiden hat, nicht kennen. Er ist bestrebt, die Unabhängigkeit Haitis nicht nur als Ergebnis einer Revolution in Ketten liegender Sklaven zu sehen, sondern als ein universales Ereignis. Denn die haitianische Revolution verkündet vor den Augen der ganzen Welt, dass diese Schwarzen, die die «Physiologisten» in niedere Ränge einordnen wollen, als Menschen volle Legitimität besitzen. Sie bestätigt – um mit Buffon zu reden – die fundamentale Gleichheit aller «Mannigfaltigkeiten der menschlichen Gattung».202 Diese Positionierung Sismondis war um so wichtiger, als die Revue encyclopédique nicht immer derart deutlich Stellung bezog, wie es Grégoire zu jener Zeit in De la noblesse de la peau203 machen konnte. In der Tat sahen sich damals auch andere Autoren durch das Beispiel Haitis zu Stellungnahmen herausgefordert. So rezensierte Garnier 1825 in der Revue encyclopédique das Buch eines obskuren Philosophen dieser Zeit namens Dunoyer, mit dem Titel L’industrie et la morale considérées dans leurs rapports avec la liberté (1825). Seine Thesen konterte Garnier mit dem Hinweis auf die nun 25jährige Erfolgsgeschichte Haitis: «Or ceci est évidemment contredit par les faits ; car les noirs d’Haïti sont aujourd’hui plus intelligents que les cuivrés de la Terre de Feu.»204 Kein Geringerer als Benjamin Constant meldet sich 1825 in der Revue encyclopédique zu Wort. Er spricht zwar Dunoyers System der Rassenunterschiede ein Quentchen Wahrheit zu, warnt aber davor, diesen Unterschieden zuviel Bedeutung beizumessen. «Le pouvoir n’est que trop disposé à représenter ses propres excès capricieux et volontaires comme une suite des lois de la nature.»205 Seinerseits nimmt er das Beispiel der Schwarzen Haitis: «[Ils] sont devenus des législateurs fort raisonnables, des guerriers assez disciplinés, des hommes d’état aussi habiles
201 202 203
204 205
Revue encyclopédique 25 (Janvier 1825), S. 37. Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 109. Dieses Werk des Abbé Grégoire von 1826 wurde neu aufgelegt: De la noblesse de la peau ou du préjugé des blancs contre la couleur des Africains et celle de leurs descendants noirs et sang-mêlés. Grenoble: Million 1996 und 2002. Zit. nach Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 110. Benjamin Constant: Écrits d’un humaniste. In: Revue encyclopédique 1825, S. 59.
175
et aussi polis que nos diplomates […]».206 Und hier gibt er sich wieder als Aufklärer und argumentiert gegen Dunoyer, dass alle Rassen zur Perfektionierung imstande wären. Seine Haltung zur Rassentheorie durchzieht seine rein politische Haltung: «Laissons les physiologistes s’occuper des différences primitives que la perfectibilité dont toute l’espèce est douée surmonte tôt ou tard ; et gardons nous d’armer la politique de ce nouveau prétexte d’inégalité et d’oppression.»207 Constant hat recht früh geahnt, wohin es führen kann, wenn angeblich wissenschaftlich abgesicherte Unterschiede zwischen den Menschenrassen als Begründung für politische und gesellschaftliche Ausgrenzung herangezogen werden. Andere in der Revue encyclopédique zeigen sich zurückhaltender: In der nächsten Ausgabe bezieht sich Paganel auf einen Artikel von Bory de Saint-Vincent im Dictionnaire classique d’Histoire Naturelle und hat keine Probleme damit, dass dieser Autor zwischen 15 Menschenrassen unterscheidet. Abschließend muss man sich fragen, ob die französischen Liberalen der Sache Haitis letztlich überhaupt dienlich waren. Wichtiger noch ist aber die Frage, inwiefern der Sieg der Sklaven und die Unabhängigkeit ihrer neuen Nation der Sache des Fortschritts in Frankreich – und weltweit – gedient haben. C.L.R James208 hat betont, dass der Volksaufstand der Französischen Revolution geholfen hat, endlich ihre langfristige Bedeutung zu erlangen: Die Abschaffung der Sklaverei setzte ein Befreiungssignal für die ganze Menschheit. Gleichzeitig wurde das unabhängige Haiti zu einem ersten Damm gegen die steigende Flut der Rassentheorien und des Rassismus ganz allgemein. Oder, in den Worten Grégoires, zu einem Leuchtturm, der aus der Ferne die universelle Gleichheit und Brüderlichkeit verkündet: denn die Freiheit haben sie nicht für sich alleine erstritten. Aus Sicht der französischen Liberalen, die sicherlich unfähig waren, den sozioökonomischen Prozess zu analysieren, dem Haiti unterlag, war es unabdingbar, ein Bild dieses Landes zu zeichnen, das mit der Fortschrittsvision der gesamten menschlichen Gattung übereinstimmte. Im Rahmen der Weltgeschichte gedacht, ist diese Vision nicht falsch.209 Fortschritt hat es tatsächlich gegeben; und er muss eine Hilfe für andere Menschen und andere Gebiete auf Erden sein. In diesem Sinn hat die haitianische Revolution, die wohl am meisten Menschenleben kostete, ihren letztlich doch universellen Wert bekommen.
IV.4. Literarische Transferprozesse in der Revue des deux mondes Bei der Revue des deux mondes handelt es sich um einen Sammelband über Politik, Administration und Sitten, der 1829 in Paris erstmals publiziert wurde und bis in die Gegenwart eine bedeutsame Zeitschrift ist. Die grundsätzlichen Leitideen der Zeitschrift werden einleitend in der ersten und zweiten Ausgabe wie folgt be-
206 207 208 209
Benjamin Constant: Écrits d’un humaniste. In: Revue encyclopédique 1825, S. 59. Benjamin Constant: Écrits d’un humaniste. In: Revue encyclopédique 1825, S. 59. James: The black Jacobins. Vgl. Bénot: Haïti et la «Revue encyclopédique», S. 112.
176
schrieben: Ausgedehnte Reisen sollten unternommen werden, um unterschiedliche Gegenden zu beschreiben. Alles Poetische, alles, was auf brillante Darstellungen abziele, jede kluge Reflexion eines Themas erfahre dort besondere Sorgfalt, besondere Aufmerksamkeit; aber was die Eigenart der lokalen Administration angehe, die zivile und politische Organisation des Landes, seine finanziellen, industriellen und landwirtschaftlichen Ressourcen, so könne man keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Um solche Fragen zu erörtern, müsse man sich mit tiefergehenden und spezielleren Studien beschäftigen. […] Eine Sammlung dieser Art fehle bisher noch. Alle Mitredakteure seien mit fremden Ländern vertraut; sie hätten diese lange bewohnt, manche von ihnen dort sogar wichtige Funktionen ausgeübt. Dank dieser Erfahrungen können sie ihre Beobachtungen von außen und ohne persönliche Involviertheit anstellen. So genieße die Revue des deux mondes das Verdienst einer historischen Neuerung. […] Man sei durchaus aufgeschlossen für neue und ungewöhnliche Beobachtungen bezüglich der Sitten und Bräuche, der religiösen Praktiken und der Wesensart der fremden Nationen. Oft lieferten die Gewohnheiten eines Volkes die Hintergründe zum Verständnis ihrer Gesetze. Die Revue werde aus diesem Grund eine große Zahl von befremdlichen (und zum Großteil noch unveröffentlichten) Informationen beinhalten […].210 IV.4.1. Gustave d’Alaux: erste Versuche haitianischer Literaturgeschichtsschreibung Über Gustave d’Alaux ist kaum etwas bekannt. Léon-François Hoffmann211 zufolge wäre d’Alaux das Pseudonym für Maxime Raybaud.212 Seine einzigen vorhandenen Texte sind die literarischen Chroniken in der bis heute existierenden prestigeträchtigen Pariser Revue des deux mondes von 1850 bis 1852.213 Unter anderem hat d’Alaux eine Reihe von Artikeln über die haitianische Literatur veröffentlicht, die er in drei Teile gliedert: «Les mœurs et la littérature nègres»214, «La littérature jaune I»215 und
210 211 212 213 214
215
Vgl. Alex-Louise Tessonneau: Dupré et la littérature jaune en Haïti sous Henri Christophe. In: Hoffmann, Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804, S. 183–200, hier S. 183. Hoffmann: Littérature d’Haïti, S. 259. Vgl. Tessonneau: Dupré et la littérature jaune, S. 183. Vgl. ebda., S. 183. D’Alaux sagt über diese Literatur: «[…] cette littérature à l’état rudimentaire ou latent est essentiellement nègre, tandis que l’autre, celle qui s’imprime, a pour foyer la classe de couleur. La première emprunte ses expressions au patois créole et à la mimique africaine, l’autre les demande presqu’exclusivement au français.» Gustave d’Alaux: Les mœurs et la littérature nègres. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, XIV (1852), S. 762–794, hier S. 764. Vgl. Tessonneau: Dupré et la littérature jaune, S. 184. Gustave d’Alaux: La littérature jaune I. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, XV (1852), S. 938–967. D’Alaux spricht auch von «politique noire» und «politique jaune» sowie von einem «antagonisme qui divise la caste sang-mêlée ou jaune et la caste noire» (Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, VIII (1850), S. 775). Tatsächlich ist der Terminus jaune eigen für die Zeit. In ihrer Studie Littérature et Colonialisme macht Martine Astier Loutfi darauf aufmerksam, dass in der ganzen
177
«La littérature jaune II»216. Diese literaturhistorischen Beiträge beinhalten erste Beispiele haitianischer Literatur aus der Frühphase der Revolution, die größtenteils als Manuskripte verlorengingen und bis heute nicht in ihrer Originalfassung rekonstruierbar sind.217 D‘Alaux, dessen Hauptaugenmerk Dupré gilt, über den wir aber keinerlei Informationen haben, schätzt diesen, der unter König Henri Christophe gelebt hat, sowohl als Dichter wie auch als Schauspieler hoch ein.218 Leider mangelt es allen Artikeln von d’Alaux an Kohärenz und Stringenz. Er springt ständig zwischen den einzelnen Themen und unterlässt eine feine Analyse beziehungsweise verzichtet auf klare Schlussfolgerungen. Aus diesem Grund geht es im Folgenden auch darum, anhand einer induktiven Vorgehensweise Hauptthemen seiner Gedanken herauszuarbeiten und darzulegen. IV.4.1.1. Die littérature jaune: zwischen Frankophilie und Plagiat Wie bereits im Einführungskapitel gezeigt, ist für die Literatur Haitis eine Dialektik der Imitation kultureller Repräsentationsformen des Mutterlandes sehr charakteristisch. Die Affirmation der politischen Unabhängigkeit und die kulturelle Imitation der französischen Romantik scheinen sich nicht auszuschließen. D’Alaux beschreibt den Kontext der neu entstandenen haitianischen Literatur, die er als littérature jaune bezeichnet, und sagt bereits zu Beginn, dass das Plagiat (in seinen Worten «l’aptitude imitatrice») ein Wesenszug haitianischer Literatur sei. Sauf de très rares exceptions, les anciens libres, tant jaunes que noirs, par qui s’est accomplie l’initiation littéraire de la jeune nationalité, n’avaient reçu qu’une instruction élémentaire ; le bouleversement social qui vint brusquement les associer aux droits, aux intérêts, aux passions de la France républicaine, les livra donc sans défense à l’influence intellectuelle de ce nouveau milieu, et la prodigieuse mémoire, l’aptitude imitatrice dont sont douées les organisations créoles facilitèrent encore la contagion, […], au moment de la rupture définitive avec la France, la minorité lettrée était déjà assez exercée pour pouvoir remonter d’elle-même aux bonnes sources littéraires.219
D’Alaux lässt keinen Zweifel daran, dass die «bonnes sources» aus Frankreich stammen. Hier kommt er das erstemal auf Dupré zu sprechen. «Mérite doublement rare et pour l’époque et chez un homme dont l’esprit était saturé de tragédie française, Dupré est, avant tout, Haitien ; drame ou comédie, ses
216 217 218 219
Literatur dieser Zeit die Benennung «Algerier» in Algerien lebender Europäer bedeutet, genauso wie «Indochinese» oder «Afrikaner» sich auf weiße Kolonisierende bezieht. Der Kolonisierte ist «der Araber», «der jaune», «der Neger». Vgl. Martine Astier Loutfi: Littérature et colonialisme. Paris: Mouton 1971, S. 79. Vgl. Tessonneau: Dupré et la littérature jaune, S. 184. Gustave d’Alaux: La littérature jaune II. Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, XVI (1852), S. 1048–1085. Vgl. Tessonneau: Dupré et la littérature jaune, S. 184. Vgl. ebda., S. 184. D’Alaux: La littérature jaune I, S. 939.
178
pièces sont exclusivement consacrées aux évènemens ou aux caractères nationaux.»220 Dann wird ein Stück beschrieben, das laut d’Alaux als eines seiner meistgewürdigten gilt und als Thema den Konflikt zwischen den alten kolonialen Bräuchen und dem relativen Puritanismus, der durch die Freiheit geschaffen wurde, darstellt. Es geht hierbei um einen englischen Kaufmann, der eine junge Schwarze heiraten möchte. Trotz der Überzeugungsarbeit der Mutter, sich für Reichtum und Wohlstand zu entscheiden, ignoriert das junge Mädchen den alten Kaufmann. D’Alaux begrüßt die Nachahmung Molières als gute Idee, da er der Meinung ist, das einfache Publikum sei für das Komische empfänglicher als für eine ernste Thematisierung seiner Lebensumstände, die es mangels künstlerischer Vorbildung nur als langweilig und abgeschmackt empfunden hätte. Dupré imitait ou devinait Molière, qui, souvent engagé dans des données tout aussi brutales [...] ne dédaigné pas d’en sortir par l’issue de la bouffonnerie. [...] Si une fraction des spectateurs partageait déjà toutes les délicatesses d’un public européen, la majorité n’en avait pas la moindre idée, et n’eût trouvé délors rien de dramatique, rien que d’effacé et de froidement vulgaire dans la peinture sérieuse d’une chose aussi généralement accepté que la prostitution des placemens […]. Qu’ils y ait dans cette trouvaille plus de hasard que de calcul, je suis disposé à le croire ; J’ai cru cependant entrevoir dans la même pièce une scène à la Beaumarchais, moitié rire, moitié larmes.221
Abschließend fasst d’Alaux nochmals zusammen und leitet den zweiten Teil zur littérature jaune ein: «Si le journalisme contribua, il y a vingt ans, à détourner du théâtre les écrivains du pays, il a produit, en revanche, la littérature de feuilleton, qui, après de stériles tâtonnemens dans le domaine de l’imitation française, a fini par se rejeter dans celui des mœurs locales».222 D’Alaux widmet sich nicht nur Literaturbesprechungen, sondern auch Gesellschaftsbildern. So macht er sich in «La littérature jaune II» über das Verhalten der noblen Damen und Herren lustig, weil sie den englischen und französischen Stil zu imitieren suchen, wobei er hier wieder die Art und Weise ins Lächerliche zieht. Er erwähnt, dass sowohl die Damen als auch die Herren mit teils mehreren Jahrzehnten Verspätung die Pariser Mode übernahmen und dabei das Gefühl hatten, zeitgemäß gekleidet zu sein wie in der französischen Hauptstadt. Dabei spielt das Vorbild der gentilhommes eine große Rolle, genauso wie englische Floskeln und Bezeichnungen wie how do you do und sportsmen.223 Interessant ist, dass sich d’Alaux die Annoncen in haitianischen Zeitschriften anschaut, denn sie sind in der Tat ein aussagekräftiger Beleg dafür, was in Port-au-Prince als chic gilt. So wirbt ein Krämer und Süßwarenhändler beispielsweise «sous la sanction, approbation et appui de toutes les hautes autorités ; ambassadeurs, jurisconsultes, etc.» und empfiehlt seinen Kautabak «à l’attention
220 221 222 223
Ebda., S. 943. Ebda., S. 944. Ebda., S. 967. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1055.
179
particulière des gentilshommes»224. D’Alaux erwähnt eine weitere Annonce und kommentiert anschließend beide Anzeigen: Un autre s’adresse spécialement aux gentlemen pour leur offrir de remettre les vieux habits à neuf, «sans que l’ami le plus intime puisse reconnaitre que ce sont des habits restaurés». Voilà un épicier qui savait prendre les chalands par leur faible, et voilà un dégraisseur qui devrait écrire le roman de mœurs haïtien.225
Der Plagiatsverdacht und die Vorbildfunktion Frankreichs werden deutlich von d’Alaux benannt, wenn er schreibt, die haitischen Dichter hätten mit einer gewissen Verzögerung die Entwicklung der französischen Schule übernommen.226 So gebe es, dank des Bruchs durch die Revolution, deutliche Unterschiede zwischen der französischen Dichtung von 1800 und 1840227, Unterschiede, die sich auch in der haitianischen Literatur (beinahe) parallel manifestieren: Si l’opéra de Chanlatte n’est presque partout que la sérieuse et confiante parodie des plus célèbres naïvetés de nos livrets, on y rencontre pourtant ça et là un ou deux morceaux qui ne valent ni plus ni moins, en somme, que les nombreux couplets taillés chez nous sur le patron de «Partons pour la Syrie» ou de «Vice Henri IV».228
Es ist bezeichnend, dass auf der einen Seite die Isolation der Intellektuellen in dieser Phase betont, auf der anderen Seite indes herausgehoben wird, dass die Entwicklungen der französischen Literatur während dieser Zeit – wenn auch leicht verspätet – nachgeahmt wurden. Diese gegenläufigen Tendenzen entsprechen dem grundsätzlichen Tenor, der es – angesichts der prekären Forschungslage – unmöglich macht, eine kohärente Positionierung beziehungsweise Analyse der Zeit zu präsentieren. In dem Artikel ist noch kurz die Rede von Milscent229, der in der Abeille Haïtienne230 aus Port-au-Prince seine Fabeln veröffentlichte. D’Alaux zeigt sein Erstaunen darüber, dass Milscent offensichtlich gut schreibt, was man in einer «brachliegenden Literaturlandschaft nicht erwarten würde»: «Ce qu’on remarque surtout dans ses fables, c’est une certaine élégance sobre, aisée et correcte qu’on ne s’attendrait guère à trouver au milieu des pousses enchevêtrées et désordonnées de cette littérature en friche.»231
224 225 226 227 228 229
230 231
Ebda., S. 1055. Ebda., S. 1056. Ebda., S. 1067. Eine Zeit, die d’Alaux als totale Isolation der haitianischen Intellektuellen sieht. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1067. Der Mulatte Jules Solime Milscent (1778–1842) war ein haitianischer Erzähler, Dichter, und Politiker. Er erhielt seine Bildung in Frankreich und war Mitbegründer der Zeitschrift L’Abeille Haytienne. Er arbeitete für mehrere haitianische Regierungen und war Mitglied der Verfassungskommission. 1842 starb er bei einem Erdbeben. Vgl. zur Abeille Haytienne auch Lüsebrink: Transfers culturels, S. 315. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1067.
180
Über Coriolan Ardouin232 schreibt d’Alaux: «Si je multiplie les citations, c’est qu’il s’agit, encore une fois, du premier véritable poète que je rencontre ici, et d’un poète entièrement imprévu ; car son nom, – rare bonheur pour lui, – n’a pas même été défloré par l’écrasante admiration des négrophiles.»233 Aufgrund seines frühen Todes, rechtfertigt d’Alaux, habe Ardouin kaum Zeit gehabt, ein originelles Werk zu schaffen. Dabei zeigt d’Alaux seine Bewunderung für Ardouin und betont, dass ihn in dessen Gedichten mehr der Mensch Ardouin interessiere, da man bei ihm noch nicht von haitianischer Poesie sprechen könne: Dans ses échos perdus de Millevoye et de Lamartine, où est, dira-t-on, l’originalité ? où est le cachet local ? – En vérité je ne les y ai même pas cherchés. Coriolan Ardouin n’avait pas encore eu le temps de demander des impressions à la nature extérieure ; sa poésie est restée jusqu’à la fin essentiellement intime, et si elle ne trouve que des notes déjà entendues, c’est qu’apparemment le cœur bat à peine près de même à Portau-Prince et à Paris. J’avais, en un mot, la prétention de montrer ici un poète et non pas la poésie haïtienne.234
Es gibt aber auch immer wieder Stellen, an denen eine scheinbare Ambivalenz235 von d’Alaux gegenüber den Nichtweißen zum Tragen kommt, beispielsweise wenn er von einer «Negerweisheit» im positiven Sinne schreibt: «La sagesse nègre, qui, plus tard, avait si bien jugé les scrupules libéraux, […], caractérisait d’une façon plus pittoresque encore la candide et enthousiaste sécurité de négrophile…»236 Nach dem Tod König Christophes, so berichtet d’Alaux237, habe mit Juste Chanlatte auch die Generation der Historiker geendet, die sich im französischen Milieu gebildet hatte. Mit Hérard-Dumesle beginne die zweite Generation, die alles selbst lernen und erarbeiten musste, da es ständig an französischen Büchern gefehlt habe. Dabei kommt d’Alaux zurück auf dessen großes historisches Werk Voyage au nord d’Haïti zu sprechen und bedauert, dass es nicht gut zehn Jahre später erschienen ist, «quand le souffle littéraire de la France avait déjà épuré et mûri le talent de l’auteur».238
232
233 234 235
236 237 238
Coriolan Ardouin (1812–1835 [nach anderen Quellen 1836 oder 1838]) war ein an der Klassik orientierter und von Delavigne und Lamartine beeinflusster haitianischer Dichter. Früh verwaist, starb er bald nach dem Tod seiner Frau, die er nach nur fünf Monaten Ehe verloren hatte. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1072. Ebda., S. 1074. Man kann hier von einer scheinbaren Ambivalenz sprechen, weil deutlich wird, dass für d’Alaux überhaupt kein Widerspruch darin besteht, einerseits die Nichtweißen zum Teil als unzivilisiert und «wild» zu beschreiben und gleichzeitig seine Bewunderung für ihre Literatur zum Ausdruck zu bringen. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1079. Dabei bittet d’Alaux ironisch Gott um Vergebung, dass er den «tyran nègre du Cap» verleumdet. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1083.
181
Die letzte Seite seines Artikels ist Linstant239 gewidmet, den man, so d’Alaux, «ehrenvoll unter den europäischen Veröffentlichungen einreihen könnte», wenn er seine Beiträge nicht mit Linstant (Haïti) unterschriebe. Er stellt zwei Werke von ihm vor: Essais sur les moyens d’extirper les préjugés de couleur (1842) und L’Émigration européenne dans ses rapports avec la prospérité future des colonies (1850). Über das erste Werk schreibt d’Alaux: Le préjugé de couleur, qui, après avoir rebondi de gradin en gradin du maître à l’esclave, est remonté du nègre au mulâtre, du nègre illettré au nègre lettré, voilà bien, en effet, le germe et comme le sanglant avant-propos de l’histoire haïtienne, de cette histoire qui commence aux massacres de Toussaint pour aboutir aux massacres de Soulouque.240
Im Vorurteil der Hautfarbe, das sich mittlerweile gegen alle Mulatten richte, sehe Linstant den Schlüssel zum Verständnis der blutigen haitianischen Geschichte, die bei den Massakern von Toussaint beginne, um bei den Massakern von Soulouque zu enden. Alle Teilaspekte des Artikels bestätigen die Imitation der französischen Romantik als Wesenszug haitianischer Literatur. Was sagt uns dies jedoch über die literaturgeschichtliche Metaebene? Da die Primärtexte nicht zugänglich sind, scheint dies eine unlösbare Frage zu sein. Fest steht indes, dass literarisches Schaffen auf Haiti die These von der Inklusionskraft Frankreichs und der bipolaren Relationalität des französischen Kolonialismus zementiert. Dies insofern, da selbst bei einem unabhängig gewordenen Staat die Folgen einstiger Integrationsmechanismen überleben. IV.4.1.2. Haitianische Herrscher als Despoten In seinen Artikeln zur haitianischen Literatur, vor allem aber in den beiden Teilen von «La littérature jaune», entwirft d’Alaux auch ein Bild des ungebildeten, abergläubischen und brutalen Tyrannen, das die Herrscher auf Haiti in seinen Augen ausmacht. Kaiser Dessalines beispielsweise legt er folgende Worte in den Mund: Je suis, j’été (j’ai été), ça parole blancs ! dit dédaigneusement Dessalines par une locution proverbiale qui sert aujourd’hui encore à exprimer l’ironique dédain du nègre pour la conjugaison française (1) ; nous pas bisoin ça ! avec blancs, ifaut (il faut) fisils avec la poudre et non papier parlé.241
Dessalines verachtet demgemäß das Wort – auch das geschriebene –, mit dem unter Umständen bestimmte Vereinbarungen getroffen wurden. Ihm genügt ge-
239 240 241
Listant hatte einen Essaywettbewerb gewonnen, der die «Ehre der schwarzen Rasse» retten sollte und von Grégoire ins Leben gerufen worden war. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1085. D’Alaux: La littérature jaune I, S. 939. In der Fußnote 1 erklärt d’Alaux, dass Verben in der kreolischen Grammatik lediglich einen bis zwei Modi haben, was zusammen mit den kreolischen Zitaten darauf schließen lässt, dass, falls er nicht selber die Sprache beherrschte, er zumindest über gute Kenntnisse verfügte.
182
genüber den Weißen das Gewehr – die nackte Gewalt. Dieser Verachtung der Schriftkultur geht d’Alaux weiter nach: So leitet sich der Titel des ersten Abschnitts, «Renaissance inconnue», von der Tatsache ab, dass mit der Revolution auf Haiti und auf Befehl Dessalines’ hin die Literatur größtenteils «vernichtet» wurde. Als Folge davon hatte die gebildete Minderheit Probleme, intellektuell auf dem Laufenden zu bleiben. [La compagnie de grenadiers de Dessalines] allait de maison en maison égorger nos malheureux compatriotes lacérait et jetait dans les rues tous les livres qu’elle découvrait. Non coutent de supprimer le «papier parlé», l’empereur allait supprimer les écoles (2), lorsqu’on le tua dans l’intérêt des lumières ; mais le mal était fait, et le groupe lettré resta limité, faute de livres, à ses premiers représentants, eux-mêmes réduits à ruminer la lourde pâture intellectuelle qu’ils avaient ramassée par bribes dans les clubs philanthropiques, les journaux jacobins et les tragédies thermidoriennes.242
Aus dem ganzen Artikel geht hervor, dass zwischen der literarischen Produktion und dem Herrscher, unter dem sie entsteht, ein wichtiger Zusammenhang besteht. Aus den unterschiedlichen Beispielen und Beschreibungen der Herrscher wird nicht nur ersichtlich, welche Zeit und welcher Teil Haitis gemeint sind, sondern auch, wie diese Herrscher Einfluss auf die Produktionen des Landes hatten. Verständlicherweise wird Pétion, der seit 1807 Präsident der Mulattenrepublik im Süden Haitis war, von ihm weit günstiger beurteilt als König Christophe, unter dessen Terrorregime alle genauso zu leiden hatten wie unter Dessalines. Le président Pétion avait fort à cœur de renouer la chaîne civilisatrice si brusquement rompue par l’empereur nègre. […] Par contre autour de Christophe, dont le despotisme avait imprimé une impulsion fabuleuse à la production, et qui prétendait organiser l’instruction aussi violemment que le travail, c’est la terreur qui créa le vide. Nos émigrans éprouvaient une répugnance bien naturelle à aller remplir des cadres universitaires d’un pays où le titre de Français équivalait, presque aussi sûrement que sous Dessalines, à un arrêt de mort.243
Eine andere «Manie» oder «Krankheit» der haitianischen Machthaber sieht d’Alaux von Dupré inszeniert, diejenige nämlich, sich mit allerlei Orden zu schmücken.244 Dupré liefert auch das Beispiel für die despotische Kombination einander zuwiderlaufender politischer Prinzipien, die d’Alaux auf Haiti diagnostiziert. Im zweiten Abschnitt von «La littérature jaune I» stellt er kurz ein Stück Duprés vor, dessen Ironie darin besteht, dass jemand sich weigert, seinen Pferden Fressen zu geben, so dass die Frage aufgeworfen wird, warum man Pferde besitzt, wenn man sie nicht füttern möchte. Ähnlich widersprüchlich verhält sich Soulouque, der sein Parlament beibehielt, obwohl er jeden, den er des Parlamentarismus verdächtigte, erschießen oder deportieren ließ.
242 243 244
Ebda., S. 939. Ebda., S. 939f. Ebda., S. 940f.
183
[…] c’est Soulouque criant tout d’une haleine : vive la liberté ! Vive l’empire ! – se faisant sacrer et droguer à la fois,– emprisonnant, déportant ou fusillant sans pitié tout député ou sénateur qu’il soupçonne de parlementarisme, mais conservant avec obstination son parlement.245
Im dritten Abschnitt macht d’Alaux einen Sprung zur Oper unter König Christophe, der sich, zusätzlich zum Hofstaat, auch eine königliche Musikakademie und ein königliches Theater leistete. Librettist war der Comte de Rosiers, mit Namen Juste Chanlatte, Bruder von Desrivières Chanlatte, der unter Pétion für die Grammatik und Druckerei zuständig war. D’Alaux stellt eine Oper von Cassian, einem Haitianer, vor, mit dem Titel La partie de chasse du roi. Diesmal spricht er explizit von einem Molière-Plagiat246 und fasst das Stück Akt für Akt zusammen. Der ganze Abschnitt widmet sich mithin dieser einen Oper, in der Christophe die Hauptrolle spielt und als guter und gerechter König dargestellt wird. «Le roi de l’opéra nègre, qui s’appelle, comme dans l’opéra français, ,le bon Henri,‘ n’est ni plus ni moins qu’Henri Christophe, lequel était mis en scène avec les principaux personnages de sa cour.»247 Es folgt eine Szenenwiedergabe, die d’Alaux als charakteristisch für das ganze Stück erachtet. Hier einige Auszüge des Dialogs: LE COMMANDANT : […] Haïti n’est déjà plus dans son adolescence politique ; en fondant
un trône, monument représentatif de sa dignité et sûr garant de ses droits, elle a donné une preuve authentique de sa virilité physique et morale. Gloire soit au Tout-Puissant qui a tendu une main secourable à l’innocent persécuté ! TOUS ENSEMBLE : Gloire au Tout-Puissant ! LE COMMANDANT : Vive à jamais Henri, ce héros bienfaisant, dont le bras immortel, après avoir reconquis nos droits, a assis l’édifice de notre consistance politique sur des bases inébranlables ! TOUS ENSEMBLE : Vive à jamais Henri ! LE COMMANDANT : Haine éternelle à la France ! TOUS ENSEMBLE : Haine éternelle à la France !248
D’Alaux erwähnt, ohne näher darauf einzugehen, dass ein Vers sich an die Despoten wendet, und erklärt, dass damit die Franzosen gemeint seien.249 Dabei werde immer wieder ein Bezug zwischen Henri Christophe (I.) und Henri IV. hergestellt, wobei, wie oben bereits erwähnt, der haitianische Henri im Gegensatz zu dem französischen stets als gerecht und gütig erscheine. D’Alaux erzählt die Handlung der Oper mit einem ironischen Unterton und erklärt anschließend, Christophe agiere im wahren Leben genau gegenteilig. So verschwindet Christoph in einer Szene während einer Jagdrunde. Seine beiden Begleiter, zwei Herzöge, sorgen sich über sein Ausbleiben. Hier betont d’Alaux, dass im wahren Leben
245 246 247 248 249
Ebda., Ebda., Ebda., Ebda., Ebda.,
184
S. S. S. S. S.
945. 952. 952. 953. 955.
diese zwei vor Freude tanzen würden,250 da Christophe viele von ihnen töten ließ, lediglich weil er von ihnen geträumt hatte, und sie somit in ständiger Angst leben mussten. Christophe taucht in dem Stück wieder auf, erzählt lachend, sein Pferd sei ausgerutscht, und es habe ihn fast das Leben gekostet. Auch hier schildert d’Alaux kurz, was in einem solchen Fall wirklich passiert wäre: Das Pferd wäre geschlagen und der für den Straßenabschnitt Zuständige bestraft worden. «Dans l’opéra c’est toujours l’opposé [de la réalité] : Christophe plaisante avec une gaieté charmante sur son accident.»251 Der zweite und dritte Akt des Stücks handeln von einer Familie Bayacou, bei der eine Hochzeit arrangiert wird und in der Christophe involviert ist. Interessant ist hier vor allem, wie d’Alaux darauf insistiert, dass Christophe im Stück nicht dem wahren Christophe entspreche. Seine Einschätzung äußert er mit so drastischen Bemerkungen wie jener, Christophe lasse im Stück an einem Morgen ausnahmsweise niemand erschießen.252 Um seine Darstellung von Christophe zu untermalen, erwähnt er ein Werk des Historikers Hérard-Dumesle, in dem erklärt wird, wie Christophe, anders als in Theaterinszenierungen, Bäder in der Menge und die Huldigungen seiner Untertanen regelrecht erzwang. […] dans une de ces tournées, où il [Christophe] était accompagné de l’amiral anglais, sir Hom Popham, il ordonnait aux inspecteurs de culture de rassembler aux barrières des habitations les malheureux dont il dévorait le prix de leur sueurs. Cette mesure prise, il avait l’air de partir fort avant le jour comme pour se dérober aux hommages empressés d’un peuple qui l’adorait ; mais le bruit des chevaux et des voitures avertissaient les royals-Dahomets de préparer les malheureux ainsi mis en station après un travail forcé durant tout le jour ; éveillés à coup de bâton, le cri de «vive le roi !» venait expirer sur leurs lèvres.253
D’Alaux gibt dann auch zur «fiktionalen» Christophe-Figur in Chanlattes Stück zu bedenken, man könne keineswegs davon ausgehen, dass dieses gewagte Gegenstück zum wirklichen Christophe ironisch oder als versteckter Ratschlag gemeint sei: «Et qu’on ne soupçonne ni l’ironie ni le conseil détourné dans cette audacieuse contre-partie du véritable Christophe.»254 Er nutzt also diesen Abschnitt über die Oper am Hofe Christophes, um das Bild des haitianischen Despoten zu beschreiben.255 Die vorgestellte Oper mit Christophe in der Hauptrolle dient gewissermaßen als vollkommene Idealisierung und somit als Gegenbild zum realen Herrscher. Zu erklären ist diese positive Darstellung des Despoten in der Oper
250 251 252 253 254 255
Ebda., S. 956. Ebda., S. 957. Ebda., S. 958. Ebda., S. 960. Ebda., S. 961. Interessant ist, dass das Bild des orientalischen Despoten von mehreren europäischen und vor allem französischen Philosophen des 18. und 19. Jahrhunderts gezeichnet wurde, um als Gegenbild eines guten europäischen Herrschers zu fungieren. Hier geht es bei d’Alaux also um eine bewusste Darstellung des haitianischen Despoten – und gleichzeitig, wohl unbewusst, um die positive Darstellung des eigenen Herrschers.
185
nur dadurch, dass auf Haiti zu Zeiten König Christophes eine strenge Zensur herrschte, der sich die Literaten unterwerfen mussten. So zitiert d’Alaux in einer Fußnote den oben erwähnten Historiker Hérard-Dumesle: «Un jour, après avoir fait cruellement châtier une femme enceinte qui avait cueillie un mango dudit verger, il lui fit ouvrir le sein pour voir si l’embryon avait gouté le fruit».256 Man muss sich fragen, inwiefern diese Geschichten wahr sind und in welchem Maße der Kampf zwischen den beiden Haitis dieser Zeit zu Diffamierungen über die Herrscher beider Regimes beigetragen hat. Für d’Alaux jedenfalls belegt diese Geschichte sein Bild Christophes und des haitianischen Despoten allgemein, denn er stellt am Ende seiner Kritik Christophes den Bezug zu seinem eigenen Zeitgenossen Soulouque her, der diesem an Grausamkeit und Rachsucht nicht nachstand. Si j’insiste sur ces détails de mœurs, c’est qu’ils ont encor un intérêt d’actualité. Ce concert de louangeuse sensiblerie qui s’élevait autour du Caligula de la petite cour du Cap n’était que l’image anticipée de ce qui ce passe aujourd’hui autour du nouveau tyran nègre – à cette différence près toutefois que les flatteurs de Soulouque obéissent bien moins encore à la peur qu’aux illusions d’un intérêt très mal entendu. Les gens de couleur se sont imaginé qu’en exaltant tout le bon, le clément Faustin 1er, ils finiront par lui donner le gout de la bonté et la clémence, […], la vanité de Soulouque ne peut au contraire que se complaire à une situation où il cumule, avec les plaisirs de la vengeance et de la cruauté, les honneurs de la clémence. Faustin Ier finira, qui pis est, par prendre sa clémence au sérieux, car il est dans le caractère africain, je le répète, d’accoupler de très bonne foi les faits, les sentimens, les idées les plus incompatibles. Christophe, bien plus éclairé pourtant que Soulouque, Christophe en était lui-même venu à se croire l’homme le plus sensible de son royaume, et personne ne pleurait, ne s’attendrissait plus aisément que lui.257
Neben der Abeille Haïtienne, schreibt d’Alaux im zweiten Teil von «La littérature jaune», habe er in Hérard-Dumesles Voyage dans le nord d’Haïti die meisten Erzählungen dieser Zeit gefunden. Über Dumesles Werk urteilt er, es sei im Grunde eine Geschichte der Grausamkeiten seit der ersten Revolution bis einschließlich der Herrschaft Christophes.258 Dann wird ein weiterer Dichter namens Darfour vorgestellt, dem Pétion und Boyer die Möglichkeit gaben, eine Zeitung herauszubringen. Da er jedoch regierungskritische Texte veröffentlichte, ließ ihn Boyer hinrichten.259 Daran erkenne man, so d’Alaux, dass man auch unter dem republikanischen Präsidenten noch weit davon entfernt war, den Errungenschaften der Französischen Revolution auch in der Praxis Geltung zu verschaffen.
256 257 258
259
D’Alaux: La littérature jaune I, S. 961, Fn. 2. Ebda., S. 962. Vgl. d’Alaux: La littérature jaune II, S. 1068. Hérard Dumesle (1784–1858) war ein haitianischer Dichter und Politiker. Als Mulatte war er in der Opposition von Jean Pierre Boyer. Sein Werk Voyage dans le nord d’Haïti stammt aus dem Jahr 1824, ist also nach Christophes Tod erschienen. Es ist fraglich, ob seine Diffamierungen, wie die Gräuelgeschichte von der schwangeren Frau, einen realen Bezug haben. Ebda., S. 1070.
186
Im weiteren Verlauf kommt d’Alaux auf Metaphern und Sprichwörter zu sprechen, die sich auf die Herrschaft von Dessalines, Toussaint und Boyer beziehen. D’Alaux erwähnt das Schicksal der französischen Soldaten, die in Spitälern zurückbleiben mussten, der «unglücklichen» colons, Männer, Frauen und Kinder, die Dessalines’ Einladung vertraut hatten, und er unterstreicht das Bild des bestialischen Despoten Dessalines. Die hasserfüllten Ausbrüche Dessalines’ gegen die Weißen im Allgemeinen und gegen die Franzosen im Besonderen lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Dessalines […] chargea Boisrond-Tonnerre de la besogne de Charairon, en lui disant : C’est ça, Mouqué, c’est ça même mon vlé ! C’est sang blanc mon besoin [Fußnote: C’est cela, monsieur, c’est cela même que je veux ! C’est du sang de blanc qu’il me faut !]. Le lendemain matin, au moment, au moment de la cérémonie, il fallait enfoncer la porte de Boisrond-Tonnerre, cette fois ivre mort, et l’on trouver sur sa table, […], cette proclamation qui fut le signal de six semaines de massacres, proclamation qui faisait dire entre autres choses à Dessalines : «Ces généraux qui ont guidé vos efforts contre la tyrannie n’ont point encore assez fait… Le nom français lugubre encore nos contrées !» C’est de la même inspiration et probablement du même baril de tafia que sont sortis les Mémoires.260
Danach stellt d’Alaux La géographie de l’île d’Haïti (1832) von Alexis-Beaubrun Ardouin (1796–1849) vor, Coriolans Bruder, und bezeichnet diese als «le seul travail véritablement irréprochable qu’ait produit la seconde génération littéraire».261 D’Alaux bedauert ein wenig, dass die Herrscher in der haitianischen Literatur idealisiert beziehungsweise verherrlicht werden, und regt deshalb an, eine neue Geschichte zu schreiben: «C’est là, en un mot, toute une histoire à refaire…»262 Und schließlich wendet er sich der zeitgenössischen Aktualität zu: Soulouque (seit 1849 Kaiser, 1852 öffentliche Krönung) stehe vor der Frage, in Port-au-Prince die Zivilisation wiederherzustellen oder möglicherweise von Piraten annektiert zu werden: […] le cri de la civilisation n’est ici que l’écho d’un ardent patriotisme. Ce cri sera-t-il spontanément répété à Port-au-Prince ? Soulouque aimera-t-il mieux attendre qu’il soit vomi par les sabords de quelque pirate annexionniste courant des bordées entre Cuba et Puerto-Rico ? Là est toute la question.263
Die Kritik d’Alaux‘ bezieht sich auf die grausamen Zustände an sich, aber auch auf einen Zusammenhang zwischen politischem Regime und Kulturproduktion. Als Referenzpunkt erscheint nie die haitianische Revolution, sondern die französische. Selbst ein indirektes Ableiten der haitianischen als Folge der Französischen Revolution findet nicht statt. Über die Person d’Alaux wird ein effizientes französisches Kolonialmodell vermittelt, das Frankreich als Kulturnation mit Strahlungskraft und Integrationsfähigkeit verherrlicht. Trotz des nicht abzustrei-
260 261 262 263
Ebda., Ebda., Ebda., Ebda.,
S. S. S. S.
1081. 1083. 1084. 1085.
187
tenden wertvollen Gehalts zeitgenössischer Momentaufnahmen einer haitianischen Gesellschaftskritik liegt die Tiefendimension der Aussage im Rückbezug auf ein französisches Selbstverständnis. Auch wenn Rassendiskurse nicht explizit beleuchtet werden, zeugt allein die Bezeichnung «La littérature jaune» für eine Außenwahrnehmung, die die existentielle Dimension einer Denomination über die Hautfarbe zu DEM entscheidenden Distinktionskriterium macht. IV.4.1.3. Voraussetzungen intellektueller Arbeit auf Haiti Liest man d’Alaux’ Ausführungen mit Blick auf seine Haltung den haitianischen Intellektuellen gegenüber, so fallen einem zwei Dinge auf: einerseits seine genaue Analyse der Bedingungen, unter denen sie leben und arbeiten – dabei ist ein Schwerpunkt das «despotische» und ungebildete Verhalten der Herrscher, wie in dem vorhergehenden Unterkapitel dargelegt. Andererseits zeigt d’Alaux’ Verständnis auch ein gewisses Maß an Bewunderung für diese Intellektuellen, die es trotz der Hindernisse schaffen, literarisch zu produzieren. Häufig bildeten sie Gruppen, die sich in den Städten in Freimaurerlogen zusammenfanden: […] ces loges, […], devinrent de petites réunions littéraires, de véritables écoles d’enseignement mutuel, où chacun apportait, sous forme de dissertations, de toasts, de fables, d’essais dramatiques, de chansons ou d’oraisons funèbres, son contingent d’élucubrations et de réminiscences.264
Zum Teil können die Textproduktionen in verschiedenen Zeitungen unter Pétion erscheinen. D’Alaux nimmt bei seiner Beurteilung der haitianischen Literatur die äußeren Begleitumstände ernst und hebt hervor, dass sich das Niveau der haitianischen Literatur seit 1825, seit der Anerkennung von Haitis Souveränität durch Frankreich, gesteigert hat. Ne sourions pas: mesurée non à sa valeur absolue, mais à sa spontanéité, aux obstacles qu’elle a dû vaincre, aux aptitudes relatives qu’elle a mises en jeu, cette naïve littérature serait à elle seule un très intéressant sujet d’observation ; elle ne s’est pas d’ailleurs arrêtée là. L’ordonnance par laquelle Charles X reconnaissait l’indépendance haïtienne, en stipulant des avantages spéciaux pour notre commerce vint rétablir, en 1825, le courant intellectuel que la révolution de 1803 avait rompu, et depuis lors le niveau littéraire haïtien s’est constamment élevé.265
D’Alaux sieht also einerseits einen kompletten Neuanfang mit der Revolution, bei der die französische intellektuelle Elite entweder vertrieben oder ermordet und ihre Bücher aus dem Verkehr gezogen wurden, und andererseits eine Wiederbelebung durch die Normalisierung der Kontakte zwischen Haiti und Frankreich. Diese Zusammenhänge beurteilt er als äußerst wichtig, da sich seines Erachtens die großen Unterschiede zwischen den entstandenen Werken durch die jeweilige Entstehungszeit erklären: «Ces préliminaires étaient indispensables pour une
264 265
D’Alaux: La littérature jaune I, S. 941. Ebda., S. 942.
188
équitable appréciation des écrivains de tous genres, – auteurs dramatiques, poètes, historiens, journalistes, – qu’a produits jusqu’à ce jour notre ancienne colonie.»266 Im letzten Abschnitt von «La littérature jaune I» spannt d’Alaux den Bogen zum Haiti seiner Zeit und versucht zu deuten, wie sich die haitianische Literatur und ihre Darbietungsform wohl entwickeln werden. Hier geht es um die Schriftsteller, Schauspieler, aber auch um das Publikum. Nachdem Charles X. die von Dessalines verordnete intellektuelle Isolierung aufgehoben hatte, so d’Alaux, erkannten die Schriftsteller auf Haiti ihre 20-jährige Verspätung und mussten feststellen, dass sie sich deutlich unterhalb des Niveaus der simpelsten französischen Dramaturgen befanden.267 D’Alaux erläutert die «infrastrukturellen» Probleme, auf die man in Haiti zusätzlich stößt. Obwohl noch 1841 drei Theater in Port-au-Prince zu finden waren, wurden sie alle innerhalb weniger Wochen geschlossen, weil sie zu viele Gegner hatten. Hinzu komme, dass es an guten und selbstbewussten Schauspielern mangele, die sich nicht bei der ersten Zeitungskritik von der Theaterwelt zurückzögen.268 D’Alaux macht auch darauf aufmerksam, dass die beschriebenen Opern und Stücke nur einen Teil der haitianischen intellektuellen Bewegung darstellen. Allerdings fehlen nach seiner Ansicht drei Facetten: die (Sitten-)Literatur, die Dichter, die Geschichtsschreiber. Merkwürdigerweise sieht d’Alaux ein Problem in der Fülle des Stoffs, der den Schriftstellern zur Verfügung steht. Außerdem scheinen Spannungen zu bestehen zwischen den französisch sozialisierten Farbigen und den «Afrikanern». Cette littérature a de nombreux obstacles à vaincre pour se faire jour en Haïti, et le principal de tous, c’est la proximité et l’abondance même des matériaux qui lui sont offerts. Dans ce pénible travail de fusion qui met, depuis un demi-siècle, aux prises la minorité presque française des sang-mêlés avec la prépondérance numérique des Africains, et les réminiscences nègres de ceux-ci avec d’incessantes et naïves contrefaçons de la civilisation européenne, tout doit être excentrique et fortement accentué.269
Fortlaufend unterstellt d’Alaux Plagiate, und das ist natürlich als Vorwurf zu verstehen, bedauert aber, dass viele der neuen haitianischen Schriftsteller Frankreich nicht persönlich kennen, was sie aber unbedingt nachholen sollten: «Malheureusement la plupart des écrivains de la nouvelle génération ne connaissent la France que par ouï-dire, d’autres n’avaient pu en rapporter que quelques souvenirs de collège, de sorte que l’ombre manquait souvent de vérité.»270 Er räumt ein, dass sie sich aufgrund ihres sozialen Rangs und ihrer Landeskenntnisse in einer guten Position befinden, um über Sitten und Bräuche des Landes zu schreiben, doch sieht er sie einer Gefahr ausgesetzt: Wenn der Schriftsteller kritisch schreibt, kann er sich die Gegnerschaft der ghion- und saint-Sekten einhandeln.271
266 267 268 269 270 271
Ebda., S. 942. Ebda., S. 963. Ebda., S. 964. D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1048. Ebda., S. 1049. Ebda., S. 1049.
189
Eine weitere Schwierigkeit sieht d’Alaux darin, dass der Absatzmarkt für haitianische Bücher nicht gegeben ist, weil einerseits kaum Leute lesen können und andererseits diejenigen, die es könnten, französische Bücher vorzögen. Insofern bleibt das Theater ein wichtiges Medium: En résumé ce ne sont pas les éléments, on le voit, qui manquent au futur roman de mœurs haïtien. Ce qui lui manque, c’est le public. Un livre de cette nature ne trouverait certainement pas à s’adresser, dans notre ancienne colonie, à plus de trois ou quatre cents lecteurs, et, roman pour roman, ceux-ci préféreraient acheter les nôtres, qui joignent à une supériorité de forme bien explicable la recommandation capitale pour le pays d’une consécration européenne. Les quelques essais de ce genre qu’ont fait les écrivains de Port-au-Prince n’ont donc eu jusqu’ici pour refuge que les journaux de l’endroit, et l’insuffisante périodicité de ces feuilles, la courte existence de la plupart272, interdisant toute œuvre de longue haleine. Le Théâtre, qui substitue, aux lecteurs la catégorie beaucoup plus nombreuse des auditeurs, le théâtre est encore une fois, le véritable débouché local de la littérature de mœurs haïtienne.273
IV.4.1.4. Essentialistische Zuschreibungen als Inspirationsquelle Die Bewunderung d’Alaux’ für dieses intellektuelle Schaffen, die Beschäftigung mit Sitten und Bräuchen mit eingeschlossen, ist von Widersprüchlichkeiten geprägt. D’Alaux berichtet teils bewundernd, teils herablassend über die lokalen Gepflogenheiten, lobt und rühmt die Tätigkeit der Intellektuellen und wirft ihnen gleichzeitig Plagiat vor – was den Ton eines tadelnden Vaters einschließt. Die Widersprüche kommen auch bei der Beschreibung der Einheimischen zum Tragen. Auf der einen Seite spricht d’Alaux von «Negerweisheit» und macht deutlich, welche Kreativität und welches Potential in dieser ehemaligen Kolonie stecken, auf der anderen Seite zeichnet er immer wieder das Bild der «unzivilisierten» Einheimischen, die ungebildet sind und teils «bestialische» Bräuche pflegen. Im Zusammenhang mit der bereits erwähnten Zerstörung von Büchern erklärt d’Alaux, französische Werke seien nicht verbrannt, sondern nur «zerfetzt» worden – so konnten Fragmente gerettet werden, die den Gebildeten doch noch als Informationsquelle dienten. Als Grund für die Rettung nennt er unter anderem die abergläubische Ehrfurcht der Schwarzen: J’ai dit que les livres des colons avaient été lacérés et non pas brûlés ; la superstitieuse vénération des négresses pour le papier parlé et la sollicitude plus positive des épiciers du pays en avaient donc sauvé de fragmens, parfois même des volumes entiers, que les lettrés, ou ceux qui voulait le devenir se mirent à collectionner avec une véritable passion.274
272
273 274
In einer Fußnote erklärt d’Alaux, dass zwischen 1812 und 1842 gut 20 Zeitungen auf Haiti nach und nach verschwanden, weil ihre Abonnenten nicht mehr zahlungsfähig waren. Ebda., S. 1065. Ebda., S. 1064f. D’Alaux: La littérature jaune I, S. 941.
190
D’Alaux beschreibt, dass jeder, der im Besitz eines Buches war, von schwangeren Frauen besucht wurde, die Namen für ihre ungeborenen Kinder aus diesen Büchern entnehmen wollten, und er nennt verschiedene Beispielnamen, die beim Leser Heiterkeit hervorrufen sollen. Unter anderem stellt d’Alaux auch die Komödie eines anonymen Autors vor, die in der Zeitung Abeille haïtienne275 abgedruckt wurde, und zwar unter dem Titel Le Physicien. Dieses Stück enthält einige interessante Aspekte, denn es geht dabei um den Konflikt zwischen moderner Wissenschaft und afrikanischem Aberglauben, der durch ein Gespräch zwischen einem Physiker und seinem Diener vermittelt wird. Der Physiker erklärt seinem Helfer, dass der Aberglaube nur wenigen Scharlatanen diene: «La magie ou la sorcellerie n’est que l’abus que quelques fourbes méchans ou intéressés font de certaines découvertes ou des connaissances qui appartiennent à la physique.»276 Über diesen Text schreibt d’Alaux, die Kritik am Aberglauben ließe sich nur in der Schriftform veröffentlichen (nicht jedoch aufführen), da Bücher ihrerseits unter dem Schutz eines Aberglaubens standen: «Cela pouvait à la rigueur s’écrire, grâce à l’inviolabilité que dont jouit le ,papier parlé‘ dans la classe illettrée des papa-loi et de leur adeptes.»277 Und dennoch sieht d’Alaux Hoffnung in der neuen Generation der Schriftsteller, wie Dupré und seine Nachkommen, in ihren Werken und Aufführungen. Gerade in einem Land, in dem Aberglaube und Analphabetismus herrschten, habe die Literatur die große Aufgabe, den Zivilisationsprozess voranzutreiben. Des pièces à la façon de Dupré, reproduisant des situations et des types nationaux qui seraient intelligibles pour tous, émaillées même de dictons et de saillies créoles qui en doubleraient la clarté et l’intérêt, ces sortes de pièces ne seraient pas seulement le plus prompt moyen de civilisation pour un pays où les masses ne savent pas lire, où la plupart des curés ne sont que la doublure des sorciers vaudoux, et où la vanité du paraître est le seul stimulant du travail : elles auraient encore un succès assuré d’argent. Le goût de l’imitation et de l’effet dramatiques est poussé jusqu’à la fureur chez les nègres et s’y manifeste sous toutes les formes, témoin leurs cérémonies magiques et religieuses, où se déploie, nous l’avons dit ailleurs, un puissant instinct de mise en scène, […].278
D’Alaux stellt zwei Geschichten eines anonymen Autors vor, die in einer Zeitschrift aus Haiti erschienen, dem Républicain279, und anhand derer er die haitianischen Bräuche und Sitten zeigen möchte. Die erste Geschichte (ohne Titel) handelt von einer anstehenden Hochzeit zweier junger Menschen, Marie und Alexandre. Im Laufe der Geschichte wird deutlich, dass die beiden Geschwister sind, und d’Alaux wundert sich, wie die Personen in der Geschichte ohne große Umschweife darüber sprechen, als sei es gängig und normal: «Marie est la sœur d’Alexandre. Ces innocentes demoiselles philosophent tout bonnement sur
275 276 277 278 279
Die Zeitung wurde 1817 von Jules Solime Milscent gegründet. D’Alaux: La littérature jaune I, S. 949. Ebda., S. 950. Ebda., S. 966. Dieser Zeitschrift folgte eine andere namens L’Union.
191
l’inceste. Faites en donc encore des tragédies !»280 Die Mutter der beiden geht zum Pfarrer und handelt die Hochzeit aus. Was für europäische Leser verwunderlich ist, erklärt d’Alaux mit lokalen Gepflogenheiten. On pourrait soupçonner l’auteur d’avoir voulu accumuler ici, comme par gageure, les monstruosités et les invraisemblances ; mais nous sommes encore une fois dans un monde à part, et, pour qui voudra bien se rappeler comment se recrute le clergé haïtien, la casuistique du «bon curé» ne pèche nullement contre la couleur locale.281
In der zweiten Geschichte, «Comment peut-on être meilleur fils ?», geht es um einen jungen Mann, der seine kranke Mutter pflegt und dabei seine Feldarbeit vernachlässigt. Gleichzeitig jedoch sammelt er über ein Jahr lang Verpflegung, Hühner und andere Dinge für das Festmahl, das bei der Beerdigung stattfinden soll. Heimlich betet er, die Mutter solle bitte bald sterben. Als es jedoch so weit ist, wenden sich seine Gebete ins Gegenteil: Au réveil, ce même cri retentit cependant comme un glas de mort au fond de sa conscience, et passant, avec cette mobilité d’impressions qui caractérise le nègre, de l’indifférence bestiale à la tendresse, il se met à la recherche de sa mère, suppliant la Vierge et les saints de la lui faire retrouver saine et sauve.282
D’Alaux bemerkt, eine solche Attitüde sei auch bei uns zu finden, jedoch relativiert er diesen Gedanken rasch wieder und erklärt die kaum nachvollziehbaren emotionalen Widersprüche mit dem Einfluss der Schwarzen auf Haiti. On pourrait trouver chez nous un type approchant : celui du paysan qui plaint plus les remèdes à son père mourant qu’à son bœuf malade ; mais le cumul sérieux et si sincèrement naïf de cette sordide dureté avec toutes les prodigalités que comporte aux colonies la religion de la famille, le contraste de ces impatiences parricides avec de sincères prétentions au sentiment filial, voilà qui est essentiellement nègre.283
Nach diesen zwei Geschichten wird Ignace Nau vorgestellt, oder besser gesagt erklärt d’Alaux, ohne auf Naus Werk einzugehen, dieser Autor zeige, wie das «Leben der Neger» permanent von Wundern durchdrungen sei.284 Der erste Abschnitt von «La littérature jaune II» endet mit der Gerichtsverhandlung eines Anwalts namens Mullery (er wird auch im Artikel «La littérature nègre» von d’Alaux erwähnt), der zugleich Besitzer einer der wenigen Zeitungen ist, der Revue des Tribunaux. Hier skizziert d’Alaux ein nicht ernst zu nehmendes Gericht (und folglich Gerichtssystem), bei dem die Beteiligten teils einschlafen und in dem manche Verhandlungen von Voodooprozessionen vor dem Gericht gestört werden.285
280 281 282 283 284 285
D’Alaux: La littérature jaune II, S. 1051. Ebda., S. 1052. Ebda., S. 1054. Ebda., S. 1054. Ebda., S. 1054. Ebda., S. 1062f.
192
Im zweiten Abschnitt widmet sich d’Alaux der Poesie und erklärt, es gäbe nur vereinzelte Dichter auf Haiti, da sich von den wenigen Gebildeten nur ein kleiner Teil der Poesie verschreibe. Ein weiteres Problem sei das fast gänzliche Fehlen von Leserinnen, die er als sehr wichtig für die Poesierezeption erachtet. Außerdem könnten viele potentielle Dichter den Kampf um das tägliche Brot nur bestehen, wenn sie sich dem Alkohol hingäben. Daraufhin entwirft d’Alaux das Bild des dem Alkohol zugeneigten Haitianers, dem auch die Dichter angehören: Usés et ennuyés par cette inféconde lutte de tous les jours avec les préoccupations d’une vie besogneuse, auxquelles ne font contre-poids ni ces jouissances intellectuelles que tout centre de civilisation offre au pauvre comme au riche, ni les encouragemens de la renommée qui se distribuent trop loin d’eux ; la plupart des poètes haïtiens finissent par abandonner la bouteille à l’encre pour la bouteille de tafia, et ils y trouvent, hélas ! leurs meilleurs poèmes, […].286
Auf den letzten Seiten schließlich häufen sich die fast selbsterklärenden Zitate d’Alaux’. Die besondere gesellschaftliche Situation – die Revolution, die Spannungen zwischen Schwarzen und Weißen, die Teilung Haitis in Nord und Süd – war nach seiner Ansicht eine wichtige Inspirationsquelle für die Schriftsteller an Christophes Hof: La haine des blancs, le partis pris cyniquement niais d’ensevelir sous les fleurs du sentiment et de l’idylle les abominations commises par les noirs, les violentes accusations qu’échangeaient les deux gouvernemens de Port-au-Prince et du Cap, la théorie de l’égalité des blancs et des noirs, voir celle de la prééminence physiologique et civilisatrice du noir sur le blanc, ont fournie aux écrivains de la cour de Christophe la matière d’assez nombreux écrits de forme et de fond plus ou moins historiques.287
D’Alaux rekurriert in seinen scheinbar neutralen Beschreibungen der zeitgenössischen haitianischen Kulturlandschaft vor allem auf vorgefertigte Bilder des spezifisch Haitianischen, die zu jenem Zeitpunkt auch in Frankreich zirkulierten. In seiner Wertung wechseln sich positive wie negative Stereotypisierungen ab. Da er durchaus mit modellhaften Exotismen operiert, entspricht sein Vorgehen dem Bemühen einer Selbstvergewisserung. Die Transferleistung ist insofern gedoppelt, als dass bereits schablonenartige Bilder die ethnographische Linse verstellen, diese aber in einem Akkulturationsprozess in die Metropole zurückübersetzt werden. Gustave d’Alaux‘ Artikel in der Revue des deux mondes richteten sich vorwiegend an ein französisches Publikum im kolonialen Zentrum, dem eine Bestätigung des französischen kulturellen Erfolgsmodells ein zentrales Anliegen war. Angesichts der nur sehr lückenhaft konservierten frühen literarischen Zeugnisse Haitis liefern seine Ausführungen sehr wertvolle Aufschlüsse über gesellschaftliche Konstellationen und unterschiedliche Beziehungsgeflechte. Dass die Relationalitäten zur Literaturproduktion des ehemaligen französischen Mutterlandes asymmetrischer Natur sind, liegt auf der Hand; dass Frankophilie teilweise zu Plagiat werden kann,
286 287
Ebda., S. 1066. Ebda., S. 1081f.
193
schreibt die Lesart einer Überhöhung der französischen kulturellen Gravitationskraft nur fort. Trotz politischer Freiheit und Möglichkeiten eines multirelationalen In-Beziehung-Tretens, scheint sich auch nach der Anerkennung Haitis ab 1825 weiterhin ein bipolares Modell durchzusetzen. Man sollte allerdings nicht außer Acht lassen, dass in der Auffassung d’Alaux‘ der Kompensationsfaktor, der mit dem Verlust Haitis zu tun hat, eine entscheidende Rolle spielt. Im Folgenden wollen wir die französische Perspektive fortsetzen, allerdings nun mit Blick auf den spanischen Nachbarn. IV.4.2. Charles de Mazade: «La société et la littérature à Cuba» Charles de Mazade gilt Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich als wichtiger Spanienhistoriker. Angesichts der komparatistischen Leitfrage dieser Arbeit bezüglich des spanischen und französischen Kolonialismus mag es aufschlussreich sein, wie die literarische Produktion auf Kuba im Mutterland der benachbarten Kolonien, sprich in Frankreich, wahrgenommen wurde. Nicht ohne Grund wird diesem Thema ein ganzer Artikel in der Revue des deux mondes gewidmet. Es gibt einige bemerkenswerte Aspekte in diesem Beitrag, in dem Mazade, wie aus dem Titel «La société et la littérature à Cuba» schon ersichtlich, die kubanische Gesellschaft sowie einige ihrer Autoren mit ihren Werken vorstellt.288 Dabei macht er früh im Text eine interessante Bemerkung über die zeitgenössische Beschleunigung des Wissenstransfers: «Ce qui est plus nouveau et plus particulièrement propre à notre siècle, c’est que la multiplicité des rapports, la rapidité électrique des communications nous font assister pour ainsi dire à tout ce qui se fait ou se tente sous toutes les latitudes».289 Diese Bemerkung zur Gleichzeitigkeit der globalen Prozesse könnte sich nahtlos in die heutigen Globalisierungsdiagnosen einfügen und betont ein weiteres Mal, auf explizite Weise, das von Ottmar Ette herausgearbeitete Phänomen historischer Phasen beschleunigter Globalisierung, das sich implizit im Rahmen dieser Studie kontinuierlich bestätigen konnte. Es mag jedoch nicht von ungefähr kommen, dass Mazade diese Bemerkung ausgerechnet im Jahre 1851 macht, also gerade am Übergang der von Ette diagnostizierten zweiten zur dritten Phase, für die Ette auch die «veränderte Bedeutung des Faktors Zeit» betont und die den globalen Schauplatz bereits mit einer Hinwendung des Blicks zum «amerikanischen Doppelkontinent» einläutet, um dann in der fortgeschrittenen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gerade dort einen neuen Höhepunkt einzuläuten.290 Für unsere Fragestellung ist von großer Bedeutung, dass der Wissenstransfer zwischen den karibischen Inseln und den Kolonialmächten relativ schnell funktionierte, wobei die Verbindung von französischen wie auch von spanischen Inseln zu Frankreich besonders ausgeprägt war.
288 289 290
Charles de Mazade: La société et la littérature à Cuba. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, XII (1851), S. 1017–1035. Mazade: La société et la littérature à Cuba, S. 1018. Ette: Weltbewußtsein, S. 27.
194
Mazades Überlegungen zeigen, inwiefern Kuba ein literarisches Vorbild für die gesamte Karibik sein kann. Weitere wichtige Themen sind die haitianische Revolution und die lateinamerikanischen Unabhängigkeitsbewegungen, ihre Auswirkungen und möglichen Einflüsse auf die Region. Zudem geht es darum, vor der angelsächsischen «Gefahr» zu warnen, die die Macht in Kuba übernehmen könnte. Der Kontext des Opiumkrieges unterstreicht die Machtambitionen der beiden angelsächsischen Großmächte. An einigen Stellen werden abfällige Bemerkungen über Nordamerika geäußert. Immer wieder nimmt Mazade Bezug auf die Condesa de Merlín, eine femme d’esprit, und dokumentiert ihren Einfluss auf die Intellektuellen der Zeit. Ihr dreibändiges Reisewerk La Havane (1849), das in Kapitel III. bereits vorgestellt wurde, beschreibt Mazade folgendermaßen: «la Havane, d’une observation vive et pénétrante, consacré surtout à décrire la vie et les moers de Cuba, mais dont la forme ingénieuse et familière ne déguise nullement ces graves questions qui se remuent au fond de la société cubanaise et constituent son originalité.»291 Auch das Verhältnis Kubas zur Kolonialmacht Spanien wird häufig tangiert. Zwar sei Kuba wirtschaftlich weitgehend unabhängig, politisch sei es aber weiterhin an Spanien gebunden, und dies soll am besten auch für alle Zeiten so bleiben, um eine angelsächsische Herrschaft über die Insel im Herzen der Karibik, die «reine de l’archipel des Antilles»292, zu verhindern. Die Umstände auf Kuba werden politisch, klimatisch und gesellschaftlich begründet: «Ces conditions et ces tendances se déduisent naturellement des traditions de ce régime politique dont nous parlions, de la séduction du climat, de la coexistence des races esclaves à côté de la race libre, et des nuances diverses de la population créole elle-même.»293 Bei der Beschreibung des Sklavereisystems merkt man den deutlichen Einfluss der Condesa de Merlín, wenn Mazade die sanftmütigen und väterlichen Züge der Sklavenhalter beschreibt. Dennoch bemerkt er: «Mais, qu’on le remarque, c’est à titre de race inférieure et dégradée que cette protection s’exerce sur l’esclave : ce n’est nullement à titre d’égalité humaine : Le sentiment de la superiorité du blanc garde toute sa puissance dans les moers vis-à-vis du noir […].»294 Die kubanische Literatur erfährt von Mazade eine zweischneidige Wertschätzung. Einerseits entbehre die Literatur Kubas historischer Tiefe und Bedeutsamkeit, andererseits verfüge sie über eine beeindruckende Vorstellungskraft. Ein gemeinsamer Zug der Übersee-Poeten sei «die unbezwingbare Liebe zu Kuba», die sich bei einigen gar gegen Spanien wende. Il y a en général dans les oeuvres des poètes cubanais comme dans le milieu social oú elles se produisent, plus d’imagination que de profondeur, plus d’éclat exterieur que de puissance, plus de grace que de caractère moral, plus mouvement que de cohésion.
291 292 293 294
Mazade: La société et la littérature à Cuba, S. 1019. Ebda., S. 1034. Ebda., S. 1020. Ebda., S. 1024.
195
C’est, dit un critique cubanais, la littérature d’un pays sans histoire et sans monumens, doué d’une nature poétique et abondante en scènes merveilleuse, où les sciences et les beaux-arts naissant à peine, et oú le spectacle des mouvemens intellectuels de l’Europe a le prestige fascinateur de la distance. Un trait commun à tous ces poetes d’outre-mer, c’est l’amour inviolable de la chère Cuba – amour qui chez quelques uns se transforme en une sorte de conjuration contre l’Espagne.295
Ein wichtiges Argument, das für das große Potential der kubanischen Literatur spreche, seien die Entdeckungsreisen und Abenteuer während der Eroberungen. Dieser Fundus an literarischem Material mache das Manko auf zivilisatorischkultureller Ebene wieder wett. Wenn manche behaupteten, Kuba könne keine Poesie hervorbringen, weil die Insel keine Erinnerungen und Traditionen habe, entspreche dies nur bedingt der Wahrheit, denn die ganze dramatische und rührende Geschichte der ersten Siedler in diesen Gebieten sei doch nichts anderes als ein wunderbarer «Traditionsstoff».296 Es ist Mazade ein großes Anliegen, vor dem angelsächsischen Einfluss auf Kuba zu warnen, der dazu führen könnte, dass die Engländer die Insel tatsächlich in Besitz nehmen. Deshalb fordert er die weiße Bevölkerung auf, für gesellschaftlichen Ausgleich zu sorgen und die bereits erreichten Fortschritte weiterzuentwickeln. […] c’est un appel adressé à la population blanche pour fortifier d’un élément civilisateur cette société mal équilibrée, [...], Les progrès les plus essentiels pour Cuba sont des progrès obscurs, pratiques et de tous les instans, dans le législations, dans les moers, dans l’éducation intellectuelle et morale.297
Schließlich hofft der französische Historiker, Kuba möge spanisch bleiben, um eine moderne und unabhängige Gesellschaft zu werden. Die in Frankreich fest verankerte Idee der mission civilisatrice wird mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit auf die benachbarte Iberische Halbinsel und ihre kolonialen Machterhaltungsmöglichkeiten übertragen. Daraus erklärt sich auch, dass der vergleichende Blick Mazades zum spanischen Nachbarn weniger einer kolonialen komparatistischen Perspektive geschuldet ist, als der Beschäftigung mit dem wichtigen Referenzpunkt Culture-Civilisation. Werfen wir nun einen Blick auf die Condesa de Merlín, die – anders als in ihrem Reisebericht – auch in der Revue des deux mondes zu Wort kommt und deren Text als Denkmal einer Abolitionismuskritik geradezu kanonische Wirkung entfaltet hat.
295 296 297
Ebda., S. 1027. Ebda., S. 1033. Ebda., S. 1035.
196
IV.4.3. Die Condesa de Merlín: «Les esclaves dans les colonies espagnoles» Die bereits vorgestellte Condesa de Merlín liefert mit diesem Artikel über die Sklaverei in den spanischen Kolonien298 ein Beispiel von Abolitionismuskritik, das sich höchst komplex vermittelt. An mehreren Stellen wiederholt sie, dass die Sklaverei keine gute Sache sei, jedoch angesichts der schlechten und chaotischen Welt eine durchaus wünschenswerte: Rien de plus juste que l’abolition de la traite des noirs ; rien de plus injuste que l’émancipation des esclaves […] Cependant, si l’on réfléchit qu’alors comme maintenant les Africains condamnés à l’esclavage ont été préalablement destinés à être tués et dévorés, on ne sait plus où est le bienfait, ou est la cruauté.299
Sklaverei sei immer noch besser als kannibalischen Afrikanern zum Opfer zu fallen. Sie erkennt zwar an, dass die Briten den Sklavenhandel unterbunden haben, wirft ihnen aber zugleich vor, zu wenig gegen die lokalen (Un)Sitten in ihren afrikanischen Besitzungen zu unternehmen. Wäre ihre humanitäre Haltung echt, müssten sie als größte Kolonialmacht die Aufgabe wahrnehmen, in Afrika erzieherisch zu wirken, «d’aller en Afrique apprendre aux tribus sauvages, soit par la persuasion, soit par la force, que l’homme doit respecter la vie et la liberté des hommes.»300 Es finden sich einige Hinweise, dass die Autorin die Sklaverei bedauert, so beispielsweise: «Une des plus tristes conséquences de l’esclavage, c’est d’avilir le travail matériel.»301 Interessanterweise gelten ihre Bedenken aber nicht der Versklavung an sich, sondern der damit verbundenen Entwertung der körperlichen Arbeit. Erhellend sind auch ihre Ausführungen über den feinen Unterschied zwischen Europäern und Kreolen. Immer wieder beschreibt sie die fürsorgliche und väterliche Art der kreolischen Sklavenhalter, dagegen käme es bei den europäischen Sklavenhaltern häufiger vor, dass sie die Sklaven malträtierten. Der Europäer, der nach Kuba die Erwartungen seines Landes mitbringe, empfinde für «den Neger» ein übertriebenes Mitleid. Von diesem empathischen Gefühl wechsle er abrupt, ohne Übergang, zur Ablehnung. Später mache ihn die Stupidität des Sklaven ungeduldig, und da der arme Neger ihn nicht verstehe, gelange der Europäer zu dem Schluss, dass ein Neger eine Art Vieh sei, und beginne, ihn daher wie ein Kamel zu schlagen. Große Teile des Artikels beschreiben das juristische System Kubas, das den Sklaven schütze. Der Status des Sklaven sei demzufolge viel besser als der befreiter Sklaven, die für sich selbst sorgen müssten. So entschieden sich manche Sklaven gegen eine angebotene Befreiung, denn der Sinn des Wortes Freiheit
298
299 300 301
María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlín: Les esclaves dans les colonies espagnoles. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, XXVI (1841), S. 734–769. Ebda., S. 735. Ebda., S. 736. Ebda., S. 741.
197
sei für den Sklaven nicht klar verständlich, er schätze das materielle Wohl viel mehr als die Unabhängigkeit. Dass die Sklaven auf Kuba von den spanischen Nachkommen gut behandelt werden, läge vor allem am Evangelium: L’Espagnol, profondément et sincèrement attaché à sa croyance, a subi cette influence dans ses lois comme dans ses mœurs, et c’est à l’application des préceptes d’humanité, de charité et de fraternité imposés par l’Évangile, que l’esclave doit ici la plupart des bienfaits qu’on lui accorde.302
Deutlich schlechter kommen die schwarzen Sklaven in den Augen der Condesa weg, deren Charakterzeichnung mit der ganzen Bandbreite der üblichen Stereotype aufwartet: Les nègres et négresses destinés au service intérieur de la maison peuvent employer leur temps libre à d’autres ouvrages pour leur propre compte ; ils profiteraient davantage de cette faveur s’ils étaient moins paresseux et moins vicieux. Leur désœuvrement habituel, l’ardeur du sang africain, et cette insouciance qui résulte de l’absence de responsabilité de son propre sort, engendrent chez eux les mœurs et les habitudes les plus déréglées.303 […] Une des sources de profit du nègre est le vol. Il est rare d’en trouver de fidèles, et, pour des gens dépourvus de principes, la raison est toute simple, c’est l’impunité.304
Überraschender erscheinen die Zuschreibungen der criollos, womit hier nicht die Nachkommen der spanischen Kolonisatoren gemeint sind, sondern in den Kolonien geborene Sklaven: «La plupart des esclaves réservés au service intérieur des maisons sont nés dans l’île : on les appelle criollos. Leur intelligence est plus développée que celle des Africains, et leur aspect franc et familier.»305 Man staunt, mit welcher Unbekümmertheit die Condesa zu Urteilen und Einschätzungen kommt, die sie niemals aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen abgeben kann, sondern nur «aus dem Bauch heraus». Es mag ja sein, dass sie einige criollos erlebt hat, die im Haushalt auffallend tüchtig waren, aber waren sie deshalb «intelligenter»? Wäre ihre Geschicklichkeit nicht leicht dadurch zu erklären, dass sie als Sklavenkinder bereits im Haushalt sozialisiert wurden? Wie widersprüchlich ihre Argumentation teilweise ist, wird deutlich, wenn sie sich an anderer Stelle grundsätzlich gegen die Sklaverei ausspricht: Ainsi, l’état de prince en Afrique ne vaut pas celui d’esclave dans nos colonies. Ceci ne veut pas dire que l’esclavage soit un état désirable : Dieu me préserve de le penser ! Je me borne seulement à tirer de ce fait une conséquence incontestable ; c’est que les bienfaits de la civilisation et des bonnes institutions corrigent même l’esclavage, et le rendent préférable à l’indépendance dépouillée de tout bien-être matériel, et toujours exposée au caprice et à la brutalité du plus fort.306
302 303 304 305 306
Ebda., Ebda., Ebda., Ebda., Ebda.,
198
S. S. S. S. S.
749. 751. 753. 756. 756.
Ausführlich räsoniert die Condesa über die Ursachen für die Unterschiede in der Arbeitskapazität und Belastbarkeit der Weißen und Schwarzen. Immer wenn sie «den Neger» und den europäischen Tagelöhner bei der Arbeit verglichen habe, habe sie bei den Schwarzen Anstrengung, Ermüdung, Niedergeschlagenheit und bei den Weißen Freude, Durchhaltevermögen und Mut vorgefunden. Un fait, m’a frappée. Toutes les fois que j’ai vu le nègre chargé du même travail que le journalier européen, et que j’ai comparé les deux labeurs, j’ai trouvé, chez le premier, effort, fatigue, accablement, et chez l’autre gaieté, vigueur et courageuse intelligence. D’où vient ce désavantage de la race africaine, si elle est, comme on le dit, plus forte que la nôtre ? Faut-il l’attribuer au climat ? Mais les nègres sont nés sous le soleil brûlant d’Afrique. Est-ce à leur stupide ignorance, qui augmente les difficultés du travail, ou à l’indolence, qui les endort ?307
Hochproblematisch sei die fehlende Gewohnheit des schwarzen Sklaven, mit jeglicher Art von Arbeit souverän zurechtzukommen. Egal wie robust er gebaut sei, er könne diesen Nachteil nicht überwinden. Er vermöge es zu rennen, zu springen und wilde Tiere308 zu zähmen, aber er verabscheue die regelmäßige, praktische, friedvolle Arbeit, die eine Frucht der Kultur und der Zivilisation sei. An einigen Stellen werden die Sklaven gar als Wilde und ihre Gruppen als Horden bezeichnet. Wie in fast allen Diskussionen über die Kultur der Schwarzen, darf ein Bezug zu Haiti nicht fehlen. Bevorzugter und glücklicher als die Mulatten SaintDomingues, so die Condesa, dächten die Farbigen Kubas nicht daran, die aufständischen Sklaven der haitianischen Revolution nachzuahmen. Im Gegenteil, sie seien jederzeit bereit, gegen Sklavenrevolten zu kämpfen. Sie seien stolz auf die liberalen Gesetze, die es ihnen ermöglichen, in die Nähe der weißen Kaste aufzurücken, und deshalb versuchten sie, sich gänzlich von der degradierten schwarzen Rasse abzusetzen. Schließlich fragt die Autorin nach den möglichen Konsequenzen einer Abolition und unterstellt, niemand könne die bürgerlich-rechtliche Gleichstellung, die für sie in der «Mischehe» mündet, tatsächlich wünschen: Supposons encore que, par un miracle, l’éducation morale des esclaves affranchis, se développant tout à coup, les amenât à l’amour du travail, […] Sous un régime politique constitutionnel, dans un pays gouverné par des lois équitables, ne pourraient-ils pas réclamer le partage des mêmes institutions ? Leur accorderiez-vous tous vos droits, tous vos privilèges ? En feriez-vous vos juges, vos généraux et vos ministres ? Leur donneriez-vous vos filles en mariage ?309
So ist es aus ihrer Sicht nur konsequent, wenn sie am Ende – zum Wohl der Sklaven – für den Erhalt des Sklavensystems plädiert: «D’ailleurs, vous avez
307 308
309
Ebda., S. 757. Vgl. zu dem umfassenden Komplex «Mensch – Tier» in der Karibik die Dissertation von Leonie Meyer-Krentler: Mensch und Tier in der Karibik. Zur Inszenierung ethnischer Konflikte in spanisch- und französischsprachigen Erzähltexten des 19. Jahrhunderts (Forthcoming). Condesa de Merlín: Les esclaves dans les colonies espagnoles, S. 767.
199
encore un moyen d’améliorer le sort des esclaves : maintenez rigoureusement l’abolition de la traite ; les maîtres veilleront avec plus de soin sur l’esclave, propriété dont la valeur augmentera, et ce qui n’aura pas été obtenu par l’humanité sera dû à l’intérêt.»310 Dieses letzte Argument zeigt eigentlich, worum es der Condesa geht. Der Handel soll abgeschafft werden, nicht aber die Sklaverei auf Kuba. Obwohl die Zahl der Sklaven hoch genug sei, achte man darauf, dass sie sich vermehren. So beschreibt sie auch, wie gut schwangere Sklavinnen behandelt werden, damit sie der Hacienda weitere «Arbeitskraft» schenken. Diese Sklavinnen vergleicht sie mit schwangeren Bäuerinnen in Europa und kommt erneut zu dem Schluss, dass es den Sklaven mit ihrem gesellschaftlichen Status nirgendwo besser ergehen kann als auf Kuba. Die Schreibsituation der Condesa de Merlín, für die ein Schreiben im Dazwischen als charakteristisch herausgearbeitet wurde, lässt sich auch auf die Ambivalenz ihrer politischen Haltung übertragen. Sie verharrt in aristokratischen Denkmodellen, die philanthropische Ideen ablehnen, gleichzeitig hält sie ihre Pro-Sklaverei-Einstellung nicht konsequent durch. Jedenfalls vermitteln sich ihre Darstellungen als Ergebnisse hochkomplexer Zirkulationen, die sich weder in einem bipolaren kolonialen Modell auflösen lassen, noch eine produktive Multirelationalität mit sich bringen. Sie will Spanien eine mit Frankreich vergleichbare Gravitationskraft unterstellen und eignet sich ein Sprechen an, das an den Realitäten vorbeigeht. Dass die Condesa von der intellektuellen Elite Kubas, wie beispielsweise Félix Tanco, nicht ernstgenommen wurde, zeigen auch die Persiflagen eines Reinaldo Arenas.311 Dass ihre Ansichten auf die Lesergemeinde der Pariser Revue des deux mondes jedoch anders gewirkt haben mögen, kann man sich gut vorstellen. IV.4.4. Lerminier: «Les rapports de la France avec le monde» Im Rahmen der entscheidenden Frage nach der Strahlungskraft der französischen Kultur verspricht der Artikel des Historikers Eugène Lerminier (1803–1857) aus dem Jahre 1836, der immer wieder die Ausnahmerolle Frankreichs in der Welt preist, spannende Einsichten. Zwar wird nicht Bezug auf die Karibik genommen – 1836 ist gerade die Erschließung Afrikas von höchster Bedeutung –, aber dennoch ist der Text sehr nützlich, da er das Selbstbild Frankreichs und seine
310 311
Ebda., S. 769. Vgl. dazu Reinaldo Arenas: La loma del Angel. Malaga: Dador 1986. Vgl. zu Arenas: Ottmar Ette: «Traición, naturalmente.» Espacio literario, poetología implícita en «La Loma del Angel», de Reinaldo Arenas. In: Reinaldo Sánchez (Hg.): Reinaldo Arenas: Recuerdo y Presencia. Miami: Ediciones Universal 1994, S. 87–107. Vgl. auch Ottmar Ette: La escritura de la memoria. Reinaldo Arenas: Textos, estudios y documentación. Frankfurt am Main: Vervuert 1992. Vgl. auch Adriana Méndez Rodenas: Gender and Nationalism in Colonial Cuba. The Travels of Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlin. Nashville u.a.: Vanderbilt Univ. Press 1998, S. 231.
200
missionarische Idee deutlich abbildet. Lerminiers sehr bemerkenswerte Thesen sollen deshalb ausführlich dargelegt werden. Zunächst gibt er eine kurze Geschichte Frankreichs wieder und sieht zwei Kennzeichen für sein Land: «Deux pensées ont tour à tour préoccupé la France : constituer son territoire et développer son génie. Tantôt elle débat chez elle, avec ses enfans, les idées dont elle cherche la solution et la vérité ; tantôt elle s’emploie à répandre au dehors et ses idées et sa puissance.»312 Er tritt für die Verständigung der Völker ein, betont aber die Führungsrolle Frankreichs, da Frankreich unter den modernen Nationen die vitalste sei: «Mais la France a déjà beaucoup vécu ; et si néanmoins elle est restée jeune, si, à la fois vieille et nouvelle, elle a un abondant passé et en même temps un long avenir, on peut envier la fortune des écrivains qui, dans plusieurs siècles, traceront les annales françaises.»313 Aufgrund der günstigen geographischen Lage sei man dazu erkoren, mit der Welt in Kontakt zu treten. Der Atlantik sei die Verbindung zu Amerika, das Mittelmeer zu Afrika und zum Nahen Osten. Man möchte zwar Spanien nicht erobern, hat aber dennoch den Anspruch, dem Land die Wege in die «neue Zivilisation» zu weisen: «les Pyrénées la séparent de la Péninsule hispanique qu’elle ne saurait songer à conquérir, mais seulement à guider dans les voies de la civilisation nouvelle».314 Lerminier ist derart von der Mission Frankreichs überzeugt, dass er die Eroberungskriege Napoleons umdeutet in Verteidigungskriege, die notwendig waren, um die modernen Ideen der Französischen Revolution in Europa zu verbreiten. «Quand à la fin du siècle dernier, la France dut résister à toute l’Europe, elle eut nécessairement l’instinct de lui opposer ses principes, et de lui lancer, au milieu de ses bombes, ses passions et ses idées.»315 Da Frankreich nahezu identisch ist mit dem Fortschritt der Menschheit, kann Lerminier den französischen Imperialismus als logische (und segensreiche) Folge dieser Vorreiterrolle rechtfertigen. C’est que la loi de la France est de marcher toujours, non qu’elle ne partage cette admirable nécessité avec le reste du genre humain ; mais elle semble y satisfaire plus vivement que les autres peuples. On la dirait plus pressée d’aboutir, d’arriver à un but, […] Aujourd’hui, à ce premier quart du XIXe siècle, la France doit avoir souci de trois choses : de son esprit progressif, de sa grandeur continentale, de son influence universelle.316
So ist es nur konsequent, wenn dieser neue Diskurs auch die jüngsten Eroberungen nicht als Angriff, sondern als Fortschritt betrachtet: Au surplus la situation morale de l’Europe ne permet plus de guerre dans le but unique d’un agrandissement, d’une conquête. Les intérêts moraux sont trop étroitement unis
312 313 314 315 316
Lerminier [ohne Vorname]: Des rapports de la France avec le monde. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, VIII (1836), S. 326–343, hier S. 326. Ebda., S. 329. Ebda., S. 330. Ebda., S. 332. Ebda., S. 334.
201
aux résultats positifs, pour que les principes et les idées n’interviennent pas parmi les causes qui feraient prendre les armes. Mais la France doit toujours cultiver la pensée et l’amour de sa grandeur continentale ; elle doit aussi entretenir avec soin son esprit militaire et ne rien permettre qui puisse l’affaiblir ou le déprécier.317
Frankreich kann nur mit dem alten Rom verglichen werden. Während aber Rom die andern Völker unterdrückte, geht es Frankreich darum, mit anderen Völkern in Kontakt zu kommen, um seine Ideen zu verbreiten. Am Ende wird nochmals deutlich, welche Bedeutung die Eroberung Afrikas für Frankreich hat und warum der Fokus darauf gerichtet ist: […] la France en Afrique ayant trouvé ses Indes, elle n’a plus à se préoccuper de conquêtes positives sur d’autres côtes, mais seulement du soin de porter partout son commerce et son nom. Dans un siècle, il doit y avoir une France d’Orient ; et puis partout, dans toutes les mers, chez tous les peuples, le nom et l’influence de la France. Voilà une ambition qui ne sent pas la vieille Rome, mais qui honore et sert l’humanité.318
Der Einfluss Frankreichs soll auf diesem Kontinent dominierend sein – zum Wohl der gesamten Menschheit. Um von anderen Völkern anerkannt zu werden, soll sich Frankreich für deren Geschichte und Kultur interessieren, weil dadurch das ohnehin vorhandene Interesse an Frankreich noch stärker geweckt werde: «il faut bannir l’insouciance et dissiper l’ignorance ; il faut s’intéresser aux mouvemens des peuples, connaître leurs rapports, leur histoire, leur géographie, comprendre que, puisque la France est si fort regardée du monde, elle doit lui répondre par une attention constante».319 Fazit Alle drei Zeitschriften, Revue des Colonies, Revue encyclopédique und Revue des deux mondes, setzen als Transfermedien per se multirelationale Zirkulationsprozesse in Gang. Da die Spartentrennung noch nicht klar abgeschlossen ist, sind sie inhaltlich im Kontext einer jungen Ethnologie anzusiedeln, aber – und dies vor allem dank vieler literarischer Texte – letztlich weit darüber hinaus an universale Dimensionen anschlussfähig. Das den Zeitschriften vorangestellte Teilkapitel zu Rassediskursen sollte als Folie dienen, zeitgenössische Gesellschaften, deren Anliegen in der Klassifizierung des Anderen lag, im Zentrum Paris vorzustellen. Dass Wissen aus der Karibik in den Grundsatzdiskussionen zur Phrenologie etc. keine wichtige Rolle spielte, mag weithin überraschen. Dies auch vor dem Hintergrund der Materialdichte einer Karibikrezeption in den drei Zeitschriften. Eine Erklärung mag sicher damit zusammenhängen, dass sich deren Redakteure weniger explizit als implizit mit Rassediskursen beschäftigen. Den meisten Beiträgen ist gemein, dass ein Ringen um Identitätszuschreibungen latent Dauerthema ist, dass sich
317 318 319
Ebda., S. 335. Ebda., S. 337. Ebda., S. 341.
202
jedoch eine Verortung, wenn überhaupt, nur in einem Dazwischen ausmachen lässt. Für die Skizzierung der insgesamt schwer eruierbaren kulturellen Zirkulationsprozesse in kolonialen und postkolonialen Konstellationen bilden sie ein unverzichtbares Element. Wenn klare Denominationen auch unmöglich sind, so lassen sich durchaus politische Programme und koloniale Funktionsmechanismen ausmachen. Auf dieser Ebene bestätigt sich die Inklusionsfähigkeit des französischen Kulturmodells trotz multirelationaler Bewegungsabläufe. Die außergewöhnliche und am weitesten vom Establishment entfernte Revue des Colonies, geführt von Mulatten und sklavereikritisch, befürwortet explizit ein französisches Integrationsmodell. Die Revue encyclopédique hat einen Sonderstatus auf Grund ihrer kurzen Erscheinungsdauer und ihres expliziten HaitiAnliegens, das eine Variante wirtschaftlichen Transfers beleuchtet. Die literaturgeschichtlichen Artikel der vielseitig ausgerichteten Revue des deux mondes vertreten die französische Vorreiterrolle auf allen Ebenen. Das folgende Kapitel will gerade bei dieser Vorreiterrolle bleiben und kanonische literarische Texte auf deren imperiale Dimension hin untersuchen. Dass dies gerade im Zusammenspiel mit karibischen Literaturen asymmetrische Relationalitäten mit sich bringt, darf nach den bisherigen Untersuchungen durchaus erwartet werden. Inwiefern sich jedoch die jeder Form von Relationalität inhärente Wechselwirkung artikuliert, mögen die folgenden Ausführungen zeigen.
203
V.
Die imperiale Dimension der französischen Romantik: Asymmetrische Relationalitäten
V.1.
Richtung Madrid oder Paris?
[…] leía yo el episodio de Atala, y las dos [María y la hermana de Efraín], admirables en su inmovilidad y abandono, oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para «hacer llorar el mundo» […] María, dejando oir mi voz, descubrió la faz, y por ella rodaban gruesas lágrimas. Era tan bella como la creación del poeta, y yo la amaba con el amor que él imaginó...¡Ay! mi alma y la de María no sólo estaban conmovidas por aquella lectura: estaban abrumadas por el presentimiento.1
Wir haben es hier mit einem Text aus einem zirkumkaribischen Land, aus Kolumbien, zu tun, dessen Autor im Valle del Cauca ansässig, jedoch Sohn eines jamaikanischen Vaters ist: Jorge Isaacs. Diese Szene aus seinem Roman María (1867), der kurz nach seiner Publikation zu einem der ersten Bestseller Lateinamerikas avancierte, illustriert in kondensierter Form ein Phänomen, das beispielhaft ist für lateinamerikanische und karibische Literaturen im 19. Jahrhundert: die explizite Orientierung an der französischen Romantik, hier in Form von Lieblingslektüren der Protagonisten narrativer Texte. In welchem Zusammenhang steht diese intensive Rezeption mitten in tropischen Gefilden? Die meisten karibischen Autoren waren, unterschiedlich lange, in den kolonialen Zentren ihrer respektiven Mutterländer. Hier zeichnet sich ein Unterschied zwischen den Schriftstellern der französischen und spanischen Kolonien ab. Für die Bewohner der frankokaribischen Kolonialsphäre scheint ein Parisaufenthalt zur selbstverständlichen Voraussetzung einer Schriftstellerexistenz zu gehören. Zum durchgängigen Leitbild der weißen kreolischen Herrschaftsschicht aus Guadeloupe oder Martinique, die bis weit ins 19. Jahrhundert das Schreibmonopol innehatte, gehörte es, die Kinder in Frankreich erziehen zu lassen und, als Kehrseite, zu ignorieren, dass dadurch die kulturelle Unterentwicklung im kolonialen Raum, dem zunächst nur ökonomische und keinerlei kulturelle Bedeutung zukommt, verstärkt wurde.2 Diese exklusive Paris-Orientierung lässt sich auch (und vielleicht sogar in besonderem Maße) im so früh unabhängigen Haiti beobachten.
1
2
Jorge Isaacs: María. Hg. von Donald MacGrady. Madrid: Cátedra (1867) 112007, S. 88. Das Beispiel aus María dient zur Veranschaulichung, auch wenn Isaacs strenggenommen als Vertreter eines «nur» zirkumkaribischen Landes, nämlich Kolumbiens, nicht zum Autorenkorpus gehört und auch nicht aus dem karibischen Teil des Landes stammt, sondern aus dem Valle del Cauca. Vgl. Wolfgang Bader: Martinique, Guadeloupe, Guyane. Eine periphere Literaturgeschichte. In: Französisch heute 17 (1986), S. 182–201, hier S. 187. Vgl. auch Gewecke: Der Wille zur Nation, S. 92ff.
205
Weit heterogener gestaltet sich die Wahl des Exilorts für die Autoren der spanischen Karibik: Gómez de Avellaneda und Hostos waren in Spanien, Heredia in Mexiko, Villaverde in den USA. Natürlich gab es, vergleichbar mit Paris, auch durchaus Beispiele für ein freiwilliges Exil in Madrid, das für bildungs- und kulturbeflissene Intellektuelle attraktiv war, die die muttersprachliche Metropole der Ville lumière vorzogen, wie etwa Gómez de Avellaneda. Andere, wie Hostos, wählten die Hauptstadt des Mutterlandes vor allem aus politischen Gründen und propagierten eine Neudefinierung kolonialer Bindungen.3 Eine weit radikalere Position bezog der Kubaner Heredia, der, angeregt durch das politische Klima im bereits unabhängigen Mexiko, an der Verschwörung gegen die spanische Krone teilnahm.4 Auch wenn es im Folgenden um die Herausarbeitung dominanter Rezeptionsmuster, und damit letztlich auch dominanter Bewegungsmuster, gehen soll, bleibt für karibische Literaturen seit ihrer Entstehung festzuhalten, dass sie immer «Literaturen ohne festen Wohnsitz» sind.5 Unter diesen Umständen überraschen die unterschiedlichen literarischen Selbstverortungen in den (ehemaligen) Kolonien Frankreichs und Spaniens wenig. Die homogene geographische Tendenz Richtung Paris seitens der Schriftsteller aus den (ehemaligen) französischen Kolonien findet ihre literarische Entsprechung: Die Autoren gliedern sich in die dortigen literarischen Strömungen ein.6 Die häufiger aus der spanischen als französischen Karibik kommenden revolutionär motivierten Schriftsteller wie Heredia oder auch Villaverde sind viel stärker einer Problematik des Dazwischen ausgesetzt: Sie schreiben ihre Literatur und sich selbst von außen, aus der Distanz, in den Kampf für eine politische und zum Teil auch kulturelle Emanzipation ein, wobei sie aber bei der Rückkehr in die Karibik häufig ernüchtert feststellen müssen, dass sie sich auch hier nicht mehr wirklich zu Hause fühlen und inzwischen auch von ihren Landsleuten als Fremde wahrgenommen werden.7 Wie bereits erwähnt, war ein längerer Aufenthalt in Paris in intellektuellen Kreisen der antillanischen Oberschicht selbstverständlich. Wie wurden sie nun dort integriert? Wurden ihre Werke rezipiert? Es gab die vielfältigsten Formen von transatlantischem Austausch in Paris, so ist beispielsweise bekannt, dass Chateaubriand eine Mätresse aus Martinique hatte, die ihm eine wichtige Inspirationsquelle für Le génie du Christianisme gewesen sein soll. Unmittelbaren Austausch pflegten einige Literaten: es lassen sich direkte Einflussnahmen von Chateaubriand auf Coussin, von Hugo auf Levilloux und Maynard de Queilhe nachweisen.8
3 4 5 6 7 8
Vgl. Gewecke: Der Wille zur Nation, S. 110. Er thematisiert das Exil ganz explizit beispielsweise in «Himno del desterrado». Vgl. Ette: ZwischenWeltenSchreiben, S. 123–156. Vgl. Bader: Martinique, Guadeloupe, Guyane, S. 187. Vgl. Gómez de Avellaneda: Sab, hg. von Servera, S. 38. Vgl. Toumson: La transgression des couleurs, Bd. I, S. 69.
206
V.2.
Dominante Rezeption der französischen Romantik
Trotz der höchst unterschiedlichen Beweggründe, ihre jeweiligen Inseln zu verlassen, vereint die literarischen Texte aller Autoren eine Orientierung an zeitgenössischen europäischen Strömungen. Welche Tendenzen stehen genau Modell? Tanco denunziert 1843 Zorrilla, Espronceda, Bréton de los Herreros und die gesamte spanische Literatur der Zeit als Epigonen fremder Ideen und Werke.9 Dem können verschiedene Szenen von Frankreichglorifizierung in Levilloux’ Roman Les créoles ou la Vie aux Antilles gegenübergestellt werden. Wie erwähnt, gehen Edmond und Estève bei ihrem Abschied vom französischen Festland im Geiste alle Wohltaten durch, die ihnen dort zuteil wurden: Wissenschaft, «Erhöhung der Seele», eine neue moralische Existenz.10 Diese Überhöhung des Mutterlandes wird auch dadurch unterstrichen, dass die konservativen französischsprachigen Autoren den primitiven spanischen Eroberer gern mit dem weißen Kolonialherrn französischer Provenienz kontrastieren, der als empfindsamer, gebildeter und von feinerer Lebensart dargestellt wird.11 Während spanischer Kolonialismus gleichbedeutend mit der Verfolgung materieller Interessen sei, wird der französischen Kolonialmacht die Ehre zuteil, aus diesen seinen alten Kolonien wahre Horte der nationalen Kultur gemacht zu machen.12 In den meisten spanischsprachigen Texten findet sich eine deutliche Abgrenzung zu Spanien im Sinne von «Ihr–Wir», der Protagonist von Levilloux hingegen spricht beispielsweise von «nous, la France»13: Französischwerden bedeutet Emanzipation von einer unkultivierten Sklavenexistenz, was aber auch als Anspruch und Forderung zu verstehen ist; Estève aus Guadeloupe stirbt gerne freiwillig den Tod fürs Vaterland auf den französischen Schlachtfeldern – genau wie der Protagonist von Bug-Jargal. An diesen Beispielen zeigt sich bereits, dass die Rezeption von Texten der französischen Romantik viel intensiver ist als die der spanischen. Vor allem die Wirkung Lamartines, Chateaubriands und Hugos ist beträchtlich.14 Doch auch in den spanischen Kolonialbesitzungen ist der Einfluss der romantischen Literaten Frankreichs prägend. So markiert Heredias Tätigkeit als Übersetzer15 von Byron, Chateaubriand16 und Lamartine einen entscheidenden
9 10 11 12 13 14
15
16
Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 100. Levilloux: Les créoles, S. 32. Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 201. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 312. Vgl. ebda., S. 132. Levilloux: Les créoles, S. 20. So äußerte sich beispielsweise der haitianische Schriftsteller Jean-Baptiste Chenêt 1846 in seinen Études poétiques: «Lamartine, Hugo, sont des dieux immortels : Ils ont reçu ma foi, je sers sur leurs autels» (S. 192), zit. nach Hoffmann: Littérature d’Haïti, S. 99. Vgl. Andrea Pagni: Traducción y transculturación en el siglo XIX. Atala de Chateaubriand por Simón Rodríguez (1801) y el Cancionero de Heine por José A. Pérez Bonalde (1885). In: Iberoamericana 24, 2/3 (78/79) (2000), S. 88–103. Vgl. zur Chateaubriandrezeption auch Michael Rössner: Das Bild der Indios in der brasilianischen und hispanoamerikanischen Romantik. In: Sybille Große, Axel Schönberger
207
Schritt innerhalb der Rezeptionsgeschichte und Entstehung der Romantik in der spanischsprachigen Karibik. Gómez de Avellaneda beteiligte sich in Madrid an der Zeitschrift El laberinto (1843–1845) von Antonio Ferrer del Río und stand damit in enger Verbindung zu anderen spanischen romantischen Literaten: Gil y Carrasco, Hartzenbusch, Carolina Coronado.17 Trotzdem zeigen ihre literarischen Texte eine deutlichere Affinität zu Frankreich.18 Sab als Archetyp des romantischen Helden deutet auf eine sozialromantische Hugo-Rezeption hin. Andere Protagonisten der kubanischen Autorin lassen eine Orientierung an Chateaubriands Atala (1801) und an Paul et Virginie des Vorromantikers Bernardin de Saint-Pierre (1787) erkennen. So erfolgreiche Vertreter der spanischen Romantik wie Larra, Zorilla oder Duque de Rivas werden selbst von hispanophonen Lesern viel weniger rezipiert als die französischen Vorbilder. Dies hängt natürlich in wesentlichem Maße mit der omnipräsenten Rolle der französischen Literatur in ganz Europa zusammen. Wenn sich die spanischen Literaten selbst an der französischen Romantik orientierten, wie konnten sie dann eine überzeugende Modellfunktion für die schreibende Oberschicht ihrer Kolonien einnehmen? In welchen Ausprägungen findet man die romantischen Modelle in der spanischen Karibik wieder? Epochengeschichtliche Klassifizierungsversuche kommen hier an ihre Grenzen, denn die späte Rezeption der Romantik in Lateinamerika überlappt sich zeitlich mit der Rezeption des Neoclasicismo. Aufklärung und Romantik wurden zu einer synkretistischen Verbindung und schufen das Paradoxon eines romanticismo positivista hervor. Klassizismus und Romantik wurden gerade nicht von allen Autoren als sich ausschließende Gegensätze gedacht, sondern häufig als komplementäre Phänomene.19 Gudrun Wogatzke hat die epochenspezifischen Zuschreibungen beziehungsweise Abgrenzungsbemühungen treffend herausgearbeitet: die kubanischen contertulianos del Montes betrachten sich, wie dieser selbst, als Eklektiker, die beiden poetologischen Präzeptionen das entnehmen, was ihrem utilitaristischen Ziel dienlich ist. Ihre Positionen variieren graduell, nicht substantiell, sind aber immer der Romantik verpflichtet. Dabei möchte keiner von ihnen – ebenso wenig wie einige ihrer europäischen Dichterkollegen – als Romantiker bezeichnet werden, was die negative Konnotation bezeugt, die sich nicht nur in den Artikeln eines Manrique oder Mesonero manifestiert, sondern auch in Suárez’ Colección de Artículos, in Villaverdes El perjuirio (1837), sowie in Ramón Palmas «La
17 18 19
(Hg.): Dulce et decorum est philologiam colere. Festschrift für Dietrich Briesemeister zu seinem 65. Geburtstag. Berlin: Domus Ed. Europaea 1999, Bd. II, S. 1709–1726, hier S. 1710f., 1720f. Vgl. Gómez de Avellaneda: Sab, hg. von Servera, S. 25. Hier muss natürlich bedacht werden, dass grundsätzlich viele spanische Romantiker von ihren französischen Kollegen beeinflusst waren. Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 95, die dafür auf Cintier Vitier verweist.
208
Romántica» und Ramón Piñas «El romántico Anselmo», die beide 1838 in El Album beziehungsweise in La Siempreviva erschienen.20
V.3.
Rezeptionsvarianten
In den karibischen Kolonien werden am häufigsten diejenigen Autoren der französischen Romantik rezipiert, die sich in ihrem Werk in irgendeiner Art und Weise mit der Neuen Welt beschäftigen21. Wie sieht diese Beschäftigung aus? Die beiden Pole sind Exotismus (vor allem vertreten durch Chateaubriand) und Sozialutopie (vor allem vertreten durch Hugo). Doch lässt sich bei allen Autoren eine zweideutige Haltung gegenüber dem von der Französischen Revolution eingeleiteten Neuen ausmachen. Selbst bei Chateaubriand, in seinen Mémoires d’Outre-Tombe, finden sich Selbstverortungen wie in dem bekannten und bereits angeführten Zitat, in dem er betont, er habe sich zwischen zwei Jahrhunderten wie am Zusammenfluss zweier Gewässer befunden, er habe sich ins trübe Wasser gestürzt, sich mit Bedauern vom alten Ufer, vom Ort seiner Geburt, entfernt und schwimme hoffnungsfroh einer unbekannten Küste entgegen.22 Diese Ambiguität wird von den Autoren der Karibik unterschiedlich aufgenommen, spiegelt sie doch ihre gemischten Gefühle gegenüber einem Ancien Régime, das bei ihnen zwar noch fortlebte, dessen Tage aber, wie den meisten klar sein musste, gezählt waren. Was bei den französischen Autoren einen Anklang von Nostalgie hat, äußert sich bei den Pflanzern der französischen Karibik bisweilen als nackte Angst, die zusätzlich noch genährt wird durch das abschreckende Beispiel Haitis. Die Autoren der hispanophonen Karibik hingegen neigen eher dazu, die sozialutopischen Momente bei den festlandfranzösischen Vorbildern aufzunehmen, ob dieser Aspekt nun abolitionistisch oder separatistisch gewendet wird. Letzteres ist eher selten vor der tatsächlichen Abolition, was die Prioritäten klar anzeigt: im Vordergrund steht der Kampf gegen die krasse soziale Ungleichheit, und erst im zweiten Schritt wird die nationale Unabhängigkeit (eventuell) zum Thema. In der Rezeption vor allem der französischen Romantik durch die karibischen Autoren lassen sich grob fünf Rezeptionsmuster unterscheiden: 1) Explizite Rezeption der französischen Romantik als ungefilterte Glorifizierung der französischen Kulturnation: So haben sich etwa Poirié de Saint-Aurèle, Xavier Eyma, J.H.J. Coussin und Ignace Nau mit hymnischen Würdigungen der französischen Vorbilder hervorgetan. Stellvertretend sei an dieser Stelle Coussin zitiert:
20 21
22
Ebda., S. 95. So beispielsweise Chateaubriand in Atala, Hugo in Bug-Jargal, Lamartine in Toussaint L’Ouverture. Dies heißt allerdings nicht, dass die karibischen Schriftsteller nur diese Fremdbilder rezipieren. So liest María aus Jorge Isaacs’ gleichnamigem Roman hingebungsvoll Lamartines Méditations. Chateaubriand: Mémoires d’outre-tombe, S. 1047. Vgl. Kap. II.3 dieser Arbeit.
209
C’est dans ces entrefaites que parut cet ouvrage immortel, où, indépendamment d’une vaste érudition, la sensibilité la plus exquise se trouve partout unie a une imagination la plus éclatante peut-être qui ait jamais paru parmi les hommes : on voit que je veux parler du Génie du Christianisme.23
2) Spiegelung der Rezeption der französischen Romantik im Leseverhalten der Protagonisten narrativer Texte: Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um eine Lamartine- oder Chateaubriand-Lektüre; als Beispiel kann das Zitat aus Isaacs’ María dienen, das dieses Kapitel einleitet. 3) Implizite Rezeption der sozialrevolutionären Romantik: Diese Variante orientiert sich vornehmlich an Victor Hugo. So hatte sein Frühwerk Bug-Jargal großen Einfluss auf Gómez de Avellanedas Sab, der im nächsten Kapitel näher untersucht wird. 4) Vermittelte Orientierung an den Fremdbildern französischer Romantiker zur Bestimmung des Eigenen: Prévost de Sansac beispielsweise nimmt sich explizit die exotistischen Südsee-Landschaften Bernardin de Saint-Pierres zum Vorbild für seine eigene Beschreibung Martiniques: «A l’exemple de l’auteur de Paul et Virginie, j’ai voulu asseoir les amants que je célèbre sur le rivage de la mer, aux pieds des rochers, à l’ombre des cocotiers, des bananiers et des citronniers en fleurs.»24 5) Evasion in die Naturbeschreibung: Häufig angelehnt an Schilderungen von Neue-Welt-Reisenden wie Chateaubriand, ist diese Spielart der Romantik bei den Béké-Autoren der französischen Antillen verbreitet. J. H. J. Coussin leitet Eugène de Cerceil ou les Caraïbes mit einer Erklärung dieser literarischen Fluchttendenzen ein, die er dann selbst in seinem Roman aufnimmt: Die Gräuel der Französischen Revolution und ihre Nachwehen bewirken einen Rückzug von der Gesellschaft, der in der Liebe zur reinen Natur mündet und zur vermehrten Landschaftsdarstellung in Bildern oder Worten führt. Aux scènes de sang, s’allièrent en France les hideuses corruptions du cœur qui restèrent après que les échafauds eurent disparu. Le vice se montra partout à front découvert ; la vertu, pâle et échevelée, se voila le visage, et chercha pour se cacher des retraites agrestes, où s’efforçant d’oublier les crimes des hommes par la contemplation des choses de Dieu, elle ne tarda pas à trouver dans ces spéculations éminemment morales, un plaisir qui embellit à ses yeux les lieux sauvages où elle s’étoit réfugiée. L’amour de la solitude augmentoit journellement à mesure que l’espèce humaine devenoit plus malheureuse. Aussi peut-on dire avec fondement qu’il y a aujourd’hui en France,- dans la classe des honnêtes gens, plus d’amour pour la campagne, qu’il n’y en avoit avant la révolution ; et cet amour conduit naturellement à celui des scènes de la nature, représentées soit par le pinceau du peintre, soit par les expressions coloriées des écrivains qui savent peindre avec la parole.25
23 24 25
Coussin: Eugène de Cerceil, Bd. I, S. xii. Prévost de Sansac: Les amours, S. 17. Coussin: Eugène de Cerceil, Bd. I, S. x–xi.
210
V.4.
Das Modell Hugo
Die Romane von Gómez de Avellaneda und Maynard de Queilhe orientieren sich besonders deutlich an Victor Hugo. Die Mulatten Marius und Sab sind romantische Helden par excellence. Marius ist einer existentiellen Dualität unterworfen, was den Einfluss Hugos erkennen lässt, mit dem Maynard de Queilhe befreundet war. In seiner préface zu Cromwell berührt Hugo eine tiefgreifende Ambivalenz der menschlichen Natur, wenn er schreibt, ein jeder schließe zwei Wesen in sich: ein vergängliches, an die Triebe, Bedürfnisse und Leidenschaften gefesseltes, und ein unsterbliches, ätherisches, beflügelt von Enthusiasmus und Träumerei; das eine ordnet er der Erde und dem mütterlichen Prinzip zu, das andere strebt beständig dem Himmel zu, seinem Vaterland.26 Wie bereits in einem anderen Zusammenhang gezeigt,27 überträgt Longuefort aus Outre-mer diese doppelte Natur in rassistischer Manier auf den Mulatten Marius.28 Während das Beispiel einer Hugo-Rezeption durch Maynard de Queilhe vor allem auf eine metaphysische Grunddimension romantischen Schreibens verweist, zeigt die literarische Debatte über Bug-Jargal im Kontext des del Monte-Kreises, dass auch gerade die sozialrevolutionäre Seite auf großen Widerhall stieß. ¿Y qué dice V. de Bug Jargal? Por el estilo de esta novelita quisiera yo que se escribiese entre nosotros. Piénselo bien. Los negros en la isla de Cuba son nuestra poesía, y no hay que pensar en otra cosa; pero no los negros solos, sino los negros con los blancos, todos revueltos, y formar luego los cuadros, las escenas, que a la fuerza han de ser infernales y diabólicas; pero ciertas y evidentes. Nazca por nuestro Víctor Hugo, y sepamos de una vez lo que somos, pintados con la verdad de la poesía, ya que conocemos por los números y el análisis filosófico la triste miseria en que vivimos.29
So schreibt Tanco y Bosmeniel in einem Brief an del Monte. Bug-Jargal von Hugo war für viele modellbildend, nicht nur für Sab von Gómez de Avellaneda, die ihn zur unmittelbaren Vorlage für ihr Sujet nimmt. Galváns Held Enrique etwa will – wie Bug-Jargal –, dass seine Rebellion sauber bleibt, er möchte sich nicht durch Vergeltungsgedanken beschmutzen, deshalb lässt er die spanischen Gefangenen frei: «decid a los tiranos que yo y mis indios sabemos defender nuestra libertad; mas no somos verdugos ni malvados».30 Der dominikanische Autor stimmt im Roman sogar eine Lobeshymne auf «el gran Hugo» an.31 Wie lässt sich diese Hugo-Begeisterung, das heißt vor allem das Modell BugJargal, erklären? Wogatzke hat auf eine wichtige Konstellation aufmerksam gemacht. Hugos vorwiegend negativ behaftete Inszenierung des schwarzen und
26 27 28 29 30 31
Vgl. Maignan-Claverie: Le métissage, S. 250. Vgl. Kap. II.2.3. Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 16. Brief von Félix Tanco an Domingo del Monte vom 13.02.1836. In: Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Sab. Hg. von Mary Cruz. Havanna: Ed. Arte y Literatura (1841) 1976, S. 46. Manuel de Jesús Galván: Enriquillo. Leyenda histórica dominicana (1503–1533). Mexiko: Porrúa (1879) ²1976, S. 210. Ebda., S. 267. Vgl. auch Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 573.
211
mulattischen Bevölkerungsteils von Saint-Domingue kollidiere mit der positiven Zeichnung seines schwarzen Titelhelden sowie den zum Teil antirassistischen Äußerungen des Erzählers und führe zu einer irritierenden Ambivalenz, die sich nicht durch den Verweis auf den bon sauvage auflösen lasse.32 In Bug-Jargal findet sich zum einen die Selbstbeschreibung der ehemaligen Pflanzer ausgestaltet, die weiterhin ihre verlorenen Güter einforderten und Hugo mit subjektiven Informationen zu den historischen Ereignissen in Saint-Domingue versorgten. Weiter betont Wogatzke, dass zu den Stereotypen, die in Bug-Jargal vertreten und von diesen und anderen Autoren immer wieder aufgenommen worden sind, nicht nur die Idealisierung der Monarchisten und Desavouierung der Revolutionäre, Philanthropen und Abolitionisten des Mutterlandes gehöre, sondern auch die Zeichnung der haitianischen Revolutionäre als eine Horde fanatisierbarer, stupider, barbarischer Schlächter, die ohne Plan und Ziel ihren niederen Instinkten gefolgt seien und zur Befriedigung ihrer blutrünstigen Gelüste unschuldige Menschen, Greise, Frauen und Kinder, gemeuchelt und deren sterbliche Überreste als Trophäen missbraucht hätten.33 Einige hätten die Gunst der Stunde erkannt und die Sklavenrevolte zu ihrem persönlichen Profit benutzt. Insbesondere die Mulatten werden als «Rädelsführer, als machthungrige, egozentrische, demagogisch versierte Manipulatoren einer ignoranten, schwarzen Masse» gezeichnet, die Freiheit als Freiheit zur Willkür interpretierten. Die vormaligen Herren seien in ihrer Gesamtheit doch eher gute, gestrenge, aber liebevolle Väter gewesen. Wenn der Herr sich in Ausnahmefällen tatsächlich als Despot mit «steinernem Herzen» erweise, dann sei er entweder ein Revolutionär oder ein Ausländer, meist ein böser Engländer oder Spanier.34 Entsprechend sind Bug und seine Familie nicht von französischen Sklavenhändlern nach Saint-Domingue verschleppt worden, sondern von einem spanischen Händler, der die Freundschaft und das Vertrauen der Familie ausnutzte, um sie auf das Schiff zu locken und auf den Antillen als Sklaven zu verkaufen. Wogatzke weist darauf hin, dass die meisten bösen (Ex-)Sklaven spanisch beziehungsweise ein kreolisiertes Spanisch sprechen, wodurch sie unter Beweis stellten, dass sie durch die schlechte spanische Sklaverei korrumpiert wurden. Die Verwendung des Spanischen ist hier durchaus als Kritik zu verstehen. Die Schuldzuweisung enthebe den guten französischen Kreolen der Verantwortung für die Gräueltaten der Sklaverei, die nicht er, der gute weiße Herr, sondern stets der andere verübte.35 Demzufolge entwerfe Hugo als Kontrast zum genannten Stereotyp das Modell einer berechtigten Revolution, exemplifiziert erstens durch die mit dem Autoste-
32
33 34 35
Wogatzke-Luckow, Gudrun: Victor Hugo: Bug-Jargal (1826). Abgesang auf den «bon sauvage» oder Inszenierung von Ambivalenzen? In: Susanne Grunwald (Hg.): Pasajes. Homenaje a Christian Wentzlaff-Eggebert = Passages. Mélanges offerts à Christian Wentzlaff-Eggebert = Passagen. Festschrift für Christian Wentzlaff-Eggebert. Sevilla: Univ. Secretariado de Publ. u.a. 2004, S. 21–138, hier S. 122. Ebda., S. 122. Ebda., S. 122. Ebda., S. 123.
212
reotyp der Pflanzer konfligierende Inszenierung des bösen grand blanc, zweitens durch den «reumütigen Rassisten» und vor allem durch den Titelhelden, der in Gestalt eines «haitianischen Revolutionsführers» als edler Rebell figuriere.36 Um Hugos Ideen zu transportieren, darf Bug kein durch die Sklaverei verdorbener, hässlicher Sklave sein, und er darf ebenso wenig an den pathologischen Folgen der Stigmatisierung der Schwarzen leiden, sich nicht über den weißen Rassismus definieren und auch nicht dessen Vorurteile internalisieren. Er ist stolz und selbstbewusst, und «zerbricht aus Altruismus, nicht aus Egoismus» symbolisch die Peitsche, das Zepter der Macht der weißen Pflanzer. Bug will Freiheit und Macht zum Wohl der anderen Sklaven. Er will das Naturrecht restituieren, das die Weißen mit der Sklaverei außer Kraft setzten. Die besonders negativ dargestellten Mulatten manipulieren die schwarzen Massen, während der schwarze Königssohn Bug-Jargal mit den ihm ergebenen congos – sie sind alle noch nicht lange genug in der Kolonie, um von der spanischen Sklaverei korrumpiert worden zu sein – die Gräuel der dekadenten Pflanzer (spanische Aristokraten) rächt und für ein Zusammenleben mit den humanen (französischen) Pflanzern kämpft.37
V.5.
Das Modell Chateaubriand
Bei J.H.J. Coussin in Eugène de Cerceil ist der Bezug zu Chateaubriand explizit und implizit präsent. Das Genie du Christianisme wird mehrfach gerühmt: C’est dans ces entrefaites que parut cet ouvrage immortel, où, indépendamment d’une vaste érudition, la sensibilité las plus exquise se trouve partout unie à une imagination la plus éclatante peut-être qui ait jamais paru parmi les hommes : on va que je veux parler du Génie du Christianisme. L’auteur avoit parcouru les déserts du Nouveau-Monde ; il avait étudié les secrets de la Sagesse Divine au milieu des forets inconnues, et sur les bords de fleuves ignorés auxquels les habitants de la terre n’avoient pas même encore donné des noms. Entrant dans la lice pour défendre la Religion Chrétienne contre les calomnies de la mauvaise foi, et les imputations de l’ignorance, il s’arma de tous les arguments touchans qu’une connoissance approfondie de la Nature suggère en faveur de la cause de Dieu, et il traça une serie de tableaux, telle que jamais ouvrage n’en avoit encore présenté une semblable à l’admiration humaine. Les scènes de déserts furent les chefs-d’œuvre de son pinceau. Il sut faire apercevoir dans ces sites incultes qui doivent tout à la nature, des beautés ravissantes, bien supérieures à celles que peuvent offrir les campagnes des ces contrées cultivés, où le paysage n’est presque partout que ce que l’homme lui prescrit d’être.38
Zwei Seiten weiter wird deutlich Atala als Quelle genannt: Je suis né dans une île qui est peut-être un des pays du monde qui présent le plus de ces sortes de beautés. Souvent dans ma jeunesse, en parcourant les montagnes aspères de ma terre natale, et en m’égarant sous les dômes des forêts vierges qui la couvrent
36 37 38
Ebda., S. 123. Middelanis: Imperiale Gegenwelten, S. 25. Coussin: Eugène de Cerceil, Bd. I, S. xj.
213
encore en grande partie, je m’affligeois que les tableaux sublimes dont j’étois environné, n’eussent point encore rencontré de poëtes ni de peintres qui eussent essayé de les rendre. Lorsque je lus la description du désert dans Atala, je retrouvais avec transport des scènes à celles que, depuis long-temps, j’admirois à-peu-près tout seul. On le sait ; les hommes qui habitent les colonies, n’ont guère, généralement parlant, qu’un unique objet en vue ; le desir de s’enrichir. Ces scènes sublimes, dont l’aspect me causoit une admiration si vive, étoient apperçues avec des yeux froids et indifférents par la plupart de ceux auxquels il étoit donné de les contempler ; ou si ces tableaux si beaux stimuloient quelque fois leur sensibilité endormie, cette émotion étoit foible et s’évaporoit à l’heure même. L’amour de l’or salit presque toujours aux yeux de celui qui y est livré, les couleurs des plus magnifiques paysages.39
An dieser Stelle ließen sich noch einige andere Beispiele einer intensiven Chateaubriand-Rezeption karibischer Autorinnen und Autoren aufzählen. Entscheidend ist nun, worin diese dezidierte Orientierung an den Schriften und Erzählungen des bretonischen Adeligen begründet lag. Nicht wenige Schriftsteller empfanden die Französische Revolution als traumatischen Einschnitt in ihrem Leben.40 Dem Aristokraten Chateaubriand waren die Entbehrungen und Depressionen des Exils beschieden, einige seiner Verwandten wurden hingerichtet. Auch beispielsweise die liberale Madame de Staël, welche die Revolution anfangs voll Begeisterung begrüßt hatte, wurde bald mit den Schattenseiten der Epoche konfrontiert.41 Wichtig für unsere Fragestellung ist, dass den Ausschlag für das Romanschaffen dieser Autoren nicht so sehr die persönliche Leiderfahrung gibt, als das Bewusstsein der Heimatlosigkeit im Niemandsland zwischen der versunkenen alten Welt und einer neuen, deren Konturen sich noch recht unscharf ausnehmen. Dingwelt und Landschaft, Tiere und Vegetation waren in der Literatur des 18. Jahrhunderts noch vorwiegend Kulisse. Mit den Indianerbüchern Chateaubriands begann der französische Roman, zum Ort einer Begegnung des schöpferischen Bewusstseins mit der Natur zu werden, welche die Vorurteile des «Zivilisierten» ausklammert, um dem sozial entwurzelten Individuum inmitten des Kosmos eine neue Heimstatt zu schaffen. Karl Hölz weist darauf hin, dass sich je nach Stimmungslage und Situation dabei die kulturelle Öffnung zum Anderen verschieden benennen lässt.42 Der zivilisierte René, Titelheld der gleichnamigen Erzählung, der unter den Indianern die Alternative des wilden Lebens sucht, erfährt seine kulturelle Spaltung in einer doppelten Fremdheiterfahrung.43 Während er als Franzose unter den Indianern marginalisiert ist, wird er als naturalisierter Indianer ausgerechnet von den Franzosen wegen Störung der kolonialen Ordnung vor ein Kriegsgericht gestellt.44 Gerade dabei kommt eine neue Dimension hinzu: das kulturelle Exil verschärft sich unter diesen Vorgaben zu einem Zwischenort
39 40 41 42 43 44
Ebda., S. xiij. Fritz Peter Kirsch: Epochen des französischen Romans. Wien: WUV 2000, S. 173. Ebda., S. 173. Hölz: Zigeuner, Wilde und Exoten, S. 33. Ebda., S. 33. Ebda., S. 33.
214
beidseitiger Ausgrenzung, «sans patrie, entre deux patries»45. Später wird René seiner indianischen Ehefrau Céluta den daraus resultierenden Schmerz mit einer ähnlichen Erfahrung des doppelten Kultur- und Naturverlusts sagen: «En Europe, en Amérique, la société et la nature m’ont lassé.»46 Kirsch betont, dass die Natur nun – im Gegensatz zum 18. Jahrhundert – keine Zuflucht mehr bietet. Die heile Welt, die Chateaubriands René bei den Indianern Nordamerikas zu finden hofft, wird von europäischen Einflüssen und nicht zuletzt durch das Wirken des Helden selbst zerstört.47 In einem alle gewachsenen Bindungen verleugnenden Europa habe sich Renés Sensibilität in die Liebe zu seiner Schwester verirrt, und ein Irrweg sei auch sein Leben bei den Natchez, durch den ein ganzes Volk mit in den Untergang des problematischen Helden gezogen werde. Die Ursache dieses mal du siècle, das jegliches Glücksstreben illusorisch mache, liege in der hoffnungslosen Unbehaustheit des Ichs, das sich weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft geborgen wisse: «La Révolution, finalement, ne nous a réellement rendus maîtres ni de nous-mêmes ni du monde. D’où le retour de l’angoisse métaphysique».48 Es ist der Zusammenbruch des alten Wertesystems, der Chateaubriand zum Erkunden mythischer Urweltzonen drängte; er förderte aber auch die dichterische Auseinandersetzung mit der Erfahrung innerer und äußerer Isolation. Je direkter der Untergang des Ancien Régime erlebt und empfunden wurde, desto unvermeidlicher war der Rückzug des Romansubjekts in die Isolation. In den Tiefen der Einsamkeit konnte die regenerierende Begegnung mit dem Naturkosmos und mit den Mythen erfolgen, die das Ich für seinen Verlust entschädigten, indem sie es zum Herrn der Schöpfung machten.49 Angesichts der Dynamik einer Gesellschaft, die nach den Erschütterungen des Revolutionszeitalters und der napoleonischen Kriege nach der ihr gemäßen Dosierung von Traditionsverbundenheit und Fortschrittsoptimismus suchte, musste gerade dem Ausflug in die Wildnis die Rückkehr in die Zivilisation und die Reflexion über deren Probleme folgen. Das in Atala inszenierte romantische Leidenschaftsdrama verortet Chateaubriand im Kontext des zivilisatorisch wenig erschlossenen Amerika. Den Rahmen bildet die von ihm geplante Geschichte der Natchez, die er im Vorwort zur ersten Ausgabe als eine «epopée de l’homme de la nature» einführt.50 Betrachtet man zunächst die räumliche Basis der Subjetstruktur, so stellt man fest, dass der amerikanische Raum auf dreifache Weise semantisiert wird.51 Matzat zeigt, dass er einerseits gekennzeichnet ist durch das Nebeneinander zweier na-
45 46 47 48 49 50 51
Les Natchez, S. 296, zit. nach Hölz: Zigeuner, Wilde und Exoten, S. 33. Les Natchez, S. 416, zit. nach Hölz: Zigeuner, Wilde und Exoten, S. 33. Vgl. René (1802) und Les Natchez (1826). Kirsch: Epochen des französischen Romans, S. 174. Pierre Barbéris: Chateaubriand, une réaction au monde moderne. Paris: Libr. Larousse 1976, S. 144; Kirsch: Epochen des französischen Romans, S. 174f. Kirsch: Epochen des französischen Romans, S. 178. Les Natchez 1826, S. 16, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113.
215
turnaher Gesellschaftsformen, der «chasseurs» und der «laboureurs»; andererseits bilde er insbesondere für Atala und Chactas einen außergesellschaftlichen Raum des Exils. Die «chasseurs» sind die noch unzivilisierten, eine Nomadenexistenz führenden indianischen Stämme. Es nimmt nicht wunder, dass ihre Lebensweise eine ambivalente Wertung erfährt. In Chactas’ Erzählung über seine Gefangenschaft wird die dem Naturzustand nahestehende indigene Bevölkerung zunächst in Rousseauscher Manier gefeiert. Tout prisonnier que j’étais, je ne pouvais, durant les premiers jours, m’empêcher d’admirer mes ennemies. Le Muscogulge, et surtout son allié le Siminole, respire la gaieté, l’amour, le contentement. Sa démarche est légère, son abord ouvert et serein. Il parle beaucoup et avec volubilité ; son langage est harmonieux et facile.52
Später, als Chactas’ Hinrichtung herannaht, wird aber auch ihre emotionslose Grausamkeit beklagt.53 Sie steht im Einklang mit Chateaubriands Affirmation im Vorwort, er sei im Gegensatz zu Rousseau kein «enthousiaste de Sauvages»54. Matzat betont jedoch bei dieser Abgrenzung, dass auch Rousseau die Grausamkeit früherer Gesellschaftsordnungen keineswegs unterschlagen hat. Ebenso beim Entwurf der zweiten gesellschaftlichen Stufe, der Gesellschaft der «laboureurs», folgt Chateaubriand Rousseauschen Vorgaben. Die von O. Aubry gegründete Mission wird charakterisiert als «le mélange le plus touchant de la vie sociale et de la vie de nature»55. Dem Missionar sei es gelungen, den sesshaft gewordenen Indigenen die Rauheit zu nehmen, ihnen aber dennoch «cette simplicité qui fait le bonheur»56 zu belassen. Erneut handelt es sich dabei um den von Rousseau immer wieder gepriesenen Schwellenzustand zwischen Natur und Kultur. Mit den Stufen der «chasseurs» und der «laboureurs» führt Chateaubriand die Naturkonzeption und die utopischen Entwürfe sowohl Rousseaus als auch anderer Aufklärer fort. Völlig gegensätzlich dazu verhält sich jedoch die dritte Form der Semantisierung des amerikanischen Raums.57 Seine Stilisierung zu einem Raum des Exils entspricht den – häufig christlich motivierten – Definitionen der romantischen Fremdheitserfahrung.58 Deren Protagonisten sind Chactas und Atala. Zum Exil, oder zum Nicht-Ort, wird ihnen die amerikanische Natur schon vor ihrer Liebe, für Chactas, da er im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen von seinen Stammesangehörigen getrennt wird, für Atala, da sie sich als Mestizin und Christin
52 53 54 55 56 57 58
Atala, S. 40, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Atala, S. 52, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Atala, S. 19, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Atala, S. 71, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Atala, S. 67, zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 113. Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 114. Eine entsprechende Formulierung findet die romantische Entfremdungserfahrung natürlich schon in Chateaubriands Ausführungen zum «vague de passions», auch wenn der Begriff «Exil» dort nicht gebraucht wird. Vgl. Matzat ebda., S. 114.
216
ihrem Volk nicht mehr zugehörig fühlen kann.59 Völlig ausgestoßen scheinen sie dann nach ihrer gemeinsamen Flucht, als sie alleine durch die Wildnis umherirren und Atala als «fille de l’exile» das Lied der «patrie absente» singt.60 Einen letzten Höhepunkt findet das Thema im Epilog, in dem das spätere Schicksal der Natchez ausgeführt wird. Nachdem der Stamm im Kampf mit den Franzosen ausgerottet wurde, müssen sich die letzten Überlebenden eine neue Bleibe suchen. Wie könnte es anders sein, als dass ihre Klage lautet: «nous sommes des exilés, et nous allons chercher une patrie»61. Matzat folgert, dass das Nebeneinander dieser Semantisierungen zunächst auf eine sozialkritische Absicht in aufklärerischer Tradition verweise. Die «chasseurs» seien beispielhaft für «Wohl und Wehe des Naturzustands», die Gesellschaft der «laboureurs» stehe für eine utopische Versöhnung von Natur und Kultur und diene damit als Modell für eine positive Form des zivilisatorischen Fortschritts, die entwurzelte Existenz von Atala und Chactas, und mehr noch das spätere Schicksal der Natchez, deuteten auf die negativen Auswirkungen der europäischen Kolonisation. Doch werden diese sozialkritischen Implikationen durch die romantische Besetzung der Exil-Thematik gebrochen. Denn sie verweist auf eine Fremdheitserfahrung, die nicht primär historischer, sondern metaphysischer Natur und als solche unaufhebbar ist.62 Es mag somit nicht von ungefähr kommen, dass karibische Autoren, selbst in einer Situation des historischen Dazwischen, besonders offen für eine Chateaubriand-Rezeption waren. Dennoch zeigt sich, im Vergleich mit der französischen Romantik, dass das Dazwischen karibischer Literaturen einen eigentümlichen Charakter hat. Denn der Referenzrahmen innerhalb des Universums eines Chateaubriand bleibt klar. Ein solcher Referenzrahmen ist im Falle von karibischen Literaturen im 19. Jahrhundert mehrfach gebrochen. Die Transferprozesse als Rezeptionsmuster sind auf vielfache Weise komplex und als solche nicht linear rekonstruierbar.63 Die beiden Erzählungen René und Atala verfasst Chateaubriand, als er nach seiner Abkehr von Napoleon im Katholizismus Zuflucht vor der nunmehr als bedrohlich wahrgenommenen neuen historischen Realität sucht. Auch die Restauration kann den Bruch nicht kitten. Ohne auf eine Wiederkehr der alten Ordnung hoffen zu können, wendet er sich mit neu erwachtem Interesse der Neuen Welt
59 60 61 62
63
Ebda., S. 114. Atala, S. 58f., zit. nach Matzat: Diskursgeschichte der Leidenschaft, S. 114. Ebda., S. 114. Schon im Essai sur les Révolutions (1797) hatte Chateaubriand die Ursache großer geschichtlicher Umbrüche in der ewigen Unruhe des Menschenherzens gesehen und auf diese Weise das romantische Ich zum Mittelpunkt des welthistorischen Geschehens gemacht. Vgl. Kirsch: Epochen des französischen Romans, S. 175. Vgl. Gesine Müller: «Je me suis rencontré entre deux siècle comme au confluent de deux fleuves...» Dynamiken des kolonialen Status quo in der französischen und spanischen Karibik im 19. Jahrhundert. In: Albrecht Buschmann, Gesine Müller (Hg.): Dynamisierte Räume. Zur Theorie der Bewegung in den romanischen Kulturen. Potsdam 2009. Online verfügbar unter: http://www.uni-potsdam.de/romanistik/ette/buschmann/dynraum/mueller. html [03.03.2011].
217
zu, die er schon früh, kurz nach der Revolution, bereist hat. In den Kolonien sieht er ein Fortleben des Alten in der überkommenen Gesellschaftsordnung und identifiziert es mit dem «edlen Wilden», so wenig wild der auch in seiner Rolle als Sklave unter einem paternalistischen Herrn erscheinen mag. Das Ganze geht einher mit der Schilderung einer Naturidylle, die es in Frankreich nicht gibt und die für einen Naturzustand steht, eine gottgewollte Ordnung, die ungeachtet der fundamentalen Veränderung auf dem europäischen Kontinent (noch) Bestand hat. Dabei wird das «noch» tendenziell verdrängt. Das wird von vielen antillanischen Autoren als Vorbild gesehen, die Angst vor einem eventuell bevorstehenden Bruch mit dem System der Sklaverei wird zurückgedrängt, und man besinnt sich auf die Schönheit der Natur auf seinen Inseln.64 Für den Fortbestand der Idylle muss zwar das französische Mutterland sorgen, doch zugleich kommen aufrührerische Ideen vom Festland, so dass die Harmonie und Rechtmäßigkeit der (kolonialen) Ordnung gerade den Franzosen unter Beweis gestellt werden muss. Die Karibik ist Natur, Frankreich ist Kultur, wobei dieser Gegensatz nicht notwendigerweise zu einer konflikthaften Auseinandersetzung führen muss, vielmehr als gegenseitige Ergänzung gedacht wird. Die Europäer müssen sich erst mit eigenen Augen von der karibischen Harmonie der habitations überzeugen, um zu begreifen, dass es sich hier nicht um ein von Weißen betriebenes Unterdrückungssystem handelt, sondern um ein Zusammenleben, das der Natur beider Seiten, der von Herren und Sklaven, am besten entspricht. Es ist nicht das Mutterland, das eine fremde Ordnung aufzwingt, sondern diese Ordnung muss von den Bewohnern sogar gegen die alles über einen Kamm scherenden politischen Ideen aus Europa verteidigt werden. Wo Verfechter der Unabhängigkeit in Erscheinung treten, sind sie Emissäre der revolutionären Ideen in Frankreich, die schnell erkennen, dass ihre Vorstellungen von den Kolonien wirklichkeitsfern waren. Afin de rectifier […] ses jugements et de l’initier, […] aux splendeurs de cette végétation qui n’a pas sa pareille dans le monde, au spectacle de l’activité d’une habitation, de l’étendue des propriétés, du côté curieux et original des rapports entre le maître et l’esclave, je résolus de le conduire, […] sur une des sucreries les plus considérables de l’île.65
Im Gegensatz zu den spanischsprachigen Autoren gestalten die französischsprachigen die von Menschen bearbeitete Natur als eine Verlängerung der tropischen Idylle. Die Gärten und Plantagen sind Paradiese von Menschenhand. Prévost, Maynard und Eyma entwerfen ein Bild der Beschaulichkeit, das die Sklaverei rechtfertigen soll.66 Die Romane wenden sich so in erster Linie an ein festlandfranzösisches Publikum, dessen umstürzlerische Ideen es viel mehr zu bändigen gilt, als die – kaum vorhandenen – der einheimischen Bevölkerung. Doch auch
64 65 66
Vgl. François Hartog: Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Seuil 2003. Eyma: Les Borgias Noirs, S. 118. Vgl. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 164. Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 164.
218
die Abolitionisten unter den antillanischen Schriftstellern richten sich an Frankreich, denn ihre Bestrebungen finden anscheinend recht wenig Anklang in der Bevölkerung vor Ort. Die spezifisch haitianische Situation: Primat der Aufklärung Auf Haiti führten die unterschiedlichsten Versuche, das eigene Selbstverständnis als erster unabhängiger schwarzer Staat Lateinamerikas zu definieren, nach einer Phase partieller Ablehnung der politischen und kulturellen Manifestationen des ehemaligen Kolonialherrn dazu, dass mehr dem Frankreich der Aufklärung als dem der Romantik erneut eine Orientierungsfunktion zugestanden wurde.67 Im Moniteur vom 7. September 1867 betont D. Delorme, dass eine von französischaufklärerischen Idealen inspirierte Zivilisation Fuß fassen werde: La civilisation que nous voulons introduire dans le pays y entrera par l’instruction publique. Ce sont les lumières qui, rayonnant de tous les côtés, répandront dans la République les saines notions d’ordre, de droit et de progrès d’une société. Il ne saurait y avoir même de richesse naturelle, profitable et solide, sans les clartés de l’esprit, qui indiquent la route à suivre, les moyens à employer, le but à atteindre.68
Immer wieder rekurriert Delorme auf die Lichtmetapher der Aufklärung, und im Hinblick auf das Schulsystem schreibt er, die Hochschulbildung müsse auf Haiti genauso aufgebaut werden wie in Paris.69 Raphaël Confiant und Patrick Chamoiseau hoben diesen Aspekt in Lettres créoles hervor. Stella beispielsweise, Bergeauds Titelheldin, sei nichts anderes als eine Personifizierung der Freiheit! Diese Allegorie stütze am Ende des Romans die Idee eines generösen Frankreichs, das die Freiheit in der Welt vorantreibe durch die universale Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Seit 1859 sei der heute so banal erscheinende Unterschied zwischen dem kolonisierenden und erobernden Frankreich auf der einen und dem Frankreich als Mutter der Künste, Literatur und Freiheit auf der anderen Seite schon präsent.70
V.6.
Die Rezeption der französischen Romantik und ihre kulturhegemonialen Folgen
Karibische Literaturen im 19. Jahrhundert und die literarische Produktion der französischen Romantik können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden. Ähnliches konstatiert Watson in Bezug auf die britische Romantik:
67 68 69 70
Ebda., S. 53. Ebda., S. 46. Edner Brutus: Instruction publique en Haïti: 1492–1945. Port-au-Prince: Impr. de l’État 1948, S. 231, zit. nach Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 53. Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant: Lettres créoles. Tracées antillaises et continentales de la littérature: Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane; 1635–1975. Paris: Hatier 1991, S. 86. Vgl. auch Wogatzke: Identitätsentwürfe, S. 509.
219
In the end, then, Caribbean Culture and British Fiction in the Atlantic World shows that realism and romance in the Caribbean context can not be easily disentangled, just as in the nineteenth century Britain and the West Indies were mutually constitutive rather than discrete entities. Again and again, the attempt to narrate the Caribbean from the point of view of plausibility, verifiability, and reason – realism, in other words – turns into the very forms it seeks to avoid: romantic narrative and its cognates, the gothic, the sentimental, and the melodrama.71
Gilt für die französische Romantik auch, was Watson für den britischen Kolonialismus konstatiert, nämlich dass aus der Perspektive des kolonialen Zentrums der karibische Raum von dem Moment an, wo er nach anfänglicher Blüte zusehends an Attraktivität einbüßte, mehr und mehr zur Erzählung wurde? «The history of the Caribbean – which from the point of view of Britain is the history of vast wealth, success, and imperial centrality turning into impoverishment and marginality – is continually transforming itself into romance.»72 In seinem Klassiker Culture and Imperialism fragt Edward Said nach den hegemonialen Tendenzen, die durch Literatur und Kultur transportiert und in den kolonialen Raum hineingetragen werden. Ihm geht es um Bilder und Darstellungsformen, die die Alterität des außereuropäischen Herrschaftsgebiets und seiner Einwohner betreffen und eine Gravitationskraft entfalten, die dieses Andere integriert. Das geschieht durch Propagierung eurozentrischer Kategorien und Werte, die den Anderen im und zugleich außerhalb des Eigenen verortet und ihn auf seinen Platz verweist, womit Herrschaft kulturell gerechtfertigt wird, eine Biopolitik also, die durch den kulturellen Filter und Verstärker noch an Macht und Konsensfähigkeit gewinnt. Obwohl sein eigentlicher Fokus die englische Literatur und ihre Stabilisierungsfunktion für das Empire ist, bringt Said auch einige Beispiele für das – ganz anders geartete – Ausgreifen der französischen Kultur auf den kolonialen Raum. So nennt er zum einen die ubiquitäre Verarbeitung der Napoleonfigur in der Literatur, die mit der exotischen Stilisierung der korsischen Herkunft und Physiognomie des Feldherren und Kaisers eine Identifikationsfigur liefert, die auch und gerade unter den Mulatten der überseeischen Herrschaftsgebiete eine besondere Kohäsionskraft entfalten konnte. Zum anderen verweist er auf die Meisterschaft, mit der sich die Literatur der akademischen Diskurse über Orient und Afrika bedient und dem fachlich abgesicherten Wissen vom ethnisch und kulturell Anderen eine für die englische Spartentrennung undenkbare Breitenwirkung verschafft hat. So berechtigt Saids Anliegen und so aufschlussreich seine Erkenntnisse auch sind, die (potentiellen) Rezipienten dieser hegemonialen Diskurse kommen bei ihm letztlich nur implizit vor und bleiben bloße Objekte. Im Rahmen dieser Studie wird hingegen gefragt, wie sich in Kulturhegemonie etablierenden Prozessen beide Seiten als Subjekte engagieren. Dabei scheint die hispanophone karibische (und lateinamerikanische) Literatur des 19. Jahrhunderts
71 72
Watson: Caribbean Culture, S. 6. Ebda., S. 3.
220
zu zeigen, dass Spanien als Kolonialmacht seine Gravitationskraft verlor und die kulturelle Hegemonie aufbrach. Die Komplexität funktionierender kultureller Hegemonie zeigt sich an ihrer Kapazität, Widerstand zu integrieren, auch im Zentrum der Kolonialmacht selbst. Die integrative Napoleonfigur Saids findet ihre komplexe und mehrfach gebrochene Entsprechung in der Figur des haitianischen Unabhängigkeitskämpfers Toussaint Louverture in Lamartines gleichnamigem abolitionistischen Drama (1850). Das Stück beginnt in dem Moment, als Toussaints Herrschaft zum erstenmal eine gemischtrassige, freie Gesellschaft auf Saint-Domingue in Aussicht stellt. Der Befreier wird vom Volk als Gesandter Gottes gefeiert. Mit dem Eintreffen Napoleons stehen sich zwei Führer gegenüber: Napoleon und seine Entourage erscheinen als doppelzüngige und moralisch verdorbene Figuren. So gelingt es Lamartine, Toussaint zum Agenten seines eigenen Antibonapartismus und seiner Ablehnung der Sklaverei zu stilisieren; allerdings mit der Konsequenz, dass der Autor einen schwarzen Napoleon geschaffen hat, der alle positiven Werte, die dem weißen von seinen Apologeten zugeschrieben werden, in sich vereint.73
Auch wenn es sich hierbei nur um ein kleines Element eines sehr viel globaleren hegemonialen Diskurses handelt, spiegelt und reproduziert sich dieser Diskurs, oder besser gesagt: diese fast schon nonverbale Repräsentationsform, selbst im Akt des Widerstands. Für die Unabhängigkeitsliteratur der hispanophonen Karibik hat das spanische Mutterland im Vergleich zu Frankreich eine weniger bedeutende Rolle gespielt. Dies ist nicht nur auf den schon lang anhaltenden kulturellen Niedergang Spaniens zurückzuführen, sondern auch auf die kurze Phase der napoleonischen Oberhoheit und die direkte Inspiration der politischen Befreiungsbewegung Lateinamerikas durch das Ideengut der Französischen Revolution. Was an der französischen imperialen Erfahrung im Vergleich zu Spanien besonders auffällt, ist, dass sie eine stärkere Kohärenz und kulturelle Gravitationskraft besitzt. Die Idee einer überseeischen Herrschaft – das Ausgreifen über angrenzende Territorien hinaus in sehr ferne Länder – hat viel mit kulturellen Projektionen und Rechtfertigungen zu tun und erwirbt sich fortgesetzte Geltung durch tatsächliche Expansion, Verwaltung, Kapitalinvestition und Engagement. Im Falle Frankreichs weist die imperiale Kultur systematische Züge auf, die sich im Schlagwort der mission civilisatrice resümieren lassen und in Spanien weitgehend fehlen.74 Die Prozesse des Kolonialismus reichten über die Ebene ökonomischer Zusammenhänge und politischer Entscheidungen hinaus und wurden durch die Autorität und unangefochtene Kompetenz kultureller Wertungen, durch fortgesetzte Konsolidierung in der Literatur auf der Ebene der nationalen Kultur
73 74
Middelanis: Imperiale Gegenwelten, S. 115. Vgl. Edward W. Said: Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht. Aus dem Amerik. übersetzt von Hans-Horst Henschen. Frankfurt am Main: S. Fischer 1994, S. 27.
221
verfestigt. Kann man so weit gehen wie William Blake, der in seinen Anmerkungen zu Reynolds Discourses für den britischen Imperialismus proklamierte: «Die Grundlage des Imperiums sind Kunst und Wissenschaft. Man räume sie aus dem Wege oder entwerte sie, und das Imperium ist nicht mehr. Das Imperium folgt der Kunst und nicht umgekehrt, wie das die Engländer voraussetzten»75? Mit Ausnahme Haitis besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen der politischen und kulturellen Abhängigkeit vom Mutterland Frankreich. Die Schriftwerke der Literaten antizipieren die politischen Ereignisse; genauer: die (Nicht-) Erreichung der Unabhängigkeit. Dieses Phänomen kann auch die wichtigsten Anhaltspunkte geben für das andersgeartete koloniale Verhältnis und die recht heftige Loslösung der spanischen Kolonien vom Mutterland.76
75 76
Vgl. ebda., S. 49. Dies unter der Voraussetzung einer Kulturtheorie, die der kulturellen Hegemonie als Legitimationsinstanz für das Herrschaftsverhältnis die entscheidende Rolle zubilligt.
222
VI.
Transkaribische Dimensionen: New Orleans als Zentrum frankophoner Zirkulationsprozesse
VI.1. Frankreich und Spanien als Kolonialmächte in Louisiana Nachdem innerhalb der karibischen Textproduktion bisher vorwiegend innerkaribische kulturelle Repräsentationsformen im Fokus standen, soll nun mit New Orleans als privilegiertem Zentrum von kolonialen Zirkulationsprozessen in der amerikanischen Hemisphäre der Radius erweitert werden um eine zirkumkaribische Dimension. Dieser Knotenpunkt von Transferprozessen erweist sich nicht nur deshalb als spannend, weil Spanien und Frankreich dort beide die Funktion von Kolonialmächten innehatten, sondern weil mit der frühen Unabhängigkeit von Frankreich im Vergleich zu den innerkaribischen Besitzungen andere postkoloniale Konsequenzen verbunden waren. Wie artikulieren sich beispielsweise die Beziehungen zum einstigen Mutterland Frankreich in einem US-amerikanischen Kontext? Welche Brückenfunktion haben literarische Inszenierungen über New Orleans als kontinentales Bindeglied hemisphärischer Amerika-Konstruktionen? Nachdem es der französischen Kolonialmacht bis Mitte des 18. Jahrhunderts gelungen war, mit New Orleans eine funktionierende koloniale Siedlung im Mississippidelta aufzubauen, änderten sich die Verhältnisse mit dem Ausgang des French and Indian War.1 Es war der Friedensvertrag von Paris aus dem Jahre 1763, in dem Frankreich seine Besitzungen im heutigen Kanada an Großbritannien abtrat und damit das Louisiana-Gebiet an Spanien verlor. Frankreich verschwand nun als Kolonialmacht von der Landkarte des nordamerikanischen Kontinents. Es sollte jedoch weitere vier Jahre dauern, bis Spanien Kolonialpersonal nach Louisiana entsandte. Der spanischen Krone war klar, dass sie das Gebiet nur dauerhaft unter ihrer Herrschaft halten konnte, wenn sie es mit ausreichend spanischen Siedlern versorgte. Aber obwohl die Bevölkerung von New Orleans während der spanischen Herrschaft tatsächlich um das Dreifache wuchs, gelang eine Kolonialisierung nur bruchstückhaft.2 Zwischen der weißen Oberschicht, die sich aus ehemaligen französischen und neu hinzugekommenen spanischen Kolonialbeamten sowie aus zugewanderten weißen Plantagenbesitzern und Händlern von den westindischen Inseln zusammensetzte, und der stetig wachsenden Zahl an Sklaven etablierte sich in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts die Gruppe der Free People of Color.3
1
2 3
Nina Möllers: Kreolische Identität. Eine amerikanische «Rassengeschichte» zwischen Schwarz und Weiß. Die Free People of Color in New Orleans. Bielefeld: Transcript 2008, S. 48. Diese Studie bildet die Grundlage für die im Folgenden zusammengefaßten historischen Konstellationen. Ebda., S. 48. Ebda., S. 48.
223
Mit der wachsenden Zahl interethnischer eheähnlicher Beziehungen ging die besondere Freilassungsgesetzgebung der spanischen Kolonialregierung einher.4 Sie erlaubte Sklaven, ihre Freiheit mit Geld zu erwerben, das sie durch Extraarbeiten außerhalb des normalen Arbeitspensums erwirtschaften konnten. Einer ungerechten Preissetzung durch den Besitzer sollte durch die Möglichkeit Einhalt geboten werden, den Preis von einem Gericht festlegen zu lassen.5 Möllers macht darauf aufmerksam, dass diese in den von Spanien kontrollierten Kolonialgebieten als coartación bezeichnete Praxis die Sklaven zwar prinzipiell weniger abhängig von der Gunst und Willkür der Besitzer machte, doch gestaltete sich der Prozess des Freikaufs häufig sehr langwierig, kostspielig und gefährlich. Dennoch gelang es in Louisiana zwischen 1769 und 1803 1.490 Sklaven, auf diese Weise ihre Freiheit zu erkaufen. Angesichts der noch sehr niedrigen Bevölkerungszahl im Jahre 1785 von 4.433 weißen Bewohnern, 9.513 Sklaven und 907 Free People of Color handelt es sich um eine beträchtliche Zahl.6 Da die spanische Kolonialregierung den französischen Code Noir, der in Louisiana 1724 eingeführt worden war, übernahm, erhielten die Freigelassenen genau dieselben Rechte und Privilegien wie alle freien Kolonialbürger Louisianas.7 Die 54 Artikel dieses Regelwerks behandeln sowohl die Rechte und Vorschriften für die Sklavenbevölkerung als auch den Status von Freigelassenen und freigeborenen farbigen Personen: Der für die Entstehung der Free People of Color entscheidende Artikel verbot die Heirat zwischen Weißen und Farbigen Louisianas, ganz gleich, welchen sozialen Status sie besaßen. Zudem wurden außereheliche Beziehungen zwischen Sklaven und Free People of Color verboten. Bis zur amerikanischen Übernahme des Gebiets im Jahr 1803 war in Louisiana eine multi-ethnische Gesellschaft entstanden.8 Einflüsse aus der französischen und spanischen Herrschaft waren mit kulturellen Elementen der Sklavenbevölkerung eine hybride Mischung eingegangen, Einwanderer aus Haiti und von den kanarischen Inseln lebten dicht neben Siedlern aus Deutschland und der Schweiz, und alle gemeinsam trugen sie bei zu einer kreolisierten Gesellschaft und Kultur, die sich in wesentlichen Dingen von der angelsächsischen Kultur der übrigen US-Bundesstaaten und Territorien unterschied.9 Trotz dieser multiethnischen Wurzeln der Bevölkerung lässt sich eine besondere Sogwirkung des im weitesten Sinne französischen Kulturkreises festmachen, die dazu führte, dass
4 5 6 7
8 9
Ebda., S. 49. Ebda., S. 49. Ebda., S. 49. Ebda., S. 49. Bei dem im Jahre 1724 für Louisiana erlassenen Code Noir handelte es sich um eine leicht abgeänderte Form des Code Noir, der 1685 für die Kolonialgebiete auf den französischen karibischen Inseln erlassen wurde. Vgl. Recueils de Reglemens, Edits, Declarations et Arretes, Concernant le Commerce, l’Administration de la Justice & la Police des Colonies Françaises de l’Amérique, & les Engagés. Avec le Code Noir et l’Addition audit Code. Paris: Chez les Libraires Associez 1745. Online verfügbar unter: http://www.archive.org/stream/recueilsdereglem00fran#page/n3/mode/2up [28.01.2011]. Möllers: Kreolische Identität, S. 53. Ebda., S. 53.
224
die kreolisierte Gesellschaft von außen als französisch wahrgenommen wurde.10 Tatsächlich gingen die Einflüsse vieler europäischer Einwandererkulturen in der französisch geprägten Gesellschaft Louisianas auf.11 Die kulturelle Dominanz des Französischen führte dazu, dass viele Free People of Color in den 1830er-Jahren von Louisiana nach Paris gingen.12 Ein Parisaufenthalt war gerade im literarischen Milieu ein Muss: B. Valcour und Armand Lanusse waren wohl zum Studium dort, Victor Séjour, Pierre Dalcour, Louis und Camille Thierry lebten einen Großteil ihres Lebens in Frankreich. Alle waren sie weder entlaufene Sklaven noch Abolitionisten. Sie gehörten einer farbigen Elite an, die einen gewissen ökonomischen Status in New Orleans genoss. Einer von ihnen war Armand Lanusse, 1812 geboren. Sehr wahrscheinlich studierte er in Paris. Von 1852 bis 1866 war er als Direktor der Katholischen Schule für Schwarze in New Orleans tätig. Weiß genug, um als Weißer zu gelten, etablierte er zusammen mit Jean-Louis Marciaq das Album littéraire, «a journal for young people, amateurs of literature»13, das Gedichte und Kurzgeschichten beinhaltete. Die Randposition der Autoren des Album littéraire in der US-amerikanischen Gesellschaft führte dazu, dass sie sich an (zur US-amerikanischen Literatur) alternativen Modellen orientierten und dort ihre Inspiration suchten. Sie fühlten sich den französischen Romantikern, vor allem Lamartine, Musset und Béranger, näher als jeder anderen Schule.
VI.2. Karibisches Louisiana Neben der kulturellen Ausrichtung an Frankreich, wurde Louisiana aber auch als Teil des karibischen Kulturkreises wahrgenommen. Die räumliche und kulturelle Nähe zur Republik Haiti schürte bei der weißen Bevölkerung in New Orleans und den umliegenden sugar parishes die Angst vor Nachahmern unter der heimischen Sklavenbevölkerung.14 Dass diese Angst nicht unbegründet war, hatten zwei Sklavenrevolten im Pointe Coupée Parish in den Jahren 1791 und 1795 gezeigt. Zwar waren diese bereits im Keim erstickt worden, eine mögliche Verbindung zu Saint-Domingue zeigte sich allerdings beim Prozess von 1791, als der angebliche Anführer des Aufstands, ein Farbiger namens Pierre Bailly, während seiner Gerichtsverhandlung zugab, er habe auf Anweisungen aus SaintDomingue gewartet.15 Diese über der weißen Bevölkerung wie ein Damokles-Schwert schwebende Gefahr eines gewaltsamen Aufbegehrens der Sklaven – womöglich initiiert und
10 11 12 13 14 15
Ebda., S. 53. Zit. nach ebda., S. 53. Vgl. Lynn Smith, Vernon J. Parenton: Acculturation among the Louisiana French. In: American Journal of Sociology 44, 3 (1938), S. 355–364. Vgl. Michel Fabre: From Harlem to Paris. Black American Writers in France, 1840– 1980. Urbana: Univ. of Illinois Press 1991. Ebda., S. 11. Möllers: Kreolische Identität, S. 75. Ebda., S. 75.
225
geplant durch gebildete Free People of Color – hatte vor der amerikanischen Machtübernahme bereits die kreolischen Sklavenbesitzer umgetrieben. In ihren Lösungsvorschlägen waren sich die ancienne population und die neuen amerikanischen Regierungsbeamten allerdings nicht immer einig. Dass eine Revolte vor allem von Sklaven aus Westindien ausgehen würde und deren Einfluss auf Louisiana deshalb minimiert werden müsse, stand außer Frage. Über die Folgen einer möglichen Einschränkung des Arbeitskräftereservoirs war man sich aber uneins. Seit Anbeginn der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Saint-Domingue, vor allem aber seit 1803, waren sowohl weiße Bewohner mit ihren Sklaven als auch Free People of Color nach Kuba geflüchtet.16 Als der Bruder Napoleons, Joseph, den spanischen Thron bestieg, kam es auf Kuba zu gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Anhängern des spanischen Monarchen Ferdinand VII. und den frankreichtreuen Ex-Bewohnern von Saint-Domingue. Zwischen Mai 1809 und Januar 1810 suchten 9.059 dieser Flüchtlinge in Louisiana Asyl, darunter 3.102 Free People of Color. Die freie Gesamtbevölkerung des Orleans Parish stieg von 17.001 im Jahr 1806 auf 24.552 vier Jahre später. Von der Hauptflüchtlingswelle 1809 waren 30 Prozent Weiße, 34 Prozent Free People of Color und 36 Prozent Sklaven. Neben den Gefahren, die von den antillanischen Sklaven ausgehen konnten, sorgte sich William Claiborne (1775–1817, von 1812–1816 erster Gouverneur des Bundesstaates Louisiana) um ein mögliches Wiedererstarken des transkaribischen Kulturkreises, was die Amerikanisierung des Orleans-Territoriums empfindlich zu stören drohte.17 Immer wieder wurde in den Diskussionen um mögliche Aufstände auf die transkaribische Verbindung verwiesen, die eine «Infizierung» der heimischen Sklaven und Free People of Color mit revolutionären Ideen mehr als wahrscheinlich machte.18 Welches Bild der kreolischen Gesellschaft Louisianas in der zeitgenössischen Literatur transportiert wurde und wie die transkaribischen Verbindungen aus literarischer Sicht beschrieben wurden, soll nun anhand zweier Erzählungen (erschienen in Paris und in New Orleans) und einer literaturhistorischen Abhandlung (erschienen in Port-au-Prince) gezeigt werden. VI.2.1. Victor Séjour: «Le mulâtre» (1837) Die Erzählung «Le mulâtre» von Victor Séjour ist in der Revue des Colonies vom März 1837 abgedruckt. Der Erzähler gibt eine Geschichte wieder, die er angeblich in dem haitianischen Küstenort Saint-Marc von einem alten Sklaven, Antoine, erzählt bekommen hat.19 Es ist die Geschichte einer jungen Sklavin namens Laïsa,
16 17 18 19
Ebda., S. 80. Ebda., S. 81. Ebda., S. 83. Für wichtige Hinweise in diesem Kapitel wie dem folgenden zu Joanni Questy danke ich Hafid Derbal.
226
die aufgrund ihrer Schönheit von einem 22jährigen (einfluss)reichen Plantagenbesitzer namens Alfred gekauft wird. Traurig, ihm ausgeliefert zu werden, findet sie auf dem Weg zur Plantage heraus, dass der Kutscher ihr Bruder Jacques ist und sie beide den gleichen Vater haben, einen Sklaven namens Chambo. Alfred, der als liebenswürdig gegenüber Weißen und erbarmungslos und schrecklich gegenüber Sklaven gilt, zwingt sie über Monate hinweg, sein Bett mit ihm zu teilen, von Vergewaltigung ist die Rede. Nachdem Laïsa schwanger wird und ihre Abneigung ihm gegenüber nicht abnimmt, verliert Alfred das Interesse an ihr und verscheucht sie und ihren neugeborenen Sohn, den sie Georges tauft (nach ihm wird die Geschichte benannt – le mulâtre). Alfred lässt Laïsa schwören, seine Vaterschaft dem Jungen nie zu verraten, da er ihn sonst töten lasse. Daher verspricht sie Georges, dass er erst im Alter von 25 Jahren die Identität des Vaters kennenlernen solle. Die Mutter stirbt innerhalb der nächsten Jahre und händigt ihm ein Portrait seines Vaters aus, das er erst mit 25 Jahren enthüllen darf. Aus Respekt vor der verstorbenen Mutter hält er sich daran. Georges und Alfred lernen sich kennen und über die Jahre schätzen. Eines Tages erfährt Georges von einem Mordkomplott gegenüber Alfred und eilt zu ihm, um ihn zu retten. Erschrocken glaubt Alfred, dass Georges’ Versuche, ihn in Sicherheit zu bringen, Teil des Mordplans der vierköpfigen Mördergruppe ist, und flüchtet vor ihm. Georges nimmt es mit den vier Einbrechern auf und bringt sie alle um, wird dabei aber sehr schwer verletzt und schwebt fast zwei Wochen lang zwischen Leben und Tod. Alfred, der seine falsche Einschätzung erkennt, schickt nach dem besten Arzt, um Georges, seinen Sohn, zu retten. An dieser Stelle wird die Frau von Georges, eine Farbige namens Zélie, mit der er einen zweijährigen Sohn hat, in die Erzählung eingeführt. Während Georges mit dem Tod ringt, versucht Alfred, sie mit Geld zu verführen. Sie widersetzt sich, und so lässt Alfred sie in sein Schlafzimmer holen. Dort wehrt sie sich gegen Alfreds Vergewaltigungsversuch und verletzt ihn am Kopf. Wohlwissend, dass sie deswegen der Tod erwartet, eilt sie unter Tränen zu Georges, um ihm die Geschichte zu erzählen. Einen Tag vor ihrer Hinrichtung fleht Georges Alfred an, einzugreifen und als Dank für seine Lebensrettung seinerseits seine Frau zu retten. Alfred zeigt keine Regung, und als Georges versteht, dass seine Rufe ungehört bleiben, fängt er an, Alfred zu drohen und ihm die versuchte Vergewaltigung vorzuwerfen. Um selbst dem Tod zu entrinnen, muss er nun flüchten, droht Alfred aber Rache an. Zélie wird gehängt und Georges bringt sich mit seinem Sohn bei einer Gruppe abtrünniger Sklaven in Sicherheit. Drei Jahre lang wartet Georges, bis Alfred heiratet und ein Kind bekommt. Dann kehrt er zu ihm zurück. Kurz nach der Geburt des Kindes schleicht sich Georges in Alfreds Schlafzimmer, vergiftet dessen Frau und droht, Alfred zu erschlagen, der ihn anfleht, Gnade mit ihm zu haben und seiner Frau das Gegenserum zu geben, das er in Händen hält. Nachdem die Frau gestorben ist, holt Georges zum Todesschlag gegen Alfred aus, der ihm in diesem Moment sagt, er könne jetzt ruhig seinen Vater töten. Da holt Georges das Portrait heraus, erkennt seine Verdammnis und nimmt sich neben der Leiche seines Vaters das Leben. 227
In der Erzählung wird das Bild des schrecklichen und skrupellosen Sklavenhalters gezeichnet. Dagegen erklärt Antoine an mehreren Stellen, dass Georges eigentlich ein gutes Herz habe, dass aber angesichts einer solchen Ungerechtigkeit selbst gerechte Menschen zu Kriminellen werden. Es wird auch gezeigt, dass die «schlechten» Eigenschaften der Sklaven beziehungsweise der Schwarzen und Farbigen durch dieses ungerechte System produziert werden. Ohne das heutige Wort von der «Sozialisierung» zu gebrauchen, wird genau dieser Prozess beschrieben. Im Gegensatz zu innerkaribischen Texten erscheint der Afrikabezug in Louisiana als pointiertes politisches Programm. Ob dies mit den nahenden Sezessionskriegen zu tun hat, sei dahingestellt. Als der weiße Reisende zu Beginn der Geschichte in Port-au-Prince ankommt, begrüßt er einen Schwarzen mit Handschlag: –Bonjour maître, me dit-il en se découvrant. –Ah! Vous voilà…, et je lui tendis la main, qu’il pressa avec reconnaissance. –Maître, dit-il, c’est d’un noble Coeur ce que vous faites là… ; mais ne savez-vous pas qu’un nègre est aussi vil qu’un chien… ; la société le repousse ; les homes le détestent ; les lois le maudissent…20
Besonders deutlich wird die relational starke, wenn auch stets asymmetrische Beziehung zu Afrika in dem Moment, als sich das Geschwisterpaar kennenlernt und als solches entdeckt. –De quel pays es-tu, Laisa? –Du Sénégal… Les larmes lui virent aux yeux ; il venait de rencontrer une compatriote. –Soeur, reprit-il, en s’essuyant les yeux, tu connais sans doute le vieux Chambo et sa fille…21
Und später äußert sich Georges, als er auf eine Gruppe Marrons trifft: «Afrique et liberté, répondit Georges sans s’émouvoir, mais en repoussant de côté le canon du fusil… je suis des vôtres.»22 New Orleans ist zwar in dieser Erzählung als Stadt nicht explizit präsent, allerdings findet die Selbstverständlichkeit der Folgen dieses Knotenpunktes unterschiedlichster Zirkulationsprozesse auf vielen Ebenen der literarischen Inszenierung ihren Widerhall. Ohne große Hinführung ist Haiti ganz selbstverständlich der Handlungsschauplatz. Auch der Bezug zu Afrika wird selbstverständlicher dargestellt und erfährt ohne große Umschweife eine positivere Bewertung als in innerkaribischen Texten: Während Texte der hispanophonen Karibik zu diesem Zeitpunkt viel programmatischer formuliert sind, sind die frankophonen Erzählungen und Romane um stärkere Abgrenzungen bemüht. Insofern sich die koloniale vergleichende Fragestellung für innerkaribische Transferprozesse zwischen Multirelationalität (spanischer Kolonialraum) und Bipolarität (französischer Kolonialraum) vermittelt – natürlich immer unter Be-
20 21 22
Victor Séjour: Le mulâtre. In: Revue des Colonies (März 1837), S. 376–392, hier S. 377. Ebda., S. 379. Ebda., S. 388.
228
rücksichtigung eines potentiellen Dazwischen, zeigt sich dieses Dazwischen in New Orleans noch dominanter, was mit der bereits vor Jahrzehnten vollzogenen politischen Loslösung vom französischen Mutterland zu tun haben dürfte. Es spricht für sich, dass «Le mulâtre» in New Orleans selbst auf Grund neuer Zensurgesetze von 1830 nie veröffentlicht werden durfte, demgegenüber über das innerkaribisch-zirkulierende Publikationsorgan Revue des Colonies eine weitere Verbreitung fand und mit Guyana, einigen Regionen Afrikas etc. bekanntlich weit darüber hinaus rezipiert wurde. VI.2.2. Die Rückkehr nach Haiti. Joanni Questy: «Monsieur Paul» (1867) In den 1850er-Jahren hatten die Free People of Color stark unter rassistischer Verfolgung zu leiden. Dies führte dazu, dass viele Kreolen aus Louisiana Exil in Frankreich, Haiti und Mexiko suchten. 50 Jahre nach der Einwanderungswelle aus dem vom Bürgerkrieg geschüttelten Saint-Domingue setzte ein Flüchtlingsstrom in umgekehrter Richtung ein. An Bord der Laura kamen am 25. Juli 1860 250 Emigranten in Port-au-Prince an: Nous nous félicitons de la prochaine arrivée de ces nouveaux frères. Puisse leur exemple être imité par tous ceux dans les veines desquels coule le sang africain et qui souffrent dans toute l’Amérique des vils préjugés de couleur. Que tous viennent se joindre à nous pour jouir de la liberté, de l’égalité sous le palmier d’Haïti, et nous aider à faire de notre beau pays, fertilisé par le sang généreux de nos pères, la métropole de la race noire dans le monde civilisé.23
Es war mehr als ein Freiheitsversprechen, das die Flüchtlinge aus Louisiana in die schwarze Republik lockte.24 Farbige Kreolen in Louisiana fühlten eine starke Verbindung zu Haiti, viele von ihnen gehörten zur dritten Generation von Immigranten aus dem einstigen Saint-Domingue: In der ersten Dekade des 19. Jahrhunderts war der Zustrom aus Saint-Domingue so stark gewesen, dass sich die Bevölkerung New Orleans’ in einem Jahr verdoppelte. In der Tageszeitung La Tribune de la Nouvelle-Orléans erschien 1867 eine Kurzgeschichte von Joanni Questy mit dem Titel «Monsieur Paul». Questy war ein prominenter Dichter und Erzieher in der kreolischen Gemeinschaft New Orleans’, der auch für die noch näher zu beschreibende Dichtergruppe Les Cenelles schrieb. In der Erzählung «Monsieur Paul», die wohl um die Jahrhundertmitte in New Orleans angesiedelt ist, spielt die Idee einer Rückkehr der Revolutionsflüchtlinge und ihrer Nachkommen nach Haiti eine große Rolle.25 Nach einem öffentlichen Theaterbesuch macht sich der Protagonist (ohne Namen in dieser Erzählung, von nun an Joanni) auf den Heimweg. Dort begegnet
23 24 25
Le Progrès. Journal Politique [Port-au-Prince] (8. September 1860), zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 163. Möllers: Kreolische Identität, S. 152. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass die wenigsten sich gut integrieren konnten, die meisten kehrten wieder nach Louisiana zurück. Ebda., S. 151.
229
er in der nächtlichen Dunkelheit einem Herren, Monsieur Paul, der ihn nach einer Zigarette fragt. Sie befreunden sich und M. Paul lädt Joanni ein, ihn in den nächsten Tagen zu besuchen. Joanni sucht den offensichtlich reichen M. Paul in seinem Haus auf, wo er Bedienstete und Sklaven hat. Als M. Paul Joanni sieht, kann er seine Irritation nicht verbergen, denn im Tageslicht erkennt er, dass Joanni schwarz ist. Seine offensichtliche Reaktion ist M. Paul sehr peinlich, und er entschuldigt sich bei Joanni. Er zeigt ihm klar, dass er eigentlich kein Problem damit hat und dass die Hautfarbe ihre Freundschaft nicht in Frage stellt. Wenige Tage danach erhält Joanni eine handschriftlich verfasste Nachricht, in der M. Paul ihn um einen Besuch bittet. Bei diesem Treffen eröffnet M. Paul Joanni, dass von ihm verlangt werde, sein Testament aufzusetzen, da er kurz vor einem Duell mit Ernest Day stehe. Er erzählt Joanni über seine Vergangenheit, dass er eine schwarze Frau namens Athénais hatte (sie hatten sich heimlich von einem Priester segnen lassen) und dass er mit ihr zwei Kinder habe. Er erklärt sehr ausführlich, wie viel sie ihm bedeuten und wie sehr er die bestehenden Vorurteile gegenüber Menschen anderer Hautfarbe bedauert: Pour m’assurer la jouissance tranquille de la femme qui m’aimait, je fis bénir secrètement notre union par un prêtre – un mariage de conscience – croyait que ses prières seraient comme un rempart autour de mes amours. Le préjugé de couleur, avec sa réprobation terrible, ne peut m’arrêter dans mon fanatisme amoureux. Quand j’épousais Athénais, je prends Dieu à témoin, mon ami, je me considérais légitimement et éternellement lié à elle.26
Der Grund des Duells ist eben diese Liebesgeschichte. Die Frau habe ihn wegen Ernest Day verlassen. Voller Eifersucht und Rachegelüste hat M. Paul einen Plan ausgedacht, den Joanni im Falle seines Todes ausführen soll. Für den Fall, dass er am nächsten Tag sterbe, hat er ein Erbe für seine Frau und die Kinder hinterlassen, das Joanni erst nach genau zwei Jahren herausgeben soll. M. Paul wolle durch diesen Schritt erreichen, dass Athénais ihre Untreue zutiefst bereut. Die Frist von zwei Jahren sei wegen der juristischen Lage notwendig, denn sonst würde das Erbe beschlagnahmt und irgendwelchen entfernten Verwandten in Frankreich übergeben: A peine mort, moi, on posera les scelles partout : la loi inflexible et tyrannique de votre pays ne reconnaît pas la validité de mon mariage : le consul français me trouvera bien quelque parent, quelque héritier perdu dans un département quelconque de France, c’est bien sûr.27
Dann kommt eine Schlüsselstelle des Textes (und die Verbindung zu Haiti), in der M. Paul seine Haltung gegenüber Schwarzen nochmals zeigt, indem er Joanni bittet, seinem Sklaven Georges ein Erbe auszuzahlen:
26 27
Questy: Monsieur Paul. Ebda.
230
[…] il ne faut pas oublier Georges ! Tenez, ce rouleau-ci lui appartient aussi bien que cette lettre : vous la lirez ensemble. Deux mille piastres en billets, voilà l’héritage de mon… esclave. Une recommandation spéciale : Mon ami, vous enverrez Georges en Haïti. Brave, jeune, intelligent, doué d’excellentes qualités, pas superstitieux, il fera son chemin dans ce pays-là. Georges a un amour de la liberté à faire trembler, n’oubliez pas cela, mon ami.28
Am nächsten Tag kommt Ernest Day beim Duell um und M. Paul wird schwer am Kopf verletzt. Seine beiden weißen Zeugen, die ihm beistehen sollten, machen sich teilnahmslos aus dem Staub und lassen ihn schwer verwundet und ohne jeglichen Beistand liegen. Dagegen kümmern sich die schwarzen Georges und Joanni fürsorglich und loyal um ihn. Nach einigen Tagen mit Wahnvorstellungen jedoch erliegt M. Paul seinen Verletzungen. Hier taucht plötzlich Frau Paul mit einem Schrei der Verzweiflung am Sterbebett auf. Interessant ist, dass hier nicht von Athénais die Rede ist, sondern von Madame Paul. Im Testament erklärt M. Paul, dass Georges nicht sein Sklave ist, sondern sein Neffe, der Sohn seines Bruders und einer Sklavin, die beide kurz nach seiner Geburt verstorben waren. Georges immigriert tatsächlich nach Haiti zu einer Zeit, in der sich die Sezessionskriege abzeichnen: Au point où nous sommes arrivés de notre récit, il se faisait des préparatifs de guerre dans tout le pays ; la future Confédération du Sud comptait déjà dans son sein plusieurs états qui avaient déclaré leur séparation de l’Union. Il était question à la Nouvelle Orléans de devenir un défenseur forcé de l’esclavage. Il s’embarqua à bord de la Laura qui partait pour Port-au-Prince, et fit le serment de ne jamais revenir dans son pays tant que «l’Institution particulière» y subsisterait.29
Nach einigen Jahren der Einsamkeit nimmt Athénais sich schließlich das Leben. Man findet das Testament ihres Mannes und Bankenbriefe in der Hand der Leiche. Zwar stellt sich am Ende der Geschichte heraus, dass M. Pauls Zuneigung zu Georges (auch) familiäre Gründe hatte, da er ja nicht nur sein Sklave, sondern auch sein Neffe war. Nichtsdestotrotz ist die positive Einstellung von M. Paul gegenüber Schwarzen nicht zu übersehen, sie zeigt sich in der unzweifelhaften Liebe zu seiner schwarzen Frau und ihren beiden gemeinsamen Kindern, in der impliziten Kritik an der Kirche und den anderen Institutionen, die diese Liebe nicht anerkennen wollen. Interessant ist auch die differenzierte Charakterzeichnung der einzelnen Figuren in diesem Text von Questy: M. Paul ist weiß, väterlich, leidenschaftlich; der Erzähler schwarz, loyal, zuverlässig, gebildet; Ernest Day ist ebenfalls weiß und bis auf die Tatsache, dass er der neue Geliebte von Athénais ist, eine relativ neutrale Gestalt; Athénais ist schwarz und hat den Geliebtenstatus; Georges wiederum ist schwarz, ein Sklave, intelligent, loyal, nicht abergläubisch, freiheitsliebend; die Händler Jean Delotte und William Brewer sind weiß, unloyal, materialistisch. Die Ausgestaltung der Personen ist weniger stereotyp auf Rasse
28 29
Ebda. Ebda.
231
bezogen als in anderen Texten. Entscheidend für unsere zentrale Fragestellung ist die Glorifizierung Haitis, das geradezu als Athen der Karibik, als Zentrum des amerikanischen Doppelkontinents inszeniert wird, wenn pathetisch Georges dorthin versprochen wird. Port-au-Prince ist zukunftsversprechend, ein Zentrum der Kultur und Bildung und wirtschaftlich prosperierend. Demgegenüber spielt Haiti in den innerkaribischen frankophonen Texten kaum eine Rolle beziehungsweise wird nur als Angstmotiv am Rande tangiert. In der spanischen Karibik zeichnen sich – wie sich in Kapitel VIII.1. zeigen wird –, durchaus Diskurse ab, die Haiti in gesamtkaribische utopische Entwürfe miteinbeziehen, dies aber immer in einer Vorbildrolle im Kampf um Rassefragen. Besonders spannend ist die Inszenierung unter Berücksichtigung der haitianischen Literaturproduktion selbst: der unidirektionale Blick Richtung Frankreich erfährt eine radikale Infragestellung durch literarische Repräsentationen wie «Monsieur Paul». Mit dem Fokus Haiti offenbart sich uns, wenn wir «durch Vergleich in Beziehung (und in Bewegung) setzen»30 in kondensierter Form eine transkulturelle Wissensformation. VI.2.3. Joseph Colastin Rousseau: «nos frères d’outre-golf» Im Jahr 1862 veröffentlicht Joseph Colastin Rousseau in L’Opinion Nationale, einer wichtigen Zeitung aus Port-au-Prince, die «Souvernirs de la Louisiane», ein frühes Beispiel für Literaturgeschichtsschreibung der farbigen Kreolen aus Louisiana. Rousseau, selbst Sohn eines Revolutionsflüchlings aus Saint-Domingue, war gerade erst aus Louisiana nach Haiti zurückgekehrt. Er beschreibt die romantischen Dichter Louisianas, weiße wie schwarze, als eine unglückliche Gruppierung, verbunden durch Verfolgung und ökonomische Krise. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Romantik in Louisiana solch eine Ausprägung erfuhr, war die Frage der Flüchtlingsbewegungen zurück nach Haiti doch ein realpolitisches Thema der Zeit, welches sich auch für literarische Inszenierungen sehr anbot. So wird zum Beispiel die Aufnahme der Flüchtlinge aus Saint-Domingue, die erst nach Kuba und dann 1809, infolge von Auseinandersetzungen mit königstreuen Kubanern wegen der napoleonischen Besetzung Spaniens, nach Louisiana kamen, ausführlich beschrieben: En 1809 un débris d’exilés haïtiens expulsés de l’île de Cuba, furent jeté sur les plages de la Louisiane, comme envoyés de Dieu pour venir grossir le petit nombre de familles dont j’ai parlé plus haut [les gens de couleur libres]. Frères déjà par le sang, enserrés dans le cercle de fer d’un inconséquent préjugé, ce malheur commun, les sacrant en les réunissant, leur inspira de pures et franches sympathies ; leurs enfans grandirent sous le même toit, de nouveau liens de fraternité, naissant de la situation, se resserrèrent chaque jour plus étroitement et, confondus dans le même sort, ils ne firent bientôt qu’une seule et même famille… 31
30 31
Ette: Alexander von Humboldt, S. 152. Vgl. zu diesem Zitat von Ottmar Ette auch die Erläuterungen in Kap. I.3.2. L’Opinion Nationale (29. November 1862), zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outregolf», S. 158.
232
Rousseau streicht die Gemeinsamkeiten zwischen Haitianern und Louisianern heraus und spricht von «nos frère d’outre-golfe».32 Die schwarze und farbige Bevölkerung Amerikas bezeichnet er als Blutsbrüder. Er bedient sich früher panafrikanischer Ideen, die in der atlantischen Welt zirkulierten, und er plädiert für eine stärkere kreolische Solidarität. Rousseau schreibt am Ende: «[…] afin de renseigner tous les membres de la grande communauté aussi bien que nos frères les Haïtiens – lesquels nous touchent de si près – sur l’existence de nos frères louisianais : parce que là-bas quand on dit : Louisianais, c’est comme si l’on disait Haïtiens.»33 Er zeigt sehr deutlich, wie die Bande einer kreolischen Schicht aus einer hybriden beziehungsweise relationalen Erfahrung zusammengetragen wurden.34 Ähnlich wie die kreolische Oberschicht auf Martinique und Guadeloupe verorten sich die Free People of Color in einem Dazwischen, artikulieren Orientierungslosigkeit, eine Unsicherheit zwischen den Welten. Dennoch bleibt die koloniale Bindung an das (einstige) Mutterland Frankreich immer die tragende Kraft. Der französische Kolonialismus ist so stark, dass er trotz einer Erfahrung des Dazwischen gerade in dieser Schwäche seine Anziehung entfaltet. Rousseaus Artikel besteht aus zwei Teilen.35 Der erste Teil führt die weißen Dichter von Louisiana vor: Adrien Rouquett, Alexandre Latil, Oscar Dugué, Tullius St. Céran. Rousseau beschreibt das einzigartige kreolische Schreiben, das diese Dichter praktizieren. Er antizipiert auch die Last eines literarischen Bovarismus, der für die gesamte frankophone Literatur Louisianas im 19. Jahrhundert steht. Ils sont restés eux quand même, et un cachet d’originalité indélébile semble sceller leurs productions. Soit qu’ils parlent de la France, soit qu’ils parlent de leur pays, l’idée de la patrie ne les abandonne jamais : Elle est toujours restée pour eux un fond sur lequel ils brodaient leurs plus riches tableaux… Des enfants du sol, exilé en France pour travailler aux soins de leur éducation, chantèrent aussi leurs cyprières, leurs bayous, leurs lacs et leurs pinières ; mille descriptions variées et précises du sauvage errant dans ses courses vagabondes.36
Rousseau betont aber auch die Wichtigkeit von Les Cenelles, einer Gedichtanthologie farbiger Autoren. Die Sammlung schaffte viel mehr, als nur diese Dichter zu vereinigen, denn die Gemeinschaft zu beschreiben, hatte für sie existentiellen Charakter:
32 33
34 35 36
Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 165. L’Opinion Nationale (27. Dezember 1862), zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outregolf», S. 155. Zu Rousseaus Verwurzelung in Saint-Domingue siehe: Rodolphe Lucien Desdunes: Nos hommes et notre histoire. Notices biographiques accompagnées de reflexions et de souvenirs personnels, hommage à la population créole, en souvenir des grands hommes qu’elle a produits et des bonnes choses qu’elle a accomplies. Montreal: Arbour & Dupont 1911, S. 111f. Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 155. Ebda., S. 155. L’Opinion Nationale (25. Oktober 1862), zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 155f.
233
Après avoir vu se succéder plusieurs autres volumes de poésie qu’on publia après ceux de St. Céran, Rouquette, Latil et Dugué, dont nous avons déjà parlé plus haut, ces jeunes gens, pleins d’une admiration sincère et respecteuse pour tout ce qui pouvait concourir à l’instruction de leur race, se sont décidés à braver les orages de la publicité, en lançant aussi leur volume de poésie indigènes. Ils se réunirent et décidèrent que chacun d’eux porterait son contingent à l’oeuvre proposée. En moins de quinze jours, dix-sept d’entr’eux donnèrent 86 pièces de vers, fruit de leur labour. Chacun donna sa quote part pour l’impression et, un mois après, parut un volume de poésies,… composé de 200 et tant de pages, intitulé: Les Cenelles.37
Wollen wir uns nach dieser Ankündigung Rousseaus mit dieser Gruppe näher beschäftigen, die für Selbstverortungen im Dazwischen paradigmatischen Charakter zu haben scheint.
VI.3. Les Cenelles: Schreiben im Dazwischen Angesichts des kritischen Blicks der US-Regierungsstellen und der Öffentlichkeit waren die Free People of Color gezwungen, ihre Gedanken in solche Formen zu gießen, die einer Zensur durch die hegemoniale Gesellschaft entkamen.38 In den 1840er-Jahren pflegten die Free People of Color noch immer einen intensiven intellektuellen Austausch mit der französisch-geprägten Karibik und dem kulturellen Mutterland Frankreich. Für die Söhne der wohlhabenderen Familien waren Reisen nach Paris und ein Studium an einer berühmten Universität Frankreichs fast schon ein Muss; erst recht galt dies für literarisch Ambitionierte. Es ist deshalb naheliegend, dass sich viele der literarisch aktiven Free People of Color in den 1840er-Jahren der französischen Romantik zuwandten.39 Möllers macht darauf aufmerksam, dass sie gerade in der Romantik eine Richtung fanden, die es ihnen erlaubte, an europäischen Konventionen orientierte Gedichte zu schreiben, die – anders als in jener Zeit ebenfalls auf den Markt drängende Formen schwarzer Literatur wie die folktale oder die slave narrative – von der weißen südstaatlichen Öffentlichkeit weniger argwöhnisch betrachtet wurden.40 Das wichtigste Publikationsorgan der Creole of Color-Dichter war das im Jahre 1843 erstmals vorgelegte Album littéraire: Journal des gens, amateurs de littérature. Diese literarische Zeitschrift wurde offiziell von dem weißen Kreolen Jean-Louis Marciaq veröffentlicht, doch waren die darin zu findenden Kurzgeschichten, Essays und Gedichte überwiegend von Creoles of Color verfasst. Als diese Zeitschrift nach einer kurzen Laufzeit wieder verschwand, erschien 1845 eine Gedichtsammlung mit dem Titel Les Cenelles. Sie enthielt etwa 85 Gedichte von 17 Creole of Color-Autoren. Der Name der Sammlung bezieht sich auf eine botanische Seltenheit Louisianas: Die roten Beeren einer Art des Hagedornbusches kommen nur in isolierten Gegenden wie dem sumpfigen Umland von New
37 38 39 40
L’Union 87 (1863), zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 157f. Möllers: Kreolische Identität, S. 141. Ebda., S. 141. Ebda., S. 141.
234
Orleans vor.41 Wegen ihrer Schmackhaftigkeit als Konfitüre eingekocht, wurden sie in Louisiana im 19. Jahrhundert zu hohen Preisen gehandelt. Vor diesem Hintergrund hat Jerah Johnson die Namensgebung dieses einzigartigen Werkes treffend gedeutet:42 «[They] evoked the image of small, uniquely flavored and rare local delicacies that struggled for life in surroundings so hostile as to make the very gathering of them a dangerous travail, but one worth the risk because of the richness of the reward.»43 Die Autoren der Gedichte, vor allem der Verfasser des Vorworts, Armand Lanusse, inszenierten die Rarität ihrer Gedichtsammlung deutlich. Dies nicht zu Unrecht, denn tatsächlich gilt sie als die erste Lyrikanthologie aus der Feder nordamerikanischer farbiger Autoren. Was die Rezeption betrifft, so blieb allerdings die Brisanz des schmalen Büchleins der Öffentlichkeit verborgen, obwohl die Gedichte größtenteils mit den Autorennamen versehen waren. Doch wem der ein oder andere nicht persönlich bekannt war, der konnte aus dem Inhalt der Sammlung nicht auf die ethnischen Identitäten der Verfasser schließen.44 So wurde Les Cenelles auf dem literarischen Markt Louisianas lediglich als eine weitere Sammlung romantischer Gedichte wahrgenommen. Wirft man einen ersten Blick auf die Gedichte, wirkt die Mehrzahl von ihnen tatsächlich zunächst wie ein «Abklatsch ihrer Vorbilder» aus der französischen Romantik.45 Im Gegensatz zu exotistischen Darstellungen innerkaribischer Romantiktexte, fehlt Lokalkolorit bei Les Cenelles fast gänzlich. Nur wenige Gedichte beziehen die besondere Lokalität von New Orleans oder Louisiana ein. Auch auf die ethnische Herkunft bezogene identifikatorische Merkmale finden sich kaum. Bis auf einige wenige Ausnahmen, die dann allerdings sehr prominent erscheinen, werden die Protagonisten der Gedichte nicht ethnisch markiert. Die Überschriften verweisen auf vordergründige Signalwörter der französischen Romantik: Liebe, Lust, Leidenschaft, Melancholie und Tod. Bei allen imitatorischen Elementen handelt es sich um Darstellungen, denen ihr eigener Charakter schwer abzusprechen ist, eine Gemeinsamkeit mit der literarischen Produktion der frankophonen Antillen. VI.3.1. Imitation der französischen Romantik Les Cenelles sind stark orientiert an Lamartines Méditations Poétiques, wie auch der explizite Hinweis Lanusse’ auf den französischen Romantiker verdeutlicht: «Naïvement un jour,/ J’ai pris pour un jouet la pure et vive flamme/ Qu’entretient
41 42 43 44 45
Ebda., S. 142. Ebda., S. 142. Jerah Johnson: Les Cenelles. What’s in a Name? In: Louisiana History 31, 4 (1990), S. 407–410, hier S. 410, zit. nach Möllers: Kreolische Identität, S. 142. Möllers: Kreolische Identität, S. 142. Ebda., S. 143.
235
Lamartine avec un saint amour.»46 In seinem Vorwort nennt der Dichter noch andere Vorbilder, denen die jungen farbigen Autoren der Cenelles nacheifern: Mais ceux pour qui nous éprouvons le plus de sympathie, ce sont ces jeunes hommes dont l’imagination s’est fortement éprise de tout ce qu’il y a de grand et de beau dans la carrière que suivent avec tant de gloire les Hugo et les Dumas ; ceux que nous voudrions défendre de toutes les forces de notre âme contre l’indifférence des uns et la méchanceté des autres, ce sont ces jeunes esprits qui, sans avoir la folle prétention d’atteindre jamais à la hauteur où sont arrivés les grands maîtres en littérature dont nous venons de parler, sont pourtant en butte à toutes les tracasseries que ces génies transcendants éprouvèrent au commencement de leur vie littéraire ; tracasseries qui les poursuivront sans doute jusqu’aux portes de leurs tombeaux, si elles n’en franchissent pas les seuils.47
Vor allem die Schriften aus dem Album littéraire, aber auch einige Gedichte aus Les Cenelles sind bei genauerer Betrachtung mehr als nur Nachzeichnungen einer von der französischen Romantik beeinflussten Schablone. Sie sind vor allem auch eine indirekte identitäre Positionierung innerhalb der komplexen nachkolonialen Sphäre Louisianas und der unterschiedlichen ethnischen, kulturellen und sozialen Gruppen und Einflüssen. So hat Henry Louis Gates Jr. beispielsweise die Literatur der Free People of Color vor allem deshalb gepriesen, weil sie durch die perfekte Erfüllung der Vorgaben einer westlichen ästhetischen Tradition dem Vorurteil, die schwarze «Rasse» und Kultur sei minderwertig, den Boden entzog.48 Und Michel Fabre betont, das vorderste Ziel der Creoles of Color sei nicht die soziale Reform, sondern die Kultivierung der französisch-geprägten Literatur in Louisiana.49 Die Free People of Color orientierten sich nicht an den Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommenden afroamerikanischen Genres wie der folktale oder der slave narrative. Mit der Entscheidung, statt auf die realistische Wiedergabe afroamerikanischen Dialekts lieber auf Hochkultur-Französisch und romantische Themen zu setzen, hoben sie die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen ihrer Gruppe und nicht-kreolischen Farbigen hervor.50 Bei zunehmender Marginalisierung ging es für die Creoles of Color in den 1840er- und 50er-Jahren in ihrer Literatur darum, ihre Ähnlichkeit und Zugehörigkeit zur weißen kreolischen Gesellschaft unter Beweis zu stellen. Indem sie sich in die französische
46
47
48
49
50
Armand Lanusse: Besoin d’écrire. In: Armand Lanusse (Hg.): Les Cenelles. New Orleans: H. Lauve et Compagnie 1845. Online verfügbar unter: http://www.centenary.edu/ french/textes/cenelles4.htm [23.02.2011]. Armand Lanusse: Préface. In: Armand Lanusse (Hg.): Les Cenelles. A Collection of Poems. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Regine Lartortue und Gleason Rex W. Adams. Boston: Hall (1845) 1979, S. xxxvii. Vgl. Thomas F. Haddox: The «Nous» of Southern Catholic Quadroons. Racial, Ethnic, and Religious Identity in Les Cenelles. In: American Literature 73, 4 (2001), S. 757–778, hier S. 758, zit. nach Möllers: Kreolische Identität, S. 155. Michel Fabre: The New Orleans Press and French-Language Literatures by Creoles of Colour. In: Werner Sollors (Hg.): Multilingual America. Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American Literature. New York: New York Univ. Press 1998, S. 29–49, hier S. 33. Möllers: Kreolische Identität, S. 155.
236
Literaturtradition der Romantik einschrieben und dabei auch identitäre Gemeinsamkeiten wie den Katholizismus evozierten, schufen sie auch ein Gegengewicht zum angloamerikanisch-protestantischen Identitätsentwurf.51 Entscheidend ist, dass die Gedichtsammlung Les Cenelles im klaren Gegensatz zu einer aufkommenden genuin afroamerikanischen Literaturtradition stand, die die Free People of Color mit den Sklaven und protestantischen freien Farbigen anderer Südstaaten verbunden hätte. VI.3.2. Dazwischen: Zerrissenheit und Produktivität Die Gedichte der Free People of Color verweisen oft auf ihre innere Zerrissenheit, sowohl auf individueller als auch auf gemeinschaftlicher Ebene. So entstammt die Gruppe der Free People of Color zum großen Teil interethnischen Beziehungen, die als inoffizielle Verbindungen unter dem Begriff der plaçage weit verbreitet waren. Angesichts dieser Tatsache musste eine Kritik am System der plaçage Schwierigkeiten bereiten,52 und die Autoren schreckten davor zurück, ihr Missfallen in starke, eindeutige Worte zu fassen. Ähnlich wie in der Reiseliteratur stand die Quadroon53 als sexuelles Objekt emblematisch für ein Machtgefälle zwischen den Free People of Color und der weißen Oberschicht.54 Im Fokus der Kritik steht jedoch nicht die sexuelle Ausbeutung der Frauen, sondern der unmoralische Aspekt der plaçage, der ein funktionierendes Familienleben unmöglich macht und die Idee einer Art kollektiven Identität der Gruppe verhindert. Dennoch bemühte man sich um eine Festigung der Gemeinschaft von innen heraus, um die gesellschaftliche und wirtschaftliche Position innerhalb Louisianas wahren zu können. Der unauflösbare Widerspruch, dem sich die Afrokreolen in ihrer literarischen Produktion gegenübersahen, war, dass sie ein System kritisierten, dem sie in weiten Teilen ihre Existenz und ihre besondere gesellschaftliche Position verdankten.55 Gerade angesichts dieses Zwiespalts verwundert es nicht, dass Stil und Ausdruck, die die Autoren wählten, ihre Unsicherheit widerspiegeln. Denn die Verwendung neuer literarischer Elemente, wie es in den aufkommenden afroamerikanischen Literaturtrends der Fall war, hätte den Creoles of Color-Autoren eine größere Aufmerksamkeit beschert und vielleicht wäre es ihnen besser gelungen, ihren Protest gegenüber der hegemonialen Gesellschaft zu artikulieren. Eingebettet in ihre französisch-kreolische Abstammung, die sie im kulturellen Bereich klar der weißen kreolischen Gesellschaft näherstehen ließ als den protestantischen Angloamerikanern, war ihr Ziel eben nicht nur die Partizipation an der machthabenden Gesellschaft, sondern auch die fortwährende Exklusion anderer Einflüsse aus der unter ihnen stehenden afroamerikanischen Kultur. Es geht also
51 52 53 54 55
Ebda., S. 156. Ebda., S. 156. Ethnische Bezeichnung, die besonders häufig für Farbige in New Orleans angewandt wurde, die zu einem Viertel schwarz waren. Möllers: Kreolische Identität, S. 156. Ebda., S. 156.
237
indirekt um die Folgen des französischen Integrationsmodells noch Jahrzehnte nach Loslösung vom Mutterland. Die Gedichte sind gezeichnet von der Erfahrung des Dazwischen-Seins der Creoles of Color und dem Widerspruch ihrer Forderungen: Auf der einen Seite widerständig gegen das Kastensystem der weißen Gesellschaft, das ihnen einen ebenbürtigen Platz in der Gesellschaft verweigert, unterstützen sie eben dieses System in ihrem Versuch, sich weiterhin sowohl gesellschaftlich als auch identitär von der Gruppe der Sklaven abzusetzen.56 Den Aspekt der unklaren Zugehörigkeit betonen auch Régine Latortue und Gleason Adams in ihrer Einleitung zu der zweisprachigen Bostoner Ausgabe der Cenelles von 1979: The legacy of Rousseau, of the French Revolution, of the Declaration of the Rights of Man and Citizen, and the foils of Classicism and Rationalism which gave substance to the musings of Lamartine and Hugo do not reverberate in the verses of their Louisiana imitators; these verses consequently have a somewhat hollow ring. Trapped between races, between classes, between cultures, the Louisiana Creole could not and would not confront the problems and conflicts that blacks, no matter how elevated, experienced; yet, no matter how much they tried, they could not succeed in completely immersing themselves in that culture which seemingly represented salvation.57
Dieses Dazwischen-Schreiben der Cenelles-Autoren erhält noch eine weitere Dimension in der Imitation nicht nur der französischen Romantiker, sondern auch der weißen Poeten von New Orleans, wie abermals aus dem Vorwort der Anthologie hervorgeht: Nous publions donc ce recueil dans le but de faire connaître les productions de quelques jeunes amans de la poésie qui ne jalousent point sans doute les beaux succès obtenus sur la scène ou dans le monde littéraire par des poètes louisianais qui ont eu le bonheur de puiser le savoir aux meilleures sources de l’Europe, car ces derniers seront toujours pour les premiers un sujet d’émulation, mais jamais un objet d’envie.58
Das bestimmende Merkmal Louisianas im 19. Jahrhundert ist seine transareale Dimension als Knotenpunkt vielschichtiger Transferprozesse: Politisch motivierte Flüchtlingsströme von Haiti nach New Orleans und von New Orleans zurück in die Karibik und nach Frankreich, wechselnde koloniale Zugehörigkeiten und mehrere kulturelle Bezugssysteme mit unterschiedlicher Durchsetzungskraft, literarische Orientierung der kreolischen Dichter an der französischen Romantik als weiße Hochkultur einerseits, als Sinnbild ihrer prekären gesellschaftlichen Situation und Zerrissenheit andererseits. Diese vielfältigen Relationalitäten finden ihren Niederschlag in dynamischen Identitätskonstruktionen, die bei den Free People of Color von frühem Pan-Afrikanismus bis hin zu krampfhafter Imitation der Weißen reichen.
56 57 58
Ebda., S. 157. Zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 139. Les Cenelles, zit. nach Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 145.
238
VII. Exkurs: Paradigmenwechsel in der historischen Karibikforschung und ihre narrative Inszenierung
In diesem Kapitel soll nun ein Bogen geschlagen werden vom 19. Jahrhundert zur Gegenwart, wobei als aktuelle Bezugspunkte zwei karibische Autoren dienen: Raphaël Confiant und Maryse Condé. Während es bei Confiant darum geht, eine narrative Inszenierung des 19. Jahrhunderts in den Blick zu nehmen und zu zeigen, inwiefern eine Theorieproduktion aus der Karibik der Gegenwart nie ohne das 19. Jahrhundert auskommt, zeigt eine parallele Lektüre von Condé und Gómez de Avellaneda, inwiefern zeitgenössische literarische Texte unmittelbar rückwirkend die Lesart eines Textes aus dem 19. Jahrhundert um entscheidende Dimensionen bereichern.
VII.1. Gómez de Avellaneda mit Maryse Condé lesen Zwei Romane karibischer Autorinnen: Gertrudis Gómez de Avellanedas Sab von 1841 und Maryse Condés Traversée de la Mangrove von 1989. Was bringt eine solche Gegenüberstellung? Was außer geographischem Raum und dem Geschlecht der Autorinnen verbindet diese beiden Romane, die zeitlich fast anderthalb Jahrhunderte trennen? In beiden Romanen beschäftigen sich die Autorinnen mit ihren Herkunftsinseln, die als isolierte Enklaven in einer (bereits) politisch unabhängigen Umgebung nach wie vor den Status von Kolonien/DOM innehaben und die sie unter Schwächung der kulturellen Bindungen an das Zentrum (wieder) stärker in die regionalen Zusammenhänge einzubinden versuchen. Beide Autorinnen verkörpern in dramatischer Form die Problematik des Dazwischen: Nachdem sie – Avellaneda um 1837 und Condé um 1953 – ihre Herkunftsländer bereits sehr früh verlassen haben, widmen sie ihr literarisches Schaffen (oder einen Teil davon) der eigenen Heimat, beziehungsweise dem, was sie als ihre Heimat bezeichnen, nicht zuletzt unter dem Eindruck einer latenten Fremdheitserfahrung in den Mutter- und Gastländern Spanien und Frankreich. Beide plädieren im Rahmen ihres Schreibaktes von außen – also aus der Distanz eines sogenannten Zentrums – für eine stärkere Betonung des spezifisch Kubanischen respektive Guadeloupanischen, beide machen eine Fremdheitserfahrung1 bei der Rückkehr auf ihre Herkunftsinsel, unter anderem da sie als Fremde wahrgenommen werden. In dieser für viele Intellektuelle aus (ehemaligen) Kolonien symptomatischen und traumatisierenden Erfahrung spiegelt sich eine Problematik, die tiefer angelegt ist und die beide Autorinnen auf eine ähnliche
1
Vgl. zur Beschreibung des «Gefühls der Fremdheit und des Fremdseins» im Fall von Condé: Ette: Literatur in Bewegung, S. 480.
239
Weise antizipieren und reflektieren: Ähnlich wie bereits für Gómez de Avellaneda herausgearbeitet, führt der Versuch, Identitätskategorien aus den Zentren für die Beschreibung eines Eigenen, Außereuropäischen dienlich zu machen, zu einem Dazwischen, das heißt zu einer Spannung, die sich meist nicht in einer dialektischen Synthese lösen lässt. Dieser Spannung gegenüber erweisen sich die beiden Autorinnen, in ihrem Schreiben im Dazwischen, als außerordentlich sensibel. Bei beiden äußert sich diese Sensibilität in einem ähnlich ambivalenten Umgang mit der Frage der eigenen Autorschaft, ein Motiv, das zum Knotenpunkt für eine ganze Reihe subtiler Grenzüberschreitungen wird, die die bestehenden geschlechtlichen und ethnischen Hierarchien in Frage stellen, wobei sich in beiden Fällen der literarischen Inszenierung Probleme von personeller und kollektiver Identitätskonstruktionen eng miteinander verwoben präsentieren. Konkret: Wie Gómez de Avellaneda nimmt auch Condé in gewisser Weise ihre Autorschaft zurück, wenn sie den Schreibprozess selbst, wie die Kubanerin 150 Jahre zuvor, in den Roman integriert und ihrem – ebenfalls männlichen – Protagonisten zuschreibt. In Avellanedas Roman erweist sich die gesamte Erzählung gegen Ende als Abschiedsbrief des Sklaven und Titelhelden Sab, und bei Condé stellt sich die verstorbene Hauptfigur Francis, um die sich die vielen Geschichten bei der nächtlichen Totenfeier ranken, als Schriftsteller heraus, der an einem Roman mit dem Titel «Traversée de la Mangrove» gearbeitet hat.2 VII.1.1. Mangroven und die Inszenierung einer identité relationnelle Wenn in Avellanedas Roman alle Handlungsstränge auf Sab zulaufen, der dann schließlich auch als Erzähler ins unverzichtbare integrierende Zentrum des Identitätsentwurfs rückt, dann sind die Identitätsvorstellungen in Traversée de la Mangrove von Maryse Condé fragmentierter und dezentraler, auch wenn sich viele formale und inhaltliche Grundkonstellationen durchaus mit Sab vergleichen lassen. Wie Avellaneda tritt Maryse Condé die Autorschaft – zumindest teilweise – an ihren Protagonisten Francis Sancher alias Francisco Alvarez Sanchez ab. So erzählt seine ehemalige Geliebte Vilma von ihrem ersten Zusammentreffen in seinem Haus, wo sie ihn bei der Arbeit an einem Manuskript gesehen habe. Sancher habe ihr auf die Frage, was er schreibe, geantwortet: –Tu vois, j’écris. Ne me demande pas à quoi ça sert. D’ailleurs, je ne finirai jamais ce livre puisque, avant d’en avoir tracé la première ligne et de savoir ce que je vais y mettre de sang, de rires, de larmes, de peur, d’espoir, enfin de tout ce qui fait qu’un
2
Vgl. zu Traversée de la Mangrove die grundlegende Interpretation von Ottmar Ette: Die Durchquerung der Mangroven. In: Ette: Literatur in Bewegung, S. 461–538. Vgl. zu Strategien der Autorschaft bei Condé: Frauke Gewecke: Der Titel als Chiffre einer Subversion. «Moi, Tituba, sorcière… Noire de Salem» von Maryse Condé. In: Jochen Mecke, Arnold Rothe (Hg.): Titel–Text–Kontext. Randbezirke des Textes. Festschrift für Arnold Rothe zum 65. Geburtstag. Glienicke, Berlin: Galda+Wilch 2000, S. 159–177, hier S. 171.
240
livre est un livre et non pas une dissertation de raseur, la tête à demi fêlée, j’en ai déjà trouvé le titre : «Traversée de la Mangrove». J’ai haussé les épaules. –On ne traverse pas la mangrove. On s’empale sur les racines des palétuviers. On s’enterre et on étouffe dans la boue saumâtre. –C’est ça, c’est justement ça.3
So ist das Identitätsprojekt als sein Projekt von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Verdopplungsstruktur bei der Autorschaft kann dahingehend gedeutet werden, dass es erst der weiblichen Schriftstellerin Maryse Condé bedurfte, um das Projekt einer «rhizomatischen» Identität im Sinne von Deleuze und Guattari4 zu einem Abschluss zu bringen und die Mangrovenwurzeln passierbar zu machen, Wurzeln, die nicht primär okzidental-baumartig in der Tiefe der Erde (also der Geschichte) verankert sind, sondern deren Verwurzelungen auf der Oberfläche in die Breite gehen und ablegerartig miteinander verbunden sind, wodurch sich die einzelnen Gewächse gegenseitig stützen. Es geht um ein Plädoyer für eine identité relationnelle in Abgrenzung zur identité racine (im Sinne Édouard Glissants)5. Dabei zeigt sich dennoch, dass der Frage der Inszenierung von Autorschaft eine nicht unbedeutende Rolle zukommt, denn die Struktur des Romans beantwortet diese Frage eigentlich eindeutig. Der Roman hat 20 Kapitel, jedes Kapitel ist die Geschichte eines anderen Erzählers. Die Erzähler sind die Teilnehmer an der Totenwache zum Andenken an den verstorbenen Francis. Ähnlich wie in García Márquez’ Cien años de soledad spielt die Handlung in einem geschlossenen dörflichen Mikrokosmos, in dem gottverlassenen guadeloupanischen Dorf Rivière au Sel, wo die Einwohner bisher offenbar recht einsam und kommunikationslos nebeneinanderher lebten. Doch ist es nicht die ewige Generationenfolge in einer gemeinsamen mythisch-magischen Vorstellungswelt, die ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schafft, es sind vielmehr die zahlreichen ineinander verwobenen Verbindungen der einzelnen Dorfbewohner untereinander. Der zirkularen, ja fast metabolistischen Diachronität des Ewiggleichen in García Márquez’ Gründungsepos stellt Condé eine außerordentlich kompakte und gedrängte erzählte Zeit entgegen, die den Eindruck der Synchronität der unterschiedlichsten zwischenmenschlichen Bindungen noch verstärkt. So bedarf es Sanchers (mysteriösen) Todes, um die Menschen auf der Beerdigung nicht nur zusammenzubringen, sondern um sie der Dynamik ihres Beziehungsgeflechts gewahr werden zu lassen, einer Dynamik, die überhaupt erst in der sprachlichen Interaktion des Sich-gegen¬seitig-Erzählens entsteht. So muss Sanchers Roman als Versuch eines Identitätskonstrukts scheitern, weil sich relationelle Identität gar
3 4 5
Maryse Condé: Traversée de la Mangrove. Paris: Mercure de France 1989, S. 202f. Vgl. Ette: Literatur in Bewegung, S. 479. Gilles Deleuze, Félix Guattari: Rhizom. Aus dem Franz. von Dagmar Berger. Berlin: Merve-Verl 1977. Vgl. Ette: Literatur in Bewegung, S. 512. Glissant: Poétique de la relation.Vgl. auch Ette: Literatur in Bewegung, S. 522.
241
nicht mehr von einem einzigen Autor beschreiben lässt.6 Sie bedarf der Auflösung auktorialer Autorität zugunsten einer Vielzahl von Erzählern und Erzählerinnen, die durch die Überlappung und Verflechtung ihrer Geschichten Identität – und das bedeutet hier: dynamischen Zusammenhang – überhaupt erst konstituieren. Das Nebeneinander ihrer Geschichten ohne eine einzige Regieanweisung, das sich wie von selbst zum Mosaik eines Mikrokosmos zusammenfügt, zeigt, dass ihr Zusammenhalt und auch ihre Gleichwertigkeit nicht auf ein übergeordnetes allgemeines Prinzip zurückgeht, das zum Beispiel in einer übergelagerten Erzählinstanz symbolisiert wäre, sondern einzig und allein auf ihre eigene wechselseitige Initiative der prise de parole. Während in Sab ein unterdrücktes Subjekt schriftstellerische Initiative ergreift und zu einer eigenen literarischen Stimme findet, die damit zum Sprachrohr und Zentrum der in unterschiedlichsten Abhängigkeits- und Machtverhältnissen gefangenen und befangenen kolonisierten Subjekte wird, so bildet bei Condé der Protagonist als Zentrum, um den die verschiedenen polyphonen Stimmen wie in einer Zentrifuge kreisen, in mehrererlei Hinsicht eine Leerstelle beziehungsweise wird in eigentümlicher Weise ausgelagert. Zum einen weiß niemand etwas Genaues über Sanchers Vergangenheit: Er ist irgendwann von außerhalb in das Dorf gekommen und trägt zwei Namen, den französischen Francis Sancher und ein spanisches Äquivalent, Francisco Alvarez Sanchez, weshalb unklar bleibt, ob er jetzt Guadeloupaner ist oder vielleicht Kolumbianer – alle Vermutungen bewegen sich jedoch innerhalb des karibischen Raums. Bei seinem Einzug in ein altes verlassenes Haus wurde er von den Einheimischen lange misstrauisch beäugt und immer als Fremder wahrgenommen, bis sich in den Erzählungen bei der Totenwache herausstellt, dass jeder in einem bestimmten Verhältnis zu ihm steht. Zum anderen ist er – der am Manuskript von «Traversée de la Mangrove» gearbeitet hat und bereits zu der Erkenntnis gelangt ist, dass er sich damit einem hoffnungslosen Unterfangen verschrieben hat – der einzige, der als Erzähler nicht zu Wort kommt. Sein Tod, und damit die Aufgabe jeglicher Eigeninitiative, ist in diesem Falle Voraussetzung für die Initiative der Vielen. Barthes’ Diktum vom Tod des Autors wird hier wörtlich in die Tat umgesetzt, nur dass die Autorität des Autors nicht einer wie auch immer gearteten Selbstreferentialität des anonymen subjektlosen Textes weicht, sondern einer Mehrstimmigkeit und wechselseitigen Referentialität. Entscheidend für diese Wechselseitigkeit und Intersubjektivität ist die Offenheit des Textes, für den es auf die Oralität der Erzählungen ankommt.7 Durch ihr Nebeneinander in einem Kontext von mündlicher Kommunikation stehen sie an der Schnittstelle von unveränderbarer Vergangenheit einerseits und andererseits einer dynamischen Gegenwart, die in eine offene Zukunft weist und die in der Macht der Akteure selbst liegt. In der diachronischen Perspektive, als
6 7
Anne Malena: The Negotiated Self. The Dynamics of Identity in Francophone Carribean Narrative. New York: Lang 1999, S. 69. Zur Oralität in diesem Roman vgl. Ette: Literatur in Bewegung, S. 482.
242
abgeschlossene Geschichte, weist die jeweilige Erzählung zurück in eine Vergangenheit, die auch das zeitgenössische Guadeloupe als voll von Stereotypen und essentialistischen Identitätszuschreibungen ausweist. Dabei spielen, wie in Avellanedas Roman, immer noch Hautfarbe und Geschlecht die Hauptrolle, auch wenn mehrere Erzähler zu verstehen geben, dass in der jüngeren Vergangenheit Bildung zu einem wichtigen Faktor sozialer Identität avanciert ist, um in der letzten Zeit schließlich von dem einzig valablen sozialen Seismographen «des Kontostands» verdrängt zu werden – ein Kriterium, das bei Sab nur den illegitimen Otways etwas bedeutet. In dieser Perspektive bleibt Guadeloupe letztlich ein heterogener Flickenteppich, eine vielfach gespaltene und durchfurchte Gesellschaft ohne jede Kohäsion. In der synchronischen Perspektive jedoch, als offene Kommunikation, werden in den Erzählungen die Geschichten zur Grundlage der Begegnung und eines pluralistischen Austauschs. Die jeweils individuelle Geschichte und Herkunft des einzelnen – und nicht die Gleichartigkeit aller – ermöglicht jedem eine eigene Perspektive auf das allen Gemeinsame, im Roman konkret: auf die Erinnerung an den Verstorbenen und dadurch auf das gemeinsame Dorf, das als Miniatur für die ganze Insel steht. Erst diese verschiedenen Standpunkte machen Kommunikation überhaupt sinnvoll; und erst im kommunikativen Austausch, in der Dynamik von Erzählen–Zuhören–Antworten können sich die Bewohner aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit als gleich, im Sinne von gleichberechtigt, anerkennen. Durch den gemeinsamen Mittelpunkt, den «toten Autor», sprechen sie nicht gegeneinander, sondern miteinander. Beide Romane weisen die Karibik als einen außerordentlich produktiven und vor allem selbstständigen Kultur- und Literaturraum aus, der gerade aus der Heterogenität als Identitätsdilemma eine unerhörte konzeptionelle Tiefe hervorbringt. Oder anders gewendet: es ist gerade der Zwischenraum zwischen Europa und Herkunftsinsel – auch wenn aufgrund geteilter Biographien oft das intellektuelle Zugehörigkeitsgefühl nicht mit dem emotionalen übereinstimmt –, der die Schriftstellerinnen zu ihrer produktiven Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen europäischen Diskursen herausfordert, mit Diskursen, die von den beiden Autorinnen auf unterschiedliche Weise (und natürlich im Rahmen ihrer Zeit) durchaus im dialektischen Spannungsfeld von Befreiung und Beherrschung begriffen werden, ohne dass die Erkenntnis dieser Ambivalenz sie deshalb vor der doppelten Fremdheitserfahrung bewahrte. In dem Versuch, das essentialistische Identitätsmodell zu überwinden, das meines Erachtens für beide Romane auf je eigene Weise konstitutiv ist, bietet Condés Roman, wenig überraschend, eine überzeugendere Alternative als es Avellanedas Sab in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts tun kann. Er ist zwar an der relationalen Identität der Poststrukturalisten orientiert, prägt diesem «Modell» aber eine ganz eigene Nuancierung auf. Ihre Perspektive von Mehrstimmigkeit und interaktiver Dynamik ist sicherlich konsequenter als die Integrationsfigur Sab, die gerade in der letztlich christlich geprägten Utopie ihres Selbstopfers besteht. Trotzdem muss offenbleiben, ob bei aller konzeptionellen Überzeugungskraft der Mangrove nicht Sab mit seinem emotionalen Appell und dem Schock, den 243
sein Selbstopfer beim Leser auslöst, eine größere historische Wirkung gehabt hat. Gerade die Wechselwirkung beider Lesarten legt die universale Dimension karibischer Literaturen offen.
VII.2. Raphaël Confiant Die zeitgenössische literarische Produktion der frankophonen Karibik befindet sich in einem äußerst komplexen kulturpolitischen Kontext. Eine Orientierung sowohl am Pariser Literaturbetrieb und am festlandfranzösischen akademischen Feld als auch an den karibischen und lateinamerikanischen Nachbarn führt zu einer Zuspitzung der Frage, wo denn das literarische Feld der französischen Antillen heute auszumachen sei. Literaturbetrieb und akademisches Feld hängen in Frankreich eng zusammen, und so kommt es nicht von ungefähr, dass die meisten namhaften Autoren der französischen Antillen gleichzeitig Professuren für Literaturwissenschaft bekleiden. Diese Verquickung von Literaturproduktion und kulturtheoretischer Reflexion gilt in besonderem Maße auch für Raphaël Confiant. Raphaël Confiant wurde 1951 geboren und ist seit 1979 Dozent für englische Sprache und Literatur an der Université des Antilles et de la Guyane (Martinique). Er schrieb zunächst kreolisch, verfasste 1988 seinen ersten Roman Eau de Café (dt. Insel über dem Winde) auf Französisch. Für Ravines du devantjour (dt. Das Flüstern der Zamanas) erhielt er 1993 den Premio Casa de las Americas und den Prix Jet Tours. Er gilt neben Patrick Chamoiseau als Mitbegründer der Créolité, die auf frühere Strömungen, wesentlich die Négritude und die Antillanité, Bezug nimmt und sich bemüht, ein neues, vielstimmiges Identitätskonzept zu entwickeln, das, anders als die Ideen ihres Mitstreiters Édouard Glissant, durchaus eine konkrete Beziehung zu den antillanischen Gesellschaften aufweist und damit der Kritik eines neuen Essentialismus ausgesetzt ist. Die nachstehenden Ausführungen sollen dazu dienen, die Relevanz einer auf das 19. Jahrhundert bezogenen Karibikforschung für narrative Karibikinszenierungen der Gegenwart zu untersuchen. Dabei sind folgende zwei Fragen leitend: 1) Im Zuge eines wissenschaftlich häufig zusammengedachten Komplexes Lateinamerika und Karibik stellt sich bei der Untersuchung von Gegenwartsliteraturen die Frage, inwiefern sich ein Schreiben im französischen ÜberseeDepartement von aktuellen lateinamerikanischen Produktionen unterscheidet. Diese Frage stellt sich bewusst der Tendenz entgegen, regional-geographische Zuschreibungen endgültig zu verabschieden (siehe Manifiesto Crack8). 2) Welche Beziehung gibt es zwischen karibischer Theorieproduktion – die sich auf literarisch-philosophischer Ebene vor allem mit den kanonisierten Texten
8
Crack ist der Name einer Gruppe mexikanischer Autoren, die alle um 1968 geboren sind und mit ihrem Manfiesto Crack (1998) eine bewusste Abwendung vom in Lateinamerika allzu dominanten Postulat des «Magischen Realismus» fordern. Die wichtigsten Vertreter sind Jorge Volpi und Ignacio Oadilla. Vgl. Gesine Müller: Die Boom-Autoren heute. García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den «großen identitätsstiftenden Entwürfen». Frankfurt am Main: Vervuert 2004, S. 280f.
244
eines Derek Walcott, Édouard Glissant oder Benítez Rojo einen Namen gemacht hat – und literarischen Ausdrucksformen? Dabei soll der Umgang mit dem Identitätsparadigma im Zentrum stehen, kann doch bei aller Unterschiedlichkeit in der Ausprägung der neuesten lateinamerikanischen und karibischen Literaturen sicherlich eine Gemeinsamkeit konstatiert werden, nämlich die allgemeine Abkehr von diesem Paradigma. Dass Raphaël Confiant dabei eine Protagonistenrolle einnimmt, ist angesichts seines Bekenntnisses zur Créolité nicht verwunderlich. Sein 2005 erschienener Roman Adèle et la pacotilleuse spielt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Karibik, ihrer Diaspora (mit einem Knotenpunkt in Halifax, Kanada) und in Frankreich. Damit drängt sich unmittelbar die Frage auf, ob es sich bei dem Roman um eine nueva novela histórica im Sinne des BolívarRomans von García Márquez oder La Campaña von Carlos Fuentes handelt. VII.2.1. Adèle et la pacotilleuse Getrieben von der unglücklichen Liebe zu einem britischen Offizier, Albert Pinson, begibt sich Adèle Hugo, die Tochter des großen französischen Dichters, auf der Suche nach ihm nach Nordamerika. Nach mehreren Jahren in Kanada, in denen anscheinend Pinson die Liebe nicht erwidert, folgt sie ihm nach Barbados, wo sie erfährt, dass dieser wohl in Birma ist. Tief unglücklich und geistig verstört wird sie (gegen Ende des Jahres 1870) in dieser Situation zwischen zwei um sie kämpfenden Schwarzen von einer pacotilleuse – einer zwischen den karibischen Inseln pendelnden Kleinwarenhändlerin – namens Céline Alvarez Bàà gefunden. Céline, die sowohl afrikanische, andalusische und karibische Ursprünge hat, entwickelt mit der weißen Französin eine Mutter-Tochter-Beziehung und wird sich fortan mit einer selbstlosen Fürsorge um Adèle kümmern und alles in ihrer Macht Stehende tun, um die verstörte junge Frau zu ihrem Vater zu geleiten. Dafür bringt sie die junge Dame nach St. Pierre de Martinique, wo sie unter großen Schwierigkeiten und mit Hilfe von Verdet, einem reichen Verehrer Hugos, Kontakt zu dem Dichter in Frankreich aufnimmt. Adèle wird zwischenzeitlich in eine Heilanstalt gebracht, Céline gelingt es jedoch, sie herauszuholen und mit Hilfe Verdets im April 1872 die Reise nach Paris zu unternehmen. Nach einer kurzfristigen Erholung Adèles wird jedoch deutlich, dass ihre Geistesstörung nicht umkehrbar ist. Céline kehrt zurück in die Karibik und bittet Hugo, dessen Mätresse sie geworden ist, Adèle mit ihr gehenzulassen, da es ihr auf den Antillen besser gehe. Er weigert sich jedoch. Zurück in der Karibik, bekommt Céline einen Brief von Hugo, der sie bittet, nach Paris zurückzukehren, da er bemerkt hatte, dass Céline als einzige eine beruhigende Wirkung auf seine Tochter hat. Zur zweiten Reise kommt es dann im Herbst 1872, bei der Céline von Hugo erstmals als erwachsene Frau behandelt wird. Er bittet sie, bei seiner Tochter zu bleiben, da er wohl bald sterben werde, sie jedoch lehnt ab und geht endgültig zurück in die Karibik. Trotz der Bitte Célines, Adèle nicht in eine Anstalt zu bringen, tut Hugo dies aus Angst, seine Erben könnten seine Tochter nach seinem Tod auf die Straße schicken. 245
Confiant gliedert den Roman in sieben Kapitel. Es handelt sich um einen polyphonen Erzählstil, in dem ein Erzähler und die Protagonisten abwechselnd das Wort haben. Somit kommen mehrere Perspektiven zu Tage, auch immer wieder Bruchstücke mehrerer karibischer Sprachen. Da Confiant auf eine lineare Zeit oder Ortsbeschreibung verzichtet, wird oft erst bei der zweiten oder dritten Erwähnung eines Ereignisses das gesamte Bild klar. Dies trägt zu einer eigentümlichen Lektüre-Dynamik bei. Obwohl der Roman auf Französisch geschrieben ist, wird vermittelt, dass dies nur eine offizielle Sprache für viele ist, mehr nicht. Als Céline in Bordeaux ankommt, wird ihre Sprachwelt zwischen Französisch und Spanisch beschrieben, und es zeigt sich, dass ihr Französisch nicht so präsent ist, weil überall, wo Französisch gesprochen wird, man auch Créole spricht. Céline betet auch nur auf Spanisch oder Englisch, nicht aber auf Französisch. Auf der Ebene der Sprachenvielfalt ist die Schlüsselszene der Moment, als Céline erfährt, dass ihre Mutter auf Haiti im Sterben liegt. Sie besucht Chrisopompe, um ihn einen Abschiedsbrief schreiben zu lassen, und kann sich nicht für eine Sprache entscheiden. Sie wählt schließlich Créole und Chrisopompe erweist sich als wahrer Meister der Verschriftlichung dieser Sprache, die eigentlich keine Schrift kennt. Seine Inspiration hat er von François Marbot, der etwa 1850 auf Créole «Fables de La Fontaine travesties en créole par un vieux commandeur» geschrieben hatte. Eine weitere spannende und sehr originelle Passage ist eine Geisterbeschwörung, die Céline, Adèle und Victor Hugo am Abend des 22. April 1872 um 22:30 halten. Die erste Frage, die sie dem Geist stellen, lautet, welche Sprache sie sprechen sollen. VII.2.2. Von Insularität zu Archipelisierung Beide Frauen, Céline und Adèle, könnten nicht unterschiedlicher sein. Die eine verkörpert Europa, die andere die Karibik in ihrer gesamten Vielfalt, die mehr als Reichtum denn als Hindernis gesehen wird. Diese Vielfalt kann vielfach verteilt, oder auch in einem vereint sein, wie beispielsweise in der Gestalt von Céline und den anderen pacotilleuses. Sie sind es, die die Sprachen dieser Welt sprechen, sie verbinden diese Inseln, und sie sind es auch, die die Käufer dank ihrer Produkte andere Welten erleben lassen. Die Karibik fungiert als Spiegel und Miniaturmodell der gesamten Welt mit Einflüssen aus Europa, der Levante, dem Orient über Indien bis nach China.9 Der ganze Planet scheint in der Karibik seine Träume zu entladen, wie Confiant formuliert: Chaque île, mystèrieusement affectionne un produit, une marchandise, une plante, un outil, des philtres et des onguents particuliers, des tissus dédaignés ailleurs. Pourtant, beaucoup de tout cela ne provient pas de l’Archipel. Toute la planète semble y déverser ses rêves.10
9 10
Vgl. Confiant: Adèle, S. 69–72. Ebda., S. 69.
246
Jede Insel, auf der die pacotilleuses ihre Waren kaufen, hat ihre eigene Spezialität. Auf Kuba sind es Spiegel und Kämme aus chinesischem Schildpatt, auf Trinidad, wo die indigene Bevölkerung noch recht zahlreich vertreten ist, gibt es Gewürze aus Indien. In St. Pierre auf Martinique kommt Seide aus Syrien, Palästina, dem Libanon. Es ist das kleine Paris der Antillen. Céline kauft ihre Ware bei Abdelwahab El Fandour und verkauft ihre Seide in St. Vincent und in Grenada. Aus dem industriellen Europa werden Enzyklopädien, Taschenuhren, Ferngläser, Stifte und Tintenfässer, Sägen und Hämmer, Zirkel und Lineale importiert. Manchmal stößt die pacotilleuse auf ein besonderes, einzigartiges Stück wie die Kristall-Sanduhr des alten Chinesen, von der Céline träumt. Sie wird sie nach seinem Tod bekommen, verspricht ihr der alte Chinese. Jedesmal, wenn sie Jamaika verlässt, hat sie Angst, das Stück nicht wiederzusehen, befürchtend, dass seine Hütte geplündert wird, bevor sie zurückkehrt. Nach fünf Jahren stirbt er an einer Grippe, gepflegt von Céline, die die Sanduhr, die mit Sand aus der Wüste Gobi gefüllt ist, erhält. Sie behält sie zwei Jahre, aber dann verkauft sie sie für ein paar Goldstücke an einen Pflanzer. Sie wird es ihr ganzes Leben lang bedauern. In Grenada gibt es die beste Muskatnuss und der Rum von Martinique ist «l’empereur des rhums». Der Kaffee aus Guadeloupe und der Tabak aus Kuba werden von allen bevorzugt.11 Als Adèle Céline trifft, ist diese 42 Jahre alt. Sie ist auf dem Meer geboren, «fille d’aucune terre, d’aucune de ces îles que se disputent depuis des siècles Espagnols, Anglais, Français, Hollandais, Danois, Suédois, Américains»12. Sie erzählt von den Kleinkrämerinnen, den Vagabundinnen der karibischen See, die keine Heimat haben und das Meer zu ihrem Zuhause gemacht haben: […], nous les pacotilleuses, femmes de vagabondages marin, bien plus en tout cas que ceux qui croupissent dans les îles, rivés à des terres qui ne leur appartiennent pas en propre. Qui ne leur appartiendront jamais. Chaque île, en effet, a conservé son nom caraïbe et c’est pourquoi elle continue d’appartenir au premier peuple qui l’a habitée quand bien même il a été massacré jusqu’au dernier. Nous y demeurons d’éternels locataires, ce qui explique pourquoi nous pouvons nous sentir à l’aise comme Blaise dans n’importe quelle partie du vaste monde. Privés de nos patries d’origines, l’univers est devenu le nôtre.13
Die pacotilleuses stehen für eine besondere solidarité géopolitique mit den Völkern der Karibik und eine solidarité anthropologique (beziehungsweise solidarité créole) mit außerkaribischen Gesellschaften, die durch ähnliche Kolonisationsund/oder Kreolisierungsbedingungen geprägt worden sind. Um ihretwillen erscheinen die Antillen nicht länger als Ort des Dispersen, sondern als ein Ort, an dem das Disperse künftig zusammengeführt, zusammengefügt werden kann.14
11 12 13 14
Ebda., S. 78–82. Ebda., S. 61f. Ebda., S. 303. Ette: Literatur in Bewegung, S. 464.
247
Während die Inselfunktion im 19. Jahrhundert vorwiegend auf Isolation und Exotismus beruhte, hat das archipelische Denken einen konsequent relationalen Charakter.15 So ist Martinique, als das Zentrum des Romans, in einem Inselverbund, welcher Kohärenz in besonderen kommunikativ-sprachlichen und kulturellen «Trans-Prozessen» findet. Archipelisierung wird im Roman zu einem entgrenzten Modell, zur Metapher für die Überwindung geschlossener, nationaler Grenzen.16 Im Traité du Tout-monde definiert Édouard Glissant dahingehend ein «archipelisches Denken»: La pensée archipélique convient à l’allure de nos mondes. Elle en emprunte l’ambigu, le fragile, le dérivé. […] c’est s’accorder à ce qui du monde s’est diffusé en archipels précisément, ces sortes de diversités dans l’étendue, qui pourtant rallient des rives et marient des horizons. Nous nous apercevons de ce qu’il y avait de continental, d’épais et qui pesait sur nous, dans les somptueuses pensées de système qui jusqu’à ce jour ont régi l’Histoire des humanités, et qui ne sont plus adéquates à nos éclatements, à nos histoires ni à nos non moins somptueuses errances.17
Homogenisierende Diskurse – so betont Torsten König –, die den Blick auf die Weltgeschichte bisher bestimmten und die Glissant «kontinental» nennt, müssen angesichts der Vielfalt, in der sich die gegenwärtigen Welten zeigen, angesichts ihrer unterschiedlichen Geschichtsverläufe aufgegeben werden. Die Denkweise, die der Erscheinung der gegenwärtigen Welt angemessen ist, nennt der martinikanische Denker deshalb «archipelisch». «La pensée de l’archipel, des archipels», schließt er den Traité emphatisch mit Topoi der Überwindung von Althergebrachtem.18 VII.2.3. Vom statischen Exilbegriff über den Black Atlantic zum Dazwischen Ein Großteil des Romans spielt sich in Saint-Pierre auf Martinique ab. Wichtiger anderer Handlungsort ist der Wohnsitz Victor Hugos in Paris. Fast die gesamte Erzählung findet zwischen dem großen und kleinen Paris statt, wo die koloniale
15 16
17 18
Vgl. Torsten König: Édouard Glissants pensée archipélique. Zwischen Metapher und poetischem Prinzip. In: Müller, Stemmler (Hg.): Raum–Bewegung–Passage, S. 113–130. Ralph Ludwig, Dorothee Röseberg: Einleitung. In: Ralph Ludwig, Dorothee Röseberg (Hg.): Tout-Monde: Interkulturalität, Hybridisierung, Kreolisierung. Kommunikationsund gesellschaftstheoretische Modelle zwischen «alten» und «neuen» Räumen. Frankfurt am Main: Lang 2010, S. 9–30, hier S. 9. Glissant selbst beschreibt den sich ausweitenden Prozess der Archipelisierung folgendermaßen: «Ce que je vois aujourd’hui, c’est que les continents ,s’archipélisent‘, du moins du point de vue d’un regard extérieur. Les Amériques s’archipélisent, elles se constituent en régions par-dessus les frontières nationales. Et je crois que c’est un terme qu’il faut rétablir dans sa dignité, le terme de région. L’Europe s’archipélise. Les régions linguistiques, les régions culturelles, pardelà les barrières des nations, sont des îles, mais des îles ouvertes, c’est leur principale condition de survie.» Édouard Glissant: Introduction à une poétique du divers. Paris: Gallimard 1996, S. 44 Glissant: Le discours antillais, S. 31. Vgl. König: Édouard Glissants pensée archipélique, S. 117f.
248
Gesellschaft mit ihrer Rassenlehre und -trennung, mit den Vorurteilen, aber auch der Lebensfreude durch Karneval, Sex und Poesie geschildert wird. Auch dass Halifax als Bindeglied zwischen Europa und dem (französischen) Amerika oft beschrieben wird, weil Adèle einige Jahre dort verbringt, ist erwähnenswert. Die Verortung im Dazwischen scheint symptomatisch für die kreolische Oberschicht der Karibik im 19. Jahrhundert. Dieses Dazwischen, von der postkolonialen Theorie auch häufig als in-between bezeichnet, findet seinen stärksten Ausdruck im Meer als dem zentralen Handlungsort, die wirkliche Verbindung zwischen Europa, Karibik und Afrika. Céline sagt, sie fühle sich nur unterwegs, also auf einem Schiff, wohl.19 Das Schiff stellt hier eine Art Schwellenraum dar: Es kann gleichsam als Vehikel betrachtet werden, das die Grenzen der Zeitebenen passiert, den Protagonisten von einer Ebene in die andere befördert und so ein Pendeln zwischen Zeitebenen und Räumen ermöglicht. Das Exil spielt eine große Rolle, wie sie festhält: «C’est que l’exil est notre condition, à nous les AmérindiensNègres-Blancs-Mulâtres-Chabins-Indiens-Chinois-Syriens de L’Archipel. L’exil nous a crée.»20 Das Tagebuch von Adèle heißt denn auch journal d’exil. Bezeichnenderweise gibt es aber eine kritische Auseinandersetzung mit dem Exilbegriff: «Le mot exil n’a pas le même sens pour Adèle et pour moi.»21 Für Céline ist das Exil der Zustand der einheimischen Bevölkerung, der Schwarzen, Weißen, Mulatten, Chabin, Inder, Chinesen, Syrer des Archipels. Es ist das Exil, das sie erschaffen hat. Sie mögen an sich das Meer nicht, es sei denn, sie sind Matrosen oder pacotilleuses. Célines Vater hasste das Meer, da es Seelen verschlingt. «L’Atlantique est le plus grand cimetière du monde.»22 Er war ein ehemaliger Sklave, der nach der Abschaffung der Sklaverei bei seinem Herrn blieb. Für Adèle ist das Exil eine Prüfung, eine Zerreißprobe. In Adèles Tagebuch, das Céline liest, wenn sie schläft, spricht sie über ihres Vaters Exil auf Jersey und Guernsey. «Exil» als konventionelles Migrationskonzept wird kritisch hinterfragt, insofern es als solches eine binäre Opposition zwischen Zentrum und Peripherie stabilisiert. Confiant spielt mit dem Kräfteverhältnis zwischen dem kolonialen Europa und der kolonisierten Karibik. In Form der Beziehung zwischen Adèle und Céline ist es die Karibik, die die Mutterrolle annimmt, während Europa die hilfsbedürftige Tochter ist. Man kann das Ganze auch als gegenseitige Zuneigung sehen. Céline möchte unbedingt eine Tochter haben (und nennt auch Adèle «ma fille»), Adèle sieht in ihr die Mutter und eröffnet ihr nach kurzer Zeit:
19
20 21 22
Das Meer nicht als verschiedene Landmassen voneinander trennendes, sondern diese miteinander verbindendes und überdies als bewegliches Element an sich, diese Idee hat ihre erste Konjunktur bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts dank der Schriften Alexander von Humboldts. Vgl. Ette: Alexander von Humboldt, S. 105f. Confiant: Adèle, S. 59. Ebda., S. 67f. Ebda., S. 60. Vgl. auch Paul Gilroy: The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press 1993.
249
Et toi négresse, tu es devenue presque une mère pour moi. Tu es la première personne à m’écouter sans me juger. Tu ne me traites point de folle à lier lorsque je te parle de l’amour que j’éprouve pour Albert Pinson. Tu me comprends, toi qui n’as jamais mangé dans une assiette en porcelaine ni dansé le menuet. Toi, Céline Alvarez Bàà ! Et comme Bug-Jargal adressant à D’Auverney, le colon blanc, cette requête sublime : «puis-je t’appeler frère ?», je te réclame désormais pour mère. Oui…23
Als Céline zu ihrem ersten Besuch in Paris ist, wird deutlich, wie Hugo als Hausherr auch im Sexuellen immer wieder wie selbstverständlich über die bediensteten Frauen verfügt und nun auch über Céline. Er überwältigt sie regelrecht. Dass Céline dies nicht als Vergewaltigung sieht und zum Teil Gefallen daran findet, zeigt folgendes Zitat, das geradezu als Persiflage auf Insel-Theorien zu lesen ist: Aussitôt le calme revenu, Hugo retrouvait son énergie habituelle, énergie étonnante pour un homme au seuil de la vieillesse. Nous montions au galetas, par une sorte d’accord tacite, et il se jetait sur ma personne, me labourait les chairs, les yeux curieusement clos. Je me laissais faire quoique j’éprouvai rarement du plaisir. La sensation d’être happée par une houle déchaînée, d’être soulevée, roulée, triturée comme si je ne pesais pas davantage qu’un fétu de paille, m’était par contre fort agréable. Je devenais une île, une petite île tropicale, que couvrait, de son aile l’immense, la puissante Europe.24
Hier wird die Übermacht Europas dargestellt. Hugo bezeichnet Céline als Täubchen und möchte im Gegenzug als Löwe gesehen werden. Aber auch hier trügt der erste Schein, denn Céline macht deutlich, dass Hugo sie vielmehr als Greifvogel, als Adler, betrachtet. Ein Konkurrenzdenken ist bei Michel Audibert zu bemerken, einem mulattischen Dichter und Liebhaber Célines. Audibert hatte Hugo übelgenommen, dass er mit keinem Wort die Aufstände auf Martinique erwähnte und kritisierte ihn als negrophob. Die stereotypisierte Darstellung wird auf die Spitze getrieben, als der Mulatte erfahren muss, dass Céline bei Hugo war, woraufhin er den Kontakt zu ihr abbricht. Das koloniale Kräfteverhältnis verlagert sich auf eine Konkurrenzsituation in der Frage, wer der bessere Dichter sei. VII.2.4. Von Identitätskonzepten zu Fragen des Zusammenlebens Confiant lässt immer wieder Situationen entstehen, in denen der Glaube der Zeit an die unterschiedlichen Rassen deutlich wird. Dass im 19. Jahrhundert, angesichts der kolonialen Konstellationen, die Frage nach dem Zusammenleben der ethnischen Gruppen besonders dicht verhandelt wird, liegt nahe:25 Alexandre Verdet liest den Essai sur l’inégalité des races humaines des Comte de Gobineau. Er verbietet Céline und Adèle, sich ein Zimmer zu teilen. Adèle erzählt, wie Hugo selbst ihr und ihrem Bruder, wenn sie unartig waren, Angst machte, er werde sie beide zu Bug-Jargal schicken. Doch sie erzählt Céline auch, dass sie seit Kanada ganz andere, vor allem positive Erfahrungen mit Schwarzen gemacht habe.
23 24 25
Confiant: Adèle, S. 53. Ebda., S. 271. Vgl. dazu Kap. I.6.
250
Dass sie biblische Namen tragen, wird implizit als Zeichen ihrer Zivilisierung verstanden. Sowohl Hugo als auch Verdet bauen jedoch ihre Vorurteile ab. Hugo sagt noch, dass, hätte er mehr von den Schwarzen gewusst, bevor er Bug-Jargal schrieb, diese Erzählung wohl nicht zustande gekommen wäre.26 Die Ärzte Rufz und de Luppe, die in der Anstalt auf Martinique arbeiten, zeigen einen offenen Rassismus – Schwarze könnten ja den Verstand nicht verlieren, weil sie keinen hätten.27 Henry de Montaigue macht eine Beobachtung, was den Umgang zwischen Mulatten und Schwarzen auf Martinique angeht: La haine entre les deux races, qui pourtant se côtoyaient journellement, m’avait interloqués. Ce n’est pas que j’éprouvai une affection particulière pour les gens de couleur, mais ceux de la Martinique me paraissaient si policés, si bien moulés dans la culture française, que j’en oubliais leur origine. D’ailleurs, personne n’évoquait l’Afrique !28
Adèle erzählt Céline von ihrem Vater. Sein erstes Werk Bug-Jargal hatte er mit sechzehn geschrieben, es spielt in Westindien. Er beschreibe die Schwarzen als «des créatures étranges, à peine sortis de l’animalité, sanguinaires […] mais dotés d’un sens de la ruse […] qui pouvait dérouter les esprits européens trop engoncés dans la froide raison magnifiée par Descartes»29. Für Victor Hugo zähle die Seele mehr als der Verstand: «les sensations de l’âme sont mille fois supérieures aux arguties de l’esprit […] Des forces invisibles nous entourent – que nous pouvons approcher en faisant tourner les tables.» Hugo glaubt, die Schwarzen seien die einzige Rasse, die sich diesen Kräften nicht verschließen. Und das erkläre ihren Sieg über Napoleons Truppen. Adèle erhielt einen Schock beim Anblick eines Schwarzen am Kai von Halifax, der gar in der Lage war, perfektes Englisch zu sprechen.30 Während in früheren Romanen des martinikanischen Schriftstellers identitäre Plädoyers, wie die Creolité-Diskurse, entwickelt wurden, die nie ohne essentialistische Zuschreibungen auskamen, wird mit einer Beleuchtung ethnischer Konstellationen im 19. Jahrhundert auf die historischen Zusammenhänge aufmerksam gemacht, die sich auch damals nie auf plakative Beschreibungsmuster wie «durchrasste Gesellschaft» reduzieren ließen. Die historische Inszenierung eines Miteinanders tritt an die Stelle eines Programms. Damit vollzieht Confiant in seinem Roman den Abschied von einer spezifischen Art karibischer Identitätskonzepte hin zu Fragen des Zusammenlebens. Im Unterschied zu den anderen hier vorgestellten inszenierten Paradigmenwechseln der Karibikforschung wie Archipelisierung ist dieser weniger theoretisch fundiert, dennoch kann die latente Präsenz des Themas Zusammenleben als Symptom gesehen werden, dass sich
26 27 28 29 30
Confiant: Ebda., S. Ebda., S. Ebda., S. Ebda., S.
Adèle, S. 276. 166. 232. 60f. 57–61.
251
ZusammenLebensWissen31 als theoretisches Paradigma durchsetzen wird, was sich ausführlicher in Kap. VIII.1 darstellen wird. VII.2.5. Topoi der Karibikforschung oder von der Créolité zum Tout-monde Raphaël Confiant nimmt in Adèle den Topos der Karibikforschung auf, die Karibik als ein «Laboratorium der Moderne» zu lesen, das nicht nur Objekt europäischer Theoriebildung ist, sondern sich international einen wichtigen Namen mit der Produktion von Kulturtheorien gemacht hat. Der Roman weist durchaus einige Gemeinsamkeiten mit dem Genre des neuen historischen Romans auf: dem europäischen chronologisch-linearen Geschichtsverständnis wird keine literarische Konstruktion mit zyklischer Zeitstruktur und mythischen Elementen mehr als Alternative gegenübergestellt. Der Filter der Subjektivität und der persönlichen Gestaltung wird durch den Erzähler explizit reflektiert. Confiant illustriert, dass Geschichte überhaupt nur subjektiv sein kann, das heißt für ein Subjekt, das sie rezipiert und erzählt. Im Zuge dieser Selbstreflexion werden geschichtsphilosophische Voraussetzungen – etwa Kontinuität, Progression und Teleologie – als Konstruktionen entlarvt. Durchaus symptomatisch für den Wandel in Literatur und Geisteswissenschaften nach der Moderne treten an die Stelle der einen universalen Geschichte (history) die vielen erzählten Geschichten (stories), die ohne Absolutheitsanspruch koexistieren. Mit der Fokussierung auf Fragen der Wissenszirkulation und unterschiedlicher Transferprozesse geht der Blick weg von der Frage nach Geschichte und Erinnerung. Im Gegensatz zum klassischen neuen historischen Roman erfährt hier das 19. Jahrhundert als Hintergrundsfolie für aktuelle Debatten eine Aufwertung, da weniger der Inszenierungscharakter von Geschichte auf einer Metaebene problematisiert wird, als dass historiographisch etablierte Relationalitäten eine Transformation erfahren. Der Roman schreibt sich ein in den längst etablierten «trans-nationalen Turn». Schreiben im Dazwischen, die pacotilleuse als exemplarische Trägerin subversiven Wissens, Relationalität, Archipelisierung: diesen Paradigmen ist gemein, sich von der Konzentration auf Identitätskonstruktionen zu lösen und die Karibik als Fallbeispiel eines «Erprobens von Zusammenleben»32 hin auf universale Dimensionen zu öffnen. Es geht nun nicht mehr darum, Identitätskonstruktionen als essentialistisch zu entlarven, sondern Identitätsfragen an sich für obsolet zu erklären. Raphaël Confiant bietet mit seinem Adèle-Roman einen Rückgriff auf eine frühere Phase beschleunigter Globalisierung, um mit ihr vor Augen zu führen, dass viele der Phänomene, die wir für unsere heutige Zeit als charakteristisch betrachten, viel früher angelegt waren, als heute angenommen. Dass er dabei mit den Konzepten jongliert, nimmt nicht wunder, hat er als Literaturwissenschaftler doch einen besonderen Zugang zu den Inhalten. Damit stellt sich aber die Frage nach der Erwartungshaltung und Orientierung am Lese-
31 32
Ette: ZusammenLebensWissen. Vgl. ebda.
252
publikum. Haben die Diskurse des Booms der lateinamerikanischen Literatur und des Magischen Realismus, die eine Erwartungshaltung hinsichtlich des Exotischen und spezifisch Lateinamerikanischen erfüllten, spätestens mit Crack und McOndo eine Absage in Form von Manifesten erhalten, orientieren sich die frankokaribischen Autoren des gegenwärtigen Jahrzehnts an der Erwartungshaltung bezüglich einer Theorieproduktion, die – mit Vertretern wie Confiant und Glissant – aus der Karibik stammt, sich aber universal öffnet. So unterzieht auch Confiant seinen Éloge de la Créolité von einst einem kritischen Rückblick. Was aber wird dieser Kritik entgegengehalten? Glissant nennt sein alternatives Modell Tout-monde (All-Welt). Er macht eine Sicht der Welt zur Leitvorstellung, die die negativen Globalisierungstendenzen durch ein positiv verstandenes Chaos-Modell ersetzt, welches nichthierarchisierte Beziehungen zwischen den Elementen des Diversen stiftet, wobei dieses Netz nicht starr, sondern vielmehr ein beständiger Prozess ist. Le Tout-monde, c’est le mouvement tourbillant par lequel changent perpétuellement – en se mettant en rapport les uns avec les autres – les cultures, les peuples, les individus, les notions, les estéthiques, les sensibilités etc. C’est ce tourbillant… Parce que quand on dit une conception du monde, c’est un a priori qui donne au monde un axe et une visée. Le Tout-monde, c’est la conception du monde sans axe et sans visée, avec seulement l’idée de la prolifération tourbillante, nécessaire et irrépressible, de tous ces contacts, de tous ces changements, de tous ces échanges.33
Adèle et la pacotilleuse vermittelt eine konsequente Umsetzung des von Glissant formulierten Kreolisierungs- oder auch Tout-monde-Konzepts. Die Literatur ist ihrer eigenen Theorie voraus, wenn Confiant auf theoretischer Ebene weiterhin auf dem alten, wenn auch modifizierten Créolité-Konzept beharrt, aber literarisch alle paradigmatischen wissenschaftlichen Verschiebungen umsetzt. Für ein Fazit mag der erste Satz des Romans stehen: Il n’est pas vrai qu’il suffit de porter à l’oreille une conque de lambi au rose nacré pour entendre les rumeurs de l’Archipel. On n’y percoit que musiques indéchiffrables et douleurs inapaisées. Celles-ci jaillissent du Tout-Monde, de l’Afrique-Guinée à jamais perdue, de l’Europe, impacable vigie qui n’a de cesse de ricaner avec tant et tellement de hautaineté. D’autres terres aussi dont j’ai peine à prononcer les noms et à imaginer l’étendue.34
33 34
Édouard Glissant: À propos de Tout-Monde. Ein Gespräch mit Ralph Ludwig. Marie Galante 17.08.1994, zit. nach Ludwig, Röseberg: Einleitung, S. 10. Confiant: Adèle, S. 13. Vgl. dazu auch Ludwig, Röseberg: Einleitung.
253
VIII. ZusammenLebensWissen oder von der Relevanz einer Karibikforschung zum 19. Jahrhundert
VIII.1. Wissensnormen von Zusammenleben: Utopien von Caribeanidad In Anlehnung an die dritte These, die dieser Studie vorangestellt wurde, soll nun, nach dem Exkurs in Gegenwartsliteraturen, ein Sprung gewagt werden, der die bereits besprochenen Texte einer paradigmatisch neuen Lesart unterwirft. Sie knüpft an an die in der Einleitung exponierte Frage nach dem Zusammenleben. Inwiefern ist das theoretische Handwerkszeug, das von aktuellen Theoretikern wie Gilroy, Appadurai, Mignolo und vor allem Ette entwickelt wurde, dienlich für Texte aus dem 19. Jahrhundert? Für die Frage, inwiefern Wissensnormen von Zusammenleben in literarischen Texten inszeniert werden, sollen nun Beispiele für die Zeit vor 1848 Beispielen nach 1848 gegenübergestellt werden, die die explizite Vermittlung eines Programms vom guten oder idealen Zusammenleben lesbar machen. Sie erweisen sich als besonders dienlich, um auf das Potential eines normativen Gehalts der Texte aufmerksam zu machen: für die Zeit vor 1848 zum einen die Utopien einer Sklavenhaltergesellschaft und zum andern einer vereinten mischrassigen Gesellschaft. Für die Zeit nach 1848, vor allem charakteristisch für die hispanophone Karibik in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Utopien von Caribeanidad. In dem 1835 veröffentlichten Roman Outre-mer des aus der französischen Kolonie Martinique stammenden Béké-Autoren Maynard de Queilhe wird die Utopie einer friedlichen Sklavengesellschaft gezeichnet. Wie bereits gezeigt, repräsentiert dieses literarische Beispiel das Modell eines idealen Zusammenlebens auf der Grundlage einer Gesellschaftsordnung, in der jeder seinen Platz hat und in der die Sklaven bestens behandelt werden. Während die Pro-Sklaverei-Haltung eines Maynard de Queilhe symptomatisch ist für die Pflanzer-Schriftsteller der französischen Antillen, gibt es durchaus auch utopische Zukunftsprojekte, die die Vermischung der «Rassen» positiv sehen. Es ist kein Zufall, dass diese Ideen oft in den kolonialen Zentren entstehen. So kann man ein Jahr nach dem Erscheinen von Outre-mer in der sklavereikritischen Revue des Colonies von der Utopie einer neuen, gemischten Rasse lesen: De ces blancs, de ces noirs, de ces rouges, il se fondera une race mélangée d’Européens, d’Africains et d’Américains, qui en quelques générations et au travers des croisements divers, arrivera, par le brun, le carmélite, le prune – monsieur, l’orangé, à un jaune pâle, légèrement cuivré. Toutes ces singularités, toutes ces merveilles de civilisation qui élèvent et intéressent notre cœur et notre esprit, sont plus ou moins prochaines.1
1
Revue des Colonies (Juli 1836), S. 20f.
255
Dank der bevorstehenden Vermischung, die noch unvorhersehbare Ergebnisse mit sich bringen wird, sind Zivilisationswunder zu erwarten – eine für die Zeit sehr ungewöhnliche Wissensnorm von Zusammenleben, die in diesem Zitat vermittelt wird. Ab 1860 betritt in der spanischen Karibik eine neue Gruppe die Bühne: Die puertoricanischen Intellektuellen Ramón Emeterio Betances und Eugenio María de Hostos sowie der Kubaner Antonio Maceo hatten festgestellt, dass sie die gleiche Geschichte teilen. Antonio Maceo war ein überzeugter Antirassist. Er war gegen die Sklaverei, gegen eine Ungleichheit der Rassen und gegen jede Form von Unterdrückung. Sein Einsatz für bessere humanitäre Voraussetzungen war unweigerlich an den Kampf um eine koloniale Unabhängigkeit von Spanien gebunden. Dies implizierte für ihn ein Engagement für die «Würde der schwarzen Rasse»2. Und dies wieder führte Maceo, genau wie Betances, zu einer starken Orientierung an Haiti. Auch Haiti sollte Teil der neuen karibischen Föderation sein. Antirassistische und pro-karibische Haltungen verschmelzen bei Maceo zu einem Programm, das einen Namen hat: Caribeanidad. Betances hatte selbst auch europäische und afrikanische Vorfahren. Er verbrachte sein ganzes Leben damit, für die Unabhängigkeit Puerto Ricos und Kubas zu kämpfen und sich für eine karibische Konföderation einzusetzen, wie er es auch in einer Rede in Port-au-Prince im Jahre 1870 tut: De ese modo, hermanos míos, nuestro pasado está tan entretejido que no puedo trazar un boceto histórico de Cuba sin encontrar otros rasgos que ya están inscritos en la historia de Haití. Ya no nos está permitido separar nuestras vidas respectivas. Lo repito: desde un punto al otro de la mayor isla del mar Caribe, cada mente está agitada por la misma cuestión: el futuro de las Antillas. ¿Quién puede ser tan ciego como para no verlo? Llevamos adelante la misma lucha; luchamos por la misma causa, por eso tenemos que vivir una misma vida […] Unidos formaremos esa cadena de fuerzas que dominará a nuestros enemigos, la única red capaz de salvarnos […] Vano será que España intente aplastar la insurrección, venderles más tarde Cuba a los Estados Unidos y abrir el camino para la absorción de todas las Antillas por parte de la raza anglosajona. Unámonos, amémonos los unos a los otros, formemos un solo pueblo.3
Für Eugenio María de Hostos waren die Antillen ein abstraktes Szenarium, das er erst wieder betreten sollte, nachdem er lange Jahre in Spanien gelebt und Nord- und Südamerika bereist hatte. Sein Denken entwickelte sich entscheidend auf der Achse zwischen der Veröffentlichung von Bayoán 1863 und der Liga de los Independientes 1876. La peregrinación de Bayoán unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen kanonisierten Gründungsfiktionen in Lateinamerika und entspricht nicht der von Doris Sommer etablierten Lesart einer foundational fiction. Der innovative Charakter von Bayoán liegt in der Distanznahme von einem organischen
2 3
Philippe Zacair: Haiti on his mind. Antonio Maceo and Caribbeanness. In: Caribbean Studies 33 (2005), S. 47–78, hier S. 57. Luis Bonafoux: Betances. San Juan de P.R.: Instituto de Cultura Puertorirqueña 1970, S. 114f., zit. nach Zacair: Haiti on his mind, S. 51.
256
Nationsmodell und dem Plädoyer für ein supra-nationales Modell. Der Roman wurde 1863 zunächst in Spanien veröffentlicht, mit der Absicht, die liberalen Kreise der spanischen Gesellschaft zu erreichen. Die Rezeption fiel – mit der bekannten Ausnahme Giner de los Ríos – sehr spärlich aus. Um so erstaunlicher, dass der Roman auf Puerto Rico selbst verboten wurde. Laut Richard Rosa liegt die politische Funktion des Romans gerade darin, dass er sich direkt an die spanischen Liberalen richtet: La novela en ese sentido tiene un carácter político explícitamente dirigido a los liberales españoles – muchos de los cuales eran amigos y compañeros de Hostos – para que incluyan dentro de su agenda política la reforma administrativa y económica de las relaciones con las Antillas, que se manifiesta en una nueva reunión familiar. Hostos pensaba que al leer la novela éstos quedarían convencidos de que es no sólo conveniente sino necesario incluir en su política una reforma colonial que podía hasta incluir la idea de la federación.4
Hostos ging es um eine Umwälzung der spanischen Gesellschaft. Erst wenn es gelingen sollte, diese zu vollziehen, könne man auch auf produktive Weise den Blick in Richtung Antillen lenken. […] lo que había implícito no era meramente un tipo de proyecto pro-colonial o conciliatorio sino una tentativa de transformar por completo el sistema político y hasta cultural de España operar una descentralización completa de este que esperaba ver con el acceso al poder de los demócratas y federalistas peninsulares.5
Die Antillen selbst waren für Hostos jedoch unbekanntes Terrain, was zu einer gewissen Idealisierung führte. Seine Rede vor dem Ateneo de Madrid im Jahre 1868 zeigt seinen klaren Bruch mit den spanischen Liberalen. Die Föderation ist für ihn die «república absoluta» und die «alianza libérrima de todas las parcialidades nacionales». Yo soy americano: yo tengo la honra de ser puertorriqueño y tengo que ser federalista. Colono, producto del despotismo colonial... me vengué de él imaginando una forma definitiva de libertad y concebí una confederación de ideas, ya que me era imposible una confederación política. Porque soy americano, porque soy colono, porque soy puertorriqueño, por eso soy federalista. Desde mi isla veo a Santo Domingo, veo a Cuba, veo a Jamaica, y pienso en la confederación: miro hacia el norte y palpo la confederación, recorro el semicírculo de islas que ligan y «federan» geográficamente a Puerto Rico con la América Latina, y me profetizo una confederación providencial.6
Hostos nimmt eine dezidiert politische Haltung ein und hat als erklärtes Ziel die Unabhängigkeit Kubas und Puerto Ricos. Sein Lateinamerikanismus entstand nicht etwa erst nach seiner Reise auf das lateinamerikanische Festland (nach
4 5 6
Rosa: Los fantasmas de la razón, S. 46. Ebda., S. 45. Eugenio María de Hostos: Discurso y rectificación en el Ateneo de Madrid, 20 de diciembre de 1868, S. 97f., zit. nach Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo, S. 47.
257
Peru), sondern er äußert sich bereits vorher, beispielsweise im Text «En el Istmo», den er 1870 in Panama schreibt, kurz vor seiner Schiffsreise nach Peru. Seine Auffassung kommt auch in einem Artikel von 1876 deutlich zum Tragen: Horizonte más extenso todavía, el designio culminante de Bolívar – la unión latinoamericana –, tiene una forma accesible en nuestro tiempo. Esta forma es la liga diplomática de todos los gobiernos de esta América, en una personalidad internacional. Por falta de esa personalidad carece de fuerza ante el mundo nuestra América Latina. De todos los obstáculos que dificultan la institución de esa personalidad internacional, la falta de un interés común es la mayor. Ni gobiernos, ni pueblos, nadie hay en los pueblos latinoamericanos que no sepa, que no presienta que es interés común de todos ellos la independencia de las Antillas.7
Bei Hostos verschmelzen Puertorriqueñismo, Antillanismo, Latinoamericanismo und Americanismo. Gemeinsam ist all seinen Konzeptionen, dass sie sich nicht auf ein rein geographisches Territorium beziehen. Ein zentraler Unterschied zwischen Betances und Hostos besteht darin, dass Betances Haiti immer in seine Überlegungen mit einbezieht, während es bei Hostos keine Rolle spielt. Im Zuge seines Aufenthalts in New York gibt letzterer eine klare geopolitische Definition seiner Bestrebungen: Pienso que es necesario que América complete la civilización, sirviendo a estas dos ideas: unidad de la libertad por la federación de las naciones; unidad de las razas por la fusión de todas ellas. A este trabajo han de concurrir todos los miembros del Continente; tierra firme e islas: la tierra firme ha entrado en fusión... fuera de la esfera de acción americana, intentando entrar en ella, las Antillas ¿qué son las Antillas? El lazo, el medio de unión entre la fusión de tipos y de ideas europeas de Norte América y la fusión de razas y caracteres dispares que penosamente realiza Colombia (la América Latina): medio geográfico natural entre una y otra parte del Continente, elaborador también de una fusión trascendental de razas, las Antillas, son, políticamente, el fiel de la balanza, el verdadero lazo federal de la gigantesca federación del porvenir; social, humanamente, el centro natural de las fusiones, el crisol definitivo de las razas.8
Die Vorstellung eines Zusammenlebens der Rassen hat bei Hostos sowohl eine politische als auch eine kulturelle Seite, ihre Vereinigung dient gleichberechtigt neben dem Zusammenschluss der Nationen auch der übergeordneten Vorstellung der Einheit. Hostos proklamiert «la confederación de todas las Antillas y, como fin por venir, la liga de la raza latina en el nuevo continente y en el archipiélago del Mar Caribe».9 Die beiden Ideen der Rassenverschmelzung und der antillanischen Konföderation verbinden sich unmittelbar auch in der Programmschrift der Liga de los Independientes:
7 8 9
Hostos’ Artikel «Lo que intentó Bolívar» erschien am 21. Dezember 1876 in La Opinión Nacional, zit. nach Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo, S. 49. Eugenio María de Hostos: Diario, Eintrag vom 28. März 1870, S. 284f., zit. nach Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo, S. 48. Brief an J.M. Mestre vom 7. November 1870, zit. nach Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo, S. 50.
258
En las Antillas, la nacionalidad es un principio de organización en la naturaleza; porque completa una fuerza espontánea de la civilización, porque sólo en un pacto de razón puede fundarse, y porque coadyuva a uno de los fines positivos de sociedades antillanas, y al fin histórico de la raza latinoamericana. El principio de organización natural a que convendrá la nacionalidad en las Antillas, es el principio de unidad en la variedad. La fuerza espontánea de civilización que completará, es la paz. El pacto de razón en que exclusivamente puede fundarse, es la confederación. El fin positivo al que coadyuvará, es el progreso comercial de las tres islas. El fin histórico de raza que contribuirá a realizar, es la unión moral e intelectual de la raza latina en el Nuevo Continente.10
Die geopolitisch strategische Lage des karibischen Archipels propagiert Hostos als «[c]entro del mundo civilizado, camino del comercio universal, objetivo de la industria de ambos mundos, fiel de una balanza que ha de pesar algún día los destinos de la civilización cosmopolita.»11 Das Konzept der Rasse ist bei Hostos, wie bei seinen Kollegen, nicht differenziert entwickelt und in sich sehr widersprüchlich. Die essentialistische Dimension bleibt auch bei ihm die Basis für ein Zusammenleben. Auf der einen Seite identifiziert er eine «verdadera raza de las Antillas» als eine Fusion aus afro/latino/ amerikanischen Elementen. Auf der anderen Seite beinhaltet sein Reden von raza blanca und subrazas den rassistischen Diskurs aus Europa. Diskurse der Differenz machen zwar das Denken von Hostos, Betances und Maceo aus, jedoch werden sie im Gegensatz zu früheren Texten produktiv umgesetzt. Die Caribeanidad eines Maceo will Differenz auflösen. Dass diese Idee als Utopie ganz im Sinne von Hostos über den karibischen Archipel hinausgeht, spricht für die universale Dimension.
VIII.2. Wissensformen von Zusammenleben. Ein ethnographisches Suchen oder die Frage der Distanz und des Abstands zum Anderen12 Wenden wir den Blick nun weg von normativen Versuchen, Zusammenleben zu projizieren, und konzentrieren uns auf Wissensformen. Diese manifestieren sich im Bemühen um Selbstverortung oder Verortung des Anderen, entweder explizit beschreibend oder als implizite Suche. So nimmt J. Levilloux in Les créoles ou la Vie aux Antilles (1835) das ethnische Kastensystem durchaus kritisch unter die Lupe. Les blancs laissent tomber le mépris sur les mulâtres. Ceux-ci laissent à leurs pères la haine de l’envie et se vengent sur les noirs de la nuance dégradante d’épiderme dont ils sont héritiers. De leur côté, les nègres reconnaissant la supériorité des blancs, repoussant
10
11 12
«Programa [de la Liga] de los Independientes», erschienen in La Voz de la Patria (13. Oktober–24. November 1876), zit. nach Gaztambide Géigel: La geopolítica del antillanismo, S. 51. Ebda., S. 51. Vgl. Ette: Literaturwissenschaft, S. 28.
259
les prétentions de la classe de couleur, conspirent contre les uns parce qu’ils sont maîtres, et haïssent les autres parce qu’ils aspirent à le devenir.13
Hier wird deutlich, dass das oft als normativ proklamierte ethnische Kastensystem von allen beteiligten Gruppen ständig in Frage gestellt wird. Von allen Seiten versucht man, die Barrieren aufzubrechen. Aufschlussreich ist auch Levilloux‘ Darstellung der Weißen: «Les créoles, descendants des colons européens: intelligences légères, en général incultes, mais vives, pénétrantes, enthousiastes du merveilleux, dédaigneuses des connaissances philosophiques de l’Europe.»14 Der Ist-Zustand, die Selbstverständlichkeit definitorischer Schärfe, erfährt eine Relativierung durch die erstaunliche Selbstkritik eines weißen Autors aus Martinique: den eingestandenen Mangel an Intelligenz. Hier wird klar: Weiß ist nicht gleich weiß. Wer sind Kreolen? Welcher Weiße schreibt für welche Weißen? Bei Levilloux zeigt sich an einer Stelle, inwieweit die Unsicherheit des WeißSeins unmittelbar an eine Angst der kreolischen Oberschicht gekoppelt ist, meist eine Angst, die Privilegien der guten alten Zeiten zu verlieren: «Les hommes sentaient le vieux monde s’abîmer sous leur pieds et se jetaient déjà vers cet avenir si prochain où devait se reconstruire une nouvelle société.»15 Die gute alte Zeit ist vorrevolutionär, und in Erinnerung an das Trauma der Französischen Revolution fühlt man sich am Vorabend der Abschaffung der Sklaverei im französischen Kolonialreich an den Vorabend von 1789 erinnert. Man befürchtet, dass sich in der Zukunft neue Formen von Zusammenleben entwickeln werden. Das Unvorhersehbare macht Angst. Auf den Zusammenhang von Angst und Rassediskursen hat Nell Irvin Painter eindrücklich hingewiesen, indem sie ausführt, inwiefern rassische Diskurse immer soziale, politische und ökonomische Dimensionen haben. So argumentiert sie, was die Diskurse der Rassenlehre im Europa der 40er-Jahre des 19. Jahrhunderts angeht: In truth, the era’s sociopolitical context had created much anxiety. The Western world was being buffeted by an extraordinary set of crisis in the mid–1840s. In France, Germany, Italy and central Europe, political unrest spurred by widespread unemployment and poverty culminated in revolution 1848. Such uprisings crystallized the thinking of writers eager to interpret class conflict as race war. In France, Arthur de Gobineau wrote his Essay on the Inequality of Races, published in the mid–1850s. Robert Know in London published his mean-spirited lectures on race in 1850 as Races of Men: A Fragment.16
Gerade der Versuch, das undefinierbare Dazwischen der gesellschaftlichen Position und identitären Selbstverortung des Mulatten zu fassen, offenbart die Anstrengung der Weißen, weiß zu sein. So die bereits erwähnte zwiespältige und rassistisch eingefärbte Verortung der Mulatten in einem widersprüchlichen Zwischenraum.
13 14 15 16
Levilloux: Les créoles, S. 9f. Ebda., S. 19. Ebda., S. 21. Painter: The History of White People, S. 137.
260
Ce mulâtre, il ne faut pas l’oublier, ce n’était pas un homme comme un autre. C’était une image de ces fortes natures où les précipices, les plantes vénéneuses et les animaux malfaisants abondent, mais où néanmoins on doit aller chercher les merveilles les plus estimées de cet univers.17
Selbst aus Sicht der Schwarzen werden die Mulatten bedauert, ihre Lage im Dazwischen wird als erbärmlich wahrgenommen: Die Kräuterheilerin Iviane aus Les créoles ou la Vie aux Antilles zeigt Mitleid mit dem Protagonisten Estève, was Levilloux durch bewusst fehlerhaftes Französisch inszeniert und damit die Hochsprache als die verbindliche normgebende Instanz relativiert. Interessanterweise spielt hier der Nationsbegriff eine Rolle. «Moi possédée de Dieu seul, répliqua la vieille. Vous mulâtre, moi negresse. Nation à moi est grande dans un grand pays. Vous pas avoir une nation, vous.»18 Ebenfalls auf der Suche nach einer treffenden Beschreibung des Mulatten, kommt die Revue des Colonies zu ähnlichen Schlüssen: Le nègre est issu d’un sang pur ; le mulâtre est au contraire issu d’un sang mélangé ; c’est un composé du noir et du blanc, c’est une espèce abâtardie. D’après cette vérité, il est aussi évident que le nègre est au-dessus du mulâtre, qu’il l’est que l’or pur est au-dessus de l’or mélangé.19
Ein forcierter Reinheitsanspruch muss herhalten, um eine Grenzziehung zwischen Schwarzen und Mulatten durch «das Blut» zu erreichen. Die bereits als Wissensnorm von Zusammenleben im Pro-Sklaverei-Zitat von Maynard de Queilhe vorgestellte literarische Textstelle zum Thema der unmöglichen Ideentransfers zwischen Metropole und Kolonie20 erfährt als Wissensform von Zusammenleben in Les créoles ou la Vie aux Antilles eine neue Ausprägung. In einem Brief an seinen Sohn warnt der Vater vor den Ideen der Französischen Revolution. Gleichheit kann es in den Kolonien nicht geben: Il est important, mon fils, de te prémunir contre les maximes et les théories qui envahissent maintenant tous les esprits, et auxquelles la candeur de ton âge te rend plus accessible. Songe que tu dois retourner bientôt à la Guadeloupe, où tu trouveras une société, qui, tout en permettant de se nourrir spéculativement de ces idées d’égalité, défend de mépriser ouvertement des préjugés conservateurs. J’ai cru deviner, par tes lettres, une tendance marquée à t’exalter pour ces dogmes que tu nommes régénérateurs, mais qui ne peuvent l’être qu’après nous avoir tués. C’est ici le moment de te dire un mot des liaisons que le hasard pourrait te faire contracter avec des jeunes gens de couleur que des blancs envoient en Europe. Ne t’arrête pas aux signes extérieurs, ils sont souvent trompeurs. Sonde, questionne tous les créoles, tes camarades. Le nombre ne doit pas être grand ainsi sera-t-il plus facile de découvrir les origines et d’échapper à des dangereuses amitiés qui deviendraient une source de regrets et de contrariétés à venir, ne pouvant jouir d’une entière liberté dans vos rapports à votre retour dans les colonies. Quelle que soit l’énergie de ta volonté à cet égard, tu ne pourras lutter contre la société qui
17 18 19 20
Maynard de Queilhe: Outre-mer, Bd. II, S. 16. Levilloux: Les créoles, S. 104. Revue des Colonies (November 1838), S. 277. Vgl. Kap. I.4.3 und II.2.2.
261
pèsera sur toi de tout le poids de ses usages et de ses idées incarnées. Songes-y, mon fils, et tout en accordant ta bienveillance, garde-toi de t’égaler par des liens d’amitié à des compatriotes de couleur. Je n’en dis pas d’avantages; que ta raison t’éclaire.21
Das Wissen um ein Zusammenleben ethnischer Gruppen, aber auch das Zusammenleben weißer Philanthropen in Paris und weißer Kreolen aus den Kolonien, wird als Balanceakt zwischen Wissensnorm und -form von Zusammenleben dargestellt. Die als Dogmen benannten philanthropischen Ideen sind mit den Lebensumständen in der Kolonie nur im Tod vereinbar. Die Klarheit der Vision, die das Gegenteil von Zusammenleben inszeniert, wird als definitorische Vorhersehbarkeit im Akt des Lesens erlebbar. Wenden wir uns wieder der spanischen Karibik zu, genauer gesagt Eugenio María de Hostos, dessen Werk wie kein anderes in der Zeit vermittelt, inwiefern die Karibik ein privilegierter Erprobungsraum von Zusammenleben sein kann. Wie in den zitierten Reden ist auch im Roman La peregrinación de Bayoán die Idee einer pan-antillanischen Konföderation tragend. Diese Idee wird über eine Suche und Irrfahrt inszeniert, die bis zum Schluss offenbleibt und sich nicht klar beantwortet. So sieht sich der Protagonist als konstant suchenden Pilger in einem Zwischenraum: «Yo soy un hombre errante en un desierto, y mi único oasis eres tú [er wendet sich an seine Herkunftsinsel]. Yo soy un peregrino… ¿Necesito peregrinar? Pues, ¡adelante!»22. Pilgern als vieldimensionale Suche, als Ausdruck von Offenheit, aber auch von Fremdheit, als Zielgerichtetheit, aber auch mit dem Weg als Ziel; eine Kreisstruktur, die vielfach gebrochen ist. Einige Aufzeichnungen schreibt Bayoán an Bord, daher auch die an Kolumbus angelehnte Bezeichnung Diario de a bordo. Das Schiff stellt so eine Art Schwellenraum dar. Es kann gleichsam als Vehikel betrachtet werden, das die Grenzen der Zeitebenen passiert und den Protagonisten von einer Ebene in die andere befördert – quasi ein Pendeln zwischen Zeitebenen und Räumen: «El viento empujaba a la fragata, y la fragata andaba como ando yo, empujado por un viento que aún no sé si lleva a puerto.»23 Die Inszenierung der Wellen als Oszillieren zwischen offenen Räumen relativiert die Bestimmtheit eines Caribeanidad-Diskurses.
VIII.3. Absage an essentialistische Identitätsmodelle In einem Zeitalter, in dem erst diskutiert werden muss, wer sich überhaupt Mensch nennen darf, wäre eine bewusste Bejahung des unvorhersehbaren Potentials, das jedem Zusammenleben zu Eigen ist, unmöglich. Dennoch werden vor der Folie heutiger Diskussionen um Zusammenleben neue Lesarten historischer Texte möglich. Die Beispiele haben gezeigt, dass kulturelle Repräsentationsformen der Karibik im 19. Jahrhundert ein ganzes Arsenal an Wissensnormen von Zusammen-
21 22 23
Levilloux: Les créoles, S. 23. Hostos: La peregrinación de Bayoán, S. 18. Ebda., S. 192.
262
leben bieten: zum Beispiel das utopische Modell der Sklavengesellschaft eines Maynard der Queilhe oder den Entwurf einer mischrassigen Gesellschaft in der Revue des Colonies. Die Fokussierung auf diese Konstellationen eines Zusammenlebens hat eine neue Dimension fruchtbar gemacht: welche Anstrengungen die Weißen unternehmen müssen, um ihr Weiß-Sein zu verteidigen. Während die ethnische Differenz vor 1848 vor allem binäre Strukturen reproduziert – sei es als für alle Beteiligten bestens funktionierendes Sklavereisystem, sei es als frühe Utopie eines Meltingpots –, ändern sich nach 1848 die normativen Modelle: besonders in der hispanophonen Karibik werden Zukunftsvisionen einer pan-karibischen Konföderation entwickelt. Für alle normativen Projektionen eines Zusammenlebens bleibt entscheidend, dass trotz utopischer Relationalitätskonstellationen essentialistische Identitätskonstruktionen bestimmend sind. Wie sieht es aber mit den Wissensformen des Zusammenlebens aus? Sie finden sich häufiger in literarischen Texten als in anderen Textgattungen. Zusammenleben gestaltet sich dort oft als unsicherer Erprobungsraum,24 als ein Ausloten der Grenzen, als ein Dazwischen, das sich viel weniger klar definieren lässt als in normativen kulturellen Repräsentationsformen. So kommt es nicht von ungefähr, dass im Zusammenhang eines nur scheinbar klar artikulierbaren Ideals des WeißSeins häufig um die Definition des Mulatten gerungen wird: die Unbestimmbarkeit des Anderen provoziert Angst. Zudem werden Verunsicherung und Angst geäußert, die alten Privilegien zu verlieren. Wirft man einen genaueren Blick auf das Thema «Unmöglichkeit des Ideentransfers», wird deutlich, wie unabdingbar Wissensnormen und -formen zusammenhängen. Das zeigt sich besonders anschaulich bei Hostos, der normativ das Ideal einer pan-antillanischen Konföderation formuliert, in seinem zeitgleich erschienenen Roman jedoch eine Suche nach Caribeanidad inszeniert, deren Ende durchaus vager formuliert ist als in seinen Reden. Wenn die Essentialismen zwar aus programmatischen Schriften des 19. Jahrhunderts nicht wegzudenken sind, relativieren sich doch die etablierten Referenzrahmen wie Rasse und Nation dank des Blicks auf Wissensformen. Bezeichnenderweise sind es gerade die literarischen Texte, bei denen eine klare Trennung zwischen Wissensnormen und -formen von Zusammenleben nicht immer möglich ist. Literatur wird ihrer Rolle als interaktives Speichermedium von ZusammenLebensWissen gerecht.25 Wenig erstaunlich also, dass Hostos dieses Ineinander von Wissensnorm und -form eines Zusammenlebens so anschaulich vorführt, hat er doch in Moral social explizit formuliert: La novela, género que aún dispone de vida, porque aún dispone de contrastes entre lo que es y lo que debe ser la sociedad humana, puede contribuir a que el arte, siendo verdadero y siendo bueno, sea completo. Entonces será un elemento de moral social.
24 25
Ette: Literaturwissenschaft, S. 27. Ebda., S. 31.
263
Cumpla con su deber, y lo será. Mientras tanto, no lo es, entre otros, por ese motivo final: porque no cumple con su deber.26
Ebenso wie dieses Zitat bestens darauf hindeutet, inwiefern Literaturwissenschaft als privilegierte Lebenswissenschaft sich seit jeher, und auch in einem von naturwissenschaftlichen Debatten stark bestimmten 19. Jahrhundert, behauptet, haben die Ausführungen gezeigt: Die Caribeanidad-Diskurse können als Vorläufer heutiger konzeptioneller Debatten über Zusammenleben aufgefasst werden. Wenn auch aus der Karibik einige wertvolle Ansätze kamen, um über ZusammenLebensWissen nachzudenken, so wird der Begriff dort in den aktuellen Debatten bisher nicht definitorisch verwendet. Doch gibt es durchaus Anzeichen, dass sich eine konzeptionelle Rezeption vor Ort anbahnt. Immerhin gründete sich auf Guadeloupe im Zuge der dortigen landwirtschaftlichen Krise im Januar 2009 eine Organisation, die den kreolischen Namen Lyannaj kont pwofitasyon (LKP) trägt. Lyannaj bedeutet Zusammenleben.27 Und so kommt es, dass Glissant diesen Begriff zum Anlass nahm, um über Vivre-ensemble nachzudenken. «Projetons nos imaginaires dans ces hautes nécessités jusqu’à ce que la force du Lyannaj ou bien du vivreensemble, ne soit plus un ‚panier de ménagère‘, mais le souci démultiplié d’une plénitude de l’idée de l’humain.»28
26 27
28
Eugenio María de Hostos: Moral social. Sociología. Caracas: Biblioteca Ayacucho 1982, S. 248. Der Generalstreik in Guadeloupe wurde von einer Koalition aus 50 Organisationen und Bewegungen geführt. Der Name des Streikbündnisses lautet Lyannaj kont pwofitasyon (LKP). Vgl.: Manifeste pour les «produits» de haute nécessité, MartiniqueGuadeloupe-Guyane-Réunion. Signataires: Ernest Breleur, Patrick Chamoiseau, Serge Domi, Gérard Delver, Édouard Glissant, Guillaume Pigeard de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar, Jean-Claude William. Paris: Éditions Galaade, en coédition avec l’Institut du Tout-Monde 2009. Online verfügbar unter: http://www.tlaxcala.es/detail_artistes. asp?lg=fr&reference=300 [20.07.2010]. Vgl. http://www.tlaxcala.es/detail_artistes.asp?lg=fr&reference=300 [20.07.2010].
264
IX.
Fazit
Was folgt nun aus der Einsicht, dass, summarisch gesprochen, Relationalitäten in Kolonialliteraturen eine neue Perspektivierung erfahren konnten? Was sagen uns Erkenntnisse einer vergleichenden Perspektive in Verbindung mit der Transferforschung und inwiefern sind diese Erkenntnisse, bezogen auf eine spezifische Region in einer bestimmten Epoche, anschlussfähig an theoretische Debatten von heute? Im Zentrum meiner Untersuchung standen Transferprozesse. Nicht Ist-Zustände, sondern Entwicklungen, Veränderungen und Verflechtungen wurden in den Blick genommen. Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Ethnologen, Redakteure, aber auch fahrende Kleinwarenhändlerinnen waren insofern Trägerfiguren. Sie könnten noch um etliche weitere ergänzt werden. Transfers von Gesellschaftskonzeptionen1 warfen die Frage auf, wie einerseits mit Revolutionserfahrungen, besonders der haitianischen, andererseits mit der schrittweisen Abolition in anderen Kontexten, in unserem Fall zunächst dem britischen, umzugehen sei: Von woher und wohin wurde was transferiert? Dabei ging es mir nicht um die Festschreibung einer nationalen Identität oder um die Betonung einer transnationalen Dimension im Sinne von konkurrierenden Kulturen, sondern um die Art und Weise, wie die Handelnden in unterschiedlichen Situationen mit mehr oder weniger hegemonialen Kulturmodellen umgehen und sie umformen. Mein Anliegen war es nicht, von apriorisch festgelegten Einheiten und Kategorien auszugehen, sondern von Problemen und Fragestellungen, die sich erst im Laufe der Analyse näher eingrenzen ließen, weil sie selbst in einer beständigen dynamischen Veränderung begriffen waren. Vorgegebene Modelle oder global definierte Konstruktionen von Nation, Gesellschaft, Kultur, Religion wurden vermieden: gerade dem kolonialen Rahmen hätte man damit nicht beikommen können. Behandelt wurde außerdem die Frage nach dem Theorietransfer: Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Karibik als privilegierter Ort von Theorieproduktion zum Topos einer lateinamerikanistischen/karibistischen Kulturwissenschaft avanciert. Dabei wird zunehmend deutlich: auch gegenwartsorientierte Theorien haben einen, wenn nicht DEN zentralen Fokus im 19. Jahrhundert. So wies Benítez Rojo bereits eindringlich auf den Zusammenhang zwischen Kreolisierung und plantación hin: «Bien, entonces, ¿qué relaciones veo entre plantación y criollización?
1
Vgl. zu diesem komplexen Feld auf einer allgemeinen Ebene die Ausführungen zu politischen, wirtschaftlichen und soziokulturellen Kulturtransfers Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 152f.
265
Naturalemente, en primer término, una relación de causa y efecto; sin una no tendríamos la otra. Pero también veo otras relaciones […]».2 Indem eine komparatistische Fragestellung mit der Transferforschung kombiniert wurde, sollte der Fokus auf die Verschränkung der Untersuchungsebenen und ihre wechselseitige Bedingtheit gelenkt werden. Wenn die karibischen Inseln dabei den Kreuzungspunkt bildeten, so erwies sich der auf den ersten Blick durch die Überkreuzung der Blickwinkel erzeugte Eindruck von Symmetrie meist als Trompe-l’œil. Je näher die historischen Zusammenhänge betrachtet wurden, desto deutlicher kamen die Asymmetrien zum Vorschein. Gerade darin liegt jedoch die Stärke des Verflechtungsansatzes. Der Vergleich der Texte der frankophonen mit denen der hispanophonen Karibik lässt zwei unterschiedliche Konstellationen erkennen: eine bipolare Achse mit den Endpunkten Kolonie und Mutterland; sowie ein multilaterales Beziehungsgeflecht mit mehreren Achsen, vor allem Kolonie–Zentren, Kolonie–andere (Ex-) Kolonien. Die enge Verschränkung von Literatur und Wissensdiskursen über das koloniale Andere, die besonders im französischen Einflussbereich zu Tage kam, hängt damit zusammen, dass Literaten der Karibik im 19. Jahrhundert wichtige Träger innerhalb der mutterländischen Wissensproduktion waren. Ebenso wie die multirelationale Vernetzung der hispanokaribischen intellektuellen Welt die Grundlage für eine transareale Literatur bildete, so war auch die damit einhergehende kulturelle Emanzipation vom Mutterland Voraussetzung für politische Loslösung. Im Zentrum stand zunächst die Frage nach den Positionierungen zum kolonialen Status quo: wie und welche europäischen Diskurse sich die Autoren aneigneten, wie sie die eigene kulturelle Identität ihrer Herkunftsinseln behaupteten und auf welche Weise sie dabei den potentiellen Widerspruch von Emanzipation und geistesgeschichtlicher Verpflichtung reflektierten. Die politischen Positionierungen über die Literatur erwiesen sich als recht eindeutig. In der spanischen Karibik gingen sie, mit wenigen Ausnahmen wie der Condesa de Merlín, in eine klare Richtung: man war für Abolition und für Unabhängigkeit. Anders in der französischen Karibik. In Bezug auf die Abolitionismusfrage lassen sich zwei konträre Haltungen festmachen. Auf der einen Seite die Abolitionisten: Levilloux, Chapus, Bonneville, Agricole (Levilloux und Chapus waren selbst Mulatten, Bonneville mit einer Mulattin verheiratet und Agricole der erste schwarze Autor auf Martinique – bezeichnenderweise fing er auch erst spät an zu schreiben (um 1870), auf der anderen Seite die Befürworter der Sklaverei: die weißen Békés Prévost de Sansac, Eyma, Maynard de Queilhe und Rosemond. Wenn die Abolitionismusfrage vor 1848 auch für Meinungsverschiedenheiten sorgte, so waren sich die Literaten alle einig in ihrer Anlehnung an das Mutterland Frankreich. Häufig ist das Anliegen der Romane aus den französischen Antillen hochpolitischer Natur: Die Philanthropen sollen davon überzeugt werden, auf jede Form der Abolition zu verzichten; die bestehenden kolonialen Diskurse werden
2
Benítez Rojo: La isla, S. 396.
266
affirmiert. In hispanophonen Texten finden sich hingegen durchaus antikoloniale Haltungen, die man auch mit dem Begriff der epistemologischen Postkolonialität fassen kann. Vereinzelt ist hier zwar – beispielsweise im Roman Enriquillo von Galván – eine latente Sympathie für die Weltmacht Spanien mit ihren großen Geistern Kolumbus und Las Casas zu beobachten. Im Gegensatz zu den literarischen Beispielen aus der französischen Karibik hindert das die Protagonisten aber nicht an ihrer Rebellion, die als Antizipation der Freiheitsbestrebungen und der Unabhängigkeitskriege mit der Kolonialmacht Spanien gesehen werden muss. Gemeinsam ist der literarischen Produktion der spanischen und französischen Antillen, dass das Paradigma Haiti einen erstaunlich geringen Raum einnimmt. Trotz einiger Unterschiede zwischen den beiden Kolonialsphären tragen damit beide kolonialen literarischen Felder dazu bei, westliche Modernediskurse zu zementieren. Die häufig komplexe Raum/Bewegungsstruktur in Texten aus und vor allem über Haiti (zum Beispiel die Artikel von d’Alaux, aber auch ein Roman wie Stella von Bergeaud) deutet darauf hin, dass die Multirelationalität der jungen haitianischen Gesellschaft weitreichende räumliche Implikationen hatte. Die Texte repräsentieren insofern koloniale Unabhängigkeit, als sie verdeutlichen, wie der junge Staat Haiti die Verbindung von externer und interner Relationalität verdichtet. Dabei zeigen sich die einzelnen Räume in sich häufig sehr statisch. Dies mag mit dem problematischen Selbstverständnis Haitis zusammenhängen, das die politische Unabhängigkeit vehement verteidigt und zugleich die kulturelle Abhängigkeit vom einstigen Mutterland affirmiert, eine Kombination, die in den Gedichten von Massillon Coicou besonders deutlich zum Ausdruck kommt. Während Haiti in jeder Hinsicht einen Sonderfall darstellt, nicht nur in der Karibik, sondern in der westlichen Hemisphäre überhaupt, so vermitteln repräsentative Romane der frankophonen und hispanophonen Kolonialsphäre andere Inszenierungen von Raum beziehungsweise Bewegungsperspektiven – das schlägt sich schon in den Titeln nieder. Häufig spiegeln sie den Blick aus der Metropole, wie beispielsweise in der Description de l’île de Martinique: eine Affirmation des kolonialen Status quo steht für den eindimensionalen kolonialen Blick. Demgegenüber liegt der Schwerpunkt in La peregrinación de Bayoán auf dem Moment der Bewegung. Die Antithese Natur–Kultur erfährt in den Literaturen der französischen Karibik eine deutlichere Polarisierung als in den spanischen Texten. Dies entspricht unterschiedlichen Funktionen des Topos Insel in den beiden Kolonialliteraturen: Die auf den französischen Antillen häufig anzutreffende Identifikation der Insel mit Exil und Isolation – ungeachtet dessen, dass sich die schreibende Pflanzeroligarchie freiwillig dort niedergelassen hat – findet man in der spanischen Karibik kaum. Dadurch, dass auf den französischen Antillen die jeweiligen Inseln meist nur als Durchgangsstation «ertragen» werden, sind auch sie Teil eines Dazwischen, das für das Schreiben in und über die Karibik im 19. Jahrhundert symptomatisch ist. Trotz vieler Unterschiede zwischen dem französischen und dem spanischen Kolonialismus zeigen sich auch aufschlussreiche Gemeinsamkeiten. Sowohl die Literaten der (ehemaligen) karibischen Kolonien Frankreichs, als auch die Autoren 267
in den spanischen Kolonien orientieren sich vorzugsweise an der französischen Romantik. Bestimmte Texte wie Hugo, Lamartine und Chateaubriand haben sich besonders durchgesetzt. Auch wenn es weit gefehlt wäre, die reiche literarische Tradition der Karibik auf folgende Lesart zu reduzieren, muss dennoch erwähnt sein: Die Imitation von Modellen/Ideen aus dem Mutterland in der Kolonie, häufig in Form von Plagiaten, kann niemals mit dem sogenannten Original identisch sein. Der Prozess der Übersetzung – die Wiederholung innerhalb eines anderen Kontexts – schlägt notgedrungen eine Lücke in das angenommene Original, was oft zu Lasten einer ästhetischen Überzeugungskraft geht. Die literarische Produktion der Kolonien orientiert sich also nicht notwendigerweise an den respektiven Mutterländern. Die politische und kulturelle Gravitationskraft des französischen Kolonialismus war weit prägender und effektvoller als das spanische Modell. Mit Ausnahme Haitis besteht ein deutlicher Zusammenhang zwischen kultureller und politischer Abhängigkeit vom Mutterland Frankreich. Dementsprechend funktioniert in einigen Romanen der frankophonen Karibik die literarische Inszenierung einer binären Opposition zwischen Metropole und Kolonie hervorragend. Die literarischen Versuche antizipieren die politischen Ereignisse, eine eher marginale Unabhängigkeitsbewegung, die ihre Ziele nicht erreicht. Auch wenn sich angesichts der speziellen Situation der kreolischen Oberschicht in Lateinamerika und der Karibik im 19. Jahrhundert das Vokabular postkolonialer Theoriebildung3 nur bedingt nutzbar machen lässt, könnte man zugespitzt formulieren, dass die intensive Rezeption der mutterländischen Literatur im Falle der frankophonen Karibik einen «Konsens» zwischen Kolonisator und Kolonisiertem schafft, der die französische Kulturhegemonie zementiert. Dieser Nexus von Kultur und Politik hat für das koloniale Verhältnis der spanischen Karibik entgegengesetzte Wirkung – daher die recht heftige Loslösung der spanischen Kolonien vom Mutterland.4 Die intensive Rezeption der französischen Literatur bedeutet für die spanischen Kolonien bereits eine kulturelle Emanzipation, wohingegen sie für die französischen Kolonien ihr Abhängigkeitsverhältnis perpetuiert: Die kulturelle Akzeptanz des, und Abhängigkeit vom eigenen Mutterland legitimiert den Fortbestand der politischen Unterordnung. Kreolisches Schreiben war Ausdruck eines permanenten Dazwischen, einer Zerrissenheit, die einerseits zu kreativem Stillstand und einer Einengung in konservative Denkstrukturen führen, andererseits aber auch hochproduktiv wirken konnte. Bezeichnenderweise besteht eine Gemeinsamkeit zwischen den literarischen Texten der französischen und spanischen Karibik darin, dass Zuschreibungen von Nation, patrie und Exil oft nicht eindeutig funktionieren. Solche Denominationen laufen nicht nach klaren Kriterien ab, sondern sie passen sich
3
4
Vgl. hierzu die überaus konstruktive Auseinandersetzung und produktive Kritik Lüsebrinks an manchen postkolonialen Studien, die der Gefahr erlegen sind, «hybride Schreibweisen» in «allzu abstrakter und modisch-theoretischer Perspektive» in den Blick zu nehmen. Vgl. Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 175. Dies unter der Voraussetzung einer Kulturtheorie, die der kulturellen Hegemonie als Legitimationsinstanz für das Herrschaftsverhältnis die entscheidende Rolle zubilligt.
268
den jeweiligen Situationen an. Der nationale Referenzpunkt wird außerordentlich problematisch. Nicht so sehr die Nation ist es, die literarisch in Szene gesetzt wird, sondern ihre Brüchigkeit selbst wird zum Dreh- und Angelpunkt des Schreibens – und hier liegt wohl eines der zentralen Motive kolonialer Umformung von mutterländischen Diskursen und Modellen. Gerade für das 19. Jahrhundert scheint eine solche literarische Inszenierung überraschend. In jedem Falle stellt sie Doris Sommers These von den foundational fictions in Frage: von einer klaren Artikulierung des Nationalen durch allegorische Verfahren, die sich mit den Phänomenen der zeitgleichen europäischen Nationalbewegungen analogisieren ließe, kann hier nicht die Rede sein. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass das von den Sozialwissenschaften entwickelte Instrumentarium einer Histoire croisée durch die exponierte Betrachtung literarischer Texte eine existentielle Bereicherung erfährt. Jene spezifische Situation eines Dazwischen lässt sich nirgends so wie in der Literatur zeigen und erfahren. So ist die Literatur der privilegierte Ort von Wissenszirkulation: man würde der Komplexität der Texte bei weitem nicht gerecht, wollte man sie in Identitätskategorien zwängen; nur die schillernden Dimensionen des Dazwischen vermögen es, diese Vielschichtigkeit zu fassen. Sie werden durch das paratextuelle Material ergänzt – so waren lange Vorworte, wie auch Briefe und Zeitungsartikel, besonders beliebte Mittel für die Selbstpositionierung bei den Autorinnen und Autoren der Karibik des 19. Jahrhunderts. Omnipräsent ist das Thema der Hautfarbe. Weiß-Sein ist die notwendige Voraussetzung für Überlegenheit und Herrschaft, ja, vielfach ist es sogar das Kriterium für die Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht. Nichts mag sich essentialistischer anhören als solche Zuschreibungen. Wo ist hier Platz für Ambiguitäten oder gar Transfers? Doch gerade in der Bestimmung der Hautfarbe kommen die größten Unsicherheiten zum Ausdruck. Denn die Zuschreibung des Weiß-Seins ist alles andere als eindeutig – und das ist in den literarischen Texten ein Dauerthema. So geht es beispielsweise um die Schwierigkeit, wie nach der haitianischen Revolution mit den befreiten Sklaven und den Mulatten umzugehen sei. Es gibt keinerlei Konsens mehr darüber, wie man sie benennen soll. Schwarze sind sie nicht mehr, Weiße aber auch nicht. Selbst wichtige Repräsentanten der Oberschichten, denen sonst Deutungshoheit zuerkannt wird, reagieren in einem Theaterstück nur mit Stottern. Klare Zuschreibungen der Hautfarbe, die in vorrevolutionären Zeiten niemand auch nur im Traum in Frage gestellt hätte, scheinen nun nicht mehr zu funktionieren, und das gerade vor dem Hintergrund, dass der Hautfarbe nach wie vor eine, wenn nicht die entscheidende juristische Bedeutung zukommt. Hier wird wie kaum sonst deutlich, wie die einstigen Fixpunkte in Bewegung geraten sind. Die Kerndomäne des Essentialismus wird zu einem der wichtigsten Felder von Fluktuationen und den wechselhaften Dynamiken diskursiver Macht. Erweitert man den Blick von der karibischen Inselwelt auf den zirkumkaribischen Raum und betrachtet das «schwarz»-frankophone Zentrum New Orleans, so tut sich erneut ein Kreuzungspunkt unterschiedlichster Transferprozesse auf, wenn zum Beispiel Joseph Colastin Rousseau deutlich vor Augen führt, wie sich die Bande der kreolischen Schicht durch eine hybride beziehungsweise relationale 269
Erfahrung konstituieren.5 Ähnlich wie die kreolische Oberschicht auf Martinique und Guadeloupe verorten sich die Free People of Color im Dazwischen: Sie artikulieren Orientierungslosigkeit und tiefsitzende Unsicherheit hinsichtlich ihrer Positionierung zwischen den Welten. Und dabei bleibt die koloniale Bindung an das (einstige) Mutterland Frankreich auch nach jahrzehntelanger Loslösung die tragende Kraft. Der französische Kolonialismus ist so stark, dass er trotz (oder gerade wegen) der Erfahrung des Dazwischen und des damit einhergehenden Gefühls der Schwäche eine große Anziehung entfaltet. Allgemein werden geographische und auch ethnologische Gesellschaften des 19. Jahrhunderts als bedeutende Lobbyisten für den französischen Imperialismus angesehen. Sofern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einer Spartentrennung überhaupt schon die Rede sein kann, gestalten sich die Ausdrucksformen gerade der ethnologisch-orientierten Organe jedoch höchst komplex und facettenreich. Eine Sonderposition nimmt die Revue des Colonies ein. Sie, eine von hommes de couleur redigierte Zeitschrift, kultiviert eine Sprache, die bereits im 19. Jahrhundert Identitätszuschreibungen entmystifiziert. Nichts kann die Fragwürdigkeit einer Identitätspolitik besser verdeutlichen, als das Paradoxon der Literatur jener hommes de couleur im Jahre 1834. Das Dazwischen eines homme de couleur, das «offiziell» von einem mulattischen Schreiber wie Cyrille Bissette besetzt ist, ist nicht mehr als ein koloniales Erzeugnis und greift voraus auf unsere heutige Welt globaler transkultureller Verstrickungen. Die im Laufe dieser Studie mehrfach zitierte Formel «durch Vergleich in Beziehung (und in Bewegung) setzen»6 zeigte auf mehreren Ebenen ihre produktive interpretatorische Kraft. Die vergleichende Betrachtungsweise mit besonderer Berücksichtigung der Transferprozesse vermittelt neue Erkenntnisse für den Zusammenhang von Kultur und Imperialismus, und – das ist das Entscheidende – sie sensibilisiert für die Kategorie des Dazwischen, die privilegiert über das Potential von Literatur vermittelbar ist. Dabei ist dieses Dazwischen nicht bloß eine (problematische) räumliche Verortung, die die Akteure in ihren sozialen, kulturellen und politischen Positionierungen schwächt, sondern sie kann auch produktive Kräfte freisetzen. Ab 1860 werden diesbezüglich in der spanischen Karibik Stimmen laut: Wenn Diskurse der Differenz schon vorher das Denken von Hostos, Betances und Maceo ausmachen, so werden sie im Gegensatz zu früheren Texten nun produktiv umgesetzt. Die Caribeanidad eines Maceo will Differenz auflösen. Dass diese Idee als Utopie ganz im Sinne von Hostos über den karibischen Archipel hinausgeht, ist bezeichnend. Seine Betonung der geostrategischen Lage des karibischen Archipels nimmt hemisphärische AmerikaKonstruktionen vorweg. Nicht umsonst sind die Orte des Schaffens teilweise auch in Zentralamerika: Hostos schreibt aus Panama, «en el Istmo», und Maceo aus Guaynava, der «primera colonia cubana» im heutigen Costa Rica. Weitere
5 6
Duplantier: «Nos frères d’outre-golf», S. 155. Ette: Alexander von Humboldt, S. 152. Vgl. dazu auch die Verbindung «Vergleichen und Verstehen» in Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation, S. 33.
270
Plädoyers folgen von beiden aus New York. Diese transterritoriale Dimension, die noch durch unzählige Beispiele ergänzt werden könnte, ist zwar – angesichts der Zeit – nicht frei von rassistischen Elementen, projiziert aber einen neuen «Erprobungsraum von Zusammenleben»7, der eine prospektive Dimension hat. Zurecht hat Gaztambide Géigel gerade im Zusammenhang mit den erwähnten Intellektuellen darauf hingewiesen, dass ab 1860, mit der Entstehung des Caribeanidad-Diskurses und dem Projekt einer karibischen Konföderation, nicht mehr die Postulierungen der Identität im Vordergrund stand, sondern eine Bewegung hin zur Solidarität einsetzte. Ohne den wertenden Charakter des Solidaritätsbegriffs von Géigel aufnehmen zu wollen, drückt sich in seiner KaribikUntersuchung die Verlagerung von Identität zum – neutraler formuliert – Fokus Zusammenleben aus. Die Konzeptionen eines Hostos oder Betances, die auch eine wichtige Bereicherung durch den Haitianer Atenor Firmin erfahren, greifen sowohl räumlich voraus, auf transareale Dimensionen, die eine Raumgeschichte durch eine Bewegungsgeschichte ersetzen, als auch auf der Ebene ethnologischer Konstellationen, die ein Plädoyer abgeben für den Fokus Zusammenleben und damit klare Denominationen der Hautfarbe für obsolet erklären. Die Erkenntnis, dass gerade die Kategorie des Dazwischen zur Erfassung karibischer Literaturen im 19. Jahrhundert von zentraler Bedeutung ist, wäre nicht möglich gewesen über das Analyseinstrumentarium des Identitätsbegriffs. Eine induktive Herangehensweise mit dem Fokus auf Transfers unterschiedlicher Dimensionen – daher der Zusatz im Vorwort des Dazwischen-Kapitels, dass bewusst keine Typologisierung vorgenommen wird – offenbarte im nachhinein, dass es immer um ein Verhandeln von Zusammenleben geht, welches in den unterschiedlichsten kulturellen Repräsentationsformen im Zentrum steht. Während dieses in den ethnologischen Zeitschriften vor allem programmatisch formuliert wird, im Sinne neuer Wissensnormen von Zusammenleben, erweist sich das Potential der literarischen Texte auf der Ebene eines Zusammenspiels der Repräsentationen sowohl von Wissensformen als auch von Wissensnormen von Zusammenleben. Eine solche Lesart der Texte hatte ihre Voraussetzung in den paradigmatischen Arbeiten zu ZusammenLebensWissen von Ottmar Ette. Diese stehen im aktuellen Kontext internationaler Debatten um Alternativen zu Identitätskonzepten. So spricht beispielsweise Paul Gilroy 2004 von Conviviality als programmatischem Konzept. Arjun Appadurai knüpft daran an und macht in einem Berliner Vortrag 2009 mit der Frage nach einer Politik des Dialogs auf drei Typen von sogenannten Risikodialogen aufmerksam. Insofern der Dialog ein wichtiges Werkzeug für Fragen des Zusammenlebens darstellt, gelte es auf drei damit verbundene Risiken zu achten: Erstens das Risiko, sich gegenseitig nicht zu verstehen, zweitens die Gefahr, zu viel zu verstehen, und drittens das Risiko, zu viel oder zu wenig über existierende interne Differenzen offenzulegen, die möglicherweise innerhalb der beiden in den Dialog eingebundenen Seiten/Partner/Gruppen etc. bestehen. Um wirksam zu sein, kann ein Dialog nicht alles behandeln. Überein-
7
Ette: Literaturwissenschaft, S. 27.
271
stimmung ist immer begrenzt und das Risiko eines überhöhten Verständnisses stets gegenwärtig. Da eine restlose Verständigung immer eine Illusion bleibt, liegt eine ernste Gefahr in der Beseitigung grundlegender Unterschiede und der Schaffung falscher Universalismen – einem Übermaß an Verständnis. In jedem Dialog bringen alle Beteiligten die eigenen Spannungen und Widersprüche «auf den Tisch». Es kann keine produktive Verhandlung mit dem «Anderen» geben, wenn es nicht auch Verhandlungen mit dem «Selbst» gibt. Das wirft die Frage nach der Repräsentation auf. Innerhalb seines Konzeptes der Kreolisierung betont Glissant, wie bereits im Einleitungskapitel formuliert, den Aspekt einer Bejahung des Unvorhersehbaren, der jedem Kreolisierungsprozess innewohne. Sind es nicht genau diese Fragen, die in der Karibik im 19. Jahrhundert explizit diskutiert werden? Während literarische Texte eines Eyma oder Maynard de Queilhe vorwiegend Wissensformen von Zusammenleben fassen und die Dialoge ihrer Protagonisten oft scheitern müssen, da man meist der Gefahr erlegen ist, zu gut zu verstehen, wer sich überhaupt Mensch nennen darf, zeugen die Äußerungen eines Bissette in der Revue des Colonies davon, wie eine Affirmierung des Unvorhersehbaren programmatische Formen eines Zusammenlebens in einer weltweiten frankophonen Diaspora annehmen kann. Rassismusdiskussionen sind für das 19. Jahrhundert seit jeher bezeichnend. Ohne die Miteinbeziehung karibischer Literaturen, die immer auch «Literaturen ohne festen Wohnsitz» waren8, würden entscheidende Dimensionen eines experimentell erprobten Zusammenlebenswissens ausgespart bleiben. Die literatur- und kulturwissenschaftlichen Paradigmen der Karibikforschung des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts hatten entscheidende Vorstufen im 19. Jahrhundert. So nehmen beispielsweise die Texte von Hostos, Maceo und Betances mit ihren Karibik-Konzepten universale Gedanken eines Édouard Glissant9 vorweg. Es geht, um mit dem unlängst verstorbenen martinikanischen Autor und Theoretiker zu schließen, um eine Vision prophétique du passée.
8 9
Vgl. unter anderem Ette: Eine Literatur ohne festen Wohnsitz; ZwischenWeltenSchreiben. Édouard Glissant: Tout-monde. Paris: Gallimard 2003. Vgl. zu Glissant auch Frauke Gewecke: Les Antilles face à la Révolution haïtienne. Césaire, Glissant, Maximin. In: Hoffmann, Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804, S. 251–266.
272
X.
Literaturverzeichnis
X.1.
Primärliteratur
Arenas, Reinaldo: La loma del Angel. Malaga: Dador 1986. Bentzon, Thérèse: Yette. Histoire d’une jeune Créole. Reprint der Ausgabe Paris: J. Hetzel, 1880. In einem Band mit: J. Levilloux: Les créoles ou la Vie aux Antilles. Morne-Rouge: Éd. des Horizons Caraïbes 1977, S. 273–409. Bergeaud, Émeric: Stella. Hg. von Beaubrun Ardouin. Paris: E. Dentu 1859. Chateaubriand, René de: Mémoires d’outre-tombe. Hg. von Maurice Levaillant. Paris: Gallimard (1848) 1958. Coicou, Massillon: Poésies nationales. Paris: Goupy et Jourdan 1892. Condé, Maryse: Traversée de la Mangrove. Paris: Mercure de France 1989. Condesa de Merlín, Maria de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo: La Havane. 3 Bände. Paris: Amyot 1844. Confiant, Raphaël: Adèle ou la pacotilleuse. Paris: Mercure de France 2005. Coussin, J.H.J.: Eugène de Cerceil ou les Caraïbes. 3 Bände. Paris: Igonette 1824. Eyma, Louis Xavier: Les Borgias Noirs. In: Louis Xavier Eyma: Les Peaux Noires. Paris: M. Lévy 1857, S. 109–132. – Le roi des Tropiques. Paris: Michel Lévy Frères 1860. – La Vie aux Etats-Unis. Notes de voyage. Paris: Plon 1876. Galván, Manuel de Jesús: Enriquillo. Leyenda histórica dominicana (1503–1533). Mexiko: Porrúa (1879) ²1976. – Enriquillo. Leyenda histórica dominicana (1503–1533). Notas del autor. Santo Domingo: Corripio (1879) 1990. Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Sab. Hg. von José Servera. Madrid: Cátedra (1841) 1997. – Sab. Hg. von Mary Cruz. La Habana: Ed. Arte y Literatura (1841) 1976. Heredia, José María: Prosas. Hg. von Romualdo Santos. Havanna: Letras Cubanas 1980. – Niagara y otros textos. Poesia y prosa selectas. Hg. von Ángel Augier. Caracas: Biblioteca Ayacucho 1990. – Obra poética. Hg. von Ángel Augier I. Havanna: Letras Cubanas 2003. Hostos, Eugenio María de: La peregrinación de Bayoán. Obras completas. Bd. I: Literatura. Hg. von Julio César López. [Rio Piedras]: Editorial de la Universidad de Puerto Rico (1863) 1988. Hugo, Victor: Bug-Jargal ou la Révolution haitienne. Les deux versions du roman 1818 et 1826. Hg. von Roger Toumson. Fort-de-France: Désormeaux 1979. Isaacs, Jorge: María. Hg. von Donald MacGrady. Madrid: Cátedra (1867) 112007. Lanusse, Armand (Hg.): Les Cenelles. A Collection of Poems. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Regine Lartortue und Gleason Rex W. Adams. Boston: Hall (1845) 1979. Lanusse, Armand: Besoin d’écrire. In: Armand Lanusse (Hg.): Les Cenelles. New Orleans: H. Lauve et Compagnie 1845. Online verfügbar unter: http://www.centenary.edu/french/ textes/cenelles4.htm [23.02.2011] Laslo, Pablo (Hg.): Breve antología de la poesía filipina. Poetas habla española. Vorwort von Luis G. Miranda. México, D. F: B. Costa-Amic 1966. Lespinasse, Bauvais: Le Chevalier de Mauduit. In: Revue des Colonies. Teil 1: «30 octobre 1790 – Le comité de l’ouest» (Oktober 1836), S. 166–170. Teil 2: «Madame Martin et Schelec» (November 1836), S. 206–211. Teil 3: «4 mars 1791» (Dezember 1836), S. 245–248.
273
Levilloux, J.: Les créoles ou La vie aux Antilles. Gefolgt von: Thérèse Bentzon: Yette. Morne-Rouge: Horizons Caraïbes (1835) 1977. Manzano, Francisco: Autobiografía del esclavo poeta y otros escritos. Hg. von William Louis. Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert, Iberoamericana (1835) 1997. Maynard de Queilhe, Louis de: Outre-mer. 2 Bände. Paris: Renduel 1835. Nau, Ignace: Isalina ou Une scène créole. Port-au-Prince: Choucoune (1836) 2000. Picquenard, Jean-Baptiste: Adonis suivi de Zoflora et de documents inedits. Hg. von Chris Bongie. [Paris]: L’Harmattan 2006. Prévost de Sansac, Auguste: Les amours de Zémédare et Carina et description de l’île de Martinique. Gefolgt von: Louis-Xavier Eyma: Emmanuel. Hg. von Auguste Joyau. Morne-Rouge: Horizons Caraïbes (1840) 1977. Questy, Joanni: Monsier Paul. In: La Tribune de la Nouvelle-Orléans (25. Oktober–3. November 1867). Online verfügbar unter: http://www.centenary.edu/french/textes/paul.html [05.02.2011] Rousseau, Jean-Jacques: Émile. Éducation. Morale. Botanique. Œuvres complètes. Bd. IV. Hg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond. Paris: Gallimard 1999. Séjour, Victor: Le mulâtre. In: Revue des Colonies (März 1837), S. 376–392. Tapia y Rivera, Alejandro: La palma del cacique. Leyenda histórica de Puerto Rico y Poesías. La leyenda de los veinte años. A orillas del Rhin. Mexiko: Orion (1852) 1977.
X.2.
Weitere Primärquellen
Catineau-La-Roche, Pierre-Marie: Notice sur la Guyane française, suivie des motifs qui font désirer que la colonisation projetée sur la Mana soit dirigée par une association en concurrence avec le gouvernement. Paris: Imprimerie de Fain 1822. Online verfügbar unter: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5460709r.r=Catineau-La-Roche.langEN [03.03.2011]. Condesa de Merlín, María de las Mercedes Santa Cruz y Montalvo: Les esclaves dans les colonies espagnoles. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, XXVI (1841), S. 734–769. D’Alaux, Gustave: La littérature jaune. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série. Teil I: XV (1852), S. 938–967, Teil II: XVI (1852), S. 1048–1085. Glissant, Édouard: À propos de Tout-Monde. Ein Gespräch mit Ralph Ludwig. Marie Galante 17.08.1994. Gómez de Avellaneda, Gertrudis: Cartas inéditas y documentos. 1859 a 1864. Colección ilustrada por José Augusto Escoto. Matanzas: Imprenta La Pluma de Oro 1912. Granier de Cassagnac, Adolphe: Voyage aux Antilles françaises, anglaises, danoises, espagnoles, à St-Domingue et aux Etats-Unis d’Amérique. 2 Bände. Paris: Dauvin et Fontaine 1842–1844. Henri Grégoire: De la noblesse de la peau ou du préjugé des blancs contre la couleur des Africains et celle de leurs descendants noirs et sang-mêlés. Grenoble: Million (1826) 1996. Hostos, Eugenio María de: Moral social. Sociología. Caracas: Biblioteca Ayacucho 1982. Jomard, Edme François: Études géographiques et historiques sur l’Arabie. Paris: Firmin Didot Frères 1839. Lanusse, Armand: Préface. In: Armand Lanusse (Hg.): Les Cenelles. A Collection of Poems. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzt und mit einem Vorwort versehen von Regine Lartortue und Gleason Rex W. Adams. Boston: Hall (1845) 1979. Lerminier [ohne Vorname]: Des rapports de la France avec le monde. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, VIII (1836), S. 326–343, hier S. 326. Louandre, Charles: De l’association littéraire et scientifique en France. In: Revue des deux mondes, Période initiale, 4e série, XVI (1846), S. 512–537.
274
Manifeste pour les «produits» de haute nécessité, Martinique-Guadeloupe-Guyane-Réunion. Signataires: Ernest Breleur, Patrick Chamoiseau, Serge Domi, Gérard Delver, Édouard Glissant, Guillaume Pigeard de Gurbert, Olivier Portecop, Olivier Pulvar, Jean-Claude William. Paris: Éditions Galaade, en coédition avec l’Institut du Tout-Monde 2009. Online verfübar unter: http://www.tlaxcala.es/detail_artistes.asp?lg=fr&reference=300 [20.07.2010]. Martínez, Melchor: Memoria histórica sobre la Revolución de Chile. Desde el cautiverio de Fernando VII hasta 1814. Hg. von Guillermo Feliú Cruz. 2 Bände. Santiago de Chile: Biblioteca Nacional 1964. Mazade, Charles de: La société et la littérature à Cuba. In: Revue des deux mondes, Nouvelle période, 1re série, XII (1851), S. 1017–1035. Ortiz, Fernando: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. [Habana:] Dir. de publicaciones, Univ. central de Las Villas 1963. Recueils de Reglemens, Edits, Declarations et Arretes, Concernant le Commerce, l’Administration de la Justice & la Police des Colonies Françaises de l’Amérique, & les Engagés. Avec le Code Noir et l’Addition audit Code. Paris: Chez le Libraires Associez 1745. Online verfügbar unter: http://www.archive.org/stream/recueilsdereglem00fran#page/n3/ mode/2up [28.01.2011]. Rousseau, Jean-Jacques: Du contrat social. Écrits politiques. Œuvres complètes. Bd. III. Hg. von Bernard Gagnebin und Marcel Raymond. Paris: Gallimard 1996. – Du contrat social ou Essai sur la forme de la République. Manuscrit de Genève. 1. Buch, 2. Kapitel. [o.J.]. Online verfügbar unter: http://philo.record.pagesperso-orange. fr/contrat/geneve.htm [05.10.2010].
X.3.
Ethnologische Zeitschriften
Revue des Colonies, hg. von Cyrille Bissette. Revue des deux mondes. Revue encyclopédique, hg. von Marc-Antoine Jullien.
X.4.
Sekundärliteratur
Abel, Johanna: Tagungsbericht zur Konferenz «Koloniales Kaleidoskop Karibik. Eine Inselwelt im Fokus kultureller Transferprozesse im 19. Jahrhundert» (09.–11. Juli 2009 in Berlin). In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, hg. von Henning Krauss, Heidelberg 2009. – «Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros.» Paradoxien in den kolonialen Schönheitsdiskursen der hispano-karibischen Literatur des 19. Jahrhunderts. In: Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Romanistik, 17, 33 (2010) (Titel des Heftes: Die Maskeraden der Schönheit), S. 15–32. – Viajes corporales al Caribe. Autoras del siglo XIX y sus saberes corporizados sobre las culturas. In: Liliana Gómez, Gesine Müller (Hg.): Relaciones caribeñas. Entrecruzamientos de dos siglos = Relations caribéennes. Frankfurt am Main: Lang 2011, S. 61–68. – Entre Island Hopping e Islas con Alas. Autoras en el Caribe y sus figuraciones archipiélicas en relatos de viaje del siglo XIX. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): worldwide/ weltweit. Archipielagos como espacios de prueba de una convivencia global. (Im Druck, erscheint in Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert). – Transatlantisches KörperDenken. Reisende Autorinnen in der spanischen Karibik des 19. Jahrhunderts. (Forthcoming). Antoine, Régis: La littérature franco-antillaise. Paris: Éd. Karthala 1992.
275
Appadurai, Arjun: Die Geographie des Zorns. Aus dem Engl. von Bettina Engels. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. Arnold, Albert James: Corsaires, Aventuriers, Flibustier et Pirates. Identité Régionale à la Frontière de l’Empire Espagnol dans la Caraïbe. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 213–227. Arzalier, Francis: Changes in Colonial Ideology in France before 1848. From Slavery to Abolitionism. In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 261–271. Astier Loutfi, Martine: Littérature et colonialisme. Paris: Mouton 1971. Aubert, Guillaume: «The Blood of France». Race and Purity of Blood in the French Atlantic World. In: The William and Mary Quarterly 61 3 (2004), S. 439–478. Bachmann-Medick, Doris: Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl 2006. Bader, Wolfgang: Martinique, Guadeloupe, Guyane. Eine periphere Literaturgeschichte. In: Französisch heute 17 (1986), S. 182–201. Bandau, Anja: Configuraciones atlánticas y modalidades de la circulación de saberes sobre la rebelión de Saint-Domingue entre 1791 y 1810. El caso de «Mon Odyssée». In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 399–419. Bandau, Anja, Marcel Dorigny u.a. (Hg.): Paris Croisé, ou comment le monde extra-européen est venu dans la capitale française (1760–1800). Paris: Karthala 2010. Barbéris, Pierre: Chateaubriand, une réaction au monde moderne. Paris: Libr. Larousse 1976. Benítez Rojo, Antonio: La isla que se repite. Barcelona: Casiopea 1998. Bénot, Yves, Marcel Dorigny (Hg.): Grégoire et la cause des noirs (1789–1831). Saint Denis u.a.: Société française d’histoire d’outre-mer u.a. 2000. Bénot, Yves: Haïti et la «Revue encyclopédique». In: Leon-François Hoffmann, Frauke Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804. Lumières et ténèbres. Impact et résonances d’une révolution. Madrid: Iberoamericana u.a. 2008, S. 99–112. Bernabé, Jean, Patrick Chamoiseau u.a.: Éloge de la Créolité. Paris: Gallimard (1989) 2002. Blumenberg, Hans: Theorie der Lebenswelt. Hg. von Manfred Sommer. Berlin: Suhrkamp 2010. Bonafoux, Luis: Betances. San Juan de P.R.: Instituto de Cultura Puertorirqueña 1970. Bongie, Chris: 1835, or «Le troisième siècle». The Creole Afterlives of Cyrille-Charles-Auguste Bissette, Louis de Maynard de Queilhe, and Victor Schœlcher. In: Chris Bongie: Islands and Exiles. The Creole Identities of Post/Colonial Literature. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press 1998, S. 264–287, 323–340. – Islands and Exiles. The Creole Identities of Post/Colonial Literature. Stanford, Calif.: Stanford Univ. Press 1998. – A Street Named Bissette. Nostalgia, Memory, and the Cent-Cinquantenaire of the Abolition of Slavery in Martinique (1848–1898). In: South Atlantic Quarterly 100, 1 (2001), S. 215–257. – «C’est du papier ou de l’Histoire en Marche?». The Revolutionary Compromises of a Martiniquan Homme de Couleur, Cyrille-Charles-August Bissette. In: Nineteenth Century Contexts 23 (2002), S. 439–473. – Friends and Enemies. The Scribal Politics of Post/Colonial Literature. Liverpool: Liverpool University Press 2008. – Politique, Mémoire, Littérature. L’«Universalité fractionniste» d’Haïti au XIXe siècle. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 231–252.
276
Borrego Plá, María del Carmen: La influencia de la Francia revolucionaria en México. El texto constitucional de Apatzingán. In: María del Carmen Borrego Plá, Leopoldo Zea (Hg.): América Latina ante la Revolución Francesa. México, D.F.: Univ. Nacional Autónoma de México 1993, S. 9–30. Bremer, Thomas: Haiti als Paradigma. Karibische Sklavenemanzipation und europäische Literatur. In: Hanns-Albert Steger, Jürgen Schneider (Hg.): Karibik. Wirtschaft, Gesellschaft und Geschichte. München: Fink 1982, S. 319–340. – Juan Francisco Manzano y su Autobiografía de un esclavo (Cuba, 1835/1840). La repercusión en Europa. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 439–448. Breña, Roberto: El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808–1824. Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico. México, D.F.: El Colegio de México 2006. Brickhouse, Anna: Transamerican Literary Relations and the Nineteenth-Century Public Sphere. Cambridge: Cambridge University Press 2004. Brutus, Edner: Instruction publique en Haïti: 1492–1945. Port-au-Prince: Impr. de l’État 1948. Castro Varela, María do Mar, Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung. Bielefeld: Transcript 2005. Chamoiseau, Patrick, Raphaël Confiant: Lettres créoles. Tracées antillaises et continentales de la littérature: Haïti, Guadeloupe, Martinique, Guyane; 1635–1975. Paris: Hatier 1991. Champion, Jean-Marcel: 30 Floréal Year X. The Restoration of Slavery by Bonaparte. In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 229–236. Chappey, Jean-Luc: La Société des Observateurs de l’Homme (1799–1804) des anthropologues au temps de Bonaparte. Paris: Soc. des Études Robespierristes 2002. Copans, Jean: Aux origines de l’anthropologie française. Les mémoires de la Soc. des Observateurs de l’Homme en l’An VIII. Vorwort von Jean-Paul Faivre. Paris: Le Sycomore 1978. Corzani, Jack: La littérature des Antilles-Guyane Françaises. 6 Bände. Fort-de-France: Desormeaux 1987. Deleuze, Gilles, Félix Guattari: Rhizom. Aus dem Franz. von Dagmar Berger. Berlin: MerveVerl 1977. Démier, Francis: Slavery, Colonial Economy and French Development Choices during the First Industrialization (1802–1840). In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 237–247. Desdunes, Rodolphe Lucien: Nos hommes et notre histoire. Notices biographiques accompagnées de reflexions et de souvenirs personnels, hommage à la population créole, en souvenir des grands hommes qu’elle a produits et des bonnes choses qu’elle a accomplies. Montreal: Arbour & Dupont 1911. Díaz, Roberto Ignacio: Merlin’s Foreign House. The Genres of La Havane. In: Cuban Studies 24 (1994), S. 57–82. Drescher, Seymour: British Way, French Way. Opinion Building and Revolution in the Second French Slave Emancipation. In: Seymour Drescher (Hg.): From Slavery to Freedom. Comparative Studies in the Rise and Fall of Atlantic Slavery. Basingstoke: Macmillan 1999, Kap. 6, S. 158–195. – Two Variants of Anti-Slavery. Religious Organization and Social Mobilization in Britain and France, 1780–1870. In: Seymour Drescher (Hg.): From Slavery to Freedom. Comparative Studies in the Rise and Fall of Atlantic Slavery. Basingstoke: Macmillan 1999, Kap. 2, S. 35–56.
277
Duchet, Michèle: Anthropologie et histoire au siècle des lumières. Buffon, Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot. Paris: Maspero 1971. – Le partage des savoirs. Discours historique et discours ethnologique. Paris: Éd. la Découverte 1985. Duke Bryant, Kelly: Black but not African. Francophone Black Diaspora and the Revue des Colonies, 1834–1842. In: International Journal of African Historical Studies 40, 2 (2007), S. 251–282. Duplantier, Jean-Marc Allard: «Nos frères d’outre-golf». Spiritualism, Vodou and the Mimetic Literatures of Haiti and Louisiana. Diss. Louisiana State University 2006. Online verfügbar unter: http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11152006-152550/unrestricted/ Duplantier_dis.pdf [15.12.2010]. Ette, Ottmar: Cirilo Villaverde: Cecilia Valdés o La Loma del Angel. In: Volker Roloff, Harald Wentzlaff-Eggebert (Hg.): Der hispanoamerikanische Roman. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1992, Bd. 1, S. 30–43; 313f. – La escritura de la memoria. Reinaldo Arenas: Textos, estudios y documentación. Frankfurt am Main: Vervuert 1992. – «Traición, naturalmente.» Espacio literario, poetología implícita en «La Loma del Angel», de Reinaldo Arenas. In: Reinaldo Sánchez (Hg.): Reinaldo Arenas. Recuerdo y Presencia. Miami: Ediciones Universal 1994, S. 87–107. – Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und Amerika. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2001. – Weltbewusstsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne. Göttingen: Velbrück Wissenschaft 2002. – Eine Literatur ohne festen Wohnsitz. Fiktionen und Friktionen der kubanischen Literatur im 20. Jahrhundert. In: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes (Heidelberg) XXVIII, 3–4 (2004), S. 457–481. – Von Inseln, Grenzen und Vektoren. Versuch über die fraktale Inselwelt der Karibik. In: Marianne Braig, Ottmar Ette u.a. (Hg.): Grenzen der Macht – Macht der Grenzen. Lateinamerika im globalen Kontext. Frankfurt am Main: Vervuert 2005, S. 135–180. – ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz. Berlin: Kulturverlag Kadmos 2005. – Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft. In: Lendemains 125 (2007), S. 7–32. – Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009. – Diskurse der Tropen – Tropen der Diskurse: Transarealer Raum und literarische Bewegungen zwischen den Wendekreisen. In: Wolfgang Hallet, Birgit Neumann (Hg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial Turn. Bielefeld: Transcript 2009, S. 139–165. – Europäische Literatur(en) im globalen Kontext. Literaturen für Europa. In: Özkan Ezli, Dorothee Kimmich u.a. (Hg.): Wider den Kulturenzwang. Migration, Kulturalisierung und Weltliteratur. Bielefeld: Transcript 2009, S. 257–296. – Le monde transarchipélien de la Caraïbe coloniale. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 23–64. – ZusammenLebensWissen. List, Last und Lust literarischer Konvivenz im globalen Maßstab. Berlin: Kadmos 2010. Ette, Ottmar, Werner Mackenbach u.a. (Hg.): Trans(it)Areas. Convivencias en Centroamérica y el Caribe. Un simposio transareal. Berlin: edition tranvia (Verlag Walter Frey) 2011. Ette, Ottmar, Gesine Müller (Hg.): worldwide/weltweit. Archipielagos como espacios de prueba de una convivencia global. (Im Druck, erscheint in Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert 2012). Fabre, Michel: From Harlem to Paris. Black American writers in France, 1840–1980. Urbana: Univ. of Illinois Press 1991.
278
–
The New Orleans Press and French-Language Literatures by Creoles of Colour. In: Werner Sollors (Hg.): Multilingual America. Transnationalism, Ethnicity, and the Languages of American Literature. New York: New York Univ. Press 1998, S. 29–49. Fink-Eitel, Hinrich: Die Philosophie und die Wilden. Über die Bedeutung des Fremden für die europäische Geistesgeschichte. Hamburg: Junius 1994. Fischer, Sibylle: Modernity Disavowed. Haiti and the Cultures of Slavery in the Age of Revolution. Durham, NC: Duke University Press 2004. Fleischmann, Ulrich: Ideologie und Wirklichkeit in der Literatur Haitis. Berlin: ColloquiumVerlag 1969. Foucault, Michel: Les mots et les choses. Paris: Gallimard 1966. Fradera, Josep: Colonias para después de un Imperio. Barcelona: Ed. Bellaterra 2005. Garber, Jörn, Heinz Thoma: Zwischen Empirisierung und Konstruktionsleistung. Anthropologie im 18. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 2004. Gazmuri Riveros, Cristián: Libros e ideas políticas francesas en la gestación de la independencia de Chile. In: María del Carmen Borrego Plá, Leopoldo Zea (Hg.): América Latina ante la Revolución Francesa. México, D.F.: Univ. Nacional Autónoma de México 1993, S. 81–108. Gewecke, Frauke: Der Wille zur Nation. Nationsbildung und Entwürfe nationaler Identität in der Dominikanischen Republik. Frankfurt am Main: Vervuert 1996. – Der Titel als Chiffre einer Subversion. «Moi, Tituba, sorcière… Noire de Salem» von Maryse Condé. In: Jochen Mecke, Arnold Rothe (Hg.): Titel–Text–Kontext. Randbezirke des Textes. Festschrift für Arnold Rothe zum 65. Geburtstag. Glienicke, Berlin: Galda + Wilch 2000, S. 159–177. – Die Karibik. Zur Geschichte, Politik und Kultur einer Region. Frankfurt am Main: Vervuert ³2007. – Les Antilles face à la Révolution haïtienne. Césaire, Glissant, Maximin. In: Leon-François Hoffmann, Frauke Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804. Lumières et ténèbres. Impact et résonances d’une révolution. Madrid: Iberoamericana u.a. 2008, S. 251–266. – Saint-Domingue/Haití – Santo Domingo. Proyectos de una isla/nación une et indivisible. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraibes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 253–281. Gilroy, Paul: The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press 1993. – After Empire. Melancholia or Convivial Culture? London: Routledge 2004. Gisler, Antoine: L’esclavage aux Antilles françaises XVIIe-XIXe siècle. Durchges. und korr. Aufl., Reprint der Ausgabe Fribourg, Schweiz, 1965. Paris: Karthala 1981. Glissant, Édouard: Poétique de la relation. Paris: Gallimard 1990. – Introduction à une poétique du divers. Paris: Gallimard 1996. – Le discours antillais. Paris: Gallimard 1997. – Tout-monde. Paris: Gallimard 2003. – Kultur und Identität. Ansätze zu einer Poetik der Vielheit. Aus dem Französischen von Beate Thill. Heidelberg: Wunderhorn 2005. – Mémoires des esclavages. La fondation d’un centre national pour la mémoire des esclavages et de leurs abolitions. Paris: Gallimard u.a. 2007. Haddox, Thomas F.: The «Nous» of Southern Catholic Quadroons. Racial, Ethnic, and Religious Identity in Les Cenelles. In: American Literature 73, 4 (2001), S. 757–778. Hallward, Peter: Absolutely Postcolonial. Writing Between the Singular and the Specific. Manchester: Manchester Univ. Press 2001. Hartog, François: Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps. Paris: Éd. du Seuil 2003. Hassauer, Friederike: Santiago. Schrift, Körper, Raum, Reise. Eine medienhistorische Rekonstruktion. München: Fink 1993.
279
Hernández Sánchez-Barba, Mario: Las cortes españolas ante la abolición de la esclavitud en las Antillas. Opinión institucional ante un tema de política social. In: Quinto Centenario 8 (1985), S. 15–36. Hoffmann, Léon-François: Le Nègre romantique. Personnage littéraire et obsession collective. Paris: Payot 1973. – Littérature d’Haïti. Vanves: Edicef 1995. Hölz, Karl: Zigeuner, Wilde und Exoten. Fremdbilder in der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Berlin: Schmidt 2002. Ianes, Raúl: La esfericidad del papel. Gertrudis Gómez de Avellaneda, la condesa de Merlín y la literatura de viajes. In: Revista Iberoamericana LXIII 178–179 (Januar bis Juni 1997), S. 209–218. James, C.L.R.: The black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo revolution. London u.a.: Penguin books (1938) 2001. Johnson, Jerah: Les Cenelles. What’s in a Name? In: Louisiana History 31, 4 (1990), S. 407–410. Kielstra, Paul Michael: The Politics of Slave Trade Suppression in Britain and France, 1814–48. Diplomacy, Morality and Economics. Basingstoke, Hampshire: Macmillan u.a. 2000. Kirsch, Fritz Peter: Epochen des französischen Romans. Wien: WUV 2000. Klein, Martin A.: Historical Dictionary of Slavery and Abolition. Lanham: Scarecrow Press 2002. König, Torsten: Édouard Glissants pensée archipélique. Zwischen Metapher und poetischem Prinzip. In: Gesine Müller, Susanne Stemmler (Hg.): Raum–Bewegung–Passage. Postkoloniale frankophone Literaturen. Tübingen: Narr 2009, S. 113–130. Korte, Barbara: Der englische Reisebericht. Von der Pilgerfahrt bis zur Postmoderne. Darmstadt: Wiss. Buchges 1996. Küpper, Joachim: Ästhetik der Wirklichkeitsdarstellung und Evolution des Romans von der französischen Spätaufklärung bis zu Robbe-Grillet. Ausgewählte Probleme zum Verhältnis von Poetologie und literarischer Praxis. Stuttgart: Steiner 1987. Lehnert, Gertrud: Des «robes à la turque» et autres orientalismes à la mode. In: Anja Bandau, Marcel Dorigny u.a. (Hg.): Paris Croisé, ou comment le monde extra-européen est venu dans la capitale française (1760–1800). Paris: Karthala 2010, S. 183–200. Lepenies, Wolf: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. München: Hanser 1976. Lionnet, Françoise, Shu-mei Shih: Minor transnationalism. Durham u.a.: Duke Univ. Press 2005. Llorens, Irma: Nacionalismo y literatura. Constitución e institucionalización de la «República de las Letras Cubanas». Lérida: Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos 1998. Lowrie, J.O.: Motif of Kingdom and Exile in Atala. In: French Review 40 (1973), S. 755– 764. Ludwig, Ralph, Dorothee Röseberg: Einleitung. In: Ralph Ludwig, Dorothee Röseberg (Hg.): Tout-Monde: Interkulturalität, Hybridisierung, Kreolisierung. Kommunikations- und gesellschaftstheoretische Modelle zwischen «alten» und «neuen» Räumen. Frankfurt am Main: Lang 2010, S. 7–30. Lüsebrink, Hans-Jürgen: «Negrophilie» und Paternalismus. Die Beziehungen Henri Grégoires zu Haiti (1790–1831). In: Reinhard Sander (Hg.): Der karibische Raum zwischen Selbstund Fremdbestimmung. Zur karibischen Literatur, Kultur und Gesellschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 1984, S. 99–108. – Aufklärerisches Erkenntnispotential versus institutionelle Erkenntnisschranken. Zur Geschichtsschreibung Henri Grégoires (1751–1831). In: Horst-Walter Blanke, Jörn Rüsen (Hg.): Von der Aufklärung zum Historismus. Zum Strukturwandel des historischen Denkens. Paderborn: Schöningh 1985, S. 203–218.
280
–
Missionarische Fremdheitserfahrung und anthropologischer Diskurs. Zu den Nachrichten von der Amerikanischen Halbinsel Californien (1772) des elsässischen Jesuitenmissionars Johann Jakob Baegert. In: Sabine Hofmann, Monika Wehrheim (Hg.): Lateinamerika. Orte und Ordnungen des Wissens. Festschrift für Birgit Scharlau. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2004, S. 69–82. – Das Europa der Aufklärung und die außereuropäische koloniale Welt. Göttingen: Wallstein 2006. – Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart: Metzler ²2008. – Transfers culturels et légitimation postcoloniale du pouvoir. L’émergence de la presse et de la littérature haïtienne pendant le règne du Roi Christophe en Haïti. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 305–325. Maignan-Claverie, Chantal: Le métissage dans la littérature des Antilles françaises. Le complexe d’Ariel. Paris: Karthala 2005. Malena, Anne: The Negotiated Self. The Dynamics of Identity in Francophone Carribean Narrative. New York: Lang 1999. Maluquer de Motes, Jordi: Abolicionismo y resistencia a la abolición en la España del siglo XIX. In: Anuario de Estudios Americanos 53 (1986), S. 311–331. Mateos, Ana: Dialéctica para una voz propia en Cecilia Valdés. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 103–120. Matzat, Wolfgang: Diskursgeschichte der Leidenschaft. Zur Affektmodellierung im französischen Roman von Rousseau bis Balzac. Tübingen: Narr 1990. Méndez Rodenas, Adriana: Voyage to La Havane. The Countess of Merlín’s Preview of National Identity. In: Cuban Studies 16 (1986), S. 71–99. – A Journey to the (Literary) Source. The Invention of Origins in Merlin’s Viaje a La Habana. In: New Literary History 21, 3 (1990), S. 707–731. – Gender and nationalism in colonial Cuba. The travels of Santa Cruz y Montalvo, Condesa de Merlin. Nashville u.a.: Vanderbilt Univ. Press 1998. Mesnard, Éric: Resistance Movements in the French Colonies. The Bissette Affair (1823–1827). In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 255–260. Meyer-Krentler, Leonie: El Bois-Caïman y la mitificación de la figura negra en Les Créoles ou la Vie aux Antilles de J. Levilloux. In: Liliana Gómez, Gesine Müller (Hg.): Relaciones caribeñas. Entrecruzamientos de dos siglos = Relations caribéennes. Frankfurt am Main: Lang 2011, S. 69–88. – Los perros ingleses y los perros esclavos. Exclusión, animalización y convivencia en Cecila Valdés de Cirilo Villaverde. In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): worldwide/ weltweit. Archipielagos como espacios de prueba de una convivencia global. (Im Druck, erscheint in Frankfurt am Main, Madrid: Vervuert). – Mensch und Tier in der Karibik. Zur Inszenierung ethnischer Konflikte in spanisch- und französischsprachigen Erzähltexten des 19. Jahrhunderts (Forthcoming). Middelanis, Carl Hermann: Imperiale Gegenwelten. Haiti in den französischen Text- und Bildmedien 1848–1870. Frankfurt am Main: Vervuert 1996. Mignolo, Walter D.: La razón postcolonial. Herencias coloniales y teorías postcoloniales. In: Alfonso de Toro (Hg.): Postmodernidad y postcolonialidad. Breves reflexiones sobre Latinoamérica. Madrid: Vervuert, Iberoamericana 1997, S. 51–70. – Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press 2000.
281
–
Historias Locales/Diseños Globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. Aus dem Amerikanischen übers. von Juan María Madariaga und Cristina Vega Solis. Madrid: Akal 2003. Möllers, Nina: Kreolische Identität. Eine amerikanische «Rassengeschichte» zwischen Schwarz und Weiß. Die Free People of Color in New Orleans. Bielefeld: Transcript 2008. Molloy, Sylvia: At Face Value. Autobiographical Writing in Spanish America. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1991. Mouffe, Chantal: On the Political. London: Routledge 2005. Müller, Gesine: Die Boom-Autoren heute. García Márquez, Fuentes, Vargas Llosa, Donoso und ihr Abschied von den «großen identitätsstiftenden Entwürfen». Frankfurt am Main: Vervuert 2004. – Conceptos de ciudadanía en vísperas de la independencia. Los literatos caribeños y su contribución al nation-building. In: Barbara Potthast, Juliana Ströbele-Gregor u.a. (Hg.): Ciudadanía vivida, (in)seguridades e interculturalidad. ADLAF Congreso Anual 2006. Buenos Aires: Fundación Foro Nueva Sociedad 2008, S. 122–131. – «Une misérable petite île! moins qu’une île…». Raumdynamiken und koloniale Positionierung in der Literatur der spanischen und französischen Karibik im 19. Jahrhundert. In: Gesine Müller, Susanne Stemmler (Hg.): Raum–Bewegung–Passage. Postkoloniale frankophone Literaturen. Tübingen: Narr 2009, S. 87–100. – Entre la francofilia y las aspiraciones de autonomía: Una mirada desde el Caribe sobre las diferentes constelaciones postcoloniales. In: Robert Folger, Stephan Leopold (Hg.): Escribiendo la Independencia. Perspectivas postcoloniales sobre la literatura hispanoamericana del siglo XIX. Frankfurt, Madrid: Vervuert, Iberoamericana 2010, S. 125–139. – El Caribe como caleidoscopio de dinámicas coloniales (1789–1886). In: Liliana Gómez, Gesine Müller (Hg.): Relaciones caribeñas. Entrecruzamientos de dos siglos = Relations caribéennes. Frankfurt am Main: Lang 2011, S. 13–36. – Exil als Heimat – Heimat als Exil? Zur romantischen Inszenierung von Entwurzelung bei Literaturen der karibischen Kolonien Frankreichs und Spaniens (1838–1844). In: Frank Estelmann, Olaf Müller (Hg.): Exildiskurse der Romantik in der europäischen und lateinamerikanischen Literatur. Tübingen: Narr 2011, S. 227–242. Naranjo Orovio, Consuelo: Los rostros del miedo. El rumor de Haití en Cuba (siglo XIX). In: Ottmar Ette, Gesine Müller (Hg.): Caleidoscopios coloniales. Transferencias culturales en el Caribe del siglo XIX = Kaléidoscopes coloniaux. Transferts culturels dans les Caraïbes au XIXe siècle. Frankfurt am Main: Iberoamericana, Vervuert 2010, S. 283–304. Ogden, Daryl: Byron, Italy, and the Poetics of Liberal Imperialism. In: Keats Shelley Journal 49 (2000), S. 114–137. Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: Beck 52010. Padura Fuentes, Leonardo: José María Heredia. La patria y la vida. Havanna: Unión 2003. Pagni, Andrea: Traducción y transculturación en el siglo XIX. Atala de Chateaubriand por Simón Rodríguez (1801) y el Cancionero de Heine por José A. Pérez Bonalde (1885). In: Iberoamericana 24, 2/3 (78/79) (2000), S. 88–103. Painter, Nell Irvin: The History of White People. New York: Norton 2010. Pedraz Marcos, Azucena: Quimeras de África. La sociedad Española de Africanistas y Colonialistas. Madrid: Polifemo 2000. Pedraza Jiménez, Felipe B., Eugenio Alonso Martín: Manual de literatura hispanoamericana. Berriozar (Navarra): Cénlit 1991. Piqueras Arenas, José Antonio: La revolución democrática (1868–1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1992. Pons, André: Blanco White Abolicionista. In: Cuadernos Hispanoamericanos 559 (1997), S. 63–76. Popkin, Jeremy D.: Facing Racial Revolution. Eyewitness Accounts of the Haitian Insurrection. Chicago: The University of Chicago Press 2007.
282
Poumier, María: José María Heredia et la révolution française (Cuba 1803–Mexico 1839). In: Cahiers des Amériques Latines 10 (1990), S. 262–274. Pratt, Mary Louise: Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. London: Routledge 1992. Reinstädler, Janett: Die Theatralisierung der Karibik. Postkoloniale Inszenierungen auf den spanisch- und französischsprachigen Antillen im 19. Jahrhundert. Habilitation. Berlin. Humboldt-Universität 2006. – La répetition interrompue. Representando la descentralización del caribe durante la Revolución Francesa. In: Ottmar Ette (Hg.): Caribbean(s) on the move. Archipiélagos literarios del Caribe. A TransArea Symposium. Frankfurt am Main: Lang 2008, S. 23–38. Rétat, Pierre: Citoyen-Sujet, Civisme. In: Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680–1820 9 (1988) (Titel des Bandes: Rolf Reichardt: Bastille – Pierre Rétat: Citoyen-Sujet, Civisme). München: Oldenbourg, S. 75–105. Riedel, Wolfgang: Anthropologie und die Literatur in der deutschen Spätaufklärung. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur, 6. Sonderheft (1994), S. 93–157. Roldán, Inés de: La diplomacia Británica y la abolición del trafico de esclavos cubanos. Una nueva aportación. In: Quinto Centenario 2 (1981), S. 219–225. Ronzón, Elena: Antropología y antropologías. Ideas para una historia crítica de la antropología española. Oviedo: Pentalfa 1991. Rosa, Richard: Los fantasmas de la razón. Una lectura material de Hostos. San Juan, Puerto Rico; Santo Domingo, Rep. Dom.: Isla Negra 2003. Rössner, Michael: Das Bild der Indios in der brasilianischen und hispanoamerikanischen Romantik. In: Sybille Große, Axel Schönberger (Hg.): Dulce et decorum est philologiam colere. Festschrift für Dietrich Briesemeister zu seinem 65. Geburtstag. Berlin: Domus Ed. Europaea 1999, Bd. II, S. 1709–1726. Said, Edward W.: Kultur und Imperialismus. Einbildungskraft und Politik im Zeitalter der Macht. Aus dem Amerik. übersetzt von Hans-Horst Henschen. Frankfurt am Main: S. Fischer 1994. [Titel der amerikanischen Originalausgabe: Culture an Imperialism. New York: A. Knopf 1993.] Schmidt-Nowara, Christopher: Empire and Antislavery. Spain, Cuba, and Puerto Rico, 1833–1874. Pittsburgh, Pa.: Univ. of Pittsburgh Press 1999. Schulin, Ernst: Die Französische Revolution. München: Beck ²1989. Servera, José: Introducción. In: Gertrudis Gómez de Avellaneda: Sab. Hg. von José Servera. Madrid: Cátedra 1997, S. 9–93. Smith, Lynn, Vernon J. Parenton: Acculturation among the Louisiana French. In: American Journal of Sociology 44, 3 (1938), S. 355–364. Sommer, Doris: Foundational Fictions. The National Romances of Latin America. Berkeley: University of California Press 1991. Staum, Martin S.: Labeling People. French Scholars on Society, Race, and Empire, 1815– 1848. Montreal u.a.: McGill-Queens Univ. Press 2003. Steiner, George: Exterritorial. Schriften zur Literatur und Sprachrevolution. Aus dem Amerikanischen von Michael Harro Siegel. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974. Tessonneau, Alex-Louise: Dupré et la littérature jaune en Haïti sous Henri Christophe. In: Leon-François Hoffmann, Frauke Gewecke u.a. (Hg.): Haïti 1804. Lumières et ténèbres. Impact et résonances d’une révolution. Madrid: Iberoamericana u.a. 2008, S. 183–200. Thiem, Annegreth: Rauminszenierungen. Literarischer Raum in der karibischen Prosaliteratur des 19. Jahrhunderts. Berlin, Münster: Lit 2010. Thoma, Heinz: Von der Geschichte des esprit humain zum esprit français. Anthropologie, kulturelle Ordnungsvorstellungen und Literaturgeschichtsschreibung in Frankreich 1790–1840. In: Hansjörg Bay, Kai Merten (Hg.): Die Ordnung der Kulturen. Zur Konstruktion ethnischer, nationaler und zivilisatorischer Differenzen 1750–1850. Würzburg: Königshausen & Neumann 2006, S. 99–120.
283
Tietz, Manfred, Dietrich Briesemeister (Hg.): Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII. Actas del coloquio internacional de Berlín, 07.–10.04.1999. Frankfurt am Main u.a.: Vervuert 2001. Torres-Saillant, Silvio: An Intellectual History of the Caribbean. New York: Palgrave Macmillan 2006. Toumson, Roger: La transgression des couleurs. Littérature et langage des Antilles, XVIIIe, XIXe, XXe siècles. Paris: Éd. Caribéennes 1989. Trouillot, Michel-Rolph: Zur Bagatellisierung der haitianischen Revolution. In: Sebastian Conrad (Hg.): Jenseits des Eurozentrismus. Postkoloniale Perspektiven in den Geschichtsund Kulturwissenschaften. Frankfurt am Main: Campus 2002, S. 84–115. Vigier, Philippe: The Reconstruction of the French Abolitionist Movement under the July Monarchy. In: Marcel Dorigny (Hg.): The Abolitions of Slavery. From Léger Félicité Sonthonax to Victor Schœlcher, 1793, 1794, 1848. Paris: UNESCO u.a. 2003, S. 248–254. Vila Vilar, Enriqueta, Luisa Vila Vilar (Hg.): Los abolicionistas españoles. Siglo XIX. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica 1996. Warning, Rainer: Romantische Tiefenperspektivik und moderner Perspektivismus. Chateaubriand/Flaubert/Proust. In: Karl Maurer, Winfried Wehle (Hg.): Romantik. Aufbruch zur Moderne. München: Fink 1991, S. 295–324. Watson, Tim: Caribbean Culture and British Fiction in the Atlantic World, 1780–1870. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2008. Weigel, Sigrid: Zum «topographical turn». Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. In: KulturPoetik 2, 2 (2002), S. 151–165. Werner, Michael, Bénédicte Zimmermann: Vergleich, Transfer, Verflechtung. Der Ansatz der «Histoire croisée» und die Herausforderung des Transnationalen. In: Geschichte und Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft 28 (2002), S. 607–636. Wogatzke, Gudrun: Identitätsentwürfe. Selbst- und Fremdbilder in der spanisch- und französischsprachigen Prosa der Antillen im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main: Vervuert 2006. Wogatzke-Luckow, Gudrun: Victor Hugo: Bug-Jargal (1826). Abgesang auf den «bon sauvage» oder Inszenierung von Ambivalenzen? In: Susanne Grunwald (Hg.): Pasajes. Homenaje a Christian Wentzlaff-Eggebert = Passages. Mélanges offerts à Christian Wentzlaff-Eggebert = Passagen. Festschrift für Christian Wentzlaff-Eggebert. Sevilla: Univ. Secretariado de Publ. u.a. 2004, S. 21–138. Wolfzettel, Friedrich: Ce désir de vagabondage cosmopolite. Wege und Entwicklung des französischen Reiseberichts im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 1986. Zacair, Philippe: Haiti on his Mind. Antonio Maceo and Caribbeanness. In: Caribbean Studies 33 (2005), S. 47–78. Zeuske, Michael: Kleine Geschichte Kubas. München: Beck 2000. – Schwarze Karibik. Sklaven, Sklavereikultur und Emanzipation. Zürich: Rotpunktverl. 2004.
X.5.
Internetquellen
Adams, Gerry: Cuba and Ireland: Two Islands in the Same Sea of Struggle. Online unter: http://www.seeingred.com/Copy/5.0_cuba_ireland.html [22.02.2011]. Castells, Irene (2002): La ciudadanía revolucionaria. Online unter http://www.casataule.org/ cast/docs/la_ciudadania_revolucionaria.doc [05.10.2010]. Ette, Ottmar: Réflexions européennes sur deux phases de mondialisation accélérée chez Cornelius de Pauw, Georg Forster, Guillaume-Thomas Raynal et Alexandre de Humboldt. In: HiN. Alexander von Humboldt im Netz. Internationale Zeitschrift für HumboldtStudien (Potsdam – Berlin) 11, 21 (2010), S. 1–28. Online unter: http://www.hin-online. de [15.03.2011].
284
Gaztambide Géigel, Antonio: La geopolítica del antillanismo en el Caribe del siglo XIX. In: Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe 4, 8 (2007), S. 41–74. Online unter: http://www.uninorte.edu.co/publicaciones/memorias/memorias_8/ articulos/gaztambide.pdf [10.12.2010]. Müller, Gesine: «Je me suis rencontré entre deux siècle comme au confluent de deux fleuves...» Dynamiken des kolonialen Status quo in der französischen und spanischen Karibik im 19. Jahrhundert. In: Albrecht Buschmann, Gesine Müller (Hg.): Dynamisierte Räume. Zur Theorie der Bewegung in den romanischen Kulturen. Potsdam 2009. Online unter: http://www.uni-potsdam.de/romanistik/ette/buschmann/dynraum/mueller. html [03.03.2011]. Zeuske, Michael: Gran Caribe. Online unter: http://www.ihila.uni-koeln.de/5593.html [05.12.2010]. http://docsouth.unc.edu/nc/walker/walker.html [31.01.2011]. http://www.centenary.edu/french/textes/cenelles4.htm [23.02.2011]. http://www.erzwiss.uni-hamburg.de/inst05/abs.../Kapitel03.pdf [09.02.2011]. http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/4h2931t.html [31.01.2011]. http://www.potomitan.info/articles/deloin.php [20.02.2011].
285
![Ästhetik des Chaos in der Karibik: »Créolisation« und »Neobarroco« in franko- und hispanophonen Literaturen [1. Aufl.]
9783839425084](https://dokumen.pub/img/200x200/sthetik-des-chaos-in-der-karibik-creolisation-und-neobarroco-in-franko-und-hispanophonen-literaturen-1-aufl-9783839425084.jpg)