Die Gestapo Trier: Beiträge zur Geschichte einer regionalen Verfolgungsbehörde [1 ed.] 9783412510077, 9783412509149
219 21 5MB
German Pages [370] Year 2017
Polecaj historie
Citation preview
Gestapo – Herrschaft – Terror Studien zum n ationalsozialistischen Sicherheitsapparat Herausgegeben von Thomas Grotum und Thomas Roth Band 1
Thomas Grotum (Hg.)
DIE GESTAPO TRIER Beiträge zur Geschichte einer regionalen Verfolgungsbehörde
Böhlau Verlag Köln Weimar Wi en | 2018
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek : Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: Das Reichsbahndirektionsgebäude in Trier, undatiert (Stadtarchiv Trier, Bild-Slg. 1, 26–68)
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien Lindenstraße 14, D-50674 Köln, www.boehlau-verlag.com Ein Unternehmen der Verlagsgruppe Vandenhoeck & Ruprecht Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist unzulässig. Korrektorat: Matthias Stangel, Rommerskirchen Satz: Michael Rauscher, Wien Einbandgestaltung: Michael Haderer, Wien Druck und Bindung : Hubert & Co., Göttingen Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in the EU ISBN 978-3-412-50914-9
Inhalt Danksagung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Thomas Grotum Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Lena Haase Die Gestapo in der Gesellschaft. Quellenlage und Forschungsfelder zur Geschichte der Staatspolizeistelle Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Matthias Klein Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei. Das Abhören ausländischer Sender im Raum Trier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Sebastian Heuft Die Gestapo als Zensurbehörde. Das Trierer Paulinusblatt in der NS-Zeit. . . . . . . . .
81
Katharina Klasen Die Gestapo am „Ort des Terrors“. Das Vernehmungskommando im SS-Sonderlager/ Konzentrationslager Hinzert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Felix Klormann „Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert. Zur Praxis des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Martin Spira Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier. Die Tagesrapporte 1939 bis 1942.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Max Heumüller Kommunisten im Visier der Gestapo Trier. Überwachung und Verfolgung 1934 bis 1936 .. 147
Frederik Rollié Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung im Spiegel der Trierer GestapoLageberichterstattung (1934–1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6
|
Inhalt
Ksenia Stähle Gefährliche Rückkehrer? Fremdenlegionäre aus Sicht der Staatspolizeistelle Trier . . . . 187
Justus Jochmann Abwehr. Die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Abteilung III der Staatspolizeistelle Trier am Beispiel Luxemburgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Hannes Brogmus Vom Nachbarn zum Verfolgten. Die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bürger Triers zwischen 1933 und 1938 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Benjamin Koerfer Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier und Umgebung in das Getto Litzmannstadt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Andreas Borsch Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden in der Vulkaneifel. Überlegungen zum öffentlichen Raum und seiner Funktionalisierung im Nationalsozialismus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Jill Steinmetz „Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“. Die Verteidigungsstrategie des Rechtsanwalts Dr. Kurt Heim im Kriegsverbrecherprozess gegen Gestapobeamte vor dem Gerichtshof des Großherzogtums Luxemburg (1949–1951) . . . . . . . . . . . . 275
Thomas Grotum Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda. Weitere Forschungen zur Geschichte der Staatspolizeistelle Trier . . . . . . . . . . . . 293 Abkürzungsverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Quellen- und Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Danksagung
Im Sommer 2011 hat sich der Trierer Leitende Oberstaatsanwalt, Jürgen Brauer, an den Geschäftsführer des Fachs Geschichte der Universität Trier, Olaf Blaschke, gewandt, um mehr über die Geschichte der Staatspolizeistelle in der Moselstadt zu erfahren, die von 1935 bis 1944 in dem Gebäude untergebracht war, in das die Staatsanwaltschaft im Herbst 2011 umziehen sollte. Als es am 5. September 2011 zu einem ersten Treffen kam, ahnte wohl keiner der Beteiligten, dass sich aus dieser Anfrage ein derartig umfangreiches Forschungsprojekt entwickeln würde. Ohne finanzielle und personelle Ressourcen erschien es zunächst sehr unwahrscheinlich, mehr über das konkrete Wirken der Gestapo Trier herauszubekommen, da geschlossene archivalische Überlieferungen nahezu vollständig fehlten. Der einzig gangbare Weg schien, mittels studentischer Abschlussarbeiten zumindest einzelne Aspekte der Geschichte der Gestapo zu erforschen. Erfahrungsgemäß lassen sich bei genauerer Suche vereinzelt Gegenüberlieferungen finden, die Einblicke in Teilbereiche bieten. Zudem hatte ich in den vorangegangenen Semestern Seminare zur Polizei-, Justiz- und NS-Geschichte angeboten, so dass die Hoffnung bestand, einzelne Studierende würden ihre Abschlussarbeit in diesem Themenbereich schreiben wollen. Das war die Geburtsstunde des Forschungsprojektes zur Geschichte der Gestapo Trier, das offiziell im Januar 2012 seine Arbeit aufgenommen hat. Der vorliegende Sammelband ist ein Zwischenergebnis der Forschungstätigkeit. Innerhalb der letzten fünfeinhalb Jahre sind 19 Magister-, Staatsexamens- oder Masterarbeiten, also deutlich mehr als ursprünglich gedacht, abgeschlossen worden, fünf weitere befinden sich derzeit in Bearbeitung. Sie haben wichtige Schneisen geschlagen, um neue Themenfelder der Gestapo-Forschung anzugehen. Darüber hinaus konnte Schritt für Schritt die Quellenlage verbessert werden. Mittlerweile sind in mehr als 35 Einrichtungen weltweit relevante Akten ermittelt und zum Großteil in Kopie nach Trier geholt worden. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Dank der Vermittlung von Olaf Blaschke, der mittlerweile an der Universität Münster tätig ist, kam es zur Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Trier und dabei zur praktischen Umsetzung einer Kombination aus Forschung, Lehre und (Wissens-)Transfer. Die beteiligten Studierenden sollten nämlich gegen Ende ihres Studiums nicht nur eine Einführung in die Quellen- und die Projektarbeit erhalten und sich – teils auch noch nach Abschluss ihres Studiums – in einen ständigen Erfahrungs- und Informationsaustausch begeben, sondern die Ergebnisse ihrer
8
|
Danksagung
Forschungen auch im Rahmen diverser Kolloquien, Ausstellungen, Vortragsreihen und Publikationen unterschiedlichen Zielgruppen präsentieren. Ohne die Initiative und die ständige Mithilfe der Staatsanwaltschaft Trier wäre dieses Projekt nicht zustande gekommen und hätte nicht bereits zahlreiche Ergebnisse der Öffentlichkeit unterbreiten können. Mein Dank gilt Jürgen Brauer, jetzt Koblenzer Generalstaatsanwalt, und seinem Nachfolger in Trier, dem Leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, sowie dem Geschäftsleiter Harald Prümm. Auch bei der Realisierung dieses Sammelbandes konnte ich mich auf ihre Unterstützung verlassen. Das Engagement der Studierenden, die sich darauf eingelassen haben, deutlich mehr Arbeit und Zeit in ihre Abschlussarbeit zu investieren als dies normalerweise üblich ist, bildet die Basis des Projektes. Ich danke Viktoria Bach, Paul Vincent Benter, Laura Bold, Hannes Brogmus, Viktoria Franz, Johanna Gouverneur, Sebastian Heuft, Max Heumüller, Justus Jochmann, Matthias Klein, Gwendolyn Kloppenburg, Felix Klormann, Felix Knecht, Mario Loncar, Katharina Müller, Jana Nieuwenhuizen, Frederik Rollié, Anke Schwebach, Martin Spira, Ksenia Stähle, Jill Steinmetz sowie Maike Vaas. Darüber hinaus haben Andreas Borsch und Benjamin Koerfer auf Basis ihrer Abschlussarbeiten einen Beitrag für den vorliegenden Band geliefert. Auch wenn das Forschungsprojekt bisher mit vergleichsweise geringen finanziellen Mitteln ausgekommen ist, so war die Förderung durch den Freundeskreis Trierer Universität e.V., die Nikolaus Koch Stiftung, die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs III (Rita Voltmer) und das Präsidium der Universität Trier eine wichtige Voraussetzung, um die vielen Aktivitäten umzusetzen. Herzlichen Dank ! Mein Dank gebührt allen Archiven und anderen Institutionen, die Quellen für das Projekt beigesteuert und somit zum erfolgreichen Verlauf beigetragen haben, und ich bitte um Verständnis, dass angesichts der Vielzahl nicht alle Beteiligten namentlich genannt werden können. Besonders erwähnen möchte ich Barbara Weiter-Matysiak (Kreisarchiv Trier-Saarburg) und Bernhard Simon (Stadtarchiv Trier), die beide vor Ort dem Projekt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln beistehen. Die grenzüberschreitende Kooperation mit dem Musée national de la Résistance in Esch-sur-Alzette, die sich aus der gemeinsamen Ausstellung „Gestapo-Terror in Luxemburg“ ergeben hat, führt immer wieder zu neuen spannenden Erkenntnissen, Georges Büchler und Frank Schroeder sei Dank. Der Leiter des Landesarchivs Speyer, Walter Rummel, ist ein Förderer der ersten Stunde, der viele wichtige Ratschläge gegeben und das Projekt jederzeit kooperativ begleitet hat. Von ihm stammt auch der Hinweis, dass in Frankreich umfangreiche Akten der Gestapo Trier aufgetaucht sind. Die Bearbeitung der 3.533 Personenakten im französischen Militärarchiv in Vincennes ist durch ein Kooperationsabkommen
Danksagung
|
des Deutschen Historischen Instituts Paris (DHIP) und dem Service historique de la Défense (SHD) mit der Universität Trier ermöglicht worden. Dank schulde ich Stefan Martens, der nicht nur den Kontakt hergestellt, sondern auch die Arbeiten in Paris koordiniert hat, und den Beteiligten im SHD : Pierre Laugeay, Agnès Beylot und Thierry Sarmant sowie Frédéric Queguineur und seinem Team. Lutz Raphael hat mir nicht nur den nötigen Freiraum für die Umsetzung des Projekts gegeben, sondern ist mehrfach eingesprungen, wenn sich finanzielle Engpässe bei der Umsetzung einzelner Arbeitsschritte auftaten. Zudem stand er mir – ebenso wie Christian Jansen – bei der Betreuung und der Begutachtung der Abschlussarbeiten zur Seite. Tobias Trexler (2012/13), Lena Haase (seit 2014), Ksenia Stähle (seit 2015) und Franziska Leitzgen (seit 2016) haben als wissenschaftliche Hilfskräfte zum erfolgreichen Verlauf des Projektes und zur Entstehung dieses Bandes wesentlich beigetragen. Lena Haase hat einen Beitrag verfasst, der aus der Perspektive der bisher ermittelten Quellen neue Forschungsfelder zur Geschichte der Gestapo Trier eröffnet. Sie war es auch, die 2015 und 2016 in insgesamt 16 Wochen im SHD in Vincennes die Bearbeitung der 3.533 Personenakten der Gestapo Trier übernommen hat. Die Landeszentralen für politische Bildung in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben diese Publikation dankenswerterweise durch die Abnahme fester Kontingente unterstützt. Ferner hat der intensive Austausch mit der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert und deren Leiterin Beate Welter einige Teilprojekte erst ermöglicht. Bei Dorothee Rheker-Wunsch und dem Böhlau Verlag bedanke ich mich für das große Interesse an dem Projekt und die jederzeit konstruktive Zusammenarbeit. Trier, im August 2017 Thomas Grotum
9
Thomas Grotum
Einleitung
Jahrzehntelang galt die Geheime Staatspolizei (Gestapo) als eine allgegenwärtige, allwissende und allmächtige Institution. Dieses Bild wurde in der NS-Zeit bewusst, auch in der Presse,1 propagiert und ist von der Forschung in der Nachkriegszeit zunächst unkritisch übernommen worden. Erst durch die Hinwendung zu einer „Sozialgeschichte des Terrors“ in den 1990er Jahren ist dieser Eindruck als Mythos entlarvt worden. Die Basis für eine kritische Gestapo-Forschung bildeten seither die Studie von Reinhard Mann über die Staatspolizeistelle Düsseldorf,2 die Untersuchung von Robert Gellately zur Durchsetzung der NS-Rassenpolitik im Zuständigkeitsbereich der Staatspolizeistelle Würzburg3 sowie das von Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul durchgeführte Projekt „Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945“4. Die reinen Organisationsgeschichten einzelner Staatspolizeistellen mit einem Schwerpunkt auf der Vorkriegszeit wurden durch multiperspektivische Studien abgelöst. Es entstand das Bild einer personell unterbesetzten und oft erst auf Hinweise von außen reagierenden Staatspolizei, die einen Großteil ihrer Informationen für die Verfolgungsmaßnahmen aus der „Mitte der Gesellschaft“ erhielt. Diese „neue“ Gestapo-Forschung präsentierte sich in drei Sammelbänden, die zwischen 1995 und 2009 herausgegeben wurden.5 Während der erste Band als eine Zwischenbilanz zu verstehen ist, in dem der 1 Vgl. beispielsweise Kölnische Illustrierte Zeitung vom 23. März 1939, 14. Jg., Nr. 12. 2 Reinhard Mann : Protest und Kontrolle im Dritten Reich. Nationalsozialistische Herrschaft im Alltag einer rheinischen Großstadt (Studien zur historischen Sozialwissenschaft, Bd. 6), Frankfurt a.M./New York 1987. 3 Robert Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945, Paderborn u.a. 1993. 4 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Das zersplitterte Nein. Saarländer gegen Hitler (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd.1) Bonn 1989 ; Dies.: Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 2), Bonn 1991 ; Dies.: Milieus und Widerstand. Eine Verhaltensgeschichte der Gesellschaft im Nationalsozialismus (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 3), Bonn 1995. 5 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995 ; Dies. (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000 ; Klaus-Michael Mallmann/Andrej Angrick (Hg.) : Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 14), Darmstadt 2009.
12
|
Thomas Grotum
Paradigmenwechsel angekündigt und anhand von diversen Beispielen ausgeführt wurde, reagierten die beiden Folgebände bereits auf kritische Anmerkungen. Die zuvor stark vernachlässigte Zeit des Zweiten Weltkriegs steht im Mittelpunkt von Band zwei, die Nachkriegskarrieren von Gestapomitarbeitern, die gesellschaftliche und juristische Aufarbeitung der Verbrechen sowie das Bild der Gestapo nach 1945 sind Themen des dritten Bandes. Während das Pendel durch die Betonung von Denunziationen und V-Leuten für die staatspolizeiliche Tätigkeit zunächst von der institutionellen Allmacht hin zur „sich selbst überwachenden Gesellschaft“ (Gellately) ausschlug, ist in der Zwischenzeit die Bedeutung der aktiven Mitarbeit staatlicher und parteiamtlicher Stellen und Einrichtungen im Rahmen der „staatspolizeilichen Praxis“ stärker in den Mittelpunkt des Interesses geraten.6 Die Gestapo war eine ausgesprochen dynamische und flexible Institution, deren Aufgabenbereiche und Organisationsstrukturen sich ständig erweiterten und wandelten. Zu ihren Aufgaben gehörten die Überwachung der Bevölkerung, die Ausschaltung politischer und ideologischer Gegner und die Unterdrückung jeglichen abweichenden Verhaltens. Ab Mitte der 1930er Jahre wurde sie immer mehr zu einer „völkischen Polizei“, die nach rassenpolitischen Vorgaben gegen Personen und Gruppen („Gemeinschaftsfremde“) vorging. In der Expansionsphase des NS-Staates ab 1938 dehnte sie nicht nur ihren Einflussbereich auf die besetzten Gebiete aus, sondern weitere Gruppen wie Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene („Fremdvölkische“), aber auch die als widerständig angesehene Bevölkerung der besetzten Länder gerieten in den Fokus der Gestapo. Zudem war sie entscheidend an der Deportation und der Ermordung der europäischen Juden beteiligt. Weder die Existenz der Geheimen Staatspolizei noch der Sitz ihrer Dienststellen waren im nationalsozialistischen Deutschland geheim. Entsprechende Einträge lassen sich in den Adress- und Telefonverzeichnissen der Zeit finden. In Trier war die Staatspolizei zunächst im alten Regierungsgebäude am Hauptmarkt untergebracht. Im Oktober 1935 ist sie in das Reichsbahndirektionsgebäude in der Christophstraße 1 umgezogen,7 das zehn Jahre zuvor eingeweiht worden war.8 Dort hatte 6 Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 4 2017 (2008), S. 95–102. 7 Im Trierer Einwohnerbuch des Jahres 1936 findet sich sowohl im alphabetischen (S. 243) als auch im Straßenverzeichnis (S. 29) ein Eintrag der „Staatspolizeistelle für den Reg.-Bezirk Trier“, und zwar in der Christophstraße 1. 8 Reichsbahndirektion Trier : Zur Erinnerung an die Einweihung des neuen Geschäftsgebäudes der Reichsbahndirektion Trier am 1. Oktober 1925, Trier 1925. Im hinteren Anzeigenteil des Bandes befindet sich auch eine Aufnahme des Gebäudes in der Kronprinzenstraße 5, dem späteren Sitz der Abteilung III der Gestapo Trier, da es sich 1925 um den Standort der Baufirma Hans Zimmer-
Einleitung
|
Abb. 1: Plan der Stadt Trier 1938 (Auszug), = Regierungsgebäude am Hauptmarkt, = Reichsbahndirektionsgebäude Christophstraße 1, = Kochstraße 1, = Kronprinzenstraße 5, = Straße Richtung Trier-Olewig. (Quelle: Einwohnerbuch der Stadt Trier 1938).
die Gestapo in Bahnhofsnähe im ersten Obergeschoss, später auch in der zweiten Etage, ihre Büros und Vernehmungsräume. Die Verwaltung (Abteilung I) war zeitweise in der Kochstraße 1, die Abwehr (Abteilung III) in der Kronprinzenstraße 5 untergebracht.9 Schwere Bombentreffer am Reichsbahndirektionsgebäude Anfang Oktober 1944 machten es notwendig, die Dienststelle kurzfristig in den Stadtteil Olewig (Villa Zeimet) zu verlegen, von wo aus sie schließlich über den Jahreswechsel 1944/45 in das Hotel „Zur Post“ nach Zeltingen (Mosel) zog.10
mann handelte, welche die Erd-, Maurer- und Eisenbetonarbeiten für das Reichsbahndirektionsgebäude ausgeführt hatte. 9 Service historique de la Défense (SHD) Vincennes, GR28 P7, 56. Im Herbst 1943 wurde die Gestapo Trier zur Außenstelle der Gestapo Koblenz, so dass die Verwaltung ab diesem Zeitpunkt in Koblenz lag. 10 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 655,123, Nr. 1251. Siehe auch den Beitrag von Lena Haase in diesem Band.
13
14
|
Thomas Grotum
Über die Tätigkeit der am 5. Mai 1933 etablierten Staatspolizeistelle Trier war bis vor einigen Jahren nur wenig bekannt, da geschlossene Aktenbestände, die Auskunft über ihre Geschichte hätten geben können, nahezu vollständig fehlten. Ein Versuch, Details über die regionalen NS-Verfolgungsinstanzen im Rahmen der in den 1980er Jahren vorgelegten Trierer Stadtgeschichte zu ermitteln, scheiterte an der schlechten Quellenlage.11 Dass die Gestapo in vielfältiger Weise an verbrecherischen Taten beteiligt war, konnte zum damaligen Zeitpunkt nur durch Einzelbeispiele belegt werden. So liegen Augenzeugenberichte von Betroffenen vor, die von Misshandlungen durch die Gestapo berichten.12 Ferner existierte eine personelle Verbindung zum nahegelegenen SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert. Das dortige „Vernehmungskommando“ setzte sich aus Beamten der Gestapo Trier und Luxemburg zusammen. Im Verlauf von „verschärften Vernehmungen“ wurde gegenüber Häftlingen oft auch Gewalt eingesetzt, um Geständnisse zu erzwingen. Dass die Gestapo Trier als Dreh- und Angelpunkt für das Lager in Hinzert diente, belegt ein Ereignis am 16. Oktober 1941. An diesem Tag holte die Gestapo Trier 70 sowjetische Kriegsgefangene eines Arbeitskommandos auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ab, um sie nach Hinzert zu bringen, wo sie sofort mittels Injektion einer Zyankalilösung ermordet worden sind.13 Eine der wenigen publizierten Quellen, die die Tätigkeit der Staatspolizeistelle Trier dokumentiert, ist das Tagebuch des N(achrichten)-Referates, das sich auf die Jahre 1944 und 1945 bezieht. Darin sind 372 Fälle festgehalten, in denen Personen von Informanten bei der Gestapo Trier denunziert wurden.14 Zwischen 2012 und 2015 ist zudem eine vierbändige Edition der Lageberichte der rheinischen Gestapostellen erschienen, die auch die monatlichen Berichte der Gestapo Trier der Jahre 1934 bis 1936 enthält.15 Anlass für die intensive Beschäftigung mit der Geschichte der Gestapo Trier war der Umzug der Staatsanwaltschaft Trier im Oktober 2011 in das Gebäude in der Christophstraße 1. Initiiert wurden die Arbeiten vom damaligen Leitenden 11 Reinhard Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus (1933–1945), in : Kurt Düwell/Franz Irsigler (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 517–572, hier S. 571. 12 „Der Angstschweiß hat die Farbe ausgelöscht…“. KATZ-Gespräch mit Willi und Maria Torgau über die Verfolgung und den Widerstand der Kommunisten in Trier während der Zeit des Nationalsozialismus, in : KATZ 16 (1994), H. 7/8, S. 24–27. 13 Uwe Bader/Beate Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.) : Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 5, München 2007, S. 17–42, hier S. 28 f. 14 Peter Brommer : Zur Tätigkeit der Gestapo Trier in den Jahren 1944/45, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 18 (1992), S. 325–368. 15 Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearbeitet von Burckhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, 3 Bde. in 4 Teilbdn., Düsseldorf 2012–2015.
Einleitung
|
Oberstaatsanwalt, Jürgen Brauer, der im Vorfeld des Ortswechsels seiner Behörde Kontakt mit dem Fach Geschichte der Universität Trier aufgenommen hatte, um eine mögliche Aufarbeitung der Geschichte zu klären. Hieraus entstand das universitäre Forschungsprojekt, dessen Mitglieder sich seit Januar 2012 im Rahmen von Abschlussarbeiten mit Teilaspekten der Geschichte der Gestapo Trier auseinandersetzen. Die Staatsanwaltschaft Trier, seit Mitte 2014 unter dem Leitenden Oberstaatsanwalt Peter Fritzen, hat diese Forschungen stets unterstützt. Der Fokus der Forschungen wurde von Anfang an bewusst weit gesetzt. Die Staatspolizeistelle Trier war für den ehemaligen Regierungsbezirk Trier und damit für knapp eine halbe Million Menschen, die sich auf 5.321 km2 (1941) verteilten, zuständig. Aufgrund spezieller historischer Konstellationen, personeller Verflechtungen und wechselnder formaler Unterstellungen erschien es sinnvoll, von Beginn an auch Akten anderer Staatspolizeistellen einzubeziehen. Bis zur Rückgliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich im Jahr 1935 stand die Region unter Beobachtung von Trierer Beamten ; diese erfolgte durch eine spezielle „Saarabteilung“, deren achtköpfige Belegschaft im Anschluss nach Saarbrücken übersiedelte und den eingearbeiteten Kern der dort neu etablierten Staatspolizeistelle bildete.16 Die Gestapo Trier unterhielt nicht nur vor der Besatzung ein Spitzelnetzwerk im benachbarten Luxemburg, sondern auch der Personalbedarf der 1940 eingerichteten Staatspolizeistelle im Großherzogtum wurde durch die Abordnung zahlreicher Beschäftigter aus Trier gedeckt. Zudem nahm der Leiter der Staatspolizeistelle Trier gleichzeitig auch die Führungsfunktion beim Einsatzkommando Luxemburg (EKL) wahr, das die drei Sparten Gestapo, Kriminalpolizei (Kripo) und Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD) umfasste.17 Schließlich wurde die Trierer Dienststelle im November 1943 der Staatspolizeistelle Koblenz unterstellt und fungierte künftig nur noch als Staatspolizeiaußenstelle.18 Angesichts der schlechten Quellenlage zum Startpunkt des Projektes wurden zudem zahlreiche andere Aktenbestände überprüft und die Justizakten in den Blick genommen. Dieses Vorgehen hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen, da viele Dokumente erst nach intensiver Recherche in Beständen aufgefunden werden konnten, die auf den ersten Blick keinen direkten Bezug zur Gestapo aufwiesen. So verbesserte sich Schritt für Schritt die Quellenlage. Den wohl spektakulärsten Fund stellen die mehr als 3.530 Personenakten der Gestapo Trier dar, die seit 2014 16 Mallmann/Paul : Herrschaft und Alltag, S. 182. 17 Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015. 18 Brommer : Zur Tätigkeit der Gestapo Trier, S. 326.
15
16
|
Thomas Grotum
im französischen Militärarchiv in Vincennes, dem Service historique de la Défense (SHD), aufbewahrt werden. Durch ein Kooperationsprojekt mit dem SHD und dem Deutschen Historischen Institut Paris (DHIP) konnten die Akten seit Sommer 2015 inhaltlich erschlossen werden und liegen in (digitaler) Kopie an der Universität Trier vor. Sie konnten bisher schon in einigen Beiträgen dieses Sammelbandes Berücksichtigung finden, werden aber im weiteren Projektverlauf noch von größerer Bedeutung sein. Auf den ersten Blick könnte man die Bedeutung der Staatspolizeistelle Trier als eine kleine und provinzielle Dienststelle eher gering einschätzen. Aber gerade die Grenzlage und das ländliche Umfeld sind wichtige Aspekte, die in der Gestapo-Forschung bisher vernachlässigt worden sind.19 Das Zentrum, die Stadt Trier, hatte in den 1930er Jahren zwischen 76.692 (1933) und 81.808 (1939) Einwohner, von denen jeweils mindestens 85 % katholischen Glaubens waren. Zum Zeitpunkt der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten lebten 796 Menschen mit einer mosaischen Konfessionszugehörigkeit (= 1,0 % der Bevölkerung) in der Moselstadt. Ihr Anteil halbierte sich bis zum Zweiten Weltkrieg.20 Die Staatspolizeistelle, die am 5. Mai 1933 neu eingerichtet worden war, umfasste auf ihrem Höhepunkt im Jahr 1938 etwa 150 Beamte und Angestellte. Das Personal war auch in Außendienststellen, die zeitweise in Bitburg, Prüm, Saarburg und Wittlich existierten, sowie in Grenzpolizeikommissariaten bzw. -posten untergebracht.21 Die Schwerpunktsetzungen im Rahmen des Forschungsprojektes waren immer von zwei Faktoren beeinflusst : den bis zu diesem Zeitpunkt ermittelten und erschlossenen Quellen sowie den inhaltlichen Interessen der Beteiligten. Nichtsdestotrotz konnte in den letzten Jahren ein breites Spektrum an Themenbereichen abgedeckt werden. Die bisher erzielten Ergebnisse der Forschungen werden im vorliegenden Band gebündelt. 19 Herbert Wagner : Die Gestapo war nicht allein… Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945 (Anpassung, Selbstbehauptung, Widerstand, Bd. 22), Münster 2004. Selbst wenn die Grenze im Titel der Studie eine Rolle spielt, beschränkt sich die Untersuchung auf die klassischen Grenzdelikte wie Schmuggel und Devisen- oder Paßvergehen. Die nachrichtendienstliche Dimension bleibt unberücksichtigt. 20 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 451 : Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1933, Heft 3 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit, Berlin 1936, S. 55 ; Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 552 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 4 : Die Juden und jüdische Mischlinge im Deutschen Reich, Berlin 1944, S. 23 ; Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 552 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 3 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Tabellenteil, Berlin 1942, S. 35. 21 Brommer : Zur Tätigkeit der Gestapo Trier, S. 326.
Einleitung
|
Abb. 2: Der Regierungsbezirk Trier, das Großherzogtum Luxemburg und das Saarland. (Grundlage: Landeshauptmann der Rheinprovinz (Hg.): Rheinprovinz und angrenzende Landesteile. Verwaltungsatlas. Stand 1936, Düsseldorf 1937, Karte 1).
Lena Haase hat die Aufgabe übernommen, sich der Geschichte der Staatspolizeistelle Trier aus der Perspektive der Quellen zu nähern und Forschungsfelder zu skizzieren, die es zu bearbeiten gilt. Dabei durchbricht sie in ihrem chronologisch angelegten Beitrag bewusst die zeitlichen Grenzen von 1933 und 1945. Politische Polizei, Sondergerichte oder „Schutzhaft“ waren keine Erfindungen der Nationalsozialisten. Allerdings machten sie daraus – in Verbindung mit „völkischen“ und rassepolitischen Elementen – ein geradezu mörderisches Instrumentarium. Doch wie nahmen die Zeitgenossen dies wahr ? Offenbar konnten Bürgermeister und Landräte in der Frühphase des NS-Staates problemlos „Schutzhaft“ gegen Kommunisten und Juden verhängen, obwohl sie keine Anhänger der NSDAP waren.22 22 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 442, Nr. 7470 bis 7478.
17
18
|
Thomas Grotum
Auch endet die Geschichte der Gestapo Trier keineswegs mit der Auflösung der Institution im Frühjahr 1945. Nicht nur die juristische Ahndung der Verbrechen, sondern auch die Netzwerke in den Ministerien und Behörden der jungen Bundesrepublik Deutschland gilt es zu erforschen.23 Die auf Ernst Fraenkel24 zurückgehende Trennung zwischen Normen- (Justiz) und Maßnahmenstaat (Gestapo) und die zunehmende Verdrängung rechtsstaatlicher Prinzipien haben dazu geführt, dass das Verhältnis der beiden betroffenen Institutionen im Regelfall als Konkurrenzsituation wahrgenommen wird. Allerdings gibt es erste Ansätze in der Forschung, die Zusammenarbeit stärker in den Blick zu nehmen.25 Matthias Klein wendet sich in seinem Beitrag dem Abhören ausländischer Sender im Raum Trier zu. Er fokussiert sich also auf einen Bereich, in dem Justiz und Gestapo, spätestens seit der „Rundfunkverordnung“ vom 1. September 1939, arbeitsteilig vorgingen. Die konkrete Ausgestaltung der Kooperation wird dabei anhand mehrerer Fallbeispiele behandelt. Eine weitgehend „vergessene“ Aufgabe der Geheimen Staatspolizei war die Funktion einer Zensurbehörde. Das Arbeitsgebiet „Presse und Schrifttum“ (Abteilung II P) fungierte dabei als Presselenkungsorgan. Am Beispiel des Trierer Paulinusblattes zeigt Sebastian Heuft, mit welchen Mitteln die Staatspolizeistelle Trier Einfluss auf das bis 1938 erscheinende Bistumsblatt nahm. Hier endete der „Burgfrieden“ unmittelbar nach der Saarabstimmung 1935 und führte zu Maßnahmen wie der Beanstandung einzelner Artikel oder dem Verbot ganzer Ausgaben. Katharina Klasen widmet sich in ihrem Beitrag dem „Vernehmungskommando“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert,26 das gemeinsam von den Staatspolizeistellen Trier und Luxemburg unterhalten wurde. In Hinzert gab es – aufgrund der speziellen Vorgeschichte des Konzentrationslagers – keine Abteilung II (Lager-Gestapo), sondern die Aufgabengebiete waren auf die Dienststellen in Trier, Luxemburg-Stadt und Esch/Alzig verteilt. Das „Vernehmungskommando“ diente in erster Linie der Zerschlagung des luxemburgischen Widerstandes, wobei brutale Verhörmethoden zur Anwendung kamen. 23 Christoph Rass : Das Sozialprofil des Bundesnachrichtendienstes. Von den Anfängen bis 1968 (Schriftenreihe der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 1), Berlin 2016, S. 172–174. Dort findet sich der Hinweis auf eine Gruppe von sechs ehemaligen Gestapobeamten aus Trier, die beim Bundesnachrichtendienst (BND) tätig waren. 24 Ernst Fraenkel : Der Doppelstaat, Frankfurt a.M. 1974. 25 Nikolaus Wachsmann : Zwischen Konflikt und Kooperation. Justiz, Polizei und Konzentrationslager im Dritten Reich, in : Jahrbuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen 9 (2015), S. 19–34. 26 Katharina Klasen : Allgegenwärtig ? Die Geheime Staatspolizei und das SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 13), Mainz/Hinzert 2015.
Einleitung
|
Mit einer speziellen Häftlingsgruppe im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert, nämlich den „Eindeutschungs-Polen“, beschäftigt sich Felix Klormann. Dabei nimmt er erstmals die Praxis des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ in den Blick, die sich in wesentlichen Punkten von den normativen Vorgaben unterschied. Polnische Zwangsarbeiter, die wegen „verbotenen Umgangs“ mit einer deutschen Frau eigentlich hingerichtet werden sollten, konnten aufgrund einer positiven „rassischen Musterung“ durch die zuständige Staatspolizeistelle in das Verfahren aufgenommen werden. Dabei war vorgesehen, dass sie sich sechs Monate als Häftlinge in Hinzert „bewähren“ sollten und parallel eine „Sippenüberprüfung“ durch das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS (RuSHA) überstehen mussten. Dieses perfide System, das an vielen Punkten nicht wie vorgesehen funktionierte, sollte dem Paar im Idealfall statt Tod (Mann) und Konzentrationslager (Frau) einen Weg in die „Volksgemeinschaft“ ebnen. Insgesamt 270 Tagesrapporte der Staatspolizeistelle Trier, die zwischen dem 27. September 1939 und dem 10. März 1942 verfasst worden sind, werden von Martin Spira ausgewertet.27 Sie bieten einen sehr guten Einblick in die Tätigkeit der Trierer Dienststelle im genannten Zeitraum, da sie jeweils die getätigten Festnahmen dokumentieren. Interessanterweise dominieren Arbeitsvergehen (274 Festnahmen) und Vergehen gegen die Regulierung der Versorgungswirtschaft (81), während das vermeintliche „Kerngeschäft“ der Gestapo, nämlich die Bekämpfung primär politischer Delikte, eine deutlich geringere Rolle spielte. Die geheimen monatlichen Lageberichte der Gestapo aus den Jahren 1934 bis 1936 sind eine wichtige Quelle der NS-Forschung. Am Beispiel des Themenschwerpunktes „Kommunismus“ verdeutlicht Max Heumüller das Potential, aber auch die Grenzen dieser Berichte. In seinem Beitrag stellt er nicht nur die Bedeutung von V-Leuten und Denunzianten, sondern auch die von institutionellen Zuträgern (z.B. Reichsbahn und Landjäger) heraus. Anhand von überlieferten Justizakten kann er an einem Beispiel zeigen, was hinter einer kurzen Meldung in einem Lagebericht – der Verhaftung des Kommunisten Johann Bauer – steckt und warum auch diese geheimen Ausführungen keinesfalls – wie gefordert – ohne Beschönigungen und schmückendem Beiwerk auskamen. Frederik Rollié wertet ebenfalls die Lageberichte der Staatspolizeistelle Trier aus. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der Landwirtschaft und der ländlichen Be27 Bisher sind nur die Tagesrapporte der Staatspolizeileitstelle Wien ediert und in Ansätzen ausgewertet worden ; Wolfgang Form/Ursula Schwarz : Die Tagesrapporte der Gestapo-Leitstelle Wien, in : Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (Hg.) : Politische Verfolgte im Lichte von Biographien (Jahrbuch 2011), Wien 2011, S. 209–229 ; Brigitte Bailer/Wolfgang Form (Hg.) : Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938–1945. Online-Datenbank : http://db.saur.de/TRAP/ login.jsf (Letzter Zugriff : 5.7.2017).
19
20
|
Thomas Grotum
völkerung. Die Gestapo erscheint in diesem Kontext nicht nur als Verfolgungsbehörde, sondern auch als Instrument der Wirtschaftssicherung. Die immer wieder auftretenden Beschwerden der Bauern dürfen dabei nicht überbewertet werden. Das abweichende Verhalten beschränkte sich meist auf die Stufe der Nonkonformität und beruhte auf der persönlichen Betroffenheit im Rahmen von Einzelmaßnahmen. Die Nationalsozialisten schränkten mit dem Reichserbhofgesetz vom 29. September 193328 frühzeitig die Verfügungsfreiheit der Hofbesitzer über ihren Besitz ein. So stießen insbesondere die Durchsetzung des Anerbenrechts (ungeteilte Vererbung) in traditionellen Realteilungsgebieten sowie die Benachteiligung der Töchter im Erbgang auf massive Kritik. Aber auch das Wetter war oft Anlass für eine schlechte Stimmung. Die Überwachung von Rückkehrern aus der französischen Fremdenlegion gehörte ebenfalls zum Aufgabengebiet der Geheimen Staatspolizei. Wie die Staatspolizeistelle Trier mit dieser Personengruppe29 umging, behandelt Ksenia Stähle in ihrem Beitrag. Die ehemaligen Fremdenlegionäre galten einerseits als mögliche Spione des „Erbfeindes“ Frankreich, potentielle Träger von Geschlechtskrankheiten und Werber für die Legion, andererseits handelte es sich um erprobte Kombattanten, die die deutsche Wehrmacht dringend benötigte. Anhand von zwei Fallbeispielen wird verdeutlicht, wie die Praxis der Überwachung aussah und die eigentlich vorgeschriebene „Wehrunwürdigkeit“ in den Hintergrund trat. In einem Fall ließen sich die Verfolgungsbehörden sogar über mehrere Jahre von einer frei erfundenen Fremdenlegionärs-Biographie täuschen. Mit dem Hinweis, sie seien vor 1945 bei der Grenzpolizei gewesen, versuchten Betroffene in der Nachkriegszeit immer wieder zu verschleiern, dass sie Gestapobeamte oder -angestellte gewesen sind.30 Die Abteilung III (Abwehr) der Staatspolizeistellen war für grenzpolizeiliche und nachrichtendienstliche Angelegenheiten zuständig, die ab 1936 immer wichtiger wurden. Entsprechend vergrößerte sich die Abteilung stetig und musste auch nach Kriegsbeginn, anders als die anderen Abschnitte der Staatspolizeistellen, keine personellen Einschränkungen hinnehmen. Justus Jochmann hat dieses Arbeitsgebiet der Gestapo Trier untersucht und sich in seinem Beitrag auf die Spionageabwehr am Beispiel Luxemburgs fokussiert. 28 Reichsgesetzblatt (RGBl.), Teil I, Berlin 1933, S. 685–692 : Reichserbhofgesetz. 29 Die Rückkehrer aus der französischen Fremdenlegion sind nicht mit den Fremdenlegionären deutscher Herkunft zu verwechseln, die Frankreich gemäß Artikel 19 des Waffenstillstandsabkommens von 1940 an das Deutsche Reich auslieferte und die in das SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert verbracht wurden. Dort waren zwischen Juni 1941 und Ende 1942 über 800 von ihnen inhaftiert ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 25. 30 Bundesarchiv (BArch) Ludwigsburg, B 162/6904 und 6905. Darin befinden sich mehrere entsprechende Zeugenvernehmungen.
Einleitung
|
Im Zentrum stehen die Ermittlungen gegen den Poste d’Alerte Luxembourg (Polux), einen Ableger des französischen Militärgeheimdienstes unter Capitaine Jean Nicolas Fernand Archen in Luxemburg-Stadt, der die deutschen Truppenbewegungen an der Grenze überwachen sollte. Hannes Brogmus widmet sich in seinem Aufsatz dem Schicksal der jüdischen Bevölkerung Triers bis zur Reichspogromnacht im November 1938. Er skizziert das jüdische Leben in Trier vor dem Hintergrund des politischen Umbruchs, um schließlich die antisemitischen Ausdruckformen im Zeitraum von 1931 bis 1938 im Raum Trier in den Blick zu nehmen. Der anschließende Aufsatz von Benjamin Koerfer behandelt die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier und Umgebung in das Getto Litzmannstadt. Mit dem ersten Transport aus dem „Altreich“ am 16. Oktober 1941, der aus Luxemburg kam, wurden 512 Menschen aus der Großregion in den Osten verschleppt. Insgesamt 189 von ihnen mussten sich ab Trier dem Transport anschließen. Der Beitrag thematisiert sowohl die Ereignisse in Trier vor der Deportation als auch die Zeit im Getto Litzmannstadt. Mit der Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden in der Vulkaneifel beschäftigt sich Andreas Borsch. Er stellt dabei verschiedene Überlegungen zur Bedeutung des öffentlichen Raumes und seiner Funktionalisierung im Nationalsozialismus an. Als Akteure identifiziert er u.a. die NSDAP-Gliederungen vor Ort, die Zuschauer während der Boykottmaßnahmen, den Dauner NSDAP-Kreisleiter Walther Kölle und den Dauner Landrat Dr. Paul Wirtz. Jill Steinmetz behandelt in ihrem Beitrag den Kriegsverbrecherprozess gegen Gestapobeamte vor dem Gerichtshof des Großherzogtums Luxemburg (1949– 1951). Dabei nimmt sie sich insbesondere den Verteidigungsstrategien des Trierer Rechtsanwaltes Dr. Kurt Heim an, der mehrere Angeklagte vor Gericht vertrat. Von den 16 angeklagten Personen waren elf anwesend. Das Verfahren bezog sich zwar auf das Personal der Staatspolizeistelle Luxemburg, durch die engen personellen Verflechtungen waren aber einige Angeklagte (zeitweise) auch Angehörige der Gestapo Trier. Dies traf beispielsweise auf Fritz Hartmann und Walter Runge zu, die beide als Leiter des Einsatzkommandos Luxemburg (EKL) gleichzeitig auch der Trierer Staatspolizeistelle vorstanden. Der letzte Beitrag von Thomas Grotum fasst schließlich die Ergebnisse von sechs Studien zusammen, die nicht durch einen eigenen Aufsatz in diesem Band vertreten sind. Im Rahmen des Forschungsprojektes zur Geschichte der Gestapo Trier sind drei biographische Untersuchungen entstanden. Eine widmet sich der Karriere des Gestapobeamten Friedrich Schmidt, der ab 1936 zunächst in Trier, dann in Luxemburg tätig war. Die zweite Studie behandelt das Schicksal der Geschwister Aurelia, Fritz und Wilhelm Torgau, die als Kommunisten ins Visier der
21
22
|
Thomas Grotum
Gestapo gerieten und alle im Dezember 1936 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Schließlich beschäftigt sich eine dritte Abhandlung mit den 43 Luxemburgern, die 1942 (im Rahmen des Generalstreiks) bzw. 1944 in der Nähe des SS-Sonderlagers/Konzentrationslagers Hinzert hingerichtet worden sind. Die anderen drei Arbeiten befassen sich mit V(ertrauens)-Leuten der Gestapo Trier in der Endphase des Krieges, katholischen Jugendlichen in der Vorkriegszeit im Raum Trier sowie der Verbreitung und Bekämpfung kommunistischer Propaganda im Untersuchungsraum. Die vorliegende Zwischenbilanz wird in der nächsten Zeit durch weitere Studien ergänzt werden. Dabei geht es sowohl um universitäre Abschlussarbeiten als auch um mehrere größere Untersuchungen, die zentrale Themenfelder der Gestapo-Forschung in den Blick nehmen.31 Neben einer Organisationsgeschichte der Staatspolizeistelle Trier sind Untersuchungen zum Verhältnis von Justiz und Gestapo, zu den grenzpolizeilichen sowie nachrichtendienstlichen Tätigkeitsfeldern an der Grenze und im Ausland und schließlich der Beziehung von Gestapo und Gesellschaft in Planung.
31 Siehe auch die Projekt-Homepage unter https://www.uni-trier.de/index.php ?id=54259.
Lena Haase
Die Gestapo in der Gesellschaft Quellenlage und Forschungsfelder zur Geschichte der Staatspolizeistelle Trier
Die Gesellschaft des nationalsozialistischen Deutschlands war geprägt vom Versuch einer totalen Durchdringung der privaten, beruflichen und öffentlichen Lebenswelt durch Parteiinstitutionen und nationalsozialistische Ideologie. Die Frage nach der Rolle der Geheimen Staatspolizei in diesem Kontext wurde seit dem Untergang des „Dritten Reiches“ zwar manches Mal gestellt, jedoch teils bis in die 1980er Jahre unter falschen Vorzeichen. In der geschichtswissenschaftlichen Forschung erhielt sich der Mythos von der Gestapo als einer allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Sonderbehörde, den sie selbst propagiert hatte. Erst eine neue Historiker-Generation begann, mit dem Mythos der Machtfülle aufzuräumen und positionierte sich – im Kontext einer sozialgeschichtlichen Herangehensweise – teils im entgegengesetzten Extrem und schuf das Bild einer sich selbst überwachenden Gesellschaft. Hervorzuheben ist hier die Forschung Gellatelys, der sich erstmals die Frage stellte, wie die Polizei die Politik der NS-Führung durchsetzte.1 Seine Fokussierung auf die Rassepolitik erfasst jedoch nur einen kleinen Ausschnitt der Alltagsarbeit der Polizeibehörden im „Dritten Reich“.2 Die aktuelle Gestapo-Forschung ist bestrebt, zwischen den beiden Extremen von staatspolizeilicher Allmacht und einer sich selbst überwachenden Gesellschaft die alltägliche Arbeitspraxis einer Staatspolizeistelle zu untersuchen. Nur so kann begreifbar gemacht werden, wie es trotz nur beschränkt zur Verfügung stehender personeller Mittel zur Überwachung der Bevölkerung möglich werden konnte, den Ruf zu erlangen, mit modernster Technik und hohem Personalaufgebot „den Schutz des Staates und der deutschen Volksgemeinschaft“3 sicherzustellen. Neben der Bedeutung von Denunzianten und 1 Robert Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945, Paderborn u.a. 21994 (1993). 2 Ebd., S. 20. 3 Kölnische Illustrierte Zeitung vom 23. März 1939, 14. Jg., Nr. 12. Zum Gestapo-Mythos vgl. auch : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ? Gestapo, Gesellschaft und Widerstand, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 41 (1993), S. 984–999 ; Robert Gellately : Allwissend und allgegenwärtig ? Entstehung, Funktion und Wandel des Gestapo-Mythos, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 47–70.
24
|
Lena Haase
V-Leuten ist an dieser Stelle insbesondere auch die Zusammenarbeit der Geheimen Staatspolizei mit Parteigliederungen, Justiz, Finanzbehörden, öffentlichen Institutionen und der kommunalen und regionalen Verwaltung zu untersuchen.4 Denn nicht nur die Installation von Außendienststellen ermöglichte der Gestapo einen regionalen Zugriff – der vor allem in den ländlichen Gebieten des Regierungsbezirks Trier prägend war –, sondern das zumindest temporäre Zusammenwirken mit anderen Institutionen machte die Wirksamkeit der staatspolizeilichen Ermittlungen und Verfolgungen möglich. Im Falle Triers ist jedoch nicht nur die Verankerung im bestehenden Reichsgebiet zu betrachten : Es gilt ebenso die nötige Neuverankerung in den eingegliederten Gebieten (Saargebiet und Luxemburg) durch Erweiterung der regionalen Zuständigkeit in den Blick zu nehmen. Bei der Frage nach der Vernetzung der Geheimen Staatspolizei in der deutschen Gesellschaft sollte jedoch nicht der Blick auf die zwölf Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft beschränkt werden. Die Existenz einer Politischen Polizei, die eine gezielte Gegnerüberwachung vornahm, war 1933 kein Novum, an das sich gewöhnt werden musste. Auch das Ende des „Dritten Reiches“ durch die bedingungslose Kapitulation und die folgende Entnazifizierung der Deutschen erscheint keineswegs als die Stunde Null der deutschen Geschichte. Untersucht man also die Verankerung der Geheimen Staatspolizei in der nationalsozialistischen Gesellschaft, so sind sowohl die Etablierung der Politischen Polizeien im Allgemeinen als Beginn als auch die Nachkriegskarrieren ehemaliger Gestapobeamter in der jungen Bundesrepublik als Endpunkt dieser Verankerung anzusehen. Folglich blickt dieser Beitrag über die Jahre 1933 und 1945 hinaus – Politische Polizei und ihre Verfügungsmethoden waren nichts Neues, an dem sich die deutsche Gesellschaft ab Januar 1933 hätte stoßen können. Nach 1945 griff man gerne auf „ausgebildete“ Polizeibeamte und Juristen zurück, um einen neuen demokratischen Staat aufzubauen. Für die Forschung zur Geschichte der Gestapo Trier5 und der durch sie überwachten Gesellschaft sind bisher Quellenbestände aus 32 Archiven zusammengetragen worden.6 Herauszuheben ist ein im Frühjahr 2015 aufgetauchtes Konvolut 4 Auch Thomas Roth fordert eine solche Untersuchung für die Staatspolizeistelle Köln ; siehe Thomas Roth : Die Gestapo Köln – Ansätze weiterer Forschung. Überlegungen zu einem Projekt des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, in : Geschichte in Köln 63 (2016), S. 245–258, hier S. 252. 5 Bisherige Forschungen des Projektes zur Geschichte der Gestapo Trier : Thomas Grotum (Hg.) : Die Gestapo Trier in der Christophstraße 1 – Eine Ausstellung, Trier 2014 ; Thomas Grotum/Lena Haase : Die Trierer Gestapo in der Christophstraße 1, in : Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 60 (2015), S. 43–44. 6 Archives Nationales de Luxembourg, Archives Nationales Paris, Bistumsarchiv Trier, Bundesarchiv
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
von 3.533 Personenakten (= Ermittlungsakten) der Geheimen Staatspolizeistelle Trier, das im Service historique de la Défense (SHD) in Vincennes lagert7 und damit den viertgrößten bisher bekannten Bestand an Gestapo-Ermittlungsakten einer Staatspolizeistelle darstellt.8
Die Politische Polizei vor 1933
Eng mit dem Aufbau moderner Staaten ist die Entwicklung einer Politischen Polizei verbunden.9 Das Fehlen nationaler Einheit hemmte im Deutschen Reich den Aufbau einer reichsübergreifend agierenden Politischen Polizei und führte zur Herausbildung dieser in den Einzelstaaten des Reiches.10 Die Bildung einer Politischen Polizei begann unter Joseph II. von Österreich und Napoleon zunächst noch unter der Bezeichnung „Geheimpolizei“. Ihre Benennung als Politische Polizei wurde erst mit der Notwendigkeit, politische, gegen die Obrigkeit gerichtete Bestrebungen des Volkes zu unterdrücken, etabliert. Die Politisierung der Bevölkerung, die Berlin, Bundesarchiv Koblenz, Bundesarchiv Ludwigsburg, Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance Luxembourg, Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Gedenkstätte Neuengamme, Gedenkstätte Osthofen, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, Hessisches Staatsarchiv Darmstadt, Hessisches Staatsarchiv Marburg, Institut für Zeitgeschichte (IfZ) München, Instytut Pamięci Narodowej (IPN) Warschau, International Tracing Service (ITS) Bad Arolsen, Kreisarchiv Bitburg, Kreisarchiv Trier-Saarburg, Landesarchiv des Saarlandes, Landesarchiv NRW – Abteilung Rheinland, Landesarchiv NRW – Abteilung Westfalen, Landesarchiv Speyer, Landeshauptarchiv Koblenz, Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette, National Archives and Records Administration Washington, Russisches Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte Moskau, Stadtarchiv Trier, Service historique de la Défense Vincennes, Universitätsarchiv Tübingen, Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg. 7 Ein Glücksfall für die Gestapo-Forschung. Eine Entdeckung im französischen Militärarchiv in Vincennes öffnet Trierer Historikern neue Horizonte, in : Unijournal 42 (2016), Heft 1, S. 24–25. Derzeit wird der gesamte Bestand durch die Projektmitarbeiter inhaltlich erschlossen, um ihn im Archiv zugänglich machen zu können. 8 Ergänzt wird dieser Bestand durch im Landesarchiv (LA) Speyer lagernde Ermittlungsakten der Gestapo Neustadt an der Weinstraße, die sich in mindestens 90 Fällen auf aus dem Regierungsbezirk Trier stammende Personen beziehen. Dort erhalten ist ebenfalls eine zweibändige Ermittlungsakte der Gestapo Trier, die zuständigkeitshalber nach Neustadt abgegeben wurde ; LA Speyer, H 91, Nr. 2842 und 2843. 9 Gellately : Gestapo (1994), S. 39. 10 Zur Entstehung der Politischen Polizei in den einzelnen Bundesstaaten vgl. besonders Wolfgang Siemann : „Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung“. Die Anfänge der politischen Polizei 1806–1866 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 14), Tübingen 1985 ; Gellately : Gestapo (1994), S. 39–40.
25
26
|
Lena Haase
sich in der Herausbildung parteipolitischer Strömungen begreifen lässt, verstärkte die Tätigkeit und die vermeintliche Notwendigkeit einer effektiv arbeitenden Politischen Polizei zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung. Insbesondere während des Vormärz und im Kontext der Revolution von 1848/49 nahm diese Tendenz zu. Im Visier der Politischen Polizeien der Einzelstaaten standen Demokraten, „Socialisten“ und „Communisten“, Burschenschaften, Katholische Vereine sowie all jene Vereinigungen, die als „autonome […] Vergesellschaftung[en] politischer Anliegen“11 bezeichnet werden konnten. In der Stadt Trier äußerte sich dies etwa während der sogenannten Kölner Wirren, dem Höhepunkt des Konfliktes zwischen katholischer Kirche und preußischem Staat in der gesamten Rheinprovinz, in einer zunehmenden Überwachung der katholischen Kirche12 und im Umfeld der 1848er-Revolution13. Auch Randgruppen der Gesellschaft gerieten bereits in den Blick der Politischen Polizei, so dass etwa „Asoziale“14, Prostituierte und Landstreicher in Trier unter besonderer Überwachung standen. Zur Gewahrwerdung kleinerer Delikte wurden nicht nur auf lokaler Ebene erste bezahlte Denunzianten eingesetzt,15 die etwa die Einhaltung der neu eingeführten Maß- und Gewichtsordnungen zu überwachen hatten. Um die „Denunzianten [nicht] unmutig und nachläßig“ in ihrem Meldewesen werden zu lassen, sollten anteilsmäßig am veranschlagten Strafsatz berechnete „Prämien“ für die Meldungen aus der Staatskasse ausgezahlt werden. Dies sollte möglichst schnell und, um die Denunzianten „ohne Nachtheil für ihre Dienstgeschäfte“ am Wohnort weiterleben und -arbeiten zu lassen, diskret vonstattengehen. Zudem wurden ab 1849 Monatsberichte der Politischen Polizei obligatorisch, die den jeweiligen Regierungspräsidenten über politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklungen des Polizeibezirks informieren sollten, und somit eine perspektivische Überwachung ermöglichen konnten.16 Für die Regierung Trier sind die sogenannten Zeitungsberichte, welche über die politische, soziale, wirtschaftliche, demographische und geographisch-meteorologische Situation der einzelnen Regierungsbezirke Preußens berichten, im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in 36 Bänden erhalten geblieben.17 Sie dokumentieren die Berichterstattung der Oberpräsidenten der Provinzen an das preußische Innenministerium in Berlin 11 Siemann : Anfänge der politischen Polizei, S. 461. 12 Stadtarchiv (StA) Trier, Best. Tb 15, Nr. 908 ; Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 403, Nr. 2535. 13 LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 6583. 14 StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 722. 15 StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 575. Alle folgenden Zitate aus ebd. 16 Gellately : Gestapo (1994), S. 40 f. 17 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 89, Nr. 16313 bis 16348.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
und umfassen die Jahre 1816 bis 1918. Die Regierung der Stadt und des Landkreises Trier sandte ebenfalls monatliche18 wie auch jährliche19 Verwaltungsberichte an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz, die über die allgemeine Stimmung und die öffentliche Meinung berichteten.20 Damit wurde nicht nur von Seiten der Polizei, sondern auch von verwaltungspolitischer Ebene eine Überwachung des Verhaltens und der öffentlichen Meinung der Bevölkerung angestrebt, die möglichst umfassend sein sollte. In der instabilen Weimarer Republik gewann die Politische Polizei erneut an Bedeutung.21 Zwar wurde 1918 die Abschaffung der Geheim- und Politischen Polizei des Kaiserreichs beschlossen, deren Notwendigkeit jedoch im unmittelbaren Anschluss mit der Gründung der Abteilung I A am Polizeipräsidium Berlin deutlich gemacht.22 Sie sollte die Überwachung „innerer Feinde“ sicherstellen. Nicht nur die Beamten der städtischen Politischen Polizei in Trier übernahmen diese Aufgabe, sondern auch die in den Gemeinden der Landkreise des Regierungsbezirkes angesiedelten Sicherheits-, Kriminal- und Schutzpolizeidienststellen.23 Dies gestaltete sich jedoch, aufgrund der noch immer bestehenden dezentralen Organisationsstruktur, zunehmend schwierig, was zeitgenössisch als Grund für die Schwäche derselben angesehen wurde.24 Nicht zuletzt aus diesem Grund war man in Trier und Koblenz ab 1919 (verstärkt noch einmal ab 1926) bestrebt, die städtische und kommunale Exekutivpolizei nach Düsseldorfer Vorbild25 zu verstaatlichen, da die Kosten in beiden Städten aufgrund von ständigen, teils über hundertprozentigen Personalaufstockungen wegen zunehmender Kriminalität nicht mehr getragen werden konnten und die ohnehin steuerlich überlastete Bevölkerung damit nicht 18 StA Trier, Best. Tb 12, Nr. 52, 53, 326 und 328 (1822, 1826, 1830–1840, 1849–1850). 19 StA Trier, Best. Tb 12, Nr. 54, 55, 327 (1818–1820 und 1828–1838). 20 Außerdem sind „Halbmonatsberichte“ in drei Bänden aus dem Regierungsbezirk Trier an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz erhalten, die zwischen Februar 1920 und Oktober 1922 entstanden ; LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 14991 bis 14993. 21 Gellately : Gestapo (1994), S. 42. 22 Christof Graf : Kontinuitäten und Brüche. Von der Politischen Polizei der Weimarer Republik zur Geheimen Staatspolizei, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 73–83, hier S. 73. 23 Die bei der Bürgermeisterei Cochem angesiedelte Sicherheitspolizei legte einen Fokus auf die „Überwachung der Sozialdemokraten und Anarchisten“ (LHA Koblenz, Best. 655,115, Nr. 147). 24 Gellately : Gestapo (1994), S. 42f. 25 Im Beschluss des Ministeriums der Justiz vom 7.5.1926 zur „Verstaatlichung der Polizei-Verwaltung Düsseldorf“, nach dem „die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Sicherheit und Ordnung“, wie auch die Politische Polizei, die Fremdenpolizei, die Verkehrspolizei, die Kriminalpolizei, die Feuerpolizei, die Ortspolizeibehörden „auf dem Gebiete der Gewerbepolizei“, sowie alle „nicht aufgeführten Zweige der Sicherheitspolizei“ in den Zuständigkeitsbereich der staatlichen Polizei-Verwaltung fallen sollten ; vgl. StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 928.
27
28
|
Lena Haase
zusätzlich belastet werden sollte. In beiden Fällen wurden die Verstaatlichungsbestrebungen in Berlin noch bis 1929 abgelehnt, da die „fremde Besatzung“ dieser Umstrukturierung der Polizei im Wege stand.26 Erneut gerieten – wie zur Zeit der 1848er-Revolution – politisch unliebsame Gruppierungen in den Blick,27 was in den 1920ern die Separatisten betraf. Separatistische Betätigung wurde insbesondere in bäuerlichen Milieus der Eifel festgestellt,28 die sich laut Weise, Regierungs-Assessor in Aachen, jedoch „aufgrund irgendwelcher Massnahmen der Behörden [etwa der Festsetzung des Getreideablieferungssolls, A.d.V.]“ und „weniger durch bestimmte politische Ideen“ konstituierte.29 Auch der Trierer Regierungs-Assessor Adolf Varain berichtete von „Abtrennungsbestrebungen in der Eifel“, die stetig besorgniserregender zu werden schienen : „[…] ständig stattfindende […] Protest-Versammlungen zeigen ein buntes Bild der Erregung und Renitenz“30. Ein Mittelpunkt der „Smeets’schen Bewegung“ wurde in Gerolstein, mit breiter, vor allem finanzieller Unterstützung aus Prüm, und Wawern ausgemacht.31 Nach der Aufnahme der Tätigkeit der Geheimen Staatspolizei in Trier begann diese, die Ermittlungen gegen die in den 1920er Jahren unter Separatismus-Verdacht stehenden Personen wieder aufzunehmen, häufig sogar unter direkter Benutzung der ehemaligen Regierungsakte „Separatismus in der Stadt Trier“.32 Mindestens 99 Personen33 gerieten so aufgrund einer früheren Erwähnung im Zuge der 26 Dazu im Trierer Fall : StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 928 ; im Koblenzer Fall : LHA Koblenz, Best. 441, Nr. 28022. Damit wurde für Koblenz, insbesondere jedoch für das ohnehin wirtschaftlich schwache Trier (samt Umland) eine erhebliche „Benachteiligung“ wahrgenommen im Gegensatz zu Köln, Düsseldorf, Dortmund, Duisburg, Bochum, Gelsenkirchen, Barmen, Elberfeld, Mühlheim, Hamborn, Recklinghausen, Remscheid und Sterkrade, die alle eine staatliche Polizeiverwaltung besaßen. Hier lag die durchschnittliche Pro-Kopf-Belastung für polizeiliche Ausgaben im Jahresdurchschnitt 1927 lediglich bei 40 bis 45 % der Belastung in Koblenz und Trier. 27 Dazu etwa die Überwachung der in Trier bestehenden politischen Vereine durch die Polizei : StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 909 und StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 913. 28 Maßgebliche Unterstützung des „Rheinstaatsgedankens“ kam im Stadt- und Landkreis Trier vor allem aus dem „Trierischen Bauernverein“, welcher gemeinsam mit der Zentrumspartei – zu der es personelle Überschneidungen gab – für einen unabhängigen Rheinstaat Stellung bezog. Vgl. dazu Martin Schlemmer : „Los von Berlin“. Die Rheinstaatsbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg (Rheinisches Archiv, Bd. 152), Köln u.a. 2007, S. 103–108. 29 LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 13439. 30 Ebd., Bl. 103–113. 31 Ebd., Bl. 267. 32 Des Weiteren wurde 1932 durch das preußische Innenministerium mit der Sammlung von Chroniken, Aufzeichnungen und persönlichen Berichten über die Besatzungszeit begonnen, die in jeder Bürgermeisterei eines Landkreises angefordert wurden. Erhalten sind diese Berichte für die Bürgermeistereien des Landkreises Bitburg : LHA Koblenz, Best. 700,012, Nr. 77. 33 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 44, 194 ; SHD Vincennes, Best. P, Nr. 24538, 25006, 25054,
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Ermittlungen gegen die separatistische Bewegung erneut in den Fokus staatspolizeilicher Überwachung.34 Auch wenn die Separatistenzeit in der Pfalz deutlich besser aufgearbeitet ist35 als im Trierer Raum, so ist der aktuellen Forschungsmeinung, es habe „keine systematische Separatistenverfolgung“36 durch die Nationalsozialisten stattgefunden, zu widersprechen. Die überlieferten Personenakten der Gestapo Trier liefern dazu ein vollkommen gegenteiliges Bild. Bei dieser Ermittlungs- und Verfolgungsarbeit der Trierer Gestapo kam eine bereits um 1923 angelegte, fast 2.000 Karten umfassende Separatistenkartei37 zum Einsatz, die unter nationalsozialistischer Herrschaft durch die Eintragung weiterer „staatsfeindlicher“ Personen, wie KPD- und SPD-Anhänger, ergänzt wurde.38 Aufbewahrt und geführt wurde die Kartei sowie anderes erhalten gebliebenes Aktenmaterial aus der Separatistenzeit in der Dienststelle der Gestapo Trier.39 Aus dieser Kartei geht nicht zuletzt auch ein großer Zulauf von Trierer Polizeibeamten zur separatistischen Bewegung hervor,40 der wohl nach dem Separatistenputsch in der Stadt am 22. Oktober 1923 und der damit erfolgten Entwaffnung der Trierer Polizei durch die Putschisten
25341, 25361, 25375, 25378, 25389, 25395, 25501, 25502, 25509, 25516, 25546, 25547, 25553, 25569, 25576, 25585, 25909, 25914, 25917, 25918, 25919, 25936, 25939, 25945, 25969, 25996, 28074, 28265, 28287, 28510, 28530, 28537, 28545, 28631, 28633, 28637, 28646, 28844, 28845, 28864, 28888, 31849, 31868 ; 32093 ; 32223 (hierin Nennung von 28 mutmaßlichen Separatisten), 32236, 32241, 32253, 32256, 32278, 32621, 32642, 32845, 32854, 32861, 33114, 33168, 33169, 33224, 33256, 33276, 34029, 34056, 34072, 34078, 471043, 471044, 471045, 471046. 34 Dazu auch : LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 16864. Hierin finden sich etwa die Ermittlungen und Prozessunterlagen gegen Pfarrer Laros aus Geichlingen (heutiger Kreis Bitburg-Prüm) wegen Hochverrats und Verdacht der separatistischen Betätigung (Bl. 177–350), Laufzeit dieser Ermittlungen : Januar bis Oktober 1934. Ermittlungsakte der Gestapo Trier in : SHD Vincennes, Best. P, Nr. 25341. 35 Neuerdings Hannes Ziegler : Die Verfolgung ehemaliger Separatisten durch die Gestapo, in : Gerhard Nestler/Roland Paul (Hg.) : Braune Jahre in der Pfalz. Neue Beiträge zur Geschichte einer deutschen Region in der NS-Zeit (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 29), Kaiserslautern 2016, S. 251–278. 36 Ebd., S. 253. 37 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 27364–27365. 38 So hatten auch die bekannten Trierer Kommunisten Hans Eiden und Fritz Torgau eine Eintragung in der Separatistenkartei. Die Weiterführung der Kartei durch die Gestapo ist belegt in : SHD Vincennes, Best. P, Nr. 32223, Bl. 10. 39 Die Gauleitung Düsseldorf wandte sich im Falle einer unter Separatismus-Verdacht stehenden Person an die Gestapo mit der Bitte um Aufklärung des Falles : „Wie wir hörten[,] soll das Aktenmaterial aus der Separatistenzeit bei Ihrer Dienststelle gut in Ordnung gebracht worden sein und hoffen wir gern, dass es Ihnen gelingen wird, auch diesen Fall restlos aufzuklären“ (SHD Vincennes, Best. P, Nr. 25054, Bl. 2). Die Betonung einer Ordnung und Systematisierung des Materials bestätigt erneut die Annahme einer systematischen Verfolgung von ehemaligen Separatisten durch die Gestapo Trier. 40 Dazu auch : LHA Koblenz, Best. 714, Nr. 6995.
29
30
|
Lena Haase
einsetzte.41 Die Überwachung politischer Gegner stand dementsprechend nicht erst mit der Machtübernahme durch die NSDAP im Januar 1933 auf der Tagesordnung, sondern wurde bereits vor der Ausrufung des „Dritten Reiches“ praktiziert. Die Integration der Politischen Polizei (später der Geheimen Staatspolizei) in die Gesellschaft musste somit nicht erst ab 1933 vorangetrieben werden, sondern hatte bereits begonnen. Denunziationen und Berichterstattungen aus der Mitte der Gesellschaft an die Polizei durch einzelne, teils gezielte Anzeigen nahmen schon während der Rheinbundzeit und verstärkt zur Zeit der Weimarer Republik einen erheblichen Einfluss auf die Arbeit der Polizei. Eine deutliche Veränderung ist lediglich darin zu erkennen, dass die NSDAP beziehungsweise die nationalsozialistische Bewegung im Inland wie auch im benachbarten Ausland42 in den 1920er Jahren noch als staatsgefährdende Partei unter Beobachtung stand, um die Republik vor radikalen Parteien und Verbänden zu schützen.43
Von der Machtübernahme bis zur „Verreichlichung“ – Die Gestapo zwischen 1933 und 1936
Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 begann der Prozess der Vereinnahmung der Politischen Polizei durch die nationalsozialistische Führungsebene. Mit der zunächst kommissarischen Ernennung Hermann Görings zum preußischen Innenminister und Chef der deutschen Polizei wurden Schlüsselpositionen im Innenministerium wie im Polizeipräsidium Berlin mit Vertrauensleuten Hitlers und Görings besetzt.44 Zudem gründete man eine Sonderabteilung „zur Bekämpfung des Kommunismus“ unter Leitung von Rudolf Diels.45 Nach der endgültigen Amtseinführung Görings im April 1933 wurde die Preußische Politische Polizei inklusive der neu gegründeten Sonderabteilung sowohl räumlich als auch organisatorisch aus dem Berliner Polizeipräsidium herausgelöst und am 26. April 1933 als Geheimes Staatspolizeiamt neu gegründet, das Außen41 Die Überlieferung zur Separatistenzeit bis in die frühen 1930er Jahre ist im Stadtarchiv Trier gut zu fassen. Vgl. etwa StA Trier, Best. Tb 32, Nr. 045 ; StA Trier, Best. Tb 32, Nr. 06. 42 LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 16766 (Beobachtung der nationalsozialistischen Bewegung in Holland [!]). 43 Vgl. dazu : LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 13381 bis 13383 ; Nr. 16740 und 16741 ; StA Trier, Best. Tb 12, Nr. 226 ; ferner Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 42017 (2008), S. 16. 44 Graf : Kontinuitäten und Brüche, S. 76. 45 Ebd., S. 76 ; Gellately : Gestapo (1994), S. 46 ; Christoph Graf : Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Die Entwicklung der Preussischen Politischen Polizei vom Staatsschutz organ der Weimarer Republik zum Geheimen Staatspolizeiamt des Dritten Reiches (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 36), Berlin 1983, S. 120.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
stellen (= Geheime Staatspolizeistellen) in allen Regierungsbezirken unterhielt.46 Mit der Gründung dieser Zentralbehörde wurden die Verfügungsgewalten der Politischen Polizei (deren Führung seit dem 29. November 1933 offiziell von Göring übernommen wurde47), die bereits in der sogenannten Notverordnung vom 28. Februar 193348 erweitert worden waren, institutionell verankert. Die wohl bedeutendste dieser Verfügungsmöglichkeiten stellte die der zeitlich unbegrenzten Inschutzhaftnahme dar, welche die Verfolgung „aller staatsgefährlichen politischen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet“, als wichtigste Aufgabe der Gestapo, unterstützen sollte.49 Die Möglichkeit der Schutzhaftverhängung, verbunden mit der Ausrufung eines permanenten Notstandes bis 1945, gilt als „formelle Basis für den Unrechtsstaat“50 des nationalsozialistischen Regimes. Doch wie die Politische Polizei war auch die Schutzhaft keine Erfindung der Nationalsozialisten. Schon im Kontext der 1848er-Revolution war die Inschutzhaftnahme „einer Person ohne Haftbefehl, zur Rettung aus einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben oder um die unmittelbar bevorstehende Begehung einer Straftat zu verhindern“51, ein Begriff.52 Es war seit September 1848 gestattet, „Personen in polizeiliche Verwahrung zu nehmen, wenn der eigene Schutz dieser Personen oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und Ruhe diese Maßregel dringend erfordern.“53 Allerdings war diese Inhaftierung lediglich bis zum übernächsten Tage nach der Verhaftung zu erwirken.54 Erst mit dem „Preußischen Gesetz über den Belagerungszustand“ vom 4. Juni 185155 – in Kraft bis 1919 – konnte diese Haft unbefristet ausgedehnt werden und war jeg46 LHA Koblenz, Best. 442,207, Nr. 13 ; Graf : Kontinuitäten und Brüche, S. 76 ; Dams/Stolle : Die Gestapo, S. 19. 47 GStA PK, Best. I. HA Rep. 90A, Nr. 2577, Bl. 400–403. 48 Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat, in : RGBl. 1933, Teil 1, Nr. 17, S. 83. 49 Graf : Kontinuitäten und Brüche, S. 77. 50 Gellately : Gestapo (1994), S. 44. 51 Ebd., S. 45 ; Otto Geigenmüller : Die politische Schutzhaft im nationalsozialistischen Deutschland, Würzburg 21937, S. 7–12. 52 Vgl. dazu das „Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit“ vom 24. September 1848, in : Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1848, Berlin [1848], S. 257–259, v.a. § 3 sowie dessen Verschärfung am 12. Februar 1850, in : Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1850, Berlin [1850], S. 45–48. Dazu : LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 2246 ; darin ein Bericht über die Einführung des Gesetzes in Trier. 53 Zitiert nach Kai Cornelius : Vom spurlosen Verschwindenlassen zur Benachrichtigungspflicht bei Festnahmen (Juristische Zeitgeschichte, Abt. I : Allgemeine Reihe, Bd. 18), Berlin 2006, S. 58 ; siehe auch : Graf : Politische Polizei, S. 256. 54 Cornelius : Vom spurlosen Verschwindenlassen, S. 59. 55 In : Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1851, Berlin [1851], S. 451–456.
31
32
|
Lena Haase
licher richterlicher Kontrolle entzogen. Mit der Verabschiedung der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ wurde die Schutzhaft ausgeweitet, da „die Unverletzlichkeit der persönlichen Freiheit“56 „zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“57 aufgehoben werden konnte. Die einzige Bedingung für die Verhängung der Schutzhaft stellte lediglich die Feststellung, häufig nur der unbegründete Verdacht, staatsfeindlichen Verhaltens dar.58 Während der nationalsozialistischen Herrschaft war die Strafanstalt in Wittlich59 eine bedeutende Haftstätte für die zu internierenden Schutzhäftlinge der Großregion. Insbesondere ab Mitte 1933 erfolgten zahlreiche Einweisungen von Schutzhäftlingen nach Wittlich, um die kleineren Gerichtsgefängnisse zu entlasten.60 Die Schutzhaftverhängungen wurden in diesen Fällen erstaunlich oft auf Landrats- und Bürgermeistereiebene erwirkt. Zwischen Februar 1933 und März 193461 waren laut Maier dementsprechend 21,5 % aller in die Wittlicher Strafanstalt eingelieferten Häftlinge mittels Schutzhaftbefehl festgenommen worden. Wenn auch ab März 1934 eine Verringerung der Zahl der Schutzhäftlinge auszumachen ist, was vor allem durch die Aufhebung der Möglichkeit zur Inschutzhaftnahme von Seiten der Landräte und Bürgermeister begründet war, erreichten immer wieder größere
56 Cornelius : Vom spurlosen Verschwindenlassen, S. 71. 57 Lothar Gruchmann : Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 28), München 32001, S. 536. 58 Cornelius : Vom spurlosen Verschwindenlassen, S. 71. 59 Zur Strafanstalt Wittlich allgemein vgl. Franz Maier : Strafvollzug im Gebiet des nördlichen Teiles von Rheinland-Pfalz im Dritten Reich, in : Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 3), Frankfurt a.M. 1995, S. 851–945 ; Claudia Schmitt : Vom königlichen Gefängnis zur modernen Justizvollzugsanstalt. Die Wittlicher Strafanstalten im Wandel der Zeit, in : Heinz-Günther Borck/Beate Dorfey (Hg.) : Unrecht und Recht. Kriminalität und Gesellschaft im Wandel von 1500–2000. Gemeinsame Landesausstellung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Archive. Wissenschaftlicher Begleitband (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 98), Koblenz 2002, S. 688–711. 60 Vgl. dazu Zahlen nach Maier : Strafvollzug, S. 910 f. 61 Die Verhängung von Schutzhaftbefehlen durch Landräte und die Kreispolizeibehörden war mit einer Verordnung Görings vom 11. März 1934 zumindest formal verboten worden. Folglich waren nur noch das Gestapa in Berlin bei reichsweiten Belangen oder die Ober- und Regierungspräsidenten sowie die Staatspolizeistellen für den regionalen Rahmen zur Verhängung der Schutzhaft befugt ; vgl. LHA Koblenz, Best. 605,002, Nr. 13934, Bl. 1. Zu diesem Thema entsteht momentan im Forschungsprojekt zur Geschichte der Gestapo Trier an der Universität Trier eine Masterarbeit unter dem Arbeitstitel „Schutzhaft. Das Instrument der Gegnerbekämpfung und Machtdurchsetzung im Regierungsbezirk Trier (1933–1935)“ von Paul Vincent Benter.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Abb. 1: Regierungsgebäude am Hauptmarkt, 1933–1935 Sitz der Gestapo Trier. (Quelle: StA Trier, Bild-Slg. 1 26–276).
Gruppen an Schutzhäftlingen die Strafanstalt, ab 1941 auch aus dem besetzten Luxemburg.62 Mit der Etablierung der Staatspolizeistelle in Trier am 5. Mai 193363 und deren Bezug des alten Regierungsgebäudes am Hauptmarkt64 begann auch in der Moselstadt ein staatlich geduldeter und geförderter polizeilicher Terror. Der Einzug in das ehemalige Regierungs- und Polizeigebäude vermittelte nicht nur eine örtliche, sondern auch eine personelle Kontinuität, da für die Personalausstattung der neuen Trierer Gestapo lediglich ausgebildete Polizeibeamte der Weimarer Republik aus der Landeskriminalpolizeistelle für die Politische Polizei in Köln herangezogen wurden. Aufgestockt wurde das schnell für die umfangreiche, da dehnbare Aufgabe der Erforschung und Sammlung „alle[r] staatsgefährlichen politischen Bestrebun62 Während männliche Schutzhäftlinge aus Luxemburg häufig in Wittlich (oder im SS-Sonderlager/ KZ Hinzert) interniert wurden, wurden die weiblichen Schutzhäftlinge nicht selten in das der Strafanstalt Wittlich angegliederte Frauenstraflager Flußbach transportiert. Zum Flußbacher Lager bisher Adalbert Rosenbaum : Das Frauenstraflager Flußbach, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 27 (2001), S. 415–461 ; Adalbert Rosenbaum : Das Frauenstraflager Flußbach, in : Minsterium der Justiz Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 3), Frankfurt a.M. 1995, S. 946–969. 63 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 5f. 64 Ebd., Bl. 7.
33
34
|
Lena Haase
gen“ sowie deren Verfolgung65 zu gering werdende Personal durch Hilfspolizeibeamte aus SA- und SS-Verbänden der Region.66 Zur Informierung des Geheimes Staatspolizeiamtes über „die allgemeine politische Lage im Bezirk der Polizeidienststelle[n]“67 wurde die Abfassung monatlicher Lageberichte gefordert, die – wie schon die Verwaltungsberichte des 19. Jahrhunderts – aktuelles politisches Geschehen und besondere Vorkommnisse „ohne Weitschweifigkeit, auf Klarheit und Vermeidung jeglicher Schönfärberei“68 bedacht, melden sollten. Diese politischen Lageberichte der Staatspolizeistelle Trier liegen lückenhaft für die Jahre 1934 bis 1936 vor.69 Durch teilweise erhaltene, gleich aufgebaute Lageberichte des Trierer Regierungspräsidenten können diese ergänzt werden.70 Verfasser der Lageberichte des Regierungspräsidenten war jedoch der Chef der Staatspolizeistelle Trier, wodurch die Inhalte nicht oder nur marginal voneinander abweichen. Frühere Lageberichte sind nur punktuell in einzelnen Ermittlungs- oder Sachakten der Staatspolizeistelle überliefert und bedienen dabei lediglich ausgewählte Themenschwerpunkte. Darüber hinaus ermöglicht die Lageberichterstattung der Landratsämter im Regierungsbezirk71, zusammengefasst in den Berichten des Regierungspräsidenten sowie der Staatspolizeistelle, den spezifisch regionalen Zugang auf Regierungsbezirksebene. Dass die Lageberichte jedoch, wie gefordert, ohne beschönigende, gar übertreibende Darstellungsweisen auskommen würden, erweist sich in der Untersuchung als Trugschluss. Sie dienten der Leitung der jeweiligen Staatspolizeistelle einer65 Ebd., Bl. 5. 66 Ebd., Bl. 13. 67 Ebd., Bl. 31. 68 Ebd. 69 GStA PK, Best. I. HA Rep. 90 Annex P., Band 9.11, Bl. 1–161 ; BArch Berlin, R 58/432, Bl. 58–84 ; BArch Berlin, R 58/510, Bl. 90–107 ; BArch Berlin, R 58/534, Bl. 47–58 ; BArch Berlin, R 58/566, Bl. 89–101 ; BArch Berlin, R 58/571, Bl. 85–101 ; BArch Berlin, R 58/656, Bl. 73–85 (darin auch : Stimmungsberichte der Staatspolizeistelle Trier, 21. September –18. Oktober 1939) ; BArch Berlin, R 58/1145, Bl. 53–75 ; BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 98–125 und Bl. 139 ; BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 689–712 ; BArch Berlin, R 58/ 3972, Bl. 2–22 ; LHA Koblenz, Best. 717, Nr. 120. Eine Edition der Lageberichte der Staatspolizeistelle Trier erfolgte bereits gemeinsam mit jenen der Staatspolizeistellen Aachen, Koblenz, Köln und Düsseldorf, siehe dazu : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, 3 Bde. in 4 Teilbdn., Düsseldorf 2012–2016. 70 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15625 ; BArch Berlin, R 58/3972, Bl. 43–45 und 60–81. Der Oberpräsident der Rheinprovinz erhielt nicht nur von den Regierungspräsidenten, sondern auch von den Gestapostellen Abschriften ihrer monatlichen Lageberichte ; vgl. LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 39. 71 Erhalten für das Landratsamt Prüm von 1934 bis Anfang 1936 im Bistumsarchiv (BA) Trier, Abt. 134, Nr. 190.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
seits zur Profilierung und Vermittlung von Effektivität und Effizienz der eigenen Arbeit,72 andererseits auch zur Unterstreichung von bereits mehrfach gestellten Forderungen, wie dem erhöhten Personalbedarf.73 Verbunden mit der Einrichtung der regionalen Staatspolizeistellen war die Forderung einer engen Zusammenarbeit der Geheimen Staatpolizei als „selbständige[r] Zweig der inneren Verwaltung“74 mit dem jeweiligen Regierungspräsidenten75, die Dr. Konrad Saassen umgehend bestätigte, da ihm die „Staatspolizeistelle […] in vollem Umfange zur Verfügung“ stehe und „auch räumlich [seinem] Büro angegliedert“76 sei. Diese enge Zusammenarbeit sollte sich auch nach dem Umzug der Geheimen Staatspolizei in die neuen Büroräume in der Christophstraße 1 im Oktober 193577 – also der räumlichen Trennung der Büros – fortsetzen. Wie in der Stadt Trier, so funktionierten auch die sukzessive eingerichteten Außendienststellen in den Landkreisen78 in engem Wechselspiel mit den dortigen Landratsämtern, Bürgermeistereien und sonstigen Einrichtungen der zivilen Verwaltung – ganz abgesehen von parteinahen Vereinigungen wie etwa der Kreisbauernschaft. Die Effektivität in allen Bereichen der staatspolizeilichen Arbeit, von der Beantragung von Schutzhaftbefehlen,79 über Abwicklung jeglicher „Judenangelegenheiten“80, bis hin zur gezielten Überwachung verdächtiger Personen81 und Umsetzung staatlicher Maßnahmen, wie
72 Dargestellt etwa anhand des Umgangs der Gestapo Trier mit dem Trierer Bistumsblatt Paulinusblatt, welches gemäß der Lageberichterstattung im Mai 1935 „3 mal verboten“ wurde (BArch Berlin, R 58/510, Bl. 96). Tatsächlich kam es jedoch kein einziges Mal zu einem vollständigen Verbot der Ausgabe, sondern lediglich zur Zensur einzelner Artikel. Vgl. dazu den Beitrag von Sebastian Heuft in diesem Band. 73 BArch Berlin, R 58/2093. Bl. 138. 74 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 117. 75 Anordnung des Oberpräsidenten der Rheinprovinz vom 23. Februar 1934, in : LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 72 f. Vgl. dazu auch Peter Brommer : Zur Tätigkeit der Gestapo Trier in den Jahren 1944/45, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 18 (1992), S. 325–368, hier S. 325 f. Erneute Anordnung zur Besserung der Zusammenarbeit am 10. Februar 1936 (Göring), in : LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 209–215. 76 Ebd., Bl. 73. 77 GStA PK, I. HA Rep. 151 IV, Nr. 1560, Bl. 2–3. 78 Dazu : LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 123. 79 Vgl. dazu die Ausführungen zur Schutzhaft in Wittlich : SHD Vincennes, Best. P, Nr. 28871. 80 Etwa StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 934, enthält Judenverzeichnisse der Landkreise und Auswanderungsverzeichnisse inklusive Notiz zu vermeintlicher politischer Einstellung der Juden ; StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 949, enthält unter anderem Nachweise zur Beteiligung von Oberbürgermeister und Landräten an Vollstreckung und Anregung für neue Verbotsmaßnahmen gegenüber jüdischen Mitbürgern. 81 SHD Vincennes, Best. P, Nr. 26973, 28584, 32635 und 32844.
35
36
|
Lena Haase
der Einführung von Gemeinschaftsschulen,82 wurde durch diese Kooperationen erreicht. Im Prozess der „Verreichlichung“ der deutschen Polizei und dem damit verbundenen Machtausbau des Polizeiapparates wandelte sich die Gestapo – so Paul – aufgrund der neuen Verfügungsmöglichkeiten und Verfolgungsmotive „von der klassischen Polizei zu einer Rassenpolizei“83, was in der zunehmenden Boykottierung jüdischer Gewerbetreibender und der Exklusion der jüdischen Mitbürger aus der „Volksgemeinschaft“ deutlich wird. Das Fortschreiten dieser „Verreichlichung“ – abgeschlossen am 17. Juni 1936 mit der Ernennung Heinrich Himmlers zum „Chef der Deutschen Polizei und Reichsführer SS“84 – und der damit verbundene Machtausbau des Polizeiapparates wurde im Wesentlichen in der „Nacht der langen Messer“ am 30. Juni 1934 und deren unmittelbarem Nachgang im Kontext des „Röhm-Putsches“ vorangetrieben. Den lokalen SA-Brigaden wurde vorgeworfen, „im blinden Gehorsam ohne jedes politische Fingerspitzengefühl und Empfinden“ dem Stabschef Röhm „blindlings in jeder Beziehung zu folgen, ohne jedoch in seine verräterischen Pläne eingeweiht zu sein.“85 Die Ausschaltung der SA als Konkurrenzorganisation auf dem Gebiet der Ordnungssicherung und Strafvollstreckung ermöglichte es Himmlers Polizei und der SS, die bereits bestehenden Befugnisse sukzessive zu erweitern.86 Nach 1934 wurde die SA erst während der Novemberpogrome 1938 wieder reichsweit aktiv. Gleichzeitig mit der Zentralisierung der Polizeiverwaltung war auch jene des bereits bestehenden Konzentrationslagersystems, das einerseits differenziert, andererseits vollkommen der Kontrolle der SS unterstellt wurde, vorangetrieben worden.87 Die enge Verbindung zwischen „Verreichlichung“ von Polizei, Anwachsen der Verfügungsgewalt derselben durch die dehnbaren Begriffe „Sicherheit“ und „Opposition“88 und der in diesem Kontext wirksam werdende Schutzhaftbefehl sowie die Entwicklung der Konzentrationslager unter Befehl Himmlers kann als Symptom für die stetig wachsende Macht der Polizei im NS-Staat angesehen werden. Mit der Zusammenfassung aller Polizeidienststellen des Reichsgebietes sowie aller 82 Dazu : BArch Berlin, R 58/5620, Bl. 207–211. 83 Gerhard Paul : Die Gestapo, in : Florian Dierl (Hg.) : Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung der deutschen Hochschule der Polizei und des Deutschen Historischen Museums, Dresden 2011, S. 54–65, hier S. 56. 84 Gellately : Gestapo (1994), S. 58. 85 LHA Koblenz, Best. 403. Nr. 16765, Bl. 89. 86 Gellately : Gestapo (1994), S. 57. 87 Ebd., S. 58 ; Nikolaus Wachsmann : KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 1708), Bonn 2016. S. 103. 88 Gellately : Gestapo (1994), S. 37.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Abteilungen der Polizei – inklusive Sicherheitspolizei (Sipo) und Kriminalpolizei (Kripo)89 unter Reinhard Heydrich – am 20. September 1936 in der Gestapozentrale Berlin war die erste vollständige Zentralisierung der Polizei in der deutschen Geschichte erfolgt.90 Gleichgeschaltet im internen Aufbau und in der polizeilichen Arbeit waren damit auch bayerisch und preußisch geprägte Polizeitraditionen.91 Die Arbeit der Staatspolizeistelle Trier war von Beginn an von ihrer Grenzlage zu Luxemburg, dem noch bis 1935 unter Völkerbundmandat verwalteten Saargebiet und Frankreich geprägt.92 Die Einrichtung von Grenzpolizeikommissariaten93 und deren Kontrolle ab 1936 im Referat IV F des Gestapa ermöglichten der Gestapo nicht nur die gezielte Grenzüberwachung im Hinblick auf Ein- und Ausreisefrequenz meist spionageverdächtiger Personen, sondern auch eine Konkurrenz zum Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD), der ursprünglich mit der Spionageabwehr betraut war.94 Über die Grenze warf die Gestapo auch bereits vor Besetzung der jeweiligen Gebiete ihren Blick : Gut ausgebaute Spitzelnetzwerke waren bereits in den 1930er Jahren in Luxemburg installiert worden. Diese lieferten regelmäßige Berichte über die allgemeine politische Lage, jedoch auch über kirchliche Angelegenheiten (etwa die Neubesetzung des Bischofsstuhls) im benachbarten Großherzogtum.95 89 Ebd., S. 58. 90 Ebd., S. 59. 91 Hier bietet sich die Untersuchung der Ermittlungspraxis innerhalb der aus preußischer Tradition entstandenen Gestapo Trier und der aus bayerischer Tradition erwachsenen Gestapo Neustadt an der Weinstraße an. Für beide Gestapostellen sind umfangreiche Bestände an Ermittlungsakten erhalten (Gestapo Trier etwa 3.530 Stück im Service historique de la Défense in Vincennes und Gestapo Neustadt an der Weinstraße etwa 12.000 Ermittlungsakten im LA Speyer). Mögliche, aus den Entstehungszusammenhängen erwachsene Unterschiede im Ermittlungsgang der Fälle wären damit herauszuarbeiten. 92 Zur Aktivität der Staatspolizeistelle Trier im Saargebiet vor der Saarabstimmung siehe Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 2), Bonn 1991, S. 180–182 ; Graf : Politische Polizei, S. 292. 93 Begonnen wurde damit bereits im 19. Jahrhundert : LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 145. Zunächst wurde dabei ab 1839 die Grenze des Regierungsbezirks Aachen zur „Unterdrückung des Schleichhandels“ (S. 27) nach Holland und Belgien mit „Grenz-Polizei-Kommissarien“ bestückt, die der Kontrolle der zuständigen Landräte unterstellt waren (S. 47). 94 Herbert Wagner : Die Gestapo war nicht allein… Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945, Münster 2004, S. 223. Zur Bedeutung der Abteilung III (Abwehr) der Gestapo Trier der Beitrag von Justus Jochmann in diesem Band und Justus Jochmann : Abwehr. Die Abteilung III der Staatspolizeistelle Trier, Magisterarbeit Universität Trier 2016. 95 Berichte über die politische Lage in Luxemburg : Russisches Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte (RGASPI), Best. 458, Findbuch (Fb.) 9, Nr. 204 und 205 ; RGASPI, Best. 458, Fb. 9, Nr. 282,
37
38
|
Lena Haase
Die Beobachtung der katholischen Kirche erweist sich in einer durchweg katholisch geprägten Region wie dem Regierungsbezirk Trier für die Politische Polizei als naheliegend. Dabei fällt der 13. Januar 1935, der Tag der Saarabstimmung, als Wendepunkt in der Behandlung der katholischen Kirche durch die Gestapo Trier ins Auge. Auf die lang ersehnte „Rückgliederung“ des Saargebietes wurde schon seit der formalen Abtrennung durch den Versailler Vertrag hingearbeitet. Ein Korrespondent der Kölnischen Zeitung brachte die Bedeutung des Saargebietes für Trier in seinem Artikel „Notland rechts und links der Mosel“ vom 6. Juli 1930 folgendermaßen auf den Punkt : Solange das Saargebiet nicht an Deutschland zurückgekommen ist, so lange schwebt der Trierer Bezirk zwischen Leben und Sterben. […] Die Lösung der Saarfrage ist also gerade für das Trierer Gebiet eine unbedingte Lebensnotwendigkeit ; solange das Saargebiet nicht rückgegliedert ist, kann an eine wirtschaftliche Gesundung des Trierer Bezirks nicht gedacht werden.96
Eine entsprechend hohe Bedeutung wurde der „Saarfrage“ zugewiesen, was sich insbesondere in der staatspolizeilichen Arbeit in der Vorbereitung der Saarabstimmung äußerte.97 In dieser stimmten über 90 % der Bevölkerung des Saargebietes, das mit Ausnahme des Saarpfalzkreises zum Bistum Trier gehörte, im Januar 1935 der Rückgliederung ins Deutsche Reich zu. Obgleich die intensive Beobachtung des Saargebietes, das nicht zuletzt als Rückzugsgebiet für viele seit 1933 verfolgte Kommunisten und Sozialdemokraten genutzt wurde,98 bereits mit der Etablierung der Staatspolizeistelle Trier einsetzte, so war das Vorgehen gegen die katholische S. 169–172. Online unter : http://rgaspi-458-9.germandocsinrussia.org/de/nodes/1-dokumentensammlung-der-deutschen-sicherheits-und-geheimdienste-1912–1945 (Letzter Zugriff : 9.4.2017). Analog dazu ist die Grenzbeobachtung der Aachener Gestapo an der deutsch-niederländischen Grenze zu betrachten, welche auch bereits während der 1930er Jahre gezielte Berichte der politischen Lage in den Niederlanden erhielt und sich insbesondere über die dortige faschistische Bewegung informieren ließ. Vgl. LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 16766. Berichte über die Kirche im Großherzogtum in den 1930er Jahren (LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 16874) und den 1930er bis 1940er Jahren (LHA Koblenz, Best. 662,006, Nr. 749). 96 StA Trier, Best. Tb 15, Nr. 928. 97 Jochmann : Abwehr, S. 63–72. 98 Vgl. Maximilian Heumüller : Politische Gegner im Visier der Gestapo. Überwachung und Verfolgung der Kommunisten in Trier im Spiegel der Lageberichterstattung 1934–1936, Masterarbeit Universität Trier 2015, S. 42 ; Maike Vaas : „Die KPD lebt“ ? Verbreitung und Bekämpfung kommunistischer Propaganda im Raum Trier, 1933–1939, Masterarbeit Universität Trier 2014 ; Gwendolyn Kloppenburg : Gezeichnet vom NS-Regime. Biographische Studien zu Trierer Kommunisten der Zwischenkriegszeit, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2014.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Kirche im Bistum Trier auf die Zeit nach der Saarabstimmung vertagt worden, um selbige nicht zu gefährden. Die Grenzdienststellen der Gestapo hatten – so bereits die Forderung am 13. März 1934 – den Oberpräsidenten der Rheinprovinz „unverzüglich über neueste Meldungen über das Saargebiet“99 in Kenntnis zu setzen, wozu sogar für die Zeit der Saarabstimmung und ihrer Vorbereitung Sonderdienste für die Trierer Polizei eingerichtet worden waren.100 Nach der erfolgten Abstimmung wurde zur „Sicherstellung der Einheitlichkeit der Arbeit“101 in den Regierungsbezirken Trier und Saarbrücken die Staatspolizeistelle Trier am 17. April 1935 kurzzeitig derjenigen in Saarbrücken als Außendienststelle unterstellt,102 wodurch die Eingliederung des Saargebietes auf verwaltungstechnischer wie auch staatspolizeilicher Ebene erleichtert werden sollte. Nachdem sowohl von Seiten des Gauleiters Gustav Simon als auch des Regierungspräsidenten Bedenken bezüglich dieser Unterstellung geäußert worden waren, wurde diese bereits am 3. Mai 1935 revidiert.103 Nichtsdestotrotz entwickelte sich zwischen den Gestapo stellen in Trier und Saarbrücken auch aufgrund der gemeinsamen Grenzlage eine intensive Zusammenarbeit. Mit der erfolgten Rückgliederung des letzten Teils des Bistums Trier zum Deutschen Reich verschärfte die Gestapo dann auch das Vorgehen gegen katholische Priester und Ordensbrüder. In Trier erreichte dies einen ersten Höhepunkt während der „Sittlichkeitsprozesse“ im Mai 1936, in welchen der katholischen Geistlichkeit unzüchtige und unmoralische Handlungen untereinander wie auch mit Schutzbefohlenen sowie Homosexualität vorgeworfen wurde. Die Gestapo wurde in Form eines extra eingerichteten Sonderkommandos Mitte Juni 1936 damit beauftragt, das Bischöfliche Generalvikariat, die Privatwohnung des Generalvikars wie auch diejenige des Bischofs Bornewasser zu durchsuchen. In seinen Augen stellte dies nicht nur eine Verletzung des 1933 geschlossenen Reichskonkordats dar, sondern wurde darüber hinaus als persönliche Demütigung wahrgenommen.104 Justiz und Reichsregierung deckten das staatspolizeiliche Vorgehen und nutzten die Öffentlichkeitswirksamkeit der Sittlichkeitsprozesse vor den Sondergerichten105 und auch den Landgerichten mit großem propagandistischen 99 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 59. 100 Ebd., Bl. 147. 101 Ebd., Bl. 170. 102 Ebd., Bl. 161, Bl. 163–167 (Dienstanweisungen zu dieser Unterstellung). 103 Ebd., Bl. 177. 104 Vgl. Hans Günter Hockerts : Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B : Forschungen, Bd. 6), Mainz 1971, S. 56. 105 Zu den Sittlichkeitsprozessen in Trier : BArch Berlin, R 58/5054 und R 58/5415c.
39
40
|
Lena Haase
Aufwand für die Herbeiführung eines Vertrauensbruchs zwischen der katholischen Kirche und den Katholiken. Es sollten die Gleichschaltung der kirchlichen Jugendorganisationen mit HJ und BDM sowie die daraus entstehenden Konflikte mit Parteigruppierungen und Gestapo, die Schließung der Konfessionsschulen106 und kirchlichen Vereine107 und das gezielte Vorgehen gegen Sympathisanten des Zentrums folgen.108 Während des Krieges gerieten außerdem Abteien, Klöster und Priesterseminare ins Visier, sodass etwa in Trier die Abtei St. Matthias am 6. Mai 1941 von der Gestapo unter Bezugnahme auf die „Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes“ wegen angeblicher staatsfeindlicher Betätigung besetzt, durchsucht und schließlich geschlossen wurde ; 16 der 44 Mitglieder wurden zum Militärdienst einberufen.109 Drei Monate später schloss man das Priesterseminar Rudolfinum in Trier-Pallien, was erneut eine „weitgreifende […] Empörung im katholischen Volke“110 hervorrief. Im Zuge seiner Beschwerde sprach sich Bischof Bornewasser gegen die „Verdrängung der Kirche aus der gesamten Wohlfahrtspflege, [und die] Tötung sogenannten unwerten Lebens“ aus, welche „in der Bevölkerung […] eine derart weitgehende Empörung hervor[ge]rufen“111 habe. Die Gliederung des Deutschen Reichsgebietes und die Einsetzung von Gestapostellen wurden 1935 mit der Einrichtung von Staatspolizeileitstellen als Zwischeninstanz zwischen Berlin und den in den Regierungsbezirken eingerichteten Stellen vervollständigt. Am 5. November 1935 wurde in Koblenz die für die Gestapostellen in Aachen, Düsseldorf, Köln und Trier zuständige Staatspolizeileitstelle etabliert,112 welche – ähnlich wie auf Ebene der Regierungsbezirke – eng mit dem Oberpräsidium der Rheinprovinz zusammenarbeiten sollte. Mit dieser Angleichung der staatspolizeilichen an die politische Hierarchisierung war die Staatspolizeileitstelle fortan in Fällen „überörtlicher Bedeutung“113 den ihr untergeordneten Stellen weisungsbefugt und sollte Ermittlungen und Einsätze über Regierungs106 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 26560. In diesem Zusammenhang ist auch die Entziehung der Erlaubnis zur Erteilung von schulplanmäßigem Religionsunterricht durch katholische Geistliche zu beachten ; BArch Berlin, R 58/5620. 107 Etwa der Kirchenbauverein „St. Bonifatius“ in Kürenz. Dazu : BArch Berlin, R 58/5576. 108 Anke Schwebach : „Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab“. Katholische Jugendliche im Raum Trier zwischen Anpassung, Unterdrückung und Widerstand zwischen 1933 und 1939, Masterarbeit Universität Trier 2014. 109 BArch Berlin, R 43 II/1271a, Bl. 28 : Brief des Heinrich Basilius Ebel, Abt von St. Matthias, an Reichsminister Lammers. Gleichzeitig wandte sich auch Bischof Bornewasser mit der Bitte um Rückgängigmachung der Aufhebung an Himmler ; vgl. ebd., Bl. 30 f. 110 BArch Berlin, R 43 II/1271a, Bl. 42–43. 111 Ebd., Bl. 39. 112 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15464, Bl. 201. 113 Ebd., Bl. 203.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
bezirksgrenzen hinweg koordinieren. Die Funktion als Staatspolizeileitstelle ging 1939 von Koblenz auf Düsseldorf über, die bis zum Kriegsende fortan Leitstelle der fünf rheinischen Staatspolizeistellen blieb.114 Die tatsächliche faktisch ausgeübte Funktion einer Staatspolizeileitstelle bleibt jedoch noch zu untersuchen.
Der Ausbau der Geheimen Staatspolizei im Vorfeld des Krieges: 1936–1939
Die Jahre nach der „Verreichlichung“ der Polizei waren im Wesentlichen von Kriegsvorbereitungen geprägt, die die gesamte Gesellschaft des Deutschen Reiches einschlossen und diese mobilisieren sollten. Neben der zunehmenden Schürung des Rassenhasses, der im November 1938 in der Reichspogromnacht gipfelte,115 standen die verschärfe Überwachung der eigenen Bevölkerung und die bauliche Verteidigung gegenüber äußeren Gegnern an der Tagesordnung. Auch die Region Trier wurde von diesen Entwicklungen erfasst. Die systematische Diskriminierung, Entrechtung und einsetzende Verfolgung der jüdischen Bevölkerung Triers und der umliegenden Orte und Städte setzte insbesondere ab 1935 mit der Verabschiedung der Nürnberger Rassegesetze ein.116 Neben „Arisierungen“ jüdischer Betriebe und jüdischen Eigentums117 wurde die 114 Thomas Gebauer : Das KPD-Dezernat der Gestapo Düsseldorf, Hamburg 2011, S. 43. Entgegen der Darstellung Gebauers kann damit die Gestapo Düsseldorf nicht auch schon vor 1939 uneingeschränkt die Funktion als Staatspolizeileitstelle ausgeübt haben, da diese Kompetenz bis dahin, in Angliederung an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz, bei der Gestapo in Koblenz lag. Zur Funktion von Düsseldorf als Staatspolizeileitstelle auch Holger Berschel : Bürokratie und Terror. Das Judenreferat der Gestapo Düsseldorf 1935–1945 (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 58), Essen 2001, S. 75. 115 Die Entwicklung des Antisemitismus und dessen öffentlichen Ausdrucksformen in der Trierer Bevölkerung bis zur Reichspogromnacht wurde eingehend behandelt von Hannes Brogmus : Die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bürger Triers 1933 bis 1938. Eine Studie zu den lokalen Ausdrucksformen des nationalsozialistischen Antisemitismus unter besonderer Berücksichtigung von Reaktionen aus der Trierer Bevölkerung, Magisterarbeit Universität Trier 2016. 116 Dazu im Wesentlichen die Magisterarbeit von Hannes Brogmus sowie seinen Beitrag in diesem Band. 117 Zur Arisierung in der Region Trier siehe Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier (Hg.) : „Arisierung“ jüdischer Gewerbebetriebe in der Region Trier, Trier 2012 ; Jutta Albrecht : Staatlich legitimierter Raub. Die „Arisierung“ der Lederfabrik Ernst und Karl Julius Schneider in der Karthäuserstraße, in : Neues Trierisches Jahrbuch 54 (2014), S. 107–131 ; Heinz Ganz-Ohlig : Romika – „Eine jüdische Fabrik“. Die Schuhfabrik in Gusterath-Tal zur Zeit ihrer vorwiegend jüdischen Inhaber Hans Rollmann, Carl Michael und Karl Kaufmann ; sowie Rollmann und Mayer in Köln und die damit zusammenhängenden Firmen- und Familiengeschichten (Schriften des Emil-Frank-Instituts, Bd. 16), Trier 2012.
41
42
|
Lena Haase
Exklusion der Mitbürger mosaischen Glaubens aus dem Berufsleben, dem öffentlichen Leben wie auch sukzessive aus der Gesellschaft betrieben. Maßgeblich daran beteiligt waren – insbesondere an der Umsetzung und Kontrolle der Maßnahmen – nicht nur die Gestapo, sondern ebenso die (Orts-)Bürgermeister, Landräte und sonstigen höheren Verwaltungsbeamten.118 Deren Effektivität konnte jedoch nur durch rege Beteiligung aus der Bevölkerung gesteigert werden. Das „wachsame Auge der gesamten Bevölkerung“119, das Himmler 1938 sogar als institutionell verankerten „Volksmeldedienst“ forderte, der im Ministerrat jedoch abgelehnt wurde,120 unterstützte die Polizei dabei maßgeblich in der angestrebten totalen Kontrolle der Bevölkerung. Die stets propagierte Allwissenheit, Allmächtigkeit und Allgegenwärtigkeit der Geheimen Staatspolizei war unerreichbar angesichts des für diese Ansprüche unzureichend großen Personalapparates.121 Nur mit Hilfe der Unterstützung von festen, in zu überwachenden Milieus und Bevölkerungskreisen eingesetzten V- und W-Personen122 sowie den sich häufenden Denunziationen aus der Bevölkerung hatte der Überwachungs- und Verfolgungsapparat der Polizei im Nationalsozialismus funktionieren können. Nichtsdestotrotz sah man von einer 118 Dazu Andreas Borsch : „Arisierung“ in der Vulkaneifel. Analyse zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1939, Magisterarbeit Universität Trier 2016. 119 Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Nürnberg 1948, Band XXIIX, S. 534 (Aussage Heydrichs in einer stenographischen Niederschrift der Besprechung über die Judenfrage bei Göring am 12. November 1938 = Dokument 1816-PS). 120 Robert Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Zur Entstehungsgeschichte einer selbstüberwachenden Gesellschaft, in : Detlef Schmiechen-Ackermann (Hg.) : Anpassung, Verweigerung, Widerstand. Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland (Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Reihe A : Analysen und Darstellungen, Bd. 3), Berlin 1997, S. 109–122, hier S. 112 f. Dazu auch Reinhard Heydrich : Der Volksmeldedienst. Die Mobilmachung gegen Verrat und Denunziation, in : Der Schulungsbrief VI (1939), 9. Folge, S. 338–339. 121 Alle Zahlen zur Personalentwicklung werden hier − angesichts der nicht vollständigen Quellenlage und des Fehlens eines Geschäftsverteilungsplanes − unter Vorbehalt gemacht. In der Anfangsphase wurde die Staatspolizeistelle Trier zunächst mit 29 (Okt. 1934) Beamten und Angestellten ausgestattet und im Zuge der Vorbereitungen zur Saarabstimmung personell auf 52 verstärkt. Am 31. März 1937 zählten 103 Beamte und Angestellte zum Trierer Personal, 1938 etwa 150. Während des Kriegsverlaufes reduzierte sich die Anzahl der Beamten : Im August 1941 waren es noch 87 (43 davon im Außendienst) und im März 1945 − kurz vor Auflösung − nur noch 20 ; vgl. dazu : BArch Berlin, R 58/611, R 58/856, R 58/1112 ; NARA, Best. M1270, Gestapo Trier ; BArch Ludwigsburg, B 162/6903 bis 6908 ; GStA PK, I. HA Rep. 90P Nr. 13, Heft 2. 122 V[ertrauens]- oder [Ge]W[ährs]-Person. Bereits Ende der 1920er Jahre begann man im Rheinland mit der gezielten Anwerbung von V-Leuten im kommunistischen Milieu. Im Vergleich zu anderen Städten und Ballungsgebieten (insbesondere im Ruhrgebiet) legte man den Fokus jedoch noch nicht auf Trier und dessen Umgegend. Vgl. dazu : LHA Koblenz, Best. 403, Nr. 16772.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Systematisierung der „Mitteilsamkeit der Bevölkerung“123 ab und blieb bei einem festen, jedoch unverbindlichen Stab an V-Leuten124 und den − wenn auch nicht selten eigennützig motivierten, aber dennoch unablässigen und gerne angenommenen − Denunziationen aus der breiten Bevölkerung. Um den äußeren Feinden des Deutschen Reiches entgegenwirken zu können, bedurfte es in den Augen der nationalsozialistischen Führungsriege mehr als bloße nachrichtendienstliche Tätigkeiten, die dennoch ohne Unterlass auch im Ausland – insbesondere in den westlichen Nachbarstaaten – vorangetrieben wurden. Mit dem Bau des Westwalles125 und der damit verbundenen Remilitarisierung des Rheinlandes wurden sichtbare Vorbereitungen für den bevorstehenden Krieg getroffen. Der Westwall als eines der größten NS-Bauwerke erstreckte sich von der niederländischen Grenze bei Kleve bis zur schweizerischen Grenze westlich von Basel und bestand im Wesentlichen aus einer befestigten, mit Bunkeranlagen, Waffen- und Munitionslagern sowie Panzersperren ausgestatteten Verteidigungsanlage, die nicht nur den Kriegsverlauf massiv beeinflussen sollte, sondern gleichfalls die an ihrem Bau direkt wie auch indirekt beteiligte, da im unmittelbaren Umfeld lebende und arbeitende, Bevölkerung betreffen sollte.126 Die Staatspolizeistelle Trier war damit in ihrem Verfügungsbereich, in dem das „Aachen-Saar-Bauprogramm“ stattfand, für einen nicht unerheblichen Teil der Arbeiter die sanktionierende und strafende Behörde im Falle eines Arbeitsvergehens. Fritz Todt, der von Adolf Hitler mit dem Bau des Westwalls, als Entsprechung zur Maginotlinie, im Mai 1938 beauftragt wurde, gründete zu diesem Bauvorhaben die Organisation Todt (OT), welche als Baugruppe unter der Leitung des Reichsministers für Bewaffnung und Munition 123 Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft (1997), S. 113. 124 Zum Einsatz von V-Leuten durch die Gestapo Trier in der Kriegsendphase siehe Johanna Gouverneur : Überwachung im Zeichen von Niederlage und Zusammenbruch. Die V-Leute der Gestapo Trier 1943–1945, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2012. Dazu : LHA Koblenz, Best. 662,005 Nr. 9 bis 13 sowie 33 und 34. 125 Der Begriff „Westwall“ wurde erstmals öffentlich am 20. Mai 1939 in Hitlers Befehl „An die Soldaten und Arbeiter des Westwalls“ verwendet. Bis dahin wurde die Bezeichnung „Limes-Programm“ in Anlehnung an den römischen Verteidigungswall gegenüber Germanien präferiert. 126 Die schon seit der preußischen Herrschaftsübernahme im linksrheinischen Gebiet als strukturschwach und unterentwickelt wahrgenommenen Gebiete in Eifel und Hunsrück erlebten durch den Westwallbau zwar einen scheinbaren Bedeutungszuwachs, die Bevölkerung – insbesondere die in der Landwirtschaft tätige – war jedoch von Zwangsenteignungen und Zusammenlegung von Klein- und Kleinstbetrieben in erheblichem Maße betroffen. Vgl. Andreas Dix : Der Westwall im Rahmen von Raumplanung und Strukturpolitik in der NS-Zeit, in : Karola Fings/Frank Möller (Hg.) : Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Überresten der NS-Anlage. Tagung in Bonn vom 3.–4. Mai 2007 (Materialen zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bd. 20), Weilerswist 2008, S. 59–66, hier S. 61.
43
44
|
Lena Haase
(bis 1942 Fritz Todt, nach dessen Tod Albert Speer) neben dem Westwallbau außerdem u.a. den Atlantikwall und die Abschussrampen der V1- und V2-Raketen baute. Im Baugebiet des Westwalles wurden sukzessive „Westwall-Lager“ eingerichtet, die als Unterbringung für die am Westwall beschäftigten Arbeiter des Reichsarbeitsdienstes (RAD) oder der OT fungierten. Das Barackenlager in Hinzert, südlich von Trier auf dem Hunsrück gelegen, war ab Juli 1938 auch als „kasernierte Unterkunft“127 dieser Art angelegt und bildete die Zentrale der „Westlager“.128 Mit Beginn des Jahres 1939 wurden bereits straffällig gewordene Westwallarbeiter, sogenannte Arbeitsscheue und „Arbeitsverweigerer“, zur Belehrung und Umerziehung für drei Wochen ins „Polizeihaftlager“ Hinzert eingewiesen, das die überfüllten Gefängnisse der Umgebung entlasten sollte. In demselben Lagerkomplex wurde unter Hermann Pister, dem ersten Lagerkommandanten Hinzerts, ein „SS-Sonderlager“ zusätzlich zum bereits bestehenden Polizeihaftlager eingerichtet, in dem „rückfällige Volksgenossen […] auf längere Zeit [ein]gewiesen“129 werden konnten. Mit dem Ende des Westwallbaues im Sommer 1940 nach dem erfolgreich verlaufenen Westfeldzug130 wurde das Hinzerter Lager ab dem 1. Juli 1940 der Inspektion der Konzentrationslager (IKL) unterstellt. Die wirtschaftliche Zuständigkeit ging damit von der OT auf die Gestapo Trier über.131 Für die Entlohnung der Waffen-SS als Wachpersonal war fortan die IKL zuständig, das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 127 Volker Schneider : Waffen-SS – SS-Sonderlager „Hinzert“. Das Konzentrationslager im „Gau Moselland“ 1939–1945. Untersuchungen zu einem Haftstättensystem der Organisation Todt, der Inspektion der Konzentrationslager und des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, Nonnweiler-Otzenhausen 1998, S. 56. 128 Uwe Bader/Beate Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.) : Hinzert. Das Konzentrationslager Hinzert und seine Außenlager, München 2008, S. 13–38, hier S. 17. 129 BArch Berlin, NS 4/Hi2. 130 Franz W. Seidler : Die Organisation Todt. Bauen für Staat und Wehrmacht 1938–1945, Koblenz 1987, S. 18. 131 Vgl. dazu die Haushaltsbücher der Staatspolizeistelle Trier in : LHA Koblenz, Best. 442 HK, Nr. 8 und 9, Nr. 25, Nr. 83 bis 103. Diese weisen die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Staats polizeistelle Trier (einschließlich ihrer Außenstellen) lückenlos von 1933 bis 1941 nach. In den entsprechenden Bänden zu den Jahren 1940 (Nr. 90, 99 und 100) sowie 1941 (Nr. 91 und 103) ist auch die monatlich entrichtete Miete für das Konzentrationslager Hinzert samt Inventar verzeichnet, welche von der Gestapo Trier übernommen wurde. Die Mietzahlungen beliefen sich dabei auf monatlich 7.500 RM, zu zahlen an die OT (LHA Koblenz, Best. 442 HK, Nr. 91, S. 21v). Zusätzlich erfolgte die monatliche Begleichung der Stromrechnung für das SS-Sonderlager Hinzert an die RWE Trier (LHA Koblenz, Best. 442 HK, Nr. 91, S. 15v). Darüber hinaus verzeichnen die Haushaltsbücher die Gehaltszahlungen für die Beamten und Angestellten der Staatspolizeistelle, die Zahlungen für die Büroräume in Trier und auch die Außendienststellen sowie laufende Kosten für Wasser und Strom, Büromaterial und Benzin.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
für das Gefangenenwesen.132 Mit der Gründung des RSHA am 27. September 1939 wurde der gesamte Sicherheitsapparat des nationalsozialistischen Deutschlands erneut gestrafft und zentralisiert. Er setzte sich – untergliedert in zunächst sechs, später sieben Abteilungen – aus Sicherheitspolizei (Gestapo sowie Kripo) und SD zusammen.133
Die Gestapo in der Kriegszeit: 1939–1945
Mit Kriegsbeginn dehnte sich der Aufgabenbereich der Geheimen Staatspolizei, der schon im Vorfeld des Krieges stetig erweitert wurde, weiter aus. Zur ursprünglichen Aufgabe der Bekämpfung politischer Gegner und der Verfolgung nach rassepolitischen Gesichtspunkten kam nun die Überwachung der „Fremd- und Ostarbeiter“ sowie der Kriegsgefangenen hinzu. In diesem Kontext ist insbesondere die Verbindung der Gestapo Trier zu den Haftstätten in und um Trier in den Blick zu nehmen. Mit dem Sieg über Frankreich und dem Waffenstillstandsabkommen von Compiègne am 22. Juni 1940 gelangten zahlreiche französische Männer in deutsche Gefangenschaft und wurden in Kriegsgefangenenlagern im gesamten Deutschen Reich interniert. Auf dem Trierer Petrisberg wurde im Juni 1940 das Stalag XII D (offizielle Eröffnung am 1. Juli 1940), ein Mannschaftslager für Kriegsgefangene, eingerichtet, das 23.000 bis 45.000 Kriegsgefangene fasste.134 Den größten Teil der Insassen machten Franzosen aus, gefolgt von Jugoslawen (ab Mitte 1941), Russen (ab Ende 1941), Italienern (ab Herbst 1943), Polen, Engländern und Belgiern.135 Obwohl das Kriegsgefangenenlager nicht in der Zuständigkeit der Gestapo Trier lag, war diese nicht selten für den Transport der Häftlinge, für die Ergreifung flüchtiger und die Bestrafung straffällig gewordener Kriegsgefangenen verantwortlich.136 Nicht zuletzt durch den Arbeitseinsatz der Stalag-Internierten 132 Dazu auch Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 17. 133 Gellately : Gestapo (1994), S. 59 ; Gerhard Paul : „Kämpfende Verwaltung“. Das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes als Führungsinstanz der Gestapo. In : Klaus-Michael Mallmann/ Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‚Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 42–81. 134 Adolf Welter : Trier-Petrisberg 1940–1945. Das Kriegsgefangenenlager Stalag XII D, Trier 2007. Über den Zustand im Lager berichten unter anderem französische Offiziere ; vgl. SHD Vincennes, Best. 2P, Nr. 69–3 und 69–4. Diese bemängeln vor allem die streckenweise unzureichende Ernährung, die desaströsen hygienischen Verhältnisse sowie die mangelhafte Ausstattung der Baracken wie auch der Häftlingsbekleidung. 135 Zu den genauen Belegzahlen siehe Welter : Trier-Petrisberg, S. 35–37. 136 Dazu Einlieferungs- und Entlassungsscheine der Franzosen in das Gefängnis in Trier, während
45
46
|
Lena Haase
in Außenkommandos, vor allem in der Landwirtschaft, ergaben sich häufig Fälle „verbotenen Umgangs“ zwischen deutschen Zivilisten und Kriegsgefangenen.137 Von der ab April 1943 gegebenen Möglichkeit zur Statustransformation von einem Kriegsgefangenen zu einem Zivilarbeiter im Deutschen Reich machten auch viele Franzosen des Stalag XII D in Trier Gebrauch. Zwischen Juni und Dezember 1943 meldeten sich mindestens 106 Männer zur Zivilarbeit.138 Fortan waren sie zu einem Großteil in Trierer Firmen (z.B. Romika, Obstverwertung Mohr), Handwerkerbetrieben, Land- und Weinwirtschaft sowie außerdem bei der Reichspost, dem Walzwerk Trier, den Lazaretten im Priesterseminar und in der Nordallee, im Hotel Porta Nigra, dem Herz-Jesu-Krankenhaus sowie bei der Stadt (Tiefbauamt und Friedhofsverwaltung) angestellt. Einige wurden auf Anforderung von Oberbürgermeister und Arbeitsamt Trier vor ihrer Anstellung von der Gestapo überprüft. In einem Fall konnte bisher außerdem nachgewiesen werden, dass Stalag-Internierte von der Trierer Gestapo als Dolmetscher bei Verhören von Franzosen herangezogen wurden.139 Inbegriffen in den Westfeldzug gegen Frankreich war auch die Einnahme des Großherzogtums Luxemburg, das nach der nationalsozialistischen Rassenideologie als genuin deutschstämmig angesehen wurde und damit „heim ins Reich“ zu holen und unter eine zivile, dem Deutschen Reich angegliederte Verwaltung zu stellen sei. Nachdem am 10. Mai 1940 Luxemburg besetzt wurde, konnten die bereits seit den 1930er Jahren durch Spionagetätigkeit gesammelten Informationen in großflächige Verhaftungen münden, welche gemeinsam von Wehrmacht und Gestapo ab dem 10. Mai 1940 durchgeführt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt können 21 Fälle benannt werden, in denen luxemburgische Bürger aus Anlass des Einmarsches der Wehrmacht, meist aufgrund eines im Vorfeld ermittelten Spionader Transporte wie auch für den dortigen Aufenthalt im Verfügungsbereich der Gestapo Trier : AN Paris, Best. AJ 40, Nr. 1570. 137 In den erhalten gebliebenen Ermittlungsakten der Gestapo Trier finden sich derzeit zwei Fälle von „verbotenem Umgang“ zwischen deutschen Frauen und französischen Kriegsgefangenen. Die Ermittlungen der Gestapo führten jeweils zu einer Verurteilung der Frauen zu einem Jahr und drei Monaten Zuchthaus sowie einer Verurteilung der Männer zu drei Jahren bzw. einem Jahr und neun Monaten Gefängnis ; SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 294 und Nr. 260. Insgesamt lassen sich bisher 17 Kriegsgefangene des Stalags XII D identifizieren, die wegen eines solchen Vergehens in Haft genommen wurden. 138 Die Zahl bezieht sich auf die erhalten gebliebenen Akten ehemaliger französischer Kriegsgefangener des Stalags aus den Archives Nationales Paris (Best. AJ 40, Nr. 1560 und 1561). Darin enthalten sind auch die Akten von 12 Französinnen, die zwischen Mai 1939 und Juni 1944 ein Aufenthaltsrecht in Trier beantragten, um dort arbeiten zu können. Sie wurden zu diesem Zweck teilweise von der Gestapo Trier überprüft. 139 SHD Vincennes, Best. P, Nr. 28692, Bl. 16.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
geverdachts, in Schutzhaft genommen und in der Strafanstalt Wittlich kurzzeitig interniert worden waren. Dort wurden sie vom seit dem 14. Mai 1940 ansässigen Vernehmungskommando der Gestapo Trier140 verhört.141 Die meisten wurden nach nur kurzzeitiger Inhaftierung in den Monaten Juni und Juli 1940 wieder nach Luxemburg entlassen.142 In einem Fall erfolgte eine Verurteilung vor dem Oberlandesgericht (OLG) Hamm wegen Landesverrats zu eineinhalb Jahren Zuchthaus und drei Jahren Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,143 in einem weiteren vor dem Volksgerichtshof (VGH) Berlin wegen Vorbereitung zum Hochverrat (mit unbekanntem Strafmaß),144 und in einem letzten Fall erfolgte nach kurzzeitiger Haftentlassung die Arbeitsverpflichtung zum Autobahnbau in der Eifel.145 Der Bau der Reichsautobahn (RAB) in der Eifel,146 durchgeführt unter Leitung der OT mit Beteiligung zahlreicher regionaler und überregionaler Firmen, zwang mehrere tausend Männer zur Arbeit und übersäte die Region erneut mit Lagern (20 auf dem Streckenabschnitt zwischen Schweich und Ulmen). Neben Arbeitserziehungshäftlingen des Polizeihaftlagers in Hinzert, KZ-Häftlingen aus Hinzert und aus dem Außenlager Wittlich sowie Kriegsgefangenen des Stalag XII D auf dem Petrisberg wurden außerdem ausländische Zivilarbeiter147 und zur Zwangsarbeit verpflichtete Luxemburger in diesem Bauvorhaben eingesetzt. Auch hier erfüllte die Gestapo Trier, obgleich sie keine Beteiligung am Bauvorhaben hatte, entweder eine „disziplinarische“ Tätigkeit, indem sie für die Inhaftierung und Ahndung von Arbeitsvergehen zuständig war,148 oder sie war aufgrund der Nutzung der Arbeits-
140 SHD Vincennes, GR28 P7, Nr. 20. 141 Ermittlungsakten der Gestapo Trier zu diesen Fällen : SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 29, 67, 114, 161, 163, 166, 178, 229, 245, 281, 293, 319, 323, 334, 340 ; SHD Vincennes, Best. P, Nr. 28514, 31895, 32237, 32274, 462765, 470236. 142 Am 10. Juni 1940 wurde aus diesem Zweck ein Sammeltransport von Wittlich nach Luxemburg zusammengestellt. 143 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 229. 144 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 161. 145 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 166. 146 In der kürzlich erschienenen Studie von Wolfgang Schmitt-Koelzer erstmals eingehend behandelt : Bau der „Reichsautobahn“ in der Eifel (1939–1941/42). Eine Regionalstudie zur Zwangsarbeit, Berlin 2016. 147 Dazu etwa : LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 14278. 148 Am 9. Dezember 1939 verhaftete die Gestapo Trier vier an einer Beschwerde beteiligte Autobahnarbeiter, die bei der „Deutsches Arbeitsfront“ (DAF) in Wittlich über die Unterbringung, die Verpflegung und die sanitären Anlagen im Lager Hasborn klagten ; vgl. LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 75. Dazu auch Schmitt-Koelzer : Bau der „Reichsautobahn“, S. 49–50. Einer der Verhafteten, Wilhelm Kröger, wurde in der Folge in der Strafanstalt Wittlich interniert (Schutzhaft) : LHA Koblenz, Best. 605,002, Nr. 2005.
47
48
|
Lena Haase
kraft von Häftlingen des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert und seiner Außenlager im Hinblick auf die Verwaltung des Häftlingseinsatzes für die Arbeit zuständig. Die Besetzung Luxemburgs und die damit verbundene Integration des Großherzogtums ins Deutsche Reich bedeutete auch eine geographische Ausdehnung der Gestapo Trier. Kurz nach dem Einsetzen einer Zivilverwaltung unter Gauleiter Gustav Simon (Chef der Zivilverwaltung = CdZ) am 29. Juli 1940 in Luxemburg, das ab dem 24. Januar 1941 als Teil des Gaues „Moselland“ deklariert wurde, nahm auch die Gestapo offiziell ihre Tätigkeit dort auf.149 Am 1. September 1940 wurde das Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Luxemburg (EKL)150 in zentralen und repräsentativen Gebäuden Luxemburgs etabliert : Die Villa Pauly wurde Hauptsitz der Gestapo (mit Außenstellen in Esch-sur-Alzette, Diekirch und Clervaux und den Grenzpolizeikommissariaten/-posten in Luxemburg, Rodingen, Kleinbettingen und Steinfort), das Hotel Staar am Bahnhof Sitz der Kriminalpolizei und die Villa Sternberg am Boulevard Joseph II. Sitz des SD. Auch wenn das EKL häufig als Außenstelle der Gestapo Trier bezeichnet wird, so blieb es bis zu seiner Auflösung am 25. Juli 1944 eigenständig. Erst ab dem 15. August 1944 wurde das „Gebiet Luxemburg“ von der Gestapo Trier übernommen.151 Die Besetzung der Leitungsstelle des EKL war stets an die Leitung der Staatspolizeistelle Trier gekoppelt,152 was nicht nur eine enge Zusammenarbeit zwischen den Staatspolizeien in Trier und Luxemburg förderte, sondern außerdem eine hohe Fluktuation der Beamten und Angestellten zwischen beiden Dienststellen bedeu-
149 Zur Gestapo in Luxemburg siehe Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015. 150 BArch Koblenz, AllProz 21/344, Bl. 3 ; Paul Dostert : Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 1940–1945, Luxembourg 1985, S. 207. Zur Tätigkeit des EKL liegen für die Konstituierungsphase eine Auflistung des Schriftverkehrs 1940 (Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance [CDRR] Luxembourg, EKL Schriftverkehr 1940), Sammlungen mit Verhaftungsverfügungen, Stimmungsberichten, Korrespondenz mit der Gestapo Trier und dem SD (CDRR, CNR 16A Gestapo ; CDRR, CNR 16B Gestapo ; CDRR, CNR 18 Gestapo) und für die Endphase tägliche Fahndungslisten (Januar – Juli 1944) und das Meldeblatt der Kriminalpolizei beim EKL (für Januar bis Juli 1944) (CDRR ; CNR 18B Gestapo Fahndungslisten) sowie die Tätigkeitsberichte vom 12. April 1944 bis 26. August 1944 (CDRR, Gestapo Tätigkeitsberichte 1944) vor. 151 Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg, S. 11–13. 152 Leiter des EKL waren dementsprechend Oberregierungsrat und SS-Obersturmbannführer Wilhelm Nölle (8/1940–2/1941), Oberregierungsrat und SS-Obersturmbannführer Fritz Hartmann (3/1941–4/1943), Regierungsrat und SS-Sturmbannführer Walter Vollmer (4/1943–8/1943) sowie Kriminalrat und SS-Sturmbannführer Walter Runge (9/1943–8/1944) ; vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/342, Bl. 11 ; BArch Ludwigsburg, B 162/6904, Bl. 235.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
tete. Bei der Einrichtung des EKL stammte der Großteil der Beamten aus den Trierer Dienststellen.153 Ein Arbeitsschwerpunkt des EKL bestand in der Aufdeckung und Zerschlagung der zahlreichen luxemburgischen Widerstandsgruppen,154 die sich der Besatzung und insbesondere den „Germanisierungsmaßnahmen“ widersetzten. Zu einem ersten Verfolgungshöhepunkt kam es nach dem sogenannten Luxemburger Generalstreik am 30./31. August 1942 – eine Antwort auf die völkerrechtswidrige Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg155 –, den Gauleiter Gustav Simon mit der „Verhängung des zivilen Ausnahmezustandes“156 am 1. September 1942 und der damit verbundenen Einrichtung eines Standgerichtes niederzuringen versuchte, das mit Genehmigung des RSHA und unter Vorsitz von Fritz Hartmann – Leiter des EKL und Chef der Gestapo Trier – zusammentrat.157 Als Beisitzer wählte Hartmann den Trierer Kriminalkommissar, SS-Obersturmführer Albert Schmidt (Leiter des Vernehmungskommandos in Hinzert), und den Vorsitzenden des Luxemburger Sondergerichts Adolf Raderschall.158 Neben 125 Überstellungen an die Gestapo Trier, was faktisch eine Einweisung nach Hinzert bedeutete, verhängte das Standgericht 20 Todesurteile, die durch Plakatierung im gesamten Großherzogtum bekanntgegeben wurden. Die Todesurteile wurden zwischen dem 2. und dem 9. September 1942 in einem Quarzitsteinbruch in unmittelbarer Nähe des Hinzerter Lagers durch Erschießung vollstreckt, die Ermordeten in ei153 BArch Koblenz, AllProz 21/342. Bl. 11. 154 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 10. Diese konnten teilweise erfolgreich durch V-Männer ausgehoben werden ; vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/275. 155 BArch Koblenz, AllProz 21/202. Bl. 473–475 ; Dani Sinner : Der Streik von 1942, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 381–411 ; Josy Fellens : Aufruf zum Generalstreik, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 413–428 ; Manuel de Ridder : Der Streik 1942 in Differdingen, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 429–434 ; Norbert Franz : Die Zwangsrekrutierung für Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst in Luxemburg – ein NS-spezifisches Unrecht ?, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das Großherzogtum Luxemburg unter deutscher Besatzung. Fachtagung, 10. Mai 2012 (Gedenkarbeit Rheinland-Pfalz, Bd. 10), Mainz/Hinzert 2013, S. 56–75, hier S. 60 ; André Hohengarten : Die Luxemburger Zwangsrekrutierten, in : Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg (Hg.) : …et wor alles net esou einfach. Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale/Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Contributions historiques accompagnant l’exposition/Ein Lesebuch zur Ausstellung, Luxembourg 2002, S. 244– 257, hier insbesondere S. 247–249. 156 BArch Koblenz, AllProz 21/358, Bl. 31. 157 Ebd., Bl. 46 ; Katharina Klasen : Allgegenwärtig ? Die Geheime Staatspolizei und das SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 13), Mainz/Hinzert 2015, S. 102–109, insbesondere S. 103. 158 BArch Koblenz, AllProz 21/189. Bl. 22. Abschriften der Standgerichtsprozesse in : CDRR, Grève 1942.
49
50
|
Lena Haase
nem Massengrab im nahegelegenen Wald verscharrt. Obwohl die Erschießungen von SS-Angehörigen unter dem Kommando Paul Sporrenbergs, des Hinzerter Lagerkommandanten, durchgeführt wurden, kann die Beteiligung der Trierer Gestapo an den Morden nicht nivelliert werden. Abgesehen von der Rekrutierung des Standgerichts zu Zweidritteln aus Trierer Gestapobeamten, verfügte diese den Transport der weiteren 125 Verurteilten ins Konzentrationslager Hinzert. Dort wurden die Häftlinge zur Vorantreibung der Aushebung luxemburgischer Widerstandsgruppen dem sogenannten Vernehmungskommando übergeben, das von Herbst 1941 bis August 1944 dauerhaft im Lager anwesend war.159 Mindestens 22 Angehörige der Gestapo Trier und des EK Luxemburg waren in dieser Zeit im Vernehmungskommando tätig, indem sie mittels verschärfter Verhöre Informationen zum luxemburgischen Widerstand sammelten.160 Mittlerweile kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Vernehmungskommando in Hinzert nicht ausschließlich für die Verhöre luxemburgischer Häftlinge zuständig war, sondern ebenfalls französische „Nacht-und-Nebel“-Häftlinge verhörte.161 Die zweite Hinrichtung von 23 luxemburgischen Widerstandskämpfern fand in Hinzert am 25. Februar 1944 statt und wurde wie die erste von Seiten der Gestapo Trier und des EKL organisiert, jedoch nicht durchgeführt. Da man nach erfolgten Ermittlungen und Verhaftungen (vor allem durch das EKL) zu viele Todesurteile erwartete, wählte eine „Gestapokommission“ unter Vorsitz von Walter Runge von einer Liste mit 50 Todeskandidaten die 25 Hinzurichtenden aus.162
159 Klasen : Allgegenwärtig ?, S. 71–97 ; Das Vernehmungskommando in Hinzert, in : Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015, S. 91–94. Ein Pendant zum Hinzerter Vernehmungskommando war in der Strafanstalt Wittlich stationiert und auch dort für die Verhöre der durch die Gestapo Trier eingelieferten Häftlinge zuständig. 160 Vgl. den Beitrag von Katharina Klasen in diesem Band. 161 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 27. Das im SS-Sonderlager/KZ Hinzert durchgeführte Verhör ist im Dokumentkopf überschrieben mit „Staatspolizeistelle Trier, z.Zt. Hinzert“. Zum Schicksal französischer „Nacht-und-Nebel“-Häftlinge in den Haftstätten der Region Trier siehe Lena Haase : Verurteilt um zu Verschwinden. „Nacht-und-Nebel“-Häftlinge in der Großregion Trier (1942–1944), in : Kurtrierisches Jahrbuch 56 (2016), S. 289–320, darin speziell zu Hinzert : S. 307–309. Zum Schicksal eines „NN“-Häftlings, der von der Gestapo Trier in Hinzert eingeliefert und dort verhört wurde, vgl. Thomas Grotum/Lena Haase/Ksenia Stähle : Une ville frontière à l’heure de la Gestapo, in : Historia, Numéro Spécial Janvier/Février 2017, S. 58–61. 162 BArch Koblenz, AllProz 21/282, Bl. 314–315. Zu den Hinrichtungen vgl. auch Jana Nieuwenhuizen : Die Massenhinrichtungen von 20 Streikteilnehmern (1942) und 23 Widerstandskämpfern (1944) aus Luxemburg in der Nähe des SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Masterarbeit Universität Trier 2015.
Die Gestapo in der Gesellschaft
Abb. 2 und 3: Ansichtskarten des Hotels Nicolay „Zur Post“ in Zeltingen an der Mosel: Sitz der Gestapo Trier vom 18. Januar bis zum 6. März 1945. (Quelle: Privat).
|
51
52
|
Lena Haase
Des Weiteren waren die Staatspolizeistelle Trier wie auch das EKL maßgeblich an der Vorbereitung, Organisation und Durchführung der Judendeportationen aus der Region beteiligt,163 für die die Gestapo nicht nur in Zusammenarbeit mit dem jüdischen Konsistorium die Deportationslisten zusammenstellte, sondern ebenfalls die Transporte bis zum Bestimmungsort begleitete.164 Mit Fortschreiten des Krieges und dem Näherrücken der Westfront erlebte die Grenzregion um Trier zahlreiche Bombenangriffe165 von den Alliierten, die im Oktober 1944 unter anderem auch die Christophstraße 1, den Sitz der Staatspolizeistelle Trier, trafen. Damit wurde die Gestapo zu einem ersten Umzug nach Olewig (Villa Zeimet) gezwungen, bevor sie aufgrund der stetig zunehmenden Häufigkeit der Luftangriffe mit erheblich verringertem Personalbestand nach Zeltingen an der Mosel (Hotel „Zur Post“) umzog.166 Dem Rückzug aus Trier war bereits die 163 Vgl. Benjamin Koerfer : Die Deportation der Juden aus Trier und Umgebung ins Getto in Litzmannstadt. Eine quantitative Analyse der Opfergruppen und Einordnung in den Prozess der Vernichtung der europäischen Juden, Saarbrücken 2016 (Masterarbeit Universität Trier 2014) ; Pascale Eberhard : Der Überlebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region im Getto Litzmannstadt. Briefe Mai 1942/Lutte pour la survie des déportés juifs du Lu xembourg et de la région de Trèves au ghetto de Litzmannstadt. Lettres de Mai 1942/The struggle for survival of the jews from Luxembourg and the Trier region deported to the Litzmannstadt Ghetto. Letters of May 1942, Saarbrücken 2012 ; Georges Büchler : Évacuation – Déportation. Le premier transport vers l’Est, 16.10.1941/Evakuierung – Aussiedlung. Der erste Polentransport, 16.10.1941 (Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette, Bd. 8), Luxembourg 2016. 164 Vgl. die Vernehmung des Angeklagten Otto Schmalz vom 10./11. August 1970, seit Juli 1936 bei der Gestapo Trier angestellt und ab August 1940 Judensachbearbeiter beim EKL. BArch Ludwigsburg, B 162/6907, Bl. 992–1018 (siehe seine Dienstbezeichnung auch im erhaltenen Geschäftsverteilungsplan des EKL, Sparte „Geheime Staatspolizei“ von Juli 1944 in : BArch Berlin, R70-Luxemburg-3, Bl. 17–19). Von Frühjahr 1940 bis September 1944 war Schmalz der alleinige „Judensachbearbeiter“ beim EKL und mit den Deportationen betraut. Im Rahmen dieser Tätigkeit nahm er unter anderem an drei Besprechungen im RSHA teil, welchen auch Adolf Eichmann beiwohnte, in denen die Deportationsverhältnisse der luxemburgischen zu den deutschen Juden, die Zusammenarbeit mit dem jüdischen Konsistorium sowie auch die Unterscheidung zwischen arbeitsfähigen und nicht-arbeitsfähigen Juden und die Zusammenarbeit mit der Reichsbahn im Rahmen der Deportation besprochen wurden. Abgesehen von der Zusammenstellung der Transporte musste Schmalz die Züge bis zu ihrem Bestimmungsort begleiten, so etwa nach Theresienstadt. 165 Vgl. Emil Zenz : Trier in Rauch und Trümmern. Das Kriegsgeschehen in der Stadt, in Ehrang, Pfalzel, Konz in den Jahren 1943–1945, Trier 1983 ; Kurt Düwell : Trier und sein Umland in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges, in : Kurt Düwell/Michael Matheus (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 97–106. 166 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15797 ; National Archives and Records Administration (NARA), M 1270, Roll 0031 (Interrogation Report No. 28 – Gestapo Trier).
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Aberkennung der Eigenständigkeit als Staatspolizeistelle vorausgegangen : Zum 1. November 1943 wurde Trier der Gestapo Koblenz als Außendienststelle angegliedert. Damit verbunden war etwa die Verlegung der Abteilung I (Verwaltung) nach Koblenz.167 Begleitet wurde das nahende Kriegsende außerdem von der Verübung von Kriegsendphasenverbrechen der Gestapo168, von denen auch die Angehörigen der Trierer Staatspolizei nicht freizusprechen sind. Am 8. und 9. September 1944, unmittelbar vor der Befreiung Luxemburgs durch die amerikanischen Truppen, wurden jeweils drei Angehörige von Widerstandsgruppen aus Frankreich und Luxemburg in Palzem und Nennig an der Mosel auf den Friedhöfen erschossen und verscharrt.169
Neuanfang nach 1945? – Kontinuitäten in der Nachkriegszeit
Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der Befreiung Deutschlands setzte unter alliierter Besatzung sowohl eine strukturelle Neuorganisation als auch eine Politik der Entnazifizierung ein. In der französischen Besatzungszone machte es sich der „Service Épuration“ zur Aufgabe „durch [seine] Demokratisierungspolitik einen breiten Elitenwechsel [zu] ermöglichen und das ‚andere Deutschland‘ an die Macht [zu] bringen“170. Er scheiterte jedoch an der personellen Schwäche dieses „anderen Deutschlands“.171 Auch wenn in der unmittelbaren Nachkriegszeit Prozesse gegen Schwerbelastete des NS-Regimes angestrebt und durchgeführt wurden, erscheinen die Urteile in der Retrospektive häufig in ihrem Strafmaß ungerechtfertigt.172 Dies erklärt sich 167 SHD Vincennes, GR28 P7, Nr. 58 ; NARA, M1270, Roll 0031 (Interrogation Report No. 28 – Gestapo Trier). 168 Gerhard Paul : „Diese Erschießungen haben mich innerlich gar nicht mehr berührt.“ Die Kriegsendphasenverbrechen der Gestapo 1944/45, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‚Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 543– 568. 169 LA Saarland, StAnw, Nr. 2660–2661 und Nr. 2665 ; KrA Trier-Saarburg, Best. P, Nr. 428. 170 Rainer Möhler : Politische Säuberung im Südwesten unter französischer Besatzung, in : Kurt Düwell/ Michael Matheus (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 175–191, hier S. 189. 171 Ebd. 172 Beispielhaft sei hier der „Gestapo-Prozess“ in Luxemburg angeführt, der vom 10. Oktober 1949 bis zum 27. Februar 1951 verhandelt wurde. Angeklagt waren 16 ehemalige Beamte der Gestapo und des EKL ; vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/344. Vier Angeklagte wurden zum Tode verurteilt,
53
54
|
Lena Haase
einerseits aus dem bereits bemerkten Personalbedarf für den Aufbau der neuen Bundesrepublik, andererseits aus der in Teilen kenntlich werdenden Kontinuität innerhalb der Verbrechensbekämpfung, die sich auch in der jungen Bundesrepublik noch mit der „Abwehr der kommunistischen Propaganda und Infiltration im Bundesgebiet“173 und der „Abwehr staatsfeindlicher Bestrebungen und Beschlagnahme von staatsfeindlichem Propagandamaterial“174 beschäftigte. Erfreulicherweise arbeiten mittlerweile nicht nur die deutsche Polizei175 und die deutschen Nachrichtendienste176 in all ihren Sparten die eigene Verantwortung während des NS-Regimes und die Rehabilitierung Belasteter nach 1945 auf, sondern auch zahlvier freigesprochen, die übrigen acht erhielten Zwangsarbeitsstrafen von zwölf und 20 Jahren, Gefängnisstrafen von drei und sechs Jahren, Zuchthausstrafen von fünf und zwei mal zehn Jahren. Alle Todesstrafen wurden jedoch sukzessive in Freiheitsstrafen umgewandelt, bis im Dezember 1957 mit Fritz Hartmann der letzte der Verurteilten in Freiheit gelangte ; vgl. dazu : BArch Ludwigsburg, B 162/6903, Liste 4 (Bl. 26–28) ; Jill Steinmetz : „Die Wahrheit steht noch über dem Recht“ ? Verlauf und Verteidigungsstrategien im Prozess gegen Gestapo-Beamte vor dem Gerichtshof für Kriegsverbrechen im Großherzogtum Luxemburg (1949 bis 1951), Masterarbeit Universität Trier 2013 ; zum Urteil insbes. S. 46–52 ; Jill Steinmetz : „Die Wahrheit steht noch über dem Recht“ ? Die Verteidigungsstrategie von Dr. Max Rau im Prozess gegen Gestapo-Beamte vor dem Gerichtshof für Kriegsverbrechen im Großherzogtum Luxemburg (1949–1951), in : Kurtrierisches Jahrbuch 54 (2014), S. 379–397. 173 Anweisung des Bundesministers für gesamtdeutsche Fragen vom 30. September 1950, in : LHA Koblenz, Best. 655,215, Nr. 712. 174 Anweisung des Trierer Regierungspräsidenten an alle Landräte, Polizeidirektionen, die Oberstaatswie auch die Amtsanwaltschaft in Trier vom 22. Januar 1952, in : LHA Koblenz, Best. 655,215, Nr. 712. 175 Bundeskriminalamt (Hg.) : Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte. Dokumentation einer Kolloquienreihe, Köln 2008 ; Bundeskriminalamt (Hg.) : Der Nationalsozialismus und die Geschichte des BKA. Spurensuche in eigener Sache. Ergebnisse – Diskussionen – Reaktionen, Dokumentation des Kolloquiums zum Forschungsbericht zur BKA-Historie vom 6. April 2011, Köln 2011 ; Klaus Weinhauer : NS-Vergangenheit und struktureller Wandel der Schutzpolizei der 1950/60er Jahre, in : Wolfgang Schulte (Hg.) : Die Polizei im NS-Staat. Beiträge eines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Frankfurt a.M. 2009, S. 139–158. 176 Christoph Rass : Das Sozialprofil des Bundesnachrichtendienstes. Von den Anfängen bis 1968 (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 1), Berlin 2016 ; Gerhard Sälter : Phantome des Kalten Krieges. Die Organisation Gehlen und die Wiederbelebung des Gestapo-Feindbildes „Rote Kapelle“ (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 2), Berlin 2016 ; Sabrina Nowack : Sicherheitsrisiko NS-Belastung. Personalüberprüfungen im Bundesnachrichtendienst in den 1960er Jahren (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 4), Berlin 2016 ; Constantin Goschler/Michael Wala : „Keine neue Gestapo“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit, Hamburg 2015.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
reiche Bundesministerien und Bundesbehörden stellen sich mittlerweile der Vergangenheit ihrer Institutionen. Angestoßen wurde diese Entwicklung 2005 durch die – öffentlich kontrovers diskutierte – Initiative Joschka Fischers als Bundesaußenminister.177 Anhand biographischer Beispiele sollen im Folgenden die Karrieren ehemaliger Trierer Gestapobeamter schlaglichtartig angeführt werden, um diese Entwicklung zu verdeutlichen. Für den Aufbau eines neuen deutschen Auslandsgeheimdienstes rekrutierten die USA potentielle Geheimdienstmitarbeiter teilweise unmittelbar aus den Internierungslagern heraus,178 was zur Folge hatte, dass in der Gründungsphase eine nicht unwesentliche Anzahl von Mitarbeitern des Bundesnachrichtendienstes (BND) als „Belastete“ des NS-Regimes zu bezeichnen waren. Als der BND 1956 in die Zuständigkeit der Bundesregierung überführt wurde, und zunächst über den Umgang mit bereits beschäftigten, dann über die Neueinstellung ehemaliger Gestapobeamter entschieden werden musste,179 wurde vom BND-Präsidenten 1963 eine „interne Überprüfung des sogenannten ‚besonderen Personenkreises‘ an[geordnet]“180. Aus diesem 157 Personen umfassenden Kreis wurden 1966 insgesamt 68 wegen Belastung in ihrer NS-Vergangenheit entlassen. Die Beschäftigung bei der Gestapo war einer der dafür genannten Gründe.181 Zehn Prozent der von dieser Entlassung betroffenen Geheimdienstmitarbeiter waren während der nationalsozialistischen Herrschaft bei der Gestapo Trier oder dem EKL tätig gewesen, womit man in diesem Falle von einem Netzwerk ehemaliger Trierer Gestapobeamter im BND sprechen könnte, da sich die Beschäftigungszeiten der Betroffenen in Trier überschnitten.182 Weitere ehemalige Trierer Gestapobeamte, für die zwar eine „politische Belastung“ festgestellt werden konnte, wurden unter Auflagen weiterbeschäftigt.183 177 Eckart Conze u.a. (Hg.) : Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010. 178 Nowack : Sicherheitsrisiko, S. 12 f. 179 Am 11. Juni 1958 wurde die Einstellung ehemaliger Gestapobeamter noch „ausdrücklich gebilligt“ ; vgl. Nowack : Sicherheitsrisiko NS-Belastung, S. 29. 180 Ebd. 181 Ebd., S. 11. 182 Ein Auszug der Liste mit dem „besonderen Personenkreis“ wurde am 17.3.2010 in FAZ-NET veröffentlicht : http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bnd-ein-besonderer-personenkreis-1927112. html (Letzter Zugriff : 27.2.2017). Ausgewählte Biographien finden sich auch in Nowack : Sicherheitsrisiko. 183 So Heinrich Hedderich (1936–1945 Gestapo Trier, ab 1941 im Vernehmungskommando Wittlich eingesetzt) ; vgl. Nowack : Sicherheitsrisiko, S. 454–455. Albert Schmidt (1939–1945 Gestapo Trier, 1942 Beisitzer am Standgericht Luxemburg, das die Hinrichtung der 20 Luxemburger anordnete) wurde zwar 1964 in den Ruhestand versetzt, aber als „freier Mitarbeiter“ weiterbeschäftigt, vgl. Nowack : Sicherheitsrisiko, S. 316–317 und S. 475.
55
56
|
Lena Haase
Neben einer Karriere im westdeutschen Geheimdienst war auch eine politische Karriere für ehemalige Trierer Gestapobeamte möglich. Prominentestes Beispiel ist Heinrich Welsch184, der nach einem Studium der Rechtswissenschaften von Februar 1934 bis März 1935 Leiter der Staatspolizeistelle in Trier war.185 Aufgrund seiner fundierten Kenntnisse der politischen und gesellschaftlichen Stimmung im Saargebiet (er war von 1921 bis 1934 Staatsanwalt in Saarbrücken) wurde er zur Vorbereitung der Saarabstimmung in das höchste Amt der Staatspolizeistelle Trier berufen und war darüber hinaus insbesondere für die Ermittlung und Aushebung kommunistischer Zellen im Saargebiet zuständig.186 Nach der erfolgten Saarabstimmung, der er als Vertreter des Deutschen Reiches am Obersten Abstimmungsgerichtshof beiwohnte,187 wurde er bis 1945 Generalstaatsanwalt am Oberlandesgericht Zweibrücken und war außerdem von 1940 bis 1945 Leiter der deutschen Justizverwaltung in Lothringen.188 Laut eigener Aussage stand er ab Dezember 1944 außerdem kurzzeitig „der Anklagebank des Sondergerichts für Lothringen“ in Metz vor.189 Nichtsdestotrotz konnte Welsch, der bei einer objektiven Beurteilung unmöglich als „unbelastet“ zu bezeichnen wäre, unter anderem Ministerpräsident des Saarlandes (29. Oktober 1955 bis 10. Januar 1956) und Minister für Justiz, Arbeit und Wohlfahrt werden. Sein Porträt hängt daher in der Saarbrücker Staatskanzlei zwischen jenen von Johannes Hoffmann, dem ersten saarländischen Ministerpräsidenten, der ein entschiedener Gegner des NS-Regimes war und aus Deutschland flüchten musste, und von Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch eine erneute Karriere im deutschen Polizeidienst erwies sich für viele ehemalige SS-Mitglieder und Gestapobeamte als durchaus möglich. Die Gründung des Bundeskriminalamtes (BKA) 1951190 sowie deren Vorbereitung ab 1945 waren 184 Parteieintritt am 1. Mai 1935, Mitgliedsnummer 3588056 ; vgl. dazu : BArch Berlin, BDC, NSDAP-Gaukartei, Karte Welsch. 185 Mallmann/Paul : Herrschaft und Alltag, S. 182. 186 Luitwin Bies : Die CDU-Saar – mit braunen Flecken. Vortrag gehalten am 5. März 2009 in Saarbrücken. Manuskript Online : http://peter-imandt.de/Braune_Flecken.pdf (Letzter Zugriff : 27.2.2017), S. 7. 187 Ernst Klee : Art. „Welsch, Heinrich“, in : Ders.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt a.M. 2005, S. 667. 188 In dieser Funktion nahm er an einer Juristentagung am 23./24. April 1941 in Berlin teil, auf welcher unter anderem über „die Vernichtung lebensunwerten Lebens mittels Gas“ informiert wurde ; vgl. Klee : Welsch, S. 667 ; Gisela Tascher : Staat, Macht und ärztliche Berufsausübung 1920–1956. Gesundheitswesen und Politik : Das Beispiel Saarland, Paderborn 2010, S. 342. 189 BArch Berlin, R 3001/80024. 190 Patrick Wagner : Prägungen, Anpassungen, Neuanfänge. Das Bundeskriminalamt und die nationalsozialistische Vergangenheit seiner Gründergeneration – Ansatz und Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in : Bundeskriminalamt (Hg.) : Der Nationalsozialismus und die Geschichte des
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
zunächst von einer ablehnenden Haltung Adenauers geprägt, der es als „vollkommen ausgeschlossen“ ansah, ehemalige SS-Angehörige beim BKA einzustellen.191 Dieses Vorhaben wurde jedoch schnell relativiert, da „Fachleute im Kalten Krieg“ benötigt würden, sodass lediglich noch „lautstarkes Bekennen zum NS-Regime“ und „Denunziation“, nicht aber die Teilnahme an Gewaltverbrechen eine Einstellung beim BKA verhinderten. Ab Ende der 1950er Jahre verstärkte sich jedoch der „informelle Druck innerhalb der Polizei, nicht nur im BKA“192, was die Überprüfung einzelner Polizei- und Kriminalbeamter nach sich zog. Ein beginnender Generationswechsel in allen gesellschaftlichen Bereichen193, die Einrichtung der „Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen“ in Ludwigsburg und der Ulmener Einsatzgruppenprozess 1958194 trugen maßgeblich zu diesem Umdenken bei. Auf Veranlassung des Bundesinnenministeriums wurden ab Mai 1960 alle vor 1945 in Ost- und Südosteuropa eingesetzten, beim BKA tätigen Polizisten überprüft, bevor diese Überprüfung 1963 auf alle während der NS-Zeit bei der Gestapo oder Kripo tätig gewesenen Beamten ausgedehnt wurde.195 Auch die Schutzpolizeien der Bundesländer wurden in den frühen 1960er Jahren auf Anweisung der Innenministerien auf die eventuellen NS-Vergangenheiten ihrer Beamten hin überprüft. 196 Der bereits erwähnte Otto Schmalz, seit 1924 in der Preußischen Schutzpolizei angestellt,197 wurde am 1. April 1936 zur Kriminalpolizei einberufen und gelangte bereits nach drei Monaten als Kriminalassistent zur Staatspolizeistelle Trier, wo er bis zum Kriegsausbruch am Grenzpolizeiposten Perl Dienst tat. Nach seiner Abkommandierung zum EKL im August 1940,198 dem er bis zur Auflösung im September 1944 angehörte, wurde er dort Leiter des Judenreferates und war damit unter anderem für die Vorbereitung der Deportationszüge zuständig.199 In den letzten Kriegsmonaten erfolgte seine Versetzung zur Staatspolizeistelle Wien,200 wo er am 7. Mai 1945 in BKA. Spurensuche in eigener Sache. Ergebnisse – Diskussion – Reaktionen. Dokumentation des Kolloquiums zum Forschungsbericht zur BKA-Historie vom 6. April 2011, Köln 2011, S. 21–35, hier S. 22. 191 Ebd., S. 27. Folgende Zitate : ebd. 192 Weinhauer : NS-Vergangenheit, S. 124. 193 Wagner : Prägungen, S. 30. 194 Ebd., S. 30 f. Im Zuge des Einsatzgruppenprozesses wurden unter anderem BKA-Beamte wegen der Teilnahme an Massenerschießungen von Juden während des Zweiten Weltkrieges verhaftet. 195 Ebd., S. 31. 196 Weinhauer : NS-Vergangenheit, S. 124. 197 BArch Ludwigsburg, B 162/6907, S. 994. 198 Ebd., S. 995. 199 Ebd., S. 996–1018. 200 Ebd., S. 995.
57
58
|
Lena Haase
amerikanische Gefangenschaft geriet, die er im „War Crimes Central Suspect and Witness Enclosure“ in Dachau zubrachte.201 Eine in Luxemburg angestrebte Anklage von Schmalz ergab jedoch „keine genügenden Anhaltspunkte zur Verfolgung des Beschuldigten als Kriegsverbrecher […], [wodurch] das Verfahren im Grossherzogtum gegen ihn einzustellen [war] und derselbe zur Verfügung des Kontrollrates in Deutschland bezw. der Besatzungsmächte zu übermitteln [war].“202 Nach seiner Entlassung aus der Haft am 30. März 1948 zog Schmalz zurück nach Düsseldorf, wo er nach zweijähriger Tätigkeit als Mechaniker und Fahrer bei der englischen Militärpolizei am 1. Juli 1950 wieder als Kriminalwachtmeister bei der Kriminalpolizei Düsseldorf in den Polizeidienst aufgenommen wurde.203 Als Kriminalobermeister ging er dort am 31. März 1964 im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand.204 Ein Gegenbeispiel zeigt den gescheiterten Versuch, erneut in den Polizeidienst aufgenommen zu werden : Friedrich Schmidt205, 1924 in die preußische Schutzpolizei eingetreten, wurde im Juni 1936 zur Geheimen Staatspolizei in Trier einberufen, obwohl er sich um einen Platz bei der Kriminalpolizei beworben hatte.206 Dort arbeitete er bis 1945 in der Abteilung II, befasst mit dem Widerstand in Luxemburg. Von 1940 bis 1944 war er zum EKL nach Luxemburg versetzt worden. Aufgrund der Angehörigkeit zu einer verbrecherischen Organisation (Gestapo und SS) wurde Schmidt am 19. August 1949 in Rastatt in Abwesenheit zum Tode verurteilt.207 Die Strafe konnte jedoch nicht vollstreckt werden, da Schmidt am 8. April 1948 aus dem Internierungslager „CIC No. 5 Paderborn Staumühle“ fliehen konnte.208 Er lebte und arbeitete zunächst mit gefälschten Papieren in Dortmund, bevor er im Dezember 1954 aus der Anonymität auftauchte – möglicherweise ermutigt durch das kurz zuvor erlassene Straffreiheitsgesetz209 – und wieder zu seiner 201 Archives Nationales de Luxembourg (AnLux), Jt-230. 202 AnLux, Jt-102. 203 BArch Ludwigsburg, B 162/6907, S. 996. 204 Ebd. 205 Viktoria Bach : Karriere in der Gestapo. Biographische Studien zu einem Trierer Gestapo-Mitglied, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2014. 206 LA Saarland, StAnW, Nr. 2664. 207 Ebd. In einem weiteren, Ende der 1950er Jahre eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen seiner Beteiligung am Vernehmungskommando Hinzert, u.a. wegen Mordverdachts, und den Erschießungen in Palzem und Nennig, wurde Schmidt nicht verurteilt. 1962 hatte man das Verfahren eingestellt ; vgl. dazu : LHA Koblenz, Best. 584,2, Nr. 1578 ; Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette : Gestapo-Terror in Luxemburg, S. 121. 208 Bach : Karriere in der Gestapo, S. 18. 209 „Gesetz über den Erlaß von Strafen und Geldbußen und die Niederschlagung von Strafverfahren und Bußgeldverfahren“ vom 17. Juli 1954, in : Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 17. Juli 1954, Nr. 21, S. 203–209.
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
Familie nach Nikolausberg im heutigen Göttingen zog. Dort arbeitete Friedrich Schmidt als Büroangestellter, bis er am 17. Januar 1968 starb.210 Seine Bemühungen, mit Berufung auf Art. 131 des Grundgesetzes erneut in den Polizeidienst des Landes Niedersachsen zurückkehren zu können, scheiterten jedoch, da sich „Anhaltspunkte für schwere strafbare Handlungen“211 ergaben. Obgleich ihm aufgrund der besonderen Schwere seiner Handlungen während der Dienstzeit bei Gestapo Trier und EKL eine Aufnahme in den Polizeidienst verweigert wurde, blieb eine strafrechtlich wirksame Verfolgung Schmidts aus.
Fazit
Um die Geschichte einer Geheimen Staatspolizeistelle im regionalen Kontext schreiben zu können, gilt es, folgende zentrale Punkte zu berücksichtigen : Zur Abbildung der staatspolizeilichen Praxis in Gänze kann es nicht genügen, sich einzig mit der Behörde selbst zu befassen. Die Wirksamkeit jeder Geheimen Staatspolizeistelle – hier dargestellt am Beispiel Triers – erschließt sich weder aus ihrer eigenen Machtfülle heraus, noch allein aufgrund der Denunziationen und Informationen von V-Leuten. Obgleich diese eine bedeutende Rolle in der staatspolizeilichen Ermittlungspraxis spielten, nahm die Zusammenarbeit und manchmal auch die Konkurrenzsituation (etwa mit dem SD im Zuge von Grenzkontrolle und Spionageabwehr) gegenüber und mit anderen Institutionen einen hohen Stellenwert ein : Nur durch das Zusammenwirken von Partei, Gestapo, Kripo, Justiz, regionalen und lokalen Verwaltungsorganen, Finanz- und Postämtern und weiteren konnte eine Polizeiarbeit möglich gemacht werden, die während des „Dritten Reiches“ von einem Großteil der Bevölkerung gefürchtet wurde. Diese institutionelle Verankerung in der nationalsozialistischen Gesellschaft war jedoch nicht möglich ohne eine kontinuierliche Präsenz in der Öffentlichkeit und damit durch die Schaffung von „Normalität“ im Hinblick auf die Existenz von Politischer Polizei im Allgemeinen. Mit der Geschichte einer Staatspolizeistelle im Jahre 1933 beginnen zu wollen, erweist sich dann als kurzsichtig, wenn eben jene Verankerung in der Gesellschaft untersucht werden soll. Das Bestehen einer Politischen Polizei seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert und die offensichtliche und damit öffentliche Zunahme polizeilichen Vorgehens gegen politische Gegner und Andersdenkende bis hin zur Weimarer Republik mögen die Bevölkerung an solche, auch vor 1933 teils drasti210 Bach : Karriere in der Gestapo, S. 20–21. 211 LA Saarland, StAnW, Nr. 2658.
59
60
|
Lena Haase
sche Maßnahmen gewöhnt haben. Sicherlich sind diese Verfahrensmethoden nicht mit den Verbrechen der Geheimen Staatspolizei zu vergleichen. Eine sukzessive Steigerung von Gewalt im Umgang mit „Staatsfeinden“ – auch im Hinblick auf die stetige Ausdehnung der Schutzhaftverfügungen – umgeht jedoch den Umbruchsmoment, der als solcher in der Bevölkerung hätte wahrgenommen werden können. Ebenso wie die Machtergreifung Hitlers in den Augen seiner Zeitgenossen möglicherweise weniger als Umbruch wahrgenommen wurde, so wurde auch die Etablierung der Geheimen Staatspolizei nicht als Beginn des staatspolizeilichen Terrors aufgefasst. So wie 1933 nicht der Beginn, so kann auch der 8. Mai 1945 nicht das Ende einer Geschichte der Gestapo sein. Zahlreiche ehemalige Gestapobeamte konnten teilweise ohne Unterbrechung, über den Systemwechsel hinaus einen nächsten Karriereschritt in der jungen Bundesrepublik anstreben. Neben der erneuten Aufnahme in die deutsche Polizei (Schutz- und Kriminalpolizei) stellten auch der neu geschaffene BND oder gar die Landespolitik mögliche Betätigungsfelder dar. Die gegenseitige Ausstellung von Leumundszeugnissen, um die vorbildliche Haltung alter Kameraden und Kollegen während der Entnazifizierungsverfahren zu bezeugen, sind ebenso Beleg für die Existenz von Netzwerken ehemaliger Gestapobeamter in der Bundesrepublik Deutschland wie auch die gemeinsame Beschäftigung mehrerer Trierer Beamter beim BND. Während des Nationalsozialismus geknüpfte Beziehungen und Zusammenschlüsse konnten dementsprechend auch über die Stunde Null hinaus aufrechterhalten und genutzt werden. Im Falle Triers ist darüber hinaus der Blick über die Grenze von immenser Bedeutung, um die Arbeit der Staatspolizeistelle im reichsweiten Kontext einordnen zu können. Die Grenzlage des Zuständigkeitsbereiches der Gestapo Trier prägte maßgeblich die alltägliche Arbeit innerhalb der Behörde. Neben der Grenze zum Saargebiet bis zur Saarabstimmung, die vor allem im Hinblick auf kommunistische Propaganda kontrolliert werden musste, stellen insbesondere die Grenzen zum Großherzogtum Luxemburg bis 1941 und nach Frankreich Charakteristika dar, die sich etwa in den im SHD Vincennes überlieferten Ermittlungsakten zeigen. Ein Großteil der überlieferten Personenakten ist von Abteilung III (Abwehr – Ausland) angelegt worden und befasst sich mit typischen Grenzdelikten von Schmuggel und Devisenvergehen über unerlaubten Grenzübertritt und Überwachung von Ausländern bis hin zur Spionageabwehr. Die Geschichte der Gestapo Trier kann aufgrund der Fülle an vorhandenem Archivmaterial nun umfassend erforscht werden. Nicht nur der Bestand der Personenakten im SHD Vincennes ermöglicht den hier geschilderten übergreifenden Blick auf die staatspolizeiliche Ermittlungs- und Arbeitspraxis im regionalen Kontext. Ergänzt durch erhaltene Häftlingsakten der regionalen Haftanstalten (Hin-
Die Gestapo in der Gesellschaft
|
zert, Wittlich, Flußbach, Trier und Luxemburg), Verfahrensakten der zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichte (Amts- bis Oberlandesgericht) und weitere, die gesellschaftliche und soziale Realität des Nationalsozialismus im Regierungsbezirk Trier darstellende Akten, kann damit nicht nur die Regional- und Landesgeschichte bereichert werden. Die Forschungen zum Nationalsozialismus und speziell zur Gestapo auf überregionaler Ebene können komplettiert oder gar unter neuen Gesichtspunkten angestoßen werden.
61
Matthias Klein
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei Das Abhören ausländischer Sender im Raum Trier
Das Hören ausländischer Sender, besonders des deutschsprachigen Programms von Radio Moskau, stellte für die nationalsozialistische Regierung von Beginn an ein Problem dar.1 Solche Programme gaben der Bevölkerung die Möglichkeit, das Informationsmonopol des Propagandaministeriums zu unterlaufen. Bereits im September 1933 ordnete das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) in Berlin an, Personen, die in Gemeinschaft Radio Moskau hörten, zunächst in „Schutzhaft“ zu nehmen und sie schließlich in ein Konzentrationslager einzuweisen.2 Dieser Erlass wurde 1938 aufgehoben, da das Reichsjustizministerium eigene Regelungen für den Umgang mit Hörern ausländischer Sender erarbeitet hatte : In einer Weisung an die Generalsstaatsanwälte vom 31. März 1936 hieß es, dass das Hören kommunistischer Sender in aller Regel als Hochverrat zu gelten habe, „wenn die Hörer politisch vorbelastet sind und das Abhören unter gewissen Sicherungsmaßnahmen stattfindet.“3 Zweifelsohne könne ein Hochverrat festgestellt werden, „wenn das Abhören gemeinschaftlich mit anderen erfolgt und im Zusammenhang damit eine Unterhaltung stattfindet, die als Werbung für die Russischen Zustände anzusehen ist.“ Eine gewisse Rolle spielte auch die „Absicht […], sich selbst in ihrer hochverräterischen Überzeugung zu erhalten und zu stärken.“ Das Hören ausländischer Sender war demnach für die Justiz nur unter sehr speziellen Bedingungen eine strafbare Handlung, welche sie mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln ahnden konnte. Die Verhandlung über diese Fälle fiel nicht den Sondergerichten, sondern in der Regel dem Volksgerichtshof zu. Dabei entsprach der Volksgerichtshof nur bedingt dem Bild, welches durch dessen späteren Präsidenten Roland Freisler entstanden ist.4 1 Ansgar Diller : Deutschsprachige Rundfunksendungen aus der Sowjetunion. Reaktion in Deutschland (1933–1939), in : Rundfunk und Geschichte 30 (2004), H. 1/2, S. 5–14, hier S. 5. 2 Michael P. Hensle : „Rundfunkverbrechen“ vor NS-Sondergerichten, in : Rundfunk und Geschichte 26 (2000), H. 3/4, S. 111–126, hier S. 112. 3 Schreiben des Reichsministers der Justiz (RMdJ) an die Generalstaatsanwälte vom 31.03.1936, zit. nach : ebd., S. 112 ; die folgenden Zitate : ebd. 4 Klaus Marxen : Einführung, in : Justizministerium Nordrhein-Westfalen (Hg.) : Terror und „Normalität“. Urteile des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs 1934–1945. Eine Dokumentation (Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 13), Düsseldorf 2004, S. 1–8.
64
|
Matthias Klein
Terror und Willkür prägten den Volksgerichthof besonders unter der Präsidentschaft Freislers ab August 1942. In der Phase seit der Gründung dieses Gerichtes 1934 bis in die ersten Jahre des Krieges hinein kann der „Eindruck juristischer Normalität“5 gewonnen werden. Dies wird für Marxen auch daran deutlich, dass fast 10 % der Verfahren mit einem Freispruch endeten.6 Eine differenzierte Betrachtung der NS-Sondergerichte fand nach Bozyakali lange Zeit nicht statt.7 Meist hätten sich frühere Arbeiten „häufig nur auf Berichte oder Aufsätze aus der Zeit zwischen 1933–1945“ gestützt und die daraus gewonnenen Erkenntnisse seien „zumeist anhand einer unrepräsentativen Auswahl weniger besonders ‚spektakulärer‘ Urteile“8 untermauert worden. Bozyakali kommt in seiner Untersuchung des Hanseatischen Sondergerichtes zu dem Ergebnis, dass die Forderung nach „kurzen Prozessen“ und „harten Urteilen“ nicht erfüllt wurde. Das Spektrum habe von Freisprüchen bis zu Todesurteilen gereicht, jedoch konnte der Autor nicht den Eindruck gewinnen, dass es sich bei dem Sondergericht um ein „Standgericht“ gehandelt habe. Ob dieses Ergebnis direkt auf das Trierer Sondergericht übertragen werden kann, muss an dieser Stelle offen bleiben. Für die Zeit 1944/45 werden dessen Urteile jedoch als mild bezeichnet.9 Das Hören ausländischer Sender an sich war für die Justiz bis zum Erlass der Rundfunkverordnung zu Beginn des Zweiten Weltkrieges keine strafbare Handlung.10 Erst mit der „Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen“ vom 1. September 1939 wurden sowohl das bloße Hören ausländischer Sender als auch die Weitergabe entsprechender Informationen aus juristischer Sicht zu strafbaren Handlungen erklärt.11 Als zuständige Gerichte wurden die Sondergerichte bestimmt. Für die Anklage vor einem Sondergericht war gemäß Paragraph 5 der Sondergerichtsverordnung die örtliche Staatsanwaltschaft zuständig.12 Doch bevor diese zu arbeiten beginnen konnte, musste laut Paragraph 5 der Rundfunkverordnung die Gestapo aktiv werden. Danach fand „die Strafverfolgung […] nur auf 5 Ebd., S. 4 6 Ebd., S. 4. 7 Can Bozyakali : Das Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht. Eine Untersuchung der NS-Sondergerichte unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung der Verordnung gegen Volksschädlinge, Frankfurt a.M. u.a. 2005, S. 23. 8 Ebd.; vgl. auch S. 305–312. 9 Justizministerium Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. NS-Sondergerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation (Schriftenreihe des Ministeriums für Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 1), Teil 1–3, Frankfurt a.M. 1994, Teil 1, S. 45. 10 Michael P. Hensle : Rundfunkverbrechen. Das Hören von „Feindsendern“ im Nationalsozialismus, Berlin 2003, S. 22. 11 Reichsgesetzblatt (RGBl.), Teil I, Berlin 1939, Nr. 169, S. 1683. 12 RGBl., Teil I, Berlin 1933, Nr. 24, S. 136.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
Antrag der Staatspolizeistellen statt.“13 Die Justiz hatte keine Möglichkeit, von sich aus ein Verfahren zu eröffnen,14 die Anklagebehörde konnte ein Verfahren lediglich einstellen. Jedoch entzog dieses Vorgehen die Verdächtigen nicht der Verfügungsgewalt der Gestapo, die jederzeit mit eigenen „staatspolizeilichen“ Mitteln gegen diese vorgehen konnte.15 Aus dem Beschriebenen wird deutlich, dass sowohl vor als auch nach dem Erlass der Rundfunkverordnung die Gestapo für die Ermittlungsarbeiten im Falle von Hören kommunistischer/ausländischer Sender zuständig gewesen ist. Das Delikt „Rundfunkverbrechen“ gehörte zu den Straftatbeständen, die „erst das dazugehörige Denunziantentum“ hervorgebracht hatten.16 Daraus erklärt sich auch die Bestimmung, dass eine juristische Verfolgung nur auf Antrag der Gestapo erfolgen sollte. Sie habe als „Filter“ gewirkt, damit die „NS-Verfolgungsbehörden“ „nicht selbst Opfer der […] provozierten Denunziationsflut“17 wurden. Diese Bestimmung hatte jedoch noch weitreichendere Folgen : Der Staatsanwaltschaft, ursprünglich „Herrin des Vorverfahrens“18, wurde das Recht genommen zu entscheiden, gegen wen wegen „Rundfunkverbrechens“ ein Verfahren eingeleitet werden sollte oder nicht.19 Nicht sie, sondern die Gestapo hatte zu entscheiden, ob eine Strafverfolgung „auch wirklich aus Gründen der Abwehr notwendig“ erschien.20 Das Verhältnis zwischen Justiz und SS- bzw. Polizeiorganen in der Zeit des Nationalsozialismus wird häufig als verzweifelter Abwehrkampf der Institutionen der Rechtspflege gegen den Terrorapparat dargestellt. So beispielsweise in Gruchmanns Standardwerk „Justiz im Dritten Reich“.21 Nach Dörner hatte die Gestapo bei „politischen Delikten“ großen Einfluss auf das Verfahren der
13 RGBl. I 1939, S. 1683. 14 Michael P. Hensle : Denunziantentum und Diktatur. Denunziation als Mittel der Machtausübung und Konfliktaustragung im nationalsozialistischen Deutschland, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51 (2003), H. 2, S. 144–161, hier S. 147. 15 Hensle : „Rundfunkverbrechen“ vor NS-Sondergerichten (2000), S. 121. 16 Hensle : Rundfunkverbrechen (2003), S. 199. 17 Ebd. 18 Christiane Oehler : Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933–1945 (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N.F., Bd. 25), Berlin 1997, S. 60. 19 Lothar Gruchmann : Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 28), München 32001 (1988), S. 905. 20 Roland Freisler u.a.: Deutsches Strafrecht, Bd. I : Erläuterungen zu den seit dem 1.9.1939 ergangenen strafrechtlichen und strafverfahrensrechtlichen Vorschriften, Berlin 1941, S. 170. Vgl. auch Gruchmann : Justiz im Dritten Reich, S. 904 f. 21 Gruchmann : Justiz im Dritten Reich, S. 5.
65
66
|
Matthias Klein
Justiz.22 Dank ihrer Ermittlungstätigkeit habe sie die Arbeit der Staatsanwälte und Gerichte „durch erpreßte oder konstruierte Geständnisse in die von ihr gewünschte Richtung“23 lenken können. Zudem habe sie „Ermittlungsvorgänge, in denen es erfahrungsgemäß zu Einstellungen, Freisprüchen oder zu ‚milden‘ Urteilen kam, […] der Justiz häufig erst gar nicht übergeben.“24 Der Gestapo habe es zudem offen gestanden, Fälle an die Justiz abzugeben, um den eigenen Apparat zu entlasten.25 Bedeutet dies, dass die Justizbehörden in ihrer Ahndung von Hörern ausländischer Sender dem folgten, was die Gestapo ihnen vorgab ? Oder konnten Sie eigene Akzente setzen und gar zu ganz eigenen Ergebnissen kommen ? Das Verhalten der Trierer Justizorgane in mehreren Fällen, die das Hören kommunistischer bzw. ausländischer Sender zum Inhalt hatten, zeigt, welcher Spielraum der Justiz trotz der Ermittlungshoheit der Gestapo immer noch zustand.
Die unterschiedliche Bewertung von Zeugenaussagen
Am 31. Juli 1938 wurde der Trierer Otto B. durch einen Nachbarn bei der Gestapo denunziert.26 Ihm wurde vorgeworfen, am Vorabend unter Abdunkelung seiner Wohnung bei verschlossenen Fenstern den „Deutschen Freiheitssender“ gehört zu haben. Über ein nicht ganz dichtes Fenster sei der Schall nach draußen gelangt, so dass ein Nachbar ihn hören konnte. Laut Aussage der Ehefrau des Nachbarn, die am 12. August 1938 zur Sache vernommen wurde, sei dies bereits öfter vorgekommen. B. selbst wurde am 5. September 1938 auf der Staatspolizeistelle in Trier vernommen. Die Anzeige gegen ihn bezeichnete er „als eine glatte Verleumdung“. Er käme aufgrund seiner Arbeit kaum zum Radiohören, was sein damaliges Dienstmädchen, das eine Woche später vernommen wurde, bestätigen könne. Anstatt B., wie er hoffte, zu entlasten, bestätigte die Hausangestellte mit ihrer Aussage die Anschuldigungen der Nachbarn. Den Sender könne sie nicht mehr genau benennen, aber es sei einer der Sender gewesen, „die gegen Deutschland hetzten“. B. habe 22 Bernward Dörner : Gestapo und ‚Heimtücke‘. Zur Praxis der Geheimen Staatspolizei bei der Verfolgung von Verstößen gegen das ‚Heimtücke-Gesetz‘, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 325–342, hier S. 328. 23 Ebd. 24 Ebd. 25 Ebd., S. 330. 26 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 584,002, Nr. 323. Die folgende Darstellung sowie die Zitate beruhen auf dieser Akte.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
zudem öfter versucht, der jungen Frau das Gehörte zu erklären. Auf die Maßregelung seiner Ehefrau, das Hören solcher Sender zu unterlassen, habe B. großspurig reagiert : „[E]r könnte hören was er wollte, es hätte ihm niemand etwas zu verbieten, noch zu befehlen.“ Des Weiteren habe B. versucht, das Dienstmädchen in ihrer Aussage vor der Gestapo zu beeinflussen. Sie habe der Staatspolizei angeben sollen, dass sie öfter den Radioapparat bei der Arbeit eingestellt hätte, ohne auf den Sender zu achten. Auch sollte sie sagen, dass B. an dem fraglichen Abend, auf dem die Anzeige beruhte, nicht zuhause gewesen sei. Ferner stellte die Hausangestellte B. als einen den Nationalsozialismus ablehnenden Menschen dar, der schon öfter versucht habe, sie zu Falschaussagen zu bewegen. Der Beschuldigte wurde daraufhin am 16. September 1938 ein weiteres Mal von der Gestapo vernommen. Er blieb bei seiner Aussage, dass er niemals Radio Moskau oder einen ähnlichen Sender in seiner Wohnung gehört habe. Das Dienstmädchen, welches er in seiner ersten Vernehmung noch als Entlastungszeugin benannt hatte, stellte er nun als „eine ganz verlogene Person“ dar, „deren Angaben kein[…] Glauben zu schenken“ sei. Ihre Vorwürfe bezüglich falscher Aussagen gegenüber der Gestapo wies er ebenfalls von sich. Die Gestapo nutzte in ihrem Abschlussbericht vom 16. September 1938 die Aussagen des Hausmädchens, um B. zu belasten. Da er die junge Frau zu einer Falsch aussage angestiftet habe, sei der Beweis erbracht, „dass die gegen ihn gerichtete[n] Anschuldigungen voll und ganz der Wahrheit entsprechen.“ Die Darstellung der Hausangestellten als „verlogene Person“ durch B. entbehre jeder Grundlage. Zudem sei der Beschuldigte gegen den Staat eingestellt, was der Berichterstatter an der fehlenden Mitgliedschaft in Parteiorganisationen festmachte. Der Bericht ging mit der Akte noch am selben Tag an das Trierer Amtsgericht − „mit der Bitte um Erlass eines Haftbefehls, wegen Abhörens des Moskausenders und Verleitung zum Meineid“. Der Fall „B.“ trägt nach der Ermittlung der Gestapo alle Bedingungen, die nach der Weisung des RMdJ von 1936 als „Vorbereitung zum Hochverrat“ anzusehen wären.27 Das Hören fand unter bestimmten Sicherheitsmaßnahmen statt, der Beschuldigte galt als politisch unzuverlässig und er soll mit anderen über das Gehörte gesprochen haben. Das Amtsgericht nahm sich unverzüglich der Sache an.28 Der Richter war jedoch mit den Ermittlungsergebnissen der Gestapo offensichtlich nicht einverstanden und bestellte am selben Tag die Hausangestellte zur erneuten Vernehmung ein. Sie wurde unter Eid vernommen und gab an, dass B. und dessen Nachbarn sich seit längerem in Streit befänden. Von den anderen Hausbewohnern 27 Hensle : „Rundfunkverbrechen“ vor NS-Sondergerichten (2000), S. 112. 28 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 323.
67
68
|
Matthias Klein
habe sie erfahren, dass ihr Arbeitgeber schlecht über sie spreche. Sie könne keine Angaben darüber machen, welche Radiosender B. hören würde, da sie sich nie in dem Raum aufgehalten habe, in dem das Gerät stand. Zudem sei sie „etwas schwerhörig“. Lediglich nach einem weiteren Streit mit den Nachbarn, in dem ihm der Vorwurf gemacht worden sei, Radio Moskau zu hören, habe B. zu Hause gesagt, er könne jeden Sender hören, den er hören wolle. Aus eigener Anschauung könne sie aber nichts dazu sagen. Den Vorwurf, dass B. sie zur Falschaussage vor der Gestapo angestiftet habe, hielt sie aufrecht. Der vernehmende Amtsgerichtsrat fasste seine Einschätzung in einem handschriftlichen Vermerk zusammen. Die „Glaubwürdigkeit“ der Zeugin könne „nicht als zweifellos angesehen werden“, da sie dem Beschuldigten gegenüber voreingenommen sei. Es könne B. nicht nachgewiesen werden, dass er mit anderen in Gemeinschaft Radio Moskau gehört habe. Es bestehe daher auch kein Grund, eine Untersuchungshaft zu verhängen, so dass B. „mangels hinreichenden Tatverdachts auf freiem Fuss belassen“ wurde. Das Verfahren wurde umgehend an die Trierer Staatsanwaltschaft weitergereicht. Der zuständige Sachbearbeiter erstellte mit Datum vom 29. September 1938 einen umfangreichen Aktenvermerk, in dem er die Sachlage bewertete. Was die Anschuldigung betreffe, staatsfeindliche Sender gehört zu haben, sei B. nicht nachzuweisen, dass er dies getan habe, „um Propaganda für Sowjet-Russland oder die KPD. zu machen“ [sic !]. Das bloße Hören von Radio Moskau war vor dem Erlass der Rundfunkverordnung kein Straftatbestand und führte, wie auch am Beispiel des Sondergerichtes München zu sehen ist,29 nicht automatisch zu einer Verurteilung. Vielmehr wurde es nach Diller erst als „Hochverrat“ angesehen, wenn die gewonnenen Informationen für „kommunistische Propaganda“ genutzt wurden.30 Dies war B. nicht nachzuweisen, weshalb in dem Bericht ohne weitere Konsequenzen davon ausgegangen werden konnte, dass er einen kommunistischen Sender hörte. Das Delikt „grober Unfug“ könne ihm auch nicht vorgeworfen werden, da der Sender in der Wohnung gehört wurde und nicht beabsichtigt gewesen sei, dass das Programm auch außerhalb derselben gehört werden konnte.31 Die Staatsanwaltschaft setzte anscheinend voraus, dass B. einen kommunistischen Sender gehört hatte. Was den Vorwurf anging, dass B. seine ehemalige Hausangestellte zur Falschaussage vor der Gestapo aufgefordert habe, so stellte der Sachbearbeiter fest, 29 Ansgar Diller : Rundfunkpolitik im Dritten Reich, München 1980, S. 298–290. 30 Ebd. Dies widerspricht Hensle, der davon ausgeht, dass schon „bloßes, passives Mitanhören kommunistischer Rundfunksendungen“ als Hochverrat gewertet werden konnte ; vgl. Hensle : Rundfunkverbrechen (2003), S. 24. 31 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 323.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
dass dies nicht unter den Straftatbestand des Meineides falle. Von daher sei das Verfahren einzustellen. B. blieb anscheinend auch vor weiteren staatspolizeilichen Konsequenzen verschont. Schließlich wandte sich dieser am 18. Oktober 1938 an das Reichsjustizministerium und beklagte sich darüber, dass er von der Staatspolizeistelle Trier seinen Rundfunkapparat noch nicht zurückerhalten habe. Ihm sei auf Nachfrage vielmehr mitgeteilt worden, dass „die Sache erst noch geprüft werden müsste.“ Er bat darum, dass er sein Gerät baldmöglichst zurück erhalte. Über die Trierer Staatsanwaltschaft wurde das Schreiben am 27. Oktober 1938 an die Gestapo weitergeleitet. Diese meldete schließlich, dass das Gerät bereits drei Tage zuvor zurückgegeben worden sei.
Die Gestapo als „Hilfsorgan“ der Staatsanwaltschaft?
Diemut Majer stellt in einem Beitrag über das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei in der NS-Zeit fest, dass die Gestapo „ein Weisungs- und Informationsrecht“ der Staatsanwaltschaften „von Anfang an niemals anerkannt“ habe.32 Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Staatsanwaltschaften nicht die Möglichkeit gehabt hätten, die Gestapo für ihre eigenen Ermittlungstätigkeiten einzusetzen, wie der nachfolgende Fall zeigt.33 Im Dezember 1938 sandte die Trierer Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen „Vorbereitung zum Hochverrat“ an den Reichsanwalt beim Volksgerichtshof. Von dem Verfahren waren mehrere Besucher einer Gastwirtschaft betroffen, von denen einer „staatsfeindliche Redensarten geführt“ haben soll. Die Gestapo hatte in diesem Fall bereits ermittelt und die Sache an die Trierer Staatsanwaltschaft weitergegeben. Diese hatte versucht, das Verfahren über die Kölner Staatsanwaltschaft vor das dortige Sondergericht zu bringen, was aber abgelehnt wurde. Daher erfolgte der Gang an den Volksgerichthof. Dieser sandte den Fall umgehend an die Trierer Gestapo „mit dem Ersuchen“ weiter, die Beschuldigten sowie den Inhaber der Wirtschaft zu vernehmen. Damit war die Gestapo erneut beauftragt, in der Sache zu ermitteln. Die Trierer Staatspolizeistelle kam diesem Gesuch innerhalb von weniger als zwei Wochen nach. Es wurden insgesamt vier Personen zu dem Fall verhört und ein ausführlicher Bericht an den Oberreichsan32 Diemut Majer : Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei im Nationalsozialismus, in : Udo Reifner/Bernd-Rüdiger Sonnen (Hg.) : Strafjustiz und Polizei im Dritten Reich (Demokratie und Rechtsstaat), Frankfurt a.M./New York 1984, S. 121–160, hier S. 133. Hervorhebung im Original. 33 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 335. Die folgende Darstellung sowie die Zitate beruhen auf dieser Akte.
69
70
|
Matthias Klein
walt verfasst. Der zuständige Kriminalassistent kam aufgrund seiner Ermittlungen zu dem Schluss, dass der Inhaber des fraglichen Lokals „des öfteren [sic !] in seiner Gastwirtschaft mit seinem dort aufgestellten Radiogerät die Nachrichten des Moskauer u[nd] des Straßburger Sender[s] abgehört hat.“ Da der Wirt bereits 68 Jahre alt sei, habe man „[v]on einer Festnahme und Vorführung […] Abstand genommen.“ Der Rundfunkempfänger „wurde zwecks Unterbindung weiterer strafbaren [sic !] Handlungen vorläufig eingezogen.“ Der Oberreichsanwalt gab den Fall daraufhin wieder an die Trierer Staatsanwaltschaft ab. Die von ihm „veranlaßten weiteren Ermittlungen“ hätten „keinen hinreichenden Verdacht einer zu meiner Zuständigkeit gehörenden Straftat ergeben“. Es lägen keine Hinweise auf Hochverrat vor. Die Trierer Staatsanwaltschaft eröffnete daraufhin ein Verfahren wegen groben Unfugs, stellte es jedoch aufgrund von Verjährung umgehend wieder ein. Der Gastwirt wurde von der Staatsanwaltschaft „eindringlich verwarnt“. Die Gestapo wurde darüber informiert und angewiesen, den beschlagnahmten Radioapparat dem Gastwirt auszuhändigen, „falls nicht eine staatspolizeiliche Beschlagnahme in Frage“ käme. Die Einstellung des Verfahrens wurde von der Gestapo zur Kenntnis genommen. Ob das Radio wieder freigegeben wurde, geht aus der Akte nicht hervor. Der vorliegende Fall zeigt, dass die Gestapo – zumindest von der Reichsanwaltschaft – zu Ermittlungsaufgaben herangezogen werden konnte. Anders als von Hensle suggeriert, nahm sie die ihr durch die Strafprozessordnung zugeteilte Aufgabe als „Hilfsorgan der Staatsanwaltschaft“ durchaus wahr, ohne zwangsläufig „zur tatsächlichen Herrin des Verfahrens“ geworden zu sein.34
Ermittlungseifer mit Kriegsbeginn
Wie bereits erwähnt, wurde die Abhängigkeit der Justizbehörden von der Gestapo durch die Rundfunkverordnung festgeschrieben, was die Bearbeitung von Fällen gegen „Rundfunkverbrecher“ anging. Die erste Möglichkeit der Gestapo zur Einflussnahme auf die Arbeit der Justiz bei Rundfunkfällen bestand in den Ermittlungen selbst und dem Abschlussbericht des zuständigen Gestapobeamten. Im Fall des am 9. September 1939 durch den NSDAP-Ortsgruppenleiter von Trier denunzierten Hilfsarbeiters Wilhelm R. ermittelte die Gestapo sofort am 34 Michael P. Hensle : Nichts hören und nichts reden : Die Verfolgung von „Rundfunkverbrechern“ und „Heimtücke-Rednern“ durch NS-Justiz und Geheime Staatspolizei, in : Sibylle Quack (Hg.) : Dimensionen der Verfolgung. Opfer und Opfergruppen im Nationalsozialismus (Schriftenreihe der Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, Bd. 2), München 2003, S. 81–120, hier S. 91.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
folgenden Tage.35 In der Anschuldigung wurde behauptet, R. habe ausländische Sender gehört und einen Nachbarn zum Mithören aufgefordert. Die in der Anzeige genannten Zeugen und der Beschuldigte selbst wurden durch die Gestapo vernommen. Ein Nachbar gab an, R. habe einen Londoner Sender gehört und von einem dort angekündigten „Fliegerbesuch“ gesprochen. Wilhelm R. war bei seiner Vernehmung geständig, den „Pariser Sender“ gehört zu haben. Er gab auch zu, dass er einen Nachbarn, der daran gezweifelt habe, dass R. mit seinem Radio diesen Sender empfangen könne, aufgefordert habe, sich selbst davon zu überzeugen. Er betonte zugleich, dass dies nicht als Einladung zum Mithören verstanden werden sollte. Die Gestapo verfasste einen achtzeiligen Schlussbericht, in welchem sie dem Beschuldigten vorwarf, „am 9.9.39 die Nachrichten des Pariser Senders abgehört und an die Hausbewohner verbreitet“ zu haben. Politisch wurde er als unbelastet bezeichnet. Am 16. September 1939 wurde R. dem Amtsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen Paragraph 2 der Rundfunkverordnung ausstellte. Damit wurde er aus der Gestapo- in Untersuchungshaft übernommen. Ein Antrag auf Strafverfolgung gemäß Paragraph 5 der Rundfunkverordnung musste von der Staatsanwaltschaft bei der Gestapo eingefordert werden. Ohne diesen hätte die Staatsanwaltschaft nicht aktiv werden können. Die Vorführung vor dem Amtsrichter erfolgte eine Woche nachdem Reinhard Heydrich am 7. September 1939 als Chef des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa) einen Erlass zur Umsetzung der Rundfunkverordnung herausgegeben hatte.36 Darin wurde bestimmt, dass die nachgeordneten Dienststellen nur solche Fälle an die Justiz abgeben sollten, welche „auch für die Allgemeinheit eine abschreckende Wirkung haben und daher zu möglichst exemplarischen Strafen – möglichst nicht zu geringen Strafen und erst recht nicht zu Freisprechungen – führen“37 sollten. Diese Anordnung wurde von den Staatspolizeistellen jedoch nicht durchweg eingehalten, wie Hensle am Beispiel des Freispruchs eines Hörers von Musiksendungen durch das Sondergericht Freiburg zeigt.38 Ähnlich gelagert war der hier beschriebene Fall. Die Trierer Staatsanwaltschaft war anders als die Gestapo der Ansicht, dass die „Mitteilungen, die R. über die Nachrichten der ausländischen Sender gemacht hat […], nicht geeignet“ seien, „die Widerstandskraft des deutschen Volkes zu gefährden.“39 Daher wurde nur ein Verfahren nach Paragraph 1 weiter verfolgt. 35 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 537. Die folgende Darstellung sowie die Zitate beruhen − sofern nicht anders vermerkt − auf dieser Akte. 36 Hensle : Nichts hören, S. 89 f. 37 Erlass Heydrichs vom 7. September 1939, zit. nach : ebd., S. 90. 38 Hensle : Rundfunkverbrechen (2004), S. 241. 39 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 537.
71
72
|
Matthias Klein
Die Staatsanwaltschaft warf R. in der Anklageschrift vor, „fortgesetzt absichtlich ausländische Sender abgehört zu haben“, worin ein „Verbrechen gegen § 1 der Verordnung über ausserordentliche Rundfunkmassnahmen“40 gesehen wurde. Als Beweismittel wurden die von der Gestapo erhobenen Zeugenaussagen und das Geständnis vorgelegt. Die Staatsanwaltschaft ging auch davon aus, dass R. einem der Zeugen angeboten habe, sich selbst davon zu überzeugen, dass er mit seinem Volksempfänger den Pariser Sender hören könne. Eine Beurteilung über R.s politische Einstellung findet in das Schreiben des Trierer Staatsanwaltes keinen Eingang.41 Obwohl Verfahren vor den Sondergerichten vor allem auf eine Erhöhung der Effizienz und eine Verkürzung der Prozessdauer ausgelegt waren,42 kam es im Verfahren zunächst zu Verzögerungen. Ein erster Termin zur Verhandlung des Sondergerichtes am 16. Oktober 1939 musste wegen Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten vertagt werden. Der Angeklagte bat aufgrund der finanziellen Situation seiner Familie − er war der Alleinernährer von vier Personen, wobei sich ein Sohn im Fronteinsatz befand − um die schnelle Festsetzung eines neuen Termins. Die Staatsanwaltschaft erreichte stattdessen nach Rücksprache mit der Gestapo die Aufhebung der Untersuchungshaft durch das Sondergericht zum 31. Oktober 1939. Dieses begründete seine Entscheidung damit, dass „die Gründe, die zum Erlaß des Haftbefehls führten, nicht mehr vorliegen“ würden. Der Haftbefehl war zuvor damit begründet worden, dass R. „fluchtverdächtig“ sei, „da ein Verbrechen den Gegenstand der Untersuchung“ ausmache. Die Justiz sah anscheinend bereits zu diesem Zeitpunkt die Wilhelm R. vorgeworfene Tat als weniger schwerwiegend an als die Gestapo zu Beginn des Verfahrens. Die Staatspolizei in Trier konnte schließlich davon überzeugt werden, dass keine Fluchtgefahr bestand. Ein weiterer Termin des Sondergerichtes wurde für den 15. Dezember 1939 festgesetzt. Neben dem Angeklagten erschienen auch zwei Zeugen, die bereits von der Gestapo vernommen worden waren. In den Prozessakten sind die Ausführungen der Zeugen während der Vernehmung nicht aufgeführt. Jedoch beantragte die Staatsanwaltschaft, einen dritten, auch bereits von der Gestapo vernommen Zeugen vorzuladen. Auch dies scheint zu keinem Ergebnis geführt zu haben, so dass die Staatsanwaltschaft beantragte, die Zeugen unter Eid zu vernehmen. Schließlich beantragte die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von vier Monaten unter Anrechnung der Untersuchungshaft. Das Sondergericht übernahm die Sicht der 40 Ebd. 41 Im Unterschied dazu das Vorgehen der Wiener Staatsanwaltschaft ; vgl. Christian Müllner : Schwarzhörer und Denunzianten. Vergehen nach §§ 1 und 2 der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vor dem Sondergericht Wien, Diss. Universität Wien, Wien 2011, S. 115. 42 Bozyakali : Sondergericht, S. 305.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten entsprechend. Die Gefängnisstrafe musste R. jedoch nie antreten. Seine Gnadengesuche wurden durch die Staatsanwaltschaft, den Vorsteher des Untersuchungsgefängnisses und sogar die Gestapo befürwortet. Die Haftstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem musste er eine Geldbuße von 50 Reichsmark (RM) zahlen.
Medienspektakel „Rundfunkverbrechen“
Im November 1939 wurde der Weinbergarbeiter Theodor H. von seiner Frau bei der örtlichen Gendarmerie denunziert.43 Sowohl sie als auch der gemeinsame Sohn beschuldigten ihn, „fast jeden Abend den Straßburger und den englischen Sender“ zu hören. Der Gendarmerie war H. schon länger bekannt, da bei ihm Abzeichen der KPD gefunden worden waren. Nachdem der Fall an die Trierer Staatspolizeistelle weitergegeben worden war, forderte diese unter anderem politische Beurteilungsschreiben vonseiten der zuständigen NSDAP-Kreisleitung und dem Ortsbürgermeister an. Die politische Einstellung der Beschuldigten hatte in Fällen von „Rundfunkverbrechen“ für die Gestapo eine große Bedeutung. Personen, die als Kommunisten angesehen wurden, mussten nach Hensle in der Regel mit härteren Strafen rechnen als beispielsweise politisch uninteressiert geltende Personen.44 H. wurde sowohl in den Beurteilungsschreiben als auch im Abschlussbericht der Gestapo als ehemaliger Kommunist beschrieben. Ihm wurde vorgeworfen, in seiner Wohnung wiederholt ausländische Sender abgehört zu haben. Warnungen seiner Angehörigen, dass dies verboten sei, habe er „immer mit zynischen Bemerken“ abgewehrt. Gegen H. wurde am 6. Dezember 1939 ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen Paragraph 1 der Rundfunkverordnung ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft verfasste auf Basis der Ermittlungsergebnisse der Gestapo eine Anklageschrift, in der sie jedoch nicht auf die politische Beurteilung des Beschuldigten einging. Anders als für die Gestapo, die besonders in ihrer Frühphase hauptsächlich für die Verfolgung politischer Gegner zuständig gewesen ist, scheint die Trierer Anklagebehörde auf dieses Detail keinen besonderen Wert gelegt zu haben.45 Ansonsten teilte die Staatsanwaltschaft die Ansicht der Gestapo, dass H. gegen Paragraph 1 der Rundfunkverordnung verstoßen habe. 43 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 595. Die folgende Darstellung sowie die Zitate beruhen − sofern nicht anders vermerkt − auf dieser Akte. 44 Hensle : „Rundfunkverbrechen“ vor NS-Sondergerichten (2000), S. 117. 45 Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 4 2017 (2008), S. 106–110.
73
74
|
Matthias Klein
Die Verhandlung gegen den Beschuldigten fand eine Woche nach Eingang der Anklageschrift am 20. Dezember 1939 statt. H. selbst und dessen Sohn wurden zur Sache vernommen, ebenso wie der Kriminalsekretär der Gestapo, der die Ermittlungen geleitet hatte. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Zuchthausstrafe von 15 Monaten unter Anrechnung der Untersuchungshaft sowie die Einbehaltung des Radios. Das Gericht schloss sich diesem Antrag an. Da H. die Hinweise seiner Familienangehörigen, dass das Hören ausländischer Sender ein Verbrechen darstelle, barsch zurückgewiesen habe, sah das Sondergericht einen leichten Verstoß gegen Paragraph 1 der Rundfunkverordnung nicht als gegeben an. Somit sei eine Zuchthausstrafe angemessen. Wie für die Staatsanwaltschaft spielte die politische Vergangenheit des H. für das Sondergericht anscheinend keine Rolle. Das Verfahren gegen H. scheint den von Reinhard Heydrich in Rundfunksachen erhofften Verlauf genommen zu haben. Das Urteil wurde, wie andere Urteile gegen „Rundfunkverbrecher“, in der reichsweiten Presse publik gemacht.46 So wurde z.B. im Westdeutschen Beobachter, in der Kölnischen Volkszeitung, in der Berliner Volkszeitung und im Westfälischen Anzeiger (jeweils in der Ausgabe vom 22. Dezember 1939) und in mindestens 25 weiteren Zeitungen über den Fall berichtet.47 Auch für H. sind mehrere Gnadengesuche überliefert. Er selbst bat im Oktober 1940 darum, ihm die Reststrafe zu erlassen. Der Leiter des Gefängnisses sprach sich jedoch dagegen aus, da H. „wenig Reue“ zeige und „seine verwerfliche Tat auch heute noch nicht einsehen“ könne. Auch hier wurde kein Bezug auf seine politische Vergangenheit hergestellt. In zwei Schreiben bat die Ehefrau um Freigabe des eingezogenen Radiogerätes. Der um Stellungnahme gebetene Vorsitzende der Trierer Großen Strafkammer sprach sich dagegen aus, der Bitte nachzukommen. Der Familie sei „das Schicksal des Angeklagten […] gleichgültig“ und sie würden nur „an ihre eigenen Interessen“ denken.
Unabkömmlich in einer evakuierten Stadt
Im November 1944 wurde der Trierer Installateur Matthias S. durch einen V-Mann angezeigt.48 Ihm wurde neben dem Abhören ausländischer Sender vorgeworfen, gegenüber seinem als Zeugen genannten Schwager Inhalte der gehörten Radio46 Karl-Heinz Reuband : „Schwarzhören“ im Dritten Reich, in : Archiv für Sozialgeschichte 41 (2001), S. 245–270, hier S. 255. 47 Die Artikel befinden sich in der Akte ; vgl. LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 595. 48 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 916. Die folgende Darstellung sowie die Zitate beruhen − sofern nicht anders vermerkt − auf dieser Akte.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
sendungen weitergegeben zu haben. Er habe sich dahingehend geäußert, dass die alliierten Truppen immer näher kämen und die Zwangsarbeiter einen Aufstand beginnen müssten. Des Weiteren sei der Schwager, ein Wehrmachtsangehöriger, von S. aufgefordert worden, nicht mehr zur Truppe zurückzukehren. Die Gestapo versuchte, den Schwager zu vernehmen, konnte ihn aber wegen dessen Versetzung zu einem anderen Truppenteil nicht ausfindig machen. Stattdessen wurde Matthias S. am 14. November 1944 von der Gestapo vorgeladen und verhört. Er gab zu, mehrfach den deutschen Dienst der BBC gehört zu haben. Bis auf wenige Unterhaltungen mit seinem Vater habe er sich nicht über das Gehörte geäußert. Den Vorwurf, den eigenen Schwager zur Fahnenflucht aufgefordert zu haben, wies er von sich, besonders, da die beiden in keinem guten Verhältnis zueinander ständen. Am selben Tag wurde auch der Vater des Beschuldigten von der Gestapo vorgeladen und vernommen. Dieser bestätigte, dass sein Sohn mit ihm einmal über den Inhalt ausländischer Rundfunksendungen gesprochen habe. Er habe ihn daraufhin gebeten, dies in Zukunft zu unterlassen, was auch geschah. Das schlechte Verhältnis zwischen seinem Sohn und dessen Schwager bestätigte er. Am 14. November 1944 setzte die Gestapo den Bericht über die Ermittlungsergebnisse auf. Es wurden die Aussagen des Beschuldigten und des Zeugen zusammengefasst und vermerkt, dass S. nach seiner Vernehmung festgenommen worden sei. Ferner wurde beim Amtsgericht ein Haftbefehl beantragt sowie Strafantrag nach Paragraph 5 der Rundfunkverordnung gestellt. Für den Fall, dass kein Haftbefehl erlassen werde, beantragte die Gestapo „Rücküberstellung des Beschuldigten“. Die Rücküberstellung war eines der Mittel, Entscheidungen der Justiz zu korrigieren, wenn diese nicht den Vorstellungen der Gestapo entsprachen.49 Für Hensle stellte der Antrag auf Rückführung im Rahmen eines Antrages auf einen Haftbefehl eine Möglichkeit der Gestapo dar, die Justiz auf die Dringlichkeit des Verfahrens hinzuweisen.50 Der Haftbefehl wurde am 15. November 1944 wegen „Verbrechen gegen §§ 1 und 2 der Verordnung über ausserordentliche Rundfunkmassnahmen“ erlassen. Die Ermittlungen der Gestapo im Verfahren gegen S. scheinen der Anklagebehörde nicht umfangreich genug gewesen zu sein. Es gelang ihr, dessen Schwager ausfindig zu machen und am 21. November 1944 zur Sache zu befragen. Dieser bestätigte, dass das Verhältnis zwischen den beiden größtenteils aus Nichtbeachtung bestand. In „den vergangenen 13 Jahren“ hätten die beiden „kaum 10 Worte“ gewechselt. Dementsprechend seien dem Schwager gegenüber auch keine staats49 Dörner : Gestapo, S. 339. 50 Hensle : Rundfunkverbrechen (2004), S. 209 f.
75
76
|
Matthias Klein
feindlichen Äußerungen gemacht worden. Vom Hören ausländischer Sender durch Matthias S. wisse er nichts. Es würde ihn vielmehr überraschen, da dieser der SS angehört habe und nur wegen „Arbeitsüberlastung“ und gesundheitlicher Probleme die damit einhergehenden Pflichten nicht erfüllen konnte. Im vorliegenden Fall zeigt sich eine weitere Besonderheit : Am 16. November 1944, also ein Tag nachdem der Haftbefehl erlassen worden war, meldete sich der Städtische Baurat von Trier beim zuständigen Amtsgericht. S. sei der „allerletzte Installationsmeister“ in der Stadt und werde daher dringend benötigt, die Kriegsschäden in der Stadt zu beseitigen.51 Da S. ein zuverlässiger Handwerker sei und es „im öffentlichen Interesse“ liege, dass dieser seiner Arbeit nachginge, wurde darum gebeten, von einer Untersuchungshaft abzusehen. Aufgrund der Zeugenaussage des Schwagers und der Bitte der Stadt Trier sorgte der Oberstaatsanwalt dafür, dass S. am 24. November 1944 aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Ihm wurde zur Auflage gemacht, dass er sich sofort zur Arbeitsaufnahme bei der Stadt melden und täglich bei der Polizei vorsprechen sollte. Ähnliches konnte Müllner auch für die Sonderjustiz in Wien feststellen. Dort konnten besonders Arbeiter aus kriegswichtigen Betrieben darauf hoffen, dass ihrem Gnadengesuch stattgegeben wurde.52 Hinzu kommt, dass sich die Staatsanwaltschaft offensichtlich auch über den Antrag der Gestapo auf Rücküberstellung hinwegsetzte. Die Staatsanwaltschaft beabsichtigte laut Mitteilung an den zuständigen Generalstaatsanwalt vom 22. November 1944, eine „Zuchthausstrafe von einem Jahre und 3 Jahre Ehrverlust zu beantragen.“ Sie sah es als erwiesen an, dass S. gegen Paragraph 1 und zudem durch seine Unterhaltungen mit seinem Vater und seiner Frau gegen Paragraph 2 der Rundfunkverordnung verstoßen hatte. Die geforderte Strafe war im Vergleich zu den Vorgaben des zuständigen Ministeriums eher gering : Freisler hatte 1940 in seiner Eigenschaft als Staatssekretär im Reichsministerium der Justiz die Gerichte angewiesen, sich für die Strafzumessung bei Verurteilungen 51 Seit August 1944 war die Stadt Trier Bombenangriffen und Artilleriebeschuss der stetig näher rückenden amerikanischen Armee ausgesetzt. Am 25. Oktober 1944 begann schließlich die Evakuierung der Bevölkerung in den Gau Thüringen mittels Sonderzügen. Bis zum 21. November 1944 verließen neun solcher Züge den Bahnhof, so dass im Januar 1945 nur noch etwa 2.000 Menschen in Trier lebten. Unter ihnen befanden sich neben Parteivertretern sowie Angehörigen der Feuerwehr und der Technischen Nothilfe (TN) auch einige Geistliche, Post- und Bahnbeamte sowie Vertreter wichtiger handwerklicher Berufe, die von den in der Stadt verbliebenen Bauamtsangestellten angefordert worden waren ; vgl. Reinhard Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus (1925–1945), in : Kurt Düwell/Franz Irsigler (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 517–589, hier S. 584–589 ; Emil Zenz : Trier in Rauch und Trümmern. Das Kriegsgeschehen in der Stadt, in Ehrang, Pfalzel, Konz in den Jahren 1943–1945, Trier 1983. 52 Müllner : Schwarzhörer, S. 357.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
wegen der Rundfunkverordnung eher an der Höchststrafe zu orientieren.53 Einem Referat des Oberlandesgerichtsrates Schroeter vom 24. Oktober 1939 zufolge lag der Rahmen für Zuchthausstrafen zwischen einem und 15 Jahren.54 Dem zuständigen Generalstaatsanwalt scheint die angestrebte Strafe nicht hoch genug gewesen zu sein. Dieser forderte mit Schreiben vom 30. Dezember 1944 (welches erst am 6. Februar 1945 in Trier ankam und somit keinen Einfluss mehr auf das Urteil des Sondergerichts haben konnte) eine Strafe von mindestens zwei Jahren Zuchthaus. Die Verhandlung gegen S. fand am 13. Dezember 1944, drei Wochen nach der Erstellung der Anklageschrift, statt. Außer dem Angeklagten selbst wurden keine weiteren Personen vernommen. Die Staatsanwaltschaft beantragte schließlich eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten und die Einbehaltung des Radios. Das Sondergericht schloss sich diesem Strafmaß an und verurteilte S. entsprechend. Auch hier lässt sich feststellen, dass sich die Justiz nicht an dem orientierte, was Heydrich in seinem Erlass vom 7. September 1939 den Staatspolizeistellen vorschrieb. Laut Gruchmann erhielt das Reichsministerium für Justiz im August 1943 Kenntnis von diesem Erlass.55 Auch die entsprechende Äußerung Freislers blieb unbeachtet. Stein unterstreicht, dass mit diesem Urteil „der letzte noch in Trier tätige Installateur […] aus seiner normalen Tätigkeit entfernt“ wurde.56 An diesem Beispiel macht er fest, dass die Urteile aufgrund der Rundfunkverordnung „gerade den aktiven Teil der Zivilbevölkerung, den man für die Kriegswirtschaft gerade dringend brauchte“57, getroffen hätten. Die Strafe selbst wurde von S. jedoch nicht angetreten. Am 30. Januar 1945 vermerkte die Staatsanwaltschaft in der Akte, dass S. sich innerhalb einer Woche im Gefängnis einzufinden habe, da ansonsten ein weiterer Haftbefehl ausgesprochen werde. Am 20. August 1945 wurde vermerkt, dass die
53 Gruchmann : Justiz im Dritten Reich, S. 905, Anm. 19. 54 Schroeter [Vorname unbekannt] : Die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1.9.1939 (RGBl. I, S. 1683), in : Die Arbeit der Sondergerichte in der Kriegszeit. Abgekürzter Bericht über die Tagung der Sondergerichtsvorsitzenden und Sachbearbeiter für Sondergerichtsstrafsachen bei den Generalsstaatsanwälten im Reichsjustizministerium am 24. Oktober 1939, Berlin 1939, S. 35–41, hier S. 38. 55 Gruchmann : Justiz im Dritten Reich, S. 905, Anm. 18. 56 Wolfgang Hans Stein : Staatsanwaltschaft und Landgericht Trier im Dritten Reich, in : Justizministerium Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 1 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 3), Frankfurt a.M. u.a. 1995, S. 501–620, hier S. 598. 57 Wolfgang Hans Stein : Die Rechtsprechung der Sondergerichte im Zweiten Weltkrieg. Das Sondergericht Koblenz und die anderen Sondergerichte auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz, in : Franz Josef Düwell/Thomas Vormbaum (Hg.) : Schwerpunktthema. Recht und Nationalsozialismus (Themen juristischer Zeitgeschichte, Bd. 1), Baden-Baden 1998, S. 76–92, hier S. 81.
77
78
|
Matthias Klein
Rundfunkverordnung nicht mehr gültig sei und demnach auch kein Haftbefehl ausgestellt werden könne. Die Akte wurde geschlossen. Gerade der Fall gegen S. zeigt, mit Verweis auf einen „Heimtücke-Fall“ aus der Pfalz im Jahre 1937, welche Spielräume die Justiz gegenüber der Gestapo in Haftfragen haben konnte. Scharf stellt in einem Aufsatz den Fall des 62-jährigen Kaufmanns Sigmund R. vor.58 Dieser war wegen eines Vergehens gegen das Heimtückegesetz am 8. September 1937 zu acht Monaten Gefängnis verurteilt worden, wobei ihm zwei Monate Untersuchungshaft angerechnet worden sind. Da R. Jude gewesen sei, habe die Staatspolizeistelle Neustadt an der Weinstraße im Februar 1938 beschlossen, ihn nach Beendigung der Haftstrafe in das Konzentrationslager Dachau einzuweisen. Die Haft sei jedoch aufgrund des gesundheitlichen Zustandes des R. durch die Justiz bereits unterbrochen worden, „doch blieb dieser Versuch, Reste justizieller Autonomie zu bewahren, für den Häftling ohne Belang : R. verstarb nur wenige Wochen später, am 13. Mai 1938 an den Haftfolgen.“59 Dieses Beispiel zeigt, dass die Justiz auch in „Heimtücke-Fällen“ in Haftfragen eine gewisse Eigenständigkeit gegenüber der Geheimen Staatspolizei behaupten konnte. Hätte die Gestapo nicht die Überführung in ein Konzentrationslager angeordnet, hätte sie wohl nie etwas über die Aussetzung der Haftstrafe erfahren, wie es in einem anderen Fall gegen einen katholischen Pfarrer aus Klingenmünster, den Scharf anspricht, geschehen ist.60 Auch Hensle findet Beispiele dafür, in denen die Justizbehörden den Weisungen der Gestapo nicht nachgekommen sind.61
Fazit
Laut Majer hatte die Staatsanwaltschaft keinen Einfluss auf die Ermittlungstätigkeit der Gestapo und musste sich, auch aufgrund des Fehlens eigener Ermittlungsorgane, mit den Fällen zufrieden geben, welche ihr von der Politischen Polizei vorgelegt wurden.62 Daraus lässt sich jedoch nicht schließen, dass die Staatsanwaltschaften keinerlei Möglichkeiten hatten, die Ergebnisse der Gestapo zu überprüfen oder weitere Ermittlungen anzustoßen, wie die vorgelegten Beispiele gezeigt haben. Sie konnten die Ergebnisse der Gestapo durchaus in Frage stellen und eigene 58 Eginhard Scharf : NS-Justiz und Politische Polizei am Beispiel der Pfalz, in: Meyer, Hans-Georg/ Berkessel, Hans (Hg.): „Eine nationalsozialistische Revolution ist eine gründliche Angelegenheit“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 1), Mainz 2000, S. 357–368, hier S. 362. 59 Ebd. 60 Ebd., S. 364. 61 Hensle : Nichts hören, S. 98. 62 Majer : Verhältnis, S. 136.
Arbeitsteilung zwischen Justiz und Sicherheitspolizei
|
Ermittlungen durchführen, diese sogar von der Gestapo ausführen lassen. Damit blieb die Rolle der Polizei (auch der Gestapo) als Ermittlungsinstanz der Anklagebehörden erhalten. Voraussetzung dafür war natürlich, dass die Gestapo ihr auch entsprechende Fälle zuleitete und diese nicht mit den ihr eigenen staatspolizeilichen Mitteln löste. Die Staatsanwaltschaft war bei der Umsetzung der Rundfunkverordnung keinesfalls zu einem Hilfsorgan der Gestapo geworden. Die Justiz im Allgemeinen lässt sich daher auch nicht pauschal als verlängerter Arm des Gestapo-Apparates auffassen. Die nachgeordneten Stellen vor Ort erfüllten, wie gezeigt, auch nicht zuverlässig die Anordnungen der Ministerialebene nach harten Urteilen. Teile der Justiz waren eben nicht „willens, den Vorgaben des Regimes nach der erwarteten Urteilshärte zu entsprechen.“ 63 Die vorgelegten Beispiele dürfen aber keinesfalls dazu verleiten, die Rolle der Justiz im Nationalsozialismus zu verharmlosen. Vielmehr soll verdeutlicht werden, dass das Nebeneinander von „Terror und Normalität“, wie für den Volksgerichtshof aufgezeigt wurde,64 auch auf den unteren Ebenen von Justiz und Polizei verortet werden kann. Und auch wenn bei den Ermittlungen der Gestapo aus Rücksichtnahme auf das Alter eines Beschuldigten auf eine Schutzhaft verzichtet wurde, darf die Rolle dieser Institution bei der Verfolgung politischer Gegner oder der Umsetzung der rassistischen Politik des Regimes nicht vergessen werden. Das Bild von Justiz und Polizei im Nationalsozialismus muss jedoch auf eine Weise weiterentwickelt werden, wie es in der NS-Täterforschung gerade geschieht : Dämonisierung und Viktimisierung müssen einem differenzierten Bild weichen.65
63 Hensle : Nichts hören, S. 92. 64 Marxen : Einführung, S. 6 f. 65 Thomas Kühne : Dämonisierung, Viktimisierung, Diversifizierung. Bilder von nationalsozialistischen Gewalttätern in Gesellschaft und Forschung seit 1945, in : Oliver von Wrochem (Hg.) : Nationalsozialistische Täterschaften. Neue Forschungen und aktuelle Diskussionen zur familiären, kulturellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung nach 1945 (Neuengammer Kolloquien, Bd. 6), Berlin 2016, S. 32–55.
79
Sebastian Heuft
Die Gestapo als Zensurbehörde Das Trierer Paulinusblatt in der NS-Zeit
„Schützt und erhaltet eure katholischen Zeitungen, die Tagespresse wie auch die Sonntagsblätter ! In jedes katholische Haus gehört auch eine katholische Zeitung.“1 Diese Aufforderung stammt aus einem Hirtenwort vom 27. Juli 1933 von Franz Rudolf Bornewasser, dem damaligen Bischof von Trier. Sie veranschaulicht zum einen die Bedeutung, die laut dem Bischof den katholischen Printmedien in dieser Zeit zukam, zum anderen deutet sie auch auf die Probleme der Zeitungen hin. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Januar 1933 war deren oberstes Ziel die Ausschaltung der politischen Gegner, vor allem der politisch linken Organisationen und Parteien, aber auch der beiden christlichen Kirchen.2 Dazu verboten oder kontrollierten sie − rechtlich durch die sogenannte Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar 1933 legitimiert − auch die jeweiligen Publikationsorgane. Während der gesamten Zeit des Nationalsozialismus bestand daher ein dauerhaftes Spannungsverhältnis zwischen der konfessionellen Presse und den Kontrollinstanzen der Nationalsozialisten, allen voran der Geheimen Staatspolizei. Dieser Beitrag widmet sich genau diesem Konfliktbereich in der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat und veranschaulicht diesen anhand der Situation des Paulinusblattes in Konfrontation mit der örtlichen Gestapo-Dienststelle in der Christophstraße 1. Dabei werden die Presselenkungsmethoden der Trierer Geheimen Staatspolizei als Kontroll- und Sanktionsorgan gegenüber dem Bistumsblatt besondere Beachtung finden.
1 Hirtenwort über die katholische Presse vom 27. Juli 1933, in : Fels im Sturm. Predigten und Hirtenworte des Erzbischofs Franz Rudolf Bornewasser, hg. von Albert Heintz, Trier 1969, S. 38. Eine erste Fassung dieses Aufsatzes ist unter dem Titel „Die Trierer Gestapo als Presselenkungsorgan der Nationalsozialisten“ erschienen ; vgl. Neues Trierisches Jahrbuch 53 (2013), S. 69–82. 2 Vgl. Kurt Bauer : Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfange, Aufstieg und Fall, Wien 2008, S. 197– 214.
82
|
Sebastian Heuft
Der Paulinus als Bistumsblatt
Das Paulinusblatt ist eine seit 1875 wöchentlich in Trier erscheinende katholische Zeitschrift. Die Gründung des Blattes fällt somit in die Periode des sogenannten Kulturkampfes, einer Zeit der Auseinandersetzungen zwischen dem Deutschen Reich und der katholischen Kirche. Der Priester und Zentrumspolitiker Georg Friedrich Dasbach rief damals den Paulinus ins Leben, um damit den katholischen Glauben in Trier vor den liberalen Strömungen des Kulturkampfes zu verteidigen. Demnach diente der Paulinus von Beginn an einem politischen Ziel. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg verlor die katholische Zeitschrift jedoch an Bedeutung und die Auflagenzahlen gingen zurück. Erst nach 1933 konnte der Paulinus als einzige Trierer Wochenzeitung seine politische Bedeutung wieder erlangen. Seit der 39. Ausgabe im Jahre 1934 trägt die Wochenzeitung den Untertitel „Trierer Bistumsblatt“, zuvor lautete er „Für das deutsche Volk“. Diese Umbenennung verdeutlicht eine der entscheidendsten Veränderungen in der langen Geschichte des Blattes. Bisher wurde das Paulinusblatt von der Paulinus-Druckerei herausgegeben, ab 1934 war es ein offizielles Bistumsblatt unter der Schirmherrschaft des Bischofs. Dieser Schritt war aus Sicht der Verantwortlichen nötig geworden, genoss die Zeitung doch durch diese Umbenennung nun gewisse rechtliche Privi1egien in der ansonsten von den Nationalsozialisten stark zensierten und kontrollierten Presselandschaft. So mussten sich zum Beispiel nach damaliger Rechtslage die Redakteure eines Bistumsblattes nicht dem Schriftleitergesetz von 1933 beugen. Im Paragraphen 5 dieses Gesetzes wurde für den Schriftleiter eine „fachmännische“3 Ausbildung vorausgesetzt. Viele der katholischen Zeitungen wurden jedoch von Klerikern geführt, die nicht über die Eignung als ausgebildeter Schriftleiter verfügten. Des Weiteren erfasste das Schriftleitergesetz alle Journalisten auf einer Liste. Sollte man − nach Meinung der Nationalsozialisten − die Eigenschaften für die Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Bevölkerung nicht besitzen, weil man im weltanschaulichen Widerspruch zur nationalsozialistischen Ideologie stand oder „nicht-arischer“ Abstammung war, wurde man von dieser Liste gestrichen und durfte nicht mehr journalistisch tätig sein. Um diese Kontrolle und Einschränkung zu umgehen, wurden viele katholische Zeitungen im Zuge der Einführung dieser Regelungen zu Bistumsblättern erklärt, so auch das Paulinusblatt. Zwar wurden ab 1936 auch diese vermeintlichen Begünstigungen der Kirchenpresse schrittweise abgebaut, dennoch blieb der Paulinus in kirchlicher Trägerschaft. Bis zu ihrem Verbot 1938 konnte die Wochenzeitung ihre Auflagenzahl von ca. 30.000 im Jahre 1933 auf 120.000 Exemplare vervierfachen. Es gilt jedoch zu 3 Reichsgesetzblatt (RGBl.), Teil I, Berlin 1933, Nr. 111, 7.10.1933, S. 713.
1936 1937 1938
101541 116227 120592 Die Gestapo als Zensurbehörde | 83 Ziehen Sie zum Ändern der Größe des Diagrammdatenbereichs die untere rechte Ecke des
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1933
1934
1935
1936
1937
1938
Abb. 1: Auflagenzahlen des Paulinus zwischen 1933 und 1938, Grafik auf Grundlage der aus den Ausgaben entnommenen Auflagenzahlen des jeweils letzten Quartals eines Jahres. (Quelle: Verfasser).
beachten, dass trotz dieses beachtlichen Wachstums die Auflagenzahlen nur wenig über die Qualität einer Zeitung aussagen. Denn diese Steigerung ist wohl der Ernennung zum offiziellen Trierer Bistumsblatt und vor allem der Wiederangliederung des Saarlandes an das Deutsche Reich im Januar 1935 geschuldet. Seit dem Abschluss des Versailler Vertrages 1919 stand das Saargebiet unter dem Mandat des Völkerbundes und hatte eine französische Verwaltung. Dieser Umstand war auch für den Trierer Bischof von Bedeutung, denn der größte Teil des Saargebietes gehörte zum Bistum Trier. Über die Rückgliederung wurde im Januar 1935 abgestimmt. Dieses politische Ereignis wirkte sich deutlich auf die Auflagenzahl des Paulinusblattes aus und erklärt den immensen Anstieg der Leser zwischen 1934 und 1935 um mehr als 100 Prozent.
Die Bistumspresse − ein Dorn im Auge der Nationalsozialisten
Die überlieferten Auseinandersetzungen zwischen Gestapo und Paulinus-Redaktion zeigen, dass das Blatt als Pressorgan der Kirche den Nationalsozialisten im Gau Moselland ein Dorn im Auge gewesen sein muss − besonders bei den rasant gestiegenen Leserzahlen. Dies belegen Aussagen des Gauleiters Gustav Simon. In einem Sitzungsprotokoll des Kreisvereins Koblenz im Reichsverband der Deutschen Presse vom 1. Dezember 1934 heißt es, dass „das herrlich redigierte Paulinusblatt […] alle andern Blätter an Verhetzung“ überbiete. Der Gauleiter wird
84
|
Sebastian Heuft
daraufhin in dem Protokoll mit den Worten zitiert : „es werde bald gehandelt werden […], man brenne darauf, sie [die katholische Presse, A.d.V.] mit der ganzen Brutalität der alten Kämpfer auszurotten.“4 Die Absichten der Nationalsozialisten gegenüber dem Paulinusblatt waren also schon früh zu erkennen. In der Zeit von 1935 bis 1938 kam es zu 16 Beanstandungen der Wochenzeitung durch die Gestapo Trier und zu fünf weiteren durch die Reichspressekammer. Dreimal wurde eine Ausgabe von der Staatspolizeistelle gänzlich verboten, bis schließlich am 30. Juli 1938 das Bistumsblatt sein Erscheinen komplett einstellen musste. Zu einer Neuauflage der Wochenzeitung kam es erst wieder nach dem Krieg. Die Häufung an Beschlagnahmungen und Verboten in manchen Monaten lassen zudem die Vermutung eines geplanten Vorgehens zu. Es können wenigstens zwei Beschlagnahmungswellen der Gestapo festgestellt werden : Die erste Welle fand im Frühjahr 1935 nach der Saarabstimmung statt. Die zweite − in ihren Ausmaßen deutlich größer − stand im direkten zeitlichen Zusammenhang mit den Olympischen Sommerspielen in Berlin im August 1936.
Das Ende des „Burgfriedens“
Die erste quellenmäßig dokumentierte Aktion gegen das Paulinusblatt in der Zeit des Nationalsozialismus fand drei Monate nach der Saarabstimmung im Januar 1935 statt. Dies ist insofern erwähnenswert, weil es gegen die katholischen Tageszeitungen in Trier, also den Trierischen Volksfreund und die Trierische Landeszeitung, bereits einige Zeit früher, nämlich seit 1933, immer wieder zu Aktionen gekommen war.5 Ganz zu schweigen von der linken Tageszeitung Volkswacht, welche bereits im Zuge der Reichstagsbrandverordnung vom Februar 1933 gänzlich verboten wurde.6 Dass man sich aus nationalsozialistischer Sicht erst 1935 in Trier der Kirchenpresse „annahm“, mag unter anderem an der innenpolitischen und vor allem gesellschaftlichen Bedeutung der katholischen Kirche im Rheinland gelegen haben. Ein zu deutliches Vorgehen in der Konsolidierungsphase des NS-Regimes wäre für die Nationalsozialisten ein zu hohes Risiko gewesen. Es kann daher festgestellt werden, dass man von nationalsozialistischer Seite zunächst bemüht war, 4 Bistumsarchiv (BA) Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 79, Protokoll der Versammlung des Kreisvereins der Presse Koblenz vom 1.12.1934. 5 Marc Profanter : Die nationalsozialistische Machtergreifung im Spiegel der Trierer Tagespresse. Ein Beitrag zur Geschichte der Trierer Zeitungen (März 1930 bis Oktober 1933), Magisterarbeit Universität Trier 2000. So wurde das Erscheinen des Trierischen Volksfreunds z.B. im Juni 1933 zunächst für drei, dann für zehn Tage verboten ; vgl. ebd., S. 88–93. 6 Ebd., S. 80–84.
Die Gestapo als Zensurbehörde
|
eventuelle Spannungen zwischen Kirche und Staat in Trier mit Blick auf die Saarfrage zu vermeiden. Ein Beleg für diesen „Burgfrieden“ zwischen Staat und Kirche in Trier im Vorfeld der Saarfrage liefert unter anderem ein Lagebericht der Trierer Staatspolizeistelle für September 1934. Darin heißt es : Die nach aussen [sic !] hin eingetretene Entspannung in der Lage zwischen Kirche und Staat kommt unbedingt der bevorstehenden Saarabstimmung zugute und muss schon deshalb erhalten bleiben.7
Im April 1935 endete dieser „Burgfrieden“ plötzlich. Der Beschlagnahmungsverfügung vom 27. des Monats ist zu entnehmen, dass am Vortag aufgrund einer mündlichen Anordnung des Gestapoleiters, Dr. Gerhard Güttler, die Ausgabe Nr. 17 des Paulinus beschlagnahmt worden war.8 Beschlagnahmung bedeutet in diesen Fällen, dass die Ausgabe nicht durch die Vorzensur gekommen war und ein Druck bis auf weiteres untersagt wurde. In der erst auf den Folgetag datierten schriftlichen Verfügung heißt es weiter, dass der Artikel ,,Aus dem katholischen Leben der Reichshauptstadt“ ausschlaggebend für die Beschlagnahmung gewesen sei. Dieser würde „die von Staat und Bewegung angeordneten Werbeveranstaltungen, Aufmärsche usw. verächtlich machen“9. Da diese Verächtlichmachung gegen die „Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes“ verstoße, sei die Ausgabe eingezogen worden. In einem Brief an das bischöfliche Generalvikariat vom 3. Mai 1935 weist der Redakteur Dr. Alois Funk darauf hin, dass diese Erklärung nur unzureichend begründet war. Entsprechend bittet er den Prälaten Tilmann, eine Rechtfertigung von der Gestapo Trier und dem Innenministerium zu verlangen.10 Es sollte sich in den folgenden Jahren zeigen, dass es nur selten eine genaue Begründung für eine Beschlagnahmung geben würde. Neben dieser Forderung gibt der Brief jedoch zusätzlich Einblick in das Verhältnis zwischen Bistum und Bistumsblatt, denn der Redakteur des Paulinus bemängelte das zögerliche Handeln der Bistumsleitung im Zuge der Beschlagnahmung. Weiterhin 7 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1934, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Landeskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, Bd. 1 : 1934, Düsseldorf 2012, S. 445–459, hier S. 449. 8 BA Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 104, Beschlagnahmungsverfügung der Staatspolizeistelle Trier vom 27.4.1935. 9 Ebd. 10 Ebd., Bl. 87, Brief des Schriftleiters Dr. Alois Funk an das bischöfliche Generalvikariat Trier vom 3.5.1935.
85
86
|
Sebastian Heuft
weigerte er sich, einen Protestbrief in seinem Namen an die staatlichen Stellen zu verfassen, da er darin eine „Minderbewertung des Bistumsblattes“11 sah, weil sich das Bistum nicht selbst hinter den Protest stellte. Wenngleich dieser Brief auf Grundlage einer mündlichen Unterredung zwischen Alois Funk und dem damaligen Prälaten Tilmann verfasst worden ist und zudem hier nur die Sichtweise des Redakteurs zum Tragen kommt, so scheint dennoch der Schluss nahezuliegen, dass die Bistumsleitung einem direkten Konflikt mit dem Staat zunächst aus dem Weg gehen wollte. Den Forderungen des Redakteurs war man jedenfalls nachgekommen und hatte noch am gleichen Tag an die Trierer Gestapo eine Nachricht geschickt, in der man Aufklärung über die Beschlagnahmung der Ausgabe 17 verlangte.12 Zugleich wird in dieser Nachricht angedeutet, dass man Beschwerde gegen das Vorgehen der Gestapo beim Innenministerium auf Grundlage des Reichskonkordates einlegen werde. Dieses Beschwerdeschreiben wurde am 21. Mai 1935 nach Berlin verschickt. Mittlerweile waren nämlich auch die Ausgaben 18 und 20 beschlagnahmt worden.13 Dieses Schreiben ist aus folgendem Grund interessant : So wird darin deutlich, dass nicht alle Artikel der Paulinus-Ausgaben in Eigenredaktion erstellt wurden. Stattdessen gab es einen Austausch zwischen den Bistumsblättern im Reich. Denn der als Grund für die Beschlagnahmung der Ausgabe 17 angegebene Artikel ,,Aus dem katholischen Leben der Reichshauptstadt“ war wörtlich aus dem Berliner Bistumsblatt entnommen worden. Da das Berliner Blatt jedoch nicht beschlagnahmt wurde, scheinen die Maßstäbe der Beschlagnahmung bei den einzelnen Staatspolizeistellen nicht einheitlich gewesen zu sein. Deutlich werden an diesem Beispiel zweierlei Dinge : Die Gestapo nutzte erstens die Vorzensur. Jede Ausgabe musste demnach zunächst der Gestapo vorgelegt werden, bevor sie in Druck gehen konnte. Dieses Vorgehen war, wie sich in einem später verfassten Brief herausstellte, jedoch schon seit längerem Routine, zu ersten Konflikten im Zuge der Vorzensur kam es aber erst 1935. Zweitens lässt sich anhand der Härte des Vorgehens, drei Monate nach Klärung der Saarfrage, ein deutlicher Kurswechsel in der nationalsozialistischen Kirchenpolitik in Trier und somit auch im Umgang mit dem Bistumsblatt erkennen. Denn auf die Beschlagnahme der Ausgabe vom 26. April 1935 folgten in unmittelbarer Folge zwei weitere Beanstandungen, nämlich die Beschlagnahmung der Ausgaben 18 und 20. Inhaltlich nahm die Geheime Staatspolizei vor allem Anstoß an den Themen der Jugenderziehung − einem großen Streitthema im damals aktuellen Staat-Kir11 Ebd. 12 Ebd., Bl. 89, Brief des bischöflichen Generalvikariats an die Gestapo Trier vom 3.5.1935. 13 Ebd., Bl. 98 ff., Beschwerdeschreiben des bischöflichen Generalvikariates an das Reichsministerium des Innern vom 21.5.1935.
Die Gestapo als Zensurbehörde
|
chen-Konflikt.14 Eine weitere mögliche Motivation für das plötzliche Vorgehen der Gestapo gegen das Paulinusblatt könnte neben der Klärung der Saarfrage in dem Personalwechsel in der Trierer Gestapo-Führung und einem damit verbundenen Ehrgeiz des neuen Verantwortlichen gegenüber seinen Vorgesetzten verborgen liegen. Denn die Leitung einer regionalen Gestapo-Dienststelle war ein beliebtes Karrieresprungbrett für junge, zielstrebige Beamte, was sich auch in einem häufigen Wechsel der Zuständigkeiten niederschlägt.15 Der Lagebericht der Gestapo Trier für den Mai 1935 scheint diesen Verdacht zu erhärten. In einem dort verfassten Unterkapitel zur katholischen Kirchenpolitik heißt es, dass der Paulinus „im Berichtsmonat 3 mal verboten werden“16 musste. Diese Darstellung erscheint nach den vorangegangenen Schilderungen der ersten Welle als eine klare Fehlinformation. Denn verboten wurde das Paulinusblatt 1935 kein einziges Mal. Allein eine Beschlagnahmung Ende April und zwei weitere im Mai konnten nachgewiesen werden. Darüber hinaus ist jede Ausgabe im Mai 1935 auch erschienen. Die Übertreibung im Trierer Lagebericht macht deutlich, dass man in Berlin im Kampf gegen die Bistumspresse ehrgeizig und vielbeschäftigt erscheinen wollte.
Schikane oder Missverständnis?
Eigentlich war nach dieser ersten Welle eine gewisse Beruhigung der Lage eingetreten ; zumindest erfolgten keine weiteren Beschlagnahmungen mehr. Strittige Fragen wurden demnach bereits im Vorzensurprozess zwischen Redaktion und Geheimer Staatspolizei geklärt. Für die Ausgabe Nr. 2 vom 12. Januar 1936 konnte oder wollte man jedoch anscheinend keine Einigung zulassen. Die Staatspolizeistelle Trier sah sich zu einer Beschlagnahmung ohne Vorgespräche veranlasst, weil es sich bei dieser Ausgabe − aus einem „Bericht über die Verhandlungen zwischen der Staatspolizei und der 14 Hauptsächlich drehte sich der Konflikt um die Bereiche der ganzheitlichen Erfassung der Jugend in den nationalsozialistischen Verbänden (und somit um die Konkurrenz zu den katholischen Jugendgruppen) und um die Ent-Konfessionalisierung der Schulen. Der Trierer Bischof engagierte sich in vielen Predigten und Hirtenworten für die katholische Jugend in diesen Bereichen ; vgl. Günter Gehl : Katholische Jugendliche im Dritten Reich in der katholischen Provinz. Grenzen der Gleichschaltung – drei Beispiele im Bistum Trier, Weimar 2008, S. 77–89. 15 Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek : Einleitung, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Landeskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, Bd.1 : 1934, Düsseldorf 2012, S. 1–32, hier S. 12 f. 16 Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/510, Bl. 96, Lagebericht der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Trier für den Berichtsmonat Mai vom 5.6.1935.
87
88
|
Sebastian Heuft
Paulinus-Schriftleitung“ − „um einen solch außergewöhnlichen und krassen Fall handle“17. Grund der Beschlagnahmung waren laut Bericht des Redakteurs Dr. Funk die beiden Artikel „Heilige Ordnung“ und „Religion des Kreuzes“.18 Wie schon die zuvor beanstandeten Artikel, so befassten sich auch diese mit Fragen der Erziehung und Jugend. In dem Artikel „Religion des Kreuzes“ wurden zwei Sätze als politisch gefährlich eingestuft und bereitwillig von der Redaktion gestrichen.19 Alle Versuche des Redakteurs, die Inhalte des Artikels „Heilige Ordnung“ unter Berufung auf das Reichskonkordat als offizielle Lehre der Kirche zu rechtfertigen, scheiterten jedoch. Deshalb schlug er selbst vor, den Artikel durch einen anderen zu ersetzen, da der Druckvorgang eine gewisse Vorlaufzeit in Anspruch nähme und man ein Erscheinen unbedingt anstrebe. Der zuständige Gestapobeamte Fischer wollte sich diesbezüglich noch einmal bei der Redaktion melden, was er aber nicht mehr tat. Ob dies bewusst geschah oder er die Vereinbarung vergessen hatte, lässt sich den Akten nicht entnehmen. Fest steht, dass er den Artikel nicht mehr einsehen konnte. Allerdings bestätigte auf Nachfragen der Redaktion ein weiterer Beamter die Druckerlaubnis telefonisch. Doch die Situation entspannte sich damit keineswegs : Denn noch am gleichen Tag rief der stellvertretende Leiter der Staats polizei, Kommissar Kluthe, in der Druckerei an und forderte „in erregtem und energischen Tone“20 die Redaktion dazu auf, bestimmte Passagen des Ersatzartikels, welche nicht den Anforderungen entsprächen, aus den Druckerplatten heraus meißeln zu lassen. Die Ausgaben, die bereits fertig gedruckt waren, wurden in der Folge von der Gestapo abtransportiert. Im Lagebericht des Monats Januar 1936 der Trierer Gestapo wird über diesen Vorfall berichtet. Dort heißt es : Auch bei dem Vertrieb des Paulinusblattes ist festzustellen, dass seitens des Verlages großes Gewicht auf eine einwandfreie Berichterstattung sowie Leitung des Verlages gelegt wird, die nach Möglichkeit das Einschreiten der hiesigen Staatspolizeistelle überflüssig machen sollen. Trotzdem war es notwendig, einige Artikel, die bei der Erziehung der Kinder das Primat der Kirche forderten, zu beanstanden. Nennenswerte Schwierigkeiten erwuchsen hieraus jedoch nicht, sondern der Verlag erklärte sich bereit, den fraglichen Artikel entweder ganz herauszunehmen oder ihn in einer abgeschwächten Form zu bringen.21 17 BA Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 114, Bericht über die Verhandlungen zwischen der Staatspolizei und der Paulinus-Schriftleitung bezüglich der Nr. 2 des Paulinusblattes von 1936 vom 12.1.1936. 18 Ebd., Bl. 115. 19 Ebd., Bl. 116. 20 Ebd., Bl. 117. 21 BArch Berlin, R 58/510, Bl. 93, Lagebericht der Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Trier für den Berichtsmonat Januar 1936 vom 5.2.1936.
Die Gestapo als Zensurbehörde
|
Dieser Bericht verweist zwar einerseits auf einen gewissen Anpassungswillen der Paulinus-Redaktion, verdeutlicht aber andererseits auch, wie sehr die Gestapo Trier darum bemüht war, dem Geheimen Staatspolizeiamt (Gestapa) in Berlin ein Bild der vollständigen Kontrolle über die Kirchenpresse zu zeichnen. Denn davon, dass einzelne Wörter aus den schon erstellten Druckplatten heraus gestemmt werden mussten, weil die Kommunikation zwischen der Redaktion und der Gestapo nicht ganz so reibungslos verlief, weiß der Lagebericht nichts zu berichten. Auch tritt eine durchaus ambivalente Sicht auf die Ereignisse zutage. In dem zuvor zitierten Bericht von Alois Funk begründete Kriminalassistent Fischer das Vorgehen damit, dass es sich bei der Beschlagnahmung um einen „außergewöhnlichen und krassen Fall handle“22. Im Lagebericht ist lediglich von einer notwendigen Beanstandung die Rede. Es ist in diesem Fall davon auszugehen, dass der Lagebericht die Situation bewusst beschönigend darstellte, um so die eigenen Fehler bei der Zensur der Ausgabe zu verdecken. Denn wollte man seitens der Gestapo das Erscheinen verhindern, indem man den Vorzensurprozess hinauszögerte, wurde dies durch die unfreiwillige Erteilung der Imprimatur im Telefongespräch mit einem nicht eingeweihten Beamten durchkreuzt. Ebenfalls negativ für die Gestapo war, dass die Lücken in den zensierten Artikeln für die Bevölkerung nun sichtbar waren und diese – laut des Betriebszellenobmanns der Paulinus-Druckerei – „großes Aufsehen erregten“23. Auch in diesem Fall ist im Ergebnis festzuhalten, dass man die Vorzensur als Lenkungs- und Kontrollmethode nutzte. Jedoch ist hierbei eine bewusste Verzögerung der Druckfreigabe zu erkennen, die letztendlich in einem Nichterscheinen des Paulinus hätte enden können. Ein späterer Vorfall um die Ausgabe Nr. 6 von 1937 belegt dies : Auch dort zögerte man die Freigabe soweit hinaus, dass schließlich die Wochenzeitung nicht erscheinen konnte. Zudem wird in diesem Fall der direkte Druck auf die Angestellten der Paulinus-Druckerei deutlich, da ausgewählte Personen persönliche Vorladungen erhielten.
Der Beginn der zweiten Offensive
Nach den beschriebenen Ereignissen im Mai 1935 dauerte es bis zum Sommer 1936, bis die Gestapo Trier erneut in konzentrierter Form das Paulinusblatt unter Druck setze. Auftakt dieser zweiten Welle ist die Beschlagnahmung der 30. Ausgabe 22 BA Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 114, Bericht über die Verhandlungen zwischen der Staatspolizei und der Paulinus-Schriftleitung bezüglich der Nr. 2 des Paulinusblattes von 1936 vom 12.1.1936. 23 Ebd., Bl. 118.
89
90
|
Sebastian Heuft
vom 26. Juli 1936. Der Vorgang ähnelt den bereits geschilderten Ereignissen bei der ersten Welle von 1935. Nach einer mündlichen Anordnung durch die Gestapo Trier am 21. Juli 1936 folgte drei Tage später die schriftliche Beschlagnahmungsbestätigung.24 Anlass für dieses Vorgehen war der Artikel „Vor dem Ziel“, der, so die Argumentation der Gau-Leitung, gegen die Verordnung des Reichspräsidenten vom 4. Februar 1933 verstoße. In diesem Artikel findet sich der Satz : Weltanschauungen ringen in ihr [der Welt, A.d.V.] miteinander, der Unglaube hat sich breit gemacht, die Kirche wird beschimpft, ihr Wirken mißdeutet, die Priester wegen Entartung einzelner [sic !] zynisch betrachtet.25
Inhaltlich und sprachlich finden sich hier zwei Auffälligkeiten. Zum einen ist der Begriff „Entartung“ vor allem eine im nationalsozialistischen Sprachgebrauch zu findende Beschreibung, zum anderen zeigt gerade der letzte Abschnitt eine offene Beschwerde über den Umgang mit der Kirche während der Sittlichkeitsprozesse.26 Die Sittlichkeitsprozesse waren Strafprozesse zwischen 1936 und 1937, in denen Geistliche im gesamten Deutschen Reich aufgrund vermeintlicher sexueller Verfehlungen angeklagt wurden. Im Zuge dessen wurden reichsweit etwa 0,1 Prozent aller Kleriker verurteilt ; in Trier waren es sogar 0,9 Prozent des Klerus. Die nationalsozialistische Propaganda nahm sich dieser Prozesse vor allem auch in Trier sehr stark an ; sie generalisierte die Schuld einzelner Priester und übertrug diese auf die gesamte Kirche. Daher auch die Aussage, dass die Kirche beschimpft und ihr Wirken missdeutet würde. Ein späterer Briefwechsel zwischen dem bischöflichen Generalvikariat und dem Ministerium für kirchliche Angelegenheiten lässt erkennen, dass sich die Redaktion des Paulinus anscheinend in diesem Falle weigerte, die in einer mündlichen Anordnung zuvor besprochenen Änderungswünsche der Gestapo zu übernehmen.27 Die Konsequenz dieser Verweigerungshaltung war, dass zum ersten Mal das Erscheinen einer Ausgabe gänzlich verboten wurde.28 Das harte Vorgehen der Gestapo zeigt, 24 Ebd., Bl. 104, Beschlagnahmungsverfügung der Gestapo Trier vom 24.7.1936. 25 Ebd., Bl. 129, Antwortschreiben des Ministeriums für kirchliche Angelegenheiten an die Paulinusblatt-Redaktion vom 30.10.1936. 26 Hans Günter Hockerts : Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/1937. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte bei der Katholischen Akademie in Bayern, Reihe B : Forschungen, Bd. 6), Mainz 1971. 27 BA Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 148, Antwortschreiben des Ministeriums für kirchliche Angelegenheiten an die Paulinusblatt-Redaktion vom 30.10.1936. 28 Flugblatt zur Paulinus-Ausgabe Nr. 30 vom 26.07.1936.
Die Gestapo als Zensurbehörde
|
Abb. 2: Flugblatt der Paulinus-Druckerei zum Erscheinungsverbot der 30. Ausgabe 1936. (Quelle: StA Trier, Ztg 22).
dass man zwar bei dem Bistumsblatt bemüht war, für seine Freiheiten zu kämpfen und damit ein durchaus resistentes Verhalten erkennen ließ, zugleich wird aber der geringe Spielraum deutlich. Methode
Anwendung
Vorzensur
1935: Nr. 18 1936: Nr. 2, 30, 34, 36, 41 1938: Nr. 13, 24, 27
Verzögerung der Druckgenehmigung/Verschweigen der Beschlagnahmungsgründe
1936: Nr. 2 1937: Nr. 6
Verbot
1936: Nr. 30 1937: Nr. 22, 29
Direkter Einfluss auf die Angestellten/Informelle Besprechung vor etwaigen Vorgängen
1936: Nr. 2
Verbotsandrohung
1937: Nr. 31, 41
Beanstandungen nach der Veröffentlichung durch die Reichspressekammer
1935: Nr. 33 1936: Nr. 32, 33, 49, 50
Tab. 1: Methoden der Gestapo Trier gegen das Paulinusblatt. (Quelle: Verfasser).
Immerhin konnte man die Leserschaft durch den Druck eines Flugblattes, welches das Verbot durch die Gestapo Trier bekannt gab, informieren. Dies war bei späte-
91
92
|
Sebastian Heuft
ren Verboten jedoch nicht mehr möglich. Das Antwortschreiben des Ministeriums für kirchliche Angelegenheiten ist im Übrigen zwei Monate nach dem Beschwerdebrief des Trierer Generalvikars verfasst worden.29 Eine sehr lange Zeitspanne, die verdeutlicht, wie gering der Kooperationswille des Ministeriums mit der Bistums presse war. Als Ergebnis steht hier schlicht das Verbot. Auf dieses Verbot sollten direkt im Anschluss an die Olympischen Sommerspiele in Berlin sechs weitere Vorgänge gegen das Paulinusblatt folgen. Insgesamt wurden damals innerhalb von zwölf Wochen sieben Ausgaben beschlagnahmt oder beanstandet. Dieses konzentrierte Vorgehen hatte mehrere Gründe. Zu nennen sind hier die Februar-Verordnungen der Reichspressekammer von 1936, die Neubesetzung der Regierungspräsidentenstelle in Trier und schließlich eine generelle Radikalisierung der Kirchenpolitik im Zuge der Sittlichkeitsprozesse in Koblenz und Trier.
Die Methoden der Trierer Gestapo
Die Beispiele haben auszugsweise gezeigt, dass die Geheime Staatspolizei zu einem wichtigen Lenkungsorgan der nationalsozialistischen Pressepolitik wurde. Nicht allein die Reichspressekammer oder das Propagandaministerium um Joseph Goebbels und deren regionale Amtsstellen bestimmten den Inhalt der Zeitungen. Viele der bisherigen Forschungsarbeiten rücken bei der Betrachtung der Presselenkung der Nationalsozialisten vor allem die Presse-Anweisungen des Nachrichtenbüros oder den institutionellen Einfluss von Reichspressekammer und Propagandaministerium in den Mittelpunkt. Aber der direkte Einfluss der Gestapo Trier auf die Bistumspresse ist auch inhaltlich groß gewesen. Die Polizeibeamten waren nicht nur Ausführer einer von Berlin gegebenen Anweisung, sondern handelten aus eigenem Antrieb heraus. Die Streichung einzelner Begriffe oder Sätze sowie das Ablehnen bestimmter Artikel prägten nicht allein die beanstandete Ausgabe, sondern wirkten auch auf das gesamte Erscheinungsbild der Wochenzeitung, die zumeist bemüht war, ihr publizistisches Überleben zu sichern. So kann vermutet werden, dass man gerade nach der zweiten Beschlagnahmungswelle 1936 versucht war, von Seiten des Paulinusblattes den Inhalt der Zeitung mit möglichst geringem Konfliktpotential zu gestalten. Die Tätigkeit als Zensor nahm die Gestapo vor allem im Umfeld der Sittlichkeitsprozesse wahr. Auffällig geworden ist zudem, dass sich die Maßnahmen gegen 29 BA Trier, Abt. B III 14,8, Bd. 8, Bl. 148, Antwortschreiben des Ministeriums für kirchliche Angelegenheiten an die Paulinusblatt-Redaktion vom 30.10.1936.
Die Gestapo als Zensurbehörde
|
den Paulinus auf die drei Jahre zwischen 1935 und 1938 konzentrierten und somit deutlich später einsetzten als die Repressionen gegen die ebenfalls in der Paulinus-Druckerei hergestellte Trierische Landeszeitung.30 Die repressiven Methoden der Geheimen Staatspolizei in Trier waren, wie eine umfassende Betrachtung der Fälle aufdeckt, vielfältig und durch die immer im Raum stehende Androhung eines Erscheinungsverbotes besonders wirkmächtig. Vor allem der Einfluss durch den ständigen direkten Kontakt mit der wöchentlichen Vorzensur kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Anhand der Auswertung der gesamten Beschlagnahmungen des Paulinusblattes lassen sich insgesamt fünf verschiedene Methoden der Trierer Gestapo identifizieren. Dabei ist anzumerken, dass deren Anwendung bei den einzelnen Fällen flexibel war und die Methoden zum Teil parallel eingesetzt wurden. Wie sich zeigt, stellte die wöchentliche Vorzensur die häufigste aller Methoden dar und konnte ein Verbot oder zumindest eine Verbotsandrohung nach sich ziehen. Der Wandel von einer routinemäßigen Kontrolle der Artikel der Paulinus-Ausgaben zu einer Beschlagnahmung oder einer Zensur erscheint dabei willkürlich und nur wenig am Inhalt der Wochenzeitung orientiert. So war es dem Berliner Bistumsblatt möglich, den Artikel „Aus dem Leben der Reichshauptstadt“ ohne Einschränkungen der Berliner Gestapo zu veröffentlichen. Derselbe Artikel führte bei dem Trierer Paulinusblatt zur zuvor geschilderten ersten Beschlagnahmung im Jahr 1935. Die Verzögerung der Druckgenehmigung ohne Nennung von Gründen ist als Methode der Trierer Gestapo in zwei Fällen nachweisbar, wobei ein Ereignis hier im zweiten Beispiel vorgestellt worden ist. Auch ein Verbotsvorgang ist in dem zuletzt geschilderten dritten Beispiel angesprochen worden. Allerdings dürfte wahrscheinlich die informelle Einflussnahme der Geheimen Staatspolizei auf die Redaktion sehr häufig vorgekommen sein, die sich in Trier aber bislang nur an einem Beispiel konkret nachweisen lässt. Zu der Vorgehensweise der Gestapo gehörte es aber auch, in den Beschlagnahmungsverfügungen den genauen Grund nicht zu nennen und so die Redaktion bewusst im Unklaren zu lassen. Die Reichspressekammer ist in den Jahren zwischen 1935 und 1936 genau fünfmal gegen den Paulinus tätig geworden. Demgegenüber hatte die Trierer Gestapo in mindestens 16 Fällen Beanstandungen oder Verbote ausgesprochen. Dies verdeutlicht noch einmal anschaulich die Bedeutung der Geheimen Staatspolizei als Kontroll- und Lenkungsorgan der Bistumspresse.
30 Profanter : Trierer Tagespresse, S. 84–88.
93
Katharina Klasen
Die Gestapo am „Ort des Terrors“ Das Vernehmungskommando im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
Da die Geheime Staatspolizei und die nationalsozialistischen Konzentrationslager die „entscheidenden Herrschaftsinstrumente“1 zur Verfolgung (politischer) Gegner waren, ist es wichtig, die Zusammenhänge, die zwischen der Staatspolizeistelle Trier und dem SS-Sonderlager/KZ Hinzert existierten, zu erforschen.2 Aus diesem Grund soll im vorliegenden Beitrag das SS-Sonderlager/KZ Hinzert in den Blick genommen werden, denn die Gestapo Trier und die Gestapo Luxemburg begingen dort viele Verbrechen. Sie fungierten als einweisende Instanzen und waren so für die Inhaftierung zahlreicher Häftlinge verantwortlich. Zudem setzte sich ein im Lager stationiertes Vernehmungskommando aus Beamten beider Dienststellen zusammen. Bevor aber die Verhör- und Foltermethoden des Vernehmungskommandos und andere Taten der Gestapo im SS-Sonderlager/KZ Hinzert thematisiert und ihre Konsequenzen dargelegt werden, ist es erforderlich, diesen „Ort des Terrors“ einleitend zu skizzieren.
Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert
Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück existierte von Oktober 1939 bis März 1945. In diesem Zeitraum waren mindestens 10.000 Menschen im Lager inhaftiert. Dabei handelte es sich ausschließlich um männliche Häftlinge aus mindestens zwanzig europäischen Ländern.3 In seiner Anfangszeit wurde das Lager als 1 Michael Wildt : Nationalsozialismus : Aufstieg und Herrschaft (Informationen zur politischen Bildung, Bd. 314), Bonn 2012, S. 64. 2 Bernward Dörner : Gestapo und ,Heimtücke‘. Zur Praxis der Geheimen Staatspolizei bei der Verfolgung von Verstößen gegen das ,Heimstücke-Gesetz‘, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 325–342, hier S. 340. 3 Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933–1945. Bd. 2 : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Ausstellungskatalog, Mainz 2009, S. 10 und 18 ; Uwe Bader/Beate Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert. In : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.) : Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 5 : Hinzert, Auschwitz, Neuengamme, München 2008,
96
|
Katharina Klasen
Polizeihaftlager und Erziehungslager für „arbeitsscheue“ und im Sinne des Nationalsozialismus straffällig4 gewordene Westwallarbeiter der Organisation Todt gegründet.5 In Hinzert sollten die Arbeiter gemäß der nationalsozialistischen Lehre „(um)erzogen“ werden.6 Da sich der Bau des Westwalls nach Aussage von Fritz Todt durch „schleppende Arbeitsleistung“ verzögerte, sollten polizeiliche „Erziehungslager“ errichtet werden, um die Leistungsfähigkeit der Arbeiter durch militärischen Drill zu steigern.7 Zusätzlich zum Polizeihaftlager existierte ein weiterer Lagerteil, S. 17–42, hier S. 20 ; Uwe Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1939–1945, in : Wolfgang Benz/ Barbara Distel (Hg.) : Terror im Westen. Nationalsozialistische Lager in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg 1940–1945 (Geschichte der Konzentrationslager 1933–1945, Bd. 5), Berlin 2004, S. 249–274, hier S. 256. 4 Sie hatten sich unerlaubt von ihrem Arbeitsplatz entfernt, waren zu spät oder gar nicht mehr aus ihrem Urlaub zurückgekommen, hatten Alkoholexzesse ausgetragen oder aus Protest gegen die hohe Arbeitsbelastung kollektiv die Arbeit niedergelegt ; vgl. Barbara Weiter-Matysiak : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück, in : Hans-Georg Meyer/Hans Berkessel (Hg.) : „Für die Außenwelt seid Ihr tot !“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Mainz 2000, S. 116–135, hier S. 116. 5 Der Westwall, eine etwa 630 km lange militärische Verteidigungsanlage entlang der Westgrenze des Deutschen Reiches, sollte die Stärke des „Dritten Reiches“ demonstrieren und die Alliierten einschüchtern. Mit der Umsetzung begann man 1938, auch wenn schon frühere Aktivitäten für ein militärisches Befestigungssystem zu beobachten sind. Die Organisation Todt, benannt nach ihrem Leiter, dem Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Fritz Todt, wurde von Adolf Hitler mit dem Ausbau des Westwalls beauftragt. Nach dem Westfeldzug 1940 wurden die Arbeiten eingestellt, die − dann oft technisch bereits veralteten − Verteidigungsanlagen 1944 beim Herannahen der alliierten Truppen aber reaktiviert. Zur Geschichte des Westwalls vgl. u.a. Edgar Christoffel : Krieg am Westwall 1944/45. Das Grenzland im Westen zwischen Aachen und Saarbrücken in den letzten Kriegsmonaten, Trier 1989 ; Frank Möller/Karola Fings (Hg.) : Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Überresten der NS-Anlage (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bd. 20), Weilerswist 2008 ; Wolfgang Benz : Die Bedeutung des Westwalls für das nationalsozialistische Regime, in : Klaus Werk/Nils Franke (Hg.) : Naturschutz am ehemaligen Westwall. NS-Großanlagen im Diskurs (Geisenheimer Beiträge zur Kulturlandschaft, Bd. 1), Geisenheim 2016, S. 18–29, online unter : https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/ Publikationen/Naturschutz_am_ehemaligen_Westwall.pdf (Letzter Zugriff : 23.7.2017). 6 Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 9, 18 und 32 ; André Heiderscheid : Nie wieder ! Bd. 2 : Als Pilger in Hinzert, Natzweiler-Struthof, Dachau, Luxemburg 2007, S. 13 ; Susanne Urban-Fahr : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert.1939–1945, Alzey 2001, S. 10 ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 13 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 250 und 254 ; Peter Bucher : Das SS-Sonderlager Hinzert bei Trier, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 4 (1978), S. 413–439, hier S. 416. 7 Gabriele Lotfi : KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich, Frankfurt a.M. 2003, S. 58–60 ; Dies.: SS-Sonderlager im nationalsozialistischen Terrorsystem : Die Entstehung von Hinzert, Stutthof und Soldau, in : Norbert Frei/Sybille Steinbacher/Bernd C. Wagner (Hg.) : Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik (Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz), München 2000, S. 209–229, hier S. 209.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
der „SS-Sonderlager“8 genannt wurde. Die Kriterien für die Unterbringung im SS-Sonderlager waren nicht eindeutig definiert, so dass unliebsame oder regimekritische Personen relativ einfach in Haft genommen werden konnten. Vorwürfe einer mangelnden Arbeitsdisziplin oder eines „asozialen Verhaltens“ genügten bereits.9 Die Zusammensetzung der sogenannten Häftlingsgesellschaft veränderte sich kontinuierlich, was insbesondere mit dem Kriegsverlauf und der stetigen Erweiterung des Lagers zusammenhing.10 Die ersten Häftlinge in Hinzert waren (reichs-)deutsche Arbeiter, die aus den oben genannten Gründen im Lager inhaftiert wurden.11 Ab Sommer 1940 kamen ausländische Gefangene aus Luxemburg, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Polen und Russland nach Hinzert.12 Während die in Haft Genommenen aus Westeuropa vor allem politische Widerstandskämpfer waren, die nach dem erfolgreichen Abschluss der deutschen Westoffensive in Gefangenschaft geraten und als Untersuchungs- und Schutzhäftlinge nach Hinzert deportiert worden waren, handelte es sich bei den Häftlingen aus Osteuropa überwiegend um verschleppte Fremd- und Zwangsarbeiter.13 Für viele Menschen war Hinzert ein Durchgangslager, eine Zwischenstation auf ihrem Leidensweg, der sie in die Konzentrationslager Buchenwald, Dachau oder Natzweiler führte.14 Insgesamt 321 Todesfälle sind für das SS-Sonderlager/KZ 8 Uwe Bader zufolge konnte bislang nicht geklärt werden, warum das Lager die Bezeichnung erhielt und weshalb es diese während der gesamten Dauer seines Bestehens führte ; vgl. Uwe Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert und seine Bedeutung im Ausland bis heute, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 21–32, hier S. 26. 9 Barbara Weiter-Matysiak : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück, in : Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg (Hg.) : …et wor alles net esou einfach. Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale/Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Contri butions historiques accompagnant l’exposition/Ein Lesebuch zur Ausstellung, Luxembourg 2002, S. 164–174, hier S. 165 ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 14 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 250. 10 Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 21. 11 Karl Wilhelm : SS-Sonderlager Hinzert, in : Verein für Heimatkunde Nonnweiler e.V. (Hg.) : Hochwald − Landschaft und Geschichte, Saarbrücken 1992, S. 258–259, hier S. 258. 12 Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 19 ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 20 ; Urban-Fahr : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 17. 13 Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 37 ; Beate Welter/Uwe Bader : Luxemburger Häftlinge im SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945, in : Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager 21 (2005) : Häftlingsgesellschaft, S. 66–82, hier S. 70 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 255. 14 Bucher : SS-Sonderlager Hinzert, S. 418 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 8–9 ; Weiter-Matysiak, Hinzert im Hunsrück (2002), S. 166 ; Marcel Engel/André Hohengarten : Hinzert. Das SS-Sonderlager im Hunsrück 1939–1945, Luxemburg 1983, S. 7 und 77 ; Bettina
97
98
|
Katharina Klasen
Hinzert nachweisbar, wobei davon ausgegangen werden kann, dass die Zahl der Todesopfer wesentlich höher war.15 Die ungewöhnliche Bezeichnung „SS-Sonderlager/KZ Hinzert“ sei hier noch zu klären. In der Nachkriegszeit herrschte lange Uneinigkeit darüber, ob es sich bei Hinzert wirklich um ein Konzentrationslager gehandelt habe.16 Der vorherrschenden Meinung zufolge war Hinzert „nur“ ein Arbeitserziehungslager gewesen. Dieser Ansicht ist zu widersprechen,17 denn die Bezeichnung „Konzentrationslager“ durften „nach ausdrücklicher Weisung des Reichsführers-SS nur die dem Inspekteur der Konzentrationslager unterstehenden Lager […] führen.“18 Und das Hinzerter Lager wurde am 1. Juli 1940 der Inspektion der Konzentrationslager (IKL)19 unterstellt und erhielt den Rang eines KZ-Hauptlagers. Folglich war es ab diesem Zeitpunkt offiziell ein Konzentrationslager „und damit fester Bestandteil des umfassenden Lagersystems.“20 Da das SS-Sonderlager weiterhin erhalten blieb, nahm Hinzert im System der nationalsozialistischen Konzentrationslager eine Son-
Wenke : Interviews mit Überlebenden. Verfolgung und Widerstand in Süddeutschland, Stuttgart 1980, S. 223, 225 und 230. 15 Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Blätter zum Land. Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Osthofen 2005, S. 8 ; Martin Jander : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkorte, Bd. 3), Berlin 2008, S. 4 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 22 ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 31 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 260. 16 Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 13 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 249 ; Ders.: Hinzert im Ausland, S. 27 ; Franz-Josef Heyen : Hinzert. Ort des Leidens und der Schmach, Gedenkstätte des Freien Luxemburg, in : Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte 35 (1983), S. 133–157, hier S. 141 ; Karin Orth : Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte, Hamburg 1999, S. 46 ; UrbanFahr : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 11. 17 Im Bundesgesetzblatt vom 2. März 1967 wurde das SS-Sonderlager Hinzert als Konzentrationslager eingestuft ; vgl. BG Bl. 1967/12, S. 233 und 242. 18 Heyen : Ort des Leidens, S. 141 ; Orth : System, S. 46. 19 Die IKL war die Verwaltungszentrale für das gesamte System der nationalsozialistischen Konzentrationslager ; vgl. Günter Morsch: Verschwiegen, vergessen, unterschätzt? Die Inspektion der Konzentrationslager – Verwaltungszentrale des KZ-Systems, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Verwaltungszentralen des KZ-Systems (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Mainz/Hinzert 2012, S. 6–35, hier S. 7 ; Johannes Tuchel : Konzentrationslager. Organisationsgeschichte und Funktion der „Inspektion der Konzen trationslager“ 1934–1938 (Schriften des Bundesarchivs, Bd. 39), Boppard am Rhein 1991 ; Günter Morsch/Agnes Ohm (Hg.) : Die Zentrale des KZ-Terrors. Die Inspektion der Konzentrationslager 1934–1945. Eine Ausstellung am historischen Ort (Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 47), Berlin 2015. 20 Urban-Fahr : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 11.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
derstellung ein – als „SS-Sonderlager/KZ Hinzert“.21 Dies macht es, so Wolfgang Benz, nicht einfach, das Lager in den Kosmos der nationalsozialistischen Haftstätten einzuordnen.22 Für ihn steht fest, dass Hinzert ein Konzentrationslager und nicht „nur“ ein Arbeitserziehungslager war. Dennoch differenziert er : In formaler Hinsicht war Hinzert seit der Unterstellung unter die Inspektion der Konzentrationslager […] ein KZ. In struktureller und typlogischer Hinsicht wies Hinzert Besonderheiten auf, die auch für die Außenlager galten. Der Charakter des Arbeitserziehungslagers und die Strukturen des Polizeihaftlagers prägten das Erscheinungsbild Hinzerts.23
Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert hatte sowohl eine regionale als auch eine internationale Dimension. Die Tatsache, dass in Hinzert Häftlinge vieler europäischer Nationen inhaftiert waren, verlieh dem Lager internationale Bedeutung.24 Regional war es gefürchtet und berüchtigt als Haft- und Vernehmungsstätte der Gestapo, als „Ort des Terrors“.25
Das Vernehmungskommando der Gestapo im SS-Sonderlager/KZ Hinzert
Was das SS-Sonderlager/KZ Hinzert – abgesehen von der Namensgebung – von anderen nationalsozialistischen Konzentrationslagern unterschied, war der Umstand, dass es dort keine „Politische Abteilung“ gab.26 Karin Orth zufolge wiesen 21 Volker Schneider : Waffen-SS. SS-Sonderlager „Hinzert“. Das Konzentrationslager im „Gau Moselland“ 1939–1945. Untersuchungen zu einem Haftstättensystem der Organisation Todt, der Inspektion der Konzentrationslager und des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, Nonnweiler-Otzenhausen 1998, S. 153, 217–219 ; Stefan Kraus : Stätten nationalsozialistischer Zwangsherrschaft (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft 5,13), Bonn 2007, S. 29. 22 Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 9. 23 Wolfgang Benz : Die Verortung des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert im System der Konzentrationslager, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Verwaltungszentralen des KZ-Systems (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Mainz/ Hinzert 2012, S. 36–50, hier S. 48. 24 Weiter-Matysiak : Hinzert im Hunsrück (2000), S. 120. 25 Schneider : Waffen-SS, S. 147. 26 Orth : System, S. 40 ; Martin Broszat : Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945, in : Hans Buchheim u.a. (Hg.) : Anatomie des SS-Staates. Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, 2 Bde., München 21979, Bd. 2, S. 9–133, hier S. 58 ; Johannes Tuchel : Registrierung, Mißhandlung und Exekution. Die ,Politischen Abteilungen‘ in den Konzentrationslagern, in : Gerhard Paul/ Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ,Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 127–140, hier S. 128 f.
99
100
|
Katharina Klasen
alle Konzentrationslager die gleiche Organisationsstruktur mit fünf Abteilungen (Kommandantur/Adjutantur, Politische Abteilung, Schutzhaftlager, Verwaltung sowie Lager- oder Standortarzt) auf. Sie verweist darauf, dass insbesondere ab 1936 die Einrichtung einer Politischen Abteilung in den Lagern obligatorisch gewesen sei.27 Auf das SS-Sonderlager/KZ Hinzert traf dies jedoch nicht zu.28 Die fehlende Politische Abteilung wurde in Hinzert stattdessen durch ein „wegen brutaler Folterpraktiken gefürchtetes, besonderes Vernehmungskommando der Staatspolizeistelle Trier und des Einsatzkommandos Luxemburg der Sipo und des SD (EKL)“29 ersetzt.30 Die zentrale Aufgabe des Vernehmungskommandos bestand in der Zerschlagung der luxemburgischen Resistenzbewegung.31 Die Vernehmungen in Hinzert verfolgten in erster Linie das Ziel, möglichst viel Wissen über die luxemburgischen Widerstandsgruppierungen zu akkumulieren, um dann gewaltsam gegen diese vorgehen zu können.32 Denn : „Was man in Luxemburg bei Verhören nicht herausbekam, sollte im SS-Sonderlager Hinzert nachgeholt werden.“33 Demnach waren hauptsächlich luxemburgische Bürger und Widerstandskämpfer die Zielgruppe des Kommandos. Am 10. Mai 1940 wurde das neutrale Großherzogtum Luxemburg im Rahmen des Westfeldzugs durch die deutsche Wehrmacht besetzt. Rasch bildeten sich in mehreren Regionen des Landes verschiedene Widerstandsgruppen, deren Hauptziel die Vertreibung der nationalsozialistischen Besatzer und die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Luxemburgs war.34 Es waren Mitglieder dieser Organisatio27 Orth : System, S. 40–45. 28 Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 18 : Die vom 21.11.1961 bis zum 10.01.1963 ergangenen Strafurteile, lfd. Nr. 523–547, Amsterdam 1978, S. 141. 29 Weiter-Matysiak : Hinzert im Hunsrück (2002), S. 166 [Hervorhebungen wie im Original]. 30 Weiter-Matysiak : Hinzert im Hunsrück (2000), S. 121 ; Eberhard Klopp : Hinzert – kein richtiges KZ ? Ein Beispiel unter 2000, Trier 1983, S. 17 ; Raymond Waringo : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Rolle Rieks in Hinzert, in : Gemeinde Befort (Hg.) : Beaufort im Wandel der Zeiten, Befort 1993, S. 77–81, hier S. 77 ; Schneider : Waffen-SS, S. 227, 231 und 236. 31 Klopp : Hinzert, S. 17 ; Waringo : Das SS-Sonderlager Hinzert, S. 77. 32 Bundesarchiv (BArch) Koblenz, AllProz 21/201 und AllProz 21/202 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 48 ; Albert Pütz : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945. Das Anklageverfahren gegen Paul Sporrenberg. Eine juristische Dokumentation (Schriftenreihe des Ministeriums für Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 8), Frankfurt a.M. u.a. 1998, S. 44. 33 Paul Dostert : Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 1940–1945, Luxemburg 1985, S. 208. 34 Namentlich zu nennen sind hier LPL (Lëtzeburger Patriote Liga), LFK (Lëtzeburger Freihétskämpfer), Alweraje, Alef (Aktiv Lëtzebuerger Enhétsfront), LVL (Lëtzeburger Volleks Legio‘n), LRL (Lëtzeburger Ro‘de Lé‘w), Armée Blanche, PI-Men (Patriotes Indépendants) und die KPL ; vgl. Paul Dostert : Die deutsche Besatzungspolitik in Luxemburg und die luxemburgische Resistenz, in : Hémecht. Zeit-
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
nen, deren Leidensweg zwischen 1941 und 1944 in die Gefängnisse der Geheimen Staatspolizei und vor allem ins SS-Sonderlager/KZ Hinzert führte. Die in Luxemburg stationierte Gestapo ging jedoch nicht nur mit unerbittlicher Härte gegen Resistenzler, sondern auch gegen unpolitische Bürger vor, die Anzeichen einer „antideutschen“ Haltung erkennen ließen. Was im Einzelnen als „antideutsche“ Haltung interpretiert wurde, war im Wesentlichen dem Ermessen der Gestapobeamten überlassen. Die „Verbrechen“, die den Verhafteten zur Last gelegt wurden, waren vielgestaltig. Die Gestapo bezichtigte sie etwa der Mitgliedschaft in einer Widerstandsbewegung oder sanktionierte sie wegen des Besitzes eines Fotos der großherzoglichen Familie. Darüber hinaus warf die Gestapo ihren Vernehmungsopfern die Herstellung und Verbreitung deutschfeindlicher Flugblätter, versuchte Fahnenflucht sowie die Beihilfe zu dieser, illegalen Grenzübertritt, illegalen Waffenbesitz, kommunistische Tätigkeiten, Landesverrat, Spionage, Feindbegünstigung, Arbeitsverweigerung, Wehrkraftzersetzung, das Abhören feindlicher Sender, Sprengstoffattentate sowie die Unterstützung entflohener Kriegsgefangener vor.35 Wollte die Gestapo eine Person in Haft nehmen, fand sie in der Regel Mittel und Wege dafür : „Selten war es der Fall, dass jemandem nach Maßstäben […] der Staatspolizei kein Vergehen nachgewiesen werden konnte.“36 Die ersten Luxemburger wurden im Frühjahr 1941 nach Hinzert deportiert. Die geographische Lage des Lagers war für die Gestapo ideal : Aus ihrer Heimat verschleppt, konnten die in Haft Genommenen im Hunsrück besser isoliert und von den Beamten des Vernehmungskommandos „bearbeitet“ werden.37 schrift für Luxemburger Geschichte 3 (1987), S. 375–392, hier S. 390 ; Ders.: Selbstbehauptung, S. 253 f.; Heyen : Ort des Leidens, S. 143 ; Welter/Bader : Luxemburger Häftlinge, S. 71 ; Klopp : Hinzert, S. 10, 69 ; Danielle Bossaert/Christian Calmes : Geschichte des Großherzogtums Lu xemburg. Von 1815 bis heute, Luxemburg 1994, S. 355 ; Jean-Pierre Koltz : Die geschichtlichen Verbindungen zwischen Luxemburg und Trier. Teil 3, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg (1983), S. 340–367, hier S. 346 f.; Mathias Wallerang : Luxemburg unter nationalsozialistischer Besatzung. Luxemburger berichten (Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz, Bd. 22), Mainz 1997, S. 125–128 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 75. 35 Archives nationales de Luxembourg (AnLux), CdG-006, CdG-061, CdG-079, CdG-087 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201 und AllProz 21/202 ; Welter/Bader : Luxemburger Häftlinge, S. 72. 36 Weiter-Matysiak : Hinzert im Hunsrück (2002), S. 168 ; vgl. auch Paul Dostert : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert aus luxemburgischer Sicht, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 60–68, hier S. 60. Diese Aussage muss möglicherweise in ihrer Eindeutigkeit relativiert werden, da erste Auswertungen der Personalakten der Gestapo Trier verdeutlichen, dass es durchaus Ermittlungen gegeben hat, bei denen es aus Mangel an Beweisen zu keinerlei Verhaftungen gekommen ist. 37 Lotfi : SS-Sonderlager, S. 224 f.
101
102
|
Katharina Klasen
Das Personal des Vernehmungskommandos
Die vollständige personelle Zusammensetzung des Vernehmungskommandos lässt sich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit rekonstruieren. In den Zeugenaussagen von Hinzert-Überlebenden vor dem Luxemburger Gerichtshof für Kriegsverbrechen im Rahmen des Gestapo- und Einsatzkommando-Prozesses38 (1949– 1951), dessen Dokumente sich als wertvolle historische Quelle erweisen, tauchten zwar immer wieder dieselben Namen auf, was jedoch nicht bedeuten muss, dass es nicht auch noch andere, namentlich unbekannte Gestapomitarbeiter in Hinzert gab. Das Vernehmungskommando war zudem nicht permanent aus denselben Beamten zusammengesetzt. Stattdessen änderte sich die personelle Besetzung im Laufe der Zeit.39 Der Trierer Gestapochef und Leiter des EKL, Oberregierungsrat Fritz Hartmann, wählte das Personal des Vernehmungskommandos aus und entsandte es nach Hinzert.40 Auf Befehl des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) setzte er im April 1941 den Trierer Kriminalkommissar Albert Schmidt als Leiter und Sonderkommissar ein, der diese Positionen bis zur Auflösung des Kommandos innehatte.41 Das Vernehmungskommando trat erstmals im April 1941 in Konstellation der Beamten Albert Schmidt, Sebastian Ranner, Franz Suder und Ruppert Schober zusammen.42 38 Die Unterlagen dieses Prozesses waren für die Erforschung der durch die Gestapo in Hinzert verübten Verbrechen essenziell, da von den 16 angeklagten Gestapobeamten sieben mit den Verbrechen, die sich im SS-Sonderlager/KZ Hinzert ereigneten, in Verbindung gebracht werden konnten. Es handelte sich um Oberregierungsrat Fritz Hartmann, Kriminalrat Walter Runge, Kriminalkommissar Sebastian Ranner, Kriminalobersekretär Hans Klöcker, Kriminalkommissar Gerhard Simon, Kriminalsekretär Karl Bieler und Kriminalsekretär Adolf Moritz. Den Angeklagten wurde zur Last gelegt, „luxemburgische Zivilpersonen – hauptsächlich Mitglieder und Mitarbeiter von Widerstandsorganisationen – vorsätzlich und völkerrechtswidrig ausgekundschaftet, festgenommen, aufs grausamste gequält, krank und arbeitsunfähig geprügelt, ins Ausland verschleppt und ermordet“ zu haben ; zit. nach : Albert Pütz : Angehörige der ehemaligen Lager-SS, Gestapo und NS-Justiz vor Gericht. Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 8), Frankfurt a.M. 2001, S. 67 [Orthographie wie im Original]. 39 Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 341. 40 Ebd., S. 40 und 48. Im Übrigen war der Leiter der Staatspolizeistelle Trier in Personalunion auch immer zugleich der Leiter des EKL ; vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/342, Bl. 120 ; BArch Ludwigsburg, B162/6904, Bl. 235. 41 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 89 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 9 ; Thomas Zuche : „Absondern, diffamieren, entwürdigen, zerbrechen…“ – das KZ Hinzert, in : Ders. (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 102–112, hier S. 111 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 48. 42 AnLux, CdG-087, Bl. 2 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 341 ; Matthias Gerstlauer : Das SS-Sonderlager Hinzert im Organisations- und Machtgefüge der SS, Magisterarbeit Universität Trier 1996, S. 49 und 132 ; Schneider : Waffen-SS, S. 231.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
Laut Volker Schneider waren ab November 1941 etwa 20 Beamte im Wechsel im Hinzerter Vernehmungskommando beschäftigt. Schneider nimmt an, dass mindestens zwei bis drei von ihnen immer im Lager präsent waren.43 Nach aktuellem Forschungsstand kann von mindestens 22 Gestapobeamten ausgegangen werden, die dem Vernehmungskommando zwischen April 1941 und August 1944 angehörten. Sieben von ihnen stammten aus den Reihen der Gestapo Trier, 15 waren Mitarbeiter der Gestapo Luxemburg.44 Verglichen mit den Mitgliedern der SS-Wachmannschaft (zeitweilig waren es bis zu 30045 Mann) war die Gruppe der Gestapobeamten des Hinzerter Vernehmungskommandos zahlenmäßig sehr gering – was ihrem Terror Häftlingen gegenüber jedoch keinen Abbruch tat.
Die Verhör- und Foltermethoden der Geheimen Staatspolizei in Hinzert
Da keinerlei Originaldokumente des Vernehmungskommandos, etwa Verhörprotokolle, als historische Quellen erhalten sind,46 wurde zur Rekonstruktion der Verhör- und Foltermethoden der Gestapo in Hinzert vornehmlich auf die vor dem Luxemburger Gerichtshof für Kriegsverbrechen gemachten und verschriftlichten Zeugenaussagen und Stellungnahmen der Angeklagten im Rahmen des Gestapound Einsatzkommando-Prozesses zurückgegriffen. Zeugenaussagen zufolge stand 43 Volker Schneider : Der dritte Kommandant des ehemaligen SS-Sonderlagers/KZ Hinzert : Paul Sporrenberg, in : Hans-Georg Meyer/Hans Berkessel (Hg.) : „Für die Außenwelt seid Ihr tot !“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz. Bd. 2), Mainz 2000, S. 182–224, hier S. 201 ; Ders.: Waffen-SS, S. 232 und 253. 44 Namentlich zu nennen sind hier Fischer (Vorname unbekannt), Heinrich Hedderich, Bernard Rockel, Andreas Sack, Albert Schmidt, Heinrich Gustav Schulte und Franz Karl Stattmann (Gestapo Trier) sowie Karl Bieler, Herbert Gerhard Paul Butzke, Wilhelm Dörstel, Max Heiden, Hans Klöcker, Adolf Moritz, Sebastian Ranner, Rudolf Rathke, Max Reiter, Fritz Schmidt, Josef Schnitzler, Ruppert Schober, Wilhelm Siemens, Gerhard Simon und Franz Edmund Otto Suder (Gestapo Luxemburg) ; vgl. Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 88, 341 und 592 ; Schneider : Waffen-SS, S. 253 ; AnLux, CdG-079, S. 22v ; AnLux, CdG-087, Bl. 2, 11, 45 ; BArch Koblenz, AllProz 21/202, Bl. 354 ; BArch Koblenz, AllProz 21/278 ; BArch Berlin, R 58/1112, Bl. 102–113 ; Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 14/2, Bl. 346 ; Gestapo-Liste, in : NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz (NS-Dok RLP), 41/78. Heinrich Hedderich war zuvor bereits Mitglied des „Vernehmungskommandos Wittlich“ der Gestapo Trier gewesen und hatte sich dort offenbar bereits „bewährt“ ; vgl. Sabrina Nowack : Sicherheitsrisiko NS-Belastung. Personalüberprüfung im Bundesnachrichtendienst in den 1960er Jahren (Veröffentlichungen der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 4), Berlin 2016, S. 454 f. 45 Wallerang : Besatzung, S. 109. 46 BArch Koblenz, AllProz 21/202, Bl. 488 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 7, 74 f. und 341.
103
104
|
Katharina Klasen
jedem Beamten in der Baracke des Vernehmungskommandos ein eigener Raum für Verhöre zur Verfügung.47 Auf diese Weise konnte die Gestapo mehrere Häftlinge gleichzeitig vernehmen, deren Aussagen abgleichen und sie bei Widersprüchen direkt einander gegenüberstellen.48 Einer der Räume war eine Art Waschraum, was für die Gestapobeamten den Vorteil hatte, dass sie die durch die Misshandlungen verursachten Spuren einfacher beseitigen konnten.49 Wann die Häftlinge nach ihrer Inhaftierung verhört wurden, variierte. Einige wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft in Hinzert zur Gestapobaracke gebracht, andere erst nach mehreren Tagen Aufenthalt im Lager.50 Dies konnte mit ihrer Einstufung zusammenhängen. Die Gestapo unterschied zwischen „Belasteten“ und „Schwerbelasteten“, wobei die Vernehmung eines „Schwerbelasteten“ Vorrang hatte.51 Manche Vernehmungen zogen sich über mehrere Monate hin.52 Dies mag daran gelegen haben, dass das Verhör ab einem gewissen Zeitpunkt als „vorerst abgeschlossen“ galt, weil die Gestapo mit ihren Ermittlungen nicht weiterkam. Fielen ihnen jedoch neue Details in die Hände, zogen die Beamten den bereits Verhörten wieder heran, um ihn mit ihren neuen Erkenntnissen zu konfrontieren. Auch die Anzahl der Vernehmungen, die ein Häftling in Hinzert über sich ergehen lassen musste, war unterschiedlich. Einige wurden nur einmal vernommen, andere bis zu 19 Mal.53 Das hing möglicherweise von dem verhörführenden Beamten ab, aber auch von der Schwere des Vorwurfs.54 Ebenso spielte die Standhaftigkeit des Häftlings eine Rolle. Es ist bekannt, dass Häftlinge vor ihrer Vernehmung bis zu 20 Strafrunden auf dem Appellplatz laufen mussten, wahrscheinlich mit der Absicht, ihren Willen zu brechen und sie körperlich ausgelaugt beim Verhör zu empfangen.55 Der Zeitzeuge Robert Stumper war sich sicher : 47 AnLux, CdG-061, S. 580 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 259 ; Schneider zufolge besaß die Gestapo nur zwei Räume ; vgl. Schneider : Waffen-SS, S. 259. 48 AnLux, CdG-061, Bl. 674 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 341. 49 Schneider : Waffen-SS, S. 259. 50 Edgar Christoffel : Der Weg durch die Nacht. Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der Zeit des Nationalsozialismus. Verfolgte aus Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager und Zuchthäuser des „Dritten Reiches“, Trier 1983, S. 223. 51 Hatte ein Luxemburger „deutschfeindliche Äußerungen“ getätigt, galt er als „belastet“. „Schwerbelastet“ war hingegen ein Häftling, der in eine Verschwörung verwickelt war ; vgl. Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 342. 52 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 67. 53 Luxemburger Wort vom 6. Januar 1950, in : BArch Koblenz, AllProz 21/278 ; BArch AllProz 21/201, Bl. 59 ; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 223. 54 Der Zeuge Camille Scholtes gab zu Protokoll, etwa 50 Mal verhört und mindestens 30 Mal mit dem Ochsenziemer misshandelt worden zu sein : vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 52 f. 55 AnLux, CdG-079, Bl. 27 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 342 ; Weiter-Matysiak : Hinzert
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
Die allgemeine Taktik der Gestapo-Verhöre kann man als Methode der Einschüchterung, der seelischen Zermürbung, der Vernichtung seelischer Spannkraft beschreiben. Bei Kleinmütigen, Nervös-Schwachen hatte die Gestapo leichtes Spiel, bei starken Persönlichkeiten wurden eben stärkere Register gezogen.56
Die Verhörmethoden der Gestapo waren vielfältiger Natur. Zu ihrem Repertoire gehörten lügnerische Versprechungen, gütige Zusprüche und freundlich wirkende Gesten (wie das Anbieten einer Zigarette), aber ebenso verbale Attacken und wüste Drohungen. Die Drohungen betrafen entweder den Tod des Häftlings oder die Verschleppung oder Umsiedlung seiner Familie.57 Der Zeitzeuge Paul Weber unterschied zwischen drei Vernehmungsmethoden : Die kulante, wo zum Ende dem Kunden das Rauchen gestattet wurde […] die strengere, wo nach stundenlangem Nase-an-der-Mauer-Stehen das ,ernstliche Zureden‘ mit Schlägen erfolgte […] der dritte Grad mit Treten, Gliederausrenken, Dunkelzelle und Stehbunker.58
Eine weitere Taktik der Gestapoagenten bestand darin, den Gefangenen zu sagen, bereits vernommene Häftlinge hätten ein Geständnis abgelegt, ein Abstreiten sei demzufolge zwecklos.59 Dies stellte die Häftlinge vor ein Dilemma, da sie nicht wussten, wie viel die Gestapo tatsächlich schon über sie in Erfahrung gebracht hatte.60 Legten sie ein Geständnis ab, lieferten sie der Gestapo möglicherweise neue Informationen. Schwiegen sie jedoch, konnte das Nachteile für sie haben, sofern die Beamten der Geheimpolizei tatsächlich bereits über weiterreichende Kenntnisse verfügten. Aus den gesichteten Prozessunterlagen geht hervor, dass die im Hunsrück (2002), S. 167 ; Bucher : SS-Sonderlager Hinzert, S. 426 ; Metty Barbel : Student in Hinzert und Natzweiler. Erlebnisaufsätze von KZ Nr. 2915 alias 2188, Luxemburg 1992, S. 33; Léon Posing : Erlebnisbericht von Posing Léon aus Ettelbrück, in : Bulletin Greg (Groupe de Recherches et d’Etudes sur la guerre 1940–1945) 1 (2008), S. 2–9, hier S. 2. 56 Robert Stumper : Gestapo-Terror in Luxemburg, Esch-Alzette 1949, S. 20. 57 AnLux, CdG-079, Bl. 18 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 21, 35, 39, 146 ; BArch Koblenz, AllProz 21/202, Bl. 299 ; BArch Koblenz, AllProz 21/342, Bl. 69 ; Joseph Schneider : In den Fängen der Gestapo. Erlebtes vom Standgericht, aus dem Konzentrationslager Hinzert, aus der Deportation nach Lublin (Polen) und aus dem Umsiedlungslager Wartha (Niederschlesien), Luxemburg 1945, S. 30 ; Stumper : Gestapo-Terror, S. 21 ; Schneider : Waffen-SS, S. 259 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 253, 259 und 341 f. 58 Paul Weber : Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg, Luxemburg 21948, S. 94 [Orthographie wie im Original]. 59 AnLux, CdG-079, Bl. 5 ; AnLux, CdG-087, Bl. 2. 60 Stumper : Gestapo-Terror, S. 21.
105
106
|
Katharina Klasen
Gestapo die Häftlinge oft mit ihrem Wissen konfrontierte, um ihnen die Ausweglosigkeit ihrer Situation bewusst zu machen.61 So legte Kriminalobersekretär Hans Klöcker dem Häftling Rudy Mach eine Mitgliederliste der Widerstandsgruppierung Lëtzeburger Volleks Legio‘n (LVL) vor, auf der dessen Name verzeichnet war.62 Ähnlich erging es dem Widerstandskämpfer Erny Gillen : Die Gestapo präsentierte ihm während des Verhörs die über ihn angelegte Akte. Die darin enthaltenen Aussagen belasteten ihn schwer.63 Obwohl die Gestapo nicht – wie so gerne propagiert wurde – allmächtig war, vermittelte sie mit solchen Machtdemonstrationen eine Aura der Allwissenheit.64 An dieser Stelle muss jedoch betont werden, dass die Beamten des Hinzerter Vernehmungskommandos nicht nur vorgaben, im Besitz von belastendem Material zu sein. In vielen Fällen entsprach dies den Tatsachen, wie die erfolgreichen Razzien der Gestapo im Großherzogtum Luxemburg belegen. Auch die direkte Gegenüberstellung mit anderen Häftlingen trug zur „Wahrheitsfindung“ bei. Hatte der andere Gefangene bereits gestanden, war ein Leugnen in den meisten Fällen unmöglich.65 Hartnäckiges Schweigen oder Abstreiten bestraften die Gestapobeamten mitunter mit mehreren Tagen Dunkelarrest und Einzelhaft im Lagergefängnis, dem sogenannten Bunker, oder indem sie die standhaften Widerstandskämpfer in besonders harte Arbeitskommandos einteilten.66 Der Zeuge Robert Streichen berichtete, dass er nach einem für den Beamten Adolf Moritz erfolg- und ergebnislos verlaufenen Verhör auf dessen Veranlassung hin zehn Tage lang ins Lagergefängnis gesperrt wurde. Das bedeutete : Einzel- und Dunkelhaft bei Wasser und Brot.67 Kriminalobersekretär Hans Klöcker bedrohte die Häftlinge darüber hinaus bevorzugt mit einer geladenen Pistole, um sie psychisch unter Druck zu setzen.68 Der Zeitzeuge Jean Pierre Cloos erinnerte sich : 61 Jean Zenner : Hinzert 1943–1944, in : Rappel 4/5 (1977), S. 127–137, hier S. 129 ; Barbel : Student, S. 43. 62 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 38. 63 Aussage Erny Gillen, in : Heiderscheid : Nie wieder, S. 12. 64 Schneider : Waffen-SS, S. 259. 65 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 11 ; AnLux, CdG-079, Bl. 68 f. und 87 ; AnLux, CdG-061, Bl. 677. 66 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 20, 37, 48 ; AnLux, CdG-079, Bl. 5, 9 ; AnLux, CdG-061, Bl. 555, 630 ; Barbel : Student, S. 41; Schneider : Waffen-SS, S. 84 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 161 und 414 ; Bucher : SS-Sonderlager Hinzert, S. 426 ; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 236 ; Zenner : Hinzert 1943–1944, S. 132 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 78 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 261 f. 67 AnLux, CdG-079, Bl. 5 ; Luxemburger Wort vom 6. Januar 1950, in : BArch Koblenz, AllProz 21/278 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 78 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 261 f. 68 AnLux, CdG-061, Bl. 656 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 25, 39 ; Schneider : Waffen-SS, S. 259.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
Abb. 1: Im Lagergefängnis in Hinzert (genannt „Bunker“) wurden Häftlinge unter verschärften Haftbedingungen eingesperrt. Aufnahme von 1946. (Quelle: Conseil National de la Résistance, Luxembourg).
Er zeigte mir eine Pistole, lud sie vor meinen Augen und sagte : Wenn Sie nicht sofort eingestehen, werde ich Sie niederknallen. Sie haben noch 2 Minuten Zeit. […] Er setzte mir die Pistole in den Nacken und sagte, in 2 Minuten werden Sie erschossen.69
Auch die sogenannte „good cop, bad cop“-Methode fand Zeugenaussagen zufolge Anwendung in den Gestapoverhören : Das eigentliche Verhoer wurde von schmit vorgenommen, waehrend Moritz anfangs stillschweigend zuhoerte. Als ich jedoch immerfort leugnete, einer luxemburgischen Widerstandsbewegung anzugehoeren, bot mir schmit eine Zigarette an, anscheinend um mir Vertrauen einzufloessen. Als ich diese jedoch verweigerte und weiterhin leugnete, trat moritz ploetzlich an mich heran und setzte mir die Pistole auf die Brust […].70
69 Aussage des Zeugen Jean Pierre Cloos, in : BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 25. 70 Aussage des Zeugen Auguste Schoettert, in : AnLux, CdG-079, Bl. 88 [Orthographie und Hervorhebung wie im Original].
107
108
|
Katharina Klasen
Eine weitere Strategie der Gestapo waren Machtdemonstrationen, die den Häftlingen die eigene Ohnmacht vor Augen führen sollten. Hierzu wurden beispielsweise Gefangene nach „verschärften Vernehmungen“71 nackt vorgeführt. Ein Blick auf die Spuren von Misshandlungen an deren Körpern sollte abschreckend wirken und mentalen Druck auf die anderen Häftlinge ausüben.72 Außerdem gab es Versuche, Häftlinge durch die Anwerbung als V-Mann zu einem Geständnis zu verleiten.73
Die Anwendung physischer Gewalt
Fruchteten alle diese Vernehmungsstrategien nicht, wurde zur Anwendung physischer Gewalt übergegangen. Zu den Folterpraktiken gehörten stundenlange Verhöre, in denen die Häftlinge mit Fußtritten, Faustschlägen, Stock- und Peitschenhieben malträtiert wurden.74 50 Schläge mit einem Gummiknüppel waren keine Seltenheit.75 Ein besonders beliebtes Folterinstrument der Gestapo war der Ochsenziemer.76 Oft mussten sich die Gepeinigten mit dem Gesicht zur Wand stellen (meist in gebückter Haltung) oder über einen Stuhl oder Tisch beugen, um die Schläge entgegenzunehmen.77 Damit sie den Schlägen nicht ausweichen, geschweige denn diese parieren konnten, waren sie in den meisten Fällen mit Handschellen gefesselt.78 Waren die Gestapobeamten mit einer Antwort ihrer Opfer unzufrieden, konnte es vorkommen, dass der jeweilige Häftling mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, gewürgt oder anderweitig gepeinigt wurde.79 Auch Methoden der Wasserfolter kamen zur Anwendung, so etwa das Überschütten mit kaltem Wasser im Winter.80 Laut Marcel Engel und André Hohengarten sind allerdings Folterme-
71 Siehe den Abschnitt „Die Anwendung physischer Gewalt“. 72 AnLux, CdG-079, Bl. 5. 73 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 57, 131, 171. 74 Ebd., Bl. 21, 35. 75 AnLux, CdG-088, Bl. 10 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 47 ; BArch Koblenz, AllProz 21/281, Bl. 254 ; Schneider : Waffen-SS, S. 259 ; Gerstlauer : Das SS-Sonderlager Hinzert, S. 101. 76 AnLux, CdG-088, Bl. 6 ; BArch Koblenz, AllProz 21/344, Bl. 34, 56 ; Schneider : Waffen-SS, S. 259. 77 Nicolas Heinen : Zeugnisse aus grosser Zeit. Aus dem heimatlichen, marianischen Schrifttum, Lu xemburg, 1978, S. 96. 78 AnLux, CdG-061, Bl. 575–580 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 160 und 341. 79 Barbel : Student, S. 41. 80 Luxemburger Wort vom 6. Januar 1950, in : BArch Koblenz, AllProz 21/278 ; Schneider : Waffen-SS, S. 259 ; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 236.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
thoden wie „Elektroschock, Hodenzerquetschung, Lötlampe, Badewanne usw., die anderorts praktiziert wurden“ für Hinzert nicht nachweisbar.81 Viele der geschilderten Foltermethoden gehörten zum Repertoire der sogenannten verschärften Vernehmung, einer euphemistischen Umschreibung, die in Wirklichkeit bedeutete : Routinemäßige Misshandlung und Folter zur Erpressung von Geständnissen.82 Laut Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul erhielt der Leiter einer Stapostelle ab Oktober 1941 die Kompetenz, „verschärfte Vernehmungen“ zu genehmigen und anzuordnen.83 Gemäß der Aussagen von Hartmanns ehemaliger Sekretärin Clara Wehmann waren Fritz Schmidt, Adolf Moritz, Rudolf Rathke, Franz Suder, Herbert Butzke und Hans Klöcker bekannt für die Durchführung „verschärfter Verhöre“ und die Misshandlung von Häftlingen.84 Nicht ersichtlich ist jedoch, wann die Gestapobeamten Gewalt anwendeten und wann nicht. Denn nicht jedes (hartnäckige) Schweigen im Verhör wurde mit Schlägen geahndet – was ein Hinweis darauf ist, dass die Gewaltherrschaft der Gestapo in Hinzert von Willkür geprägt war. Der im November 1941 festgenommene Robert Stumper erinnerte sich beispielsweise : [Ich] [w]urde bei den Vernehmungen nicht geschlagen, auch nicht von Suder, der der gefürchtetste Beamte im ganzen Gau Moselland und ein ausgezeichneter Psychologe war, der wusste, wie man mit den Festgenommenen am schnellsten zum Geständnis kommt.85
Die Aussage des luxemburgischen Hinzert-Überlebenden Christian Calmes vor dem Luxemburger Gerichtshof für Kriegsverbrechen steht exemplarisch für die unzähligen grausamen Vernehmungen, die von Beamten der Trierer und der Luxem burger Gestapo im SS-Sonderlager/KZ Hinzert durchgeführt wurden : Als ich bei der Vernehmung nicht sofort ein Geständnis machte, wurde ich von bieler auf die gröblichste Art und Weise misshandelt. Ich musste mich mit dem Bauch auf einen Stuhl legen und habe dabei von bieler immerhin 30 Schläge mit einem massiven Gummischlauch erhalten. Einschalten möchte ich hier, dass die Häftlinge bei diesen Vernehmungen gewöhnlich keine Hose getragen haben. […] Ausserdem wurde 81 Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 342. 82 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 15 ; BArch Koblenz, AllProz 21/344, Bl. 89 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 46, 341. 83 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 2), Bonn 1991, S. 236. 84 AnLux, CdG-061, Bl. 703 ; AnLux, CdG-079, Bl. 17. 85 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 7 [Orthographie wie im Original].
109
110
|
Katharina Klasen
ich von Bieler mit dem Handballen derart wuchtig an die Schläfe geschlagen, dass ich mit dem Kopfe gegen einen dort stehenden Schrank anstiess. Unter dem Druck dieser Misshandlungen, machte ich schliesslich ein teilweises Geständnis, das aber nicht in allen Teilen richtig war […] Es steht fest, dass jeder Häftling misshandelt wurde, der nicht sofort ein Geständnis machte. Aus früher stattgefundenen Vernehmungen und dabei erzielten Geständnissen, wussten die Gestapobeamten meist schon wie weit der Einzelne belastet war, bevor sie zu seiner Vernehmung schritten. Von szronka hiess es, dass man ihm ein kaltes Stück Eisen in den After gepresst hatte, um ihn zu einem Geständnis zu zwingen. Bei der Vernehmung von Pierre maroldt war szronka in demselben Vernehmungszimmer in einem Schrank eingesperrt und hatte dabei von dem Gestapobeamten die Aufforderung erhalten, bei jeder Unwahrheit die maroldt sagen würde, gegen die Türe des Schrankes zu klopfen.86
Aufgrund dieser grausamen Foltermethoden erlitten die Häftlinge schwerste körperliche und seelische Verletzungen. Einige überlebten die Vernehmungen durch die Gestapo nicht bzw. starben an den Folgen der zugefügten Misshandlungen. Zu den Opfern gehörten beispielsweise die Luxemburger August Konen, Karl Hansen, Léon Saeul, Pierre Nati und Bernhard Weber.87
Die Folgen der Vernehmungen
Die geschilderten Verhörpraktiken entsprechen den in der Gestapo-Forschung bekannten Vernehmungs- und Foltermethoden der Geheimen Staatspolizei.88 Durch die Effektivität der Verhör- und Foltertechniken gelang es dem Hinzerter Vernehmungskommando, zahlreiche Geständnisse zu erzwingen und mehrere Verhaftungswellen durchzuführen, in deren Folge über 1.500 Luxemburger nach Hinzert deportiert wurden. Einige der Gefangenen ließen sich aus Todesangst und Furcht 86 AnLux, CdG-079, Bl. 64–65 [Orthographie und Hervorhebung wie im Original]. 87 BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 218 ; BArch Koblenz, AllProz 21/344, Bl. 29 ; Luxemburger Wort vom 5. Dezember 1949, in : BArch Koblenz, AllProz 21/278 ; NS-Dok RLP, 28/503, Bl. 107 ; Dostert : Hinzert aus luxemburgischer Sicht, S. 63 ; Heinen : Zeugnisse aus grosser Zeit, S. 96 ; Stumper : Gestapo-Terror, S. 23 ; Schneider : Waffen-SS, S. 257 f.; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 236 ; Yveline Pendaries : Les process de Rastatt (1946–1954). Le jugement des crimes de guerre en zone française d’occupation en Allemagne, Bern u.a. 1995, S. 175 f. 88 Carsten Dams/Michael Stolle: Das Unternehmen Gestapo − Eine historische SWOT-Analyse, in: Manuel Becker/Christoph Studt (Hg.): Der Umgang des Dritten Reiches mit den Feinden des Regimes, Münster 2010, S. 79–97, hier S. 83 ; Hans-Joachim Heuer : Geheime Staatspolizei. Über das Töten und die Tendenzen der Entzivilisierung, Berlin u.a. 1995, S. 128–132.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
vor weiterer Quälerei „umdrehen“ und stellten sich der Gestapo als Spitzel zur Verfügung. Sowohl ihre Geständnisse als auch ihre Spitzeltätigkeit fügten der luxem burgischen Résistance einen erheblichen Schaden zu, was letztlich dazu führte, dass mehrere Widerstandsorganisationen gezielt zerschlagen wurden.89 Zugleich generierte und förderte die Gestapo auf diese Weise ihr Image, eine allmächtige, allwissende und allgegenwärtige Geheimpolizei zu sein.90 Zwischen 1941 und 1944 führte die Gestapo in Luxemburg mehrere Verhaftungswellen durch. Bei der ersten großen Razzia im November 1941 wurden 29491 Personen verhaftet und ins SS-Sonderlager/KZ Hinzert deportiert – so viele wie nie zuvor.92 Die Gefangenen wurden mit dem Vernehmungskommando konfrontiert.93 Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte die Gestapo das Lager zu einer „teuflischen Untersuchungs- und Folterstätte umfunktioniert“94. Eine weitere große Verhaftungswelle gab es nach dem Generalstreik Anfang September 1942, nach dessen Niederschlagung 20 luxemburgische Bürger in der Nähe des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert ermordet wurden.95 Zur Unterdrückung des Streiks erhielt der Trierer Gestapochef und Leiter des EKL, Fritz Hartmann, vom RSHA den Befehl, den zivilen Ausnahmezustand zu verhängen und ein Standgericht einzurichten.96 Das RSHA ernannte Hartmann zum Vorsitzenden dieses Gerichts.97 Als einer seiner beiden Beisitzer fungierte der Trierer Kriminalkommissar Albert Schmidt, der Leiter des Hinzerter Vernehmungskommandos. Insgesamt sprach das Standgericht 21 Todesurteile gegen willkürlich ausgewählte Streikteilnehmer aus. 20 von ihnen wurden zwischen dem 2. und 9. September
89 Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 342 f.; Schneider : Waffen-SS, S. 259 ; Dostert : Hinzert aus luxemburgischer Sicht, S. 63 ; Die Verhaftung der Eheleute Kipgen-Meiers aus Michelbouch, in : Bulletin Greg (Groupe de Recherches et d’Etudes sur la guerre 1940–1945) 1 (2000), S. 18–22, hier S. 21 ; BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 53, 128 ; AnLux, CdG-079, Bl. 102. 90 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ? Gestapo, Gesellschaft und Widerstand, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 41 (1993), S. 984–999. 91 AnLux, CdG-087, Bl. 17–34, darin eine vollständige Namensliste. 92 Vor dieser Aktion waren bis Oktober 1941 nur ca. 40 bis 50 Luxemburger in Hinzert inhaftiert gewesen, vgl. BArch Koblenz, AllProz 21/201, Bl. 179 ; Schneider : Waffen-SS, S. 139 f.; Dostert : Selbstbehauptung, S. 197 ; Welter/Bader : Luxemburger Häftlinge, S. 72. 93 AnLux, CdG-087, Bl. 8 ; Gerstlauer : Das SS-Sonderlager Hinzert, S. 72. 94 Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 88. 95 Stumper : Gestapo-Terror, S. 14 f. 96 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 21, 60 ; BArch Koblenz, AllProz 21/358, Bl. 36–39 ; Klopp : Hinzert, S. 39–42 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 20 ; Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 25 ; Bader : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 264 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 170 ; Barbel : Student, S. 80. 97 BArch Koblenz, AllProz 21/358, Bl. 44 ; Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 90.
111
112
|
Katharina Klasen
1942 von SS-Angehörigen standrechtlich erschossen.98 Darüber hinaus wurden 125 Menschen an die Gestapo überstellt und in verschiedene Konzentrationslager deportiert.99 Der Luxemburger Gerichtshof für Kriegsverbrechen legte Hartmann in der Nachkriegszeit zur Last, als Leiter des EKL die Festnahmen und Inhaftierungen angeordnet sowie als Vorsitzender des Standgerichts die Todesurteile verhängt und ihre Vollstreckung veranlasst zu haben.100 Das Gericht schrieb Hartmann und Schmidt die Verantwortung am Massenmord zu, weil sie an den verbrecherischen Todesurteilen unmittelbar mitwirkten und durch diese Todesurteile zu der völkerrechtswidrigen Hinrichtung der 20 Blutopfer […] eine derartige Beihilfe leisteten, daß ohne diese Beihilfe diese Verbrechen nicht hätten begangen werden können101.
Zwischen Oktober 1943 und Februar 1944 wurden rund 350 Luxemburger festgenommen und nach Hinzert verschleppt.102 Die Gewalt fand mit Voranschreiten des Krieges einen nächsten Höhepunkt in der Massenhinrichtung am 25. Februar 1944. An diesem Tag erschossen SS-Männer in der Nähe von Hinzert 23 Widerstandskämpfer aus Luxemburg. Für diese Massenexekution wurde in der Nachkriegszeit Walter Runge, Chef der Gestapo Luxemburg, vom Luxemburger Gerichtshof für Kriegsverbrechen mitverantwortlich gemacht.103 Zeugenaussagen zufolge hatte er gemeinsam mit Kriminalkommissar Gerhard Simon und Kriminalsekretär Fritz Schmidt die Selektion der 23 Todeskandidaten vorgenommen.104 Dieser Massenmord war eine direkte Folge von Ermittlungsergebnissen, die u.a. aufgrund der grausamen Verhörmethoden des Hinzerter Vernehmungskommandos erzielt werden konnten.105 98 Vgl. Landeszentrale : Verfolgung und Widerstand, S. 20 und 90 ; Heiderscheid : Nie wieder, S. 33 f.; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 242 ; Zuche : Absondern, S. 108 ; Pütz : Angehörige, S. 64. 99 Pütz : Angehörige, S. 66 ; Heiderscheid : Nie wieder, S. 34 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 179 ; Michel Pauly : Geschichte Luxemburgs, München 2011, S. 98 ; Weber : Geschichte, S. 69. 100 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 21 ; BArch Koblenz, AllProz 21/344, Bl. 81 ; Pütz : Angehörige, S. 66. 101 BArch Koblenz, AllProz 21/189, Bl. 87 [Orthographie wie im Original]. 102 Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 252 ; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 221–223. 103 BArch Koblenz, AllProz 21/282, Bl. 314 f. 104 AnLux, CdG-040, Bl. 318 ; AnLux, CdG-094, Bl. 2 ; AnLux, CdG-079, Bl. 65, 75 ; BArch Koblenz, AllProz 21/282, Bl. 314 ; Heiderscheid : Nie wieder, S. 41, 46–48 ; Pütz : Sporrenberg, S. 198 ; Landeszentrale :Verfolgung und Widerstand, S. 21, 94–97 ; Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 245 ; Klopp : Hinzert, S. 21 f. 105 AnLux, CdG-079, Bl. 5, 9, 22, 64, 66, 73–74, 79 ; Engel/Hohengarten : Hinzert, S. 244 f., 258 und 341.
Die Gestapo am „Ort des Terrors“
|
Die Gestapobeamten hatten den beiden durch die Lager-SS vollstreckten Hinrichtungen zwar nie beigewohnt, geschweige denn sie selbst durchgeführt, aber sie waren für die notwendige logistische beziehungsweise ermittlungstechnische Vorarbeit verantwortlich, durch die es überhaupt erst zu den Morden kommen konnte. Zudem hatten Angehörige der Gestapo in beiden Fällen die Entscheidungsgewalt darüber, welche Menschen bei den Aktionen hingerichtet werden sollten. Folglich ist die Mitverantwortung der Trierer und Luxemburger Gestapo für diese Morde unbestreitbar.
Das Ende des Vernehmungskommandos
Bis August 1944 ist die Anwesenheit der Vernehmungsbeamten Bieler und Moritz im SS-Sonderlager/KZ Hinzert nachweisbar.106 Im Spätsommer 1944 musste das Vernehmungskommando seine Tätigkeit in Hinzert einstellen, denn als die amerikanischen Truppen am 10. September 1944 das besetzte Großherzogtum befreiten, wurde das Kommando, dessen Hauptaufgabe das Vorgehen gegen luxemburgische Resistenzkräfte war, obsolet.107 Unabhängig vom Ende der Tätigkeit des Vernehmungskommandos wies die Geheime Staatspolizei jedoch noch bis Februar 1945 Häftlinge ins Lager ein. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass nicht nur Mitarbeiter aus Trier und Luxemburg Gefangene nach Hinzert verschleppen ließen. Auch die Staatspolizeistellen in Saarbrücken, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Neustadt an der Weinstraße, Darmstadt, Frankfurt am Main, Ludwigshafen, Karlsruhe, Magdeburg und Salzburg überwiesen Häftlinge nach Hinzert.108 Die Bedeutung des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert als „Ort des Terrors“ der Geheimen Staatspolizei wird insbesondere durch die dargelegten Verhör- und Foltermethoden sowie die in der unmittelbaren Nähe des Lagers durchgeführten Massenmorde untermauert.
106 AnLux, CdG-079, Bl. 66. 107 Ebd.; Pauly : Geschichte Luxemburgs, S. 101. 108 BArch Koblenz, AllProz 21/342, Bl. 85 ; Beate Welter : Zwangsarbeiter im SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Ein Forschungsüberblick, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 54–59, hier S. 58 f.; Schneider : Waffen-SS, S. 130 und 256 ; Robert Gellately : Hingeschaut und weggesehen. Hitler und sein Volk, Bonn 32005, S. 254 ; Lotfi : KZ der Gestapo, S. 69 ; Dies., SS-Sonderlager, S. 226 ; Mallmann/Paul : Herrschaft und Alltag, S. 315 und 360 ; Schneider : Waffen-SS, S. 256.
113
Felix Klormann
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/ Konzentrationslager Hinzert Zur Praxis des „Wiedereindeutschungsverfahrens“
Insgesamt 4,66 Millionen Zwangsarbeiter, davon 1,3 Millionen polnischer Herkunft, waren allein im November 1942 im Deutschen Reich zur Arbeit eingesetzt.1 Ohne Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten wäre die Wirtschaft des Deutschen Reiches kaum in der Lage gewesen, alle für den Krieg notwendigen Ressourcen zuverlässig zur Verfügung zu stellen.2 Das Ausmaß der Beschäftigung von „Fremdvölkischen“ barg in den Augen Heinrich Himmlers aber auch ein enormes Risiko, wollte er doch eine „Überfremdung“ der deutschen Bevölkerung unter allen Umständen vermeiden. Gerade aufgrund des „volksnahen“ Einsatzes der Zwangsarbeiter – etwa in der Landwirtschaft oder in kleineren lokalen Betrieben – schien es umso wichtiger, den Umgang mit ausländischen Arbeitskräften streng zu reglementieren. Entsprechend war der Alltag dieser Menschen von Verboten, Einschränkungen sowie einer Kennzeichnungspflicht geprägt. Bereits in den sogenannten Polen-Erlassen vom 8. März 1940 findet sich eine Passage, in der festgelegt wurde, dass der intime „verbotene Umgang“ mit einer deutschen Frau oder einem deutschen Mann mit dem Tode zu bestrafen sei.3 In der Regel drohte den betroffenen (polnischen) Männern der Tod durch Erhängen, den (deutschen)
1 Zur Zwangsarbeit in der NS-Zeit vgl. u.a. Mark Spoerer : Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart u.a. 2011 ; Stefan Hördler u.a. (Hg.) : Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Begleitband zur Ausstellung „Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg“, Göttingen 2016 ; Ulrich Herbert : Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880–1980. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Berlin u.a. 1986. Vgl. auch Hedwid Brüchert/Michael Matheus (Hg.) : Zwangsarbeit in Rheinland-Pfalz während des Zweiten Weltkriegs. Mainzer Kolloquium 2002 (Geschichtliche Landeskunde, Bd. 57), Stuttgart 2004. 2 Isabel Heinemann : „Rasse, Siedlung, deutsches Blut“. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas (Moderne Zeit. Neue Forschungen zur Gesellschaftsund Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2), Göttingen 2003, S. 477. 3 Merkblatt „Pflichten der Zivilarbeiter und -arbeiterinnen polnischen Volkstums während ihres Aufenthaltes im Reich“ vom 8.3.1940, abgedruckt in : Praca przymusowa polaków pod panowaniem hitlerowskim, 1939–1945 (Documenta occupationis, Bd. X), Poznań 1976, S. 19.
116
|
Felix Klormann
Frauen eine mehrmonatige Haft in einem Konzentrationslager.4 Allerdings wurden diese Erlasse vom Reichsführer-SS, Heinrich Himmler, bereits im Jahre 1941 folgendermaßen geändert : Rassische Beurteilungen von Fällen, die zu einer Sonderbehandlung führen können, sollen daher in Zukunft nur von den Führern des Rasse- und Siedlungswesens [RuS-Führer] bei den Höheren SS- und Polizeiführern oder den Referenten des Rasseund Siedlungshauptamtes-SS sowie bei den Ergänzungsstellen der Waffen-SS durchgeführt werden. […] Wird die Eindeutschungsfähigkeit anerkannt, entscheidet das RSHA weiter. […] Kommt eine Eindeutschung nicht in Betracht, so ist die übliche Sonderbehandlung unter Beifügung der vorgesehenen Unterlagen einschließlich des vom RuS-Führer gefertigten Gutachtens vorzuschlagen.5
Dies bedeutet, dass der „üblichen Sonderbehandlung“, sprich : der Hinrichtung durch Erhängen, eine „rassische Beurteilung“ vorausgehen sollte, mit deren Hilfe eine mögliche „Eindeutschungsfähigkeit“ festgestellt werden konnte. Der Grund für diese „Bewährungschance“ liegt auf der Hand : Abgesehen von den vermeintlichen Risiken versprach der Fremdarbeitereinsatz auch ein großes Potential. So war zum einen gewährleistet, der massiven Nachfrage nach Arbeitern gerecht zu werden, zum anderen, die polnische „(Rassen-)Elite“ für die eigenen Zwecke zu nutzen. Denn – so dachten die „Rasseexperten“ des NS-Regimes – es existierte auch in den „minderwertigen“ Völkern der Sowjetunion und Polens ein geringer Anteil an „arischem“, sogenanntem „kostbaren Blut“.6 Der nationalsozialistischen Rassentheorie entsprechend waren jene Betroffenen, denen diese Eigenschaften nachgesagt wurden, angeblich besonders durchsetzungsstark, intelligent und mit überdurchschnittlichen Führungsqualitäten ausgestattet. Das übergeordnete Ziel war es demnach, diese „Eliten“ als „erwünschten Bevölkerungszuwachs“ in den „deutschen Volkskörper“ zu integrieren. Für Himmler ging es darum, einerseits rassisch wertvolle Familien dem deutschen Arbeitseinsatz zuzuführen, andererseits, dem polnischen Volkstum diejenigen nordisch bestimmten Familien zu entzie4 Joseph Wulf : Aus dem Lexikon der Mörder. „Sonderbehandlung“ und verwandte Worte in nationalsozialistischen Dokumenten, Gütersloh 1963, S. 50 f. Zum Schicksal der Frauen vgl. Eginhard Scharf : Die Verfolgung pfälzischer Frauen wegen „verbotenen Umgangs“ mit Ausländern, in : Hans-Georg Meyer/Hans Berkessel (Hg.) : „Unser Ziel ist die Ewigkeit Deutschlands“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 3), Mainz 2011, S. 79–88. 5 Schnellbrief des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei vom 5. Juli 1941, zit. nach : Wulf : Lexikon der Mörder, S. 52. 6 Peter Longerich : Heinrich Himmler. Biographie, München 32008, S. 612.
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
hen, aus denen sich erfahrungsgemäß die polnische Führerschicht in der Hauptsache zu ergänzen pflegte.7
Um dies zu gewährleisten, wurde bereits 1940 das „Wiedereindeutschungsverfahren“ (WED-Verfahren) entwickelt und in Kraft gesetzt.8 Das Resultat : Ein perfides zweigliedriges System, das polnische Zwangsarbeiter aufgrund charakterlicher und „rassischer“ Prüfungen entweder in „eindeutschungsfähige“ oder „minderwertige“ Menschen einteilte. Überstand der Betroffene die erste „rassische Musterung“, wurde er ins „Altreich“ verbracht und dort in ein Konzentrationslager eingewiesen. Sofern er alle Anforderungen erfüllen konnte, wurde er als „erwünschter Bevölkerungszuwachs“ anerkannt und entlassen. Alle Überprüften, die nicht den Anforderungen entsprachen, wurden entweder – sofern Sie aufgrund des „GV-Delikts“ verhaftet wurden – direkt hingerichtet oder auf unbestimmte Zeit in ein Konzentrationslager gesperrt. Die Hinrichtung erfolgte meist in der Öffentlichkeit und andere Zwangsarbeiter mussten ihr beiwohnen oder sogar die Henker unterstützen. So wollte die zuständige Gestapo die Hinrichtung nicht nur zur Bestrafung nutzen, sondern sie diente auch zur Abschreckung. Jedem, der sich des „verbotenen Umgangs“ strafbar machte, drohte dasselbe Schicksal.9
Der geplante Ablauf des „Wiedereindeutschungsverfahrens“
Für das „Wiedereindeutschungsverfahren“ war folgender Ablauf vorgesehen :10 Machte sich ein Fremdarbeiter aufgrund des „verbotenen Umgangs“ strafbar und wurde inhaftiert, so hatte er die Möglichkeit, eine „Wiedereindeutschung“ zu bean7 Anordnung über den Einsatz von eindeutschungsfähigen Polen vom 3.7.1940, zit. nach : Isabel Heinemann : „Wiedereindeutschungsfähig“ oder „unerwünschter Bevölkerungszuwachs“ ? Die Bedeutung der „Rassenauslese“ in der NS-Umsiedlungspolitik, in : Paula Diehl (Hg.) : Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, München 2006, S. 267–280, hier S. 275. 8 Der Grundgedanke des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ wurde am 9. Mai 1940 durch die Anordnung 17/II des Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums, Heinrich Himmler, festgelegt ; vgl. auch Gerhard Wolf : Ideologie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012, S. 218–227. 9 Thomas Muggenthaler : Verbrechen Liebe. Von polnischen Männern und deutschen Frauen. Hinrichtungen und Verfolgung in Niederbayern und der Oberpfalz während der NS-Zeit, Viechtach 2010, S. 7 ff. 10 Matthias Hamann : Erwünscht und unerwünscht. Die rassenpsychologische Selektion der Ausländer, in : Götz Aly u.a. (Hg.) : Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 1939–1945 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, Bd. 3), Berlin ²1989, S. 143–180.
117
118
|
Felix Klormann
tragen. Dafür war zunächst eine Musterung durch die zuständige Staatspolizeistelle notwendig, um sicherzustellen, ob die „rassischen“ Voraussetzungen erfüllt waren. Diejenigen, die diese Hürde überwanden, wurden im Anschluss als „Eindeutschungs-Polen“ (im Folgenden : „E-Polen“) für sechs Monate im SS-Sonderlager/ KZ Hinzert interniert, um dort auf ihre „charakterliche Eignung“ überprüft zu werden. Parallel dazu erfolgte seitens des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS (RuSHA) eine „rassische“ Musterung der Angehörigen, die sogenannte Sippenüberprüfung. Sofern beide Ergebnisse zugunsten des „E-Polen“ ausfielen, wurde er wieder entlassen, konnte die betroffene Frau heiraten und wurde in einem regimenahen Betrieb als Arbeitskraft angestellt. Das Ergebnis des Verfahrens fußte demnach auf einem komplexen System, das alle körperlichen, „rassischen“ wie geistigen Merkmale des Betroffenen auf bizarre Weise miteinander in Verbindung bringen sollte. Für das gesamte Verfahren war in der Theorie eine Dauer von etwa einem halben Jahr vorgesehen, was sich aber in der Praxis nur selten bestätigte. Die Abweichungen zwischen den normativen Vorgaben und der praktischen Umsetzung werden in diesem Beitrag erstmals behandelt. Dabei ist nach den Gründen zu fragen, die für die Diskrepanz – so viel sei an dieser Stelle bereits vorweggenommen – verantwortlich waren. Und wie wirkte sich das auf das Ergebnis des Verfahrens sowie das weitere Leben der Betroffenen aus ? Anhand qualitativer und quantitativer Analysen können einzelne Gesichtspunkte des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ in den Blick genommen werden. Ausgewählte Fallbeispiele sowie eine quantitative Analyse von 367 Personalakten11 (insgesamt waren es mindestens 916 „E-Polen“, die in Hinzert ab der Implementierung des Verfahrens bis zum Ende des Krieges inhaftiert waren12) dienen als Argumentationsgrundlage. Es gab mehrere Akteure, die das Ergebnis und damit das Leben der „E-Polen“ beeinflussten. Hervorzuheben sind die sogenannten Rasseexperten des RuSHA.13 11 Die zugrunde liegende Studie wurde im Auftrag der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert durchgeführt, die im Rahmen einer Kooperation mit dem International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen etwa 3.500 Dokumente aus deren Beständen zur Thematik erhielt. Diese beziehen sich auf 367 Personen. Darüber hinaus wurden Personenakten der Staatspolizeistelle Neustadt a.d. Weinstraße herangezogen, um auch die negative „rassische Musterung“ bei der Gestapo in die Untersuchung einbeziehen zu können ; vgl. Landesarchiv Speyer, Best. H 91, u.a. Nr. 524, 3398, 4225, 5943, 6091, 6767 und 6800. Insgesamt wurden 19 Fälle mit einer negativen „rassischen Musterung“ berücksichtigt. 12 Beate Welter : „Wenn Liebe zum Verbrechen wird“, Vortrag während der Fachtagung „Wenn aus Liebe ein Verbrechen wird. Zum Schicksal der Eindeutschungshäftlinge des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert“ am 13. Mai 2013 in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Diese Mindestanzahl ergibt sich aus der höchsten nachweisbaren Häftlingsnummer dieser Serie : E-916. 13 Isabel Heinemann : Ambivalente Sozialingenieure ? Die Rasseexperten des SS, in : Gerhard Hirschfeld/Tobias Jersak (Hg.) : Karrieren im Nationalsozialismus. Funktionseliten zwischen Mitwirkung und Distanz, Frankfurt a.M. 2004, S. 73–95.
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
Diese „RuS-Führer“ waren für die Kontrolle des Verfahrens und für die Musterung von Angehörigen im Rahmen der „Sippenüberprüfung“ verantwortlich und entschieden somit über das weitere Schicksal vieler Menschen.14 Mit Einführung des Verfahrens waren jedoch viel zu wenige dieser Eignungsprüfer für zu viele „E-Polen“ zuständig. Deshalb wurde in 14-tägigen Schnellkursen versucht, diesem Mangelzustand entgegenzuwirken. An der Gesamtsituation änderte sich allerdings wenig. Und dass das RuSHA weiterhin stetig unterbesetzt war, zeigt sich nicht zuletzt auch an den viel zu langen Wartezeiten, die im Rahmen der hier präsentierten Untersuchung ermittelt worden sind und regelmäßig 15 bis 18 Monate betrugen.15
Die Praxis des „Wiedereindeutschungsverfahrens“
Zunächst musste entschieden werden, ob ein Betroffener, dem „verbotener Umgang“ mit einer deutschen Frau vorgeworfen wurde, für das „Wiedereindeutschungsverfahren“ geeignet war. Das oblag der zuständigen Staatspolizeistelle. Um zugelassen zu werden, mussten die Betroffenen eine „Rasseuntersuchung“ über sich ergehen lassen. Nur wenn diese positiv ausfiel, war ihnen die Teilnahme am Verfahren gestattet und die Verlegung in das SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert16 wurde veranlasst. Die Grundlage der „Rasseuntersuchungen“ bildeten die sogenannten Rassekarten, welche sowohl Ergebnisse ärztlicher Untersuchungen und persönliche Daten enthielten als auch die „Rassenzugehörigkeit“, die sich aus 21 unterschiedlichen Parametern mit jeweils fünf Optionen von der Körperhöhe (sehr groß – groß – mittelgroß – klein – sehr klein) über die Augenlage (sehr tief – tief – mittel – flach – stark vorspringend) bis zur Hautfarbe (rosig-weiß – fahl-weiß/grau-weiß – gelblich – bräunlich – braun) ergab. Das endgültige Urteil wurde schließlich mit einer komplexen „Rassenformel“ ermittelt. Auf diese Weise wurden jene verhafteten Zwangsarbeiter, die in den Augen der Nationalsozialisten nicht über das vermeintliche „wertvolle Blut“ verfügten, von dem Verfahren ausgeschlossen. 14 Heinemann : „Rasse, Siedlung, deutsches Blut“, S. 480 f. 15 Markus Leniger : Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit“ und Umsiedlungspolitik 1933–1945. Von der Minderheitenbetreuung zur Siedlerauslese, Berlin 2006, S. 190 f. 16 Das SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert hatte im Verlauf seiner Existenz eine Reihe von Sonderfunktionen wahrgenommen, u.a. die Inhaftierung der „E-Polen“ oder auch der von Vichy-Frankreich ausgelieferten Deutschen, die sich in der französischen Fremdenlegion befanden. Zur Geschichte des Lagers in Hinzert vgl. Uwe Bader/Beate Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.) : Der Ort des Terrors, Bd. 5 : Hinzert, Auschwitz, Neuengamme, München 2007, S. 17–42.
119
120
|
Felix Klormann
Bereits aus der Vielzahl von Merkmalen, die während der ersten Untersuchungen erfüllt werden mussten, wird deutlich, dass schon die Musterung zu Beginn durch reine Willkür zu positiven oder negativen Ergebnissen führen konnte – ein willkürliches System von Auslese, Ausrottung oder auch „Eindeutschung“ entstand damit im Verfügungsbereich der regional zuständigen Staatspolizeistellen. Ein derartig beliebiges Vorgehen wird auch bei der vorgeworfenen „Straftat“ im folgenden Fallbeispiel deutlich, einem typischen Beleg für die eklatanten Unterschiede zwischen geplantem Vorgehen und tatsächlicher Umsetzung des Verfahrens : Das Schicksal des „E-Polen“ Josef Krajewski17, der am 10. Juni 1942 festgenommen wurde, weil er mit seinem Fuhrwerk einem Ortsbauernführer angeblich nicht ausreichend Platz gemacht hatte, als sich diese auf einem engen Weg begegnet waren, ist als besonders tragisch anzusehen. Denn zum Verhängnis wurde dem Polen nicht dieses „Vergehen“, sondern die Tatsache, dass ihm gerüchteweise vorgeworfen wurde, mit einer deutschen Frau eine sexuelle Beziehung zu führen. Nachdem sich seine vermeintliche Geliebte im Anschluss an Verhaftung und Verhör von Krajewski schließlich erhängte, wurde dieser Selbstmord als Schuldeingeständnis seitens der Frau gewertet und der Verdacht schien bestätigt. Josef Krajewski wurde daraufhin ohne handfeste Beweise des „verbotenen Umgangs“ beschuldigt. Nachdem er die „rassische Überprüfung“ überstanden hatte und als geeignet für eine „Wiedereindeutschung“ erschien, veranlasste man schließlich die „Sippenüberprüfung“ sowie die Internierung im SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Entlassen wurde er indes nie. Stattdessen starb er als KZ-Häftling im Krankenhaus in Hermeskeil.18 Trotz ausbleibender Beweise, lediglich auf Gerüchte und Vermutung hin, wurden also Menschen verhaftet und lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt, obwohl sie doch über sogenanntes wertvolles Blut verfügten. Darüber hinaus waren nicht nur die „E-Polen“ von diesen Repressalien betroffen. Den reichsdeutschen Frauen, die des „verbotenen Umgangs“ bezichtigt wurden, drohte ebenfalls eine Inhaftierung in einem der Konzentrationslager.19 17 Landesarchiv Speyer, Best. H 91, Nr. 5596. Vgl. auch Thomas Grotum : Die Ermittlungsakten der Geheimen Staatspolizeistelle Neustadt a.d.W. Ein außergewöhnlicher Quellenbestand im Landesarchiv Speyer, in : Walter Rummel (Hg.) : 200 Jahre Landesarchiv Speyer. Erinnerungsort pfälzischer, rheinhessischer und deutscher Geschichte, 1817–2017 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 122), Koblenz 2017, S. 111–114. 18 Aufgrund einer schweren Lungen- und Rippenfellentzündung schien eine vollkommene Genesung des Betroffenen in absehbarer Zeit unwahrscheinlich. Aus diesem Grund besiegelte SS-Sturmbannführer Dr. Theophil Hackethal, der verantwortliche Lagerarzt und gleichzeitige Leiter des Hermeskeiler Krankenhauses, das Schicksal des Betroffenen folgendermaßen : Die Haftdauer wurde verlängert und Krajewski wurde als „untauglich“ eingestuft. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus an den Folgen seiner in KZ-Haft erlittenen Krankheit ; Landesarchiv Speyer, Best. H 91, Nr. 5596. 19 Die Haftstrafe, die bei verbotenem Umgang mit osteuropäischen Arbeitern im Regelfall von der
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
Abb. 1: Auf der für jeden „E-Polen“ angelegten „Rassekarte“ wurde neben den Angaben zur Person und dem Delikt mit 21 physiognomischen Merkmalen die vermeintliche „rassische“ Zugehörigkeit des Häftlings ermittelt. (Quelle: Hamann: Erwünscht und unerwünscht, S. 149).
121
122
|
Felix Klormann
Konnte ein „E-Pole“ alle Anforderungen der Gestapo erfüllen und wurde er zum „WED-Verfahren“ zugelassen, folgte der lebensbedrohliche Aufenthalt in der „Sonderabteilung für Wiedereindeutschungsfähige“ im Hinzerter Lager. Dies war ein wichtiges Bewertungskriterium, schließlich sah man ausschließlich führungsstarke und belastbare Personen als „erwünschten Bevölkerungszuwachs“ an. Während der Haft musste sich der Betroffene durch besondere Aufgaben beweisen, teils als Funktionshäftling, aber auch den extremen Lageralltag bewältigen.20 Am Ende der Internierung oblag es offiziell der Lagerleitung, in einem Bericht ein positives oder negatives Urteil zu fällen und damit das Schicksal des Häftlings zu besiegeln. Der Lageralltag in Hinzert war geprägt von einer prekären Nahrungssituation,21 kräftezehrender Zwangsarbeit sowie der Willkür und den Launen des Wachpersonals. Das Ergebnis : ein rechtsfreier Raum voll unnötiger sowie übertriebener Gewalt. Zeitzeugen wie die „Nacht- und Nebel-Häftlinge“ Joseph de la Martinière und Peter Hassall beleuchten diesen Lageralltag eindrücklich in ihren Autobiographien. Bezüglich einer Situation decken sich alle Berichte der Betroffenen, seien es „E-Polen“ oder andere Häftlinge, die in Hinzert interniert waren : Die Begrüßung
Gestapo verhängt wurde, führte die betroffenen Frauen meist ins Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Es kam aber auch zu Sondergerichtsverfahren, die mit Zuchthausstrafen endeten. Eine Auswertung von 100 Akten der Staatspolizeistelle Neustadt a.d. Weinstraße, die das Delikt des „verbotenen Umgangs“ behandeln, verdeutlicht, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle (73) französische Kriegsgefangene zu enge Beziehungen zur deutschen Bevölkerung pflegten ; vgl. Scharf : Die Verfolgung pfälzischer Frauen, bes. S. 80 und 83–86. 20 Wie die Gerichtsprotokolle des Bezirksgerichts Bydgoszcz/Bromberg verdeutlichen, war etwa der „E-Pole“ Jan W. als „Kommando-Kapo“ bei der Firma Romika in Gusterath eingesetzt. Sein Aufgabenbereich lag in der Verteilung der Arbeiten und der Überwachung der Häftlinge. Er diente sozusagen als „verlängerter Arm“ des Wachpersonals. Somit befand sich W. in einer äußerst prekären Situation, schließlich war er dafür verantwortlich, dass die anfallenden Arbeiten ausgeführt wurden. Geschah dies nicht zur Zufriedenheit des Wachpersonals, wurde er als Funktionshäftling zur Rechenschaft gezogen. Merkte er also, dass Häftlinge ihre Arbeiten nicht richtig ausführten, war er gezwungen, zu reagieren, da er andernfalls selbst dafür bestraft werden sollte. So entstand ein durchdachtes System aus Druck und Bestrafung, dem sich der „E-Pole“ und alle anderen Häftlinge beugen mussten ; vgl. Heinz Ganz-Ohlig : Romika – „eine jüdische Fabrik“. Die Schuhfabrik in Gusterath-Tal zur Zeit ihrer vorwiegend jüdischen Inhaber Hans Rollmann, Carl Michael und Karl Kaufmann. Sowie Rollmann & Meyer in Köln und die damit zusammenhängende Firmen- und Familiengeschichte (Schriften des Emil-Frank-Instituts, Bd. 16), Trier 2012, S. 91. 21 Berichte des „Nacht-und-Nebel“-Deportierten Dr. Claude Meyroune erlauben Rückschlüsse auf die Ernährung der Gefangenen : 300 bis 500 Gramm Brot, eine fettarme Suppe, meist aus Kohl, ein halber Liter Tee- oder Kaffeeersatz – aus diesen Bestandteilen setzte sich die durchschnittliche Mahlzeit eines Häftlings in Hinzert zusammen. Dies ergibt eine Gesamtenergiemenge von unter 800 Kalorien, woraus ein massiver Gewichtsverlust der Häftlinge binnen der ersten zwei Monate resultierte ; vgl. Bader/Welter : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, S. 31.
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
seitens der Lagerleitung, die unmissverständlich klarmachte, in welcher misslichen Situation sich jeder einzelne von ihnen befand : Ihr seid hier nicht in einem Sanatorium. Ihr seid hier, um zu krepieren […]. Hier existiert ihr nicht mehr, Ihr seid nur noch Nummern […]. Ihr braucht überhaupt nicht zu hoffen, hier lebend rauszukommen. Hier warten reihenweise Särge auf euch : Ihr werdet sie im Vorübergehen sehen.22
So konnten sich auch „E-Polen“ – obwohl es Anordnungen gab, diese aufgrund ihres „wertvollen Bluts“ human zu behandeln – nicht sicher sein, die Haft unbeschadet zu überstehen. Besonders aufgrund der subjektiven Behandlung seitens des Wachpersonals und der Lagerleitung musste jeder Häftling täglich mit schweren Misshandlungen rechnen. Ähnlich wie auch bei der „rassischen“ Musterung eines potentiellen „E-Polen“ lassen sich auch im Hinblick auf die charakterliche Prüfung des nunmehr als Häftling in Hinzert Internierten Abweichungen von Norm und Praxis feststellen. So waren überdurchschnittlich lange Lageraufenthalte die Regel, bei manchen Betroffenen sogar, obwohl das Ergebnis der abschließenden „Sippenüberprüfung“ bereits vorlag. Im Fall des Inhaftierten Wladislaw B., der am 14. Juni 1915 in Rostoworow in Polen geboren wurde, zeigt sich eben dieser Umstand.23 Nach seiner Verhaftung 1943 (genauere Daten vor der Zeit in Hinzert sind bisher nicht bekannt) und einer „positiven rassischen Überprüfung“ gelangte er schließlich in das „Wiedereindeutschungsverfahren“. Während B. in Hinzert war, wurde auch die Musterung seiner Familie veranlasst. Am 23. Februar 1944 fiel diese jedoch negativ aus, so dass er trotz einer positiven Bewertung seitens der Lagerleitung für eine „Wiedereindeutschung“ nicht in Frage kam. Anders als vorgesehen, erfolgte jedoch nicht die Deportation in ein größeres Konzentrationslager. Stattdessen musste B. noch ein weiteres Jahr in Hinzert verbringen und wurde schließlich – so lässt es sich zumindest trotz der nach 1945 nicht mehr vorhandenen Unterlagen deuten – von den Alliierten befreit. Die grundlos verlängerte Haft in Hinzert sollte Wladislaw B. wohlmöglich am Ende das Leben gerettet haben, weil er so nicht frühzeitig in das System der Evakuierungs- und Todesmärsche der Jahre 1944/45 hineingeraten war, deren Strapazen viele Häftlinge zum Opfer fielen und deren Endpunkte oft Lager mit einer ausgesprochen hohen Todesrate waren. 22 Joseph de La Martinière : Meine Erinnerung als NN-Deportierter, Mainz 2005, S. 17. 23 ITS Bad Arolsen, Personalakte, Doc. No. 11342035#1 (1.2.2.1/0190–0374/0324/0179) und CM/1 Deutschland, Doc. No. 78914944#1 (3.2.1.1/B03841–03910/B03897/0002).
123
124
|
Felix Klormann
Grundsätzlich drängt sich die Frage auf, wie überhaupt charakterliche Urteile gefällt werden konnten, insbesondere wenn man in Betracht zieht, unter welchen Umständen die Häftlinge sich „bewähren“ mussten. Wenn sich die Betroffenen eines Vergehens wie Diebstahl oder Gewalt während der Haft schuldig machten, so ist dies zunächst auf die prekäre Lebenssituation zurückzuführen und nicht unbedingt auf den Charakter der Person. Gepaart mit den radikalen Ansichten, die Lagerleiter Paul Sporrenberg24 – ein zentraler Akteur im „WED-Verfahren“ – nachgesagt wurden, zeigt sich ein weiteres Mal, dass häufig Willkür statt Objektivität für den Ausgang des Verfahrens verantwortlich war. Hinzu kommt, dass sich Sporrenberg nicht persönlich von jedem „E-Polen“ ein genaues Bild machen konnte. Stattdessen war er auf die Aussagen und Beurteilungen seiner Untergebenen angewiesen, die die „E-Polen“ bei ihrer täglichen Zwangsarbeit bewachten.25 Es galt für die Betroffenen also nicht nur, die hohen Verantwortlichen im Lager zu überzeugen, sondern auch das weniger einflussreiche Wachpersonal. Dessen waren sich auch die Beamten im RuSHA bewusst, weshalb bei einer positiven „Sippenüberprüfung“ als Reaktion auf eine als subjektiv bewertete negative „charakterliche Beurteilung“ durchaus zusätzliche Bewährungschancen eingeräumt wurden. Solche Fälle sind es, die den breiten Handlungsspielraum der Akteure hervorheben und verdeutlichen, dass die Beurteilungen des Kommandanten des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert im „WED-Verfahren“ ein ums andere Mal ganz unterschiedlich – zu Gunsten oder zu Lasten der Betroffenen – ausgelegt wurden. Im Gesamtgefüge des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ spielte die „Sippenüberprüfung“ – obgleich formell mit der „rassischen“ sowie der „charakterlichen“ Beurteilung gleichgesetzt – eine übergeordnete Rolle. Das zeigt sich anhand der statistischen Erhebungen sowie diverser Sonderfälle.26 Wurde die Familie eines 24 Paul Sporrenberg (Jg. 1896) wurde von ehemaligen Häftlingen als unvorstellbar brutal charakterisiert. In einer biographischen Skizze wird er folgendermaßen beschrieben : „Bei ihm verschmolz ein pervertierter, primitiver Ordnungsbegriff mit den niederen Instinkten eines bildungsfernen, rohen Spießers“ ; Volker Schneider : Der dritte Kommandant des ehemaligen SS-Sonderlagers/KZ Hinzert : Paul Sporrenberg, in : Hans-Georg Meyer/Hans Berkessel (Hg.) : „Für die Außenwelt seid Ihr tot !“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Mainz 2000, S. 182–224, Zitat S. 183 ; vgl. auch Albert Pütz : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945. Das Anklageverfahren gegen Paul Sporrenberg (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Frankfurt a.M. u.a. 1998. 25 ITS Bad Arolsen, Personalakte, Doc. No. 11342974#1 (1.2.2.1/0190–0374/0329/0098). 26 Von den Betroffenen, deren Akten im Rahmen einer Abschlussarbeit untersucht wurden, konnten 32 Prozent aufgrund einer „negativen Sippenüberprüfung“ nicht „eingedeutscht“ werden. Zum Vergleich : In 54 Prozent der Fälle bestand der „E-Pole“ das Verfahren, während lediglich 13 Prozent der Betroffenen aufgrund einer negativen charakterlichen Bewertung nicht tauglich waren. Zieht man ausschließlich die negativen Ergebnisse des Verfahrens in Betracht, so sind 69 Prozent aufgrund einer negativen „Sippenüberprüfung“ nicht „eingedeutscht“ worden.
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
Häftlings im Rahmen der „Sippenüberprüfung“ positiv gemustert, während im gleichen Fall eine negative charakterliche Bewertung zu Buche stand, ist eine Prioritätenverschiebung zugunsten der „Sippenüberprüfung“ zu beobachten. Das Beispiel des Wladislaus G., der am 9. September 1943 zur „Wiedereindeutschung“ nach Hinzert gebracht wurde, verdeutlicht dies. Wie aus den Quellen hervorgeht, schien er besonders aufgrund körperlicher Gebrechen, die durchaus erst im Rahmen der Haft aufgetreten sein könnten, für eine „Wiedereindeutschung“ nicht geeignet gewesen zu sein. Diesem Urteil stand eine „positive Sippenüberprüfung“ gegenüber. Daraufhin erhielt er eine weitere Bewährungschance, welche er bestand. Er wurde entlassen und konnte in einem zivilen Betrieb eine Arbeit aufnehmen.27 Das RuS-Hauptamt-SS schlägt daher, vor allem aufgrund der sonst sehr günstigen Sippenbeurteilung vor, die Einbeziehung in das Wiedereindeutschungsverfahren vorzunehmen. Sobald jedoch auch bei diesen neuen Voraussetzungen die Wiedereindeutschung erfolglos erscheint, würde eine dauernde Einweisung in das KL angebracht.28
Offenbar spielte in den Augen der „Rasseexperten“ die „wiedereinzudeutschende“ Einzelperson eine weniger große Bedeutung als ihre im besten Fall „rassisch positiv gemusterte“ Familie. Die Gründe sind offensichtlich : So lag es im Interesse der Dienststelle, möglichst viele Familien mit „arischen“ Merkmalen herauszufiltern, nicht zuletzt um die Wichtigkeit der eigenen Tätigkeit zu untermauern. Des Weiteren wurde bei einer negativen „charakterlichen“ Bewertung der prekäre Lageralltag durchaus in die Beurteilung des Rasse- und Siedlungshauptamtes einbezogen. Hierbei handelt es sich um eine Verschiebung zugunsten der „Sippenüberprüfung“, die exemplarisch für die Abweichung von Norm und Praxis steht. Auch die verlängerte Haftdauer fiel häufig auf die „Sippenüberprüfung“ zurück, da das für die Untersuchung zuständige RuSHA in Litzmannstadt (Łódź)29 vor zwei grundsätzlichen Problemen stand : Einerseits war oft nicht nur der vom Verfahren Betroffene als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich, sondern auch weitere Familienangehörige, die es zu überprüfen galt. Andererseits wurde es mit Herannahen der Ostfront zunehmend schwieriger, an die Unterlagen zur Überprüfung aller Familienmitglieder zu gelangen, wenn nämlich der Heimatort des „E-Polen“ nicht 27 ITS Bad Arolsen, Personalakte, Doc. No. 11343176#1 (1.2.2.1/0190–0374/0330/0100) ; Personalakte, Doc. No. 11343179#1 (1.2.2.1/0190–0374/0330/0103) ; Personalakte, Doc. No. 11343183#1 (1.2.2.1/0190–0374/0330/0107). 28 ITS Bad Arolsen, Personalakte, Doc. No. 11343176#1 (1.2.2.1/0190–0374/0330/0100). 29 Zur Geschichte des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS vgl. grundsätzlich Heinemann : „Rasse, Siedlung, deutsches Blut“.
125
126
|
Felix Klormann
mehr im deutschen Einflussbereich lag. Nicht zuletzt an den vielen Betroffenen, deren Verfahren nach der Befreiung noch nicht abgeschlossen waren, zeigt sich dieser Umstand,30 auch wenn davon auszugehen ist, dass ein Teil dieser offenen Verfahren schlichtweg aufgrund verschollener Akten heute nicht mehr vollständig dokumentiert werden können.
Das Problem der Zuständigkeiten
Es gibt einige Fälle, bei denen der verantwortliche Akteur für einen abweichenden Verlauf des Verfahrens gar nicht ausgemacht werden kann. Wer war für die Verlängerung der Haft federführend, wenn alle Auflagen erfüllt wurden ? Anders als im Fall von Wladislaw B., der nicht als „wiedereindeutschungsfähig“ gemustert wurde und womöglich daher noch weiter inhaftiert blieb, ist das folgende Schicksal anders gelagert. Warum Franz B., der am 11. April 1911 in Zaborowiec, Polen, geboren wurde, nach Deutschland kam, ob als Zivil- oder Zwangsarbeiter, geht aus den Akten nicht hervor. In die Fänge der Gestapo geriet er, weil er eine intime Beziehung zur vier Jahre älteren Emma W. unterhielt. „Ich wäre nicht abgeneigt[,] den Polen später zu heiraten, falls dies behördlicherseits zulässig ist“31, bekräftigte die Betroffene im Verhör bei der Gestapo Neustadt an der Weinstraße. Ihr Geliebter wurde nach positiver „rassischer Musterung“ in das „Wiedereindeutschungsverfahren“ aufgenommen. Die gesamte Haft dauerte vom 15. Februar 1943 bis zum 7. August 1944, also fast 18 Monate. Der positive Befund der „Wiedereindeutschungsfähigkeit“ war der Lagerleitung in Hinzert bereits am 12. Mai 1944 vom RuSHA übermittelt worden. Bemerkenswert ist zudem, dass das Rasse- und Siedlungshauptamt erst am 13. September 1943 – also fünf Monate nach der Einweisung des B. in Hinzert am 14. April 1943 – aktiv wurde und die genaue Anschrift sowie die Lichtbilder der Eltern und Geschwister anforderte, um die Familie des Betroffenen auf ihre „rassischen Merkmale“ zu überprüfen.32 Die gewünschten Informationen erreichten das RuSHA am 15. Oktober 1943. Wieder vergingen sieben Monate, bis der positive Ausgang der „Sippenüberprüfung“ mitgeteilt wurde. Ob dies aufgrund der Anzahl der zu bewältigenden Verfahren oder einer möglicherweise nicht 30 Bei 91 der 367 untersuchten Personalakten konnte kein valides Ergebnis über den Verbleib nach Kriegsende festgestellt werden. 31 Landesarchiv Speyer, Best. H 91, Nr. 6800. 32 Mutter und Kind sterben am 23. Mai 1943 kurz nach der Geburt. Ein Zusammenhang mit der verzögerten Bearbeitung der „Sippenüberprüfung“ geht aus den Akten nicht hervor, kann aber auch nicht ganz ausgeschlossen werden ; vgl. ebd.
„Eindeutschungs-Polen“ im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert
|
so schnell zu ermittelnden Angabe erfolgte, muss offen bleiben. Hätte das RuSHA gleich im Oktober 1943 reagiert, wäre die Haftzeit in Hinzert möglicherweise auf ein halbes Jahr beschränkt geblieben. Jedenfalls lag der folgende, auf den 21. Oktober 1943 datierte und an das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) gerichtete, positive Führungsbericht von Lagerleiter Sporrenberg vor : B[…] ist ein williger und fleissiger Häftling, der die ihm übertragenen Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt hat. Gegen eine Eindeutschung werden von uns aus Bedenken nicht erhoben.33
Dennoch wurde die Schutzhaft um mehrere Monate verlängert, so dass als nächster Entlassungstermin der 18. Februar 1944 festgelegt wurde. Ähnlich verlief es kurz vor der geplanten Freilassung im Februar 1944. Es erfolgte eine weitere Verlängerung der Haftdauer mit der Anfrage auf Entlassung am 25. Juli 1944. Der endgültige Marschbefehl, der gleichzeitig auch für eine gelungene „Wiedereindeutschung“ stand, ging schließlich am 7. August 1944 in Hinzert ein. Warum die Haftdauer zweimal verlängert wurde, obwohl bereits feststand, dass B. sowohl „rassisch“ als auch „charakterlich“ geeignet erschien und seine Familie „positiv gemustert“ worden war, ist nicht ersichtlich und belegt ein weiteres Mal, dass der vorgesehene Ablauf in der Praxis nicht immer eingehalten wurde – in diesem Fall sogar bei durchweg positiven „Befunden“.34
Fazit
Die genannten Beispiele belegen, dass das „Wiedereindeutschungsverfahren“ in den Augen der Verantwortlichen zwar als ausgereiftes System zur Identifikation „eindeutschungswürdiger“ Osteuropäer galt, es in der Praxis jedoch nur in den seltensten Fällen nach den Vorgaben ablief. Nach pseudo-wissenschaftlichen Kriterien und mit willkürlich auslegbaren Ergebnissen sollte einer kleinen Gruppe von Betroffenen der Weg (zurück) in die „Volksgemeinschaft“ ermöglicht werden. Dies betraf natürlich auch die involvierten Frauen und den (erwarteten) Nachwuchs – denn oft wurde der „verbotene Umgang“ erst durch eine Schwangerschaft oder Geburt bekannt. Nichtsdestotrotz konnten auch unbewiesene Beschuldigungen oder Aussagen im Rahmen einer „verschärften Vernehmung“ dazu führen, dass die zuständige Staatspolizeistelle eine „rassische Musterung“ vornahm. Fiel diese 33 Ebd. 34 Ebd.
127
128
|
Felix Klormann
„Berechnung nach der Rasseformel“ negativ aus, bedeutete dies die Hinrichtung des Beschuldigten. Somit stellte die Gestapo die erste und entscheidende Hürde dar, um dem sicheren Todesurteil zu entgehen und überhaupt in das Verfahren zu gelangen. Dass selbst dies keine Garantie war, zu überleben, verdeutlicht eindrucksvoll das Schicksal von Josef Krajewski. Die Beurteilungen über die „E-Polen“ während des Lageraufenthaltes in Hinzert sind ebenfalls als subjektiv zu bewerten. Schließlich basierten die Einschätzungen der Lagerleitung auf Handlungen der Häftlinge, die von Todesangst und Rechtsfreiheit geprägt waren. Dessen waren sich auch die „RuS-Führer“ bewusst, was teilweise zu zusätzlichen „Bewährungschancen“ führte, dabei aber auch den Lageraufenthalt verlängern konnte. Die übermäßig langen Haftzeiten waren jedoch nicht nur auf die Bedingungen vor Ort zurückzuführen. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS in Litzmannstadt hatte immer wieder Probleme, die „Sippenüberprüfungen“ ordnungsgemäß und in der vorgesehenen Zeitspanne von sechs Monaten durchzuführen. Das hatte zwei Gründe : zum einen die personelle Unterbesetzung, die bereits bei Einführung des „Wiedereindeutschungsverfahrens“ zu beobachten war, zum anderen die Schwierigkeiten, die aufgrund der herannahenden Front bzw. der ebenfalls zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppten Familienangehörigen entstanden. Welcher Akteur auch in den Blick genommen wird, jede zuständige Stelle hatte ihre Befugnisse zwar wahrgenommen, die Ergebnisse jedoch weder im geplanten Zeitraum noch mit der vorgeschriebenen Art und Weise erzielt. Abschließend stellt sich noch eine Frage, die bisher in der Forschung noch nicht erschöpfend behandelt wurde : Was geschah mit den betroffenen Frauen oder den Kindern ? Es ist bekannt, dass die Frauen oftmals in das Konzentrationslager Ravensbrück deportiert wurden.35 Welche Auswirkungen das „WED-Verfahren“ auch noch in der Nachkriegszeit hat, zeigt eine eindrucksvolle Reportage des Bayerischen Rundfunks, in welcher die Schicksale der Frauen und auch der gezeugten Kinder beleuchtet werden. Das Fazit der Reportage lautet : Auch in der Gegenwart gibt es noch viele Betroffene, die unter dem „Wiedereindeutschungsverfahren“ zu leiden haben.36
35 Insa Eschebach : „Verkehr mit Fremdvölkischen“. Die Gruppe der wegen „verbotenen Umgangs“ im KZ Ravensbrück inhaftierten Frauen, in : Dies. (Hg.) : Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Neue Beiträge zur Geschichte und Nachgeschichte (Forschungsbeiträge und Materialien der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 12), Berlin 2014, S. 154–173 ; Scharf : Die Verfolgung pfälzischer Frauen. 36 Verbrechen Liebe – Von polnischen Zwangsarbeitern und deutschen Frauen, BR Fernsehen, 2014.
Martin Spira
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier Die Tagesrapporte 1939 bis 1942
Die Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, alle staatsgefährlichen Bestrebungen im gesamten Staatsgebiet zu erforschen und zu bekämpfen […].1
Durch diesen Satz wird im ersten Paragraphen des dritten Gestapo-Gesetzes vom 10. Februar 1936 die Aufgabe der Geheimen Staatpolizei definiert. Was unter „staatsgefährlichen Bestrebungen“ zu verstehen ist, wird dort allerdings nicht genauer erläutert. Diese unklare Abgrenzung des Tätigkeitsfeldes der Gestapo war freilich so gewollt. Die Reichweite dieses zentralen Instrumentes des nationalsozialistischen Terrorapparates sollte nicht eingeschränkt werden. Gleichzeitig bedeutete dies jedoch auch zwangsläufig, dass die Gestapo dieser Aufgabe unmöglich in ihrer Gänze gerecht werden konnte. Zu weit war das Feld, das sie mit ihrer begrenzten Zahl an Kräften und Mitteln überwachen sollte. Hinzu kam eine ständige Aufgabeninflation, die während des Krieges mit der Bekämpfung der Wehr- und Wirtschaftskraftzersetzung und der Überwachung der Zwangsarbeiter ihren Höhepunkt erreichte.2 Somit war die Geheime Staatspolizei gezwungen, bei ihrer Überwachungs- und Sanktionierungstätigkeit Schwerpunkte zu setzen und sich auf bestimmte Feinde zu konzentrieren. Im Laufe der nationalsozialistischen Herrschaft verschoben sich diese Schwerpunkte der Verfolgung immer wieder und passten sich den politischen und gesellschaftlichen Bedingungen an. Diese Phasen, sowie die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehenden Vergehen und Verbrechen, wurden in der Wissenschaft schon häufiger untersucht, sodass wir heute über eine recht gute Übersicht über die Tätigkeit der Gestapo verfügen.3 Dies gilt allerdings nur für einen allgemeinen Überblick. Die genauen Tätigkeiten der regionalen Gestapostellen sind hinge1 Drittes Gestapo-Gesetz vom 10. Februar 1936, in : Quellen zur Geschichte Thüringens. Die Geheime Staatspolizei im NS-Gau Thüringen 1933–1945, hg. von Marlis Gräfe u.a., Erfurt 2009, S. 92–95, hier S. 95. 2 Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 4 2017 (2008), S. 106. 3 Eine kurze Übersicht findet sich zum Beispiel in ebd., S. 103–106.
130
|
Martin Spira
gen nur lückenhaft erforscht. An dieser Stelle soll dieser Beitrag ansetzen und der Frage nachgehen, auf die Verfolgung welcher Verbrechen sich die Gestapo Trier in der ersten Hälfte des Zweiten Weltkrieges konzentrierte. Dabei dient eine bisher in der Forschung vernachlässigte Quelle als Grundlage der Untersuchung : die Tagesrapporte der Gestapo.
Die Funktion der Tagesrapporte
Im nationalsozialistischen Deutschland spielte eine verzweigte, umfangreiche Berichterstattung regionaler Behörden und Parteiorganisationen an die Zentralbehörden in Berlin eine bedeutende Rolle bei der Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung und des Widerstandes. Die Berichte waren somit Teil des NS-Verfolgungssystems.4 Der Berichterstattung der Gestapo als dem zentralen nationalsozialistischen Überwachungs- und Terrororgan fiel dabei eine besondere Bedeutung zu. Die verschiedenen Berichte dokumentierten politische Verfolgung, polizeiliche Angelegenheiten, unterschiedliche Einzelereignisse aber auch die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung.5 Die Forschung widmete unter den verschiedenen Berichten der Gestapo bisher vorwiegend den Lageberichten besondere Aufmerksamkeit, die bis zu ihrer Einstellung im April 1936 monatlich verfasst wurden.6 Deutlich weniger Beachtung fanden bisher hingegen die Tagesrapporte der Geheimen Staatspolizei.7 Dies ist insofern verwunderlich, da die Tagesrapporte die einzige Gattung unter den Gestapoberichten darstellen, die seit ihrer Einführung am 1. Juni 1934 durchgängig und systematisch über beinahe den gesamten Zeitraum der NS-Herrschaft verfasst wurden. In diesen Berichten meldeten die regionalen Stapo-(Leit-)Stellen zunächst täglich, später dann unregelmäßiger politische Vorkommnisse und ergriffene Repressi4 Wolfgang Form/Ursula Schwarz : Die Tagesrapporte der Gestapo-Leitstelle Wien, in : Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (Hg.) : Politische Verfolgung im Lichte von Biographien (Jahrbuch 2011), Wien 2011, S. 209–229, hier S. 209. 5 Rainer Eckert : Gestapo-Berichte. Abbildung der Realität oder reine Spekulation ?, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 200–215, hier S. 200. 6 Ebd., S. 202. 7 Eine Ausnahme stellt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands dar, das die Tagesrapporte der Gestapo-Leitstelle Wien in einer Datenbank aufgearbeitet hat ; Brigitte Bailer/ Wolfgang Form (Hg.) : Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938–1945. Online-Datenbank http://db.saur.de/TRAP/login.jsf (Letzter Zugriff : 5.7.2017).
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
Abb. 1: Ein Tagesrapport der Gestapo Trier vom 5. März 1940, der über die Festnahmen der vergangenen Tage berichtet. (Quelle: LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792).
131
132
|
Martin Spira
onsmaßnahmen der letzten Tage nach Berlin.8 Mit ihrer Hilfe sollte die Stimmung, die politische Lage und die Sicherheitslage in den jeweiligen Regionen charakterisiert werden.9 Die Bedeutung, die die NS-Führung dieser Berichterstattung zumaß, wird auch in der Tatsache deutlich, dass sie per Eilmeldung nach Berlin geschickt werden sollten.10 Ab dem 16. November 1936 waren die Rapporte zusätzlich an die SD-Ober- und -Unterabschnitte zu übermitteln,11 was möglicherweise einer besseren Kooperation und Abstimmung zwischen den beiden Behörden dienen sollte, aber auch eine Kontrollfunktion gehabt haben könnte.
Die Tagesrapporte der Gestapo Trier
Grundlage dieser Arbeit sind 270 Tagesrapporte der Staatspolizeistelle Trier, die zwischen dem 27. September 1939 und dem 10. März 1942 verfasst wurden.12 Die Rapporte aus diesem Zeitraum sind fast vollständig erhalten, was den Bestand besonders wertvoll macht.13 Während der grundsätzliche Aufbau der einzelnen Berichte der in Abbildung 1 zu erkennenden Struktur entspricht, variiert die Anzahl an Einzelmeldungen pro Rapport sehr stark und reicht von einem bis zu 18 Einzeleinträgen pro Bericht.14 In 667 dieser insgesamt 856 Meldungen werden Festnahmen durch die Gestapo dokumentiert. Aber auch Berichte über Gerichtsurteile, Luftangriffe und Flug blattabwürfe sind zu finden. Dieser Aufsatz beschränkt sich jedoch auf die Betrachtung der berichteten Festnahmen. Die Meldungen über Festnahmen sind überwiegend kurz gehalten und enthalten lediglich wenige Angaben über den Delinquenten und knappe Informationen über den Grund der Verhaftung. Der einzelne Bericht ist aufgrund dieses niedrigen Informationsgehalts von geringerem historischem Interesse. Er dokumentiert nur einen Einzelfall und bietet somit keinen Blick auf die tatsächliche soziale, politische oder wirtschaftliche Situation. Isoliert betrachtet könnte er sogar aufgrund subjek-
8 Eckert : Gestapo-Berichte, S. 209. 9 Ebd. 10 Ebd., S. 212. 11 Ebd., S. 202. 12 Tagesrapporte der Gestapo Trier 27.09.1939 bis 10.03.1942 in : Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 442, Nr. 15792. 13 Der Untersuchungszeitraum wird durch die Quellenlage begrenzt, da nur vereinzelte Rapporte außerhalb dieses Zeitraums überliefert sind. 14 Tagesrapport Nr. 2 vom 10. März 1942, in : LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 659–663.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
tiver Informationsquellen ein verzerrtes Bild vermitteln.15 Statt einer qualitativen Auswertung einzelner Berichte bietet sich aber aufgrund des zusammenhängenden Bestandes und der vergleichsweise großen Zahl an Berichten eine quantitative Auswertung aller erhaltenen Rapporte an. Dies ist auch deshalb möglich, weil die Tagesrapporte Charakteristika serieller Quellen aufweisen. Das bedeutet, mit Hilfe dieser Quelle lassen sich Aussagen treffen, die weit über den Einzelfall hinausgehen. Somit können Tendenzen und Charakteristika der Entwicklung der Tätigkeit der Gestapo und der von ihr verfolgten Opfer im gesamten Untersuchungszeitraum aufzeigt werden. Als besonderer Vorteil erweist sich dabei die hohe Anzahl an überlieferten Berichten. Einzelne Fehler können dabei aufgrund der großen Zahl einigermaßen kompensiert werden und fallen somit weniger ins Gewicht. Abgesehen von einzelnen, bewussten oder unbewussten, Falschangaben kann die Zuverlässigkeit der Berichte insgesamt als relativ hoch eingeschätzt werden. Schließlich dienten die Tagesrapporte, wie die übrige Berichterstattung auch, dem NS-Regime als notwendige Lageeinschätzung. Zahlreiche grobe Fehler wären daher sicherlich nicht toleriert worden.16 Zu beachten ist hierbei allerdings stets, dass die Quelle die Perspektive der Verfolgungsbehörde wiedergibt. Sie ermöglicht keinen objektiven Blick auf die Realität, sondern ist geprägt durch die Intentionen und ideologisch geprägte Sichtweise der Geheimen Staatspolizei. Die Berichte über die Festnahmen stellen also nicht zwangsläufig einen Spiegel der tatsächlichen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Situation oder der Stimmung in der Bevölkerung und im Widerstand dar. Zum einen weil sie die Situation nur aus der Perspektive der Nationalsozialisten beleuchten, zum anderen da sie auch diese Perspektive nur verzerrt abbilden können, schließlich blieben viele Vergehen und Verbrechen unentdeckt oder wurden weniger stark verfolgt.17 Die Gestapo war personell häufig überfordert und konnte infolgedessen gar nicht alle Vergehen verfolgen. Sie fokussierte sich je nach politischen Vorgaben und aktuellen Erfordernissen häufig auf bestimmte Verstöße. Dieser Fokus verschob sich oftmals. Eine Ab- oder Zunahme an Festnahmen wegen eines bestimmten Vergehens muss also nicht bedeuten, dass sich die tatsächliche Häufigkeit dieser Straftat verändert hatte, sondern kann auch auf eine Intensivierung der Verfolgung dieser Taten seitens der Gestapo hinweisen. Die Tagesrapporte eignen sich somit nur bedingt, um Aussagen über die tatsächliche Stimmung, Lage und das Verhalten der Menschen in der Region Trier treffen zu können. Es sollten höchstens 15 Eckert : Gestapo-Berichte, S. 214. 16 Ebd., S. 206. 17 Als Beispiel sei hier die große Zahl unentdeckter „Rundfunkverbrechen“ genannt. Genauer nachzulesen bei Dams/Stolle : Gestapo, S. 92.
133
134
|
Martin Spira
vorsichtige Rückschlüsse getroffen werden oder Beobachtungen und Vermutungen aus weiterführenden Untersuchungen, basierend auf weiterem Quellenmaterial, gestützt werden.18 Für andere Forschungsbereiche ist diese Quelle hingegen umso ergiebiger, beispielsweise Untersuchungen, in deren Zentrum die alltägliche Arbeit der Gestapo selbst und deren Verfolgungstätigkeit steht. Auch bei einer Herangehensweise aus dieser Perspektive ist quellenkritisches Gespür gefragt. Denn natürlich haben die Tagesrapporte auch bei einer solchen Fragestellung ihre Grenzen und Schwächen. So gewähren die Rapporte vor allem in den Teilbereich der Festnahmen durch die Gestapo Einblicke. Wer auf der Suche nach Informationen über die Überwachungstätigkeiten und die Ermittlungsarbeit der Gestapobeamten ist, wird diese in der vorliegenden Quelle nur selten finden. Auch Sonderaktionen, die über die alltäglichen Festnahmen hinausgehen, sind in den Tagesrapporten der Gestapo Trier nicht zu finden. Insbesondere die zentrale Rolle der Gestapo bei der Organisation der Judendeportation bleibt unerwähnt.19 Trotzdem ermöglicht eine Analyse der Festnahmen, dem zentralen Werkzeug der Gestapo, direkte Rückschlüsse auf die alltägliche Arbeit der Behörde und die verschiedenen Schwerpunkte und Aufgaben der Geheimen Staatspolizei in Trier und Umgebung.
Die Entwicklung der Festnahmezahlen im Untersuchungszeitraum
Als Erstes soll hier die Entwicklung der Festnahmezahlen im Gesamten betrachtet werden. In den untersuchten Rapporten werden insgesamt 667 Festnahmen gemeldet. Die erste gemeldete Festnahme stammt vom 19. September 1939, die letzte vom 9. März 1942. Insgesamt 667 Festnahmen in etwa zweieinhalb Jahren klingen noch nach einer recht überschaubaren Zahl und könnten die Tätigkeit der Gestapo Trier auf den ersten Blick verharmlosen. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass dies ein Fehlurteil wäre, wie im Folgenden genauer erläutert werden soll.
18 Zu den Grenzen derartiger Berichte vgl. auch Peter Longerich : „Davon haben wir nichts gewusst !“. Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945, München 2006, S. 38–53. 19 Zimmermann stellt die Organisation und die Beteiligung der Gestapo an der Deportation am Beispiel der Stapo-Stelle Düsseldorf genauer dar ; vgl. Michael Zimmermann : Die Gestapo und die regionale Organisation der Judendeportation. Das Beispiel der Stapo-Leitstelle Düsseldorf, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 357–372, hier S. 358–368.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
Abb. 2: Anzahl der in den Tagesrapporten erfassten, monatlichen Festnahmen. (Quelle: Verfasser).
Zunächst sollte nicht unterschätzt werden, dass die reine Anzahl an Festnahmen nicht den Aufwand widerspiegelt, der im Vorfeld und Nachgang einer solchen Festnahme betrieben wurde, also die Ermittlungen, die Aufnahme von Zeugenaussagen, Verhöre, Dokumentation und so weiter. Zudem ist zu bedenken, dass bei weitem nicht jede staatspolizeiliche Ermittlung oder Überwachung auch eine Festnahme zur Folge hatte. Ein Verdächtiger konnte sich als unschuldig erweisen oder die Gestapo konnte es bei geringeren Vergehen bei Verwarnungen belassen, die allerdings effektive psychologische Wirkungen haben konnten. Schließlich wendete die Gestapo auch enorme Ressourcen zum reinen Sammeln von Informationen auf, um umfangreiches Wissen über die Bevölkerung zu erlangen. Hinzu kamen Sonderaufgaben, wie die Organisation der Judendeportationen. Die insgesamt 667 Festnahmen stellen also nur einen Ausschnitt aus der tatsächlich sehr viel umfangreicheren alltäglichen Tätigkeit der Gestapo dar. Ebenfalls sollte die geringe personelle Stärke der Staatspolizeistelle Trier bedacht werden. Laut Angaben vom August 1940 sollte mit gerade einmal 87 Beamten und Angestellten ein Gebiet von 5.321 km² mit 495.730 Einwohnern überwacht werden.20 Aus dieser Perspektive erscheint die eher überschaubare Zahl an Festnahmen nicht wie ein Hinweis auf die scheinbar geringe Bedeutung der Gestapo Trier, sondern vielmehr als ein Beleg für die Überforderung der Behörde, die selbst diese scheinbar geringen Festnahmezahlen nur durch die massive Mithilfe der Bevölkerung und anderer Behörden erreichen konnte.21 20 Schlüsselmäßige Stellenverteilung auf die Staatspolizei(leit)stellen (ohne Ostgebiete, Elsaß, Lothringen und Luxemburg), Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/856, Bl. 116–119, hier Bl. 119. 21 Gisela Diewald-Kerkmann : Denunziantentum und Gestapo, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 288–305, hier S. 289.
135
136
|
Martin Spira
Bei Betrachtung der Entwicklung der monatlichen Festnahmen (Abbildung 2) ist eine zyklische Abnahme der Festnahmezahlen in den Wintermonaten zu erkennen. Dies lässt sich mit dem durch die Jahreszeit bedingten Rückgang an Arbeiten in der Land- und Bauwirtschaft erklären. In diesen Bereichen waren ansonsten viele dienstverpflichtete Deutsche und ausländische Zwangsarbeiter tätig. Mit dem winterlichen Rückgang dieser Arbeitsstellen sanken somit auch die damit verbundenen Delikte und Festnahmen, wie Arbeitsvergehen oder Umgangsdelikte. Diese machten einen so erheblichen Anteil an den Gesamtfestnahmen aus, dass sich dieser Rückgang auch in den Tagesrapporten widerspiegelt. Jenes wichtige Feld der Arbeit der Gestapo wird im folgenden Abschnitt noch genauer behandelt. Neben der zyklischen Entwicklung sind auch zahlreiche kleinere Schwankungen zu erkennen. Allerdings sollten diese nicht überbewertet werden. Hierbei kann es sich um zufällige Veränderungen handeln, die aber aufgrund der insgesamt überschaubaren Zahlen stark ins Gewicht fallen, oder auch um Verzerrungen durch fehlende Rapporte, wie beispielsweise im Mai 1940. Aus diesem Monat fehlen wenigstens zwei, vermutlich sogar drei Rapporte. Dennoch fallen drei außergewöhnlich starke Schwankungen auf, deren nähere Betrachtung lohnt. Als Erstes stechen die hohen Festnahmezahlen im Oktober 1939 hervor. Hier ist das verschärfte Vorgehen der Geheimen Staatspolizei bei Kriegsbeginn zu erkennen, das die Einheit an der „Heimatfront“ gewährleisten sollte. Dass die Festnahmen im September 1939 niedriger erscheinen, liegt daran, dass der erste überlieferte Rapport erst vom 27. September 1939 stammt. Die ersten vier Rapporte des Monats fehlen leider. Dass dennoch immerhin 21 Festnahmen aus dem September überliefert sind, führt zu der Vermutung, dass die tatsächliche Anzahl an Verhaftungen noch deutlich höher lag. Die zweite interessante Schwankung ist ein stärkerer Anstieg der Verhaftungen im März und April 1940. Diese Steigerung lässt sich mit den Vorbereitungen auf den am 10. Mai 1940 beginnenden Westfeldzug erklären. Trier und die Umgebung waren aufgrund ihrer Lage unmittelbar von diesen Vorbereitungen betroffen. Bereits 1939 war eine große Anzahl an Soldaten in Trier stationiert.22 Nach dem Sieg über Polen wurden im unmittelbaren Vorfeld des Westfeldzuges weitere Truppen in die Region verlegt.23 Der gesamte Alltag war durch diese Einquartierungen geprägt. Insgesamt waren die Bevölkerungszahlen vorübergehend massiv erhöht, Trier war regelrecht überbelegt, die Versorgungslage war kritisch.24 Diese angespannte Situation hatte sicherlich auch einen Anstieg der Verbrechensrate zur 22 Emil Zenz : Die Stadt Trier im 20. Jahrhundert, Bd. 1 : 1900–1950, Trier 1981, S. 287. 23 Ebd., S. 319. 24 Ebd.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
Folge. Wichtiger noch ist allerdings, dass vermutet werden kann, dass die Gestapo im Vorfeld des Feldzuges besonders bemüht war, gegen Verbrechen und Verstöße vorzugehen, um mögliche Unzufriedenheit und Widerstand bereits frühzeitig zu unterdrücken und so die Stabilität der Grenzregion und die reibungslose Vorbereitung der Kriegshandlungen zu gewährleisten. Somit kann dieser Anstieg als eine regionale Ausprägung im Sinne des obersten Ziels der Gestapo, die Wehr- und Wirtschaftskraft im Krieg zu erhalten,25 angesehen werden. Auch der dritte ungewöhnliche Anstieg an Festnahmen Mitte 1941, insbesondere im Juli, lässt sich auf den Kriegsverlauf zurückführen, war jedoch eine reichsweite Entwicklung. Am 22. Juni 1941 begann der Angriffskrieg gegen die Sowjetunion. In der Vorbereitung und der Folge stieg das Sicherheitsbedürfnis der Nationalsozialisten deutschlandweit. Das Vorgehen gegen Oppositionelle wurde aus Angst vor möglichem kommunistischem Widerstand und Unzufriedenheit in der Bevölkerung im gesamten Reich verschärft, was sich auch in Trier zeigte. Außerdem wurde verstärkt gegen Fremdarbeiter vorgegangen, da der Krieg gegen die Sowjetunion auch die Angst vor dem Feind im eigenen Land intensivierte.26 Schon diese erste Betrachtung der Festnahmezahlen macht eines deutlich : Die Gestapo Trier passte die Intensität ihrer Verfolgungstätigkeit den politischen Erfordernissen an. Dass die Geheime Staatspolizei diese verstärkte Überwachung und Sanktionierung nur kurzfristig aufrechterhielt, ist aber auch ein Hinweis auf eine Überforderung der Institution. Interessant ist auch, dass im Untersuchungszeitraum kein genereller Anstieg der Festnahmezahlen zu erkennen ist. Diese Entwicklung ist gerade im Zusammenhang mit der Aufgabeninflation auffällig, könnte doch erwartet werden, dass durch die zusätzlichen Aufgabenbereiche auch die Gesamtzahl der Festnahmen angestiegen sei. Dies ist jedoch kaum der Fall. Vielmehr zeigt sich, dass die Aufgabeninflation mit einer Konzentration der Tätigkeit auf bestimmte Arbeitsfelder und der gleichzeitigen Vernachlässigung anderer Bereiche einhergeht.
Vergehen im Fokus der Gestapo Trier
Die Fokussierung der Gestapo Trier auf bestimmte Vergehen lässt sich ebenfalls durch eine Analyse der Rapporte nachweisen. Um allerdings eine zuverlässige Aus25 Dams/Stolle : Gestapo, S. 106. 26 Gerhard Paul/Alexander Primavesi : Die Verfolgung der ‚Fremdvölkischen‘. Das Beispiel der Staatspolizeistelle Dortmund, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 388–401, hier S. 388.
137
138
|
Martin Spira
Abb. 3: Anzahl der berichteten Festnahmen nach Deliktkategorien. (Quelle: Verfasser).
sage treffen zu können, war es nötig, die vielfältigen, in den Rapporten geschilderten Verstöße und Verbrechen zu kategorisieren. Bei dieser Einteilung wurde sich, wie auch in der Datenbank der Wiener Tagesrapporte, an den Rubriken, in welche die Tagesrapporte ab September 1941 unterteilt wurden, orientiert. Diese wurden allerdings nochmals verfeinert, um genauere Aussagen zu ermöglichen. Bei der Betrachtung der Festnahmezahlen in den verschiedenen Deliktkategorien (Abbildung 3) fällt sofort auf, dass vor allem Festnahmen wegen primär wirtschaftlicher Vergehen die Statistik dominieren. Allen voran sind die Arbeitsvergehen mit 274 Festnahmen innerhalb des Untersuchungszeitraums zu nennen, aber auch Vergehen gegen die Regulierung der Versorgungswirtschaft mit 81 Festnahmen.27 Dem Erhalt der Wirtschaftskraft kam also eine besondere Bedeutung zu. Die Bekämpfung von primär politischen Delikten, das vermeintliche „Kerngeschäft“ der Gestapo, spielt eine deutlich geringere Rolle. Hier ist vor allem die individuelle Opposition mit 85 Festnahmen zu nennen, während linksgerichteter Widerstand oder Opposition aus dem katholischen Milieu im Untersuchungszeit27 Wobei in diese Kategorie vor allem Delikte von Landwirten aus dem Trierer Umland fallen, die gegen die Regularien der Milchabgabemengen, der Butterherstellung und Viehschlachtung verstoßen hatten.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
raum eine geringere Bedeutung einnimmt.28 Bei der Bekämpfung dieser oppositionellen Delikte lassen sich im Untersuchungszeitraum zwei Hochphasen erkennen. Die erste reicht von September 1939 bis Mai 1940. In dieser Zeitspanne fanden 40 der 85 Festnahmen statt. Dieses verschärfte Vorgehen der Gestapo lässt sich wohl damit erklären, dass sie versuchte, Widerstand aufgrund des beginnenden Krieges zu unterdrücken und die Einheit an der „Heimatfront“ zu gewährleisten. Die zweite Phase reichte von Januar bis Oktober 1941, in der weitere 30 Festnahmen stattfanden. Hierfür lassen sich zwei Ursachen nennen : Zum einen ist dies die Bekämpfung des luxemburgischen Widerstandes gegen die „Eindeutschungspolitik“,29 zum anderen die Vorbereitungen und der Beginn des Russlandfeldzuges. Diese Zahlen zeigen, dass sich die Gestapo Trier nur noch phasenweise mit der Bekämpfung von Opposition und Widerstand beschäftigte, wenn die politischen Bedingungen dies scheinbar besonders erforderten. Stattdessen hatte die Gestapo während des Krieges ein anderes Hauptaufgabengebiet : die Erhaltung der Arbeitsdisziplin bei deutschen und ausländischen Arbeitern.
Die Überwachung der Arbeitsdisziplin als Hauptaufgabe der Gestapo Trier
Mit 274 von 667 Festnahmen ist die Kategorie der Arbeitsvergehen die mit Abstand größte in den Tagesrapporten. Mehr als ein Drittel aller Festnahmen lassen sich auf Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin, das unerlaubte Niederlegen der Arbeit, das grundlose Verlassen des Arbeitsplatzes oder ähnliche Vergehen und Verbrechen zurückführen. Die Delinquenten waren dabei zum einen dienstverpflichtete Deutsche, zum anderen ausländische Zwangsarbeiter. Hintergrund für die Festnahme wegen Arbeitsdelikten bei deutschen Bürgern war das Ziel der Nationalsozialisten, die Wirtschaft und vor allem die Rüstungsindustrie im Krieg mit genügend Arbeitskräften zu versorgen. Um dies zu gewährleisten, konnten die Arbeitsämter auf Grundlage der sogenannten Kräftebedarfsverordnung deutsche Bürger auch gegen ihren Willen zu Arbeiten bei kriegswichtigen Betrieben oder militärisch bedeutsamen Bauprojekten dienstverpflichten.30 Personen, die gegen diese Verpflichtung verstießen, machten sich strafbar.31 Während 28 Was aufgrund der weitgehenden Zerschlagung des linken Widerstandes bis 1937 wenig überrascht ; vgl. Dams/Stolle : Gestapo, S. 110. 29 Hierfür spricht auch, dass etwa die Hälfte der festgenommenen Oppositionellen in dieser Phase Luxemburger waren. 30 Andreas Kranig : Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung im Dritten Reich, Stuttgart 1983, S. 80. 31 Norbert Götz : Gemeinschaft aus dem Gleichgewicht. Die Ausweitung von Dienstpflicht im Nationalsozialismus, Berlin 1997, S. 19.
139
140
|
Martin Spira
die Kontrolle der Arbeitnehmer in erster Linie in der Hand der Arbeitsämter lag,32 konnte hier nun auch die Staatspolizei Maßnahmen ergreifen. Insgesamt 168 der dokumentierten Festnahmen lassen sich auf solche Maßnahmen zurückführen. Somit stellen diese Arbeitsvergehen auch schon ohne Einbeziehung der ausländischen Zwangsarbeiter die größte Deliktgruppe in den Tagesrapporten dar. Dabei sollte bedacht werden, dass die Festnahmen nur einen Teilbereich der Tätigkeit der Gestapo auf diesem Feld darstellen. Nicht selten wurden diese Verhaftungen durchgeführt, um abschreckende Exempel zu statuieren, Wiederholungstäter zu sanktionieren33 oder besonders schwere Fälle, zum Beispiel politisch motivierte Arbeitsverweigerung, zu bestrafen.34 Zu den üblichen Sanktionsmitteln der Gestapo bei minderschweren Delikten zählte das Aussprechen von staatspolizeilichen Verwarnungen. Auch bei Arbeitsvergehen war es üblich, dass Personen einfach wieder ihrer Arbeitsstelle zugeführt und ermahnt wurden, ohne allerdings offiziell festgenommen zu werden. Dies belegen mehrere Rapporte, in denen darauf hingewiesen wird, dass die festgenommene Person zuvor bereits ermahnt worden war.35 Somit war die Gestapo Trier noch deutlich häufiger mit der Verfolgung von Arbeitsvergehen betraut, als es die reinen Festnahmezahlen erkennen lassen. Die Tagesrapporte zeigen auch, dass sich die Gestapo bei der Überwachung der Arbeitsdisziplin auf zwei Bereiche konzentrierte. Mindestens 60 Festgenommene waren beim Bau der Reichsautobahn36 oder des Westwalls37, also bei staatlichen, 32 Diese konnten auch bereits zuvor erheblichen Druck ausüben, beispielsweise indem sie das 1935 eingeführte Arbeitsbuch einbehielten und so einen Arbeitsplatzwechsel verhinderten oder indem sie Personen, die einen angebotenen Arbeitsplatz ablehnten, erheblich die Sozialleistungen kürzten. 33 Tagesrapport Nr. 9 vom 18. Juni 1940, LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 209–211 : Am 15. Juni 1940 wurde ein Reichsautobahnarbeiter verhaftet, der, obwohl er „bereits am 2.3.40 wegen Arbeitsvernachlässigung verwarnt worden war, […] weiterhin tagelang unentschuldigt der Arbeit ferngeblieben [ist].“ 34 Tagesrapport Nr. 8 vom 24. August 1940, LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 255 : Am 22. August 1940 wurden drei Arbeiter festgenommen, die „auf ihren Baustellen ständig schlechteste Arbeitsleistungen gezeigt“ hatten. Einer der Verhafteten habe zudem „seine Arbeitskameraden stark beunruhigt, indem er erzählte, dass Deutschland den Krieg bestimmt verlieren werde und dass Russland und Amerika auch noch in den Krieg eintreten würden“. 35 Tagesrapport Nr. 49 vom 14. August 1941, LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 501 : „D. hat trotz zweimaliger staatspolizeilicher Verwarnung die Arbeit erneut niedergelegt.“ 36 Wolfgang Schmitt-Koelzer : Bau der „Reichsautobahn“ in der Eifel (1939–1941/42). Eine Regionalstudie zur Zwangsarbeit, Berlin 2016. 37 Wolfgang Benz : Die Bedeutung des Westwalls für das nationalsozialistische Regime, in : Klaus Werk/Nils Franke (Hg.) : Naturschutz am ehemaligen Westwall. NS-Großanlagen im Diskurs (Geisenheimer Beiträge zur Kulturlandschaft, Bd. 1), Geisenheim 2016, S. 18–29, online : https:// mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/Naturschutz_am_ehemaligen_Westwall.pdf (Letzter Zugriff : 23.7.2017).
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
militärisch bedeutsamen Bauprojekten tätig gewesen. Hinzu kamen 55 als Arbeiter bezeichnete Delinquenten. Obwohl der Regierungsbezirk Trier industriell gering entwickelt war38 und dementsprechend nur über wenige wehrwirtschaftlich wichtige Betriebe verfügte,39 konzentrierte sich die Gestapo also auch auf die Überwachung der Industrie. Beides zeigt, dass die staatliche Lenkung der Arbeitskräfte sowie die Überwachung und Sanktionierung durch die Gestapo auch in Trier vor allem darauf abzielten, die Wehr- und Wirtschaftskraft im Krieg zu erhalten. Mit dem Fortschreiten des Krieges kam zu der Kontrolle der reichsdeutschen Werktätigen die verstärkte Überwachung ziviler, ausländischer Zwangsarbeiter hinzu. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hatte sich mit Kriegsbeginn massiv verschärft. Die Einberufung von immer mehr Männern zum Kriegseinsatz entzog der deutschen Wirtschaft zunehmend die Arbeitskräfte. Die Nationalsozialisten befürchteten im Rüstungswettlauf den Anschluss an die Kriegsgegner zu verlieren.40 Zur Lösung dieses Problems wurde der massive Einsatz von Kriegsgefangenen und zivilen Arbeitskräften aus den besetzten Gebieten als Zwangsarbeiter im Deutschen Reich forciert. Im Frühjahr 1941 arbeiteten bereits 1,2 Millionen überwiegend französische Kriegsgefangene und 1,3 Mio. polnische „Zivilarbeiter“ im Deutschen Reich.41 Während die Nationalsozialisten hofften, auf diese Weise die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und personellen Engpässe einzudämmen, brachte der massive Zwangsarbeitereinsatz gleichzeitig politische und vor allem psychologische Probleme mit sich. Er stand im krassen Gegensatz zu dem Sicherheitsbedürfnis der Nationalsozialisten, die sich vor dem Feind im eigenen Land fürchteten. Göring warnte bereits im März 1940 vor der vermeintlichen Gefahr, die die Beschäftigung von einer Million ausländischer Arbeiter in Deutschland mit sich brachte und forderte staatspolizeiliche Maßnahmen, um dieser Bedrohung zuvor zu kommen.42 Die Auswirkungen dieser Furcht spiegeln sich auch in den Tagesrapporten wider. Ab Frühling 1941 verschob sich der Fokus der Gestapo Trier verstärkt auf die Überwachung ausländischer Arbeitskräfte. Zwischen April 1941 und dem Ende 38 Reinhard Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus (1925–1945), in: Kurt Düwell/Franz Irsigler (Hg.): Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 517–589, hier S. 548. 39 So waren laut Angaben der Gestapo im April 1940 nur 1.595 Personen im Regierungsbezirk bei wichtigen Wehrwirtschaftsunternehmen tätig ; vgl. Schlüsselmäßige Stellenverteilung auf die Staats polizei(leit)stellen (ohne Ostgebiete, Elsaß, Lothringen und Luxemburg), BArch Berlin, R 58/856, Bl.116–119, hier Bl. 119. 40 Adam Tooze : Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2008 (engl. London 2006), S. 593. 41 Ebd., S. 595. 42 Paul/Primavesi : Verfolgung der ‚Fremdvölkischen‘, S. 389.
141
142
|
Martin Spira
des Untersuchungszeitraums im März 1942 waren 62 % der festgenommenen Arbeitsverweigerer sogenannte Fremdarbeiter. Dies lag zum Teil an der steigenden Zahl der eingesetzten Zwangsarbeiter, sodass es natürlich insgesamt zu mehr Vergehen durch diese kam. Im Amtsbereich der Gestapo Trier ist zudem zu bedenken, dass in der Grenzregion der Überwachung und Verfolgung von Fremdarbeitern eine besondere Rolle zukam, da nicht nur die dort tätigen Ausländer zu überwachen waren, sondern auch Zwangsarbeiter aus anderen Gebieten aufgegriffen wurden, die versuchten, Deutschland zu verlassen. So finden sich in den Rapporten beispielsweise belgische Fremdarbeiter, die in Thüringen tätig waren,43 oder französische Arbeiter, die von ihrer Arbeitsstelle in Gelsenkirchen flüchteten.44 Noch bedeutender als ein tatsächlicher Anstieg der Vergehen durch die Fremdarbeiter war die weitgehend unbegründete Angst der Nationalsozialisten vor feindlichen Aktionen im Deutschen Reich. Diese führte dazu, dass sich die Gestapo extrem auf die Überwachung der Ausländer konzentrierte und auch schon geringes Fehlverhalten, ganz im Sinne der Prävention durch Terror, scharf sanktionierte.45 Dies ist eine Entwicklung, die sich über den Untersuchungszeitraum hinaus noch weiter zuspitzte. 46 Mit diesem zusätzlichen, ständig an Bedeutung gewinnenden Aufgabengebiet dürfte die Überforderung der Gestapo Trier noch weiter zugenommen haben, sodass die übrigen Tätigkeitsfelder immer stärker vernachlässigt wurden. Somit entwickelte sich die Gestapo in Trier, ebenso wie die Dienststellen im übrigen Deutschland, von einem Organ zur Zerschlagung des politischen Widerstands zu einem „Repressionsinstrument gegenüber den ausländischen Arbeitern und Kriegsgefangenen“47. Dabei ist zu bedenken, dass diese zusätzliche Belastung in anderen Regionen noch deutlich stärker ausgefallen sein dürfte als in Trier. So wurden hier verhältnismäßig sicherlich weniger zivile Zwangsarbeiter eingesetzt, zum einen aufgrund der geringen industriellen Bedeutung Triers, zum anderen, weil anfallende Arbeiten vor allem in der Landwirtschaft häufig von in Trier und 43 Tagesrapport Nr. 6 vom 15. Oktober 1940, LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 287–289 : Am 14.10.1940 wurden zwei Belgier festgenommen, die „ihre Arbeitsstelle eigenmächtig verlassen [hatten], um nach Belgien zurückzukehren.“ 44 Tagesrapport Nr. 77 vom 6. November 1941, LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 577–579 : Bericht über die Festnahme von drei Franzosen am 2.11.1941, die, „in der Absicht nach Frankreich zu fahren“, ihren Arbeitsplatz verlassen hatten. Eine Rückführung zum Arbeitsplatz „mittels Sammeltransport“ wurde von Trier aus veranlasst. 45 Paul/Primavesi : Verfolgung der ‚Fremdvölkischen‘, S. 393. 46 Diese Vermutungen werden durch Primavesis Untersuchung zur Gestapo in Dortmund nahegelegt. Hier fanden im Juni 1941 insgesamt 78 % aller Festnahmen aufgrund von unerlaubter Arbeitsnie derlegung ausländischer Arbeitskräfte statt. Im Juni 1943 hatte sich dieser Anteil sogar auf 97 % gesteigert ; vgl. ebd., S. 390. 47 Ebd.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
Umgebung stationierten Kriegsgefangenen ausgeführt wurden, deren Überwachung allerdings in den Verantwortungsbereich der Wehrmacht fiel.
Fazit
Schon die hier vorgenommene begrenzte Betrachtung der Tagesrapporte der Gestapo Trier fördert Erkenntnisse über die Tätigkeit der Behörde während der ersten Kriegsjahre in der Region zutage. Dem erklärten Ziel, einer umfassenden politischen und ideologischen Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung, konnte die unterbesetzte Staatspolizeistelle in Trier nicht nachkommen. Sie musste gezwungenermaßen Schwerpunkte setzen. Die Bekämpfung von politischem Widerstand spielte dabei im Untersuchungszeitraum eine untergeordnete Rolle und wurde nur noch phasenweise betrieben, wenn die politischen Bedingungen es gerade erforderten. Die Hauptaufgabe der Gestapo Trier im Untersuchungszeitraum war stattdessen die Überwachung der Arbeitskräfte in der Region. Bis April 1940 konnte sich die Gestapo dabei auf die deutschen Arbeitnehmer konzentrieren. Als dann vermehrt ausländische Zwangsarbeiter zum Einsatz kamen, mussten auch diese verstärkt überwacht werden. Dabei verfolgte die Gestapo sowohl ökonomische und politische als auch ideologische Ziele. Ökonomisch sollte die Versorgung der Wirtschaft mit genügend Arbeitskraft sichergestellt werden, um die Kriegsziele nicht zu gefährden. Auf politischer Ebene sollte zudem möglicher Widerstand, vor allem durch die ausländischen Arbeiter, verhindert werden. Aus einer ideologischen Perspektive ging es bei der Überwachung der deutschen Arbeiter darum, die Idealvorstellung des fleißigen, tatkräftigen deutschen Bürgers zu verteidigen und die vermeintliche Belastung der „Volksgemeinschaft“ durch Personen, die diesem Anspruch nicht genügten, auszuschalten. Die Repression der ausländischen Zwangsarbeiter sollte wiederum den rassenpolitischen Kosmos der Nationalsozialisten aufrechterhalten. Die hohe Bedeutung, die dieser Aufgabe zugemessen wurde, spiegelt sich nicht nur in den Zahlen der Festnahmen wider, sondern beispielsweise auch darin, dass es ab April 1941 zu monatlichen Zusammenfassungen über die Arbeitsvergehen kam.48 Für kein anderes Delikt wurde eine derartige Vorgehensweise gewählt. Ar48 So werden im Tagesrapport Nr. 9 vom 21. April 1941 etwa die Verhaftungen wegen Arbeitsvergehen des vorhergegangenen Monats März resümiert : „Im Monat März 1941 wurden im Bereich der Staatspolizeistelle Trier 21 Personen wegen Arbeitsverweigerung festgenommen und staatspolizeilich verwarnt.“ (LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 391). Für den Monat April 1941 fasst der Tagesrapport Nr. 6 vom 12. Mai 1941 sogar 38 Personen, die „wegen Arbeitsverweigerung bezw. Arbeitsuntreue festgenommen und staatspolizeilich verwarnt“ wurden, zusammen (LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 15792, Bl. 405).
143
144
|
Martin Spira
beitsdelikte waren alltägliche, weit verbreitete Vergehen, wie die Festnahmezahlen zeigen. Für die Gestapo bedeutete dies, dass eine sehr große Zahl an Personen überwacht werden musste, was die Behörde an sich schon überforderte. Die ausländischen Zwangsarbeiter erschwerten diese Situation zusätzlich. Um diese Aufgabe überhaupt nur in Ansätzen bewältigen zu können, war die Gestapo auf Mithilfe aus der Bevölkerung und Unterstützung durch andere Behörden, Parteiorgane und kollaborierende Fremdarbeiter angewiesen.49 Doch auch mit dieser Unterstützung war für das gewaltige Arbeitsfeld nicht genügend Abhilfe geschaffen. Dies hatte nicht nur eine Vernachlässigung anderer Aufgabenbereiche zur Folge, sondern auch eine Radikalisierung und Brutalisierung der staatspolizeilichen Praxis.50 Für die deutsche Bevölkerung und die ausländischen Zwangsarbeiter bedeutete die Konzentration der Gestapo auf diese Art der Vergehen, dass schon alltägliche Bagatelldelikte dazu führen konnten, in das Visier der Gestapo zu geraten. Dies stellte, selbst wenn zunächst selten harte Strafen angewandt wurden, eine erhebliche Bedrohung für das eigene Wohlergehen dar, da bei weiteren Verfehlungen drastischere Sanktionen drohten. Dies hatte sicherlich die von der Gestapo beabsichtigte abschreckende Wirkung. Auch der Mythos der Allwissenheit der Gestapo wurde auf diese Weise genährt, da der Eindruck entstand, dass die Gestapo jeden Bereich des alltäglichen Lebens überwachen und schon kleinste Verfehlungen entdecken und bestrafen könne.51 Dass die Gestapo, trotz ihrer geringen Stärke, überhaupt dazu in der Lage war, sich so massiv mit der Verfolgung solcher, eher unbedeutender Vergehen zu beschäftigen, lag aber auch daran, dass es kaum eine echte Bedrohung für den nationalsozialistischen Staat von Seiten der Bevölkerung gab. Die grundlegende Akzeptanz oder zumindest Toleranz, die bedeutende Teile der Allgemeinheit den nationalsozialistischen Zielen und Methoden entgegenbrachten, war somit eine wichtige Voraussetzung für den Terror der Gestapo.
49 Paul/Primavesi : Verfolgung der ‚Fremdvölkischen‘, S. 391. In einer erhaltenen Aufstellung mit Agenten und Informanten der Staatspolizeistelle Trier (BArch Berlin, R 58/1134) sind auch „Ostarbeiter“ verzeichnet. Zudem ist beispielsweise eine Sammlung von Berichten und Mitteilungen von russischen V-Leuten über Vorgänge in Betrieben mit zahlreichen Ostarbeitern überliefert, vgl. LHA Koblenz, Best. 662,005, Nr. 449. 50 Gerhard Paul : Die Gestapo, in : Florian Dierl u.a. (Hg.) : Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung der Deutschen Hochschule der Polizei, Münster und des Deutschen Historischen Museums, Dresden 2011, S. 54–65, hier S. 58. 51 Zum „Gestapo-Mythos“ vgl. Robert Gellately : Allwissend und allgegenwärtig ? Entstehung, Funktion und Wandel des Gestapo-Mythos, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 47–70.
Einblicke in die Verfolgungstätigkeit der Staatspolizeistelle Trier
|
Ausblick
Dieser Beitrag gibt nur einen Teilaspekt der Erkenntnisse wieder, die aus den überlieferten Tagesrapporten der Gestapo Trier gewonnen werden konnten. In der zugrunde liegenden Masterarbeit wurden weitere Bereiche und Deliktkategorien genauer beleuchtet, so zum Beispiel die Altersstruktur der Festgenommenen, die Verstöße gegen die Regelungen der Versorgungswirtschaft oder die Verfolgung von sogenannten Umgangsdelikten. Die Rapporte gewähren dementsprechend einen relativ guten Einblick in die Entwicklung der alltäglichen Verfolgungspraxis der Gestapo. Wird die einseitige Perspektive beachtet und die Informationen aus den Rapporten mit entsprechender Vorsicht behandelt, bieten die Tagesrapporte einige Chancen für die zukünftige Forschung. Die Ergebnisse dieser Arbeit könnten bei weiterführenden Untersuchungen der angeschnittenen Themenbereiche mit Hilfe zusätzlicher Quellen vertieft werden. Hier seien etwa Häftlingsakten des Gefängnisses in Wittlich und des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert, Personenakten (Ermittlungsakten) der Gestapo Trier sowie Justizakten der zuständigen Staatsanwaltschaften, Amts-, Landes-, Sonder- und Oberlandesgerichte zu nennen. Auch sind die Rapporte bisher alles andere als erschöpfend ausgewertet. So könnten die Daten aus den Berichten zum Beispiel genutzt werden, um die Opfergruppen der Gestapo genauer zu untersuchen − ein Thema, das auch in der Abschlussarbeit nur angeschnitten werden konnte. Einzelne Rapporte könnten zudem hilfreich sein, um Einzelschicksale nachzuverfolgen oder bestimmte Fälle aufzuarbeiten. Schließlich bleibt zu hoffen, dass auch die Tagesrapporte anderer Dienststellen analysiert werden, sodass regionale Vergleiche ermöglicht werden. Ein großes Glück wäre weiterhin, wenn weitere Berichte der Staatspolizeistelle Trier in den Archiven gefunden würden. In diesem Fall könnte die Entwicklung der Verfolgungspraxis über einen noch längeren Zeitraum untersucht werden. Ein Vergleich mit Rapporten, die vor Beginn des Krieges verfasst wurden, würde beispielsweise eine genauere Einordnung der Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen.
145
Max Heumüller
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier Überwachung und Verfolgung 1934 bis 1936
Eine erfolgreiche Bekämpfung der zweifellos anwachsenden illegalen marxistischen Opposition ist mir vor Auffüllung der Dienststelle mit geeigneten Beamten nicht möglich. Zur Zeit ist hier nur 1/5 der nach dem Etat für meine Dienststelle vorgesehenen Arbeitskräfte vorhanden.1
Diese Beschreibung der personellen Zustände der Geheimen Staatspolizeistelle Trier durch ihren Dienststellenleiter im Juli 1935 legt nahe, dass die Gestapo sich auch etwa zwei Jahre nach der nationalsozialistischen Machtübernahme nicht in der Lage sah, politische Gegner erfolgreich zu bekämpfen und die an sie gestellten Erwartungen und Aufgaben zu erfüllen. Die geübte Kritik in der oben genannten Lagebeschreibung wirft die Frage nach dem Wahrheitsgehalt und der Intention hinter der Meldung des Gestapostellenleiters auf. Ohne Kontextualisierung ist es zunächst nicht möglich zu klären, ob es sich um eine Übertreibung, einen Appell, eine Tatsache oder eine Schutzbehauptung handelt. Die staatspolizeiliche Lageberichterstattung muss, um den Wert und die Aussagekraft der Quelle herausarbeiten zu können, einer gezielten Bewertung unterzogen werden. Nur so können anhand dieser Quelle Aspekte der Tätigkeit der Staatspolizeistelle Trier näher beleuchtet werden. Eine unscharfe rechtliche Abgrenzung des Tätigkeitsfeldes der Gestapo hatte zur Folge, dass die überbürokratisierte Sicherheitspolizei mit ihren begrenzten Mitteln und geringen personellen Kapazitäten schlichtweg nicht imstande war, die an sie gestellten Anforderungen gänzlich zu erfüllen. Trotzdem war der politische Widerstand sowohl reichsweit als auch in Trier spätestens 1936/37 gebrochen und die innenpolitische Konsolidierungsphase des nationalsozialistischen Regimes abgeschlossen.2 In der hier vorliegenden Untersuchung soll mithilfe der geheimen 1 Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/2093, Bl. 138. 2 Die zwischen 1933 und 1936 vor den Oberlandesgerichten verhandelten Massenprozesse gegen kommunistische Widerstandsgruppen zerbrachen den aktiven Widerstand. Dazu : Beatrix Herlemann : Kommunistischer Widerstand, in : Wolfgang Benz/Walter H. Pehle (Hg.) : Lexikon des deutschen Widerstandes, Frankfurt a.M. 1994, S. 29–41.
148
|
Max Heumüller
Gestapo-Lageberichte sowie weiteren überlieferten ergänzenden Akten die Arbeitsweise der Staatspolizeistelle Trier in der Frühphase des NS-Regimes (1934–1936) in den Blick genommen und die Frage beantwortet werden, wie es der Gestapo gelang, trotz personeller Unterbesetzung und rasch wachsendem Aufgabenfeld, als schlagkräftiger und gefürchteter Terrorapparat das NS-Regime zu unterstützen und die Durchsetzung der nationalsozialistischen Idealvorstellung der „Volksgemeinschaft“ zu propagieren. Die Nationalsozialisten sahen in den Kommunisten ihren politischen Hauptgegner, so dass diese in der Frühphase des Regimes als tatkräftigster Bestandteil des antifaschistischen Widerstands in besonderem Fokus der staatspolizeilichen Ermittlungen standen. Dieser Aufsatz soll die Überwachungsund Verfolgungstätigkeit der Gestapo exemplarisch an der Bekämpfung der Kommunisten in der Region Trier herausarbeiten. Des Weiteren ermöglicht es die Quellenlage am Fallbeispiel Johann Bauer zu untersuchen, welch umfangreicher Sachverhalt sich hinter einer kurzen Erwähnung in einem Lagebericht verbergen kann. Das konkrete Vorgehen der Gestapo, ihre Kooperation mit anderen staatlichen Institutionen sowie ihr Berichtswesen können exemplarisch dargelegt werden.
Die Geheime Lageberichterstattung der Gestapo Trier
Die Gestapo war das wichtigste Instrument der Exekution des Führerwillens und der Inbegriff des nationalsozialistischen Terrors.3 Damit spielte die Lageberichterstattung der Gestapo eine besondere Rolle in der NS-Diktatur. Als internes Kommunikationsmittel war das Berichtswesen integraler Bestandteil des Beobachtungs-, Kontroll- und Exekutivsystems der Gestapo.4 Die Überwachung und Verfolgung des Widerstandes und der Resistenz5 waren neben der Berichterstattung über wirtschaftliche, soziale, kirchliche und politische Entwicklungen und Ereignisse von zentralem Erkenntnisinteresse für die Zentralinstitutionen in Berlin.6 Ebenso fanden polizeiliche Angelegenheiten und diverse Einzelereignisse, je nach
3 Gerhard Paul : Die Gestapo, in : Florian Dierl u.a. (Hg.) : Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung der deutschen Hochschule der Polizei, Münster und des Deutschen Historischen Museums, Dresden 2011, S. 54–65, hier S. 56. 4 Anselm Faust : Die Lageberichte rheinischen Gestapostellen 1934–1936, in : Geschichte im Westen 27 (2012), S. 125–139, hier S. 137. 5 Vgl. weiterführend zur Widerstandsthematik den Forschungsüberblick von Ian Kershaw : Der NSStaat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek b. Hamburg 32002, S. 279–328. 6 Faust : Die Lageberichte, S. 137.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
Einschätzung des Berichterstatters, Niederschlag in den Meldungen der Geheimen Staatspolizei. Für den Regierungsbezirk Trier sind die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei zu großen Teilen im Bestand R 58 (Reichssicherheitshauptamt) des Bundesarchivs in Berlin überliefert.7 Der Adressat der Berichte war das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) in Berlin. Darüber hinaus erhielten der jeweilige Regierungspräsident, zeitweise der Oberpräsident, sowie die anderen rheinischen Gestapostellen Kopien der Berichte,8 sodass sich weitere Exemplare der Trierer Lageberichte im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz befinden.9 Trotz der Vielzahl der hier vorliegenden Quellen sind aufgrund der Kriegseinwirkungen und der Aktenvernichtung durch die Gestapo selbst nicht alle Lageberichte überliefert. Für den Zeitraum von November 1933 bis Februar 1936 liegen insgesamt siebzehn vollständige Lageberichte sowie fünf Auszüge von Lageberichten das Themengebiet „Marxismus“ betreffend vor. Für die jeweiligen Monate, in denen Berichte der Gestapo fehlen, wurde auf die Lageberichte des Trierer Regierungspräsidenten zurückgegriffen.10 Diese unterscheiden sich, da sie gleichfalls vom Leiter der Stapostelle Trier verfasst wurden, höchstens marginal von denen der Gestapo selbst. Somit ist es möglich, von Juli 1934 bis zur Einstellung der monatlichen Berichterstattung 1936 über einen Zeitraum von zwanzig Monaten das Themenfeld „Marxismus“ in den Lageberichten lückenlos analysieren zu können.
Die Verfolgung der Kommunisten in Trier
Bereits Anfang der 1920er Jahre waren die Kommunisten im Regierungsbezirk Trier im reichsweiten Vergleich – insbesondere mit den Hochburgen in Berlin und dem Ruhrgebiet – unterrepräsentiert. Im Verlauf der 1920er Jahre bildeten sich im Raum Trier einige KPD-Ortsgruppen sowie weitere parteiliche Nebenorganisationen heraus. Diese Strukturen formten das Fundament der in der Region Trier organisierten Kommunisten und waren Fixpunkte ihrer Tätigkeit. Gleichwohl, gemessen an den Rahmenbedingungen im tief katholischen Trier, konnten die Kommunisten auf eine verhältnismäßig solide Basis zurückgreifen, sodass die Wahlergebnisse der KPD gleichauf mit denen der SPD lagen. Eine wichtige Rolle 7 BArch Berlin, R 58/432, 510, 534, 566, 571, 656, 1145, 2093, 2096, 3035c, 3037c, 3038d, 3039c, 3040c, 3043c und 3044c. 8 Faust : Die Lageberichte, S. 134. 9 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11. 10 BArch Berlin, R 58/3972.
149
150
|
Max Heumüller
spielte die Nähe zum Saarland, wo das kommunistische, in Kohle- und Stahlindustrie beschäftigte, Arbeitermilieu die soziale Basis der KPD stellte. Eine erfolgreiche Mobilisierung machte es der kommunistischen Partei dort möglich, dass sie auf einen permanent anwachsenden Personenkreis zurückgreifen konnte.11 Als die monatliche Lageberichterstattung der Gestapo Trier im Juli 1934 einsetzte, lag die erste große Verhaftungswelle gegen die Kommunisten im Regierungsbezirk bereits rund ein Jahr zurück. Diesen ersten Verhaftungen gingen nur bedingt Ermittlungen der Gestapo voraus, denn diese hatte zu diesem Zeitpunkt erst kürzlich ihre Arbeit aufgenommen. Vielmehr konnte die Verfolgung durch SA, SS und Polizei auf Grundlage von Akten der Politischen Polizei aus der Weimarer Republik aufgenommen werden. Von den in der ersten Hälfte des Jahres 1933 Verhafteten wurden etliche bereits kurze Zeit später wieder aus der Schutzhaft entlassen. Im Untersuchungszeitraum 1934 bis 1936 stehen also Wiederaufbauversuche der Kommunisten und deren öffentlichkeitswirksame Aktionen, sowie die Maßnahmen der Gestapo diese zu unterbinden, im Fokus. Die Darstellung der Arbeit der für Kommunisten zuständigen Beamten – Güttler erwähnt in einem Lagebericht die Existenz einer KPD-/SPD-Abteilung12 – soll im Folgenden nach thematischen Gesichtspunkten gegliedert werden. Nach der Massenverhaftung potentieller Gegner im Zuge der Besetzung des Rheinlandes am 7. März 1936, aber spätestens nach dem großen Hochverratsprozess am Oberlandesgericht Hamm gegen 36 Kommunisten aus Trier musste der kommunistische Widerstand in Trier als zerschlagen gelten.
V-Leute und Denunzianten
Einen Großteil ihrer Arbeit bewältigte die Geheime Staatspolizei auf der Basis von Erkenntnissen, die den Berichten von V-Leuten entnommen worden sind.13 So 11 Vgl. weiterführend zur Geschichte der Kommunisten im Saarland Joachim Heinz : Sozialdemokratie und Kommunisten 1933 bis 1945 im Saarland. Ein Überblick, in : Hans-Christian Herrmann (Hg.) : Widerstand, Repression und Verfolgung. Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus an der Saar (Geschichte, Politik und Gesellschaft, Bd. 14), St. Ingbert 2014, S. 185–211 ; Luitwin Bies : Klassenkampf an der Saar 1919–1935. Die KPD im Saargebiet im Ringen um die soziale und nationale Befreiung des Volkes, Frankfurt a.M. 1978. 12 BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 96. 13 Vgl. weiterführend dazu u.a.: Thomas Mang : „Er brachte sehr gute und schöne Nachrichten. “ – Leutgebs V-Leute der Gestapo. Das Verhörprotokoll, Belgrad 1947/48, in : Jahrbuch/Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (2014), S. 165–193 ; Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 42017 (2008), S. 77–84 ; Wilhelm Mensing : Bekämpft, gesucht, benutzt. Zur Geschichte der Gestapo V-Leute und „Gestapo-Agen-
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
wie andere Dienststellen im Reich14 führte auch die Gestapo Trier ein Netz von Spitzeln, deren an die Gestapo herangetragene Informationen sich auch in den Lageberichten niederschlugen. In der Regel wurden Personen aus dem zu bespitzelnden Umfeld angeworben, „umgedreht“ oder erpresst. Die Motivlagen eines Vertrauensmannes, sich in den Dienst der Geheimen Staatspolizei zu stellen, variierten damit stark : Während die einen auf ihren finanziellen Vorteil bedacht waren, wurden andere wiederrum unter Androhung von Repressalien gegen sich oder Angehörige zur Spitzeltätigkeit gezwungen.15 Insgesamt existierte in Trier, wie es auch schon Mallmann feststellte, ein „erhebliches Spektrum zwischen Freiwilligkeit und Zwang“16 bezüglich der aktiven V-Leute. Die Personalien der V-Leute für den Zeitraum 1934 bis 1936 lassen sich nicht ermitteln. Sie wurden zwecks Geheimhaltung ihrer Identität nur unter Decknamen geführt oder tauchten sogar als Sammelposten im Haushaltsetat auf. Die Lageberichte selbst sprechen nicht dezidiert von Spitzeln, dennoch lassen sich zahlreiche Feststellungen seitens der verfassenden Behörde finden, die nur auf die Informationen eines Vertrauensmanns zurückzuführen sind. Sicherlich fußt die Analyse der Lageberichte nicht auf einer breiten empirischen Basis. Dennoch wäre es fahrlässig, diese unübersehbaren Hinweise in der Lageberichterstattung zu vernachlässigen. Sowohl unter der Ägide Heinrich Welschs als auch Gerhard Güttlers weisen insgesamt neun der überlieferten Berichte Anhaltspunkte zu V-Leuten auf.17 Nichtsdestotrotz bleiben die Lageberichte den Beweis der Existenz der V-Leute schuldig, die jedoch an anderer Stelle belegt wird. Die Staatspolizeistelle beantragte beim Preußischen Innenministerium monatlich Mittel für den geheimen politischen Nachrichtendienst. Eine exakte Zusammenstellung der besonderen, nicht aus planmäßigen Mitteln zu deckenden Ausgaben der Staatspolizeistelle für politische Nachrichtenund Ermittlungsdienste sowie zur Bekämpfung von Landesverrat und Spionage ten“, in : Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat 17 (2005), S. 111–135 ; Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 561 f. (Bibliographie zu V-Leuten) ; Klaus-Michael Mallmann : Die V-Leute der Gestapo. Umrisse einer kollektiven Biographie, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 268–287 ; Walter Otto Weyrauch : Gestapo V-Leute. Tatsachen und Theorie des Geheimdienstes, Frankfurt a.M. 1989. 14 Weitere Beispiele zu V-Leuten regionaler Staatspolizeistellen : Franz Weisz : Die V-Männer der Gestapoleitstelle Wien. Organisation, Personalstruktur, Arbeitsweise, in : Zeitgeschichte 40/6 (2013), S. 338–357 ; Siegfried Grundmann : Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler, Berlin 2010. 15 Mallmann : V-Leute, S. 271. 16 Ebd., S. 279. 17 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 76/6. Bl. 38 ; GStA PK, I. HA Rep. 90, Annex P, Nr. 78/6, Bl. 8 f.; BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 68 ; BArch Berlin, R 58/2096, Bl. 17 ; BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 138 und BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 132.
151
152
|
Max Heumüller
wurde jeden Monat nach Berlin geschickt. Für Trier sind solche detaillierten Zusammenstellungen von Dezember 1933 bis September 1934 lückenlos überliefert. Von Dezember 1933 bis September 1934 zahlte die Gestapo Trier in 284 Fällen insgesamt 10.432,53 Reichsmark (RM) an von ihr geführte V-Leute.18 Neben den Beiträgen von V-Leuten konnte die Gestapo häufig auf die freiwillige Mithilfe aus der Bevölkerung zurückgreifen.19 Die Denunziationsbereitschaft in der Bevölkerung nahm dabei ein geradezu unvorstellbares Ausmaß an.20 Die Gestapo wusste dies bereits früh für sich zu nutzen, erkannte aber auch die ambivalente Problematik, die der Denunziationsbereitschaft innewohnte.21 Häufig wurden private Streitigkeiten unter einem politischen Deckmantel auf dem Rücken der Gestapo ausgetragen. Denunziationen aus der Bevölkerung waren derart häufig, so dass die Verfasser der Berichte dies wohl nicht mehr ständig für erwähnenswert hielten. An einigen Stellen zeugen die Lageberichte der Gestapo Trier jedoch explizit von der Bereitschaft der Bevölkerung zur Mithilfe : Es erfolgen auch häufig Anzeigen von Privatpersonen […], durch die Bewohner von Grenzdörfern staatsfeindlicher Betätigung bezichtigt werden. Die daraufhin angestellten Ermittlungen haben jedoch in keinem Falle ein greifbares Ergebnis gehabt.22
18 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 118–127, Bl. 70–88. 19 Vgl. weiterführend dazu u.a.: Stephanie Abke : Denunziation, Überwachung und Kontrolle 1933– 1945 in einer ländlichen Region in Nordwestdeutschland, in : Anita Krätzner (Hg.) : Hinter vorgehaltener Hand : Studien zur historischen Denunziationsforschung (Analysen und Dokumente. Wiss. Reihe des BStU, Bd. 39), Göttingen 2015, S. 37–49 ; Dams/Stolle : Gestapo, S. 84–94 ; Barbara Engelking : „Sehr geehrter Herr Gestapo.“ Denunziationen im deutsch besetzten Polen 1940/41, in : Klaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial (Hg.) : Genesis des Genozids. Polen 1939–1941 (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 3), Darmstadt 2004, S. 206–220 ; Jan Ruckenbiel : Soziale Kontrolle im NS-Regime : Protest, Denunziation und Verfolgung. Zur Praxis alltäglicher Unterdrückung im Wechselspiel von Bevölkerung und Gestapo, Köln 2003 (Diss. Siegen 2001), http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2005/51/pdf/ruckenbiel.pdf (Letzter Zugriff : 19.7.2017) ; Paul/Mallmann : Die Gestapo, S. 560 f. (Bibliographie zu Denunziantentum) ; Gisela Diewald-Kerkmann : Denunziantentum und Gestapo. Die freiwilligen „Helfer“ aus der Bevölkerung, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 288–305 ; Robert Gellately : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945, Paderborn u.a. 21994 (1993), bes. S. 151–181 ; Robert Gellately : „In den Klauen der Gestapo.“ Die Bedeutung von Denunziationen für das nationalsozialistische Terrorsystem, in : Anselm Faust (Hg.) : Verfolgung und Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933–1945, Köln 1992, S. 40– 49. 20 Diewald-Kerkmann : Denunziantentum, S. 289. 21 Ebd., S. 302–305. 22 BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 79.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
Die Gestapo Trier nahm Anzeigen von Privatpersonen zum Anlass für weitere Ermittlungen, die einen erheblichen Mehraufwand bedeuteten.
Institutionelle Zuträger: Reichsbahn, Landesverwaltungen und Landjäger
Neben den Informanten aus der Bevölkerung konnte die Gestapo auf ein breites Netzwerk von institutionellen Zuträgern aus Staat und Partei zurückgreifen. Zahlreiche und wichtige Helfer der Gestapo kamen aus den Reihen des SD, der SS und anderer NS-Parteiorganisationen sowie von weiteren Abteilungen der Polizei.23 Zudem wurde Amtshilfe von staatlichen Unternehmen wie der Reichsbahn und der Reichspost eingefordert und von diesen bereitwillig geleistet. Ihren Höhepunkt erreichte die Kooperationsbereitschaft der Reichsbahn während des nationalsozialistischen Regimes mit der bereitwilligen Unterstützung bei der Deportation zahlloser Opfer in die nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager.24 Doch auch bereits in der Frühphase der nationalsozialistischen Herrschaft wurde die Gestapo von der Reichsbahn insbesondere bei der Grenzüberwachung und dem Erfassen von staatsfeindlichem Propagandamaterial unterstützt. Auch die Trierer Lageberichte legen Zeugnis über die Mithilfe der Bahn ab. Eine mit Geheimstatus versehene Meldung vom 1. Dezember 1934 der Reichsbahndirektion Trier an die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft in Berlin übermittelte den genauen Personalbestand der in der Zugüberwachung der Reichsbahn tätigen Beamten.25 Im Berichtsmonat November betrug die Zahl der im „Grenz- und Zugüberwachungsdienst“ und im „politischen Überwachungsdienst“ tätigen Bediensteten insgesamt 65 Personen. Mit breiter personeller Basis – zu diesem Zeitpunkt war mehr Personal der Reichsbahn in der Zugüberwachung tätig, als die Staatspolizeistelle Trier Mitarbeiter hatte – überwachte die Reichsbahndirektion den Grenzverkehr. Insbesondere der Saargrenzverkehr stand vor der Saarabstimmung im Januar 1935 im Fokus. Die Haupttätigkeit der Gestapo, mit Unterstützung durch die Zugüberwachung der Reichsbahn, war dabei das Erfassen von in den Zügen ausgelegten oder mitgeführten kommunistischen Propagandaschriften sowie die Ermittlung verdächtiger Zugpassagiere. Von derartigen Erfolgen berichten etwa die Lageberichte für Juli und November 1934 : Im Juli übermittelte die Reichsbahn 23 Dams/Stolle : Gestapo, S. 94. 24 Zur bereitwilligen Kooperation der Reichsbahn bei der Vernichtung der Juden vgl. Andreas Engwert/Susanne Kill (Hg.) : Sonderzüge in den Tod. Die Deportationen mit der Deutschen Reichsbahn. Eine Dokumentation der Deutschen Bahn AG, Köln u.a. 2009 ; Hans Günther Adler : Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974. 25 BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 71–73.
153
154
|
Max Heumüller
sichergestellte marxistische Zeitungen und Flugblätter aus dem Saargrenzverkehr an die Trierer Gestapo26 und im November berichtete der Regierungspräsident, dass „Überwachungsbeamte“ in Eisenbahnzügen aus dem Saargebiet „eine mehr oder minder große Anzahl dieser Druckerzeugnisse“ beschlagnahmt hatten.27 Auch die Berichte aus den Monaten Dezember 193428, März 193529 und April 193530 enthielten gleichlautende Meldungen des Dienststellenleiters der Staatspolizeistelle Trier über Propagandamaterial, das Bedienstete der Reichsbahn in den Grenzzügen zum Saargebiet und nach Belgien beschlagnahmt hatten. Des Weiteren wurde die Staatspolizeistelle Trier bei der Überwachung der Grenze von saarländischen Landjägern, Grenzpolizei, Zollbeamten und Feldjägerbereitschaften unterstützt. Für die Nacht vom 18. auf den 19. August 1934 erwartete die Gestapo Trier, aufgrund der anstehenden „Volksbefragung“31, eine verstärkte Flugblatteinfuhr an der saarländischen Grenze. Die eigenen Polizeikräfte kooperierten in dieser Nacht mit Feldjägerbereitschaften.32 Im selben Berichtsmonat fingen laut Lagebericht sowohl „Beamte der hiesigen Stelle“ als auch saarländische Landjäger Radfahrerkolonnen aus dem Saargebiet ab, die Propagandamaterial in den Regierungsbezirk Trier transportieren wollten.33 Zu guter Letzt lieferten die Lage- und Stimmungsberichterstattungen der kommunalen Verwaltungen ihrerseits Informationen, die auf Ebene des Regierungsbezirks vom Staatspolizeistellenleiter bzw. dem Regierungspräsidenten zusammengeführt wurden. Im September 1934 berichtete der Landrat in Trier über den Fund der verbotenen marxistischen Zeitung Deutsche Freiheit bei dem ehemaligen kommunistischen Funktionär Gerhard aus Ehrang. Die Gestapo Trier veranlasste daraufhin die „erforderlichen Maßnahmen.“34 Die zweifellos im Zeitraum der Lageberichterstattung dünn besetzte Trierer Gestapo konnte den offenkundigen Personalmangel wenigstens streckenweise durch ein ausgedehntes System an gemeinschaftlicher Zuarbeit kompensieren oder zumindest kaschieren. Zudem ist in den Lageberichten bei Weitem nicht das gesamte 26 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 76/6, Bl. 40. 27 BArch Berlin, R 58/3972, Bl. 48. 28 BArch Berlin, R 58 2093, Bl. 79. 29 BArch Berlin, R 58/2096, Bl. 18. 30 BArch Berlin, R 58/2096, Bl. 17. 31 Gemeint ist die Volksabstimmung, in der Hitler sich nach dem Tod Hindenburgs als Staatsoberhaupt, Regierungschef, Parteiführer und Oberbefehlshaber der Streitkräfte bestätigen ließ ; vgl. Ian Kershaw : Hitler 1889–1945, München 2009, S. 343. 32 GStA PK, I. HA Rep. 90, Annex P, Nr 77/1, Bl. 61f. 33 Ebd. 34 GStA PK, I. HA Rep. 90, Annex P, Nr 78/6, Bl. 8 f.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
Spektrum der Zusammenarbeit offengelegt. So ist beispielsweise die Verbindung der Gestapo zur Reichspost in den Lageberichten in keiner Weise dokumentiert.35
Tätigkeitsberichte – Die Maßnahmen der Gestapo
Die Ermittlungstätigkeit der Gestapo Trier ist in den Lageberichten im Detail schwierig nachzuvollziehen. Gleichwohl wollte jede regionale Staatspolizeistelle Maßnahmen und Erfolge nach Berlin melden, um die eigene Legitimität und Effizienz zu untermauern. Dadurch ist die monatliche Berichterstattung häufig nicht nur als ein reiner Tätigkeitsbericht und Faktenrapport zu begreifen. Da der Dienststellenleiter die eigene Behörde nicht in schlechtem Licht erscheinen lassen wollte, sind die Berichte ob ihrer Vollständigkeit kritisch zu hinterfragen. Berichtete Maßnahmen wurden zwar nicht erfunden, konnten aber zum Positiven verzerrt werden. Aus welchen Gründen vereinzelt auch verhaftete Personen mit ihrem Vergehen namentlich in den Lageberichten genannt wurden, ist nicht nachzuvollziehen, weist aber möglicherweise auf die Beispielhaftigkeit und Bedeutung dieses Falles hin. Schlaglichtartig finden sich Hinweise und Belege auf die exekutiven Maßnahmen der Gestapo Trier in der von ihr verfassten Lageberichterstattung. Hetzreden bei Notstandsarbeitern etwa nahm die Gestapo zum Anlass, an einzelnen Orten „energisch einzuschreiten“, mehrere Marxisten zu verhaften und dem Richter wegen „Beleidigung des Führers oder der Regierung“ vorzuführen.36 Beispiele systematischer Abwehrarbeit, wie Observationen, Verhöre, Post- und Telefonkontrollen oder kollektive Schutzhaftbefehle, lassen sich in den Lageberichten der Gestapo Trier hingegen nicht finden. Im Gegenteil, Güttler gestand im Juni 1935 ein, dass aufgrund der „völlig unzulänglichen Besetzung der Dienststelle mit Beamten“ eine systematische Abwehrarbeit kaum möglich sei.37 Auch weil die Gestapo Trier bis Januar 1935 in der Hauptsache für die Überwachung des Saargebietes zuständig gewesen war, erfolgten „staatspolizeiliche Maßnahmen“ oftmals nach Denunziationen, V-Mann-Berichten oder zufälligen Treffern. Hinter der Umschreibung „staatspolizeiliche Maßnahmen“ verbarg sich ein Bündel von Sanktionsmitteln, das „Belehrung“ und „Verwarnung“ und die Erteilung eines „Sicherungsgeldes“ ebenso
35 Zur Rolle der Reichspost vgl. Wolfgang Lotz/Gerd R. Ueberschär : Die Deutsche Reichspost 1933–1945. Eine politische Verwaltungsgeschichte, 2 Bde., Berlin 1999. 36 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 76/6. Bl. 40 f. 37 BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 96.
155
156
|
Max Heumüller
einschloss, wie die Verhängung von „Schutzhaft“38 und die „Sonderbehandlung“, also Exekution.39 Die Anwendung einer der genannten „staatspolizeilichen Maßnahmen“ war dabei nicht zwingend an ein bestimmtes „Vergehen“ gekoppelt. Die Begründungen zur Verhängung der Schutzhaft etwa reichten von Hochverrat, kommunistischen Umtrieben und Propagandatätigkeit bis zur Verbreitung unwahrer Gerüchte und Beleidigung der Reichsregierung. Häufig reichte sogar bereits der Verdacht auf „Verteilung kommunistischer Flugschriften“40 zur Inschutzhaftnahme.
Der Fall hinter einer „Meldung“ – Ermittlungen und Prozess gegen Johann Bauer
Der von der Gestapo verhaftete Kommunist Johann Bauer wird im Lagebericht für Juli 1934 namentlich erwähnt. Die Festnahme erachtete die Gestapo Trier für berichtenswert. Ihm wurde der Vertrieb der illegalen Druckschrift Die Rote Fahne vorgeworfen.41 Die Verfahrensakten des Oberlandesgerichts (OLG) Hamm, das den Fall im Anschluss an die Ermittlungstätigkeit seitens der Gestapo Trier übernahm, und die entsprechenden Ermittlungsakten der Gestapo sind überliefert.42 Die Akten zum Prozess gegen Johann Bauer am Oberlandesgericht Hamm sind mit 236 Blatt umfangreich und verdeutlichen, welches Schicksal hinter einer kurzen Erwähnung in einem Lagebericht steckte. Im Folgenden wird der Fall des Johann Bauer, aber auch der des ebenfalls verurteilten und nicht im Lagebericht erwähnten Karl M. untersucht. Der Hauptangeklagte und Namensgeber des Verfahrens Johann Bauer wurde am 1. März 1911 in Mettmann im Regierungsbezirk Düsseldorf geboren. Zum 38 Eine Übersicht der Staatspolizeistelle Trier über alle Schutzhäftlinge im Zeitraum vom 1. Mai bis zum 8. August 1934 ist überliefert und dokumentiert außerdem, aus welchen Gründen die Gestapo Schutzhaft anordnete. In : GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 112. Bl. 143–146. 39 Dams/Stolle : Gestapo, S. 90. 40 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 112. Bl. 143–146. 41 GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Nr. 76/6. Bl. 40. 42 Vgl. Ralph J. Jaud : Der Landkreis Aachen in der NS-Zeit. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einem katholischen Grenzgebiet 1929–1944, Frankfurt a.M. u.a. 1997, S. 37. In aller Regel wurden politische Verfahren und Prozesse gegen illegale Widerstandsgruppen aus dem Rheinland und Westfalen vor den Strafsenaten am Oberlandesgericht Hamm verhandelt. Damit fiel auch Trier in den Zuständigkeitsbereich des OLG Hamm. Das OLG Hamm spielte eine wesentliche Rolle bei der Durchsetzung des totalitären Unrechtsstaates. Weder der Volksgerichtshof noch das Berliner Kammergericht verurteilten in den zwölf Jahren der nationalsozialistischen Diktatur mehr Menschen in politischen, erstinstanzlichen Verfahren als das OLG Hamm. Glücklicherweise sind mindestens 63 Verfahren mit mehr als 200 Akten des Oberlandesgerichts mit Bezug zur Region Trier und der dortigen Gestapostelle aus dem Zeitraum 1933 bis 1945 erhalten geblieben.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
Zeitpunkt seiner Verhaftung, am 24. Juli 1934, wohnte er in der Hornstraße 23 in Trier.43 Laut eigener Aussage im Vernehmungsprotokoll vom gleichen Tag war Johann Bauer Vollwaise und lebte vom 5. bis zum 21. Lebensjahr in verschiedenen Anstalten in Fürsorgeerziehung. Karl M., sein Schwager, geboren am 20. Januar 1896 in Ruwer, Kreis Trier-Land, wurde im gleichen Verfahren ebenfalls verurteilt. Er wohnte in der Gneisenaustraße 41/43 in unmittelbarer Nachbarschaft von Johann Bauer.44 Karl M. war von Beruf Fuhrmann, aber zum Zeitpunkt seiner Vernehmung bezog er Unterstützung vom Arbeitsamt. Sowohl Bauer als auch M. waren nie Mitglied in einer Partei und politische Aktivitäten sind in den Akten nicht dokumentiert worden. Beide wurden aufgrund kleinerer Delikte (Steuerhinterziehung, Schmuggel) bereits verurteilt und mussten kurze Haftstrafen verbüßen sowie Strafgelder zahlen.
Die Ermittlungen der Gestapo Trier
Am 14. Juli 1934 nahm der Kriminalassistent Matthes der Staatspolizeistelle Trier die Meldung eines „V.M.“ entgegen. Ihm wurde „[v]ertraulich […] mitgeteilt, dass der Karl M[…] sich noch heute die ‚Rote Fahne‘ kommen lassen soll.“45 Gesehen habe er sie bereits vor fünf Wochen bei M. und zwar in der Wohnung von Hubert K. in der Gneisenaustraße 41. Zeuge des Vorgangs war der ebenfalls anwesende Nachbar Alfred F. An diesem Sachverhalt wird der schwammige Übergang von Denunziantentum zur V-Mann-Tätigkeit deutlich. Die Tatsache, dass der „V.M.“ erst fünf Wochen nach der „Tat“ Meldung erstattete, deutet auf eine persönliche Motivation hin. Es erweckt den Anschein, als sei das Wissen erst dann genutzt worden, als ein persönlicher Konflikt mit Karl M. zum Tragen kam. Der tatsächliche Grund für die Meldung kann jedoch abschließend nicht geklärt werden. Ebenfalls auf eine spontane, persönlich motivierte Meldung deutet die Zusammenstellung aller V-Mann-Bezahlungen aus dem Monat Juli 1934 hin, die für den infrage kommenden Zeitraum keine Bezahlung eines „V.M.“ ausweist. Ohne die Zuträgerschaft aus der Bevölkerung – gleich welcher Motivation folgend – hätte die Gestapo Trier jedoch keine Kenntnis über das „Vergehen“ des Karl M. erlangt. Noch am selben Tag der vertraulichen Meldung bestellte der Kriminalassistent Matthes den Zeugen Alfred F. zur Vernehmung. F. sagte aus, dass er mit Karl M. und Hubert K. vor fünf Wochen in der Wohnung von K. auf das Hören des Mos43 Landesarchiv-NRW – Abt. Westfalen [LA-NRW (Westf.)], Q 211a/3319, Bl. 11. 44 Ebd., Bl. 9 f. 45 Ebd., Bl. 5.
157
158
|
Max Heumüller
kauer Senders zu sprechen kam. Da die Sendefrequenzen des Senders nicht bekannt waren, sei M. kurz in seine Wohnung gegangen, um die Zeitung Die Rote Fahne zu holen, in der die Welle und die deutschen Sendezeiten des Senders angegeben waren. Laut F. wollte M. die Zeitung für 15 Pfennig wann immer möglich beziehen können. Des Weiteren erzählte F. von einem vorangegangenen Gespräch mit M., in dem sie über kommunistische Flugblätter sprachen, die M. gefunden, gelesen und anschließend verbrannt haben soll. Zum Abschluss der Vernehmung spekulierte F. über die Bezugsquelle der Druckschrift Die Rote Fahne : „Der Schwager des M[…], Hans Bauer, der Schmuggler ist und auch in der Hornkaserne wohnt, soll des Öfteren nach Luxemburg fahren. Wahrscheinlich ist der Bauer derjenige, der die Rote Fahne mitbringt.“46 Der erwähnte Schwager „Hans Bauer“ ist der später verhaftete Johann Bauer. Unter welchen Umständen die Vernehmung stattfand und damit auch die Aussage zustande kam, kann nicht beantwortet werden. Es ist jedoch bemerkenswert, dass der zuständige Kriminalassistent im Anschluss des Protokolls vermerkte, sowohl die Aussage des Vertrauensmanns als auch die Aussage F.s seien mit Vorsicht aufzunehmen, denn dieser habe bereits wegen fälschlicher Anzeige im Gefängnis gesessen. Unmittelbar nach dem geschilderten Verhör muss die Gestapo Trier tätig geworden sein, denn im gleichen Protokoll wurde (nachträglich hinzugefügt) eine Hausdurchsuchung bei Karl M. und Johann Bauer unter der Leitung des Kriminalassistenten Schulz erwähnt, die allerdings ergebnislos verlief. Erst acht Tage später, am 23. Juli 1934, wurde der zweite Zeuge Hubert K. zur Vernehmung in die Staatspolizeistelle Trier bestellt. Die verhältnismäßig lange Dauer zwischen den Zeugenvernehmungen ist entweder darauf zurückzuführen, dass K. sich zeitweise nicht in Trier aufhielt oder aber, dass die Gestapo Trier aufgrund personeller Engpässe sowie der fragwürdigen Glaubwürdigkeit des Vertrauensmanns und F.s dem Vorgang zunächst eine geringe Priorität zuwies. In seiner Vernehmung bestätigte K. die Aussagen F.s im „Wesentlichen“47. Einen Tag nach der Vernehmung wurde Karl M. als Beschuldigter von der Gestapo Trier verhört.48 Er gab zu, dass er vor einiger Zeit im Besitz eines Exemplars der illegalen kommunistischen Druckschrift Die Rote Fahne gewesen sei. Offensichtlich leugnete er zunächst, etwas über die Herkunft der Druckschrift zu wissen, um seinen Schwager Johann Bauer zu schützen. Die Gestapo erreichte die Preisgabe des Namens von Karl M. jedoch trotzdem. Weiterhin bestätigte M., im Besitz eines weiteren Exemplars der Zeitung gewesen zu sein, das der Zeuge bei ihm gesehen hatte. Auch den Fund der Flugblätter mit dem Titel „8 Hamburger 46 Ebd., Bl. 6. 47 Ebd., Bl. 8a f. 48 Verantwortliche Vernehmung des Beschuldigten Karl M., ebd., Bl. 9 f.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
Antifaschisten von dem Schafott bedroht“ stritt er nicht ab. M. gab an, er habe sie gemeinsam mit seinem Schwager Johann Bauer auf dem Rückweg vom Fischen zufällig in der Luxemburgerstraße gefunden, aber gleich nach der Lektüre vernichtet. Aus dem Vernehmungsprotokoll wird ersichtlich, dass Johann Bauer am Morgen des Verhörs die Gelegenheit hatte, seinen Schwager zu warnen und ihm riet, die Druckschriften nicht zu erwähnen. Augenscheinlich war er der Ansicht, dass sein Schwager dem Verhör standhalten würde, denn er entzog sich nicht seiner bevorstehenden Verhaftung am nächsten Tag. Karl M. wurde am Tag seiner Vernehmung wieder entlassen. Am 24. Juli 1934 um 11 :15 Uhr wurde Johann Bauer vorläufig festgenommen, weil „er dringend verdächtig ist, staatsfeindliche illegale kommunistische Druckschriften (Die Rote Fahne) im Reichsgebiet verbreitet zu haben. Bauer hat Anfang Juni des Jahres seinem Schwager Karl M[…] ein Exemplar dieser Druckschrift zum Lesen übergeben.“49 Gegen Bauer bestand der Verdacht der Vorbereitung zum Hochverrat. Im Verhör der Gestapo verhielt sich Johann Bauer geschickt : Er gab nicht mehr zu als bekannt war und hatte für alle Anschuldigungen harmlose Erklärungen. Bauer bestritt vehement kommunistische Druckschriften eingeführt zu haben, sondern gab an, nur ein Exemplar in einer Bedürfnisanstalt am Hauptmarkt gefunden zu haben, das er in der Folge seinem Schwager überließ. Bezüglich der gefundenen Flugblätter bestätigte er die Aussage seines Schwagers. Ob die Aussagen Johann Bauers der Wahrheit entsprachen oder Schutzbehauptungen gegenüber der Gestapo waren, kann aus heutiger Sicht nicht mehr geklärt werden. Bauer schmuggelte von Zeit zu Zeit Konsumgüter wie Tabak und Zigarettenpapier aus Luxemburg, weswegen er auch bereits belangt worden war. Es erscheint am plausibelsten, dass er für sich und seinen Schwager bei Gelegenheit ein Exemplar der Roten Fahne in Luxemburg gekauft hatte. Gegen den Verdacht des umfangreichen Vertriebs kommunistischer Druckschriften spricht zudem, dass bei beiden Hausdurchsuchungen, am 14. und 24. Juli, keine solchen gefunden werden konnten. Lediglich der Besitz von acht Päckchen unversteuertem Zigarettenpapier konnte Bauer zur Last gelegt werden. Angesprochen auf seinen Bruder G. Bauer, der angeblich als Emigrant in Saarbrücken lebte, gab er an, keine Verbindung mehr zu diesem zu unterhalten. Die Gestapo Trier hielt die Angaben Johann Bauers für vollkommen unglaubwürdig.50 Da Johann Bauers Bruder G. sich als früherer KPD-Funktionär im Saargebiet aufhielt, ging sie davon aus, dass Johann Bauer die Rote Fahne über ihn bezog oder sogar Teil eines kommunistischen Kurierapparats sei. Offensichtlich versuchte die Gestapo, über Johann Bauer an dessen Bruder G. 49 Einlieferungsanzeige des Kriminalpolizeiamts, ebd., Bl. 11. 50 Einschätzung der Politischen Abteilung am 24.7.1934, ebd., Bl. 14.
159
160
|
Max Heumüller
Bauer heranzukommen. Die Gestapo führte eine „kommunistische Emigrantenliste“, in der G. Bauer als früherer KPD-Funktionär mit der Nummer 807 geführt wurde. Laut Personalbericht der Gestapo soll er „langjähriges und eifriges Mitglied der KPD, des Roten Frontkämpferbundes und des Kampfbundes gegen den Faschismus“51 gewesen sein. Bereits seit dem 23. Mai 1934 fahndete die Gestapo Trier nach ihm. Durch die Meldung des Denunzianten Theodor J. vom 8. Mai 1934 wusste die Gestapo bereits über G. Bauers Aufenthalt in Saarbrücken Bescheid.52 Noch im Laufe des Vorverfahrens bat der Oberreichsanwalt in Berlin das OLG Hamm um Meldung, sollte G. Bauer ergriffen werden. Daraufhin schickte das Oberlandesgericht wiederum einen Ermittlungsauftrag mit Personenbeschreibung an die Staatspolizeistelle Trier. Die daraufhin angestellten Ermittlungen blieben allerdings ohne Erfolg. Am 25. Juli 1934, einen Tag nach der Verhaftung, stellte das Amtsgericht Trier Haftbefehl gegen den bereits in Untersuchungshaft sitzenden Johann Bauer aus und übernahm die Begründung der Staatspolizei : „Verdacht auf Vorbereitung zum Hochverrat“.53 Nun, nachdem die Gestapo ihre Ermittlungsergebnisse an den Oberstaatsanwalt in Trier abgegeben hatte, fungierte sie sozusagen nur noch als unterstützende „Hilfsbeamte“ der Justiz.54 Da es sich um ein politisches Verfahren handelte, übernahm umgehend das Oberlandesgericht Hamm die Leitung des Vorverfahrens.
Vorverfahren, Prozess und Urteil am OLG Hamm
Die Beweislage gegen Johann Bauer schien dem OLG Hamm auszureichen. Weitere Ermittlungsanweisungen seitens der Justiz erfolgten nicht mehr. Die Gestapo Trier verfasste lediglich einen Bericht über Johann Bauer und Karl M., in dem sie ihre Einschätzung des Sachverhalts darlegte.55 Die Polizeibeamten bezeichneten Bauer als einen „verlogenen, dreisten, asozialen und nicht besserungsfähigen Fürsorgezögling“ und mussten eingestehen, dass ein umfassendes Geständnis nur bei „restloser Überführung“ möglich gewesen sei. Obwohl Bauer sich noch nie poli51 Ebd., Bl. 26. 52 Vernehmung von Theodor J. zu G. Bauer, ebd., Bl. 28. 53 Ebd., Bl. 16–19. 54 Hans-Eckhard Niermann : Die Durchsetzung politischer und politisierter Strafjustiz im Dritten Reich. Ihre Entwicklung aufgezeigt am Beispiel des OLG-Bezirks Hamm (Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 3), Düsseldorf 1995, S. 403. 55 Bericht der Politischen Abteilung der Polizei über Johann Bauer und Karl M., LA-NRW (Westf.), Q 211a/3319, Bl. 29. Alle folgenden Zitate aus ebd.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
tisch, geschweige denn kommunistisch betätigt hatte, schloss die Gestapo einen kommunistischen Hintergrund nicht aus. Einzig die Schmugglertätigkeit Bauers konnte aufgrund der vergangenen Verurteilungen belegt werden. Die Beurteilung von Karl M. fiel wesentlich besser aus. Er galt als „unbedingt glaubwürdiger“, nicht zuletzt, weil er seinen Schwager im Verhör belastet hatte. Auch bei M. konnte die Gestapo keine politischen Aktivitäten nachweisen. Karl M. und Johann Bauer wurden angeklagt, „das hochverräterische Unternehmen, die Verfassung des Reichs mit Gewalt zu ändern, vorbereitet zu haben.“ Die Anklageschrift basierte auf den Geständnissen der Angeschuldigten sowie den Zeugenvernehmungen von F. und K. Als weiteres Beweismittel wurde eine Maiausgabe der Roten Fahne beigefügt. Die zentrale Anschuldigung war der Besitz eines solchen Exemplars sowie das Zugänglichmachen der Druckschrift an Dritte. Aufgrund einer vertraulichen Mitteilung sah es die Anklage als erwiesen an, dass M. die Rote Fahne regelmäßig über seinen Schwager Bauer bezog. Als weiteren Hinweis auf die enge Zusammenarbeit der beiden Angeklagten führte die Staatsanwaltschaft den Fund der kommunistischen Flugblätter im Mai 1934 an. Die Hauptverhandlung am 12. Dezember 1934 wurde als öffentliche Sitzung vor dem Ersten Strafsenat am Oberlandesgericht Hamm abgehalten.56 Die Staatsanwaltschaft beantragte für beide Angeklagte ein Jahr und drei Monate Gefängnis wegen der Vorbereitung zum Hochverrat. Der Verteidiger Dr. Spenneberg beantragte Freispruch für Karl M. sowie Freispruch beziehungsweise eine mildere Bestrafung für Johann Bauer. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verhängte für beide Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Zusätzlich mussten die beiden Angeklagten für die Kosten des Verfahrens aufkommen. Das Gericht schenkte den Aussagen der beiden Zeugen in vollem Umfang Glauben. Dementsprechend sahen es die Richter als erwiesen an, dass M. die Rote Fahne regelmäßig bezogen hatte und darüber hinaus auch Hubert K. ein Exemplar zum Kauf angeboten hatte. Karl M. bestritt das Verkaufsangebot und bezeichnete K. im Laufe des Verfahrens als Verräter und gab an, dass selbiger „wegen einer anderen Sache nicht gut auf ihn zu sprechen“ gewesen sei. Des Weiteren führte das Gericht aus, Bauer und sein Mitangeklagter hätten sich aufgrund des Besitzes, der Aufbewahrung und der Weitergabe der Druckschrift strafbar gemacht. Es sei offensichtlich gewesen, dass sie durch die Weitergabe der Zeitung für die „Umsturzziele der KPD werben“ wollten. Die Richter deuteten außerdem die Weitergabe der Sendezeiten und Frequenzen des Moskauer Senders als flagranten Beweis für die bereits bezeichneten kommunistischen Umsturzziele der Angeklagten. Der Strafsenat ging davon aus, dass Johann Bauer die Zeitungen von seinem 56 Ebd., Bl. 61–65.
161
162
|
Max Heumüller
Bruder aus dem Saargebiet bekommen habe, konnte dafür jedoch keinen Beweis vorlegen. Da den Angeklagten eine umfangreiche kommunistische Betätigung nicht nachgewiesen werden konnte, stufte das Gericht beide als Mitläufer ein, die sich dennoch der Vorbereitung zum Hochverrat schuldig gemacht hatten. Bei der Begründung des Strafmaßes berücksichtigte das Gericht außerdem die Vorstrafen zu Lasten der Verurteilten. Letztendlich stützte sich das Gericht im gesamten Urteil auf die Zeugenaussagen von Alfred F. und Hubert K. sowie auf die Verhöre der beiden Verurteilten durch die Gestapo Trier. Im Gegensatz dazu, dass man den Angeklagten ihre Vorstrafen negativ auslegte, um ein hohes Strafmaß zu rechtfertigen, stellte das Gericht die Glaubwürdigkeit des Zeugen Alfred F. nicht in Frage, obwohl dieser ebenfalls bereits mehrfach vorbestraft war, unter anderem sogar wegen Falschaussage vor Gericht. Insgesamt erscheint die Strafe des OLG Hamm in Anbetracht der Beweislage äußerst hart. Johann Bauer und Karl M. stammten beide aus sozial und wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen und waren aufgrund von Arbeitslosigkeit auf Wohlfahrtsunterstützung angewiesen. Bauer entsprach nicht dem Ideal des nationalsozialistischen Menschenbildes, sondern befand sich am Rande beziehungsweise außerhalb der konstruierten „Volksgemeinschaft“. Er war arbeitslos, vorbestraft und galt als „verlogen, dreist [und] asozial“57. M., der vier Jahre im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte, wurde von der Gestapo zwar wesentlich besser beurteilt, bekam schlussendlich aber das gleiche Strafmaß. Das Herkunftsmilieu und die Glaubwürdigkeit der Zeugen betrachtete die Gestapo als kritisch, was aber für die Urteilsfindung keinen Unterschied machte, da ihre Aussagen im Sinne des Regimes waren und die Einschätzung der Angeklagten bestätigten. Die Meldung der Gestapo Trier über Johann Bauer im Lagebericht Juli 1934 erscheint im Kontext des anschließenden Verfahrens am OLG Hamm in einem anderen Licht. Der Lagebericht suggerierte einen erfolgreichen Schlag gegen einen Trierer Kommunisten, der sich umfänglich des Vertriebs illegaler kommunistischer Zeitungen schuldig gemacht hatte. Dieses Bild kann angesichts des Verfahrens schlichtweg nicht aufrechterhalten werden. Die Gestapo erfand keinen Sachverhalt, verfasste die Meldung aber dergestalt, dass ausreichend Interpretationsspielraum bei den Rezipienten blieb. Dienststellenleiter Heinrich Welsch schaffte es an dieser Stelle, ohne die Unwahrheit zu sagen, die Ermittlungstätigkeit „seiner“ Staatspolizeistelle in ein positives Licht zu rücken. Ort, Namen und der Besitz der Roten Fahne entsprachen zwar den Tatsachen, aber die Gestapo Trier nutzte die Unschärfe der Darstellung, um die Erwartungshaltung des Gestapas in Berlin zu erfüllen. Der Inhalt der Lageberichte darf also nicht vorbehaltlos übernommen, 57 Ebd., Bl. 29.
Kommunisten im Visier der Gestapo Trier
|
sondern muss kritisch reflektiert werden. Das Fallbeispiel zeigt nichtsdestoweniger exemplarisch sowohl die Ermittlungstätigkeit der Gestapo als auch die reibungslose Kooperation zwischen Justiz und Gestapo.
Schlussbetrachtung
Der aktuelle Forschungskonsens einer unterbesetzen und überbürokratisierten Behörde, die es ohne systematische und flächendeckende Überwachung dennoch schaffte, die Ziele nationalsozialistischer Machtinteressen durchzusetzen, konnte am regionalen Beispiel überprüft werden. Zur Entkräftung und weiteren Differenzierung des Mythos einer allgegenwärtigen und allmächtigen Gestapo konnte ein Stück weit beigetragen werden. Zwar war die Gestapo logistisch nicht in der Lage, die deutsche Bevölkerung in ihrer Gesamtheit zu überwachen, aber durch die Zuträgerschaft aus der Bevölkerung und einem weiten Kooperationssystem mit anderen staatlichen und parteiamtlichen Institutionen vermochte sie es, wie in einem Spiegelkabinett, die Illusion zu erschaffen, jeder widerständigen Handlung gewahr zu werden. Die Gestapo war nicht nur erfolgreich, weil die staatliche Verwaltung, die NSDAP und deren Organisationen sowie die Bevölkerung ihr zuarbeiteten, sondern auch, weil die von ihr geleisteten Ermittlungen von einer kooperierenden Justiz häufig ungeteilt übernommen und vollstreckt wurden. Die Einschätzung von Dams und Stolle zur Gestapo bestätigt sich auch für die Region Trier : Durch die Vielzahl von bereitwilligen Helfern war auch die Gestapo „mehr als die Summe der ihr nominell zugeordneten Beamten und Angestellten.“58 Insgesamt belegt das überlieferte Aktenmaterial einen bürokratischen Alltag im Gestapo-Innendienst. Die Beamten nahmen Denunziationen und Anzeigen entgegen, führten V-Mann-Akten, fertigten Verhörprotokolle an, korrespondierten mit einer Vielzahl von Ämtern und Gerichten und erfüllten nicht zuletzt eine umfassende Berichterstattungspflicht. Gleichzeitig scheute sich die Gestapo nicht, den ihr zur Verfügung stehenden Maßnahmenkatalog im Außendienst zu nutzen. Hier zeigte sich allerdings eine Schwäche der Lageberichte : Zwar finden sich schlaglichtartig Hinweise auf die Ermittlungstätigkeit, aber in welcher Weise und mit welchen Mitteln Verhöre und Festnahmen stattfanden, wurde von den Berichterstattern nicht festgehalten. Mit Hilfe des Fallbeispiels zu Johann Bauer konnten jedoch exemplarisch die Ermittlungstätigkeit und die Zusammenarbeit mit der Justiz rekonstruiert werden. Die Gestapobeamten führten Razzien durch, verhörten 58 Dams/Stolle : Gestapo, S. 195.
163
164
|
Max Heumüller
Beschuldigte und Zeugen und überstellten den Delinquenten nach Vollstreckung der Schutzhaft der Justiz. Trotz der breiten Unterstützung war die Gestapo keineswegs omnipräsent. Die Lageberichte zeigen vielfach die Unzulänglichkeiten bei der Verfolgung ihrer Gegner. Durch gezielten, punktuellen Terror erreichte sie Prävention und Abschreckung und konnte zukünftiges nicht-systemkonformes Verhalten unterbinden. Grundsätzlich muss dazu angemerkt werden, dass innerhalb weiter Teile der deutschen Bevölkerung Akzeptanz, Toleranz oder Desinteresse gegenüber den Maßnahmen der Gestapo herrschte. Diese Verbindung aus Konsens und Terror ermöglichte es der Gestapo, trotz geringer Personalstärke, massiv zu der Konsolidierung nationalsozialistischer Macht beizutragen. Nach Analyse der Lageberichte der Gestapo Trier mit dem Fokus auf der Überwachung des Marxismus und Kommunismus kann abschließend konstatiert werden, dass die Verbindung von Konsens und Terror auch in Trier bei der Etablierung nationalsozialistischer Ordnungsvorstellungen eine zentrale Rolle gespielt hat. Wie bereits für andere Regionen geschehen, konnte auch auf regionaler Ebene für den Raum Trier der Mythos einer allgegenwärtigen Gestapo weiter entkräftet werden.
Frederik Rollié
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung im Spiegel der Trierer Gestapo-Lageberichterstattung (1934–1936)* Der Bauer verlangt klare Führung in der Provinz, er kennt das Führerprinzip vom Militär her und schätzt es, er hat deshalb das Führerprinzip der NSDAP mit heißem Herzen ersehnt und begrüßt.1
Mit diesen Worten positionierte sich der ehemalige Präsident des Deutschen Landwirtschaftsrates, Dr. Ernst Brandes, selbst kein Nationalsozialist, gegenüber Reichsbauernführer Richard Walther Darré in der Phase der Umwandlung der landwirtschaftlichen Genossenschaften und verdeutlicht damit die Existenz einer Schnittmenge zwischen deutschnationaler und nationalsozialistischer Agrarpolitik.2 Die wirtschaftlichen Ziele des „Dritten Reiches“ konnten nur durch eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion erreicht werden. Damit diese nicht zum Erliegen kam, war es notwendig, die Stimmung der betroffenen Bauern zu kontrollieren, um bei aufkommenden Problemen eingreifen zu können. Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) arbeitete nicht nur an der Eindämmung der politischen Opposition, um den Staat als solchen zu schützen. Auch der Schutz des deutschen Volkes gehörte zu ihrem Aufgabenbereich. Dessen schützenswerte „Reinheit“ wurde ideologisch hochstilisiert und eine permanente, allerdings fiktive, Bedrohung des deutschen Volkes wurde verkündet. Auf diese Weise galten nun nicht mehr nur kriminelle Handlungen sowie politische Abweichungen von der NS-Norm als feindliche Bedrohung, sondern auch soziale und „rassische“ Abweichungen.3 Damit folgte die Gestapo der Idee des NS-Chefideologen Werner Best, welcher die Aufgaben der Gestapo in der Überwachung des politischen Gesundheitszustandes des deutschen Volkes4 sowie in der „Ausübung notwendiger * Für Timo Anton. Plötzlich war die Welt eine andere. 1 Brandes an Darré am 26.9.1933, zit. nach : Gustavo Corni/Horst Gies : Brot, Butter, Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der Diktatur Hitlers, Berlin 1997, S. 123. 2 Ebd., S. 122 f. 3 Ingrid Bauz : Von der politischen Polizei zur Gestapo. Brüche und Kontinuitäten in : Ingrid Bauz/ Sigrid Brüggemann/Roland Maier (Hg.) : Die Geheime Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern, Stuttgart 2013, S. 23–77, hier S. 68. 4 Burkhard Dietz/Anselm Faust/Bernd-A. Rusinek : Einleitung : Die Lageberichte der Geheimen Staatspolizei 1934–1936, in : Lageberichte rheinischen Gestapostellen (Publikationen der Gesell-
166
|
Frederik Rollié
Funktionen des Volksorganismus“5 sah. Dabei hatte die Gestapo in seinen Augen die Aufgabe, ein „Instrument des inneren Selbstschutzes des Deutschen Volkes“6 zu sein. Zur Aufrechterhaltung der „Lebenskraft des Volkes“ gehörte, neben der Überwachung und Verfolgung von vermeintlichen Staatsfeinden, auch die Aufrechterhaltung der Nahrungs- und Rohstoffversorgung. Aus diesem Grund wurde sowohl die Stimmung in der landwirtschaftlichen Bevölkerung als auch die Lage in der Landwirtschaft überwacht. In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, wie die Überwachung der Landwirtschaft geschah und was genau in den Fokus geriet. Des Weiteren wird sich mit der Frage beschäftigt, ob es im Regierungsbezirk Trier normabweichendes Verhalten in der Bauernschaft gab und welche Qualität diese Normabweichungen hatten. Dazu wurden die Gestapo-Lageberichte der Staatspolizeistelle Trier genutzt. Es liegen 16 Berichte aus dem Zeitraum von Juli 1934 bis Februar 1936 mit insgesamt 187 Meldungen zur landwirtschaftlichen Lebenswelt vor.
Exkurs: Widerstand im „Dritten Reich“
Generell ist es schwierig, den Widerstand gegen das NS-Regime genau zu definieren. In der Forschung sind seit der unmittelbaren Nachkriegszeit unterschiedliche Ansätze diskutiert worden, ohne zu einem eindeutigen Ergebnis zu kommen.7 In diesem Beitrag wird auf das Vier-Stufen-Modell des abweichenden Verhaltens nach Detlef Peukert Bezug genommen. Die breite Basis des Widerstandes stellte die Nonkonformität dar. Dementsprechend wurde auf dieser ersten Stufe hauptsächlich im privaten Raum partielle Kritik an der NS-Herrschaft geäußert, ohne diese grundsätzlich in Frage zu stellen. Dem folgen die Stufen der Verweigerung, auf der sich gegen behördliche Anordnungen widersetzt wurde, und die des Protestes, auf welcher das NS-System weitgehend abgelehnt wurde. Die oberste Stufe in Peuschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), Bd. I : 1934, Düsseldorf 2012, S. 1–32, hier S. 21. 5 Werner Best : Der Aufbau der Sicherheitspolizei und des SD einschließlich des Reichssicherheitshauptamtes unter besonderer Berücksichtigung der Stellung und der Aufgaben der Inspekteure der Sicherheitspolizei und des SD (Vortragsmanuskript, 29.1.1940), Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/243, Bl. 243–254, hier Bl. 244v. 6 Ebd. 7 Michael Kissener : Von punktuellen Dissonanzen, Schwarzschlächtern und aktivem Umsturz. Der Widerstandsbegriff im Wandel der Zeit, in : Nils Kleine/Christoph Studt (Hg.) : „Das Vermächtnis ist noch in Wirksamkeit, die Verpflichtung noch nicht eingelöst.“ Der Widerstand gegen das „Dritte Reich“ in Öffentlichkeit und Forschung seit 1945 (Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e.V., Bd. 19), Augsburg 2016, S. 29–40.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
Reichweite der Systemkritik
Generell ……………………………………… . Partiell Privat ………………………………………. staatsbezogen
Wirkungsraum der Handlung
Abb. 1: Formen abweichenden Verhaltens im Dritten Reich. (Quelle: Peukert: Volksgenossen, S. 97).
kerts Modell bildete der eigentliche Widerstand. Dieser manifestierte sich durch die gänzliche Ablehnung des NS-Systems und die Anstrengung, dieses zu stürzen. Von Stufe zu Stufe verlagert sich die Form des abweichenden Verhaltens vom privaten Raum hin in den öffentlichen Handlungsraum, sowie von partieller hin zur generellen Systemkritik.8 Bei jeder im weitesten Sinne als „Widerstand“ bezeichneten Verletzung der nationalsozialistischen Normen sind zudem die jeweilige Situation und der Einfluss des sozialen Umfelds des Widerständigen zu berücksichtigen. Nur so können die Motivation und das Bewusstsein des Einzelnen für die Tragweite der Handlungen untersucht werden.9 8 Detlef Garbe: Zwischen Widerstand und Martyrium. Die Zeugen Jehovas im „Dritten Reich“ (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 42), München 41999, S. 517. Vgl. auch Ian Kershaw: Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek b. Hamburg 32002, S. 310 f. 9 Detlef Peukert : Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus, Köln 1982, S. 96.
167
168
|
Frederik Rollié
Die Lageberichte der Gestapo Trier
Die Lageberichte der Gestapo Trier waren weisungsgemäß in vier Oberkategorien gegliedert : „A : Allgemeine Stimmung und Lage in der Bevölkerung“, „B : Gegner des Staates“, „C : Bewegung und ihre Organisation“ und „D : Wirtschafts- und Sozialpolitik“. Diese Themenbereiche blieben über den gesamten Berichtszeitraum hinweg unverändert. Um die Überwachung der Landwirtschaft und der landwirtschaftlichen Bevölkerung in der Region Trier durch die Gestapo zu beleuchten, wurden die Gliederungspunkte „A :2 Stimmung in der Bauernschaft“ und „D :2 Landwirtschaft“ ausgewertet. Bei Wirtschaftsthemen herrschte bei den Gestapobeamten aufgrund fehlender Fachkenntnisse häufig Überforderung. Daher wurden Informationen meistens direkt von den Wirtschaftskammern oder den landwirtschaftlichen Organisationen des Nationalsozialismus in die Lageberichte übernommen.10 Auch für das Berichtswesen der Staatspolizeistelle Trier kann davon ausgegangen werden, dass die Informationen fast wortgetreu weitergegeben wurden. Eine Besonderheit der landwirtschaftlichen Überwachung für den Regierungsbezirk Trier stellt die Behandlung des Weinbaus dar.11 Dieser wird in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht thematisiert. Zur besseren Einordnung der Aussagen zur Stimmung in der Bauernschaft des Regierungsbezirks Trier erfolgte eine Kategorisierung in zehn Abstufungen : 1. Zustandsbeschreibungen der Verhältnisse im Regierungsbezirk, hauptsächlich über den Stand der Landwirtschaft (56 Meldungen). 2. Stimmung aufgrund aktueller wirtschaftlicher Verläufe. Hierzu zählen Preis entwicklungen und Maßnahmen der Regierung oder des Reichsnährstandes12, welche Einfluss auf die wirtschaftliche Lage der Bauernschaft hatten (38 Meldungen).
10 Faust/Rusinek/Dietz : Einleitung, S. 22. 11 Christof Krieger : „Wein ist Volksgetränk !“ Weinpropaganda im Dritten Reich am Beispiel des Anbaugebietes Mosel-Saar-Ruwer, Diss. Trier 2015. 12 Der Reichsnährstand war eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und diente in der NS-Zeit der Lenkung der Produktion sowie des Vertriebs und der Preise von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Untergliedert war er in Landes-, Kreis- und Ortsbauernschaften. Alle in Landwirtschaft, Fischerei und Gartenbau tätigen Personen samt Angehörigen, die landwirtschaftlichen Genossenschaften, der Landhandel sowie die Be- und Verarbeiter landwirtschaftlicher Erzeugnisse waren Zwangsmitglieder dieser Organisation, die mit etwa 17 Millionen Mitgliedern zu den größten während der NS-Zeit zählte ; vgl. Corni/Gies : Brot – Butter – Kanonen, S. 75–167.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
3. Aussagen und Einschätzungen der Gestapo über die Bauernschaft und die generelle Stimmung. Die Einschätzungen über die Bauernschaft sind sowohl positiv als auch negativ gefärbt (22 Meldungen). 4. Stimmung aufgrund äußerer bzw. natürlicher Bedingungen. Hierzu zählen Ernteausfälle, Wetter, Wildschäden und Ähnliches (15 Meldungen). 5. Handlungen gegen einzelne Maßnahmen des „Dritten Reiches“ und dessen Vertreter (15 Meldungen). 13 6. Positive Reaktionen auf Maßnahmen der Regierung oder des Reichsnährstandes (12 Meldungen). 7. Stimmung aufgrund von Bürokratie, Verwaltung und Politik. In diese Kategorie wurden alle Kommentare eingefügt, welche einen Bezug auf politische oder bürokratische Missstände von Regierung oder Reichsnährstand enthielten (11 Meldungen). 8. Lageeinschätzungen der Gestapo sowie Handlungsempfehlungen der Gestapoleiter (11 Meldungen). 9. Stimmung aufgrund von Maßnahmen der Regierung oder des Reichsnährstandes, welche die bäuerliche Gesellschaftsordnung beeinflussten (4 Meldungen). 10. Stimmung aufgrund von Baumaßnahmen (3 Meldungen). Die Bestrebungen des nationalsozialistischen Staates eine Nahrungsautarkie herzustellen sowie die baldige Kriegsfähigkeit zu erreichen, zeigen deutlich, wie wichtig die Überwachung der landwirtschaftlichen Betriebe für das Erreichen dieser Ziele war. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Stimmung und die Haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung neben der Produktion gesondert überwacht wurden. Im Folgenden werden fünf Kategorien behandelt, um die Haltung der landwirtschaftlichen Bevölkerung gegenüber dem Regime und dessen Maßnahmen zu betrachten. Es handelt sich um die Reaktionen auf wirtschaftliche Gegebenheiten [2], Einflüsse auf die Gesellschaftsordnung [9], Vorgänge in Verwaltung und Politik [7], Baumaßnahmen [10] und die als Widerstand gekennzeichneten Handlungen [5].
13 Eine Gewichtung dieser wurde an dieser Stelle noch nicht vorgenommen.
169
170
|
Frederik Rollié
Das abweichende Verhalten in der Bauernschaft im Regierungsbezirk Trier
Wird die Reaktion der ländlichen Bevölkerung auf Baumaßnahmen [10] überprüft, fällt auf, dass Umlegungsarbeiten der Reichsbahn und Meliorationsarbeiten die Ursachen für bäuerlichen Unmut in der Region Trier waren.14 Im April 1935 gab zudem die Leitung der Gestapo Trier die Einschätzung ab, dass bei weiteren schleppend vorangehenden Meliorationsarbeiten zu befürchten sei, „dass es in Zukunft kaum noch möglich sein wird, die Landbesitzer in Entund Bewässerungsgenossenschaften zusammenzuschließen“15. An dieser Stelle wurde vor einer Verweigerung der Bauern gegenüber Maßnahmen des Reichsnährstandes als einer die Regierung vertretenden Institution gewarnt. Auch wenn sich diese Verweigerung auf eine partielle Situation, die Bildung von Bewässerungsgenossenschaften, bezog, handelte es sich dennoch um eine Widersetzung gegen behördliche Anweisungen. Die Befürchtung, dass sich die Stimmung gegen das Regime wenden könnte, ist allerdings nicht zu vergleichen mit Protestmaßnahmen von Bauern gegen nationalsozialistische Bauprojekte, wie beispielsweise die Aktionen von 1936 gegen die Zwangsverkäufe für den Truppenübungsplatz Bergen/ Munster.16 Werden die Meldungen über Maßnahmen und deren Einfluss auf die bäuerliche Gesellschaftsordnung [9] betrachtet, fällt auf, dass drei der vier Meldungen das Reichserbhofgesetz17 betrafen. Im Februar 1935 wurde angemerkt, dass Teile 14 Lagebericht der Gestapostelle Trier für März 1935, BArch Berlin, R 58/432, Bl. 58–84, hier Bl. 65. Vgl. auch Lagebericht der Gestapostelle Trier für April 1935, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 95 sowie Lagebericht der Gestapo stelle Trier für Mai 1935, BArch Berlin, R 58/510, Bl. 91–102, hier Bl. 101. In diesem Beitrag werden die Lageberichte über ihre Archivsignatur nachgewiesen. Vgl. aber auch die folgende Edition : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz/Anselm Faust/Bernd-A. Rusinek, 3 Bde. in 4 Teilbänden, Düsseldorf 2012–2016. 15 Lagebericht der Gestapostelle Trier für April 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 95. 16 Daniela Münkel : Das Reichserbhofgesetz in der Praxis, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 44 (1996), H. 4, S. 549–580, hier S. 564. 17 Das Reichserbhofgesetz vom 29. September 1933 diente der Herauslösung eines Großteils der Landwirtschaft aus dem Marktgeschehen, indem die betroffenen Erbhöfe (7,5 bis 125 ha) nur noch ungeteilt an einen Erben übertragen werden konnten und sämtliche Veränderungen des Grundbesitzes (Tausch, Verpachtung, Verkauf ) durch eigens eingesetzte Anerbengerichte genehmigt werden mussten. Bauer, so die Bezeichnung der Erbhofbesitzer, konnte nur noch sein, wer „deutsches oder stammesgleiches Blutes“ und gleichzeitig „ehrbar“ war. Das sehr stark durch die „Blut-und-Boden-Ideologie“ geprägte Gesetz ist allerdings in der Praxis oft nach ökonomischen Gesichtspunkten ausgelegt worden und musste durch mehrere Durchführungsverordnungen den Erfordernissen der
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
Abb. 2: Handlungsanweisung des Reichsnährstandes zur richtigen Umsetzung der Meliorationen. (Quelle: Erzeugungsschlacht, S. 61).
der Bauernschaft die Ansicht vertreten würden, dass die Abgaben für die örtliche Wohlfahrt und das Winterhilfswerk (WHW) an die falschen Personen, welche die Fürsorge nicht verdient hätten, ausgezahlt würden. Interessanterweise gab der Leiter der Gestapo den Bedenkenträgern Recht, indem er die Objektivität bestimmter Dorfschulzen oder Amtswalter der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) bestritt.18 Im Mai 1935 wurde gemeldet, dass die Eintrittsbereitschaft in die NSV nicht den Erwartungen entsprechen würde.19 Es ist also erkennbar, dass Teile der Bauernschaft sich der NS-Wohlfahrt verweigerten und damit in Peukerts Modell auf Stufe zwei agierten, auch wenn diese Handlungen noch auf partieller Ebene stattfanden. In den Monaten Juli bis September 1934 wurden Stimmen gegen das Reichs erbhofgesetz laut. Im Juli hieß es, in den „Eifelkreisen wird auch immer noch
landwirtschaftlichen Traditionen angepasst werden ; vgl. Daniela Münkel : Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag, Frankfurt a.M./New York 1996, bes. S. 112–120. 18 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 694 f. 19 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Mai 1935, BArch Berlin, R 58/510, Bl. 94.
171
172
|
Frederik Rollié
gemeldet, daß das Erbhofgesetz nach wie vor starke Ablehnung erfährt.“20 Auch im August fand das Reichserbhofgesetz eine negative Erwähnung im Zusammenhang mit dem, scheinbar für Trier nicht ganz zufriedenstellenden, Ergebnis der Volksabstimmung vom 19. August 1934 über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches.21 Im Regierungsbezirk Trier stimmten 11,7 % der Wahlberechtigten gegen die nachträgliche Bestätigung Adolf Hitlers als Reichskanzler und -präsident.22 Damit lag die Zahl der Nein-Stimmen leicht über dem reichsweiten Wert von 9,6 %.23 Im September 1934 hieß es : Auch die Gegnerschaft gegen das Erbhofgesetz hat sich noch nicht beruhigt, vielmehr lässt die Durchführung des Gesetzes den Widerstand der Betroffenen gerade jetzt neu aufleben. Besonders diejenigen Bauern, die mehrere Kinder haben, sind mit dem Gesetz nicht zufrieden und erwarten Ausgleichsbestimmungen.24
Es fehlen Aussagen über die Qualität des abweichenden Verhaltens. In Verbindung mit den Nein-Stimmen der Volksbefragung kann aber davon ausgegangen werden, dass es sich zumindest im August 1934 um Verweigerung handelte. Auch wenn in diesem Fall Adolf Hitler als uneingeschränktes Staatsoberhaupt abgelehnt wurde, dürfte das Abstimmungsergebnis eher auf der Unzufriedenheit über das Reichs erbhofgesetz und weiteren unpopulären Einzelmaßnahmen gefußt und nicht das gesamte nationalsozialistische System in Frage gestellt haben.25 Eine weitere Kategorie, welche sich für die Analyse des abweichenden Verhaltens durch die bäuerliche Bevölkerung im Regierungsbezirk Trier eignet, ist die Untersuchung der Stimmung aufgrund von Bürokratie, Verwaltung und Politik [7]. Im Juli 1934 gab es in vielen Orten Verstimmungen über die Zusammensetzung der Gemeinderäte,26 denn dieses Gremium wurde im Verlauf der nationalsozialistischen Machtübernahme und später zur Machtfestigung von den Na20 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 38. 21 Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 61. 22 Statistik des Deutschen Reiches, Bd. 449 : Wahlen zum Reichstag und die Volksabstimmung am 12. November 1934 sowie die Volksabstimmung am 19. August 1934, Berlin 1934, S. 68. 23 Ebd., S. 108. 24 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 5 f. Da im Reichserbhofgesetz die ungeteilte Vererbung der Erbhöfe festgelegt worden war, stieß diese Regelung insbesondere in Realteilungsgebieten wie dem Regierungsbezirk Trier auf wenig Verständnis. 25 Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 61. 26 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 38.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
tionalsozialisten infiltriert und sukzessive besetzt. Erkennbar ist eine Ablehnung gegenüber den von den Nationalsozialisten eingesetzten politischen Vertretern auf der untersten Ebene, insbesondere dann, wenn es offensichtlich um die Versorgung „Alter Kämpfer“ ging, die keinerlei Fachkenntnisse mitbrachten. So wurden im September 1934 folgende Beschwerden über Politik und Verwaltung verzeichnet : Häufig wird auch über teilweise nicht richtige Behandlung der Bauern durch die örtlichen politischen Leiter und vor allem darüber geklagt, daß häufig in rein bäuerlichen Ortschaften die Leitung in Händen von Nichtbauern liegt, die die Belange der Bauern nicht verstehen.27
Hier wurde u.a. die Praxis kritisiert, dass Landes- und Kreisbauernführer bei der Einsetzung der Ortsbauernführer nicht auf die Vorschläge der Gemeinden eingehen mussten.28 Im Februar 1935 wurde angemerkt, dass Vertreter des Reichsnährstandes auf Kreis- und Landesebene nicht in der Lage seien, die Interessen der Bauernschaft zufriedenstellend zu vertreten.29 Zwei Monate später wurde aus der Kreisbauernschaft Baumholder eine „ausgesprochen feindliche Stimmung gegenüber dem Kreisbauernführer“30 gemeldet. Die Äußerungen lassen sich in den Bereich der Nonkonformität einordnen, da sie nicht mehr nur im privaten Rahmen geäußert wurden. Sowohl im Februar 1935 als auch im April/Mai 1935 wurden Beschwerden über zu hohe Beiträge für den Reichsnährstand laut. Dass diese Beschwerden gerechtfertigt waren, lässt sich an einer knappen Verdoppelung der Einnahmen des Reichsnährstandes durch landwirtschaftliche Arbeitnehmer von 2.800.000 RM im Jahr 1936 auf 5.000.000 RM im Folgejahr31 belegen. In der Kreisbauernschaft Baumholder sorgte eine Mischung aus einer feindlichen Haltung gegenüber dem Kreisbauernführer, einer Ablehnung der als zu hoch erachteten Reichsnährstandbeiträge und dem Empfinden einer Überorganisation und Verkomplizierung von Vorgängen bei dem verantwortlichen Landrat für Sorgen über die Stabilität und den Einfluss der Kreisbauernschaft auf die Bauern.32 Die feindlichen Haltungen 27 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 5. 28 Corni/Gies : Brot, Butter, Kanonen, S. 122. 29 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 694. 30 Lagebericht der Gestapostelle Trier für April/Mai 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 99. 31 Corni/Gies : Brot, Butter, Kanonen, S. 115. 32 Lagebericht der Gestapostelle Trier für April/Mai 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 99.
173
174
|
Frederik Rollié
gegenüber dem Kreisbauernführer und die damit verbundene Sorge des Einflussverlustes weisen auf eine partielle Verweigerung gegen dieses NS-Organ hin. Den mit 38 Meldungen am stärksten vertretenen Aspekt abweichenden Verhaltens bildeten Stimmungen aus dem Bereich der Wirtschaft [2]. Von diesen Meldungen können 31 einer negativen Stimmung zugeordnet werden. So ist über fast den gesamten Beobachtungszeitraum eine Futtermittelknappheit und, damit verbunden, eine Abnahme der Viehpreise dokumentiert. Vor allem die Differenz zwischen Schlacht- und Verkaufspreis der Endprodukte führte bei den betroffenen Bauern zu Unmut und wurde teilweise als Unrecht angesehen. Es hieß beispielsweise für Juli 1934, „daß die Preise, die der Metzger erhält, in keinem Verhältnis zu denen stehen, die ihr [der Bauernschaft, A.d.V.] selbst gezahlt werden.“33 Trotz einer kurzen Erholung des Viehpreises im Juni und August 193534 drückten die Notverkäufe wegen Futtermangels im Mai 1935 immer noch auf die Stimmung. Dies könnte einer der Gründe für die im selben Monat getätigte Aussage über die mangelnde Würdigung der preisgestaltenden Maßnahmen des Reichsnährstandes und der Regierung gewesen sein : Es hat aber den Anschein, als ob ein Teil der Bauernschaft diesen Maßnahmen immer noch skeptisch gegenüber steht und noch nicht recht zu erkennen vermag, daß gerade die Masse der Verbraucher erhebliche Opfer für die Bauernschaft bringt, daß sie für Lebensmittel Preise zahlen muß, die weit über den Weltmarktpreisen und auch weit über den Preisen liegen, die die Bauernschaft vor der Machtergreifung für ihre Erzeugnisse erhalten hat.35
Erkennbar ist eine deutliche Unzufriedenheit wegen des Viehabsatzes, die sich allerdings in den hier vorgestellten Fällen in der Form einfachster Kritik zeigte und daher höchstens der Nonkonformität zuzuschreiben ist. In fast allen überlieferten Lageberichten dominierten negative Meldungen über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen, welche der Reichsnährstand als Vertreter des nationalsozialistischen Regimes erließ.36 Es wurden vor allem die Teile der 33 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 38. 34 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juni 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 110 ; Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 142. 35 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Mai 1935, BArch Berlin, R 58/510, Bl. 94. 36 Insgesamt neun der 16 Lageberichte enthalten mindestens eine negative Meldung über agrarpolitische Maßnahmen. Darunter befinden sich auch die seit 1934 immer wieder ausgerufenen Erzeugungsschlachten, in deren Zusammenhang Maßnahmen zur Steigerung der Produktivität propagiert wurden, die dem Ziel einer Nahrungsmittelautarkie dienen sollten ; vgl. auch Die deutsche
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
Marktordnung37 kritisiert, welche das Wirtschaftsleben der bäuerlichen Bevölkerung direkt beeinflussten. Beispielsweise wurde im Juli 1934 die Absatzregelung von stadtnahen Bauern beanstandet.38 Einen Monat später wurden auch Beschwerden der stadtfernen Bauernschaft aus der Eifel aufgeführt. Diese Bauern waren mit dem System der Zwischenhändler, die man als unnötige Zwischenstation auffasste, nicht zufrieden, da ihre Obsternte so nur unter erschwerten Bedingungen verwertbar war. Der Ertrag aus dieser Ernte wurde häufig verwendet, um kurzfristige Verbindlichkeiten abzudecken.39 Auch die Absatzregelungen des Reichsnährstandes und das damit verbundene Festpreis- und Preisspannensystem wurden kritisiert. Hier lagen die Kritikpunkte unter anderem darin, dass die Preisspanne zwischen Erzeugerpreis und dem Verkaufspreis zu hoch wären und dass das sonstige Beziehungsverhältnis zwischen Erzeuger und Konsument gestört würde.40 Auch über die Reglementierung der Milchablieferung wurden in den Berichten kritische Äußerungen gefunden. Im März und April 1935 wurden Beschwerden über den Milchabgabezwang und dessen Kontrolle dokumentiert.41 In punkto Erzeugungsschlacht wurden im Februar 1935 Bedenken laut, dass deren Ausführung mit erheblichen Anschaffungskosten verbunden sei.42 Ein Jahr später wurde aus den Hochwaldgebieten gemeldet, dass zum Beispiel bei den Bauern in Hermeskeil der Sinn der Erzeugungsschlacht nicht verstanden worden sei und dass vor allem konservative Bauern die für die Region neu eingeführte Flachssaat nicht mit tragen würden.43 Erkennbar ist eine partielle Verweigerung des vom Regime in der Erzeugungsschlacht getätigten Befehls. Im Februar 1935 wurde aus einigen Teilen des Regierungsbezirks gemeldet, dass die geforderten Getreideablieferungen nicht in ausreichender Menge durchgeführt Erzeugungsschlacht 1934/35. Wie schlägt man die Erzeugungsschlacht. Richtige Ratschläge in drastischen Bilderfolgen, hg. vom Reichsnährstand, Essen 1935. 37 Die Regulierung der landwirtschaftlichen Marktverhältnisse wurde bereits im Reichsnährstandsgesetz vom 13. September 1933 festgehalten. Die so erteilte Aufsichts- und Eingriffsbefugnis des zuständigen Landwirtschaftsministers wurde schließlich im Februar 1935 dem Reichsnährstand übertragen, der dann die vollständige Überwachung und Lenkung der Marktordnung übernahm ; vgl. Münkel : Agrarpolitik, S. 106–112. 38 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 38. 39 Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 60 f. 40 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1934, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 4. 41 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3037c, Bl. 703 ; Lagebericht der Gestapostelle Trier für April 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 80. 42 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 695. 43 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1936, BArch Berlin, R 58/656, Bl. 74.
175
176
|
Frederik Rollié
wurden. Der Grund für die geringen Abgaben wurde in der anhaltenden Futtermittelknappheit gesehen.44 Ob diese anhaltenden Handlungen als Verweigerung eingeordnet werden können, ist fraglich. Deutlicher in diese Richtung verweist eine Meldung vom Mai 1935 : Es spricht auch nicht für ein Verständnis der Bauernschaft für die wirtschaftlichen Maßnahmen der Regierung, daß in der letzten Zeit das Bestreben der Bauern zu erkennen ist, entbehrliche Hafervorräte zurückzuhalten, um durch eine bestehende Knappheit letzten Endes Preise zu erzielen, die über die festgesetzten und auskömmlichen Preise hinausgehen.45
Das Zurückhalten von entbehrlichen Vorräten wird der Verweigerung und damit der zweiten Stufe des Modells nach Peukert zugeordnet. Ebenfalls in den Bereich der Umgehung oder Verweigerung von wirtschaftlichen Vorgaben zählt eine Meldung vom Oktober 1935. Dort hieß es : […] so besteht mit Rücksicht auf den Mangel an Schlachtschweinen doch die Vermutung, dass die vorgeschriebenen Höchstpreise nicht immer eingehalten werden. […] den Preis je Gewichtseinheit genau nach den Höchstsätzen festzulegen, jedoch findet ein Wiegen der Schlachttiere nicht immer statt, sondern einigen sich die Parteien auf ein nach beiderseitigem Übereinkommen geschätztes Gewicht.46
Es kann eine Verweigerung des Festpreissystems angenommen werden, da von der Gestapo dessen stärkere Überwachung gefordert wurde.47 Im Januar 1936 wurde zusätzlich empfohlen, auch für Rinder einen Schlachtviehhöchstpreis, wie bei Schweinen, einzuführen. Diese Aussage lässt darauf schließen, dass bis dahin Rinder zu überteuerten Preisen verkauft worden waren.48 Ein Problem, das im März 193549 angesprochen wurde und im Februar 1936 weiterhin bestand, war eine Steuersäumigkeit, welche vor allem bei Bauern im Entschuldungsverfahren vorkam. Im Februar wurde beanstandet, dass es Bauern in einigen Gebieten bis zur Zwangsbeitreibung kommen lassen würden.50 Dies war allerdings ein Problem, das nicht nur im Regierungsbezirk Trier vorkam, sondern 44 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 710. 45 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Mai 1935, BArch Berlin, R 58/510, Bl. 94. 46 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Oktober 1935 BArch Berlin, R 58/566, Bl. 99. 47 Ebd. 48 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Januar 1936, BArch Berlin, R 58/571, Bl. 89. 49 Lagebericht der Gestapostelle Trier für März 1935, BArch Berlin, R 58/3037c, Bl. 706. 50 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1936, BArch Berlin, R 58/656, Bl. 75.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
reichsweit beobachtet werden konnte. Im ideologischen Verständnis der Nationalsozialisten konnten steuersäumige Bauern keine ehrbaren Bauern und damit keine Erbhofbauern mehr sein.51 Auch wenn durch das Entschuldungsverfahren52 bei manchem Bauern die Annahme entstand, dass das Zahlen der Steuern nicht mehr in seine Zuständigkeit fallen würde, und damit unbewusst gegen das System verstoßen wurde, wird das Verzögern oder das Einstellen von Steuerzahlungen doch als Verweigerung im Sinne von Peukerts Widerstandsmodell gesehen. Im Januar 1936 wurde ein Rückgang der Teilnahmebereitschaft bei den Aufklärungsversammlungen der Kreisbauernschaften festgestellt. Ob dies aufgrund deren ablehnender Haltung oder anstehender Winterarbeiten geschah, ist in dem Bericht nicht verzeichnet. Allerdings wird erwähnt, dass vor allem die Bauern abwesend waren, die Betriebe führten, auf denen Umstellungsmaßnahmen notwendig gewesen seien, die sie aus eigener finanzieller Kraft tätigen sollten.53 Bei dieser Trotzreaktion durch die betroffenen Bauern handelte es sich um ein Entziehen aus der Einflussnahme des Reichsnährstandes als Vertreter des Regimes und dies kann als Verweigerungshaltung bewertet werden. Eine Zuspitzung der wirtschaftlichen Lage und damit ein Kippen der Stimmung scheint der Bericht im September 1935 zu dokumentieren. Dieser sticht aus den überlieferten Berichten dadurch hervor, dass in ihm detaillierte und tiefergehende Informationen über bestimmte Vorkommnisse enthalten sind. Als Ursache für den in dem Bericht beschriebenen Eklat wurde Unzufriedenheit über die Preisgestaltung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse aufgeführt, welche zu wiederholten Versuchen von Stimmungsmache führte. Um die Geschehnisse in vollem Umfang darzustellen, wurde auf eine Zusammenfassung durch den Leiter der Gestapo verzichtet und direkt aus einem Bericht des betreffenden Kreisleiters zitiert. Aus dem Bericht geht nicht hervor, um welche Kreisbauernschaft es sich handelte. In ihm wurde vermeldet, dass es planmäßige Hetze gegen die vom Regime festgesetzten Preise gab und dass gegen diese scharf angegangen wurde. Diesen Protesten seien auch NSDAP-Mitglieder auffällig zugeneigt gewesen. Während einer Mitarbeiterbesprechung einer NSDAP-Ortsgruppe forderten zwei Parteigenossen und der Ortsbauernführer die Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung des Kartoffelpreises. Um ihre Argumente zu untermauern, ließen sie verlauten :
51 Beatrix Herlemann : Der Bauer klebt am Hergebrachten. Bäuerliche Verhaltensweisen unterm Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Reihe XXXIX : Niedersachen 1933–1945, Bd. 4), Hannover 1993, S. 119–127. 52 Der Versuch, hoch belastete Höfe in einen schuldenfreien Zustand zu überführen. 53 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Januar 1936, BArch Berlin, R 58/571, Bl. 89.
177
178
|
Frederik Rollié
[…] bei den gegenwärtigen Preisen feiere kein Bauer Erntedankfest. Die Beamten könnten Erntedankfest halten. Es solle aber ja kein Beamter am Erntedankfest zu einem Bauern kommen, er würde hinausgeworfen.54
Auch ein Angestellter der Kreissparkasse nahm Partei für die Bauern und forderte sogar unter Hinweis auf zu hohe Beamtengehälter eine Stabilisierung des Kartoffelpreises. Der Ortsgruppenführer schien das Anliegen der Bauernschaft zu billigen, so dass der Kreisleiter zu der Einsicht gelangte, dass dies keine Bauernführung im nationalsozialistischen Sinne mehr sei. Er war aber der Meinung, dass sich die Bauernschaft, nach einer Prüfung, an die Festlegungen der Regierung halten würde. Ein weiteres Beispiel für die Stimmungsmache gegen die Preisgestaltung wurde aus dem Amtsbezirk Berschweiler (Gemeinde im Restkreis St. Wendel-Baumholder) gemeldet. In diesem Kreis schienen mehrere Bauern in Polizeihaft genommen worden zu sein. Diese versuchten, die Strafe zu umgehen, indem sie eine Spende von einem Pfund Getreide an das Winterhilfswerk anboten. Sie drohten an, dass sie ansonsten für sich Konsequenzen ziehen würden. Ein Anklagepunkt ist in diesem Bericht nicht genannt, allerdings lässt der Zusatz, „[a]uch dieser Fall zeigt zur Genüge, dass hier Elemente am Werke sind, die die an sich zufriedene Bauernschaft gegen den Staat und seine Organe auszuspielen versuchen“55, darauf schließen, dass es auch hier massive Kritik an der nationalsozialistischen Preisgestaltung gegeben hat.56 Über den weiteren Verlauf ist nichts bekannt. Auch in dem Bericht über Oktober 1935 wurde immer noch von „Miesmachern und Schreiern“57 berichtet. Die angedrohten Boykotte der Erntedankfeste schienen großflächig ausgefallen zu sein. So hieß es : Die Beteiligung der Bauernschaft am Erntedankfest war stellenweise sehr gut. In einzelnen Bezirken haben Beamte und Arbeiterabordnungen als Gäste der Bauern teilgenommen.58
Eine Bewertung dieser Ereignisse gestaltet sich schwierig. Nach wie vor lagen die Ursachen hauptsächlich in der Unzufriedenheit über die Preisgestaltung und richteten sich damit nur gegen eine Einzelmaßnahme des nationalsozialistischen Regimes. Da explizite Beispiele für die Stimmungsmache genannt wurden, kann nicht 54 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1935, BArch Berlin, R 58/534, Bl. 50. 55 Ebd. 56 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1935, BArch Berlin, R 58/3039c, Bl. 639. 57 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Oktober 1935, BArch Berlin, R 58/566, Bl. 92. 58 Ebd.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
mehr von einem rein nonkonformen Verhalten gesprochen werden. Auch der Verweis auf eine „planmässige Verhetzung“59 sowie die Androhung von Gewalt durch zwei Parteigenossen gegen Beamte sprechen gegen die Einordnung in den Bereich der Nonkonformität. Durch die eingeleitete Strafverfolgung gegen die Bauern aus Berschweiler und die zuvor angeführten Argumente liegt die Vermutung nahe, dass sich der Unmut über die Preisspannen im Oktober 1935 zu einem partiellen Protest entwickelte. Die Tatsache, dass der Eklat über die Preisgestaltung im Rahmen einer Mitarbeiterbesprechung der Ortsgruppe stattfand, sowie die Strafverfolgung gegen die Bauern aus Berschweiler zeigen, dass das abweichende Verhalten nicht mehr im privaten Rahmen stattfand, sondern in der Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Auch Peukert stellt fest, dass sich der Protest nicht gegen die gesamte Regierung richten musste, sondern dass auch einzelne Aspekte im „Dritten Reich“, in diesem Falle die Preisregulierung des Reichsnährstandes, in den Fokus des Protestes gelangen konnten.60 Im Oktober 1935 wurden in den Berichten immer noch Stimmungsmacher erwähnt, so dass angenommen werden kann, dass dieses Problem nicht gelöst wurde und die Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit über die Wichtigkeit der Preisgestaltung durch die Behörde nicht überall erfolgreich war. Es scheint, als wäre ein flächendeckendes Fernbleiben der Bauern von den Erntedankfesten ausgeblieben. Aber Äußerungen, dass die Beteiligung an diesen nur stellenweise sehr gut war und dass nur in einzelnen Bezirken auch Beamte und Arbeiterabordnungen als Gäste teilgenommen hatten, deuten darauf hin, dass sich die Lage nicht in dem gesamten Regierungsbezirk beruhigt hatte. Es kann davon ausgegangen werden, dass die angedrohten Protesthandlungen zumindest teilweise vollzogen wurden.
Ergebnis der Auswertung
Es konnte festgestellt werden, dass zahlreiche Berichte die Zustandsbeschreibungen der landwirtschaftlichen Verhältnisse als inhaltlichen Schwerpunkt hatten. Dies ist nicht verwunderlich, wenn bedacht wird, dass es ein vorrangiges Ziel im „Dritten Reich“ war, eine Nahrungs- und Versorgungsautarkie zu erreichen. Die Durchführung und Einhaltung von Gesetzen, wie dem stark ideologisch gefärbten Reichserbhofgesetz, wurden ebenfalls überwacht. Das Ausbleiben weiterer diesbezüglicher Meldungen nach September 1934 ist verwunderlich. Da im 59 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1935, BArch Berlin, R 58/3039c, Bl. 639. 60 Peukert : Volksgenossen, S. 97.
179
180
|
Frederik Rollié
Regierungsbezirk Trier traditionell eine Realteilung des Erbes vollzogen wurde, stellt sich die Frage, warum die Berichte über das Reichserbhofgesetz schon im September 1934 endeten. Dieses Gesetz wurde bis 1943 immer wieder abgeändert und modifiziert. Es besteht daher die Möglichkeit, dass durch eine solche Modifikation ein Grund für bäuerlichen Missmut wegfiel. Es wurden vor allem Bauern, die mehrere Kinder hatten, als Kritiker des Gesetzes genannt. Daraus lässt sich schließen, dass sich die Kritik an der Unteilbarkeit der Höfe entzündete. Es erscheint allerdings wahrscheinlicher, dass die vor allem in der Eifel lokalisierten Beschwerden eher durch die Anerbengerichte geklärt wurden, als dass eine Lösung des Problems durch eine gesetzliche Änderung erreicht wurde. Bei den Anerbengerichten konnten Änderungen des Anerben beantragt werden. Diese Anträge wurden häufig im Sinne der antragstellenden Bauern entschieden, damit keine allzu großen Widerstände entstanden.61 Unter Zuhilfenahme der Berichte ließen sich verschiedene Maßnahmen des Reichsnährstandes feststellen, die im Regierungsbezirk Trier zu Reaktionen in der ländlichen Bevölkerung führten. Neben der Durchführung des Reichserbhofgesetzes betraf dies Anbauvorschriften im Zuge der Erzeugungsschlacht, zum Beispiel den Anbau des Flachses. Aber auch die Anwendung der nationalsozialistischen Marktordnung, in welcher landwirtschaftliche Erzeugnisse über Zwischeninstanzen weitergeleitet wurden, sowie die Festlegung eines Preissystems von oben, die eine freie Marktwirtschaft ausschlossen, konnten ausgemacht werden. Ebenso ließ sich die Durchsetzung des Zwangssystems, sowohl bei der Abgabe bestimmter Erzeugnisse, verbunden mit einer Kontingentierung, als auch für die Mitgliedschaft im Reichsnährstand erkennen. Neben der reinen Wiedergabe von Geschehnissen und Situationen lassen sich Einschätzungen über Entwicklungen in diesem Themengebiet finden. Ob diese vom Gestapoleiter stammten oder aus den Zubringerberichten übernommen wurden, ist nicht immer zu erkennen. Selbiges gilt für Handlungsempfehlungen, um Situationen zu entschärfen oder um Vorgänge und Maßnahmen effizienter zu gestalten. Teilweise konnte in der Berichterstattung erkannt werden, dass die Schilderungen von positiven Maßnahmen der Regierung oder erfreulichen Situationen nur vorgeschoben waren, um die Fülle der negativen Berichtselemente abzufedern. In der Natur der Lageberichte lag es jedoch, dass die Berichterstattung möglichst kurz und präzise gehalten wurde, auch wenn eine ausführlichere Darstellung einen differenzierten Blick auf die Entwicklungen gewährt hätte. 61 Münkel : Reichserbhofgesetz in der Praxis, S. 567.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
Abb. 3: Aufruf an deutsche Bauern zur Fokussierung des Flachsanbaus. (Quelle: Erzeugungsschlacht, S. 61).
In Verbindung mit Peukerts Modell über die Formen abweichenden Verhaltens im „Dritten Reich“ lässt sich sagen, dass die meisten Meldungen nicht oder nur im untersten Bereich der Nonkonformität eingeordnet werden konnten. Bei den dokumentierten Stimmungen handelte es sich hauptsächlich um Unmutsäußerungen, welche noch nicht als abweichendes Verhalten gewertet werden können. Die unterste Stufe in Peukerts Modell wurde dann erreicht, wenn die Unmutsäußerungen einen schärferen Ton annahmen und explizite Maßnahmen der Regierung als Grund erkennbar waren. Es konnten allerdings auch vereinzelt Handlungen festgestellt werden, die in Peukerts Modell die zweite Stufe erreichten. Dabei konnten Haltungen erkannt werden, welche nicht mehr nur im privaten Raum stattfanden, sondern auch durch Boykott von verschiedenen Gesetzen und Instanzen gekennzeichnet waren. In zwei Fällen konnten sogar Protesthandlungen beobachtet werden. Diese richteten sich gegen die nationalsozialistische Preisgestaltung und somit gegen einen Teil des Systems. Während die zuerst erwähnte Handlung im September 1935 im Rahmen einer NSDAP-Ortsgruppenmitgliederversammlung stattfand, musste die zweite in einer weitaus größeren Öffentlichkeit und Intensität aufgetreten sein. Dies ist daraus zu schließen, dass gegen die dort erwähnten Bauern polizeiliche
181
182
|
Frederik Rollié
Strafmaßnahmen vollzogen werden sollten. Über den Ausgang dieser Strafmaßnahmen und über die Konsequenzen der NSDAP-Mitgliederversammlung sind keine weiteren Informationen in den Berichten vorhanden. Interessanterweise lassen sich keine Stimmungsreaktionen über die im Februar 1936 vollzogenen Betriebs- und Hofbegehungen62 belegen. Dabei wäre anzunehmen, dass gerade dieser tiefe Einschnitt in die Privatsphäre der Betriebsführung von den Bauern negativ aufgenommen worden sei. In den Berichten wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bauern Maßnahmen der Regierung zur Preissicherung als selbstverständlich angenommen hätten, allerdings Maßnahmen zur Regulierung nicht nachvollziehen konnten und diesen grundsätzlich skeptisch gegenüberstanden. In dem Bericht über den Monat Juni 1935 hieß es sogar : Immer noch hält die Opferfreudigkeit des Bauern absolut nicht Schritt mit dem ihm durch die Agrarpolitik erwachsenen Vorteil. Es wird noch einer geraumen Zeit bedürfen, bis die dem Bauerntum eigene materielle Einstellung einem sozialen Verständnis Raum gibt.63
Es ist eine gewisse Enttäuschung des Gestapoleiters erkennbar. Einen Monat später hieß es : Es scheint der Bauernschaft ferner nicht genügend bekannt, dass ein großer Teil der Volksgemeinschaft für sie Opfer bringt, […] und andererseits die zur Unterstützung und Förderung der Landwirtschaft aufgewendeten Mittel aufbringt.64
Diese Beobachtungen spiegeln allerdings eine, nicht nur die Region Trier betreffende, Haltung des Bauernstandes während des „Dritten Reiches“ wider. Wie die Trierer Gestapo selbst herausstellte, war die von ihr überwachte Bauernschaft eher unpolitisch65 eingestellt. Daher richteten sich bäuerliche Distanzierungen, kritische Ablehnungen oder Proteste meist gegen konkrete Sachverhalte. Zu diesen gehörten unter anderem religiös motivierte Handlungen, aber vor allem Einstellungen oder Handlungen gegen unliebsame politische oder wirtschaftliche Maßnahmen der Regierung. Widerstand im engeren Sinne gab es kaum und findet in der Trierer Lageberichterstattung keine Erwähnung. Schließlich bleibt zu be62 Lagebericht der Gestapostelle für Februar 1936, BArch Berlin, R 58/656, Bl. 84. 63 Lagebericht der Gestapostelle für Juli 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 125. 64 Lagebericht der Gestapostelle für August 1935, GStA PK, I. HA Rep. 90 Annex P, Bd. 9.11, Bl. 142. 65 Lagebericht der Gestapostelle für Februar 1935, BArch Berlin, R 58/3035c, Bl. 693.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
rücksichtigen, dass der primäre Sektor von der nationalsozialistischen Politik auch profitierte.66 Zahlreiche Forderungen der Agrarverbände seit dem Kaiserreich sind von den Nationalsozialisten aufgenommen und umgesetzt worden, auch wenn die Einschränkung der Verfügungsfreiheit sicher ein grundsätzlicher Kritikpunkt blieb. Es konnte außerdem festgestellt werden, dass der Charakter des jeweiligen Bauernführers auf lokaler Ebene einen erheblichen Einfluss auf die anderen Bauern hatte. Der Bauernführer in der Kreisbauernschaft Baumholder wurde in der Kritik gegen die politische Leitung besonders deutlich. Aber auch allgemeine Beschwerden über die lokale Führung konnten mehrfach festgestellt werden. Die Bauern, welche im September 1935 besonders stark gegen die Preisbestimmungen des Reichnährstandes protestierten, wurden von einem Ortsbauernführer geleitet, der die Forderungen der Bauern unterstützte. Dies machte die Situation für die Gestapo nicht einfacher, zeigt aber deutlich den Einfluss, den eine gute Beziehung zwischen Bauernführer und Bauern ausüben konnte.
Fazit und Schlussbetrachtung
Durch die partielle Auswertung der Lageberichte der Trierer Staatspolizeistelle konnte die Überwachungstätigkeit der Gestapo in einem Wirtschaftssektor genauer beleuchtet werden. So war es ein Anliegen des NS-Staates, die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen in einem Maße zu sichern, dass Versorgungslücken, wie sie im Ersten Weltkrieg vorgekommen waren, nicht erneut auftraten. In den ab 1934 immer wieder ausgerufenen Erzeugungsschlachten wurde versucht, den Bauern in Deutschland ihre Verantwortung gegenüber der deutschen „Volksgemeinschaft“ einzuschärfen. Dabei ging es auch um die Optimierung der Devisenbilanz. Die vorhandenen Mittel sollten weniger für Nahrungs- und Versorgungsmittel ausgegeben werden, sondern vielmehr in die Rüstungsindustrie investiert werden. Die Umsetzung der Gesetze und Maßnahmen, die vom Reichsnährstand und der Regierung zum Erreichen der geforderten Autarkie erlassen wurden, hatte die Gestapo zu kontrollieren. Die Lageberichte sind dabei als eine Art Echo der landwirtschaftlichen Bevölkerung auf die vom NS-Staat verfügten Maßnahmen zu lesen. Die Gestapo war in diesem Kontext nicht nur Verfolgungsbehörde, sondern auch ein Instrument der Wirtschaftssicherung. 66 Michael Schwartz : Bauern vor dem Sondergericht. Resistenz und Verfolgung im bäuerlichen Milieu Westfalens, in : Anselm Faust (Hg.) : Verfolgung und Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933–1945 (Schriften zur politischen Landeskunde Nordrhein-Westfalens, Bd. 7), Köln 1992, S.113–123, hier S. 115.
183
184
|
Frederik Rollié
Es scheint, als ob es bei den immer wieder auftretenden Beschwerden aus der Bauernschaft des Regierungsbezirkes Trier keinen Monat ohne negative Stimmungsaufzeichnungen gab. Ferner entsteht der Eindruck, dass von der Exekutive Zurückhaltung geübt wurde. In den Berichten wurde von Stimmungsmache und Hetze gesprochen. Dies konnte durchaus als Verstoß gegen Paragraph 3 der „Heimtückeverordnung“ vom 21. März 1933 angesehen werden. Aus dieser Verordnung entstand 1934 das „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiuniformen“. In diesem heißt es : Wer vorsätzlich eine unwahre oder gröblich entstellte Behauptung tatsächlicher Art aufstellt oder verbreitet, die geeignet ist, das Wohl des Reichs oder eines Landes oder das Ansehen der Reichsregierung oder einer Landesregierung oder der hinter diesen Regierungen stehenden Parteien oder Verbänden schwer zu schädigen, wird, soweit nicht in anderen Vorschriften eine schwerere Strafe angedroht ist, mit Gefängnis bis zu zwei Jahren und, wenn er die Behauptung öffentlich aufstellt oder verbreitet, mit Gefängnis nicht unter drei Monaten bestraft.67
Die Bauernschaft im Regierungsbezirk Trier war keine homogene Gruppe, sondern unterschied sich nach Größe der Betriebe und der Form der Landwirtschaft. Daher sollten die in dieser Arbeit getätigten Aussagen nicht als allgemeingültig auf die gesamte Bauernschaft im Regierungsbezirk Trier angewendet werden. Bis auf die in den Berichten geäußerten Grundstimmungen basierten die festgehaltenen Momente auf vielen kleinen Einzelhandlungen, welche in den Berichten allerdings, aufgrund der Berichtsstruktur, nicht weiter behandelt werden konnten. Es zeigte sich, dass die nationalsozialistische Herrschaft von den Bauern größtenteils angenommen und nur in den seltensten Fällen hinterfragt wurde. Von einer politisierten Bauernschaft kann in dem Beobachtungszeitraum nicht die Rede sein. Die Auswertung der Lageberichte ergab, dass die Stimmung in der landwirtschaftlichen Bevölkerung hauptsächlich von unbeeinflussbaren Bedingungen, wie Witterung und Ernte, abhing. Zu einer Verweigerung des Systems kam es nur dann, wenn direkt in das Leben der Bauern eingegriffen wurde. Dies betraf vor allem wirtschaftliche Belange, wie Änderungen der Marktordnung, die der Bauernschaft Nachteile bescherten. Hinzu kam, dass lange geforderte Maßnahmen, wie ein Schutz vor Hofzersplitterung oder ein einheitlicheres Genossenschaftswesen, 67 Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung, in : Marlis Gräfe/Bernhard Post/Andreas Schneider (Hg.) : Die Geheime Staatspolizei im NS-Gau Thüringen 1933–1945 (Quellen zur Geschichte Thüringens, Bd. 24/1), Bd. 1, Erfurt 2009, S. 59–61, hier S. 59.
Landwirtschaft und ländliche Bevölkerung
|
nicht nach der Vorstellung vieler Bauern umgesetzt wurden und daher auf wenig Akzeptanz stießen. Auch bezog sich die Verweigerung des Systems nicht auf das gesamte NS-Regime, sondern hauptsächlich auf den Reichsnährstand als landwirtschaftlichen Vertreter der Regierung. Das abweichende Verhalten der Bauernschaft im Regierungsbezirk Trier beschränkte sich, bis auf einige Ausnahmen, zumindest bis 1936 auf die Stufe der Nonkonformität. Die auf dem Land weit verbreitete Nörgelei und Meckerei ließ sich auch in einem repressiven Herrschaftssystem nicht ganz unterdrücken. Über mögliche Proteste gegen Landenteignungen beim Bau des Westwalls oder die Verschärfung der wirtschaftlichen Überwachung und die zunehmenden Zwangskontingentierungen nach Kriegsausbruch kann keine Auskunft gegeben werden, da die Berichterstattung auf Anweisung von Reinhard Heydrich im April 1936 eingestellt wurde. Offensichtlich trugen die Berichte, die einem immer größeren Personenkreis zugänglich waren, „selbst zu Verschlechterung der Stimmung bei […]“68. Für weiterführende Analysen der landwirtschaftlichen Situation sowie der Stimmung der Bauern im Regierungsbezirk wäre eine vergleichende Auswertung der noch in Erschließung befindlichen Ermittlungsakten der Gestapo Trier oder der zahlreich überlieferten Justizakten wünschenswert. Ob sich jedoch darin der eingangs zitierte „Herzenswunsch“ nach Führung wiederfinden wird, bleibt fraglich.
68 Aus einem Schreiben von Hermann Göring an die Ober- und Regierungspräsidenten vom 2. April 1936, zit. nach : Günter Plum : Staatspolizei und Innere Verwaltung 1934–1936, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 13 (1965), S. 191–224, hier S. 222.
185
Ksenia Stähle
Gefährliche Rückkehrer? Fremdenlegionäre aus Sicht der Staatspolizeistelle Trier
Ein zurückkehrender Legionär ist stets zunächst spionageverdächtig und muss entsprechend behandelt werden.1
Deutsche Reichsangehörige, die in der französischen Fremdenlegion gedient hatten und nach Ablauf ihrer Dienstzeit freiwillig zurückkehrten, stellten für das „Dritte Reich“ ein sicherheitspolitisches Dilemma dar. Einerseits waren es erprobte Kombattanten, welche die Wehrmacht benötigte, andererseits unterstellte man ihnen, für Frankreich zu spionieren, Geschlechtskrankheiten einzuschleppen und damit ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die viel beschworene „Volksgemeinschaft“ darzustellen sowie für die Fremdenlegion werben zu wollen.2 Die französische Fremdenlegion ist zum ersten Mal während des deutsch-französischen Krieges von 1870/71 in das Bewusstsein der Deutschen getreten. Die Tatsache, dass deutsche Männer für Frankreich und gegen das Reich kämpften, stellte für das öffentliche Bewusstsein einen regelrechten Schock dar.3 Seit diesem Ereignis widmete die deutsche Öffentlichkeit der Fremdenlegion große Aufmerksamkeit, die bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts anhielt. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema gründete auf zwei Faktoren. Zunächst war der Anteil der deutschen Soldaten in der Legion zu bestimmten Zeiten im Verhältnis zu anderen Nationalitäten recht hoch − allerdings nicht so hoch, wie es in den deutschen Medien dargestellt wurde. Ferner spiegelte das Verhältnis zur Legion auch stets die angespannte Beziehung Deutschlands zu Frankreich wider und bezog sich weniger auf die reale Schlagkraft der Truppe.4 Daher war die Fremdenlegion während der beschriebenen Phase Gegenstand einer intensiven Mythenbildung.5 1 Institut für Zeitgeschichte München (IfZ), MA 553/1, Bl. 4837–4919 (Die Geheime Staatspolizei), hier Bl. 4915. 2 Eckhard Michels : Deutsche in der Fremdenlegion 1870–1965. Mythen und Realitäten, Paderborn u.a. 1999, S. 105. 3 Ebd., S. 14. 4 Ebd., S. 12. 5 Ebd.
188
|
Ksenia Stähle
Der SPD-Abgeordnete Hermann Wendel sprach zu Beginn des 20. Jahrhunderts spöttisch von einer „Legionitis“6. Gemeint war damit die in der Öffentlichkeit und den Sicherheitsbehörden kursierende Meinung, überall würden Werber für die Fremdenlegion lauern, die nur darauf warteten, junge deutsche Männer mit falschen Versprechungen in die Legion zu locken. Obwohl die französische Fremdenlegion früher eine so bedeutsame Rolle spielte, gibt es nur wenige wissenschaftliche Publikationen, die sich ihr widmen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Veröffentlichungen von Christian Koller7 und Eckhard Michels8. Allerdings beschäftigen sich beide Autoren mit der Fremdenlegion als einer Institution und weniger mit dem Leben der Heimkehrer. Der vorliegende Aufsatz soll die Frage, wie die Gestapo Trier mit zurückkehrenden Fremdenlegionären umging, näher beleuchten.
Der Umgang mit ehemaligen Fremdenlegionären vor und nach 1933
Bereits in der Weimarer Republik wurden ehemalige Legionäre bei ihrer Rückkehr verhaftet und vernommen.9 In Zeitschriften erschienen regelmäßig Artikel, welche über Brutalität, Alkoholismus und Homosexualität in der Fremdenlegion und tapfere deutsche Mütter berichteten, die angeblich nach Algerien reisten, um ihre minderjährigen Söhne aus den Klauen der Legion zu befreien.10 Ab 1933 änderte sich der Umgang mit angehenden und rückkehrenden Legionären. Zunächst sank die Anzahl deutscher Rekruten in der Fremdenlegion.11 Während 1934 ganze 37 % der angehenden Legionäre aus Deutschland kamen, fiel deren Anteil vier Jahre später auf 12 %.12 Dieses Absinken hatte mehrere Ursachen. Zum einen führte die Aufrüstung in Deutschland zu einem Anstieg der Beschäftigungsrate.13 Zuvor war für viele aus der gesellschaftlichen Unterschicht stammende Rekruten der Legion die Arbeitslosigkeit ein Motiv für den Eintritt in die Legion gewe 6 Ebd., S. 11. 7 Christian Koller : Die Fremdenlegion. Kolonialismus, Söldnertum, Gewalt 1831–1962, Paderborn 2013. 8 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion. 9 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 442, Nr. 7568−7571. 10 LHA Koblenz, Best. 442, Nr. 7568. 11 Paul Klein : Von der Mehrheit zur Minderheit. Deutsche in der französischen Fremdenlegion, in : Gerhard Kümmel (Hg.) : Die Truppe wird bunter : Streitkräfte und Minderheiten (Militär und Sozialwissenschaften, Bd. 47), Baden-Baden 2012, S. 73–82, hier S. 76. 12 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion, S. 103. 13 Ebd.
Gefährliche Rückkehrer?
|
sen, das somit größtenteils wegfiel.14 Aufgrund der wirtschaftlichen Verbesserung wurde die Fremdenlegion nicht mehr als der letzte Ausweg aus der Armut angesehen.15 Diese Nachricht drang auch in die Fremdenlegion vor, weshalb die Zahl der Weiterverpflichtungen abnahm. Des Weiteren wurde mit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht ab März 1935 eine militärische Laufbahn innerhalb Deutschlands möglich.16 Die Vergrößerung der Streitkräfte hatte ebenfalls ein Fernbleiben potentieller Legionäre zur Folge. Eine Bestandsauffüllung durch Gegner oder Flüchtlinge des NS-Regimes erfolgte nicht.17 Schließlich unternahm das NS-Regime mehrere innenpolitische Maßnahmen, um den Zulauf zur Fremdenlegion zu stoppen.18 Aufgrund des Misserfolgs der gegen die Legion gerichteten Kampagnen im Kaiserreich und der Weimarer Republik gelangte man zu der Schlussfolgerung, dass das mediale Aufgreifen des Themas in der deutschen Öffentlichkeit den Zulauf zur Legion nur verstärkt hätte.19 Aus diesem Grund versuchte man, die öffentliche Kommunikation darüber gänzlich zu beenden.20 Bereits im November 1933 wurden sämtliche Zusammenschlüsse ehemaliger Fremdenlegionäre verboten. Gleichzeitig wurden die meisten Verbände, die sich gegen die Legion einsetzten, untersagt21 oder mit neu gegründeten nationalsozialistischen Vereinigungen gleichgeschaltet, sodass sie ab diesem Zeitpunkt de facto nicht mehr aktiv waren.22 In einem weiteren Schritt wurden sämtliche Aufklärungsvorträge von nicht autorisierten Rednern sowie Bücher und Filme zum Thema unterbunden.23 Ab 1935 wurde der Eintritt in die französische oder spanische Fremdenlegion als eine schwere Straftat eingestuft und entsprechend geahndet.24 Ein Jahr später wurde der Straßenverkauf von Erlebnisberichten ehemaliger Fremdenlegionäre verboten. Berichte über die Legion in Tageszeitungen und Zeitschriften verschwanden ebenso wie ihre Darstellung in Liedern, Panoramen und auf Jahrmärkten. Damit wurde die vorher bestehende Veröffentlichungsflut beendet.25
14 Koller : Die Fremdenlegion, S. 365. 15 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion, S. 103. 16 Ebd. 17 Ebd., S. 104. 18 Ebd. 19 Ebd. 20 Koller : Die Fremdenlegion, S. 61. 21 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion, S. 104. 22 Koller : Die Fremdenlegion, S. 61. 23 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion, S. 104. 24 Ebd., S. 106. 25 Ebd., S. 104.
189
190
|
Ksenia Stähle
Ab 1934 mussten auch Heimkehrer mit gegen sie gerichteten Zwangsmaßnahmen rechnen, die 1936 nochmals verschärft wurden.26 Die Grenzpolizei nahm die Männer unmittelbar bei Grenzübertritt fest und verhörte sie anschließend. Zudem wurden ihnen sämtliche persönlichen Unterlagen abgenommen.27 Dabei zielten die Grenzbeamten besonders auf zwei Dokumente. Es handelte sich um das Certificat de bonne conduite und das Soldbuch. Das Certificat war eine Auszeichnung für besonders gute Führung in der Legion. Durch die Konfiszierung hatte der Betroffene keinen Nachweis mehr über seine besonderen Verdienste, was sicherlich sein soldatisches Selbstwertgefühl schädigte. Die Abnahme des Soldbuches traf die Rückkehrer in wirtschaftlicher Hinsicht, da dieses den ehemaligen Legionären ein Anrecht auf den Aufenthalt in Frankreich sowie eine Pension nach 15 Dienstjahren oder Rente im Falle der Invalidität durch den französischen Staat gewährte.28 Somit verloren die Männer bei Grenzübertritt sämtliche Ansprüche gegenüber dem französischen Staat. Ferner erfolgte eine Einweisung in das Bewahrungslager Kislau in Baden.29 Die Internierung fand zunächst nur in Einzelfällen statt, wurde aber ab 1936 auf alle Heimkehrer ausgeweitet. Gemäß einer Weisung des Innenministers sollten die Männer vier Wochen lang im Lager verbleiben.30 Der Aufenthalt war von Einschüchterungs- und Umerziehungsmaßnahmen gekennzeichnet.31 Die Männer sollten bereits in Kislau auf die durch das Regime geschaffenen Verhältnisse eingewöhnt werden.32 Bis zum Kriegsausbruch wurden etwa 1.800 ehemalige Fremdenlegionäre dieser Behandlung unterzogen. Die Entlassung aus Kislau erfolgte nach Unterzeichnung einer Erklärung. Darin verpflichteten sich die Männer, sich an einen zuvor bestimmten Ort zu begeben, sich dort umgehend polizeilich zu melden und diesen Wohnort nur zu verlassen, wenn ein anderer fester Wohnort den Ämtern mitgeteilt wurde. Sie verpflichteten sich, kein Wandergewerbe auszuüben, das Reichsgebiet nicht zu verlassen und keinen Briefkontakt zu ehemaligen Kameraden zu unterhalten. Es wurde ihnen zudem verboten, innerhalb der Familie oder
26 Ebd. 27 Ebd., S. 105. 28 Ebd. 29 Ebd.; vgl. ferner Angela Borgstedt : Das nordbadische Kislau. Konzentrationslager, Arbeitshaus und Durchgangslager für Fremdenlegionäre, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.) : Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933–1939 (Geschichte der Konzentrationslager 1933– 1945, Bd. 2), Berlin 2002, S. 217–229. 30 Generallandesarchiv (GLA) Karlsruhe, Best. 521, Nr. 8356. 31 Michels : Deutsche in der Fremdenlegion, S. 105. 32 Ebd.
Gefährliche Rückkehrer?
|
Abb. 1: Beispiel eines Certificat de bonne Conduite, das dem betreffenden Legionär jeweils vom Kommandanten seines Regiments ausgestellt wurde. Ihm wurde mit dieser Auszeichnung ein stets treuer und ehrenvoller Dienst bescheinigt. (Quelle: SHD Vincennes).
mit ehemaligen Kameraden über die Erlebnisse in der Fremdenlegion zu sprechen und Druckerzeugnisse über die Legion zu veröffentlichen. Die Rückkehrer wurden trotz der Wiedereinführung der Wehrpflicht als „wehr unwürdig“ eingestuft und damit vom Wehrdienst ausgeschlossen.33 Daneben durften sie nicht in Rüstungsbetrieben oder ähnlichen Bereichen, die für die nationale Sicherheit als wichtig eingestuft wurden, arbeiten. Laut derzeitigem Forschungsstand blieben die beiden Beschränkungen selbst nach Kriegsausbruch bestehen.34 Während die anderen Restriktionen bei guter Führung nach drei Jahren aufgehoben werden konnten, drohte bei Verstößen gegen die zuvor unterzeichnete Verpflichtungserklärung eine Einweisung nach Kislau auf unbestimmte Zeit.35 Aufgrund der spezifischen Behandlung wird der Umgang mit Fremdenlegionären derzeit widersprüchlich charakterisiert. Angesichts der strengen Überwachung und des Aufenthaltes in Kislau werden Parallelen zum Umgang mit Prostituierten, Obdachlosen und anderen Randgruppen gesehen, die im Reich als „Asoziale“ dif33 Ebd., S. 106. 34 Ebd. 35 Ebd.
191
192
|
Ksenia Stähle
famiert wurden.36 Gleichzeitig wird den ehemaligen Legionären mit dem Verweis auf die kurze Aufenthaltsdauer in Kislau eine herausgehobene Stellung innerhalb dieser Gruppe zugesprochen.37 Die Disparität der Bewertung gründet vermutlich auf der Tatsache, dass sich die bisherige Forschung lediglich auf die Weisungen und Normen gestützt hat, die den Umgang mit Fremdenlegionären theoretisch regelten. Dagegen lässt sich mit den Personalakten der Gestapo Trier die Praxis beobachten.38 Bei Personalakten39 handelt es sich um eine Ansammlung von Unterlagen, welche die jeweiligen Gestapo-Sachbearbeiter über eine oder mehrere Personen im Zusammenhang mit einem Sachverhalt zusammengestellt haben. Diese können dabei unterschiedlich ausführlich sein. Neben den standardisierten Personalbögen enthalten die Personalakten teilweise Meldungen über die jeweilige Person, den Schriftverkehr mit anderen Gestapostellen und Ämtern sowie Vernehmungsprotokolle und interne Vermerke. Die in den Akten enthaltenen Verhörprotokolle sind für die hier bearbeitete Fragestellung besonders interessant, da die betroffenen Heimkehrer darin erläutern, was sie zum Eintritt in die Fremdenlegion bewogen hatte, wie lange sie dort waren, an welchen Kampfhandlungen sie teilgenommen hatten sowie wie und warum sie nach Deutschland zurückkehrten. Allerdings müssen die vorgefundenen Angaben mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, da sie im Zuge einer spezifischen Verhörsituation entstanden. Hierbei waren Gestapobeamte – nicht zuletzt im Hinblick auf ihre eigene Karriere – bemüht, möglichst viele Regime-Gegner zu enttarnen.40 Somit ist jedes Vernehmungsprotokoll in gewissem Maß als eine Selbstdarstellung des zuständigen Beamten anzusehen.41 Sein Gegenüber war an einer möglichst geringen Strafe und einer unkomplizierten Rückkehr nach Hause interessiert. Die Nachricht über die Befragung und Überwachung durch die Gestapo erreichte auch die Fremdenle36 Ebd., S. 105. 37 Ebd. 38 Im französischen Militärarchiv, dem Service historique de la Défense (SHD) in Vincennes, sind insgesamt mehr als 3.530 dieser Akten der Staatspolizeistelle Trier aufgetaucht, die seit 2015 erschlossen werden. 39 Julia Lederle : Gestapo-Personenakten, in : Jens Heckl (Hg.) : Unbekannte Quellen. „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren, Bd. 2 (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Bd. 43), Düsseldorf 2012, S. 85–96. Die Originalbezeichnung „Personalakte“ wird im Archivwesen oft durch den nachträglich vergebenen Terminus „Personenakte“ ersetzt, um Verwechselungen mit Personalakten von Gestapo-Bediensteten zu vermeiden. 40 Vgl. Bernd-A. Rusinek : Vernehmungsprotokolle, in : Ders./Volker Ackermann/Jörg Engelbrecht (Hg.) : Einführung in die Interpretation historischer Quellen. Schwerpunkt : Neuzeit, Paderborn 1992, S. 111–131, hier S. 120. 41 Ebd.
Gefährliche Rückkehrer?
|
gion, sodass die Rückkehrer mit der ihnen bevorstehenden Behandlung vermutlich rechneten. Es ist davon auszugehen, dass die Betroffenen sich bereits eine passende Schilderung ihrer bisherigen Aktivitäten zurechtgelegt hatten. Die folgenden, hier vorgestellten Fälle dienen der Veranschaulichung des Sachverhalts.
Der Fall „Nikolaus Harens“
Die Akte des ehemaligen Fremdenlegionärs Nikolaus Harens erstreckt sich über eine Laufzeit von 6 Jahren.42 Am 28. Januar 1936 meldete der Trierer Bürgermeister der dortigen Staatspolizeistelle, dass ein ehemaliger Fremdenlegionär, Nikolaus Harens, beabsichtigte, nach Deutschland zurückzukehren. Harens befand sich zu dieser Zeit im Hauptstützpunkt der französischen Fremdenlegion in Sidi-bel-Abbés. Er hatte zwei Bürgern seines einstigen Heimatortes Mesenich sein Porträt mit der Bitte geschickt, seine Identität zu bestätigen. Daraufhin forderte der zuständige Sachbearbeiter einen Personalbericht und einen Auszug aus dem Strafregister an. Nach Begutachtung der Akten, Harens hatte im Übrigen keine Vorstrafen, teilte die Gestapo Folgendes mit : Für deutsche Behörden liegt kein Anlaß [sic !] vor, Urkunden für Reichsangehörige zu erteilen, die bei einer fremden Wehrmacht Dienste leisten.43
Obwohl die beiden Unterschriften der Bürger aus Mesenich bereits vorlagen, wurde das weitere Vorgehen bis zur Ankunft von Harens zurückgestellt. Tatsächlich überschritt Harens im Oktober desselben Jahres die deutsche Grenze bei Perl und wurde dort festgenommen. Bei der in Perl stattgefundenen Vernehmung gab er an, bis 1930 in Mesenich gelebt zu haben und dann nach Luxemburg gegangen zu sein. Harens verpflichtete sich Anfang Juli 1931 in Diedenhofen für fünf Jahre bei der französischen Fremdenlegion. Als Gründe für seine Verpflichtung gab er Arbeitslosigkeit und Familienstreitigkeiten an. Er beteuerte weiterhin, freiwillig in die Legion eingetreten zu sein und zunächst einen Vertrag auf Französisch erhalten zu haben, welcher jedoch von einem Dolmetscher für ihn direkt übersetzt wurde. Des Weiteren versicherte er, dass er bei der Vertragsunterzeichnung völlig nüchtern gewesen sei. Damit widersprach Harens der Legende, laut welcher die künftigen Legionäre von den Werbern mit Hilfe von Drogen oder Alkohol gefügig
42 Service historique de la Défense (SHD) Vincennes, Best. P, Nr. 24930. 43 Ebd., Bl. 10.
193
194
|
Ksenia Stähle Abb. 2: Nikolaus Harens auf einem Foto, das während seiner Dienstzeit in der französischen Fremdenlegion aufgenommen wurde. (Quelle: SHD Vincennes).
gemacht wurden und unter Zwang und bei kompletter Unkenntnis der Sachlage einen unbekannten, da fremdsprachlichen Vertrag unterzeichneten.44 Nach Ablauf der Dienstzeit hat Harens noch einige Zeit in Oran (Westalgerien) in einer Autowerkstatt gearbeitet, die von einem Deutschen geleitet wurde. Im Gegensatz zu vielen anderen Rückkehrern berichtet Harens sehr ausgiebig über seine Dienstzeit. Er teilte bereits bei seiner ersten Vernehmung mit, dass er als Chauffeur tätig war und oftmals seine Vorgesetzten gefahren habe. Ferner hatte er Fotografien von seiner Kompanie und seinen Vorgesetzten dabei, was recht untypisch war. Während sich viele ehemalige Legionäre nicht an ihre deutschen Kameraden erinnern konnten oder angaben, dass alle anderen ihnen bekannten Reichsbürger bei irgendeinem Einsatz, an welchen sie sich ebenfalls nicht erinnern konnten, umkamen, nannte Harens sieben Kameraden, mitsamt ihrer Dienstzeit und ihres derzeit vermuteten Aufenthaltsortes.45 Insgesamt erwies sich Harens daher als überaus kooperativ. Nach der ersten Vernehmung wurde Harens von der Gestapo Trier zunächst in Schutzhaft genommen und am 12. November 1936 in das Bewahrungslager Kislau in Baden gebracht. Entgegen der zuvor beschriebenen Aufenthaltsdauer wurde Harens jedoch bereits nach sechs Tagen aus Kislau entlassen. Außer dem Entlassungsschein erhielt die Gestapo Trier einen weiteren Vernehmungsbericht sowie eine von Harens unterzeichnete Verpflichtungserklärung. Gemäß dem vorgesehenen Ablauf kam Harens in Mesenich zur polizeilichen Anmeldung und sollte dort überwacht werden. Die mit der Überwachung zunächst beauftragte Staatspolizeistelle Trier delegierte diesen Auftrag an den Landrat, der zudem ab Februar 1937 angewiesen wurde, vierteljährlich Berichte über Harens an die Gestapo Trier zu erstatten.46
44 Vernehmungsprotokoll vom 22. Oktober 1936, in : ebd., Bl. 20–24. 45 Ebd., Bl. 24. 46 Ebd., Bl. 42.
Gefährliche Rückkehrer?
|
Im April 1938 kam es zu einer weiteren Vernehmung. Zuvor hatte die Gestapo mit der Fahndung nach Harens begonnen, da sich dieser nach Hesslingen abgemeldet hatte, jedoch dort nie zur Anmeldung kam. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Gestapo ein Fehler unterlaufen war : Harens meldete sich in der Tat ab, allerdings nach Kesslingen, wo er sich anschließend korrekt angemeldet hatte. Bei der Gestapo hatte sich ein Tippfehler eingeschlichen, während die zuständige Stelle in Kesslingen es schlichtweg versäumt hatte, die Anmeldung rechtzeitig weiterzuleiten. Im Juli des darauffolgenden Jahres erhielt Harens einen Gestellungsbefehl, laut dem er sich im Kriegsfall mitsamt seinem Lastkraftwagen bereithalten sollte.47 Dieser Befehl widerspricht der Annahme, alle ehemaligen Fremdenlegionäre seien selbst nach Kriegsausbruch wehrunwürdig geblieben. Der Gestellungsbefehl stand mit einer Fahndung in Verbindung, da die Gestapo zu dieser Zeit davon ausging, dass Harens sich in Wittlich ohne Anmeldung aufhielt. Harens wurde in Wittlich ausfindig gemacht, wo er bei dem dortigen Pionierstab beschäftigt war. Doch auch hier schien der Gestapo ein Fehler unterlaufen zu sein, denn die rechtzeitige Ummeldung von Harens nach Wittlich wurde offensichtlich übersehen. Im November 1939 wurde Harens zum aktiven Wehrdienst zugelassen, hierauf wurde seine Überwachung laut Akte für beendet erklärt.48 Trotzdem wurde Harens im Juli und Oktober 1940 zu nochmaligen Verhören vorgeladen.49 Bei den Verhören wurde er immer wieder über seine Zeit in der Fremdenlegion sowie sein Leben danach ausgefragt. Zudem wurden ihm bei jeder Vernehmung die Statuten der Verpflichtungserklärung eingeschärft. Eine weitere Vernehmung erfolgte im Dezember 1941. Hierbei wurde Harens neben dem üblichen Ablauf auch zu seiner politischen und weltanschaulichen Einstellung befragt. Zudem forderte die Gestapo bei dem zuständigen NSDAP-Kreisleiter in Wittlich ein Gutachten über Harens an. Der bei der Gestapo Trier mit der Akte betraute Sachbearbeiter kam zu folgendem Schluss : Da der Eintritt des Harens in die Fremdenlegion nicht aus moralisch verwerflichen Gründen erfolgte und seine Gesamthaltung vor und nach Beendigung der Dienstzeit auf eine anständige Gesinnung schließen läßt [sic !], bestehen gegen seine Weiterbelassung in der Wehrmacht seitens der Geheimen Staatspolizei keine Bedenken.50
47 Ebd., Bl. 81. 48 Ebd., Bl. 96. 49 Ebd., Bl. 89 und 93a. 50 Ebd., Bl. 106.
195
196
|
Ksenia Stähle
Die Akte von Nikolaus Harens wurde hier exemplarisch vorgestellt, weil sie angesichts ihrer Vollständigkeit eine Musterakte darstellt und zudem die stattgefundenen Abläufe sehr gut nachvollziehbar sind. Dass jedoch der Mesenicher Bürgermeister, noch bevor er den Sachverhalt eines potentiell zurückkehrenden Fremdenlegionärs an die Gestapo meldete, zunächst von den beiden Bürgern die entsprechenden Unterlagen ausfüllen ließ, spricht für ein Kommunikationsproblem in der Verwaltung. Offenbar hatte sich in dieser Situation der vorgeschriebene Ablauf der Behandlung eines zurückkehrenden Fremdenlegionärs noch nicht etabliert. Wie in anderen Akten lassen sich auch hier Falschmeldungen und Fehler feststellen, die zu aufwendigen Fahndungen führten und die ohnehin personell schwach besetzte Staatspolizeistelle belasteten. Insgesamt ist Harens als außergewöhnlich kooperativ zu beschreiben. Während viele Rückkehrer eher bemüht waren, möglichst wenige Informationen über ihren Aufenthalt in der Legion preiszugeben und sich kaum an Einsatzorte oder Kameraden erinnerten, gab Harens zahlreiche Informationen an die Gestapo weiter. Er hatte einen sehr kurzen Aufenthalt in Kislau, dagegen aber eine sehr lange Zeit der Überwachung und eine überaus hohe Anzahl an Vernehmungen. Zwischen 1936 und 1941 musste er insgesamt sieben Mal bei der Trierer Gestapo vorstellig werden und über seinen Dienst in der Legion Auskunft geben. Die wiederholten Verhöre dienten jedoch nicht der Informationsgewinnung, sondern sollten Harens einschüchtern und ihm das Gefühl geben, dass er ständig beobachtet wurde.
Der Fall „Karl Jung“
Die den rückkehrenden Fremdenlegionär Karl Jung betreffende Personenakte wurde über einen Zeitraum von neun Jahren geführt.51 Jung wurde 1901 in Konz bei Trier geboren und lebte nach seiner Rückkehr ins Deutsche Reich in Kinderbeuren (bei Wittlich). Im Mai 1933 war er an Bord des Dampfers „Adalia“ nach Hamburg gekommen und wurde dort als ehemaliger Fremdenlegionär der Wohlfahrtsbehörde zugeführt, mit der Begründung, er sei mittellos. Von dieser erhielt er einen Freifahrtschein nach Trier. Das erste Verhör fehlt in der Akte. Nach etwas mehr als drei Jahren wurde die Überwachung des Jung im Oktober 1936 eingestellt, „da bisher nichts Nachteiliges über ihn bekannt geworden ist.“52 Im April 1937 wurde Jung jedoch erneut von der Gestapo Trier vorgeladen, um mittels einer Fotografie einen anderen Fremdenlegionär zu identifizieren und an51 SHD Vincennes, Best. P, Nr. 24912. 52 Ebd., Bl. 20.
Gefährliche Rückkehrer?
|
zugeben, ob und wann er Kontakt zu dem Betreffenden gehabt hatte. Auch dieses Mal verhielt sich Jung aus Sicht der Gestapobeamten unauffällig. Im März 1940 meldete sich der Kreisbeauftragte für Alt- und Abfallstoffe in Wittlich bei der Gestapo Trier und erkundigte sich, warum Jung, der in diesem Bereich tätig war, keinen Wandergewerbeschein erhalten konnte.53 Ein Jahr zuvor war die Abfallwirtschaft neu geregelt worden, was zu einem erheblichen Arbeitskräftemangel in der Branche geführt hatte,54 der durch die zahlreichen Einberufungen zum Wehrdienst zusätzlich verstärkt wurde. Die Erkundigung des Kreisbeauftragten gründete somit nicht auf persönlicher Sympathie gegenüber Jung, sondern auf einem regionalen Abfallproblem, dass vor der Anfrage bei der Geheimen Staatspolizei bereits mit dem Landrat besprochen worden war. Dieser hatte ebenfalls mitgeteilt, dass Jung der Wandergewerbeschein aus politischen Gründen vorenthalten wurde. In diesem Zusammenhang entstand zum ersten Mal ein interner Vermerk, der auf Unregelmäßigkeiten in der Akte Jung hinweist. Der zuständige Beamte stellte fest, dass die vorliegenden Unterlagen keine Information zu Jungs Dienstzeit enthielten. Aus diesem Grund fasste er zusammen, was bislang über den Mann bekannt war : Er ist während der Inflationszeit aus eigener Veranlassung in die Legion eingetreten, vermutlich 1926 aus dieser desertiert. Wegen Desertion will er in Cayenne 7 Jahr [sic !] Zwangsarbeit abgeleistet haben und 1933 über Hamburg nach Deutschland zurückgekehrt sein. Von der Stapo Trier ist er bis 1936 überwacht worden.55
Des Weiteren ließ der Gestapobeamte dem Kreisleiter mitteilen, dass Jung auch weiterhin kein Wandergewerbeschein erteilt werden würde, da dies ehemaligen Fremdenlegionären in Grenzgebieten generell verwehrt bliebe. Daraufhin entgegnete der Kreisleiter, dass Jung zwar zugab, in seiner Jugend „ein bewegtes Leben geführt zu haben“, jedoch stets beteuerte, nicht in der Legion gedient zu haben.56 Der Kreisleiter betonte in seinem Schreiben die gute Arbeit, die Jung leistete, und bat darum, den Wandergewerbeschein für wenigstens fünf Orte im Kreis Wittlich auszustellen. In einem weiteren internen Vermerk vermutete der Sachbearbeiter, dass Jung seinen Dienst schlichtweg verschwiegen habe. Aufgrund des Schriftverkehrs mit dem Kreisleiter sowie der nach wie vor unbekannten Aufenthaltsdauer in der Fremdenlegion sollte Jung erneut vernommen werden. 53 Ebd., Bl. 29. 54 Dorothee Neumaier : Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement im Dritten Reich, in : Journal of New Frontiers in Spatial Concepts 5 (2013), S. 49–67, hier S. 50. 55 SHD Vincennes, Best. P, Nr. 24912, Bl. 30v. 56 Ebd., Bl. 30.
197
198
|
Ksenia Stähle
Die Vernehmung fand am 8. Mai 1940 in Trier statt.57 Laut Vernehmungsnie derschrift gibt Jung an, als junger Mann wegen Diebstahls vorbestraft gewesen zu sein. 1926 sei er von zu Hause weggegangen, da er das Gefühl hatte, „daß [er] zu streng gehalten wurde.“58 Jung sei daraufhin nach Metz gegangen, wo er seinen Lebensunterhalt mit illegalem Handel finanziert habe, der auf dem Verkauf von Gegenständen, welche die Gäste in Metzer Hotels angeblich vergessen hatten, basierte. In diesem Zusammenhang hatte ein Bekannter Jung einen Koffer mit Goldgegenständen zum Weiterverkauf angeboten. Obwohl es Jung klar war, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelte, habe er nichtsdestotrotz dem Handel zugestimmt. Auf dem Weg zum Bahnhof wurde Jung mitsamt dem Koffer von der Gendarmerie angehalten und wegen des Verdachts auf Diebstahl festgenommen. Während der sich daran anschließenden Untersuchungshaft wollte ihn ein Mithäftling dazu überredet haben, den Diebstahl zu gestehen, da man mit der entsprechenden Strafe zu Zwangsarbeit in den Kolonien verpflichtet werden würde und somit bessere Fluchtmöglichkeiten gehabt hätte.59 Dieser Empfehlung war Jung nach eigenen Angaben gefolgt und wurde zu sieben Jahren Zwangsarbeit verurteilt, die Fluchtmöglichkeiten hätten sich jedoch als weniger günstig herausgestellt, als sein Mithäftling sie versprochen hatte. Nach mehreren gescheiterten Fluchtversuchen, die zu härteren Strafversetzungen führten, gelang Jung die Flucht nach Suriname60. Von dort sei er ins Deutsche Reich zurückgekehrt. Nachdem wir in Hamburg gelandet waren, wurden wir dort von der Polizei festgehalten und in einem Polizeigewahrsam im Hafen untergebracht. Der Vater des M. [eines Mitflüchtenden, A.d.V.] war mittlerweile in Hamburg eingetroffen, um seinen Sohn in Empfang zu nehmen. Um ihn nun sofort mitnehmen zu können, sagte er seinem Sohne, er solle bei der Behörde angeben, er sei in der Fremdenlegion gewesen. Aufgrund dieser Angabe kam M. auch tatsächlich sofort frei. Ich folgte nun seinem Beispiel und gab ebenfalls an, ich sei in der Fremdenlegion gewesen. Ich wurde daraufhin auch kurz vernommen und wurde sofort entlassen. Meine obigen Angaben entsprechen der Wahrheit. Ich bin nicht in der Fremdenlegion gewesen, sondern habe diese Ausrede nur gebraucht, um schneller frei zu kommen.61
57 Ebd., Bl. 32–37. 58 Ebd., Bl. 34. 59 Ebd., Bl. 35. 60 Heute : Republik Suriname, bis 1975 niederländische Kolonie, grenzt an das französische Überseedépartement Französisch-Guayana. 61 SHD Vincennes, Best. P, Nr. 24912, Bl. 37.
Gefährliche Rückkehrer?
|
Hiernach entschied sich der zuständige Gestapobeamte dazu, ohne weitere Überprüfung der Angaben, dem Jung einen Wandergewerbeschein auszustellen. Entgegen des zuvor geäußerten Ausschlusses der Fremdenlegionäre aus der Wehrmacht wurde Jung im Mai 1941 zudem zum 45. Infanterie-Ersatz-Regiment in Kaiserslautern eingezogen.62 In diesem Jahr wurde ein interner Vermerk von einem neuen Sachbearbeiter abgefasst, der den vorherigen Ermittlungsverlauf kritisierte. Bei Durchsicht der Akte, die seit dem 25.6.1941 z.d.A. lag, wurde festgestellt, dass Jung nach seinen letzten Angaben – er wurde im Mai 1940 nochmals vernommen − überhaupt nicht in der Legion gedient hat. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jung auf Grund seiner früheren Angaben als Legionär geführt worden. […] Eine Herausstellung dieser Angaben [kein Fremdenlegionär, A.d.V.] innerhalb der Akte erfolgte jedoch nicht […]. Unter diesen Umständen wurde Jung auch zur Sonderverwendung gemeldet, was allerdings bei richtiger Nachprüfung des letzten Blattes der Akte hätte vermieden werden können. Außerdem ist der Karteivermerk ebenfalls unterblieben. In der Akte selbst fehlt auch die erste Vernehmung des Jung.63
Erst hiernach wurde die Kopie der ersten Vernehmung im Jahr 1934 aus Hamburg angefordert. Diese ist im Gegensatz zu den Vernehmungsniederschriften ab 1936 recht kurz.64 Offenbar wurde der Verdächtige zunächst stichpunktartig zu seinem Aufenthalt befragt und dann aufgefordert, über seine Zeit in der Fremdenlegion zu erzählen. Die Möglichkeit, frei über seine Dienstzeit in der Legion berichten zu können, nutzte Jung offensichtlich dazu, eine vorher zurechtgelegte Geschichte zu erzählen. Bei der Vernehmung gab er an, wegen einer durch die Eltern verhinderten Heirat in die Legion eingetreten zu sein. Die Angaben, die er zur Fremdenlegion machte, entsprachen eher dem durch Bücher und Filme transportierten Bild der Legion und erscheinen recht floskelhaft. Im Gegensatz zu den detaillierten Angaben, die Harens zu seiner Dienstzeit und anderen zurückgekehrten Fremdenlegionären geben konnte, war Jung zu keinerlei differenzierter Beurteilung fähig ; die Legion galt in seiner Schilderung in allen Belangen als schlecht. Ende 1941 nahm die Staatspolizeistelle Trier die Akte Karl Jungs erneut in Bearbeitung. Die Abwehrstelle in Kaiserslautern hatte mitgeteilt, dass Jung nach Pirmasens entlassen wurde, da er „geistig nicht ganz normal“65 sei. Im Februar 1942 62 Ebd., Bl. 38v. 63 Ebd., Bl. 41. 64 Ebd., Bl. 44–46. 65 Ebd., Bl. 48.
199
200
|
Ksenia Stähle
korrigierte der Landrat von Pirmasens diese Falschmeldung und berichtete, dass sich Jung „nach wie vor bei der Wehrmacht“66 befinde. Im selben Monat noch wurde Jung zu einer erneuten Vernehmung bezüglich seiner Legionärszeit vorgeladen, die relativ knapp ausfiel. Darin bestätigte Jung seine vorab getätigte Aussage, die Zugehörigkeit zur Fremdenlegion vorgetäuscht zu haben, um die formale Rückkehr ins Deutsche Reich zu vereinfachen.67 Erst im April 1942 wurde Jung endgültig von der Liste der Fremdenlegionäre gestrichen.68 Im Falle Karl Jungs liegt ein Kuriosum vor. Hier wurde die besondere Behandlung freiwillig zurückkehrender Fremdenlegionäre bewusst ausgenutzt, um die formalen Hürden einer Rückkehr in das Deutsche Reich zu überwinden. Die nachlässige Befragungsform ermöglichte es Jung, sich ohne genaue Kenntnisse und mit Hilfe von Phrasen glaubhaft als Legionär auszugeben. Die Falschmeldung aus Kaiserslautern und der damit verbundene Schriftverkehr mit dem Landrat und dem Oberbürgermeister von Pirmasens zeigen die teilweise chaotischen Verhältnisse in der behördlichen Kommunikation, die mit zunehmendem Kriegsverlauf stetig zugenommen haben müssen und die Erledigung des Ermittlungsfalles erheblich verzögerten. Vor allem widersprechen die kritischen internen Vermerke des Sachbearbeiters, der ab 1941 die Zuständigkeit für den Fall Jung übernommen hatte, dem von der Gestapo verbreiteten Bild einer perfekt funktionierenden Geheimpolizei.
Fazit
Bei den bislang untersuchten Fällen handelt es sich um sehr individuelle Sachverhalte. Nichtsdestotrotz kann bereits die Feststellung getroffen werden, dass es einen eklatanten Unterschied zwischen dem beschriebenen Umgang mit ehemaligen Fremdenlegionären und ihrer tatsächlichen Behandlung gab. Die Differenz begann bereits beim Aufenthalt im Lager Kislau und endete bei der Aufgabe sicherheitspolitischer Bedenken zugunsten der Kriegswirtschaft, indem die ehemaligen Legionäre trotz zuvor beschriebener Wehrunwürdigkeit recht zügig in die Wehrmacht aufgenommen wurden. Die auf den bisherigen Forschungsstand gründende Zuordnung der Legionäre zu einer gesellschaftlichen Randgruppe erscheint an dieser Stelle wenig sinnvoll zu sein. Anhand der Personalakten der Staatspolizeistelle Trier lässt sich ab 1936 eine Verschärfung der Überwachung der Rückkehrer feststellen, 66 Ebd., Bl. 54. 67 Ebd., Bl. 58. 68 Ebd., Bl. 59.
Gefährliche Rückkehrer?
|
die auf beide vorgestellten Fälle zutrifft. Noch zu überprüfen ist der Einfluss, welchen die einzelnen Sachbearbeiter auf die Ergebnisse der Verfahren ausübten.
201
Justus Jochmann
Abwehr Die nachrichtendienstliche Tätigkeit der Abteilung III der Staatspolizeistelle Trier am Beispiel Luxemburgs
Die Staatspolizeistelle Trier nahm aufgrund ihrer geographischen Lage eine Sonderrolle ein. Gelegen im Grenzgebiet der Saarregion, Frankreichs, Belgiens und Luxemburgs, ergaben sich für die Gestapo Trier besondere Gegnergruppen, Verfolgungsräume und potentielle Kooperationsinstanzen, die sich von denen einer Staatspolizeistelle aus dem Reichsinneren unterschieden. Im Besonderen lässt sich dies in dem Teilbereich der Gestapo ausdrücken, der sich funktional mit der Grenze und den Institutionen der angrenzenden Länder beschäftigte, der Abteilung III. Diese Organisationseinheit der Gestapo soll hier Betrachtung finden. Dabei liegt der Fokus auf dem abwehrpolizeilichen Bereich und der konkreten Arbeitsweise dieses Sektors. Das grenzpolizeiliche Tätigkeitsfeld, welches eng verknüpft war mit der Abwehrarbeit der Gestapo,1 findet in diesem Beitrag keine weitere Berücksichtigung. Vor allem auf der Grundlage der „Personenakten“ wird der Blick auf die staatspolizeiliche Ermittlungs- und Arbeitspraxis der Gestapo Trier gerichtet. Trotz der in jüngerer Zeit vermehrt aufkommenden regional orientierten Studien, die oftmals bestimmte Tätigkeitsbereiche der jeweiligen Staatspolizeistellen beleuchten, sind viele Lücken noch nicht gefüllt. Dies gilt etwa für die Sparten der Abwehr- und Grenzpolizei innerhalb der Gestapo, firmierend unter „Abteilung III“2. Für die Erforschung des abwehrpolizeilichen Tätigkeitsbereichs zeigt sich vor 1 Der Stellvertreter Heydrichs, Dr. Werner Best, seit Anfang 1935 Chef der Abwehrpolizei, richtete weitere Grenzpolizeikommissariate und Grenzpolizeiposten ein, die als „auswärtige Dienststellen“ vor allem abwehrpolizeiliche Aufgaben wahrzunehmen hatten. Ihnen kam entsprechend auch die Bekämpfung von Landesverrat und Spionage sowie die Bekämpfung „staatsfeindlicher politischer Bestrebungen“ zu ; vgl. Thomas Sandkühler : Von der „Gegnerabwehr“ zum Judenmord. Grenzpolizei und Zollgrenzschutz im NS-Staat, in : Christian Gerlach (Hg.) : „Durchschnittstäter“. Handeln und Motivation (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 16), Berlin 2000, S. 95–155, hier S. 98 f. 2 Ab Ende 1939 war die Abwehrabteilung unter der Abteilungsbezeichnung IV E 3 zusammengefasst. Dass dies ein rein formaler Vorgang war, zeigt auch der Umstand, dass bei der Bearbeitung der Personenakten durch die ehemalige Abteilung III weiterhin deren Stempel benutzt wurden. Vgl. Service historique de la Défense (SHD) Vincennes, GR28 P7, Nr. 56 ; SHD Vincennes, Best. P, Nr. 28898.
204
|
Justus Jochmann
allem Franz Weisz als Vorreiter. Mit seinem Aufsatz „Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht“3 gelang ihm eine Einordnung der Gestapo in das nachrichtendienstliche Umfeld der NS-Zeit, in welchem sich auch die Wehrmacht und der SD zu behaupten versuchten. Besonders in der Konsolidierungsphase der Abwehrinstanzen waren Sicherheitsdienst, militärische Abwehr und Gestapo bemüht, sich Kompetenzen im Feld der Spionageabwehr zu sichern. Gemeinsam mit Diana Albu betrachtete Weisz bereits, einem regionalspezifischen Ansatz folgend, mit „Spitzel und Spitzelwesen der Gestapo Wien“4 die Verfolgungspraxis der Gestapo Wien bzw. ihres Nachrichten-Referates. Das Gebiet der Spionageabwehr wurde jedoch bisher eher über den Zusammenhang mit der militärischen Abwehr erforscht. In derartigen Untersuchungen, wie etwa in Uwe Brammers „Spionageabwehr und geheimer Meldedienst“5, wird die Gestapo nur angeschnitten.
Die Entwicklung der Abteilung III
Die Abteilung III gewann spätestens mit der Verkündung des Vierjahresplanes und der damit einsetzenden Vorbereitung der deutschen Wirtschaft auf den Krieg immer mehr an Bedeutung. Ab 1936 erfolgte entsprechend in den Folgejahren eine Aufstockung des Personals6, die einer voranschreitenden sachlichen Ausdif-
3 Franz Weisz : Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht, in : Hans Schafranek/Johannes Tuchel (Hg.) : Krieg im Äther. Widerstand und Spionage im Zweiten Weltkrieg, Wien 2004, S. 215–246. 4 Diana Albu/Franz Weisz : Spitzel und Spitzelwesen der Gestapo in Wien von 1938 bis 1945, in : Wiener Geschichtsblätter 3 (1999), S. 169–208. 5 Uwe Brammer : Spionageabwehr und „Geheimer Meldedienst“. Die Abwehrstelle X im Wehrkreis Hamburg 1935–1945 (Einzelschriften zur Militärgeschichte, Bd. 33), Freiburg im Breisgau 1989. 6 Dennoch war der Personalbestand reichsweit und auch in Trier alles andere als großzügig. So wurde dieser in den Gestapostellen selbst als unzureichend empfunden und als Behinderung der Arbeit angesehen, was sich durch die Ausweitung der Tätigkeitsfelder und den weiterhin zu stemmenden Bürokratieapparat noch intensivierte ; vgl. Burkhard Dietz/Anselm Faust/Bernd-A. Rusinek : Einleitung, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz/Anselm Faust/Bernd-A. Rusinek, Bd. I : 1934, Düsseldorf 2012, S. 1–32, hier S. 6. Auch der Personalstamm der Abteilung III stellte wohl keine Ausnahme dar. Reinhard Heydrich veröffentlichte im April 1936 in der Zeitschrift Deutsches Recht zur Personalgröße der Abwehr der Staatspolizei sogar einen strategischen Gedanken, wonach „es erforderlich [ist], daß für besondere Aufgaben (z.B. Abwehr) der Mitarbeiterkreis möglichst klein gehalten wird, um zu verhüten, daß die hier zu wahrenden Geheimnisse bekannt werden“ ; Abschrift aus Deutsches Recht, Heft 718 vom 15. April 1936, in : Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/243, Bl. 124.
Abwehr
|
ferenzierung gerecht zu werden versuchte. Dr. Werner Best7 versah die Abwehrpolizei im Gegensatz zur Abteilung II nicht vorrangig mit exekutiven Aufgaben. Sie sollte hauptsächlich Feststellungen auf dem Abwehrgebiet auswerten, kartieren und an die zuständige Abteilung des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa) berichten. Ihr eigenes Netz aus V-Leuten und Agenten gewann mit Kriegsbeginn weiter an Größe. In rüstungs- und später kriegswirtschaftlich wichtigen Betrieben setzte die Abteilung III beispielsweise informelle Bedienstete, sogenannte Abwehrbeauftragte, ein, welche die Betriebe vor Sabotage und feindlicher Spionage schützen sollten. Im Zuge der Schutztätigkeit der Gestapo in diesen Betrieben wurde auch die politische Überprüfung8 von einzustellenden Personen in Rüstungsbetrieben und militärischen Bauvorhaben Teil ihrer abwehrpolizeilichen Aufgaben. Zusätzlich, als Anknüpfung zur grenzpolizeilichen Tätigkeit, hatte die Gestapo auch Devisenvergehen in den beobachteten Bauvorhaben zu verfolgen. Der Abwehrabteilung der Gestapo fiel als eine Sonderaufgabe die sogenannte Gruppenüberwachung zu. Hier sollten vor allem ausländische Deserteure, Fremdenlegionäre, aber auch Funkamateure und Brieftaubenbesitzer beobachtet werden.9 Die personelle Aufstockung der Abteilung III wurde stetig vorangetrieben, bis sie mancherorts auf etwa zwei Drittel der Stärke der Abteilung II angewachsen war, ein Hinweis auf die größer werdende Bedeutung ihrer Überwachungstätigkeiten.10 Dies fand auch Ausdruck in einem Vorgang aus dem Jahr 1939, in welchem die vorhandenen Kräfte der Gestapo auf die „wichtigsten Sachgebiete“ konzentriert werden sollten. Die Abteilung III sollte im Gegensatz zu den anderen Abteilungen ohne Einschränkungen weiterarbeiten.11 Ihre Kompetenzen wurden stattdessen besonders mit Kriegsbeginn erweitert und betrafen neben den Abwehrfragen auch 7 Dr. Werner Best war ein enger Vertrauter Himmlers und späterer Stellvertreter Heydrichs. Er war der Organisator, Personalchef und Theoretiker der Gestapo und am Aufbau und der Etablierung der Gestapo im NS-Verfolgungsapparat maßgeblich beteiligt ; vgl. Carsten Dams/Michael Stolle : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 42017 (2008), S. 51 sowie Ulrich Herbert : Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903–1989, Bonn 1996. 8 Vgl. beispielsweise SHD Vincennes, Best. P, Nr. 28898. 9 Gerhard Paul : Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung. Die Gestapo in Schleswig-Holstein (IZRG-Schriftenreihe, Bd. 1), Hamburg 1996, S. 49 f. 10 Hans-Dieter Schmid : Gestapo Leipzig. Politische Abteilung des Polizeipräsidiums und Staatspolizeistelle Leipzig 1933–1945 (Leipziger Hefte, Bd. 11), Leipzig 1997, S. 16. 11 Die kriegsbedingt umfangreiche Sonderverwendung von Gestapobeamten hatte es notwendig gemacht, die Gestapo zu entlasten. Hierzu wurden einige Referate der Abteilung II verkleinert oder, wie die Referate II E (Wirtschaftsangelegenheiten), II H (Parteiangelegenheiten) und II P (Presse), fast komplett aufgelöst und anderen Institutionen übertragen ; vgl. Schreiben Heydrichs vom 31.8. 1939, in : BArch Berlin, R 58/243, Bl. 276 f.
205
206
|
Justus Jochmann
die Bearbeitung der staatspolizeilichen Belange, die mit dem verstärkt aufkommenden Einsatz ausländischer Arbeitskräfte zu tun hatten. Die Aufgaben differenzierten sich aus und betrafen beispielsweise die Vorwürfe der Arbeitsverweigerung, Fahndung nach flüchtigen Vertragsbrüchigen und deren Rückführung, Fahndung nach geflohenen Kriegsgefangenen und Weiteres mehr. Hier fanden auch die N[achrichten]-Referate verstärkt Einsatz.12 Die Abteilungen und Referate der Abwehr- und Grenzpolizei innerhalb der Gestapo hatten noch verschiedenste Ausprägungen und Entwicklungen in ihren Tätigkeiten und Kompetenzen, etwa die Behandlung von Fremdenlegionären13, der Umgang mit Fremdarbeitern, mit Kriegsgefangenen, den sogenannten „NN-Häftlingen“14 und auch im Umgang mit Abschiebungen, Schleusungen und Deportationen von Juden15 spielte die Abteilung III eine Rolle. 12 Paul : Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung, S. 51 f. 13 Die Gestapo Trier hatte beispielsweise im Juni 1941 im Auftrag des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) die Überführung von 300 Fremdenlegionären in das Arbeitserziehungslager Hinzert zu leisten und sich um deren Unterbringung zu kümmern ; vgl. Katharina Klasen : Allgegenwärtig ? Die Geheime Staatspolizei und das SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 13), Mainz/Hinzert 2015, S. 116. 14 In der Behandlung der „Nacht- und Nebel“-Häftlinge kam es zu einem Zusammenwirken von militärischer Abwehr, der Gestapo, weiteren Polizeiinstanzen und, in besonderer Rolle, den deutschen Sondergerichten. Der Gestapo kam vor allem die Aufgabe zu, die Häftlinge an der Reichsgrenze zu übernehmen und den Sondergerichten zuzuführen. Neben dem Transport übernahm die Gestapo aber später auch eigenmächtig Ermittlungstätigkeiten. Einen Überblick über das Zusammenwirken der Institutionen bietet Lothar Gruchmann : „Nacht- und Nebel“-Justiz. Die Mitwirkung deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den besetzten westeuropäischen Ländern 1942–1944, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 (1981), H. 3, S. 342–396. Zur Region Trier vgl. Lena Haase : Verurteilt um zu Verschwinden. „Nacht- und Nebel“-Häftlinge in der Großregion Trier (1942–1944), in : Kurtrierisches Jahrbuch 56 (2016), S. 289–320. 15 Einen Überblick über die Entwicklung im Umgang der Gestapo mit Juden, beginnend bei der Unterstützung freiwilliger Auswanderungstendenzen über Abschiebepraktiken der Grenzpolizei bis zum Mitwirken an der Massendeportation nach Osten und der daraus resultierenden Katastrophe des europäischen Judentums, bietet Jacob Toury. Er betrachtet dabei im Besonderen die Situation an der Westgrenze und somit auch Luxemburg und die Tätigkeit der Staatspolizeistelle Trier. Auch dort war die Gestapo an der inoffiziellen Weiterleitung von Juden über die „Grüne Grenze“ nach Luxemburg beteiligt ; vgl. Jacob Toury : Ein Auftakt zur „Endlösung“. Judenaustreibungen über nichtslawische Reichsgrenzen 1933 bis 1939, in : Ursula Büttner/Werner Johe/Angelika Voß (Hg.) : Das Unrechtsregime. Internationale Forschung über den Nationalsozialismus. Festschrift für Werner Jochmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 1986, S. 165–196. Auch Hans-Dieter Schmid betrachtet die Zusammenarbeit zwischen Gestapo und der Finanzverwaltung beim verbrecherischen Umgang mit den Juden Deutschlands, angefangen bei der „Reichsfluchtsteuer“ bis zur Arbeitsteilung zwischen Gestapo und Finanzverwaltung bei den Deportationen ; vgl. Hans-Dieter Schmid : „Finanztod“. Die Zusammenarbeit von Gestapo und Finanzverwaltung bei der Ausplünderung der
Abwehr
|
Die Bekämpfung des politischen und „rassischen“ „Staats- bzw. Volksfeindes“ blieb zwar zentral im staatspolizeilichen Handeln, der Krieg verschob allerdings die programmatische Frontstellung. Die Gestapo wurde immer stärker mit abwehrpolizeilichen Aufgaben betraut, mit Aufgaben im Rücken der Front, welche weniger im Kredo einer „völkischen Polizei“ verankert waren.16 Reinhard Heydrich beschrieb die kriegsbedingte Ausdifferenzierung der Aufgaben der Gestapo 1941 wie folgt : Zur Bekämpfung der allgemeinen Volks- und Staatsfeindlichkeit (wie politische Zersetzungsversuche alter und vom Ausland gesteuerter unverbesserlicher politischer Gegner) kommt das unerschöpfliche Vielerlei der Tätigkeit gegen Spionage, Sabotage, gegen die krampfhaften Versuche des Feindes, Deutschland zu erforschen und Verräter zu finden, der Schutz der unendlichen Zahl der Rüstungsbetriebe, die unerhört wichtigen Aufgaben der Grenzpolizei […], die schier unermeßliche Vermehrung der Tätigkeit durch die Vielzahl der kriegsmäßig bedingten Gesetze und Verordnungen, die Behandlung der Judenfrage, die Steuerung der Judenauswanderung […], der sicherheitspolizeiliche Einsatz im Rahmen des Heeres, sowohl zum kleinen Teil als Geheime Feldpolizei, zum überwiegenden Teil aber als besondere sicherheitspolizeiliche Einsatzkommandos mit dem Ziel der politischen Sicherung in den besetzten Gebieten.17
Die Abteilung III im überregionalen und institutionellen Kontext
Der Aufbau des Nachrichtendienstes der Gestapo ging, wie auch der Aufbau ihrer Gesamtorganisation, uneinheitlich vonstatten. Dies lag an der langsamen Zentralisierung der Institution. Die Politische Polizei wurde aus den Kompetenzen der Länderverwaltungen gelöst und direkt dem Gestapa in Berlin unterstellt. Dieses fungierte mit der Zeit als Oberbehörde sämtlicher Gestapo-(Leit-)Stellen im gesamten Deutschen Reich.18 Es kam nicht nur zwischen den Ländern zu Organisationsproblemen, sondern auch innerhalb des Gestapa.19 Zur Kenntlichmachung der breit gefächerten Tätigkeitsbereiche wurden sogar im GeschäftsverteilungsJuden in Deutschland, in : Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg, Darmstadt 2000, S. 141–154. 16 Paul : Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung, S. 161. 17 Reinhard Heydrich : Politisches Soldatentum in der Polizei, in : Generalanzeiger der Stadt Frankfurt a.M. vom 17.2.1941, zitiert nach : Paul : Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung, S. 162 f. 18 Weisz : Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht, S. 215. 19 Ebd.
207
208
|
Justus Jochmann
plan einige Abteilungen mit dem Hinweis versehen, dass möglicherweise andere Dezernate zuständig sein können, wie in der allgemein gehaltenen Tätigkeitsbeschreibung des Dezernats VII zu „sämtlichen politischen Bewegungen“ ersichtlich wird.20 Die Versuche aus Berlin, das lokale Handeln zu ordnen und zu vereinheitlichen, liefen häufig ins Leere und auch die Runderlasse vom Gestapa mit Handlungsrichtlinien wurden nicht immer umgesetzt. Die Bestimmung vom 2. Mai 1939, dass die Exekutivbeamten der jeweiligen Sachreferate nicht in direkten Kontakt mit den Konfidenten treten durften, steht hierfür exemplarisch. Dieser Anordnung wurde nur allzu häufig zuwidergehandelt.21 Und doch zeigen die ergangenen Bestimmungen, dass man mit Richtlinien zu verwaltungstechnischen und taktischen Grundsätzen die Kompatibilität der Gestapostellen untereinander zu verbessern versuchte. Diese hatten sich auf Grundlage regionaler Erfahrungen und Nöte eigene Arbeitsweisen und Behelfe geschaffen, die entsprechend uneinheitlich waren.22 In vielen Fällen hatten die Abwehrstellen im Zuge der Abwehr von Sabotage und Spionage auch institutionsübergreifend zusammenzuarbeiten. Die bereits erwähnten „Abwehrbeauftragten“ in Rüstungsbetrieben konnten Ausführungsorgane sowohl der militärischen Abwehr als auch der Gestapo sein. Bis zum 1. Juni 1944 wiesen die jeweiligen Abwehrstellen die „Abwehrbeauftragten“ in Spionageund Sabotageabwehr an. Die Gestapo-(Leit-)Stellen erteilten diesen zunächst nur in politischen, staatspolizeilichen Angelegenheiten Aufträge. Ab Juni 1944 gingen schließlich sämtliche Weisungen von der Gestapo aus.23 Nachdem ab September 1939 bereits das Hauptamt Sicherheitspolizei, die staatliche Zentralbehörde für die Gestapo (Gestapa) und die Kriminalpolizei (Reichskriminalpolizeiamt) zum Reichssicherheitshauptamt (RSHA) vereinigt worden waren, wurde im Juni 1944 auch der geheime militärische Nachrichtendienst in das RSHA eingegliedert. Dieser Schritt entsprach dem schon lange angestrebten Ziel Himmlers und Heydrichs, die Geheimdienste im „Dritten Reich“ zum Zweck der totalitären Herrschaftsausübung zu einem straff zentralisierten Apparat zusammenzufügen. Die ersten Stufen der nachrichtendienstlichen Konzentration waren entsprechend die Schaffung der Gestapo als innenpolitischer Nachrichtendienst im nationalsozialistischen Machtapparat und der Weg des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD) zum 20 Geschäftsverteilungsplan des Gestapa vom 19. Juni 1933, in : Johannes Tuchel/Reinold Schattenfroh : Zentrale des Terrors. Die Prinz-Albrecht-Str. 8. Hauptquartier der Gestapo, Berlin 1987, S. 70 f. 21 Albu/Weisz : Spitzel und Spitzelwesen der Gestapo in Wien von 1938 bis 1945, S. 173. 22 Weisz : Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht, S. 216. 23 Ebd., S. 231 f.
Abwehr
|
alleinigen Nachrichtendienst der NSDAP.24 Neben dem Durchsetzungsvermögen der SS bzw. Himmlers und Heydrichs gegenüber der Wehrmacht waren auch die militärischen Rückschläge von 1941/42 Ursachen für die Zusammenlegung des militärischen Nachrichtenwesens mit dem der Gestapo und des SD. Die Personalsituation in Deutschland wurde kriegsbedingt immer angespannter, so dass in die Idee einer Zusammenlegung von Gestapo, Kripo und SD im RSHA auch wichtige Teile des Amtes Ausland/Abwehr integriert wurden. Die Position der militärischen Abwehr wurde zudem durch eine Reihe nachrichtendienstlicher Pannen bis zum Jahr 1944 geschwächt.25 Das Verhältnis von militärischer Abwehr zum SD und der Gestapo war bis zum Jahr 1944 geprägt von Zeiten der Spannungen, die sich abwechselten mit Phasen guter Zusammenarbeit. Bis zum Kriegsausbruch26 hatte die militärische Abwehr in Exekutivangelegenheiten die Gestapo heranzuziehen. Die Zusammenarbeit war entsprechend gesetzlich verankert. Die militärische Abwehr war besonders durch das gemeinsame Vorgehen in Fällen der Spionage und des Landesverrats mit der Gestapo und dem SD konfrontiert. Die Konflikte zwischen den NS-Organisationen und der Wehrmacht waren dem Kompetenzgerangel im Kampf um die Vormachtstellung geschuldet und drückten sich auch in zahlreichen Fällen von Bespitzelungen27 durch Telefonüberwachungen und Berichterstattung über die 24 Brammer : Spionageabwehr und „Geheimer Meldedienst“, S. 39 f. 25 Weisz : Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht, S. 233. 26 Im Kriegsfall konnte die von dem Ressort Abwehr III geleitete Geheime Feldpolizei (= GFP) exekutiv tätig werden. Eigentlich für den Schutz des Heeres im Operationsgebiet vorgesehen, konnte die Abwehr in dringenden Fällen ab 1939 die GFP etwa bei der Verfolgung von Spionagefällen auch außerhalb des Operationsgebietes und damit im gesamten Reichsgebiet einsetzen. Die Beamten der GFP bekamen mitunter die Befugnisse, die den Behörden und Beamten des Polizei- und Sicherheitsdienstes per Gesetz zustanden. Dennoch hatte die GFP die örtlich zuständige Staatspolizeistelle über ihre Tätigkeit zu informieren ; Heinz Höhne : Canaris. Patriot im Zwielicht, München 1976, S. 358. 27 So wurde von Seiten der Gestapo etwa dem Verdacht nachgegangen, das Offizierskorps wäre dem NS-Regime nicht positiv genug gegenüber eingestellt. Entsprechend wurden nicht nur militärische Korrespondenzen und Telefonate überwacht. In der Wehrmacht dienende Parteigenossen wurden angehalten, sogenannte Erfahrungsberichte anzufertigen und damit einen Einblick in das komplette Innenleben der Truppe zu ermöglichen. Dies erzeugte im Besonderen Unmut, sodass sich der Reichskriegsminister allzu häufig bei dem „Stellvertreter des Führers“ Rudolf Heß, dem für Parteiangelegenheiten zuständigen Minister, über die unzulässige Einmischung beschwerte ; vgl. Klaus-Jürgen Müller : Das Heer und Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime 1933–1944 (Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, Bd. 10), Stuttgart 21988, S. 172 f. Es entstand sogar auf militärischer Seite die Vermutung, es würde sich bei den Bespitzelungen nicht um Einzelfälle handeln, den Versuchen einer Erkundung der politischen Einstellung von Offizieren durch regionale Gestapo- und SD-Stellen würde vielmehr eine generelle Weisung des Gestapa zugrunde liegen. Auf
209
210
|
Justus Jochmann
politische Zuverlässigkeit von Offizieren aus, mit welcher die Gestapo und der SD die Wehrmachtführung mitunter verstimmten.28 Ohne große Gegenliebe begegneten sich Wehrmacht und die später gegründeten Einsatzkommandos von SD und Sicherheitspolizei. In den besetzten Gebieten, wie etwa Belgien, konkurrierten die Institutionen auch im Bereich der Gegenspionage. Heydrich war von der Qualität der Wehrmacht bzw. deren Abwehr nicht besonders überzeugt, die Wehrmacht misstraute ihrerseits prinzipiell dem Treiben von SS-nahen Institutionen.29 Und doch waren die Konflikte zwischen Wehrmacht, SD und der Gestapo nicht durchgehend bestimmend für das Verhältnis. Das Gebiet der Spionageabwehr wurde auch kollegial von Gestapo und militärischer Abwehr bearbeitet.30 Auftretende Spannungen waren häufig Ausdruck individueller Umstände wie örtlicher Gegebenheiten, Augenblickssituationen (Trunkenheit etc. führten zu kolportierten Zwischenfällen, wie z.B. Schlägereien unter Angehörigen der verschiedenen Lager) und persönlicher Temperamente. In den Spannungen drückte sich allerdings auch ein generelles Misstrauen aus.31 Überhaupt versuchte man, die Arbeit der einzelnen Institutionen und gleichzeitig ihre Zusammenarbeit effektiver zu gestalten. Dieses Bemühen erhielt mit Kriegsbeginn erneuten Aufschwung. Heydrich wies etwa in seinen „Grundsätzen der inneren Staatssicherung während des Krieges“ die lokalen SD- und Stapostellen an, nach der Verhaftung eines Verdächtigen Unterlagen und Informationen beider Institutionen übergreifend in die folgenden Ermittlungen einzubeziehen.32
Die abwehrpolizeiliche Tätigkeit am Beispiel Luxemburgs
Das Großherzogtum Luxemburg war − besonders bis zum Einmarsch der Deutschen Wehrmacht − eine Region, in der antifaschistische und kommunistische einer Besprechung der Ic-Bearbeiter der Wehrkreise in Berlin im Januar 1936 wurde festgestellt, dass durch die SS wohl planmäßig Stimmung gegen die Wehrmacht erzeugt würde ; vgl. ebd., S. 178 f. Der Ic-Dienst war für die Feindaufklärung des Heeres zuständig. Als Abteilung des Generalstabes bildete „Fremde Heere Ost“ deren Spitzenorganisation, die in den Jahren 1942 bis 1945 unter der Führung von Reinhard Gehlen stand ; vgl. Magnus Pahl : Fremde Heere Ost. Hitlers militärische Feindaufklärung, Berlin 2013, S. 13. 28 Brammer : Spionageabwehr und „Geheimer Meldedienst“, S. 40 f. 29 Rupert Butler : Illustrierte Geschichte der Gestapo, Augsburg 1996, S. 138. 30 Brammer : Spionageabwehr und „Geheimer Meldedienst“, S. 41. 31 Müller : Das Heer und Hitler, S. 173. 32 Schreiben Heydrichs vom 3. September 1939, in : BArch Berlin, R 58/243, Bl. 202 f.
Abwehr
|
Flugblätter hergestellt wurden, und bildete damit einen Ausgangspunkt für Gegenbewegungen. Von hier aus wurden die Flugblätter auf verschiedenste Weise über die Grenze geschmuggelt.33 Nach der Saarabstimmung im Jahr 1935 und der damit verbundenen Eingliederung ins Deutsche Reich34 verschob sich die vorher größtenteils im Saargebiet stattfindende Produktion von kommunistischer Propaganda und entsprechend auch deren Einfuhr nach Luxemburg und Belgien.35 Darüber hinaus war Luxemburg besonders in den Vorkriegsjahren eine Region, über die französische Spione nach Deutschland eingeschleust wurden.36 Das Großherzogtum diente bereits seit Ende des Ersten Weltkrieges und der alliierten Rheinlandbesetzung als Operationsgebiet der französischen Nachrichtendienste. Schon beinahe traditionell wurde von dort aus die Erforschung der angrenzenden deutschen Gebiete durchgeführt. Dabei war für die Franzosen besonders das gute Verhältnis zur Luxemburger Bevölkerung von Vorteil, aus deren Reihen eine große Bereitschaft zur Unterstützung kam.37 Mit der Machtübernahme Hitlers und der offenen Wiederaufrüstung steigerte sich diese Bereitschaft sogar noch. Der französische Nachrichtendienst war Nutznießer dieser Entwicklung und konnte so im neutralen Luxemburg seine Spionagenetze weiter ausbauen. Eine Unterstützungsbereitschaft fand sich auch bei Mitgliedern der luxemburgischen Regierung, Verwaltungschefs, Gerichtsbehörden, dem Zoll und der Gendarmerie. Im luxemburgisch-deutschen Grenzgebiet hatte die französische Seite damit gegenüber den Deutschen einen großen Zeitvorsprung, wie der relativ späte
33 Barbara Mausbach-Bromberger : Der Widerstand der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus in Frankfurt a.M. 1933–1945, Diss. Marburg 1976, S. 149. 34 In ihrer Frühphase zeigte sich die Auswirkung der Unterbesetzung bei der Trierer Gestapo. Im Lagebericht vom April 1935 wurde ausgedrückt, dass „[…] bis zur Errichtung der Stapo Saarbrücken die Arbeit der Staatspolizeistelle Trier fast ausschließlich der Betreuung des Saargebiets gewidmet werden musste.“ Dies ging bis dato „notgedrungen“ zu Lasten der Überwachung der luxemburgischen, belgischen und lothringischen Grenzen ; Lagebericht der Gestapostelle Trier für Mai 1935, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI). Band II,1 : Januar–Juni 1935, Düsseldorf 2014, S. 503. Das nicht zum Reichsgebiet gehörende Saargebiet galt nach der Machtübernahme Adolf Hitlers als Ausgangspunkt von Gegenbewegungen und, wie es die in Saarbrücken erscheinende Tageszeitung Deutsche Freiheit im Juni 1933 nannte, als „freie deutsche Insel“ ; vgl. Hans Jörg Schmidt : Die Deutsche Freiheit. Geschichte eines kollektiven semantischen Sonderbewusstseins, Frankfurt a.M. 2010, S. 187. 35 BArch Berlin, R 58/2093, Bl. 149. 36 Oskar Reile : Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg. Westfront. Der Kampf der Abwehr im westlichen Operationsgebiet, in England und Nordafrika, Augsburg 1990, S. 41. 37 Auch die Gestapo Trier registrierte dies und berichtete über eine sich in Luxemburg seit der Macht übernahme verschärfende feindliche Stimmung gegen Deutschland ; vgl. Lagebericht der Gestapostelle Trier für August 1934, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Bd.1 : 1934, S. 350.
211
212
|
Justus Jochmann
Auf- und Ausbau der Abwehrnebenstelle und der Gestapo in Trier belegt.38 Im Zuge dieser Gegebenheiten konnte schließlich auch der Poste d´Alerte Luxembourg (Polux) gegründet werden. Frankreich stellte mit seinem „Deuxième Bureau“ den Hauptgegenspieler der Abwehrbestrebungen in Luxemburg und dem deutschen Grenzraum dar. Der französische Geheimdienst wirkte hier mittels seiner Dienststelle namens „Polux“. Das Deuxième Bureau war die zweite Abteilung des Generalstabs der französischen Armee und deren nachrichtendienstliche Abteilung. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges war der französische Geheimdienst der wichtigste und technisch am besten ausgerüstete Nachrichtendienst der Alliierten. Die Unterabteilung Service de Renseignements39 (= S.R.; der Geheime Meldedienst) mit Mitarbeitern aus Heer und Luftstreitkräften und der recht selbstständige Marinenachrichtendienst arbeiteten dem Deuxième Bureau zu.40 Der französische Geheimdienst unterhielt seit Juni 1930 in Metz das Bezirksbüro Bureau Regionale d’Etudes à Metz (BREM). Diese Stelle hatte wiederum untergeordnete Dienststellen, wovon sich ab dem 10. Mai 193641 eine in Luxemburg befand. Capitaine Jean Nicolas Fernand Archen wurde durch die Verwaltungsanweisung Nr. 183 E.M.A42 abgeordnet, eine eigene Dienststelle zu gründen.43 Errichtet wurde der Polux schließlich in Luxemburg-Stadt in der 250, Rue Bel Air, der späteren Avenue Gaston Diderich. Archen, der als Kopf des Polux fungierte, tarnte sich vor Ort als Weinhändler.44 Nach eigener Aussage wählte er diese 38 Emile Melchers : Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914/Mai 1940, Luxemburg 1963, S. 172 ff. 39 Diese Unterabteilung firmierte auch als das „fünfte Bureau“. Es sollte die Nachrichten beschaffen, während das „zweite Bureau“ die Aufgaben deligierte, die Ergebnisse auswertete und nach oben berichtete. In den Vorkriegsjahren nahm die Bedeutung des fünften Bureaus immer weiter ab. Die Nachrichtenlage, vieles davon auch direkt vom Gegner kommend und entsprechend fingiert, erschien dem französischen Nachrichtendienst als durchaus umfangreich ; vgl. Wilhelm von Schramm : Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Organisation, Methoden, Erfolge, München/ Wien 31979, S. 45 f. 40 Ernst R. May : Die Nachrichtendienste und die Niederlage Frankreichs 1940, in : Wolfgang Krieger (Hg.) : Geheimdienste in der Weltgeschichte. Spionage und verdeckte Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart, München 2003, S. 170–181, hier S. 175 ff. 41 Etwa auf die gleiche Zeit der Polux-Gründung fällt auch die Gründung der Abwehr in Trier. Die militärische Spionageabwehr, die Abteilung III F, nahm ihre Arbeit in Trier im März 1936 auf ; vgl. Fernand Archen : Missions Spéciales au Luxembourg, Paris 1968, S. 171. 42 Die Anweisung des französischen Kriegsministers findet man in : ebd., S. 158. 43 Neben Capitaine Fernand Archen waren noch die Lieutenants Brault, Camille Scheider, André Vernier, der Journalist René Hauth, der Bankier Knoll, Martin Schiltz, Paul Fisch, Henri KochKent, Eugène und Gustave Simon, Charles Lutty sowie M. JT de Saint Hardouin offizieller Teil des sogenannten Poste d´Alerte Luxembourg (Polux). 44 Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale (Hg.) : Lieutenant-colonel Jo-
Abwehr
|
Tarnung selbst : Er hatte einen Onkel, der an der luxemburgischen Mosel einen großen Weinhandel führte.45 Laut einem Vermerk der Gestapo Trier war die Hauptaufgabe der Nachrichtenstelle in Luxemburg die Überwachung der deutschen Truppenbewegungen, so dass einem plötzlichen Angriff das Überraschungsmoment genommen werden sollte. Die Eifel erkannte man folglich als Hauptausspähungsgebiet. Erkundungen erstreckten sich außerdem auf den Bau des Westwalls, die Überwachung der Tätigkeiten deutscher Staatsangehöriger in Luxemburg sowie den Verkehr der Reichsbahn. Hierzu baute Archen ein doppeltes Agentennetz im Landesinneren und besonders an der deutsch-luxemburgischen Grenze auf, welches durch Kurzwellensender, Motorradfahrer und Brieftauben unterstützt wurde. Der Gestapovermerk nennt bereits den 5. Mai 1936 als Beginn des Aufbaus dieses Netzes. Das Netzwerk der Nachrichter, die für Polux tätig waren, arbeitete gegen Unkostenentschädigung und eine kleinere Vergütung, die von Archen als „honorable correspondant“ bezeichneten Nachrichter gehörten also nicht offiziell zum BREM in Metz.46 Die Dienststelle von Capitaine Archen, das sogenannte Bureau Polux, wurde am 9. Mai 1940 von den deutschen Truppen entdeckt. Sie war unbesetzt und so fiel den Deutschen sämtliches Material, das Archen dort aufbewahrte, in die Hände. Ihm selbst gelang mit Lieutenant Brault, Sergent-Chef Vernier und vier Luxemburgern per Auto die Flucht über Belgien nach Frankreich.47 Das umfangreiche Nachrichtenmaterial verblieb in der Hand der Wehrmacht bzw. der Abwehr und wurde durch die Auswertestelle West48 gesichtet. Durch einen Blick in die Personalakten der Gestapo Trier soll nun die staatspolizeiliche Ermittlungs- und Arbeitspraxis vor Ort verdeutlicht werden. Die untersuchten Personalakten von sowohl natürlichen Personen als auch anonymen Unbekannten zeichnen sich alle durch eine Verbindung zum Ermittlungsgegenstand „Polux“ aus.
seph Doudot. Le B.R.E.M. Bureau Régional d’Etudes Militaires de Metz, online unter : http://www. aassdn.org/001.pdf (Letzter Zugriff : 20.8.2017). 45 Archen : Missions Spéciales au Luxembourg, S. 160. 46 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 62. 47 Melchers : Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914/Mai 1940, S. 176 f.; Oskar Reile gibt eine Beschreibung des Vorgehens am 9. Mai 1940 aus der Sicht der militärischen Abwehr ab, spart dabei allerdings den Vorgang des Aktenfundes aus ; Reile : Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg. Westfront, S. 21 ff. 48 Die Auswertestelle West lag in Oberursel ; vgl. Stefan Geck : Dulag Luft/Auswertestelle West. Vernehmungslager der Luftwaffe für westalliierte Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. u.a. 2008, S. 9.
213
214
|
Justus Jochmann
Im Auftrag der Trierer Gestapo und im Dienste des Einsatzkommandos Luxem burg (EKL) beteiligte sich der ehemalige Mitarbeiter der Trierer Abteilung III, Heinrich Katzbach, an den Ermittlungen zum Thema „Polux“. Am Beginn einer jeden Ermittlungstätigkeit gegen der Gestapo noch unbekannte Verdächtige stand die eindeutige Feststellung der Identität, um Verwechslungen späterhin ausschließen zu können. Im Fall von Maurice D., einem mutmaßlichen Informanten des Polux, regte man etwa an, dessen letzte Meldeadresse in Paris aufzusuchen und vor Ort zu ermitteln, was vom Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) in Paris genehmigt und unterstützt wurde. Durch „vertrauliche Nachfrage“ bei der ausfindig gemachten Mutter des D. wollte man dessen Aufenthaltsort in Erfahrung bringen. Zusätzlich schrieb man ihn im „Deutschen Fahndungsbuch“ aus. Da D. nicht ausfindig gemacht werden konnte, verblieb seine Mutter als einzige Spur zu ihm, weswegen auch ihre Wohnungswechsel erfasst wurden. Der Fall D. blieb dann auch bis zuletzt beim BdS in Paris. Im Erfolgsfalle wäre die Trierer Abwehrpolizei erneut benachrichtigt worden.49 Im Ermittlungsfall des „Unbekannten LY 18“ ersuchte die Gestapo Trier bei der Staatspolizeistelle Saarbrücken um Auskunft, ob in deren Material zur BREM dieser Agent auftauchen würde. Die Saarbrücker Gestapo führte hierzu das „Forbacher Material“ an, verknüpfte also Ermittlungsergebnisse unterschiedlicher Herkunft miteinander. Diese Verknüpfung leistete Kriminalkommissar und SS-Hauptsturmführer Preuss50, welcher zuvor in Trier bereits für das N[achrichten]-Referat verantwortlich gewesen war. Neben dem Einsatzkommando Luxemburg, mit seinen drei Sparten Gestapo, Kripo und SD, kamen durch die Personalverschiebungen51 auch aus Saarbrücken ehemalige Kollegen innerhalb der Ermittlungstätigkeiten wieder zusammen. Zu „LY 18“ gab es in weiteren Personalakten Vermerke, etwa in der des Ernst C. Mit einem beigefügten Auszug wurde auf die Berücksichtigung der Personalakte „LY 18“ bei einer eventuellen Festnahme des C. verwiesen. Zwar war es bis dato noch zu keiner Festnahme gekommen, dennoch ordnete Kriminalsekretär und SS-Untersturmführer Gustav Feick an, eine Anfrage über die Akte C. an das Unterkommando Diekirch/Moselland des Einsatzkommandos der SiPo und des SD in Luxemburg zu stellen. Der Vorgang wurde bis zur Festnahme C.s zurückgestellt, da dieser sich auf der Flucht befand.52 Obwohl die Gestapo also bestrebt war, Netzwerke, die in den Akten sichtbar wurden, zu verfolgen, gestaltete 49 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 75. 50 National Archives and Records Administration (NARA), M 1270, Roll 0031 : Interrogation Section 8. August 1945, Report 28. 51 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), Rep. 90 P, Nr. 14, H. 2. 52 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 157.
Abwehr
|
sich dies schwierig, da zahlreiche Agenten des Polux nicht unter ihrem bürgerlichen Namen geführt wurden. Zu den einzelnen unbekannten Agenten wurden teilweise die gesammelten Erkenntnisse zusammengefasst und als Abschriften den betreffenden Personalakten beigefügt. Zusätzlich wurden Abschriften ganzer Quellen aus dem „Material Polux“ angefügt, so etwa in der Akte „L 128“ die deutsche Übersetzung des Tätigkeitsberichts der Stelle Polux für die Woche vom 4. bis 10. Juni 1939.53 Im Falle der gänzlich unbekannten Personen verliefen die Ermittlungen aufgrund der dürftigen Materiallage häufig im Sande. Aus der Akte „L 128“ wird ersichtlich, wie umfangreich das EK Luxemburg in den aus Trier geführten Polux-Ermittlungen tätig wurde. Deren durchgeführte Vernehmungen ergaben für die Gestapo Trier die Zweckmäßigkeit, den Luxemburger Felix K. erneut zu befragen und vorläufig festzunehmen, denn man hielt ihn für den Unbekannten „L 128“, über den man bereits eine Akte führte. Die Zuordnung nahm man vor, da es sich bei den Individuen sowohl der Personalakte „L 128“ als auch der Personalakte K. übereinstimmend um Männer handelte, die als Grenzbewohner in Echternach angesiedelt waren. Zusätzlich wiesen sie die Gemeinsamkeit auf, eine dritte Person zu kennen, welche die Gestapo Trier wiederum für Agent „L 125“ hielt. Dieser einzige Zeuge war jedoch bereits verstorben, so dass weitere Ermittlungen in Echternach und speziell in dessen familiärem Umfeld eine endgültige Klärung bringen sollten. Die Ermittlungen hatten vertraulich zu geschehen und erst nach Erledigung mit entsprechend belastendem Ausgang sollte es zur Festnahme des K. kommen. Die Ermittlungen vor Ort sollten von einem „hiesigen“ Sachbearbeiter durchgeführt werden, also einem in Echternach tätigen Beamten. Dies geschah auch, blieb jedoch genauso ergebnislos wie die zusätzlichen Ermittlungen durch dessen „zuverlässige Gewährsleute“. Gendarmeriemeister Krause und Gendarmeriehauptwachtmeister Heinrich ermittelten gegen K., unternahmen gemeinsame Wirtshausbesuche und führten persönliche Gespräche. Beide Gewährsleute sollten K. in Echternach weiter überwachen. Nach drei ergebnislosen Monaten findet sich im Bericht zur Wiedervorlage des Falles der Hinweis, dass sich die Kontaktaufnahme mit den Gewährsleuten schwierig gestaltete. Eine offensichtliche Verbindung musste vermieden werden, so dass die Überwachung zu keinen weiteren Erkenntnissen führte. Als einzig verbleibende Möglichkeit, K. der Akte „L 128“ zuzuordnen, wurde letztendlich die Ergreifung des flüchtigen Archens gesehen, der man durch die erfolgte Besetzung Frankreichs wohl zuversichtlich entgegen sah.54 53 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 155. 54 Ebd.
215
216
|
Justus Jochmann
Eine noch weitreichendere Zusammenarbeit bei den Ermittlungstätigkeiten als die mit EKL und Gestapo Saarbrücken wird am Fall des „L 93“, einem weiteren unbekannten Zubringer des Polux, deutlich. Aus dieser Akte geht unter anderem die Beteiligung des Oberreichsanwalts beim Volksgerichtshof hervor, der direkten Einfluss auf die Ermittlungen nehmen konnte. Im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren gegen Arthur T. beauftragte die Oberreichsanwaltschaft die Gestapo Saarbrücken, gegen T. weitere Ermittlungen anzustellen. Die Grenzinspektion III (West) verfügte kurz darauf, im Fall T. über die Ermittlungsergebnisse informiert zu werden, da ihr die Aufgabe zukam, im Falle, dass mehrere Stapostellen in einen Fall involviert waren, koordinierend tätig zu werden.55 Die Wiesbadener Abwehrstelle des Wehrkreises XII stellte eine Verbindung des T. zum Fall „Polux“ her und teilte dies der Saarbrücker Gestapo mit. Den sich hieraus verdichtenden Verdacht einer „landesverräterischen Betätigung“ meldeten die Saarbrücker schließlich wie gefordert nach Koblenz an den Grenzinspekteur III (West) und gaben gleichzeitig die Vorgänge zu weiteren Ermittlungen an die Staatspolizeistelle Trier ab, da diese für das „Material Polux“ federführend war. Um eine Verbindung zwischen „L 93“ und Arthur T. herzustellen, schaltete man von Trier aus neben der Reichsanwaltschaft, den Abwehrstellen und Grenzinspektionen nun auch das EKL und die Abwehrnebenstelle in Luxemburg ein, die über Originalmaterial des Polux verfügte. Hierin ergaben sich tatsächlich Hinweise auf eine Agententätigkeit des T. im Dienste des Polux. Von einer Vernehmung des T. wurde aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst abgesehen, um die Vorbereitung anderer Festnahmen nicht zu gefährden. Obwohl die Identität des „L 93“ nicht eindeutig bestimmt werden konnte, so legte man trotzdem Karteikarten an, die auf die mutmaßliche Identität verwiesen, oder ergänzte − wie in diesem Fall − die bereits bestehenden Karteikarten entsprechend.56 Auch innerhalb des deutschen Zolls wurden potentielle Polux-Agenten verfolgt. Die Personalakte „Unbekannter deutscher Zollbeamter“ wurde dem Kriminalsekre55 Da die sachliche Weisung von der Abteilung III des Gestapa, später dann Abteilung IV E des RSHA, also den abwehrpolizeilichen Referaten der Gestapo ausging, blieben einer eigenen Führungsorganisation der Grenzpolizei allein Koordinierungsaufgaben sowie die Inspektion der Grenzpolizei als Aufgabenbereiche. Tatsächlich gab es eine solche in Form von Grenzinspekteuren. Der Grenzinspekteur für den Trierer Bereich saß in Koblenz in der Grenzinspektion West. Diese war für die Grenzen zu Luxemburg, Belgien, Frankreich, die Niederlande, die Schweiz und Dänemark, inklusive der Seehäfen, verantwortlich. Der Grenzinspekteur sollte die grenzpolizeiliche Arbeit kontrollieren und im Falle, dass ein Vorgang mehrere Stapostellen gleichzeitig betraf, koordinieren. Die Grenzinspekteure waren jedoch Angehörige der Abteilung III des Gestapa ; vgl. Hans Buchheim : Die Grenzpolizei der Geheimen Staatspolizei, in : Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, Band II, Stuttgart 1966, S. 157–167, hier S. 162 f. 56 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 154.
Abwehr
|
tär Friedrich Schmidt57 vom Unterkommando Esch zugesandt. Indizien aus dem „Material Polux“ ließen darauf schließen, dass er zu dieser Akte Erkenntnisse beitragen könnte. So machte man in Nennig, dem Wohnort des Kriminalsekretärs,58 einen Mann aus, dessen Familie in Geschäftsbeziehungen mit dem Weinhändler D. aus Remich stehen sollte, welcher wiederum in direktem Kontakt mit Archen stand. Alles deutete auf die Enttarnung des Agenten innerhalb des deutschen Zolls hin. Sowohl das Hauptzollamt als auch die Stapostellen Saarbrücken und Köln trugen mit Hinweisen zum Erhärten des Verdachts bei. Abschließen ließ sich der Vorgang jedoch nicht. Er wurde im Oktober 1942 auf lange Sicht zurückgestellt. Einer Vernehmung des V. aus Nennig stand dessen Dienst bei der Wehrmacht59 im Weg, so dass der Fall erst wieder mit dessen Entlassung aus dem Militärdienst aufgenommen werden sollte.60 Konnte die militärische Abwehr in diesem Fall nicht zum Abschluss der Ermittlung der Trierer Gestapo beitragen, so scheint die allgemeine Zusammenarbeit der lokalen Abwehrinstitutionen dennoch effektiv gewesen zu sein. Die Unterstützung zwischen der Trierer Spionageabwehr der Gestapo und der Trierer Abwehrnebenstelle III F61 erfolgte dabei wechselseitig. So wurde etwa die Abwehrpolizei im Auftrag der militärischen Abwehr in den Ermittlungen gegen den Gastwirt 57 Kriminalsekretär Friedrich Schmidt (Jg. 1902), gelernter Schlosser aus Göttingen, kam nach einer zwölfjährigen Dienstzeit bei der Schutzpolizei im Jahr 1936 zur Gestapo nach Trier. Nach der Besetzung Luxemburgs im Mai 1940 wechselte er zur neu geschaffenen Dienststelle der Geheimpolizei im Großherzogtum. Er war sowohl in Luxemburg-Stadt (Villa Pauly) als auch in der Außenstelle in Esch-sur-Alzette tätig. Ferner gehörte er zum Vernehmungskommando im SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Seine Hauptaufgabe bestand in der Bekämpfung des luxemburgischen Widerstands. Er war SS-Oberscharführer ; vgl. Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxem burg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015, bes. S. 38–42 und 120–124. 58 BArch Berlin, BDC, NSDAP-Gaukartei, Karteikarte des Friedrich Schmidt (Mitgliedsnummer 2848756). 59 Die Befugnisse der Gestapo zur Untersuchung der Spionage endeten bei Wehrmachtsangehörigen. Diese hatten sich wegen aller Straftaten vor den Gerichten der Wehrmacht zu verantworten ; vgl. Schreiben des Dr. Best vom 28. November 1939 an alle Staatspolizeistellen, in : BArch Berlin, R 58/243, Bl. 218. Schon in Friedenszeiten waren die Befugnisse der Gestapo gegenüber Wehrmachtsangehörigen stark reglementiert und sahen eher im Ausnahmefall eine Ermittlungstätigkeit der Politischen Polizei vor ; vgl. Schreiben des Dr. Best vom 10. Mai 1935, in : ebd., Bl. 29 ff. 60 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 151. 61 Die Abwehrnebenstelle des Wehrkreises XII (Wiesbaden) in Trier wurde im März 1936 eingerichtet. Die in der Abteilung III F geführte Nebenstelle bestand aus einem Offizier, einem Angestellten und einer Schreibkraft. Trotz dieser reduzierten Personalausstattung war dieser Posten äußerst aktiv und leistete von hieraus mittels Agenten und V-Leuten seinen Teil zur Aufklärung in Frankreich ; vgl. Melchers : Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914/Mai 1940, S. 179.
217
218
|
Justus Jochmann
H. aus Luxemburg tätig. Abwehr-Offizier Oscar Reile62 erlangte mittels seines V-Mann-Netzwerkes die Verdachtsmomente einer Spionagetätigkeit des H. Die Abwehrpolizei sollte Ermittlungen aufnehmen, besonders in dem Fall, dass der Luxemburger nach Deutschland einreisen würde. Daraufhin legte man bei der Abwehrpolizei eine Karteikarte über H. an und setzte ihn auf die „tägliche Fahndungsliste“ mit spezieller Berücksichtigung einer Einreise.63 Auch die Personalakte „Ernest W.“ bietet Einblick in die Zusammenarbeit von Abwehrpolizei und militärischer Abwehr. Der V-Mann „E 919“ der Nebenstelle Trier der Abwehrstelle im Wehrkreis XII berichtete im Mai 1940, dass der Hotelbesitzer Michel Peter W., der Vater von Ernest, ein französischer Agent sei. Auch ein Gewährsmann brachte entsprechende Vorwürfe gegen beide vor. Die Abwehrnebenstelle Trier III F berichtete der Abteilung III der Gestapo Trier von diesen Erkenntnissen und erbat aus Trier weitere Veranlassungen zur Klärung des Sachverhaltes. Noch im Mai wurde die Abwehrnebenstelle Trier exekutiv tätig und verhaftete Vater und Sohn. Sie übergab beide dem Vernehmungskommando Wittlich64, wo Ernest wohl geständig war, im Dienst des Französischen Nachrichtendienstes (FND) zu stehen. Die Vorwürfe der Spionage im Dienste Frankreichs betrafen Vater und Sohn. Ernest wurde als „Haupttäter“ geführt, sein Vater als „Teilnehmer“. Kriminaloberassistent Hedderich, der als Sachbearbeiter in dieser Ermittlung zum Verdacht des Landesverrats fungierte, wurde aus Trier zu Vernehmungen des Vaters nach Wittlich beordert. Während der Vater am 25. Juni 1940 aus der Schutzhaft65 62 Oskar Reile war von August 1936 bis Mai 1940 bei der Abwehrnebenstelle Trier beschäftigt und war dort für das Enttarnen französischer Agenten und Spionagetätigkeit zuständig. Er führte ein größeres Netzwerk von V-Leuten, welche von Luxemburg und Belgien aus operierten und alle Französisch sprachen ; vgl. Reile : Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg. Westfront, S. 52. Zu seiner Tätigkeit in Trier vgl. ebd., S. 25–57 ; Personalakte des Oskar Reile aus dem Personalamt der Heeresleitung im Reichswehrministerium, in : NARA, Record Group 263, Vol. 2, RC Box 107, Location 230/86/24/02 : Reihle [sic !], Oskar ; http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/1705143/REIHLE,%20OSKAR_0001.pdf (Letzter Zugriff : 10.8.2017). 63 Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (CDRR) Luxemburg, Akte 716. 64 Das Vernehmungskommando Wittlich hatte die spezielle Aufgabe, Spionageverdachtsfällen aus Luxemburg nachzugehen. Nachdem das Vernehmungskommando aufgelöst wurde, kehrten deren Mitglieder zurück auf ihre jeweiligen Stellen im EK Luxemburg und der Staatspolizeistelle Trier. Neben den Vernehmungen in Wittlich kam es auch zu einer größeren Aktion des Kommandos : Das Vernehmungskommando Wittlich ließ bei seiner Ankunft in Luxemburg am 17. August 1940 etwa 150 Personen festnehmen, die Funktionäre der lokalen Polizei, des Zolls oder der Wache der Großherzogin waren. Ziel dieser Operation war es, Agenten zu enttarnen und zu fassen, die im Auftrag anderer Länder in Luxemburg tätig waren. Von den Verhafteten blieben vier in Haft und wurden den Gerichten zugeführt. Bei den Gerichtsverhandlungen in Berlin sollten aus Trier Beamte als Zeugen auftreten ; vgl. SHD Vincennes, Best. P, Nr. 828542. 65 Michel W. war schon einmal am 12. Juni 1940 aus Mangel an Beweisen aus dem Gefängnis in
Abwehr
|
in Wittlich entlassen und durch die Geheime Feldpolizei66 mittels Sammeltransport nach Luxemburg gebracht wurde, führten Beamte der Ortspolizei Wittlich den Sohn am 12. Juli 1940 dem Untersuchungsgefängnis in Berlin-Moabit zu. Der Oberstaatsanwalt in Trier hatte bereits am 12. Juni 1940 das gegen Ernest W. eingeleitete Ermittlungsverfahren an den Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof in Berlin abgegeben.67 Der Beschuldigte wurde noch im Juli 1940 vom Oberreichskriegsanwalt angeklagt. In der Strafsache Ernest W. trat der Reichskriegsgerichtsoberinspektor mit der Forderung an die Abwehrpolizei Triers heran, die Ermittlungen weiter fortzuführen. Diese wiederum delegierte die Vernehmung zweier Zollbeamter an das EK Luxemburg und bat auch das Hauptzollamt Luxemburg um die Ermittlung und möglichen Vernehmungen verdächtigter, in Luxemburg und Belgien tätiger Zollbeamter. Da aus Berlin mehrfach angemahnt wurde, die Vernehmungsergebnisse zu liefern, forderte man aus Trier sogar Amtshilfe in Bordeaux bei der dortigen Außenstelle des EK an, wo ein ehemaliger Trierer Zollbeamter jetzt beschäftigt war. Im Mai 1941 erreichte die Abwehrpolizei Trier aus Berlin die Nachricht, dass das Verfahren gegen Ernest W. eingestellt und dieser frei gelassen worden sei, da er die französische Staatsbürgerschaft besitze und der Ort seiner Agententätigkeit im Ausland lag. Nichtsdestotrotz hielt die Gestapo Trier dessen Überwachung weiter aufrecht und beauftragte das EK Luxemburg mit selbiger. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde 1941 aus dem allgemeinen Spionagefall Ernest W. ein „Polux-Fall“. Ernest war ebenso wie sein Vater Michel im „Material Polux“ aufgetaucht.68
Wittlich entlassen worden. Da die Abteilung III ihn aber weiter für verdächtig hielt, beantragte man beim Oberstaatsanwalt in Trier eine weitere Untersuchungshaft, welche jedoch nicht gewährt wurde. Daraufhin hatte man Michel W. am 12. Juni 1940 in Schutzhaft genommen ; vgl. SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 333. 66 Die GFP war hier zuständig, da Luxemburg noch bis zum 21. Juli 1940 unter deutscher Militärverwaltung stand. Die GFP diente ab Beginn des Zweiten Weltkrieges als Pendant der Gestapo innerhalb der unter Militärverwaltung stehenden besetzten Gebiete, arbeitete jedoch mit der Gestapo zusammen und rekrutierte auch einen Teil ihres Personalbedarfs aus der Gestapo. Erst mit dem Status der Zivilverwaltung übernahm das Einsatzkommando Luxemburg dort die staatspolizeilichen Aufgaben ; vgl. Peter Lutz Kalmbach : Polizeiliche Ermittlungsorgane der Wehrmachtjustiz, in : Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für kriminalistische Wissenschaft und Praxis 67 (2013), H. 2, S. 118–122, hier S. 118 f.; Paul Dostert : Luxemburg unter deutscher Besatzung 1940–1945. Ein Volk zwischen Kollaboration und Widerstand, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das Großherzogtum Luxemburg unter deutscher Besatzung. Fachtagung 10. Mai 2012 (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 10), Mainz 2013, S. 6–21, hier S. 6 f. 67 SHD Vincennes, Best. 40VD, Nr. 333. 68 Ebd.
219
220
|
Justus Jochmann
Die Personalakten mit Polux-Bezug zeigen, dass deren Bearbeitung bzw. die Einleitung dieser Ermittlungen durch die Abteilung III bzw. IV E der Stapostelle Trier meist auf Grundlage des „Materials Polux“ geschah, welches im Original durch die militärische Abwehr in Wiesbaden verwahrt und bearbeitet wurde. Neben den Hinweisen zu anonymen Agenten konnten auch Verbindungen zu bereits durch die Gestapo erfassten Personen hergestellt werden. Deren Personalakten wurden dann im Kontext der Polux-Ermittlungen weiter bearbeitet. Da der Polux in Luxemburg tätig war, nahm das EK Luxemburg eine entsprechend zentrale Rolle bei den Ermittlungen ein. Zusätzlich wurden, um das gesamte nachrichtendienstliche Netzwerk der Polux erfassen zu können, weitere Einsatzkommandos in Brüssel und Paris in die Ermittlungen eingebunden. Diese leisteten dann die geforderte Unterstützung. Reichsweit bemühte die Abwehrpolizei Trier Verfolgungsinstanzen, um Gesuchten habhaft zu werden und Haftbefehle zu vollstrecken. Neben Landräten und Bürgermeistern waren mit Rathke und Preuss auch ehemalige Mitarbeiter der Gestapo Trier aus Saarbrücken und Brüssel erneut Teil der Verfolgungsbemühungen. Die Abwehrnebenstellen in Trier und Luxemburg wie auch der SD sorgten mit eigenen Ermittlungsergebnissen dafür, dass die Abwehrpolizei in Trier tätig wurde oder unterstützten deren bereits laufende Ermittlungen. Der Volksgerichtshof bzw. der Oberreichsanwalt konnten Ermittlungen anregen und auf diese Einfluss nehmen. War es der Gestapo Trier möglich, gegen ihren grenzpolizeilichen Zuarbeiter, die Zollbehörde, ungehindert im Spionageverdachtsfall zu ermitteln, endete die Kooperationsbereitschaft bei Anliegen solcherart innerhalb des abwehrpolizeilichen Zuarbeiters, der militärischen Abwehr. Die Gestapo Trier hatte keine Kompetenzen, in Kriegszeiten gegen Wehrmachtsangehörige zu ermitteln. Eine Bereitschaft, auch über die festgelegten Vereinbarungen der Zusammenarbeit hinaus, die abwehrpolizeilichen Ermittlungen zu unterstützen, lag unter diesen Voraussetzungen nicht vor. Hier mussten entsprechende „Polux-Fälle“ enden. Insgesamt brachen die meisten der hier betrachteten Ermittlungen in „Polux-Fällen“ ohne Ergebnis ab und wurden mit dem Verweis auf Wiedervorlage nach Kriegsende zu den Akten gelegt. Geht aus den Fallbeispielen bereits eine umfangreiche Zusammenarbeit der Abwehrpolizei mit verschiedensten Institutionen hervor, war diese laut der Vernehmung des Hans Ernzerhoff sogar personell institutionalisiert. Ernzerhoff, der von 1941 bis 1944 selbst in der Abteilung II der Staatspolizeistelle Trier gearbeitet hatte,69 wurde in Idar-Oberstein durch französische Ermittler im September 1945 verhört und gab an, dass es innerhalb der Abteilung I (Verwaltung) der Stapostelle Trier ein spezielles Referat zur Verbindung mit dem SD gab. Auch für die Ver69 Akte Ernzerhoff, in : SHD Vincennes, GR28 P7, 56.
Abwehr
|
bindung zwischen Gestapo und Wehrmacht gab es zumindest für den Zeitraum von Dezember 1944 bis März 1945 eine spezielle Verbindungseinrichtung. Albert Schmidt wird im Interrogation Report No. 28 vom 8. August 1945 für diesen Zeitraum als Verbindungsoffizier genannt.70 Auch der in der Abteilung II der Trierer Stapo tätige Kriminalangestellte Josef Stempel soll für die Verbindung zur Abwehr zuständig gewesen sein.71 Wie die Tätigkeit dieser Verbindungseinrichtungen genau aussah, lässt sich bisher aus den Korrespondenzen, die sich in den Personalakten befinden, nicht rekonstruieren.
Fazit
Mit dem Anschluss der Saarregion an das Deutsche Reich verlagerte sich das Wirken des französischen Nachrichtendienstes vor allem nach Luxemburg. Folglich legten die Gestapo Trier und ihre Abteilung III bzw. später IV E den Fokus ihrer abwehr- und grenzpolizeilichen Tätigkeit auch dorthin. Arbeitete die Gestapo Trier bereits seit ihrer Einrichtung bei Ermittlungen mit Stapostellen des Reiches zusammen, kam im lokalen Umfeld noch die 1935 neu gegründete Stapostelle Saarbrücken dazu. Mit dieser verband Trier seit deren Gründung auch die Ermittlungsarbeit gegen den französischen Geheimdienst und dessen Agenten im deutsch-französischen und deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet. Die Stapo Saarbrücken übernahm in ihren Personalstamm ehemalige Angestellte aus Trier, welche im Zuge der Ermittlungen so mit ihren ehemaligen Kollegen wieder zusammenkamen. Dies galt auch für das Einsatzkommando Luxemburg. Einige ehemalige Mitglieder der Trierer Abteilung III unterstützten im Dienste des EKL die Abwehrtätigkeit und insbesondere die auf den Polux gerichtete Verfolgungstätigkeit aus Trier. Neben den ehemaligen Mitarbeitern, die von Saarbrücken und Luxemburg aus mit der Abteilung III kooperierten, traf dies auch auf den ehemaligen Mitarbeiter Kriminalkommissar Rathke zu. Im Dienste des EK Brüssel stehend, unterstützte er tatkräftig die Abteilung III bei der Identifizierung eines mutmaßlichen Agenten. Trotz Ausscheidens aus dem Dienst der Trierer Abteilung III konnten ehemalige Mitarbeiter somit weiter Teil des Verfolgungsnetzwerkes der Trierer Abwehrpolizei bleiben. Aus den exemplarisch betrachteten „Polux-Fällen“ konnte die Arbeitsweise der Trierer Abwehrpolizei verdeutlicht werden. Aus Trier und den zugehörigen Ne70 NARA, M 1270, Roll 0031 : Interrogation Section 8. August 1945, Report 28, Bl. 33. 71 SHD Vincennes, GR28 P7, Nr. 56.
221
222
|
Justus Jochmann
benstellen heraus wurden verschiedenste Institutionen des NS-Staates in die Verfolgung involviert. Diesen erteilte die Abteilung III Aufträge, exekutiv tätig zu werden, oder instrumentalisierte sie zur Informationsgewinnung. Ermittlungen gingen oftmals von den der Gestapo zuarbeitenden Institutionen aus, und wurden durch SD, militärische Abwehr, EK Luxemburg oder verschiedene Ämter72 angeregt. Das Ausmaß der Zusammenarbeit erscheint anhand der Korrespondenzen als sehr groß. Die Vielzahl an Kooperationsinstitutionen bedeutete gleichzeitig auch, dass das Instrument der Denunziation gewichtiger wurde. Die verschiedenen Institutionen boten potentiellen Denunzianten umso mehr Anlaufstellen abseits der Staatspolizeistellen und wiesen darüber hinaus deren Beamten an, ihre Informationen weiterzugeben und somit auch den Beginn von Ermittlungen zu bewirken, die dann wiederum der Gestapo zukamen. Trotzdem konnte die Abteilung III dem omnipotenten Bild auch unter diesen Voraussetzungen nicht gerecht werden.73 Zum recht kleinen Personenkreis der offiziell zum Verfolgungs- und Unterdrückungsapparat der Gestapo gehörenden Angestellten addierte sich eine schwer überschaubare Zahl an Funktionsträgern des Regimes und der Verwaltung74, die als kleine Rädchen das Wirken der Verfolgungsmaschinerie der Staatspolizei garantierten. Das Verfolgungsnetz der Abteilung III gewinnt mit Blick auf die Zuarbeiter aus verschiedenen Institutionen und aufrecht erhaltenen Verbindungen zu ehemaligen Mitarbeitern an Größe. Ein einfaches Betrachten der geschäftsmäßigen Anzahl von Mitarbeitern und V-Leuten wird dem tatsächlichen Verfolgungs72 Herbert Wagner : Die Gestapo war nicht allein…Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945, Münster 2004, S. 208–263. 73 Dieser Mythos wurde bereits in der Zeit des Nationalsozialismus gepflegt und hatte zeitgenössisch seinen Sinn. Er sollte der Gestapo eine Aura kriminalistischer Effizienz verleihen. Der Mythos der Gestapo-Allmacht blendete jedoch die Ursachen der staatspolizeilichen Erfolge aus. Das Bild der mächtigen Gestapo ist in der Hinsicht stimmig, dass sie juristisch und administrativ mit Sonderrechten ausgestattet war, so wie keine Polizei in der deutschen Geschichte jemals zuvor. Omnipotent und allgegenwärtig konnte die Politische Polizei des NS-Regimes wohl schon aufgrund ihrer quantitativen personellen Ausstattung nicht sein. Nichtsdestotrotz hielt sich dieses von Heydrich produzierte Bild auch nach Kriegsende in der Literatur, Edward Crankshaw (Gestapo. Instrument of tyranny, London 1956) oder Gerhard Schulz (Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates (Die nationalsozialistische Machtergreifung, Bd. II), Frankfurt a.M. 1974) sind hier exemplarisch als unkritische Rezipienten zu nennen, ebenso Jacques Delarue. Schon in der Einleitung kommt Delarue zu der Einschätzung : „Dabei war die Gestapo der Mittel- und Hauptpfeiler des nationalsozialistischen Staates […]. Noch nie, in keinem Land und zu keiner Zeit, hatte eine Organisation diese allumfassende und alles durchdringende Vollständigkeit erlangt, eine solche Macht besessen und an Wirksamkeit wie in der Erregung von Furcht und Grauen eine solche ‚Vollkommenheit‘ erreicht.“ Jacques Delarue : Geschichte der Gestapo, Düsseldorf 1964, S. 9. 74 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Oktober und November 1934, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Bd.1 : 1934, S. 622.
Abwehr
|
apparat der Trierer Abwehr- und Grenzpolizei nicht gerecht, erfasst diesen und seine Grundlage der Effektivität nicht. Die Aufgabenlast der Gestapo im abwehrpolizeilichen Bereich konnte wohl auch durch diese Unterstützung verschiedener Institutionen und Akteure gestemmt werden, die die tägliche Arbeit an behördlicher Effektivität und Effizienz erhöhte.
223
Hannes Brogmus
Vom Nachbarn zum Verfolgten Die Diskriminierung und Verfolgung der jüdischen Bürger Triers zwischen 1933 und 1938
Hilde Deutsch, geb. Monz, lebte seit ihrer Geburt im Jahr 1926 in der Neustraße 3 in Trier. Die Eigentümer des Hauses waren ihre Nachbarn, die jüdischen Möbelhändler Gustav und Emma Blum sowie deren Kinder Werner und Grete. Hilde pflegte freundschaftliche Kontakte zu den älteren Kindern, die Blums selber waren für sie wie ihre Großeltern. Die Erinnerungen, die Hilde Deutsch am 7. September 2011 verfasste, bilden einen wertvollen Zeitzeugenbericht über die Reichspogromnacht vom 10. November 1938 in Trier, deren detaillierte Rekonstruktion mangels ähnlicher Quellen nur schwer nachzuvollziehen ist.1 Gleichzeitig liefert Deutsch ein Beispiel für ein herzlich nachbarschaftliches Verhältnis zwischen Nichtjuden und Juden in Trier. Dieses Verhältnis sollte, allen Widrigkeiten zum Trotz, auch für die Zeit des Nationalsozialismus zwischen den beiden Familien bestehen bleiben.2
Das jüdische Leben in Trier
Wie in allen deutschen Städten bildeten die Juden auch in Trier eine Minderheit. Sie machten im Jahr 1933 mit 796 Personen lediglich 1,0 % der gesamten Stadtbevölkerung aus. Mit 89,5 % war der Großteil der Trierer Bürger katholischer Konfession. Die größte Minderheit waren mit 9,1 % die evangelischen Christen, 0,4 % der Bürger gehörten einer anderen Religion an oder waren konfessionslos.3 Trotz ihrer relativ geringen Anzahl gehörten die Trierer Juden auch aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeiten zum alltäglichen Stadtbild. So waren viele der von jüdischen Be1 Herbert Sartoris : Verfolgung der Juden, in : Thomas Zuche (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 44–53, hier S. 48. 2 Deutsch, Hilde : Erinnerung an meine Kinder- und Jugendjahre. Wiesbaden 2012, S. (5) 1 ff. (Stadtarchiv Trier, Sam 183/3). 3 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 451 : Volkszählung, Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1933, Heft 3 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit, Berlin 1936, S. 55. Prozentangaben auf Grundlage eigener Berechnungen.
226
|
Hannes Brogmus
sitzern geführten Geschäfte in allen wichtigen Straßen der Trierer Innenstadt vertreten. Dabei gab es für nahezu jede Ware des täglichen Bedarfs auch ein jüdisches Geschäft.4 Dennoch lässt sich das Zusammenleben von Juden und Christen im Trier der Weimarer Republik keineswegs auf den Handels- und Geschäftsbereich reduzieren. Das überkonfessionelle Vereinsleben oder der Besuch von jüdischen Kindern in christlichen Kindergärten sorgten für Berührungspunkte unter den Stadtbewohnern. Da viele jüdische Kinder bereits nach der vierten Klasse von ihren jüdischen Schulen auf die weiterführenden städtischen Schulen, das Auguste-Viktoria-Gymnasium oder das Hindenburg-Gymnasium, wechselten, war auch der Trierer Schulalltag von einem konfessionellen Miteinander geprägt.5 Eine jüdische Emanzipation ist für Trier in der Weimarer Republik in weitem Umfang zur Realität geworden. Es bestanden gute Verhältnisse zwischen Juden und Nichtjuden, was sich beispielsweise im gegenseitigen Respektieren der jeweiligen religiösen Feiertage widerspiegelte.6 Der Trierer Jude Jacques Jacobs berichtet von einer zur Wirklichkeit gewordenen Gleichstellung zwischen Christen und Juden ab dem Beginn der Weimarer Republik.7 Nach Willi Körtels wurde Trier in der Zeit vor 1933 sogar von den jüdischen Bürgern geliebt.8 Und nicht zuletzt der Bericht von Hilde Deutsch, die auch mit weiteren jüdischen Kindern aus der Nachbarschaft befreundet war, bezeugt ein durchaus gutes Verhältnis zwischen Nichtjuden und Juden.9 Entgegen dieser stark emanzipatorischen Elemente konnte das konfessionelle Miteinander allerdings auch von negativen Erscheinungen begleitet sein. „Bei aller nachbarschaftlichen Nähe gab es mehr oder minder starke Gefühle von Fremdheit 4 Besonders viele jüdische Geschäfte waren innerhalb des Stadtkerns in der Brotstraße, der Simeonstraße, der Fleischstraße und der Neustraße sowie außerhalb des Stadtkerns insbesondere in der Saarstraße. Eine Auflistung der jüdischen Gewerbebetriebe aus dem Jahr 1938 zeigt für das Ende des Untersuchungszeitraumes die große Anzahl der jüdischen Geschäfte in Trier. Vgl. Jutta Albrecht : Die „Arisierung“ der jüdischen Gewerbebetriebe in Trier im NS-Regime, Staatsexamensarbeit Trier 2008, S. 116. 5 Willi Körtels : Die jüdische Schule in der Region Trier, Konz 2011, www.mahnmal-trier.de/juedschul.pdf (Letzter Zugriff : 13.7.2017), S. 213. Da ein Großteil der jüdischen Schüler eine weiterführende Schule besuchte, Körtels gibt ca. 90 % an, muss die Bildungsorientierung der Trierer Juden im Verhältnis zur übrigen Gesellschaft, hier nach Körtels etwa ein Drittel, sehr hoch gewesen sein. 6 Edgar Christoffel : Der Weg durch die Nacht. Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der Zeit des Nationalsozialismus. Verfolgte aus Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager und Zuchthäuser des „Dritten Reiches“, Trier 1983, S. 105. 7 Jacques Jacobs : Existenz und Untergang der alten Judengemeinde Triers, Trier 1984, S. 79 f. Seit 1919 waren auch zwei jüdische Beamte in Trier im Dienst. 8 Willi Körtels : Elise Haas. Eine Lyrikerin aus Trier, Konz 2011, S. 117. 9 Deutsch : Erinnerung, S. (6) 2.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
und Distanz“, beschreiben Burkard und Thill die Situation zwischen Christen und Juden in Boppard am Rhein in der Zeit der Weimarer Republik.10 Ein Phänomen, welches sich auch problemlos auf Trier beziehen lässt. So kolportiert Marianne Bühler ein Fortbestehen alter Stereotype im gesamten Bistum Trier. Demnach sind bestimmte Jahrhunderte alte Vorurteile über die gesamte Zeit der Weimarer Republik und bis in die NS-Zeit konserviert worden. Insbesondere der Vorwurf des „jüdischen Wuchers“ erhielt sich auch in Trier.11 Da allerdings bis zum Jahr 1931 keine größeren antisemitischen Aktionen belegt sind, schienen diese Vorurteile noch keine drastischen Folgen für die Trierer Juden gehabt zu haben. So fällt ein Überfall auf eine jüdische Jugendwandergruppe im April 1931, als erste öffentlich antisemitische Aktivität, erst in die Endphase der Weimarer Republik.12 Somit bleibt zu konstatieren, dass die Juden für nahezu die gesamte Zeit der Weimarer Republik unter Akzeptanz am gesellschaftlichen Leben in Trier partizipieren konnten. Dies galt für die Annehmlichkeit des städtischen Lebens ebenso wie für die zahlreichen Probleme, mit denen sich die Trierer in einer gesellschaftlich und politisch angespannten Zeit konfrontiert sahen.13
Die Stadt Trier in der Zeit des politischen Umbruchs
Die Trierer Bürger lebten in der Weimarer Republik, nach einem kurzen US-amerikanischen Intermezzo in der unmittelbaren Nachkriegszeit, von 1919 bis 1930 unter französischer Besatzung. Die französischen Soldaten, unter ihnen auch viele nordafrikanische Kolonialtruppen, waren mehr als zehn Jahre lang ein fester Bestandteil des Trierer Stadtbildes. Das Zusammenleben von Besatzern und Besetzten erzeugte nach kurzer, weitestgehend friedlicher Zeit einige Spannungen.14 10 Karl-Josef Burkhard/Hildburg-Helene Thill : Unter Juden. Achthundert Jahre Juden in Boppard, Boppard 1996, S. 73. 11 Marianne Bühler : Katholiken und Juden vor, während und nach der Katastrophe, in : Bernhard Schneider/Martin Persch (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier. Beharrung und Erneuerung 1881– 1981, Bd. 5, Trier 2004, S. 506–524, hier S. 516. 12 Körtels : Die jüdische Schule, S. 217. Im Umland von Trier ist es hingegen bereits früher zu öffentlichem Antisemitismus gekommen. So sind zwischen 1929 und 1932 drei Schändungen von jüdischen Friedhöfen begangen worden. 13 Richard Laufner : Unter dem Schicksal der Verfolgung und Vertreibung, in : Walter Queck : Presse und Informationsamt der Stadt Trier : Dr. Adolf Altmann zum Gedenken, Trier 1979, S. 13–22, hier S. 18. 14 Wurde den französischen Truppen zu Unrecht die Schuld an der Wohnungsnot zugeschrieben, stellte die teils harte Gerichtsbarkeit der Besatzer ein tatsächlich auf sie zurückzuführendes Konfliktpotential dar. So zwangen die französischen Gerichte der einheimischen Bevölkerung bei kleins-
227
228
|
Hannes Brogmus
Zusätzlich zu dieser speziellen politischen Konstellation war Trier, abgesehen von einer kurzen Stabilitätsphase zur Mitte der 1920er Jahre, die gesamte Zeit der Weimarer Republik und auch darüber hinaus äußerst wirtschaftsschwach. Erst ab 1936 gingen die hohen Arbeitslosenzahlen allmählich zurück.15 Nicht zuletzt auch damit zusammenhängend wurde Trier häufig von politischen Unruhen erschüttert, so kam es immer wieder zu teils heftigen Auseinandersetzungen verschiedener politischer Gruppen. Waren es in den ersten Jahren noch Separatisten und Reichstreue, die den Kampf auf Triers Straßen austrugen,16 bekämpften sich gegen Ende der Weimarer Republik Nationalsozialisten mit Kommunisten und anderen politischen Gruppierungen.17 Dabei sind teils bürgerkriegsähnliche Zustände entstanden. Dies jedoch nicht aufgrund einer umgreifenden politischen Mobilisierung der Bevölkerung, sondern vielmehr durch politisch aktive Minderheiten des linken und rechten Flügels. Eine mehrheitliche Ablehnung der Republik kann den Trierer Bürgern nicht zugeschrieben werden. So stimmten sie bei der letzten noch freien Reichstagswahl vom 6. November 1932, wie schon in den Jahren zuvor, mehrheitlich für die demokratischen Parteien. Die NSDAP lag mit 20 % der Stimmen weit unter ihrem Reichsdurchschnitt (31,1 %), ihr gegenüber stand in Trier die Zentrumspartei mit 48,1 % als stärkste Kraft. Und selbst bei der letzten Reichstagswahl vom 5. März 1933, welche schon unter starker Einflussnahme der Nationalsozialisten erfolgte, lag die NSDAP mit 31,9 % (Reichsdurchschnitt 43,9 %) klar hinter der Zentrums partei mit 43,5 % der Stimmen.18 Trotz dieser hohen Zustimmung zum Zentrum kann die Stadt Trier aber nicht als „Bollwerk“ gegen den Nationalsozialismus bezeichnet werden. Die größtenteils katholische Stadtbevölkerung fühlte sich naturgemäß am besten durch den politischen Katholizismus vertreten, was allerdings tatsächliche politische Belange der Wähler nicht verschleiern konnte. Schließlich musste die durch eine gewisse ten Vergehen, wie z.B. dem Nichtgrüßen eines Offiziers, empfindliche Geldstrafen auf ; vgl. Emil Zenz : Die Stadt Trier im 20. Jahrhundert, Bd. 1 : 1900–1950, Trier 1981, S. 153 f. 15 Rudolf Müller : Trier in der Weimarer Republik (1918–1933), in : Kurt Düwell/Franz Irsigler (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 495–516, hier S. 512. 16 Im Jahr 1923 kam es zu heftigen Unruhen, da separatistische Gruppen die Loslösung Triers bzw. des gesamten Rheinlandes vom Reich erzwingen wollten ; vgl. Müller : Weimarer Republik, S. 504. 17 Insbesondere die kommunistischen „Rotfrontkämpfer“, aber auch die „Eiserne Front“ beteiligten sich an gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Nationalsozialisten. Die „Eiserne Front“ ist aus dem „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ hervorgegangen, einer republikanischen Bewegung aus SPD (90 % der Mitglieder), DDP und Zentrum. Sie sollte reichsweit SA und SS Paroli bieten, blieb jedoch auf weiter Strecke erfolglos ; vgl. Hans-Ulrich Wehler : Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band IV : 1914–1949, München 22003, S. 396. 18 Vgl. Zenz : Trier im 20. Jahrhundert, S. 258 und S. 270 ff.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
„Wahlnorm“ hervorgerufene Affinität zum Zentrum nicht zwangsläufig die Ablehnung des Nationalsozialismus bedeutet haben.19 Zumal die NSDAP auch in Trier, trotz ihrer verhältnismäßig schlechten Wahlergebnisse, bei den letzten Wahlen immerhin zweitstärkste Kraft wurde. Auch die Trierer Ortsgruppen der NSDAP konnten nach anfänglichen Schwierigkeiten ab 1930 stetig neue Mitglieder gewinnen. Spätestens seit 1932 zeigte sich die Partei vor Ort sehr gut organisiert.20 Der spätere Gauleiter Gustav Simon warb hartnäckig für den ihm unterstellten Ortsverband. So wurde die im April 1932 etwa 830 Mitglieder zählende Trierer NSDAP auch in der Öffentlichkeit immer präsenter und gerade die steigende Mitgliederzahl in den Parteiorganisationen SA und SS spiegelte sich auf Triers Straßen wieder.21 Am 22. April 1932 stattete Adolf Hitler der Stadt einen groß inszenierten Besuch ab. Das Trierer Nationalblatt22 berichtete von 30.000 Menschen, die Hitler begrüßten und bejubelten. Auch wenn diese Zahl viel zu hoch angesetzt worden sein dürfte, hatte sein Besuch für erneuten Zündstoff in der Öffentlichkeit gesorgt. Die Straßenunruhen steigerten sich abermals und ab 1932 trat vor allem die SA dominanter und aggressiver auf als zuvor.23
19 Gerade die katholische Lebenswelt mit ihrem ausgeprägten Vereinswesen, den eigenen Moralvorstellungen und der starken Bindung der Gläubigen an die Kirche sorgte gleichsam für einen großen Zuspruch zum politischen Katholizismus ; vgl. Maximilian Hommens : Die Orden und Ordensähnlichen Gemeinschaften, in : Martin Persch/Bernhard Schneider (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier, Band 5 : Beharrung und Erneuerung 1881–1981, S. 216–236, hier S. 223. Vgl. ferner Jürgen W. Falter : Hitlers Wähler, München 1991, S. 172. 20 Die Gründung und Entwicklung der NSDAP-Ortsgruppen lässt sich anhand von Berichten des Regierungspräsidenten an den Oberpräsidenten der Rheinprovinz rekonstruieren ; vgl. Franz Josef Heyen : Nationalsozialismus im Alltag. Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus vornehmlich im Raum Mainz, Koblenz, Trier (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 9), Boppard am Rhein 1967, S. 66–81. 21 Siehe ebd., Bericht vom 14. April 1932, S. 76 f. 22 Zum Pressewesen in Trier vgl. Marc Profanter : Die nationalsozialistische Machtergreifung im Spiegel der Trierer Tagespresse. Ein Beitrag zur Geschichte der Trierer Zeitungen (März 1930 bis Oktober 1933), Magisterarbeit Universität Trier 2000 ; Gunther Franz/Hermann Lücking : 250 Jahre Trierer Zeitungen. Ausstellung der Stadtbibliothek Trier in Verbindung mit dem Trierischen Volksfreund. Begleitband und Katalog (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, Bd. 26), Trier 1995. Siehe auch den Beitrag von Sebastian Heuft in diesem Band. 23 Vgl. Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 21–29. In diesem Jahr kam es im Zuge von Straßenunruhen sogar zu zwei Todesfällen in Trier. Am 10. Juli 1932 wurde das Reichbannermitglied Hermann Möschel und am 31. Dezember 1932 das KPD-Mitglied Peter Greif von Nationalsozialisten ermordet. In den Jahren 1930 bis 1932 war die SA in der gesamten Republik sehr aktiv und sorgte dadurch immer wieder für bürgerkriegsähnliche Zustände mit insgesamt über 400 Toten ; vgl. Wehler : Deutsche Gesellschaftsgeschichte IV, S. 393.
229
230
|
Hannes Brogmus
Als Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, dauerte es nur wenige Tage, bis die NSDAP und ihre Parteiorganisationen die absolute Kontrolle über Triers Straßen erlangten. Der sich erst ab Mitte Januar im Dienst befindliche Polizeidirektor Stötzel24 gab sich nun als „Alter Kämpfer“25 zu erkennen. Am 1. März 1933 wurden 20 mit Karabinern bewaffnete SA-Männer der städtischen Polizei zur „sofortigen Verwendung“ bereitgestellt. Am 23. März wurde eine 63 Mann starke, sogenannte Regierungspolizeireserve geschaffen, die sich aus Angehörigen der SA, der SS und des Stahlhelms zusammensetzte. Die Stadtverwaltung hatte zu diesem Zeitpunkt folglich jegliche Kontrolle über die städtische Polizei verloren.26 Symbolträchtig hissten die Nationalsozialisten bereits am 28. Februar 1933 die erste Hakenkreuzfahne am Hauptmarkt, wobei die SA unter Drohungen die Unantastbarkeit dieser Fahne festlegte. Im Anschluss an die letzte Reichstagswahl wurde am 7. März 1933 die Hakenkreuzfahne auch über dem Rathaus und dem Regierungspräsidium gehisst : ein für alle Bürger sichtbares Zeichen nationalsozialistischer Herrschaft.27 Auch der direkte Einfluss der NSDAP auf die administrative Ebene nahm nach der Machtergreifung vom 30. Januar 1933 stetig zu. Während das Zentrum auch bei der letzten Wahl zur Stadtverordnetenversammlung mit 23 Sitzen die Mehrheit der Verordneten stellte, fiel die NSDAP mit nur 14 Sitzen klar hinter die Katholiken. Dennoch folgte die Gleichschaltung der Stadtverwaltung rasch. Die KPD (zwei Sitze) schied aufgrund eines Verbots der Partei am 31. März 1933 aus, die SPD (drei Sitze) wurde am 22. Juni 1933 aufgelöst. Auch wenn sich der Trierer Zentrumspolitiker und Reichstagsabgeordnete Ludwig Kaas federführend für die Zustimmung seiner Partei zum sogenannten Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933 stark machte, konnte auch dieses Entgegenkommen seine Partei nicht retten. Sie löste sich als letzte der großen bürgerlichen Parteien am 5. Juli 1933 selbst auf. Die 15 noch übrig gebliebenen Abgeordneten des Zentrums im Trierer Stadtrat blieben allerdings noch bis Ende Oktober im Amt. Danach wurden acht von ihnen, ebenso wie die drei Abgeordneten der Kampffront, als sogenannte Hospitan24 Reinhard Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus (1933–1945), in : Kurt Düwell/Franz Irsigler (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 517–572, hier S. 524. 25 Der Ausdruck „Alter Kämpfer“ bezieht sich auf NSDAP-Mitglieder, die eine Mitgliedsnummer unter 100.000 besaßen und somit spätestens 1928 der Partei beigetreten waren. Diejenigen mit einer höheren Nummer, die vor dem 30. Januar 1933 Mitglied der NSDAP wurden, bezeichnete man parteiamtlich als „Alte Parteigenossen“ ; vgl. Hermann Weiss : Art. „Alte Kämpfer“, in : Enzyklopädie des Nationalsozialismus, hg. von Wolfgang Benz, Hermann Graml und Hermann Weiß, Stuttgart 31998, S. 358. 26 Zenz : Trier im 20. Jahrhundert, S. 266. 27 Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus, S. 25.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
ten in die NSDAP eingegliedert. Der Oberbürgermeister und Zentrumspolitiker Dr. Heinrich Weitz wurde zuvor am 31. August 1933 abgesetzt und durch das NSDAP-Mitglied Dr. Ludwig Christ ersetzt. Die Trierer Stadtverwaltung stand folglich spätestens ab Herbst 1933 unter der völligen Kontrolle der Nationalsozialisten. Bestimmte Veränderungen in der Gemeindeordnung, welche die Benennung von Abgeordneten in die Hände der Landes- bzw. Reichsführung legten, festigten den Einfluss der NSDAP auf die Stadt und Gemeindeverwaltungen im gesamten Reich.28 Parallel zur Entmachtung der Verwaltung wurden auch die örtlichen Organisationen im Sinne der Nationalsozialisten reorganisiert. Die im ganzen Reich üblichen Gründungen, wie die des „Kampfbundes des gewerblichen Mittelstandes“ (KdgM) oder des „Nationalsozialistischen Lehrerbundes“ (NSLB), gehörten auch in Trier zum Prozess der nationalsozialistischen Machtentfaltung. Als politisch unzuverlässig eingestufte Beamte konnten durch das „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933, wie im erwähnten Fall des Oberbürgermeisters Weitz geltend gemacht, zwangspensioniert werden. Da dieses Gesetz mit dem § 3 auch Beamte mit sogenannter nichtarischer Abstammung in den vorzeitigen Ruhestand zwang, wurden somit insbesondere jüdische Bürger ihres Dienstes verwiesen.29 Wenige Tage nachdem die jüdischen Beamten ausgegrenzt wurden, folgte ein Berufsverbot für jüdische Richter, Staatsanwälte und Rechtsanwälte,30 und kurz darauf wurden auch die jüdischen Ärzte von den Krankenkassen ausgeschlossen.31 Diese zahlreichen Gesetze und Verordnungen verweisen auf das einheitliche Muster, nach dem die Gleichstellung im gesamten Reich vollzogen wurde. Auch das katholische Trier musste bald erkennen, dass die kurz zuvor deutliche Mehrheit dem demokratischen Zentrum nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur Milderung der Umstände bot. Während oppositionelles Handeln bereits vor der Machtergreifung, auch aufgrund mangelnder Kooperation zwischen den anderen größeren Parteien, erschwert worden war,32 erlosch die Möglichkeit einer parteipolitischen
28 Emil Zenz : Die kommunale Selbstverwaltung der Stadt Trier seit Beginn der preußischen Zeit 1814–1959, Trier 1959, S. 127. 29 Reichsgesetzblatt (RGBl.) Teil I, Berlin 1933, Nr. 34, S. 175 : „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“. 30 RGBl. I 1933, Nr. 37, S. 195 : „Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“. 31 RGBl. I 1933, Nr. 42, S. 222 : „Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen“. 32 Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus, S. 523.
231
232
|
Hannes Brogmus
Opposition im Zuge der Gleichschaltung nahezu vollständig.33 Nach der Auflösung des Zentrums blieb in Trier einzig die katholische Kirche als potentieller Gegenspieler zum Nationalsozialismus bestehen. Während die Kirche in der Weimarer Republik von höchster Stelle vor dem Nationalsozialismus gewarnt hatte, wurden ihre mahnenden Rufe kurz nach der Machtübernahme leiser. Am 28. März 1933 erkannte die Fuldaer Bischofskonferenz die neue Regierung als rechtmäßige Obrigkeit an. Obgleich sie die religiösen und sittlichen Differenzen zwischen dem Katholizismus und dem NS-Regime noch immer betonte, sollte von Widerstand abgesehen werden. Am 20. Juli 1933 wurde das Reichskonkordat zwischen der Regierung und der römisch-katholischen Kirche abgeschlossen. Damit erhielt die Kirche einige eingeforderte Zugeständnisse, wie den Schutz kirchlicher Rechte und Institutionen. Im Gegenzug sollten die Bischöfe von der reichspolitischen Beteiligung absehen.34 Zur von der Kirche angestrebten friedlichen Koexistenz zwischen ihr und dem Regime kam es allerdings nur sehr bedingt. In Trier wurden bereits ab Mitte des Jahres 1933 die katholischen Jugendvereine, die mit der HJ in unmittelbarer Konkurrenz standen, stark von den Nationalsozialisten bedrängt. Im Jahr 1934 wurden der Kirche zahlreiche rechtliche Beschränkungen für ihre Versammlungstätigkeiten auferlegt.35 Zudem kam es immer wieder zu Störungen kirchlicher Veranstaltungen. Nachdem die kirchlichen Jugendvereine spätestens ab dem Vereinsverbot 1937 nahezu ausgeschaltet waren, widmete sich das Regime vermehrt dem kirchlichen Einfluss auf die Schulen. In der Folge wurde den kirchlichen Geistlichen die Ausübung des Religionsunterrichts verboten und der zuvor zugesicherte Erhalt der Bekenntnisschulen mit deren Auflösung verworfen.36 Von diesen auch reichsweit umgesetzten Maßnahmen nicht unberührt, reagierte der Vatikan im März 1937. Die päpstliche Enzyklika „Mit brennender Sorge“ erreichte auch das Trierer Bistum und wurde in sämtlichen Kirchen verlesen. Die Nationalsozialisten antworteten allerdings mit einer Intensivierung ihres Vorgehens gegen die Kirche. Auf die Befindlichkeiten der gläubigen Katholiken wurde zunehmend weniger Rücksicht genommen. Vandalismus an Kircheneigentum und
33 Das „Gesetz gegen die Neubildung von Parteien“ vom 14. Juli 1933 und der dort enthaltene § 1, demzufolge in Deutschland als einzige politische Partei die NSDAP bestehen durfte, verdeutlichte die neue Staatsform unmissverständlich. Von nun an konnte parteipolitische Opposition nur noch unter großen Gefahren im Verborgenen oder aus dem Exil erfolgen ; RGBl. I 1933, Nr. 81, S. 479. 34 Wehler : Deutsche Gesellschaftsgeschichte IV, S. 811 f. 35 Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 35 f. 36 Christoph Zuche : Loyalität und Widerspruch : Die christlichen Kirchen, in : Thomas Zuche (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 54–67.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
Verhöre von Priestern durch die Gestapo beschnitten das kirchliche Leben in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß.37 Trotz dieser Maßnahmen blieb die starke konfessionelle Prägung der Trierer Bevölkerung erhalten.38 Nichtsdestotrotz müssen sich, schon in Anbetracht ihrer hohen Anzahl, auch katholische Trierer für die NS-Propaganda empfänglich gezeigt haben. Schließlich gab es zwischen Katholiken und Nationalsozialisten auch gewisse ideologische Überschneidungspunkte. Die größten politischen Feindbilder des Regimes, die Kommunisten und die Sozialdemokraten, wurden auch von den Katholiken zumindest mit Skepsis beäugt. Und selbst der nationalsozialistische Antisemitismus konnte im Katholizismus durchaus auf Gehör stoßen. So erfüllte der religiös motivierte Antijudaismus, der auch in Trier bereits im Mittelalter in Judenverfolgungen ausgeartet war, eine Art Vorläuferfunktion.39 Zwar lehnten die Katholiken die Rassenkomponente der Nationalsozialisten ab, die jahrhundertealten Vorurteile gegenüber dem Judentum gehörten allerdings fortlaufend zur christlichen Gedankenwelt.40 Auch in der Region Trier waren es nicht zuletzt katholische Publikationen, die antisemitisches Gedankengut bis in die Weimarer Zeit trugen.41 Zu einem katholischen Bekenntnis zum nationalsozialistischen Antisemitismus kam es in Trier nicht, allerdings auch zu keiner umgreifenden Parteinahme für die jüdischen Bürger. Der kirchliche Widerstand, welcher vor allem
37 Ebd., S. 60 f. 38 Zenz : Trier im 20. Jahrhundert, S. 304. 39 Im Jahre 1096 kam es in Trier im Zuge des ersten Kreuzzuges zur ersten belegten Judenverfolgung. Im Jahr 1349 wurden die Trierer Juden abermals verfolgt und vollständig aus Trier vertrieben. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts werden Juden wieder in der Stadt Trier erwähnt ; vgl. Richard Laufner : Geschichte der jüdischen Gemeinde Triers, in : Juden in Trier. Katalog einer Ausstellung von Stadtarchiv und Stadtbibliothek Trier, März – November 1988, bearb. von Horst Mühleisen, Bernhard Simon und Reiner Nolden (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, Nr. 15), Trier 1988, S. 11–28, hier S. 11–15. 40 Olaf Blaschke : Heimatgeschichte als Harmonielehre. Warum ausgerechnet stets in „unserem“ Ort Toleranz herrschte und niemals Judenhass. Erklärung eines Widerspruchs, in : Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hg.) : Nebeneinander − Miteinander − Gegeneinander ? Zur Koexistenz von Juden und Katholiken in Süddeutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Gerlingen 2002, S. 137–161, hier S. 144. 41 Der bis heute in der Stadt hoch angesehene Politiker, Verleger und katholische Priester Georg Friedrich Dasbach verunglimpfte mit seiner 1887 erschienen Schrift „Der Wucher im trierischen Lande“ insbesondere jüdische Händler. Das von ihm geführte Paulinus-Blatt beinhaltete in einer gewissen Regelmäßigkeit antisemitische Artikel und trug vor allem auch aufgrund seiner großen katholischen Leserschaft zur Manifestierung gesellschaftlicher Aversionen gegen Juden bei ; vgl. Bühler : Katholiken und Juden, S. 513.
233
234
|
Hannes Brogmus
ab 1937 aufgrund stärker werdender Repressionen erstarkte, diente vorrangig dem Selbstschutz der Institution und der eigenen Gläubigen.42
Die antisemitischen Ausdrucksformen in Trier von 1931 bis 1938
Bei der Darstellung von Antisemitismus kann zwischen Alltagsantisemitismus und singulär- bzw. exzeptionell auftretenden Ausdrucksformen unterschieden werden. Des Weiteren biete es sich an, die Wirkung von antisemitischen Gesetzen und Verordnungen auf die Stadt Trier zu untersuchen. Gerade der Alltagsantisemitismus dürfte sehr häufig kein Zeugnis seiner Existenz hinterlassen haben. Er konnte sich in latenter bis radikaler Ausprägung auf sämtliche Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens auswirken. Einige größere antisemitische Einzelaktionen hingegen, welche in ihrer Intensität den Alltagsantisemitismus übertrafen, lassen sich für Trier gut rekonstruieren. Die erste Schändung eines jüdischen Friedhofs ereignete sich in der Region Trier im Jahre 1929. Hierbei wurden im Ort Hermeskeil Grabsteine umgeworfen und beschmiert. Ebenso soll es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Nationalsozialisten und Juden gekommen sein. Das SPD-Presseorgan Volkswacht, das als einzige nicht-jüdische Zeitung der Trierer Region von der Schändung berichtete, schrieb in diesem Zusammenhang von schweren Misshandlungen jüdischer Personen. Während im Reich der Weimarer Republik bereits ab 1923 erste ähnliche Vorfälle zu verzeichnen waren, war diese Schändung für die Trierer Region gewissermaßen der antisemitische Auftakt in der Öffentlichkeit. Es folgten noch zwei weitere Schändungen von jüdischen Friedhöfen in der Region, 1931 in Neumagen-Dhron und 1932 in Butzweiler. Für die Stadt Trier sind derlei Vorkommnisse während der Weimarer Zeit nicht überliefert.43 Die erste für Trier belegte antisemitische Aktion mit nationalsozialistischem Hintergrund ereignete sich am 12. April 1931. Dabei wurde die, bereits erwähnte, jüdische Jugendwandergruppe von sechs bis sieben Nationalsozialisten beleidigt, bedroht und angegriffen. Dieses Ereignis erreichte ein wesentlich größeres Interesse
42 Ebd., S. 515 ff. Einige kirchliche Geistliche des Bistums Trier haben durchaus auch Juden unterstützt. Dies beschränkte sich allerdings auf einzelne Personen und ging auf deren persönliches Engagement zurück ; vgl. ebd., S. 520 ff. 43 Willi Körtels : Antisemitische Übergriffe in der Region Trier vor 1933, Konz 2011, online unter : www.mahnmal-trier.de/uebergriffe_1933.pdf (Letzter Zugriff : 13.7.2017), S. 5–21. Eine Aufstellung über Friedhofsschändungen im gesamten Deutschen Reich während der Zeit der Weimarer Republik findet sich in der C[entral]V[erein]-Zeitung vom Juli 1932, dokumentiert in : ebd., S. 19.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
in der Trierer Presse als die benannten Friedhofsschändungen.44 So wird berichtet, dass die Täter, wohl von unbeteiligten Zeugen aus der Bevölkerung, angezeigt wurden und sich auch vor Gericht verantworten mussten. Dieser Fall macht dennoch bereits deutlich, dass die politisch unruhige Zeit, in der sich das Selbstbewusstsein der Nationalsozialisten zusehends steigerte, auch für Juden zunehmend gefährlicher wurde. Während die Rechte der Juden bei diesem Ereignis noch durch die juristische Aufarbeitung des Falles gewahrt wurden, löste sich der rechtsstaatliche Rückhalt für jüdische Bürger nach der Machtergreifung zusehends auf. Die Boykotte jüdischer Geschäfte stellten eine erste, im gesamten Reich auftretende Form der Diskriminierung von Juden dar. Während es in einigen Städten bereits vor Hitlers Amtsantritt zu derartigen Maßnahmen kam, ereigneten sie sich in Trier das erste Mal kurz nach der letzten Reichstagswahl, zwischen dem 8. und 10. März 1933. Organisiert wurden diese Boykotte von lokalen Parteiaktivisten, darunter insbesondere SA-Leute. Diese Aktionen waren weder von der NSDAP-Führung angeordnet noch mit ihr abgestimmt, weshalb sie auch relativ schnell wieder eingestellt wurden. Die NSDAP war zu diesem Zeitpunkt noch auf die Zustimmung der gemäßigten Parteien zum Ermächtigungsgesetz angewiesen, weshalb sie mit einer derart offensiven Diskriminierung der Juden zunächst noch abwarten wollte. Dennoch nutzen die Nationalsozialisten auch die inoffiziellen Boykotte für ihre Propagandazwecke, indem sie diese als Ausdruck des „Volkswillens“ darzustellen vermochten.45 In Anbetracht der tatsächlichen Initiatoren war dies eine klare Verzerrung der Tatsachen. Nachdem am 24. März 1933 das „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“,46 das sogenannte Ermächtigungsgesetz, verabschiedet worden war, rückte die Boykottierung von jüdischen Geschäften auch auf die Agenda der nationalsozialistischen Führung in Berlin. Für den 1. April 1933 wurde ein reichsweiter Boykott jüdischer Geschäfte organisiert, der auch in Trier aufwendig inszeniert wurde.47 Am Vorabend des Boykotts wurden auf Lastkraftwagen befestigte Plakate durch die Straßen gefahren, welche zum Boykott aufriefen und Juden diffamierende Inhalte proklamierten.48 Während die Trierer Zeitungen auch über den „Ge-
44 Die beiden wichtigsten Trierer Zeitungen, der Trierische Volksfreund und die Trierische Landeszeitung, berichteten beide am 14. April 1931 von diesem Ereignis. Siehe die Zeitungsausschnitte in Körtels : Übergriffe, S. 25–27. 45 Bollmus : Tier und der Nationalsozialismus, S. 526 f.; Zenz : Die Stadt im 20. Jahrhundert, S. 265. 46 RGBl. I 1933, Nr. 25, S. 141. 47 Peter Longerich : „Davon haben wir nichts gewusst !“ Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945, München 2006, S. 59. 48 Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 107.
235
236
|
Hannes Brogmus
neral Boykott“ berichteten, hatte das Trierer Nationalblatt49 den Boykott bereits Tage vorher in den Mittelpunkt seiner Berichterstattung gestellt.50 Wohl aufgrund des offiziellen Charakters wurden die Geschäfte durch die SALeute kompromissloser blockiert, als es noch im Zuge der inoffiziellen Boykotte vom März der Fall gewesen war. Einem Luxemburger Zeitungsbericht nach zu urteilen, verhielten sich die Trierer während der Aktionen eher ängstlich und zurückhaltend, nur wenige Menschen hätten Zustimmung suggeriert.51 Eine Einschüchterung von Teilen der Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt ist sicherlich denkbar, schließlich hatte der jahrelange Straßenterror der Nationalsozialisten durchaus seine Spuren hinterlassen. Parallel zu den Boykottaktionen erfolgten auch Maßnahmen gegen einzelne jüdische Bürger. Im gesamten Reich wurden um die Tage des 1. Aprils viele Juden in Schutzhaft genommen. In Trier wurden sieben jüdische Männer verhaftet, die sich laut SA-Führer Hermann Funken durch ihr eigenes Verhalten in die Lage gebracht hätten, sie vor tätlichen Angriffen schützen zu müssen. Eine solche Umkehrung von Tatsachen gehörte zur täglichen Praxis nationalsozialistischer Propa ganda. Auch der offizielle Boykott am 1. April wurde als Ausdruck des „Volkswillens“ dargestellt, eine Behauptung, die sich wiederum anhand der Beobachtungen in Trier entkräften lässt. Bereits zwei Tage vor dem Boykott, am 30. März, wurde das Schächten im Trierer Schlachthof verboten und die Schächtmesser eingezogen. Der Versuch, den jüdischen Viehhändlern den Zugang zum Schlachthof zu versperren, gab man jedoch auf, da der Direktor des Schlachthofes angab, ohne sie den Fleischbedarf der Stadt nicht decken zu können. Ebenso versuchte die NSDAP, den Juden die Benutzung des Stadtbades zu verbieten. Da der noch amtierende Oberbürgermeister Weitz hierzu jedoch keine rechtliche Handhabe sah, konnte auch dieses Vorhaben vorerst abgewendet werden.52 Nach den Boykotten am 1. April ebbten die öffentlichen Diskriminierungen langsam ab. Nachdem es im Juni 1933 zu weiteren kleineren Boykotten einiger jüdischer Kaufhäuser in Trier gekommen war, beruhigte sich die Lage vorerst. Von der zweiten Jahreshälfte bis zum 49 Das Trierer Nationalblatt wurde am 2. Juni 1930 unter der Herausgeberschaft von Dr. Robert Ley, dem damaligen Leiters des NSDAP-Gaues Rheinland-Süd, gegründet. Ab dem 15. Oktober 1931 fungierte der Gauleiter Gustav Simon im neu geschaffenen Gau Koblenz-Trier-Birkenfeld als Herausgeber, sein Bruder Paul übernahm die Leitung des Trierer Lokalteils. Das NS-Presseorgan zeichnete sich durch Verleumdungen, Beleidigungen und Drohungen aus ; vgl. Profanter : Trierer Tagespresse, S. 18–20. 50 Siehe hierzu die intensive antijüdische Propaganda des Trierer Nationalblattes, jeweils auf der Titelseite, in den Ausgaben vom 27. bis 31. März 1933, Jg. 4, Nr. 73–77. 51 Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus, S. 529. 52 Zenz : Die Stadt Trier im 20. Jahrhundert, S. 266.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
Dezember 1934 sind keine Boykottaktionen belegt. Eine erste Phase verstärkter, öffentlicher antisemitischer Ausschreitungen war somit zu Ende. Ab Weihnachten 1934 lebte der öffentliche Antisemitismus in Trier wieder auf. Das Trierer Nationalblatt verschärfte erneut den Ton gegen Juden und es kam immer wieder zu Schmierereien an jüdischen Geschäften.53 Dieses Erstarken des Antisemitismus war in der ersten Hälfte des Jahres 1935 ein reichsweit zu beobachtendes Phänomen. Obgleich häufig durch den radikalen Teil der Parteibasis initiiert, bemühte sich die NSDAP-Propaganda wiederum, die Ausschreitungen als das Resultat eines au der Bevölkerung erwachsenen Antisemitismus darzustellen. Nichtsdestotrotz wurden illegale Aktionen von der Parteileitung ausgebremst, da sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdeten und die Autorität der Reichsregierung unterminierten. Gleichzeitig wollte sie durch eine Verschärfung der antijüdischen Politik eine juristische Grundlage für den Umgang mit Juden liefern und dadurch auch ihren radikalen Parteimitgliedern Rechnung tragen.54 Am 15. September 1935 wurden auf dem „Reichsparteitag der Freiheit“ in Nürnberg die später sogenannten Nürnberger Rassengesetze verabschiedet. Ihnen folgten diverse ergänzende Verordnungen. Während im ersten und zweiten Gesetz die Juden nicht explizit erwähnt wurden, regelte das dritte Gesetz, das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“, unter anderem die Bestimmungen zur Eheschließung (§ 1 Abs. 1) und zum Geschlechtsverkehr (§ 2) zwischen Juden und „Deutschen“.55 Die Wirkung dieser Gesetze entfaltete sich im gesamten Reich mit etwas Verzögerung ganz im Sinne der nationalsozialistischen Führung. Die illegalen Einzelaktionen gingen einige Wochen nach dem Parteitag erheblich zurück, ohne dass die antisemitische Ausrichtung des Staates in Zweifel gezogen werden musste. Vielmehr erhielt die fortgeführte Ausgrenzung der Juden bei gleichzeitiger Wahrung der öffentlichen Ordnung einen gesetzlichen Rahmen.56 Für das jüdische Leben erwiesen sich die Gesetze als ein weiterer Schritt hin zur völligen Entrechtung. Auch in Trier scheinen sie sich unmittelbar auf die Juden
53 Jacobs : Existenz, S. 78. 54 Longerich : „Davon haben wir nichts gewusst !“, S. 92 f. 55 Das erste Gesetz, das „Reichsflaggengesetz“, bestimmte die Reichsfarben schwarz-weiß-rot (Art. 1). Diese Farben durften laut § 4 des „Gesetzes zum Schutze des Deutschen Blutes“ nicht von Juden gezeigt werden. Das zweite Gesetz, das „Reichsbürgergesetz“, sollte den „Reichsbürger […] als alleinige[n] Träger aller politische[n] Rechte“ (§ 2 Abs. 3) vom Staatsbürger unterscheiden. Ein „Reichsbürgerbrief“ (§ 2 Abs. 2) sollte nur an einen „Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes“ (§ 2 Abs. 1) vergeben werden ; vgl. RGBl. I 1935, Nr. 100, S. 1145–1147. 56 Longerich : „Davon haben wir nichts gewusst !“, S. 96.
237
238
|
Hannes Brogmus
ausgewirkt zu haben. Die Lageberichte der Trierer Gestapostelle57 beschreiben einige Reaktionen der Trierer Juden. So attestiert der Bericht vom September 1935 eine „gewisse Nervosität“ in jüdischen Kreisen. Viele Juden sollen sich nach Auslandspässen erkundigt haben.58 Die Juden, die jetzt noch in Trier blieben, taten dies auch eventuell aufgrund ihrer hilfsbereiten Nachbarn und Freunde. Andere hatten nicht die Möglichkeiten, eine Ausreise zu organisieren, da diese mittlerweile durch das Regime erheblich erschwert wurde. So mussten Ausreisewillige auf der Grundlage einer sogenannten Reichsfluchtsteuer empfindliche Abgaben zahlen.59 Zudem gab es oftmals niedrige Einwanderungsquoten oder strenge Auflagen in den bevorzugten Zielländern der Migration. Dadurch wurde die Beschaffung von Visa deutlich schwieriger. Die nicht ausgewanderten Juden lebten in zunehmender Isolation von der Gesellschaft. Bereits seit Juli 1936 war ihnen das Betreten des Hallen- und Strandbades untersagt.60 Da christliche Eltern ihren Kindern häufig den Umgang mit Juden verbaten, wurden diese in der Schule von ihren Klassenkameraden gemieden. Traf man seine jüdischen Nachbarn auf der Straße, wurde häufig lieber weggeschaut als gegrüßt. Der Alltagsantisemitismus hatte eine neue Dimension erreicht, dies allerdings nicht zwangsläufig aus tatsächlicher antisemitischer Überzeugung. Es wurde schlechthin riskanter, als ein „Judenfreund“ zu gelten.61 Der Lagebericht für den Februar 1936 beschreibt, „dass die Bevölkerung jeden Verkehr mit Juden meidet“.62 Diese Einschätzung der Gestapo klingt in Anbetracht der geschilderten Lebenssituation plausibel. Dennoch war die vollkommene Isolation zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch nicht erreicht und sogar einige jüdische Geschäfte konnten sich immer noch in Trier halten. Auch wenn die Gestapo kurz vor den Nürnberger Gesetzen, im Juli 1935, von einem Rückgang der Kundenzahlen be-
57 Die Lage- und Stimmungsberichte von Gestapostellen werden als Quelle in diesem Band bereits in den Beiträgen von Martin Spira und Max Heumüller behandelt. 58 Lagebericht der Gestapostelle Trier für September 1935, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, Bd. II,2 : Juli – Dezember 1935, Düsseldorf 2015, S. 1110–1116, hier S. 1113. 59 Ab Mai 1934 wurde die noch aus der späten Weimarer Republik stammende Reichsfluchtsteuer stark ausgeweitet. Dies betraf in erster Linie die jüdische Bevölkerung ; RGBl. I 1935, Nr. 54, S. 292. 60 Zenz : Trier im 20. Jahrhundert, S. 308. 61 Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus, S. 564. 62 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Februar 1936, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Burkhard Dietz, Anselm Faust und Bernd-A. Rusinek, Bd. III : Januar–März 1936, Düsseldorf 2016, S. 326–334, hier S. 330.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
Abb. 1: Die im Jahr 1938 steigenden Auswanderungsbewegungen wurden von hetzerischen Zeitungsartikeln der lokalen Presse begleitet. (Quelle: Trierer Nationalblatt, Nr. 5 vom 6. Januar 1939).
richtete,63 wurden die meisten Gewerbeabmeldungen jüdischer Geschäfte erst um den Jahreswechsel 1938/39 getätigt.64 Zwar hatten antisemitische Parteianhänger immer wieder die Ausgrenzung der Juden aus der Wirtschaft gefordert, doch beinhalteten auch die Nürnberger Gesetze noch keine Regelung für einen solchen Schritt. Während der Trierer Schlachthof bereits 1933 im Falle eines Ausschlusses der jüdischen Viehhändler ein Problem mit der Fleischversorgung der Stadt gehabt hatte, wäre ein umgreifender antisemitischer Eingriff für die deutsche Wirtschaft auch 1935 nicht ohne Schaden geblieben.65 Zwischen 1936 und Herbst 1937 wurde es, gemessen an der Anzahl antisemitischer Aktionen, im gesamten Deutschen Reich ruhiger. Die NS-Propaganda behandelte die Judenfrage nur noch selten, ferner wurden keine umfangreichen neuen Maßnahmen gegen Juden in die Wege geleitet.66 Auch in Trier sind in die63 Lagebericht der Gestapostelle Trier für Juli 1935, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen, Bd. II,2, S. 873–883, hier S. 878. 64 Albrecht : Die „Arisierung“ der jüdischen Gewerbebetriebe, S. 108 : Verzeichnis der jüdischen Gewerbebetriebe in Trier Stadt (Stand : Dezember 1938). 65 Longerich : „Davon haben wir nichts gewusst !“, S. 93. 66 Ebd., S. 104.
239
240
|
Hannes Brogmus
sem Zeitraum keine antisemitischen Einzelaktionen zu verzeichnen. Dies bedeutet natürlich nicht, dass sich der alltägliche Antisemitismus in dieser Zeit gelegt hatte. Im Jahr 1937 sind mit 117 Personen die bisher meisten Juden innerhalb eines Jahres ausgewandert. Bis zum 1. September 1938 verließen weitere 112 jüdische Personen aus der Stadt Trier das Reich. Somit waren insgesamt 444 Trierer Juden seit 1933 aus dem Reich emigriert. Dabei handelte es sich teilweise auch um solche, die kurz zuvor aus den umliegenden Orten in Stadt gezogen waren.67 Die verbliebenen Juden wurden im November 1938 zu Opfern der bis dato größten, reichsweiten antisemitischen Aktion der NS-Zeit. Nachdem am 7. November 1938 der 17-jährige Jude Herschel Grynszpan in Paris ein Attentat auf den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath verübt hatte, inszenierte die Reichsführung reichsweite gewaltsame Ausschreitungen gegen jüdische Personen, ihre Geschäfte und Wohnhäuser. Diese wurden insbesondere in der Nacht vom 9. auf den 10. November vollzogen. Wie bereits bei den Boykotten vom April 1933, stellte die NS-Propaganda auch die „Novemberpogrome“ als Ausdruck einer allgemeinen Volksempörung dar.68 In Trier begann der Pogrom in den frühen Morgenstunden des 10. November 1938. SA- und SS-Männer versammelten sich auf dem Hauptmarkt und marschierten von dort aus zu jüdischen Wohnungen und Geschäften. Dabei wurden Schaufenster zerschlagen und Waren auf den Straßen verteilt. Die Synagoge in der Zuckerbergstraße wurde stark beschädigt, die Nationalsozialisten verbrannten 23 der 24 Thorarollen. Neben den Zerstörungen jüdischen Eigentums wurden auch mehr als 100 jüdische Personen in Schutzhaft genommen. Einige der Inhaftierten durften erst im Dezember des Jahres wieder das Gefängnis in der Windstraße verlassen.69 Gerade in der Neustraße wüteten die Täter mit besonderer Härte. Hilde Deutsch schildert ihre Eindrücke aus dieser Straße im eingangs erwähnten Bericht. Als sie am 10. November aus der Schule kam, offenbarte sich ihr das Bild der Zerstörung : Die Wohnung von Familie Blum war nahezu komplett verwüstet. Die Möbel wurden von den Tätern mit Äxten zerschlagen, die Schränke umgeworfen, die Vitrine zerbrochen, Lebensmittel in der Wohnung verteilt und die Kleidung zerrissen. Hilde Deutschs Mutter will unter den Tätern insbesondere SA-Männer ausgemacht haben, darunter „angesehene Geschäftsleute“, die womöglich in 67 Zenz : Die Stadt im 20. Jahrhundert, S. 309. 68 Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 112. 69 Jacobs : Existenz, S. 84. Die verbliebene Thorarolle konnte über die Zeit des Nationalsozialismus im Bistumsarchiv versteckt werden. Sie wurde nach der NS-Zeit der neu gegründeten jüdischen Gemeinde überreicht.
Vom Nachbarn zum Verfolgten
|
Gustav Blum einen ehemaligen Konkurrenten sahen. Die Blums wurden während der Aktion im Keller des Hauses eingesperrt. Später saßen Gustav und Emma Blum zitternd bei Hilde Deutschs Eltern auf dem Sofa in der Küche. Das nachbarschaftliche Verhältnis der Familien Monz und Blum hatte offensichtlich auch in dieser Krisensituation Bestand.
Zynismus der Geschichte?
Sicherlich lässt sich das Verhalten der Familie Monz in diesem Zusammenhang als moralisch beispielhaft beschreiben. Bezieht man das folgende Schicksal der jüdischen Bürger des „Dritten Reichs“ in die Betrachtung mit ein, lässt es allerdings eine differenzierte Bewertung zu. Der Rabbiner Joachim Prinz bemängelte bereits im April 1935, dass es den Juden an Nachbarn fehle.70 Demnach ging es der Familie Blum wohl besser als vielen anderen Juden. So hatte Hilde Deutschs Vater auch noch während des Krieges durch „gute Kontakte“ die Möglichkeit besessen, die Familie Blum mit Lebensmitteln zu versorgen. Und auch die Unterstützung kurz nach den „Novemberpogromen“ wird den Blums eine große Hilfe gewesen sein. Eine andere Perspektive auf gute nachbarschaftliche Verhältnisse zwischen Nichtjuden und Juden während der NS-Zeit nimmt den Holocaust mit in den Blick und kommt somit nicht ohne Zynismus aus. Edgar Christoffel vermutet, dass einige Trierer Juden gerade aufgrund ihrer solidarischen Nachbarn den möglichen Zeitpunkt für eine Emigration verpasst haben könnten.71 Und auch nach Götz Aly et. al. minderten freundliche und hilfsbereite Nachbarn die Überlebenschancen der Juden dramatisch, da diese unter Umständen auch derentwegen auf eine Flucht ins Ausland verzichteten.72 Ob Gustav und Emma Blum, wie ihre beiden Kinder Werner (noch vor 1938 in die USA emigriert) und Grete (nach den Novemberpogromen nach England emigriert), ohne ihre helfenden Nachbarn ausgereist wären, ist nicht mehr nachzuvollziehen. Mit ziemlicher Sicherheit wäre eine solche Entscheidung jedoch die richtige gewesen. Gustav und Emma Blum wurden am 16. Oktober 1941 nach Litzmannstadt deportiert und entweder dort
70 Jüdische Rundschau : Rede von Rabbiner Joachim Prinz im April 1935 über die soziale und kulturelle Isolation der jüdischen Bevölkerung (Nr. 31/32 vom 17.4.1935, S. 3), in : Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 (VEJ), Bd. 1 : Deutsches Reich 1933–1937, bearb. von Wolf Gruner, München 2008, Dok. 161, S. 426–429, hier S. 427. 71 Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 105. 72 Einleitung, in : VEJ 1, S. 13–50, hier S. 43.
241
242
|
Hannes Brogmus
oder in einem anderen der zahlreichen Lager ermordet.73 Damit teilten sie das Schicksal mit mehr als 600 Trierer Juden. Die Angaben über die Rückkehrer nach dem Zweiten Weltkrieg variieren zwischen 14 und 20 Personen.74
73 Hilde Deutsch gibt an, dass Gustav und Emma Blum im Jahr 1943 in Theresienstadt ermordet wurden ; Deutsch : Erinnerungen, S. (6) 2. Allerdings befinden sich die beiden auf einer Liste der Deportierten des Transports vom 16. Oktober 1941 nach Litzmannstadt, die vom Finanzamt Trier angelegt worden ist ; LHA Koblenz, Best. 572, Nr. 15959, online : http://www.statistik-des- holocaust.de/list_ger_rhl_411016.html (Letzter Zugriff : 13.7.2017). 74 Bollmus : Trier und der Nationalsozialismus, S. 568.
Benjamin Koerfer
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier und Umgebung in das Getto Litzmannstadt „Man sollte die Tragödie der Juden beschreiben, die aus Deutschland und Tschechien zu uns umgesiedelt worden sind. Es ist eine Tragödie, wie die Geschichte keine zweite kennt“1 – so schrieb Jakub Poznański, ein polnischer Jude im Getto in Litzmannstadt, in seinem Tagebuch. Opfer dieser Tragödie waren unter anderem auch jüdische Bewohner Triers, die am 16. Oktober 1941 zusammen mit Leidensgenossen aus Luxemburg in das Getto in Litzmannstadt deportiert wurden. Dieses Datum jährte sich 2016 zum 75. Mal und bot damit Anlass zum öffentlichen Gedenken an die damaligen Ereignisse. Die Erforschung des Themas auf regionaler Ebene wurde in den letzten Jahren verstärkt betrieben, sei es durch ehrenamtliche Initiativen oder universitäre Arbeiten. Dennoch sind noch längst nicht alle Forschungslücken geschlossen – weder sind die Schicksale der Trierer Bürgerinnen und Bürger sämtlich geklärt, noch ist die Zusammenarbeit der verschiedenen, damals involvierten Behörden systematisch erforscht. Richtet man den Blick auf die Rolle der Gestapo bei diesem Prozess, so offenbart sich auch hier eine derartige Forschungslücke. Diese wird auch durch den vorliegenden Beitrag nicht zu schließen sein. Vielmehr wird die Geschichte der Deportierten nachgezeichnet und die Rolle der Gestapo bezüglich dieser spezifischen Personengruppe verdeutlicht. Im Wesentlichen sind die folgenden Ausführungen in zwei Sinnabschnitte gegliedert : den der Ereignisse in Trier vor der Deportation und den der Vorgänge in Litzmannstadt. Ziel ist es, schlaglichtartig darzustellen, an welchen Stellen die Gestapo involviert war. Somit stellt der Aufsatz auch eine Anregung dar, künftige Forschungen zur Gestapo in Trier stärker an ihrer Rolle bei der Verfolgung, Beraubung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung auszurichten. Darüber hinaus wird in diesem Aufsatz jedoch auch das Ziel verfolgt, über das Schicksal der nach Litzmannstadt Deportierten aufzuklären und die Erkenntnisse aufzuzeigen, die beim Erstellen der zugrunde liegenden Abschlussarbeit gewonnen wurden.2 Durch die angestellten 1 Zit. nach : Ingo Loose : Das Getto Litzmannstadt 1940–1944, in : Pascale Eberhard (Hg.) : Der Überlebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region im Getto Litzmannstadt. Briefe Mai 1942, Saarbrücken 2012, S. 12–20, hier S. 12. 2 Benjamin Koerfer : Die Deportation der Juden aus Trier ins Getto in Litzmannstadt. Eine quanti-
244
|
Benjamin Koerfer
Recherchen wurden neue Quellen entdeckt, die zuvor unbekannte Informationen über die Trierer in Litzmannstadt lieferten.
Die Zeit in Trier
Ohne eine exakte Nacherzählung der lokalen Ereignisgeschichte anzustreben, lässt sich festhalten, dass die Entwicklung der Diskriminierung, Beraubung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung Triers – wie auch andernorts – ein komplexer, mehrstufiger Prozess war, der bereits Anfang 1933 begann. Dieser Prozess erstreckte sich vom Boykott der jüdischen Geschäfte Triers im Frühjahr 1933, über die „Arisierungen“ jüdischen Besitzes, den Ereignissen der Reichspogromnacht in Trier (bei denen die Synagoge in der Zuckerbergstraße zerstört wurde), bis hin zu den Vorbereitungen der Deportation im Oktober 1941. Zu diesen vorbereitenden Maßnahmen zählten sicherlich – intendiert oder nicht – auch die Konzentration der Juden in sogenannten Judenhäusern und die Kennzeichnung der jüdischen Bevölkerung durch den „Judenstern“ im September 1941 ; diese Anordnung ist in den Beständen des Stadtarchivs Trier dokumentiert.3 Durch diese Maßnahmen ergaben sich zwei Migrationsströme : den der Juden, die auf dem Land wohnten, in die Stadt und die Emigration vieler Juden aus der Stadt ins Ausland (hier wäre vor allem Luxemburg als Ziel zu nennen). Insgesamt ist für Trier in dieser Zeit eine signifikante Reduzierung der jüdischen Bevölkerung festzustellen. Lag der Anteil der Juden 1925 im Landkreis Trier noch bei 0,6 % und in der Stadt bei 1,4 %, so gingen diese Werte in der Personenstandsaufnahme vom 10. Oktober 1938 auf 0,2 % bzw. 0,5 % zurück.4 Im Jahr 1941 begannen die unmittelbaren Vorbereitungen für die Deportation. Nachdem die Entscheidung gefallen war, Juden aus den deutschen Städten zu deportieren, erging der Befehl an die jüdischen Gemeindeverwaltungen, Listen für die Deportation anzufertigen.5 In Luxemburg versandte die Gestapo bezüglich des bevorstehenden Transports „staatspolizeiliche Verfügungen“ an die Kultus-
tative Analyse der Opfergruppe und Einordnung in den Prozess der Vernichtung der europäischen Juden, Saarbrücken 2016. 3 Stadtarchiv (StA) Trier, Best. Tb 15/940, Schnellbrief zur Polizeiverordnung über Kennzeichnung der Juden (1.9.1941). Siehe auch die Beiträge von Hannes Brogmus und Andreas Borsch in diesem Band. 4 Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 442, Nr. 10961, Bl. 66, Kreisweise Zusammenstellung der Juden im Regierungsbezirk Trier. 5 Raul Hilberg : Die Vernichtung der europäischen Juden, 3 Bde., Frankfurt a.M. 1982, S. 476.
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
gemeinde, welche diese an die Betroffenen weiterzuleiten hatte.6 Des Weiteren wurden „Vermögenserklärungen“ verschickt, in denen die zur Deportation Vorgesehenen ihre ganze Habe bis ins Detail anzugeben hatten.7 Verantwortlich für die Feststellung des Vermögens der jüdischen Bevölkerung war die Geheime Staats polizei. Aus den Unterlagen des Finanzamtes Trier geht hervor, dass die Gestapo diese Vermögensverzeichnisse bis zum 20. Oktober 1941 ablieferte. Anschließend versiegelte sie die Wohnung der Betroffenen.8 Die Unterlagen der Gestapo dienten später als Grundlage für die Enteignungsverfahren im Nachgang der Deportation. Hans Adler bezeichnete diese Abläufe als „einen bürokratischen Höhepunkt der Verwaltungsvorgänge im Zusammenhang mit der Deportation“9. Nachdem die Opfer deportiert worden waren, wurde umgehend damit begonnen, die Enteignung durchzusetzen. Rechtliche Grundlage hierfür war die 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz – diese regelte zwar „dem Namen nach nur den Verlust der Staatsangehörigkeit, doch bezweckte sie mit diesem ‚bürgerlichen Tod‘ [in Anlehnung an Adler] gleichzeitig den ‚Antritt der Erbschaft des Vermögens [der] derart gleichsam Verstorbenen‘“10 durch das Deutsche Reich. Ausschlaggebendes Kriterium für den Verlust der Staatsangehörigkeit und damit der Einziehung des Vermögens wurde eine „Auswanderung“ der deutschen Juden ins Ausland – womit de facto nichts anderes gemeint war als ihre Deportation.11 Diese Regelungen führten zur Beschlagnahmung des jüdischen Besitzes 6 Georges Büchler : Évacuation – Déportation. Le premier transport vers l’Est, 16.10.1941/Evakuierung – Aussiedlung. Der erste Polentransport, 16.10.1941 (Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette, Bd. 8), Luxembourg 2016, S. 60. 7 Pascale Eberhard : Jüdische Bürger in der Trierer Region 1933–1941, in : Dies. (Hg.), Der Überlebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region im Getto Litzmannstadt. Briefe Mai 1942, Saarbrücken 2012, S. 34–45, hier S. 43. Dieser Vorgang war der Normalfall und lässt sich auch für andere Städte nachweisen ; siehe etwa : Dieter Corbach : 6 :00 Uhr ab Messe Köln-Deutz. Deportationen 1938–1945 (Spuren jüdischen Wirkens, Bd. 6), Köln 1999, S. 32–48. Hier findet sich auch eine Blankoversion der Erklärung. 8 LHA Koblenz, Best. 572, Nr. 15959. 9 Hans Adler : Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974, S. 560. 10 Walter Rummel/Jochen Rath : Dem Reich verfallen – den Berechtigten zurückzuerstatten. Enteignung und Rückerstattung jüdischen Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938– 1953 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 96), Koblenz 2001, S. 88. 11 Ebd., S. 89 ; Hilberg : Vernichtung, S. 493–505 ; Peter Longerich : Die Ermordung der europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941–1945, München 1989, S. 153 f. Unterlagen zu diesen Vorgängen finden sich auch für Trier ; siehe beispielsweise : LHA Koblenz, Best. 572, Nr. 15959, Verfügung über den Verlust der Staatsbürgerschaft von ausgesiedelten Juden, § 2 der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz ; LHA Koblenz, Best. 572, Nr. 20670, Bl. 2, Schreiben
245
246
|
Benjamin Koerfer
durch das Deutsche Reich und anschließend vielfach zur Versteigerung desselben und dem Erwerb durch Trierer Bürger. Den Betroffenen der Deportation war es erlaubt, 50 kg Gepäck und 100 Reichsmark (RM) an Bargeld mitzunehmen. Ihren restlichen Besitz mussten sie zurücklassen und ihre Wohnungen in gutem Zustand hinterlassen.12 Die endgültigen Mitteilungen über die unmittelbar bevorstehende Deportation wurden am 12. Oktober 1941 übergeben. Die Deportation selbst fand am 16. Oktober statt, der Deportationszug kam aus Luxemburg (insgesamt umfasste er rund 512 Personen) und hatte bereits zahlreiche, zuvor emigrierte Juden aus dem Trierer Land an Bord. Über die Deportation aus Trier sind – im Unterschied zu anderen deutschen Großstädten wie etwa Köln13 – keine Augenzeugenberichte überliefert. Vergleichbare Berichte von anderen Transporten lassen allerdings erahnen, unter welch katastrophalen Bedingungen die Fahrt nach Litzmannstadt stattfand. Die Gestapo Trier war auch anderweitig in die Deportation der Juden mit eingebunden – so wurden beispielsweise Juden aus Sülm bei Bitburg im Februar 1942 nach Trier gebracht und dort der Gestapo übergeben.14
Die Einrichtung des Gettos
Die Deportation der Trierer nach Litzmannstadt war Teil einer Reihe von Transporten, die insgesamt etwa 20.000 Personen aus Westeuropa betrafen. Das Getto in Litzmannstadt war neben dem in Warschau die größte nationalsozialistische Einrichtung dieser Art. Neben diesen beiden gab es eine Vielzahl von „wilden“ Gettos. Die Lebensbedingungen in den Gettos waren katastrophal und von dort aus führte der Leidensweg der Menschen meist weiter in die Konzentrations- und Vernichtungslager – falls sie die Zustände im Getto überlebten. Somit spielten die Gettos eine zentrale Rolle im Verlauf der nationalsozialistischen Judenverfolgung und -ermordung. Diese verlief keineswegs linear nach des Reichsministeriums des Inneren (RMdI), Betreff : Anordnung zur Durchführung der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz (3.12.1941). 12 Pascale Eberhard/Barbara Weiter-Matysiak : Die Deportation der Trierer und Luxemburger Juden ins Getto Litzmannstadt. Zum 70. Jahrestag am 16. Oktober 2011 wurde in der Basilika in Trier eine Ausstellung eröffnet, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg 2012, S. 178–185, hier S. 179 f.; Alfred Bernd Gottwaldt/Diana Schulle : Die Judendeportationen aus dem Deutschen Reich, 1941–1945. Eine kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005, S. 64 f. 13 Corbach : 6 :00 Uhr, S. 50–54. Der Bericht wurde allerdings erst kurz nach Kriegsende verfasst. 14 http://www.bitburg-gedenkt.de/index.php/dokumente/35-ablieferungsbestaetigung.html (Letzter Zugriff : 4.1.2017).
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
einem klaren Plan, sondern war zahlreichen Einflüssen durch die Entscheidungen der Machteliten in Berlin (allen voran Heinrich Himmler oder Reinhard Heydrich), den Initiativen von lokalen Entscheidungsträgern im besetzten Europa sowie dem Kriegsverlauf unterworfen. Das Getto in Litzmannstadt spielte in diesem unübersichtlichen Geflecht eine Schlüsselrolle, da es das erste eingerichtete und das am längsten existierende Großgetto war, in dem zuerst damit begonnen wurde, ein System der Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie einzurichten. Von hier aus gingen zudem die ersten Deportationen in ein Vernichtungslager (ab Dezember 1941), und Litzmannstadt war zum Ziel der ersten Großdeportation von Menschen aus Mitteleuropa geworden.15 Eingerichtet wurde das Getto ursprünglich auf Initiative der lokalen Behörden, um die jüdische Bevölkerung der Region zusammenzufassen, dabei zu enteignen und schließlich weiter nach Osten in das sogenannte Generalgouvernement zu deportieren. Es wurde im April 1940 vom Rest der Stadt abgeriegelt, um etwa 157.000 Menschen hier zusammenzupferchen. Der Regierungspräsident Friedrich Uebelhoer brachte diese zunächst angedachte zeitliche Begrenzung der Existenz des Gettos auf den Punkt : Die Errichtung des Ghettos [sic !] ist selbstverständlich nur eine Übergangsmaßnahme[, denn das] Endziel muß jedenfalls sein, daß wir diese Pestbeule [gemeint sind die Juden in Litzmannstadt, A.d.V.] restlos ausbrennen.16
Da die Pläne, die Juden weiter nach Osten zu deportieren, jedoch scheiterten, entwickelte sich im Laufe der Zeit ein System der Zwangsarbeit für die deutsche Rüstungsindustrie. Federführend dafür waren der Leiter der nationalsozialistischen Verwaltung des Gettos, Hans Biebow, und der sogenannte Judenälteste Chaim Mordechai Rumkowski als Vorsitzender der jüdischen Gettoverwaltung. Diese jüdische Verwaltung war von den deutschen Besatzern zwangsweise eingesetzt worden und ihnen direkt unterstellt. Es handelte sich dabei um eine „Scheinautonomie“17 oder „Zwangsorganisation“18, denn bei allen wichtigen Entscheidungen und Ereignissen
15 Wolfgang Scheffler : Das Getto Łódź in der nationalsozialistischen Judenpolitik, in : Hanno Loewy/Gerhard Schoenberner (Hg.), „Unser einziger Weg ist Arbeit“. „Unzer eyntsiger ṿeg iz arbeyṭ“ : das Getto in Łódź, 1940–1944, Wien 1990, S. 12–16, hier S. 12. 16 Zit. nach : Longerich : Ermorderung, S. 62. Auf den Seiten 59–63 findet sich das komplette, hier zitierte Schreiben. 17 So die Überschrift des entsprechenden Kapitels bei Andrea Löw : Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten, Göttingen 2006, S. 97–154. 18 Dieter Pohl : Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1933–1945, Darmstadt 32011, S. 67.
247
248
|
Benjamin Koerfer
(wie etwa den späteren Deportationen) stand die deutsche Besatzungsmacht im Hintergrund.19 Rumkowski entwickelte aus dieser Position heraus die Vorgabe „Unser einziger Weg ist Arbeit“. Dahinter verbarg sich die Idee, dass „sich das Getto durch seine Arbeitsleistung für die Deutschen unentbehrlich machen musste, um zu überleben“20. Hintergrund für diese Überlegungen war die katastrophale Versorgungslage der Bevölkerung nach der Einrichtung des Gettos. Rumkowskis Idee setzte sich im Laufe der Zeit durch, was auch leichte Verbesserungen bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln etc. nach sich zog. Die Lebensbedingungen im Getto blieben dennoch hart und waren von Krankheiten, Kälte, mangelnder Hygiene, Enge und auch nach wie vor von Hunger geprägt – denn die Verpflegung wurde nach erfolgter Arbeitsleistung bemessen, so dass Kindern, alten und kranken Menschen nur sehr wenig zugeteilt wurde.21 Die Arbeit wiederum war so hart und fordernd, dass auch die Rationen für den arbeitenden Teil der Bevölkerung nicht ausreichend waren. Die örtliche Gestapo beschwerte sich dennoch im März 1942 bei Biebow, dass zu viele Lebensmittel im Getto verteilt würden.22 Im Sommer und Herbst 1941 rückte das Getto in den Fokus der nationalsozialistischen Judenpolitik im Zuge des Vorhabens, das „Altreich“ „judenfrei“ zu machen. Neben der Machtzentrale − hier sind vor allem Heydrich und Himmler zu nennen, Hitler stimmte den Deportationen wohl im September zu23 – hatten sich auch lokale Parteiinstanzen innerhalb des Reiches das Ziel gesetzt, ihre Städte „judenfrei“ zu bekommen, woraus sich ein regelrechter Wettlauf entwickelte.24 Die Entscheidung, das Getto in Litzmannstadt als Deportationsziel zu wählen, war insofern folgerichtig, weil es sich – nach nationalsozialistischen Maßstäben – um den einzigen Ort handelte, der die geplante Menschenmenge aufzunehmen im Stande 19 Für ausführliche Informationen über die Verwaltung des Gettos empfiehlt sich Peter Klein : Die Gettoverwaltung Litzmannstadt 1940 bis 1944. Eine Dienststelle im Spannungsfeld von Kommunalbürokratie und staatlicher Verfolgungspolitik, Hamburg 2009. 20 Andrea Löw : Das Getto Litzmannstadt. Eine historische Einführung, in : Sascha Feuchert/Erwin Leibfried/Jörg Riecke (Hg.), Die Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt. Supplemente und Anhang, Göttingen 2007, S. 145–165, hier S. 153. 21 Florian Freund/Bertrand Perz/Karl Stuhlpfarrer : Das Getto in Litzmannstadt (Lodz), in : Hanno Loewy/Gerhard Schoenberner (Hg.), „Unser einziger Weg ist Arbeit“. „Unzer eyntsiger ṿeg iz arbeyṭ“ : das Getto in Łódź, 1940–1944, Wien 1990, S. 17–31, hier S. 23. 22 Michael Alberti : Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939– 1945 (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 17), Wiesbaden 2006, S. 308 f. 23 Peter Longerich : Ungeschriebener Befehl. Hitler und der Weg zur „Endlösung“, München 2001, S. 187. 24 Longerich : Ermordung, S. 154.
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
war.25 Ursprünglich sollten 60.000 Menschen deportiert werden ; diese Pläne trafen die Verantwortlichen vor Ort völlig unerwartet. Sie reagierten ablehnend, weil das Getto eine so große Zahl zusätzlicher Bewohner nicht hätte aufnehmen können und erreichten nach zähen Verhandlungen eine Reduzierung der Personenzahl auf 20.000 Juden und 5.000 Sinti und Roma. Doch auch diese Zahlen bedeuteten im Angesicht der ohnehin schon prekären Versorgungslage des Gettos „ein kaum zu bewältigendes logistisches Problem“26. Mitten in diese Situation hinein führte die Trierer ihr Deportationstransport.
Das Leben der Trierer im Getto
Die Neuankömmlinge im Getto müssen, so Löw, „einen ungeheuren Schock bei der Ankunft“ erhalten haben und von einem „Gefühl der absoluten Fremdheit“27 befallen worden sein. Die Gestapo war an der Ankunft beteiligt. So schildert der Prager Jude Oskar Rosenfeld die Ankunft der Menschen aus Westeuropa : Der Zug hielt auf freiem Feld. Die Coupétüren wurden aufgerissen. Müde, zerquält, in den Händen Koffer, auf den Rücken die Rucksäcke, unter den Armen die Bündel, so krochen mehr als tausend Menschen die Trittbretter hinab. Tiefer Kot, Schlamm, Wasser, wohin sie traten. Es war Herbst. Polnisch-russischer Herbst. Feldgraue Gestapo trieb an. „Vorwärts ! Lauf ! Lauf !“, schrien blonde gutgenährte Jungens. Unvergesslich der eine, mit rötlichem borstigen Bart und rötlichen Augenbrauen, stechendem Blick, schnarrender Stimme. Er schrie die ‚Neueingesiedelten‘ an : „Lauf du Judensau“, stieß gegen Frauen, die nicht wussten, wohin sie sich wenden sollen. Wo war man gelandet ? Wem gehörte man ? Wo war die hilfreiche Hand, die sich entgegenstreckte ? Wer übernahm die 1000, die in die Öde von Lodz hineingeschleudert worden waren ? Nichts, nichts. Man kam nicht zur Besinnung. Das Hirn war leer, man vergaß sogar daran, dass man einen Tag und eine Nacht fast nichts gegessen hatte.28
Während bei den Neuankömmlingen Bestürzung und Schock über die Verhältnisse im Getto vorherrschten, sie „befremdet und wohl auch entsetzt über den Ort waren“29, waren die bereits internierten Juden überrascht vom optisch guten Zustand 25 Alberti : Verfolgung, S. 389. 26 Ebd., S. 396. 27 Löw : Juden im Getto Litzmannstadt, S. 231. 28 Zit. nach : ebd., S. 232. 29 Angela Genger/Hannelore Steinert : Früher gültige Regeln griffen nicht mehr. Die ersten Monate der aus Düsseldorf Deportierten im Getto Litzmannstadt − Oktober 1941 bis April 1942,
249
250
|
Benjamin Koerfer
und der teuren Kleidung der „Westjuden“. Auch noch im Getto war deren Kaufkraft höher als die der polnischen Juden, so daß sie einen Großteil der knappen Waren aufkaufen konnten.30 Schon sehr bald verschob sich diese monetäre Kluft jedoch und die Neuankömmlinge waren auf Unterstützung der restlichen Bevölkerung angewiesen. Nachdem die mitgebrachten Lebensmittel aufgebraucht waren, musste die Versorgung der „Westjuden“ zunächst auf Gemeindekosten erfolgen. Die Neueingetroffenen wurden von den schon zuvor Internierten mit Nahrung versorgt, etwa durch zentral organisierte Ausgabe von Suppen in den Massenunterkünften.31 Diese sogenannten Kollektive der „Westjuden“ wurden im Wesentlichen in den Schulen des Gettos eingerichtet. Sie waren nach der Herkunft des jeweiligen Transports benannt. Diese Form der Unterbringung war als Übergangslösung geplant und dem begrenzten Raum im Getto geschuldet.32 Die Verhältnisse in diesen Kollektiven waren katastrophal. Es war räumlich sehr eng, wodurch weder Privatsphäre noch Rückzugsmöglichkeiten oder ausreichende sanitäre Einrichtungen existierten.33 Ein Augenzeuge beschreibt die Kollektive daher als „Nester des Elends und zahlloser Krankheiten“34. Oskar Singer, aus Prag stammend und selbst eine Zeit lang in einem Kollektiv wohnhaft, nennt sie eine „Hölle“35, die nicht besser gewesen sei als das Gettogefängnis. Am 9. November besuchte der „Präses“ einige Kollektive, unter anderem das des Luxemburger Transports. Der Augenzeuge Szmul Rozensztajn schilderte seine Eindrücke (im Vergleich mit dem zuvor besuchten Kollektiv von Juden aus Prag) wie folgt : in : Angela Genger/Hildegard Jakobs (Hg.), Düsseldorf, Getto Litzmannstadt, 1941, Essen 2010, S. 87–117, hier S. 87 f. 30 Dawid Sierakowiak/Alan Adelson/Kamil Turowski : The diary of Dawid Sierakowiak. Five notebooks from the Łódź ghetto, New York 1996, S. 142. Hier heißt es : „They are dressed splendidly (you can tell they haven’t lived in Poland). They are buying up all they can in the ghetto, and all the prices have doubled.“ 31 Krystyna Radziszewska : Deutschsprachige Juden im Getto Lodz/Litzmannstadt 1941–1944, in : Stefan Dyroff/Krystyna Radziszewska/Isabel Röskau-Rydel (Hg.), Lodz jenseits von „Fabriken, Wildwest und Provinz“. Kulturwissenschaftliche Studien über die Deutschen in und aus den polnischen Gebieten (Polonio-Germanica, Bd. 4), München 2009, S. 129–150, hier S. 135 f. 32 Avraham Barkai : Hoffnung und Untergang. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Hamburg 1998, S. 237 und 240. 33 Avraham Barkai : Between East and West. Jews from Germany in the Łódź Ghetto, in : Yad Vashem Studies 16 (1984), S. 271–332, hier S. 288 f. und 293. 34 Janusz Gumkowski/Adam Rutkowski/Arnfrid Astel : Briefe aus Litzmannstadt, Köln 1967, S. 67 f. 35 Oskar Singer : „Im Eilschritt durch den Gettotag…“, in : Oskar Singer/Sascha Feuchert (Hg.), Im Eilschritt durch den Gettotag. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, Berlin 2002, S. 27–175, hier S. 42.
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
Much worse is the shelter for the Jews from Luxembourg, where some 500 people live in four rooms of modest size. There are no plank beds, not even chairs. Everyone sleeps on the floor, together with their few belongings.36
Nach einigen Wochen war es den „Neueingesiedelten“ gestattet, die Kollektive zu verlassen und in Wohnungen im Getto einzuziehen. Auf den Anmeldekarten und der Deportationsliste des gesamten Luxemburger Transports wurden die neuen Adressen der Menschen festgehalten. Eine Auswertung dieser Quellen ermöglicht die Identifikation derjenigen Straßenzüge, in welchen die Deportierten aus Trier unterkamen. Gettostraßen,* in denen nachweislich Deportierte aus Trier gewohnt haben Adresse Polnischer traßenname S
Deutscher Straßenname
Personenzahl aus Trier insgesamt
Verschiedene Familien (teilweise unter derselben Adresse gemeldet)
Talweg
Dolna
26
12
Baluter Ring
Balucki Rynek
12
8
Korbgasse
Koszykowa
12
5
Trödlergasse
Szklana
9
3
Hanseatenstr.
Lagiewnicka
9
4
Gänsestr.
Gesia
8
3
Richterstr.
Mickiewizca
8
2
Zimmerstr.
Drukarska
4
3
Rastweg/-straße
Orawska
3
2
Storchengasse
Masarska
3
2
Wirkergasse
Stefana
2
1
Hohensteinerstr.
Zgierska
2
1
Blattbinderstraße/-gasse
Lotnicza
2
1
Reiterstraße
Urzednicza
1
1
Alt Markt
Stary Rynek
1
1
16
–
Ohne Adresse Tab. 1: Unterkünfte der Trierer Deportierten im Getto Litzmannstadt.
* Eigene Darstellung auf Basis einer Kombination aus Daten der Deportationsliste des Luxemburger Transports, Archiwum Państwowe Łodzi (APL), PSZ, L-19621, Bl. 84–110; und Meldekarten von Deportierten aus Trier, APL, PSZ, L-21125, L-21116, L-21120, L-21111, L-21117, L-21107.
36 Zit. nach : Alan Adelson/Robert Lapides/Marek Web : Lodz ghetto. Inside a community under siege, New York 1989, S. 188.
251
252
|
Benjamin Koerfer
Die Trierer haben demnach relativ konzentriert gelebt : Insgesamt 42,4 % der Trierer, denen eine Adresse zugeordnet werden konnte, und 51 % der Trierer Familien sind in nur drei Straßen gemeldet : dem Talweg, dem Baluter Ring und der Korbgasse. Hinzu kommen noch weitere vier Straßen mit neun bzw. acht gemeldeten Personen. Diese Straßen lagen vor allem im westlichen Teil des Gettos. Für das Frühjahr 1942 sind nochmals einige Fälle dokumentiert, bei denen die Gestapo aktiv in das Schicksal der deportierten Trierer eingriff. In Trier liefen noch immer die Verfahren zur Enteignung der deportierten Personen. Im Zuge dieser Vorgänge wurden einzelne der Trierer Juden bezüglich ihrer Vermögenswerte und Immobilien auf dem Gettogelände durch die Gestapo befragt. Die Aussagen der Personen wurden daraufhin für die weiteren Verfahren bezüglich der Erbfolgereglungen genutzt.37 Der Versuch, die Enteignung wie einen rechtsstaatlichen Vorgang wirken zu lassen, ist hieran klar zu erkennen. Der „Präses“ Rumkowski versuchte von Anfang an, mit einer Mischung aus „Fürsorge und Drohgebärden“, die „Westjuden“ „zur Arbeitsleistung zu verpflichten und ihnen schlicht und ergreifend die Illusion zu nehmen, der Aufenthalt hier sei als schlechte Zwischenetappe zu betrachten“38 – Ziel der Gettoverwaltung war die Integration der Neueingesiedelten in das bestehende System des Gettos und die Nutzbarmachung ihrer Arbeitskraft für die Gemeinschaft. Das ausführende Werkzeug der Gettoverwaltung stellte dabei die neugeschaffene „Abteilung für Eingesiedelte“ dar. Rumkowski sah sich in einer Rede vom 20. Dezember 1941 dazu veranlasst, folgende Worte an die Neueingesiedelten zu richten : Wir haben alle in gleichem Maße gastfreundlich aufgenommen. Alles, was wir selber besaßen – unser Obdach und unser Essen – haben wir mit den Neueingesiedelten geteilt. Mehr als wir unser Eigen nannten, vermochten wir ihnen nicht anzubieten. Leider haben nicht alle Neuankömmlinge unsere guten Absichten verstanden. […] [L]eider muss aber offen gesagt werden, dass ein sehr beträchtlicher Prozentsatz davon als niederträchtige Personen zu bezeichnen ist.39
Die Enttäuschung des „Präses“ rührte daher, dass der Großteil der Neueingesiedelten für die Arbeitsanforderungen in der Gettowirtschaft nicht geeignet war. Seine Hoffnung hatte darin bestanden, junge und arbeitsfähige Personen zu erhalten, am 37 LHA Koblenz, Best. 572, Nr. 15959. Hier lassen sich für die betroffene Personengruppe drei derartige Vorgänge nachweisen. 38 Klein : Gettoverwaltung, S. 427. 39 Zit. nach : Sascha Feuchert/Imke Janssen-Mignon : Die Chronik des Gettos Litzmannstadt. 1941, Göttingen 2007, S. 313 f.
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
liebsten Handwerker und Arbeiter, um die Arbeitsleistung des Gettos zu erhöhen. Diese Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht,40 denn bei den Neueingesiedelten handelte es sich „insgesamt um eine Gruppe mit nur wenigen einsetzbaren Arbeitskräften, was das Integrationsproblem für Rumkowski noch verstärkte : Sie stellten eine Belastung dar, waren ‚unproduktiv‘ und passten nicht in sein Konzept der ‚Rettung durch Arbeit‘“41. Aufgrund ihres Alters waren die meisten Neuankömmlinge nicht in der Lage, die schweren körperlichen Arbeiten bei prekärer Versorgung zu erledigen. Neben der Altersstruktur waren auch die Berufe der Neueingesiedelten oft wenig hilfreich : Für Akademiker, Künstler etc. war es ein regelrechter Schock, dass sie im Getto plötzlich „niedere“ Aufgaben und körperliche Arbeit verrichten sollten.42 Andererseits waren im Getto ohnehin nicht mehr genug freie Arbeitsstellen vorhanden, die von den Neuankömmlingen hätten besetzt werden können. So gelang es nur einigen speziellen Berufsgruppen (vor allem Beamten und Ärzten), Arbeit zu finden. Diese beiden Hindernisse bei der Integration in die Arbeitswelt des Gettos lassen sich auch für die Deportierten aus Trier feststellen, auch wenn es noch keine belastbaren Zahlen zu ihrer tatsächlichen Integration in die Arbeitswelt des Gettos gibt. Betrachtet man zunächst die Altersstruktur der Trierer Deportierten im Vergleich zu der des gesamten Luxemburger Transports prozentual, erkennt man, dass die Trierer im Durchschnitt älter waren als die Deportierten aus Luxemburg. Ähnlich problematisch stellte sich auch die Berufsstruktur der Trierer dar, bei der sich eine nach Geschlechtern unterteilte Untersuchung anbietet. Daraus wird ersichtlich, dass die Frauen meist keinen Beruf erlernt hatten und als Hausfrauen tätig waren. Bei den Männern handelte es sich vor allem um Kaufleute. Arbeiter und Handwerker waren weit weniger vertreten. In Kombination mit dem hohen Alter der meisten Deportierten und dem relativ hohen Anteil an Kindern wird deutlich, dass die Trierer für die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Getto nur sehr unzureichend geeignet waren. Dieser geringe ökomische „Nutzen“ für die Gettogesellschaft erschwerte die Integration der Neueingesiedelten zusätzlich. Zwar ist in den offiziellen Quellen der Gettoverwaltung häufiger die Rede davon, dass sich die „Westjuden“ nach einiger Zeit gut eingefügt hätten43 ; liest man jedoch die persönlichen Berichte von Zeit40 Klein : Gettoverwaltung, S. 428. 41 Löw : Juden im Getto Litzmannstadt, S. 233 f. Siehe auch : Löw : Das Getto Litzmanstadt, S. 156 f.; Freund/Perz/Stuhlpfarrer : Das Getto in Litzmannstadt (Lodz), S. 26 : „Sie [die Westjuden, A.d.V.] waren nicht in erster Linie jene Arbeitskräfte, die er benötigt hätte, sondern zu einem erheblichen Teil ältere Menschen, die nur Wohnstellen und Lebensmittelversorgung beanspruchten.“ 42 Radziszewska : Deutschsprachige Juden, S. 141 f. 43 Feuchert/Janssen-Mignon : Chronik, S. 61–67.
253
254
|
Benjamin Koerfer
zeugen, erkennt man, dass die Neueingesiedelten von der restlichen Bevölkerung relativ isoliert blieben. Oskar Singers Essay „Zum Problem Ost und West“ ist hierfür ein gutes Beispiel. Er führt aus : Freilich, der echte deutsche Jude brachte auch allerhand Eigenschaften mit, die ihm sehr schnell die Sympathien verscherzten […]. Das erste, was er tat, war eine verletzende Kritik an allen äußeren Umständen des Gettos. […] Der Neueingesiedelte reagierte mit allen Kräften des Andersgearteten. Er schimpfte, schmähte, beleidigte. Seine Arroganz, die schon früher auszeichnete, tobte sich aus. […] [J]eder deutsche Jude wollte schon sofort nach Ankunft organisieren. Nun, das Getto war aber schon organisiert und zwar besser, als der deutsche Jude auch nur ahnte.44
Unter diesem Umständen sei ein fruchtbares Miteinander zwischen den Opfergruppen nicht zu Stande gekommen : Man verstand einander nicht und die Vorbehalte wuchsen. Die Politik der jüdischen Verwaltung hatte außerdem die Separierung der Gruppen zur Folge, die auch an der räumlichen Konzentration der Trierer Juden deutlich wird.45 Kontakte der westeuropäischen Juden mit den osteuropäischen dürften daher als Ausnahme anzusehen sein, wie auch Löw es bestätigt : Kontakt mit den polnischen Juden hatten nur wenige. Anfangs kam es aufgrund der getrennten Wohnverhältnisse kaum zu Begegnungen, die über den Handel mit Waren hinausgingen. […] Die auf beiden Seiten vorhandenen Fremdheitsgefühle konnten in den meisten Fällen nicht überwunden werden.46
Tod im Getto und Deportationen ins Vernichtungslager: Das weitere Schicksal der Trierer
Nach bisherigen Erkenntnissen überrascht es wenig, dass die Überlebenschancen der Trierer Juden sehr schlecht waren. Mindestens 19,5 % der untersuchten Gruppe verstarben bis zum April 1942, also nach etwa einem halben Jahr im Getto. Neben der Arbeitsbelastung und der mangelnden Versorgung dürften vor allem Krankheiten, der harte Winter, aber auch Suizid-Fälle, die Hauptursachen dafür gewesen sein. Die Sterbequote der Trierer lag damit ungefähr bei demselben Wert 44 Oskar Singer : Zum Problem Ost und West. Essays, in : Oskar Singer/Sascha Feuchert (Hg.), Im Eilschritt durch den Gettotag. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, Berlin 2002, S. 177– 206, hier S. 188 f. 45 Ebd., S. 197 f. 46 Löw : Juden im Getto Litzmannstadt, S. 259.
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
Abb. 1: Die Bekanntmachung Nr. 380 der jüdischen Gettoverwaltung bereitete die „Aussiedlung“, sprich Deportation, der aus Trier und Luxemburg stammenden Juden in die Vernichtungslager vor. (Quelle: Eberhard: Briefe, S. 61).
wie die des Luxemburger Transports : Für diesen haben Isaiah Trunk und Robert Moses Shapiro einen Wert von 19,3 % ermittelt.47 Parallel zur Dezimierung der Gettobevölkerung durch die Lebensbedingungen liefen ab Dezember 1941 die Deportationen ins Vernichtungslager nach Chelmno/ Kulmhof – die Gettobeweohner Litzmannstadts waren damit die ersten Opfer der nationalsozialistischen Vernichtungslager.48 Das Lager wurde zum „Zentrum für die Ermordung der Juden im Ghetto [in] Łódź sowie dem gesamten […] War
47 Isaiah Trunk/Robert Moses Shapiro : Lodz Ghetto. A History, Bloomington 2006, S. 217. 48 Die Mordtechnik in Chelmno war noch nicht so effizient wie die in späteren Lagern. Statt Gaskammern wurden in diesem Lager Gaswagen verwendet. Zum Ablauf der Tötungen in Chelmno siehe Peter Klein : Kulmhof/Chelmno, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 8, München 2008, S. 301– 328, hier S. 307 f.; ein Augenzeugenbericht findet sich bei Pohl : Verfolgung, S. 88.
255
256
|
Benjamin Koerfer
thegau“49. Die erste Opfergruppe waren Sinti und Roma, gefolgt von polnischen Juden.50 Als diese erste Phase der Deportationen im April des Jahres 1942 endete, waren laut jüdischer Verwaltung insgesamt 44.056 Personen deportiert und somit ermordet worden.51 Im Mai 1942 gerieten die „Westjuden“ – und damit auch die Trierer – in den Fokus. Wie genau es zu der Entscheidung kam, diese Personengruppe ebenfalls in das Vernichtungslager zu deportieren, ist immer noch nicht geklärt. Michael Alberti oder Peter Longerich etwa vermuten hier jedoch tatsächlich die Umsetzung eines von der Machtzentrale in Berlin vorgegebenen Plans, der den lokalen Akteuren aber große Handlungsspielräume ließ.52 In der ersten Maihälfte 1942 wurden insgesamt 10.915 Personen aus dem Getto Litzmannstadt deportiert. Darunter befanden sich auch 41 Personen aus der untersuchten Gruppe. Dies entspräche fast der Hälfte (49,4 %) der gesicherten Schicksale dieser Personengruppe. Die Deportationsdaten gehen aus den Meldekarten der Gettobewohner hervor, wo für den Großteil der 5. und 10. Mai als Deportationsdatum eigetragen wurden.53 Die Deportationswelle endete offiziell am 15. Mai, nach ihr waren nur noch wenig mehr als 20 % der untersuchten Trierer, deren Schicksal bekannt ist, am Leben. Im September 1942 kam es zu einer dritten Deportation. Bei der „Sperre“ sollten gezielt Kinder unter 10 Jahren, Senioren über 65 Jahren sowie Kranke deportiert werden, um Litzmannstadt zu einen reines Arbeitsgetto zu machen. In den Aufzeichnungen der Gettoinsassen wird der Schrecken dieser Tage erfahrbar.54 Anders als bei den Deportationen zuvor meldeten sich die meisten Ausgewählten 49 Shmuel Krakowski : Chelmno, in : Israel Gutman (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, 3 Bde., Berlin 1993, Bd. 1, S. 280–283, hier S. 280. 50 Feuchert/Janssen-Mignon : Chronik, S. 42 f., 52, 80 f., 85–88. Strafffällig gewordene Personen und solche ohne Arbeitsstelle sollten primär ausgewählt werden. Bei Löw : Juden im Getto Litzmannstadt, S. 266, fällt die Bezeichnung „Ruhestörer“ für die ersten Deportierten. 51 Feuchert/Janssen-Mignon : Chronik, S. 99. 52 Peter Longerich : Der Beginn des Holocaust in den eingegliederten polnischen Gebieten. Überlegungen und Tendenzen der neueren Forschung, in : Jacek Andrzej Młynarczyk/Jochen Böhler (Hg.), Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten. 1939–1945 (Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, Bd. 21), Osnabrück 2010, S. 15–25, hier S. 18 f.; Alberti : Verfolgung, S. 443. 53 Allerdings muss man anmerken, dass die Deportations- bzw. − wie es offiziell euphemistisch hieß − die „Abmeldedaten“ erst im Nachhinein eingetragen wurden, so dass hier eine Quelle für Ungenauigkeiten in den Aufzeichnungen liegen könnte. 54 Löw : Juden im Getto Litzmannstadt, S. 292 : „Die Menschen im Getto schilderten diese Tage im September 1942 atemlos und gehetzt. […] Ihrem Schmerz über den Verlust der Angehörigen gaben die Menschen in Selbstzeugnissen auf eine Weise Ausdruck, die die Bedeutung des nationalsozialistischen Terrors für den Einzelnen erahnen lässt.“
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
diesmal nicht an den Sammelpunkten. Stattdessen wurden die Kinder und die Alten versteckt. Deutsche Kräfte betraten daraufhin das Getto und nahmen Selektionen unter der Bevölkerung vor. Dabei kam es zu tumultartigen Szenen : Eltern, die ihre Kinder nicht hergeben wollten, wurden oft standrechtlich erschossen oder zusammen mit ihren Kindern deportiert.55 Nachweislich wurden zehn der Trierer im September 1942 deportiert, von denen sieben nicht den ursprünglichen Vorgaben der Deportation entsprachen, also zwischen zehn und 65 Jahren alt waren. Diese Zahlen verdeutlichen im kleinen Rahmen, wie sehr das Getto zu dieser Zeit im Chaos versank, und dass willkürlich nach Augenmaß durch die Deutschen entschieden wurde, wer in den Tod geschickt werden sollte. Nach der „Sperre“ lebten wohl insgesamt nur noch rund 5.000 „Westjuden“ im Getto. Ihre Spur verliert sich innerhalb der Gettogesellschaft, wie auch die der (wenigen) verbliebenen Trierer. Der letzte aufgeklärte Todesfall einer Triererin ist auf den 14. Januar 1944 zu datieren.56 In diesem Jahr fiel auch die Entscheidung, das Getto endgültig aufzulösen und die Überlebenden nach Chelmno/Kulmhof und Auschwitz zu bringen. Im größten NS-Konzentrations- und Vernichtungslager wurde schließlich auch der „Judenälteste“ Rumkowski ermordet. Auf dem Gettogelände überlebten nur einige hundert Menschen, die zum Aufräumkommando gehörten oder sich versteckten, bis am 19. Januar 1945 das Getto schließlich befreit wurde. Aus der graphischen Darstellung (siehe Abb. 2) gehen nicht nur die mutmaßlichen Todeszeiträume der Trierer Juden hervor,57 sondern es wird auch deutlich, wie viele Schicksale nach wie vor ungeklärt sind. 55 Schilderungen dieser Vorgänge finden sich in vielen persönlichen Aufzeichnungen. Siehe etwa : Richard Bugajer/Reinhard Engel : Mein Schattenleben. Eine Jugend im Ghetto und KZ, Wien 2000, S. 63–68 ; auf S. 67 f. heißt es etwa : „Wie ein Hurrikan sind diese Bestien ins Ghetto gefegt, haben jedes Haus durchstöbert, jeden Winkel, jeden Keller, jeden Schrank nach versteckten Säuglingen, kleinen Kindern, alten Menschen oder auch nur nach Menschen, deren Gesicht ihnen nicht gepasst hat. Sie haben nach Lust und Laune in die Menschenmenge geschossen.“ In der Forschungsliteratur finden sich sehr genaue Darstellungen in : Shmuel Krakowski : Das Todeslager Chełmno/ Kulmhof. Der Beginn der „Endlösung“. Göttingen 2007, S. 113–119. 56 APL, PSZ, L-20539 II, Bl. 158, Statistische Abteilung : Todesfälle 17. bis 23. Januar 1944. 57 Anzahl der Deportations- und Todesopfer aus Trier in verschiedenen Zeiträumen, eigene Darstellung auf Basis einer Kombination aus folgenden Quellen : Meldekarten von Deportierten aus Trier (APL, PSZ, L-21125, L-21116, L-21120, L-21111, L-21117, L-21107, diverse Blätter) ; Liste des Stadtarchivs (Trier vergisst nicht. Gedenkbuch für die Juden aus Trier und dem Trierer Land, Trier 2010, S. 22–26) ; Todesliste Luxemburg (APL, PSZ, L-19792, Bl. 5–7) ; Statistische Abteilung : Aufstellung der Todesfälle 17.–23. Januar 1944 (APL, PSZ, L-20539 II, Bl. 158) ; Liste der gemeldeten Todesfälle 1942 (APL, PSZ, L-19581, Bl. 22, 197, 222, 255, 262, 264) ; Liste der am 6.3.1942 verstorbenen Neueingesiedelten (APL, PSZ, L-19829, Bl. 23).
257
Todeszeitraum Anzahl Todesopfer in verschiedenen Zeiträumen
258
|
bis Ende 1941 2
Benjamin Koerfer
Anzahl Opfer aus Trier in verschiedenen Zeiträumen (N=118) unbekannt nach September 1942 im September 1942 Mai bis September 1942 im Mai 1942
Zeitraum
bis Mai 1942 bis Ende 1941
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Abb. 2: Die Anzahl der Opfer in verschiedenen Zeiträumen (N=118). (Quelle: eigene Berechnungen).
Fazit
Schon die hier vorgenommene schlaglichtartige Betrachtung verdeutlicht, inwieAnzahl an Opfern fern die Gestapo in den Prozess der Judenverfolgung involviert war. Sowohl bei der Vorbereitung der Deportation als auch bei der anschließenden Enteignung der Betroffenen war sie beteiligt, interessanterweise nicht nur in der Heimat der Deportierten, sondern auch noch am Ziel der Deportation. Diese Vorgänge – die hier bezüglich der nach Litzmannstadt Deportierten dargestellt wurden – vermitteln einen Eindruck davon, warum eine eingehendere Untersuchung dieser Zusammenhänge im regionalen Kontext zielführend wäre. Die Untersuchung des Schicksals der Deportierten aus Trier in Litzmannstadt hat bereits neue Erkenntnisse gebracht. Nachdem sie im Herbst 1941 in das Getto deportiert worden waren, waren sie dort umgehend mit den überaus harten Bedingungen des Gettolebens konfrontiert. Den Herausforderungen, die sich ihnen stellten, konnten sie nicht gewachsen sein, da sie überdurchschnittlich alt und von ihren erlernten Berufen her ungeeignet für die Gettowirtschaft waren. Ihre räumliche Konzentration in Kombination mit den Eindrücken über die Integration der gesamten „Westjuden“ lässt darauf schließen, dass es nur zu einer sehr geringen Interaktion mit den polnischen Juden im Getto kam. Viele Trierer starben binnen eines halben Jahres an den Folgen des harten Lebens in Litzmannstadt. Die großen Deportationen aus dem Getto nach Chelmno/Kulmhof im Mai und September
Die Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Trier
|
1942 trafen sie überaus hart, so dass von überlebenden Trierern in Litzmannstadt bislang nichts bekannt ist. Ordnet man das Schicksal der Trierer Juden in den gesamten Prozess der Judenvernichtung in Europa ein, so bleibt festzuhalten, dass die hier untersuchte Gruppe zu den ersten Juden aus dem „Altreich“ gehörte, die aus West- und Mitteleuropa nach Polen deportiert wurden. Vor ihnen waren zwar schon Juden osteuropäischer Herkunft verschleppt worden, jedoch nie Personen, die seit Generationen im Deutschen Reich ansässig waren. Zusätzlich waren sie im zweitgrößten nationalsozialistischen Getto interniert und wurden in großer Zahl Opfer des ersten Vernichtungslagers der Geschichte. Die Recherchen, die diesen Ausführungen zugrunde liegen, haben auch wichtige Erkenntnisse für die lokale Geschichtsschreibung Triers geliefert. So konnten bei 18 Personen erstmals Todesdaten ermittelt werden – ihr Schicksal galt bislang als „unbekannt“. Bei elf Deportierten wurden Todesdaten gefunden, welche dem bisherigen Forschungsstand in Trier widersprechen.58 Schon allein diese Widersprüche und die immer noch hohe Zahl unbekannter Schicksale von Trierern verdeutlichen, dass nach wie vor Bedarf an weiteren Forschungen zur Thematik besteht. Andere deutsche Städte, wie etwas Düsseldorf oder Berlin, in denen jeweils umfassende Studien zur Deportation der jüdischen Bevölkerung vorgelegt wurden, sind hier ein großes Stück weiter.
58 Benjamin Koerfer : Neue Erkenntnisse über das Schicksal von Juden aus der Region Trier im Getto Litzmannstadt, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg (2015), S. 179–191.
259
Andreas Borsch
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden in der Vulkaneifel Überlegungen zum öffentlichen Raum und seiner Funktionalisierung im Nationalsozialismus
Die öffentliche Diskussion um den rechtmäßigen Erwerb der mehr als 1.500 Kunstwerke aus dem Nachlass des Kunsthändlers und Museumsdirektors Hildebrand Gurlitt (1895–1956), die sein Sohn Cornelius in München und Salzburg verwahrte, verdeutlicht, welches Potential dem Forschungskomplex der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung innewohnt. Der Fall wurde breit rezipiert und löste emotionale Diskussionen aus. Dieser spektakuläre Fall soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass bis heute ungezählter geraubter „Hausrat“ jüdischer Mitbürger noch in so manchem Haushalt stehen mag. Gerade dieser Umstand verdeutlicht, dass die Erforschung der wirtschaftlichen Existenzvernichtung bis in den sozialen Nahbereich langt. Zudem führt es vor Augen, dass auch über 70 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft diese mitnichten vollständig erforscht ist. Die Aktualität des Themenkomplexes forciert geradezu eine intensivere Auseinandersetzung mit der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung, da eine ausreichende wissenschaftliche Erschließung für viele Regionen bisher fehlt. Sie trat lange Zeit hinter die Erforschung der physischen Vernichtung, der Shoah, zurück.1 Die erste Arbeit zum Thema legte Helmut Genschel im Jahr 1966 vor.2 Er konnte aber zunächst keine entscheidenden Impulse für eine weitere Beschäftigung mit der Thematik aussenden. Zwei Jahrzehnte später veröffentlichte Avraham Barkai seine Studie zum Thema.3 Durch seine Auseinan1 Zunächst war die wirtschaftliche Existenzvernichtung Bestandteil von Studien zur Judenverfolgung oder -vernichtung. So werden in der Studie von Uwe D. Adam (Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1979) im vierten Kapitel die „Stationen der Ausschaltung aus der Wirtschaft“ (S. 145– 203) nachgezeichnet. Der monumentale Beitrag zur Judenvernichtung von Hans G. Adler (Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974) tangiert die wirtschaftliche Exklusion der jüdischen Bevölkerung ebenfalls, indem er in Kapitel 18 die finanzielle Ausbeutung infolge der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz erörtert (S. 491–545). Vgl. auch ebd., S. 166. 2 Helmut Genschel : Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen 1966. 3 Avraham Barkai : Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933–1943, Frankfurt a. M. 1987.
262
|
Andreas Borsch
dersetzung mit Genschels Studie erfuhr der junge Forschungszweig einen methodisch neuen Zugriff sowie einen Perspektivwechsel.4 Im Jahr 1997 verfasste Frank Bajohr eine weitere Arbeit zum Thema,5 welche − wie die beiden vorgenannten − heute als Standardwerk gilt. Es kann konstatiert werden, dass es ab den 1990er Jahren zu einer Zunahme der Forschungstätigkeit in diesem Feld kam. Einen Überblick über die europäische Forschertätigkeit zum Themenkomplex lieferte 2008 Martin Dean,6 während Benno Nietzel 2009 die bisherigen deutschen Ergebnisse zusammenfasste.7 Für den hier behandelten Raum stellt sich die Quellenlage als sehr lückenhaft dar. Ein Grund dafür dürfte die gezielte Vernichtung von Akten sein.8 Dementsprechend liegen für manche Teilaspekte detailreiche Dokumente vor, wohingegen für andere Bereiche entweder gar keine oder nur rudimentäre Artefakte überliefert sind. Hervorzuheben sind die Bestände „Bezirksamt für Wiedergutmachung“ (540,002), „Finanzamt Daun“ (572,014), „Landgericht Trier“ (583,002) und „Notariate“ (587A) des Landeshauptarchivs (LHA) Koblenz sowie die Akten des Amtes für Wiedergutmachung Saarburg (AfWS).9 Diese regionalgeschichtliche Studie porträtiert einen Teilausschnitt aus einem regionalen Verdrängungsgeschehen. Der stark agrarisch geprägte Untersuchungsraum besteht aus den fünf in direkter Nähe zueinander liegenden Orten Gerolstein, Hillesheim, Jünkerath, Stadtkyll und Lissendorf, die im heutigen Rheinland-Pfalz in der Vulkaneifel angesiedelt sind und im Untersuchungszeitraum jüdische Bürger
4 Eine Übersicht des teils heftig geführten Streits mit Berücksichtigung der „Goldhagen-Debatte“ gibt Ian Kershaw (Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Reinbek bei Hamburg 32002). 5 Frank Bajohr : „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933– 1945, Hamburg 1997. 6 Martin Dean : Robbing the Jews. The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust 1933–1945, Cambridge 2008. 7 Benno Nietzel : Die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der deutschen Juden 1933–1945. Ein Literatur- und Forschungsbericht, in : Archiv für Sozialgeschichte 49 (2009), S. 561–613. 8 Bevor Anfang März 1945 amerikanische Truppen in die Vulkaneifel einrückten, erging im Februar desselben Jahres die Direktive des Reichswirtschaftsministeriums an „alle zuständigen regionalen Institutionen zur Vernichtung“ der sogenannten Entjudungsakten ; vgl. Bajohr : Hamburg, S. 22. 9 Eine Facharbeit aus dem Jahr 1981 kann als erste Studie angesehen werden, die Verdrängungsmaßnahmen und Übertragungen jüdischer Geschäfte in „arischen“ Besitz für Gerolstein nachweist ; vgl. Christoph Stehr : Die jüdische Bevölkerung in Gerolstein bis 1945, in : Gegen das Vergessen. Das Schicksal der Gerolsteiner Juden, Gerolstein ²2009, S. 15–34.
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
beheimateten.10 Dabei liegt der Fokus auf den 30 jüdischen Gewerbetreibenden, die für den Untersuchungsraum ermittelt werden konnten.11 Dieses wirtschaftliche Verdrängungsgeschehen wird vom Großteil der bisherigen Forschung als „Arisierung“12 bezeichnet. Der Begriff wurde erstmals in völkisch-antisemitischen Verlautbarungen der 1920er Jahre verwendet und ging einher mit der Forderung nach einer „arischen Wirtschaftsordnung“, die die Exklusion der Juden aus dem Wirtschaftsleben beinhaltete. Dieser Neologismus wurde ab Mitte der 1930er Jahre im behördlichen und medialen Sprachgebrauch des „Dritten Reichs“ verwendet und fand zunehmend Eingang in die Alltagssprache der Bevölkerung. Während der NS-Herrschaft erfuhr der Begriff der „Arisierung“ keine offizielle Definition.13 Daneben findet sich auch der Terminus „Entjudung“, welcher ab der Machtübergabe die wirtschaftliche Verdrängung der Juden bezeichnete. Beide Begriffe wurden oft synonym verwendet. Zur Zeit des Nationalsozialismus erfuhr der Begriff der „Arisierung“ eine Begriffserweiterung. Unter dieser wurden die Übertragung jüdischer Häuser, Geschäfte, Unternehmen oder Grundstücke in „arische Hände“ sowie die „Arisierung“ einer Branche oder der ganzen Wirtschaft zusammengefasst. Zudem findet sich auch eine Erweiterung des Begriffs auf immaterielle Felder, wie die Forderung der „Arisierung“ von Jesus seitens der Deutschen Christen oder das Ernennen von Nichtariern zu „Ehrenariern“. Im Gegensatz dazu rekurriert die vorliegende Analyse auf die Kritik14 am Begriff der „Arisierung“ und operiert mit dem Terminus der wirtschaftlichen Exis10 Während Stadtkyll zum Altkreis Prüm gehörte, zählten die anderen Orte zum Altkreis Daun. Zum Landjudentum vgl. Monika Richarz/Reinhard Rürup (Hg.) : Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, Tübingen 1997. 11 Andreas Borsch : „Arisierung“ in der Vulkaneifel. Analyse zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1939, Magisterarbeit Trier 2016, S. 99–101. 12 Christiane Fritsche : Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt. Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim, Mannheim 2013, S. 14. 13 Britta Bopf : „Arisierung“ in Köln. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933–1945, Köln 2004, S. 11. 14 Van Laaks begriffsgeschichtliche Auseinandersetzung, auf die sich der Großteil der Forschung bezieht, harrt noch einer Fortsetzung ; vgl. Dirk van Laak : Die Mitwirkenden bei der „Arisierung“. Dargestellt am Beispiel der rheinisch-westfälischen Industrieregionen 1933–1940, in : Ursula Büttner (Hg.) : Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich, Hamburg 1992, S. 231–257, hier S. 253. Kritik wird des Weiteren hinsichtlich einer tendenziellen Verengung der Forscherperspektive artikuliert, was zu einer Ausblendung der Liquidierungen von jüdischen Betrieben und zu einer Begrenzung des Blickfeldes auf die Täter und Nutznießer führe, wodurch die Verfolgten nur am Rande vorkämen ; vgl. Martin Rappl : „Unter der Flagge der Arisierung… um einen Schundpreis zu erraffen“. Zur Präzisierung eines problematischen Begriffs, in : Angelika Baumann (Hg.) : München arisiert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004, S. 17–30. Ein Überblick über die Auseinandersetzungen um „Arisierung“ als Analysebegriff liefert
263
264
|
Andreas Borsch
tenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung. Grund hierfür ist unter anderem die unscharfe Trennung des zeitgenössischen „Täterbegriffs“ vom gegenwärtigen wissenschaftlichen Begriff. Jedoch werden die Ausdrücke „Arisierungsakteur“, „Arisierungsnetzwerk“ sowie „Arisierungspraxis“ verwendet, da eine Umschreibung zu langatmig wäre. Der „Arisierungsakteur“ müsste demnach „Akteur, der an der wirtschaftlichen Existenzvernichtung beteiligt war“ heißen. Die folgende Analyse basiert auf der Einsicht, dass die größte Verdrängungsund Raubaktion der Neuzeit „nicht in KZs, sondern inmitten der bürgerlichen Gesellschaft statt[fand]“15. Zudem kann festgehalten werden, dass die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden auf dem Rassenantisemitismus16 und nicht auf wirtschaftlichen Erwägungen basierte, was innerhalb der Geschichtswissenschaft bisher weitestgehend Konsens ist. In diesem Kontext ist besonders auf die antisemitischen Figuren des „raffenden Juden“ und des „schaffenden Deutschen“ als dessen konstitutives Gegenüber hinzuweisen.17 Vor diesem Hintergrund geht die Untersuchung von der Annahme aus, dass die wirtschaftliche Existenzvernichtung ein „gesellschaftlicher Prozess“ war,18 der „vor Ort“ von verschiedenen regionalen und lokalen Akteuren praktiziert wurde. Außerdem möchte die Analyse mit dem Aufzeigen des Exklusionsgeschehens in der Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung den Blick dafür schärfen, dass dieser Prozess nicht erst mit dem offiziellen Hinzutreten des NS-Staates 1938, der
Nietzel : Forschungsbericht, S. 561–613. Für die Analyse bedeutet das, dass der Begriff „Arisierung“ keine Analysekategorie darstellt. 15 Walter Rummel/Jochen Rath : „Dem Reich verfallen“ – „den Berechtigten zurückzuerstatten“. Enteignung und Rückerstattung jüdischen Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938–1953, Koblenz 2001, S. XII. Den rund 550.000 Juden, die 1933 im Deutschen Reich lebten, wurde nahezu der gesamte Besitz geraubt ; vgl. auch Bopf : Köln, S. 11. 16 Zum Antisemitismus vgl. Hannah Ahlheim : „Deutsche, kauft nicht bei Juden !“. Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland 1924 bis 1935, Göttingen 2011, S. 19 f. Vgl. ferner Saul Friedländer : Das Dritte Reich und die Juden, Bd. 1 : Die Jahre der Verfolgung 1933–1939, München 1998. 17 Eine Betrachtung zum Arbeitsverständnis der Nationalsozialisten findet sich bei Holger Schatz/ Andrea Woeldike : Freiheit und Wahn deutscher Arbeit. Zur historischen Aktualität einer folgenreichen antisemitischen Projektion, Münster 2001. 18 Frank Bajohr : „Arisierung“ als gesellschaftlicher Prozeß. Verhalten, Strategien und Handlungsspielräume jüdischer Eigentümer und „arischer“ Erwerber, in : Irmtrud Wojak/Peter Hayes (Hg.) : „Arisierung“ im Nationalsozialismus. Volksgemeinschaft, Raub und Gedächtnis, Frankfurt a. M. 2000, S. 15–30.
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
allgemein benannten Phase der „Zwangsarisierungen“19, begann.20 Dementsprechend sollen die „Arisierungsakteure“ des Untersuchungsraums der Frühphase ermittelt werden. Gleichzeitig zeigt die Analyse die sozialen Praxen21 dieser Akteure auf, um verschiedene Praxisformen kenntlich machen zu können. Zudem wird die jüdische Perspektive auf das Exklusionsgeschehen dargestellt. Dabei wird die Kategorie Raum als zusätzliches Analyseinstrument hinzugezogen.22 Anhand der Adaption von „Raum als Kategorie zur Verortung von Gemeinschaftspraktiken“23, werden verschiedene Raumtypen herangezogen, anhand derer sowohl die jeweilige Praxis der „Arisierungsakteure“ als auch die jüdische Perspektive auf diese Praxis sowie das Handeln der Juden erörtert werden können. Dementsprechend können zwei disparate Raumtypen angegeben werden, die zum einen die NS-Perspektive, zum anderen die jüdische Perspektive widerspiegeln.24 19 In der Forschung wird die wirtschaftliche Existenzvernichtung, wenn auch kontrovers diskutiert, in die Phasen der „freiwilligen Arisierung“ bis 1938 sowie der „Zwangsarisierung“ ab 1938 unterteilt. In Anlehnung an Bruns-Wüstefeld wird diese Begrifflichkeit abgelehnt. Es gilt somit zu reflektieren, dass „freiwillige Arisierung“ in spezifischer Relation zur „Zwangsarisierung“ steht, da erstere ihren Zusatz aufgrund der rigideren staatlichen Maßnahmen der „Zwangsarisierung“ erhalten hat und für die Phase bis 1938 einen zwanglosen Zustand vortäuscht ; vgl. Alex Bruns-Wüstefeld : Lohnende Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Hannover 1997, S. 12. 20 Bereits seit den frühen 1920er Jahren zielten Boykottaktionen von antisemitischen Aktivisten im Deutschen Reich auf die Verdrängung von jüdischen Gewerbetreibenden ; vgl. Ahlheim : Boykott. 21 In Anlehnung an Alf Lüdtkes Konzept von Herrschaft als sozialer Praxis sei darauf verwiesen, dass nicht von einer Bipolarität von Herrschenden und Beherrschten ausgegangen werden kann. Stattdessen wird der Blick auf die differenten Beziehungen der verschiedenen Akteure gerichtet ; vgl. Alf Lüdtke : Einleitung : Herrschaft als soziale Praxis, in : Ders. (Hg.) : Herrschaft als soziale Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 91), Göttingen 1991, S. 9–63. Vgl. auch Dietmar von Reeken/Malte Thiessen (Hg.) : „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort (Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Studien zu Konstruktion, gesellschaftlicher Wirkungsmacht und Erinnerung, Bd. 4), Paderborn u.a. 2013. 22 Mit der Adaption der Raumkategorie können die sozialen Praxen zu verschiedenen lokalen Räumen in Beziehung gesetzt werden ; vgl. Habbo Knoch : Gemeinschaften im Nationalsozialismus vor Ort, in : Dietmar von Reeken/Malte Thießen (Hg.) : „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort (Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Studien zu Kon struktion, gesellschaftlicher Wirkungsmacht und Erinnerung, Bd. 4), Paderborn u.a. 2013, S. 37–50. 23 Knoch : Gemeinschaften, S. 42. Da die Raumkategorie aus der Forschung zur Volksgemeinschaft entstammt, sei hier lediglich auf den Zusammenhang von wirtschaftlicher Existenzvernichtung und Konstituierung von Volksgemeinschaft verwiesen. 24 Das Verhältnis der beiden Raumtypen kann als Abhängigkeit des jüdischen Typs von dem nazistischen charakterisiert werden, was aus dem Machtverhältnis zwischen jüdischer Bevölkerung und nicht-jüdischer Bevölkerung sowie NS-Herrschaftsträgern resultiert. Damit soll nicht die von den Nationalsozialisten als essentialistisch behauptete unversöhnliche Bipolarität zwischen jüdischer und nicht-jüdischer Bevölkerung in analytischen Kategorien perpetuiert, sondern die jüdische
265
266
|
Andreas Borsch
Zu Beginn der NS-Herrschaft lebten etwa 90 Menschen jüdischen Glaubens im Untersuchungsraum, was einen Anteil von 1,16 % der Gesamtbevölkerung ausmachte und über dem Reichsdurchschnitt von 0,76 % lag.25 In Bezug auf das Zusammenleben der jüdischen und nicht-jüdischen Bürger in der Vulkaneifel kann angegeben werden, dass dieser Komplex noch nicht bearbeitet ist.26 Zentral für die Analyse sind die 30 jüdischen Gewerbetreibenden, die während der NS-Zeit 27 Betriebe leiteten.27 Dabei fächerte sich die innerjüdische Berufstätigkeit der Gewerbetreibenden während der NS-Herrschaft wie folgt auf : Mit 16 Betrieben und 18 Inhabern nahm der Viehhandel eine dominante Position ein. Des Weiteren existierten vier Einzelhandelsgeschäfte mit sechs Gewerbetreibenden, drei Metzgereien mit drei Inhabern, zwei Vermietungen von Wohnungen28 mit zwei jüdischen Inhabern und ein Fellhandels- sowie ein Rohproduktenhandelsbetrieb mit jeweils einem Gewerbetreibenden.29 Der Großteil der Betriebe stand somit in direktem Zusammenhang mit dem agrarisch geprägten Untersuchungsraum. Die NS-Herrschaft vor Ort gründete sich auf die kumulative Durchherrschung30 des öffentlichen Raums, der regionalen und lokalen politischen GrePerspektive auf den Prozess der wirtschaftlichen Existenzvernichtung gestärkt werden. Den hegemonialen NS-Raumtypen wird mit den jüdischen Raumtypen eine spezifisch jüdische Perspektive entgegengestellt, auch wenn diese zum Großteil als Reaktionen entstanden. Diese erlauben es, die oftmals subtilen Auswirkungen der NS-Praxen auf die jüdische Bevölkerung durch die entsprechenden Raumkategorien zu erschließen. 25 Zu den Angaben im Untersuchungsraum vgl. Borsch : Vulkaneifel, S. 98. Zu den reichsweiten Angaben vgl. Kurt Düwell : Die Rheingebiete in der Judenpolitik des Nationalsozialismus vor 1942. Beitrag zu einer vergleichenden zeitgeschichtlichen Landeskunde, Bonn 1968. 26 Für Gerolstein vgl. Gegen das Vergessen. Das Schicksal der Gerolsteiner Juden, Gerolstein ²2009. Die bisherige Fokussierung auf die Religion als Differenzmerkmal ist jedoch zu einseitig, um ein detailliertes Bild des Zusammenlebens zeichnen zu können. Zudem kann an dieser Stelle nur auf die Bedeutung der spezifischen lokalen Agrargeschichte für das Verhältnis von jüdischer und nicht-jüdischer Bevölkerung hingewiesen werden ; vgl. Monika Richarz : Ländliches Judentum als Pro blem der Forschung, in : Dies./Reinhard Rürup (Hg.) : Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, Tübingen 1997, S. 1–8, hier S. 7. 27 Dabei handelt es sich um die Mindestangabe von Gewerbetreibenden und Betrieben, da die Gesamtzahl aufgrund der Quellenlage sehr wahrscheinlich nicht ermittelt werden konnte. Zu den Details vgl. Borsch : Vulkaneifel, S. 99–101. 28 Für zwei Personen konnte das Vermieten von Wohnungen als Erwerbsquelle ermittelt werden. Diese Tätigkeit wird als Betriebstätigkeit gezählt. 29 Borsch : Vulkaneifel, S. 102. 30 In Rekurs auf Hachtmann wird der Begriff der „kumulativen Durchherrschung“ genutzt, da in diesem sowohl die polykratische Form der NS-Herrschaft als auch die Gleichzeitigkeit von Exklusion und Inklusion, wie auch die Relevanz sozialer Praxis bei der Konstituierung der NS-Herrschaft, angelegt ist. Hachtman entwickelte bezugnehmend auf Kocka und Lüdtke den Begriff der „kumulativen Durchherrschung“, um den Prozess der nationalsozialistischen Durchdringung der
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
mien sowie der lokalen Dorfbevölkerung.31 Das Resultat war eine Neujustierung der etablierten Herrschaftskonstellationen. Auf dieser Basis fand die wirtschaftliche Existenzvernichtung im Untersuchungsraum statt. Eine maßgebliche Rolle im Prozess der Herrschaftskonsolidierung spielten die lokalen Parteigliederungen.32 In Gerolstein, Hillesheim, Jünkerath, Stadtkyll und Lissendorf existierten seit 1933 NSDAP-Ortsgruppen oder -Stützpunkte.33 Diese unterstanden dem ranghöchsten und mächtigsten „Hoheitsträger“ der Partei im Untersuchungsraum, dem Kreisleiter des Kreises Daun, Hans Walther Kölle34. Administrativ unterstand der Untersuchungsraum dem NS-Gau Koblenz-Trier und wurde von Gauleiter Gustav Simon geführt.35 Der Boykott am 1. April 1933 stellte die erste reichsweit organisierte antisemitische Aktion des NS-Regimes dar, obgleich die Durchführung dieser Maßnahme den lokalen Parteigliederungen vorbehalten blieb. Zudem kann der Boykott als Auftakt der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden betrachtet werden. Für den im Zentrum stehenden Landstrich konnten Boy-
Gesellschaft adäquat darstellen zu können ; vgl. Rüdiger Hachtmann : Elastisch, dynamisch und von katastrophaler Effizienz. Zur Struktur der Neuen Staatlichkeit des Nationalsozialismus, in : Sven Reichardt/Wolfgang Seibel (Hg.) : Der prekäre Staat. Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M./New York 2011, S. 29–74. 31 Weitere Beobachtungen zum Nationalsozialismus in der Region finden sich bei Horst Möller/ Andreas Wirsching/Walter Ziegler (Hg.) : Nationalsozialismus in der Region. Beiträge zur regionalen und lokalen Forschung und zum internationalen Vergleich, München 1996. 32 Die herausragende Bedeutung der NSDAP-Ortsgruppen für die NS-Herrschaft untersucht Carl-W. Reibel : Das Fundament der Diktatur : die NSDAP-Ortsgruppen 1932–1945, Paderborn u.a. 2002. 33 In Hillesheim und Gerolstein existierte seit mindestens 1932 eine Ortsgruppe der NSDAP, in Lissendorf spätestens seit 1933 eine weitere. Für Jünkerath und Stadtkyll können ebenso seit 1933 weitere Stützpunkte nachgewiesen werden. Zu den NS-Aktivitäten im Untersuchungsraum bis 1933 vgl. Josef Dreesen : Der Kreis Daun im Dritten Reich, Meckenheim 1990, S. 39–70. 34 Der am 8. Februar 1897 in Köln geborene Kölle war seit dem 1. November 1928 Mitglied der NSDAP und bis 1930 Adjutant des SS-Standartenführers Karl. Ab 1931 war er Kreisleiter des Kreises Daun und ab 1938 Kreisleiter des Kreises Daun-Wittlich ; vgl. Franz Maier : Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer Gliederungen im Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 2007, S. 320. Da keine Quellen bezüglich des Kreisleiters des Kreises Prüm, Walter Müller, ermittelt werden konnten, liegt der Fokus auf Kölle. 35 Simon stand dem Gau vom 1. Juni 1931 bis 1945 vor. Weiterführende biographische Angaben zu Gustav Simon finden sich bei Maier : Biographisches Organisationshandbuch, S. 82 sowie S. 445– 447. Zur Historie dieses Gaus vgl. ebd., S. 22–30. Zur Funktion der Gaue vgl. Jürgen John/Horst Möller/Thomas Schaarschmidt : Die NS-Gaue. Regionale Mittelinstanzen im zentralistischen „Führerstaat“ (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Sondernummer), München 2007.
267
268
|
Andreas Borsch
kottaktionen für Gerolstein,36 Hillesheim37 und Jünkerath38 nachgewiesen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Praxis auch in Stadtkyll und Lissendorf zur Anwendung kam. So postierten sich in Gerolstein zwei mit Gewehren bewaffnete junge Männer vor den Eingang des „Kölner Kaufhauses“, des größten Kaufhauses der Region.39 Zudem stellten sich vor dem Lebensmittelgroßhandelsgeschäft des Leopold Mayer in der Bahnhofstraße 26 zwei SA-Männer auf, um die Kunden am Einkauf zu hindern.40 In dieser „Kernszene des Boykotts“41 trafen im öffentlichen Raum lokale SA- und Parteiangehörige, potentielle Einkäufer, Zuschauer und jüdische Geschäftsleute aufeinander. Zum einen verzeichneten die jüdischen Kaufleute durch diese Praxis einen Umsatzrückgang42, zum anderen schüchterten die bewaffneten Posten potentielle Kunden wie auch die jüdischen Kaufleute und deren Familien ein. Der öffentliche Raum fungierte hierbei als Interaktions-43 sowie Machtraum44. Ein weiterer Effekt des Boykotts bestand in der intendierten Sichtbarmachung von Juden und jüdischen Geschäften.45 Flankiert durch eine reichsweite Propagandakampagne, die den schädlichen Einfluss „der“ Juden proklamierte,46 wurden „die Juden“ und „die jüdischen Unternehmen“ erst im nationalsozialistischen 36 Amt für Wiedergutmachung Saarburg (AfWS), Jakob Hanau, Best. 74206, Bd. II, Bl. 32 sowie AfWS, Moritz Ermann, Best. 251576, o.P. und AfWS, Moritz Hertz, Best. 73689, Bl. 2. 37 AfWS, Kurt Zimmermann, Best. 255584, Bl. 1–3. 38 AfWS, Samuel Lorig, Best. 75506, Bl. 6. 39 LHA Koblenz, Best. 583,002, Nr. 3638, Bl. 26–28. 40 AfWS, Leopold Mayer, Best. 75037, Bl. 12. Christoph Stehr gibt an, dass es in Gerolstein am 1. April 1933 keinen Boykott gegeben habe, was nachweislich falsch ist ; vgl. Stehr : Bevölkerung, S. 26 f. 41 Ahlheim : Boykott, S. 8. 42 AfWS, Leopold Mayer, Best. 75037, Bl. 12 sowie LHA Koblenz, Best. 583,002, Nr. 3638, Bl. 26– 28. 43 Der öffentliche Raum kann die Funktion eines Interaktionsraumes vor Ort einnehmen, in dem „sich die Ansprüche auf eine neue Ordnung im Verhältnis zu bestehenden Strukturen, Funktionsträgern und gesellschaftlichen Leitpersonen“ konkretisieren ; vgl. Knoch : Gemeinschaften, S. 42 f. 44 Aus NS-Perspektive fungierte der öffentliche Raum als Machtraum, wenn dort administrative Vorgaben ausgehandelt und durchgesetzt wurden und durch „temporäre symbolische Maßnahmen“ eine neue Topographie der lokalen Herrschaft errichtet wurde ; vgl. ebd., S. 42. 45 Eine Analyse zum Komplex Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit im Rahmen antisemitischer Boykotte findet sich bei Benno Nietzel : Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit. Die Konstruktion „jüdischer Unternehmen“ und die Öffentlichkeit der Judenverfolgung in Frankfurt am Main 1933–1939, in : Christiane Fritsche/Johannes Paulmann (Hg.) : „Arisierung“ und „Wiedergutmachung“ in deutschen Städten, Köln 2014, S. 65–88. 46 Eifel Zeitung (EZ), Jg. 14, vom 29.3.1933, Nr. 74, S. 1 sowie S. 3. Siehe dazu ebenso Trierische Landeszeitung (TLZ), Jg. 59, vom 29.3.1933, Nr. 73 und Trierischer Volksfreund (TV), Jg. 58, vom 29.3.1933, Nr. 74, S. 1.
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
Sinne durch die Praxis der lokalen Parteiangehörigen konstruiert. Diese Sichtbarmachung durch die von den bewaffneten Posten hergestellte gewaltförmige Drohkulisse sollte eine radikale Grenzziehung zwischen „arischen“ Volksgenossen und als „deutsch“47 bezeichneten Geschäften auf der einen und Juden und „jüdischen“ Geschäften48 auf der anderen Seite bewirken und diese im Alltag der Dorfbevölkerung verankern. Dadurch wurde das Gegensatzpaar der „ehrlichen, deutschen Arbeit“ und der „unehrlichen, raffenden jüdischen Nicht-Arbeit“ wieder in den Mittelpunkt gestellt. Vor diesem Hintergrund kann das Verhalten der Einkäufer und Zuschauer präzisiert werden. Mittels der immensen Politisierung des Einkaufverhaltens wurden die potentiellen Käufer gezwungen, sich zu positionieren. Wollten sie sich „deutsch“ verhalten oder als „Volksverräter“ gelten, wenn sie sich solidarisch mit den jüdischen Mitbürgern zeigten und bei diesen einkauften ? Die Zuschauer erfüllten gerade durch ihre Passivität die ihnen von den lokalen Boykott-Akteuren zugedachte Funktion.49 Denn durch passives Verhalten waren sie als Nicht-Einkäufer Teil des Boykotts. Die Boykott-Aktivisten vor Ort beabsichtigten somit eine selbstdisziplinierende Wirkung auf die Mehrheitsgesellschaft zu entfalten.50 Das Ziel war die Stigmatisierung und die Exklusion der Juden aus der Volksgemeinschaft bei gleichzeitiger Inklusion der nicht-jüdischen „arischen“ Dorfbevölkerung.51 Wie schnell die von den lokalen NSDAP-Gliederungen propagierte antisemitische Doktrin im Untersuchungsraum aufgenommen wurde und Verbreitung fand, zeigt der Fall einer versuchten Erpressung des Gerolsteiner Viehhändlers Salomon Siegler am 25. April 1933. Siegler wurde von einem nicht näher ausgeführten „Geheimdienst“ per Brief dazu aufgefordert, 1.200 Reichsmark zu zahlen, andernfalls würde er erschossen.52 Als Erpresser konnte ein Schlosser ermittelt werden, der seine Tat dadurch zu rechtfertigten suchte, dass er geglaubt habe, „daß so etwas den
47 Aufgrund der Weigerung des NS-Regimes, „jüdische Unternehmen öffentlich als solche zu kennzeichnen“, änderten lokale NS-Akteure reichsweit ihre Taktik und brachten Schilder mit der Aufschrift „Deutsches Geschäft“ in Umlauf, die nach einer Prüfung an nicht-jüdische Geschäfte ausgegeben wurden ; vgl. Nietzel : Sichtbarkeit, S. 75. 48 Hinweise zu den Schwierigkeiten der Definition jüdischer Unternehmen findet man ebd., S. 66–72. 49 Ahlheim : Boykott, S. 11. 50 Michael Wildt : Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939, Hamburg 2007. 51 Untersuchungen zur Thematik von Inklusion und Exklusion finden sich bei Lutz Raphael/Herbert Uerlings (Hg.) : Zwischen Ausschluss und Solidarität. Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike (Inklusion, Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 6), Frankfurt a. M. u.a. 2008. 52 LHA Koblenz, Best. 584,002, Nr. 419, S. 35 f.
269
270
|
Andreas Borsch
Juden gegenüber nicht schlimm sei“53. Mag die Motivation des Erpressers ökonomischer Natur gewesen sein, so stellten sowohl die Auswahl des Opfers als auch die verwendete Drohkulisse eines Geheimdienstes sowie der Verweis auf die angenommene Rechts- und Schutzlosigkeit der jüdischen Bürger ein Aufgreifen des vorherrschenden Zeitgeistes dar. Den Interessen des NS-Regimes, das zu diesem Zeitpunkt um die Durchsetzung des Gewaltmonopols bemüht war, widersprach dieser Versuch der eigenmächtigen Beraubung, sodass es zu einer Verurteilung des Erpressers kam.54 Die grundlegenden Veränderungen gesellschaftlicher Normen, die auch im lokalen Nahbereich anzutreffen waren, wurden durch die am 7. Juni 1933 von der Propagandaabteilung des Gaus Koblenz-Trier an alle Kreisleitungen versandte Direktive mit dem Titel „Judenbekämpfung“ bestätigt.55 Darin wurden die Kreisleitungen einerseits gebeten, eine Liste der jüdischen Geschäfte des Untersuchungsraums zu vervollständigen,56 andererseits wurden die Kreisleitungen beauftragt, Ausschüsse und Unterausschüsse zu bilden, die beim Kreisausschuss Daun (KaD)57 sowie bei den NSDAP-Ortsgruppen angesiedelt waren.58 Diese Ausschüsse sollten das Einkaufverhalten von Parteiangehörigen und Beamten, und damit die jüdischen Geschäfte des Untersuchungsraums, überwachen. Falls diese in jüdischen Geschäften einkauften, sollte der KaD mittels anonymer Briefe, die vom Kampfbund des gewerblichen Mittelstands (KdgM)59 bezahlt werden sollten, die Beamten und Parteiangehörigen unter Druck setzen.60 Ziel der Aktion war es, die bereits seit dem Boykott am 1. April konstruierte Trennung zwischen „deutsch“ und „jüdisch“ weiter zu verfestigen und die Beamten und Parteiangehörigen zu disziplinieren. Auch wenn nicht eruiert werden kann, ob und wie lange diese Anweisungen umgesetzt worden sind, ist belegt, dass zumindest Kreisleiter Walther Kölle Kenntnis von diesen Plänen hatte. Die Idee einer arbeitsteiligen Organisationsform, in der jeder Akteur seine spezifischen Ressourcen einbringt, war damit im Untersuchungsraum präsent. Zudem bestätigt die Direktive die große Relevanz informeller 53 Ebd., S. 17. 54 Ebd. 55 LKA Koblenz, Best. 583,002, Nr. 3638. 56 Ebd. 57 Der Kreisausschuss Daun war das wichtigste Gremium des Kreistags Daun, das sich aus Mitgliedern des Kreistags zusammensetzte. Die NSDAP dominierte den Ausschuss ; vgl. LHA Koblenz, Best. 462[VK], Nr. 11. 58 LHA Koblenz, Best. 583,002, Nr. 3638. 59 Die Gerolsteiner Gruppe wurde im August 1933, laut Eifel Zeitung, in die DAF eingegliedert. EZ, Jg. 14, vom 11.8.1933, Nr. 183, S. 3. 60 LHA Koblenz, Best. 583,002, Nr. 3638.
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
Absprachen, da diese ausdrücklich darauf hinwies, dass diese Maßnahme verdeckt ablaufen sollte.61 Wurden der 1. April-Boykott und die weiteren Überwachungsmaßnahmen auch von Instanzen initiiert, die außerhalb des Untersuchungsraums angesiedelt waren, so wurden sie vor Ort von lokalen Akteuren umgesetzt. Die Direktive belegt zudem durch die Einbindung des KaD als Knotenpunkt und Entscheidungsträger des anvisierten Überwachungsnetzwerks dessen hegemoniale Position im regionalen Herrschaftsgefüge. Mit dem Landrat Dr. Wirtz62 als Vorsitzendem sowie dem Kreisleiter Kölle als 1. Kreisdeputiertem waren die beiden ranghöchsten Herrschaftsträger der Region in diesem Gremium vereint. Zudem waren mit dem Landratsamt Daun und der Kreissparkasse (KSK)63 zu Daun mit den Zweigstellen Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath bedeutende regionale Instanzen mit dem KaD verbunden. So fungierte Landrat Wirtz als Vorsitzender des KSK-Vorstandes, während Kreisleiter Kölle dessen Stellvertreter war. Die eidesstattlichen Erklärungen der Juden, die die NS-Zeit überlebt haben, nennen übereinstimmend 1933 als das Jahr, in dem die wirtschaftlichen Einschränkungen einsetzten, die als „Verfolgungsmaßnahmen“64 wahrgenommen wurden. Dabei sprechen die Quellen von einer „dauernde[n] Boykottierung“65, was ein weiterer Beleg dafür ist, dass die am 1. April 1933 begonnenen Boykottmaßnahmen im Untersuchungsraum von dem Großteil der Mehrheitsgesellschaft befolgt wurden und dass diese Maßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die jüdischen Gewerbetreibenden hatten. „Kunden kamen nicht mehr“66 in die Geschäfte, die Bauern hatten „infolge des Naziterrors gegen Juden Angst […], mit einem jüdischen Händler in Verbindung zu stehen“67, sodass der Kontakt zwischen jüdischen Viehhändlern und Bauern immer mehr abebbte. Die Folge war bei allen jüdischen Gewerbetreibenden ein erheblicher „Umsatzrückgang“68. So bestätigten 1955 das Finanzamt Daun sowie die Amtsverwaltung Gerolstein, dass Leopold Mayers „Einkommen auf Grund Boykottmaßnahmen 1933/34 um 25 % und 1935/36 um 50 %
61 Ebd. 62 Dr. Paul Wirtz, seit 1932 NSDAP-Mitglied, löste Landrat Liessem in Daun ab und stand von Juli 1933 bis 1940 an der Spitze dieser obersten regionalen Gebietskörperschaft. Daneben war er oberster Leiter der Kreisverwaltung Daun ; vgl. EZ, Jg. 14, vom 17.8.1933, Nr. 188, S. 3 sowie Stehr : Bevölkerung, S. 27. 63 Der Kreis Daun fungierte als Gewährsträger der Kreissparkasse Daun, so dass besonders der Kreistag und damit der KaD mit der Sparkasse verwoben war. 64 AfWS, Jakob Hanau, Best. 74206, Bd. II, Bl. 32. 65 Ebd. 66 AfWS, Leopold Mayer, Best. 75037, Bl. 4. 67 AfWS, Moritz Ermann, Best. 251576, o. S. 68 AfWS, Moritz Hertz, Best. 73689, Bl. 2 und AfWS, Kurt Zimmermann, Best. 255548, Bl. 1–3.
271
272
|
Andreas Borsch
zurückgegangen ist“69. Das Jahr 1933 wurde von den Juden des Untersuchungsraums, soweit sich dies aus den vorliegenden Quellen rekonstruieren lässt, auch aufgrund des Beginns des ökonomischen Abstiegs als Zäsur wahrgenommen.70 Für die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung in der Vulkaneifel konnten folgende Akteure bestimmt werden : die NSDAP-Gliederungen vor Ort, die Nicht-Einkäufer und Zuschauer während der Boykottierungen, der Erpresser und sehr wahrscheinlich die NSDAP-Kreisleitung mit Kreisleiter Walther Kölle an der Spitze, der Kreisausschuss Daun, Landrat Wirtz und der Kampfbund des gewerblichen Mittelstands. Die Geheime Staatspolizei konnte in dieser Phase nicht als Akteur identifiziert werden. Damit konnte die Analyse die Annahme bestätigen, dass die wirtschaftliche Existenzvernichtung im Untersuchungsraum ein „gesellschaftlicher Prozess“ war, der „vor Ort“ von regionalen und lokalen Akteuren praktiziert wurde. Die dominanten Praxisformen der „Arisierungsakteure“ bestanden in der Boykottierung, worunter die unterschiedlichen Modi der Überwachung, der Denunziation und der Angstgenese zu rechnen sind. Das vorrangige Ziel der Frühphase war es, das antisemitische Gegensatzpaar „deutsch“ versus „jüdisch“ zu konstruieren und nachhaltig in der Mehrheitsgesellschaft zu verankern. Diese gleichzeitige Inklusion wie Exklusion bedeutete für die Juden des Untersuchungsraums eine Stigmatisierung sowie den Beginn der wirtschaftlichen Verdrängung, wie der Umsatzrückgang verdeutlicht. Der öffentliche Raum wandelte sich sukzessive zu einem NS-Machtraum. Hinsichtlich der Beziehungen der einzelnen Akteure untereinander konnte zumindest angedeutet werden, welch wichtige Funktion der Kreisausschuss innerhalb des Exklusionsgeschehens einnehmen sollte. Zudem ist ersichtlich geworden, dass eine Zusammenarbeit verschiedener Akteure vor Ort in der Frühphase intendiert war. Dabei steuerten die einzelnen Akteure ihre bestimmte Ressource in die arbeitsteilig vollzogene „Arisierungstätigkeit“ bei. Dass dieses „Arisierungsnetzwerk“ tätig wurde, konnte nicht eruiert, kann aber angenommen werden. Für die 69 AfWS, Leopold Mayer, Best. 75037, Bl. 12 sowie a.a.O. Bl. 10. 70 Augrund der Überlieferungslage liegen keine Zeugnisse darüber vor, wie die Juden des Untersuchungsraums die Konstruktion des Gegensatzpaares deutsch/jüdisch wahrnahmen oder wie sie auf den Antisemitismus reagierten. Die eidesstattlichen Erklärungen, welche die Grundlage für die Darstellung der jüdischen Perspektive stellen, sind Teil von „Wiedergutmachungsverfahren“, so dass der Fokus in diesen Dokumenten auf der Erörterung der ökonomischen Verhältnisse und nicht auf der der emotionalen Verfassung lag. Da es sehr wahrscheinlich ist, dass neben der ökonomischen Ebene auch die emotionale die Wahrnehmung auf das Jahr 1933 mitbestimmte, dies aber nicht verifiziert werden kann, soll durch das „auch“ vermieden werden, einen komplexen Sachverhalt verkürzt wiederzugeben, weil das vorliegende Quellenmaterial nicht umfassend ist.
Die Frühphase der wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Gewerbetreibenden
|
jüdische Bevölkerung stellte sich die Umfunktionierung des öffentlichen Raums als Exklusionspraxis dar, die eine unbeschwerte Bewegungsfreiheit zunehmend unmöglich machte. Dementsprechend fungierte der öffentliche Raum ab 1933 als Angstraum71 oder als Gewaltraum72. Mit Blick auf den weiteren Fortgang des Prozesses der wirtschaftlichen Existenzvernichtung kann für den Untersuchungsraum konstatiert werden, dass zu Beginn ein eher unorganisierteres Handeln lokaler NSDAP-Gliederungen das Exklusionsgeschehen dominierte, sich die Praxen der wirtschaftlichen Existenzvernichtung sukzessive zu einem bürokratisch-formellen Verwaltungshandeln transformierten, das von lokalen Institutionen praktiziert wurde.
71 Der Angstraum ist eine Reaktion auf die physische Gewaltpraxis und -rhetorik sowie die Propagierung nationalsozialistischer Werte und Codes ; vgl. Knoch : Gemeinschaften, S. 42 f. 72 Der öffentliche Raum als Gewaltraum resultierte aus den physischen Übergriffen aus dem Machtoder Interaktionsraum heraus ; vgl. ebd.
273
Jill Steinmetz
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“ Die Verteidigungsstrategie des Rechtsanwalts Dr. Kurt Heim im Kriegsverbrecherprozess gegen Gestapobeamte vor dem Gerichtshof des Großherzogtums Luxemburg (1949–1951)
Bereits während des Zweiten Weltkrieges hatten Hitlers Gegner ihre Absicht verkündet, die Verantwortlichen für Verbrechen gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Ab Oktober 1945 wurden als erstes die bei Kriegsende noch lebenden und inhaftierten „Hauptkriegsverbrecher“ vor dem dafür eingerichteten Internationalen Militärtribunal in Nürnberg angeklagt und verurteilt.1 Weitere Verfahren vor Militärgerichten wurden in den vier Besatzungszonen Deutschlands durchgeführt. Zu vergleichbaren Prozessen kam es auch vor Gerichten im europäischen Ausland. Angeklagt waren Angehörige der Wehrmacht, der SS und der deutschen Besatzungsverwaltung, die sich als Offiziere und Funktionäre ihrer Verantwortung für die ihnen zur Last gelegten Kriegsverbrechen und Straftaten während des Zweiten Weltkriegs stellen mussten. Prozesse gegen deutsche Kriegsverbrecher waren somit ein transnationales Phänomen.2 Auch die luxemburgische Staatsanwaltschaft ermittelte nach dem Ende der Besatzung wegen Kriegsverbrechen gegen insgesamt 181 Reichsdeutsche und gegen 162 von ihnen wurde in Luxemburg ein Gerichtsverfahren eröffnet. Im Laufe der Jahre wurden 44 Deutsche verurteilt, davon fünf zum Tode (drei in Abwesenheit), 15 wurden freigesprochen und in 103 Fällen wurde das Verfahren eingestellt.3
Juristische Grundlagen des Prozesses
Da in der unmittelbaren Nachkriegszeit weder ein internationales Völkerstrafgesetzbuch noch ein ständiger Internationaler Gerichtshof existierten, stellt sich die 1 Einen Überblick bietet Annette Weinke : Die Nürnberger Prozesse, München 22015. 2 Norbert Frei (Hg.) : Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006. 3 Emile Krier : Luxemburg am Ende der Besatzungszeit und der Neuanfang, in : Kurt Düwell/Michael Matheus (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 69–95, hier S. 89.
276
|
Jill Steinmetz
Frage nach der Gesetzesgrundlage für die Kriegsverbrecherprozesse in Luxemburg. Bereits während des Zweiten Weltkriegs erklärten am 13. Januar 1942 in London Vertreter der Exilregierungen von Belgien, Frankreich, Griechenland, Luxemburg, Norwegen, Polen und Jugoslawien sowie der Niederlande und der Tschechoslowakei im Beisein der Großmächte, eines ihrer Hauptziele sei die „Bestrafung der Schuldigen oder der für diese Verbrechen Verantwortlichen im ordentlichen Gerichtsverfahren, gleichgültig, ob sie sie angeordnet oder begangen oder an ihnen teilgenommen haben.“4 In der St.-James-Deklaration war die Bestrafung von Einzelpersonen als Kriegsverbrecher vorgesehen, unter der speziellen Berücksichtigung, dass die besetzende Macht in Verletzung der Bestimmungen der Haager Landkriegsordnung von 1907 „Gewalttaten gegen Zivilisten begangen, die bestehenden Gesetze ausser Kraft gesetzt und die eigenstaatlichen Einrichtungen umgestossen hatte“5 [sic !]. Im Rahmen der St.-James-Deklaration bemerkte der luxemburgische Außenminister Joseph Bech (1887–1975) : Umsonst werden am Tage des Sieges die Peiniger unserer Völker sich darauf berufen, dass sie nur das taten, was man ihnen befohlen, oder ihren Gesetzen gemäss handelten. […] Die Schuldigen werden den Gesetzen des Staates, in dem die Verbrechen begangen wurden, unterstehen.6
Bei einem Treffen der Außenminister der UdSSR, Großbritanniens und der USA zwischen dem 19. und 30. Oktober 1943 verabschiedeten Wjatscheslaw Molotow, Robert Anthony Eden und Cordell Hull in Moskau die sogenannte Moskauer Deklaration, welche es den Nachkriegsregierungen der besetzten Länder ermöglichte, die Verantwortlichen für die auf ihrem Territorium begangenen Verbrechen dort selbst vor Gericht stellen zu können.7 Diese Deklaration machte den Prozess in Luxemburg gegen deutsche Kriegsverbrecher überhaupt erst möglich. Dabei bleibt festzuhalten, dass es Unterschiede in der nationalen Besatzungsgerichtsbarkeit in den einzelnen europäischen Ländern gab. Luxemburg gehörte zu den Ländern, die dem Londoner Statut angepasste Gesetze mit den Tatbeständen „Kriegsverbrechen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ erließen, die 4 Bundesarchiv (BArch) Koblenz, AllProz 21/353, S. 72. Zur Kriegsverbrecherpolitik der Exilregierungen in London vgl. Arieh J. Kochavi : Britain and the Establishment of the United Nations War Crimes Commission, in : English Historical Review 107 (1992), No. 423, S. 323–349. 5 BArch Koblenz, AllProz 21/353, S. 72. 6 Ebd., S. 74. 7 Cord Arendes : Zwischen Justiz und Tagespresse. „Durchschnittstäter“ in regionalen NS-Verfahren, Paderborn 2012, S. 80.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
für die Zeit der Besatzung galten, in denen diese Länder sich mit Deutschland im Kriegszustand befanden. Hierzu zählten neben Luxemburg (2.8.1947) auch Norwegen (24.5.1946), Dänemark (12.7.1946), Belgien (20.6.1947), Niederlande (10.7.1947) und Frankreich (25.9.1948).8 Eine weitere juristische Grundlage stellte das Strafgesetzbuch dar, welches bereits seit 1943 zahlreiche Änderungen und Ergänzungen erfahren hatte. Wie in allen anderen besetzten Gebieten hatte sich auch in Luxemburg die Rechtsmeinung gegen das Rückwirkungsverbot durchgesetzt, da es andernfalls auf den Anspruch, Kriegsverbrechen zu ahnden, hätte verzichten müssen.9
Anklagepunkte
Der sogenannte Gestapo-Prozess war einer von vier Kriegsverbrecherprozessen, welche im Großherzogtum Luxemburg fünf Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs gegen deutsche Kriegsverbrecher stattfanden. Daneben gab es den Standgerichtsprozess, den Clermont-Ferrand-Prozess und den Prozess betreffend der Verbrechen, welche im Zuge der Rundstedt-Offensive begangen wurden. Dabei wurde in Erwägung gezogen, die Prozesse mit einem Gesamturteil abzuschließen, denn einige der Beschuldigten waren in mehreren der vier Prozesse angeklagt.10 Dies trifft unter anderem auf Fritz Hartmann (1906–1974) zu, vom 8. März 1941 bis zum 9. April 1943 Leiter des Einsatzkommandos in Luxemburg. Der Prozess gegen 16 ehemalige, im Großherzogtum Luxemburg beschäftigte Gestapobeamte begann am 10. Oktober 1949 um 9 :30 Uhr im Stadthaus am Wilhelmsplatz in Luxemburg-Stadt.11 Das Gericht setzte sich aus fünf Richtern 8 Günther Wieland : Verfolgung von NS-Verbrechen und Kalter Krieg, in : Claudia Kuretsidis-Haider/Winfried R. Garscha (Hg.) : Keine „Abrechnung“. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945, Leipzig/Wien 1998, S. 185–203, hier S. 190 f. Die Gesetze sind veröffentlicht in Pierre Boissier : Völkerrecht und Militärbefehl. Ein Beitrag zur Frage der Verhütung und Bestrafung von Kriegsverbrechen, Stuttgart 1953, S. 139–148. 9 Claudia Moisel : Frankreich und die deutschen Kriegsverbrecher. Politik und Praxis der Strafverfolgung nach dem Zweiten Weltkrieg (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 2), Göttingen 2004, S. 100. 10 BArch Koblenz, AllProz 21/345. Dies geht aus einem Brief von Rechtsanwalt Dr. Kurt Heim an Rechtsanwalt Dr. Römer von der Rechtsschutzstelle des Roten Kreuzes für die französische Zone vom 16. März 1950 hervor. 11 BArch Koblenz, AllProz 21/344, S. 2. Angeklagt waren Oberregierungsrat Wilhelm Nölle, Oberregierungsrat Fritz Hartmann, Kriminalrat Walter Runge, Kriminalkommissar Sebastian Ranner, Kriminalsekretär Josef Stuckenbrock, Kriminalobersekretär Hans Klöcker, Kriminalsekretär Paul Merten, Kriminaloberassistent Jakob Reif, Kriminalobersekretär Otto Hantel, Kriminalobersekretär
277
278
|
Jill Steinmetz
zusammen, von denen zwei der Beisitzer Angehörige von Widerstandsorganisationen sein mussten. Der Gerichtssitz befand sich in Luxemburg.12 Auffällig ist, dass das Verfahren gegen Otto Schmalz, Judensachbearbeiter und Leiter der Abteilung IV b „Juden und Emigranten“ beim Einsatzkommando Luxemburg von 1942 bis 1943, eingestellt und er somit trotz seiner Schlüsselposition im Bereich der Judendeportationen nicht weiter von der luxemburgischen Justiz belangt wurde.13 Ein derartiges Vorgehen ist jedoch kein Einzelfall. Auch in der Bundesrepublik Deutschland führten die Ermittlungen gegen die Judensachbearbeiter oft zur Einstellung des Verfahrens, oder Verdächtige hatten sich bereits vorher ins Ausland absetzen können. Es kam daher nur selten zu einer Verurteilung der ehemaligen Judensachbearbeiter.14 Die Anklage warf den Beschuldigten vor, gegen das Kriegsrecht und das Völkerrecht verstoßen zu haben. Allen 16 Angeklagten wurde angelastet, Mitglied in einer – laut Urteil des Internationalen Militärgerichts in Nürnberg – verbrecherischen Organisation gewesen zu sein und in ihrer jeweiligen Position freiwillig an der Veränderung von gesetzlichen Einrichtungen oder Organisationen teilgenommen, die Treue der Bevölkerung gegenüber der Großherzogin und dem Staat erschüttert, die Propaganda unterstützt und völkerrechtlich geschützte Belange der Bürger verletzt zu haben.15 Weiterhin wurden einige der Angeklagten in den Anklagepunkten drei bis neun beschuldigt, während der Vernehmungen an Misshandlungen und Bedrohungen von Häftlingen zur Erpressung von Geständnissen beteiligt gewesen zu sein.16 Bei diesen Häftlingen handelte es sich vor allem um Mitglieder der zahlreichen luxemburgischen Widerstandsorganisationen. Unter dem Anklagepunkt zehn wurden Einzelfälle und Kollektivfälle von misshandelten Personen zusammengefasst, die keiner Widerstandsorganisation angehörten.17 Der Anklagepunkt 11 warf einigen der Angeklagten vor, dem Feind Hilfe geleistet zu Erich-August Höhmann, SD-Referent Herbert Jost, Grenzpolizeikommissar Herbert-Otto-Waldemar Dietrich, Kriminalsekretär Friedrich-Theodor Sterzenbach, Kriminalkommissar Gerhard Simon sowie die Kriminalsekretäre Karl Bieler und Adolf Moritz. 12 Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg N° 38 vom 11. August 1947, online unter : http:// legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1947/08/08/n1/jo (Letzter Zugriff : 22.4.2017). 13 BArch Berlin, R 70-Luxemburg/3, Geschäftsverteilungsplan des Einsatzkommandos der Sicherheitspolizei und des SD in Luxemburg, Sparte Geheime Staatspolizei vom 15. Juli 1944 ; BArch Ludwigsburg, B 162/6639, S. 129 f. 14 Annette Weinke : Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigungen 1949–1969, oder : Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg, Paderborn u.a. 2002, S. 260 f. 15 BArch Koblenz, AllProz 21/344, S. 5. 16 Ebd., S. 17 f. 17 Ebd., S. 54 f.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
haben, indem sie ihm luxemburgische Arbeitskräfte zugeführt hatten.18 Anklagepunkt 12 betraf nur Hartmann, Runge und Klöcker und beschäftigte sich mit dem Vorwurf der Enteignung und Verschleppung von Juden ins Ausland.19 So wurden Ende Juli 1941 auf Befehl der Gestapo 120 in Luxemburg verbliebene Juden in das ehemalige Herz-Jesu-Kloster Fünfbrunnen überführt, wo sie sich selbst verwalten mussten.20 Die Verwaltung lag laut des Zeugen Cornelius Bausch in den Händen eines Herrn Edelstein und des Ehepaars Heumann.21 Ziel war es, eine Isolierung und Konzentration aller noch im Großherzogtum befindlichen Juden herzustellen.22 Laut der Zeugin Henriette Kleeblatt kam die Gestapo, unter anderem auch Hartmann, alle paar Tage zur Kontrolle und um Drohungen auszusprechen.23 Von Fünfbrunnen aus wurden die Juden dann in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert.24 Der Anklagepunkt 13 beschäftigte sich mit der Inhaftierung von Privatpersonen, die „wegen angeblicher Gefährdung des Bestandes und der Sicherheit von Volk und Staat“ inhaftiert worden waren.25 Den Angeklagten Hartmann, Runge, Merten und Stuckenbrock wurde im darauf folgenden Anklagepunkt zudem vorgeworfen, Privatpersonen, die gegen die Einführung der deutschen Wehrpflicht26 in Luxemburg protestiert hatten, inhaftiert zu haben, woraufhin sie Misshandlungen ausgesetzt waren.27 Darüber hinaus wurde Runge, Merten und Bieler im Anklagepunkt 15 vorgeworfen, Personen inhaftiert zu haben, die notgelandeten alliierten Fliegern zur Flucht verholfen hatten.28 Der Umsiedlung einer nicht näher bestimmten Anzahl von Personen ins 18 Ebd., S. 66 f. 19 Ebd., S. 72 f. Beim Einzug der deutschen Truppen in Luxemburg am 10. Mai 1940 sollen sich im Großherzogtum etwa 2.500 ansässige Juden und 1.200 aus Deutschland und Österreich geflüchtete Juden aufgehalten haben ; vgl. BArch Ludwigsburg, B 162/6907, S. 928. Vgl. auch Georges Büchler : Évacuation – Déportation. Le premier transport vers l’Est, 16.10.1941/Evakuierung – Aussiedlung. Der erste Polentransport, 16.10.1941 (Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette, Bd. 8), Luxembourg 2016. 20 BArch Koblenz, AllProz 21/344, S. 71. Insgesamt wurden laut des Berichts über die Judendeportation aus Luxemburg zwischen dem 19.10.1941 und dem 29.09.1943 674 Juden aus Luxemburg deportiert ; vgl. BArch Ludwigsburg, B 162/6904, S. 152. 21 BArch Koblenz, AllProz 21/201, S. 160. 22 André Hohengarten : Die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg, Luxemburg 2002, S. 41. 23 BArch Koblenz, AllProz 21/201, S. 161. 24 BArch Koblenz, AllProz 21/344, S. 71 f. 25 Ebd., S. 77. 26 Archives nationales de Luxembourg (ANLux), CdG-140, Verordnung über die Wehrpflicht in Luxemburg vom 30. August 1942. 27 BArch Koblenz, AllProz 21/344, S. 80 f. 28 Ebd., S. 86 f.
279
280
|
Jill Steinmetz
Ausland mit dem Ziel, ihr Leben, ihre Freiheit oder ihre körperliche Unversehrtheit zu gefährden, wurden Hartmann, Runge und Jost angeklagt.29 Im vorletzten Anklagepunkt wurden Runge und Merten beschuldigt, aufgrund der am 20. Juli 1944 erfolgten Erschießung des Ortsgruppenleiters der Volksdeutschen Bewegung (VdB) namens Kalmes, mehrere Personen ins Ausland verschleppt zu haben.30 Der letzte Anklagepunkt beschäftigte sich mit der Verschleppung von Refraktären und Wehrmachtsflüchtlingen ins Ausland.31
Die Verteidigungsstrategie von Dr. Kurt Heim
In seinem Plädoyer32 für die Angeklagten Paul Merten und Josef Stuckenbrock, gehalten am 8. und 9. März 1950 vor dem Gerichtshof für Kriegsverbrechen in Luxemburg, bestand Rechtsanwalt Dr. Kurt Heim33 auf einem Freispruch für den Angeklagten Stuckenbrock, da dieser seiner Auffassung nach keine Schuld auf sich geladen habe.34 Paul Merten habe hingegen einige Fehler begangen, die man jedoch keineswegs als Kriegsverbrechen bezeichnen könne.35 Um dies zu begründen, verwies Heim zunächst auf einige bereits gefällte Urteile : Unter anderem sei das Urteil des Luxemburger Kassationsgerichtshofes vom 1. Dezember 1949 für ihn nicht duldbar, denn in diesem Verfahren wurde der gestellte Antrag zur Nachprüfung des Kriegszustandes mit der Begründung abgelehnt, dass „le legislateur [sic !] luxembourgeois a nécessairement admis l’existence de l’état de guerre“.36 Dr. Heim ging davon aus, dass nicht zwischen 1940 und 1945 Krieg zwischen Deutschland und Luxemburg geherrscht hatte, sondern erst ab 1944, womit der Tatbestand des Kriegsverbrechens nicht haltbar sei, denn „ [es] gehört doch zum Tatbestand
29 Ebd., S. 90 f. 30 Ebd., S. 93 f. 31 Ebd., S. 95. 32 Dr. Kurt Heim gab seine Unterlagen (insgesamt 82 Bände), die Verteidigung von deutschen Kriegsverbrechern betreffend, im Jahr 1982 an das Bundesarchiv ab. 33 Kurt Heim (*11.8.1905 in Neumagen) wurde 1931 zum Dr. jur. promoviert und im Oktober desselben Jahres als Rechtsanwalt in Trier zugelassen. Er stammte aus katholischem Elternhaus und arbeitete vor allem als Strafverteidiger in zahlreichen Kriegsverbrecherprozessen im In- und Ausland. Nach Kriegsende setzte er sich für den Wiederaufbau der Rechtsanwaltschaftsorganisation ein und wurde in den Vorstand der neu gebildeten Rechtsanwaltskammer Koblenz gewählt ; vgl. Trierischer Volksfreund, Jg. 106, vom 1.10.1981, Nr. 238. 34 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 1. 35 Ebd., S. 1. 36 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 1.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
des Kriegsverbrechens auch das Bewusstsein im Kriege zu leben und Kriegsgesetze beachten zu müssen.“37 In diesem Zusammenhang spielte Heim auch auf die Unwissenheit und geringe Bildung der Angeklagten an, denn laut Heim konnten sie nicht wissen, dass zwischen Luxemburg und dem Deutschen Reich ein Kriegszustand bestand, da beide Angeklagten nicht einmal die höhere Schule absolviert hatten.38 Auch waren sie „kaum in der Lage, einen Unterschied zwischen dem [E]rsten und dem [Z]weiten Weltkrieg zu finden.“39 Dies mochte vielleicht für Merten gelten, der bereits im Ersten Weltkrieg gedient hatte, nicht aber für den zur Kriegsjugendgeneration gehörenden Hantel. Diese Unwissenheit der Angeklagten läge jedoch nicht nur an ihrem geringen Bildungsgrad, sondern wäre auch Resultat der deutschen Propa ganda, denn [i]hre eigene Führung erwähnte […] nie etwas von einem Kriege mit Luxemburg. Peinlich bemühte sie sich, den Gedanken der Heimkehr in das grosse [sic !] deutsche Volk zu betonen und den Beamten Sand in die Augen zu streuen, die vielfach wie Merten von der entgegengesetzten Kante des Reiches herübergeholt wurden, selber oben erst eingegliedert in die Beamtenschaft des Reiches wie ihre Heimatstadt Danzig.40
Des Weiteren verglich Rechtsanwalt Heim die angeklagten Beamten mit den einfachen Soldaten. Er forderte, dass die Beamten („Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“) dieselbe Straffreiheit genießen sollten wie die Soldaten („Kämpfer mit der Waffe“), denn beide Personengruppen hätten Personen, Eigentum und Souveränität des fremden Staates verletzt.41 Er stützte sich dabei insbesondere auf das Gutachten von Professor Walter Schätzel42 aus Mainz : Auch aus einem rein persönlichen Grund sind alle deutschen Soldaten und Beamten aus der Besatzungszeit von der luxemburgischen Gesetzgebung exempt. […] Sicher 37 Ebd., S. 2. 38 Ebd. 39 Ebd. 40 Ebd., S. 2 f. 41 Ebd., S. 10 f. 42 Prof. Dr. jur. Walter Schätzel (1890–1961) war von 1946 bis 1951 Professor für Völkerrecht an der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Mainz. Von 1938 bis 1945 war er Mitglied der NSDAP. Am 5. September 1945 erfolgte seine Verhaftung wegen seiner Stellung als Kriegsgerichtsrat. Es handelte sich hierbei um eine sogenannte automatische Haft, die für verschiedene Beamtengruppen festgelegt wurde ; vgl. Walter Schätzel, in : Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz, online unter : http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz. de (Letzter Zugriff : 21.12.2016).
281
282
|
Jill Steinmetz
ist, dass jedes kriegsführende Heer sein Recht mit sich führt […]. Straftaten, die im kriegsführenden Heer begangen werden, werden nach seinem Recht und nicht nach Landesrecht bestraft. […] Wenn aber das gesamte vorgefundene Strafrecht für den Okkupanten nicht gilt, so kann der verdrängte Staat [Luxemburg] noch viel weniger nachträgliche Strafgesetze43 gegen Okkupanten […] erlassen.44
In diesem Gutachten wird nicht nur deutlich, dass Soldaten und Beamte als eine Personengruppe (Okkupanten) angesehen wurden, sondern auch, dass die gesamte Gruppe nicht nach luxemburgischem Strafrecht verurteilt werden könne. Daraus schloss Heim, dass eine Anwendung des Artikels 118 auf deutsche Besatzungsangehörige nicht möglich war, denn das Völkerrecht stehe über dem Landesrecht.45 In eine ähnliche Richtung geht auch das Zitat aus der Stellungnahme von Professor Donnedieu de Vabres : „Nul ne songe à rendre les officiers ou les soldats d’une armée belligérante, responsable de l’acte d’agression impute aux gouvernants.“46 Da in Luxemburg niemand auf die Idee gekommen sei, „den Offizier oder Soldaten, der mit der Maschinenpistole oder Handgranate in das Grossherzogtum eingedrungen ist“47, wegen Kriegsverbrechen zu verurteilen, sondern man ihm im Gegenteil Straflosigkeit zusicherte, so musste dies auch für die „Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“ uneingeschränkt gelten. Im Laufe seiner weiteren Argumentation ging Heim auch auf den Anklagepunkt ein, dass die Angeklagten als Mitglieder einer verbrecherischen Organisation zu bestrafen seien. Hier merkte er an, dass einige Gruppen von dieser Strafbarkeit ausgeschlossen seien und berief sich auf das Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs : […] cette définition devra exclure les personnes qui n’ont pas eu connaissance de buts ou des actes criminels de l’organisation. Elle devra exclure également ceux qui ont été mobilisée par l’Etat pour en faire partie, à moins qu’ils aient été personnellement impliqués, en qualité de membres de l’organisation, dans la perpétration d’actes déclarés criminels par l’art. 6 du Statut. La seule appartenance formelle à l’organisation ne suffit pas à elle seule pour rentrer dans le cadre de ces déclarations.48
In diesem Auszug werde deutlich, dass die Angeklagten als Gestapo-Angehörige nicht wegen der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation bestraft werden 43 Hierbei handelt es sich um den „Artikel 118 bis“ des Code Pénal. 44 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 12 f. 45 Ebd., S. 13 f. 46 Ebd., S. 10. 47 Ebd., S. 10 f. 48 Ebd., S. 38.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
könnten. Personen, die nichts von den kriminellen Zielen oder Aktionen der Gestapo wussten, dürften nicht bestraft werden. Dies gelte ebenso für Personen, die nicht freiwillig der Gruppe beigetreten seien und nicht persönlich an der Begehung von Straftaten beteiligt waren. Das Urteil des Internationalen Militärgerichtshof erwähnte auch, dass bei der Bestrafung von Gruppenkriminalität die individuelle Schuld des Einzelnen untersucht werden müsse.49 Die Angeklagten Merten und Stuckenbrock könnten laut Dr. Heim nicht wegen ihrer Zugehörigkeit zur Gestapo verurteilt werden, da sie als Beamte zum Einsatzkommando befohlen worden seien und somit nicht freiwillig nach Luxemburg zur Gestapo gekommen waren.50 Er ging jedoch nicht darauf ein, inwiefern seine Mandanten Kenntnis von kriminellen Akten der Gestapo hatten beziehungsweise inwiefern sie in diese Akte verwickelt waren. Am Beispiel des Mitangeklagten Jakob Reif zeigt sich allerdings, dass es Gestapobeamte in Luxemburg gab, die durchaus Kenntnis von kriminellen Aktivitäten hatten. Reif wird in den Zeugenaussagen als äußerst brutaler Beamter dargestellt, der in Vernehmungen gerne den „Lautsprecher“ benutzte, gemeint ist der Ochsenziemer, mit dem er dann auf den Zeugen beziehungsweise Verdächtigen einschlug, bis dieser zusammenbrach oder bereit war, auf seine Fragen zu antworten.51 Die Zeugin Marguerite Michels berichtete über die folgende Begebenheit : Nachdem Reif meinen Bruder Nikolaus (körperlich behindert) verhört hatte, suchte er mich am folgenden Tage im Gefängnis in Diekirch auf und sagte er mir hier u. a.: „Ihr Bruder lügt noch mehr wie sie. Der kommt nach Deutschland. Den sehen sie nie mehr wieder. Was machen wir mit solch einem Kerl ? Der ist doch nichts nutze. So eine Kreatur ! “52
Die letzten Tage vor seinem Tod am 5. April 1944 verbrachte er im Rhamhospiz, da ein ihm bekannter Arzt sich für ihn eingesetzt hatte. Frau Michels ging davon aus, dass nur auf Drängen dieses Arztes ihr Bruder nicht nach Deutschland gebracht wurde, was ihrer Meinung nach die Absicht von Reif gewesen sei. Die von der Zeugin zitierte Aussage Reifs, macht deutlich, dass die Beamten der Gestapo in Luxemburg durchaus die Möglichkeit hatten, Personen zur Deportation auszuwählen. Und selbst wenn Sie nicht die persönliche Befugnis besaßen, konnten sich bei Vorgesetzten in Luxemburg und Berlin dafür einsetzen, dass von ihnen ausge49 Ebd. 50 Ebd., S. 39. 51 ANLux, CdG-149. 52 Ebd.
283
284
|
Jill Steinmetz
wählte Personen in die mörderische Maschinerie, hier die verdeckt laufende Aktion T4, gerieten. Auch macht die Aussage deutlich, dass Beamte der Gestapo, wie Reif, Kenntnis davon hatten, was in Deutschland mit körperlich oder geistig behinderten Menschen passierte. Diese, in den Augen der Nationalsozialisten, wertlosen „Untermenschen“ sollten nicht mehr Teil der „Volksgemeinschaft“ sein dürfen. Im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation zog Dr. Kurt Heim ein weiteres Mal den Vergleich mit der Personengruppe der Soldaten, denn er verglich die Kriegsbeorderung der Beamten mit dem Mobilmachungsbefehl der Soldaten.53 Die Versetzung von Beamten sei bindend und somit konnten die Angeklagten Stuckenbrock und Merten die Versetzung nicht ablehnen. Dies galt ebenso für den Mobilmachungsbefehl für Mitglieder der Wehrmacht.54 Um die Machtlosigkeit der beiden Angeklagten zu verdeutlichen, ging Heim auf die militärische Gebundenheit und Ausrichtung des Einsatzkommandos in Luxemburg (EKL) ein. Auch den erfolglosen Versuch Stuckenbrocks, eine Versetzung an die Front zu erwirken, sah Heim als Beweis für den fehlenden Einfluss der Beamten.55 Neben Stuckenbrock sei auch Merten Opfer der „nationalsozialistische[n] Willkür“ geworden, denn er wollte aufgrund gesundheitlicher Probleme bei seiner Familie in Danzig bleiben.56 Hätten sich die beiden Beamten geweigert, der Versetzung nachzukommen, hätte ihnen vermutlich ein Strafverfahren wegen Ungehorsams gedroht.57 Anhand dieser aufgeführten Punkte kam Heim zu dem Schluss, dass sowohl Stuckenbrock als auch Merten keinerlei verbrecherische Handlungen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft bei der Gestapo nachgewiesen werden könnten.58 Eine weitere Strategie des Verteidigers Dr. Kurt Heim bestand in der Bewertung der Zeugenaussagen, die zur Beweisaufnahme beigetragen hatten. Heim bat zu beachten, dass die Geschehnisse, die die Zeugen schilderten, bereits mehrere Jahre zurückgelegen hätten und deshalb ihre Aussagen Fehler enthalten könnten.59 Hinzu käme, so Heim, die Subjektivität der Aussagen, denn „Trauer und Bitterkeit trüben oft den Blick für das tatsächliche Geschehen“60. Einigen Zeugen warf Heim sogar bewusst vor, bei ihrer Aussage gelogen zu haben, da sie „zum flunkern neigen
53 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 39. 54 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, § 5, Abs. 1, in : Reichsgesetzblatt (RGBl.) Teil I, Berlin 1933, Nr. 34, S. 175–177. 55 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 40. 56 Ebd., S. 40 f. 57 RGBl. I 1939, S. 2107 und BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 39. 58 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 41. 59 Ebd., S. 42. 60 Ebd., S. 42.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
[und] mit der Zeit [haben] feststellen können, wie die von ihnen vorgebrachte Erzählung bei den Zuhörern gefiel“61. Allein die verwendeten Begriffe „flunkern“ und „Erzählung“ verdeutlichen, dass laut Verteidiger Heim diese Aussagen nicht ernst genommen werden dürften, denn die Zeugen hätten den Anschein vermittelt, dass sie den Gerichtssaal als Bühne benutzten, um sich selbst darzustellen und das Publikum zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang warf er auch einigen Zeugen vor, Dinge „erfunden oder umgedeutet, hinzugedichtet oder ersetzt“62 zu haben, was einer Falschaussage vor Gericht gleichkäme. Auch posttraumatische Störungen sollten das Erinnerungsvermögen einiger Zeugen beeinflusst haben.63 Demnach hätten einige Zeugen vor Gericht Ereignisse in den Villen Pauly, Conter und Seligmann64 mit Vergehen in dem SS-Sonderlager/KZ Hinzert65 verwechselt.66 Bereits während der Beweisaufnahme versuchten die Verteidiger, so auch Dr. Heim, die Zeugen zu verunsichern. Er glaubte, dass Merten Opfer einiger Verwechslungen gewesen sei.67 Mitangeklagte sowie einzelne Zeugen waren der Auffassung, dass Merten seinem Kollegen Siedenborg ähnelte und dadurch die Möglichkeit einer Verwechslung bestanden hätte.68 Dieselbe Strategie benutzte später auch der Strafverteidiger Hans Laternser im ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess. Er war der Auffassung, dass es unmöglich sei, nach so langer Zeit eine Person mit Gewissheit wiederzuerkennen.69 Um die Mehrdeutigkeit von Zeugenaussagen zu verdeutlichen, führte Dr. Heim einige Beispiele aus Prozessen in den Nachbarländern Luxemburgs auf, unter an61 Ebd. 62 Ebd. 63 Ebd., S. 43. 64 Bei den drei Gebäuden handelte es sich um den Sitz der Gestapo in der Stadt Luxemburg sowie der Gestapo-Außenstellen in Diekirch und Esch. 65 Zur Rolle der Gestapo Trier und Luxemburg im SS-Sonderlager/KZ Hinzert vgl. Katharina Klasen : Allgegenwärtig ? Die Geheime Staatspolizei und das SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 13), Mainz/Hinzert 2015. 66 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 43. 67 BArch Koblenz, AllProz 21/345, Brief des Rechtsanwalts Heim an Frau Merten vom 23. Januar 1950. 68 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 45. 69 Christian Dirks : Selekteure als Lebensretter. Die Verteidigungsstrategie des Rechtsanwalts Dr. Hans Laternser, in : Gerichtstag halten über uns selbst. Geschichte und Wirkung des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses (Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2001), hg. vom Fritz Bauer Institut, Frankfurt a. M. 2001, S. 163–192, hier S. 175. Ähnliche Strategien wurden in Prozessen in Österreich verfolgt ; vgl. Gabriele Pöschl : (K)ein Applaus für die österreichische Justiz, in : Heimo Halbrainer/Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.) : Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, Bd. 1), Graz 2007, S. 297–301, hier S. 297–299.
285
286
|
Jill Steinmetz
derem den Prozess gegen KZ-Wächterinnen in Rastatt und den Prozess gegen den Hauptmann Dietrich in Metz, bei denen es zu personalen Verwechslungen in den Zeugenaussagen gekommen war.70 Neben den personenbezogenen Verwechslungen bat Heim, auch die Möglichkeit von ortsbezogenen Verwechslungen in Betracht zu ziehen. Um seine beiden Klienten weiter zu entlasten, benannte Heim gegen Ende seines Plädoyers Zeugenaussagen, die die Anständigkeit des Angeklagten Stuckenbrock bestätigen sollten.71 Es handelte sich hierbei unter anderem um eine Zeugin, die Stuckenbrock eine Dankeskarte geschickt hatte.72 Ein weiterer Zeuge schilderte Stuckenbrock als Person, die in erster Linie Mensch gewesen sei und dann erst Beamter.73 Auch die Tatsache, dass die Bekämpfung von Widerstandsgruppen und deren Mitgliedern zu den Rechten und Pflichten einer Besatzungsmacht gehörte und dies somit nicht völkerrechtswidrig sein könne, spräche für die Entlastung Stuckenbrocks, dem in der Beschuldigtenvorladung die Verhaftung und Vernehmung von Mitgliedern luxemburgischer Widerstandsgruppen vorgeworfen wurde.74 Auch hier stellte der Verteidiger wieder die positiven Eigenschaften seines Mandanten in den Vordergrund, wenn er sagte, dass Stuckenbrock an einzelnen Verhaftungen beteiligt gewesen sei, aber sich auch für Verhaftete eingesetzt hätte, indem er zum Beispiel Entlastungsbeweise für sie gesammelt hätte. Ein Beispiel sei der Fall Sevenig : Da kommt das gute mitfühlende Herz zum Durchbruch, das ihm in der Betrachtung des Ortsgruppenleiters das Urteil einbrachte, das müsse doch ein eigenartiger Gestapobeamter sein, der sich da selbst um Entlastungsbeweise für den von ihm vernommenen Staatsanwalt Sevenig bemühe.75
Insgesamt hätte Stuckenbrock sein Amt als Polizeibeamter nach rheinischer Art ausgeübt, mit Verständnis und Mitgefühl, mitunter auch mit einem Zwinkern in seinen stets zum Schmunzeln bereiten Augen, die auch schon mal geneigt waren, ein wenig sich zudrücken zu lassen, wo sie nicht alles sehen wollten, wo das Herz mehr auf der Seite des Bedrängten stand als bei dem nur befehlenden Vorgesetzten.76 70 BArch Koblenz, AllProz 21/16, S. 44 f. 71 Ebd., S. 46. 72 Ebd. 73 Ebd., S. 48. 74 Ebd., S. 47. 75 Ebd., S. 48. 76 Ebd., S. 49.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
Auch von dem Vorwurf, er hätte Kenntnis von Missständen gehabt und diese nicht gemeldet, wäre Stuckenbrock laut Heim freizusprechen.77 Was seinen Klienten Merten anbelangt, so sprach Dr. Heim hier von „gelegentlichen Entgleisungen“, die der Angeklagte begangen hätte.78 Einzig der Zeuge Josef Pinnel sprach von „systematischen Quälereien“ Mertens. Die Aussage dieses Zeugen wies laut Verteidiger jedoch einige Irrtümer auf und sei deshalb nicht ausreichend, um den Angeklagten Merten zu verurteilen.79 Daneben versuchte Heim die Taten des Angeklagten zu bagatellisieren, denn es hätte sich nur um „ein oder zwei Schläge mit einem Weidenstock oder einer Gerte“80 gehandelt. Hinzu kam, dass er die Schläge Mertens damit rechtfertigte, dass Merten sich in einer Ausnahmesituation befunden hätte und das Verhalten der vernommenen Jugendlichen möglicherweise Anlass für die Entgleisungen Mertens gewesen sei.81 Auch bleibende Schäden hätte keiner der Jugendlichen von der Misshandlung davongetragen.82 Man könne somit laut Heim zwar „zweifellos [von] Entgleisungen des Angeklagten Merten“ sprechen, jedoch nicht von einem „systematischen Handeln“ oder von einer „bewussten Quälerei“.83 Mertens Verhalten resultierte möglicherweise aus seinen im Ersten Weltkrieg erlebten Kriegserfahrungen, da diese zu einer Abstumpfung geführt haben könnten und somit seine Brutalität im Umgang mit Häftlingen erklärten. Insgesamt könne man, so Heim, keines der Vergehen Mertens als Kriegsverbrechen bezeichnen, auch wenn sie ihn als Beamten durchaus belasten würden.84 Es verwundert, dass Heim sich hier nicht des Arguments bediente, Merten hätte nach gültigen Gesetzen des „Dritten Reiches“ gehandelt, wozu auch die „verschärften Vernehmungen“ gehörten. Dieses Argument taucht − auch deutlich später − immer wieder in den betreffenden Verfahren auf. Heim schloss sein Plädoyer mit Zeugenaussagen ab, welche die positiven Eigenschaften und Taten Mertens hervorheben sollten.85
77 Ebd., S. 51. 78 Ebd., S. 54. 79 Ebd., S. 55–64. 80 Ebd., S. 66 f. 81 Ebd., S. 67. 82 Ebd. 83 Ebd., S. 68. 84 Ebd., S. 72. 85 Ebd., S. 73–75.
287
288
|
Jill Steinmetz
Die Urteilsverkündung im Spiegel der Annäherungspolitik der 1950er Jahre
Von den 16 angeklagten Personen waren nur elf im Gericht anwesend. Vier von ihnen wurden zum Tode verurteilt : Fritz Hartmann, Walter Runge, Erich-August Höhmann und Herbert Otto Waldemar Dietrich. Für den Vertreter der Anklage war Walter Runge der Hauptschuldige für die Verbrechen, die die Gestapo und ihre Beamten in Luxemburg während der Besatzung begangen hatten : Wir [Vertretung der Anklage, A.d.V.] sind nämlich der Ansicht […], dass Runge derjenige Gestapomann war, der dauernd in Luxemburg anwesend war und dessen Verantwortung mit Vorbedacht als feststehend und bewiesen angesehen werden muss. Im Gegensatz zu allen Annahmen der öffentlichen Meinung war es viel weniger Hartmann oder Nölle als Runge, der der Hauptschuldige an all den Schreckenstaten war, welche während vier langen Jahren von seinen direkten Untergebenen begangen wurden.86
Vier Angeklagte − Sebastian Ranner, Josef Stuckenbrock, Herbert Jost und Friedrich Theodor Sterzenbach − wurden freigesprochen. Die übrigen Angeklagten erhielten Zuchthausstrafen, mehrere Jahre Zwangsarbeit sowie Gefängnis- und Geldstrafen. Fritz Hartmann und Herbert Otto Waldemar Dietrich, die in Anwesenheit zum Tode verurteilt worden waren, wurden mehrfach begnadigt. Wenige Monate nach der Urteilsverkündung wurden im Gnadenerlass vom 20. Dezember 1951 die Todesurteile in lebenslängliche Zwangsarbeit umgewandelt. Im Jahr 1957 wurde die verbliebene Strafe bei Hartmann auf 15 Jahre und bei Dietrich auf 16 Jahre Zwangsarbeit reduziert. Hans Klöckers Strafe wurde im Gnadenerlass vom 21. Dezember 1953 auf 15 Jahre herabgesetzt. Die frühen Begnadigungen der verurteilten Kriegsverbrecher beruhten auf politischen Entwicklungen und der damit verbundenen Diplomatie, denn die 1950er Jahre waren gekennzeichnet durch das Bemühen um Solidarität innerhalb der westlichen Länder gegen den gemeinsamen Gegner im Kalten Krieg, die Sowjet union. Auch in Frankreich stand der Wunsch nach einer Kooperation mit dem deutschen Nachbarn und einer europäischen Einigung, auch hinsichtlich einer gemeinsamen Verteidigungsgemeinschaft, über dem Sachverhalt der Kriegsverbrecherprozesse und den daraus resultierenden Urteilen. Die Begnadigungen waren auch beeinflusst durch den politischen Druck seitens der deutschen Regierung und des Landes Rheinland-Pfalz, mit dem Luxemburg unter anderem wirtschaftlich kooperierte. Die Gründung der Bundesrepublik und der damit verbundene Beginn der Normalisierung der Beziehungen zwischen Deutschland und Luxemburg 86 ANLux, CdG-173, S. 143.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
hatten Einfluss auf den Umgang mit den inhaftierten Kriegsverbrechern und deren Begnadigung gehabt.87 Im Fall Fritz Hartmann soll sich Bundeskanzler Konrad Adenauer persönlich für dessen Begnadigung eingesetzt haben. Vor dem Deutschen Bundestag versicherte er, sich „in umfassender Weise [für] Entlassungen von Inhaftierten“ einzusetzen, die im Ausland verurteilt wurden und dort im Gefängnis ihre Strafe absäßen.88 Die Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte e.V.89 setzte sich für die Freilassung der in Luxemburg inhaftierten Kriegsverbrecher ein. In einem Schreiben vom 7. November 1956 bat Prinzessin Helene Elisabeth von Isenburg, erste Präsidentin und bis 1959 Vorsitzende der „Stillen Hilfe“, um „die Rücksendung unserer 3 deutschen Kriegsverurteilten“ [Dietrich, Hartmann und Steffen]. Damit würde ein wesentlicher Beitrag zum Frieden in Europa geleistet werden, denn „solange noch Gefangene in anderen Ländern festgehalten werden, solange können aus Gegnern keine Partner werden.“90 Bereits 1950 äußerte sich Heim in einem Schreiben an Dr. Hans Gawlik, Leiter der Zentralen Rechtsschutzstelle91, dass sich von den Angeklagten im Gestapo-Prozess am 4. September 1950 noch Hartmann, Klöcker, Reif und Dietrich in Luxemburg in Haft befänden, er jedoch davon ausgehe, dass die luxemburgische Regierung im Zeichen der Annäherung der europäischen Völker sich nicht mehr lange weigern könne, die restlichen Verurteilten deutscher Staatsangehörigkeit freizulassen, da diese größtenteils zwischen vier und fünf Jahren Haft verbüßt hätten.92 Entgegen der Erwartung Heims wurde Fritz Hartmann als letzter inhaftierte Kriegsverbrecher jedoch erst kurz vor Weihnachten 1957 nach Deutschland abgeschoben. Der Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und vermissten Angehörigen Deutschlands e.V. (VdH)93 begrüßte die Entlassung in einem Schreiben an Justizminister Victor 87 Krier : Luxemburg, S. 89. 88 Mathias Wallerang : Luxemburg unter nationalsozialistischer Besatzung. Luxemburger berichten (Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz, Bd. 22), Mainz 1997, S. 141 f. 89 Der 1951 in das Vereinsregister von Wolfratshausen eingetragene Verein Stille Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte e.V. sorgte für die juristische Betreuung der Kriegsverbrecher und zahlte Urlaubs-, Entlassungs- und Weihnachtsgelder an die Häftlinge sowie deren Angehörige. Die Kriegsverbrecherprozesse wurden vom Verein als Siegerjustiz diffamiert. Vgl. auch Norbert Frei : Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996, S. 166. 90 ANLux, Jt-057. 91 Die Zentrale Rechtsschutzstelle (ZRS) bestand von 1950 bis 1970 und war zunächst dem Bundesjustizministerium, ab 1953 dem Auswärtigen Amt unterstellt. Ihre Aufgabe war es, „den Rechtschutz für diejenigen Deutschen sicherzustellen, die in Auswirkung des Krieges im Ausland festgehalten“ wurden ; vgl. Frei : Vergangenheitspolitik, S. 181 f. 92 BArch Koblenz, AllProz 21/286. 93 Birgit Schwelling : Heimkehr − Erinnerung − Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn 2010.
289
290
|
Jill Steinmetz
Bodson vom 10. Januar 1958 als „einen weiteren Schritt auf dem Weg einer über das Militärische und Wirtschaftliche hinausgehenden Zusammenarbeit der freien europäischen Völker“94. Die Begnadigungen, welche bereits früh nach der Urteilsverkündung erfolgten, wurden unter anderem durch die Vereinigung Mouvement national pour la paix95 stark kritisiert. In einem Brief vom 15. Januar 1952 wendete sie sich direkt an die Großherzogin Charlotte und drückte ihren Missmut aus : Celui-ci [das luxemburgische Volk, A.d.V.] se refuse à attribuer cette action de grâce vis-à-vis des contempteurs de notre indépendance et de toute humanité, à l’initiative de Celle [Großherzogin Charlotte, A.d.V.] qui représentait pendant la guerre pour des milliers de Luxembourgeois le symbole de notre droit à l’existence nationale et de notre résistance à l’oppression et à la guerre.96
Weiter befürchtete der Verein, dass der Druck, welcher auf manche Regierungen ausgeübt wurde, zum Ziel hatte, die verurteilten Kriegsverbrecher nach ihrer Freilassung an die Spitze einer wiederaufgebauten deutschen Armee zu setzen. Man widersetzte sich „contre toute tentative de l’entraîner [das luxemburgische Volk, A.d.V.] dans une guerre nouvelle côte à côte avec des Allemands et de lui faire subir à nouveau le régime des Hartmann et Dietrich“97. Die Begnadigungen im Großherzogtum Luxemburg sind keine Einzelfälle gewesen. Sie spiegeln die Umsetzung von Milde und Amnestie, die allgemein in europäischen Prozessen zu beobachten ist, wider. Das Argument des politischen Einflusses auf die Begnadigungen wird zusätzlich dadurch bekräftigt, dass es in Prozessen gegen luxemburgische Kollaborateure, die nicht von politischem, wirtschaftlichem oder diplomatischem Interesse waren, zu zwölf Todesurteilen gekommen war, von denen acht vollstreckt wurden.98 Dies ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei den Kollaborateuren und Denunzianten um Täter aus der eigenen Umgebung handelte, welche Verbrechen begangen hatten, unter denen die eigene Bevölkerung schwer zu leiden gehabt hatte. Dies erklärt, warum man sich in den ehemals nationalsozialistisch besetzten Ländern, wie den Niederlan94 ANLux, Jt-057. 95 Hierbei handelte es sich um den 1949 gegründeten Luxemburger Ableger von Mouvement de la paix, einer ursprünglich im Februar 1948 in Frankreich von 60 Persönlichkeiten aus der Résistance geschaffenen pazifistischen Organisation. 96 ANLux, Jt-057. 97 Ebd. 98 Paul Cerf : De l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la seconde guerre mondiale, Luxemburg 1980, S. 218.
„Kämpfer mit dem überzeugenden Wort“
|
den und Luxemburg, in den Nachkriegsjahren, die durch den Kampf gegen die deutsche Besatzung und für die Wiedererlangung von Freiheit und Souveränität gekennzeichnet waren, vorrangig mit Kollaborateuren beschäftigte und diese mitunter sehr hart bestrafte. Es stellt sich nun die Frage, wie das Urteil vom 27. Februar 1951 und die darauf folgenden Gnadengesuche in die einzelnen Phasen der Verfolgung von NS-Verbrechen einzuordnen sind. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte, so Norbert Frei99, in einer ersten Phase eine intensive Verfolgung von NS-Verbrechern durch die Alliierten, an deren Ahndungspolitik sich auch die übrigen europäischen Staaten orientierten. Diese erste Phase endete mit der Teilung Deutschlands, und es begann eine zweite Phase, die vor allem durch Milde und Amnestie gekennzeichnet war, so dass sich Ende der 1950er Jahre kaum noch deutsche Kriegsverbrecher in Europa in Haft befanden. Gegen Ende des Kalten Krieges folgte eine neue Welle von Kriegsverbrecherprozessen, die jedoch stark von der jeweiligen politischen Situation der einzelnen Länder abhing. Dies resultierte daraus, dass in Teilen der europäischen Bevölkerung Kritik sowohl in moralischer als auch in rechtlicher Form als Reaktion auf die Amnestiepolitik entstanden war. Folgt man dieser Einteilung, so sind die Kriegsverbrecherprozesse in Luxemburg und ihre Urteile in die zweite Phase der Verfolgung einzuordnen. Daraus ergibt sich, dass keines der Todesurteile vollstreckt wurde, sondern noch im selben Jahr die in Anwesenheit der Angeklagten ausgesprochenen Todesurteile in Haftstrafen umgewandelt wurden. Das kann man durchaus als Amnestiehandlung bezeichnen. Darüber hinaus ist es auffällig, dass das Gericht in einigen Fällen schwerere Strafen verhängte als gefordert. So beantragte der Militärauditor für den Angeklagten Hartmann im Gestapoprozess lediglich eine Zwangsarbeitsstrafe, das Gericht verhängte jedoch ein Todesurteil. Am größten war die Diskrepanz zwischen der Forderung des Militärauditors und dem anschließenden Urteil bei dem Angeklagten Dietrich. Während der Militärauditor eine „prinzipielle Bestrafung [forderte], weil [er] im vorliegenden Verfahren kaum in Erscheinung getreten ist“100, verurteilte das Gericht ihn in Anwesenheit zum Tode. Der Grund für die zum Teil überaus strengen Urteile war möglicherweise der Druck von Seiten der ehemaligen luxem burgischen Widerstandskämpfer, von denen in den Jahren 1944 und 1945 einige in die Regierung aufgenommen worden waren : Pierre Frieden (Aufnahme am 23.11.1944), Robert Als, Guillaume Konsbrück (beide Aufnahmen am 23.2.1945) 99 Norbert Frei : Nach der Tat. Die Ahndung deutscher Kriegs- und NS-Verbrechen in Europa – Eine Bilanz, in : Ders. (Hg.) : Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006, S. 7–36, hier S. 22. 100 BArch Koblenz, AllProz 21/345.
291
292
|
Jill Steinmetz
und Nicolas Margue (Aufnahme am 21.4.1945). Den größten Einfluss auf die Strenge des Urteils hatten wohl die zwei Beisitzer im Kriegsverbrechertribunal, die Mitglieder von Widerstandsorganisationen waren und damit ein persönliches Interesse an hohen Strafen hatten. Zudem vertraten sie in dieser Position zahlreiche Widerstandskämpfer, die Vergeltung forderten. Den in Luxemburg verurteilten deutschen Kriegsverbrechern bot sich nach Verbüßung ihrer Strafen die Möglichkeit, ihre Vergangenheit in den Hintergrund treten zu lassen, angesehene bürgerliche Berufe auszuüben und sich in die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft zu integrieren. Fritz Hartmann, der sich nach seiner vorzeitigen Haftentlassung kurz vor Weihnachten 1957 nach Düsseldorf zu seiner Frau und seinem Sohn begab und dort anschließend als Rechtsanwalt arbeitete, wurde im August 1970 noch einmal als Beschuldigter in einem Ermittlungsverfahren gegen sich und Andere vernommen. Eine Anklage wegen der Beteiligung an der Deportation von insgesamt 674 Juden aus Luxemburg in der Zeit vom 19. Oktober 1941 bis zum 28. September 1943 wurde nicht mehr erhoben.101
101 BArch Ludwigsburg, B 162/6903 bis 6908, hier 6907, Bl. 972–991, Vernehmungsprotokoll des Beschuldigten Fritz Hartmann vom 6.8.1970.
Thomas Grotum
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda Weitere Forschungen zur Geschichte der Staatspolizeistelle Trier
Nicht alle im Rahmen des Forschungsprojekts zur Geschichte der Gestapo Trier entstandenen Studien sind durch einen eigenen Beitrag in diesem Band vertreten. Das hat nichts mit der Qualität der Arbeiten zu tun, sondern ist allein dem Umstand geschuldet, dass die potentiellen Autorinnen aufgrund ihrer Tätigkeit als Referendarinnen bzw. Lehrerinnen nicht die Zeit gefunden haben, einen entsprechenden Text zu verfassen. Deshalb sollen zumindest die Themen von sechs Arbeiten hier etwas ausführlicher vorgestellt werden,1 ohne den Anspruch zu erheben, alle gewonnenen Erkenntnisse erschöpfend darstellen zu wollen. Teilweise werden auch Aspekte angesprochen, die erst nach Abschluss der Studien durch neue Quellenfunde zutage gefördert worden sind. Zunächst gilt es, Erkenntnisse aus drei biographischen Studien zu präsentieren, und zwar aus einer Gruppen-, einer Familien- und einer Einzelbiographie. Sie haben sowohl einen Täter als auch verschiedene Opfergruppen in den Blick genommen.
Die Karriere des Gestapobeamten Friedrich Schmidt
Viktoria Bach hat sich näher mit dem Gestapobeamten Friedrich Schmidt beschäftigt.2 Ausgangspunkt waren die familiengeschichtlichen Nachforschungen der Sozialpädagogin Katrin Raabe (Eppelheim)3 über ihren Großonkel. Der gelernte 1 Eine weitere Studie (Viktoria Franz : Die Nationalpolitische Erziehungsanstalt St. Wendel. Eine privilegierte oder eine instrumentalisierte Elite ? Masterarbeit Trier 2014) weist keinen direkten Bezug zur Gestapo Trier auf und ist deshalb unberücksichtigt geblieben. 2 Viktoria Bach : Karriere in der Gestapo. Biographische Studien zu einem Trierer Gestapo-Mitglied, Staatsexamensarbeit Trier 2014. 3 Im Januar 2015 hat Katrin Raabe gemeinsam mit Roland Laich den Verein NS-Familien-Geschichte : hinterfragen – erforschen – aufklären e.V. gegründet, um die Erfahrungen weiterzugeben, ähnliche Recherchen zur NS-Familiengeschichte anzuregen und die Ergebnisse insbesondere jüngeren Menschen zugänglich zu machen ; vgl. auch die Homepage des Vereins : http://www.ns-familien- geschichte.de (Zuletzt besucht : 17.8.2017).
294
|
Thomas Grotum
Schlosser aus Göttingen, Jahrgang 1902, kam im Anschluss an seine Dienstzeit bei der Schutzpolizei in Erfurt im Jahr 1936 zur Gestapo nach Trier. Nach der Besetzung Luxemburgs im Mai 1940 wechselte er im September zur neu geschaffenen Dienststelle der Geheimpolizei im Großherzogtum. Er war sowohl in LuxemburgStadt (Villa Pauly) als auch in der Außenstelle in Esch-sur-Alzette (Villa Seligmann) tätig. Ferner gehörte er dem „Vernehmungskommando“ im SS-Sonderlager/ Konzentrationslager Hinzert an.4 Seine Hauptaufgabe bestand in der Bekämpfung des luxemburgischen Widerstands. Der Kriminalsekretär Friedrich Schmidt, der im Mai 1942 die Aufnahme in die Schutzstaffel (SS) beantragte und letztendlich den Grad eines SS-Oberscharführers führte,5 gehört zu der großen Gruppe der Akteure, ohne deren tatkräftige Mitwirkung die Maschinerie der Geheimen Staatspolizei nicht funktioniert hätte. Von einer seiner drei Töchter noch jüngst als „treusorgender“ Familienvater beschrieben,6 nutzte der Angehörige der Kriegsjugendgeneration, das fünfte von acht Kindern eines Pferdewärters, die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs und wagte den Quereinstieg in die preußische Schutzpolizei. Am 1. Mai 1933 wurde er Mitglied der NSDAP und gehörte somit zur Gruppe der „Maiveilchen“, also derjenigen, die unmittelbar vor dem Aufnahmestopp noch einen Antrag gestellt hatten.7 Nach dem Ende der 12-jährigen Gesamtdienstzeit im Jahr 1936 verließ Schmidt die Schutzpolizei als Revier-Oberwachtmeister. Er bewarb sich bei der Vormerkstelle der Polizei in Potsdam, die ihn zur Staatspolizeistelle Trier vermittelte.8 Friedrich Schmidt verblieb bis zum Ende des NS-Regimes in der Region Trier/ Luxemburg. Im September 1944 war er als verantwortlicher Gestapobeamter an Kriegsendverbrechen beteiligt. Unmittelbar vor der Befreiung des Großherzogtums durch US-amerikanische Truppen befehligte er Ende August/Anfang September ein Erschießungskommando der Gestapo aus Esch, das auf den Friedhöfen von Palzem und Nennig, zwei kleinen Moselorten auf deutscher Seite, französische und luxemburgische Gefangene tötete. Die französischen Staatsbürger Georges Claudon, Germaine Causier, Marcel Voyat, Henri Uguccioni und Edmont Helck
4 Siehe den Beitrag von Katharina Klasen in diesem Band. 5 Bundesarchiv (BArch) Berlin, ehem. BDC-Unterlagen, Friedrich Schmidt. 6 Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015, S. 121. 7 Jürgen W. Falter : Die „Märzgefallenen“ von 1933. Neue Forschungsergebnisse zum sozialen Wandel innerhalb der NSDAP-Mitgliedschaft während der Machtergreifungsphase, in : Geschichte und Gesellschaft 24 (1998), H. 4, S. 595–616, hier S. 596. 8 Landesarchiv des Saarlandes (LA Saarland), StAnw, Nr. 2664.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
sowie die Luxemburger Emile Deiskes, Michel Bockler und Nicolas Weiwers wurden in diesem Zusammenhang ermordet.9 Im März 1945 geriet Friedrich Schmidt in amerikanische Gefangenschaft, konnte aber ein halbes Jahr später entkommen. Im August 1946 verhafteten ihn die Briten in seiner Heimatstadt Göttingen und verbrachten ihn schließlich in das Lager Staumühle bei Paderborn. Auch von dort konnte der ehemalige Gestapobeamte im April 1948, kurz bevor er nach Frankreich ausgeliefert werden sollte, fliehen. Er tauchte – im wahrsten Sinne des Wortes – mehrere Jahre unter und arbeitete unter falschem Namen im Bergbau. In der Zwischenzeit wurde er 1949 vom Tribunal Général der französischen Besatzungsmacht in Rastatt in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Nachdem für ihn feststand, dass die Bundesrepublik Deutschland ihre Hoheitsrechte wieder erlangt hatte, kehrte Schmidt im Dezember 1954 zurück zu seiner Familie.10 Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaften Göttingen, Saarbrücken und Trier sind eingestellt worden. Seine Bewerbung bei der niedersächsischen Polizei hat man allerdings abgelehnt, so dass er schließlich als Büroangestellter tätig war. Friedrich Schmidt starb 1964, ohne jemals in der Bundesrepublik Deutschland wegen seiner Taten als Gestapobeamter gerichtlich belangt worden zu sein. Die Recherchen im Fall „Friedrich Schmidt“ führten auf Initiative von Katrin Raabe zur Bildung einer deutsch-luxemburgischen Forschergruppe. Neben vier Mitgliedern des universitären Forschungsprojekts zur Geschichte der Gestapo Trier beteiligten sich das Musée national de la Résistance in Esch-sur-Alzette, das Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (Luxemburg) und der Verein NS-Familien-Geschichte : hinterfragen – erforschen – aufklären e.V. an der Ausarbeitung einer Ausstellung, die vom 17. Oktober 2015 bis zum 8. Mai 2016 unter dem Titel „Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung“ im beteiligten Museum gezeigt wurde und seitdem als Wanderausstellung zur Verfügung steht.11
9 Kreisarchiv (KrA) Trier-Saarburg, P 428 ; LA Saarland, StAnw, Nr. 2658 bis 2665 ; Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz, Best. 584,002, Nr. 660 und 1578. Die Akten im LHA Koblenz beziehen sich auf Tötungsdelikte im SS-Sonderlager/Konzentrationslager Hinzert. 10 LA Saarland, StAnw, Nr. 2658. 11 Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg.
295
296
|
Thomas Grotum
Die Geschwister Torgau im Trierer kommunistischen Widerstand
Gwendolyn Kloppenburg widmete ihre Studie den Geschwistern Aurelia (* 1914), Friedrich (* 1908) und Wilhelm (* 1911) Torgau aus Trier.12 Geprägt durch das politische Engagement ihres Vaters August, der 1919 aus französischer Internierungshaft als überzeugter Sozialist nach Trier zur Familie zurückkehrte, zu den „roten Betriebsräten“ der Eisenbahnhauptwerkstätte Trier-West zählte, Mitbegründer der Trierer Ortsgruppe der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) war und dieser 1921 für kurze Zeit auch vorstand, waren die drei Geschwister während der Zwischenkriegszeit Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD). Eine einheitliche politische Meinung herrschte in der Familie allerdings nicht vor. Der Vater war als Vertreter der „Einheitsfront“ im August 1923 vorübergehend aus der KPD ausgeschlossen worden. Im Jahr 1929 wechselte er in die KPD-Opposition (KPD-O), da er den Kurs der Kommunistischen Internationale, ihren Kampf auf die Sozialdemokratie zu konzentrieren, nicht mitgehen wollte.13 Der älteste Sohn Emil – so sein Bruder Friedrich während einer polizeilichen Vernehmung am 28. April 1936 – ist 1928 in die NSDAP eingetreten.14 In der Endphase der Weimarer Republik kam es auch in Trier zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten bzw. Sozialdemokraten. Die Sturmabteilung (SA) trat immer öfter selbstbewusst und gewalttätig auf. Dabei waren zwei Tote zu beklagen. So griffen SA-Männer am 10. Juli 1932 einen Festzug des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold in Trier-Pfalzel an. Durch fünf Schüsse getroffen, brach Herrmann Möschel (SPD) zusammen und erlag am Folgetag seinen Verletzungen. Zwei andere Reichsbannermitglieder wurden ebenfalls durch Schüsse verwundet, weitere Männer durch Messerstiche oder Schläge mit Pflastersteinen, Reitpeitschen, Schlagringen oder Zaunpfählen schwer verletzt. Kinder und Frauen, die sich im Festzug befunden haben, kamen glücklicherweise mit leichten Blessuren davon. Die eingeleiteten Ermittlungen gegen die Täter wurden ein halbes Jahr später eingestellt.15 Ein zweites Todesopfer gab es in der Silvesternacht 1932/33. Um 2 :00 Uhr traf eine Gruppe von SA-Männern in Trier-Ehrang auf eine Gruppe von Kommunisten. Nach einem Wortwechsel kam 12 Gwendolyn Kloppenburg : Gezeichnet vom NS-Regime. Biographische Studien zu Trierer Kommunisten der Zwischenkriegszeit, Staatsexamensarbeit Trier 2014. 13 Bernd Steger/Peter Wald : Hinter der grünen Pappe. Orli Wald im Schatten von Auschwitz – Leben und Erinnerungen, Hamburg 2008, bes. S. 18–26. 14 Landesarchiv-NRW – Abt. Westfalen [LA-NRW (Westf.)], Q 211a/9662, Bl. 161. 15 Edgar Christoffel : Der Weg durch die Nacht. Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der Zeit des Nationalsozialismus. Verfolgte aus Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager und Zuchthäuser des „Dritten Reiches“, Trier 1983, S. 21–26.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen. Die SA-Männer zogen Pistolen und gaben Schüsse ab. Der KPD-Ortsvorsitzende Peter Greif ist offensichtlich gezielt durch einen Bauchschuss niedergestreckt worden, als er einem am Bein verletzten Genossen zur Hilfe kam. Der 30-jährige erlag am 5. Januar 1933 seinen Verletzungen. Die Täter setzten sich für kurze Zeit ins Ausland ab. Die Ermittlungen gegen einen Beteiligten, der am 16. Januar 1933 festgenommen werden konnte, wurden fallen gelassen. Durch die Machtübernahme zwei Wochen später blieben die Täter unbehelligt.16 Die drei Geschwister gerieten unmittelbar nach der „Machtergreifung“ in das Visier der neuen Machthaber. Noch im Vorfeld der Reichstagswahlen vom 5. März 1933 waren in Trier zum ersten Mal SA-Männer als Hilfspolizisten eingesetzt worden. Mehr als 50 kommunistische Funktionäre wurden in Trier und Umgebung verhaftet. Sie landeten zum Teil – wie weitere „Schutzhäftlinge“ – in der Trierer Hornkaserne, wo sich ein „frühes KZ“ befand. Im November 1933 sind schließlich 15 Kommunisten in das Konzentrationslager Sonnenburg (bei Frankfurt/Oder) eingeliefert worden. Unter ihnen befand sich Wilhelm („Willi“) Torgau17, der nach der Schließung der Haftstätte in das Emslandlager Esterwegen überführt wurde. Von dort entließ man ihn im März 1934 wieder nach Trier.18 Friedrich („Fritz“) Torgau war im August 1933 zunächst in Schutzhaft genommen worden, da er sich an der Herstellung kommunistischer Flugblätter beteiligt hatte, die zwei Monate zuvor in Trier und Umgebung verteilt worden waren. Am 15. des Monats wurde gegen vier beteiligte Personen Haftbefehl durch das Amtsgericht Trier erlassen. Nach Prüfung der Sachlage gab der Oberreichsanwalt das Verfahren an das Oberlandesgericht (OLG) Hamm ab. Im Laufe der Ermittlungen kam ein weiterer Beschuldigter hinzu, der sich allerdings zum Zeitpunkt der Anklagerhebung (10. Februar 1934) bereits im Konzentrationslager Sonnenburg befand und elf Tage später nach Papenburg verlegt wurde. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat wurde Fritz Torgau am 28. März 1934 vom 1. Strafsenat des OLG Hamm zu anderthalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe hat er unter Anrechnung der Untersuchungshaft in den Gefängnissen in Siegburg und Bad Kreuznach bis zum 14. Februar 1935 verbüßt.19 16 Ebd., S. 27–29. 17 Beate Dorfey : Art. „Torgau, Wilhelm“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 469–470. 18 Barbara Weiter-Matysiak : Widerstand im Raum Trier, in : Dieter Schiffmann/Hans Berkessel/ Angelika Arenz-Morch (Hg.) : Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. Wissenschaftliche Darstellung und Materialien für den Unterricht, Mainz 2011, S. 157–169, hier S. 158. 19 LA-NRW (Westf.), Q 211a/13859 und 13860.
297
298
|
Thomas Grotum
Auch gegen Aurelia („Orli“) Torgau20 wurde seitens der Staatspolizeistelle Trier vorgegangen, nachdem sie als kommunistische Kurierin denunziert worden war. Eine Durchsuchung der elterlichen Wohnung am 29. Mai 1934 morgens um 6 :10 Uhr, die ein Gestapobeamter gemeinsam mit einem hinzugezogenen SA-Mann durchführte, verlief zwar ergebnislos, trotzdem wurde Aurelia Torgau auf ihrer Arbeitsstelle in der Zigarettenfabrik Neuerburg festgenommen und „in das Gerichtsgefängnis zur Verfügung der Staatspolizeistelle eingeliefert.“21 Während ihrer Vernehmung bestritt sie die Vorwürfe, kommunistische Druckschriften besessen oder vertrieben zu haben bzw. als Kurierin tätig gewesen zu sein, betonte aber, dass sie „keine Nationalsozialistin“ sei und sich „auch nicht der NS-Frauenschaft bezw. BDM anschliessen [sic !] werde.“22 Nach vier Tagen wurde sie aus dem Gefängnis entlassen und das Verfahren gegen sie schließlich im Oktober 1934 eingestellt, da „der Tatbestand der Vorbereitung zum Hochverrat nicht hinreichend nachgewiesen werden“23 konnte. Die drei Geschwister hatten demnach alle bereits Erfahrung mit den NS-Verfolgungsbehörden gemacht und waren in diesem Zusammenhang in einer Haftstätte festgesetzt worden, bevor der Gestapo Trier im Jahr 1936 der entscheidende Schlag gegen die kommunistische Bewegung in der Moselstadt gelang. Im März 1934 waren zwei Personen vom Zentralkomitee der KPD in Brüssel – Henriette Meulenberg und Anton Knipping – nach Trier entsandt worden, um die Untergrundarbeit neu zu formieren. Sie bildeten autonome Dreiergruppen, die jeweils zusammenarbeiteten, aber nichts von den Aktivitäten der anderen wussten. So sollte verhindert werden, dass das ganze Netzwerk aufflog, wenn einzelne Mitglieder bei der Herstellung oder Verteilung von Flugblättern erwischt wurden. Im Mai 1934 entdeckte man bei Henriette Meulenberg zahlreiche illegale Schriften, so dass sie festgenommen und schließlich zu einer 6-jährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Die in Trier in der Illegalität existierende Widerstandsgruppe stand somit wieder ohne direkte Kontakte da. Deshalb kam es zu einem Treffen in der Wohnung des Zeitungsverkäufers Anton Falday, um den organisatorischen Zusammenhalt neu zu formieren und auf weitere Personen auszudehnen. Zudem sollten Verbindungen ins Saargebiet und nach Luxemburg hergestellt werden. Zu der Gruppe gehörten nicht nur ehemalige KPD-Mitglieder, sondern auch zwei parteilose Bürger sowie das HJ-Mitglied Max Fassbender. Letztgenannter scheint ein doppeltes Spiel ge20 Thomas Zuche : Art. „Torgau-Wald, Aurelia“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 470. 21 LA-NRW (Westf.), Q 211a/2801, Bl. 16. 22 Ebd., Bl. 17 f. 23 Ebd., Bl. 102.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
spielt zu haben. Der 18-jährige war es, der durch seine Aussage Mitte Februar 1936 bei der Staatspolizeistelle Trier die Ermittlungen ins Rollen brachte.24 Da er zwar von seinen Aktivtäten für die illegale KPD berichtete, aber ein Schriftstück, das er – nach seinem ersten Kontakt mit der Gestapo – aus Brüssel von einer Konferenz mitgebracht hatte, verschwieg, wurde er ebenfalls der Vorbereitung zum Hochverrat angeklagt. Sein Vater hatte das Papier in den Kleidern seines Sohnes gefunden und einem befreundeten SS-Mann übergeben.25 Nach dem Schneeballprinzip wurde ein Verdächtiger nach dem anderen verhaftet und verhört. So füllten sich sieben Ermittlungsakten bevor am 21. Dezember 1936 gegen 36 Angeklagte vor dem 5. Strafsenat des OLG Hamm in Trier ein Urteil gesprochen wurde. Wilhelm und Fritz Torgau wurden zu je sieben Jahren Zuchthaus, ihre Schwester Aurelia, seit dem 6. August 1935 mit dem Baufacharbeiter Friedrich Wilhelm Reichert26 verheiratet, aber seit März 1936 bereits wieder getrennt von ihm lebend, zu viereinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt.27 Willi Torgau wurde am 1. Januar 1937 in das Zuchthaus Siegburg eingeliefert und hat seine Strafe dort bis zum 21. Mai 1943 abgesessen.28 Nach viereinhalb Jahren Einzelhaft arbeitete er unter anderem in einem Außenkommando in einer Zementfabrik29 und auch als Koch, wie eine Aufnahme des Mithäftlings und Gefängnisfotografen Erich Sander belegt.30 Nach seiner Entlassung kehrte er nach 24 Christoffel verweist im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die 36 Kommunisten auf die Rheinlandbesetzung am 7. März 1936 und die damit einhergehenden Massenverhaftungen, da befürchtet wurde, dass sich illegale Gruppen mit den möglicherweise einmarschierenden Franzosen hätten verbünden können ; vgl. Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 124 f. Allerdings beginnen die Festnahmen und Vernehmungen erst in der zweiten April-Hälfte 1936. 25 LA-NRW (Westf.), Q 211a/9662, Bl. 28–30. Bisher ist davon ausgegangen worden, dass der Dokumentenfund in den Kleidern von Hans Fassbender die Ermittlungen ausgelöst hat ; vgl. Horst Gobrecht : „Er arbeitete lieber vor Ort mit den Genossen“. Interview mit Maria und Willi Torgau, in : Ders.: Eh‘ die Sonne lacht. Hans Eiden, Kommunist und Lagerältester im KZ Buchenwald, Bonn 1995, S. 45–94, hier S. 67. 26 Friedrich Wilhelm Reichert war bis 1932 Mitglied des KJVD, dann aber auf Druck seiner Eltern ausgetreten. Die Ehe entwickelte sich für Orli sehr schnell zu einer Katastrophe, da ihr Mann die illegale Tätigkeit für die KPD nicht guthieß, sondern hinter den politischen (Auslands-)Kontakten auch noch Untreue vermutete. Zudem gehörte er seit 1933 der Deutschen Arbeitsfront (DAF) an und beteiligte sich seit Januar 1936 an den Proben eines SA-Spielmannszuges. Er war zum Zeitpunkt seiner Festnahme am 23. Juni 1936 SA-Anwärter ; vgl. ebd., Bl. 148–151. Siehe auch Steger/ Wald : Hinter der grünen Pappe, S. 36–40. 27 LA-NRW (Westf.), Q 211a/9662 bis 9719 (komplettes Verfahren). 28 LA-NRW (Westf.), Q 211a/9670. 29 Gobrecht : Interview mit Maria und Willi Torgau, S. 80. 30 NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Hg.) : August Sanders unbeugsamer Sohn. Erich Sander als Häftling und Gefängnisfotograf im Zuchthaus Siegburg 1935–1944 (Veröffentli-
299
300
|
Thomas Grotum
Trier zurück, sicherlich auch um seine Frau und seinen Sohn, der zum Zeitpunkt seiner Verhaftung sechs Monate alt war, wieder zu sehen.31 Ganz ähnlich war die Ausgangssituation bei Fritz Torgau. Zum Zeitpunkt der Verurteilung war er verheiratet und Vater eines siebenmonatigen Kindes, das das Ehepaar kurz vor seiner Verhaftung angenommen hatte. Das Urteil, sieben Jahre Zuchthaus, muss für seine Ehefrau Katharina ein Schock gewesen sein, da sie in einem Brief vom 13. September 1936 noch voller Hoffnung war, dass die junge Familie bald gemeinsam mit dem kleinen „Fritzl“ etwas unternehmen könnte.32 Die lange Haftzeit führte dann auch dazu, dass Katharina im Jahr 1939 die Scheidung einreichte.33 Fritz Torgau wurde ebenfalls am 21. Mai 1943 aus dem Zuchthaus in Siegburg entlassen, um nach Trier zurückzukehren.34 Hier arbeitete er als Hilfsfärber und heiratete im November die Schwester seiner Schwägerin, Anni Gillesheim. Die beiden verließen Trier 1944 und zogen ins thüringische Auma bei Gera. Aurelia Reichert, wie sie zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung hieß, musste ihre Zuchthausstrafe in der Strafanstalt Ziegenhain bei Kassel absitzen. Unter Anrechnung der 6-monatigen Untersuchungshaft wurde sie am 21. Dezember 1940 entlassen – allerdings nicht in die Freiheit, sondern zur Überführung in das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück.35 Ein erstes Gnadengesuch ihrer Mutter vom 27. Mai 1939 war zuvor abgelehnt worden.36 Der Vorstand des Frauenzuchthauses stellte Aurelia Reichert zwar ein positives Zeugnis aus, hielt die Befürwortung eines Gnadenerweises aber noch für verfrüht. Der Vorsitzende des zuständigen Strafsenats sprach sich – in einer vorgefertigten Stellungnahme – gegen jeden Gnadenerweis aus, da bereits sämtliche Milderungsgründe bei der Strafzumessung hinreichend berücksichtigt worden seien. Mit Datum vom 3. November 1939 folgte ein zweites Gnadengesuch, diesmal vom Vater. Der Anstaltsleiter befürwortete die bedingte Aussetzung eines Strafrestes von sechs Monaten. Allerdings wurde diesmal auch die Staatspolizeistelle Trier um eine Stellungnahme gebeten. Dort stufte man Aurelia Reichert als „fanatische Kommunistin“ ein, die nach ihrer Haftentlassung
chungen des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, Bd. 1), Berlin 2015, S. 162 („Mann mit der weißen Mütze“) ; vgl. ferner S. 140 (Fotografie des Wilhelm Torgau aus der Gefangenenakte) und 126 (biographische Notiz). 31 Zu seinem weiteren Schicksal siehe die Ausführungen weiter unten. 32 LA-NRW, Abt. Westfalen, Q 211a/9664, Bl. 163–165. 33 Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Rudolstadt, Bezirkstag und Rat des Bezirks Gera, Nr. 8021, Bl. 10 (handschriftlicher Lebenslauf von Fritz Torgau vom 23.6.1951) und 20. 34 LA-NRW (Westf.), Q 211a/9676, Bl. 47. 35 LA-NRW (Westf.), Q 211a/9679, Bl. 8 und 17. 36 Die folgenden Ausführungen basieren auf dem Gnadenheft ; vgl. LA-NRW (Westf.), Q 211a/9697.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
„eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“37 darstellen würde. Die Bewertung wurde über das Geheime Staatspolizeiamt (Gestapa) in Berlin an das OLG Hamm zurückgeschickt, so dass von dort eine weitere Stellungnahme in die Akten gelangte, in der einem Gnadenerweis widersprochen und Wert auf die restlose Strafverbüßung gelegt wurde. Da der zuständige Strafsenat bei seiner Position blieb, wurde auch dieser Antrag abgelehnt. Schließlich stellte die Verurteilte selbst am 21. April 1940 einen Antrag auf Straferlass. Zu ihrer Entlastung führte sie an, dass sie zum Zeitpunkt der Straftat „noch jung war und mehr gefühlsmässig [sic !] als aus Überzeugung gehandelt habe.“38 Trotz erneuter Befürwortung durch den Anstaltsleiter betonten Gestapo Trier, Gestapa und der Strafsenat weiterhin ihre ablehnende Haltung, da sich für sie keine Veränderungen in den Verhältnissen im Vergleich zur vorangegangenen Entscheidung ergeben hätten. Auch dieses Gnadengesuch wurde abgelehnt. Am 28. Dezember 1940, mittlerweile offiziell geschieden, wurde Aurelia Reichert im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück inhaftiert. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den leitenden Funktionär der Kommunistischen Partei Luxemburgs (KPL), Zénon Bernard, beauftragte der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof die Staatspolizeistelle Trier, diverse Personen zu vernehmen, u.a. auch Aurelia Reichert. Der zuständige Kriminal-Kommissar Schmidt aus Trier fuhr aus diesem Grund in das 80 km nördlich von Berlin gelegene Frauen-Konzen trationslager, um am 11. März 1941 die Befragung durchzuführen. Aurelia Reichert berichtete ausführlich über ihre Kontakte nach Luxemburg, die der Gestapo allerdings bereits seit 1936 bekannt waren. Am stärksten belastete sie Henriette Meulenberg, die im Februar 1937 im Zuchthaus Aichach verstorben war,39 sowie Helmut Erler, der sich 1936 während der umfangreichen Ermittlungen bereits in Luxemburg befand und absetzen konnte. Auf Seiten der KPL beschränkte sie sich auf Zénon Bernard, um nicht Hinweise auf weitere – bisher unbekannte – Perso nen zu liefern.40 Trotz möglicher Vergünstigungen verzichtete sie darauf, weitere Details preiszugeben. Ein Jahr später wurde Aurelia Reichert mit dem ersten Frauen-Transport in das Konzentrationslager Auschwitz verlegt und erhielt dort am 26. März 1942 die Häftlingsnummer 502. Ab März 1943 wurde sie als Lagerälteste des Krankenreviers eingesetzt, eine durchaus schwierige Position, die sie schwer belastete und zu einem Suizidversuch veranlasste. Nichtsdestotrotz genoss sie hohes 37 Ebd., Bl. 19v. 38 Ebd., Bl. 27. 39 LA-NRW (Westf.), Q 211a/2802. 40 Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (CDRR) Luxemburg, Ordner KPL. Helmut Erler war im März 1941 immer noch flüchtig und wurde zur Fahndung ausgeschrieben.
301
302
|
Thomas Grotum
Ansehen unter den weiblichen Häftlingen und erhielt aufgrund ihrer Hilfsbereitschaft den Beinamen „Engel von Auschwitz“. Sie überstand 1945 den Todesmarsch von Auschwitz nach Ravensbrück und gelangte in das Außenlager Malchow. Dort konnte sie Ende April 1945 – krank und geschwächt – mit etwa 30 anderen Frauen aus dem kaum noch bewachten Lager flüchten. Ihre Freiheit war aber mit einem weiteren Trauma verbunden. Im nahegelegenen Goldberg, in das die Frauen nach ihrer Entdeckung gebracht wurden, waren sie Vergewaltigungen und anderen Übergriffen durch Soldaten der Roten Armee ausgesetzt. Erst das Eintreffen eines sowjetischen Stadtkommandanten setzte dem Treiben ein Ende. In der Folgezeit verbrachte Aurelia Reichert knapp zwei Jahre in einem Sanatorium für NS-Verfolgte und lernte dort Eduard Wald kennen, den sie 1947 heiratete. Beide zogen nach Hannover. Bis zu ihrem Tod am 1. Januar 1962 litt Aurelia Wald an den Folgen des Erlebten und musste wiederholt längere Aufenthalte in psychiatrischen Krankenanstalten durchmachen. Sie war ein psychisch und physisch gebrochener Mensch und machte sich immer wieder Vorwürfe, warum sie nicht noch mehr für „ihre Häftlinge“ getan hatte.41
Luxemburger Opfer von zwei Massenhinrichtungen (1942 und 1944) bei Hinzert
In einer dritten biographischen Studie hat sich Jana Nieuwenhuizen mit den insgesamt 43 Luxemburgern befasst, die 1942 und 1944 in unmittelbarer Nähe des SS-Sonderlagers/Konzentrationslagers Hinzert hingerichtet worden sind.42 Die erste Massenexekution erfolgte im Zeitraum vom 2. bis 9. September 1942. Es handelte sich um die Vollstreckung von 20 Todesurteilen, die ein Standgericht in Luxemburg ausgesprochen hatte. Nach der Verkündung der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Luxemburg für die Jahrgänge 1920 bis 1924 (später bis 1927) durch Gauleiter Gustav Simon am 30. August 1942 wurde am Folgetag zum Generalstreik aufgerufen. Die damit verbundenen Maßnahmen erstreckten sich über mehrere Tage und erfassten zahlreiche Orte im Großherzogtum. Auf Anweisung des Geheimen Staatspolizeiamtes in Berlin wurden deshalb die Verhängung des zivilen Ausnahmezustandes angeordnet sowie die Zuständigkeit und die Befugnisse des zu bildenden Standesgerichts geregelt.43 Als Vorsitzender des Standge41 Zur Biographie von Aurelia Torgau-Reichert-Wald vgl. Steger/Wald : Hinter der grünen Pappe. 42 Jana Nieuwenhuizen : Die Massenhinrichtungen von 20 Streikteilnehmern (1942) und 23 Widerstandskämpfern (1944) aus Luxemburg in der Nähe des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert, Masterarbeit Trier 2015. 43 Die insgesamt vier Verordnungen sind veröffentlicht im Verordnungsblatt für Luxemburg vom 31. August 1942, Nr. 50 und 51. Sie sind rückwirkend auf den 31. August 1942 datiert worden.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
richts bestimmte der Leiter des Einsatzkommandos Luxemburg (EKL), Fritz Hartmann44, seine beiden Beisitzer. Es handelt sich um den Trierer Gestapobeamten Albert Schmidt45 und den Vorsitzenden des Sondergerichts in Luxemburg, Adolf Raderschall46. Als Ankläger fungierte Leonhard Drach47, der Erster Staatsanwalt am Sondergericht Luxemburg war. Die ersten beiden Opfer, die am Morgen des 2. September 1942 hingerichtet worden sind, waren Nicolas Muller und Michel Worré.48 Beide stammten aus Wiltz, einem der Zentren des Generalstreiks. Worré war Leiter des Wirtschaftsamtes, Muller Stadtsekretär. Am Folgetag verkündeten Plakate in ganz Luxemburg, dass neun weitere Luxemburger hingerichtet worden waren, darunter vier Lehrer aus Wiltz : Alfred Bruck, Joseph Ewen, Célestin Lommel und Charles Meiers. Ferner gehörten der Dreher Alphonse Weets, der Werkzeugschlosser Jean Pierre Schneider und der Tiefofenarbeiter Ernest Toussaint, alle aus Differdingen, zu den Opfern. Auch der Postunterinspektor Nicolas Konz aus Luxemburg-Stadt und der Werkzeugschlosser Nicolas Betz aus Kahler wurden an diesem Morgen exekutiert. Die Namen des Schriftsetzers Léon Zeimes (Itzig), des Schlossers Robert Micho (Differdingen), des Schlossers Réne Angelsberg (Differdingen) und des Postbeamten Jean Schroeder (Luxemburg-Stadt) waren auf den Plakaten vom 4. September 1942 zu lesen. Am vierten Tag erschoss man morgens um 6 Uhr Michel Dax, Eisenbahnarbeiter aus Ettelbrück, Alphonse Schmit, Professor aus Echternach, Jean Thull, Eisenbahnanstreicher aus Ettelbrück, und Emile Heiderscheid, Dachdecker aus Diekirch. Schließlich wurde am 9. September 1942 noch der Walzendreher Eugène Biren aus Schifflingen hingerichtet. 44 Oberregierungsrat und SS-Obersturmbannführer Fritz Hartmann war von März 1941 bis April 1943 Leiter der Staatspolizeistelle Trier und – in Personalunion – Leiter des EKL. Zur Biographie vgl. auch Joachim Henning : Art. „Hartmann, Fritz“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 157–158. Hier wird irrtümlich Kriminalkommissar Fritz Schmidt als Beisitzer des Standgerichts genannt. 45 Sabrina Nowack : Sicherheitsrisiko NS-Belastung. Personalüberprüfungen im Bundesnachrichtendienst in den 1960er Jahren (Schriftenreihe der Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 4), Berlin 2016, S. 316 f. und 475. 46 Joachim Henning : Art. „Raderschall, Adolf“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 351–352. 47 Joachim Henning : Art. „Drach, Leonhard“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 87–88. 48 Die Schreibweise der Namen folgt hier nicht den „eingedeutschten“ Fassungen auf den Plakaten. Fotos der 20 Ermordeten finden sich in Landeszentrale für politische Bildung RheinlandPfalz (Hg.) : Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933–1945, Bd. 2 : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Ausstellungskatalog, Mainz 2009, S. 90–93.
303
304
|
Thomas Grotum
Eine wahrscheinlich unvollständige Aufstellung, die am 21. Juli 1948 niedergeschrieben wurde, enthält die Namen der 20 Hingerichteten, von 15 Personen, die freigesprochen wurden oder deren Verfahren man einstellte, 45 Personen, die vom Standgericht der Gestapo übergeben wurden, und 65 Personen, die auf Beschluss des Standgerichts in ein Konzentrations- oder Arbeitserziehungslager eingewiesen worden sind. Hartmann erinnerte sich an 20 Verurteilte, etwa 60 Freigesprochene und rund 120 an die Gestapo Überstellte.49 Ferner wurde der gebürtige Deutsche Hans Adam am 10. September 1942 vom Sondergericht Luxemburg wegen Arbeitseinstellung bzw. Aufforderung zur selbigen in einem schweren Fall – er hatte das Signal zum Streik in der ARBED-Hütte in Schifflingen50 gegeben, indem er einen schweren Eisenhaken in den Griff der Dampfsirene hängte – zum Tode verurteilt und am nächsten Tag in Köln-Klingelpütz, der zentralen Hinrichtungsstätte des Rheinlandes, exekutiert.51 Betrachtet man die Wohnorte der Hingerichteten, so bildet Wiltz (6) zwar einen eindeutigen Schwerpunkt, trotzdem scheint das Standgericht bemüht gewesen zu sein, Männer aus allen Teilen des Großherzogtums auszuwählen, um eine flächendeckende Abschreckung zu erzielen. Zudem ist auffällig, dass alle sozialen Schichten betroffen waren. Der älteste Verurteilte war Jahrgang 1886, der jüngste noch minderjährig (Jg. 1923). Kriterien, warum das Standgericht trotz ähnlicher „Vergehen“ unterschiedliche Urteile fällte, sind nicht zu ermitteln gewesen. Im Herbst 1943 gelang der deutschen Besatzungsmacht in Luxemburg ein entscheidender Schlag gegen den Widerstand im Großherzogtum. Im Rahmen mehrerer Razzien wurden etwa 350 Männer festgenommen und in das SS-Sonderlager/ Konzentrationslager Hinzert verschleppt. Die anschließenden Ermittlungen der Gestapo ergaben, dass gemäß der Praxis der Sondergerichtsverfahren in Luxemburg mit 50 Todesurteilen zu rechnen sei. Allerdings waren sich Gauleiter Simon und der Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD (IdS) in Wiesbaden, SS-Standartenführer Otto Sohmann, einig, dass die Verhängung von 50 Todesstrafen durch ein Sondergericht zum damaligen Zeitpunkt politisch nicht tragbar sei und deshalb – unter Ausschaltung der Justiz – die Anzahl der Todesurteile halbiert werden sollte. Nur die „Rädelsführer“ seien zu erschießen. Dieses Vorgehen bestätigte das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) in Berlin und ordnete die sofortige Exekution der betroffenen 25 Gefangenen an. Dies geschah am 25. Februar 1944 in der Nähe 49 CDRR Luxemburg, Ordner Grève 1942. Die Listen befinden sich auf S. 8–13 des Berichts, das Zitat von Hartmann auf S. 157. 50 ARBED ist das Akronym für Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Vereinigte Stahlhütten Burbach-Eich-Düdelingen). 51 André Hohengarten : Vom Halbmond zum Ziegenkopf. Die Geschichte der Luxemburger Häftlinge in Lublin 1942–1945, Luxemburg 1991, S. 82 f.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
des SS-Sonderlagers/Konzentrationslagers Hinzert.52 Zwei der Betroffenen, Jules Jost und Henri Ney, waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Lager in Hinzert und konnten auch nicht rechtzeitig zur Exekution zurückgebracht werden.53 So überlebten sie die NS-Herrschaft durch eine „organisatorische Panne“. Auch wenn der abschreckende Charakter der beiden Massenhinrichtungen eindeutig zu belegen ist, spielten bei der letztendlichen Auswahl der Männer, die getötet werden sollten, Willkür und Zufall eine wichtige Rolle.
V-Leute der Gestapo Trier im Zeichen von Niederlage und Zusammenbruch
Die erste Studie, die im Rahmen des Forschungsprojekts zur Geschichte der Gestapo Trier abgeschlossen werden konnte, stammt von Johanna Gouverneur. Der Fokus der Arbeit liegt auf den V-Leuten, die in der Endphase des Zweiten Weltkriegs von der Gestapo in Trier eingesetzt wurden.54 Sie basiert im Wesentlichen auf acht Sachakten des Landeshauptarchivs Koblenz, die sich unter den zurückgegebenen Akten aus den National Archives, Alexandria/USA (Best. 662,005) befinden und unter der Überschrift „Gestapo Trier“ gebündelt vorliegen.55 Auch wenn die herausragende Bedeutung der V(ertrauens)-Leute bei der Informationsgewinnung für die Gestapo immer wieder betont wird, so ist diese sehr heterogene Per-
52 Albert Pütz : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945. Das Anklageverfahren gegen Paul Sporrenberg (Schriftenreihe des Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Frankfurt a.M. u.a. 1998, S. 197–199. Es handelt sich um die Ergebnisse der Ermittlungen, die in diesem Fall auf den Aussagen damals Beteiligter beruhen, die sich möglicherweise selbst nicht belasten wollten. Vgl. ferner Aloyse Raths : Die Opfer des 25. Februar 1944, in : Rappel 34 (1979), H. 1/2, S. 3–6. 53 Hingerichtet wurden Edgar Barbieur (Jg. 1912, Soldat), Louis Bassing (Jg. 1907, Kommunalbeamter), Lucien Bentz (Jg. 1916, Sportlehrer), Léon Bristel (Jg. 1917, Hüttenarbeiter), Adolphe Christophe (Jg. 1896, Maschinist), Mathias Dal Zotto (Jg. 1901, Hüttenarbeiter), Georges Everling (Jg. 1903, Eisenbahnbeamter), Hubert Glesener (Jg. 1911, Schlosser), Robert Grzonka (Jg. 1903, Geometer), Raymond Heyard (Jg. 1916, Frisör), Léon Koob (Jg. 1903, Bäckermeister), Emile Kunsch (Jg. 1908, Elektrotechniker), Jules Kuhn (Jg. 1912, Kaufmann), Emile Laux (Jg. 1915, Postangestellter), Jean Lemmer (Jg. 1915, Installateur), Théodor Mannon (Jg. 1895, Kaufmann), Pierre Maroldt (Jg. 1916, Kaufmann), Arthur Michel (Jg. 1919, Anstreicher), Antoine Noesen (Jg. 1905, Drucker), Conrad Pauly (Jg. 1916, Schuster), Aloyse Sandt (Jg. 1902, Weinhändler), Joseph Schoos (Jg. 1911, Hüttenarbeiter), Nicolas-Joseph Steinmetzer (Jg. 1898, Ingenieur) ; vgl. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Verfolgung und Widerstand, Bd. 2, S. 94–97. 54 Johanna Gouverneur : Überwachung im Zeichen von Niederlage und Zusammenbruch. Die V-Leute der Gestapo Trier 1943–1945, Staatsexamensarbeit Trier 2012. 55 LHA Koblenz, Best. 662,005, Nr. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 33 und 34.
305
306
|
Thomas Grotum
sonengruppe in der Forschung bisher nur ausgesprochen selten in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt worden.56 V-Leute haben aus den unterschiedlichsten Gründen für die Gestapo Trier gearbeitet. Das Spektrum reichte von ideologischer Überzeugung über berufliche Verpflichtung und ökonomischem Interesse57 bis zur erzwungenen Kooperation. Unmittelbar nach der Machtübernahme versuchte die Gestapo zunächst Personen aus den Milieus zu gewinnen, in denen sich politische oder ideologische Gegner bewegten. Die Staatspolizeistelle Trier unterhielt aber auch Spitzelnetzwerke im ausländischen Luxemburg58 und (bis zur Rückgliederung 1935) im Saargebiet59. Während des Krieges kam die Überwachung von ausländischen Zwangs- und Zivilarbeitern sowie Kriegsgefangenen hinzu. Ferner erweiterte sich das Deliktspektrum durch neue, kriegsspezifische Vergehen, die die gesamte Bevölkerung trafen.60 Hier ist eine zunehmende „Entgrenzung der Gewalt“61 in der Endphase des NS-Staates zu beobachten. Neben den erwähnten Sachakten liegen für die Staatspolizeistelle Trier 125 doppelseitige DIN A4-Bögen vor, die Angaben über insgesamt 122 V- oder W-Per56 Walter Otto Weyrauch : Gestapo V-Leute. Tatsachen und Theorie des Geheimdienstes, Frankfurt a.M. 1992 (1989). Der Autor hatte 1945 kurzfristig Zugriff auf die etwa 130.000 Karten umfassende Gestapo-Kartei der Frankfurter Staatspolizei und die Aufgabe, die etwa 1.200 Karten über V-Leute zu entnehmen. Jahrzehnte später hat er die genannte Studie erstellt. Die Frankfurter Gestapo-Kartei ist überliefert, allerdings ohne die Karten der V-Leute ; Volker Eichler : Die Frank furter Gestapo-Kartei. Entstehung, Struktur, Funktion, Überlieferungsgeschichte und Quellenwert, in : Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 178–199, hier S. 194. Zum Thema V-Leute vgl. ferner Siegfried Grundmann : Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler, Berlin 2010 ; Wilhelm Mensing : Vertrauensleute kommunistischer Herkunft bei der Gestapo und NS-Nachrichtendiensten am Beispiel von Rhein und Ruhr, in : Jahrbuch für historische Kommunismusforschung (2004), S. 111–130. 57 V-Leute wurden für ihre Tätigkeit (teilweise) bezahlt. Zwangsarbeiter gelangten so in eine privilegierte Stellung und konnten auf Vergünstigungen hoffen. 58 Russisches Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte (RGASPI), Best. 458, Findbuch (Fb.) 9, Nr. 204 : Gestapa-Dossier „Luxemburg“, http://rgaspi-458-9.germandocsinrussia.org/de/nodes/ 207-akte-nr-204-dokumente-aus-dem-gestapa-dossier-luxemburg-berichte-der-gestapo-stellen-intrier-kar (Letzter Zugriff : 23.8.2017). 59 Klaus-Michael Mallmann/Gerhard Paul : Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 2), Bonn 1991, S. 182. 60 Nachdem zunächst viele Verfahren auf der Basis des „Heimtückegesetzes“ (1934) durchgeführt worden sind, kamen innerhalb kürzester Zeit die „Kriegssonderstrafrechts-“ (1938), die „Kriegswirtschafts-“ (1939), die „Rundfunk-“ (1939) und die „Volksschädlingsverordnung“ (1939) hinzu. 61 Elisabeth Thalhofer : Entgrenzung der Gewalt. Gestapo-Lager in der Endphase des Dritten Reichs, Paderborn u.a. 2010 ; vgl. auch Bernd-A. Rusinek : Gesellschaft in der Katastrophe. Terror, Illegalität, Widerstand – Köln 1944/45 (Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 24), Essen 1989.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
sonen aus dem Zeitraum von November 1941 bis Mai 1944 enthalten.62 Bei der überwiegenden Mehrzahl handelt es sich um Gewährsmänner (W-Personen), die Auskünfte über staatsfeindliche Bestrebungen aller Art geben sollten. Die „Inneren Gegner“ standen ganz offensichtlich im Vordergrund. Daneben beobachteten Zwangsarbeiter den Ostarbeitereinsatz und die Verhältnisse in den entsprechenden Lagern oder berichteten über kommunistische Aktivitäten der „Fremdvölkischen“. Einzelne Personen galten als Informanten über kriegswirtschaftliche Angelegenheiten sowie Sabotage und waren „abwehrmäßig“ tätig. Handlungsreisende und Hotelangestellte, die während ihrer Arbeit mit vielen Menschen in Kontakt kamen und so manche Information aufschnappen konnten, waren als Gewährspersonen gern gesehen. Interessant ist, dass allein acht Personen gegen Kriegsende das kommunistische Milieu beobachteten, obwohl die Strukturen einer im Untergrund tätigen KPD in Trier bereits 1936 zerschlagen worden waren. Einer der V-Leute der Gestapo Trier war Wilhelm Torgau. Offensichtlich hatte man den überzeugten Kommunisten unter Druck gesetzt. Andere Verurteilte – Hans Eiden, Fritz Grieshaber, Jakob Prunk, Christoph Wagner, Anton Falday, Max Fassbender, Fritz Wolffs und nicht zuletzt seine Schwester Aurelia Reichert – sind direkt nach der Verbüßung der Haftstrafe in ein Konzentrationslager eingewiesen worden.63 Seit dem Tag seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Siegburg wurde Wilhelm Torgau als V-Person der Gestapo Trier geführt. Auf seinem Bogen findet sich folgender Vermerk : „Wie durch andere V-Personen zum Ausdruck gebracht wird, kann nur über Torgau festgestellt werden, ob und in welchem Umfange die KPD erneut tätig wird.“64 Willi Torgau arbeitete in einer Kohlenhandlung in Trier und gab mehrere mündliche Berichte, um – so der zuständige Kriminalsekretär Hedderich – „seine früheren politischen Verfehlungen durch Mitarbeit wieder gut zu machen.“65 Allerdings konnte (oder wollte) er nichts zum Thema „KPD“ sagen, da alle ehemaligen Genossen einen weiten Bogen um ihn und seinen Bruder machen würden. Darüber hinaus würde sich niemand trauen, etwas „Gefährliches“ zu unternehmen. Stattdessen machte er die Gestapo darauf aufmerksam, dass sein Chef der Wehrmacht heimlich Kohlen vorenthalten würde und – so seine Vermutung – zugunsten des Generalvikariats 62 Bundesarchiv (BArch) Berlin, R 58/1134. Der Unterschied zwischen Vertrauens- und Gewährspersonen war graduell. Während die einen gezielt verschiedenen Referaten oder Sachbearbeitern zuarbeiteten, lieferten die anderen gelegentlich Berichte. 63 Weiter-Matysiak : Widerstand im Raum Trier, S. 159. 64 BArch Berlin, R 58/1134. Hervorhebung im Original. Es existieren zwei Ausfertigungen des Bogens. In einem wird Torgau als W-, im anderen als V-Person geführt ; vgl. auch LHA Koblenz, Best. 662,007, Nr. 88. 65 LHA Koblenz, Best. 662,007, Nr. 88.
307
308
|
Thomas Grotum
veräußere.66 Im Jahr 1944 wurde Willi Torgau für Schanzdienste in der Eifel herangezogen und anschließend zum „Volkssturm“ einberufen.67 Nach dem Krieg wurde Willi Torgau zunächst Zweiter, nach dem Tod von Hans Eiden († 6. Dezember 1950) Erster Sekretär des KPD-Kreisvorstandes Trier. Von 1945 bis 1948 fungierte er im Rahmen der Entnazifizierung als Ankläger der Spruchkammer II in Trier. Bis zu seinem Tod am 14. April 1999 engagierte er sich als überzeugter Kommunist, zunächst in der KPD, später (als Mitbegründer der Trierer Ortgruppe) in der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP).68 Die Tätigkeit als V-Person war keine Garantie dafür, nicht selbst in die Fänge der Geheimen Staatspolizei zu geraten. Dabei konnten intimste Details in den Akten verhandelt werden. Dies verdeutlicht das Beispiel einer der wenigen V-Frauen der Gestapo Trier. Die 22-jährige Hilfsarbeiterin und Witwe Auguste P. nahm Ende August 1943 ihre Tätigkeit für die Staatspolizeistelle Trier auf. Hervorgehoben wurde, dass Sie „[i]nfolge ihrer sexualen [sic !] Einstellung und ihres unsoliden Lebenswandels“69 mit vielen Personen in Kontakt käme. Zum Zeitpunkt der Anwerbung unterhielt sie eine intime Beziehung zu einem Fabrikanten, der ausländische Sender höre und die Nachrichten an Stammtisch verbreite. Die Gestapo erhoffte sich also, über Auguste P. Informationen zu erhalten, um einen „Staatsfeind“ dingfest zu machen. Ob dies gelang, muss offen bleiben. Kurz vor Weihnachten 1943 wird Auguste P. gemeinsam mit einer Freundin aus Hamburg bei der Frühkontrolle eines Luxemburger Hotels durch die Kriminalpolizei festgesetzt. Ihren Ausführungen, sie seien zum Einkaufen nach Luxemburg gereist, wird kein Glauben geschenkt. Schließlich gibt die junge Witwe zu, die Nacht mit einem Trierer Fabrikdirektor im Hotel verbracht zu haben. Daraufhin werden die beiden Frauen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und Auguste P. eingewiesen, da man sie verdächtigte, geschlechtskrank zu sein. Die junge Frau scheint sich gegen die unwürdige Behandlung, die sie als Prostituierte abstempelte, zur Wehr gesetzt zu haben. Im Krankenhaus habe sie sich als „V-Mann von der Stapo Trier“70 zu erkennen gegeben. Zudem sei sie eine wichtige Zeugin in einem Sondergerichtsverfahren. Dies schien sich am nächsten Tag zu bestätigen. Die Gestapo Trier bat die Staatspolizeistelle Luxemburg um Amtshilfe, um so die Entlassung von Auguste P. zu erwirken. Da diese allerdings auch angegeben haben 66 Ebd. 67 Eberhard Klopp (Hg.) : Geschichte der Trierer Arbeiterbewegung. Ein deutsches Beispiel, Bd. 3 : Kurzbiographien, Trier 1979, S. 124. 68 Porträt „Willi Torgau“, in : Thomas Zuche (Hg.) : StattFührer, Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 154–156. 69 BArch Berlin, R 58/1134. Folgende Schilderung nach dieser Akte. 70 LHA Koblenz, Best. 662,005, Nr. 34.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
soll, ein intimes Verhältnis mit einem Trierer Kriminalkommissar gehabt zu haben, weigerte sich der zuständige Kriminalbeamte in Luxemburg dem Ersuchen zu folgen. Es kam zu einer erneuten Intervention am Folgetag, die unter Einschaltung des Leiters der Kriminalpolizei Luxemburg erfolgte. Aber auch diese scheint nicht erfolgreich gewesen zu sein, da die junge Frau erst vier Wochen später „als geheilt“ aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Der Kriminalbeamte kam nicht umhin, die Auguste P. als „bessere Hure“ zu bezeichnen, „die nach ihrem Lebenswandel nicht geeignet erscheint, als V-Mann tätig zu sein.“71 Nachdem im Zuge der Erforschung möglicher Ansteckungsquellen auch noch der Name eines Gestapo-Beamten aus Trier gefallen war, untersagte ein Kollege aus Luxemburg der Krankenhausverwaltung, dies − wie üblich − den zuständigen Gesundheitsämtern zu melden. Der Betroffene, der sich gerade auf Urlaub befand, versicherte schriftlich, keinen Geschlechtsverkehr mit Frau P. gehabt zu haben. Bei der Staatspolizeiaußenstelle Trier nahm sich der stellvertretende Leiter, Kriminaldirektor Wendling, der Sache an. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus wurde Auguste P. in der Christophstraße 1 in Trier vorgeführt und musste bestätigen, dass kein weiterer Beamter der Dienststelle mit ihr in intimen Kontakt stand. In einer zweiten Vernehmung am gleichen Tag versicherte die weibliche Vertrauensperson, ihre Tätigkeit für die Gestapo Trier keinesfalls öffentlich gemacht zu haben. Sie habe lediglich gesagt, dass sie mit einigen Beamten der Staatspolizei bekannt sei, um so zu belegen, dass sie „nicht eine x-beliebige hergelaufene Person sein.“72 Daraufhin wurde sie in die Freiheit entlassen, aber gleichzeitig der Stadt Trier verwiesen. Man machte ihr zur Auflage, sich außerhalb des Stadtgebietes dem Arbeitsamt zur Verfügung zu stellen. Ganz wollte man aber offensichtlich nicht auf ihre Tätigkeit verzichten, wie dies aus einem handschriftlichen Vermerk der übergeordneten Dienststelle in Koblenz vom 3. Februar 1944 hervorgeht : „Die P[…] ist nur noch mit Vorsicht als VM zu verwenden. In erster Linie soll sie sich an Geistliche der Ordinariate Trier u. Koblenz heranmachen.“73 Das Beispiel der V-Person Auguste P. verdeutlicht, wie unterschiedlich die Bewertung einzelner Personen und deren Verhalten ausfallen konnten. Während der Luxemburger Kriminalbeamte die junge Frau als eine Prostituierte74 ansah und sie nach den Regeln der NS-Rassenhygiene zu einer „Gemeinschaftsfremden“ machte, wollte die Staatspolizei ihren „lockeren Lebenswandel“ ausnutzen, um Er71 Ebd. 72 Ebd. 73 Ebd. 74 Wolfgang Ayass : „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995 ; Eva Pfanzelter : Homosexuelle und Prostituierte, in : Rolf Steininger (Hg.) : Vergessene Opfer des Nationalsozialismus, Innsbruck 2000, S. 75–97.
309
310
|
Thomas Grotum
mittlungserfolge zu verbuchen. Dabei scheint man sie auch gezielt auf Personen angesetzt zu haben.
Katholische Jugendliche in der Vorkriegszeit im Raum Trier
Die Lage der Jugend im katholischen Milieu75 im Raum Trier vor dem Zweiten Weltkrieg hat Anke Schwebach untersucht.76 Die Nationalsozialisten setzten in der Phase der Machtkonsolidierung im „schwarzen Trier“77 zunächst auf ein scheinbar kooperatives Miteinander mit der katholischen Kirche, das zumindest bis zur Abstimmung im Saargebiet im Januar 1935 anhielt. So sollte den Gläubigen des Bistums Trier, die im Saargebiet lebten, kein Grund für ein Votum gegen die Rückangliederung ins Deutsche Reich gegeben werden. Die loyale Zusammenarbeit von Katholischer Kirche und NS-Machthabern zeigte sich sowohl anlässlich der Reichstagseröffnung am 19. März 1933, als zu diesem Anlass die katholische Jugend gemeinsam mit der Hitler-Jugend (HJ), der Sturmabteilung (SA), der Schutzstaffel (SS) und dem „Stahlhelm“ in Trier an einem Aufmarsch teilnahm,78 als auch während der Heilig-Rock-Tage im Juli 1933, bei denen die SA Ordnungsfunktionen übernahm und der Trierer Bischof Bornewasser anlässlich der Wallfahrteröffnung mit dem Hitlergruß grüßte.79 Zwar kam es in dieser frühen Phase vereinzelt zu Auseinandersetzungen, wenn beispielsweise die HJ katholische Jugendheime besetzte und beschlagnahmte, das Reichskonkordat vom 20. Juli 1933 wurde aber
75 M. Rainer Lepsius : Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in : Wilhelm Abel u.a. (Hg.) : Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Friedrich Lütge, Stuttgart 1966, S. 371–393. 76 Anke Schwebach : „Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab“. Katholische Jugendliche im Raum Trier zwischen Anpassung, Unterdrückung und Widerstand (1933–1939), Masterarbeit Trier 2014. 77 Sowohl bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 als auch bei der Stadtverordnetenwahl vom 12. März 1933 erhielt das Zentrum deutlich mehr Stimmen (und Sitze) als die NSDAP. Bei der ersten Wahl erzielte die NSDAP 31,9 % und das Zentrum 43,5 % der abgegebenen gültigen Stimmen, bei der kommunalen Abstimmung siegte das Zentrum mit 23 zu 14 (von insgesamt 45) Ratssitzen ; vgl. Günter Mick : Politische Wahlen und Volksentscheide in der Stadt Trier zur Zeit der Weimarer Republik, Diss. Bonn 1969, S. 384 f. und 393. Nichtsdestotrotz verliefen Machtwechsel und Gleichschaltung in der Folgezeit ähnlich wie in anderen Regionen des Deutschen Reiches. 78 Weiter-Matysiak : Widerstand im Raum Trier, S. 157. 79 Heinrich Küppers : Herausforderungen und Bedrohungen im Zeichen des Hakenkreuzes, in : Martin Persch/ Bernhard Schneider (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier, Bd. V : Beharrung und Erneuerung, 1881–1981 (Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier, Bd. 39), Trier 2004, S. 627–670, hier S. 632.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
vom Klerus (und von der katholischen Bevölkerung) mehrheitlich als Signal für eine friedliche Koexistenz gewertet. Die schrittweise Begrenzung des milieuspezifischen Raumes und damit einhergehende Ausweitung des NS-Machtanspruches hatte bei den betroffenen katholischen Jugendlichen ein breites Verhaltensspektrum zur Folge. Nach Widerstand (im engeren Sinne) wird man aber vergeblich suchen. Letztendlich passte sich die überwiegende Mehrheit dem Regime an und befolgte die „Spielregeln“, auch wenn deren Einführung zunächst auf Unverständnis traf oder in Einzelfällen sogar Protest auslöste.80 Das Eindringen des Staates in das Milieu konnte durchaus eine gewisse Unangepasstheit zur Folge haben und Reaktionen wie Respektlosigkeit, Trotz und Wut hervorrufen. Für die katholischen Jugendlichen, die ihren konfessionellen Vereinigungen treu bleiben wollten, begann spätestens ab Juli 1933 – mit dem Verbot einer Doppelmitgliedschaft für HJ-Angehörige – eine Phase mit vielen Schikanen. Durch das HJ-Gesetz vom 1. Dezember 1936 erfolgte eine weitere Zurückdrängung der katholischen Jugendorganisationen in den seelsorgerischen Bereich, da ab diesem Zeitpunkt alle Kinder und Jugendlichen ab dem zehnten Lebensjahr zum HJ-Dienst verpflichtet wurden.81 Noch vor der Einführung der Jugenddienstpflicht im März 1939 verfügte die Gestapo Trier im November 1937 die Auflösung des Katholischen Jungmännervereins (KJMV) in der Moselstadt.82 Der Sinneswandel von Bischof Bornewasser, der zunächst seine anerkennende Haltung ablegte, zunehmend skeptisch reagierte und sich schließlich ablehnend gegenüber einzelnen Maßnahmen des NS-Staates äußerte, lässt sich auch anhand seines Engagements für die katholische Jugend aufzeigen. So kommunizierte er durch seine „Jugendpredigten“ einen direkt an den Nachwuchs gerichteten Verhaltenskodex. Bei diesen Veranstaltungen war der Trierer Dom oft bis auf den letzten Platz gefüllt.83 Primär ging es um die Wahrung eigener Milieuprivilegien, ohne dabei das Staatsgebilde infrage zu stellen. Die katholische Jugend fand in der Liturgischen Bewegung einen Rückzugsort. Zudem erfuhr die Jugendseelsorge einen Aufschwung. Allerdings wurde das seelsorgerische Verhalten des Klerus zusehends politisiert und in den Fokus staatlicher Maßnahmen gerückt. Aus der Sicht der NS-Verfolgungsbehörden ergab sich im Jahr 1935 eine veränderte Situation. Der neue Dienststellenleiter der Staatspolizeistelle Trier, Dr. Gerhard Güttler, äußerte sich in einem Nachtrag seines monatlichen Lageberichts 80 Zur Diskussion über den Widerstandsbegriff vgl. Ian Kershaw : Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen im Überblick. Reinbek b. Hamburg 32002, S. 279–328. 81 Arno Klönne : Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner, München 1995. 82 Bistumsarchiv (BA) Trier, Abt. 113, Nr. 5, S. 40. 83 Christoffel : Der Weg durch die Nacht, S. 49.
311
312
|
Thomas Grotum
zum Monat Mai 1935, dass 80 % der Bevölkerung „blindlings ihrem Geistlichen ergeben“ seien und die Katholische Aktion „einer der gefährlichsten Gegner für den Staat“ darstelle und „immer offener und hemmungsloser zum Angriff vorgehen“84 würde. Dieser Bericht beschreibt nicht etwas eine plötzliche Radikalisierung der katholischen Bevölkerung, sondern ist als Versuch zu werten, die Bedeutung der Staatspolizeistelle Trier in Berlin zu unterstreichen. Gerade ist eine, wenn nicht die Hauptaufgabe der Dienststelle weggefallen, nämlich die Überwachung des Saargebietes. Der bisherige Leiter der Gestapo Trier, Heinrich Welsch85, ist nach erfolgreicher Mission als Vertreter an den Obersten Abstimmungsgerichtshof für das Saargebiet gewechselt. Die Staatspolizeistelle in Trier war sogar der neu eingerichteten Gestapo in Saarbrücken unterstellt worden. Auch wenn diese Degradierung nach nur einem Monat am 9. Mai 1935 wieder zurückgenommen wurde, weil sich Gauleiter Gustav Simon und Regierungspräsident Dr. Konrad Saassen gegen die Maßnahme stemmten, so musste dringend ein neues Aufgabenfeld gefunden werden. Das war die Zurückdrängung der Katholischen Kirche. Rücksicht musste nicht mehr genommen werden. Entsprechend finden sich Hinweise auf angebliche Verbindungen des KJMV zur illegalen KPD,86 Pfarrer werden als „Wühler übelster Sorte“87 bezeichnet und homosexuelle Verfehlungen von HJ-Führern würden „zum Kampf gegen die HJ verwendet“88. Argwöhnisch beobachtete die Gestapo Trier, dass die Geistlichkeit ab September 1935 durch außerordentliche Passivität und Mäßigung auffallen würde. Ab 1936 folgten dann staatlicherseits diverse Vorstöße gegen die Kirche, darunter die Sittlichkeitsprozesse89, die Entfernung von Kreuzen aus den Klassenräumen90 und die Abschaffung der Konfessionsschule91. 84 Lageberichte der rheinischen Gestapostellen, bearbeitet von Anselm Faust, Bernd-A. Rusinek und Burckhard Dietz (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), Bd. II,1 : Januar – Juni 1935, Düsseldorf 2014, S. 645–647 (Nachtrag zum Lagebricht für den Monat Mai 1935). 85 Gisela Tascher : Staat, Macht und ärztliche Berufsausbildung 1920–1956. Gesundheitswesen und Politik : Das Beispiel Saarland, Paderborn u.a. 2010, S. 341–346. 86 Lageberichte der rheinischen Gestapostellen, bearbeitet von Anselm Faust, Bernd-A. Rusinek und Burckhard Dietz (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), Bd. II,12 Juli – Dezember 1935, Düsseldorf 2015, S. 878 (Lagebricht für den Monat Juli 1935). 87 Ebd., S. 879. 88 Ebd., S. 881. 89 Hans Günter Hockerts : Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/1937. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Bd. 6), Mainz 1971. 90 Franz Josef Heyen : Nationalsozialismus im Alltag. Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus vornehmlich im Raum Mainz-Koblenz-Trier (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 9), Koblenz 1985, S. 240–255. 91 Ebd., S. 237–239.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
Um auch die Sozialisationsinstanz Schule zu berücksichtigen, wurden in der Studie von Anke Schwebach zwei Volksschulchroniken herangezogen. Am Beispiel des Winzerdorfes Klüsserath an der Mosel mit seinen 1.140 Einwohnern (1933) lässt sich die Bedeutung von einzelnen Personen bei der nationalsozialistischen Durchdringung des (Schul-)Alltages besonders gut verdeutlichen.92 Der Hauptlehrer Peter Fell, der die Schul- und Ortschronik bis April 1933 geführt hat, betont anlässlich der Reichstagswahl im März 1933, dass er die Bedeutung der „nationalen Revolution“ verstanden habe. Die Schulfeierlichkeiten anlässlich der Reichstagseröffnung fallen mit dem gemeinsamen Hören der Radioübertragung, der Beflaggung des Schulgeländes mit Hakenkreuzfahnen und einem Fackelzug durch den Moselort bereits sehr im Sinne der neuen Machthaber aus. Fell kann somit als ein Sympathisant des NS-Regimes in der Frühphase des Regimes angesehen werden. Sein Nachfolger, Peter Ameln, fungierte dagegen geradezu als Schaltstelle der Nationalsozialisten in der Gemeinde. Als NSDAP-Ortsgruppenleiter gründete er im Mai 1933 die lokale HJ-Gruppe und bewarb sie intensiv in der Schule. Selbst die Gründung einer BDMGruppe gelang ihm, nachdem er einige Mädchen nach monatelanger Überzeugungsarbeit, übrigens auch der Eltern, zum Beitritt bewegen konnte. Der Schulalltag wurde durch ihn schnell nationalsozialistisch geprägt. Christliche Feiertage traten in den Hintergrund und der NS-Festkalender wurde ausgiebig zelebriert. Als Gegenspieler in der Gemeinde konnte der katholische Geistliche, Pfarrer Salz, identifiziert werden. Aber trotz zahlreicher kirchlicher Versuche, die NS-Vereinnahmung zu begrenzen, vermochte Ameln bis Mai 1935 insgesamt 96 % aller Jungen und 80 % aller Mädchen entsprechenden Alters im Jungvolk, sowie 90 % der älteren in der HJ bzw. 50 % im BDM zu organisieren. Dies hielt er jedenfalls voller Stolz in der Chronik fest. Ab Jahresbeginn 1935 war Peter Ameln offiziell Hauptlehrer der Volksschule und scheint mehrmals auch die übergeordnete Schulbehörde gegen dem Pfarrer in Stellung gebracht zu haben. Schließlich versetzte man ihn 1940 als Organisationsleiter in das besetzte Luxemburg, um in Esch eine NSDAP-Ortsgruppe aufzubauen. Bereits 1942 kehrte er als Rektor der Volksschule in Schweich an die Mosel zurück. Ganz anders scheint der Alltag in der Volksschule in Damflos, einem 550 Seelen-Dorf bei Hermeskeil, verlaufen zu sein. Die reine Schulchronik wurde von dem Lehrer Josef Stedem geführt.93 Er berichtete eher stichpunktartig oder in wenigen Sätzen, um Angaben zu Schulbeginn, Schülerzahl, Schulbetrieb, Ferien, Klassenfahrten, Sporttagen oder regierungsamtlichen Anweisungen zu dokumentieren. 92 Kreisarchiv (KrA) Trier-Saarburg, Best. F, Nr. 34.2 : Schulchronik der Volksschule Klüsserath 1927– 1942. Das Original befindet sich in der heutigen Grundschule Klüsserath. 93 KrA Trier-Saarburg, Best. F, Nr. 11.2 : Schulchronik der Schule Damflos 1889–1973. Das Original befindet sich in der Hauptschule Hermeskeil.
313
314
|
Thomas Grotum
Wenn NS-Feiertage genannt werden, so sind sie mit dem Hinweis „lt. Anordnung der Regierung …“ versehen. Durchbrochen wird die strikte Trennung von Schulund Ortschronik nur einmal, als nämlich die Pfarrei am 26. Juli 1933 in einem Sonderzug nach Trier fuhr, „um den Hl. Rock zu schauen und zu verehren. Die Schuljugend ging geschlossen mit.“94 Jede Einschränkung im Zusammenhang mit christlichen Feiertagen wird aufgezeichnet, vom NS-Festkalender findet sich keine Spur. Während die Auseinandersetzungen um die Abschaffung der Bekenntnisschule keine Erwähnung finden, dokumentiert der Chronist die Einführung der Gemeinschaftsschule in der gesamten Rheinprovinz am 18. April 1939 und erwähnt, dass die eigene Schule sich nunmehr „Deutsche Gemeinschaftsschule Damflos“ zu nennen habe. Seine Einstellung zum Nationalsozialismus vermag Josef Stedem erst nach dem Ende des NS-Regimes in der Chronik vermerken. Einen längeren Absatz zum Stichwort „Bekenntnisschule“ beendete er mit den Worten : „und so blieb trotz nationalsoz. Willkür u. Omnipotenz das Kreuz in den beiden Schulsälen.“95
Verbreitung und Bekämpfung kommunistischer Propaganda vor dem Zweiten Weltkrieg
Josef Görgen aus Merzig, Bauarbeiter und KPD-Mitglied, war nach der Macht übernahme der Nationalsozialisten daran beteiligt, Flugblätter aus dem Saargebiet in das Deutsche Reich zu schmuggeln. Die Gestapo Trier verhaftete ihn am 9. August 1933 und brachte ihn in das Trierer Gefängnis in der Windstraße. Das OLG Hamm verurteilte ihn schließlich am 10. Oktober 1934 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu sieben Jahren Zuchthaus. Diese Haftstrafe verbüßte er in den Haft anstalten Rheinbach und Siegburg. Anschließend verbrachte man Josef Görges in das Konzentrationslager Oranienburg, später in das Konzentrationslager Dachau. Als Häftling dieses Lagers wurde er im Verlauf eines der Evakuierungsmärsche von den alliierten Truppen im Jahr 1945 befreit.96 Mit der Verbreitung und der Bekämpfung kommunistischer Propaganda im Raum Trier bis 1939 hat sich Maike Vaas in ihrer Studie beschäftigt.97 Dabei hat 94 Ebd., S. 48. 95 Ebd., S. 78. 96 LA Saarland, Best. Landesentschädigungsamt (LEA), Nr. 11997. Es handelt sich um einen der vielen Fälle, die das Projekt „Widerstand im Rheinland 1933–1945“ aufgearbeitet hat ; vgl. http://www. rheinische-geschichte.lvr.de/Widerstandskarte/Seiten/home.aspx (Zuletzt besucht : 29.8.2017). Siehe auch Helmut Rönz/Markus Gestier (Hg.) : „Herr Hitler, ihre Zeit ist um !“. Widerstand an der Saar 1935–1945, St. Ingbert 2016. 97 Maike Vaas : „Die KPD lebt“ ? Verbreitung und Bekämpfung kommunistischer Propaganda im Raum Trier, 1933–1939, Masterarbeit Trier 2014.
Biographische Studien, V-Leute, katholische Jugend und kommunistische Propaganda
|
sie erst gar nicht den Versuch unternommen, Vollständigkeit anzustreben, da es Hinweise auf eine Vielzahl von Fällen in weit verstreuten Beständen gibt. Die Herstellung und Verbreitung illegaler Schriften spielte in fast allen Prozessen gegen Kommunisten eine wichtige Rolle. Der Region rund um Trier kam durch seine geographische Nähe zu Luxemburg, Frankreich, Belgien und dem Saargebiet (bis 1. März 1935 als Mandatsgebiet des Völkerbundes) eine besondere Bedeutung zu. Entsprechend war die Staatspolizeistelle Trier in den beiden ersten Jahren ihrer Existenz auf das Saargebiet fokussiert. Selbst bei der Wahl des zweiten Dienststellenleiters Anfang 1934 spielte diese Frage eine zentrale Rolle. „Staatsanwaltschaftsrat Welsch kennt die politische und kulturelle Struktur des Saargebietes und dürfte deshalb als Leiter der Staatspolizeistelle Trier geeignet sein“98, so Ministerpräsident Hermann Göring an Reichsinnenminister Wilhelm Frick in einem Schreiben vom 31. Januar 1934. Flugblätter, Broschüren und Zeitungen wurden auf unterschiedlichste Art und Weise ins Reichsgebiet geschmuggelt. Fuß- und Fahrradkuriere kamen dabei ebenso zum Einsatz wie Personen, die den Grenzzugverkehr nutzten. Entsprechend kooperierte die Gestapo Trier mit diversen Institutionen, die ihr Personal einsetzten, um den Schmuggel zu verhindern (Zollbeamte, Feldjäger, Bahnbeamte etc.). Sie alle fungierten als Zuarbeiter der Staatspolizei. Bei der Kontrolle von hinterlegten Gepäckstücken auf dem Hauptbahnhof in Trier wurde im April 1934 in einem Koffer 2.500 Exemplare der kommunistischen Zeitung Die Junge Garde gefunden. Zunächst beobachteten Beamte der Staatspolizeistelle Trier vier Tage lang die Ablagestelle, übergaben die Aufgabe dann aber an die Bahnpolizei. Diese konnte nach weiteren vier Tagen den Boten festnehmen. Im Laufe der Ermittlungen wird auch der Schwager des Kuriers festgenommen, da er sich mindestens zweimal am Schmuggel von verbotenen Druckschriften aus dem Saarland beteiligt hatte. Allerdings hielt sich die Gestapo Trier merklich zurück, da sie eine „umfangreiche Ermittlungssache […], die die Aufdeckung der illegalen Einfuhr kommunistischen Schriftmaterials aus dem Saargebiet nach Deutschland zum Ziel hat“99, nicht gefährden wollte. Selbst als in den späten Abendstunden des 25. Mai 1934 in der Trierer Innenstadt zahlreiche kommunistische Flugblätter auf den Straßen verteilt worden waren, nahm man zwar neun Verdächtige fest, entließ sie aber nach vier Tagen wieder aus der Haft.100 Die beiden Obengenannten wurden schließlich am 10. Oktober 1934 wegen Vorbereitung zum Hochverrat vor dem OLG Hamm zu jeweils zwei Jahren und sechs Monaten Zuchthaus verur 98 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK), I. HA Rep. 90 P, Nr. 5. 99 LA-NRW (Westf.), Q 211a/2258, Bl. 7. 100 Ebd., Bl. 48.
315
316
|
Thomas Grotum
teilt.101 Selbst wenn der Koffer nicht bei einer Routinekontrolle aufgefallen wäre, hätte die Untergrundtätigkeit der beiden Schmuggler kurze Zeit später ein Ende gefunden. Der Grund hierfür ist der Umstand, dass der KPD-Funktionär Friedrich Wolff aus Saarbrücken der Staatspolizeistelle Trier seine Dienste angeboten hatte und dort 1934 als V-Mann geführt wurde. Er hatte Kontakt zum Kurierdienstleiter der Bezirksleitung Saar und konnte so im Detail über die Strukturen der KPD und das Verteilersystem für Druckschriften berichten. Deshalb war die Staatspolizeistelle Trier bereits im Vorfeld über den Koffer mit den illegalen Druckschriften informiert, der im April 1934 in der Gepäckaufbewahrung des Trierer Hauptbahnhofs lagerte.102 Die Gestapo Trier konnte mit seiner Hilfe einen Teil des KPD-Kuriersystems aus dem Saarland Richtung Frankfurt am Main zerschlagen. Friedrich Wolff war auch nach der Rückgliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich für das NS-Regime tätig. Als V-Mann „Alfred“ des SD-Abschnitts Saar agierte er in Luxemburg. Allerdings warf man ihm 1936 Nachrichtenschwindel vor, da die Überprüfung diverser von ihm gelieferter Karteien und Listen negativ ausfiel. Deshalb verhängte die Staatspolizeistelle Saarbrücken Schutzhaft gegen ihn und überführte ihn in das Konzentrationslager Esterwegen.103
101 Ebd., Bl. 113. 102 Ebd., Bl. 145–150, 154 und 157. 103 Siehe auch die drei Gestapa-Akten zum Fall „Friedrich Wolff“ : RGASPI, Best. 458, Fb. 9, Nr. 160, 161 und 162.
Abkürzungsverzeichnis AfWS Alef AN ANLux ARBED
Amt für Wiedergutmachung Saarburg Aktiv Lëtzebuerger Enhétsfront Archives Nationales Paris Archives Nationales de Luxembourg Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Vereinigte Stahlhütten Bur bach-Eich-Düdelingen) Art. Artikel APL Archiwum Państwowe w Łodzi (Staatsarchiv Łodz) BA Bistumsarchiv BArch Bundesarchiv BBC British Broadcasting Corporation BDC Berlin Document Center BDM Bund Deutscher Mädel BdS Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD Best. Bestand BfV Bundesamt für Verfassungsschutz BKA Bundeskriminalamt BND Bundesnachrichtendienst BREM Bureau Regionale d’Etudes à Metz CDRR Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance CdZ Chef der Zivilverwaltung CIC Counter Intelligence Corps DAF Deutsche Arbeitsfront DDP Deutsche Demokratische Partei DHI Deutsches Historisches Institut DHIP Deutsches Historisches Institut Paris DKP Deutsche Kommunistische Partei EKL Einsatzkommando Luxemburg E-Pole Eindeutschungs-Pole FND Französischer Nachrichtendienst Gestapa Geheimes Staatspolizeiamt Gestapo Geheime Staatspolizei GFP Geheime Feldpolizei GLA Generallandesarchiv GStA PK Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz HJ Hitlerjugend IdS Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD
318
|
Abkürzungsverzeichnis
IfZ Institut für Zeitgeschichte IKL Inspektion der Konzentrationslager ITS International Tracing Service KaD Kreisausschuss Daun KdgM Kampfbund des gewerblichen Mittelstands KJMV Katholischer Jungmännerverein KJVD Kommunistischer Jugendverband Deutschlands KL / KZ Konzentrationslager KPD Kommunistische Partei Deutschlands KPD-O KPD-Opposition KPL Kommunistische Partei Luxemburg KrA Kreisarchiv Kripo Kriminalpolizei KSK Kreissparkasse LA Landesarchiv LA-NRW (Westf.) Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Westfalen LEA Landesentschädigungsamt LFK Lëtzeburger Freihétskämpfer LHA Landeshauptarchiv LPL Lëtzeburger Patriote Liga LRL Lëtzeburger Ro‘de Lé‘w LVL Lëtzeburger Volleks Legio‘n NARA National Archives and Records Administration NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NS-Dok RLP NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz NSLB Nationalsozialistischer Lehrerbund NSV Nationalsozialistische Volkswohlfahrt OLG Oberlandesgericht OT Organisation Todt Pi-Men Patriotes Indépendants Polux Poste d´Alerte Luxembourg RAB Reichsautobahn RAD Reichsarbeitsdienst RGASPI Russisches Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte Moskau RGBl. Reichsgesetzblatt RM Reichsmark RMdI Reichsministerium des Inneren RMdJ Reichsministerium der Justiz RSHA Reichssicherheitshauptamt RuS-Führer Führer des Rasse- und Siedlungswesens RuSHA Rasse- und Siedlungshauptamt der SS RWE Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke SA Sturmabteilung
Abkürzungsverzeichnis
|
SD Sicherheitsdienst des Reichsführers SS SHD Service historique de la Défense Sipo Sicherheitspolizei SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands S.R. Service de Renseignements SS Schutzstaffel StA Stadtarchiv Stalag Stammlager TN Technische Nothilfe V-Mann/-Person Vertrauens-Mann/-Person VdB Volksdeutsche Bewegung VdH Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und vermissten Angehörigen Deutschlands e.V. VGH Volksgerichtshof VL Vernichtungslager WED Wiedereindeutschung WHW Winterhilfswerk W-Person (Ge-)Währsperson ZRS Zentrale Rechtsschutzstelle
319
Quellen- und Literaturverzeichnis
Ungedruckte Quellen Amt für Wiedergutmachung Saarburg (AfWS) Best. 73689. Best. 74206, Bd. II. Best. 75037. Best. 75506. Best. 251576. Best. 255584. Archives Nationales de Luxembourg (AnLux) CdG (Criminels de Guerre), Nr. 006, 040, 061, 079, 087, 088, 094, 140, 143, 149. Jt (Epuration) : Jt-057, Jt-102, Jt-230. Archives Nationales Paris (AN) AJ 40 (La France et la Belgique sous l’occupations allemande, 1940–1944), Nr. 1560, 1561, 1570. Archiwum Państwowe Łodzi (APL) PSZ (Przełożony Starszeństwa Żydów w Getcie Łódzkim), L-19581, L-19621, L-19829, L-20539 II, L-21107, L-21111, L-21116, L-21117, L-21120, L-21125. Bistumsarchiv (BA) Trier Abt. 113 (Jugendamt BGV Trier). Abt. 134 (Nationalsozialismus), Nr. 190. Abt. BIII 14 (Pastorelle Betreuung), Nr. 8, Band 8. Bundesarchiv (BArch) Berlin BDC (Berlin Document Center), NSDAP-Gaukartei, Karte Schmidt, Karte Welsch. NS 4-HI (Konzentrationslager Hinzert), Nr. 2. R 43 II (Reichskanzlei), Nr. 1271a. R 58 (Reichssicherheitshauptamt), Nr. 243, 432, 510, 534, 566, 571, 611, 656, 856, 1112, 1134, 1145, 2093, 2096, 3035c, 3037c, 3038d, 3039c, 3040c, 3043c, 3044c, 3972, 5054, 5415c, 5576, 5620. R70-Luxemburg (Deutsche Polizeidienststellen in Luxemburg), Nr. 3. R 3001 (Reichsjustizministerium), Nr. 80024.
322
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Bundesarchiv (BArch) Koblenz AllProz 21 (Prozesse gegen Deutsche im europäischen Ausland : Handakten von Rechtsanwälten), Nr. 3, 4, 5, 16, 189, 201, 202, 275, 278, 281, 282, 286, 342, 344, 353, 358. Bundesarchiv (BArch) Ludwigsburg B 162 (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen), Nr. 6639, 6903 bis 6908. Centre de Documentation et de Recherche sur la Résistance (CDRR) Luxemburg CNR (Conseil national de la Résistance), 16A Gestapo, 16B Gestapo, 18 Gestapo, 18B Gestapo Fahndungslisten. EKL (Einsatzkommando Luxemburg), Schriftverkehr 1940. Gestapo, Tätigkeitsberichte 1944. Grève 1942. KPL. Nr. 716. Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz (GStA PK) I. HA Rep. 89 (Geheimes Zivilkabinett), Nr. 16313 bis 16348. I. HA Rep. 90 Annex P. (Geheime Staatspolizei), Band 9.11, Nr. 14/2, Nr. 76/6, Nr. 77/1, Nr. 78/6, Nr. 112, Nr. 118–127. I. HA Rep. 90 A (Staatministerium, jüngere Registratur), Nr. 2577. I. HA Rep. 90 P (Lageberichte) Nr. 5 ; Nr. 13, Heft 2 ; Nr. 14, Heft 2. I. HA Rep. 151 (Finanzministerium) IV, Nr. 1560. Generallandesarchiv (GLA) Karlsruhe Best. 521 (Kislau : Arbeitshaus, Schutzhaftlager, Konzentrationslager, Durchgangslager für Fremdenlegionäre, Strafgefängnis), Nr. 8356. Institut für Zeitgeschichte (IfZ) München Best. MA 553, Nr. 1 (Die Geheime Staatspolizei). International Tracing Service (ITS) Bad Arolsen CM/1 Akten aus Deutschland. Personalakten. Kreisarchiv (KrA) Trier-Saarburg Best. F (Schulchroniken), Nr. 11.2, 34.2. Best. P (Amt Palzem), Nr. 428. Landesarchiv (LA) NRW, Abteilung Westfalen Best. Q 211a (Generalstaatsanwaltschaft Hamm, Erstinstanzliche Strafsachen), Nr. 2258, 2801, 2802, 3319, 3323, 9662–9719, 13859, 13960.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Landesarchiv (LA) Saarland Landesentschädigungsamt (LEA), Nr. 11997. StAnW (Staatsanwaltschaft Saarbrücken), Nr. 2658–2665. Landesarchiv (LA) Speyer Best. H 91 (Geheime Staatspolizei Neustadt), Nr. 524, 2842, 2843, 3398, 4225, 5943, 6091, 6767, 6800. Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Rudolstadt Best. Bezirkstag und Rat des Bezirks Gera, Nr. 8021. Landeshauptarchiv (LHA) Koblenz Best. 403 (Oberpräsidium der Rheinprovinz), Nr. 145, 2246, 2535, 6583, 13381–13383, 13439, 14991–14993, 16740, 16741, 16765, 16766, 16772, 16864, 16874. Best. 441 (Bezirksregierung Koblenz), Nr. 28022. Best. 442 (Bezirksregierung Trier), Nr. 7470–7478, 7568–7571, 10961,14278, 15464, 15625, 15792, 15797, 26560, 27364, 27365. Best. 442 HK (Regierungshauptkasse Trier), Nr. 8, 9, 25, 83–103. Best. 462 [VK] (Kreisausschuss Daun), Nr. 11. Best. 572 (Finanzämter), Nr. 15959, 20670. Best. 583,002 (Landgericht Trier), Nr. 3638. Best. 584,002 (Staatsanwaltschaft Trier), Nr. 323, 335, 419, 537, 595, 660, 916, 1578. Best. 605,002 (Justizvollzugsanstalt Wittlich), Nr. 2005, 13934. Best. 655,115 (Cochem, Bürgermeisterei), Nr. 147. Best. 655,123 (Zeltingen-Rachtig, Bürgermeisterei und Zeltingen, Gemeinde), Nr. 1251. Best. 655,215 (Bernkastel-Land, Bürgermeisterei), Nr. 712. Best. 662,005 (Zurückgegebene Akten aus den National Archives, Alexandria/USA), Nr. 5, 9–13, 33, 34, 449. Best. 662,006 (Sicherheitsdienst der SS Koblenz), Nr. 749. Best. 662,007 (NS-Mischbestand für Einzelakten), Nr. 88. Best. 700,012 (Besatzungszeit und Separatismus), Nr. 77. Best. 714 (Publizistisches Schriftgut), Nr. 6995. Best. 717 (Reproduktionen von Archivalien und Bibliotheksgut), Nr. 120. National Archives and Records Administration (NARA) M 1270, Roll 0031 (Interrogation Report No. 28 – Gestapo Trier). Record Group 263, Vol. 2, RC Box 107, Location : 230/86/24/02. NS-Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz (NS-Dok RLP) Best. 28/503. Best. 41/78.
323
324
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Russisches Staatsarchiv für sozialpolitische Geschichte (RGASPI) Moskau Best. 458, Findbuch (Fb.) 9, Nr. 160–162 (Friedrich Wolff). Best. 458, Fb. 9, Nr. 204 und 205 (Gestapa Luxemburg). Best. 458, Fb. 9, Nr. 282 (Lageberichte Kommunistische Bewegung). Service historique de la Défense (SHD) Vincennes Best. 2P (Vichy, Cabinet du ministre et organismes en dependant directement), Nr. 69. Best. 40VD (Personalakten Gestapo Trier), Nr. 27, 29, 44, 62, 67, 75, 114, 151, 154, 155, 157, 161, 163, 166, 178, 194, 229, 245, 260, 281, 293, 294, 319, 323, 333, 334, 340. GR28 P7 (DGER, Section Special Allemagne, 1934–1953), Nr. 20, 56, 58. Best. P (Personalakten Gestapo Trier), Nr. 24538, 24912, 24930, 25006, 25054, 25341, 25361, 25375, 25378, 25389, 25395, 25501, 25502, 25509, 25516, 25546, 25547, 25553, 25569, 25576, 25585, 25909, 25914, 25917, 25918, 25919, 25936, 25939, 25945, 25969, 25996, 26973, 28074, 28265, 28287, 28510, 28514, 28530, 28537, 28545, 28584, 28609, 28631, 28633, 28637, 28646, 28692, 28844, 28845, 28864, 28871, 28888, 28898, 31849, 31868 ; 31895, 32093 ; 32223 ; 32236, 32237, 32241, 32253, 32256, 32274, 32278, 32621, 32635, 32642, 32844, 32845, 32854, 32861, 33114, 33168, 33169, 33224, 33256, 33276, 34029, 34056, 34072, 34078, 462765, 470236, 471043, 471044, 471045, 471046. Best. P (Fonds allemand), Nr. 828542. Stadtarchiv (StA) Trier Best. Tb 12 (Verwaltung/Personalakten), Nr. 52, 53, 54, 55, 226, 326, 327, 328. Best. Tb 15 (Polizei), Nr. 575, 772, 908, 909, 913, 928, 934, 940, 949. Best. Tb 32 (Besatzung 1914–1931), Nr. 06, 045.
Gedruckte Quellen Bailer, Brigitte/Form, Wolfgang (Hg.) : Tagesrapporte der Gestapoleitstelle Wien 1938– 1945. Online-Datenbank : http://db.saur.de/TRAP/login.jsf (Letzter Zugriff : 5.7.2017). Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 17. Juli 1954, Nr. 21 ; Teil 12 vom 2. März 1967. Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Internationalen Militärgerichtshof, Band XXIIX, Nürnberg 1948. Deutsch, Hilde : Erinnerung an meine Kinder- und Jugendjahre. Wiesbaden 2012. Die Arbeit der Sondergerichte in der Kriegszeit. Abgekürzter Bericht über die Tagung der Sondergerichtsvorsitzenden und Sachbearbeiter für Sondergerichtsstrafsachen bei den Generalsstaatsanwälten im Reichsjustizministerium am 24. Oktober 1939, [Berlin 1939]. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945 (VEJ), Bd. 1 : Deutsches Reich 1933–1937, bearb. von Wolf Gruner, München 2008. Eifelzeitung, Jg. 14, vom 29.3.1933 (Nr. 74), 11.8.1933 (Nr. 183) und 17.8.1933 (Nr. 188).
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Fels im Sturm. Predigten und Hirtenworte des Erzbischofs Franz Rudolf Bornewasser, hg. von Albert Heintz, Trier 1969. Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1848, Berlin [1848]. Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1850, Berlin [1850]. Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten 1851, Berlin [1851]. Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, Bd. 18 : Die vom 21.11.1961 bis zum 10.01.1963 ergangenen Strafurteile, lfd. Nr. 523–547, Amsterdam 1978. Kölnische Illustrierte Zeitung vom 23. März 1939, 14. Jg., Nr. 12. Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Dietz, Burkhard/Faust, Anselm/Rusinek, Bernd-A., 3 Bde. in 4 Teilbdn., Düsseldorf 2012–2016. Praca przymusowa polaków pod panowaniem hitlerowskim, 1939–1945 (Documenta occupationis, Bd. X), Poznań 1976. Quellen zur Geschichte Thüringens. Die Geheime Staatspolizei im NS-Gau Thüringen 1933–1945, hg. von Marlis Gräfe u.a., Erfurt 2009. Reichsgesetzblatt (RGBl.) Teil I, Berlin 1933, Nr. 17, Nr. 24, Nr. 25, Nr. 34, Nr. 37, Nr. 42, Nr. 81, Nr. 111 ; Teil I 1935, Nr. 54, Nr. 100, Nr. 111 ; Teil I 1939, Nr. 169. Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 449 : Wahlen zum Reichstag und die Volksabstimmung am 12. November 1934 sowie die Volksabstimmung am 19. August 1934, Berlin 1934. Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 451 : Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni 1933, Heft 3 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit, Berlin 1936. Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 552 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 3 : Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Tabellenteil, Berlin 1942 ; Heft 4 : Die Juden und jüdische Mischlinge im Deutschen Reich, Berlin 1944. Trierer Nationalblatt, Jg. 4, 27.–31. März 1933 (Nr. 73–77). Trierische Landeszeitung, Jg. 59, vom 29.3.1933 (Nr. 73). Trierischer Volksfreund, Jg. 58, vom 29.3.1933 (Nr. 74) ; Jg. 106, vom 1.10.1981 (Nr. 238). Verordnung des Reichspräsidenten zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung, in : Gräfe, Marlis/Post, Bernhard/Schneider, Andreas (Hg.) : Die Geheime Staatspolizei im NS-Gau Thüringen 1933–1945 (Quellen zur Geschichte Thüringens, Bd. 24/1), Bd. 1, Erfurt 2009, S. 59–61. Verordnungsblatt für Luxemburg vom 31. August 1942 (Nr. 50/51).
Literatur Abke, Stephanie : Denunziation, Überwachung und Kontrolle 1933–1945 in einer ländlichen Region in Nordwestdeutschland, in : Krätzner, Anita (Hg.) : Hinter vorgehaltener Hand : Studien zur historischen Denunziationsforschung (Analysen und Dokumente. Wiss. Reihe des BStU, Bd. 39), Göttingen 2015, S. 37–49.
325
326
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Adam, Uwe D.: Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1979. Adelson, Alan/Lapides, Robert/Web, Marek : Lodz ghetto. Inside a community under siege, New York 1989. Adler, Hans Günther : Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974. Ahlheim, Hannah : „Deutsche, kauft nicht bei Juden !“. Antisemitismus und politischer Boykott in Deutschland 1924 bis 1935, Göttingen 2011. Alberti, Michael : Die Verfolgung und Vernichtung der Juden im Reichsgau Wartheland 1939–1945 (Deutsches Historisches Institut Warschau. Quellen und Studien, Bd. 17), Wiesbaden 2006. Albrecht, Jutta : Die „Arisierung“ der jüdischen Gewerbebetriebe in Trier im NS-Regime, Staatsexamensarbeit Trier 2008. Albrecht, Jutta : Staatlich legitimierter Raub. Die „Arisierung“ der Lederfabrik Ernst und Karl Julius Schneider in der Karthäuserstraße, in : Neues Trierisches Jahrbuch 54 (2014), S. 107–131. Albu, Diana/Weisz, Franz : Spitzel und Spitzelwesen der Gestapo in Wien von 1938 bis 1945, in : Wiener Geschichtsblätter 3 (1999), S. 169–208. Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale (Hg.) : Lieutenant-colonel Joseph Doudot. Le B.R.E.M. Bureau Régional d’Etudes Militaires de Metz, online unter : http://www.aassdn.org/001.pdf. (Letzter Zugriff : 23.07.2017). Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier (Hg.) : „Arisierung“ jüdischer Gewerbebetriebe in der Region Trier, Trier 2012. Archen, Fernand : Missions Spéciales au Luxembourg, Paris 1968. Arendes, Cord : Zwischen Justiz und Tagespresse. „Durchschnittstäter“ in regionalen NS-Verfahren, Paderborn 2012. Ayaß, Wolfgang : „Asoziale“ im Nationalsozialismus, Stuttgart 1995. Bach, Viktoria : Karriere in der Gestapo. Biographische Studien zu einem Trierer Gestapo-Mitglied, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2014. Bader, Uwe : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert und seine Bedeutung im Ausland bis heute, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 21–32. Bader, Uwe : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1939–1945, in : Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.) : Terror im Westen. Nationalsozialistische Lager in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg 1940–1945 (Geschichte der Konzentrationslager 1933–1945, Bd. 5), Berlin 2004, S. 249–274. Bader, Uwe/Welter, Beate : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, in : Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.) : Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Bd. 5 : Hinzert, Auschwitz, Neuengamme, München 2007, S. 17–42. Bader, Uwe/Welter, Beate : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, in : Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.) : Hinzert. Das Konzentrationslager Hinzert und seine Außenlager, München 2008, S. 13–38.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Bader, Uwe/Welter, Beate : Luxemburger Häftlinge im SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940– 1945, in : Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager 21 (2005) : Häftlingsgesellschaft, S. 66–82. Bajohr, Frank : „Arisierung“ als gesellschaftlicher Prozeß. Verhalten, Strategien und Handlungsspielräume jüdischer Eigentümer und „arischer“ Erwerber, in : Wojak, Irmtrud/ Hayes, Peter (Hg.) : „Arisierung“ im Nationalsozialismus. Volksgemeinschaft, Raub und Gedächtnis, Frankfurt a.M. 2000, S. 15–30. Bajohr, Frank : „Arisierung“ in Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933–1945, Hamburg 1997. Barbel, Metty : Student in Hinzert und Natzweiler. Erlebnisaufsätze von KZ Nr. 2915 alias 2188, Luxemburg 1992. Barkai, Avraham : Between East and West. Jews from Germany in the Łódź Ghetto, in : Yad Vashem Studies 16 (1984), S. 271–332. Barkai, Avraham : Hoffnung und Untergang. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Hamburg 1998. Barkai, Avraham : Vom Boykott zur „Entjudung“. Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933–1943, Frankfurt a.M. 1987. Bauer, Kurt : Nationalsozialismus. Ursprünge, Anfänge, Aufstieg und Fall, Wien 2008. Bauz, Ingrid : Von der politischen Polizei zur Gestapo. Brüche und Kontinuitäten in : Bauz, Ingrid/Brüggemann, Sigrid/Maier, Roland (Hg.) : Die Geheime Staatspolizei in Württemberg und Hohenzollern, Stuttgart 2013, S. 23–77. Benz, Wolfgang : Die Bedeutung des Westwalls für das nationalsozialistische Regime, in : Werk, Klaus/Franke, Nils (Hg.) : Naturschutz am ehemaligen Westwall. NS-Großanlagen im Diskurs (Geisenheimer Beiträge zur Kulturlandschaft, Bd. 1), Geisenheim 2016, S. 18–29, online unter : https://mueef.rlp.de/fileadmin/mulewf/Publikationen/Naturschutz_am_ehemaligen_Westwall.pdf (Letzter Zugriff : 23.7.2017). Benz, Wolfgang : Die Verortung des SS-Sonderlagers/KZ Hinzert im System der Konzentrationslager, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Verwaltungszentralen des KZ-Systems (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Mainz/Hinzert 2012, S. 36–50. Berschel, Holger : Bürokratie und Terror. Das Judenreferat der Gestapo Düsseldorf 1935– 1945 (Düsseldorfer Schriften zur Neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 58), Essen 2001. Bies, Luitwin : Die CDU-Saar – mit braunen Flecken. Vortrag gehalten am 5. März 2009 in Saarbrücken. Manuskript Online : http://peter-imandt.de/Braune_Flecken.pdf (Letzter Zugriff : 27.02.2017). Bies, Luitwin : Klassenkampf an der Saar 1919–1935. Die KPD im Saargebiet im Ringen um die soziale und nationale Befreiung des Volkes, Frankfurt a.M. 1978. Blaschke, Olaf : Heimatgeschichte als Harmonielehre. Warum ausgerechnet stets in „unserem“ Ort Toleranz herrschte und niemals Judenhass. Erklärung eines Widerspruchs, in : Haus der Geschichte Baden-Württemberg (Hg.) : Nebeneinander − Miteinander − Gegeneinander ? Zur Koexistenz von Juden und Katholiken in Süddeutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Gerlingen 2002, S. 137–161.
327
328
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Boissier, Pierre : Völkerrecht und Militärbefehl. Ein Beitrag zur Frage der Verhütung und Bestrafung von Kriegsverbrechen, Stuttgart 1953. Bollmus, Reinhard : Trier und der Nationalsozialismus (1933–1945), in : Düwell, Kurt/Irsigler, Franz (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 517–572. Bopf, Britta : „Arisierung“ in Köln. Die wirtschaftliche Existenzvernichtung der Juden 1933–1945, Köln 2004. Borgstedt, Angela : Das nordbadische Kislau. Konzentrationslager, Arbeitshaus und Durchgangslager für Fremdenlegionäre, in : Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.) : Herrschaft und Gewalt. Frühe Konzentrationslager 1933–1939 (Geschichte der Konzentrationslager 1933–1945, Bd. 2), Berlin 2002, S. 217–229. Borsch, Andreas : „Arisierung“ in der Vulkaneifel. Analyse zur wirtschaftlichen Existenzvernichtung der jüdischen Bevölkerung zwischen 1933 und 1939, Magisterarbeit Universität Trier 2016. Bossaert, Danielle/Calmes, Christian : Geschichte des Großherzogtums Luxemburg. Von 1815 bis heute, Luxemburg 1994. Bozyakali, Can : Das Sondergericht am Hanseatischen Oberlandesgericht. Eine Untersuchung der NS-Sondergerichte unter besonderer Berücksichtigung der Anwendung der Verordnung gegen Volksschädlinge, Frankfurt a.M. u.a. 2005. Brammer, Uwe : Spionageabwehr und „Geheimer Meldedienst“. Die Abwehrstelle X im Wehrkreis Hamburg 1935–1945 (Einzelschriften zur Militärgeschichte, Bd. 33), Freiburg im Breisgau 1989. Brogmus, Hannes : Die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bürger Triers 1933 bis 1938. Eine Studie zu den lokalen Ausdrucksformen des nationalsozialistischen Antisemitismus unter besonderer Berücksichtigung von Reaktionen aus der Trierer Bevölkerung, Magisterarbeit Universität Trier 2016. Brommer, Peter : Zur Tätigkeit der Gestapo Trier in den Jahren 1944/45, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 18 (1992), S. 325–368. Broszat, Martin : Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933–1945, in : Buchheim, Hans u.a. (Hg.) : Anatomie des SS-Staates. Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, 2 Bde., München 21979, Bd. 2, S. 9–133. Brüchert, Hedwig/Matheus, Michael (Hg.) : Zwangsarbeit in Rheinland-Pfalz während des Zweiten Weltkriegs. Mainzer Kolloquium 2002 (Geschichtliche Landeskunde, Bd. 57), Stuttgart 2004. Bruns-Wüstefeld, Alex : Lohnende Geschäfte. Die „Entjudung“ der Wirtschaft am Beispiel Göttingens, Hannover 1997. Bucher, Peter : Das SS-Sonderlager Hinzert bei Trier, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 4 (1978), S. 413–439. Buchheim, Hans : Die Grenzpolizei der Geheimen Staatspolizei, in : Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, Band II, Stuttgart 1966, S. 157–167. Büchler, Georges : Évacuation – Déportation. Le premier transport vers l’Est, 16.10.1941/ Evakuierung – Aussiedlung. Der erste Polentransport, 16.10.1941 (Musée national de la Résistance Esch-sur-Alzette, Bd. 8), Luxembourg 2016.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Bugajer, Richard/Engel, Reinhard : Mein Schattenleben. Eine Jugend im Ghetto und KZ, Wien 2000. Bühler, Marianne : Katholiken und Juden vor, während und nach der Katastrophe, in : Schneider, Bernhard/Persch, Martin (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier. Beharrung und Erneuerung 1881–1981, Bd. 5, Trier 2004, S. 506–524. Bundeskriminalamt (Hg.) : Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte. Dokumentation einer Kolloquienreihe, Köln 2008. Bundeskriminalamt (Hg.) : Der Nationalsozialismus und die Geschichte des BKA. Spurensuche in eigener Sache. Ergebnisse – Diskussionen – Reaktionen, Dokumentation des Kolloquiums zum Forschungsbericht zur BKA-Historie vom 6. April 2011, Köln 2011. Burkhard, Karl-Josef/Thill, Hildburg-Helene : Unter Juden. Achthundert Jahre Juden in Boppard, Boppard 1996. Butler, Rupert : Illustrierte Geschichte der Gestapo, Augsburg 1996. Cerf, Paul : De l’épuration au Grand-Duché de Luxembourg après la seconde guerre mondiale, Luxemburg 1980. Christoffel, Edgar : Der Weg durch die Nacht. Verfolgung und Widerstand im Trierer Land während der Zeit des Nationalsozialismus. Verfolgte aus Trier und dem Trierer Land durchleben die Konzentrationslager und Zuchthäuser des „Dritten Reiches“, Trier 1983. Christoffel, Edgar : Krieg am Westwall 1944/45. Das Grenzland im Westen zwischen Aachen und Saarbrücken in den letzten Kriegsmonaten, Trier 1989. Conze, Eckart/Frei, Norbert/Hayes, Peter/Zimmermann, Moshe (Hg.) : Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich und in der Bundesrepublik, München 2010. Corbach, Dieter : 6 :00 Uhr ab Messe Köln-Deutz. Deportationen 1938–1945 (Spuren jüdischen Wirkens, Bd. 6), Köln 1999. Cornelius, Kai : Vom spurlosen Verschwindenlassen zur Benachrichtigungspflicht bei Festnahmen (Juristische Zeitgeschichte, Abt. I : Allgemeine Reihe, Bd. 18), Berlin 2006. Corni, Gustavo/Gies, Horst : Brot, Butter, Kanonen. Die Ernährungswirtschaft in Deutschland unter der Diktatur Hitlers, Berlin 1997. Crankshaw, Edward : Gestapo. Instrument of tyranny, London 1956. Dams, Carsten/Stolle, Michael : Das Unternehmen Gestapo − Eine historische SWOT-Analyse, in : Becker, Manuel/Studt, Christoph (Hg.) : Der Umgang des Dritten Reiches mit den Feinden des Regimes, Münster 2010, S. 79–97. Dams, Carsten/Stolle, Michael : Die Gestapo. Herrschaft und Terror im Dritten Reich, München 42017 (2008). Das Vernehmungskommando in Hinzert, in : Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015, S. 91–94. Dean, Martin : Robbing the Jews. The Confiscation of Jewish Property in the Holocaust 1933–1945, Cambridge 2008. Delarue, Jacques : Geschichte der Gestapo, Düsseldorf 1964. „Der Angstschweiß hat die Farbe ausgelöscht…“. KATZ-Gespräch mit Willi und Maria
329
330
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Torgau über die Verfolgung und den Widerstand der Kommunisten in Trier während der Zeit des Nationalsozialismus, in : KATZ 16 (1994), H. 7/8, S. 24–27. Die deutsche Erzeugungsschlacht 1934/35. Wie schlägt man die Erzeugungsschlacht. Richtige Ratschläge in drastischen Bilderfolgen, hg. vom Reichsnährstand, Essen 1935. Die Verhaftung der Eheleute Kipgen-Meiers aus Michelbouch, in : Bulletin Greg (Groupe de Recherches et d’Etudes sur la guerre 1940–1945) 1 (2000), S. 18–22. Dietz, Burkhard/Faust, Anselm/Rusinek, Bernd-A.: Einleitung, in : Lageberichte rheinischer Gestapostellen (Publikationen der Gesellschaft für rheinische Landeskunde, Bd. LXXXI), bearb. von Dietz, Burkhard/Faust, Anselm/Rusinek, Bernd-A., Bd.1 : 1934, Düsseldorf 2012, S. 1–32. Diewald-Kerkmann, Gisela : Denunziantentum und Gestapo, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 288–305. Diller, Ansgar : Deutschsprachige Rundfunksendungen aus der Sowjetunion. Reaktion in Deutschland (1933–1939), in : Rundfunk und Geschichte 30 (2004), H. 1/2, S. 5–14. Diller, Ansgar : Rundfunkpolitik im Dritten Reich, München 1980. Dirks, Christian : Selekteure als Lebensretter. Die Verteidigungsstrategie des Rechtsanwalts Dr. Hans Laternser, in : Gerichtstag halten über uns selbst. Geschichte und Wirkung des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses (Jahrbuch zur Geschichte und Wirkung des Holocaust 2001), hg. vom Fritz Bauer Institut, Frankfurt a. M. 2001, S. 163–192. Dix, Andreas : Der Westwall im Rahmen von Raumplanung und Strukturpolitik in der NSZeit, in : Fings, Karola/Möller, Frank (Hg.) : Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Überresten der NS-Anlage. Tagung in Bonn vom 3.–4. Mai 2007 (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bd. 20), Weilerswist 2008, S. 59–66. Dorfey, Beate : Art. „Torgau, Wilhelm“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 469–470. Dörner, Bernward : Gestapo und „Heimtücke“. Zur Praxis der Geheimen Staatspolizei bei der Verfolgung von Verstößen gegen das „Heimtücke-Gesetz“, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 325– 342. Dostert, Paul : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert aus luxemburgischer Sicht, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 60–68. Dostert, Paul : Die deutsche Besatzungspolitik in Luxemburg und die luxemburgische Resistenz, in : Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte 3 (1987), S. 375–392. Dostert, Paul : Luxemburg unter deutscher Besatzung 1940–1945. Ein Volk zwischen Kollaboration und Widerstand, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das Großherzogtum Luxemburg unter deutscher Besatzung. Fachtagung 10. Mai 2012 (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 10), Mainz 2013, S. 6–21. Dostert, Paul : Luxemburg zwischen Selbstbehauptung und nationaler Selbstaufgabe. Die
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
deutsche Besatzungspolitik und die Volksdeutsche Bewegung 1940–1945, Luxembourg 1985. Dreesen, Josef : Der Kreis Daun im Dritten Reich, Meckenheim 1990. Düwell, Kurt : Die Rheingebiete in der Judenpolitik des Nationalsozialismus vor 1942. Beitrag zu einer vergleichenden zeitgeschichtlichen Landeskunde, Bonn 1968. Düwell, Kurt : Trier und sein Umland in der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges, in : Düwell, Kurt/Matheus, Michael (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 97–106. Eberhard, Pascale : Der Überlebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region im Getto Litzmannstadt. Briefe Mai 1942/Lutte pour la survie des déportés juifs du Luxembourg et de la région de Trèves au ghetto de Litzmannstadt. Lettres de Mai 1942/The struggle for survival of the jews from Luxembourg and the Trier region deported to the Litzmannstadt Ghetto. Letters of May 1942, Saarbrücken 2012. Eberhard, Pascale/Weiter-Matysiak, Barbara : Die Deportation der Trierer und Luxemburger Juden ins Getto Litzmannstadt. Zum 70. Jahrestag am 16. Oktober 2011 wurde in der Basilika in Trier eine Ausstellung eröffnet, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg 2012, S. 178–185. Eckert, Rainer : Gestapo-Berichte. Abbildung der Realität oder reine Spekulation ?, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 200–215. Eichler, Volker : Die Frankfurter Gestapo-Kartei. Entstehung, Struktur, Funktion, Überlieferungsgeschichte und Quellenwert, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 178–199. „Ein besonderer Personenkreis“, in : FAZ-NET vom 17.3.2010, online unter : http://www. faz.net/aktuell/politik/inland/bnd-ein-besonderer-personenkreis-1927112.html (Letzter Zugriff : 27.02.2017). Ein Glücksfall für die Gestapo-Forschung. Eine Entdeckung im französischen Militärarchiv in Vincennes öffnet Trierer Historikern neue Horizonte, in : Unijournal 42 (2016), Heft 1, S. 24–25. Engel, Marcel/Hohengarten, André : Hinzert. Das SS-Sonderlager im Hunsrück 1939–1945, Luxemburg 1983. Engelking, Barbara : „Sehr geehrter Herr Gestapo.“ Denunziationen im deutsch besetzten Polen 1940/41, in : Mallmann, Klaus-Michael/Musial, Bogdan (Hg.) : Genesis des Genozids. Polen 1939–1941 (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 3), Darmstadt 2004, S. 206–220. Engwert, Andreas/Kill, Susanne (Hg.) : Sonderzüge in den Tod. Die Deportationen mit der Deutschen Reichsbahn. Eine Dokumentation der Deutschen Bahn AG, Köln u.a. 2009. Eschebach, Insa : „Verkehr mit Fremdvölkischen“. Die Gruppe der wegen „verbotenen Umgangs“ im KZ Ravensbrück inhaftierten Frauen, in : Dies. (Hg.) : Das Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück. Neue Beiträge zur Geschichte und Nachgeschichte (Forschungs-
331
332
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
beiträge und Materialien der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 12), Berlin 2014, S. 154–173. Falter, Jürgen W.: Die „Märzgefallenen“ von 1933. Neue Forschungsergebnisse zum sozialen Wandel innerhalb der NSDAP-Mitgliedschaft während der Machtergreifungsphase, in : Geschichte und Gesellschaft 24 (1998), H. 4, S. 595–616. Falter, Jürgen W.: Hitlers Wähler, München 1991. Faust, Anselm : Die Lageberichte rheinischen Gestapostellen 1934–1936, in : Geschichte im Westen 27 (2012), S. 125–139. Fellens, Josy : Aufruf zum Generalstreik, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 413–428. Feuchert, Sascha/Janssen-Mignon, Imke : Die Chronik des Gettos Litzmannstadt. 1941, Göttingen 2007. Form, Wolfgang/Schwarz, Ursula : Die Tagesrapporte der Gestapo-Leitstelle Wien, in : Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (Hg.) : Politische Verfolgung im Lichte von Biographien (Jahrbuch 2011), Wien 2011, S. 209–229. Fraenkel, Ernst : Der Doppelstaat, Frankfurt a.M. 1974. Franz, Gunther/Lücking, Hermann : 250 Jahre Trierer Zeitungen. Ausstellung der Stadtbibliothek Trier in Verbindung mit dem Trierischen Volksfreund. Begleitband und Katalog (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, Bd. 26), Trier 1995. Franz, Norbert : Die Zwangsrekrutierung für Wehrmacht und Reichsarbeitsdienst in Luxemburg – ein NS-spezifisches Unrecht ?, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das Großherzogtum Luxemburg unter deutscher Besatzung. Fachtagung, 10. Mai 2012 (Gedenkarbeit Rheinland-Pfalz, Bd. 10), Mainz/Hinzert 2013, S. 56–75. Franz, Viktoria : Die Nationalpolitische Erziehungsanstalt St. Wendel. Eine privilegierte oder eine instrumentalisierte Elite ? Masterarbeit Trier 2014. Frei, Norbert : Nach der Tat. Die Ahndung deutscher Kriegs- und NS-Verbrechen in Europa – Eine Bilanz, in : Ders. (Hg.) : Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006, S. 7–36. Frei, Norbert (Hg.) : Transnationale Vergangenheitspolitik. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006. Frei, Norbert : Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996. Freisler, Roland/Grau, Fritz/Krug, Karl/Rietzsch, Otto : Deutsches Strafrecht, Bd. I. Erläuterungen zu den seit dem 1.9.1939 ergangenen strafrechtlichen und strafverfahrensrechtlichen Vorschriften, Berlin 1941. Freund, Florian/Perz, Bertrand/Stuhlpfarrer, Karl : Das Getto in Litzmannstadt (Lodz), in : Hanno Loewy/Gerhard Schoenberner (Hg.), „Unser einziger Weg ist Arbeit“. „Unzer eyntsiger ṿeg iz arbeyṭ“ : das Getto in Łódź, 1940–1944, Wien 1990, S. 17–31. Friedländer, Saul : Das Dritte Reich und die Juden, Bd. 1 : Die Jahre der Verfolgung 1933– 1939, München 1998. Fritsche, Christiane : Ausgeplündert, zurückerstattet und entschädigt. Arisierung und Wiedergutmachung in Mannheim, Mannheim 2013.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Ganz-Ohlig, Heinz : Romika – „Eine jüdische Fabrik“. Die Schuhfabrik in Gusterath-Tal zur Zeit ihrer vorwiegend jüdischen Inhaber Hans Rollmann, Carl Michael und Karl Kaufmann ; sowie Rollmann und Mayer in Köln und die damit zusammenhängenden Firmen- und Familiengeschichten (Schriften des Emil-Frank-Instituts, Bd. 16), Trier 2012. Garbe, Detlef : Zwischen Widerstand und Martyrium. Die Zeugen Jehovas im „Dritten Reich“ (Studien zur Zeitgeschichte, Bd. 42), München 41999. Gebauer, Thomas : Das KPD-Dezernat der Gestapo Düsseldorf, Hamburg 2011. Geck, Stefan : Dulag Luft/Auswertestelle West. Vernehmungslager der Luftwaffe für westalliierte Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a.M. u.a. 2008. Gegen das Vergessen. Das Schicksal der Gerolsteiner Juden, Gerolstein ²2009 Gehl, Günter : Katholische Jugendliche im Dritten Reich in der katholischen Provinz. Grenzen der Gleichschaltung – drei Beispiele im Bistum Trier, Weimar 2008. Geigenmüller, Otto : Die politische Schutzhaft im nationalsozialistischen Deutschland, Würzburg ²1937. Gellately, Robert : Allwissend und allgegenwärtig ? Entstehung, Funktion und Wandel des Gestapo-Mythos, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 2003, S. 47–70. Gellately, Robert : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933–1945, Paderborn u.a. ²1994 (1993). Gellately, Robert : Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Zur Entstehungsgeschichte einer selbstüberwachenden Gesellschaft, in : Detlef Schmiechen-Ackermann (Hg.) : Anpassung, Verweigerung, Widerstand. Soziale Milieus, Politische Kultur und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus in Deutschland (Schriften der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Reihe A : Analysen und Darstellungen, Bd. 3), Berlin 1997, S. 109–122. Gellately, Robert : Hingeschaut und weggesehen. Hitler und sein Volk, Bonn 32005. Gellately, Robert : „In den Klauen der Gestapo.“ Die Bedeutung von Denunziationen für das nationalsozialistische Terrorsystem, in : Faust, Anselm (Hg.) : Verfolgung und Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933–1945, Köln 1992, S. 40–49. Genger, Angela/Steinert, Hannelore : Früher gültige Regeln griffen nicht mehr. Die ersten Monate der aus Düsseldorf Deportierten im Getto Litzmannstadt − Oktober 1941 bis April 1942, in : Angela Genger/Hildegard Jakobs (Hg.), Düsseldorf, Getto Litzmannstadt, 1941, Essen 2010, S. 87–117. Genschel, Helmut : Die Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Dritten Reich, Göttingen 1966. Gerstlauer, Matthias : Das SS-Sonderlager Hinzert im Organisations- und Machtgefüge der SS, Magisterarbeit Universität Trier 1996. Gobrecht, Horst : „Er arbeitete lieber vor Ort mit den Genossen“. Interview mit Maria und Willi Torgau, in : Ders.: Eh‘ die Sonne lacht. Hans Eiden, Kommunist und Lagerältester im KZ Buchenwald, Bonn 1995, S. 45–94. Goschler, Constantin/Wala, Michael : „Keine neue Gestapo“. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die NS-Vergangenheit, Hamburg 2015.
333
334
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Gottwaldt, Alfred Bernd/Schulle, Diana : Die Judendeportationen aus dem Deutschen Reich, 1941–1945. Eine kommentierte Chronologie, Wiesbaden 2005. Götz, Norbert : Gemeinschaft aus dem Gleichgewicht. Die Ausweitung von Dienstpflicht im Nationalsozialismus, Berlin 1997. Gouverneur, Johanna : Überwachung im Zeichen von Niederlage und Zusammenbruch. Die V-Leute der Gestapo Trier 1943–1945, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2012. Graf, Christof : Kontinuitäten und Brüche. Von der Politischen Polizei der Weimarer Republik zur Geheimen Staatspolizei, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo. Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 73–83. Graf, Christoph : Politische Polizei zwischen Demokratie und Diktatur. Die Entwicklung der Preussischen Politischen Polizei vom Staatsschutzorgan der Weimarer Republik zum Geheimen Staatspolizeiamt des Dritten Reiches (Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 36), Berlin 1983. Grotum, Thomas : Die Ermittlungsakten der Geheimen Staatspolizeistelle Neustadt a.d.W. Ein außergewöhnlicher Quellenbestand im Landesarchiv Speyer, in : Rummel, Walter (Hg.) : 200 Jahre Landesarchiv Speyer. Erinnerungsort pfälzischer, rheinhessischer und deutscher Geschichte, 1817–2017 (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 122), Koblenz 2017, S. 111–114. Grotum, Thomas (Hg.) : Die Gestapo Trier in der Christophstraße 1 – Eine Ausstellung, Trier 2014. Grotum, Thomas/Haase, Lena : Die Trierer Gestapo in der Christophstraße 1, in : Unsere Archive. Mitteilungen aus den rheinland-pfälzischen und saarländischen Archiven 60 (2015), S. 43–44. Grotum, Thomas/Haase, Lena/Stähle, Ksenia : Une ville frontière à l’heure de la Gestapo, in : Historia, Numéro Spécial Janvier/Février 2017, S. 58–61. Gruchmann, Lothar : Justiz im Dritten Reich 1933–1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Bd. 28), München 3 2001. Gruchmann, Lothar : „Nacht- und Nebel“-Justiz. Die Mitwirkung deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den besetzten westeuropäischen Ländern 1942– 1944, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 29 (1981), H. 3, S. 342–396. Grundmann, Siegfried : Die V-Leute des Gestapo-Kommissars Sattler, Berlin 2010. Gumkowski, Janusz/Rutkowski, Adam/Astel, Arnfrid : Briefe aus Litzmannstadt, Köln 1967. Haase, Lena : Verurteilt um zu Verschwinden. „Nacht-und-Nebel“-Häftlinge in der Großregion Trier (1942–1944), in : Kurtrierisches Jahrbuch 56 (2016), S. 289–320. Hachtmann, Rüdiger : Elastisch, dynamisch und von katastrophaler Effizienz. Zur Struktur der Neuen Staatlichkeit des Nationalsozialismus, in : Reichardt, Sven/Seibel, Wolfgang (Hg.) : Der prekäre Staat. Herrschen und Verwalten im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M./New York 2011, S. 29–74. Hamann, Matthias : Erwünscht und unerwünscht. Die rassenpsychologische Selektion der Ausländer, in : Aly, Götz u.a. (Hg.) : Herrenmensch und Arbeitsvölker. Ausländische Arbeiter und Deutsche 1939–1945 (Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik, Bd. 3), Berlin ²1989, S. 143–180.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Heiderscheid, André : Nie wieder ! Bd. 2 : Als Pilger in Hinzert, Natzweiler-Struthof, Dachau, Luxemburg 2007. Heinemann, Isabel : Ambivalente Sozialingenieure ? Die Rasseexperten des SS, in : Hirschfeld, Gerhard/Jersak, Tobias (Hg.) : Karrieren im Nationalsozialismus. Funktionseliten zwischen Mitwirkung und Distanz, Frankfurt a.M. 2004, S. 73–95. Heinemann, Isabel : „Rasse, Siedlung, deutsches Blut“. Das Rasse- und Siedlungshauptamt der SS und die rassenpolitische Neuordnung Europas (Moderne Zeit. Neue Forschungen zur Gesellschafts- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2), Göttingen 2003. Heinemann, Isabel : „Wiedereindeutschungsfähig“ oder „unerwünschter Bevölkerungszuwachs“ ? Die Bedeutung der „Rassenauslese“ in der NS-Umsiedlungspolitik, in : Diehl, Paula (Hg.) : Körper im Nationalsozialismus. Bilder und Praxen, München 2006, S. 267–280. Heinen, Nicolas : Zeugnisse aus grosser Zeit. Aus dem heimatlichen, marianischen Schrifttum, Luxemburg, 1978. Heinz, Joachim : Sozialdemokratie und Kommunisten 1933 bis 1945 im Saarland. Ein Überblick, in : Herrmann, Hans-Christian (Hg.) : Widerstand, Repression und Verfolgung. Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus an der Saar (Geschichte, Politik und Gesellschaft, Bd. 14), St. Ingbert 2014, S. 185–211. Henning, Joachim : Art. „Drach, Leonhard“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 87–88. Henning, Joachim : Art. „Hartmann, Fritz“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 157–158. Henning, Joachim : Art. „Raderschall, Adolf“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 351–352. Hensle, Michael P.: Denunziantentum und Diktatur. Denunziation als Mittel der Machtausübung und Konfliktaustragung im nationalsozialistischen Deutschland, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 51 (2003), H. 2, S. 144–161. Hensle, Michael P.: Nichts hören und nichts reden : Die Verfolgung von „Rundfunkverbrechern“ und „Heimtücke-Rednern“ durch NS-Justiz und Geheime Staatspolizei, in : Quack, Sibylle (Hg.) : Dimensionen der Verfolgung. Opfer und Opfergruppen im Nationalsozialismus (Schriftenreihe der Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Europas, Bd. 2), München 2003, S. 81–120. Hensle, Michael P.: Rundfunkverbrechen. Das Hören von „Feindsendern“ im Nationalsozialismus, Berlin 2003. Hensle, Michael P.: „Rundfunkverbrechen“ vor NS-Sondergerichten, in : Rundfunk und Geschichte 26 (2000), H. 3/4, S. 111–126. Herbert, Ulrich : Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 1903–1989, Bonn 1996.
335
336
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Herbert, Ulrich : Geschichte der Ausländerbeschäftigung in Deutschland 1880–1980. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Berlin u.a. 1986. Herlemann, Beatrix : Kommunistischer Widerstand, in : Benz, Wolfgang/Pehle, Walter H. (Hg.) : Lexikon des deutschen Widerstandes, Frankfurt am Main 1994, S. 29–41. Herlemann, Beatrix : Der Bauer klebt am Hergebrachten. Bäuerliche Verhaltensweisen unterm Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Niedersachsen (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Reihe XXXIX : Niedersachen 1933–1945, Bd. 4), Hannover 1993. Heuer, Hans-Joachim : Geheime Staatspolizei. Über das Töten und die Tendenzen der Entzivilisierung, Berlin u.a. 1995. Heuft, Sebastian : Die Trierer Gestapo als Presselenkungsorgan der Nationalsozialisten, in : Neues Trierisches Jahrbuch 53 (2013), S. 69–82. Heumüller, Maximilian : Politische Gegner im Visier der Gestapo. Überwachung und Verfolgung der Kommunisten in Trier im Spiegel der Lageberichterstattung 1934–1936, Masterarbeit Universität Trier 2015. Heydrich, Reinhard : Der Volksmeldedienst. Die Mobilmachung gegen Verrat und Denunziation, in : Der Schulungsbrief VI (1939), 9. Folge, S. 338–339. Heyen, Franz-Josef : Hinzert. Ort des Leidens und der Schmach, Gedenkstätte des Freien Luxemburg, in : Hémecht. Zeitschrift für Luxemburger Geschichte 35 (1983), S. 133– 157. Heyen, Franz Josef : Nationalsozialismus im Alltag. Quellen zur Geschichte des Nationalsozialismus vornehmlich im Raum Mainz, Koblenz, Trier (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 9), Boppard am Rhein 1967. Hilberg, Raul : Die Vernichtung der europäischen Juden, 3 Bde., Frankfurt a.M. 1982. Hockerts, Hans Günter : Die Sittlichkeitsprozesse gegen katholische Ordensangehörige und Priester 1936/37. Eine Studie zur nationalsozialistischen Herrschaftstechnik und zum Kirchenkampf (Veröffentlichungen der Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B : Forschungen, Bd. 6), Mainz 1971. Hohengarten, André : Die Luxemburger Zwangsrekrutierten, in : Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg (Hg.) : …et wor alles net esou einfach. Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale/Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Contributions historiques accompagnant l’exposition/Ein Lesebuch zur Ausstellung, Luxembourg 2002, S. 244–257. Hohengarten, André : Die nationalsozialistische Judenpolitik in Luxemburg, Luxemburg 2002. Hohengarten, André : Vom Halbmond zum Ziegenkopf. Die Geschichte der Luxemburger Häftlinge in Lublin 1942–1945, Luxemburg 1991. Höhne, Heinz : Canaris. Patriot im Zwielicht, München 1976. Hommens, Maximilian : Die Orden und Ordensähnlichen Gemeinschaften, in : Persch, Martin/Schneider, Bernhard (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier, Band 5 : Beharrung und Erneuerung 1881–1981, S. 216–236. Hördler, Stefan u.a. (Hg.) : Zwangsarbeit im Nationalsozialismus. Begleitband zur Aus-
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
stellung „Zwangsarbeit. Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg“, Göttingen 2016. Jacobs, Jacques : Existenz und Untergang der alten Judengemeinde Triers, Trier 1984. Jander, Martin : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkorte, Bd. 3), Berlin 2008. Jaud, Ralph J.: Der Landkreis Aachen in der NS-Zeit. Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in einem katholischen Grenzgebiet 1929–1944, Frankfurt a.M. u.a. 1997. Jochmann, Justus : Abwehr. Die Abteilung III der Staatspolizeistelle Trier, Magisterarbeit Universität Trier 2016. John, Jürgen/Möller, Horst/Schaarschmidt, Thomas : Die NS-Gaue. Regionale Mittelin stanzen im zentralistischen „Führerstaat“ (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Sondernummer), München 2007. Justizministerium Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. NS-Sondergerichtsverfahren in Rheinland-Pfalz. Eine Dokumentation (Schriftenreihe des Ministeriums für Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 1), Teil 1–3, Frankfurt a.M. 1994. Kalmbach, Peter Lutz : Polizeiliche Ermittlungsorgane der Wehrmachtjustiz, in : Kriminalistik. Unabhängige Zeitschrift für kriminalistische Wissenschaft und Praxis 67 (2013), H. 2, S. 118–122. Kershaw, Ian : Der NS-Staat. Geschichtsinterpretationen und Kontroversen im Überblick, Hamburg 32002. Kershaw, Ian : Hitler 1889–1945, München 2009. Kißener, Michael : Von punktuellen Dissonanzen, Schwarzschlächtern und aktivem Umsturz. Der Widerstandsbegriff im Wandel der Zeit, in : Kleine, Nils/Studt, Christoph (Hg.) : „Das Vermächtnis ist noch in Wirksamkeit, die Verpflichtung noch nicht eingelöst.“ Der Widerstand gegen das „Dritte Reich“ in Öffentlichkeit und Forschung seit 1945 (Schriftenreihe der Forschungsgemeinschaft 20. Juli 1944 e.V., Bd. 19), Augsburg 2016, S. 29–40. Klasen, Katharina : Allgegenwärtig ? Die Geheime Staatspolizei und das SS-Sonderlager/KZ Hinzert (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 13), Mainz/Hinzert 2015. Klee, Ernst : Art. „Welsch, Heinrich“, in : Ders.: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945, Frankfurt a.M. 2005, S. 667. Klein, Paul : Von der Mehrheit zur Minderheit. Deutsche in der französischen Fremdenlegion, in : Kümmel, Gerhard (Hg.) : Die Truppe wird bunter : Streitkräfte und Minderheiten (Militär und Sozialwissenschaften, Bd. 47), Baden-Baden 2012, S. 73–82. Klein, Peter : Die Gettoverwaltung Litzmannstadt 1940 bis 1944. Eine Dienststelle im Spannungsfeld von Kommunalbürokratie und staatlicher Verfolgungspolitik, Hamburg 2009. Klein, Peter : Kulmhof/Chelmno, in : Wolfgang Benz/Barbara Distel (Hg.), Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, Band 8, München 2008, S. 301–328. Klönne, Arno : Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner, München 1995. Klopp, Eberhard (Hg.) : Geschichte der Trierer Arbeiterbewegung. Ein deutsches Beispiel, Bd. 3 : Kurzbiographien, Trier 1979. Klopp, Eberhard : Hinzert – kein richtiges KZ ? Ein Beispiel unter 2000, Trier 1983.
337
338
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Kloppenburg, Gwendolyn : Gezeichnet vom NS-Regime. Biographische Studien zu Trierer Kommunisten der Zwischenkriegszeit, Staatsexamensarbeit Universität Trier 2014. Knoch, Habbo : Gemeinschaften im Nationalsozialismus vor Ort, in : Reeken, Dietmar von/Thießen, Malte (Hg.) : „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort (Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Studien zu Kon struktion, gesellschaftlicher Wirkungsmacht und Erinnerung, Bd. 4), Paderborn u.a. 2013, S. 37–50. Kochavi, Arieh J.: Britain and the Establishment of the United Nations War Crimes Commission, in : English Historical Review 107 (1992), No. 423, S. 323–349. Koerfer, Benjamin : Die Deportation der Juden aus Trier und Umgebung ins Getto in Litzmannstadt. Eine quantitative Analyse der Opfergruppen und Einordnung in den Prozess der Vernichtung der europäischen Juden, Saarbrücken 2016 (Masterarbeit Universität Trier 2014). Koerfer, Benjamin : Neue Erkenntnisse über das Schicksal von Juden aus der Region Trier im Getto Litzmannstadt, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg (2015), S. 179–191. Koller, Christian : Die Fremdenlegion. Kolonialismus, Söldnertum, Gewalt 1831–1962, Paderborn 2013. Koltz, Jean-Pierre : Die geschichtlichen Verbindungen zwischen Luxemburg und Trier. Teil 3, in : Jahrbuch Kreis Trier-Saarburg (1983), S. 340–367. Körtels, Willi : Antisemitische Übergriffe in der Region Trier vor 1933, Konz 2011, online unter : www.mahnmal-trier.de/uebergriffe_1933.pdf (Letzter Zugriff : 13.7.2017). Körtels, Willi : Die jüdische Schule in der Region Trier, Konz 2011, online unter http:// www.mahnmal-trier.de/juedschul.pdf (Letzter Zugriff : 13.7.2017). Körtels, Willi : Elise Haas. Eine Lyrikerin aus Trier, Konz 2011. Krakowski, Shmuel : Chelmno, in : Israel Gutman (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, 3 Bde., Berlin 1993, Bd. 1, S. 280– 283. Krakowski, Shmuel : Das Todeslager Chełmno/Kulmhof. Der Beginn der „Endlösung“. Göttingen 2007. Kranig, Andreas : Lockung und Zwang. Zur Arbeitsverfassung im Dritten Reich, Stuttgart 1983. Kraus, Stefan : Stätten nationalsozialistischer Zwangsherrschaft (Geschichtlicher Atlas der Rheinlande, Beiheft 5,13), Bonn 2007. Krieger, Christof : „Wein ist Volksgetränk !“ Weinpropaganda im Dritten Reich am Beispiel des Anbaugebietes Mosel-Saar-Ruwer, Diss. Trier 2015. Krier, Emile : Luxemburg am Ende der Besatzungszeit und der Neuanfang, in : Kurt Düwell/ Michael Matheus (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 69– 95. Kühne, Thomas : Dämonisierung, Viktimisierung, Diversifizierung. Bilder von nationalsozialistischen Gewalttätern in Gesellschaft und Forschung seit 1945, in : Wrochem, Oliver von (Hg.) : Nationalsozialistische Täterschaften. Neue Forschungen und aktuelle Diskus-
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
sionen zur familiären, kulturellen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung nach 1945 (Neuengammer Kolloquien, Bd. 6), Berlin 2016, S. 32–55. Küppers, Heinrich : Herausforderungen und Bedrohungen im Zeichen des Hakenkreuzes, in : Persch, Martin/Schneider, Bernhard (Hg.) : Geschichte des Bistums Trier, Bd. V : Beharrung und Erneuerung, 1881–1981 (Veröffentlichungen des Bistumsarchivs Trier, Bd. 39), Trier 2004, S. 627–670. Laak, Dirk van : Die Mitwirkenden bei der „Arisierung“. Dargestellt am Beispiel der rheinisch-westfälischen Industrieregionen 1933–1940, in : Büttner, Ursula (Hg.) : Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich, Hamburg 1992, S. 231–257. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Blätter zum Land. Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Osthofen 2005. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Verfolgung und Widerstand in Rheinland-Pfalz 1933–1945. Bd. 2 : Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Ausstellungskatalog, Mainz 2009. Laufner, Richard : Geschichte der jüdischen Gemeinde Triers, in : Juden in Trier. Katalog einer Ausstellung von Stadtarchiv und Stadtbibliothek Trier, März – November 1988, bearb. von Horst Mühleisen, Bernhard Simon und Reiner Nolden (Ausstellungskataloge Trierer Bibliotheken, Nr. 15), Trier 1988, S. 11–28. Laufner, Richard : Unter dem Schicksal der Verfolgung und Vertreibung, in : Queck, Walter (Hg.) : Presse und Informationsamt der Stadt Trier : Dr. Adolf Altmann zum Gedenken, Trier 1979, S. 13–22. Lederle, Julia : Gestapo-Personenakten, in : Heckl, Jens (Hg.) : Unbekannte Quellen. „Massenakten“ des 20. Jahrhunderts. Untersuchungen seriellen Schriftguts aus normierten Verwaltungsverfahren, Bd. 2 (Veröffentlichungen des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen, Bd. 43), Düsseldorf 2012, S. 85–96. Leniger, Markus : Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit“ und Umsiedlungspolitik 1933– 1945. Von der Minderheitenbetreuung zur Siedlerauslese, Berlin 2006. Lepsius, M. Rainer : Parteiensystem und Sozialstruktur. Zum Problem der Demokratisierung der deutschen Gesellschaft, in : Abel, Wilhelm u.a. (Hg.) : Wirtschaft, Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift zum 65. Geburtstag von Friedrich Lütge, Stuttgart 1966, S. 371–393. Longerich, Peter : „Davon haben wir nichts gewusst !“ Die Deutschen und die Judenverfolgung 1933–1945, München 2006. Longerich, Peter : Der Beginn des Holocaust in den eingegliederten polnischen Gebieten. Überlegungen und Tendenzen der neueren Forschung, in : Jacek Andrzej Młynarczyk/Jochen Böhler (Hg.), Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten. 1939– 1945 (Einzelveröffentlichungen des DHI Warschau, Bd. 21), Osnabrück 2010, S. 15–25. Longerich, Peter : Die Ermordung der europäischen Juden. Eine umfassende Dokumentation des Holocaust 1941–1945, München 1989. Longerich, Peter : Heinrich Himmler. Biographie, München 32008. Longerich, Peter : Ungeschriebener Befehl. Hitler und der Weg zur „Endlösung“, München 2001. Loose, Ingo : Das Getto Litzmannstadt 1940–1944, in : Pascale Eberhard (Hg.) : Der Über-
339
340
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
lebenskampf jüdischer Deportierter aus Luxemburg und der Trierer Region im Getto Litzmannstadt. Briefe Mai 1942, Saarbrücken 2012, S. 12–20. Lotfi, Gabriele : KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich, Frankfurt a.M. 2003. Lotfi, Gabriele : SS-Sonderlager im nationalsozialistischen Terrorsystem. Die Entstehung von Hinzert, Stutthof und Soldau, in : Frei, Norbert/Steinbacher, Sybille/Wagner Bernd C. (Hg.) : Ausbeutung, Vernichtung, Öffentlichkeit. Neue Studien zur nationalsozialistischen Lagerpolitik (Darstellungen und Quellen zur Geschichte von Auschwitz, Bd. 4), München 2000, S. 209–229. Lotz, Wolfgang/Ueberschär, Gerd R.: Die Deutsche Reichspost 1933–1945. Eine politische Verwaltungsgeschichte, 2 Bde., Berlin 1999. Löw, Andrea : Das Getto Litzmannstadt. Eine historische Einführung, in : Sascha Feuchert/ Erwin Leibfried/Jörg Riecke (Hg.), Die Chronik des Gettos Lodz/Litzmannstadt. Supplemente und Anhang, Göttingen 2007, S. 145–165. Löw, Andrea : Juden im Getto Litzmannstadt. Lebensbedingungen, Selbstwahrnehmung, Verhalten, Göttingen 2006. Lüdtke, Alf : Einleitung : Herrschaft als soziale Praxis, in : Ders. (Hg.) : Herrschaft als soziale Praxis. Historische und sozial-anthropologische Studien (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 91), Göttingen 1991, S. 9–63. Maier, Franz : Biographisches Organisationshandbuch der NSDAP und ihrer Gliederungen im Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 2007. Maier, Franz : Strafvollzug im Gebiet des nördlichen Teiles von Rheinland-Pfalz im Dritten Reich, in : Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 3), Frankfurt am Main 1995, S. 851–945. Majer, Diemut : Das Verhältnis von Staatsanwaltschaft und Polizei im Nationalsozialismus, in : Reifner, Udo/Sonnen, Bernd-Rüdiger (Hg.) : Strafjustiz und Polizei im Dritten Reich (Demokratie und Rechtsstaat), Frankfurt a.M./New York 1984, S. 121–160. Mallmann, Klaus-Michael : Die V-Leute der Gestapo. Umrisse einer kollektiven Biographie, in : Paul, Gerhard/Mallmann, Klaus-Michael (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 268–287. Mallmann, Klaus-Michael/Angrick, Andrej (Hg.) : Die Gestapo nach 1945. Karrieren, Konflikte, Konstruktionen (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart, Bd. 14), Darmstadt 2009. Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard : Allwissend, allmächtig, allgegenwärtig ? Gestapo, Gesellschaft und Widerstand, in : Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 41 (1993), S. 984–999. Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard : Das zersplitterte Nein. Saarländer gegen Hitler (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 1), Bonn 1989. Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ und besetztes Europa, Darmstadt 2000.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995. Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard : Herrschaft und Alltag. Ein Industrierevier im Dritten Reich (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 2), Bonn 1991. Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard : Milieus und Widerstand. Eine Verhaltensgeschichte der Gesellschaft im Nationalsozialismus (Widerstand und Verweigerung im Saarland 1935–1945, Bd. 3), Bonn 1995. Mang, Thomas : „Er brachte sehr gute und schöne Nachrichten.“ Leutgebs V-Leute der Gestapo. Das Verhörprotokoll, Belgrad 1947/48, in : Jahrbuch/Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (2014), S. 165–193. Mann, Reinhard : Protest und Kontrolle im Dritten Reich. Nationalsozialistische Herrschaft im Alltag einer rheinischen Großstadt (Studien zur historischen Sozialwissenschaft, Bd. 6), Frankfurt a.M./New York 1987. Martinière, Joseph de La : Meine Erinnerung als NN-Deportierter, Mainz 2005. Marxen, Klaus : Einführung, in : Justizministerium Nordrhein-Westfalen (Hg.) : Terror und „Normalität“. Urteile des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs 1934–1945. Eine Dokumentation (Juristische Zeitgeschichte, Bd. 13), Düsseldorf 2004, S. 1–8. Mausbach-Bromberger, Barbara : Der Widerstand der Arbeiterbewegung gegen den Faschismus in Frankfurt am Main 1933–1945, Diss. Marburg 1976. May, Ernst R.: Die Nachrichtendienste und die Niederlage Frankreichs 1940, in : Krieger, Wolfgang (Hg.) : Geheimdienste in der Weltgeschichte. Spionage und verdeckte Aktionen von der Antike bis zur Gegenwart, München 2003, S. 170–181. Melchers, Emile : Kriegsschauplatz Luxemburg August 1914/Mai 1940, Luxemburg 1963. Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg N° 38 vom 11. August 1947, online unter : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1947/08/08/n1/jo (Letzter Zugriff : 22.4.2017). Mensing, Wilhelm : Bekämpft, gesucht, benutzt. Zur Geschichte der Gestapo V-Leute und „Gestapo-Agenten“, in : Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat 17 (2005), S. 111–135. Mensing, Wilhelm : Vertrauensleute kommunistischer Herkunft bei der Gestapo und NS-Nachrichtendiensten am Beispiel von Rhein und Ruhr, in : Jahrbuch für historische Kommunismusforschung (2004), S. 111–130. Michels, Eckhard : Deutsche in der Fremdenlegion 1870–1965. Mythen und Realitäten, Paderborn u.a. 1999. Mick, Günter : Politische Wahlen und Volksentscheide in der Stadt Trier zur Zeit der Weimarer Republik, Diss. Bonn 1969. Möhler, Rainer : Politische Säuberung im Südwesten unter französischer Besatzung, in : Düwell, Kurt/Matheus, Michael (Hg.) : Kriegsende und Neubeginn. Westdeutschland und Luxemburg zwischen 1944 und 1947 (Geschichtliche Landeskunde. Veröffentlichungen des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz, Bd. 46), Stuttgart 1997, S. 175–191. Moisel, Claudia : Frankreich und die deutschen Kriegsverbrecher. Politik und Praxis der
341
342
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Strafverfolgung nach dem Zweiten Weltkrieg (Beiträge zur Geschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 2), Göttingen 2004. Möller, Frank/Fings, Karola (Hg.) : Zukunftsprojekt Westwall. Wege zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit den Überresten der NS-Anlage (Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland, Bd. 20), Weilerswist 2008. Möller, Horst u.a. (Hg.) : Nationalsozialismus in der Region. Beiträge zur regionalen und lokalen Forschung und zum internationalen Vergleich, München 1996. Morsch, Günter/Ohm, Agnes (Hg.) : Die Zentrale des KZ-Terrors. Die Inspektion der Konzentrationslager 1934–1945. Eine Ausstellung am historischen Ort (Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Bd. 47), Berlin 2015. Morsch, Günter : Verschwiegen, vergessen, unterschätzt ? Die Inspektion der Konzentrationslager – Verwaltungszentrale des KZ-Systems, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Verwaltungszentralen des KZ-Systems (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Mainz/Hinzert 2012, S. 6–35. Muggenthaler, Thomas : Verbrechen Liebe. Von polnischen Männern und deutschen Frauen. Hinrichtungen und Verfolgung in Niederbayern und der Oberpfalz während der NSZeit, Viechtach 2010. Müller, Klaus-Jürgen : Das Heer und Hitler. Armee und nationalsozialistisches Regime 1933–1944 (Beiträge zur Militär- und Kriegsgeschichte, Bd. 10), Stuttgart 21988. Müller, Rudolf : Trier in der Weimarer Republik (1918–1933), in : Düwell, Kurt/Irsigler, Franz (Hg.) : Trier in der Neuzeit (2000 Jahre Trier, Bd. 3), Trier 1988, S. 495–516. Müllner, Christian : Schwarzhörer und Denunzianten. Vergehen nach §§ 1 und 2 der Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vor dem Sondergericht Wien, Diss. Universität Wien 2011. Münkel, Daniela : Das Reichserbhofgesetz in der Praxis, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 44 (1996), H. 4, S. 549–580. Münkel, Daniela : Nationalsozialistische Agrarpolitik und Bauernalltag, Frankfurt a.M./ New York 1996. Musée national de la Résistance (Hg.) : Gestapo-Terror in Luxemburg. Verwaltung, Überwachung, Unterdrückung – La terreur de la Gestapo au Luxembourg. Administration, surveillance, répression, Luxembourg 2015. Neumaier, Dorothee : Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement im Dritten Reich, in : Journal of New Frontiers in Spatial Concepts 5 (2013), S. 49–67. Niermann, Hans-Eckhard : Die Durchsetzung politischer und politisierter Strafjustiz im Dritten Reich. Ihre Entwicklung aufgezeigt am Beispiel des OLG-Bezirks Hamm (Juristische Zeitgeschichte NRW, Bd. 3), Düsseldorf 1995. Nietzel, Benno : Die Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der deutschen Juden 1933– 1945. Ein Literatur- und Forschungsbericht, in : Archiv für Sozialgeschichte 49 (2009), S. 561–613. Nietzel, Benno : Sichtbarkeit/Unsichtbarkeit. Die Konstruktion „jüdischer Unternehmen“ und die Öffentlichkeit der Judenverfolgung in Frankfurt am Main 1933–1939, in : Frit-
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
sche, Christiane/Paulmann, Johannes (Hg.) : „Arisierung“ und „Wiedergutmachung“ in deutschen Städten, Köln 2014, S. 65–88. Nieuwenhuizen, Jana : Die Massenhinrichtungen von 20 Streikteilnehmern (1942) und 23 Widerstandskämpfern (1944) aus Luxemburg in der Nähe des SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Masterarbeit Universität Trier 2015. Nowack, Sabrina : Sicherheitsrisiko NS-Belastung. Personalüberprüfungen im Bundesnachrichtendienst in den 1960er Jahren (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 4), Berlin 2016. NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln (Hg.) : August Sanders unbeugsamer Sohn. Erich Sander als Häftling und Gefängnisfotograf im Zuchthaus Siegburg 1935–1944 (Veröffentlichungen des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, Bd. 1), Berlin 2015. Oehler, Christiane : Die Rechtsprechung des Sondergerichts Mannheim 1933–1945 (Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen, N.F., Bd. 25), Berlin 1997. Orth, Karin : Das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische Organisationsgeschichte, Hamburg 1999. Pahl, Magnus : Fremde Heere Ost. Hitlers militärische Feindaufklärung, Berlin 2013. Paul, Gerhard : „Diese Erschießungen haben mich innerlich gar nicht mehr berührt.“ Die Kriegsendphasenverbrechen der Gestapo 1944/45, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‚Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 543–568. Paul, Gerhard : Die Gestapo, in : Dierl, Florian (Hg.) : Ordnung und Vernichtung. Die Polizei im NS-Staat. Eine Ausstellung der deutschen Hochschule der Polizei und des Deutschen Historischen Museums, Dresden 2011, S. 54–65. Paul, Gerhard/Primavesi, Alexander : Die Verfolgung der ‚Fremdvölkischen‘. Das Beispiel der Staatspolizeistelle Dortmund, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 388–401. Paul, Gerhard : „Kämpfende Verwaltung“. Das Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes als Führungsinstanz der Gestapo, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ‚Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 42–81. Paul, Gerhard : Staatlicher Terror und gesellschaftliche Verrohung. Die Gestapo in Schleswig-Holstein (IZRG-Schriftenreihe, Bd. 1), Hamburg 1996. Pauly, Michael : Geschichte Luxemburgs, München 2011. Pendaries, Yveline : Les process de Rastatt (1946–1954). Le jugement des crimes de guerre en zone française d’occupation en Allemagne, Bern u.a. 1995. Peukert, Detlef : Volksgenossen und Gemeinschaftsfremde. Anpassung, Ausmerze und Aufbegehren unter dem Nationalsozialismus, Köln 1982. Pfanzelter, Eva : Homosexuelle und Prostituierte, in : Steininger, Rolf (Hg.) : Vergessene Opfer des Nationalsozialismus, Innsbruck 2000, S. 75–97. Plum, Günter : Staatspolizei und Innere Verwaltung 1934–1936, in : Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 13 (1965), S. 191–224. Pohl, Dieter : Verfolgung und Massenmord in der NS-Zeit 1933–1945, Darmstadt 32011.
343
344
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Porträt „Willi Torgau“, in : Zuche, Thomas (Hg.) : StattFührer, Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 154–156. Pöschl, Gabriele : (K)ein Applaus für die österreichische Justiz, in : Heimo Halbrainer/Claudia Kuretsidis-Haider (Hg.) : Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen und die europäische Strafjustiz von Nürnberg bis Den Haag (Veröffentlichungen der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz, Bd. 1), Graz 2007, S. 297–301. Posing, Léon : Erlebnisbericht von Posing Léon aus Ettelbrück, in : Bulletin Greg (Groupe de Recherches et d’Etudes sur la guerre 1940–1945) 1 (2008), S. 2–9. Profanter, Marc : Die nationalsozialistische Machtergreifung im Spiegel der Trierer Tagespresse. Ein Beitrag zur Geschichte der Trierer Zeitungen (März 1930 bis Oktober 1933), Magisterarbeit Universität Trier 2000. Pütz, Albert : Angehörige der ehemaligen Lager-SS, Gestapo und NS-Justiz vor Gericht. Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 8), Frankfurt am Main 2001. Pütz, Albert : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert 1940–1945. Das Anklageverfahren gegen Paul Sporrenberg (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 6), Frankfurt a.M. u.a. 1998. Radziszewska, Krystyna : Deutschsprachige Juden im Getto Lodz/Litzmannstadt 1941– 1944, in : Stefan Dyroff/Krystyna Radziszewska/Isabel Röskau-Rydel (Hg.), Lodz jenseits von „Fabriken, Wildwest und Provinz“. Kulturwissenschaftliche Studien über die Deutschen in und aus den polnischen Gebieten (Polonio-Germanica, Bd. 4), München 2009, S. 129–150. Raphael, Lutz/Uerlings, Herbert (Hg.) : Zwischen Ausschluss und Solidarität. Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike (Inklusion, Exklusion. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 6), Frankfurt a.M. u.a. 2008. Rappl, Martin : „Unter der Flagge der Arisierung… um einen Schundpreis zu erraffen“. Zur Präzisierung eines problematischen Begriffs, in : Baumann, Angelika (Hg.) : München arisiert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, München 2004, S. 17–30. Rass, Christoph : Das Sozialprofil des Bundesnachrichtendienstes. Von den Anfängen bis 1968 (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 1), Berlin 2016. Raths, Aloyse : Die Opfer des 25. Februar 1944, in : Rappel 34 (1979), H. 1/2, S. 3–6. Reeken, Dietmar von/Thießen, Malte (Hg.) : „Volksgemeinschaft“ als soziale Praxis. Neue Forschungen zur NS-Gesellschaft vor Ort (Nationalsozialistische Volksgemeinschaft. Studien zu Konstruktion, gesellschaftlicher Wirkungsmacht und Erinnerung, Bd. 4), Paderborn u.a. 2013. Reibel, Carl-W.: Das Fundament der Diktatur : die NSDAP-Ortsgruppen 1932–1945, Paderborn u.a. 2002. Reichsbahndirektion Trier : Zur Erinnerung an die Einweihung des neuen Geschäftsgebäudes der Reichsbahndirektion Trier am 1. Oktober 1925, Trier 1925.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Reile, Oskar : Der Deutsche Geheimdienst im II. Weltkrieg. Westfront. Der Kampf der Abwehr im westlichen Operationsgebiet, in England und Nordafrika, Augsburg 1990. Reuband, Karl-Heinz : „Schwarzhören“ im Dritten Reich, in : Archiv für Sozialgeschichte 41 (2001), S. 245–270. Richarz, Monika/Rürup, Reinhard (Hg.) : Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, Tübingen 1997. Richarz, Monika : Ländliches Judentum als Problem der Forschung, in : Dies./Rürup, Reinhard (Hg.) : Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte, Tübingen 1997, S. 1–8. Ridder, Manuel de : Der Streik 1942 in Differdingen, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 429–434. Rönz, Helmut/Gestier, Markus (Hg.) : „Herr Hitler, ihre Zeit ist um !“. Widerstand an der Saar 1935–1945, St. Ingbert 2016. Rosenbaum, Adalbert : Das Frauenstraflager Flußbach, in : Minsterium der Justiz Rheinland-Pfalz (Hg.) : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 2 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz Rheinland-Pfalz, Bd. 3), Frankfurt am Main 1995, S. 946–969. Rosenbaum, Adalbert : Das Frauenstraflager Flußbach, in : Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 27 (2001), S. 415–461. Roth, Thomas : Die Gestapo Köln – Ansätze weiterer Forschung. Überlegungen zu einem Projekt des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln, in : Geschichte in Köln 63 (2016), S. 245–258. Ruckenbiel, Jan : Soziale Kontrolle im NS-Regime. Protest, Denunziation und Verfolgung. Zur Praxis alltäglicher Unterdrückung im Wechselspiel von Bevölkerung und Gestapo, Köln 2003 (Diss. Siegen 2001), Online unter : http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/ opus/volltexte/2005/51/pdf/ruckenbiel.pdf (Letzter Zugriff : 19.7.2017). Rummel, Walter/Rath, Jochen : „Dem Reich verfallen“ – „den Berechtigten zurückzuerstatten“. Enteignung und Rückerstattung jüdischen Vermögens im Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz 1938–1953, Koblenz 2001. Rusinek, Bernd-A.: Gesellschaft in der Katastrophe. Terror, Illegalität, Widerstand – Köln 1944/45 (Düsseldorfer Schriften zur neueren Landesgeschichte und zur Geschichte Nordrhein-Westfalens, Bd. 24), Essen 1989. Rusinek, Bernd-A.: Vernehmungsprotokolle, in : Ders. u.a. (Hg.) : Einführung in die Interpretation historischer Quellen. Schwerpunkt : Neuzeit, Paderborn 1992, S. 111–131. Sälter, Gerhard : Phantome des Kalten Krieges. Die Organisation Gehlen und die Wiederbelebung des Gestapo-Feindbildes „Rote Kapelle“ (Unabhängige Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des Bundesnachrichtendienstes 1945–1968, Bd. 2), Berlin 2016. Sandkühler, Thomas : Von der „Gegnerabwehr“ zum Judenmord. Grenzpolizei und Zollgrenzschutz im NS-Staat, in : Gerlach, Christian (Hg.) : „Durchschnittstäter“. Handeln und Motivation (Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 16), Berlin 2000, S. 95–155. Sartoris, Herbert : Verfolgung der Juden, in : Zuche, Thomas (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 44–53.
345
346
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Scharf, Eginhard : Die Verfolgung pfälzischer Frauen wegen „verbotenen Umgangs“ mit Ausländern, in : Meyer, Hans-Georg/Berkessel, Hans (Hg.) : „Unser Ziel ist die Ewigkeit Deutschlands“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 3), Mainz 2011, S. 79–88. Scharf, Eginhard : NS-Justiz und Politische Polizei am Beispiel der Pfalz, in: Meyer, Hans-Georg/Berkessel, Hans (Hg.): „Eine nationalsozialistische Revolution ist eine gründliche Angelegenheit“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 1), Mainz 2000, S. 357–368. Schatz, Holger/Woeldike, Andrea : Freiheit und Wahn deutscher Arbeit. Zur historischen Aktualität einer folgenreichen antisemitischen Projektion, Münster 2001. Scheffler, Wolfgang : Das Getto Łódź in der nationalsozialistischen Judenpolitik, in : Hanno Loewy/Gerhard Schoenberner (Hg.), „Unser einziger Weg ist Arbeit“. „Unzer eyntsiger ṿeg iz arbeyṭ“ : das Getto in Łódź, 1940–1944, Wien 1990, S. 12–16. Schlemmer, Martin : „Los von Berlin“. Die Rheinstaatsbestrebungen nach dem Ersten Weltkrieg (Rheinisches Archiv, Bd. 152), Köln/Weimar/Wien 2007. Schmid, Hans-Dieter : „Finanztod“. Die Zusammenarbeit von Gestapo und Finanzverwaltung bei der Ausplünderung der Juden in Deutschland, in : Mallmann, Klaus-Michael/ Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg, Darmstadt 2000, S. 141–154. Schmid, Hans-Dieter : Gestapo Leipzig. Politische Abteilung des Polizeipräsidiums und Staatspolizeistelle Leipzig 1933–1945 (Leipziger Hefte, Bd. 11), Leipzig 1997. Schmidt, Hans Jörg : Die Deutsche Freiheit. Geschichte eines kollektiven semantischen Sonderbewusstseins, Frankfurt a.M. 2010. Schmitt, Claudia : Vom königlichen Gefängnis zur modernen Justizvollzugsanstalt. Die Wittlicher Strafanstalten im Wandel der Zeit, in : Borck, Heinz-Günther/Dorfey, Beate (Hg.) : Unrecht und Recht. Kriminalität und Gesellschaft im Wandel von 1500–2000. Gemeinsame Landesausstellung der rheinland-pfälzischen und saarländischen Archive. Wissenschaftlicher Begleitband (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 98), Koblenz 2002, S. 688–711. Schmitt-Koelzer, Wolfgang : Bau der „Reichsautobahn“ in der Eifel (1939–1941/42). Eine Regionalstudie zur Zwangsarbeit, Berlin 2016. Schneider, Joseph : In den Fängen der Gestapo. Erlebtes vom Standgericht, aus dem Konzentrationslager Hinzert, aus der Deportation nach Lublin (Polen) und aus dem Umsiedlungslager Wartha (Niederschlesien), Luxemburg 1945. Schneider, Volker : Der dritte Kommandant des ehemaligen SS-Sonderlagers/KZ Hinzert : Paul Sporrenberg, in : Meyer, Hans-Georg/Berkessel, Hans (Hg.) : „Für die Außenwelt seid Ihr tot !“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Mainz 2000, S. 182–224. Schneider, Volker : Waffen-SS – SS-Sonderlager „Hinzert“. Das Konzentrationslager im „Gau Moselland“ 1939–1945. Untersuchungen zu einem Haftstättensystem der Organisation Todt, der Inspektion der Konzentrationslager und des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes der SS, Nonnweiler-Otzenhausen 1998. Schramm, Wilhelm von : Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Organisation, Methoden, Erfolge, München/Wien 31979.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Schroeter [Vorname unbekannt] : Die Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen vom 1.9.1939 (RGBl. I, S. 1683), in : Die Arbeit der Sondergerichte in der Kriegszeit. Abgekürzter Bericht über die Tagung der Sondergerichtsvorsitzenden und Sachbearbeiter für Sondergerichtsstrafsachen bei den Generalsstaatsanwälten im Reichsjustizministerium am 24. Oktober 1939, Berlin 1939, S. 35–41. Schulz, Gerhard : Die Anfänge des totalitären Maßnahmenstaates (Die nationalsozialistische Machtergreifung, Bd. II), Frankfurt a.M. 1974. Schwartz, Michael : Bauern vor dem Sondergericht. Resistenz und Verfolgung im bäuerlichen Milieu Westfalens, in : Faust, Anselm (Hg.) : Verfolgung und Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933–1945 (Schriften zur politischen Landeskunde Nordrhein-Westfalens, Bd. 7), Köln 1992, S.113–123. Schwebach, Anke : „Von der Jugend hängt die Zukunft des deutschen Volkes ab“. Katholische Jugendliche im Raum Trier zwischen Anpassung, Unterdrückung und Widerstand zwischen 1933 und 1939, Masterarbeit Universität Trier 2014. Schwelling, Birgit : Heimkehr − Erinnerung − Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehemaligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft, Paderborn 2010. Seidler, Franz W.: Die Organisation Todt. Bauen für Staat und Wehrmacht 1938–1945, Koblenz 1987. Siemann, Wolfgang : „Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung“. Die Anfänge der politischen Polizei 1806–1866 (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 14), Tübingen 1985. Sierakowiak, Dawid/Adelson, Alan/Turowski, Kamil : The diary of Dawid Sierakowiak. Five notebooks from the Łódź ghetto, New York 1996. Singer, Oskar : „Im Eilschritt durch den Gettotag…“, in : Oskar Singer/Sascha Feuchert (Hg.), Im Eilschritt durch den Gettotag. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, Berlin 2002, S. 27–175. Singer, Oskar : Zum Problem Ost und West. Essays, in : Oskar Singer/Sascha Feuchert (Hg.), Im Eilschritt durch den Gettotag. Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, Berlin 2002, S. 177–206. Sinner, Dani : Der Streik von 1942, in : Rappel 47 (1992), H. 3, S. 381–411. Spoerer, Mark : Zwangsarbeit unter dem Hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und Häftlinge im Deutschen Reich und im besetzten Europa 1939–1945, Stuttgart u.a. 2011. Steger, Bernd/Wald, Peter : Hinter der grünen Pappe. Orli Wald im Schatten von Auschwitz – Leben und Erinnerungen, Hamburg 2008. Stehr, Christoph : Die jüdische Bevölkerung in Gerolstein bis 1945, in : Gegen das Vergessen. Das Schicksal der Gerolsteiner Juden, Gerolstein ²2009. Stein, Wolfgang Hans : Die Rechtsprechung der Sondergerichte im Zweiten Weltkrieg. Das Sondergericht Koblenz und die anderen Sondergerichte auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz, in : Düwell, Franz Josef/Vormbaum, Thomas (Hg.) : Schwerpunktthema. Recht und Nationalsozialismus (Themen juristischer Zeitgeschichte, Bd. 1), Baden-Baden 1998, S. 76–92.
347
348
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Stein, Wolfgang Hans : Staatsanwaltschaft und Landgericht Trier im Dritten Reich, in : Justiz im Dritten Reich. Justizverwaltung, Rechtsprechung und Strafvollzug auf dem Gebiet des heutigen Landes Rheinland-Pfalz, Teil 1 (Schriftenreihe des Ministeriums der Justiz, Bd. 3), Frankfurt a.M. u.a. 1995, S. 501–620. Steinmetz, Jill : „Die Wahrheit steht noch über dem Recht“ ? Die Verteidigungsstrategie von Dr. Max Rau im Prozess gegen Gestapo-Beamte vor dem Gerichtshof für Kriegsverbrechen im Großherzogtum Luxemburg (1949–1951), in : Kurtrierisches Jahrbuch 54 (2014), S. 379–397. Steinmetz, Jill : „Die Wahrheit steht noch über dem Recht“ ? Verlauf und Verteidigungsstrategien im Prozess gegen Gestapo-Beamte vor dem Gerichtshof für Kriegsverbrechen im Großherzogtum Luxemburg (1949 bis 1951), Masterarbeit Universität Trier 2013. Stumper, Robert : Gestapo-Terror in Luxemburg, Esch-Alzette 1949. Tascher, Gisela : Staat, Macht und ärztliche Berufsausübung 1920–1956. Gesundheitswesen und Politik : Das Beispiel Saarland, Paderborn 2010. Thalhofer, Elisabeth : Entgrenzung der Gewalt. Gestapo-Lager in der Endphase des Dritten Reichs, Paderborn u.a. 2010. Tooze, Adam : Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus, München 2008 (engl. London 2006). Toury, Jacob : Ein Auftakt zur „Endlösung“. Judenaustreibungen über nichtslawische Reichsgrenzen 1933 bis 1939, in : Büttner, Ursula u.a. (Hg.) : Das Unrechtsregime. Internationale Forschung über den Nationalsozialismus. Festschrift für Werner Jochmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 1986, S. 165–196. Trier vergisst nicht. Gedenkbuch für die Juden aus Trier und dem Trierer Land, Trier 2010. Trunk, Isaiah/Shapiro, Robert Moses : Lodz Ghetto. A History, Bloomington 2006. Tuchel, Johannes : Konzentrationslager. Organisationsgeschichte und Funktion der „Inspektion der Konzentrationslager“ 1934–1938 (Schriften des Bundesarchivs, Bd. 39), Boppard am Rhein 1991. Tuchel, Johannes : Registrierung, Mißhandlung und Exekution. Die ,Politischen Abteilungen‘ in den Konzentrationslagern, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. ,Heimatfront‘ und besetztes Europa, Darmstadt 2000, S. 127–140. Tuchel, Johannes/Schattenfroh, Reinold : Zentrale des Terrors. Die Prinz-Albrecht-Str. 8. Hauptquartier der Gestapo, Berlin 1987. Urban-Fahr, Susanne : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert.1939–1945, Alzey 2001. Vaas, Maike : „Die KPD lebt“ ? Verbreitung und Bekämpfung kommunistischer Propaganda im Raum Trier, 1933–1939, Masterarbeit Universität Trier 2014. Wachsmann, Nikolaus : KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager (Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 1708), Bonn 2016. Wachsmann, Nikolaus : Zwischen Konflikt und Kooperation. Justiz, Polizei und Konzen trationslager im Dritten Reich, in : Jahrbuch der KZ-Gedenkstätte Mauthausen 9 (2015), S. 19–34. Wagner, Herbert : Die Gestapo war nicht allein … Politische Sozialkontrolle und Staatsterror im deutsch-niederländischen Grenzgebiet 1929–1945, Münster 2004.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Wagner, Patrick : Prägungen, Anpassungen, Neuanfänge. Das Bundeskriminalamt und die nationalsozialistische Vergangenheit seine Gründergeneration – Ansatz und Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in : Bundeskriminalamt (Hg.) : Der Nationalsozialismus und die Geschichte des BKA. Spurensuche in eigener Sache. Ergebnisse – Diskussion – Reaktionen. Dokumentation des Kolloquiums zum Forschungsbericht zur BKA-Historie vom 6. April 2011, Köln 2011, S. 21–35. Walter Schätzel, in : Verzeichnis der Professorinnen und Professoren der Universität Mainz, online unter : http://gutenberg-biographics.ub.uni-mainz.de (Letzter Zugriff : 21.12.2016). Wallerang, Mathias : Luxemburg unter nationalsozialistischer Besatzung. Luxemburger berichten (Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz, Bd. 22), Mainz 1997. Waringo, Raymond : Das SS-Sonderlager Hinzert und die Rolle Rieks in Hinzert, in : Gemeinde Befort (Hg.) : Beaufort im Wandel der Zeiten, Befort 1993, S. 77–81. Weber, Paul : Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg, Luxemburg 21948. Wehler, Hans-Ulrich : Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band IV : 1914–1949, München 2 2003. Weinhauer, Klaus : NS-Vergangenheit und struktureller Wandel der Schutzpolizei der 1950/60er Jahre, in : Schulte, Wolfgang (Hg.) : Die Polizei im NS-Staat. Beiträge e ines internationalen Symposiums an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster, Frankfurt am Main 2009, S. 139–158. Weinke, Annette : Die Nürnberger Prozesse, München 22015. Weinke, Annette : Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigungen 1949–1969, oder : Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten Krieg, Paderborn u.a. 2002. Weiß, Hermann : Art. „Alte Kämpfer“, in : Enzyklopädie des Nationalsozialismus, hg. von Benz, Wolfgang/Graml, Hermann/Weiß, Hermann, Stuttgart 31998, S. 358. Weisz, Franz : Die Nachrichtendienste von Gestapo, SD und Wehrmacht, in : Schafranek, Hans/Tuchel, Johannes (Hg.) : Krieg im Äther. Widerstand und Spionage im Zweiten Weltkrieg, Wien 2004, S. 215–246. Weisz, Franz : Die V-Männer der Gestapoleitstelle Wien. Organisation, Personalstruktur, Arbeitsweise, in : Zeitgeschichte 40/6 (2013), S. 338–357. Weiter-Matysiak, Barbara : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück, in : Meyer, Hans-Georg/Berkessel, Hans (Hg.) : „Für die Außenwelt seid Ihr tot !“ (Die Zeit des Nationalsozialismus in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Mainz 2000, S. 116–135. Weiter-Matysiak, Barbara : Das SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück, in : Musée d’histoire de la Ville de Luxembourg (Hg.) : …et wor alles net esou einfach. Questions sur le Luxembourg et la Deuxième Guerre mondiale/Fragen an die Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg. Contributions historiques accompagnant l’exposition/Ein Lesebuch zur Ausstellung, Luxembourg 2002, S. 164–174. Weiter-Matysiak, Barbara : Widerstand im Raum Trier, in : Schiffmann, Dieter/Berkessel, Hans/Arenz-Morch, Angelika (Hg.) : Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf dem Gebiet des heutigen Rheinland-Pfalz. Wissenschaftliche Darstellung und Materialien für den Unterricht, Mainz 2011, S. 157–169.
349
350
|
Quellen- und Literaturverzeichnis
Welter, Adolf : Trier-Petrisberg 1940–1945. Das Kriegsgefangenenlager Stalag XII D, Trier 2007. Welter, Beate : Zwangsarbeiter im SS-Sonderlager/KZ Hinzert. Ein Forschungsüberblick, in : Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (Hg.) : Konzentrationslager, Sonderlager, Polizeihaftlager. SS-Sonderlager/KZ Hinzert und andere Orte des Verbrechens in den Lagersystemen der NS-Zeit (Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz, Bd. 2), Alzey 2007, S. 54–59. Wenke, Bettina : Interviews mit Überlebenden. Verfolgung und Widerstand in Süddeutschland, Stuttgart 1980. Weyrauch, Walter Otto : Gestapo V-Leute. Tatsachen und Theorie des Geheimdienstes, Frankfurt a.M. 1989. Wieland, Günther : Verfolgung von NS-Verbrechen und Kalter Krieg, in : Claudia Kuretsidis- Haider/Winfried R. Garscha (Hg.) : Keine „Abrechnung“. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in Europa nach 1945, Leipzig/Wien 1998, S. 185–203. Wildt, Michael : Nationalsozialismus : Aufstieg und Herrschaft (Informationen zur politischen Bildung, Bd. 314), Bonn 2012. Wildt, Michael : Volksgemeinschaft als Selbstermächtigung. Gewalt gegen Juden in der deutschen Provinz 1919 bis 1939, Hamburg 2007. Wilhelm, Karl : SS-Sonderlager Hinzert, in : Verein für Heimatkunde Nonnweiler e.V. (Hg.) : Hochwald − Landschaft und Geschichte, Saarbrücken 1992, S. 258–259. Wolf, Gerhard : Ideologie und Herrschaftsrationalität. Nationalsozialistische Germanisierungspolitik in Polen, Hamburg 2012. Wulf, Joseph : Aus dem Lexikon der Mörder. „Sonderbehandlung“ und verwandte Worte in nationalsozialistischen Dokumenten, Gütersloh 1963. Zenner, Jean : Hinzert 1943–1944, in : Rappel 4/5 (1977), S. 127–137. Zenz, Emil : Die kommunale Selbstverwaltung der Stadt Trier seit Beginn der preußischen Zeit 1814–1959, Trier 1959. Zenz, Emil : Die Stadt Trier im 20. Jahrhundert, Bd. 1 : 1900–1950, Trier 1981. Zenz, Emil : Trier in Rauch und Trümmern. Das Kriegsgeschehen in der Stadt, in Ehrang, Pfalzel, Konz in den Jahren 1943–1945, Trier 1983. Ziegler, Hannes : Die Verfolgung ehemaliger Separatisten durch die Gestapo, in : Nestler, Gerhard/Paul, Roland (Hg.) : Braune Jahre in der Pfalz. Neue Beiträge zur Geschichte einer deutschen Region in der NS-Zeit (Beiträge zur pfälzischen Geschichte, Bd. 29), Kaiserslautern 2016, S. 251–278. Zimmermann, Michael : Die Gestapo und die regionale Organisation der Judendeportation. Das Beispiel der Stapo-Leitstelle Düsseldorf, in : Mallmann, Klaus-Michael/Paul, Gerhard (Hg.) : Die Gestapo – Mythos und Realität, Darmstadt 1995, S. 357–372. Zuche, Christoph : Loyalität und Widerspruch : Die christlichen Kirchen, in : Zuche, Thomas (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 54–67. Zuche, Thomas : „Absondern, diffamieren, entwürdigen, zerbrechen…“ – das KZ Hinzert, in : Ders. (Hg.) : StattFührer. Trier im Nationalsozialismus, Trier 32005, S. 102–112. Zuche, Thomas : Art. „Torgau-Wald, Aurelia“, in : Trierer Biographisches Lexikon (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz, Bd. 87), Koblenz 2000, S. 470.
Quellen- und Literaturverzeichnis
|
Internetseiten Arbeitskreis Gedenken Bitburg, online unter : http://www.bitburg-gedenkt.de/index.php/ dokumente/35-ablieferungsbestaetigung.html (Letzter Zugriff : 4.1.2017). Statistik und Deportation der jüdischen Bevölkerung aus dem Deutschen Reich, hier : Deportationslisten/Rheinland/16.10.41 nach Litzmannstadt, online unter : http://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_rhl_411016.html (Letzter Zugriff : 13.7.2017). Widerstand im Rheinland 1933–1945. Zwischen Courage, Nonkonformismus, Opposition und offenem Widerstand : Rheinländer im Widerstand gegen den Nationalsozialismus 1933–1945 (Portal Rheinische Geschichte), online unter : http://www.rheinische-geschichte.lvr.de/Widerstandskarte/Seiten/home.aspx (Letzter Zugriff : 29.8.2017).
351
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Andreas Borsch, Historiker, Lehrer für Deutsch als Zweitsprache in Trier Hannes Brogmus, Historiker Thomas Grotum, Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Neuere und Neueste Geschichte und Leiter des Forschungsprojekts zur Geschichte der Gestapo Trier an der Universität Trier Lena Haase, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt zur Geschichte der Gestapo Trier an der Universität Trier und Mitarbeiterin der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert Sebastian Heuft, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Flottenmanagement, Bonn Max Heumüller, Lehrer für Geschichte und Biologie am Max-Planck-Gymnasium Trier Justus Jochmann, Historiker, Mitarbeiter der Unternehmensberatung „Ideentransfer“, Leipzig Katharina Klasen, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin Matthias Klein, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsprojekt zur NS-„Rassenhygiene“ im Raum Trier an der Universität Trier Felix Klormann, Historiker, Pressesprecher des Zweckverbandes Verkehrsverbund Region Trier (VRT) Benjamin Koerfer, Historiker, Pressesprecher der Agentur für Arbeit Trier
354
|
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Frederik Rollié, Lehrer für Geschichte und Biologie an der Lise-Meitner-Gesamtschule Köln-Porz Martin Spira, Lehrer für Geschichte und Biologie an der Integrierten Gesamtschule Emmelshausen Ksenia Stähle, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsprojekt zur Geschichte der Gestapo Trier an der Universität Trier Jill Steinmetz, Historikerin, Dokumentarin beim Gesundheitsministerium in Luxemburg
Register
Personen Adam, Hans 304 Adenauer, Konrad 57, 289 Als, Robert 291 Ameln, Peter 313 Angelsberg, René 303 Archen, Jean Nicolas Fernand 21, 212 f., 215, 217 Barbieur, Edgar 305 Bassing, Louis 305 Bauer, Johann 19, 148, 156–162, 164 Bausch, Cornelius 279 Bech, Joseph 276 Bentz, Lucien 305 Bernard, Zénon 301 Best, Dr. Werner 165 f., 203, 205, 217 Betz, Nicolas 303 Biebow, Hans 247 f. Bieler, Karl 102 f., 109 f., 113, 278 f. Biren, Eugène 303 Blum, Emma 225, 240–242 Blum, Grete 225, 240 f. Blum, Gustav 225, 240–242 Blum, Werner 225, 240 f. Bockler, Michel 295 Bodson, Victor 290 Bornewasser, Franz Rudolf (Bischof von Trier) 39 f., 81, 310 f. Brandes, Dr. Ernst 165 Bristel, Léon 305 Bruck, Alfred 303 Butzke, Herbert Gerhard Paul 103, 109 Calmes, Christian 109 Causier, Germaine 294 Charlotte von Nassau-Weilburg (Großherzogin v. Luxemburg) 290
Christ, Dr. Ludwig 231 Christophe, Adolphe 305 Claudon, Georges 294 Cloos, Jean Pierre 106 f. Dal Zotto, Mathias 305 Darré, Richard Walther 165 Dasbach, Georg Friedrich 82, 223 Dax, Michel 303 Deiskes, Emile 295 Diels, Rudolf 30 Dietrich, Herbert Otto Waldemar 278, 286, 288–291 Dörstel, Wilhelm 103 Drach, Leonhard 303 Ebel, Heinrich Basilius 40 Eden, Robert Anthony 276 Eichmann, Adolf 52 Eiden, Hans 29, 307 f. Ernzerhoff, Hans 220 Everling, Georges 305 Ewen, Joseph 303 Falday, Anton 298, 307 Fassbender, Max 298 f., 307 Feick, Gustav 214 Fell, Peter 313 Fisch, Paul 212 Fischer (Gestapobeamter) 88 f., 103 Freisler, Roland 63 f., 76 f. Frick, Wilhelm 315 Frieden, Pierre 291 Funk, Dr. Alois 89 Funken, Hermann 236 Gawlik, Dr. Hans 289 Gehlen, Reinhard 210 Gillen, Erny 106
356
|
Register
Glesener, Hubert 305 Görgen, Josef 314 Göring, Hermann 30–32, 35, 42, 141, 185, 315 Greif, Peter 297 Grieshaber, Fritz 307 Grynszpan, Herschel 240 Grzonka / Szronka, Robert 110, 305 Gurlitt, Cornelius 261 Gurlitt, Hildebrand 261 Güttler, Dr. Gerhard 85, 150 f., 155, 311 Hackethal, Dr. Theophil 120 Hansen, Karl 110 Hantel, Otto 277, 281 Harens, Nikolaus 193–196 Hartmann, Fritz 21, 48 f., 54, 102, 109, 111 f., 277, 279 f., 288–292, 303 f. Hassal, Peter 122 Hauth, René 212 Hedderich, Heinrich 55, 103, 218, 307 Heiden, Max 103 Heiderscheid, Emile 303 Heim, Dr. Kurt 21, 275, 277, 280–287, 289 Helck, Edmont 294 Heß, Rudolf 209 Heyard, Raymond 305 Heydrich, Reinhard 37, 42, 71, 74, 77, 185, 203–205, 207–210, 222, 247 f. Himmler, Heinrich 36, 40, 42, 115–117, 205, 208 f., 247 f. Hindenburg, Paul von 154 Hitler, Adolf 30, 43, 60, 96, 154, 172, 211, 229 f., 235, 248, 275 Hoffmann, Johannes 56 Höhmann, Erich-August 278, 288 Hull, Cordell 276
Koch-Kent, Henri 212 Kölle, Hans Walther 21, 267, 270–272 Konen, August 110 Konsbrück, Guillaume 291 Konz, Nicolas 303 Koob, Léon 305 Kunsch, Emile 305 Kuhn, Jules 305 Lammers, Hans Heinrich 40 Laternser, Hans 285 Laux, Emile 305 Lemmer, Jean 305 Ley, Dr. Robert 236 Liessem, August 271 Lommel, Célestin 303 Lutty, Charles 212 Mach, Rudy 106 Mannon, Theodor 305 Margue, Nicolas 292 Maroldt, Pierre 305 Martinière, Joseph de la 122 Mayer, Leopold 268, 271 Meiers, Charles 303 Meulenberg, Henriette 298, 301 Merten, Paul 277, 279–281, 283–285, 287 Meyroune, Dr. Claude 122 Michel, Arthur 305 Michels, Marguerite 283 Michels, Nikolaus 283 Micho, Robert 303 Molotow, Wjatscheslaw 276 Moritz, Adolf 102 f., 106 f., 109, 113, 278 Möschel, Hermann 296 Muller, Nicolas 303 Müller, Walter 267
Isenburg, Helene Elisabeth von 289 Jost, Herbert 278, 280, 288 Jost, Jules 305 Jung, Karl 196–200
Nati, Pierre 110 Ney, Henri 305 Noesen, Antoine 305 Nölle, Wilhelm 48, 277, 288
Kaas, Ludwig 230 Katzbach, Heinrich 214 Kleeblatt, Henriette 279 Klöcker, Hans 102 f., 106, 109, 277, 279, 288 f.
Pauly, Conrad 305 Pinnel, Josef 287 Pister, Hermann 44 Poznański, Jakub 243
Register
Prinz, Joachim 241 Prunk, Jakob 307 Raderschall, Adolf 49, 303 Ranner, Sebastian 102 f., 277, 288 Rath, Ernst vom 240 Rathke, Rudolf 103, 109, 220 f. Reichert, Aurelia (Orli), s. Torgau, Aurelia (Orli) Reif, Jakob 277, 283 f., 289 Reiter, Max 103 Rockel, Bernhard 103 Rosenfeld, Oskar 249 Rozensztajn, Szmul 250 Rumkowski, Chaim Mordechai 247 f., 252 f., 257 Runge, Walter 21, 48, 50, 102, 112, 277, 279 Saassen, Dr. Konrad 35, 312 Sack, Andreas 103 Saeul, Léon 110 Sander, Erich 299 Sandt, Aloyse 305 Schätzel, Prof. Dr. jur. Walter 281 Scheider, Camille 212 Schiltz, Martin 212 Schmalz, Otto 52, 57 f., 278 Schmidt, Albert 49, 55, 102 f., 111 f., 221, 301, 303 Schmidt, Friedrich 21, 58 f., 217, 293–295 Schmidt, Fritz 109, 112, 303 Schmit, Alphonse 303 Schneider, Jean Pierre 303 Schnitzler, Josef 103 Schober, Ruppert 102 f. Schoettert, Auguste 107 Scholtes, Camille 104 Schoos, Joseph 305 Schroeder, Jean 303 Schulte, Heinrich Gustav 103 Siegler, Salomon 269 Siemens, Wilhelm 103 Simon, Eugène 212 Simon, Gerhard 102 f., 112, 278 Simon, Gustav 39, 48 f., 83, 229, 236, 267, 302, 304, 312 Simon, Gustave 212 Simon, Paul 236
|
Sohmann, Otto 304 Speer, Albert 44 Sporrenberg, Paul 50, 124, 127 Stattmann, Franz Karl 103 Stedem, Josef 313 f. Steinmetzer, Nicolas-Joseph 305 Stempel, Josef 221 Sterzenbach, Friedrich-Theodor 278, 288 Stötzel, Maximilian 230 Streichen, Robert 106 Stuckenbrock, Josef 277, 279 f., 283 f., 286–288 Stumper, Robert 104, 109 Suder, Franz (Edmund Otto) 102 f., 109 Tilmann, Franz 85 f. Thull, Jean 303 Todt, Fritz 43 f., 96 Torgau, August 296 Torgau, Fritz 21, 29, 296 f., 299 Torgau, Wilhelm 21, 296 f., 299 f., 307 f. Torgau, Aurelia (Orli) 21, 296, 298–302, 307 Toussaint, Ernest 303 Uebelhoer, Friedrich 247 Uguccioni, Henri 294 Varain, Adolf 28 Vernier, André 212 f. Vollmer, Walter 48 Voyat, Marcel 294 Wagner, Christoph 307 Wald, Aurelia (Orli), s. Torgau, Aurelia (Orli) Wald, Eduard 302 Weber, Bernhard 110 Weber, Paul 105 Weets, Alphonse 303 Wehmann, Clara 109 Weitz, Dr. Heinrich 231, 236 Weiwers, Nicolas 295 Welsch, Heinrich 56, 151, 162, 312, 315 Wendel, Hermann 188 Wirtz, Dr. Paul 21, 271 f. Wolff, Friedrich 316 Wolffs, Fritz 307 Worré, Michel 303
357
358
|
Register
Zeimes, Léon 303 Zimmermann, Hans 12 f.
Orte Die Stadt Trier wird in diesem Register nicht nachgewiesen. Aachen 28 Aachen (Reg.-Bez.) 37 Algerien 188 Barmen 28 Baumholder 173 Basel 43 Belgien 37, 97, 142, 154, 203, 210 f., 213, 216, 218 f., 276 f., 315 Bergen 170 Berlin 26–28, 30, 32, 37, 40, 56, 63, 84, 86 f., 89, 92 f., 130, 132, 148 f., 152 f., 155 f., 160, 163, 207 f., 210, 218 f., 225, 235, 247, 256, 259, 283, 301 f., 304, 312 Berlin-Moabit 219 Berschweiler 178 f. Bitburg 16, 28, 246 Bitburg-Prüm (Kreis) 29 Bochum 28 Boppard 227 Bordeaux 219 Bromberg (Bydgoszcz) 122 Brüssel 220 f., 298 f. Butzweiler 234 Cayenne 197 Chelmno 255, 257, 259 Clervaux 48 Cochem 27 Dachau 58 Dänemark 216, 277 Danzig 281, 284 Darmstadt 113 Daun 21, 271 Daun (Landkreis) 263, 267, 271 Daun-Wittlich (Landkreis) 267 Diedenhofen 193
Diekirch 48, 214, 283, 285, 303 Dortmund 28, 58, 142 Duisburg 28 Düsseldorf 27 f., 40 f., 58, 113, 134, 259, 292 Düsseldorf (Reg.-Bez.) 157 Echternach 215, 303 Eifel 28, 43, 47, 171, 175, 180, 213, 308 Elberfeld 28 England 45, 241 Esch-sur-Alzette 18, 48, 217, 285, 294 f., 313 Flußbach 33, 61 Frankfurt am Main 113, 306, 316 Frankreich 20, 37, 45 f., 53, 60, 97, 119, 142, 187, 190, 203, 212 f., 215–218, 276 f., 288, 290, 295, 315 Fünfbrunnen 279 Gau Düsseldorf 29 Koblenz-Trier 267, 270 Koblenz-Trier-Birkenfeld 236 Moselland 48, 83, 109 Rheinland-Süd 236 Thüringen 76 Geichlingen 29 Gelsenkirchen 28, 142 Generalgouvernement 247 Gerolstein 28, 262, 267–271 Göttingen 59, 217, 294 f. Griechenland 276 Großbritannien 276 Gusterath 122 Hamborn 28 Hamburg 196–199, 308 Hamm 47, 150, 156, 160–162, 297, 299, 301, 314 f. Hasborn 47 Hermeskeil 120, 175, 234, 313 Hillesheim 262, 267–268, 271 Hinzert 14, 18 f., 44, 47, 49 f., 96, 100–104, 109 f., 112 f., 118, 122 f., 125–128, 302, 305 Hochwald 175 Hunsrück 43 f., 95, 101
Register
Idar-Oberstein 220 Jugoslawien 276 Jünkerath 262, 267–268, 271 Kaiserslautern 199 f. Karlsruhe 113 Kesslingen 195 Kinderbeuren 196 Kislau 190–192, 194, 196, 200 Kleinbettingen 48 Kleve 43 Klingenmünster 78 Koblenz 13, 15, 27 f., 34, 40 f., 53, 83, 92, 113, 216, 280, 309 Köln 24, 28, 33 f., 40, 113, 217, 246, 267, 304 Konz 196 Kulmhof, s. Chelmno Kürenz 40 Lissendorf 262, 267 f. Litzmannstadt 21, 125, 128, 241, 243 f., 246–248, 251, 255 f., 258 f. Łódź, s. Litzmannstadt London 276 Lothringen 56, 135, 141 Ludwigsburg 57 Ludwigshafen 113 Luxemburg 18, 21, 48, 61, 100 f., 212, 217, 294, 302 f., 308 Luxemburg (Großherzogtum) 14 f., 18, 21, 24, 33, 37, 46–49, 53, 58, 60, 97, 100, 106, 111 f., 135, 141, 158 f., 193, 203, 206, 210–214, 216–222, 243 f., 246, 253, 275–285, 288–292, 294, 298, 301–304, 306, 308 f., 313, 315 f. Magdeburg 113 Mainz 281 Mesenich 193 f., 196 Mettmann 157 Metz 56, 198, 212 f., 286 Moskau 276 Mühlheim 28 Munster 170 Nennig 53, 58, 217, 294
Neumagen 280 Neumagen-Dhron 234 Neustadt an der Weinstraße 25, 37, 78, 113, 118, 120, 122, 126 Niederlande 38, 97, 216, 276 f., 290 Niedersachsen 59 Nikolausberg (b. Göttingen) 59 Norwegen 276 f. Nürnberg 237, 275, 278 Oberursel 213 Olewig 13, 52 Oran 194 Paderborn 58, 295 Pallien 40 Palzem 53, 58, 294 Paris 214, 220, 240 Perl 57, 193 Pfalz 29, 78 Pirmasens 199 f. Polen 45, 97, 105, 123, 126, 136, 259, 276 Prag 250 Prüm 16, 28 Prüm (Landkreis) 34, 263, 267 Rastatt 58, 286, 295 Recklinghausen 28 Remich 217 Remscheid 28 Rheinland 42 f., 84, 150, 156, 211, 228, 299, 304 Rheinland-Pfalz 262 Rheinprovinz 26 f., 34, 39 f., 229, 314 Rodingen 48 Rostoworow 123 Ruhrgebiet 42, 149 Russland 68, 97, 140 Ruwer 157 Saarbrücken 39, 56, 113, 159 f., 211, 214, 216, 220 f., 295, 312, 316 Saarbrücken (Reg.-Bez.) 39 Saargebiet 15, 24, 37–39, 56, 60, 83, 154 f., 160, 162, 211, 298, 306, 310, 312, 314–316 Saarland 56, 83, 150, 315 f. Saarpfalzkreis 38
|
359
360
|
Register
Salzburg 113, 261 Schweich 47, 313 Schweiz 216 Sidi-bel-Abbés 193 Sowjetunion 116, 137, 288 Stadtkyll 262 f., 267 f. Steinfort 48 Sterkrade 28 St. Wendel-Baumholder (Restkreis) 178 Sülm 246 Suriname 198 Trier (Bistum) 38 f., 81–93, 227, 229, 234, 240, 310 Trier (Landkreis) 17, 27 f., 244 Trier (Reg.-Bez.) 15, 17, 24 f., 27, 34, 38 f., 61, 141, 149 f., 154, 166, 168, 170, 172, 175 f., 179 f., 184 f. Tschechoslowakei 276 UdSSR, s. Sowjetunion Ulmen 47, 57 USA 55, 241, 276 Vulkaneifel 21, 261 f., 266, 272 Wawern 28 Westfalen 156 Wien 19, 57, 76, 130, 204 Wiesbaden 216 f., 220, 304 Wittlich 16, 32 f., 47, 50, 61, 145, 195–197, 218–219 Wolfratshausen 289 Zaborowiec 126 Zeltingen an der Mosel 13, 51 f. Zweibrücken 56
Sachen Abhören ausländischer Sender, s. Rundfunkverbrechen Abwehr 13, 20, 37 f., 54, 59 f., 65, 155, 199, 203–210, 212 f., 216–223 Aktion „T4“ 284
Antisemitismus 41, 227, 233 f., 236–239, 263 f., 267, 272 Arbeitsamt 42, 139 f., 157 Arbeitserziehungslager 47, 96, 98 f., 206, 304 Arbeitsvergehen 19, 43 f., 47, 101, 136, 138–141, 205 f. Arbeitsverpflichtung 47 Arisierung 41, 244, 263, 264 f., 272 Auswanderung / Emigration 159 f., 238, 240 f., 244 f. Auswertstelle West 213 Außenstelle 13, 15 f., 24, 30, 35, 39, 48, 53, 217 Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) 214 Besatzung 15, 28, 276 f., 281 f., 286, 294, 304 Boykott (jüdische Geschäfte) 21, 36, 178, 181, 235–237, 240, 244 f., 267–272 Bund Deutscher Mädel (BDM) 40, 298, 313 Bundeskriminalamt (BKA) 56 f. Bundesnachrichtendienst (BND) 18, 55, 60 Bundesrepublik Deutschland 18, 24, 54, 60, 278–288, 295 Bürgermeister 17, 32, 35, 42, 46, 73, 193, 196, 200, 220, 231, 236 Burgfrieden 18, 84 f. Denunzianten, s. Denunziation Denunziation 12, 19, 23, 26, 30, 42 f., 57, 59, 65, 150, 152, 155, 157, 160, 163, 222, 272, 290 Deutsche Arbeitsfront (DAF) 47 Deutsche Demokratische Partei (DDP) 228 Deuxième Bureau 212 f. Eindeutschung, s. „Wiedereindeutschung“ „Eindeutschungspolen“ / E-Polen 118, 125, 128 Einsatzkommando der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes Luxemburg (EKL) 15, 21, 48–50, 52, 55, 57–59, 100, 102 f., 111 f., 207, 210, 214–216, 219–222, 277 f., 283 f., 303 Brüssel 221 „Eiserne Front“ 228 Entnazifizierung 24, 53, 60, 308 Épuration, s. Entnazifizierung
Register
Ermächtigungsgesetz 230, 235 Erzeugungsschlacht 171, 174 f., 180 f., 183 Evakuierung 74, 123, 314 Exilregierung 276 Finanzamt 24, 59, 245, 262, 271 Frauenstraflager Flußbach, s. Lager Fremdarbeiter 116 f., 237, 142, 144, 206 Fremdenlegion (französische) 20, 187–200, 205 f. Gauleitung 39, 48 f., 83, 229, 235, 267, 302, 304, 312 Gefängnis / Haftanstalt / Zuchthaus 32, 44, 72–74, 77 f., 101, 106 f., 145, 158, 161, 184, 219, 240, 250, 283, 288 f., 297–299, 314 Aichach 301 Bad Kreuznach 297 Berlin-Moabit 219 Emslandlager Esterwegen 297, 316 Rheinbach 314 Siegburg 297, 299 f., 307, 314 Trier (Windstraße) 45, 240, 314 Wittlich 32, 47, 61, 145 Ziegenhain 300 Geheime Feldpolizei (GFP) 207, 209, 219, 315 Geheimes Staatspolizeiamt (Gestapa) 30, 34, 37, 63, 71, 89, 149, 163, 205, 207–209, 216, 301 f. Geheimpolizei, s. Politische Polizei Generalstreik 22, 49, 111, 302 f. Gericht Amtsgericht 67 f., 75 f., 160, 297 Anerbengericht 170, 180 Bezirksgericht 122 Kammergericht Berlin 156 Landgericht 39, 262 Militärgericht 275, 278, 282 f. Oberlandesgericht Hamm 47, 56, 61, 77, 145, 150, 156, 160 f., 297, 299, 301, 314 f. Oberster Abstimmungsgerichtshof 312 Sondergericht 17, 39, 49, 56, 63 f., 68 f., 71 f., 74, 77, 206, 303 f., 306, 308 Standgericht 49 f., 64, 111 f., 277, 302 –304 Volksgerichtshof Berlin 47, 63, 69, 79, 216, 219 f., 301 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums 231
|
Geheime Staatspolizei (Gestapo) Aachen 40 Darmstadt 113 Dortmund 58 Düsseldorf 11, 27, 40 f., 113 Frankfurt am Main 113 Karlsruhe 113 Koblenz 15, 40 f., 53, 113, 309 Köln 40, 113, 217 Ludwigshafen 113 Luxemburg 283, 308 Magdeburg 113 Neustadt an der Weinstraße 78, 113, 126 Saarbrücken 39, 113, 211, 214, 216 f., 220 f., 312, 316 Salzburg 113 Wien 56, 204 Gestapobeamte 20 f., 24, 50, 55 f., 60, 70, 88, 101, 103 f., 106, 108–110, 113, 134, 164, 168, 192, 197, 199, 275, 277, 283, 286, 293–295, 298, 303 Getto, s. Lager Gleichschaltung 40, 230, 232 Grenzpolizei 16, 20, 37, 48, 57, 154, 190, 203, 206 f., 216, 223 Haftbefehl 31, 67, 71–73, 75–77, 160, 220, 297 Häftlinge 196, 206, 278, 287, 289, 299, 301 f., 314 Funktionshäftling / Kapo 122 Gewalt gegen 14, 103, 106, 108–110, 278, 287 in Hinzert 97, 99, 104, 107, 113 Nacht-und-Nebel 50, 122, 206 Transport / Deportation 45 Schutzhäftlinge 32 f., 97, 156, 297 „Heimatfront“ 136, 139 Heimtücke 78, 184 Hitlerjugend (HJ) 40, 232, 298, 310–313 Hochverrat / Landesverrat 47, 63, 67–70, 101, 150 f., 156, 159–162, 209, 216, 218, 297–299, 314 f. Homosexualität 39, 188, 312 Hornkaserne (Trier) 297 Inspektion der Konzentrationslager (IKL) 44, 98 f.
361
362
|
Register
Inspekteur der Sicherheitspolizei und des SD (IdS) 304 Juden 225–259, 261–273, 279 Auswanderung 207, 239, 245 Deportation 52, 57, 134 f., 206 f., 241, 243–259, 278 f., 283, 292, 301 Exklusion / Verfolgung 17, 233, 235–240, 244, 249, 258, 263 f., 269–272 Ermordung 12, 242, 246 f., 255, 257, 259 Jugend 22, 86, 88, 197, 281, 287, 294, 310–314 Jugendorganisationen, s. auch Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel jüdische 227, 234 katholische 232, 310 f., 314 kommunistische 296 Justiz 18, 22, 24, 39, 56, 59, 63–66, 70–72, 75–79, 160, 163 f., 278, 304 Akten 15, 19, 145, 185 Behörden 66, 70, 78 Verwaltung 56 f. Kaiserreich 27, 183, 189 „Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes“ 231, 270, 272 Kirche Geistliche / Priester 39 f., 46, 82, 90, 232–234, 309–313 Katholische Kirche 26, 38–40, 82–85, 88, 90, 229, 232, 310, 312 politischer Katholizismus 228 f., 232 f. Bistum 227, 234, 310 Kollaboration / Kollaborateure 290 f. Kommunismus 19, 164 Bekämpfung des 30, 56, 314–316 Kommunisten 17, 19, 21, 38, 73, 147–150, 154, 156, 162, 228–230, 233, 296–300, 307 f., 314 f. Kommunistische Partei Luxemburg (KPL) 301 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 150, 230, 296–299, 307 f., 312, 314, 316 KPD-Opposition 296 Propaganda 22, 54, 60, 68, 153, 156, 158–162, 210 f., 293, 297 f., 314–316 Sender 63, 65 f., 68 Verfolgung der Kommunisten 88, 149
Widerstand 150, 296 Zentralkomitee der KPD 298 Konzentrationslager, s. Lager Krankenhaus 46, 120, 308 f. Kreisbauernführer / Kreisbauernschaft 35, 173 f., 177, 183 Kreissparkasse 178, 271 Kreisleiter / Kreisleitung 21, 73, 177 f., 195, 197, 267, 279, 270–272 Kriegsendphasenverbrechen 53, 294 Kriegsgefangene 12, 14, 45–47, 101, 141, 143, 206, 289, 306 Kriegsverbrechen 102 f., 109, 112, 275–277, 280–282, 287, 289 f., 292 Kriminalpolizei (Kripo) 15, 33, 37, 45, 48, 57–60, 208 f., 214, 308 f. Kulturkampf 82 Lageberichte 14, 19, 34, 130, 147–150, 165 f., 168, 174, 177–184, 211, 238, 311 f. Lager 246 f., 346, 257, 264, 304 Auschwitz (KL) 257, 301 f. Außenlager 47 f., 99, 302 Buchenwald (KL) 97 Chelmno/Kulmhof (VL) 255, 257, 259 Dachau (KL) 58, 78, 97, 314 Flußbach (Frauenstraflager) 61 Hinzert (SS-Sonderlager/KL) 285, 294, 302, 304 f. Kislau (Bewahrungslager) 190–192, 194, 196, 200 Litzmannstadt (Getto) 21, 241, 243 f., 246–259 Natzweiler (KL) 97 Oranienburg (KL) 314 Papenburg (Emslandlager) 297 Ravensbrück (KL) 128, 300 f. Sonnenburg (KL) 297 Theresienstadt (Getto) 242, 279 Kriegsgefangenenlager 45–47 Landkreis 35 Bernkastel 17 Bitburg 17, 28 Daun / Daun-Wittlich 17, 267 Prüm 17, 267 Trier 17, 27, 244 Wittlich 17, 197
Register
Landrat(samt) 17, 21, 32, 34 f., 42, 154, 173, 194, 197, 200, 220, 271 f. Landwirtschaft 19, 46, 115, 142, 165 f.,168 f., 182, 184 Machtübernahme 16, 30, 81, 147, 172, 211, 231 f., 235, 297, 306, 314 Marktordnung 175, 180, 184 Marxismus 149, 164 Meliorationen 170 f. Ministerium des Inneren 26, 30, 57, 85 f., 151, 190, 315 der Justiz 63, 69, 76 f., Landwirtschafts- 175 für Bewaffnung und Munition 43 für kirchliche Angelegenheiten 90, 92 Propaganda- 63, 92 Wirtschafts- 262 Monatsberichte, s. Lageberichte Nachkriegsprozesse 291 Frankfurter Auschwitz-Prozesse 285 Gestapo-Prozess Luxemburg 275–292 Internationales Militärtribunal Nürnberg 275, 282, 283 Ulmer Einsatzgruppenprozess 57 Rastatter Prozesse 58, 286, 295 Nachkriegszeit 11, 20, 53, 98, 112, 128, 166, 227, 275 Nachrichtendienst / Geheimdienst 20–22. 43, 54–56, 151, 203 f. 207–209, 211 f., 217 f., 220 f., 269 f. „Nacht-und-Nebel“, s. Häftlinge Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) 171 Nationalsozialistischer Lehrerbund 231 NS-Frauenschaft 298 Nürnberger Gesetze 41, 237–239 Oberbürgermeister, s. Bürgermeister Oberpräsident, s. Oberpräsidium Oberpräsidium 26, 149 der Rheinprovinz 27, 39 f., 229 Organisation Todt (OT) 43, 96 Ortsbauernschaft / -führer 120, 173, 177, 183 Ortsgruppenleitung / -leiter 177, 313 Ostarbeiter, s. Fremdarbeiter
|
Polen-Erlasse 115 Politische Polizei 17, 24 f., 27, 30 f., 33, 38, 111, 200, 207, 294 Polizeidienststellen 27, 34, 36 Poste d’Alerte Luxembourg (Polux) 21, 212–221 Presse 205, 229 Die Junge Garde 315 Kölnische Zeitung 38, 74 Paulinusblatt 18, 81–93, 233 Trierische Landeszeitung 84, 93, 235 Trierer Nationalblatt 229, 235–237 Trierischer Volksfreund 84, 235 Volkswacht 84, 234 Randgruppen 26, 191 „Rassenschande“ 237 Rasse- und Siedlungshauptamt der SS (RuSHA) 19, 116, 118, 125 f., 128 Regierungsbezirk 15, 17, 24, 26 f., 31, 34, 38–41, 61, 141, 149 f., 154, 157, 166, 168, 170, 172, 175 f. 179 f., 184 f. Regierungspräsident, s. Regierungspräsidium Regierungspräsidium 26, 35, 149, 154, 230, 247, 312 des Regierungsbezirks Trier 34, 39, 92, 149, 154, 229, 312 Reichsanwalt(schaft) 69 f., 160, 216, 219 f. 297, 301 Reichsarbeitsdienst (RAD) 44 Reichsautobahn (RAB) 47, 140 Reichsbahn 12 f., 19, 153 f., 170, 213 Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 228 f., 296 Reichsbürgergesetz 194, 237, 245 Reichserbhofgesetz 20, 170–172, 179 f. Reichsflaggengesetz 237 Reichsfluchtsteuer 238 Reichskonkordat 39, 86, 88, 232, 310 Reichsnährstand 168–171, 173–175, 177, 179 f., 183, 185 Reichspogromnacht 21, 41, 225, 240 f., 244 Reichspressekammer 84, 91–93 Reichssicherheitshauptamt (RSHA) 44, 102, 127, 149, 206, 208 f., 216, 304 Reichstagsbrandverordnung 81, 84 Remilitarisierung des Rheinlandes 43 Résistance / Resistenz, s. Widerstand Revolution 1848/49 26, 28, 31
363
364
|
Register
Rheinlandbesetzung 211 Rheinstaat 28 Röhm-Putsch 36 Rotfrontkämpfer 228 Rundfunkverbrechen 18, 63–79, 101, 133, 308 Radio Moskau 63, 67 f., 70, 158, 162 Rundfunkverordnung 18, 64 f., 68, 70 f., 73–77, 79 Rüstungsindustrie 139, 183, 247 Saarabstimmung 18, 38 f., 56, 60, 84 f., 153, 211, 306, 316 Saarfrage, s. Saarabstimmung Schule 226, 232, 238, 250, 313 f. Konfessionsschulen 40, 132, 232, 312, 314 Schutzhaft 32, 35 f., 155, 194, 218, 236, 240, 316 Schutzhäftling 32 f., 97, 297 Schutzpolizei 294 Schutzstaffel (SS) 34, 36, 50, 57 f., 65, 75, 103, 112 f., 116, 128, 150, 153, 209 f., 214, 217, 228–230, 275, 294, 299, 304, 310 Separatismus 28 f., 228 Service de Renseignements (S.R.) 212 Sicherheitsdienst des Reichsführers SS (SD) 15, 37, 45, 48, 59, 100, 132, 153, 204, 208–210, 213 f., 220, 222, 304, 316 Sicherheitspolizei (Sipo) 37, 45, 48, 63, 100, 147, 208, 210, 214, 304 Sinti und Roma („Zigeuner“) 249, 256 Sittlichkeitsprozesse 39, 90, 92, 312 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 29, 149, 150, 188, 228, 230, 234, 296 Spionage 46, 101, 151, 205, 207–209, 218–220 Spionageabwehr 20, 37, 59 f., 204, 210, 217 Staatspolizeileitstelle 40 f., 207 f. „Stahlhelm“ 230, 310 Stalag, s. Lager, Kriegsgefangene Strafanstalt Wittlich, s. Gefängnis Sturmabteilung (SA) 34, 36, 228230, 235 f., 240, 268, 296–298, 310 Tagesrapporte 19, 129 f., 132–134, 136, 138–141, 143, 145 Überwachung 12, 20, 23 f., 26 f., 29 f., 35, 37, 41 f., 45, 60, 129 f., 132–143, 145, 147 f.,
153–155, 163–166, 168 f., 176, 183, 185, 191 f., 194–196, 201, 205, 209, 213, 215, 219, 271 f., 295, 306, 312 Umsiedlung 105, 279 „Verbotener Umgang“ 119 Vereine Bauernvereine 28 Katholische Vereine 26, 229, 232, 311 f. Verhaftung 19, 31, 46, 50, 101, 110 f., 117, 120, 123, 132, 136, 140, 150, 157, 159 f., 210, 286, 297, 299 f., 314 Vernehmung 14, 67, 71 f., 75, 100, 104, 108–110, 127, 157–159, 193–200, 215–220, 278, 283, 286 f., 296, 298, 309 Vernehmungskommando Hinzert 14, 18, 49 f., 95, 99–104, 106, 110–113, 217 f., 294, 305 Wittlich 47 Verordnung zum Schutze des Deutschen Volkes 40, 85 „Verreichlichung“ 30, 36, 41 Versailler Vertrag 38, 83 Verstaatlichung 28 Verwaltungsberichte, s. Lageberichte Villa Pauly, Luxemburg 28, 217, 285, 294 Villa Seligmann, Esch-sur-Alzette 285, 294 V(ertrauens)-Person 24, 42 f., 59, 144, 150–152, 205, 217 f., 222, 305–309, 316 Völkerbund 37, 83, 315 Volksdeutsche Bewegung (VdB) 279 f. Volksgemeinschaft 23, 36, 127, 143, 148, 162, 182 f., 187, 269, 284 Vormärz 26 Wehrmacht 20, 46, 75, 100, 143, 187, 193, 195, 199 f., 204, 209 f., 213, 217, 220 f., 275, 280, 284, 307 Wehrpflicht 49, 189, 191, 279, 302 Weimarer Republik 27, 30, 33, 60, 150, 188 f., 226–228, 232–234, 238, 296 Weltkrieg Erster 82, 162, 183, 211, 281, 287 Zweiter 12, 16, 53, 64, 130, 212, 242, 247, 275–277, 281, 291, 305, 310, 314 Westwall 43 f., 96, 140, 185, 213 Widerstand 11, 18, 49 f., 53, 58, 97, 100 f.,
Register
106 f., 111–113, 130, 133, 137–139, 142 f., 147 f., 150, 166 f., 169, 172, 177, 180, 182, 217, 228, 232 f., 278, 286, 290–292, 294–296, 298, 304, 311 „Wiedereindeutschung“ 19, 115–120, 122–128, 139 Wiedereindeutschungsverfahren, s. „Wiedereindeutschung“ Wiedergutmachung 262, 272 Winterhilfswerk (WHW) 171 f., 178
Wirtschaftliche Existenzvernichtung 21, 261, 263 f., 267, 272 f. W-Person 42, 215, 306 f. Zensur 18, 81, 85–87, 89, 93 Zentrumspartei 40, 82, 228–232 Zwangsarbeit(er) 12, 19, 47, 74, 97, 115, 117, 119, 122, 124–126, 128 f., 136, 139–144, 197 f., 247, 252, 288, 291, 306 f.
|
365
ISTVÁN DEÁK
KOLLABORATION, WIDERSTAND UND VERGELTUNG IM EUROPA DES ZWEITEN WELTKRIEGES AUS DEM UNGARISCHEN ÜBERSETZT VON ANDREAS SCHMIDT-SCHWEIZER
In den vom nationalsozialistischen Dritten Reich besetzten Ländern und in den verbündeten Staaten verliefen die Grenzen zwischen passiver Anpassung, aktiver Kollaboration und Widerstand ebenso fließend wie jene zwischen Rache und Vergeltung im und nach dem Krieg. István Deák verbindet diese Themenfelder zu einer Gesamtdarstellung über die unterschiedlichen Ausprägungen komplexer Phänomene in schwierigen Zeiten. 2017. 367 S. 12 S/W-ABB. UND 5 KARTEN GB. 135 X 210 MM. ISBN 978-3-205-20218-9
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, a-1010 wien, t: + 43 1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar
JOHANNES KOLL (HG.)
„SÄUBERUNGEN“ AN ÖSTERREICHISCHEN HOCHSCHULEN 1934–1945 VORAUSSETZUNGEN, PROZESSE, FOLGEN
Austrofaschismus, Nationalsozialismus, Entnazifi zierung nach der Befreiung – die mehrfachen Regimewechsel der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hatten auch auf die Hochschulen in Österreich gravierende Auswirkungen. ‚Säuberungen‘ beim Personal und bei den Studierenden sollten jeweils zu einer Neuausrichtung der Gesellschaft beitragen. Unter welchen Voraussetzungen, auf welche Weise und mit welchen Folgen der politisch gewollte Eingriff in die Zusammensetzung von Lehrkörper und Hörerschaft vor sich ging, wird in diesem Buch untersucht. Neben der Darstellung allgemeiner Rahmenbedingungen stehen Fallbeispiele zu einzelnen Hochschulen und die Vorstellung von Einzelschicksalen im Mittelpunkt. Dadurch werden Vergleiche zwischen den Hochschulen und zwischen den verschiedenen Regimen möglich. 2017. 540 S. 21 S/W-ABB. GB. 170 X 240 MM. | ISBN 978-3-205-20336-0
böhlau verlag, wiesingerstrasse 1, a-1010 wien, t: + 43 1 330 24 27-0 [email protected], www.boehlau-verlag.com | wien köln weimar

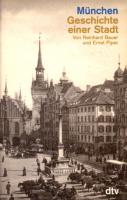
![Aristophanes und Eupolis: Zur Geschichte einer dichterischen Rivalitat: Zur Geschichte einer dichterischen Rivalität [Reprint 2012 ed.]
3110191393, 9783110191394](https://dokumen.pub/img/200x200/aristophanes-und-eupolis-zur-geschichte-einer-dichterischen-rivalitat-zur-geschichte-einer-dichterischen-rivalitt-reprint-2012nbsped-3110191393-9783110191394.jpg)




![Die Prüfung: Zur Geschichte einer pädagogischen Technologie [1 ed.]
9783412512095, 9783412511838](https://dokumen.pub/img/200x200/die-prfung-zur-geschichte-einer-pdagogischen-technologie-1nbsped-9783412512095-9783412511838.jpg)


![Die Gestapo Trier: Beiträge zur Geschichte einer regionalen Verfolgungsbehörde [1 ed.]
9783412510077, 9783412509149](https://dokumen.pub/img/200x200/die-gestapo-trier-beitrge-zur-geschichte-einer-regionalen-verfolgungsbehrde-1nbsped-9783412510077-9783412509149.jpg)