Choreographien der Homogenisierung: Zur Verkörperung von Gleichheiten in der Grundschule 9783839455425
Der Umgang mit scheinbar gegebenen, weiter zunehmenden Heterogenitäten in schulischen Lerngruppen wird wirkmächtig disku
144 19 5MB
German Pages 198 Year 2021
Polecaj historie
Table of contents :
Inhalt
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
I THEORIE
1. Homogenisierung als Folie der Differenzierung: eine Hinführung
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm – theoretische Annäherungen
II EMPIRIE
3. Methodologie
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
7. Zusammenfassung
Literatur
Citation preview
Valerie Riepe Choreographien der Homogenisierung
Pädagogik
Valerie Riepe, geb. 1988, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Art&Design an der University of Europe for Applied Sciences, Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Theoretisierung von (Un)Gleichheit sowie Kulturund Sozialtheorie von Körper und Verkörperung.
Valerie Riepe
Choreographien der Homogenisierung Zur Verkörperung von Gleichheiten in der Grundschule
Lüneburg, Leuphana Universität, Dissertation, 2019
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2021 transcript Verlag, Bielefeld Alle Rechte vorbehalten. Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen. Umschlaggestaltung: Maria Arndt, Bielefeld Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar Print-ISBN 978-3-8376-5542-1 PDF-ISBN 978-3-8394-5542-5 https://doi.org/10.14361/9783839455425 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. Besuchen Sie uns im Internet: https://www.transcript-verlag.de Unsere aktuelle Vorschau finden Sie unter www.transcript-verlag.de/vorschau-download
Inhalt
Danksagung ........................................................................ 7
I THEORIE 1.
Homogenisierung als Folie der Differenzierung: eine Hinführung .............13
2.
Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm – theoretische Annäherungen .................................................. 19 2.1. Subjektpositionen innerhalb der Institution Schule: zwischen Homogenisierung und Individuierung ................................ 20 2.2. Soziale Choreographien: von der Tanz- in die Geistes- und Sozialwissenschaft .......................... 58
II EMPIRIE 3. 3.1 3.2 3.3 3.4
Methodologie ................................................................ 67 Fokussierte Ethnographie ..................................................... 70 Ethnographische Collage ..................................................... 72 Feld und Datenkorpus ........................................................ 96 Décollagen ................................................................... 101
4. 4.1 4.2 4.3
Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen.................107 Nach außen gerichtetes U ................................................... 108 Gruppentische ............................................................... 113 Test ......................................................................... 118
5.
Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische........ 127
5.1 In Reihen ................................................................... 128 5.2 Stuhlkreis .................................................................. 139 5.3 Sitzkreis ..................................................................... 151 6.
Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische ............................................ 159
7.
Zusammenfassung.......................................................... 173
Literatur .......................................................................... 181
Danksagung
Dieses Buch und der damit verbundene, methodisch explorative Zugang, konnten nur durch die kritische Unterstützung und Mitarbeit engagierter Kolleg*innen und Freund*innen auf den Weg gebracht werden. Für die Ermöglichung und umfassende Begleitung der wissenschaftlichen Arbeit möchte ich zuallererst Cornelie Dietrich danken, deren Denk- und Herangehensweisen mich stets inspirieren und stark geprägt haben. Genauso bin ich Anke Wischmann zu großem Dank verpflichtet, unter anderem für ihren unermüdlichen Elan, für aufmunternde Worte und kritische Nachfragen. Auch Kerstin Rabenstein hat sich mit meinem Vorhaben intensiv auseinandergesetzt und dieses unterstützt, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Danke, an die Teilnehmer*innen diverser Forschungskolloquien und Interpretationswerkstätten für ihren kritischen Blick und die gemeinsamen Anstrengungen, darunter insbesondere Jutta Wedemann, Lisa-Katharina Heyhusen, Niels Uhlendorf, Isabel Wullschleger, Anna Lettow und Vanessa Friedberger. Für die Lektüre und damit verbundene Geduld danke ich zudem Maike Möller und Anne Brüggemann. Danke, Isabel Schultheis. Zu guter Letzt bedanke ich mich bei meiner Familie, für die tatkräftige Unterstützung in vielerlei Hinsicht und bei meinem Sohn Julius im Besonderen. Dankeschön! Valerie Riepe, Oktober 2020
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Fotoaufnahme Nr. 35 .................................................. 86 Abbildung 2: Kriterien der Berechnung des Sozialindex für die Grundschulen (Eigene Abbildung nach: Drucksache 20/7094 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode, Anlage 3) .............................................. 99 Abbildung 3: Videostill: Museum Jorn, (2014): Décollage............................. 102 Abbildung 4: Grundformen geradliniger und kurviger Raumwege (Eigene Abbildung nach Haselbach, 1971:66) .......................................................... 105 Abbildung 5: Schema – nach außen gerichtetes U ................................. 108 Abbildung 6: Schule A – nach außen gerichtetes U ................................. 108 Abbildung 7: Schema – Gruppentisch ............................................... 114 Abbildung 8: Schule B – Gruppentische ............................................. 114 Abbildung 9: Schule B – Test ....................................................... 118 Abbildung 10: Schule A – Test ....................................................... 118 Abbildung 11: Schema – in Reihen ................................................. 128 Abbildung 12: Schule B – in Reihen ................................................. 128 Abbildung 13: Bewegungsdiagramm in Höhen ...................................... 133 Abbildung 14: Hylia in Reihen ...................................................... 134 Abbildung 15: Alessandro in Reihen ................................................ 135 Abbildung 16: »Die Liste« oder »Startklar zum Lernen« ............................ 136 Abbildung 17: Schema – Stuhlkreis ................................................. 139 Abbildung 18: Schule B – Stuhlkreis ................................................ 139 Abbildung 19: Schema – Kinositz ................................................... 146 Abbildung 20: Schule A – Kinositz .................................................. 146 Abbildung 21: Schule B – Flöten .................................................... 149 Abbildung 22: Schema – Sitzkreis .................................................. 151 Abbildung 23: Schule A – Sitzkreis .................................................. 151 Abbildung 24: Schule A – Dezentrale Körperordnung 1 .............................. 159 Abbildung 25: Schule A – Dezentrale Körperordnung 2 .............................. 160 Abbildung 26: Unter dem Tisch ..................................................... 161
10
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 27: Hinter dem Vorhang .................................................. 161 Abbildung 28: Schule B – Hexagon ................................................. 163 Abbildung 29: Visueller Raumnutzungsvergleich Kreis zu Hexagon .................. 163 Abbildung 30: Höhenachse Versuchsanordnung .................................... 166 Abbildung 31: Plakat – Braunbär ................................................... 169 Abbildung 32: Jonte, Henri und der Braunbär ....................................... 171
I THEORIE
1. Homogenisierung als Folie der Differenzierung: eine Hinführung
Die kulturelle Praxis der Benennung von ›Gleichen‹ und ›Ungleichen‹ ist in unserem alltäglichen Leben fest verankert. Schon Kleinkinder sortieren Farben, Lebensmittel oder Spielzeuge und werden in dieser Differenzierung von ihren erwachsenen Ansprechpartner*innen zumeist bestärkt. Der Einbezug des (kindlichen) Körpers in diese Kategorisierung sowie Zugehörigkeitsbeziehung erfolgt dabei nicht ausschließlich explizit über die Ansprache: »Du bist ja schon groß«, sondern genauso über nicht sprachliche körperliche Praktiken, die in sozialen Handlungen wirksam werden. Spiele wie »Möhrenziehen«1 , tragen beispielsweise nicht nur zur körperlichen Einübung einer hierarchisierten Beziehung von Leiter*innen und Geleiteten, Gewinner*innen und Verlierer*innen, innen und außen, sondern genauso zu Zugehörigkeits- und Differenzerfahrungen bei. Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht, so halten Dietrich und Riepe (2019) fest, gilt die konstruktivistische Grundüberzeugung, dass Differenzen anhand von Kategorien wie Geschlecht, Migrationserfahrung, sprachliche oder religiöse Zugehörigkeit, Alter sowie Leistung nicht in ontologischer Form gegeben sind, dabei inzwischen als Ausgangspunkt der meisten qualitativ-rekonstruktiven Untersuchungen der Differenzforschung (Rademacher/Wiechens, 2001; Hormel/Emmerich, 2013; Diehm/Kuhn/Machold, 2013; Dietrich/Wischmann, 2016; Stošić, 2016).
1
Alle Kinder legen sich für dieses Spiel kreisförmig auf den Bauch auf den Boden mit Blick in die Kreismitte und verhaken ihre Arme miteinander. Die Gruppenleiter*in versucht nun die Kinder auseinander zu ziehen – ein Kind an den Beinen heraus zu ziehen. Umso mehr Kinder wie eine Möhre aus der Erde gezogen werden, umso mehr Kinder ziehen an den Beinen der verbleibenden Möhren-Kinder bis am Ende nur noch zwei übrig sind. Diese zwei Kinder haben das Spiel gewonnen.
14
Choreographien der Homogenisierung
»Vielmehr erlangen diese Differenzen in Abhängigkeit von und Interdependenz mit den jeweiligen sozialen Umwelten erst ihre je besonderen Ausprägungen. Diese Betonung der prozeduralen und dynamischen Aspekte, macht die Fokussierung der Mikroprozesse der Heterogenisierung als ›doing difference‹ [(West/Fenstermaker, 1995) V.R.] im pädagogischen Feld nötig, um die interaktive Generierung hierarchisierter Differenzen, die Beteiligungsweisen der unterschiedlichen Akteur*innen sowie auch die unterschiedlichen Rollen von Institution und Situation rekonstruieren zu können.« (Dietrich/Riepe, 2019: 670) Die der Heterogenisierung komplementär zugehörige Dimension der Homogenisierung – als Herstellung und Entstehung von Spielarten der Gleichheit – ist dabei eigens kaum empirisch untersucht, wie vor allem Cornelie Dietrich (2017) (motiviert durch theoretische Überlegungen von Prengel, 2010; 2014 und Wenning/Lutz, 2001) im Rahmen ihres Beitrags »Im Schatten des Vielfaltsdiskurses: Homogenität als kulturelle Fiktion und empirische Herausforderung« eindrücklich zeigt, oder bisher vor allem aus bildungspolitischer, historischer sowie schulorganisatorischer Perspektive befragt worden (Wenning/Lutz, 2001; Gomolla/Radtke, 2007; Budde, 2012; Hummrich, 2016). Bevor Abstände gemessen, Niveaus bestimmt, Besonderheiten fixiert und somit Unterschiede benannt und zueinander in ein (hierarchisiertes) Verhältnis gesetzt werden können, besteht jedoch erst einmal die Notwendigkeit der Herstellung eines ›gleichen‹ Bezugspunktes – einer Norm, von der ausgehend überhaupt erst differenziert werden kann. Denn: »Ungleichheit gibt es nicht an sich, sondern immer nur relational zwischen (mindestens) zwei Vergleichsdingen, die im Hinblick auf ein Drittes als entweder gleich oder verschieden erkannt, beschrieben oder produziert werden.« (Dietrich, 2017:124) So liegt dieser Forschungsarbeit die Überzeugung zu Grunde, dass doingdifference-Analysen nur im Horizont von Analysen eines doing-sameness greifen können. »Homogenität wird so als zugleich notwendige wie auch illusionäre Folie für doing-difference-Prozesse verstanden.« (Dietrich/Riepe, 2019: 670) Notwendig, hier innerhalb der Logik des curricularen Lernens, um dann eine Gleichbehandlung nach dem Leistungsprinzip legitimieren zu können (Dietrich, 2017). Illusionär, im Sinne Pierre Bourdieus (1999), als der Glaube
1. Homogenisierung als Folie der Differenzierung: eine Hinführung
daran, dass es tatsächlich so sei, wie es scheint. Als Anpassung der Deutung von Wirklichkeit zugunsten der Reproduktion des Spiels. Das Gleichheitsverständnis der Illusio, das diesem Vorhaben zugrunde liegt, lässt sich dabei auf einen machttheoretischen Zugang zurückführen: »Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven ›Polizei‹ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muss.« (Foucault, [1966] 2003 :25) So differenziert sich innerhalb der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft vor allem seit den 2000er Jahren eine machtsensible Diskussion sensu Michel Foucault immer weiter aus, insbesondere in der Bildungs- und Erziehungsphilosophie (z.B. Ricken/Rieger-Ladich, 2004; Ricken/Balzer, 2012), aber auch als Grundlage empirischer Auseinandersetzungen (z.B. Schmidtke, 2009; Kelle, 2010; Reh/Rabenstein/Fritzsche/Idel, 2015; Wolter, 2018). Auch die vorliegende Forschungsarbeit soll das Anregungspotential der Schriften Foucaults für die pädagogische Reflexion zu erproben suchen. Der Anknüpfungspunkt »Körper« ermöglicht dabei im praxeologischen Sinne, (pädagogische) Wirklichkeiten nicht länger allein als Text zu lesen und zu identifizieren, sondern die Praktiken des Repräsentierens in den Mittelpunkt zu rücken (Wulf/Zirfas, 2007; Budde/Bittner/Bosen/Rißler, 2018). Darüber hinaus kann durch das Performative (Butler, 1991) die ästhetische Dimension sozialer Arrangements fokussiert werden: Momente der Herstellung und konkrete Handlungsvollzüge in ihnen, deren Dynamiken, Materialien, Rahmungen sowie Aspekte der Körperlichkeit, Dramaturgie und Inszenierung. Der Fokus auf den Prozess der Herstellung von (illusionärer) Gleichheit, sowie das Erläutern und Anwenden eines innovativen Zugangs zu den Analysen dieser Vorgänge über die Ästhetik der Verkörperung im Rahmen der Sozialen Choreographie (Hewitt, 2005), ist dabei ein besonderes Anliegen dieser Abhandlung. Als Soziale Choreographien werden hier regelmäßig ablaufende Bewegungsformen bezeichnet, die für alle Beteiligten selbstverständlich (geworden) sind. Als verlässliche Ordnungen strukturieren sie die Bewegungen einer Gruppe im Raum nach bestimmten Regeln und sind als solche auch bedeutsam für die jeweilige soziale Ordnung im (pädagogischen) Feld (Hewitt, 2005; Klein, 2010). Die Verbindungen zwischen beidem, der Bewegung als solcher, ihrer Regelhaftigkeit und dem, was sie über das soziale Setting sagt bzw. wie
15
16
Choreographien der Homogenisierung
sie dieses mit hervorbringt, soll somit über den Zugang der Sozialen Choreographie erfasst werden können (Dietrich/Riepe, 2019). Soziale Choreographie kann dann zu einer analytischen Kategorie werden, die das Ästhetische im Sozialen sucht (Hewitt, 2005). Dies erscheint insofern besonders vielversprechend, als dass Momente der Interaktion und Kollision der vitalistischen2 und materialistischen3 Dimensionen neu fokussiert werden können: »Die Beweglichkeit der Bewegung kann somit auch dort besonders ernst genommen werden, wo sie sich eindeutigen Bedeutungszuschreibungen entzieht« (Dietrich/Riepe, 2019: 676) und so die körperlich-materiale Seite der Homogenisierung thematisiert. Auf der Basis eines kulturwissenschaftlich performativen Verständnisses des pädagogischen Feldes (Reckwitz, 2003; Wulf/Zirfas, 2007) widmet sich die vorliegende Darstellung also der Beobachtung, Identifizierung und Analyse von homogenisierenden Formierungen von Kinder-Körpern, innerhalb einer ethnografisch angelegten Studie. Diese wurde in zwei dritten Klassen unterschiedlicher Grundschulen im großstädtischen Raum durchgeführt. Die Leitfragen, die durch das theoretische und empirische Material führen sollen, lauten dabei: Wie stellt sich Gleichheit – über die Körperlichkeit der Kinder – innerhalb der jeweiligen, beobachteten Klasse her? Welche Gleichheitsvorstellungen werden dabei aufgerufen? Wie (re)agieren und widerstehen die Kinder in dem Prozess der Herstellung dieser Gleichheitsvorstellungen? Und welche Art von Abweichung wird innerhalb dieser Praktiken von den Beteiligten akzeptiert oder kann im Rahmen der spezifischen Unterrichts-Situation akzeptiert werden? So handelt es sich um eine zweigeteilte Forschungsarbeit, die in ihrem ersten Teil eine (macht-)theoretische Rahmung im Anschluss an Michel Foucault herstellen will. Über die Erläuterung seiner These der Macht als praktisches Prinzip (Foucault, [1975] 1994; Foucault [1976] 2012) sollen einleitend Gedanken zur historischen Herleitung von Prozessen von Normierungen und Homogenisierung der Körper als Ausgangspunkt für Differenzierung darge-
2
3
Vitalismus hier im Sinne der Ideologie physischer Immanenz, innerhalb derer der Körper und die Körper-Bewegung den finalen Punkt des Widerstandes (sozialen und diskursiven Determinanten gegenüber) bilden (Hewitt, 2005). Materialismus hier im Sinne des Körpers als Material der Aufführung vorgeschriebener bestimmender Diskurse (Hewitt, 2005).
1. Homogenisierung als Folie der Differenzierung: eine Hinführung
stellt werden, um im Weiteren eine Grundlage für die Identifikation der verschiedenen machtvollen Dimensionen von Gleichheit bieten zu können. Wurde den Thesen Foucaults noch bis in die späten 1980er Jahre – gerade auch innerhalb der Erziehungswissenschaft – eine lähmende Aussichtslosigkeit vorgeworfen (Schäfer, 2004), so sind es im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Positionen Judith Butlers zur Wiederholung der Norm und zum Widerstand, die Foucaults Gedanken erweitern sollen. Besonders Butlers produktiver Widerstandsbegriff (Butler, 1991) soll dabei eine zentrale Rolle spielen, um mögliche Spielräume und Grenzen der machtvollen Gleichheits-Formationen erörtern zu können. Über den Zugang der Pädagogik des Performativen, soll schließlich der Bezugspunkt »Körper« und seine erziehungswissenschaftlich geprägte Bedeutung innerhalb der vorliegenden Arbeit erhellt werden, um anschließend die Dimensionen von Homogenität nach Cornelie Dietrich (2017) differenziert nachvollziehen und Pierre Bourdieus Theorie der Illusio (Bourdieu, 1999) innerhalb der Deutung von Homogenität verorten zu können. Dieser theoretische Rahmen soll dann zu Gedanken über den Unterschied von Gleichheitsdimensionen des doing-sameness, im Sinne einer Verkörperung von ›(Merkmals-)Gleichheit‹ und doing-equality, im Sinne einer ›Gleichberechtigung‹ und einer Vorstellung von ›Gerechtigkeit‹ anregen. Unter Bezugnahme auf das Konzept der Sozialen Choreographie des Tanzwissenschaftlers Andrew Hewitt (2005) soll anschließend ein neuartiger Zugang zu dem empirischen Material geschaffen werden, der Bewegungsfigurationen in den Mittelpunkt stellt. Im zweiten Teil der Forschungsarbeit führt ein Exkurs über die Methodologie, die fokussierte Ethnographie und Ethnographische Collage im Besonderen, schließlich zu der Darstellung des empirischen Materials. So sind durch drei Beobachtungsphasen, im Umfang von insgesamt sechs Wochen, Feldnotizen und daraus entstandene Beobachtungsprotokolle im Umfang von 324 Seiten und 182 Fotoaufnahmen entstanden, deren Ergebnisse im Sinne von dicht beschriebenen Portraits im Rahmen von drei Kategorien von Körperformationen vorgestellt werden sollen: Erste Position – Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen, Zweite Position – verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tischen, Dritte Position – dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische – und allen Positionen inhärent: der Widerstand. Im Unterschied zu dem Begriff der »Sitzordnung« sollen über den Begriff der Körperformation jene Beweglichkeiten mitgesprochen werden, die über die bloße Haltung des Sitzens innerhalb der jeweiligen Anordnungen
17
18
Choreographien der Homogenisierung
hinausgehen und gleichzeitig die Position der Lehrer*innen mit einbeziehen, die klassisch häufig als stehend gegenüber den sitzenden Kindern verstanden wird. Verdichtet werden die Ergebnisse dieser Portraits dann im Rahmen der abschließenden Zusammenfassung.
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm – theoretische Annäherungen
Die theoretische Fassung dieser Arbeit soll im Folgenden über den Bezugsrahmen der Schule als Ort der Homogenisierung eingeführt und über die poststrukturalistischen Betrachtungen Michel Foucaults und Judith Butlers zur Homogenisierung als Normalisierung ausbuchstabiert werden. So betrachtet Foucault das machtvolle Vergleichsfeld, das Individuen untereinander und im Hinblick auf bestimmte Gesamtregeln differenziert. Dabei rückt er diejenigen Momente in den Fokus, die homogenisierend, normierend und normalisierend wirken und somit eine Differenzierung und Ausschließung erst ermöglichen (Foucault, [1975] 1994). Foucaults Positionen sollen im Rahmen dieser Abhandlung dazu beitragen, nicht vorschnell in dichotome Beschreibungsmuster des vorliegenden Materials zu verfallen, sondern den komplexen Verflechtungen von Machttechniken, Wissensformen und Subjektivitätstypen, die pädagogische Handlungsfelder charakterisieren (Ricken/Rieger-Ladich, 2004: 9), differenzierter nachspüren zu können. Dabei steht allem voran die Erläuterung der konzeptionellen Fassung des Foucault’schen Machtbegriffes (Foucault, [1975] 1994) innerhalb der vorliegenden Abhandlung, sowie die »Entdeckung des Körpers« (ebd.) im Rahmen seiner historischen Analysen im Fokus. Diese werden anschließend durch Judith Butlers Perspektiven auf Subjektivation als Ermöglichung von Handlungsfähigkeit und Körperlichkeit erweitert. Eine Einbettung dieser Grundannahmen in den erziehungswissenschaftlichen Forschungskontext, führt dann zu einer klareren Positionierung dieser Arbeit in ihrer praxeologischen Orientierung sowie zu einer Eröffnung der erziehungswissenschaftlichen Dimensionen von Gleichheit nach Cornelie Dietrich (2017). Der Butler’sche Widerstandsbegriff soll dann die Perspektive des Forschungsvorhabens auf die Um-
20
Choreographien der Homogenisierung
deutung der Norm abrunden und Momente der Verkörperung und ihre Ästhetik mit Hilfe des Konzepts der Sozialen Choreographie zugänglich machen.
2.1.
Subjektpositionen innerhalb der Institution Schule: zwischen Homogenisierung und Individuierung
Besonders innerhalb der Institution Schule stehen Schüler*innen dauerhaft im Widerstreit zwischen dem homogenisierenden Druck, so zu sein wie alle Anderen und dem individuierenden Streben nach Individualität. So ist die ›gute Schüler*in‹ ruhig, fleißig und leistungsstark, soll darüber hinaus aber auch mit innovativen Ideen glänzen, sich – aus Perspektive der Lehrperson – positiv aus der Klassengemeinschaft hervorheben und im Gedächtnis bleiben (Breidenstein, 2006). Der Vollzug von Subjektivierung im Unterricht lässt sich dabei zum Beispiel mit Pille und Alkemeyer (2018) als Norm der Anerkennbarkeit denken, die im Unterricht sowohl aufgerufen als auch überhaupt erst hervorgebracht wird. Dabei realisieren sich Subjektivierungsprozesse inmitten von und mittels Dingen und Körpern vor dem Hintergrund je spezifischer Klassenidentitäten als Arrangement verbindlicher, schulischer Anerkennungsordnung: »Indem sich Schüler*innen und Lehrer*innen in den sozio-materiellen Arrangements des Unterrichts engagieren und die Welt des Klassenzimmers auf schultypische Weise beleben, vollziehen sie performativ eine normative Struktur des folgenden Lernens und führenden Lehrens, inserieren sich zugleich in dieser Struktur und treten damit als Schul-Subjekte in Erscheinung.« (ebd.: 168f). Die schulische Produktion von Subjektivität untersucht auch Wolter (2018) in Bezug auf Disziplinierungspraktiken, die er als »Felder der Gängelung sozialer Vorgaben, die ebenso Beschränkungen wie auch Ermöglichungen von In-Verhältnis-Setzungen und sozialer Bezugnahmen bedeuten« (ebd.: 99) versteht. Dabei identifiziert er Schule als Ort der Herrschaftsproduktion durch Gewöhnung an Regeln und Ordnung und Schüler*innen und Lehrer*innen in der Gewöhnung an die Unterwerfung unter ein abstraktes Prinzip. Nicht nur in Bezug auf die Erwartungshaltung an Schüler*innen, sondern auch auf bildungsorganisatorischer Ebene und in weiten Bereichen der Fachdidaktiken kann – als Antwort auf die zunehmende (Leistungs-)Heterogenität von Schulklassen – eine spannungsvolle Entwicklung von zunehmen-
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
der Standardisierung einerseits und intensivierter Individualisierung andererseits beobachtet werden. Ihre unterschiedlichen Referenzrahmen erscheinen dabei jedoch als theoretisch nicht hinreichend systematisiert und damit nicht transparent diskutierbar zu sein (Dietrich, 2017). Widmen sich kritische Stimmen im Kontext zunehmender Heterogenität innerhalb der Institution Schule zum Beispiel dem individualisierten Unterricht, gelangen dabei solche reformpädagogischen Unterrichtssettings in den Fokus, die den Schüler*innen größere individuelle Spielräume für das Lernen ermöglichen sollen (Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projektarbeit etc.). Aber auch diese Lehr- und Lernformen kommen, wie Reh und Rabenstein gezeigt haben, nicht ohne Standardisierung aus (vgl. Rabenstein/Reh 2008; Rabenstein/Reh/Steinwand, 2012). Sie bringen lediglich eine verschobene Normalitätserwartung hervor, die sich durch ein hohes Maß an Aktivität, Neugierde, Selbstdisziplinierung und selbst organisierter Aufmerksamkeit auszeichnet. Den Standardisierungsbestrebungen als solchen widmet sich Annedore Prängel im Dialog mit Bildungsphilosophie und Gerechtigkeitsphilosophie, um herauszustellen, dass Heterogenität, wie sie uns im grundschulpädagogischen Kontext beschäftigt, nur im Horizont von Homogenität, Ungleichheit nur im Horizont von Gleichheit zu diskutieren ist (z.B. Pregnel, 2010; 2014). Trotzdem bleibt die Homogenität als das Fundament aller Differenzierungen – die Skala der Normverteilung, auf der alle Unterscheidungen festgeschrieben werden – als eigener Schauplatz überwiegend unberührt (Budde, 2012; Hummrich, 2016; Dietrich, 2017). Das Vorhaben dieser Arbeit soll es deshalb sein, Homogenität auf theoretischer und empirischer Ebene zu fokussieren. Um eine solche Analyse innerhalb des erhobenen Materials vornehmen zu können, ist es unumgänglich vorerst einige Grundannahmen des hier vorliegenden Theoriekonstruktes zu umreißen. Diesem voran steht die theoretische und empirische Erforschung der Homogenitäts-Vorstellungen, -Erwartungen, -Fiktionen und -Praktiken (Dietrich, 2017). Zu diesem Zweck soll im Folgenden das machtvolle Geflecht von Subjektivierung/Subjektivation, Subjektpositionen und Homogenität mit Hilfe der Konzepte Michel Foucaults und Judith Butlers dargestellt werden, um anschließend – durch eine Rückbindung auf die aktuelle Schulforschung – mit Hilfe der Impulse von Cornelie Dietrich – deren Spezifika in Bezug auf die Institution Schule herauszuarbeiten.
21
22
Choreographien der Homogenisierung
2.1.1.
Von Subjektivation zu Subjektivierung und Subjektpositionen: Eine philosophische Betrachtung
Innerhalb der Erziehungswissenschaft führt die Thematisierung von Machtverhältnissen direkt in das Zentrum des modernen Erziehungsverständnisses: »Pädagogische Theorien handeln daher immer auch von dem Problem der Legitimation der beanspruchten Macht angesichts der allgemein in Anspruch genommenen Selbstbestimmung. Sie können als Versuche der Grenzbestimmung eigener Machtansprüche gelesen werden […].« (Schäfer, 2004: 158) So wird pädagogisches Handeln – innerhalb der Entwicklung der Pädagogik der Aufklärung von Locke [1693] (2007), über Rousseau [1762] (1983) und Kant [1784] (1999) – zum Drahtseilakt zwischen machtvollen Positionen auf dem Weg zum »souveränen Subjekt« (ebd.; vgl. auch Habermas, [1981]1995; Zirfas/Jörissen, 2007). Dass den Ideen Michel Foucaults dabei innerhalb der deutschsprachigen pädagogischen Diskussion lange Zeit eher abwehrend begegnet wurde (Ricken/Rieger-Ladich, 2004), erscheint deshalb erstaunlich. So wurden Foucaults Arbeiten innerhalb des erziehungswissenschaftlichen Diskurses noch bis Ende der 1980er Jahre gerne als Plädoyer gegen Erziehung überhaupt gelesen (Balzer, 2004). Denn hält man die Perspektiven Foucaults auf Macht, Wissen und Subjektivierung für plausibel, so zerfällt nicht nur die Vorstellung einer ›freien‹ Selbstkonstitution, sondern genauso die Legitimation des pädagogischen Handelns zum Zwecke dieser ›Befreiung‹: »Der Prozesscharakter von ›Erziehung‹, der es erlaubt, konkrete Machtausübung im Hinblick auf die spätere Einsicht des Adressaten zu legitimieren, die dann Macht überflüssig machen werde« (Schäfer, 2004:158), wird unhaltbar. Ein Ort des, »(pädagogischen) Subjekts jenseits der ›Machtspiele‹« (ebd. 161), wird unhaltbar. Das Verständnis des Foucault’schen Machtbegriffs entzieht sich dabei nahezu gänzlich einer klaren und einheitlichen Fassung sowie Festlegung. Seine Bedeutung ist abhängig von weitreichenden Vorverständnissen und »nicht
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
unabhängig von menschlichen Selbstbedeutungen«1 (Ricken, 2004: 119). So stand für Foucault die Frage danach, was Macht eigentlich ist, nie im Mittelpunkt, sondern die Untersuchung, wie Macht in verschiedenen historischen Epochen wirkt. Was innerhalb dieser Arbeit konzeptionell als Machtgeflecht nach Foucault verstanden werden soll und welche Perspektiven für die späteren Analysen dadurch eröffnet werden können, gilt es also nun zu erläutern. Die Foucault’schen Konzepte zu Macht und Subjekt: von dem Körper in die Seele »Mir scheint, dass eines der grundlegenden Phänomene des 19. Jahrhunderts in dem bestand und noch besteht, was man die Vereinnahmung des Lebens durch die Macht nennen könnte.« (Foucault, 2002: 276) Mit diesem Satz leitete Michel Foucault sein analytisches Vorhaben im Rahmen einer seiner Vorlesungen am Collège de France in Paris ein, die später unter dem Titel »In Verteidigung der Gesellschaft« (ebd.) veröffentlicht wurden. Innerhalb dieser Vorlesung vom 17. März 1976 und weiter ausgeführt in seinen Monografien »Überwachen und Strafen« [1975] (1994) und »Der Wille zum Wissen« [1976] (2012) entwirft Michel Foucault einen neuen, differenzierten sowie positiven Machtbegriff. Sein Augenmerk hierbei liegt auf der Betonung der produktiven und nicht allein auf der destruktiven Wirkung der Macht. So ist die Macht – Foucault zufolge – tatsächlich produktiv, da sie Wirklichkeit produziert. Macht ist demnach nicht die Macht, als dominante Eigenschaft eines Machthabenden, sondern eine Relation, ein Kräfteverhältnis, das das Netz gesellschaftlicher Verhältnisse vollständig durchzieht: »[…] [Das, was V.R.] man mit als Erstes verstehen muss, [ist, V.R.] dass die Macht nicht im Staatsapparat lokalisiert ist und dass nichts in der Gesellschaft sich verändern wird, solange nicht die Mechanismen der Macht verändert werden, die außerhalb der Staatsapparate, unterhalb davon und neben ihnen, auf einem sehr viel niedrigeren, alltäglichen Niveau funktionieren.« (Foucault, 2005:79)
1
Norbert Ricken übertitelt seine Überlegungen zu der Unklarheit des Foucault’schen Begriffs mit »Die Macht der Macht«: »Wenn aber das, was unter ›Macht‹ verstanden werden kann, oft als irgendwie bekannt vorausgesetzt wird und werden muss, dann lässt Macht sich gerade nicht gegenständlich thematisieren, sondern jeweilig nur interpretativ umreißen.« (Ricken, 2004:119)
23
24
Choreographien der Homogenisierung
Die Mechanismen dieses Kräfteverhältnisses differenziert Foucault von dem Begriff der Gewalt und unterstreicht zugleich die zentrale Position der Handlung als solche und des handelnden Subjekts: »Tatsächlich ist das, was ein Machtverhältnis definiert, eine Handlungsweise, die nicht direkt und unmittelbar auf andere einwirkt, sondern eben auf deren Handeln. Handeln auf ein Handeln, auf mögliche oder wirkliche, künftige oder gegenwärtige Handlungen. Ein Gewaltverhältnis wirkt auf einen Körper, wirkt auf Dinge ein: Es zwingt, beugt, bricht, es zerstört: Es schließt alle Möglichkeiten aus; es bleibt ihm kein anderer Gegenstand als der der Passivität. Und wenn es auf einen Widerstand stößt, hat es keine andere Wahl als diesen niederzuzwingen. Ein Machtverhältnis hingegen errichtet sich auf zwei Elementen, ohne die kein Machtverhältnis zustande kommt: So dass der ›andere‹ (auf den es einwirkt) als Subjekt des Handelns bis zuletzt anerkannt und erhalten bleibt und sich vor dem Machtverhältnis ein ganzes Feld von möglichen Antworten, Reaktionen, Wirkungen, Erfindungen eröffnet.« (Foucault, 1996: 17f.) Dieses Feld der möglichen Antworten als soziale Praktiken, wird in seinen potentiell grenzenlosen Aussagemöglichkeiten jedoch permanent kontrolliert, begrenzt und verknappt. Mittel der Kontrolle ist nach Foucault dabei der Diskurs. »Warum wird das gesagt und nicht jenes? Warum gibt es diese Ordnung der Aussagen und nicht eine andere? Warum wurde nur das gesagt und nicht noch so vieles Anderes, was das endlose Spiel der Zeichen zu sagen ermöglichte?« (Sarasin, 2005: 64). So stellt sich Foucault unter dem Namen des Diskurses dem Zusammenhang von Sprache und Denken. Diskurse sind dann »als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen« (Foucault, [1981] 2012: 74). So ist der Diskurs nicht als bloßer Sprechakt zu verstehen, sondern vielmehr als Ordnung oder Geflecht von Aussagen. Diese Aussagen strukturieren zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Raum eines Wissensgebietes (z.B. der Psychiatrie oder der Ökonomie) und bringen auf geregelte Weise soziale Wirklichkeit in Form von Wahrheit, Realität und Normalität, bzw. Wahnsinn, Lüge und Abweichung, sowie die ihnen entsprechenden Subjektivitäten hervor. Die fundamentale Aufgabe des Diskurses ist es somit, den Dingen einen Namen zuzuteilen und ihre Existenz in ihrem Namen
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
zu benennen sowie diesen Namen als Wahrheit zu markieren (vgl. Foucault, [1980] 2001: 673). Paula-Irene Villa (2012:22) wählt folgendes Bild um dies zu verdeutlichen: »Kämen Kartoffeln mit einer Gravur aus der Erde, auf der ›Kartoffel‹ stünde, oder kämen Frauen mit einem Etikett ›Frau‹ auf der Stirn zur Welt, so wüssten wir mit Sicherheit, dass es sich um naturgegebene, vielleicht sogar objektive und vom Menschen nicht zu verändernde Entitäten handelte. So aber kommen weder Kartoffeln noch Menschen zur Welt – so kommt nichts und niemand in die Welt. Denn zwischen den Dingen und uns stehen immer, unausweichlich und sozusagen in einem totalen Sinne, Diskurse. Mehr noch, Diskurse bringen aufgrund ihrer produktiven Fähigkeit die Dinge, die wir betrachten, in gewisser Weise selbst hervor.« Der philosophische Begriff der Entität spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn er ist in der Philosophie ein ontologischer Sammelbegriff für etwas Existierendes bzw. Seiendes. Der Begriff wird verwendet, um allgemein über Existierendes zu sprechen, ohne auf konkrete Eigenschaften Bezug nehmen zu müssen (Waibl/Rainer, 2008). Er beschreibt demzufolge ein Sosein, das Foucault in seinen – und im Verlauf dieser Arbeit vor allem Judith Butler in ihren – Arbeiten immer wieder anzweifeln wird: Akte und Gesten erzeugen den Effekt eines inneren Kerns oder einer inneren Substanz, die a priori mit dem Körper kam. Erzeugt wird dieser wiederum nur auf der Oberfläche des Körpers. Wesen oder Identität, die dabei angeblich zum Ausdruck gebracht werden sollen, werden also durch leibliche Zeichen und andere diskursive Mittel überhaupt erst hergestellt. Da Diskurse dabei keineswegs zufällig sind, liegt in der Folge Foucaults Augenmerk auf der Untersuchung der Beschränkung und Begrenzung von ihnen: auf Ausschluss und Verbot (Foucault, [1991] 2012). So setzen ihm zufolge Kontroll- und Disziplinierungspraktiken die Regeln für Diskurse, und diesen gilt seine Aufmerksamkeit: »Ich setzte voraus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu bannen.« (ebd.: 10f.) Anhand der Analyse von Diskursen und ihren Ein- und Ausschlussmechanismen ist es Foucaults Anliegen die Episteme einer Epoche zu identifizieren.
25
26
Choreographien der Homogenisierung
Der Begriff der Episteme kommt der Wortbedeutung des Wissens oder der Wissenschaft nach (Kluge, 2001). Geprägt wurde der Begriff durch Aristoteles, der diesen in seinem Werk »Nikomachische Ethik« [1909] (2016) verwendete, um ihn im engeren Sinne als theoretisches Wissen gegenüber »Techne«, dem praktischen Können, abzugrenzen. Zuvor wurden die beiden Begriffe mehr oder weniger synonym verwendet (Waibl/Rainer, 2008). Foucault jedoch fasst den Begriff der Episteme differenzierter. In seinem Buch »Archäologie des Wissens« [1981] (2013) untersuchte er deshalb, »[…] ob die Individuen, die verantwortlich für den wissenschaftlichen Diskurs sind, nicht in ihrer Situation, ihrer Funktion, ihren perzeptiven Fähigkeiten und in ihren praktischen Möglichkeiten von Bedingungen bestimmt werden, von denen sie beherrscht und überwältigt werden. Kurz, ich versuche, den wissenschaftlichen Diskurs nicht vom Standpunkt der sprechenden Individuen aus zu erforschen […]. Mir scheint, dass die historische Analyse des wissenschaftlichen Diskurses letzten Endes Gegenstand nicht einer Theorie des wissenden Subjekts, sondern vielmehr Theorie diskursiver Praxis ist.« (Foucault, [1981] (2013): 15) Foucault entscheidet sich somit für einen funktionalen2 Begründungsansatz des Wissens und der Wissenschaft: Was der Mensch überhaupt denken und erfahren kann, kommt nicht von ihm, sondern ist immer die Folge von etablierten Ordnungsstrukturen des Wissens. Es gibt keine Strukturen, die auf eine A-priori-Erfahrung aufbauen; vielmehr verhält es sich umgekehrt: Die jeweilige Erfahrung ist stets schon Effekt der Ordnungsstrukturen des Wissens (Foucault, [1976] 2012: 15). Diese Bedingungen des Wissens und der Wissenschaft nennt Foucault Episteme. Die Episteme bestimmt, was zu einer bestimmten Zeit – an einem bestimmten Ort – überhaupt als wahr angesehen, als wahr gedacht werden kann, was überhaupt als eine untersuchenswerte Frage formuliert und in den wissenschaftlichen Diskurs gestellt werden kann. »Wenn Du so willst, könnte ich die Episteme, indem ich zu ihr zurückkehre, als strategisches Dispositiv definieren, das es erlaubt, unter allen möglichen Aussagen diejenigen herauszufiltern, die innerhalb, ich sage nicht: wissenschaftlichen Theorie, aber eines Feldes von Wissenschaftlichkeit akzeptabel 2
Philosophisches Modell, wonach mentale Zustände als berechenbare Funktionen (ähnlich einem Computerprogramm) begriffen werden können (vgl. Waibl/Rainer, 2008).
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
sein können und von denen man wird sagen können: Diese hier ist wahr oder falsch. Die Episteme ist das Dispositiv, das es erlaubt, nicht schon das Wahre vom Falschen, sondern vielmehr das wissenschaftlich Qualifizierbare vom Nicht-Qualifizierbaren zu scheiden.« (Foucault, [1978] 2008: 124). Unter dem Begriff des Dispositivs versteht Foucault dabei eine zweckmäßige Anordnung oder machtstrategische Verknüpfungen, ein Netz von diskursiven Elementen, das sich zu einer Art Spiel zusammenfügt: »Das, was ich mit diesem Begriff [des Dispositivs, V.R.] zu bestimmen versuche, ist erstens eine entschieden heterogene Gesamtheit, bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen Lehrsätzen, kurz, Gesagtes ebenso wie Ungesagtes, das sind die Elemente des Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz, das man zwischen diesen Elementen herstellen kann.« (Foucault, [1966] 2003: 392) So kann Foucaults Dispositivbegriff als ein Beobachtungsbegriff verstanden werden, der es erlauben soll, das Problem der historischen Gegenstandskonstitution zu lösen. Damit gewährt das Dispositiv-Konzept zum einen die Aufhebung der einfachen Opposition von Subjekt und Objekt, zum anderen beruht die Analyse eines solchen Oberflächennetzes nicht auf einer »zugrunde-liegenden Realität« (Foucault, [1976] (2012): 128) oder einem tiefer liegenden Unbewussten. Es sind vielmehr Wissen und Erkenntnisse, Praxis und Macht, die sich zum strategischen Dispositiv formieren. Strategisch ist das Dispositiv somit, da es nicht einfach gegeben ist, sondern es vielmehr aus einem übergeordneten Zweck in einer historischen Anordnung entsteht. Dieser übergeordnete Zweck ist es, der Dispositive der Macht generiert: »Diskurse üben Macht aus, da sie Wissen transportieren, das kollektives und individuelles Bewusstsein speist. Dieses zustande kommende Wissen ist die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln und die Gestaltung von Wirklichkeit.« (ebd.: 8) Entsprechende Beispiele dieser Dispositive der Macht ergeben sich laut Foucault aus der Unterwerfung des Wahnsinns (Foucault, [1961] 2008), der Einsperrung (Foucault, [1975] 1994) und der Sexualität (Foucault, [1976] 2012). So lässt sich konkludieren, dass Diskurse Macht ausüben, da sie Wissen transportieren, das kollektives und individuelles Bewusstsein speist (vgl. auch
27
28
Choreographien der Homogenisierung
Jäger, 2001). Dieses zustande kommende Wissen ist die Grundlage für individuelles und kollektives Handeln und somit für die Gestaltung von Wirklichkeit. Erst durch den Begriff der Episteme, dann durch die Dispositive befreit sich Foucault von einer Logik, die sich allein auf Denken und Bewusstsein stützt. Vielmehr werden Diskurs und daraus konstruierte Wirklichkeit sowie Gegenstände zu Elementen des Dispositivs, dem machtvollen Netz zwischen den Elementen. Die Wirklichkeit existiert dabei nur in der Form, als ihr von den in Diskurse verstrickten Handelnden Bedeutung zugewiesen wurde und wird. Die Soziologin Hannelore Bublitz versteht diese Foucault’sche Auslegung wie folgt: »Obwohl Foucault also einerseits Nicht-Diskursives dem Diskursiven […] gegenüberstellt, vertritt er die These, dass es keinen Gegensatz zwischen dem ›was getan, und dem, was gesagt wird, gibt‹ (Foucault 1976: 118). Er geht vielmehr davon aus, dass die gesamte zivilisierte abendländische Gesellschaft, jenes komplexe Netz aus unterschiedlichen Elementen – Mauern, Raum, Institution, Regeln, Diskursen, als Fabrik zur Herstellung unterworfener Subjekte erscheint.« (Bublitz, 1999: 90) Um auf das Machtverständnis zurück zu kommen, macht Foucault deutlich, dass die Diskurse nicht als strukturell Erstes zu betrachten sind, sondern nicht-diskursive Bedingungen das Entstehen von Diskursen begründen. Diese werden als machtvoll identifiziert. Ihr Ziel ist es, die bedrohlichen Kräfte und Gefahren des Diskurses unter Kontrolle zu halten, um den jeweiligen Zwecken der historischen Machtformen genügen zu können. Macht ist hierbei kein Besitz, sondern eine Strategie, ein immerwährendes Gefecht, kein Privileg einer herrschenden Klasse, sondern »die Gesamtwirkung ihrer strategischen Positionen«, die sich in der Position der Beherrschten offenbart (Foucault, [1975] 1994). Dem Subjekt kommt innerhalb dieses Gewebes eine zentrale Rolle zu: Es wird zur Schaltstelle zwischen Wissen und Macht, zu dem Ort, der Wissen erst zu Macht werden lässt. So ist Macht nicht die Reproduktion einer Struktur, sondern der Prozess, der ohnmächtige und mächtige Positionen erst hervorbringt. Bedingung der Hervorbringung des Subjekts innerhalb dieses Machtgefüges ist die Unterwerfung. Damit pocht Foucault – als Gegensatz zum erkenntnisfähigen Subjekt – auf ein Subjekt, das die eigene Konzeption den Wissenssystemen seiner Zeit verdankt (ebd.). Die Trennung des Subjektbegriffs von dem des Individuums beschreibt Foucault dabei wie folgt: Das Individuum sei ein Ding, eine Entität oder einzelnes Seiendes,
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
insofern es von Gegenständen klar unterschieden werden könne, das hieße: insofern Identitätskriterien angegeben werden könnten. ›Das Subjekt‹ seien somit die Formen, in denen die Herrschaft auf das Individuum oder das Individuum auf sich selbst einwirken (Foucault, 1993: 27f). So formiert sich das Subjekt in zweifacher Weise: Es präsentiert sich einerseits als ›subiectum‹3 , als dasjenige, das unterworfen ist, bestimmten Regeln unterliegt und sich ihnen unterwirft. Aber andererseits konstituiert sich das Subjekt als eine agierende Instanz mit Spielräumen der Selbstgestaltung (Wiede, 2014: 4). In Bezug auf die Linguistik wird an dieser Stelle auch die Weiterentwicklung der verwendeten Suffixe in Bezug auf das Subjekt deutlich. Ist das Suffix (Subjektiv)-ation noch stärker mit dem Ergebnis einer Handlung verbunden, so betont das Suffix (Subjektiv)-ierung deutlicher die Handlung als solche. Innerhalb der Konstitution des Subjekts betrachtet Foucault die Einwirkung des Individuums auf sich selbst, die »Regierung des Selbst« als das weniger sichtbare, aber schwerwiegendere Problem der Unterwerfung: »Der Mensch, von dem man uns spricht und zu dessen Befreiung man einlädt, ist bereits in sich das Resultat einer Unterwerfung, die viel tiefer ist als er. Eine ›Seele‹ wohnt in ihm und schafft ihm eine Existenz, die selber ein Stück der Herrschaft ist, welche die Macht über den Körper ausübt. Die Seele: Effekt und Instrument einer politischen Anatomie. Die Seele: Gefängnis des Körpers.« (Foucault, 1977 :42) Die sich ausprägende liberale Form von Regierung funktioniert also nicht länger alleine durch die Disziplinierung der Einzelnen, sondern durch die Ermächtigung und Initiative des Individuums zur Selbstregierung. Subjektivierung wird dann als Zusammenspiel von Fremd- und Selbstformierung sichtbar. Das Subjekt ist dabei fest verflochten in die »Mikrophysiken der Macht« und kann sich »niemals außerhalb der Macht« aufhalten (Foucault, 2002). Dieser Feststellung ist die sogenannte »Aussichtslosigkeit« (Schäfer, 2004:42) geschuldet, die Foucaults Analysen unterstellt und gerade in Bezug auf die Rezeption innerhalb der Erziehungswissenschaft vorgeworfen wurde.
3
Latein: Subjekt, das Unterworfene, das Zugrundeliegende, das Tragende, das Empfangende
29
30
Choreographien der Homogenisierung
»Es ist durchaus seit langem bekannt, dass der Mensch nicht mit der Freiheit beginnt, sondern mit der Grenze und der Linie des Unübertretbaren.« (Foucault nach Stingelin, 2009: 34) So gibt es zwar keinen Ort des (pädagogischen) Subjekts jenseits der Machtspiele, jedoch aber die Möglichkeit der Kritik als Praxis und mit ihr die Vermittlung und Eröffnung der Perspektive des »nicht dermaßen regiert Werdens« (Foucault, [1978] 1992).
Die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden So sollen die vorangegangenen Erkundungen zu Michel Foucault an dieser Stelle durch seine Frage »Was ist Kritik?« (ebd.) abgerundet werden: »Als Gegenstück zu den Regierungskünsten, gleichzeitig ihre Partnerin und ihre Widersacherin, als Weise ihnen zu misstrauen, sie abzulehnen, sie zu begrenzen und sie auf ihr Maß zurückzuführen, sie zu transformieren, ihnen zu entwischen oder sie immerhin zu verschieben zu suchen, als Posten zu ihrer Hinhaltung und doch auch als Linie der Entfaltung der Regierungskünste ist damals in Europa eine Kulturform entstanden, eine moralische und politische Haltung, eine Denkungsart, welche ich nenne: die Kunst nicht regiert zu werden bzw. die Kunst nicht auf diese Weise und um diesen Preis regiert zu werden.« (Foucault 1992: 11). Foucaults Ziel dabei ist es, Kritik als Praxis zu denken, in der wir die Frage nach den Grenzen unserer sichersten Denkweisen stellen. Danach zu streben, den Dingen selbst zu jener Artikulation zu verhelfen, von der sie sonst durch die vorherrschende (Körper-)Sprache abgeschnitten sind (vgl. Butler, 2002). »Die kritische Ontologie unserer selbst darf beileibe nicht als Theorie, eine Doktrin betrachtet werden, auch nicht als ständiger, akkumulierender Korpus von Wissen; sie muss als eine Haltung vorgestellt werden, ein Ethos, ein philosophisches Leben, in dem die Kritik dessen, was wir sind, zugleich die historische Analyse der uns gegebenen Grenzen ist und ein Experiment der Möglichkeit ihrer Überschreitung.« (Foucault 1992: 53) Das Verlassen des Denkens in Oppositionen hin zu einer Analyse der »›Verflechtungen‹ und des ›Zugleich‹ von Macht und Freiheit, Autonomie und Heteronomie, Fremd- und Selbstbestimmung […], um die – auch pädagogisch zentrale – Frage danach ›was wir sind und was wir sein können‹« (vgl. Foucault 1994: 250, [eigene Hervorhebung V.R.]), wieder stellen zu lernen«
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
(Balzer, 2004: 31), ist bei der Entscheidung für diese theoretischen Bezüge innerhalb der folgenden Analysen sowohl große Motivation als auch hehres Ziel. »Die Kunst nicht dermaßen regiert zu werden« beschreibt somit eine kritische Denkungsart, die sich – ähnlich der Regierung selbst – wesentlich im »Bündel der Beziehungen zwischen der Macht, der Wahrheit und dem Subjekt« (Foucault 1992: 15) formiert. Kritik lässt sich dabei als die »Bewegung, in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin« – kurz: »Kritik [ist V.R.] die Kunst der freiwilligen Unknechtschaft, der reflektierten Unfügsamkeit. In dem Spiel, das man die Politik der Wahrheit nennen könnte, hätte die Kritik die Funktion der Entunterwerfung« (Foucault 1992: 15). In Bezug auf die vorliegende Arbeit sollen diese Gedanken dazu beitragen, das Macht-Geflecht, innerhalb dessen die Schüler*innen sowie die Lehrer*innen der beobachteten Klassen als ›Gleiche‹ zu- und angeordnet werden und sich selbst zu- und anordnen, sowie ihre Option auf die Eröffnung von Spielräumen, zu beleuchten. Die Identifikation der verschiedenen, machtvollen Dimensionen der Verkörperung von Gleichheit ist dabei ein besonderes Anliegen. Das »werdende« Subjekt bei Judith Butler Das Streben nach der Überwindung begrifflicher und kategorialer Dichotomien sowie der Bezugspunkt der Körperlichkeit führen die theoretischen Grundlagen dieser Abhandlung nun weiter zu den Arbeiten Judith Butlers. Foucaults Frage nach dem Subjekt ist dabei zentral für nahezu alle Arbeiten Butlers und genauso innerhalb erziehungswissenschaftlicher Diskurse fest verankert (Ricken/Blazer, 2012:11). Dabei wurde Judith Butler vor allem durch ihre Untersuchung des Zusammenwirkens von Fremd- und Selbstformierung des Subjekts anhand der Differenzierung der Begrifflichkeiten von »sex« und »gender« (Butler, 1991) und der Aufführung von Körperlichkeit (Butler, 1997) bekannt. Hier fokussiert sie eben nicht ein spezifisches Frau-Sein oder ein humanistisches Gleichheitsideal, sondern die kritische Befragung der Begriffe selbst, in ihrer Verknüpfung mit impliziten Denktraditionen und politischen Konzepten. So widmet sich Butler mit ihrer Theorie des »Devenir«, des »Werdens« (vgl. Butler, 1991; 1997), dem: Wie wird das Subjekt? Wie wird der Körper?, der
31
32
Choreographien der Homogenisierung
Tatsache, dass wiederkehrend auf etwas zurückgegriffen wird, das selbst erst im Prozess entsteht. Ihre Subjekttheorie soll im Folgenden anhand ihrer »genealogischen Kritik« (Butler, 1991) eingeführt und um ihre Konzepte von »Handlungsfähigkeit« (Butter, 2001) und »Performativität« (Butler, 1991) erweitert werden. Ziel dabei ist es, Prozesse der Formierung des Subjekts: »in Verknüpfung mit intersubjektivitäts- und anerkennungstheoretischen sowie performativitäts- und praxistheoretischen Einsichten zu (er-)fassen« (Ricken/Balzer, 2012:11). Innerhalb ihrer genealogischen Kritik fasst Butler zusammen, dass alle Dinge bereits und immer schon Interpretationen seien. Dabei schließt sie an Foucaults These an, dass die Dinge, »ohne Wesen sind oder ihr Wesen ein Stückwerk aus Fremden Bedeutungen« (Foucault, [1976] 2012:86), sei. Die Kernvorstellung hierbei ist, dass Worte die Macht besitzen, Dinge – wie etwa den biologischen Körper – aus einer Begriffssubstanz heraus zu erschaffen: »Die Bezeichnung erzeugt den Effekt des Apriori des Bezeichneten. Übertragen auf die Materialität des Körpers bedeutet dies: Der bezeichnende Akt produziert den Körper mit dem Effekt, dieser gehe der Bezeichnung voran […].« (Lorey, 1993: 15) So ist es auch Butlers Ziel, scheinbare Ursachen als »naturalisierte Effekte diskursiver Praktiken auszuweisen und die binären Oppositionen als veränderbare Konstruktionen zu entlarven. Im Unterschied zu Foucault zielt Butlers ›kritische Genealogie‹ jedoch nicht auf historische Analysen spezifischer diskursiver Formationen ab; vielmehr hinterfragt sie verschiedene Theorien (wie etwa die Psychoanalyse, den Feminismus und nicht zuletzt Foucaults Diskursanalyse selbst) im Hinblick auf ihre impliziten Annahmen und Identitätskategorien.« (Babka/Posselt, 2016: 59) Ihr theoretisches Gerüst stützt Judith Butler bei den eben genannten Überlegungen auf die Kritik an aktuellen geschlechterbezogenen Schlussfolgerungen aus philosophischen Grundlagen wie zum Beispiel der Unterscheidung des Aristoteles von Materie und Form der Substanz, zusammengefasst im Konzept des »Aristotelischen Hylemorphismus«. Demnach bestehe die Substanz aus Materie (griechisch ›hýle‹) und Form (griechisch ›morphé‹). Einzel-
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
dinge, so Aristoteles, bestehen aus Materie. Diese Materie bezeichnet er als etwas Bestimmbares, wie einen Klumpen Teig zum Beispiel, der noch nicht bearbeitet ist. Unbearbeitet kommt Materie in der Wirklichkeit aber nicht vor. Hier findet man sie immer schon bearbeitet, bestimmt oder geformt. Und das, was die Materie zu dem macht, als was sie am Ende erscheint, bezeichnet Aristoteles als das Bestimmende, die Form. Diese Form ist aber nicht mit einer äußeren Form, zum Beispiel einer Kuchenform, vergleichbar, die durch Einwirkung von außen dafür sorgt, dass der Teig am Ende der Bearbeitung eine bestimmte Gestalt hat. Nach Aristoteles sorgt die Form zwar dafür, dass aus der unbestimmten Materie ein bestimmtes Einzelding wird, sie ist aber nichts, das von außen auf die Materie wirkt. Sonst gebe es ungeformte Materie in der Wirklichkeit. Da Materie aber immer nur als geformte Materie auftritt, bedeutet das, dass sowohl die Materie von der Formung, als auch die Form von der Verbindung zur Materie abhängt. Beides gehört zusammen und bildet vereint die Substanz. (vgl. Aristoteles, [1909] (2016); Wuchterl, 1998) Diese Ausführungen sind nötig, um verstehen zu können, dass Butler der Ansicht ist, dass die vorherrschende Geschlechtertheorie an der traditionellen Überbewertung der Form festhält, indem sie Materie als jeder kulturellen Hervorbringung vorgängig – a priori – betrachtet. Auch Foucault hält an der Aristoteli’schen Materialität in gewisser Weise fest. Der Begriff der Materie unterliegt bei ihm noch insofern dem Form-Materie-Dualismus, als die Materie durch sozio-kulturelle Einschreibungsprozesse geformt und diszipliniert wird. Butler ist vorerst genauso der Meinung, dass Materie Wirkungsort der Macht ist und der kulturellen Formierung unterworfen. Daraus schließt sie jedoch, dass die Form der Materie nicht äußerlich bleiben kann (vgl. Butler, 1991 und 2001). Anders gesagt: Akte und Gesten erzeugen den Effekt eines inneren Kerns oder einer inneren Substanz, die mit dem Körper kam. Erzeugt wird diese wiederum nur auf der Oberfläche des Körpers. Wesen oder Identität, die dabei angeblich zum Ausdruck gebracht werden, werden vielmehr durch leibliche Zeichen und andere diskursive Mittel hergestellt: »Was ich an Stelle dieser Konzeption von Konstruktion vorstellen möchte, ist eine Rückkehr zum Begriff der Materie, jedoch nicht als Ort oder Oberfläche vorgestellt, sondern als ein Prozess der Materialisierung, der im Laufe der Zeit stabil wird, so dass sich die Wirkung von Begrenzung, Festigkeit und Oberfläche herstellt, den wir Materie nennen.« (Butler, 1997: 32)
33
34
Choreographien der Homogenisierung
So wird der Körper bei Butler hier – in seiner Materialität – Effekt der Anrufung, Effekt der Norm. Diese Norm materialisiert sich ihres Erachtens durch das Zitieren des symbolischen Gesetzes. Der vermeintlich natürliche Körper wird hierbei zu nichts anderem als dem naturalisierten Effekt des Diskurses. Denn was »materiell« ist, entkommt niemals ganz dem sprachlichen Signifikationsprozess (Butler, 1997: 24-35). Das Subjekt und der Körper werden laut Butler dann erst durch die Hinwendung zum Anrufenden, durch die Reaktion auf die Benennung. Dabei schließt sie an den Begriff der Interpellation bei Louis Althusser an. In seinem 1969 verfassten Essay »Ideologie und ideologische Staatsapparate« (1977) entwickelt Althusser sein Konzept der Ideologie als »Interpellation«. Dieser beschreibt die Anrufung von Subjekten und deren Unterwerfung durch die Ideologie. Der französische Begriff der Interpellation ist dabei im allgemeinen Sprachgebrauch ein Ausdruck für eine vorübergehende Festnahme zur Überprüfung Verdächtiger. Die Ideologie hat in diesem Falle die Funktion, »konkrete Individuen zu Subjekten zu konstituieren« (Althusser, 1977: 140). So wird in einem einmaligen Akt das, was dieser benennt, vollständig konstituiert. Ruft die Hebamme also bei der Geburt die Worte: ›Es ist ein Mädchen!‹ aus, so ist das Kind als unterworfenes Subjekt mit all den in der aktuellen Ideologie verankerten Rechten und Pflichten einer Frau in ihrer historischen Episode geprägt. Gleichzeitig stellt diese Anrufung, laut Butler, eine Disziplinierungsmaßnahme dar, eine »Bereitwilligkeit, Schuld zu akzeptieren, um Identität zu gewinnen« (Butler, 1991: 103). Beschränkt sich der Begriff der Schuld hierbei auf die Annahme des Sag- und Repräsentierbaren, so geht Butler im Anschluss an Althusser davon aus, dass Sprache, die »Gelegenheit des Individuums [ist], Verständlichkeit zu gewinnen und zu reproduzieren« (Butler, 1997: 15). »Subjektivation ist buchstäblich die Erschaffung des Subjekts, das Reglementierungsprinzip, nach dem das Subjekt ausformuliert und hervorgebracht wird. Subjektivation ist eine Art von Macht, die nicht nur einseitig beherrschend auf ein gegebenes Individuum einwirkt, sondern das Subjekt auch aktiviert oder formt. Subjektivation ist also weder einfach Beherrschung, noch einfach Erzeugung eines Subjekts, sondern beschreibt eine gewisse Beschränkung in der Erzeugung, eine Restriktion, ohne die das Subjekt gar nicht hervorgebracht werden kann, eine Restriktion, durch welche die Hervorbringung sich erst vollzieht.« (Butler, 1997: 82)
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
So wird das Subjekt nicht nur angerufen, sondern erlangt durch die Hinwendung zum Anrufenden, durch die Einbezogenheit in die Machtbeziehungen, Handlungsvermögen: »Das Subjekt lässt sich durchaus so denken, dass es seine Handlungsfähigkeit von eben der Macht bezieht, gegen die es sich stellt, so unangenehm und beschämend das insbesondere für Jene sein mag, die glauben, Komplizenschaft und Ambivalenz ließen sich ein für allemal ausrotten. Wenn das Subjekt weder durch die Macht voll determiniert ist noch seinerseits vollständig die Macht determiniert (sondern immer beides zum Teil), dann geht das Subjekt über die Logik der Widerspruchsfreiheit hinaus, es ist gleichsam ein Auswuchs, ein Überschuss der Logik. Die Behauptung, das Subjekt gehe über das Entweder/Oder hinaus, besagt nicht, dass es in irgendeiner selbstgeschaffenen Freizone lebt. Das Hinausgehen ist kein Entkommen, und das Subjekt geht genau über das Hinaus, an was es gebunden ist. In diesem Sinn kann das Subjekt die Ambivalenz seiner eigenen Konstitution nicht ersticken. Schmerzlich, dynamisch und vielversprechend, ist dieses Schwanken zwischen dem Schon-Da und dem Noch-Nicht ein Scheideweg, der jedem einzelnen Schritt seiner Überquerung anhängt, eine sich ständig wiederholende Ambivalenz im Kern der Handlungsfähigkeit. Die reartikulierte Macht wird ›re‹-artikuliert im Sinn des schon Getanen und im Sinne des wieder aufs neue Getanen.« (ebd.: 22) [Hervorhebung im Original] Für die poststrukturalistische Position Butlers entscheidend ist hierbei die Differenzierung zwischen den Begriffen Performanz und Performativität und somit die Hinwendung zum Körper. So führt der Begriff der Performanz Judith Butler zu der Sprechakttheorie des Philosophen John Langshaw Austin. Im Rahmen seines Werks »How to do things with words« (1986) geht Austin davon aus, dass Sprache die Funktion haben kann, Handlungen auszuführen. Äußerungen wie: ›Ich verspreche, pünktlich zu sein‹, nennt Austin performativ, da sie sprachliche Ausführungen zugleich als Handlung vollziehen. Dem entgegen stehen konstative Äußerungen, die allein einen deskriptiven Charakter besitzen, wie: ›Es schneit.‹ (vgl. Butler, 1991; 2006). Um zu zeigen, worin der Unterschied zwischen performativen und konstativen Äußerungen besteht, untersucht Austin »was es alles bedeuten kann, dass man dadurch, dass man etwas sagt, etwas tut« (Austin, 1986: 112). Performanz wird so zur handlungspraktischen Dimension des Sprechens, zur sprachlich (vor-)gegebenen Struktur einer Handlung.
35
36
Choreographien der Homogenisierung
Butler übernimmt dabei zwar Austins sprachphilosophischen Zugang, nach dem Sprache Handlung ist, erweitert ihn allerdings in Anlehnung an Derrida um die Zitatförmigkeit. In seinen 1988 in deutscher Sprache erschienenen Aufsätzen »Die différance« (Derrida, 1988: 29-52) und »Signatur Ereignis Kontext« (ebd.: 291-314) im Rahmen seines Buches »Randgänge der Philosophie« verhandelt Jaques Derrida die Prozesse der sprachlichen Unterscheidung. Einer der Hauptaspekte dabei ist die »Iteration«, die Wiederholbarkeit des Geschriebenen oder Gesagten mit ihrem neuen Moment. So werden bereits erfolgte Sprechakte zitiert und diese Zitierbarkeit beinhaltet – so Derrida – immer Veränderungen gegenüber dem vermeintlichen Original. Somit ereignen sich mit jeder Wiederholung Veränderungen des Wiederholten und damit »wird die Intention, welche die Äußerung beseelt, sich selbst und ihrem Inhalt nie vollkommen gegenwärtig sein« (ebd.: 310). Durch die Feststellung, dass »die Wiederholung [sich] mit der Andersheit verbindet« (ebd.: 298), wird hier ein konzeptionelles Fassen der sozialen Veränderungen und der sich wandelnden Handlungen durch Sprache möglich: »Die Performativität ist demzufolge kein einmaliger ›Akt‹, denn sie ist immer die Wiederholung [eigene Hervorhebung V.R.] einer oder mehrerer Normen; und in dem Ausmaß, in dem sie in der Gegenwart einen handlungsähnlichen Status erlangt, verschleiert oder verbirgt sie die Konventionen, deren Wiederholung sie ist.« (Butler, 1997: 36) Innerhalb Butlers Theorie ist es die Vorstellung von Zitatförmigkeit, die die Macht der Norm begründet. Um ihr Norm-Verständnis einzuführen, bezieht sie sich in ihren Ausführungen dabei auf den »Habitus« Begriff von Pierre Bourdieu (Butler, 2006). In dem Kapitel »Zur Genese der Begriffe Habitus und Feld« (Bourdieu, 1997: 59-78) beschreibt Pierre Bourdieu in seinem Buch »Der Tote packt den Lebenden« sein Konzept des »Habitus« detailliert. Unter diesem in seinem Buch »Die feinen Unterschiede« erstmals verwendeten Begriff versteht er zum einen das Erzeugungsprinzip von Praktiken, zum anderen das Klassifizierungssystem, nach dem diese Praktiken und die Dinge, mit denen jede*r von uns umgeben ist, bewertet werden. Der Habitus ist damit die Grundhaltung der Einzelnen zur Welt und zu sich selbst und besteht aus den Denk- und Verhaltensstrukturen, die die Möglichkeiten und Grenzen des Denkens und Handelns dieser Einzelnen bestimmen. So können daraus resultierend, durch gesellschaftliche Strukturen, praktische Handlungen der Subjekte reproduziert werden:
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
»Als Vermittlungsglied zwischen der Position oder Stellung innerhalb des sozialen Raumes und spezifischen Praktiken, Vorlieben usw. fungiert das, was ich ›Habitus‹ nenne, das ist eine allgemeine Grundhaltung, eine Disposition gegenüber der Welt, die zu systematischen Stellungnahmen führt.« (Bourdieu 1992: 31) Der Habitus als »strukturierende und strukturierte Struktur« (ebd.) ist hierbei zum einen der Organisator von Praxis und Wahrnehmung und zum anderen selbst ein Produkt dieser verinnerlichten Struktur. Darin besteht auch der Anknüpfungspunkt für Butler: »Die unbewusst angewandten Regeln lagern sich in den Körpern der Subjekte ab, werden inkorporiert […], werden dann im Habitus sichtbar und dort konserviert, damit wieder auf sie zurückgegriffen werden kann.« (Ebd.) So ist die Unterwerfung unter die Norm gleich der Annahme der Norm, der Wiederholung eben dieser: »Wenn eine sexuisierte Position ›anzunehmen‹ heißt, auf eine gesetzgebende Norm zurückzugreifen, […] dann ist die ›Annahme‹ eine Angelegenheit des Wiederholens der Norm, des Zitierens oder mimetischen Nachahmens der Norm.« (Butler, 1997: 149) »Anders gesagt setzt sich die Norm des Geschlechts in dem Maße durch, in dem sie als eine solche Norm zitiert wird, aber sie bezieht ihre Macht auch aus den Zitierungen, die sie erzwingt.« (ebd.: 37) In Anknüpfung an den produktiven Machtbegriff von Foucault beschreibt Butler die Macht der Norm somit als ein Zusammenspiel. Zum einen aus der Annahme der Norm: als Reaktion auf eine Kombination aus der Althusser’schen Anrufung, dem Sprachakt nach Austin und dem Habitus-Konzept bei Bourdieu im weitesten Sinne. Und zum anderen aus der Wiederholung der Norm: als die Erweiterung der Wiederholungsgedanken Derridas. Butler zufolge strebt der Mensch unweigerlich nach dieser Norm, da er in einem »Komplizentum mit der Macht« (ebd.: 39) stünde, aus welcher er werde: »Der Prozess der Sedimentierung oder das, was wir auch Materialisierung nennen können, wird eine Art Zitatförmigkeit sein, ein Erlangen des Daseins durch das Zitieren von Macht, ein Zitieren das in der Formierung des ›Ichs‹ ein ursprüngliches Komplizentum mit der Macht herstellt.« (ebd.: 39)
37
38
Choreographien der Homogenisierung
Performativität sind für Butler also wiederholte Handlungen, die eine produktive und generative Wirkung auf die soziosymbolische Realität entfalten, gerade weil sie auf kontingenten sozialen Grundlagen operieren. Das Sein oder So-Sein eines Geschlechtes ist demnach kein ontologischer Status, der aus einer vordiskursiven Wirklichkeit schöpft, sondern das Ergebnis performativer Inszenierungen, die sich selbst erfolgreich als Sein darstellen, d.h. ihre Konstruiertheit verschleiern und einen Naturalisierungseffekt hervorrufen. Geschlechtsidentität erscheint damit als das Ergebnis einer rituellen Wiederholungspraxis. Das Subjekt entsteht also aus der Macht und zitiert diese unweigerlich. Es rührt aus ihr und bemächtigt sie so erneut. Butlers These zufolge müssen Individuen also Subjekte sein und Subjektpositionen gerecht werden, weil es keinen anderen Weg gibt, der zum Erreichen des Akteur*innenstatus führt (vgl. Balzer/Ludewig, 2012). Judith Butlers Motivation, gerade diesen Bereich der Wiederholung der Norm immer wieder differenziert zu betrachten, ist es dabei, dass jeder, der diese Norm verkörpern will, auf eine Weise unweigerlich daran scheitern muss, die ihr viel interessanter zu sein scheint, als ein Erfolg es je sein kann (Butler, 1997). Während die Anrufung bei Althusser demnach noch ungebrochen zu gelingen scheint, hat sie bei Butler immer auch »Wirkungen, die über die ursprüngliche Absicht der Benennung hinausgehen« (Butler, 2004: 230). Nicht nur aber ist nach Butler »jeder Versuch einer diskursiven Anrufung oder Konstituierung dem Scheitern ausgesetzt« (Butler, 1997: 264), sondern vielmehr »funktioniert die Interpellation oder Anrufung indem sie scheitert« (Butler, 1997: 183). Subjektivation geht dementsprechend immer mit der Unterwerfung unter spezifische Regeln und Normen einher und kann gleichzeitig als Bedingung, um Verständlichkeit zu erlangen und zu reproduzieren, verstanden werden. Die Zuschreibung und Annahme spezifischer Subjektpositionen – also beispielsweise Frau-Sein, Jung-Sein, Weiß-Sein – ist dabei inbegriffen. Sein wie jede*r Andere durch Annahme von Norm und Anrufung und sein wie kein*e und Andere durch Reiteration gehen dabei unausweichlich miteinander einher. Die Unterscheidung von Materiellem und Immateriellem spielt für Butler dabei eine große Rolle. So sucht sie mithilfe von Nietzsche und Freud eine Erklärung für die Annahme von Norm und Schuld im immateriellen Innen. Dabei kommt sie durch Bourdieus Begriff des Habitus zu dem, was Nietz-
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
sche »Gewissen« nennt und Freud das »Über-Ich«. Annahme wäre somit zum einen das Nach-innen-Richten von aggressiven Trieben, die aus der Zivilisierung des Menschen entstehen, und zum anderen das Streben nach dem Ich-Ideal, damit verbundene Unterdrückung und Scheitern. Außerdem folgt sie nicht nur Spinoza in der These, dass »jedes Streben, Streben nach dem Beharren im eigenen Sein« (ebd.: 31) ist, sondern sie folgt auch Hegel entlang der These, »dass ›Sein‹ bedeutet, anerkannt zu sein« (Butler, 2012: 372). So kreist Butler auch um die Frage, was ein menschliches Leben ist und »wie das Menschliche produziert, reproduziert und deproduziert wird« (Butler, 2009: 64). Dabei geht es insbesondere um jene Normen und Praktiken, welche die Voraussetzung des Menschlichen bilden und »ohne die wir das Menschliche überhaupt nicht denken können« (ebd.: 97). Diese Überlegungen führen sie immer wieder zu der Frage: »was es bedeuten könnte, restriktiv normative Konzeptionen des […] Lebens aufzulösen« (ebd: 9). Konkludierend sollen die Thesen Butlers die Haltung und das Vorhaben dieser Forschungsarbeit insofern erweitern, als dass sie zum einen die Bedingung der Subjektivierung als Ermöglichung von Handlungsfähigkeit betonen. So hält Butler fest, dass das der Anrufung folgende Individuum das »Versprechen« des Rufs (an-)erkennt. Der Gedanke dieses »Versprechens« soll im weiteren Verlauf durch den Begriff der »Illusio« Pierre Bourdieus umgedeutet und auf verschiedene Dimensionen von ›Gleichheit‹ bezogen werden. Zum anderen lenken Butlers Positionen den Betrachtungsfokus innerhalb des folgenden Materials auf jene bezeichnende Akte, die die Körperlichkeit der Kinder überhaupt erst als ›Gleiche‹ hervorbringen; auf jene machtvolle Performativität der Konstitution von körperlicher Subjektivierung die im Folgenden genauer betrachtet werden soll.
2.1.2.
Performativität, Praxeologie und Körperlichkeit innerhalb der Erziehungswissenschaft
In Bezug auf die aktuelle erziehungswissenschaftliche Diskussion lassen sich Butlers zentrale Kategorien der Performanz und Verkörperung in Teilen sowohl innerhalb des kulturwissenschaftlich geprägten Zugangs der Pädagogik des Performativen (z.B. Wulf/Zirfas, 2007) als auch innerhalb der praxistheoretischen Erziehungswissenschaft wiederfinden (z.B. Budde/Bittner/Bosen/Rißler, 2018).
39
40
Choreographien der Homogenisierung
Über einen Einstieg in beide Teilbereiche soll im Folgenden die Relevanz des Bezugspunktes ›Körper‹ und seine erziehungswissenschaftlich geprägte Bedeutung innerhalb der vorliegenden Arbeit erhellt werden. So hat der performative turn (Fischer-Lichte, 2004) oder practical turn (Schatzki/Knorr-Cetina/Savigny, 2001; im deutschsprachigen Raum durch Reckwitz als Sozialtheorie systematisiert: Reckwitz, 2003) innerhalb der Kultur- und Sozialwissenschaften auch für die Erziehungswissenschaft Konsequenzen. Damit wird eine Wende in den Arbeiten verschiedenster Theoretiker*innen diagnostiziert, die es als gerechtfertigt erscheinen lässt, den Fundus der sozialtheoretischen Grundbegriffe um jene des Performativen und/oder der Praktiken zu erweitern und inhaltlich die ›Materialität‹ sozialer Praktiken in ihrer Abhängigkeit von Körpern und Artefakten zu fokussieren. Bei der Begrifflichkeit des Performativen handelt es sich dabei um einen in den Sozialwissenschaften mittlerweile etablierten Diskurs, der die aus der Sprachwissenschaft stammenden Begriffe »performativ« und »Performanz« (Austin, 1998; Chomsky, 1973), den kunst- und theaterwissenschaftlichen Begriff der »performance« (Carlson,1996) und den zunächst in der Genderforschung verwendeten Begriff der »Performativität« (Butler, 1991) zusammenführt. Dabei werden nicht länger allein Struktur und Funktion, Text oder Symbol, sondern die Herstellung von Wirklichkeit und der Prozess der Darstellung fokussiert: »Die Perspektive des Performativen rückt die Inszenierungs- und Aufführungspraktiken sozialen bzw. pädagogischen Handelns, deren wirklichkeitskonstitutive Prozesse sowie den Zusammenhang von körperlichem und sprachlichem Handeln, Macht und Kreativität in den Mittelpunkt. Mit der Idee, Prozesse der Interaktion und dramaturgische Sprach- und Handlungsvollzüge sowie Körperlichkeit und Materialität der Erziehungsund Bildungssituationen in den Mittelpunkt zu rücken, fokussiert der Blickwinkel des Performativen auf Rahmungen, Szenerien, mimetische Zirkulationsformen, Präsentationspraktiken und Darstellungssituationen.« (Wulf/Zirfas, 2006: 291) Die grundsätzliche Verschiebung, die mit diesem Blickwinkel verbunden ist, besteht darin, (pädagogische) Wirklichkeiten nicht länger allein als Text zu lesen und zu identifizieren, sondern die Praktiken des Repräsentierens in den Mittelpunkt zu rücken:
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
»Das Performative benennt das, was sich in Äußerungen und Handlungen zugleich zeigt und verbirgt; es benennt das, was nicht reduzierbar ist auf das Allgemeine als Konstitutivum des Besonderen noch auf das Einzelne als Ausdruck des Allgemeinen. Indem der Blickwinkel des Performativen auf die Formen der wirklichkeitskonstituierenden Momente mit ihrem mimetischen Charakter, aber auch mit ihren Brüchen und Differenzen gerichtet ist, wird die Idee des Textes als Repräsentation ergänzt.« (Wulf/Zirfas, 2007: 9)«Innerhalb der performativen Forschungsorientierung geht es nicht um die Aufhebung der hermeneutischen Position, sondern um die Verschiebung des Blickwinkels: Dementsprechend bezieht sich die performative Betrachtungsweise nicht vorrangig auf das in der Repräsentation Repräsentierte, sondern auf den Umgang mit der Repräsentation bzw. mit den Praktiken des Repräsentierens.« (ebd.: 11) Die Pädagogik des Performativen versteht Performativität hierbei als inszenierendes und aufführendes, theatrales Geschehen, dessen bildungstheoretische Relevanz in der Offenlegung eben jener inszenierenden Momente pädagogischen Handelns bestünde (ebd. 18). Damit gerieten »die Körperlichkeit der Handelnden, der Ereignischarakter und die inszenatorische Qualität ihrer Handlungen ins Zentrum des Interesses« (Wulf/Zirfas, 2001:339), mit dem Ziel der empirischen Beobachtung der Herstellung von Wirklichkeit – als Reflexionsfolien und Verstehensgrundlagen des Pädagogischen. So wird durch das Performative hier die ästhetische Dimension sozialer Arrangements fokussiert: Momente der Herstellung und konkrete Handlungsvollzüge in ihnen, deren Dynamiken, Materialien, Rahmungen sowie Aspekte der Körperlichkeit, Dramaturgie und Inszenierung. Unter dem Begriff der Ästhetik soll an dieser Stelle und im Verlauf dieser Arbeit ein Zugang zur Sinngenese über sinnliche Wahrnehmung oder Anschauung verstanden werden: »Etwas um seines Erscheinens willen in seinem Erscheinen zu vernehmen – das ist der Brennpunkt der ästhetischen Wahrnehmung […], eine radikale Form des Aufenthalts im Hier und Jetzt.« (Seel 2000:47/62) Aus phänomenologischer Perspektive kommt hier über die Auseinandersetzung mit sinnlichen Qualitäten eines Gegenstandes oder Prozesses die Sache selbst zur Sprache (Brenne, 2008). Diese soll über ein Sinn-Verstehen hinaus genauso Sinn-Emergenzen (Fischer-Lichte, 2005; Klein, 2015A; Kelter, 2017) betrachten:
41
42
Choreographien der Homogenisierung
»Performative Prozesse vollziehen sich in diesem Sinne in einem Wechselspiel von intentionaler Planung (Strategie) und nicht-intendierter, unvorhersehbarer Emergenz, womit die Offenheit, Unvorhersehbarkeit und Dynamik performativer beziehungsweise kultureller und sozialer Prozesse betont ist.« (Kelter, 2017: 126) Der Ansatz der Pädagogik des Performativen betont also die performative Kraft von Sprache und Imagination, künstlerischer Inszenierung und Aufführung, pädagogischem Handeln und rituellem Geschehen, wobei das Verhältnis von singulärer Handlung und mimetischer Wiederholung zentral wird. Ist eine phänomenologische Perspektive (vor allem in Bezug auf Merleau-Ponty, 1966) innerhalb dieser Arbeit mit Foucault und Butler zwar nicht umfassend haltbar4 , so verweist sie doch auf einen vitalistischen5 Moment der SinnEmergenz. Denn gerade in Bezug auf die Erziehungswissenschaft, in Auseinandersetzung mit Kindern, gilt es, die Theorie insofern zu sensibilisieren, als dass vitales kindliches Verhalten mehr sein kann als ein »Stören«. Dass in bestimmten vitalen Situationen vielleicht mehr agiert als aufgeklärt werden kann. Auch dieser Umstand soll hier mit Butler als »Widerstand« (Kapitel 2.1.5), als unumgängliche Abweichung von der Norm, gefasst und im weiteren Verlauf durch den Blickwinkel der Sozialen Choreographie erweitert werden (Kapitel 2.2). Zurück zum Begriff der Performativität: Dieser ist innerhalb der deutschsprachigen, kulturwissenschaftlich geprägten Forschung stark durch die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte geprägt worden (FischerLichte 2004; 2012), die den – innerhalb der Pädagogik des Performativen thematisierten – theatralen Aufführungscharakter fokussiert. In FischerLichtes Verständnis von Performativität emergieren sinnhafte Phänomene dabei zufällig. Im Gegensatz dazu sind bei Butler – auf die auch Wulf und 4
5
So kritisiert Michel Foucault, phänomenologische Positionen, als ledigliche Überführung der ontologischen Trennung von Subjekt und Objekt in eine anthropologische Leib-Dimension, ohne jedoch dem Anspruch der Aufhebung dieser Kategorien gerecht zu werden (Foucault, [1974] 2012: 392f). Auch Judith Butler äußert sich kritisch zu phänomenologischen Körper/Leib-Überlegungen (Butler, 1991) und zu Merleau-Pontys Positionen innerhalb seines Frühwerks direkt (Butler, 1989). Aus feministischer Perspektive unterstellt sie ihm einen männlich fixierten Blick und unterschwellig immer noch wirksame metaphysische Konstruktanordnungen. Der Körper, »behält damit das äußerliche und dualistische Verhältnis zwischen der bedeutungsverleihenden Immaterialität und der Materialität des Körpers selbst bei« (Butler, 1991: 221, 15). Im Sinne von »Kraft« und »Bewegung« Andrew Hewitts (2005).
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
Zirfas rekurrieren – Bedeutungen in Form von Normen und Regeln diskursiv festgelegt. Während die Theaterwissenschaftlerin mit dem Leibbegriff Wahrnehmungs- und Herstellungsvorgänge verbindet, spricht Butler vom Körper als geformter Materie, dessen scheinbare Identität verkörpert wird. So schließt Fischer-Lichte auch – trotz ihrer Herleitung des begrifflichen Entstehungsprozesses aus der Ethnologie – keine kritischen kulturwissenschaftlichen Bezüge (z.B. Hall, 1994; Hooks, 1996) mit in ihre Betrachtung ein. Diese liefern bereits grundlegende Erkenntnisse für performative Untersuchungen, indem unter anderem erkenntnistheoretische Mechanismen in ihrem Zusammenhang mit hegemonialen Machtstrukturen erfasst wurden (vertiefend dazu Kapitel 3). Der Zugang der praxistheoretischen Erziehungswissenschaft hingegen, sucht seine Wurzeln innerhalb der Soziologie und erscheint mittlerweile als breit gefächertes, aber insgesamt unscharf konturiertes Feld (Bittner/Bossen/Budde/Rißler, 2018). So lässt sich unter dem Label »Praxistheorie« kein einheitliches Paradigma verstehen, sondern ein Forschungsfeld, das mit Praktiken sowohl diskursives als auch nicht-diskursives Handeln umschreibt. Die erziehungswissenschaftlich ausgerichteten Konzepte fußen dabei weitestgehend auf der Grundlage der Ideen Andreas Reckwitz‹ (2001; 2003; 2006), der an Theodore Schatzki anschließt (1996), unter häufigem weiterem Bezug auf Judith Butler, Pierre Bourdieu oder Michel Foucault. Auch Reckwitz betont die Körperlichkeit der Praktiken im Besonderen: als kleinste Einheit des Sozialen, d.h. routinisierter Nexus von »doings« and »sayings« (Schatzki, 1996: 89). Praktiken beziehen sich demnach sowohl auf Kommunikations- und Verstehensprozesse als auch auf angenommene Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge. Die Unterscheidung von Praxis und Praktik beschreibt Reckwitz dabei wie folgt: » ›Practice‹ [Praxis V.R,] in the singular represents merely an emphatic term to describe the whole of human action (in contrast to ›theory‹ and mere thinking). ›Practices‹ in the sense of the theory of social practices, however, is something else. A ›practice‹ [Praktik V.R.] is a routinized type of behaviour which consists of several elements, interconnected to one other: forms of bodily activities, forms of mental activities, ›things‹ and their use, a background knowledge in the form of understanding, know-how, states of emotion and motivational knowledge.« (Reckwitz 2002: 249) So sind Praktiken mehr als eine vereinzelte Handlung, sie verweisen viel mehr auf den Vollzug von sinnhaftem Handeln und der sich wiederholenden
43
44
Choreographien der Homogenisierung
Anwendung von Bedeutung. Damit ist eine praxistheoretische Perspektive begründet, »welche die gleichzeitige Beständigkeit und Transformierbarkeit symbolischer Ordnungen auf der Ebene von Praktik-en lokalisiert« (Budde, 2012: 535). Ebenfalls stets mit der Absicht verbunden, Reflexionsfolien und Verstehensgrundlagen des Pädagogischen zu bestimmen anhand des Analyse-Gegenstandes der Ordnung sozialer Praxis: »Eine praxistheoretische Erziehungswissenschaft fokussiert auf die soziale Praxis des Pädagogischen bzw. pädagogischer Ordnungen und nimmt hierbei grundlegende epistemologische Erweiterungen für eine gehaltvolle Erfassung erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen vor.« (Bittner/Bossen/Budde/Rißler, 2018: 10). Eine besondere Perspektivierung leistet auch die Praxistheorie durch die Betonung der Bedeutung von Materialität für den Vollzug der Praxis selbst und verweist damit auf den »body turn« (Gugutzer, 2006), also die Verkörperung sozialer Akteur*innen und Strukturen als zentrales Thema soziologischer Untersuchungen. Wie jedoch die theoretische Weichenstellung zu Andreas Reckwitz und Judith Butler von Nicole Balzer und Dominic Bergner (2012) detaillierter zeigt, gibt es auch Passungsprobleme zwischen den Theoretiker*innen. So werden beispielsweise, »Subjekte nach Butler in Subjektpositionen nicht bloß ›gesetzt‹ […] wie es bei Reckwitz bisweilen scheint, sondern sie [müssen V.R.] ihre Position in der Ansprache durch andere auch ›erhalten‹ und sowohl verkörpern als auch bestätigen (lassen)« (Balzer/Bergner, 2012: 256). Die Bezugnahme auf den Körper, wie sie sowohl innerhalb des Zugangs der Pädagogik des Performativen als auch innerhalb der praxistheoretisch ausgerichteten Strömung der Erziehungswissenschaft zu finden ist, blickt dabei auf eine Geschichte zurück, die so alt ist wie die Idee von Erziehung selbst: »Die Körper- bzw. Leiblichkeit des Educandus ist Grundvoraussetzung allen Lernens, Grundvoraussetzung für Erziehung überhaupt.« (Schmidtke, 2008: 4). So entwickelte sich die noch im 19. Jahrhundert vorherrschende »Angst vor dem Körper des Educandus«, den es zu formen, disziplinieren und züchtigen galt, im 20.Jahrhundert vor allem durch die Reformpädagogik weiter. Der »befreiende humanisierende« Einbezug des Körpers in die Erziehung sollte einen positiven Einfluss auf alle am Lehr-Lern-Prozess Beteiligten bewirken (ebd.). Heute findet sich der Körper – fernab von performativen und praxistheoretischen Ansätzen – vor allem dann in pädagogischen Diskursen
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
wieder, »wenn er zum Problem wird, sei es, weil Kinder und Jugendliche zu dick, zu dünn, zu träge oder zu unruhig werden.« (ebd.: 5) Mit Foucault wären wir hier wieder bei der Analyse der Machtformen angelangt: von der Disziplinarmacht (der bezwungene Körper) zur Bio-Macht (der statistisch vorhersehbare Körper) zur Normalisierungsgesellschaft (der beständig an einer Norm orientierte, ökonomisierte Körper). Die vorliegende Arbeit will es sich – anschließend an die vorangegangenen Ausführungen zu Performativität, Praxeologie und Verkörperung – zur Aufgabe machen, die Bezugnahme auf den kindlichen Körper theoretisch und empirisch noch besser zu fassen und damit für qualitativ-empirische Fragestellungen in machttheoretischer Hinsicht sensu Foucault und Butler weiter nutzbar zu machen. Die Momente der Verkörperung und ihre Ästhetik sollen dabei eine entscheidende Rolle spielen und im späteren Verlauf durch das Konzept der Sozialen Choreographie zugänglich gemacht werden.
2.1.3.
Homogenität und Erziehungswissenschaft
Der Begriff der Homogenisierung beschreibt die Zunahme der Homogenität – also der Gleichartigkeit von Elementen – eines Systems und steht dem Begriff der Heterogenität – also Verschiedenes, einander nicht Untergeordnetes – gegenüber (Prengel, 2010; Stoeger/Ziegler 2013). Ist die Forschung zu Heterogenität im pädagogischen Feld dabei mittlerweile breit ausdifferenziert (z.B. Koller/Casale/Ricken, 2014; Budde, 2013; Trautmann/Wischer, 2011; Lutz/Wenning, 2001) bleibt demgegenüber die theoretische und auch empirische Erforschung des Themenkomplexes der Homogenität noch blass (Dietrich, 2017). Um die Problematik dieser Schieflage darzustellen, soll nun der Begriff der Homogenität – entlang der impulsgebenden Argumentation von Cornelie Dietrich (2017) – auf die Entwicklung seiner Bedeutung innerhalb der Erziehungswissenschaft bezogen werden. In ihrem Artikel »Im Schatten des Vielfaltsdiskurses: Homogenität als kulturelle Fiktion und empirische Herausforderung« stellt Cornelie Dietrich (2017) dreierlei zeitgenössische erziehungswissenschaftliche Zugänge zu Homogenitäts- und Gleichheitsvorstellungen gegenüber, die innerhalb der neueren und ausdifferenzierten Forschung zur Heterogenitätsdebatte wirksam werden. Diese sollen hier zusammenfassend erörtert werden, um das unauflösliche Spannungsfeld zwischen den Argumentationsmustern von
45
46
Choreographien der Homogenisierung
Gleichheit als Kontrastfolie zu Heterogenität nachvollziehen zu können, die im Rahmen dieser Arbeit immer wieder auftreten werden. I.
Die Bezugnahme auf Menschen und bürgerliche Freiheitsrechte (Dietrich, 2017:125f) Entlang der Argumentation Annedore Prengels (2014) und der historischen Diskussion um Menschen- und Bürgerrechte ab den 1960er und -70er Jahren, argumentiert Dietrich zunächst auf dem Boden allgemeiner Menschenrechte. Ausgehend von einer ursprünglichen Gleichheit aller Bildung und Erziehung, könne nach Prengel eine pädagogische Konzeption von Heterogenität und Teilhabe entfaltet werden, die, in Rücksichtnahme auf Prinzipien egalitärer Differenz, einerseits auf Anerkennung der Vielfalt, andererseits auf Vermeidung von Kategorisierung, ziele. Damit sei sowohl eine Anerkennung nichthierarchisierender Verschiedenheit im interpersonalen Verhältnis angesprochen, als auch die Berücksichtigung vielschichtiger Zugehörigkeiten im Sinne eines intersektionalen Ansatzes. Dadurch könne eine naive Identitätspolitik vermieden und die Gefahr der Positionierung der Einzelnen innerhalb bestimmter determinierender Differenzkategorien verringert werden. Die Normalisierungsdebatte um Angleichung der Lebensverhältnisse von Menschen mit Behinderung dient Dietrich im Weiteren als Illustration für die Bestrebung der Transformation hin zu einer konkludierenden Normalität, die in Separierungspraktiken hervorgebrachte Differenzen durch Normalisierung minimieren wolle. Gleichheit werde hier zum Fundament aller Bildungsprozesse mit dem Ziel der Angleichung von Lebensverhältnissen und Verwirklichungs-chancen. II.
Gleichheit der Chancen im Wettbewerb um gesellschaftliche Positionen (Dietrich 2017: 126ff) Mit der Rückbindung an das meritokratische Prinzip und die Doppelbewegung gemeinsam mit der Nationalstaatlichkeit, thematisiert Dietrich die Debatte um Chancengleichheit, die zu gewährleisten das Bildungswesen beansprucht. Ausgehend von den Ursprüngen im 18. Jahrhundert, skizziert sie die Entwicklung des meritokratischen Prinzips als Instrument der Emanzipation der bürgerlichen Klasse, das die Verteilung und Erreichbarkeit von beruflichen und sozialen Positionen nicht länger von Geburt an zuschreiben, sondern von erbrachten Leistungen des Individuums abhängig machen sollte.
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
Dieser Weg führt Dietrich zu Homogenisierungspraktiken in Bezug auf den Pflichtcharakter des Schulbesuchs, auf einheitlichen Ein- und Austrittsregelungen sowie auf Altersgruppen-Homogenisierung. Bis heute sei das meritokratische Prinzip zum einen die Basisnorm und legitimation für soziale Ungleichheit, zum anderen die Grundlage der Gleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen in der Schule, gemessen an gleichen Standarderwartungen der Lernresultate. Es befinde sich jedoch im Widerstreit zwischen skeptischen Befragungen (z.B. in Bezug darauf wie und von wem festgelegt wird, was als gute oder weniger gute Leistung zu gelten hat: Heid, 2012; oder wie Schüler*innen dazu gelangen, sich selbst als leistungsstark, -willig, -motiviert oder auch leistungsschwach zu inszenieren: Breidenstein, 2012; Rabenstein/Reh/Steinwand/Breuer, 2014) und ungebrochenem Optimismus ob seiner weiterhin geltenden Wirksam- und Tauglichkeit (vor allem unter Vertreter*innen der quantitativen Bildungsforschung). Der Einstieg in die Argumentationen der widerstreitenden Position führt Dietrich im Weiteren zu einer anderen Kontextualisierung von Gleichheit: Chancengleichheit gelte dabei als herzustellender Ausgangspunkt curricularen Lernens. Dieser sei notwendig, um dann eine Gleichbehandlung nach dem Leistungsprinzip legitimieren zu können. Dies erfolge jedoch nicht, um der Erhöhung von Verwirklichungschancen der Bildungsbenachteiligten willen – andernfalls müsse auch eine Entscheidung gegen das Leistungsprinzip denkbar sein –, sondern folge dem Ziel der Bildungsrenditensteigerung: »Bildung wird hier in Hinsicht auf seine ökonomische Struktur, nämlich als Investition und damit Kostenverursacher für die im Besitz befindlichen, dimensioniert. Dieses Angebot der Besitzenden muss aber von den Individuen entsprechend genutzt werden; sie verhalten sich sonst gegenüber den Anbietern unsolidarisch, die auf die Freiheit verzichten, ihr Geld anders zu verwenden; ebenso verhielten sie sich auch gegenüber der Gesamtgesellschaft unsolidarisch, die erwarten kann, dass durch die Ermöglichung von Chancengleichheit auch das gemeinsame Ziel, nämlich einer Anhebung des Leistungsniveaus von allen, ernsthaft verfolgt wird.« (ebd. 127) III. Kritik der Homogenisierung im kindheitssoziologischen Diskurs Anschließend an Foucault und die neuere, machtsensible Kindheitssoziologie (etwa Alanen und Mayall 2001; Sgritta 1987) geht Dietrich auf die Thematisierung von Homogenisierung mit den Begriffen der Normierung und Normalisierung ein. Durch den Verweis auf Standardisierungs-Ambivalenzen –
47
48
Choreographien der Homogenisierung
zwischen Legitimation durch rechtzeitige Intervention und Exklusion – die Helga Kelle innerhalb ihrer Forschung herausarbeitet (Kelle/Tervooren, 2008; Kelle, 2010; Kelle/Mierendorff, 2013; auch Stechow 2004) gelangt Dietrich dabei zu der schulpädagogisch rekonstruierten Durchsetzung einer Normalität an schulische Leistungserwartungen in drei Schritten – und ist damit nah an den Thesen Foucaults (vgl. Foucault: Disziplinartechniken, [1975] (1994): 181ff): 1) Homogenisierung durch Gleichstellung (z.B.: Altersgrenzen, Eingangsvoraussetzungen) 2) Festlegung des Maßstabs zur Bewertung der individuellen Leistung 3) Normalisierung durch die Bestimmung des Durchschnitts, als Analyse der Leistungsbewertung, aus der eine Kurve der Normalverteilung entsteht, jenseits derer das Anormale beginnt
In diesem Argumentationskontext könne Homogenisierung als Herstellung und Homogenität als Resultat des Erziehungs- und Sozialisationsprozesses aus der kritischen Perspektive poststrukturalistischen Denkens untersucht werden (Dietrich, 2017: 128ff). Im Weiteren konstatiert Dietrich die unauflösliche Spannung, in der diese drei Argumentationsstrukturen stünden. Zwar rekurrierten die vorgestellten Kontexte auf unterschiedliche Bildungsbegriffe und thematisierten unterschiedliche Einsetzungspunkte von Gleichheit und Homogenität, doch wäre die Trennung normativ ethischer Thematisierungen von Gleichheitsansprüchen von deskriptiv kulturellen Analysen von Homogenisierung nur analytisch möglich. Sowohl in praktischen als auch in erziehungswissenschaftlichen und bildungspolitischen Debatten sei beides meist unweigerlich miteinander verwoben, ohne dass dies explizit wird: »Die vergleichbare Ähnlichkeit der Chancen, die vergeben werden, die vergleichbare Ähnlichkeit menschlichen Vermögens und Bedürfnisse, mit denen alle in das Erziehungs- und Bildungssystem eintreten, die vergleichbare Ähnlichkeit der kulturellen Orientierungen, wie z.B. der Sprache oder dem schweigsamen Zustimmen zum Leistungsprinzip, die für ein gegenseitiges Verstehen notwendig sind, lassen sich nicht zu einem harmonischen Gesamtbild von Gleichheit zusammenfügen, sondern erfordern die Berücksichtigung der situativ und prozedural je veränderlichen Gleichzeitigkeit von Gleichheit und Ungleichheit, Homogenität und Heterogenität. So eröffnet die theoretische Reflexion Zugang zu einem notwendig in quali-
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
tativer Methodologie aufzusuchenden Forschungsfeld, in welchem danach gefragt wird, wie sich im Vollzug pädagogischer Praxis die interne Relativität von Gleichheit realisiert. Denn neben der grundlagentheoretischen Arbeit an der Verhältnisbestimmung von Heterogenität und Homogenität, von hierarchisierter und egalitärer Differenz existiert immer schon eine Praxis pädagogischer Felder, in welcher Gleichheit unter den Akteuren sich ereignet.« (ebd. :132) Wie diese Gleichheit sich ereignet und wie sich diese Ereignisse empirisch erforschen lassen, führt Dietrich in einem letzten Schritt zu einem Verständnis des pädagogischen Feldes als Ort kultureller Bedeutungsproduktion und einem praxeologischen Kulturbegriff nach Reckwitz (2000). Der Ausgangspunkt, dass sich anhand von diesem, Kultur immer erst in verschiedenen Praktiken eines aufeinander abgestimmten Handelns herstelle, welches auf für alle Teilnehmenden gültige Sinnsysteme oder Sinnordnungen bezogen sei, führe somit zu einem Praxisbegriff, der die Beobachtung und Analyse der Bedeutung performativer, in körperlichen und materialisierten Interaktionsformen enthaltenen Handlungsformen ermögliche. Mit diesem Ansatz will Dietrich ein zukünftiges Forschungsfeld, das in Komplementarität zur Doing-difference-Forschung die Doing-equalityProzesse in pädagogischen Feldern in den Blick nimmt, skizzieren. Diesem Fokus auf Prozesse komplementär zu Doing-difference will sich auch diese Arbeit anschließen, jedoch wird hier die Begrifflichkeit der Doing-Sameness präferiert (siehe Kapitel 2.1.4). Dietrich verweist dabei auf Bourdieus Begriff der »illusio« (Bourdieu, 1998). Da dieser Begriff von großer Relevanz für die Grundannahmen dieser Arbeit ist, soll er hier in einem kurzen Exkurs stärker umzeichnet werden. Den Begriff der »Illusio« entfaltet der Soziologe Pierre Bourdieu im Rahmen seiner Theorie des Feldes als Spielfeld. Im Laufe ihrer Entwicklung bilden sich nach Bourdieu innerhalb von Gesellschaften »Universen« aus, die er »Felder« nennt, die eigenen Gesetzen folgen und autonom agieren würden (Bourdieu, 1998: 148): »die also das, was sich in ihnen abspielt, und die Einsätze, um die in ihnen gespielt wird, nach Prinzipien und Kriterien bewerten, die nicht auf die der anderen Universen reduzierbar sind.« (ebd. 149). So gehorcht jedes Feld eigenen inneren Gesetzen, die nicht auf ökonomische Ziele reduziert werden können. Stattdessen treten innerhalb der Felder die Habitusformen in Kontakt miteinander und streben nach Prestige, Anse-
49
50
Choreographien der Homogenisierung
hen und Distinktion, das heißt sie befinden sich in sozialem Wettstreit, wie Bourdieu am Beispiel des ästhetischen Feldes ausführt: »Jeder Autor nimmt eine Position in einem Raum ein, das heißt in einem […] Kraftfeld, das auch ein Feld von Kämpfen um den Erhalt oder die Veränderung dieses Kraftfelds ist, und insofern existiert er und bestreitet er seine Existenz nur unter den strukturierten Zwängen des Felds […]; zugleich aber vertritt er […] seinen Standpunkt, verstanden als die Sichtweise, zu der man von einem bestimmten Standpunkt aus kommt, indem er eine der aktuell oder virtuell möglichen ästhetischen Positionen im Feld des Möglichen bezieht (und indem er auf diese Weise Position zu den anderen Positionen bezieht).« (ebd. 65f) Soziale Felder sind dabei insofern Machtfelder, als ihre Struktur durch die sozial ungleiche Verteilung des feldspezifischen Kapitals die Akteur*innen mit unterschiedlicher Macht gegenüber anderen Akteur*innen ausstattet. Soziale Felder sind zudem Spielfelder, da in ihnen bestimmte Regeln vorherrschen, an denen die Handlungen der Akteur*innen sich orientieren müssen, wenn sie einen Effekt im Feld haben und damit dem Feld zugehörig sein sollen: »Bei den ›Spielen‹ handelt es sich um Kämpfe um die Position im Feld als Konkurrenzfeld sowie um die Regeln des Spiels selbst. Dadurch, dass in sozialen Feldern die Spielregeln selbst beständig auf dem Spiel stehen, sind soziale Felder von anderen Spielen markant unterschieden. Sie bilden eine besondere Form von Spielen aus, in denen die Regeln zugleich als konstitutiv und regulativ gedacht werden müssen.« (Bongerts, 2008: 111) Die »illusio« wird im Rahmen seiner Theorie des Feldes als Spielfeld zur Voraussetzung für ein funktionierendes Spiel. Sie beschreibt den Glauben an die Sinnhaftigkeit eines Spieles – den Glauben daran, dass es tatsächlich so sei, wie es scheint: »Jedes Feld erzeugt seine eigene Form von illusio im Sinne eines SichInvestierens, Sich-Einbringens in das Spiel, das die Akteure der Gleichgültigkeit entreißt und sie dazu bewegt und disponiert, die von der Logik des Feldes her gesehen relevanten Entscheidungen zu treffen.« (Bourdieu 1999: 360) [eigene Hervorhebung V.R.] Sie kann dem Spiel sowohl vorausgehen, als auch als sein Ergebnis verstanden werden.
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
Zweck der »illusio« ist es dabei, die Spieler*innen so weit in das Spiel zu involvieren, dass die Spieleinsätze – ohne Vergegenwärtigung, worum es in dem Spiel eigentlich geht – stillschweigend anerkannt werden, so dass ein »heimliches Einverständnis« mit den Spielregeln erwächst (Bourdieu, 1998: 141). So führt die Illusio zu einer Akzeptanz, die zur Reproduktion des Spiels innerhalb eines Feldes unerlässlich ist. Für Bourdieu ist die Feldtheorie immer auch eine Herrschaftstheorie, da sich die Positionen innerhalb eines Feldes hierarchisch anordnen – es also Herrschende und Beherrschte in einem Feld gibt. Die Reproduktion des Feldes kann dabei sowohl zum Machterhalt der Machthabenden beitragen, als auch Veränderung erzeugen. Dieses Theorem bezieht Dietrich nun auf Prozesse der Homogenisierung innerhalb des Schulunterrichts: »Die Frage, ob und in welcher Weise eine illusio von Gleichheit und Homogenität in der Praxis des pädagogischen Feldes wirksam wird, wird damit zu einer empirischen. Einerseits ist schulischer Unterricht wie jedes pädagogische Gruppengeschehen auf ein Mindestmaß an Verhaltens-Homogenität angewiesen, um als Geschehen einer Gruppe zu funktionieren, die auf einen gemeinsamen Lerngegenstand gerichtet ist und deren Lernresultate interindividuell aufeinander bezogen werden sollen; andererseits aber ist jedenfalls im Feld Schule diese notwendige Verhaltens-Ähnlichkeit ganz eng gebunden an die Herstellung einer Bühne zur Aufführung von Leistung, mit der eine andere Dimension von Homogenität ins Spiel kommt.« (Dietrich, 2017: 133) So wird zusammenfassend deutlich, dass – vielschichtige Absichten verfolgende (Gleichheit als Angleichung von Lebensverhältnissen und Verwirklichungschancen, Gleichheit der Chancen im Wettbewerb um gesellschaftliche Positionen, Gleichheit als Normalisierungsbestrebung) – HomogenisierungsBestrebungen innerhalb eines traditionellen Verständnisses von Erziehung und somit innerhalb der Institution Schule im Besonderen, immer noch von großer Aktualität sind. Nach wie vor wirkt Schule als Vermittler von Normalitätsmaßstäben, die sie selbst (mit-)generiert. Die disziplinierten Körper scheinen hierbei ein wesentliches Merkmal für eine ökonomische Vermittlung des Lernstoffes zu sein und zu bleiben, wie auch die aktuelle Forschung weiterhin belegt (Wolter, 2018). Den schulischen Standardisierungsbestrebungen stehen jedoch Individualisierungstendenzen gegenüber, die auf den ersten Blick an Butlers Theo-
51
52
Choreographien der Homogenisierung
rie der Diskrepanz zwischen dem Sein wie jede*r Andere und dem Sein wie kein*e Andere anzuknüpfen scheinen. Dieser Pol der Individualisierung, der der Homogenisierung direkt gegenüberzustehen scheint, soll an dieser Stelle nicht ignoriert werden. Dennoch möchte dieses Vorhaben bewusst auf Prozesse der Homogenisierung fokussieren. So gilt es festzuhalten, dass innerhalb der traditionellen Schule, Homogenisierung durch Bestrebungen hin zu Normalisierung und Standardisierung weiterhin forciert wird. Sie wird – sogar darüber hinaus – zu einer illusionären Folie, zu einer falschen Vorstellung darüber, dass Lernen in homogenen Gruppen stattfände. Diese Illusion der homogenen Gruppe, diese Inszenierung der scheinbar homogenen Gruppe, führt wiederum zu dem Effekt einer Illusion von »Gleichheit« im Sinne von »Chancengleichheit«, die im folgenden Kapitel noch genauer differenziert werden soll (Kapitel 2.1.4). Wie diese Illusion der homogenen Gruppe im Schulalltag immer wieder von Neuem erzeugt wird, soll im Folgenden – anhand sozialer Choreographien – genauer untersucht werden. Ziel dabei ist es, Doing-sameness-Prozesse zu fokussieren und durch die Identifizierung und Analyse homogenisierender Alltagspraktiken im Unterricht, Prozesse der Differenzierung nach Leistung, Verhalten, Ethnizität, Sprache, Geschlecht etc. besser verstehbar zu machen.
2.1.4.
Doing Sameness/doing equality
Der Begriff des Doing Difference geht auf die (Gender-)Forschung durch West/Fenstermaker (1995) zurück und beschreibt den interaktiven Prozess der Herstellung von Differenz, am Beispiel Geschlecht, soziale Klasse und Ethnizität. Doing Difference bezieht sich dabei auf die kulturelle und soziale Konstruktion von Kategorien. Die Fragestellung lautet dementsprechend nicht: ›Was ist z.B. Ethnizität?‹, sondern: ›Wie wird Ethnizität hergestellt?‹. Difference wird so als performativ hergestellt verstanden. Innerhalb einer Diskussion um Homogenisierung als Folie von Differenzierung, erscheint es somit sinnvoll, dem Begriff des Doing Difference einen neuen Begriff des Doing Sameness zur Seite zu stellen, der an dieser Stelle über Cornelie Dietrichs Versuch der Formulierung von »Doing Equality« (2017) differenzierter hergeleitet werden soll. Ist die Begrifflichkeit des Doing Difference der Geschlechterforschung entsprungen, so führt auch die Diskussion um die Begriffe Equality und Sameness auf diese zurück (z.B. Walby, 2004), ist des Weiteren innerhalb der Debatte um Critical Whiteness/Critical Race Theory
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
(z.B. Jay/Jones, 2005) angesiedelt und bis in die Rechtswissenschaft verwurzelt (z.B. Littleton, 1987). Innerhalb der englischsprachigen Diskussion wird der Gleichheitsbegriff der Sameness dabei als: ›von gleichen Merkmalen‹ beschrieben. Für Strömungen der feministischen Theorie wird er somit als unzureichend identifiziert, denn: »women are not the same as men. They never will be as long as they lack men’s access to the gender privilege that operates in work and Family life« (Williams, 1991) [Hervorhebung im Original]. So würde der Begriff der Sameness zusammenbrechen sobald geschlechtsspezifische Unterschiede wie Schwangerschaft oder geschlechtsspezifische Erfahrungen, die Frauen vorbehalten wären, innerhalb derer sie spezielle Bedürfnisse hätten – wie zum Beispiel der Mutterschutz – in Betracht gezogen würden. Außerdem würde er die strukturelle Benachteiligung von Frauen negieren, sich in »männliche« Normen integrieren zu müssen (ebd.). Der Gleichheitsbegriff der »Equality« hingegen beschreibe Gleichheit im Sinne der Gleichberechtigung (Bock/James, 2005). Der Begriff der »Equality« jedoch impliziert zwar ›Gleichberechtigung‹ und ›Gerechtigkeit‹, die hier innerhalb der performativen Herstellung von Gleichheit dennoch nicht an erster Stelle fokussiert werden sollen. Dabei liegt die Entscheidung gegen den Begriff der »Equality« auch im Theorie-Gerüst dieser Arbeit begründet. So würde eine Geschichte der philosophischen Diskussion um den Begriff der »Gerechtigkeit« von Platon [408 v. Chr.] (nach Apelt/Bormann, 1989) bis Rawls [1971] (1979) an dieser Stelle zwar zu weit führen, jedoch soll er auch nicht allein als »der beständige, dauerhafte Wille, jedem sein Recht zuzuteilen« (Ulpian nach Honoré, 1982: D1,1,10), verstanden werden. Denn ›Gerechtigkeit‹ ist im Sinne der ›Sozialen Gerechtigkeit‹ und ›Bedarfsgerechtigkeit‹ ein Verteilungsmodus innerhalb der kapitalistischen Logik, der durch die Formel ›x verteilt y an z‹ nicht nur danach fragt, was für die Variablen x, y und z eingesetzt werden kann, sondern diese Formel in einem zweiten Schritt mit einem ›Gerechtigkeitsbegriff‹ kombiniert, so dass sich die Formel auf ›x verteilt y an z auf die Weise a resp. nach dem Kriterium a‹ erweitern muss (Kersting, 2000: 9). In Bezug auf den vorliegenden Forschungskontext wirft das die Fragen auf: 1. Wer (x) verteilt an die Schüler*innen (z)? Staat, Lehrer*innen, Familie? 2. Was (y) wird an die Schüler*innen verteilt? Bildung, Qualifikations-Zertifikate, Sorge? 3. Nach welchem Kriterium (a) wird verteilt? All diese Fragen berühren dabei große Felder wie die Begriffe ›Menschenrechte‹, ›Chancengleichheit‹ und ›Chancengerechtigkeit‹ (siehe auch Kapitel 2.1.3).
53
54
Choreographien der Homogenisierung
Doch zurück zu Foucault kann ›Verteilungsgerechtigkeit‹ nur als Machtinstrument der ökonomischen Form identifiziert werden: »Wenn die Gerechtigkeit in einem Kampf bemüht wird, dann als Machtinstrument und nicht in der Hoffnung, dass eines Tages die Menschen gemäß ihren Verdiensten belohnt oder für ihre Fehler bestraft werden. Anstatt die gesellschaftliche Auseinandersetzung in Begriffen der Gerechtigkeit zu verstehen, muss man vielmehr die Gerechtigkeit in Begriffen der gesellschaftlichen Auseinandersetzung verstehen.« (Foucault, [1974] 2002: 624f) ›Gerechtigkeit‹ wird hier zu einer (in der historisch aktuellen ökonomischen Form lebend) generell unmöglichen Illusion, deren Nacheiferung jene Mechanismen der Macht zu negieren scheint, die hier in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. So wird für das Vorhaben dieser Arbeit die Begrifflichkeit des Doing Sameness als Gegenhorizont zu und Begleitung von Doing difference passend. Denn es geht mit Hilfe der Folie der Homogenisierung um die performativ hergestellte Illusion der materialisierten Merkmalsgleichheit. Zum Beispiel: Alle Schüler*innen haben ein Heft, einen Stift und ein Radiergummi vor sich liegen, sitzen auf einem Stuhl an einem Tisch, so dass sie scheinbar alle die gleichen Voraussetzungen erfüllen, um eine »erfolgreiche« Benotung in der Klassenarbeit zu erzielen. Die Illusion der »gerechten« Gleichbehandlung (auch im Sinne von Chancengleichheit) schwingt dabei immer mit (siehe Kapitel 2.1.3; Dietrich, 2017) und kann ergänzend mit Ricken (2015) auch als »Versprechen« verstanden werden, »das Versprechen, dass durch ›Bildung‹ alles besser werde« (Ricken, 2015: 41). Jedoch ist diese Illusion erstmal nur ein Effekt der Verkörperung, ein machtvoller Effekt der Herstellung von Merkmalsgleichheit zur Plausibilisierung des Spiels.
2.1.5.
Praktiken des Widerstandes
»Wo es Macht gibt, gibt es Widerstand. Und doch oder vielmehr deswegen liegt der Widerstand niemals außerhalb der Macht.« (Foucault [1976] 2012: 96) Anschließend an die Auseinandersetzung mit den machtvollen Gefügen der Illusion von Gleichheit und Verteilungsgerechtigkeit soll nun der Widerstandsbegriff nach Michel Foucault und Judith Butler in den Mittelpunkt gerückt werden, um Spielräume der Umdeutung der Norm beleuchten zu können.
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
Wurde den Thesen Foucaults – gerade auch innerhalb der Erziehungswissenschaft – eine lähmende Aussichtslosigkeit vorgeworfen (Kapitel 2.1.1), so sind es im weiteren Verlauf dieser Arbeit die Positionen Judith Butlers zur Wiederholung der Norm und Widerstand, die Foucaults Gedanken erweitern sollen. Besonders Butlers produktiver Widerstandsbegriff soll dabei eine zentrale Rolle spielen, um mögliche Spielräume und Grenzen der machtvollen Gleichheits-Formationen erörtern zu können. Dieser unterscheidet sich deutlich von dem Widerstandsbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs und soll im Folgenden genauer beleuchtet werden. Der rechtswissenschaftliche und am stärksten verbreitete Widerstandsbegriff beinhaltet ein Verständnis des Sich-Widersetzens und -Entgegenstellens. Dieses könne insofern als Opposition verstanden werden, als dass es die Gesamtheit aller Personen, Gruppen, Organisationen, Ideen, Meinungen, Handlungen und Absichten umfasse, die sich den Inhaber*innen einer wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, geistigen, und/oder politischen Autorität entgegenstellen und diese bekämpfen würden. Juristisch könne dabei zwischen legalen und illegalen Methoden des Widerstandes unterschieden werden (Ballestrem, 2013: 68f). Legaler Widerstand ist seit 1968 außerdem in Artikel 20 (4)6 des deutschen Grundgesetzes verankert. Jedoch wird und wurde innerhalb der rechtsphilosophischen Auseinandersetzung ein allgemeines Widerstandsrecht – vor allem in Bezug auf die Frage, wer wem und warum das Recht gebe, Befehle zu erteilen, Regeln zu bestimmen, gegen die Widerstand entstünde – stets kritisch diskutiert (z.B. Kant, 1902A & 1902B; Krölls, 2009). »Denn darin besteht eben das Ansehen der Regierung, dass sie den Untertanen nicht die Freiheit lässt, nach ihren eigenen Begriffen, sondern nach Vorschrift der gesetzgebenden Gewalt über Recht und Unrecht zu urteilen.« (Kant, 1902B:25). So soll nun dem juristischen Widerstandsbegriff, derjenige dieser Arbeit gegenübergestellt werden. Dieser orientiert sich in seinem Ausgangspunkt an Michel Foucaults Frage »Was ist Kritik?« (Foucault, [1978] 1992) und kann mit
6
GG Art. 20 Abs. 4: »Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.«
55
56
Choreographien der Homogenisierung
Foucaults Worten als »Kunst nicht dermaßen regiert zu werden« (ebd. 12), charakterisiert werden (Kapitel 2.1.1). Dabei wird der Umgang mit sich selbst, mit dem eigenen Körper als Teil einer politischen Analyse moderner Gesellschaften sichtbar. Wenn »Regierung« eine Machtform darstellt, die über Fremd- und Selbstführung, über Subjekte und ihre Freiheit funktioniert und immer auch am Körper ansetzt, dann heißt dies nicht, dass die modernen Machtmechanismen auf Subjekte und ihre Körper bloß äußerlich einwirken. Vielmehr konstituieren sie diese und agieren durch sie hindurch, tief in ihnen.7 Der durch eine historische Analyse identifizierte Zweck liegt laut Foucault in der Generalisierung der ökonomischen Form, um ein beständiges und kalkulierbares (Wirtschafts-)Wachstum zu sichern. Das zentrale Anliegen der Foucault’schen Analytik der Macht ist es dabei, die Deutungsmacht der Wissenschaften sichtbar zu machen und zu entschlüsseln. Norm wird hier – mit Hilfe der Disziplinierung – sowohl hervorgebracht, wie auch eine darauf folgende Normalisierung möglich gemacht. Laut Foucault läge Widerstand somit in der Kritik an der Art und Weise, wie Menschen, soziale Praxen und Gesellschaften regiert werden und sich selbst regieren und ziele auf eine Überschreitung der konventionellen Regeln des Denk-, Sag- und Machbaren. Dies ist jedoch nicht mit einem Handlungsspielraum für die Einzelnen gleichzusetzen. Diese sogenannte ›Aussichtslosigkeit‹ innerhalb Foucaults Werk, mag einer der Gründe für das Meiden einer dezidierten und breiten FoucaultRezeption innerhalb der Erziehungswissenschaft vor den 2000er Jahren gewesen sein. Ein Anderer ist vielleicht eher ein romantisches Festhalten an der durch die Macht so pfleglich kultivierten Idee der vermeintlichen Freiheit und Selbstbestimmung – die von Kant über Humboldt und Habermas bis heute zum Fundament vieler Konzepte von Erziehung gehört und nach Foucault in dieser Form schlicht nicht existiert (siehe Kapitel 2.1.1). Viel deutlicher als Foucault nimmt Butler zumindest die konkrete Andeutung vor, dem Subjekt Spielräume der Variation zu eröffnen. Damit das Subjekt aber variieren kann, damit es sprechen und handeln kann, muss es sich der Struktur und den Regeln des Sag- und Repräsentierbaren unterwerfen. Erst dann kann es diese Regeln und Strukturen – bis zu einem gewissen Grad – verwerfen. Die Macht, die das Subjekt zunächst unterwirft, der 7
Vertiefend dazu interessant: Maren Möhrings Beschäftigung mit den Selbsttechniken der Körperbildung in ihrem historischen Wandel nach Foucault (Möhring, 2006).
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
es sich unterwirft, wird Bedingung der Subjektivierung, der Bildung eines (anders) handlungsfähigen Subjekts (vgl. Wischmann, 2010). Die Verhaftung in der Unterwerfung bleibt dabei jedoch unweigerlich bestehen. So kann es auch für Butler kein Ich geben, dessen Tun – und Widerstand – gänzlich der individuellen Kontrolle unterliegt. Wenn es also laut Butler kein Ich gibt, das seinen Willen durch den Diskurs vollstreckt, kann auch die Variation und Umdeutung von Normen nicht aus der Absicht oder Willenskraft eines Individuums entstehen. Handlungsfähigkeit bezieht das Subjekt laut Butler also – im Anschluss an Derrida – aus dem Wirkungsfeld der Normen, da es zur unentwegten Wiederholung der Normen ((Re)iteration) gezwungen ist und damit – im Sinne der Interpellation – die Unmöglichkeit der identischen Wiederholung einhergeht. Durch diese Unmöglichkeit der identischen Wiederholung und die Notwendigkeit der Wiederholung selbst, ist die Umdeutung von Normen keine Ausnahme, sondern die Regel. Das Subjekt ist also ein handelndes, da es gar keine Möglichkeit hat, nicht zu handeln. Durch diese Umdeutung ist das Subjekt genauso ein widerständiges Subjekt, da »es Interpellation und Normen widersteht, indem es re-iteriert und in der Iteration umlenkt.« (Balzer/Ludewig, 2012: 105). So wird in diesem Moment der Widerstand zu einer unbewussten Äußerung der Macht, da er aus ihrer Zitation entsteht. Infolgedessen wird seine Bedingtheit, auch im Konzept Butlers, deutlich. So wird also davon ausgegangen, dass Normen den Willen konstituieren, der wiederum die Normen reartikulieren und dabei wird nicht nur das Subjekt sozial geschaffen, sondern auch seine Reflexivität (vgl. Butler, 2002). Der Widerstandsbegriff der vorliegenden Untersuchung ist also nicht als bewusste Entscheidung zur Auflehnung gegen eine Autorität zu verstehen, die als legitim oder illegitim bewertet werden kann. Vielmehr soll Widerstand hier als unweigerliches inhärentes Umlenken der Norm – einschließlich der in Kapitel 2.1.1 erwähnten vitalistischen Momente – innerhalb jeder Wiederholung der Norm, betrachtet und so zu einem besonderen Aspekt der Analyse werden. Die Momente der Verkörperung und ihre Ästhetik sollen dabei im Folgenden mit Hilfe des Konzepts der Sozialen Choreographie zugänglich gemacht werden.
57
58
Choreographien der Homogenisierung
2.2.
Soziale Choreographien: von der Tanz- in die Geistes- und Sozialwissenschaft
Der hergeleitete Fokus des Forschungsvorhaben auf Prozesse der Herstellung von (illusionärer) Gleichheit führt nun zu der Erläuterung des innovativen (Betrachtungs-)Zugangs der Ästhetik der Verkörperung im Rahmen der Sozialen Choreographie. Entstanden aus einer Kombination der Übertragung des Erziehungsgedankens auf den Körper und dem Wunsch nach der Aufwertung einer Kunstform (Brandstetter, 2005), wird der Begriff der Choreographie im Volksmund heute recht einheitlich als Erdenken und Einstudieren von Bewegungsmustern verstanden. Innerhalb der Tanzwissenschaft jedoch wird die Frage danach, was Choreographie eigentlich ist, stetig kontrovers diskutiert (Siegmund, 2010). Dass dabei zum Beispiel die umfassende Rekonstruktion der Geschichte der Choreographie – und damit auch die Geschichte der »jeweils historischen und ästhetischen Vorstellungen vom Körper, seiner Disziplinierung und der repräsentativen Bedeutung von Tanzaufführungen« (Brandstetter, 2005:54) – nach wie vor ein Forschungsdesiderat bleibt (ebd.), trägt folglich nicht zu einer Glättung der Wogen bei. Dieser Diskurs um das Spannungsfeld aus schriftzentriert-festschreibenden und performativ-prozessorientierten Aspekten von Choreographie hat eine lange Tradition. So war es Raoul Auger Feuillet, der am Hofe Ludwigs XIV den Begriff der Chorégraphie (gr. choros: Tanz, Reigen und graphein: schreiben) eingeführt haben soll, welcher ab dem späten 17. Jahrhundert synonym für »Tanzschrift« verstanden und verwendet wurde (ebd.). Die Entstehung des Begriffs kann somit als Versuch verstanden werden, die Praxis des Tanzes am königlichen Hofe über das Medium der Schriftsprache festzuhalten: »Dies dient nicht nur der Dokumentation von unterschiedlichen Tänzen, deren Flüchtigkeit in die wiederholte Aufführbarkeit überführt werden soll, sondern auch der Reflexion und Repräsentation der Praxis. Die Anweisungen zur Übertragung von Tanz in Schrift folgen dabei dem Modell der Traktate zur Erziehung des Hofmanns8 ; […]. Die Choreographie und ihre Prinzipien des Tanzes und der Interaktion vermitteln neben ›sprezzatura‹, der Mü8
»Als Regelwerk zur Ausprägung sozialer Distinktionsmuster geben die ChoreographieTraktate Anweisungen für standesgemäßes Handeln im öffentlichen Raum.« (Brandstetter, 2005:53)
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
helosigkeit der Bewegung, zugleich eine Anleitung zum Habitus höfischer Repräsentation.« (ebd. 52f) So wurde der Begriff der Choreographie lange Zeit als »Die Kunst nach der Choreographie zu tanzen und Tänze zu schreiben« (Feldtenstein, 1767) verstanden und diente – im Rahmen der Choreographie-Traktate – zugleich als Anweisung für ein standesgemäßes Handeln im öffentlichen Raum. Erst mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts konnte sich dann die breitere Bedeutung von Choreographie als Begriff für »Kreation und Produktion von Tanzstücken« durchsetzen und befeuerte eine anhaltende, rege Diskussion um »Vor-Schriften«, um normative Repräsentationen von Körpern, um Bewegung und Performance (Brandstetter, 2005; Siegmund, 2010). Daran anknüpfend scheint es umso erstaunlicher, dass sich die Theorie der Choreographie fast ausschließlich auf den Tanz bezieht, ließen sich doch so viele der eben genannten Diskussionspunkte beispielsweise auf performative Ansätze vieler Disziplinen übertragen (vgl. z.B. Austin, 1986; Butler, 2001/2006;). Stellen Choreographien für die Tanzwissenschaft »ein grundlegendes Material für die Erforschung von Bewegungskonzepten und –praktiken« (Brandstetter 2005:53) dar, so strebt erst Andrew (2005) mit seinem Konzept der »Social Choreographie« die Verwebung von ästhetischen und soziologischen Deutungsmustern an. So verwendet er den Begriff der »Sozialen Choreographie« um eine Denktradition der sozialen Ordnung anzudeuten, die in Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Bereich entsteht und die dem direkten Einfließen dieser Ordnung in den Körper nachspürt. Diese Tradition hat die dynamische Beschaffenheit des Tanzes in ihrer reinsten Form beobachtet und sie begehrt die Übertragung dieser Formen auf die weitere soziale und politische Sphäre (Hewitt, 2005: 3). In dialektischer Manier stellt Hewitt in seiner Abhandlung dabei immer wieder zwei Gegenpole heraus: 1) Materialität: der Körper als Material der Aufführung vorgeschriebener bestimmender Diskurse. 2) Vitalismus: die Ideologie physischer Immanenz, innerhalb derer der Körper und die Körper-Bewegung den finalen Punkt des Widerstandes (sozialen und diskursiven Determinanten gegenüber) bildet.
59
60
Choreographien der Homogenisierung
Die Herausforderung bestünde – nach Hewitt – darin, diesen zwei widerstrebenden und doch gleichsam verlockenden Ideologien der Körperpolitik zu widerstehen: »Our task, then, must be to develop a critical hermeneutic that eschews the undialectical ›materiality‹ of the body on the one hand, and vitalist celebration of ›force‹ or ›movement‹ on the other.« (ebd.10) So ist es Hewitts Anliegen, eine kritische Hermeneutik zu entwickeln, die die undialektische ›Materialität‹ auf der einen Seite scheue und das vitalistische Feiern von ›Kraft‹ oder ›Bewegung‹ auf der anderen Seite. Es bräuchte eine Semiotik, die deren Interaktion und Kollision ausdrücke. Die kritische Herausforderung sei es, die textbasierte Analyse mit der Analyse von Performance zu verheiraten. Eine Herausforderung, die nicht nur für Tanzhistoriker*innen bestünde, sondern genauso für diejenigen Kulturhistoriker*innen, die vom Tanz lernen wollten und die unzufrieden mit der Tendenz ihrer Disziplin seien, ästhetische Phänomene auf den Status des Dokuments zu reduzieren, auf ihre einfachsten soziologischen Determinanten (ebd.). Soziale Choreographie sieht er dabei nicht als Metapher. Der Grund dafür sei 1) methodologischer und 2) substantieller Art: »This study differs in substance from the writings on the dance metaphor cited in an earlier note by stressing the social and political function of choreography – its disposition and manipulation of bodies in relation to each other – over the metaphysical resolution that dance offers. Rather than being interested in questions of how the metaphor, or even the practice, of choreography resolves problems of metaphysical subjectivity, this study will concern itself instead with the historical emergence of choreography (within [P 12] modernism broadly defined) as a medium for rehearsing a social order in the realm of the aesthetic. Particularly when dealing with performative genre, moreover, that constantly demarcates its own artistic borders even as it acknowledges what its material (the body) has in common with extraaesthetic – »metaphor« is an inadequate model for understanding the relationship of aesthetics to politics.« (ebd.11-12)9 9
Eigene Übersetzung: Diese Studie unterscheidet sich in der Substanz von den Schriften über die im Vorangegangenen zitierte Tanz-Metapher insofern, dass sie die soziale und politische Funktion von Choreographie hervorhebt – die Anordnung und Manipulation von Körpern in Beziehung zueinander – und nicht die metaphysische Auflösung der Problematik wählt, die der Tanz anbietet. Anstelle von einem Interesse an Fragen
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
Damit wendet er sich sowohl gegen Performativitätstheorien wie die Erika Fischer-Lichtes (z.B. 1998), denen die These zugrunde liegt, dass Performativität keinem Skript folge, sondern erst im Tun entstünde; als auch gegen den wissenschaftlichen Habitus »you think you are acting spontaneously, but look, let me show you the script« (Hewitt, 2007: 46), welchen er beispielsweise der Perfomativitätstheorie Judith Butlers unterstellt (ebd.). Es ist dabei nicht Hewitts Anliegen, eine Lösung mitsamt ihrer methodischen Vorgehensweise zu präsentieren, sondern vielmehr zu verdeutlichen: »Bodys are not writing. This being said, however, they clearly do signify; the challenge is to understand how they do it.« (Hewitt, 2005: 8) [eigene Hervorhebung V.R.] Weiterhin warnt Hewitt davor, sich weder für den rein vitalistischen oder den rein materialistischen Deutungsweg zu entscheiden. Denn das, was über eine Bewegung gesagt wird, sollte die Beweglichkeit der Bewegung mitsagen und Deutungsmuster somit möglichst weit öffnen. In der Erziehungswissenschaft wurde der Begriff der Choreographie zwar bereits verwendet, dabei jedoch nicht auf seine ästhetischen Wurzeln zurückgeführt oder die Begrifflichkeit selbst auf ihre Anschlussfähigkeit für erziehungswissenschaftliche Fragestellungen untersucht. So verfolgen Alkemeyer, Brümmer, Kodalle und Pille (2009) eher sozial-, kultur-, und sportwissenschaftliche Perspektiven. Dabei stehen Probleme des praktischen Hervorbringens sozialer Mikroordnungen im Zentrum und nicht die Choreographie als solche. Oser und Patry (1990) sowie Oser, Patry, Elsässer, Sarasin und Wagner (1997) hingegen nutzen den Choreographie-Begriff in ihrer Basismodelltheorie von Unterrichts-Strukturierung als Metapher. Lehrer*innen stünden bei der Planung von Unterricht innerhalb eines ähnlichen Spannungsverhältnisses zwischen Freiheit und Strenge wie Tänzer*innen: Allein durch eine bestimmte Musik würden sich für die Bewegungen bestimmte Vorgaben ergeben, denen sich nicht entzogen werden könne. Dennoch bliebe ein ge-
danach, wie die Metapher oder sogar die Praktik von Choreographie, Probleme metaphysischer Subjektivität löst, möchte diese Studie sich mit der historischen Entstehung von Choreographie als ein Medium zur Einübung sozialer Ordnung im Bereich des Ästhetischen beschäftigen. Besonders um Umgang mit dem performativen Genre, welches andauernd seine eigenen künstlerischen Grenzen de-markiert, obwohl es anerkennt was sein Material (der Körper) mit dem Extra-Ästhetischen gemein hat – ist das Model der ›Metapher‹ inadäquat, um die Beziehung von Ästhetik zu Politik zu verstehen.
61
62
Choreographien der Homogenisierung
wisser Spielraum zur freien Entfaltung, den Lehrer*innen wie Tänzer*innen kreativ nutzen könnten. Die Tanzwissenschaftlerin und Soziologin Gabriele Klein hingegen denkt Hewitts Konzept in Bezug auf den öffentlichen Raum weiter und veranschaulicht mit Hilfe von alltagskulturellen Beispielen, »wie das Soziale als choreographische Ordnung dem öffentlichen Raum bereits eingeschrieben ist« (Klein, 2010:97). So versucht sie mit Hilfe von Beispielen wie Militärparaden, Olympischen Spielen, Karneval, Schlagermove, Laufmarathon, Demonstration und Christopher Street Day deutlich zu machen, dass »soziale Choreographien […] nicht unabhängig von räumlichen Gegebenheiten und Architekturen [existieren], man denke nur an den Straßenverkehr, die Fußgängerampel, an Bahnhöfe und Flughäfen. Und sie existieren nicht unabhängig von sozialen Normen, Konventionen und Werten. Vielmehr werden diese in den Choreographien performativ hervorgebracht und entfalten dadurch ihre Wirkmächtigkeit. Als performative soziale Ordnungen sind soziale Choreographien immer auch kontingent. Das Konzept der sozialen Choreographie thematisiert von daher nicht primär das Soziale der Choreographie im Sinne eines tänzerischen Aspekts des Tänzerisch-Ästhetischen. Vielmehr thematisiert soziale Choreographie die Ästhetik des Sozialen als performative Ordnung von Raum, Körper, Bewegung und Subjekten.« (ebd.:101) [eigene Hervorhebung V.R.] Daran anschließend geht Klein davon aus – und knüpft damit sowohl an Hewitt als auch an Butler an –, dass soziale Choreographien soziale Wirklichkeit erzeugen. So wird im Prozess der bewegten Ordnung der Körper, der bestimmten, vorgegebenen oder selbst erschaffenen Spielregeln folgt, soziale Wirklichkeit produziert (ebd.). Demnach zeigt sich, Klein zufolge, »in dem Beziehungsgefüge zwischen Bewegungsausführung und choreografischer Ordnung die von Foucault beschriebene Mikrophysik der Macht auf vier Ebenen: in den Raum- und Zeitordnungen sozialer Figurationen, in der Art und Weise, wie Körper in der Bewegung interagieren, in den einzelnen Körpern selbst, die das Soziale habitualisiert haben und zugleich in ihren Bewegungen hervorbringen und schließlich in den Strategien der Beglaubigung choreografischer Ordnungen.« (Klein, 2012: 612 ; vgl. auch Klein, 2010) Soziale Choreographie kann so zu einer »analytische[n] Kategorie [werden], die es erlaubt, die Räumlichkeit und Zeitlichkeit des Sozialen als bewegli-
2. Choreographien der Homogenisierung und die Macht der Norm
ches, aber in der Bewegung strukturiertes Muster von In- und Exklusion, von Marginalisierung und Macht, aber auch von Subversion, Transformation oder Revolution zu denken.« (ebd.:101). So werden im Rahmen dieser Arbeit Soziale Choreographien im Anschluss an Hewitt und Dietrich/Riepe als regelmäßig ablaufende Bewegungsformen sichtbar, die für alle Beteiligten selbstverständlich (geworden) sind. Als verlässliche Ordnungen strukturieren sie die Bewegungen einer Gruppe im Raum nach bestimmten Regeln und sind als solche auch bedeutsam für die jeweilige soziale Ordnung im pädagogischen Feld. Die Verbindungen zwischen beidem, der Bewegung an sich, ihrer Regelhaftigkeit und ihrem Widerstand und dem, was sie über das soziale Setting sagt bzw., wie sie dieses mit hervorbringt, soll hier über den Zugang der Sozialen Choreographie erfasst werden können. Diese analytische Kategorie für die Erziehungswissenschaft zu erschließen und ihre noch undefinierte Methodik nutzbar zu machen, soll somit ein Forschungsdesiderat dieser Arbeit sein. Soziale Choreographie wird dann zu einem machttheoretischen Fokus, der das Ästhetische im Sozialen sucht. Dies erscheint insofern besonders vielversprechend, als dass Momente der Interaktion und Kollision der vitalistischen und materialistischen Dimensionen neu fokussiert werden können. Die Beweglichkeit der Bewegung kann somit auch dort besonders ernst genommen werden, wo sie sich eindeutigen Bedeutungszuschreibungen entzieht (Dietrich/Riepe, 2019). So kann der Rhythmus – in diesem Fall des Rhythmus einer Klassengemeinschaft, einer Arbeitsgruppe, von Schüler*innen – neu fokussiert werden, um daran anschließend diejenigen Momente in Bewegung und sozialem Verhalten herauszuarbeiten, die eine Homogenisierung dieses Rhythmus und einen Bruch in dieser Homogenisierung erzwingen und diese gegebenenfalls verändern können.
63
II EMPIRIE
3. Methodologie
Die vorangegangenen theoretischen Überlegungen führen nun zu einer methodologischen Einbettung des Forschungsvorhabens. So ist der verwendete Zugang der Ethnographie als ein methodenpluraler Ansatz des »Entdeckens« (Breidenstein/Hirschauer/Kalthoff/Nieswand, 2013) zu verstehen und blickt auf eine lange Tradition der Erforschung bzw. der Konstruktion von Kultur und Differenz – verstanden als »das Fremde« – zurück (Tervooren/Engel/Göhlich/Miethe/Reh, 2014). Als ausformuliertes Konzept, entsprungen aus dem methodischen Postulat Bronislaw Malinowskis [1922] (1960), bestand ihr Auftrag in der systematischen Beschreibung fremder Kulturen im Sinne einer ethnologisch und anthropologisch orientierten Gesellschaftsbeschreibung, mit dem Mittel der langfristigen teilnehmenden Beobachtung. Das angestrebte Ziel dieser Beobachtung sollte sein »to grasp the native ́s point of view, his relation to life, to realise his vision of his world« (Malinowski, [1922] 1960 :25). Angetrieben durch die Anfänge der Globalisierung und die zunehmende Begegnung von Kulturen war die Forschung zunächst auf die teilnehmende Beobachtung in »entlegene[n] Gesellschaften mit aus europäischer Sicht unverständlichen Sprachen und seltsamen Sitten und Gebräuchen« (Breidenstein/Hirschauer/Kalthoff/Nieswand, 2013:13) fokussiert. Erst seit der »Krise der Repräsentation« (Writing Culture Debate) (Marcuse/Clifford; 1986) – also der theoretischen Reflexion der Kontexte der Produktion von Wissen über »Andere« – arbeitet die Disziplin »in dem Bewusstsein, dass gerade die verstehende Aneignung des Differenten immer auch (post-)koloniale Beziehungen politischer und ökonomischer Abhängigkeit transportiert« (Tervooren/Engel/Göhlich/Miethe/Reh, 2014: 10) und ebnete den Weg zu einer Weiterentwicklung des Interessengegenstandes.
68
Choreographien der Homogenisierung
Die paradoxe Stellung der Ethnographie bewegt sich damit einerseits zwischen dem Pol des Angelpunkts kolonialer Verstrickungen und Angriffspunkts für massive postkoloniale Kritik: »Ethnologie war lange ein europäisches Projekt für die Erforschung des nicht-europäischen, nicht-modernen, nicht-aufgeklärten Teils der Weltbevölkerung zuständig (vgl. Troillot, 1991), in deren Deskription die Überlegenheit des wissenden Sprechersubjekts (des/der EthnografIn) und die unmarkierte Universalität des Westens (vgl. Coronil, 1996) strukturell angelegt war.« (Münster, 2012: 191) Und andererseits dem Pol der eigenen Geschichte der anti-hegemonialen politischen Kritik und der im ethnologischen Projekt angelegten »Destabilisierung eurozentristischer, kultureller und gesellschaftlicher ›Normalitäten‹ wie Familie, Sexualität, Person, Gender, Recht, Staatlichkeit, Rationalität und vieler weiterer« (ebd. 191f). Das kritische Konzept des »Othering« (Said, 1978; Spivak, 1985), das den Diskurs des ›Fremdmachens‹ als eine gewaltvolle, hegemoniale Praxis beschreibt (Mecheril/Castro Varela/Dirim/Kalpaka/Melter, 2010: 42), bereichert die kritische Diskussion dabei mittlerweile auch in der erziehungswissenschaftlichen Diskussion (im deutschsprachigen Raum vor allem durch Christine Riegel, 2016&2017). »Othering« gilt dabei als in Machtverhältnissen verankerte Praxis der »Konstruktion des Anderen« (Said, 1978) in Abgrenzung zu einem ›Eigenen‹, das als selbstverständlich, positiv und übergeordnet angesehen wird. Diese Praxis erscheint als permanente Grenzziehung, Kategorisierung und diskursive Unterscheidung zwischen einem ›Wir‹ und ›den Anderen‹. So wird das ›Andere‹ abgewertet, dem ›Eigenen‹ unterworfen, dessen Dominanz untermauert, was letztlich bestehende Machtverhältnisse legitimiert. So wurde und wird das »Fremde«, so wie es der Ethnologe Clifford Geertz in seinen einführenden Abhandlungen noch versteht ([1983] 1995; 1993), immer stärker umgedeutet. Innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion ist Fremdheit somit heute eher als (methodisch) befremdeter Blick oder Beobachtung eines fremden Phänomens zu verstehen. Die Anwendung auf die »eigene Kultur« wird dabei als weiterführend angesehen (siehe auch: Amann/Hirschhauer, 1997:10ff.). Das neuere Forschungsprogramm der Ethnografie, welches sich auch die Erziehungswissenschaft zu eigen macht, vollzieht nun einen Perspektivwechsel vom nachvollziehenden Verstehen hin zur Analyse der Herstellung von Wirklichkeit und einer Praxistheorie, die den Handlungs- durch
3. Methodologie
den Praktikenbegriff ersetzt (Reckwitz, 2004). Dabei wird die Körperlichkeit und Materialität des Tuns zum entscheidenden Moment der Aufführung von (Alltags-)Kultur (wie bereits in Kapitel 2.1.1 weiter ausgeführt). Eine ethnographische Auslegung von Forschungsprojekten innerhalb der Erziehungswissenschaft wurde hingegen erst in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts populärer, erfreut sich heute jedoch einer weiter zunehmenden Konjunktur, wie entsprechende Veröffentlichungen dokumentieren (vgl. z.B. Hünersdorf/Maeder/Müller, 2008; Frieberts-häuser/Huf, 2012; Tervooren/Engel/Göhlich/Miethe/Reh, 2014). Das Potenzial der Ethnographie für die erziehungswissenschaftliche Forschung wird dabei auf unterschiedliche Weise beschrieben, soll hier aber mit Göhlich, Reh und Tervooren gefasst werden: »In der erziehungswissenschaftlichen Bildungsforschung erlauben es ethnographische Designs […] [vor allem durch teilnehmende Beobachtung V.R.], auf eine besondere Weise Fragestellungen zu verfolgen, die im Kern gegenwärtiger bildungspolitischer Bemühungen stehen, durch Bildung soziale Ungleichheit abzubauen und die sozialen Kohäsionskräfte in der Gesellschaft (z.B. in ›inklusiven‹ Schulen) zu stärken, gerade weil jene trotz allgemeiner Zustimmung in ihren Erfolgen merkwürdig begrenzt bleiben. So kann der Blick auf die Unmöglichkeit der Herstellung von Gleichheit in pädagogischen Feldern geworfen und gefragt werden, in welchem Bezug an verschiedenen Orten produzierte Ungleichheiten zueinander stehen, oder ob und wie in und durch die Konstituierung sozial-geographischer Räume – vor allem in urbanen Ballungsräumen – Differenzen im Sinne von Bildungsungleichheit verstärkt werden.« (Göhlich/Reh/Tervooren, 2013: 640) Die Fruchtbarkeit der ethnographischen Feldforschung für den Zugang der vorliegenden Arbeit liegt somit vor allem innerhalb der Einblicke in soziale (Körper-)Praktiken, da sich die Inszenierungen von Sozialen Choreographien der Homogenisierung und der kindliche Widerstand gegen diese häufig auf der Ebene von unreflektierten Alltagshandlungen, in körperlichen Arrangements sowie in nonverbalen Kommunikationen vollzieht und darin sichtbar wird. So sollen im Folgenden die methodischen Zugänge des Forschungsvorhabens umrissen werden. Ausgehend von dem Konzept der Fokussierten Ethnographie (Knoblauch, 2001), wird dann die Materialsammlung im Sinne der Ethnographischen Collage vorgestellt (Friebertshäuser/Richter/Boller, 2010) und um die Komponente der zirkulären Dekonstruktion
69
70
Choreographien der Homogenisierung
(Jaeggi/Faas/Mruck, 1998) erweitert. Im Anschluss können dann analytische Zugänge des hermeneutischen Vorgehens der Sequenzanalyse (Oevermann/Allert/Konau/Krambeck, 1979) und der Fotoanalyse nach Verfahrensrichtlinien der Objektiven Hermeneutik (Ackermann 1994; Loer, 1996) dargestellt werden, um schließlich Clifford Geertz Konzept der Dichten Beschreibung (Geertz, 1983) zu umreißen. Abgerundet werden die methodischen Zugänge schließlich mit dem Versuch der Reflexion des Problems der Positionalität (Braidotti, 2002).
3.1
Fokussierte Ethnographie
Der Forschungsstil der fokussierten Ethnographie (Knoblauch, 2001) beruht auf dem Prinzip der klassischen Ethnographie mit dem Erkenntnisziel des Entdeckens des Unbekannten (Geertz, 1983; Amann/Hirschauer, 1997) und modifiziert beziehungsweise fokussiert dieses in bestimmter Weise. Wird im Rahmen der klassischen Ethnographie von dem Beobachten einer ›fremden Kultur‹ über eine lange Zeitspanne ausgegangen, so besteht das Spezifikum des soziologisch geprägten Ansatzes der fokussierten Ethnographie darin, dass dieser in der eigenen Kultur, der heimischen Gesellschaft, praktiziert wird und dabei bestimmte Ausschnitte derselben untersucht. Die Prämisse der Beziehung von Forscher*in und Erforschten als Fremdheitsrelation wird dabei verschoben. Die Ethnographin kennt ihr Feld bereits aus eigener Erfahrung (als ehemalige Schülerin einer Grundschule) und macht sich diese Erfahrung zunutze, um den Blick des Unbekannten lediglich hinsichtlich des fokussierten Aspektes der Untersuchung nutzen zu können, welcher sich oftmals schon durch seine mikroskopisch feine Auflösung einstellen kann. Anstatt auf ganze soziale Felder – was hier den gesamten Schulalltag bedeuten würde – wird auf einzelne Feldausschnitte fokussiert. In diesem Falle: Bewegungsabläufe, die Anordnung von Körpern im Raum und die (sprachliche und körperliche) Kommentierung dessen durch die Kinder. Anstatt über lange Zeiträume werden in kurzen Erhebungszeiträumen intensiv Daten gesammelt. Dabei werden hier teilnehmende Beobachtung, daraus entstandene Feldnotizen und einzelne Fotoaufnahmen genutzt, die im Weiteren im Sinne einer Ethnographischen Collage (Friebertshäuser/Richter/Boller, 2010) betrachtet werden sollen.
3. Methodologie
Die Chance der relativ kurzen Feldaufenthalte steht dem in methodologischen Schriften und Handbüchern verbreiteten Bild entgegen, dass methodisch »richtige« Ethnographie eines langen (am besten einjährigen) Feldaufenthalts bedürfe (Knoblauch, 2001; Lüders, 2009). Der Vorzug der fokussierten Ethnographie besteht jedoch in einer anderen Intensität: im Sinne der Menge an detaillierten Daten. Diese Datenintensität liegt auch im – nicht verpflichtenden – Einsatz technischer Aufzeichnungsgeräte begründet, hier der Fotografie: »Gerade das macht ihre Neuigkeit aus: daß die klassische teilnehmende Beobachtung in »natürlichen Situationen« durch den Einsatz (…) digitalisierter Aufzeichnungsverfahren ergänzt [wird]. Insofern zeichnet sich diese Ethnographie also keineswegs mehr durch den ›Verzicht auf extrakorporale Forschungsinstrumente‹ (Amann/Hirschauer 1997: 25) aus. Technische Geräte zählen vielmehr zum wesentlichen Instrument der Forschung, das gleichrangig neben der menschlichen Beobachtung fungiert.« (Knoblauch, 2001: 130). Darüber hinaus geht es um eine Datenintensität von » ›Mikro-Ausschnitte[n]‹ der sozialen Wirklichkeit […]: zeitweilige Tätigkeiten bestimmter Personen, zuweilen sogar nur einzelner Aktivitäten (z.B. Beobachten, Sehen, Zeigen)« (ebd. 135). Jedoch versteht sich Fokussierte Ethnographie dabei nicht als »mikro-soziologisch«: »Indem sie nämlich einzelne Prozesse der Konstruktion des Sozialen analysieren, beanspruchen sie zugleich, die Prinzipien der gesellschaftlichen Konstruktion des untersuchten Phänomenbereichs offenzulegen.« (ebd. f) Die beobachtende Teilnahme am Unterricht als Beziehung zwischen Nähe der Teilnahme und Distanz der Beobachtung bleibt auch hier der zentrale Ausgangspunkt der Datenerhebung: »Dabei ist die Annahme leitend, dass durch die Teilnahme an face-to-faceInteraktionen bzw. die unmittelbare Erfahrung von Situationen Aspekte des Handelns und Denkens beobachtbar werden, die in Gesprächen und Dokumenten – gleich welcher Art – über diese Interaktionen bzw. Situationen nicht zugänglich wären.« (Lüders 2001: 151) Für die vorliegende Untersuchung hat die Perspektive der Fokussierten Ethnographie also vielschichtige Vorteile. So kann durch die Datenintensität in
71
72
Choreographien der Homogenisierung
Bezug auf Fotografien und mikroskopischen Fokus eine genauere Analyse der Anordnung von Körpern und Bewegungen – der Sozialen Choreographien – vorgenommen werden. Außerdem sind die Fotografien anderen Beobachter*innen prinzipiell auf dieselbe Weise zugänglich wie der Forscherin selbst und somit in der Lage, die Validität der Forschung in Bezug auf Intersubjektivität der Beobachtungen und Analysen in gewissem Maße zu stützen. Innerhalb dessen versteht sich die Forscherin im kulturwissenschaftlichen Sinne als Teil jener Lebenswelt, die sie untersucht. Das Problem der Positionalität soll dabei im späteren Verlauf noch genauer erläutert werden, da die Studie durch dieses in besonderer Weise begleitet wurde und außerdem Teile der Kritik an Ethnografischer Forschung im Allgemeinen und des im Folgenden weiter aufgegriffenen Konzepts der Dichten Beschreibung im Besonderen berührt.
3.2
Ethnographische Collage
Der Frage, wie im Rahmen dieser Erhebung nun aus der Materialsammlung wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und »diese dann für andere nachvollziehbar und kontrollierbar präsentiert« (Friebertshäuser/Richter/Boller, 2010: 380) werden können, findet innerhalb der vorliegenden Studie in dem Begriff der Ethnographischen Collage (ebd.) eine adäquate Antwort. Dabei werden aus unterschiedlichen methodischen Vorgehensweisen gewonnene »Relevanzzusammenhänge«, die »füreinander Kontexte darstellen, die sich aneinander reiben und nicht notwendig zur Übereinstimmung gebracht werden können« und sollen (Kelle 2001:206) collagiert. Den Begriff des Collagierens verstehen die Autorinnen dabei als das Zusammenstellen, miteinander Verbinden oder Gegenüberstellen, das Ergänzen aber auch wieder Herausstreichen und Verdichten von Daten: »Die Kunst der Erstellung der Ethnographischen Collage besteht in der wissenschaftlich kontrollierten Zusammenführung der Daten, bei der die Gegenstandskonstruktion der einzelnen Zugänge und Daten ebenso in die Reflexion einfließen muss, wie die Form der Zusammenführung und Verknüpfung. […] Die Collage enthält am Ende alle Elemente, auf die in der späteren Deutung eingegangen wird.« (Richter/Friebertshäuser, 2013: 83) Die Collage der vorliegenden Studie besteht also aus Feldnotizen und daraus entstandenen Beobachtungsprotokollen sowie Fotografien, die im Rah-
3. Methodologie
men von teilnehmender Beobachtung gewonnen wurden. Diese wurden auf Grundlage der Zirkulären Dekonstruktion in einen Themenkatalog extrahiert und mit Hilfe der hermeneutischen Sequenzanalyse interpretiert sowie durch hermeneutische Bildanalysen angereichert. Aus der Zusammenführung, Verknüpfung und Reflexion dieser Daten, konnten schließlich dicht beschriebene Portraits einzelner Körperformationen entstehen. Die Verankerung dieser methodischen Konzepte soll im Folgenden also umrissen und der Datenkorpus eingehender beschrieben werden.
Die Zirkuläre Dekonstruktion »Codieren ist die Kategorisierungstätigkeit eines Lesers, der aus einem zufällig und chronologisch angewachsenen Datenkorpus allmählich mittels Schlagwörtern und Begriffshierarchien eine thematisch-analytische Ordnung entwickelt und mit ihrer Hilfe diesen Korpus umstrukturiert.« (Breidenstein/Hirschauer/Kalthoff/Nieswand, 2013:138) Diese Kategorisierungstätigkeit, Auswertung und Analyse der vorliegenden Arbeit beruht auf der methodischen Grundlage der Zirkulären Dekonstruktion (Jaeggi/Faas/Mruck, 1998). Das Verfahren der Zirkulären Dekonstruktion leitet sich in seiner Begrifflichkeit aus seinem konkreten Vorgehen ab: Das Ausgangsmaterial ist ein Text (im Folgenden auch Fotografien), um diesen herum werden kreative Gedankenschleifen intuitions- und theoriegeleitet bewegt. Damit wird der Text zirkulär und rekursiv »dekonstruiert«, um ihn anschließend so zusammenzusetzen, dass implizite Sinngehalte sichtbar werden können. Auf diese Weise soll ein mehrfacher Perspektivenwechsel stattfinden, durch den die Bausteine für eine Theorie über den Forschungsgegenstand gefunden werden können, die neuartige Erkenntnisse versprechen (Jaeggi/Faas/Mruck, 1998: 5f). Das Anliegen der Entwicklung der Methode bestand laut den Autorinnen darin, »das Konstruktive und Kreative qualitativen Arbeitens im Blick zu halten und für den Deutungsprozess schöpferisch zu nutzen« anstelle der zu verzeichnenden »Tendenz zur Verregelung« zu folgen (ebd.: 3). Das scheint diesen Ansatz für die Nutzung im Rahmen dieser Studie – im Rückschluss auf die Theorie der Sozialen Choreographie – im hohen Maße zu qualifizieren. Konkret hat die Codierung im Sinne der Zirkulären Dekonstruktion die Materialauswahl (von Bild und Text) in Form der folgenden Schritte unterstützt: (ebd.: 7ff):
73
74
Choreographien der Homogenisierung
1) die Formulierung von Mottos für die Beobachtungsprotokolle, die einen Eindruck vom Text bündeln 2) die zusammenfassende Nacherzählung der Kernereignisse einzelner Textstücke 3) das Sammeln auffällig gehaltvoller Worte und Ereignisse innerhalb einer Stichwortliste 4) das Extrahieren verschiedener vorgefundener Themenbereiche in einen Themenkatalog
Mit Hilfe des Themenkatalogs konnten dann relevante Meta-Themen innerhalb des Materials herausgefiltert und bestimmte Situationen zur genaueren Analyse dieser Themen ausgewählt werden. Die Hauptaspekte der Ergebnisse aus den Feinanalysen wurden anschließend in Form von dicht beschriebenen Portraits zusammengefasst.
Hermeneutisches Vorgehen: Sequenzanalyse Das Konzept der objektiven Hermeneutik beruht in weiten Teilen auf den Arbeiten Ulrich Oevermanns (vgl. z.B. Oevermann, 1979; 1986: 1990) und ist ein komplexes theoretisches, methodologisches und methodisches Konzept der qualitativen Textanalyse. So fokussiert sie die Regelgeleitetheit sozialen Handelns und die in dieser Regelgeleitetheit liegende Sinnstrukturiertheit von sozialen Abläufen. Dabei zielt sie auf die hinter den subjektiven Bedeutungen verborgenen, objektiv latenten Sinn-Strukturen. Die Bezeichnung objektiv führte innerhalb der wissenschaftlichen Diskussion immer wieder zu Objektivismusvorwürfen, weshalb sogar Oevermann selbst vorübergehend von strukturaler statt von objektiver Hermeneutik sprach (Reichertz, 1997; Peez, 2006). So rekurriert der Begriff der Objektivität nicht primär auf objektive Ergebnisse eines Verfahrens zur Aufdeckung von Wirklichkeit, sondern auf die Rekonstruktion von Bedeutungsgehalten und latente Sinnstrukturen menschlichen und sozialen Handelns. Also auf typische, charakteristische Strukturen der untersuchten Erscheinungen: »Latente Sinnstrukturen und objektive Bedeutungsstrukturen sind also jene abstrakten, d.h. selbst sinnlich nicht wahrnehmbaren Konfigurationen und Zusammenhänge, die wir alle mehr oder weniger gut und genau ›verstehen‹ und ›lesen‹, wenn wir uns verständigen, Texte lesen, Bilder und Handlungsabläufe sehen, Ton- und Klangsequenzen hören und alle denkbaren Begleitumstände menschlicher Praxis wahrnehmen, die in ihrem objektiven
3. Methodologie
Sinn durch bedeutungsgenerierende Regeln erzeugt werden und unabhängig von unserer je subjektiven Interpretation objektiv gelten.« (Oevermann 2002: 2) Diese Strukturen zu identifizieren und die hinter den Erscheinungen operierenden Gesetzmäßigkeiten ans Licht zu bringen, ist Ziel der objektiven Hermeneutik (ebd.). Nach Oevermann ist die objektive Hermeneutik demnach: »[…] nicht eine Methode des Verstehens im Sinne eines Nachvollzugs subjektiver Dispositionen oder der Übernahme von subjektiven Perspektiven des Untersuchungsgegenstandes, erst recht nicht eine Methode des SichEinfühlens, sondern eine strikt analytische, in sich objektive Methode der lückenlosen Erschließung und Rekonstruktion von objektiven Sinn- und Bedeutungsstrukturen.« (ebd. 6). »Viel mehr macht die objektive Hermeneutik ernst mit den Konsequenzen der grundlegenden Erkenntnis, daß jede subjektive Disposition, d.h. jedes psychische Motiv, jede Erwartung, jede Meinung, Haltung, Wertorientierung, jede Vorstellung, Hoffnung, Fantasie und jeder Wunsch methodisch überprüfbar nie direkt greifbar sind, sondern immer nur vermittels einer Ausdrucksgestalt oder einer Spur, in der sie sich verkörpern oder die sie hinterlassen haben. Zutreffend entschlüsseln läßt sich daher eine solche Disposition erst, wenn man zuvor die objektive Bedeutung jener Ausdrucksgestalt entziffert hat. Erst dann kann man zur begründeten Erschließung der Struktur der subjektiven Disposition selbst übergehen.« (ebd.2) Ausgangspunkt der Analyse ist dabei die Textförmigkeit sozialer Wirklichkeit als Ausdrucksgestalt, also als sinnstrukturierte menschliche Praxis in allen ihren Ausprägungen (ebd.). Objektive Hermeneutik ist insofern als Textwissenschaft zu verstehen, da ihr methodischer Zugriff stets über Protokolle der Wirklichkeit stattfindet. Ihr liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Sinn-Strukturen der Welt durch Sprache konstituieren und in Texten materialisieren. Nicht-sprachliches Material stellt für diese Konzeption solange keine Schwierigkeit dar, insofern es in Protokollen festgehalten werden kann. Sowohl Text- als auch Protokollbegriff werden hierbei methodologisch erweitert verstanden und können in vielerlei Erscheinungen von Spuren-Fixierung und Aufzeichnung von menschlicher Praxis bis hin zu Landschaften, Erinnerungen und Dingen der materialen Alltagskultur vorliegen. Eine sinnliche Wahrnehmung ist dabei inbegriffen.
75
76
Choreographien der Homogenisierung
Die spezifische Leistung der Vorgehensweise im Sinne der objektiven Hermeneutik für die vorliegende Arbeit besteht also darin, die vielfältigen Ausdrucksformen der Praxis von Sozialen Choreographien und Homogenisierung als individuierte Gebilde im Spannungsfeld von Allgemeinem und Besonderem zu rekonstruieren. Das Vorhaben wird des Weiteren als ein hermeneutisches beschrieben, da hier dieses bestimmte Verständnis und Vorgehen der Textinterpretation vor allem in Bezug auf die Sequenzanalyse verwendet, aber neben der »Interpretationskunst« (Reichertz, 1991) nicht alle Punkte des Gesamtkonzeptes der objektiven Hermeneutik im Spezifischen – z.B. in Bezug auf die Struktur- oder Sozialisationstheorie Oevermanns – fokussiert werden sollen. Im konkreten Vorgehen ist dabei für die Erschließung der Sinnstrukturen die geduldige, präzise und streng sequentielle – also schrittweise – Ausdeutung des Materials entscheidend. Finden sich diesbezüglich innerhalb der objektiven Hermeneutik und Oevermanns Schriften unterschiedliche Varianten der Textauslegung und der Darstellung der Forschungspraxis (ebd.) so soll hier die Sequenzanalyse verwendet werden. Die Sequenzanalyse widmet sich dabei Zug um Zug – in der Reihenfolge ihres Auftretens – jedem einzelnen Interaktionsbeitrag, ohne vorab den inneren oder äußeren Kontext der Äußerung zu erörtern. So bietet sie der Struktur die Möglichkeit, sich selbst zu explizieren (Oevermann, 1983). Sie ist also als pfadabhängige Rekonstruktion zu verstehen, die davon ausgeht, dass sich Handlungen in Sequenzen vollziehen, die aufeinander aufbauen. Im Rahmen eines Interaktionsprotokolls im hermeneutischen Sinne gilt dann jede Sequenz als motivierte Folge aus den vorhergegangen und Auslöser für weitere Handlungen. Das eigentliche Vorgehen ist dabei in drei Schritte zu unterteilen: »Die Rekonstruktion der objektiven Bedeutungsstruktur einer konkreten Äußerung beginnen wir im Rahmen der objektiven Hermeneutik damit, dass wir zunächst Geschichten über möglichst vielfältige, kontrastierende Situationen erzählen, die konsistent zu einer Äußerung passen, ihre Geltungsbedingungen pragmatisch erfüllen. Im nächsten Schritt werden diese erzählten Geschichten, die implizite gedankenexperimentelle Konstruktionen darstellen, explizit auf ihre gemeinsamen Struktureigenschaften hin verallgemeinert, die in ihnen zum Ausdruck kommen, und im dritten Schritt werden diese allgemeinen Struktureigenschaften mit den konkreten Kon-
3. Methodologie
textbedingungen verglichen, in denen die analysierte Äußerung gefallen ist.« (Oevermann 1983: 236f.) 1. Gedankenexperiment/Lesarten bilden In einem ersten Schritt geht es um das Imaginieren von Kontexten, innerhalb derer die zu analysierende Interaktionssequenz, ohne dass sie eine sprachlich-pragmatische Regelabweichung darstellt, vorkommen könnte. 2. Lesarten ausbuchstabieren In einem zweiten Schritt wird das vorangegangene Gedankenexperiment – weiterhin in Reflexion der Vernünftigkeitsvorstellungen (Normen und Regeln) der Interaktionsgemeinschaft – ausbuchstabiert. Latente Sinnstrukturen der jeweiligen Lesart werden dabei an der Wörtlichkeit des Textes nachgewiesen und herausgearbeitet. 3. Konfrontation mit dem tatsächlichen Äußerungskontext Im dritten Schritt wird dann die kontextunabhängige Interpretation verlassen, so dass die sinnrukturellen Befunde aus der Ausbuchstabierung der Lesarten anhand des tatsächlichen Äußerungskontexts überprüft werden können. Eine Typisierung des Einzelfalls als besondere Lösung eines allgemeinen Problems wird somit möglich. (vgl. Oevermann, 1983; Reichertz, 1997; Wernet, 2010; Kurt/Herbrink, 2014) Die Sequenzanalysen der vorliegenden Arbeit fanden auch immer wieder in Gruppen unterschiedlicher Zusammensetzung statt, so zum Beispiel in ethnographischen Doktorand*innen Workshops der Universität Freiburg, auf unterschiedlichen Tagungen und in kollegialen und institutsbezogenen Zusammenhängen der Leuphana Universität Lüneburg. So konnte im Gegensatz zum »Genius Einzelner«, die »Genialität improvisatorischer Teamarbeit« innerhalb der Interpretation wiederkehrend fokussiert werden (Kurt/Herbrink, 2014). Eine exemplarische Illustration des Vorgehens der Gedankenexperimente im Rahmen der Feinanalysen soll hier nun kurz vorgestellt werden:
77
78
Choreographien der Homogenisierung
Forschungsphase 3 Auszug aus Protokoll 14 08.04.2015 »Startklar zum Lernen« Sequenz Nur Hylia wirkt abwesend. Sie legt den Oberkörper auf ihre Oberschenkel, so dass ihre langen, dunklen Haare vornüber fallen und schüttelt Hände, Arme, Oberkörper und Kopf. In dieser langsamen Schüttelbewegung richtet sie sich vorsichtig auf, die Schultern kreisend, die Haare fallen ihr über das Gesicht. Als sie wieder aufrecht sitzt, lässt sie sich nun langsam rückwärts über den Hocker gleiten. Erst berühren ihre Haare, dann der Kopf den Boden. Ihre Hände verbleiben an der Hüfte. Alessandro, der links neben ihr sitzt, beugt sich zu ihr herunter und lächelt. Sonst beachtet sie niemand. Sie schaut mich an – ich sitze hinter den Sitzreihen auf einem einzelnen Stuhl – und lacht. Dann setzt sie die Hände ebenfalls, neben dem Kopf, auf den Boden auf. Frau Knapper bittet die Kinder nun die Silben der Worte an der Tafel zu zählen. Hylia setzt sich daraufhin wieder gerade auf den Hocker und beteiligt sich. Auch Alessandro zählt mit, kniet sich erst auf den Hocker, stellt sich dann dahinter und wiegt von einem Bein auf das andere, hin und her. Er meldet sich und wird auch von Frau Knapper an die Reihe genommen. Dann stellt Hylia sich auf den Hocker, nach nur wenigen Sekunden ruft Frau Knapper scharf: »Hylia setzt Dich hin!«, und rückt ihren Namen an der Tafel nach unten. »Wo bin ich?«, flüstert sie zu Alessandro. »Du rutschst immer weiter runter!«, antwortet dieser. »Bei startklar!«, flüstert Ardi. »Ach ok«, winkt Hylia mit einer Handbewegung ab.
Erster Interpretationsschritt: Gedankenexperimente Fragen: In welchen mir qua alltäglicher Regelkompetenz bekannten Kontexten ist diese Textsequenz ein wohlgeformter Sprechakt? Dazu ist ein gedankenexperimentelles Vorgehen notwendig, in dem soziale Situationen bzw. Sprechhandlungen konstruiert werden, in denen der zu interpretierende Text, ohne dass er eine sprachlich-pragmatische Regelabweichung darstellt, vorkommen könnte (Wernet, 2011: 10f). Die Grundideen der hier nun ausformuliert erscheinenden, exemplarischen Gedankenexperimente entstanden in einer gemeinsamen Interpretationssitzung mit Anna Lettow, Niels Uhlendorf und Isabell Wullschläger.
3. Methodologie
Gedanken-Experiment 1 Tanztheater-Aufführung Der Vorhang öffnet sich, so dass dem Publikum der Blick auf die Bühne freigegeben wird. Zu sehen ist eine Klassen-Situation in klaren, parallel gradlinigen Formen arrangiert. Darsteller*innen sind auf Hockern mit Sitzflächen für je zwei Personen in drei parallelen Reihen mit dem Blick zur Tafel und dem Rücken zum Publikum angeordnet. Dem Publikum zugewandt, mit dem Rücken zur Tafel steht eine Darstellerin, die man als Lehrerin identifizieren kann. Von dem statischen Bild hebt sich das zweite Mädchen von links – aus der ersten Reihe vom Publikum aus gesehen – ab. Sie legt den Oberkörper auf ihre Oberschenkel, so dass ihre langen, dunklen Haare vornüber fallen. Im Gegensatz zum Vorhang der Bühne schließt sie ihren Haar-Vorhang der Szene gegenüber oder eröffnet einen ganz eigenen Inhalt: sich selbst die Sicht auf die Tafel und die gesamte Umgebung nehmend, die Augen verhängend, eine geschlossene Einheit für sich selbst bildend. In Bezug auf das Gesamtbild grenzt sie sich körperlich aus der Publikumsperspektive klar von der Gruppe ab, aus der Lehrerinnenperspektive verschwindet sie lediglich hinter den Rücken der Personen in den Reihen vor ihr. Als aus der gleitenden Bewegung nach vorne eine schüttelnde Artikulation von Händen, Armen, Oberkörper und Kopf wird, ist sie außerdem der einzige dynamische Aspekt im Bild. Ihre Vereinzelung erscheint durch die vitalen Gesten offensiver und als die Umgebung spannungsvoll abwehrender. In dieser langsamen Schüttelbewegung richtet sie sich vorsichtig auf, die Schultern kreisend, die Haare fallen ihr über das Gesicht. Sie nähert sich also behutsam und doch spannungsvoll der Position der anderen Personen an, bleibt aber was die Sicht betrifft weiterhin verschlossen. Die Kurve ihrer Bewegung von oben nach vorne unten und zurück in die Ausgangsposition führt sie nun weiter nach hinten unten. Als sie wieder aufrecht sitzt, lässt sie sich also langsam rückwärts über den Hocker gleiten. Erst berühren ihre Haare, dann der Kopf den Boden. Ihre Hände verbleiben an der Hüfte. Die Verbindung mit dem Boden und die gleichzeitige Freigabe ihres Gesichts führt sie nun wieder mit dem Gesamtbild zusammen, auch indem der Darsteller links von ihr sich zu ihr herüber und herunter beugt und sie anlächelt. Der Rest der Situation schenkt ihr weiterhin keine Beachtung. Der Spannungsbogen ihrer Bewegung erreicht seinen Höhepunkt als der Blick
79
80
Choreographien der Homogenisierung
der Protagonistin sich nun klar und nahezu herausfordernd an das Publikum richtet und sie lacht. Ihre Ausrichtung auf sich selbst, scheinbar in ihr Inneres, wird damit wieder nach außen gekehrt. Durch die Adressierung der nicht direkt in die Szene involvierten Personen durch Blickkontakt und das darauf folgende Lachen präsentiert sie sich nicht als schamvoll ertappt, sondern aufmüpfig motiviert. Ihr Ausstieg aus dem Gesamtbild ist also nicht länger introvertiert und nahezu unsichtbar, sondern wird extrovertiert für die Betrachter*innen sichtbar und erscheint rebellisch motiviert. Dann setzt sie die Hände neben dem Kopf auf den Boden auf und manifestiert somit den oppositionellen Eindruck: Du siehst mich, aber ich weiche nicht zurück, sondern festige meine Position. Der Moment wird unterbrochen durch eine Artikulation der LehrerinnenDarstellerin, die dazu auffordert, die Silben der Worte an der Tafel zu zählen. Die Protagonistin setzt sich daraufhin wieder konform auf ihren Hocker und verschwindet aktiv mitarbeitend, homogen im Gesamtbild. Ein gemeiner Rhythmus aller Tänzer*innen ist hergestellt und doch agiert jeder für sich. Auch der Darsteller links neben der Protagonistin, der ihre Bewegungen bisher als einziger beantwortet hat, zählt aktiv die Silben mit. Nun wird er zum körperlich dynamischen Mittelpunkt, kniet sich erst auf den Hocker, stellt sich dann dahinter – eröffnet somit die bisher höchste Ebene unter der stehenden Lehrperson – und wiegt von einem Bein auf das andere, hin und her im Rhythmus der silbenzählenden Klasse. Er meldet sich und wird auch an die Reihe genommen. Seine Abweichung vom Gesamt-Arrangement wird somit als gesehen und akzeptabel markiert, da sein Körper sich im einheitlichen Rhythmus der Aufführung befindet. Als müsste sie seine ›Höhe‹ überbieten, stellt sich die Protagonistin auf den Hocker und bildet somit den körperlichen und dramaturgischen Gipfel der Anordnung. Dieser wird akustisch durch den scharfen Zwischenruf der Lehrerin untermauert: »Hylia setz dich hin!« und sie rückt ihren Namen an einer Liste an der Tafel nach unten. So folgt auf ihren höchsten Stand der steilste Abfall: körperlich vom geraden Stehen auf dem Hocker zum Sitzen und bewertend an einer hierarchischen Messlatte an der Tafel durch die Lehrerin. »Wo bin ich?«, flüstert sie zu dem Darsteller links von ihr – führt damit zurück zu dem sich selbst suchenden, innenblickenden Bild aus dem Szenenbeginn und passt sich gleichzeitig durch die geringe Sprachlautstärke wieder den Regeln der Umgebung an. »Du rutschst immer weiter runter!«, antwortet dieser und fasst damit ihre Bewegungskurve zusammen. »Bei startklar!«,
3. Methodologie
flüstert ein Darsteller aus der Reihe vor ihr. »Ach ok«, winkt Hylia mit einer Handbewegung ab, denn »startklar« bildet die Null-Linie, von der aus wieder alle Kurven der Bewegung nach oben und unten möglich sind. Gedanken-Experiment 2 Verhaltenspsychologin in einer Schulklasse Für die dritte Klasse einer Kollegin haben wir einen Verstärkerplan/TokenSystem entwickelt, um erwünschtes Verhalten der Kinder zu fördern. Heute hospitiere ich vor Ort, um den Erfolg des Plans und die Entwicklung eines der Kinder, Hylia, zu betrachten. Mit Hylia habe ich ein Skills-Training absolviert, das sie innerhalb des geregelten Ablaufs der Klasse bei der Mitarbeit unterstützen soll. Die erlernten Übungen – die mit Meditationstechniken kombiniert werden – sollen ihre innere Achtsamkeit unterstützen und das Aushalten von Spannung ermöglichen, bzw. diese reduzieren (Linehan, 1978). Als Token-System (Münzverstärkungs-System) ist ein Verfahren der Verhaltenstherapie zu verstehen, das auf Prinzipien der operanten Konditionierung basiert (Cole, 2008). Token werden dabei verwendet, um die zeitliche Verzögerung zwischen dem erwünschten Verhalten und der »eigentlichen« (primären) Verstärkung zu überbrücken – eine Art Belohnungsaufschub. Die Liste, die in dieser Klasse genutzt wird, ist als Modifizierung einer Ampel zu verstehen, an der die Kinder bei grün starten (startklar) und zu gelb (Ermahnung, Verwarnung) und rot (Auszeit) herunter rutschen könnten, bzw. zu »grüner« (prima, super, fantastisch) aufsteigen, in Verbindung mit besprochenen Klassenregeln. Allen Kindern soll die Möglichkeit eines neutralen Starts geboten werden, von dem aus sowohl auf- als auch abgestiegen werden kann. Jeden Morgen starten also alle Kinder bei »startklar zum Lernen« und am Ende jedes Schultages erhalten die Kinder im Bereich »fantastisch« und »super« einen Sticker (Token) auf einer speziellen Karteikarte. Bei 10 Stickern ist die Karte voll und das Kind darf sich eine Kleinigkeit aus einer Überraschungskiste aussuchen (primäre Verstärkung). Die unteren Zeilen haben keine Konsequenz, rutscht ein Kind jedoch bis zu dem untersten Punkt »Auszeit« herunter wird es in die sogenannte »Insel« gebracht: Ein von Erzieherinnen und Erziehern betreuter Raum. Dort muss das Kind dann die Liste mit den Klassenregeln noch einmal lesen und aufschreiben gegen welche Regel es verstoßen hat.
81
82
Choreographien der Homogenisierung
Nach verhaltenspsychologischen Richtlinien müssten die Regeln für ein Rücken innerhalb des Plans eigentlich noch klarer sein: z.B. alle 10 Minuten eine Bewertung der Regelkonformität o.Ä., auch die Aufteilung der Kinder nach Mädchen und Jungen anhand der Liste ist eher untypisch. Auch könnten die Kategorien noch einmal überarbeitet/verdichtet werden, da es keinen Belohnungsunterschied gibt, egal ob die Kinder am Ende des Tages nach wie vor »startklar« sind, oder doch »prima« erreicht haben. Auf den Aspekt der Stigmatisierung von Kindern, z.B. auch durch das Messen untereinander, sind wir innerhalb der Implementierung nicht weiter eingegangen. Ich nehme hinten in der Klasse Platz und beobachte wie die Kinder sich in drei Reihen hintereinander setzen und mit einer Aufgabenstellung beginnen. Nur Hylia wirkt abwesend. Sie legt den Oberkörper auf ihre Oberschenkel, so dass ihre langen, dunklen Haare vornüber fallen und schüttelt Hände, Arme, Oberkörper und Kopf. Die Bewegung lässt sich unserem Training zuordnen, da sie dem Yoga nahe liegt (Vorbeugesitz/ herabschauender Hund). Die Position suggeriert eine Innenschau Hylias und die Abgrenzung vom Geschehen um sie herum sowie von dem Unterrichtsgegenstand. Das Schütteln hingegen erscheint als ein »Abschütteln« ihrer Spannung und/oder ihrer Abneigung gegen das Beugen unter die Regeln der Situation. In dieser langsamen Schüttelbewegung richtet sie sich vorsichtig auf, die Schultern kreisend, die Haare fallen ihr über das Gesicht, so dass sie weiterhin nicht an dem Geschehen innerhalb der Klasse teilnehmen kann. Als sie wieder aufrecht sitzt, lässt sie sich nun langsam rückwärts über den Hocker gleiten. Erst berühren ihre Haare dann der Kopf den Boden. Ihre Hände verbleiben an der Hüfte (Schulterbrücke/Kopfstand). Die Kinder sind dazu angehalten, Hylias ruhige Übungen zu ignorieren, aber Alessandro, der links neben ihr sitzt, beugt sich zu ihr herunter und lächelt. Sonst beachtet sie niemand, ihre Sitzposition in der letzen Reihe begünstigt das. Dann schaut sie mich an – ich sitze hinter den Sitzreihen auf einem einzelnen Stuhl – und lacht, anschließend setzt sie die Hände ebenfalls, neben dem Kopf, auf den Boden auf. Damit wechselt sie von einer scheinbaren Innenschau auf sich bezogen, zu einer Repräsentation nach außen hin zu Alessandro und vor allem mir als ihre Beobachterin. Ich bin mir dabei nicht sicher, ob das Lachen an mich als ihre Verbündete adressiert ist, die ihre Abwehr der Situation gegenüber versteht, oder mir ironisierend als Vertreterin der Regeln, gegen die sie sich tief rückwärts aufbäumt, entgegengebracht wird. Kurz frage ich mich darüber hinaus, was nun folgen wird: Kann sie die Anspannung loslassen oder wird sie die Übung übertreiben, wie zum Beispiel
3. Methodologie
mit einer vollen Ausführung des Kopfstandes inklusive Strecken der Beine in die Luft? Laut des Skill Trainings sollen die Übungen ihr die Möglichkeit geben ihren Körper zu spüren, um dann zur Ruhe kommen zu können und wieder aufnahmefähig zu sein. Als Frau Knapper die Kinder nun bittet die Silben der Worte an der Tafel zu zählen und Hylia sich daraufhin wieder gerade auf den Hocker setzt und beteiligt, bin ich erstmal sehr zufrieden und werte die Übung als Erfolg. Außerdem kann ich den Blickkontakt somit als Komplizenschaft werten, da sie als Erdung, um wieder in der Realität der Klasse anzukommen, fungieren konnte. Auch wenn Alessandro ihr durch seinen Blick und sein Lachen eine ganz ähnliche Komplizenschaft angeboten hat, nimmt sie ihn gar nicht weiter wahr und geht auch nicht auf ihn ein. Als hätte sie ihm beim Staffellauf den Stab übergeben, übernimmt Alessandro nun Hylias Anspannung/Entspannung. Er zählt die Silben mit, kniet sich erst auf den Hocker, stellt sich dann dahinter und wiegt von einem Bein auf das andere, hin und her. Er meldet sich und wird auch von Frau Knapper an die Reihe genommen. Durch das Aufrufen von Alessandro bestätigt Frau Knapper die Dehnbarkeit der Regel des »ordentlichen Sitzens« während des Unterrichts für ihn und markiert ihn gleichzeitig als »gesehen«, anders als Hylia zuvor. So kann Alessandros Verkörperung als »voller Einsatz« im Rhythmus des Silbenzählens verstanden werden, als Einnehmen einer Position mit besserem Blick auf die Tafel aus der letzten Reihe, aber auch als Aushandlung der Handlungsspielräume innerhalb der Regeln des Unterrichts. Dann stellt Hylia sich auf ihren Hocker, nach nur wenigen Sekunden ruft Frau Knapper scharf: »Hylia setz dich hin!« und rückt ihren Namen an der Tafel nach unten. Hylias körperliches Aufbäumen wird von Frau Knapper als Provokation oder Grenzübertritt gewertet. Aber warum hat sie sich auf den Hocker gestellt? Wollte sie Frau Knapper provozieren? Wollte sie auch besser an der Tafel sehen? Wollte sie Alessandro überhöhen? Oder ist die Anspannung so nun einfach aus ihr herausgebrochen? Wurden alle anderen Bewegungen innerhalb der Klasse bisher von Frau Knapper toleriert, markiert sie das Stehen auf dem Hocker klar als Regelbruch. Die Frage danach, warum Frau Knapper das Stehen nicht akzeptiert, könnte vielfältig beantwortet werden: So lässt sie vielleicht keinen Blickhöhe innerhalb der Klasse über ihrer zu oder die Einzelne soll nicht wichtiger werden als der Unterrichtsgegenstand oder auch nur eine kulturelle Regel, denn im Restaurant oder in der S-Bahn würde auch ein Wippen von einem Bein
83
84
Choreographien der Homogenisierung
auf das andere toleriert, aber wahrscheinlich kein Stehen (mit Schuhen) auf dem Stuhl. Das Rücken von Hylias Namen auf der Liste nach unten markiert den Regelbruch für alle sichtbar. »Wo bin ich?«, flüstert sie zu Alessandro, stellt implizit gleichzeitig die Fragen: Wo soll ich sein? Wo darf ich sein? Wie weit kann ich gehen? Und unterwirft sich durch das Flüstern wieder den Regeln des Unterrichts. Auch wird der Aspekt der eingeschränkten Sicht durch diese Frage bestätigt. »Du rutschst immer weiter runter!«, antwortet dieser. Hat Hylia also zuerst nur ihren Körper »herunter« bewegt (und später »hinauf«), wurde sie durch Frau Knapper nun an der Tafel vor allen »runter geschoben«. Zum ersten Mal realisiere ich dabei, wie nah das »runter rutschen« an den Ausdruck »auf die schiefe Bahn geraten« angelehnt ist. »Bei startklar!«, flüstert Ardi aus der Reihe vor ihnen. So ist zum einen klar, dass sie vorher im »grüneren« Bereich verortet war, zum anderen befindet sie sich nach wie vor bei »startklar zum Lernen« dem Ausgangspunkt im grünen Bereich. »Ach ok«, winkt Hylia deshalb mit einer Handbewegung ab und sieht ihre Position nicht als kritisch an. Darauf folgt die Konfrontation mit dem tatsächlichen Äußerungskontext Die an die Ausformulierung der tatsächlichen Interpretationsrichtung anschließenden methodischen Fragen lauten dann: Handelt es sich um ein vereinzeltes Phänomen? Sind empirische Varianten auffindbar?
Fotoanalysen nach Verfahrenslinien der objektiven Hermeneutik Auch die Fotoanalyse nach Verfahrenslinien der Objektiven Hermeneutik (Ackermann 1994; Loer, 1996), bezieht sich auf die Grundthesen Oevermanns (1979). Die Rekonstruktion der objektiven Bedeutungsstruktur soll dabei anhand der Betrachtung einer Fotografie möglich werden: »Die zentrale Herausforderung hierfür ist die Sequenzialität […]. Die Fotografie fixiert nicht nur einen bestimmten Augenblick, sondern sie bietet all dessen Aspekte simultan. […] Die wahrgenommenen Aspekte müssen nacheinander zu Papier gebracht werden. Dies soll über die formale Eigendynamik gelingen, die die zu analysierende Fotografie bietet, über die Gewichtung ihrer Bildgegenstände, über Zentren, Schwerpunkte, dominante Linien wie Diagonale, Senkrechte oder Waagerechte, aber auch mittels Kontrasten, der Formen, Farben, Richtungen oder Hell- und Dunkelverteilungen. Diese formalen Elemente beeinflussen zunächst die Blickführung eines Betrach-
3. Methodologie
ters, gekoppelt mit dem fast gleichzeitigen Erkennen der gegenständlichen Komponenten des Fotos.« (Peez, 2006: 123) So verfolgen die hier vorgenommenen Fotoanalysen die Sequenzen der Fotografie insofern, dass sie davon ausgehen, dass die Fotograf*in durch die vorgegebene Komposition einen oder mehrere Wege in ihr Werk vorgibt, die »den Blick wie ein ikonischer Pfad durch das Bild führen« (Ackermann, 1994: 203). So wandert das Auge der Betrachtenden anhand von beschreibbaren Linien in das Bild und in seine ikonischen Zentren hinein. »Sequenzialität der sinnstrukturierten Welt ist somit im simultanen ikonischen Text nicht aufgehoben, sondern tritt nur in anderer Gestalt auf: räumlich« (Loer, 1996: 51). Die Pfade des Bildes werden also als sequenziell und von einem oder mehreren Zentren aus kommend gedacht. Erst anhand der Rekonstruktion der Pfade – auf der Ebene von formalen Aspekten der Komposition – kann dann das, »was« auf dem Bild zu »sehen« ist, erreicht werden (ebd.). Für das konkrete Vorgehen bedeutet das, dass sich das Auge der Betrachtenden auf verschiedenen Bild-Pfaden bewegt, entlang der Blickrichtungen, die von der Fotografie zunächst vor allem durch ihre formalen, später vermehrt durch ihre inhaltlichen Elemente vorgegeben werden. Die Aufmerksamkeit der Betrachtenden sucht dabei nach Blickpunkten und ikonischen Zentren. Auf diese Weise wird die Fotografie für die Interpretation sequenziell erschlossen (Peez, 2006). Über die Erschließung der Fotografien auf diesem Wege soll es möglich werden die Verkörperung der Abgebildeten und deren Anordnung innerhalb der Gruppe besser zu registrieren sowie körperliche Ausdrucksbewegungen und ihre Ästhetik innerhalb der Formation stärker deuten zu können. Illustriert werden soll dieses Vorgehen hier nun anhand einer exemplarischen Bildinterpretation aus dem Material: Feldphase 3, Schule B, Fotoaufnahme Nr. 35, 13.04.2015 Der Blick führt von vorne rechts und der Rückenansicht eines Stuhles und einer darauf sitzenden Person nach links in das Bild und an zwei Sitzgruppen an Tischen entlang in den Bildhintergrund der querformatigen Fotografie. Im Bildhintergrund befindet sich an einer Wand stehend ein Schreibtisch mit einem Computer darauf und ein Regal mit Einschüben, auf dem ein tragbarer CD-Spieler steht. Links im Bild ist eine hohe Fensterfront leicht angeschnitten, die das Licht/Schatten-Spiel des Bildes bestimmt. Unter der Fensterfront an der
85
86
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 1: Fotoaufnahme Nr. 35
Wand hängen bunte Pappen und eine längliche Tafel. Die gestalteten Pappen beschäftigen sich thematisch mit den Jahreszeiten und damit verbundenen Geburtsdaten, mit Fotos versehen. Weitere Poster thematisieren »Gutes Vorlesen«, »Ämter« und »Forschen«. Über der Tafel hängt außerdem ein perspektivisch angeschnittener Zahlenstrahl. An der Tafel ist die laminierte Überschrift »Hausaufgaben« befestigt und mit Kreide steht das Datum »13.04.2015« unterstrichen und »Ma: AB« darauf. Der linke Vordergrund des Bildes wird von einer leeren Fläche, die durch einen dunkelblauen PVC-Boden bestimmt wird, dominiert. Rechts am Bildrand ist außerdem ein aus hölzernen Sitzbänken mit blauem Bezug gestalteter Sitzkreis angeschnitten. Das langärmlige T-Shirt der Person im rechten Vordergrund zieht mit seiner strahlenden blauen Farbe den Blick auf sich. Bei genauerer Betrachtung wird die Person als Mädchen mit langen dunkelbraunen Haaren wahrgenommen, die nach vorne gebeugt auf einem hölzernen Stuhl mit grünen MetallDetails sitzt, der Betrachterin die Stuhllehne und den Rücken zugewandt. Sie trägt eine Jeans und das taillierte, blaue Oberteil mit einer gestickten Blumenverzierung am unteren Rand. Sie nutzt einen Hocker aus dem Sitzkreis als ihren Tisch, auf dem ein Blatt, ein weißes, rechteckiges Radiergummi und ein geöffnetes pinkes Etui liegen. Sie sitzt nach vorne gebeugt über dem
3. Methodologie
Blatt und stützt ihren rechten Ellenbogen auf das rechte Knie. Ihr Gesicht ist nicht zu sehen, nur ihr Ohr, Hinterkopf und langer Zopf. Die prominente Sitzposition des Mädchens in der Fotografie wird unterstrichen, wenn sich der Blick nun nach links zu der Sitzgruppen-Diagonale im Bild orientiert. Dort sitzen einmal zwei und einmal drei Kinder an zwei Vierer-Tischen. Es stehen sich jeweils ein Tisch für zwei Personen und zwei Stühle gegenüber. An dem ersten Tisch sitzt am linken Bildrand eine als Mädchen wahrgenommene Person mit blond-braunen Haaren, weißem Pullover, dunkelblauer Jeans, weißen Socken und geblümten Ballerinas. An ihrer Stuhllehne hängt eine pinke Jacke, an dem Haken ihres Tisches hängt ein rosafarbener geöffneter Rucksack. Sie sitzt relativ gerade auf ihrem Stuhl, hält einen roten Stift in ihrer rechten Hand und stützt den Kopf auf eben diese und ihren aufgestellten Ellenbogen. Ihr Gesicht wird von einer Haarsträhne verdeckt. Ihr Blick ist auf den Tisch und ein darauf liegendes Blatt gerichtet. Rechts von ihr liegt ein in lila und rosa gemustertes Stiftemäppchen. Vor ihr auf dem Tisch stehen zwei bunte Pappen – eine pinke und eine blaue – die in der Mitte zu einem A gefaltet sind. Sie dienen als Sichtschutz und Abgrenzung zu der ihr gegenübersitzenden Person. Die als Junge wahrgenommene Person ist ebenfalls dem Blatt vor sich zugewandt, trägt einen schwarzen Trainingsanzug mit neongelben Details und der Aufschrift »adidas« und schwarz-rote Socken, keine Schuhe. Der Trainingsanzug sitzt relativ eng und unterstreicht die runde Körperlichkeit des Jungen. Er hat dunkelbraune Haare und trägt eine schwarze Brille. Sein linker Ellenbogen und Unterarm sind auf den Tisch gestützt, seine rechte Hand liegt auf dem Tisch und er hält damit einen Stift in Schreibposition. Seine Füße sind unter dem Tisch überkreuzt. Sein Gesicht ist nach rechts von der Betrachterin abgewandt und nur sein Profil ist sichtbar. Links von ihm steht ein blau roter »Spiderman«-Schulranzen, in dem an der Seite eine Wasserflasche steckt. Rechts von ihm steht ein leerer Stuhl. Da auf dem Boden aber ein weiterer Rucksack – schwarz mit weißen und neongelben Details und der Aufschrift »nike« – steht, ist zu vermuten, dass neben ihm auch jemand sitzen könnte. Am Gruppentisch weiter hinten rechts sitzen drei als Jungen gelesene Personen. Der Betrachterin mit dem Rücken zugewandt sitzen zwei dunkelblonde Jungen. Der linke trägt ein weißes Langarmshirt und darüber ein dunkelblaues T-Shirt, eine dunkelblaue fast schwarze Jeans und gelbe Socken. Sein Blick ist auf seinen Tisch gerichtet und in der rechten Hand, die auf dem Tisch
87
88
Choreographien der Homogenisierung
aufliegt, hält er einen Stift. Sein Gesicht ist nur leicht im Profil zu erkennen, ansonsten sieht man seinen Nacken und Hinterkopf und beide Ohren. Oberhalb seines Zettels ist sein Etui wie eine Art Grenze aufgebaut, rechts von ihm steht eine hellblaue Abgrenzungs-Pappe. Neben seinem Stuhl steht kein Rucksack. Rechts neben ihm sitzt ein Junge mit grauem Kapuzenpullover und Jeans bekleidet. Er sitzt auf dem Stuhl auf seinem linken Fuß, so dass die weiße Schuhsohle zu sehen ist und hält sich mit der rechten Hand an der Tischkante fest. In der Hand hält er einen gelben Stift. Mit der linken Hand blättert er seinen Zettel um. Sein Blick ist auf den Zettel gerichtet und auch ihn sieht man nur im Profil rechts. Rechts neben ihm steht ein dunkelblauer, aufgeklappter Schulranzen mit orangefarbenen Details. Daraus stehen eine gelbe und eine grüne Mappe hervor. Vor ihm ist eine mittelblaue Pappe aufgebaut, die ihn von seinem Gegenüber, einem Jungen mit kurzen, braunen Haaren im orangefarbenen Kapuzenpullover, abgrenzt. Der Junge in orange trägt außerdem eine dunkelblaue Jeans und dunkelblau-hellblau gestreifte Kunststoff-Schlappen (die auch als Badeschuhe bezeichnet werden könnten) sowie dunkelblaue Socken. Einige seiner Zettel ragen etwas über die Tischkante hinaus. Seine rechte Hand hält er in einer Art »Denkerpose« am Kinn, sein linker Ellenbogen liegt auf zwei Zetteln und sein Blick ist auf einen weiteren Zettel gerichtet. Neben ihm steht ein geschlossener grün gemusterter Schulranzen. Vieles deutet also darauf hin, dass es sich bei dieser Situation um einen Test in einer Grundschulklasse handelt. Viele Kinder befinden sich – bei Tageslicht – zusammen in einem Raum mit Tafel (an der Geburtstage, »Gutes Vorlesen«, »Hausaufgaben« und ein Zahlenstrahl befestigt sind), Tischen und Stühlen. Das Geschehen ist dabei nicht frontal auf Tafel und/oder Lehrperson konzentriert, sondern jedes Kind sitzt auf einem Stuhl am Tisch, mit der Konzentration auf das Arbeitsmaterial vor sich. Eine Lehrperson ist nicht sichtbar. Die Körperhaltung der Kinder entspricht dabei den schulischen Gepflogenheiten: ruhig auf einem Stuhl sitzend. Es liegt nahe, dass es sich um eine Prüfungssituation handelt, da die bunten Pappen die Kinder separieren und leere Stühle mit Schulranzen daneben und Kinder ohne Schulranzen neben sich auf veränderte Sitzpositionen hindeuten. Auch wirken alle Kinder ausnahmslos auf das Arbeitsmaterial konzentriert. Auf den ersten Blick nehmen alle Kinder die gestellten Aufgaben sehr homogen wahr. Erst beim genaueren Hinsehen lässt sich die Variation erken-
3. Methodologie
nen: Stuhlposition, Körper und Armhaltung scheinen nur identisch und eröffnen Raum für individuelle Interpretation. Die noch vereinzeltere Sitzposition des Mädchens im Vordergrund, die ohne einen »richtigen« Tisch alleine am Sitzkreis positioniert ist, schreibt ihr eine (räumliche) Sonderposition zu und zwingt sie außerdem in einer gebeugten Haltung, da der Hocker-Tisch eine niedrigere Höhe (gleiche Höhe wie die Sitzfläche des Stuhles – und der Stühle aller anderer) hat, als die tatsächlichen Tische. So wirkt sie auf der Höhenebene als ›erniedrigt‹. Aus einem sich visuell nicht erklärenden Grund sitzt sie als Einzige nicht an einem der Gruppentische, sondern alleine außen an dem Hocker-Kreis in der Mitte des Raumes und ist damit deutlich sichtbarer als alle anderen Kinder. Dabei wirkt sie in der Ästhetik des Bildes als Aufmerksamkeitsfokus und differenziert vom Rest der Klasse. Obwohl alle Kinder innerhalb ihrer eigenen Ab- und Begrenzung sitzen, nimmt die Betrachterin sie als eine Gruppe wahr, zu der das einzelne Mädchen im Gegensatz steht.
Dichte Beschreibung Inmitten der Anfänge der vorangehend umrissenen Debatte um die Krise der Repräsentation innerhalb der Ethnographie ist es Clifford Geertz, der erstmals darauf hinweist, dass es keine objektive Ethnographie geben könne und Ethnograph*innen durch die Abbildung einer fremden Welt zugleich eine Fiktion erschaffen würden (Geertz, [1983] 1995). Zentral innerhalb dieser Logik ist sein Kulturbegriff, der ihn zu seinem Konzept der »Dichten Beschreibung« [1983] (1995) führt: »De[r] Kulturbegriff, den ich vertrete […], ist wesentlich ein semiotischer. Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbst gesponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Gewebe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissenschaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Bedeutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten gesellschaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen.« (Geertz, [1983] 1995:9) Damit rückt Geertz den Moment der Interpretation – verstanden als Suche nach Bedeutung, da kulturelle Phänomene bedeutungsvoll sind – in den Fokus des Prozesses der Entstehung einer Ethnographie und mit ihm die Forschenden in ihrer machtvollen Deutungs-Position.
89
90
Choreographien der Homogenisierung
»Die Untersuchung von Kultur besteht darin (oder sollte darin bestehen), Vermutungen über Bedeutungen anzustellen, diese Vermutungen zu bewerten und aus den besseren Vermutungen erklärende Schlüsse zu ziehen; nicht aber darin, den Kontinent Bedeutung zu entdecken und seine unkörperliche Landschaft zu kartographieren. Es gibt also drei Merkmale der ethnographischen Beschreibung: sie ist deutend; das was sie deutet, ist der Ablauf des sozialen Diskurses; und das Deuten besteht darin, das »Gesagte« eines solchen Diskurses dem vergänglichen Augenblick zu entreißen.« (ebd.:30) Geertz theoretisches Konzept zum Verständnis einer Kultur entwickelt sich dabei unter dem Titel der »Dichten Beschreibung« [1983] (1995) – inspiriert durch Gilbert Ryles Unterscheidung zwischen »dichter« und »dünner Beschreibung« in seinem Essay »The thinking of thoughts« [1971] (2005) – als Ergänzung von Beobachtung und Teilnahme durch die Verantwortung der Interpretation und Autor*innenenschaft. So solle die Beobachtung eines sozialen Phänomens nicht zu einer objektiv verallgemeinerten Theorie führen, sondern zu einer dichten Beschreibung eines Einzelfalles, die auf einer bestimmten Form des Wissens beruht. Um dies zu illustrieren, nutzt Geertz, Ryles Beispiel des Zwinkerns zweier Jungen: »Stellen wir uns […] zwei Knaben vor, die blitzschnell das Lid des rechten Auges bewegen. Beim einen ist es ein ungewolltes Zucken, beim anderen ein heimliches Zeichen an seinen Freund. Als Bewegungen sind die beiden Bewegungen identisch; vom Standpunkt einer photographischen, »phänomenologischen« Wahrnehmung, die nur sie sieht, ist nicht auszumachen, was Zucken und was Zwinkern war oder ob nicht gar beide gezuckt und gezwinkert haben. Obgleich man ihn nicht photographisch festhalten kann, besteht jedoch ein gewichtiger Unterschied zwischen Zucken und Zwinkern, wie jeder bestätigen wird, der ersteres fatalerweise für letzteres hielt. Der Zwinkerer teilt etwas mit, und zwar auf ganz präzise und besondere Weise: (1) er richtet sich absichtlich (2) an jemand Bestimmten, (3) um eine bestimmte Nachricht zu übermitteln, (4) und zwar nach einem gesellschaftlich festgelegten Code und (5) ohne daß die übrigen Anwesenden eingeweiht sind. Es ist nicht etwa so […], daß derjenige, der zwinkert, zwei Dinge tut – sein Augenlid bewegt und zwinkert –, während derjenige der zuckt, nur sein Augenlid bewegt. Sobald es einen öffentlichen Code gibt, demzufolge das absichtliche Bewegen des Augenlids als geheimes Zeichen gilt, so ist das eben
3. Methodologie
Zwinkern. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt: ein bißchen Verhalten, ein wenig Kultur und – voilà – eine Gebärde.« (Geertz, 1983:10f) So unterscheidet sich die dünne Beschreibung des reinen Ablaufs der Bewegung eines Augenlids also von der dichten Beschreibung, dieses bestimmten Zwinkerns und somit einer Kombination aus Beschreibung und Interpretation durch spezifisches Wissen über »öffentliche Codes«. Das Niederschreiben einer Beobachtung wird so unumgänglich bereits zu einer Interpretation und zwar zu einer Interpretation zweiter oder dritter Ordnung, da nur die Handelnden selbst Informationen erster Ordnung geben können (ebd.:23). Die Besonderheit der Beschreibung besteht darüber hinaus in ihrem mikroskopischen Ansatz, also in der Konzentration auf einzelne überschaubare soziale Phänomene. Geertz Anliegen ist es dabei, diejenigen »symbolischen Elemente einer Kultur zu isolieren, welche die grundlegenden Erfahrungs- und Orientierungsweisen dieser Kultur« – exemplarisch – »zum Ausdruck bringen« (Wolff; 2000:89) – mit dem Ziel, »ein Repertoire von sehr allgemeinen akademischen Begriffen und Begriffssystemen […] in den Korpus dichter ethnographischer Beschreibung ein[zuweben], in der Hoffnung, bloße Ereignisse wissenschaftlich aussagekräftig zu machen. Das Ziel dabei ist es, aus einzelnen, aber sehr dichten Tatsachen weitreichende Schlußfolgerungen zu ziehen und vermöge einer präzisen Charakterisierung dieser Tatsachen in ihrem jeweiligen Kontext zu generellen Einschätzungen der Rolle von Kultur im Gefüge des kollektiven Lebens zu gelangen« (Geertz, 1983: 40). Auch wenn Geertz nicht müde wird zu betonen, dass es sich bei der Ethnographie nicht um eine Frage von Methode bzw. Methodologie handle, sondern um eine bestimmte Form des Wissens, was das Unternehmen zu einer besonderen geistigen Anstrengung und zugleich einem Wagnis mache, unternimmt Stephan Wolff (2000) den Versuch, das Vorgehen einer dichten Beschreibung in zwei Schritten zusammenzufassen (ebd.: 98f): 1) eine knappe Schilderung des Geschehens, wie es sich den Beobachtern der betreffenden Abläufe unmittelbar bietet. 2) das Suchen von anderen Beschreibungen, die hinter der Ebene des Offensichtlichen liegen, als Zusammentragen von Bedeutungsebenen, die das betreffende Phänomen jeweils unter einer anderen Perspektive transparent werden lassen. Dafür gibt es keinen Endpunkt: Die Dichte Beschreibung bleibt somit grundsätzlich unabgeschlossen.
91
92
Choreographien der Homogenisierung
Büttner & Pütz (2007) erweitern diese Schritte um einen dritten: 3) das theoretische Spezifizieren der gewonnenen Schlussfolgerungen.
An »Dichte« gewinne die Beschreibung in dem Maße, in welchem die verschiedenen Darstellungsebenen aneinander anknüpfen und sich ergänzen. Dabei dürfe der Begriff der »Dichte« nicht mit einer induktiven Generalisierung, Triangulation oder gar Folgebeziehung verwechselt werden. Vielmehr sollten die Beschreibungsebenen textlich und argumentativ so zusammengebracht werden, dass sie gleichzeitig miteinander verbunden und kontrastiert werden könnten (Wolff, 2000: 90). Der große Vorteil dieses methodisch so wenig definierten Vorgehens für diese Arbeit ist zum einen sein offener Zugang, der im Foucault’schen Sinne die größtmögliche Chance bietet in Bezug auf die Methode nicht »dermaßen regiert zu werden«. Zum anderen geht mit einer Dichten Beschreibung ein Gewinn an Imagination und somit literarisch ästhetischer Qualität einher, der im Hinblick auf die Betrachtung von Sozialen Choreographien von großer Bedeutung sein kann. Dem gegenüber steht der Vorwurf an die Dichte Beschreibung, dass durch ihr »Genre Blurring« – zwischen literarischem Text und wissenschaftlicher Abhandlung – ein Verlust an Vertrauen in die empirische Erdung entstünde (ebd: 95). Dieser Kritik soll innerhalb dieser Studie jedoch mit dem Ansatz der Ethnographischen Collage entgegengetreten werden. Entstehend aus dieser Collage sollen aus dem (analysierten) Material dicht beschriebene Portraits resultieren.
Das Problem der Positionalität Durch die Wahl in Bezug auf Methodologie und Methode im Rahmen der vorliegenden Studie bin ich gerade durch Clifford Geertz und die Dichte Beschreibung im Besonderen – als aktive ›Schöpferin von Text‹1 – mit dem machttheoretischen Problem der Positionalität in Berührung gekommen. Angeregt durch Erlebnisse innerhalb meines Forschungsalltags und durch die
1
Zur Kritik des Ethnograph*innen als Literat*innen siehe auch Clifford/Marcuse (1986:7) »All constructed truths are made possible by powerful ›lies‹ of exclusion and rhetoric. Even the best ethnographic texts – serious, true fictions – are systems, or economies, of truth. Power and history work through them, in ways their authors cannot fully control. Ethnographic truths are thus inherently partial – committed and incomplete.«
3. Methodologie
Lektüre von Charlotte Chaddertons Artikel »Problematising the role of the white researcher in social justice research« (2012), sowie Müller (2013), Scharathow (2014) und Lidola (2016), soll dieses hier weiter ausgeführt und reflektiert werden. Anschließend an Braidotti (2002) und die Denkanstöße von Engel/Schulz/Wedel (2005) besteht das Anliegen des hier verwendeten Begriffs der Positionalität darin, jene Machtverhältnisse aufzudecken, in die ein jeder – hier im Speziellen die Forscherin – verwickelt ist. Angetrieben durch das Erfordernis des Umgangs mit Machtdifferenzen und Verantwortlichkeit (accountability) (Braidotti, 2002:12). So geht es bei dem Problem der Positionalität um eine Zustandsbeschreibung von performativen Subjektpositionen, die von unterschiedlichen Machtachsen durchwoben sind. Positionalität fungiert dabei »[…] nicht allein als analytische, sondern als politisch-ethische Kategorie, die angesichts einer dynamischen Komplexität sich durchkreuzender Herrschaftsrelationen konkrete Handlungsentscheidungen begründen und eine relativistische Beliebigkeit verhindern kann« (Engel/Schulz/Wedel, 2005:13). Dieses Theorem wird im Weiteren anhand eines Beispiels aus der Beobachtungspraxis der vorliegenden Studie illustriert und es soll erörtert werden, inwiefern es für die folgende Interpretation, beziehungsweise in Bezug auf eine Reflexion einer gewissen Befangenheit oder Bedingtheit der Forscherinnenrolle, von Bedeutung ist. Wie aus den später folgenden Ausführungen zum Feld hervorgehen wird, wurden im Rahmen der Forschung zwei milieuspezifisch unterschiedliche Grundschulen besucht. Diese Entscheidung resultierte zum einen aus pragmatischen Gründen, die sich aus Schwierigkeiten beim Zugang zum Feld begründeten. Zum anderen war es ein Anliegen, möglichst unterschiedliche Orte zu besuchen, um eine Vielfalt des erhobenen Materials gewährleisten zu können. Trotzdem soll das Material aus den Schulen nicht vergleichend behandelt werden. Durch einen Vergleich wäre eine Reifizierung von Stereotypen zu naheliegend, die tunlichst vermeiden werden soll, sowie der Verlust des Fokus auf die Folie der Homogenität hin zu unweigerlich weiterführenden Fragestellungen der Differenz. Trotz aller Bemühungen um Objektivität und Reflexivität – gerade in Bezug auf die Forscherinnenrolle – bin ich jedoch schon an meinem ersten Tag im Feld und darauf folgend immer häufiger und deutlicher an meine persönlichen Grenzen in Bezug auf meine eigene Positionalisierung gestoßen.
93
94
Choreographien der Homogenisierung
So möchte ich mein Verständnis dieses Terminus mit zwei Beispielen aus meinen Beobachtungsprotokollen illustrieren: 1) Der erste Tag der ersten Feldphase 11.11.2014 Entgegen meiner Erwartungen beginnt mein »erster Schultag« nicht erst mit dem Betreten der Schule, sondern bereits mit dem Einsteigen in den Bus um 7.20 Uhr. Die ca. 38 Sitzplätze des Busses sind – bis auf 4 Ausnahmen – belegt und außer mir sind nur 3 weitere »Erwachsene« im Bus. Ich setze mich auf den freien Platz rechts neben einem Mädchen mit braunen, zu einem Zopf gebundenen Haaren und einem rosafarbenen Rucksack auf ihrem Schoß. Ich schätze sie auf ca. 12 Jahre. Die meisten Kinder im Bus werden wahrscheinlich eine weiterführende Schule besuchen. Rechts neben mir, auf einer Sitzgruppe für 4 Personen, sitzen 3 Jungen. Einer von ihnen hat zwei Schulhefte vor sich auf den Knien liegen und »schreibt Mathe ab«, wie er selbst kommentiert. Ich lasse meinen Blick durch den Bus schweifen und mir fällt auf, dass fast alle Kinder Schuhe der Marke »UGG« oder Sneaker der Marke »Nike« tragen. Dann erreichen wir bereits die Haltestelle, an der ich aussteigen muss, und der Großteil der Kinder verlässt ebenfalls den Bus. (…) Der Junge links von mir fragt mich: »Was schreibst du da eigentlich auf über uns?«, wartet aber keine Antwort ab und setzt nach: »Coole Nikes! Nur der Glitzer wäre jetzt nichts für mich«, dann wendet er sich wieder seinem Butterbrot zu.
2) Feldphase 3, dritter Tag 09.04.2015 »Geile Schuhe übrigens«, kommentiert Alessandro, als er an mir vorbei geht. Ich schließe einen Moment die Augen, erahne bereits, was ich gleich sehen werde, öffne sie dann wieder und lasse den Blick durch die Klasse wandern. Viele Kinder tragen Sportschuhe, kein einziges aber welche der Firma »Nike«. Ich schon. In diesem Moment muss ich mir eingestehen, dass ich mich an den vorangegangenen Tagen, ohne dies besonders zu reflektieren, für schwarze Stoffschuhe ohne Markenemblem entschieden hatte, um diesbezüglich einfach nicht
3. Methodologie
weiter bei den Kindern aufzufallen – wie bereits in der anderen Schule. Heute hatte ich schlicht und ergreifend nicht über meine Schuhwahl nachgedacht. Unter dem Terminus des ›Problems der Positionalität‹ möchte ich innerhalb dieser Arbeit also meine eigene machtvolle und bedingte Position als weiße, der Mittelschicht angehörige Forscherin und Autorin – in diesem Falle mit Turnschuhen der Marke »Nike« bekleidet und somit ein Attribut einer gewissen Form von Macht und Zugehörigkeit nach außen tragend – reflektieren und problematisieren. Denn immer wieder bin ich in meinem Forschungsalltag dieser Studie an persönliche Grenzen meiner Bedingtheit gestoßen, innerhalb derer ich wiederkehrend mit meinen eigenen Wert- und Moralvorstellungen, meinen persönlichen (und unerwünschten) Vorurteilen, meiner Milieuzugehörigkeit, meinem scheinbar nicht erfüllbaren Wunsch nach Objektivität und noch Vielem mehr – man könnte es mit Bourdieu (1982) auch meinen Habitus2 nennen – konfrontiert wurde. Ein Verweis in Bezug auf mein Bewusstsein des Diskurses um das Problem der Objektivität innerhalb qualitativer Sozialforschung (z.B. Flick, 1996: 159), sowie der Probleme der Rolle der teilnehmenden Beobachterin (z.B. Lüders, 2001: 153), reicht dabei – vor allem innerhalb des machttheoretischen Zugangs dieser Arbeit – an dieser Stelle nicht aus. Die wiederkehrende Reflexion dieser Momente und dieses Problems innerhalb dieser Abhandlung kann die Bedingtheit der vorliegenden Aufzeichnungen und Interpretationen nicht aufheben. Auch kann sie nicht leugnen, dass ich (als Forscherin und Person) überhaupt und innerhalb der beiden Schulen dabei ganz unterschiedliche Zugehörigkeitsgefühle entwickelt habe. Der Versuch, diese im Verlauf der Analysen immer wieder aufzudecken, soll jedoch einen Schritt in diese Richtung bedeuten. Auch habe ich mich bemüht vor dem Forschungsbeginn und während der Übertragung der Feldnotizen in Beobachtungsprotokolle, Selbstbeobachtungen zu explizieren und Vorwissen, Erwartungen und Werturteile zu identifizieren und markieren. Hier ein weiterer Auszug, der dieses Vorgehen illustriert, in der Thematik dieser Arbeit aber keinen weiteren Platz gefunden hat: 2
»Im Habitus eines Menschen« – so fasst Annette Treibel (2004: 226) den HabitusBegriff Bourdieus zusammen – »kommt das zum Vorschein, was ihn zum gesellschaftlichen Wesen macht: seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder Klasse und die ›Prägung‹, die er (oder sie) durch diese Zugehörigkeit erfahren hat.«
95
96
Choreographien der Homogenisierung
Feldphase 3, dritter Tag 09.04.2015 Als einige Kinder schon rausgelaufen sind und ich mich vorne an das Pult zu Frau Meyer gesetzt habe, kommt Sadaf wieder in die Klasse gerannt. Auf dem Flur ist ein lautes Weinen zu hören. Dustin ruft: »Sadaf hat Leticia geschlagen!« Sadafs Stimme überschlägt sich, während sie Frau Meyer erklärt: »Sie hat zuerst meine Jacke in den Mülleimer gesteckt und mich geschubst!« Frau Meyer geht auf den Flur und holt Leticia zurück in die Klasse, während Dustin auf Sadaf zugeht, ihr – für mich völlig unvermittelt – eine schallende Backpfeife verpasst und sagt: »Schlag Leticia nicht!« »Popelfresser!«, entgegnet Sadaf. »Pimmellutscher!«, schließt Dustin und geht. Ich weiß weder, wo ich zuerst hinsehen soll, noch kann ich so schnell eingreifen. Sollte ich überhaupt eingreifen? Am meisten irritiert bin ich wohl darüber, dass Sadaf diesen starken Schlag ins Gesicht, ohne mit der Wimper zu zucken, verkraftet. Sie weint nicht, scheint nicht entsetzt, auch nicht sonderlich wütend. Mein erster Gedanke dazu ist: Ist das ihr Alltag, Backpfeifen einzustecken? Wie kann sie sonst augenscheinlich so unberührt davon bleiben? Ich fühle mich im Nachhinein tief betroffen von der Situation – vor allem davon, dass alles was ich dazu beitrage, still dasitzen und scheinbar unwichtiges Aufschreiben ist. So als wäre ich eine dieser schrecklichen Personen, die extra langsam an einem Unfall auf der Autobahn vorbeifährt, um alles beobachten zu können und damit den eigentlichen Rettungsverkehr blockiert.
Die wiederholte Reflexion und Interpretation dieser Selbstbeobachtungen, des Materials und der Analysen überhaupt, im Rahmen von regelmäßigen Interpretations- und Forschungswerkstätten sowie während Tagungsteilnahmen in unterschiedlicher Zusammensetzung der Teilnehmer *innen, kann das Problem der Positionalität nicht aufheben, jedoch den Versuch begehen, die jeweiligen Verstrickungen bestmöglich zu identifizieren und analysieren.
3.3
Feld und Datenkorpus
Im Folgenden sollen die Durchführung und Ergebnisse der, dieser Forschungsarbeit zu Grunde liegenden, qualitativen Studie veranschaulicht und im Kontext des theoretischen Rahmens diskutiert werden.
3. Methodologie
So gilt es zuerst, das Feld und den Zugang zu diesem zu beschreiben, um anschließend den Datenkorpus zu umreißen und die Forschungsergebnisse in Form von dicht beschriebenen Décollagen vorzustellen. Das Feld der Beobachtung innerhalb dieser Studie ist dabei der Unterricht zweier dritter Klassen, zweier Grundschulen im großstädtischen Bereich des Bundeslandes Hamburg. Die Entscheidung der Beobachtung von Klasse 3 rührt aus dem Umstand, dass die Kinder zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Schul- und Fächerstrukturen mit all ihren Gegebenheiten und Regeln angekommen sind. Allerdings noch nicht kurz vor ihrer weiterführenden Schulempfehlung3 und somit unter besonderem (Lern-Erfolgs-)Druck stehen. Besonderheit der Hamburger Grundschulen ist dabei die Umsetzung des politischen Vorhabens, die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Förderformen an Hamburgs allgemeinen Schulen (Integrationsklassen, integrative Regelklassen, integrative Förderzentren usw.) »zugunsten einer auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmten, einheitlichen Kriterien folgenden sonderpädagogischen Förderung zusammenzuführen«. So sind seitdem alle Hamburger Schulen »auf dem Weg zur inklusiven Schule« (Handreichung der Stadt Hamburg: »Inklusive und sonderpädagogische Förderung« vom 21.10.2012).4 Relevantes, politisches Kriterium zur Unterscheidung und Klassifizierung der einzelnen (Grund-)Schulen ist in Hamburg der KESS (Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern) -Faktor (Bos/Pietsch, 2006) beziehungsweise der darin enthaltene sogenannte »Sozialindex« (Schulte/Hartig/Pietsch, 2014). Dieser soll in der Lage sein, »die sozialen Rahmenbedingungen der Schulen« (ebd. 67) zu bestimmen und tut dies anhand einer »Zuordnung zu sechs abgestuften Belastungsgruppen« (ebd.). Diese reichen von 1 (stark belastete soziale
3
4
Die weiterführende Schulempfehlung durch Lehrer*innen ist in Hamburg nicht bindend, es herrscht ein Elternwahlrecht (HmbSG §42). Zeugnisse werden dabei – je nach Entscheidung der einzelnen Schule – als Lernentwicklungsbericht, als Punktebewertung oder als Notenzeugnis erteilt (HmbSG §44). Politischer Anlass zu dieser Veränderung war die Verabschiedung des Artikels 24 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006, auf die eine einstimmige Änderung von §12 des Hamburgischen Schulgesetzes (HmbSG) durch die Bürgerschaft folgte, die mit Verabschiedung der Drucksache 20/3642 »Inklusive Bildung an Hamburger Schulen« im Juni 2012 beschlossen wurde.
97
98
Choreographien der Homogenisierung
Lage) bis hin zu 6 (bevorzugte soziale Lage) und beruhen auf einer quantitativen Längsschnittstudie im Bildungsbereich in Hamburg in den Klassen 4, 7, 8, 10/11 und 13. Bildungspolitisch »determiniert der Sozialindex unterschiedliche Ressourcen-allokationen (z.B. kleinere Klassenfrequenzen oder höhere Sprachfördermaßnahmen für Schulen mit niedrigeren Indizes)« (ebd.). Theoretisches Fundament sollen dabei die Kapitalarten nach Bourdieu bieten, so würden »verschiedene Aspekte der sozialen Belastung voneinander« unterschieden: »soziales Kapital, kulturelles Kapital, ökonomisches Kapital, Migrationshintergrund« (ebd.). Die Erhebung des »Sozialindexes« erfolge durch »eine Schüler- und Elternbefragung an allen staatlichen Grundschulen und staatlichen weiterführenden Schulen mit Ausnahme der Sonder- und Förderschulen. Den nicht-staatlichen Schulen stand die Teilnahme frei« (ebd. 70). Zur Illustration ein Auszug der verwendeten Variablen innerhalb der Studie in Abbildung 2. Im Bereich der wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist die Kritik am Sozialindex bisher nicht ausreichend breit gestreut. Jedoch wird innerhalb der Diskussion zum Beispiel die Unterscheidung von deutscher und nichtdeutscher Herkunftssprache als zwei Gruppen – wobei nicht-deutsche Herkunftssprache als Abweichung von der Norm erfasst wird (zur Analyse des monolingualen Selbstverständnisses des deutschen Bildungswesens siehe Gogolin, [1994] 2008) – problematisiert oder auch die Definition von Armut und kulturellem Hintergrund über die Lebenssituation der Eltern (Müller, 2010). Lindmeier (2004) merkt außerdem fragwürdige Kausalannahmen des Sozialindex an, so dass zum Beispiel eine formale Unterversorgung der Eltern mit ökonomischem Kapital nicht zwangsläufig eine Unterversorgung des Kindes zur Folge haben müsse, genauso wie es umgekehrt zu einer Unterversorgung von Kindern in finanziell gutgestellten Haushalten kommen könne. Auf politischer Ebene hingegen gibt es mittlerweile mehrere kritische Stimmen, da sich laut KESS bestimmte Schulen im Vergleich zum Vorjahr verbessert hätten und dies – auf Grund des Zusammenhangs von KESSFaktor und Ressourcenverteilung – bedeute, dass dort nun Lehrpersonal abgebaut werden müsse. So würden Schulen durch Mittelkürzungen für ihre gute Arbeit bestraft. Alles in allem wird deutlich, dass innerhalb der Hamburger Schullandschaft an den Begriffen ›KESS‹ und ›Sozialindex‹ bei oder gerade wegen all ihrer Problematiken nicht vorbeizukommen ist.
3. Methodologie
Abbildung 2: Kriterien der Berechnung des Sozialindex für die Grundschulen (Eigene Abbildung nach: Drucksache 20/7094 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 20. Wahlperiode, Anlage 3)
99
100
Choreographien der Homogenisierung
Bereits innerhalb der Antragstellung »auf Genehmigung einer wissenschaftlichen Untersuchung« durch die »Behörde für Schule und Berufsbildung« wurde diese Studie also mit der Begründung einer Auswahl der zu besuchenden Schulen und somit auch mit dem KESS-Faktor konfrontiert. Denn wie auch Foucault und Butler wiederkehrend zu bedenken geben, mag es Normen und Klassifizierungen geben, mit denen wir nicht einverstanden sind, sie zu leugnen, entzieht ihnen jedoch nicht ihre Wirkungsmacht. So fiel die Entscheidung vorerst darauf, zwei Schulen mit dem KESSFaktor 3 – mit der Einstufung: tendenziell belastete soziale Lage der Schülerschaft – zu besuchen, um zum einen nicht durch einen Vergleich von ausgezeichneten ›Extremen‹ in eine größere Reifizierungs-Falle zu tappen und zum anderen trotzdem eine in vielerlei Hinsicht durchmischte Schülerschaft beobachten zu können. Online zugängliche Listen der Stadt, die den KESSFaktor des Schuljahres jeder einzelnen Schule beinhalten, ermöglichten dabei eine leichte Identifizierung der Klassifizierung sowie Zugang zu Kontaktinformationen der Institutionen. An diverse Anfragen an »KESS-3-Grundschulen« schloss sich jedoch eine lange Wartezeit, gespickt mit persönlichen Gesprächen in manchen Schulen, an, die allesamt zu Absagen oder keinerlei Antwort in Bezug auf die Ermöglichung von Beobachtungsphasen führten. Erst durch persönliche Beziehungen konnte Kontakt zu einer Lehrerin einer KESS-6 (bevorzugte soziale Lage) Grundschule hergestellt werden, die dem Forschungsvorhaben von diesem Zeitpunkt an sehr hilfreich zur Seite stand und zwei Beobachtungsphasen an ihrer Schule ermöglicht hat. Auch konnte sie den Kontakt zu einer weiteren Grundschule herstellen mit dem KESS-Faktor 1 (stark belastete soziale Lage). So konnten zwar nun zwei sehr unterschiedliche Schulen besucht werden, jedoch wurde die Studie, vor allem aus pragmatischen Gründen, genau mit jenen zwei Extremen der durch KESS bestimmten Normverteilung konfrontiert. Letztlich verbrachte die Forscherin also eine explorative Phase im Umfang von zwei Wochen sowie eine weitere Beobachtungsphase im Umfang von zwei Wochen in einer dritten Klasse einer Grundschule mit dem Etikett »bevorzugte soziale Lage« und weitere zwei Wochen in einer dritten Klasse einer Grundschule mit dem Etikett »stark belastete soziale Lage«. Da der Tagesablauf beider Schulen nicht nach Schulfächern, sondern Zeitfenstern bei bestimmten Lehrpersonen strukturiert war, wurden in jeder Klasse an allen Zeitfenstern der je zwei hauptverantwortlichen Lehrerinnen für die Klasse teilnehmend beobachtet.
3. Methodologie
Dabei saß die Forscherin zumeist auf einem einzelnen Stuhl am hinteren Ende (der Tafel gegenüberliegend) der Klasse und hat sich einzelnen Szenen situativ genähert. Die Fotoaufnahmen sind auf Grund des geringeren Eingriffs in die Situation mit einem Handy entstanden. Dies hatte den Nachteil, dass kein direkter Einfluss auf Parameter wie Belichtungszeit und Schärfe genommen werden konnte, jedoch ist somit keinerlei Geräusch beim Auslösen entstanden und auch der Aufnahmeprozess als solcher erschien weniger raumgreifend und störend, da kein großes Gerät mitgebracht und vor das Gesicht geführt wurde. So sind durch drei Beobachtungsphasen im Umfang von insgesamt sechs Wochen, Feldnotizen und daraus entstandene Beobachtungsprotokolle im Umfang von 324 Seiten und 182 Fotoaufnahmen entstanden.
3.4
Décollagen
Mit dem Begriff der »Décollage« (frz.: décoller = abheben, losmachen, trennen, abkratzen) wird eine künstlerische Technik der 1950er und 1960er Jahre bezeichnet, die im Folgenden als Metapher für das Vorgehen im Rahmen der Darstellung des empirischen Materials verstanden werden kann. Décollagen entstehen, wenn mindestens zwei Schichten bedruckten oder bemalten Papiers übereinander geklebt und dann an einigen Stellen eine oder mehrere der oberen Lagen wieder abgerissen werden (Abb. 3), so dass Ausrisse der überklebten Schichten wieder sichtbar werden. Was am Ende des Prozesses verdeckt bleibt und was wieder sichtbar wird, ist dabei nie von Anfang an vorhersagbar, bzw. umfassend intentional steuerbar (Thomas, 1977:56). Wurde das erhobene Material also erst collagiert und zusammengestellt, so sollen nun einzelne Aspekte der Collagen herausgestellt, Überlappungen identifiziert und bestimmte Schichten des scheinbar Offensichtlichen wieder abgetragen werden, um die Choreographien der Homogenisierung und deren Spielarten näher kommen zu können. So soll sich das in den Feldphasen dieser Studie gewonnene Material nun anhand der Sozialen Choreographien der beobachteten Klassen – also anhand der regelmäßig ablaufenden Bewegungsformationen, die für alle Beteiligten selbstverständlich (geworden) sind – dem Phänomen der Herstellung von (vermeintlicher) Gleichheit anhand der Körperlichkeit von Schüler*innen widmen, in Form von décollagierten Darstellungen aus der gewonnenen Collage.
101
102
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 3: Videostill: Museum Jorn, (2014): Décollage
Museum Jorn, Silkeborg, Dänemark (2014): Décollage [Video zur Veranschaulichung der Décollage-Technik nach Asger Jorn], TC: 00:00:46: https://www.youtube.com/watch?v= D8BySd1wXuw [abgerufen 23.09.2018]
Ziel dabei ist es zu untersuchen, wie sich in Grundschulklassen Gleichheit herstellt, ob es eine Ordnung der Homogenisierung gibt und wie unordentlich diese Ordnung sein darf, wo also die Grenzen des Erlaubten verlaufen und wie und von wem sie bewacht, kontrolliert oder auch verschoben werden. Fokussiert wird dabei das Statische einer Ausgangsposition sowie deren Beweglichkeit. Das Vorhaben soll hier anhand dreier verschiedener signifikanter und regelhafter Körperformationen des beobachteten Unterrichts untersucht werden. Im Unterschied zu dem Begriff der ›Sitzordnung‹, sollen über den Begriff der Körperformation jene Beweglichkeiten mitgesprochen werden, die über die bloße Haltung des Sitzens innerhalb der jeweiligen Anordnungen hinaus gehen und gleichzeitig die Position der Lehrerin mit einbeziehen, die klassisch häufig als stehend gegenüber den sitzenden Kindern verstanden wird. Diese zu beschreibenden Ausgangspositionen der Körper können dabei parallel zu den Grundpositionen des klassischen Balletts verstanden werden. Die grundlegenden Arm- und Beinpositionen im Ballett gelten als stilisierte Bewegungen, die im Laufe der Zeit ausgearbeitet und kodifiziert wurden und ein festgelegtes, wenn auch wandelbares, System des »danse d´école« (akade-
3. Methodologie
mischen Balletts) bilden. So basiert nicht nur jedes Aufwärmen an der Stange auf diesen Stellungen, sondern sie bilden vielmehr den Baukasten und den sichtbaren Anfangs- und Endpunkt jeder fließenden Tanzbewegung. Übertragen auf die Körper-Formationen des beobachteten Grundschulunterrichts konnten innerhalb der Feldaufenthalte folgende Grundpositionen identifiziert werden, die nun die empirischen Ergebnisse strukturieren sollen: (Kapitel 4) Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen; (Kapitel 5) Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische; (Kapitel 6) Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische; allen Positionen inhärent: das »en dehors« – der Widerstand. Das »en dehors« soll hierbei als allen Positionen inhärente Metapher für die Erwartungshaltung an die Kinder und deren damit verbundene Widerständigkeit verstanden werden, die einzelnen Positionen um jeweils einen Aspekt erweitern und nicht als eigenständige Position interpretiert werden. Im klassischen Ballett wird eine Auswärtshaltung der Beine angestrebt, die als »en dehors« bezeichnet wird. Diese bestimmt die körperlichen Voraussetzungen, die Balletttänzer*innen auf professioneller Ebene erfüllen sollen. Das »en dehors« entscheidet, bis zu welchem Grad der Perfektion die Schritte und Positionen des Balletts ausgeführt werden können und wird zum größten Teil durch die Rotationsfähigkeit der Hüfte beeinflusst. Dabei ist es notwendig, dass der Bewegungsradius der Hüfte in alle Richtungen über das Normalmaß hinaus geht. Hier soll es sinnbildlich für den Grad der Perfektion – und damit verbundenem Widerstand – der Reiteration der Norm der Einzelnen verstanden werden. Aus historisch-erziehungswissenschaftlicher Perspektive erscheint die schulische Körperformation – seit Einführung der Schulpflicht – erstmal als wenig dynamisch. Ihre Statik manifestiert sich anhand der Schulbank, die mit Hnilica (2010:141) als Kern oder Kristallisationspunkt einer disziplinierenden Schularchitektur bezeichnet werden kann: »Adolf Lorenz 1888 leitete seinen Artikel ›Die heutige Schulbankfrage‹ mit der Bemerkung ein, dass ›unsere Lehrjahre auch Sitzjahre heißen‹ könnten. In Preußen verbrachte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erstmals in der Geschichte praktisch die gesamte Bevölkerung eines Staates einen großen Teil ihrer Kindheit und Jugend in der Schule sitzend. Sitzend in speziellen Bänken, die in einer intensiven Fachdebatte von Pädagogen, Ärzten und Architekten gemeinsam entwickelt wurden. Der Krefelder Schuldirek-
103
104
Choreographien der Homogenisierung
tor Wilhelm Buchner konstatierte 1868, die Schulbank sei ein ›Geräth‹, »an welches unsere Jugend vom 6. bis 16. Jahre wöchentlich durchschnittlich 2830 Stunden lang gebannt ist‹, und ›von dessen gesundheitsgemäßem Bau das Augenlicht, die kräftige Brust, der gerade Wuchs von Hunderttausenden von Kindern abhängt.‹ Die These dieses Beitrags ist: Die Schulbank als in Reihen aufgestellte und fix mit dem Pult verbundene Sitzgelegenheit wurde als technischer Apparat gesehen, um den Körper zu formen, und über den Körper auch den Geist.« (Ebd.) So begann die Entwicklung einer einheitlichen Sitzordnung in Schulen bei der geometrischen Anordnung in Reihen hintereinander, an Schulbank und Pult mit Ausrichtung zum Pult der Lehrperson und der Tafel. Foucault betrachtet diese Anordnung als Effekt der Machtform der BioPolitik (Kapitel 2.1.1): »Sie sitzen hier in Reihen vor mir. Das mag Ihnen ganz selbstverständlich erscheinen […]. Heute sitzen die Schüler in Reihen, und der Lehrer kann sie individuell ins Auge fassen, kann sie einzeln aufrufen, um ihre Anwesenheit zu prüfen, kann sehen, was sie tun, ob sie träumen oder gähnen … Das sind Kleinigkeiten, aber sie sind dennoch sehr wichtig, denn in Verbindung mit einer ganzen Reihe weiterer Formen der Machtausübung sorgen erst diese kleinen Techniken dafür, dass die neuen Mechanismen auch funktionieren […]. Ich spreche hier von einer individualisierenden Machttechnologie, weil sie letztlich auf den Einzelnen bis in seine Körperlichkeit und sein Verhalten hinein zielt. Es handelt sich grosso modo um eine politische Anatomie, eine anatomische Politik, eine Anatomie, die auf den Einzelnen zielt und ihn dabei gleichsam in seine anatomischen Bestandteile zerlegt.« (Foucault, 2005: 230) Der nächste Entwicklungsschritt der Körperformationen in Schule folgte dann erst im Zuge des Strukturplans des Deutschen Bildungsrates 1970, der ›Chancengleichheit‹ fördern und sich an skandinavischen Ländern orientieren sollte. Daraus resultierend wurden neue, demokratischere Formationen wie das »Hufeisen« oder »U« ohne und später mit Zwischenstreben kultiviert. Innerhalb der 90er Jahre vollzog sich dann der »Siegeszug« des Stuhlkreises (Heinzel, 2001; 2016) innerhalb der deutschen Grundschulen, »als Sinnbild für: Gemeinschaft, Verbundenheit, Hineingestelltsein und Selbstfindung im Kreis, Ganzheit und immer wieder: Gleichheit« (Dietrich/Riepe, 2019: 678). Auch »Gruppentische« unterstrichen in diesem Zuge sowohl den Gemein-
3. Methodologie
schaftsaspekt des Lernens wie auch den individuellen Lern- und Optimierungsweg stärker. Die Wirkung von Anordnungen im Allgemeinen kann aus choreographischer Perspektive mit Haselbach (1971: 68) in kurvige und geradlinige Raumwege unterschieden werden:
Abbildung 4: Grundformen geradliniger und kurviger Raumwege (Eigene Abbildung nach Haselbach, 1971:66)
Jede gewählte Position, jede darin liegende Handlung mit ihrer Form, ihrem Ort und ihrer Richtung, bringe somit etwas anderes zum Ausdruck und solle durch den Choreographen reflektiert werden: »Each direction or path of Action has a direct bearing on the expressive value of dance« (Hawkins, 1988: 47). Geradlinigen Formen, die direkt auf die Zuschauer*innen zugehen wie Reihen und Diagonalen, wird dabei die stärkste Wirkung auf das Publikum zugesprochen. Runde- und Kreislinien hingegen betonten eher die Verbindung oder Beziehung einer Person zu anderen oder mit etwas nicht notwendiger Weise Offensichtlichem. Ein weiteres signifikantes Spezifikum ergebe sich außerdem aus der Blickrichtung der Tanzenden (Postuwka, 2008). Kurzum wird der geometrisch-dynamische Aspekt der Formation relevant, bestätigt aber genauso die Unterscheidung von geradlinigen, »straken« Linien und kurvigen »Beziehungs«-Linien. Wie statische und dynamische Aspekte das Phänomen der Herstellung von (vermeintlicher) Gleichheit anhand der Körperlichkeit von Schüler*innen mitbestimmen, soll also im Folgenden genauso anhand der Positionen beleuchtet werden.
105
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Die Grundaufstellung der Sitzordnung des Klassenverbandes wurde innerhalb des erhobenen Materials insgesamt 28 Mal und in besonderer Häufigkeit zu Beginn einer Unterrichtsstunde beobachtet und beschreibt somit die erste Position. Vor allem zu Beginn eines Schultages innerhalb der Begrüßungssequenz ist sie eines der wichtigsten Elemente zur Herstellung einer einheitlichen Ausrichtung, die dabei gleichzeitig am stärksten individualisiert erscheint. Die aufgezeichneten Sitzpläne der Lehrerinnen halten diese Ordnung fest und bestimmen die für alle (Lehrpersonen) sichtbare Verortung aller Einzelnen an einem festgelegten Ort innerhalb der Klasse. Sie bildet die Ausgangssituation für den gemeinsamen Schultag und ist dabei in ihrer Herstellung von besonderer Relevanz, auch wenn sie nicht zwingend das größte Zeitfenster über den Tag bestimmt. Wenn sie als Start- und Endpunkt fungiert, ist sie besonders stark ritualisiert und bietet zumeist wenig Raum für Spielarten. In Pausenzeiten und beispielsweise beim Frühstücken hingegen dient sie auch als Grundformation, ist dann aber nicht durch die Lehrperson angeleitet und entwickelt all ihre Vielfalt. Anhand des in den besuchten Schulen erhobenen Materials sollen die Grundaufstellungen anhand der folgenden Positionen erörtert werden: nach außen gerichtetes U (Kapitel 4.1), Gruppentische (Kapitel 4.2) und Test (Kapitel 4.3). Die Grundaufstellung der Testposition gehört dabei genauso zur Darstellung der ersten Position, da sie zum einen an Tischen und Stühlen stattfindet und außerdem von starker Vereinzelung und stärkster Ritualisierung geprägt ist.
108
Choreographien der Homogenisierung
4.1
Nach außen gerichtetes U
Abbildung 5: Schema – nach außen gerichtetes U
Abbildung 6: Schule A – nach außen gerichtetes U
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Die Körperformation der Klasse wurde zum Beginn der ersten Feldphase gerade neu in das nach außen gerichtete U organisiert – zuvor saßen die Kinder an Gruppentischen. Die Tische stehen nun U-förmig an drei Außenwänden des Klassenraumes und die Kinder sitzen mit ihren Stühlen in der Klassenmitte mit dem Blick zur Wand (2/3 der Schüler*innen) oder Fensterfront (1/3 der Schüler*innen). Die neu eingesetzte Sitzordnung ist dabei von starker körperlicher Vereinzelung geprägt, da sich die Kinder bei frontaler Ausrichtung zum Tisch nicht ansehen können und ein Kontakt nur zu den zwei direkten Nachbar*innen möglich ist. Aus mehreren Perspektiven erscheint diese Anordnung als bemerkenswert. So drehen die Jahrzehnte lang auf Lehrerperson und Tafel ausgerichteten Schüler*innen diesem Mittelpunkt nun den Rücken zu – haben ihn eher ›im Nacken‹. Auch blicken sie sich nicht gegenseitig an, sondern erscheinen zur ›Innenschau‹ ausgerichtet mit dem Blick zur Wand. Nur 1/3 der Klasse hat die Sicht aus dem Fenster zur Option. Der Platz am ›Schreibtisch‹ wird dabei zu einer individualisierenden, optimierenden und machtgefälligen Instanz, an dem individuelleres Arbeiten nach genauen Vorgaben und unter Überwachung stattfindet – ganz nach Foucaults Gedanken zum Panopticon: »Das Panopticon ist eine Maschine zur Scheidung des Paares Sehen/Gesehenwerden: Im Außenring wird man vollständig gesehen, ohne jemals zu sehen; im Zentralturm sieht man alles, ohne je gesehen zu werden.« (Foucault, [1975] 1994: 259) Dass die Körperformation des außengerichteten Us dabei nicht der runden Form des Panopticons folgt, sondern auf geraden Linien liegt, unterstreicht aus ästhetisch-choreographischer Sicht dabei den Aspekt der Strenge und Stärke der Anordnung. Dabei wird nicht die Beziehung zwischen den Elementen der Anordnung fokussiert, sondern die Gruppe aus individualisierten Elementen gleicher Ausrichtung. Das Konzept dieser Formation lässt sich aus didaktischer Perspektive auf die Ideen Heiko Peschels (2002) zurückführen. Die Anordnung soll ihm zufolge die Konzentration während Phasen der Einzelarbeit steigern, da der Austausch von Blicken und Gesprächen nur mit den direkten Sitznachbar*innen möglich sei. Außerdem entstünde so eine große Freifläche in der Mitte des Raumes, die für einen Sitzkreis oder Spiele genutzt werden könne. Das ›lästige‹ Ver-
109
110
Choreographien der Homogenisierung
schieben von Tischen entfalle darüber hinaus: Ein Sitzkreis könne bereits durch das bloße Umdrehen der Stühle der Kinder gebildet werden. Durch das Umdrehen zur Mitte oder zur Tafel sei sichergestellt, dass die Schüler*innen nicht mehr weiter schrieben oder sich mit Gegenständen auf ihren Tisch ablenkten. Nur das Abschreiben von der Tafel erfordere ein ständiges Umdrehen und solle deshalb möglichst vermieden werden. Die positiven Hauptaspekte dieser Sitzordnung seien der Raumgewinn und die damit verbundene Öffnung des Raumes, die nun vielfache Nutzungsmöglichkeiten erlauben würde. In der untersuchten Schule wurde diese Körperformation den Kindern gegenüber mit den folgenden Worten eingeführt: »Wir haben überlegt: Wie musst du am besten sitzen, damit du am besten arbeiten kannst? Wir glauben, das hier ist eine gute Lösung. Wenn du mit dem Blick zur Wand oder zum Fenster sitzt, kannst du alleine, konzentriert arbeiten. Wenn du dich mit deinem Stuhl zur Tafel umdrehst, können wir gemeinsam arbeiten. Und wenn wir noch enger sein wollen, können wir einen kleinen Kreis um den Tisch bilden.« Die Erläuterung der Anordnung ist dabei von Dichotomien geprägt: wir als Lehrerinnenkollektiv/du als Schüler*in, du alleine/wir gemeinsam, wir Lehrerinnen/wir als Klasse aus Lehrerinnen und Schüler*innen, du als Einzelperson/das kollektive Du der Klasse, aber richtet sich an die Optimierung aller angesprochenen Kinder. Eine körperliche Vereinzelung der Gruppe wird dabei durch die individualisierende Ansprache mit dem kollektiven »Du« (2. Person Singular) verbalisiert. Hat das »Du« innerhalb der didaktischen Diskussion eine stärkere Involviertheit und Aufnahmebereitschaft der Schüler*innen zum Ziel1 , appelliert es an ein »Ihr« an dieser Stelle auf gebotartige Weise: Du sitzt am besten! Du arbeitest am besten! Du arbeitest alleine und konzentriert! »Sitzen, konzentrieren und arbeiten« werden so als »zu verbessern« identifiziert mit dem Ziel, durch die neue Sitzordnung »am besten« sein zu können.
1
Vgl.: https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Satz%20und%20 Anweisungsverständnis%20fördern.%20Deutsch.Sprechen-Zuhören.pdf [Stand: 29.01.2018]
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Das »Du« separiert die Kinder auch von dem »Wir« der Klassenlehrerinnen, die gemeinsam die neue Sitzordnung initiiert und installiert haben und diese nun vertreten und legitimieren. Das artikulierte Ziel der neuen Anordnung bleibt, die »beste« Arbeitssituation zu schaffen – und somit Ausgangspunkt für Leistung – für jedes einzelne Kind gleichermaßen. In Bezug auf Bourdieu (Kapitel 2.1.3) verbalisiert die Lehrerin hier die Sinnhaftigkeit der Sitzordnung dem »Du« – also jedem einzelnen Kind – gegenüber, um »die Akteur[*innen] der Gleichgültigkeit [zu] entreiß[en] und sie dazu [zu] beweg[en] und [zu] disponier[en], die von der Logik des Feldes her gesehen relevanten Entscheidungen zu treffen [V.R.]« (Bourdieu 1999: 360). Wenn du genau so sitzt, dann kannst du am besten arbeiten; Wenn ihr alle genau so sitzt, könnt ihr alle die beste Benotung erreichen. So wird die Sitzordnung hier – über die Verhaltens-Homogenität zugunsten einer Ausrichtung einer Gruppe auf einen gemeinsamen Lerngegenstand hinaus – zu einer Bühne der Aufführung von Leistung, die suggeriert, dass jede Schüler*in, jedes »Du« durch Sitzen, Konzentrieren und Arbeiten »am besten« sein könne. Anhand der Körper der Kinder wird die Grundposition (und ihre Variationen) innerhalb der Beobachtungen fünf Mal – mit Hilfe der Einzelkörper als Material für die Gesamtkomposition – eingeübt und ritualisiert wiederholt. Die Lehrperson nimmt dabei die Position der Choreographin ein mit der Herrschaft über Timing, Koordination und Raum für Variation der Bewegungsabläufe der Inszenierung: »Dong! Unterricht beginnt. Alle sitzen so. So muss das sein.« (Frau Roth) Innerhalb des Materials wird die choreographisch-korrigierende Rolle der Lehrerin auf besonders strenge Weise verkörpert, wenn die Anordnung den Anfang der Unterrichtseinheit oder des Schultages beschreibt: Frau Roth lässt die Klangschale erklingen, stellt sich dann vor die Tafel und legt den Zeigefinger auf die Lippen. Alle Kinder drehen sich mit den Stühlen um 180° um, so dass nun ihr Blick zur Tafel gerichtet ist. Sie spricht Mino an, der sich nur körperlich umgedreht hat, nicht aber mit dem Stuhl: »Mino, du müsstest das noch mal richtig machen.« Mino dreht den Stuhl um 90°. »Neee, ganz richtig.«
111
112
Choreographien der Homogenisierung
Der Unterricht beginnt, indem die Lehrerin die Klangschale ertönen lässt, sich dann vor die Tafel stellt und den Zeigefinger auf die Lippen legt. Auf das akustische Signal hin drehen sich die Kinder um 180° mit ihrem Stuhl um, so dass nun ihr Blick zur Tafel gerichtet ist. Durch den Ton fordert Frau Roth also die Aufmerksamkeit der Kinder und signalisiert den Beginn der Einheit sowie die eingeübte Aufforderung zum Umdrehen des Stuhles. Aus einer vorangehenden Außen-Orientierung wird dann eine Innen-Orientierung körperlicher (Ausrichtung Körper zu Lehrperson und Tafel) ›räumlicher (Ausrichtung inklusive Stuhl) und suggeriert geistiger (Erwartung in Bezug auf die Konzentration auf den Lerngegenstand) Natur. Die Klangschale als akustisches Signal erscheint hier nicht als willkürlich austauschbar mit beispielsweise einer Trillerpfeife. Die Klangschale ist als Utensil der Meditation der buddhistischen Tradition entlehnt. Ihr warmer, anhaltender Ton dient dabei nicht nur als Signal zur Einnahme der Startposition, sondern ruft auch alle Anwesenden auf, zur-Ruhe-zu-kommen, ruhig auf das Ausklingen des Tones zu warten und diesem die Aufmerksamkeit zu schenken. Kombiniert mit der Gestik des Zeigefingers auf den Lippen der Lehrerin, fordert diese ihre Schüler*innen zu einheitlicher akustischer Ruhe auf. Ein Schüler fällt dabei aus dem Rahmen der Genauigkeit dieses Vorganges, da er sich nur körperlich umdreht, nicht aber mit dem Stuhl. Für Frau Roth scheint diese erste Ausrichtung aber so essenziell, dass sie ihn anspricht und zur Korrektur auffordert. Seine ungenaue Umsetzung markiert sie als »falsch« gegenüber eines »Richtig«. Mino dreht den Stuhl daraufhin um 90°. Das kann einerseits als Provokation verstanden werden (»Ich mache das nicht so, wie du es willst.«), aber auch als Unverständnis der engen Grenze der Situation gegenüber (»Ich sitze doch so wie alle anderen.«). Auch diese Sitzposition – ungeachtet ihrer Motive – entspricht nicht der Genauigkeits-Erwartung von Frau Roth und sie fordert ihn zu einem »ganz richtig« auf. Damit verbalisiert sie den nicht vorhandenen Spielraum der Auslegung der Sitzposition. Alle sollen exakt aus der (vermeintlich) gleichen Ausgangsposition starten. Innerhalb der Illusio geht es hier aber um mehr als die vorgegebenen Regeln der Lehrperson. Es geht um ein Einverständnis der Kinder mit den Spielregeln der Sitzordnung und des Schulalltages zugunsten des Glaubens an ihre Sinnhaftigkeit. Aus dieser Position heraus werden die Kinder selbst zu Vertreter*innen der einstudierten Regeln, auch der Choreographin gegenüber:
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Sie [Frau Roth] lässt die Klangschale ertönen »Klong« und deutet eine Kreisbewegung mit ihrem Finger. Einige Kinder beginnen sich mit ihrem Stuhl in einen Stuhlkreis zu setzen, andere drehen sich mit Stuhl und Oberkörper zur Tafel um. Frau Roth unterbricht: »Nein, ihr sollt euren Stuhl umdrehen!« Oskar ruft: »Stuhl umdrehen ist einfach nur auf den Gong hauen! Dann drehen wir um!«
Obwohl akustisches Zeichen und Gestik so deutlich erscheinen, sind sie in dieser Kombination und Reihenfolge für die Kinder mit keiner einheitlich klaren Bedeutung besetzt. So verhalten sich die Schüler*innen unterschiedlich zu der Anweisung und es entsteht eine Unordnung. Handelt es sich nun um das Signal zu einem engen Erzähl- und Stuhlkreis oder beginnt eine gemeinsame Unterrichtseinheit vom Sitzplatz aus mit Fokus auf Lehrerin und Tafel? Die Ausrichtung der Körperformation ist den Kindern nicht einheitlich klar. Frau Roth unterbricht die Situation und formuliert eine unmissverständliche Anweisung sowie Erklärung der Signale: Klangschale und Handbewegung bedeuten hier und jetzt, dass die Kinder sich mit ihren Stühlen zu ihr umdrehen sollen. Oskar markiert durch seinen Zwischenruf dabei eine Abweichung dieses Prozedere von dem rituellen Ablauf im Unterricht (der anderen KlassenLehrerin) – also eine uneinheitliche Regelung. Sein Appell an Frau Roth lautet: So machen wir das immer und so soll Frau Roth das auch machen. Die Regeln, die Oskar und seine Körperlichkeit im Unterricht begrenzen und bestimmen, fordert er nun in klarer Deutlichkeit bei Frau Roth ein und verteidigt/validiert sie damit. So wird der enge Rahmen dieser verkörperten Grundaufstellung, als Bedingung für das Gelingen des (Klassen-)Spiels, nicht nur für die Lehrerinnen als relevanter Moment hervorgebracht, sondern genauso aus Schüler*innenPerspektive zu einer Fassung, die es verbindlich zu sichern und sich ihrer zu versichern gilt.
4.2
Gruppentische
Die Organisation der Gruppentische innerhalb der dritten Feldphase bestand schon vor dem Feldaufenthalt und ist in vier Tische zu je vier Kindern aufgeteilt. Zwei Tische stehen dabei seitlich an der Fensterfront und zwei seitlich an der Wand.
113
114
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 7: Schema – Gruppentisch
Abbildung 8: Schule B – Gruppentische
Auch diese Anordnung ist durch gerade Linien und deren starke Ausrichtung geprägt. Die große Gruppe lässt sich dabei jedoch in kleine Gruppen von je vier Kindern unterteilen, die einander zugewandt sind.
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
In Bezug auf die Ausrichtung zur Tafel und Lehrperson sitzen dabei je zwei Kinder jeder Gruppe mit dem Rücken zu diesen gewandt. Die überwachende Position der Lehrerin wird auch innerhalb dieser Sitzordnung aufrechterhalten, ist jedoch nicht klar in Sehen und Gesehenwerden unterteilt. Aus didaktischer Sicht soll diese Ordnung den Einsatz von Gruppenarbeit fördern und habe somit eine starke soziale Komponente (Schicke/Brylla, 2005). Unter dem Anspruch des Erwerbs von sozialen und emotionalen Schlüsselqualifikationen, wie Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft oder Teamfähigkeit, gehören Gruppentische zu den beliebtesten Ordnungen im didaktischen Alltag (Buddensiek, 2009).
Sie [Frau Knapper] berichtet mir, dass die Sitzordnung der Klasse bis vor Kurzem noch U-förmig mit Zwischenstreben organisiert gewesen wäre. Nun habe sie sich aber für Gruppentische entschieden. Das sei eine sehr freundliche und offene Ordnung und die Kinder könnten sich gegenseitig unterstützen.
So geht es auch innerhalb dieser Ordnung um Leistungsoptimierung, jedoch unter der Überschrift der gegenseitigen Unterstützung und der Betonung des Gemeinschaftsaspekts. Die Bedeutung als Grundposition ist darüber aber im Schulalltag nicht gemindert:
Frau Knapper stellt sich mit dem Blick in die Klasse vor die Tafel. Mit dem linken Zeigefinger aufzeigend, die rechte Hand den »Leisefuchs« formend und Alessandro spurtet schnell zurück zu seinem Sitzplatz am Gruppentisch.
Durch das von Frau Knapper selbst verkörperte Signal deutet sie das Ende oder die Unterbrechung der Arbeitsphase und fordert den Fokus der Kinder auf sich und die Tafel ein. Das Signal des aufzeigenden Zeigefingers soll dabei die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich ziehen und das Fingerzeichen des »Leisefuchses« zur Ruhe aufrufen: Ohren gespitzt, Mund zu. Der Leisefuchs, auch Flüsterfuchs, Schweigefuchs oder Stillefuchs genannt, ist dabei ein weit verbreitetes Handzeichen, um Einzelpersonen oder eine Personengruppe zum Schweigen und/oder zum aufmerksamen Zuhören zu bringen. Als Anregung findet sich dieses Handzeichen in diversen
115
116
Choreographien der Homogenisierung
(Lern-)Ratgebern2 . Wenn der Lärmpegel innerhalb einer Gruppe über ein bestimmtes Maß ansteigt, hebt die Gruppenleiter*in die Hand und zeigt den Leisefuchs. Dafür werden Zeigefinger und kleiner Finger nach oben gestreckt, um die Ohren eines Fuchses anzudeuten und Mittelfinger und Ringfinger gegen den Daumen gepresst, um das geschlossene Maul zu imitieren. Der Leisefuchs hat seine Ohren gespitzt und sein Maul geschlossen. Das Zeichen soll die Personen innerhalb der Gruppe dazu anregen, es dem Leisefuchs gleichzutun – mit den Ohren zuzuhören und nicht mehr zu sprechen. Auf interkultureller Ebene ist das Handzeichen des Leisefuchses jedoch mehrdeutig. So entspricht es dem sogenannten »Wolfsgruß«, dem Erkennungs- und Gruß-Zeichen der Grauen Wölfe (türkisch: Bozkurtlar oder Bozkurtçular), einer rechtsextremen, nationalistischen Gruppierung in der Türkei (Hennemann, 2016), und erscheint somit im Schulunterricht als unangebracht. So geht es innerhalb der Formierung der Kinder auch immer wieder um das Erlernen und die Reproduktion anerkannter Gesten, die den Unterricht regulieren, wie z.B. das Sich-Melden (Mietzner/Pilarczyk, 2000) oder in diesem Falle der verkörperte Appell an akustische Ruhe. Alessandro spurtet auf Frau Knappers Gesten hin also schnell zurück zu seinem Sitzplatz an den Gruppentisch, da die Position, die Frau Knapper eingenommen hat, außerdem von den Kindern zu fordern scheint, die Grundaufstellung einzunehmen. Auch hier wird durch die Grundposition also immer wieder ein End- und Ausgangspunkt eingenommen, von dem aus eine gemeinsame Ausrichtung (in Richtung Tafel und Lehrperson) und ein gemeinsamer Fokus (auf einen Lerngegenstand) vorgenommen wird. In Bezug auf die Gruppentische gibt es – wie bei dem außen gerichteten U – dabei genauso Momente der Grenzziehung durch die Lehrerin, »Nein, setzt Dich wieder hin, wir besprechen noch die Hausaufgaben!« (Frau Knapper)
wie der Grenzverteidigung durch die Kinder,
2
z.B. Britta Winters, 2010: Komm, das schaffst Du! Aufmerksamkeitsprobleme und ADHS
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Helene: »Wir dürfen so nicht!«
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass innerhalb der Grundformation der Sitzordnungen mit Tischen und Stühlen die beobachteten Lehrpersonen die illusionäre Ordnung im Sinne des doing sameness besonders stark anrufen. Gleichheit wird hier vor allem über die Ausrichtung von Stuhl und Körper auf strengen horizontalen und vertikalen Linien und das Ruhehalten in sprachlicher und körperlicher Hinsicht bis hin zur Anlehnung an mentale Ruhe (Konzentration) durch das Stilmittel der Klangschale hergestellt. Die Körperachsen der (exakten) frontalen Ausrichtung spielen hier eine wichtige Rolle und sind besonders klar definiert. Antrieb ist dabei die illusio einer einheitlichen (körperlichen) Ausgangssituation für das »erfolgreiche« Lernen. Mit Ricken (2015) kann der Glaube an die Sinnhaftigkeit dieser Inszenierung auch als omnipräsentes »Versprechen« verstanden werden, »das Versprechen, dass durch ›Bildung‹ alles besser werde« (ebd.: 41 Herv. I. Orig.), womit auch die Ebene des scheinbaren »doing equality« berührt wird. Unordnung oder unklare Signale werden in diesem Rahmen wenig geduldet, wobei die Grenzen des Erlaubten vor allem von Lehrerinnen-Seite aus, aber auch von den Schüler*innen selbst bewacht werden. Als besondere Variation der Grundaufstellung sind Test-Situationen zu sehen. Diese sollen im Folgenden das Bild der ersten Position komplettieren.
117
118
Choreographien der Homogenisierung
4.3
Test Abbildung 9: Schule B – Test
Abbildung 10: Schule A – Test
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Die Klassenarbeit, der Test oder die Prüfung als »Höhepunkt und Ziel schulischen Arbeitens«, (Breidenstein, 2006: 203) gilt als ritualisiert wie kaum eine andere schulische Situation und ist stets anhand von geraden Linien organisiert: »Es gibt oft eine besondere Sitzordnung, verwendet wird ein besonderes Heft oder eigens ausgeteiltes Papier, es gibt besondere Regularien über das, was auf dem Tisch liegen darf und ob und wann die Toilette besucht werden darf. In der Klassenarbeit ist alles anders (als im »Unterricht«) und alles wie immer (in der »Klassenarbeit«). […] Die ganze Konzentration gilt der Bearbeitung der Aufgabe.« (Ebd.) Die Beobachtungen in den Feldphasen unterstreichen diese Annahme: Frau Roth schüttelt nur den Kopf und fährt mit ihrer Erklärung des Tests fort. Hannah unterbricht sie: » Wo schreib ich das rein?«, kopfschüttelnd sieht Frau Roth sie an: »Nicht dein Ernst?!« »In dein Heft«, flüstert Lisanne Hannah zu. (…) Während Frau Roth den Test verteilt, ruft Hannah: »Hä? Frau Roth, wie geht das jetzt?« Frau Roth kommt auf sie zu und sagt: »Es kann nicht sein, dass du in der dritten Klasse nachfragst, wie ein Test abläuft!« Dann verteilt sie die restlichen Zettel. Hannah (und all ihre Mitschüler*innen) sollte aus Lehrerinnen-Perspektive nun – in der dritten Klasse – über ein gewisses Regel- und Ablaufwissen in Bezug auf Testsituationen verfügen, das ihr hilft ihre Fragen zu beantworten. Die Regeln und der Ablauf der Prüfungssituation dienen dabei nicht nur der Verhinderung von Täuschungsversuchen, sondern auch zur Schaffung einer illusio der homogenen Ausgangslage im besonderen Sinne, die über 1. Körperposition, 2. Zeitfenster 3. Arbeitsmaterial und 4. akustische Ruhe hergestellt wird. So soll die vereinzelte, sitzende Körperposition nicht nur ein Abschreiben und Austauschen verhindern, sondern auch für akustische Ruhe und Separiertheit sorgen, die die Kinder in ihrer Konzentration unterstützen soll. Ungeliebte Veränderungen der Sitzposition können so plausibel gemacht werden. Sobald alle Kinder im Klassenraum sind, verteilt Frau Knapper bunte Pappen. Ein Raunen geht durch die Kinder: »Oh nein!« »Schon wieder ein Test!«
119
120
Choreographien der Homogenisierung
Frau Knapper nickt: »Ja! Und wir tauschen die Sitzordnung.« Ein erneutes Raunen: »Neeee!« Und Frau Knapper entgegnet mit einer bremsenden Handbewegung: »Nur für diese Stunde!« Ardi soll mit Patricio tauschen, Dustin sich neben Elias setzen: »Jamal hier an den Tisch, Sadaf setzt sich hier in die Mitte!« Zu Beginn des Unterrichts verteilt Frau Knapper bunte Pappen. Die farbenfrohen Pappen, die zuerst auf ein anstehendes Basteln oder Präsentieren von Unterrichtsthemen auf Postern schließen lassen, dienen in diesem Fall als Erkennungsmerkmal für die Kinder für ein separiertes Sitzen in einer Prüfungssituation. Die Pappen, die wie eine Art »Wahlkabine« aufgebaut werden, sollen aus Lehrerinnen-Sicht also eine objektivere Leistungserhebung ohne Abschreiben gewährleisten und die Ruhe und Konzentration der Kinder fördern. Es wird also eine Klassenarbeit geschrieben, für die das kollektive »Wir« die Sitzordnung für eine Stunde tauschen muss. Das suggeriert die gemeinsame Involviertheit von Lehrerin und Schüler*innen. Das Pappen-Séparée wird also durch eine Modifikation der Sitzordnung komplettiert. Die Kinder sind darüber wenig amüsiert und wollen sich nicht von ihren gewohnten Sitzpositionen trennen. Frau Knapper versucht diesen Unmut mit einer beschwichtigenden Handbewegung sowie mit der Ankündigung der Auflösung der Neuanordnung nach dem Test zu beruhigen und so wird die Regelung akzeptiert. Der ›Abstand‹ zwischen den Kindern wird aber auch hier wieder nicht nur von den Lehrerinnen hergestellt: Gustav, Paul, Ida, Leonie und Helene werden an andere Plätze gesetzt »zum Entzerren«. Sondern teilweise auch durch die Kinder forciert: Helene sitzt Ida nun am Gruppentisch gegenüber und baut mit ihrem Etui eine »Mauer« auf. Dies unterstreicht den vorhandenen Glauben der Kinder an die Sinnhaftigkeit der Aufführung der Prüfung, deren Regeln und die damit verbundene illusio (Bourdieu, 1999).
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
Der Faktor Zeit wirkt in diesem Gefüge sowohl als von der Prüfung finalisiert: es wird einem Zeitabschnitt ein bestimmtes Ziel gesetzt, das durch eine Prüfung ausgewiesen wird und die Fähigkeiten der Individuen differenziert; sowie innerhalb der Prüfungssituation als strukturierend: um eine einheitliche Situation herzustellen, die durch die Lehrperson überwacht und dem Vergleich unterzogen werden kann. Die zeitliche Rhythmisierung des Schulablaufs, als Zeit-Maß von Unterricht in Vermittlung, Einübung, Vertiefung und Überprüfung des Lernens (Nüberlin, 2002), wird an dieser Stelle besonders spürbar. So kann die Prüfungssituation und ihr begrenztes Zeitfenster als Zeitdruck aufgefasst werden, der zum einen von der Lehrperson artikuliert wird: Frau Roth betritt die Klasse und kündigt umgehend an: »Wir haben nicht so viel Zeit. Alle hinsetzen!« Sich aber bis in den anhaltenden Vergleich der Kinder untereinander erstreckt: Mino beugt sich über Hannahs Test und merkt mit einem Fingerzeig an: »Ich hätte das hier weggemacht.« »Alta! Wie weit bist du schon!«, setzt er dann nach. »Ich bin erst da«, und deutet auf seinen Zettel. (…) Mino zeigt Hannah: »Ich bin erst beim zweiten. Da bin ich.« Und Hannah merkt erstaunt an: »Oh Gott!« »Ich weiß«, grummelt Mino. (…) Hannah ruft: »Fertig!« Und Mino: »Kacke!« So erscheint effiziente Schnelligkeit als besonderes Merkmal einer erfolgreichen Lösung der Aufgaben. Nüberlin nennt diesen Umstand die »institutionalisierte Testfrage: Schafft ein Schüler das Lern- oder Prüfungspensum trotz des Zeitdrucks, oder nicht?« [Hervorhebung aus dem Original übernommen] und kritisiert dabei die Annahme eines zeitliches »Normalmaßes« aller Lernvorgänge (Nüberlin, 2002: 112). Angerufen und eingeübt wird diese Schnelligkeit drei Mal im Rahmen der Beobachtungen durch Spiele innerhalb der Klasse, zum Beispiel während Schnell-Rechenübungen: Oskar hibbelt auf seinem Stuhl herum: »Ich muss erst noch etwas trinken, sonst überhitze ich.« Und Lisanne ermahnt Conrad: »Erst anfangen, wenn’s
121
122
Choreographien der Homogenisierung
losgeht!« (…) Langsam rufen immer mehr Kinder ihren Namen und Frau Schuhmann nennt ihnen ihre Zeit. Mino stellt fest: »Ich habe mich um eine Minute verbessert!« ›Gute‹ Schüler*innen zeichnen sich unter diesen Voraussetzungen nicht nur durch eine schnelle Auffassungsgabe innerhalb der vorgegebenen Zeit, sondern auch durch ihre Druckresistenz bei der überprüfenden Wiedergabe des Lernstoffes aus (ebd.). Auch die Warnung vor Ungenauigkeit steht dabei – häufig an das kollektive Du gerichtet – im Raum und gilt vermieden zu werden: »Lies genau, was da steht. Erst wenn du wirklich verstanden hast, worum es geht, fängst du an.« (Frau Roth)
Wird an dieser Stelle also der Kernaspekt Nüberlins (und Foucaults, [1975] 1994) Ausführungen unterstrichen: »Der institutionelle Effekt des Lernens pro Zeit besteht darin, an den Schülerinnen und Schülern Unterschiede im Wissen herzustellen und vorhandene zu verstärken« (Nüberlin, 2002: 113) [Hervorhebung im Original], so liegt der illusionäre, homogenisierende Ausgangspunkt sowohl in der sichtbaren Gemeinsamkeit des einheitlichen Zeitfensters: »Wie viel Zeit haben wir?«, ruft Leonie. »45 Minuten«, antwortet Frau Roth.
− kann aber genauso durch eine gemeinsame Struktur angerufen werden: »Mund zu, einkreisen! Keiner geht einfach schon weiter, wir machen das zusammen«, gibt Frau Knapper dann das Startsignal. (…) »Dann könnt ihr auch gleich weiterblättern!«, moderiert Frau Knapper. »Da ist ein Stoppzeichen!«, ruft Alessandro. »Ja, und du sollst weiterblättern!«, entgegnet Frau Knapper und erklärt die folgende Aufgabe.
So schafft die Lehrerin eine vermeintliche Einheit der Kinder durch gleiches Vorgehen und Rhythmus sowie klaren Bezug auf artikulierte und visualisierte
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
(Stoppzeichen) Regeln und Arbeitsanweisungen und verschafft sich dennoch gleichzeitig einen besseren Überblick über das Voranschreiten der Einzelnen. Die Frage nach dem Arbeitsmaterial komplettiert die Ausgangsposition der Prüfung: »Haben jetzt alle Kinder einen Bleistift und ein Radiergummi am Platz?«, fragt Frau Knapper die Klasse abschließend und teilt dann die Test-Hefte aus. »Test Nr. 28.« So wurden die Punkte der Verteilung im Raum, der Strukturierung der Zeit und des einheitlichen Arbeitsmaterials sichergestellt und alle können aus einer illusionär gleichen Ausgangslage mit dem Test beginnen: »Der Mund ist zu, ich möchte nichts hören. Name, Datum, Mund zu.« (Frau Roth) Innerhalb der Beobachtungen erscheint der Toleranzspielraum in Bezug auf körperlichen Interpretationsspielraum der Kinder innerhalb der Grundaufstellung am geringsten und wird nicht nur durch die Requisiten Tisch und Stuhl forciert: Die Kinder sind sehr unruhig und viele von ihnen sitzen nicht wirklich auf ihren Stühlen. Laura hockt unter dem Tisch, Mino dreht seinen Stuhl nicht um und auch Leonie sitzt noch mit dem Blick zur Wand. »Stopp! Noch mal von vorne! Ich zähle bis drei und dann sitzen alle, wie sie sollen! 1, 2, 3!«, und die Kinder setzen sich hin und drehen die Stühle zur Tafel um. Die Sitzpositionen verschiedener Kinder markieren – in den Augen der Lehrerin – noch keine Bereitschaft für den Beginn der folgenden Überprüfung. Die Unruhe kann dabei vielerlei Auslöser haben: Ist den Kindern zu warm/zu kalt? Sind sie aufgeregt vor dem anstehenden Test? Vielleicht wissen sie, dass sie nicht gut vorbereitet sind und haben Angst zu scheitern? Haben Einzelne noch nicht gefrühstückt oder sich gerade zuhause mit ihren Geschwistern oder Eltern gestritten? Frau Roth schiebt all diese Aspekte zu Gunsten der einheitlichen (körperlichen) Ausrichtung bei Seite und ermahnt: »Stopp! Noch mal von vorne! Ich zähle bis drei und dann sitzen alle, wie sie sollen! 1, 2, 3!«, und die Kinder setzen sich hin und drehen die Stühle zur Tafel um.
123
124
Choreographien der Homogenisierung
Sie nutzt dabei die 1-2-3-Formel. Diese thematisiert ein Stopp-Verhalten, das es zu beenden gilt (hier die Unruhe und »falsches« Sitzen) und das Suggerieren einer kurzen Bedenkzeit, um die »richtige« Entscheidung zu treffen. Die Zählung kann aber auch als eine Art Countdown verstanden werden, auf den eine disziplinierende Konsequenz folgt, wenn der Forderung der Lehrerin nicht nachgekommen wird. Es geht also um eine konsequente Aufforderung zum Lernen, die Störungen beenden soll. Konsequent wird sie durch das Mitschwingen der Strafe bei »falscher« Entscheidung. Also reagieren die Kinder und setzen sich Frau Roths Vorstellung entsprechend hin. In Bezug auf Momente der Homogenisierung kommt der Prüfung und ihrer Choreographie also eine besonders interessante Rolle zu, die sich mit Foucault als »Zeremonie der Objektivierung« (Foucault, [1975] 1994:242) beschreiben und ästhetisch am ehesten mit dem Synchronschwimmen in der Kombination (bis zu zehn Schwimmer*innen, Variation aus Solo-, Duett- und Gruppenteilen) vergleichen lässt. In der technischen Kür müssen dabei vorgegebene Elemente in einer bestimmten Reihenfolge ausgeführt werden, wobei die Synchronizität zur Musik und der Schwimmenden untereinander in besonderem Maße bewertet wird. Abweichungen führen zu Punktabzug. Eine augenscheinlich homogene Gruppe wird also in Bezug auf das Verhältnis ihrer Mitglieder zueinander differenziert. Die Körperachsen der Mitglieder sind durch diese Synchronizität eben nicht auf eine Beziehung zueinander, sondern eine jeweils einzelne Verkörperung der Erwartung (zu Tafel und Tisch/Test hin) ausgerichtet. Innerhalb der Inszenierung der Prüfung konstituieren sich die Individuen der Schüler*innen dann als beschreib- und erfassbarer Gegenstand (ihr Wissen, ihre eigentümliche Entwicklung, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten). Andererseits lässt sich dadurch ein Vergleichssystem aufbauen, das die Messung globaler Phänomene, die Beschreibung von Gruppen, die Charakterisierung kollektiver Tatbestände, die Einschätzung der Abstände der Individuen und ihre Verteilung in einer »Bevölkerung« erlaubt. »Die Prüfung macht mit Hilfe ihrer Dokumentationstechniken aus jedem Individuum einen Fall« (ebd.: 244). Gekoppelt ist sie dabei an das Prinzip der Besserung, der Steigerung individueller (und kollektiver) Effektivität und Produktivität, womit immer wieder an die Ebene des »doing equality« appelliert wird. So wird innerhalb der Grundposition der Prüfungsanordnung nicht nur eine homogene (Körper)Gruppe mit scheinbar gleichen Voraussetzungen angerufen: Alle sitzen vereinzelt, alle kennen Struktur, Ablauf und Zeitrahmen, allen steht das notwendige Material zur Verfügung. Sondern genauso wird durch den Glauben
4. Erste Position: Grundaufstellungen mit Tischen und Stühlen
an die Prüfung (als Feststellungsinstrument) eine illusio der ›Chancen für alle‹ aufrechterhalten, dass durch diese zwar ›Defizite‹ ermittelt werden können, die – erstmal ›festgestellt‹ – dann aber die Möglichkeit der ›Besserung‹ eröffnen.
125
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Frau Roth: »Sooooo weiter geht’s. Erstmal auf den Platz setzen, bitte.« Alle Kinder setzen sich auf ihre Plätze, die Stühle sind zu den Tischen hin ausgerichtet, die meisten Oberkörper zur Lehrerin gewandt. Die Klangschale ertönt und alle drehen ihre Stühle zu Lehrerin und Tafel um. »Jetzt machen wir einen richtigen Stuhlkreis um den Tisch.«
Ausgehend von ›dem Platz‹ (Erste Position) der Einzelnen innerhalb der Klasse entwickelten sich im Laufe der Beobachtungen der Schultage immer wieder diverse ritualisierte Formations-Variationen. Innerhalb der zweiten Position sollen dabei nun die verengten Körperformationen ohne Tische in den Fokus rücken, die innerhalb der Beobachtungszeiträume in ihren Modifikationen insgesamt 24 Mal beobachtet wurden. Als verengt werden diese Formationen insofern beschrieben, als dass sie zum einen im Verhältnis zum gesamten Klassenraum nur eine geringe Grundfläche beanspruchen und zum anderen – auch durch das fehlende Requisit Tisch – die Distanz der einzelnen Körper zueinander verkleinern. Durch diese zusammenfassende Form wird gleichzeitig eine persönlichere und weniger formale (Arbeits-)Atmosphäre suggeriert, innerhalb derer auch Spiele oder Gespräche jenseits des klassischen Unterrichtsgeschehens, beispielsweise in Form des »Klassenrats«, möglich sind. Unterteilt werden die Variationen der Position im Folgenden in die Aufstellungen: in Reihen (Kapitel 5.1), Stuhlkreis (Kapitel 5.2) und Sitzkreis (Kapitel 5.3).
128
Choreographien der Homogenisierung
5.1
In Reihen
Abbildung 11: Schema – in Reihen
Abbildung 12: Schule B – in Reihen
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Die Sitzordnung auf Hockern in Reihen wurde ausschließlich in Schule B beobachtet und erscheint dem verengenden Prinzip erst einmal nur in Bezug auf die Distanzen der Körper zueinander zu folgen. So fokussiert sie nicht einen Gleichheitsbegriff im Sinne einer partizipativen Kommunikation unter Schüler*innen und Lehrer*innen wie es das Kreisgeschehen (Heinzel, 2001; 2016) mit seinen »Beziehungslinien« (Kapitel 5.2) verspricht. Vielmehr schaffen die verengten, starken Linien eine gestauchte Form der frontalen Fokussierung und damit auch einer verengten Überwachung. Zwar sitzen die Schüler*innen enger beieinander, sind jedoch mit dem Rücken oder parallel zueinander ausgerichtet, so dass die stringenten Kommunikationsachsen auf Tafel und Lehrerin ausgerichtet sind. Suggeriert die Verengung also im ersten Moment eine weniger formale und von Beziehung geprägte Atmosphäre, so erscheint sie hier als vereinzelt, reglementiert und durch die Kategorien ›Jungen‹ und ›Mädchen‹ homogenisiert sowie differenziert: Frau Knapper kündigt an: »Bitte schließt das Schreiben ab und legt das Geschichten-Buch in euer Fach. Danach setzt ihr euch hier zu mir.« Nach und nach setzen sich die Kinder – abwechselnd Mädchen und Jungen auf die in zwei Reihen angeordneten Sitzbänke ohne Lehne (drei Stück pro Reihe) in der Klassenmitte mit Blick zu Frau Knapper. So scheint es in dieser Formation die ritualisierte Regel zu sein, denn das Prozedere wurde von Frau Knapper nicht verbalisiert. Vereinzelt kommentieren die Kinder: »Ihhhh!«, »Nicht so nah!«, »Immer abwechselnd, Mann! Junge, Mädchen!« Frau Knapper beobachtet den Prozess und dirigiert mit kurzen, pointierten Armbewegungen (Assoziation: Dirigentin) an manchen Stellen: »Etwas enger zusammen, sonst passt da keiner mehr hin!« Sadaf kommt etwas verspätet in die Reihen und setzt sich neben Hylia: »Wir dürfen so nicht! Immer abwechselnd!«, ermahnt Alessandro sie und sie rutscht einen Platz weiter. Frau Knapper nickt. Als alle sitzen folgt eine kurze Rechtschreibübung zu Fehlern, die Frau Knapper in den Geschichten-Büchern der Kinder gefunden habe, an der Tafel. Frau Knapper schreibt die Wörter in der »falschen« Form an die Tafel und die Kinder sollen die Fehler berichtigen. Frau Knapper begründet die wiederkehrende Aufteilung anhand der Kategorien ›Mädchen‹ und ›Junge‹ innerhalb der Klasse – auf mein Nachfragen hin – mit »weniger Gequassel« durch »Entzerrung« und einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Einzelnen in Richtung Tafel und weg von den Sitznachbar*innen.
129
130
Choreographien der Homogenisierung
So bittet die Lehrerin, Frau Knapper, die Schüler*innen zum Abschluss einer Unterrichtssequenz, das Schreiben abzuschließen und ihr Unterrichtsmaterial an den jeweils dafür vorgesehenen Platz zu legen. Anschließend sollen die Kinder sich »hier zu mir« setzen und eine neue Einheit kündigt sich an. Die stärkere (körperliche) Nähe und räumliche Begrenztheit der angekündigten Formation wird dabei zwar verbal ausgerufen, die geradlinige Anordnung der Kinder in Reihen auf den vorgesehenen Bänken und nach dem einstudiert, differenzierenden Ordnungsprinzip ›Mädchen/Junge‹, steht dieser ›Nähe‹ jedoch entgegen. Die Inszenierung und Betonung der Kategorien ›Mädchen/Junge‹ führt bei den Kindern unter anderem zu einer »Dramatisierung« (Faulstrich-Wieland/Weber/Willems, 2004) und überbetonten Abgrenzung der Geschlechterrollen: »Ihhhh!«, ein Mädchen/ein Junge1 . Dabei werden die Gruppen Mädchen/Jungen als jeweils homogene Einheiten angerufen, die sich anhand der Formel A-B-A-B anordnen sollen, um Frau Knappers möglichem Zweck – Mädchen und Jungen »quasseln« weniger miteinander (»Entzerrung«) als mit gleichgeschlechtlichen Freund*innen und Nachbar*innen – zu folgen und somit die klaren Kommunikationslinien der Formation noch weiter zu schärfen. Die Kinder regeln die Verteilung auf den Hockern dabei sowohl eigenständig: »Nicht so nah!«, »Immer abwechselnd, Mann! Junge, Mädchen!«, »Wir dürfen so nicht! Immer abwechselnd!«, was die anerkannte Gültigkeit der Formation und ihrer Ordnung unter den Schüler*innen unterstreicht, als auch mit Hilfe von Frau Knappers Anweisungen: »Etwas enger zusammen, sonst passt da keiner mehr hin!« Ihre kurzen, pointierten Armbewegungen veranlassen die Beobachterin zu einer Anmerkung der Assoziation mit einer Dirigentin. Das Dirigieren als eine Orientierungs-, Koordinierungs- und Gestaltungshilfe für die ausführenden Musiker*innen eines musizierenden Ensembles wird dabei hauptsächlich durch Handbewegungen einer Dirigent*in ausgeführt und erfüllt mehrere Funktionen: Es koordiniert die Musiker*innen am Beginn und am Ende des Stücks sowie beim Einhalten des Takts. Darüber hinaus werden die Einsätze angezeigt und fortlaufend die musikalische Gestaltung geprägt. Die Schlagfigur (Taktart) wird dabei zumeist mit der rechten Hand und einem Taktstock geschlagen, während die linke Hand Ausdrucks- und Phrasierungsnuancen – unabhängig von
1
Vertiefend dazu: Die Ethnographische Längsschnitt-Studie Doing Gender im heutigen Schulalltag (Faulstich-Wieland/Weber/Willems, 2004) widmet sich der Frage nach den Inszenierungsformen des Doing Gender im gymnasialen Schulunterricht.
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
dem Schlagmuster der rechten Hand – durch verschiedene Gesten mit anzuzeigen sucht (Scherchen, [1981] 2011). So überblickt und koordiniert Frau Knapper mit ihren kurzen, pointierten Armbewegungen die finale Verteilung ihres Mädchen/Jungen-Ensembles auf den Hockern ›bei ihr‹. Dabei wird das hierarchische Verhältnis von Leitung und Geleiteten, von Mädchen und Jungen – gegensätzlich zu der verbalisierten und suggerierten Nähe – deutlich differenziert. So werden beispielsweise situativ auch zuerst Jungen organisiert und die Mädchen dann zu ihnen zugeordnet oder im Sprachgebrauch wird stets die Ordnung »Jungen« (erstgenannt) »und Mädchen« verwendet. Weiteres Stilmittel zur Kategorisierung, Homogenisierung sowie Differenzierung der Situation ist das Gegensatzpaar ›richtig und falsch‹. Das Anordnen der Kinder auf den Bänken wird in diese Kategorien aufgeschlüsselt sowie der Unterrichtsgegenstand der Rechtschreibung; alles unter den Augen von Frau Knapper als verkörperte »Wahrheits-Polizei« im Foucault’schen Sinne (Foucault, [1966] 2003: 25). Der widerständige Umgang der Kinder mit der Situation – also mit der hierarchisch klar übergeordneten Rolle Frau Knappers und der körperlichen Anordnung innerhalb der geringen Grundfläche der Formation und der Begrenzungen durch das Requisit Sitzbank – äußert sich dabei vor allem über die Bewegung in unterschiedlichen Höhen im Raum: Hylia wirkt abwesend. Sie legt den Oberkörper auf ihre Oberschenkel, so dass ihre langen, dunklen Haare vornüber fallen und schüttelt Hände, Arme, Oberkörper und Kopf. In dieser langsamen Schüttelbewegung richtet sie sich vorsichtig auf, die Schultern kreisend, die Haare fallen ihr über das Gesicht. Als sie wieder aufrecht sitzt, lässt sie sich nun langsam rückwärts über den Hocker gleiten. Erst berühren ihre Haare, dann der Kopf den Boden. Ihre Hände verbleiben an der Hüfte. Alessandro, der links neben ihr sitzt, beugt sich zu ihr herunter und lächelt. Sonst beachtet sie niemand. Sie schaut mich an – ich sitze hinter den Sitzreihen auf einem einzelnen Stuhl – und lacht. Dann setzt sie die Hände ebenfalls, neben dem Kopf, auf den Boden auf. Frau Knapper bittet die Kinder nun, die Silben der Worte an der Tafel zu zählen. Hylia setzt sich daraufhin wieder gerade auf die Bank und beteiligt sich. Auch Alessandro zählt mit, kniet sich erst auf die Bank, stellt sich dann dahinter und wiegt von einem Bein auf das andere, hin und her. Er meldet sich und wird auch von Frau Knapper an die Reihe genommen. Dann stellt Hylia sich auf die Bank, nach nur wenigen Sekunden ruft Frau Knapper scharf: »Hylia setz dich hin!«, und rückt
131
132
Choreographien der Homogenisierung
ihren Namen an der Tafel nach unten. »Wo bin ich?«, flüstert sie Alessandro zu. »Du rutschst immer weiter runter!«, antwortet dieser. »Bei startklar!«, flüstert Ardi. »Ach ok«, winkt Hylia mit einer Handbewegung ab.
So hebt sich Hylia von der statischen Formation insofern ab, als dass sie sich um eine Höhenlinie von den anderen Schüler*innen unterscheidet. Sie legt den Oberkörper auf ihre Oberschenkel, so dass ihre langen, dunklen Haare vorne über fallen, schließt ihren Haar-Vorhang der Szene gegenüber oder eröffnet der Beobachterin einen ganz eigenen Inhalt: Hylia nimmt sich selbst die Sicht auf die Tafel und die gesamte Umgebung, die Augen verhängend, eine geschlossene Einheit für sich selbst bildend, in einer Art ›Innenschau‹. In Bezug auf das Gesamtbild grenzt sie sich körperlich, aus der Beobachterinnen-Perspektive, klar von der Gruppe ab. Aus der Lehrerinnenperspektive verschwindet sie lediglich hinter den Rücken der Personen in den Reihen vor ihr. Als aus der gleitenden Bewegung nach vorne eine schüttelnde Artikulation von Händen, Armen, Oberkörper und Kopf wird, ist sie außerdem der einzige dynamische Aspekt im Bild. Ihre Vereinzelung erscheint durch die vitalen Gesten nun offensiver und als die Umgebung spannungsvoll abwehrend. In dieser langsamen Schüttelbewegung, richtet sie sich vorsichtig auf, die Schultern kreisend, die Haare fallen ihr über das Gesicht. Sie nähert sich also behutsam und doch spannungsvoll der Position der anderen Schüler*innen an, bleibt aber – was die Sicht betrifft – weiterhin verschlossen. Die Kurve ihrer Bewegung von oben nach vorne unten und zurück in die Ausgangsposition führt sie nun weiter nach hinten unten (Abbildung 13). Als sie wieder aufrecht sitzt, lässt sie sich also langsam rückwärts über den Hocker gleiten. Erst berühren ihre Haare, dann der Kopf den Boden. Ihre Hände verbleiben locker an der Hüfte. Die Arme sind dabei nicht mit frontal sichtbaren Fingern in die Hüfte gestemmt, so dass die Geste weniger Platz einnehmend oder aggressiv wirkt, sondern eher als Kontakt erhaltend zum Requisit Bank (Abbildung 14). Die Verbindung mit dem Boden und die gleichzeitige Freigabe ihres Gesichts führen sie nun wieder mit dem Gesamtbild zusammen, auch indem Alessandro sich zu ihr herüber und herunter beugt und sie anlächelt. Der Rest der Situation bleibt weiterhin von ihrer Aktivität unberührt. Der Spannungsbogen von Hylias Bewegung erreicht seinen Höhepunkt, als ihr Blick sich nun klar an die Beobachterin richtet und sie sie anlacht.
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Ihre Ausrichtung auf sich selbst, scheinbar in ihr Inneres, wird damit wieder nach außen gekehrt. Durch die Adressierung der nicht direkt in die Szene involvierten Person der Beobachterin durch Blickkontakt und das darauf folgende Lachen, präsentiert sie sich nicht als schamvoll ertappt, sondern aufmüpfig motiviert (Abbildung 14).
Abbildung 13: Bewegungsdiagramm in Höhen
Ihr Ausstieg aus dem Gesamtbild ist also nicht länger introvertiert und nahezu unsichtbar, sondern wird extrovertiert für die Beobachterin sichtbar und erscheint rebellisch motiviert. Dann setzt sie die Hände neben dem Kopf auf den Boden auf und manifestiert somit den oppositionellen Eindruck: Du siehst mich, aber ich weiche nicht zurück, sondern festige meine Position. Der Moment wird unterbrochen durch eine Aufforderung der Lehrerin, die Hylia bittet, die Silben der Worte an der Tafel zu zählen und sich somit wieder in das Gesamtbild einzufügen. Hylia setzt sich daraufhin konform auf ihre Bank und verschwindet aktiv mitarbeitend, homogen innerhalb der Formation. Ein gemeinsamer Rhythmus aller Schüler*innen ist wiederhergestellt und doch agiert jede*r für sich. Auch Alessandro, der Hylias Bewegungen bisher als einziger beantwortet hat, zählt aktiv die Silben mit. Nun wird er zum körperlich dynamischen Mit-
133
134
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 14: Hylia in Reihen
telpunkt, kniet sich erst auf den Hocker, stellt sich dann dahinter – eröffnet somit die bisher höchste Ebene unter der stehenden Lehrperson – und wiegt von einem Bein auf das andere, hin und her im Rhythmus der silbenzählenden Klasse. Er meldet sich und wird auch an die Reihe genommen. Seine Abweichung vom Gesamtarrangement wird somit als ›gesehen‹ und akzeptabel markiert, da sein Körper sich im einheitlichen Rhythmus der Situation befindet (Abbildung 15). Als müsste sie seine »Höhe« überbieten, stellt sich Hylia nun auf die Bank und bildet somit den körperlichen und dramaturgischen Gipfel der Anordnung. Dieser wird akustisch durch den scharfen Zwischenruf der Lehrerin untermauert: »Hylia setz dich hin!«, und sie rückt ihren Namen an einer Liste an der Tafel nach unten (Abbildung 16). So folgt auf ihren höchsten Stand der steilste Abfall: körperlich vom geraden Stehen auf dem Hocker zum Sitzen und bewertet an einer hierarchischen Messlatte an der Tafel durch die Lehrerin. Hylias körperliches Aufbäumen wird von Frau Knapper als Provokation oder Grenzübertritt gewertet. Aber warum hat sie sich auf den Hocker gestellt? Wollte sie Frau Knapper provozieren? Wollte sie einen besseren Blick
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Abbildung 15: Alessandro in Reihen
auf die Tafel haben? Wollte sie Alessandro überhöhen? Oder ist die Anspannung so nun einfach aus ihr herausgebrochen? Wurden alle anderen Bewegungen innerhalb der Klasse bisher von Frau Knapper toleriert, markiert sie das Stehen auf dem Hocker klar als Regelbruch. Die Frage danach, warum Frau Knapper das Stehen nicht akzeptiert, kann dabei zwar als Verteidigung einer kulturellen Regel verstanden werden: So würde im Restaurant oder in der S-Bahn auch ein Wippen von einem Bein auf das andere toleriert werden, aber wahrscheinlich kein Stehen (mit Füßen/Schuhen) auf dem Stuhl. Bleibt die Interpretation jedoch bei den Höhenachsen der Körper der Klasse, so lässt sich die scharfe Disziplinierung deutlich der Blickhöhe der Klassenlehrerin zuordnen. Ihr Augenpaar steht über dem aller Kinder (auch hockender/stehender; Abbildung 13). So ist die oberste Höhen- und Machtachse innerhalb der Klasse allein ihr vorbehalten bzw. wird allein durch sie verkörpert. Die »Liste«, die innerhalb der Klasse verwendet wird, lässt sich dabei dem Token-Prinzip (auch Münz-Verstärkungs-Prinzip) zuordnen. Sie kann als ein Verfahren der Verhaltenstherapie verstanden werden, das auf Prinzipien der operanten Konditionierung basiert (Ayllon/Azrin, 1965). Token (Ersatzwährung) werden dabei verwendet, um die zeitliche Verzögerung zwischen dem erwünschten Verhalten und der ›eigentlichen‹ (primären) Verstär-
135
136
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 16: »Die Liste« oder »Startklar zum Lernen«
kung zu überbrücken – eine Art Belohnungsaufschub. Die Liste, die in dieser Klasse genutzt wird, ist als Modifizierung einer Ampel zu verstehen, an der die Kinder bei grün starten (startklar) und zu gelb (Ermahnung, Verwarnung) und rot (Auszeit) herunter rutschen könnten bzw. zu intensiverem grün (prima, super, fantastisch) aufsteigen in Verbindung mit besprochenen Klassenregeln. Als Mittel der Illusio der homogenen Ausgangslage starten zu Beginn eines jeden Tages alle Kinder bei »startklar zum Lernen« und steigen von dort aus »auf« oder »ab« oder werden entsprechend ihres jeweiligen Ranges durch die Lehrperson differenziert. Am Ende des Schultages erhalten die Kinder im Bereich »fantastisch« und »super« dann einen Sticker (erneuter Token) auf einer speziellen Karteikarte. Bei 10 Stickern ist die Karte voll und das Kind darf sich eine Kleinigkeit aus einer Überraschungskiste aussuchen (primäre
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Verstärkung). Die unteren Zeilen der Liste haben erstmal keine Konsequenz (positiv wie negativ); rutscht ein Kind jedoch bis zu der untersten roten Kategorie »Auszeit« herunter, wird es in die sogenannte »Insel« gebracht. Ein von Erzieher*innen betreuter Raum. Dort muss das Kind dann die Liste mit den Klassenregeln noch einmal lesen und aufschreiben, gegen welche Regel es verstoßen hat. Nach verhaltenspsychologischen Richtlinien erscheinen die Regeln dieser speziellen Liste und ihre Umsetzung innerhalb der Klasse über den Beobachtungszeitraum als unberechenbar und die Intervalle für ein Rücken innerhalb des Plans als teilweise willkürlich: So müsste in klaren Zeitfenstern (z.B. alle 10 Minuten) eine Bewertung der Regelkonformität aller Kinder erfolgen (ebd.) und nicht situativ die spontane Einordnung einer Einzelnen. Auch die Aufteilung der Kinder nach Mädchen und Jungen anhand der Liste ist untypisch und wird innerhalb der Klasse als subjektive Kategorisierungs-Vorliebe der Lehrerin sichtbar. Genauso gibt es keinen Belohnungsunterschied egal ob die Kinder am Ende des Tages nach wie vor »startklar« sind oder doch »prima« erreicht haben. Der Aspekt der Stigmatisierung von Kindern, z.B. durch das Messen untereinander: »Immer bist du unten!«, oder in Bezug auf das Selbstbild: »Schon wieder unten …«, wird innerhalb der Klasse und auf Lehrerinnenebene auch nicht weiter reflektiert. Die Bezugsgrößen ›oben‹ und ›unten‹ zeigen sich dabei als besonders relevant innerhalb der Kommunikation, was Hylias körperliche Auseinandersetzung mit den Höhenebenen weiter plausibilisiert. »Wo bin ich?«, flüstert Hylia Allesandro zu, führt damit zurück zu dem sich selbst suchenden, innenblickenden Bild aus dem Szenenbeginn und passt sich gleichzeitig durch die geringe Sprachlautstärke wieder den Regeln der Umgebung – und der Disziplinierung durch die Liste – an. »Du rutschst immer weiter runter!«, antwortet dieser und fasst damit ihre Bewegungskurve zusammen. Hat Hylia zuerst nur ihren Körper ›herunter‹ bewegt (und später ›hinauf‹), wurde sie durch Frau Knapper nun an der Tafel vor allen ›runter geschoben‹. Eine Parallele der Ausdrücke »runter rutschen« und »auf die schiefe Bahn geraten« könnte dabei hergestellt werden; als eine unerwünschte ›Fehlentwicklung‹ nehmend oder ein moralisches Absinken. »Bei startklar!«, flüstert Ardi aus der Reihe vor ihr. »Ach ok«, winkt Hylia mit einer Handbewegung ab, denn »startklar« bildet die Null-Linie, von der aus wieder alle Kurven der Bewegung nach oben und unten möglich sind. So ist die Anordnung in Reihen durch ihre relative Statik stark durch die Bewegungs-Achsen ›hoch‹ und ›tief‹ sowie die homogene ›0-Linie‹ geprägt.
137
138
Choreographien der Homogenisierung
Ist die homogene ›0-Linie‹ in Bezug auf die Körperlichkeit der Formation dabei angestrebtes Ziel, so gilt im Hinblick auf die Leistungs-Maxime und den Unterrichtsgegenstand ein individualisierteres Ideal des positiven Hervorstechens, vergegenständlicht durch den andauernd präsenten Token-Plan an der linken Seite der Tafel.
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
5.2
Stuhlkreis
Abbildung 17: Schema – Stuhlkreis
Abbildung 18: Schule B – Stuhlkreis
139
140
Choreographien der Homogenisierung
Im Rahmen des Artikels »Praktiken der Homogenisierung. Soziale Choreographien im Schulalltag« arbeiten Cornelie Dietrich und Valerie Riepe (2019) den Kreis als geometrische, aus den Kinder-Körpern geformte Figur, unter Bezugnahme auf die Perspektive der Homogenisierung (Dietrich, 2017) und Soziale Choreographien heraus: »Von Kindergarten und Schule bis in die Erwachsenenbildung hinein: als Stuhl- oder Morgenkreis, Gesprächs- oder Erzählkreis, Sing- oder Besinnungskreis. Heinzel nennt in ihrer Habilitationsschrift (Heinzel 2001; 2016) die symbolischen Bedeutungen des Kreises: Gemeinschaft, Verbundenheit, Hineingestelltsein und Selbstfindung im Kreis, Ganzheit und immer wieder: Gleichheit. Sie interpretiert den »Siegeszug« des Stuhlkreises in der Grundschule der 90er Jahre als eine Form, in der kinderkulturelle und schulkulturelle Inhalte und Gesprächs- und Lernformen zueinander kommen, Hierarchien abgebaut werden können. So wird der Kreisfigur ein Gelingen demokratischer Lernprozesse sowie Streitschlichtung und Problemlösung zugeschrieben. Mit der Begrifflichkeit des »runden Tischs«, wie er in politischen Kontexten häufig auftaucht, ist ebenso das Moment der Erwartung an eine kommunikative Ordnung der Gleichberechtigung und der nichthierarchischen Lösungsfindung verbunden. Laut Peterßen (2001) ist der Sitzkreis in der Reformpädagogik vom Familientisch in die Schule gewandert und gilt seitdem als stabiles Komplementärelement von individualisiertem und kompetitiv organisiertem schulischen Lernen.« (Dietrich/Riepe, 2019: 678) Im untersuchten Schulalltag von Dietrich und Riepe (ebd.) sowie auch innerhalb des Materials der vorliegenden Studie stellt sich nun diese Gleichheit im Kreis keineswegs so vollkommen dar wie die erläuterten Programmschriften suggerieren: »Sowohl de Boer (2006) als auch Kellermann (2008) haben innerhalb ihrer ethnografischen Forschungen festgestellt, wie allein über die Organisation der Redebeiträge die asymmetrische Generationen- und Rollendifferenz zwischen Lehrer*in und Schüler*innen auf mehr oder weniger subtile Weise stets aufrechterhalten und damit der konzeptionelle Anspruch eines ›egalitären Austausch[s] der Kinder miteinander und mit der Lehrerin‹ (Kellermann 2008: 190) durchkreuzt werden. In der Regel entscheidet etwa die Lehrkraft, wann es Zeit ist für den Kreis, sie bestimmt Anfangs- und End-
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
punkt der Szene, sie choreographiert die Szene und bestimmt häufig auch das Thema und dessen Aufführungsregeln.« (ebd. 679) Während in der bisherigen Forschung ausschließlich die sprachlichen Akte innerhalb des Kreises berücksichtigt wurden, sollen im Folgenden (im Anschluss an Dietrich/Riepe, 2019) nun die körperlich fundierten, choreografischen Bewegungsanalysen hinzu-kommen, die das ›Innen‹ und ›Außen‹ der inhaltlichen und körperlichen Kreisformation erheblich mitbestimmen. So eröffnet sich mit Dietrich und Riepe (ebd.) ein weiterer Interpretationshorizont, indem der Kreis als Resultat und Ausgangspunkt von Bewegungen im Handlungsraum der Kinder in den Blick genommen wird. Die Kinder erschaffen erst den Kreis, indem sie selber die Außenlinie bilden und sich nach innen hin ausrichten. Diese Linie scheint in ihrer Beweglichkeit fragil und keineswegs selbstverständlich zu sein, jedoch durch das Requisit Stuhl der Formation Stuhlkreis noch stärker gesichert als im Sitzkreis. Auch die kulturgeschichtlichen Wurzeln der kreisförmigen Anordnung um einen Gegenstand – die weit tiefer zurückführen als es die Beobachtungen in Schule und Kindergarten zunächst vermuten lassen – verfolgen Dietrich und Riepe zurück: »Laut Curt Sachs (1933) ist sie auf das Grundbedürfnis des Menschen zurückzuführen, ›mit dem Körper Räume zu durchmessen und zu gestalten« (Sachs, 1933: 100). Häufig wurden gerade innerhalb früher Kreistänze, nicht nur (imaginäre) Mittelpunkte, sondern darin befindliche Gegenstände oder Personen umkreist. Einen Gegenstand zu umkreisen bedeute dabei, »ihn in Besitz zu nehmen, ein[zu] verleiben, [zu] fesseln und bannen (›Bann-Kreis‹)‹ (ebd.).« (ebd. 685) Dasjenige, was umtanzt wird, wird also einerseits in seiner Gefährlichkeit gebannt, andererseits geht es in die Gemeinschaft der Tanzenden über. Dasjenige, das im Rahmen des Stuhlkreises umschlossen wird, gilt es für die Kinder also zu um- und erschließen:
Die Kinder bilden einen kleinen Stuhlkreis um den Tisch in der Klassenmitte mit der Anweisung der Lehrerin: »Das Wörterbuch liegt vor dir auf dem Boden.« Nun wird thematisiert, wie man am einfachsten ein Wort im Wörterbuch finden kann und Frau Roth macht die Suche »mit Hilfe von lautem Denken« für die Kinder vor. »Du hörst nur zu!«, lautet ihr Arbeitsauftrag. Nikolai
141
142
Choreographien der Homogenisierung
sitzt vor mir im Stuhlkreis, angelt mit den Füßen nach dem Wörterbuch und wischt damit fast geräuschlos über den Boden. Er wird von Frau Roth ermahnt: »Nikolai, kannst du das bitte lassen?!« Oskar sitzt links neben Frau Roth, trägt nur einen seiner Hausschuhe, der zweite steht unter seinem Tisch am Rand der Klasse und schaut betont nah direkt in das Buch, in dem die Lehrerin das Suchprozedere demonstriert. Frau Roth schnauft mit einem genervten Gesichtsausdruck und sackt körperlich zusammen: »Pffffffffffff«, wodurch Oskar sich etwas zurückzieht. Dann sagt sie: »Könnt ihr bitte eure Wörterbücher auf dem Boden liegen lassen?!« Damit spricht sie all diejenigen Kinder an, die das Suchprozedere in ihren eigenen Wörterbüchern mitmachen – entgegen der Einweisung. Elisabeth sitzt weiter rechts im Stuhlkreis, rutscht auf ihrem Stuhl von rechts nach links und links nach rechts. Dann streckt sie die Zehenspitzen so weit wie möglich nach vorne und rutscht an die vorderste Kante ihres Stuhles. Dabei spannt sie ihren Körper stark an, so dass Gesäß und durchgestreckte Arme zur Stütze ihrer Linie von den Füßen bis zu ihrem Kopf an der Stuhllehne werden. Dabei überbrückt sie das Wörterbuch mit ihren durchgestreckten Beinen. Sie rutscht wieder zurück, schmiegt den Rücken gerade an die Lehne, Arme nach wie vor angespannt an den Seiten der Sitzfläche abstützend und greift das Wörterbuch mit ihren Füßen. Zwischen ihren Füßen eingeklemmt – wie eine Art Zange – hebt sie das Buch durch eine Beinbewegung hoch und lässt es durch ein Öffnen von Beinen und Füßen fallen: »klatsch«. Die Kinder werden nun aufgefordert selbst von der Lehrerin genannte Worte im Wörterbuch zu finden. Zuerst: Baum.
So wird hier das eigene Wörterbuch der Kinder zu einem Requisit innerhalb des Kreises, das laut Anweisung der Lehrerin an das kollektive Du aber vorerst nicht adressiert werden soll. Dadurch, dass die Bücher nicht auf einem Stapel in einer gemeinsamen Mitte liegen, sondern »jeder seins« vor sich liegen hat, appellieren die Bücher durch ihre vereinzelte und geringe Distanz zu den Kindern mit einem starken Aufforderungs-Charakter an diese. Daraus entstehen verschiedene Annäherungsversuche der Er- und Umschließung der Kinder eben dieses Requisits in ihrer Mitte. So angelt Nikolai mit den Füßen nach seinem Buch. Ohne es direkt vom Boden vor ihm zu entfernen, nähert er sich dem Wörterbuch mit den Gliedmaßen, die diesem in der Sitzposition am nächsten sind. Die Füße sind dabei eigentlich nicht zur feinmotorischen Auseinandersetzung mit dem Buch prä-
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
destiniert und biologisch vorrangig auf das federnde Tragen des Körpergewichts und die Vorwärtsbewegung eingerichtet. Durch dieses Vorgehen kann Nikolai jedoch seine Sitzposition aufrechterhalten und trotzdem in einen körperlichen Austausch mit dem Buch treten. Durch den bloßen Kontakt muss er es dabei erstmal nicht direkt von dem von der Lehrerin vorgesehenen Platz entfernen. Die Regel: »Das Wörterbuch liegt vor dir auf dem Boden«, hält er dabei vorerst scheinbar ein. Durch die nahezu geräuschlose, wischende Bewegung mit dem Buch über den Boden, behält er zwar immer noch seine Sitzposition, Bodenhaftung des Buches und relative, akustische Ruhe bei, geht jedoch in eine dynamische Bewegung über und übergeht den Aspekt des »liegenden« Buches. Spätestens die Dynamik veranlasst die Lehrerin zu einer verbalen Ermahnung. Damit unterstreicht sie die Enge ihres Auftrags an jedes einzelne Du der scheinbar homogenen Gruppe: »Du hörst nur zu!« und trittst nicht in einen (dynamischen) Kontakt mit deinem Buch. Oskar sucht den körperlichen Austausch mit dem Wörterbuch über das ›erlaubte‹ Exemplar von Frau Roth. In seiner äußerlichen Erscheinung markiert die Beobachterin ihn insofern als auffällig, als dass er nur einen seiner zwei Hausschuhe trägt und sich der zweite Hausschuh auch nicht in seiner direkten Nähe befindet, sondern an einem entfernten Tisch, der hier nicht Teil der Anordnung ist. Zwar könnte Oskar durch den fehlenden Schuh eine mangelnde Bodenhaftung oder mangelnde mentale ›Ganzheit‹ unterstellt werden, jedoch hat er seine Aufmerksamkeit augenscheinlich nicht bei seinem zweiten Schuh am Tisch stehen lassen, sondern widmet diese ganz Frau Roths Wörterbuch. Durch die überbetonte Nähe zu den Buchseiten entfaltet auch er seine spannungsvolle, körperliche Annäherung an das Buch. Ist die Aufgabenstellung an einen suchenden Überblick gerichtet, so deutet die überbetonte Nähe Oskars hingegen auf einen körperlichen und nicht unterrichtsgegenständlich ausgerichteten Zugangsversuch hin. Zwar spricht Frau Roth ihn innerhalb ihrer folgenden Aufforderung nicht direkt an, durch ihre körperliche Reaktion als Kombination von Mimik und zusammensackendem, akustischem Ausatmen: »Pffffffffffff«, zieht sich Oskar jedoch zurück. Umgangssprachlich könnte man Frau Roths Reaktion als Kombination von Ausatmen und Zusammensacken als ein Symbol für: »die Luft ist raus«, interpretieren. Im Sinne der Einhaltung des ›verbotenen‹ körperlichen Kontakts der Kinder mit dem Wörterbuch trifft das auch zu. In diesem Falle sind jedoch vor allem diejenigen Kinder angesprochen, die das Wörterbuch ganz im Sinne der Aufgabenstellung inhaltlich benutzen, da Frau Roth nach wie vor den ›richtigen‹ Suchweg erstmal »mit Hilfe von lautem Denken«
143
144
Choreographien der Homogenisierung
selbst demonstrieren möchte. Trotzdem verbalisiert sie dabei alleine den körperlichen Aspekt und die Bodenhaftung des Buches: »Könnt ihr bitte eure Wörterbücher auf dem Boden liegen lassen?!« Elisabeths spannungsvolle (körperliche) Auseinandersetzung mit dem Buch hingegen bezieht auch ihren Stuhl als Requisit stärker mit ein. Das Hinund Herrutschen auf der Sitzfläche vermittelt dabei einen aufbrechenden, antreibenden Charakter. Aus der rutschenden Bewegung wird dann eine maximale Anspannung. Indem sie mit dem Gesäß ganz an die vordere Kante des Stuhles rutscht, ist es ihr möglich, den Körper maximal durchzustrecken und anzuspannen, ohne den Stuhl und die vorgegebene Sitzposition (Gesäß auf der Sitzfläche) körperlich zu verlassen. In diesem Moment deutet ihr Körper eine Gerade an, die von ihren Füßen bis zu ihrem Kopf ansteigt; über die stützenden Arme auf den Seiten der Sitzfläche und die Stuhllehne führend. Mit ihren durchgestreckten Beinen überbrückt sie dabei das Wörterbuch. So umfasst sie das Buch körperlich, ohne es zu berühren. Auf die gespannte Überbrückung folgt dann eine Rückkehr in eine aufrechte Sitzposition mit einem Kontakt von geradem Rücken und Stuhllehne. So bewegt sie sich von der weit entferntesten Möglichkeit im Kontakt mit ihrem Stuhl – bei Fuß-Kontakt mit dem Boden und Gesäß auf der Sitzfläche verbleibend – zum engstmöglichen Kontakt innerhalb dieser Bedingungen – an Sitzfläche und Lehne angeschmiegt, Arme an den Seiten der Sitzfläche abgestützt – nach wie vor in einer stark angespannten, kraftvollen Körperhaltung. Wird Elisabeths Bewegung als wellenförmig betrachtet: Gleiten, Strecken, Zusammenziehen; so folgt nun ein erneutes Strecken, diesmal aber nur der Beine und damit verbunden ein direkter Kontakt mit dem Wörterbuch durch Ergreifen und Fixieren mit den Füßen. Der Spannungsbogen der Annäherung hat im anschließenden Anheben des Buches vom Boden seinen Höhepunkt erreicht, da Elisabeth sich hier erstmalig konkret einer Anweisung widersetzt: »Das Wörterbuch liegt vor dir auf dem Boden«, und nicht länger nur das Feld der (Annäherungs-)Möglichkeiten innerhalb ihrer Sitzposition auf dem Stuhl erprobt. Ihre Bewegungssequenz endet zwar nicht mit einem Paukenschlag, jedoch mit dem »Klatsch« des fallenden Wörterbuches, das sie durch ein Öffnen der ›Fuß-Zange‹ fallen lässt. So krönt sie ihre Auseinandersetzung mit dem Requisit nicht nur durch eine Erhebung, sondern – durch die Öffnung der Beine und den Fall des Buches – auch durch ein lautes Geräusch.
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Frau Roth geht dabei weder auf Elisabeths Bewegungen noch den akustischen Reiz ein, sondern leitet zum nächsten Arbeitsauftrag über und löst damit das tabuisierte (Körper-)Verhältnis zum Requisit Wörterbuch auf. Verschiedene Variationen der Stuhlkreis-Formation eröffnen hier verschiedene Darstellungsräume für die Kinder, vor allem innerhalb des Kreises und auf der Kreislinie selbst. Das Requisit Stuhl spielt dabei eine statische Rolle auf der gebogenen Linie, die wiederum auch von den Kindern interpretiert werden kann. Die Kinder sitzen im »Kinositz« (Halbkreis mit und ohne Stühle) und arbeiten an der Tafel im Hunderterbereich am Zahlenstrahl. Frau Schuhmann notiert Zahlen an der Tafel, die von den Kindern vorne »in zwei klugen Schritten zum nächsten Hunderter ergänzt« werden sollen. Frau Schuhmann ermahnt Gustav: »Gustav, ich befürchte, dass du gar nicht richtig dabei bist. Stimmt das?« Gustav schüttelt den Kopf. »Du kommst gleich dran!«, setzt Frau Schuhmann mit einer Bewegung des rechten Zeigefingers auf Gustav nach. Gustav sitzt ganz links auf dem Boden vor der Stuhlreihe vor Laura. In einer rückwärts gleitenden Bewegung (erst die Füße und dann den restlichen Körper nachgleitend) zieht er sich durch Lauras Stuhl(-gestell) hindurch zurück hinter den Halbkreis, so dass er auf dem Boden hinter Emilias Stuhl sitzt (Emilia sitzt einen Platz rechts von Laura). »Du kommst dran, egal ob du dich versteckst oder nicht«, setzt Frau Schumann nach. Dann nimmt sie Helene an die Reihe, dann Ida, dann Conrad. Währenddessen kriecht Gustav unter den Stühlen einiger Kinder durch den Halbkreis entlang, dann wieder zurück bis unter Lauras Stuhl. »Gustav, du bist dran!«, ruft Frau Schuhmann ihn an die Tafel. »Er ist hier! Er ist hier!«, ruft Laura aufgeregt. Gustav steht auf und trottet mit gesenktem Kopf zur Tafel. So wird, in Schule A, unter dem Begriff des »Kinositzes« eine HalbkreisFormation bestehend aus einer erhöhten Ebene, aus auf Stühlen sitzenden Kindern, und davor liegendem Halbkreis, aus auf dem Boden sitzenden Kindern, verstanden. Dabei sind alle Kinder auf die Tafel ausgerichtet (Abbildung 19 + 20). Innerhalb dieser Körperordnung widmet sich die Klasse nun, an der Tafel, dem Zahlenstrahl im Hunderterbereich nach einem bestimmten Rechenweg: »in zwei klugen Schritten zum nächsten Hunderter«. Dabei adressiert Frau Schuhmann Gustav: »Ich befürchte, dass du gar nicht richtig dabei bist.« Ihr Anliegen formuliert sie dabei als Appell: Gustav soll »richtig dabei« sein
145
146
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 19: Schema – Kinositz
Abbildung 20: Schule A – Kinositz
und markiert es außerdem als »Befürchtung«, also in Erwartung einer unangenehmen Antwort. Gleichermaßen deutet die »Befürchtung« aber auch
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
auf ein ungesichertes Ergebnis hin, was durch Frau Schuhmanns Nachfrage: »Stimmt das?«, unterstrichen wird. Gustavs Kopfschütteln ist hier nicht unmissverständlich zu deuten. Dadurch dass es sich bei Frau Schuhmanns Frage aber um eine Entscheidungsfrage handelt, liegt die Interpretation bei: »Nein, das stimmt nicht, ich bin ›richtig dabei‹.« Nach der positionierten, aber offenen Frage Frau Schuhmanns folgt nun eine relativ unvermittelte Strenge auf Gustavs Kopfschütteln. Sowohl verbal als auch nonverbal: Durch den Fingerzeig markiert sie Gustav als bloßgestellt, also durch eine (aus Frau Schuhmanns Perspektive) blamable Handlung in eine peinliche Lage gebracht. Das von ihr gewählte Mittel zur Disziplinierung ist dabei vorerst die Drohung zur Überprüfung: »Du bist gleich dran!« Durch diese Kommunikation zwischen Frau Schuhmann und Gustav wird die Kausalität der Illusio dieser Situation greifbar: Wenn ›Du‹ ›richtig dabei bist‹, kannst ›Du‹ an der Tafel vor allen in »zwei klugen Schritten zum nächsten Hunderter ergänzen«; kannst ›Du‹ ›erfolgreich‹ lernen. Gustavs Sitzposition befindet sich links außen auf dem Boden vor Laura, die auf einem Stuhl sitzt. Sein körperlicher Rückzug aus der Situation führt ihn dann durch das Gestell von Lauras Stuhl hinter ihm. Die gleitende, von den Beinen ausgehende, Rückwärtsbewegung suggeriert eine nahezu leichte und gleichmäßige, über die Bodenfläche hinweg und durch das Stuhlgestell hindurch streichende Dynamik; ein Abtauchen und Verschwinden. Erst außerhalb des Halbkreises, hinter Emilias Stuhl, taucht er wieder auf und setzt sich hin, als wäre er durch eine Art Kanalisation von einem Ort zum nächsten gelangt, heraus aus Frau Schuhmanns Blick. Um zurück auf Curt Sachs zu kommen, entrinnt Gustav damit augenscheinlich, körperlich der Umschließung seiner selbst durch die (Kreis-)Gemeinschaft, indem er nicht länger einen Punkt auf einer der parallelen Kreislinien bildet, sondern diese ›unterwandert‹. »Du kommst dran, egal ob du dich versteckst oder nicht«, setzt Frau Schumann nach und durchkreuzt damit die räumliche Separiertheit durch die Kreis- und Stuhl-Barriere verbal und unterstreicht vor allem ihre hierarchisch übergeordnete Position Gustav gegenüber. Anhand ihres Fortfahrens im Unterricht (dann nimmt sie Helene an die Reihe, dann Ida, dann Conrad) greift sie erstmal nicht weiter in Gustavs körperliche und räumliche Ausflucht ein. Dieser verschwindet wieder in die ›Kanalisation‹ der Stuhlgestelle bis ganz rechts außen. Dort trifft er auf die Begrenztheit und Undurchlässigkeit des ›halben‹ Kreises – und damit sinnbild-
147
148
Choreographien der Homogenisierung
lich auf seine Begrenztheit durch die Regeln – und kriecht zurück zu seiner Ausgangsposition den Halbkreis entlang unter Lauras Platz ganz links. »Gustav, du bist dran!«, zitiert Frau Schuhmann ihn dann an die Tafel und die angedrohte (Über-)Prüfung steht letztlich bevor. Laura, die ›über-irdisch‹ über Gustav sitzt, ruft aufgeregt: »Er ist hier! Er ist hier!« So vertritt Laura die körperlichen Ebenen der Anordnung auch verbal: Gustav kriecht über den Boden, sie sitzt auf dem Stuhl über Gustav und ›verrät‹ ihn an die stehende Frau Schuhmann. Laura zeigt sich damit nicht mit Gustav solidarisch, sondern mit Frau Schuhmann und den von ihr implementierten Regeln. Über ein stillschweigendes Anerkennen der Regeln hinaus verteidigt Laura hier aktiv die Akzeptanz der Spielregeln und die Reproduktion des Spiels sowie das Feld als Konkurrenzfeld (Kapitel 2.1.3). Gustav beugt sich der Situation; auch körperlich: So trottet er mit gesenktem Kopf — und damit Unterordnung signalisierend – zur Tafel. Im Bourdieu’schen Sinne kann Gustavs Reaktion somit als funktionierendes Spiel betrachtet werden. Trotz all seines Widerstandes und Bedürfnisses des ›Abtauchens‹ aus der Situation, bewegt seine Akzeptanz der Sinnhaftigkeit des Spiels ihn letztlich dazu, die von der Logik des Feldes her gesehen ›richtige‹ Entscheidung zu treffen und die Illusio der homogenen Körperformation wie auch (Lern-)Gruppe ist wiederhergestellt. Als Höhepunkt der körperlichen Homogenisierung der Schüler*innen innerhalb der Beobachtungsphasen hat sich eine besondere StuhlkreisFormation dargestellt: das Flöten im Stuhlkreis (Abbildung 21). Die Kinder verteilen sich auf den kreisförmig angeordneten SitzbankHockern in der Mitte des Raumes und bringen ihre Flöte und Notenmappe mit. Frau Knapper, die noch am Pult außerhalb des Kreises steht, wedelt mit einer antreibenden, kreisenden Handbewegung in Elias Richtung: »So, jetzt rück mal ein bisschen auf, damit jeder genug Platz hat.« Elias rückt und nach und nach verteilen sich alle Kinder gleichmäßig im Kreis und auch Frau Knapper nimmt anschließend, gemeinsam mit ihrer Flöte, auf den Hockern Platz. »Wir flöten erstmal gemeinsam durch, so hören wir auch, wer zuhause geübt hat«, zwinkert Frau Knapper lächelnd. »Wir beginnen geschlossen, mit einem C. Daumen und Mittelfinger!« Das gemeinsame Flöten beginnt in der kreisförmigen Hockerformation in der Mitte der Klasse. Die Kinder kommen mit ihrer Flöte und Notenmappe in den Kreis. Die Notenmappen legen sie aufgeschlagen zu ihren Füßen,
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
Abbildung 21: Schule B – Flöten
innerhalb des Kreises, ab (Abbildung 21). Von ihrem Standort außerhalb des Kreises am Pult aus, beobachtet und dirigiert Frau Knapper die Ausführung der Formation. Dabei spricht sie Elias körperlich und verbal an. Mit der dynamisch kreisenden Handbewegung verkörpert sie zum einen eine (an)treibende Aufforderung und zum anderen begründet sie im Kreisen die Verbindung von Elias und den anderen Kindern als ›Ganzes‹, ›wohl Verteiltes‹, innerhalb der runden Formation, »damit jeder genug Platz hat«. Durch die verbale Aufforderung, »jetzt rück mal ein bisschen auf«, präzisiert sie ihre Gesten und fordert Elias zu einer expliziten Handlung auf, der er auch nachkommt, so dass sich alle Kinder gleichmäßig im Kreis verteilen. Mit dem für sie zufriedenstellenden Ende des Formations-Prozesses kann auch Frau Knapper ihre überwachende Außenposition aufgeben und zum Teil des Kreises werden. Das wird auch in ihrer Wortwahl des inklusiven »Wir« deutlich: »Wir flöten erstmal gemeinsam durch.« Jedoch bleibt auch das neue »Wir« im Kreis ein Überwachendes und Selektierendes, da im gemeinsamen Prozess des Flötens von allen herausgehört werden soll, wer zuhause geübt hat und wer nicht. Durch das lächelnde Zwinkern suggeriert Frau Knapper zwar eine freundlich zugewandte Haltung den Kindern gegenüber, droht aber verbal trotzdem mit der unweigerlichen Enttarnung der »nicht Geübten« von allen und vor allen im folgenden gemeinsamen Flöten. Das von Frau Knapper gewünschte Ziel
149
150
Choreographien der Homogenisierung
der gleichmäßig im Kreis verteilten Kinder, die durch ausreichendes Üben zuhause fehlerfrei gemeinsam Flöten, wird dabei deutlich angerufen. Durch die Aussage: »Wir beginnen geschlossen, mit einem C. Daumen und Mittelfinger!«, fordert Frau Knapper die Kinder abschließend auf, sich in eine solche Haltung zu bringen (zum Flöten gerade sitzen, Luft holen), sich so zu bewegen und die Flöte so zu bedienen (Daumen und Mittelfinger), dass ihr Stuhlkreis und Flöten-Kreis zu einer homogen gemeinsamen, nach außen abgeschlossenen, nach innen umschlossenen Inszenierung wird. So wenig individueller Handlungs-, Ausdeutungs- und Bewegungsspielraum der Kinder wie in dieser Formation und Situation war in keiner anderen Anordnung innerhalb der Beobachtungen wiederzufinden. Allein der Grad der Rumpf-Aufrichtung und Fußpositionen war unterschiedlich (siehe Abbildung 21). Umso erstaunlicher erschien der kaum vorhandene Grad an Widerständigkeit der Kinder, der sich innerhalb der weiteren Beobachtungen vor allem durch den starken Wunsch nach Zugehörigkeit (hier: zu »den Geübten«) begründen lässt: »Francis kann noch nicht mal nen’ grades C!« – »Stimmt gar nicht! Kann ich!« Dabei findet der Musikunterricht innerhalb der Beobachtungszeiträume ausschließlich im Stuhlkreis statt (innerhalb des Klassenraumes), auch wenn z.B. gerade für das (Block-)Flötenspiel ein Spielen im Stehen – auf Grund der freien Atmung – als Ideal gilt (Engel/Heyens/Hünteler/Linde, 2014). Interessant dabei wäre die Motivation zu erfragen, die den Körper als Klang-Körper zugunsten des Körperkontakts mit der Sitzbank ignoriert. Die Aufeinanderfolge dieser besonderen Inszenierung von stark restriktiver Gleichheit der Körper mit ihrem Ganzheitsanspruch (an gemeinsame (Körper-)Haltung und Rhythmus) und der folgenden (akustischen) Selektion in Verbindung mit der formulierten Kausalität der »Übung« wird hier unweigerlich zur Bühne von Differenzerfahrungen für die Kinder. Denn die Norm, auf die sie bezogen werden, könnte kaum ausdrücklicher beschrieben werden und weniger Spielraum beinhalten.
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
5.3
Sitzkreis Abbildung 22: Schema – Sitzkreis
Abbildung 23: Schule A – Sitzkreis
In Abgrenzung zum Stuhlkreis wird die (Außen-)Linie des Sitzkreises allein von den Körpern der Kinder gebildet und erscheint dadurch als fragiler
151
152
Choreographien der Homogenisierung
in seiner geometrischen Figuration. Sitzbänke und Stühle bilden nicht länger eine Barriere der Kinder zwischeneinander und der eigene Bewegungsspielraum sowie die Distanz zu den Sitznachbar*innen kann individueller bestimmt werden. So lautete eine Hypothese, dass gerade diese Formation eine starke Strukturvorgabe durch Regeln und Lehrperson mit sich bringe, da die fehlenden Requisiten keine Struktur vorgeben könnten: Dann kündigt Frau Schuhmann einen Sitzkreis an. Der Kreis müsse aber etwas anders aussehen als sonst: »Der Kreis muss weniger kreisig« [sein], »eher wie ein Rechteck«, »hier darf keiner sitzen«, »hier muss Platz sein für eine Menschen-Schlange«, dirigiert sie und zeigt mit den Armen in der Art einer Flugbegleiterin mit großen Bewegungen – weit ausgebreiteten Arme und angespannten Händen fast im 90 Grad-Winkel ab dem Ellenbogen geneigt – eine Lücke an, während die Kinder sich auf den Boden, um den kleinen Tisch und den runden, grünen Teppich herum, setzen. Durch weitere langsame Bewegungen mit den Armen – Arme und Hände parallel ausgesteckt eng nebeneinander, vor dem jeweiligen Kind mit paralleler Ausrichtung von Beinen und Füßen stehend – weist sie den Kindern an den Öffnungen des Kreises eine Art ›Parklücke‹ auf der Kreislinie zu. Am Ende sitzen die Kinder und Frau Schuhmann gemeinsam in einem Kreis mit einer größeren Öffnung vor der Tafel. Die Lehrerin markiert hier die Einsetzung des Kreises über ein gesprochenes Signal und formuliert gleichzeitig ihre Vorstellung von der Sitzkonstellation: Es soll ein Kreis sein, der aber »weniger kreisig« ist. Damit kreiert sie aus dem Nomen »Kreis« ein Adjektiv und steigert dieses im Negativen zum Komparativ »weniger kreisig«. Durch die Ankündigung des »etwas anders als sonst« wird zum einen die Normalität des Kreises bestätigt zum anderen dessen Abweichung als weniger Kreis, eher Rechteck aufgerufen. Die Reihe der Ausdrücke »Sitzkreis«, »aber weniger kreisig«, »eher wie ein Rechteck« ergänzt durch »hier darf keiner sitzen«, »hier muss Platz sein für eine MenschenSchlange«, muss den Kindern widersprüchlich erscheinen; in der Umschließung von Tisch und Teppich appelliert zudem die Materialität der Raumgestaltung an die Beibehaltung des Gewohnten. So beginnt die Lehrerin, die Schüler*innen mit Hilfe verdeutlichender Körpergesten zu ordnen. Ihre Bewegungen erinnern an diejenigen einer Fluglotsin oder Parkplatzwächterin, die den ankommenden Maschinen ihren Platz zuweist. Die großen Bewegungen ihrer Arme stecken dabei zuerst einen (gesperrten) Bereich ab, der nicht
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
von den Kindern besetzt werden darf, um im Weiteren die äußeren Ankerpunkte der Anordnung festzulegen. Durch die langsamen, großen Bewegungen der parallel gestellten Arme fordert sie die Kinder gestisch auf, sich zu ihr parallel auszurichten, ihre Position praktisch zu spiegeln, um ihr Vorhaben, das den Kindern hier noch nicht bekannt ist, realisieren zu können. Sie etabliert damit in Sprache und Körpergesten ihre wissende Position, ebenso wie sie die Kinder als unwissende Ausführungsinstrumente ihrer Vorstellung adressiert. Damit hat sie innerhalb des Herstellungsprozesses die asymmetrische Rollendifferenz zwischen den Kindern und ihr erneut inszeniert, obwohl die endgültige Formation dann als Kreis mit einer größeren Öffnung und keineswegs als Rechteck zu lesen ist. Die Linie des Kreises, als von homogen allen Kindern gebildet, ist dabei immer bindendes Element: Frau Roth kündigt an: »So, schneller Sitzkreis«, und innerhalb weniger Sekunden sitzen die meisten Kinder auf dem Boden um den grünen Teppich. Nur Hannah sitzt noch an ihrem Platz. Frau Roth fragt: »Hannah was ist mit dir?« – »Ich kann auch von hier gut sehen!«, antwortet diese. »Nehhheee!«, schließt Frau Roth diese Option sofort mahnend aus.
Jedoch hat sich diese erste Annahme nicht uneingeschränkt bestätigt. Vielmehr eröffnet das freie Sitzen – das anhand weniger, körperlicher Merkmale überprüft werden kann als es das Sitzen auf einem Stuhl erlaubt – den Kindern auch viele Möglichkeiten zur Positions-Variation innerhalb der Regeln. Dazu trägt auch das häufige Fehlen von (Lern-)Material bei, das Arme und Hände für Bewegungen frei(er) gibt. Jedoch funktioniert die gegenseitige Reglementierung der Kinder auch innerhalb dieser Formation, besonders durch das Prinzip ›Jede*r sieht Jede*n‹: Oskar sitzt rechts von mir im Sitzkreis und zieht die Arme aus den Ärmeln seiner Sweatshirt-Jacke in das Innere des Kleidungsstücks. Von innen lässt er den Reißverschluss bis ganz oben zu seiner Nase gleiten, so dass nur noch seine Augen und Haare herausschauen und flüstert leise in seinen Pullover: »Oaaah, ich bin soooo müüüüde.« Währenddessen malt sich Emilia mit einem pinken Filzstift Blumenranken auf den linken Arm. Leonie sitzt ihr im Kreis gegenüber und ermahnt sie: »Emilia! Nich’!«
153
154
Choreographien der Homogenisierung
Durch das Verlassen der Ärmel seines Pullovers mit den Armen, zieht Oskar sich mit seinem Oberkörper in die Hülle seines Kleidungsstücks zurück. Die Hände gehören dabei nicht mehr zum ›Außen‹ von dem Pullover, sondern befinden sich nun im Inneren. So wird Oskar körperlich nicht länger nur als Teil des Sitzkreises umschlossen und auf ein Innerhalb und Außerhalb bezogen, sondern stellt eine eigene Innen-/Außen-Referenz her. Vom Inneren ausgehend, schieben seine Hände den Reißverschluss der Jacke weiter hoch, so dass Oskar immer mehr in sein ›Innen‹ abtaucht, bis nur noch seine Augen und Haare die Verbindung zum ›Außen‹ aufrechterhalten. Seine in den Pullover geflüsterte Botschaft: »Oaaah, ich bin soooo müüüüde«, unterstreicht dabei zum einen den langsam, gezogenen Prozess des Verschließens (Reißverschluss) durch das Langziehen der Worte, zum anderen legt sie ebenfalls seinen Wunsch nach Rückzug aus der (Schul-)Situation nahe, genauso wie die Umhüllung. Auch Emilia hat währenddessen eine mentale Distanz zum Unterrichtsgegenstand und der homogenisierten Einheit des Sitzkreises hergestellt, indem sie sich der Bemalung ihrer eigenen Hülle – in Abgrenzung zur Hülle des gesamten Kreises – widmet. Im Foucault’schen Sinne des Panoptismus ist in dieser Situation nicht einmal die Lehrerin als Überwacherin der Situation erforderlich, sondern Leonie – die Emilia im Kreis gegenübersitzt – übernimmt die Verteidigung der Regeln, ermöglicht durch die Funktion des Kreises, alle allen sichtbar zu machen. Sowohl innerhalb des Sitzkreises – aber genauso innerhalb der anderen Positionen – werden dabei immer wieder unterschiedlich große Spielräume der einzelnen Kinder, vergeben durch die Lehrpersonen und dann auch durch die Gruppe vertreten, sichtbar. Das Prinzip der Markierung als korrektionsbedürftig aber nur bedingt korrektionsfähig (Foucault [1999] 2007), als abwertende Abgrenzung der Einzelnen von der restlichen, illusionär homogenen Gruppe, spielt dabei eine entscheidende Rolle, wird ermöglicht durch die ständige Aufstellung der Einzelnen (Körper) in Relation zur Gruppe und bildet Abstufungen der Gleichheit. Laura meldet sich erneut, jedoch wird nun Tjark aufgerufen. Während Tjark an der Tafel unterstreicht, gleitet Laura vom Schneidersitz in eine seitliche Liegeposition – das Gesicht zur Tafel gewandt – und wischt mit den Armen in großen Wellenbewegungen – ausgehend vom Handgelenk über den Ellenbogen bis in die Schulter – vor sich über den Boden. Emilia beobachtet sie und imi-
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
tiert sie. Frau Roth ermahnt sie sofort: »Emilia, setz dich bitte richtig hin!«, und auch Laura setzt sich wieder in den Schneidersitz. Kurz darauf legt sie sich auf den Bauch, wechselt rollend immer wieder zwischen Bauch- und Seitenlage und hört der neuen Aufgabenstellung zu. Dann streckt sie sich in seitlich liegender Position der Länge nach aus. Von den Fingerspitzen bis zu den Fersen bildet sie eine gerade Linie. Frau Roth kündigt die nächste Aufgabe an, die am Sitzplatz durchgeführt werden soll.
So meldet sich Laura zum wiederholten Mal, jedoch wird diesmal nicht sie, sondern Tjark von der Lehrerin aufgerufen. Während Tjark an der Tafel unterstreicht, entfernt sich Laura körperlich aus der Situation, indem sie vom Schneidersitz in eine seitliche Liegeposition gleitet und mit den Armen in großen Wellenbewegungen – ausgehend vom Handgelenk über den Ellenbogen bis in die Schulter – vor sich über den Boden wischt. Zwar ist ihr Gesicht weiter zur Tafel gewandt, allerdings schwimmt sie dem Geschehen, angetrieben von den Wellenbewegungen ihrer Arme, nun bildlich davon. Emilia beobachtet ihre Bewegungen und imitiert sie, als würde sie ebenfalls von Lauras Welle erfasst werden. Entgegen der Statik des Sitzkreises der übrigen Anwesenden, schließt sich Emilia dem Bewegungsfluss von Laura an. Frau Roth ermahnt sie aber sofort: »Emilia, setz dich bitte richtig hin!«, und auch Laura setzt sich wieder in den Schneidersitz. Der Appell von Frau Roth an das Wissen der Klasse über die »richtige« Sitzposition, markiert hier zugleich die Abweichung als das »Falsche« – auf der Seite liegen und mit den Armen in wellenförmigen Bewegungen über den Boden wischen. Von diesem Wissen um die Spielregeln fühlt sich auch die nicht direkt angesprochene Laura adressiert und wechselt ebenfalls wieder in eine Sitzposition. Durch die alleinige Adressierung von Emilia, kann eine Auslegung hin zur Homogenisierung – das Ausbrechen eines Körpers aus der Gruppe kann unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. akustische Ruhe; das Ignorieren des Ausbrechenden vom weiten Rest der Gruppe) toleriert werden, zwei Körper stören die Einheit aber zu stark – hier nicht umfassend greifen. Vielmehr wird für Laura sehr individuell ein anderer, größerer Spielraum in Bezug auf das »richtige« Sitzen sichtbar als für Emilia, was sich im weiteren Verlauf der Situation manifestiert. Denn nun legt sich Laura auf den Bauch, entfernt sich somit um eine weitere Höhenstufe vom Sitzen und begibt sich sogar in die maximal tiefst mögliche Position, die sie in der Klasse einnehmen kann. Frau Roth markiert
155
156
Choreographien der Homogenisierung
Laura dabei nicht als »von ihr gesehen«, spricht sie nicht an und ermahnt sie somit auch nicht. Als Laura nun rollend immer wieder zwischen Bauch- und Seitenlage wechselt, stört sie mit der dynamischen Bewegung eindeutig das statische Bild des Sitzkreises, wenn es auch naheliegt, dass sie der neuen Aufgabenstellung zuhört. Dann streckt sie sich in seitlich liegender Position der Länge nach aus. Von den Fingerspitzen bis zu den Fersen bildet sie eine gerade Linie. Wie ein Ausrufezeichen liegt sie nun gerade in der geschwungenen Linie des Kreises aus den anderen Kindern. Es ist nicht möglich, dass Frau Roth diese letzte, spannungsvolle Position nicht wahrgenommen hat, trotzdem spricht sie Laura – weder verbal noch nonverbal – nicht an, sondern kündigt die nächste Aufgabe an, die am Sitzplatz durchzuführen ist. Die Frage soll hier aber nun nicht lauten: Warum muss Lauras Körper weniger ›gleich‹ zu den anderen sein als Emilias? Sondern: Warum muss Emilias Körper ›gleicher‹ zu den anderen sein als Lauras? Suggeriert die scheinbare größere Enge von Emilias Spielraum bei Frau Roth zwar augenscheinlich erst einmal einen Nachteil für Emilia, so markiert sie Emilia andersherum doch als ›gleicheren‹ Teil der Gruppe. Laura hingegen wird innerhalb dieser – ihr gegenüber scheinbar passiven – Inszenierung, in Abgrenzung, als Anormale hervorgebracht (siehe dazu auch: Wischmann/Riepe, 2017) und Emilia und der Gruppe gegenüber abgewertet. In Bezug auf die Kreisformation wirkt dieser Prozess besonders widersprüchlich. So wird die Illusio von ›gleichberechtigter Teilhabe‹ zwar angerufen, jedoch werden die Positionen der Einzelnen als Elemente der Kreislinie dabei als hierarchisiert hervorgebracht: Sie sind unterschiedlich gleich. So finden die Anordnungen der zweiten Position zwar auf einer verengten Grundfläche statt, diese ist aber nicht zwingend gleichbedeutend mit einer Verdichtung der individuellen Interaktion der Körper untereinander. Die Anordnung in Reihen oder das Beispiel des Flötenspiels verkörpern die Illusio der homogenen Gruppe dabei im besonderen Maße durch die streng vorgegebenen Kommunikationswege. Das Ausloten in Bezug auf die Spielräume der Bewegung und durch sie hindurch auch auf die Spielräume der hierarchischen Strukturen der Situation findet innerhalb dieser Position vor allem über die Höhenebene statt. Auf diese Weise kann die vorgegebene Grundfläche beibehalten – und somit die Grundregeln scheinbar eingehalten – werden. Die Bezugspunkte ›oben und unten‹ und ›innen und außen‹ beschreiben die Rahmung der körperlichen Formationen der Position im Besonderen. So
5. Zweite Position: verengte Körperordnungen mit Stühlen ohne Tische
gilt es zum einen das ›Eingekreiste‹ in der Mitte für die Gemeinschaft zu umund erschließen und das ›Außen‹ davon abzuschirmen. Zum anderen dienen die (Körper-)Ebenen ›oben‹ und ›unten‹ als permanente Kontrollinstanzen der hierarchischen Verteilung der Situation. Die Erwartung an ein ›Gleichsein‹ der Kinder erscheint dabei auch innerhalb dieser Position als widersprüchlich. So werden durch die unterschiedlichen Referenzrahmen der Verkörperung des ›Gleicher‹-Seins auch immer wieder Differenzerfahrungen hervorgebracht bzw. bringen sich selbst hervor.
157
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
Abbildung 24: Schule A – Dezentrale Körperordnung 1
Die dezentrale Anordnung durch die Schüler*innen selbst (auch freie Platzwahl) wurde im erhobenen Material 11 Mal beobachtet. Innerhalb dieser Position ist es den Schüler*innen möglich, ihren körperlichen Standort – innerhalb des Klassenraumes1 – selbst zu wählen. Die Kommunikationsachsen dieser Formation sind dabei nicht länger auf einen gemeinsamen
1
Eine Erweiterung der Grundfläche der Formation durch die Lehrerinnen – beispielsweise auf Flure oder Räume wie Musikraum oder Bibliothek – wurde nicht beobachtet.
160
Choreographien der Homogenisierung
Abbildung 25: Schule A – Dezentrale Körperordnung 2
Punkt, wie Tafel oder Kreismitte, fokussiert, sondern erscheinen als individuell für Gruppen oder einzelne Schüler*innen, je nach Arbeitsauftrag. Die Requisiten in Form von Tisch und Stuhl und die Vorgabe der horizontalen Linienführung der Anordnung werden hier nur als unverbindliche Optionen sichtbar. Inhalte wie Projekt- und Gruppenarbeiten sowie individualisierte Lern-Werkstätten finden – innerhalb des erhobenen Materials – mit Vorliebe innerhalb dieser de-zentralen Formation statt. In Bezug auf die Choreographie der Position kommt die freie Platzwahl – auf den ersten Blick – dem zeitgenössischen Tanzstil der Contact Improvisation am nächsten. Dabei erkunden die Tänzer*innen alle Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungen des Körpers im Raum für sich selbst und in Auseinandersetzung mit den anderen, z.B. indem sie gegenseitig das Gewicht aneinander abgeben, anund übereinander rollen, klettern und schwingen (Horwitz, 1995). So erscheint die ›freie‹ Handhabung der »individualisierten und Schüler [*innen V.R.] selbsttätigen« (Budde, 2013: 170) Elemente innerhalb dieser Position vor allem durch die Nutzung von – im regulären Unterricht – tabuisierten Räumen innerhalb des Klassenraums, wie zum Beispiel unter Tischen (Abbildung 26) oder hinter Vorhängen an der Fensterbank (Abbildung 27).
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
Abbildung 26: Unter dem Tisch
Abbildung 27: Hinter dem Vorhang
Die überwachende Funktion und Position der Lehrperson bleibt hier durch die Rahmung der gemeinsamen Räumlichkeit bestehen, toleriert dabei aber den körperlichen Rückzug aus der direkten Sichtbarkeit.
161
162
Choreographien der Homogenisierung
In Bezug auf bestimmte Aufgabenstellungen wie ›Lern-Stationen‹ wird die Räumlichkeit zwar eventuell durch Requisiten wie Tische oder Hocker (auf denen sich die Materialien befinden) durch die Lehrperson vorstrukturiert, jedoch bleibt die Interpretation der Raum-Linien weiterhin den Kindern überlassen. Während alle Kinder noch an ihren Mathe-Tests arbeiten, rückt Frau Knapper immer jeweils zwei Sitzbänke in der Klassenmitte zusammen und bestückt sie mit verschiedenen Mathematik-Spielen, die jeweils alleine oder in kleinen Gruppen gespielt werden können. Jolina ist als erstes fertig und zeigt auf, dann Alessandro. »Ich bin fertig!«, flüstert er, zeigt mit durchgedrücktem Rücken, gerade ausgestrecktem Arm und Zeigefinger und leicht erhobenem Kopf auf und bleibt ruhig sitzen. Als Frau Knapper sein Heft eingesammelt und ihm etwas zugeflüstert hat, steht er auf und widmet sich einem Zettel auf einem der Hocker in der Mitte der Klasse. Immer mehr Kinder sind fertig und setzen sich an und auf die Hocker in der Mitte. Alessandro absolviert sein Spiel alleine und sitzt im Schneidersitz auf den zusammengeschobenen Bänken. Jolina, Michael, Ardi, Christoph und Omar sitzen gemeinsam im Kreis um zwei Hocker und rechnen. Der Lautstärke-Pegel steigt. Auch Dustin und Nischhal setzen sich nun gemeinsam auf zwei Hocker. Elias setzt sich mit auf den Boden an Alessandros Hexagon, nutzt den Hocker jedoch nur als Lehne und dreht Alessandro den Rücken zu. Während die Kinder an ihrem Mathematik-Test arbeiten, bereitet Frau Knapper den folgenden Arbeitsauftrag vor. Dabei schiebt sie je zwei der Sitzbänke aus der Klassenmitte zusammen, so dass diese jeweils ein Hexagon bilden (Abbildung 28). Die Form des Vielecks, die durch das Requisit Sitzbank vorgegeben wird, nimmt dabei die Raummitte für sich ein und erinnert an ein Waben-Muster. Die hexagonale Form erscheint hier als Optimierung (im Sinne möglichst effizienter Nutzung von Raum) der Kreisform. Sie nutzt alle räumlichen Vorteile des Kreises, ohne jedoch ungenutzte Zwischenräume (zwischen mehreren, aneinander gefügten Kreisen) hinterlassen zu müssen und vermittelt innerhalb der Linienführung geradlinige, vereinzelte Stringenz (Abbildung 29). Die Veränderung der Requisiten innerhalb der Raum-Mitte eröffnet den Kindern bereits die Perspektive auf das Ende der Test-Phase und den Beginn eines neuen Arbeitsauftrages, ohne dass Frau Knapper das verbal äu-
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
Abbildung 28: Schule B – Hexagon
Abbildung 29: Visueller Raumnutzungsvergleich Kreis zu Hexagon
ßert. Auch verweist sie auf ein baldiges Auslaufen der begrenzten Zeit, die den Kindern für die Bearbeitung der überprüfenden Aufgaben zur Verfügung steht.
163
164
Choreographien der Homogenisierung
Die entstandenen Sechsecke bestückt Frau Knapper mit verschiedenen Mathematik-Spielen, deren Spieler*innen-Anzahl variabel ist. Erst Jolina, dann Alessandro markieren den Abschluss ihrer Arbeit an dem Test durch die Geste des ›Aufzeigens‹ oder ›Meldens‹. Alessandro drückt dabei seinen Rücken durch, streckt Arm und Finger aus und hebt leicht den Kopf. Durch die angespannte Körperhaltung nutzt Alessandro die Höhenebene seiner Sitzposition auf dem Stuhl maximal aus und hebt sich körperlich als ›aufsteigend‹ hervor. Durch das Flüstern: »Ich bin fertig!«, unterstreicht er seine starke Körperhaltung, die durch das Melden eben keine Frage, sondern eine Leistung, eine positive Abhebung von der (Lern-)Gruppe markiert: »Fertig« – im Sinne von: Alessandro hat im Test-Vorgang, im Hinblick auf den angestrebten Zweck (der Überprüfung), einen Zustand erreicht, der einen gewissen Abschluss darstellt, auch wenn er weiterer Verbesserung und Fortführung zugänglich bleiben mag. Diesen Zustand hat Alessandro bereits als Zweiter in der Klasse erreicht. »Fertig« – im Sinne von ›fix und fertig‹ als Zustand der großen Erschöpfung – wäre im Hinblick auf die Testsituation zwar ebenfalls eine legitime Annahme, die durch die kraftvolle Körperhaltung jedoch ausgeschlossen werden kann. Frau Knapper sammelt Alessandros Heft ein und flüstert ihm etwas zu. Dadurch erkennt sie seine Überprüfung als abgeschlossen an und er wendet sich den Zetteln auf den Hockern in der Klassenmitte zu. Immer mehr Kinder schließen die Arbeit an dem Test ab und setzen sich an und auf die Hocker in der Klassenmitte. Das Verhalten der Kinder zum Requisit Hexagon ist dabei ganz unterschiedlich. So nutzt Alessandro die Anordnung als Hocker und setzt sich im Schneidersitz darauf. Auf Grund der Folge von Entspannung auf Anspannung (der Prüfungssituation), lässt sich die Körpergeste der gekreuzten Beinhaltung hier als aus den Bereichen Meditation und Yoga stammend, lesen, wo sie als »Easy Pose« zu Entspannung und einer Aktivierung von positiver Energie führen soll. Jolina, Michael, Ardi, Christoph und Omar hingegen runden gemeinsam die geraden Linien des Hexagons ab, indem sie einen Sitzkreis um die Hocker bilden und die Bänke als gemeinsamen Tisch nutzen. Auch Dustin und Nischhal entscheiden sich dazu – wie Alessandro –, die Hocker als Sitzgelegenheit zu nutzen. Elias hingegen sitzt auf dem Boden und nutzt die Hocker nicht als Tisch, sondern als Rückenlehne. Auch verbindet ihn das Hexagon nicht inhaltlich mit Alessandro. Zwar befinden sich die beiden körperlich an einem gemeinsamen Vieleck, beschäftigen sich aber jeder für sich mit dem
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
Material. So bilden die Sechsecke in der Klassenmitte zwar eine homogene, räumliche Rahmung der Formation, jedoch bleibt die Nutzung in Bezug auf Anzahl der Nutzer*innen und Ausdeutung des Requisits (als Tisch, Hocker, Lehne) genau so individuell wie die Kommunikationsachsen der Kinder, die sich nicht zwingend über die Zuordnung zu einem Hexagon auch einer Person zuordnen. Diejenige Linie, die es allerdings auch innerhalb dieser Position nicht frei durch die Kinder zu interpretieren gilt, ist die Obergrenze der Höhenachse. So werden von der tiefst möglichen Position – des auf dem Bauch auf dem Boden Liegens – bis hin zum Stehen alle Verkörperungen der Höhenlinien innerhalb der Klasse durch die Lehrerinnen akzeptiert. Das Erschließen der Kinder der maximierten Höhenlinie durch ein Requisit jedoch wird zugunsten der homogenen Klasse unterhalb der Blicklinie der Lehrperson diszipliniert. [Mit Hilfe von »Versuchskarten« führen die Kinder in Kleingruppen (2-4 Personen) Versuche durch, die sie anhand von bestimmten besprochenen Schritten in ihren »Forscherbüchern« festhalten sollen. Fabian und Lasse bilden eine Gruppe und suchen sich die Versuchskarte mit Föhn und Tischtennisbällen aus – Bernoulli Effekt]. (…) Dann steigt Lasse auf einen Stuhl und lässt dort oben die zwei Bälle über dem Föhn tanzen: »Guckt mal, Leute!«, ruft er. Mit beiden Händen hält er den Föhn fest und wippt mit den Knien. »Jetzt bin ich mal, Lasse! Jetzt bin ich mal dran!«, hibbelt Fabian, der nun auf einem weiteren Stuhl neben ihm steht. Frau Schumann kommt entschlossenen Schrittes auf die beiden zu: »Was macht ihr da?! Bitte schreibt jetzt erstmal auf was ihr gesehen habt!« Und die Jungs steigen von den Stühlen, schalten den Föhn aus, stellen sich an einen Tisch und schreiben in ihr »Forscherbuch«. Lasse bewegt sich mit einer schwungvoll dynamischen Bewegung aufwärts, über die mittlere Höhenebene der stehenden Personen der Klasse hinaus, und erreicht damit eine stehende Position auf einem Stuhl. Durch die Positionsänderung nimmt er eine exponierte Stellung ein und erhöht seine Körperlichkeit. So vergrößert er nicht nur seinen Umfang in Bezug auf die Höhenachse, sondern erhöht auch seine Bedeutung innerhalb der Wahrnehmung aller Körper der Klasse (Abb. 30). Dort oben lässt er – im Sinne der Versuchsdurchführung – zwei Tischtennisbälle über dem Föhn, den er in den Händen hält, steigen. Schweben die Bälle aufgrund des Bernoulli-Effekts über dem Föhn, da Widerstandskraft und Gewichtskraft im Gleichgewicht sind, so bringt Lasses
165
166
Choreographien der Homogenisierung
Körper das Gleichgewicht der ›Höhen-Normalverteilung‹ der Klassenformation jedoch ins Wanken. Durch den Ausruf »Guckt mal, Leute!«, macht er seine Position auch auf akustischer Ebene sichtbar. Dabei spricht er seine Mitschüler*innen mit der vertrauten, umgangssprachlichen Anrede »Leute« an. Die althochdeutschen Wurzeln des Wortes zielen besonders auf den Bezug der ›Gefolgschaft‹ in Abgrenzung zu Herrschenden, so dass Lasse eine Zugehörigkeit zu ›seinem Team‹ der Schüler*innen in Abgrenzung zur Lehrperson herstellt. Die spannungsvolle Verkörperung wird dabei durch das kraftvolle Festhalten des Föhns mit beiden Händen und die Dynamik des Wippens unterstrichen. Halten die Hände noch fest an der Aufgabenstellung, befinden sich die treibenden Beine auf dem Weg der körperlichen Auseinandersetzung mit den Begrenzungen der Formation.
Abbildung 30: Höhenachse Versuchsanordnung
Von Lasses kraftvoller (Körper-)Welle erfasst, stellt sich nun auch Fabian auf einen Stuhl neben Lasse. »Jetzt bin ich mal, Lasse! Jetzt bin ich mal dran!«, fordert er Lasse auf, ihm den Föhn auszuhändigen. Nicht nur die Wiederholung seiner Aufforderung, sondern auch die zugehörige Verkörperung im Sin-
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
ne der kurzen, hastigen Körpergesten unterstreichen dabei seine Erwartung an eine sofortige Übergabe von Föhn und Bällen. Hat Lasses alleinige, exponierte Position die Lehrerin bisher nicht zu einer umgehenden Disziplinierung veranlasst, so ist die körperliche Überhöhung durch beide Jungen nun der Auslöser für sie, um energisch und ohne Zögern auf die beiden zuzugehen. Die rhetorische Frage: »Was macht ihr da?!«, ist dabei das gewählte verbale Mittel ihrer Ermahnung, unterstrichen von der starken Körperhaltung. So markiert sie die Positionen der Jungen als ›nichtregelkonform‹, ohne diese konkret zu thematisieren. Durch die Aufforderung: »Bitte schreibt jetzt erstmal auf, was ihr gesehen habt!«, suggeriert sie außerdem die Erwartung an ein Beenden des aktuellen Verhaltens zugunsten des Ergebnisses in Bezug auf die Aufgabenstellung. In Kombination mit der Höflichkeitsformel »bitte« erscheint der zweite Teil ihrer Ermahnung weniger streng als durch die starke Körpergeste erwartet und lässt sich auf den bestehenden Bezug Lasses und Fabians zur Aufgabenstellung erklären. Die Schüler beugen sich anschließend den (Spiel-)Regeln der Situation – verkörpert durch die Lehrerin –, steigen von den Stühlen, schalten den Föhn aus, stellen sich an einen Tisch und schreiben in ihr »Forscherbuch«. So treffen sie die, von der Logik des Feldes her gesehen, relevanten Entscheidungen zugunsten der Verkörperung der illusio der homogenen Gruppe. Auf die illusionär homogene Gruppe werden die Jungen außerdem über den Faktor Zeit bezogen. Trägt im Rahmen der anderen Positionen hauptsächlich die Lehrerin die Kinder durch die zeitlichen Phasen der Unterrichtseinheiten, so wird den Schüler*innen innerhalb der dezentralen Körperformation hingegen die Verantwortung für die effiziente Nutzung der Unterrichtszeit scheinbar selbst überlassen. Die Schüler*innen sind also dazu angehalten, sich – mindestens in Bezug auf den Faktor Zeit – im Foucault’schen Sinne selbst zu regieren (Foucault, [1975] 1994; siehe dazu ausführlich die kritische Betrachtung des Leitbildes selbstständiger Schüler*innen: Rabenstein, 2007). So verkörpert die Lehrperson eine lineare Zeitvorstellung der Unterrichtsstunde, die sie mit bestimmten Erwartungen an Zeitfenster und damit einhergehende (Lern-)Ergebnisse verbindet. Der Bezug der Gruppe auf diese Erwartungen verbleibt dabei jedoch in ihrer überwachenden Hand. »Starte bitte jetzt mit deinem Tier!«, löst Frau Schuhmann den Sitzkreis auf. Jonte und Henri holen sich eine große orangefarbene Pappe aus dem Regal,
167
168
Choreographien der Homogenisierung
setzen sich beide im Schneidersitz auf den Boden im hinteren Bereich der Klasse. Nach einer kurzen Absprache zwischen den beiden schreibt Henri die Überschrift »Braunbär« auf das Plakat. Während Henri die Überschrift mit verschiedenen Farben unterstreicht, holt Jonte weitere Buntstifte von seinem Platz. Im Hopser-Lauf kehrt er zu Henri zurück, wechselt ein paar Worte mit ihm, legt die Stifte ab und dreht dann eine hopsende Runde durch die Klasse. Dabei schlenkert er mit dem ganzen Körper, vor allem mit Schultern und Armen. Am Materialregal macht er einen kurzen Halt und unterhält sich mit Frau Schuhmann, dann hüpft er zurück, setzt sich neben Henri auf den Boden und malt mit – nun an der Umrandung des Plakats. Dazu wechselt er in eine Bauchlage und lässt die Füße in der Luft baumeln. (…) Frau Schuhmann kommt auf sie zu: »Aufgabe für euch beide: Bis Freitag findet ihr auch zuhause Infos zum Braunbären. Sonst reicht die Zeit gar nicht für euch aus. Momentan malt ihr ja nur.«
Die Arbeit in Kleingruppen wird durch Frau Schuhmann mit den Worten »Starte bitte jetzt mit deinem Tier!«, ausgerufen. Der »Start« – als aus dem Sport-Vokabular entlehnter Anfang eines Wettkampfes – wird somit markiert. Durch einen »korrekten« Start wird (im Sport) gewährleistet, dass alle Teilnehmer*innen entweder gleichzeitig oder aber unter denselben, zeitlichen Bedingungen den Wettbewerb beginnen. Auch hier fängt nun eine zeitlich begrenzte Einheit an, deren Aufforderung an das kollektive Du – und damit an alle zusammen und jede*n Einzelne*n – gerichtet ist. Der Arbeitsauftrag »mit deinem Tier« suggeriert zudem eine vorangegangene Aufteilung der Schüler*innen in bestimmte Gruppen und zu bestimmten Tieren, die allen Anwesenden klar sein sollte. Henri und Jonte nähern sich »ihrem Tier« zuerst über die Beschaffung des Arbeitsmaterials, einer orangefarbenen Pappe aus dem Regal. Sie setzen sich beide im Schneidersitz auf den Boden im hinteren Bereich der Klasse. Der Schneidersitz als solcher kann dabei als Arbeitshaltung im Sinne seines Bedeutungs-Ursprungs – als nach der Sitzweise mit überkreuzten Beinen von Schneider*innen auf deren Werktisch, damit die bearbeiteten Stoffe nicht auf dem Boden hängen – verstanden werden und die Bereitschaft der beiden zur Erfüllung der Aufgabe unterstreichen. Als Standort wählen sie den hinteren Bereich des Klassenraumes – im Gegensatz zu ihrem festgelegten Sitzplatz vorne rechts in der Klasse – und sind weiter von dem überwachenden Blick der Lehrerin an ihrem Pult vor der Tafel entfernt. Auch wählen sie keines der Requisiten Tisch oder Stuhl als Hilfsmittel,
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
sondern bevorzugen die freie Bodenfläche. Folgend auf eine kurze Absprache übertitelt Henri die Pappe mit der Aufschrift »Braunbär«, mittig, am oberen Rand (Abbildung 31).
Abbildung 31: Plakat – Braunbär
Somit schreibt er der orangefarbenen Pappe die neue Bedeutung des Plakats – als großformatiges Stück festes Papier mit einem Text, das zum Zwecke der Information dient – zu. Während Henri die Überschrift mit verschiedenen Farben unterstreicht, holt Jonte weitere Buntstifte von seinem Platz. Henri hebt also den Titel des Plakats farbig hervor und Jonte unterstützt die Vielgestaltigkeit der Unterstreichung mit weiteren Buntstiften, die er von seinem festen Sitzplatz holt. Im Hopser-Lauf kehrt er zu Henri zurück, wechselt ein paar Worte mit ihm, legt die Stifte ab und dreht dann eine hopsende Runde durch die Klasse. So vielgestaltig die Unterstreichung erscheint, so vielgestaltig erscheinen auch Jontes Bewegungen. Die Fortbewegung zeigt sich als abwechselndes Springen mit dem rechten oder linken Bein. Begleitend wird das jeweils andere Bein, als Schwungbein, angewinkelt nach oben gezogen. Dann landet Jonte zunächst auf dem Sprung-Fuß und etwas verzögert mit dem Schwung-Fuß. In diesem Zwischenschritt wird das Sprungbein gewechselt. Der Hopser-Lauf hat im Unterschied zum Gehen also eine Phase ohne Bodenkontakt und im Unterschied zum Laufen eine Phase, innerhalb derer beide Füße den Boden berühren.
169
170
Choreographien der Homogenisierung
Diese dynamische Fortbewegung verkörpert positive Kraft im Sinne des ›Luftsprünge‹-Machens, als körperlichen Ausdruck von Energie, Freude und Ausgelassenheit. Mit der raumgreifenden Bewegung des Hopser-Laufs erschließt sich Jonte nun den Klassenraum, indem er die zur Verfügung stehende Fläche einmal ›umhüpft‹. Maximiert wird der genutzte Raum der Bewegung durch das Schlenkern mit dem ganzen Körper, vor allem mit Schultern und Armen, und den Sprung in Bezug auf die Höhenachse. Das nachlässige (im Sinne von geringer Anspannung) Hin- und Herschwingen seines Körpers ergreift den Raum – über die Grundfläche hinaus – auch in seinem Volumen, innerhalb eines arm-langen Radius um Jonte herum. Das körperlich lockere Pendeln oder Trudeln vermittelt dabei – trotz der Dynamik der Bewegung – einen lässigen, spazierenden Eindruck. Der Halt bei Frau Schuhmann und Jontes Unterhaltung mit ihr markieren die Bewegungen einerseits als gesehen und toleriert, obwohl der Sprung als solcher in der Höhenachse bereits die Position von Frau Schuhmann erreicht. Andererseits beschreiben sie auch die weiterhin bestehende Verbindung Jontes zur Regel-Rahmung, da er die Konfrontation mit Frau Schuhmann selbst wählt. Als hätte die Begegnung mit Frau Schuhmann ihn zurück zur Aufgabenstellung geführt, hüpft Jonte zu Henri und setzt sich neben ihn auf den Boden. Dort malt er mit ihm weiter an dem Plakat und die beiden umranden es mit einer roten Linie (Abbildung 31 + 32). So ziehen sie sinnbildlich einen Rahmen um ihr (Lern-)Thema, ohne sich diesem inhaltlich weiter zu nähern. Körperlich wechselt Jonte dazu in die Bauchlage und lässt die Füße in der Luft baumeln. Dabei behält er die Dynamik in den Beinen bei, obwohl sein Oberkörper nun auf dem Boden ruht. Frau Schuhmann kommt auf die beiden zu und bezieht sie, über den Faktor Zeit, einerseits zurück auf die Überprüfung des Ergebnisses: Tier-Plakat, und andererseits auf ihr Verhältnis zur Gruppe der Klasse: »Aufgabe für euch beide: Bis Freitag findet ihr auch zuhause Infos zum Braunbären. Sonst reicht die Zeit gar nicht für euch aus.« »Nur malen« wird somit als nicht ›richtig‹ genutzte Zeit durch die Lehrerin identifiziert. Daraus entsteht eine Disziplinierung durch die Lehrerin, geäußert als Notwendigkeit »zuhause« Material für den Arbeitsauftrag zusammenzustellen, also die nicht effizient genutzte Zeit (im Sinne der Lehrerin) innerhalb der Schule, außerhalb der Schule nachzuholen. Denn sonst »reicht die Zeit
6. Dritte Position: dezentrale Körperordnungen mit und ohne Stühle und Tische
Abbildung 32: Jonte, Henri und der Braunbär
gar nicht für euch aus«, wobei sie die beiden von der restlichen Gruppe – für die die Zeit ausreicht – differenziert. Innerhalb der Position der freien Platzwahl werden Momente der Verkörperung von Homogenisierung nicht zwingend auf den ersten Blick sichtbar. Der Interpretationsspielraum der Raum-Linien durch die Schüler*innen erscheint groß und erstreckt sich bis hin zur Erschließung von Räumen (unter Tischen, hinter Vorhängen), die dem Blick der Lehrpersonen verschlossen bleiben. Die Erkundung der Bewegungsmöglichkeiten und Bewegungen des Körpers im Raum durch die Kinder wird jedoch homogenisiert über den Bezug auf eine gemeinsame Räumlichkeit, eine homogene Vorstellung von effizienter Nutzung von Zeit in Bezug auf (Lern-)Ergebnisse durch die Lehrerinnen und die Höhenachse als hierarchische Achse innerhalb der Rollenverteilung von Lehrerin und Schüler*innen.
171
7. Zusammenfassung
»Das Motiv, das mich getrieben hat, ist sehr einfach. Manchen, so hoffe ich, kann es für sich selber genügen. Es war Neugier – die einzige Art Neugier, die die Mühe lohnt, mit einiger Hartnäckigkeit betrieben zu werden: nicht diejenige, die sich anzueignen sucht, was zu erkennen ist, sondern die, die es gestattet, sich von sich selber zu lösen. Was sollte die Hartnäckigkeit des Wissens taugen, wenn sie nur den Erwerb von Erkenntnissen brächte und nicht in gewisser Weise und so weit wie möglich das Irregehen dessen, der erkennt? Es gibt im Leben Augenblicke, da die Frage, ob man anders denken kann, als man denkt, und anders wahrnehmen kann, als man sieht, zum Weiterschauen oder Weiterdenken unentbehrlich ist.« (Foucault, [1984] 1997: 15) Es war ein besonderes Anliegen dieser Erhebung, den Betrachtungsfokus im Rahmen einer machtsensiblen Auseinandersetzung sensu Foucault und Butler, auf Praktiken der Homogenisierung zu lenken. Denn Ungleichheit kann überhaupt erst in dem Moment existieren, in dem von Gleichheit zwischen Vergleichsdingen ausgegangen wird. Auf Basis der Grundüberzeugung, dass ›Gleichheit‹ und ›Gerechtigkeit‹ ein generell unmögliches Trugbild innerhalb der historisch aktuellen, ökonomischen (Macht-)Form darstellen, sollte mit Hilfe der Folie der Homogenisierung die performativ hergestellte Illusio von materialisierter Merkmalsgleichheit – innerhalb ihrer spezifischen Logik des (Spiel-)Feldes Schule – transparenter thematisiert werden können. Der Ausgangspunkt, dass Kinder, wenn sie in die Schule kommen, ebenso wenig gleich sind wie sie verschieden sind, sondern in Akten der Adressierung und durch alltägliche schulische Praktiken als Gleiche und Ungleiche in je besonderen Hinsichten erst hervorgebracht werden (Dietrich/Riepe, 2019), führte die theoretischen Auseinandersetzungen dabei mitten in das machtvolle Netz der Legitimation der Illusio von Gleichheit. So erzeugt die Inszenierung
174
Choreographien der Homogenisierung
der scheinbar homogenen Gruppe den Effekt einer Illusion von ›Gleichheit‹ im Sinne von ›Chancengleichheit‹, die das Bildungswesen zu gewährleisten beansprucht (Dietrich, 2017). Dieser Effekt wird notwendig, um dann eine Gleichbehandlung nach dem Leistungsprinzip – zugunsten der Bildungsrenditensteigerung – legitimieren zu können. Der Glaube an ein doing equality, im Sinne eines Versprechens, »dass durch ›Bildung‹ alles besser werde« (Ricken, 2015: 41), entreißt die Akteur*innen dabei der Gleichgültigkeit und bewegt sie dazu, die von der Logik des Feldes her gesehen relevanten Entscheidungen zu treffen. Die Spieleinsätze werden dann – ohne Vergegenwärtigung, worum es in dem Spiel eigentlich geht – stillschweigend anerkannt. So führt die Illusio zu einer Akzeptanz, die zur Reproduktion des Spiels innerhalb des Feldes unerlässlich ist. Zu einer Logik, die Homogenisierung, Differenzierung und das Streben nach ›(Ver-)Besserung‹ innerhalb des anerkannten Konkurrenzfeldes legitimiert. Basierend auf diesen Feststellungen, galten für die empirische Untersuchung folgende Fragen als richtungsweisend: Wie stellt sich Gleichheit – über die Körperlichkeit der Kinder – innerhalb der jeweiligen beobachteten Klasse oder Formation her? Welche Gleichheitsvorstellungen werden dabei aufgerufen? Wie (re-)agieren und widerstehen die Kinder in dem Prozess der Herstellung dieser Gleichheitsvorstellungen? Und welche Art von Abweichung wird innerhalb dieser Praktiken von den Beteiligten akzeptiert oder kann im Rahmen der spezifischen Unterrichts-Situation akzeptiert werden? Mit Hilfe des Zugangs der Sozialen Choreographie sollten so Momente eines doingsameness – und widerständische Brüche innerhalb dieser – in Bezug auf Körperlichkeit und Bewegung neu thematisiert werden können. Die Beweglichkeit der Bewegung sollte somit auch dort besonders ernst genommen werden können, »wo sie sich eindeutigen Bedeutungszuschreibungen entzieht« (Dietrich/Riepe, 2019: 676). So konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit die körperlich-materiale Seite der Homogenisierung betrachtet und thematisiert werden. Innerhalb der dicht beschriebenen Portraits der Körperformationen der beobachteten Klassen, konnten dabei (angeregt durch Dietrich, 2017; Dietrich/Riepe 2019) ganz unterschiedliche Erscheinungsformen von materialisierter Gleichheit herausgearbeitet werden. Den thematisierten Erscheinungsformen gemein ist, dass Gleichheit vor allem über eine homogene Ausrichtung von Körpern und Requisiten innerhalb eines Geflechts von bestimmten Zeit-, Raum- und Kommunikationsachsen angerufen wurde.
7. Zusammenfassung
Diese können insofern als Machtachsen bezeichnet werden, als dass sie ein Machtgefälle und eine Polarisierung des Verhältnisses von Lehrer*innen und Schüler*innen beschreiben und so die hierarchische Verteilung der Situation (mit-)bestimmen. Die Anrufung von verkörperter Gleichheit spielte innerhalb dieser Rahmung an Start- und Endpunkten von Unterrichtstagen und -sequenzen eine besondere Rolle und kann, innerhalb der Logik des Feldes, vor allem auf die Zeitachse zurückgeführt werden. So wird durch einen ›korrekten‹ homogenen Start- oder Ziellauf – im Sinne der scheinbaren Gleichbehandlung – gewährleistet, dass alle Teilnehmer*innen entweder gleichzeitig oder aber unter denselben, (zeitlichen) Bedingungen den Wettbewerb des Schulalltages oder der Unterrichtssequenz beginnen oder beenden. Darüber hinaus gewährleistet die »Zeitplanung« als Technik des vorgegeben Rhythmus durch die Lehrperson, eine Formierung eines anatomischchronologischen Verhaltensschemas, um die Durcharbeitung der Aufgabenstellung gewährleisten zu können und ihren Ablauf und ihre Phasen in Bezug auf eine festgesetzte Norm kontrollierbar zu machen. Auch die »erschöpfende Ausnutzung« als Prinzip von Effizienz und NichtMüßiggang (Foucault, [1975] 1994: 92 ff) wird in Bezug auf die Zeitachse sichtbar, so dass aus Perspektive der Lehrperson immer noch mehr verfügbare Augenblicke und aus jedem Augenblick immer noch mehr nutzbare Kräfte durch die Kinder hervorgebracht werden sollen. Die Raumachsen wiederum wirken im Sinne der Parzellierung zwar individualisierend, jedoch mit dem Verweis auf verkörperte Gleichbehandlung: »Jedem Individuum seinen Platz, auf jedem Platz ein Individuum« (ebd.: 181f). Durch die hergestellte Übersichtlichkeit innerhalb der Grundfläche des Raumes oder über die Grundfläche der jeweiligen Formation, kann – vor allem über die Requisiten Tisch und Stuhl im Sinne der illusionären Logik der universellen, optimalen Lern-Körper-Haltung – eine homogene (Lern-)Gruppe verkörpert werden. Diese wird durch die Überprüfung der Lehrperson bis hin zu einem exakten Ausrichtungsgrad von Körper zu Körper, Körper zu Gegenständen des Unterrichts, Körper zu Stuhl, Stuhl zu Stuhl, Stuhl zu Tafel oder Stuhl zu Tisch eingefordert und innerhalb ihrer Gleichheit optimiert. Über die Raumachsen und das immer wieder (unterschiedlich stark) durch die Lehrperson formulierte Ziel des ›Stillsitzens‹, wird außerdem nicht nur an eine einheitlich akustische Ruhe appelliert, sondern genauso an eine einheitliche Verkörperung von scheinbarer mentaler Fokussierung
175
176
Choreographien der Homogenisierung
durch Bewegungsarmut – als illusionäre einheitliche Ermöglichung von Konzentration und, kausal erscheinend, daraus resultierendem Lernerfolg. Die Regierung des Selbst durch die Kinder – im Sinne von innerer Selbstführung, Selbstdisziplin und Selbstmanagement der Individuen – wird dabei immer wieder angerufen. In Bezug auf den Körper spielt hier auch die Beziehung zwischen den Gesten und der Gesamthaltung des Körpers eine wichtige Rolle als Feststellungsmerkmal von (Selbst-)Disziplin und Leistungsstärke. So sind die erfolgreich disziplinierten Körper Träger einer leistungsstarken Geste: Beispiele dafür wären eine »gut« leserliche Handschrift, oder das ›richtige‹ Sitzen. In Bezug auf die Machtachsen innerhalb der Formationen bezieht sich das Abstecken von erwünschten und tolerierten Kommunikationsachsen durch die Beteiligten nicht länger nur auf Zugehörigkeits- und Ausschlussbeziehungen − •
•
•
von vorne und hinten: »Du kommst jetzt nach vorne!« (Frau Schuhmann) »Hier vorne spielt die Musik!« (Frau Roth) »Ich setz mich lieber ganz nach hinten.« (Jolina) »Du setzt dich jetzt nach hinten und nimmst eine Auszeit!« (Frau Knapper) rechts und links: »Komm schnell! Setz dich hier neben mich!« (Elisabeth) »Ihr Zwei nicht nebeneinander!« (Frau Knapper) »Mein rechter, rechter Platz ist frei!« (Ardi) und innen und außen: »Leg das erstmal in die Mitte.« (Frau Knapper) »Bücher bleiben draußen! Nur Klemmbrett und Stift mit in den Kreis!« (Frau Schuhmann)
−, sondern kann durch die Betrachtung der Beweglichkeit der Bewegung, innerhalb der Analysen der vorliegenden Arbeit, um die Dimensionen der (Macht-)Achse oben und unten erweitert werden. So bekommt die Analyse von Körperpositionen innerhalb des Forschungsvorhabens eine neue Richtung oder Dimension. Die Körperebene zwischen oben und unten wird als permanente Kontrollinstanz der hierarchischen Verteilung der Situation sichtbar und bezieht somit zum einen liegende, sitzende und stehende Körperhaltungen mit ein. Zum anderen bringt sie sowohl die
7. Zusammenfassung
homogene (Null-)Linie des angestrebten Mittelwerts der Normalverteilung – als sitzende Schüler*innen – immer wieder hervor als auch die stets den Kindern (körperlich) übergeordnete Machtachse der Blicklinie der Lehrperson. Erscheinen die Bezugsgrößen vorne und hinten, rechts und links und innen und außen innerhalb von stärker dezentralen, individualisierten Formationen (wie der dritten Position) als diffuser, weniger relevant und somit weniger homogenisierend, so verbleibt die Höhenachse innerhalb des erhobenen Materials stets als indiskutable Ebene der hierarchischen Verteilung der Situation – mindestens in Bezug auf die nicht tolerierte körperliche Überschreitung der Blicklinie der Lehrperson gegenüber der homogenen Schüler*innengruppe. Die Betrachtung von widerständischen Momenten und Antworten innerhalb der Formationen macht darüber hinaus sowohl die Statik als auch die Durchlässigkeit der jeweiligen (Körper-)Regeln der Situation deutlich, so auch auf der Höhenachse. Mit Hilfe des Zugangs der Sozialen Choreographie kann dabei sowohl der Platz und die Bewegung der einzelnen Körper als auch der Platz (im Sinne des Rangs) und die Bewegung der Individuen in einem sozialen Zusammenhang erweitert betrachtet und thematisiert werden. Die vitalistisch-spontanen (Körper-)Antworten der Kinder auf die Ordnungs- und Machtsachsen der jeweiligen Situation treffen dann, auf empirischer Ebene, auf neue Betrachtungs- und damit Deutungsmöglichkeiten und eröffnen den Kindern außerdem im praktischen Vollzug die einzig realistische Möglichkeit »nicht dermaßen regiert« zu werden (Dietrich/Riepe, 2019). Denn während die Kinder mit der Herstellung von – in sich stets widersprüchlichen – Gleichheiten befasst sind, ist ihnen die Körperbewegung andauernd immanent (ebd.) und bildet somit den finalen Punkt des (verkörperten) Widerstandes. Die Referenzrahmen von Gleichheit, die innerhalb dieser Verstrickungen angerufen werden, stellen sich dabei nicht nur je nach Situation unterschiedlich dar, sondern auch je nach Kind. So wird im Anschluss an die Herstellung eines Rahmens der Gleichheit zwischen den Kindern und deren Schulleistungen als Vergleichsdingen, nicht nur deren (Leistungs-)Niveau und Rang definiert, sondern damit auch ein je nach Niveau und Rang individuell größerer oder weniger großer Spielraum für deren Verkörperung als Gleiche. Fragen wie: Wird von als ›leistungsstark‹ markierten Schüler*innen stärkere (Verkörperung von) Gleichheit erwartet als von als ›leistungsschwach‹
177
178
Choreographien der Homogenisierung
markierten Schüler*innen?, oder: Welche Differenzerfahrungen werden über welche Referenzrahmen von Homogenisierung hergestellt?, könnten an dieser Stelle innerhalb der empirischen Forschung anschließen. Auf bildungspolitischer Ebene wäre es darüber hinaus interessant zu fragen, warum es innerhalb dieses instabilen Glaubens an ›Gleichheit‹ und ›gerechte Gleichbehandlung‹, innerhalb der andauernden Hervorbringung von Ungleichen im (Regel-)Schulalltag, plausibel bleibt, Gleichheit auf diese Weise überhaupt anzurufen, zu verkörpern und zu disziplinieren? Denn in Zeiten von Diskussionen um »Partizipation«, »Inklusion« und »Individualisierung«, so wie von vermeintlich offenen, freundlichen und kindgerechten Unterrichtssettings: geprägt von wechselnden Körperformationen, Bewegungsspielräumen und »Stuhlkreis-Ideologie« (im Sinne von Teilhabe und Gemeinschaft) erscheint es – wie auch Rabenstein (2007) und Rabenstein/Reh (2008) am Beispiel von reformpädagogischen Settings bereits zeigten – umso widersprüchlicher, dass tradierte Disziplinierungsund Regierungspraktiken sensu Foucault nach wie vor in dieser Genauigkeit aufgezeigt werden können. In Bezug auf ihre Anschlussfähigkeit kann die Vorliegende Studie einen weiteren Anlass bieten, Chancen und Grenzen der Methodenpluralität oder des hier gewählten Zugangs zur ethnographischen Collage (Richter/Friebertshäuser: 2012), sowie der Sozialen Choreographie (Hewitt, 2005; Klein, 2010) zu diskutieren. Genauso könnten mit ihr praxistheoretische Forschungsperspektiven bewusst um den Fokus auf die Körperebene zwischen oben und unten und damit um eventuell zusätzlich relevante Nuancen erweitert werden (z.B. Wolff, 2020). Auch reiht sie sich in Bezug auf das Anliegen an das ethnographische Scheiben ein (z.B. Hirschauer, 2001; Falkenberg, 2013), etwas zur Sprache bringen zu wollen »das vorher nicht Sprache war« (Hirschauer, 2001: 430). Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf der Hinwendung zu der Ergänzung des Aspektes der Ästhetik (Jameson, 1991; Featherstone 1992; Reckwitz, 2006; Goebel/Prinz, 2015), bzw. der Ästhetik des Sozialen (Klein, 2010; 2015B) – über das Schreiben hinaus – und den Fragen nach Möglichkeiten der Formulierung dieser, liegen. So kann mit der Erschließung des Zugangs der Sozialen Choreographien und dessen Plausibilisierung im Rahmen dieser Studie ein Zugang geschaffen werden, um etwas um seines Erscheinens Willen in seinem Erscheinen besser zu vernehmen und damit letztlich auch innerhalb der wissenschaftlichen
7. Zusammenfassung
Disziplin immer wieder neue Formen einer bedingten »Unknechtschaft« als Forscher*innen anzustreben: »Doch die Aufgabe der Philosophie, kritische Analyse unserer Welt zu betreiben, wird immer wichtiger. Das zentrale philosophische Problem ist wohl das der Gegenwart und dessen, was wir in eben diesem Moment sind. Wobei das Ziel heute weniger darin besteht, zu entdecken, als vielmehr abzuweisen, was wir sind. Wir müssen uns das, was wir sein könnten, ausdenken und aufbauen, um diese Art von politischem ›double-bind‹ abzuschütteln, der in der gleichzeitigen Individualisierung und Totalisierung durch moderne Machtstrukturen besteht. Abschließend könnte man sagen, dass das politische, ethische, soziale und philosophische Problem, das sich uns heute stellt, nicht darin liegt, das Individuum vom Staat und dessen Institutionen zu befreien, sondern uns sowohl vom Staat als auch vom Typ der Individualisierung, der mit ihm verbunden ist, zu befreien. Wir müssen neue Formen der Subjektivität zustandebringen, indem wir die Art von Individualität, die man uns jahrhundertelang auferlegt hat, zurückweisen.« (Foucault, 1996: 28)
179
Literatur
Aristoteles [1909] (2016): Nikomachische Ethik. Berlin: Hofenberg. Ackermann, F. (1994): Die Modellierung des Grauens. Exemplarische Interpretation eines Werbeplakats zum Film »Schlafwandler« unter Anwendung der »objektiven Hermeneutik« und Begründung einer kultursoziologischen Bildhermeneutik. In: Garz, D./Kraimer, K. (Hg.): Die Welt als Text. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 195-225. Alanen, L. & Mayall, B. (Hg.). (2001): Conceptualizing Child-Adult Relations. London/New York: Psychology Press. Alkemeyer, T./Brümmer, K./Kodalle, R./Pille, T (2009): Ordnung in Bewegung. Choreographien des Sozialen: Körper in Sport, Tanz, Arbeit und Bildung. 1. Aufl. Bielefeld: Transcript. Althusser, L. (1977): Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie. Hamburg/West-Berlin: VSA. Amann, K./Hirschauer, S. (Hg.) (1997): Die Befremdung der eigenen Kultur. Zur ethnographischen Herausforderung soziologischer Empirie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Apelt, O./Bormann, K. (1989): Platon: Der Staat. Über das Gerechte. Hamburg: Meiner. Austin, J. L. (1986): Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with words). Stuttgart: Reclam. Ayllon, T./Zarin, N.H. (1965): The measurement and reinforcement of behavior of psychotics. In: Journal of the Experimental Analysis of Behaviour, 7. P.327331. Babka, A./Posselt, G. (2016): Gender und Dekonstruktion. Begriffe und kommentierte Grundlagentexte der Gender- und Queer-Theorie. Wien: facultas. Ballestrem, K. (2013): Widerstand. Ziviler Ungehorsam, Opposition – Eine Typologie. Wiesbaden: Springer VS.
182
Choreographien der Homogenisierung
Balzer, N. (2004): Von den Schwierigkeiten, nicht oppositional zu denken. Linien der Foucault-Rezeption in der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. In: Ricken, N./Rieger-Ladich, M. (Hg.): Michel Foucault. Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: VS Verlag. S. 15-35. Balzer, N./Bergner, D. (2012): Die Ordnung der ›Klasse‹. Analysen zu Subjektpositionen in unterrichtlichen Praktiken. In: Ricken, N./Balzer, N. (Hg.): Judith Butler: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Springer VS. Balzer, N./Ludewig, K. (2012): Quellen des Subjekts. Judith Butlers Umdeutung von Handlungsfähigkeit und Widerstand. In: Ricken, N./Balzer, N. (Hg.) (2012): Judith Butler: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Springer VS. S. 95-124. Bock, G./James, S. (Hg.) (2005): Beyond equality and difference: citizenship, feminist politics and female subjectivity. London/New York: Routledge. Bongerts, G. (2008): Verdrängung des Ökonomischen: Bourdieus Theorie der Moderne. Bielefeld: transcript. Bos, W./Pietsch, M. (Hg.) (2006): KESS 4 – Kompetenzen und Einstellungen von Schülerinnen und Schülern am Ende der Jahrgangsstufe 4 in Hamburger Grundschulen, Münster: Waxmann. Bourdieu, P. [1979] (1982): Die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1997): Der Tote packt den Lebenden. Hamburg: VSA Verlag. Bourdieu, P. (1998): Praktische Vernunft. Zur Theorie des Handelns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bourdieu, P. (1999): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Braidotti, R. (2002): Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of Becoming. Cambridge: Polity Pess. Brandstetter, G. (2005): Choreographie. In: Fischer-Lichte, E./Kolesch, D./Warstat, M. (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart u.a: Metzler, S. 52-55. Breidenstein, G. (2006): Teilnahme am Unterricht – Ethnographische Studien zum Schülerjob. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Breidenstein, G. (2012): Zeugnisnotenbesprechung. Zur Analyse der Praxis schulischer Leistungsbewertung. Pädagogische Fallanthologie. Bd. 12. Opladen: Verlag Barbara Budrich. Brenne, A. (2008): Künstlerisch-Ästhetische Forschung – Über substanzielle Zugänge zur Lebenswelt – Eine Einführung. In: ders. (Hg.) (2008): Zarte
Literatur
Empirie. Theorie und Praxis einer künstlerisch-ästhetischen Forschung. Kassel: Kassel University Press. S. 5-22. Breidenstein, G./Hirschhauer, S./Kalthoff, H./Nieswand, B. (Hg.) (2013): Ethnografie. Eine Praxis der Feldforschung. Konstanz und München: UVK. Budde, J. (2012): Problematisierende Perspektiven auf Heterogenität als ambivalentes Thema der Schul- und Unterrichtsforschung. In: Zeitschrift für Pädagogik, 58 (4), S. 522-540. Budde, J. (Hg.) (2013): Unscharfe Einsätze. (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld. Wiesbaden: Springer VS. Budde, J./Bittner, M./Bossen, A./Rißler, G. (Hg.) (2018): Konturen Praxis-theoretischer Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz. Buddensiek, W, (2009): Fraktale Schularchitektur. In: Böhme, J. (Hg.): Schularchitektur im interdisziplinären Diskurs: Territorialisierungskrise und Gestaltungsperspektiven des schulischen Bildungsraums. Wiesbaden: Springer VS. S. 315329. Bürgerschaft der freie und Hansestadt Hamburg (2013): Kriterien der Berechnung des Sozialindex f ür die Grundschulen, Drucksache 20/7094, 20. Wahlperiode. Butler, J. (1989): Sexual Ideology and Phenomenological Description. A Feminist Critique of Merleau-Ponty’s Phenomenology. In: Allen, J./Young I.M. (eds.): The Thinking Muse: Feminism and Modern French Philosophy. Indiana University Press. Pp. 85-100. Butler, J. (1991): Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Butler, J. (1997): Körper von Gewicht: Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Butler, J. (2001): Die Psyche der Macht. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Butler, J. (2002): Was ist Kritik? Ein Essay über Foucaults Tugend. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 50 (2002), H. 2, S. 249-265. Butler, J. (2006): Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Butler, J. (2009): Die Macht der Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Büttner, G./Pütz, T. (2007): »Dichte Beschreibung« als methodische Möglichkeit bei der Erstellung von Praktikumsberichten. In: journal für lehrerinnenund lehrerbildung 3. S. 56-64. Carlson, M. (1996): Performance: A Critical Introduction. London/New York: Routledge.
183
184
Choreographien der Homogenisierung
Chadderton, C. (2012): Problematising the role of the white researcher in social justice research. Ethnography and Education 7:3. P. 363-380. Clifford, J./Marcuse, G. E. (Ed.) (1986): Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press. Coronil, F. (1996): Beyond Occidentalism: Toward Nonimperial Geohistorical Categories. In: Cultural Anthropology 11 (1). P.51-87. de Boer, H. (2006): Der Klassenrat als interaktive Praxis. Auseinandersetzung Kooperation Imagepflege. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Derrida, J. (1988): Randgänge der Philosophie. Wien: Passagen. Diehm, I./Kuhn, M./Machold, C. (2013). Ethnomethodologie und Ungleichheit? Methodologische Herausforderungen einer ethnographischen Differenzforschung. In: Budde, J. (Hg.): Unscharfe Einsätze. (Re-)Produktion von Heterogenität im schulischen Feld. Wiesbaden: Springer Fachmedien (Studien zur Schul- und Bildungsforschung, 42), S. 29-51. Dietrich, C. (2017): Im Schatten des Vielfaltsdiskurses: Homogenität als kulturelle Fiktion und empirische Herausforderung. In: Diehm, I./Kuhn, M./Machold, C. (Hrsg) (2017): Differenz – Ungleichheit – Erziehungswissenschaft, Verhältnisbestimmungen im (Inter-)Disziplinären, Wiesbaden: Springer VS, S. 123-138. Dietrich C./Riepe, V. (2019): Praktiken der Homogenisierung. Soziale Choreographien im Schulalltag. In: Zeitschrift für Pädagogik, 5/2019, S. 669-691. Dietrich, C./Wischmann, A. (2016): Genese von Heterogenität im Fachunterricht: Ein Beitrag zur Kontextualisierung von Differenzierungspraktiken. In: Roose, H./Schwarz. E. E. (Hg.): »Da muss ich dann auch alles machen, was er sagt«: Kindertheologie im Unterricht. Stuttgart: Calwer Verlag. S. 62-74. Engel, G./Heyens, G./Linde, H.M./Hünteler, K. (2014): Spiel und Spaß mit der Blockflöte. Mainz: Schott Music. Engel, A./Schulz, N./Wedel, J. (2005): Queere Politik: Analysen, Kritik, Perspektiven, In: femina politica 1/2005, S. 9-22. Faulstich-Wieland, H./Weber, M./Willems, K. (2004): Doing Gender im heutigen Schulalltag: empirische Studien zur sozialen Konstruktion von Geschlecht in schulischen Interaktionen. Weinheim: Juventa. Featherstone, M. (1992): Postmodernism and the Aestheticization of Everyday Life, In: Lash, S./Friedmann, J (Hg.): Moderrnity and Identity. Oxford: Blackwell, S. 64-80. Feldtenstein, C. J. (1767): Die Kunst nach der Choreographie zu tanzen und Tänze zu schreiben. Braunschweig.
Literatur
Fischer-Lichte, E./Kolesch, D. (1998): Kulturen des Performativen. Berlin: Akademie Verlag. Fischer-Lichte, E. (2004): Die Ästhetik des Performativen. Berlin: Suhrkamp. Fischer-Lichte, E. (2005): Emergenz. In: Dies. Kolesch, D./Warstat, M. (Hg.) (2005): Metzler Lexikon Theatertheorie. Stuttgart u.a: Metzler. S. 85-87. Fischer-Lichte, E. (2012): Performativität. Eine Einführung. Bielefeld: transcript. Flick, U. (1996): Qualitative Forschung: Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften. Reinbek: Rowohlt. Foucault, M. [1961] (2008): Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1963] (2011): Die Geburt der Klinik: Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. Frankfurt a.M.: Fischer. Foucault, M. [1966] (2003): Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1970] (2012): Die Ordnung des Diskurses. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt a.M.: Fischer. Foucault, M. [1975] (1994): Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1976] (2012): Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1978] (1992): Was ist Kritik? Berlin: Merve Verlag. Foucault, M. [1978] (2008): Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit. Berlin: Merve. Foucault, M. [1980] (2001): Raymond Roussel. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1981] (2013): Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. [1984] (1997): Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Foucault, M. (1993): Technologien des Selbst. In: Martin, L.H./Gutman, H./Hutton P.H. (Hg.) (1993): Technologien des Selbst. Frankfurt a.M.: Fischer Verlag. Foucault, M. (1996): Warum ich die Macht untersuche: Die Frage des Subjekts. In: Seitter, W. (Hg.) (1996): Das Spektrum der Genealogie, Bodenheim: Philo, S. 14-28. Foucault, M. [1999] (2007): Die Anormalen – Vorlesungen am Collège de France 1974/1975. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. (2002): In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Foucault, M. (2005): Analytik der Macht. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
185
186
Choreographien der Homogenisierung
Freie und Hansestadt Hamburg (2014) (Hg.): Hamburgisches Schulgesetz (vom 16. April 1997 zuletzt geändert am 6. Juni 2014) Hamburg: Behörde für Schule und Berufsbildung. Freie und Hansestadt Hamburg (2015) (Hg.): Handreichung: Inklusive Bildung und sonderpädagogische Förderung (Stand 20.Oktober 2015) Hamburg: Behörde für Schule und Berufsbildung. Friebertshäuser, B./Richter, S./Boller, H. (2010): Theorie und Empirie im Forschungs-prozess und dieËthnographische Collage« als Auswertungsstrategie. In: Friebertshäuser, B./Langer, A./Prengel, A.: Handbuch qualitativer Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Juventa. Geertz, C. [1983] (1995): Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Goebel, H.K./Prinz, S. (2015) (Hg.): Die Sinnlichkeit des Sozialen. Wahrnehmung und materielle Kultur. Bielefeld: transcript. Gogolin, I. [1994] (2008): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann. Gomolla, M./Radtke, F.-O. (2007): Institutionelle Diskriminierung. Wiesbaden: VS-Verlag. Habermas, J. [1985] (1995): Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 1. Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Gugutzer, R. (2006): Body turn: Perspektiven der Soziologie des Körpers und des Sports. Bielefeld: transcript. Haselbach, B. (1971): Tanzerziehung – Grundlagen und Modelle für Kindergarten, Vor- und Grundschule. Hamburg: Klett. Hawknis, A. (1988): Creating through dance. Princeton: Princeton Book Company Pub. Heid, H. (2012): Der Beitrag des Leistungsprinzips zur Rechtfertigung sozialer Ungerechtigkeit. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 81. Jg., Heft 1, S. 22-34. Heinzel, F. (2001): Kinder im Kreis. Kreisgespräche in der Grundschule als Sozialisationssituationen. Universitäts-Habilitations-Schrift. Halle. Heinzel, F. (2016): Der Morgenkreis – Klassenöffentlicher Unterricht zwischen schulischen und peerkulturellen Herausforderungen. Berlin: Barbara Budrich. Hennemann, G. (2016): Länderporträt: Türkei. In: Jahrbuch Extremismus & Demokratie (E & D). Nomos Verlagsgesellschaft. S. 241-262. Hewitt, A. (2005): Social Choreography. Ideology as performance in dance and everyday movement. Durham, NC: Duke Univ. Press.
Literatur
Hewitt, A. (2007): Choreograph is a way of thinking about the relationship of aesthetics to politics. In: frakcija. Performing Arts Journal. No.42. P.44-42. Hnilica, S. (2010): Schulbank und Klassenzimmer – Disziplinierung durch Architektur. In: Egger R., Hackl B. (Hg.): Sinnliche Bildung? Pädagogische Prozesse zwischen vorprädikativer Situierung und reflexivem Anspruch. Wiesbaden: VS. S. 141-162. Honoré, T. (1982): Ulpian. Oxford: Carendon Press. Horwitz, C.A. (1995): Challenging dominant gender ideology through dance: contact improvisation. University of Iowa: Dissertation. Hummrich, M. (2016): Homogenisierung und Heterogenität – Die erziehungswissenschaftliche Bedeutung eines Spannungsverhältnisses. In: Tertium Comparationis Journal für International und Interkulturell Vergleichende Erziehungswissenschaft, Jahrgang 22, Heft 1 (2016), S. 39-58. Jaeggi, E./Faas, A./Mruck, K. (1998): Denkverbote gibt es nicht! Vorschlag zur interpretativen Auswertung kommunikativ gewonnener Daten. Forschungsbericht aus der Abteilung Psychologie im Institut f ür Sozialwissenschaften. Nr.2-98. Berlin: Technische Universität Berlin, Institut für Sozialwissenschaften, Abt. Psychologie. Jameson, F. (1991): Postmodernism. Or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham: Duke University Press. Jay, G./Jones, S. E. (2005): Whiteness studies and the multicultural literature classroom. In: Melus, 30(2), Pp. 99-121. Kant, I. [1784] (1999): Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften. Hamburg: Meiner. Kant, I. (1902A): Die Metaphysik der Sitten, in: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Hg.) (1902): Kants Werke, Bd. VI, Berlin, S. 203-372. Kant, I. (1902B): Der Streit der Fakultäten, in: Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften (Hg.) (1902): Kants Werke, Bd. VII, Berlin, S. 1-116. Kelle, H. (2001): Ethnographische Methodologie und Probleme der Triangulation. Am Beispiel der Peer Culture Forschung bei Kindern. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 21(2), 192-208. Kelle, H. (Hg.) (2010): Kinder unter Beobachtung. Kulturanalytische Studien zur pädiatrischen Entwicklungsdiagnostik. Opladen: Barbara Budrich. Kelle, H./Mierendorff, J. (Hg.) (2013): Normierung und Normalisierung der Kindheit. Weinheim: Juventa. Kelle, H./Tervooren, A. (Hg.) (2008): Ganz normale Kinder. Heterogenität und Standardisierung kindlicher Entwicklung. Weinheim: Juventa.
187
188
Choreographien der Homogenisierung
Kellermann, I. (2008): Vom Kind zum Schulkind. Die rituelle Gestaltung der Schulanfangsphase. Opladen: Barbara Budrich. Kelter, K. (2017): Die Praxis der Performance zwischen Strategie und Emergenz. Das Beispiel T.E.R.R.Y. In: Klein, G./Göbel, H.K. (Hg.): Performance und Praxis. Praxeologische Erkundungen in Tanz, Theater, Sport und Alltag. Bielefeld: transcript. Kersting, W. (2000): Theorien Sozialer Gerechtigkeit. Wiesbaden: Springer VS. Klein, G. (2010): Das Soziale choregographieren. Tanz und Performance als urbanes Theater. In: Haitzinger N./Fenböck, K. (Hg.): Denkfiguren. Performatives zwischen Bewegen, Schreiben und Erfinden. München: epodium, S. 94103. Klein, G. (2012): Choreografien des Alltags. Bewegung und Tanz im Kontext Kultureller Bildung. In: Bockhorst, H./Reinwand, V.I./Zacharias, W./Schönfeld, F.I. (Hg.): Handbuch kulturelle Bildung. München: Kopaed, S. 608-613. Klein, G. (Hg.) (2015A): Choreografischer Baukasten. Das Buch. Bielefeld: transcript. Klein, G. (2015B): Zur Performativität und Medialität des Sinnlichen n Alltag und (Tanz-)Kunst, In: Goebel, H.K./Prinz, S. (Hg.): Die Sinnlichkeit des Sozialen. Wahrnehmung und materielle Kultur. Bielefeld: transcript. S. 305-316. Klein, G./Göbel, H.K. (Hg.) (2017): Performance und Praxis. Praxeologische Erkundungen in Tanz, Theater, Sport und Alltag. Bielefeld: transcript. Knoblauch, H. (2001): Fokussierte Ethnographie: Soziologie, Ethnologie und die neue Welle der Ethnographie. In: Sozialer Sinn 2.1. S. 123-141. Koller, H.-C./Casale, R./Ricken, N. (Hg.) (2014): Heterogenität. Zur Konjunktur eines pädagogischen Konzepts. Paderborn: Ferdinand Schöningh. Krölls, A. (2009): Das Grundgesetz ein Grund zum Feiern? Eine Streitschrift gegen den Verfassungspatriotismus, Hamburg: VSA. Kurt, R./Herbrik, R. (2014): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie. In: Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung. Wiesbaden: Springer. S. 473-491. Lidola, M. (2016): Intime Arbeit und migrantische Unternehmerschaft, Professionalität, Körperlichkeit und Anerkennung in brasilianischen Waking Studios Berlins, Bielefeld: transcript. Lindmeier, B. (2004): Kinder in Unterversorgungslagen: Wie kann Schule zu einer Ressource werden? In: Schnell, I./Sander, A. (Hg.): Inklusive Pädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 111-124.
Literatur
Littleton, C. A. (1987): Reconstructing sexual equality. In: California Law Review 75, Pp. 1279-1337. Locke, J. [1693] (2007): Gedanken über Erziehung. Stuttgart: Reclam. Loer, T. (1996): Halbbildung und Autonomie. Über Struktureigenschaften der Rezeption bildender Kunst. Opladen: VS. Lorey, I. (1993): Der Körper als Text und das aktuelle Selbst: Butler und Foucault. In: Feministische Studien, 2 (1993). S. 10-23. Lüders, C. (2001): Teilnehmende Beobachtung. In: Bohnsack, R./Marotzki, W./Meuser, M. (Hg.): Hauptbegriffe Qualitativer Sozialforschung, Opladen: Budrich, S. 51-153. Lüders, C. (2009): Beobachten im Feld der Ethnographie. In: Flick, U./Kardoff, E./Steinke, I. (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek: Rowohlt. S. 384-401. Malinowski, B. [1922] (1960): Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. London/New York: Routledge. Marx, K./Engels, F. (1953): Die deutsche Ideologie. Berlin: Dietz. Mecheril, P./Castro Varela, M.d.M./Dirim, I./Kalpaka, A./Melter, C. (2010): Migrationspädagogik. Weinheim, Basel: Beltz. Merleau-Ponty, M. (1966). Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin: de Gruyter. Mietzner, U./Pilarczyk, U. (2000): Gesten und Habitus im pädagogischen Gebrauch. Ein historischer Vergleich der Entwicklung von Gesten und Körperhabitus im Unterricht der DDR und der Bundesrepublik Deutschland seit 1945. In: Paedagogica historica, 36(1), S. 472-497. Möhring, M. (2006): Die Regierung der Körper »Gouvernementalität« und »Techniken des Selbst«. In: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe, 3 (2006) H. 2. URL: . (abgerufen am: 19.01.2016) Müller, F. (2010): Verteilung von Armut im Primarbereich in Berlin. Zeitschrift Für Inklusion, 4(4). URL: www.inklusion–online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/85/86 (abgerufen am: 26.01.2017). Müller, G. (2013): Arrangement und Zwang, zur Reproduktion patriarchaler Strukturen durch türkische Migrantinnen in Deutschland, Bielefeld: transcript. Münster D. (2012): Postkoloniale Ethnologie. Vom Objekt postkolonialer Kritik zur Ethnografie der neoliberalen Globalisierung. In: Reuter J., Karentzos A. (Hg.): Schlüsselwerke der Postcolonial Studies. Wiesbaden: VS.
189
190
Choreographien der Homogenisierung
Nüberlin, G (2002): Selbstkonzepte Jugendlicher und schulische Notenkonkurrenz: zur Entstehung von Selbstbildern Jugendlicher als kreative Anpassungsreaktion auf schulische Anomien. Herbolzheim: Centaurus. Oevermann, U., Allert, T., Konau, E., & Krambeck, J. (1979): Die Methodologie einer »objektiven Hermeneutik« und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozial-wissenschaften. In: Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften (S. 352-434). Stuttgart: Metzler. Oevermann, U. (1983): Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos methodologischem Selbstverständnis für die Begründung einer materialen soziologischen Strukturanalyse. In: Friedeburg, L./Habermas, J.: Adorno-Konferenz 1983. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. S. 234-292. Oevermann, U. (1986): Kontroversen über sinnverstehende Soziologie: einige wiederkehrende Probleme und Mißverständnisse in der Rezeption der »objektiven Hermeneutik«. In: Aufenanger S.; Lenssen, M. (Hg.): Handlung und Sinnstruktur (S. 19-83). München: Kindt. Oevermann, U. (1990): Exemplarische Analyse eines Gedichtes von Rudolf Alexander Schröder mit dem Verfahren der objektiven Hermeneutik. In: Kulturanalysen. Zeitschrift für Tiefenhermeneutik und Sozialisationstheorie, 2, 244-260. Oevermann, U. (2002): Klinische Soziologie auf der Basis der Methodologie der objektiven Hermeneutik – Manifest der objektiv hermeneutischen Sozialforschung. https://www.ihsk.de/publikationen/Ulrich*Oevermann-Manif est*der*objektiv*hermeneutischen* Sozialforschung.pdf (abgerufen am 10.11.2017.) Oser, F./Patry, J.-L. (1990): Choreographien unterrichtlichen Lernens, Basismodelle des Unterrichts. Berichte zur Erziehungswissenschaft, Nr. 89. Pädagogisches Institut der Universität Freiburg, Schweiz. Oser, F. K./Patry, J.-L./Elsässer, T./Sarasin, S./Wagner, B. (1997): Choreographien unterrichtlichen Lernens – Schlussbericht an den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Pädagogisches Institut der Universität Freiburg, Schweiz. Peez, G. (2006): Fotoanalyse nach Verfahrensregeln der Objektiven Hermeneutik. In: Marotzki, W./Niesyto, H. (Hg.): Bildinterpretation und Bildverstehen. Methodische Ansätze aus sozialwissenschaftlicher, kunst- und medienpädagogischer Perspektive. Wiesbaden: VS. S. 121-141. Peschel, H. (2002): Offener Unterricht – Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion. Teil I: Allgemeindidaktische Überlegungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
Literatur
Peterßen, W. H. (2001). Kleines Methodenlexikon. (2. akt. Aufl.) München: Oldenbourg. Pille, T./Alkemeyer, T. (2018): »Noch mal ganz langsam für Michele!« Ein praxeologisch-performativer Blick auf Anerkennungsprozesse und Differenzbildung im Unterricht. In: Budde, J./Bittner, M./Bossen, A./Rößler, G. (Hg.) (2018): Konturen Praxistheoretischer Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz. S. 150-172. Postuwka, G. (2008). Der Tanz schafft Raum. In: Sammelband Tanzen, Sportpädagogik, Januar 2008, S. 33-37. Prengel, A. (2010): Heterogenität als Theorem der Grundschulpädagogik. In: Zeitschrift für Grundschulforschung. Bildung im Elementar- und Primarbereich. Jahrgang 3, Heft1/2010, S. 7-17. Prengel, A. (2014): Heterogenität oder Lesearten von Gleichheit und Freiheit in der Bildung. In: Koller, H.-C./Casale, R./Ricken, N. (Hg.): Heterogenität. Zur Konjunktur eines pädagogischen Konzepts. Paderborn: Ferdinand Schöningh. S. 45-67. Rabenstein, K. (2007): Das Leitbild des selbstständigen Schülers. Machtpraktiken und Subjektivierungsweisen in der pädagogischen Reformsemantik. In: Rabenstein, K/Reh, S: Kooperatives und selbstständiges Arbeiten von Schülern. Zur Qualitätsentwicklung von Unterricht. Wiesbaden: Vs Verlag. S. 39-60. Rabenstein, K./Reh, S. (2008): Die pädagogische Normalisierung der ›selbstständigen Schülerin‹ und die Patologisierung des ›Unaufmerksamen‹. Eine diskursanalytische Skizze. In: Bilstein, J./Ecarius, J.(Hg.): Standardisierung – Kanonisierung, Erziehungswissenschaftliche Reflexionen, Wiesbaden: Vs Verlag. S. 159-180. Rabenstein, K./Reh, S./Steinwand, J. (2012): Praktiken gegenseitiger Hilfe im individualisierten Unterricht. Welche Positionen nehmen Schüler(innen) ein und welche Gefahren können damit verbunden sein? In: Pädagogik, 64. Jg. H. 6, S. 32-35. Rabenstein, K./Reh, S./Steinwand, J./Breuer, A. (2014): Jahrgang und Entwicklung. Zur Konstruktion von Leistung in jahrgangsgemischten Lerngruppen. In: Kleiner, B./Rose, N. (Hg.), (Re-)Produktion von Ungleichheiten im Schulalltag. Opladen: Barbara Budrich. S. 135-154. Rademacher, C./Wiechens, P. (Hg.) (2001). Geschlecht – Ethnizität – Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz. Berlin: Springer VS. Rawls, J. [1971] (1779): Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
191
192
Choreographien der Homogenisierung
Reckwitz, A. (2000): Die Transformation der Kulturtheorie. Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Reckwitz, A. (2001): Multikulturalismustheorien und der Kulturbegriff: Vom Homogenitätsmodell zum Modell kultureller Interferenzen. In: Berliner Journal für Soziologie, Jg. 11, H. 2, S. 179- 200. Reckwitz, A. (2002): Toward a Theory of Social Practices. A Development in Culturalist Theorizing. In: European Journal of Social Theory, Jg. 5, H. 2. S. 245- 265. Reckwitz, A. (2003): Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken. Eine sozialtheoretische Perspektive. In: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 32, H. 4, S. 282301. Reckwitz, A. (2004): Die Reproduktion und die Subversion sozialer Praktiken. Zugleich ein Kommentar zu Pierre Bourdieu und Judith Butler. In: Hörning K. H. (Hg.): Doing Culture. Zum Begriff der Praxis in der gegenwärtigen soziologischen Theorie. Bielefeld: transcript. S. 40-54. Reckwitz, A. (2006): Das hybride Subjekt. Eine Theorie der Subjektkulturen von der bürgerlichen Moderne zur Postmoderne. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Reh, S./Fritzsche, B./Idel, T. S./Rabenstein, K. (Hg.) (2015): Lernkulturen: Rekonstruktion pädagogischer Praktiken an Ganztagsschulen. Wiesbaden: Springer VS. Reichertz, J. (1991): Objektive Hermeneutik. In: Flick, U./Kardoff, E./Keupp, H./Rosenstiel, L./Wolff, S. (Hg.): Handbuch qualitative Sozialforschung: Grundlagen, Konzepte, Methoden und Anwendungen. München: Beltz. S. 223492. Richter, S./Friebertshäuser, B. (2012). Der schulische Trainingsraum–Ethnographische Collage als empirische, theoretische und methodologische Herausforderung. In: Friebertshäuser, B./Kelle, H./Boller, H./Bollig, S./Huf, Ch./Langer, A.(Hg.): Feld und Theorie. Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Ethnographie. Opladen: 71-88. Ricken, N. (2015): Bildung als Dispositiv. Bemerkungen zur (Macht-)Logik eines Subjektivierungsmusters. In: Medien–Bildung–Dispositive. Wiesbaden: Springer. S. 41-58. Ricken, N./Balzer, N. (Hg.) (2012): Judith Butler: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Springer VS. Ricken, N./Rieger-Ladich, M. (Hg.) (2004): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Springer VS. Riegel, C. (2016): Bildung, Intersektionalität, Othering. Pädagogisches Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen. Bielefeld: transcript.
Literatur
Riegel, C. (2017): Othering in der Bildungsarbeit. Zu pädagogischem Handeln in widersprüchlichen Verhältnissen. In: Außerschulische Bildung (2017) 2, S. 16-22. Rousseau J.-J. [1762] (1983): Emile oder über die Erziehung. Stuttgart: Reclam. Ryle, G. [1971] (2005): The thinking of thoughts. In: Gilbert Ryle – Collected Papers 2. London/New York: Routledge. P. 494-510. Sachs, C. (1933). Eine Weltgeschichte des Tanzes. (3. Nachdr. der Ausg. Berlin 1933) Hildesheim: Olms. Said, E. (1978): Orientalism. New York: Pantheon. Sarasin, P. (2005): Michel Foucault zur Einführung. Hamburg: Junius. Seel, M. (2000): Ästhetik des Erscheinens. München/Wien: Hanser. Schäfer, A. (2004): Macht – ein pädagogischer Grundbegriff? In: Ricken, N./Rieger-Ladich, M. (Hg.): Michel Foucault: Pädagogische Lektüren. Wiesbaden: Springer VS. S. 15-35. Scharathow, W. (2014): Risiken des Widerstandes, Jugendliche und ihre Rassismuserfahrungen, Bielefeld: transcript. Schatzki, T. R. (1996). Social practices: A Wittgensteinian approach to human activity and the social. Cambridge University Press. Scherchen, H. [1981] (2011): Handbuch des Dirigierens. Mainz: Schott. Schicke, C./Brylla, B. (2005): Projektbericht: Sitzordnungen im Vergleich – Auswirkungen verschiedener Sitzordnungen innerhalb eines Klassenraums auf das Lernklima einer dritten Klasse einer Grundschule. www.politik-lernen.at/dl/ mnurJKJKoMmKOJqx4KJK/projektberichtsitzordnungen.pdf [abgerufen 29.01.2018]. Schmidtke, A. (2008): Körper und Erziehung in historischer Perspektive: Theorien, Befunde und methodische Zugänge – ein Forschungsüberblick. Göttingen: Pädagogisches Seminar der Georg-August-Universität.http://webdoc.sub.gw dg.de/pub/mon/2008/schmidtke.pdf [abgerufen: 05.10.2018] Schulte, K./Hartig, J./Pietsch, M. (2014): Der Sozialindex für Hamburger Schulen. In: Fickermann, D./Maritzen, N. (Hg.): HANSE – Hamburger Schriften zur Qualität im Bildungswesen. Bd. 13: Grundlagen für eine datenund theoriegestützte Schulentwicklung. Konzeption und Anspruch des Hamburger Instituts für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung (IfBQ), Münster: Waxmann, S. 67-80. Sgritta, G.B. (1987): Childhood: Normalization and project. In: The Sociology of Childhood, edited by J. Qvortrup, International Journal of Sociology, 17(3), P. 38-57.
193
194
Choreographien der Homogenisierung
Siegmund, G. (2010): Choreographie und Gesetz: Zur Notwendigkeit des Widerstands. In: Haitzinger, N./Fenböck, K. (Hg.): Denkfiguren. Performatives zwischen Bewegen, Schreiben und Erfinden. München: epodium. S. 118-12. Spivak, G. C. (1985): The Rani of Sirmur: an essay in reading the archives. In: History and Theory, 24 (3), Pp. 247-272. Stechow, E. von (2004): Erziehung zur Normalität. Eine Geschichte der Ordnung und Normalisierung der Kindheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. Stingelin, M. (Hg.) (2009): absolute Michel Foucault. Freiburg: orange press. Stöger, H./Ziegler, A. (2013): Heterogenität und Inklusive im Unterricht. Schulpädagogik heute, 4.Jg, Heft 7, S. 1-31. Stošić, P. (2016): Kinder mit ›Migrationshintergrund‹ – Reflexionen einer (erziehungs-)wissenschaftlichen Differenzkategorie. In: Diehm, I./Kuhn, M./Machold, C. (Hg.): Differenz – Ungleichheit – Erziehungswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 81-99. Tervooren, A./Engel, N./Göhlich, M./Miethe, I./Reh, S. (Hg.) (2014): Ethnographie und Differenz in pädagogischen Feldern. Internationale Entwicklungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. Bielefeld: transcript. Thomas, K. (1977): DuMont’s kleines Sachwörterbuch zur Kunst des 20. Jahrhunderts. Von Anti-Kunst bis Zero. Köln: DuMont. Trautmann, M./Wischer, B. (2011): Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung. Wiesbaden: VS-Verlag. Treibel, A. (2004): Einführung in soziologische Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: Springer VS. Trouillot, M.-R. (1991): Anthropology and the Savage Slot: The Poetics and Politics of Otherness. In: Fox (ed.): Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa Fe: School of American Research Press. P17-44. Villa, P.-I. (2003): Judith Butler. Frankfurt a.M.: Campus. Waibl, E./Rainer, F.J. (2008): Basiswissen Philosophie in 1000 Fragen und Antworten. 2. Auflage. Wien: Facultas Verlag. Walby, S. (2004): The European Union and gender equality: Emergent varieties of gender regime. In: Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 11(1), P. 4-29. Wenning, M./Lutz, H. (2001): Unterschiedlich verschieden: Differenz in der Erziehungswissenschaft. Opladen: Leske + Budrich. Wernet, A. (2010): »Mein erstes Zeugnis« Zur Methode der Objektiven Hermeneutik und ihrer Bedeutung für die Rekonstruktion pädagogischer Handlungsprobleme. In: www.fallarchiv.uni-kassel.de/wpcontent
Literatur
/uploads/2010/07/wernet*objektive* hermeneutik.pdf [abgerufen: 17.11.2017]. West, C./Fenstermaker, S. (1995): Doing difference. In: Gender & Society, 9 (1), P. 8-37. Williams, J.C. (1991): Dissolving the Sameness/Difference Debate: A Post-Modern Path beyond Essentialism in Feminist and Critical Race Theory. Duke Law Journal 1991/2. P.296-323. Wischmann, A. (2010): Adoleszenz – Bildung – Anerkennung: Adoleszente Bildungsprozesse im Kontext sozialer Benachteiligung. Wiesbaden: VS. Wischmann, A./Riepe, V. (2017): Resistant agency in German lessons in primary education in Germany. In: Ethnography and Education, doi.org/10.10 80/17457823.2017.1405735 Wolff, S. (2000): Clifford Geertz. In: Flick, U./Kardoff, E./Steinke, I. (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg: rowohlt. S. 84-96. Wolter, J. (2018): Disziplinierungspraktiken in der Grundschule: Formalisierung sozialer Bezugnahme und Egalisierung von Differenz. In: Budde, J./Weuster, N. (Hg.): Erziehung in Schule: Persönlichkeitsbildung als Dispositiv. Wiesbaden: Springer VS. S. 93-114. Wortelkamp, I. (Hg.) (2012): Bewegung Lesen. Bewegung Schreiben. Berlin: Revolver. Wulf, C./Althans, B./Audehm, K./Bausch, C./Göhlich, M./Sting, S./Tervooren, A./Wulf, C./Zierfas, J. (2001): Das Soziale als Ritual: Perspektiven des Performativen. In: Wulf, C./Althans, B./Audehm, K./Bausch, C./Göhlich, M./Sting, S./Tervooren, A./Wagner-Willi, M./Zirfas, J.: Das Soziale als Ritual. Opladen: Lecke + Budrich. S. 339-347. Wulf C./Zirfas J. (2006): Bildung als performativer Prozess – ein neuer Fokus erziehungswissenschaftlicher Forschung. In: Fatke R., Merkens H. (Hg.): Bildung über die Lebenszeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. S. 291301. Wulf, C./Zirfas, J. (Hg.) (2007): Pädagogik des Performativen. Weinheim: Beltz. Zirfas, J./Jörissen, B. (2007): Phänomenologien der Identität. Human-, sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen. Wiesbaden: VS.
195
Pädagogik Kay Biesel, Felix Brandhorst, Regina Rätz, Hans-Ullrich Krause
Deutschland schützt seine Kinder! Eine Streitschrift zum Kinderschutz 2019, 242 S., kart., 1 SW-Abbildung 22,99 € (DE), 978-3-8376-4248-3 E-Book: 20,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4248-7 EPUB: 20,99 € (DE), ISBN 978-3-7328-4248-3
Karin Lackner, Lisa Schilhan, Christian Kaier (Hg.)
Publikationsberatung an Universitäten Ein Praxisleitfaden zum Aufbau publikationsunterstützender Services 2020, 396 S., kart., 14 SW-Abbildungen 39,00 € (DE), 978-3-8376-5072-3 E-Book: kostenlos erhältlich als Open-Access-Publikation PDF: ISBN 978-3-8394-5072-7 ISBN 978-3-7328-5072-3
Julia Heisig, Ivana Scharf, Heide Schönfeld
Kunstlabore: Für mehr Kunst in Schulen! Ein Ratgeber zur Qualität künstlerischer Arbeit in Schulen 2020, 216 S., Klappbroschur, durchgängig vierfarbig 27,99 € (DE), 978-3-8376-4985-7 E-Book: kostenlos erhältlich als Open-Access-Publikation PDF: ISBN 978-3-8394-4985-1
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
Pädagogik Nadja Köffler, Petra Steinmair-Pösel, Thomas Sojer, Peter Stöger (Hg.)
Bildung und Liebe Interdisziplinäre Perspektiven 2018, 412 S., kart., 11 SW-Abbildungen 39,99 € (DE), 978-3-8376-4359-6 E-Book: PDF: 39,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-4359-0
Joachim Willems (Hg.)
Religion in der Schule Pädagogische Praxis zwischen Diskriminierung und Anerkennung 2020, 432 S., kart. 39,00 € (DE), 978-3-8376-5355-7 E-Book: kostenlos erhältlich als Open-Access-Publikation PDF: ISBN 978-3-8394-5355-1
Ulaș Aktaș (Hg.)
Vulnerabilität Pädagogisch-ästhetische Beiträge zu Korporalität, Sozialität und Politik 2020, 194 S., kart., 26 SW-Abbildungen, 26 Farbabbildungen 39,00 € (DE), 978-3-8376-5444-8 E-Book: PDF: 38,99 € (DE), ISBN 978-3-8394-5444-2
Leseproben, weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.transcript-verlag.de
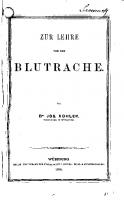

![Mathematiklernen in der Grundschule [2 ed.]
9783662608715](https://dokumen.pub/img/200x200/mathematiklernen-in-der-grundschule-2nbsped-9783662608715.jpg)







