Zweiheit statt Einheit: Versorgungsüberleitung Ost [1 ed.] 9783428545346, 9783428145348
Versäumnisse in der Vereinigungspolitik und ungelöste Konflikte in der gesellschaftlichen Entwicklung haben politische u
147 15 2MB
German Pages 243 Year 2015
Polecaj historie
Citation preview
Beiträge zur Politischen Wissenschaft Band 183
Zweiheit statt Einheit Versorgungsüberleitung Ost Von Werner Mäder
Duncker & Humblot · Berlin
WERNER MÄDER
Zweiheit statt Einheit
Beiträge zur Politischen Wissenschaft Band 183
Zweiheit statt Einheit Versorgungsüberleitung Ost
Von Werner Mäder
Duncker & Humblot · Berlin
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten
© 2015 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Fremddatenübernahme: Konrad Triltsch GmbH, Ochsenfurt Druck: buchbücher.de gmbh, Birkach Printed in Germany ISSN 0582-0421 ISBN 978-3-428-14534-8 (Print) ISBN 978-3-428-54534-6 (E-Book) ISBN 978-3-428-84534-7 (Print & E-Book) Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
Zur Würdigung des ungebrochenen Engagements von Ingeborg und Karl-Heinz Christoph
„Mit Recht also ist, wenn in allen Dingen das leichtfertige Urteil und die Unwissenheit verwerflich sind, die Kunst, die dergleichen beseitigt, eine Tugend genannt worden.“ Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.) aus: Vom höchsten Gut und vom größten Übel (De finibus bonorum et malorum libri quinque), III, 72 „Was wir freilich gegenwärtig in diesem Land erleben, ist noch nicht einmal jener Versuch richtigen Ausgleiches, sondern eher das Recht des Siegers, des Stärkeren sowohl über die Geschichte wie über die Güter eines anderen Landes.“ Friedrich Schorlemmer über Recht und Gerechtigkeit aus: Gerechtigkeit und Utopien …
Inhaltsverzeichnis A. Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 B. Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 C. Eine unendliche Geschichte … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 I. Von Gewinnern zu Verlierern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 II. Prozesse, Eingaben, Petitionen (1991 – 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 III. Bundestag – 16. Wahlperiode (2005 – 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 IV. Bundestag – 17. Legislaturperiode (2009 – 2013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 V. Vereinte Nationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 VI. Bundestag – 18. Wahlperiode (2013 – …) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 VII. Versöhnung und innere Einheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 D. Alterssicherungssysteme in Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 I. Das Alterssicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 1. Gesetzliche Rentenversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2. Zusatzversorgungssysteme, Gesamtversorgungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3. Gesamtversorgungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 4. Private Eigenvorsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 II. Das Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). 49 1. Allgemeine Sozialversicherung – Sozialversicherung und Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 a) Sozialpflichtversicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 b) Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2. Zusatzversorgungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3. Gesamtversorgungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 4. Eigene Altersvorsorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 I. Eigentum im europäischen Völkerrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 II. Bundesrepublik Deutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1. Eigentum nach Artikel 14 Abs. 1 GG als variabler Begriff . . . . . . . . . . . . . . 57 2. Bundesverfassungsgericht: Schwindende Eigentumsfreiheit . . . . . . . . . . . . . 59 3. Menschenrechtlicher Eigentumsbegriff vs. praktische Verfassung . . . . . . . . 61
10
Inhaltsverzeichnis 4. Eigentum durch Arbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 III. Einung, Übergang und Angleichung der Rechtsordnungen . . . . . . . . . . . . . . . . 63 1. Deutsche Demokratische Republik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2. Der Systemwechsel zur rechtsstaatlichen Ordnung in der DDR . . . . . . . . . . 64 a) Das Verfassungsgrundsätzegesetz vom 17. 6. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 aa) Zum Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 bb) Systemwechsel nach der Revolution von 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 b) Staatspolitische Einwendungen von westdeutscher Seite . . . . . . . . . . . . . 65 c) Vorrang des Völkerrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 I. Der Staatsvertrag vom 18. 5. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1. Zum sozialpolitischen und -rechtlichen Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2. Einwendungen von westdeutscher Seite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 3. Allgemeine Regeln des Völkerrechts als unmittelbar geltendes Recht . . . . . 71 II. Das Rentenangleichungsgesetz der DDR vom 28. 6. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 1. Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen der DDR . . 73 2. Der Rahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 3. Geltung des Befehls zur Anwendung des Grundgesetzes vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR am 3. 10. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 4. Rechtsangleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 a) Artikel 8 des Einigungsvertrages [Überleitung von Bundesrecht] . . . . . . 76 b) Art. 9 des Einigungsvertrages [Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 aa) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet F: Sozialversicherung (Allgemeine Vorschriften) Abschnitt III Nr. 8 zum EV: Rentenangleichungsgesetz der DDR vom 28. 6. 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 bb) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung Abschnitt III Nr. 6 zum EV: Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 (1) LSG Thüringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 (2) Zur Kontinuität trotz Verfassungswechsels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 cc) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung Abschnitt III Nr. 9 zum EV: Regelungen für Sonder- und Zusatzversorgungssysteme (Versorgungssysteme) . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 (1) Garantie des Bestandes der Ansprüche nach Art, Grund und Umfang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 (2) Zur Bedeutung der Beitragsleistungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 (3) Die Zahlbetragsgarantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 IV. Zwischenergebnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 V. Die sog. Systementscheidung und die Versorgungsüberführung . . . . . . . . . . . . 87
Inhaltsverzeichnis
11
VI. Schlussfolgerungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 G. Wende rückwärts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 1. Verfassungsrechtliche Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2. Das Renten-Überleitungsgesetz vom 25. 7. 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 a) Der Rentenzugriff des AAÜG als strafgleiche Sanktion . . . . . . . . . . . . . . 95 aa) „Staatsnahe“ Versorgungssysteme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 bb) „Staatsnahe“ Tätigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 cc) Ausnahme-Exemtionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 dd) Versorgungssystem des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 b) Begrenzung der Rentenzahlbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3. Das Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (Rü-ErgG) von 1993 . . . . . . . . . 100 II. Gesetzliche Novation: eine sozialversicherungsfremde Rechtsfigur . . . . . . . . . 102 1. Gesetzliche Novation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2. Wende rückwärts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 III. Erneute Teilung nach der „Einigung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 H. Ein Schritt vorwärts: Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 I. Verletzung des Eigentumsgrundrechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 II. Die Zahlbetragsgarantie und Dynamisierung der Versorgungsbeträge . . . . . . . 115 I. Zwischenbilanz 1991/1993: Fall eines Konzepts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 I. Die wissenschaftliche Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 1. Zahlbetragsgarantie (Leiturteil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 2. Staats- und Systemnähe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 3. Ministerium für Staatsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 4. Versicherungsbiographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 III. Grundrechtsschutz der Zusatz- und Sonderversorgungsberechtigten . . . . . . . . 129 J. Wende rückwärts II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 I. Bundesgesetzgebung II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 1. Das AAÜG-Änderungsgesetz (AAÜG-ÄndG) von 1996 . . . . . . . . . . . . . . . 131 2. Das 2. AAÜG-Änderungsgesetz von 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2004/2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 1. Staats- und Systemnähe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2. Hin – und – Her . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 3. Balletttänzer/innen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 4. Auffüllbeträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
12
Inhaltsverzeichnis
K. Rentenstrafrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 I. Politische Vorgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 II. Verfassungswidrigkeit der Renten„konfiskation“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 III. Systemwidrigkeit des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes . . 141 IV. Eigentum im Völkerrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 L. Bundesgesetzgebung III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 I. Das 1. AAÜG-Änderungsgesetz von 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 1. Recht-Sprechung der Sozialgerichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 a) Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 b) Überhöhte Entgelte? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 c) Kadernomenklatur oder Selbstprivilegierung? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 d) Staats- und Systemnähe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 e) Sonstige Privilegien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 f) Berufsbiographie eines Ministers der DDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 g) Wahrung des Rechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 2. Rechtsprechung „Im Namen der Regierung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 a) Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 b) Einbindung in das System der Überwachung und Informationsbeschaffung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 c) „System der Selbstprivilegierung“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 d) Andere Privilegien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 e) Kommentar der Betroffenen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 M. Machtpolitik vs. Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 I. Die Bundesregierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 II. Der Bundesgesetzgeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 III. Das Bundesverfassungsgericht: Zum Beschluss vom 6. 7. 2010 . . . . . . . . . . . . 164 N. Vergangenheit, die nicht vergeht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 I. Afterdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 II. Verlust der Rechtskultur im Zwange des Zeitgeistes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 III. Zum Ideal einer „lebendigen Demokratie“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 1. Staatsrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 2. Sphären der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 3. „Kreativer Umgang“ mit Grundrechten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 a) Aus alter Zeit … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 b) Abgesang auf den Dreiklang „Staat – Freiheit – Eigentum“ . . . . . . . . . . 188
Inhaltsverzeichnis
13
O. Das Gesicht eines Machtstaates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 P. Hoffnung aus der Welt der Wunder? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Sachwortverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
A. Einführung Die Bundeskanzlerin hat wiederholt auf große Veränderungen und Erfolge seit der Vereinigung der beiden Staaten auf deutschem Boden, der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, zu Recht hingewiesen. Trotz der beachtlichen, in einem zusammenwachsenden Europa vollbrachten Leistungen, die ihresgleichen suchen, hat die Bundeskanzlerin aufgefordert, bisher nicht gelösten Fragen Aufmerksamkeit zu schenken und möglichst bald einer Lösung zuzuführen, sind doch immerhin zwei Jahrzehnte vergangen, in denen Unbewältigtes nicht bewältigt wurde. Das findet Zuspruch, und viele Menschen aus der DDR sind ihr für eine solche Position dankbar. Jedoch, vieles was mit der Einigung versprochen wurde, ist aber leider bis heute offen.1 Die Gleichheit der Rentenansprüche sollte noch in den 90er Jahren hergestellt werden. Sie ist bis heute zum Nachteil von einstigen DDR-Bürgern noch immer nicht verwirklicht. In vielen Verfahren und Prozessen wurde gegen die ungleiche, diskriminierende Unterscheidung vorgegangen. Eine besondere Rolle spielt dabei die „Versorgungsüberleitung Ost“. Der Kreis der nach wie vor Betroffenen ist groß und schließt eine ganze Reihe unterschiedlicher Berufsgruppen ein. Eisenbahner, Balletttänzer, Krankenhausschwestern und viel andere mehr gehören dazu. Nach dem Einigungsvertrag (EV)2 sind Ansprüche aus den Versorgungssystemen der DDR „nach Art, Grund und Umfang“ nach den allgemeinen Regeln der Sozialversicherung in dem Beitrittsgebiet unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragsleistungen anzupassen. Der Einigungsvertrag in Fortsetzung des Staatsvertrages
1
So auch Hans Modrow (vom November 1989 bis April 1990 Ministerpräsident der DDR), „Zweiheit“ statt Einheit. Hans Modrow kritisiert im Brief an Angela Merkel die Ost-WestUngerechtigkeit, in: ND vom 16. 4. 2012, S. 3. – Vgl. auch Gertrud Höhler, Die Patin – Wie Angela Merkel Deutschland umbaut, 2012: „Wer Normen und Werte einer demokratischen Gesellschaft zur Manövriermasse macht wie Angela Merkel, der arbeitet am Zerfall der Demokratie.“ 2 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands – Einigungsvertrag (EV) – vom 31. 8. 1990 (BGBl. II S. 889). – Die Zustimmung zum Einigungsvertrag ist mit dem Vertragsgesetz vom 23. 9. 1990 (BGBl. II S. 885) erfolgt. Der Einigungsvertrag ist am 29. 9. 1990 in Kraft getreten.
16
A. Einführung
(StV)3 gibt damit eine Garantie der erworbenen Rechte. Wenn diese Garantie, wie geschehen, nicht eingelöst wird – die Bundesgesetzgebung hatte alle Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen „liquidiert“ -, ist es verständlich, wenn viele Menschen keine Einheit, sondern eine „Zweiheit“ erleben und die berechtigte Auffassung haben, Bürger zweiter Klasse zu sein.4 Als der erste gesamtdeutsche Bundestag sich im Dezember 1990 konstituierte und der Alterspräsident Willy Brandt bekannte, dass nun zusammenwachsen möge, was zusammen gehört, hat er Erwartungen und Hoffnungen vieler Menschen, die in der DDR gelebt haben, zum Ausdruck gebracht. Hans Modrow an die Adresse der Bundeskanzlerin Merkel: „Ausdruck dessen ist heute für viele Menschen auch die Tatsache, dass Sie mit Ihrem der DDR nahen Elternhaus, mit einer soliden Ausbildung und Förderung in der und durch die Gesellschaft der DDR heute das hohe Amt der deutschen Bundeskanzlerin im vereinigten Deutschland ausüben.“5 Unvergessen bleibt die Botschaft des Bundeskanzlers Helmut Kohl von „blühenden Landschaften“ in Mitteldeutschland binnen fünf Jahren. Und so versprach seinerzeit der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Norbert Blüm, dass es jedem DDR-Bürger nach der Einigung nicht schlechter, eher besser gehen werde. Die Versprechen und damit geweckten Erwartungen wurden für einen großen Teil der DDR-Bürger nicht erfüllt. Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat nach der Einigung 1990 alle Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen der DDR zur Alterssicherung beseitigt und die betroffenen ehemaligen DDR-Bürger auf die minimale Rente aus der westdeutschen gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Sozialgesetzbuch herabgestuft. Nachdem anfangs das Bundesverfassungsgericht 1999 noch bereit war, den Betroffenen das Eigentumsgrundrecht aus Artikel 14 des Grundgesetzes zuzugestehen, hat es in der Folgezeit unter seinem Präsidenten Papier – in Kehrtwendung – einen Schutz für die alten, in der DDR rechtmäßig erworbenen Ansprüche verneint. Damit ist die Versorgungsüberleitung Ost zu einem Dauerproblem bis in die heutigen Tage geworden, zumal das Parlament als Bundesgesetzgeber nicht bereit ist, wider besseres Wissen die allseitig beklagten Ungerechtigkeiten zu beseitigen.
3 Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18. 5. 1990 (BGBl. II S. 537). – Die Zustimmung zu dem Vertragsgesetz ist mit Gesetz vom 25. 6. 1990 erfolgt (BGBl. II S. 518). Der Staatsvertrag ist am 30. 6. 1990 in Kraft getreten (BGBl. II S. 700). 4 H. Modrow, „Zweiheit“ statt Einheit, in: ND vom 16. 4. 2012, S. 3. – Vgl. auch: Kirchlicher Herausgeberkreis, Jahrbuch Gerechtigkeit: Zerrissenes Land. Perspektiven der deutschen Einheit, in: Jahrbuch Gerechtigkeit III, Oberursel November 2007. Die Herausgeber stellten fest: „Tiefe Risse gehen durch unser Land.“ und erklären: „Der Riss zwischen West- und Ostdeutschland ist noch längst nicht geschlossen.“, S. 7. 5 H. Modrow, „Zweiheit“ statt Einheit.
A. Einführung
17
So sah sich auch jüngst der UN-Ausschuss für die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Angelegenheiten in seinem Staatenbericht zur Bundesrepublik Deutschland zu der Rüge veranlasst für die Fälle, in denen das Rentenrecht zur politischen und sozialen Diskriminierung genutzt wird.6 Diese Aussage hat er unter Punkt 22 seiner abschließenden Bemerkungen präzisiert, in dem er sich besorgt zeigte „über die Diskriminierung hinsichtlich der Rechte über soziale Sicherheit zwischen den östlichen und westlichen (Bundes-)Ländern, wie sie in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 20107 über die Renten der (DDR-)Minister und stellvertretenden Minister zum Ausdruck kommt“. Entgegen den wohlfeilen politischen Erklärungen bundesdeutscher Politiker hat es die Bundesregierung angesichts der Bedeutung und des allgemein anerkannten Wirkens der UN und ihrer Ausschüsse bisher pflichtwidrig unterlassen, mit ihrer Mehrheit im Bundestag die gerügte Gesetzgebung zu korrigieren, den Verstoß gegen den Einigungsvertrag zu beenden, dem Grundgesetz zu folgen, in dem es heißt: „Das Eigentum … wird gewährleistet. (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) und „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ (Art. 3 Abs. 1 GG), und geschaffenes Unrecht aufzuheben. Nichts dergleichen wurde auf den Weg gebracht. So setzt sich das Übel auch im 3. Jahrzehnt nach der Einigung fort. Abertausende ehemalige deutsche Bürger aus der DDR müssen durch die Enteignung ihrer Rentenansprüche am Rande des Existenzminimums leben, während die Bundesregierung unzählige Milliarden Euro, zuletzt über den unbefristeten Rettungsschirm (ESM-Vertrag und Fiskalpakt), in das europäische Ausland und an die Finanzoligarchie transferiert.8 Das eigene Volk gilt nichts.
6 Der Ausschuss zeigte sich im Mai 2011 besorgt über die Diskriminierung in Ostdeutschland, wie sie im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 6. 7. 2010 über die Versorgungsansprüche ehemaliger Minister und stellvertretender Minister der DDR zum Ausdruck kommt. Vgl. Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 46. Tagung, Prüfung der Staatenberichte nach den Artikeln 16 und 17 des Paktes, Punkt 22, Übersetzung des BMA nach der englischen Originalfassung vom 12. 7. 2011. 7 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010 – 1 BvL 9/06, 2/08 – BVerfGE 126, 233 – 268. 8 Vgl. statt aller allumfassend Karl Albrecht Schachtschneider, Die Rechtswidrigkeit der Euro-Rettungspolitik. Ein Staatsstreich der politischen Klasse, 1. Aufl., Rottenburg 2011; Friedrich Romig, ESM-Verfassungsputsch in Europa, Schnellroda 2012.
B. Einleitung Bis zur Einigung Deutschlands war für die Deutschen in der alten Bundesrepublik die Lage in der Deutschen Demokratischen Republik weitgehend unbekannt. Dies gilt für viele bedeutende Bereiche, für die mentalen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen, realpolitischen, staatssicherheitsorganisatorischen, aber auch für die kulturellen Verhältnisse.1 Die Begegnungen der Menschen konzentrierten sich vornehmlich auf die private Sphäre (Verwandtenkontakte und –besuche) und auf parteipolitische Verbindungen. Das Geschichtsbild der meisten Menschen war auf die Mauer, den Schießbefehl und die Frontstadt Berlin reduziert. Bis heute werden ehemalige DDR-Bürger als „Ossis“ herabqualifiziert. Nicht anders verhielt es sich mit der westdeutschen Politischen Klasse, deren Blickwinkel auf den „Unrechtsstaat“ DDR fokussiert war und weiterhin ist, und die sich auf den Vorwurf konzentrierte, ein wirtschaftlich und moralisch abgewirtschaftetes System habe in die Einigung nichts eingebracht und könne deshalb keine Ansprüche geltend machen. Diese einseitige Schwarz-Weiß-Malerei und Einteilung in Böse und Gut hat ihre Erkenntnis blockiert, dass die Dinge doch differenziert beurteilt werden müssen. Diese Erkenntnis wollten und konnten sie sich nicht verschaffen, zumal unmittelbar nach der Einigung die letzten Mitglieder der letzten DDR-Regierungen von der westdeutschen Politischen Klasse an den Rand gedrängt wurden, so dass sie ihre Erfahrungen nicht einbringen konnten. Eine Siegermentalität hatte sich breit gemacht.2 *** Bundeskanzler Kohl kam die deutsche Einheit wie ein Wunder. Gegen Ende der achtziger Jahre hatte er politisch abgewirtschaftet. Wahlforscher sagten seine Abwahl bei der Bundestagswahl 1999 voraus. Die Chance der Wiedervereinigung, die Kohl geschickt zu nutzen wusste, brachte ihm dann politisch „die zweite Luft“. 1
Hierzu Christian Zak/Werner Mäder, Vor und nach der Revolution. Von der Doppelkultur der DDR zu antagonistischer Solidarität, in: ZFSH/SGB 3/2002, S. 142 – 150, und 4/2002, S. 195 – 200. 2 Vgl. z. B. Ralph Hartmann, DDR-Legenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, 2009; ders., Die DDR unter dem Lügenberg, 3. Aufl., 2008; ders., Die Liquidatoren, 3. Aufl., 2008, S. 39 – 53 „Wahlhelfer; Klaus Blessing u. a., Die Schulden des Westens. Wie der Osten Deutschlands ausgeplündert wird, Berlin 2006 (Selbstverlag; www.klaus-blessing.de); Siegfried Wenzel, Was kostet die Wiedervereinigung?, Berlin 2003; vgl. ferner Werner Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 186 – 189.
B. Einleitung
19
Wirtschaftlich war das ganze ein billionenschwerer Fehlschlag, was auch zu Lasten des „Beitrittsgebietes“ und seiner Bevölkerung ging. Das lag auch daran, dass weder Kohl noch sein Finanzminister Theo Weigel oder sein Wirtschaftsminister Helmut Hausmann (1988 bis Januar 1991) und Jürgen Möllemann (1991 bis 1993) wirklich wirtschaftliches Verständnis und Bildung besaßen. Die Einigung glich einem Blindflug im Nebel ohne Navigationsinstrumente. „Ökonomisch wurde alles falsch gemacht, was falsch gemacht werden konnte. Für diese Ignoranz der politischen Spitze muss ein ganzes Land generationenlang büßen.“3 Insbesondere bei den durch die Bundesregierung initiierten Gesetzgebungsmaßnahmen für das Beitrittsgebiet und seine Bürger wurden falsche Einschätzungen der Sach- und Rechtslage zugrunde gelegt, insbesondere – wäre die DDR bankrott, also zahlungsunfähig gewesen; – wäre die DDR-Wirtschaft durchgängig marode gewesen und hätte keinen Tag länger bestehen können; – hätten die Renten bzw. Alterseinkommen von der DDR nicht weitergezahlt werden können. Insgesamt wurden die Leistungen der DDR und ihrer Bürger nach dem Fall der Mauer und vor dem „Beitritt“ diskreditiert. Das sind bis heute noch wesensbestimmende, die Situation der DDR vor der Wende und die DDR-Bürger diskriminierende Positionen. Davon ausgehend werden seitdem für in Deutschland negative Erscheinungen als Schuldige die DDR und ihre Bürger ausgemacht, denen z. B. zu hohe Einkommen oder zu hohe Renten gewährt würden und von denen viele privilegiert gewesen wären. *** Tatsächlich war die Lage anders, wie sich aus Äußerungen von Personen entnehmen lässt, die die Entwicklung 1989/1990 selbst mit gestaltet haben. So hat sich der Direktor der Staatsbank der DDR Most, der anschließend Bankdirektor bei der Deutschen Bundesbank war, definitiv zu diesen Problemen in einem Buch geäußert.4 Ferner konnte der Wirtschaftsminister aus der De Maizière-Regierung Pohl die Lage realitätsgerecht beurteilen, und zwar aus seiner Sicht als Minister, Mittelständler in 3 Hans Herbert von Arnin, Die Deutschlandakte. Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun, 1. Aufl., 2009, S. 250; vgl. auch Wilhelm Hankel, Ohne ökonomischen Sachverstand. Helmut Kohl wird 80. Dem Kanzler fehlte der Blick für das Machbare, in: JF 14/ 10 vom 2. 4. 2010, S. 9; vgl. ferner Thorsten Hinz, Der Sprung ins Dunkle. Warum Helmut Kohl die D-Mark preisgab, in: JF Nr. 37/12 vom 7. 9. 2012, S. 18. 4 Edgar Most, Fünfzig Jahre im Auftrag des Kapitals. Gibt es einen dritten Weg?, 2. Aufl., Berlin 2009; vgl..www.das-neue-berlin.de.
20
B. Einleitung
der DDR und danach mittelständischer Unternehmer sowie Angehöriger verschiedener mittelständischer Vereinigungen. Insbesondere belegen die Erläuterungen des Bankiers Most, dass die FinanzBilanz des Staates und die Kreditbilanz der Staatsbank „die langlebige Meinung, die DDR wäre ohnehin bankrott gewesen“, nicht belegen, dass auch die Renten hätten weiter gezahlt werden können.5 Von Regierungsseite wurde erklärt, die Bundesregierung sei im übrigen nicht verpflichtet, Ungerechtigkeiten oder Verfassungsverstöße der DDR zu korrigieren. Das lenkt einerseits davon ab, dass die Bundesrepublik angetreten war, rechtsstaatliche Verhältnisse für die DDR-Bürger besser durchzusetzen als die DDR, und es verschleiert andererseits, dass die Ungerechtigkeiten bei den Alterseinkommen nicht auf Nachwirkungen des DDR-Rechts, sondern auf den Auswirkungen des RentenÜberleitungsgesetzes nach der Einigung beruhen.6 Hierbei handelt es sich nicht lediglich um bloße Mutmaßungen verdrossener ehemaliger DDR-Bürger. Politische Erklärungen gingen anlässlich der Einigung in eine andere Richtung. So hatte der frühere Bundeskanzler Kohl, unbeschadet der Kenntnis der realen Lage der DDR, „blühende Landschaften“ für das Beitrittsgebiet innerhalb von fünf Jahren versprochen. In seiner politischen Karriere hatte er immer wieder betont, dass für ihn „Wort halten“ und Verlässlichkeit einen hohen Stellenwert haben. Es war eindeutiger Wille der Bundesregierung, den Bewohnern in der DDR „die Chance auf eine rasche, durchgreifende Verbesserung ihrer Lebensbedingungen“ zu eröffnen.7 Bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag war es der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung Blüm, der „die sozialen Errungenschaften des Westens auf das Beitrittsgebiet übertragen“ wollte.8 Mit dem Ziel einer Verbesserung der sozialen Lage für die Bewohner der DDR ist ein erheblicher Eingriff in den „sozialen Besitzstand“ nicht zu vereinbaren, weshalb die Garantie der „erworbenen“ Ansprüche und Anwartschaften das nach DDR-Recht „Erworbene“ meinen muss, ohne Rücksicht, ob der Erwerb mit der „reinen“ Sozialversicherungslehre der Bundesrepublik vereinbar war.9 Der im Staatsvertrag und im Einigungsvertrag garantierte Bestand an Rechten, Ansprüchen und Anwartschaften als „Ergebnisschutz“10 wird zusätzlich untermauert durch die im Einigungsvertrag enthaltene Zahlbetragsgarantie (Art. 9 Abs. 2 EV i.V.m. Anl. II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b Satz 4). Die Zahlbetragsgarantie überlagert und ergänzt die Garantie der erworbenen Versor5
Ebd., bes. S. 9 – 11, 258 ff. Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 151/152. 7 So die weitere Erklärung des Bundeskanzlers Dr. Kohl anlässlich der Unterzeichnung des Staatsvertrages, abgedr. bei Stern/Schmidt-Bleibtreu, Staatsvertrag, 1990, S. 321 ff. (322). 8 Vgl. Wolfgang Schäuble, Der Vertrag, 1991, S. 154. 9 Detlef Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung. Zur Erstreckung westdeutschen Rentenversicherungsrechts auf die neuen Länder, 2. Aufl., 1994, S. 83. 10 Ebd., S. 82 ff. 6
B. Einleitung
21
gung.11 Sie soll eine Absenkung des sozialen Besitzstandes vermeiden. Die Sicherung des Zahlbetrages setzt das Versprechen um, das in der Regierungserklärung zum Staatsvertrag abgegeben wurde: „Den Deutschen in der DDR“, so Kohl, „kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Maizière betont hat: Es wird niemanden schlechter gehen als zuvor – dafür vielmehr besser.“12 Bei allem vollmündigen Wortgeklingel ist es geblieben. Die Landschaften sind nicht flächendeckend „erblüht“, partiell verödet. Eine allgemeine Landflucht aus Mitteldeutschland – wie zu Zeiten der DDR – besteht unvermindert fort,13 auch eine Folge der Deindustrialisierung.14 Die Beschäftigten in den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen mussten vergebens jahrzehntelang gegen die Liquidierung oder nachhaltige Beeinträchtigung ihrer Rechte vor Gerichten kämpfen. Bundesregierung, ihre Exekutive und die von ihr beherrschte Legislative15 haben die Vorgaben des Staatsvertrages und Einigungsvertrages nicht umgesetzt. Vielmehr wurde aus dem Hause des Nachfolgers vom ehemaligen Arbeits- und Sozialminister Blüm das Gutachten von Prof. Papier, dem späteren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, in Auftrag gegeben mit dem Ziel, alle Ansprüche abzuwehren.16 Nachdem Kohl wiedergewählt worden war, die Regierungspolitik fest im Griff hatte, störten ihn „die Reden von gestern“ nicht mehr. Der Bürger hingegen erinnert sich an die Erklärungen und Zusagen, mag auch die Politik in unserer schnelllebigen Zeit vom Gegenteil ausgehen. Erweckte Erwartungen, die enttäuscht werden, sind der Humus für Politikverdrossenheit.17 *** In das Reich einer Erzählung gehört auch, wenn von Regierungsseite der Vorwurf laut wird, die DDR habe wirtschaftlich abgewirtschaftet, sei praktisch „pleite“ ge11
Ebd., S. 84 ff. Regierungserklärung des Bundeskanzlers Dr. Kohl zum Staatsvertrag anlässlich der abschließenden Beratung des Vertragsgesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 21. 6. 1990, abgedr. bei Stern/Schmidt-Bleibtreu, Staatsvertrag, S. 347 ff. (348). 13 W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 168 – 171. 14 Ebd., S. 153 f. 15 Vgl. hierzu Karl Albrecht Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, in: Dietrich Murswik u. a. (Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, FS für Helmut Quaritsch zum 70. Geburtstag, 2000, S. 141 – 161; ferner Hans Herbert von Arnim, Politische Parteien im Wandel. Ihre Entwicklung zu wettbewerbsbeschränkenden Staatsparteien – und was daraus folgt, Berlin 2011, mit umfangreichem Literaturnachweis, S. 89 – 94. 16 Hans Jürgen Papier, Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, 1994 (Forschungsbericht Nr. 238 des BMA). 17 Vgl. auch Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (1911), 2. Aufl., 1925/ 1970; K. A. Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, S. 141 – 161. 12
22
B. Einleitung
wesen. Es gehört dazu schon ein gerüttelt Maß an Gegenwartsverdrängung, dabei zu verschweigen, dass die Bundesrepublik immerhin 2 Billionen Euro Schulden aufzuweisen hat, die nicht einigungsbedingt aufgelaufen sind.18 Als weiteres Argument für die Beibehaltung der Enteignungen wurde auch – allerdings ohne weitere Information hierzu – erklärt, dass eine Anerkennung der Zusicherungen des EV nicht finanzierbare Leistungen zur Folge habe. Ausgeklammert bleibt, dass den späteren Transferleistungen von West nach Ost im Einigungsprozess eine umfassende Enteignung und Entrechtung der ehemaligen DDR-Bürger, eine Privatisierung des Volkseigentums zugunsten von Bürgern aus der Bundesrepublik (West) und aus anderen Ländern – also nicht an ehemalige DDRBürger – und eine maßlose Bereicherung der Bundesrepublik, bundesdeutscher Unternehmen und Institutionen des öffentlichen Bereichs vorausgegangen war.19 Eine amtliche Bilanz darüber wurde aus wohlweislichen Gründen nicht erstellt.20 Die Ostdeutschen haben die Bundesrepublik nicht ärmer, sondern reicher gemacht. „Aber wer, wie die Bundesregierung, die Armut der Braut als Ursache des schmal gewordenen Familienbudgets ausgeben will, darf den Reichtum der Mitgift nicht preisgeben. So ächzt sie denn ständig unter der ,Erblast‘ der DDR, die sie auf Heller und Pfennig ,berechnet‘, aber sich beharrlich weigert, eine Bestandsaufnahme des volkseigenen Gesamtvermögens der DDR vorzulegen.“21 Die Verantwortung für den einmaligen Absturz des Industrielandes und seine Folgen für ganz Deutschland tragen die Bundesregierung und politischen Kräfte, die gleich ob mit Jubel oder Skrupeln – ihre Politik der überstürzten Währungsunion und der Industriemontage durch die Treuhand22 mitgetragen haben und jetzt die ,schwere Erblast der DDR‘ beklagen. Zu der ansehnlichen Mitgift gehörte ein volkseigenes Wirtschaftsvermögen, das der Präsident der Treuhandanstalt Rohwedder bekanntlich mit 600 Milliarden DM bezifferte. Fünf Jahre später, im Jahresgutachten der sogenannten Fünf Weisen, wurde diese Angabe präzisiert. Danach betrug der Anfangskapitalbestand der mitteldeutschen Unternehmen zum 30. 6. 1990 rund 584 Milliarden DM. Wenn die mit seiner Verwertung betraute Treuhandanstalt das wahrhaft einmalige Kunststück fertiggebracht hat, aus dieser riesigen Mitgift in nur wenigen Jahren einen Schuldenberg zu machen, ist dies nicht der DDR anzulasten. Zwischen dem 600-Milliarden-Reichtum von Rohweder und den 256-Milliarden-Schuldenberg der Frau Breuel besteht eine Differenz von 856 Milliarden, in Zahlen: 856.000.000.000.23 18
Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 106. Zur Bodenreform vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 176 ff. 20 Aufschlussreich und durch Quellen unterlegt das Buch von Ralph Hartmann, Die Liquidatoren. Der Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland, 3. Aufl., 2008. – Der Autor stellt die Rolle der Treuhandanstalt dar. 21 Ebd., S. 123 ff. 22 Ebd., S. 119 f. 23 Ebd., S. 117 f., 133. 19
B. Einleitung
23
Das mittlerweile verschleuderte Treuhandeigentum bildete dabei nur einen und dazu geringen Teil der DDR-Mitgift. Laut Rohwedder gehörten der Anstalt nicht einmal die Hälfte, sondern nur 40 Prozent des DDR-Vermögens. Über die restlichen 60 Prozent hüllen sich die „Mitgiftjäger“ am liebsten in Schweigen. Dabei handelt es sich um ein Vermögen von rund 800 Milliarden DM, zu dem u. a. die volkseigenen Wohnungen, die hohe Zahl von Gebäuden und Grundstücken zentraler und lokaler staatlichen Einrichtungen, einschließlich der bewaffneten Organe, die Sondervermögen der Deutschen Reichsbahn24 und der Deutschen Post, die Botschaften und Residenzen in aller Welt sowie das andere Auslandsvermögen gehörten. Das alles haben die DDR-Bürger, Deutsche, in die Einheit eingebracht. Seriöse Wirtschaftswissenschaftler stimmen auch darin überein, dass die Ökonomie der DDR trotz Missstände und Disproportionen 1989/1990 keinesfalls vor einem baldigen Zusammenbruch stand. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dem in Fragen der DDR-Wirtschaft in der Bundesrepublik die größte Sachkunde und Objektivität beigemessen wurde, konstatierte noch 1987: „Die DDR ist im RGW überhaupt das Land mit dem höchsten Leistungsniveau (und damit auch das mit dem höchsten individuellen Lebensstandard).25 Anfang 1984 war das Institut nach einer Analyse der Veränderungen im Planungs- und Wirtschaftssystem der DDR zu der Einschätzung gelangt: „Insgesamt ist der jetzige Wirtschaftsmechanismus aber zweifellos für die Lösung der gegenwärtigen Probleme angemessener und leistungsfähiger als das System der siebziger Jahre. Deshalb kann auch ein gewisser Erfolg erwartet werden.“26 Und noch Mitte 1989 registrierte es „bessere Ergebnisse bei der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und der Senkung des spezifischen Produktionsverbrauchs“.27 Zum 1. 7. 1990 betrugen die internen Schulden des DDR Staatshaushalts 28 Milliarden DM, die Wohnungsbaukredite, die ebenfalls Verbindlichkeiten des Staatshaushalts waren, 38 Milliarden DM und die Netto-Auslandsverschuldung 20,3 Milliarden DM. Damit hat die DDR eine Gesamtschuld von 86,3 Milliarden in die staatliche Einheit eingebracht. Die Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik belief sich zum selben Zeitpunkt auf annähernd 1 Billion DM, genauer auf 994 Milliarden DM. „Die ach so verschuldete ostdeutsche Braut hatte sich mit einem über beide Ohren Verschuldeten eingelassen.“28 So wird verständlich, dass die Bundesregierung mit DDR-Vermögen die prekäre Situation des eigenen Staatshaushalts aufbessern konnte, wobei sie tunlichst die Erstellung
24
Allein in Berlin umfasste das Grundeigentum der Deutschen Reichsbahn etwa die Fläche eines Berliner Bezirks. 25 DIW-Vierteljahreshefte 1 – 2/1987, S. 81. 26 DIW-Vierteljahreshefte 2/1984, S. 220. 27 DIW-Vierteljahreshefte 31/1989. 28 R. Hartmann, Die Liquidatoren, S. 128. – Zur Verschuldung der Bundesrepublik vgl. auch Bernd Thomas Ramb, Vor der nächsten Währungs-„Reform“, Dossier, Hamburg 2005.
24
B. Einleitung
einer Gesamtbilanz vermied.29 Die Landnahme der Bodenreformgrundstücke war Teil dieser Strategie.30 *** Mit der These vom „Unrechtsstaat“ und von der „Zweiten deutschen Diktatur“ sowie mit den damit verbundenen Absichten setzt sich Hartmann auseinander.31 Er benennt als eine Quelle den damaligen Justizminister Klaus Kinkel,32 der 1991 den Richtern und Staatsanwälten der Bundesrepublik vorgab: „Ich baue auf die deutsche Justiz. Es muss gelingen, das SED-Regime zu delegitimieren, das bis zum bitteren Ende seine Rechtfertigung aus antifaschistischer Gesinnung, angeblich höheren Werten und behaupteter absoluter Humanität hergeleitet hat, während es unter dem Deckmantel des Marxismus-Leninismus einen Staat aufbaute, der in weiten Bereichen genauso unmenschlich und schrecklich war wie das faschistische Deutschland.“ Hartmann stellt dazu fest: „Selten hat ein Mitglied der Bundesregierung die enge Verbindung zwischen der Gleichsetzung von NS-Regime und Unrechtsregime der DDR sowie Delegitimierung, Kriminalisierung der DDR und politischer Strafverfolgung so offen und präzise dargelegt wie Kinkel.“ Hartmann erläutert die Kinkelschen Positionen zu den Grundfragen dieser Politikrichtung und zum Bruch des Einigungsvertrages sowie des Grundgesetzes und legt auch andere aus dem Faschismus herrührende Quellen solcher Positionen offen.33 *** Die Zusatzversorgung der DDR sollte den Berechtigten einen prozentualen Teil des zuletzt erzielten Nettoeinkommen – in der Regel 90 v.H. – unter Anrechnung der Altersrente aus der Allgemeinen Sozialpflichtversicherung sichern. Die Rentenhöhe
29
R. Hartmann, Die Liquidatoren, S. 123 ff. W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 204. 31 Ralph Hartmann, DDR-Legenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, Berlin 2009. 32 Kinkel, früher nicht sehr erfolgreicher Chef des BND und Flügelmann für den Bruch des Einigungsvertrages, ist wie Professor Arnulf Baring, der die DDR-Bürger u. a. als „deutschsprachige Polen“ diffamierte, ein Schüler von Kissinger und Vorkämpfer für den Antikommunismus. Er wirkte nachhaltig auf für die DDR-Bürger negative Regelungen im Einigungsvertrag ein und betrieb intensiv den Bruch jener Bestimmungen, die die Grund- und Menschenrechte der Bürger aus der DDR schützen sollten. 33 R. Hartmann, DDR-Legenden …, S. 11 – 24. 30
B. Einleitung
25
aus der Gesamtversorgung (auch Sonderversorgung genannt) betrug grundsätzlich 90 v.H. der letzten Nettobesoldung.34 Der Bundesgesetzgeber hat die in der DDR erworbenen Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen unter Bruch des Staatsvertrages und des Einigungsvertrages liquidiert, nicht, wie geboten, „überführt“.35 Hier sah die Bundesregierung erhebliches Einsparpotential. Denn nach ihrer Lesart handelte es sich bei der DDR um einen „Unrechtsstaat“. Folglich waren seine Institutionen und deren Mitarbeiter „staatsnah“ und „Stützen der Diktatur“ – bis hin zu gewöhnlichen Bürgern, zu den Künstlern und Ballettmitgliedern, weshalb sie z. B. auch keinen Anspruch auf die in der DDR erworbenen Rechte hätten. Kein DDRBürger sollte in der DDR bewilligte Zusatzrenten oder Versorgungsansprüche in die Bundesrepublik mitnehmen dürfen.36 Das auf die Kategorien „Unrechtsstaat“, „Täter“ und „Opfer“ reduzierte Denken ist auch unter Abgeordneten verbreitet. Maria Michalk (MdB – CDU/CSU) gibt als Ursache der vom Rentenüberleitungsgesetz geschaffenen Ungerechtigkeit im Alterssicherungssystem Ost das „Unrecht der DDR“ an.37 Sie geht offensichtlich von der These aus, dass die DDR ein Unrechtsstaat mit – auch über das Rentenrecht! – zu bestrafenden Tätern wäre. *** Die gewaltige Enteignungsaktion betrifft alle Rentnergruppen aus der DDR. Das sind jene, die bereits Renten vor 1991 bezogen haben, denen sukzessive aber die Bezüge „abgeschmolzen“ wurden, weil der Gesetzgeber ihnen nach und nach umgewertete und „angepasste“ Renten neu zuerkannte. Das gilt auch für die zweite Gruppe, die nach 1971 ins Arbeitsleben eintrat. Für sie wurde eine besondere Beitragsbemessungsgrenze Ost eingeführt, die von einem Einkommen von monatlich 600 Mark ausging. Zudem wurde das Arbeitsjahr für den DDR-Bürger (Entgeltpunkte) wesentlich niedriger bewertet als das Arbeitsjahr für Westdeutsche. Zusätzliche Rechte einer dritten Gruppe aus den Zusatzversorgungssystemen wurden liquidiert. Schließlich wurden die Renten einer ganzen Reihe von Staatsbediensteten
34
D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 13 f., 14. f., 143. Zu dem, was mit „Überführung“ im rechtlichen Sinne gemeint ist, vgl. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 107 ff. 36 Eindrucksvolle Kritik und schonungslose Abrechnung bei Karl-Heinz Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag. Kampf dem Rentenabbau Ost, Berlin 2010. 37 StenBer., 224. Sitzung des Bundestages vom 28. 5. 2009, S. 24599 f. 35
26
B. Einleitung
auf Grund von Gesamtversorgungssystemen noch unter das allgemeine Niveau gesenkt (sog. Rentenstrafrecht).38 *** Dies alles konnte auch deshalb geschehen, weil mit dem Untergang der DDR auch die Verhandlungsführer des Vertragspartners DDR und die zuletzt im Amte befindlichen Regierungspersonen nach der Einigung an den Rand oder aus dem Amt gedrängt wurden, d. h. keiner mehr als Partner aus der DDR da war, der über die Einhaltung der Verträge hätte wachen können, so dass die Bundesregierung schalten und walten konnte, wie sie wollte. *** Das Übel hat sich weiter verfestigt, weil die Obersten Gerichtshöfe des Bundes und das Bundesverfassungsgericht die Positionen der Bundesregierung weitestgehend übernommen haben. Der Bürger, ob in Ost oder West, ist heute zunehmend der Oligarchie des Parteienstaates ausgeliefert, „in dem das Volk keine zureichende gesetzgeberische Vertretung mehr hat, die die Freiheitssphäre gegen den Staat verteidigt. Er ist auf die Rechtsprechung verwiesen, die hinreichend Schutz leistet, solange sie nicht von den politischen Parteien beherrscht ist. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts werden von dem im Parlament vertretenen Parteien nominiert, gehören im Regelfall einer dieser Parteien an. Bei der immer weiteren Ausdifferenzierung der Lebensverhältnisse verliert das Bundesverfassungsgericht in seinem Auftrag zur Überprüfung ,richtiger‘ Gesetzgebung zunehmend den Blick für das Wesentliche von Freiheit und Eigentum. Wegen seiner Nähe zur Politik trifft es nicht selten politisch motivierte Entscheidungen nach ,in dubio pro res publica‘ und nicht nach ,in dubio res populi‘. Wer darüber urteilen darf, was Politik machen darf und was nicht, macht Politik.“39 Hinzu kommt, dass bei den oberen Gerichten und dem Bundesverfassungsgericht hauptsächlich Richter tätig sind, die aus der alten Bundesrepublik stammen, und denen die Verhältnisse der DDR weitgehend fremd geblieben sind, die nicht bereit sind, ihr Geschichtsbild über die DDR zu überdenken und zu überprüfen, die weitgehend das übernehmen, was ihnen die Bundesregierung vorträgt, ohne ernsthaft dieses zu hinterfragen. So kommt es vor, dass z. B. in Fragen der Versorgungsüberleitung eine schlüssige Begründung der Entscheidungen zu Lasten des Bürgers ausbleibt, ihr Vortrag aufgrund allgemeiner Annahmen des Gerichts unge38
Zur politisch motivierten Entwertung vgl. K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 10 – 24. 39 W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, in: ZFSH/SGB 11/2009, S. 655 ff., und 12/2009, S. 707 ff.
B. Einleitung
27
hört bleibt, eben weil es so sein muss wie angenommen. An die Stelle seriöser Ermittlungen können auch persönliche Auffassungen treten, denen keine Anhörungen, keine belegbaren eigenen Erfahrungen und auch keine anderen Maßnahmen aus einer vorurteilsfreien Beweiserhebung zugrunde liegen.40 *** Für die Bürger ist es beinahe unmöglich, gegen die geballte Staatsmacht vorzugehen und Änderungen zu erreichen. Dass sie es dennoch weiter versuchen, ist Zeugnis ihres ungebrochen Rechtsgefühls.
40 Vgl. z. B. BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010 – 1 BvL 9/06, 2/08 – BVerfGE 126, 233 – Minister Reichelt/Rentenstrafrecht.
C. Eine unendliche Geschichte … Die Versorgungsüberleitung Ost wird zur unendlichen Geschichte.1 Mehr als zwanzig Jahre nach der Einigung soll sich der Bundestag auch in der 17. Legislaturperiode mit einer Reparatur des Gesetzgebungswerkes befassen. Während bisher alle Bundesregierungen unisono das Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) und das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG) von 19912 als eine „große historische Leistung“ einstufen, wurden sie mehrfach vom Bundesverfassungsgericht (BVerfG) auf den Boden der Tatsachen gestellt, insbesondere durch dessen vier Grundsatzurteile vom 28. 4. 1999,3 nachdem das Gericht nicht umhin konnte, wesentliche Teile dieser Gesetze für verfassungswidrig zu erklären, nachdem es sich die rechtlichen Vorbehalte von Merten zu eigen gemacht hatte.4 Renten- und Versorgungsansprüche und -anwartschaften hatten in der DDR den gleichen verfassungsrechtlich geschützten Rang wie in der Bundesrepublik Deutschland. In der DDR gehörten diese bis zur Einigung zum „persönlichen Eigentum“ des Bürgers.5
I. Von Gewinnern zu Verlierern Trotz der Grundsatzurteile hat das BVerfG in der Folgezeit seine Rechtsprechung zum Eigentumsschutz immer weiter relativiert, eingeschränkt, bis es schließlich unter der Führung seines Präsidenten Papier ganz auf die harte Linie der Bundesregierung eingeschwenkt ist, dass die DDR-Bürger, die ursprünglich Berechtigten, insbesondere diejenigen aus den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen der DDR, entgegen den Regelungen im Staatsvertrag und im Einigungsvertrag, nicht den Schutz des Eigentumsgrundrecht nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG genießen, obwohl
1
Vgl. schon Karl-Heinz Christoph/Werner Mäder, Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/ SGB 4/2005, S. 195 – 213. 2 Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) vom 25. 7. 1991 (BGBl. I S. 1606), mehrfach geändert, insbes. durch das Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (Rü-ErgG) vom 24. 6. 1993 (BGBl. I S. 1038) und das AAÜG-Änderungsgesetz (AAÜG-ÄndG) vom 11. 11. 1996 (BGBl. I S. 1674); 2. AAÜG-Änderungsgesetz vom 2. 8. 2001 (BGBl. I S. 1939). 3 BVerfGE 100, 1 – 59 (Zahlbetragsgarantie); 100, 104 – 137 (Versicherungsbiographie); 100, 59 – 103 (Staats- und Systemnähe); 100, 139 – 195 (Ministerium für Staatssicherheit); auch BVerfG, Beschl. vom 23. 6. 2004 – 1 BvL 3/98, 9/02 und 2/03 (Staats- und Systemnähe II). 4 Detlef Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, 2. Aufl., 1994. 5 Werner Mäder/Johann Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 10/2005, S. 579 – 595 und 11/2005, S. 651 – 659 (S. 580 ff., 584 – 586).
III. Bundestag – 16. Wahlperiode (2005 – 2009)
29
das Gericht in seinen Grundsatzurteilen mit anderer Besetzung das Gegenteil entschieden hat.6 Verlautbarungen der Bundesregierung und der Medien, die DDR-Rentner seien „Gewinner der Einheit“, treffen nicht zu. Verbessert wurde lediglich die Lage der Menschen, deren Rente aus der einfachen einheitlichen Sozialpflichtversicherung in eine Rente aus der westdeutschen gesetzlichen Rentenversicherung umgestellt wurde. Es handelt sich um viele, Abertausende Menschen, deren Zusatz- und Versorgungsrenten „enteignet“, ja „konfisziert“ wurden.7
II. Prozesse, Eingaben, Petitionen (1991 – 2005) Gerichte aller Zweige und Instanzen beschäftigten sich seit Jahren mit unzähligen Klagen betroffener Bürger, und trotz abweisender Entscheidungen ist kein Ende in Sicht. Zu nachhaltig sind die Einschnitte in die Existenzgrundlagen. Parallel zu den Gerichtsverfahren erhielten die Abgeordneten des Bundestages und der Landtage eine Flut von Eingaben und Petitionen, mit denen die nachteiligen Auswirkungen der Bundesgesetze konkret und detailliert dargestellt werden. In diesen zähflüssigen, langwierigen Verfahren und Meinungsbildungsprozessen dämmerte es langsam bei einigen Abgeordneten, die sich am Rande des Fraktionszwanges bewegten, später dann auch bei weiteren Parlamentariern, dass seinerzeit nach der Wende die Überleitungsgesetze zu schnell „durchgewinkt“ worden waren. Der Glaube an die immer wiederkehrenden Äußerungen der Regierungsvertreter bröckelte, es sei alles rechtsstaatlich geordnet, wobei man sich jedoch jeweils auf die Entscheidungen des BVerfG zurückzog und wenig Handlungsbedarf einräumte. Änderungen kamen nicht zustande, eben weil sich die Mehrheit der Abgeordneten der Regierungsparteien dem Fraktionszwang unterwarfen und bereitwillig dem Zeitgeist folgten.
III. Bundestag – 16. Wahlperiode (2005 – 2009) Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat in der 16. Wahlperiode unter dem 7. 11. 2008 siebzehn Anträge mit dem Ziel eingebracht, eine gerechte Versorgungsüberleitung herbeizuführen.8 Welches Ausmaß die nachteiligen Auswirkungen der un-
6 Zur Rolle des Präsidenten Papier, der vor seinem Wechsel auf den Richterstuhl die Bundesregierung als Gutachter unterstützt hat, Versorgungsansprüche abzuwehren, vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 128 ff. 7 Hierzu D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 42 f., 29 f. – Siehe auch Karl-Heinz Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1999; ders., Bestohlen bis zum Jüngsten Tag. Kampf dem Rentenabbau Ost, 2010. 8 BT-Drs. 16/7019 bis 16/7035. – Vgl. auch Antrag der Fraktion der FDP vom 3. 12. 2008 „Faires Nachversicherungsangebot zur Vereinheitlichung des Rentenrechts ist Ost und West“,
30
C. Eine unendliche Geschichte …
vollendeten Versorgungsüberleitung hatten, lässt sich an dem Katalog von Tatbeständen ablesen, für die Nachholbedarf geltend gemacht wird.9 Die Titel der Anträge lauten wie folgt: 1.
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberleitungsgesetzes (2. AAÜG-ÄndG) – BT-Drs. 16/7035;
2.
keine Diskriminierung und Ungerechtigkeiten gegenüber Älteren in den neuen Bundesländern bei der Überleitung von DDR-Alterssicherungen in das bundesdeutsche Recht – BT-Drs. 16/7019;
3.
gerechte Alterseinkünfte für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen – BT-Drs. 16/7020;
4.
gerechte Lösung für die rentenrechtliche Situation von in der DDR Geschiedenen – BT-Drs. 16/7021;
5.
Schaffung einer gerechten Versorgungslösung für die vormalige berufsbezogene Zuwendung für Ballettmitglieder in der DDR – BT-Drs. 16/7022;
6.
Regelung der Ansprüche der Bergleute in der Braunkohleveredlung – BTDrs. 17/7023;
7.
Beseitigung von Rentennachteilen für Zeiten der Pflege von Angehörigen in der DDR – BT-Drs. 16/7024;
8.
rentenrechtliche Anerkennung für fehlende Zeiten von Land- und Forstwirten, Handwerkern und anderen Selbständigen sowie deren mithelfende Familienangehörigen aus der DDR – BT-Drs. 16/7025;
9.
rentenrechtliche Anerkennung von zweiten Bildungswegen und Aspiranturen in der DDR – BT-Drs. 16/7026;
10. rentenrechtliche Anerkennung von Sozialversicherungsregelungen für ins Ausland mitreisende Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie von im Ausland erworbenen rentenrechtlichen Zeiten – BT-Drs. 16/7027; 11. rentenrechtliche Anerkennung aller freiwilligen Beiträge aus DDR-Zeiten – BTDrs. 16/7028; 12. kein Versorgungsunrecht bei den Zusatz- und Sonderversorgungen der DDR – BT-Drs. 16/7029; 13. Regelung der Ansprüche und Anwartschaften auf Alterssicherung für Angehörige der Deutschen Reichsbahn – BT-Drs. 16/7030;
BT-Drs. 16/11236. Aufzählung der Anträge: Deutscher Bundestag, StenBer., 224, Sitzung vom 28. 5. 2009, S. 24593 A ff. 9 BT-Drs. 16/7017 bis 16/7035. – Eine aufschlussreiche Übersicht zu der Problemstellung mit allein 27 Tatbeständen zur Benachteiligung betroffener Bürger und aufschlussreichen Informationen findet sich im Internet unter www.ostrentner.de.
III. Bundestag – 16. Wahlperiode (2005 – 2009)
31
14. angemessene Altersversorgung für Professorinnen und Professoren neuen Rechts, Ärztinnen und Ärzten im öffentlichen Dienst, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Beschäftigte universitärer und anderer wissenschaftlicher außeruniversitären Einrichtungen in den neuen Bundesländern – BT-Drs. 16/ 7031; 15. Schaffung einer angemessenen Altersversorgung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die nach 1990 ihre Tätigkeit fortgesetzt haben – BT-Drs. 17/ 7032; 16. Schaffung einer angemessenen Altersversorgung für Angehörige von Bundeswehr, Zoll und Polizei, die nach 1990 ihre Tätigkeit fortgesetzt haben – BTDrs. 16/7033; 17. einheitliche Regelung der Altersversorgung für Angehörige der technischen Intelligenz der DDR – BT-Drs. 16/7034. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hatte offizielle Stellungnahmen von „sachverständigen“ Einrichtungen und Personen eingeholt.10 Die Stellungnahmen von unmittelbar Betroffenen wurden nicht berücksichtigt.11 Der AuS-Ausschuss des Bundestages hat in seiner Sitzung eine Anhörung zu den Anträgen der Fraktion DIE LINKE,12 der FDP13 und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN14 zur Versorgungsüberleitung Ost durchgeführt. Die Anhörung verlief einseitig. Es kamen im Hinblick auf die Zeiteinteilung fast nur von der Regierungskoalition bestellte Vertreter in einem vorab abgesprochenen Frage- und Antwort-Rhythmus zu Wort, die seit Jahr und Tag dieselbe abweisende Haltung mit nicht hinterfragten Argumenten einnehmen. Prof. Ruhland, „ständiger Vertreter“ der Bundesregierung, meinte resümierend, man müsse „sich lieber den Problemen der Jungen als künftige Rentengeneration zuwenden“ als den Ost-Rentnern, die eine höhere Versorgung als die West-Rentner genössen, die „Gewinner der Einheit“ wären. Aber Tausende von Betroffenen hingegen können anhand ihrer Biographie und ihres (Alters-) Einkommen das Gegenteil beweisen. Für die interessierten und betroffenen Zuhörer im Ausschuss war die Sitzung zugleich plastisches Beispiel, wie Demokratie heutzutage verstanden wird, Akklamation ohne Rede und Gegenrede. Die Vorlagen zur Rentenüberleitung und Alterssicherung Ost wurden – mit den Stimmen der Regierungskoalition von CDU/CSU und SPD – nach drei Debatten und mehreren Ausschusssitzungen in namentlicher Abstimmung am 28. 5. 2009 mehrheitlich abgelehnt. Hier kam wieder die alte Taktik zum Vorschein, wenn man die Probleme nicht ernsthaft bewältigen will: abweisen, verweisen, vertagen. 10 11 12 13 14
Hierzu Ausschussdrucksache 16 (11) 1355. Hierzu Ausschussdrucksache 16 (11) 1360 und 16 (11) 1361. BT-Drs. 16/7019 bis 16/7035. BT-Drs. 16/11236. BT-Drs. 16/11684.
32
C. Eine unendliche Geschichte …
Die Vertreter der Regierungskoalition haben in der Debatte eingeräumt, dass es Ungerechtigkeiten und Gesetzgebungsbedarf gibt.15 Wenn sie dies ernst gemeint haben, hätte sie nichts daran gehindert, ans Werk zu gehen. Statt dessen: Vertreter aller Parteien hingegen haben zugesichert, sich nach der Wahl am 27. 9. 2009 im neuen Bundestag unverzüglich mit den Ostrentenproblemen zu befassen.16 Ungewiss blieb dabei, ob es in der 17. Legislaturperiode, der fünften nach der Einigung (!), zu einem weiteren, die Betroffenen zufriedenstellenden Gesetz kommen wird.17 Viele Imponderabilien waren zu vergegenwärtigen: verweisen, vertagen.
IV. Bundestag – 17. Legislaturperiode (2009 – 2013) Ein Hindernis ist, dass die Kenntnisse der Abgeordneten über die wahren Verhältnisse der DDR und über die Umstände, unter denen sich die Einigung vollzog,18 sowie über die konkreten Auswirkungen des Renten-Überleitungsgesetzes immer noch lückenhaft sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKEN haben, anknüpfend an ihre Initiativen in der 16. Legislaturperiode, einen neuen Anlauf genommen, der wieder zeigt, dass sie etwas von der Sache verstanden haben. Mit ihrem Antrag „Korrektur der Überleitung von DDR-Alterssicherungen in bundesdeutsches Recht“ vom 6. 5. 15
Vgl. die Diskussionsbeiträge und die Erklärungen der Abgeordneten der Regierungskoalition gem. § 31 GO, StenBer. über die 224. Sitzung des Bundestages vom 28. 4. 2009, bes. S. 24593 ff., 24789 ff. 16 Für die Regierungskoalition Maria Michalk (CDU/CSU), StenBer. 224, Sitzung des Bundestages vom 28. 5. 2009, S. 24599 f.; Paul Lehrieder (CDU/CSU), S. 24605 f.; Arnold Vaatz u. a. (CDU/- CSU), Erklärung nach § 31 GO, Anl. 9 und 10, S. 24790 ff.; Klaus Hübner (SPD), S. 24606 ff.; Silvia Schmidt (SPD) u. a., Erklärung nach § 31 GO, Anl. 5 bis 8, S. 24789 ff. – Vertreter der Opposition bekräftigen ihre Vorlagen: Irmingard Schewe-Gerig (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), S. 24603 f.; Heinrich L. Kolb (FDP), S. 24596 ff.; Gregor Gysi (DIE LINKE), S. 24600 ff. 17 Entwurf der Fraktion DIE LINKE eines „Zweiten Gesetzes zur Änderung des Anspruchsund Anwartschaftsüberführungsgesetzes (2. AAÜG-ÄndG)“, BT-Drs. 16/7035 vom 7. 11. 2008; Forderung von Klaus Hübner (SPD) namens der SPD-Fraktion für ein „Rentenüberleitungsgesetz“, vgl. BT vom 28. 5. 2009, StenBer. 244. Sitzung, S. 24606 ff.; Karl-Heinz Christoph/Ingeborg Christoph, Stellungnahme vom 4. 5. 2009 an den AuS-Ausschuss des Bundestages, Ausschussdrucksache 16 (11) 1361, schlagen die Erarbeitung eines „Renten- und Versorgungsüberleitungskorrekturgesetzes“ vor (S. 4). 18 Ralf Hartmann, Die Liquidatoren. Der Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland, 3. Aufl., 2008; ders., Die DDR unter dem Lügenberg, 3. Aufl., 2008; ders., DDRLegenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, 2009; Constanze Paffrath, Macht und Eigentum. Die Enteignungen 1945 – 1949 im Prozess der deutschen Wiedervereinigung, 2004. – Vgl. auch Klaus Huhn, Raubzug Ost. Wie die Treuhand die DDR plünderte, 2. Aufl., 2009; Olaf Bahle, Abbau Ost, Lügen und Vorurteile und sozialistische Schulden, 2008; Michael Jürgs, Die Treuhänder. Wie Helden und Halunken die DDR verkauften, 1997; Dirk Laabs, Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, 2. Aufl., München 2012.
IV. Bundestag – 17. Legislaturperiode (2009 – 2013)
33
201019 haben sie die parlamentarischen Erörterungen wieder in Gang gesetzt, ohne abzuwarten, ob die Parteien der Regierungskoalition, die CDU/CSU und nunmehr mit der FDP, etwas unternehmen, im Anschluss an die Zusagen der 16. Periode. In der nur für eine halbe Stunde vorgesehenen Aussprache am 20.5. 2010 im Plenum des Bundestages über den Antrag der Fraktion DIE LINKEN wurde von den Sprechern der CDU/CSU, der FDP und der SPD als alter Koalitionspartner der Wille bekräftigt, in dieser Legislaturperiode noch ein „Rentenüberleitungsabschlussgesetz“ zu beschließen, ohne dass jedoch schon Konturen dafür angegeben wurden.20 So müssen die Betroffenen erst einmal der Dinge harren, die da kommen sollen. Bisweilen mussten sie sich wieder die alten Vorurteile anhören,21 so dass weiter Arges zu erwarten ist, so, dass – die Betroffenen in der DDR „Kunstrenten“ erhalten hätten, „die jeglicher Rechtsgrundlage entbehrt“ hätten. Davon kann keine Rede sein; die Renten wurden tatsächlich gezahlt, haben allerdings nur eine bescheidene Lebenshaltung ermöglicht. – die DDR-Rentner „Gewinner der Einheit“ wären. Verbessert wurde lediglich die Lage der Menschen, die in der DDR nur die einfache Rente aus der gesetzlichen Sozialversicherung der DDR erhielten und nun eine abgesenkte Rente aus der westdeutschen gesetzlichen Rentenversicherung erhalten. „Verlierer“ sind Aber-Tausende Menschen, deren Zusatz- bzw. Versorgungsrenten enteignet wurden. – „Versprechungen gemacht wurden, die mit dem Ende des Systems nicht eingelöst werden konnten“. Tatsache ist, dass die Regierung Dr. Kohl/Dr. Schäuble, die die Staatsverträge ausgehandelt haben, sich an ihre „Versprechungen“ nicht gehalten und die Verpflichtungen aus dem Staats- und dem Einigungsvertrag nicht erfüllt haben. – Die Gerichte die Position der Bundesregierung bestätigt hätten. Tatsache ist, dass das Bundesverfassungsgericht – ohne Mitwirkung des befangenen Präsidenten Papier – wesentliche Teile des Renten-Überleitungsgesetzes (RÜG) mit seinem Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AÜGG) wegen Verstoßes gegen § 14 Abs. 1 Satz 1 bzw. Art. 3 Abs. 1 GG für verfassungswidrig erklärt hat. – Die westdeutsche gesetzliche Rentenversicherung nicht der „Reparaturbetrieb“ der Ost-Versorgung sei. 19
BT-Drs. 17/1631. Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode, 43. Sitzung vom 20. 5. 2010, Sitzungsbericht, S. 4285 – 4293. 21 Ebd. 20
34
C. Eine unendliche Geschichte …
Darum geht es aber nicht. So haben die Staatsverträge die eindeutige Regelung getroffen, dass die Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen in das gesamtdeutsche Rechtssystem zu überführen sind. Die Rechte wurden nicht überführt, obwohl sie nach dem BVerfG den Eigentumsschutz nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG genießen. – die Ost-Renten und -anwartschaften bereits in das gesamtdeutsche Rechtssystem „überführt“ worden seien. Gerade dies ist nicht der Fall. „Überführen“ im Rechtssinne und in der Gesetzessprache bedeutet eine Bestandsgarantie als Erwerbsschutz und als „Ergebnisschutz“ sowie eine Zahlbetragsgarantie. Renten wurden gekürzt oder völlig beseitigt. – die Rentensysteme in der DDR und der Bundesrepublik inkompatibel seien. Beide Alterssicherungssysteme haben hingegen die gleiche Struktur. – die Renten-Überleitungsgesetze „eine große historische Leistung waren“. Die Meinungen sind hierüber geteilt. Die gesamte rechtswissenschaftliche Literatur, soweit sie nicht die Meinung der Gerichtspräsidenten teilte, war von Anfang an der Meinung, dass der Bundesgesetzgeber seine Aufgabe nicht ausreichend bewältigt hat. Im Jahre 2010 bis in die erste Hälfte des Jahres 2011 breitete die Regierungskoalition den „Mantel des Schweigens“ über ihre Ankündigung, etwas zu unternehmen. Die Opposition unternahm einen neuen Anlauf, dieses Mal mit der SPD, die von der Regierungsbank auf die Oppositionsstühle wechseln musste, und wieder DIE LINKE, und zwar mit folgenden Anträgen: – Antrag der SPD vom 6. 7. 2011 auf Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines „Rentenüberleitungsabschlussgesetzes“ und zur Einrichtung eines „Härtefallfonds“ – BT-Drs. 17/6486. In ihrer Begründung heißt es zwar, dass die Überleitung bis heute kein alle Seiten befriedigendes Recht geschaffen hat, dass im Zuge der Überleitung soziale Härten und Ungleichbehandlungen entstanden sind, die bis heute weiter bestehen. Sie bleibt jedoch auf halbem Wege stehen. An einer umfassenden Überarbeitung des Gesetzespakets ist nicht gedacht. Die Einrichtung eines „Härtefallfonds“ sei eher geeignet, die Interessen der einzelnen Betroffenen und des Gemeinwohls in Einklang zu bringen und soziale Härten abzufedern. Sybillinisch wird vermerkt: „Diese Versorgungslücken müssen größtenteils auf die Rentenüberleitung zurückzuführen sein und dürfen nicht Ursache eines generell niedrigen Alterseinkommens sein, das sich auch nach Anwendung des Rentenrechts der DDR ergeben hatte. Der Ansatz leitet schon fehl, weil nicht die Lebensverhältnisse in der DDR zugrunde gelegt werden können, eben weil das niedrigere Einkommen in das Verhältnis zu den sicher geringeren Lebenshaltungskosten in der DDR gesetzt werden muss. Maßstab ist der Überleitungsbefehl der Staatsverträge, die eine „Überführung“ der
IV. Bundestag – 17. Legislaturperiode (2009 – 2013)
35
Rechte und Anwartschaften in ein gesamtdeutsches Rentenversicherungssystem gebietet, das sich an den Lebenshaltungskosten der geeinten Teile Deutschlands, d. h. der Bundesrepublik nach der Wende orientieren muss. Das Konzept verspricht keine befriedigende und befreiende Lösung. Eine Härtefallprüfung stellt zudem auf den Einzelfall ab, was nur zu weiteren Auseinandersetzungen ad infinitum führen muss. – Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 21. 9. 2011 auf Einrichtung einer „Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Korrektur der Überleitung von DDR-Alterssicherungen in bundesdeutsches Recht“ – BT-Drs. 17/703422 – mit dem Ziel, die Wirkungen des Renten-Überleitungsgesetzes (einschließlich AAÜG) zu überprüfen, dabei einen Vergleich der sozialen Lage gleicher Berufsgruppen in Ost und West im Alter vorzunehmen und auf deren Grundlage so zeitnah, dass diese noch in der 17. Legislaturperiode gesetzgeberisch umgesetzt werden können. Die Arbeitsgruppe soll Lösungsvorschläge für die Problemfelder und die Tatbestände bzw. die Personengruppen unterbreiten, die die Partei bereits in der 16. Wahlperiode mit ihren Anträgen vom 7. 11. 200823 aufgeführt hatte. Mit ihrem Antrag vom 21. 9. 2011 erstrebt die Fraktion – anders als die Initiative der SPD vom 6. 7. 2011 – weiterhin eine umfassende Korrektur der Rentenüberleitungsgesetzgebung. Es sei nicht hinnehmbar, wie die bisherigen Bundesregierungen die durch die Rentenüberleitung entstandenen Probleme ignoriert haben. Auch die derzeitige Bundesregierung schiebe das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, ein einheitliches Rentenrecht zu schaffen, immer wieder auf. Nicht erkennbar sei, dass sie Korrekturen an der Art und Weise der Überleitung der DDR-Ansprüche in bundesdeutsches Recht vornehmen will. Während bis vor einiger Zeit führende Politiker aus Bund und Ländern bei protestierenden Betroffenen durchaus die Hoffnung geweckt hätten, dass es zu Änderungen kommen wird, stünden in jüngster Zeit Abwicklungen im Vordergrund. Das Fazit für das Jahr 2011: verweisen, vertagen, abwickeln, vergessen. Für den 28. 10. 2011 war eine Debatte zu den Ostrenten im Bundestag vorgesehen, auf deren Tagesordnung auch die parlamentarischen Initiativen der SPD vom 6. 7. 2011 und der Fraktion DIE LINKE vom 21. 9. 2011 standen. Die Debatte wurde wieder von der Tagesordnung genommen. Für die Regierung Merkel/Schäuble gab es „Wichtigeres“ zu tun. Es musste Europa gerettet und der Euro-Rettungsschirm für das europäische Ausland weit ausgebreitet werden;24 im ungünstigsten Fall haftet die Bundesrepublik mit einem Betrag bis zu 2 Billionen Euro.25 Da fiel demgegenüber das Schicksal unzähliger 22 23 24
2011.
Der Antrag, BT-Drs. 17/7034, ist ein Zeitdokument. BT-Drs. 16/7019 – 16/7035. Siehe hierzu K. A. Schachtschneider, Die Rechtswidrigkeit der Euro-Rettungspolitik,
25 Vgl. auch Thilo Sarrazin, Europa braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, München 2012; Stefan Homburg, Die bisherigen
36
C. Eine unendliche Geschichte …
eigener Rentenberechtigter aus dem eigenen Land nicht ins Gewicht, getreu dem Motto „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“.
V. Vereinte Nationen Die Sache hat nicht nur national, sondern auch international weite Kreise geschlagen. Zusätzliche Versorgungen wurden durch die Renten„überführung“ weitestgehend liquidiert. Wer einer solchen Zusatzversorgung angehört hatte, steht zum Teil bis heute von vornherein im Verdacht einer Staatsnähe, „Systemtreue“, was immer darunter verstanden wird, und Privilegierung. Davon betroffen sind unter anderem viele Wissenschaftler, die nach 1990 am Aufbau einer neuen Forschungslandschaft im Beitrittsgebiet beteiligt waren und/oder international als anerkannte Fachleute gelehrt und geforscht haben.26 Im Vergleich mit ihren Altersgefährten aus dem Westteil der Bundesrepublik erhalten sie nur einen Bruchteil von deren Versorgung. Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte des Wirtschaftsund Sozialrates der Vereinten Nationen hat deshalb die Bundesrepublik Deutschland bei der Behandlung ihres Berichts schon am 2. 12. 1998 aufgefordert, „als Akt der nationalen Aussöhnung Staatsbediensteten und Wissenschaftlern, die mit dem alten Regime in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik verbunden waren, eine Entschädigung zu gewähren und dafür zu sorgen, dass eine solche Entschädigung angemessen und fair ist“.27 Bei als besonders „staatsnah“ eingestuften Versicherten wurde willkürlich in die Rentenformel eingegriffen – ein historisch einmaliger Akt in der Geschichte der deutschen Sozialgesetzgebung. Dieses Vorgehen hat jüngst nachhaltige Kritik, wieder durch den Wirtschafts- und Sozialausschuss der Vereinten Nationen, erfahren. Der Ausschuss für wirtschaftliKosten der Euro-Rettung – eine Zwischenbilanz, in: Der Hauptstadtbrief, 106. Ausgabe/2012, S. 4 – 7; Dietrich Murswiek, Das „Bail-out-Verbot“ wird für immer ausgehebelt, in: ebd., S. 12 – 17. 26 Prof. Dr. Morik Mebel, Professor der Medizin, bekannter Arzt der DDR, der die erste Nierentransplantation vorgenommen hat; Prof. Dr. Richard Klare, langjähriger Präsident der Akademie der Wissenschaften, langjährige Forschungsarbeiten, international bekannter und anerkannter Wissenschaftler, Erfinder der Dederon-Faser; Prof. Dr. Adolf Thiessen, Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften und Präsident des Forschungsrates; Prof. Rolf Reuter, Generalmusikdirektor, langjähriger Chef der Komischen Oper Berlin, international bekannter und anerkannter Musikmanager, Nationalpreisträger (höchster Orden der DDR) und Inhaber des Bundesverdienstkreuzes. 27 Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, Behandlung der Staatenberichte nach den Artikeln 16 und 17 des internationalen Pakts über wirtschaftliche und soziale Rechte, Punkt 36, 54. Sitzung am 2. 12. 1998.
VI. Bundestag – 18. Wahlperiode (2013 – …)
37
che, soziale und kulturelle Rechte zeigte sich im Mai 2011 besorgt über Diskriminierungen in Ostdeutschland, wie sie im Beschluss des BVerfG vom 6. 7. 201028 über die Versorgungsansprüche ehemaliger Minister und stellvertretender Minister der DDR zum Ausdruck kommen.29 Nicht bekannt ist, dass die Bundesregierung den Aufforderungen des UN-Gremiums gefolgt ist, rasch wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Benachteiligungen auszugleichen.
VI. Bundestag – 18. Wahlperiode (2013 – …) Es ist nicht damit zu rechnen, dass in der 17. Wahlperiode noch etwas Entscheidendes auf den Weg gebracht wird. Jedoch ist nicht damit zu rechnen, dass die Frage nach einer Korrektur der Überleitungsgesetze in der 18. Wahlperiode wieder aufgegriffen wird. Die Zeichen deuten darauf hin, dass die betroffenen Bürger nicht aufgeben werden. Hier scheint noch etwas aus der friedlichen Revolution weiter Kreise aus der DDR-Bevölkerung mit ihrem Kampf für Freiheit nachzuwirken. So hat z. B. die Interessengemeinschaft von Angehörigen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn getreu dem Motto „Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht!“ (Berthold Brecht) zu einer Kundgebung gegen „Enteignung der Eisenbahner“ am 11. 6. 2012 aufgerufen und den Willen bekundet, weiterhin für die Durchsetzung ihrer Versorgungsansprüche zu kämpfen.30 Die Reichsbahner machen ihre in der DDR begründeten, durch den Einigungsvertrag garantierten betrieblichen Versorgungsrechte und -anwartschaften geltend, weil es immer noch an einer Durchführungsbestimmung zur Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Auflagen, d. h. an einer Überführung des Rahmenkollektivvertrages der Deutschen Reichsbahn31 in gesamt-deutsches Recht fehlt. Auch andere Berufsgruppen werden diesem Beispiel folgen.
28
BVerfGE 126, 233. Wirtschafts- und Sozialausschuss der Vereinten Nationen, Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 46. Tagung, Prüfung der Staatenberichte nach den Artikeln 16 und 17 des Pakts, Punkt 22. 30 Offener Brief der Interessengemeinschaft von Angehörigen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn vom 15. 4. 2012 an die Bediensteten der ehemaligen Deutschen Reichsbahn (Reichsbahner) mit Aufruf zur Kundgebung am 11. 6. 2012 vor dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Berlin. 31 Eisenbahner-Verordnung vom 28. 3. 1973 (§§ 11 – 15); Versorgungsordnung der Deutschen Reichsbahn, Anlage zum Rahmenkollektivvertrag (RKV) der Deutschen Reichsbahn vom 20. 5. 1960 i. d. F. des 53. Nachtrages vom 20. 4. 1989; Eisenbahnneuordnungsgesetz von 1994 (Artikel 1, §§ 1 und 7). 29
38
C. Eine unendliche Geschichte …
VII. Versöhnung und innere Einheit In diesem Zusammenhang ist die Mahnung von Egon Bahr weisend, der bei der Festveranstaltung zum 75. Geburtstag Manfred Stolpes in Potsdam vor ca. 700 Gästen erklärte: „Wir versöhnen uns eher mit unseren Nachbarn als mit uns selbst.“ Er mahnte, dass nach 1990 ein „Akt der Amnestie angezeigt gewesen wäre, der alles außer schwerer Kriminalität hätte erfassen müssen“. Die Öffnung der Stasi-Akten in der praktizierten Form und die dabei durchgehaltene „penetrante“ Einseitigkeit hätten einen Anteil daran, dass die innere Einheit bislang nicht zustande kam. Und: „Die Stasi-Behörde kann keine Gerechtigkeit schaffen.“ Die Herstellung der inneren Einheit, mahnte er, „verlangt von den Opfern Bereitschaft zur Versöhnung“.32 Im sogenannten „Rentenstrafrecht“ gibt es zwar nichts zu amnestieren. Bahr hat jedoch den Kern des Problems getroffen: Ohne Versöhnung keine innere Einheit. Marten hat darauf hingewiesen, dass ein Rentenzugriff als strafähnliche Sanktion unzulässig und systemwidrig ist, da das Sozialversicherungsrecht seit jeher wertneutral ist, im westdeutschen Sozialversicherungsrecht gleiches nicht vorgesehen ist und eine Leistungsversagung nur in eng begrenzten Ausnahmefällen, nämlich bei Rechtsmissbrauch vorgesehen ist.33 Egon Bahrs Mahnung wird ein Wunsch bleiben, solange „Kalte Krieger“ wie Klaus Kinkel, Arnulf Baring und andere mit ihren Polemiken nachwirken und Kampagnen ähnlichen offenen oder unterschwelligen Inhalts über die gleichgerichteten Medien verbreitet werden. Hier wird eine „Vergangenheitsbewältigung“ zelebriert, deren wahres Ziel es nicht ist, nicht zu bewältigen, deren Ziel es ist, immerzu eine Front aufrechtzuerhalten. Der Leser sollte sich nur einmal das Buch von Arnulf Baring „Deutschland, was nun?“34 vornehmen, in dem eine lange Reihe von Unterredungen zwischen Baring, Rumberg und Siedler aus der Zeit zwischen März und August 1991 wiedergegeben wird. Das Buch enthält eine ganze Reihe von bissigen Betrachtungen über die DDR und ihre Menschen bis hin zur Häme und Hetze, dass man sich als Deutscher, der im Westen Deutschlands groß geworden ist, nur schämen kann. Schon das Vorwort lässt Schlimmes erahnen, zeigt auf, in welche Richtung „gebissen“ wird. – „ … Im Ostteil des Kontinents – und damit auch in der sowjetischen Zone Deutschlands – herrschten gleichzeitig Terror und Stagnation; im Laufe der Zeit breiteten sich dort Wüsten aus.
32
Vgl. Neues Deutschland vom 17. 5. 2011, S. 5. Ausführlich D. Marten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 25 – 48, 48 – 65 (52 f.). 34 Arnulf Baring, Deutschland, was nun? Arnulf Baring. Ein Gespräch mit Dirk Rumberg und Wolf Jobst Siedler, Berlin 1991. 33
VII. Versöhnung und innere Einheit
39
– Jetzt werden, und das ist ja nur ein Aspekt der Sache, Wohlstands- und Wüstengebiete vereint – falls sie denn vereint werden, das überhaupt gelingen kann, irgendwann. …“35 Baring verwendet die in der alten Bundesrepublik negativ besetzte Bezeichnung „SBZ“, obwohl die DDR als DDR von der Bundesrepublik Deutschland als Staat völkerrechtlich anerkannt worden ist. Würde Baring heute sein Buch in neuer Auflage herausgeben, müsste er feststellen, dass die neue Bundesrepublik auch allmählich „verwüstet“ wird durch allgemeine Landflucht – jährlich verlassen ca. 160000 Menschen, darunter gut ausgebildete Berufler das Land, die sich im Ausland eine bessere Zukunft in existenzieller Freiheit versprechen.36 Es wird behauptet, dass von den vierhundert Mitarbeitern des Elite-Instituts für Internationale Politik und Wirtschaft (IPW) nur über dreißig wissenschaftlich gearbeitet hätten.37 Auf die Frage von Rumberg, was denn die anderen gemacht hätten, Baring: „Das habe ich mich auch gefragt. Ich bekam die Antwort (von wem?, der Verfasser): ,Ja, was machte man? Man las Zeitung, hielt Sitzungen ab, Kaderarbeit, hielt Vorträge irgendwo, erledigte die Dinge des Alltags, die immer notwendigen Besorgungen, saß vielleicht auch einfach zu Hause mit der Familie, versorgte den Garten, trank Kaffee.‘ Können Sie sich das vorstellen? 370 Leute an einem solchen Institut, die nichts taten?38 Von dem Ausmaß aller Missstände in der früheren DDR macht man sich bei uns keinen Begriff; sie übersteigen unsere Phantasie. Dass solche Leute nicht plötzlich Initiativen ergreifen, jedenfalls nicht die 370, sondern still abwarten und sich ressentimentgeladen vielleicht hinter der PDS verschanzen, irgendwo als Kampfgruppe Unqualifizierter überdurchschnittliche Bezahlungen ergattern wollen, ist doch sehr naheliegend. Naja, Sie lachen, aber das wird uns in den nächsten Jahren noch enorm zu schaffen machen. Es ist ein Massenphänomen, keineswegs beschränkt auf parteinahe Forschungsinstitute und Funktionärskreise. …“39
Ein derartiges, mit Übertreibungen gespicktes Szenario, das aus der „Gerüchteküche“ eines Propagandaministeriums stammen könnte, würdigt die Leistungen von Akademikern herab, die Leistungen erbracht haben, unabhängig davon, ob ihre Zuarbeiten von der Staatsführung verwertet wurden, verschweigt, dass sie unmittelbar nach der Einigung von heute auf morgen quasi auf die Straße gesetzt wurden, äußert kein Verständnis dafür, dass die nun beruflich „heimatlos“ Gewordenen sich mit Parteien solidarisieren, von denen sie meinen, dass zumindest diese noch ihre Interessen vertreten. Ein derartiges Szenario verstellt den Blick zu den eigenen Fehlentwicklungen mit Ursprung in der alten Westrepublik: siebzehn überdimen35
Ebd. (Baring), S. 2. W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 168 ff. – Vgl. auch Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab, 8. Aufl., 2010. 37 A. Baring, Deutschland, was nun?, S. 52 (Baring). 38 Ebd., S. 52/53. 39 Ebd., S. 53 (Baring). 36
40
C. Eine unendliche Geschichte …
sionierte Parlamente für den Bund und die Länder; aufgeblähte Parlamentsverwaltungen; Bundesbehörden, die ihre Arbeit anstelle der Beamten durch externe Einrichtungen, Lobbyisten und sonstige außenstehende Personen verrichten lassen; parteinahe Stiftungen, die sich rein vom Staatssäckel „ernähren“, die davon leben, Probleme zu schaffen denn unabhängige Leistungen im Interesse des Gemeinwohls zu erbringen; große Parteiapparate, die aus dem Staatshaushalt finanziert werden; sechzehn Länderverwaltungen, von denen ein Teil es an Verwaltungsqualität mangelt, etc. etc. Die Probleme sind umfassend rechts- und politikwissenschaftlich in einer Vielzahl von Werken dargestellt und aufgearbeitet worden.40 Nur: sie haben in dem Netzwerk einer Politikverflechtung keine nachhaltige Wirkung. Es ändert sich nichts. Es erfordert ein großes Maß Selbstüberschätzung, die eigenen Mängel zu verschweigen und die nur die DDR-Verhältnisse „bewältigen“ zu wollen. Unter der Überschrift „Die frühere DDR: ein kopfloses Land“41 treibt Barings Geschichte einem Höhepunkt zu, Baring: „Die heutige Lage in der ehemaligen DDR ist in der Tat vollkommen anders als bei uns nach 1945. Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt,“(!) „ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Jeder sollte nur noch ein hirnloses Rädchen im Getriebe sein, ein willenloser Gehilfe. Ob sich heute einer dort Jurist nennt oder Ökonom, Pädagoge, Psychologe, Soziologe, selbst Arzt oder Ingenieur, das ist völlig egal: Sein Wissen ist auf weite Strecken völlig unbrauchbar. In den meisten Fällen fehlt heute vom Fachlichen her eine Berufsperspektive in den Bereichen, in denen man ausgebildet wurde. Wir können den politisch und charakterlich Belasteten ihre Sünden vergeben, alles verzeihen und vergessen. Es wird nichts nützen; denn viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar. Sie haben einfach nicht gelernt, was sie in eine freie Marktwirtschaft einbringen können.“42
40 Vgl. statt vieler Hans Herbert von Arnim, Die Deutschlandakte. Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun, 1. Aufl., München 2009 (umfassend); ders., Ämterpatronage durch politische Parteien, 1980; ders., Auswirkungen der Politisierung des öffentlichen Dienstes, in: Die Personalvertretung 1982, S. 449; ders., Die finanziellen Privilegien von Ministern in Deutschland, 1992; ders., Der Staat als Beute, 1993; ders., Staatliche Fraktionsfinanzierung ohne Kontrolle?, 1987; ders., Parteienfinanzierung, 1982; ders., Staat ohne Diener. Was schert die Politiker das Wohl des Volkes?, 1993; ders., Die Partei, der Abgeordnete und das Geld. Parteifinanzierung in Deutschland, 1996; ders., Fetter Bauch regiert nicht gern. Die politische Klasse – selbstbezogen und abgehoben, 1997; ders., Diener vieler Herren. Die Doppel- und Dreifachversorgung von Politikern, 1998; ders., Vom schönen Schein der Demokratie – Politik ohne Verantwortung – am Volk vorbei, 2000; ders., Das System. Die Machenschaften der Macht, 2001; ders., Politik macht Geld. Das Schwarzgeld der Politiker – weißgewaschen, 2001; ders. (Hrsg.), Korruption. Netzwerke in Politik, Ämtern und Wirtschaft, 2003; ders., Der Verfassungsbruch, 2011; ders., Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977; ders., Entmündigen die Parteien das Volk? Parteiherrschaft und Volkssouveränität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 321/1990, S. 25 ff.; ders., Wer kümmert sich um das Gemeinwohl? Auflösung der politischen Verantwortung im Parteienstaat, in: ZRP 5/2002, S. 223 – 232. 41 A. Baring, Deutschland, was nun?, S. 54 ff. 42 Ebd., S. 59.
VII. Versöhnung und innere Einheit
41
Es soll hier dahingestellt bleiben, inwieweit die Äußerungen Volksverhetzung sind. Als Historiker müsste Baring objektiv argumentieren. Nach Kriegsende mussten die Menschen in der SBZ/DDR unter unsagbar schwierigeren Bedingungen als denen der Westdeutschen ihr Land wieder aufbauen. Die sowjetische Besatzungsmacht hat alles mitgenommen, was mitgenommen werden konnte. Nur die Äcker konnten sie nicht mitnehmen. Dennoch wurde die DDR die führende Industrienation unter den Staaten des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Der Mangel in der DDR beruhte weitgehend darauf, dass sie ihre volkswirtschaftlichen Erträge exportierten, u. a. an die UdSSR „abführen“ mussten, eine Situation und Folge des russischen Besatzungsregimes. Die Lebensleistung der Menschen in der DDR schmälert dies nicht, schon gar nicht Äußerungen Baring’scher Ergüsse. Ferner sei daran erinnert, dass Baring zwar nicht der Zwergen-Generation der DDR angehört, aber der westdeutschen Generation, die von den Abgesandten der USA „umerzogen“ wurde.43 Im Text an anderer Stelle heißt es, so Baring: „… Außerdem fordert unser Rechtsstaat geradezu Dreistigkeit heraus. Jetzt halten sich die Funktionäre und Förderer der SED-Elite noch auffällig ruhig. Aber bleibt das so? Wird uns bald ein Großteil der Träger und Mitträger des früheren Regimes mit unverschämten Forderungen auf Gleichbehandlung, auf gleiche Bezüge, Renten und Pensionen konfrontieren? Und es geht ja nicht nur um Geld. Wird es nicht, angesichts all der neuen Probleme, zu einer nachträglichen Idealisierung der alten DDR kommen, zu ihrer Blattvergoldung im Nachhinein? Wird die jetzige Verweigerungshaltung und Selbsterniedrigungssucht darüber nicht bald da und dort in trotzige Selbstbehauptung umschlagen, wird man in den neuen Bundesländern nicht das Recht auf Eigenbestimmung, auf Autonomie einklagen? Deutet sich im neuen, besonderen DDR-Bewusstsein nicht ein mentaler, ein ostdeutscher Sonderweg an?“44
Man kann Baring nicht zugute halten, dass er als Historiker, nicht als Jurist befindet. Von einem akademisch Gebildeten, einem Hochschullehrer muss erwartet werden, dass er die Grundzüge der Rechtsstaatlichkeit beherrscht. Es ist kein Zeichen von „Dreistigkeit“, sondern nicht zu beanstandendes Anliegen, sein „gutes Recht“ einzufordern, wenn Grundlagen hierfür – offensichtlich oder vermeintlich – gegeben sind. Ihm wird der Staatsvertrag und Einigungsvertrag nicht unbekannt gewesen sein, wonach erworbene Rechte, so Renten- oder Versorgungsansprüche oder -anwartschaften, bestandsgeschützt und zu „überführen“ sind in ein gesamtdeutsches Sozialversicherungssystem. Wenn den Betroffenen diese Rechte genommen werden, nimmt es nicht wunder, dass sie ihre von der Politik gestärkte Selbsterniedrigung überwinden und ihre Rechte geltend machen und auch einklagen, wie es im Rechtsstaat selbstverständlich ist (Art. 19 Abs. 4 GG). 43
Hierzu Caspar von Schrenck-Notzing, Charakterwäsche. Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden Auswirkungen, erw. Neuausgabe, Graz 2004; Rolf Kosiek, Die Frankfurter Schule und ihre zersetzenden Auswirkungen, Tübingen 2001. 44 A. Baring, Deutschland, was nun?, S. 61.
42
C. Eine unendliche Geschichte …
Das Recht auf Selbstbehauptung gehört zur menschlichen Natur, ist im Rahmen des Gebots gegenseitiger Rücksichtnahme unabdingbar. Selbstbestimmung ist Ausfluss menschlicher Autonomie, persönlicher und politischer Freiheit. Es ist nur zu begrüßen, wenn ehemalige DDR-Bürger Autonomie und Selbstbestimmung erstreben,45 unabhängig davon, ob sie „staatsnah“ waren, wenn sie das erstreben, was ihnen im System der DDR vorenthalten war. In den „neuen“ Bundesländern muss Autonomie und Selbstbestimmung nicht „eingeklagt“ werden, haben doch ihre Bürger über ihre Parlamente das Recht auf politische Teilhabe in einem Bundesland mit Staatsqualität. Von demokratischer Teilhabe ist niemand ausgeschlossen, gleich ob SED-Mitglied, Funktionär oder „einfacher“ Bürger. Insoweit sind alle gleich. Das Arge bleibt, dass die Ungereimtheiten in dem Buch immer noch bei vielen Bundesbürgern Vorurteile bekräftigen. Siedler hat noch einen darauf gesetzt, wobei Baring den Abdruck seiner folgenden Äußerung zu verantworten hat: „Man kann den estnischen Präsidenten zitieren, nach Ihrem Walesa-Ausspruch vorhin. Er hat als Ideal seines Volkes formuliert: Zu leben wie die Finnen, zu arbeiten wie die Russen und dabei freie Esten zu werden. Das ist der Traum und das Problem des ganzen Ostblocks. In der alten DDR herrschte im Grunde, wie man es früher formuliert hätte, polnische Wirtschaft. Als Variation davon hat mir neulich jemand, die Provokation auf die Spitze treibend, gesagt: ,und aus den Menschen dort sind weithin deutsch sprechende Polen geworden‘.“46
Es fällt auf, dass dieser „Jemand“ nicht namentlich genannt wird. Es liegt nahe, dass dieser Anonymus nur vorgeschickt ist, um zu verdecken, dass hier eine eigene Meinung wiedergegeben wird. Unabhängig davon handelt es sich hier um eine üble Beleidigung nicht nur der DDR-Deutschen, sondern auch der Polen. Herabgewürdigt wird die Berufs- und Lebensleistung vieler Hunderttausender Bürger, die nach 40 Arbeitsjahren mit der Einigung ihre erworbenen Rechte verloren haben und nur über etwas mehr als das Existenzminimum verfügen. Die drei Männer treiben die Sache dann noch weiter auf die Spitze, wenn sie meinen, dass zur Bewältigung der Probleme „eine neue Ostsiedlung die Rettung wäre“,47 weil nichts aus der Hinterlassenschaft der DDR brauchbar sei und die DDR sich entvölkern werde.48 Baring: „… Es wird entscheidend darauf ankommen, dass sich sehr viele Menschen, jüngere, aber auch ältere, erfahrene, in diese neuen Gebiete begeben, was für sie in vielerlei Hinsicht sehr unangenehm sein wird. Sie werden dort nicht willkommen sein. Man wird sie ausbluten.“(!) „Werden Westdeutschen nicht oft ganz unverschämt hohe Mieten abverlangt, unglaubliche Quartiere zugemutet? Sie werden auf eine von starken Ressentiments zerrissene Gesell45 Zur Kant’schen Autonomie des Willens vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Freiheit in der Republik, Berlin 2007, S. 41, 68 ff., 83 ff., 203 ff., 274 ff., 285 ff., 456 ff., 616 ff., 632 ff. 46 W. J. Siedler, in: A. Baring, Deutschland, was nun?, S. 63 (kursiv vom Verfasser). 47 In: A. Baring, was nun?, S. 63 ff. 48 Ebd., S. 64 ff.
VII. Versöhnung und innere Einheit
43
schaft treffen, auf beschädigte, verbitterte, von der Vergangenheit heimgesuchte, untereinander vielfältig zerstrittene Menschen.49 Man ist versucht zu sagen: Es handelt sich wirklich um eine langfristige Rekultivierung, eine Kolonisierungsaufgabe, eine neue Ostkolonisation, obwohl man das öffentlich fast nicht sagen kann. Es klingt schrecklich hochmütig. Es ist überhaupt eine Frage des Taktes, den Bewohnern der neuen Bundesländer schonend klar zu machen, was sich eigentlich bei ihnen, bei uns vollzieht.“50
Was Baring sagt, ist in der Tat hochmütig. Selten hat ein Zeithistoriker das Thema verfehlt wie Baring in Bezug auf die DDR. Nur ohne tiefgreifende Kenntnisse der volkswirtschaftlichen Verhältnisse ist die Annahme erklärbar, die zuziehenden Westdeutschen würden ausgebeutet werden, die gerade deshalb sich verändern, weil anfangs die Lebenshaltungskosten in Mitteldeutschland niedriger waren. Man muss ihm zugute halten, dass er sein Buch bereits 1991 herausgegeben hat, als die Treuhandanstalt im Auftrag und mit Rückendeckung der Bundesregierung Kohl gerade daran ging, das Volksvermögen der DDR auszuplündern und der Bevölkerung zu entziehen.51 Das ändert aber nichts daran, dass Personen wie Kinkel, Baring u. a. ebenso wie die westdeutsche politische Klasse und wie Vertreter der Bundesregierung, nachdem die Wahl gewonnen war, mit Siegermentalität Vorurteile und Ressentiments gepflegt und verfestigt haben und diese in die Exekutive, den Verwaltungsapparat, das Parlament als Gesetzgeber als politische Leitlinien hineingetragen haben und letztlich auch die oberen Gerichte und das Bundesverfassungsgericht „influenzierten“.52 Nachdem anfangs bis Ende der 90er das Bundesverfassungsgericht zum Teil noch mit gestandenen Hochschullehrern und anerkannten Professoren in dem für die Versorgungsüberleitung Ost zuständigen Senat besetzt war, die geneigt waren, die betroffenen Verfassungsbeschwerdeführer anzuhören und auf ihre Positionen einzugehen,53 kam danach eine neue Richtergeneration mit sehr guten Parteiverbindungen in das Amt, die mit seltener Rigorosität alle Beschwerden zurückweisen,54 die – immer weiter entfernt vom Geschehen – keine Erfahrungen mit den rechtspolitischen Verhältnissen in der DDR gesammelt haben. Bezeichnend ist, dass kein Verfassungsrichter berufen ist, der aus der DDR stammt.
49 50 51 52 53 54
Ebd., S. 70 (kursiv vom Verfasser). Ebd., S. 70 (kursiv vom Verfasser). D. Laabs, Der deutsche Goldrausch … R. Hartmann, DDR-Legenden …, S. 11 – 24. BVerfGE 100, 1 ff., 59 ff., 104 ff., 139 ff. BVerfGE 123, 233.
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland Von der jeweils regierenden politischen Klasse wird immer wieder betont, dass es eine Vergleichbarkeit der Rentensysteme der DDR und der Bundesrepublik Deutschland nicht gäbe und daher auch keine anderen Lösungen. Diese Einschätzung beruht auf einem grundlegenden Irrtum. Um die gegenwärtigen Probleme der Rentenüberleitung zu erfassen und zu verstehen, ist es nützlich, auf die Situation vor der Einigung zu verweisen. Ohne Verständnis für das Vergangene, kann die Gegenwart nicht angemessen erfasst und die Zukunft nicht ausgleichend gestaltet werden.1 In den Grundstrukturen unterscheiden sich die Alterssicherungssysteme der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht. Gegenteilige Annahmen entbehren der Substanz. Dem steht nicht entgegen, dass die Rentenversicherungssysteme in beiden Teilen Deutschlands unter formellen Aspekten – Organisation und Verfahren – nicht ohne weiteres kompatibel sind.2
I. Das Alterssicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) Das Alterssicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist das Ergebnis einer ca. 150jährigen Entwicklung in Deutschland. Es hat sich weitgehend bewährt. Das Alterssicherungssystem beruht traditionell auf drei Säulen. Soweit nicht Wirtschaftskrisen die Volkswirtschaft durcheinander bringen, funktionieren sie recht zuverlässig. Bei einer positiven gesellschafts- und bevölkerungspolitischen Entwicklung, stabilen Wirtschaftslage und relativen Vollbeschäftigung gewährleisten diese Säulen den Bürgern eine angemessene Altersversorgung. Für die Anspruchserwerbszeiten bis 1989 in der Bundesrepublik trifft das weitgehend zu. Infolge der Krise des politischen Systems,3 des sorglosen Umgangs mit den Einnahmen aus der Rentenversicherung, des Entzugs von Ressourcen für versicherungsfremde Leistungen, der wachsenden (verdeckten) Arbeitslosigkeit, der
1 Die folgende Darstellung beruht auf Karl-Heinz Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1. Aufl., Berlin 1999, S. 2 ff.; Werner Mäder/ Johann Wipfler, Wendezeiten – Kulturschaffende im neuen Europa. Zur Versorgungsdiskriminierung von Balletttänzern aus der DDR, St. Augustin 2004, S. 21 ff. 2 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 21 ff. 3 H. H. von Arnim, Das System, 2001.
I. Alterssicherungssystem (alte Bundesländer)
45
nachhaltigen Wirtschaftskrise,4 der Veränderung der Bevölkerungsstruktur (Umkehrung der Alterspyramide) etc. türmen sich die Probleme vor allen Zweigen der Sozialversicherung auf,5 wobei ungewiss ist, ob Abhilfe zu erwarten ist. Das sind Gründe, weshalb der Bundesgesetzgeber die durch den Staatsvertrag und den Einigungsvertrag gestellte Aufgabe der „Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus den Alterssicherungssystemen der DDR in ein gesamtdeutsches Rentenversicherungsrecht“ nicht bewältigt hat, d. h. gelöst hat, dass er mehr Verfassungsprobleme geschaffen denn befriedigend gelöst hat.6 Der extreme Sparzwang war ein Grund für die Beeinträchtigung der Ansprüche und Anwartschaften von Bürgern aus der DDR. Die drei Säulen im Alterssicherungssystem ergänzen sich und sollen gemeinsam sichern, dass der im Arbeitsleben erreichte Lebensstandard im Alter erhalten werden kann. Es sind: – Die gesetzliche Rentenversicherung – 1. Säule –, die hauptsächlich eine Pflichtversicherung für die abhängig Beschäftigten ist. – Die Zusatzversorgungssysteme (Betriebsrentensysteme) – 2. Säule; sie bestehen insbesondere für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sowie für die Beschäftigten in der privaten Wirtschaft, denen Zusagen für Betriebsrenten gegeben wurden. – Die Gesamtversorgungssysteme, von denen gleichzeitig die Funktionen der 1. und 2. Säule der Alterssicherung wahrgenommen werden. Dazu gehören u. a. die Beamtenversorgung, die Versorgungen der Richter, Staatsanwälte und der Soldaten der Bundeswehr, sowie die berufsständischen Versorgungswerke für freiberuflich Tätige. – Die Eigenvorsorge – 3. Säule –, zu der u. a. die privaten Lebens- und Rentenversicherungen, die Vermögensbildung und vielfältige andere Maßnahmen gehören. 4
Hierzu Günter Hannich, Wer in der Schuld ist, ist nicht frei, 2. Aufl., 2006. Vgl. hierzu auch Bernd Schulte, Soziale Grundrechte in Europa. Auf dem Weg zu einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Bausteine Europas, Bd. IX), 2001, S. 94 ff. 6 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, 1999; D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, 2. Aufl., 1994; Ernst Bienert, Die Altersversorgung der Intelligenz in der DDR – Betrachtungen zur Entstehung und Abwicklung von Ansprüchen und Anwartschaften, in: ZSR 1993, S. 349 ff.; Michael Mutz, Aufstieg und Fall eines Konzepts. Die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR und ihre Überführung, in: DAngVers. 11/ 1999, S. 509 ff.; Kai-Alexander Heine, Die Eigentumsrelevanz der Systementscheidung – Anmerkung zum Leiturteil des BVerfG vom 28. 4. 1999 – Az.: 1 BvL 32/95, 2105/95 (NJW 1999, S. 2393 ff.), in: DRV 11/1999, S. 201 ff.; ders., Die Versorgungsüberleitung, Berlin 2003; Bernd Heller, Das 2. AAÜG-Änderungsgesetz zur Rentenüberleitung, in: NJ 7/2001, S. 350 ff.; Henner Wolter, Zusatzversorgungssysteme der Intelligenz – Verfassungsrechtliche Probleme der Rentenüberleitung in den neuen Bundesländern, Baden-Baden 1992; Olaf Fasshauer, Die Überführung der Zusatzversorgung der Hochschullehrer der ehemaligen DDR in die bundesdeutsche Rentenversicherung – Verfassungsrechtliche Probleme (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 628), München 2000. 5
46
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland
1. Gesetzliche Rentenversicherung Die Gesetzliche Rentenversicherung – 1. Säule – hat als Versorgungsziel eine Grundversorgung. Sie beruht auf den Vorgaben eines Generationenvertrages. Die arbeitenden Generationen zahlen Rentenbeiträge, aus denen die Renten für die älteren Generationen finanziert werden. Den – abhängig – Beschäftigten, die pflichtversichert sind, und den freiwillig Versicherten wird in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen eine Rente gewährt, die eine Grundsicherung garantieren soll.7 Die gesetzliche Rente wird, ausgehend von der Höhe des Einkommens (Lohn, Gehalt, anderes Einkommen), das maximal bis zur allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt wird, von der Versicherungsdauer und der Art der beanspruchten Rente (Alters-, Hinterbliebenenrente) berechnet. Aus dem Einkommen für jeden Anspruchserwerbszeitraum, jeweils für ein Jahr, ggf. auch für kürzere Zeiträume, werden nach vorgegebenen Kriterien persönliche Entgeltpunkte (PEP) berechnet. Sie gehen als wesentliche Elemente (u. a. neben der Versicherungszeit) in die Rentenformel ein. Über die Rentenformel ergibt sich die Höhe der Rente.8 Die Beiträge werden je zur Hälfte vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber erbracht. Die Höhe der Beiträge wird, ausgehend vom Leistungsbedarf, jährlich durch Gesetz festgelegt. Die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze lag in der letzten Zeit zwischen dem 1,74- bis 1,87-fachen des vom Gesetzgeber für jedes Jahr gesondert festgelegten Durchschnittseinkommens. Teile des Verdienstes, die darüber liegen, sind für die gesetzliche Rente unbeachtlich.9 Die Beschränkung der Pflichtversicherung auf eine Grundversorgung geht vom Folgenden aus: Wer ein höheres Einkommen haben möchte als die Pflichtversicherung berücksichtigt, oder wer Einkommen hat, das über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, und wer später über ein entsprechend höheres Alterseinkommen verfügen möchte, muss die Voraussetzungen dafür selbst schaffen. Das kann z. B. bei der Wahl des Arbeitsplatzes berücksichtigt werden, wenn dort Ansprüche in einem Zusatzversorgungssystem (2. Säule) erworben werden können. Das kann auch durch eigene Vorsorge (3. Säule) geschehen, z. B. durch Abschluss einer Lebens- und Rentenversicherung, durch Vermögensbildung u. a.m.10 Die gesetzliche Rentenversicherung geht davon aus, dass eine Rente als ein wesentlicher Teil des Alterseinkommens in einem Land, in dem regelmäßig die Löhne und Gehälter im Ergebnis der Tarifverhandlungen (Art. 9 GG) an die Veränderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst werden, nicht statisch sein darf. Bei einem nominell gleichbleibenden Zahlbetrag würde sich die Kaufkraft der Renten zügig vermindern. Es würde, wie das Bundesverfassungsgericht festgestellt hat, im Verhältnis zur Kaufkraft und im Vergleich zu den Löhnen und Gehältern ein 7
Hierzu und zu Folgendem K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 3. Ebd., S. 3. 9 Ebd., S. 3 f. 10 Ebd., S. 4 f. 8
I. Alterssicherungssystem (alte Bundesländer)
47
enteignungsgleicher Effekt eintreten.11 Die Dynamisierung (Anpassung) bewirkt für die Renten eine Realwertgarantie (Gewährleistung der Kaufkraft). Sie passt zu diesem Zweck nach festgelegten Regeln (durch die Rentenanpassungsverordnungen) jährlich die Höhe der Renten der Entwicklung der Löhne und Gehälter an.12 2. Zusatzversorgungssysteme, Gesamtversorgungssysteme Die Zusatz- und Gesamtversorgungssysteme verfolgen das Versorgungsziel, den im Arbeitsleben erreichten Lebensstandard zu erhalten. Die Zusatzversorgungssysteme umfassen die betriebliche Altersversorgung. Dazu gehören die Zusatzversorgungen für die Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst oder in kulturellen Einrichtungen. Jene werden durch die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL), diese durch die Versorgungsanstalt Deutscher Bühnen, Anstalten des öffentlichen Rechts, organisiert.13 Von den Systemen der 2. Säule und den Gesamtversorgungssystemen profitieren nach Schätzungen etwa 75 bis 80 % der Beschäftigten der alten Länder, die über Ansprüche und Anwartschaften aus den Erwerbszeiten bis 1990 verfügen. Insgesamt gibt es in der Bundesrepublik etwa 200 zusätzliche Versorgungssysteme.14 Die verschiedenen Systeme sind sehr unterschiedlich angelegt und in ihrer Ausgestaltung nicht überschaubar. Zwischen einer Vollversorgung im Alter und der realen Versorgung durch die gesetzliche Rente klafft eine empfindliche Versorgungslücke. Sie entsteht insbesondere bei einem Versorgungsberechtigten mit geringem Einkommen, das unter der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Die Zusatzversorgung stockt die gesetzliche Rente für alle Einkommensgruppen auf. Bei Rentnern mit überdurchschnittlichen Arbeitseinkommen wird die Versorgungslücke zunehmend größer, sie kann 50 %, 60 % und mehr erreichen.15 Stets aber kann der Versorgungslücke nur durch Ansprüche aus Versorgungssystemen der 2. Säule und/oder der 3. Säule der Alterssicherung abgeholfen werden. „Reine“ Zusatzversorgungen wie die des öffentlichen Dienstes und die Betriebsrenten ergänzen die Grundversorgung aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Dadurch wird die Rente aufgestockt, im öffentlichen Dienst bis zu ca. 91,75 % des Nettoeinkommens der letzten oder verdienstgünstigsten Jahre. Die Betriebsrenten sind in den von Gewerkschaften abgeschlossenen Versorgungstarifverträgen bzw. in betrieblichen Vereinbarungen geregelt.16 11 12 13 14 15 16
BVerfGE 100, 1 [34 ff.]. K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 5. Ebd., S. 5 ff. Ebd., S. 5, 6. Ebd., S. 6. Ebd., S. 7.
48
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland
Die zusätzlichen Versorgungen haben ihren Rahmen im Betriebsrentengesetz.17 Dieses Gesetz ist mit dem Ziel geschaffen worden, den Arbeitnehmern mehr Sicherheit für die Beibehaltung bzw. Durchsetzung ihrer Leistungsansprüche zu geben. Es garantiert z. B. auch, dass selbst bei Insolvenz (Bankrott) des Unternehmens die Leistungen dauerhaft bis zum Lebensende weiter erfolgen können. 3. Gesamtversorgungssysteme Gesamtversorgungen wie die Beamtenversorgung haben inhaltlich das Versorgungsziel, das dem der Zusatzversorgungen in etwa entspricht. Sie ergänzen aber die gesetzliche Rentenversicherung nicht, sondern ersetzen sie durch ein leistungsfähigeres komplexes Versorgungssystem. Das erfüllt die Ziele der gesetzlichen Rentenversicherung und eines Zusatzversorgungssystems zusammengenommen.18 Gesamtversorgungen wie die Beamtenversorgung z. B. werden aus dem Steueraufkommen finanziert. Die Beamten leisten keine Beiträge zur Rentenversicherung (was auch systemwidrig wäre) oder zu ihrer speziellen Altersvorsorge. Allerdings wird ein geringer Prozentsatz aus nicht erhöhter Besoldung für Pensionsrückstellungen verwandt. Außerdem folgt das Absehen von Beitragszahlungen der Tatsache, dass die Besoldung der Beamten sich nach dem Alimentationsprinzip richtet und die Vergütung schon den Abschlag im Hinblick auf die Pensionsverpflichtung des Dienstherrn enthält. Beamtenversorgungsempfänger haben außerdem – wie Berechtigte aus der gesetzlichen Rentenversicherung ab einem bestimmten Alterseinkommen – auf ihre Versorgung Steuern zu entrichten.19 Zu den Beamtenversorgungssystemen gehören die berufständischen Versorgungswerke, vor allem Freiberufler (Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten) und deren Mitarbeiter, meist mit erheblich günstigerem Versorgungsziel. Dabei muss vergegenwärtigt werden, dass Freiberufler zumeist über das 65. Lebensjahr hinaus arbeiten, günstigere Hinzuverdienstmöglichkeiten dabei haben und außerdem unter Umständen über Vermögen verfügen. 4. Private Eigenvorsorge Private Eigenvorsorge – 3. Säule – hat als Versorgungsziel die zusätzliche Einkommensabsicherung zur Beibehaltung oder Erhöhung des Lebensniveaus. Jeder kann nach seinen finanziellen Möglichkeiten und seinem Willen ergänzend Vorsorge für den Lebensunterhalt im Alter treffen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. Eigenvorsorge kann durch private Lebens- und Rentenversicherung, Konten- und 17 Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung vom 19. 12. 1974 (BGBl. III 800 – 22). 18 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 25. 19 Ebd., S. 25.
II. Das Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik
49
Wertpapiersparen, Kauf von Aktien, Fondsanteilen etc., Kauf von Eigentumswohnungen, Beteiligung an Immobilienfonds oder durch Schaffung von Eigentum/ Vermögen in anderen Formen getroffen werden.20
II. Das Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) In der DDR bestand das Alterssicherungssystem ebenfalls mit 3 Säulen, die mit denen der Bundesrepublik verglichen werden können.21 In ihrer Art und Leistungsfähigkeit waren sie allerdings – bis zur Wende 1989 – eingezwängt in die Realität der sozialistischen Wirtschafts- und Rechtsordnung. Aber auch in der DDR ergänzten sich die drei Säulen gegenseitig und sicherten gemeinsam, dass der im Arbeitsleben erreichte Lebensstandard im Alter stets unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen grundsätzlich erhalten werden konnte. Die 3 Säulen, wesentliche Elemente des Alterssicherungssystems in der DDR im engeren Sinne, waren: – Die Sozialversicherung der DDR (SV) in ihrer Funktion als gesetzliche Rentenversicherung – 1. Säule; – die Zusatzversorgungssysteme – 2. Säule; Sie bestanden insbesondere für die Angehörigen der Intelligenz (u. a. Wissenschaftler, Hochschullehrer, Ärzte, Ingenieure, Lehrer und Künstler), weiter für die Beschäftigten der staatlichen Organe der DDR, für Mitarbeiter der Parteien u. a.m., sowie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens der DDR und für Angestellte wichtiger Betriebe (gemäß AO 54). – die Gesamtversorgungssysteme, die zugleich die Funktion der 1. und 2. Säule der Alterssicherung (Grundsicherung und Lebensstandardsicherung) hatten. Es waren die Versorgungsordnungen für die Angehörigen der Nationalen Volksarmee der DDR, der Deutschen Volkspolizei und der Zollverwaltung der DDR sowie der Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR, schließlich für Eisenbahner und Postbedienstete; – die Eigenvorsorge – 3. Säule, zu der insbesondere die Freiwillige zusätzliche Altersversicherung (FZR 1968 und FZR 1971) aufgrund von Versicherungsverträgen mit der SV sowie einige Lebens- und Rentenversicherungen, die mit der Staatlichen Versicherung der DDR abgeschlossen werden konnten, gehörten. 20 Günter Schaub u. a., Erfolgreiche Altersvorsorge, 3. Aufl., 1989, S. 3, 26. Hierzu und im Folgenden K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 9 – 23 (13 ff.). 21 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 26.
50
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland
1. Allgemeine Sozialversicherung – Sozialversicherung und Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR) In der DDR bestand von Beginn an eine einheitliche Sozialpflichtversicherung mit Versicherungsschutz vor den Risiken des Alters, der Invalidität und des Todes. Die dadurch bewirkte Grundsicherung wurde ergänzt durch eine Freiwillige Zusatzrentenversicherung.22 a) Sozialpflichtversicherung Die gesetzliche Rentenversicherung – 1. Säule – gehörte zu „der einheitlichen und umfassenden Versicherung für Arbeiter und Angestellte, Genossenschaftsmitglieder der LPG und PGH, Mitglieder der Rechtsanwaltskollegien sowie freiberuflich und selbständige Erwerbstätige“,23 nämlich zu der Sozialversicherung. Pflichtversichert waren einerseits die „Werktätigen“ in der Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten beim FDGB,24 andererseits Selbständige und Genossenschaftsmitglieder in der Staatlichen Versicherung der DDR.25 Altersrenten aus der Pflichtversicherung wurden nach Erreichen der Altersgrenze und nach einer mindestens fünfzehnjährigen versicherungspflichtigen Tätigkeit gezahlt, deren Höhe sich im wesentlichen nach der Beschäftigungsdauer und dem erzielten Verdienst richtete. Die Renten waren jedoch relativ niedrig, weil die Beitragsbemessungsgrenze über einen langen Zeitraum unverändert bei 600,– M im Monat (7.200,– M im Jahr) lag und es keine regelmäßige Anpassung der Renten gab. Sie betrugen als Mindestrente je nach Zahl der Arbeitsjahre zuletzt 330,– bis 470,– M und konnten höchstens 510,– M erreichen.26 Die Leistungen der Pflichtversicherung beruhten auf einem beitragsfinanzierten Umlageverfahren. Für die Versicherten betrug der Beitrag i. d. R. 10 % des Arbeitsverdienstes. Betriebe und Einrichtungen führten 12,5 % als Beitrag ab. Ein zusätzlicher Finanzbedarf wurde durch öffentliche Mittel aus dem Staatshaushalt der DDR gedeckt.27 Versorgungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung war, eine Grundversorgung zu gewährleisten.
22 Hierzu K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 14 – 16, 20 – 23; D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 12 f.; BVerfGE 100, 1 [3 f.]. 23 Vgl. Meyers Neues Lexikon, Leipzig 1975, Stichwort: Sozialversicherung (SV). 24 Vgl. Verordnung zur Sozialpflichtversicherung der Arbeiter und Angestellten (SVO) vom 17. 11. 1977 (GBl. I, S. 373). 25 Verordnung über die Sozialversicherung bei der Staatlichen Versicherung der Deutschen Demokratischen Republik vom 9. 12. 1977 (GBl. I 1978, S. 1). 26 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 13. 27 BVerfGE 100, 1 [3 f.].
II. Das Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik
51
b) Freiwillige Zusatzrentenversicherung (FZR) Da die Sozialversicherung den Anforderungen einer angemessenen Altersversicherung nicht genügte, wurde den Sozialpflichtversicherten ab 1968 die Möglichkeit gegeben, in einer freiwilligen zusätzlichen Versicherung Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze zu versichern und damit die Höhe der Altersversorgung individuell zu bestimmen. Beitrittsberechtigt zur FZR waren alle Sozialpflichtversicherten, deren Einkommen die Versicherungspflichtgrenze überstieg. Träger der FZR waren die Verwaltung der Sozialversicherung des FDGB und die Staatliche Versicherung der DDR für die jeweils bei ihnen Pflichtversicherten. Der Betrag betrug im Regelfall 10 % des Einkommens über 600,– M. Bei einem Einkommen über 1.200,– M monatlich (14.400,– M jährlich) konnte der Versicherte wählen, ob er für das gesamte 600,– M übersteigende Einkommen oder nur für das Einkommen bis zu dieser Grenze Beitrag entrichten wollte. Einrichtungen und Betriebe zahlten den gleichen Betrag wie die Versicherten.28 Die Höhe der monatlichen Zusatzrente betrug 2,5 % des 600,– M übersteigenden beitragsbelasteten Durchschnittseinkommens pro Jahr der Zugehörigkeit zur FZR. Die FZR verbesserte zunächst die Relation zwischen Rente und Arbeitseinkommen beträchtlich. Da die Einkommen stiegen, die Berechnungsfaktoren konstant blieben, öffnete sich in der Folgezeit wieder die Schere zwischen Rente und zuletzt erzieltem Arbeitsentgelt. Für das Rentenzugangsjahr 1985 betrug die Rente in der DDR (Sozialpflichtversicherung und FZR) bei maximaler Beitragszahlung im gesamten Zeitraum durchschnittlich 548,– M, für das Rentenzugangsjahr 1988 578,– M und für das Rentenzugangsjahr 1990 602,– M monatlich.29 Von der Möglichkeit der FZR machten etwa 85 v.H. aller Berechtigten Gebrauch, so dass 1989 mehr als ein Drittel aller Altersrentner sowie die Hälfte aller Invalidenrentner eine Zusatzrente bezogen, die durchschnittlich jedoch nur knapp 100,– M ausmachte.30 2. Zusatzversorgungssysteme Die Zusatz- und Gesamtversorgungssysteme – 2. Säule Altersversicherung – verfolgen das Versorgungsziel, nach Beendigung der Berufstätigkeit den Lebensstandard erhalten zu können.31 Sie bestanden für bestimmte Gruppen.
28
BVerfGE 100, 1 [4]. BVerfGE 100, 1 [4]. 30 Vgl. im einzelnen Bertram Schulin, Sozialrecht, 5. Aufl., 1993, Rn. 963 ff.; Andreas Polster, Grundzüge des Rentenversicherungssystems der Deutschen Demokratischen Republik, in: DRV 1990, S. 154 ff.; Hans-Jörg Bonz, Die Sozialversicherung in der DDR und die „Politik der Wende“, in: ZSR 1990, S. 11 ff.; Volker Meinhardt/Heinz Vortmann, Vereinheitlichung des Rentenrechts, in: DA 1991, S. 1254 ff.; Ulrich Lohmann, in: Hans F. Zacher (Hrsg.), Alterssicherung im Rechtsvergleich, 1991, S. 193 ff. 31 Vgl. im einzelnen K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 16 – 20. 29
52
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland
Die Zusatzversorgungssysteme betrafen nicht nur Mitglieder des Staatsapparates sowie gesellschaftlicher Organisationen und des FDGB, sondern auch die wissenschaftliche und technische Intelligenz, Ärzte, Künstler und Mitglieder des Schriftstellerverbandes bis zu Ballettmitgliedern an staatlichen Einrichtungen der DDR. Das Grundmuster gibt die zusätzliche Altersversorgung für die Intelligenz (AVI).32 Es haben sich in 3 Entwicklungsetappen mehrere Formen für unterschiedliche Gruppen entwickelt. In der Zeit bis 1969 waren 13 zusätzliche Versorgungssysteme entstanden; 1970 bis 1980 kamen 12 und 1981 bis 1989 weitere 9 hinzu. Die meisten wichen von der Struktur der bestehenden Systeme nur geringfügig ab; verschiedene stellen daher keine eigenständigen Systeme dar.33 Das Renten-Überleitungsgesetz führt 27 Zusatzversorgungssysteme auf.34 Ziel der Zusatzversorgung war, den Berechtigten einen prozentualen Teil ihres letzten Erwerbseinkommens (in der Regel 90 % des Nettolohnes) unter Anrechnung der Rente aus der Sozialversicherungspflicht zu sichern. Für manche Berufsgruppen war die Einbeziehung obligatorisch, (z. B. für Hochschullehrer, Pädagogen, Mediziner in bestimmten Funktionen), konnte aber im Einzelfall durch Ministerentscheidung erfolgen,35 wie es für die Mitglieder des Balletts in staatlichen Einrichtungen erfolgt ist.36 Erst ab 1971 wurde eine Beitragspflicht für die Zusatzversicherung eingeführt. Auch danach hatten jedoch Versorgungsberechtigte in den Zusatzversorgungssystemen der Generaldirektoren der zentral geleiteten Kombinate,37 der Ballettmitglieder an staatlichen Einrichtungen,38 die Pädagogen an Einrichtungen der Volksund Berufsbildung39 sowie die obligatorisch in die Zusatzversorgungssysteme der Anlage 1 Nr. 4 und Nr. 6 AAÜG Einbezogenen, nämlich die Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen, sowie Ärzte, Zahnärzte u. a. in konfessionellen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens keine Beiträge zu leisten.40 Soweit eine Beitragspflicht bestand, waren die Beiträge an die FZR zu entrichten, wobei die Beitragshöhe – anstelle des üblichen 32 Verordnung über die Altersversorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. 7. 1951 (GBl. Nr. 85, S. 675); Verordnung zur Änderung der VO vom 12. 7. 1951, vom 13. 5. 1959 (GBl. S. 521); VO über die Neuregelung von Ansprüchen auf zusätzliche Altersversorgung der Intelligenz vom 1. 3. 1962 (GBl. Teil II, S. 116). 33 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 16. 34 Art. 3, Anlage 1 RÜG. – Die dortige Aufzählung ist allerdings nicht vollständig: vgl. K.H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 16, Fn. 43, S. 19. 35 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 13. 36 Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 32 ff. 37 Anl. I Nr. 2 AAÜG. 38 Anl. I Nr. 17 AAÜG. 39 Anl. I Nr. 18 AAÜG. 40 Vgl. Henner Wolter, Zusatzversorgungssysteme der Intelligenz, 1992, S. 186 ff. (187, 190, 192, 195, 207).
II. Das Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik
53
Satzes von 10 % – oftmals nur 5 oder 3 % des maßgeblichen Verdienstes ausmachte.41 Die Höhe der Zusatzversorgungsleistungen waren am zuletzt erzielten Erwerbseinkommen ausgerichtet und betrug 50 und 80 % des letzten Nettoverdienstes. Einige Systeme sahen dabei eine Obergrenze von 800,–M vor, von der durch Minister (rats)beschluss befreit werden konnte. Im Regelfall sollten die Leistungen zusammen mit der Rente aus der Rentenversicherung 90 % des letzten Nettoverdienstes ergeben.42 Leistungen aus Zusatzversorgungssystemen bezogen rd. 200 000 bis 225 000 Versorgungsberechtigte. Die Zusatzversorgungsrenten betrugen im Zeitpunkt der Umstellung in etwa der Hälfte aller Fälle nicht mehr als 200,– M, in etwa 800 Fällen mehr als 2000 M.43 Die Zusatzversorgung in der DDR ähnelt der Zusatzversorgung für Arbeiter und Angestellte des öffentlichen Dienstes in der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder sowie der betrieblichen Altersvorsorgung in den westdeutschen Bundesländern.44 3. Gesamtversorgungssysteme Die Gesamtversorgungssysteme der DDR, jetzt Sonderversorgungssysteme genannt,45 verfolgen das Versorgungsziel, das dem der Zusatzversorgungen entspricht. Sie stellen eine eigenständige Sicherung für Staatsbedienstete außerhalb der Sozialpflichtversicherung dar,46 ersetzen die gesetzliche Rentenversicherung. Das Gesamtversorgungssystem erfüllte die Ziele der gesetzlichen Rentenversicherung und die eines Zusatzversorgungssystems – 1. und 2. Säule der Alterssicherung – und gleichzeitig die der Krankenversicherung. Die Versorgungsberechtigten hatten 10 % ihrer vollen Bezüge ohne Bemessungsgrenze als Beiträge an den Sonderversorgungsträger zu entrichten.47 Die
41
Vgl. Axel Reimann, Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der ehemaligen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung, in: DAngVers. 1990, S. 281 ff.; vgl. auch V. Meinhardt/H. Vortmann, Vereinheitlichung des Rentenrechts, S. 1254 ff. 42 BVerfGE 100, 1 [5 f.]. 43 Vgl. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 14 m.N. 44 Ebd., S. 14; BVerfGE 100, 1 [15]. 45 Mit der Bezeichnung „Sonderversorgungssystem“ wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, es handle sich um eine besondere Privilegierung. 46 Hierzu und zum Folgenden D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 14 f.; K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 19 f. 47 Hierzu A. Reimann, Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme …, S. 281 ff.
54
D. Alterssicherungssysteme in Deutschland
Rentenhöhe betrug grundsätzlich 90 % der jeweiligen Nettobesoldung vor dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis.48 Es bestanden vier Gesamtversorgungssysteme, nämlich für Angehörige der Nationalen Volksarmee, des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit, Angehörige der Zollverwaltung, der Deutschen Volkspolizei und der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs.49 Insgesamt gab es rund 120 000 Empfänger von Sonderversorgungen.50 Die Bezieher von Renten aus der Gesamtversorgung hatten einen den Ruhestandsbeamten in den westdeutschen Ländern vergleichbaren Status.51 4. Eigene Altersvorsorge Die eigene Altersvorsorge – 3. Säule – war in der DDR, abgesehen von einzelnen Vorformen, von den Lebens- und Rentenversicherungen der Staatlichen Versicherung der DDR, die wegen der sozialistischen Wirtschaftsordnung und aufgrund des Fehlens privater Versicherungen nie größere Bedeutung erlangen konnten, und der Zusatzrente nach der FZR 1968 vor allem mit der FZR, die mit der Sozialversicherung abgeschlossen werden konnte, eingeführt worden.52 Weitergehende, über die FZR-Ansprüche und die Ansprüche aus Lebens- und Rentenversicherungen hinausgehende Ansprüche auf Alterseinkommen aus weiteren und unterschiedlich gestalteten Lebens- und Rentenversicherungen sowie Ansprüche aus anderen Quellen, wie sie in erheblichem Maße bei Bürgern der westdeutschen Länder zu einer angemessenen Alterssicherung aus der sog. 3. Säule der Alterssicherung beitragen, konnten DDR-Bürger nicht erlangen. Neben der Sozialversicherung gab es auf den einschlägigen Gebieten nur die Staatliche Versicherung der DDR. Auch andere Alterssicherungsmöglichkeiten, wie sie in den alten Ländern bestanden, gab es für DDR-Bürger nicht.53
48 Vgl. Michael Mutz/Ralf-Peter Stephan, Aktuelle Probleme des AAÜG, in: DAngVers. 1992, S. 281 ff. 49 Art. 3, Anlage 2 RÜG. 50 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 15 m.N. 51 Ebd., S. 15; BVerfGE 100, 1 [5]. 52 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 20. 53 Ebd., S. 20 f.
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum ist das älteste Menschenrecht.1 Die staatliche Verfassung findet es vor. Eigentum als Ausprägung des Freiheitsrechts ist unveränderliche Grundlage des politischen Gemeinwesens.2 Aufgabe einer Verfassung ist es, Eigentum zu garantieren und zu schützen. Dies verheißt die Staats- und Rechtsphilosophie, wie sie in Sonderheit ihre Ausprägung im Europa seit Ausbruch der Neueren Zeit erfahren hat. Sie ist geistiges Erbe des Abendlandes.3
I. Eigentum im europäischen Völkerrecht Erwerb und Erhaltung des Eigentums ist ein Menschenrecht, das im Völkerrecht verankert ist.4 Nach Art. 1 Abs. 1 Satz 1 des Zusatzprotokolls zur EKMR5 hat „jede natürliche … Person ein Recht auf Achtung ihres Eigentums“. Nach Satz 2 dieses Absatzes „darf niemandem sein Eigentum entzogen werden, es sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen“. Nach Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebiets. Der Mensch hat Eigenes als Mensch und als solcher um der allgemeinen Freiheit willen, die gebietet, das Eigene des Menschen, das Mein und Dein, zu schützen, ein Recht als Mensch, also ein Menschenrecht auf bestmöglichen Schutz des Seinen, also auf Schutz des Staates und damit im übrigen als Recht auf einen Staat. Prinzipiell wird das Eigene durch dieses Eigene schützende Gesetze zum Eigentum.6 Wenn die Gesetze das Eigene nicht als Menschenrecht des Eigentums schützen, ist das Menschenrecht verletzt und der Mensch hat ein Recht auf den angemessenen 1 Gottfried Dietze, Korollarium 200 Jahre nach Kant und Schiller, in: ders., Amerikas Schuldgefühl, 2005, S. 71 (76); Oscar Schneider, Kultur des Eigentums, in: Schwäbisch-HallStiftung (Hrsg.), Kultur des Eigentums, 2006, S. 103 – 108. 2 Zur „Freiheitlichen Eigentumsgewährleistung“ Karl Albrecht Schachtschneider, Freiheit in der Republik, 2007, S. 537 ff. 3 Vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 21. 4 Ebd., S. 125, 159 – 162, 177, 178, 197 f., 199, 225. 5 Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 6 K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 537 ff.
56
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
Schutz des Seinen. Das Eigentum hängt somit nicht davon ab, ob es dem Menschenrecht entsprechend geschützt wird/wurde, sondern davon, dass der Mensch ein schützenswertes Eigentum besitzt. Das Eigene kann sich nur in der jeweiligen Ordnung entfalten, in der der Mensch lebt; für die Betroffenen war das bis zur deutschen Einigung 1990 die DDR. Nach den Lebensverhältnissen in der DDR ist somit zu ermitteln, ob die Betroffenen Eigentum hatten und haben, das den Schutz des Zusatzprotokolls zur EMRK genießt.7 In der arbeitsteiligen Gesellschaft besteht Eigentum nicht nur in Gütern, die man im Sinne tatsächlicher Gewalt im Besitz haben kann, also vor allem an unbeweglichen und beweglichen Sachen, sondern das Eigene und Eigentum sind alle Möglichkeiten des Lebens und Handelns, im Gegensatz zur Freiheit als der Fähigkeit des Handelns.8 Die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls praktiziert vermögenswertes Recht als Eigentum.9 Das ist zu eng. Eigentum besteht in einem Gemeinwesen, in dem die meisten Menschen von der Arbeit in Arbeitsverhältnissen leben, der sogenannten Arbeitnehmergesellschaft, wesentlich in Rechten aus dem Arbeitsverhältnis, insbesondere in den Ansprüchen auf geldwerte Leistungen aus diesen Verhältnissen. Arbeitsverhältnisse sind menschliche Verhältnisse, die in jedem Gemeinwesen unabhängig von der jeweiligen Rechtsordnung bestehen und Verhältnisse des Mein und Dein, des Eigenen, hervorbringen, die entweder als Eigentum geschützt werden oder des Eigentumsschutzes bedürfen.10 Die Rechtsphilosophie hat zu diesem Behuf das menschenrechtliche Eigentum erkannt, dessen Schutz der Souverän sich nicht entziehen darf.11 In der DDR erworbenes „privates“ Eigentum ist mit der Einigung der beiden Teile Deutschlands 1990 nicht untergegangen. Im Jus publicum Europaeum, dem europäischen Völkerrecht, bestand seit jeher Einmütigkeit, dass im Falle einer „Landnahme“, territorialen Veränderung oder Staatensukzession der Grundsatz der Respektierung wohlerworbener Rechte unbedingt gilt.12 „… Dadurch, dass öffentlichrechtliche staatliche Herrschaft (imperium oder jurisdictio) auf der einen, privatrechtliches Eigentum (dominium) auf der anderen Seite scharf getrennt werden, wird es möglich, die schwierigste Frage, nämlich die eines mit dem Gebietwechsel verbundenen Verfassungswechsels, aus der juristischen Erörterung herauszuhalten. Vor dem Hintergrund der anerkannten staatlichen Sou7
K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 537 ff.; ders., Verletzung des Menschenrechts auf Eigentum. Rechtsgutachten in Sachen Gisela Kirsten/Deutschland in dem Verfahren vor dem EGMR, Beschwerde Nr. 19124/02. 8 K. A. Schachtschneider, Freiheit der Republik, S. 537 ff. 9 Ebd., S. 537 ff., insbes. 541 ff.; BVerfGE 14, 288 [293]; 95, 167 [300]; 100, 1 [33]. 10 Zur Arbeit als Privateigentum schon John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung (1679/1689), Frankfurt am Main 1977, 5. Kap., S. 231; zu Locke vgl. auch W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 52 – 57. 11 Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum, Abschnitt C. bis G., S. 31 – 65. 12 Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus publicum Europaeum (1950), 4. Aufl., 1997, S. 169.
II. Bundesrepublik Deutschland
57
veränität blieb der Bereich des Privaten, das bedeutet hier insbesondere der Bereich der Wirtschaft und des privaten Eigentums, von dem Gebietswechsel unberührt. Die internationale freie, d. h. liberale von privaten Unternehmen und Kaufleuten getragene Marktordnung, der internationale in gleicher Weise freie Welthandel, die Freizügigkeit des Kapitals und der Arbeit, alles das hatte bei einem Gebietswechsel im wesentlichen alle internationalen Sicherungen, deren es praktisch bedurfte. Allen zivilisierten Staaten ist in diesem Zeitabschnitt sowohl die Unterscheidung von öffentlichem und privatem Recht, wie auch der Standard des liberalen Konstitutionalismus gemeinsam, für den das Eigentum (property) und damit Handel, Wirtschaft und Industrie zur Sphäre des verfassungsrechtlich geschützten Privateigentums gehören. Dieser Verfassungsstandard konnte bei allen an dem Gebietswechsel beteiligten Staaten grundsätzlich als anerkannt vorausgesetzt werden.13 Das bedeutet den entscheidenden Gesichtspunkt für unsere Frage: ein Gebietswechsel war kein Verfassungswechsel im Sinne der Sozial- und Eigentumsordnung. Auch hier ist die Eigentumsordnung ein Teil der Völkerrechtsordnung. …“14 Auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 8. 4. 1997 geht in etwa in diese Richtung, wobei es ungewiss ist, ob es dabei den völkerrechtlichen Rahmen präsent hatte:15 „Weder trifft die Ansicht zu, dass in der Deutschen Demokratischen Republik Rechtsbeziehungen, die für den Rechtsstaat anerkennungsfähig wären, überhaupt nicht entstehen konnten, noch ist es richtig, dass mit der Verfassung eines Territoriums auch die in ihm bestehenden Rechtsbeziehungen untergehen. Beim Verfassungswechsel ist vielmehr die Kontinuität der nicht unmittelbar begründeten Rechtsbeziehungen die Regel, während ihre Aufhebung ausdrücklich angeordnet wird. Davon geht das intertemporale Privatrecht aus, wie der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung annimmt (vgl. BGHZ 10, S. 391 [394]; 120, S. 10 [16]“.16
II. Bundesrepublik Deutschland Das Eigentumsrecht hat einen festen Bestandteil im Katalog der verfassungsmäßig verankerten Grundrechte.17 1. Eigentum nach Artikel 14 Abs. 1 GG als variabler Begriff Das Grundgesetz garantiert das Eigentum(srecht); so jedenfalls sagt es Art. 14 Abs. 1. Jedoch: Weder der Gehalt noch der Wesensgehalt der Eigentumsgewähr13 14 15 16 17
Ebd., S. 169/170. Ebd., S. 170. BVerfG, Urt. vom 8. 4. 1997 – 1 BvR 48/94 – BVerfGE 95, 267 – Altschulden. BVerfG 97, 267 [303 f.], zu C, III 1 a. Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 108 ff.
58
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
leistung des Art. 14 Abs. 1 GG lässt sich aus dem Begriff des Eigentums gewinnen, dessen Inhalt und Schranken nach Satz 2 dieser Vorschrift durch die Gesetze bestimmt werden soll. Das Grundgesetz überantwortet es dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Idee des Eigentums, den Wert „Eigentum“18 gegen den Gesetzgeber zu verteidigen, was immer der Gesetzgeber beschließen mag. Der Verfassungsgeber hat Eigentum zu einer Grundlage des Gemeinwesens erklärt, ohne mit dem Wort Eigentum angesichts der Geschichte des Begriffs19 definieren zu können, was Eigentum unter dem Grundgesetz sei. Es bleibt offen, welche Rechtsverhältnisse den Namen Eigentum verdienen, insbesondere aber, welche „Kern des Eigentums“, „Kernbereich des Eigentums“, „grundlegender Gehalt der Eigentumsgarantie“ seien oder wie sonst das BVerfG ausspricht, was Eigentum bleiben muss.20 Mit dem Begriff Eigentum delegiert das Grundgesetz mittels der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG21 die Entscheidung über die den legislativen Gesetzgeber bindende Eigentumsverfassung des Grundgesetzes dem BVerfG, diesem in besonderer Weise der Politik und damit richtiger Gesetzgebung verpflichteten Gericht. Es soll das Volk bei der Erkenntnis dessen vertreten, ob die Gesetze der Legislative angesichts der Entscheidung des Grundgesetzes für das Eigentum dem politischen Grundkonsens des Gemeinwesens entsprechen, der in der jeweiligen Erkenntnis erst zu einer materialen Bestimmtheit geführt wird, welche eine Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes ermöglicht. Eigentum i.S. von Art. 14 Abs. 1 GG ist ein variabler und dynamischer Verfassungsbegriff.22 Gestern war grundrechtsgeschütztes Eigentum etwas anderes, als es heute ist oder morgen sein wird.23
18 Vgl. BVerfGE 14, 263 [278]; 18, 12 [132]; auch BVerfGE 37, 132 [140]; 58, 300 [382]; 62, 169 [183], das von einer „grundlegenden Wertentscheidung zugunsten des Privateigentums“, von „einer Wertentscheidung von besonderer Bedeutung“ spricht; dazu Walter Leisner, Eigentum, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR VI, 1989, § 149 Rn. 18 ff. 19 Dazu W. Leisner, Eigentum, § 149 Rn. 25 ff.; Dieter Schwab, Art. „Eigentum“, in Otto Brunner u. a. (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 2, Studienausgabe, 1. Aufl., 2004, S. 65 ff. 20 Vgl. etwa BVerfGE 21, 73 [79 f., 82 f.]; 42, 263 [295]; 45, 142 [173]; 45, 272 [296]; 50, 290 [341]; 52, 1 [30]; 56, 249 [260]; 95, 48 [61]; dazu W. Leisner, Eigentum, § 149 Rn. 77 ff., zu dem verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff in der Rspr. des BVerfG. 21 Das gilt auch für die Eigentumsgewährleistung des Art. 14 Abs. 1 GG. – Ludwig Schneider, Der Schutz des Wesensgehalts der Grundrechte nach Art. 19 Abs. 2 GG, 1983, S. 57 ff., insbes. S. 65 ff.; W. Leisner, Eigentum, § 149 Rn. 22 f., 62 (Kern als Menschenrecht). 22 Dazu K. A. Schachtschneider, Res publica res populi, 1994, S. 1023 ff.; Peter Badura, Eigentum, in: Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-Jochen Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1983, S. 655, spricht von „auffälliger Plastizität“ des Eigentums. 23 K. A. Schachtschneider, Freiheitliche Eigentumsgewährung, in: ders., Freiheit in der Republik, 2007, S. 537 (578).
II. Bundesrepublik Deutschland
59
2. Bundesverfassungsgericht: Schwindende Eigentumsfreiheit Das Bundesverfassungsgericht, das für sich beansprucht, „oberster Hüter“ der Verfassung zu sein, leidet mittlerweile an „Bildstörungen“, wenn es das Grundgesetz mit seiner Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG für das Gebiet der „neuen Länder“ und der Bundesgesetzgebung zur Regelung offener Vermögensfragen außer Kraft setzt, ohne Rücksicht auf das entgegenstehende Völkerrecht. „Der Gesetzgeber darf im Rahmen seiner Regelungsbefugnis nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bei der generellen Neugestaltung eines Rechtsgebiets unter bestimmten Voraussetzungen auch bestehende, durch die Eigentumsgarantie geschützte Rechtspositionen beseitigen.“24
In einer späteren Entscheidung heißt es dann sogar: „Auch können grundlegende Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse den Regelungs- und Gestaltungsspielraum erweitern.“25
Hier ist reine politische Justiz am Werke, die an Marx erinnert: „Eine Definition des Eigentums als eines unabhängigen Verhältnisses, einer besonderen Kategorie, einer abstrakten und ewigen Idee geben zu wollen, kann nichts anderes sein als eine Illusion der Metaphysik oder der Jurisprudenz.“26
Der juristische Eigentumsbegriff wurde hier – wie im Marxismus27 – für die Jurisprudenz entbehrlich.28 Die Erosion des Eigentumsschutzes setzt sich fort unter der Regierung Merkel/Schäuble, die mit ihren Euro-„Rettungsschirm“ es verantworten muss, dass das Vermögen der deutschen Bürger und das vermögensbildende Eigentum völlig aufgezehrt wird.29 Die Tendenz geht dahin, dass alles, was in einem formellen Gesetz bestimmt wird, mit materiellem Recht gleichgesetzt wird. Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht gehen dazu über, die Reine Rechtslehre Hans Kelsens30 zu praktizieren,
24
BVerfG, Beschl. vom 9. 1. 1991, BVerfGE 83, 201 [211] = NJW 1991, S. 1807; vgl. auch BVerfGE 84, 90; 94, 12. 25 BVerfG, VIZ 2001, S. 113. 26 Karl Marx, Das Elend der Philosophie (1847), MEW, Bd. 4 (1959), § 4, S. 165. 27 Vgl. hierzu D. Schwab, Art. „Eigentum“, IV 3·, S. 110 ff. 28 Torsten Purps, Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards?, in: NJ 6/2009, S. 233 – 240: „Per Saldo darf man festhalten, dass die Bilanz bei der Abwicklung der Bodenreform katastrophal ausfällt.“ (S. 238). 29 Hierzu eindringlich Karl Albrecht Schachtschneider, Die Rechtswidrigkeit der EuroRettungspolitik. Ein Staatsstreich der Politischen Klasse, 1. Aufl., 2011, zu Art. 14 GG, S. 79 f., 98, 111, 117, 122, 131, 136 f., 140, 142, 209, 211 ff., 225, 227 ff.; Michael Paulwitz, Stirb langsam, in: JF Nr. 38/12 vom 14. 9. 2012, S. 1. 30 Hans Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911; ders., Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1920; ders., Allgemeine Staatslehre 1925; ders., Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Ein Beitrag zu einer reinen Rechtslehre, 1920.
60
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
wonach im Grundsatz alles Recht ist, was das Gesetz produziert.31 Das führt vom Rechtsstaat weg zum reinen Gesetzesstaat.32 Der Rechtspositivismus kommt der modernen ,Parteien‘-Demokratie und ihren parteipolitischen Abwechslungen, mit einer Parteioligarchie33 auffallend entgegen. Die Rechts- und Unrechtsmöglichkeiten sind grenzenlos. Es gibt keine Hindernisse. Die Herrschaft ist absolut. Recht wird somit das, was die Mehrheiten im Parlament und die Macht„elite“ gerne sehen.34 So hat sich auch der amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts Voßkuhle zu Kelsen sehr lobend geäußert, den er als sein „Vorbild“ vorgestellt hat.35 Dann wird er auch die radikale Auffassung Kelsens kennen. Eine besondere Form der Entartung in der Staatsrechtslehre ist der Rechtspositivismus. Er erklärt einfach jedes Gesetz, das von irgendeiner Regierung (Monokratie, Monarchie, Aristokratie, Demokratie, Oligarchie, Diktatur) erlassen wird, als „zu Recht“ erlassen und bindend. Er verwirft – als „reines Recht“ – Wertvorstellungen religiöser, philosophischer, kultureller oder traditioneller Art. Der reine Rechtsstaat beruht hingegen darauf, das Recht dank einer bestimmten Weltsicht und -anschauung theologisch-philosophischer Art so unveränderlich zu erhalten, um eine Rechtsunsicherheit zu vermeiden.36 Der Gedanke des reinen Rechts taucht zuerst auf in der Reinen Rechtslehre Kelsens. Für ihn kommt es nicht auf den Inhalt von Rechtsnormen an, sondern allein auf deren ordnungsgemäßes Zustandekommen (Gültigkeit) und Durchsetzbarkeit. Lag letztere vor, war für ihn alles Rechtsstaat, denn er sah jedwedes Unrecht des Staates als einen Widerspruch in sich selbst.37 Kelsen schreibt: „Vollends sinnlos ist die Behauptung, dass in der Despotie keine Rechtsordnung bestehe, sondern Willkür des Despoten herrsche … Der despotisch regierte Staat (stellt auch) irgendeine Ordnung menschlichen Verhaltens dar … Diese Ordnung ist eben die Rechtsordnung. Ihr den Charakter des Rechts absprechen, ist eine naturrechtliche Naivität oder Überhebung … Was als Willkür gedeutet wird, ist nur die rechtliche Möglichkeit der Autokraten, jede Entscheidung an sich zu ziehen, die Tätigkeit der untergeordneten Organe bedingungslos zu bestimmen und einmal gesetzte Normen jederzeit mit allgemeiner oder nur besonderer Geltung aufzuheben oder abzuändern. Ein solcher Zustand ist ein Rechtszustand, auch wenn er als nachteilig empfunden wird. Doch er hat seine guten Zeiten. Der im modernen Rechtsstaat gar nicht seltene Ruf nach Diktatur zeigt dies ganz deutlich.“38 31 Josef Isensee, Staatsrechtslehre als Wissenschaft, in: JZ 19/2009, S. 949 – 954. – Hierzu Oliver Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen, in: JF Nr. 45/09 vom 30. 10. 2009, S. 17. 32 W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 219. 33 K. A. Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, S. 141 – 161. 34 W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 220. 35 O. Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen, in: JF vom 30. 10. 2009, S. 17. 36 Erik von Kuehnelt-Leddihn, Demokratie: eine Analyse, 1996, S. 58. 37 H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 249. 38 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 335 f.
II. Bundesrepublik Deutschland
61
Selbst nach Ende des Dritten Reiches änderte Kelsen, ein Opfer der Rassengesetze dieses Reiches, seine Ansicht nicht.39 Hermann Heller befindet kurz und treffend zu Kelsens Allgemeiner Staatslehre: „… der Unterschied zwischen einer Räuberbande und dem Staat war unauffindbar geworden.“40 Schon Bodin wusste einfach, aber doch grundlegend zu befinden: „Unter dem Staat versteht man die am Recht orientierte souveräne Regierungsgewalt …“41 An erster Stelle steht die Betonung „einer am Recht orientierten Regierung. Dadurch unterscheiden sich Staaten von Räuberund Privatbanden, …“42 Bleibt zu hoffen, dass der Geist Kelsen im höchsten Gericht keine Wurzeln schlägt. 3. Menschenrechtlicher Eigentumsbegriff vs. praktische Verfassung Die menschenrechtliche Idee des Eigentums bleibt jedoch, ist unwandelbar, gehört zur Verfassungstheorie. Sie ist immer mit einer lange mäßigen Verwirklichung und – wie auch in der Bundesrepublik – mit restriktiver Verfassungspraxis konfrontiert.43 Hier zeigt sich die Sollbruchstelle zwischen dem menschenrechtlichen, von Natur gegebenen Eigentum und dessen Schutz und der Reichweite in der Praxis unter dem Mantel der Verfassung. Mit der Idee soll die Privatheit, die Privatnützigkeit, sowie die Staatlichkeit, die Sozialpflichtigkeit, bestmöglich gefördert werden.44 Denn das Eigentum ist begrifflich ein Recht des Einzelnen, also ein Recht zur Privatheit als Recht zur freien Willkür, das sich in der die allgemeinen Interessen verwirklichenden Staatlichkeit entfaltet.45 Eigenes und Eigentum gehören zusammen.
39
Hans Kelsen, Foundations of Democracy, in: Ethics, LXVI (1955), S. 100; vgl. auch Hermann Klenner, Rechtsleere – Verurteilung der Reinen Rechtslehre, 1972. – Massive Kritik an der Reinen Rechtslehre Kelsens schon von Hermann Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), in: ders., Gesammelte Schriften, 2. Bd., 2. Aufl., 1992, S. 3 – 23 (8 ff.); ders., Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (1927), in: ebd., 2. Bd., 1992, S. 31 – 202 (120 – 165); vgl. Werner Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, 2002, S. 48 ff., 133 ff.; ders., Vom Wesen der Souveränität, 2007, S. 53, 161; ders., Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 219 f. 40 Hermann Heller, Die Krisis der Staatslehre, S. 9. 41 Jean Bodin, Sechs Bücher über den Staat (1576), Erstes Buch, 1. Kap., S. 98. 42 Ebd., S. 98. 43 BVerfGE 52, 1 [29 ff.]. 44 BVerfGE 87, 114 [138]; 89, 1 [8]; 91, 294 [308, 310 ff.]; vgl. auch BVerfGE 37, 132 [141]; 71, 230 [250]; W. Leisner, Eigentum, § 149 Rn. 143 ff. 45 K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, S. 537 ff.; zu „Eigentum und Herrschaft“; vgl. Kristian Kühl, Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kantischen Rechts- und Eigentumslehre, 1984, S. 297 ff.
62
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
„Alle Werte, welche der Existenzsicherung dienen können, sind eigentumsfähig.“46 Heutzutage werden alle „vermögenswerte Rechte“ erfasst, sogar die des öffentlichen Rechts, letztere aber nur, wenn sie auf „eigener Leistung“ beruhen.47 Zum Eigentum gehört das „Vermögen“ des Menschen, auch wenn dieses als solches kein juristisch fassbarer Begriff ist. 4. Eigentum durch Arbeit Eigentum entsteht auch durch Arbeit. Leben heißt wesentlich arbeiten.48 Die Arbeit als „Beruf hat für alle gleichen Wert und gleiche Würde.“49 Hegel hat von der „Ehre“, „eine Subsistenz durch seine Arbeit zu finden“, und von dem „Gefühl des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen“, und von der ohne „Arbeit vermittelnden Subsistenz der Bedürftigen“, die gegen das „Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft und des Gefühls ihrer Individuen von ihrer Selbständigkeit und Ehre“ wäre, gesprochen.50 Nach Locke muss jedem das als Eigentum zugestanden werden, das er selbst erarbeitet, weil das „Werk seiner Hände“ von Natur aus in der Hand des Menschen bleibe und ihm darum gehöre, freilich nur soweit er das, was er durch Arbeit erworben habe, für sein Leben nutzen könne, weil dieses Maß am Eigentum niemanden schaden könne.51·Das Bundesverfassungsgericht anerkennt „die eigene Leistung als besonderen Schutzgrund für die Eigentümerposition.52 Eigene Leistung ist vor allem Arbeit.53
46 W. Leisner, Eigentum, HStR VI, § 149 Rn. 93; ders., Eigentum als Existenzsicherung? Das „soziale Eigentum“ in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1986), in: ders., Eigentum, Schriften zum Eigentumsrecht und Wirtschaftsverfassung 1970 – 1996 (hrsg. von Josef Isensee), 1996, S. 52 ff., wo er sich gegen eine Restriktion des Eigentumsschutzes wendet. 47 BVerfGE 14, 288 [293]; st. Rspr.: etwa BVerfGE 30, 292 [334]; 53, 257 [289 ff.]; 58, 81 [112 f.]; 69, 272 [300 ff.]; 70, 191 [199]; 72, 175 [193]; 83, 201 [209]; 95, 267 [300]; 97, 350 [371]; 100, 1 [33]. – Vgl. auch BGHZ (Großer Senat) 6, 270 (278), wonach „jedes vermögenswerte Recht“, „das ganze Vermögen der Bürger“ durch die Eigentumsgarantie und den Eigentumsschutz geschützt sei, „gleichgültig, ob es dem bürgerlichen oder dem öffentlichen Recht“ angehört. 48 Vgl. Hannah Arendt, Vita activa oder vom tätigen Leben (1981), 6. Aufl., München 2007. 49 BVerfGE 7, 377 [397]; 50, 290 [362]. 50 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), Werke 7, Frankfurt am Main 1986, §§ 244, 245. 51 Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung, II. 5., § 27, S. 216 f., § 36, S. 221 f. – Zur „Begrenzung gesellschaftlicher Machtpositionen“ vgl. auch K. Kühl, Eigentumsordnung …, S. 267 ff.; Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976; Hans Heinrich Rupp, Vom Wandel der Grundrechte, in: AöR 101 (1976), S. 161 ff. 52 BVerfGE 1, 264 [277 f.]; 14, 288 [293 f.]; 22, 241 [253]; 24, 220 [226]; 30, 292 [334]; 50, 290 [340]; 53, 257 [291 f.]; 58, 81 [112 f.]; 69, 272 [301]; 72, 175 [193]; 97, 350 [371]. 53 K. A. Schachtschneider, Res publica res populi, S. 244 ff.; Peter Häberle, Arbeit als Verfassungsproblem, in: JZ 1984, S. 345 ff. (354 f.); ders., Aspekte einer Verfassungslehre der
III. Einung, Übergang und Angleichung der Rechtsordnungen
63
Deshalb kann gesagt werden, dass die Naturrechtsphilosophie vom Recht auf Eigentum und Recht am Eigentum aus der Neueren Zeit zumindest in der Theorie fortwirkt.54 Die Rechtswirklichkeit geht in eine andere Richtung.55 Rechte aus dem Arbeitsverhältnis und – in Fortsetzung dessen – aus dem System der sozialen Sicherheit, in der Bundesrepublik aus der Sozialversicherung, namentlich Rentenansprüche,56 sind grundsätzlich Eigentum. Renten sind kapitalisiertes Eigentum. Diese Ansprüche gehen auf die Zahlung von Geld als Position des Eigentums und des Vermögens. „Geld ist geprägte Freiheit“, sagt die schöne Literatur, ebenso das BVerfG.57 Es kann frei in Gegenstände eingetauscht werden. Die Verfügungsmacht über Geld ist für den Einzelnen die Voraussetzung seiner Teilnahme am Wirtschaftsleben und seiner Existenz. Die Existenz von Geld ist die Bedingung für die arbeitsteilige Wirtschaft, in der der Leistungsausgleich über das Medium eines Zahlungsmittels abgewickelt wird.58
III. Einung, Übergang und Angleichung der Rechtsordnungen 1. Deutsche Demokratische Republik In der DDR waren Arbeitsverhältnisse die Realität der meisten Menschen, und sie fanden ihren Schutz in der Ordnung der DDR (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 Verfassung der DDR 1974) als eines, wie das BVerfG ausgesprochen hat, „sozialistischen Rechtssystems“. Weil Arbeitsverhältnisse unter Menschen keine Verhältnisse in bezug auf Sachen, wie das Sacheigentum, sind, bestehen sie aus Rechten und Pflichten. Diese Rechte können Eigenes und Eigentum sein, jedenfalls wenn sie vermögenswert sind, allemal die Leistungsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis. Dabei kommt es nicht darauf an, ob diese Leistungsansprüche in der Bundesrepublik Deutschland hätten bestehen können, sondern alleine darauf, ob sie in der DDR bestanden und als durch die Ordnung der DDR gewährleistete Rechte, besser Rechte, die den Berechtigten
Arbeit, in: AöR 109 (1984), S. 630 ff.; BVerfGE 31, 229 [239]; 40, 65 [80]; 53, 257 [291]; 58, 81 [112 f.]; 69, 272 [301]; 72, 175 [193]; 97, 350 [371]. 54 W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 112, 21 – 65. 55 Ebd., S. 105 ff. 56 Zum Anspruch auf Sozialleistungen als „Eigentum“ vgl. K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, 10. Kap., II. 4., S. 565 ff. – Zum Grundrechtsschutz für erworbene Versorgungsansprüche und -anwartschaften ausführlich D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 70 – 117. 57 F. M. Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Totenhaus (1860 – 62), in der Übersetzung von Hermann Röhl, 1986, 1. Teil I, S. 30. – BVerfGE 97, 350 [371]. 58 Klassisch bei Adam Smith, Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, dt. Übersetzung von M. Streissler, 2005, S. 105 ff.
64
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
Lebensmöglichkeiten gaben, zu verstehen waren. Das ist fraglos.59 Im übrigen kannte und kennt die Bundesrepublik seit eh und je gleichartige Rechte.60 Die Versorgungsrechte und -anwartschaften waren stabilisiert. Art. 11 Abs. 1 der Verfassung der DDR von 1974 hat „das persönliche Eigentum“ der Bürger gewährleistet. Zu diesem persönlichen Eigentum gehörten auch die vermögenswerten Ansprüche aus Arbeits- und Dienstverhältnissen, einschließlich der Versorgungsansprüche. Dieser rechtlich gesicherte Anspruch war Eigentum im Sinne des Menschenrechts auf Eigentum.61 2. Der Systemwechsel zur rechtsstaatlichen Ordnung in der DDR Im Zusammenhang mit dem friedlichen Vollzug der „Wende“ 1989 in der DDR und mit Blick auf die Herstellung der Vereinigung beider Teile Deutschlands wurde das „realsozialistische“ System der DDR durch die DDR beseitigt. In dieser Zeit bildete sich ein rechtsstaatliches System nach westlichem Muster heraus. Das führte zu tiefgreifenden Veränderungen der Verfassungs- und Rechtsordnung der DDR. a) Das Verfassungsgrundsätzegesetz vom 17. 6. 1990 Am 17. 6. 1990 beschloss die am 17. 3. 1990 neu gewählte Volkskammer der DDR das Verfassungsgrundsätzegesetz.62 Es trat am selben Tag in Kraft. Spätestens damit vollzog die vom Volk demokratisch gewählte Volkskammer den Systemwechsel, d. h. die Ersetzung der realsozialistischen Verfassungs- und Rechtsordnung der „alten“ DDR durch eine rechtsstaatliche Verfassungs- und Rechtsordnung. Dies geschah juristisch endgültig und unwiderruflich. Der für die Beseitigung der realsozialistischen Ordnung notwendige Systemwechsel erfolgte allein, also in und durch der/die DDR. Schon längere Zeit vor dem Rücktritt Honeckers hatten grundlegende Änderungen der Staats- und Rechtsordnung begonnen. Vor Verabschiedung des Verfassungsgrundsätzegesetzes waren von der Volkskammer zahlreiche Verfassungsänderungen beschlossen worden. Seit der „Wende“ 1989 wurde der Systemwechsel juristisch durch eine schrittweise Umgestaltung der Verfassungs- und Rechtsordnung vorangebracht. So wurden z. B. die führende Rolle der SED und der sog. Demokratische Zentralismus abgeschafft. Nach der Neuwahl der Volkskammer der DDR 59 K. A. Schachtschneider, Verletzung des Menschenrechts auf Eigentum, Rechtsgutachten in Sachen Gisela Kirsten/Deutschland in dem Verfahren vor dem EGMR, Beschwerde Nr. 19124/02, März 2007. 60 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 21 ff., 26 ff., 150 f. 61 W. Mäder, Freiheit und Eigentum …, S. 160 f. 62 Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (Verfassungsgrundsätzegesetz) vom 17. 6. 1990 (GVBl. I Nr. 33, S. 299).
III. Einung, Übergang und Angleichung der Rechtsordnungen
65
war der Höhepunkt dieses Prozesses die Verabschiedung des Verfassungsgrundsätzegesetzes. Ausgehend davon wurden in den letzten Monaten der DDR viele weitere Gesetze erlassen. Sie stellten auf allen wesentlichen Gebieten rechtsstaatliche Verhältnisse her.63 aa) Zum Inhalt Das Verfassungsgrundsätzegesetz verankerte komplex die bedeutenden und unverzichtbaren Grundprinzipien des Rechtsstaates. Es zog in allen grundlegenden Fragen der Ausgestaltung der Staats- und Rechtsordnung mit den Grundsätzen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK)64 gleich, gab dem Eigentumsschutz (Art. 2), dem Rechtsstaatsprinzip und der Freiheit des Menschen (Art. 1) die ihnen zukommende verfassungsrechtliche Gestalt. Gleichzeitig verankerte es nach dem Vorbild des Grundgesetzes die notwendigen Instrumente zur Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte, u. a. die Rechtsweggarantie und eine umfassende Verwaltungsgerichtsbarkeit. bb) Systemwechsel nach der Revolution von 1989 Nach dem 17. 6. 1990 konnten wegen des schnellen Einigungsprozesses verständlicherweise die Institutionen, die zur Verwirklichung der neuen Verfassung und der sie untersetzenden Gesetze notwendig waren, nicht mehr umfassend eingerichtet, d. h. auf- und ausgebaut werden. Das vermag jedoch die überragende Bedeutung der verfassungsrechtlichen Verankerung des Systemwechsels und seines juristischen Vollzugs sowie der Konstituierung des Rechtsstaates DDR durch die frei gewählte Volkskammer nicht zu mindern. Der Systemwechsel und die neue Verfassungs- und Rechtsordnung wurden also nicht erst mit dem Beitritt und damit nicht gewissermaßen über Nacht, „in der logischen Sekunde“, vom 2. zum 3. 10. 1990 vollzogen, wie die landläufige, die ministerielle und judikative Position der alten Bundesrepublik dies annehmen will. Diese Position verkennt die Bedeutung der „Wende“ und des Wandels noch in der DDR, die aufgrund der Revolution ihrer Bürger zu einem Staat mit einer rechtsstaatlichen Verfassung wurde, der erst danach als solcher mit dem Wegfall der Zentralinstanz zur Bundesrepublik Deutschland beitrat.65 b) Staatspolitische Einwendungen von westdeutscher Seite Unbeschadet dessen wird gegen den kontinuierlichen Weiterbestand von Rechten, Ansprüchen und Anwartschaften aus der DDR gerade so argumentiert, als ob zwi63 Hierzu K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1. Aufl., 1999, S. 98 f. 64 Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten i. d. F. des Protokolls Nr. 11, in Kraft getreten am 1. 11. 1998. 65 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 99; W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 41 f.
66
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
schen der Rechtssituation am 2. und 3. 10. 1990 eine unüberwindliche, vom gegensätzlichen Wesen der Rechtsordnungen der DDR und der Bundesrepublik her gegebene Barriere bestanden hätte und als ob alle in der DDR bestehenden Rechte vom 2. zum 3. 10. 1990 untergegangen wären.66 Nur neu gewährte Rechte stünden unter dem Schutz des Grundgesetzes. Es wäre daher unmöglich, dem in der DDR unter Schutz stehenden Eigentum kontinuierlich nach dem Beitritt den Grundrechtsschutz des Grundgesetzes zukommen zu lassen.67 So publiziert Wilmerstadt seine kühne, aber unrichtige Meinung, dass „die Eigentumsgarantie des Artikels 14 GG im Beitrittsgebiet jedenfalls erst seit dem 3. 10. 1990 gilt.“68 Weiter erklärt er, dass „der Gesetzgeber … die Möglichkeit hat, aus Gründen des Allgemeinwohls an früheren Entscheidungen nicht mehr festzuhalten und Neuregelungen zu treffen, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen sowie den damit verbundenen wechselnden Interessenlagen Rechnung tragen … und damit eine vom Inhalt des Einigungsvertrages abweichende Regelung vorsehen kann.“69 Darüber hinaus gibt er weitere zahlreiche Orientierungen, die ausweisen, dass das Beitrittsgebiet in den Augen dieses Experten des vormals Bonner Ministeriums als ein rechtlich zu beackerndes Niemandsland angesehen wird, in dem dessen Bürger nur nach dem Beitritt beliebig neu zuerkannte Ansprüche/Anwartschaften gewährt werden sollen und nicht jene Ansprüche/Anwartschaften bzw. jenes Eigentum, das sie mit ihren Leistungen rechtmäßig erworben haben und das ihnen mit dem Einigungsvertrag auch garantiert wurde.70 Dieser abwegigen Auffassung folgt auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 2. 7. 2002 zur Frage des Schutzes der Zusatzversorgung für Balletttänzer,71 wenn es ausführt, dass nur ein gesetzlicher Entzug oder eine gesetzliche Kürzung der Zuwendungen bis zum 31. 12. 1991 am Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG zu messen wäre. Dabei lässt es die Verpflichtung aus dem Einigungsvertrag völlig außer acht, die Ansprüche und Anwartschaften zu „überführen“.72 Diese Verpflichtung ist Bestandteil der mitgebrachten Eigentumspositionen und zu beachten. Die formaljuristische Auffassung lässt die Konzeption des Einigungs66
Vgl. BSG, Urt. vom 14. 9. 1995 – 4 RA 39/95 -, in: SGb. 7/1996, S. 342. Hans-Jürgen Papier, Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG), Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, erstattet im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung, München 1994. – Vgl. ferner Rainer Wilmerstadt, Das neue Rentenrecht (SGB V), München 1992, S. 267 ff. (verantwortlicher Mitarbeiter im BMA). 68 R. Wilmerstadt, Das neue Rentenrecht, S. 267 f. 69 Ebd., S. 268. 70 Ebd., S. 267 – 269. 71 Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR von 1976 i. d. F. von 1983. 72 Hierzu siehe D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 108 ff. 67
III. Einung, Übergang und Angleichung der Rechtsordnungen
67
vertrages außer acht, die gerade das Verfassungsgrundsätzegesetz inkorporiert und den gleichen Grundrechtsschutz wie den des Grundgesetzes einbringt.73 c) Vorrang des Völkerrechts Nachdem durch die politische Wende 1989 auch in der DDR die Verfassungsprinzipien des Grundgesetzes galten, insbesondere das Eigentumsprinzip (Art. 2 des Verfassungsgrundsätzegesetzes; Art. 1 StV), wurden die Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen durch das bundesdeutsche Eigentumsprinzip geschützt und schließlich nach der Einigung seit dem 3. 10. 1990 unmittelbar durch Art. 14 Abs. 1 GG, ohne dass sich dadurch der Charakter des Eigentumsschutzes geändert hätte. Denn als Menschenrecht hat das Eigentumsprinzip einen unveränderlichen Charakter, wenn es auch unterschiedlich durch die verschiedenen Gesetze der jeweiligen staatlichen Ordnungen verwirklicht und geschützt wird.74 Keinesfalls hat der Schutz des Eigentums in der DDR erst mit dem Einigungsvertrag und der durch diesen ausdrücklich geregelten Geltung des Grundgesetzes auf dem Gebiet der DDR begonnen. Das Eigentum der Versorgungsberechtigten ist nicht erst durch den Einigungsvertrag begründet, sondern durch diesen aufrechterhalten worden. Das Bundesverfassungsgericht hat den grundgesetzlichen Eigentumsschutz aus Art. 14 Abs. 1 GG immer wieder davon abhängig gemacht, dass die geschützten vermögenswerten Rechte durch den Einigungsvertrag oder durch andere Rechtsakte des dem Grundgesetz verpflichteten Gesetzgebers geregelt wurden.75 Es hat in diesen Regelungen aber nicht die Begründung des jeweiligen Eigentumsrechts gesehen.76 Zu Unrecht ist das Bundesverfassungsgericht allerdings davon ausgegangen, und geht nach wie vor davon aus, dass die deutschen Staatsangehörigen in der DDR nicht den Grundrechtsschutz des Grundgesetzes hatten. Das Grundgesetz galt aber seinem Selbstverständnis nach auch für diese Deutschen, wie die Präambel von 1949 klargestellt hat. Denn „das Deutsche Volk hat in den Ländern Baden …“, das das Grundgesetz verfasst haben soll,77 „auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war“.78 73
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 43/44. Karl Albrecht Schachtschneider, Sozialistische Schulden nach der Revolution. Kritik der Altschuldenpolitik. Ein Beitrag zu der Lehre von Recht und Unrecht, 1996, S. 161 ff. 75 Etwa BVerfGE 100, 1 [33]; vgl. auch BVerfGE 77, 137 [150 ff.]. 76 Vgl. BVerfGE 100, 1 [33]. 77 Vgl. hierzu Michael Stolleis, Besatzungsherrschaft und Wiederaufbau deutscher Staatlichkeit 1945 – 1949, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR I, Historische Grundlagen, 3. Aufl., 2003, § 7; Reinhard Mußgnug, Zustandekommen des Grundgesetzes und Entstehen der Bundesrepublik Deutschland, in: ebd., § 8. 78 Dazu K. A. Schachtschneider, Sozialistische Schulden nach der Revolution …, S. 162; Helmut Quaritsch, Wiedervereinigung in Selbstbestimmung – Recht, Realität, Legitimation, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR VII, 1995, § 193 Rn. 28 f., S. 344 f. 74
68
E. Das Recht auf Eigentum und das Recht am Eigentum
Im übrigen schützt der Art. 14 GG als verfassungsgesetzlicher Schutz eines Menschenrechts jedes Eigentum. Denn das Grundgesetz verpflichtet alle Organe, Behörden und Gerichte der Bundesrepublik Deutschland zur menschenrechtlichen Eigentumsgewährleistung. Das Argument des Bundesverfassungsgerichts, dass vor der deutschen Einigung das Grundgesetz in der DDR nicht gegolten habe, ist irrig.79 Richtig ist, dass das Grundgesetz in diesem Gebiet bis zur Einigung nicht durchgesetzt und angewandt werden konnte. Das ist von der Geltung zu unterscheiden. Im übrigen gilt der menschenrechtliche Eigentumsschutz gänzlich ohne verfassungsgesetzlichen Text, ganz einfach, weil Menschen Eigenes haben, das als Eigentum geschützt werden muss und gegebenenfalls, durch welche Ordnung auch immer, geschützt ist. Die irrige Dogmatik des Bundesverfassungsgerichts hat für die Praxis Deutschlands die weitgehende Verweigerung des Eigentumsschutzes zur Folge, die auch Grund für eine Menschenrechtsbeschwerde war, weil das Gericht in seinen angegriffenen Beschlüssen vom 2.7. und 4. 7. 200280 davon ausgeht, dass der Einigungsvertrag das Recht auf Zusatzversorgung nicht begründet oder auch aufrechterhalten, sondern zum 31. 12. 1991 beendet habe.81 Darauf kommt es aber menschenrechtlich nicht an, sondern lediglich darauf, ob die Betroffenen Eigentum hatten, das von dem Mitglied des Europarates Deutschland missachtet wird oder gar entzogen worden ist. Nicht entscheidend ist, durch welchen Rechtsakt Deutschland, also irgendeines seiner Organe, Behörden oder Gerichte, das Menschenrecht verletzt.82
79
Etwa BVerfGE 100, 1 [33]; so schon BVerfGE 3, 288 [319 f.]; 36, 1 [16]; 77, 137 [155 f.]. 1 BvR 2544/95, 1 BvR 1944/97, 1 BvR 2270/00 und 1 BvR 2052/98. – Der Beschluss vom 2. 7. 2002 ist abgedruckt in: W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 171 – 177. 81 K. A. Schachtschneider, Verletzung des Menschenrechts auf Eigentum, Rechtsgutachten in Sachen Gisela Kirsten/Deutschland vor dem EGMR – Beschwerde Nr. 19124/02, März 2007. 82 Ebd. 80
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess Schritte zur Herstellung einheitlicher Verhältnisse waren im wesentlichen der Staatsvertrag vom 18. 5. 19901 und der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990.2
I. Der Staatsvertrag vom 18. 5. 1990 Formaljuristisch ist der Staatsvertrag ein völkerrechtlicher Vertrag, materiellinhaltlich ein verfassungsrechtlicher Vertrag. Die Bundesrepublik Deutschland hatte schon früher die DDR als Staat anerkannt. Nicht nur das Wirtschaftssystem, die soziale Marktwirtschaft, aber auch das Gebot zu einem Sozialstaat sind mit dem Staatsvertrag bekräftigt und konkretisiert worden. Der Staatsvertrag ist das Ergebnis gleichberechtigter Partnerschaft. Allein schon die Wortwahl wie „Rechtsanpassung“ oder „Rechtsangleichung“ (so z. B. Art. 4 Abs. 1 Satz 1, Art. 20 Abs. 1 Satz 1 StV) dokumentiert, dass Gegenstand des Staatsvertrages nicht die reine Übernahme oder Rezeption des Rechts der Bundesrepublik ist. Grundlage ist ferner der Rechtszustand, wie er sich in der DDR nach der „friedlichen und demokratischen Revolution“ (Präambel zum Staatsvertrag) entwickelt hat. Mit dem Verfassungsgrundsätzegesetz wurde eine Staats- und Rechtsordnung in der DDR konstruiert, die der des Grundgesetzes gleich ist. Der für die Beseitigung der realsozialistischen Ordnung notwendige Systemwechsel erfolgte in und durch der/die DDR vor der Herstellung der Einheit Deutschlands.3 1. Zum sozialpolitischen und -rechtlichen Inhalt Die Sozialunion „wird insbesondere bestimmt durch eine von der sozialen Marktwirtschaft entsprechende Arbeitsordnung und ein auf den Prinzipien der
1
Vertrag über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 18. 5. 1990 (BGBl. II S. 537). – Die Zustimmung zu dem Vertragsgesetz ist mit Gesetz vom 25. 6. 1990 erfolgt (BGBl. II S. 518). Der Staatsvertrag ist am 30. 6. 1990 in Kraft getreten (BGBl. II S. 700). 2 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. 8. 1990 (BGBl. II S. 889). – Die Zustimmung zum Einigungsvertrag ist mit Vertragsgesetz vom 23. 9. 1990 (BGBl. S. 885) erfolgt. Der Einigungsvertrag ist am 29. 9. 1990 in Kraft getreten. 3 Hierzu Abschnitt E. III. 2.
70
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Leistungsgerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs beruhendes umfassendes System der sozialen Sicherung“ (Art. 1 Abs. 4 Satz 2 StV). Was die Sozialunion weiter betrifft, so verpflichtet sich die DDR, ein gegliedertes System der Sozialversicherung einzuführen (Art. 18), ein System der Arbeitslosenversicherung einzuführen (Art. 19) und Renten-, Kranken- und Unfallversicherung dem Recht der Bundesrepublik anzugleichen (Art. 20, 21, 23). Der Staatsvertrag lässt die in der DDR erworbenen Rechte, Ansprüche und Anwartschaften im Bereich der sozialen Sicherheit unberührt. Rechtsangleichung bedeutet nicht Rechtsbeseitigung oder die Ermächtigung zum entschädigungslosen Entzug von Rechten.4 Art. 20 StV enthält die Grundsatzentscheidungen. Die DDR verpflichtet sich gemäß Art. 20 Abs. 1 Satz 1 StV lediglich, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um ihr Rentenrecht an das auf dem Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit beruhende Rentenversicherungsrecht der Bundesrepublik anzugleichen. Dabei wird in einer Übergangszeit von fünf Jahren für die rentennahen Jahrgänge dem Grundsatz des Vertrauensschutzes Rechnung getragen. Maßgabe für die DDR war also eine „Angleichung“ und der Grundsatz des „Vertrauensschutzes“, dessen Auswirkungen auch die Bundesrepublik als Vertragspartner zu beachten hatte. Von Beseitigung von Rechten oder Wegfall erworbener Ansprüche oder Anwartschaften ist keine Rede.5 Nach Absatz 2 Satz 2 werden die bestehenden Zusatz- und Sonderversorgungssysteme zum 1. 7. 1990 geschlossen. Von Beseitigung von Rechten oder Wegfall erworbener Ansprüche und Anwartschaften durch den Vertrag ist keine Rede. Nach Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 werden bisher erworbene Ansprüche und Anwartschaften in die Rentenversicherung überführt. Die Schließung der Systeme zum 1. 7. 1990 bedeutet, dass keine neuen Ansprüche und Anwartschaften danach – ex nunc – begründet werden sollten. Allerdings sollten bei der Überführung Leistungen aufgrund von Sonderregelungen gemäß Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 mit dem Ziel überprüft werden, ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen. Diese Einschränkung erwies sich als höchst problematisch, da der damit beauftragte Bundesgesetzgeber völlig überfordert war, operable Tatbestände anzugehen.6. Zweck dieser Vorschrift war, staats- bzw. systemnahe Tätigkeit zu erfassen. Das Bundesverfassungsgericht hat später Regelungen des Bundesgesetzgebers über die pauschale Verkürung der gesetzlichen Versichertenrente aus allgemeinpolitischen Gründen, den Entzug von Teilen der Versichertenrente wegen früher ausgeübter systemnützlicher Tätigkeit für verfassungswidrig erklärt.7 4 5 6
242.
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 45. Ebd. Zum Rentenstrafrecht vgl. K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 203 –
7 Vgl. BVerfGE 100, 138; D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 25 ff., 114 ff., 127 ff., 143 ff.
I. Der Staatsvertrag vom 18. 5. 1990
71
Ferner sieht Art. 20 Abs. 5 StV vor, dass die freiwillige Zusatzversicherung in der DDR geschlossen wird. Von Beseitigung von Rechten oder Wegfall erworbener Ansprüche oder Anwartschaften ist hier ebenfalls keine Rede.8 2. Einwendungen von westdeutscher Seite Nach Papier sind durch die Regelungen im Staatsvertrag oder im Einigungsvertrag keine von der grundgesetzlich legitimierten konstituierten deutschen öffentlichen Gewalt (mit)begründete Eigentumspositionen i.S. des Art. 14 GG geschaffen worden. Die Konstituierung möglicherweise eigentumskräftiger und daher durch Art. 14 GG geschützter Rechtspositionen bleibe nach den vertraglichen Regelungen der späteren (bundesgesetzlichen) Normsetzung vorbehalten, die vertraglichen Regelungen gäben dafür nur gewisse Regelungs- bzw. Anpassungsdirektiven.9 Das Ergebnis mit seiner Begründung ist falsch; die Frage trifft nicht den Kern der Sache, geht von selbst gesetzten Annahmen aus.10 3. Allgemeine Regeln des Völkerrechts als unmittelbar geltendes Recht Weder durch den Staatsvertrag noch durch den Einigungsvertrag musste eine Eigentumsposition geschaffen werden. Die Staatsverträge setzen die in der DDR erworbenen Rechtspositionen voraus, bringen sie als Bestand ein, ohne sie selbst zu verändern. In der Bundesrepublik Deutschland ist die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung, sind die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden (Art. 20 Abs. 3 GG). Zur verfassungsmäßigen Ordnung gehört Art. 25 GG. Danach sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten für die Bewohner des Bundesgebiets. Zu den Regeln des Völkerrechts gehört der Schutz des Eigentums (Art. 17 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte; Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK). Vor diesem Hintergrund mussten die Staatsverträge nicht den Schutz erworbener Rechte, insbesondere des Eigentums, noch einmal ausdrücklich verankern. Die in der DDR wohl erworbenen Rechte, Ansprüche und Anwartschaften sind, soweit sie in den Schutz der allgemeinen Regeln des Völkerrechts fallen, von der Legislative, Exekutive und Judikative der Bundesrepublik 8
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 45. H.-J. Papier, Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, Rechtsgutachten 1994, S. 110. 10 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 46. – Zur Rolle von Papier im Einigungsprozess und der Versorgungsüberleitung Ost vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 128 ff. 9
72
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Deutschland zu beachten und im Rahmen der gesamtdeutschen Rechtsordnung zu wahren.11 Der Fehlschluss von Papier liegt auch dem Beschluss des BVerfG vom 2. 7. 2002 zur Frage des Schutzes der Versorgung der Ballettmitglieder,12 an dem Papier mitgewirkt hat, zugrunde, wenn er den Eigentumsschutz (des Art. 14 Abs. 1 GG) davon abhängig macht, dass die Renten oder rentenähnlichen Ansprüche und Anwartschaften auf der Grundlage von DDR-Rechtsvorschriften im Einigungsvertrag nach dessen Maßgaben als Rechtspositionen der gesamtdeutschen Rechtsordnung anerkannt wurden und dies von einer überführungs- bzw. bundesgesetzlichen Anschlussregelung bestätigt wurde.13 Abgesehen davon, dass die dauerhafte Sicherung der Ansprüche und Anwartschaften als Eigentumsposition Wille der DDR als Vertragspartner der Verträge war und sie diesen zum Ausdruck gebracht hat, ist die vorvertragliche Rechtslage mit den bereits in der DDR-Verfassungs- und Rechtsordnung verankerten Grundrechten und ihrer unmittelbaren völkerrechtlichen Geltung auch für die gesamtdeutsche Rechtsordnung entscheidend und maßgebend.14 Für die Fehleinschätzung des höchsten deutschen Gerichts wie zuvor der obersten Gerichtshöfe des Bundes mag mit ursächlich gewesen sein, dass der Status der DDR als gleichwertiges und -berechtigtes Völkerrechtssubjekt15 verdrängt und die Tatsache, dass die DDR nach dem Systemwechsel eine rechtsstaatliche Verfassung mit gleich geltenden Grund- und Menschenrechten hatte, sowie die real geänderten Verhältnisse in der DDR substantiell nicht erfasst wurden.
II. Das Rentenangleichungsgesetz der DDR vom 28. 6. 1990 Mit dem Rentenangleichungsgesetz16 wurden auf der Basis des Staatsvertrages zunächst erste Schritte zur Angleichung der Alterssicherungssysteme Ost und West abgesteckt. Am 30. 6. 1990 wurden die Zusatzversorgungssysteme geschlossen. Die Versorgungsbezüge von Berechtigten aus dem staatsnahen Bereich wurden zum 1. 7. 1990 auf maximal 1500,– DM begrenzt. Dieser Betrag zuzüglich einer Sozialversiche11
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 46. Vgl. auch D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 70 ff. 13 Beschluss vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95, 1944/97, 2270/00 -, S. 8. 14 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 47. 15 Zum Wesen und Inhalt der Souveränität vgl. W. Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, 2002; ders., Vom Wesen der Souveränität, 2007. 16 Gesetz zur Angleichung der Bestandsrenten an das Nettorentenniveau der Bundesrepublik Deutschland und zu weiteren rentenrechtlichen Regelungen (Rentenangleichungsgesetz – RAG) vom 28. 6. 1990 (GBl. I Nr. 38, S. 495, ber. S. 1457) i. d. F. des Einigungsvertrages vom 31. 8. 1990 (BGBl. II S. 885, 889, 1213, 1244). 12
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
73
rungsrente von maximal 510,– DM ergibt den später relevanten Betrag von 2010,– DM. Weitere Überführungsschritte erfolgten nicht. Das Programm des RAG konnte wegen des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland nicht mehr umgesetzt werden.
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990 Der Einigungsvertrag hat die Einigung beider Teile Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, zum 3. 10. 1990 bewirkt. 1. Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen der DDR Der Einigungsvertrag hat die im Staatsvertrag verankerten Bestimmungen zur Schließung und Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme (Versorgungssysteme) bestätigt. Der Termin für die Überführung der Ansprüche und Anwartschaften wurde auf den 31. 12. 1991 verschoben.17 Es wurde bestätigt und noch einmal festgeschrieben, dass Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen der DDR „nach Art, Grund und Umfang“ nach den allgemeinen Regelungen der Sozialversicherung unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragszahlungen anzupassen sind.18 Ungerechtfertigte Leistungen sollten abgeschafft und überhöhte Leistungen abgebaut werden, und eine Besserstellung gegenüber vergleichbaren Ansprüchen und Anwartschaften aus anderen öffentlichen Versorgungssystemen sollte nicht erfolgen.19 Trotz dieser Ausnahmen gilt die Garantie der Rechte „nach Art, Grund und Umfang“. Denn der im Staats- und im Einigungsvertrag garantierte Bestand an Rechten, d. h. Ansprüchen und Anwartschaften, wird zusätzlich untermauert durch die im Einigungsvertrag enthaltene Zahlbetragsgarantie20 für Personen, die am 3. 7. 1990 leistungsberechtigt waren. Die Höhe entsprach dem Betrag, der am 1. 7. 1990 nach den Vorschriften des Rentenangleichungsgesetzes der DDR zu erbringen war. Personen mit einer Versorgungszusage, für die bis zum 30. 6. 1995 ein Anspruch auf eine Leistung nach der Versorgungsvorschrift entstand, wurde ein entsprechender Zahlbetragsbesitzschutz zugesichert.21
17
Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung, Abschnitt III Nr. 9 Buchst. b) Satz 1 zum Einigungsvertrag (EV). 18 Ebd., Nr. 9 Buchst. b) Satz 3 Nr. 1. 19 Ebd., Nr. 9 Buchst. b) Satz 3 Nr. 1. 20 Art. 9 Abs. 2 EV i.V. mit Anl. II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b) Satz 4 zum EV. 21 Ebd.
74
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Die Zahlbetragsgarantie überlagert und ergänzt die Garantie der erworbenen Versorgung.22 Die Sicherung des Zahlbetrags, die eine Absenkung des sozialen Besitzstandes vermeiden sollte, fügt sich ein in das Versprechen, das in der Regierungserklärung zum Staatsvertrag abgegeben wurde: „Den Deutschen in der DDR“, so der Bundeskanzler Kohl, „kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Maizière betont hat: Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor – dafür vielen besser.“23 2. Der Rahmen Alle wichtigen Regelungen sind im Vertrag und dessen umfangreichen Anlagen enthalten. – Anlage I: Besondere Bestimmungen zur Überleitung von Bundesrecht gemäss Art. 8 und 11 des Vertrages; – Anlage II: Besondere Bestimmungen für fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik; – Anlage III: Gemeinsame Erklärung der Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik zur Regelung offener Vermögensfragen vom 15. 6. 1990. Der Einigungsvertrag selbst gliedert sich wie folgt: a) Verfassungsänderungen Er enthält sechs Grundgesetzänderungen, die Neufassung der Präambel, Aufhebung des Art. 23 GG, Neufassung des Art. 51 Abs. 2 GG, Änderung und Ergänzung des Art. 135 a GG, Einführung eines neuen Art. 143 GG und Neufassung des Art. 146 GG (Art. 4 Nr. 1 bis 6 EV). b) Empfehlungen für Verfassungsänderungen c) Mit Art. 5 EV werden Empfehlungen für weitere Verfassungsänderungen gegeben. d) Weitere Regelungen Weitere grundlegende bzw. bedeutsame Regelungen für beinahe alle Staatsaufgaben sind Art. 7 ff. EV zu entnehmen.
22
D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 84 ff. Regierungserklärung des Bundeskanzlers Dr. Kohl zum Staatsvertrag anlässlich der abschließenden Beratung des Vertragsgesetzes zum Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR vom 21. 6. 1990, abgedr. bei Klaus Stern/Bruno Schmidt-Bleibtreu, Staatsvertrag, 1990, S. 347 ff. (348). 23
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
75
Der Einigungsvertrag ist ein Verfassungsgesetz. Daran gibt es keinen berechtigten Zweifel.24 Auf ihn werden zwei Verfassungen, das Verfassungsgrundsätzegesetz der DDR und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland fokussiert und zum Ausgleich gebracht. Daran ändert sich auch nichts, dass mit dem Untergang der DDR auch deren Verfassung weggefallen ist. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990 ist vor dem Beitritt am 3. 10. 1990 abgeschlossen worden. 3. Geltung des Befehls zur Anwendung des Grundgesetzes vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR am 3. 10. 1990 Der Einigungsvertrag setzt das Ziel, „schrittweise einheitliche Lebensverhältnisse im vereinten Deutschland“ zu schaffen.25 In den Einigungsvertrag sind auch die Bestimmungen der Verfassung der DDR eingegangen. So heißt es z. B. in Art. 1 Abs. 1 Satz 2 EV, dass für die Bildung und die Grenzen der Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen die Bestimmungen des Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern der Deutschen Demokratischen Republik vom 22. 7. 199026 gem. Anlage II maßgebend sind. Mit Art. 4 Nr. 1 EV wird das Grundgesetz geändert. Die Präambel, Satz 3 lautet danach wie folgt: „Damit gilt das Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.“ Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990, dem von westdeutscher Seite durch Vertragsgesetz vom 23. 9. 1990 zugestimmt worden war, trat am 29. 9. 1990 in Kraft. Damit ist der Anwendungsbefehl für die Geltung des Grundgesetzes noch vor dem Wirksamwerden des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. 10. 1990 (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 EV) in Kraft getreten. Demnach sind die in der DDR erworbenen Rechte, Ansprüche und Anwartschaften noch vor dem Beitritt in den Schutzbereich des Grundgesetzes einbezogen worden. Demgemäss ist auch die von westdeutscher Seite geäußerte Auffassung schon aus formalrechtlicher Sicht unhaltbar, wonach im Wege der sog. gesetzlichen Novation alle Ansprüche und Anwartschaften aus der DDR liquidiert worden sind und nur die nach dem Beitritt am 3. 10. 1990 durch bundesdeutsche Gesetze eingeräumten Rechtspositionen bzw. im Vergleich zum DDR-Recht die dadurch erfolgte Schmälerung oder Entziehung von Rechten am Grundgesetz gemessen werden darf.27 Diese Auffassung kann sich Art. 3 EV nicht zugute halten. Danach tritt mit dem Wirksamwerden des Beitritts das 24 Zum Begriff und zur Deutung von „Verfassung“ grundlegend Carl Schmitt, Verfassungslehre (1928), 8. Aufl., 1993, S. 3 ff.; vgl. auch Hermann Heller, Staatslehre (1934), in: ders., Gesammelte Schriften, 3. Bd., 2. Aufl., 1994, S. 79 (361 ff.). 25 Art. 4 Nr. 5, 30 Abs. 5 EV; Denkschrift zum EV zu Kapitel VII, BT-Drs. 11/7760, S. 369. 26 Ländereinführungsgesetz (GBl. I Nr. 51, S. 955). 27 Erläuterung und Einzelheiten hierzu bei K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 43 ff., 153 ff.
76
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Grundgesetz in den „neuen“ Ländern sowie in dem Teil Berlins, in dem es nicht galt (Ost-Berlin), mit den sich aus Art. 4 EV ergebenden Änderungen in Kraft. Der Einigungsvertrag ist ein Verfassungsgesetz und zugleich ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen zwei souveränen deutschen Staaten, denen es unbenommen ist, schon vor Erstreckung der westdeutschen Verfassung auf das Beitrittsgebiet die in der DDR entstandenen Rechte nicht nur dem Schutzgesetz der DDR-Verfassung, sondern dem Grundrechtsschutz des Grundgesetzes zu unterstellen.28 4. Rechtsangleichung Rechtsangleichung bedeutet Herbeiführung der Übereinstimmung oder Annäherung von Rechten aus zwei Rechtskreisen und nicht Wegfall eines Rechts aus einem Rechtskreis, wenn ein gleichartiges oder gleichwertiges Recht in dem anderen Rechtskreis besteht und im Zuge der Einigung bestehen bleibt.29 a) Artikel 8 des Einigungsvertrages [Überleitung von Bundesrecht] Danach tritt mit dem Wirksamwerden des Beitritts im Beitrittsgebiet Bundesrecht in Kraft, soweit es nicht in seinem Geltungsbereich auf bestimmte Länder oder bestimmte Landesteile der Bundesrepublik Deutschland beschränkt ist und soweit durch den Einigungsvertrag, insbesondere dessen Anlage I, nichts anderes bestimmt ist. In der Anlage I Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung werden Festlegungen zur Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung für das Beitrittsgebiet getroffen. Es werden (im Abschnitt I) zahlreiche, nicht immer schlüssig begründbare Ausnahmen und (im Abschnitt II) Ergänzungen des Bundesrechts vorgesehen. Abschnitt III legt die Maßgaben fest, mit denen das Rentenreformgesetz 199230 im Beitrittsgebiet in Kraft tritt. b) Art. 9 des Einigungsvertrages [Fortgeltendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik] Nach Art. 9 Abs. 2 EV bleibt das in der Anlage II aufgeführte Recht der DDR mit den dort genannten Maßgaben in Kraft, soweit es mit dem Grundgesetz unter Berücksichtigung des Vertrages sowie mit dem unmittelbar geltenden Recht der Europäischen Gemeinschaften vereinbar ist. Soweit es Gegenstände der konkurrie28
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 50. Diese Begrifflichkeit bedarf keiner vertiefenden Erläuterung. Sie ist Allgemeingut. Insofern kann auch auf die Bestimmungen über die Rechtsangleichung im EG-Vertrag (Art. 94 bis 97) und auf deren Anwendungspraxis Bezug genommen werden. 30 Rentenreformgesetz 1992 vom 18. 12. 1989 (BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337), geändert durch Gesetz vom 22. 12. 1989 (BGBl. I S. 2406). 29
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
77
renden Gesetzgebung oder der Rahmengesetzgebung betrifft, gilt es als Bundesrecht fort, wenn und soweit es sich auf Sachgebiete bezieht, die im übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes bundesrechtlich geregelt sind (Art. 9 Abs. 4 Satz 2 EV). Schon danach gilt im Grundsatz, dass in der DDR entstandene Versorgungsansprüche weiterbestehen, da sie schon vor dem Beitritt auch unter das Grundgesetz fallen und als Eigentum i.S. von Art. 14 Abs. 1 GG geschützt sind. aa) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet F: Sozialversicherung (Allgemeine Vorschriften) Abschnitt III Nr. 8 zum EV: Rentenangleichungsgesetz der DDR vom 28. 6. 1990 Nach dieser Vorschrift gilt das Rentenangleichungsgesetz vom 28. 6. 199031 einschließlich der auf der Grundlage des § 29 erlassenen Regelungen zur Überführung der zusätzlichen Versorgungssysteme mit sechs Maßgaben fort, die Änderungen des RAG vorsehen (Nr. 8 Buchst. a bis f.) Am Beispiel der Zusatzversorgung für Balletttänzer schon lässt sich nachweisen, dass deren Ansprüche bestehen bleiben sollten. Die einschlägige Vorschrift des § 33 RAG bleibt unberührt, d. h. wird nicht geändert. Danach gilt die Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR von 1976 i. d. F. von 1983 (bbZ) sowie, dass aus betrieblichen Mitteln gezahlte Renten oder Pensionen weiter in Deutscher Mark gezahlt werden. Hinsichtlich der bbZ sind weiter jene Regelungen anzuwenden, die für die zusätzlichen Versorgungssysteme der Intelligenz getroffen waren, insbesondere – auch die nicht geänderten – §§ 24 und 25 RAG, und die keine Einstellung, sondern eine Fortdauer der Ansprüche und Anwartschaften aus Versorgungssystemen durch Überführung verfügten.32 Die bbZ ist demnach „überführt“ worden in das gesamtdeutsche Rechtssystem. bb) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung Abschnitt III Nr. 6 zum EV: Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung Die Vorschrift lautet wie folgt: „Folgendes Recht der Deutschen Demokratischen Republik bleibt mit folgenden Maßgaben in Kraft: … 6. Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen vom Juni 1983 mit folgenden Maßgaben: Die Anordnung ist bis zum 31. 12. 1991 anzuwenden. 31 32
GBl. I Nr. 38, S. 495. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 51/52.
78
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess Von der Anordnung kann für die Zeit bis zum 31. 12. 1990 durch Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung abgewichen werden.“
Der Einigungsvertrag bestimmt an keiner Stelle die Einstellung der Zahlungen, sondern vielmehr, dass – nach dem 31. 12. 1990 aufgrund der AO bbZ keine weiteren Ansprüche und Anwartschaften mehr neu erworben werden können. Bis dahin, also zunächst noch nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, erwarben die aktiven Ballettmitglieder aus der DDR an den entsprechenden Einrichtungen weiter Ansprüche aus der AO bbZ. – spätestens ab dem 1. 1. 1992 eine weiterführende Regelung über die Verfahrensweise mit der bbZ gelten sollte, die eine Überführung auch dieser Versorgungsleistung sichern sollte.33 (1) LSG Thüringen Das weisen Antworten der zuständigen Länderministerien im Jahre 1991 und ein Beschluss des Thüringischen Landessozialgerichts34 nach, in dem es u. a. heißt: „Dabei lag der Grund der Regelung unter a) nicht etwa in einem damals zum 31. 12. 1991 beabsichtigten Auslaufenlassen der AO. Die Regelung ist vielmehr im Zusammenhang mit der besonders schwierigen Überleitung des Rentenrechts der DDR … zu sehen. … die eigentliche Überleitung des DDR-Rentenrechts mit seinen vielfältigen, zum Teil auch vom westdeutschen Rentensystem abweichenden Ansprüchen und Anwartschaften sollte dann erst im Laufe des Jahres 1991 in einem eigenen ,Rentenüberleitungsgesetz‘ geregelt werden … Das Fortgeltenlassen einer rentenrechtlichen Regelung bis zum 31. 12. 1991 ohne ausdrückliche Anschlussregelung war im Einigungsvertrag daher nicht außergewöhnlich und bedeutete zu jenem Zeitpunkt auch keinesfalls eine Festlegung oder auch nur ein Indiz in Richtung auf einen beabsichtigten Wegfall einer bestimmten rentenrechtlichen Regelung. Dieser Weg wurde vielmehr auch für die Sozialpflichtversicherungsrente …, die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme …, die Versorgung der Eisenbahner … gewählt. Alle diese Systeme sollten also keinesfalls tatsächlich mit dem 31. 12. 1991 auslaufen und ersatzlos gestrichen werden, sondern vielmehr einstweilen bis zur Verabschiedung eines ,Rentenüberleitungsgesetzes‘ fortgelten (,geparkt werden‘), das dann erst über die endgültige Übernahme oder Nichtübernahme der Systeme entscheiden sollte. Irgendeine Wertung oder gar Entscheidung über eines der Systeme oder seine Versorgungsleistungen konnte in diesem generellen Verfahren mithin nicht gesehen werden, also auch nicht bezüglich der AO 1983 und der bbZ.“
Der Beschluss des LSG Thüringen entspricht dem Ziel und Zweck des Einigungsvertrages, sein Ergebnis lässt sich mittels aller Auslegungsmethoden (gram-
33
Ebd., S. 52 ff. LSG Thüringen, Beschl. vom 6. 9. 1993 – L 3 SB 18/93; ebenso ArbG Frankfurt (O), Urt. vom 15. 5. 1996 – 5 (3) Ca 20 295/95. 34
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
79
matikalische, systematische, teleologische und historische Auslegung) untermauern.35 Es ist angesichts dieser in sich geschlossenen, stringenten Regelung widersinnig, die Vorschrift der Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 6 als Einstellungsregelung umzudefinieren, wie es vom BSG, BAG und auch vom BVerfG geschah.36 Es ist offensichtlich widersprüchlich, eine auf lebenslange Einkommenssicherung zielende Regelung so anzuwenden, dass – einerseits zwar bis zum Auslaufen der AO bbZ, also bis zum 31. 12. 1991, noch Ansprüche und Anwartschaften insgesamt auf die bbZ erworben werden können, – andererseits aber mit dem Ablauf desselben Monats bzw. Tages alle bis dahin rechtmäßig erworbenen Ansprüche und Anwartschaften rückwirkend liquidiert werden sollten: Das Ende der Zuerkennungspflicht und den Ablauf der Leistungspflicht auf einen Tag zu legen, wäre ein „exquisites Meisterstück“ unsinniger Gesetzgebung, das man in dieser Art „Schildbürgerstreich“ den Vertragspartnern nicht unterstellen sollte. Eine andere Hand nimmt, was die andere Hand gibt, an einem Tag.37 Ein solches Ergebnis widerspricht dem auch vom BVerfG als verfassungskräftig anerkannten Postulat der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung.38 Das Bundesverfassungsgericht ignoriert die Entscheidungen der Instanzgerichte völlig und stellt die Dinge auf den Kopf. In seinem Beschluss vom 2. 7. 2002 meint es irrig, der Einigungsvertragsgesetzgeber habe sich mit Art.9 Abs. 2 i.V. mit der Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 6 Buchst. a) dafür entschieden, die berufsbezogenen Zuwendungen nicht in die Sozial- und Arbeitsrechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland als weiter zu gewährende Leistungen zu überführen, und habe ihre Einstellung zum 31. 12. 1991 angeordnet. In die Irre führt auch die Frage, ob die entstandenen Ansprüche und Anwartschaften „schon deshalb nicht eigentumsrechtlich durch das Grundgesetz geschützt sind, weil sie nicht auf Beiträgen beruhen“.39 Abgesehen davon, dass das BVerfG in seinem Grundsatzurteil vom 28. 4. 199940 diese Frage eindeutig verneint, d. h. entschieden hat, dass sie den Schutz des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG genießen, knüpft der Bundesgesetzgeber selbst mit dem Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) im Anspruchs- und Anwartschafts-
35
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 53. BSG, Urt. vom 29. 4. 1997 – 4 RA 98/95; BAG, Urt. vom 24. 3. 1998 – 3 AZR 384/97; BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95, 1944/97, 2270/00 – und vom 4. 7. 2002 – 1 BvR 2052/98. 37 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 59/60. 38 BVerfGE 98, 83. 39 BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95 u. a., S. 8; abgedruckt in W. Mäder/ J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 171 – 177. 40 BVerfGE 100, 1. 36
80
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
überführungsgesetz nicht an die Beitragsleistungen, sondern an das erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen an (§ 6 Abs. 1 AAÜG).41 Das Bundesverfassungsgericht meint in seinem Beschluss vom 2. 7. 2002 ferner, dass die Beschwerdeführer sich nicht auf das Grundsatzurteil vom 28. 4. 199942 berufen können, das den Eigentumsschutz des Art. 14 Abs. 1 GG davon abhängig gemacht habe, dass sie im Einigungsvertrag nach dessen Maßgaben als Rechtsposition der gesamtdeutschen Rechtsordnung anerkannt werden. Es behauptet kühn, dass die Versorgungsbezüge der Ballettmitglieder vom Einigungsvertrag nicht überführt worden seien, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Der Entzug der bbZ durch das BVerfG geht über eine Enteignung hinaus, da nicht ersichtlich und auch nirgendwo begründet worden ist, dass die Entziehung „zum Wohle der Allgemeinheit“ erfolgt ist (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG). Im Vordergrund steht die Entziehung, die nach Auffassung des BVerfG durch Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 6 Buchst. a) zum EV, in Wahrheit durch die Beschlüsse des BVerfG erfolgt ist. Es handelt sich um eine Konfiskation. Diese unterscheidet sich von der Enteignung nicht nur durch die fehlende Entschädigung, sondern vor allem durch die Zielrichtung. Die Enteignung verfolgt einen objektiven Zweck. Sie richtet sich gegen das Eigentumsobjekt, weil dieses „zum Wohle der Allgemeinheit“ benötigt wird (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG). Deshalb ist die Person des Eigentümers für die Enteignung irrelevant, weil primär die Eigentumserlangung gewollt und vom Gemeinwohl gefordert ist.43 Demgegenüber ist die generelle oder spezielle, überwiegend politisch motivierte Konfiskation subjektiv zielgerichtet.44 Sie wendet sich gegen den Eigentümer, und ihr Hauptzweck ist die Entziehung, die durch Gesetz oder administrativen Einzelakt45 erfolgt. Dabei wird die Personengerichtetheit mitunter durch eine scheinbar objektbezogene Argumentation verschleiert.46 Dass die Entziehung sich gegen die Ballettmitglieder als Personen richtet, unterlegt auch die Begründung des BVerfG, wonach dessen – allerdings falscher – Meinung die bbZ „den Charakter einer besonderen Begünstigung für eine bestimmte Berufsgruppe“ habe, die zu streichen sei.47 Damit schwingt die Behauptung mit, dass es sich hierbei um eine ungerecht41
Siehe auch H.-J. Papier, Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, 1994, S. 13 f.; D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 70; W: Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 160. 42 BVerfGE 100, 1 [32 f.]. 43 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 43. 44 Zu dieser Unterscheidung Hans Peter Ipsen, Enteignung und Sozialisierung, in: VVDStRL 10 (1952), S. 88; ihm folgend Hans Jürgen Papier, in: G. Dürig/Th. Maunz, GG, Komm., Art. 14 Rdnr. 577. Zur Definition E. R. Huber, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. II, S. 42; H.-J. Papier, in: G. Dürig/Th. Maunz, GG, Komm., Art. 14 Rdnr. 577. 45 Zur Definition H.-J. Papier, in: Th. Maunz/G. Dürig, Komm. zum GG, Art. 14 Rdnr. 577. 46 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 43. 47 BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002, S. 9.
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
81
fertigte Leistung handelt. Die Beschlüsse des BVerfG48 verstoßen eindeutig gegen Art. 20 Abs. 2 Satz 3 StV und den Einigungsvertrag, Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b) Satz 1 und 2. Die hergebrachten Ansprüche und Anwartschaften wurden einfach konfisziert. Die Aberkennung von Renten begegnet insbesondere durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken, wenn – wie bei der bbZ – Rentenansprüche und -anwartschaften als öffentlich-rechtliche Rechtspositionen das „Äquivalent einer Leistung“ darstellen.49 „Eigentum“ im Sinne des Art. 14 Abs. 1 GG darf gesetzlich nur beschränkt werden, darüber hinaus aber lediglich in den Fällen der Enteignung (Art. 14 Abs. 3 GG) oder Vergesellschaftung (Art. 15 GG) – und auch dann nur gegen Entschädigung – entzogen werden. Da der Gesetzgeber pönale und quasi-pönale Sanktionen nur im Rahmen und nach Maßgabe der Verfassung verhängen darf,50 wäre eine von der Eigentumsgarantie nicht gedeckte Entziehung des Eigentums als Strafe nach Art der früher üblichen Konfiskationen51 unter dem Grundgesetz verfassungswidrig. (2) Zur Kontinuität trotz Verfassungswechsels Das Bundesverfassungsgericht lässt es an der Einheitlichkeit seiner Rechtsprechung vermissen. Der ersatzlose Wegfall von Renten- oder Versorgungsansprüchen ist auch, abgesehen davon, dass diese den Schutz des Eigentums genießen, was auch vom BVerfG in ständiger Spruchpraxis bestätigt wird,52 aus folgenden Gründen unzulässig. Wenn eine Rechtsgrundlage für den Erwerb einer Leistung wegfällt, fallen nicht auch die auf der Grundlage der gewährenden Vorschrift erlassenen Verwaltungsakte oder ein rechtmäßig erworbener Anspruch oder eine Anwartschaft weg. Der Wegfall der Regelungen über die Eheschließung in der DDR führte z. B. selbstverständlich nicht zur Aufhebung oder zum Wegfall der die Ehe gestaltenden Rechtsakte. Es bestehen vielmehr die auf der Grundlage der früher erlassenen Verwaltungsentscheidungen oder abgeschlossenen Verträge entstandenen Rechte und Pflichten dauerhaft weiter. Das gilt nicht nur im Einigungsprozess,53 sondern auch stets dann, wenn neue Vorschriften mit anderem Inhalt geschaffen werden. 48
Vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95, 1944/97, 2270/00 – und vom 4. 7. 2002 – 1 BvR 2052/98. Vgl. BVerfGE 14, 288 [293]; 22, 241 [253]; 24, 220 [226]; 53, 257 [289 ff.]; 55, 114 [131]; 58, 81 [109]. 50 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 42, 29 f. 51 Ebd., S. 42 m.w.N. 52 Vgl. schon BVerfGE 14, 288 [293]; 22, 241 [253]; 24, 220 [226]; 53, 257 [289 ff.]; 55, 114 [131]; 58, 81 [109]; vgl. auch BVerfGE 31, 222 [239]; 42, 64 [76 f.]; 46, 325 [334]. 53 In Konsequenz dessen schreibt Art. 19 EV vor, dass vor dem Wirksamwerden des Beitritts ergangene Verwaltungsakte der DDR wirksam bleiben (Satz 1), sie nur aufgehoben werden können, wenn sie mit rechtstaatlichen Grundsätzen oder mit Regelungen des Einigungsvertrages unvereinbar sind (Satz 2), dass im übrigen die Vorschriften über die Bestandskraft von Verwaltungsakten unberührt bleiben (Satz 3). 49
82
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Das Bundesverfassungsgericht hat in einem (Grundsatz-)Urteil vom 8. 4. 1997,54 auch hier einschlägig, ausgeführt: – „Weder trifft die Ansicht zu, dass in der Deutschen Demokratischen Republik Rechtsbeziehungen, die für einen Rechtsstaat anerkennungsfähig wären, überhaupt nicht entstehen konnten, noch ist es richtig, dass mit der Verfassung eines Territoriums auch die in ihm bestehenden Rechtsbeziehungen untergehen. Beim Verfassungswechsel ist vielmehr Kontinuität der nicht unmittelbar verfassungsrechtlich begründeten Rechtsbeziehungen die Regel, während ihre Aufhebung ausdrücklich angeordnet wird.55 Davon geht auch das temporale Privatrecht aus, wie der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung annimmt (vgl. BGHZ 10, 391 [394]; 120, 10 [16].56 – Der Umstand, dass sich die Rechtsordnung der Deutschen Demokratischen Republik von derjenigen der Bundesrepublik in Leitvorstellungen und Ausformungen grundlegend unterschied, führt ebenfalls nicht dazu, dass sämtliche Rechtsbeziehungen wie Ehen, Verwandtschafts-, Arbeits-, Mietverhältnisse, Vereinsmitgliedschaften endeten und unter den neuen Bedingungen erneut begründungsbedürftig geworden wären. Das gilt nicht nur für Rechtsbeziehungen, die zwar in derjenigen Form, die sie als Ausprägung des sozialistischen Rechtssystems in der Deutschen Demokratischen Republik gefunden hatten, in der Bundesrepublik nicht hätten entstehen können, aber auch nicht Ausdruck des besonderen Unrechtsgehalts der früheren Ordnung sind.“57 Das Urteil des BVerfG lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen, findet seine Substanz im Völkerrecht. Hieraus lässt sich „glasklar“ entnehmen, dass in der DDR begründete Rechte auf eine Altersversorgung in die gesamtdeutsche Rechtsordnung gewechselt sind. cc) Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H: Gesetzliche Rentenversicherung Abschnitt III Nr. 9 zum EV: Regelungen für Sonderund Zusatzversorgungssysteme (Versorgungssysteme) Die Vorschrift enthält Regelungen zur Weitergeltung von Recht der DDR und zur Überführung der Ansprüche aus Versorgungssystemen. Danach sind „die noch nicht geschlossenen Versorgungssysteme zum 31. 12. 1991 zu schließen“ (Nr. 9 Buchst. a). Bis dahin bzw. bis zur Überführung (Nr. 9 Buchst. b) waren grundsätzlich die „versicherungs- und beitragsrechtlichen Regelungen der jeweiligen Versorgungssysteme weiter anzuwenden“ (Nr. 9 Buchst. a). Lediglich „Neueinbeziehungen“ waren ab dem 3. 10. 1990 nicht mehr zulässig. Hinsichtlich der Leistungen wurde 54 55 56 57
1 BvR 48/94, BVerfGE 95, 267 – Altschulden. Kursiv vom Verfasser. Siehe auch oben Abschnitt E, III. 2. Buchst. c) „Vorrang des Völkerrechts“. BVerfGE 95, 267 [306 f.].
III. Der Einigungsvertrag vom 31. 8. 1990
83
somit Kontinuität gewahrt. Die Ansprüche und Anwartschaften waren, „soweit dies noch nicht geschehen ist, bis zum 31. 12. 1990 in die Rentenversicherung zu überführen“ (Nr. 9 Buchst. b). (1) Garantie des Bestandes der Ansprüche nach Art, Grund und Umfang Die Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen waren also nach dem Einigungsvertrag nicht irgendwie „untergegangen“, liquidiert bzw. „noviert“ worden, waren vielmehr „nach Art, Grund und Umfang … nach den allgemeinen Regeln der Sozialversicherung unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragszahlungen anzupassen“ (Nr. 9 Buchst. b) 1.).58 Auch ergibt sich daraus nicht, dass sie auf irgendeine Beitragsbemessungsgrenze rückwirkend zu kürzen oder aufzuheben waren. Es war typisch für die Renten aus Versorgungssystemen in Ost und West (und es ist in West immer noch so), dass sie zusätzlich zu den Versichertenrenten gewährt und von keiner besonderen Beitragsbemessungsgrenze eingeschränkt werden. Die Ansprüche konnten nur „unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragszahlungen (Nr. 9 Buchst. b) offensichtlich nur dann wie vorgesehen angepasst werden, wenn diese Anpassung von keiner rückwirkend eingeführten Beitragsbemessungsgrenze von vornherein unmöglich gemacht wurde. Das ergibt sich aus dem Einigungsvertrag. Er sieht eine volle, nur durch die Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze eingeschränkte Überführung der Rentenansprüche und -anwartschaften aus der Sozial- in die gesetzliche Rentenversicherung vor. Die Anwendung der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze wurde für die Bürger, die nur Ansprüche oder Anwartschaften in der allgemeinen Sozialpflichtversicherung der DDR erworben hatten, durch den EV nicht auf die Erwerbszeiten bis zum 28. 2. 1974 eingeschränkt. Dies geschah erst mit § 256 a SGB VI, der die besondere Beitragsbemessungsgrenze Ost schuf. (2) Zur Bedeutung der Beitragsleistungen Die Orientierung auf Beitragszahlungen war allerdings ungenau, da nur in einigen der unter Nummer 9 in Bezug genommenen Versorgungssystemen Beitragsleistungen für Entgelte vorgesehen waren (z. B. die Beiträge der Arbeitgeber in der zusätzlichen Altersversorgung der technischen Intelligenz [Nr. 1 der Anlage 1 des AAÜG]; die Beiträge der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber in der freiwilligen zusätzlichen Altersversorgung für hauptamtliche Mitarbeiter des Staatsapparats [Nr. 19 der Anlage 1 des AAÜG]; die Beiträge in der freiwilligen zusätzlichen Versorgung für Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und andere Hochschulkader in staat-
58 Hierzu D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 81 f., zur Bestandsgarantie als „Erwerbsschutz“ und zur Bestandsgarantie als „Ergebnisschutz“.
84
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
lichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens einschließlich der Apotheker in privaten Apotheken [Nr. 8 der Anlage 2 des AAÜG]). In anderen Fällen erfolgte der Anspruchserwerb unmittelbar durch Arbeitsleistung. Die Frage der Beitragsleistung spielt demgemäss keine besondere Rolle. Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Grundsatzentscheidung vom 28. 4. 199959 zur Versorgungsüberleitung Ost u. a. ausgeführt: „Wie das Bundesverfassungsgericht bereits im Zusammenhang mit westdeutschen sozialversicherungsrechtlichen Positionen hervorgehoben hat, beruht der Eigentumsschutz in diesem Bereich wesentlich darauf, dass die in Betracht kommende Rechtsposition durch die persönliche Arbeitsleistung der Versicherten mitbestimmt ist, die in den einkommensbezogenen Leistungen lediglich einen Ausdruck findet (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [301]). Es hat deshalb nicht nur vom Versicherten selbst gezahlte Beiträge, sondern auch die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung den eigentumsrelevanten Eigenleistungen des Arbeitnehmers zugerechnet (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [302]). Der Annahme einer nicht unerheblichen Eigenleistung steht danach nicht von vornherein entgegen, dass eine rentenrechtliche Position – ebenso wie Sachgüter, die mit Hilfe von Subventionen oder Steuererleichterungen erworben wurden – auch oder überwiegend auf staatliche Gewährleistung zurückgeht, wenn der Versicherte sie jedenfalls als ,seine‘, ihm ausschließlich zustehende Rechtsposition betrachten kann (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [301]).“60
Und weiter: „Im Hinblick auf die besonderen Bedingungen des Alterssicherungs- und Entlohnungssystems der Deutschen Demokratischen Republik kommt daher der Eigentumsschutz auch dann zum Tragen, wenn die Rentenansprüche und -anwartschaften nicht in erster Linie durch Beitragszahlungen, sondern maßgeblich durch Arbeitsleistung erworben wurden. Der erforderliche Zusammenhang zwischen Zusatzversorgung und Arbeitsleistung wurde im Entlohnungssystem der Deutschen Demokratischen Republik auf vielfache Weise hergestellt. In einigen Zusatzversorgungsregelungen war die Bedeutung der beruflichen Leistungen und Arbeitserfolge ausdrücklich hervorgehoben und als Rechtfertigung für die Höhe der Versorgung genannt (vgl. § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Altersversorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. 7. 1951, GBl., S. 675). …“61
(3) Die Zahlbetragsgarantie Außer der schon im Staatsvertrag enthaltenen Bestandsgarantie gewährleistet der Einigungsvertrag zusätzlich eine Zahlbetragsgarantie (Art. 9 Abs. 2 EV i.V. mit Anl. II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b Satz 4 und 5), auf die auch seine allgemeinen Grundsätze anzuwenden waren. Die Zahlbetragsgarantie überlagert und ergänzt die Garantie der erworbenen Versorgung. Sie bedeutet, dass die in ihrem realen Wert garantierten Zahlbeträge an die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse 59
BVerfGE 100, 1. BVerfGE 100, 1 [34 f.], zu C, I 1 b, bb). 61 BVerfGE 100, 1 [35], zu C, I 1 b, bb (kursiv vom Verfasser). – Vgl. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 114 ff. 60
IV. Zwischenergebnis
85
angepasst werden. Nach dem Einigungsvertrag wurde der Zahlbetrag einer Rente nur dann nicht „unterschritten“, wenn er unter Berücksichtigung der Grundsatzbestimmung des Art. 30 Abs. 5 EV62 ebenso an die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse angeglichen wurde wie die Löhne und Gehälter. Von diesen Vorgaben und Festlegungen des EV zur Vertrauens- und Besitzstandswahrung63 ist die Bundesregierung allerdings abgewichen. Zitiert und interpretiert wird die Regelung hingegen so, als ob sie einen nominalen Höchstbetrag bestimmt hätte. Eine derartige Begrenzung gibt es jedoch nicht.64
IV. Zwischenergebnis 1.
In ihren Grundstrukturen unterscheiden sich die Alterssicherungssysteme der Bundesrepublik Deutschland und der DDR nicht. Gegenteilige Annahmen treffen nicht zu. Dem steht nicht entgegen, dass die Rentenversicherungssysteme in beiden Teilen Deutschlands unter formellen Aspekten, bezüglich Organisation und Verfahren, Unterschiede aufweisen.
2.
Die DDR selbst hat – zwischen der Wende 1989 und dem Beitritt am 3. 10. 1990 – den zur Beseitigung der realsozialistischen Ordnung notwendigen Systemwechsel vollzogen. Das Verfassungsgrundsätzegesetz vom 17. 6. 1990 verankerte die Grundprinzipien des Rechts- und Sozialstaates. Es zog in allen Fragen der Ausgestaltung der neuen Staats- und Rechtsordnung mit den Grundsätzen des Grundgesetzes und der EMRK gleich, gab dem Eigentumsschutz, dem Rechtsstaatsprinzip und der Freiheit der Menschen die ihnen zukommende verfassungsrechtliche Gestalt.
3.
Ansprüche und Anwartschaften auf Renten und Versorgung standen unter dem Schutz der DDR-Verfassung, der jenem des GG, insbesondere dem der Art. 1, 2, 3, 14, 19 und 20 GG glich. Dieser Schutz wurde bestätigt und konkretisiert durch das Rentenangleichungsgesetz (RAG) der DDR vom 28. 6. 1990, das eine Fortführung der Ansprüche/Anwartschaften aus den Versorgungssystemen verfügte. Diese Rechte sind mit dem Beitritt nicht untergegangen, wurden durch den Staatsvertrag (StV) und den Einigungsvertrag (EV) gewahrt.
4.
Der Staatsvertrag vom 18. 5. 1990, ein völkerrechtlicher und materiell-rechtlich ein verfassungsrechtlicher Vertrag, hat zur Grundlage den Rechtszustand, wie er sich in der DDR nach der „friedlichen und demokratischen Revolution“ (Präambel) entwickelt hat (Rechts- und Sozialstaatlichkeit).
62 Art. 30 Abs. 5 Satz 3 EV lautet wie folgt: „Im übrigen soll die Überleitung von der Zielsetzung bestimmt sein, mit der Angleichung der Löhne und Gehälter in dem in Artikel 3 des Vertrages genannten Gebiet an diejenigen in den übrigen Ländern auch eine Angleichung der Renten zu verwirklichen.“ 63 Zu diesen Grundsätzen vgl. u. a. Art. 18 und Art. 19 EV, Art. 232 EGBGB, auch BVerfGE 95, 267 – Altschulden. 64 Zu Zahlbetragsgarantie vgl. K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 55 f., 173.
86
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
5.
Mit der Konstituierung einer Sozialunion (Art. 1 Abs. 4 Satz 2 StV) hatte sich die DDR zur Rechtsangleichung verpflichtet (Art. 18 ff. StV). Rechtsangleichung bedeutet nicht Rechtsuntergang oder -beseitigung, nicht Ermächtigung zum entschädigungslosen Entzug von Rechten.
6.
Der Staatsvertrag lässt die in der DDR erworbenen Rechte nicht nur unberührt; er hat sie zugleich bekräftigt. Schon der Staatsvertrag hatte zwar vorgesehen, bestehende Zusatz- und Sonderversorgungssysteme zum 1. 7. 1990 zu schließen, hatte jedoch – zugleich als Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland – angeordnet, erworbene Ansprüche und Anwartschaften in die Rentenversicherung zu überführen (Art. 20 Abs. 2 StV). Der Vertrag gestattet keine Eingriffe in das „Erworbene“. Der (Rechts-)Begriff „überführen“ hat nur den Wechsel des Organisationsträgers (Einführung eines gegliederten Systems der Sozialversicherung) im Auge.
7.
Der Staatsvertrag verlangt die schrittweise Angleichung des Rechts der DDR an das Bundesrecht. Das gilt auch für das Alterssicherungsrecht. Dabei sollen die Leistungsgerechtigkeit des Systems der sozialen Sicherheit sowie die Lohn- und Beitragsbezogenheit der Rentenversicherung, die Funktion der Rente als angemessener Arbeitslohn für die Lebensleistung und die Zuverlässigkeit der Altersvorsorge gewährleistet werden. Die Systementscheidung des Staatsvertrages (Art. 20)65 wird vom Einigungsvertrag übernommen und weitergeführt.66
8.
Die Kontinuität des Besitzstandes, der Ansprüche, Rechte und Anwartschaften der Bürger der DDR war eine der entscheidenden Grundpositionen des Einigungsvertrages (Art. 8 i.V.m. Anlage I Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 1; Art. 30 Abs. 5, Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9) und des von den Vertragspartnern zugesicherten, der Verfassung der DDR, dem Grundgesetz und der EMRK entsprechenden Bestands- und Vertrauensschutzes.67 Der Einigungsvertrag verfügt weder die ersatzlose Streichung der rechtmäßig erworbenen Ansprüche und Anwartschaften auf Renten aus den Zusatz- oder Gesamtversorgungssystemen noch aus der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung und stellt auch nicht den „Untergang“ von in der DDR erworbenen Rentenansprüchen und -anwartschaften fest, die zu „ersetzen“ gewesen wären.68 Er ließ das Rentenangleichungsgesetz im wesentlichen bis zu seiner Überführung in Kraft (EV, Anlage II Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. III Nr. 869).
65
Hierzu K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 48, 153, 169. Ebd., S. 50 ff. 67 Ebd., S. 272; zur Kontinuität der Rechtsbeziehungen bei Verfassungswechsel BVerfGE 95, S. 267. 68 Ebd., S. 50. 69 Alle vom EV nicht ausdrücklich geänderten Vorschriften des RAG und auch der Rentenverordnung vom 21. 11. 1979 und der Zweiten Rentenverordnung vom 26. 7. 1984 galten 66
V. Die sog. Systementscheidung und die Versorgungsüberführung
9.
87
Die Versorgungsleistungen sollten nach den Staatsverträgen (StV, EV) lediglich „überführt“, d. h. auf ein anderes System umgestellt werden. Eine Versorgungstransposition darf Modalitäten (Auszahlungsstelle, Versorgungsart oder -bezeichnung) ändern, nicht jedoch ein vorgegebenes Gefüge mit vorbezeichneten Abständen und Werten antasten. Transposition und Transformation haben sich am Vorgegebenen zu orientieren und möglichst werkgetreu umzusetzen, müssen jedoch das Original soweit wie möglich erhalten und dürfen es nicht verfälschen.70 Dies hat der Bundesgesetzgeber mit seiner Folgegesetzgebung jedoch getan.71
10. Nach dem Bundesverfassungsgericht ist die Kontinuität der nicht unmittelbar verfassungsrechtlich begründeten Rechtsbeziehung die Regel.72 Dies gilt auch für die durch die Versorgungsordnungen der DDR entstandenen Rechte. Auch nach Merten entfalten die Grundrechte insbesondere bei Verträgen, die dem Beitritt anderer Teile Deutschlands dienen, eine Vorwirkung. Art. 20 Abs. 2 Satz 3 StV enthalte eine Bestandsgarantie für die Versorgung, die vom EV bekräftigt wird.73 Im übrigen gilt der menschenrechtliche Eigentumsschutz gänzlich ohne verfassungsgesetzlichen Text, unabhängig von einem Verfassungswechsel.74
V. Die sog. Systementscheidung und die Versorgungsüberführung Die Überführung der Rentenansprüche und -anwartschaften nach Maßgabe der Staatsverträge in die Rentenversicherung wurde als sog. Systementscheidung deklariert. Sie wurde zwar vom Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform bezeichnet.75 Dieser „Systementscheidung“ stand die Alternative einer Regelung außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung in Form einer eigenständigen Versorgung (analog den Betriebsrenten, der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes oder der Beamtenversorgung) gegenüber. Entsprechend dem juristischen Sprachgebrauch kann die „Überführung“ von Ansprüchen und Anwartschaften der Versorgungsberechtigten in die gesetzliche
unverändert bis zum 31. 12. 1990 „in vollem Umfange weiter“ (vgl. Nr. 1 und Nr. 10 dieses Abschnitts IV). 70 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 108 f. 71 Siehe weiter unten Abschnitt G. I., J. und L., I. und II. 1. 72 BVerfGE 95, 267 [306 f.] – Altschulden. 73 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 108 ff., 145 f. 74 Siehe oben unter Abschnitt E., III. 2. c). 75 Zuletzt BVerfG, Urt. vom 23. 6. 2004 – 1 BvL 3/98 u. a.; BVerfGE 111, 115.
88
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Rentenversicherung nur zur Änderung von Organisation und Verfahren der Versorgung, nicht aber zu Eingriffen in die Versorgungsleistungen ermächtigen.76 Art. 20 Abs. 2 Satz 3, 1. Satzteil StV regelt nur die Modalität der Versorgungszahlungen und sieht nur in dem folgenden Relativsatz eine Überprüfung von Leistungen vor mit dem Ziel, „ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen“. Da die Versorgungslasten ohnehin im Staat und nicht von der Versichertengemeinschaft aufgebracht werden sollen, stellt die Rentenversicherung gleichsam die organisatorische Abwicklungsstelle dar, weil für die Versorgungsberechtigten keine beamtenähnliche Lösung mit möglichen politischen Implikationen gewollt war.77 Nach dem Einigungsvertrag sind – wie erwähnt – Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen „nach Art, Grund und Umfang“ den Ansprüchen und Anwartschaften nach den allgemeinen Regelungen der Sozialversicherung in dem Beitrittsgebiet unter Berücksichtigung der jeweiligen Beitragszahlungen anzupassen.78 Damit geht der Einigungsvertrag (vorbehaltlich spezieller Eingriffsmöglichkeiten) ebenfalls von der Garantie der Ansprüche und Anwartschaften nach „Art, Grund und Umfang“ aus. Die Versorgungsleistungen sollen lediglich, wie schon im Staatsvertrag vorgesehen, „überführt“, d. h. auf ein anderes System umgestellt werden. „Eine Versorgungstransposition darf Modalitäten (Auszahlungsstelle, Versorgungsart oder Versorgungsbezeichnung) ändern, nicht jedoch ein vorgegebenes Gefüge mit vorgezeichneten Abständen und Werten antasten. Transposition und Transformation haben sich am Vorgegebenen zu orientieren und möglichst werkgetreu umzusetzen, müssen jedoch das Original soweit wie möglich erhalten und dürfen es nicht verfälschen.“79 Zu einem anderen Ergebnis konnte man auch nicht dadurch gelangen, dass man die in den Staatsverträgen vorgesehene Überführung der Versorgungsansprüche und -anwartschaften in die Rentenversicherung als „Systementscheidung“80 qualifiziert. „Denn die Entscheidung für das Sozialversicherungssystem bedeutet zunächst nur die Absage an besondere Versorgungsträger81 oder an eine quasi-beamtenrechtliche Lösung. Aus ihr folgt weiterhin, dass die überführten Versorgungsansprüche und -anwartschaften in der Zukunft systemkonform wie sozialversicherungsrechtliche Ansprüche und Anwart76 Vgl. Ernst Bienert, Die Altersversorgung der Intelligenz in der DDR – Betrachtungen zur Entstehung und Abwicklung von Ansprüchen und Anwartschaften, in: ZSR 1993, S. 349 ff. (353); D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 109. 77 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 108. 78 Arg. Art. 20 Abs. 2 Satz 2 StV. 79 So D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 109. 80 So BSGE 72, 50 (65, 67). 81 Diese Entscheidung ist durch das Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz vom 24. 6. 1993 (BGBl. I S. 1038) nachträglich durchbrochen worden. Nach Art. 3 Nr. 5 Buchst. b) bb) des Gesetzes wurde die „Partei des demokratischen Sozialismus (PDS)“ zum Versorgungsträger für das Zusatzversorgungssystem der Anl. I Nr. 27 AAÜG gemacht, d. h. für hauptamtliche Mitarbeiter der SED/PDS.
VI. Schlussfolgerungen
89
schaften zu behandeln sind, d. h. dass sie beispielsweise der Rentenanpassung teilhaftig werden müssen. Dagegen besagt eine ,Systementscheidung‘ als solche nicht, dass das (westdeutsche!) Sozialversicherungssystem nachträglich für die Art und den Umfang des Erwerbs von Versorgungsansprüchen ausschlaggebend sein soll. Denn ausweislich des Vertragstextes sollen die (nach dem Recht der DDR) erworbenen Ansprüche und Anwartschaften infolge der Wiedervereinigung in die (ehemals westdeutsche und nunmehr gesamtdeutsche) Rentenversicherung überführt werden. Dabei ist eine möglichst weitgehende Entsprechung anzustreben, wie auch bei einer Umstellung der Währung vom Duodezimalsystem auf ein Dezimalsystem keine Vermögensverluste auftreten, sondern die vorhandenen Werte entsprechend umzurechnen sind. Im übrigen dürfen aus einem im Gesetzestext nicht enthaltenen, sondern ihm nachträglich übergestülpten Begriff keine begriffsimmanenten Folgerungen gezogen werden, für die der Wortlaut der Norm keine Anhaltspunkte gibt.“
So treffend und unwiderlegbar Merten.82
VI. Schlussfolgerungen Um einheitliches Rentenrecht in ganz Deutschland durchzusetzen, um vergleichbare Rechte, Ansprüche und Anwartschaften für alle Bürger in einem Deutschland zu garantieren und das weitere Auseinanderdriften der Einkommensund Lebensverhältnisse Ost zu West zu verhindern, muss das Alterssicherungssystem nicht nur formal gleich, sondern – für alle Generationen, die in der DDR Renten- und andere Alterssicherungsansprüche/-anwartschaften erworben haben, unter Wahrung der damit dauerhaft geschaffenen Rechte gegenüber dem Recht der Bürger der westdeutschen Bundesländer auch materiell-rechtlich gleich ausgestaltet werden; – in ein für ganz Deutschland und alle Bürger entsprechend einheitlich ausgestaltetes komplexes Altersicherungsrecht unter Berücksichtigung notwendiger Differenzen eingeordnet werden.83 Die Differenzierung kann nicht so weit gehen, dass der Vergleich der Versicherungsbiographien völlig außer acht gelassen wird. Höhere Rentenversicherungsleistungen an Versicherte in den „neuen“ Ländern können auf geschlossenen Versicherungsbiographien beruhen. So liegen den Versichertenrenten der Männer in den „neuen“ Ländern im Durchschnitt 46,14 Versicherungsjahre gegenüber 39,60 Versicherungsjahren in den alten Ländern zugrunde. Bei den Frauen sind es 33,54 Versicherungsjahre gegenüber 25,29 Versicherungsjahren in den alten Ländern.84
82
D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 109. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 64. 84 Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 1997, BT-Drs. 13/ 8450 vom 1. 9. 1997, S. 15, 74 ff. 83
90
F. Versorgungsüberleitung im Einigungsprozess
Keinesfalls kann davon gesprochen werden, dass die „Ost-Rentner“ Gewinner der deutschen Einheit wären.85
85 Mit diesem unbegründeten Vorurteil räumt K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, Drittes Kapitel: Vergleich der Versichertenrenten und Alterseinkommen Ost und West, S. 73 – 93, auf.
G. Wende rückwärts Der Staatsvertrag verlangt die schrittweise Angleichung des Rechts der DDR an das Bundesrecht. Das gilt auch für das Alterssicherungsrecht. Mit der Renten- und Versorgungsüberleitung sollten die Leistungsgerechtigkeit des Systems der sozialen Sicherung, die Lohn- und Beitragsbezogenheit der Rentenversicherung, die Funktion der Rente als angemessener Arbeitslohn für die Lebensleistung und die Zuverlässigkeit der Altersvorsorge gewährleistet werden.1 Die Vorgaben des Staatsvertrages sollten sicherstellen, dass den DDR-Bürgern keine Ansprüche und Anwartschaften, die bis zum 30. 6. 1990 in Versorgungssystemen (2. Säule der Alterssicherung) oder in der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung (3. Säule der Alterssicherung) rechtmäßig erworben worden sind, verloren gehen. „Bisher erworbene Ansprüche und Anwartschaften werden in die in Rentenversicherung überführt.“
Keineswegs war an eine Liquidierung bzw. einen Untergang oder eine allgemeine Reduzierung der Ansprüche/Anwartschaften gedacht.2 Auch der Einigungsvertrag wahrte die verfassungsrechtlich begründete Systementscheidung. Er verfügt weder die ersatzlose Liquidierung der rechtmäßig erworbenen Ansprüche und Anwartschaften auf Renten aus den Zusatz- oder Gesamtversorgungssystemen noch der Leistungen aus der FZR und stellt auch nicht den Untergang von in der DDR erworbenen Ansprüchen und Anwartschaften fest, die zu „ersetzen“ wären.3 Das Sozialversicherungsgesetz und das Rentenangleichungsgesetz der DDR hatten den vom Staatsvertrag vorgezeichneten Weg schon vorbereitet.4
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch Die Bundesregierung Kohl und der ihr folgende Bundestag haben die Vereinbarungen, Gesetzesvorschriften mit Verfassungsqualität, in ihr Gegenteil verkehrt. Der Staatsvertrag (Art. 20 Abs. 2) statuiert eine Bestandsgarantie für erworbene 1 Zur Bedarfs-, Leistungs- und Besitzstandsgerechtigkeit als Postulate sozialistischer Sicherung vgl. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 64 ff. 2 Ausführlich K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 45 – 48, 153 – 156. 3 Ebd., S. 50 – 56; D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 78 – 84. 4 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 48 – 50.
92
G. Wende rückwärts
Ansprüche und Anwartschaften.5 Der Einigungsvertrag hat die Bestandsgarantie in doppelter Weise, und zwar als Erwerbsschutz und als Ergebnisschutz mit einer Zahlbetragsgarantie6 ausgestaltet. Der Bundesgesetzgeber hat den verfassungsrechtlich vorgegebenen Weg verlassen. Er hat das Renten- und Versorgungsrecht der DDR weder dem Bundesrecht angeglichen noch im Wege der Angleichung übergeleitet oder überführt. Er hat den Auftrag der Staatsgesetze nicht erfüllt. Er hat vielmehr neues „Recht“ geschaffen, das nicht nur aus der Sicht der Betroffenen Un-Recht ist.7 Bei dem neu geschaffenen Bundesrecht handelt es sich nicht etwa um eine quantitative Abstufung, sondern um ein „aluid“. 1. Verfassungsrechtliche Vorgaben Nach allgemeiner Auffassung entfalten Grundrechte insbesondere bei Verträgen, die dem Beitritt des anderen Teils Deutschlands dienen, eine Vorwirkung.8 Das Bundesverfassungsgericht betont, die Kontinuität der nicht unmittelbar verfassungsrechtlich begründeten Rechtsbeziehungen sei die Regel.9 Das gilt auch für die durch die Versorgungsordnungen der DDR begründeten Rechte.10 Unabhängig davon, dass die Begründungen im einzelnen abweichen, stimmen sie mit den europarechtlichen Vorgaben zum menschenrechtlichen Eigentum überein.11 Der Eigentumsschutz ist Bestandteil des Internationalen und des Völkerrechts.12 Art. 14 GG schützt demgemäß Eigentum, das aufgrund einer fremden Rechtsordnung besteht, sofern diese Rechtsordnung nicht der deutschen widerspricht.13 Eigentum können auch durch vorkonstitutionelles ausländisches Recht erzeugte Rechtspositionen sein. Für die Bestimmung eines Rechts als vermögenswertes und eigentumsfähiges Recht werden materielle Kriterien benötigt. In der Bundesrepublik 5
D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 79 f. Ebd., S. 80 f.; vgl. auch SG Potsdam, Beschl. vom 18. 6. 1992, SGb. 1992, S. 566 (568 r.Sp. unten); vgl. ferner Jan Thiessen, Zahlbetragsgarantie und Rentendynamisierung, in: NJ 9/ 2000, S. 456 ff. 7 K.-H. Christoph, Verfassungsprobleme …, S. 115 – 151, 159 – 174. 8 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 30 ff. 9 BVerfGE 95, 267 [306 f.] – Altschulden. 10 Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 40 – 42, 54 ff. 11 Vgl. auch W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 10/2005, S. 579 f., 582 f. 12 Zur Wahrung des Eigentums im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum vgl. Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum (1950), 4. Aufl., 1997, als durchgängiges Gemeinschaftsrecht, S. 185: „Der wichtigste Anwendungsfall ist ein über die Grenzen der Staaten und Völker hinweggehendes, allgemein anerkanntes Recht freier Menschen auf Eigentum und ein Minimum von Verfahren (due process of law).“ Zur Staatensukzession vgl. S. 169, 208. 13 BVerfGE 45, 142 [169]; 101, 239 [259]; zur „überpositiven“ Garantie des Eigentums vgl. auch W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, S. 589 ff. 6
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch
93
genießen Versorgungsrechte und -anwartschaften den gleichen Schutz wie er für die DDR zu verzeichnen war.14 Die westdeutsche politische Klasse mit dem Bundeskanzler an der Spitze hat diese eindeutige Staats- und verfassungsrechtliche Lage von Anfang an mit juristisch-dogmatisch äußerst abwegigen Argumenten untergraben. Sie ist – nach wie vor – der Meinung, Versorgungsansprüche und -anwartschaften von Bürgern der DDR unterfielen nicht dem Eigentumsschutz, weil der (territoriale) Geltungsbereich des Grundgesetzes sich nach Art. 23 GG a.F. bis zur Wiedervereinigung auf das Gebiet der alten Bundesländer beschränkte, so dass Art. 14 GG nicht anwendbar sei.15 Auf deren Geheiß hat der Bundesgesetzgeber (die Legislative), von der Regierung beherrscht, einen nun tatsächlichen radikalen Systemwechsel vollzogen.16 2. Das Renten-Überleitungsgesetz vom 25. 7. 1991 Das Renten-Überleitungsgesetz (RÜG)17 einschließlich seiner Artikelgesetze – Art. 2: Übergangsrecht nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets,18 und Art. 3: Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz (AAÜG)19 – bewirkte die Liquidierung aller in der DDR erworbenen Versorgungsansprüche und -anwartschaften.20 Das sind Ansprüche/Anwartschaften auf Renten in der Sozialversicherung der DDR (1. Säule der Alterssicherung), aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen (2. Säule) und aus der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung – FZR (3. Säule), für die allesamt die Vorschriften der westdeutschen Rentenversicherung Anwendung finden (vgl. §§ 2, 2a AAÜG a.F.).21 Es gab die Grundlage für die Einräumung neuer Ansprüche/ Anwartschaften, die nun auf die bloße gesetzliche Rentenversicherung des Sozialgesetzbuches – Sechstes Buch – (SGB VI) (1. Säule der Alterssicherung der Bundesrepublik) begrenzt wurden.22 14
Siehe W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, S. 582 ff., 584 ff. Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 42 ff., 46, 96; dies., „Gewendetes Eigentum“, S. 589; W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Teil 2, in: ZFSH/SGB 12/ 2009, S. 707 (713 ff.). 16 Ausführlich K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 43 ff., 95 ff., 153 ff. 17 Gesetz zur Herstellung der Einheit in der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung (Renten-Überleitungsgesetz – RÜG) vom 25. 7. 1991 (BGBl. I S. 1606), geändert durch das Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (Rü-ErgG) vom 24. 6. 1993 (BGBl. I 1038, 1052). 18 Übergangsrecht für Renten nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets vom 25. 7. 1991 (BGBl. I S. 1606, 1663), zuletzt geändert durch das 4. Euro-Einführungsgesetz vom 21. 12. 2000 (BGBl. I S. 1983, 2014). 19 Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets (Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz – AAÜG) vom 25. 7. 1991 (BGBl. I S. 1606, 1677), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. 12. 2007 (BGBl. I S. 3024, 3034). – Das AAÜG aus 1991 wurde seitdem 14 Male (!) geändert. 20 Darstellung des Inhalts bei D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 15 – 23. 21 Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 10/2005, S. 580 f. 22 Ebd., S. 587. 15
94
G. Wende rückwärts
Entgegen der Konzeption der Staatsverträge und im Widerspruch zum Titel des Art. 3 RÜG „Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz“ „überführt“ das RÜG nicht irgendwelche Ansprüche/Anwartschaften aus der DDR. Deren Substanz wurde beseitigt. Es bestimmt, dass Rechte, die in den drei Säulen der Alterssicherung der DDR23 erworben waren, durch andere Ansprüche/Anwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung des SGB VI „ersetzt“ werden. „Ersetzen“ ist kein „Überführen“. Dabei erfolgte auch keine Ersetzung in dem Sinne, dass irgendetwas von dem realen Wert der früheren Ansprüche und Anwartschaften erhalten oder weitergeführt wird.24 Die neuen Ansprüche/Anwartschaften entstehen vielmehr originär dadurch, dass die Kriterien für den Anspruchserwerb des SGB VI über 45 Jahre rückwirkend auf den Lebenslauf des Betroffenen angewandt und zur Bestimmung der nach neuem Recht möglichen Ansprüche genutzt werden.25 Von einer Angleichung im Sinne der Staatsverträge kann keine Rede sein. Es wurden Rudimente des Sozialversicherungsrechts der Bundesrepublik auf das DDR-Gebiet erstreckt, allerdings mit zusätzlichen Einschränkungen.26 Auf die Erwerbstatbestände dieses neuen Rechts konnten sich die Betroffenen in ihrem Leben nie einstellen. Sie sind „Objekt“ eines für sie unbekannten Rechts geworden.27 Die „Sonderrechtsordnung“ für Berechtigte aus den Zusatz- und Gesamtversorgungssystemen der DDR bewirkt, dass sie in das „Prokrustesbett“ der gesetzlichen Rentenversicherung mit einer viel niedrigeren, etwas über dem Existenzminimum liegenden, die Lebenshaltung einschränkenden (Grund-)Rente gezwängt wurden. Die besonders bedeutsame Zahlbetragsgarantie für Ansprüche aus Versorgungssystemen wurde durch die Regelung des § 10 Abs. 1 AAÜG außer Kraft gesetzt.28 Die „beigetretenen“ Bürger, ob ungelernte Bauhilfsarbeiter oder Hochschulprofessoren, Verkäuferinnen oder ehemalige Ballettmitglieder, erhalten danach keine den Lebensstandard wahrende, sondern eine echt rückwirkend und nachteilig berechnete Pflichtversicherungsrente. Deren Spitzenwert für ein DDR-Arbeitsjahr lag für 1988 oder 1989 bei 1,85 PEP-Ost (= 42,4945 Euro). Professoren Ost erhalten danach insgesamt 30 % des Alterseinkommens vergleichbarer Professoren West, auch wenn sie inzwischen zehn Jahre lang an derselben Universität in vergleichbaren Funktionen mit vergleichbarem Gehalt tätig waren. Entsprechend gestaltet sich die Benachteiligung von Ingenieuren, Angehörigen der technischen Intelligenz und anderen Hochschulabsolventen, von Eisenbahnern, Angestellten im Gesundheitswe23
Hierzu Abschnitt D. II. W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, S. 587, 591 f. 25 Zum Rechtsstaatsprinzip und Verbot rückwirkender Gesetze vgl. BVerfGE 13, 261 [270 f.]; W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 138 f., 164, ferner 85 ff. 26 Hierzu K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1999, S. 115 ff.; ders., Bestohlen bis zum Jüngsten Tag. Kampf dem Rentenabbau Ost, 2010. 27 Hierzu Günter Dürig, in: Theodor Maunz/ders., Komm. zum GG, Art. 2 Rdn. 47. 28 Die Vorschrift wurde vom BVerfG mit Urteil vom 28. 4. 1999 für nichtig erklärt. BVerfGE 100, 1 – Zahlbetragsgarantie. 24
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch
95
sen, Künstlern, Ballettmitgliedern und weiteren Berufsgruppen29 aus Zusatz- und Gesamt-/Sonderversorgungssystemen.30 Die Zahlbetragsgarantie (Art. 30 Abs. 5 EV) wurde für Bestandsrentner aus der Sozialpflichtversicherung und der FZR durch Neuberechnung nach § 307 a SGB VI ausgehöhlt. Die Bestandsrenten wurden mit Auffüllbeträgen versehen und dadurch, dass sie zunächst nur statisch gewährt wurden, bald ganz „abgeschmolzen“.31 Fakt ist, dass das neu berechnete Alterseinkommen der Ostrentner nach allem nur ein Drittel bis maximal zwei Drittel des Alterseinkommens eines in der Lebensleistung vergleichbaren Bürgers Westdeutschlands erreicht. Keiner erhält eine Vollversorgung, wie sie vergleichbaren Westdeutschen in der Regel zusteht.32 a) Der Rentenzugriff des AAÜG als strafgleiche Sanktion Von dem in § 6 Abs. 1 Satz 1 AAÜG geregelten Grundsatz der sog. „Überführung“ der Versorgungssysteme in die Rentenversicherung macht(e) das Gesetz zahlreiche Ausnahmen. Diese Ausnahmen sind teils bereichsspezifischer (z. B. für das Ministerium für Staatssicherheit/Amt für Nationale Sicherheit),33 teils funktionsspezifischer Art, wobei mitunter von den Ausnahmevorschriften wieder Ausnahmen gemacht wurden (z. B. für Angehörige der Berufsfeuerwehr34). Auf diese Weise entstand insgesamt ein schwer durchschaubares Gesetzesdickicht von Sonderregelungen von Sonderbestimmungen. aa) „Staatsnahe“ Versorgungssysteme Eine bereichsspezifische Sonderregelung traf § 6 Abs. 2 AAÜG für sog. staatsnahe Versorgungssysteme, die in Anl. 1 Nr. 2, 3 oder 19 bis 27 und Anl. 2 Nr. 1 bis 3 aufgeführt sind. Hierzu gehörten z. B. hauptamtliche Mitarbeiter der Parteien, Angehörige der Nationalen Volksarmee, der Deutschen Volkspolizei, der Organe der Feuerwehr und des Strafvollzugs sowie der Zollverwaltung, hauptamtliche Mitarbeiter des Staatsapparates. Für die Zeiten der Zugehörigkeit zu diesen Versorgungssystemen war den sozialversicherungsrechtlichen Pflichtbeitragszeiten als Verdienst das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nur dann zugrunde zu legen, wenn es
29 30 31 32 33 34
Siehe BT-Drs. 16/7017 bis 16/7035. Eine Liste aller Systeme findet sich in Anlage 1 und 2 zum AAÜG. Hierzu D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 22 f., 88 ff. Eine Fülle von Informationen bei Karl-Heinz Christoph, www.ostrentner.de. Anlage 2 Nr. 4 AAÜG. Anlage 7 letzter Satz AAÜG. Die Anlage 7 wurde mittlerweile aufgehoben.
96
G. Wende rückwärts
das Durchschnittsentgelt (Anl. 5 AAÜG) nicht mehr als das 1,4fache35 übersteigt. Übertraf das individuelle Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen das Durchschnittsentgelt um mehr als das 1,4fache, aber nicht mehr als das 1,6fache, wurde der Versorgungsberechtigte so behandelt, als ob er 140 v.H. des Durchschnittsentgelts (Anl. 4 AAÜG36) bezog. Verdiente der Versorgungsberechtigte mehr als 160 v.H. des Durchschnittsentgelts (Anl. 8 AAÜG37), so wurden ihm nicht einmal 140 v.H. des Durchschnittsentgelts gutgebracht. Vielmehr wurde das anzurechnende Entgelt degressiv unter diesen Betrag, maximal jedoch bis zur Höhe des Durchschnittsverdienstes (Anl. 5 AAÜG) abgesenkt. Dabei betrug die Degression das Doppelte des Mehrverdienstes mit der Folge, dass bei einem Individualentgelt von 165 v.H. des Durchschnittsentgelts der anzurechnende Betrag um (2x5 v.H.=)10 v.H. auf 130 v.H. des Durchschnittsentgelts, bei einem Individualentgelt von 170 v.H. des Durchschnittsentgelts auf 120 v.H. des Durchschnittsentgelts und bei einem Individualentgelt von 180 v.H. (und mehr) auf 100 v.H. des Durchschnittsentgelts gesenkt wurde. Demgegenüber hatte das AAÜG in seiner ursprünglichen Fassung (Dezember 1991) sogar eine Absenkung des erzielten Arbeitsentgelts/Arbeitseinkommens auf die Beträge nach Anl. 5 AAÜG (Durchschnittsverdienst) vorgesehen, sofern die Versorgungsberechtigten während der bereichsspezifischen Zugehörigkeit zu den entsprechenden Versorgungssystemen eine „leitende Funktion“, eine Tätigkeit als Richter oder Staatsanwalt oder eine solche in einer „Berufungs- oder Wahlfunktion im Staatsapparat“38 ausübten. Dabei galt kraft der unwiderlegbaren Vermutung39 des § 6 Abs. 2 Satz 3 AAÜG a.F. eine Funktion immer dann als leitend, „wenn in ihr ein Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen über dem jeweiligen Betrag der Anl. 4 bezogen wurde“. Während diesen Personengruppen anfangs ohne Rücksicht auf ihr individuelles Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen nur der Durchschnittswert nach Anl. 5 AAÜG angerechnet wurde, ist ihnen aufgrund einer Gesetzesnovellierung40 nunmehr ein Entgelt bis höchstens 140 v.H. des Durchschnittsverdienstes gutgebracht, sofern ihr individuelles Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen nicht mehr als 160 v.H. des Durchschnittsverdienstes betrug.
35 Wie es in der Tabelle der Anl. 4 AAÜG niedergelegt war. Anl. 4 ist mittlerweile aufgehoben worden. 36 Anl. 4 AAÜG ist mittlerweile aufgehoben worden. 37 Anl. 8 AAÜG ist mittlerweile aufgehoben worden. 38 Das galt auch dann, wenn für Zeiten einer Tätigkeit in einer Berufungs- und Wahlfunktion eine Zugehörigkeit zu einem anderen Zusatz- oder Sonderversorgungssystem bestand. 39 Vgl. hierzu Hans Schneider, Gesetzgebung, 2. Aufl., 1991, Rn. 366. 40 Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (Rü-ErgG) vom 24. 6. 1993 (BGBl. I S. 1038), das rückwirkend zum 1. 8. 1991 in Kraft trat.
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch
97
§ 6 Abs. 2 AAÜG i.V.m. seinen Anlagen 4 und 8 in seiner ursprünglichen Fassung ist durch das Urteil des BVerfG vom 28. 4. 199941 gegenstandslos geworden. bb) „Staatsnahe“ Tätigkeiten Dieselbe Begrenzung galt für eine Gruppe, die nicht nach bereichsspezifischen, sondern allein nach funktionsspezifischen Merkmalen abgegrenzt wurde.42 Unabhängig von dem zuständigen Versicherungssystem traf § 6 Abs. 3 AAÜG Ausnahmeregelungen für nachfolgende Tätigkeiten als – Betriebsdirektor, soweit diese Funktion nicht in einem Betrieb ausgeübt wurde, der vor 1972 in dessen Eigentum stand; – Fachdirektor eines Kombinats auf Leitungsebene oder einer staatlich geleiteten Wirtschaftsorganisation; – Direktor oder Leiter auf dem Gebiet der Kaderarbeit; – Sicherheitsbeauftragter oder Inhaber einer entsprechenden Funktion, sofern sich diese Tätigkeit nicht auf die technische Überwachung oder die Einhaltung von Vorschriften des Arbeitsschutzes in den Betrieben und Einrichtungen des Beitrittsgebiets bezog; – hauptamtlicher Parteisekretär; – Professor oder Dozent in einer Bildungseinrichtung einer Partei oder der Gewerkschaft FDGB; – Richter oder Staatsanwalt; – Inhaber einer hauptamtlichen Wahlfunktion auf der Ebene der Kreise, Städte, Stadtbezirke oder Gemeinden im Staatsapparat oder in einer Partei sowie Inhaber einer oberhalb dieser Ebene im Staatsapparat oder in einer Partei ausgeübten hauptamtlichen oder ehrenamtlichen Berufungs- oder Wahlfunktion. Auch für diese Gruppe war als Verdienst das erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen nur dann zugrunde gelegt worden, wenn es 140 v.H. des Durchschnittsentgelts überstieg. Bei Überschreitung dieser Grenze bis höchstens zu 160 v.H. des Durchschnittsentgelts wurde das zu berücksichtigende Einkommen auf 140 v.H. des Durchschnittsentgelts abgesenkt. Bei einem darüber hinausgehenden Verdienst wurde der zu berücksichtigende Betrag wieder degressiv, maximal bis zur Höhe des Durchschnittsentgelts verringert. Die ursprünglich funktionsspezifische Ausnahme für Direktoren oder Leiter einer pädagogischen Einrichtung im Bereich der Volks- und Berufsbildung mit Ausnahme von Einrichtungen für Behinderte (§ 6 Abs. 3 Satz 3 Nr. 6 AAÜG a.F.) war in der 41
BVerfGE 100, 59 – Staats- und Systemnähe. Vgl. auch A. Reimann, Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der ehemaligen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung, in: DAngVers. 1991, S. 281, 289 l. Sp. 42
98
G. Wende rückwärts
Neufassung des § 6 Abs.3 AAÜG (durch Art. 3 Nr. 3 Buchst. a) Rü-ErgG) nicht mehr enthalten. § 6 Abs. 3 AAÜG ist durch Urteil des BVerfG vom 28. 4. 1999 aufgehoben worden.43 cc) Ausnahme-Exemtionen Von den bereichs- und funktionsspezifischen Ausnahmeregelungen in § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG wurden wiederum Ausnahmen für bestimmte Personengruppen gemacht, die trotz ihrer Zugehörigkeit zu „staatsnahen“ Versorgungssystemen auf Grund ihrer Funktion (z. B. als Angehörige der Berufsfeuerwehr) weniger „belastet“ erscheinen und daher im Ergebnis weniger „privilegiert“ seien. Für diesen im einzelnen abgegrenzten Personenkreis traf § 6 Abs. 4 AAÜG in Verbindung mit dessen Anlage 7 eine Sonderregelung. Es handelte sich um hauptamtliche Mitarbeiter – von Banken, Sparkassen, Versicherungen, der Sozialversicherung sowie des Feriendienstes für Zeiten der Zugehörigkeit zu einem Zusatzversorgungssystem nach Anlage 1 Nr. 19 oder 22; – des Blinden- und Sehschwachenverbandes; – des Bundes der Architekten; – des Deutschen Roten Kreuzes; – des Gehörlosen- und Schwerhörigenverbandes; – der Kammer der Technik; – des Kulturbundes; – der Volkssolidarität; – der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Veterinärmedizin; – der Agrarwissenschaftlichen Gesellschaft. Darüber hinaus wurden Angehörige der Berufsfeuerwehr für Zeiten ihrer Zugehörigkeit zu dem Sonderversorgungssystem nach Anlage 2 Nr. 2 erfasst. Wegen der bereichsspezifischen Sonderregelungen in § 6 Abs. 2 AAÜG wäre für diese Personengruppe eigentlich nur der Verdienst höchstens bis zum jeweiligen Betrag nach Anlage 4 AAÜG, d. h. bis zu 140 v.H. des Durchschnittsentgelts, zugrunde zu legen. Durch die Ausnahme-Exemtion verblieb es nun bei der Grundregel des § 6 Abs. 1 Satz 1 AAÜG, d. h. bei Berücksichtigung des individuellen Arbeitsentgelts bis zur Höhe der Beitragsbemessungsgrenze. Auch § 6 Abs. 4 AAÜG mit seiner Anlage 4 hat – ebenso wie § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG mit Anlage 7 und 8 – nicht lange überdauert. Abgesehen von dem nach nur speziellem Studium durchschaubaren Gesetzesgeflecht musste sich schon jedem Laien die Annahme als unwahrscheinlich auf43
BVerfGE 100, 59 – Staats- und Systemnähe.
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch
99
drängen, dass große Teile der DDR-Bevölkerung überhöhte oder ungerechtfertigte Entgelte für Arbeiten, die sie tatsächlich geleistet hatten, bezogen hatten, und das bei der aus westdeutscher Sicht eingeschätzten Armut des Staates. dd) Versorgungssystem des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit Die empfindlichste Beschränkung des zu berücksichtigenden Entgelts erfolgte bei der Zugehörigkeit zu dem Versorgungssystem des Ministeriums für Staatssicherheit/ Amtes für Nationale Sicherheit. Das Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen wurde bis höchstens 70 v.H. des Durchschnittsentgelts berücksichtigt, wie es in den Beträgen der Anlage 6 AAÜG niedergelegt ist (§ 7 Abs. 1 Satz 1 AAÜG a.F.). Zudem bestimmte § 7 Abs. 1 Satz 3 AAÜG a.F.,44 dass rentenversicherungsrechtliche Vorschriften über Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt nicht anzuwenden sind, so dass es auf jeden Fall bei der 70 v.H. - Begrenzung blieb und diese nicht durch eine rentenrechtliche Höherbewertung im Rahmen der Rente nach Mindesteinkommen gemildert wurde.45 Ursprünglich war in dem Gesetzentwurf sogar eine Höchstbegrenzung auf 65 v.H. des Durchschnittsverdienstes vorgesehen.46 Die 70 v.H. - Begrenzung galt aufgrund der Novellierung des RÜG auch dann, wenn während einer verdeckten Tätigkeit als hauptamtlicher Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit eine Zugehörigkeit zu dem Sonderversorgungssystem nach Anlage 2 Nr. 4 AAÜG nicht bestand (§ 7 Abs. 1 Satz 2 AAÜG a.F.). Das Bundesverfassungsgericht hat durch das Urteil vom 28. 4. 1999 – 1 BvL 11/94 -47 § 7 Abs. 1 Satz 1 (in Verbindung mit Anlage 6) AAÜG (BGBl. I S. 1606, 1677) i. d. F. des Gesetzes zur Änderung des RÜG (RüG-ÄndG) vom 18. 12. 1991 (BGBl. I S. 2207) als mit Art. 3 Abs. 1 und 14 GG unvereinbar für nichtig erklärt, soweit für die Rentenberechnung das zugrunde zu legende Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen und das jeweilige Durchschnittsentgelt im Beitrittsgebiet abgesenkt wird. § 7 Abs. 1 Satz 1 und 2 AAÜG in der gegenwärtig geltenden Fassung bestimmt nunmehr, dass das bis zum 17. 3. 1990 maßgebende Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen bis zum jeweiligen Jahreshöchstverdienst der Anlage 6 AAÜG zugrunde gelegt wird. b) Begrenzung der Rentenzahlbeträge § 10 Abs. 1 Satz 1 AAÜG begrenzt die Summe der Zahlbeträge aus gleichartigen Renten der Rentenversicherung und Leistungen der Zusatzversorgungssysteme nach 44
In der Fassung von Nr. 3 des RÜG-ÄndG vom 18. 12. 1991 (BGBl. I S. 2207). Vgl. auch A. Reimann, Überführung …, in: DAngVers. 1991, S. 289 r.Sp. 46 § 7 i.V. mit Art. 4 des Gesetzentwurfs eines Renten-Überleitungsgesetzes vom 11. 4. 1991 – BT-Drs. 197/91 vom 11. 4. 1991 – sowie Amtliche Begründung zu § 7, S. 147. 47 BVerfGE 100, 138; BGBl. I S. 944. 45
100
G. Wende rückwärts
Anlage 1 Nr. 2, 3 oder 19 bis 27 sowie die Zahlbeträge der Leistungen der Sonderversorgungssysteme nach Anlage 2 Nr. 1 bis 348 (einschl. des Ehegattenzuschlags) für Versichertenrenten auf 2010 DM.49 In Abweichung hiervon limitiert § 10 Abs. 2 AAÜG die Zahlbeträge der Leistungen des Sonderversorgungssystems des MfS/AfNS für Versichertenrenten auf 802 DM.50 Für die Summe der Zahlbeträge aus gleichartigen Renten der Rentenversicherung und Leistungen aus den übrigen Zusatzversorgungssystemen nach Anlage 1 oder 4 bis 18 sah § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG51 für die Zeit ab 1. 8. 1991 für Versichertenrenten52 einen Höchstbetrag von 2700 DM vor.53 Die Begrenzung von Zahlbeträgen wird zwar in der Paragraphenüberschrift als „vorläufig“ ausgewiesen, ohne dass dies im Gesetzestext selbst zum Ausdruck kommt. Das Bundesverfassungsgericht hat die Regelung des § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG über die vorläufige Zahlbetragsbegrenzung wegen Verstoßes gegen Art. 14 Abs. 1 GG für nichtig erklärt.54 3. Das Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz (Rü-ErgG) von 1993 Das AAÜG 1991 erfuhr durch Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz vom 24. 6. 1993,55 das rückwirkend zum 1. 8. 1991 in Kraft trat, gewichtige Änderungen. Die Regelungen über die pauschalen Begrenzungen des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens für „systemnahe“ Beschäftigte nach § 6 Abs. 2 bis 4 AAÜG wurden in größerem Umfang reduziert bzw. modifiziert und durch eine dreifach unterteilte Beurteilung ersetzt. Bei einem Arbeitsentgelt zwischen dem 1,4fachen und 1,6fachen des Durchschnittsentgelts wurde nunmehr der der Rentenberechnung zugrunde liegende Verdienst auf das 1,4fache begrenzt. Bei Arbeitsentgelten über dem 1,6fachen des Durchschnittsentgelts wurde der das 1,6fache übersteigende Anteil verdoppelt und vom 1,4fachen Durchschnittsentgelt abgezogen. Mindestens das Durchschnittsentgelt jedoch war bei allen Begrenzungen 48
Oder die Summe der Zahlbeträge der Leistungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AAÜG. Entsprechend geringer sind die Witwen- oder Witwerrenten (DM 1206), die Vollwaisenrenten (DM 804) und die Halbwaisenrenten (DM 603). 50 Der Höchstbetrag für Witwen- und Witwerrenten beläuft sich auf DM 481, für Vollwaisenrenten auf DM 321 und für Halbwaisenrenten auf DM 241. 51 Angefügt durch Art. 3 Nr. 6 a) bb) Rü-ErgG vom 24. 6. 1993 (BGBl. I S. 1038). 52 Der Höchstbetrag für Witwen- oder Witwerrenten beträgt DM 1620. – Für Voll- und Halbwaisenrenten ist – anders als in § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 AAÜG – kein Höchstbetrag ausgewiesen. 53 § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG ist mittlerweile wieder gestrichen worden. 54 BVerfG, Urt. vom 28. 4. 1999 – 1 BvL 32/95, 1 BvR 2105/95 – BVerfGE 100, 1 – Zahlbetragsgarantie. 55 Gesetz zur Ergänzung der Rentenüberleitung (Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz – Rü-ErgG) vom 24. 6. 1993 (BGBl. I S. 1038). 49
I. Bundesgesetzgebung I: Systembruch
101
anzurechnen. Einzelheiten können der Darstellung unter Abschnitt G. I. 2. a) entnommen werden.56 Die Regelungen des § 6 Abs. 2 bis 4 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG von 1993 wurden jedoch durch das 2. AAÜG-Änderungsgesetz vom 27. 7. 2001 (BGBl. I S. 1939) wieder aufgehoben, nachdem das Bundesverfassungsgericht durch Urteil vom 28. 4. 1999 entschieden hatte, dass § 6 Abs. 2 (i.V. mit den Anlagen 4, 5 und 8) und § 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG von 1993 seit dem 1. 7. 1993 mit Art. 3 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG unvereinbar ist, und den Gesetzgeber verpflichtet hatte, bis zum 30. 6. 2001 eine ordnungsgemäße Regelung zu treffen.57 Das Gericht sah insbesondere keine ausreichende Begründung für die Ungleichbehandlung von Personen, die unterschiedlichen Versorgungssystemen angehörten. Auch der Grenzwert in Höhe des 1,4fachen Durchschnittsentgelts wurde als willkürlicher, ohne Tatsachenunterlegung gewählter Wert abgelehnt. Das BVerfG mahnte damit weitgehend eine begründete Einzelfallentscheidung für Begrenzungen an.58 Bis zum 30. 6. 1993 sei das Gesetz verfassungskonform, da dem Gesetzgeber bis zu diesem Zeitpunkt ein größerer Ermessensspielraum bei der Einordnung von Personen in die Kategorien derjenigen, deren Entgelte aus politischen Gründen gezahlt seien, eingeräumt werden müsse.59 Das Gericht hielt durchaus für möglich, die Zugehörigkeit zu bestimmten Personen- oder Beschäftigungsgruppen als Indiz für eine „Systemnähe“ zugrunde zu legen. Dass der Gesetzgeber in einem solchen Fall den Weg der Entgeltbegrenzung geht, hielt das BVerfG generell für verfassungskonform.60 Hierzu kann grundsätzlich eingewendet werden, dass das Merkmal „Systemnähe“ kein Abgrenzungsmerkmal sein kann. Denn jeder DDR-Bürger war vom Staats- und Regierungssystem erfasst, diesem verantwortlich, konnte sich diesem nicht entziehen, es sei denn durch Flucht. Jede Person des öffentlichen Lebens oder in einem öffentlichen Amt, so z. B. Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, etc. war kraft Gesetzes zur Zusammenarbeit mit den Staatsorganen verpflichtet. Auch Personen der Kirche in herausgehobener Stellung (so Manfred Stolpe) konnten sich dem nicht entziehen. Eine Abgrenzung nach „Systemnähe“ oder „Systemferne“ mit dazwischen liegenden Abstufungen ließ sich in der Realität gar nicht vornehmen. Weiter enthielt die Bestimmung über die vorläufige Zahlbetragsbegrenzung in § 10 AAÜG teilweise durch Art. 3 Nr. 6 Rü-ErgG eine Neufassung.61 Auch hierzu wurde § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG 1993 durch das 2. AAÜG56 57 58 59 60 61
Vgl. auch BVerfGE 100, 59 [68 – 72] – Staats- und Systemnähe. BVerfGE 100, 59 [60]. Ebd., S. 90 ff. Ebd., S. 90, 101 ff. Ebd., S. 92 f. Hierzu auch BVerfGE 100, 1 [16 – 18].
102
G. Wende rückwärts
Änderungsgesetz vom 27. 7. 2001 aufgehoben, nachdem das BVerfG durch Urteil vom 28. 4. 1999 entschieden hatte, dass § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG wegen Verstoßes gegen Art. 14 Abs. 1 GG nichtig ist.62
II. Gesetzliche Novation: eine sozialversicherungsfremde Rechtsfigur Die Bezeichnung „Überleitung“ im Renten-Überleitungsgesetz (RÜG) ist ein Etikettenschwindel. Mit dem RÜG (AAÜG) haben die DDR-Bürger ihre alten Renten verloren. Ihnen wurden nur noch mindere Rechte aus dem SGB VI gewährt, das über Jahrzehnte echt rückwirkend auf abgeschlossene Lebensläufe und beschränkt auf eine besondere Beitragsbemessungsgrenze angewandt wird. 1. Gesetzliche Novation Das Bundessozialgericht (BSG) hat mit zum Teil grotesken Gründen die Durchbrechung des Normprogrammes63 der Staatsverträge durch das RÜG gebilligt64 und dazu die begriffliche Neuschöpfung „der gesetzlichen Novation“ eingeführt, die es im Sozialversicherungsrecht der Bundesrepublik bislang nicht gab und an die Stelle der Renten- und Versorgungsüberleitung gesetzt worden ist.65 Die Novation ist dessen Bezeichnung für die „Ersetzung“ aller rechtmäßig erworbenen Ansprüche und Anwartschaften. Das BSG ist in seiner Argumentation selbst widersprüchlich. Ansprüche aus der DDR haben – zumindest bis zum 31. 12. 1991 für alle Bestandsrentner – zunächst weiter bestanden, was das BSG auch anerkannt hat. Die Ansprüche sind demgegenüber nicht sang- und klanglos untergegangen, wie an anderer Stelle vom BSG dargelegt wurde. Bei einem Untergang der Ansprüche wäre logisch auch keine Novation möglich, denn Novation heißt nichts anderes, als dass bestehende Ansprüche durch anders geartete Ansprüche ersetzt werden. Die Rechtsfigur der Novation würde nicht gebraucht, wenn das BSG es mit dem „Untergang“ ernst meinen würde. Das wäre nämlich dann der an anderen Stellen vom BSG in Anspruch genommene Fall des Untergangs der Rechte/Ansprüche und der von Papier beschriebenen „Rechtsgewährung“.66 Die „gesetzliche Novation“ mit ihrem aus dem Bürgerlichen Recht (§ 305 BGB) stammenden Inhalt widerspricht in ihrem Wesen und mit ihrer rechtlichen Konse62
BVerfGE 100, 1. D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 49. 64 Ausführliche Kritik und Auseinandersetzung mit der Rspr. des BSG bei K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 166 – 170. 65 BSG, Urt. vom 31. 7. 1997 – 4 RA 35/97. 66 Vgl. zu allem K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 170 f.; zur „Rechtsgewährung“ vgl. H.-J. Papier, Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, 1994, S. 110. 63
II. Gesetzliche Novation
103
quenz allem, was der Einigungsvertrag mit Art. 19, Art. 18 oder dem durch den Einigungsvertrag eingefügten Art. 232 § 1 EGBGB (Anlage I Kap. III Abschn. II Nr. 1) zum Schutz der Rechte ehemaliger DDR-Bürger gewährleisten soll. Denn – „bei der … Novation wird ein bestehendes Schuldverhältnis vertraglich durch ein neues ersetzt. Der Unterschied zum Aufhebungsvertrag besteht darin, dass nicht nur das alte Schuldverhältnis beseitigt, sondern gleichzeitig ein neues begründet wird. Vom Abänderungsvertrag unterscheidet sich die Novation dadurch, dass das bisherige Schuldverhältnis erlischt. (…) – Zentrale Rechtsfolge einer Novation ist das Erlöschen des bisherigen Schuldverhältnisses. Damit erlöschen auch bestehende Sicherheiten. (…) – Ob im Einzelfall eine Novation gewollt ist oder ob das alte Schuldverhältnis nur abgeändert werden sollte, muss sich aus einer Auslegung der Vereinbarung ergeben. In der Regel kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Parteien das bisherige Schuldverhältnis wegfallen lassen wollen.“67 An anderer Stelle wird der Charakter der Novation im selben Sinne erläutert. Zu der schon im Schuldrecht einschränkenden Anwendung der Novation heißt es: „Eine Novation darf wegen ihrer weitreichenden Folgen nur bejaht werden, wenn der auf Schuldumschaffung gerichtete Wille der Parteien deutlich hervortritt (BGH NJW 1986, S. 1490).“68
2. Wende rückwärts „Die in der DDR entstandenen und im Beitrittsgebiet bis zum 31. 12. 1991 kraft (partiellen) Bundesrechts der Art nach aufrechterhaltenen Systeme der Sozialversicherung, der FZR, der Zusatzversorgungssysteme und der Sonderversorgungen wurden also ab 1. 1. 1992“, so das BSG, „durch ein für die ganze Bundesrepublik Deutschland einheitliches Rentenversicherungssystem ersetzt, das von der DDR schichtenspezifisch gegliederte Versorgungsgefüge wurde abgeschafft.“69 Die Annahmen des BSG sind irreführend.70 Erstens: Es gab in der DDR kein „schichtenspezifisch gegliedertes Versorgungsgefüge“. Es gab vielmehr – abgesehen von den vier Gesamtversorgungssystemen – eine einheitliche, alle Beschäftigten in der DDR erfassende Sozialversicherung und zu ihrer Ergänzung (zur Ergänzung der Mindestsicherung) auf dem Gebiet der Alterssicherung mehrere Versorgungssysteme (zum Zwecke des Lohnersatzes), die unmittelbar vergleichbar sind mit entsprechenden Versorgungssystemen in der alten Bundesrepublik Deutschland.71 Die DDR-Systeme waren aber viel 67 68 69 70 71
Münchener Rechts-Lexikon, 1987, Stichwort: Novation. Palandt, BGB, Komm., 57. Aufl., § 305 Anm. 8. BSG, Urt. vom 31. 7. 1997 – 4 RA 35/97 -, S. 8. K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 167 f. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 121 ff.
104
G. Wende rückwärts
einfacher und insgesamt überschaubarer als letztere, zu denen u. a. das allein schon komplizierte SGB VI (in dem Regelungsziel vergleichbar mit der Sozialversicherung der DDR), die reichhaltigen Zusatzversorgungssysteme gemäß Betriebsrentengesetz (VBL, Versorgungstarifverträge u. a., vergleichbar mit den Zusatzversorgungssystemen AVI, AVSt, FZV-med.), die berufsständischen Versorgungswerke, die Beamtenversorgung (vergleichbar mit den Gesamtversorgungssystemen der Anlage 2 AAÜG) sowie die unüberschaubaren privaten Renten- und Lebensversicherungen (für die als einziger Vergleich nur die FZR genannt werden kann) u. a.m., gehören. Zweitens: Ein „für die ganze Bundesrepublik Deutschland einheitliches Rentenversicherungssystem“ könnte, selbst wenn es geschaffen worden wäre, die unterschiedlichen Versorgungssysteme der 2. und 3. Säule der Alterssicherung der alten Bundesrepublik ebenso wenig „ersetzen“ wie die unterschiedlichen – wesentlich schmaleren Versorgungssysteme, die es in der DDR gab: Ansprüche aus der 1. Säule der Alterssicherung, d. h. der gesetzlichen Rentenversicherung, auf die die Alterssicherung ehemaliger DDR-Bürger geschrumpft ist, können schon von der Logik her Versorgungsaufgaben aus der 2. Säule (Zusatz- und Gesamtversorgungssysteme) und der 3. Säule (FZR, Eigenvorsorge) nicht „ersetzen“. Erklärt man es trotzdem, führt man die Betroffenen in die Irre, denen die Ansprüche aus der 2. und 3. Säule ersatzlos verloren gehen. Drittens: Ein „für die ganze Bundesrepublik einheitliches Rentensicherungssystem“ gibt es nicht. Es könnte unter Berücksichtigung der Anforderungen des Art. 3 GG nur unter einheitlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden, da Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt werden muss. Bei der Rentenund Versorgungsüberleitung hingegen wird Gleiches ungleich und Ungleiches gleich behandelt. – Für die beigetretenen Bürger gibt es für Erwerbszeiten aus der DDR kein vergleichbares Umfeld für eine neue 2. und 3. Säule der Alterssicherung. Diese beiden tragenden Säulen der Alterssicherung Ost wurden abgeschafft. Es fehlen also Rahmenbedingungen für die Erfüllung der Versorgungsaufgaben für die Bürger in Ost und West. Isolierte Teilergebnisse führen zu falschen Ergebnissen.72 – Für die beigetretenen Bürger gilt gem. § 256 a SGB VI für die Anspruchserwerbszeiten ab dem 1. 7. 1971 eine besondere Beitragsbemessungsgrenze (Ost), die viel niedriger ist als die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (West). Es besteht also in wesentlichen Rechtsfragen kein einheitliches Rentenrecht.73 – Die beigetretenen Bürger mussten sich in ihrem Arbeitsleben in der DDR auf andere tatsächliche und rechtliche Konsequenzen beim Erwerb von Ansprüchen und Anwartschaften einstellen. Sie sind nicht in der Lage, sich nachträglich auf die anderen Anforderungen des für sie neuen Rechts, des SGB VI, einzustellen.
72 73
Hierzu K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 73 ff. Hierzu D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 105 f., 110 ff., 121 f., 124 f., 129.
III. Erneute Teilung nach der „Einigung“
105
Dadurch entstehen eminente Benachteiligungen gegenüber den alten Bundesbürgern.74
III. Erneute Teilung nach der „Einigung“ Die Entscheidungen der bundesrepublikanischen Legislative, Exekutive und Judikative zur Renten- und Versorgungsüberleitung, v. a. die Nichtberücksichtigung der in der Sozialversicherung der DDR erworbenen Rechte und das Programm des Renten-Überleitungsgesetzes nach dem Beitritt der DDR führen nicht zur Angleichung, sondern zur Teilung der Alterssicherung und -vorsorge, indem sie bewirken, dass – die in einem Teil Deutschlands, in der SBZ bzw. der DDR seit 1945 regelmäßig auf Renten erworbenen Rechte und Ansprüche als liquidiert angesehen werden, sei es durch den Untergang der Rechte und Ansprüche – wie es das BVerfG für die bbZ befunden hat75 – oder durch die sogenannte Novation, während in den alten Ländern der Bundesrepublik die in derselben Zeit erworbenen Ansprüche unangetastet weiter bestehen. – durch die schematische, über ca. 50 Jahre auf einen beruflichen Lebenslauf echt rückwirkende Anwendung der Regelungen des – angeblich – für Ost und West einheitlichen Rentenrechts der gesetzlichen Rentenversicherung DDR-Bürger ungleich behandelt werden gegenüber den beruflich und in ihrem Lebenslauf vergleichbaren Bürgern mit Alterssicherungsansprüchen aus den alten Ländern. Um diese beiden unterschiedlichen Gruppen von Bürgern hinsichtlich ihrer Alterssicherungsansprüche in etwa gleichzustellen und behandeln zu können, müssten die Vorschriften der GRV für diese beiden Gruppen nicht gleich, sondern vielmehr unterschiedlich sein, die abweichenden Verhältnisse in der DDR umfassend berücksichtigen und den Betroffenen die Möglichkeit bieten, sich auf die neue Situation dauerhaft einzustellen und gravierende Schlechterstellungen (u. a. Verlust z. B. wesentlicher rentenrechtlicher Zeiten) ausschließen zu können. – dadurch eine Diskriminierung erfolgt, dass die über die Grundrente aus der GRV hinausgehenden Zusatzversorgungsansprüche nicht anerkannt werden, weil sie in der DDR erworben wurden, im Unterschied zu den Bürgern der alten Länder durch rückwirkende Festlegung jegliche Ansprüche auf eine zusätzliche Altersversorgung (Bestand, Anpassung, Dynamisierung) genommen werden. In entsprechende Ansprüche und Anwartschaften der beruflich etc. vergleichbaren Bürger der alten Länder wird auch hier nicht eingegriffen. Auch dies trägt dazu bei, dass nicht eine schrittweise Angleichung des Lebensniveaus, sondern vielmehr ab Eintritt in das Rentenalter – entgegen dem Verfassungsgebot und der Vorgabe des 74 Zur Verfassungswidrigkeit rückwirkender Gesetze vgl. nur BVerfG 13, 261 [271 f.]; K.H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 308 f. 75 BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95 u. a. – Balletttänzer.
106
G. Wende rückwärts
Einigungsvertrages – eine weitere Vertiefung der Einkommens- und Vermögensunterschiede zu Ungunsten der beigetretenen Bürger erfolgt. – jeder aus der DDR kommende Betroffene sachwidrig ungleich behandelt wird im Vergleich zu Berufskollegen aus den alten Ländern, nur einen Bruchteil des Alterseinkommens der Vergleichspartner erhält und eine allmähliche Angleichung für ihn unerreichbar ist. – ein Betroffener willkürlich gleich behandelt wird zu Bürgern aus dem Beitrittsgebiet, denen bei anderem Einkommen, anderer Lebensleistung und anderen Ansprüchen aus der DDR gleiche Rentenansprüche zuerkannt werden, soweit deren Einkommen bei oder über der für 45 Jahre rückwirkend neu eingeführten Beitragsbemessungsgrenze liegt und sie über eine gleich hohe Anzahl von Arbeitsjahren verfügen: Alle erhalten die gleichen Einheitsrentenanteile, die dauerhaft das maximale Alterseinkommen der Bürger im Beitrittsgebiet begrenzen, die einen spürbaren Teil der Alterssicherungsansprüche bzw. -anwartschaften in der DDR erworben haben und vor ca. 2030 in das Rentenalter eintreten.76 – ein betroffener Bestands- oder Zugangsrentner sachwidrig ungleich behandelt wird im Vergleich zu Bürgern aus dem Beitrittsgebiet, die sich im Arbeitsverhältnis befinden und deren gesamtes Arbeitseinkommen seit dem 1. 7. 1990 schrittweise an die neuen wirtschaftlichen Verhältnisse angepasst wird, während die entsprechende Anpassung des Arbeitsersatzeinkommens der Rentner, das aus den Renten der Sozialversicherung der DDR bzw. der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) und aus einem zusätzlichen Versorgungssystem bzw. aus der FZR besteht, nicht oder zumindest nicht dauerhaft erfolgt: Die Ansprüche aus der Zusatzversorgung bzw. aus der FZR wurden als über die Grundrente hinausgehende Ansprüche vielmehr liquidiert. – ein betroffener Zugangsrentner mit Ansprüchen aus der Sozialversicherung der DDR, der AVI oder ähnlichen Versorgungssystemen oder der FZR willkürlich ungleich behandelt wird im Vergleich zu Berufskollegen aus den neuen Ländern, die Bestandsrentner waren bzw. die bis zum 31. 12. 1993 Rente erlangten. Dem Erstgenannten wird im diskriminierenden Unterschied zu diesen Berufskollegen, die zumindest den Zahlbetrag weiter erhielten oder erhalten, der ihnen am 30. 6. 1990 bzw. 31. 7. 1991 zustand, nicht einmal dieser geringfügige Bestandsschutz gewährt. Mit dem Beitritt der DDR sind die beiden Teilstaaten zu einem Gesamtstaat zusammengewachsen. Dann ist allein schon in der Parallelwertung der Laiensphäre unverständlich, weshalb rechtmäßig in der DDR entstandene Anwartschaften und Ansprüche, d. h. Rechte nicht unter den Schutz der Gesamtverfassung fallen sollen, mögen sie auch zu einem Zeitpunkt entstanden sein, als das Grundgesetz im Bei-
76
Hierzu D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 121 ff.
III. Erneute Teilung nach der „Einigung“
107
trittsgebiet suspendiert war. Das Grundgesetz soll die Verfassung aller Deutschen sein, und die DDR-Bürger waren Deutsche vor dem Beitritt.77 Der Bundesgesetzgeber hat nach dem Beitritt nicht die Einigung gefördert, was seine Pflicht war, sondern die Teilung auf dem Gebiet der Altersvorsorge bewirkt, die Grenze der Sozialstaatlichkeit partiell gegen Ost gezogen.78
77 Zur „personalen Geltung der Grundrechte” vgl. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 72 ff. 78 W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 110.
H. Ein Schritt vorwärts: Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999 Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem (Grundsatz-)Urteil vom 28. 4. 19991 abweichende Maßstäbe gesetzt und ist wieder auf dem Einigungsvertrag zurückgekommen. Da die nachfolgende spätere Besetzung des Gerichts diese Maßstäbe wieder unterlaufen hat, ist es zum Verständnis von Interesse, weite Passagen des Urteils wiederzugeben.
I. Verletzung des Eigentumsgrundrechts Wörtlich heißt es hierzu: „Die in der Deutschen Demokratischen Republik erworbenen und im Einigungsvertrag nach dessen Maßgaben als Rechtspositionen der gesamtdeutschen Rechtsordnung anerkannten Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen genießen den Schutz des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.“2
Am Beispiel der Berufsgruppe der Balletttänzer lässt sich darstellen, welche Folgerungen das Urteil vom 28. 4. 1999 eigentlich für deren Versorgung haben musste, weil das BVerfG später in anderer Besetzung mit seinen Beschlüssen vom 2. 7. 2002 und 4. 7. 2002 genau das Gegenteil entschieden und jeglichen Eigentumsschutz verweigert hat.3 Durch die „Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR“ von 1976/1983 ist für die Ballettmitglieder ein Zusatzversorgungssystem geschaffen worden, das der Bundesgesetzgeber – wenn auch verspätet, weil er es schlichtweg übersehen hatte – mit dem 1. ÄndG-AAÜG von 1996 als solches anerkannt hat (Anlage Nr. 17 zum AAÜG). Mit § 33 RAG wurde die Fortdauer der Ansprüche auf Zahlung dieser Versorgung und der entsprechenden Anwartschaften angeordnet. Der Einigungsvertrag hat diese Regelung übernommen (Anlage II Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. III Nr. 8). Ungeachtet der Frage, wie Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 6 Buchst. a) zum EV zu interpretieren ist, steht fest, dass der Einigungsvertrag 1
1 BvL 32/95, 1 BvR 2105/95 – BVerfGE 100, 1. BVerfGE 100, 1 [Erster Leitsatz], und 32. 3 1 BvR 2544/95, 1994/97, 2270/00, in: NJ 11/2002, S. 586 f., und 1 BvR 2052/98 (nicht veröffentlicht). 2
I. Verletzung des Eigentumsgrundrechts
109
diese Ansprüche und Anwartschaften als Rechtspositionen gewahrt hat und diese nach seiner Maßgabe in die gesamtdeutsche Rechtsordnung eingebracht hat. Die bbZ wurde auch bis zum 31. 12. 1991 unter Anerkennung des Anspruchs gezahlt, und auch Anwartschaften liefen bis dahin auf. Das Bundesverfassungsgericht in seinem Grundsatzurteil weiter: „Wie das Bundesverfassungsgericht seit seinem Urteil vom 28. 2. 1980 (BVerfGE 53, S. 257 [289 ff.] in ständiger Rechtsprechung annimmt, erfüllen die gesetzlich begründeten rentenversicherungsrechtlichen Positionen eine soziale Funktion, deren Schutz gerade Aufgabe der Eigentumsgarantie ist, und weisen auch die konstitutiven Merkmale des Eigentums im Sinne von Art. 14 GG auf. Der Eigentumsgarantie kommt im Gesamtgefüge der Grundrechte die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm dadurch eine eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens zu ermöglichen. In der modernen Gesellschaft erlangt der Großteil der Bevölkerung seine wirtschaftliche Existenzsicherung weniger durch privates Sachvermögen als durch den Arbeitsvertrag und die daran anknüpfende, solidarisch getragene Altersversorgung, die historisch von jeher eng mit dem Eigentumsgedanken verknüpft war. Insoweit sind die Anrechte des Einzelnen auf Leistungen der Rentenversicherung an die Stelle privater Vorsorge und Sicherung getreten und verlangen daher denselben Grundrechtsschutz, der dieser zukommt. Rentenansprüche und Anwartschaften tragen als vermögenswerte Güter auch die wesentlichen Merkmale verfassungsrechtlich geschützten Eigentums. Sie sind dem privaten Rechtsträger ausschließlich zugeordnet und zu seinem persönlichen Nutzen bestimmt. Auch kann er im Rahmen der rechtlichen Ausgestaltung wie ein Eigentümer darüber verfügen. Ihr Umfang wird durch die persönliche Leistung des Versicherten mitbestimmt, wie dies vor allem in den Beitragszahlungen Ausdruck findet. Die Berechtigung steht also im Zusammenhang mit einer eigenen Leistung, die als besonderer Schutzgrund für die Eigentumsposition anerkannt ist. Sie beruht damit nicht allein auf einen Anspruch, den der Staat in Erfüllung einer Fürsorgepflicht einräumt und der mangels einer Leistung des Begünstigten nicht am Eigentumsschutz teilnimmt. Sie dient schließlich auch zur Sicherung seiner Existenz (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [300 f.]; st. Rspr.]).“4
Die Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung der DDR lag bei 600,– M im Monat. Altersrenten wurden nach Erreichen der Altersgrenze und einer mindestens fünfzehnjährigen versicherungspflichtigen Tätigkeit gezahlt. Sie betrugen als Mindestrente je nach Zahl der Arbeitsjahre zuletzt 330,– bis 470, M und konnten höchstens 510,– M erreichen.5 Dies war für Ballettmitglieder auch für DDRVerhältnisse keine ausreichende Alterssicherung. Ihre wirtschaftliche Existenzsicherung konnten sie nicht durch privates Sachvermögen, sondern nur durch den Arbeitsertrag erlangen. Die daran anknüpfende solidarisch getragene Altersversorgung musste durch eine Zusatzversorgung gesichert werden, wie sie durch die Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR von 1976 i. d. F. von 1983 (AO-bbZ) 4 5
BVerfGE 100, S. 1 [32 f.], zu C, I 1 a (kursiv vom Verfasser) D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 12 f.
110
H. Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999
geschaffen wurde. Die bbZ konnte höchstens monatlich 800,– M betragen (§ 2 Abs. 5 AO-bbZ). Den Ballettmitgliedern war es nicht möglich, eine private Eigenvorsorge zu treffen, weil das die soziale Lage der Tänzer in der DDR nicht zuließ, eine dafür in Frage kommende Institution (Versicherung u. ä.) nicht bestand und die Ballettmitglieder ohnehin in staatlichen Einrichtungen der DDR tätig waren. Die Rentenansprüche und -anwartschaften mit ihrer Ergänzung durch Ansprüche und Anwartschaften aufgrund der AO-bbZ, der Zusatzversorgung tragen als vermögenswerte Güter alle wesentlichen Merkmale geschützten Eigentums.6 Sie sind – nach Beendigung der aktiven Karriere – dem Ballettmitglied als privatem Rechtsträger zugeordnet und zu seinem persönlichen Nutzen bestimmt. Die bbZ wurde – auch kraft eines Vertrages – von der Einrichtung gezahlt, zu der das Ballettmitglied bei seinem Ausscheiden aus dem Tänzerberuf im Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis stand (§ 4 Abs. 1 AO-bbZ), und zwar im Auftrag und für Rechnung der staatlichen Behörde. Die bbZ beruht nicht auf einem Anspruch, den der Staat in Erfüllung einer Fürsorgepflicht einräumt.7 „Für die in der Deutschen Demokratischen Republik begründeten und im Zeitpunkt ihres Beitritts zur Bundesrepublik bestehenden Zusatz- und Sonderversorgungssysteme kann im Grunde nichts anderes gelten.“8
Der Anspruch bzw. die Anwartschaft auf Zahlung bestand im Zeitpunkt des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. „Sie nehmen als Rechtspositionen, die der Einigungsvertrag grundsätzlich anerkannt hat, am Schutz des Art. 14 GG teil. Zwar entfaltet Art. 14 GG seine Schutzwirkung nur im Geltungsbereich des Grundgesetzes. Dieser erstreckte sich vor der Vereinigung der beiden deutschen Staaten nicht auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Das Grundgesetz trat dort mit dem Beitritt auch nicht rückwirkend in Kraft. Bis zum Beitritt genossen daher die in der Deutschen Demokratischen Republik erworbenen Rentenansprüche und -anwartschaften nicht den Schutz von Art. 14 Abs. 1 GG. Mit dem Beitritt und der Anerkennung durch den Einigungsvertrag gelangten sie jedoch wie andere vermögenswerte Rechtspositionen in den Schutzbereich dieses Grundrechts (vgl. BVerfGE 91, S. 294 [307 f.]).“9
Die bbZ gelangt wie jede andere vermögenswerte Rechtsposition in den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG. „Im Einigungsvertrag ist bestimmt, dass die in den Versorgungssystemen der Deutschen Demokratischen Republik erworbenen Ansprüche und Anwartschaften ohne Rücksicht auf Grund und Art ihrer Entstehung in das gesamtdeutsche Rechtssystem zu übernehmen und durch weitere Regelungsschritte in die gesetzliche Rentenversicherung zu überführen sind. Zwar sieht der Vertrag vor, dass die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens noch nicht geschlossenen Versorgungssysteme bis zum 31. 12. 1991 zu schließen sind. Dadurch sollen 6 7 8 9
Ebd., S. 70. Ebd., S. 70, mit Hinweis auf BVerfGE 16, 94 [113]; 18, 392 [397]; 53, 257 [292]; 69, 272 [302]. BVerfGE 100, 1 [33], zu C, I 1 b. BVerfGE 100, 1 [33], zu C, I b, aa).
I. Verletzung des Eigentumsgrundrechts
111
jedoch die in diesen Versorgungssystemen erworbenen Ansprüche und Anwartschaften nicht zum Erlöschen gebracht werden. Vielmehr tritt die Bundesrepublik in die nach den Versorgungsordnungen der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme begründeten leistungsrechtlichen Beziehungen grundsätzlich ein (vgl. für andere fortgeführte Rechtsverhältnisse auch BVerfGE 84, S. 133 [147]; 85, S. 360 [373]; 91, S. 294 [309]; 95, S. 267 [305, 306 f.]). Die Versorgungssysteme wurden dementsprechend bis zur Überführung der darin erworbenen Ansprüche und Anwartschaften in die Rentensicherung und bis zur Anpassung an die allgemeinen Regelungen der Sozialversicherung weitergeführt. Verantwortlich für die Erbringung der Leistungen waren bis zu dieser Überführung die jeweiligen Funktionsnachfolger der Versorgungssysteme (Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 Buchst. c EV).“10
Die Bundesrepublik Deutschland ist in die Versorgungsordnung der AO-bbZ als Zusatzversorgungssystem eingetreten. „Die Ansprüche und Anwartschaften, die in den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der Deutschen Demokratischen Republik erworben worden waren, weisen auch die wesentlichen Merkmale des Eigentums im Sinne von Art. 14 GG auf.“11
Dies gilt demgemäß für die Ansprüche und Anwartschaften, die aufgrund der AObbZ erworben wurden. „Sie waren in ähnlicher Weise wie entsprechende Rechtspositionen der westdeutschen gesetzlichen Rentenversicherung den Berechtigten privatnützig zugeordnet und dienten zur Sicherung ihrer Existenz. Auch fehlte es ihnen, wenn man die besonderen Gegebenheiten des Alterssicherungssystems der Deutschen Demokratischen Republik berücksichtigt, nicht an einer nennenswerten Eigenleistung. Nicht nur zur Sozialpflichtversicherung und zur Freiwilligen Zusatzrentenversicherung wurden Beiträge entrichtet. Auch Arbeitnehmer, die Zusatz- und Sonderversorgungssystemen angehören, haben vielfach Beiträge gezahlt, die bis zu 10 vom Hundert der Bruttoentgelte erreichen konnten. Allerdings gilt dies nicht ausnahmslos. Soweit eine Beitragspflicht bestand, waren die Beiträge überdies teilweise niedrig und der zugesagten Versorgungsleistung nicht adäquat. Diese Besonderheiten stehen jedoch der eigentumsrechtlichen Schutzwürdigkeit nicht entgegen.“12
Die Frage der Beitragsleistung spielt demgemäß keine entscheidende Rolle. Auch das nachträglich erlassene AAÜG knüpft nicht an die tatsächlichen Beitragsleistungen, sondern an das erzielte Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen an (§ 6 Abs. 1 AAÜG, § 256 a Abs. 2 SGB VI, Anlage 3 zum AAÜG). „Wie das Bundesverfassungsgericht bereits im Zusammenhang mit westdeutschen sozialversicherungsrechtlichen Positionen hervorgehoben hat, beruht der Eigentumsschutz in diesem Bereich wesentlich darauf, dass die in Betracht kommende Rechtsposition durch die persönliche Arbeitsleistung der Versicherten mitbestimmt ist, die in den einkommensbezogenen Leistungen lediglich einen Ausdruck findet (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [301]). Es hat deshalb nicht nur vom Versicherten selbst gezahlte Beiträge, sondern auch die Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung den eigentumsrelevanten Eigenleistungen 10 11 12
BVerfGE 100, 1 [33 f.], zu C, I 1 b, aa) (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 [34], zu C, I 1 b, bb). BVerfGE 100, 1 [34], zu C, I 1 b bb) (kursiv vom Verfasser).
112
H. Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999
des Arbeitnehmers zugerechnet (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [302]). Der Annahme einer nicht unerheblichen Eigenleistung steht danach nicht von vornherein entgegen, dass eine rentenrechtliche Position – ebenso wie Sachgüter, die mit Hilfe von Subventionen oder Steuererleichterungen erworben wurden – auch oder überwiegend auf staatliche Gewährung zurückgeht, wenn der Versicherte sie jedenfalls als ,seine‘, ihm ausschließlich zustehende Rechtsposition betrachten kann (vgl. BVerfGE 69, S. 272 [301]).“13
Die finanziellen Mittel für die bbZ wurden aus dem Haushalt der staatlichen Organe bereitgestellt, weil es den Ballettmitgliedern angesichts ihres im Verhältnis zu ihren anerkannten Leistungen geringen Verdienstes in keinem Fall zumutbar war, zusätzlich Einkommensanteile abzuführen. Mit der Anerkennung der Berechtigung für die bbZ wurde diese eine ausschließlich dem Tänzer zustehende Rechtsposition. „Im Hinblick auf die besonderen Bedingungen des Alterssicherungs- und Entlohnungssystems der Deutschen Demokratischen Republik kommt daher der Eigentumsschutz auch dann zum Tragen, wenn die Rentenansprüche und -anwartschaften nicht in erster Linie durch Beitragszahlungen, sondern maßgeblich durch Arbeitsleistung erworben wurden. Der erforderliche Zusammenhang zwischen Zusatzversorgung und Arbeitsleistung wurde im Entlohnungssystem der Deutschen Demokratischen Republik auf vielfache Weise hergestellt. In einigen Zusatzversorgungsregelungen war die Bedeutung der beruflichen Leistungen und Arbeitserfolge ausdrücklich hervorgehoben und als Rechtfertigung für die Höhe der Versorgung genannt (vgl. § 9 Abs. 1 der Verordnung über die Altersversorgung der Intelligenz an wissenschaftlichen, künstlerischen, pädagogischen und medizinischen Einrichtungen der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. 7. 1951, Gbl., S. 675). …“14
Diese Begründung wurde vom Ministerrat der DDR gerade auch für die „Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR“, gleichfalls künstlerisches Personal, gegeben.15 „Teilweise sollten Zusagen einer verhältnismäßig hohen Altersversorgung auch fehlende leistungsgerechte Entlohnung ausgleichen, die der Staat aufgrund seiner Finanzlage nicht durchweg zahlen konnte (vgl. Bienert, ZSR 1993, S. 349 [351 f.]).“16
Die bbZ sollte die fehlende leistungsgerechte Entlohnung ausgleichen, da einerseits die Ballettleistungen auf hohem künstlerischen Niveau erbracht wurden, andererseits der Staat keine ausreichenden „Schaffens“-, d. h. Vergütungsbedingungen geben konnte.17 „Ebenso wenig hatten sie (die Berechtigten) Einfluss darauf, ob und in welcher Höhe für ihre Zusatzversorgung Beiträge aufzubringen waren.“18
13 14 15 16 17 18
BVerfGE 100, 1 [34 f.], zu C, I 1 b, bb) (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 [35], zu C, I 1 b, bb) (kursiv vom Verfasser). Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 33 –40. BVerfGE 100, 1 [35], zu C, I 1 b, bb). W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 36 ff. BVerfGE 100, 1 [36], zu C, I 1 b, bb).
I. Verletzung des Eigentumsgrundrechts
113
Das trifft auch für die Tänzer/Ballettmitglieder zu. „In jedem Fall knüpfte die Bereitstellung von Zusatzversorgungsleistungen an die erbrachte Arbeitsleistung der Versicherten an und wurde nicht als Maßnahme staatlicher Fürsorge verstanden, auch wenn die Mittel weithin aus dem Staatshaushalt stammten. Solche Erwägungen liegen auch in der Bundesrepublik Deutschland den Leistungen der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder mit der ergänzenden Direktversicherung durch die Arbeitgeber zugrunde.“19
Die Bereitstellung der bbZ knüpfte an die erbrachte Arbeitsleistung des versicherten Ballettmitglieds an, wurde nicht als Maßnahme staatlicher Fürsorge begründet. „Der verfassungsrechtliche Eigentumsschutz kommt den Rentenansprüchen und -anwartschaften aber nur in der Form zu, die sie aufgrund der Regelungen des Einigungsvertrages erhalten haben. Auch für rentenversicherungsrechtliche Rechtspositionen gilt, dass sich die konkrete Reichwerte der Eigentumsgarantie erst aus der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums ergibt, die nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Sache des Gesetzgebers ist (vgl. BVerfGE 53, S. 257 [292]. Der Gesetzgeber genießt dabei aber keine völlige Freiheit. Er muss vielmehr die grundsätzliche Privatnützigkeit und Verfügungsbefugnis, die zum Begriff des Eigentums gehören (vgl. BVerfGE 37, S. 132 [140], achten und darf diese nicht unverhältnismäßig einschränken. Doch variiert sein Spielraum dabei je nach dem Anteil personaler und sozialer Komponenten des Eigentumsobjekts.“20
Der Einigungsvertrag hat die Ansprüche und Anwartschaften auf Gewährung der bbZ erhalten.21 „Diese Grundsätze gelten auch für die Ausgestaltung von Eigentumspositionen durch den Einigungsvertrag, die auf Arbeits- und Beitragsleistungen in der Deutschen Demokratischen Republik zurückgehen. Zwar sind diese Rechtspositionen erst aufgrund des Vertrages und mit seinem Wirksamwerden dem Schutz von Art. 14 GG unterstellt worden. Das ändert aber nichts daran, dass der Gesetzgeber bei der Ratifikation des Einigungsvertrages an das Grundgesetz gebunden war. Inhalts- und Schrankenbestimmungen, die mit Art. 14 Abs. 1 GG unvereinbar sind, durfte er deswegen nicht erlassen (vgl. BVerfGE 91, S. 294 [308 f.]).“22
Der Einigungsvertragsgesetzgeber hat die Ansprüche und Anwartschaften auf Gewährung der bbZ respektiert und gewahrt (Anlage II Kap. VIII Sachgebiet F, Abschn. III Nr. 8 zum EV i.V. mit § 33 RAG). Mit Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H, Abschn. III Nr. 6 Buchst. a) zum EV hat er die Verpflichtung zum Ausdruck gebracht, die Ansprüche und Anwartschaften aus dem Zusatzversorgungssystem der AO-bbZ und Wahrung der Rechte durch eine Anschlussregelung zu überführen.23 19 20 21 22 23
Ebd. (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 [37], zu C, I 1 c (kursiv vom Verfasser). Hierzu W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 42, 45, 51 ff., 95 f. Ebd. (kursiv vom Verfasser). W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 51 ff., 95 f.
114
H. Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999
„Allerdings kommt dem Gesetzgeber bei der Bestimmung von Inhalt und Schranken rentenversicherungsrechtlicher Positionen grundsätzlich eine weite Gestaltungsfreiheit zu. Rentenansprüche und -anwartschaften weisen zwar einen hohen personalen Bezug auf. Zugleich stehen sie jedoch in einem ausgeprägten sozialen Bezug (vgl. im einzelnen BVerfGE 53, 257 [292 f.]). Deswegen verleiht Abs. 14 Abs. 1 Satz 2 GG dem Gesetzgeber auch die Befugnis, Rentenansprüche zu beschränken, Leistungen zu kürzen und Ansprüche und Anwartschaften umzugestalten, sofern dies einem Gemeinwohlzweck dient und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügt ( vgl. BVerfGE 53, 257 [293]).“24
Das BVerfG spricht bei der Ausgestaltung von Rechten von Beschränkung, Kürzung oder Umgestaltung. Keineswegs ist die Liquidierung von Rechten gemeint, die auch nicht von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG gedeckt wäre, abgesehen davon, dass für eine Beschränkung oder Liquidierung ein Gemeinwohlzweck überhaupt nicht ersichtlich ist, so dass auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht erforderlich ist. „Allerdings verengt sich seine Gestaltungsfreiheit in dem Maß, in dem Rentenansprüche und Rentenanwartschaften durch den personalen Bezug des Anteils eigener Leistung der Versicherten geprägt sind.“25
Der Gestaltungsraum wäre bei der Überführung der bbZ, so sie überhaupt stattgefunden hätte, was jedoch der Bundesgesetzgeber verfassungsrechtswidrig unterlassen hat,26 äußerst eingeengt. „Der Einigungsvertrag fand die Rentenansprüche und -anwartschaften in der modifizierten Form vor, die sie zwischenzeitlich durch die Gesetzgebung der Deutschen Demokratischen Republik erhalten hatten …“27
Der Einigungsvertrag, der § 33 RAG inkorporiert hat, hat unmodifiziert, d. h. die Regelung zur Weitergewährung uneingeschränkt übernommen. „… welche den Anforderungen des Grundgesetzes nicht unterlag und daher an ihr auch nicht gemessen werden kann. In den Geltungsbereich des Grundgesetzes traten diese Rechtspositionen aufgrund ihrer Anerkennung durch den Einigungsvertragsgesetzgeber, der die Beitrittsbedingungen und -folgen festlegte, und mit den Maßgaben, die dieser in Ausübung seiner Befugnis aus Art. 14 Abs. 1 und 2 GG für sie festgesetzt hatte.“28
Der bereits realisierte Anspruch auf Zahlung der bbZ und die einmal darauf begründete Anwartschaft trat „in den Geltungsbereich des Grundgesetzes“ ein und wurde von der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG erfasst. Ihr ersatzloser Wegfall, unabhängig davon, ob diesen der Bundesgesetzgeber bewirkt hat oder ob dieser von der Exekutive oder der Judikative29 veranlasst wurde, bedeutet nicht
24 25 26 27 28 29
BVerfGE 100, 1 [37 f.], zu C, I 1 c (kursiv vom Verfasser). Ebd., S. 38. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 99 ff. BverfGE 100, 1 [38]. Ebd. BverfG, Beschl. vom 2. 7. 2002–1 BvR 2544/95, 1944/97, 2270/00.
II. Die Zahlbetragsgarantie und Dynamisierung der Versorgungsbeträge
115
nur eine Verletzung des Art. 14 Abs. 1 GG, sondern stellt sich materiell-rechtlich zudem als Konfiskation dar.30
II. Die Zahlbetragsgarantie und Dynamisierung der Versorgungsbeträge Der Gesetzgeber hat eine Zahlbetragsgarantie in Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b Satz 4 und 5 zum Einungsvertrag abgegeben. Diese Verpflichtung musste, so das Bundesverfassungsgericht, eingelöst werden.31 Es hat zwar ausgeführt: „Aus Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG ergibt sich keine Verpflichtung des Gesetzgebers, das Altersversorgungssystem der Deutschen Demokratischen Republik einschließlich der Zusatzund Sonderversorgungen beizubehalten. Er war nicht gehindert, dieses System in einer ihm geeignet erscheinenden Form in das Rentenversicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland einzugliedern. Darin liegt keine Abschwächung der verfassungsrechtlichen Gewährleistungen gegenüber der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik. Auch das Rentensystem der Bundesrepublik Deutschland genießt als System keinen verfassungsrechtlichen Bestandsschutz, sondern könnte vom Gesetzgeber auf andere Grundlagen gestellt werden.“32
Das BVerfG sagt eindeutig, dass durch die Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen für ehemalige DDR-Bürger gewahrt bleiben (müssen), auch wenn diese Systeme unter Aufgabe dieser Systeme in das Rentenversicherungssystem der Bundesrepublik eingepasst werden. Das BVerfG unterscheidet eindeutig zwischen dem System und dem Recht (Anspruch, Anwartschaft); jenes betrifft die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers, dieses genießt trotz Wechsels im System den verfassungsrechtlichen (Grundrechts-) Schutz. Dieses wird untermauert, wenn es weiter befindet: „Bei den mit einem solchen Systemwechsel verbundenen Übergangsproblemen für diejenigen Personen, die bereits Ansprüche oder Anwartschaften erworben haben, muss freilich die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG berücksichtigt werden.“33
Die Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG) unterliege zwar der Inhaltsbestimmung nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG; diese habe jedoch ihre Grenzen. „Inhalt und Schranken des Eigentums werden gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG vom Gesetzgeber bestimmt, der dabei auch nach Art. 14 Abs. 2 GG die Sozialpflichtigkeit des Eigentums zu beachten hat. Diese Befugnis schließt auch Änderungen erworbener Rechtspositionen ein. Das gilt nicht nur für die im Einigungsvertrag anerkannten Rechtspositionen der Rentner und Rentenanwärter aus der Deutschen Demokratischen Republik, es ist auch für diejenigen aus der Bundesrepublik Deutschland unbestritten (vgl. BVerfGE 30 31 32 33
W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 117 f. BVerfGE 100, 1 [38–47], zu II. BVerfGE 100, 1 [39], zu II. 2 a (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 [39 f.], zu II. 2 a (kursiv vom Verfasser).
116
H. Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999
53, S. 257 [293]; 69, S. 272 [304]). Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG lässt es jedoch nicht zu, dass die Umstellung mit Einbußen einhergeht, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit widersprechen und Eigentumspositionen in unzumutbarer Weise schmälern.“34
Das Bundesverfassungsgericht zieht die Grenze mit der Zahlbetragsgarantie. „… Denn der Gesetzgeber hat durch die Zahlbetragsgarantie in Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 Buchst. b Satz 4 und 5 EV das Überführungskonzept um eine Schutzmaßnahme der … Betroffenen ergänzt. Damit soll verhindert werden, dass es im Zuge der Schließung der Versorgungssysteme und der Überführung der darin erworbenen Ansprüche und Anwartschaften in die gesetzliche Rentenversicherung für Rentner und rentennahe Jahrgänge im Ergebnis zu einer unverhältnismäßigen Verminderung von Versorgungsleistungen kommt. Diese Funktion setzt allerdings voraus, dass mit der Zahlbetragsgarantie eine Rechtsgrundlage für konkrete sozialrechtliche Ansprüche geschaffen worden ist.“35
Nach dem BVerfG soll die Zahlbetragsgarantie sicherstellen, dass mit der Überführung es nicht zu einer unverhältnismäßigen Verminderung der Versorgungsleistung kommt. Von einer Liquidierung der Versorgungsleistung ist nirgends die Rede. Mit der Zahlbetragsgarantie sollte eine Rechtsgrundlage für konkrete sozialrechtliche Ansprüche geschaffen werden. Das war in dem vom BVerfG entschiedenen Fall so, und das war im Fall der bbZ so, für die eine konkrete sozialrechtliche Anspruchsgrundlage geschaffen und durch den Einigungsvertrag aufrechterhalten worden ist. Die Zahlbetragsgarantie soll zugleich eine Ausgleichsfunktion erfüllen. Der in der DDR erreichte Standard sollte nicht nachhaltig verschlechtert werden.36 Es sollte ferner eine inflationsbedingt fortlaufende Wertminderung der Sozialleistung vermieden werden.37 „Unter diesen Umständen könnte die im Einigungsvertrag enthaltene Zahlbetragsgarantie die ihr zugedachte Schutz- und Ausgleichsfunktion nicht mehr erfüllen. Das entspräche nicht den Intentionen des Einigungsvertrages, denn die Garantie der Weiterzahlung des für Juli 1990 geltenden Betrags nach Anlage II Kapitel VIII Sachgebiet H Abschnitt III Nr. 9 Buchst. b Satz 4 und 5 EV sollte lediglich als Übergangsmaßnahme bis zur endgültigen Eingliederung in die gesetzliche Rentenversicherung dienen.“38
Das Bundesverfassungsgericht weiter: „Die damit verbundenen Nachteile für die Bestandsrentner“ (Anm.: keine Dynamisierung in der Übergangszeit bis zum Inkrafttreten des SGB VI am 1. 1. 1992) „waren im Hinblick auf die bevorstehende Anpassung zumutbar. Ab dem Zeitpunkt der Überführung aller Renten in die gesetzliche Rentenversicherung mussten sie aber nicht mehr hingenommen werden. Anderenfalls kämen die Betroffenen nicht mehr in den Genuss zweier grundlegender Charakteristika der Rentenversicherung. Zum einen wäre nicht gewährleistet, dass die durch 34 35 36 37 38
Ebd. BVerfG 100, 1 [41], zu II. 2 c (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 [41], zu II. 2 d. Ebd., S. 42. Ebd.
II. Die Zahlbetragsgarantie und Dynamisierung der Versorgungsbeträge
117
Lebensleistung erreichte relative Position innerhalb der jeweiligen Rentengeneration nach Eintritt des Versicherungsfalles erhalten bleibt; zum anderen wären diese Personen auf Dauer von der Dynamisierung, die seit 1957 zu den Wesensmerkmalen der gesetzlichen Rentenversicherung gehört, ausgeschlossen.39 Die Tatsache, dass die Garantie des Einigungsvertrages auf einen bestimmten Zahlbetrag bezogen ist, steht seiner Dynamisierung nach der Rentenüberführung nicht entgegen. Der Einigungsvertrag hat an eine Größe angeknüpft, die den Stand der einzelnen Rentenansprüche und -anwartschaften im Rentengefüge der Deutschen Demokratischen Republik widerspiegelte. Damit markierte er nach Anerkennung der Ansprüche aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen durch den Einigungsvertrag auch eine Eigentumsposition der aus diesen Systemen Begünstigten im Verhältnis zu den Positionen der übrigen Rentner. Diese Position hatte sich bereits durch die zweimalige Anhebung der Renten aus der Sozialpflichtversicherung und der Freiwilligen Zusatzrentenversicherung um jeweils 15 vom Hundert durch die beiden Rentenanpassungsverordnungen verschlechtert, von denen Berechtigte aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen mit hohen Ansprüchen nicht profitierten.40 Nach dem Ende der bis zum 31. 12. 1991 dauernden Übergangsphase konnte sich der Gesetzgeber, ohne diesen Personenkreis unverhältnismäßig zu belasten, nicht mehr auf die weite Gestaltungsfreiheit berufen, die ihm bei Übergangsregelungen zukommt. Der Verzicht auf die Dynamisierung der Leistungen würde sonst einen für die Betroffenen nicht mehr zumutbaren Eingriff in ihre eigentumsgeschützten Ansprüche bewirken. Unterbliebe die Dynamisierung für die Bestandsrentner aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, käme dies der Beseitigung ihrer relativen Position gleich. Der Wert ihrer Ansprüche würde sich stetig auf einen Bruchteil seines ursprünglichen Wertes verringern.“41
Danach gilt: Der Anspruch auf Gewährung der Versorgung für Ballettmitglieder genießt nicht nur als verfestigte vermögensrechtliche Position die Eigentumsgarantie, und ihr Wegfall (Liquidierung) verstößt gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG. Die Zahlbetragsgarantie nach Anlage II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b Satz 4 und 5 EV sichert nicht nur, dass nicht nur nominell eine Verringerung des Zahlbetrags eintritt. Sie ist zugleich die Basis für die Dynamisierung, entsprechend der Entwicklung der Rentenhöhe. Eine Kappung, d. h. ohne Dynamisierung bedeutet für die betroffenen Ballettmitglieder einen nicht mehr zumutbaren weiteren Eingriff in ihre eigentumsgeschützten Ansprüche. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 199942 weist eigentlich einen geraden Weg zum Erhalt der Ansprüche aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen nicht nur für Ballettmitglieder, sondern für alle Personengruppen.
39 40 41 42
Ebd. (kursiv vom Verfasser). Ebd., S. 43 (kursiv vom Verfasser). Ebd., S. 43 (kursiv vom Verfasser). BVerfGE 100, 1 – Zahlbetragsgarantie.
I. Zwischenbilanz 1991/1993: Fall eines Konzepts Mit dem Programm aus dem AAÜG 1991 i. d. F. des Rü-ErgG 1993 ist der Bundesgesetzgeber und als ,spiritus rector‘ die Bundesregierung in wichtigen Fragen gescheitert.1
I. Die wissenschaftliche Literatur Die wissenschaftliche Literatur war von Anfang an der Auffassung, dass der Bundesgesetzgeber die durch die Staatsverträge vorgegebenen Aufgaben bei der „Überführung“ der Alterssicherungssysteme der DDR in das gesamtdeutsche Rentenversicherungs- und Versorgungsrecht nicht bewältigt, dass er mehr Verfassungsprobleme geschaffen denn befriedigend gelöst hat.2 Das gleiche gilt für einigungsbedingte Probleme.3 Unter Berufung auf Merten, der die ersten Gesetze verfassungsrechtlich untersucht hat,4 setzt Gerechtigkeit5 und Recht Maßstäbe, die die Bundesgesetzgebung ausgeklammert hat. • Aus wohlerwogenen rechtsstaatlichen Gründen kann das Sozialversicherungsrecht nicht an Stelle einer Strafverfolgung treten. Wegen seiner Wertneutralität und moralischen Indifferenz ist es von vornherein als pönales Ersatzinstrument untauglich. Bei der Überleitung von Versorgungsansprüchen und -anwartschaften hat sich der Bundesgesetzgeber von Kollektivsanktionen, pauschalen Diskriminierungen und ungerechtfertigter Prangerei leiten lassen.6 1 Michael Mutz, Aufstieg und Fall eines Konzepts. Die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR und ihre Überführung, in: DAngVers. 11/1999, S. 509 ff. 2 Nachweise bei W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 12. 3 Vgl. nur Klaus Peter Krause, Fortgesetztes Unrecht. Der bis heute als „Bodenreform“ verharmloste Klassenkampf, in: MUT Nr. 515, September 2010, S. 26 – 35; Thorsten Purps, Die Wunderschätze der Wiedervereinigung und ihr verheerender Makel, in: MUT Nr. 516, Oktober 2010, S. 50 – 58; ders.: Vom Staat enterbt – Die Bodenreformaffäre – Eine Skandalchronik aus dem Land Brandenburg, Mitteldeutscher Verlag 2010; Karl Albrecht Schachtschneider, Habe den Mut, das Recht zu wahren, in: MUT Nr. 513, Juni 2010, S. 6 – 12. 4 Detlef Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung. Zur Erstreckung westdeutschen Rentenversicherungsrechts auf die neuen Länder, 2. Aufl., Berlin 1994. 5 Hermann Klenner, Gerechtigkeitstheorien in Vergangenheit und Gegenwart, in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Band 8, Jg. 1995, Heft 8/9, S. 91 – 110. 6 D. Merten, Verfassungsprobleme …, Vorwort.
I. Die wissenschaftliche Literatur
119
• Der Wunsch nach Vergangenheitsbewältigung vermag den Zugriff auf Renten nicht zu legitimieren. Jede Strafe (im weiteren Sinne) setzt von Verfassungs wegen individuelle Schuld voraus. Das Postulat „nulla poena sine culpa“ folgt sowohl dem Verfassungsprinzip (formeller) Rechtsstaatlichkeit als auch aus dem Menschenwürde-Satz des Art. 1 Abs. 1 GG. Es gilt auch für strafähnliche Sanktionen, die ein „sozialistisches Unwerturteil“ ausdrücken.7 • Daher verbietet der Rechtsstaat jede Form der Kollektiv- und Gruppenschuld. Schuld bedingt individuelle Verantwortung und individuelle Vorwerfbarkeit.8 Die Bundesgesetzgebung darf daher nicht aufgrund bloßer „Staats- und Systemnähe“, die mit der Höhe des Einkommens begründet wird, ganzen Gruppen von Versorgungsberechtigten ein Täter-Merkmal aufdrücken. Abwegig ist der Einwand, man könne den „Opfern“ des Systems nicht zumuten, dass die „Täter“ eine höhere Rente als sie erhielten, solange nicht in einem rechtsstaatlichen Verfahren eine individuelle Täterschaft festgestellt worden ist.9 • Mangels unterschiedlichen Verhaltens in einem sozialrechtlichen Verfahren sind Rentenkürzungen auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Renten“verwirkung“ zu rechtfertigen. Eine Renten“konfiskation“ verstößt eindeutig gegen die grundgesetzliche Eigentumsgarantie.10 • Aufgabe des Sozialversicherungsrechts ist es, Versicherte gegen Lebensrisiken zu sichern, nicht aber, Unrecht oder Lebensführungsschuld zu sühnen. Die sittliche Qualität versicherungspflichtiger Tätigkeit und deren gesellschaftliche Qualifizierung ist grundsätzlich irrelevant. Das Sozialversicherungsrecht ist in dieser Hinsicht wertneutral und moralisch indifferent. Ihm sind die Kategorien „Täter“ und „Opfer“ unbekannt. Es differenziert nur zwischen „Versicherten“ und „Nichtversicherten“. Kann schon das Strafrecht nicht verhindern, dass Täter nach ihrer Verurteilung möglicherweise bessergestellt sind als ihre Opfer, so ist erst recht dem Sozialversicherungsrecht eine derartige Wiedergutmachungsfunktion fremd. Rentenleistungen bemessen sich nicht nach Gesetzestreue oder Gesetzesbruch des Versicherten. Nimmt die Rechtsordnung hin, dass ein verurteilter Täter eine höhere Rente als sein Opfer bezieht, weil er mehr Jahre mit sozialversicherungsrechtlicher Tätigkeit aufzuweisen hat, so kann sie umso weniger Rentenkürzungen bei bloß vermuteter Täterschaft verhängen.11 • Das Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz trägt seine Systemwidrigkeit quasi „auf der Stirn“, da es das Prinzip der „Wertneutralität“ durchbricht. Denn es bleibt trotz der Sonderregelungen in Art. 3 RÜG auch in Zukunft dabei, dass wegen Mordes oder Landesverrats Verurteilte ihre rentenversicherungs7
Ebd., S. 25 ff. Gottfried Dietze, Schuld und Schulden, Berlin 2007. 9 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 25 – 29. 10 Ebd., S. 39 – 48. 11 Ebd., S. 56 f., 145. 8
120
I. Zwischenbilanz 1991/1993
rechtlichen Anwartschaften behalten, während die rechtmäßig erworbenen Ansprüche/Anwartschaften der Versorgungsberechtigten aus der DDR in teilweise drastischer Weise reduziert werden. Politische Missliebigkeit allein wurde mit dem Mantel des „Rechts“ bekleidet.12 Auf diese Weise kann Vergangenheit nicht bewältigt werden, zumal der Bundesgesetzgeber hierzu nicht berufen ist. • Demgegenüber gibt Art. 20 Abs. 2 Satz 3 StV eine Bestandsgarantie für die Versorgungsberechtigten, die vom Einigungsvertrag bekräftigt wurde. Diese vom Gesetzgeber begründeten Ansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts „Gegenstand der Eigentumsgarantie“.13 Die Staatsverträge bewirken darüber hinaus einen „Ergebnisschutz“, so dass erworbene Versorgungsrechte wie ein „Sozialversicherungssaldo“ in die Rentenversicherung zu überführen waren. Zusätzlich enthält der Einigungsvertrag eine Zahlbetragsgarantie zur Sicherung des sozialen Besitzstandes. Da diese als Realwertgarantie zu qualifizieren ist, besteht die Pflicht zur Anpassung bei steigenden Lebenshaltungskosten.14 • Art. 10 Abs. 1 AAÜG verstößt gegen die im Einigungsvertrag normierte und durch Art. 14 GG gesicherte Zahlbetragsgarantie. Sie ist auch nicht durch den Kürzungsvorbehalt im Falle des Verstoßes gegen die Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit bzw. des Funktionsmissbrauchs15 gerechtfertigt, weil die Begrenzung generell erfolgt, ohne dass im Einzelfall eine individuelle Schuld in einem Verfahren mit rechtsstaatlichen Klientelen festgestellt wird.16 Aus denselben Gründen ist § 10 Abs. 2 AAÜG mit Art. 14 GG unvereinbar.17 Das Bundessozialgericht hat § 10 AAÜG als „blanken politischen Machtmissbrauch im Sinne einer Kollektivbestrafung, Kollektivdisziplinierung oder gar der politischen Rache“ disqualifiziert.18 • Soweit § 6 Abs. 1 AAÜG das individuelle Arbeitsentgelt der Versorgungsberechtigten nur bis zur (westdeutschen) Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, verstößt er gegen Art. 14 GG. Die Staatsverträge gestatten keine Eingriffe in das „Erworbene“. Die Beitragsbemessungsgrenze, die im westdeutschen Rentenversicherungssystem eine übermäßige und damit verfassungswidrige Zwangssicherung ausschließt und Eigenverantwortung respektiert, kann nicht nachträglich einem fremden System übergestülpt werden, weil für die Vergangenheit DDR-Bürger private Vorsorge nicht 12 Ebd., S. 58 f. – Vgl. auch Heinz-Dietrich Steinmeyer, Die deutsche Einigung und das Sozialrecht, in: VSSR 1990, S. 83 (100). 13 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 68 – 88. 14 Anl. II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b) Satz 3 Nr. 2 EV. 15 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 95 ff. 16 Ebd., S. 103 – 105 17 Ebd., S. 105 ff., 110, 147. 18 BSGE 72, 50 (75).
I. Die wissenschaftliche Literatur
121
mehr treffen können. „Der Gesetzgeber hätte bei der Rentenüberleitung von der Beitragsbemessungsgrenze um so leichter abgehen können, als sie nicht die ,Bundeslade der Sozialversicherung‘ darstellt und auch schon für zurückliegende Zeiten Ausnahmen gemacht wurden.“19 Der durch den § 6 Abs. 1 AAÜG bewirkte Kappungs-Effekt dient weder der Abschaffung „ungerechtfertigter“ noch dem Abbau „überhöhter“ Leistungen. Denn das Gesetz stellt nicht auf vergleichbare Beamtenversorgungs- oder Sozialversicherungsleistungen bei entsprechender Tätigkeit in den alten Bundesländern ab, sondern kappt alle Ansprüche und Anwartschaften durch nachträgliche Einführung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsbemessungsgrenze. Übertrüge man diese Kappungsgrenze auf die Beamtenversorgung, würden etwa vom Regierungsdirektor (A 15) an aufwärts alle Beamten die gleichen Versorgungsbezüge wie dieser erhalten, was evident unangemessen wäre.20 • Art. 14 GG wird auch durch die §§ 6 Abs. 2 und 7 AAÜG verletzt. Durch die Berücksichtigung des individuellen Arbeitsentgelts lediglich bis zu den in den Anlagen 5 und 6 AAÜG für die jeweiligen Kalenderjahre festgelegten Jahreshöchstverdienstgrenzen wird in die auf Eigenleistungen der Versorgungsberechtigten (Beiträge bzw. Arbeitsleistungen) beruhenden Ansprüche/Anwartschaften in disproportionaler Weise eingegriffen. Offensichtlich werden nicht „überhöhte Leistungen“ abgebaut, wenn alle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ohne Rücksicht auf ihre individuelle Funktion oder ihr effektiv erzieltes Entgelt gleichmäßig maximal mit einem Verdienst berücksichtigt werden, der noch 5 v.H. unter dem sog. Mindesteinkommen liegt. Auch für Richter oder Staatsanwälte sind Versorgungsleistungen aufgrund eines 140 v.H. des Durchschnittsentgelts übersteigenden Einkommens keinesfalls „überhöht“ oder „ungerechtfertigt“.21 • Das AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG von 1991/1993 widerspricht auch in wesentlichen Teilen dem Gleichheitssatz. Art. 3 Abs. 1 GG enthält als Kehrseite des Willkürverbots das Gebot der Sachgerechtigkeit, der Systemgerechtigkeit und Gruppengerechtigkeit.22 Personen oder Gruppen dürfen nicht durch Gesetz ohne rechtlich zureichenden Grund schlechter gestellt werden als andere, die man als vergleichbar gegenüberstellt. Insbesondere darf eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu einer anderen dann nicht anders behandelt werden, wenn zwischen beiden Gruppen keine die differenzierende Behandlung rechtfertigenden Unterschiede bestehen.23
19 20 21 22 23
So D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 111 f. Ebd., S. 113, 147. Ebd., S. 118 – 120. Hierzu auch W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 70 ff. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 118 – 120.
122
I. Zwischenbilanz 1991/1993
• Wenn § 6 Abs. 1 AAÜG nur das anrechenbare Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt, verletzt er Art. 3 Abs. 1 GG sowohl im Außenals auch im Binnenvergleich. Bei dem vom Einigungsvertrag vorgegebenen Vergleich mit dem Versorgungssystem der alten Bundesländer wird deutlich, dass die Versorgungsberechtigten im Beitrittsgebiet schlechter gestellt sind als vergleichbare Beamte oder Angestellte in Westdeutschland.24 Der Binnenvergleich zeigt, dass Versorgungsberechtigte mit Einkünften bis zur Beitragsbemessungsgrenze letztlich wie vergleichbare westdeutsche Versicherte behandelt werden, während die Versorgung von Personen mit grenzüberschreitenden Einkünften fallbeilartig gekappt wird, so dass sie rigoros denjenigen Versorgungsberechtigten gleichgestellt werden, die Einkünfte in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze bezogen.25 • § 6 Abs. 2 und 3 i.V. mit Anlage 4 und 5 oder 8 AAÜG verstießen gegen Art. 3 Abs. 1 GG.26 Sie behandeln Personen in erheblicher Weise unterschiedlich, je nachdem, ob deren Arbeitsentgelt bis zu 140 v.H., zwischen 140 und 160 v.H. oder über 160 v.H. des Durchschnittsentgelts betrug.27 Angesichts des gesetzgeberischen Regelungsziels einer einkommensadäquaten Versorgungsüberleitung muss grds. ein höheres Arbeitsentgelt auch zu einer höheren, darf aber keineswegs zu einer geringeren Versorgung führen, weil Art. 3 Abs. 1 GG auch die Achtung vertikaler Gleichheit im Verhältnis geringeren zu höheren Einkommen gebietet. Unter dem Gesichtspunkt einer Ahndung von Verstößen gegen Grundsätze der Menschlichkeit oder Rechtsstaatlichkeit zieht die Regelung eine willkürliche Unrechtsbegehungsgrenze. Sie läuft auf die These hinaus, dass bei Einkünften bis zu 140 v.H. des Durchschnittsentgelts unrechtes Tun ausgeschlossen ist, so dass sich Kürzungen erübrigen, während bei Einkünften über 160 v.H. des Durchschnittsentgelts Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte übermäßig verletzt wurden, so dass eine Degression geboten ist.28 • Die generelle und unterschiedslose Absenkung des individuellen Arbeitsentgelts während der Zugehörigkeit zum Versorgungssystem des Ministeriums für Staatssicherheit ist mit dem Gleichheitssatz unvereinbar. § 7 AAÜG führt zu dem frappierenden Ergebnis, dass ein Abteilungsleiter im Ministerium ceteris paribus dieselbe Versorgung erhält wie der Pförtner.29 Hält der Gesetzgeber am Prinzip der „Wertneutralität“ des Sozialversicherungsrechts fest, handelt er nicht nur systemwidrig, sondern auch willkürlich, wenn er dem verurteilten Massenmörder 24
Ebd., S. 121 ff. Ebd., S. 124 ff. 26 Sie sind mittlerweile aufgehoben worden. 27 Hierzu oben unter G. I. 2. a) aa) 1. bis 3. 28 Im einzelnen D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 126 – 135. – Vgl. hierzu BVerfGE 18, 159 [170]; 87, 153 [170]. 29 Näheres über das Personal David Gill/Ulrich Schröter, Das Ministerium für Staatssicherheit, 1991. 25
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1999
123
eine beitrags- und lohnadäquate Rente zahlt, diesen Grundsatz aber bei Versorgungsberechtigten der DDR durchbricht, indem er „Regierungskriminalität“ unterstellt, ohne dass individuelle Schuld nachgewiesen ist.30 • Schließlich ist die Begrenzung der Zahlbeträge gemäß § 10 AAÜG mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar. § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG hatte zur Folge, dass eine Gruppe von Versorgungsberechtigten ihren Zahlbetrag in voller Höhe weiter erhielt, während er für andere um mehr als die Hälfte reduziert wird. § 10 Abs. 1 Satz 1 AAÜG behandelt alle Beschäftigten im „staatsnahen“ Versorgungssystem gleich und erfasst damit unterschiedslos Angehörige der Grenztruppen der Nationalen Volksarmee ebenso wie Techniker und Mathematiker in Ministerien. Selbst wenn § 10 Abs. 2 AAÜG ohne individuelle Schuldfeststellung der institutionellen Nähe des Ministeriums für Staatssicherheit zum Unrechtssystem Rechnung tragen will, fehlt es an jedem einleuchtenden Grund dafür, alle Beschäftigten unterschiedslos gleich zu behandeln, so dass für die Küchenhilfe derselbe Höchstbetrag gilt wie für Abteilungsleiter.31
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1999 Neun Jahre nach dem Einigungsvertrag und den Eingriffen des AAÜG in die Ansprüche/Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen hat das Bundesverfassungsgericht vier Urteile am 28. 4. 199932 erlassen, mit denen wesentliche Teile des AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG für verfassungswidrig erklärt werden. Es ist der bis dahin durch die Legislative, Exekutive und der obergerichtlichen Rechtsprechung zur Geltung verholfenen, von Papier in einem Auftragsgutachten untermauerten Meinung33 entgegengetreten und hat, wie es auf den ersten Blick erscheint, apodiktisch entschieden, dass die Versorgungen den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG genießen.34 Die Urteile wurden ohne Mitwirkung des Richters Papier gefällt, der vor Berufung zum BVerfG für die Bundesregierung tätig gewesen war und auftragsgemäß die Verfassungsmäßigkeit des Unterganges aller in der DDR erworbenen Ansprüche aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen bescheinigt hatte, der deshalb wegen 30
D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 135 – 138. Ebd., S. 139 – 142. 32 BVerfGE 100, 1 – 59 (Zahlbetragsgarantie); BVerfGE 100, 59 – 104 (Staats- und Systemnähe); BVerfGE 100, 104 – 137 (Versicherungsbiographie, AO FZV med); BVerfGE 100, 138 – 195 (MfS/AfNS). – Besprechung der Urteile bei: Rosemarie Will, Rente als Eigentum – die „Ostrentenentscheidungen“ des Bundesverfassungsgerichts, in: NJ 7/1999, S. 337 – 346; Michael Mutz, Aufstieg und Fall eines Konzepts, in: DAngVers. 11/1999, S. 509 – 519. 33 Hans-Jürgen Papier, Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, 1994. 34 BVerfGE 100, 1 (Leiturteil). 31
124
I. Zwischenbilanz 1991/1993
Besorgnis der Befangenheit an der Entscheidungsfindung ausgeschlossen war.35 Der Inhalt der Urteile ist öfter dargestellt worden.36 Um den Gang der Entwicklung chronologisch weiter zu verfolgen, wird das Ergebnis dargestellt.
1. Zahlbetragsgarantie (Leiturteil)37 Bestandsrentner aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen, deren Arbeitseinkommen auf 2700 DM gekürzt worden war (Art. 10 Abs. 1 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG 1993), erhalten nach dem Urteil, das § 10 Abs. 1 Satz 2 AAÜG über die sog. vorläufige Zahlbetragsbegrenzung wegen Verstoßes gegen Art. 14 GG für nichtig erklärt hat, wieder den höheren, nach DDR-Recht gewährten Betrag, der zudem ab 1. 1. 1992 anhand des Steigens des aktuellen Rentenwertes (Ost) „dynamisiert“ wird.38 Das Bundesverfassungsgericht entschied, dass die in der DDR erworbenen und im Einigungsvertrag nach dessen Maßgaben als Rechtspositionen der gesamtdeutschen Rechtsordnung anerkannten Ansprüche und Anwartschaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen den Schutz des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG genießen.39 Mit der Schließung der Versorgungssysteme bis zum 31. 12. 1991 seien die aus den Versorgungsordnungen erworbenen Ansprüche und Anwartschaften „nicht zum Erlöschen“ gebracht worden, d. h. sie sind nicht untergegangen. Die Bundesrepublik sei in die begründeten leistungsrechtlichen Beziehungen grundsätzlich eingetreten.40 Insoweit ist es Merten gefolgt.41 Jedoch hat es die sog. Systementscheidung des Bundesgesetzgebers nicht zu Fall gebracht, wie es eigentlich die Staatsverträge gebieten (vgl. hierzu oben unter J. I.) Es hat seine Grundentscheidung derart relativiert, dass eine Rechtssicherheit für künftig zu entscheidende Fälle nicht zu erwarten war. Es hat sich – aus welchen Gründen auch immer – gescheut, dem Gesetzgeber in voller Breite entgegenzutreten.42 Die Aussage, dass die Versorgungen den Schutz des Art. 14 Abs. 1 GG genießen, gelten danach nicht absolut, sondern aus der Vielzahl der Tatbestände nur für die Bestandsrentner, d. h. die Personen, die bis zum 3. 12. 1991 rentenberechtigt wurden, 35 Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Teil 2, in: ZFSH/SGB 12/ 2009, S. 707 (713 ff.). 36 Vgl. z. B. Karl-Heinz Christoph/Werner Mäder, Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/SGB 4/2005, S. 195 – 213; Werner Mäder/Johann Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, Teil 2, in: ZFSH/SGB 11/2005, S. 651 ff. 37 BVerfGE 100, 1. 38 Ebd., S. 50 ff. 39 Ebd., S. 1, 32. 40 Ebd., S. 1, 34. 41 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 107 ff. 42 Zur Rolle des Präsidenten des BVerfG im Einigungsprozess vgl. Werner Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 128 ff.
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1999
125
denen die Zahlbetragsgarantie nach dem realen Wert der Rente mit einer Anpassung an die Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter Ost (Art. 2 Abs. 4 StV) zugesprochen wird. Wie es sich mit den Zugangsrentnern der „1.Generation“ (Rentenberechtigung in der Zeit vom 1. 1. 1992 bis zum 30. 6. 1995) verhält, war nicht Gegenstand des Leiturteils. Für die Zugangsrentner der „2.Generation“ (Rentenberechtigung ab 1996) soll nach beiläufigen Äußerungen die in der DDR zeitanteilig erworbene Anwartschaft nicht mehr geschützt sein, weil diese Personen nach der Einigung, noch im erwerbsfähigen Alter stehend, ihre Versicherungsbiographie noch günstig beeinflussen können, insofern sie noch Zugang zu ergänzenden Alterssicherungssystemen finden können.43 Das Bundesverfassungsgericht hat weiter relativiert. Der Eigentumsschutz komme den Ansprüchen nur in der Form zu, die sie aufgrund der Regelungen des EV erhalten haben. Die konkrete Reichweite ergebe sich erst aus der Bestimmung von Inhalt und Schranken des Eigentums. Dies sei nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Sache des Gesetzgebers, der jedoch nicht völlig frei sei und das Eigentum nicht unverhältnismäßig einschränken dürfe, allerdings bei rentenversicherungsrechtlichen Positionen „grundsätzlich eine weite Gestaltungsfreiheit“ habe.44 Diese unbestimmte „Bestimmtheit“ ließ folglich jede Entscheidung zu. Schließlich sieht das Bundesverfassungsgericht in dem sog. Systemwechsel des RÜG, nämlich darin, dass der Bundesgesetzgeber die in der DDR erworbenen Ansprüche/Anwartschaften durch „eine einheitliche, ausschließlich aus der gesetzlichen Rentenversicherung stammende Versorgungsleistung unter Verzicht auf Zusatzleistungen, die der betrieblichen Altersversorgung oder Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes gleichen, ersetzt hat“, bei verfassungskonformer Auslegung keinen Verstoß gegen Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG oder Art. 3 Abs. 1 GG.45 Dasselbe gelte für die weitere Absenkung des Sicherungsniveaus dadurch, dass die versicherten Arbeitsentgelte nur bis zur Beitragsbemessung berücksichtigt werden. Die Überführung als Ganzes diene einem wichtigen Gemeinwohlbelang, mit der „Rechtsangleichung“46 im Rentenrecht bleibe zugleich die Finanzierbarkeit der Sozialversicherung insgesamt erhalten.47 Die Eigentumsgarantie verleihe der individuellen Rechtsposition des DDR-Bürgers keinen absoluten Schutz.48 Im Zuge all dieser Einschränkungen des anfangs aufgestellten Grundsatzes hat das BVerfG „bei verfassungskonformer Auslegung“ in späteren Entscheidungen mit
43
BVerfGE 100, 1 [46]. BVerfGE 100, 1 [37 f.] mit Verweis auf BVerfGE 53, 257 [292 f.]. 45 Ebd., S. 37 ff. 46 Das BVerfG sagt „Rechtsangleichung“, meint Harmonisierung. 47 BVerfGE 100, 1 [40 f.]. – Vgl. auch W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 11/2005, S. 651 – 653. 48 BVerfGE 100, 1 [39 ff.]. 44
126
I. Zwischenbilanz 1991/1993
dem befangenen Richter Papier – mit einer Ausnahme ohne Mitwirkung des befangenen Richters49 – immer zu Lasten der Betroffenen entschieden. 2. Staats- und Systemnähe50 Das Urteil entschied über die Verfassungsmäßigkeit der Rentenkürzung wegen Staats- und Systemnähe. Arbeitsentgelte werden nach § 6 Abs. 1 AAÜG von vornherein nur bis zur Höhe der in der gesetzlichen Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt. Im Falle der Zugehörigkeit zu „staatsund systemnahen“ Versorgungssystemen sowie der Ausübung „systemnaher“ Funktionen wird das bei der Bemessung der Höhe der Rente berücksichtigungsfähige Einkommen begrenzt (Begrenzungsregelungen des § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG). In dem einen Fall erfolgte die Begrenzung, weil der Kläger dem Zusatzversorgungssystem nach Anlage 1 Nr. 19 (Mitarbeiter des Staatsapparates) (§ 6 Abs. 2 AAÜG) angehört hatte und vor Rentenbeginn Richter war (§ 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG), im zweiten Fall, weil der Kläger (früher Wachtmeister der Volkspolizei) in dem für die Deutsche Volkspolizei geschaffenen Sonderversorgungssystem nach Anlage 2 Nr. 2 AAÜG (§ 6 Abs. 2 AAÜG) erfasst war.51 Nach dem Urteil verletzen § 6 Abs. 2 i.V. mit Anlage 4, 5 und 8 und § 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG die Art. 3 Abs. 1 und 14 GG. Der Gesetzgeber wurde verpflichtet, bis zum 30. 6. 2001 eine verfassungsmäßige Regelung zu treffen.52 Die von § 6 Abs. 2 AAÜG erfassten Personengruppen wurden gegenüber allen Rentnern, deren tatsächlich erzielten Arbeitsentgelte bei der Rentenberechnung nur durch die Beitragsbemessungsgrenze gekappt werden, benachteiligt. Im Bereich des § 6 Abs. 2 AAÜG wurde die Gruppe ferner mit solchen Berechtigten aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen ungleich behandelt, deren Arbeitseinkommen in tatsächlicher Höhe ungekürzt anerkannt werden, weil sie nur eine Vergütung bis zu 140 v.H. des Durchschnittsentgelts erzielt haben. Soweit bei Personen wegen eines Verdienstes i.H. von 180 v.H. des Durchschnittsentgelts oder mehr dieser Verdienst nur bis zum Durchschnittsentgelt angerechnet wird, wurden auch sie gegenüber solchen Personen benachteiligt, deren Arbeitsentgelt zwischen 140 v.H. und 160 v.H. des Durchschnittsentgelts lag. Diese Personen wurden vergleichsweise auf 140 v.H. des Durchschnittsentgelts begrenzt.53 Für die Ungleichbehandlung gebe es keinen rechtfertigenden Grund;54 sie verfehle auch das angestrebte Ziel, weil unzulässig typisierend unterstellt worden sei, 49 50 51 52 53 54
BVerfG, Beschl. vom 23. 6. 2004 – 1 BvL 3/98, 9/02, 2/03 -, BVerfGE 111, 115. BVerfGE 100, 59. Ebd., S. 75 – 77, 81 f. Ebd., S. 60, 103. Ebd., S. 90 f. Ebd., S. 91 ff.
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1999
127
dass die Arbeitseinkommen dieser Personengruppen durchweg überhöht gewesen seien.55 § 6 Abs. 2 AAÜG verletze auch das Eigentumsrecht, verstoße gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil er nicht geeignet sei, den Gemeinwohlzweck zu verwirklichen. Hierzu werden dieselben Argumente wie zu Art. 3 Abs. 1 GG verwendet.56 § 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG 1993 verstoße ebenfalls gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Das Urteil stellt eine Schlechterstellung der Personengruppe gegenüber anderen Versichertengruppen fest,57 für die es ebenfalls keinen hinreichenden Grund gebe,58 so in Bezug zu anderen Versichertengruppen, die in der DDR ebenfalls eine herausgehobene Stellung innehatten, aber keine Begrenzung ihrer Arbeitsentgelte hinnehmen mussten, weil deren Funktion in § 6 Abs. 3 AAÜG nicht genannt und daher nicht von ihr erfasst werde.59 Der – typisierenden – Bestimmung des von § 6 Abs. 3 AAÜG erfassten Personenkreises anhand des Kriteriums der Zugehörigkeit zu bestimmten Funktionsebenen hafte, so das BVerfG weiter, der gleiche Mangel an wie derjenigen des § 6 Abs. 2 AAÜG. Die Begrenzungsregelung des § 6 Abs. 3 AAÜG treffe unterschiedslos Personen, die „leitende Funktionen“ im Staatsapparat, in den Parteien und in der Wirtschaft der DDR ausgeübt haben.60 § 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG verletze auch das Eigentumsrecht, weil er zur Erreichung seines Zwecks ungeeignet sei.61 Der Gesetzgeber habe an Merkmale angeknüpft, die allein nicht als Indikatoren für ein überhöhtes Entgelt ausreichen, insofern nicht hinreichend sichergestellt worden sei, dass die Kürzungen nur solche Personen betrafen, deren tatsächlich überhöhte Entgelte bezahlt worden waren.62 Das Bundesverfassungsgericht geht zwar in seinen Entscheidungen von der ungesicherten Annahme aus, dass es Fälle von überhöhten Entgelten gibt. Gemessen an den realen Verhältnissen in der DDR erweist sich dies jedoch eher als eine Jagd auf ein Phantom. 3. Ministerium für Staatsicherheit63 Das dritte Urteil richtet über die Verfassungsmäßigkeit der Kürzung von Ansprüchen aus dem Gesamt- bzw. Sonderversorgungssystem des MfS/AfNS durch § 7 Abs. 1 Satz 1 AAÜG i.V. mit Anlage 6 und § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AAÜG 1991 i. d. F. des Rü-ErgG 1993. 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Ebd., S. 93 f., 95, 97. Ebd., S. 97 f. Ebd., S. 98 f. Ebd., S. 99, 100. – Vgl. auch schon D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 128 f. BVerfGE 100, 99. Ebd. S. 99 f. Ebd., S. 101. Ebd., S. 98. BVerfGE 100, 139 – 195.
128
I. Zwischenbilanz 1991/1993
• Vor der Überleitung in die gesetzliche Rentenversicherung wurden Ansprüche gem. § 7 Abs. 1 AAÜG auf höchstens 70 v.H. des Durchschnittsentgelts abgesenkt. Gründe für eine Kürzung auf gerade 70 v.H. wurden in der Gesetzesbegründung und im Gesetzgebungsverfahren nicht genannt, nur der allgemeine Hinweis, dass die Regelung dem sozialen Rechtsempfinden wegen der relativ hohen Staatsnähe der MfS-Mitarbeiter entspreche.64 Das Gericht sah darin keinen rechtfertigenden Grund. Für eine Verwirklichung des gesetzgeberischen Anliegens komme höchstens eine Absenkung auf das Durchschnittsentgelt, mithin auf 100 v.H. in Betracht. Es müsse ein Leistungsrest erhalten bleiben, der den Zweck einer bedürftigkeitsunabhängigen Sicherung nach einem vollen Versicherungsleben erfüllt. Die Betroffenen dürften nicht von Sozialleistungen abhängig gemacht werden.65 § 7 Abs. 1 Satz 1 AAÜG i.V. mit Anlage 6 wird wie die anderen Kürzungsregelungen des AAÜG wegen Unvereinbarkeit mit Art. 3 Abs. 1 GG und Art. 14 GG für nichtig erklärt.66 Ein Abbau unter 100 v.H. des Durchschnittsentgelts schränke Art. 14 GG unverhältnismäßig ein.67 • Die von der Rentenüberleitung und für eine Übergangszeit nach DDR-Recht gezahlten Beträge wurden aus Bestandsgründen weitergezahlt, wenn die Rentenberechnung nach neuem Recht (SGB VI) einen niedrigeren Betrag ergibt. Die „geschützten“ Zahlbeträge wurden für ehemalige Angehörige des MfS/AfNS noch einmal ab 1. 8. 1991 auf monatlich 802 DM begrenzt durch § 10 Abs. 2 Satz 1 AAÜG. Wie das Leiturteil, das die in der DDR erworbenen Ansprüche aus Zusatzund Sonderversorgungssystemen unter den Schutz von Art. 14 Abs. 1 GG stellt, geht auch dieses Urteil davon aus, dass die Ansprüche/Anwartschaften des Sonderversorgungssystems des MfS/AfNS dem Schutz dieser Vorschrift unterstehen.68 Das Bundesverfassungsgericht erklärt § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AAÜG wegen Verstoßes gegen Art. 14 GG für nichtig. Die vorläufige Zahlbetragsbegrenzung auf 802 DM monatlich führe dazu, dass den Betroffenen z. B. etwa 19 v.H. der ihnen im EV zugesagten Altersversorgung so lange vorenthalten werde, bis der sich aus der Überführung ergebende dynamische Rentenanspruch erreicht werde. Der Eingriff habe erhebliches Gewicht. Zwar erhielten Angehörige des MfS/AfNS seit dem 1. 1. 1992 eine Rente der GRV, die der Dynamisierung unterliegt, und damit einen gewissen Ersatz für die in der DDR bezogene Versorgungsleistung. Jedoch werde vielen Versorgungsempfängern ein Teil dieser Leistung in Höhe der Differenz zwischen dem ursprünglichen Zahlbetrag und dem Höchstbetrag endgültig vorent64 65 66 67 68
Ebd., S. 151 f. Ebd., S. 181 ff. Ebd., S. 138, 195. Ebd., S. 182 f. Ebd., S. 184, mit Verweis auf BVerfGE 100, 32 ff.
III. Grundrechtsschutz der Zusatz- und Sonderversorgungsberechtigten
129
halten. Eine spätere Nachzahlung des Differenzbetrages sei gesetzlich nicht vorgesehen.69 Die Höchstbetragsregelung verändere nachträglich und verletze die Zahlbetragsgarantie, der Eigentumsschutz zukomme.70 Die Begrenzungsregelung bewege sich nicht mehr im Rahmen des Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG. Die vom Gesetzgeber genannten Gründe seien nicht überzeugend.71 4. Versicherungsbiographie72 Die Verfassungsbeschwerde hatte insoweit Erfolg, als 1 der Beschwerdeführerin für längere Zeit der im EV garantierte Zahlbetrag nur in nomineller Höhe geleistet wurde, ohne dass er – wie es für Bestandsrentner mit Ansprüchen aus der Sozialpflichtversicherung und der FZR vorgesehen war – ab 1. 1. 1992 an die Lohn- und Gehaltsentwicklung angepasst wurde73 (Verletzung des Art. 14 Abs. 1, 3 Abs. 1 GG)74 und 2 sich eine Benachteiligung für Bestandsrentner mit Zusatz- und Sonderversorgung gegenüber jenen aus der Sozialpflichtversicherung und der FZR insofern ergibt, dass bei der Neuberechnung ihrer Renten die während der gesamten Versicherungszeit bezogenen tatsächlichen Arbeitsentgelte oder -einkommen berücksichtigt werden, während Grundlage der für die sonstigen Rentner im Beitrittsgebiet erfolgenden Umwertung nach § 307 a Abs. 2 Satz 1 SGB VI günstigere Zeitraum der letzten 20 Arbeitsjahre maßgeblich ist. Neue Regelungen seien unter Berücksichtigung des § 307 a SGB VI bis zum 1. 7. 2001 zu schaffen.75
III. Grundrechtsschutz der Zusatzund Sonderversorgungsberechtigten Staatsvertrag und Einigungsvertrag bieten die Grundlage dafür, dass die in den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen Versicherten auch unter dem Grundgesetz für ihre einmal in der DDR erworbenen Ansprüche/Anwartschaften den Schutz der dafür für Eigentum und Freiheit76 geltenden Grundrechte genießen. 69
Ebd., S. 184, mit Verweis auf BVerfGE 100, 49 f. Ebd., S. 187, mit Verweis auf BVerfGE 100, 31 ff., 41, 49 f. 71 Ebd., S. 187 ff. – Darstellung des Urteils auch bei K.-H. Christoph/W. Mäder, Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/SGB 4/2005, S. 195 (205 – 207). 72 BVerfGE 100, S. 104 – 137. 73 Ebd., S. 126. 74 Hierzu BVerfGE 100, 1 [43 f.] – Leiturteil. 75 Ebd., S. 126 ff. 136. 76 „… Denn die Persönlichkeit macht die Grundbestimmung des Rechts aus: sie tritt hauptsächlich im Eigentum ins Dasein, …“. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke 12, Suhrkamp: Frankfurt am Main 1970, S. 340. 70
130
I. Zwischenbilanz 1991/1993
Das Bundesverfassungsgericht hat anfangs dies in seinen Grundsatzurteilen bestätigt und sich zu Art. 14 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 sowie Art. 2 Abs. 1 GG geäußert.77 Allerdings hat das BVerfG in seinen vier Grundsatzurteilen vom 28. 4. 199978 Fragen offen lassen müssen, die der Bundesgesetzgeber zu Lasten der Betroffenen geregelt hat.
77
BVerfGE 100, 1 ff.; 59 ff.; 104 ff.; 139 ff. und BVerfGE 95, 267 – Altschulden – zu Art. 2 Abs. 1 GG – Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mit dem Schutz der freien Entfaltung der Persönlichkeit und der allgemeinen Handlungsfreiheit (S. 303 f.). 78 BVerfGE 100, 1 ff.
J. Wende rückwärts II Obwohl das Konzept des RÜG, das die Herstellung der vom Einigungsvertrag gewollten einheitlichen Rechtsordnung zur Alterssicherung in Deutschland und die schrittweise Angleichung der Alterseinkommen sowie des Lebensniveaus der Rentner/Ruheständler Ost an West abweichend vom Titel des Gesetzes verhindert, spätestens mit den Urteilen des BVerfG vom 28. 4. 1999 gescheitert war,1 hielten Regierung und Legislative unverrückbar an dem gescheiterten Konzept fest, wissend, dass sie durch den Präsidenten des BVerfG Papier Rückendeckung erhalten würden, der zwar von der Mitwirkung an den Urteilen vom 28. 4. 1999 ausgeschlossen war, später jedoch als Vorsitzender des für die Rentenüberleitung Ost zuständigen 1. Senats wieder mitwirkte und in zahlreichen Verlautbarungen sich gegen die Grundsatzurteile gewandt hatte.2
I. Bundesgesetzgebung II Dies spiegelt sich in der weiteren Gesetzgebung und späteren Gerichtsentscheidungen wider. 1. Das AAÜG-Änderungsgesetz (AAÜG-ÄndG) von 1996 Noch vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. 4. 1999 (BVerfGE 100, 59: Staats- und Systemnähe) wurde das Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG-ÄndG) vom 11. 11. 19963 erlassen, das die Vorschriften des § 6 Abs. 2 und 3 für Bezugszeiten ab dem 1. 1. 1997 zugunsten der Betroffenen änderte. Es war nicht Gegenstand des vorgenannten Urteils. Abgesehen von den hauptamtlichen Mitarbeitern des MfS/AfNS sind nach diesem Gesetz von Kürzungen „nur“ Angehörige „staats- und systemnaher“ Zusatz- und Sonderversorgungssysteme in einkommensmäßig „privilegierter“ Stellung und Personen in „staats- oder systemnahen“ Funktionen mit einer angeblich ebenfalls einkommensmäßig besonders hervorgehobenen Stellung. Das im Nebel liegende 1
Michael Mutz, Aufstieg und Fall eines Konzepts, in: DAngVers. 11/1999, S. 509 ff.; ders., Aktiv im Ruhestand, 9/1999: „Am Ende ein Fiasko“. Die Gerichte haben das RÜG zerpflückt: „Der Gesetzgeber steht vor einem Scherbenhaufen.“ 2 Hierzu K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, 1. Aufl., 2010, S. 98 ff. 3 BGBl. I S. 1674.
132
J. Wende rückwärts II
Ziel, „überhöhte Leistungen abzubauen“, sollte dadurch erreicht werden, dass das Einkommen, ab dem eine Entgeltbegrenzung stattfindet, durch die Gehaltsstufe E 3 (ab 1985: Gehaltsstufe 12) einschließlich Aufwandentschädigung bestimmt wurde. Ist diese Gehaltsstufe erreicht oder überschritten, wird als Arbeitsentgelt das durchschnittliche Jahreseinkommen der Beschäftigten in der DDR zugrunde gelegt. Ein Gehalt dieser Stufe bezog z. B. ein Hauptabteilungsleiter im zentralen Staatsapparat der DDR. Der Hauptabteilungsleiter stand in der Verwaltungshierarchie direkt unterhalb des Staatssekretärs. Die jährlichen Werte dieser Gehaltsstufe waren in der neuen Anlage 4 zum AAÜG festgelegt. Damit wurde das berücksichtigungsfähige Arbeitsentgelt/-einkommen nur noch für Personen begrenzt, die aufgrund der Wahrnehmung politischer Verantwortung oder Mitverantwortung in der DDR ein „besonders hohes, privilegiertes Einkommen“ erzielt hatten.4 Wird die Gehaltsstufe erreicht oder überschritten, wird der Rentenberechnung das durchschnittliche Jahresarbeitseinkommen der Beschäftigten in der DDR zugrunde gelegt. Schon bei den parlamentarischen Beratungen wurde gegen die Regelung eingewandt, der Begrenzung liege weiterhin ein sehr grober Kürzungsmechanismus zugrunde. Die Abgrenzung des betroffenen Personenkreises sei nicht überzeugend gelungen.5 Die zahlreichen Änderungsanträge konnten sich aber nicht durchsetzen.6 2. Das 2. AAÜG-Änderungsgesetz von 2001 Durch das 2. AAÜG-Änderungsgesetz (2. AAÜG-ÄndG) vom 27. 7. 20017 kam der Gesetzgeber der Aufforderung des Bundesverfassungsgerichts aus seinem Urteil vom 28. 4. 19998 nach, die von ihm für verfassungswidrig und nichtig erklärten Regelungen des AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG von 1991/19939 zu ändern. Die Neuregelung sieht vor, dass die zum 1. 1. 1997 durch das AAÜG-Änderungsgesetz von 1996 erfolgte Anhebung der Entgeltbegrenzungsstufe rückwirkend zum 1. 7. 1993 in Kraft tritt (Art. 13 Abs. 7 des 2. AAÜG-ÄndG). Auch diese Regelung war im Gesetzgebungsverfahren umstritten.10 Die Diskussion führte insbesondere dazu, dass die Änderung des AAÜG mit einer Ver-
4 Vgl. Gesetzentwurf der BReg. zum AAÜG-ÄndG, BT-Drs. 13/4587, S. 8; Beschlussempfehlung und Bericht des AS-Ausschusses vom 25. 9. 1996, BT-Drs. 13/5606, S. 16. 5 Vgl. Äußerung des Abgeordneten Mascher, 108. Sitzung des 13. Deutschen Bundestages vom 24. 5. 1996, StenBer. 13/108, S. 9585 f.; vgl. zur Diskussion auch Beratung des ASAusschusses des BT, BT-Drs. 13/5606. 6 Vgl. BT-Drs. 13/5626, 13/5628, 13/5629 – 13/5652. 7 BGBl. I S. 1939. 8 BVerfGE 100, 1. 9 Hierzu oben unter J. II. 2. a). 10 Vgl. 161. Sitzung des BT vom 29. 3. 2001, StenBer. 14/171, S. 16771 bis 16779; BRDrs. 3/2/01; BT-Drs. 14/6106, S. 2; 14/6088; 14/6092.
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2004/2005
133
besserung der Rechte der Opfer des SED-Regimes verknüpft wurde.11 Obwohl der Gesetzgeber betonte, den Entscheidungen des BVerfG und dessen Vorgaben für eine verfassungskonforme Regelung zu folgen, geschah dies nur vermeintlich. Der grobe, nicht an Tatsachen orientierte Kürzungsmechanismus wurde beibehalten, und man meinte, diesen durch Koppelung mit einer Verbesserung der Opfer politischer Verfolgung überspielen zu können. Regierung und Gesetzgeber wähnten sich sicher, konnten sie sich doch wieder auf Papier berufen, der auch dem Änderungsgesetz Verfassungsmäßigkeit bescheinigte.12
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2004/2005 1. Staats- und Systemnähe Das Bundesverfassungsgericht hat im Anschluss an BVerfGE 100, 59 (Staats- und Systemnähe) durch Beschluss vom 23. 6. 200413 erneut § 6 Abs. 2 i.V. mit den Anlagen 4 und 5 und § 6 Abs. 3 Nr. 8 AAÜG i. d. F. des AAÜG-Änderungsgesetzes von 1996 und des 2. AAÜG-Änderungsgesetzes von 2001 mit Art. 3 Abs. 1 GG für unvereinbar erklärt, mit der Folge, dass die Vorschriften nicht mehr angewendet werden dürfen. Es hat den Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 30. 6. 2005 eine verfassungsgemäße Regelung zu treffen.14 Der Gerichtspräsident war von der Mitwirkung an der Entscheidung wegen Besorgnis der Befangenheit ausgeschlossen.15 Das Gericht erinnert an seine im Urteil vom 28. 4. 199916 in Bezug auf die Entgeltbegrenzung in § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG 1993 bereits konkretisierten Grundsätze zum Gleichheitsgebot. Diesen Maßstäben werde auch die Neuregelung nicht gerecht. Mit ihr sei bei gleich bleibendem Mechanismus ohne tatsächliche weitere Erkenntnis lediglich die benachteiligte Gruppe verkleinert, der Kürzungsmechanismus allerdings vergrößert worden.17 Der Gesetzgeber habe die in den zur Prüfung gestellten zwei Kriterien, die nach der Entscheidung BVerfGE 100, 59 [93 ff.] unzulässig differenzieren, nicht in verfassungskonformer Weise abgewandelt, sondern nur eines der beiden – die Höhe des Arbeitsentgelts – in der Wirkung abgemildert.18 Die Abgrenzung der Berechtigten nach ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Zusatzversorgungssystemen sei unverändert geblieben. Bei den Zusatzversorgungssystemen, die weiterhin Kürzungen bei den Betroffenen auslösen, sei die maßgebende Einkommensgrenze zwar großzügiger festgelegt, beruhe aber nicht auf 11 Vgl. Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses, BT-Drs. 14/6355; vgl. auch 764. Sitzung des BR vom 1. 6. 2001, StenBer. S. 261 f. – Änderung des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes. 12 Vgl. hierzu oben unter J. II. 2. a). 13 BVerfGE 111, 115. 14 Ebd., S. 116. 15 BVerfG, Beschl. vom 17. 9. 2003 – 1 BvL 3/98, 1 BvL 9/02, 1 BvL 2/03. 16 BVerfGE 100, 59 [90 ff.]. 17 BVerfGE 111, 115 [139]. 18 Ebd., S. 140 f.
134
J. Wende rückwärts II
sachgemäßen Erwägungen. Auch für die nunmehr maßgebliche Gehaltsstufe E 3 (ab 1985: Stufe 12) bleibe offen, wie diese Anknüpfung zu begründen ist. Der Gesetzgeber komme damit der Wirklichkeit nicht näher, weil auch diese Anknüpfung nicht von Erkenntnissen über eine strukturelle Erhöhung von Gehältern getragen werde. Die unzulässige Gleichstellung von „hohen Einkommen“ und „überhöhten Einkommen“ bestimme weiterhin das Konzept der neu gefassten Vorschriften.19 Erkenntnisse darüber, dass gerade in den betroffenen Versorgungssystemen ab Überschreiten der Gehaltsstufe E 3 überhöhte, weil nicht mehr leistungsorientierte Entgelte erzielt wurden, seien nicht verfügbar.20
Der 50-seitige Beschluss zieht lediglich die Folgerung, dass der Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG verletzt ist. Deshalb, so das BVerfG, erübrige sich eine Prüfung anhand des Art. 14 Abs. 1 GG.21 Andererseits verweist es auf seine Entscheidung BVerfGE 100, 59 [97 f., 101],22 mit der es festgestellt hat, dass § 6 Abs. 2 und § 6 Abs. 3 Nr. 7 AAÜG i. d. F. des Rü-ErgG von 1993 das Eigentumsrecht des Art. 14 Abs. 1 GG verletzt. Das Gericht umgeht die brisante Eigentumsfrage, mit dem Schatten des in diesem Verfahren ausgeschlossenen Präsidenten Papier, der – entgegen BVerfGE 100, 1 – den DDR-Bürgern jeglichen Eigentumsschutz für ihre in der DDR erworbenen Alterssicherungsansprüche abspricht,23 so dass es ihm Raum gibt, seine Ansicht in späteren von ihm geleiteten Verfahren doch wieder durchzusetzen, was auch dann geschah. Das Gericht hätte hingegen durch eine weitere Klärung der Eigentumsfrage nachhaltig dazu beitragen können, die Grundsatzprobleme endlich zu klären, die verfassungsrechtlich auch 21 Jahre nach In-Kraft-Treten des Renten-Überleitungsgesetzes noch offen waren (so Fragen des Eigentumsschutzes für Alterssicherungsansprüche aus der DDR, des Bestands- und Vertrauensschutzes für Zugangsrentner, denen die Zahlbetragsgarantie und Vergleichsberechnung verweigert werden, der Dynamisierung Ost, der Auffüllbeträge, der Zusatzversorgung für jene, die nicht in die VBL oder andere Versorgungssysteme aufgenommen wurden, des Faktors „1,5“ für ehemalige Reichsbahner und viele andere mehr). Das hätte zur Herstellung des Rechtsfriedens im Beitrittsgebiet beitragen können für jene, die ihre Ansprüche in der DDR erworben haben.24 Das BVerfG hat zwar beanstandet, dass seine damaligen Feststellungen in den Grundsatzurteilen vom 28. 4. 1999 von der Regierung und vom Gesetzgeber nicht beachtet worden sind und dadurch das 2. AAÜG-ÄndG von vornherein verfassungswidrig angelegt worden war. Sie hätten beim 2. AAÜG-ÄndG ihre Verant19
Ebd., S. 141 f. Ebd., S. 141. 21 Ebd., S. 145. 22 Ebd., S. 145. 23 Hans-Jürgen Papier, Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, Rechtsgutachten 1994. 24 Besprechung des Beschlusses des BVerfG vom 23. 6. 2004 bei K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 223 – 231. 20
II. Das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2004/2005
135
wortung nicht wahrgenommen, verfassungskonforme Vorschriften zu schaffen.25 Das Hin – und – Her in der mittlerweile zum „Trauerspiel“ gewordenen Versorgungsüberleitung Ost ist weitergegangen. 2. Hin – und – Her So wirkte der Richter Papier in Folgeverfahren wieder mit, so, als sei nichts gewesen, setzte sein Gutachten zur Eigentumsfeindlichkeit um in neue Entscheidungen, obwohl der Senat ihm in seinen Grundsatzentscheidungen von 1999, an denen er nicht mitgewirkt hat, nicht gefolgt ist, behauptet einfach, jene stünden nicht im Widerspruch zu diesen. Außerdem waren die Richterkollegen im 1. Senat des BVerfG, was den Ausschluss des Richters Papier betrifft, eher aus kollegialer Rücksicht und im Hinblick auf den Schein der Würde des obersten Richters zurückhaltend. Sie umgingen das Problem, indem sie als Kriterium die sachliche Nähe oder Ferne seines Parteigutachtens zu dem jeweiligen Gegenstand der zu treffenden Entscheidung herbeibemühen, obwohl das Gutachten in seiner Rigorosität Geltung für alle Versorgungs- und Alterssicherungsansprüche aus der DDR unbedingt beansprucht.26 So war der Richter in allen Fällen der Versorgungsüberleitung Ost unmittelbar oder kraft seines Einflusses präsent.27 So konnte die Bundesregierung mehrfach die Meinung äußern, dass alles in Ordnung sei und es keinen Gesetzgebungsbedarf gäbe.28 Die Staatsgewalt befolgt nicht die Grundsatzurteile des 1. Senats des BVerfG bzw. kommt diesen nur zögerlich und nur soweit nach, soweit Korrekturen nur unbedingt minimalistisch unvermeidbar sind, lässt die wissenschaftliche Literatur gänzlich außer acht, die die Rechte der Betroffenen stützt, und hält einseitig an der verfehlten „Systementscheidung“ und dem Konzept von Papier zum Rentenüberleitungsgesetz fest. Es erweist sich, dass den historisch zu nennenden Grundsatzurteilen vom 28. 4. 199929 unter Vorsitz des Bundesverfassungsrichters Grimm die notwendige Durchschlagskraft gegen die geballte Staatsgewalt fehlt. „Den Senatsurteilen wurde der Gehorsam verweigert.“30 Während noch der Beschluss des BVerfG vom 23. 6. 25 BVerfG, Beschl. vom 23. 6. 2004, zu C. I. 1 bis 4. – Zu weiteren Gründen des Beschlusses vgl. die Darstellung bei K.-H. Christoph/W. Mäder, Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/SGB 4/2005, S. 209 f. 26 H.-J. Papier, Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG), 1994 (Rechtsgutachten, erstattet im Auftrag der Bundesregierung). 27 Zur Befangenheit eines Richters grundsätzlich auch BVerfGE 20, 1 [5]; 20, 9 [16 f.]; 35, 171 [174]; 35, 246 [251 f.]. 28 Vgl. z. B. Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE, BT-Drs. 16/5418, S. 33 – 34 zur Frage 64. 29 BVerfGE 100, 1. 30 Jan Thiessen, Zahlbetragsgarantie und Rentendynamisierung, in: NJ 9/2000, S. 456 ff.
136
J. Wende rückwärts II
200431 hinter dem Leiturteil vom 28. 4. 199932 relativierend zurückbleibt, versagt das Gericht in späteren Entscheidungen den Betroffenen jeglichen Grundrechtsschutz. 3. Balletttänzer/innen Nach einer halben Wende vorwärts macht das Bundesverfassungsgericht, wieder unter Vorsitz von Papier eine Wende rückwärts. In einer späteren Entscheidung von 2005 spricht es den Bestandsrentnern aus dem Zusatzversorgungssystem für Balletttänzer jeglichen Eigentumsschutz ab.33 Es scheut sich nicht, diese mit rentenstrafrechtsähnlichen, höchst diskriminierenden Äußerungen zu bedenken, wenn es deren Versorgung als „eine besondere Begünstigung für eine bestimmte Berufsgruppe“ wahrheitswidrig einstuft.34 Auch hier kommt unterschwellig die Siegermentalität zum Ausdruck, dass die im „Unrechtsstaat DDR“ Tätigen nichts zu beanspruchen hätten. 4. Auffüllbeträge In einer weiteren Entscheidung unter Vorsitz von Papier aus dem Jahre 200535 zum „Auffüllbetrag“ betont es zwar für die Bestandsrentner aus der Sozialversicherung der DDR und der FZR grundsätzlich die Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 GG, öffnet jedoch die Hintertür und entwertet diese Position dadurch, dass es die Zahlbetragsgarantie in einen statischen Auffüllbetrag ohne Angleichung an die Einkommensentwicklung Ost umwertet. Das BVerfG hat alle Verfassungsbeschwerden zurückgewiesen.36
31
BVerfGE 111, 115. BVerfGE 100, 1. 33 BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95 u. a. (Balletttänzer), abgedr. bei W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 171 ff.; auch in: NJ 2002, S. 568. – Massive Kritik in: W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 110 ff.; vgl. auch Werner Mäder, Wende rückwärts. Das BVerfG und die berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder der DDR, in: NJ 3/2003, S. 124 f. 34 Siehe bei W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 171 (176). 35 BVerfG, Beschl. vom 11. 5. 2005 – 1 BvL 368/97, 2300/98, 2144/00 -, in: NJW 31/2005, S. 2213. 36 Besprechung der Entscheidung und Kritik bei W. Mäder/J. Wipfler, „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 11/2005, S. 651 (657 f.). 32
K. Rentenstrafrecht Ein Kernstück der sog. „Systementscheidung“ zur Rentenüberleitung bilden die gemeinhin als „Rentenstrafrecht“ bezeichneten Maßnahmen gegen Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit/Amtes für Nationale Sicherheit (MfS/AfNS).
I. Politische Vorgaben Die Zusatzversorgung der DDR sollte den Berechtigten einen prozentualen Teil des zuletzt erzielten Nettoeinkommens – in der Regel 90 v.H. – unter Anrechnung der Altersrente aus der allgemeinen Sozialpflichtversicherung sichern. Die Rentenhöhe aus der Sonderversorgung betrug grundsätzlich 90 v.H. der letzten Nettobesoldung.1 Der Bundesgesetzgeber hat die in der DDR erworbenen Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Sonderversorgungssystemen unter Bruch des Staatsvertrages und des Einigungsvertrages liquidiert, nicht „überführt“.2 Hier sah die Bundesregierung nach 1990 ein erhebliches Einsparpotential. Denn nach ihrer Lesart handelte es sich bei der DDR um einen totalen „Unrechtsstaat“. Folglich waren seine Institutionen „staatsnah“ und „Stützen der Diktatur“ – bis hin zu den Künstlern und Ballettmitgliedern, weshalb sie beispielsweise keinen Anspruch auf die in der DDR erworbenen Rechte hätten, unabhängig davon, dass viele nicht einmal in der SED Mitglied gewesen sind. Kein DDR-Bürger sollte in der DDR erworbene Zusatzrenten oder Versorgungsansprüche in die Bundesrepublik mitnehmen dürfen.3 Mit der These vom „Unrechtsstaat“ und von der „Zweiten deutschen Diktatur“ sowie mit den damit verbundenen Absichten setzt sich Hartmann auseinander.4 Er benennt als eine Quelle den damaligen Justizminister Kinkel,5 der 1991 den Richtern und Staatsanwälten vorgab: „Ich baue auf die deutsche Justiz. Es muss gelingen, das 1
D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, S. 13 f., 14 f., 143. Ebd., S. 107 ff., zu dem, was mit „Überführung“ im rechtlichen Sinne gemeint ist. 3 K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 10. 4 Ralph Hartmann, DDR-Legenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, Berlin 2009. 5 Klaus Kinkel, früher nicht sehr erfolgreicher Chef des BND und Flügelmann für den Bruch des Einigungsvertrages ist wie Professor Baring, der die DDR-Bürger u. a. als „deutschsprachige Polen“ diffamierte, ein Schüler von Kissinger und Vorkämpfer des Antikommunismus. Er wirkte nachhaltig auf für DDR-Bürger negative Regelungen im Einigungsvertrag ein und betrieb intensiv den Bruch jener Bestimmungen, die die Grund- und Menschenrechte der Bürger aus der DDR schützen sollten. 2
138
K. Rentenstrafrecht
SED-System zu delegitimieren, das bis zum bitteren Ende seine Rechtfertigung aus antifaschistischer Gesinnung, angeblich höheren Werten und behaupteter absoluter Humanität hergeleitet hat, während es unter dem Deckmantel des Marxismus-Leninismus einen Staat aufbaute, der in weiten Bereichen genauso unmenschlich und schrecklich war wie das faschistische Deutschland.“ Hartmann stellt dazu fest: „Selten hat ein Mitglied der Bundesregierung die enge Verbindung zwischen der Gleichsetzung von NS-Regime und Unrechtsregime der DDR sowie Delegitimierung, Kriminalisierung der DDR und politischer Strafverfolgung so offen und präzise dargelegt wie Kinkel.“ Hartmann erläutert die Kinkelschen Positionen zu den Grundfragen dieser Politikrichtung und zum Bruch des Einigungsvertrages sowie des Grundgesetzes und legt auch andere aus dem Faschismus herrührende Quellen solcher Positionen offen.6 Das auf die Kategorien „Unrechtsstaat“, „Täter“ und „Opfer“ reduzierte Denken ist auch unter den Abgeordneten verbreitet. Maria Michalk (MdB – CDU/CSU) gibt als Ursache der vom Rentenüberleitungsgesetz geschaffenen Ungerechtigkeit im Alterssicherungssystem Ost das „Unrecht der DDR“ an.7 Sie geht offensichtlich von der These aus, dass die DDR ein Unrechtsstaat mit – auch über das Rentenrecht!! – zu bestrafenden Tätern gewesen wäre. Die gewaltige Enteignungsaktion betrifft alle Rentengruppen aus der DDR. Das sind jene, die bereits Renten vor 1991 bezogen haben, denen aber sukzessive die Bezüge „abgeschmolzen“ wurden, weil der Gesetzgeber ihnen nach und nach umgewertete und „angepasste“ Renten zuerkannte, in denen Kriterien aus der DDR ignoriert wurden. Das gilt auch für die zweite Gruppe, die nach 1971 ins Arbeitsleben eintrat. Für sie wurde eine besondere Beitragsbemessungsgrenze Ost geschaffen, die von einem Einkommen von monatlich 600 Mark ausging. Zudem wurde das Arbeitsjahr für den DDR-Bürger (Entgeltpunkte) wesentlich niedriger bewertet als das Arbeitsjahr für Westdeutsche. Zusätzliche Rechte aus den Zusatzversorgungs- und Sonderversorgungssystemen wurden liquidiert.8 Das alles konnte auch deshalb geschehen, weil mit dem Untergang der DDR 1990 auch der Vertragspartner des Staats- und des Einigungsvertrages auf Seiten der DDR weggefallen war, der über die Einhaltung der Verträge hätte wachen können, so dass die Bundesregierung schalten und walten konnte wie sie wollte, und die Gerichte unter Führung des Bundesverfassungsgerichts deren Position übernommen haben.
6 R. Hartmann, DDR-Legenden …, S. 11 – 24. – Schon Paul Spiegel hatte „die Deutschen“ als „das Volk der Täter und deren Nachkommen“ bezeichnet: Paul Spiegel, Was ist koscher? Jüdischer Glaube – Jüdisches Leben, 3. Aufl., München 2003, S. 301. 7 StenBer., 224. Sitzung des BT vom 28. 5. 2009, S. 24599 f. 8 Zur politisch motivierten Entwertung vgl. K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 10 – 24.
II. Verfassungswidrigkeit der Renten„konfiskation“
139
II. Verfassungswidrigkeit der Renten„konfiskation“ Unbeschadet des rechtsstaatlichen Prinzips „nulla poena sine culpa“ ist die Aberkennung oder Kürzung von Renten als quasi-pönale Maßnahme verfassungswidrig, weil Rentenansprüche und -anwartschaften als öffentlich-rechtliche Rechtspositionen eigentumsrechtlich insbesondere dann geschützt sind, wenn sie das „Äquivalent einer Leistung“ sind.9 Da der Gesetzgeber pönale und quasi-pönale Sanktionen nur im Rahmen und nach Maßgabe der Verfassung verhängen darf,10 ist eine von der Eigentumsgarantie nicht gedeckte Entziehung des Eigentums als Strafe nach Art der früher üblichen Konfiskation unter dem Grundgesetz verfassungswidrig.11 Die Konfiskation unterscheidet sich von der Enteignung nicht nur durch die fehlende Entschädigung, sondern vor allem durch die Zielrichtung. Die Enteignung verfolgt einen objektiven Zweck. Sie richtet sich gegen das Eigentumsobjekt, weil dies „zum Wohle der Allgemeinheit“ benötigt wird (Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG). Deshalb ist die Person des Eigentümers für die Enteignung irrelevant, weil primär die Eigentumserlangung, nicht aber die Eigentumsentziehung gewollt und vom Gemeinwohl gefordert ist. Demgegenüber ist die generelle oder spezielle, überwiegend politisch motivierte Konfiskation subjektiv zielgerichtet. Sie wendet sich gegen den Eigentümer, und ihr Hauptzweck ist die Entziehung, die durch Gesetz oder administrativen Einzelakt erfolgt. Dabei wird die Personengerichtetheit mitunter durch eine scheinbar objektivbezogene Argumentation verschleiert.12 Der Wunsch nach Vergangenheitsbewältigung vermag den Zugriff auf die Renten nicht zu legitimieren. Überhaupt ist zu fragen, ob Bundesregierung oder Bundestag dazu berufen sind, die Vergangenheit der immerhin als Staat anerkannten und insoweit souveränen DDR zu „bewältigen“, hätte doch die politische Klasse immerhin noch viel Eigenes in der Bundesrepublik zu bewältigen.13 In erster Linie ist es den
9 Vgl. BVerfGE 14, 288 [293]; 22, 241 [253]; 24, 220 [226]; 53, 257 [289 ff.]; 55, 114 [131]; 58, 81 [109]. 10 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 29 f. 11 Zur Konfiskation der Bodenreform „Junkerland in Bauernhand“ in der sowjetisch besetzten Zone vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, in: ZFSH/SGB 12/2009, S. 707, 716 ff., m.w.N. 12 D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 25 ff., 33 ff., 41 ff. 13 Thor von Waldstein, Totalitärer Liberalismus?, in: Deutschland in Geschichte und Gegenwart (DGG) 2/2012, S. 2 – 11; Wolfgang Sofsky, Verteidigung des Privaten, Bonn 2007, S. 136 f.; Johann Braun, „Unsere Wirklichkeit“, in: Gegengift-Zeitschrift für Politik und Kultur vom 1. 1. 2010, S. 14; ders., Wahn und Wirklichkeit – über die innere Verfassung der Bundesrepublik, Tübingen 2008; Hannes Hofbauer, Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung – Rechtssprechung als politisches Kampfinstrument, Wien 2011, insbes. S. 224 ff.; Günter Jacobs, Feindstrafrecht – Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit, in: HRRS (www.hrr-strafrecht.de), August/September 2006, S. 295; H. H. von Arnim, Die Deutschlandakte, 2011.
140
K. Rentenstrafrecht
Menschen aus der DDR vorbehalten, sich dieser Aufgabe zu stellen. Der Rechtsstaat verbietet jede Form der Kollektiv- oder Gruppenschuld. Schuld bedingt individuelle Verantwortung für rechtswidriges Verhalten und individuelle Vorwerfbarkeit. Die Versorgungsüberleitung des RÜG hat auf Grund bloßer und angeblicher „Staats- oder Systemnähe“, verstehe jeder darunter, was er will, die teilweise mit der Höhe des Einkommens begründet wurde, ganzen Gruppen von Versorgungsberechtigten ein Täter-Merkmal aufgedrückt. Die bei der Gesetzesbegründung angeführte Einrede, man könne den „Opfern“ nicht zumuten, dass die „Täter“ eine höhere Rente erhielten, setzt die Feststellung individueller Täterschaft in einem rechtsstaatlichen Verfahren voraus.14 Mangels unredlichen Verhaltens in einem sozialrechtlichen Verfahren sind Rentenkürzungen auch nicht unter dem Gesichtspunkt einer Renten„verwirkung“ gerechtfertigt. Die Renten„konfiskation“ verstößt gegen die grundgesetzliche Eigentumsgarantie, die lediglich die herkömmlichen Strafen des Verfalls und der Einziehung akzeptiert. Selbst die nicht unproblematische Vermögensstrafe (§ 43 a StGB) kann nur nach Feststellung individueller Schuld in einem strafgerichtlichen Verfahren verhängt werden.15 Aufgabe des Sozialversicherungsrechts ist es, Versicherte vor elementaren Lebensrisiken zu sichern, nicht, Unrecht zu sühnen oder Lebensführungsschuld zu sanktionieren. Die sittliche Qualität versicherungspflichtiger Tätigkeit mit deren gesellschaftlicher Qualifizierung ist grundsätzlich irrelevant. In dieser Hinsicht ist das Sozialversicherungsrecht „wertneutral“ und moralisch indifferent. Von diesen Prinzipien hatten sich nur Nationalsozialismus und Besatzungsrecht entfernt. Jedoch wurden Angehörige der Gestapo, die von Ansprüchen auf Grund des Ausführungsgesetzes zu Art. 131 GG ausgeschlossen waren, in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichert, so dass sie eine Rente unter Berücksichtigung ihrer Bezüge bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhielten.16 Dem Sozialversicherungsrecht sind die Kategorien „Täter“ und „Opfer“ unbekannt, weil es nur zwischen „Versicherten“ und „Nichtversicherten“ differenziert. Kann schon das Strafrecht nicht verhindern, dass Täter nach ihrer Verurteilung bessergestellt sind als ihre Opfer, so ist erst recht dem Sozialversicherungsrecht eine derartige Wiedergutmachungsfunktion fremd. Rentenleistungen bemessen sich nicht nach Gesetzestreue oder Gesetzesfeindschaft des Versicherten. Nimmt es die Rechtsordnung hin, dass ein verurteilter Täter eine höhere Rente als sein Opfer bezieht, so kann sie nicht Rentenkürzungen bei bloß vermuteter Täterschaft verhängen.17
14 15 16 17
D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 25 – 39, 144 f. Ebd., S. 39 – 48, 145. Siehe hierzu auch K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 11 ff. D. Merten, Verfassungsprobleme …, S. 48 – 67, 145.
III. Systemwidrigkeit
141
III. Systemwidrigkeit des Anspruchsund Anwartschaftsüberführungsgesetzes Misst man insbesondere §§ 6, 7 AAÜG an dem Grundsatz der „Wertneutralität“ des Sozialversicherungsrechts, zeigt sich, dass der Gesetzgeber sein System nicht infolge einer Neubewertung auf Grund gewandelter Verhältnisse grundlegend geändert hat, sondern es nur für die Angehörigen der Versorgungssysteme der DDR durchbricht. Verfassungswidrig ist das Gesetz nicht wegen einer Aufgabe, sondern wegen der Durchbrechung des Prinzips der „Wertneutralität“.18 Lässt grundsätzlich selbst eine rechtskräftige Verurteilung wegen schwerer Straftaten sozialversicherungsrechtlich Ansprüche und Anwartschaften unberührt, so führte die bloße Zugehörigkeit zum Versorgungssystem des MfS/AfNS der DDR gemäß § 7 i.V.m. Anl. 5 AAÜG zu einer Reduzierung erworbener Versorgungsansprüche bis unter das Niveau einer Rente nach Mindesteinkommen, wobei mangels Feststellung individueller Schuld die bloße „Systemnähe“ ausreicht. Da es ähnlich wie bei der Bewertung „leitender Funktionen“ nach § 6 Abs. 3 AAÜG letztlich um politische Missliebigkeit geht, kann unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten mangels Klärung in einem fairen Verfahren das Gewicht dieser Durchbrechung des Sozialversicherungssystems, insbesondere seines Grundprinzips moralischer Indifferenz, die Schwere der Intensität der getroffenen Ausnahmeregelungen nicht rechtfertigen.19
IV. Eigentum im Völkerrecht Das Rentenüberleitungsgesetz verstößt nicht nur gegen nationales (Verfassungs-) Recht, sondern auch gegen Völkerrecht. Im Jus publicum Europaeum, dem (klassischen) europäischen Völkerrecht, bestand seit jeher Einmütigkeit, dass im Falle einer „Landnahme“, territorialen Veränderung oder Staatensukzession der Grundsatz der Respektierung privater wohlerworbener Rechte unbedingt gilt.20 Nach dem klassischen Völkerrecht werden Existenz, Leben, Gesundheit, Freiheit, Ehre und Eigentum, Wohnrecht und sogar die bürgerlichen Rechte der einzelnen Bürger weder durch kriegerische Besetzung noch durch Gebietsabtretung in irgendeiner Weise berührt.21
18
Ebd., S. 58. Ebd., S. 58/59. – Ebenso Heinz-Dietrich Steinmeyer, Die deutsche Einigung und das Sozialrecht, in: VSSR 1990, S. 83 (100); vgl. auch Carl Schmitt, Die Tyrannei der Werte, 3. Aufl., Berlin 2011. 20 Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus publicum Europaeum (1950), 4. Aufl., 1997, S. 169; Näheres auf S. 170 f. 21 Otto Kimminich, Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Völkerrechts, Carl Friedrich von Siemens Stiftung (Hrsg.), Themen XXIV, München 1974, S. 19. 19
L. Bundesgesetzgebung III I. Das 1. AAÜG-Änderungsgesetz von 2005 Den Bundesgesetzgeber ficht dies alles nicht an. Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes vom 21. 6. 20051 kam der Gesetzgeber lediglich der Aufforderung des BVerfG nach, die im Beschluss vom 23. 6. 2004 für verfassungswidrig erklärten Vorschriften des § 6 Abs. 2 und 3 AAÜG neu zu regeln. Das Rentenstrafrecht wurde im wesentlichen beibehalten.2 Der von den Kürzungen der der Rentenberechnung zugrundeliegenden Arbeitsentgelte betroffene Personenkreis wurde mit der Neufassung des § 6 Abs. 2 AAÜG wie folgt bestimmt: 1. Mitglied, Kandidat oder Staatssekretär im Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), 2. Generalsekretär, Sekretär oder Abteilungsleiter des Zentralkomitees der SED sowie Mitarbeiter der Abteilung Sicherheit bis zur Ebene der Sektorenleiter oder die jeweiligen Stellvertreter, 3. Erster und zweiter Sekretär der SED-Bezirks- oder Kreisleitung sowie Abteilungs- oder Referatsleiter für Sicherheit oder Abteilungsleiter für Staat und Recht, 4. Minister, stellvertretender Minister oder stimmberechtigtes Mitglied von Staatsoder Ministerrat oder ihre jeweiligen Stellvertreter, 5. Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates, Vorsitzender des Staatsrats oder Vorsitzender des Ministerrats sowie in diesen Ämtern ernannte Stellvertreter, 6. Staatsanwalt in den für vom Ministerium für Staatssicherheit sowie dem Amt für Nationale Sicherheit durchzuführenden Ermittlungsverfahren zuständigen Abteilung I der Bezirksstaatsanwaltschaften, 7. Staatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft der DDR, 8. Mitglied der Bezirks- und Kreis-Einsatzleitung, 9. Staatsanwalt oder Richter der I-A-Senate.
1 2
BGBl. I S. 1672. BVerfGE 111, 115.
I. Das 1. AAÜG-Änderungsgesetz von 2005
143
Danach ist den Pflichtbeitragszeiten als Verdienst höchstens der jeweilige Betrag der Anlage 5 zugrunde zu legen. Gemeint ist damit das in der DDR erreichte Durchschnittseinkommen, dem in der Rentenberechnung jeweils ein Entgeltpunkt je Arbeitsjahr entspricht. § 7 AAÜG ist unverändert geblieben. Danach wird das während der Zugehörigkeit zu den Versorgungssystemen des MfS/AfNS bis zum 17. 3. 1990 maßgebende Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen höchstens bis zum jeweiligen Betrag der Anlage 6 zugrunde gelegt. Die Beibehaltung der bedrückenden Rentenkürzung gegenüber MfS-Angehörigen und ihren Hinterbliebenen hatte das BVerfG bereits mit einer früheren Entscheidung bestätigt.3 Bei ihnen wird zur Rentenberechnung für die Zeit der maßgebenden Beschäftigung höchstens das Durchschnittsentgelt aller Beschäftigten in der DDR berücksichtigt, dem in der Rentenberechnung jeweils maximal 1 PEP-Ost zugrunde liegt. Nachdem das BVerfG schon am 28. 4. 1999 die sog. „Privilegiertentheorie“ als fehlerhaft erkannt hatte und Vorschriften zum Rentenstrafrecht bereits zweimal als verfassungswidrig verworfen hat, wurde es durch eine weitere kuriose gesetzgeberische Fehlleistung durch das 1. AAÜG-ÄndG von 2005 erneut „gerettet“. Die Fehler des Gesetzes kann unschwer feststellen, wer das Gesetz sowie die früheren Positionen des BVerfG prüft und die DDR-Situation kennt. Ein Gesetz, – dessen Titel schon offensichtlich falsch ist – es wäre zumindest das 3. AAÜGÄndG (das 2. AAÜG-ÄndG stammt vom 27. 7. 2001); – mit dem Funktionäre als abstrafungswürdig benannt werden, deren Funktionen es in der DDR nicht gab – es gab keinen „Staatssekretär im Politbüro“; – in dem Aufgaben, die nur als Bestandteil bestimmter Ämter bzw. ehrenamtlich erledigt wurden – Mitglieder der Einsatzleitungen in den Bezirken und Kreisen – als abzustrafende Funktionsausübung bestimmt, und – das rechtsstaatswidrig rückwirkend erhebliche Verschlechterungen von Rechtspositionen verfügt; so wurden Personengruppen mit Rentenkürzungen überzogen, die zuvor vom Rentenstrafrecht nicht betroffen waren und, soweit sie bei Erlass des Gesetzes über einen bestandskräftigen Rentenbescheid verfügten, eigentlich auch nicht mehr bestraft werden durften,4 würde niemand mehr ernst nehmen, wenn es nicht so schlimme Auswirkungen hätte und so hingebungsvoll von eifrigen Beamten umgesetzt wurde.5
3
BVerfG, Beschl. vom 22. 6. 2004 – 1 BvR 1070/02. Zur Un-/Zulässigkeit rückwirkender Gesetze BVerfGE 7, 129 [152]; 11, 64 [72]; 13, 261 [270 f.]. 5 K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 186. 4
144
L. Bundesgesetzgebung III
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“ Die Entscheidungen der Sozialgerichte und des Bundesverfassungsgerichts können widersprüchlicher nicht sein. Recht und Recht sind hier zweierlei. 1. Recht-Sprechung der Sozialgerichte Das SG Berlin vertritt in einer Vorlage vom 9. 6. 20066 an das BVerfG, der sich das Thüringer Landessozialgericht angeschlossen hat,7 die Auffassung, dass § 6 Abs. 2 AAÜG i. d. F. des 1. AAÜG-ÄndG von 2005 i.V. mit Anlage 5 mit seinen Rentenkürzungen für Minister und die anderen dort konkret aufgelisteten Funktionäre nach der Anlage 5 gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG verstößt und deshalb verfassungswidrig ist, weil die Vorschrift gleichheitswidrig gegenüber Rentnern aus der DDR benachteiligt, bei deren Rentenberechnung grundsätzlich die tatsächlich erzielten Arbeitsentgelte bis zur Obergrenze der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigungsfähig sind.8 Es sei kein sachlicher Grund erkennbar, der diese Ungleichheit rechtfertigen könnte. Es sei nicht erkennbar, nach welchen verfassungsrechtlichen Kriterien der Personenkreis des § 6 Abs. 2 AAÜG ausgewählt wurde. Der Gesetzgeber habe zwar verschiedene Merkmale genannt, die zur Bestimmung des Personenkreises geführt haben sollen. Die genannten Merkmale gäben jedoch keine schlüssige Begründung dafür, dass gerade dieser Personenkreis von der Kürzungsregelung erfasst wird. Die genannten Merkmale träfen teilweise auf die erfassten Personen gar nicht zu oder beträfen umgekehrt eine viel größere Anzahl von Funktionären der DDR, die davon nicht erfasst sind. Unabhängig davon seien die genannten Merkmale ohnehin nicht geeignet, einen Eingriff in rentenrechtliche Positionen zu rechtfertigen.9 Der Beschluss lässt an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. Im einzelnen zur Kritik an den Begründungen des Gesetzgebers: a) Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS? Die Auswahl des Personenkreises wurde vom Gesetzgeber im wesentlichen damit begründet, dass insbesondere Funktionäre ausgewählt wurden, „die eine Weisungsbefugnis gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS)“ besaßen.10 Der Gesetzgeber ging allerdings von falschen Voraussetzungen für die Rentenkürzung aus. § 6 Abs. 2 Nr. 4 AAÜG erfasst Minister, stellvertretende Minister – so auch 6
SG Berlin, Vorlagebeschluss vom 9. 6. 2006 – S 35 RA 5653/97 W05. Thüringer Landessozialgericht, Vorlagebeschluss vom 25. 2. 2008 – L 6 R 885/05. 8 SG Berlin, Beschl. vom 9. 6. 2006, S. 16. 9 Ebd., S. 16/17. 10 BT-Drs. 15/5314; vgl. auch BT-Drs. 15/5488. 7
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
145
der Kläger – oder stimmberechtigte Mitglieder des Staats- und Ministerrats oder ihre jeweiligen Vertreter. Abgesehen vom Minister für Staatssicherheit selbst besaß jedoch kein Minister und auch kein Stellvertretender Minister eine Weisungsbefugnis dem MfS gegenüber. Eine solche Weisungsbefugnis besaßen nur das Politbüro der SED als Organ, das Zentralkomitee als Organ sowie der Generalsekretär des Zentralkomitees. Gerade die Zugehörigkeit zum Zentralkomitee der SED ist jedoch von § 6 Abs. 2 AAÜG nicht erfasst, während umgekehrt viele Personengruppen (darunter Minister und deren Stellvertreter) erfasst sind, die gerade keine Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS hatten.11 b) Überhöhte Entgelte? Der Einigungsvertrag hatte dem Gesetzgeber zwei Möglichkeiten eröffnet, um in der DDR entstandene Rentenansprüche zu kürzen oder sogar vollständig abzuerkennen: – eine Einzelfall-Überprüfung auf schwere persönliche Verfehlungen der Berechtigten (Verstöße gegen die Grundsätze der Menschlichkeit, schwerwiegender Missbrauch der beruflichen Stellung zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil anderer); – eine typisierende Beschreibung von Personengruppen, die in der DDR auf Grund politischer Begünstigung einen Anspruch auf überhöhte Leistungen erworben hatten.12 Der Gesetzgeber hatte ursprünglich die zweite Variante des Einigungsvertrages für § 6 Abs. 2 AAÜG genutzt. Während die Kürzung für MfS-Mitarbeiter nach § 7 AAÜG allein damit begründet wurde, dass auf Grund konkreter Ermittlungen festgestellt wurde, dass die Entgelte und sonstige versicherungsrelevante Zuwendungen keinen Bezug zur realen Arbeitswelt der DDR besaßen, vielmehr ein sog. System der Selbstprivilegierung darstellen sollten,13 sind nach wie vor für § 6 Abs. 2 AAÜG keine Tatsachen erkennbar, die eine rentenrechtliche Gleichsetzung anderer Spitzenfunktionäre der DDR mit den Mitarbeitern des MfS rechtfertigen.14 Der Verstoß gegen Art. 3 GG lag nach Ansicht des BVerfG darin, dass der Gesetzgeber keine ausreichenden Tatsachen ermittelt hatte, mit denen belegt werden konnte, welche Bestandteile des Entgelts als politisch überhöht zu werten waren. Insbesondere hatte der Gesetzgeber keine ausreichenden Zahlen über die Lohn- und Gehaltsstrukturen in der DDR ermittelt. Es fehlten zuverlässige Erkenntnisse zum 11 SG Berlin, Beschl. vom 9. 6. 2006, S. 17 unter Berufung auf die Zeugenaussage des Vertreters des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. 12 Vgl. An. II Kap. VIII Sachgebiet H Abschn. III Nr. 9 Buchst. b) zum EV. 13 BVerfGE 100, 1 [59]; BVerfG, Beschl. vom 22. 6. 2004 – 1 BvR 1070/02. 14 SG Berlin, Beschl. vom 9. 6. 2006, S. 20.
146
L. Bundesgesetzgebung III
allgemeinen volkswirtschaftlichen Mittelwert und zum Einkommensgefüge in den Beschäftigungsbereichen, die gekürzt werden sollten. Von der ersten Entscheidung des BVerfG im April 1999 bis zum Ablauf der letzten Frist im Juni 2005 besaß der Gesetzgeber 6 Jahre lang die Gelegenheit, die verfassungsrechtlichen Vorgaben umzusetzen. Er hat diese Zeit nicht genutzt, um z. B. eine wissenschaftliche Studie über die einschlägigen Lohn- und Gehaltsstrukturen in Auftrag zu geben oder sich auf andere Weise die notwendigen Erkenntnisse zu verschaffen. Im Gegenteil: Der Gesetzgeber hat bei der Verabschiedung des AAÜGÄndG 2005 den vom BVerfG gewiesenen Weg nunmehr vollständig verlassen. Nach den Angaben des zuständigen Referatsleiters im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem sachverständigen Zeugen Köhler, vor dem SG Berlin waren „Überlegungen zur Entgeltüberhöhung nicht der Ansatzpunkt für die aktuelle gesetzliche Regelung.“ Auf Nachfrage hat er bekräftigt: „Die Gehaltsstruktur hat keine Rolle gespielt.“15 Hieran zeigt sich die ganze Hilflosigkeit der Exekutive und des Gesetzgebers. Auch die Gesetzesmaterialen zum AAÜG-ÄndG 2005 enthalten keinen Hinweis darauf, dass die Personengruppen des § 6 Abs. 2 danach ausgewählt wurden, wie hoch ihr Arbeitsentgelt war und welcher konkret bezifferte Anteil davon auf einer politischen Überhöhung beruhte. c) Kadernomenklatur oder Selbstprivilegierung? In den Materialien zum AAÜG-ÄndG 2005 wird noch ein weiteres Kriterium genannt, um die Auswahl für den Personenkreis des § 6 Abs. 2 zu rechtfertigen. In die Rentenkürzung seien die „Funktionen auf den höchsten Ebenen des so genannten Kadernomenklatursystems der DDR einbezogen, da die Betreffenden einkommensund versorgungsseitig Teil eines Gesamtsystems der Selbstprivilegierung innerhalb des Staates waren“.16 Der Gesetzgeber rechtfertigt seine Auswahl damit, dass durch § 6 Abs. 2 AAÜG die „höchsten Ebenen“ des Kadernomenklatursystems erfasst werden sollten. Aus den Gesetzesmaterialien geht nicht hervor, welche Ebenen dieses Stufensystems als die „höchsten“ im Sinne von § 6 Abs. 2 AAÜG ausgewählt wurden. Am Beispiel von § 6 Abs. 2 Nr. 4, der auch die Kläger (Minister, stellvertretender Minister) erfasst, lässt sich ersehen, dass zumindest die beiden obersten Ebenen von § 6 Abs. 2 erfasst werden sollten: – Bestätigung durch das Politbüro (hier: Minister) und – Bestätigung durch das Sekretariat des Zentralkomitees der SED (hier: stellvertretender Minister). Der Gesetzgeber hat dieses von ihm selbst gewählte Ordnungsprinzip verletzt. § 6 Abs. 2 AAÜG erfasst nur einen kleinen Teil dieser beiden Nomenklatur-Ebenen, ohne
15 16
Ebd., S. 21. BT-Drs. 15/5314, S. 1.
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
147
dass ein sachlicher Grund erkennbar ist, warum nur dieser Teil für die Rentenkürzung ausgewählt wurde. So führt z. B. die Tätigkeit als Generalsekretär des Zentralkomitees der SED zur Rentenkürzung. Nicht erfasst sind jedoch die Vorsitzenden der Blockparteien (CDU!, Deutsche Bauernpartei etc.), obwohl sie ebenfalls zur höchsten Ebene des Kadernomenklatursystems der DDR gehörten: Ihre Wahl musste vorher vom Politbüro bestätigt werden.17 Ein weiteres Beispiel: Die Mitgliedschaft im Zentralkomitee der SED führt nicht zur Anwendung des § 6 Abs. 2, obwohl in diesem Zentralkomitee die „einflussreichsten und wichtigsten Partei- und Staatsfunktionäre der DDR“ versammelt waren. Dementsprechend rangierten die Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees in der protokollarischen Rangfolge der DDR vor den Mitgliedern des – von § 6 Abs. 2 erfassten – Ministerrates der DDR. Sämtliche Mitglieder des ZK der SED wären daher nach den Maßstäben, die der Gesetzgeber selbst aufgestellt hat, ebenfalls den höchsten Ebenen des Kadernomenklatursystems der DDR zuzuordnen. Es ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum sie nicht von § 6 Abs. 2 AAÜG erfasst werden.18 Vergleichbares gilt für die leitenden Wirtschaftsfunktionäre, die entsprechend dem politischen System der DDR ebenfalls in die höchsten Ebenen des Kadernomenklatursystems eingebunden waren. In der Kadernomenklatur 1986 waren sie auf derselben Ebene angeordnet wie beispielsweise die von § 6 Abs. 2 erfassten Staatssekretäre und Stellvertreter eines Ministers: Sie mussten ebenfalls vom Sekretariat des ZK der SED bestätigt werden. Das Ausmaß der Ungleichbehandlung wird deutlich an den Spitzenfunktionären aus dem Zuständigkeitsbereich „Abteilung Handel, Versorgung und Außenhandel“. Auf der Sekretariats-Ebene der Kadernomenklatur werden von § 6 Abs. 2 Nr. 4 AAÜG erfasst: 4 Staatssekretäre und 14 Stellvertreter des Ministers. Nicht erfasst sind: 46 Generaldirektoren der Außenhandelsbetriebe, 11 Generaldirektoren der wirtschaftsleitenden Organe des Binnenhandels, 80 Leiter der Handelspolitischen Abteilungen und Handelsräte der DDR. Alle diese Funktionsträger waren in gleicher Weise von der politischen Förderung der SED-Spitzen abhängig wie die Staatssekretäre oder Stellvertreter des Ministers. Ihre Funktionen befanden sich auf derselben Ebene des NomenklaturSystems. Sie mussten vom Sekretariat des ZK der SED bestätigt werden.19 Der Gesetzgeber hat die unterschiedliche Behandlung innerhalb der Nomenklatur-Ebene vom „Einkommen“ oder von der „Versorgung“ der jeweiligen Gruppen abhängig gemacht, wie es der Hinweis auf die „einkommens- und versorgungsseitigen Privilegien“ in der Gesetzesbegründung andeutet. Die Höhe der Arbeitsent17 SG Berlin, Beschluss vom 9. 6. 2006, S. 22 mit Angabe der Quelle: Anlage Nr. 1 zum Protokoll Nr. 97 vom 3. 12. 1986 – „Bestätigung der Kadernomenklatur des Zentralkomitees der SED“, in der Folge: Kadernomenklatur 1986. 18 SG Berlin, Beschluss vom 9. 6. 2006, S. 22, mit Quellenangabe zum Zentralkomitee und zur protokollarischen Rangfolge: Enzyklopädie der DDR zum Stichwort „Zentralkomitee“. 19 Ebd., S. 23.
148
L. Bundesgesetzgebung III
gelte, so die Aussage des Vertreters des zuständigen Bundesministeriums, hat bei der Auswahl überhaupt keine Rolle gespielt.20 Im übrigen wäre die Höhe des Einkommens, so das Sozialgericht weiter, auch kein geeigneter Anknüpfungspunkt für die Ungleichbehandlung innerhalb derselben Nomenklatur-Ebene gewesen. Der Stellvertreter eines Ministers verdiente z. B. sogar weniger als die Generaldirektoren, die nach der „Ordnung über das Gehaltsregulativ für Generaldirektoren und Kombinatsdirektoren“ bezahlt wurden.21 So lag das Grundgehalt eines Stellvertreters des Ministers bei 2500 Mark und einer Aufwandsentschädigung von 1250 M. Ein Staatssekretär erhielt 2500 und 1350 M.22 Generaldirektoren der Gehaltsgruppe 1 erhielten ein Grundgehalt zwischen 3400 und 3800 M. Außerdem erhielten die Generaldirektoren einen „leistungsorientierten“ Gehaltszuschlag. Möglich war die Festlegung von „Sondergehältern in Einzelfällen“, die über diese Beträge hinausgingen. Generaldirektoren wurden ebenfalls in das „Zusatzversorgungssystem der technischen Intelligenz“ einbezogen. Sie waren in die „Nomenklatur der medizinischen Dispensairebetreuung für leitende Kader der Staats- und Wirtschaftsorgane“ aufzunehmen. Das bedeutete, dass sie und ihre Familienangehörigen z. B. Anspruch auf eine Behandlung im Berliner Regierungskrankenhaus besaßen. Normierte Vorzüge bestanden auch für Heilkuren und die Betreuung nach dem „ehrenvollen Ausscheiden aus dem beruflichen Leben“ (Tz. 3.3, 3.4, 4.1, 6).23 Dennoch ist diese Gruppe von § 6 Abs. 2 AAÜG nicht erfasst.24 Dass es in der DDR noch andere Gruppen von Spitzenverdienern gab, deren Gehälter (und damit auch Rentenansprüche) von politischen Vorzügen abhingen, zeigt z. B. die „Verordnung über die Erhöhung des Arbeitslohnes für qualifizierte Arbeiter in den wichtigsten Industriezweigen“ vom 28. 6. 1952.25 Gemäß § 9 der Verordnung waren für „besonders hervorragende Spezialisten“ auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik Gehälter bis zu 15000 M pro Monat festzusetzen. Das entsprach im Jahr 1952 etwa dem 50fachen Verdienst eines durchschnittlichen Arbeitnehmers in der DDR (vgl. Anlage zum AAÜG, wo die jährlichen Durchschnittsverdienste festgestellt sind). § 10 der Verordnung bestimmte, dass die bisherigen Begrenzungen für die Höhe der Renten auch für die Spitzenverdiener entfallen. Die Verordnung bestimmte weiter, dass diesen „Spezialisten“ „auf Kosten des Staates andere Vergünstigungen zu gewähren sind, die für die fruchtbringende Arbeit in Wissenschaft und Produktion notwendig sind“. Welcher Spezialist diese Vorzüge 20
Ebd., S. 23. Ebd., S. 23, mit Hinweis auf den Beschluss des Ministerrates vom 10. 12. 1985. 22 Ebd., S. 23, mit Hinweis auf den Beschluss des Ministerrates vom 9. 5. 1985 zu den „leistungsorientierten Gehaltserhöhungen in den zentralen Staatsorganen“, Az. 291/85. 23 Alles Vorzüge, die sich die Wirtschaftsbosse der alten Bundesrepublik aufgrund ihrer Gehälter und Versorgung um ein Vielfaches mehr leisten können. 24 SG Berlin, Beschluss vom 9. 6. 2006, S. 23/24. 25 GBl. der DDR vom 2. 7. 1952, S. 501. 21
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
149
genießen durfte, war gem. § 9 Abs. 2 der Verordnung von einer Entscheidung des Ministerrats abhängig, der auf Antrag des zuständigen Ministers oder Staatssekretärs tätig wurde. Die Entscheidung wurde also genau von den Staatsdienern getroffen, deren Rente aktuell durch § 6 Abs. 2 AAÜG gekürzt werden soll, weil sie nach Auffassung des Gesetzgebers „Teil eines Systems der Selbstprivilegierung“ waren. Folgt man dem Maßstab des Gesetzgebers, müsste der Personenkreis, der von gerade diesen Staatsdienern das 50fache des Durchschnittsverdienstes sowie weitere Vorteile zugesprochen bekam, ebenfalls „Teil“ dieses Systems gewesen sein. Nirgendwo findet sich ein Anhaltspunkt, aus welchem Grund hier dennoch von einer Kürzung der Rentenansprüche abgesehen wurde.26 d) Staats- und Systemnähe Eine besondere „Staats- und Systemnähe“ ist keine Rechtfertigung für die Kürzung von Entgelten unterhalb der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze. Dies hat das BVerfG bereits in seiner Entscheidung vom 28. 9. 1999 zu der schon seinerzeit misslungenen Fassung des § 6 Abs. 2 AAÜG betont.27 e) Sonstige Privilegien Die Gesetzesbegründung enthält keinen Hinweis darauf, was der Gesetzgeber unter dem Begriff der „Selbstprivilegierung“ verstanden hat. Es wäre eine ganze Reihe von „sonstigen“ geldwerten Privilegien denkbar, mit den Spitzenleute gegenüber der Durchschnittsbevölkerung ausgestattet waren.28 Derartige Privilegien besaßen jedoch weitaus mehr Menschen in der DDR als der Personenkreis, der von § 6 Abs. 2 AAÜG-ÄndG erfasst wird. In einer Mangelwirtschaft haben sich auch in der DDR in allen Lebensbereichen Privilegien herausgebildet, die nicht nur dem Personenkreis des § 6 Abs. 2 AAÜG zugänglich waren. Unabhängig davon ist festzuhalten, dass „sonstige“ Vorteile bei der Rentenberechnung keine Vorteile bringen. Die Kürzung der Rente ist nicht dadurch gerechtfertigt, dass in der DDR Privilegien erzielt wurden, die gar keinen Einfluss auf die Rentenberechnung haben können.29
26
SG Berlin, Beschluss vom 9. 6. 2006, S. 24. Ebd., S. 25 unter Verweis auf BVerfG 100, 57. 28 Zu den Pfründen der politischen Klasse in der Bundesrepublik, die jedes Maß überschreiten, vgl. H.H. von Arnim, Die Deutschlandakte, Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun, 1. Aufl., München 2009, S. 92 ff., 138 ff., 175 ff., 257 ff., 280 ff., 289 ff.; vgl. auch Thomas Wieczorek, Die geschmierte Republik, 2009, zur „Vorteilsnahme“ in öffentlichen Bereich; ders., Die Dilettanten, 2009. 29 SG Berlin, Beschl. vom 9. 6. 2006, S. 25/26. 27
150
L. Bundesgesetzgebung III
Auch hier hat die Gesetzgebung ein völlig untaugliches, zudem rentenrechtlich fremdes Merkmal eingeführt, das in besonderem Maß die Voreingenommenheit der westlichen politischen Organe dokumentiert. f) Berufsbiographie eines Ministers der DDR Die vom SG Berlin festgestellte willkürliche Ungleichbehandlung ist auch nicht durch eine Typisierung zu rechtfertigen. Die Berufsbiographie des Klägers im Verfahren vor dem Sozialgericht und seine Einkünfte sind kein vereinzelter Sonderfall, wo die pauschalisierte Kürzung im Rahmen einer Massenverwaltung hingenommen werden müsste.30 Jedoch zeigt der Einzelfall des Klägers die ganze Fehlleistung durch § 6 Abs. 2 AAÜG. *** Im maßgebenden Zeitraum, während seiner ununterbrochenen Tätigkeit im staatlichen Bereich von 1950 bis 1990, übte der Kläger als Mitglied der Bauernpartei folgende Ämter aus: Minister für Landwirtschaft, Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft, Stellvertreter des Produktionsleiters des Landwirtschaftsrates für den Bereich Pflanzliche Produktion und Mitglied des Ministerrates, Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft, Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates. Er wurde 1953 Minister für Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Nach dem Amt hatte er sich nicht gedrängt. Aus politischen Gründen wurde er 1963 als Minister abgelöst. Er blieb zunächst Stellvertreter des Ministers. Ihm wurde ausnahmsweise die Befugnis erteilt, für eine weitere Legislaturperiode Mitglied des Ministerrates zu bleiben. Damit sollte die Bauernpartei ruhig gestellt werden, deren Mitglieder durch den Verlust der staatlichen Leitungsfunktionen brüskiert waren.31 1967 hat er mit Ablauf der Legislaturperiode den Ministerrat endgültig verlassen und auch seine Funktion als Stellvertreter des Ministers verloren. 1971 wurde in der DDR ein Umweltministerium gebildet. Der designierte Minister starb allerdings kurz vor der Amtsübernahme. Ohne Kenntnis des Klägers beschloss das Politbüro im Januar 1972, ihn für das Amt vorzuschlagen.32 Er erfuhr davon erst im Februar. Am 9. 3. 1972 wurde er von der Volkskammer zum Minister
30
Ebd., S. 26/27. Gleiche Vorgänge spielen sich bei den Koalitionsverhandlungen für die Aufstellung des Kabinetts der Bundesregierung ab. 32 Ähnliches geht in den Parteizentralen der Bundesparteien vor sich. 31
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
151
gewählt. Der Kläger war dann bis Januar 1990 Minister für Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Er ging dann mit 65 Jahren in Rente.33 *** Die Arbeitsverdienste in der Zeitspanne von 1956 bis 1989 betrugen jährlich anfangs 48.000 M (monatlich 3.500 M), die sich über die Jahre maßvoll steigerten bis 1989 auf 52.000 M (monatlich 4.350 M). Die Bezüge hielten sich im Rahmen der Vergütung für politische Ämter und waren – auch für DDR-Verhältnisse – nicht „überhöht“. *** Ab dem 1. 3. 1990 bezog der Kläger eine Altersversorgung in Höhe von 2992 Mark. Der Rentenversicherungsträger hat mehrmals die Regelaltersrente des Klägers berechnet und neu festgestellt (Bescheid vom 30. 11. 1994 – Zahlbetrag ab 1. 12. 1995: 1.986,92 DM; Bescheid vom 6. 1. 2000 – Zahlbetrag ab 1. 3. 1992: 2.153,11 DM; Bescheid vom 18. 2. 2002 – Zahlbetrag ab 1. 4. 2002: 1.128,69 Euro). Mit Bescheid vom 9. 12. 2005 hat der beklagte Rentenversicherungsträger die Regelaltersrente für die Zeit ab 1. 7. 1993 neu festgestellt mit einem Zahlbetrag ab 1. 4. 2002 von 1.179,45 Euro. Die Neufeststellung erfolgte, weil durch das AAÜG-ÄndG 2005 die Begrenzung des § 6 Abs. 2 für einige Zeiträume wegfiel. Ohne Anwendung von § 6 Abs. 2 AAÜG-ÄndG 2005 wären ab 1. 5. 2006 monatlich 1.805,43 zu zahlen gewesen mit einer Nachzahlung für die zurückliegenden 13 Jahre. Der Kläger hat als Minister zwar das Mehrfache eines durchschnittlichen Arbeitnehmers in der DDR verdient. Selbst wenn auf seinen Fall die allgemeinen Regeln der gesetzlichen Rentenversicherung mit der allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze anzuwenden wären, würde er maximal nur das 1,8fache einer durchschnittlichen Rente erhalten. Die Probeberechnung des Rentenversicherungsträgers zeigt, dass sich seine Rente nach den allgemeinen Regeln des Rentenrechts von bislang knapp 1200 Euro auf rund 1800 Euro erhöhen würde. Nach dem AAÜG wären auch ohne § 6 Abs. 2 keine „Phantasie“-Renten an Spitzenfunktionäre zugelassen gewesen. Infolge der für alle Rentner festgelegten Allgemeinen Beitragsbemessungsgrenze werden die Entgelte nur bis zum etwa 1,8fachen des Durchschnittsverdienstes aller Arbeitnehmer berücksichtigt. Darüber hinausgehende Einkommen werden bei der Rentenberechnung nicht berücksichtigt. Selbst wenn das Gehalt eines der in § 6 Abs. 2 genannten „Spezialisten“ oder Generaldirektoren der DDR das Mehrfache des Durchschnittsverdienstes betrug: Bereits nach den allgemeinen Regeln des Rentenrechts fließt es – abgesehen von den 33
Es handelt sich um die Berufsbiographie von Dr. Hans Reichelt.
152
L. Bundesgesetzgebung III
verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzregelungen – nur bis zum 1,8fachen des Durchschnittsverdienstes in die Rentenberechnung ein. Es ist auch insoweit kein sachlicher Grund erkennbar, warum für den Kläger und die anderen Betroffenen darüber hinaus eine besondere Bemessungsgrenze in § 6 Abs. 2 angeordnet wird und für die vorgenannten Spitzenverdiener nicht.34 Die ganze Systemwidrigkeit des Gesetzes mag man auch daraus ersehen, dass der Kläger nach immerhin 40 Arbeitsjahren in verantwortungsvollen hohen Ämtern eine Rente von nur 1.179,45 Euro erhalten soll, die eine angemessene Lebensführung nicht erlaubt. So geht die Bundesrepublik mit ihren ehemaligen Ministern, die um ein Vielfaches versorgt werden, nicht um. *** Es liegen auch keine Erkenntnisse vor, dass der Kläger als Minister Einfluss auf die Arbeit des MfS genommen hat.35 Besondere Privilegien hatte der Kläger nicht erhalten. Von 1964 bis 1986 hat er in einem Plattenbau im Bezirk Berlin-Mitte gelebt. Ab 1964 hatte er einen Garten gepachtet. Er hat weder ein Grundstück gekauft oder besessen. Als Minister hat er Urlaubsaufenthalte in Gästeheimen der Regierung und in ausländischen Heimen zum vollen Preis gezahlt. Einen Anspruch auf die in der DDR üblichen billigen FDGBPreise hat er nicht gehabt. So habe er beispielsweise für einen dreiwöchigen Urlaub in Polen im Jahr 1988 für zwei Personen 1.720 Mark bezahlt. Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Wirtschaftsbetriebe der Regierung habe er nach den gültigen Preisen vollständig bezahlt, z. B. eine Wohnungsmodernisierung im November 1975 (5.055,50 Mark), Maler-, Sanitär- und Dekorationsarbeiten im Juni 1981 (3.050,15 Mark), den Einsatz eines Busses während der Hochzeit seiner Tochter im Jahr 1983 (263,69 Mark).36 g) Wahrung des Rechts Der Vorlagebeschluss des SG Berlin vom 9. 6. 2006 ist in seiner Argumentationskette dicht und unangreifbar, in seiner juristischen Klarheit und sorgfältigen Subsumtion so überzeugend, dass die Erwartungen, die die Betroffenen, aber nicht nur sie, auch stringent denkende Juristen, an einen funktionierenden Rechtsstaat hegen, erfüllt wurden.
34 35 36
So zu allem SG Berlin, Beschl. vom 9. 6. 2006, S. 2/3, 3/4, 24 f. Ebd., S. 8. Ebd., S. 6 f.
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
153
2. Rechtsprechung „Im Namen der Regierung“ Dem Bundesverfassungsgericht muss in der nun jahrzehntelangen Auseinandersetzung um die Versorgungsüberleitung mit seinem die Vorlage des SG Berlin bescheidenden Beschluss vom 6. 7. 201037 bescheinigt werden, dass – es – wie schon die Bundesregierung und der Bundesgesetzgeber zuvor – die realen Gesellschaftsverhältnisse der DDR verkannt hat oder verdrängt hat; – es an der notwendigen Sensibilität für die Lebensumstände und Einzelschicksale von Staatsdienern hat fehlen lassen; – es eine Entscheidung getroffen hat, ohne die realen Verhältnisse von Parteibuchund Vetternwirtschaft in der alten Bundesrepublik, die bei weitem materiell unvergleichbare Dimensionen angenommen hat, als Maßstab zu nehmen, dass das Gericht als Hüterin der Verfassung versagt hat, hier unterschwellig eine „Siegermentalität“ Pate gestanden hat. Zwei Vorgängerregelungen des § 6 Abs. 2 AAÜG waren 1998 und 2004 vom Bundesverfassungsgericht als mit dem Grundgesetz nicht vereinbar erklärt worden. Im Hinblick auf die an sich unangreifbare Rechtsauffassung der Sozialgerichte in den Vorlagebeschlüssen38 bestand die berechtigte Erwartung, dass auch die neue Regelung des § 6 AAÜG einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht standhält. Die ursprüngliche Konzeption, das Rentenstrafrecht mit angeblich überhöhten Gehältern zu begründen, war zweimal verworfen worden. Erwartet wurde auch, dass das BVerfG sich konkret zu allen in § 6 aufgeführten Personengruppen äußert. Dies ist nicht erfolgt. Das Bundesverfassungsgericht hat hingegen durch Beschluss vom 6. 7. 201039 entschieden, dass die Kürzung der Renten für ehemalige Minister der DDR und ihre Stellvertreter nach § 6 Abs. 2 Nr. 4 i. d. F. des 1. AAÜG-ÄndG verfassungsgemäß sei. Zugleich hat das BVerfG keinen Zweifel an seiner Auffassung aufkommen lassen, dass die Rentenkürzungen auch für alle anderen im § 6 Abs. 2 aufgeführten Personengruppen keine Verletzung des Grundgesetzes darstellen.40 Jedoch ist es unangenehmen Fragen ausgewichen, insbesondere warum es 2005 fünfzehn Jahre nach der Einigung notwendig wurde, Personengruppen mit Rentenkürzungen zu überziehen, die zuvor vom Rentenstrafrecht nicht betroffen waren und soweit sie bei Erlass des Gesetzes über einen bestandskräftigen Rentenbescheid verfügten und auch nicht mehr nachträglich bestraft werden durften (SED-Funktionäre, Mitglieder von Bezirks- und Kreiseinsatzleitungen, Richter und Staatsanwälte). Oder aber,
37
BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010 – 1 BvL 9/06 und 1 BvL 2/08, BVerwGE 126, 233. SG Berlin, Vorlagebeschluss vom 9. 6. 2006 – S 75 RA 5653/97 W 05; LSG Thüringen, Vorlagebeschluss vom 25. 2. 2008 – L 6 R 885/05. 39 BVerfGE 126, 233. 40 Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 89. 38
154
L. Bundesgesetzgebung III
warum Funktionäre auf Kreisebene auf einmal mit Ministern oder Politbüro-Mitgliedern auf eine Stufe gestellt werden müssen. a) Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS Der Gesetzgeber hatte die Rentenkürzung hauptsächlich mit einem – tatsächlich bei allen ausgewählten Personengruppen nicht existierenden – Weisungsrecht gegenüber dem MfS und sich daraus ergebenden Wertungswidersprüchen begründet. Diese Personengruppe dürfe rentenrechtlich nicht besser gestellt werden als die Mitarbeiter des MfS selbst. Nachdem diese Annahme bereits im Gesetzgebungsverfahren sehr umstritten war, hatte das SG Berlin nach eigener gründlicher Ermittlung des Sachverhalts nachgewiesen, dass es eine Weisungsbefugnis des fraglichen Personenkreises gegenüber dem MfS nicht gab. Dieser Tatsache konnte sich das BVerfG nicht entziehen. In seinem Beschluss wird dazu ausgeführt: „Eine Weisungsbefugnis gegenüber dem Ministerium für Staatssicherheit ist als Rechtfertigung für eine Kürzung des berücksichtigungsfähigen Entgelts der von § 6 Abs. 2 Nr. 4 AAÜG erfassten Personengruppe (Minister, stellvertretender Minister oder stimmberechtigtes Mitglied von Staats- und Ministerrat oder als ihre jeweiligen Stellvertreter) ungeeignet. Das folgt aus den unbeanstandet gebliebenen Feststellungen des Sozialgerichts Berlin, wonach die Mitglieder des Ministerrats der DDR – abgesehen von dem Minister für Staatssicherheit – keine Weisungsbefugnis gegenüber der Staatssicherheit hatten.“41
Man hätte erwarten müssen, dass die Verfassungsrichter deutlich aussprechen, dass das Kriterium „Weisungsbefugnis“, selbst wenn es bestanden hätte, rentenrechtlich nicht relevant sein kann. Vielmehr besteht der Eindruck, dass die Richter diesen Fakt nur widerwillig zur Kenntnis nahmen. Da damit die Hauptbegründung des Gesetzgebers für die Rentenkürzung unrichtig war, wäre außerdem zu erwarten gewesen, dass die Richter zugunsten der Betroffenen entscheiden. Das aber wollten sie nicht. b) Einbindung in das System der Überwachung und Informationsbeschaffung Anstatt diese nachweisbar falsche Begründung zurückzuweisen, „entdeckte“ das BVerfG die Feststellung, dass „die Minister der DDR wegen ihrer Regimetreue und politischen Zuverlässigkeit fest in das System der Überwachung und Informationsbeschaffung des MfS eingebunden waren“. Das gelte auch für den Kläger, der zwar gegenüber dem MfS nicht weisungsgebunden war, aber als Minister eng mit diesem zusammengearbeitet hätte.42
41 42
Beschluss vom 6. 7. 2010, Rn. 69. Ebd., Rn. 76.
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
155
Abgesehen davon, dass hierzu keine Aussagen über die Quantität oder Qualität einer etwaigen Zusammenarbeit gemacht werden, haben solche Hinweise keinerlei rentenrechtliche Bedeutung. Sie sind geeignet, die Betroffenen öffentlich zu diskreditieren. Das gleiche gilt für die Feststellung, dass alle von der Rentenkürzung erfassten Personen, die an der Spitze der staatlichen Verwaltung standen, durch das Politbüro berufen worden seien und „Förderer des Systems“ waren.43 Dabei blendet das BVerfG, um dies nur am Rande zu bemerken, die Verhältnisse der Politischen Klasse in der alten Bundesrepublik aus. In der Parteioligarchie herrscht unbedingte „Nibelungentreue“ und Systemverhaftung, wobei das Politsystem durch mittlerweile totale Überwachung der Geheimdienste, Verfassungsschutzämter und Polizeibehörden sich jegliche Information über missliebige Personen verschaffen kann.44 c) „System der Selbstprivilegierung“ Die Rentenkürzung nach dem 1. AAÜG-ÄndG 2005 knüpft nicht mehr an die Entgelthöhe an. Der Gesetzgeber stützte die Kürzung auf ein „System der Selbstprivilegierung der Personen auf der höchsten Stufe des Kadernomenklatursystems der DDR“,45 dessen Fortsetzung im Rentenrecht er verhindern wollte. Die Betroffenen seien Teil eines Systems der Selbstprivilegierung gewesen. Dieses angebliche System der Selbstprivilegierung ist ein ideologisches, nicht definierbares und dem Rentenrecht fremdes Konstrukt, das auch vom BVerfG nicht überzeugend nachzuweisen war. Die GBM hatte in ihrer Stellungnahme an das BVerfG zu Recht darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber sich mit dieser Begründung nicht auf den Einigungsvertrag berufen konnte, der für die Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungen die Möglichkeit vorgesehen hatte, „ungerechtfertigte Leistungen abzuschaffen und überhöhte Leistungen abzubauen“.46 Die Verfassungsrichter des Jahres 2010 ließen dieses Argument nicht gelten: Mit einer regelrechten Zungenakrobatik wird im Beschluss gesagt, dass ein rentenrechtliches Fortwirken des Systems der Selbstprivilegierung verhindert werden sollte und dass ein solches Ziel einer verfassungsrechtlichen Überprüfung standhalte.47 Damit wurde auch die Kritik aus den Urteilen vom Tisch gewischt, dass als Beweis für überhöhte Gehälter von der Regierung keinerlei Analysen zur Lohnund Gehaltsstruktur vorgelegt wurden. Die von Kaufmann und Napierkowski erstellten Gutachten darüber, dass im Staatsapparat keine überdurchschnittlich hohen 43
Ebd., Rn. 72. – Vgl. auch Prof. Dr. Ernst Bienert, Rachefeldzug fortgesetzt – Neue Verfassungsrichter kippen Renten-Urteile ihrer Vorgänger, in: ISOR aktuell 9/2010, S. 2. 44 Hierzu Ronald Gläser, Hände hoch, Passwort her!, in: JF 46/12 vom 9. 11. 2012, S. 2. 45 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 71. 46 Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V. (GBM), zitiert ebd., Rn. 60. 47 Ebd., Rn. 74, 70.
156
L. Bundesgesetzgebung III
Gehälter gezahlt wurden,48 spielten keine Rolle mehr. Nach Meinung der Richter besteht jetzt, nachdem auf eine bestimmte Entgelthöhe als Kriterium verzichtet wurde, keine Notwendigkeit mehr, Erhebungen zur tatsächlichen Gehaltsstruktur vorzunehmen. Sie flüchten sich dagegen – wie vom Gesetzgeber vorgegeben – in den schwammigen Begriff „Selbstprivilegierung“, für den es – wie gesagt – keinerlei Maßstäbe und Kriterien gibt.49 Die an die Ausübung einer Funktion als Minister oder Stellvertreter des Ministers anknüpfende Entgeltbegrenzung sei geeignet, einen „Gemeinwohlzweck“ zu erreichen,50 einen Begriff, in den man alles hineingeben oder herausholen kann. Die Kläger seien „Förderer des Systems“ gewesen, und in Bezug auf den jetzt erfassten Personenkreis sei der Schluss des Gesetzgebers gerechtfertigt, dass „diese Personengruppen bei generalisierender Betrachtungsweise leistungsfremde, politisch begründete Arbeitsverdienste bezogen haben“.51 Der Gesetzgeber sei befugt, gegenüber spezifisch eingegrenzten Gruppen im Blick auf deren allgemein privilegierte Sonderstellung in der DDR ohne langwierige Ermittlungen zur Einkommens-, Qualifikations- und Beschäftigungsstruktur Rentenkürzungen vorzunehmen.52 Der Hinweis auf „leistungsfremde, politisch begründete Arbeitsverdienste“ liegt nun vollends neben der Sache. Die Regierung eines Staates ist dazu berufen, Politik zu betreiben. Ein Minister oder sein Stellvertreter in der Regierung ist folglich politisch tätig. Und der Arbeitsverdienst, den er bezieht, ist selbstverständlich in politischer Tätigkeit begründet. Der Beschluss vom 6. 7. 2010 enthält das genaue Gegenteil von dem, was das BVerfG 1999 und 2004 geurteilt hat. Dort hat es ausgeführt, dass allein schon mit der Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme in die gesetzliche Rentenversicherung neben hohen auch „überhöhte“ Rentenansprüche auf das durch die Beitragsbemessungsgrenze vorgegebene Maß vermindert worden sind. Einer darüber hinausgehenden zusätzlichen Bestimmung von Überhöhungstatbeständen müssten Kriterien zugrunde gelegt werden, die in den tatsächlichen Verhältnissen eine Entsprechung fänden. Aus der „Staats- und Systemnähe“ der Berufstätigkeit allein ergebe sich keinesfalls, dass durchgängig Entgelte gezahlt worden seien, die nicht durch Arbeit und Leistung gerechtfertigt und insoweit „überhöht“ gewesen seien. Auch sei eine „fallbeilartige“ Kürzung zu beanstanden, bei der eine erreichte Rentenhöhe nicht beibehalten, sondern plötzlich nur noch von einem Durchschnittseinkommen ausgegangen werde.53 48
BVerfGE 100, 138 [179 f.]; hingegen BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 73. Es sei denn, man nimmt H. H. von Arnims, Die Deutschlandakte, vor, das ein wahres Handbuch über „Selbstbedienung“ der Politischen Klasse und Umgebung in der Bundesrepublik ist. 50 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 73. 51 Ebd., Rn. 73. 52 Ebd., Rn. 73. 53 BVerfGE 100, 59 [90 ff.]. 49
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
157
Das BVerfG 2010 meint hingegen: „Die durch § 6 Abs. 2 Nr. 4 AAÜG bewirkte Rentenkürzung, die nur Zeiten einer Tätigkeit in weit herausgehobener Stellung als Minister bzw. stellvertretender Minister erfasst, ist nicht unverhältnismäßig, da auch die nach der Kürzung verbleibenden Renten der Kläger immer noch erheblich über der Durchschnittsrente eines früheren Bürgers der DDR liegen.“54 Diese eher sarkastische Bemerkung bedeutet, dass ein Hauptabteilungsleiter allein durch seine Beförderung zum Stellvertretenden Minister Rentenansprüche verliert und ab diesem Zeitpunkt auf das Rentenniveau eines Facharbeiters in der DDR herabgestuft wird, obwohl er danach zweifellos eine größere Verantwortung und eine anspruchsvolle Tätigkeit auszuüben hatte. Dabei hätte es den Verfassungsrichtern eigentlich angelegen sein müssen, im Spiegelbild der Ost-West-Verhältnisse in Fragen der „Staats- und Systemnähe“ und „Selbstprivilegierung“ äußerste Zurückhaltung zu üben. Die Politische Klasse in der Bundesrepublik, die politischen Beamten, Minister etc., selbst die Richter am Bundesverfassungsgericht, verdanken die Berufung in ihre Ämter der fest gefügten Parteienoligarchie,55 wobei über die Qualifikation keine Rechenschaft abgelegt zu werden braucht. Die Politische Klasse repräsentiert nicht das System; sie ist „das System“. Bücher füllen eine beeindruckende Bibliothek.56 d) Andere Privilegien Auch der Hinweis auf „andere Privilegien“57 ist für die Festlegung von Rentenbezügen völlig irrelevant. Der Wortlaut der Entscheidung des BVerfG macht an vielen Stellen deutlich, dass den Richtern die tatsächlichen Verhältnisse und Zusammenhänge in der DDR unbekannt geblieben sind oder dass sie sie absichtlich ausblenden. So schreiben sie: 54
BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 79. K. A. Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, in: Dietrich Murswiek u. a. (Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, FS für Helmut Quaritsch zum 70. Geburtstag, Berlin 2010, S. 141 – 161. 56 Vgl. allein Hans Herbert von Arnim, Die Partei, der Abgeordnete und das Geld. Parteifinanzierung in Deutschland, München; ders., Fetter Bauch regiert nicht gern. Die Politische Klasse – selbstbezogen und abgehoben, München 1997; ders., Diener vieler Herren. Die Doppel- und Dreifachversorgung von Politikern, München 1998; ders., Vom schönen Schein der Demokratie – Politik ohne Verantwortung – am Volk vorbei, München 2000; ders., Politik macht Geld. Das Schwarzgeld der Politiker – weißgewaschen, München 2001; ders., Wer kümmert sich um das Gemeinwohl? Auflösung der politischen Verantwortung im Parteienstaat, in: ZRP 5/2002, S. 223 – 232; insbes. ders., Das System. Machenschaften der Macht, München 2001. – Zur Parteibuchwirtschaft im BVerfG vgl. H. H. von Arnim, Die Deutschlandakte, S. 94 ff., 95 zur Wahl der Bundesverfassungsrichter: „… und Staatsrechtslehrer wie Wilhelm Karl Geck und Rainer Wahl haben das Unaussprechliche – mutig und gegen alle Political Correctness – denn auch beim Namen genannt: Die Besetzung des Verfassungsgerichts ist verfassungswidrig.“ 57 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 77. 55
158
L. Bundesgesetzgebung III
„Die Funktion eines Ministers oder stellvertretenden Ministers war mit einer Selbstbegünstigung verbunden, die sich nicht allein in der Entgelthöhe spiegelt … Gleichzeitig ist mit der Berufung in diese Position die Teilhabe an einem System vielfältiger Vergünstigungen verbunden gewesen, von denen der Durchschnittsbürger ausgeschlossen war.“58 Dann nennen sie „Beweise“ für ihre Behauptungen: „Anspruch auf Wohnraumversorgung aus dem Kontingent des Ministerrates.“
Ein Kläger wohnte in einer „Plattenwohnung“. Diesen Anspruch gab es für Durchschnittsbürger auch. Jeder volkseigene Betrieb, jede Genossenschaft und jede staatliche Dienststelle verfügte über ein Wohnungskontingent. Über die Reihenfolge der Vergabe entschied eine Wohnungskommission aus Vertretern von Gewerkschaft, Frauenverband und Jugendorganisation. „Zugang zu Instandhaltungs- und Dekorationsarbeiten seitens der Wirtschaftsbetriebe des Ministerrates.“
Auch Durchschnittsbürger nutzten die Instandhaltungskapazitäten der Betriebe und Genossenschaften gegen Entgelt. Baubrigaden halfen z. B. beim Bau von Eigenheimen. „Ferienaufenthalt in Ferienheimen der Regierung.“
Außer den Ferienheimen der Gewerkschaft hatte die Mehrzahl der Betriebe, Genossenschaften, Vereinigungen und staatlichen Verwaltungen eigene Betriebsferienheime, die allen Beschäftigten offen standen. Über die Vergabe entschied auch hier eine Ferienkommission aus gewählten Betriebsangehörigen. „Gesundheitsversorgung in den Krankenhäusern der Regierung.“
Außer den Ministern wurden auch Durchschnittsbürger im Regierungskrankenhaus behandelt, wenn sie in Einrichtungen zentraler staatlicher Verwaltungen arbeiteten. Viele Betriebe und Institutionen hatten eigene Betriebspolikliniken. Auch im Krankenhaus der Volkspolizei wurden nicht nur Volkspolizisten behandelt. Offenbar ist den Verfassungsrichtern die Lage in der Bundesrepublik unbekannt. So gibt es ein Bundeswehrkrankenhaus in Berlin-Mitte, das zivilen Patienten offen steht. Und auch Bundes- und Landesminister genießen mit ihrem Status und ihrer gewiss nicht unbescheidenen Versorgung eine Vorzugsbehandlung in Krankenhäusern. Die Kläger jedenfalls hatten keine Teilhabe an dem vom BVerfG konstruierten sog. „System der Selbstprivilegierung“. Dem Gericht sollte eigentlich auch klar sein, dass in keinem politischen System alle Durchschnittsbürger in Versorgungseinrichtungen der Regierung versorgt werden können. Wenn die Karlsruher Richter, abgeschottet vom Durchschnittsbürger, in einem noblen Speiseraum ihr Mittagessen einnehmen, kommt niemand auf die Idee, ihnen dies als Selbstprivilegierung an58
Ebd.
II. Die Gerichte: Recht versus „Recht“
159
zukreiden. Und auch die Bundestags- und Landtagsabgeordneten, die die Höhe ihrer Bezüge selbst regelmäßig festlegen, immer erhöhen, niemals herabsetzen, verwahren sich entrüstet gegen den Vorwurf der Selbstbedienung.59 Die Verfassungsrichter übergehen geflissentlich die Feststellungen des Sozialgerichts Berlin, dass all diese Dinge nichts mit der Rentenbemessung zu tun haben.60 Sie sagen im Gegenteil mit Wortgeklingel nebulös-unbestimmt: „Dieser Befund trägt im Rahmen des hier besonders weiten Einschätzungsermessens die Annahme des Gesetzgebers, dass unabhängig von der persönlichen und fachlichen Eignung im Einzelfall, die an solche Führungskräfte der DDR gezahlten Entgelte zu einem gewissen Teil nicht als durch Leistung erworben, sondern als Belohnung für politische Anpassung und unbedingte Erfüllung des Herrschaftsanspruchs der SED anzusehen sind.“61 Die Bundesrepublik ist voll von Beispielen, in denen Minister aufgrund der unbedingt geforderten Anpassung an die Partei berufen werden. Das geht bis zum Amt des Bundespräsidenten.62 Bienert stellt die Frage: „Braucht es noch Begründungen dafür, dass ein solches Urteil ein Missbrauch des Rentenrechts als politisches Strafrecht darstellt?“ und bemerkt: „Es ist eine Schande für die deutsche Gesetzgebung und die Justiz! Vergleichbares gab es nur zur Zeit des Faschismus bei der Regelung der Rentenansprüche von Juden und Polen.“63 e) Kommentar der Betroffenen Bemerkenswert ist, was einer der Betroffenen zum Beschluss des BVerfG angemerkt hat: „Die Feststellung … unter Ziffer 64, dass Empfänger von Zusatz- und Sonderversorgungen ,grundsätzlich weniger schutzbedürftig als die sonstigen Rentner‘ sind, ist ein politischer und juristischer Skandal. Solche Einteilungen ganzer Gruppen von Menschen in ,schutzbedürftig‘, ,weniger schutzbedürftig‘, ,minderwertig‘ und ,artfremd‘ kenne ich nur aus der braunen Vergangenheit. M. E. verbietet das GG eine solche Einteilung.“64
59
Hierzu H. H. von Arnim, Die Deutschlandakte, S. 138 ff. SG Berlin, Beschluss vom 9. 6. 2006, S. 25 ff. 61 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 78. 62 Der Ministerpräsident von Niedersachsen Wulff ist auf persönliche Intervention von der CDU-Vorsitzenden Merkel für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen worden. 63 E. Bienert, Rachefeldzug fortgesetzt, in: ISOR aktuell 9/2010, S. 4. 64 Dieter Wunderlich, Gedanken zur Entscheidung des BVerfG vom 6. 7. 2010, in: ISOR aktuell 9/2010, S. 4: Zitiert aus einem Brief von Willi Seifert, Stellvertretender Minister des Innern, der von der Modrow-Regierung, nicht vom Politbüro der SED, 1989 berufen wurde. 60
M. Machtpolitik vs. Recht Das Bundesverfassungsgericht bestreitet, dass die erfolgten Rentenkürzungen Rentenstrafrecht seien und beruft sich dabei vor allem auf die Intentionen der letzten Volkskammer der DDR, meint, dass das Rentenstrafrecht seinen Ursprung in der DDR habe.1 Mitgestalter des Staatsvertrages vom 18. 5. 1990 und des Rentenangleichungsgesetzes vom 28. 6. 1990 auf der DDR-Seite bezeugen persönlich, dass es niemals Wille der letzten Volkskammer der DDR war, die Zusatz- und Sonderversorgungen der DDR vollständig zu beseitigen und für „staatsnahe“ Personen eine politisch motivierte Rentenkürzung vorzunehmen, so wie es später mit dem AAÜG zum Nachteil hunderttausender Bürger geschehen ist.2 Bundesregierung und Bundestag (Bundesgesetzgeber) haben aus reinem machtpolitischen Kalkül die Vorschriften des Staats- und Einigungsvertrages zur Alterssicherung der DDR-Bürger in ihr Gegenteil verkehrt und garantierte Rechte einfach beseitigt. Das BVerfG hat sich letztlich aus dem „Olymp unabhängiger Rechtsprechung“ verabschiedet, sich in politische Niederungen begeben und den politischen Willen der Herrschenden über rechtliche und sachliche Argumente gestellt, hat Ko-Politik betrieben, indem es die Inkompetenz des Gesetzgebers durch reinen Gesetzespositivismus sanktioniert hat. Die Fassade des Rechtsstaates hat weitere Risse bekommen.3
I. Die Bundesregierung Gegen Ende der Verhandlungen zum EV brachte Staatssekretär Kinkel4 die These vom Unrechtsstaat DDR, dessen Rechtsordnung sofort beseitigt werden müsse.5 Obwohl die DDR seit dem Fall der Mauer durch von den DDR-Bürgern durchgeführte Maßnahmen und Verfassungsänderungen grundlegend verändert worden war 1
BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010, Rn. 74. E. Bienert, Rachefeldzug fortgesetzt, S. 4. 3 Vgl. insbesondere Constanze Paffrath, Macht und Eigentum. Die Enteignungen 1945 – 1949 im Prozess der deutschen Wiedervereinigung, Köln 2004; ferner W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Berlin 2011, S. 176 ff., zur Bodenreform. 4 Staatssekretär im Bundesjustizministerium, zuvor Chef des Bundesnachrichtendienstes, dann Bundesjustizminister, später Bundesaußenminister. Er gab die Integration der beigetretenen Bürger als beispielhaft für die anderen Länder des früheren Ostblocks aus. 5 R. Hartmann, DDR-Legenden …, S. 11 – 24; K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 49 f., 179. 2
I. Die Bundesregierung
161
und spätestens seit dem 17. 6. 1990 die einem bürgerlichen Rechtsstaat entsprechende Verfassungsordnung besaß,6 übernahmen die Staatsgewalten der Bundesrepublik nach dem Beitritt die Kinkelsche Ausgangsposition für die Gesetzgebung,7 für behördliche Maßnahmen und für Gerichtsentscheidungen. Die DDR-Bürger haben zum Fall der Mauer beigetragen, sich von Stalinismus und Dogmatismus ab- und rechtsstaatlichen Traditionen zugewandt sowie die Gesellschafts-, Wirtschafts- und Rechtsordnung geändert. Die von ihnen vor dem 3. 10. 1990 vollzogenen Veränderungen wurden nicht zur Kenntnis genommen. Gegen diese Bürger richteten sich nun die von der Delegitimierung der DDR ausgehenden enteignenden, entrechtenden und diskriminierenden Maßnahmen, für deren Durchführung nahezu alle bürgerlichen Rechtstraditionen als hinderlich über Bord geworfen wurden. Die generellen Eingriffe in das Alterseinkommen bzw. die Versorgungen der DDR-Bürger ordnen sich in diese Strategie ein. Die ehemaligen DDR-Bürger müssten anders als westdeutsche Bürger und anders als im Einigungsvertrag behandelt werden, – weil sie in die Westversicherungen nichts eingezahlt hätten; – weil ihre überhöhten Renten- und Versorgungsansprüche auf „Unrechtsentgelten“, Privilegien etc. beruhten; – weil die frühere Arbeit der beigetretenen Bürger nicht als Leistung und Grundlage von Versicherungsansprüchen anerkannt werden könnte; – Dazu benannte das BSG u. a. die „dreistufige Typik“ der Arbeit in der DDR8 sowie Positionen zu „Unrechtsentgelten“, zu überhöhten Einkommen, zu einer „Nominalwertgarantie“ – die von jedem, der logisch denken kann und die Situation zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialreform kennt, nur belächelt werden könnte, wären damit nicht tief einschneidende negative Wirkungen verbunden – und zur „gesetzlichen Novation“.9 – weil die DDR-Bürger aufgrund ihrer Bildungsdefizite in der Bundesrepublik ohnehin unbrauchbar wären;10 – weil den Bürgern in der DDR ohnehin privilegierende überhöhte Alterssicherungsansprüche gewährt worden wären: der LPG-Bäuerin ebenso wie den
6 Gesetz zur Änderung und Ergänzung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (Verfassungsgrundsätzegesetz) vom 17. 6. 1990 (GBl. I Nr. 33, S. 299). 7 Was Wolfgang Schäuble u. a. in seinem Buch „Der Vertrag“ für einen gravierenden Fehler hielt. 8 BSG, Urt. vom 31. 7. 1997 – 4 RA 35/97. Vgl. dazu Karl-Heinz Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1. Aufl., 1999, S. 219, 233 ff. 9 K.-H. Christoph, Das Rentenüberleitungsgesetz …, S. 61 f., 159 ff. 10 Vgl. hierzu Arnulf Baring, Deutschland, was nun? Berlin 1991, S. 59.
162
M. Machtpolitik vs. Recht
Trümmerfrauen Ost und den Ärzten, den Facharbeitern, den Ingenieuren, den Hochschulprofessoren sowie den Beschäftigten des Staatsapparates. So verbreitete die Bundesregierung und deren Gefolge die Auffassung, dass die neue Regierung und neuen Behörden den neuen Bundesbürgern gegenüber beliebig schalten und walten, ihnen auch die Ansprüche auf eine Vollversorgung bzw. angemessene Alterssicherung nehmen dürfe. Wie Papier, später Präsident des BVerfG, in einem Gutachten für die Kohl-Regierung zur Untermauerung ihrer Position begründete, gäbe es – entgegen den Staatsverträgen – keinen Eigentums-, Bestandsund Vertrauensschutz für die mit viel Vertrauen zum rechtsstaatlichen System der Bundesrepublik beigetretenen DDR-Bürger.11 Die Renten derer, die durch Mitgliedschaft in bestimmten „staatsnahen“ Versorgungssystemen angeblich (besonders) privilegiert gewesen wären, kürzte man mit dem RÜG mit viel öffentlicher Propaganda drastisch. Die Renten der anderen DDRBürger vermindert man schrittweise durch dasselbe Gesetz, aber verdeckt hinter einem Vorhang von Unwahrheiten und irreführenden gesetzlich verbrämten Spitzfindigkeiten. Z. B. wurde die Beseitigung der Zahlbetragsgarantie (Art. 30 Abs. 5 EV) als Verbesserung des Vertrauensschutzes durch Auffüllbeträge und Renten- und Übergangszuschläge ausgegeben, und die Rentner Ost wurden zu Gewinnern der Einheit erklärt, die (1995) schon mehr Rente als die Rentner West bekämen. Der Einigungsvertrag enthält keine Grundlagen für die Beseitigung der Zusatzund Sonder(Gesamt)-Versorgungssysteme, für solche Rentenkürzungen, auch nicht für das Rentenstrafrecht. In ihm wurden Vermutungen darüber angestellt, dass in der DDR Mitgliedern von Versorgungssystemen „ungerechtfertigte oder überhöhte Leistungen“ gewährt worden sein könnten und dass diese nicht zu überhöhten Alterseinkommen führen dürften. Solche Verdächtigungen und Unterstellungen waren auf Einschätzungen von Bürgern hin aufgenommen worden, die die Verhältnisse in der DDR nicht kannten oder nur verzerrt wahrgenommen hatten oder das Regime hassten, die Lebensleistungen der in der DDR gebliebenen Bürger gering achteten und sie mit dem längst beseitigten Regime identifizierten.12
11 Hans-Jürgen Papier, Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes (AAÜG), München 1994, veröffentlicht als Forschungsbericht Nr. 238 des BMA. – Vgl. ferner ders., Verfassungsrechtliche Probleme der Eigentumsregelung im Einigungsvertrag, in: NJW 4/1991, S. 193 – 197; ders., Die Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des AAÜG, in: DRV 12/1994, S. 840 – 871; ders., Rentenrecht und Rentenunrecht, in: DRiZ 10/1995, S. 402 – 411; ders., Eigentumsgarantie bei DDR-Renten, in DtZ 2/ 1996, S. 43 – 44; ders., in: ders./Detlef Merten, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. II, Heidelberg 2006, § 30 Rn. 45 ff.; ders., in: Theodor Maunz/Günter Dürig, GG, Kommentar, Stand: Dezember 2007, zu Art. 14. – Zur Befangenheit eines Richters des BVerfG vgl. auch BVerfG, NJW 50/2011, S. 3637 ff. 12 K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 181. Christoph, Jurist und zuletzt Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz der DDR, war an der Abfassung des Einigungsvertrages maßgeblich beteiligt.
II. Der Bundesgesetzgeber
163
II. Der Bundesgesetzgeber Die unsubstantiierten Annahmen, Verdächtigungen und Unterstellungen wurden 1991 vom Deutschen Bundestag, dem parlamentarischen Gesetzgeber, als Tatsachen genommen und mit dem RÜG in einschneidende Rentenkürzungen und weitere benachteiligende Regelungen umgesetzt (u. a. §§ 6 Abs. 2 und 3; 7 und 10 AAÜG). Die vom Einigungsvertrag und vom Rentenangleichungsgesetz der DDR vorgegebenen – und in der rechtsstaatlichen Ordnung der Bundesrepublik eigentlich selbstverständlichen – Voraussetzungen für solche Rentenkürzungen sowie der dafür vorgesehen Entscheidungswege wurden beiseite geschoben. Anlage II Kap. VIII Sachgebiet F Abschn. III Nr. 8 zum EV brachte unter Buchst. e) und f) eine Neufassung des § 27 Abs. 1 RAG sowie eine Änderung der Maßgabe Buchst. b) Satz 3 Nr. 2 in Abschnitt II Nr. 9. Dort waren Voraussetzungen für die Kürzung bzw. Aberkennung genauer geregelt. Entscheidungen über die in Nummer 8 genannten Kürzungen waren gem. § 27 Abs. 2 RAG zu bildenden Kommissionen übertragen worden. Die zum Rentenstrafrecht vom RÜG vorgesehene Verfahrensweise lag offensichtlich außerhalb der Vorstellungen der Schöpfer des Einigungsvertrages und der Volkskammerabgeordneten. An Stelle dessen schuf der Bundesgesetzgeber sich einen Ausweg pauschaler Eingriffsrechte gegen mit unbestimmten, nicht bestimmbaren Begriffen angeblich ausreichend „bestimmte“ Gruppen von Betroffenen. Die Flucht in die Pauschalität und Unbestimmtheit diente als Ersatz für jede konkrete Feststellung, warum die aus der DDR stammenden Leistungen ungerechtfertigt oder überhöht gewesen sein sollen. Sie ersetzt noch heute bei Gerichten alle Nachforschungen, die nach dem Amtsermittlungsprinzip Pflicht der Gerichte sind, um den Umfang der Benachteiligungen festzustellen, so dass die Betroffenen keine Chance haben, sich zu verteidigen. Der Wahrheitsgehalt der Gesetzesbegründung und der pauschalen Annahmen wurde erst Jahre später aufgrund von Vorlagebeschlüssen und Verfassungsbeschwerden durch das BVerfG, und zwar ohne Mitwirkung des befangenen Gerichtspräsidenten geprüft. Im Ergebnis stellte es am 28. 4. 1999 fest, dass die Rentenkürzungen gegenüber Angehörigen der ehemaligen DDR-Intelligenz und dass das Rentenstrafrecht (§§ 10 Abs. 1, 6 Abs. 2 und 3 AAÜG) verfassungswidrig sind,13 entschied am 23. 6. 2004, dass die Vermutungen, auf die die Kürzungen und das Rentenstrafrecht gestützt waren, von Anfang an fehlerhaft waren.14 Obwohl das BVerfG zweimal dem Gesetzgeber mangelhafte Arbeit bescheinigen musste, hielt er stur an seinem unzureichenden Konzept fest, wieder mit Begründungen, die nach der Rechtslogik keiner Nachprüfung standhalten.15 Es ist des Rechtsstaates unwürdig, dass der Gesetzgeber weiter versucht, die pauschalen Ab13 14 15
BVerfGE 100, 1 – 137. BVerfGE 111, 115. Siehe hierzu oben unter L. II. 2.
164
M. Machtpolitik vs. Recht
strafungen des Rentenstrafrechts durch das sog. 1. AAÜG-ÄndG zu erhalten. Hinzu kam, dass die Auszahlung der zu Unrecht einbehaltenen Teile des Alterseinkommens der Betroffenen durch die Behörde weiter verzögert wurde. Die meisten Betroffenen hatten bis zum 31. 12. 2005 noch immer nicht die gemäß dem Rentenstrafrechtsbeseitigungsbeschluss des BVerfG vom 23. 6. 2004 zu leistenden Nachzahlungen erhalten. Kein Politiker hat sich gefunden, der wenigstens sein Bedauern darüber ausgesprochen hat, dass der Gesetzgeber vielen tausend Bürgern verfassungswidrig empfindliche Benachteiligung auferlegt und ihnen damit eineinhalb Jahrzehnte lang ihren Lebensabend vergällt hat, dass die Nachzahlungen nicht verzögert werden dürfen und dass die Ehre der zu Unrecht Benachteiligten zu wahren sei.16 Es ist bekannt, wie auch die Diskussion auf dem Juristentag 2005 Bonn gezeigt hat, dass die Bundesrepublik große Schwierigkeiten hat, Gesetze zu erlassen, die den formellen, methodischen und inhaltlichen Anforderungen der Verfassung entsprechen und umsetzbar sind. Das bezeugen die Gesetze zu Hartz IV ebenso wie die Steuergesetze und das komplizierte Alterssicherungsrecht des Bundes. Einen Höhepunkt bilden jedoch die Gesetze zur Alterssicherung Ost, zur Rentenund Versorgungsüberleitung. Sie können weder von den Betroffenen noch von den Bearbeitern in den Behörden oder von den Richtern der Instanzgerichte verstanden werden. Es ist schon erstaunlich, dass noch kein Richter den Mut gehabt hat, dass die unüberschaubaren und komplizierten Vorschriften schon deshalb verfassungswidrig sind, weil sie für die Betroffenen und die Öffentlichkeit unverständlich und zudem so unbestimmt sind, dass sie die Entscheidungen der Behörden der unverzichtbaren Kontrolle entziehen. Rechtsfrieden kommt dadurch nicht zustande.
III. Das Bundesverfassungsgericht: Zum Beschluss vom 6. 7. 2010 Hat das BVerfG anfangs – ohne Mitwirkung des befangenen Präsidenten Papier – in seinen Entscheidungen noch eine relative Souveränität und richterliche Unabhängigkeit gegenüber der Bundesregierung und dem Bundesgesetzgeber und gewisse Rechts-Klarheit obwalten lassen,17 hat es in der Zwischen- und Folgezeit nun wieder unter Mitwirkung des in seiner Parteinahme für die Bundesregierung befangenen Präsidenten Papier eine völlige Kehrtwendung von seinen früheren Entscheidungen gemacht und sich, um die Position der Bundesregierung und des Gesetzgebers, die stur an ihrem verfehlten Konzept, unbeeindruckt von der Rechtswahrheit, festhalten, zu halten, reinem Gesetzespositivismus verschrieben und die jeweils nachgeschobenen, wechselnden, realitätsblinden und unhaltbaren Begründungen des Gesetzgebers für die drastischen Rentenkürzungen bis hin zur Liquidierung der Ansprüche aus den Zusatz- und den der westdeutschen Besoldungs16 17
K.-H. Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, S. 183 f. BVerfGE 100, 1 – 157; 111, 115.
III. Zum Beschluss vom 6. 7. 2010
165
versorgung der öffentlich Bediensteten ähnelnden – Sonder- bzw. Gesamtversorgungssystemen akzeptiert.18 Die vorläufige „Krönung“ der Rechtsverweigerung stellt der Beschluss vom 6. 7. 2010 des 1. Senats des BVerfG dar,19 dem der Präsident Papier bis zu seinem Ausscheiden angehörte und dessen „Geist“ in der Rechtsverweigerung nachwirkt. Wenn ein Gesetz – wie § 6 Abs. 2 i. d. F. des 1. AAÜG-ÄndG – auf einem unrichtigen Tatbestand – Weisungsbefugnis des aufgelisteten Personenkreises gegen dem MfS – aufbaut, aus denen sich Sanktionen ergeben, dann sind die Sanktionen nichtig. In einem Rechtsstaat muss ein solches Gesetz für verfassungswidrig erklärt werden. Das BVerfG praktiziert eine Aufhebung aller kausalen Zusammenhänge: „§ 6 Abs. 2 AAÜG sanktioniert nicht früheres Verhalten der Betroffenen durch Kürzung ihrer Renten, sondern versagt die Fortschreibung von Vorteilen aus dem System der DDR im Rentenrecht der Bundesrepublik.“20 Es ist aber offensichtlich: Wenn kein „früheres Verhalten“ vorliegt, gibt es auch bei diesen Personen keinen Grund eines abwegigen, gesetzlich sanktionierten Eingriffs in ihre Rentenansprüche. Dass aber „früheres Verhalten“ sanktioniert wird, unterstreicht das BVerfG durch Begründungen an anderer Stelle wie „Parteilichkeit und Systemtreue“ oder „System der Selbstprivilegierung“, alles Dinge, die der Wertneutralität des Rentenrechts widersprechen. In den früheren Entscheidungen von 1999 und 2004 galt noch die für das wertneutrale Rentenrecht wichtige Aussage, dass eine für die DDR nützliche Tätigkeit allein kein Grund sein darf, eine Rentenkürzung vorzunehmen. Aus der „Staats- und Systemnähe“ allein ergebe sich keinesfalls, dass Entgelte gezahlt worden seien, die nicht durch Arbeit und Leistung gerechtfertigt und insoweit „überhöht“ gewesen seien. Das BVerfG sieht die Schuld der Betroffenen darin, dass sie „einen erheblichen Beitrag zur Stärkung oder Aufrechterhaltung des politischen Systems der DDR geleistet haben“.21 Dies war aber Auftrag dieser Personen aus der Verfassung der DDR. Die Rentenkürzungen der Minister und ihrer Stellvertreter erfolgte also, weil sie treu zur Verfassung standen und zum Wohle der Bürger ihren Staat stärkten. Es sei daran erinnert, dass die Bundesrepublik Deutschland seinerzeit die DDR als souveränen Staat anerkannt hatte. Es wird für unnötig erachtet, was den Betroffenen konkret vorzuwerfen sei, ob und inwieweit sie durch bestimmte Handlungen oder Verhaltensweisen Schuld im rechtsethischen Sinne auf sich geladen hätten. Für das BVerfG genügt der pauschale, völlig unsubstantiierte Vorwurf der „Parteilichkeit und Systemtreue“. 18
BVerfG, Beschl. vom 2. 7. 2002 – 1 BvR 2544/95 u. a. – Balletttänzer; Beschl. vom 22. 6. 2004 – 1 BvR 1070/02, vgl. Internet BVerfGE – MfS-Angehörige; Beschl. vom 11. 5. 2005 – 1 BvL 368/97, 1304/98, 2300/98 und 2144/00 – Auffüllbeträge. 19 BVerfG, Beschl. vom 6. 7. 2010 – 1 BvL 9/06, 2/08 – Minister, stellvertretender Minister. 20 Beschluss vom 6. 7. 2010, Rn. 74. 21 Ebd., Rn. 85.
166
M. Machtpolitik vs. Recht
Hier zeigt sich, dass man mit solchen verschwommenen Begriffen beliebig schalten und walten kann, in sie alles hinein- oder herauslesen kann. Goethe würde dem BVerfG heute wieder zurufen: „Im Auslegen seid frisch und munter! Legt ihr’s nicht aus, so legt was unter.“22
Dem BVerfG hätte gut getan, in Fragen der System- und Pflichttreue und Parteilichkeit zumindest einen scheuen Blick in das Grundgesetz mit seinem Amtseid (Art. 56, 64 Abs. 2 GG) zu werfen. Vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler bis hin zu den Bundesministern gilt, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm abzuwenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen, ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben haben. Für die Verfassungsrichter gilt Entsprechendes, urteilen sie doch „Im Namen des Volkes“. Niemand hat bisher den Vorschlag unterbreitet, dass den Mitgliedern der Bundesorgane die Bezüge oder die Versorgung zu kürzen seien, weil sie das politische System der Bundesrepublik repräsentieren und stützen, ohne konkret damit Vorwürfe zu verbinden, dass das System nicht mehr funktioniert.23 Das BVerfG versagt sich ebenfalls den Blick auf das dichte Geflecht der „Selbstprivilegierung“ bis hin zur „Selbstbedienung“ im politischen System der Bundesrepublik,24 dem es von Verfassung wegen einen Einhalt gebieten müsste. Demgegenüber sind die vom BVerfG im Beschluss vom 6. 7. 2010 aufgezählten Beispiele angeblicher „Selbstprivilegierung“ bis zur Unbedeutendheit zu vernachlässigen, im Vergleich „ärmlich“, abgesehen davon, dass hier nicht einmal von Privilegierung gesprochen werden kann, weil die Chancen, etwas zugeteilt zu bekommen, für breite Bevölkerungsschichten bestanden und es in der Natur der Planwirtschaft liegt, Güter materieller und immaterieller Art zu organisieren und zuzuteilen. Den Richtern und ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern geht hier schlicht die Phantasie durch. Sie haben sich – das jedenfalls ist nachvollziehbar – ausgehend von Erfahrungen mit Vorteilsstreben bis hin zu Korruption in der Bundesrepublik – von den Ackermännern bis zu Zumwinkels – ein Bild ausgemalt, nach dem in der DDR noch schlimmere Egoismen täglicher Brauch gewesen sein müssen als in der Bundesrepublik. Dem BVerfG kann der Vorwurf nicht erspart werden, nicht nur 20 Jahre nach Herstellung der Einheit die gesellschaftlichen, tatsächlichen Verhältnisse in der DDR 22 Aus dem 2. Buche der Goetheschen „Zahmen Xenien“; Bd. 3 der Weimarer Ausgabe, 1890, S. 258. 23 Zu den Krankheiten des Systems vgl. statt vieler Hans Herbert von Arnim, Die Deutschlandakte, 1. Aufl., München 2010; ders., Das System, die Machenschaften der Macht, München 2001. 24 Vgl. hierzu statt vieler Hans Herbert von Arnim, Diener vieler Herren. Die Doppel- und Dreifachversorgung von Politikern, München 1998; ders., Die Partei, der Abgeordnete und das Geld. Parteienfinanzierung in Deutschland, München 1996.
III. Zum Beschluss vom 6. 7. 2010
167
nicht erfasst und erkannt zu haben, sondern in Selbstgenügsamkeit die eigenen, nicht akzeptablen Verhältnisse in der Bundesrepublik im Vergleich ausgeblendet zu haben (Äquivokation der Begriffe). Zusammenfassend muss zu dem Beschluss vom 6. 7. 2010 gesagt werden, – dass er für jeden Sachkundigen einen geradezu grotesken Mangel an Exaktheit und eine logisch nicht nachvollziehbare Gedankenführung aufweist; – dass er sich im wesentlichen nur auf allgemeine Aussagen in Form von Annahmen bzw. Vermutungen stützt, die als objektive Gegebenheiten ausgegeben werden und einer exakten Subsumption nicht standhalten; – dass es in Wirklichkeit keinen einzigen nachvollziehbaren Anhaltspunkt für die Behauptung der Richter gibt, dass der Gesetzgeber beim 1. AAÜG-ÄndG berechtigt gewesen wäre, davon auszugehen, „dass die an solche Führungskräfte gezahlten Entgelte zu einem gewissen Teil nicht durch Leistung, sondern als Belohnung für politische Anpassung und unbedingte Erfüllung des Herrschaftsanspruchs der SED erworben wurden“;25 – dass die Rentenkürzung auch nicht dadurch gerechtfertigt ist, um „die Fortschreibung von Vorteilen aus dem System der DDR im Rentenrecht der Bundesrepublik“ zu versagen.26 Solche vermeintlichen „Vorteile“ konnten die Richter weder orten noch nachvollziehen, speziell auch in dem Fall der Kläger, beschreiben. Alles in allem hat richterliche Macht das Recht verdrängt.
25 26
Rn. 78. Rn. 74.
N. Vergangenheit, die nicht vergeht Mit den gravierenden Abweichungen des Beschlusses des BVerfG vom 6. 7. 20101 von anderen, früheren Entscheidungen des Gerichts wäre zumindest eine eingehende und konkret werdende Auseinandersetzung mit dem Inhalt früherer Entscheidungen2 erforderlich gewesen. Weil das versäumt wurde und nicht gewollt war, eröffnet sich nun durch die nebeneinander existierenden widersprüchlichen Positionen in den unterschiedlichen Entscheidungen des BVerfG für die nachfolgenden Rechtsstreitigkeiten3 bei den Sozial- und Landessozialgerichten ein Spielraum, dem diese Gerichte in eigener Unabhängigkeit und mit eigenen Gedanken ausfüllen könnten – wenn sie sich das nur trauen würden. Die Interessengemeinschaften haben angekündigt, ihren „Kampf“ vor den Gerichten weiterzuführen.4 Zudem ermöglichen die offenen Gegensätze zwischen den Entscheidungen des BVerfG auch die Verwerfung des Rentenstrafrechts. Bereits vor Jahren hatte Rudolf Dreßler – MdB – namens SPD im Bundestag 1998 erklärt: „Wir fordern die Abschaffung des Rentenstrafrechts (…) um des Rechtsstaates willen.“5
I. Afterdienst6 In Anbetracht der Gesetzesentwicklung des RÜG/AAÜG ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Gesetzgeber besserer Einsicht beugt, sein bloßes Meinen aufgibt und sich an dem orientiert, was die Wirklichkeit vom Recht erheischt, eine weitere Änderung vorlegt, um die Situation endgültig zu befrieden. Die Gesetzge-
1
BVerfGE 126, 233. BVerfGE 100, 1 – 157; 111, 115. 3 Siehe hierzu auch Abschnitt P. 4 Mitteilungen der Initiativgemeinschaft zum Schutz der sozialen Rechte ehemaliger Angehöriger bewaffneter Organe und Zollverwaltung der DDR, in: ISOR aktuell 9/2010, S. 2 – 5. 5 BT-Plenarprotokoll vom 26. 1. 1998, 13/15, S. 959. 6 Das Wort „Afterdienst“ ist dem Werk Kants, Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft (1773/74), in: Werkausgabe Bd. VII, hrsg. von Wilhelm Weischedel, 1. Aufl., Frankfurt am Main 1977, S. 646 ff., Viertes Stück, zweiter Teil, S. 838 ff., entlehnt. Er verwendet die Bezeichnung, um eine Situation zu beschreiben, in der aus einem bloßen Meinen auf die Existenz einer Tatsache geschlossen wird. Von der wahren Vernunftreligion unterscheidet Kant den Kultusdienst der statuarischen, auf Offenbarung gegründeten Kirche, die ungeachtet der Realität und der Welt der Tatsachen rein durch subjektive Gründe wie das Gefühl, die Existenz Gottes zu beweisen versucht. 2
II. Verlust der Rechtskultur im Zwange des Zeitgeistes
169
bung ist nach den Erfahrungen lediglich Vollzugsorgan der jeweiligen Regierung.7 Und auch die Regierungskoalition aus CDU/CSU und FDP hat bisher, im vierten Jahr ihrer Regierung in 2012, keinen ernsthaften Versuch unternommen, die Dinge voranzubringen, obwohl dies in der vergangenen 16. Legislaturperiode vollmundig zugesichert worden war.
II. Verlust der Rechtskultur im Zwange des Zeitgeistes Das Bundesverfassungsgericht befindet sich im gefährlichen Strom von Machtpolitik, die den Zeitgeist bestimmt, Hand in Hand mit den Medien, die bestimmen, was der Bürger zu denken hat. Das lässt sich auch an Hand anderer umstrittener Entscheidungen zum Völkerrecht, Staatsrecht und zum politischen Recht verdeutlichen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich niemals gegen eine breite politische Strömung gestellt, vor allem aus dem Regierungslager, dem die Bundesverfassungsrichter ihr Amt verdanken.8 Das hat es bei den Ostverträgen9 nicht getan, nicht bei der Abtreibung und bei den europäischen Verträgen,10 letztlich auch nicht beim sog. „Volksverhetzungsparagraphen“, zu § 130 Abs. 4 StGB.11 Auch im Falle der 7
H. H. von Arnim, Die Deutschlandakte, S. 26 ff., 190 ff. Paul Rosen, Zur letzten Instanz, in: JF Nr. 27/12 vom 29. 6. 2012, S. 13. 9 Zu den Ostverträgen vgl. Otto Luchterhandt, Die staatliche Teilung Deutschlands, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR I, 3. Aufl., § 10 Rn. 55 ff.; Karl Albrecht Schachtschneider, Die Souveränität Deutschlands, 1. Aufl., 2012, S. 139 ff. 10 BVerGE 89,159 – Maastricht-Urteil. BVerfGE 97, 350 – Währungsunion/Euro. – Vgl. Wilhelm Hankel/Wilhelm Nölling/Karl Albrecht Schachtschneider/Joachim Starbatty, Die Euro-Klage. Warum die Währungsunion scheitern muss, Reinbek 1998. BVerfGE 123, 267 – Lissabon-Urteil. BVerfG, Beschl. vom 7. 5. 2010 – 2 BvR 987/10 – BVerfGE 125, 385 – Währungspolitik/ Griechenlandhilfe. BVerfG, Urteil vom 7. 9. 2011 – Vorläufiger Rettungsschirm. – Zu den europäischen Verträgen vgl. Karl Albrecht Schachtschneider, Die Rechtswidrigkeit der Euro-Rettungspolitik. Ein Staatsstreich der politischen Klasse, 1. Aufl., Rottenburg 2011; Dirk Meyer, Euro-Krise. Austritt als Lösung?, Lit Verlag, Berlin 2012. 11 BVerfGE 124, 300. – Hierzu aus der reichhaltigen Kommentierung: Felix Krautkrämer, Das Kreuz mit der Meinung. Paragraph 130 Strafgesetzbuch: Im Spannungsfeld zwischen Demokratieschutz und Maulkorberlass, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 12. – Vgl. ferner Johannes Masing, Meinungsfreiheit und Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, in: JZ 12/ 2012, S. 585 – 592. Vgl. auch Thorsten Hinz, Klima der Furcht, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 1: „Gesinnungsschnüffelei und Denunziantentum beherrschen hierzulande den öffentlichen Raum.“; zur Meinungsfreiheit in Deutschland vgl. auch Ken Jebsen, „Das erinnert mich an die DDR“, in: ebd., S. 3; Henning Hoffgaard, Grenzen wurden überschritten. Streit um Ruderin: Politiker fordern Konsequenzen für Nadja Drygalla, in: ebd., S. 4; Junge Freiheit, Artikel Vorsicht, Falle!, in: ebd., S. 7. 8
170
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
Versorgungsüberleitung Ost ist es weitgehend eingeschwenkt, nachdem es anfangs gute Ansätze gemacht hatte,12 dann aber später die Linie der Regierungspolitik verfolgt hat. Der Beschluss des BVerfG vom 6.7. 201013 zum Rentenstrafrecht ist politische Justiz. Wider besserer Erkenntnis, ungeachtet schwebender parlamentarischer Beratungen zur Korrektur der Überleitung von DDR-Alterssicherungen in bundesdeutsches Recht,14 der Kritik in der rechtswissenschaftlichen Literatur15 und aus der Öffentlichkeit der Betroffenen und ihrer Vereinigungen, aber auch entgegen des sich mittlerweile anbahnenden Meinungsumschwunges bei einigen Sozialgerichten16 setzt das BVerfG in der Versorgungsüberleitung Ost seine grundrechtsaufhebende Rechtsprechung zu Art. 14 Abs. 1 Satz 1, 3 Abs. 1 GG fort. Es weigert sich, die staatspolitischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten und Notwendigkeiten für die Bürger der DDR zu erfassen und zu verstehen; oder es blendet sie aus, falls sie sie sieht – alles muss so sein, wie es sein Meinungsbild suggeriert. Für den Kundigen, den Wissenden, bleibt nur die missliebige Folgerung, dass das höchste Gericht ein „gebrochenes“ Verhältnis zum anderen Teil Deutschlands hat oder die verlängerte „Werkbank“ der Herrschenden ist.17 Sarrazin hat hierzu aus seiner Erfahrung treffend die Situation kommentiert: „Niemals würde sich das Bundesverfassungsgericht gegen eine breite politische Strömung stellen.“18 „Die Waffe des Verfassungsgerichts ist seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil zum europäischen Stabilisierungsmechanismus stumpf geworden.“19 In einem bissigen Kommentar zum Urteil des BVerfG über den Einsatz von Tornadoflugzeugen20 hat Prantl in der Süddeutschen Zeitung vom 4. 7. 2007 die Wahrheit auf den Punkt gebracht: „Wer darüber urteilen darf, was Politik machen darf und was nicht, macht Politik; also macht das Bundesverfassungsgericht Politik.“ „Politik aus Karlsruhe“ ist ein alter, weit verbreiteter und schwerwiegender Vorwurf gegenüber dem Bundesverfassungsgericht. Hassemer hat den Vorwurf auf
12 13 14 15
1994. 16
BVerfGE 100, 1 – Zahlbetragsgarantie. BVerfGE 126, 233. BT-Drs. 17/1631 vom 6. 5. 2010. Vgl. statt vieler D. Merten, Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, 2. Aufl.,
Bisher wurde Richtern, die eine andere Meinung vertreten, durch Änderung der Geschäftsverteilung die Zuständigkeit entzogen, ein weiteres Beispiel, auf welche Weise die Politik in die Justiz und Unabhängigkeit der Richter „hineinregiert“. 17 Zur Bodenreform vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Berlin 2011, S. 176 ff.; Thorsten Purps, Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards?, in: NJ 6/2009, S. 233 ff. 18 Thilo Sarrazin, Deutschland braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, 1. Aufl., München 2012, S. 207. 19 Ebd., S. 211. 20 BVerfG, Urt. vom 3. 7. 2007 – 2 BvE 2/07.
II. Verlust der Rechtskultur im Zwange des Zeitgeistes
171
seinen Inhalt, seine Berechtigung und seine Konsequenzen befragt.21 Seine Zusammenfassung lautet:22 „Es lässt sich erklären und an Beispielen studieren, dass das Gericht nicht nur situativ, sondern auch aus strukturellen Gründen immer wieder vom Pfad der justiziellen Tugend abkommt. Auf diese Strukturen passen Vorkehrungen, mit denen der Gesetzgeber, vor allem im Grundgesetz und im Gesetz über das BVerfG, die Entscheidungsmacht des BVerfG bremst und bricht. Demselben Ziel dienen Routinen, die das Gericht befolgt, um den Respekt vor den anderen Verfassungsorganen im Alltag der Rechtsprechung zu sichern.“
In seinem Fazit räumt Hassemer immerhin ein:23 „… Dass Karlsruhe sich der Politik enthält, lässt sich begründen und fordern, es lässt sich aber nicht streng sichern. Immerhin lassen sich Abwege beobachten und markieren, und am Ende ist eine kritische Öffentlichkeit das beste Mittel gegen ,Politik aus Karlsruhe‘.“
Das Problem, das verständlicherweise auch Hassemer entgleiten muss, stellt sich insbesondere unter zwei Aspekten: 1. Politik wird dann gemacht, wenn das Gericht einen zu großen „Respekt“ gegenüber der politischen Exekutive und Legislative walten lässt. Das tritt dann ein, wenn ein Richter sich von der Nähe zu einer Regierungspartei, der er sein Amt zu verdanken hat, bewusst oder unbewusst nicht löst. 2. Eine kritische Öffentlichkeit als Kontrollinstanz gegen „Politik aus Karlsruhe“ lässt sich schwerlich organisieren, wenn es um grundsätzliche Fragen geht, die der Regierung besonders angelegen sind, wenn die Regierung Hand in Hand mit den Medien eine Propagandawelle inszeniert, die jeden Kritiker ins Abseits stellt. Das war bei der Versorgungsüberleitung Ost der Fall, das ist zum weiteren Beispiel bei den europäischen Verträgen auch seit langem der Fall. Zu politisch brisanten, existenziellen Fragen ist die Versuchung groß, jede grundsätzliche Diskussion um die Sinnhaftigkeit einer Regelung weiterhin zu unterbinden. Für den Einigungsprozess und der Versorgungsüberleitung Ost ist dies mit der Formel „Die Ost-Rentner sind die Gewinner der Einheit“, die dazu geführt hat, den Graben zwischen westdeutschen Rentnern und ehemaligen DDR-Bürgern zu vertiefen, suggeriert die Formel doch eindringlich, dass zu Unrecht üppige OstRenten auf Kosten westdeutscher Steuerzahler gewährt werden. Das Beispiel lässt sich beliebig vermehren, ist kein Einzelfall. Für Deutschland ist dies Angela Merkel mit der „Totschlags“-Formel „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ meisterhaft gelungen.24 Denn niemand in Deutschland, außer einigen Andersdenkenden, möchte für das Scheitern Europas verantwortlich sein. Für den Wirtschaftshistoriker
21 Winfried Hassemer, Politik aus Karlsruhe?, in: JZ 1/2008, S. 1 – 10. Hassemer war Vizepräsident des BVerfG. 22 Ebd., S. 10. 23 Ebd., S. 10. 24 Th. Sarrazin, Europa braucht den Euro nicht, S. 245.
172
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
Abelshausen gilt hingegen: „Die Parole ,Scheitert der Euro – scheitert Europa‘ ist gefährlich, weil sie falsch ist. Eher ist das Gegenteil richtig. …“25 Diese Entwicklung ist bedauerlich, ist sie jedoch darauf zurückzuführen, dass die Suche nach der Wahrheit einen offenen Diskurs mit Rede und Gegenrede im Parlament, an sich der Vertretung des Volkes, und in der außerparlamentarischen Öffentlichkeit durch eine Parteioligarchie blockiert wird.26
III. Zum Ideal einer „lebendigen Demokratie“ Eine „lebendige Demokratie“ setzt die Bereitschaft voraus, Informationen zu geben und zu verbreiten, als Grundlage einer Informationsfreiheit und der Meinungsäußerungsfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht ist in einer schwierigen Situation, wenn ihm zu Gesetzesvorhaben nicht die ganze Wahrheit vermittelt wird.27 Auch ihm sind der Erkenntnisfreiheit Grenzen gesetzt, es sei denn, es verschließt sich weiterer Erkenntnis, soweit es diese kraft seiner prozessualen Möglichkeiten in Erfahrung bringen kann. Eine „lebendige Demokratie“, wie das Bundesverfassungsgericht sagt,28 bedarf des bestmöglichen Diskurses und damit bestmöglicher Institutionen des Diskurses, die nicht erst von den Gesetzen zur Wahrheitlichkeit und Richtigkeit erzwungen werden müssen, sondern deren Ethos der bestmögliche Beitrag zum Recht als Wirklichkeit des gemeinsamen Lebens in Freiheit ist.29 Eine Demokratie erstarrt zur bloßen Form,30 wenn wichtige Fakten unterdrückt werden und damit die Ausübung der Meinungsfreiheit aufgrund von Rede und Gegenrede und damit eine Pluralität von Meinungen verhindert wird. Schachtschneider dringt zum Kern vor:31
25
Werner Abelshauser, Deutschland, Europa und die Welt, in: FAZ vom 9. 12. 2011, S. 12. Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Abschnitt J „Deutsche Republik und Parteienstaat“, S. 83 – 104. 27 Vgl. hierzu z. B. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 179, zur Rolle der Bundesregierung im Zuge der Aufarbeitung der Folgen der Bodenreform, und BVerfGE 84, 90 = NJW 1991, 1997. 28 BVerfGE 89, 155 [LS 3 b, S. 186, 213]. 29 Karl Albrecht Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, in: Dietrich Murswiek u. a. (Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, Berlin 2000, S. 141 (150). 30 Zur Demokratiekritik der Bundesrepublik vgl. statt vieler H. H. von Arnim, Vom schönen Schein der Demokratie, 2000; ders., Das System, 2001; ders., Die Deutschlandakte, 2009. – Zu den Ursprüngen der griechischen Demokratie in der Polis und zum Wesen der Rede als ein Mittel des Überredens und Überzeugens Aristoteles, Rhetorik, 1354 a 12 ff., 1355 b 26 ff.; Hannah Arendt,Vita activa …, S. 36 – 38; dies., Der Sinn von Politik, in: dies., Denken ohne Geländer, 2006, S. 74 – 79. 31 K. A. Schachtschneider, Der republikwidrige Parteienstaat, S. 150. 26
III. Zum Ideal einer „lebendigen Demokratie“
173
„Nur Beiträge zum Wahren und Richtigen sind … Meinungen im Sinne des Art. 5 Abs. 1 GG, der Meinungsfreiheit. In der Republik als aufklärerischem Gemeinwesen ist der Versuch, die Menschen zu einer bestimmten Meinung zu drängen, sie zu erziehen, nicht der bestmögliche Beitrag, sondern als geistiger Zwang eine Form der Entmündigung, zumal, wenn sie folgenreich political correctness einfordert. Kants Leitspruch der Aufklärung: Sapere aude! ,Habe den Mut, dich des eigenen Verstandes zu bedienen‘,32 verlangt Information ohne jeden Vorbehalt, ohne jeden Hintergedanken, wahrheitliche Berichterstattung, die allein Grundrecht des Rundfunks ist (Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG). Nach dem oben zitierten Art. 1 AEMR ist der Mensch ,mit Vernunft und Gewissen begabt‘, als fähig, sich eine Meinung im Politischen zu bilden. Er kann aber nur am Diskurs teilnehmen, wenn er so informiert wird, wie man jemanden informiert, den man als Bürger achtet, als seinesgleichen. Die informationelle Fremdbestimmung der Menschen spricht diesen die Bürgerlichkeit ab und beansprucht, gestützt durch die (fehlinformierte) Zustimmung der Vielen und das Schweigen verängstigter Opponenten, Herrschaft, weitgehend vereint mit der Parteioligarchie, Herrschaft sogar über die Verwaltungen und vor allem die Gerichte, deren Entscheidungen, wenn sie nicht opportun sind, in einer Weise diffamiert werden, die deren amtliche Unabhängigkeit verletzt. Die genaue Information ist auch ein Akt der Sittlichkeit, nicht der Paternalismus des Gesinnungsjournalismus, der sich ohnehin nur behauptet, wenn er (illegitimer) Herrschaft dient, und wegen der Bündnisse mit den Herren der Republik besonders abträglich ist. Dieses Bündnis ist das Problem unserer Zeit, in der der Widerspruch der parteistaatlichen Despotie zum Republikanismus in der Krise ist.“
Auch das Bundesverfassungsgericht ist im Falle der Versorgungsüberleitung Ost in der Falle des organisierten Verschweigens geraten, speziell mit seinem Beschluss vom 6. 7. 201033 zum Rentenstrafrecht, hat sich besserer Erkenntnis verschlossen, obwohl ihn diese vom SG Berlin in seinem Vorlagebeschluss vom 9. 6. 2006 vermittelt worden ist, hat sich den Zwängen der informationellen Fremdbestimmung unterworfen. Auf die Rechtsprechung trifft manchmal sinngemäß zu, was Hegel so treffend zur Philosophie gesagt hat:34 „Das was ist zu begreifen, ist Aufgabe der Philosophie, denn was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes Sohn seiner Zeit, so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst. Es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gehe über die gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über den Rhodus hinaus. Geht eine Theorie in der Tat darüber hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, aber nur in unserem Meinen – einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden lässt.“
In dem sehr sensiblen Bereich der Versorgungsüberleitung Ost, speziell des „Rentenstrafrechts“ haben Regierung und das Bundesverfassungsgericht eine Welt gebaut, wie sie sein soll, aber nur in ihrem Meinen existiert. 32
Zitat Schachtschneider, ebd.: Beantwortet die Frage: Was ist Aufklärung?, (1784), in: Kant, Sämtliche Werke, Bd. 9, S. 53. 33 1 BvL 9/06, 2/08 – Minister, stellvertretender Minister; BVerfGE 126, 233. 34 Georg Friedrich Wilhelm Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), Werke 7, 1. Aufl., Frankfurt am Main 1986, Vorrede, S. 26.
174
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“ Die Bundesregierung geht dazu über, die Reine Rechtslehre Hans Kelsens35 zu praktizieren, eine Theorie, die schon längst überwunden zu sein schien. Auch das Bundesverfassungsgericht scheint neuerdings gegen ihren Einfluss nicht gefeit zu sein. Nach dieser Lehre ist im Grundsatz alles „Recht“, was das Gesetz produziert. Klenner hat die Reine Rechtslehre als „Rechtsleere“ verurteilt.36 Liberaldemokratische Regierungen, die auf einer auswechselbaren Parteiherrschaft im Parteienstaat beruhen, haben die Möglichkeit, rechtliche Bestimmungen unaufhörlich zu ändern, und zwar aufgrund eines einfachen oder qualifizierten Mehrheitsbeschlusses.37 Der echte Rechtsstaat beruht hingegen darauf, das Recht dank einer bestimmen Weltansicht und -anschauung theologisch-philosophischer Art so unveränderlich zu erhalten, nicht zuletzt um eine Rechtsunsicherheit zu vermeiden.38 Die ideologische Schaukelherrschaft fördert den steten Rechtswandel.39 Eine besondere Form der Entartung ist der Rechtspositivismus. Er erklärt einfach jedes Gesetz, das von irgendeiner Regierung (Monarchie, Aristokratie, Demokratie, Oligarchie, Diktatur) erlassen wird, als „zu Recht“ erlassen und bindend. Er verwirft – als „reines Recht“ – Wertvorstellungen religiöser, philosophischer oder traditioneller Art. Der Gedanke des reinen Rechts taucht zuerst in der Reinen Rechtslehre Kelsens auf. Für ihn kommt es nicht auf den Inhalt von Rechtsnormen an, sondern allein auf ordnungsgemäßes Zustandekommen (Gültigkeit) und Durchsetzbarkeit. Lag letztere vor, war für ihn alles Rechtsstaat, denn er sah jedwedes Unrecht des Staates als einen Widerspruch in sich selbst.40 Kelsen schreibt:41 „Vollends sinnlos ist die Behauptung, dass in der Despotie keine Rechtsordnung bestehe, sondern Willkür des Despoten herrsche … Der despotisch regierte Staat [stellt auch] irgendeine Ordnung menschlichen Verhaltens dar. … Diese Ordnung ist eben die Rechtsordnung. Ihr den Charakter des Rechts abzusprechen, ist eine naturrechtliche Naivität oder Überhebung. … Was als Willkür gedeutet wird, ist nur die rechtliche Möglichkeit der Autokraten, jede Entscheidung an sich zu ziehen, die untergeordneten Organe bedingungslos zu bestimmen und einmal gesetzte Normen jederzeit mit allgemeiner oder nur besonderer Geltung aufzuheben oder abzuändern. Ein solcher Zustand ist ein Rechtszu-
35
Hans Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911; ders., Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1920; ders., Allgemeine Staatslehre, 1925; ders., Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Beitrag zu einer reinen Rechtslehrs, 1920. 36 Hermann Klenner, Rechtsleere – Verurteilung der Reinen Rechtslehre, Berlin 1972. 37 So wie es mit den Gesetzen in der Versorgungsüberleitung Ost geschehen ist, mit den Gesetzen zur Europäischen Union permanent geschieht. 38 Erik von Kuehnelt-Leddihn, Demokratie – eine Analyse, 1996, S. 58. 39 Gottfried Dietze, Begriff des Rechts, 1997, S. 42 ff. 40 H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 1911, S. 249. 41 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre, 1925, S. 335 f.
IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“
175
stand, auch wenn er als nachteilig empfunden wird. Doch er hat seine guten Zeiten. Der im modernen Rechtsstaat gar nicht seltene Ruf nach Diktatur zeigt dies ganz deutlich.“42
Der Rechtspositivismus kommt der modernen, liberalen Demokratie mit ihren parteipolitischen Abwechslungen auffallend entgegen. Die Rechts- und Unrechtsmöglichkeiten sind grenzenlos. Es gibt keine Hindernisse. Die Herrschaft ist absolut.43 Recht ist somit das, was die Mehrheiten gerne sehen. Selbst nach dem Dritten Reich änderte Kelsen, ein Opfer der Rassengesetze dieses Reiches, seine Auffassung nicht.44 *** Der Bürger muss sich fragen, was er erwarten soll von einem Präsidenten des höchsten (Bundesverfassungs-)Gerichts, namentlich Andreas Vosskuhle, der sich der geistigen Verwandtschaft eines solchen rechtsleerenden Rechtsgelehrten rühmt – Kelsen sei sein Vorbild45 -, zumal Kelsen weitere Ansichten vertreten hat, die von geistigen Größen der Weimarer Staatsrechtslehre mit barscher Kritik46 bis hin zu verdeckter Häme47 überzogen wurde. Die moderne Gesellschaftstheorie kommt ohne den Menschen aus. Niklas Luhmanns Systemtheorie eliminiert radikal das Individuum (den Handelnden) aus dem sozialen Kontext – und folglich aus der Gesellschaft – und ersetzt dessen Stelle als „Letztelement der Gesellschaft durch Kommunikation“.48 Eine solche Gesell42
Ebd. Hans Kelsen, Foundations of Democracy, in: Ethics, LXVI (1955), S. 100; hierzu H. Klenner, Rechtsleere … . – Massive Kritik an der Reinen Rechtslehre Kelsens schon von Herrmann Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), in: ders., Gesammelte alte Schriften, 2. Bd., 2. Aufl., 1992, S. 3 – 23 (8 ff.); ders., Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (1927), in: ebd., Bd. 2, 1992, S. 31 – 202 (120 – 165); vgl. auch W. Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, 2002, S. 48 ff., 133 ff.; ders., Vom Wesen der Souveränität, 2007, S. 53, 161; ders., Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 219 f. – Heller befindet kurz und treffend zu Kelsens Allgemeiner Staatslehre: „… der Unterschied zwischen einer Räuberbande und dem Staat war unauffindbar geworden.“ (Die Krisis der Staatslehre, S. 9). 44 Aus ganz anderer philosophischer Perspektive Hermann Klenner, Juristenaufklärung über Gerechtigkeit. Festvortrag auf dem Leibniztag 2006, in: Sitzungsberichte der LeibnizSozietät, Bd. 88, Jg. 2007, S. 35 – 96. 45 Hierzu Oliver Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen, in: JF Nr. 45/09 vom 30. 10. 2009. 46 Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922), 8. Aufl., Berlin 2004, S. 26 ff. 47 H. Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), S. 3 – 30; ders., Die Souveränität (1927), S. 31 – 202 (42, 74, 79). 48 Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 1. Aufl., 1. Bd., Frankfurt am Main 1998, S. 16 (29 f., 78 ff., 92 ff.); zur selbstreferentiellen Konzeption der Gesellschaft, S. 190 ff.; ders., Soziologische Aufklärung 2, Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen 1975, zum Gesellschaftsbegriff, S. 11 – 18. 43
176
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
schaftstheorie steht spiegelbildlich in der Tradition Kelsens „Reiner Rechtslehre“, dessen Staatslehre zu einer Lehre ohne Staat und zu einem Staatsrecht ohne Staat und zu einer Souveränität ohne Souveränitätssubjekt führt.49 *** Kelsen löst das Problem des Souveränitätsbegriffs50 dadurch, dass er es negiert. Der Schluss seiner Deduktion ist: „Der Souveränitätsbegriff muss radikal verdrängt werden.“51 In der Sache ist das die alte liberale Negierung des Staates gegenüber dem Recht und die Ignoranz des selbständigen Problems der Rechtsverwirklichung.52 Kelsen sucht eine einfache „Lösung, indem sie eine Disjunktion: Soziologie-Jurisprudenz aufstellt und mit einem simplistischen Entweder-Oder etwas rein Soziologisches oder etwas rein Juristisches gewinnt“.53 Kelsen hat in seinen Schriften diesen Weg verfolgt. Alle soziologischen Elemente werden aus dem juristischen Begriff ferngehalten, damit in unverfälschter Reinheit ein System von Zurechnungen auf Normen und auf eine letzte einheitliche Grundnorm gewonnen wird. „Die alte Gegenüberstellung von Sein und Sollen, von kausaler normativer Betrachtung wird mit größerer Nachdrücklichkeit und Rigorosität, als es bereits Georg Jellinek und Kistiakowsky getan hatten, aber mit derselben unbewiesenen Selbstverständlichkeit, auf den Gegensatz von Soziologie und Jurisprudenz übertragen.“54
Schmitt fährt in seiner Analyse äußerst bedacht wie folgt fort: „Es scheint zum Schicksal der juristischen Wissenschaft zu gehören, dass ihr von irgendeiner anderen Wissenschaft oder von der Erkenntnistheorie her solche Disjunktionen appliziert werden. Kelsen kommt mit Hilfe dieses Verfahrens zu dem keineswegs überraschenden Resultat, dass für die juristische Betrachtung der Staat etwas rein Juristisches sein müsse, etwas normativ Geltendes, also nicht irgendeine Realität oder Gedachtes neben oder außer der Rechtsordnung, sondern nichts anderes als eben diese Rechtsordnung selbst, freilich (dass hier das Problem liegt, scheint keine Schwierigkeiten zu machen) als eine Einheit. Der Staat ist also weder der Urheber noch die Quelle der Rechtsordnung; alle solche Vorstellungen sind nach Kelsen Personifikationen und Hypostasierungen, Verdoppelungen der einheitlichen und identischen Rechtsordnung zu verschiedenen Subjekten. Der Staat, das heißt die Rechtsordnung, ist ein System von Zurechnungen auf einen letzten Zurechnungspunkt und eine letzte Grundnorm. Die im Staat geltende Über- und Unterordnung beruht darauf, dass von dem einheitlichen Mittelpunkt bis zur untersten Stufe Ermächti49 H. Kelsen, Das Problem der Souveränität …, S. 292, 164 usw.; hierzu H. Heller, Die Souveränität, S. 120 ff. 50 Zum Souveränitätsbegriff vgl. W. Mäder, Vom Wesen der Souveränität. 51 H. Kelsen, Das Problem der Souveränität, S. 320. 52 C. Schmitt, Politische Theologie, S. 29. 53 Ebd., S. 26. – H. Kelsen, Das Problem der Souveränität, Tübingen 1920; ders., Der soziologische und juristische Staatsbegriff, Tübingen 1922. 54 C. Schmitt, Politische Theologie, S. 26/27.
IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“
177
gungen und Kompetenzen ausgehen. Die höchste Kompetenz kommt nicht etwa einer Person oder einem soziologisch-psychologischen Machtkomplex zu, sondern nur der souveränen Ordnung selbst in der Einheit des Normensystems. Für die juristische Betrachtung gibt es weder wirkliche noch fingierte Personen, sondern nur Zurechnungspunkte. Der Staat ist der Endpunkt der Zurechnung, der Punkt, an dem die Zurechnungen, die das Wesen der juristischen Betrachtung ,haltmachen könne‘. Dieser ,Punkt‘ ist zugleich eine ,nicht weiter ableitbare Ordnung‘. Ein durchgehendes System von Ordnungen, ausgehend von der ursprünglichen, letzten, höchsten zu einer niederen, das heißt delegierten Norm, kann auf solche Weise gedacht werden. Das entscheidende, immer und immer von neuem wiederholte und gegen jeden wissenschaftlichen Gegner von neuem vorgebrachte Argument bleibt immer dasselbe: der Grund für die Geltung einer Norm kann wiederum nur eine Norm sein; der Staat ist daher für die juristische Betrachtung identisch mit der Verfassung, das heißt der einheitlichen Grundnorm.“55
Nach Kelsens Lehre ist es unbeachtlich, wer die Norm verfasst und erlässt. Die aus Zurechnungen bestehende Ordnung beansprucht Geltung. In Konsequenz dieser Lehre ist auch der totale Staat legitimiert. *** Für Hermann Heller (1926) ist (vier) Jahre nach Schmitt (1922) die Dauerkrise durch Kelsens „Allgemeine Staatslehre“ nicht nur dokumentiert, sondern „als für Sehende erst in vollem Umfang in ihrer Gefährlichkeit offenbar geworden“.56 Heller hat sich eingehend mit Kelsen befasst. Er führt ein und bemängelt, wie Schmitt, dass Jurisprudenz, Soziologie und Philosophie „in selbstgenügsamer Verschubkastung“ das Staatsproblem jeweils autark angingen. „Zu der Isolierung der Staatslehre von der Soziologie trat – nicht ohne wechselseitige Bedingtheit – ihr Abtrennung von Ethik und Metaphysik hinzu, die im historischen, logistischen und naturalistischen Positivismus ihr Vollendung fand. Man konnte auf diesem Wege im Staate bald nicht mehr als ein Rassen- oder Klassenunterdrückungsinstrument sehen, jedenfalls sollte er sich in Macht, Macht und noch einmal Macht erschöpfen, die Frage nach dem Zweck und Sinn dieser Macht galt als unwissenschaftlich, das Recht wurde zu einem bloßen Befehl dieser Macht an ihre Beamten, der Jurist zum Interpret jedes Befehls; der Unterschied zwischen einer Räuberbande und dem Staate war unauffindbar geworden. (…) Eine positivistische, vom soziologischen Substrat ebenso wie von ethisch-metaphysischen Bestimmungen absehende Rechtswissenschaft wird von Gerber/Laband als Staatslehre inauguriert und schließlich dieser nach unten und oben substanz- und bindungslose Formalismus zur allein wissenschaftlichen, juristischen Methode der Staatslehre erhoben.“57
55 56 57
Ebd., S. 27; Kritik an Kelsens Lehre, S. 28 ff. H. Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), S. 8. Ebd., S. 9 (kursiv vom Verfasser).
178
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
Heller gibt Antwort auf die Frage, wie sich diese radikale Verselbständigung der positivistischen Jurisprudenz in der Staatslehre ausgewirkt hat. „Wird diese dogmatische Methode der Jurisprudenz, die lediglich Interpretations- und Systematisierungszwecken innerhalb einer bestimmten positiven Rechtsordnung dient, zur einzig legitimen Methode einer allgemeinen Staatslehre gemacht, so könnte daraus bestenfalls eine Sammlung der in den verschiedenen Staaten geltenden Rechtsbegriffe werden. Sämtliche Probleme, die seit jeher dem Staatsdenken als die wichtigsten erschienen sind, so die Fragen nach dem Wesen, der Realität und Einheit des Staates, das staatliche Zweck- und Rechtfertigungsproblem,58 die Untersuchung des Verhältnisses von Recht und Macht, damit aber das Staatsproblem als solches wie auch seine Beziehung zum Gesellschaftsbegriff, müssen damit als metajuristisch aus der Staatslehre verbannt werden. Wer aber diese Problematik ausschalten, auf eine allgemeine Staatslehre verzichten und lediglich Staatsrechtslehre treiben zu können meint, ist über die wahre Hierarchie von Sein, Sinn und Sollen in einem schweren Irrtum befangen. Denn die juristische Norm kann sich vom historischsoziologischen Sein und von Wertgesichtspunkten vollständig lösen, ohne sinn- und gehaltlos zu werden. Auch bloße Staatsrechtsjurisprudenz, die zu methodischen Zwecken den Sinn von gesollten Imperativen isolieren wollte, wäre ohne ständigen Ausblick auf die soziologische und teleologische Problematik unmöglich. Die Folgen der fast unbeschränkten Herrschaft des formal-juristischen Positivismus mussten deshalb die folgenden sein: Wurde mit seiner Methode ernst gemacht, so war Staatslehre überhaupt unmöglich; so erklärt sich zum Teil die oben angedeutete, fast völlige literarische Unfruchtbarkeit auf diesem Gebiet.59 (…)“
Heller, auf Kelsen eingehend: „Kelsen will aber nicht etwa das kritische Vermögen des Juristen schulen und ihm zu Bewusstsein bringen, dass und wann er auf historische Gegebenheiten reflektieren und wann er Werturteile fällen muss. Im Gegenteil! Seine mit der einfachen Ebene konstruierende Normlogik will die Rechtswissenschaft zur reinen Normwissenschaft machen; sie zielt auf eine radikale Ausscheidung aller substantiellen Elemente aus den als reine Formen zu fassenden Rechtsbegriffen, auf eine ,Geometrie der totalen Rechtserscheinung‘.60 Wie sieht nun dieses juristische Weltbild aus, das sich aus reiner Logik und aus den ausgeblasenen Eiern reiner Rechtsformen aufbaut? Auf der einen Seite liegt das zu ignorierende Reich lediglich kausal-explikativ zu erfassenden, völlig sinnfremden Seins, ein naturalistisches Gewühl unverbundener sinnlicher Realitäten, darunter auch die menschlichgesellschaftliche Welt samt dem empirischen Ich zu rechnen ist. Auf der anderen Seite, durch keinen begreifbaren Zusammenhang verbunden, ohne Zwischenschaltung einer Sphäre teleologisch zu fassender individueller und sozialer Einheiten, erhebt sich das Reich des ideellen, notwendig inhaltslosen Sollens, eine reine Formenwelt, in der kein Erdenrest, zu tragen peinlich, bleibt.61 (…)“ 58
Instruktiv hierzu Josef Isensee, Die alte Frage nach der Rechtfertigung des Staates, in: JZ 6/1999, S. 165 – 278. 59 H. Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), S. 9, 10. 60 Ebd., Zitat von Heller: ,Hans Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz, Wien 1911, S. 93‘. 61 Ebd., S. 16.
IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“
179
Heller gibt uns auch die Antwort zur Frage, wie nun die „Allgemeine Staatslehre“ Kelsens einer solchen reinen Normwissenschaft aussieht: „Mit dürren Worten sagt uns der Autor nicht bloß, dass man nur entweder reine Rechtslehre treiben kann und beides zusammen nicht geht, sondern dass Allgemeine Staatslehre unmöglich ist. Bleibt nur die Frage, warum er seinem Werk einen so irreführenden Titel gegeben hat?62 Über die Unmöglichkeit der Allgemeinen Staatslehre tröstet uns Kelsen mit der kühnen, aber historisch selbstverständlich falschen Behauptung, die Staatsrechtslehre sei ,der weitaus bedeutendste, jedenfalls der haltvollste [!] Bestandteil‘ der Allgemeinen Staatslehre.63 Sei es! Liefert uns also die reine Rechtslehre wenigstens eine allgemeine Staatsrechtslehre? Nein. Denn nachdem die toten Punkte ,Gesellschaft‘ und ,Moral‘ mehr oder weniger glücklich überwunden sind, verschwindet auch der Staat! Nun wird ernst gemacht mit der merkwürdigen Behauptung der ,Einheit von Staat und Recht‘;64 die ,Staatslehre als Staatsrechtslehre‘ wird ausschließlich eine ,Lehre vom objektiven Recht. Nicht aber eine Lehre von irgendwelchem subjektiven Recht oder irgendwelchem Subjekt von Rechten‘. Falsch ist also die Lehre vom ,Staat als Rechtssubjekt, d.i. als Person‘.65 Über das nun vorliegende peinliche Ergebnis einer Staatslehre ohne Staat tröstet uns Kelsen wieder mit der noch kühneren, historisch noch falscheren Behauptung: ,Untersucht man aber, welches jene Probleme sind, die als ,Allgemeine Staatslehre‘ dargestellt zu werden pflegen, so zeigt es sich, dass es eine Art allgemeinste Rechtslehre ist, als die sich die Allgemeine Staatslehre darstellt. Es sind – neben der Frage nach dem Wesen des Staates (und somit des Rechtes) überhaupt – die Probleme der Geltung und der Erzeugung der staatlichen Ordnung.‘66 Überraschend kommt uns das immerhin tragische Resultat, dass einer Staatslehre schließlich das Staatsrecht samt Staat abhanden kommt, gewiss nicht. …67
Heller kommt zu dem Ergebnis: „Der einheitliche Aufbau einer Staatslehre vom Standpunkt der Jurisprudenz als dogmatische Wissenschaft darf dank der Folgerichtigkeit als endgültig gescheitert betrachtet werden.“68
Während Hegel für seine Zeit zur Staats(rechts)lehre noch sagen konnte, dass sie die Realität zwar beschrieb, aber nur in Gedanken sich ein Staatswesen schuf,69 musste Heller für seine Zeit zur Krise der Staatslehre – im Gegenteil – befinden, dass sie die Realität völlig abgekoppelt hatte, Jurisprudenz ohne Soziologie und Philosophie betrieb, eine Staatslehre ohne Staatsrecht und ohne Staat lehrte, die Souve62
Ebd., S. 17. Ebd., Zitat von Heller: ,Kelsen, Allgemeine Staatslehre, a.a.O., S. 7‘. 64 Ebd., Zitat von Heller: ,Kelsen, a.a.O., S. 16 ff.‘. 65 Ebd., Zitat von Heller: ,Kelsen, a.a.O., S. 47‘. 66 Ebd., Zitat von Heller: ,Kelsen, a.a.O., S. 45‘. 67 H. Heller, Die Krisis der Staatslehre (1926), S. 17, 18. 68 Ebd., S. 24. 69 Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770 – 1831), Kritik der Verfassung Deutschlands (1800/01). Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers, hrsg. von Georg Mollat, Kassel 1883, S. 7 – 9, 39, 132. 63
180
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
ränität des Rechts (gemeint ist das formale Gesetz), eine Rechtssouveränität ohne Souverän verkündete, also dem Staat als Rechtssubjekt keine Souveränität zukommen ließ.70 Alte Zeiten kommen wieder, im Gewande einer roten Robe? Ein Bundesverfassungsgerichtspräsident, der seine geistige Nähe zu Hans Kelsen und damit seiner Lehre bekundet, die bereinigt ist von Recht im materiellen Sinne, Gerechtigkeit, Ethik und Rechtsphilosophie, der Krone der Rechtswissenschaft, einer Lehre der Leere, die das Staatsrecht, den Staat als Rechtssubjekt aus ihrem System verbannt und der Souveränität kein Rechtssubjekt als dem Bürger Verantwortlicher zuordnet. Das führt dazu, unter dem Mantel der Souveränität des „Rechts“, dass im Grunde niemand, auch nicht derjenige, der die Gesetze in die Welt setzt, als Verantwortlicher dingfest gemacht werden kann. Das führt weiter dazu, dass die Gesetze jedweden Inhalt haben dürfen, sie zu beachten und durchzusetzen sind, nur weil sie gelten. Am Ende steht gesetzliche Willkür, totale Macht. Das hat Kelsen auch so verlautbart. *** In dieses geistige Bild passt die Gesetzgebung zur Versorgungsüberleitung Ost und die jüngere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts hierzu: Herrschaft des formalen Gesetzes unter Verdrängung materiell-rechtlicher Elemente der Gerechtigkeit.71 *** Die Verhältnisse werden sich sobald nicht ändern, zumal die deutsche Staatsrechtslehre auch kein Gegengewicht bildet, die sich weitgehend darauf beschränkt, im wesentlichen das nach- zuschreiben, was vorgeschrieben wird.72 Sie bildet einen erlauchten Kreis, der in Fragen der Kritik vornehme Zurückhaltung übt. Es fehlen klare Positionen, die entzünden und an denen man sich reiben kann. Während in der Weimarer Zeit noch ganz offen um die geistigen Grundlagen und Methoden des Staatsrechts und der Staatslehre gerungen wurde,73 werden Richtungskämpfe – wenn überhaupt, dann eher verdeckt und indirekt – im Zusammenhang mit konkreten Verfassungsproblemen geführt. Die deutsche Staatsrechtslehre ist heute in hohem 70
H. Heller, Die Souveränität (1927), S. 127. Anschaulich Hermann Klenner, Juristenaufklärung über Gerechtigkeit, Festvortrag auf dem Leibniztag 2006, in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät Berlin, Bd. 88, Jg. 2007, S. 35 – 96. 72 Zur Krisis der Staatslehre eingehender W. Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, 2002, S. 133 – 141. 73 Hierzu Max-Emanuel Geis, Methoden und Richtungsstreit in der Weimarer Staatslehre, in: JuS 2/1989, S. 91 – 95. 71
IV. Rechtspositivismus: Herrschaft der „Gesetze“
181
Maße grundgesetz- „zentriert“, wenn nicht gar „-fiziert“.74 Offen klare Positionen zu beziehen, schadet offenbar der Reputation in einem von „political correctness“ geprägten Land, dessen Zeitgeist nur noch eine bestimmende, bestimmte Meinung duldet.75 Zudem wird es für Juristen beinahe unmöglich, sich mit einer Geistesströmung Gehör zu verschaffen, die nicht in das Konzept der gescheiterten Moderne76 oder in den politisierenden Liberalismus linksorientierter weltbeglückender Politiker und Soziologen passen. *** Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Vosskuhle, dem eine eigentümliche Karriere anhaftet, hält sich gern für ein Mitglied „einer offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten“. Hierzu bedarf es näherer Erläuterung, zumal im Bundesverfassungsgericht „linksliberale Verfassungsdeuter“ an Boden gewinnen und exzellente Universitätsprofessoren der Rechtswissenschaft aus anerkannten Hochschulen kaum noch berufen werden.77 Josef Isensee hat in einem Beitrag Kritik an einer Tagung linksliberaler Verfassungsdeuter und ihrem Anspruch, für die ganze Zunft zu sprechen, formuliert.78 Isensee zählt zu den angesehensten deutschen Staatsrechtlern. Nachdem der 72jährige, geborene Bonner als Ordinarius 2002 emeritiert wurde, bleibt er als Wissenschaftler, Publizist und verfassungsrechtlicher Gutachter weiterhin äußerst produktiv, so dass die stattliche Zahl seiner Gegner fürchten muss, auch der quirlige Jurist werde mindestens jene 90 Jahre erreichen, die in seinem Metier wie bei Hobbes (1588 – 1679) oder Carl Schmitt (1888 – 1985) üblich zu sein scheinen. Wie alle wahren Denker ist der Katholik Isensee sich unserer begrenzten Vernunftkräfte hinreichend bewusst, respektiert die Komplexität des Wirklichen zu sehr, als dass er 74
W. Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, S. 137, 138. Rühmliche Ausnahmen z. B.: Detlef Merten zur Versorgungsüberleitung Ost: Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung, 2. Aufl., 1994. – Karl Albrecht Schachtschneider zum Staatsrecht: Die Rechtswidrigkeit der Euro-Rettungspolitik, 2011; ders., Der republikwidrige Parteienstaat, in: Dietrich Murswiek u. a. (Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, 2000, S. 141 – 161. – Hans Herbert von Arnim, Die Deutschlandakte, 1. Aufl., 2009. – Vgl. ferner T. Sarrazin, Europa braucht den Euro nicht, S. 262 f., zum „Außenseitertum“ und dem Preis dafür, Kollektivirrtümern zu entgehen. 76 Alain de Benoist, Aufstand der Kulturen, Europäisches Manifest für das 21. Jahrhundert, 1999, S. 13 ff. 77 Zur Verfassungsrichterin Susanne Baer vgl. Eike Erdel, Kreativer Umgang mit dem Grundgesetz, in: JF Nr. 47/10 vom 19. 11. 2010, S. 6. – Zum Verfassungsrichter Peter Müller, zuvor saarländischer Ministerpräsident, der zuvor keine besondere juristische Qualifikation erworben hat, vgl. Joachim Wille, Merkels Abgängerriege, in: Berliner Zeitung Nr. 19 vom 24. 1. 2011, S. 6; Eike Erdel, Kungelei um rote Roben, in: JF Nr. 52/10 – 1/11 vom 31. 12. 2010, S. 2, 8. 78 Josef Isensee, Staatsrechtslehre als Wissenschaft, in: JZ 19/2009, S. 949 – 954. 75
182
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
der Versuchung widerstehen könnte, die Bonner oder Berliner Zeitabläufe ironisch zu kommentieren. Reichlich Gelegenheit bot ihm die Festschrift für einen Kollegen, den Würzburger Staatsrechtler Helmuth Schulze-Fielitz, einen erklärten „Alt-68er“, der Isensee in der Juristen Zeitung einen Rezensionsessay widmet.79 Aus Anlass von Schulze-Fielitz’ 60. Geburtstag fand im Mai 2007 ein Symposium in der hehren Absicht statt, „der Staatsrechtslehre als Wissenschaft Ziel und Richtung zu weisen“. Persönlich und fachlich verbunden mit dem Jubilar kamen in Unterfranken jedoch nur Professoren „linksliberaler Observanz“ zusammen. „Weltanschauliche Homogenität“ sei also garantiert gewesen, die Tagung insoweit „abgeschottet gegen fundamentale Kritik wie gegen inkompatible Doktrin“. Paradox, wie Isensee befindet, denn unter dem „Leitgedanken einer offenen Gesellschaft der Verfassungsinterpreten tage hier eine geschlossene Gesellschaft der Offenen“, die ungeachtet solcher Verpanzerung sich darin gefiel, „fundamentale Kritik und Pluralismus“ als „wissenschaftliche Größen geradezu rituell“ zu beschwören und zu beanspruchen, „für die ganze Zunft zu reden und sie zu belehren“. In solcher hybriden Selbstgerechtigkeit entdeckt Isensee den Kitt, der diese Gruppierung zusammenhält, deren Netzwerk inzwischen viele hohen Richterstellen und zahlreiche Lehrstühle umspannt.80 Gleichwohl klagen diese Etablierten mit dem Gustus der Nonkonformen über die „Vermachtungsprozesse“, denen sie einiges verdanken, die „Seilschaften“ in der Berufungspolitik, in denen sie mitziehen, die „Monopolbildung im Verlagswesen (C. H. Beck)“, den übermächtigen Einfluss der Max-Planck-Institute, den „politischen Proporz“ in der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer und natürlich die vorgeblich untergründige Virulenz der „SchmittSchule“, zu der in diesem Lager wahre Gelehrte wie Isensee gerechnet werden. Tatsächlich belegten solche Kraftübungen, für sich selbst die „reine Wissenschaft“ und souveräne Reflexivität zu reklamieren, „den anderen“ hingegen Parteilichkeit und Machtstreben zu unterstellen, wie das Symposium sich in den linksliberalen Stammtisch verwandle, „und zwar in einer solchen neuen Art: einen Stammtisch, der die Lufthoheit anstrebt und über den Schreibtisch der Kollegen“. Dass sich darüber hinaus recht massive gesellschaftspolitische Ziele hinter dem ganzen arroganten Objektivitäts-, eher Budenzauber verstecken, verrät Isensees Hinweis auf die derart perhorreszierte „Moralisierung des Rechts“. Darunter verstünden Linksliberale einen „forcierten vorgeburtlichen Lebensschutz“ in Theorie und Rechtsprechung, dessen Korrektur sie anmahnten.81
79
2007.
Ebd.; hierzu Helmuth Schulze-Fielitz (Hrsg.), Staatsrechtslehre als Wissenschaft, Berlin
80 O. Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen, in: JF Nr. 45/09 vom 30. 10. 2009, www.jungefreiheit.de 45/09 vom 30. Oktober 2009. – Vgl. auch H. H. von Arnim, Die Deutschlandakte, 2009, S. 232 ff. 81 J. Isensee, Staatsrechtslehre als Wissenschaft, in: JZ 19/2009, S. 949 – 954; O. Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen.
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
183
Selbstredend verfüge diese Gemeinde auch über einen Heiligen, den Liberalen und Emigranten Hans Kelsen (1881 – 1973), den sie in einem durchsichtigen Kanonierungsmanöver zum „Jahrhundertjuristen“ hochgejubelt haben. Man erinnert sich, wie einer der erfolgreichen Protagonisten und Propageure dieser Gruppe, der heutige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Vosskuhle, im Umfeld seines Karrieresprunges jeden Interviewer in den Block diktierte, dass Kelsen sein Vorbild sei. „Hätte er Carl Schmitt genannt, wäre ihm kaum noch eine Planstelle am Amtsgericht Pasewalk sicher gewesen.“82 Sich selbst kürende „Objektivisten“ wie Vosskuhle raten, wie Isensee zitiert, mit viel Pathos gern dazu, während der Amtszeit als Richter oder Minister auf publizistische Interventionen zu verzichten: eine Regel, die sie für sich natürlich nicht gelten lassen. Folglich fand die JZ-Redaktion nichts dabei, vor Isensees Rezensionsessay einen Leitaufsatz zu platzieren zum salbungsvollen Thema „Stabilität, Zukunftsoffenheit und Vielfaltsicherung – Die Pflege des verfassungsrechtlichen ,Quellcodes‘ durch das BVerfG“. Autor: Bundesverfassungsrichter Vosskuhle.83
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz Zu Beginn seiner Abhandlung stellt Voßkuhle die Jubiläumsfrage, ob sich das Grundgesetz bewährt habe. Die Frage bejaht er: „Indizien sprechen dafür, dass die Kombination aus Grundgesetz und BVerfG ein Erfolgsmodell darstellt.“84 Sodann trifft er den Kern des Problems heutiger Zeit, nämlich dass jede Verfassung nur so gut wie ihre Interpreten sei, dass dem BVerfG „in besonderer Weise die Pflege der Verfassung anvertraut“ sei.85 Abgesehen davon, dass das Grundgesetz in vielen Teilen seine Wirkungskraft verloren hat durch die zahlreichen Änderungen, besonders durch die europäischen Verträge, geht die Tendenz des Gerichts dahin, die Verfassung in wichtigen Fragen des Staatsrechts und der Grundrechte „wegzuinterpretieren“. 1. Staatsrecht Wie die „Zukunftsoffenheit“ der Verfassung nach Voßkuhle aussieht, lässt sich direkt am Urteil seines Zweiten Senats unter seinem Vorsitz vom 30. 6. 2009 zum 82
O. Busch, Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen. Andreas Voßkuhle, Stabilität, Zukunftsoffenheit und Vielfaltssicherung – Die Pflege des verfassungsgerichtlichen „Quellcodes“ durch das BVerfG, in: JZ 19/2009, S. 917 – 924. 84 Ebd., S. 917, mit Verweis auf Paul Kirchhof, Das Grundgesetz – ein oft verkannter Glücksfall, in: DVBl. 9/2009, S. 541 – 552; Thomas Oppermann, Deutschland in guter Verfassung? – 60 Jahre Grundgesetz, in: JZ 10/2009, S. 481 – 491; Michael Sachs, Das Grundgesetz in seinem sechsten Jahrzehnt, in: NJW 21/2009, S. 1441 – 1449; Helge Sodan, Kontinuität und Wandel im Verfassungsrecht. Zum 60.–jährigen Jubiläum des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, in: NVwZ 9/2009, S. 545 – 551. 85 Ebd., S. 918. 83
184
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
Lissabon-Vertrag und den folgenden europäischen Gesetzen ablesen,86 auf dem Weg der Aufgabe staatlicher Souveränität87 und der Entstaatlichung der Bundesrepublik Deutschland88 hin zu einem diktatorischen Bundesstaat munter voranschreitend.89 Die äußere Freiheit des Volkes und des Staates wird aufgegeben. Bedroht sind zudem Grundrechte, so das – Bürgerrecht auf Demokratie und demokratische Gesetzlichkeit der Politik, Art. 38 GG; – Recht auf einen eigenständigen Staat aus Art. 146 GG (Wahrung der Verfassungsidentität Deutschlands); – Recht auf Eigentum und das Grundrecht am Eigentum, Art. 14 Abs. 1 GG (Bürgerrecht auf Stabilitätsschutz); – Bürgerrecht auf Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG; – Bürgerrecht auf Rechtsschutz aus Art. 19 Abs. 4 GG; – Recht auf die deutsche Staatsangehörigkeit (Art. 16 Abs. 1 GG).90 Nicht nur die eherne Säule einer jeder verfassten politischen Gemeinschaft, das Staatsrecht mit einer konstruktiven Staatslehre als Grundlage, die den Namen verdient, wankt mächtig. Sondern auch die zweite Säule, die Sphäre der Freiheit.91 2. Sphären der Freiheit Für einen wissenschaftlich brauchbaren Begriff von Grundrechten im absoluten Sinn muss unbedingt daran festgehalten werden, dass Grundrechte im bürgerlichen Rechtsstaat nur solche Rechte sind, die als vor- und überstaatliche Rechte gelten können, die der Staat nicht nach Maßgabe seiner Gesetze verleiht, sondern als ihm vorgegeben anerkennt und schützt und in welche er in einem messbaren Umfang und nur in einem geregelten Verfahren eingreifen darf.92 Diese Grundrechte sind ihrer Substanz nach keine Rechtsgüter, sondern Sphären der Freiheit,93 aus der sich 86
BVerfGE 97, 350; 123, 267; 125, 385. Hierzu W. Mäder, Vom Wesen der Souveränität, 2007. 88 Hierzu W. Mäder, Kritik der Verfassung Deutschlands, 2002; ders., Europa ohne Volk Deutschland ohne Staat, Bonn 1999. 89 Hierzu Karl Albrecht Schachtschneider, Die Souveränität Deutschlands, 1. Aufl., 2012, S. 315, 319. 90 Werner Mäder, Verfassungsbeschwerde vom 6. 7. 2012 – BVerfG 2 BvR 1782/12 und Karl Albrecht Schachtschneider u. a., Verfassungsbeschwerde vom 29. 6. 2012 gegen die Gesetze zum Europäischen Rettungsschirm (ESM) und zum Fiskalpakt. 91 Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 83 ff. 92 Carl Schmitt, Verfassungslehre (1928), 8. Aufl., Berlin 1993, S. 163. 93 Hierzu Karl Albrecht Schachtschneider, Freiheit in der Republik, Berlin 2007; W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 19, 47 ff. – Zur Entwicklung von Freiheit und Eigentum vgl. Dieter Schwab, Art. „Eigentum“, in: Otto Brunner/Reinhart Koselleck (Hrsg.), 87
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
185
Rechte, und zwar Abwehrrechte, ergeben. Das zeigt sich am klarsten bei den Freiheitsrechten, die geschichtlich den Anfang der Grundrechte bedeuten: Religionsfreiheit, persönliche Freiheit, Eigentum, Recht der freien Meinungsäußerung bestehen nach dieser Vorstellung vor dem Staat, erhalten ihren Inhalt nicht aus irgendwelchen Gesetzen, nicht nach Maßgaben von Gesetzen oder innerhalb der Schranken von Gesetzen, sondern bezeichnen den prinzipiell unkontrollierten Spielraum der individuellen Freiheit. Der Staat dient ihrem Schutz und findet darin seine Existenzberechtigung.94 Grundrechte im eigentlichen Sinne sind wesentlich Rechte des freien Einzelmenschen, und zwar Rechte, die er dem Staat gegenüber hat. Von jedem echten Grundrecht gilt, was Richard Thoma sagt: „Grundrechtsverbürgungen sind Stationen in dem ewig hin- und herflutenden Prozess the Man versus the State.“95 Dazu gehört aber, dass der Mensch kraft eigenen „natürlichen“ Rechts dem Staate gegenübertritt und der Gedanke vor- und überstaatlicher Rechte des einzelnen nicht völlig beseitigt sein darf, solange man überhaupt noch von Grundrechten sprechen soll. „Rechte, welche dem Belieben eines absoluten Fürsten“ (für die Gegenwart in der Demokratie: einer Parteioligarchie) „oder einer einfachen oder qualifizierten Parlamentsmehrheit ausgeliefert sind, können ehrlicherweise nicht als Grundrechte bezeichnet werden.“96 Grundrechte im eigentlichen Sinne sind also nur die liberalen Menschenrechte der Einzelperson. „Die rechtliche Bedeutung ihrer Anerkennung und Erklärung liegt darin, dass diese Anerkennung die Anerkennung des fundamentalen Verteilungsprinzips des bürgerlichen Rechtsstaates bedeutet: eine prinzipiell unbegrenzte Freiheitssphäre des einzelnen und eine prinzipiell begrenzte, messbare und kontrollierte Eingriffsmöglichkeit des Staates.“97 Daraus, dass es sich um vorstaatliche Menschenrechte handelt, folgt weiter, dass diese echten Grundrechte für jeden Menschen ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit gelten. – Diese gelten auch für ehemalige DDR-Bürger, wie noch später zu erwähnen ist, wobei sie von der Bundesrepublik auch als eigene Bürger „geführt“ worden sind. – Es sind Individualrechte, d. h. Rechte des Einzelmenschen. Grundrechte im eigentlichen Sinne sind individualis-
Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch sozialen Sprache in Deutschland (1975), Studienausgabe, Bd. 2, 1. Aufl., 2004, S. 65 – 115; Jürgen Blicken/Werner Conze/Christof Dipper/Horst Günter/Diethelm Klippel/Gerhard May/Christian Meyer, Art. „Freiheit“, ebd., S. 425 – 542. 94 Hierzu C. Schmitt, Verfassungslehre (1928), S. 163/164; vgl. auch John Locke, Zwei Abhandlungen über die Regierung (1679/89), Suhrkamp: Frankfurt am Main 1977, II., 5. Kapitel „Das Eigentum“, S. 215 ff.; vgl. auch Gilbert H. Gornig, Menschenrechte und Naturrecht, in: ders./Burkhard Schöbner/Winfried Bausback/Tobias H. Irmscher (Hrsg.), Justitia et Pax, Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Berlin 2008, S. 409 – 431. 95 Richard Thoma, Festgabe für das Preußische Oberverwaltungsgericht, 1925, S. 187. 96 C. Schmitt, Verfassungslehre (1928), S. 164. 97 Ebd., S. 164.
186
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
tische Freiheitsrechte, nicht soziale Forderungen.98 Dahin gehören: Gewissensfreiheit, persönliche Freiheit, Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis, Privateigentum; dazu gehören aber auch: Freiheit der Meinungsäußerung mit Redefreiheit und Pressefreiheit, Kultfreiheit, Versammlungsfreiheit, Vereinsfreiheit und Vereinigungsfreiheit, letztere, solange sie nicht politischen Charakter annehmen und nicht aus dem Gesellschaftlichen heraustreten.99 Alle echten Grundrechte sind absolute Grundrechte, d. h. sie werden nicht „nach Maßgabe der Gesetze“ gewährleistet, sondern der gesetzliche Eingriff erscheint als Ausnahme, und zwar als prinzipiell begrenzte und messbare, generell geregelte Ausnahme.100 3. „Kreativer Umgang“ mit Grundrechten Teile des Bundesverfassungsgerichts sind sich offenbar nicht mehr bewusst, welche überragende Bedeutung die vor- und überstaatlichen Grund- und Menschenrechte haben, welche Anstrengungen es dem Volk und seinen Bürgern gekostet hat, in jahrhundertelangen Auseinandersetzungen mit dem Herrscher diesen Anerkennung zu verschaffen. Ein „kreativer Umgang“ mit den elementaren Grundrechten hat sich breit gemacht. Besonders augenfällig hervorgetreten ist die reine Rechtslehre im Zuge der angeblichen Verwirklichung der Einheit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den sog. neuen Ländern aus der untergegangenen DDR. Das Bundesverfassungsgericht ist mit seinem „Beliebigkeits-Eklektizismus“, der sich den Begründungsansätzen seiner Entscheidungen entnehmen lässt, zunehmend in massive Kritik geraten.101 Das Gericht ist auf dem Wege, seinen bis Anfang der 90er Jahre im In- und Ausland gepriesenen guten Ruf zu lädieren und den Vertrauensbonus zu verspielen. Anders als die Entwicklung der Rechtsprechung des EGMR wird die Spruchpraxis des Bundesverfassungsgerichts durch eine Einschränkung der Geltung von Grundrechten bis hin zu deren Beseitigung, vornehmlich für das Beitrittsgebiet, geprägt.102 An die Stelle der Lobeshymnen, die einst auf das Gericht angestimmt wurden, ist harsche Kritik getreten. Hierzu stehen ne-
98
Ebd., S. 164/165. Ebd., S. 165, 166 ff. 100 Ebd., S. 166. 101 Vgl. Thorsten Purps, Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet im Lichte der Auseinandersetzung zwischen BVerfG und EGMR, in: NJ 4/2005, S. 145 – 152. 102 Hierzu insb. Klaus Märker, Der Staatsraison verpflichtet! Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit des Entschädigungs– und Ausgleichsleistungsgesetzes, in: VIZ 2001, Heft 5, S. 233 – 241; siehe auch Rudolf Wassermann, Wohin treibt das Bundesverfassungsgericht?, in: ders., Gestörtes Gleichgewicht, 1995, S. 119 ff. Wolfgang Graf Vitzthum, in: Klaus Stern, Deutsche Wiedervereinigung, Bd. 2, 1992, S. 20. Hans Forkel, Das Bundesverfassungsgericht, das Zitieren und die Meinungsfreiheit, Überlegungen aus Anlass des Maastricht-Urteils, in: JZ 13/1994, S. 637 – 642; Konrad Hesse, Verfassungsrecht im geschichtlichen Wandel, in: JZ 6/1995, S. 263 – 273. 99
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
187
gative Attribute wie „Zeitgeistlastigkeit“,103 die Förderung bestehender Rechtsunsicherheiten ebenso wie Vorhaltungen einer „letztlich“ geprägten „Blindheit“ des Gerichts104 im Raum. Schwer wiegt auch der Vorwurf, das Gericht arbeite nicht mehr sauber.105 a) Aus alter Zeit … Der verbrauchte Ruf des Bundesverfassungsgerichts wurde nicht zuletzt durch die Akzentuierung fundamentaler Aspekte des Geltungsgrundes von Normen untermauert. Zur Verdeutlichung soll aus früheren Entscheidungen zitiert werden: „Die Garantie des Eigentums ist ein elementares Grundrecht, das im engen Zusammenhang mit der persönlichen Freiheit steht. Ihr kommt im Gesamtgefüge der Grundrechte die Aufgabe zu, dem Träger des Grundrechts einen Freiheitsraum im vermögensrechtlichen Bereich zu sichern und ihm dadurch eine eigenverantwortliche Gestaltung seines Lebens zu ermöglichen.“106
Des weiteren führte es aus: „Soweit es um die Funktion des Eigentums als Element der Sicherung der persönlichen Freiheit des Einzelnen geht, genießt dieses einen besonders ausgeprägten Schutz (…).“107
Grundlage dieses hohen Grundrechtsstandards war das ausgeprägte Verständnis des Geltungsgrundes von Verfassungsnormen. Nach damaliger Rechtsprechung des BVerfG fußt der Eigentumsschutz auf einem verfassungsrechtlichen Eigentumsbegriff „an sich“, der dem Gesetzgeber Leitbild und Maßstab sein muss.108 In Anlehnung an Grabitz109 wurde von dem Gericht die legislatorische Qualifikationskompetenz des Gesetzgebers in einem fein justierten Schema nach sachlichen Erwägungen eingeschränkt. Im Normbereich des Grundrechts auf Freiheit der Person begrenzte das Gericht z. B. die Aktivität des Gesetzgebers auf die Geltend103
R. Wassermann, Wohin treibt das Bundesverfassungsgericht? Hierzu Fromme, in: Welt am Sonntag vom 4. 10. 1998, S. 52; ferner Ursula Weidenfeld, Ein Zwischenruf zu … Scheinriesen, in: Der Tagesspiegel vom 26. 9. 2012: „Das höchste Gericht lebt immer weniger aus eigener Autorität als aus der, die ihm zugebilligt wird. Es ist ein Scheinriese.“ 105 Kurz nach der Veröffentlichung des Bodenreform-Urteils vom 23. 4. 1991 (BVerfGE 84, 90 = NJW 1991, S. 1597 – 1601 = NJ 1991, Sonderheft 1) wurde eine Vielzahl von Zitatfehlern nachgewiesen: W. Vitzthum, Deutsche Wiedervereinigung, S. 20, Fn. 221. Das unkorrekte Zitieren ist kein Einzelfall; auch ein Bundesverfassungsrichter hat das BVerfG heftig kritisiert, indem er schrieb, wenn es „hart auf hart“ ginge, fälle es Urteile, die man keinem Jura-Studenten durchgehen ließe (Zitat ZAP aktuell, I/2001, S. 3). 106 BVerfGE 50, 290 [339] – Mitbestimmung. 107 Vgl. BVerfGE 21, 87 [90 f.]; 21, 306 [310]; 26, 215 [232]. 108 BVerfGE 42, 263 [282]. 109 Eberhard Grabitz, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: AöR 98 (1973), S. 568 – 616 (602); Ernst-Wolfgang Böckenförde, Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechtsdogmatik, in: Der Staat 29.Bd. (1990), S. 1 – 31. 104
188
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
machung und Verwirklichung absoluter öffentlicher Interessen. Danach steht dem Gesetzgeber nicht einmal legislatorische Qualifikationskompetenz zu. Dieser Typus von Gestaltungsmöglichkeiten wurde deshalb „legislatorische Konkretisierungskompetenz“ genannt.110 Nicht zuletzt die ausgewogene und äußerst differenzierte Bewertung öffentlicher Interessen bei der Beurteilung von gesetzgeberischen Befugnissen führte zu einem konsequenten Schutz vor Eingriffen der öffentlichen Gewalt. Der Wirkungskreis des Eigentumsschutzes liegt im Funktionszusammenhang eines zulässigen Enteignungsaktes. Dieser war nach Auffassung des BVerfG beschränkt auf solche Fälle, in denen Güter hoheitlich beschafft werden, mit denen ein konkretes, der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienendes Vorhaben durchgeführt werden soll. Das Gericht hat mit dieser Rechtsprechung die Rückkehr zum klassischen Eigentumsbegriff vollzogen.111 Bemerkenswert ist hier, dass der Entzug einer konkreten Eigentumsposition der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen muss. Liegt ein Bezug zu konkreten öffentlichen Vorhaben nicht vor, fehlt es bereits an einem Eigentumsentzug i.S. von Art. 14 Abs. 3 Satz 1 GG, so dass es sich allenfalls nur noch um eine Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums handeln kann.112 Papier hat noch im Jahre 1991 bemerkt, dass die Eigentumsgarantie des Grundgesetzes in der Tradition der Philosophie der Aufklärung steht.113 Danach habe das Bundesverfassungsgericht in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG immer ein elementares Grundrecht gesehen, das im inneren Zusammenhang mit der Garantie der persönlichen Freiheit steht.114 Als Papier dann als Richter zum Bundesverfassungsgericht mit Hilfe seines Parteifreundes wechselte, hat er sich als „juristisches Chamäleon“ entpuppt, dem Eigentumsschutz keinen besonderen Rang eingeräumt.115 b) Abgesang auf den Dreiklang „Staat – Freiheit – Eigentum“ Wenn der Staat, das Staatsrecht und die Staatslehre keine besondere Rolle mehr spielen, der Staat im europäischen Integrationsprozess allmählich verschwindet, nimmt es nicht wunder, dass im Zuge dieser Auflösungserscheinungen der Glanz der Grundrechte, die zu wahren und zu schützen, zu garantieren vornehmste Aufgabe des Staates ist, verblasst. Diese Erosion schlägt bis auf das Bundesverfassungsgericht 110
E. Grabitz, Der Grundsatz …, S. 602. Vgl. etwa BVerfGE 70, 191 [199 m.w.N.]; vgl. auch K. A. Schachtschneider, Freiheit in der Republik, Berlin 2007, S. 535 ff. zur freiheitlichen Eigentumsgewährleistung. 112 BVerfGE 104, 1 [9 f.]. 113 Hans Jürgen Papier, Verfassungsrechtliche Probleme der Eigentumsregelung im Einigungsvertrag, in: NJW 4/1991, S. 193 (195). – Weiter zurück geht er nicht. Die Traditionslinie reicht noch weiter zurück auf die Naturrechtslehren. Kant hat im Zuge der Aufklärung die Grundrechte in den Zusammenhang der republikanischen Freiheit gestellt. Die Bundesrepublik will insbesondere vorrangig eine Republik sein. 114 Vgl. BVerfGE 24, 367 [389]; 30, 292 [334]; 31, 229 [239]; 50, 290 [339]. 115 Vgl. W. Mäder/J. Wipfler, Wendezeiten …, S. 15 ff. 111
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
189
durch, dessen Rechtsprechung zum Grundrecht auf Eigentum und am Eigentum nur ein Zeichen ist, dass ganz allgemein die Freiheitsrechte des Bürgers eingeschränkt werden. Der Dreiklang „Souveräner Staat, Freiheit des Bürgers und Eigentum“116 erhält schwere Misstöne, wenn das eine oder andere oder mehrere Elemente dieser Harmonie zerbrechen.117 *** Den Pfad des fast absoluten Schutzes des Eigentums hat das Bundesverfassungsgericht spätestens seit dem Bodenreform-Urteil vom 23. 4. 1991 verlassen, ist den Irrweg kontinuierlich weitergegangen. „Der Gesetzgeber darf im Rahmen seiner Regelungsbefugnis nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bei der generellen Neugestaltung eines Rechtsgebietes unter bestimmten Voraussetzungen auch bestehende, durch die Eigentumsgarantie geschützte Rechtspositionen beseitigen.118 … Auch können grundlegende Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse den Regelungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers erweitern.“119
Im Grunde hat diese Rechtsprechung die Wirkung einer Sozialisierung (Art. 15 GG). Der Paradigmenwechsel hat sich vor allem auf die sog. Neuen Bundesländer ausgewirkt. Die vom BVerfG so gewählten Vorbehaltskriterien tauchen in ständiger Regelmäßigkeit in Entscheidungen zu offenen Vermögensfragen auf.120 Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundesgesetzgeber hierdurch beinahe unbegrenzte Möglichkeiten für den Beurteilungsspielraum, d. h. bis zum Entzug des Eigentums, eröffnet. Damit wird einem „Beliebigkeits-Eklektizismus“ der Boden bereitet. Sowohl der vollständige Entzug wohl erworbener Rechte als auch bis hin zu einer entschädigungslosen Enteignung konnte nunmehr gerechtfertigt werden.121 Die Kritik ließ aus nachvollziehbaren Gründen nicht lange auf sich warten.122 116 Zum Dreiklang „Leben, Freiheit und Eigentum“ bei Locke vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 29 f., 50 ff., 55 f., 70, 222. 117 Hans D. Barbier, Wenn das Eigentum fällt, so muss der Bürger nach, in: SchwäbischHall-Stiftung (Hrsg.), Kultur des Eigentums, 2006, S. 3 – 7; Michael Stürmer, Leben, Freiheit, Eigentum, in: ebd., S. 117: „Wir leben in der Epoche des Artensterbens. Bisher ist darin für das Eigentum keine Ausnahme vorgesehen.“ 118 BVerfGE 83, 201 [211] = NJW 1991, S. 1597. 119 BVerfGE 83, 201 [211]; BVerfG, NJ 2001, S. 247 = VIZ 2/2001, S. 111 – 115 (112). 120 BVerfG, Beschl. vom 6. 10. 2000, NJ 2001, S. 247; Beschl. vom 25. 10. 2000, VIZ 2/ 2001,S. 115; BVerfGE 84, 90. 121 BVerfGE 83, 201 [211]; 70, 191 [200 f.]; vgl. dagegen BVerfGE 52, 1 [28]; 53, 349 [363]; 58, 300 [331]; dazu BVerwG, NJW 1993, S. 2949. 122 Siehe insbesondere Fritz Ossenbühl, Inhaltsbestimmung des Eigentums und Enteignung – BVerfGE 83, 201, in: JuS 3/1993, S. 200 – 203; Joachim Lege, Wohin mit den Schwellen-
190
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
Auch auf anderen Gebieten konnte ein schleichender Wandel zum Abbau liberaler Grundrechte ermittelt werden.123 Es wurde insbesondere nachgewiesen, dass in jüngsten Entscheidungen zur Berufsfreiheit124 bei der Rechtfertigung von Eingriffen bei Art. 12 Abs. 1 GG zunehmend großzügiger verfahren wird und nebenbei frühere Positionen aufgegeben werden.125 Aufgabe und offenbar vollzogene Relativierung liberaler Grundansätze kann mit Fug und Recht als „Nährboden für Grundrechtsverstöße zu Lasten der betroffenen Bürger“ bezeichnet werden.126 *** Eine Vielzahl von Einzelregelungen, vornehmlich auf dem Gebiet der offenen Vermögensfragen, hat hierbei in Mitteldeutschland zu einer dramatischen Schieflage geführt.127 Es kann mit guten Gründen behauptet werden, dass als Ergebnis der vom Bundesverfassungsgericht gerechtfertigten Erweiterung des Gestaltungsspielraumes des Gesetzgebers ein „Zweiklassensystem des Grundrechtsschutzes auf dem Gebiet des Eigentumsschutzes“ etabliert wurde.128 Bedauerlich ist dies insbesondere auch, weil am Anfang des Einigungsprozesses die Forderung nach der Einheit der Verfassung stand.129 Nutznießer dieses erheblich aufgeweichten Grundrechtsschutzes in den sog. Neuen Bundesländern sind nahezu ausnahmslos die öffentliche Hand, der Bund und die Länder.130 theorien? Die neue Rechtsprechung von BGH und BVerwG zur Entschädigung bei Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, in: JZ 9/1994, S. 431 – 440; Klaus Märker, Der Staatsräson verpflichtet! Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes, in: VIZ 5/2001, S. 233 – 241; Rudolf Wassermann, Wohin treibt das Bundesverfassungsgericht?, in: ders., Gestörtes Gleichgewicht, 1995, S. 119 ff. 123 Vgl. Helge Sodan, Verfassungsrechtsprechung im Wandel – am Beispiel der Berufsfreiheit, in: NJW 4/2003, S. 257 – 260; Kurt Fassbender, Wettbewerbsrelevantes Staatshandeln und Berufsfreiheit: Quo vadis, Bundesverfassungsgericht?, in: NJW 12/2004, S. 816 – 818. 124 BVerfG 98, 83 = NJW 1998, S. 1776; BVerfGE 98, 106 = NJW 1998, S. 2341 = NJ 1998, S. 364; BVerfGE 98, 265 = NJW 1999, S. 841; BVerfGE 103, 173 = NJW 2001, S. 1779. 125 Vgl. K. Fassbender, Wettbewerbsrelevantes Staatshandeln …, S. 816. 126 Th. Purps, Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet …, in: NJ 4/2005, S. 145 (148). 127 Aufzählung bei Thorsten Purps, Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards? Zumutung, Rechtfertigung oder Herausforderung?, in: NJ 6/2009, S. 233 ff. (236 – 239); ders., Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet im Lichte der Auseinandersetzung zwischen BVerfG und EGMR, in: NJ 4/2005, S. 145 ff. (148 – 150). 128 Th. Purps, Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet …, S. 148. – Zur Versorgungsüberleitung Ost vgl. insbes. Karl-Heinz Christoph, Bestohlen bis zum Jüngsten Tag, 1. Aufl., Berlin 2010. – Generell zum Schwinden des Eigentumsschutzes Michael Nier, Deutschland und die Dramatik der Eigentumsfrage. Die Ausraubung der Bürger, in: DGG 2/2012, S. 18 ff. 129 Rupert Scholz, Der Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, in: BB 1990, Beilage 23 zu Heft 18, S. 1 – 9. 130 Das Gut Samow der Familie von Polier, 40 km östlich von Rostock war nach 1945 konfisziert worden. Marc von Polier kehrte nach Zusammenbruch der DDR in seine Heimat
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
191
Die Grundrechtseinbuße wurde wie eine „Betriebsanleitung“ bewusst-gewollt verankert. Eine unrühmliche Rolle spielte dabei Roman Herzog (CDU), der eine verfassungswidrige Änderung des Grundgesetzes mit eingefädelt hatte, dann im Gegenzug Präsident des Bundesverfassungsgerichts wurde und dann die grundlegende Entscheidung des Gerichts zur Bodenreform unterschrieben hat.131 Gemäß Art. 143 Abs. 1 GG durfte die Rechtssetzung längstens bis zum Ablauf des 31. 12. 1992 von Bestimmungen des Grundgesetzes – ohne Rücksicht auf Art. 79 Abs. 3 GG – abweichen, soweit und solange infolge der unterschiedlichen Verhältnisse in Ost und West die völlige Anpassung an die grundgesetzliche Ordnung noch nicht erreicht werden konnte. Das Grundgesetz liefert somit selber eine Steilvorlage für die Ansicht, wonach der Einigungsprozess bildlich gesprochen ein territoriales „Ozonloch“ bei der Wahrung etablierter Grundrechte hinterlassen hat. So wurde das Grundgesetz zur „Beute“ der justiz- und politischen Klasse. Dem unbefangenen Betrachter wird hier auf Anhieb das Zeitlimit des Art. 143 Abs. 1 GG auffallen. Dieses Datum wird nicht ohne Grund hervorgehoben. Tatsächlich sind nämlich gerade nach dem Stichtag, den 31. 12. 1991, besonders einschneidende Gesetze auf dem Gebiet der offenen Vermögensfragen erlassen worden.132 Eine Vielzahl weiterer Gesetze, die Gegenstand sechs großer Gesetzgebungsinitiativen nach der Wende waren, führten zu durchgreifenden Änderungen im Beitrittsgebiet.133 Mit nahezu sämtlichen Gesetzen hatte sich das Bundesverfassungsgericht in der Zwischenzeit zu befassen, hat „Schleifspuren“ hinterlassen. Nahezu
zurück und kaufte das Gut für einen fünfstelligen Betrag von der Treuhand zurück. Etwa 1 Mio. Euro hat er für die Restauration des Gutes investieren müssen. Der FAZ gegenüber sagte er u. a.: „Die Bundesrepublik ist ein Hehlerstaat; denn er verkauft geklautes Gut.“ Philip Plickert, Burgen in der ehemaligen DDR: Die Schlossretter, in: FAZ vom 10. 8. 2012. 131 BVerfG, Urt. vom 23. 4. 1991, BVerfGE 84, 90; vgl. ferner BVerfG, Beschl. vom 18. 4. 1996, BVerfGE 94, 12; BVerfGE 102, 254 = VIZ 2001, S. 16. – Zur Bodenreform und zur Rolle Herzogs vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 183 ff., 192 ff.; umfassend und investigativ Constanze Paffrath, Macht und Eigentum. Die Enteignungen 1945 – 1949 im Prozess der Wiedervereinigung, Köln 2004, S. 217 ff., 299 ff. 132 Mauergrundstücksgesetz vom 15. 7. 1996 (BGBl. I S. 980); Sachenrechtsbereinigungsgesetz vom 1. 10. 1994 (BGBl. I S. 2457); Schuldrechtsanpassungsgesetz vom 21. 9. 1994 (BGBl. I S. 2538); Entschädigungs-Ausgleichsgesetz vom 27. 9. 1994 (BGBl. I S. 2624); Wohnraummodernisierungsgesetz vom 23. 7. 1997 (BGBl. I 1823); Verkehrsflächenbereinigungsgesetz vom 1. 10. 2001 (BGBl. I S. 2716). 133 1. Hemmnisbeseitigungsgesetz vom 22. 3. 1991 (BGBl. I S. 776); 2. Vermögensrechtsänderungsgesetz vom 14. 6. 1992 (BGBl. I S. 1257); 3. Registerverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 10. 12. 1993 (BGBl. I S. 2182); 4. Wohnraummodernisierungssicherungsgesetz vom 17. 7. 1997 (BGBl. I S. 1823; 5. Grundstücksrechtsänderungsgesetz sowie Vermögensrechtsänderungsgesetz vom 8. 11. 2000 sowie 22. 9. 2000 (BGBl. I S. 1481); 6. Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz vom 1. 10. 2001 (BGBl. I S. 2716).
192
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
sämtliche Gesetze stießen auf das Wohlwollen der Richter in Karlsruhe,134 wobei die beiden Senate bereits frühzeitig einen besonderen Akzent gesetzt haben. Aus der Chronik der Entscheidungen des Karlsruher Gerichts seit 1990 sticht der Irrweg weisend zur sog. Bodenreform-Entscheidung des 1. Senats vom 23. 4. 1991 unter Vorsitz von Herzog hervor, die in aller Eile nach der vollzogenen Einung im Oktober 1990 erlassen wurde.135 Das Urteil ist für den Rechtsanwender in mehrfacher Hinsicht verblüffend. Obwohl zunächst die Härtefallklausel mit Blick auf Art. 19 Abs. 2 i.V. mit Art. 79 Abs. 3 GG in ihrem Wirkungsspektrum hervorgehoben wird, lässt sich doch am Ende feststellen, dass spätestens das Grundgesetz für den Bereich der offenen Vermögensfragen nur als „poröse Schutzhülle“ Verwendung findet. In der BodenreformEntscheidung ist die Rede von der „beitrittsbedingten Änderung des Grundgesetzes unter den gegebenen Umständen“.136 Es könne auch dahingestellt bleiben, ob eine Verfassungsänderung darüber hinaus grundsätzlich erkennen lassen müsse, in welcher Hinsicht und in Bezug auf welchen konkreten Regelungsgegenstand das Grundgesetz geändert werde und was in Zukunft als Verfassungsrecht gelten sollte. Hier greift das BVerfG auf „die besondere Situation des Wiedervereinigungsprozesses“ zurück. Dies knüpft an eine drei Monate zuvor bereits verkündete Entscheidung des BVerfG an. Mit Beschluss vom 9. 1. 1991 hob der Erste Senat aus seinem Argumentationshaushalt nämlich seine berühmte „Anlassthese“ aus der Taufe, die in der Folgezeit wahre Triumpfe erleben sollte. Die offensive Dynamik dieser neuen Begründungsformel kann in ihren Auswirkungen nur lückenlos erfasst werden, wenn der oben schon wiedergegebene Wortlaut noch einmal gelesen wird: „Der Gesetzgeber darf im Rahmen seiner Regelungsbefugnis nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG bei der generellen Neugestaltung eines Rechtsgebietes unter bestimmten Voraussetzungen auch bestehende, durch die Eigentumsgarantie geschützte Rechtspositionen erweitern.“137
In einer späteren, in der Entscheidung vom 6. 10. 2000 heißt es dann sogar: „Auch können grundlegende Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse den Regelungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers beseitigen.“138 134 Zum Mauergrundstücksgesetz: BVerfG, Beschl. vom 22. 3. 2007 – 1 BvR 779/06 (Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen); zur Abwicklung der Bodenreform: BVerfG, Beschl. vom 25. 10. 2000, VIZ 2001, 111 f.; zum Sachenrechtsbereinigungsgesetz: VIZ 2001, 330 (Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen); zum Besitzschutzmoratorium: BVerfG, VIZ 2001, 334 (Verfassungsbeschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen); zur Aufhebung der Ersatzgrundstücksregelung gemäß § 9 VermG: BVerfG, Beschl. vom 28.7. 2004 – 1 BvR 1581/04 (Beschwerde wurde nicht zur Entscheidung angenommen); zum Entschädigungsausgleichsleistungsgesetz: BVerfG, Urt. vom 22. 11. 2000, VIZ 2001, 16 (Verfassungsbeschwerde wurde zurückgewiesen). 135 BVerfGE 84, 90; vgl. auch BVerfGE 83, 201. 136 BVerfGE 84, 90 = NJW 1991, S. 1597 (1599). 137 BVerfGE, 83, 201 [211] = NJW 1991, S. 1807. 138 BVerfG, VIZ 2001, S. 113
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
193
Die Architekten dieser neuen Botschaft und „Argumente“ haben in der Folgezeit des Empfangsgebietes auf das gesamte Umfeld der Vermögensfragen und -rechte ausgeweitet. Die permanent schwebende Frage, ob die von den Bürgern angegriffenen Gesetze und Entscheidungen Auslegungsfehler erkennen lassen, die auf einer grundsätzlich unrichtigen Auffassung von der Bedeutung und der Tragweite eines Grundrechts, insbesondere vom Umfang seines Schutzbereichs beruhen, konnte unter Rückgriff auf diese beiden Schleusen mit einem klaren Nein beantwortet werden. Erstaunlich oder auch nicht mehr ist bei diesem Kassensturz zu Lasten der Bürger ergangenen Entscheidungen, dass das Bundesverfassungsgericht gegen überzeugende Kritik immun ist.139 Angesichts der zu Tage geförderten Resultate zum Tun und Lassen der Karlsruher Richter wird im folgenden das neue „Design“ der von ihnen gewählten Begründungsansätze unter dem Titel „Anlassdynamik der Rechtsordnung“ beschrieben. In den Gerichtssälen verwendet man in diesem Kontext den von EGMR entwickelten Begriff der „außergewöhnlichen Umstände“.140 Auf der Suche nach der „normativen Schmerzgrenze“ dieses Begriffspaares tappen wir jedoch weiter im Dunkeln. Es fällt lediglich auf, dass mit dieser „Weltformel“ ein Potential von Beliebigkeitsargumenten ausgeschöpft werden kann, das mit dem in Art. 20 Abs. 3 GG verankerten Rechtsstaatsprinzip nur schwer vereinbar ist. Immerhin zählt zu den Gewährleistungen dieses Grundsatzes die Rechtssicherheit, die mit Blick auf die konturlose Optik dieser neuen Unbestimmtheiten verdrängt wird. Mit Blick auf die Einschränkungen der Rechte freier Bürger in der sog. „Zivilgesellschaft“ wirken sich diese „Bildstörungen“ im Wirkungskreis von offenen Vermögensfragen und Rentenüberleitung Ost als negatives Vor-Bild auf die Akteure im Parlament und in den Gerichtssälen aus. Es ist ein Dammbruch, der die Gesetzesanwendung und Grundrechte auf die schiefe Ebene leitet. An dieser Stelle drängt sich die immer wieder zitierte Feststellung Böckenfördes auf, dass der freiheitlich säkulare Rechtsstaat von Voraussetzungen zehrt, die er selbst weder erzeugen noch garantieren kann. Positives Gesetzesrecht auf der einen Seite und Moral, Ethik und materielles Recht auf der anderen Seite suchen zunehmend wieder nach einem Wirkungszusammenhang,141 gerade weil Exekutive, Legislative und Judikative beides auseinanderdriften lassen. Unsere Rechtsordnung beruht auf dem kognitiven Erbe der (Rechts-)Philosophie des Naturrechts, der Aufklärung, die seit Locke den grundle-
139 Christian von Hammerstein/Wolfram Hertel, Das Erwerbsrecht öffentlicher Nutzer gemäß §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1 Verkehrsflächenbereinigungsgesetz – Ein Verstoß gegen die Eigentumsgarantie und das Gleichheitsgebot?, in: LKV 2004, S. 385 – 392. 140 EMRK, Urt. vom 23. 11. 2000, NJW 2002, S. 49 (54) – Constantin II; EMRK, 1994, Serie A, Bd. 301, S. 35 Nr. 71 (Heilige Klöster/Griechenland). 141 Th. Purps, Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards?, in: NJ 6/2009, S. 233, 234 ff., 236, 237 f.
194
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
genden Dreiklang von „Leben, Freiheit und Eigentum“ für unabänderlich herausstellt.142 *** Der Zauber einer vereinten Nation ist verblasst. Im Vordergrund steht die ohne Not zugelassene Konjunktur rechtlicher DDRStandards, die sich als Mitgift im Einigungsprozess erwiesen hat.143 Gemeint sind die von der Rechtsprechung entwickelten Floskeln „gelebte Rechtswirklichkeit“ und „wirksame Staatenpraxis“. Immer dann, wenn es darum ging, die Enteignungsmaßnahmen der sowjetischen Besatzer oder der DDR-Behörden nachträglich zu rechtfertigen, damit betroffene Alteigentümer und auch Tausende Bürger aus der DDR keine Chance haben sollten, ihr Eigentum zurückzuerhalten oder behalten zu dürfen, wurde dieser „Giftschrank“ der außerrechtlichen Argumentation geöffnet. Um beispielsweise die beharrliche Weigerung zur Rückübertragung von Mauergrundstücken an die Alteigentümer zu rechtfertigen, traut sich auch heute noch der Bundesgerichtshof, auf die „gelebte Rechtswirklichkeit“ sowie „wirksame Staatenpraxis“ als sterbliche Überreste eines untergegangenen Politsystems zurückzugreifen.144 Das Bundesverfassungsgericht hat die Tendenz der Rechtsprechung untermauert, die verheerenden Folgen der großflächig betriebenen Enteignungsprozesse und -exzesse zu verharmlosen, um gleichzeitig die kritische Debatte weichzuspülen. Nach der steinernen Rechtsprechung rechtfertigen grundlegende Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse, dass der Regelungs- und Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers erweitert wird. Kurzum: wenn es um die Bewältigung (angeblich) großer politischer Aufgaben geht, kann der Grundrechtsschutz geschleift werden.145 ***
142
Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 50 ff. Ralph Hartmann, Die Liquidatoren, 3. Aufl., Berlin 2008; ders., Die DDR unter dem Lügenberg, 3. Aufl., Berlin 2008; ders., DDR-Legenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, Hannover 2009. 144 BGH, Urt. vom 7. 3. 2008 – V ZR 89/07; hierzu Th. Purps, Die Wiedervereinigung …, S. 238 f. 145 Hierzu auch Thorsten Purps, Die Wunderschätze der Wiedervereinigung und ihr verheerender Makel, in: MUT, Oktober 2010, S. 50 – 58 (53 f.). 143
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
195
Unter dem Einfluss der Bundesregierung146 und des Bundesverfassungsgerichts gab es weitere Gefälligkeiten aus Straßburg.147 Hatte die Große Kammer des EGMR in ihrer Entscheidung vom 2. 3. 2005 noch die Auffassung vertreten, dass die Beschwerdeführer sich nicht auf Art. 1 Zusatzprotokoll zur EMRK über den Schutz des Eigentums berufen können, weil sie keine „berechtigte Erwartung“ auf Restitution oder Entschädigung bzw. Ausgleichsleistung hätten,148 so ist sie in dem Verfahren über das Urteil der Dritten Kammer (Sektion) vom 22. 1. 2004149 davon abgerückt. Sie hat zwar anerkannt, dass die Erben von Bodenreformland mit dem In-Kraft-Treten des Modrow-Gesetzes vom 16. 3. 1990150 „vollwertiges Eigentum“ erlangt haben, dass die Verurteilung solcher Erben zur Auflassung ihrer Grundstücke an den Landesfiskus eine Enteignung i.S. des Art. 1 Abs. 1 Satz 2 Zusatzprotokoll zur EMRK war.151 Bewegt sich diese Feststellung noch in der Bahn des Rechts, gibt die Große Kammer diesen Weg auf und fällt die rein politisch motivierte Entscheidung, dass die Erben trotz ihrer „formalen“ Eigentumsposition nicht sicher sein konnten, ihre Rechtsposition zu behalten. Hierfür führt sie drei Überlegungen an, dass – erstens das Modrow-Gesetz von einem nicht demokratischen Parlament verabschiedet worden sei, dies ein „glücklicher Zufall“ für die Betroffenen gewesen sei;152 – zweitens der bundesdeutsche Gesetzgeber in relativ kurzer Zeit mit dem 2. VermRÄndG tätig geworden ist, um die ungerechten Folgen des Modrow-Gesetzes zu korrigieren; und 146
Hierzu W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 213. Sitz des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte. 148 EGMR, NJW 2005, S. 2530 (2535), Nr. 112 f. (Wolf-Ulrich von Maltzan u. a./ Deutschland). 149 EGMR, NJW 2004, S. 923 (Jahn u. a./Deutschland) = NJ 4/2004, S. 167. 150 GBl. I der DDR, S. 134. – Das Gesetz vom 6. 3. 1990 über die Rechte der Eigentümer von Grundstücken aus der Bodenreform hob alle Verfügungsbeschränkungen aus bisherigen Rechtsvorschriften der DDR auf. Dieses sog. Modrow-Gesetz machte die Eigentümer zu vollwertigen Eigentümern. – Hierzu Hans Modrow, Ein nunmehr endgültig abgeschlossenes Kapitel, in: ders./Hans Watzek (Hrsg.), Junkerland in Bauernhand. Die deutsche Bodenreform und ihre Folgen, 2. Aufl., 2005, S. 7 – 12; Hans Watzek, Der Streit und die Reform, ebd., S. 13 – 45. – Am 14. 7. 1992 verabschiedete der bundesdeutsche Gesetzgeber das 2. VermR-ÄndG über die Abwicklung der Bodenreform im Gebiet der DDR (BGBl. I S. 1257), mit dem das ModrowGesetz der Volkskammer der DDR im Grundsatz rückgängig gemacht wurde. Das BVerfG hat die Rückgängigmachung gebilligt: BVerfG, Beschl. vom 17. 6. 1996 – 1 BvR 839/96 -, NJ 10/ 1996, S. 525; Beschluss vom 6. 10. 2000 – 1 BvR 1637/99 -, NJ 5/2001, S. 247 – 249; Beschl. vom 25. 10. 2000 – 1 BvR 2062/09 -, NJ 5/2001, S. 280. Die Beschwerdeführer hatten hiergegen Beschwerde beim EGMR eingelegt. Hierzu und zur entschädigungslosen Enteignung der Erben von Neubauern vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 205 – 213. 151 EGMR (Große Kammer), Urt. vom 30. 6. 2005 – 46720/99, 72203/01 und 72552/01 (Jahn u. a./Deutschland), NJW 2005, S. 2907 – 2909. 152 Die Volkskammer der DDR, die das Modrow-Gesetz erlassen hat, ist in einer freien Wahl gewählt worden. 147
196
N. Vergangenheit, die nicht vergeht
– drittens die Meinung der Bundesregierung nicht offensichtlich unvernünftig sei, die Folgen des Modrow-Gesetzes aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit (!) zu korrigieren.153 Im Hinblick darauf und auf die von den deutschen Behörden angeführten Gründe154 kam der EGMR zu dem worthülsenreichen Ergebnis, „dass in dem einzigartigen Zusammenhang der deutschen Wiedervereinigung der Ausschluss jeglicher Entschädigung den zwischen dem Schutz des Eigentums und den Erfordernissen des Allgemeininteresses zu wahrenden ,gerechten Ausgleich‘ nicht verletzt hat“.155 Abgesehen davon, dass hier Unkenntnis der Geschichte herrscht, denn Umwälzungen im Staatengeschehen hat es seit jeher gegeben, und von einer „Einzigartigkeit“ kann deshalb keine Rede sein, stellt sich der Widerspruch, dass für „den einzigartigen Zusammenhang“, der friedlichen Einung eines Landes, nicht das gelten soll, was für die Folgen eines Krieges nach dem Jus Publicum Europaeum gilt, nämlich Schutz und Bewahrung des Privateigentums durch den Landnehmer bzw. Sieger.156 Die Große Kammer hat – unter Korrektur der Kleinen Kammer – voll die äußerst dürftige und rechtlich substanzlose Position der Bundesregierung übernommen, wobei der Zusammenhang damit auffällig ist, dass – was nachträglich allgemein bekannt wurde – Mitglieder des Gerichtshofes vor dem Urteil der Großen Kammer zu einem Gespräch mit Vertretern der Bundesregierung in Berlin gewesen sind. Diese Art von Gefälligkeitsjustiz reiht sich ein in die zahlreichen Politik- und Justizskandale, die den Einigungsprozess begleitet haben. *** Die Große Kammer hat nicht einstimmig entschieden. Stellvertretend für die abweichende Meinung der Richter Barreto, Pawlovschi, Costa, Botoucharova und dem deutschen Richter Ress, die in der entschädigungslosen Enteignung eine Verletzung des Art. 1 des Zusatzprotokolls Nr. 1 zur EKMR sehen, sollen einige treffende Äußerungen aus dem abweichenden Votum des Richters Ress zitiert werden: „… wenn der Gerichtshof ,außergewöhnliche Umstände‘ zulässt, um Eingriffe in die Rechte des Einzelnen zu rechtfertigen, handelt es sich um eine auf das Staatsinteresse eingestellte Denkweise, die weit von der Vorstellung des Schutzes der Menschenrechte entfernt ist. (…) Soweit ich in der Vergangenheit feststellen konnte, hat der Gerichtshof nie einen solchen Eingriff aufgrund ,außergewöhnlicher Umstände‘ zugunsten des Staates 153
NJW 2005, S. 2911, Nr. 116. Im Urteil unter Nr. 90 angeführt: NJW 2005, S. 2909. 155 Urteil Nr. 117, NJW 2005, S. 2911. 156 Hierzu C. Schmitt, Der Nomos der Erde (1950), 4. Aufl., 1997, S. 18, 37 f., 119, 121, 169, 177, 185, 208. – Vgl. auch Thorsten Purps, Neusiedlererben: Kein Menschenrecht auf Eigentum, in: ZOV 2008, S. 131. 154
V. „Kreativer Umgang“ mit dem Grundgesetz
197
gerechtfertigt. (…) Wird hierdurch jedoch ein Freibrief dafür ausgestellt, Menschenrechtsverletzungen zu begehen oder Verletzungen mit Nichtverletzungen gleichzusetzen?“157
Ress stellt die rhetorische Frage, wer dann den Bürger vor den Gerichten schützen soll. *** Die laxe Haltung der höchsten Gerichte führt zu einer Deformation des Grundrechtsschutzes, wie für jedes Rechtsgebiet nachzuweisen ist, bei dem es um existenzielle Fragen der DDR-Bürger und sonstigen Betroffenen geht (Bodenreform; offene Vermögensfragen; Rentenüberleitung Ost). In Bezug auf die Neusiedlererben sind nicht weniger als rund 70000 Menschen in den „neuen Bundesländern“ bei einem geschätzten Transfervermögen von rd. einer Milliarde Euro betroffen. Welche negative Nachahmerfunktion diese Konjunktur rechtlicher DDR-Vorgaben haben sollte, wird an dem zügellosen Vorgehen des Finanzministeriums des Landes Brandenburg im Fall der anonymen Erben deutlich. Hier wurden bis zum Ablauf des 2. Oktober 2000 – wohl unter dem vermeintlichen „Rettungsschirm“ von Gerichten – durch Täuschung von Genehmigungsbehörden auf sittenwidrige Weise 10.208 ehemalige Bodenreformgrundstücke in Selbstbedienung durch Einschaltung gesetzlicher Vertreter dem Landeshaushalt zugeführt. Bei so viel Dreistigkeit war schließlich auch dem Bundesgerichtshof „die Hutschnur geplatzt“, mit der Folge, dass den Akteuren im Brandenburger Finanzministerium in einer „Blitzschlagentscheidung“ vom 7. 12. 2007158 sittenwidriges Vorgehen bescheinigt wurde, welches an die rücksichtslose Praxis der staatlichen Verwaltung zu DDR-Zeiten erinnere.159 Per Saldo hat dieses kriminelle Betreiben dem Landesfiskus etwa 90 Millionen Euro in den Haushalt gespült. Trotz der schallenden Ohrfeige des BGH agieren die Täter nach wie vor nach dem Motto „bussiness as usual“.160
157 Anmerkung: Das Votum von Ress ist in der NJW 2005, S. 2510 ff., nicht mit abgedruckt worden. 158 BGH, Urt. vom 7. 12. 2007 – V ZR 65/07. 159 Ebd. 160 Thorsten Purps, Vom Staat enterbt – Die Bodenreformaffäre – Eine Skandalchronik aus dem Land Brandenburg, Mitteldeutscher Verlag 2010, hat in seinem Buch das genaue Ausmaß dieser fulminanten Entgleisung der „Staatsdiener“ im Landesfinanzministerium ausgewertet.
O. Das Gesicht eines Machtstaates Spannt man den Bogen von – der rechtswidrigen entschädigungslosen Enteignung bzw. Konfiskation der Ansprüche und Anwartschaften aus den Zusatz- und Gesamt- bzw. Sonderversorgungssystemen für ehemalige Bürger der DDR in der Bundesrepublik,1 bis hin zu – den Enteignungen bzw. Konfiskationen der sowjetischen Besatzungsmacht und der staatlichen Organe der DDR und deren Aufrechterhaltung der staatlichen Organe der Bundesrepublik zu Lasten der Alteigentümer, deren Erben sowie der Neubauern bzw. deren Erben,2 bis hin zu – den bundesdeutschen Gesetzen zur Regelung offener Vermögensfragen,3 bis hin zu – den Machenschaften der Treuhandanstalt,4 offenbart sich das systematische Vorgehen der staatlichen Organe der Bundesrepublik, die Betroffenen unter Verstoß gegen Art. 20 Abs. 3 GG zu entrechten, zeigt sich das Gesicht eines reinen Machtstaates5 in Siegermentalität. Die Methoden, die Betroffenen um ihr rechtmäßiges Vermögen zu bringen, mögen zwar unter dem einen oder anderen Aspekt unterschiedlich strukturiert sein; sie alle hatten jedoch dieselbe Wirkung. Während in der Versorgungsüberleitung Ost das erworbene und durch die Staatsverträge garantierte Eigentum mit Hilfe des 1 Werner Mäder, Eine unendliche Geschichte: Versorgungsüberleitung Ost, in: ZFSH/SGB 5/2012, S. 235 – 265. 2 C. Paffrath, Macht und Eigentum. Die Enteignungen 1945 – 1949 im Prozess der Wiedervereinigung, 2004. 3 Th. Purps, Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards?, in: NJ 6/2009, S. 233 – 240; ders., Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet im Lichte der Auseinandersetzung zwischen BVerfG und EGMR, in: NJ 4/2005, S. 145 – 152. 4 R. Hartmann, Die Liquidatoren, 2008; Klaus Huhn, Raubzug Ost. Wie die Treuhand die DDR plünderte, 2. Aufl., Berlin 2009. 5 Vgl. auch Hermann Heller, Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte (1921), in: ders., Gesammelte Schriften, 1. Bd., 2. Aufl., Tübingen 1992, S. 21 – 240. – Vgl. hierzu auch Karl Albrecht Schachtschneider, Die Souveränität Deutschlands, 1. Aufl., Rottenburg 2012, S. 49 ff., 57 ff., 238 ff. zur „Führerstaatlichen Rechtlosigkeit“.
O. Das Gesicht eines Machtstaates
199
höchsten Gerichts im wesentlichen „wegdefiniert“ wurde, hat der bundesrepublikanische Gesetzgeber in einem Gesetzespaket zu offenen Vermögensfragen Ansprüche „abgeschnitten“, ebenfalls mit der Billigung des höchsten Gerichts.6 So wurden ganze Bevölkerungsgruppen benachteiligt, ohnmächtig gegenüber der geballten politischen Macht, Änderungen herbeizuführen. Die Gründe hierfür sind mittlerweile durch die Literatur bekannt gemacht worden, die jedoch keine Wirkung entfaltet, zumal sie kein Forum in der Öffentlichkeit und in den Medien, weitestgehend Sprachrohr der Politischen Klasse, hat.7 Der Bürger ist in einem politischen Netzwerk verfangen, aus dem es kein Entrinnen gibt. In dem Parteienstaat mit einer Parteioligarchie gibt es in dem allerdings von ihm selbst gewählten Parlament keine wahre Opposition, die seine Interessen vertritt.8 Zaghafte Versuche der Opposition, die selbst „etabliert“ ist, werden im Keim erstickt. Wechselt die Oppositionspartei in der Regierung, setzt sie die Politik ihrer Vorgänger fort. Was soll der Bürger von einem höchsten Gericht halten, dessen Richter ihr Amt der Parteizugehörigkeit verdanken oder zumindest einer der im Parlament vertretenen Partei nahestehen? Die Richter sind Einflüssen auf ihre Unabhängigkeit ausgesetzt, denen sie sich nicht völlig entziehen können, die sie erst nach längerer Amtszeit oder gar nach der Zurruhesetzung abstreifen. So kann die Frage des Richters Ress abgewandelt werden, wer den Bürger nicht nur vor der Regierung, sondern auch vor dem Gericht schützt. Oder soll die Feststellung von Felix gelten, dass die „Würde des Staates“ verloren ging?9
6
Th. Purps, Die Wiedervereinigung … Zur Presse vgl. schon Oswald Spengler,Der Untergang des Abendlandes (1917), 14. Aufl., 1999, S. 1137 ff. – Zur Situation heute vgl. Thorsten Hinz, Papier ist geduldig, in: JF Nr. 36/12 vom 31. 8. 2012, S. 1, mit der Bemerkung, dass Opposition nicht in der Politik, sondern auf dem Büchermarkt stattfindet, was leider folgenlos ist. 8 Zur Situation der Abgeordneten vgl. W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, S. 94 ff. 9 Günther Felix, Vielleicht eine verdeckte Junkerabgabe?, in: NJW 41/1995, S. 2697 f. 7
P. Hoffnung aus der Welt der Wunder? Im Bereich der Versorgungsüberleitung Ost bestehen alles in allem noch viele Ungereimtheiten bis hin zu Ungerechtigkeiten. Der Appell des UNO-Ausschusses für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte aus dem Jahre 1998, den entlassenen Wissenschaftlern, Lehrern u. a. in einem „Akt der nationalen Aussöhnung“ eine angemessene Entschädigung zu gewähren, „damit möglichst viele von ihnen in den Hauptstrom des Lebens in Deutschland aufgenommen werden können“ und einen fairen Ausgleich bzw. eine angemessene Rentenversorgung erhalten,1 blieb von der Bundesregierung unbeachtet. Fragen und Stellungnahmen dazu reißen im Bundestag nicht ab. So unterstützten 2007 10 SPDBundestagsabgeordnete in einem Brief an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Menschenrechtsbeschwerden ehemaliger Mitarbeiter des Gesundheitsund Sozialwesens wegen ihrer ungerechten Rentenbemessung. Die Bundesregierung vertrat noch am 23. 5. 2007 die Auffassung, dass die Überführung der Alterssicherungsansprüche und -anwartschaften keine Ungerechtigkeiten und Diskriminierung ehemaliger DDR-Bürger enthalte und Rechtsänderungen nicht erforderlich seien.2 Kurz danach forderte hingegen die Bundeskanzlerin dazu auf, ihr offene Fragen zum Einigungsprozess, u. a. zur Renten- und Versorgungsüberleitung, zuzuarbeiten.3 Der Bürger fragt sich, was die Aufforderung bewirken soll, sind doch die Nöte und Sorgen der Betroffenen durch die unzähligen Eingaben, Petitionen und Beschwerden, durch endlosen Schriftwechsel mit den Ministerien hinreichend bekannt. Dieses Wechselspiel des Hin und Her bei politischen Problemen lässt erkennen, dass dies organisierte Verantwortungslosigkeit ist, um zu erreichen, dass die Probleme „ausgesessen“ werden und sich durch Zeitablauf erledigen.4 Die Erfahrungen aus der bisherigen Entwicklung weisen darauf hin, dass die Vergangenheit nicht vergeht, solange die betroffene Generation sich mit der unzulänglichen Situation nicht abfindet. Diese lässt sich auch nicht durch die abwei1
www.ostrentner.de enthält unter „Aktuelles“ zu Frage 12 Ausschnitte aus der Pressemitteilung der Vereinten Nationen zum Abschluss der Herbsttagung des Ausschusses (HR/ESC/ 98/46 vom 4. 12. 1998), dessen Experten die Situation im Beitrittsgebiet „mit Bestürzung“ zur Kenntnis nahmen. Dort wird auf die unangemessene Reaktion der Bundesregierung und darauf hingewiesen, dass sich die Situation seit jeher verschlechtert hat. 2 Antwort der Bundesregierung auf die Große Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Zum Stand der Deutschen Einheit und der perspektivischen Entwicklung bis zum Jahr 2000“, BTDrs. 16/5418, S. 33 – 34 zur Frage 64. 3 Informationen über die Aufforderung der Bundeskanzlerin wurden über die Presse vermittelt. 4 Hierzu auch Gertrud Höhler, Die Patin – Wie Angela Merkel Deutschland umbaut, 2012.
P. Hoffnung aus der Welt der Wunder?
201
senden Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts abschrecken, mit denen Politik, und zwar Politik der Regierung gemacht wird.5 Auch für die Politik gilt, was Hegel zur Philosophie zu befinden wusste: „Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau lässt sie sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.“6
Sollte doch einmal die „Eule der Minerva“ über das Bundesverfassungsgericht im noch fahlen Lichte der Dämmerung Erkenntnis vermitteln, wird es für die Betroffenen zu spät sein. Aber es ist nicht damit zu rechnen, dass sie sich dahin verirrt, zumal auch die neue Richtergeneration sich weitere Verfassungsbeschwerden verbitten, diese nicht mehr annehmen und neue Beschwerdeführer oder deren Vertreter mit einer Missbrauchsgebühr gemäß § 34 Abs. 2 BVerfGG überziehen.7 Bleibt dann nur noch die Hoffnung auf ein Wunder8 oder letztlich die zeitgeschichtliche Aufarbeitung mit einer Stelle im Schlossgarten9 als Symbol und Erinnerung an die versteinerte Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, dass grundlegende Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland zur Bewältigung politischer Aufgaben es rechtfertigen, den Grundrechtsschutz zu schleifen und Eigentum entschädigungslos zu enteignen?10 Das letzte Kapitel ist jedoch noch nicht geschrieben.
5 W. Mäder, Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, 2011, S. 109, 123, 129 f., 149, 180, 195, 196, 200, 210, 221. 6 Hegel, Rechtsphilosophie (1821), Vorrede, S. 8. 7 So z. B. im Falle des Generalmusikdirektors der DDR: Verfassungsbeschwerde vom 12. 8. 2008; Nichtannahmebeschluss vom 24. 11. 2009 – BVerfG 1 BvR 3324/08; Missbrauchsgebühr i.H. von 500 Euro gegen die Prozessbevollmächtigten des Beschwerdeführers; deren Beschwerde Nr. 20308/10 an den EGMR wegen rechtswidriger Behinderung der Berufsausübung und rechtswidrigen Ausschlusses der Beschreitung des Rechtsweges. 8 Zum Wunderglauben in der Politik vgl. Hannah Arendt, Politik und das Wunder des Neuanfangs, in: dies., Denken ohne Geländer. Texte und Briefe, München 2006, S. 79 ff. 9 Adresse des Bundesverfassungsgerichts: Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe. 10 Vgl. auch Th. Purps, Die Wunderschätze der Wiedervereinigung und ihr verheerender Makel, in: MUT Nr. 516, Oktober 2010, S. 50 – 58 (53 f.); vgl. auch Bernd Rüthers, Demokratischer Rechtsstaat oder oligarchischer Richterstaat?, in: JZ 8/2002, S. 365 – 371; ferner Günter Hirsch, Im Namen des Volkes: Gesetz – Recht – Gerechtigkeit, in: ZRP 7/2012, S. 205 – 209, „Die Richter haben dafür zu sorgen, dass der Rechtsstaat nicht nur auf dem Papier steht, sondern sich täglich bewährt.“ (S. 209)
Literaturverzeichnis Abelshauser, Werner: Deutschland, Europa und die Welt, in: FAZ vom 9. 12. 2011, S. 12. Arendt, Hannah: Vita activa oder vom tätigen Leben (1981), 6. Aufl., München 2007. – Der Sinn von Politik, in: dies., Denken ohne Geländer, München 2006, S. 74 – 79. – Politik oder das Wunder des Neuanfangs, in: dies., Denken ohne Geländer, München 2006, S. 79 – 86. Aristoteles: Rhetorik. Arnim, Hans Herbert von: Gemeinwohl und Gruppeninteressen, 1977. – Ämterpatronage durch politische Parteien, 1980. – Auswirkungen der Politisierung des öffentlichen Dienstes, in: Die Personalvertretung, 1982, S. 449 ff. – Parteienfinanzierung, 1982. – Staatliche Fraktionsfinanzierung ohne Kontrolle?, 1987. – Entmündigen die Parteien das Volk? Parteiherrschaft und Volkssouveränität, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 21/1990, S. 25 ff. – Die finanziellen Privilegien von Ministern in Deutschland, 1992. – Der Staat als Beute, 1993. – Staat ohne Diener. Was schert die Politiker das Wohl des Volkes?, 1993. – Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, Parteifinanzierung in Deutschland, München 1996. – Fetter Bauch regiert nicht gern. Die politische Klasse – selbstbezogen und abgehoben, München 1997. – Diener vieler Herren. Die Doppel- und Dreifachversorgung von Politikern, München 1998. – Vom schönen Schein der Demokratie – Politik ohne Verantwortung – am Volk vorbei, München 2000. – Das System. Die Machenschaften der Macht, München 2001. – Politik macht Geld. Das Schwarzgeld der Politiker – weißgewaschen, München 2001. – Wer kümmert sich um das Gemeinwohl? Auflösung der politischen Verantwortung, in: ZRP 2002, Heft 5, S. 223 – 232. – Hrsg., Korruption, Netzwerke in Politik, Ämtern und Wirtschaft, 2003. – Die Deutschlandakte. Was Politiker und Wirtschaftsbosse unserem Land antun, 1. Aufl., München 2009.
Literaturverzeichnis
203
– Politische Parteien im Wandel. Ihre Entwicklung zu wettbewerbsbeschränkenden Staatsparteien – und was daraus folgt, Berlin 2011. – Der Verfassungsbruch, 2011. Badura, Peter: Eigentum, in: Ernst Benda/Werner Maihofer/Hans-Joachim Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1998, S. 655 ff. Bahle, Olaf: Abbau Ost, Lügen, Vorurteile und sozialistische Schulden, München 2008. Barber, Hans D.: Wenn das Eigentum fällt, muss der Bürger nach, in: Schwäbisch-Hall-Stiftung (Hrsg.), Kultur des Eigentums, Heidelberg 2006, S. 3 – 7. Baring, Arnulf: Deutschland, was nun?, Arnulf Baring, Ein Gespräch mit Dirk Rumberg und Wolf Jobst Siedler, Berlin 1991. Benoist, Alain de: Aufstand der Kulturen. Europäisches Manifest für das 21. Jahrhundert, Berlin 1999. Bienert, Ernst: Die Altersversorgung der Intelligenz in der DDR – Betrachtungen zur Entstehung und Abwicklung von Ansprüchen und Anwartschaften, in: ZSR 1993, S. 349 ff. – Rachefeldzug fortgesetzt. Neue Verfassungsrichter kippen das Renten-Urteil ihrer Vorgänger, in: ISOR aktuell 9/2010, S. 2 ff. Blessing, Klaus u. a.: Die Schulden des Westens. Wie der Osten Deutschlands ausgeplündert wird, Berlin 2006 (Selbstverlag; www.klaus-blessing.de). Blicken, Jürgen/Conze, Werner/Dipper, Christof/Günter, Horst/Klippel, Diethelm/May, Gerhard/Meyer, Christian: Art. „Freiheit“, in: Otto Brunner/Reinhart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (1975), Studienausgabe, Bd. 2, 1. Aufl., Stuttgart, S. 425 – 524. Böckenförde, Ernst-Wolfgang: Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976. – Grundrechte als Grundsatznormen. Zur gegenwärtigen Lage der Grundrechts-dogmatik, in: Der Staat, 29. Bd. (1990), S. 1 – 31. Bodin, Jean: Sechs Bücher über den Staat (1576), Buch I-III, München 1981. Bonz, Hans-Jörg: Die Sozialversicherung in der DDR und die „Politik der Wende“, in: ZSR 1990, S. 11 ff. Braun, Johann: Wahn und Wirklichkeit – über die innere Verfassung der Bundesrepublik, Tübingen 2008. – „Unsere Wirklichkeit“, in: Gegengift – Zeitschrift für Politik und Kultur vom 1. 1. 2010, S. 14. Busch, Oliver: Eine geschlossene Gesellschaft der Offenen, in: JF Nr. 45/09 vom 30. 10. 2009, S. 17. Christoph, Karl-Heinz: Das Rentenüberleitungsgesetz und die Herstellung der Einheit Deutschlands, 1. Aufl., Berlin 1999. – Bestohlen bis zum Jüngsten Tag. Kampf dem Rentenabbau, Berlin 2010. – www.ostrentner.de.
204
Literaturverzeichnis
Christoph, Karl-Heinz/Christoph, Ingeborg: Stellungnahme vom 4. 5. 2009 zum Entwurf der BT-Fraktion DIE LINKE „eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des An-spruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetzes“ (BT-Drs. 16/7035) sowie zu weiteren 16 Anträgen der BT-Fraktion DIE LINKE zur „Alterssicherung Ost/Renten und Versorgungsüberleitung Ost“ (BT-Drs. 16/7019 bis 16/7034) an den BT-Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ausschussdrucksache 16 (11) 1361. Christoph, Karl-Heinz/Mäder, Werner: Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/SGB 2005, Heft 4, S. 195 – 213. Dietze, Gottfried: Begriff des Rechts, Berlin 1977. – Korollarium 200 Jahre nach Kant und Schiller, in: ders., Amerikas Schuldgefühl, St. Augustin 2005, S. 71 – 86. – Schuld und Schulden, Berlin 2007. Dostojewski, F.M.: Aufzeichnungen aus einem Totenhaus 1860 – 62, in der Übersetzung von Herrmann Rohl, 2005. Dürig, Günter: in: Theodor Maunz/ders., GG, Kommentar, Kommentierung der Art. 1 und 2. Erdel, Eike: Kreativer Umgang mit dem Grundgesetz, in: JF Nr. 47/10 vom 19. 11. 2010, S. 6. – Kungelei in roten Roben, in: JF Nr. 52/10 vom 31. 12. 2010, S. 2, 8. Faßbender, Kurt: Wettbewerbsrelevantes Staatshandeln und Berufsfreiheit: Quo vadis, Bundesverfassungsgericht?, in: NJW 2004, Heft 12, S. 816 – 818. Fasshauer, Olaf: Die Überführung der Zusatzversorgung der Hochschullehrer der ehemaligen DDR in die bundesdeutsche Rentenversicherung – verfassungsrechtliche Probleme (Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung, Bd. 628), München 2000. Felix, Günter: Vielleicht eine verdeckte Junkerabgabe?, in NJW 1995, Heft 41, S. 2697 f. Forkel, Hans: Das Bundesverfassungsgericht, das Zitieren und die Meinungsfreiheit, Überlegungen aus Anlass des Maastricht-Urteils, in: JZ 1994, Heft 13, S. 637 – 642. Geis, Max-Emanuel: Methoden und Richtungsstreit in der Weimarer Staatslehre, in: JuS 1989, Heft 2, S. 91 – 95. Gill, David/Schröter, Ulrich: Das Ministerium für Staatssicherheit, 1991. Gläser, Ronald: Hände hoch, Passwort her!, in: JF Nr. 46/12 vom 9. 11. 2012, S. 2. Gornig, Gilbert H.: Menschenrechte und Naturrecht, in: ders./Burkhard Schöbner, Winfried Bausback, Tobias H. Irmscher (Hrsg.), Justitia et Pax, Gedächtnisschrift für Dieter Blumenwitz, Berlin 2008, S. 409 – 431. Grabitz, Eberhard: Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: AöR Bd. 98 (1973), S. 568 – 616. Häberle, Peter: Arbeit als Verfassungsproblem, in: JZ 1984, Heft 8, S. 345 – 355. – Aspekte einer Verfassungslehre der Arbeit, in: AöR 109 (1984), S. 630 ff. Hankel, Wilhelm: Ohne ökonomischen Sachverstand. Helmut Kohl wird 80. Dem Kanzler fehlte der Blick für das Machbare, in: JF 14/10 vom 2. 4. 2010, S. 9.
Literaturverzeichnis
205
Hankel, Wilhelm/Nölling, Wilhelm/Schachtschneider, Karl Albrecht/Starbatty, Joachim: Die Euro-Klage. Warum die Währungsunion scheitern muss, Reinbek 1998. Hannich, Günter: Wer in der Schuld ist, ist nicht frei, 2. Aufl., Rottenburg 2006. Hartmann, Ralph: Die Liquidatoren. Der Reichskommissar und das wiedergewonnene Vaterland, 3. Aufl., Berlin 2008. – Die DDR unter dem Lügenberg, 3. Aufl., Berlin 2008. – DDR-Legenden – Der Unrechtsstaat, der Schießbefehl und die marode Wirtschaft, Hannover 2009. Hassemer, Winfried: Politik aus Karlsruhe?, in: JZ 2008, Heft 1, S. 1 – 10. Hegel, Georg Friedrich Wilhelm: Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), Werke 7, Frankfurt am Main, 1986. – Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Werke 12, Frankfurt am Main 1970. – Kritik der Verfassung Deutschlands (1800/01). Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers, hrsg. von Georg Mollat, Kassel 1883. Heine, Kai-Alexander: Die Eigentumsrelevanz der Systementscheidung – Anmerkungen zum Leiturteil des BVerfG vom 28. 4. 1999 – Az. 1 BvL 32/95 und BvR 2105/95 (NJW 1999, S. 2393 ff.), in: DRV 1999, Heft 11, S. 201 ff. – Die Versorgungsüberleitung, Berlin 2003. Heller, Bernd: Das 2. AAÜG-Änderungsgesetz zur Rentenüberleitung, in: NJ 2001, Heft 7, S. 350 ff. Heller, Hermann: Die Krisis der Staatslehre (1926), in: ders., Gesammelte Schriften, 2. Bd., 2. Aufl., Tübingen 1992, S. 3 – 30. – Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staats- und Völkerrechts (1927), in: ders., Gesammelte Schriften, 2. Bd., 2. Aufl., Tübingen 1992, S. 31 – 202. – Staatslehre (1934), in: ders. Gesammelte Schriften, 3. Bd., 2. Aufl., Tübingen 1992, S. 79 – 395. – Hegel und der nationale Machtstaatsgedanke in Deutschland. Ein Beitrag zur politischen Geistesgeschichte (1921), 1. Bd., 2. Aufl., Tübingen 1992, S. 21 – 240. Hesse, Konrad: Verfassungsrecht im geschichtlichen Wandel, in: JZ 1995, Heft 6, S. 263 – 273. Hinz, Thorsten: Klima der Furcht, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 1. – Papier ist geduldig, in: JF Nr. 36/12 vom 1. 9. 2012, S. 1. – Der Sprung ins Dunkle. Warum Helmut Kohl die D-Mark preisgab, in: JF Nr. 37/12 vom 7. 9. 2012, S. 18. Hirsch, Günter: Im Namen des Volkes: Gesetz – Recht – Gerechtigkeit, in: ZRP 2012, Heft 7, S. 205 – 209. Hofbauer, Hannes: Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung – Rechtsprechung als politisches Kampfinstrument, Wien 2011. Hoffgaard, Henning: Grenzen wurden überschritten: Streit um Ruderin: Politiker fordern Konsequenzen für Nadja Drygalla, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 4.
206
Literaturverzeichnis
Höhler, Gertrud: Die Patin – Wie Angela Merker Deutschland umbaut, Zürich 2012. Homburg, Stefan: Die bisherigen Kosten der Euro-Rettung – eine Zwischenbilanz, in: Der Hauptstadtbrief, 106. Ausgabe/2012, S. 4 – 7. Huber, E. R.: Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bd. II, 2. Aufl., Tübingen 1954. Huhn, Klaus: Raubzug Ost. Wie die Treuhand die DDR plünderte, 2. Aufl., Berlin 2009. Ipsen, Hans Peter: Enteignung und Sozialisierung, in: VVDStL, Heft 10 (1952), S. 74 – 123. Isensee, Josef: Staatsrechtslehre als Wissenschaft, in: JZ 2009, Heft 19, S. 949 – 954. Jacobs, Günter: Feind = Strafrecht – Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit, in: HRRS (www.hrr-strafrecht.de), August/September 2006. Jebsen, Ken: „Das erinnert mich an die DDR“, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 3. Junge Freiheit: Vorsicht Falle!, in: JF Nr. 33/12 vom 10. 8. 2012, S. 7. Jürgs, Michael: Die Treuhänder. Wie Helden und Halunken die DDR verkauften, München 1997. Kant, Immanuel: Die Religion in den Grenzen der bloßen Vernunft (1773/74), in: Werksausgabe Bd. VII, herausgegeben von Wilhelm Weischedel, 1. Aufl., Frankfurt am Main. Kaufmann, Manfred: Stand und Entwicklung von Alterseinkommen in den neuen Bundesländern auf der Basis der Löhne und Gehälter in der DDR und der in der DDR erworbenen Ansprüche und Anwartschaften (Sachverständigengutachten für das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1998), Jena/Berlin Ausgabe 2003. Kelsen, Hans: Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Tübingen 1911. – Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1920. – Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Beitrag zur reinen Rechtslehre, Tübingen 1920. – Der soziologische und juristische Staatsbegriff, Tübingen 1922. – Allgemeine Staatslehre, 1925. – Foundations of Democracy, in: Ethics, LXVI (1955), S. 100. Kimminich, Otto: Entwicklungstendenzen des gegenwärtigen Völkerrechts, Carl Friedrich von Siemens Stiftung (Hrsg.), Themen XXIV, München 1974. Kirchhof, Paul: Das Grundgesetz – ein oft verkannter Glücksfall, in: DVBl. 2009, Heft 9, S. 541 – 552. Kirchlicher Herausgeberkreis: Zerrissenes Land. Perspektiven der deutschen Einheit, in: Jahrbuch Gerechtigkeit III, Politik – Forum Verlagsgesellschaft mbH, Oberursel November 2007. Klenner, Hermann: Rechtsleere – Verurteilung der Reinen Rechtslehre, 1972. – Gerechtigkeitstheorien in Vergangenheit und Gegenwart, in: Sitzungsberichte der LeibnizSozietät, Bd. 8, Jg. 1995, Heft 8/9, S. 91 – 110. – Juristenaufklärung über Gerechtigkeit. Festvortrag auf dem Leibniztag 2006, in: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Bd. 88, Jg. 2007, S. 35 – 96.
Literaturverzeichnis
207
Kosiek, Rolf: Die Frankfurter Schule und ihre zersetzenden Auswirkungen, Tübingen 2001. Krause, Klaus Peter: Fortgesetztes Unrecht. Der bis heute als „Bodenreform“ verharmloste Klassenkampf, in: MUT Nr. 15, September 2010, S. 26 – 35. Krautkrämer, Felix: Das Kreuz mit der Meinung. Paragraph 130 Strafgesetzbuch. Im Spannungsfeld zwischen Demokratieschutz und Maulkorberlass, in: JF Nr. 33/12, S. 12. Kuehnelt-Leddihn, Erik von: Demokratie: eine Analyse, Graz 1996. Kühl, Kristian: Eigentumsordnung als Freiheitsordnung. Zur Aktualität der Kan-tischen Rechts- und Eigentumslehre, 1984. Laabs, Dirk: Der deutsche Goldrausch. Die wahre Geschichte der Treuhand, 2. Aufl., München 2012. Lege, Joachim: Wohin mit den Schwellentheorien?, Die neue Rechtsprechung von BGH und BVerwG zur Entschädigung bei Inhalts- und Schrankenbestimmung des Eigentums, in: JZ 1994, Heft 9, S. 431 – 440. Leisner, Walter: Eigentum, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR VI, Heidelberg 1989, § 149. – Eigentum als Existenzsicherung? Das „soziale Eigentum“ in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (1986), in: ders., Eigentum, Schriften zum Eigentumsrecht und zur Wirtschaftsverfassung 1970 – 1996 (hrsg. von Josef Isensee), 1996, S. 52 ff. Locke, John: Zwei Abhandlungen über die Regierung (1679/1689), Frankfurt am Main 1977. Lohmann, Ulrich: in: Hans F. Zacher (Hrsg.), Alterssicherung im Rechtsvergleich, 1991, S. 193 ff. Luchterhand, Otto: Die staatliche Teilung Deutschlands, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR I, 3. Aufl., Heidelberg 2003, § 10. Luhmann, Niklas: Soziologische Aufklärung 2, Aufsätze zur Theorie der Gesellschaft, Opladen 1975. – Die Gesellschaft der Gesellschaft, Bd. 1, 1. Aufl., Frankfurt am Main 1998. Mäder, Werner: Kritik der Verfassung Deutschlands – Hegels Vermächtnis 1801 und 2001, Berlin 2002. – Wende rückwärts: Das BVerfG und die berufsbezogene Zuwendung an Ballettmitglieder der DDR, in: NJ 2003, Heft 3, S. 124 f. – Vom Wesen der Souveränität. Ein deutsches und europäisches Problem, Berlin 2007. – Freiheit und Eigentum aus Neuerer Zeit, Berlin 2011. – Eine unendliche Geschichte – Versorgungsüberleitung Ost, in: ZFSH/SGB 2012, Heft 5, S. 235 – 265. Mäder, Werner/Christoph, Karl-Heinz: Versorgungsüberleitung ohne Ende, in: ZFSH/SGB 2005, Heft 4, S. 195 – 213. Mäder, Werner/Wipfler, Johann: Wendezeiten – Kulturschaffende im neuen Europa. Zur Diskriminierung von Balletttänzern aus der DDR, St. Augustin 2004. „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 2005, Heft 10, S. 579 – 595, und Heft 11, S. 651 – 659.
208
Literaturverzeichnis
Mäder, Werner/Zak, Christian: Vor und nach der Revolution 1989. Von der Doppelkultur in der DDR zu antagonistischer Solidarität, in: ZFSH/SGB 2002, Heft 3, S. 142 – 150, und Heft 4, S. 195 – 200. Märker, Klaus: Der Staatsräson verpflichtet! Zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit des Entschädigungs- und Ausgleichsleistungsgesetzes, in: VIZ 2001, Heft 5, S. 233 – 241. Marx, Karl: Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“ (1847), in: ders./Friedrich Engels, Werke (MEW), Bd. 4, Berlin 1959, S. 63 – 182. Masing, Johannes: Meinungsfreiheit und Schutz der staatlichen Ordnung, in: JZ 2012, Heft 12, S. 585 – 592. Meinhardt, Volker/Vortmann, Heinz: Vereinheitlichung des Rentenrechts, in: DA 1991, S. 1254 ff. Merten, Detlef: Verfassungsprobleme der Versorgungsüberleitung. Zur Erstreckung westdeutschen Rentenversicherungsrechts auf die neuen Länder, 2. Aufl., Berlin 1994. Merten, Detlef/Papier, Hans-Jürgen: Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. II, Heidelberg 2006. Meyer, Dirk: Euro-Krise, Austritt als Lösung?, Berlin 2012. Michels, Robert: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (1911), 2. Aufl., 1925/1970. Modrow, Hans: Ein nunmehr endgültig abgeschlossenes Kapitel, in: ders./Hans Watzek (Hrsg.), Junkerland in Bauernhand. Die deutsche Bodenreform und ihre Folgen, 2. korr. Aufl., Berlin 2005, S. 7 – 12. – „Zweiheit“ statt Einheit, in: ND vom 16. 4. 2012, S. 3. Most, Edgar: Fünfzig Jahre im Auftrag des Kapitals. Gibt es einen dritten Weg?, 2. Aufl., Berlin 2009. Murswiek, Dietrich: Das „Bail-out-Verbot“ wird für immer ausgehebelt, in: Der Hauptstadtbrief, 106. Ausgabe/2012, S. 12 – 17. Mußgnug, Reinhard: Zustandekommen des Grundgesetzes und Entstehen der Bundesrepublik Deutschland, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR I, 3. Aufl., Heidelberg 2003, § 8. Mutz, Michael: Aufstieg und Fall eine Konzepts. Die Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der DDR und ihre Überführung, in: DAngVers. 1999, Heft 11, S. 509 – 519. Mutz, Michael/Stephan, Ralf-Peter: Aktuelle Probleme des AAÜG, in: DAngVers. 1992, S. 281 ff. Nier, Michael: Deutschland und die Dramatik der Eigentumsfrage. Die Ausraubung der Bürger, in: DGG 2012, Heft 2, S. 18 – 23. Oppermann, Thomas: Deutschland in guter Verfassung? – 60 Jahre Grundgesetz, in: JZ 2009, Heft 10, S. 481 – 491. Ossenbühl, Fritz: Inhaltsbestimmung des Eigentums und Enteignung – BVerfGE 83, 201, in: JuS 1993, Heft 3, S. 200 – 203.
Literaturverzeichnis
209
Paffrath, Constance: Macht und Eigentum. Die Enteignungen 1945 – 1949 im Prozess der deutschen Widervereinigung, Köln/Weimar 2004. Palandt: BGB, Kommentar, 61. Aufl., München 2002. Papier, Hans Jürgen: Verfassungsrechtliche Probleme der Eigentumsregelung im Ei-nigungsvertrag, in: NJW 1991, Heft 4, S. 193 – 197. – Rechtsgutachten zur Verfassungsmäßigkeit der Versorgungsüberleitung, 1994 (Forschungsbericht Nr. 238 des BMA). – Die Verfassungsmäßigkeit der Regelungen des AAÜG, in: DRV 1994, Heft 12, S. 840 – 871. – Rentenrecht und Rentenunrecht, in: DRiZ 1995, Heft 10, S. 402 – 411. – Eigentumsgarantie bei DDR-Renten, in: DtZ 1996, Heft 2, S. 43 – 44, – in: ders./Detlef Merten, Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, Bd. II, Heidelberg 2006, § 30, Rn. 45 ff. – in: Theodor Maunz/Günter Dürig, GG, Kommentar, Stand: Dezember 2007, zu Art. 14. Paulwitz, Michael: Stirb langsam. Karlsruhe hat den ESM durchgewinkt – mit Auf-lagen, die in der Praxis kaum Auswirkungen haben, in: JF Nr. 38/12 vom 14. 9. 2012, S. 1. Plickert, Philip: Burgen in der ehemaligen DDR: Die Schlossretter, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10. 8. 2012. Polster, Andreas: Grundzüge des Rentenversicherungssystems der Deutschen Demokra-tischen Republik, in: DRV 1990, S. 154 ff. Purps, Thorsten: Eigentumsschutz im Beitrittsgebiet im Lichte der Auseinandersetzung zwischen BVerfG und EGMR, in: NJ 2005, Heft 4, S. 145 – 152. – Neusiedlererben: Kein Menschenrecht auf Eigentum, in: ZOV 2008, S. 131. – Die Wiedervereinigung als Anlass zur Einschränkung von Grundrechtsstandards? Zumutung, Rechtfertigung oder Herausforderung?, in: NJ 2009, Heft 6, S. 233 – 240. – Die Wunderschätze der Wiedervereinigung und ihr verheerender Makel, in: MUT Nr. 516, Oktober 2010, S. 50 – 58. – Vom Staat enterbt – Die Bodenreformaffäre – Eine Skandalchronik aus dem Land Brandenburg, Mitteldeutscher Verlag 2010. Quaritsch, Helmut: Wiedervereinigung in Selbstbestimmung – Recht, Realität, Legitimation, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR VII, Heidelberg 1995, § 193. Ramb, Bernd Thomas: Vor der nächsten Währungs-„Reform“, Dossier, Hamburg 2005. Reimann, Axel: Überführung der Zusatz- und Sonderversorgungssysteme der ehemaligen DDR in die gesetzliche Rentenversicherung, in: DAngVers. 1990, S. 281 ff. Romig, Friedrich: ESM-Verfassungsputsch in Europa, Schnellroda 2012. Rosen, Paul: Zur letzten Instanz, in: JF Nr. 27/12 vom 29. 6. 2012, S. 13. Rupp, Hans Heinrich: Vom Wandel der Grundrechte, in: AöR 101 (1976), S. 161 – 201. Rüthers, Bernd: Demokratischer Rechtsstaat oder oligarchischer Richterstaat?, in: JZ 2002, Heft 8, S. 365 – 371.
210
Literaturverzeichnis
Sachs, Michael: Das Grundgesetz im sechsten Jahrzehnt, in: NJW 2009, Heft 21, S. 1441 – 1449. Sarrazin, Thilo: Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen, 8. Aufl., München 2010. – Deutschland braucht den Euro nicht. Wie uns politisches Wunschdenken in die Krise geführt hat, 1. Aufl., München 2012. Schachtschneider, Karl Albrecht: Res publica res populi, Berlin 1994. – Sozialistische Schulden nach der Revolution. Kritik der Altschuldenpolitik. Ein Beitrag von der Lehre von Recht und Unrecht, 1996. – Der republikwidrige Parteienstaat, in: Dietrich Murswiek/Ulrich Storost/ Hein-rich A. Wolff (Hrsg.), Staat – Souveränität – Verfassung, Festschrift für Helmut Quaritsch zum 70. Geburtstag, Berlin 2000, S. 141 – 161. – Verletzung des Menschenrechts auf Eigentum. Rechtsgutachten in Sachen Gisela Kirsten/ Deutschland in dem Verfahren vor dem EGMR, Beschwerde Nr. 19124/02. – Freiheit in der Republik, Berlin 2007. – Freiheitliche Eigentumsgewährleistung, in: ders., Freiheit in der Republik, Berlin 2007, Zehntes Kapitel, S. 537 – 605. – Habe den Mut, das Recht zu wahren, in: MUT Nr. 513, Juni 2010, S. 6 – 12. – Die Rechtswidrigkeit der Euro-Rettungspolitik. Ein Staatsstreich der politischen Klasse, 1. Aufl., Rottenburg 2011. – Die Souveränität Deutschlands. Souverän ist, wer frei ist, 1. Aufl., Rottenburg 2012. Schaub, Günter: Erfolgreiche Altersvorsorge, 3. Aufl., 1989. Schäuble, Wolfgang: Der Vertrag, 1991. Schmitt, Carl: Verfassungslehre (1928), 8. Aufl., Berlin 1993. – Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus publicum Europaeum (1950), 4. Aufl., Berlin 1997. – Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922), 8. Aufl., Berlin 2004. – Die Tyrannei der Werte, 3. Aufl., Berlin 2011. Schneider, Hans: Gesetzgebung, 2. Aufl., 1991. Schneider, Ludwig: Der Schutz des Wesensgehalts der Grundrechte nach Art. 19 Abs. 2 GG, 1983. Schneider, Oscar: Kultur des Eigentums, in: Schwäbisch-Hall-Stiftung (Hrsg.), Kultur des Eigentums, Heidelberg 2006, S. 103 – 106. Scholz, Rupert: Der Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion, in: BB 1990, Beilage 23 zu Heft 13, S. 1 – 9. Schorlemmer, Friedrich: Gerechtigkeit und Utopien der Bürgerbewegung, in: Plädoyers für Gerechtigkeit, Universität Rostock 1994 (Rostocker Philosophische Manu-skripte, Neue Folge, Heft 1), S. 34 ff.
Literaturverzeichnis
211
Schrenck-Notzing, Caspar von: Charakterwäsche. Die Re-education der Deutschen und ihre bleibenden Auswirkungen, erw. Neuausgabe, Graz 2004. Schröter, Ulrich: siehe Gill, David. Schulin, Bertram: Sozialrecht, 5. Aufl., 1993. Schulte, Bernd: Soziale Grundrechte in Europa. Auf dem Weg zu einer Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Bausteine Europas, Bd. IX), St. Augustin 2001. Schulze-Fielitz, Helmuth (Hrsg.): Staatsrechtslehre als Wissenschaft, Berlin 2007 (Die Verwaltung, Beihefte, Bd. 7). Schwab, Dieter: Eigentum, in: Otto Brunner/Werner Conze/Reinhart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Historisches Lexikon der politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 2, Studienausgabe, 1. Aufl., Stuttgart 2004, S. 65 – 115. Smith, Adam: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völker, dt. Übersetzung von M. Streissler, 2005. Sodann, Helge: Verfassungsrechtsprechung im Wandel – am Beispiel der Berufsfreiheit, in: NJW 2003, Heft 4, S. 257 – 260. – Kontinuität und Wandel im Verfassungsrecht. Zum 60-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, in: NVwZ 2009, Heft 9, S. 545 – 551. Sofsky, Wolfgang: Verteidigung des Privaten, Bonn 2007. Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte (1917), 8. Aufl., München 1999. Steinmeyer, Heinz-Dietrich: Die deutsche Einigung und das Sozialrecht, in: VSSR 1990, S. 83 ff. Stern, Klaus/Schmidt-Bleibtreu, Bruno (Hrsg.): Verträge und Rechtsakte zur Deutschen Einheit, Bd. 1, Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion im Ver-tragsgesetz, Begründung und Materialien, München 1990. Stolleis, Michael: Besatzungsherrschaft und Wiederaufbau deutscher Staatlichkeit, in: Josef Isensee/Paul Kirchhof (Hrsg.), HStR I Historische Grundlagen, 3. Aufl., Heidelberg 2003, § 7. Stürmer, Michael: Leben, Freiheit, Eigentum, in: Schwäbisch-Hall-Stiftung (Hrsg.), Kultur des Eigentums, Heidelberg 2006, S. 117 – 121. Thiessen, Jan: Zahlbetragsgarantie mit Rentendynamisierung, in: NJ 2000, Heft 9, S. 456 ff. Thoma, Richard: Festgabe für das Preußische Oberverwaltungsgericht, 1925. Vitzthum, Graf Wolfgang: in: Klaus Stern, Deutsche Wiedervereinigung, Bd. 2, 1992, S. 20. Voßkuhle, Andreas: Stabilität, Zukunftsoffenheit und Vielfaltssicherung – Die Pflege des verfassungsgerichtlichen „Quellencodes“ durch das BVerfG, in: JZ 2009, Heft 19, S. 917 – 924. Waldstein, Thor von: Totalitärer Liberalismus?, in: DGG 2012, Heft 2, S. 2 – 11. Wassermann, Rudolf: Wohin treibt das Bundesverfassungsgericht?, in: ders., Gestörtes Gleichgewicht, 1995, S. 119 ff.
212
Literaturverzeichnis
Watzek, Hans: Der Streit um die Reform, in: Hans Modrow/ders. (Hrsg.), Junkerland in Bauernhand. Die deutsche Bodenreform und ihre Folgen, 2. korr. Aufl., Berlin 2005, S. 13 – 45. Weidenfeld, Ursula: Ein Zwischenruf zu … Scheinriesen, in: Der Tagesspiegel vom 26. 9. 2012. Wenzel, Siegfried: Was kostet die Wiedervereinigung?, Das Neue Berlin 2003. Wieczorek, Thomas: Die geschmierte Republik, München 2005. – Die Dilettanten, München 2005. Will, Rosemarie: Rente als Eigentum – die Ostrenten – Entscheidungen des Bundes-verfassungsgerichts, in: NJ 1999, Heft 7, S. 337 – 346. Wille, Joachim: Merkels Abgängerriege, in: Berliner Zeitung Nr. 19 vom 24. 1. 2011, S. 6. Wilmerstadt, Rainer: Das neue Rentenrecht (SGB V), München 1992. Wipfler, Johann/Mäder, Werner: Wendezeiten – Kulturschaffende im neuen Europa. Zur Versorgungsdiskriminierung von Balletttänzern aus der DDR, St. Augustin 2004. – „Gewendetes Eigentum“, in: ZFSH/SGB 2005, Heft 10, S. 579 – 595, und Heft 11, S. 651 – 659. Wolter, Henner: Zusatzversorgungssysteme der Intelligenz, 1992. – Zusatzversorgungssysteme der Intelligenz – Verfassungsrechtliche Probleme der Rentenüberleitung in den neuen Bundesländern, Baden-Baden 1992. Wunderlich, Dieter: Gedanken zur Entscheidung des BVerfG vom 6. 7. 2010, in: ISOR aktuell 9/ 2010, S. 4. f. Zak, Christian/Mäder, Werner: Vor und nach der Revolution 1989. Von der Doppel-kultur in der DDR zu antagonistischer Solidarität, in: ZFSH/SGB 2002, Heft 3, S. 142 – 150, und Heft 4, S. 195 – 200.
Sachwortverzeichnis Abendland – geistiges Erbe 55 Abgeordnete 138, 159, 163 Ämterpatronage 157, 171 Alimentation 48 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 71 Alterseinkommen 20, 34, 46, 54, 109 – Ungerechtigkeiten 20, 34 161 Altersgrenze 50 Alterssicherung 31, 46, 47, 51, 52, 53 f, 72, 86, 89, 91, 95, 104, 105, 109, 112, 125, 131, 134, 135, 138, 151, 160, 161, 164, 170 Alterssicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland 34 ff., 85, 104 – Eigenvorsorge, Ziel 48 f. – Geschichte, Entwicklung, drei Säulen, Ziele 44, 45 – Gesamtversorgungssysteme, Ziele 48 – gesetzliche Rentenversicherung, Ziel, Inhalt 45, 46 f. – Zusatz-, Gesamtversorgungssystem 47 f. Alterssicherungssystem der Deutschen Demokratischen Republik 49 ff., 84, 85, 103, 104, 111, 112, 118 – eigene Altersvorsorge 54 – Freiwillige Zusatzrentenversicherung, Berechtigte, Ziele, Höhe der Zusatzrente 51 – Mitglieder 49, 50, 103 – Gesamt(Sonder)versorgungssysteme, Ziele, Mitglieder 53 f. – Sozial(pflicht)versicherung, Ziele, System, drei Säulen, Ziele 49, 103 – Vergleichbarkeit mit Alterssicherung der DDR 103, 105 – Zusatzversorgungssysteme, Ziele, Mitglieder, Höhe der Zusatzrente 51 – 53 Amnestie 38 Amt für Nationale Sicherheit siehe Ministerium für Staatssicherheit
Anordnung über die Gewährung einer berufsbezogenen Zuwendung an Ballettmitglieder in staatlichen Einrichtungen der DDR 77 ff., 105 108 ff., 113 – Begründung des Ministerrates 112 – Höhe der Zuwendung 110 Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz 28, 80, 93 f., 95, 96, 97, 98, 99, 100 ff., 108, 111, 119, 120, 121 f., 123, 124, 126 ff., 132, 133 f., 141, 142, 160, 162, 163, 164, 167, 168 – Ausnahme-Exemtionen für bestimmte Personengruppen 95, 98 – Ausnahmen bereichsspezifischer Art 95, 96, 98 – Ausnahmen funktionsspezifischer Art 95, 97, 98 – Begrenzungsregelungen 126, 127, 129, 132, 141, 160 – Höchstbetragsregelung 129 – Kappungseffekt 121, 122, 132, 133 – Korrektur 170 – mangelnde Begründung 128, 155 f., 164 – mangelnde Wertneutralität 141 – Scheitern des Konzepts 118 ff., 131, 134, 163, 164 – Sonderregelungen 95 – Systemwidrigkeit 119, 135, 140, 152 – undurchschaubares Gesetzesgeflecht 98, 164 – Verfassungswidrigkeit 28, 33, 97, 98, 99, 101, 102, 117, 120, 121, 122, 123 – 130, 132, 133 ff., 135, 139 f., 141, 142, 143, 144, 145 f., 149, 153, 156, 163, 164 – Zielverfehlung 126 f., 133 – Zweckverfehlung 127, 133 siehe auch Versorgungsüberleitung Ost AAÜG-Änderungsgesetz 131 f., 133 – erfasster Personenkreis 131 f. AAÜG-2. Änderungsgesetz 132 f., 134 f.
214
Sachwortverzeichnis
AAÜG-1. Änderungsgesetz 142 f., 144 – 159, 164, 165 – Abweichen von Vorgaben des BVerfG 146 – erfasster Personenkreis 142, 144 – Fehlleistung 142, 144, 147, 150, 163, 164, 165, 167 – Gehaltsstruktur 146 – Gleichbehandlung 144, 145, 147, 149 – mangelnde Begründung 144, 155 f, 164, 167 – Materialien 146, 155 – Ordnungsprinzip 146 f. – Rentenkürzungen für Minister 144 ff., 149, 153, 155, 156 – System der Selbstprivilegierung 155 – 157, 167 – Ungenauigkeiten 146, 156 f., 164 – Verfassungswidrigkeit 144 ff., 163, 164, 165 – Wechsel der Begründung 145, 146, 156 – Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS 144, 154, 164 Ansprüche und Anwartschaften 20, 28, 34, 37, 41, 45, 69, 70, 71, 73 f., 75, 77, 78, 81, 82 f., 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 102, 105, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118, 121, 124, 125, 128, 129, 134, 137, 139, 141, 145, 164 – Balletttänzer 117, 136 – Beeinträchtigung 44, 105, 133 ff. – Ersetzung 102, 104 – Erwerbszeiten 104 – Fortdauer 77, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 108 f., 110, 111, 113, 114, 128, 129 – rückwirkende Festlegung 105 – im Schutzbereich des Grundgesetzes 75, 81, 110 – Kürzungsregelung 144, 145, 155 ff. – Liquidierung 26, 66, 75, 79, 81, 83, 91, 93, 104, 105, 106, 119, 120, 123, 138, 164 – Schutz der Gesamtverfassung 106 – Überführung 25, 82, 83, 86, 87, 88, 110, 113, 128 – Umgestaltung 114 – Untergang 102 – Weiterbestand nach dem Beitritt der DDR 65, 66, 70, 71, 75, 86, 87, 88, 124, 129
– kein Wegfall der Rechte 70, 71, 75, 86, 87, 88, 124, 134 – Vergleich mit Ansprüchen der Westdeutschen 105, 106, 121, 122, 138, 162, 164 f. – Wertverlust 94, 120 – Zahlbetragsgarantie 117, 124 ff., 128, 136, 162 Arbeit 62, 112 – Arbeitserfolge 112 – Beruf und Wert 62, 80 Arbeitsjahre 42, 94, 106, 109, 129, 138, 143, 152 Arbeitsleben in der DDR 104, 112, 138 Arbeitsverdienste – leistungsfremde, politisch begründete Arbeitsverdienste 156 Arbeitsverhältnis 56, 62, 63, 106, 109, 110 Aristokratie 60, 174 Aufgaben, öffentliche 188 Aufklärung – bei Kant 173 Auslegungsmethoden 78 f., 103, 166 – verfassungskonforme Auslegung 125 – Auslegungsfehler 193 – Bundesverfassungsgericht 166, 170, 193 Aussöhnung 36 Autokraten 60, 174 Autonomie 41, 42
Bahr, Egon 38 – Mahnung zur Versöhnung 38 Balletttänzer siehe Bundesverfassungsgericht, Versorgungsüberleitung Ost Bankrott 19, 48 Baring, Arnulf 38 – Buch „Deutschland, was nun?“ 32-43 – deutsch-sprechende Polen 42 – polnische Wirtschaft 42 – Propagator 39 – Selbstüberschätzung 40 – Sündenvergebung 40 – Verzwergung der Menschen der DDR 40 – Vorurteile 42 Beamte 48, 122 – Beamtenversorgung 48, 54, 87, 122 – Pensionsrückstellungen 48 Begrenzung von Zahlbeträgen 99 ff.
Sachwortverzeichnis Beitragsbemessungsgrenze 83, 98, 102, 120, 121, 122, 125, 126, 140, 144, 149, 151, 152, 156 – Bundeslade der Sozialversicherung 121 – Ost 25, 83, 102, 104, 106, 109, 138 – West 104, 120 Beitragszahlungen 83, 84, 86, 88, 111, 112, 113 – Bedeutung 83 f., 112 – in der Rechtsprechung des BVerfG 84, 109, 111 – siehe auch Rentenversicherung, Sozialversicherung Beitritt 65, 73, 75, 76, 77, 78, 85, 87, 104, 106, 107, 110, 134, 160 Beitrittsgebiet 15, 19, 20, 36, 66, 76, 88, 93, 99, 103, 106, 122, 129, 134, 186, 189, 191 – suspendiertes Grundgesetz 106 Beleidigung 42 – siehe auch Baring, Arnulf Berufsbiographie eines Ministers der DDR 150 – 152, 154, 155, 158 f. – Ämter 150, 151 – Arbeitsverdienst und Rentenhöhe 150, 151 – und MfS 154, 155 – keine rentenerhebliche „Privilegien“ 157 – 159 – ohne Privilegien 152, 155 – 157, 158 f. Berufsgruppen 15, 35, 40, 52, 66, 77 ff., 84, 94, 95, 97, 101, 123, 126, 127, 136, 137 – Akademiker 39, 83, 94, 96, 162 – Diskriminierung 15, 25, 66 – Facharbeiter 157, 162 – Intelligenz 84, 94, 112, 148, 163 – Künstler 49, 95, 112, 136, 137 – Mitarbeiter des Staatsapparates 83, 122, 155 – Postbedienstete 49 – in Ost und West 35, 94, 95 – Richter 153 – Staatanwälte 153 – technische Intelligenz 83, 84, 112, 162 – Trümmerfrauen 162 – Wissenschaftler 36, 52, 94, 112, 162 Besitz 56 – Besitzstand 20, 21, 77, 85, 86, 105, 120, 128 – Garantie 83, 84
215
Bestandsgarantie 34, 83, 84, 87, 91, 92, 120 Bestandsschutz 86, 105, 106, 134, 162 Besatzungsrecht 140 Betriebsrenten 45, 49, 87, 125 Betriebsrentengesetz 104 – Ziele, Insolvenz 48 Bevölkerungsstruktur 44 Bilanz 22 Blockparteien 147 Blüm, Norbert 20 – Erklärung zu den Staatsverträgen mit der DDR 16 Bodenreform 24, 189 – 192, 194, 197 – Änderung des Grundgesetzes 191, 192 – Alteigentümer 194 – Anlassthese 192, 193 – Beseitigung von Rechtspositionen und der Eigentumsgarantie 189, 192 – beitrittsbedingte Änderung des Grundgesetzes 192 – neue Begründungsformeln und -floskeln 192, 193, 194 – Enteignung 195 – Erben von Bodenreformland 195 – Grundstücke 24, 197 – Härtefallklausel 192 – Herzogs Rolle 191, 192 – Land Brandenburg 197 – Neusiedlererben 197 – Nutznießer 190 – Ozonloch im Grundgesetz 191, 192 – politische Justiz 196 – Rückübertragung 194 – sittenwidriges Vorgehen des Landes Brandenburg 197 – Sozialisierung 189 – Urteil des BVerfG vom 23. 4. 2011, 189 ff., 192 siehe auch Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte Bodin, Jean – siehe Regierung, Staat Brandt, Willi 16 Bürgerliches Gesetzbuch 102 – Einführungsgesetz 103 Bundesgerichtshof 57, 92, 197 – Begründungsfloskeln 194
216
Sachwortverzeichnis
– sittenwidriges Beschaffen von Bodenreformland des Landes Brandenburg 197 Bundesgesetzgeber 16, 34, 44, 70, 87, 107, 108, 113, 114, 118, 160, 163 f. – Amtsermittlungsprinzip 163 – Bruch der Staatsverträge 137, 160, 163 – Diskriminierung von Versorgungsberechtigten 130 – Fehlleistungen 70, 87, 105, 114, 118, 153, 163 – Flucht in die Pauschalität und Unbestimmtheit 163 – Liquidierung der DDR-Renten 137, 160 – Machtpolitik 160. 163 f. – mangelhafte Arbeit 163 – Missachtung der Entscheidungswege des Einigungsvertrages 163 – Nichtbeachtung der Vorgaben des BVerfG 133, 135, 163, 164 – Teilung der Altersvorsorge 105, 107 – drastische Rentenkürzungen 163 – Substanzlosigkeit der Begründung des RÜG 163 – Systementscheidung 124, 125, 137 – unbewältigte Versorgungsüberleitung 118 ff., 130, 163 – Vergangenheitsbewältigung 120 Bundesgesetzgebung 55, 91 ff., 119 – und berufsbezogene Zuwendung 108 ff. – Faktenverdrängung 153, 163 – Folgegesetzgebung 87, 101, 113, 130 – Liquidierung der Ansprüche und Anwartschaften aus den Versorgungssystemen der DDR 16, 87, 92, 105 – Machtpolitik 160 – Staats- und Systemnähe 119 – Überforderung mit der Versorgungsüberleitung Ost 70, 101, 163 – unbewältigte Versorgungsüberleitung Ost 118 ff., 130, 133 163 – Ungleichbehandlung der DDR-Bürger 105 – Verstoß gegen die Staatsgesetze 92, 118, 163 – Vorrang des Völkerrechts 55 – Systembruch 91 f. Bundeskanzler 166 – Kohl 18, 20, 91, 93, 162 Bundeskanzlerin 15, 200
– Merkel 16, 35, 59, 171 – Totschlags-Formel 171 Bundesjustizminister 24 Bundesländer 189, 190, 197 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 20, 21, 66, 146, 148 Bundespräsident 159, 166 Bundesrecht 55, 76, 77, 86, 91, 92, 103 – Angleichung 91 Bundesregierung 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 35, 43, 66, 84, 91, 123, 135, 138, 153, 160 – 162, 195, 196 – Abweichungen vom Einigungsvertrag 85, 91, 117, 123, 138, 160, 196 – und Bundesverfassungsgericht 164 – Divergenz zum BVerfG 195 – Erblast der DDR 22, 161 f. – und EGMR 196 – Gewinner der Einheit 29, 43, 162 – Irreführungen zum RÜG 162 – Merkel 35, 59 – Modrow-Gesetz 196 – ökonomische Ignoranz 15 – Position zur Versorgungsüberleitung Ost 65 f., 71, 74, 75, 123, 135, 137, 138, 160 – 162 – Regierungserklärung zum Staatsvertrag 74 – Reine Rechtslehre 59 ff. – Rentenüberleitung 35, 66, 75, 123, 137 – Schäuble 59 – unbewältigte Versorgungsüberleitung 118 ff. – Unrechtsstaat 137, 138 – Vergangenheitsbewältigung 139 – Verkennung der DDR Gesellschaftsverhältnisse 153, 162 – siehe auch Klinkel, Klaus; Kohl, Helmut Bundesrepublik Deutschland 15, 17, 18, 26, 34, 36, 61, 63, 65, 70, 71, 76, 92, 103, 111, 113, 139, 152, 166, 184, 186, 198 – Alterssicherung 93, 103, 113 – Anerkennung der DDR 69, 165 – Bereicherung des DDR-Vermögens 22, 23 – Beitritt der DDR 65, 76, 110 – diktatorische 184 – Eigentum 61 – Eintritt in die Versorgungssysteme der DDR 111, 124
Sachwortverzeichnis – – – – – – – – –
Entstaatlichung 184 Fehlentwicklungen 39 Korruption 166 Mangel der Gesetzgebung 164 Ministerversorgung 152 Mitglied des Europarates 68 Parteibuch und Vetternwirtschaft 153, 157 Politische Klasse 155, 157 Pflicht zur Wahrung des Staats- und Einigungsvertrages 70, 72, 113 – Pflicht zur Überführung der Versorgungsansprüche aus der DDR 110 f. – Rechtsstaat 162 – Schulden 22, 23 – System 166 – und UNO 17, 36, 37 Bundessozialgericht 102 – 105, 161 – und AAÜG 120, 161 – Beseitigung des Versorgungsgefüges 103, 161 – Durchbrechung des Normprogramms der Staatsverträge 102, 161 – gesetzliche Novation 102, 161 – irreführende Annahmen 103 ff. – einheitliches Rentenversicherungssystem 103 – Untergang der DDR-Renten 102, 161 – Unrechtsentgelte 171 Bundestag 28, 32, 35, 37, 91, 138, 139, 160, 163, 168, 200 – Abgeordnete 29, 32, 138, 168, 200 Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung 31, 132 Bundestagswahl 2019 18 Bundesverfassungsgericht 16, 26, 43, 46, 59 ff., 81, 87, 120, 124, 125, 126, 131, 132, 136, 142, 143, 144, 153 – 159, 163, 170, 171, 173, 180, 181, 186 f., 188, 189 ff., 194, 195, 199, 201 – zum AAÜG-1. ÄndG 152, 153, 154, 167 – Aufgabe 26, 183 – Beliebigkeits-Eklektizismus 186 ff., 189 – Beseitigung von Rechtspositionen 59, 66, 125, 164 f., 183 – Besetzung 181 – Bildstörungen 59, 193 – Bodenreform 59, 189 – 192, 193 – lebendige Demokratie 172
217
– Eigentum 56, 58, 63, 66, 67, 81, 128, 187, 188 – keine Eigentumsgarantie für die neuen Bundesländer 16, 28, 59, 66, 68, 125, 128, 186 – Eigentumsgrundrecht 16, 67, 187, 188 – Eigentumsschutz 34, 58, 63, 67, 81, 84, 125, 128, 136, 187, 190 – Enteignung 188 – Entscheidung zum Verfassungswechsel 82, 87, 92 – Entscheidung zur Versorgung der Balletttänzer 66, 68, 79, 80, 105, 136 – Entziehung von Eigentum 80, 126, 134, 136, 186, 188, 194 – Divergenz zu den Entscheidungen zur Versorgungsüberleitung 168 – Geschichtsbild von der DDR 26, 63, 153, 157, 166, 167 – Gesetzespositivismus 160, 164, 193 – Grundrechtsaufhebung 170, 183, 194 – Grundrechtsschutz für DDR-Bürger 16, 66, 67, 125 – Grundsatzurteile zur Versorgungsüberleitung Ost 16, 28, 29, 33, 40, 67, 70, 79, 80, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 108 – 117, 120, 122, 123 – 130, 131, 132, 133 – 135, 142, 143, 145 f., 149, 153, 156, 163 – Herrschaft des formalen Gesetzes 180 – Hüter der Verfassung 59, 153 – in der Kritik 186, 187, 189, 192, 193, 194 – Kehrtwendung in der Versorgungsüberleitung 164 ff., 170 – keine/Geltung des Grundgesetzes in der DDR 67, 68, 110, 186 ff., 192 – Konfiskation 80 – kreativer Umgang mit Grundrechten 186 – 188, 192 – Kritik des Beschlusses des BVerfG vom 6. 7. 2030 (Minister) 153 ff., 156 ff., 167, 168, 170, 173 – Liquidation der Rentenansprüche 164 – Macht gegen Recht 167 ff., 192 – Machtpolitik 169, 192 – Meinen statt Recht 173 – MfS/AfNS Rentenkürzungen 143, 153 – Missbrauch des Rentenrechts 159
218
Sachwortverzeichnis
– Nähe zur Politik 26, 153 – 159, 160, 169, 193 – offene Vermögensfragen 189, 190, 191, 192, 193 – Parteizugehörigkeit 26 – Pflege der Verfassung 183 – und Politik 58, 138, 153 ff., 160, 170, 171 – politische Justiz 170, 193 – Reine Rechtslehre 59 ff, 186 ff. – zu rentenversicherungsrechtlichen Positionen 109, 114, 133 ff. – Rentenstrafrecht 160, 163, 164 – Rentenstrafrechtbeseitigungsbeschluss vom 23. 6. 2024, 164 – Ruf 186, 187 – Sachverhaltsaufklärung, mangelhafte 26, 43, 127, 129, 133 f., 145 f., 167 – Selbstgenügsamkeit 167 – Selbstprivilegierung 155 – 157, 158, 167 – Souveränität 153 – Sozialversicherungsrechtliche Ansprüche 81, 114 – Staatsrecht 169, 183 – Suspendierung des Grundgesetzes 59, 189 – Systementscheidung 87, 91, 124, 135 – Übernahme der Regierungspositionen 26 f, 138, 160, 167 – Unabhängigkeit 160, 164 – Unkenntnis der Gesellschaftsverhältnisse der DDR 143 ff., 166, 167, 170 – zum Verfassungswechsel 57, 66, 81, 87 – Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 186, 187 – zur Versorgungsüberleitung Ost 43, 66, 87, 125, 135, 163, 164 ff., 170, 173 – Vertretung des Volkes 58 – Völkerrecht 169 – Vorgaben an den Gesetzgeber 142, 163 – Wahl 26 – Werkbank der Herrschenden 170 – widersprüchliche Argumentation für Rentenkürzungen 165 – Wortgeklingel 192 – Zeitgeistlastigkeit 187 – Zweiklassensystem des Grundrechtsschutzes 190 Bundesverfassungsrichter 123, 133, 135, 154, 155, 156, 157, 166, 169, 192, 193
– Befangenheit 33, 123, 124, 125, 131, 133, 134, 135, 163, 164 – Im Namen des Volkes 166 – mangelnde Kenntnisse der DDR-Verhältnisse 43, 153, 156, 157, 158 – Richter Grimm 135 – Parteiverbindung 43, 157 – Präsident Herzog 190, 192 – Präsident Papier 28, 33, 34, 102, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 162, 163, 164, 188 – Präsident Voßkuhle 60, 175, 180, 181, 183 – neue Richtergeneration 43 – Rechtsgutachten Papier zur Versorgungsüberleitung Ost 71, 102, 133, 134, 135, 162 – Selbstprivilegierung 158 – Wortgeklingel 159 Bündnis 90/DIE GRÜNEN 31 Bürger 59, 89, 104, 141, 186, 199 – Achtung als Bürger 173 – der Bundesrepublik 22, 42, 54, 55, 89, 162 – Graben zwischen Ost- und Westrentnern 171 – Schutz vor Gerichten 197 – zweiter Klasse 16, 161 Bürger der DDR 15 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 37, 41, 42, 45, 54, 64, 86, 91, 94, 99, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 120, 125, 134, 137, 138, 157, 160, 161, 162, 170, 185, 193, 194, 197 – Durchschnittsbürger 158 – Lebensleistung 4, 42, 95, 106, 162 – ohne Nutzen für die Westversicherung 161 f. – ohne Schuld 165 – Objekt der Versorgungsüberleitung Ost 94, 105, 137, 161 f., 162 – persönliches Eigentum 64, 140 Bürgerrechte 184 Christlich Demokratische Union Deutschlands 31, 33, 35, 138, 169, 190 – ohne Bereitschaft zur Korrektur des RÜG 169 – Roman Herzog 191 Christlich Soziale Union Deutschlands 31, 33, 35, 138, 169 – ohne Bereitschaft zur Korrektur des RÜG 169
Sachwortverzeichnis Degression siehe Versorgungsüberleitung Ost Delegitimierung 161 Demokratie 31, 60, 174 – Bundesverfassungsgericht 172 – demokratischer Zentralismus 64 – Erstarrung zur Form 172 – Informationsfreiheit 172 f. – lebendige Demokratie, Inhalt 172 f. – bestmöglicher Diskurs 172 – Bürgerrecht auf Demokratie 184 – Liberaldemokratie 173, 175 – Meinungsfreiheit 172 f. – Parteiendemokratie 60 – Rede und Gegenrede 172 – bei Schachtschneider 172, 173 Despotie 60, 174 – parteistaatliche 173 Deutsche 107 – DDR-Bürger 107 Deutsche Bauernpartei 147, 150 Deutsche Bundesbank 19 Deutsche Demokratische Republik 15, 17, 81, 82, 84, 92, 105, 110, 138, 157, 186 – Anfangskapitalbestand der Bilanz 22 – Arbeitsproduktivität 23 – Arbeitsverhältnisse 63 f. – Bilanz, Kreditbilanz 20, 22, 23 – Deindustrialisierung 21 – Delegitimierung 138, 161 – Eigentum 28, 56, 63 f., 67, 85 – Einkommensentwicklung 136 – Entlohnungssystem 112, 145 f., 156 – fortgeltendes Recht 76 ff. – Funktionäre 144 – Geschichtsbild 18 – Gesetzgebung 114 – führende Industrienation im RGW 23 – Lohn- und Gehaltsstrukturen 145, 146, 155, 156 – Minister, stv. Minister 17, 37 – Missstände 39 – Montage der Industrie durch Besatzer 22 – rechtsstaatliche Verhältnisse vor der Wende 65, 85, 161 – Regierung 18, 26 – Regierung de Maizière 19, 20, 74 – Revolution 2009 37, 65, 69, 160
– – – –
219
Schulden nach der Wende 22 Staatliche Einrichtungen 110 Staatsbankrott 11 Staats- und Rechtsordnung 64, 65, 69, 82, 85, 87, 92, 160 – Staats- und Regierungssystem 101 – Souverän 76, 139, 165 – Sozial(pflicht)versicherung 93, 95, 103, 105, 106, 109, 111, 136, 137 – Systemwechsel noch vor dem Beitritt 65, 69, 85 – „Unrechtsstaat“ 18, 137, 160 – Untergang 26, 65, 75, 138, 186 – Vereinigung 64, 65 – Verfassung 63, 64, 65, 76, 82, 85, 86, 160 – Verfassungsgrundsätzegesetz – Inhalt, Systemwechsel 64 f., 67, 69, 75, 85, 160 – Verhältnisse, gesellschaftliche und staatliche 18, 26, 32, 105 – Vermögen 23 – Versorgungssysteme 15, 63, 73, 76, 92, 93, 110, 141 – Völkerrechtssubjekt 69, 75 – Wechsel der Verfassungs- und Rechtsordnung 64, 65, 67, 75, 82, 92, 160 – Wiederaufbau 40 – Wirtschaft 19, 23, 69, 127 Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung – siehe Wirtschaftswissenschaftler Deutschland 89 DIE LINKE 29, 31, 32 – Anträge zur Versorgungsüberleitung Ost 30 f., 32 f., 34, 35 Diktatur 24, 25, 60, 137, 174, 175, 184 – zweite deutsche Diktatur 137 Diskreditierung 155, 161 Diskriminierung 15, 17, 37, 43, 94 f., 105, 106, 118, 200 – von Forschern der DDR 36 Doktrin 182 dominium 56 Dreiklang von Staat, Freiheit und Eigentum 188, 189, 194 Dreßler, Rudolf (MdB) siehe Rentenstrafrecht Durchschnittsentgelt/-verdienst 96 f., 98, 99, 100, 101
220
Sachwortverzeichnis
Eigentum 28, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 77, 80, 81, 87, 99, 109, 123 ff., 127, 188, 189, 194, 195 – als Naturrecht 61, 68 – ältestes Menschenrecht 55 – Alteigentümer 198 – Änderung des Begriffs 56, 58 – angeborenes Eigentum 62 f. – in der Arbeitnehmergesellschaft 56, 62 – aus der DDR 28, 56, 63, 66, 77, 80, 84, 108 ff, 129 – aus fremder Rechtsordnung 56, 66, 67, 68, 77, 87, 92, 108 ff. – aus neuerer Zeit 55, 62 – aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen der DDR 28, 66, 67, 68, 77, 80, 87, 108 ff., 113, 114 f., 123 ff., 128, 129 – Auszehrung der Substanz 59 – bei Hegel 62 – bei Locke 56, 62, 193 – bei Marx 59 – bei Papier 66, 71, 123, 162 – bei Schachtschneider 55, 56, 58, 61, 68 – Begriff 58, 59, 61, 62, 68, 111, 113, 187 – im Beitrittsgebiet 66, 67, 71, 77, 87, 111, 113, 123 ff. – Bildung von Eigentum 48 f., 63 – Bundesverfassungsgericht 28, 56, 58, 62, 80, 99,100, 101, 102, 108 – 117 – Definition 59, 61, 111, 113, 120, 123 – 130, 133 – 135, 136, 187 – durch persönliche Arbeitsleistung 84, 110, 113 – Eigentumsformen 56 – Einigungsvertrag 125 – Entwertung 59, 66, 80, 128 – Entzug 16, 55, 58, 66, 80, 81, 85, 110, 114 f., 136 – Freiheitsrecht 55, 63, 65, 109 – Gewährleistung 17, 55, 58, 68, 87, 108 ff., 120, 125, 128, 129, 136, 139, 140, 162, 184, 187 188, 192 – Grundrecht 33, 34, 55, 57, 77, 92, 109, 111, 113, 123, 124, 127, 128, 134, 184, 187, 188, 189 – Grundlagen 55, 58 – Idee 61 – im Europarecht 56, 65
– im Naturzustand 62 – im Völkerrecht 55 ff., 57, 66 f., 68, 71, 92, 141 – in der DDR-Verfassung 28, 56, 65, 67, 92 – Inhalt und Schranken 58, 71, 81, 113, 114, 125, 129, 188 – Kern 58 – Konfiskation 29, 80, 81, 117, 119, 162 – menschenrechtlicher Begriff 55, 56, 61, 64, 67, 68, 87, 92 – ohne Grenzen 56 – Privatnützigkeit 61, 113 – Recht auf Eigentum und Recht am Eigentum 55 ff., 63, 77, 188 – rechtsphilosophische Begründung 55, 56, 63 – Rentenansprüche 63, 66, 77, 109, 110, 128, 129, 162 – Sacheigentum 63 – Schutz 55, 56, 59, 61, 62, 66, 67, 71, 77, 80, 84, 87, 92, 93, 110, 111, 112, 113, 119, 123, 124, 125, 128, 136, 162, 188, 189, 190 – sozialversicherungsrechtliche Positionen 66, 79, 81, 84, 109, 110, 111, 125, 129, 134, 139, 187 – Steuern und Abgaben 84 – Substanzverlust 66, 80 – Treuhandeigentum 22 – Umfang 56, 58 – und Eignes 55, 56, 61, 68 – und Einigungsvertrag 66, 67, 71, 77, 80, 81, 87, 110, 111, 117, 123 – und Freiheit 55, 56, 109 – und Gebietswechsel 56, 57, 71, 77 – und Geld 56, 63 – und Gerechtigkeit 80 – und Recht 71, 80 – und Staatsvertrag 71 – und Versorgungsüberleitung Ost 71, 80, 84, 110, 113, 123 ff., 162 – unveränderlich 55, 61, 67, 194 – unveräußerlich 61 – Ursprung 55, 68 – vermögenswertes Recht 56, 63, 92, 110, 117, 187 – Versorgungsansprüche Ost 28, 65 f., 77, 80, 84, 87, 110, 111, 113, 123 ff. 162 – Vorstaatlichkeit 55, 68, 71, 87, 92
Sachwortverzeichnis – – – –
Wächterfunktion des Staates 55, 56, 68 Wert 58, 62, 110 Wesensgehalt 57, 58, 187 Zahlbetragsgarantie 84 f., 117, 128, 129, 134, 136 Eigentumserwerb, Begrenzungen 66, 80 Eigentumsfreiheit 71 f, 77 Eigentumsverteilung 74 Eingriff – in die Sozialgesetzgebung 36 – in bestandskräftige Rentenbescheide 153 Einheit 15, 16, 18, 23, 69, 89, 166, 186 – Gewinner 29, 31, 33, 43, 90, 162, 171 – innere Einheit 38 – der Verfassung 190 Einigung 15, 16, 17, 18, 20, 26, 28, 32, 39, 42, 56, 67, 73, 105, 107, 125, 196 Einigungsprozess 22, 65, 81, 171, 190, 191, 194, 196 – Einzigartigkeit 196 – Skandale 196 Einigungsvertrag 15, 20, 21, 33, 41, 44, 66, 67, 68, 69, 71, 73 ff., 78, 80, 82, 83, 87, 88, 91, 102, 103, 106, 107, 108, 110, 113, 114, 117, 120, 122, 123, 129, 130, 131, 138, 145, 155, 160, 161, 162, 163 – Änderung des Grundgesetzes 74, 75 – Anpassungsdirektiven 71, 83, 106, 118 – Anwendungsbefehl 75, 78, 108 – Bruch des Vertrages 24, 25, 28, 33, 80, 81, 85, 137, 138, 160, 162 – Eigentumsschutz und Wahrung des Vorhandenen 66, 67, 68, 71, 77, 80, 83, 85, 87, 88, 103, 108 – 117, 124 – Garantie erworbener Rechte 20, 37, 66, 67, 74, 77, 83, 85, 86, 87, 88, 91, 108 – 117, 120 – und Grundgesetz 80, 87, 110, 113, 114 – Grundposition 86 – Konzeption 66, 67, 83, 86, 94, 106, 114 – zur Kürzung von Rentenansprüchen 145 f., 155, 162 – Rahmen/Regelungen 74 f., 78, 82, 83, 114 – Rechtsangleichung 76 ff., 94, 106 – Erklärung beider deutscher Regierungen zur Regelung offener Vermögensfragen 74 – Rechtsangleichung 94, 106, 125, 131 – Systementscheidung 86, 88, 91, 124, 135
221
– Überführung der Rentenansprüche und Anwartschaften 44, 66, 67, 68, 73, 77, 78, 87, 110, 114, 162, 171 siehe auch Ansprüche und Anwartschaften – Überführungsbefehl 34, 66, 77, 78, 87 – Verhandlungen 160 – und Verfassung der DDR 75 – Verfassungsänderungen 74 – Verfassungsgesetz 75, 76 – Vertragspartner 138 – Weitergeltung von DDR-Recht 82 ff., 87, 110 – Zahlbetragsgarantie 20, 21, 73, 74, 84 f., 92, 94, 95, 117, 120, 141 Einkommen 19, 20, 46, 47, 51, 84 f., 94, 96, 97, 126, 134, 136, 138, 140, 143, 147, 148, 161 – Absenkung 96, 99, 106, 111, 112, 119, 122 – Alterseinkommen 94, 95, 106, 111, 131, 161, 162 – Arbeitseinkommen 47, 52, 80, 95, 96, 97, 100, 124, 126, 127, 129, 132, 143, 151 – DDR 19, 24, 31, 34, 161 – Durchschnittseinkommen 46, 96, 97, 132, 152, 156 – Einkommensentwicklung 136 – Einkommensgrenze 133 – Einkommensverhältnisse 89 – geringes Einkommen 47, 112, 138 – hohes Einkommen 134, 148, 155 – Mindesteinkommen 99, 141 – Nettoeinkommen 24, 47, 137 – Sicherung 79 – überhöhtes Einkommen 153, 162 – Unterschiede 106 – zu Unrecht einbehaltenes Alterseinkommen 164 Enteignung(en) 22, 25, 29, 37, 46, 80, 81, 138, 139, 188, 189, 194, 195, 198 – durch Besatzungsrecht 198 – Bundesverfassungsgericht 188, 194 – der Eisenbahner 37 – entschädigungslose Enteignung 80, 86, 139, 189, 198 – und Konfiskation 29, 80, 135, 139, 198 – zugunsten des Landesfiskus 195 – Legalisierung 80, 198
222
Sachwortverzeichnis
– der Rentenansprüche 17, 29, 33, 80, 86, 138 – aller Rentnergruppen 25 f., 138 – des Volksvermögens 22 – Voraussetzungen 188 – Zielrichtung 139 – Zweck und Ziel 80, 139 Entgelt 80, 95, 96, 99, 122, 129, 132, 133 f., 143, 146, 149, 154, 155, 156, 159, 165, 167 – Anhebung 132 – Arbeitsentgelt 99, 100, 109, 111, 120, 122, 125, 126, 127, 129, 132, 133 f., 142, 143, 144, 146, 156 – Begrenzung 133, 143, 149 – Bruttoentgelt 111 – Degression 96, 97, 122, 132 – Durchschnittsentgelt 96, 97, 98, 99, 100, 101, 122, 126, 128, 132, 143, 148, 149 – Entgelthöhe kein Kriterium für Rentenkürzung 156, 158, 159, 165 – Individualentgelt 96, 98 – Kürzungsmechanismus 133, 134 – politische Bestandteile 145, 167 – überhöhtes Entgelt 127, 132, 134, 145 f., 153, 165 – Unrechtsentgelte 161 Entgeltpunkte 25, 46, 138, 143 – PEP Ost 143 Entlohnungssystem der DDR 112 Entschädigung 36, 81, 139 – Aufwandsentschädigung 148 – entschädigungsloser Rentenentzug 70, 81 – Pflicht zu angemessener Entschädigung 36, 81 Entzug – von Eigentum 188, 189 – von Eigentum als Strafe 81, 139 Erben 198 Ergebnisschutz 92, 120 Erwerbsschutz 92 Erwerbszeiten 104 Ethik 177, 180, 193 Eule der Minerva 201 Euro 22, 35, 59, 171, 172 Europa 15, 35, 171, 172, 188 – Europarecht 92 Europäische Gemeinschaft 76
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 55, 65, 71, 85, 86, 195 – zum Eigentum 55, 56, 65, 71, 195 – entschädigungslose Enteignung 196 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 186, 195, 196 – abweichende Meinung von Richtern 196, 197 – außergewöhnliche Umstände für Grundrechtseinschränkungen 193, 196 – Beliebigkeitsbegründungen 193, 196 – Einvernehmen mit der Bundesregierung 196 – divergierende Entscheidungen zum Eigentumsschutz 195, 196 – Erben von Bodenreformland 195 – Freibrief für Rechtsverletzungen 197 – Gefälligkeiten aus Straßburg 195 – Gefälligkeitsjustiz 196 – Kontakte zur Bundesregierung 196 – Modrow-Gesetz 195 – politisch motivierte Entscheidung 195, 196 – soziale Gerechtigkeit 196 – Unkenntnis der deutschen Geschichte 196 – Votum von Ress 196, 197 – Weltformel 193 – Worthülsen 196 Europarat 68 Exekutive 21, 71, 114, 123, 146, 193 – Hilflosigkeit 146 Existenz 61, 109, 111, 197 – Minimum 17, 42, 94 – Sicherung 61, 109, 111 – Sicherung durch Geld 63
Faschismus 159 Feuerwehr 95 Finanzoligarchie 17 Fiskalpakt 17 Förderer des Systems 155, 156 Forscher der DDR 36 Forschung 36 Fortbestand von Rechten – trotz Verfassungswechsels 82, 85 Fraktionszwang 29 Freiberufler 48
Sachwortverzeichnis Freie Demokratische Partei Deutschlands 31, 33, 35 Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 50, 51, 52, 152 – Träger der FZR 51 Freiheit 26, 37, 39, 41, 56, 63, 85, 113, 129, 141, 172, 186, 188, 189, 194 – allgemeine 55, 85, 129, 130, 141 – äußere Freiheit des Volkes und des Staates 184 – bei Schachtschneider 56, 58, 63 – Berufsfreiheit 190 – Einschränkung 189 – in der DDR-Verfassung 65, 85 – Erkenntnisfreiheit 172 – Informationsfreiheit 172 f. – und Eigentum 26, 55, 63, 113, 129, 141, 185, 187, 188 – als Tätigkeit des Handelns 56 – geprägte Freiheit 63 – Freiheitsrechte 185, 186, 188 – und Geld 63 – Grundrechte als Sphären der Freiheit 184 ff. – Kampf für Freiheit 37 – durch Landflucht 39 – Meinungsfreiheit 172 f., 185, 186 – persönliche Freiheit 41, 85, 109, 141, 185, 186, 187 – politische Freiheit 41, 85 – Freiheitssphäre(n) 26, 184 – 186 – freiheitlich säkularer Rechtsstaat 193 – schwindende Eigentumsfreiheit 59 ff. – durch Vermögen 109, 187 – im Völkerrecht 141 Freiwillige zusätzliche Rentenversicherung 49, 50, 52, 54, 71, 86, 91, 93, 95, 103, 106, 111, 129, 136 – Höhe der Zusatzrente 51 siehe auch Versorgungsüberleitung Ost Freizügigkeit 57 – des Kapitals und der Arbeit 57 Fremdbestimmung – informationelle 173 Fürsorgepflicht siehe Staat Funktion von Bediensteten 97 f., 127, 131, 143 – Funktionäre 144, 145, 147
223
– Funktionsebenen 127, 146 f. – leitende Funktion 96, 127, 141, 146 f., 150, 157 – nicht vorhandene Funktionen im 1. AAÜG-ÄndG 143 – staats- und systemnahe Funktionen 131 Funktionäre 144, 145, 147, 153, 154 – der DDR 145, 151, 153, 154, 159, 167 – Spitzenfunktionäre 151 – Spitzenverdiener 152 – Wirtschaftsfunktionäre 147 Funktionsmissbrauch 120 Garantie 65 – des Eigentums 55, 59, 66, 88, 114, 117, 119, 139, 140, 187, 188, 189, 192 – von Renten 16, 66, 73, 74, 140 – Realwertgarantie 120 – der Renten nach Art, Grund und Umfang 83, 88 Gebietswechsel 56, 57, 66, 94 – Eigentum 57, 66 – Verfassungsstandard 57, 63 f. Gehälter – Strukturvergleich 134 Gehaltsstufen 132, 134 Gehorsam 135 Geld 41, 63 – als Eigentum 63 – geprägte Freiheit 63 – Realwertgarantie 120 Gemeinschaft 88, 184 – politische Gemeinschaft 184 Gemeinwesen 56, 58 – Grundkonsens 58 – politisches 55 Gemeinwohl 34, 40, 66, 80, 114, 125, 127, 139, 156, 165 – Allgemeinwohl 139 Generaldirektion der zentral geleiteten Kombinate 52 Gerechtigkeit 70, 86, 118, 121, 166,180 – Gruppengerechtigkeit 121 – Leistungsgerechtigkeit 86, 91, 112 – Sachgerechtigkeit 121 – soziale Gerechtigkeit 196 – Systemgerechtigkeit 121 Gerichte
224
Sachwortverzeichnis
– Unabhängigkeit 173 – Vorlagebeschlüsse 163 Gesamtversorgungssysteme 25, 26, 34, 47, 49, 53, 103, 104 – Staatsbedienstete 25 f., 53, 54 – Zahl 54 – Ziele 53 – siehe auch Zusatz- und Sonderversorgungssysteme Gesellschaft 42 f., 56, 109, 175, 178 – Arbeitnehmergesellschaft 56 – bürgerliche 62 – geschlossene Gesellschaft der Offenen 182 – zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde 155 – Systemtheorie Luhmanns 175, 176 Gesetz(e) 55, 57, 163, 191 f. – fehlerhafte Begründung 163 – zum Eigentum 57, 71 – Ethos 172 – fehlerhaftes 1. AAÜG-ÄndG 143, 144 ff. – Gesetzestreue 119, 140 – mit jedwedem Inhalt 180 – und Recht 60 – rückwirkende Gesetze 104, 105, 143 – Systemwidrigkeit des AAÜG-1. ÄndG 152 – unverständliche Gesetze 164 – Verfassungsgesetz 76 – Verfassungsmäßigkeit 58 – auf dem Gebiet offener Vermögensfragen 191, 192, 193 – Wahrheit und Richtigkeit 172 Gesetzespositivismus 160 Gesetzesrecht 193 – positives Gesetzesrecht und Moral und Ethik 193 Gesetzgeber 42, 58, 81, 101, 113, 120, 122, 124, 133 f., 144, 146, 147, 154, 155, 156, 159, 189, 192, 195 – zum Eigentum 58, 66, 67, 71, 79, 81, 113, 125, 187, 189 – Einigungsvertragsgesetzgeber 79, 113, 114 – Ermessens-/Gestaltungsspielraum 59, 66, 101, 114, 125, 159, 189, 192, 194 – Hilflosigkeit 146 – Inkompetenz 160, 164 – Ratifikation des Einigungsvertrages 113
– Regelungsspielraum 59, 66, 71, 113, 189, 192 – sachwidrige Erwägungen 133 f., 144, 147, 155, 164 – und Grundgesetz 67, 71, 81, 101, 113, 124, 189 – Selbstprivilegierung 149, 155 ff. – fehlende Tatsachenermittlung 145 f., 154, 156 – Ungleichbehandlung 147 – Untätigkeit 146, 156, 168 – Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen 113, 114 – Verpflichtung zur Neuregelung des AAÜG 101, 126, 129, 132, 133, 134 f., 142, 145 f. – Zweck- und Zielverfehlung im AAÜG 126, 127, 129, 132 f., 134, 141, 144 f., 146 f. Gesetzgebung 17, 35, 114, 140, 150, 154, 159, 161, 180 – Bedarf 32 – Begrenzung des Eingriffs in das Eigentum 187 f. – konkurrierende Gesetzgebung 76 f. – mangelnde Begründung 128, 154, 164 – Rahmengesetzgebung 77 – Reparatur 28, 132 – fremdes Rentenmerkmal 150 – richtige Gesetzgebung 58, 168 – Schande 159 – Sozialgesetzgebung 36 – Überarbeitung 16, 28, 29, 33, 40, 67, 70, 101, 168 – unsinnige Gesetzgebung 79, 164 – Versorgungsüberleitung Ost 180 – Vollzugsorgan der Regierung 169 Gestapo 140 Gesundheitswesen 148 – der DDR 49, 158 Gewalt 61, 188 Gewinner 90, 171 Gleichbehandlung 121, 122 – Differenzierung 121 – Gruppenvergleich 122 Grabitz, Eberhard zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beim BVerfG 187 f. Grenze – zwischen Ost und West 107
Sachwortverzeichnis Grundgesetz 17, 24, 58, 61, 66, 67, 71, 75, 76, 77, 79, 85, 92, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117, 121, 125, 129, 139, 140, 153, 166, 183, 190, 192 – Änderung 191, 192 – allgemeine Regeln des Völkerrechts 71 f., 92 – Amtseid 166 – Anforderungen des Einigungsvertrages 74, 75 – Ausführungsgesetz zu Art. 133 GG 140 – Bindung an Gesetz und Recht 71, 81, 85 – Bruch des Grundgesetzes 24, 138, 189, 192 – und Bundesverfassungsgericht 58, 67, 79, 100, 101, 102, 108 ff., 114, 123 – 129, 133 – 135, 189 ff. – Enteignung 80, 139 – Erfolgsmodell 183 – Garantie des Eigentumsrechts 34, 57, 58, 59, 66, 75, 77, 79, 80, 92, 93, 102, 110, 111, 119, 123, 124, 125, 139, 170, 184, 188 – Eigentumsverfassung 58, 66, 92, 113 – Erstreckung auf das Beitrittsgebiet 76, 77, 107, 113 – für alle Deutschen 67, 69, 71, 75, 108 ff. – Geltungsbereich 66, 67, 75, 76, 92, 110, 113, 114 – Geltung für DDR-Bürger 66, 67, 76, 92, 107, 108 ff., 113, 124 – Gleichheitsgebot 17, 33, 41, 99, 101, 104, 105, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 133 f., 144, 145, 170 – unzulässige Gleichstellung 134 – kreativer Umgang 183 f, 189, 192 – Jubiläum 183 – Menschenwürde 119, 120, 122 – Niemandsland DDR 65 – Ozonloch im Beitrittsgebiet 191, 192 – Persönlichkeitsrecht 130 – Pflicht aller staatlichen Organe zur Eigentumsgewährleistung 68, 117 – Rechtsschutz 184 – Rechtsweggarantie 65 – Schutzbereich 122, 123 – Sozialisierung 189 – Suspendierung bei grundlegender Änderung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 59, 189, 192
– – – – –
225
Verfassungsidentität 184 Verfassungsprinzipien 67, 68, 127 verfassungswidrige Änderung 190, 191 Vergesellschaftung 81 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 113, 114, 127, 128, 187, 188 – Vertrauensschutz 86, 152, 162 – Völkerrecht 71 f., 92, 141 – und vorkonstitutionelles Recht 92 – Wesensgehalt 190 – Wirkungsverlust 183 – Zukunftsoffenheit 183 f. Grundrechte 57, 65, 66, 129, 136, 183, 184 ff, 187, 188, 189, 191, 193 – Abbau 190, 193 – Abwehrrechte 184 – Aufhebung 170, 183, 193, 194 – Bedrohung 184 – Begriff im absoluten Sinne 184, 186 – DDR-Bürger 185, 186 f. – Inhalt 185 f. – kreativer Umgang 186 f., 193 – überstaatlich 184, 186 – Vorwirkung 87, 92 Grundrechtsschutz 65, 67, 71, 76, 129, 133, 134, 135, 136, 185, 197, 201 – Deformation 197 Grundsicherung 50 Gutachten – zur Versorgungsüberleitung Ost 155, 156 Güter 110, 112, 166, 188 – materieller und immaterieller Art 166 – Sachgüter 112 Häme 38, 175 Handel 57 Handelsbetriebe 147 – Außenhandel 147 – Binnenhandel 147 – Gehälter 148 – Handelsräte 147 – Versorgung 147 – Wirtschaftsfunktionäre 147 Härten – soziale 34 Hartmann, Ralph 137 f. – Kinkels Rolle 137 f. – Kriminalisierung der DDR 138
226
Sachwortverzeichnis
Hassemer, Winfried – zur Politik aus Karlsruhe 170/171 Hegel, Georg Friedrich Wilhelm 201 – über Philosophie 173 – siehe auch Eigentum, Staatsrechtslehre Heller, Hermann siehe Reine Rechtslehre Kelsens, Staat Herrschaft 56, 60, 160, 170, 173, 186 – absolute 60, 175 – über Exekutive und Judikative 173 – Herrschaftsanspruch 159, 167 – Herrschaft der Gesetze 174, 180 – Parteiherrschaft 174 – Parteioligarchie 173 – des formal-juristischen Positivismus 178 – staatliche Herrschaft 56 Herzog, Roman siehe Bodenreform, Bundesverfassungsrichter Hetze 38 Historiker – Aufgabe 42 – Erwartungen 41 Humanität 137 Indifferenz 141 – moralische 141 Informationsbeschaffung – siehe Überwachung Informationsfreiheit 172 f. Institut für Internationale Politik und Wirtschaft 39 Institutionen der DDR 137 – Stützen der Diktatur 137 Integrationsprogramm 188 Intelligenz 49, 52 – Versorgungssysteme 77 Internationales Recht 92 Isensee, Josef 181 – 183 – Personelles 181 – zum Symposium aus Anlass des . 60. Geburtstages von Helmut Schulze-Fielitz 182 f. – Rezensionsessay 183 – zur Staatsrechtslehre als Wissenschaft 181 ff. Jahresgutachten – der fünf Weisen 22
Journalismus 173 – Bündnis mit den Herren der Republik 173 – Gesinnungsjournalismus 173 – Paternalismus 173 – siehe auch Medien Judikative 71, 105, 114, 123, 193 Jurisprudenz 178 – ohne Eigentum 59 – Formaljuristik 66, 178 – ohne Soziologie 179 – als dogmatische Wissenschaft 179 Juristen 101, 177, 178, 180 – Jahrhundertjurist 183 Juristentag 2025 164 juristischer Begriff 176 Jus publicum Europaeum 56, 196 – zum Eigentum 56, 196 Justiz 24, 38, 137 f., 159, 160, 161 – Beeinflussung der Justiz 24, 137 f., 160 – Delegitimierung der DDR 138 – Justizskandal 196 – Kinkels Rolle 24, 43, 137 f., 160, 161 – politische Justiz 170, 191, 193 – Schande 159 Justizklasse 191 – Grundgesetz als Beute 191 Kader 148 Kadernomenklatur/system 146 – 149, 155 – Funktionen auf der höchsten Ebene 146, 147, 155 – medizinische Dispensairebetreuung 148 – Ungleichbehandlung der Gruppen 147 – Wirtschaftsfunktionäre 147 Kelsen, Hans siehe Reine Rechtslehre, Rechtsordnung, Staat, Staatslehre, Staatsrechtslehre Kinkel, Klaus siehe Justiz, Beeinflussung der Justiz, Unrechtsstaat Kirsten, Gisela siehe Balletttänzer, Menschenrechtsbeschwerde, Versorgungsüberleitung Ost Klenner, Hermann – zu Kelsens Reiner Rechtslehre 173 – Rechtsleere 173, 180 Koalitionsvertrag 35 Kohl, Helmut 16, 18, 20, 33, 162 – blühende Landschaften 16, 20
Sachwortverzeichnis – Bundestagswahl 2019, 18 f. – und deutsche Einheit 18 – Regierungserklärung 21, 74 – Wiederwahl 21 – wirtschaftliches Verständnis 19 Kollektivsanktionen 118, 120, 139 Kolonisierung 43 – Ostkolonisation 43 Kommentare der Betroffenen 159 Kommunikation 173, 175 Konfiskation – von Eigentum 80, 139 – und Enteignung 139 – Hauptzweck 80 – Personengerichtetheit 80, 139 – von Renten 119, 138, 140 – Zielrichtung 139 Kontinuität 86 – trotz Verfassungswechsels 81, 82, 83, 87, 92 – von Rechtsbeziehungen 92 Korruption 166 Kosten 120 Krankenhaus 148 Krankenversicherung 53 Kriegsfolgen 196 Kriminalisierung 118, 119 – der DDR 24, 119 Kriminalität 38 Kritiker – im Abseits 171 Künstler 49, 95, 112 Kultivierung 43 – Rekultivierung des Ostens 43 Länderverwaltungen 40 – Qualität 40 Landessozialgericht – Thüringen 78 f., 144 Landflucht 21, 39 Landnahme 56, 141, 196 Landwirtschaftliche Produktions-Genossenschaft 50 Leben 20, 62, 104, 194 – und Arbeiten 62 – einheitliche Lebensverhältnisse 75, 89, 105 – Lebensbedingungen 20, 149, 153
227
– Lebensgestaltung 109, 187 – Lebenshaltung 48, 94, 120, 152 – Lebensleistung 86,91, 95 – Lebensrisiken 140 – Lebensunterhalt 48 – Verbesserung der Bedingungen 20 Lebenslauf der DDR-Bürger 94, 102, 105 Lebensstandard 47, 49, 51, 94, 105, 131 Lebensversicherung 46, 48, 54, 104 Legislative 21, 71, 105, 123, 131, 193 Legislaturperiode 32, 35, 169 – 16. Periode 169 Lehrstühle 182 Leistung(en) 62, 81, 84, 109, 111, 112, 119, 159, 165, 166 – durch Arbeit 62, 81, 84, 86, 109, 111, 112, 113, 165 – einkommensbezogene Leistungen 111 – Kürzung 114 – Leistungsansprüche 63, 81 – Leistungsausgleich 63 – Leistungsgerechtigkeit 70, 86, 91, 112 – Leistungsrecht 111 – überhöhte Leistungen 145, 159, 161 – Versorgungsleistungen 87, 88, 89, 100, 111, 113 – Wegfall der Rechtsgrundlage 81 Liberalismus 174, 181, 183 – Linksliberale 181, 182 Liquidierung 75, 91, 93, 138 – der Versorgung 91, 93, 106, 114, 117, 138 Lissabon-Vertrag 184 Literatur 34, 63, 118 – 123, 135, 157, 170 – Rechts- und Politikwissenschaft 34, 40, 118 ff., 135, 170 – siehe auch Versorgungsüberleitung Ost Lobbyismus 40 Locke, John siehe Eigentum Logik – der Normwissenschaft 178 Lohn 46, 86, 91 – angemessener Arbeitslohn 91 – Lohnersatz 103 – Nettolöhne- und Gehälter 125 Lohn- und Gehaltsstrukturen 146 – in der DDR 145, 148, 155, 156 – unterbliebene Ermittlung 146, 155, 156
228
Sachwortverzeichnis
Macht 26, 177, 180, 182 – Machtelite 60 – Machtkomplex 177 – Machtmissbrauch 120 – Machtpolitik 160 ff., 169 – politische 199 – und Recht 178 – Staatsmacht 26 – totale Macht 180 – Vermachtungsprozesse 182 Maizière, Lothar de 19, 20, 21, 74 Mangelwirtschaft 149 – und Privilegien 149 Marktordnung 57 Marktwirtschaft 40, 57, 69 Marxismus-Leninismus 24, 138 Mauer 161 Medien 29, 34, 169, 173, 199 – gleichgerichtet 34, 169, 173 – Propaganda 171 Mein und Dein 55, 56 Meinungsfreiheit 172 f., 185, 186 Menschen- und Bürgerrechte 65, 67, 68, 87, 92, 122, 185, 186, 196 – Eigentum 55, 65, 67, 68, 87, 92 – Freiheit 65 – Schutz 196 – universell 185 – Verletzungen 197 – vorstaatlich 185, 186 Menschenrechtsbeschwerde(n) 68, 200 Menschenwürde 119, 120, 122 Menschlichkeit 145 Merten, Detlef siehe Versorgungsüberleitung Ost, Systementscheidung Metaphysik 177 – des Eigentums 59 Minister (der DDR) 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150 – 152, 154, 156, 157, 158, 165 – Entscheidung 52, 53 – Regimetreue 154, 165 – Rentenkürzung 153, 154, 156, 157 ff. – Staatssekretär 143, 147, 148, 149 – für Staatssicherheit 145, 154 – Vergünstigungen 158 f. – Verfassungstreue 165 – siehe auch Reichelt, Hans Ministerrat 142, 145, 147, 150, 154
– Ministerratsbeschluss 53, 148 – Staatssekretär 132, 143, 147 – Wirtschaftsbetriebe 158 Ministerium für Staatssicherheit 49, 54, 95, 123 127 – 129, 131, 137 – 141, 143, 144 f., 152, 165 – Begrenzung der Rentenzahlbeträge 99 f., 128 f., 143 – Mitarbeiter 131, 137 – 141, 143, 145, 154 – Renteneinschnitt für Angehörige 99 f., 128, 143, 145 – Rentenkonfiskation 139 f. – Schutz der Ansprüche als Eigentum 128 – Staatsnähe 128 – überhöhtes Entgelt 145 – verdeckte Tätigkeit 99 – Verfassungswidrigkeit der Rentenkürzung auf 70 v.H. des Durchschnittsentgelts 128 f., 141 – Versorgungssystem 99 f., 127 f., 137, 141, 143 – Überwachung und Informationsbeschaffung 154 Missbrauch der beruflichen Stellung 145 Mitgift 22 f., 194 Mittel – finanzielle Mittel 112 Missbrauchsgebühr 201 Mittelstand 20 Moderne 181 Modrow, Hans 16, 195, 196 – siehe auch Bodenreform, Bundesregierung Monarchie 60, 174 Monopolbildung 182 Moral 118, 119, 179 193 Most, Edgar 19, 20 Nation 194 Nationale Volksarmee der DDR 49, 54, 95, 123 Nationalsozialismus 138, 140 – Vergleich mit der DDR 138 – Gestapo 140 Nettolohn, -verdienst 52, 53, 54, 137 Neubauern 198 – deren Erben 198 Nibelungentreue 155 Niveau
Sachwortverzeichnis – künstlerisches 112 Nomenklatur – siehe Kadernomenklatur Nominalwertgarantie 161 Norm 187 – und Realität 178 – Geltungsgrund 187 Novation 75, 102 ff., 105, 161 – Bedeutung 102 – von Rentenansprüchen 83, 94 – gesetzliche Novation 102 f., 161 – Schuldumschaffung 103 – siehe auch Bundessozialgericht nulla poena sine lege 119, 139 Nutznießer der Einigung 190 Offene Vermögensfragen 189, 190, 191, 197 – Gesetzgebung 191, 192, 193 Öffentliche Hand 190 öffentliches Amt 101 öffentlicher Dienst 45, 47, 72, 101 – Beamtenversorgung 45 – Rentensystem 45 – Staatsapparat 95, 96, 123, 126 – Zusatzversorgung 47, 87, 125, 164 f. öffentliches Interesse 55, 188 – bei Einschränkung von Grundrechten 187 f. öffentliches Recht 57 Öffentlichkeit 170, 199 – als Kontrollinstanz 171 öffentlich-rechtliche Rechtspositionen – als Eigentum 81, 139 Oligarchie 26, 60, 174 Opfer 119, 132, 138, 140 – des SED-Regimes 133 – des Systems 119 – politischer Verfolgung 133 Opposition 34, 199 Ordnung 64, 82, 174, 191 – Arbeitsordnung 69 – realsozialistische Ordnung 64, 69, 82, 85 – Versorgungsordnungen 87, 92, 124 Ordnung über das Gehaltsregulativ für Generaldirektoren und Kombinatsdirektoren 148 Organisationsträger – Wechsel 86
229
„Ossis“ 18 Ostrentner 90, 171 – Gewinner der Einheit 171 Ostsiedlung – Besiedlung des Beitrittsgebietes 42, 43 Ost-West-Verhältnisse 157, 191
Papier, Hans-Jürgen 16, 21, 28, 102, 123, 131, 135, 136, 162, 163, 164, 165, 188 – Auftragsgutachten 123, 162 – Befangenheit 33, 131, 133, 134, 163, 164 – Parteigutachter 71, 102, 133, 135 – zum Eigentumsschutz der DDR-Bürger 28, 66, 71, 102 – siehe auch Bodenreform, Bundesverfassungsrichter, Eigentum – Präsident des BVerfG 21 Parlament(e) 33, 40, 43, 138, 163, 185, 193, 195 – Beratungen 132, 170 – Initiativen 34 – Abgeordnete 138 – ohne offenen Diskurs mit Rede und Gegenrede 172 – Überdimensionierung 40 Partei des Demokratischen Sozialismus 39, 88 Partei(en) 39, 49, 95, 127, 159 – Anpassung an die Partei 159 – Apparate 40 – Funktionäre 147 – Regierungspartei 171 – Oppositionspartei 199 – Parteibuch und Vetternwirtschaft 153, 157 – Parteilichkeit 165, 166, 182 – Parteiendemokratie 60 – Parteienstaat 173, 199 – Parteienoligarchie 60, 155, 157, 172, 173, 185, 199 – Regierungspartei(en) 29 – Stiftungen 40 PEP 94, 143 – Mindestentgeltpunkte 99 Pflicht(en) 165, 166 Pflichtversicherungsrente 94, 95 Phantomjagd 127 Philosophie 174, 179, 180, 188, 193
230
Sachwortverzeichnis
– Rechtsphilosophie, Krone der Rechtswissenschaft 180, 193 Planwirtschaft 166 Pluralismus 182 – der Aufklärung 188, 193 politicel correctness 173, 181 Politik 22, 26, 137, 138, 156, 160, 184, 199 – aus Karlsruhe 170, 171 – demokratische Gesetzlichkeit 184 – Exekutive, Legislative und Justiz 171 – Machtpolitik 160 ff. – Politikskandale 196 – Verantwortung 132, 156 – Verflechtung 40 – Voreingenommenheit 150 Politiker 17, 164 – mangelnde Sensibilität 164 – Voreingenommenheit 150 – weltbeglückend 181 Politikverdrossenheit 21 Politische Beamte 157 Politische Begünstigung 145, 156, 157, 159 politische Justiz siehe Justiz Politische Klasse 18, 43, 93, 139, 155, 157, 191 – Systemverhaftung 155, 157 Politische Missliebigkeit 120, 141 Politische Rache 120 Politische Strömung 170 Politische Zuverlässigkeit 154 Politischer Proporz 182 Politisches Recht 169 Politisches System 44, 137 f., 155, 157, 165, 166 Prangerei 118 Privatrecht 57, 141 – intertemporales 57 – temporales 82 Privilegien 147, 148, 149, 152, 157 – keine Rechtfertigung für Rentenkürzungen 149, 157 Privilegierung 36, 98, 131, 147, 156, 162, 166 – Einkommen 132, 156 – Privilegiertentheorie 143 – Selbstprivilegierung 145, 146 – 149, 155 – 157, 166 Prinzip – Rechtsstaatsprinzip 85
Propaganda 39 Publizistische Intervention 183 Qualifikationskompetenz – siehe Grabitz, Eberhard Quellcodes – des Verfassungsrechts 183 Recht(e) 25, 41, 63, 71, 87, 89, 92, 105, 118, 160, 168, 169, 172, 173, 174, 180 – einheitliches Alterssicherungsrecht 89, 91 – ausländisches Recht 92 – als bloßer Befehl 177 – auf einen Staat 55 – Besatzungsrecht 140 – Beseitigung von Rechten 70, 71, 86, 92, 189 – Bürgerrechte 184 – Bundesrecht 55, 76, 77, 86, 92 – der DDR 20, 63, 67, 82 ff., 87, 91, 92, 124 – Entzug von Rechten 189 – und Gesetz 60, 71 – Grundlagen 174 – Liquidierung 21, 25, 70, 102, 138 – und Macht 178 – Mantel des Rechts 120 – Maßstäbe 118 – im materiellen Sinne 180, 193 – Moralisierung 182 – Naturrecht 60, 61, 185, 193 – privates Recht 57 – auf Recht 184 – Rechtsangleichung 76 ff., 86, 91, 92 – Rechtsgefühl 27 – reines Recht 60 – Rentenrecht 25, 35, 104 – Schutz erworbener Rechte 71, 92, 103 – und Unrecht 37 – Verlust 42, 76, 102 – Vermögensrecht 117 – Versorgungsrecht der DDR 92, 102 – vor- und überstaatliche Rechte 184 ff. – Wegfall 76, 102 – als Wirklichkeit des gemeinsamen Lebens in Freiheit 172 Recht und Recht 144 Recht und Unrecht 160 ff.
Sachwortverzeichnis Rechtsangleichung 69, 70, 76 ff., 86, 91, 92, 94, 105, 125, 131 Rechtsanpassung 69 Rechtsempfinden 128 Rechtsform 178 Rechtsfrieden 134, 164 Rechtsgrundlage – Wegfall 92 Rechtsklarheit 164 Rechtskultur 169 Rechtslehre 173 Rechtsnormen – Durchsetzbarkeit 60 – Inhalt 60 – Zustandekommen 60 Rechtsordnung 56, 64, 71, 79, 80, 119, 131, 140, 174, 176 f., 193 – bei Kelsen 176 ff. – der DDR 82 – in der Despotie 60 – gesamtdeutsche 108, 109, 124, 131 – Einheitlichkeit 81 – Sonderrechtsordnung 94 – Widerspruchsfreiheit 79 Rechtsposition 84, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 124, 125, 143 – öffentlich-rechtliche Rechtspositionen 139, 144 – Vermögenswert 109 f. Rechtspositivismus 174 – 183, 186 – absolute Herrschaft 175, 177, 178, 180 – allgemeine Rechtslehre 179, 180 – Bundesregierung 174 – Carl Schmitt 176, 177 – Despotie 174, 180 – Disjunktion: Soziologie-Jurisprudenz 176, 177 – Gesetz gleich Recht 174 – Hellers Kritik 177 – 180 – Identität von Staat und Verfassung 177 – Inhalt der Lehre 174 f., 176 ff., 179, 180 – Kelsen 174, 175, 176, 177, 178, 180, 183 – Klenner, Hermann 174, 180 – Kritik 175 – für neue Bundesländer 186 ff. – Lehre ohne Staat 175, 176, 177, 180 – Negierung des Staates 176, 177, 180 – Normwissenschaft 178, 179, 180
– – – – – – –
231
Theorie 174, 178, 180 Rechtsordnung 174, 175, 177 Rechtspositivismus 174, 177 reines Recht 174, 175, 179 Souveränitätsbegriff 176 f., 179, 180 Einheit von Staat und Recht 179 Staat als System von Zurechnungen 176, 177 – Staatslehre 177, 178, 179 – Staatsrechtslehre 179, 180 – Präsident Voßkuhle 180, 183 – siehe auch Reine Rechtslehre Rechtsprechung 171, 182, 191 – Einheitlichkeit 81 – im Parteienstaat 26 – zwischen Politik und Justiz 171, 191 Rechtsschutz 184 Rechtssicherheit 124, 174, 193 Rechtsstaat 41, 57, 60, 64, 65, 82, 85, 118, 119, 120, 122, 139, 141, 160, 162, 163, 165, 174, 175, 184, 185, 193 – rechtsstaatswidrige Rückwirkung eines Gesetzes 143 – rechtsstaatliches Verfahren 185 Rechtssystem – gesamtdeutsches 34, 35, 44, 71, 77, 78, 110 – sozialistisches 63, 82 Rechtswahrheit 164 Rechtsweggarantie 65 Rechtswissenschaft 177, 178, 180 Rechtsverweigerung 165 Rechts(un)sicherheit 60, 153, 187 – Rückwirkung zu Lasten von Rentnern 153 Rechtswandel 174, 192 Re-eduction 41 Reichelt, Hans siehe Berufsbiographie eines Ministers der DDR Regelaltersrente 151 Regierung 20, 61, 131 – 133, 162, 171, 174, 199 – am Recht orientiert 61 – Aufgabe 156 – bei Bodin 61 – Einrichtungen 158 – Erklärung beider deutscher Staaten zur Regelung offener Vermögensfragen zur DDR 74
232
Sachwortverzeichnis
– Festhalten am gescheiterten RÜG-Konzept 133, 134, 155 – Hauptabteilungsleiter 132 – Kohl 33, 162 – Regierungskrankenhaus 148, 158 – und Medien 171, 173 – Ministerversorgung 158 – Regierungsgewalt 61 – Regierungskoalition 31, 32, 34, 169 – Regierungskriminalität 123 – Regierungspartei(en) 29, 171 – Regierungspolitik 74, 170 – Regierungsvertreter 29 – Säumnis im Gesetzgebungsverfahren 155 – Staatssekretär 132, 143, 147, 148 – Versorgungseinrichtungen 158 – Wirtschaftsbetriebe 152 Reine Rechtslehre Kelsens/ Regimetreue 154 Renten 41, 46, 47, 50, 52, 62, 77, 99, 100, 105, 119, 123, 138, 140 – Absenkung 33, 100, 106, 128 f. – Altersgrenze 109 – Altersrente 24, 46, 50, 81, 109, 114, 137, 151 – Ansprüche 15, 77, 109, 114, 120, 161, 165 – Begrenzung 99, 100, 114, 126, 128 f., 132 – Bestandsgarantie 34, 77, 83, 86, 128 – Bestandsrenten 95, 124 – Betriebsrenten 45, 47, 77 – Durchschnittsrenten 157 – Dynamisierung 124, 134 – Funktion als Eigentum 63, 81, 109, 110, 114, 124, 128 – Grundrente 94, 105, 106 – Höhe 24, 25, 46, 53, 72 f., 84 f., 95, 109, 137, 156, 157 – Höchstbegrenzung 99, 100, 126 f., 128 – Kaufkraft 46 – Kürzung 114, 119, 122, 124, 126 f., 128, 132, 133, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 153, 155, 156, 160, 162, 163, 164 f., 167 – Kunstrenten 33, 151 – Liquidation 106, 114, 138, 139, 160, 163, 164 – Mindestrente 16, 50, 109, 141 – Nachzahlung 164 – Neuberechnung 129, 164
– politische und soziale Diskriminierung 17, 94, 123 – Rentenalter 105, 106 – Rentenformel 36, 46 – Rentenwert 124, 125 – Rentenzugriff als strafähnliche Sanktion 38, 95 ff., 136, 139, 160, 163, 164 – Überführung 34, 36, 77, 102 – Versichertenrenten 100, 109 – wohlerworbene Rechte 56, 77 – Zugriff 119, 163 – Zusatz- und Versorgungsrente 33, 51, 54, 77, 78, 86, 114, 137, 160 Rentenangleichungsgesetz – siehe Versorgungsüberleitung Ost Rentenansprüche 15, 46, 106, 114, 125, 148, 156, 157 Rentenbescheid 143, 151 Rentendynamisierung 46, 83 f., 105, 117, 124, 128, 134 Rentenreformgesetz 76 Rentenstrafrecht 137 – 141, 142, 143, 153, 160, 162, 163, 164, 168, 170, 173 – im AAÜG-1. ÄndG 163, 164 – Bruch des Einigungsvertrages 138, 162 – Bruch des Grundgesetzes 138 – Bundesverfassungsgericht 153, 160, 173 – Forderung von Dreßler, Rentenstrafrecht abzuschaffen 168 – Konfiskation der Renten 139 f. – Konsequenz aus Unrechtsstaat 137 f. – Missachtung der Vorgaben des RAG 163 – Politikrichtung 138 – politische Strafverfolgung 138, 159 – Rentenstrafrechtbeseitigungs-beschluss 164 – Rolle der Bundesjustiz 137 f. – Schuld 140 – Verfassungswidrigkeit 163 – rückwirkende Verschlechterung bestandskräftiger Rentenbescheide 159 – fehlende Täterschaft 140 – Stützen der Diktatur 137 – Systementscheidung 137 – Verfassungswidrigkeit 143 – Vergleich mit dem Nationalsozialismus 138
Sachwortverzeichnis – Verstoß gegen Prinzipien des Sozialversicherungsrechts 140 – Vorgaben 137 f. Renten-Überleitungsgesetz 20, 25, 28, 32, 34, 35, 52, 78, 79, 88, 93 ff., 102, 105, 118, 119, 121, 123, 124, 127, 132, 135, 138, 140, 162, 163, 168 – Abschlussgesetz 33, 34 – Ergänzungsgesetz 98, 99, 100 ff., 118, 121, 131 ff., 134 – Korrektur 37, 134 f. – Novellierung 99 – Scheitern des Konzepts 118 ff., 131, 134 f. – Systemwechsel 44, 78, 85, 87, 88, 120, 125 – Systemwidrigkeit 141 – Verfassungswidrigkeit 33, 141 – siehe auch Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz Rentenüberleitungs-Ergänzungsgesetz 100 ff., 118, 121, 123, 124, 127, 132, 134, 193 Renten- und Versorgungsüberleitung 31, 69 ff., 99, 100, 102, 104, 105, 128, 164, 200 Rentenversicherung 34, 44, 46, 48, 54, 83, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 99, 100, 105, 109, 111, 120 – Anpassung der Renten 50, 70, 111, 128 – Arbeitgeberanteile 112 – Beiträge, Beitragsleistungen 15, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 70, 80, 83 f., 86, 111 – Beitragsbezogenheit 9, 111 – Beitragsbemessungsgrenze 46, 47, 50, 51, 53, 102, 109, 120, 121, 122, 125, 126 – Beitragspflicht 52, 143 – Eigenleistungen 112, 114 – einheitliches Rentenrecht 89, 103, 120 – Entgeltpunkte 46, 94, 99 – Erwerbszeiten 46, 109 – gesetzliche Rentenversicherung 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 76, 83, 84, 94, 95, 104, 105, 106, 110, 111, 125, 127, 128, 140, 151, 156 – Jahreshöchstverdienst 99 – Leistungen 89 – Pflichtbeitragszeit 143 – private Rentenversicherung 46, 47, 104 – Prokrustesbett 94 – Rechtsangleichung 125
233
– Rentenversicherungsrecht, gesamtdeutsch 45, 70, 89, 104, 110, 118 – soziale Bezüge 114 – Versicherungsdauer 46 – versicherungsfremde Leistungen 44 – westdeutsche gesetzliche Rentenversicherung 16, 29, 33, 93, 105, 111 Rentenverwirkung 119 Rentner – Biographie 31 Reparaturbetrieb 33 Republik 173 Reputation 181 Ress, Georg siehe EGMR Rettungsschirm 17, 35, 59 Revolution 37, 65, 69, 85 Rezeption bundesdeutschen Rechts 69 Richter 126, 135, 153, 182, 199 – der DDR 153 – des Bundesverfassungsgerichts 26, 126, 135, 181 – siehe auch Bundesverfassungsrichter – Nähe zur Regierungspartei 171 – Parteizugehörigkeit 26, 199 – Unabhängigkeit 126, 199 Rückwirkung – im Rentenstrafrecht 153 Sachen – Sacheigentum 56 Sachverständige 31 Sanktionen 81, 95 ff., 140, 165 – pönale Sanktionen 81, 95, 118, 139 – strafähnliche Sanktionen 119, 136, 139 Sarrazin, Thilo – zum Bundesverfassungsgericht 170 Schachtschneider, Karl Albrecht – siehe Demokratie, Eigentum, Freiheit Schande – für Gesetzgebung und Justiz 159 Schäuble, Wolfgang – siehe Bundesregierung Schildbürgerstreich 79 Schmitt, Carl 181, 182. 183 – siehe auch Reine Rechtslehre, Staat Schuld 119, 120, 123, 140, 141, 165 – Kollektiv- und Gruppenschuld 119, 140 – Lebensführungsschuld 140
234
Sachwortverzeichnis
– Voraussetzungen 119 Schulden 22, 23, 35 – der DDR 23 – der Bundesrepublik 23, 35 Schuldverhältnis 103 – Änderungsvertrag 103 – Aufhebungsvertrag 103 – Erlöschen 103 – und Novation 103 SED siehe Sozialistische Einheitspartei Deutschlands SED-Regime 24, 133, 137 – Mitglied 137 – Selbstbegünstigung 159 Selbständigkeit 62 Selbstbedienung 166, 197 Selbstbehauptung 41, 42 Selbstbestimmung 42 Selbstgerechtigkeit 182 Selbstprivilegierung 145, 146 – 149, 155 ff., 158 f., 165, 166 – begriffskonturlos 149 – schwammiger Begriff 156 – ideologisches Konstrukt 155 – in der Bundesrepublik 15, 156, 166 – ohne Belang im Rentenrecht 155, 157 – rentenrechtliches Fortwirken 155 – System 145, 146, 149, 155 – 157, 158, 165 Seilschaften 182 Sein und Sollen – Gegenüberstellung 176 – Hierarchie von Sein, Sinn und Sollen 178 – sinnfremdes Sein und inhaltsloses Sollen 178 Sicherung – bedürftigkeitsunabhängige Sicherung 128 Siegermentalität 18, 43, 136, 153, 170, 198 Sittlichkeit 173 Sonderregelungen 95, 98, 119, 156 Sonderversorgung 25, 47, 53, 54, 103, 129 Sonderversorgungssystem 47, 53, 54, 98, 99, 100, 104, 108, 110, 111, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 137, 138, 155, 156, 159, 160, 162, 164 Souveränität 56, 57, 61, 76, 139, 176 – Aufgabe staatlicher Souveränität 184 – der Gesetze 179/180 – ohne Souveränitätssubjekt 175, 180
– Staat als durchgehendes Subjekt von Ordnungen 177 Sowjetische Besatzungszone 38, 39, 105 – Besatzungsmacht 40, 194 – Stagnation 38 – Terror 38 – Wüsten 38, 39 Sozialdemokratische Partei Deutschlands 34, 41, 168 – Anträge zur Versorgungsüberleitung Ost 34, 35 – Dreßler, Rudolf 168 Sozialgericht Berlin 144 – 152, 154 – 157, 159, 165, 173 – zur Berufsbiographie des Klägers 154 – 157 – zur Gehaltsstruktur in der DDR 146, 148 – zum Gleichbehandlungsgrundsatz 144, 147, 150 – zur Nomenklatur 146 f. – Rentenkürzungen für Minister 144 ff. – zu überhöhten Entgelten 145 f. – Verfassungswidrigkeit des AAÜG1. ÄndG 144 ff. – Vorlage an das BVerfG zum AAÜG-1. ÄndG 144 – 152, 173 – zur Weisungsbefugnis gegenüber dem MfS 144 f., 152, 154, 165 Sozialgesetzbuch – Teil VI 16, 93, 94, 102, 104, 111, 128, 129 Sozialismus 64, 119 – Wirtschafts- und Rechtsordnung 49 Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 64, 142, 159, 167 – Generalsekretär 145, 147 – Mitglied 137, 142, 153 – Politbüro 145, 146, 147, 150, 153, 155 – Zentralkomitee 145, 146, 147 Sozialleistungen 78, 128 – sozialer Ausgleich 70 Sozialpflichtversicherung der DDR 24, 29, 33, 53, 83, 93, 95, 103, 105, 106, 109, 111, 129, 136, 137 Sozialrecht 119, 140 Sozialstaat 69, 85, 107 Sozialunion 69, 70, 85 Sozialversicherung 54, 63, 73, 77 ff., 83, 86, 121
Sachwortverzeichnis – allgemeine Regeln 15, 73, 83, 88, 111 – Beiträge 46, 51, 73, 79, 80, 83 f., 86, 111 – Eigentum durch Rentenansprüche 79, 81, 125 – Finanzierbarkeit 125 – Probleme 44 – Sozialversicherungslehre 20 – keine Straffunktion 118 – Versicherungspflicht 52 – Wertneutralität 118, 119, 122, 140, 141, 165 Sozialversicherungsgesetz 91 Sozialversicherungsrecht 70, 78, 94, 102 – Aufgabe 119, 140 – keine Einteilung in Täter und Opfer 140 – Rechtsmissbrauch 38 – Wertneutralität 38, 118, 119, 122, 140, 141, 165 – ohne Wiedergutmachungsfunktion 119, 140 Sozialversicherungssystem 41, 70, 141 – Durchbrechung 141 Soziologie 176, 177, 180 Spitzenverdiener 148, 149 Staat 61, 138, 176, 177, 184, 185, 188, 189 – Aufgaben 74, 188 – Auflösungserscheinungen 188 – Bedienstete 36 – Bankrott 11 – bei Bodin 61 – Bundesstaat 184 – bei Heller zur Lehre Kelsens 177-179 – bei Kelsen 61, 176, 177, 179 – bei Schmitt zur Lehre Kelsens 176, 177 – DDR 39 – Despotie 60, 174 – Einheit zwischen Staat und Recht 179 – Eingriffsschranken bei Grundrechten 186, 188 – und Faschismus 24, 138 – Fürsorgepflicht 109, 110, 113 – Gesamtstaat 106 – Gesetzesstaat 60 – Gewährung 112 – Grundrechte 184 ff. – Identität von Staat und Verfassung 177 – Machtstaat 198, 177, 180 – Negierung 176
– – – –
235
Parteienstaat 26, 173, 199 Räuberbande 61, 177 Recht auf einen Staat 55 Rechtsstaat 41, 60, 82, 85, 118, 119, 120, 122, 141, 160, 162, 163, 165, 174, 175, 184, 185, 193 – Reine Rechtslehre 59 ff., 174 – 183 – als reine Rechtsordnung 176 – Schutz des Eigentums 55, 185 – Souveränität 56 f., 139, 180, 189 – Sozialstaatlichkeit 107 – Staatsgewalten 160 – ohne Staatsrecht und Staatslehre 179 – Staatsmacht 135 – Staatsorgane 148 – Staatsrecht 169, 179, 180 – System von Zurechnungen 176, 177 – Teilstaaten 106 – totaler Staat 177, 180 – Unrecht 60, 174 – Unrechtsstaat 18, 24, 25, 136, 137, 138 – Versorgungslasten 88 – vorstaatliche Grundrechte 185 – Wahrung der Grundrechte 188 – Wesen, Zweck und Rechtfertigung 178, 185, 188 – Würde des Staates 199 Staatensukzession 56, 141 – Grundsätze 141 Staatliche Einrichtungen der DDR 110, 158 – Hauptabteilungsleiter 132, 157 – Staatssekretär 143, 147, 148, 149 Staatliche Versicherung der DDR 49, 50, 51, 54 Staatsangehörigkeit 184 Staatsapparat 95, 96, 101, 126, 127, 132, 155, 162 Staatshaushalt 40 – der DDR 50, 112, 113 Staatslehre 177 ff., 184, 188 – Kelsens 177, 178, 179 – Krise 179, 180 – Isolierung von der Soziologie 177 – Staatslehre ohne Staat und Staatsrecht 179 Staatsnähe 36, 42, 72, 119, 126 f., 128, 130, 133 – 135, 137, 143, 160, 165 – Richter 126 – Volkspolizei 126
236
Sachwortverzeichnis
Staatsnahe Tätigkeiten 70, 97, 98, 126 – Katalog der Betroffenen 97, 98 Staatsnahe Versorgungssysteme 95 ff., 141, 162 Staatsordnung 64 Staatsrat 145, 175 Staatsrecht 169, 175, 178, 180, 183 f., 188 – bei Kelsen 176, 177, 178, 180 – ohne Staat 175, 180 Staatsrechtslehre 60, 61. 175, 178, 179, 180, 182 – bei Hegel 179 – Kelsens 61, 176, 177, 178, 179 – grundgesetzfixiert 181 – Kritik der deutschen Lehre 180, 182 – ohne Staat 179, 180 – zur Weimarer Zeit 175 – als Wissenschaft 182 Staatsrechtslehrer 180 ff. – erlauchter Kreis 180 – 183 – Netzwerk 182 Staatssicherheit – Akten 38 – Behörde 38 Staats- und Systemnähe 119, 126 f., 131, 133 – 135, 140, 149, 156, 157, 165, 166 – keine Rechtfertigung für Rentenkürzung 149, 156, 165 Staatsvertrag 15 f., 20, 21, 33, 41, 44, 67, 69 ff., 71, 73, 80, 84, 87, 88, 91, 102, 118, 120, 125, 129, 138, 160 – Bruch 25, 28, 81, 137, 162 – Eigentumsprinzip 67 – Garantie erworbener Rechte 16, 20, 70, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 120, 124 – Inhalt, Grundsatzentscheidungen 69 ff., 70, 87, 88, 91, 93, 124 – Konzeption 95 – Präambel 85 – Rechtsangleichung 70, 91, 94 – Regierungserklärung 21, 74 – Sozialunion 69 f., 86 – Systementscheidung 86, 87 ff., 124 – Überleitungsbefehl 34, 70, 87 – Verfassungsvertrag 85 – völkerrechtlicher Vertrag 69, 85 Stabilisierungsmechanismus 170 Stalinismus 161
Stammtisch 182 Steuer(n) 48, 112 Steueraufkommen 48 Stiftungen 40 – parteinah 40 – Staatssäckel 40 Stolpe, Manfred 101 Strafe 81, 118, 139 – Einziehung 140 – und Schuld 118, 140 – Verfall 140 – Vermögensstrafe 140 Strafrecht 119, 123, 140 – politisches Strafrecht 159 – quasi-pönale Maßnahmen 139, 163 – und Rentenkürzungen 119, 123, 163 f. – individuelle Täterschaft 140 Straftaten 141 Strafverfolgung 24, 118, 119, 138 – politische 138 Strafvollzug 95 Struktur – Einkommens-, Qualifikations- und Beschäftigungsstruktur in der DDR 156 Substanz – der Staatsverträge 94 Subventionen 112 System 44, 78, 87, 88, 99, 120, 149, 154, 155, 158, 166, 194 – der DDR 42, 64, 65, 85, 101, 103, 120, 123, 138, 147, 165, 167, 194 – der sozialen Sicherheit 63, 70, 85, 86, 89, 91, 103, 138 – Systemwechsel 44, 78, 85, 87, 88, 120, 141 – Versorgungssysteme 91, 99 – von Zurechnungen 176, 177 Systementscheidung 86, 87 ff., 91, 124, 135 – Bedeutung 88 f. – bei Merten 88 f. Systemnähe 101, 126, 131, 133 – 135, 141 – Abgrenzung zu Systemferne 101 Systemwidrigkeit 141 Systemnahe Tätigkeit 70, 100, 101, 126, 141, 165 – Systemnützlichkeit 70, 165 – Systemverhaftung 155 Systemtreue 36, 165
Sachwortverzeichnis Tarife – Tarifverhandlungen 46 – Versorgungstarifverträge 42 Tarifvertrag 42, 78, 104 Täter und Opfer 25, 119, 138, 140 Teilhabe 48 – demokratische 42 – politische Teilhabe 42 Teilung 105 – der Alterssicherung 105 Territorium – Wechsel der Verfassung 82, 141 Theologie 174 Theorie 174, 182 – Erkenntnistheorie 176 Thoma, Richard – zu Grundrechten 185 Transferleistungen – von West nach Ost 22 Transferleistungen, -vermögen 197 Transformation – siehe Versorgungstransposition Treue – System und Pflichttreue 16, 166 Treuhandanstalt 22, 23, 43 – Machenschaften 43, 198 – Präsident Rohwedder 22, 23 – Schuldenberg nach der Wende 22 – Verschleuderung DDR-Vermögens 22, 43 Übel 17, 26 Überleitung siehe Überführung Überführung 35, 77, 78, 82, 86, 87, 88 f., 91, 95, 102, 122, 128, 137, 153, 155, 156, 170, 200 – der Alterssicherungssysteme 118, 122, 170 – von Ansprüchen und Anwartschaften 25, 34, 35, 37, 41, 44, 66, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 88 f., 93, 95, 110, 111, 114, 125, 128, 137, 155 – im Rechtssinne 34, 86, 87, 94 – von Bundesrecht 76 – des Rentenrechts der DDR 78, 82 ff., 86, 87, 88 f., 91, 92, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 125, 128, 137, 155 – unbewältigt 118 Überwachung und Informationsbeschaffung 154, 155
237
Umerziehung 41 Umlageverfahren – beitragsfinanziert 50 Umwälzungen im Staatengeschehen 196 Unbewältigtes 15, 31, 45, 118 ff. Ungerechtigkeit(en) 16, 20, 32, 138 Ungleichbehandlung 34, 94, 95, 101, 104, 105, 106, 121, 122, 123, 126, 133 ff., 144, 147 – im AAÜG-1. ÄndG 147, 148 UNO siehe Vereinte Nationen Unrecht 17, 25, 37, 60, 92, 119, 122, 138, 140, 164, 174 – Unrechtsentgelt 161 – in der Parteiendemokratie 60 – des Staates 60 – Unrechtsregime 138 – Unrechtssystem 123 Unrechtsstaat 25, 136, 137, 138, 160 – Kinkels Rolle 24, 137, 160 Untergang – von Rechten 91, 105, 124 Unternehmen 22 Unterschied 106 Unwert 119 Urteil – sozialistisches Unwerturteil 119 VBL 104, 134 Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse 189, 192, 194, 196 Verantwortung 119, 120, 134 f., 140 Verantwortungslosigkeit 134 f., 200 Verdienst 50, 95 f., 99, 100, 112, 148 Verdrängung – der Realität 153 Vereinbarung – betriebliche 47 Vereinigung 15, 39, 64, 65, 110, 134 Vereinigungen 170 Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 182 Vereinte Nationen 200 – Ausschuss für ökonomische, soziale und kulturelle Rechte bzw. Angelegenheiten 17, 36, 37, 200 – Diskriminierung 37
238
Sachwortverzeichnis
– zur Entscheidung des BVerfG vom 6. 7. 2030, 17 – Staatenbericht 17 – Wirtschafts- und Sozialausschuss 17 Verfassung 57, 58, 81, 107, 139, 177 – Angleichung der Lebensverhältnisse 105 – Aufgabe zum Schutz von Eigentum 55, 68, 81 – der DDR 63, 65, 66 – Eigentum 55, 68, 86, 187 – Eigentumsschutz auch ohne Verfassungstext 68, 87 – Einheit der Verfassung 190 – Kontinuität der Rechtsbeziehungen bei Verfassungswechsel 57, 87 – Prinzipien 67, 119, 122, 127, 139 – Staatsvertrag 69, 91 – Verfassungsänderungen 64, 65, 74, 160, 192 – Verfassungsdeuter 181, 182, 183 – Verfassungsgrundsätzegesetz der DDR 75, 85 – Verfassungsidentität 184 – Verfassungsprobleme 45, 118, 180 f. – Verfassungstheorie 61 – Verfassungswechsel 57, 64, 65, 81, 85, 87, 107 – Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 113, 114, 127, 128 – Verstöße 20, 141 – Vorgaben 92 f., 105 Verfassungsbeschwerden 20, 43, 129, 136, 163, 201 – ohne Anhörung 43 – Zurückweisung(en) 43, 136 Verfassungskonformität 133, 134 Verfassungsrecht 183 – Quellcodes 183 Verfehlungen 145 Vergangenheitsbewältigung 38, 119, 120, 139, 168 Vergünstigungen 158, 159 – Katalog 158 f. Verhältnismäßigkeit 113, 114, 127, 128, 157 Verlässlichkeit 20 Vermögen 23, 46, 56, 59, 62, 63, 189, 198 – Bestandsaufnahme des volkseigenen Gesamtvermögens der DDR 22
– als Eigentum 59, 62, 63, 67, 92, 109 – als Recht 56, 67, 92 – Regelung offener Vermögensfragen 59, 74, 199 – Sachvermögen 109 – Vermögensbildung 45, 46 – Vermögensunterschiede 106 – Vermögenswert 110 – volkseigenes Wirtschaftsvermögen 22 Vermutung – unwiderlegbare Vermutung 96 Vernunft 181 Verordnung über die Erhöhung des Arbeitslohnes für qualifizierte Arbeiter in den wichtigsten Industriezweigen 148, 149 Versichertengemeinschaft 88 Versicherung 54 – Ansprüche 161 – private Vorsorge 45, 54, 120 – Pflichtversicherung 46, 50, 94 – Versicherungsleben 128 – Versicherungspflichtgrenze 51 – Versicherungssystem 97 Versicherungsbiographien 89, 125, 129 – Vergleich zwischen neuen und alten Ländern 89, 94, 161 Versicherungsjahre 89, 129 Versöhnung 38 Versorgung 47, 48, 64, 74, 77, 78, 87, 104, 122, 124, 125, 147, 161, 162, 166 – Ansprüche 118, 128, 135, 137, 141, 161, 162 – Altersversorgung 47, 52, 53, 64, 77, 80, 94 f., 104, 109, 112, 162 – Anspruchserwerb durch Arbeitsleistung 84, 109 – Beamtenversorgung 48, 51, 87, 104, 121 – der Bundesorgane 166 – Dynamisierung 117, 124, 128 – Grundversorgung 46, 50 – Höhe 110, 112 – Rahmenbedingungen 104 – der Richter, Soldaten, Staatsanwälte 45, 87, 96, 126 – Versorgungsberechtigte 96, 119, 120, 122, 123 – Versorgungsleistung 111, 125 – Versorgungslücke 47
Sachwortverzeichnis – Versorgungsrecht 118, 120 – Versorgungssysteme 104, 110 – Volkspolizei 126 – Vollversorgung 47, 95 – Ziele 50 – Zusatzversorgung 125 Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 47, 53, 104, 113, 134 Versorgungsanstalt Deutscher Bühnen 47 Versorgungsberechtigte 96, 119, 120, 122, 140 – Täter-Merkmal 119, 123, 140 Versorgungssystem(e) 47, 48, 52, 73, 82, 83, 85, 91, 94, 95, 96, 101, 103, 106, 110, 111, 134, 141, 143, 162 – der alten Bundesländer 122 – berufsständische 48, 104 – des MfS/AfNS 99 ff., 122, 141, 143 – Schließung 124 – Sonderversorgungssystem 98, 100, 101, 103, 104, 108, 110, 111, 141 – staatsnahe Versorgungssysteme 88, 123, 126, 133 – 135, 141, 162 – Zahl 47, 52 – siehe auch Staatsnahe Versorgungssysteme Versorgungstransposition 87, 88 – Bedeutung 87, 88 Versorgungsüberleitung Ost 15, 26, 30, 31, 43, 69 ff., 88, 91, 93 ff., 131, 135, 140, 163, 164, 170, 171, 173, 180, 193, 197, 198, 200 – Aberkennung 139, 145, 160, 163 – Abschmelzung 95, 99, 122, 138 – Absenkung 125, 126, 156 – Angleichung der Ansprüche 70, 85, 86 – Anpassung der Rentenansprüche 70, 83, 84 f., 93, 105, 106, 120, 125, 129, 138 – Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz 28, 33, 35, 80, 93, 95, 97, 98, 99, 100 ff., 111, 120, 121 f., 123, 124, 126 f., 128, 141, 142 ff., 160, 163 – Auffüllbeträge 95, 134, 136, 162 – Auseinandersetzungen 65 – 67, 134 f., 160 ff., 163, 167, 168 – Balletttänzer 52, 66, 68, 77 f., 80, 81, 94, 95, 105, 108, 109 ff., 113, 114, 117, 136, 137 – bei Merten 28, 38, 87, 88 f., 118 ff., 120, 124
239
– Beiträge 15, 46, 48, 50, 51, 52, 70, 73, 79, 83 f., 86, 112 – berufsbezogene Zuwendung 77 ff., 80, 81, 105, 108, 109, 136 – Berufsgruppen 66, 72, 77, 94 f., 126, 136, 163 – Beseitigung von Ansprüchen 70, 71, 79, 81, 91, 93, 99 f., 102, 160 – Besitzstand 41, 70, 74, 77, 83, 85, 86, 87, 105, 120, 128, 134 – besondere Begünstigung 80, 136 – Bestandsrentner 25, 95, 102, 106, 124, 128, 136 – Biographie 102, 104, 105, 150 – 152 – Bundesverfassungsgericht 28, 66, 68, 70, 79, 80, 97, 100, 101, 105, 108 – 117, 120, 122, 123 – 130, 132, 133 – 135, 136, 153 ff., 156, 160, 163, 164 – 167, 173, 180 – Dauerprobleme 16, 134 f. – Degression 96, 97, 122, 126 – Diskriminierung 94, 95, 105, 106, 118, 136 – Dynamisierung 83 f., 105, 117, 124, 128, 134 – Eigenleistungen 84, 109, 111, 112 – Eigentum 66, 71, 81, 108 ff., 111, 113, 123, 128, 129, 134 – Einigungsvertrag 67, 71, 76, 77, 81, 86, 87, 108 ff., 113, 120, 160, 163 – Einstellung von Leistungen 79, 81, 86, 93 – Entwertung von Renten 136 – Entzug von Renten 70, 71, 81, 93, 99, 104, 114, 126, 134, 136, 160, 162 – Ersetzung der Ansprüche 94, 99, 102, 104 – Freiwillige Zusatzrentenversicherung 49, 50, 51, 52, 71, 86, 91, 93, 95, 103, 105, 106, 111, 129, 136 – Garantie der Rentenansprüche 73, 74, 77, 83, 85, 86, 87, 91, 110 f., 113, 114, 120, 128, 160 – Gegenposition der Bundesregierung 65, 66, 71, 75, 105, 123, 133 f., 160 – 162, 163 – im Geltungsbereich des Grundgesetzes 76, 77, 110 f., 113 – Gutachten 155 f. – Konfiskation 80, 81, 117, 119, 139 f., 162 – Korrekturen 37, 135 – Kürzung der Renten 128 f., 133 f., 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149,
240
– – – – – – – – – – – – – – – –
–
– – – –
– – – – –
Sachwortverzeichnis
150, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 162, 163, 164 f., 167 Liquidierung 93, 105, 106, 114, 117, 137, 138, 160, 162 Literatur 34, 45, 118 – 123, 135, 170 siehe auch Merten Ministerium für Staatssicherheit 127 – 129 Novation 75, 102 ff. parlamentarische Initiativen 29, 30, 31, 168 f. Phantasie-Renten 151 Rentenangleichungsgesetz 72, 73, 77, 85, 86, 91, 113, 160, 163 rückwirkende Eingriffe 105, 153 Staatsvertrag 69 ff., 71, 72, 85 f., 91, 108, 114, 160 Staats- und Systemnähe 126 f., 133 – 135, 165 Systementscheidung 87 ff., 91, 124 offene Fragen 134 Übergangszeit 128 Umwertung 129, 138 ungerechtfertigte und/oder überhöhte Leistungen 70, 73, 80, 88, 99, 121, 127, 132, 134, 145, 153, 155, 156, 160, 161, 162, 163, 165 Untergang aller Rechte aus der DDR 66, 71, 79, 81, 92, 93, 102, 123, 134, 137, 160, 162 unverständliche Gesetze 164 Vergleichsberechnung 134 Verfassungsrang der DDR-Renten 28, 63, 77, 85, 86, 87 Verfassungswidrigkeit der Überleitung 16, 28, 29, 33, 40, 67, 70, 81, 84, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 117, 120, 121, 122, 123 – 130, 132, 133 f., 134 f., 141, 142, 143, 145 f., 149, 153, 156, 163, 164 Vertrauensschutz 70, 77, 85, 105, 134, 152, 162 Verwirkung 140 vollwertiges Eigentum 28, 63, 67 Wegfall von Renten 78, 79, 81, 86, 91, 93, 95, 99, 114, 133 f. Zahlbetragsgarantie 20, 21, 34, 73, 74, 84 f., 94, 95, 101, 117, 120, 123, 124 f., 129, 134, 136, 162
– Zermürbungsprozess der Bundesregierung 65 f., 128 f. – Zugangsrentner 25, 106, 125, 134 – Zusatzleistung 125 – Zusatz- und Gesamt-/Sonderversorgungssysteme 16, 21, 25, 67, 72, 73 f., 77, 82 ff., 86, 91, 100, 108, 110 – siehe auch Zusatz- und Gesamtversorgungssysteme – Zusatzversorgung für Balletttänzer 66, 77 – 81, 105, 137 – Zuschläge 162 Versorgungswerke 45, 104 Versprechung(en) 33 Vertagen 35 Vertrag 92, 103, 105, 110, 184 – Änderung 103 – Aufhebung 103 – Einhaltung der Verträge 26, 92, 138 – europäische Verträge 169, 171, 183 – ESM-Vertrag 17 – Fortbestehen des Vertragsrechts trotz Wegfall der Rechtsgrundlage 81, 92 – Ostverträge 169 – Lissabon-Vertrag 184 – Tarifvertrag 78 – Verfassungsvertrag 85 – Versicherungsverträge 49 – völkerrechtlicher Vertrag 76, 85 Vertrauensschutz 70, 86, 152, 162 – bei der Rentenüberleitung 70, 86, 105, 152, 162 Verwaltungsakt(e) 103 – Fortbestehen trotz Wegfalls der Rechtsgrundlage 81, 103 Verwirkung – von Renten 140 Völkerrecht 57, 69, 82, 141, 169 – allgemeine Grundsätze 55, 71, 82, 141 – Anerkennung der DDR 57, 69 – Bundesverfassungsgericht 169 – Eigentum 55 – 57, 71, 92, 141 – Einigungsvertrag 76, 87 – europäisches Völkerrecht 56, 141 – Staatsvertrag 69, 86, 87 – unmittelbar geltendes Recht 71 – Verfassungsvertrag 76 – Verfassungswechsel 56, 57, 82
Sachwortverzeichnis – Völkerrechtsordnung 57 – Vorrang vor Bundesrecht 55, 67 – kein Untergang von Renten bei Verfassungswechsel 82, 87 Volk 17, 42, 58, 64, 166, 186 – Volksverhetzung 41 – ohne Vertretung 26, 172 – Wohl des Volkes 166 Volks- und Berufsbildung 52, 97 Volkseigentum 22 – Privatisierung 22 Volkskammer der DDR 64, 65, 150, 160, 163 Volkspolizei der DDR 49, 54, 95, 126, 158 Volksverhetzung 169 Vollbeschäftigung 44 Vorbild Kelsen 60 Vorsorge 48, 86, 91, 105 – Eigenvorsorge 49, 104, 110 – private Vorsorge 48, 49, 104, 109 Vorteilsstreben 166, 167 Vorurteile – gegenüber Ost-Rentnern 171 Vorwerfbarkeit 119
Währungsunion 22 Wahl(en) 32, 43 – Bundestagswahl 18, 32 – Volkskammerwahl 64 Wahlperiode 29, 37 Wahrheit – der Berichterstattung 173 – Suche nach Wahrheit 172 Weisungsbefugnis – gegenüber dem MfS 144 f., 152, 154, 155 – rentenrechtlich unerheblich 154 Weiterbestehen – von Rechten trotz Wegfalls der Rechtsgrundlage 81 Weltanschauung 174, 178, 182 – Homogenität 182 Weltbild – Kelsens 178 Welthandel 57 Weltsicht 60 Werte 61, 119, 122, 124, 125, 138 Werturteile 178 Wertvorstellungen
241
– religiöser, philosophischer, kultureller Art 60 Wesen – deutsches 36 Westdeutsche 42, 43 Westrepublik 39 Wiederaufbau 40 Wiedervereinigung – besondere Bedingungen für die Schleifung des Grundgesetzes 192 – Wiedervereinigungsprozess 192 Willkür 36, 60, 61, 101, 106, 121, 122, 174, 180 – gesetzliche Willkür 180 – Willkürverbot 121 Wirtschaft 44, 46, 57, 63, 127, 147 – der DDR 127, 158 – private Wirtschaft 45 – Volkswirtschaft 44 – Wirtschaftslage 44 – wirtschaftliche Verhältnisse 85, 106 Wirtschaftsfunktionäre 147 Wirtschaftskrisen 44, 45 Wirtschaftsleben 63 Wirtschaftswissenschaftler 23, 52 Wissenschaft 148, 176, 179, 180, 182 – juristische 176, 179, 180, 181 Wohl der Bürger und des Staates 165, 166 Würde – des Gerichts 135 Wunder 18, 201 Zahlbetragsbegrenzung 124, 128 Zahlbetragsgarantie 20, 21, 34, 73, 74, 92, 94, 95, 101, 106, 117, 120, 123, 124 f., 129, 134, 136, 162 – Eigentumsschutz 124, 136 Zahlungsmittel 63 Zeitgeist 29, 169, 181 Zivilgesellschaft 193 Zollverwaltung der DDR 49, 54, 95 Zugangsrentner siehe Versorgungsüberleitung Ost Zukunftsoffenheit der Verfassung 183 f. Zusage 73 Zusammenarbeit mit Staatsorganen 101 Zusatz- und Gesamtversorgungssysteme 16, 21, 28, 34, 45, 47, 53, 67, 70, 73, 78, 82 ff.,
242
Sachwortverzeichnis
86, 91, 93, 94, 95, 100, 104, 110, 111, 123, 124, 126, 128, 129, 131, 137, 138, 155, 156, 159, 160, 162, 164 – Schutz 67 – Ziel 52, 112 – siehe auch Sonderversorgungssystem Zusatzprotokoll zum EMRK 195, 196 Zusatzversorgung 24, 25, 36, 47, 48, 68, 84, 87, 105, 106, 109, 110, 112, 126, 128, 129, 131, 137 – Höhe der Renten 53, 84, 112 – Ziel 52, 112
Zusatzversorgungssystem(e) 25, 46, 49, 51, 52, 53, 67, 70, 72, 82 ff., 86, 88, 99, 103, 104, 108, 112, 113, 117, 126, 133, 148, 198 – Balletttänzer 68, 109 ff., 113, 117, 136 – Mitglieder 49, 52 – Schließung 72, 73 – der technischen Intelligenz 148 – Zahl 52 – Zahl der Berechtigten 53 – Ziele 51 Zweiheit 16 Zwergengeneration 41


![Generationen-Mix: Gestalten statt verwalten [1 ed.]
9783896446893, 9783896736895](https://dokumen.pub/img/200x200/generationen-mix-gestalten-statt-verwalten-1nbsped-9783896446893-9783896736895.jpg)



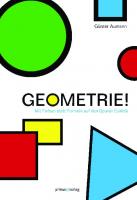


![Steuerreform statt Tarifanpassung [1 ed.]
9783428458493, 9783428058495](https://dokumen.pub/img/200x200/steuerreform-statt-tarifanpassung-1nbsped-9783428458493-9783428058495.jpg)
![Zweiheit statt Einheit: Versorgungsüberleitung Ost [1 ed.]
9783428545346, 9783428145348](https://dokumen.pub/img/200x200/zweiheit-statt-einheit-versorgungsberleitung-ost-1nbsped-9783428545346-9783428145348.jpg)