Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts: Festgabe für Kazimierz Opaƚek zum 75. Geburtstag [1 ed.] 9783428473908, 9783428073900
Der Beitrag, den die polnische Theorie und Philosophie des Rechts bei der Entwicklung der Rechtstheorie in diesem Jahrhu
144 104 59MB
German Pages 512 [515] Year 1993
Polecaj historie
Citation preview
Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts Festgabe für Kazimierz Opałek zum 75. Geburtstag
Herausgegeben von
Werner Krawietz und Jerzy Wróblewski
Duncker & Humblot . Berlin
Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts Festgabe für Kazimierz Opatek zum 75. Geburtstag
Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts Festgabe für Kazimierz Opatek zum 75. Geburtstag
Herausgegeben von
Werner Krawietz und Jerzy Wróblewski
Duncker & Humblot * Berlin
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts : Festgabe für Kazimierz Opatek zum 75. Geburtstag / hrsg. von Werner Krawietz und Jerzy Wróblewski. - Berlin : Duncker und Humblot, 1993 ISBN 3-428-07390-8 NE: Krawietz, Werner [Hrsg.]; Opatek, Kazimierz: Festschrift
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 1993 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Germany ISBN 3-428-07390-8
Vorwort Kazimierz Opafeks Rechtstheorie in internationaler Perspektive betrachtet Wer auch immer die Geschichte der Entwicklung der Rechtstheorie in diesem Jahrhundert, das in wenigen Jahren zu Ende geht, nachzuzeichnen bzw. zu rekonstruieren sucht, was hier nicht meine Absicht ist, kann nicht umhin, den Beitrag, den die polnische Theorie und Philosophie des Rechts dabei geleistet hat, aufrichtig zu bewundern. Mag sein, daß Recht und Staat es in Polen - ähnlich wie in einigen benachbarten, vormals marxistischen bzw. sozialistischen Rechtssystemen - in der Vergangenheit besonders schwer hatten, ihre eigene Identität zu gewinnen und zu behaupten, doch gilt dies jedenfalls nicht für die polnische Rechts- und Staatstheorie. Weit entfernt von jedem Uniformismus des Rechtsdenkens, hat sich die Rechtswissenschaft in Polen schon früh mit den philosophischen, psychologischen und soziologischen Grundlagen der rechtstheoretischen Konzeptionen befaßt, die im Verhältnis zu den traditionellen juristischen Disziplinen in den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur hier, sondern in aller Welt in der rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung eine ständig wachsende Bedeutung erlangt haben. I. 1. Mit dieser Festgabe, die Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Kazimierz Opaîek, Universität Krakow, zu seinem 75. Geburtstag am 13. Juli 1993 überreicht wurde, ehrt die internationale Wissenschaftsgemeinschaft, deren Vertreter sich in diesem Bande vereint haben, einen weit über die Grenzen seines Landes hinaus bekannten, geachteten und geschätzten Gelehrten. Er gehört heute nicht nur, national betrachtet, zu den profiliertesten polnischen Rechtstheoretikern und Rechts- und Moralphilosophen, sondern nimmt auch international seit vielen Jahrzehnten einen bedeutenden und bestimmenden Platz in der Gemeinschaft derjenigen ein, die auf diesen Gebieten forschen und lehren. Sein originärer Beitrag zur Normentheorie, dessen Eigenständigkeit und Fruchtbarkeit nicht nur in Polen Schule gemacht hat, reicht weit über den Bereich des Forschungsfeldes hinaus, das durch die staatlich organisierten Rechtssysteme und die Positivität allen Rechts abgesteckt wird. Er erstreckt sich nicht bloß auf die formalen, sondern auch auf die informalen sozialen Normen, deren Einbeziehung in die Rechtstheorie bei ihm auch zur Berück-
VI
Vorwort
sichtigung empirisch-soziologischer und rechtssoziologisch-theoretischer Forschungen führte. a) Wie in anderen marxistischen bzw. sozialistischen Rechtssystemen war die Rechtstheorie in Polen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkriege mit der Ausbreitung des Marxismus naturgemäß gewissen Forderungen ausgesetzt, die von seiten der Politik und der sie stützenden Rechtsideologie erhoben wurden. Hier waren es vor allem die von Opatek u.a. angestellten Forschungen im Bereich der Rechtsmethodologie, die zu einer heimlichen Emanzipation der Wissenschaft von einer unangemessenen Indienstnahme durch die Partei, d.h. von bloßer Parteipolitik und von einer am Prinzip der Parteilichkeit orientierten Rechtsideologie und Rechtspraxis, beitrugen. Er vermochte nachzuweisen, daß die speziellen Eigenschaften und Regeln, die nun einmal für den Umgang mit dem jeweils geltenden Recht und demzufolge auch für alle Methodologie des Rechts charakteristisch sind, auch gegenüber der allgemeinen Methodologie des Marxismus eigenständige Geltung besitzen und deshalb, wenn man dem Primat der Rechtspraxis folgt, auch in der Rechtswissenschaft berücksichtigt werden müssen. b) Bei ihren für die heutige rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung bahnbrechenden Untersuchungen konnten Opatek und andere seiner Kollegen, zu denen auch der Mitherausgeber dieses Bandes gehörte, sich auf frühe Forschungen von Leon Petrazycki (1867 - 1930) und Jerzy Lande (1886 1954) stützen. Aus ihnen ergaben sich Anregungen für den Aufbau einer diverse Stufen oder Ebenen der Rechtsbetrachtung unterscheidenden, parallelen Betrachtung verschiedener Aspekte des Rechts, die von ihnen konsequent in rechtsmethodologischer und rechtstheoretischer Hinsicht genutzt wurden. Im Ergebnis geht es dabei vor allem darum, bei der Analyse von Rechtstexten und ihrer Bedeutung im rechtlichen Handlungszusammenhang zu unterscheiden zwischen (1) der logisch-linguistischen Ebene, d.h. der Stufe der rechtsnormativen Aussagen, (2) der psychologischen Ebene des rechtlichen Erlebens, (3) der soziologischen Ebene des rechtlichen Verhaltens und - bisweilen noch, wenn auch nicht unumstritten! - (4) der axiologischen, d.h. der Werte objektivierenden Ebene. c) Was die Emanzipation der Wissenschaft von der Theorie und Philosophie des Marxismus angeht, war vermutlich die Entwicklung der polnischen logisch-philosophischen Schule, deren Anforderungen schon früh nachhaltige Auswirkungen auf das Rechtsdenken, insbesondere auf die Konzeption von Rechtswissenschaft und Ethik, zeitigten, ein ganz maßgebender Grund dafür, daß die Rechtstheorie sich hier besonders wirksam allen unangemessenen Forderungen zu entziehen vermochte, die vom philosophisch-methodologischen Standpunkt des Marxismus an sie herangetragen wurden. Vor allem vermochte die polnische Rechtstheorie und Rechtsmethodologie den ihr politisch angesonnenen Anpassungsleistungen, deren Vornahme und Erfüllung ihre
Vorwort
eigenen Denkansätze korrumpiert hätten, durch konsequent immer weiter vorangetriebene, hochdifferenzierte begriffliche Unterscheidungen auf den diversen Ebenen der Analyse zugleich auch kritisch zu begegnen. In der Tat sind die formallogischen, durch sprachliche Symbole vermittelten Notierungen, die in den Partituren der modernen Normentheorie, insbesondere der Normenlogik und Rechtslogik, verzeichnet werden, gegenwärtig nicht einmal zu denken ohne den Anteil, den die polnische Philosophie und Theorie des Rechts und der Moral seit dem Ausgang des 19. Jhdts. und im Verlaufe dieses Jahrhunderts, vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkriege, bis auf den heutigen Tag erbracht hat. 2. Dank seiner - international ganz einhellig anerkannten - überragenden wissenschaftlichen Autorität und Reputation fungiert Kazimierz Opatek seit den 70er Jahren als ständiger Ansprechpartner im wissenschaftlichen Dialog zwischen West und Ost. Auch seit dem Zusammenbruch des politischen Systems der Sowjetunion und der mit ihr verbundenen sozialistischen Staatenwelt hat er hier nach wie vor ein gewichtiges Wort mitzusprechen. a) Seine rechts- und staatsphilosophische wie seine moralphilosophische Kompetenz und seine verläßliche, jahrzehntelang immer wieder erneut praktizierte Präsenz auf Internationalen Symposien und Weltkongressen und in den internationalen Wissenschaftsgremien ließen ihn schon früh zu einer Art Transformator des rechtstheoretischen Denkens in West und Ost werden, der sich in beiden Richtungen höchst effizient betätigte. Es ist - zumindest was die deutschsprachige rechtstheoretische Diskussion in Österreich, der Schweiz und der Bundesrepublik angeht - das Verdienst von Opatek, daß für dieiwestliche Grundlagenforschung im Bereich von Recht und Staat nach dem Zweiten Weltkriege die Situation der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie in Polen zu keinem Zeitpunkt eine terra incognita gewesen ist. Seinen stets aktuellen, auch im System- und Theorie vergleich geübten Analysen ist es zu danken, daß die rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung Polens - vermittelt durch seine Problemsicht und sein Verständnis divergierender Auffassungen auch für den westlichen Beobachter zu jeder Zeit ein wohlbekanntes Terrain und ein ernstzunehmender Faktor gewesen und geblieben ist, der nach wie vor Anlaß zu vielfältigen Diskussionen und fruchtbaren Auseinandersetzungen bietet. b) Die westliche Rechtstheorie kennt auch das, was in Polen, wie in anderen vormals sozialistischen Staaten, unter dem Label „Theorie des Staates und des Rechts" durchaus selbstkritisch geforscht und gelehrt wurde, vor allem aus den deutschsprachigen Darstellungen von Opatek. Von ihm bezieht der Leser auch seine Kenntnis über die Einbettung dieser Entwicklung in das rechtstheoretische und rechtsphilosophische Denken in Polen um die Jahrhundertwende. Entsprechendes gilt für die intime Kenntnis der diversen Schulrichtungen der modernen Rechtstheorie, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit Blick
VIII
Vorwort
auf Recht und Staat an den polnischen Universitäten und Rechtsfakultäten, wie beispielsweise in Krakow, Lodz und Tonm sowie in Poznatì, gelehrt wurden, aber auch in Warszawa, Wrocîaw und Lublin Bedeutung erlangten. c) Es verdient festgehalten zu werden, daß Opatek und eine Reihe polnischer Kollegen, zu denen auch Jerzy Wróblewski, der Mitherausgeber dieser Festgabe, gehörte, in jenen für sie schwierigen Jahrzehnten durch ihren engagierten, bisweilen auch persönlich riskanten Einsatz unter Beweis stellten, daß es praktisch wie theoretisch nicht möglich ist, das Wissenschaftssystem eines Landes hermetisch abzuriegeln und die in ihm tätigen, mit dem jeweils geltenden Recht befaßten Wissenschaftler auf Dauer in den engen, politisch-moralischen Grenzen eines einzelnen staatlich organisierten Rechtssystems gefangenzuhalten. 3. Ferner hat das Rechtsdenken von Kazimierz Opatek schon früh und sehr nachhaltig die methodologischen und rechtstheoretischen Auffassungen der in Polen herangewachsenen, inzwischen längst in Amt und Würden befindlichen Generation von jüngeren Gelehrten und deren Schülern geprägt. Seine Vertrautheit mit allen Schulrichtungen und Trends der zeitgenössischen Rechtstheorie hat ihn, national wie international, zu einem gesuchten und gefragten Diskussionspartner im Wissenschaftsdialog werden lassen. Maßgebend ist dabei, daß Opatek - dank seiner internationalen Erfahrung und seiner subtilen Kenntnisse der modernen Rechtstheorie, aber auch jahrzehntelang unter den widrigen Anforderungen eines sozialistischen Rechtssystems stehend stets die Verbindung des polnischen Rechtsdenkens mit der internationalen Entwicklung der Rechtstheorie herzustellen, laufend zu unterhalten und auf Dauer zu gewährleisten wußte. In den letzten Jahrzehnten hat so mancher Fachkollege und Nachwuchswissenschaftler - nicht selten ohne es zu wissen - von den internationalen Kontakten und der Vermittlung profitiert, die Opatek stets uneigennützig einsetzt, wenn es um Auslandsaufenthalte oder sonstige Hilfestellungen für jüngere polnische Fachkollegen geht. Kein Wunder, daß unter diesen Umständen - auch und gerade nach dem Zusammenbruch der sozialistischen Staatenwelt - der Anschluß der jüngeren Forschergeneration an die internationale, rechts- und sozialwissenschaftliche Grundlagenforschung sich in Polen sehr viel ungehinderter und rascher vollzogen hat als in anderen postrealsozialistischen Staaten mit vergleichbarer Ausgangslage. II. 1. Naturgemäß muß es schwerfallen, eine Forscherpersönlichkeit von internationalem Range und Gewicht, wie Kazimierz Opatek dies nun einmal ist, in angemessener Weise zu würdigen. Jeder seiner Freunde und Kollegen kennt, wie der Autor dieser Zeilen gesprächsweise erfahren mußte, nur einen bestimmten, vom jeweiligen Zugang zur Person und vom Beobacfoterstand-
Vorwort
I
punkt abhängigen und geprägten Lebensausschnitt, aber jeder einen anderen. Auch sind Personen, Leben und Werk des hier zu Ehrenden schon bei anderer, früherer Gelegenheit seiner Emeritierung gewürdigt worden. Deshalb konzentriert sich der folgende, für den internationalen Leser gedachte Bericht auf einige wenige Lebensdaten und Eckpunkte des bisherigen akademischen Werdegangs von Opaïek. Dies geschieht in der Annahme, daß dem Leser auf diese Weise sehr viel leichter eine - zumindest zeitliche - Einordnung seines Lebens und seines Werks in das Gesamtpanorama der polnischen Rechtstheorie und Rechtsphilosophie möglich sein wird. a) A m 13. Juli 1918 geboren, studierte Kazimierz Opaïek 1936 - 39 an der Juristischen Fakultät der Universität Krakow. Nach Magisterium (1945) und Doktorat (1946) erfolgte seine Habilitation im Jahre 1952. Von 1954 - 61 war er als außerordentlicher Professor, von 1962 - 88 als ordentlicher Professor (Leiter des Lehrstuhls für Theorie des Staates und des Rechts) an der Universität Krakow tätig. Hier wurde er im Jahre 1988 emeritiert. b) A n sonstigen Ämtern und Ehrungen hat es ihm im Verlaufe seiner akademischen Laufbahn nicht gefehlt. 1954 - 56 amtierte er als Dekan der Juristischen Fakultät der Universität Krakow. 1956 - 62 war er Vize-Direktor des Instituts für Rechtswissenschaft der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warszawa. 1962 - 64 war er als Prorektor der Universität Krakow tätig. 1972 - 83 amtierte er als Präsident des Komitees für Politikwissenschaft der Akademie; desgleichen seit 1975 als Vorsitzender der Kommission für Rechtswissenschaft der Abteilung der Akademie in Krakow. 1976 wurde er korrespondierendes Mitglied, 1986 ordentliches Mitglied der Polnischen Akademie der Wissenschaften. c) Zu diesen Tätigkeiten kamen eine Reihe von internationalen Ehrungen und Ehrenämtern. 1967 verlieh ihm die Universität Pécs (Ungarn) den Titel eines Dr. h.c. Im Jahre 1971 wurde er Mitglied der Académie Internationale d'Histoire des Sciences. Daneben wirkte er von 1973 - 79 als Mitglied des Exekutivkomitees der International Political Science Association; ferner 1975 - 84 als Vorstand der polnischen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR). 1980 wurde er vom Hans Kelsen-Institut in Wien zum ausländischen Korrespondenten, 1981 von der Serbischen Akademie der Wissenschaften zum ausländischen Mitglied berufen. Im Jahre 1991 wurde er auf dem 15. Weltkongreß der I V R in Göttingen auf vier Jahre in das Präsidium dieser Vereinigung gewählt, dem er seither als Mitglied angehört. 2. Es gibt wohl kaum ein Land in Europa - unter Einschluß der USA und Kanada - , an dessen Rechtsfakultäten Kazimierz Opaïek in den letzten Jahrzehnten noch nicht als Vortragender zu Gast gewesen ist. Als gern gesehener kurzzeitiger Besucher, aber auch anläßlich längerer Forschungsaufenthalte in aller Herren Länder hat er dabei immer wieder zu den aktuellen Themen und
Vorwort
Problemen der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie seine Stellungnahmen abgegeben. a) Es wäre jedoch gänzlich verfehlt (und dies sei nur ganz vorsorglich bemerkt, auch mit Blick auf die vielfältigen Auslandserfahrungen von Opaïek, die den Horizont seines geschichtlichen und gesellschaftlichen Rechtsdenkens geweitet haben), eine Staatszentriertheit seines Rechtsdenkens zu vermuten oder ihm gar einen Eurozentrismus zu unterstellen. Dies verbietet sich schon deswegen, weil sein eigener Denkansatz weit davon entfernt ist, Recht und Staat zu identifizieren oder dem Staat (bzw. dem europäischen Staat) den Primat oder gar ein Monopol für Rechtserzeugung einzuräumen. Er ist vielmehr, ganz im Gegenteil, stets bestrebt, den gesamten Gegenstandsbereich des Rechts - unter Einschluß des nichtstaatlichen, gesellschaftlichen Rechts - auszuschöpfen, wie es eine wirklich allgemeine Rechtstheorie heute verlangt. b) A n einer unziemlichen Verengung des rechtstheoretischen Forschungsbereichs hinderte ihn vor allem die - hier bereits mehrfach erwähnte - von ihm wie auch von Jerzy Wróblewski in modifizierter Form propagierte „Lehre von den Rechtsebenen", die in der Rechtsforschung mit Grund die Vielzahl der zu berücksichtigenden Forschungsaspekte betont. Sie hat die von ihm vertretene Theorie und Philosophie der Normen (nicht bloß diejenige des Rechts!) davor bewahrt, die Orientierung an einzelnen speziellen Aspekten des Rechts, wie beispielsweise an den logisch-linguistischen der jeweils verwendeten Rechtssprache oder an den psychologischen des rechtlichen Erlebens bzw. an den soziologischen des rechtlichen Verhaltens, zu verabsolutieren. Die Internationalität und Interdisziplinarität dieser Festgabe und der in ihr vereinten Forschungsbemühungen, die alle partikularistischen Bindungen an einzelne staatlich organisierte Rechtssysteme transzendiert, kommt auch in dem Rahmenthema „Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts" zum Ausdruck, das einige zentrale Ansatzpunkte der von Opaïek erarbeiteten Normentheorie in das Zentrum der hier verfolgten Erkenntnisinteressen rückt. 3. Gleichfalls international, aber in einem anderen, etwas engeren Sinne sind die Forschungsvorhaben und Arbeitskontakte, die Opaïek seit Jahrzehnten in Österreich, vor allem in Graz, Wien und Salzburg, in der Schweiz, besonders in Zürich, und in Deutschland betrieb und nach wie vor unterhält. In der Tat gibt es gegenwärtig kaum einen ausländischen Rechtstheoretiker, der mit der zeitgenössischen Theorie und Philosophie des Rechts im deutschsprachigen Raum bis in kleinste Details vertraut und durch eigene, zum Teil auch bereits veröffentlichte Forschungen so eng verbunden ist, wie Kazimierz Opaïek. a) Schon seit Mitte der 60er Jahre hat Opaïek sich immer wieder erneut für kürzere oder längere Zeit, auch im Rahmen von Gastprofessuren, als Gast österreichischer Rechtsfakultäten in Graz, Wien und Salzburg aufgehalten. Er gehörte zu den Mitherausgebern der Proceedings eines 1979 in Graz veranstal-
Vorwort
XI
teten Internationalen Symposiums „Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz", in dessen Rahmen er in seinem eigenen Beitrag das Verhältnis von „Sprachphilosophie und Jurisprudenz" beleuchtete. Aus seiner Feder ist - wohl auf Anregung des Wiener Hans Kelsen-Instituts - kurz nach der posthumen Veröffentlichung von Kelsens Spätwerk „Allgemeine Theorie der Normen" eine der wohl sachkundigsten und eigenständigsten Kritiken des Normativismus der Wiener rechtstheoretischen Schule erschienen. Sein - bislang wahrscheinlich bedeutendstes - Werk, die „Theorie der Direktiven und Normen", entstand 1984 in einer ersten „Version eines beträchtlichen Teils" im Rahmen einer Gastprofessur an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und wurde dort 1986 auch veröffentlicht. b) Seit Beginn der 70er Jahre kamen hierzu immer häufiger auch Gastvorträge sowie kürzere oder längere Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren in Deutschland. Etappen dieser Forschungs- und Lehrtätigkeit waren u. a. die Rechtsfakultäten in Freiburg i.Br., Göttingen, Hannover, Mainz, München und Saarbrücken. Auf Einladung der Westfälischen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR), Sitz Münster, sowie der Münsterschen Rechtswissenschaftlichen Fakultät hielt Kazimierz Opaïek 1980, 1981 und 1991 eine Reihe von Vorträgen, die in der hier redigierten Zeitschrift RECHTSTHEORIE erschienen sind. Im Frühjahr 1993 weilte er wiederum als Gastprofessor in Göttingen. Wie seine Freunde und Kollegen wissen, arbeitet er seit Jahren an einer Monographie über „Deutsche Rechtsphilosophie der Gegenwart", auf deren Erscheinen man gespannt sein darf. c) A l l dies sind Gründe genug, Kazimierz Opaïek mit einer internationalen Festgabe seiner Freunde und Kollegen zu ehren. Daß sie in einem deutschen Verlag und unter einem deutschen Titel erscheint, ist rein zufällig. III. 1. Sieht man - anders als die praktische dogmatische Rechtswissenschaft von bestimmten konkreten Inhalten der Normsätze, mit deren Bedeutung letztere es zu tun hat, einmal ab, so gelangt man, wie dies für die Rechtstheorie und die rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung charakteristisch ist, zu Themen und Problemstellungen, die notwendigerweise recht abstrakter Natur sind. Angesichts der kritischen, bisweilen auf mangelnder Information basierenden Einstellung der Rechtsdogmatik gegenüber der modernen Rechts theorie, deren Erkenntnisse bei manchen Rechtsdogmatikern als von der Rechtspraxis ,abgehoben4 gelten, d.h. als von ihr zu weit entfernt, praktisch wenig hilfreich und daher irrelevant angesehen werden, hat Opaïek schon zu Beginn der 70er Jahre mit Grund darauf hingewiesen, es handele sich dabei „um ein Mißverständnis über die Art der Probleme, die zur Rechtstheorie gehören". In der Tat sind, wie die von ihm in unmittelbarem Anschluß an
II
Vorwort
einige polnische Vorläufer konzipierte „Theorie der Rechtsebenen" sehr eindrucksvoll belegt und nachgewiesen hat, die zur Rechtstheorie gehörigen Themen und Problemstellungen „von einer ganz anderen ,Stufe 4 als die der Rechtsdogmatik". Die Aufgabe und der Beruf der zeitgenössischen Rechtstheorie könne und müsse deshalb, wie er treffend ausführt, darin erblickt werden, daß sie nicht rechtsdogmatische, sondern „grundsätzliche Probleme zu lösen" sucht. Auf diese Weise gelange die Rechtstheorie, wenn auch der Gefahr von Irrtümern ausgesetzt, zu Resultaten, „die sich in einer Perspektive praktisch als bedeutender erweisen können als die Resultate einer Duplizierung der Arbeit der Rechtsdogmatiker". Auch hat Opaïek durch sein Werk - vereint mit Jerzy Wróblewski, dem Mitherausgeber dieser Festgabe - en passent mit einer alten, aber nur vermeintlich ,guten4 Praktiker- und Dogmatikerweisheit aufgeräumt, die besagt, daß die mit dem Recht und seiner Anwendung befaßte rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung und Rechtstheorie gleichsam aphilosophisch und völlig indifferent gegenüber den logisch-linguistischen, psychologischen und soziologischen Voraussetzungen operieren könne, wenn nicht müsse. Derartige Naivitäten verbieten sich heute von selbst, nicht zuletzt angesichts der Ergebnisse, die Opaïek hierzu in seinen methodologischen und rechtstheoretischen Forschungen auf allen „Rechtsebenen44 seiner Theoriearbeit vorgelegt hat. Es gibt für die moderne Rechtstheorie kein Zurück zu einer allgemeinen, bloß enzyklopädischen Rechtslehre, die - aphilosophisch und atheoretisch vorgehend - nur das aus der Fülle und Vielfalt des anfallenden Rechtsstoffs theorielos herausgreifen und lehren möchte, was ihr als wissens- und bewahrenswert erscheint, ohne es theoretisch zu begreifen, zu deuten und zu erklären. 2. Hier ist nicht der Ort, um - der weiteren Entwicklung vorgreifend einen Versuch zu unternehmen, das bislang von Kazimierz Opaïek vorgelegte rechtstheoretische und rechtsphilosophische Œuvre resümierend zu würdigen. Dies würde schon jetzt, wie man bei Durchsicht seines diesem Bande beigefügten Schrifttumsverzeichnisses ermessen kann, ein eigenes Buch erforderlich machen und muß deshalb künftigen Bemühungen um die Deutung seines Werks vorbehalten bleiben. Auch ist letzteres, was einige ganz wesentliche, schon angedeutete Schwerpunkte angeht, noch mitten im Fluß und in einer Reihe von wichtigen Punkten, wie Opaïek selbst konzediert, nicht abgeschlossen. Es sei jedoch erlaubt, wenigstens auf drei Aspekte in seinem rechtstheoretischen Schaffen hinzuweisen, die sich schon jetzt ganz deutlich abzeichnen und für die weitere Entwicklung seines Rechtsdenkens, insbesondere seiner Theorie und Philosophie des Rechts, von zentraler Bedeutung erscheinen: (i) Indem Opaïek seine Normentheorie in gegenständlicher Hinsicht nicht auf Rechtsnormen reduziert, sondern auch sonstige soziale Normen mit einbezieht, ist es ihm gelungen, die konventionelle Verengung zu durchbrechen, die
Vorwort
XIII
in den staatlich organisierten Rechtssystemen der modernen Gesellschaft, nicht zuletzt auch im kontinentaleuropäischen Recht, zu einer weitgehenden Identifikation von Recht und Staat - und demzufolge in der Theorie der Rechtsquellen zu einer Reduktion allen Rechts auf das staatliche (oder doch zumindest: auf das vom Staat abgeleitete!) Recht - geführt hat. Auch vermochte er in seinem deutschsprachigen Hauptwerk „Theorie der Direktiven und der Normen" die von ihm konzipierte Theorie der Normen einzubetten in eine sie umfassende Theorie der Direktiven. Letztere kennt neben den eigentlichen Normen auch andere, „gleichartige" Äußerungen, die mit ihnen im Hinblick auf Bedeutung und pragmatische Funktionen eng verwandt sind. Zu denken ist hier beispielsweise an Befehle, Bitten, Empfehlungen, Ratschläge, Warnungen, Wünsche u.a.m., die gleichfalls als verbale Instrumente der Beeinflussung des menschlichen Verhaltens fungieren und deshalb Vergleiche mit der Funktionsweise der Rechtsnormen ermöglichen. In Anknüpfung an die Philosophie der normalen Sprache, an die von J. L. Austin entwickelte Theorie der Performative sowie an dessen (leider unbeendet gebliebene) allgemeine Theorie der Sprechakte hat Opaïek mit Bezug auf alle diejenigen Fachwissenschaften, die sich mit den Normen und ihrer laufenden Anwendung befassen, klargestellt, daß wir es hier, insbesondere in Recht und Rechtswissenschaft, mit verschiedenen „Arten der Auffassung der Norm" zu tun haben. Es geht dabei um „Varianten zweier prinzipiell gegensätzlicher Standpunkte". Während nach der einen Auffassung die „Norm ein sprachliches Gebilde in der Form des Satzes im grammatischen Sinne" darstellt, handelt es sich nach der anderen Auffassung stets um eine im wesentlichen „nichtsprachliche Tatsache". In der Tat können Normen, insbesondere Rechtsnormen, einmal abgesehen davon, daß sie sich als sprachliche Äußerungen vom syntaktischen, semantischen und pragmatischen Standpunkt aus höchst unterschiedlich charakterisieren lassen, auch als Faktum mit ganz verschiedenartigen Tatsachen identifiziert werden. So hat es beispielsweise die Norm als Erlebnis mit einer psychischen Tatsache, die Norm als soziales Faktum, d. h. in ihrer Beziehung auf das Sozialverhalten, mit einer sozialen Tatsache zu tun. Mit seinen rechtsmethodologischen und rechtstheoretischen Forschungen hat Opaïek nicht nur die grundsätzliche „Opposition der linguistischen und der nicht-linguistischen Konzeption der Norm" diagnostiziert. Er hat auch zur möglichen Überwindung des Dualismus in der rechtswissenschaftlichen Auffassung der Norm, insbesondere der Rechtsnorm, maßgebend beigetragen. Freilich dauern die rechtstheoretischen Auseinandersetzungen noch an. Sie sind, wenn nicht alles trügt, auch noch längst nicht abgeschlossen. (ii) Im Hinblick auf die - den Nichtfachmann sehr häufig irritierende - Vielzahl und Vielfalt der normen- und rechtstheoretischen Richtungen und Schulen und auf die hieraus resultierenden Folgeprobleme, die sich vom Standpunkt eines Kognitivismus/Non-Kognitivismus bezüglich der Möglichkeit einer wissenschaftlichen Erkenntnis des Rechts ergeben, hat Opaïek durch seine rechts-
I
Vorwort
theoretischen und rechtsmethodologischen Forschungen in ganz herausragendem Maße zur Klärung zahlreicher, seit langem umstrittener Probleme und Zweifelsfragen beigetragen. a) In kritischer Auseinandersetzung mit dem Einfluß, den die Reine Rechtslehre der Wiener Schule und ihr Normativismus auf die Rechtstheorie in Polen vor dem Zweiten Weltkriege ausübte, vermochte er schon früh, sich einerseits von dem mit ihr üblicherweise verbundenen juristischen Positivismus, hier verstanden als staatsrechtlicher Gesetzes- und Rechtspositivismus, abzusetzen, andererseits jedoch zugleich auch den Gefahren zu begegnen, die der Normen- und Rechtstheorie von Seiten eines extremen Psychologismus wie eines extremen behaviouristischen Rechtsrealismus drohen. Diese Gefahren bestehen bekanntlich, wie er mit Grund bemängelt, vor allem darin, daß man versucht, die logisch-linguistisch durchaus identifizierbare Normativität allen Rechts einzuebnen oder gar zu ignorieren, um sie zu bloßen Regularitäten psychischer Vorgänge (beispielsweise faktischer Erwartungen) oder zu statistisch beobachtbaren - Regularitären des Sozialverhaltens (beispielsweise beobachtbarer Körperbewegungen) zu verflüchtigen. Opaïek selbst verficht eine Konzeption, nach der die Norm den „nicht-linguistischen Charakter der Dezision" besitzt. Die Norm als Dezision kann „erlassen werden, in Kraft sein und befolgt werden", und eben dies macht ihren „nicht-linguistischen Charakter" aus. Verglichen mit der „nicht-linguistischen Auffassung der Norm, die aus den Denkweisen der Rechtsdogmatik stammt", führt letztere die „Realität der Norm auf die autoritativen Akte (Willensakt, Befehl)" zurück. b) Der Beitrag seiner eigenen Theorie der Direktiven und Normen, insbesondere der Rechtsnormen, ist demzufolge vor allem in der vermittelnden Funktion zu erblicken, die seiner Konzeption - verglichen mit den obigen Richtungen und Schulen der modernen Rechtstheorie - ganz ohne jeden Zweifel zukommt. Jedoch liegt das eigentliche Verdienst und der Ertrag seiner rechtstheoretischen und rechtsmethodologischen Forschungen, wie ich sie sehe, auf einem ganz anderen Feld. Indem Opaïek die „Lehre von den Rechtsebenen", die bekanntlich nicht nur in der polnischen Rechtstheorie, sondern auch in anderen Ländern vertreten wird, einer philosophischen (ontologischen, epistemologischen) Überprüfung unterzieht, vermag er den Nachweis zu führen, daß die vielschichtige Problematik der Normen und ihrer Anwendung im Bereich des Rechts - ganz abgesehen von der alltäglichen Rechtspraxis und der sie kontrollierenden praktischen (dogmatischen) Rechtswissenschaft - weder allein auf die logisch-linguistische Ebene noch auf die psychologische oder soziologische Ebene reduziert werden kann und darf, da die eingangs schon geschilderte Problematik der Norm - ontologisch und methodologisch betrachtet - zugleich auf allen Ebenen der rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung auftritt. Dies muß naturgemäß zu schwierigen Folgeproblemen einer Integration der diversen Ebenen des Rechts bzw. des
Vorwort
X
Rechtsdenkens führen. Der Autor dieser Zeilen gesteht übrigens gern, daß er für seine eigene Version eines Multi-Level-Approach, der gleichfalls eine Mehrebenenanalyse des Rechts favorisiert [zuletzt in: RECHTSTHEORIE 24 (1993), Heft 1/2], aus den seit den 70er Jahren mit Opaïek und Wróblewski geführten Diskussionen sehr viel gelernt und auch manche Anregungen übernommen hat, für die er beiden Fachkollegen großen Dank schuldet. Dies hat ihn bei der Integration der fachsystematisch heterogenen Einsichten und Erkenntnisse aber nicht daran gehindert, hierfür eine Institutionen- und sytemtheoretisch fundierte Rahmentheorie des Rechts zu konzipieren. c) Auch die von Opaïek sehr treffsicher diagnostizierte, im letzten Jahrzehnt in der Tat immer weiter umsichgreifende Entwicklung von Spezialdisziplinen, wie beispielsweise Rechtslogik, Rechtslinguistik, Rechtsinformatik, Rechtskybernetik und Rechtssoziologie, hat zu schwierigen Problemen der Integration dieses fachsystematisch heterogenen Wissens in die Rechtstheorie geführt. Sie konnten bislang noch nicht zufriedenstellend gelöst werden, doch hat er auch hierzu eine Reihe von Vorschlägen beigetragen. Sie werfen zugleich auch ein neues Licht auf die alte, immer noch umstrittene Frage nach dem Stellenwert der Logik im Recht. (iii) Angesichts der Tatsache, daß das Recht der modernen Gesellschaft vom Standpunkt der Weltgesellschaft gesehen - durch den Verlust einer einheitlichen, alle staatlich organisierten Rechtssysteme miteinander verbindenden integrierenden Perspektive gekennzeichnet ist, kommt den normen- und sprechakttheoretischen Bemühungen Opaîeks um eine Theorieintegration ganz besondere Bedeutung zu. Indem die rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung die auseinanderdriftenden, sich immer stärker spezialisierenden Forschungstendenzen im Bereich des Rechts wieder zusammenzuführen sucht, erfüllt sie in puncto Rechtsforschung, wie gerade die rechtstheoretischen und rechtsmethodologischen Forschungen Opaïeks deutlich machen, neben zahlreichen anderen Aufgaben auch das Erfordernis der laufenden Selbstkontrolle und Fortentwicklung der Rechtstheorie. Indem die Rechtstheorie die diversen Levels der Theoriekonstruktion reintegriert, vermag sie - sehr viel besser als alle einzelnen Rechtsdogmatiken, die an die engeren politischrechtlichen Grenzen ihres jeweiligen Rechtssystems inhaltlich gebunden sind! das Recht der modernen Gesellschaft zu beschreiben, zu deuten und in seinen Funktionen und Leistungen zu erklären, also genau das zu tun, was die Rechtsdogmatik aufgrund ihrer andersartigen Aufgabenstellung und ihrer methodologischen Möglichkeiten nicht zu leisten vermag. Der Beitrag, den Opaîeks Philosophie und Theorie des Rechts hierzu bislang erbracht hat, kann insofern gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Unabgeschlossen und nicht vollständig aufgeklärt sind jedoch zwei Forschungsschwerpunkte, denen Opaïeks Erkenntnisinteressen, wie seine Freunde und Kollegen wissen, schon seit langem gewidmet sind.
VI
Vorwort
a) Sehr treffend hat Opaïek bei seiner Differenzierung diverser „Rechtsebenen" seit jeher das Erfordernis betont, präzise zu unterscheiden zwischen den Ebenen im methodologischen Sinne sowie den Ebenen im ontologischen Sinne. Geht man aus von dem - heute gewöhnlich sprachanalytisch bzw. sprachphilosophisch geläuterten - Verständnis und Verhältnis, das im Bereich der Normen zwischen Sprache und Performanz des Rechts sowie des Rechtshandelns besteht, so wird man in der Tat, wie er in einer Reihe von Veröffentlichungen herausgearbeitet hat, bezüglich des Rechtserlebens und Rechts/iöndelns auf die Ontologie des Rechts verwiesen. Selbstverständlich handelt es sich bei dieser Normenontologie bzw. Rechtsontologie, wie er eingehend belegt, um eine Ontologie neuer Art, die ihren Durchgang durch die sprachphilosophische Reflexion und Kritik nicht verleugnen kann. Man ist deshalb geneigt, Opaîeks Theorie der Direktiven und Normen ohne weiteres auch darin zu folgen, daß es sich mit Blick auf das Rechts erleben und Rechtshandeln, so wie dieses sich aus der Perspektive der Psychologie bzw. Soziologie des Rechts darstellt, vom sprachphilosophischen Standpunkt aus betrachtet, eben um verschiedenartige ontologische Ebenen handelt. Jedoch ist durch diese Vor-Ordnung der Philosophie vor die fachwissenschaftlichen Analysen des menschlichen Erlebens und Handelns noch nichts gesagt über die theoretische Eigenart des psychologischen und soziologischen Zugangs zum Recht. Vielmehr muß man sich fragen, ob das Recht, d.h. die Rechtsnorm in ihrer befolgten Form als Regel sowie das Rechtssystem, nicht zunächst einmal genuin fachwissenschaftlich, nämlich vom Standpunkt der Psychologie und Soziologie, behandelt sein muß, bevor nach den philosophischen (ontologischen und epistemologischen) Voraussetzungen und Implikationen eines derartigen Vorgehens gefragt werden kann. Es geht somit - abgesehen von den behandelten sprachanalytischen und sprachphilosophischen Prämissen - um die Frage, ob beim Aufbau einer Normentheorie des Rechts, die eine „nichtlinguistische Konzeption der Norm" verfolgt, zunächst die philosophischen ,Vorgaben', beispielsweise in ontologischer Hinsicht, zu klären sind oder ob nicht - zumindest im Bereich der empirischen Forschung, die zu der psychologischen und soziologischen Ebene gehört - die Reihenfolge zwischen philosophischer und fachwissenschaftlicher Forschung sich umkehren muß. Sollte dies zutreffen, dann wäre mit Blick auf das jeweils geltende Recht sowie das Rechtssystem zuerst die psychologische und soziologische Problemstellung herauszuarbeiten und erst, nachdem dies geschehen ist oder pari passu hierzu, sodann nach den philosophischen Prämissen jeder derartigen Grundlagenforschung, also beispielsweise auch nach den rechts- und sozialphilosophischen Voraussetzungen, zu fragen. In dieser Festgabe sind den hier ansetzenden Fragestellungen, die sich aus dem Verhältnis von Direktiven und Normen in rechtsontologischer Perspektive sowie bezüglich des Verhältnisses von Ontologie und Soziologie des Rechts ergeben, eigens zwei besondere Abschnitte gewidmet. Wie auch immer die Antworten hierauf letzten Endes ausfallen
Vorwort
X I I
mögen, so ist doch eins nach den Darlegungen von Opaïek schon jetzt gewiß: Die zeitgenössische Normen- und Rechtstheorie kann der Frage nach ihrer jeweiligen philosophischen Basis nicht entrinnen. Es gibt keine philosophisch indifferenten Positionen in der Rechtswissenschaft, schon gar nicht in der Rechtstheorie. b) Wegen des performativen Charakters der Normen, insbesondere der Rechtsnormen, der nach allem - im Anschluß an die von J. L. Austin, Searle und Hart durch Opaïek entwickelte nicht-linguistische Konzeption des Rechts - bedeutet, daß man auch in der Rechtspraxis ,Dinge mit Worten tun' kann, kommt der ontologischen/deontologischen Begründung des Rechts eine gesteigerte Bedeutung zu. Wer Dinge mit Worten tut, also beispielsweise ein Schiff vor seinem Stapellauf mit den Worten „Ich taufe Dich auf den Namen ,Königin der Meere'" auf eben diesen Namen tauft, oder - die Kompetenz hierzu einmal vorausgesetzt - jemand durch Aushändigung einer entsprechenden Ernennungsurkunde mit den Worten „Ich ernenne Sie zum Regierungsrat unter gleichzeitiger Berufung in das Beamtenverhältnis" eben hierdurch zum Beamten macht, dessen Tätigkeit ist, wie Opaïek betont, „nicht das Urteilen, daß die Sachen sich so und so verhalten", sondern ein „Eingreifen in den Verlauf dieser Sachen". Dieses Eingreifen besteht seinem Wesen nach in einem Normieren. Die nicht-linguistische Konzeption der Norm, so wie er sie rekonstruiert, unterscheidet deshalb zwischen (1) dem Normierungsakt, (2) der Norm als dessen Produkt und (3) der normativen Aussage, die ein „Ausdruck der Norm" ist. Dies bedeutet in der Perspektive seiner Normenontologie/ Deontologie, daß der Normierungsakt stets eine „psycho-physische Handlung" ist, die - von irgend jemand erbracht - zu den „performativen Akten vom Charakter der Dezisionsakte" gehört. Die Norm als das Normierte ist selbst „keine Aussage", sondern - verstanden als „Produkt des dezisionalen Normierungsaktes" - stets irgend jemandes „Dezision". Dementsprechend ist allein die normative Aussage, in der ein Sprecher darauf hinweist, daß er selbst oder irgend jemand anderer „durch seinen Normierungsakt vorher die Norm erzeugt" hat, eine „ A r t der performativen Aussage". Ganz abgesehen von den Konsequenzen, die diese Konzeption der Norm, insbesondere der Rechtsnorm, für die Frage hat, ob es eine eigenständige Normenlogik gibt, überhaupt geben kann oder geben sollte, oder ob wir uns mit einer deontischen Logik y verstanden als „Logik der normativen Aussagen", begnügen können und müssen, wird es Opaïek mit Hilfe dieser Unterscheidungen möglich, der Tatsache Rechnung zu tragen, daß das Recht, rechtssprachlich gesehen, für den Juristen und für die Rechtswissenschaft gewöhnlich als Text,gegeben' ist, aber gleichwohl nicht eine linguistische Auffassung der Norm einzunehmen. Vielmehr sucht er - seiner nicht-linguistischen Auffassung der Norm folgend - die Normativität des Rechts ganz im Sinne seiner Normenontologie in psychischer und sozialer Hinsicht, d.h. mit Blick auf das menschliche Erleben und Handeln, zu würdigen. Für ihn bedeutet, ,Dinge mit Worten tun' im Hinblick auf
Vorwort
das Recht und seine Anwendung, daß stets ein „Eingreifen in den Verlauf" dieser Dinge stattfindet, d. h. eine „Dezision konkreter Personen in der realen Welt, eine Dezision über das Verhalten anderer Personen oder über eigenes Verhalten". Dies wirft die - bis auf den heutigen Tag nicht zureichend behandelte - Frage auf, welche psychologische bzw. soziologische Theorie des Rechts wir wählen müssen, um das rechtlich konstituierte Erleben und Handeln der Normadressaten sozialadäquat begreifen und beschreiben, deuten und erklären zu können. Auch fragt es sich, ob bei der ontologischen Begründung der Normentheorie von einer psychologischen Theorie des Rechts auszugehen ist oder ob einer soziologischen Theorie des Rechts der Vorrang gebührt. Der Verfasser dieses Vorworts hatte seinen Mitherausgeber, Jerzy Wróblewski, schon vor Jahren gebeten, einmal die psychologische und soziologische Theorie des Rechts von Leon Petrazycki zu rekonstruieren, die auch den Ausgangspunkt und den Hintergrund für Opaîeks Theorie der Direktiven und Normen abgibt. Sein Beitrag wird hier als eine Art Vermächtnis vorgelegt, das für die künftige Auseinandersetzung von Belang sein dürfte. Es erscheint ferner nützlich, darauf hinzuweisen, daß auch Opatek selbst sich inzwischen (vgl. Bibliographie B. 237) in einer 1992 veröffentlichten Abhandlung zur psychologischen Theorie des Rechts von Petrazycki geäußert hat. IV.
Die normative Kommunikation im Bereich der Rechtspraxis kann somit, wie die Forschungen von Opatek zur Ontologie bzw. Deontologie des Rechts beweisen, auch und gerade unter Zugrundelegung einer sprachanalytischen und sprachphilosophischen Methode der Normenbegründung - aus den Gründen seiner Normenontologie - nur zureichend verstanden werden, wenn man dabei von einer nicht-linguistischen Auffassung der Norm ausgeht. Die zeitgenössische Rechtstheorie wird somit von ihm mit Grund auf die Klärung des Verhältnisses verwiesen, das zwischen der Rechtsnorm und dem menschlichen Rechtserleben und Rechtshandeln besteht. I m Zentrum der hier ansetzenden Rechtsforschungen steht die Frage, was es heißt, eine im Alltagsleben institutionell auf Dauer gestellte normative Regel, insbesondere eine Rechtsregel, zu befolgen. In dieser Problemstellung treffen sich die von Opatek in seiner Theorie der Direktiven und Normen verfolgten Erkenntnisinteressen mit denjenigen, die heute in der Normentheorie im Anschluß an die Spätphilosophie von Wittgenstein sowie die Theorie und Soziologie des Rechts von Max Weber verfolgt werden. Es geht somit beim weiteren Aufbau einer Theorie der Normen, insbesondere des Rechts, nicht etwa um die Preisgabe der sprachanalytischen und sprachphilosophischen Methode, deren weitere Verfolgung - ganz im Gegenteil - für die Rechtstheorie unerläßlich erscheint, sondern um die Einlösung der Postulate, die sich aus der mit ihr verbundenen neuen Normenontologie ergeben. Opatek hat hier der modernen Rechtsfor-
Vorwort
XI
schung ganz neue Wege gewiesen. Man darf deshalb darauf gespannt sein, zu welchen Antworten er im Hinblick auf das - stets recht ^sprachlich vermittelte - Rechts erleben und Rechts handeln derjenigen gelangt, die im Alltagsgeschehen an der praktischen Rechtskommunikation beteiligt sind. Wie Rechtsnormen als Direktiven, die vermöge ihrer „direktiven Bedeutung" das menschliche Verhalten, insbesondere das Rechtshandeln, zu beeinflussen vermögen, auf die menschlichen Verhaltensweisen einwirken, ist eine Frage, die - auch aus den Gründen seiner Normenontologie - jedenfalls nicht ohne Rekurs auf eine Theorie und Soziologie des Rechts behandelt werden kann. Die Erfahrungs- und Beobachtungsmöglichkeiten sowie die Einsichten, die uns die soziologischen Gruppentheorien zur Verfügung stellen, auf die auch Opaîek sich beruft, wenn er in seinen Erwägungen auf die „sozialen Gruppen" abstellt, erweisen sich aber insoweit als problematisch, als das Individuum und die Vereinigung von Individuen zu Gruppen in den rechtsrealistischen wie in den soziologisch fundierten Rechtstheorien nicht mehr zu den zentralen Variablen des Rechtsgeschehens gezählt werden. Auch erscheint Opaîek in seiner Theorie der Direktiven und Normen den modernen soziologischen Institutionen- und Systemtheorien des Rechts, die in der Theorie der Normenkommunikation von der Autopoiese allen Rechts ausgehen, längst sehr viel näher als er selbst wahrhaben möchte, wenn er von der Auto-Extensionalität bzw. der Auto-Intensionalität der Direktiven und Normen ausgeht, d.h. davon, daß „die Direktiven sich selbst denotieren und konnotieren".
V.
Habent sua fata libelli. Noch vor Veröffentlichung dieser Festgabe sind zwei der Beitragenden, nämlich Prof. Dr. Jerzy Wróblewski, zuletzt Universität Lodz, und Prof. Dr. Vladimir KubeS, zuletzt Universität Brno, verstorben. Mit ersterem hat der Verfasser nicht nur einen Kollegen und Freund verloren, von dem ursprünglich die Anregung zu dieser Festschrift ausging, sondern auch den Mitherausgeber, dem die Aufgabe zugedacht war, dieses Vorwort zu schreiben. Wenn ich dies hier statt seiner getan habe, so in dem Gefühl seiner Unersetzbarkeit, da mir sein immenses Wissen fehlte, und in dem schmerzlichen Bewußtsein der Lücke, die sein unerwarteter und allzu früher Tod [vgl. RECHTSTHEORIE 21 (1990), S. 133ff.] gerissen hat. Herausgeber und Verlag haben es deshalb für angebracht gehalten, keinen neuen Mitherausgeber zu kooptieren, sondern diese Festschrift so ins Werk zu setzen und zu veröffentlichen, wie er es mitgeplant hatte. Für Fehler und Versäumnisse bin selbstverständlich ich allein verantwortlich. Sein Beitrag in dieser Festgabe wie derjenige von Prof. Dr. Vladimir KubeS haben unter diesen Umständen gleichsam den Stellenwert von Vermächtnissen in Sachen Ontologie bzw. Psychologie und Soziologie des Rechts erlangt, die deshalb besondere Beachtung verdienen.
Vorwort
Nicht alle, die von den Herausgebern um einen Beitrag gebeten wurden, waren in der Lage, zu dem Projekt beizutragen, das mit dieser Festgabe verfolgt wird. Für den Herausgeber viel schmerzlicher ist aber der Gedanke, daß er - nicht zuletzt wegen des Rahmens, der jedem derartigen Vorhaben vom Umfange her gesetzt ist - bei weitem nicht alle diejenigen zur Mitarbeit einladen konnte, zu denen Kazimierz Opaïek im Laufe von Jahrzehnten enge Arbeitskontakte unterhalten hat. Dies gilt auch und gerade für eine Reihe von polnischen Fachkollegen, die in dieser internationalen Festgabe zu kurz gekommen sind. Der Herausgeber bittet hier um die Nachsicht und das Verständnis der Kollegen. Herzlich danken möchte ich allen Beitragenden zu dieser Festschrift, die mir in kollegialer Verbundenheit und Hilfsbereitschaft die langwierigen Herausgebergeschäfte leicht gemacht haben. Besonderer Dank gebührt dem Verlag Duncker & Humblot GmbH in Berlin, vor allem dessen Geschäftsführer (Gesellschafter), Herrn Professor Norbert Simon, der das Erscheinen dieses Bandes dank seiner großzügigen Förderung und Unterstützung möglich gemacht hat. Ferner danke ich sehr herzlich den Mitarbeitern an meinem Lehrstuhl für ihre wertvolle Mithilfe. Frau Assessor Petra Werner, Herr Assessor Andreas Schemann und Herr Dr. Athanasios Gromitsaris, Prof. a contratto an der Universität Lecce, zur Zeit als Stipendiat der A . v. Humboldt-Stiftung an der Universität Münster, haben eine Reihe von Beiträgen ins Deutsche übertragen bzw. schon übertragene Manuskripte lektoriert, wofür ihnen großer Dank gebührt. Für ihre unermüdliche Arbeit beim Druckfertigmachen der Manuskripte sowie bei der Durchführung und Überwachung der Fahnen- und Umbruchkorrekturen danke ich meiner Sekretärin Frau Andrea Freund. Das Korrekturlesen und mancherlei sonstige Hilfsdienste bei der Drucklegung dieser Festgabe wurden besorgt von den Herren cand. iur. Markus Ausetz und Athanassios Vrettis sowie von Frau stud. iur. Birgit Hoffmann und Herrn stud. iur. Matthias Neeb. Münster, im Frühsommer 1993 Werner Krawietz
Inhaltsverzeichnis I. Identifikation von Nonnen und Fakten in der Sprache des Rechts Aulis Aarnio On the Knowledge of Legal Facts through Norms
3
Fernando Galindo Die Reinheit der Sprache als Voraussetzung einer juristischen Methodenlehre
9
Stig J0rgensen The State of Legal Dogmatics
35
Stanley L. Paulson Kelsen in the Role of Critic
45
Michel Troper Deklaration oder Konstitution von Rechten
57
Roberto J. Vernengo Legal Rationality and Divergent Normative Logics
75
Zygmunt Ziembiùski Prescriptive and/or Descriptive Language in Legal Sciences
85
Π. Ethisch-politische Prämissen rechtsstaatlicher Autoritätsausübung Jan M. Broekman Sprechakt, Freiheit und Autorität
95
Ernesto Garzón Valdés Repräsentation und Demokratie
111
Hermann Klenner Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit
131
Aleksander Peczenik Morality, Law and Rights
141
Marek Zirk-Sadowski Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty
159
Inhaltsverzeichnis
χχπ
ΠΙ. Direktiven und Normen in rechtsontologischer Perspektive Jes Bjarup The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
171
Arthur Kaufmann Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
187
Vladimir Kubes Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
207
Wiestaw Lang The Ontology of Law
221
Karl A. Mollnau Maß und Geltung des Rechts
231
Csaba Varga The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
245
IV. Normativismus und Positivismus in der modernen Normentheorie Ralf Dreier Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
261
Hannu Tapani Klami I Johanna Kastinen / Minna Hatakka Legal Language and Evidence
279
Victor Knapp Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
295
Walter Ott Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus
307
Gregorio Robles Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
317
Robert Walter Das Problem des „normativen Syllogismus" in Kelsens „Allgemeiner Theorie der Normen" 347 Jerzy Wróblewski Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leon Petrazycki
357
Inhaltsverzeichnis
Χ Χ ΠΙ
V. Ontologìe versus Soziologie des Rechts? André-Jean Arnaud Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural Perspective
395
Vincenzo Ferrari Rechtssoziologie gestern und heute
405
Tomasz Gizbert-Studnicki The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
423
Ota Weinberger Der semantische, der juristische und der soziologische Normbegriff
435
Kenneth /. Winston Reflections on Model Institutions
455
Bibliographie Kazimierz Opaïek
467
Verzeichnis der Mitarbeiter
487
Identifikation von Normen und Fakten in der Sprache des Rechts
1 Festgabe Opatek
On the Knowledge of Legal Facts through Norms By Aulis Aarnio, Helsinki I. The problem of subsumption Tomasz Gizbert-Studnicki has pointed out that there is a certain asymmetry between theoretical and practical reasoning. The theoretical, such as research work in the natural sciences, does not always lead to positive solution of the problem. The result of even an extensive effort may be: We still don't know enough about this issue. Previous research results may be refuted, but without being able to create a new layer of knowledge. The parties of practical reasoning, on the other hand, will not tolerate a negative result claiming that: We don't know the answer. They aim to find a positive solution to the problem, to find an end to the conflict 1 . This issue becomes clearly evident in the determination of legal facts: It is not enough to confess lack of knowledge; what can be proved to have occurred must be determined, and it must be asked whether anything has happened which would justify or obligate the application of legal norms. The legal solution can always be ex post treated as syllogism comprising a major premise and a minor premise. The major premise shows the norm applicable to the event, whereas the minor premise defines the facts that have occurred. The problem solver's task is to place the facts into the realm of the major premise. This operation, or subsumption, is used to reach the conclusion, i.e. the judgment norm. The difficulty of the major premise is associated with interpretation of legal texts. Only when interpreted do legal provisions give enough information about legal norms. Interpretation, in turn, is linked with legal consideration and argumentation. Problems affecting it, or the question of legal rational discussion, are not considered here. Attention is focused on difficulties pertaining to the minor premise. Subsumption thinking rests on two basic assumptions: (1) The legal question and the factual question are two different issues. They can - and should - be solved independently of each other. The judge
1 Tomasz Gizbert-Studnicki , The Burden of Argumentation in Legal Disputes. Lecture in the symposium Legitimacy of Law, Murikka, Finland 1988 (to be published).
1*
Aulis Aarnio
4
must first determine what in fact has happened, and then he must apply the appropriate legal provision to the facts he has determined. (2) The legal claim regarding the facts and the (natural) scientific proposition can be proved according to the same outlines. In the same way as the researcher can determine whether or not a certain state of affairs exists, the judge can solve the factual side of the case2. The problems of the syllogism model, however, involve not only interpretation but also, specifically, whether content of the major premise and the minor premise can be determined in the assumed manner independently of each other. If this is impossible, the value of the syllogism model in the theoretical outlining of the solution is questionable. I I . Description of the facts and the claim regarding the facts The following norm can be taken as the departure point: "Who intentionally kills another should be judged." The first part of the norm has normally been called the description of the facts (F k ). Such description takes no stand as to whether or not a certain intended state of affairs exists. It merely presents a description of the states of affairs so that if a corresponding fact exists a certain legal consequence must be judged. If it is claimed that A at moment ti in place pi kills Β with a knife, a claim regarding the facts (F v ) has been presented. Then the process of events is described without being given any legal colouring. In the case considered here, the claim regarding the facts is the same as, e. g. the sentence "It rained yesterday." From the point of view of the legal system, the problem is whether the issue described in the claim (F v ) regarding the facts belongs to the sphere of the legal description (F k ), i.e.: whether there exists a correspondence between F k and F v (F k e F v ) . The event or fact becomes legally meaningful when, and only when, there is a sufficient correspondence relationship. If the occurred fact does not belong to any sphere of description of the facts, it does not fall within the scope of the legal system at all. This is often called qualification. Here one meets the difference between interpretation and qualification, which has often been emphasized in legal theory. Interpretation aims to specify precisely the meaning contained in the text, and it enables presentation of a particular norm statement. Qualification is used legally to classify a deed or state belonging to the factual world. The basic assumption given above in (2) requires that the accuracy of the claim regarding the facts (F v ) can be ascertained in precisely the same way as 2
Aulis Aarnio, On Legal Reasoning, 1976, p. 128ff.
On the Knowledge of Legal Facts through Norms
5
the truth concerning any other concrete chain of events. For example, witnesses' testimony makes it possible to determine whether or not A has acted in the alleged way. After it has been confirmed that F v has taken place, it is simply compared to the description of the facts (F k ) and, if a sufficient correspondence is found, the legal consequence specified in the norm is handed down. The issue is not so problem-free. Jerzy Wroblewski has defined a total of six different ways in which the legal description of facts can be formulated 3 . He uses the following pairs of concepts: (1) The definition requiring description / evaluation . The descriptive definition is a question, e.g. in the expression: "who kills another". Typical definitions requiring evaluation are, for example, "important reason", "fairness", and "special circumstances". (2) The simple / relative definition. The simple definition refers to objects and states of affairs which exist independently of the legal system. This includes philosophers' beloved tables and chairs but also, e.g. artworks, dreams, or even our physical living environment. The objects of the relative description of facts exist only through provisions of the legal system. Examples include marriage, a share in the estate of the deceased, contracts, crime, officials and Parliament. The relative definition thus creates institutional facts. (3) The positive / negative definition. A l l the examples given above belong to the scope of positive definition. The negative definition always includes the word "no" or some expression referring to the negative (e. g. "incompetent"). Various combinations of definitions can be formed. It is thus possible to have a definition which is simultaneously descriptive, simple and positive. Such a definition is, e.g. the word "book". Considerably more complex are definitions which require e.g. valuation and which are simultaneously relative, such as an unfair contract clause or a legal act contrary to bona fides. I I I . Facts and legal facts A fact as intended above can be as follows: someone at moment ti has been in place pi and has done deed Τχ. For instance, A has killed Β with a knife. In criminal procedure the prosecutor presents a factual claim about the said deed, based on the pretrial investigation. The claim is true if and only if A really has committed the alleged deed. Evaluation of the truth of the factual claim is normal weighing of the evidence.
3
Jerzy Wroblewski , The Problem of the So-called Judicial Truth, 1975, p. 19ff.
6
Aulis Aarnio
When the prosecutor considers that A has committed a murder and demands that A ought to be punished for it, a claim has been presented concerning a legal fact (F r ). It is no longer a question of "pure" fact which could be investigated independently of its legal background. A legal fact is a state of affairs belonging to the sphere of a certain legal description of fact. The fact has been qualified into a legal fact. A sentence like " A committed a murder" cannot be verified only by means of objective observations. The information obtained from reality must be interpreted, it must be given legal "colouring". In order to be able to prove that the claim of murder is true, we must have a clear concept of what "murder" means. This knowledge, in turn, depends on our concepts concerning the content of the legal system. The definition is no longer simple, but relative. In fact, all legal terms are relative, and just for this reason the definition of the correspondence relationship (F k e F r ) is difficult. Thus "contract" is specifically a legal construction (an institutional fact) not naturally existing as such, and therefore it is not a thing which can be detected in nature, for instance by simple observation. The contract as an institutional fact is made possible by means of so-called constitutive norms. The problem-solver often has to rely on dispersed single observations, witnesses' testimony, statements made by the parties concerned and other presented evidence to decide whether a contract meant by a constitutive provision has existed and if so, what kind of contract. In this sense the legal question is thus always linked to the factual question. The problem-solver's knowledge of provisions of contract law determine the way in which he evaluates the facts made available to him. When speaking about eidetic constitutive norms, Amedeo Conte pointed out (1) that such norms cannot be recognized from practices themselves, because they are the preconditions of practices, and (2) that single phenomena cannot be identified by means of the eidetic-constitutive provision 4 . We cannot know anything about a concrete deed on the basis of our knowledge of the provisions. We can merely understand the phenomenon. With respect to institutional facts, such as a contract, marriage, authorization, etc., the application of law, however, is precisely a question of understanding facts. We give meaning to the events through provisions. In this respect I refer only to the pioneering work done by G. i f . von Wright in the sphere of deontic logic and the logic of actions5. In our case, too, the issue is that we try to distinguish the legally relevant event from that which is legally irrelevant. This is where provisions (knowledge of provisions) play a central role. 4 Amedeo Conte , Konstitutive Regeln und Deontik, in: Edgar Morscher / Rudolf Stranzinger (Hrsg.), Ethik, 1981, p. 82ff. 5 G. H. von Wright, A n Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action, 1968, passim.
On the Knowledge of Legal Facts through Norms
7
In many cases consideration of fairness or some other evaluation may even affect evaluation of facts. Then the problem-solver's value-tainted overall concept of the issue is reflected in the way he sees some detail. He does not inspect different events as unconnected things; he tries continually to combine them in order to form some kind of coherence. Combining, in turn, is possible only if the problem-solver has at his disposal a value system enabling him to see "ties of fairness" between different events. Ascertainment of a correspondence relationship (F k e F r ) thus is not a simple operation of logic. Description of facts and reality are very seldom in a clear isomorphic relationship; legal issues and facturai issues are intertwined. Legal qualification of facts means solution of legal questions, i.e. the norm gives the problem-solver a certain framework and interpretation of the facts, in turn, makes the legal meaning of issues more specific. I V . Intertwinement of knowledge of provisions with the knowledge of facts We can, however, go one step further and ask whether even a factual claim (F v ) can always be proved fully independently of the factual description (F k ) concerning the issue. Is it possible that in some cases our knowledge of the legal system affects even what we think we know about reality itself? For example, can the conception about A's act at moment ti in place pi depend on what we know about the content of legal provisions? The question can be illustrated by reconstructing a situation in which what has actually happened is uncertain. Let us assume that the prosecutor claims that A has killed B. The case can be assumed to have several unclear issues. It is not certain that A at moment ti was at place pi, or that he has acted in exactly the alleged way, or that A has acted intentionally, etc. It is clear that separated from legal deliberation the contention about A's behaviour is a factual claim, and its evaluation is one of probability. But when it is deliberated whether the proof of A's behaviour can be considered legally sufficient in this case, the question is not any more merely a factual one. The question of the sufficiency of proof is always a question of whether proof can be considered sufficient with respect to some norm. The judge may think, for instance, that sentencing A for murder on the basis of this presented proof would be unreasonable. Therefore proof is interpreted to constitute the essential elements only of some other crime, e.g. involuntary manslaughter or abandonment. A t the same time this means, however, that in the judge's opinion, reality is not what has been claimed. Knowledge concerning legal description of facts (essential elements) affects how proof, i.e. facts claimed to have happened are evaluated. Some aspect is considered to be unproved (A has not acted in way T) on the grounds that, in view of the whole, it would lead to an
8
Aulis Aarnio
unfair or even unjust result. The claimed event simply is not considered to have happened. Example: The pretrial investigation examines whether a municipal official has taken a bribe. In advance the policeman has the conception that a certain town planning solution has come about partly under the influence of corruption. The advance conception is reflected - as taught by hermeneutics - in how the whole is perceived. Single events and deeds, for their part, are components of the whole, and their meaning is derived from the whole. If the preknowledge (Vorwissen) of the corruptness of the act is very strong, it is possible that in reality things which never occurred will be "seen". Pieces to the puzzle of presenting evidence are put together so that reality and the "true" picture of it given ex post do not correspond with each other. The same may occur when a certain interpretation concerning the content of a norm begins to dominate the problem-solver's thinking, and is reflected in how he perceives factual events.
In its clearest way this concerns cases where it is unsure which description of a deed the presented evidence is applicable to. For instance, the judge has to consider the issue in the light of two parallel (alternative) descriptions of the deed. It may be asked: Was the deed a serious theft, or merely a "regular" theft? If the sentence for the former would be unfairly harsh in view of the entire set of facts about the case, it may happen that only a deed involving a lighter sentence "is considered to be proved". Many so-called mitigating circumstances play in this way an important role in the deliberation of facts. They make it possible to preserve the conceptual clearness of the crime type A , because the content of criteria is not tampered with; the only problem solved is the problem concerning fulfilment of the criteria . A n event of crime type Β is thus considered to have been proved. Consideration of the facts thus may depend on the problem-solver's (subjective) concepts. Those most clearly supporting this view include some American realists. Jerome Frank claims that even the solving of a factual question depends on the judge's intuition. The court's task is to reconstruct factual material, but this reconstruction does not take place only on the basis of "determination". The judge makes the facts what his overall evaluation requires them to be. Although we do not go as far as Frank, it can still be claimed that (1) the picture that can be obtained from the actual event depends on the problem-solver's experienced knowledge, and that (2) at least in certain cases, (advance) concept concerning the legal system affects what is considered to be proved true. In this respect the factual claim (F v ) may depend on the factual description (F k ). Even undisputed facts should always be evaluated with respect to the legal system. Intertwined are knowledge concerning the legal system, information obtained about facts, experienced knowledge pertaining to society and the problem-solver's own outlook on life.
Die Reinheit der Sprache als Voraussetzung einer juristischen Methodenlehre Von Fernando Galindo, Zaragoza Wenn es eine gemeinsame Charakteristik gibt, die heute sowohl das philosophische als auch das wissenschaftliche Denken kennzeichnet - und Philosophie und Wissenschaften sind immer weniger weit voneinander entfernt, ähnlich wie die Sozial- und Naturwissenschaften - , dann ist es die des Interesses an einer Annäherung an die alltäglichen Aktivitäten von Technikern, Wissenschaftlern und Philosophen. Sie besteht darin, daß praktische Vorschläge unterbreitet werden, die bei diesen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit und Einstellung Berücksichtigung finden. Deshalb darf es nicht verwundern, daß der Forschung, die sich auf das Studium des Entscheidungsmechanismus konzentriert, über den sich die Handlungen von Philosophen, Wissenschaftlern, Staatsbürgern und Juristen abwickeln, ein theoretischer Charakter nachgesagt wird. Ich beziehe mich hier auf die sogenannte Argumentationstheorie. In den „Natur"-Wissenschaften wird demgegenüber eher von der Geschichte der Wissenschaften gesprochen. Diese Forschung ist, wenn wir uns auf das Gebiet des Rechts konzentrieren, nicht auf das Studium des Rahmens praktischen Handelns begrenzt. Sie ist bereits auf das Studium der Charakteristik dieser Aktivitäten übergegangen, die mal beschrieben, mal rekonstruiert werden. Mal geht es darum, daß deren Mitteilungen erfüllt werden, mal geht es um den Horizont der Erkenntnis, von dem aus sie erklärt werden. Diese Haltungen sind auch näher ausgelegt worden. Was bislang noch nicht geschaffen worden ist, ist eine Theorie, die eine ausreichende Erklärung der juristischen Aktivitäten abgibt und zugleich konkrete Handlungsvorschläge unterbreitet. Zur Zeit gibt es nur Vorschläge und Skizzen, aber die Entwicklung der Theorie kommt nicht voran. U m es konkret auszudrücken: Bisher ist noch keine zureichende Theorie der Rechtsauslegung entwickelt worden, die auf den durch die juristische Argumentation festgesetzten Rahmen eingeht. 1 Es gibt auch keine Anwendungstheorie, die die Vorschläge näher prüft und ausarbeitet, die in den Diskussionen der letzten
1
Von Interesse und Bedeutung bei der erneuten Beschäftigung mit dem Thema der Rechtsauslegung ist die Arbeit von Viktor Knapp, Auslegung im Recht, in: ARSP 74 (1988), S.145 - 153.
10
Fernando Galindo
Jahre unterbreitet wurden. 2 Dagegen gibt es bereits Rekonstruktionen oder Definitionsvorschläge des Rechts, die wenigstens mit dieser Diskussion rechnen. 3 Immerhin existieren theoretische Vorschläge, die an die Philosophen und Rechtstheoretiker adressiert werden, aber es gibt nur wenige Vorlagen, die an die Juristen selbst gerichtet sind bzw. an die Dogmatik. Leider findet in der Rechtstheorie keine Diskussion über die verschiedenen Typen von Rationalität oder die diversen Methoden statt, mittels derer es möglich ist, das Recht zu studieren. Vielleicht verdankt man dies der Tatsache, daß der Weg zu Theorien, die die Tätigkeit der Juristen adäquat rekonstruieren, bislang noch nicht hinreichend geebnet ist. Tatsächlich werden in der Rechtsphilosophie zahlreiche heterogene Auffassungen geäußert. Dies führt zu Diskussionen, die parallele, immer viel zu theoretische Wege gehen, obwohl die Notwendigkeit, das Recht aus unterschiedlichen Perspektiven, mittels verschiedener Methoden oder vom Ganzen her zu untersuchen, wie es bei anderen Wissensbereichen der Fall ist, ständig wächst. Deshalb wird immer wieder der Ruf nach einer Methode laut. Der Bereich der Methodenlehre ist der Ausgangspunkt und die Grundlage all dessen, was im Recht weiterhin von Bedeutung ist. Es ist zu klären, inwieweit in diesem Zusammenhang von der Reinheit der Sprache als Methode Gebrauch gemacht werden kann. Dafür werde ich mich als erstes auf den methodologischen Paradigmawechsel der letzten Jahre beziehen (I.). Zweitens werde ich zusammenfassend die Reaktion auf diesen Wechsel seitens der Rechtsphilosophie darstellen (II.) Abschließend werde ich auf bestimmte normativistische Positionen eingehen, wobei ich die in den ersten beiden Abschnitten genannten Angaben und das Prinzip der Reinheit der Sprache im Rechtsbereich als Methode berücksichtigen möchte (III.). I. Die gegenwärtigen Positionen der Philosophie und der wissenschaftlichen Forschung sind nicht neu. Es gibt mehr oder weniger w.eit zurückreichende 2 Siehe die Vorschläge zum Thema der Rechtsanwendung und ihrer Pluralität, wobei die Berücksichtigung des legalen Textes als einziger Ausgangspunkt der Anwendung kritisiert wird, bei: Karl-Heinz Ladeur, Computerkultur und Evolution der Methodendiskussion in der Rechtswissenschaft. Zur Theorie rechtlichen Entscheidens in komplexen Handlungsfeldern, in: ARSP 74 (1988), S. 218 - 238. 3 Vgl. beispielsweise: Ralf Dreier, Rechtsbegriff und Rechtsidee. Kants Rechtsbegriff und seine Bedeutung für die gegenwärtige Diskussion, Frankfurt a. M. 1986; ders., Der Begriff des Rechts, in: Neue Juristische Wochenschrift 1986, S. 890 - 896; Norbert Hoerster, Die rechtsphilosophische Lehre vom Rechtsbegriff, in: Juristische Schulung 1987, S. 181 - 188; Werner Krawietz, Neues Naturrecht oder Rechtspositivismus?, in: RECHTSTHEORIE 18 (1987), S. 209 - 254 sowie ders., Der soziologische Begriff des Rechts, in: Rechtshistorisches Journal 7 (1988), S. 157 - 177.
Die Reinheit der Sprache
11
geschichtliche Präzedenzfälle dafür in unserer Kultur. 4 Aber hier ist hervorzuheben, daß eine der Hauptcharakteristiken darin besteht, daß diese Positionen mit dem Ziel konstruiert werden, die Bedingungen des Wissens heute neu zu entwerfen. Es geht mit anderen Worten darum, die Charakteristiken des gegenwärtigen „wissenschaftlichen Paradigmas" zu erkennen. 5 Vor allem wird die Gültigkeit der Kategorien angezweifelt, auf die sich die Wissenschaft und die Kenntnis der Modernität stützt. Dies gilt vor allem mit Blick auf das Vertrauen in das Subjekt als Ausgangspunkt der Erkenntnis und das Vertrauen, das in die Entwicklung von abstrakten Sprachen als das Objekt des typischen und der Philosophie eigenen Wissens gesetzt wird. Ihr Hauptziel ist jetzt, die Unzulänglichkeit von Theorien aufzuzeigen, die sich als sicher wähnten, weil sie als ihr hauptsächliches Wissensobjekt die Rekonstruktion der empirischen Objekte in Angriff genommen hatten. Ansatzpunkt waren dabei funktional äquivalente Strukturen. Sie wurden rekonstruiert mit Hilfe verschiedener formaler Kommunikationszeichen, von denen im folgenden die Rede sein wird. Es ist schon häufig gesagt worden, daß die Philosophie im Laufe des X X . Jahrhunderts einen Wandel erfahren hat. Wenn im Laufe des X I X . Jahrhunderts der Zweck der Philosophie das Herausfinden der Bedingungen und Charakteristiken des Wissens war, wobei von den Charakteristiken des kognitiven Individuums ausgegangen wurde, so stellte man im Laufe des X X . Jahrhunderts das Prinzip auf, daß das Ziel der Philosophie weder das Studium von transzendenten Themen noch die Charakteristiken des Subjekts sein können, weil über diese Themen, soweit sie metaphysisch sind, gar nicht gesprochen werden kann. 6 Gegenstand der Diskussion wurde daher der konventionelle Charakter des Wissens, den die Philosophie in den Mittelpunkt des Studiums der Sprache rückte, sofern die Sprache Übereinstimmung oder Konvention mit dem Wissen bedeutet. Von dieser Einsicht ausgehend, wurde die Sprachphilosophie zur Philosophie par excellence. Eine Philosophie, die als Studienobjekt die Sprache hat, machte es zugleich möglich, den Rahmen des Wissens und damit seinen konventionellen Charakter zu berücksichtigen. Dies war aber nur der gemeinsame Ausgangspunkt der vorherrschenden Philosophie im Laufe des X X . Jahrhunderts. Im weiteren Verlauf kam es zu 4
Siehe zu diesen Präzedenzfällen Theodor Viehweg, Topik und Jurisprudenz, München 1974, S. 10 - 30, der seine Gründe mit klassischen Ausführungen (Aristoteles) zur Argumentation verbindet. Vgl. ferner: Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt a.M. 1981, Bd. I , S.44ff.; Hans Georg Gadamer, Verdad y Mètodo. Fundamentos de una hermeneùtica filosofica, Salamanca 1977, S. 638ff. Diese Position wird gewöhnlich mit der bestehenden Wissenschaftstheorie verknüpft: KarlOtto Apel, Transformation der Philosophie, Buch I, Frankfurt a.M. 1976, S. 22 - 34. 5 Hierzu und zum folgenden: H. L. Brown, La nueva filosofia de la ciencia, Madrid 1983, S. 105 - 223 et passim, der eine Zusammenfassung der Charakteristiken des wissenschaftlichen Paradigmas in der heutigen Zeit bietet. 6 Hierzu und zum folgenden: Apel (FN 4), Buch 2, S. 311 - 329.
12
Fernando Galindo
einer Aufspaltung. Über den logischen Neopositivismus, die analytische Philosophie, den frühen Wittgenstein und den späten Wittgenstein sehen wir, daß das Studium der Sprache als außerhalb des Studiums des Erkenntnisprozesses liegend angesehen wird. Das Studium der Sprache bleibt unabhängig und wird am Ende auf die Konstruktion von geläuterten Sprachen reduziert. Es ist nicht interessiert an der Reflexion über die Bedingungen der Erkenntnis oder jeder anderen Reflexion, die sich nicht mit der Entwicklung von reinen Sprachen befaßt. Ziel der Sprachphilosophie ist es, eine abstrakte Sprache herzustellen, die den nicht metaphysischen Zielen gerecht wird: den wissenschaftlich nachweisbaren und nachprüfbaren. Zusammen damit erscheint in der Praxis eine andere Metaphysik: die der Repräsentationsformen. 7 Nach und nach nimmt das Interesse an der Wirklichkeit ab, über die die Repräsentationen nachzudenken haben, und an dem Leben, im Hinblick auf das sie aktualisiert werden müssen.8 Schließlich glaubt man, daß die genannten Repräsentationen das gleiche sind wie das Leben oder sein Inhalt. Die formale - logische und mathematische - Sprache, die andererseits eine große historische Tradition hat, wird so verstanden, daß sie die geeignetste Methode für die Beschreibung oder Konstruktion der Gesellschaft biete. Die Philosophie der Sprache verzichtet damit auf die Diskussion über das Subjekt oder das Objekt sowie auf die Diskussion über den konventionellen Rahmen der Erkenntnis. Ihr einziges Ziel ist ein äußerliches Objekt, eben die Konstruktion und die Vervollkommnung der Sprache, mit der man am besten die empirisch beweisbare Wirklichkeit beschreiben oder rekonstruieren kann. Die beste ist ganz offensichtlich die reinste Sprache. Das bedeutet im Recht die Konzentration des Studiums auf die Rechtssprache, auf die sogenannten normativen Präpositionen und ein Beiseitelassen des Studiums der Tatbestände und juristischen Bewertungen. Die Theorien befassen sich heutzutage am liebsten mit der Kommunikation: Sie bringen zum Ausdruck, daß weder die Objekte noch deren Verbindungen noch die verschiedenen Sprachen, in denen sie ausgedrückt werden können, als ganz rein zu erkennen sind, weil alle Objekte und ihre festgesetzten Verbindungen beeinflußt sind von der Perspektive oder der „Beobachtung" des Beobachters. Letzterer ist kein einzelnes Individuum, sondern dieses ist in einer bestimmten Kollektivität integriert (nicht nur in der wissenschaftlichen). Das genannte Individuum erkennt von einem bestimmten Horizont aus: von dem der Überzeugungen, Werte, Gebräuche und dem Glauben der sozialen Gruppe, in der es lebt. 9 7
Ebd., S. 313. Siehe dazu John Dewey, La reconstruction de la filosofia, Übersetzung von Amado Lâzaro Rios, Barcelona 1986, S. 155 - 158. 9 Insoweit unterscheidet sich die individuelle menschliche Erkenntnis nicht von der sozialen. So zum Beispiel Richard Rorty, Méthode, science sociale et espoir social, in: Critique, Buch 471 - 472, 1986, S. 888f. Mit Blick auf die Verbindung der Methoden 8
Die Reinheit der Sprache
13
Das bedeutet anzuerkennen, daß nicht einmal die Strukturen, über die die formalen Analysen Auskunft geben, ein Wesen haben. Manche sagen, daß sie höchstens das haben, was die Kommunikationskultur oder -gewohnheiten selbst schaffen, an denen diejenigen teilhaben, die die Analyse vornehmen oder die Strukturen anfertigen. Daher haben sie keine eigene Entität und müssen, um bestätigt zu werden, vom Verständnis oder den Überzeugungen derer ergänzt werden, die sie benutzen, damit sie auf diese Weise einen Sinn erhalten. Deshalb ist heute ganz allgemein die Ansicht verbreitet, daß die formalen Theorien zwar Hilfsmittel sein können, es aber nicht möglich ist, sie exklusiv zu gebrauchen, um sich mit ihrer Hilfe bessere Kenntnisse der Realität zu verschaffen. 10 Zugleich wird damit akzeptiert, daß die genannten Theorien einfache Instrumente zur Annäherung an die Wirklichkeit sind. Diese Vorgaben werden sowohl gegenüber den analytischen Theorien als auch gegenüber den empirischen Theorien oder Instrumenten gemacht. Es ist also zuzugeben, daß die Suche nach der formalen, universalen Sprache, letzten Endes gemeinsames Ziel aller „reinen" Theorien, an Bedeutung verliert. Sie bleibt ein Problem, das nicht verschwindet, aber einen nachrangigen Stellenwert erhält durch das Auftreten eines anderen Problems, das philosophisch und wissenschaftlich den vorrangigen Platz einnimmt. Es geht nunmehr darum herauszufinden, unter welchen Bedingungen oder Umständen sich das Wissen verändert. Häufig wird gesagt, daß die genannten Bedingungen oder Umstände das Wissen selbst sowie die Konstruktion von Theorien beeinflussen. Auch wird gesagt, daß die „Bedingungen des Vortrags", das „Interesse" an der Erkenntnis und die „Hermeneutik der Sätze oder Wissensgegenstände" usw. berücksichtigt werden müssen. Wenn wir diese Vorschläge historisch situieren, dann deshalb, weil seit Ende der sechziger Jahre, um nicht noch weiter zurückgreifen zu müssen, in zahlreichen Polemiken in verschiedenen Wissensbereichen offenkundig wurde, daß das nicht nur von den transzendentalen Kategorien (des Subjekts oder der Sprache) ausgeht, sondern von den Konstruktionen, Bräuchen, Bewertungen und Ansichten oder kulturellen Überzeugungen eines weiten Kreises von Subjekten, in welchem aus dem gleichen Grunde verschiedene Faktoren interferieren. Als Ergebnis von alldem wurde klar, daß die diversen Faktoren, die bei der Bearbeitung eines Problems berücksichtigt werden müs-
allgemein Walter R. Fisher, Technical Logic, Rhetorical Logic and Narrative Rationality, in: Argumentation 1 (1987), S. 3 - 21. 10 Auch wenn der Wert der deduktiven Studie der praktischen Begründung zugegeben wird, weist man auf die philosophische Unzulänglichkeit einer rein deduktiven Betrachtung der genannten Begründung hin, zum Beispiel bei Bruce Aune, Formal Logic and Practical Reasoning, in: Robert Audy (Hrsg.), Action, Decision and Intention: Studies in the Foundations of Action Theory as an Approach to Understanding Rationality and Decision, Dordrecht 1986, S. 301 - 320, 318.
Fernando Galindo
14
sen, insgesamt für dessen Lösung relevant sind und nicht nur einer allein: Genau gesagt, geht es darum, wie schon der Neopositivismus es forderte, das Problem mittels seiner Repräsentation in einer formalen Sprache zu rekonstruieren. Die Hermeneutik legte - ausgehend vom Studium der humanwissenschaftlichen Arbeiten - dar, daß die Lösungen etwas mit der kulturellen Geschichte der Personen zu tun haben, die an dem jeweiligen Geschehen beteiligt sind. 11 Das fundamentale Interesse der Hermeneutik besteht darin, im Unterschied zu dem, was der Positivismus vorschlug, zum Ausdruck zu bringen, daß es bei der Auslegung von Texten keine kategorische Trennung zwischen dem auslegenden Individuum und dem ausgelegten Text gibt, sondern daß eine Wechselbeziehung zwischen beiden besteht, wobei der Ausleger beeinflußt durch seine Geschichte - einschließlich kultureller Vorurteile und Werte dem ausgelegten Text seinen Sinn gibt, und das gleiche geschieht umgekehrt: Die Charakteristiken oder die Geschichte des Textes beeinflussen das Individuum. In eben diesem Sinne kann man sagen, daß bei der rechtlichen Anwendung eines Gesetzes nicht der absolute Text des Gesetzes angewandt wird, sondern daß das, was angewandt wird, der vom Richter ausgelegte Text ist. Es ist die Auslegung desjenigen, der das Urteil fällt, und zwar vor allem in den schwierigen Fällen. Dies geschieht mit Hilfe seiner Beurteilung der Geschehnisse, über die im Prozeß entschieden wird, wobei für ihn auch seine eigene Geschichte maßgeblich ist. Man weiß, daß der Ausleger das Recht von seiner Weltvorstellung und seinem persönlichen Horizont aus anwendet. Wie wir schon erwähnt haben, hat die „Wissenschaftsgeschichte" gleichzeitig betont, daß die Lösungen der wissenschaftlichen Probleme von den tradierten Kenntnissen der wissenschaftlichen Gemeinschaft beeinflußt werden, letzten Endes von der Gesellschaft, soweit sie daran interessiert ist. 12 So ist das Verhältnis von Wissenschaft und Moral, das seit der Kritik der reinen Vernunft von Kant kaum noch Beachtung fand, wiederentdeckt worden. Auch die moderne Theorie der sozialen Systeme stellt eine Verbindung zu diesen Behauptungen her. Diese Theorie ist von zahlreichen Autoren des soziologischen Bereichs untersucht worden, in ihrer philosophischen Dimension vor allem durch die Arbeiten von Niklas Luhmann. Es ist darauf aufmerksam zu machen, daß diese Theorie in ihrer gegenwärtigen Fassung nicht abgeschlossen vorliegt. Sie wird durch eine Gruppe fundamentaler Konzepte integriert, die durch das Ergebnis der vergleichenden Untersuchung der verschiedenen sozialen Systeme, insbesondere der unterschiedlichen Funktionssysteme der Gesellschaft verbunden sind. Bisher handelt es sich nur um eine 11
Vgl. beispielsweise Gadamer (FN 4), S. 333f. Thomas S. Kuhn, La estructura de las revoluciones cientificas, Mexiko 1975, S. 68 - 79, 78f. 12
Die Reinheit der Sprache
15
methodologische Vorlage. 13 Vom Standpunkt einer Methodik der Systemanalyse ausgehend, kann man sagen, daß es hier vor allem um eine „ A r t " oder „Methode" geht, sich der Realität zu nähern, angepaßt an die Charakteristiken der Ziele der Sozialwissenschaften und deren Verbindung mit denjenigen des Beobachters. Letzterer ist selbst ein Sozialsystem, das sich an diesen Zielen orientiert. In keiner Form wird vorgeschlagen, diese Methode als „die" Erklärung der Gesellschaft anzusehen. Um die Methode zu präzisieren, die durch die Operation des Erkennens definiert wird, bedient sich Luhmann der Erkenntnisse, die von der Neurobiologie und der Psychologie in mehreren, von den Wissenschaftlern Maturana und Varela geleiteten Arbeiten beigebracht wurden. Seine fundamentale These ist die des Prinzips der „Autopoiesis", was mit Maturanas Worten soviel bedeutet, wie „der Prozeß des Erkennens ist passend für jedes lebende System und er entfaltet sich so, daß er in seiner eigenen Wechselwirkungszone gegliedert wird und sich nicht auf die Außenwelt gründet". 14 Diese Operation des Erkennens wird charakterisiert durch die genannten Untersuchungen. Sie setzt sich zusammen aus verschiedenen Elementen, in denen die Eigenselektivität der Entscheidung („auto"), Machen („poiesis") und Selbsterkennen zusammenfließen, indem Kenntnisse, ausgehend von den vorherigen Kenntnissen des erkennenden Subjekts, hergestellt werden. Das ist die Operation, die von den Sozialsystemen in dem Moment ausgeführt wird, in dem sie mit anderen Systemen in Kontakt kommen und sie zu Beobachtungsobjekten machen. So wie bei der Hermeneutik, wird das Objekt durch die Erkenntnis des beobachtenden Individuums verwandelt. Der Unterschied besteht darin, daß in der Hermeneutik das Subjekt eine Person und das Objekt ein Text ist; im Rahmen des Autopoiesekonzepts ist dagegen das Subjekt ein Sozialsystem und das Objekt irgendein anderes Sozialsystem, das sich von dem ersten unterscheidet. Für die Systemtheorie ist grundlegend, an die Autopoiesis zu erinnern oder, mit anderen Worten, die Appellation an die Idee der selbstreferentiellen Systeme. Die älteren Theorieversionen beschrieben die Situation des Systems, indem der zwischen dem System und seinen Teilen bestehende Unterschied aufgezeigt wurde, wobei das System mehr war als die Gesamtheit seiner Teile. Die Theorie geht demgegenüber jetzt von der Überzeugung aus, daß das System autonom ist und nicht hierarchisch bestimmt wird. Seine Existenz wird durch seine eigenen Elemente, einschließlich derjenigen seiner Teilsysteme, charakterisiert. Es differenziert sich aus, indem es lernt, sich von seiner
13
Niklas Luhmann, Soziale Systeme, Frankfurt a.M. 1987, S. 12. Humberto Maturana, Biologie der Kognition, Paderborn 1977, S. 78. Dieses Werk ist die Übersetzung eines Artikels, der im Buch von Paul L. Garvin (Hrsg.), Cognition: A Multiple View, New York 1970, erschienen ist. 14
16
Fernando Galindo
Umwelt zu unterscheiden, also die Differenz System/Umwelt zu handhaben. 15 Die Systeme sind in diesem Sinne selbstreferentiell. Sie produzieren ihre Elemente unter Abgrenzung von ihrer Umwelt selbst. Gegenüber den analytischen Theorien zeichnet sich die Systemtheorie durch eine Perspektivenvielfalt aus, die auf die Beobachterabhängigkeit der Erkenntnis und der Beschreibung der Realität hinweist. Ähnlich wie die postpositivistischen Theorien geht ihr Interesse letztlich dahin zu zeigen, wie Sinnselektionen und -Verwendungen in sozialen Systemen tatsächlich erfolgen. Bei der Theorie geht es trotz allem aber um wissenschaftliche Grundlagenforschung, bei der die Frage der wissenschaftlichen Methoden in unterschiedlichen Disziplinen eine wesentliche Rolle spielt. Beispielsweise werden Ideen und Anregungen aus der Hermeneutik aufgegriffen und mittels biologischer Erkenntnisse präzisiert und ausgearbeitet. Die Theorie ist insofern positiv, als sie auf der Verwendung der sogenannten synthetischen Verfahren besteht : Es ist unerläßlich, daß die Sozial Wissenschaften diese Arbeitsmethode übernehmen, wodurch aber die Gesellschaft von der Gemeinschaft der Wissenden ausgeschlossen wird. Ganz allgemein ist diese Gemeinschaft auf das Wissenschaftssystem begrenzt. Bestätigt wird dies durch Luhmanns rechtssoziologische Schriften, deren Adressaten nicht die Rechtswissenschaftler sind, sondern die Rechtstheoretiker und die Rechtsphilosophen.16 Er bestreitet nicht die Bedeutung empirischer Realitätsanalysen, die ebenfalls von der Teilung des Untersuchungsgegenstands ausgehen, wie sie von der analytischen Beschreibung her festgesetzt worden ist. Dies wirft aber ernsthafte Zweifel an den Fundamenten der Theorie auf: Es sind keine konkreten Referenzen in bezug auf die Werte, Vorurteile, Überzeugungen oder den kulturellen Hintergrund der Beobachter erkennbar. Das grundlegendste Problem der Theorie besteht deshalb in dem Erfordernis der notwendigen Reduktion der Realität auf begrenzte, präzise und konkrete soziale Systeme. Die Schwierigkeit liegt darin, daß es sich um das Studium von Materien mit offenem Inhalt handelt, wie Gesetze und Recht 17 : Es muß berücksichtigt werden, daß die juristischen Texte nicht nur an Techniker oder Juristen gerichtet sind, sondern an alle Bürger, die an ihrer Schaffung teilhaben und zur ihrer Ausführung verpflichtet sind, wie die konstitutionellen Prinzipien es vorschreiben. Andererseits, und um das Thema der wissen15
Luhmann (FN 13), S. 25. Siehe zum Beispiel die Vorschläge, die Luhmann macht in: Luhmann, Positivität als Selbstbestimmtheit des Rechts, in: RECHTSTHEORIE 19 (1988), S. 11 - 27,25ff. Hier setzt sich Luhmann für die Ausarbeitung rechtstheoretischer und dogmatischer Vorschläge ein, die losgelöst von den traditionellen Vorstellungen des Naturrechts und des juristischen Positivismus erfolgen. Dies mag zwar erforderlich sein, darf aber nicht dazu führen, daß diese Themen ausschließlich aus der Sicht der Systemtheorie behandelt werden. 17 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1961, S. 121 - 132. 16
Die Reinheit der Sprache
17
schaftlichen Erkenntnis fortzusetzen, entsprechen die letzten Aussagen Luhmanns nicht der Vision, die man in diesem Moment von der Realität hat: Die Teilung von Elementen, Teilen, Gruppen und Kernen, ohne die Wirklichkeit allzusehr zu reduzieren, ist schwierig. Die wiederholte Bezugnahme auf das Interdisziplinäre, die in verschiedenen Bereichen stattfindet, ist treffend zur Charakterisierung der Objekte der Erkenntnis und des Beobachtungsvorgangs selbst. Man muß bedenken, daß die Grundlage der einen und des anderen auch in den komplizierten Kommunikationsmechanismen zu suchen ist. Genau gesagt: wenn wir an das Recht denken, dann ist es nicht so einfach, eine rigorose Trennung zwischen dem, was der Richter der Dogmatik schuldet, den sozialen Gewohnheiten der Richter, ihren persönlichen Vorlieben, den Vorschlägen der Parteien, den legalen Texten usw. zu vollziehen, denn wir haben es bei der Anwendung des Rechts mit allen diesen Systemreferenzen zugleich zu tun. Mit diesen Vorgaben rechnend, wurde die Notwendigkeit eines idealen, rationalen, selbst Schlüsse ziehenden Informations Vorgangs bestätigt, der ohne die wissenschaftlichen Gewohnheiten oder die Erkenntnisse unserer Kultur zu vergessen - die Bedingungen der Erkenntnisse und der komplexen Lösung konkreter Probleme aufzeigt. 18 Nicht von ungefähr gibt es deshalb heute zahlreiche Studien über die Charakteristiken der Kommunikationsprozesse in der menschlichen Gemeinschaft. Dabei handelt es sich auch um kritische Studien in bezug auf das Finden einer einzigen einheitlichen Sprache, die - einmal in Form gebracht - einziges Kommunikationsmittel zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen sein könnte. 19 Die Kritiken und die Befürwortungen, die in dieser Art von Arbeiten gemacht werden, sind verschiedenartig, aber niemals absolut. Besonders dann, wenn man das Thema der Begründungsmethoden betrachtet, wird die Tatsache betont, daß die Wirklichkeit zu sehr unterteilt wird, wenn die Konstruktion einer Sprache oder ihrer Regeln nur analytisch, nur über ihre Entwicklung oder nur empirisch untersucht wird. Das hat auch mit den positiven Bewertungen der sogenannten synthetischen Methoden zu tun sowie mit der Infragestellung des Vertrauens, das in die analytischen Verfahren gesetzt wurde, wobei die analytisch-synthetische Gegenposition als nicht genügend aufklärend angesehen wird. 2 0 Gleichzeitig, vielleicht weil es schon seit Jahren gesagt wird, wieder18 Habermas (FN 4), Bd. I, S. 440 - 452. Über den Unterschied zwischen dieser und den positivistischen Positionen: ebd., S. 369 - 452 und Bd. I I , S. 223 - 228. 19 Vgl. zum Beispiel die Kritik von Bunge am Formalismus von Chomsky: Mario Bunge, Linguistica y Filosofia, Barcelona 1983. Diese Kritik ist schon alt. Vgl. hierzu die Ansichten, die gegen die „ausschießlich linguistischen" Visionen der Sprache vorgebracht werden, beispielsweise bei E. H. Lenneberg, Nuevas direcciones en el estudio del lenguaje, Madrid 1974. 20 Weitere Argumente außer den bisher zusammengefaßten bei: Mario Bunge, La Ciencia, su mètodo y su filosofia, Buenos Aires 1963, S. 62 u. 63 - 98.
2 Festgabe Opaîek
18
Fernando Galindo
holt man die Notwendigkeit, die Partialisierung der Erkenntnis durch eine interdisziplinäre und problematische Behandlung der Realität zu überwinden, indem man, selbst über die Interdisziplinarität hinausgehend, instrumentale „analytisch-synthetische" politische Theorien sucht, die Vorschläge für alle Techniker machen, nicht nur für Philosophen und Wissenschaftler, und die auf verschiedene Erkenntnisbereiche anwendbar sind. Dabei wird versucht, wirksame Verfahren zu entwickeln, um die Erkenntnisse in ihrer Komplexion an Spezialisten verschiedener Gebiete oder sogar an die Bürger weiterzugeben. Außerdem sind, von einer anderen Perspektive her gesehen, aber kongruent mit dem Gesagten, die Ausdrücke Sicherheit, Wahrhaftigkeit, Verfälschung, die auf einen Zugang zur Erkenntnis, gewonnen durch die aufgezeigten positivistischen Begründungsmethoden vertrauten, durch Ausdrücke wie Wahrscheinlichkeit, Glaubhaftigkeit, Möglichkeit, Vorsicht usw. ersetzt worden, wobei der Annäherungscharakter aller Erkenntnis herausgestellt wird. Im Recht wird demgegenüber von Abwägung gesprochen. Philosophen und Wissenschaftler stimmen darin überein und lassen außerdem Zweifel an der strikten „traditionellen" Trennung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft aufkommen 21 oder - neuerdings aus einer anderen Perspektive - zwischen Theorien und Ideologien und sogar an der Teilung zwischen Sozial- und Naturwissenschaften oder zwischen Recht und Moral oder zwischen Wissenschaft und Ethik. Deshalb und unter Berücksichtigung dessen, daß jeder Erkenntnisprozeß gemeinsame oder topische Ausgangspunkte voraussetzt, wird heute mehr von einer Annäherung der Denkansätze als von Theorien gesprochen, und wenn von Theorien gesprochen wird, dann handelt es sich dabei eher um solche Annäherungen. Von einer Annäherung der diversen Ausgangspunkte geht auch die kommunikative Handlungstheorie aus. Diese Theorie interessiert sich für den Rahmen, in dem die Anwendung der gebräuchlichen Methoden der Beweisführung stattfindet, ohne ihrerseits besondere Methoden vorzuschlagen. Wichtig ist nur, folgendes zu überwinden: die Teilung Subjekt - Objekt und die Teilung Theorie - Praxis. Die Theorie der kommunikativen Handlung kritisiert die Teilung, die der Positivismus vom Subjekt und vom Objekt her über die abstrakte Sublimierung der wissenschaftlichen Methode vornimmt: Der Forscher wird von der Gesellschaft getrennt, obwohl er ein Teil von ihr ist. Mit dieser Haltung ist die Gesellschaft ein differenziertes Objekt, eine andere „Sache". Die Theorie schlägt tatsächlich vor, Wissenschaftler und Gesellschaft zusammen zu betrachten, denn der Wissenschaftler kann sich nicht von der Gesellschaft iso21
Habermas legt seine Vision des Problems dar, indem er Kunst, Wissenschaft, Moral und Recht miteinander verbindet: Habermas, Die Moderne - ein unvollendetes Projekt (1980), in: ders., Kleine politische Schriften: (I - I V ) , Frankfurt a.M. 1981, S. 444 - 464, 460ff.
Die Reinheit der Sprache
19
lieren, von der er ein wesentlicher Teil ist. Auch kritisiert sie den Umstand, daß der Forscher oder Wissenschaftler, der Theorien aufstellt, seine Theorie als eine Sache betrachtet und die Anwendung dieser Theorie in der Realität als eine ganz andere Sache ; damit überläßt man dem Politiker die Anwendung der Theorie, was dazu führt, daß die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten nur wenige soziale Änderungen hervorbringen, denn sie werden nur in geringem Maße verwendet. Es wird politisches, auch moralisches Handeln des Wissenschaftlers vorgeschlagen. 22 Dies alles sind Vorschläge, über die aus einer juristischen Perspektive insgesamt gesagt werden kann, daß die Bezeichnung Wissenschaftler - unter Berücksichtigung der Funktion - in einem Land mit kontinentalem Rechtssystem durch die Bezeichnung Rechtsphilosoph oder Dogmatiker ersetzt werden kann. 23 Nach dieser kurzen Beschreibung des Forschungsstands bezüglich der Frage nach der Erkenntnismethodologie in der gegenwärtigen Lage werden im folgenden die Auswirkungen auf das Rechtssystem untersucht.
II.
Mit Blick auf das Rechtssystem muß als erstes festgestellt werden, daß alle Rechtstheorien eine an und für sich nur geringe Relevanz für die praktische Rechtspflege hatten. Die größte Ausnahme bildet vielleicht die Aufnahme eines Teils der Konzepte, die in der Reinen Rechtslehre von Kelsen - einer, wie man weiß, nicht analytischen, sondern neukantianischen 24 -zusammenge22 Harald R. Wohlrapp, Handlungsforschung, in: Jürgen Mittelstrass, Methodenprobleme der Wissenschaften vom gesellschaftlichen Handeln, Frankfurt a.M. 1979, S. 126 f. 23 Wenigstens aus einer fachlichen Perspektive ist es nicht möglich, diese Verbindung zu verneinen: Wenn die Existenz der Welten akzeptiert wird, so daß man von der Welt der Wissenschaft und der Welt des Rechts spricht, dann ist die der wissenschaftlichen Rolle ähnlichste soziale Rolle die des Rechtsphilosophen und die des Dogmatikers oder letzten Endes die der Universitätsprofessoren. Zweifellos sind die Erkenntnisobjekte verschieden, aber die Einstellungen ihnen gegenüber haben eine gewisse Ähnlichkeit. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht zwischen Mathematik und „Jurisprudenz". Engisch sagt: „Der Unterschied zwischen beiden Disziplinen besteht darin, daß man bei der Mathematik oft von wenigen Prinzipien ableitet, während man bei der Jurisprudenz selten von vielen Prinzipien ableitet... Während aber in einer mathematischen Disziplin, deduktiv-axiomatisch behandelt, die formale Deduktion fast die gleiche Sache ist, erscheint sie in der Jurisprudenz eher als ein Ideengerüst. Denn hier muß bei jedem logischen Schritt so viel an Materie beherrscht werden, daß das rein Deduktive im Vergleich zu den fälligen kognitiven Handlungen auf den zweiten Platz k o m m t . . . " Karl Engisch, Sentido y alcance de la sistemàtica juridica, Übersetzung von Marcelino Rodriguez Molinero, in: A F D 1986, S. 14. Und all das kann mit noch größerer Berechtigung für die berufliche, nicht akademische Praxis extrapoliert werden. 24 Siehe dazu: Felipe Gonzalez vicen, Sobre el neokantismo lógico-juridico, in: D O X A 1985, S. 51 - 54. Auch Kazimierz Opatek, Überlegungen zu Hans Kelsens „Allgemeine Theorie der Normen", Wien 1980, S. 24f.
2*
20
Fernando Galindo
faßt sind oder gewisser Vorlagen von Hart - vielleicht wegen ihres die Rechtspflege beschreibenden oder soziologischen Charakters. Das bezieht sich aber nicht nur auf die Rechtspflege im Bereich der Rechtsprechung, der Verwaltung und der Gesetzgebung, sondern sogar auf die Dogmatik oder die akademische Betrachtung des Rechts. Seitens der Rechtssoziologie hat es bislang nur wenige bedeutende Anregungen gegeben, die über rein empirische Forschungen, meist einfache - häufig ohne Juristen erstellte - Feldarbeiten, hinausgehen. Es ist wirklich so, daß in den Handbüchern die dogmatische Konstruktion vorherrscht, die Schulprinzipien begriffsjuristischer oder exegetischer Art verfolgt. Von den im vorhergehenden Kapitel dargelegten Strömungen oder Theorien haben im Rahmen juristischer Überlegungen (Rechtsphilosophie, Dogmatik und selbst Rechtspflege) allenfalls diejenigen Konzepte eine besondere Bedeutung erlangt, die in jüngerer Zeit seitens der Hermeneutik den Humanwissenschaften unterbreitet worden sind, also von einer philosophischen Richtung, die sich im wesentlichen mit der Erklärung der Charakteristiken der Auslegung von Texten befaßt. Und das ist nicht weiter verwunderlich, denn ihre und andere naheliegende Vorschläge, die sämtlich ihre Wurzeln in der Rechtsdiskussion der fünfziger Jahre haben, nähern sich den Impressionen und Intuitionen der Juristen, die Überlegungen über ihre praktische Tätigkeit anstellen, in größerem Maße als es die formalen oder analytischen Konstruktionen des Rechts tun. Bei einer angemessenen Beschreibung des Rechts ist festzustellen, daß die Hermeneutik tatsächlich Vorschläge erarbeitet, die sich der beruflichen Tätigkeit des Juristen in der Prozeßpraxis des Rechtsstaats anpassen.25 Dieser Gedankenstrom läuft in Wirklichkeit parallel zu den Arbeiten von Autoren wie Perelman und Vieh weg, die bemerkten, daß die gewöhnliche Tätigkeit der Juristen die Rhetorik oder Dialektik im klassischen Sinne ist, 25
Siehe Gadamer (FN 4), S. 604ff. In seiner Antwort an den Juristen Betti in einem privaten Brief, in dem er die Charakteristiken seines Vorschlags synthetisiert, sagt er diesbezüglich: „ I m Grunde genommen schlage ich keine Methode vor, sondern beschreibe das, was vorhanden ist. Und daß die Dinge so sind, wie ich sie beschrieben habe, das, glaube ich, kann wirklich nicht bezweifelt werden... Sie selbst, zum Beispiel, wenn Sie eine klassische Untersuchung von Mommsen lesen, werden sofort merken, wann sie geschrieben worden sein muß. Nicht einmal ein Meister der historischen Methode ist in der Lage, sich völlig von der Voreingenommenheit seiner Zeit, seiner sozialen Umgebung, seiner nationalen Position usw. zu befreien. Muß das unbedingt ein Mangel sein? Und selbst wenn es einer wäre, dann ist es, glaube ich, philosophisch eine Pflicht, zu überlegen, warum dieser Mangel jedesmal auftritt, wenn etwas getan wird. Mit anderen Worten, ich halte es nur für Wissenschaft, das anzuerkennen, was vorliegt und nicht von dem auszugehen, was sein müßte oder was sein möchte. In diesem Sinne versuche ich, über das Konzept der Methode der modernen Wissenschaft hinaus zu denken (die unbedingt ihre relative Berechtigung bewahrt) und prinzipiell auf die allgemeine Weise zu denken, was immer geschieht." (Ebd., S.606f., das Kursivgedruckte stammt aus dem Original.)
Die Reinheit der Sprache
21
und dies nicht nur in der Rechtspflege, sondern auch in der Konstruktion der Dogmatik. Diese Autoren zeigten, daß die Haltung des Juristen nicht darin besteht, die Erkenntnis als Zweck zu erreichen, sondern darin, die geeigneteste Begründung für den Prozeß zu entwickeln, womit nicht die logische Begründung als der zu erfüllende Zweck gemeint ist, also nicht der von Aristoteles formulierte Syllogismus, sondern gerade das durch die topische und rhetorische Begründung zu erreichende Ziel, so wie es Aristoteles selbst in seinen Werken verteidigte, später erweitert durch die Verwendung in der römischen Rechtsprechung, zunächst durch Cicero und später durch andere kulturelle Äußerungen im Laufe der Geschichte der Länder der westlichen Welt. Der Grund hierfür ist, daß diese Begründungen nicht auf klaren Prämissen aufbauen, die zu ebenfalls klaren Folgerungen führen, sondern sie werden mittels allgemeiner Ideen und Argumente erstellt, die im Laufe der juristischen Diskussion ausgeführt werden. Dies geschieht, wie die erwähnten Autoren erklären, gemäß entsprechenden Regeln, die niemals die Regeln sind, die die Richtschnuren für die logische Begründung festsetzen. Man kommt so weit zu sagen, daß eben dies die typische Begründung der Juristen ist und damit die geeignete Arbeitsmethode, sowohl im Zeitpunkt der Anwendung, der Auslegung oder der Schaffung des Rechts als auch im Zeitpunkt der Aufstellung von Dogmen oder einer Rechtstheorie. 26 Diese Positionen haben - anders als die rein formalen der Logik, der analytischen Theorie oder als die neopositivistische Wissenschaftsgläubigkeit des skandinavischen Realismus (Ross) - unter den Juristen starke Wurzeln gefaßt. Für die erwähnten Autoren sind Deduktion und Induktion wissenschaftseigene Methoden, aber nicht die geeignetsten Methoden für das Recht. Sie kritisieren die Starrheit der Vorschläge der sogenannten juristischen Logik, die ihre Thesen in den gleichen Jahren vermehrte, in denen die Topik oder neue Rhetorik ihre eigenen festsetzte, animiert durch die Revitalisierung des Formalen, das die sogenannte analytische Rechtstheorie erreichte. Sie kritisierten auch die Begriffsjurisprudenz wegen fehlender Legitimation ihrer Vorschläge. Die Aufnahme dieser Strömungen durch die Rechtsphilosophie, aber auch durch die Dogmatik selbst, wurde - ausgehend von der Kritik an dem wissenschaftlichen Positivismus - durch das philosophische Wiedererscheinen der Hermeneutik verstärkt. Die Hermeneutik schlägt Richtlinien für die Auslegung der juristischen Texte vor. Daher bietet sie kritische Beiträge in bezug auf die analytische Rechtstheorie. Deshalb ist sie auch seit Ende der sechziger Jahre von verschiedenen Seiten her, sowohl von Rechtsphilosophen als auch von Dogmatikern unterschiedlicher doktrinärer Herkunft, zuletzt von Gada26
Dazu und zum folgenden: Viehweg (FN 4), S. 31 - 45, 95 - 110.
22
Fernando Galindo
mer, weitgehend anerkannt worden. 27 Über die Hermeneutik und ergänzt durch die Bekräftigungen der neuen Rhetorik oder Topik werden verstärkt die Charakteristiken von Rechtsauslegungs- und Rechtsanwendungsprozessen aufgezeigt. In gleicher Weise nimmt auch das Interesse am Kennenlernen der typischen Charakteristiken von Aktivitäten der praktisch tätigen Juristen zu, einschließlich ihrer persönlichen Merkmale und Umstände - beispielsweise ihrer Wertvorstellungen und Überzeugungen sowie ihrer Geschichte. Viele der Juristen (Rechtsphilosophen), die erklären, die Vorschläge der Hermeneutik zu akzeptieren, haben deren Anregungen aber nur begrenzt in die Praxis umgesetzt. Das liegt an dem Umstand, daß die Hermeneutik - wie wir gesagt haben - nicht nur die Revision der Fundamente der wissenschaftlichen Erkenntnis ist, sondern sie ist gleichbedeutend mit der Auslegung von Texten; es ist so, daß die Hermeneutik-Juristen sich damit befaßt haben, Vorschläge für die Auslegung der juristischen Texte auszuarbeiten, die weiter nichts sind als Anwendungen der traditionellen Auslegungsmethoden (vorgeschlagen vom modernen Humanismus, von der Schule der Exegese, der historischen Schule oder den verschiedenen Naturrechtslehren). Wie bei der Analytik, handelt es sich dabei um Positionen, die sich ausschließlich mit dem textlichen Aspekt des Rechts und seiner normativen Konfiguration beschäftigen. Sie haben auch ein erneutes Interesse an der Geschichte geweckt. A l l das hat außerdem eine augenscheinlich aktualisierte, barocke Naturrechtslehre hervorgebracht, bei der häufig Konfusion, heterogene Verbindung von Methoden und Verschwommenheit ihrer Bestätigungen die charakteristische Note ausmachen. Daher kommt es, daß diese Positionen die Praktiker unter den Juristen zum Verlassen der in unserer Gesellschaft üblichen Erkenntnisgewohnheiten genötigt haben (wissenschaftliche Gewohnheiten), was ein schwerer Nachteil in bezug auf die Einheit der Juristen und Spezialisten in anderen Bereichen bedeutet. Sie wird gerade jetzt benötigt in einem Moment, in dem der hohe Grad an Komplexität einer sehr weitgehend organisierten und technifizierten Gesellschaft von den Juristen hinreichende Ausdruckskapazität und gleichzeitig Präzision verlangt, um sich mit anderen Fachleuten 28 zu verständigen oder einfach um das geltende Recht zu kennen.
27 Vgl. zum Diskussionsstand: Winfried Hassemer, Juristische Hermeneutik, in: ARSP 72 (1986), S. 195 - 212. Das geschieht aber nicht nur im Bereich der „kontinentalen" Rechtsphilosophie, sondern im Rahmen von Überlegungen, die mit der „Rechtstheorie" zusammenhängen: Neil MacCormick / Ota Weinberger, A n Institutional Theory of Law, Dordrecht 1986, S. 17ff., 105ff., 169. Siehe ferner: Giuseppe Zaccaria, Deutsche und italienische Tendenzen in der neueren Rechtsmethodologie, in: ARSP 72 (1986), S. 299 - 308. 28 Dieser Gefahr setzt man sich aus, wenn man berücksichtigt, daß die hauptsächlichen Themen dieser juristischen Hermeneutik nach Hassemer (FN 27), S. 207 - 212, folgende sind: „Konkretes Naturrecht", „Einsichtstheorie", „Tatsache der Norm und Konstitution des Sachverhalts", „Vorverständnis", „szenisches Verständnis".
Die Reinheit der Sprache
23
Andere Möglichkeiten bietet die Argumentationstheorie. Diese Theorie wurde in bezug auf das Recht Mitte der sechziger Jahre in mehreren philosophischen und wissenschaftstheoretischen Beiträgen 29 entwickelt. Sie erklärt, daß die menschlichen Handlungen in einem kommunikativen Rahmen stattfinden, der ihren Charakter bestimmt. Die Eigentümlichkeiten dieses Rahmens, aber ganz besonders seine idealen Charakteristiken wurden - ausgehend von Arbeiten von Habermas - erstellt, wobei die vom wissenschaftlichen Positivismus durchgemachte Entwicklung, die beispielsweise in Arbeiten von Popper und Albert zum Ausdruck kommt, 3 0 außer acht gelassen wurde. Im Unterschied zur Hermeneutik besitzen für diese letztgenannte Theorie weder der Text, in dem sich die Handlung widerspiegelt, noch die Merkmale der Handlung selbst ein Interesse. 31 Im Falle des Rechts, des Anwendungsvorgangs, demjenigen des Auslegens usf. sind die Charakteristiken der dogmatischen Konstruktion, der Ausarbeitungsprozesse der allgemeinen Gesetze usw. konkrete Operationen und Aktivitäten, die ohne weiteres über die traditionellen Begründungsweisen präzisiert werden können. Demgegenüber ist die Theorie von Habermas eine Folge der Kritik am wissenschaftlichen Positivismus und an seiner Erneuerung Ende der sechziger Jahre. Die Theorie der kommunikativen Handlung stellt die Gültigkeit der gegenwärtigen Begründungsmethoden nicht in Frage, nur stellt sie sie an zweite Stelle: Letztere werden vor allem als Begründungsmethode angesehen und nicht allein als eine der Erkenntnis ; außerdem werden sie bei der historischen Plazierung relativiert. Sie ist um die berufliche Praxis besorgt und nicht nur um die „wissenschaftliche", „theoretische", „philosophische" oder 29 Es gibt nicht „die" Theorie der juristischen Argumentation; es gibt eine Pluralität diverser Theorien der juristischen Argumentation, die ihre Wurzeln nicht nur in der Rechtspflege, sondern auch in der Tradition der Moralphilosophie, der Hermeneutik, der analytischen Philosophie, dem skandinavischen Realismus, der Wissenschaftstheorie und sogar in der Logik haben. Die Koinzidenz wird durch die skizzierte postpositivistische Diskussion über die Erkenntnis „abgestützt". Habermas ist der Autor, der es ermöglicht, diese Überzeugungen miteinander zu verbinden. Damit wirkt sich gegenwärtig auf dem Gebiet des juristischen Denkens das aus, was im Laufe der Geschichte und ganz besonders in den letzten zwei Jahrhunderten geschah: Es wird beeinflußt von den philosophischen Strömungen, die die allgemeinen Bedingungen der Erkenntnis zum Ausdruck brachten, und von den Gewohnheiten der Rechtsvertreter (Juristen und Staatsbürger). Eine detaillierte Darlegung der Pluralität der Strömungen, die sich hinter der Bezeichnung „Theorie der juristischen Argumentation" verstecken, findet man bei: Ulfried Neumann, Juristische Argumentationslehre, Darmstadt 1986, S. 2 - 6 (über die moralische Begründung der Theorie, 96 - 111, über die Verbindung mit der Theorie der Wissenschaft: mehrere Beispiele). 30 Die positivistischen Überzeugungen werden - gegen Habermas und Apel - beibehalten. Vgl. beispielsweise: Hans Albert, The Problem of Method in Social Sciences and Law, in: Ratio Juris 1 (1988), S. 1 - 19. 31 Diese Charakteristik der Theorie ist die, die sie als gültiges Programm sogar für die Umwandlung der Theorie der juristischen Argumentation in „die" Rechtstheorie par excellence bezeichnet. So: Neumann (FN 29), S. 118.
24
Fernando Galindo
„abstrakte". Sie ist um den Inhalt besorgt. Sie versteht, daß es andere Erkenntnismethoden gibt, die den verschiedenen Kulturen eigen sind, zu denen auch die Individuen der Gesellschaft gehören. Damit kann leichter die Ansicht zugegeben werden, daß bei der Erkenntnis auch die Werte oder die Moral selbst von Bedeutung sind. Dies gilt auch für den Wissenschaftler, was aber nicht die Ausübung dieser Erkenntnismethode verhindert, denn die Theorie betont gleichzeitig, daß die Bewertungen über soziale „Standard"Prozesse erworben oder erkannt werden. Die Erkenntnis wird von der Position oder dem Interesse des Individuums beeinflußt: sowohl durch die Umwelt, in der dieses sich bewegt, als auch durch seine Gefühle. Das bedeutet, daß die Theorie Vorschläge, wie die von Viehweg und anderen Autoren, ausarbeitet und präzisiert, die nur durch die heutzutage wenig aussagekräftige Einsicht verbunden sind, daß das typische Argument im Recht nicht das logische, sondern das topische ist. III.
Wenn man an die bisherigen Ausführungen anschließt und dabei nicht von der analytischen Tradition abgeht, die formalen oder normativen Rechtsstudien besonderen Nachdruck verleiht, dann gibt es in der Gegenwart verschiedene Rechtstheorien, die eher schon Theorien der juristischen Begründung und Beweisführung sind oder, wenn man Ausdrücke aus dem Bereich der positivistischen Wissenschaft zusammenfaßt, Theorien der Rechtfertigung, die die methodischen Traditionen weiterführen. Dies sind teilweise, wie wir noch sehen werden, die bisher aufgezeigten. Anschließend zeigen wir einige der bedeutendsten Positionen dieser Diskussion auf, wie beispielswiese diejenigen von Alexy, Peczenik und Aarnio, 3 2 beschränken uns aber darauf zu unterstreichen, welches ihr Wissensziel und ihr Vorschlag in bezug auf die zum Studium geeignete Methode ist. Danach veranschaulichen wir einige der Anwendungen der Theorie sozialer Systeme im Bereich des Rechts, soweit es
32 Wenn ein Studium dieser drei Autoren vorgeschlagen wird, dann deshalb, weil es ihr Wunsch war, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen früheren, für die Argumentationstheorie bedeutsamen Ansätze, ihre Position in einem gemeinsamen Artikel zusammenzufassen. Ich beziehe mich auf: Aulis Aarnio / Robert Alexy / Aleksander Peczenik, The Foundation of Legal Reasoning, in: RECHTSTHEORIE 12 (1981), S. 133 153, 257 - 280, 423 - 448. U m den repräsentativen Charakter der einzelnen Standpunkte in bezug auf ihre entsprechende Tradition zu zeigen, nehme ich als Referenz frühere Werke, die vor der erwähnten Arbeit liegen. Dies gilt sowohl im Fall von Aarnio (Aarnio, Denkweisen der Rechtswissenschaft, Wien/New York 1979) als auch in dem von Alexy (Alexy, Theorie der juristischen Argumentation, Frankfurt a.M. 1978). Bei Peczenik stütze ich mich auf ein späteres Werk (Peczenik, The Basis of Legal Justification, Lund 1983). Auch habe ich folgende Werke im Sinn: Alexy, Theorie der Grundrechte, Frankfurt a.M. 1986 und ders., Rechtssystem und praktische Vernunft, in: RECHTSTHEORIE 18 (1987), S. 405 - 419. Ebenfalls: Aarnio, The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification, Dordrecht 1987.
Die Reinheit der Sprache
25
sich um Beiträge zur Kenntnis der juristischen Argumentation aus empirischen oder induktiven Perspektiven handelt, wobei sie in diesem Sinne ergänzend zu den Theorien der juristischen Argumentation herangezogen werden. Die Schwierigkeit der einen oder der anderen Beiträge liegt, wie wir sehen werden, darin, daß es nicht unbedingt „postpositivistische" Vorschläge sind, die letzten Endes den Wertschätzungen oder der Pluralität moralischer Welten oder Welten der Kultur angehören, die in den Rechtsvorschriften, einschließlich der verfassungsrechtlichen, enthalten sind. Im Grunde gehören sie nicht der Rechtspraxis und ihrer Komplexion an: Sie bewegen sich in einer Welt der „Wissenschaft" und hören nicht auf die Gebote der Politik oder auf die der handelnden Juristen. Der Position von Robert Alexy gehört insofern das Interesse, als sie durch Bezeichnungen, wie beispielsweise Auslegung, Hermeneutik, Argumentation und Topik, mit der Tradition der neuen deutschen Rechtsphilosophie verknüpft ist. 33 Diese Verknüpfung kommt im Laufe des gesamten Werks „Die Theorie der juristischen Argumentation", das wir hier kommentieren wollen, zum Ausdruck. Man muß bedenken, daß dieses Werk akademischen Ursprung hatte: Es handelt sich um die These einer juristischen Doktorarbeit. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Begründung der Position von Alexy „philosophisch" ist, insbesondere soweit es Aussagen sind, die bestimmte analytische Ethiker zum „praktischen Tun" machen. Teilweise gehört hierzu auch die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas, aber diese Begründung ist im kommentierten Werk zweitrangig, denn, wie Alexy selbst sagt, gilt seine einzige Sorge der Ausarbeitung einer Rechtstheorie und nicht einer Theorie über die Überlegungen von Juristen. 34 In diesem Sinne werden in seiner Theorie der juristischen Argumentation ausgehend von der Überlegung, daß dieser Vortrag ein spezieller Fall des praktischen Vortrags ist - die idealen Regeln und Formen zusammengefaßt. Für Alexy sind die erwähnten Regeln zur Begründung oder Rechtfertigung der Rechtsanwendung unerläßlich. 35 Dabei ist zu beobachten, daß der Reduzierung des Rechts auf Formen oder Normen besonderer Nachdruck verliehen wird, wenn man die Charakteristiken der juristischen Argumentation untersucht, die sich in der Aufzeigung ihrer üblichen Regeln und Formen widerspiegeln. Alexy bringt konkret zum Ausdruck, daß seine Absicht die der Bezugnahme und des rationalen Gebrauchs der rechtlichen Topiken ist, indem die Vorlagen von Viehweg sowie die anderer entsprechender Autoren rationalisiert/formalisiert werden. 36 Die Rationalisierung ist auf den Vor-
33
Alexy, Theorie der juristischen Argumentation (FN 32), S. 17 - 49. Ebd., S. 48f. 3 5 Ebd., S. 356ff. 36 Ebd., S.43. 34
26
Fernando Galindo
schlag reduziert, daß diese - formalen - Topiken der Bezugsrahmen der Rechtsanwendung sind, wenn man ihn als Norm betrachtet. So kommt es, daß die Ausfüllung dieses Rahmens unter Verzicht auf das geschieht, was in Wahrheit bei der Rechtsanwendung passiert. Es wird nicht überprüft, wie die Regeln und Formen der juristischen Argumentation wirklich gebraucht werden. Diese Regeln und Formen sind die, die in verschiedenen Doktrinen oder Theorien von Moralisten, Philosophen sowie Theoretikern aus Wissenschaft und Recht vorgeschlagen wurden. Ausgehend von diesen Vorlagen stellt der Autor seine eigenen auf. Wiederholt behauptet er, daß seine Position analytisch sei. Trotz allem wird aber von Alexy und anderen Autoren, die wir hier kommentieren, ausdrücklich anerkannt, daß Prinzipien und Regeln der juristischen Argumentation empirisch zu gewinnen sind. Alexy lehnt es aber ab, dieses Verfahren zu verfolgen: Er appelliert an den bestehenden Unterschied zwischen der Welt des Seins und der Welt des Sollens. 37 Damit stellen wir fest, daß in seiner Theorie in Wirklichkeit keine Theorie der juristischen Argumentation entwickelt wird. Mit der Anwendung rechnend, erstellt Alexy eine „normative" Rechtstheorie. Das Studienobjekt wird aufgeteilt. In Wirklichkeit haben wir es nicht mit einer Rechtstheorie, sondern mit einer Theorie der juristischen Norm zu tun. Es ist bezeichnend, daß für Alexy die Topiken des juristischen Vortrags nicht die „Gemeinplätze" sind, von denen die „neue Rhetorik" spricht, sondern daß sie hauptsächlich aus Gesetzen, der Dogmatik und der Rechtsprechung bestehen. 38 Dies ermöglicht zu sagen, daß diese Auffassung über Kelsen, Hart und Ross hinausgeht, weil sie sich nicht darauf beschränkt, eine Untersuchung der Norm oder des Rechts als zwingenden Vorschlag durchzuführen. Es ist hervorzuheben, daß Alexys „Theorie des rationalen Rechts vortrags" keine alleinstehende Theorie ist, sondern daß sie „eine rationale und angemessene Ordnung der Gesellschaft" 39 voraussetzt, eine Rationalität, die über das rationale Studium der Rechtssprache erreicht wird. In diesem Sinne handelt es sich um eine positivistische Theorie, die nicht konsequent mit den Grundlagen der Argumentationstheorie oder der Theorie des kommunikativen Handelns übereinstimmt, welche als Bezugspunkt nicht die Gewohnheiten der wissenschaftlichen oder technischen Gemeinschaft als solche wählt, sondern diejenigen der Gesellschaft als ganzer. Jedenfalls muß sein Interesse an dem Rahmen der juristischen Argumentation hervorgehoben werden. Auch die von Peczenik vertretene Rechtstheorie scheint nicht ausreichend zu sein. Lobenswert ist sein Wille, eine normative Rechtstheorie zu schaffen, 37 Ebd., S. 227ff. 38 Ebd., S. 365f., 352ff. 39 Ebd., S. 359.
Die Reinheit der Sprache
27
die sich mit der Komplexion des juristischen Phänomens befaßt, nämlich mit Norm, Handlung und juristischem Denken. Dies kann nicht von Alexy gesagt werden, der sich darauf beschränkt, den rationalen normativen Rahmen des juristischen Vortrags aufzuzeigen. Die Grundthese von Peczenik, die gleichzeitig der Ausgangspunkt des Werks ist, das wir hier in Betracht ziehen („Die Grundlage der legalen Rechtfertigung"), besteht darin, folgendes Schema zu bestätigen. Sie besagt, daß bei allen menschlichen Tätigkeiten - intellektuellen und evaluierenden - , die zu Schlußfolgerungen führen, „Umwälzungen" oder „Sprünge" vorkommen. Diese Sprünge sind Schritte von einem Kenntnisstand oder -niveau zum anderen und entstehen als Folge des Zusammentreffens unendlich vieler Faktoren, Gründe und Inferenzregeln („deduktive" oder „nicht deduktive"), die sie rechtfertigen, bei allen Aktivitäten. Diese Faktoren, Gründe und Regeln sind schwer zu präzisieren, auch wenn sie absolut nicht willkürlich sind. Rationalität kommt ihnen durch die Tatsache zu, daß die menschlichen Aktivitäten in ihrer Gesamtheit auf das erwähnte Schema reduziert werden können. Dieses Schema bringt es mit sich, daß die Rechtfertigung im Zusammenhang mit dem Vortrag letzten Endes in der Lebensweise besteht, 40 eine Appellation, die an den späten Wittgenstein erinnert. Bei den menschlichen Aktivitäten, die zu juristischen Schlußfolgerungen führen, beobachtet Peczenik ganz allgemein einen Unterschied, beispielsweise im Verhältnis zu den wissenschaftlichen Aktivitäten. Er weist darauf hin, daß die letzteren hauptsächlich von deduktiven „Inferenzregeln" und letzten Endes von dem Prinzip der Wahrheit gelenkt werden, während bei ersteren, ähnlich wie bei moralischen Aktivitäten, die nicht deduktiven Inferenzen vorherrschen: Letzten Endes herrscht hier das Prinzip der Kohärenz. Das soll aber nicht heißen, daß die Rechtshandlungen für Peczenik immer irrational sind, sondern daß bei ihrer Ausarbeitung ein Gleichgewicht von deduktiven und nicht deduktiven Kriterien besteht. Dieses Gleichgewicht wird von dem „gewöhnlichen Rationalitätsstandard" beherrscht, der andererseits von „unserer" Lebensweise festgelegt wird. Deshalb ist er der Ansicht, daß im Recht von Kohärenz und nicht von Wahrheit gesprochen werden müsse.41 Hiervon ausgehend, fertigt Peczenik eine detaillierte Studie über die Eigenheiten der Rechtshandlungen an. Er zeigt die juristischen Regeln und Gründe auf, die zur Ausarbeitung von Normen, Schlußfolgerungen oder Vorschlägen für das geltende Recht und die korrekte Rechtsentscheidung führen. Er arbeitet eine Art begrifflicher - normativer 42 - Theorie der „juristischen Begründung" 4 3 aus. 40
Peczenik, The Basis of Legal Justification (FN 32), S. Iff. Ebd., S. 111. 42 Peczenik möchte die juristischen Gründe und Regeln untersuchen, die zur Ausarbeitung von Schlußfolgerungen, Vorschlägen oder Normen über das geltende Gesetz 41
28
Fernando Galindo
In diesem Zusammenhang erwähnt Peczenik aber trotz allem nicht obwohl sie ihm sicher nicht unbekannt sind - die juristischen Studien, die von einer anderen als der normativen Perspektive aus durchgeführt wurden. Er sagt sogar, daß die einzig mögliche juristische Überlegung die ist, die Normativisten und begriffliche Dogmatik ausführen. 44 Deshalb kommt es auch gar nicht dazu, daß Überlegungen in bezug auf das Recht in Betracht gezogen werden, die von den formalen abweichen. Andererseits wird ein Trennungsstrich zwischen wissenschaftlichem und juristischem Wissen gezogen, wobei ersteres nicht einmal an der „Lebensweise" als einer seiner letzten Bezugspunkte teilhat, was er dagegen dem juristischen Wissen zugesteht,45 so daß seine postpositivistische Position beschränkt ist. Er ist weiterhin Anhänger der rein analytischen Strömungen des Rechtsstudiums. Den vorhergehenden Positionen verwandt, wenn auch mit eigenen Merkmalen ausgestattet, ist die Haltung Aarnios. Dieser befaßt sich, indem er die Initiativen des skandinavischen Realismus (sowie diejenigen von Wrights und anderen) vertieft, mit dem Studium der allgemeinen Charakteristiken der Aktivitäten, der Verhaltensweisen und der Aufgabe der Juristen: mit ihrer Arbeitsweise. Er beschäftigt sich mit der „letzten Begründung" der Beweisführung der Juristen, 46 indem er sich sowohl den Juristen gegenüber, die Theorien aufstellen, als auch denen gegenüber, die das Recht anwenden - da letztere es ja verstehen müssen - , zu den letzten Ursachen der juristischen Formen und ihrer Anwendung äußert. Das geschieht nach dem philosophischen hermeneutischen - und analytischen Studium besonders des Vorgangs der Annäherung an das positive Recht, welches die juristische Lehre, ganz besonders die dogmatische, voranbringt. Bei Aarnio kann man eine epistemologische Studie des Rechts finden, die es wert ist, hervorgehoben zu werden (ich befasse mich hauptsächlich mit dem Werk, das den bedeutungsvollen Titel „Denkweisen der Rechtswissenschaft" trägt 4 7 ). Seine Position charakterisiert sich durch die Betrachtung des Rechts als komplexe Handlung der Juristen, beeinflußt von ihrer akademischen Schulung und von der Umgebung, in der sie sich täglich bewegen. Er meint sogar, indem er an Wittgenstein anknüpft, daß es die „Lebensweise" ist, die die Rechtskenntnis markiert. 48 Eine Definition dessen, was er unter „Lebens-
und die juristische Entscheidung führen, sagt aber auch, daß er die vielseitigen Facetten, die das Recht hat, nur als Norm versteht. Ebd., S. 6 u. 136, Anm. 1. « Ebd., S. 83. 44 Ebd., S. 132ff. 45 Ebd., S. 120, 125ff., 134. 46 Das spiegelt sich als Gemeinplatz der hier behandelten Autoren im Titel des in der FN 32 genannten Kollektivwerks wider. 47 Aarnio, Denkweisen (FN 32). Vgl. auch ders., The Rational (FN 32). 48 Ders., Denkweisen (FN 32), S. 124.
Die Reinheit der Sprache
29
weise" versteht, wird wie bei Wittgenstein nur ungenau formuliert: als Sprachspiel und daher ohne materiellen oder selbstbezüglichen Inhalt. Aarnio ist der Ansicht, daß die Arbeit der Juristen sich nicht grundsätzlich von der der Doktrinäre anderer Forschungsbereiche oder der der Wissenschaftler unterscheidet. Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. A n einer Stelle räumt Aarnio ein, daß es im Rechtsbereich einige Besonderheiten gebe. Anders als im Bereich der sogenannten Naturwissenschaften gewinnen bei einer näheren Beschäftigung mit dem Recht die nicht objektiven Werte und Faktoren einen größeren Stellenwert. 49 A m Ende des Werks sagt Aarnio, 5 0 daß die Aufgaben der Rechtsdoktrin folgende sind: die logisch-formale Auslegung der juristischen Sätze, die Präsentation technischer Normen und die Formulierung ,calmierender' Sätze über die Wahl von Auslegungsalternativen. Für Aarnio sind die ersten beiden Aufgaben identisch mit denen der Forschung im allgemeinen, nicht aber der letzte, „denn die »Rechtsdoktrin' ist eine Geisteswissenschaft" und hat es mit der „Bedeutung" der Rechtsvorschriften zu tun. 5 1 Mit diesen Aussagen verficht er eine Entfernung des Juristen von der empirischen Forschung, obwohl er bei anderen Gelegenheiten zum Ausdruck bringt, daß diese Forschung möglich und wünschenswert ist. 52 Ständig bezieht er sich auch auf die „gemeinen Lebensbedingungen" als letzten Bezugspunkt des Rechts, womit er die Möglichkeit einer systemischen oder „soziologisch vernünftigen" Analyse des Rechts bestätigt. Trotz allem verleiht er in seinem Werk der normativen Betrachtung besonderen Nachdruck, indem er die Tätigkeit der Juristen mit Grund als überwiegend analytisch bezeichnet. Er ist daher ebenfalls ein Autor, der an die methodischen Prinzipien des wissenschaftlichen Positivismus glaubt, ohne sie in Frage zu stellen, und er schlägt den Juristen eine wissenschaftliche Arbeit vor, bei der das normative Studium des Rechts im Mittelpunkt steht. In Anbetracht der offensichtlichen Unzulänglichkeit der vorgenannten Theorien, die insbesondere in einer einseitigen Betonung der Normativität zum Ausdruck kommt, stellt sich die Frage, ob sie nicht durch Elemente der Theorie sozialer Systeme ergänzt werden können. Wie schon im ersten Teil erwähnt, baut Luhmann, ebenso wie die zuvor behandelten Autoren, seine Theorie sozialer Systeme auf, indem er zunächst den Rahmen seiner Forschungen absteckt. Seit Ende der sechziger Jahre analysiert Luhmann die Gesellschaft und insbesondere das Recht aus einer systemischen Perspektive. Anfangs war das Studium der sozialen Systeme von einer überwiegend positivistischen Sicht der 49
Ebd., S. 67. so Ebd., S.231 ff. Ebd., S. 5ff. 52 Ebd., S. 35ff.
30
Fernando Galindo
Systemtheorie beeinflußt, die einen statischen Charakter zu haben schien. Das Recht wurde definiert als die „Struktur eines Sozialsystems, das sich auf die konsequente Generalisierung der Erwartungen eines normativen Verhaltens bezieht". 53 Diese Definition war insofern interessant, als sie nicht ausschließlich normativ war, wie es bei den soziologischen Theorien von Weber oder Geiger der Fall ist. Aber es ist eine reine Beschreibung, die nicht daran interessiert ist, den Sinn oder die Charakteristiken des Verständnisses des Handelnden, der die Struktur anfertigt, herauszufinden. Entsprechendes gilt auch für den Beobachter. Gegenwärtig besteht noch die Möglichkeit, die Theorie bei dem Aufbau einer Rechtstheorie als Methode zu verwenden. Dies ist heute eher möglich, da die neuere Fassung der Systemtheorie dem Umstand stärker Rechnung trägt, daß und wie die Erkenntnis von Umwelteinflüssen und der Position des Beobachters abhängig ist. 5 4 Insofern bestehen Parallelen zur Hermeneutik. Die Theorie ist, wie wir im vorangehenden Kapitel sagten, selbstreferentiell: Sie bezieht sich auf und appelliert bis zu einem gewissen Grade an den Inhalt. Gegenstand einer Theorie sozialer Systeme können sein: das Recht, die Moral, der Bau eines Hauses, der Mensch, die Juristen (jeder Jurist), die Richter (jeder Richter) usf. Sie ist als Beobachtungsinstrument konstruiert, das mit bestimmten Charakteristiken des Erkenntnisvorgangs rechnet, die sich bei der Erkenntnis jeder Art von Objekten auswirken, unabhängig davon, ob es Rechtstexte, Verhaltensweisen oder Verhaltenssysteme oder Legislativsysteme, Regelungen usw. sind. 55 Dadurch ist ihr Aktionsfeld deutlich erweitert, und ihre Hypothesen sind auf eine große Zahl von Situationen anwendbar, die sich im Alltag ergeben. Gegenwärtig übt sie bereits ihre Wirkung bei dem Studium der Rolle des Staates aus. Auch das macht sie zu einer überzeugenden Erklärung für die Rechtsauslegung und -anwendung, denn die diversen Vorgänge im Rechtssystem sind von zahlreichen Elementen beeinflußt, die bei der Beschreibung des Rechts und seiner Anwendung interferieren. Im Ergebnis ist sie effektiver als die Hermeneutik, da sie dazu anhält, ausgehend von institutionalisierten Wissensregeln und Standardperspektiven zu beachten, daß das Recht sich nicht in den Rechtssätzen erschöpft, sondern vielmehr ebenso Verhalten und letztlich ein soziales Funktionssystem ist. Sie ergänzt die Hermeneutik: Diese greift auf die Geschichte des Jetzt und des Individuums 53
Luhmann, Rechtssoziologie, Opladen 1983, S. 105. Luhmann kritisiert selbst an seiner früheren Position den Perspektivismus. Luhmann, Die Lebenswelt - nach Rücksprache mit Phänomenologen, in: ARSP 72 (1986), S.176 - 194. 55 Luhmann (FN 13), S. 67f. Er bringt auch zum Ausdruck, daß der Mensch sich selbst oder ein anderer ihn als eine Einheit beobachten kann. Auf keinen Fall kann er aber als ein System angesehen werden, da seine Komplexion nicht auf einmal beobachtet werden kann, denn in ihm laufen verschiedene physische, chemische und andere Prozesse ab. 54
Die Reinheit der Sprache
31
zurück, eine von traditionellen Methoden freigelegte Geschichte; die Systemtheorie beschäftigt sich mit gegenwärtig sich autopoietisch entwickelnden Systemen. Der Unterschied resultiert im wesentlichen daraus, daß die Hermeneutik bestimmte Anforderungen an die Auslegung von Texten stellt. Für die Hermeneutik hat diese immer von der Geschichte des Auslegers selbst auszugehen; vom Standpunkt der Systemtheorie dagegen ist die Erklärung der juristischen Auslegung komplexer. Die Auslegung ist beeinflußt durch die Verhaltensweisen oder Haltungen der Akteure im rechtlichen Geschehen: der Richter, Parteien, Zeugen, Sachverständigen usw. oder durch die Verhaltensweisen oder Haltungen von Rechtswissenschaftlern. 56 Die Problemstellungen der Gesetzgebungslehre oder die Art der Überprüfung der Wirksamkeit bzw. der Befolgung der Gesetze ändern sich zwangsläufig, sobald in Rechnung gestellt wird, daß die Rechtsgenossen ihr Verhalten nicht ausschließlich an der Rechtsordnung, sondern auch an anderen sozialen Normenordnungen, wie Moral und Religion, orientieren. Dies darf auch bei der Ausarbeitung einer Rechtstheorie nicht außer acht gelassen werden. Seitdem der staatliche Zwang nicht mehr als entscheidendes Kriterium für die Bestimmung des Rechtsbegriffs gilt, ist es möglich, das Recht als Verhaltenserwartung zu bestimmen, die grundsätzlich von den zuständigen staatlichen Organisationen geändert werden kann. Allerdings wird die rechtschaffende Funktion nicht ausschließlich vom Staat, sondern ebenso unabhängig von ihm in den alltäglichen gesellschaftlichen Rechtskommunikationen wahrgenommen. Die Systemtheorie bietet die Möglichkeit, bei der Beschreibung des Rechts die Beiträge, die seitens der Hermeneutik und der Argumentationstheorien normativistischer Prägung gemacht werden, zu integrieren. Letztere sehen ebenso wie die Systemtheorie die Rechtsentstehung als einen Mechanismus wechselseitiger Kopplungen, beispielsweise zwischen Rechtshandlung oder Rechtsanwendung und Rechtsvorschrift bzw. zwischen dogmatischer Aussage und Rechtssatz.57 Die Beschreibung des Rechts als ein funktionales Sozialsystem, welches aus verschiedenen Subsystemen besteht und mit anderen Funktionssystemen der Gesellschaft in einem Verhältnis der Wechselwirkung steht, bietet die Möglichkeit, über Phänomene Auskunft zu geben, die charakteristisch für die moderne Gesellschaft sind. Es kann geprüft werden, ob es in anderen Funktionssystemen Alternativen zu rechtlichen Problemlösungen gibt oder welches der Funktionssysteme in der Lage ist, einen gesellschaftlichen Konflikt zu lösen. 56 Ein Beispiel bildet Reginald Walter Michael Dias, Autopoiese and the Judicial Process, in: RECHTSTHEORIE 11 (1980), S. 257 - 282. 57 Gunther Teubner, Hyperzyklus in Recht und Organisation. Zum Verhältnis von Selbstbeobachtung, Selbstkonstitution und Autopoiese, in: Hans Haferkamp / Michael Schmid (Hrsg.), Sinn, Kommunikation und soziale Differenzierung, Frankfurt a.M. 1987, S. 89 - 128,111, 113.
32
Fernando Galindo
Mittels systemtheoretischer Überlegungen kann auch die Rolle des Staates besser analysiert werden. Gegenwärtig setzt sich zunehmend die Auffassung durch, daß der Staat nicht mehr die alles leitende und entscheidende Organisation ist, wie man noch vor wenigen Jahren meinte, als man ihn mit gesellschaftlichen Führungs- und Planungsaufgaben ausstattete. Heutzutage überwiegt die Auffassung, dem Staat obliege in der Gesellschaft hauptsächlich die generelle Regierungsfunktion. Die Gesellschaft ist durch einen Polyzentrismus gekennzeichnet, da ihre Architektur nicht ausschließlich auf den juristischen und staatlichen Einrichtungen aufbaut, sondern auch auf anderen Institutionen mit ganz unterschiedlichen Charakteristiken. Nach dem bislang Gesagten ist zusammenfassend festzuhalten, daß weder die Hermeneutik noch die Argumentationstheorien eine umfassende Rechtstheorie hervorgebracht haben, die das Recht insgesamt beschreibt. Die Hermeneutik beschränkt sich zu sehr auf Vorschläge für das Textstudium und auf die Vermittlung von Richtschnuren für die Auslegung. Zudem betont sie einen einseitig geschichtlichen Zugang zu den Gegenwartsfragen, wodurch verschiedentlich eine „humanistische" Betrachtung des Rechts - rhetorischer oder gar naturrechtlicher Art - gerechtfertigt wurde. Die Theorie der juristischen Argumentation betont demgegenüber schwerpunktmäßig die Bedeutung der traditionellen Begründungsmethoden: vor allem der Deduktion. Sie bezieht aber gleichzeitig in gewisser Weise auch den Verständnishorizont des Beobachters in ihre Argumentation ein. Die argumentationstheoretischen Arbeiten liefern insgesamt keine adäquate Beschreibung des Rechts und des Prozesses der Rechtsgewinnung. Sie vermitteln lediglich ein normatives, analytisches oder deduktives Teilwissen des Rechts. Gelegentlich wird die Argumentationstheorie als Erkenntnismethode bezeichnet, die losgelöst sei von den Begründungsmethoden, wobei zugestanden wird, daß auf die von der Hermeneutik oder der kommunikativen Handlungstheorie aufgezeigten Bedingungen der Erkenntnis nicht eingegangen wurde und so die traditionellen Vorlagen der analytischen Philosophie weiterverfolgt wurden. Eine angemessene Ergänzung dieser Theorievorschläge bieten die Anregungen, die von der Theorie der sozialen Systeme ausgehen. Allerdings machen weder die Argumentationstheorie noch die Systemtheorie Vorschläge für Juristen oder für die tägliche berufliche Rechtsausübung, sondern für Philosophen und/oder Rechtstheoretiker. U m diese Vorschläge real nutzbar zu machen, muß mittels der beschriebenen Theorieansätze eine komplexe Rechtsstudie erstellt werden, die das Verhältnis von Rechtsnorm, Verhalten und sozialem System angemessen beschreibt. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß Gegenstand der Theorie eine Gesellschaft ist, in der es keine eindeutige Führungsrolle mehr gibt, wie sie in der Vergangenheit Staat und Recht zukam, da ständig neue Einrichtungen oder Organisationen entstehen, die entsprechende Aufgaben wahrnehmen und die die konstitutionellen Erforder-
Die Reinheit der Sprache
33
nisse des Rechts durchaus in Rechnung stellen. 58 Will man den Gegenstandsbereich einer adäquaten Rechtstheorie umreißen, so sind folgende Aspekte zu berücksichtigen: das Recht als Rechtssatz und Rechtsvorschrift, als Verhalten (individuelles oder solches sozialer Gruppen), als Gedankenvorgang (der Staatsbürger oder des Rechtsstabs) jeweils in einer Gesellschaft, die sich durch Polyzentrismus (Staat und andere Einrichtungen, wie Unternehmen, Syndikate, wissenschaftliche Gemeinschaften usf., als Verhaltensvorschriften hervorbringende Zentren) und durch Komplexion auszeichnet oder, was das gleiche ist, durch die Intervention (Interaktion) von anderen als rechtlichen Instrumenten sozialer Kontrolle im Alltag. 5 9 (Aber diese Vorlage muß als fundamentales Objekt kritisch erkennen, ob man die Rolle des Rechts evaluativ in der Gesellschaft will und zugibt, daß dieses Wissen von der teilnehmenden Position des Beobachters mit seinem besonderen Begreifen der Gesellschaft betroffen ist.) Diese Rechtstheorie muß aber, um die idealen Erfordernisse der Theorie der kommunikativen Handlung zu erfüllen, vor allem Vorschläge ausarbeiten, die für die Juristen Geltung besitzen, die sich von Berufs wegen mit dem Recht beschäftigen, indem sie es auslegen und anwenden. Die Praktiker müssen über Werkzeuge verfügen, mit denen sie ihren Beruf in einer komplexen Umgebung ausüben können: rechtliche Regelungsprinzipien, 60 normative Ausarbeitungen, angemessene Gewohnheiten - u.a. bestimmt durch Rechtsverordnungen, aber auch durch andere Instrumente, die nicht ausschließlich für juristische Einrichtungen typisch sind, wie statistische, wirtschaftliche, medizinische Vorschriften - sowie Sensibilität für die verschiedenen Kulturen und Werte oder Arten von Moral, wie sie in der Gesellschaft vorhanden sind, in der sie arbeiten. Daher ist es wichtig, daß die Dogmatik und die Rechtsphilosophie ihre Vorschläge ausarbeiten, indem sie die juristischen und außerjuri-
58
Vgl. hierzu die Betrachtungen zur Rolle des Staats in der Gegenwart in dem Vortrag von Habermas vor dem spanischen Kongreß. Habermas, Die Krise des Wohlfahrtsstaates, in: ders., Die neue Unübersichtlichkeit, Frankfurt a.M. 1986, S. 141 - 163. Er weist auf die Problematik in bezug auf die juristische Methodologie von Ladeur hin (siehe Ladeur (FN 2), S. 219ff.). 59 Helmut Willke, The Tragedy of the State. Prolegomena to a Theory of the State in Polycentric Society, in: ARSP 72 (1986). Opafek besteht darauf, die ganze Komplexion zu übernehmen, ohne sich dabei vom Prinzip der Reinheit der Sprache als juristische Methode abzuwenden, doch werden dabei die Arbeiten der Rechtssoziologie und der Psychologie respektiert. (Dies hat er immer gemacht, indem er der Tradition des polnischen Rechts gefolgt ist, das auf L. Petrazycki und J. Lande zurückgeht, wie Opalek, Die Rechtstheorie in Polen im X X . Jahrhundert, in: ARSP 68 (1982), S.551 - 570, zeigt.) Er schlägt vor, von Direktiven statt von Normen zu sprechen, womit er der theoretischen Studie - nicht nur der rein sprachlichen - einen größeren Spielraum einräumt und ebenso auch der bewertenden. Er bezieht sich auf J. L. Austin und J. R. Searle: Opatek, Theorie der Direktiven und der Normen, Wien/New York 1986, S. 11 - 27. 60 Alexy hat, wenn auch beschränkt, Vorschläge in diesem Sinn mit seiner allgemeinen Theorie der Grundrechte unterbreitet. Alexy, Theorie der Grundrechte (FN 32). 3 Festgabe Opatek
34
Fernando Galindo
stischen Daten der sozialen Wirklichkeit berücksichtigen, die sie mittels der „Standard"-Beweisführungsmethoden gewonnen haben. Zwar ist es eben deshalb schwierig, eine für Juristen gültige Rechtstheorie zu entwickeln, aber man kann einige Verfahrensvorschläge für die verschiedenen Organisationen unterbreiten, die sich damit beschäftigen, das Recht zu beschreiben und anzuwenden, immer unter Berücksichtigung der verschiedenen, von unserer Kultur erlaubten Beweisführungsmethoden, der beruflichen Handlungsgewohnheiten der Juristen und der konstitutionellen Prinzipien. Es erscheint wünschenswert, daß Rechtsphilosophen und Dogmatiker den Charakter der Aktivitäten der Juristen und die Rolle des Rechts in der gegenwärtigen Gesellschaft beleuchten. Sie müssen Ausarbeitungen über die Probleme (zumindest über einige, denn es ist unmöglich, alle aufzudecken) vorlegen, mit denen sich die Rechtsregelung befaßt, indem ihr Echo oder ihre soziale Wirksamkeit beachtet und der Rahmen der verfassungsmäßigen Prinzipien respektiert werden, und nicht nur die normativen, rein analytischen Rekonstruktionen der juristischen Texte. U m diese theoretischen Arbeiten realisieren zu können, müssen sie sich auf „sichere" Daten der Realität stützen, die von Experten im Wege empirischer Forschung geliefert werden. Hinsichtlich mancher Fragestellungen erscheint eine interdisziplinäre Arbeit erforderlich zu sein. Bei dieser Aufgabe sind die methodologischen Vorschläge der Theorie der sozialen Systeme - nicht ihre theoretischen oder philosophischen Behauptungen über die Realität - von Nutzen: Sie sind ein höchst fruchtbringendes Instrument zur Beschreibung dieser Realität. Aufgrund der Anwendung dieser Vorschläge können konkrete und wirksame Empfehlungen ausgearbeitet werden. Letztlich sollen dem praktisch tätigen Juristen bei der Rechtsanwendung - gleichgültig, ob deduktiv oder nicht deduktiv - Begründungshilfen für die Auslegung an die Hand gegeben werden, die sich stets innerhalb des normativen und prinzipiellen Rahmens des Rechtsstaats, wie er verfassungsmäßig verankert ist, halten müssen. Soweit diese in die Praxis der Rechtsanwendungsaktivitäten und -kommunikationen umgesetzt worden sind, ist es mittels der analytisch-synthetischen und dogmatischen Theorien möglich, die typischen Aktivitäten der Juristen und deren Charakteristika zu untersuchen und zu beschreiben. Damit ist der Rahmen für die Strömungen vorgegeben, die das Prinzip der Reinheit der Sprache als Rechtsmethode zu erweitern trachten.
The State of Legal Dogmatics By Stig J0rgensen, Aarhus I. Scandinavian Realism (Jurisprudence) "Is 'jurisprudence' a science?", asked "Scandinavian Realism" 1 . By limitation of the concept of science so that it only embraced synthetic statements of the physical reality or analytical statements about logical coherence, the concept of legal science was strictly limited compared to the traditional conception2. Though the Swedish version is primarily a theory of cognition 3 , there are also so great similarities with the logical-positivistic theory of science that I intend to confine myself to A l f Ross' conception. According to this, science consists of propositions which can be verified , i.e. propositions the linguistic contents of which in accordance with special procedures can be proved to refer to external phenomena (or logical connexions). So, only sentences with "semantic reference" are scientific. Consequently, statements of "metaphysics" (God) and "evaluations" (justice) are unscientific (nonsense). Thus traditional legal dogmatics is not "scientific" as far as it consists of statements "de sententia ferenda", i. e. advice to the courts as to how rules of law have to be interpreted, or how a hypothetic legal conflict has to be solved. It is only scientific in case of statements "de lege lata", i.e. description of the existing legislation. It is self-evident that statements "de lege ferenda" (advice to the legislation) have got another character. Anyhow, Ross would characterize both of them as "political" as they involve "evaluations". Logical positivism wanted to limit science in the above way in order to put up a defence against religious, political and ideological usurpations, but it made the mistake of presupposing that it is possible to give an objective description of reality. Especially the conception of the social reality is attached to words and concepts which according to the "hermeneutic" philosophy of language are "intentional" and thus linked up with human aims and values. It 1 Björn Ahlander y Ä r juridiken en vetenskap, 1950. See as to the following Stig J0rgensen , Fragment und Ganzheit in der juristischen Methode, Rechtsdogmatik und praktische Vernunft. Symposion zum 80. Geburtstag von Franz Wieacker. Herausgegeben von Okko Behrends, Malte Dießelhorst und Ralf Dreier, Göttingen 1990. 2 Alf Ross, On Law and Justice, 1974. 3 Stig Strömholm / H.-H. Vogel, Le "Realisme Scandinave" dans la Philosophie du Droit, 1975, p. 19ff.
3*
36
Stig J0rgensen
is therefore impossible to "describe" phenomena with unknown "functions"; and any "description" implies an evaluating (analogical) attitude to the "similarity" with words and concepts compared to the previous application, and not a deductive (logical) application of the words on reality. Language and reality belong to separate logical categories, and each actual situation - concrete or hypothetic - must be "ascribed" to the concept, i.e. any "application of the concept" implies an extension of the concept or an "interpretation" 4 . The greatest problem for legal science is not the interpretation of the legal material but the application of the law, i.e. the selection of the relevant legal material and the corresponding description of the actual facts of the case (the legal qualification), respectively. Just because an objective description is impossible, the distinction of logical positivism between a descriptive legal science and an estimating legal politics or ideology of law is untenable. Otherwise, the traditional legal dogmatics, which has been the essence of legal science for hundreds of years, had to be regarded as unscientific ("the engineering of society"). I I . What is Science? Science consists of sentences about something (propositions), i.e. external phenomena or formal phenomena, e.g. language, figures and norms. Sentences in norms, i.e. rules of law or orders, cannot be science. The aim of science is to increase cognition, and what separates science from other forms of cognition is the method 5. There is no single, but instead several scientific methods according to the type of cognition aimed at; a common feature in all scientific method is its generalizing features as distinct from the casuistic features, i.e. the attempts at putting the gained cognition into a systematic coherence. Of course, the natural sciences apply other methods by the "description", "systematization" and development of "acts" for the relations between the phenomena of nature than the humanities, even if there are also here problems of description. The description must in all respects be linked up with the "relations" which the observer is interested in and thus also with the methods applied. A "complete" description is not possible for science; such belongs to art! Also the "social sciences" try to "describe" society in its many relations and with still more difficulties, both in that the description becomes dependent on 4
The actual situation has to be "qualified" linguistically. See Kazimierz Opalek, The Problem of "Directive Meaning", in: Festschrift for Alf Ross, 1969, p. 405ff. (413 - 14). 5 Meth-odos = the road by which . . .
The State of Legal Dogmatics
37
"intersubjective" criteria (ideologies), and in that the description helps to affect and change social reality. Legal science is in a way a social science as it deals with certain phenomena of society: the legal norms and their interplay with social reality. I I I . Legal Science Legal science consists of several legal sciences: the dogmatic and the nondogmatic ones. The last ones can only be defined negatively as they use many methods, all of them differing from the dogmatic ones. Sociology of law, history of law and comparative legal science use comparative methods. Sociology of law and comparative legal science compare horizontally the rules of law to social reality and the rules of law to different legal systems, respectively; history of law compares vertically the rules of law in different periods. The aim of these sciences is not to answer questions of the type: What am I obliged to? The aim is to obtain an insight in the function of law and its connexion with the social, historical and cultural phenomena in society. Thus, a better insight in the possibilities of controlling a society by legal means is obtained. We are now approaching legal political science and legal economics , which are new branches of science examining the connexion between the political and economic phenomena on one hand and the rules of law on the other. Legal politics is an old science, which altogether examines the need for changes in the social conditions and especially their manifestation in legal institutions and rules. In this respect legal dogmatics is an important preliminary condition, as it is not possible to comment on the need for changes of the rules of law if you have no precise knowledge of "the existing legislation". The comparative legal sciences are going to be an important source of inspiration, as they take a position on changes in the conditions of society and law and are thus able to comment on the need for changes in the rules of law as a consequence of changes in society. Usually, the preparatory work of new acts thus contains material from these sciences. Legal philosophy (and jurisprudence) concern the different superior questions: What is law? How is the relation between law and society, law and morals and law and politics? What is valid material (sources of law) in the sense that it has to, or is able to, form part of the legal decision? How is a judicial decision made? What is legal science? Consequently, this paper is a legal-philosophical work.
38
Stig J0rgensen
I V . Legal Dogmatics Legal dogmatics consists of sentences about what is at present valid law in a certain legal system; what are you obliged or entitled to in different relations? The relation of legal dogmatics to the humanities is that it largely deals with interpretation of texts, and in this respect it has to use the same methods for determining the logical, systematic, syntactic and semantic character of the text. However, legal dogmatics is not interpreting in the same way as interpretation of texts in general, a.o. works of art. Thus there are also different theories in the interpretation of art: the subjectively teleological one, which tries to work out the intention of the author with the text, and also the objectively teleological one, which lets the text speak for itself, and it excludes the intention of the author and stresses the perception of the recipient. Legal dogmatics and the theological sciences have the common feature that they must make a dogmatic-exegetic interpretation of authoritative (binding) texts. As it is the purpose of legal rules (just like that of other social norms, e.g. moral and convention) to be applied to social reality, you must attach importance to both the social purpose and the practical consequence of the rules on an equal footing with the linguistic effect of the interpreting and systematizing activities of dogmatics6. Legal dogmatics is a practical science , which develops the judicial doctrine: "the existing law" in a dialectical cooperation with court practice 7. V . Sources of Law 1. The Words and Purpose of Law A teleological interpretation of the legislation will therefore be a necessary, but not sufficient, basis. For one thing the purpose of society (utilitarism ) in a constitutional state (Rechtsstaat) has to compete with the regard for the legal security (Rechtssicherheit), which since the oldest (Western) cultures has claimed that the citizens must be able to calculate beforehand their legal status, and therefore laws must be announced, and they must not have retroactive effect. It is a derivation of this regard that the Danish Supreme Court has established that changes of administrative practice and internal circulars do not have an effect for the citizens until "some time" after the change of practice, if it is burdensome for the citizens.
6
Stig J0rgensen, Reason and Reality, 1986, p. 38. Stig J0rgensen, Review of J. Dalberg-Larsen, Retsvidenskaben som samfundsvidenskab, 1977, in: Rechtstheorie 9 (1978), also in: Reason and Reality, (1. c. note 6), p. 80f. 7
The State of Legal Dogmatics
39
For the same reason the "usual linguistic meaning " must be the basis of the interpretation. However, this is not unambigious, and in case of doubt pragmatic regards ("real regards") must supervene, i.e. by doubts as to the interpretation the alternative must be chosen which is best suited to consider the regard for the purpose of the law and other social regards on one hand and concrete justice on the other. The judicial decision is primarily a decision of the concrete case, but in consideration of the suitability of the decision as a pattern of future decisions. It is thus obvious that judicial decisions and administrative decisions must be material of source of law, as law in a community governed by law consists of rules which secure both the governing of society and the possibility of the citizens of being able to calculate beforehand the consequences of their legal conduct. In modern technique of legislation it is, however, not usual to comment on the purpose of the acts in a preamble, as it was in the former absolute acts. Therefore, you will find a tendency to search for information about the law or the individual rules in the preparatory work of the law instead. In modern technique of legislation the laws usually 1) originate in expert reports , 2) are accompanied by detailed motives , and 3) are supplemented with reports from the debates in Parliament. This technique, in which the preparatory work forms part of the interpretation, is called a "subjective ideological" method as distinct from the "objective ideological" method, where you subscribe to the presumed purpose of the law or the rules on the basis of an analysis of the law and its concrete contents. 2. Systematic and Principal Regards In the last respect systematic regards 8 are going to supervene, especially in the interpretation of the individual rules. Therefore, this factor is especially important in the legal systems which base especially private law on a major codification, like e.g. the continental one. Besides, general principles and ideals will form a necessary basis for the understanding of the rules of law in the different dogmatic branches of jurisprudence.
8 Stig J0rgensen, Law and Society, 1971, Recht und Gesellschaft 1971, Ch. 4, Pluralis Juris, 1982, p. 29f. Sometimes the term "coherence" is used to describe the connexion of a rule with the legal system from the assumption that it has got a systematic character. However, "coherence" also constitutes a concept of theory of cognition. As distinct from correspondence it implies an idealistic (as opposed to a realistic) theory of cognition: See Stig J0rgensen, Values in Law, 1978, p. 29ff., R. Zippelius, Die Bedeutung kulturspezifischer Leitideen für die Staats- und Rechtsgestaltung, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Nr. 7 (1987).
40
Stig J0rgensen
a) Private Law In the branch of private law private autonomy is going to be a natural basis of the interpretation, and there is thus reason to believe that the supplementing rules of law are not complete. Therefore, there is a possibility of analogical extensions of the applications when the courts find it well-founded, primarily as to the obligatory effects 9, i. e. the effects on the parties, whereas the effects in rem (the effects on a third party, e.g. rules of priority) are supposed to base on indispensable rules, which are then complete just like the rules with the purpose of protecting specific social groups, e.g. the consumers (reversed conclusion). The fact that private law as an institution has got private autonomy as basis does not mean that the further development of the rules of private law has to be deduced from the hypothetic will or assumptions of the parties, e.g. the "doctrine of assumption" (implied condition) of the law of contracts and the "doctrine of adequacy" (foreseeable consequence) of the law of torts are both based on the foreseeability of the relevant consequences. Such scientific method, which has been a common element in the theory of legal science, is an unfounded continuation of the Aristotelian metaphysics, which presupposes that the same principles which apply to a gender also have to control its species. Nowadays, it is generally recognized that the specified concretization of the legal institutions must take place on the basis of general rules resting on a "weighing of the average interests of the parties" 10. b) Administrative
Law
The administrative legislation will largely be based on regards of opportuneness and a detailed statement of aims and legal effects. Although the preparatory work plays an important role for the courts and consequently the argumentation of dogmatics, as society has developed from a constitutional state to a welfare state, the aspect of the security of life and property will continue to involve that the words of the acts, and not the motives, are binding on the citizens. If there is a contradiction between words and motives, the words must have priority, and in case of doubt of interpretation the regard for the legal security must usually have priority over public utility. Besides, administrative law has to respect both the principle of authority , i.e. the principle of the legal administration and of the finiteness of favouring 9 The preparatory works for the Scandinavian Acts of Contracts, which only concern the entering into and invalidity of contracts, emphasize that the act is not complete and that legal usage has largely used the rules analogically. Stig J0rgensen, Vertrag und Recht, 1968, p. 13ff. 10 Stig J0rgensen, Fragments of Legal Cognition, 1988, p. 40ff.
The State of Legal Dogmatics
41
decisions, when they have been communicated to the beneficiary, and the principles of equality , which means that the administration cannot use its authority to decide on other regards than the objective one; abuse of power implies invalidity, if the administration uses its authority to arrive at decisions which are detrimental to the citizens in order to attain other objects as intentional objects of the law. The principle of equality is also the basis of the interpretation in the law of bankruptcy , where a statement of right of priority ought to have special authority. c) Criminal Law and Law of Legal Procedure In a community governed by law criminal law will be based on the principle of th e freedom of action of the individual, i.e. that an action is allowed unless there is a punishable exception in an act which has been announced and which is not retroactive; therefore analogy is in principle forbidden in criminal law. It is also a consequence of the principle of freedom that the Prosecution has to prove the guilt of a charged person, and that the case is public and oral and based on the principle of contradiction (audiatur et altere pars) and on the free assessment of evidence . Just like the administrative law the law of legal procedure must respect the principle of standing decision , i.e. that a judicial decision is binding , unless it is changed by a higher court by means of the rules of appeal. d) The Constitution The systematic considerations can, besides the placing in the individual act (general / special part, same or different sections and so on) also be based on the connexion with the entire legal system. Obviously, a constitutional democracy must base on an individualistic ideology, and this must be the basis for the interpretation of the entire legal system, which rests on a political system. This fact has been illustrated by the above examples of legal principles , which are behind and control the interpretation of the rules in the different branches of jurisprudence. Quite a different thing is that "critical jurisprudence " has intended to proceed further and include the civic rights of the constitutions in the interpretation of both private law and administrative law. Especially in the U.S.A. and Western Germany the federal courts have got a special political function as regards harmonization of the legislation of the individual constituent states. The constitution is the common element where especially the principle of equality has been applied as grounds for processes concerning changes of the rules of law and administration of the constituent states. In the U.S.A. the racial integration has followed his road, just as death penalty has been tem-
42
Stig J0rgensen
porarily suspended through legal practice. In Western Germany a. ο. the principles of "social state " of the constitution have been referred to as control of the liberalistic system of the BGB 1 1 . In both common law countries, like the U.S.A. and England, and codification countries, like Western Germany and other continental countries, it is the task of the courts to adapt the rules of law to the development of society. On the other hand, however, it is evident that the law-creating power of the courts is limited, as the courts have no political authority. In the interests of the status of the courts as independent solvers of conflicts and of the political legitimation, there is a line between arguments de sententia ferenda and de lege ferenda. In the U.S.A. and Western Germany the courts have recently hesitated to involve in politically delicate affairs and have e.g. refused to contest the competence of the political authorities to decide the position of atomic power stations. In Denmark the Supreme Court has declared that it cannot judge the character of the "Christiania free city" as a "social experiment" 12 . V I . Priorities It seems to appear from the above that no single superior principle for the method of application of the law or the method of legal dogmatics can be referred to concerning priorities of the material of legal sources. The "legal method" is largely a professional "skill" which has developed through centuries or millenniums, just like other trades. The Greek Sophistics was the beginning of the differentiation of philologies between gender and species, between analysis and synthesis, concluding in the logic and rhetoric oi Aristotle, which lay down rules for safe conclusions by means of induction and deduction on one hand and for probable conclusions through the finding of arguments on the other 13 . Already Plato pointed out the principal risk of unjustice by using general rules in concrete cases, and he therefore introduced the concept epieikeia (fairness) as a concept of interpretation. Later on, influenced by the Stoics, the Romans introduced the concept aequitas and formulated the maxime: summum ius summa iniuria (the highest justice is the highest unjustice). The mediaeval rhetoric 14 continued to develop the theory of interpretation, and besides the linguistic-logical categories it also developed the artistic means analogy and contradiction and rules of priority for acts: higher prior to lower,
11
R. Wiethölter, Rechtswissenschaft, 1968. Ugeskrift for Retsvaesen, 1978, p. 315, see Stig J0rgensen, (1. c. note 6), p. 41. 13 Stig J0rgensen, Hermeneutik und Auslegung, in: Rechtstheorie 9 (1978), p. 66. f. 14 H. Coing, Die juristischen Auslegungsmethoden und die Lehren der allgemeinen Hermeneutik. 1959. 12
The State of Legal Dogmatics
43
new prior to older, special prior to general, but not rules solving all conflicts, e.g. new general acts as opposed to older and special acts. It is only on the surface that these rhetoric principles are logical; in the last end they are based on values and evaluations, a.o. the conclusion by analogy is based on the condition of a general principle, of which the separate rules are supposed to be a "manifestation". The mediaeval Romance jurisprudence, the rationalistic theory of natural law, and the idealistic conceptual jurisprudence (Begriff sjurisprudenz) have developed the legal method through the formation of an abstractive and generalizing apparatus of definition and concept, which has made the legal rules suited for control of the modern technological society. Legal dogmatics has, especially in cooperation with legal practice, created new "legal models " and "constructions" , which sum up a plurality of legal decisions which the courts arrive at intuitively and provide with formal grounds, until dogmatics finds the "leading views" being able to summarize and rationalize legal decisions. Not only in common law countries like England, where the precedent doctrine (stare decises) has prevailed, and in mixed constitutions like the Scandinavian ones, but also in codified legal systems, this constructive task is an essential element in dogmatics. On the basis of BGB § 242 (Treu und Glauben) the dogmatics of private law has during this century succeeded in developing very important innovations as e.g. "Geschäftsgrundlage", "Vertrauensschutz and "negatives Vertragsinteresse in the law of contracts and "Schutzzweck"Produkthaftung" and other objective liability rules in the law of torts 15 . It is the generally accepted view in Scandinavian philosophy of law and jurisprudence that there are no such general rules of priority for courts and for dogmatics16. Although the English precedent doctrine has been weakened, it is still customary here, like in Scandinavian theory and practice, that a judgment of the Supreme Court is considered to be of extremely strong guidance for theory and practice. However, concurrently with changed conditions especially older judgments of the Supreme Court might lose their authority. Besides, it can be established in Danish legal practice (and dogmatics) that the number of legal arguments is increasing, and that a shifting in the priority has also taken place. During the last decades the courts have increasingly used open arguments , i.e. direct references to social considerations on one hand and fairness and justice on the other. Direct references to previous legal usage and the legal doctrine have also become more usual. A t the same time refer-
15
F. Wieacker, Zur rechtstheoretischen Präzisierung des § 242 BGB, 1956. Magnus Aarbakke, Harmonisering af rettskilder, in: Tidsskrift for Rettsvitenskap, 1966, p. 501 ff. 16
44
Stig J0rgensen
ences to the preparatory work of the acts and to administrative practice have increased concurrently with the extension of the administrative legislation 17 . In the last tendency there is probably an indication that we have moved from the "constitutional state" to the "welfare state"; however, at the same time the first tendency indicates that the protection of the individuals and the regard for fairness pull in opposite directions. There is hardly any doubt that the courts still regard themselves as the "third power of the State" which has to adapt the regard for the interests of the community with the regard for the individual citizens. Legal dogmatics has to take this establishment as the starting point for the constant development of "the legal method " which in the stated sense of the word must be regarded as scientific and as the tools with which the legal dogmatics is constructed and built. It may be right when "realistic" legal science maintains that the solving of legal problems take place intuitively, and that the legal grounds are given subsequently18. This in on the other hand a truism, as the judicial decision is always a decision which is a result of a psychological motivation process , whereas the legal grounds subsequently ensure the authority and rationality of the decision by making the linguistic conclusion (syllogism), with which it is ensured that the decision can be traced back to "the existing legislation" through approved methods and general logic and be fit into a "systematic" connexion (dogmatics, doctrine) 19 .
17
Stig J0rgensen, Die rechtliche Entscheidung und ihre Begründung, in: Rhetorische Rechtstheorie, hrsg. von O. Ballweg / T.-M. Seibert, 1988, p. 337; and Stig J0rgensen, (1. c. note 6), p. 47ff. 18 Alf Ross, (1. c. note 2), p. 43, with references to the American Realism. Gnaeus Flavius (Hermann Kantorowicz) , Der Kampf um die Rechtswissenschaft, 1906, p. 21 f., with references to Bartolus, see R. Zippelius, Jurisprudenz, eine rationale Wissenschaft, Universitas, 1988, p. 53ff. 19 Stig J0rgensen, (1. c. note 6), p. 38ff., 47ff. and the above note 17.
Kelsen in the Role of Critic By Stanley L. Paulson, St. Louis* I. Introduction In his "Verfassungslehre" (1928), Carl Schmitt contrasts aspects of Hans Kelsen's Pure Theory of Law with, as Schmitt puts it, a truly thoroughgoing form of "normativity", the "bourgeois Rechtsstaat " of the seventeenth and eighteenth centuries 1. From concepts such as private property and personal freedom, proponents of the Rechtsstaat constructed norms that were "valid in and of themselves", "valid because they were correct and reasonableSuch norms "therefore contained, quite apart from their positive-law efficacy, a genuine 'ought'". With respect to normativity understood in this way, one could in fact speak "of system, of order, of unity" 2 . In Kelsen's theory, Schmitt continues, it is just the opposite: Norms are valid not because they are reasonable, just, and the like, but simply "because they are positive norms". "Here the notion of 'ought' suddenly vanishes, and the notion of normativity is severed. Taking over is the tautology of raw factuality: Something is valid if and because it is valid." "This", Schmitt concludes grimly, "is positivism" 3 . Positivism, in other words, is fact-based positivism, and this empiricopositivistic theory is familiar from the tradition. According to Schmitt, Kelsen's Pure Theory is just one more case in point. Is this approach helpful as a way of understanding Kelsen? I think not. It presupposes, as viable for purposes of criticism, precisely that view of the tradition in jurisprudence and legal philosophy that Kelsen himself rejects in the end. In particular, it presupposes that the natural law theory (Schmitt's exam-
* This essay reflects research I conducted as a guest in the Faculty of Law, University of Münster. Among the many colleagues and friends in Münster to whom I am indebted for kindnesses over the course of my long visit, I should like especially to mention Werner Krawietz, Valentin Petev, Martin Schulte, Dieter Wyduckel, and the late Norbert Achterberg. 1 Carl Schmitt, Verfassungslehre, Munich/Leipzig 1928, reprinted: Berlin 1970, pp. 8 - 9. 2 Ibid. (Emphasis in original.) 3 Ibid, p. 9. (Emphasis in original.)
46
Stanley L. Paulson
pie is the "bourgeois Rechtsstaat ") and the empirico-positivistic theory cover the field - a view that I shall call, a bit inelegantly, the "two-camp" doctrine. To repeat: Schmitt's approach is less than helpful if Kelsen's own doctrine of normativity, "normativity without natural law", represents a break from the tradition rather than a continuation of it. To appreciate Kelsen's strategy here, I want to trace his steps in constructing what I shall term the jurisprudential antinomy 4 . The antinomy is generated by the two-camp doctrine; in resolving it, Kelsen prepares the way for his own theory. Whether it is in fact possible to make out a prima facie case for the twocamp doctrine is an important question, and I return to it below. For now, it is enough to say that Kelsen himself makes a case for the two-camp doctrine by arguing in the alternative: Either the theory in question is straightaway an example of one of the traditional types of theory. Or at any rate that part of the theory that survives Kelsen's criticism reflects one or the other of the traditional types of theory. Felix Somló, a prominent Continental spokesman for Austinian legal positivism, is an example of the first alternative 5 , and Georg Jellinek is an example of the second6. Before turning to Kelsen's critique of Jellinek, I want to introduce the jurisprudential antinomy. I I . The Jurisprudential Antinomy7 Kelsen writes again and again that the sole aim of the Pure Theory of Law is cognition or knowledge of its object, precisely specified as the law itself. In constructing such a theory of specifically legal cognition, Kelsen's special task is to ward off the "foreign elements" that, he believes, have led legal theory astray so often in the past. Jurists and legal scholars have become entangled in "alien" disciplines - in ethics and theology on the one hand, in psychology and biology on the other 8 . And by venturing into these non-legal fields in search of answers to legal questions, they have been chasing a will-o'-the-wisp. 4 The jurisprudential antinomy represents my reconstruction of a particular line of thought in Kelsen' s texts; it is not a restatement of an argument explicitly developed by Kelsen. 5 Felix Somló, Juristische Grundlehre, Leipzig 1917, reprinted: Aalen 1973, which Kelsen in his work, Das Problem der Souveränität, Tübingen 1920, reprinted: Aalen 1960, pp. 31 - 36, identifies (and dismisses) as an example of empirico-positivistic theory. 6 Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte, 2nd ed., Tübingen 1905, reprinted: Aalen 1979, pp. 12 - 41 et passim. In Section I V of the paper, I sketch Kelsen' s critique in his early Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Tübingen 1911,2nd printing 1923, reprinted: Aalen 1960, pp. 172 - 188, of Jellinek's inorganic theory. 7 Section I I of the present paper is an abbreviated version of one section of my introduction to Hans Kelsen's Introduction to the Problems of Legal Theory, a translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre, Leipzig/Vienna 1934, Oxford 1992. 8 Kelsen, Legal Theory (FN 7), § 1.
Kelsen in the Role of Critic
47
Why is it that Kelsen resists, in the name of legal theory, the natural inclination to turn to ethics, psychology, and the like for help on legal questions? A closer look at Kelsen's allusions to what he terms "alien" fields is telling. He writes that the discipline known as the "specific science of law" must be "distinguished from the philosophy of justice on the one hand and from sociology, or the cognition of social reality, on the other" 9 . As these lines suggest, Kelsen's allusions to "alien" fields are thinly disguised references to the main competing views in the Western tradition of jurisprudence and legal philosophy, and it is from these traditional views that a "pure" theory of law must be sharply distinguished. In an early work he expresses the same notion at greater length, writing that "the purity of the theory . . . is to be secured in two directions. It is to be secured against the claims of a so-called 'sociological' point of view, which uses the methods of the causal sciences to appropriate the law as a part of nature. And the purity of the theory is to be secured against the claims of the natural law theory, which . . . takes legal theory out of the realm of positive legal norms and into the realm of ethico-political postulates" 10 . Three points, drawn in part from the texts quoted above, hint at the strategy Kelsen employs in some of his arguments in the Pure Theory of Law generally. The first point is historical: Kelsen, along with many others, understands the Western tradition in jurisprudence and legal philosophy in terms of two basic types of theory - the natural law theory and an empirical, sociological, or "positivistic" theory of law. In the natural law theory, the law is interpreted as a part of morality; in the empirico-positivistic theory, it is interpreted as belonging to the world of fact or nature. A second point builds on the first, even if to be sure going beyond the view expressed in the texts quoted above. This point is of philosophical import: Many in the tradition have understood the natural law theory and the empirico-positivistic theory as not only mutually exclusive but also jointly exhaustive of the possibilities. Thus understood, the two types of theory together rule out any third possibility ( tertium non datur). Pretenders theories that appear to be distinct from both traditional theories - are ultimately reducible to either the one or the other. The third point, like the first stemming directly from the texts quoted above, is Kelsen's rejection of the traditional theories. Neither the natural law theory nor the empirico-positivistic theory is defensible. Proponents confuse the law with morality and with fact respectively, failing to see that the law has a "specific reality" of its own 1 1 . 9 Kelsen, The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, in: Harvard Law Review 55 (1941), pp. 44 - 70, at 44, reprinted in: Kelsen , What is Justice?, Berkeley/ Los Angeles 1957, pp. 266 - 287, 390, at 266. 10 Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), Foreword to Second Printing, at p. v.
48
Stanley L. Paulson
If one takes the second and third of these points together, things become interesting. For if one holds that the two traditional types of theory together exhaust the field, precluding any third type of theory, and if one holds, too, that neither type of theory is defensible, then one faces an antinomy - the jurisprudential antinomy , as I shall dub it 1 2 . Two views together exhaust the field, and neither is defensible. Clearly, something has to give. The antinomy blocks every move and must be resolved before one can go forward. Kelsen resolves the antinomy by showing that the traditional theories are not exhaustive of the field after all. Having done that, he is in a position to introduce his alternative to the traditional theories - the Pure Theory of Law. The theory is "pure" in being free of the "foreign elements" of both types of traditional theory; it turns, in other words, neither on considerations of morality nor on matters of fact. The key point in Kelsen's construction of the jurisprudential antinomy deserves a closer look. The thesis and antithesis that together give rise to the antinomy are deemed to be representative of the traditional theories: the morality thesis is understood as a capsule formulation of the natural law theory; its antithesis, the separability thesis , is understood as a formulation of the empirico-positivistic theory. The thesis - the morality thesis - gives expression to the idea that the nature of law is explicated ultimately in moral terms. For the sake of contrast with the antithesis, the morality thesis might be said to claim the inseparability of law and morality. The antithesis - the separability thesis - claims just the opposite, the separability of law and morality. Although everyone grants that there are positive and negative ties between law and morality, the separability thesis has it that these ties are not conceptual or a priori in character. The legal validity of a statutory provision, say, does not depend on conformity of the provision to some overriding moral precept; it depends, rather, on the satisfaction of formal or procedural conditions associated with the law-making process. Thus, the claim that the nature of law is to be explicated in moral terms is without basis - or so the proponent of the separability thesis contends. In summary, the jurisprudential antinomy arises from juxtaposing the morality thesis and its express contradictory, the separability thesis. If thesis and antithesis do indeed give adequate expression to the traditional theories, then
11
See, e.g., Kelsen, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1925, reprinted: Bad Homburg v. d. Höhe 1966, p. 43. 12 The notion of antinomy is familiar from the work of legal philosophers - one thinks, in the modern literature, of Chaim Perelman, Gustav Radbruch, A l f Ross and others. In my development of the form of the antinomy in the present paper, however, I have drawn primarily on Kant s mathematical antinomies in the First Critique, at A426 - A443, B454 - B471.
Kelsen in the Role of Critic
49
these theories are not only mutually exclusive but also jointly exhaustive of the possibilities. Finally, lest we forget the all-important antinomic turn in juxtaposing thesis and antithesis, neither of them, neither thesis nor antithesis, is defensible. Kelsen rejects them both, and in doing so, he faces squarely the jurisprudential antinomy. Kelsen's resolution of the jurisprudential antinomy stems from the observation, fundamental here, that while the traditional theories have been stated in terms of the morality and separability theses alone, there are in fact four theses to reckon with. The traditional reading, spelled out solely in terms of the relation between law and morality, fails to take account of a second issue, the relation between law and fact. Once this second issue is recognized, its theses - combined in various ways with the traditional theses - give the lie to the notion that the natural law theory and the empirico-positivistic theory alone could exhaust the field, that their respective theses, when juxtaposed, could give rise to an antinomy. To see what this neglected issue of the relation between law and fact comes to, it is useful to examine the two theses associated with it. The reductive thesis claims that the law is explicated ultimately in factual terms; it claims, in a word, the inseparability of law and fact. Its antithesis, the normativity thesis , champions the separability of law and fact. The reductive thesis, by definition, is an aspect of the empirico-positivistic theory of law, and the normativity thesis, more by implication than by express argument, reflects a part of natural law theory 13 . Taking as the point of departure four theses rather than the traditional two, the theses may be paired in various combinations. Three pairs of theses are of special interest here. The natural law theory is represented by bringing together the morality thesis and the normativity thesis. The empirico-positivistic theory of law is represented by bringing together the separability thesis and the reductive thesis. Finally, Kelsen's Pure Theory of Law is represented by bringing together the normativity thesis and the separability thesis. To have shown that some new type of theory is possible, debunking the notion that legal theorists fall inevitably into one or the other of the two traditional camps, does not of course help one whit in making a substantive case for the new theory. How is Kelsen to proceed? He cannot appeal directly either to morality or to fact, for he has ruled out both with his own critique of the traditional theories. Many contend that he makes the case for his Pure Theory
13 See Kelsen , Hauptprobleme (FN 6), p. 7, where he tacitly acknowledges the tie between the normativity thesis and the traditional natural law theory; compare Joseph Raz, who in The Authority of Law, Oxford 1979, p. 144, writes that Kelsen, though rejecting natural law theories, "consistently uses the natural law concept of normativity, i.e. the concept of justified normativity."
4 Festgabe Opatek
50
Stanley L. Paulson
of Law - "normativity without morality" - in Kantian terms 14 . My present interest, however, lies elsewhere. I I I . Jellinek vis-à-vis the Two-Camp Doctrine Is it obvious to suppose that the many remarkable figures with whom Kelsen quarreled - thinkers as different as Eugen Ehrlich, Otto von Gierke, Bernhard Windscheid, and Georg Jellinek 15 - will all fit into one or the other of the two traditional camps of legal theorists? Without a prima facie case on behalf of the two-camp doctrine, there is no basis for the jurisprudential antinomy either. From the standpoint of the history of legal philosophy, a tidy fit into one camp or the other is not at all obvious. From that standpoint, the two-camp doctrine is a forced fit that obscures, or ignores altogether, far too much that is of interest and significance. Kelsen, however, is not defending a thesis about the history of legal philosophy. Rather, as I suggested at the outset, his strategy reflects a critical thesis: Either the theorist in question is straightaway a proponent of one or the other of the traditional theories. Or, alternatively, that part of the theorist's work that survives Kelsen's criticism amounts to a natural law view or, more often than not for Kelsen, an empirico-positivistic view. Thus, Kelsen contends in his first major work, "Hauptprobleme der Staatsrechtslehre" (1911), that Rudolf Stammler' s theory amounts to an empirical view, not because Stammler says so but because Kelsen claims that the teleological method in Stammler's theory reduces to a causal or explicative method, which by definition is empirical in character 16. If Kelsen can fit as unlikely a case as Stammler into one of the traditional camps, then he will have a relatively easy time of it with other, less unlikely cases. (To be sure, Kelsen's 14
One statement and - in the course of his own development - increasingly skeptical evaluation of this idea may be found in Fritz Sander's early papers, namely, Rechtswissenschaft und Materialismus, in: Juristische Blätter 47 (1918), pp. 333 - 335, 350 - 352, Das Faktum der Revolution und die Kontinuität der Rechtsordnung, in: Zeitschrift für öffentliches Recht 1 (1919/20), pp. 132 - 164, and Die transzendentale Methode der Rechtsphilosophie und der Begriff des Rechtsverfahrens, in: ibid., at pp. 468 - 507. In my essay Läßt sich die Reine Rechtslehre transzendental begründen?, in: RECHTSTHEORIE 21 (1990), pp. 155 - 179,1 argue that a transcendental argument, understood by analogy to Kant's transcendental argument in the First Critique, cannot have any application in the law. 15 On Ehrlich, see Kelsen, Eine Grundlegung der Rechtssoziologie, in: Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 39 (1915), pp. 839 - 876; on Gierke, see Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), pp. 164 - 171; on Windscheid, ibid., at pp. 123 - 133; on Jellinek, ibid., at pp. 172 - 188 et passim. 16 Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), pp. 58 - 62, criticizing the distinction between teleological and causal methods defended by Rudolf Stammler in his early work, Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung, 2nd ed., Leipzig 1906.
Kelsen in the Role of Critic
51
view of Stammler's theory is not without problems of its own 1 7 , but it is nevertheless revealing on Kelsen's perception of Stammler.) What of Georg Jellinek? Is Kelsen able to fit him into the two-camp doctrine? Jellinek is an unusually interesting figure vis-à-vis Kelsen, and for a number of reasons. Above all, he is the single most important influence on Kelsen, both positively and negatively 18 . As for the positive influence, consider these lines: "Jurisprudence does not, indeed, cannot aim at the cognition of natural phenomena. . . . Rather, the task of jurisprudence is to comprehend norms - that is to say, those rules that have as their content not the 'must' of necessity but an 'ought' that governs the practical affairs of human beings as free agents" 19 . These lines are Jellinek's, not Kelsen's, and they reflect the "normative side" of Jellinek's so-called two-sided theory. Given language like this, one is tempted to say that Kelsen's own theory is an elegant restatement and further development of Jellinek's theory. The normative side is, however, but one side of Jellinek's two-sided theory. And this fundamental qualification is, for Kelsen, the rub: Jellinek, looking to what he terms the "social side" of the law, writes that the law is "factual in character . . . and, as such, is one of the social forces serving to form and develop the cultural life of a people" 20 . Kelsen will have none of it. Here one is tempted to say that Kelsen's theory represents an effort to show how this "social" or "factual" side can be avoided - and, indeed, why it must be avoided. Jellinek sometimes suggests that the social or factual side is basic to his theory 21 , and it might be expected that Kelsen in his criticism of Jellinek would
17
In particular, Kelsen seems to be proceeding here as though, in Radbruch's words, "a natural concept of crime could be substituted for a concept of crime related to a legal value", and likewise for other legal concepts. Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8th printing, Stuttgart 1973, § 1. 18 Kelsen hints at Jellinek's influence, both positive and negative, in praising him (see, e.g., Hauptprobleme (FN 6), p. 172), in criticizing harshly his doctrines (see, e.g., Soziologischer und juristischer Staatsbegriff, Tübingen 1922, reprinted: Aalen 1962, p. 106), and in combining praise and blame (see, e.g., Hauptprobleme (FN 6), p. 179). More telling, certain doctrinal developments in Kelsen's theory cannot, I believe, be understood apart from Jellinek. For example, on his "source norm" or basic norm Kelsen is indebted to Jellinek for the concept of conceptual necessity (cp. Jellinek, System (FN 6), p. 29, and Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3rd ed., Berlin 1914, reprinted: Kronberg/Ts. 1976, p. 182, with Kelsen, Souveränität (FN 5), p. 33n). And, interestingly, it is to Walter Jellinek that Kelsen is indebted for the notion of a highest, presupposed norm (cp. Walter Jellinek, Gesetz, Gesetzesanwendung und Zweckmäßigkeitserwägung, Tübingen 1913, reprinted: Aalen 1964, pp. 26 - 29, with Kelsen, Reichsgesetz und Landesgesetz nach österreichischer Verfassung, in: Archiv des öffentlichen Rechts 32 (1914), pp. 202 - 245, 390 - 438, at 215 - 220). 19 Jellinek, System (FN 6), p. 16. 20 Jellinek, Allgemeine Staatslehre (FN 18), p. 138. 21 See, e. g., ibid., at p. 163. See also Jellinek on the "normative force of the factual", ibid., at pp. 338 - 340, and Kelsen's dismissal thereof, in: Hauptprobleme (FN 6), p. 9. 4*
52
Stanley L. Paulson
then follow suit, arguing that the normative side of the theory is parasitic on the social or factual side. For the most part, however, Kelsen does not take this tack. For example, the main thrust of his argument in "Soziologischer und juristischer Staatsbegriff" (1922) has it that Jellinek's two-sided theory is incoherent 22 . In the early "Hauptprobleme", however, Kelsen attempts to show that from a different vantage point, Jellinek's theory does reduce in the end to an empirico-positivistic theory 23 . Recalling the two-camp doctrine, this critique of Jellinek provides the required fit into one of the traditional camps. In the section that follows, I turn briefly to Kelsen's critique of this aspect of Jellinek's work, his so-called inorganic theory.
I V . Kelsen on the Inorganic Theory Jellinek's label "inorganic theory" reflects a development parallel in some respects to Gierke's organic theory. The origins of Jellinek's theory, however, go back to the modern development of certain key concepts in the German private law, above all in the work of Carl Friedrich von Savigny and the Pandectisten. Here I am thinking, in particular, of the concepts legal subject and legal person , will, and unity 24. Savigny, as developments in the nineteenth century would show, put the leading question when he asked: "Who can be the bearer or subject of a legal relation?" 25 Only human beings can be, Savigny answers, and in support of his position he adduces an argument reflecting Kant's moral philosophy: " A l l law is for the sake of the moral freedom of every individual", and "individual" refers here to human beings, since only human beings can enjoy moral freedom. "Thus, the original concept of legal person or legal subject coincides with that of the human being" 26 . (To be sure, Savigny is closely identified with the complementary doctrine of the "artificial subject, created by way of a pure fiction" and contrasted with the natural - the real - human being 27 . The doctrine of the artificial subject, however, does not represent a retraction of the initial answer to the question as to the character of the legal subject. Rather,
22 Kelsen, Staatsbegriff (FN 18), pp. 114 - 120, see also 105 - 113. 23 Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), pp. 172 - 188 et passim. 24 In what follows I have drawn on Julius Binder, Das Problem der juristischen Persönlichkeit, Leipzig 1907. See also Hans Kiefner, Der Einfluß Kants auf Theorie und Praxis des Zivilrechts im 19. Jahrhundert, in: Philosophie und Rechtswissenschaft, J. Blühdorn / J. Ritter, eds., Frankfurt 1969, pp. 3 - 25; Eggert Winter, Ethik und Rechtswissenschaft, Berlin 1980, pp. 294 - 310. 25 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, Berlin 1840, § 60. 2 * Ibid. 27 Ibid., § 85.
Kelsen in the Role of Critic
53
Savigny introduces the artificial subject as a means of taking account of those constructions to which legal capacity is actually attributed 28 .) The concept of will, the second of the concepts listed above, was already evident in Savigny's own theory 29 ; it made its way into the foreground in the course of development of the Pandectistic30. Its special role in the present context is linked to the third concept listed above, that of unity. For it was in terms of will that the legal subject, the human being, was qualified as a unity. The conceptual scheme of legal subject, will, and unity is then transferred over - lock, stock, and barrel - from the Pandectistic to public law. Here the key figure was Carl Friedrich von Gerber, himself a private lawyer and a constructivist in his earlier period, who used the method of the Pandectistic31. Later Gerber shifts his attention to public law, taking the private law conceptual scheme with him, and his move marks the beginning of what came to be known as the Gerber-Laband-Jellinek School. Gerber's "conceptual transfer" and its reception meant that the public lawyers - including Georg Jellinek - would be explicating their doctrines in terms of will, specifically the notion of state will. In a word, the very elements providing the conceptual base for the legal person in private law turn up again for the state, as a legal person, in public law. But with a difference. While, as noted above, it was believed that one could make in psychical or quasi-psychical terms at least a prima facie case for the unity of the will of an individual, one cannot take that path to arrive at the unity of state will. Jellinek and Kelsen agree that the unity of the will of the state cannot be identified with the will of any natural person (that is, human being), for the state qua legal subject is properly understood as independent of each and every natural person 32 . By appealing to the notion of purpose, Jellinek resolves the problem presented by the conceptual transfer. That is, one can speak of a unified state will in virtue of the common goals or purposes of the state's organs or officials. Jellinek argues here, inter alia , by analogy: Just as a group of human beings, whose activities manifest "continuous, unified and interconnected purposes,
28 See ibid., §§ 60, 85 - 86. 29 Savigny, System (FN 25), vol. 1, Berlin 1840, § 4. 30 See, e.g., the role of will, in: Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, 9th ed., vol. 1, Frankfurt 1906, reprinted: Aalen 1984, § 69; Windscheid, Wille und Willenserklärung, Leipzig 1878, p. 3, reprinted in: Windscheid, Kleine Schriften, Reden und Rezensionen, Part I I : 1859 - 1892, Leipzig 1984, p. 293. 31 Gerber developed his System des Deutschen Privatrechts, first appearing in 1848 (Part I I in 1849), on the model of Roman law constructivism. No Romanist himself, Gerber became "in the eyes of his more dogmatic fellow Germanisten", what with this adoption of constructivism, "a 'romanizing Germanist Peter von Oertzen, Die soziale Funktion des staatsrechtlichen Positivismus, Frankfurt 1974, p. 217. 32 See Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), p. 172.
54
Stanley L. Paulson
appears to us as an association (in ordinary usage, a unity)", so likewise for state organs or officials 33 . How, starting with the individual psychical wills of various state officials, does one arrive at this common purpose? Jellinek's reply reflects the sharp distinction he makes, like Kelsen after him, between causal and normative methods 34 . He says that the common property - the common purpose - of various state organs or officials is abstracted from their individual psychical wills. And this act of abstraction belongs to the juridico-normative method of cognition, not the causal or explicative method familiar from the physical sciences and psychology. Kelsen replies, first, by flatly denying that there is any common element that might be abstracted and, second, by arguing that even if there were a common element, Jellinek's doctrine of abstraction would be of no help in arriving at it. In the first part of his reply, Kelsen argues that state legislative organs cannot be regarded as having psychically "willed" the content of the statutes they enact and that therefore legislation cannot be regarded as a ground upon which the notion of unity might be constructed. In many cases legislators have merely random knowledge as to the content of the bills they enact into law; only members of the legislative committee will be conversant with the details of the legislative bill under discussion35. And one cannot will that which is not present to the imagination 36 . In a word, here Kelsen rejects Jellinek's position on the ground that without a defensible notion of psychically willing the content of the statute, there is simply no basis for speaking of a common element of purpose. In the second part of his reply, Kelsen argues that even if there were a common element of purpose, Jellinek would not be able to arrive at it by means of his doctrine of abstraction. Here Jellinek distinguishes the doctrine of abstraction from that of the fiction: "Real processes in the world of external and internal events underlie the abstraction, whereas the fiction sets an invented fact in place of the natural fact and equates the former with the latter. The abstraction is based on [an] event, the fiction on something invented" 37 . In distinguishing between the abstraction as presupposing real events and the fiction as something invented, Jellinek sets the stage for Kelsen's reply. These "real events", according to Kelsen, that are presupposed by the abstrac33
Jellinek, System (FN 6), p. 29, quoted, in: Kelsen , Hauptprobleme (FN 6), p. 172. See Jellinek, System (FN 6), pp. 13 - 19. 35 Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), p. 176 (on Jellinek), and see Kelsen's more extensive discussion of the same point, criticizing Gierke, at ibid., pp. 169 - 170. 36 Ibid., p. 170. 37 Jellinek, System (FN 6), p. 17. 34
Kelsen in the Role of Critic
55
tion known as state will, are acts of human will. By way of abstraction, by way of eliminating some properties of a thing in order to highlight others, one can only arrive at an "abstract" version of the same thing. If that from which one abstracts is empirical, that which one arrives at by way of the abstraction will be empirical too. If, then, the thing from which one abstracts is an aggregate of human wills, that is, an aggregate of "the will[s] of human being[s]", one cannot go from there via the process of abstraction to the will of a legal person, for the former is empirical, the latter is not 3 8 . In fact, Kelsen says, Jellinek does not arrive at the concept of a unified will of the state by way of abstraction from an aggregate of human wills at all; rather, Jellinek is in fact introducing or "thinking up" a new property 39 ; he is assuming a quality that cannot be cognized by appeal to anything in the external world 4 0 . Quite apart from the question of its cogency, Kelsen's argument in reply to Jellinek tells us something about how Kelsen interprets Jellinek: He falls into the camp of "empiricist" legal theorists on the ground that his fundamental notion of a unified state will, if it is intelligible at all, is intelligible only empirically. As noted above, Kelsen's classification of Jellinek reflects Kelsen's critique of Jellinek, not Jellinek's own view of what he was about 41 . V . Concluding Remark My thesis, illustrated by the example above, is that Kelsen in his role as critic is working out a strategy. His task in the example is to set the would-be normativist Jellinek 42 into the empirico-positivist camp. Proceeding in the same way with other theorists, Kelsen makes a prima facie case for the two-camp doctrine. The two-camp doctrine generates, in turn, the jurisprudential antinomy, which Kelsen exploits as a means of highlighting problems in the traditional views. His resolution of the antinomy prepares the way for his own position, now seen as having real bite: "normativity without natural law" and, at the same time, the "separability principle without reduction to fact". Whether - it is worth repeating - Kelsen succeeds in the end in making a convincing
38
Kelsen, Hauptprobleme (FN 6), p. 178. * Ibid. 40 "Construction" is Kelsen's label, in his own early theory, for the intellectual process at work here; see ibid., pp. 183 - 184. 41 Similarly for Kelsen's classification of Gierke, ibid., pp. 164 - 171. Here Kelsen appears to grant that the Gierke who emerges from the critique in the Hauptprobleme does not reflect Gierke's own view of what he was about; see ibid., at p. 177. 42 See text quoted at FN 19, and see generally the normative side of Jellinek's twosided theory, e.g., Jellinek, Allgemeine Staatslehre (FN 18), pp. 11 - 12, 74, 137 - 139 et passim. 3
56
Stanley L. Paulson
case for his own position is another question, more difficult than anything considered here. He is denied even the semblance of a hearing, however, when Schmitt and others 43 relegate him without further ado to the empiricopositivist camp.
43 See, e.g., Hermann Heller , Die Souveränität. Ein Beitrag zur Theorie des Staatsund Völkerrechts, Berlin/Leipzig 1927, at pp. 53 - 57, reprinted in: Heller, Gesammelte Schriften, vol. I I , Leiden 1971, pp. 75 - 79.
Deklaration oder Konstitution von Rechten Von Michel Troper, Paris 1. In Frankreich ist ein leidenschaftliches Wiederaufleben der Debatte über die Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 festzustellen. Dieses Phänomen erklärt sich, was das Politische angeht, aus der Notwendigkeit, die 200-Jahr-Feier durch die moderne Form der Zelebration und das universitäre Kolloquium einzurahmen, aber auch aus der Existenz einer wichtigen Kontroverse, die sich aus dem engen Zusammenhang ergibt, der zwischen der offensichtlich theoretischen Frage nach der Deklaration, nach ihrem Inhalt, nach ihrer Natur und ihrem Wert einerseits und der politischen Frage nach der Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit andererseits besteht. In dieser Hinsicht ist ein merkwürdiges chassé-croisé zwischen Naturrechtlern und Positivisten zu beobachten, die mitunter verschiedene Positionen beziehen, und zwar solche, die gänzlich konträr zu den Auffassungen sind, die zu erwarten wären. Zur Frage nach der Natur der Deklaration hätte man sich beispielsweise vorstellen können, daß die Naturrechtler von dem eigentlichen Sinn des Begriffs der Deklaration ausgingen und die Auffassung vertreten würden, daß die Verfasser von 89 nichts anderes im Sinn hätten, als natürliche Rechte zu proklamieren. Im Gegensatz dazu müßten die Positivisten ihre Position dahingehend bekräftigen, daß es keine natürlichen Rechte gebe und daß es trotz der Bezeichnung nicht um eine Deklaration, sondern um eine wirkliche Konstitution von Rechten gehe, anders ausgedrückt um einen Text positiven Rechts, der einfach den bestimmt erklärten, aber kontingenten Willen der Menschen zum Ausdruck bringt. Nun kommt es im Gegenteil häufig vor, daß die Naturrechtler die Auffassung vertreten, es handele sich um einen Text des positiven Rechts, während die Positivisten meinen, es gehe um eine Deklaration natürlicher Rechte. Die Positionen beider Seiten lassen sich im Lichte der zeitgenössischen französischen Verfassungsgeschichte erklären. Zur Zeit der III. Republik gab es keine Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit der Gesetze. Einerseits hatten die Verfassungsgesetze von 1875 keine Verfassungsgerichtsbarkeit eingerichtet. Andererseits enthielten diese Gesetze weder eine Deklaration noch eine Präambel, nicht einmal einen Verweis auf die Deklaration von 1789, die demgemäß keinen Teil des positiven Rechts ausmachte. Schließlich sind die wiederholten und nachdrücklichen Appelle von Duguit und Hauriou an die Berufsrichter, Gesetze, die sich gegen den Geist der Deklaration richten, nicht anzuwenden, nicht beachtet worden. Zur Erklärung dieses Phä-
58
Michel Troper
nomens hat man sich oft auf die in Frankreich herrschende Meinung berufen, das Gesetz sei Ausdruck des allgemeinen Willens, und der Richter dürfe sich dem nicht entgegenstellen. Aber trotz der Tatsache, daß diese Überzeugung heutzutage immer noch besteht, kann die Kontrolle stattfinden. Der wirkliche Grund muß in der formalen Quelle des Statuts und der richterlichen Befugnisse, die nicht durch die Verfassung garantiert waren, sondern vielmehr aus einfachgesetzlichen Gesetzen resultierten, liegen, so daß die Gerichte, die die Gesetzesanwendung mit dem Vorwand der Verfassungswidrigkeit verweigern würden, eine einschneidende Einschränkung ihrer Befugnisse durch ein neues Gesetz hätten befürchten müssen, von strafrechtlichen Sanktionen gar nicht zu sprechen. Wie dem auch sei, zur Zeit der I I I . Republik ist die Situation klar und, wenn man so will, normal. Die Naturrechtler wollen das Gesetz dem Naturrecht, d.h. der Deklaration von 1789 unterwerfen, und die Positivisten bekräftigen erneut ihre Auffassung, daß es kein anderes Recht außer dem positiven Recht gibt. 1 Die Situation beginnt, sich mit der Verfassung von 1946 zu ändern. Diese bekräftigte nachdrücklich in ihrer Präambel „die Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers, die in der Deklaration der Rechte von 1789 verankert waren". Sie hat zwar einen Verfassungsausschuß geschaffen, dieser war aber nur dafür zuständig, die Gesetze auf ihre Konformität mit den in der Verfassung aufgeführten Bestimmungen hin zu prüfen. Eine Überprüfung anhand der Präambel war dem Ausschuß verwehrt. Zudem war es ihm lediglich gestattet, seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Man könnte also die Deklaration einerseits als einen Teil des geltenden Rechts ausmachen, der aber andererseits für den Gesetzgeber nicht zwingend war. Deshalb haben die Cour de Cassation und der Conseil d'Etat angefangen, ihre Entscheidungen auf die Deklaration zu stützen. Diese Entwicklung gestaltete sich zur Zeit der V. Republik in zwei Phasen. Zuerst hat die Verfassung von 1958 einen Verfassungsrat etabliert, dessen Entscheidungen für alle Staatsgewalten zwingend sind. Er kann Gesetze gleich nach ihrer Annahme durch das Parlament zum Prüfungsgegenstand machen, und wenn er sie als verfassungswidrig erklärt, können sie nicht mehr verabschiedet werden. Aber der entscheidende Wendepunkt, das, was man den französischen Fall „Marbury v. Madison" genannt hat, kam 1971. Seitdem erklärt sich der Verfassungsrat als zuständig zu bestimmen, daß ein gegen die Präambel und damit auch gegen die Deklaration der Menschenrechte, auf welche diese verweist, verstoßendes Gesetz verfassungswidrig ist. Wenn auch heutzutage die Verfassungsmäßigkeitskontrolle der Gesetze in Frankreich etabliert ist, läßt sich die Frage nach ihrer Legitimität wohl kaum 1 Ch. Eisenmann, La justice constitutionelle et la Haute Cour constitutionelle d'Autriche, Paris 1928, Préface de Hans Kelsen, réédit, Paris 1986, Avant-Propos de Georges Vedel, Postface de Louis Favoreu.
Deklaration oder Konstitution von Rechten
59
als geregelt ansehen. Sie stellt sich insbesondere in bezug auf die Deklaration. 1982 mußte der Rat über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die die jüngst an die Macht gekommene Linke zur Verstaatlichung von Unternehmen eingeführt hatte, befinden. Der Artikel 17 der Deklaration der Menschenrechte bestimmt, daß „aufgrund der Unantastbarkeit und Heiligkeit des Rechts auf Eigentum niemand um das Eigentum gebracht werden darf, es sei denn unter der Bedingung, daß eine von Gesetzes wegen festgestellte öffentliche Notwendigkeit dies offensichtlich erfordert und unter der Bedingung einer gerechten und angemessenen Entschädigung". Der Rat hat die Verstaatlichungsgesetze mit diesem Text verglichen und befunden, daß, wenn es dem Gesetzgeber allein zustehe, die öffentliche Notwendigkeit der Verstaatlichungen festzustellen, ihm ebenfalls zustehe zu untersuchen, ob die angemessene Entschädigung „gerecht" sei. Im vorliegenden Fall hat er diese Voraussetzung als nicht gegeben angesehen. Die Entscheidung hat somit erhebliche finanzielle Konsequenzen gehabt, da es nötig gewesen ist, das Gesetz zu modifizieren, um den ehemaligen Eigentümern eine höhere Entschädigung zu gewähren. Die Verstaatlichungen repräsentierten einen zentralen Punkt im Programm der Linken, so daß einige meinen konnten, der Rat könne einer von der Mehrheit der Wahlberechtigten gewollten Politik unter Berufung auf die Deklaration beträchtlich entgegenwirken. Daher ist die Debatte über den Charakter dieses Textes auch so bedeutend. 2 Eine Meinung geht dahin, daß es sich um die Anerkennung der natürlichen Menschenrechte handele. Diese Auffassung vertreten Naturrechtler, die damit behaupten können, das positive Recht solle künftig dem Naturrecht unterstehen, aber auch Positivisten, die sich im allgemeinen gegenüber der Verfassungsmäßigkeitskontrolle und insbesondere gegenüber einer Kontrolle, die einen früheren vagen und doppelsinnigen Text als Maßstab anlegt, reserviert zeigen und die sich auf den naturrechtlichen Charakter der Deklaration stützen, um zu bekräftigen, daß das Gesetz nur dem positiven Verfassungsrecht unterstehen soll. Auch wird gesagt, die Deklaration sei ein positiv-rechtlicher Text, weil er von dem Willen der politischen Autorität gesetzt wurde, sei es die Assemblée Constituante von 1789 oder der „constituant" von 1958. Diese Meinung wird vertreten von Verfechtern der Verfassungsmäßigkeitskontrolle, aber es handelt sich entweder um Positivisten, die eine Kontrolle nur mit Bezug auf das positive Recht akzeptieren, oder um Naturrechtler, die behaupten, daß die Deklaration in Wirklichkeit ein in Naturrecht verkleidetes positives Recht sei. Letztere hoffen auf diese Weise die Kritik ihrer positivistischen Gegner zu ent2 Man findet eine Darstellung einiger der im Text schematisierten Positionen in: Revue du Droit Public 3 (1989), insbesondere in den Artikeln von B. Jeanneau, Juridicisation et Actualisation de la Déclaration des Droits de 1789, S. 635 - 664; H. Oberdorff, A propos de l'actualité juridique de la Déclaration de 1789, S. 665 - 684; G. Bacot, La Déclaration de 1789 et la Constitution de 1958, S. 685 - 739.
60
Michel Troper
schärfen, oder aber sie wollen das Gesetz den unabhängig vom Deklarationstext interpretierten Menschenrechten unterwerfen. Zur Vereinfachung werden wir trotzdem im folgenden diejenigen als Positivisten bezeichnen, die meinen, daß die Deklaration Ausdruck des Willens der Mitglieder der Assemblée Nationale von 1789 ist, und als Naturrechtler werden wir diejenigen bezeichnen, die der Auffassung sind, daß die Assemblée nichts anderes gemacht hat als die Rechte, die der Mensch kraft seiner Natur besitzt und die demnach unabhängig und vor einer jeden Deklaration existieren, zu deklarieren und festzustellen. Es ist offensichtlich, daß die Antworten auf die wichtigsten und schwierigsten Fragen, die mit der Ausübungsmöglichkeit einer Verfassungsmäßigkeitskontrolle, mit der Legitimität der Kontrolle aufgrund der Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 und mit den geeigneten Interpretationsmethoden dieses Textes zusammenhängen, in hohem Maße durch das Verständnis der Natur der Deklaration bedingt sind. Was die Legitimitätskontrolle aufgrund der Deklaration angeht, ist die Rechtfertigung der Kontrolle schwach, wenn man die erste Auffassung akzeptiert und diesen Text als den Ausdruck des Willens der Assemblée Constituante von 1789 betrachtet: Wie ist es zu verstehen, daß wir dem Willen von Menschen unterworfen sind, die schon so lange tot sind? Wenn man im Gegenteil davon ausgeht, daß dieses Dokument den Charakter einer naturrechtlichen Deklaration hat, dann sind die in ihm enthaltenen Bestimmungen verbindlich, nicht weil sie von der Assemblée Constituante von 1789 angenommen worden sind, sondern weil die in ihm angeführten Rechte objektiv existieren. Diese ihre Existenz ist unabhängig von den Begriffen, in denen sie ihren Ausdruck gefunden haben, sowie von der Intention der Verfasser der Deklaration. Auf dieser Grundlage lautet die Rechtfertigung der Verfassungsmäßigkeitskontrolle wie folgt: Sie erfordert nicht die Unterwerfung des aktuellen Gesetzgebers einem historischen, kontingenten Willen, sondern einer ewigen Wahrheit. Wenn man der Auffassung ist, daß der Text im allgemeinen den Charakter einer Deklaration von objektiven Rechten besitzt, so kann die Interpretation ihrer Bestimmungen, was die Interpretationsmethoden angeht, sehr frei sein. Der „constituant" hat nach bestem Können diese Rechte festgestellt und zum Ausdruck gebracht, aber er ist durch die sprachlichen Doppelsinnigkeiten und Ungenauigkeiten notwendigerweise eingeschränkt gewesen. Es steht also jedem zu, die natürlichen Rechte mit Hilfe seiner eigenen Vernunft zu entdekken. Deshalb konnte Condorcet behaupten: „Weder die französische Verfassung noch selbst die Deklaration der Menschenrechte werden einer Bürgerklasse als vom Himmel herabkommende Tafeln dargestellt, die es zu loben und zu preisen gilt .. .". 3 Er zieht daraus die Konsequenz, daß man das Volk
Deklaration oder Konstitution von Rechten
61
öffentlich instruieren müßte, daß es von seiner eigenen Vernunft selbständig Gebrauch machen kann. In einem System, in welchem zur gesetzlichen Verfassungsmäßigkeitskontrolle die Deklaration der Menschenrechte als Maßstab angelegt wird, kann die Interpretation nach dieser Auffassung sehr frei sein und die Autorität, die für die Beachtung der natürlichen Menschenrechte zu sorgen hat, kann letztere direkt jenseits der Finessen und Ungereimtheiten des Textes festzulegen versuchen. Wenn man im Gegenteil die Deklaration der Menschenrechte als einen positiv-rechtlichen Text ansieht, dann kommt der Textsprache eine wichtige Bedeutung zu. Der Text muß dann nach den üblichen Methoden der Gesetzesauslegung interpretiert werden. Die Bedeutung und die Neuheit dieser Konsequenzen rechtfertigen also durchaus, daß man sich Gedanken über die Natur und die Bedeutung der Deklaration macht und daß man auch zu untersuchen beginnt, welche Bedeutung die Verfasser der Deklaration diesem Text zugemessen hatten. 2. Dies ist aber keine einfache Frage, weil das Wort „Bedeutung" seinerseits mindestens drei Bedeutungen hat, die grundverschieden sind und die in der Diskussion über die Deklaration der Menschenrechte allzu oft vermengt werden. Erstens, stricto sensu, kann sich die Bedeutung auf ein Wort oder auf einen Zusammenhang von Wörtern beziehen. In diesem üblichen Sinne ist die Bedeutung einer juristischen Aussage, z.B. eines Gesetzesparagraphen oder der Verfassung nichts anderes als das, was er vorschreibt. Diese Bedeutung ist durch einen Interpretationsakt bestimmt. Sucht man nach der Bedeutung des Artikels der Deklaration der Menschenrechte „Das Gesetz darf nur schädliche Handlungen verbieten", heißt dies, die Frage nach dem Sinn eines jeden Wortes, den er enthält, zu stellen und insbesondere zu bestimmen, was eine schädliche Handlung ist, so daß man wissen kann, welche die Handlungen sind, die mittels Gesetzes verboten werden dürfen, und, a contrario, welche nicht. Aber diese Auslegung hat nur einen Sinn, wenn das Gesetz, um das es geht, etwas vorschreibt. Diese Interpretation setzt also eine zweite Bedeutung lato sensu voraus, die nicht diejenige der Wörter, sondern diejenige des Textes selbst ist, gesehen im Gesamtzusammenhang oder, wenn man so will, eine zweite Interpretation, die auf die Form des Textes zielt. Man versucht demnach, den Textcharakter, die Art, welcher er angehört, zu bestimmen. Auf diese Weise kann ein Willensakt in der Terminologie Kelsens die Bedeutung einer Rechtsnorm darstellen. Er ist somit eine Norm. In diesem Sinne die Bedeutung eines Textes festlegen, heißt behaupten, daß er im allgemeinen
3 Zit. in E. Badinter/R. S. 399.
Badinter, Condorcet; un intellectuel en politique, Paris 1988,
62
Michel Troper
einen präskriptiven oder indikativen Charakter besitzt. Im Falle der Deklaration der Menschenrechte die Bedeutung festlegen zu wollen, heißt zu untersuchen, ob sie aus einem Zusammenhang von an den Gesetzgeber adressierten Vorschriften besteht, ob diese Vorschriften rechtlichen Charakter haben und ob dieser Charakter dem kontingenten Willen der Verfasser dieser Vorschriften oder der universellen menschlichen Natur zuzurechnen ist. Drittens ist die Bedeutung eines Textes, latissimo sensu, die Ideologie, der Inbegriff der Glaubensüberzeugung und der Werte, die ihn inspirieren, oder die Weltanschauung, die er zum Ausdruck bringt. Sich über die Bedeutung der Deklaration der Menschenrechte in diesem Sinne Gedanken zu machen, heißt zu untersuchen, in welchem Maße sie beispielsweise einer individualistischen Philosophie, einer rationalistischen Anschauung, entspricht sowie welches Bild sich ihre Verfasser von dem Menschen, von der Natur, von der Gesellschaft oder von der Rolle des Gesetzes machten. In dieser aktuellen Debatte über den natur- oder positiy-rechtlichen Charakter der Deklaration der Menschenrechte zeugen mehrere Argumente von einer Konfusion zwischen diesen drei Bedeutungsarten. Auf diese Weise rechtfertigt man den naturrechtlichen Charakter der Deklaration entweder aufgrund einer Wortinterpretation eines ihrer Artikel (z.B. das Wort „gleich" im 1. Artikel, „die Menschen werden . . . frei und gleich vor dem Recht geboren") oder aufgrund des Titels selbst der Deklaration, der einen indikativen Charakter zu implizieren scheint, oder auch aufgrund eines Hinweises auf diese oder jene naturrechtliche Philosophie, etwa diejenige von Locke oder diejenige von Rousseau. Diese drei Argumentationstypen sind in Wirklichkeit vollkommen unabhängig voneinander, und wenn man - wie üblicherweise der Auffassung ist, daß der Einfluß von Locke oder Rousseau zur Idee der natürlichen Rechte des Menschen, die nur noch deklariert werden müssen und die der Gesetzgeber gehalten ist zu respektieren, führen konnte, könnte man durchaus auch umgekehrt der Auffassung sein, daß der Einfluß von Locke oder Rousseau die Assemblée Constituante dazu geführt hatte, die Gleichbehandlung der Menschen zu wollen und dem Gesetzgeber vorzuschreiben oder sogar es zu wollen, ohne eine entsprechende rechtliche Verpflichtung vorzusehen. In diesem Fall würde die Deklaration eine Philosophie des Naturrechts zum Ausdruck bringen und wäre dennoch durch einen positiven, aber nicht notwendigerweise juristischen Charakter gekennzeichnet. Die Bedeutung, die man sucht, d. h. der naturrechtliche oder positivistische Charakter der Deklaration, ist also eine Bedeutung im zweiten Sinne latos sensu. Mit anderen Worten, um festzustellen, ob die Deklaration auf Naturrechte oder auf gesetzte oder auf geschaffene Rechte zielt, muß man direkt ihre Merkmale untersuchen und alle Argumente beiseite schieben, die sich auf die philosophischen Hintergründe ihrer Verfasser oder auf die Wörter ihrer besonderen Bestimmungen beziehen könnten.
Deklaration oder Konstitution von Rechten
63
3. Bis vor kurzem ging man fast einstimmig davon aus, daß die Deklaration sowohl hinsichtlich ihres Titels als auch hinsichtlich ihres Inhalts der Ausdruck einer naturrechtlichen Philosophie war; seit einigen Jahren vertreten einige Autoren die These, daß sich die Deklaration unter einem naturrechtlichen Deckmantel in Wirklichkeit von einer positivistischen und voluntaristischen Rechtsauffassung inspirieren läßt. Im folgenden werden wir uns der Untersuchung dieser These, den Gründen, aus denen wir sie ablehnen, und dem wirklichen Hintergrund der Diskussion zuwenden. I. Die These der Konstitution der Rechte Die Verfechter dieser These meinen, daß der Bezug zum Naturrecht völlig illusorisch sei und daß die Assemblée Constituante von 1789 die Rechte nicht deklariert, sondern konstituiert habe. Sie stützen sich auf wenige einfache, aber überzeugende Argumente: 1. Das moderne Naturrecht, und darunter verstehen wir das von Leibnitz und vor allem das von Christian Wolff, hat vor der Revolution in Frankreich eindringen können. Es wird, abgesehen von Straßburg, nicht an den Juristischen Fakultäten unterrichtet und stößt, seit es bekannt ist, auf den Widerstand der Philosophen. In der Assemblée Nationale war diese Richtung nie vertreten, bis auf Mirabeau - so die Meinung einiger Forscher - der von den Genfern beeinflußt war. Mirabeau hat also die Abfassung der Präambel stark bestimmt, aber was den Rest angeht, mußte er sich den anderen anpassen.4 2. Der wichtigste Einfluß ist der von Locke. 5 Locke ist kein wirklicher Naturrechtler. Für ihn ist die Natur nicht erkennbar und das Recht „reine Erfindung". Seine Anhänger „negieren" selbst die Wirklichkeit der rationalen Naturgesetze, die für den Menschen verbindlich wären. Das Recht könne nichts anderes als das aus einem Autoritätswillen entspringende positive Gesetz sein.6 3. Nachdem der Artikel 2 festgelegt hat, „daß der Zweck einer jeden politischen Assoziation die Bewahrung der natürlichen und unveräußerlichen Men4 M. Thomann, Origines et sources doctrinales de la Déclaration des Droits, in: Droits 8 (1989), S. 55 - 70; P. Wachsmann, 1789, Déclaration ou Constitution des droits, Communication au colloque „1789 et l'invention de la Constitution", Association Française de Science Politique, im Druck; doch Stéphane Rials stellt in Abrede, daß Mirabeau „aus Überzeugung ein moderner Naturrechtler oder ein Wolffianer gewesen sei" (La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris 1989, S. 461.) Antoine de Baecque rechnet Mirabeau außer der Vaterschaft der Präambel auch noch die des Artikels 6 zu (Le choc des opinions, in: A . de Baecque/W. Schmale/M. Vovelle, L'an I des droits de l'homme, Paris 1989, insbes. S. 31). 5 M. Thomann (FN 4); St. Rials (FN 4). 6 M. Thomann (FN 4); insbes. S. 65 f.
Michel Troper
64
schenrechte sei", gibt er eine einschränkende Liste der Rechte „Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung". „Die Zäsur, die die zwei Satzteile des Artikels trennt, schreibt P. Wachsmann, ist irreversibel und besiegelt das Ende des Naturrechts." 7 Die Enumeration bedeutet in der Tat, daß es nicht jedem Bürger freisteht, von seiner Vernunft Gebrauch zu machen, um die Naturrechte zu entdecken, und daß es keine Rechte gibt, außer denjenigen, die im Text erwähnt sind. 4. Anschließend verweist die Deklaration ständig auf das positive Gesetz, um den Inhalt und die Grenzen der Rechte zu bestimmen.8 So der Artikel 4 „Die Ausübung der Naturrechte jedes Menschen hat keine anderen Schranken als diejenigen, die den anderen Mitgliedern der Gesellschaft den Genuß derselben Rechte sicherstellen. Diese Schranken können nur durch das Gesetz bestimmt werden." Man kann hinzufügen, daß es in derselben Weise dem Gesetz obliegt, gewisse Handlungen vorzuschreiben oder zu verbieten (Artikel 5), die Fälle und die Formen, in welchen ein Mensch festgehalten werden darf, zu bestimmen, die Delikte und die Strafen festzusetzen (Artikel 8), die öffentliche Ordnung sicherzustellen (Artikel 10), die Mißbrauchsfälle der Meinungsäußerungsfreiheit zu bestimmen (Artikel 11), die Notwendigkeit der contribution publique festzustellen (Artikel 14) oder die öffentliche Notwendigkeit festzulegen, die es erfordert, daß sich ein Mensch seines Eigentums entledige (Artikel 17). 5. Die Deklaration steht zu Beginn der Verfassung und macht einen Teil dieser aus, so daß ihre Geltung ausschließlich auf ihrer Positivität beruht. 9 Eine Bezugnahme auf das Naturrecht wäre also eine einfache „Tarnung", ein „Betrug" der Assemblée, ein geeigneter Kunstgriff der verfassungsgebenden Tätigkeit, um ihr Legitimität zu verleihen und um zu vermeiden, daß ein freier und unvermeidlich willkürlicher Wille zum Vorschein kommt. II· Prüfung dieser Argumente Alle diese Argumente sind in Wirklichkeit auswechselbar oder widerlegbar: 1. Zunächst kann die Wirkung des Werkes von Wolff, wie übrigens eines jeden anderen Autors, für das Frankreich des 18. Jh. nicht so wie für Deutschland eingeschätzt werden, d.h. mit Blick auf eine Juristische Fakultät. Der intellektuelle Einfluß juristischer Fakultäten war schwach, und es gab andere und wichtigere Kanäle. Von dieser Prämisse ausgehend, ist es wahrscheinlich wahr, daß die Anhängerschaft des Naturrechts von Christian Wolff begrenzt war. Aber mit dieser Feststellung kann man sich nicht zufrieden geben. Sie 7
Ebd. Wachsmann (FN 4). 9 Ebd. 8
Deklaration oder Konstitution von Rechten
65
stellt insofern ein Argument dar, als man zeigt, daß der Text erhebliche Unterschiede aufgewiesen hätte, falls der Einfluß Wolffs maßgeblich gewesen wäre. Wenn man von der Hypothese ausgeht, daß Mirabeau (aus Überzeugung oder objektiv) ein Anhänger Wolffs war, müßten z.B. die Texte, die aus seiner Feder stammen, als solche klar identifizierbar sein. Wenn es also einen unzweifelhaften Stilunterschied zwischen der Präambel und den in der Deklaration angeführten Artikeln gibt, kann er der Tatsache zugeschrieben werden, daß diese zwei Teile, auch was die Rechtsphilosophie angeht, verschiedene Gegenstände beinhalten. Andererseits richtet sich das Projekt, das Mirabeau im Namen des Komitees der Fünf eingereicht hatte, keineswegs mehr nach der Philosophie Wolffs als jedes andere Projekt und verweist dennoch und sogar nachdrücklicher auf das positive Gesetz. 10 Was den Text angeht, den er selbst 1788 abgefaßt hatte, gibt es sicherlich Unterschiede zu dem 89 angenommenen Text, aber Ähnlichkeiten zu vielen anderen Texten derselben Zeit, was sich sehr einfach erklären läßt: Es ging zu diesem Zeitpunkt nicht um das Aufstellen von Verfassungsprinzipien, sondern eher darum zu zeigen, daß die Naturrechte von der absoluten Monarchie nicht beachtet wurden. 11 Es läßt sich nur schwer vorstellen, wie eine authentisch-naturrechtliche Deklaration - ganz unabhängig von dem Verhältnis zu Mirabeau - hätte aussehen können, weil nur eins von beiden stimmen kann: Entweder ist das Naturrecht durch die Vernunft erkennbar, so daß jeder Mensch direkten Zugang zu ihm hat, und in diesem Fall die Deklaration unnötig ist; oder aber diese Rechte bilden ein geschlossenes und kohärentes System, das man als Ganzes zum Ausdruck bringen muß, und die schlichte Tatsache, daß eine politische Autorität die Rechte zum Ausdruck bringt, reicht schon aus, um sie zu positivieren. 2. Was das Argument angeht, daß Locke kein wirklicher Naturrechtler sei, hängt seine Stichhaltigkeit davon ab, was man unter Naturrecht versteht. Wenn das „wirkliche" Naturrecht eine monistische Doktrin ist, nach welcher es Recht nur in der Natur gibt und dieses nur erkannt, aber nicht gesetzt werden kann, so ist Locke sicherlich kein Naturrechtler. Aber es gibt keinen Grund, solch eine restriktive Definition anzunehmen: Wenn das Naturrecht sich nicht allein auf den rationalistischen Strom reduzieren läßt, sich eine dualistische Doktrin definieren läßt, die das Vorhandensein von zwei Rechten akzeptiert, des Naturrechts und des positiven Rechts, die die Geltung des zweiten von seiner Konformität zum ersteren abhängig macht, ist Locke ohne Zweifel ein Naturrechtler. 12 10 So der Artikel 9 „Der Bürger darf reisen, seinen Wohnsitz frei wählen, das Staatsgebiet verlassen, unter dem Vorbehalt der im Gesetz bestimmten Fälle", in: Rials (FN 4), S. 747. 11 Rials (FN 4), S. 519. 12 „Die Naturgesetze existieren immer wie ewige Regeln für alle Gesetzgeber wie für alle anderen. Wenn die Gesetzgeber Gesetze machen, um die Handlungen der Staats-
5 Festgabe Opatek
66
Michel Troper
3. Wenn die Enumeration des Artikels 2 einen erschöpfenden Charakter besitzt, nimmt das keineswegs den indikativen oder präskriptiven Charakter des Textes vorweg. Es ist sicherlich möglich, die Entscheidung zu treffen, Rechte zu schaffen und diese aufzulisten, so daß andere ausgeschlossen sind. Aber angenommen, das Naturrecht sei erkennbar, ist es ebenfalls denkbar, die in der Natur existierenden Rechte zu suchen und eine Liste derselben aufzustellen. In beiden Fällen ist es eine einschränkende Liste. Der einzige Unterschied liegt darin, daß man in der zweiten Hypothese einen Fehler begehen konnte, sei es, daß man ein nicht existierendes Recht genannt hat, sei es, daß einige Rechte ausgelassen worden sind. Aber es ist nicht möglich, Schlüsse aus dem Vorhandensein einer Liste zu ziehen. 4. Das Argument, das sich aus dem häufigen Hinweis auf ein positives Gesetz ergibt, muß erklärt werden. Es zielt auf die Bekräftigung der Meinung, daß die in der Deklaration erwähnten Rechte keine wahren Naturrechte seien, da ihre Existenz in der Natur nicht festgestellt ist und aus den vom künftigen Gesetzgeber angenommenen Gesetzen resultieren wird. Es ist ausreichend, die in Frage stehenden Artikel zu lesen, um sich davon zu überzeugen, daß es in der Deklaration keinen Appell für die Schaffung von Rechten durch den Gesetzgeber gibt. Die Verweise auf das positive Gesetz gehören in Wirklichkeit zu zwei unterschiedlichen Arten. In den meisten der ins Auge gefaßten Fälle (Artikel 5, 8, 10, 11, 14, 17) appelliert der Text nicht an das Gesetz, um den Inhalt oder die Grenzen eines Rechts zu bestimmen; er beruft sich insofern vielmehr auf ein Naturrecht, als gewisse Handlungen nur durch das Gesetz geregelt werden dürfen. Durchaus eine Konzeption Lockescher Prägung: Es ist nicht das Gesetz, das das Recht begründet, sondern das Naturrecht, das das positive Gesetz begründet. Was den Artikel 4 angeht, beruht er seinerseits auf der den damaligen Juristen vertrauten Unterscheidung zwischen dem Inhalt und der Ausübung des Rechts. Diese Unterscheidung, die aus den alten das Eigentum betreffenden Doktrinen stammt, ist allerdings auch im vorigen Artikel im Hinblick auf die Souveränität getroffen worden: „Das Prinzip einer jeden Souveränität beruht wesentlich auf der Nation. Kein Körper, kein Individuum darf Amtsgewalt ausüben, die nicht ausdrücklich aus der Nation entspringt." Also gehört Souveränität im eigentlichen Sinn zur Nation. Dennoch ergibt sich daraus nicht, daß sie diese allein ausüben kann, sondern daß sich diejenigen, die diese ausüben, in einem gewissen Verhältnis zu ihr befinden müssen. Auf diese Art mitglieder zu regeln . . . , diese müssen zu den Naturgesetzen konform sein, d.h. zu dem Willen Gottes, dessen Deklaration sie sind; und da das Grundgesetz der Natur Aufrechterhaltung des menschlichen Geschlechts zum Gegenstand hat, gibt es keine menschliche Vorschrift, die gut und gültig sein könnte, falls sie gegensätzlich zu diesem Gesetz ist" (Simone Goyard-Fabre (Hrsg.), Traité du Gouvernment Civil, Paris, S. 282).
Deklaration oder Konstitution von Rechten
67
wird aus der Natur der Inhalt der Menschenrechte abgeleitet; diese werden in der sozialen Verfassung bewahrt und das Gesetz dient nur noch der Bestimmung ihrer Schranken, aber man muß sich davor hüten zu meinen, daß der Begriff der Schranke die Grenzen bezeichnet, die den Rechten selbst auferlegt werden. Noch weniger geht es um eine Aufgabe des Gesetzgebers, die Rechte zu schaffen, sondern lediglich darum, die Grenzen ihres Gebrauchs zu ziehen. Diese Funktion des Gesetzgebers entspringt allerdings aus der Natur selbst, denn wenn der natürliche Status verlassen wird, bedeutete dies einen Nachteil: Da es keine Grenzen der Ausübung der Naturrechte gab, war diese Ausübung Quelle von Konflikten. Ein Gesetzgeber ist also nötig, um die Grenzen festzulegen, und dies ist auch der Grund dafür, warum sich seine Autorität aus dem natürlichen Recht des einzelnen auf Sicherheit ableitet. 13 5. Letztlich ist es wahr, daß die Deklaration am Anfang der Verfassung steht. Aber dies autorisiert keineswegs dazu, auf den konstitutiven Charakter dieses Textes in den Augen seiner Verfasser zu schließen. Es muß zunächst einmal daran erinnert werden, daß es mitunter in einem Rechtstext Vorschriften gibt, die offensichtlich keinen präskriptiven Charakter haben. Das berühmteste Beispiel ist das der Verordnung der Konvention nach welchem „das französische Volk die Existenz Gottes und die Unsterblichkeit der Seele anerkennt". Es muß noch darauf hingewiesen werden, daß die Deklaration am Anfang der Verfassung steht, aber keinen Teil des Textes selbst ausmacht, gerade weil es gilt, Grundlagen zu setzen und nicht vorzuschreiben. Aus diesem Grund setzte man anschließend einen ersten Titel ein: „Fundamentale durch die Verfassung garantierte Dispositionen", der an den Gesetzgeber adressierte Vorschriften zum Ausdruck bringt. Wäre die Deklaration selbst ein Korpus von Vorschriften, wäre natürlich der erste Titel eine unnütze Wiederholung. Man kann dem gewiß entgegenhalten, daß die verfassungsgebende Versammlung sich eines Mittels bediente, um die Deklaration versteckt zu ergänzen oder zu modifizieren. Dennoch wurde der 89 angenommene Text keineswegs als abgeschlossen angesehen. Die Versammlung hatte am 27. August 1789 verordnet, „die Diskussion über die der Deklaration der Menschenrechte hinzuzufügenden Artikel auf die Zeit nach der Verabschiedung der Verfassung zu verschieben". Es wäre also zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Verfassung im Sommer 1791 möglich gewesen, die Debatte wieder aufzugreifen. Daß man es nicht gemacht hat, liegt nicht nur daran, daß man schneller abschließen wollte oder daß die Deklaration nach dem Wort von Thouret „einen religiösen und heiligen Charakter angenommen hatte"; es liegt auch daran, daß man das Gefühl hatte - immer nach Thouret - „daß sie sämtliche Keime enthalte, aus
13 P. Raynaud, Artikel „Locke", in: F. Chatelet/O. Duhamel/E. Pisier, Dictionnaire des Oeuvres Politiques, Paris 1986.
5*
Michel Troper
68
denen die dem Wohl der Gesellschaft dienlichen Konsequenzen erwachsen würden". 14 In der Tat wird alles, was zu diesem Zeitpunkt als natürliches Recht angesehen wird, angeführt. Wenn sich der erste Titel von der Deklaration unterscheidet, wie z.B. hinsichtlich der öffentlichen Unterrichtung und der Fürsorge, heißt das, daß es nicht um natürliche Rechte, sondern einfach um durch die verfassungsgebende Versammlung verliehene Rechte geht, die über den Ausweg positiv-rechtlicher Verpflichtungen dem Gesetzgeber aufgezwungen werden. Der indikative Charakter der Deklaration läßt sich aus dem präskriptiven Charakter des ersten Titels der Verfassung mühelos ableiten. I I I . Modalitätsstatut der Deklaration Der Fehler dieser Doktrin geht darauf zurück, daß der Boden, auf welchem diese Debatte geführt wird, verkannt worden ist. Dies führte zu einer trügerischen Äquivalenz zwischen Naturrecht und deklaratorischem Charakter einerseits und Positivismus und konstitutivem Charakter andererseits sowie zur unzulässigen Verquickung der Frage nach den Quellen mit der Frage nach dem Inhalt. 1. Zunächst sind Naturrecht und Positivismus mehrdeutige Begriffe, die sich nicht notwendigerweise gegenseitig ausschließen. Die Naturrechtslehre kann sich einmal als eine Rechtsquellenlehre und einmal als eine Ideologie über die Inhalte des Rechts darstellen. Im ersten Fall ist die Naturrechtslehre monistisch oder dualistisch. Monistisch ist sie, wenn sie behauptet, daß das einzige Recht das Recht der Natur sei. Meistens ist sie aber dualistisch, und zwar, wenn sie die Möglichkeit der Existenz eines positiven Rechts neben oder unter dem Naturrecht akzeptiert. Wenn sie als eine Ideologie mit Blick auf den Rechtsinhalt angesehen wird, beruht sie auf der Auffassung, daß das Naturrecht diesen oder jenen Inhalt hat und daß das positive Recht zu ihm konform sein müsse. Im Gegensatz dazu sind ihr die positiv-rechtlichen Inhalte gleichgültig. Diese Naturrechtsauffassung konzipiert das Recht als den Ausdruck einer zuständigen Willensautorität unabhängig von jeglichem Inhalt. Es ist also durchaus möglich - und es kommt sehr oft vor - , daß man das Recht in positivistischer Weise definiert und daß man nichtsdestotrotz eine naturrechtliche Position hinsichtlich der Rechtsinhalte bezieht. Wenn der Gesetzgeber Regeln setzt, deren Inhalt sich von den Konzeptionen der naturrechtlichen Doktrin inspirieren läßt, wird diesen Regeln Rechtscharakter zukommen, sei es unter einem naturrechtlichen Gesichtspunkt hinsichtlich der Regelinhalte, sei es unter einem positivistischen Gesichtspunkt aufgrund der Tatsache, daß sie auf die gesetzgeberische Autorität zurückgehen.
14 Zit. bei Rials (FN 4), S. 264.
Deklaration oder Konstitution von Rechten
69
Es kann also vorkommen, wie es beispielsweise bei der Abfassung des code civil der Fall gewesen ist, daß der Gesetzgeber im positiven Recht naturrechtliche Prinzipien zum Ausdruck bringt und daß er der Meinung ist, daß er das Recht „deklariere" und nicht setze. Ein und derselbe A k t kann hinsichtlich der Rechtsinhalte als „deklarativ" und hinsichtlich der Rechtsquellen als „konstitutiv" angesehen werden, d.h. zugleich als deklaratorisch und positiv.^ 2. Die hier erörterte Doktrin läßt andererseits den konstitutiven Charakter nicht einfach aus der Tatsache entspringen, daß die Deklaration von einer politischen Versammlung konzipiert worden ist, sondern aus der Tatsache, daß ihr Inhalt, die Rechte, die sie proklamiert, keine wahrhaft naturrechtliche Doktrin darstellt. Wenn das ausreicht, um den Text seines deklaratorischen Charakters zu entledigen, dann liegt dies daran, daß dieser Charakter nicht aus einer vollkommenen Konformität zum „wirklichen" Naturrecht entspringen kann. Es ist möglich zu behaupten, dies sei ein Betrug, wenn man von der Prämisse ausgeht, es gebe eine ehrliche Deklaration, weil man glaubt, es gebe natürliche Rechte oder ein „authentisches" Naturrecht. Wenn man aber diese Metaphysik ablehnt, so muß man gewiß die Frage nach dem konstitutiven oder deklaratorischen Charakter von derjenigen nach den Rechtsinhalten unterscheiden. Zudem darf sie nicht mehr als eine Frage nach den Quellen des Rechts behandelt werden. Es ist klar, daß alles Recht nur auf der Grundlage der gesetzgeberischen Tätigkeit Recht sein kann, und daß in diesem Sinne die Deklaration, wie jeder juristische A k t , konstitutiv ist. Aber das, worum es hier geht, ist bloß ihre Bedeutung. Haben die Verfasser dieses Textes es beabsichtigt, Rechte deswegen zum Ausdruck zu bringen, weil sich diese aufgrund ihres naturrechtlichen Charakters durchsetzen oder einfach Ausdruck ihres gesetzgeberischen Willens sein sollten? Die Frage ist nicht psychologischer Art. Das innere Gefühl der Verfassungsgeber, wenn wir es erkennen könnten, spielt keine Rolle. Es geht eigentlich darum, die Funktion zu beschreiben, welche die Aussagen der Deklaration in der juristischen Argumentation erfüllen können. Die Frage zielt also einfach auf den Modalitätsstatus dieser Aussagen, d.h. auf ihren präskriptiven oder deskriptiven Charakter. 3. Man muß vor allem betonen, daß nach einer zu jener Zeit landläufigen Auffassung das Gesetz, jedes Gesetz, ein Wahrheitsurteil zum Ausdruck
15 Das ist genau die Schwierigkeit, auf welche ein englischer Jurist des 16. Jh., Christopher St. German, hinwies: „ I n every law positive well made is somewhat of the law of reason . . . ; and to discern . . . the law of reason from the law positive is very hard. And though it be hard, yet it is much necessary in every moral doctrine, and in all laws made for the Commonwealth", zit. in: J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford 1980, S. 281.
70
Michel Troper
bringt. Diese Wahrheit besteht gleichzeitig in der Übereinstimmung mit der Natur („die Gesetze gehen nach einem berühmten Spruch von Montesquieu auf die notwendigen Verhältnisse, die der Natur der Sachen entspringen, zurück"), in einer Bezugnahme zum Allgemeinwillen („für Rousseau ist das Gesetz, selbst von allen gewollt, kein Gesetz, wenn es den Allgemein willen nicht wirklich zum Ausdruck bringt") und in der Konformität zu den Prinzipien. Diese Auffassung bringt es notwendigerweise mit sich, daß man eine wirkliche Deklaration abfaßt, ehe man mit der verfassungsgebenden Tätigkeit beginnt. Zum einen kann die Verfassung nicht die Willensäußerung ihrer Verfasser sein. Sie muß also objektive Prinzipien zur Anwendung bringen, und diese Prinzipien müssen im voraus dargelegt werden. Diese Prinzipien dürfen zum anderen keine willkürlichen oder vereinbarten Postulate, sondern müssen ihrerseits mit Wahrheitswert ausgestattet sein. Sie müssen aus der Offensichtlichkeit entspringen. 16 Es gibt also in der Deklarationsidee selbst keinen Platz für irgendeinen Voluntarismus, selbst nicht in der im Artikel 6 enthaltenen Gesetzesdefinition, „das Gesetz ist der Ausdruck des Allgemeinwillens". Dieser Ausdruck bedeutet nicht, daß die Verfasser von 89 es „wollen", daß das Gesetz künftig durch den Allgemeinwillen geschaffen werde. Es handelt sich einfach um eine Definition und ein realistisches Urteil: „Wenn etwas Äußerung des Allgemeinwillens ist, dann ist es ein Gesetz", und diese Aussage ist ihrerseits ein Prinzip, das die Vernunft am Naturrecht ablesen kann. 4. Man kann die Eigenart der Debatte nur verstehen, wenn man das Werk der Versammlung als eine wahrhafte Deklaration auffaßt. Befremdlich ist beispielsweise die ständige Berufung der Aussagen auf die Wahrheit. Es ist Champion de Cicé, der am 27. Juli 1789 angibt: . . . „ Wir haben befunden, daß der Verfassung eine Deklaration der Menschen- und Bürgerrechte vorangestellt werden müsse; nicht weil diese Darlegung es zum Gegenstand haben könnte, ersten Wahrheiten eine Kraft zu verleihen, die sie der Moral und der Vernunft, die sie der Natur entnehmen, welche sie in alle Herzen neben dem Keim des Lebens hineingepflanzt hat ..., aber sie haben es gewollt, daß diese unauslöschlichen Prinzipien unseren Augen und unserem Geist ständig gegenwärtig seien". 11 Man könnte unzählige andere Beispiele anführen. So der erste Deklarationsentwurf von Sieyes, der mit den Worten beginnt: „es gibt zwei Arten, den Menschen große Wahrheiten nahezulegen ... " ; 1 8 oder außerdem die 16 Das ist genau das, was Sieyes in seinem ersten Entwurf der Deklaration ausdrückt: „les représentants de la nation française . . . jugent donc que . . . l'exposition raisonnée [de ces droits] doit précéder le plan de constitution, comme en étant le préliminaire indispensable, et [qu'elle droit] présenter à toutes les constitutions politiques, l'objet ou le but que toutes, sans distinctions, doivent s'efforcer d'atteindre", in: Rials (FN 4), S. 592. 17 s. Rials (FN 4), S. 378. is Ebd., S. 591.
Deklaration oder Konstitution von Rechten
71
Deklaration von Lafayette vom 11. Juli: „das Verdienst einer Deklaration der Rechte besteht in der Wahrheit und in der Genauigkeit; sie muß ausdrücken, was alle wissen, was alle verspüren". 19 Daraus folgt, daß die Aussagen der Deklaration an und für sich nicht als Ermächtigung für die Festsetzung von Rechtsfolgen angesehen werden, was dadurch erklärt werden kann, daß, wie Stéphane Rials bemerkt, „sich die Mehrheit der Verfassungsgeber nicht sehr für die Vorbereitungsarbeit und die Abfassung der Deklaration interessiert hat, und die Deklaration hat a fortiori selbst in ihren aufgeklärtesten Partien die Meinung der Verfassungsgeber nicht wirklich festgehalten". 20 Man versteht in der Tat sehr gut, daß aus indikativen Aussagen keine Rechtsfolgen abgeleitet werden können. Eine indikative Aussage konstituiert keine Verpflichtungen. Gewiß war die durch das Gesetz von Hume etablierte Unmöglichkeit, eine Präskription aus einer indikativen Aussage abzuleiten, nicht immer von den Verfassungsgebern klar ins Auge gefaßt worden. Aber es war für alle klar, daß diese Aussagen ebenso wie die Prämissen eines Urteils nur diejenigen binden können, die sie akzeptiert hatten. Bestehen sie aus Aussagen, die wahr oder falsch sein können, so resultiert ihr Wahrheitswert und ihr Wert, kurz gesagt, nicht aus ihrer Annahme durch die Versammlung, sondern aus ihrer Übereinstimmung mit der Natur. Auf diese Weise ist es durchaus möglich, daß in einer späteren Debatte jemand den Anspruch erhebt, aus einer Bestimmung der Deklaration oder aus irgendeiner anderen indikativen Aussage eine Regel - oder die Unmöglichkeit, eine Regel anzunehmen - abzuleiten. Man könnte ihm immer entgegenhalten, daß diese Bestimmung falsch sei und daß man sich geirrt habe. Dies erklärt die besondere Ausdrucksweise der Reden in der Nationalversammlung, die immer mit einer Darstellung der Prinzipien beginnen, auf welche sich der Redner stützt. Es sind die Prinzipien, die er postuliert, und die mit vorher akzeptierten Prinzipien nicht zu vermengen sind. Die Deklaration war also von ihren Verfassern durchaus als ein aus indikativen Aussagen gebildeter Text, d.h. als ein Naturrechte deklarierender Text verstanden worden. Das heißt, wir sind keineswegs an die Auffassungen von 1789 gebunden und es wäre durchaus legitim anzunehmen - daß die Revolutionäre entweder einen Willen zum Ausdruck zu bringen oder Rechte zu konstituieren glaubten, während die Naturrechte in Wirklichkeit objektiv existieren und den Gesetzgeber unabhängig von der Deklaration binden oder - daß es im Gegenteil keine Rechte gibt und daß die Geltung der Deklaration der Rechte auf ihre Positivität zurückgeht, einerlei, was ihre Verfasser annehmen wollten. 19 20
s. de Baecque (FN 4), S. 65. Ebd., S. 257.
72
Michel Troper
Die historische Untersuchung läßt also das Problem der Entscheidung für eine bestimmte Bürgerrechtsauffassung und daher die Grundlagenfestlegung der Verpflichtung zur Beachtung der Menschenrechte außer acht. Angesichts dieser Lage sind beide Lösungen gleichermaßen wenig zufriedenstellend. Wir können also die Ontologie der Verfasser von 89 ablehnen und annehmen, daß die Deklaration sich durchsetzt, weil sie der Ausdruck eines Willens ist. Warum sollen wir aber Menschen gehorchen, die schon so lange tot sind? Gewiß können wir geltend machen, daß es nicht die Verfasser von 89 sind, denen wir unterstehen, sondern die verfassungsgebende Versammlung von 1958, die die Bindung des französischen Volks an die Menschenrechte proklamiert hat. Die Verfassung von 1958 schreibt dennoch die Unterordnung unter die Menschenrechte vor, „in der Form, in der sie durch die Deklaration von 1789 definiert worden sind". Dies scheint in der Tat ein Hinweis auf den Willen der „Menschen der Revolution" zu sein. Wir können aber andererseits, wie verschiedentlich gefordert, eine Ontologie annehmen. Wir akzeptieren die Auffassung, daß die Menschenrechte wahrhaft existieren. Aus dieser Konzeption folgt aber, daß die Rechte durch die Vernunft, d.h. durch jeden einzelnen erkennbar sind. Dann ist nur noch die Einrichtung eines Kontrollorgans zu rechtfertigen. Vielleicht ist es zulässig, im vorliegenden Zusammenhang auf einen dritten Weg hinzuweisen, der aus zwei Ideen bestünde. Die erste Idee liegt darin, daß sich die Deklaration der Rechte aufgrund des Willens der verfassungsgebenden Versammlung durchsetzt. Letztere bringt jedoch nichts als eine formale Auffassung zum Ausdruck. Sie ordnet die Beachtung der Menschenrechte an; sie weist zwar auf eine Liste hin, aber sie präzisiert nicht, worin diese Rechte bestehen, und sie schreibt keine präzisen Verhaltensweisen vor. Es wird denjenigen, die die Interpretation vornehmen sollen, anheimgestellt, diesen Rechten einen Inhalt zu verleihen: „Wenden Sie die Doktrin der Menschenrechte in einer Form an, die an die Gesellschaft, in welcher Sie leben, am besten angepaßt ist." Man kann also feststellen, daß die Kontrollinstanz eine außerordentliche Funktion übernimmt, da es ihr obliegt, den Inhalt der Menschenrechte zu bestimmen, d.h. über die gesellschaftlichen Grundwerte zu entscheiden trotz der Tatsache, daß solch eine Entscheidung ausschließlich vom Allgemeinwillen zeugen dürfe. Es muß somit angenommen werden, wie die Deklaration der Rechte es ohnehin im Artikel 6 proklamiert, daß das Gesetz der Ausdruck des Allgemein willens ist. Nach Maßgabe der französischen Konzeption des repräsentativen Systems muß - und das ist die zweite Idee - der allgemeine Wille und demzufolge die Nation nicht durch die Erwählten, sondern gerade durch all diejenigen, die durch ihre Entscheidungen zur Gesetzesbildung beitragen, zum Ausdruck gebracht und repräsentiert werden. Das ist offensichtlich der Fall beim Parlament, aber auch beim Verfassungsrat, der besonders aufgrund eines großen
Deklaration oder Konstitution von Rechten
73
Interpretationsspielraums hinsichtlich der Deklaration über das Ermessen verfügt, die vom Parlament angenommenen Texte zu genehmigen oder zurückzuweisen. Man muß also davon ausgehen, daß der allgemeine Wille, wenn auch unter verschiedenen Einschränkungen, sowohl durch das Parlament als auch durch den Verfassungsrat zum Ausdruck gebracht wird, die von da an beide als die Vertreter der souveränen Nation angesehen werden dürfen.
Legal Rationality and Divergent Normative Logics By Roberto J. Vernengo, Buenos Aires 1. Reason in law - law's rationality - is, paradoxically, a perplexingly entagled affair. Perhaps it could be admitted that legal science, where it has evolved in an objective discourse accepted by social scientists and legal scholars, must have, as all scientific discourses, a logical structure; legal science must obviously be logically organized. But the existence of a scientific knowledge of the law is a very contingent historic phenomenon for it is a fact that many cultures did not ever attempt anything in that direction. Jurists, on the other hand, pretend not only that legal science is rational - a verdict that may sound like a truism - , but that law itself, positive law is rational. For modern thinkers, positive law is somehow composed of rules or norms. Norms as such are sentences lacking truth value. Nevertheless, in some decisions, judges infer rules or norms from normative premises, as if logical inferences were valid also between norms. And everybody recognizes conflicts of norms where logically incompatible norms pretend to be simultaneously valid. If norms are not sentences having truth value, the question arises of how to allow logical operations on normative premises that are knowingly unqualified to function like classical propositions. This quandary was formulated many years ago by J. J0rgensen as a dilemma threatening a rational normative knowledge. Some of the classical proposals for dealing with this dilemma are problematic. Kelsen, for instance, suggested that norms, in their primary prescriptive function, are not susceptible of deductive procedures, but that in their use as descriptive sentences by legal science they were subject to logical strictures. Accordingly, prescriptive norms could be considered to be also indirectly subject of logical rules, as a reflexion or extension of their appearence as descriptive normative sentences. Prescriptions or norms as such are neither propositions (Sätze) nor declarative sentences (Aussage); therefore it is inconsistent to attach to them semantic characteristics proper of those linguistic forms. Legal norms, in their prescriptive sense, lack truth or falsity. They are another kind of linguistic data, expressing the meaning (Sinn) of will acts. Therefore it would be absurd to claim that they are subject to logical principles, which correspond only to Sätze expressing the sense of intellectual acts. Notwithstanding that conclusion, Kelsen owns that "daß logische Prinzipien, wenn nicht direkt, so doch indirekt, auf Rechtsnormen angewendet werden können, sofern sie auf die diese Rechtsnormen beschreibenden Rechtssätze, die wahr oder
76
Roberto J. Vernengo
unwahr sein können, anwendbar sind". 1 This acknowledgment sounds Strange, not only because it implies that norms, as prescriptions, are irrational objects, as Ross and Weinberger stressed, but also inasmuch as law's rationality becomes a contingent property ascribed to law. In those cultures where no legal science has been developed and where, consequently, there are no Rechtssätze in existence, legal norms would not even have an indirect logical status. It presupposes also a not defined isomorphism between prescriptive norms and the descriptive sentences of legal science, an isomorphism that is not the mere correspondence relation that a Tarskian truth concept would suggest. Rechtssätze may be true as adequate descriptions of norms, but that does not imply that there is any syntactical similarity between them. As logic operates syntactically, it is not clear what is meant when the logic applicable to Rechtssätze is extended, although indirectly, to norms. Nevertheless, the Kelsenian proposal concerning the relationship between law as a set of prescriptive norms and logic in some of its traditional forms, is generally accepted. Thus, G. von Wright's pronouncement: "on the prescriptive interpretation deontic formulas have a «prescriptive meaning» and do not express true or false propositions. It makes no sense to speak of relations of contradiction or entailment between the formulas thus interpreted. The positivistic sceptics who, like A l f Ross, doubted the possibility of a deontic logic were in an important sense right in maintaining that norms have no logic or that normative discourse is «alogic»", 2 although a deontic logic has sense as "a logic of descriptively interpreted formalized norm-formulation". For norms, as such, as "expressions of a norm-giving authority's will", and under the supposition of the rationality of that will, deontic logic could be interpreted as the set of "principles of rational norm-giving" and, "on the basis of this criterion, one can then determine the analogical meanings of contradiction and entailment also for norms, although norms have no truth-value". Those analogical logical expressions resemble the indirect logic of Kelsen. In any case, the postulated analogy presupposes also some kind of isomorphism between norm-formulations (descriptive sentences) and norms as prescriptions. Hence, that debatable assumption does not require an a priori acceptation. Opaïek has in that respect a rather negative opinion: "Die Schlüsse, die vor dem Hintergrund von Normen und Aussagen über Normen in der natürlichen Sprache aus diesen Überlegungen über deontische Sätze gezogen werden können, sind deprimierend". 3 And, therefore, he draws a very sceptic conclusion about the endeavours to get a rational analysis of the logical structure of law: 1
H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 n d edition, Wien 1960, p. 77. G. H. von Wright , Practical reason, Philosophical Papers, vol. I: "Norms, truth and logic", Oxford 1983, p. 132. 3 Κ Opatek , Theorie der Direktiven und der Normen, Wien - New York 1986, p. 169. 2
Legal Rationality and Divergent Normative Logics
77
"Deshalb kann man mit Recht sagen, daß die formale Analyse der normativen Begriffe als eine besondere Logik für den Bereich der Normen zumindest in den bisherigen Versionen problematisch ist", a conclusion with which he closes a book where the present situation of theories about norms and directives is thouroughly discussed. I think it has some interest to put into a general perspective those very sceptical attitudes regarding the rationality of law from the point of view of what kind of logical rationality can be attributed to norms. I tried some time ago to give a provisional picture of the different trends existing in the contemporary technical literature about that matter. 4 But some very recent developments into that controversial field need to be heeded if the question of the rationality of law is not to remain in the domain of mere wishful thinking and vacuous proclaims. 2. One can think, as O. Weinberger has proposed, that legal theory, through some of its most distinguised masters, like Kelsen, has given up any pretension to admit law's rationality, incurring a normative irrationalism, as it has been branded. Or to renounce to a strict rational control of law, accepting that it has to be accepted as a kind of objective domain where only prudential reasons or a kind of more or less intuitive reasonableness should prevail. That seems to be, for instance, the present attitude shown by H. von Wright. 5 This claimed irrationalism or resigned rationalism joins, in their practical consequences, influential trends of modern scientific ideologies, as exemplified by the so called critical theories of law, hermeneutical movements and, surprisingly enough, by repeated revivals of scolasiic legal philosophy. Another form of that unsatisfactory situation, regarding the question of law's rationality, appears in some new proposals concerning first the analysis of the kind of logic required by law, and secondly the development of new logics supposed to be more suitable for modelling legal reasoning. 3. One tentative approach of the first sort can be found, for instance, in F. Miro Quesada's "idiomatic legal logic", 6 which is expressedly developed with the aim of "formalizing deduction as it takes place in the practice of law". That new logic is taken to be, from the outset, different from classical propositional logic and from predicate logic of first order and, intriguingly enough, from the current modal deontic logics. The specific legal logic proposed would deviate from ordinary logics in the fact that it would recognize "sui generis inference rules". Let us discuss some of its tenets cursorily, as, according to its creator, it lacks up to now of sufficient development to authorize a thorough criticism of its adequacy. 4
R. J. Vernengo , Derecho y lògica: un balance provisional, Madrid 1987. Von Wright , Vetenskapen och förnunfted, Stockholm 1987. 6 F. Mirò Quesada, Lògica juridica idiomàtica, in: Conferências I I I Congresso Brasileiro de Filosofia do Direito, Paraiba 1988, p. 224/232. 5
78
Roberto J. Vernengo
Mirò Quesada stresses, at the very beginning of his essay, that the currently accepted formalization of legal norms as conditionals - be they the vague hypothetical judgments of Kantian descent in the Reine Rechtslehre or the Horn clauses fancied in logical programming - is questionable. Norms, as deontically modalized sentences, do not give expression to propositions having truth value and, therefore, its meaningless to apply to them logical operators that are extensionally defined on a binary truth calculus. Those classical operators are closed on the functions they establish; they produce propositions operating on propositions. They could not, by definition, produce propositions when operating upon norms lacking truth value. Hence, to accept as an adequate formalization of a so called conditional legal norm a formula like CpOq, where ρ is a sentence representing the proposition referring to a fact, and Oq the formal representation of a norms saying that q ought to be, implies that the molecular formula resulting from applying the if-then operator to a factual proposition and to a norm had to produce, due to its closeness, the formal representation of a material conditional, that is, a molecular proposition having a precise truth value. But, by definition of its formation rules, CpOq is generally taken to be a normative expression that cannot be the result of the traditional operation symbolised by the if-then operator. Consequently, propositional logic's operators and forms are not adequate to represent the very current relationship that jurists introduce between facts and norms. Kelsen, in this point, had always been very reluctant to accept material conditionals as proper representation of the relationship that jurists attribute to sentences expressing the normative consequence of some factual antecedents; Kelsen thought that, under whatever verbal form, a peculiar category, Zurechnung , different from the causal categories applicable to natural laws, was there at work. But, although relegated to the obscure domain of Kantian transcendental categories, no further light was given about the logical behaviour of Zurechnung. Instead, Mirò Quesada advances a more radical interpretation: legal norms do not exhibit a classical logical form as working field of gnoseological categories, but they show an original logical form as a result of the operation of suitable deontic operators, similar nevertheless in the denomination to classical propositional operators. That is: there is an "and" and an "or" and an "if" which differ, in normative context, from the very trite words "and", "or" " i f ' , etc. This suggestion involves that the language spoken by jurists differs deeply from the normal language spoken by less exalted mortals, where mere classical propositional logic and its operators work currently. Deontic negation, conjunction, disjunction, etc., are not equivalent to what is normally understood as negation, conjunction, etc., nor are they construable taking the latter as primitives.
Legal Rationality and Divergent Normative Logics
79
Trivial logical rules reflecting the operation of classical binary propositional operators would have to be rejected in legal language or jargon, as, for instance, the rule for the introduction of a disjunction: CpApq, a principle banal enough in classical logic, but forbidden, it seems, in the new legal idiomatic logic. It is true that, with this formal manoeuvering some obnoxious paradoxes, like Ross', are radically quelled, because it is not possible to obtain them in this new logic. In any case, the not equivalence between propositional classical operators and the new deontic operators has as an outcome that "a complete isomorphism between deontic expressions descriptively interpretated" - as Kelsen and von Wright suggested as a way out for the eradication of classical logic from normative discourse - "and deontic expressions prescriptively interpreted" has to be rejected. For instance: in a prescriptive construction, the normative expression CpOq (where C represents deontic implication) implies A'C'pOq CrOs (where A1 represents deontic disjunction). The first formula "is a norm, whereas the second is not a norm in any case", so that the parallelism or even isomorphism proposed by Kelsen and von Wright between normative expressions in descriptive sense and norms in prescriptive function, disappears. 4. If as Kelsen, von Wright and Miro Quesada recommend it is necessary "to distinguish carefully between propositions and norms", it would not be possible to accept as valid the classical logical laws in legal language except when they were ratified by legal practice. Nevertheless, this new legal logic requires, to take heed of multiple aspects of practical legal discourse, of some type of propositional logic, because "in law's practice propositional deduction can take place". Miro Quesada, to avoid undesirable consequences, like deontic expressions of the form Ο a, where α is a classical tautology, suggests the usefulness of relevant logic where "no tautology could be inferred from any proposition whatsoever". The new legal logic would demand, therefore, from relevant operators, plus the deontic propositional operators and the usual deontic modalizers. These are defined in the ordinary way: Op = VNp = NPNp, etc., with the exception that the indifference operator, Fp, read as ρ is strongly permitted, is not defined as the normal conjunction of the permission of the action described by ρ and of its forbearence, Np, but as the deontic conjunction of action and forbearance: K'PpPNp where K' represents the new deontic operator. But Miro Quesada finds that, with formation rules ad hoc as he proposes and with due respect for the distinction between norms and descriptive propositions, no satisfactory set of axioms can be evinced for this legal idiomatic logic. Principles like the deontic contrariness rule, NKOpONp, in its "idiomatic" version may have a certain theoretical interest, "as a guide for the elaboration of a normative system, but by itself seems to lack any direct use in legal inferences". Therefore, Miro Quesada advocates an inferential logic à la
80
Roberto J. Vernengo
Gentzen instead of a deductive apparatus build on a set of axioms. The inferential rules are just those that "are used when in legal practice deductions are made". Some of the rules suggested are quite similar to the deductive procedures permissible in classical propositional logic or in standard deontic logic. Moreover, others, like the one authorizing to infer from a permitted disjunction, PApq, the distributive deontic conjunction of the permitted acts, K'PpPq, leads, in principle, to similar difficulties as those stressed by von Wright when adopting the so called "free choice permission", a formula literally identical with Miró's scheme of inference, except that for the Finish writer conjunction is always the known classical conjunction. 7 5. But, just when this inferential rule has to be explained and justified, we find a rather odd declaration: "we believe" - says Miro Quesada in the text we are commenting - "that this rule" (the one mentioned at the end of last paragraph, whose resemblance with von Wright's axiom its inventor notes) "is founded in an evident intuition " (our undelining); "it shows that a legal logic that effectively corresponds to the manner in which deductive inferences are done in the practice of law is very different from propositional logic". 8 That "evident intuition" must be very solid indeed when, after all, the very same serious difficulties that von Wright pointed out regarding the similar standard deontic formula are put aside only by virtue of a conventional formation rule authorizing the introduction of the so called deontic conjunction, an operator that, whatever be said, seems to be, in my opinion, not very evident or clear in its functioning from an intuitive point of view. It seems, rather, a pure conventional solution at the level of the adopted symbolism, a solution needed by the initial presupposition: the exclusive distinction between norms (prescriptive sentences) and propositions (sentences having a truth value). It follows that some of these rules of inference are subject to a sort of proof rather peculiar in logic: "the rule seems correct to us (maintains Mirò), but we will not present it as definitely valid meanwhile, until further analyses of its possible application are made". "Up to now we have not found a counterexample that puts us under the obligation to eliminate it". 9 But, it may be asked, is the dearth of counterexamples sufficient reason for accepting a logical rule of inference? On the other hand, in the very same text, Miro Quesada concludes that one of his rules of inference, although prima facie intuitively evident, authorizes that "a conjunction with a complete arbitrary component deontically implies an action", a thing that is not a paradox (affirms Miro) but that gives way to expressions not usual in legal jargon, to expressions, avers our author, that are simply ridiculous in legal speech.10 7 Cf. A. Soeteman, A weak and strong permission in the law, in: The structure of law, edited by A . Frändberg, Uppsala 1987. 8 Mirò Quesada (note 6), p. 231. 9 Ibid., p. 231.
Legal Rationality and Divergent Normative Logics
81
I would rather not discuss here the greater or lesser adequacy of the inference schemata proposed by Miro Quesada. But, what to think of rules of inference, not endorsed by classical logic, rules supposedly educed from the deductions made by jurists in their practice of law, that, nevertheless, result in expressions that those very same jurists would reject as unusual? Or, more generally, how can one expect that this kind of logic, a sort of logic ad hoc built according to what jurists are supposed to do in their practice, to constitute a necessary condition of the rationality of law? 6. The special logic just examined somehow presupposes that in the practice of law an adequate answer to the query about the kind of logic law requires is automatically given. But it is not at all clear why the deduction lawyers supposedly do, which after all may be a merely rethorical device, have to be accepted at their face value. The traditional function of logic has been, on the contrary, to act as a means of rational control of arguments offered as constraining, their effective use not being sufficient reason for their acceptance as valid. Other attempts have been made to evolve a specific legal logic according, not to the argumentative practice of lawyers, but to ontological characteristics attributed to law. A case in point, which I have discussed elsewhere, is the legal-moral paraconsistent logic proposed by N. da Costa. 11 In it some postulated relationships between values and norms, or between morals and legal rules, are taken into account to propose several sets of axioms. Those logics, still in development, take as their inspiring factor the postulated ontologies suggested by different law philosophers. Another kind of approach, although somehow related to Miro Quesada's endeavour to emphasize logic as an inferential artifice, is found in the very recent proposal by C. Alchourrón and A . Martino to built a deontic logic as a sequence logic, following Genzen's model. 12 Accepting at face value the challenge introduced by J0rgensen's dilemma, they try to build a normative logic where inferences are not dependent on the alleged truth value of norms. Their starting point is the acceptance as a primitive of the notion of consequence, a notion which admits, following Tarki's insinuations, a pure syntatical formal explanation. Hence a logic without truth is postulated as possible; as no semantical interpretation is necessary for the inferences authorized in a Genzen's type of logic, the current operators and also the deontic modalizers are introduced by rules indicating how to introduce or eliminate those logical and modal words from the antecedent sequence or the consequent sequence in a logic of sequences. Therefore, as regards deontic operators, one operational 10 Ibid., p. 231. 11 N. da Costal L. Z. Puga, Logic with deontic and legal modalities: preliminary account, Bulletin of the Section of togic, vol. 16, n° 2, Lodz 1987. 12 C. Alchourrón!A. A. Martino , Logic without truth, in: Acts of Expert Systems in law, Conference on Law & Intelligence, Bologna 1989. 6 Festgabe Opatek
82
Roberto J. Vernengo
rule is proposed, that sets out that a duty (a normative expression) can be inferred from a set of duties; the ought operator thus defined, Opy the other deontic operators can be defined in the traditional way through external and internal negation of the O-operator and the propositional operand. But that normative logic without truth has some limitations as it depends on the Tarskian notion of consequence as an operation between sets of sentences in some language. The definition properties of that function are accepted without much ado, through the sets of axioms proposed and their different formulations. One of the essential characteristics so endorsed is mono tonicity, which the authors summarise thus: "when the premises are . . . increased, the consequences obtained with a smaller set must be maintained", a principle, sensible enough, that classical logics, as algebraic lattices, for instance, certainly presuppose. But it as has repeatedly been pointed out lately it is very doubtful that legal reasoning - what is known currently as such - is monotonie. On the contrary, it seems natural to regard it as one of those kinds of reasoning where "the addition of new information . . . renders no longer acceptable conclusions that were previously so". 1 3 Makinson hints that typical ways of legal thinking, like the use of presumptions, are typical of non monotonie ways of reasoning, be they called non-deductive or quasi-deductive or what not. If that is so - and the experiences with expert systems in law show that strict monotonie reasoning may be inadequate as regards legal reasoning - , one wonders how to understand a normative logic built accepting the monotonicity condition which now seems not necessary for the interpretation of a sufficiently rational consequence function. Let the problem be further worked out by logicians, computer scientists and jurists. But for the legal philosopher, traditionally fettered to the idea that rationality is essentially linked to a single logic - a belief that even Carnap's dictum about the arbitrariness in the choice of one's logic did not shake - , some observations by Alchourrón and Martino sound always irritating. The logic they propose, they say, "is that logic where the rules for the introduction and elimination of the operators can be given univocally, following a common linguistic practice . But whether these rules fit with a common practice is an empirical fact. 14 Is the validity of the logical rules empirically verified and justified? Is there no "right logic" as Carnap announced? And, therefore, no "right" or unique notion of rationality? Do legal scientists have to yield, not only to an ethical relativism, as positivists are supposed to indulge in, but also to a sort of logical relativism that prevents any attempt to speak harmoniously of law's rationality? Is it true, as Opaîek affirms that "die Ergebnisse der logischen 13
D. Makinson , General theory of cumulative inference, paper presented to the second international workshop on non-monotonic reasoning, Grassau 1988. 14 Op. cit., p. 35.
Legal Rationality and Divergent Normative Logics
83
Operationen, in ihrer Anwendung auf deontische Sätze, sind gewiß zufriedenstellend, wenn man annimmt, daß es sich um modale Sätze handelt, die man deontische Sätze zu nennen vereinbart. Sie sind aber nicht zufriedenstellend, wenn man die allgemeinen Intuitionen der natürlichen Sprache im Hinblick auf das Funktionieren der normativen Begriffe berücksichtigt". 15 But, then, what to think when it is taken into account that logics were built for the purposes of a scientific endeavour where "normative concepts" are differentiated from the notion offered by the "general intuitions of natural languages" and that now, at the end of our tether, it is concluded that those logics are not satisfying because they do not answer to the exigences of natural languages for which they were not fashioned? Must we still regard with reverence the timehonoured distinction between science and opinion?
15
6*
Opatek (note 3), p. 170.
Prescriptive and/or Descriptive Language in Legal Sciences By Zygmunt Ziembmski, Poznatì I. The methodological status of legal sciences is very specific. They cannot be compared with empirical sciences which describe natural phenomena and they have a rather particular character as social sciences. Presenting a very simplified picture of the system of legal sciences one ought to distinguish between a general study of law (theory of law, philosophy of law, general jurisprudence) and many so-called dogmatic legal sciences, putting aside some auxiliary disciplines dealing with legal phenomena (criminology, criminalistics, legal informatics, etc.), the disciplines which cannot be characterized from the methodological point of view in such a short paper. The main task of "dogmatic" legal disciplines is to determine what norms of conduct are at the given moment legally valid in a given state organization and, consequently, what is the legal qualification of actions of various kinds in relation to those norms. The history of law (e.g. of Roman law) may also be studied in this paradigm. Thus the "dogmatic" legal sciences are rather of idiographic character (the so-called comparative dogmatic studies seem to play a subsidiary role in the dogmatic legal sciences). They formulate the propositions concerning the validity of some norm in a given system and the legal qualification of some acts. However, such a characterization would be perfunctory and oversimplified. Genuine tasks of dogmatic legal sciences cannot be reduced to a simple description of elements of some legal systems. A general study of law may be realized as (1) a theory of law, (2) a philosophy of law, or (3) a general jurisprudence 1. Yet the terms denoting those different patterns of general study of law are used confusedly. Our analysis will concern a theory of law understood as a theoretical study aiming at building a theory (in the methodological meaning of the word) of legal phenomena both in their formal (linguistic) and their real (sociological, psychological, etc.)
1
Cf. Κ. Opatek, Filozofia prawa - jurysprudencja analityczna - teoria prawa. Porównanie i wnioski (Philosophy of Law - Analytical Jurisprudence - Theory of Law. A Comparison and Conclusions), "Paristwo i Prawo", 1961, ζ. 1, p. 3 - 19.
86
Zygmunt Z i e m b s k i
aspects2. Hence, the main task of so conceived a discipline must be a systematization of statements explaining legal phenomena, just as other social sciences construct theories of economical, political, etc., phenomena. However, a theoretical description of legal system, of its genesis and its functioning, constitutes only a score of a legal discipline realized e.g. at present in Poland, as will be indicated later, under the appelation of "general theory of law" 3 . This discipline as will be indicated later, formulates not only descriptive but also some prescriptive utterance. However, the problem of distinguishing the prescriptive and descriptive language in this domain is particularly intricate and often causes some verbal contentions. One of the basic problems discussed not only in the philosophy but also in legal sciences is a problem of reciprocal relation between the "is" and "ought" sentences concerning legal phenomena. The problem of derivability or non-derivability of some norms from the statements concerning social facts is concealed in many contentions in the domain of legal sciences. It is necessary to analyze the semiotical basis of those contentions.
II.
The utterances formulated in a language have a descriptive character if they are interpreted as describing some states of affairs or events. From this point of view they may be qualified as true or false, if they describe a state of affairs or an event in agreement with or contrary to reality. Of course, descriptive utterances formulated in the everyday language usually do not have a character of propositions in the logical sense of this term: they are equivocal or incomplete, yet they may still fulfil the role of the proposition in a logical sense in so far as the listener is aware of some assumptive supplementary elements omitted by the speaker (elliptical propositional utterances). The concept of proposition in a logical sense is a kind of idealization of actually formulated utterances, interpreted in one and only one way as a description of something definite. The utterances formulated in a language have prescriptive character if they are interpreted as directly suggesting to somebody a given behaviour under definite circumstances. They do not describe any state of affairs or event, thus they cannot describe anything truthfully or falsely. They themselves realize a
2
Cf. Opatek, Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. piaszczyzn prawa (The Object of the Study of Law and the Problem of So-Called Levels of Law), "Paùstwo i Prawo", 1969, z. 6, p. 983 - 995. 3 Z. Ziembinski, The Methodological Problems of Theory and Philosophy of Law. A Survey, in: Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law, Poznaù Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, vol. 12 (1987), p. 39 - 73.
Prescriptive and/or Descriptive Language in Legal Sciences
87
pragmatic, not a semantic, function. Of course in the everyday language the utterances of this character may be equivocal and incomplete. The descriptive and the prescriptive utterance determined in this way are uncomparable as to their character and they cannot be derived from one another. Yet those idealizing characterizations cannot be simply referred to the utterances of the natural language which very often may be interpreted both as descriptive and prescriptive, according to a linguistic context and social circumstances under which the expression of a given shape is formulated 4 . There are many occasions giving rise to such an ambiguity 5 . (1) A n expression "Every A in the circumstances Β ought to do C" is first of all interpreted as a norm of conduct, i. e. an utterance which orders or forbids to behave in some way under definite circumstances. But the same expression may be interpreted (e.g. if it is printed in the legal textbook) as a proposition stating the fact that such a norm is valid in some legal system (as a norm having an appropriate tethical justification). (2) A n expression which formulates the proposition stating the fact that some persons are obliged by an enthymematically assumed norm to behave so and so is often identified with this norm itself. (3) A n expression stating that a behaviour of a person is ordered, forbidden, permitted or optional from the point of view of a norm or a system of norms (i.e. a deontic proposition) is often identified with a norm. Even such an authority in the domain of deontic logic as G.H. von Wright sometimes ascribes this hybrid character to the expression of the shape Ο A / B. By the way, by identifying deontic propositions with norms of conduct one provokes a lot of misunderstandings concerning so-called "permissive norms" 6 . (4) A n expression of the shape " I n view of an evaluation E (or: in view of the act of enacting undertaken by the competent person P) every A in the circumstances Β ought to do C" or e.g. " A , inasmuch as he has promised R, ought to do C in the circumstances B " is presented by some authors 7 as a
4
Opaîek , Les normes, les énoncés sur les normes et les propositions déontiques, in: L'interprétation dans le droit, Archives de Philosophie du Droit, vol. X V I I (1972), p. 355 - 372. 5 Cf. M. Zirk-Sadowski, Legal Norm as a Pragmatic Category, Archiv für Rechtsund Sozialphilosophie, Bd. LXV/2 (1979), p. 212 - 215; A. G. Conte , Nove studi sul linguaggio (1967 - 1978), Torino 1985, p. 44 - 45. 6 A n expression that some behaviour is permitted may be interpreted as a restriction of a generally prohibiting norm, as an abrogation of such a norm, or also as a norm of competence authorizing somebody to realize some conventional acts actualizing in this way the duties of some persons. See Z. Ziembmski , On So-Called Permissive Norms, Archivum Juridicum Cracoviense, vol. I X (1976), p. 169 - 178. 7 Cf. H. Ν. Castaneda , Ought, Reasons, Motivation, and the Unity of the Social Sciences, in: Normative Structures of the Social World, ed. by G. di Bernardo, Poznaù
88
Zygmunt Z i e m b s k i
model of a norm of conduct, but strictly speaking such an expression has rather a character of a metaexpression, a proposition stating what kind of justification a norm included in this expression has. (5) In everyday language it is often doubtful if the expression " A ought to do C (not to do C)" has a semiotical character of a norm suggesting (ordering) such and such act to the addressee or whether it only has a character of an utterance expressing a positive (negative) evaluation on such an act. (6) A n impersonal optative 8 expression "It ought to be S" may be sometimes interpreted as a norm of conduct directed to one assumed addressee and ordering him / her to produce S by his / her activity. (7) Normative utterances as such do not have a descriptive character. Thus the possibility of ascribing a logical value of truth or falsity is in principle excluded. However, sometimes one can observe the identification of the question about the logical value of the norm with the question about the logical value of the sentence which expresses some assumptions of a person enacting such a norm. Usually one assumes the rationality of the normgiver and thus the fact of his enacting one norm may be conceived as a symptom of the situation in which such a norm may be useful for realizing the aims ascribed to the normgiver. If someone orders us to close the window now, it reveals his belief that the window is open, and if we assume that he is not mistaken, the enacting of this norm is a symptom that the window is open now. "Boil the water!" is an order based on the assumption that a necessary portion of water is available, that water can be boiled with the help of means known and available at the moment for the addressee of the norm, and, moreover, that the portion of water in question is not boiling at the moment. The opinion that "ought" implies "can" is based not on the semantical character of the norm, but on the assumption of rationality of the normgiver 9 . From the linguistic point of view a norm ordering something which is logically or empirically impossible is well formulated, but enacting such a norm would be an irrational activity. Legal norms established in some country may be a more or less adequate symptom of not only the value system of lawgivers, but of social situation in that country, or at least - of the perspective of this situation taken for granted by the lawgivers (assuming that they are rational) 10 .
Studies in the Philosophy of Sciences and the Humanities, vol. 11 (1988), Cz. Znamie rowski, Prolegomena do nauki a panstwie (Prolegomena on Science of the State), 2nd ed., Poznan 1947, p. 176f. 8 Cf. Opatek, Directives, Optatives and Value Statements, Logique et Analyse, 1973, nr. 61 - 62, p. 221 - 298. 9 Cf. J. L. Gardies, L'erreur de Hume, Paris 1987, p. 36 - 48; G.H. von Wright, Norm and Action, London 1963, p. 108 - 111. 10 O. Weinberger, Können Sollsätze (Imperative) als wahr bezeichnet werden? Rozpravy Ceskoslovenske Akademie Ved. R. 68, 1958, s. 9, p. 157.
Prescriptive and/or Descriptive Language in Legal Sciences
89
(8) In the situations in which people's behaviour is determined, the descriptive information that such a situation arises (e. g. "Enemy air raid!") may function as an order, i. e. a norm of conduct immediately addressed to the present persons. (9) The directival utterances suggesting to somebody some activity may be of very different characters. Beside typical norms of conduct, of a particular character are technical, teleological directives, concerning means to realize some aims 11 , and also rules concerning the realization of some conventional acts, especially those which bring about some legal effects. In the simplest cases, in which the desire to realize some aims is undisputable and there is only one way of realizing the aim in question, technical directives may be identified by some authors with anancastic propositions, i.e. propositions which state (truly or falsely) the necessary relationship between such and such activity and its results 12 . Rules concerning the realization of conventional acts (constitutive rules) have not been sufficiently analyzed by philosophers and lawyers. There are different types of constitutive rules with highly diversified character and it does not seem possible to present their complete typology in such a short essay13. Some of them may be interpreted as a specific kind of partial definitions of conventional acts, and they may also be analyzed as the elements which fulfil the function analogous to the one performed by anancastic propositions in founding technical directives based on a natural relation between some human acts and their physical effects. (10) The text of a law or regulation is composed of expressions numbered as articles, paragraphs or sections. Those expressions, called legal provisions, usually do not have a shape of a fully developed norm of conduct. Such norms ought to be decoded on the basis of a legal text by means of applying some rules of exegesis, i.e. rules of interpretation, rules of inference from the fact of binding force of one norm about binding force of other norm within the legal system, and rules eliminating the discordance of norms within the system. Those rules of exegesis, as well as other methodological rules formulated by legal sciences, may be presented also in the descriptive manner: i.e. instead of declaring that the provision or a set of provisions of a certain shape ought to be interpreted in a certain way, one declares that in legal sciences those tasks are realized in a certain manner. And vice versa - propositions stating that in
11 Cf. Opatek, Some Problems of the Theory of Norms, Logique et Analyse, 1969, nr. 45, p. 110; Ziembinski, Practical Logic, Warszawa / Dordrecht 1976, p. 128f. 12 See von Wright, (FN 9), p. 10f., p. 95. 13 See A. G. Conte, Eidos. A n Essay on Constitutive Rules, in: Normative Structures of the Social World, p. 251 - 257; Ziembmski, Le contenu et la structure des normes concédant les compétences, ibidem, p. 165f.
90
Zygmunt Ziembinski
legal sciences some problems are solved in a certain manner are often interpreted as methodological rules. The above survey of instances of mixing up the interpretations of some expressions as descriptive or prescriptive in character is not complete. A precise reconstruction of semiotical rules of a natural language in this area is practically impossible. The chances that two theoreticians of law would use precisely the same conceptual apparatus when discussing the problem of prescriptive or descriptive character of some expressions used in legal writings are rather poor. Sometimes one unnoticeably changes the interpretation of some expressions, doing it unconsciously and unknowingly - and such is the essence of Hume's famous observation. III. The language of legal sciences cannnot be reduced to only descriptive utterances. Such an approach would deform the actual perspective of those sciences. Almost all statements formulated by legal sciences are related directly or indirectly to some legal norms, but actually legal writings contain not only propositions concerning legal norms and social phenomena connected with formation of functioning of these norms, but also some implicit teleological directives and - on a higher semiotical level - the rules of constructing the legal system, both with respect to the construction of bills and to the exegesis of a legal text. The solution of a typical dogmatic problem consists in (1) formulating the statement of a social fact considered to be a law-creating fact following the rules of validation accepted in a given country and (2) in interpreting this fact as creating a definite legal norm. However, the acceptance of rules of validation is not arbitrary. On the contrary, it is limited by some very general principles of constructing the legal system. The latter principles are formulated mainly by legal sciences and express the political culture of a given country 14 . The acceptance of rules of interpretation and inference is limited in a similar way. One can distinguish some fragmentary parts of a general theory of law: the theory of sources of law, the theory of interpretation of a legal text, the theory of legal reasonings. But one must realize that under the denomination of such partial "theories" legal writers do not present statements which say that certain facts are respected as "sources of law" in some countries, that legal provisions are interpreted in certain ways, etc., or which explain those occurences by some hypotheses of a higher methodological level. Instead, legal writers 14 Cf. Opatek, The Concept "Culture" in Legal Theory and in Political Science, Archivum Juridicum Cracoviense, vol. X I (1978), p. 13f., p. 20f.
Prescriptive and/or Descriptive Language in Legal Sciences
91
formulate the rules of the "proper" construction of the legal system (the rules of a doctrine of sources of law, of interpretation, of inference, etc.). The doctrine of some legal system and the theory concerning that system must be distinguished 15 . Similarly, the rules of constructing the legal system must not be identified with the methodological rules of examining the actual and past legal systems. It is a well known phenomenon that at the beginning of the development of every science the science and metascience, especially the methodological research in a given field, are not sharply differentiated, but in legal sciences the situation is more complicated. Namely in the practice of legal sciences there is no clear and sharp division between: (a) the theoretical statements describing and explaining the practice of constructing legal systems, (b) the rules of constructing such systems, and (c) the methodological rules of studying legal systems. The above criticism may appear too severe, but the examination of a great part of legal writings may furnish the justification. In this way a dogmatic legal science becomes in practice an element co-creating the object of its research. However, one cannot accept, the least as far as a "continental" legal system is concerned, a simple thesis, that a legal science is "a source of law", i. e. that the fact of formulating some opinion by a legal writer is a law-creating act (even in the cases of communis opinio doctorum). Of course, both the sentences formulated by eminent legal writers and those formulated in a legal text realize illocutionary functions, but of a different character. The fact of printing some provisions in the appropriate journal of law has a character of enacting "hereby" the norms, coded in the form of those provisions, and the performative character of such a publication is evident 16 . The declaration of a legal writer that such a norm is valid in a given legal system or that one ought to accept some rules of interpreting legal texts does not have the official character. "Hereby" the author expresses only his conviction, although his convictions may actually evoke similar convictions of other lawyers. Legal sciences analyze the performative utterances of a "legislator" or other organs of the State, yet contemporary legal writers do not formulate the performatives through which officially binding acts of enacting legal norms are realized (they are "unhappy" as such acts 17 ). However, the "legislator's acts" are performed 15 Sometimes one uses the terms: "normative theory" and "descriptive theory", but those attributes may be misleading, for they may create the impression, that there is a common genus of those two "kinds of theory". 16 E.g. French "Journal Officiel" uses the formula: "L'Assemblée national et le Senat ont adopté, le Président de la République promulgue la loi dont le teneur suit: . . . " . Cf. G. Kalinowski, Sur les langages respectifs du législateur, du juge et de la loi, in: Le langage du droit, Archives de Philosophie du Droit, t. X I X (1974), p. 63 - 65. 17 Cf. Opaîek , Directives, Norms and Performatives, in: Normative Structures of the Social World, p. 193.
92
Zygmunt Z i e m b s k i
with a presupposition that the provisions will be "suitably" interpreted - and the "proper" rules of interpretation are seldom formulated in a legal text. These rules are created first of all by the tradition of legal sciences. Besides, a legal text may often formulate the evaluative premises of applying such rules; however, it is a separate problem. Legal sciences cannot be qualified simply as technical sciences which formulate teleological directives indicating what should be done to attain required results. However, it is a communis opinio that typical dogmatic problems of legal sciences, i.e. the problems of "proper" interpretation of a legal text and then those of the legal qualification of some human acts, ought to be solved so as to aim at causing some optimum social results from the point of view of the accepted value system18. The examples of the above may be the maximization of the degree of security and certainty of legal transaction or, to the contrary, the possibility of changing the interpretation of a legal text following the changes in the system of actually dominating social preferences. Thus dogmatic problems of legal sciences are tightly intertwined with the sociotechnical problems concerning the ways of enacting and applying legal provisions so that to reach definite social effects, i.e. with the problems of policy of law. Legal sciences seldom formulate sociotechnical directives in an axiologically neutral way, i.e. in a fully conditional form which would not predetermine the preferred results to be realized. Usually legal sciences represent sociotechnics axiologically engaged in achieving preferred social effects. Those preferences may be presented as being beyond any argument, especially in the circumstances of totalitarian dépendance of legal sciences. IV. It seems that the language of legal sciences contains both descriptive and prescriptive utterances, but also a lot of expressions which in the practice of lawyers' discussions (and sometimes even in theoreticians' discussions about the methodological models of different legal sciences) have a hybrid character: they are interpreted unconsciously in one way or another, what in turn makes such discussions far from being conclusive. The practical consequences of the above statement are rather trivial. It is necessary to intensify the research on semiotics and on formulating a sufficiently clear and precise conceptual apparatus which might be sufficiently generally accepted as the instrument of discussion. Otherwise a great part of methodological contentions in the field of legal sciences will be, as heretofore, reduced to logomachy. 18 L. Nowak, De la rationalité du législateur comme élément de l'interprétation juridique, Logique et Analyse, 1969, nr. 45, p. 81 - 84.
I I . Ethisch-politische Prämissen rechtsstaatlicher Autoritätsausübung
Sprechakt, Freiheit und Autorität Von Jan M. Broekman, Leuven I. Unsere Sprechstrategien sind so aufgebaut, daß sie eine bestimmte Interpretation des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit realisieren. Darin läßt sich ein überragender Sinn solcher Strategien erblicken: einheitliche Formen der Diskursivität werden vorausgesetzt und zugleich durch die Bestätigung jener Voraussetzung im aktuellen Sprechen realisiert. Aber dieser Sinn tritt selten offen zutage, er bleibt meistens verhüllt in einer naiven Auffassung vom Wesen der Sprache und zugleich von der unbestreitbaren Meisterschaft des Menschen hinsichtlich seiner Sprachfähigkeit. Die Tragkraft der Sprache wird weder beim Sprechen noch beim Entwurf der jeweiligen Sprechstrategien thematisiert. Menschliche Diskursivität liegt scheinbar in der Beherrschung der Wörter und Ausdrucksweisen einer Sprache verborgen. Das dürfte nicht nur für natürliche Sprachen gelten, sondern ebenfalls für Fachsprachen und künstlich hergestellte Sprachen. Sie sind immer als eine bestimmte Normalität für den Sprechenden da, und diese Selbstverständlichkeit wirkt sich als Normativität aus; als eine Normativität, die nicht nur den Gebrauch der Wörter, sondern auch hintergründige Interpretationen bezüglich des Verhältnisses von Sprache und Wirklichkeit betrifft. In diesem Zusammenhang ist es geradezu eine Selbstverständlichkeit, daß Wittgenstein im ,Tractatus' formuliert: „Die Gesamtheit der Sätze ist die Sprache" 1 . Diese These steht im Hintergrund der Abbildtheorie des ,Tractatus' wie auch der Gebrauchstheorie der Sprache in den philosophischen Untersuchungen4. Beide Sprachtheorien erscheinen in diesem Lichte als Äußerungen ein und desselben sprachphilosophisch relevanten Prinzips hinsichtlich der Interpretation von Sprache und Wirklichkeit. In den ,Untersuchungen' heißt es: „Wieviele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? - Es gibt unzählige solcher Arten: unzählige verschiedene Arten der Verwendung all dessen, was wir „Zeichen", „Worte", „Sätze" nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes; sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen." Wie im ,Tractatus' ist diese orga1
L. Wittgenstein,
Tractatus Logico-Philosophicus, Frankfurt a.M. 1969, Nr. 4.001.
96
Jan M. Broekman
nizistische Sprachauffassung möglich, weil es „kleinste Einheiten" von Sprache gibt, deren Gesamtheit die Sprache ist und die in irgendeiner Weise eine logische Struktur der Wirklichkeit enthalten. Dasselbe gilt für Erwägungen der philosophischen Grammatik' 2 , wo sogar in einem späten Manuskript (1936) Bedenken formuliert werden hinsichtlich der Frage, ob ein Elementarsatz lediglich ein solcher ist, wenn seine logische Analyse zeigt, daß er nicht mittels Wahrheitsfunktionen aus anderen Sätzen zusammengesetzt ist. Wittgenstein akzentuiert die Problematik der Analyse und reflektiert nicht auf den Gedanken des elementaren Satzes an und für sich, das heißt auf den Satz als mutmaßlichen Baustein der Sprache. Hier tritt ein allgemeines Merkmal der gegenwärtigen Theorie der Bedeutung hervor. Sie fußt durchweg auf einer Sprachtheorie, die sich Sprache aufgebaut denkt aus kleinsten Einheiten und bestimmt durch Zusammenfügung solcher kleinsten Einheiten zur Totalität. Solche „kleinsten Einheiten" sind auf dem Niveau der Bedeutung Wörter oder Sätze (Frege, Wittgenstein, Husserl), sèmes (Greimas), phrases (Kristeva). Eine Grenze der Linguistik und mit ihr auch der Sprachphilosophie wird dadurch sichtbar: die linguistische Regelbildung hört sozusagen beim Satz auf - die Verknüpfung der Sätze zu diskursiven Strukturen und Texten wurde bisher kaum problematisiert. Die Bedeutungsanalyse von Konversationstypen, rhetorischen Figuren, spezifischen Argumentationsweisen hat sich ebenfalls kaum von dem grundlegenden Gedanken der „kleinsten Einheit" gelöst. In demselben Zusammenhang führt Dummett in Würdigung der Fregeschen Bedeutungstheorie aus: "Because philosophy has, as its first if not its only task, the analysis of meaning, and because, the deeper such analysis goes, the more it is dependent upon a correct general account of meaning, a model for what the understanding of an expression consists in, the theory of meaning, which is the search of such a model, is the foundation of all philosophy, and not epistemology as Descartes mislead us into believing. Frege' s greatness consists, in the first place, in his having percieved this . . . he starts from meaning by taking the theory of meaning as the only part of philosophy whose results do not depend upon those of any other part, but which underlies all the rest. By doing this, he effected a revolution in philosophy as great as the similar revolution previously effected by Descartes .. . " 3 .
Interessant ist, daß die hier dargestellte Wende der philosophischen Perspektive nicht zu einer korrelativen Wende geführt hat, nämlich von einer Sprachtheorie der kleinsten Einheit zu einer Sprachtheorie des Textes und des Diskurses. Beide Perspektiven: die traditionelle erkenntnistheoretische wie die bedeutungstheoretische haben jene Idee einer kleinsten Einheit beibehal-
2 3
L. Wittgenstein, Philosophische Grammatik, Frankfurt a.M. 1973, S. 491. M. Dummett, Frege, London 1973, S. 669.
Sprechakt, Freiheit und Autorität
97
ten. So radikal ist diese Wende also nicht. Denn weder die Diskussion von Freges Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung, noch seine Differenzierungen hinsichtlich Sinn, Ton und Kraft in Beziehung auf die Bedeutung, weder die Verbindung von Sätzen mit Wahrheitsfunktionen und logischen Kalkülen noch die Betonung des analytischen Charakters der Satzanalyse führen zu einer Diskussion des Übergangs von einer auf „kleinsten Einheiten" fundierten Sprachtheorie zu einer Diskurstheorie. Dies alles ist um so verwunderlicher, wenn man bedenkt, daß jede praktische Entscheidung - Entscheidung des Juristen, des Politikers, des Technikers oder eben des Menschen im alltäglichen Leben - als Bedeutungszuweisungsprozeß zu verstehen wäre. Keine Entscheidung, die nicht das Ergebnis einer Herstellung von Bedeutungsdominanzen ist. Immer erscheint eine solche Herstellung als wichtiges diskursives Ereignis. Aber solange die Sprache als Repräsentationsereignis gedacht wird, können Bedeutungen nicht als Produktionsergebnis aufgefaßt werden. Der wirklich emanzipatorische Charakter einer Theorie der Bedeutung bleibt in dieser Weise verschleiert. Die Frage ist, ob der Mensch sich innerhalb seines eigenen sprachlichen Weltverhältnisses emanzipieren kann, solange er dieser Sprache einen Repräsentationscharakter verleiht. Damit beraubt er sich nämlich der Möglichkeit, die Struktur der Diskursivität als solche zu klären. Eine solche Aufklärung wäre nur als diskursives Ereignis möglich, vielleicht nur als Theorie oder Philosophie der Sprache. Mehrere Schritte könnten dazu beitragen, die heutige politische Bedeutungslosigkeit der Theorie der Bedeutung, welche das Ergebnis jener Theorie ist, zu beseitigen: Die Einführung und Durchführung von Kristevas Unterscheidungen zwischen Phäno- und Genotext in bezug auf die Diskursivität; eine Untersuchung über das Verhältnis zwischen Transformation und Produktion als diskursive Prozesse; ein Ausblick auf die Dynamik der Bedeutung. Die erwähnte Unterscheidung von Phänotext und Genotext eröffnet neue Möglichkeiten für das Verständnis von Sprache und Bedeutung. Diese sind einmal gegeben durch den Umstand, daß jenes Verhältnis der beiden Textebenen nicht als eine Differenz von Ebenen zu betrachten ist, die aus einer Einschränkung von Reflexionsmöglichkeiten der Sprache resultiert, woraus dann Bedeutungskomplexitäten erwachsen, sondern als Produktionsverhältnis. „Le texte n'est pas un phénomène linguistique, autrement dit il n'est pas la signification structurée qui se présente dans un corpus linguistique vu comme une structure plate. I l est son engendrement: un engendrement inscrit dans ce ,phénomène' linguistique, ce phénotexte qu'est le texte imprimé, mais qui n'est lisible que lorsqu'on remonte verticalement à travers la genèse: 1) de ses catégories linguistiques, et 2) de la topologie de l'acte signifiant. La signifiance sera donc cet engendrement qu'on peut saisir doublement: 1) engendrement du tissu de la langue; 2) engendrement de ce ,je' qui se met en position de présenter la signifiance. Ce qui s'ouvre dans cette 7 Festgabe Opatek
98
Jan M. Broekman verticale est l'opération (linguistique) de génération du phéno-texte. Nous appellerons cette opération un géno-texte . . . analyser une production signifante comme textuelle reviendrait à démonstrer comment le processus de génération du système signifiant est manifesté dans le phénotexte . . . " 4 .
Den Nachweis des Produktionsverhältnisses auf den verschiedenen Ebenen des Textes muß man auch philosophisch als eine Neuorientierung betrachten. Die Zunahme an Komplexität hinsichtlich der Bedeutungsstruktur impliziert nämlich vor allem eine Relativierung der sprachlichen Macht des sprechenden Subjekts. Das „Ich" des Sprechers, das die Bedeutung als Oberfläche ausspricht, ist selber als Funktion der Sprache zu betrachten. Innerhalb der Sprache finden fortwährend Transformationen statt. Diese beschränken sich nicht auf „kleinste Einheiten" wie Wörter und Sätze; sie sind genauso relevant in bezug auf textuelle und diskursive Einheiten. Diese Einheiten sind materialiter nicht nur von sprachlichem, sondern ebenfalls von sozialem Charakter. Diese Tatsache wird beispielsweise auch von George Steiner 5 ins Licht gerückt. Sprache ist für ihn als historischer Vorgang, folglich als Komplex von Übersetzungen zu verstehen. Diese finden sowohl von einer natürlichen Sprache in eine andere statt, wie auch innerhalb ein und derselben natürlichen Sprache. Kultur, Tradition ist größtenteils als Übersetzungsarbeit zu betrachten - eine Arbeit an und mit Wörtern und Sätzen, Texten, Sprechsituationen und Redeweisen. Dies betrifft die kulturhistorische Dimension dessen, was Übersetzung genannt wird. Sie wäre jedoch in einem weiteren Sinne als Transformation zu betrachten. Unter demselben Stichwort klingt bei Walter Benjamin die metaphysische Dimension des Problems an. In einem Aufsatz aus dem Jahre 1923 „Die Aufgabe des Übersetzers" schreibt er: „Übersetzung ist eine Form . . . Die Frage nach der Übersetzbarkeit eines Werkes ist doppelsinnig. Sie kann bedeuten: ob es unter der Gesamtheit seiner Leser je seinen zulänglichen Übersetzer finden werde? oder, und eigentlicher: ob es seinem Wesen nach Übersetzung zulasse . . . " 6 . Der Begriff der Übersetzung ist für Benjamin konsequenterweise ein Relationsbegriff. Aber: möge das Transformations- bzw. Übersetzungsereignis sich nicht absolut nach dem Willen des Subjektes vollziehen, möge die Unübersetzbarkeit als Eigenart von Sprache, ja, möge die Unmittelbarkeit jener Sprache bezeichnenderweise dominieren - eben solche Dominanzen sind nicht auf der Konstitutionsseite alles Sprachlichen zu suchen, sondern vielmehr als Produktion von Bedeutungdynamismen zu betrachten, die aber selten ans Licht kom-
4
J. Kristeva , Semeiotike, Paris 1969, S. 280. G. Steiner, After Babel, London 1975. 6 W. Benjamin, Die Aufgabe des Übersetzers, in: Gesammelte Schriften, I V , 1, Frankfurt a.M. 1972, S. 9 - 10. 5
Sprechakt, Freiheit und Autorität
99
men. Es heißt, daß eine Übersetzungsarbeit bereits stattgefunden hat, wenn wir mit einem Text konfrontiert werden. Die Übersetzung ist bereits als Spracharbeit textuell geworden, also in den Bannkreis der Produktion von Bedeutung getreten und somit verantwortlich für die Aufhebung der Dominanz des Satzes oder des Wortes als „kleinster Einheit". Wenn die Transformationsarbeit in den Bereich der Produktion von Texten eintritt, so ist damit notwendigerweise eine Einstellungsänderung bezüglich der philosophischen Interpretation von Sprache verbunden. Zumindest vier Prozesse spielen eine Rolle in einem derartigen Produktionsprozeß von Bedeutung im Text: es gibt Prozesse der Verdrängung - hier bricht die psychoanalytische Dimension in die Semiotik ein; es gibt syntaktische Prozesse - diese linguistische Dimension ist, als Lehre der Verbindung, hauptsächlich topologisch; es gibt weiterhin die Entwicklung von Autoritätsund Machtphänomenen - damit dringt die soziologische Dimension ins Semiotische ein, und schließlich gibt es das Phänomen der Verteilung von Knappheit - im ökonomischen Sinne werden im Bereich des Textes knappe Stellen, knappe Sinngebungsmomente usw. verteilt. Das Merkwürdige ist, daß im Hinblick auf das Semiotische jene Prozesse immerzu ineinander transformiert werden und erst zusammen eine einheitliche Produktionsstruktur von Bedeutung ausmachen. Verdrängung, Topologie, Autorität, Macht und Verteilung bilden ihre eigene Phänomenalität im Text. II. Autorität wäre nicht als Ding, Gewohnheit oder Eigenschaft zu verstehen, die Personen oder Institutionen in einem naiv-ontologischen Sinn des Wortes besitzen. In der Tiefenstruktur unserer Sprechaktivität wird ausnahmslos nach einem sozialen Gleichgewicht referiert - das hat Aristoteles in aller Anschaulichkeit und Schärfe dargestellt. Autorität zerstreut, indem sie dieses Gleichgewicht transformiert in eine Vielheit von sozialen Bedeutungen. Damit ist sie ein wesentliches Moment unserer Sprechaktivität. Aus Zerstreuung und Differenz entsteht eben das Material, aus dem die Lebenswelt geschaffen wird. Autorität wäre, so betrachtet, für diese Lebenswelt ein nicht-abzuwerfendes Werturteil. Die Begriffsbestimmung von Autorität, ganz besonders wenn sie von der unmittelbaren Beziehung zu Macht und Herrschaft losgelöst werden soll, scheint uns geradezu in Engpässen philosophischer Reflexionen zu führen, aus denen man nicht so leicht herausfindet. Ähnliches gilt für das Verhältnis von Autorität und Freiheit. Man nimmt gemeinhin an, daß Freiheit einen Gegensatz zu Autorität bildet. Das beruht zu einem großen Teil auf der Idee, daß Freiheit mit Differenz zusammenhängt. Nun ergibt sich aus der vorangehenden Analyse, daß Differenz eine Grundlage sowohl für das Sprechen, für die 7*
100
Jan M. Broekman
Autorität und für die Freiheit wäre: natürlich in jeweils sehr unterschiedlicher Art und Weise, und mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Wir leben heutzutage ohne Zweifel in einer Kultur, die als Kultur der Freiheit bezeichnet werden darf. Es gibt wohl kein politisches System mehr, welches sich nicht den Begriff der Freiheit angeeignet und ihn nicht für die eigenen Einsichten und Ziele verwendet hat. Das gilt für die totalitären Regimes genauso wie für die demokratischen. Auch die Handhabe der Rechtsstaatsidee ist mit dem Freiheitsbegriff eng verbunden. Es dürfte eine triviale Bemerkung sein, wenn man darauf hinweist, daß der Inhalt des Freiheitsbegriffs wesentliche Unterschiede über die ganze Welt aufweist. Wichtiger ist die weltweite Rhetorik, da diese auf Grundbedingungen hinweist, die erfüllt sein sollen, damit ein Staat oder irgendein politisches System überhaupt gedacht werden kann. Auch wenn die radikalsten Formen der staatlichen Autorität ausgeübt werden, dann werden diese noch als Maßnahmen der Freiheit legitimiert. Die Kultur der Freiheit ist die des Buches. Das Buch gilt immer noch als die spezifische Textform jener westlichen Welt, die Freiheit zu einem weltweiten Konzept hat werden lassen. Das Buch dürfte nach seiner äußerlichen Gestalt heutzutage durch die raffiniertesten Methoden und Gestaltungen der Elektronik bedroht sein - es bleibt eine politische Dimension bestehen, welche dem Buch seine Dauer gibt. Das Buch ist nämlich ohne das Konzept einer autonomen und souveränen Person nicht denkbar, also einer Person, die sich als Subjekt des Textes und als Subjekt in dem Text zu einer besonderen Weltorientierung einstellt. Der Peruanische Schriftsteller Mario Vargas Llosä 7 betont, daß diese Idee einer souveränen Person eine exotische und sehr neuzeitliche Idee ist, die nur in einer ganz bestimmten Zivilisation, der abendländischen, entstanden ist. Wer über Freiheit spricht, so könnte man dieser Beobachtung hinzufügen, spricht also unausweichlich über Individualität. Damit vollzieht man aber einen Bruch in die Geschichte der Menschheit. Zerstreuung und Differenz ist offensichtlich auch hier am Werke. Denn die Geschichte der Menschheit ist jene des kollektiv denkenden und lebenden und in diesem Sinne freien Menschen - nicht jene des alleinstehenden, autonomen und sich so für frei haltenden Menschen. Das Individuum, so Llosa, ist Produkt des individualistisch verstandenen Freiheitsbegriffs, genauso wie Ilias oder die großen wissenschaftlichen Entdeckungen unseres Zeitalters das sind. Der individualistische Freiheitsbegriff (und einen anderen gibt es in einer ähnlich profilierten Weise nicht) ist zusammen mit gleichartigen philosophischen und politischen Theorien der sozialen Realität entstanden. Kaum vermag man kausale Zusammenhänge und eindeutige Erklärungen dieses Phäno7 M. Vargas Llosa, La cultura de la Liberdad, Vortrag anläßlich des neunzigjährigen Jubiläums des Verlags Meulenhoff & Co, Amsterdam 1985.
Sprechakt, Freiheit und Autorität
101
mens der Freiheit zu geben. Die Souveränität des Individuums und so auch seine Autorität, die mit diesem spezifischen Freiheitsbegriff verbunden ist, enthält immer einen Bruch mit der Geschichte der Menschheit. Bruch ist hier zugleich: Aufbruch, Aufstand, Dispersion. Die Idee der sozialen Gerechtigkeit, sagt Llosa, die Gleichheitsutopien, die Menschenrechte und selbstverständlich die Theorie und Praxis der Demokratie sind die fruchtbarsten Folgen jener Doktrin, die das Individuum - das unsichtbare Teilchen der Materie zum Mittelpunkt des Universums erhob. Croce spricht in diesem Zusammenhang von einer Heldentat der Freiheit. Dabei blickt er zweifelsohne auf die Ursprünge der Individualität und des Freiheitsdenkens in die Periode der Renaissance zurück. Llosa hält dasselbe Phänomen für eine ethische tour de force. Er formuliert auch, daß der individuelle Mensch dabei als eine Einheit von Rechten und Pflichten verstanden wird. Diese Einheit bildet das Zentrum des gesamten sozialen Lebens, sie ist jedoch ebenso als Zweck der Gemeinschaft anzusehen. Alle Zivilisationen und Kulturen haben Formen der Kunst, der Wissenschaft und der Technik hervorgebracht. In solchen Formen sind immer Spuren und Ansätze zu einer Individualität in dem hier beschriebenen Sinne wiederzufinden. Aber keine sind so dauerhaft, zahlreich, widerstandsfähig und reich an Potenz als die des Abendlandes. Nirgends ist die Individualität in diesem Sinne verstanden, so stark entwickelt worden, so sehr zugespitzt wie in unserer homerischen Kultur. Das erklärt nach Llosa die Tatsache, daß die abendländische Zivilisation eine ungeheuere Vielzahl von Gewohnheiten, Religionen, Institutionen und Wertorientierungen zerstreut, vernichtet oder nach eigenen Maßstäben transformiert hat. Daß dabei Konzepte wie Individualität, Öffentlichkeit oder Familie, Gemeinschaft und Staat in anderen Kulturkreisen anders gewertet wurden, fällt angesichts der Abstraktheit und Allgemeinheit des Freiheitsbegriffs nicht mehr ins Gewicht. Die Stichworte ,Abstraktheit' und ,Allgemeinheit 4 sind in Zusammenhang mit dem Freiheitsbegriff sehr bedeutsam geworden. Vielleicht sind heute die Grenzen der Abstraktion und Verallgemeinerung, jedenfalls in politischer Hinsicht, erreicht. Das ließe sich erst zu einem späteren Zeitpunkt feststellen. Wichtiger ist, daß dieselben Stichworte ganz konkret in einem der wichtigsten Diskurse unseres Zeitalters funktionieren, nämlich in dem juristischen Diskurs. Die allgemeine Individualität und die mit ihr verbundene Freiheit wurden auch von Llosa - vermutlich wegen einer allzu naiven Haltung gegenüber dem juristischen Diskurs - mit Hilfe juristischer Kernbegriffe gekennzeichnet. Das ist der Preis, welcher für den Siegeszug der Individualität und Autonomie der Person bezahlt werden muß. Der juristische Ausdruck ist keineswegs eine nur äußerliche Bezeichnung irgendeiner besonderen Fachsprache. Er ist
102
Jan M. Broekman
wirklich als Ausdruck zu nehmen, d. h., er drückt aus, was Freiheit und Individualität als Errungenschaften des gegenwärtigen Zeitalters bedeuten. Soll heutzutage eine Kultur der Freiheit tatsächlich existieren, dann muß dieser Charakterzug und diese besondere Praxis der Freiheit lediglich juristisch aufgefaßt werden. Es handelt sich um die abstrakte und allgemeinste Formel eines Gleichgewichts von Recht und Pflicht. Damit ist klar, was sich seit der Renaissance vollzogen hat. Es geht um einen bedeutsamen Transformationsprozeß, der augenscheinlich nur das Subjekt der Freiheit, aber im Grunde die Gesellschaft als solche betrifft. Der Begriff der Freiheit ist geradezu unbemerkt zu einem Schlüsselbegriff unserer juristisch aufgefaßten und interpretierten Kultur geworden. Diese allgemeine Juridisierung der Kultur ist also der Preis, den man für die Verallgemeinerung der Individualität hat zahlen müssen. Heutzutage gibt es keine anderen Möglichkeiten mehr, um über Freiheit in bezug auf den Rechtsstaat oder gewisse politische Systeme in einer anderen Art und Weise zu denken. Die weitgehende Politisierung der Menschenrechtsdebatte zeigt, wie sehr die juristische Auffassung vom Menschen als Inhaber von Recht und Pflicht gerade in seiner Allgemeinheit zu der letztmöglichen Konkretion von Freiheit geworden ist. Die besagte binäre Struktur von Recht und Pflicht bringt die anthropologischen Grundmuster des Rechts deutlich zum Ausdruck. Aber in demselben Augenblick wird klar ersichtlich, daß Recht nur in dieser ganz bestimmten Art und Weise „Recht" sein kann. Das subtile Gleichgewicht zwischen den beiden Komponenten Recht und Pflicht ist einziger Gegenstand des Rechts. Die Praxis der Freiheit ist die Praxis der Aufrechterhaltung von diesem Gleichgewicht geworden. Aus gutem Grund hat Llosa die Individualität des gegenwärtigen Menschen in Staat, Recht, Politik und Wirtschaft juristisch ausformuliert. Der individuelle Mensch kann als souveräner Mensch nicht als irgendeine Romanfigur dargestellt werden, mit kompliziertesten Verwicklungen von zwischenmenschlichen Beziehungen, privaten Gefühlen oder gar ethischen Konflikten. Er kann nur als Inhaber von Recht und Pflicht klar dargestellt werden - und diese Klarheit der Darstellung soll herrschen. Ja, Klarheit und Darstellung sollten letzten Endes identisch sein. Die Kennzeichnung der Entwicklung dieses Konzepts als einer ethischen Errungenschaft macht deutlich, wie umfassend diese Weltsicht des Juristischen ist und wie wenig man sich auf die unmittelbare Wirkung gesetzlicher Maßnahmen beschränken kann. Recht ist anscheinend immer mehr als nur Recht! Für Llosa, und für ihn nicht allein, ist diese Ethik als Moment des im Grunde juristischen Diskurses bestimmbar. Auch die Ethik wird in die Problematik des Gleichgewichts von Recht und Pflicht mit einbezogen. Die perfekte Ausgewogenheit jenes Gleichgewichts wird juristisch überwacht. Das Recht ist universaler Hüter dieses Gleichgewichts. Die Realität wird infolgedessen als ein mixtum compositum von tatsächlichen oder
Sprechakt, Freiheit und Autorität
103
virtuellen Interessenkonflikten betrachtet, die durch Rechtssubjekte jederzeit vertreten werden. „Gerechtes Handeln" wird so identisch mit „Handeln als Rechtssubjekt"; Gerechtigkeit, Ethik und Handhabe des Gleichgewichts werden nahezu identisch. Es hat demzufolge überhaupt keinen Sinn, darüber nachzudenken, wie menschliches Handeln zu orientieren wäre, wenn Gerechtigkeit und Gleichgewicht nicht miteinander identisch wären 8 . Die Dichotomie, welche das Gleichgewicht in eine Selbstverständlichkeit transformiert und demzufolge in einem Rechtssubjekt, ist die grundlegende Autorität im Recht. Im juristischen Diskurs, so wird ersichtlich, besteht Autorität darin, daß Differenz in Bipolarität umgesetzt wird. So existiert in der westlichen Welt kein Rechtssystem und kein Rechtsdenken ohne die Bipolarität von Recht und Pflicht. Die Autorität im Recht ist die Handhabe dieser Auffassung als einer faktischen und lebensweltlichen Realität. Grundzug der Autorität im Recht ist demnach ein semantischer Vorgang, nämlich die Aufrechthaltung in Theorie und Praxis, daß die Welt des Rechts mit jener der Lebens weit identisch ist. Es geht bei alledem nicht um die Transformation von Subjektivität in Rechtssubjektivität allein. Auch das menschliche Handeln soll eine andere Dimension bekommen, damit die erwähnte Zielsetzung erreicht wird. Das ist wichtig, denn Handeln und Freiheit sind immer schon in engster Beziehung zueinander gedacht worden. Die Freiheit ist in jenem Kontext aufgefaßt als Manifestierung der Komplexität des menschlichen Handelns. Das gilt anthropologisch wie juristisch oder ethisch. Die ausschließlich bipolare Interpretation des menschlichen Handelns kann darum befremdend wirken, wenn man darin nicht sofort die Wirkung des Denkens eines perfekten Gleichgewichts erkennt. Denn Handeln, so müßte man doch annehmen, ist niemals binär, es ist niemals nur negativ oder positiv, sondern vielmehr nach sich verflüchtigenden, relativierenden und sich widersprechenden Kriterien zu bewerten. Ist die Bipolarität der juristischen Auffassung des menschlichen Handelns wohl angemessen? Oder ist Handeln im Sinne des juristischen Diskurses in einer anderen Art und Weise aufzufassen als im Sinne der lebensweltlichen Praxis? Erneut ist damit das Problem der Differenz zweier semantischer Ebenen angeschnitten. Die innere Komplexität des humanen Handelns wird erst im Sinne des juristischen Diskurses beherrschbar und beurteilbar. Wer wird die ethischen, moralischen, politischen Dimensionen des Handelns ermessen? Nur durch den technischen Eingriff des Rechts, die aus jenem Handeln buchstäblich eine Ermessensfrage macht, entsteht ein Wertmaßstab für die Autonomie, die Autorität, die Autorschaft, die Freiheit des Menschen. Dieser Maßstab trägt den verborgenen Namen: Gleichgewicht. 8 /. M. Broekman, Justice as Equilibrium, in: Law and Philosophy, 1986, 3, S. 5, 369 - 391.
104
Jan M. Broekman
III. Die Rechtstheorie hat eine „recieved view" entwickelt über den Zusammenhang von Freiheit, Autonomie und Autorität. Diese Auffassung nimmt die hervorgehobene iterative binäre Struktur als eine Selbstverständlichkeit an. Die Dualität von Recht und Pflicht ist ein Grundsatz der Theorie; Handeln als Rechtssubjekt ist ein Muster alles menschlichen Handelns. Diese „recieved view" akzeptiert die Abstraktion vom konkreten Individuum als eine zu erfüllende Bedingung für jede Theorie, und sie realisiert damit einen positivistischen Wissenschaftsbegriff. Für die Rechtstheorie ist die Ausübung von Autorität demnach a priori zum Moment eines institutionalisierten Handelns geworden. Unsere Kultur der Freiheit repräsentiert die allgemeine Praxis des juristischen Denkens und der juristischen Interpretation von Wirklichkeit in Staat und Gesellschaft. Die Freiheit des Individuums wird als lebensweltlich verstanden, ja sogar die Juristen fassen sie so auf. Sie kann jedoch nur realisiert und in der politischen Praxis bedeutsam werden, wenn sie nicht lebensweltlich, sondern juristisch verstanden wird. Diese Grundbedingung bleibt anscheinend in dem Alltag wie in der juristischen Praxis verborgen. Wie soll Freiheit realisiert werden ohne eine derartige Transformation? Diese Frage betont den formalen Charakter des Rechts. Sie betont ebenfalls, daß das Subjekt des Rechts durch formalisierende, abstrahierende und generalisierende semantische Transformationen zustandekommt und demnach mit der lebensweltlichen Faktizität nicht zusammenfällt. Dieser Gedankengang, der für das Verständnis der Autorität von großem Belang ist, scheint annehmbar im Rahmen eines Kodifikationsdenkens, aber bereits abwegig in beispielsweise der deutschen Interessenjurisprudenz oder in Tendenzen einer reflexiven Rechtsauffassung - vom common law ganz zu schweigen - , in dem der Begriff der Rechtssubjektivität, also der legal persons, eine geringere Rolle spielt als im Kodifikationsdenken. Man sollte jedoch das Kodifikationsdenken einmal nicht als eine besondere rechtstheoretische Auffassung verstehen, sondern als Idealtyp der Internalisierung und Sozialisierung von Recht. Damit wird angedeutet, daß es nicht ausschließlich um das Funktionieren des Rechts in Staat und Gesellschaft geht. Denn dieses Funktionieren könnte durch den Begriff der Gesetzesanwendung charakterisiert werden. Internalisierung und Sozialisierung des Rechts in der Gesellschaft sind jedoch umfassendere Prozesse. Von ihnen erwartet die Rechtstheorie, daß der formale Charakter des Rechts gemildert werden kann oder gar verschwindet. Diese Erwartung wird beispielsweise konkret formuliert, wenn es um das Recht des Wohlfahrtsstaates geht. Dort soll das formale Kriterium für Recht gemildert werden durch Nützlichkeit, soziale Akzeptierbarkeit des Rechts oder gar „fairness". Die Frage, die
Sprechakt, Freiheit und Autorität
105
dadurch entsteht, ist nun, ob in der postliberalen Gesellschaft in dieser Art und Weise die Rechtsstaatsidee nicht aufgelöst wird, zumal Wohlfahrt weitaus determinierender wirkt als die formalen juristischen Kriterien (Unger). Aber die Internalisierung des Rechts führt nicht nur zu der konkreten Rechtsausbildung, Rechtsanwendung oder Staatsauffassung allein. Mit ihr entsteht eine allgemeine, von allen Voraussetzungen des Rechts durchtränkte Auffassung von Wirklichkeit. In dieser Sicht sind juristische Grundschemen wirksam, ohne daß sie als solche unmittelbar wiederzuerkennen sind. Diese Auffassung gilt für alle Handlungen, Beziehungen und Erfahrungsbereiche; bei allen ist sie selbstverständlich und kein Gegenstand der Diskussion. In einem derartigen Internalisierungsprozeß ist die Autorität des Rechts aufgenommen worden. Jene Sozialisierung bildet eine Lebensform, die als solche unter Einfluß des Rechts weiterhin artikuliert wird. Das kodifizierte Recht ist eine solche Lebensform, in der nicht nur die Juristen des europäischen Kontinents, sondern natürlich auch jene des common law Systems leben. Die technischen Ausarbeitungen, ob durch Normsetzung, Regelbildung, ob durch Fallstudien, ist dabei nicht ausschlaggebend. In jener Lebensform kann der Staat ein allesbeherrschendes Kriterium für Gemeinschaft, Gerechtigkeit und Recht werden. Dabei bildet sich ein Charakter heraus, welcher als „autoritäre Persönlichkeit" gekennzeichnet werden kann. Untersuchungen eines R. E. Money-Kyrle oder Th. W. Adorno haben klar erscheinen lassen, daß in einem solchen Fall die humanitären Aspekte der Persönlichkeit von den autoritären geradezu unterdrückt werden. Diese Wertordnung der Persönlichkeitsaspekte hängt mit der skizzierten, hierarchisch-formalistischen Lebensform des Kodifikationsdenkens mitsamt ihrer Grundschemen eng zusammen. Man könnte sagen, daß fast alle rechtstheoretischen Entwürfe heutzutage das Recht in einer entgegengesetzten Richtung zu konzeptualisieren versuchen. Dabei wird immer vernachlässigt, wie sehr das formal-juristische Denken als Lebensform eine Rolle in Recht und Alltag spielt. Hinzu kommt, daß diese rechtstheoretischen Entwürfe gewöhnlich an der Tatsache vorbeigehen, daß ein Rechtssystem ohne ein Minimum an Positivismus einfach nicht denkbar ist. In dem Sinne ist die Neigung der Rechtstheorie, das Problem der Autorität als das der Legitimation und der inneren Rechtfertigung einzuschränken, zugleich ein Versuch, den harten Kern des Positivismus im Recht nicht zur Debatte zu stellen9. Die Existenz des Rechtssystems selber wäre davon betroffen, und es könnte dadurch sogar gefährdet werden. Einige Stichworte sind in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung. Sie sind etwa: Bedeutung und Differenz, Abstraktion und Allgemeinheit, Transformation und Unterwerfung. Diese Stichworte kennzeichnen von ver9 J. M. Broekman, The Minimum Content of Positivism. Positivism in the Law and in Legal Theory, in: RECHTSTHEORIE 16 (1985), S. 349 - 366.
106
Jan M. Broekman
schiedenen Perspektiven aus das Problem der Autorität. Die semantischen, soziologischen und rechtstheoretischen Besonderheiten der Problematik der Autorität sind in ihnen wiederzuerkennen. Es ist in unserem Zusammenhang nun besonders interessant, daß die Gesamtheit dieser Stichworte zutrifft für die Welt, welche Franz Kafka als Welt der Bürokratie beschrieben hat. Kafkas Arbeiten sind eigentlich nicht als Beschreibungen der Bürokratie zu lesen, sie repräsentieren diese also nicht, sondern sie präsentieren diese, sie stellen diese Welt gegenwärtig. Autor und Leser sind identisch gegenüber jeder Potenz, die Bürokratie als eine perfekte Gestalt der Autorität erscheinen läßt. Milan Kundera hat in einem Aufsatz über Kafka jene Züge des Bürokratismus mit dem literarischen Begriff des Kafkaesken gekennzeichnet. In diesem Sinne ist die spezifische Erfahrung, welche Kafka seiner literarischen Gestalt gegeben hat, als eine Theorie der Autorität zu betrachten, die in besonderen Sprechakten immer wieder konkret wird. Als erstes Merkmal soll die Macht erwähnt werden, die der Autorität innewohnt. Macht ist nicht präzise zu identifizieren: sie ist allgegenwärtig, sie ist mikrologisch (Foucault). Aber sie ist ebensosehr allgemein und strukturiert. Eben durch diese Struktur ist es deutlich, daß Autorität in dem Sinne zu lesen ist wie ein Text. Die Struktur ist auf einen Autor angelegt, aber die Spezifizität dieser Tatsache, die Kafkas Texte hervorhebt, ist nun, daß man den Autor nicht antreffen kann; er ist buchstäblich überall und nirgends. Das ist, was Foucault die Mikrologie der Macht genannt hat. Macht, und mit ihr Autorität, ist in allen Bestandteilen der Struktur gegenwärtig. Aber die Macht hat, im Gegensatz zur Autorität, nicht die Potenz der bedeutungstiftenden Differenzierung. Im Lichte der Autorität ist es darum nicht wesentlich, daß der Autor nicht zu identifizieren ist und seine Aussagen unverständlich sind. Denn die Autorität ist immer schon internalisiert worden und damit steht jede Bedeutsamkeit fest. Die Welt wird als Labyrinth erfahren, man kann sie weder verneinen noch verstehen. Sie, diese Welt der Autorität, ist eine Maschine geworden, die als letztendliche Referenz die machina machinarum des Hobbes hat. Zweitens soll der paradoxale Charakter der Autorität hervorgehoben werden. Es ist klar, daß auch hier eine Beziehung zu den Texten von Kafka besteht. Sein Werk ist eben als Text eines unmeßbaren und unauslotbaren Paradoxons zu lesen. Die Autorität ist in diesem Sinne jenseits von Ernst und Scherz, sie ist lächerlich und todernst im selben Augenblick. Der Sinncharakter der Autorität ist darum nur ex post facto festzustellen, und dabei wird erst recht deutlich, wie riskant und arbiträr es ist, Autorität auf einen Begriff festlegen zu wollen. Der Ernst und der ridiküle Charakter der Autorität ist in Kafkas Texten geradezu handgreiflich. Es herrschen in dieser Hinsicht nur Unbestimmtheitsrelationen. Ein jeder ist Angeklagter, ein jeder klagt an, ein jeder
Sprechakt, Freiheit und Autorität
107
lebt mit einer Beschuldigung oder wird verfolgt. Die Struktur des Autoritären ist derart, daß alle Differenzierungen möglich sind und daß dadurch ein Universum an Bedeutungen entsteht - oder auch eine Maschine, die kontinuierlich Bedeutungen hervorbringt, aber keiner ist eigentlich vollständig imstande, sie zu verstehen und zu erkennen. Diese Maschine, die Bedeutungen hervorbringt, stockt niemals. Bedeutungen bekommen ihren Niederschlag in Texten. Es ist diese machina machinarum y welche das Gesetz als Text hervorbringt. Als Text ist dieser Text zugleich die Institution aller Institutionen. Die Rolle des Autors ist von der Potenz der Autorität übernommen worden. Diese Autorität ist weder der Besitz noch die Befugnis irgendeiner bestimmten Persönlichkeit oder Instanz, sie ist lediglich Selbstdarstellung. Sie ist sie selbst, sie besitzt sich selbst. Text ist in diesem Sinne Instanz, Autorität und Gesetz in einem. Darum ist der Angeklagte vor dem Gesetz keine Person, die in einer ganz bestimmten Lebenslage hineingeraten ist (das ist er vielleicht auch, aber dieses „auch" ist belanglos), sondern eine festgelegte Bedeutung, die er (Kafkas „ E R " ) zu sein - und nicht: zu repräsentieren hat. Denn vor dem Gesetz ist keine Repräsentation möglich. Das Gesetz und das Existieren vor dem Gesetz ist unmittelbare Wirklichkeit. Ein Problem vieler Kafka-Interpretatoren ist, daß sie diese existentielle Situation immer noch als Situation einer Re-präsentation lesen und dadurch etwa das Gesetz oder das Existieren vor dem Gesetz als Symbol der humanen Existenz auffassen, ohne die Unmittelbarkeit zu verstehen. Es ist, so müßte man sagen, vielmehr umgekehrt: nicht die textuelle Situation ist in die humane Existenz hineininterpretiert, sondern die humane Existenz ist in den Text hineingetragen worden. Der Mensch ist Funktion des Textes. Die textuelle Gegenwart ist sein letztmögliches Schicksal und sein ultimes Selbstverständnis. Das führt zu der dritten Dimension der Autorität, welche wir hervorheben möchten. Sie ist die vielleicht komplizierteste und unverständlichste Dimension, der man in unserem Kontext begegnen kann. Ihre metaphysische Tiefe ist geradezu unauslotbar. Denn, wie gesagt, der Angeklagte ist nicht von irgend jemanden oder von irgendeiner Instanz beschuldigt worden. Er ist Angeklagter, weil er „bestraft werden will". Das „bestraft werden wollen" ist Grund und Kennzeichen seiner Existenz, ja, der humanen Existenz überhaupt. Die Sünde, für die er bestraft werden soll, hat er (in einem naiv-ontologischen Sinne aufgefaßt) vielleicht gar nicht „begangen". Die Sünde existiert naiv-ontologisch nicht als Ursache für dieses „Bestraft werden wollen", denn es gibt für ein solches Wollen keine Ursache. Dieses „Wollen" entzieht sich dem Kausaldenken. Die Anklage sucht und findet infolgedessen seine Motivation, ja, sie konstruiert sie selber, um Existenz überhaupt möglich sein zu lassen. In dem Sinne kommt also eine Inversion zustande, die für ein logisches Denken kaum faßbar ist. Grundlage für die Gerechtigkeit ist in dieser Per-
108
Jan M. Broekman
spektive das Faktum, daß wir alle Angeklagte sind. Dadurch ist die Autorität legitimiert, ja, sie bedarf überhaupt keiner Legitimation mehr. Die Überflüssigkeit und dadurch auch die Abwesenheit der Legitimation ist eben: Autorität. Darum konstruiert und sucht der Angeklagte seine Anklage. Er soll sich seiner Bestrafung unterwerfen können, damit seine Existenz überhaupt Bedeutung bekommt. Auch hier tritt (es erübrigt sich fast, dies auszuformulieren) die Autorität derart in das Leben ein, daß erst durch sie Bedeutung zustandekommt. U m die dafür notwendige Differenz entstehen zu lassen, soll die Wirklichkeit so betrachtet werden, daß darin die Strafe seine Sünde findet. Milan Kundera betrachtet diese Inversion als einen typischen Kafkaesken Charakterzug des Autoritären. Und die Autorität des Rechts - ist sie ebenfalls Kafkaesk? Wäre eine solche Schlußfolgerung nicht doch eine negativistische und vielleicht sogar anarchistische Deutung des Rechts? Wenn das so wäre, dann müßte man zuerst fragen, warum die Rechtstheorie diese Tatsache nicht längst untersucht und hervorgehoben hat, statt die Problematik der Autorität als Problem der Rechtfertigung und Legitimation zu behandeln. Die Antwort ist klar und überraschend. Tatsächlich ist jene Differenz und Dispersion, die vielleicht im Recht als Kafkaesk charakterisiert werden kann, ein wesentliches Merkmal der Autorität. Aber die Autorität im juristischen Diskurs invertiert die Inversion, welche hier beschrieben wurde. Denn die Autorität im Recht und des Rechts beruht auf einem positivierenden und vereindeutigenden, Differenzen aufhebenden Verfahren. Die Dispersion soll im Recht zurückgedrängt werden, bis die Selbstreferenz des juristischen Diskurses wieder ihren ungestörten Verlauf nimmt. Es spricht dabei für sich, daß hier die Selbstreferenz des juristischen Diskurses nicht als ganz bestimmte, etwa an dem französischen Kodifikationsdenken ausgerichtete, rechtstheoretische Auffassung verstanden wird. Es geht hier nicht um eine theoretische Deutung, sondern um einen Wesenszug aller Rechtssysteme der westlichen Welt. Es ist die Selbstreferenz als Wirkung und als Grundlage des Rechts, die hier gemeint ist. Und hiervon kann man sagen, daß Recht durch jede Bedeutung bedroht wird, die nicht mit dem inneren dogmatischen Diskurs innerhalb des umfassenderen juristischen Diskurses in Übereinstimmung gebracht werden kann. Das Zurückdrängen der Dispersion durch Inversion läßt folgende Merkmale der Autorität im Recht erkennen: a) Herrschaft, Macht und Autorität des Rechts können nur sozial funktionieren, wenn eindeutige semantische Verhältnisse vorherrschen. Das wäre an und für sich ein Hauptmerkmal des jedem Rechtssystem innewohnenden Positi vismus. b) Die Einheit des Dogmatischen soll nicht nur in einem juristisch-technischen Sinne gewährleistet werden, sondern ebenso als kontinuierlicher Sozialisierungsvorgang von Recht in der Gesellschaft.
Sprechakt, Freiheit und Autorität
109
c) In einem wichtigen Zusammenhang soll damit die Sehnsucht nach dem perfekten Gleichgewicht aufrechterhalten bleiben. Darin kann man die mythomane Dimension des Rechts wiedererkennen. Die bipolare Wertorientierung, welche das Recht immerfort praktiziert, soll schließlich in jene Perfektion des Gleichgewichts übergehen. In seinem Grunde ist das Subjekt des Rechts ein binäres Wesen, und die juristische Aktivität besteht darin, daß Gleichgewichte hergestellt werden sollen. Erst durch diesen Vorgang kann Recht seine Selbstreferenz aufrechterhalten. Eine Schlußfolgerung liegt auf der Hand. Wenn die Autoritätsproblematik in der Rechtstheorie zu Theorien der Legitimation und Rechtfertigung Anlaß gibt, dann ist das nicht wegen einer Notwendigkeit, die aus ethischen oder sozialen Motivierungen entstanden ist. Es geschieht vielmehr darum, daß die Dispersion durch das Recht eingeschränkt, Bedeutung vereindeutigt und positiviert, Inversionen einen Halt zugerufen und daß damit die Selbstreferenz in Stand gehalten wird. Dies ist also die merkwürdige Dynamik der Autorität im Recht: sie soll sich im Recht zerstören, d.h. ihre Dispersion aufheben, damit Autorität im Recht existieren kann.
Repräsentation und Demokratie Von Ernesto Garzón Valdés, Mainz Ich möchte im folgenden das Problem der ethischen Rechtfertigung der parlamentarischen Repräsentation in der modernen demokratischen Gesellschaft behandeln. Es geht mir also um die Frage der Legitimität einer Institution, die in einer ganz bestimmten Epoche der europäischen Geschichte als „technisches Hilfsmittel" zur Sicherung der Rechte und Freiheiten einer ganz bestimmten sozialen Klasse, nämlich der Bourgeoisie, eingeführt wurde. Häufig dient diese Entstehungsbeziehung zwischen Institution und sozialer Klasse als Grundlage für die Auffassung, daß die Institution überholt sei, da die sozio-politischen Bedingungen, die der Anlaß für ihre Entstehung waren, nicht mehr gegeben sind. Es ist daher angebracht, zunächst kurz auf die Argumente einzugehen, die seinerzeit zugunsten der Repräsentation vorgebracht und die später dann auch in der Kritik am demokratischen Parlamentarismus wieder aufgegriffen wurden. Dabei kann man sich sehr gut an Edmund Burke und Carl Schmitt orientieren (I). Anschließend möchte ich einige Hauptpunkte der Rechtfertigung des Parlamentarismus darstellen. Dafür werde ich mich auf zwei schon klassische Arbeiten von Hans Kelsen beziehen (II). Die Gegenüberstellung der beiden Positionen wird es schließlich erlauben, einige Schlußfolgerungen hinsichtlich der Möglichkeit der Rechtfertigung und hinsichtlich der ethischen Grenzen für die Politik in der demokratischen parlamentarischen Demokratie zu ziehen (III). I. Edmund Burke y hat unter den Theoretikern der parlamentarischen Repräsentation wohl mit der größten Klarheit die Beziehung zwischen Parlament und Bourgeoisie herausgearbeitet. Er vertrat diesbezüglich die Ansicht, die Bourgeoisie sei aufgrund ihrer Bildung und ihres wirtschaftlichen Status am besten geeignet, die allgemeine Repräsentation der Nation zu übernehmen. Bekanntlich besteht die Aufgabe des Repräsentanten nach Burke darin, nicht nur technisch zweckmäßige, sondern auch ethisch richtige Gesetzgebungsentscheidungen zu fällen. Diese ethische Richtigkeit setzt aber voraus, daß es in Politik und Ethik Wahrheiten gibt sowie Kriterien, die es erlauben, Sätze, die solche Wahrheiten zu formulieren behaupten, zu verifizieren oder zu falsifizieren.
112
Ernesto Garzón Valdés
Da es aber moralisch richtige Antworten auf politische Fragen gibt, so Burke, besteht auch eine moralische Pflicht, diese Antworten zu finden. Das Regieren ist also nicht in erster Linie eine Angelegenheit des Willens, sondern der Vernunft und der Weisheit. Und das Parlament ist das Forum, in dem vermittels öffentlicher Diskussion und rationaler Auseinandersetzung die Wahrheit gefunden werden kann. Diese entspricht dem nationalen Interesse, das, wenn es als solches befriedigt wird, auch jedem einzelnen Mitglied der Gemeinschaft Nutzen bringt. Anders als Mill war Burke nicht der Meinung, jeder sei selbst am besten zur Beurteilung seiner eigenen Interessen geeignet. Für ihn gibt es daher auch keine notwendige Beziehung zwischen dem, was die Leute wollen, und der Befriedigung ihrer Interessen. Folglich macht es keinen Sinn, die Meinung der Repräsentierten über das, was im Parlament beschlossen werden soll, einzuholen. Nur der Repräsentant ist ja bei den Parlamentssitzungen anwesend, nimmt also teil an der Suche nach der Wahrheit. Deswegen konnte Burke sagen: "What sort of reason is that in which the determination precedes the discussion, in which one set of men deliberate and another decide, and where those who form the conclusion are perhaps three hundred miles distant from those who hear the arguments?" 1
Wenn aber das Regieren eine Tätigkeit des Verstandes und nicht des Willens ist, dann kann der Wille des Volkes keinen Sonderstatus beanspruchen. Das Volk muß den Repräsentanten größtmögliche Freiheit geben, so zu handeln, wie sie es für richtig halten. Der Repräsentant, der sein eigenes Urteil der Meinung der Wähler „opfert", „verrät sie, anstatt ihnen zu dienen" 2 . In seiner berühmten Rede vor den Wählern von Bristol sagte Burke: "Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but Parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole - where not local prejudices ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole." 3
Die Diskrepanz zwischen Interesse und Wille hängt mit einer anderen Unterscheidung bei Burke zusammen: derjenigen zwischen Interesse und Meinung. Das objektive Interesse eines Wahlbezirks kann sich von den Meinungen einiger oder sogar aller Bürger des Bezirks unterscheiden. Die Meinung neigt dazu, voreilig, übertrieben, voller Vorurteile und großen Schwankungen unterworfen zu sein; sie ist subjektiv und enthält daher ein gerütteltes Maß an Irrationalität. Das Interesse dagegen ist objektiv und läßt sich in der parlamentarischen Debatte rational begründen. Das Volk ist bei der Ergründung seines eigenen Interesses in einer ungünstigen Lage, da es an den parla1 2 3
Edmund Burke, Burke's Politics, New York 1949, S. 115. Ders., (FN 1). Ders., (FN 1), S. 116.
Repräsentation und Demokratie
113
mentarischen Sitzungen nicht teilnehmen kann. Erst im Laufe der Zeit können (und sollten) sich parlamentarische Entscheidungen und die Meinung der Bürger einander annähern. Das Parlament „imitates in the sphere of government the natural character of society as a whole" 4 , und es gelangt mit Hilfe der rationalen Diskussion und eines abgewogenen Urteils zu Schlußfolgerungen, zu denen die Gesellschaft nur indirekt und viel langsamer gelangen kann. Deshalb konnte Burke seinen Wählern sagen: " I aim to look, indeed, to your opinions; but such opinions as you and I must have five years hence. I was not to look at the flash of a day." 5
Die langfristige Übereinstimmung zwischen dem Ergebnis der rationalen parlamentarischen Entscheidung und den Meinungen des Volkes äußert sich in den Gefühlen der Zustimmung des Kollektivs für die parlamentarischen Entscheidungen. Nur selten täuschen sich die Leute in ihren Gefühlen. Erst wenn sie versuchen, auf der Grundlage dessen, was sie fühlen, weiter zu spekulieren, verlieren sie sich in Meinungen: "The most poor, illiterate, and uninformed creatures upon earth are the judges of a practical oppression. It is a matter of feeling; and as such persons generally have felt most of it, and are not of an over-lively sensibility, they are the best judges of it. But for the real cause, or the appropriate remedy, they ought never to be called into council about one or the other." 6
Anders als die wissenschaftliche Tatsache oder das Interesse, sind Meinungen im wesentlichen persönlicher Art, und die einzig vertrauenswürdige Autorität bezüglich dessen, was man fühlt, ist man selbst. Demnach ist es für das Handeln der Regierung wichtig, daß die Leute ihre Gefühle mit größtmöglicher Genauigkeit kundtun: "The people are the masters. They have only to express their wants at large and in gross. We are the expert artists; we are the skillful workmen, to shape their desires into perfect form, and to fit the utensil to the use . . . They are the sufferers, to tell the symptoms of the complaint; but we know the exact seat of the disease, and how to apply the remedy." 7
Die Übermittlung dieser „Symptome" erfolgt durch die Wahlen, die so als Korrektiv für eventuelle Irrtümer der Parlamentarier bei der Bestimmung des Nationalinteresses dienen. Die elitistische Auffassung der parlamentarischen Repräsentation bei Burke stützte sich auf ein empirisches Datum - nämlich die Homogenität der Wählerschaft - und auf eine erkenntnistheoretische Annahme - daß es nämlich politische Wahrheiten gibt, die man durch Einsatz der Vernunft in der 4
Oers., Zitiert 6 Burke, 7 Zitiert 5
(FN 1), S. 348. nach James Hogan, Election and Representation, Cork 1945, S. 189. (FN 1), S. 492f. nach Ernest Barker, Essays on Government, Glencoe (III.) 1951, S. 201.
8 Festgabe Opatek
114
Ernesto Garzón Valdés
parlamentarischen Debatte finden kann. Das Kriterium für die Wahrheit ist für Burke die Übereinstimmung mit dem Nationalinteresse, welches wiederum durch die Äußerung der Gefühle des Volkes bei den Wahlen als solches bestätigt oder falsifiziert wird. Gegen Ende der 20er Jahre dieses Jahrhunderts formulierte Carl Schmitt eine der bisher schärfsten Kritiken gegen das parlamentarische System. Er bezog sich dabei zum Teil auf die Interpretation von Burke sowie auf Überlegungen von Donoso Cortés. A n einige seiner Hauptargumente sei hier erinnert. Auch Schmitt ging von der Möglichkeit aus, eine politische Wahrheit durch Diskussion zu erkennen, also davon, „daß aus dem freien Kampf der Meinungen die Wahrheit entsteht" 8 . Das Parlament sei aber - so Schmitt - nicht mehr ein Forum, „zur Bildung eines überegoistischen, überparteilichen und staatspolitischen Willens" 9 . Vielmehr sei es „aus dem Schauplatz einer einheitlichen, freien Verhandlung freier Volksvertreter, aus dem Transformator parteiischer Interessen in einen überparteiischen Willen, zu einem Schauplatz pluralistischer Aufteilung der organisierten gesellschaftlichen Mächte (geworden)." 10
Das Scheitern des Parlamentarismus gründe sich auf „labile, von Fall zu Fall wechselnde Parlamentsmehrheiten zahlreicher, in jeder Hinsicht heterogener Parteien . . . Die Mehrheit ist immer nur eine Koalitionsmehrheit, und nach den verschiedenen Gebieten des politischen Kampfes - Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Kulturpolitik - ganz verschieden." 11
In dieser Situation sei rationale Diskussion durch Verhandlung und Kompromiß ersetzt worden: „Verhandlungen . . . , bei denen es nicht darauf ankommt, die rationale Richtigkeit zu finden, sondern Interessen und Gewinnchancen zu berechnen und durchzusetzen und das eigene Interesse nach Möglichkeit zur Geltung zu bringen .. . " 1 2 „Große politische und wirtschaftliche Entscheidungen, in denen heute das Schicksal der Menschen liegt, sind nicht mehr ... das Ergebnis einer Balancierung der Meinungen in öffentlicher Rede und Gegenrede und nicht das Resultat parlamentarischer Debatten." 1 3
Die eigentlichen Entscheidungen fallen in parlamentarischen Ausschüssen, und dort erfolgt auch die Abwägung der Interessen von Gruppierungen mit 8 Carl Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, 2. Aufl., Berlin 1926, S. 45f. 9 Ders., Der Hüter der Verfassung, Tübingen 1931, S. 88. 10 Ders., (FN 9), S. 89. 11 Ders., (FN 9). S. 88. 12 Ders., (FN 8), S. 10. ι 3 Ders., (FN 8), S. 62.
Repräsentation und Demokratie
115
politischer und wirtschaftlicher Macht. „Das Privileg der Redefreiheit verliert dadurch seine Voraussetzungen" 14. Was für die Diskussion gilt, gilt - nach Schmitt - auch für die Öffentlichkeit. Die Angewohnheit, in immer kleineren Ausschüssen zu arbeiten, bringt die Neigung mit sich, auch die Funktionen des parlamentarischen Plenums zunehmend zu beschneiden: „Die engeren Komitees, in welchen der Beschluß tatsächlich zustandekommt, sind nicht einmal immer Ausschüsse des Parlamentes selbst, sondern Zusammenkünfte von Parteiführern, vertrauliche interfraktionelle Besprechungen, Besprechungen mit den Auftraggebern der Parteien, den Interessenverbänden usw." 1 5
Wenn auch das Parlament nach der ursprünglichen liberalen Auffassung der Ort politischer Integration mit Hilfe unabhängiger Repräsentanten war, so sind diese doch inzwischen zu bloßen Delegierten geworden, zu den „Botschaftern", die Burke kritisiert hatte. Nach Schmitt herrschten in Weimar die streng organisierten Verbände und Parteien, wobei die einflußreiche Bürokratie völlig von entgegengesetzten Interessen abhängig war. Zur pluralistischen Zersplitterung des Parlaments kam das Phänomen der Polikratie hinzu, das heißt die verwirrende gleichzeitige Existenz verschiedener autonomer Zentren des Wirtschaftslebens. Nach Schmitt fehlte dem polikratischen System, das auch eine Folge der Massengesellschaft war, eine einheitliche Führung und jegliche Koordination. Die Demokratie der Massengesellschaft konnte demnach die Interessenverfolgung nicht vermittels der parlamentarischen Repräsentation kanalisieren, sondern muß te ihre Identität dadurch suchen, daß sie die Ursachen der heterogenen Pluralität ausschaltete. Die von Schmitt vorgeschlagene Lösung ist hinreichend bekannt und muß hier nicht erläutert werden. Ich möchte stattdessen drei Punkte der gemeinsamen Position von Burke und Schmitt hervorheben: 1. die Behauptung der Existenz ethischer und politischer Wahrheiten; 2. die Überzeugung von der Notwendigkeit einer homogenen Gesellschaft, damit parlamentarische Repräsentation funktionieren kann; 3. die Auffassung der Beziehung zwischen Diskussion und Verhandlung unter dem Gesichtspunkt der Befriedigung der „wahren" Interessen der Individuen.
14 15
8*
Ders., Verfassungslehre, München/Leipzig 1928, S. 319. Ders., (FN 14).
116
Ernesto Garzón Valdés
II. War der Leitfaden für die Position von Burke und Schmitt die Suche nach der politischen Wahrheit, so war es bei Hans Kelsen die Verteidigung der individuellen Freiheit bzw. Autonomie sowie der wesentlichen Gleichheit aller Menschen. Es ist die Synthese dieser beiden Prinzipien, die nach Kelsen die Demokratie ausmacht. Kelsen ist der Ansicht - darin der Auffassung Kants folgend - , daß die natürliche Freiheit gleicher Wesen nur verwirklicht werden kann, wenn sie in politische Freiheit umgewandelt wird. Das heißt, daß wir nur dann frei sein können, wenn wir die Herrschaft des Staates akzeptieren. Politisch frei ist aber nur, wer zwar Untertan eines Staates ist, aber dennoch nur seinem eigenen und nicht einem fremden Willen gehorcht. Diese völlige Übereinstimmung des Willens der einzelnen mit den Beschlüssen des Staates kann sich jedoch nur in der hypothetischen Situation der Gründung der politischen Ordnung mit Hilfe des Urvertrages ergeben. In der Realität des politischen Lebens muß das Einstimmigkeitsprinzip durch das Mehrheitsprinzip ersetzt werden, da dieses die bestmögliche Annäherung an den Gedanken der Freiheit bedeutet. „Nur der Gedanke, daß - wenn schon nicht alle - so doch möglichst viel Menschen frei sein, d.h. möglichst wenig Menschen mit ihrem Willen in Widerspruch zu dem allgemeinen Willen der sozialen Ordnung geraten sollen, führt auf einem vernünftigen Wege zum Majoritätsprinzip." 16
Daß das Treffen von Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip eine Beschränkung der Freiheit derer bedeutet, die zur Minderheit gehören, ist offensichtlich. Ebenso gewiß ist aber, daß Demokratie in Gesellschaften mit einer ziemlich großen Anzahl von Mitgliedern nur möglich ist, wenn diese Art von Beschränkungen akzeptiert wird. Da nämlich direkte Demokratie nicht möglich ist, muß man auf ein System von Repräsentanten, also auf ein parlamentarisches System, zurückgreifen, dessen Hauptfunktion nach Kelsen die „Bildung des maßgeblichen staatlichen Willens durch ein vom Volke auf Grund des allgemeinen und gleichen Wahlrechts, also demokratisch gewähltes Kollegialorgan, nach dem Mehrheitsprinzipe" 11 ist. Der Parlamentarismus stellt einen Kompromiß zwischen der demokratischen Forderung nach Freiheit und der durch die modernen Nationalgesellschaften erzwungenen Arbeitsteilung dar 18 . Aufgrund der Komplexität der modernen Gesellschaft ist das „Volk" als solches nicht in der Lage, direkte Demokratie zu praktizieren, und muß sich daher auf die Schaffung des Organs beschränken, das den staatlichen Willen bildet. Da aber andererseits der
16 17 18
Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tübingen 1929, S. 9f. Ders., (FN 16), S. 28. Ders., Das Problem des Parlamentarismus, Wien/Leipzig 1925, S. 7.
Repräsentation und Demokratie
117
Anschein gewahrt bleiben soll, daß im Parlament unverbrüchlich der Gedanke der Freiheit ausgedrückt ist, verfällt man auf die Fiktion der Repräsentation, auf den Gedanken, daß das Parlament nichts anderes ist als ein Repräsentant des Volkes und daß das Volk im Parlament seinen Willen ausdrücken kann, obwohl in allen liberalen Verfassungen das Prinzip des freien Mandats der Repräsentanten anerkannt wird, nach dem diese nicht an Weisungen der Repräsentierten gebunden sind. Diese Unabhängigkeit der Repräsentanten von den Repräsentierten unterscheidet das moderne Parlament von den alten Stände Vertretungen, wo das System des imperativen Mandats herrschte. Die Repräsentation ist demnach eine Fiktion, die den Parlamentarismus unter dem Aspekt der Volkssouveränität legitimieren soll. Der Fiktionscharakter des Repräsentationsgedankens gelangte nicht in den Vordergrund des politischen Bewußtseins, solange die Demokratie sich im Kampf gegen die Autokratie befand und das Parlament sich noch nicht völlig gegenüber dem Monarchen und den Ständen hatte durchsetzen können. Nachdem dieser Triumph aber einmal errungen war, begann man, an der Realisierbarkeit dieser Fiktion zu zweifeln. Es wurde argumentiert, daß der Wille, der im Parlament gebildet wird, nicht der Wille des Volkes sei. Dieses Argument ist nach Kelsen nur dann korrekt, wenn man das Wesen des Parlamentarismus allein auf der Grundlage des Freiheitsgedankens rechtfertigen will und nicht als einen unumgänglichen Kompromiß zwischen Freiheit und Arbeitsteilung. Grundlage dieses Kompromisses ist das Mehrheitsprinzip, gekoppelt mit dem Schutz der Minderheit. Begrifflich bzw. logisch setzt das Mehrheitsprinzip „die Existenzberechtigung einer Minorität" voraus 19 . Der Schutz der Minderheit ist die wesentliche Funktion der Erklärung der Grund- bzw. Menschenrechte, die in den modernen freiheitlich-demokratischen Verfassungen enthalten ist: „Sie bedeutet, daß der Katalog von Grund- und Freiheitsrechten aus einem Schutz des Individuums gegen den Staat zu einem Schutz der Minderheit... gegen die bloß absolute Mehrheit wird. Sie bedeutet, daß Maßnahmen, die in gewisse nationale, religiöse, wirtschaftliche oder allgemein geistige Interessensphären eingreifen, nur im Einverständnis zwischen Majorität und Minorität möglich sind." 2 0
Außerdem gilt: „Worauf es ankommt, ist: daß von der Tendenz, eine Majorität zu bilden . . . die Wirkung ausgeht, daß sich schließlich . . . im wesentlichen nur zwei Gruppen gegenüberstehen, die um die Herrschaft ringen . . . Diese Kraft der sozialen Integration ist es zunächst, die das Majoritätsprinzip soziologisch charakterisiert." 21
19
Ders., (FN 18), S. 31; (FN 16), S. 53. 20 Ders., (FN 16), S. 54. 21 Ders., (FN 16), S. 56.
Ernesto Garzón Valdés
118
W a r für Carl Schmitt der Ersatz der Diskussion durch den verhandelten K o m p r o m i ß eine der Ursachen für die Krise des Parlamentarismus, so ist für Kelsen das Erreichen eines Kompromisses gerade ein wesentliches M e r k m a l der parlamentarischen D e m o k r a t i e : „Daß sich das Majoritätsprinzip gerade innerhalb des parlamentarischen Systems als ein Prinzip des Kompromisses . . . bewährt, das zeigt schon ein flüchtiger Blick auf die parlamentarische Praxis." 22 „Kompromiß bedeutet: Zurückstellen dessen, was die zu Verbindenden trennt, zugunsten dessen, was sie verbindet. Jeder Tausch, jeder Vertrag ist ein Kompromiß, denn Kompromiß bedeutet: sich vertragen." 23 D e r Gedanke der Kelsenschen Toleranz gründet auf einem axiologischen Relativismus, der die M ö g l i c h k e i t bestreitet, absolute ethische oder politische Wahrheiten zu erkennen. D i e O b j e k t i v i t ä t v o n W e r t e n w i r d verneint; j e d e m einzelnen bleibt es überlassen, seine Werteskala subjektiv festzulegen. Für diejenigen, die eine subjektive Auffassung v o n den W e r t e n vertreten, erlaubt nur der tolerante K o m p r o m i ß ein organisiertes Zusammenleben, das die A u t o n o m i e der I n d i v i d u e n nicht völlig aufgibt. Es ist diese auf einem axiologischen Relativismus begründete H a l t u n g der Toleranz, die es erlaubt, die D e m o k r a t i e zu rechtfertigen: „Ausgehend von der Unmöglichkeit, absolute Wahrheit oder absoluten Wert zu erkennen, und daher unfähig, für irgend eine Anschauung alleinige, alle anderen ausschließende, sozusagen diktatorische Geltung zu beanspruchen, sondern stets geneigt, auch die Gegenanschauung zumindest für möglich zu halten, ist der philosophische Relativismus zu jener dialektischen Methode gedrängt, die Meinung und Gegenmeinung allererst sich entfalten lassen muß . . . Ist das aber nicht, im Grunde genommen, die gleiche Methode, wie die des demokratischen Parlamentarismus mit seiner Anerkennung des Minoritätsrechtes und seinem kontradiktorischen, auf die Erzielung eines Kompromisses gerichteten Verfahren?" 24 Das ganze parlamentarische Verfahren ist auf die Suche nach einem M i t t e l weg zwischen den entgegengesetzten Auffassungen v o n M e h r h e i t u n d M i n d e r heit ausgerichtet. „Es schafft Garantien dafür, daß die verschiedenen Interessen der im Parlament vertretenen Gruppen zu Worte kommen, sich als solche in einem öffentlichen Prozeß manifestieren können. Und wenn das spezifisch dialektisch-kontradiktorische Verfahren des Parlaments einen tieferen Sinn hat, so kann es nur der sein, daß aus der Gegenüberstellung von Thesis und Antithesis der politischen Interessen irgendeine Synthesis zustande komme. Das kann aber hier nur heißen: nicht etwa - wie man dem Parlamentarismus, seine Realität mit seiner Ideologie verwechselnd, fälschlich unterstellte: eine »höhere4, absolute Wahrheit, ein über den Gruppeninteressen stehender, absoluter Wert, sondern ein Kompromiß." 2 5 22 23 24
Ders., (FN 16), S. 57. Ders., (FN 18), S. 31; (FN 16), S. 57. Ders. , (FN 18), S. 40f.
Repräsentation und Demokratie
119
Der Kompromißgedanke verstärkt auch die Kelsensche Auffassung vom Mehrheitsprmzi/?, das nicht mit der Mehrheitsherrschaft gleichgesetzt werden darf, wie sie etwa von Auffassungen vertreten wird, die die absolute Herrschaft einer von der Mehrheit der Gesellschaft gebildeten gesellschaftlichen Klasse verfechten. Wenn die Anwendung des Mehrheitsprinzips aber eine gewisse Verständnisgrundlage zwischen Mehrheit und Minderheit voraussetzt, dann erfordert dies allerdings auch einen niedrigen Grad gesellschaftlicher Heterogenität. Für Kelsen ergibt sich die Garantie der gesellschaftlichen Homogenität aus der Kultur- und Sprachgemeinschaft. Diesbezüglich ist der Hinweis interessant, daß diese beiden Elemente auch in der Kantischen Auffassung die unerläßliche Grundlage für die nationalen Einheiten als die Akteure des internationalen Systems waren. Die vom Marxismus als schweres Hindernis für die repräsentative Demokratie angesehenen sozio-ökonomischen Unterschiede werden von Kelsen in den Hintergrund gestellt. Selbst bei Vorliegen solcher Unterschiede bleibt für Kelsen die Demokratie der einzig mögliche Weg, um die Gefahr der Diktatur zu überwinden: „Und wenn es, wie gerade die marxistische Kritik der sog. bürgerlichen Demokratie mit Nachdruck betont, auf die tatsächlichen sozialen Machtverhältnisse ankommt, dann ist die parlamentarisch demokratische Staatsform mit ihrem eine wesentliche Zweigliederung konstituierenden Majoritäts-Minoritätsprinzip der ,wahre' Ausdruck der heutigen wesentlich in zwei Klassen gespaltenen Gesellschaft. Und wenn es überhaupt eine Form gibt, die die Möglichkeit bietet, diesen gewaltigen Gegensatz, den man bedauern, aber nicht leugnen kann, nicht auf blutig-revolutionärem Wege zur Katastrophe zu treiben, sondern friedlich und allmählich auszugleichen, so ist es die Form der parlamentarischen Demokratie .. . " 2 6
Das Vertrauen Kelsens in die Möglichkeit, in einer von schweren sozio-ökonomischen Unterschieden gespaltenen Gesellschaft eine Klassendiktatur, wie sie vom Marxismus vorgeschlagen wurde, oder eine „Führer"-Diktatur, wie sie Carl Schmitt befürwortete, zu vermeiden, wurde von einem anderen großen Verfechter der parlamentarischen Demokratie, nämlich von Hermann Heller, bezweifelt, der sich gerade zur Überwindung gesellschaftlicher Heterogenität für die Schaffung eines sozialen Rechtsstaates einsetzte. Seine Haltung muß aber im vorliegenden Zusammenhang nicht behandelt werden. Ich möchte stattdessen die Unterschiede zwischen der Position von Burke und Schmitt und der von Kelsen hervorheben. Es sind offenbar zumindest die folgenden: 1. Während es für Burke-Schmitt absolute Wahrheiten im Bereich der Ethik und der Politik gibt, läßt sich für Kelsen nur der axiologische Relativismus rational vertreten. 25 Ders (FN 16), S. 58. 26 Ders., (FN 16), S. 68.
120
E e s t o Garzón Valdés
2. Der Kern der parlamentarischen Aktivitäten besteht für Kelsen in Verhandlung und Kompromiß, also gerade in dem, was Schmitt für eine entartete Form der Diskussion hält. 3. Anders als bei Burke und Schmitt ist für Kelsen gesellschaftliche Heterogenität kein Faktum, das die Realisierbarkeit der repräsentativen Demokratie gefährden könnte, die sich für ihn gerade in solchen Fällen als zweckmäßigstes Instrument zur Bewahrung des sozialen Friedens erweist. Dies scheinen die bedeutendsten Unterschiede zu sein, die - nimmt man sie wörtlich - die beiden Positionen unvereinbar machen. Betrachtet man die Dinge jedoch etwas genauer, dann läßt sich Kelsen auf eine Weise lesen, die ihm viel von seinem radikalen Relativismus nimmt. Ausgangspunkt für seine Verteidigung des demokratischen Parlamentarismus ist nämlich die Anerkennung zweier Grundwerte: Freiheit und Gleichheit. Dies erklärt den Rückgriff Kelsens auf die Idee eines hypothetischen, einstimmig angenommenen Gesellschaftsvertrages und auf das Mehrheitsprinzip in Verbindung mit der Respektierung der Minderheit. Kelsen verteidigt zwar eine formale Demokratieauffassung. Man muß sich aber fragen, inwieweit eine Demokratie rein formal ist, die auf der Einhaltung der Grund- bzw. Menschenrechte als Garantie für die Existenz der Minderheit beruht. Diese Garantie hängt, wie wir gesehen haben, logisch mit dem Mehrheitsprinzip zusammen, das seinerseits die größtmögliche Annäherung an das Ideal der Freiheit ist, verstanden als Gehorsam nur gegenüber den Gesetzen, die sich jeder selbst geben würde. Unter diesem Gesichtspunkt ist das Mehrheitsprinzip kein inhaltlich leeres Verfahren, das ein politisches System unabhängig von den Ergebnissen legitimiert, die damit erzielt werden. Würde man dies bei Kelsen annehmen, so würde man ihn damit in die Reihen derer einordnen, die - wie Niklas Luhmann - behaupten, daß die bloße Existenz eines bestimmten Verfahrens schon notwendige und hinreichende Bedingung für die Legitimität eines politischen Systems sei. Kelsen betont, daß Verhandlungen das Wesen der parlamentarischen Tätigkeit ausmachen. Es geht aber um Verhandlungen im Rahmen des Toleranzgedankens, des gegenseitigen Sichvertragens, das begrifflich mit dem Vertragsgedanken zusammenhängt, also mit der Idee der hypothetischen einstimmigen Annahme einer Staatsform, die die Anarchie überwindet, ohne die individuelle Autonomie aufzuheben. In diesem Sinne ist zwar die Verhandlung das wesentliche Element der parlamentarischen Aktivität, es scheinen aber - wiederum nach Kelsen - Dinge wie die Autonomie der Individuen nicht verhandlungsfähig zu sein. Würde man die Schranke dessen, was nicht verhandlungsfähig ist, ausschalten und auf der bedingungslosen Gleichsetzung aller moralischen Überzeugungen beharren, wie ließe sich dann der Hinweis Kelsens auf die „Existenzberechtigung einer Minorität" verstehen, die die „Möglichkeit
Repräsentation und Demokratie
121
des Schutzes der Minorität gegenüber der Majorität" eröffnet 27 , sowie die Tatsache, daß er die „wesentliche Funktion" der Menschenrechte im Schutz der Minderheit vor der Mehrheit sieht? Es ist gerade das Mehrheitsprinzip, das nach Kelsen die Herrschaft einer Klasse über eine andere verhindert, also die Mehrheitsherrschaft oder den „Zufall der Arithmetik" 2 8 . Die Kelsensche Argumentation richtet sich gerade gegen die Gleichsetzung von „Mehrheitsprinzip" und „Mehrheitsherrschaft". Folglich ist auch die Feststellung, daß das Mehrheitsprinzip die Existenz einer Minderheit voraussetzt, mehr als eine bloße Tautologie in dem Sinne, daß man von einer Mehrheit ohne die Existenz einer Minderheit nicht sprechen kann. Das Vertrauen Kelsens in die Realisierbarkeit des demokratischen Parlamentarismus trotz sozio-ökonomischer Heterogenität der jeweiligen Gesellschaft läßt sich auch bezweifeln, ohne daß man dafür die Vorteile der parlamentarischen Repräsentation bestreiten müßte. A n dieser Stelle scheint es angebracht, sich mit der Frage zu beschäftigen, worin eigentlich die ethisch-politische Rechtfertigung der demokratisch-parlamentarischen Repräsentation besteht. Dies führt uns zu der dritten der Fragen, deren Behandlung ich angekündigt hatte. III. Das Problem der ethischen Rechtfertigung der parlamentarischen Repräsentation läßt sich in drei Hauptfragen zusammenfassen. 1. Welche Beziehung soll zwischen Repräsentierten und Repräsentanten bestehen? 2. Darf jede Art von Fragen der parlamentarischen Diskussion anheimgestellt werden? 3. Gibt es einen Mindestrahmen, dessen Einhaltung bei der parlamentarischen Verhandlung und beim Kompromiß ethisch geboten ist? Der erste Punkt hängt mit der Beziehung zwischen Wünschen und Interessen (Burke) bzw. zwischen Autonomie und Regierung (Kelsen) zusammen. Der zweite bezieht sich auf die Existenz oder Nichtexistenz politischer Wahrheiten (Burke - Schmitt) bzw. auf die mögliche Beschränkung der diskutierund verhandelbaren Inhalte (Kelsen). Der dritte geht auf die Voraussetzung der Homogenität ein (Burke - Schmitt). 1. Auf die erste Frage haben zwei unterschiedliche theoretische Ansätze zu antworten versucht. Nach der ersten, der Delegations- oder Mandats-Theorie, 27 28
Ders., (FN 18), S. 31; (FN 16), S. 53.
Ders., (FN 16), S. 55; dies ist eine Wendung, die an das Urteil von Jorge Luis Borges erinnert, die Demokratie sei „ein auf Statistik gegründeter Aberglaube".
122
Ernesto Garzón Valdés
soll der Repräsentant das tun, was der Repräsentierte will. Nach der zweiten, der Theorie der Unabhängigkeit des Repräsentanten, soll er das tun, was dem Interesse des Repräsentierten entspricht, unabhängig von dessen augenblicklichen Wünschen. Die erste Theorie geht nicht nur von einer logischen Beziehung zwischen Wunsch und Interesse aus, sondern auch davon, daß hinsichtlich dessen, was den eigenen Interessen nutzt oder schadet, niemand ein besserer Richter ist als der Betroffene selbst. Dies ist die Position von John Stuart Mill, der bemerkte, daß bezüglich der eigenen Interessen "the most ordinary man or woman has means of knowledge immeasurably surpassing those that can be possessed by anyone else." 29
A n anderer Stelle 30 habe ich diese radikale These Mills gegen jede Form des Rechtspaternalismus behandelt und zu zeigen versucht, daß sie als allgemeine Aussage falsch ist. Die damals angeführten Argumente will ich hier nicht wiederholen, sondern nur daran erinnern, daß die Bestimmung der Interessen einer Person unter gegebenen Umständen bzw. im Hinblick auf eine bestimmte Politik die Kenntnis der für den Fall relevanten Fakten sowie die Konsistenz der angestrebten Ziele und die nötigen Mittel zu ihrer Verfolgung voraussetzt. Burke zog die Beziehung zwischen der Befriedigung dessen, was die Leute wollen, und der Förderung ihrer Interessen ganz grundlegend in Zweifel. Wie wir gesehen haben, unterschied er daher zwischen Meinung und Wissen um die politische Wahrheit, die er mit der Befriedigung der Interessen der Gemeinschaft gleichsetzte. Man könnte jedoch darauf bestehen, daß es zweckmäßig sei, eine notwendige Beziehung zwischen dem, was der Repräsentierte will, und dem Verhalten des Repräsentanten beizubehalten. Wenn die Grundlage für die Rechtfertigung des Staates im allgemeinen und der parlamentarischen Repräsentation im besonderen in der Zustimmung besteht, die jedes Individuum diesen Institutionen entgegenbringt, dann darf der Repräsentant die Wünsche der von ihm Repräsentierten nicht ignorieren, da sich ja die Autonomie des Individuums gerade in dem ausdrückt, was es will oder nicht will. Sieht man einmal von Fällen ab, in denen die Repräsentierten basisinkompetent sind - so daß der Rechtspaternalismus gerechtfertigt wäre - , dann muß man, so könnte diese Position einwenden, schließen, daß der Repräsentant ethisch verpflichtet ist, gemäß den Wünschen der von ihm Repräsentierten zu handeln. Dem könnte man wiederum entgegnen, daß zwar das Argument korrekt ist, daß aber die faktische Prämisse der Basiskompetenz der Repräsentierten im allgemeinen falsch ist, da diese in der Regel keine Kenntnis von vielen rele29
John Stuart Mill, On Liberty, Glasgow 1978, S. 207. Ernesto Garzón Valdés, Kann Rechtspaternalismus ethisch gerechtfertigt werden?, in: RECHTSTHEORIE 18 (1987), S. 273 - 290. 30
Repräsentation und Demokratie
123
vanten Fakten besitzen, über die nur der Repräsentant informiert ist. Daher sind die Vorschläge der Repräsentierten im allgemeinen nichts als Meinungen, wie Burke sagen würde. Ihre bedingungslose Übernahme könnte zu einem dem gewünschten entgegengesetzten Ergebnis führen. Akzeptiert man dieses Argument, dann könnte man schließen, daß gute Repräsentation eine solche ist, die sich nicht an den Wünschen, sondern an den Interessen der Repräsentierten orientiert. Die Zustimmung der Repräsentierten kann den Akten der Repräsentanten nur dann Legitimität verleihen, wenn jene über genügend Informationen verfügen und wenn sie bereit sind, bezüglich der von ihnen vorgeschlagenen Maßnahmen nicht nur Kriterien der Rationalität, sondern auch der Vernünftigkeit zu akzeptieren. Relevant wäre also nicht die faktische Zustimmung, sondern eine hypothetische, die nämlich die Repräsentierten geben würden, wenn sie über alle für den Fall relevanten Informationen verfügen und an der parlamentarischen Diskussion teilnehmen könnten. Dies ist das starke Argument derer, die das Prinzip der Freiheit des Repräsentanten beim Versuch der Befriedigung der wahren Interessen der Repräsentierten vertreten. Für diese Position spricht ihr unbestreitbarer Realismus hinsichtlich der Beziehung zwischen den Wünschen unzureichend informierter Individuen, wie sie in komplexen modernen Gesellschaften anzutreffen sind, und der tatsächlichen Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Sie öffnet jedoch Tür und Tor für einen nicht zu rechtfertigenden Rechtspaternalismus, der unter dem Vorwand, die Interessen der Leute immer besser zu kennen als die Betroffenen selbst, leicht zu ständiger Einmischung in die individuellen Lebenspläne degenerieren kann, wodurch die Autonomie des Individuums verletzt würde. Die Probleme, die diese beiden extremen Positionen mit sich bringen, lassen es geraten scheinen, nach einem Mittelweg zu suchen. Ich werde darauf noch zurückkommen. Zuvor möchte ich aber auf die zweite der erwähnten Fragen eingehen, nämlich darauf, ob jede Art von Fragen der parlamentarischen Diskussion unterworfen werden darf. 2. Unabhängig davon, ob nun die Meinung vertreten wird, die parlamentarische Diskussion sei das zweckmäßige Mittel, um die politische Wahrheit zu finden (Burke), oder daß Verhandlung und Kompromiß die bestmögliche Annäherung an das Ideal der Freiheit und Gleichheit darstellen (Kelsen), scheint es auf den ersten Blick nicht so auszusehen, als gäbe es Fragen, die prinzipiell von der parlamentarischen Debatte auszuschließen sind. Diese unbeschränkte Öffnung wird jedoch tatsächlich weder von Burke noch von Kelsen vertreten. Bei Burke wird eine Grenze durch die Voraussetzung der Gewährleistung des bürgerlichen Eigentums gesetzt. Zudem dürfen nur solche Maßnahmen getroffen werden, die „wahr" sind, das heißt, die das Interesse der Gesamtheit befriedigen. Bei Kelsen wird die Anwendung des Mehrheitsprinzips durch die Achtung der Rechte der Minderheit einge-
124
Ernesto Garzón Valdés
schränkt, die er bezeichnenderweise Grund- oder Menschenrechte nennt. Diskussions- und Verhandlungssituationen erinnern an die von Ökonomen beschriebenen Marktsituationen, bei denen die Individuen die subjektiven Präferenzen Dritter berücksichtigen und auf der Grundlage der unterschiedlichen Kosten über die Handlungen entscheiden, die sie ausführen wollen. Aber auch in Marktbeziehungen existiert Konsens in dem Sinne, daß sie nur dann funktionieren können, wenn man zuerst die Respektierung bestimmter Grundwerte wie Individualität und Wahlfreiheit sichert. Aber nicht nur das: Wer das Marktmodell und die damit implizierte Vorstellung von Verhandlung und Kompromiß vertritt, der gibt damit zu, daß notwendigerweise jene Güter aus dem freien Spiel des Marktes ausgenommen werden müssen, die als fundamental für die Verwirklichung eines jeden Lebensplans anzusehen sind. In diesem Sinne scheint der Ausschluß einiger grundlegender Themen aus der parlamentarischen Verhandlung bzw. aus dem Rahmen des Marktes ethisch geboten zu sein. Bezüglich der Frage, welches diese Themen sein sollten und was das Kriterium für den Ausschluß ist, mache ich folgenden Vorschlag: a) Aus der Verhandlung und dem parlamentarischen Kompromiß sind alle jene Güter auszuschließen, die als unverzichtbar für die Verwirklichung jeden Lebensplanes anzusehen sind. b) Die Bestimmung des Ausschlußbereichs darf weder dem faktischen Konsens der Repräsentierten noch dem der Repräsentanten überlassen bleiben. Der faktische Konsens kann nur den Bereich der positiven Moral eines bestimmten Kollektivs in einem bestimmten Augenblick seiner Geschichte bestimmen. Aus der Tatsache, daß die Mitglieder eines Kollektivs in der Einschätzung bestimmter Verhaltensrichtlinien übereinstimmen, folgt nicht ohne weiteres, daß diese auch vom Standpunkt einer aufgeklärten Moral, also einer Ethik, erlaubt sind. Die rationale Begründung moralischer Normen erfordert den Rückgriff auf das künstliche Gebilde hypothetischer Situationen, in denen Rahmenbedingungen wie Unparteilichkeit und Universalität akzeptiert werden. c) Für die Geltung der Rechte innerhalb des „Sperrbezirks" der Grundgüter sind Wille und Wünsche der Mitglieder der Gemeinschaft unerheblich. In diesem Bereich ist eine paternalistische Haltung voll und ganz gerechtfertigt, falls die Mitglieder der Gemeinschaft die Bedeutung dieser Grundgüter nicht begreifen. Dies ist so, weil es ein deutliches Anzeichen von Irrationalität oder von Unkenntnis über grundlegende kausale Beziehungen - wie etwa derjenigen zwischen der Verfügbarkeit solcher Güter und der Realisierbarkeit jeglichen Lebensplans - ist, wenn die Gewährleistung der eigenen Grundgüter nicht akzeptiert wird. In beiden Fällen - Irrationalität oder Ignoranz - ist derjenige, der die Bedeutung der Grundgüter nicht begreift, als basisinkompetent aufzufassen.
Repräsentation und Demokratie
125
d) Akzeptiert man das in Abschnitt c) Gesagte, dann muß man auch akzeptieren, daß für den, der die Verfügbarkeit der Grundgüter verteidigt, nicht das „Prinzip der Nichtdiktatur" gilt, wie es von Kenneth J. Arrow formuliert wurde: „There is no individual whose preferences are automatically society's preferences independent of the preferences of all the other individuals" 31 . Meines Erachtens konnte beispielsweise jeder, der sich im Deutschland der Nazizeit gegen die Ziele Hitlers stellte, für sich unbestreitbar eine ethische Rechtfertigung in Anspruch nehmen, die die Mehrheitsmeinung nicht besaß, und er war sogar ethisch dazu berechtigt, seine Position gegen die Position der Mehrheit durchzusetzen 32. Daß man in solchen Fällen vom Prinzip der Nichtdiktatur im Sinne Arrows abgeht, liefert gerade den Ausgangspunkt für den Kampf gegen Diktaturen wie die faschistischen oder alle jene, in denen - um mit Kelsen zu sprechen - das Mehrheitsprinzip durch die Mehrheitsherrschaft verdrängt wurde. e) Gibt man, wie ich es für richtig halte, zu, daß die Ethik eine Tendenz zur Ausweitung ihrer Forderungen besitzt, dann ist es nicht allzu gewagt zu behaupten, daß auch der Sperrbezirk der Grundgüter eine Tendenz zur Ausdehnung hat. Dies kann durch zwei Arten von Faktoren bedingt sein: 1) Faktoren kognitiver Art, also die Einsicht, daß aus den Prämissen des ethischen Systems bisher nicht erkannte Schlüsse gezogen werden können. Dies scheint der Fall zu sein, wenn man etwa von verschiedenen Generationen von Menschenrechten spricht. Es geht dabei nicht um die Aufnahme neuer Prämissen, sondern allein neuer Schlußfolgerungen, die sich aus schon anerkannten Prämissen ableiten lassen. Man braucht beispielsweise nur an die Beziehung zwischen dem Recht auf Leben (einem Menschenrecht der sogenannten „ersten Generation") und dem Recht auf eine nicht verschmutzte Umwelt (ein Recht der „dritten Generation") zu denken oder an die Beziehung zwischen der negativen Pflicht, niemanden zu schädigen, und der positiven Pflicht, Hilfe zu leisten, wenn dadurch Schaden verhindert werden kann. 2) Es gibt aber auch materielle Faktoren, nämlich die Verfügbarkeit von wirtschaftlichen, technischen oder kulturellen Ressourcen, die eine Verschiebung der Grenzen des Sperrbezirks erforderlich machen können. f) Berücksichtigt man drese Einschränkungen, dann erstreckt sich der Handlungsbereich des Repräsentanten einerseits auf die Sicherung der tatsächlichen Verfügbarkeit von Grundgütern. Es handelt sich dabei also um die Verteidigung der Primärgüter (Rawls) bzw. der verallgemeinerungsfähigen Interessen (Habermas). Er umfaßt aber auch den Bereich von Verhandlung und Kompromiß, also den Bereich, den man nach einem Vorschlag von 31 Kenneth J. Arrow, Values and Collective Decision-Making, in: P. Laslett / W.G. Runciman (Hrsg.), Philosophy, Politics and Society, Third Series, Oxford 1967, S. 226. 32 Vgl. dazu Otfried Höffe, Entscheidungstheoretische Denkfiguren und die Begründung von Recht, in: Argumentation und Recht, ARSP Beiheft 14, 1980.
126
E e s t o Garzón Valdés
James O. Grunebaum 33 den Bereich der sekundären Wünsche der Menschen nennen kann, eben der Wünsche, die nichts mit Primärgütern zu tun haben. Hier gilt das Prinzip, daß die Wünsche der Repräsentierten zu respektieren sind, allerdings mit einem Proviso, das ich folgendermaßen formulieren würde: Die sekundären Wünsche der Repräsentierten sollen erfüllt werden, vorausgesetzt, daß - nach den Informationen, über die der Repräsentant verfügt - ihre Befriedigung nicht verlangt, daß ein Grundgut geopfert wird oder daß sekundäre Wünsche unerfüllt bleiben, die von den Repräsentierten höher geschätzt werden als der sekundäre Wunsch, um dessen Erfüllung es geht.
Man nehme zum Beispiel an, die Erfüllung des sekundären Wunsches W i Errichtung einer Fabrik an einem bestimmten Ort - führt zu einer derartigen Umweltverschmutzung, daß das Grundgut der Gesundheit der Anrainer gefährdet wird, oder ein Koalitionspartner der Partei, die den Bau vorschlägt, ist dagegen - auch ohne daß die Fabrik umweltverschmutzend ist - und droht damit, die Koalition zu kündigen, was die Nichterfüllung eines anderen, höher als W i eingeschätzten, sekundären Wunsches W 2 der Mitglieder derjenigen Partei, die den Fabrikbau betreibt, zur Folge hätte, nämlich des Wunsches, an der Regierung zu bleiben. In beiden Fällen würde sich aufgrund des Provisos ein Beharren auf dem Bauprojekt verbieten. Der Bereich von Verhandlung und Kompromiß ist der angemessene Bereich für die Verfolgung sekundärer Interessen auf der Grundlage von Kosten-Nutzen-Abschätzungen. Der Repräsentant unterliegt hier der ethischen Verpflichtung, die größtmögliche Befriedigung der sekundären Wünsche der von ihm Repräsentierten - innerhalb der aufgezeigten Grenzen - zu betreiben. Seine Verhandlungs- und Kompromißstrategie muß sich dabei an den Gründen orientieren, die einen klugen Menschen auszeichnen. Das heißt mit den Worten von David P. Gauthier: "He is willing to temper his single-minded pursuit of advantage only by accepting the obligation to adhere to prudentially undertaken commitments. He has no real concern for the advantage of others, which would lead him to modify his pursuit of advantage when it conflicted with the similar pursuits of others. Unless he expects to gain, he is unwilling to accept restrictions on the pursuit of advantage which are intended to equalize the opportunities open to all. In other words, he has no concern with fairness." 34
Aber selbst wenn man zugesteht, daß der Bereich von Verhandlung und Kompromiß Klugheitsüberlegungen und Kosten-Nutzen-Kalkulationen unterliegt, bleibt doch immer noch die Frage offen, ob nicht auch diesem Bereich 33 James O. Grunebaum , What Ought the Representative Represent?, in: Norman E. Bowie (Hrsg.), Ethical Issues in Government, Philadelphia 1981. 34 David P. Gauthier, Morality and Advantage, in: Joseph Raz (Hrsg.), Practical Reasoning, Oxford 1978, S. 196.
Repräsentation und Demokratie
127
der Klugheit eine Grenze gesetzt werden muß, die auf der Basis ethischer Überlegungen festzulegen ist. Damit komme ich zu der dritten Frage, die ich behandeln wollte. 3. Da der Bereich von Verhandlung und Kompromiß große Ähnlichkeit mit dem des Marktes aufweist, können meines Erachtens hier die Überlegungen der Wirtschaftswissenschaftler sowie derjenigen Rechtswissenschaftler von Interesse sein, die bei der Behandlung dieses Themas die Überlegungen der ersteren aufgenommen haben. Selbst so liberale Ökonomen wie James Buchanan sind der Ansicht, daß Verhandlungen innerhalb des Marktes nur sinnvoll sind, wenn die daran Beteiligten zumindest die Hoffnung auf Erfolg besitzen: "'Hope' is an extremely important component of any social order that lays claim to being 'just'." 3 5
Dabei geht es hier aber nicht um die Möglichkeit des Erfolges aufgrund von Faktoren wie Glück oder Eigenanstrengung, sondern um die Erfolgschancen aufgrund gleicher Rechte, mit denen die Individuen in das „Spiel" der Marktverhandlungen eintreten: "Few persons could say that the economic game is intrinsically unfair just because some persons are lucky or because some persons make better choices or because some persons exert more effort than others. Unfairness in the economic game described by the operation of market institutions ... tends to be attributed to the distribution of endowments with which persons enter the game in the first place, before choices are made, before luck rolls the economic dice, before effort is exerted." 36
Hermann Heller, der die Erfordernis gesellschaftlicher Homogenität als notwendige Bedingung für das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie hervorhob, unterstrich ebenfalls die Bedeutung der Hoffnung auf die Möglichkeit erfolgreicher Verhandlungen für alle Beteiligten: „Erst wenn das Proletariat zu dem Glauben gelangt, daß die demokratische Gleichberechtigung seines übermächtigen Gegners den Klassenkampf in demokratischen Formen zur Aussichtslosigkeit verdammt, erst in diesem Augenblick wird es zur Diktatur greifen." 37
Das mangelnde Vertrauen des Proletariats in die demokratischen Spielregeln war nach Heller das Ergebnis sozialer Ungleichheit, die summum ius in summa iniuria verwandelte. Auch Jürgen Habermas 38 erkennt im Zusammenhang mit seiner Unterscheidung zwischen verallgemeinerungsfähigen (also mit Hilfe des Diskurses 35
James M. Buchanan, Liberty, Market and State, Oxford 1986, S. 135f. 6 Ders., (FN 35), S. 129f. 37 Hermann Heller, Gesammelte Schriften, Leiden 1971, I I , S. 430. 38 Jürgen Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, Frankfurt a.M. 1977. 3
128
Ernesto Garzón Valdés
ethisch zu rechtfertigenden) und nicht verallgemeinerungsfähigen bzw. partikularen Interessen einen Weg für die indirekte ethische Rechtfertigung der letzteren an, nämlich den Kompromiß: „Einen normierten Ausgleich zwischen partikularen Interessen nennen wir dann, wenn er unter Bedingungen eines Machtgleichgewichts zwischen den beteiligten Parteien zustande kommt, einen Kompromiß." 3 9
Ist die Bedingung des Machtgleichgewichts nicht erfüllt, dann ist die Einigung unter den Betroffenen - mit den Worten von Habermas - nur ein Scheinkompromiß oder eine „ideologische Form der Rechtfertigung" 40 , die zu einem allein auf Gewalt beruhenden normativen System führt. Verhandlung und Kompromiß erfordern daher die annähernde Gleichheit der Beteiligten hinsichtlich ihrer politischen und rechtlichen Ressourcen. In diesem Sinne setzen parlamentarische Verhandlungen, um ethisch akzeptabel zu sein, eine gewisse Homogenität voraus, die es erlaubt, die Hoffnung auf Erfolg zu wecken, von der Buchanan und Heller sprachen. Dann ist es aber auch notwendig, daß man über ein Kriterium verfügt, das es erlaubt festzustellen, wann eine Gesellschaft homogen genug ist, damit ein Kompromiß fair sein kann und damit alle gesellschaftlichen Gruppen den Eindruck gewinnen können, durch die Tätigkeit des Parlaments integriert zu werden. Mein Vorschlag für ein solches Kriterium wäre der folgende: Eine Gesellschaft ist homogen, wenn alle ihre Mitglieder die Rechte genießen, die zum Sperrbezirk der Grundgüter gehören.
Ist dies nicht der Fall, dann wird das Mehrheitsprinzip zur Mehrheitsherrschaft (Kelsen) bzw. zu einer ideologischen Form der Rechtfertigung normativer Macht (Habermas). Schon im 19. Jahrhundert sagte Abraham Lincoln: " I f by the mere force of numbers a majority should deprive a minority of any clearly written constitutional right, it might in a moral point of view justify revolution." 41
Ähnliche Argumente wurden auch im 20. Jahrhundert benutzt, um Phänomene wie etwa den zivilen Ungehorsam ethisch, politisch und juristisch zu rechtfertigen. Daß ein Mindestmaß an Homogenität erforderlich ist, wird offensichtlich, wenn man daran denkt, daß die durch die Arbeitsteilung erzwungene parlamentarische Repräsentation die einzig mögliche Form der Demokratie in den heutigen Gesellschaften ist und daß diese auch der beste Kandidat für die ethische Rechtfertigung ist, sofern sie sich nicht auf die bloße Anwendung eines 39 Ders., (FN 38), S. 154. 40 Ders., (FN 38), S. 155. 41 Abraham Lincoln, First Inaugural Address.
Repräsentation und Demokratie
129
Verfahrens beschränkt, sondern auch den normativen Inhalt der Respektierung von Freiheit und Gleichheit umfaßt. Gerade dies erlaubt es Kelsen, für seine Argumentation zur Rechtfertigung der Demokratie die natürliche Freiheit und ihre vertragliche Umwandlung in politische Freiheit zum Ausgangspunkt zu machen. Dieser Gedanke war nicht nur von Kant, sondern auch von Rousseau vertreten worden: „Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle . . . ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile . . . On pourrait sur ce qui précède ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté moral, qui seule rend l'homme vraiment maître de l u i . " 4 2
Auch bei Burke gab es die Idee der Homogenität, aber er beschränkte sie auf die öffentliche Meinung der 400000 britischen Wähler. Carl Schmitt seinerseits verwandelte die Forderung nach Homogenität in die nach der Gemeinschaft von Blut und Boden und sah deren höchsten Ausdruck in der Identität mit dem „Führer". Kelsen führte die Beschränkung der Rechte der Mehrheit als begriffliche Erfordernis des Prinzips der parlamentarischen Verhandlung ein. Und obwohl er nicht explizit auf Homogenität bestand, zielte er mit seiner Verteidigung der Grundrechte doch auch auf die Schaffung von Verhandlungsbedingungen ab, die den hier vorgeschlagenen ähneln. So komme ich mit einer vielleicht banalen Schlußfolgerung zum Ende: Die parlamentarische Repräsentation läßt sich ethisch rechtfertigen, wenn sie die Geltung des Rechts jedes einzelnen auf die primären Güter respektiert und wenn sie sich bemüht, durch Kompromisse die Erfüllung der sekundären Wünsche der Mitglieder der politischen Gemeinschaft zu erreichen. Vielleicht war jedoch der Umweg über die Analyse der Argumente von Burke, Schmitt und Kelsen notwendig, um diese offenkundige Wahrheit deutlich zu machen, die leider in großen Teilen der heutigen Welt weit davon entfernt ist, eine gelebte Banalität zu sein. Vom rechtspositivistischen Standpunkt aus ist die ebenfalls evidente Schlußfolgerung, daß die Rechte, die zum Sperrbezirk der verallgemeinerungsfähigen Interessen bzw. der Menschenrechte gehören, nicht der Beschneidung infolge parlamentarischer Verhandlungen unterliegen dürfen. Sie bilden vielmehr den nicht verhandlungsfähigen Kern einer freiheitlich-demokratischen Verfassung, die den sozialen Rechtsstaat ermöglicht. Für den Sperrbezirk gilt das Änderungsverbot (wie es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland durch Artikel 79 (3) festgeschrieben ist) sowie das Gebot, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um seine volle Geltung zu gewährleisten. Für das hier Gesagte wird nicht der Anspruch erhoben, daß damit die Problematik der parlamentarischen Repräsentation hinsichtlich möglicher Konfliktsituationen im Zusammenhang mit der vollen Gewährleistung der primä42
Jean-Jacques Rousseau, Oeuvres complètes, Paris 1964, I I I , S. 364f.
9 Festgabe Opatek
130
Ernesto Garzón Valdés
ren Güter erschöpfend behandelt wäre. Es sind zumindest zwei mögliche Konfliktquellen denkbar: 1) daß die gleichzeitige Befriedigung zweier Grundgüter nicht möglich ist oder 2) daß ein Grundgut nicht befriedigt werden kann, weil die Ressourcen dazu fehlen. Im ersten Fall werden die Entscheidungen, die von den Repräsentanten diesbezüglich getroffen werden, vielleicht dahin gehen, daß das größte Übel verhindert wird. Sieht man den Ausdruck „Kompromiß" als einen Terminus technicus an, der im Falle verallgemeinerungsfähiger Interessen (zu denen die primären Güter gehören) nicht sinnvoll ist, dann kann man dabei strenggenommen nicht von einem Kompromiß sprechen, sondern vielmehr von einer Entscheidung unter Bedingungen, die denen einer „tragic choice" entsprechen. Im zweiten Fall ist, sofern man das Kantische Prinzip akzeptiert, nach dem Sollen Können impliziert, die ethische Pflicht solange außer Kraft gesetzt, bis die notwendigen Bedingungen für ihre Erfüllbarkeit vorliegen. Wichtig ist aber, daß diejenigen, die sich auf eine Situation der „tragic choice" oder auf einen Mangel an Ressourcen berufen, die Beweislast tragen, daß sie also ihre Behauptung empirisch zu belegen haben. Diese Auflage ist angesichts der Neigung vieler Politiker, die unvollständige Geltung von Rechten aus dem Sperrbezirk mit dem Argument der „tragic choice" oder des Ressourcenmangels zu rechtfertigen, keineswegs trivial. Es könnte natürlich auch einer einwenden, daß diese Anforderung wohl allzu anspruchsvoll ist, da sie nur von wenigen politischen Regimen erfüllt wird. Letzteres ist sicher richtig; das Argument an sich entspricht aber eher der Feststellung, daß die Ethik dem individuellen Verhalten strenge Bedingungen auferlegt, die nur von wenigen Personen voll erfüllt werden. Auf dieses „Argument" läßt sich nur entgegnen: „ U m so schlimmer!"
Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit Von Hermann Klenner, Berlin "The lion called the sheep, to ask her if his breath smelt; she said, aye; he bit off her head for a fool. He called the wolf and asked him; he said no; he tore him in pieces for a flatterer. A t last, he called the fox and asked him; truly, he had got a cold and could not smell. Wise man say nothing in dangerous times." 1 Soweit John Seiden (1584 - 1654), der bedeutende Erastianische Jurist, Gegner auch von Grotius (1583 - 1645), jahrelang Eingekerkerter zweier Stuart-Könige und jahrzehntelang guter Freund von Thomas Hobbes (1588 - 1679). Aber auch der war nicht weise. Er ließ zu Beginn der großen Auseinandersetzungen zwischen Parlament und Krone - er wäre übrigens beinahe für das Kurze Parlament nominiert worden - seine „Elements of Law, Natural and Politic" in Abschriften kursieren; als politischer Emigrant publizierte er nach King Charles I. öffentlicher Hinrichtung von Paris aus binnen Jahresfrist vier seiner Werke in London, darunter den „Leviathan", alles zu einem Zeitpunkt, da er, der gewesene Mathematiklehrer von Prinz Charles, die Rückkehr in seine Heimat vorbereitete. Er schrieb als Achtzigjähriger „Behemoth", eine Geschichte der englischen Revolution, auch wenn er für sie wie für alle anderen in seiner Muttersprache geschriebenen Werke politischen Inhalts keine Druckerlaubnis erhielt. Und dabei war doch dieser Thomas Hobbes bloß ein kluger Analytiker (und kein Kritiker) des Rechts, den heutige Analytical Jurisprudence mit Fug und Recht als ihren großen Ahnherrn betrachtet oder jedenfalls betrachten könnte, wie es Jeremy Bentham und John Austin auch getan haben. In seinem großen Dialog zwischen einem Philosophen und einem Jurisprudenzbeflissenen bekennt Hobbes unmißverständlich: I read them [the statutes] not to dispute, but to obey them [...] It is not wisdom, but authority that makes a Law [ . . . ] Statutes are not philosophy, but Commands or prohibitions which ought to be obeyed2. Es mag verwundern, daß der Autor solch einer, wie es
1
John Seiden, Table Talk, London 1927, S. 139f. H D 54, 55, 69. - Hobbes' Publikationen werden innerhalb des Textes gemäß folgender Siglen zitiert: H B Behemoth [1668], London 1969. HC De Cive [1642], Oxford 1983. H D A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England [1681], Chicago/London 1971. 2
9*
132
Hermann Klenner
den Anschein hat, Ergebenheitsphilosophie gegenüber dem geltenden, dem jeweils herrschenden Recht sich zu keiner Zeit seines literarischen Lebens - er hat seine epochalen Werke zwischen seinem fünfzigsten und achtzigsten Lebensjahr entwickelt - der Hochachtung der Herrschenden seiner Zeit und seines Landes sicher sein konnte. Dies zur Kenntnis zu nehmen, mag für meinen großen Kollegen Kazimierz Opatek, dessen bewundernswerte Beiträge zu einer Analyse von Rechtsnormen ein unverzichtbarer Baustein gegenwärtiger, international relevanter Rechtstheorie sind, einen gewissen Trost darstellen, was immer für Konsequenzen er daraus zieht. Zurück zu Hobbes. Für sein in Seidens Sinn unweises Dauerverhalten, besonders natürlich für seine Unklugheit, die Welt nicht nur interpretieren, sondern sie auch verändern zu wollen, hatte Hobbes zu zahlen. Roms Kirche erließ ein Opera-omnia-Verbot gegen ihn, gerechterweise, muß man sagen; es galt bis zur Abschaffung des Index, also bis 1966. In Paris hatte er die Rache des katholischen, in London die des anglikanischen und des presbyterianischen Klerus zu fürchten. Das House of Commons bereitete im Oktober 1666 ein Gesetz gegen den Atheismus vor, dem bereits eingesetzten Parlamentskomitee gehörte der Generalanwalt der Krone an; als Beispielsobjekte der Untersuchung wurden nur zwei Bücher genannt, darunter war „the Book of Mr. Hobbes, called the Leviathan" 3 . Selbst im damals freiesten Land Europas, in den Niederlanden, wurde, nachdem in Amsterdam 1667 eine Leviathan-Übersetzung ins Holländische und 1670 eine solche ins Lateinische publiziert worden waren, ein Druck-, Verkaufs- und Verbreitungsverbot gegen Hobbes' Meisterwerk erlassen, im gleichen Atemzug übrigens wie gegen Spinozas „Tractatus theologico-politicus" 4 . In England selbst begnügte man sich zunächst mit einer literarischen Hexenjagd auf Hobbes, jenes „Monster of Malmesbury", den Erzatheisten, das Schreckgespenst seiner Nation, seiner Generation schwarze Bestie (und schwarzhaarig war er tatsächlich). Knapp einhundert Pamphlete erschienen gegen ihn 5 (nicht eines für ihn!). Ihm, der es nie zum Universitätsprofessor, H E The Elements of Law Natural and Politic [1640], London 1969. H L Leviathan [englisch, 1651], London 1988. H L L Leviathan [lateinisch, 1668], Amsterdam 1670. H O Opera philosophica, London 1839 - 1845 (Reprint: Aalen 1961). H R De cive [English Version: Philosophical Rudiments, 1651], Oxford 1983. H W The English Works, London 1839 - 1845 (Reprint: Aalen 1966). 3 Vgl. Journals of the House of Commons, London 1666, S. 636; John Dowell, The Leviathan Heretical, or the Charge Exhibited in Parliament against M. Hobbs, Oxford 1683. 4 Abgedruckt in: Carl Gebhardt (ed.), Spinoza - Lebensbeschreibungen und Gespräche, Hamburg 1977, S. 128. 5 Vgl. vor allem Samuel /. Mintz, The Hunting of Leviathan, Cambridge 1970, S. 157: Checkliste of Anti-Hobbes Literature in England 1650 - 1700; John Bowle, Hobbes and His Critics, London 1951, S. 57ff.
Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit
133
geschweige denn zum Akademiemitglied gebracht hat, wurde die Zerrüttung der Studentenerziehung angelastet, seiner Gottlosigkeit das Ausbrechen von Pest und Feuersbrunst in London. John Bramhall (1594 - 1663), Bischof von Derry, publizierte gegen Hobbes den Pontifex maximus des Unglaubens, sein so giftiges wie voluminöses „Castigations of Mr. Hobbes" mit seinem Anhang „The Catching of Leviathan", wobei er zu beweisen sich anheischig machte, daß kein Hobbist ein guter Christ, ein guter Staatsbürger, Herr, Knecht, Vater oder Ehegatte sein könne; ein Aufruhrtrompeter sei er in Wahrheit und sein „Leviathan" ein Rebellenkatechismus6. Eduard Hyde, First Earl of Clarendon (1609 - 1674), publizierte einen mehr als dreihundertseitigen Überblick über die für Kirche und Staat bösartigen, ja aufrührerischen Irrlehren des dem Cromwell in die Hände philosophierenden Hobbes und widmete seine (übrigens höchstintelligente) Denunziation Charles II., dem er einst als Chefberater und Lordkanzler gedient hatte 7 . Dem literarischen Vernichtungskrieg folgte schließlich der offizielle: Die Universität von Oxford erließ am 21. Juli 1683 ein Dekret, das unter die als aufrührerisch, häretisch und gotteslästerlich bezeichneten Lehrsätze auch die von Hobbes vertretenen Behauptungen auflistete, wonach der Naturzustand ein Kriegszustand und die Staatsgewalt ursprünglich auf das Volk zurückzuführen sei; unter den (wenigen) Büchern, die, da sie zu Atheismus, Rebellion und Königsmord aufhetzten, öffentlich zu verbrennen seien, wurden „De cive" und „Leviathan" genannt8. Das passierte, wie gesagt, 1683, und da war Hobbes schon vier Jahre tot. Aber kann man es ihm verdenken, daß er, der wohl wußte, wie fanatisch die Menschen beim Disputieren sind, wenn es um Machtfragen geht, und „kreuzigt ihn" schreien, statt über das Recht nachzudenken (HW 4/407), befürchtete, man werde außer seinen Büchern auch deren Autor, ihn selbst also, verbrennen? John Aubrey (1626 - 1697), dem wir die Details aus seines Freundes Hobbes Leben verdanken, berichtet jedenfalls, daß die Bischöfe im House of Lords beantragten „to have the good old Gentlemen burn't for a Heretique. Which, he hearing feared that his papers might be search't, by their order, and he told me he had burnt part of them 9 . Erhalten geblieben ist - außer dem Häresie-Anhang seiner lateinischen Leviathan-Version ( H L L 346), seiner „Historical Narration of Heresy" (HW 4/385 - 409) und dem Ketzerei-
6 John Bramhall y The Catching of Leviathan, London 1658, S. 503, 513. Die Antwort von Hobbes auf Bramhalls Attacken findet sich in H W 4/279 - 384. 7 Edmunde Hyde , A Brief View and Survey of the Dangerous and Pernicious Errors to Church and State in Mr. Hobbes's Book Entitled Leviathan, Oxford 1670, S. 5, 317. 8 Vgl. J.P. Kenyon (ed.), The Stuart Constitution. Documents and Commentary, 1603 - 1688, Cambridge 1976, S. 473: „The judgement and decree of the University of Oxford, Juli 21, 1683, against certain pernicious books and damable doctrines". 9 JohnAubry , Brief Lives, Harmondsworth 1982, S. 235.
134
Hermann Klenner
Abschnitt seines Dialoges zwischen einem Philosophen und einem Juristen ( H D 122 - 132) - ein erst vor zwanzig Jahren in der Handschrift seines Amanuensis aufgefundenes Manuskript, in dem er, ausdrücklich gegen seine Ankläger gerichtet, die ganze englische Rechtsgeschichte durchforstet, um die Illegalität von Häretikerverbrennungen nachzuweisen10. Auch wenn der wirkliche Einfluß des erwähnten Bücherverbrennungsdekretes von Oxfords Universität kaum festzustellen sein dürfte: Tatsache ist schließlich, daß die englischsprachigen Versionen von „De cive" und „Leviathan" nach ihrer Erstauflage von 1651 als Monographien (von zwei Raubdrukken abgesehen) das nächste Mal erst, es hält schwer zu glauben, 1881 bzw. 1949 publiziert worden sind. Und dabei hatte bereits die (lateinische) Erstauflage von „De cive", nach Gassendis Zeugnis 11 , das Käuferverlangen mehr bewirkt als befriedigt, hatte „Leviathan" auf der einschlägigen Londoner Bestsellerliste des Jahres 1658 zu dritter Stelle gestanden12 und wurde zehn Jahre später, wie Samuel Pepys seinem Tagebuch anvertraut 13 , statt für acht Schilling nun, da es „mightily" verlangt wurde, für dreißig Schilling gehandelt, „it being a book, the Bishops will not let be printed again." Dem Übersetzer der ersten deutschsprachigen Leviathan-Ausgabe (Halle 1794/95) gelang es nicht, ein englischsprachiges Exemplar aufzutreiben, weshalb er sich mit der lateinischen Version begnügen mußte. Die erste vollständige Leviathan-Übertragung aus dem Englischen ins Deutsche konnte übrigens erst 1966 publiziert werden. Mir ist wohl bewußt, daß der wissenschaftliche Wert eines rechtsphilosophischen Werkes weder von den Widrigkeiten der Zeitumstände, unter denen es produziert und publiziert worden ist, noch von dem Wagemut seines Autors bestimmt wird. Doch hätte sich der Aufwand bereits gelohnt, wenn er den Situationsunterschied, zwischen den englischen und den französischen Großtheoretikern des 17. bzw. 18. Jahrhunderts hervortreten lassen würde, von denen die einen alle vor der Revolution ihres Landes, die anderen aber: Hobbes wie Harrington, Milton wie Sidney und Locke, und Winstanley nicht zu vergessen, während der Revolution ihres Landes schrieben. Daß aber die Revolution von Staaten keine sonderlich günstige Konstellation für die Geburt von Wahrheiten abgibt (so: H L 728!), hat Hobbes nicht gehindert, eine, jedenfalls der Absicht nach, von Anfang bis Ende wissenschaftliche, also Wahrheit für ihre Ergebnisse beanspruchende Philosophie zu konstruieren. 10
Hobbes [On the Law of Heresy], in: Reinhard Koselleck / R. Schnur (ed.), Hobbes-Forschungen, Berlin [W] 1969, S. 56 ff. (Aufgefunden und kommentiert von Samuel Hintz). 11 Pierre Gassendi , Brief vom 28. April 1646 an Samuel Sorbiere, in: HC, S. 85,297. 12 Quentin Skinner , in: Maurice Cranston / R. Peters (ed.), Hobbes and Rousseau, Garden City, N.Y., 1972, S. 113. 13 Samuel Pepys, The Diary, Bd. 8, London 1912, S. 97 (3. September 1668).
Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit
135
Auch ist nur zu oft die souveräne Mißachtung der Situation, in der situationsübergreifende Gedankenkomplexe entstehen, vom Unverständnis ihrer Inhalte geprägt. Zudem verringert sich die Ausstrahlungskraft gewesener Vorgänge in dem Maß, in dem diese auf die objektiven Gesetzmäßigkeiten reduziert werden. Es gibt jedoch kein Allgemeines ohne ein Besonderes. Zu Abstraktion pur sterilisierte Geschichte ist auch dann impotent, wenn es sich um Wissenschaftsgeschichte handelt. Bereits in seiner Todesanzeige bezeichnete ein Anonymus im „Mercurius Anglicus" vom 10. Dezember 1679 (S. 30) Hobbes als much blamed, but little understood. Und bis zum heutigen Tag ist nicht einmal die Frage hinreichend beantwortet worden, auf welcher Seite im englischen Bürgerkrieg des 17. Jahrhunderts er denn eigentlich gestanden habe. Von sich selbst sagte er nicht ohne Stolz: „ I am one of the common people" ( H D 61); auch berief er sich auf seinen plebejischen Namen (HW 7/355). Aber vieles in seinem Leben scheint sich nicht in ein klares Bild zu fügen: Fast sein ganzes Leben war er seit dem Verlassen von Oxfords Magdalen College bis zu seinem Tod dem Grafengeschlecht der Devonshires als Hauslehrer und Hausgelehrter und Hausfreund verbunden. Seine „Elements of Law" widmete er am 9. Mai 1640, also vier Tage nach Auflösung des Kurzen Parlaments, dem Grafen von Newcastle, damals Governor to the Prince of Wales. Als das Lange Parlament zusammentrat, entschied er sich binnen dreier Tage, etwa Mitte November 1640, nach Frankreich zu emigrieren 14 , wie er später schrieb, „the first of all that fled, . . . to his damage some thousands of pounds deep" (HW 4/414). In Paris unterrichtete er ab 1646 den Prince of Wales in Mathematik, versuchte aber vergeblich, sein der Amsterdamer Zweitauflage von „De Cive" (1647) ohne sein Wissen vorgebundenes Porträt mit einer ihn als Tutor des Prinzen ausweisenden Inschrift auf eigene Kosten entfernen zu lassen, und zwar auch mit der Begründung, daß sonst seine Rückkehr in sein Heimatland - und warum sollte er eigentlich nicht zurückkehren, wenn England pazifiziert sein wird? - abgeschnitten sein würde 15 . Im „Leviathan" wird Hobbes dann die theoretische Begründung dafür nachliefern, daß der Untertan eines durch Eroberung pazifizierten Landes gegenüber seinem früheren Souverän, der ihm doch keinen Schutz mehr bieten könne, keinerlei Verpflichtungen mehr hat ( H L 719f.). Auch später beanspruchte Hobbes, den „Leviathan" weder zum Nachteil des Königs noch um Cromwell zu schmeicheln geschrieben zu haben (HW 4/415), sondern im Interesse tausender ehemaliger Untertanen und Soldaten Charles I., denen er demonstriert habe, daß sie nun frei seien, ihren Schutz ohne
14 Vgl. Perez Zagorin, Thomas Hobbes's Departure from England in 1640. A n Unpublished Letter, in: The Historical Journal, Cambridge, 21 (1968), 159. 15 Abdruck des Hobbes-Briefes vom 22. März 1647 an Sorbiere in: HC, S. 310 sowie bei Ferdinand Tönnies, Studien zur Philosophie und Gesellschaftslehre im 17. Jahrhundert, Stuttgart 1975, S. 62.
136
Hermann Klenner
Verrat dort zu suchen, wo immer sie ihn zu finden vermöchten (HW 4/421; 7/ 336). Er selbst bereitete sich spätestens seit September 1649 - Charles I. war inzwischen hingerichtet, der Bürgerkrieg entschieden - auf seine Heimkehr vor, wie aus einem Brief an Gassendi zu entnehmen ist (HO 5/307). Ausschlaggebend scheint dann die vernichtende Niederlage in der Schlacht von Worcester (3. September 1651) gewesen zu sein, die sich Charles II. bei seinem Versuch geholt hatte, seinen Anspruch auf die Thronfolge zu realisieren. Hobbes jedenfalls überreichte seinem ehemaligen Mathematikschüler ohne Thron, mit dem auch nur zu korrespondieren durch Parlamentsgesetz verboten war, im Oktober oder November dieses Jahres ein besonders prächtiges Exemplar seines im April in London erschienen „Leviathan", und floh heimlich, nachdem er zur Freude vieler Höflinge beim Hofe Charles II. nicht mehr empfangen und vom Pariser Katholikenklerus als Atheist verdächtigt wurde, endgültig nach London, wo er sich den neuen Machthabern unterwarf: „ I do declare and promise that I will be true and faithful to the Commonwealth of England as it is now, without a King or House of Lords", so die gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtungserklärung 16 . Nach der neun Jahre später erfolgten Restauration der Stuart-Monarchie widmete Hobbes 1662 seine „Seven Philosophical Problems and Two Propositions of Geometry" seinem ehemaligen Mathematikschüler und nunmehrigen wirklichen König mit einer kurzen, dafür aber umso durchtriebeneren Apologie für seinen „Leviathan", unterzeichnend als „Your Majesty's poor and most loyal subject" (HW 7/6); Charles II. gewährte Hobbes eine Hundert-Pfund-Jahrespension, deren Auszahlung freilich untertänigst angemahnt werden mußte (HW 7/471), hing dessen Porträt in den Privatgemächern von Whitehall auf und verweigerte jegliche Publikationsgenehmigung für gesellschaftswissenschaftliche Schriften; auch für den „Behemoth", Hobbes' Revolutionsgeschichte, mit Sonderlob für Charles I. (HB 95: the best King perhaps that ever was) wie für Charles II. (HB 144: our present most gracious Sovereign) gab es keine Ausnahme. Der erst kürzlich wieder geäußerte Verdacht, der König habe „Behemoth" verboten, um Hobbes vor der Kirche zu schützen, kann sich immerhin auf die Vermutung des ältesten Hobbes-Freundes und Biographen stützen 17 . Welcher Seite also im englischen Bürgerkrieg beabsichtigte Hobbes zu dienen, und welcher Seite diente er? War er ein Royalist, ein Vertreter der aristokratischen Oberschicht des verbürgerlichten Adels oder ein Krypto-Liberaler 16 Vgl. C.H. Firth / R.S. Rait (ed.), Acts and Ordinances of the Interregnum 1642 1660, Bd. 2, London 1911, S. 550 (Act, prohibiting correspondence with Carles Stuart, 12. August 1651); 325 (Act for subscribing the engagement, 2. Januar 1650). 17 Mark Hartmann, Hobbes's Concept of Political Revolution, in: Journal of the History of Ideas, Philadelphia, 47 (1986) 493; John Aubrey, Brief Lives, Harmondsworth 1982, S. 85. Vgl. auch Christopher Hill, Puritanism and Revolution, Harmondsworth 1986, S. 267: „Thomas Hobbes and the Revolution in Political Thought"; Franck Lessay, Souveraineté et légitimité chez Hobbes, Paris 1988.
Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit
137
- alles geäußerte Ansichten? Oder heulte er einfach mit den Wölfen der jeweiligen Macht? Die zuletzt geäußerte Auffassung erhielt vor wenigen Jahren neue Nahrung, als man feststellte, daß in dem berühmten Titelkupfer der Erstauflage des „Leviathan" - hinter Bergen, Dörfern und einer Stadt taucht ein Herrscher mit Schwert und Hirtenstab auf, ein aus natürlichen Menschen zusammengesetzter künstlicher Mensch - dieser Leviathan die Gesichtszüge Cromwells trägt, daß aber dem Geschenkexemplar an Charles II. eine von dessen ehemaligem Zeichenlehrer stammende Titelzeichnung von gleichem Symbolgehalt beigegeben war, deren Gesichtszüge Charles II. abgeborgt worden sind 18 . Die bisher gründlichste Untersuchung zu dem hier angedeuteten Problem stammt von Julius Lips, der einer von Ferdinand Tönnies, dem bisher bedeutendsten Hobbes-Forscher (von der englisch-sprachigen Literaturflut der Gegenwart durchwegs übersehen), gewiesenen Bahn folgend, bereits 1927 die These glaubhaft machte, daß Hobbes von allen Parteien der englischen Revolution den Independenten, und zwar der Gruppe um Cromwell, am nächsten stand 19 . Dieses Plausibilitätsurteil hat dann Franz Borkenau in seiner bekannten Pariser Studie von 1934 über den Übergang zum bürgerlichen Weltbild relativiert: Hobbes sei ihrer aller Theoretiker, des Königs, der Presbyterianer und im höchsten Grade Cromwells 20 . Auch auf die Gefahr hin, eine sozialphilosophische Großtat, wie es der „Leviathan" nun einmal ist, auf das Niveau der etwa 20000 Polit.-Pamphlete zu nivellieren, die Englands bürgerliche Revolution, wie sich aus dem Thomason-Katalog aller auf den Bürgerkrieg bezogenen zeitgenössischen Bücher und Broschüren ergibt, hervorgebracht hat, es ist nun einmal das Schicksal einer politischen Theorie gleich welcher Dimension, sich auch am Zeitgeist messen lassen zu müssen. Was nun Hobbes anlangt, so steht sein persönliches Verhalten, was alles anders als selbstverständlich ist, in völliger Übereinstimmung mit seiner Theorie: zur Loyalität ist ein Bürger nur demjenigen Souverän gegenüber verpflichtet, der ihn auch zu schützen vermag ( H L 375). Insofern war er bei Cromwell und danach bei Charles II. gut aufgehoben. Nicht aber hat Hobbes dessen (und dessen Vaters) Refeudalisierungstendenzen intellektuell gestützt, denn die hätten, wie die Dinge international lagen, nur mit Hilfe von Rekatholisierungstendenzen eine Chance gehabt. Hobbes aber war der bis ins Extrem gesteigerte Vertreter einer Cuius-regio-eius-reli18
Vgl. Keith Brown, The Artist of the Leviathan Title-Page, in: The British Library Journal, London, 4 (1978), S. 24 - 36. Bereits im vorigen Jahrhundert als Vermutung ausgesprochen. 19 Julius Lips, Die Stellung des Thomas Hobbes zu den politischen Parteien der großen englischen Revolution, Leipzig 1927, S. 73. 20 Franz Borkenau, Der Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Weltbild, Paris 1934, S. 446, 442. Vgl. H. D. Metzger, Hobbes und die englische Revolution, Stuttgart 1991, S. 257.
138
Hermann Klenner
gio-Politik, mit einer Konzeption von der, philosophisch gesehen, gleichen Gültigkeit der Religionen, die bis an die Grenze einer Gleichgültigkeit gegenüber Religionen reichte: Glauben war ihm staatlich sanktionierter Aberglauben ( H L 124: Fear of power invisible, feigned by the mind or imagined from tales publicly allowed, religion; not allowed, superstititon). Daher attackierte er die Presbyterianer (wohlgemerkt nicht die independenten Puritaner!) kaum weniger scharf als die Päpstlichen, waren doch beide Glaubensfanatiker und schon deshalb außerstande, sich mit einer Theorie auszusöhnen, die der Kirche bestenfalls die Rolle einer Ideologieabteilung innerhalb der Staatsmaschinerie zuzubilligen bereit war. Aber deshalb war Hobbes noch lange kein Liberaler, wie man neuerdings entdeckt zu haben glaubt 21 . Er war Absolutist, und das zu einer Zeit und in einem Land, da, wie nach jeder Revolution, ein sich erst konsolidieren müssender Staatszustand eine energische Diktatur erforderlich machte 22 . Daß Hobbes dafür prinzipiell die parlamentarische Form der monarchischen gleichgestellte (wenn er auch persönlich der zuletzt genannten den Vorzug gab), hat sicher dazu beigetragen, daß man seine Diktaturkonzeption zwar in der Theorie verurteilte, in der Praxis aber befolgte. Übrigens: Hobbes negiert auf seine Weise die innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft nicht aufhebbare Differenz zwischen Bourgeois und Citoyen: er kennt keine Citoyen! Dafür begründet er die für die bürgerliche Gesellschaft (im Unterschied zum Feudalismus) charakteristische personelle Nichtidentität zwischen den Regierenden und den Profitierenden, das Auseinanderfallen von politischer und ökonomischer Macht, was die sie Ausübenden betrifft. Allerdings: indem Hobbes die Staatsallmacht in argumentierbare (wissenschaftlich begründbare, aber auch widerlegbare!) Zusammenhänge, sie in rationale Zweck/Mittel-Relationen stellte und sie überdies in jeder ihrer Formen letztlich aus der Willensübereinstimmung aller, also demokratisch, entstehen ließ, relativierte er sie. Und er relativierte sie ein weiteres Mal dadurch, daß er in Zeiten des Aufruhrs, da das imperium summum et absolutum in zwei höchste Staatsgewalten auseinanderbrach (HC 142), die Revolutionierenden als Kriegführende, als potentiell Erobernde erkannte und folglich die Bürger von jeglicher Gehorsamsverpflichtung gegenüber ihrem früheren Souverän dann entband, wenn das Land im Ergebnis des Bürgerkrieges von dem Mächtigeren, dem neuen Souverän pazifiziert worden war ( H L 719f.). 21 Vgl. Frank M. Coleman, Hobbes and America: Exploring the Constitutional Foundations, Toronto 1977, S. 68, 98; Aryk Botwinnik, Hobbes and Modernity, Boston/London 1982, S. 57. 22 Vgl. die allgemeine Einschätzung bei Marx / Engels, Werke, Bd. 5, Berlin 1959, S. 402. - Eine Marx / Engels-Anthologie zu Hobbes findet sich in der Leviathan-Ausgabe des Reclam-Verlages, Leipzig 1978, S. 369, 387.
Thomas Hobbes, ein Theoretiker des Rechts in böser Zeit
139
Ein relativierter Absolutismus ist aber als widersprüchlich in sich im Wortsinn gar kein Absolutismus. Jedenfalls aber war er so ungefähr das Gegenteil von jener Absolutismuskonzeption, die James I., der Vater von Charles I., oder während der Revolution der mit Hobbes gleichaltrige Sir Robert Filmer publiziert hatten. „As to dispute what God may do is blasphemy, so it is sedition in subjects to dispute what a king may do . . . " , hieß es bei dem einen 23 , und der andere lieferte mit seiner Behauptung, daß die Staatsmacht willkürlich ausgeübt werden können müsse - „every power of making laws must be arbitrary, for to make law according to law is contradictio in adjecto" 24 - die Begründung für einen nichtrelativierten, also wirklichen Absolutismus. Auch in seinem Absolutismuskonzept erwies sich Hobbes als gegenfeudaler, als bürgerlicher Denker. Die Bedeutung von Hobbes' Gedankensystem erschöpft sich gewiß nicht in dessen Einfluß auf das englische 17. Jahrhundert. Der epochale Rang seiner Rechtsphilosophie ist vielmehr darin begründet, daß Hobbes mit ihr den sich seit Jahrhunderten anbahnenden Paradigmenwechsel im politischen Denken vom feudaltheologischen zum bürgerlichrationalen Welt-, Gesellschafts-, Menschen- und Rechtsbild als erster systematisch vollzog. Insofern ist er intellektueller Revolutionär, und zwar unabhängig von seiner praktisch-politischen Parteinahme während Englands großer Revolution. Der brisanteste Gegenstand, an und mit dem die neue Weltanschauung ihren ersten Triumph feierte, war nun die von Hobbes in griffigen Formeln geforderte Überführung des Naturzustandes in den Gesellschaftszustand, des Kriegszustandes in einen Friedenszustand zwischen den Menschen. Im Naturzustand, einem estate of war (HE 73), bellum omnium contra omnes (HC 81), war of every man against every man ( H L 185), continual war of one upon another (HD 58) habe ein jeder das Recht auf alles: every man by nature has right to all things (HE 72), natura dedit unicuique ius in omnia (HC 95). Wenn aber jeder Mensch ein Recht auf alles habe, so sei die Wirkung dieses Rechts so ziemlich dieselbe, as if there had been no right at all (HC 96): die Natur zerstöre sich selbst und es ermordeten einander die Menschen (HE 73). Unter solchen Bedingungen eines perpetual desire of power after power that ceases only in death (HC 161) gebe es demzufolge weder Fleiß noch Ackerbau, weder Wissenschaft noch Kultur, weder Eigentum noch Gerechtigkeit, und das Leben der Individuen sei poor, nasty, brutish and short ( H L 186). Daher sei der Mensch gezwungen, seine naturgegebenen Homo-homini-deusVerhältnisse umzugestalten (HC 73). Die im Prinzip gleichen Ängste, Befürchtungen. Leidenschaften, Hoffnungen, Sehnsüchte eines jeden Menschen erzeugten schließlich bei einem jeden die gleiche Einsicht in die der 23 24
James /., The Political Works, New York 1965, S. 307. Robert Filmer, Patriarcha and Other Political Works, Oxford 1949, S. 277 [1648].
140
Hermann Klenner
Natur gemäßen Gesetze eines menschenwürdigen Zusammenlebens. Solch ein von seinem Naturrecht (right of nature, jus naturale) wohl zu unterscheidendes Naturgesetz (law of nature, lex naturalis) sei eine von der Vernunft ermittelte Vorschrift oder Verhaltensregel, die letztlich gebiete, mittels eines Vertrages den Krieg aller mit allem in einen Frieden aller mit allem, also in einen Zustand zu verwandeln, in dem „man to man is not an arrant wolf, but a kind of God" (HR, Ep. ded.). Hobbes selbst war sich seines intellektuellen Revolutionarismus wohl bewußt: bilderstürmerisch behauptete er von den Schriften aller (!) seiner Vorgänger, daß sie zur Wahrheitserkenntnis aber auch gar nichts beigetragen hätten (HC 75). Alle Welt wandele zwar auf deren Denkwegen wie auf Landstraßen, auf beiden aber werde nicht geerntet. Worin aber besteht eigentlich der von Hobbes als erstem vollzogene Bruch in der Geschichte von Rechtsund Sozialphilosophie? Darin, daß er dem aristotelischen Zoon-politikonAxiom das Bellum-omnium-contra-omnes-Axiom mit seinem Komplementoder Kontrast axiom, dem Homo-homini-Deus-Ziel entgegenstellte? Doch wohl nicht. Vielmehr dürfte es sein Denk-Einsatz sein, der den Gegenwartswert seiner Theorie ausmacht, also mittels Vernunft die Verallgemeinerungsfähigkeit menschlicher (materieller und ideeller) Interessen, Leidenschaften und Gemütserregungen herauszufinden, um die (materielle und geistige) Reichtumsentwicklung des Menschen zu ermöglichen. Darin besteht nämlich die Zentralidee seiner ganzen civil philosophy, daß man das bellum omnium contra omnes mittels eines Vertrages aller mit allen in einen allgemeinen Frieden überführen könne, sofern Interessengegensätze Vernunftkoalitionen erzwingen. Dieser zugleich materialistische wie dialektische Ansatz von matter und motion, von passions und reason, von Individuell- und Allgemeinmenschlichem ist von bisher nicht ausgeloteter Tiefe. Er ist zugleich von einer ungeheuren Aktualität.
Morality, Law and Rights By Aleksander Peczenik, Lund The point of this paper is dual: First, to show great complexity of the act of weighing and balancing, necessary for both moral and legal reasoning. Second, to provide means for a theoretical analysis of this complexity. I. Prima facie The first key to understanding this paper is the distinction between provisional and definitive reasons. A practical statement is prima-facie if, and only if, it constitutes a provisional reason for adapting one's opinion or one's conduct (action or forbearance) to what it states. For example, a statement of a prima-facie duty to do H constitutes a provisional reason for doing H. The reason is provisional, since other considerations may justify the contrary conclusion. Logically incompatible actions can be, at the same time, prima facie good. One can also simultaneously have a prima facie duty to perform logically incompatible actions. II· Value-principles and Value-statements The most basic subclass of prima-facie practical reasons consists of valueprinciples and value-statements. This is the case regardless the fact that many legal rules, inter alia expressed in statutes, have also a merely prima-facie character because their interpretation involves a value-laden reasoning which may lead to the results incompatible with the literal sense of the interpreted text. The word "principle" is ambiguous. It can designate a general norm, an important norm, a practical statement that establishes a certain ideal, etc. I will discuss only the last meaning of the word. A principle in this sense, let me call it a value-principle, establishes an ideal. The ideal can be carried into effect to a certain degree, more or less. The higher the degree of realisation of the ideal, the better from the point of view of the principle. Ch. 1 Sec. 2 of the Swedish Constitution (The Instrument of Government, Regeringsformen) thus stipulates, what follows: "The public power shall be exercised with the respect for equal value of all human beings and for each individual person's freedom and dignity." The greater respect for equality, freedom and dignity,
142
Aleksander Peczenik
the better from the point of view of the provision. In fact, the provision expresses three principles: (1) Those in power shall respect equal value of all human beings. (2) Those in power shall respect freedom of each individual. (3) Those in power shall respect dignity of each individual. The difference between value principles and rules is, what follows. If one is in a situation regulated by a rule , one has only two possibilities, to obey the rule in question or not. A rule qualifies, e.g., a human action as prescribed (obligatory), permitted, or prohibited (forbidden). The individual rule " A ought not to park his car here" thus qualifies A's action of "parking the car here" as prohibited. From another point of view, a rule qualifies a human action as conforming to or violating the rule 1 . A n important property of this mode of qualification is its binary, either-or, 0-or-l character. A value principle, on the other hand, establishes an ideal that can be carried into effect to a certain degree, more or less. If the terminology of qualification is applicable at all to principles, one can merely state that a principle qualifies, e.g., a human action as more or less perfect in the light of the principle. A principle is a yardstick of a graded qualification. This mode of qualification is not binary but graded, more-or-less. For that reason, the difference between rules and value-principles is profound. Each principle expresses a single value. The difference between principles and value-statements is not particularly profound. Roughly speaking, they are different expressions for the same thing. It follows that one can express the same thoughts in two different terminologies, that is, employing principles and values. Principles can collide with each other. A n increased respect to equality in the particular case under consideration can, e. g., cause a decrease of freedom and vice versa , an increased respect to freedom can decrease equality. Consequently, one has merely a provisional, prima facie duty to follow the wording of the principles. I I I . All-things-considered Practical Statements One has a definitive (all-things-considered) moral duty to follow the best compromise, achieved through weighing and balancing of different value-principles (or value-statements). A practical statement is definitive only if by uttering it one declares that one no longer is prepared to pay attention to reasons which justify the contrary conclusion.
1
Cf. A. Peczenik , Norms and Reality, in: Theoria, 1968, pp. 117f.
143
Morality, Law and Rights
From another point of view, the definitiveness of a practical statement implies that one would endorse it, if one had a complete information about all morally relevant circumstances. In order to justify an all-things-considered practical statement, one must weigh and balance prima-facie practical statements which support it against such statements supporting the contrary conclusion. One shall thus see to it that, e. g., a small increase of equality in the considered case does not cause a too great limitation of freedom; nor shall a small increase of liberty be "paid" by a too great inequality. In other words, the higher is the degree to which a particular action contradicts one principle the more important is that it conforms to the other one. When freedom decreases, a greater and greater increase of equality is required to compensate a further decrease of freedom 2. I V . Practical and Theoretical Meaning of Practical Statements Let me now discuss the problem of justification
of practical statements.
Practical statements, inter alia moral and legal norm- and value-statements, have both a certain practical and a certain theoretical meaning. A practical statement has, first of all, a practical (emotive, volitional, conative) meaning. The most important function of a norm-expressive statement is to affect people, that is, to bring about some actions and suppress other. A norm-expressive statement is thus a reason for action. A value statement is also a reason for action. Suppose that a person, A , seriously claims that H is a morally good action and that nothing incompatible with H is better. It is then natural for A to have a disposition both to approve of H and to perform H , if an opportunity exists. On the other hand, most, if not all, practical statements may be justified. They thus have not only a practical but also a theoretical (propositional, cognitive) meaning3. I will discuss here only the theoretical meaning of moral statements, thus leaving aside the problem whether other practical statements have the same properties. Moreover, I will discuss in this paper only critical morality, not any kind of ("positive") social, conventional morality. In the established moral language, a theoretical statement about some "good-making" facts thus implies a value-statement (and, consequently, also a 2 Cf. R. Alexy y Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985, pp. 146 ff. One can thus regard principles as commands to weigh and balance. Cf. id., pp. 71 ff. 3 Cf. Peczenik , On Law and Reason, Dordrecht / Boston / London 1989, pp. 54ff. and a more cautious version of the theory - A. Peczenik / H. Spector, A TTieory of Moral Ought-Sentences, in: ARSP, 1987, pp. 441 ff.
144
Aleksander Peczenik
principle) stating that a certain person, action, event, object etc. is prima-facie good. Consequently, one can proffer these (but not some other) facts as (insufficient but meaningful) reasons for the conclusion that it is all-things-considered (definitively) good. Moreover, since this value statement is a reason for action (see above), theoretical statements about "good-making" facts also are (indirect) reasons for action. The theoretical meaning of moral statements is, however, vague. One can, e.g., tell what actions are certainly prima-facie good (e.g., to make sacrifices in order to help ill people) and what are certainly not (e.g., take and kill hostages), but there are many actions which perhaps are good, perhaps not. Several competing moral theories are thus admissible, formulating or implying various definitions of or at least criteria for a good action etc. A brief survey of the best known moral theories reveals, inter alia y the following criteria of moral goodness. A n action, H , is prima-facie, morally good, if it increases happiness of other people; or if it fits a certain calculus of human preferences; or if it promotes fulfilment of human talents ; or if it fits some goals and standards of perfection, inherent in established social practices. Moreover, if A helps others, works efficiently, tells the truth, keeps promises, shows courage, etc., then he is (prima facie) a good person. Some other "moral criteria" would be meaningless, unthinkable. If somebody, e.g., uttered the statement " A is a morally good person, since his nose is shorter than two centimetres", one would suspect that he is joking, does not know the language or is insane. In a similar manner, a theoretical statement about some "ought-making" facts implies a prima-facie norm-statement, e.g. that a certain person, A , ought prima-facie to perform a certain action, H. Consequently, these facts can be proffered as (insufficient but meaningful) reasons for the all-things-considered norm-statement " A ought to do H " and, finally, for A's doing H. One may thus claim that the following theses are plausible explications of analytic relations between practical statements and, on the other hand, goodand ought-making facts: (1.1)
If, and only if, at least one ought-making fact (FiOaH or F 2 OaH o r , . . . or F n OaH) takes place, then A ought prima-facie to do H ;
and (1.2)
if, and only if, at least one good-making fact F i G H or F 2 G H or, . . . or F n G H ) takes place, then H is prima-facie good;
where the symbols FiOaH - F n O a H and F i G H - F n G H stand for all oughtund good-making facts. By the way, I disregard here the problem whether the list of these facts is finite or infinite. I also disregard the question of mathematical notation, one would need to express the idea of an infinite list.
Morality, Law and Rights
145
V . The Law A big part of morality consists of principles. A big part of the law consists of rules. The result of weighing and balancing of moral principles can thus consist in a legal rule . Principles are "soft", since they must be weighed and balanced against each other. On the other hand, the lawgiver compares the weight of several principles and thus creates some more or less exact rules, telling one what to do. Whereas one can say that each principle expresses a single value, a rule is often a compromise of many values (and corresponding principles). In contrast to morality, mostly consisting of principles, the main part of the law thus consists of rules. Legal reasoning thus is supported by a more extensive set of reasonable premises than a law-free moral reasoning. This is due both to the existence of legal rules and to some assumptions constituting this form of reasoning. Paraphrasing Aulis Aarnio' s, theory of the matrix of legal dogmatics, one may list the following four kinds of assumptions: 1. A set of philosophical presuppositions, inter alia , the assumption that legal reasoning is based on valid law. 2. A set of values, first of all concerning legal certainty (the rule of law) and justice. 3. Presuppositions concerning the sources of the law, such as statutes, precedents, legislative preparatory materials etc. One assumes that some of these are either binding or at least constituting authority reasons. 4. Presuppositions concerning legal method. One thus assumes that legal reasoning is and should be governed by some methodological norms. Legal reasoning of different times and societies involve different assumptions concerning valid law, legal sources, legal method etc. But all legal reasoning is based on some presuppositions of these kinds 4 . Let me give some examples of methodological norms of legal reasoning. A l l courts and authorities must use statutes in the justification of their decisions, if any are applicable. They should use applicable precedents and legislative preparatory materials. One should not construe extensively provisions imposing penalties, taxes or other burdens on a person. When an earlier statute is incompatible with a later one, one must apply the latter. When interpreting a statute, one must pay attention to its purpose.
4 A. Aarnio , The Rational as Reasonable, Dordrecht / Boston / Lancaster / Tokyo 1987, pp. 17ff.
10 Festgabe Opatek
146
Aleksander Peczenik
Certainly, one may doubt each such norm. But the total set of them is not only established in the legal practice and research but also related to the concept of legal reasoning. It would be strange to simultaneously refute a significant part of the set of such norms and still try to perform a legal reasoning. Neither can one simultaneously doubt an extensive part of valid statutes, precedents and other important sources of the law. A l l this restricts the need of weighing and balancing in the law. Legal reasoning is thus often more precise, more concise and much easier to formulate than the non-legal one. Assume, e.g., that the court has a legal duty to ignore oral contracts concerning the sale of real estate. The main legal reason for this duty is, of course, that the law imposes a written form of such contracts. Now, one may say, independently from the content of the law, that the court also has a moral duty to act in this way. But to justify such a moral duty, independently from the law, one must adopt a broad view of the society as a whole, and thus speculate about the immoral consequences of uncertainty concerning ownership of real estate, allegedly resulting from recognition of such oral contracts etc. Only in "hard" cases, not in the routine cases, one must complete such a set of established legal premises with a free act of weighing, in order to state precisely whether a given legal rule applies or not. V I . Prima-facie
Law and Prima-facie
Morality
Let me now introduce the concept of prima-facie law. This law is explicitly stated in sources of the law, such as enacted statutes, established precedents, authoritative legislative history etc. Duties, claims etc., explicitly stated in the sources of the law are merely prima-facie legal ones, since other considerations may justify the contrary conclusion concerning legal duties, claims etc. I am now in the position to discuss the relation between the prima-facie law and prima-facie moral duties, claims, etc. There thus exists the general primafacie moral duty to follow the prima-facie law. More generally: (2.1)
If the prima-facie law explicitly contains, implies or otherwise supports the conclusion that A has a certain legal duty, claim, competence or right to a holiding, then A has a moral prima-facie duty, claim, competence or right of the same content.
One may thus express an inclusion-thesis concerning the relationship between the legal and moral prima-facie : The prima-facie law is a part of the prima-facie morality. It follows that all legal prima-facie duties, claims etc. are also moral prima-facie duties, claims etc. but the converse is not true. If a person has a legal prima-facie duty, claim etc., concerning an action, H , then he also has a moral prima-facie duty, claim etc. of the same content.
Morality, Law and Rights
147
To understand the inclusion thesis properly, one must pay attention to the following comments: 1. We adopt here the broad sense of the word "moral", according to which morality is the system of values determining what is good or bad in general (not merely for a certain purpose). 2. One has thus a prima-facie moral duty to follow all law, not because of its content but because of the following general considerations. Moral reasoning is relatively uncertain, as a result of its ultimate dependence upon value principles that one must weigh and balance against each other. Mutually incompatible moral statements can thus simultaneously possess support of both moral principles and morally relevant facts. Different persons may agree what principles and facts are relevant to the moral question under consideration, yet disagree as regards weighing and balancing of them. The law, on the other hand, is more "fixed" than morality. A morally objectionable chaos would thus occur in a modern society, if it no longer possessed a legal order. It is thus morally justifiable to have a society possessing a legal order which in some cases leads to decisions whose content is morally wrong (when judged in isolation from the beneficial results of having the law at all). To have even such laws is morally better than to force individual persons to rely upon own moral judgments in all cases. 3. The basis of the moral prima-facie duty, claim etc., corresponding to the legal prima-facie duty, claim etc. of the same content, is complex. It always includes the general prima-facie duty to obey the law. In some cases it also comprises a prima-facie moral duty to follow some special systems of norms or values, such as economic values. Finally, in another class of cases one can morally justify the particular content and interpretation of the rule in question. Consequently, an action, H , is prima-facie morally obligatory not only if it fits a certain calculus of human preferences or some standards of perfection inherent in established social practices, etc. but also if the prima-facie law contains, implies or otherwise supports the conclusion that A has a legal duty to do H. This makes it possible to formulate the following comment to the thesis (1.1) concerning the relation between ought-making facts and one's primafacie duty. The list of ought-making facts comprises not only moral substantive reasons but also the prima-facie law.
V I I . Definitive Law and Definitive Morality As soon as one formulates a general rule, its application to any particular case calls for an act of weighing and balancing. Such an act is necessary at least in order to establish whether the case under consideration is a routine case, not involving a further weighing, or a "hard" case. In the latter type of cases, 10*
148
Aleksander Peczenik
one must weigh and balance the rule against other reasons. Consequently, all general legal rules must be merely prima-facie. A n all-things-considered legal rule must be individual, applicable only to the case under consideration. It states what to do in view of the morally interpreted prima-facie law. The second key to understanding this paper is the thesis that weighing and balancing is a necessary part of moral reasoning, impossible to replace with rigid priority orders of reasons. Let me thus express the following thesis: (2.2)
If a person, A , has a legal all-things-considered duty, claim etc., concerning an action, H , then he also has a moral all-things-considered duty, claim etc. of the same content.
This is an inclusion-thesis concerning the relationship between the legal and moral all-things-considered. A l l legal all-things-considered duties etc. are also moral all-things-considered duties etc. but the converse is not true. Even if a person has no legal all-things-considered duty, claim etc. of a given content, he can still have a moral all-things-considered duty, claim etc. of this content. The following reason justifies the inclusion thesis concerning the all-thingsconsidered law and morality. Morality demands that one's act of weighing and balancing must pay attention not only to prima-facie moral values (and principles) but also to the prima-facie law. The law is a morally relevant factor, that is, it implies prima-facie moral duties, claims etc. Consequently, one cannot disregard the prima-facie law and yet consistently state that one considered all morally relevant things. Assume, e.g., that a prima-facie moral principle demands that one ought not to denunciate one's neighbour for the authorities. Moral weighing and balancing must determine the compromise between this principle and the prima-facie law. This act of weighing thus may support the following conclusion "one may in some cases denunciate one's neighbour for the authorities, since a statute demands this"; this conclusion is right only if the value of obedience to the law weighs more than the principle under consideration. Y I I I . Permissibility of Particular Action Passing to rights, let me state, at first, that simple rights are of three kinds: (1) permissions, (2) claims and (3) competences. "Rights to holdings" are clusters of 1, 2 and 3. Now, the following theses constitute a plausible interpretation (explication) of an analytic relation between permissibility of a particular action and duty: (3.1)
If, and only if, a reason exists supporting the statement that it is not the case that A ought to do not-H, then it is prima-facie permissible for A to do H.
Morality, Law and Rights
149
Moreover: (3.2)
If, and only if, reasons supporting the statement that it is not the case that A ought to do not-H override the norm " A ought prima-facie to do not-H", then it is definitively (all things considered) permissible for A to do H. I X . Claim
The concept "a right" is used, however, not only in the sense of permissibility but also to cover a claim. Let me start from a claim to another person's forbearance. One person has a right, or a claim, not to be exposed to (not to bear, non pati) a given action of another person. This claim corresponds to a duty of the other to forbear from a given action (non f acéré). For example, a person, A , has a right not to be molested in his home, and, all other people have a duty not to molest him 5 . In a similar manner, one can discuss a claim of a person to receive (or to accept) something ( accipere ); this claim thus corresponds to a duty of another to perform a positive action (facere). One may thus say: "a baby has a claim to be fed by its mother" 6 . When claim is interpreted in this way, the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (3.3)
If a person, A , has a claim that another person, B, does H , then Β has a duty to do Η
For example, the norm (2) "a baby has a claim to be fed by its mother" entails the norm (1) "The mother has a duty to feed her baby". The difference between the claim and the corresponding duty concerns something else as the normative content. Speaking about a claim or a right, one emphasises the grounds for the norm, its reasons, namely the interest of the person having the claim.
5 Cf. L. Lindahl , Position and Change, Dordrecht 1977, pp. 15 ff. on Bentham's corresponding concept. Cf. L. Petrazycki, Teoria prawa i panstwa w zwiazku ζ teoria moralnoéci, Warsaw 1959, vol. 1, pp. 103ff.; the first Russian edition of the book appeared in 1909. In Petrazycki's terminology, rights could not be "moral", but they could belong to the "intuitive law". For our purposes, the "intuitive law" may be identified with a part of morality. 6 Cf. Petrazycki , id.
150
Aleksander Peczenik
X . Competence The third kind of rights, besides permissibility and claims, consists of competences. A has a competence to create B's deontic (normative) position D if, and only if, A can bring it about that Β has the normative position D 7 . Consequently, the following equivalence is logically necessary: (3.4)
A has a competence to create B's deontic position D if, and only if, the following is true: if A performs an action, H , then Β obtains the position D. X I . Right to a Holding
Not only permissibility, claims and competences but also more complex entities, such as ownership, are called rights. Let me call them "rights to holdings" or "rights to a property", in the broad sense covering not merely ownership but all kinds of "rights to something", that is, rights to an object, material or ideal 8 . These composed rights can be analysed as complexes of permissibility, claims and competences. Let me take the concept of "ownership" as an example. For the sake of simplicity, let me approximately define ownership solely in terms of its direct normative consequences9. Let me also restrict the discussion to ownership of material objects, leaving out other complex rights 10 . One may now claim that the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (3.5)
A has the right to the property G with regard to the person Β if, and only if, - it is permissible for A to use the property G; and - A has the claim that Β does not interfere with A's use of G; and - A has competence to create A's own claim against the court, C, together with the duty of the court to perform a certain action directed against B's interference with A's using G; and - A has competence to perform an action, such as entering into a salepurchase contract, shaping B's normative position, D , with regard to the property G.
7 Cf. Lindahl (FN 5), pp. 212ff. 8 Cf. Alexy , Individuelle Rechte . . . (FN 2), pp. 6ff.: Rechte auf etwas. 9 According to a more complex analysis, e. g. by Alf Ross, On Law and Justice, London 1958, pp. 170ff., "ownership" is an "intermediate" concept. Its meaning is related to two clusters of norms, the first determining conditions of becoming an owner, the second prescribing legal consequences of being an owner. 10 Concerning complex rights in general, cf. Lindahl (FN 5), pp. 34ff.
Morality, Law and Rights
151
A set of permissions, claims and competences is thus unified into one right to a property. This unification makes it possible to modify each component of the set without changing the identity of the composite right itself 11 .
X I I . Sphere of Freedom How can a moral permissibility be justified? Let me divide the argument in two parts. 1) A t first, I will report the well-known arguments, according to which a sphere of freedom is justified, because it is necessary for action and communication. 2) Then, I will discuss the problem, how extensive the free sphere ought to be. Let me, at first, consider the relation between freedom and action . The fact that one's sphere of freedom is necessary for one's action supports the conclusion that one ought to have a sphere of freedom. The following intellectual steps elucidate this idea: (1) I do act intentionally, for my purposes. (2) A sphere of freedom to act for my purposes is a necessary condition of all my actions. (3) I ought to have what is a necessary condition of all my actions. (4) Consequently, I ought to have a sphere of freedom. (5) A l l people are similar in principle to myself. (6) A l l people are purposive agents. (7) A sphere of freedom to act for one's purposes is a necessary condition of all actions of anybody. (8) Anyone ought to have what is a necessary condition of one's actions. (9) Consequently, all people ought to have a sphere of freedom 12 . This justification includes two contestable steps: First, the assumption 3, constituting a step from the Is to the Ought, is open for criticism. To be sure, one can plausibly interpret the statement: "anyone has an all-things-considered right to what is necessary for one's capacity to act" as a meaning-postulate, characterising a possible sense of the concept of "a right" within our moral culture. A t the same time, one can plausibly regard this interpretation
11
Cf., e.g., I. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford 1980, p. 202. I have thus paraphrased Gewirth's steps according to W.D. Hudson , The TsOught' Problem Resolved?, in: Edward Reis Jr., Gewirth's Ethical Rationalism, Critical Essays with a Reply of Alan Gewirth, Chicago 1984, pp. 115ff.: I do X for purpose E. E is good. My freedom and well-being are good as the necessary conditions of all my actions. I have a right to freedom and well-being. A l l other agents ought to refrain from interfering with my freedom and well-being. A l l prospective, purposive agents have a right to freedom and well-being. I ought to refrain from interfering with the freedom and well-being of all prospective purposive agents. 12
152
Aleksander Peczenik
as too strong. But the much weaker statement "anyone has a prima-facie right to what is necessary for one's capacity to act" is certainly such a meaning postulate. Similarly, one can perhaps interpret the statement: "all things considered, anyone ought to have what is necessary for one's capacity to act" as a meaning postulate, characterising a contestable but possible sense of the concept of "ought". But the weaker statement "anyone prima-facie ought to have what is necessary for one's capacity to act" is certainly such a meaning postulate. Another justification of a sphere of freedom is based on requirements of human communication. In this context, let me follow Robert Alexy y s idea that a social order not taking individuals seriously, and thus - let me add - not recognising any sphere of freedom at all, cannot be justified in a rational discourse. One may thus reason in the following way. (I) Each participant of a rational practical discourse, in which one justifies norms, must take seriously the addressees of his argument. Otherwise the discourse would be impossible. Neither would it be possible to understand why a rational practical discourse is better than bribery and other kinds of emotional manipulation of people. One must thus assume that the other participants, in order to participate in the discourse, must be autonomous individuals, having a sphere of freedom. A society in which individuals do not have any sphere of freedom at all, though logically possible, is thus discursively impossible, that is, unjustifiable 13 . The following intellectual steps elucidate this idea: (1) I do discuss the problem of justification of norms with other people. (2) Such a discourse is possible only if I assume that other persons, participating in it, have a sphere of freedom. (3) Anyone ought to have what is a necessary condition of one's capacity to participate in the practical discourse. (4) Consequently, other people ought to have a sphere of freedom. But again, this justification includes a contestable step 3, from the Is to the Ought. One can plausibly interpret the statement: "all things considered, anyone ought to have what is necessary for one's capacity to participate in the practical discourse" as a meaning postulate, characterising a contestable but possible sense of the concept of "ought". Certainly, one can also regard this interpretation as too strong. But the weaker statement "anyone ought primafacie to have what is necessary for one's capacity to participate in practical discourse" is certainly such a meaning postulate.
13 Cf. Alexy , Individuelle Rechte und kollektive Güter, red at the Scandinavian Seminar of I V R , Frostavallen, August 1986, manuscript, pp. 32 - 34.
Morality, Law and Rights
153
(II) Each participant of a rational practical discourse, thus qualified as an autonomous individual, acts against his interest in preserving the autonomy, if he consents to establishment of a social order which does not recognise any sphere of freedom at all 14 . The following intellectual steps elucidate this idea: (1*) If I had consented to establishment of a social order which does not recognise any sphere of freedom at all of other people, I would have a small chance of may own sphere of freedom being accepted by others. (2*) Acceptance of my own sphere of freedom by others is a necessary condition of preserving my status as an autonomous individual. (3*) I ought to have what is a necessary condition of my preserving my status as an autonomous individual. (4*) I ought not to consent to establishment of a social order which does not recognise any sphere of freedom at all of other people. Once again, this justification includes a contestable assumption, that is the step 3*, from the Is to the Ought. One can plausibly interpret the statement "all things considered, nobody ought to consent to establishment of a social order which would destroy his status as an autonomous individual" as a meaning postulate, characterising a contestable but possible sense of the concept of "ought". Though one can also plausibly deny this interpretation as too strong, the much weaker statement "nobody ought prima facie to consent to establishment of a social order which would destroy his status as an autonomous individual" is certainly such a meaning postulate. X I I I . Permissibility-making Facts Now, how can one justify a particular permissibility-sentence? The abovementioned thesis (1.1) concerning the relation of prima-facie ought to the ought-making facts implies that if no ought-making fact (neither FiOa not-H nor F 2 Oa not-H nor, . . . nor F n Oa not-H) takes place, then no reason at all supports the conclusion that A ought prima-facie not to do H. One may thus claim that the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (4.1)
If no ought-making fact (neither FiOa not-H nor F 2 Oa not-H nor, . . . nor F n Oa not-H) takes place, then the norm " A ought prima-facie not to do H " cannot be correctly included in moral weighing.
One must keep in mind here that such an ought-making fact may be either moral (substantive), such as an increase of happiness etc., or legal, that is a socially established norm, expressing a prima-facie legal duty (cf. supra on the first inclusion thesis). 14 Cf. id.
154
Aleksander Peczenik
In any case, this means that, from a purely cognitive point of view, it is permissible for A to do H. One may then characterise the cognitive (propositional) aspect of moral permissibility, as follows: if no ought-making fact (neither FiOa not-H nor F 2 Oa not-H nor, . . . nor F n Oa not-H) takes place, then, from the cognitive point of view, it is permissible for A to do H. Independently from the primacy of liberty, one may base the answer to the question, What actions ought to be permissible, on a list of "permissibilitymaking" facts, such as basic human wants, needs, interests etc. Let the symbols FiPaH-F n PaH indicate theoretical statements about the "permissibilitymaking" facts that imply A's prima-facie permission to do H. One may then claim that the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (4.2)
If at least one permissibility-making fact (FiPaH or F 2 PaH or, . . . or F n PaH) takes place, then it is prima-facie permissible for A to do H.
For example, if H significantly increases chance of fulfilling A's need to survive, then A prima-facie may do H. I will return to the question what such facts are. A t this place, it is sufficient to conclude that there is a plurality of permissibility-making facts 15 . Moreover, one may claim that the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (4.3)
If the most important permissibility-making fact (F w PaH), justifying A's freedom to do Η , takes place, then it is, all things considered, permissible for A to do H.
Identification of a fact, capable to justify the permissibility of doing H , as the most important one, may mean several things. The interpretation chosen here is a very strong one, thus assuming that no other fact, nor a combination of facts, can outweigh the presence of the most important permissibility-making fact. X I V . Claim-making Facts Let me now pass to justification of claims. As said above (3.3)
if a person, A , has a claim that another person, B, does H , then Β has a duty to do Η .
The reverse implication is more complex. If, and only if, a person, B, has a duty to do H , and a "claim-making" relation between Β and another person, A , exists, then A has a prima-facie claim that Β does H. Sometimes a duty exists without a corresponding claim 16 . A n important question thus is, What 15
Cf. same, Individuelle . . . (FN 2), p. 3. Cf. Petrazycki (FN 5), pp. 70ff. Cf. Feinberg, Rights, Justice and the Bounds of Liberty, Princeton 1980, p. 144. 16
Morality, Law and Rights
155
relation between A and Β establishes A's claim? It is rather a complex cluster of relations. Let me mention two kinds of these relations, (1) the explicit or implicit content of the norm establishing both A's duty and B's claim; and (2) the fact that this norm is justifiable by B's claim. 1. The duty-constituting (legal or moral) norm may thus explicitly state that A's duty is related to B, for example the norm "a mother ought to feed her baby" states explicitly that it is the baby who is to be fed. The norm " A ought to keep his promises" together with the meaning of the word "promise" implies that there exists another person, B, who has the claim that A keeps the promises; a promise must be made to someone. 2. But a norm of the type "B has a duty to do H " may support a norm of the type " A has a claim that Β does H " , even though the first norm does not mention A at all. Assume that (1) Β has a duty to do Η and, at the same time (2) some "claim-making" relations between A and Β exist, justifying both this duty, the corresponding claim and the thesis that one has this duty because of this claim. Assume, e.g., that B's doing Η importantly increases the degree of fulfilment of A's wants, needs, interests or benefits 17 . This assumption implies three conclusions: (1) A has a prima-facie claim that Β does H ; (2) Β has a duty to do Η and (3) Β has a duty to do Η because A has a prima-facie claim that Β does H. One may thus conclude that the following thesis is a plausible explication of an analytic relation: (5.1)
If Β ought to do Η and at least one claim-making relation between A and Β (FibaH or F 2 baH or, . . . or F n baH) takes place, then A has a prima-facie claim that Β does H.
Moreover, one can formulate the following thesis. (5.2)
If Β definitively (all things considered) ought to do Η and the most important claim-making relation between A and B, F w baH, takes place, then A has, all things considered, a claim that Β does H.
This thesis assures derivation of A's claim from B's duty together with an estimate of importance of claim-making facts, the latter resulting from an act of weighing and balancing. One may also attempt an abstract and general justification of claims based solely on claim-making facts, without any mention of B's "correlative" duty. These facts are either independent of the law or created by the prima-facie law (cf. supra). Moreover, some of these complex facts have something to do with protected permissibility and correlative duties, but this information is not relevant in the present section.
17 But wants, needs, interests etc. are not identical with the rights they support; cf., e.g., K. Opatek, Prawo podmiotowe, Warsaw 1957, p. 302.
156
Aleksander Peczenik
In a similar manner as in the preceding sections, one may then express the following theses: (6.1)
If at least one of the claim-making facts (FiRabH or F 2 RabH o r , . . . , or F n RabH) takes place, then A has a prima-facie claim that Β does Η
and (6.2)
if the most important claim-making fact (F w RabH) takes place, then A has an all-things-considered claim that Β does H.
X V . Competence-making Facts One can also consider some theses relating competences with some competence-making facts. The theses are expressed with help of the following symbols. K p f a H b D means that a person, A , has a prima-facie competence to create through an action, H , another person's (B's) normative position, D. In other words, A can bring it about that another person, B, has a prima-facie normative position, D 1 8 . The symbols FiKaHbD - F n K a H b D thus indicate the facts that entail a prima-facie competence of A to do Η and thus create B's position D. (Again, these facts are either independent of the law or created by the prima-facie law). Consequently, these facts are meaningful reasons, capable of supporting the conclusion that there is a corresponding all-things-considered competence. The following thesis is thus a plausible explication of an analytic relation: (7.1)
If at least one competence-making fact, FiKaHbD or F 2 KaHbD or, . . . or F n K a H b D , takes place, then A has a prima facie competence to create B's normative position, D.
Moreover: (7.2)
If the most important competence-making fact (F w KaHbD) takes place, then A has an all-things-considered competence to create B's normative position, D. X V I . Complex Right-making Facts
One can develop similar theses as regards rights to holdings: (8.1)
18
If at least one complex right-making fact, FiaUG or F 2 a U G or, . . . F n aUG, takes place, then A has a prima facie right to the holding H.
For more details, cf. Lindahl (FN 5), pp. 212ff.
Morality, Law and Rights
157
Moreover: (8.2)
If the most important complex right-making fact (F w aUG) takes place, then A has an all-things-considered right to the holding H. X V I I . More About AU-Things-Considered Rights
I have thus separately discussed justifiable permissibility, claims, competences and rights to holdings. One must now consider the following question: Can these rights of different kinds collide with each other? If so, one must weigh them together. A t the prima-facie level, this is indeed the case. But not so at the level of definitive (all-things-considered) rights. Being definitive, the all-things-considered liberties, claims, competences and rights to holdings are a result of weighing and balancing, and cannot be subject to additional act of weighing. One must thus avoid contradictions between them in another manner. The best way to assure logical consistency is to cumulatively consider all liberties, claims, competences and rights to holdings each time one performs weighing in order to decide which fact is the most important permissibility-maker (F w PaH), or claim-maker (F w RabH), or competence-maker (F w KaHbD), or right-to-holdings-maker (F w aUG). This means that the theses (4.3), (5.2), (6.2), (7.2) and (8.2) are compatible because the content of the importance-indicating concepts, inter alia "the most important permissibilitymaking fact", "the most important claim-making fact", "the most important competence-making fact" and "the most important complex right-making fact", is mutually dependent and so defined that it assures logical consistency of the discussed theses. X V I I I . Conclusions One may conclude that the all-things-considered law constitutes a part of all-things-considered morality and that knowledge of this law presupposes a very complex act of weighing and balancing of several kinds of ought-, and right-making facts. Some of these facts are independent from the law, others are embodied in the prima-facie law. There is no weighing-free cognition of the definitive law, the definitive morality or the definitive rights. Neither is it possible to definitively replace this complex act of weighing and balancing by a series of mutually independent simple acts. One can, however, perform an analysis, showing what aspects are included in this complexity. In this way, one gains theoretical understanding and lowers the risk of forgetting something that ought to be included in the act of weighing.
Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty By Marek Zirk-Sadowski, Lodz 1. In the system of continental law a judicial decision is often blamed for normative novelty. What this adds up to is the statement that a new content was introduced to the system of law in the process of its execution, and not through the methods of creation accepted in a given legal system. Thus, in considering the problem of normative novelty our subject will be exclusively the relation of the contents of a norm or a group of norms included in a system to the contents of a judicial decision made on the grounds of these norms. 2. Since in legal discussions the concept of normative novelty appears in different contexts, our proposal is to differentiate, for the sake of this discussion, between axiological and logical types of normative novelty. Axiological normative novelty is strictly connected with the problems of interpretation of law. Normative novelty of this type results from different evaluative attitudes adopted by interpreters. As is known, in spite of the fact that there are factors which neutralize the influence of evaluative elements, every argument over the proper objective interpretation remains, nonetheless, an argument over values first of all. If two persons accept different ideologies of interpretation, then their evaluation of whether a decision is in accordance with the norm, can be different 1 . In such a situation one of these persons can raise the objection that the decision being evalutated introduces normative novelty. For us, this will constitute axiological normative novelty because it is connected with controversies over the interpretation of a legal norm, and these controversies result from different systems of values adopted by interpreters. To indicate who is right in such an argument, on the grounds of natural language, is actually almost impossible. That is why the term "normative novelty" applied in such cases, is, in fact, persuasive in character. Behind it is hidden an argument over the ideology of interpretation. Thus the philosophical problems connected with the axiological type of normative novelty constitute a version of the centuries-old argument between 1 J. Wróblewski, Sadowe stosowanie prawa/Judicial Application of Law, Warszawa 1972, p. 114 - 123. Idem, L'interprétation en droit: théorie et idéologie, Archives de philosophie du droit X V I I I , 1972; Idem, Meaning and Truth in Judicial Decision, Helsinki 19832, p. 80 - 103, 145sq.
160
Marek Zirk-Sadowski
cognitivists and anti-cognitivists. These problems have been presented quite well in our literature on legal subjects, and therefore in the further part of our considerations we shall focus our attention not on them, but on the philosophical aspects of logical normative novelty. We must add, however, that we shall deal with problems which reveal themselves in the perspective of analytical philosophy. 3. Logical normative novelty is possible when in an argument over the character of a decision D one ideology of interpretation is accepted, and, as a result of this, a given interpretation of a norm Ν is recognized as proper. What does the term "normative novelty" mean, then? It is obvious that we must be aware that neither logic nor any other science possesses methods by means of which all the doubts arising in this case could explicitly be cast aside. Therefore, we have two possibilities to choose. Firstly, we can speak about normative novelty in the language of classical legal discourse which means that we use arguments which every lawyer uses while judging a legal case. Secondly, we can try to make use of certain methods of logical analysis and confront them with empirical material. We say "confront" because the word "interpret" in a logical sense certainly would not fit here. In our considerations we shall choose the second possibility. It enables us to reveal psychological assumptions and that is the purpose of this paper. Since to solve a legal case is to formulate a proposition claiming deontic status for certain actions, now the problem is to express this case in a convenient form and to be able to compare its solutions - one made by a law-maker and the other - made by a court. To do this we shall use some analyses from the work "Normative Systems" by C.E. Alchourron and E. Bulygin, in fact, from the first part of it, where the logic of normative systems is formulated 2 . These considerations will be extended by conclusions resulting from the work "Meaning and Neccesity" by R. Carnap 3. A set of states of affairs or situations in which this action can take place will be called a Universe of Discourse (UD) 4 . The states of affairs which belong to U D are its elements. A l l the elements of U D share a certain property which is the defining property of U D . U D can be described as the set of all elements identified by a certain property. From among actions in whose deontic status we are interested while solving a given problem, we can distinguish so-called basic actions and the propositions by which they are expressed. The former are basic in the sense that all other actions are parts of them. The propositions by which they are expressed
2 3 4
C.E. Alchourron / E. Bulygin , Normative Systems, Wien/New York 1974. R. Carnap , Meaning and Necessity, Chicago 1947. Alchourron / Bulygin (FN 2), p. 10.
Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty
161
are the truth-functional compounds of basic actions i.e. such compounds in which the logical value of the whole proposition is a function of the logical value of its compounds. Any finite set of such basic actions will be called a Universe of Actions (in short U A ) . Every property divides the elements into 2 classes: the class of elements in which this property is present and the class of elements in which it is absent. If the negation of the property is its complementary property, hence for any property Ρ each element of the Universe of Discourse has either property Ρ or its complement ( - P). The presence of the property in an element of U D will be marked with + , e.g. + Z, and the absence of the property with - , e.g. - Z. Any set of properties which can be present or absent in the elements of U D will be called a Universe of Properties, in short UP. Every property of UP and every correct truth-functional compound made on the basis of these properties will be called a case. When a defined case is a conjunction of all the properties belonging to UP or their negation (but not both), we shall call such a case an elementary case. We shall call any case which is not elementary a complex case. The set of all elementary cases (corresponding with U D ) makes up a Universe of Cases, in short UC 5 . Since every property has got its complementary property, the number of possible elements of the UC set will equal 2 n , where η is the number of properties included in UP. The set of all possible cases will be called the factual range of the model. While the factual range of a model is determined by a number of possible cases, the normative range of the model will include all deontic characteristics of possible actions. In the logic applied here, the particular actions from U A can go with the following operators: P-permitted, O-obligatory, Ph-prohibited, F-f acuitati ve. Ρ is a primary operator because other operators are defined by means of it and functors of the proposition calculus6. A n action R is obligatory /OR/ when R is permitted and not-R is not permitted: OR = [(PR) · ( - Ρ - R)] A n action R is prohibited when not-R is not permitted: PhR = [(— PR) · (P - R)] A n action R is facultative when both R and not-R are permitted: FR = [(PR) · (P - R)] Expressions of the PR form and all non-tautological and non-contradictory truth-functional compounds of such expressions will be called solutions. Action within U A which is preceded with deontic characteristics will be called deontically determined. If a solution is of a type which determines all the 5 Ibidem, p. 12. 6 The problem of a normative range - cf. Aichourron / Bulygin (FN 2), p. 12 - 15. 11 Festgabe Opatek
Marek Zirk-Sadowski
162
actions included in U A , it will be called a maximum solution. The set of all possible maximum solutions will be called a Universe of Maximum Solutions, in short USmax. A solution which is not maximum will be called a partial solution. Thus USmax marks the normative range of a model. A deontic proposition correlates a certain solution (e.g. OR) with a certain case (e.g. (Z · C · K) : OR (Z · C · K)) In order to represent how the assumptions adopted here work, let us now assume that there is a system of 3 norms on the basis of which we could formulate the following deontic propositions: FS/(Z C K) N 2 : PhS/(- Z) · ( - C) N 3 : PhS/(- Z) . ( - K) So the model of a legal problem will be as follows: UP 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ζ
+
c
Ni 1 κ
-
+ +
+ + + +
+
-
-
-
+ -
+ +
+
-
-
-
-
-
FSI (Ζ · C'K) FS
N2 PhS/(~ Z) ·
N3 Q
PhS/(~
Z)
PhS
-
PhS
-
PhS
PhS
Now we shall discuss this model pointing to its basic properties: N i is a proposition which joins the maximum solution FS with the case Ζ · C · K. It is an elementary case marked with number 1, therefore FS determines only one level of the Universe of Cases. N 2 is a proposition which joins the maximum solution PhS with the case ( - Z) · ( - C). In contrast to the case we have come across in Ni, this one is a complex case because it is not made up of a conjunction of all properties belonging to UP or of their negations. Therefore PhS is a maximum solution for 2 elementary cases which include a complex case. They are marked by the numbers 4 and 8. N 3 is a proposition which joins maximum solution PhS with the case ( - Z) · ( - K). Like the case N 2 it is a complex case. The consequences of this fact are identical with those of N 2 , but the maximum solution goes with the elementary cases marked with numbers 6 and 8. After we have presented in general the logic of Alchourron and Bulygin, we shall try, on the basis of this logic, to present the concept of normative novelty. To formulate a deontic proposition three decisions must be made: first -
Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty
163
within U A , second - within USmax and third - within U D . The third possibility can be reduced to the choice within UP and UC because UP is the set of properties which can be present or absent in the elements of U D , and UC is the set of possible combinations of these properties. Having accepted the logical apparatus, presented above, now we shall formulate the conditions which two deontic propositions Νχ and N 2 must fulfil so that the deontic proposition N2 does not contain normative "novelty" in relation to the deontic proposition Νχ: 1. Considering USmax: Ν χ and N 2 in the same way deontically determine a specific action. 2. Considering U A : a) N i deontically determines an action which belongs to the class of actions defined in Νχ, b) or it deontically determines the same action 3. Considering UP: Νχ contains properties belonging to classes assigned by the properties defined in Νχ. 4. Considering UC: properties defined in N 2 make the same case as the properties in Νχ. These conditions are joined so the violation of even one of them brings about normative "novelty". For the time being we assume that everyone who has read those 4 conditions can intuitively understand their meaning. We shall analyse in detail the concept of class later on. A t present we shall briefly discuss the definition presented here. It assumes a definite relation between Νχ and N 2 . Νχ is a norm of a higher level in the sense of Kelsen's static system. It has been reflected in Condition 3, and partially also in Condition 2a). The definition refers to an intuition which our legal culture contains, and which is connected with executive acts. According to this definition, however, executive acts comprise, apart from legal acts i.e. the orders of the minister, the decisions of the court. Condition 1 of the definition is obvious. The deontic characteristics of the action assumed by us, do not differ as between a statute, the order of a minister or a court decision. It is always either P-permitted, O-obligatory, Ph-prohibited or F-facultative. Difference will appear only on the level of action which becomes deontically determined. This problem is connected with Condition 2. Condition 2 enables us to differentiate between "executing" of the statute by the order of a minister when Condition 2b) is fulfilled, and "executing" of the statute by a court decision when Condition 2a) is fulfilled. So it is in accordance with the statement that executive acts are general norms and the courts' decisions are individual norms. By the court decision we mean here an individual norm. In our legal culture we say that an executive act which does not fulfil Condition 2b) surpasses legal full powers, and that a court decision which 11*
164
Marek Zirk-Sadowski
does not fulfil Condition 2a) constitutes an infringement of law. Of course, the violation of Condition 2 is only one of many possible reasons for such claims. Violation of law can take place as a result of non-fulfilment of even one of other conditions. But both executive acts and the courts' decisions share these claims. In turn, Condition 3 is to reflect the opinion that an executive act, in a broad sense of the word, is only an extension of the legal act to a higher level. We shall define this condition more precisely when we make a more detailed analysis of the concept of a class. Finally, it must be said that Condition 5 is indispensable because, according to our definition of UP, the term "property" can mean the presence or absence of a property. We used here the term "property" and "complementary property". We must also notice that it is possible to ascertain that this condition is fulfilled only when the fulfilment of Condition 3 has been ascertained. It is the result of the relation between UP and UC presented above. In our graphic model of a legal case Condition 4 will be fulfilled as soon as the actions deontically determined, which belong to N i and N 2 are placed on the same level UC, e.g. 1 or 2 etc. Now we can discuss more precisely certain notions we have made use of in our definition. First of all we must analyse the problem of so-called classes and properties. In Frege's terminology, when a property and a class corresponding with it are discussed, two different expressions are used. This brings about several inconvenient inconsistencies such as e.g. the necessity of duplication of beings. Therefore we shall try to give a more detailed presentation of the notions of interest to us by using Carnap's distinction between extension and intension. These are tools of semantic analyses, which are analogous to the notions of property and class. However they are applicable in a more general way in different types of expressions, propositions and individual expressions included. Carnap creates a metalanguage which does not treat a property and a class corresponding with it as two different beings, but instead, as one being only. He assumes as a language object mainly symbolic languages, but at times also a natural language. This is very significant for us. In our considerations object languages are made of deontic propositions created on the basis of norms appearing in the solution of a given legal problem i.e. the norms included in normative acts and some court decisions. To be more precise, according to our model of a legal case, they will be the universes corresponding with our problem: U D , U A , UC, and USmax. We shall mark an object language with the letter S. It also contains functors of proposition calculus. Free variables: x, y etc, individual constants: a, b, c, etc, as well as quantifiers. Metalanguage M contains examples of propositions and other expressions of our object language, names (descriptions) and special semantic terms. We put
Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty
165
the name of the expression in quotation marks. Speaking generally about expressions, we use signs Uj, Uj for any expression, Zj, Zj for sentences. The term "proposition matrix" or "function" will be applied to expressions which either are propositions or are made up of them after individual constants have been replaced by free variables. If a matrix contains any number of free cases of η variables, we can say that it is of η degree. A proposition consisting of the n-argument predicate followed by n-individual constants is called an atomic proposition, e.g. Pb. Now we shall present the rule of truth for atomic propositions. A n atomic proposition S consisting of a predicate and individual constant is true if and only if the individual to which the individual constant refers possesses a property to which the predicate refers. So here we refer directly to reality. On this basis we shall formulate the rule of truth for disjunction and material equivalence. The proposition Zi Zj is true in S if and only if at least one of its components is true. The proposition Zi Zj is true if and only if both components are true or false. The equivalence is defined here on the grounds of the notion of logical value, unlike in colloquial language where it is understood as the identity of meanings. We shall call it, after Carnap, L-truth. The notion L-truth is defined here as explicatum of what philosophers call logical truth, or necessary or analytical truth. Speaking most generally, a proposition in the semantic system is L-true if and only if semantic rules of the system are sufficient to establish its truth. A class of propositions in S which for each atomic proposition contains either this proposition or its negation but never both at the one time, and no other propositions, is called a state description of a possible state of Universe of Individuals concerning all properties and relations expressed by the predicate of the system. A proposition occurs in a given state description - which means that it would be true if the state description were true. The idea of state description is analogous to the notions U D , UP, UC applied in our model. The definition of L-truth must, therefore, assume that a proposition is L-true in the semantic system if and only if Ζ is true in S in such a way that its truth can be established on the basis of semantic rules of the system S without any reference to extralinguistic facts. Thus the definition of L-truth will be as follows: proposition Zi is L-true (in S) Zi occurs in every state description in S. Then: Zj is L-false (in S) ** - Zi is L-true. Zi L-implies Zj (in S) ^ proposition Zj —» Zj is L-true. Zi is L-equivalent Zj (in S) & proposition Zi = Zj is L-true. Zi is L-determined (in S) ^ Zi is either L-true of L-false.
166
Marek Zirk-Sadowski
So it results from the definitions given above that Zj is L-false if and only if Zi does not occur in any state description. Zi L-implies Zj if and only if Zj occurs in each state description in which Zi occurs, whereas Zi is L-equivalent to Zj if and only if Zi and Zj occur in the same state descriptions. Carnap also distinguishes the idea of a factual proposition for which there exists at least one state description in which it occurs and at least one in which it does not occur. He formulates the concept of F-truth and F-falsness, F-implication, F-equivalence. However, we are interested only in the concept of L-truth because - as we have already said - it enables us to define equivalence on the basis of identity of meanings, e. g. in the way that it is done in colloquial language. Equivalence so defined will be used between different kinds of designators. The notion of designator is understood in this method very widely: it comprises propositions, predicates (i.e. predicative expressions in a wide sense, classes of expressions included), functors and individual expressions. The term "designator" does not mean that these expressions are the names of any beings, but only that they have independent meanings, which originate from the way they participate in making up the proposition in which they appear. So propositions have always meaning of the highest degree of independence. We shall also extend the notion of a symbol = which we shall apply not only between propositions, but also between designators of the same type. Now, on the basis of the concept of truth and L-truth, we shall introduce the terms "intension" and "extension". The definition of extension: two designators have the same extension (in S) ftf they are equivalent (in S). The definition of intension: two designators have the same intention (in S) they are L-equivalent (in S). It is easy to notice that expressions "have the same extension'Vintension/", though they refer to certain beings, do not create any new beings because they are based on the definitions of the terms "equivalent" and "L-equivalent" which, further, reduces them to the terms "true" and "L-true". This can be precisely defined in S. Thus finally these terms are relative to a certain language. Now we shall define the conditions of identity for the predicates of propositions. We shall not deal with individual descriptions because we analyse the problem of normative novelty for deontic propositions which do not contain descriptors of this type. Whereas when we talk about the court's decision we mean that element of the decision which contains the formulation of a legal basis for the decision. To explain the problem connected with such characteristics of a predicate we must make some remarks concerning the logical term "property". By "property" Carnap means everything what can be said sensi-
Philosophical Aspects of the Problem of Normative Novelty
167
bly, truthfully or falsely about any individual. On the other hand, property does not mean anything what refers to language expressions, e. g. to the word "human"; in such a case we apply the term "predicate". The concept of property is usually accompanied by the concept of class e. g. the property of being human has its counterpart in the class of human beings. However, class is always a set of certain elements distinguished by a certain property. For Carnap the extension of the predicate of the first degree is the class corresponding with it, and the intension - the property corresponding with it. Predicates are equivalent when classes corresponding with them are identical, i. e. when, with the help of only logical means and without any reference to facts, we can indicate what when anything has one property, it also has another one - and vice versa. In turn, we shall define extension and intension of propositions. Extension of a proposition is its logical value. So we apply the term "extensional" for the truth-functional compounds, i. e. for such compounds in which logical value of the whole proposition is a function of logical values of its compounds. We applied this term while characterising the model of a legal case. The intension of a proposition is the logical judgement expressed by it. Now we shall introduce the concept of intensional structure. If the compound expressions A and Β have the same structure (i.e. they are isomorphic), whereas the elements of those expressions corresponding with each other are L-equivocal, then A and Β have the same intensional structure (in other words: they are intensionally isomorphic). The concept of isomorphy is the same as in the theory of relations. If A and Β are simple expressions, we say that they are intensionally isomorphic as soon as they are logically equivalent. On the basis of the considerations presented above, we shall define a more precise definition of normative novelty. It should be recapitulated that normative novelty is defined for each universe separately, that is why the term " N i and N 2 " , applied in the definition, stands for the part of a deontic proposition corresponding with a given universe. Deontic proposition N 2 is normatively novel in relation to deontic proposition N i when one of the three conditions mentioned below is violated: 1. Considering USmax - N i and N 2 have the same intensional structure 2. Considering U A : a) a descriptor defining the action deontically, determined in N 2 in L-equivalent to one descriptor of the same type, which defines the action belonging to the class marked in N i b) Ν ι and N 2 have the same intensional structure, and if they are simple expressions they are L-equivalent 3. Considering UP - a predicate defining the property included in N 2 is L-equivalent with all predicates defining the properties which belong to the class marked in N i
168
Marek Zirk-Sadowski
4. Considering UC - N i and N 2 have the same intensional structure, and if they are simple expressions they are L-equivocal In conditions 2b) and 4 there is a remark about simple expressions. Our explanations of U A and UC justify such an additional condition. We only want to remark that with UC such a situation occurs when we deal with some complex cases, e.g. - Z. The problem of belonging to a class has been explained by the concept of an element of a set. The definition given above avoids elements of evaluation by introducing the concept of universe and L-equivalence. Consequently, the evaluative elements are transferred to the phase of construction of the object language, speaking more precisely - to particular universes. They result from the interpretation of particular legal acts. 4. So we have at our disposal a definition of normative novelty which does not contain any evaluative elements. However, it does assume the existence of agreement as to the meaning of the norms in question. It is the condition which must always be fulfilled to make it possible to say that any "legal norm" contains the element of normative novelty in relation to another one. Everyone who formulates the problem of normative novelty must accept this requirement. Actually this is quite a rare situation. Usually a discussion does not reach the level demanded for bringing a claim of normative novelty. It is necessary always to investigate whether the claim of normative novelty is not a persuasive expression which covers an argument over interpretation. As is well known, it is impossible to establish generally accepted limits of interpretation, if we assume a paradigm of the theory of law which does not allow of evaluative judgements that are not relativistic. Such a phase of discussion in which the claim of normative novelty can appear is very rare because of the following conditions: a) agreement as to the interpretation of norm N, b) indication of a concrete logical method of semantic analysis and a definition according to it of a concept of "a new content", c) comparison of the contents of deontic propositions made on the basis of norm Ν and decision D.
I I I . Direktiven und Normen in rechtsontologischer Perspektive
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered By Jes Bjarup, Aarhus I . Introduction In this paper I mean to pay my tribute in honour of Professor Kazimierz Opalek by reconsidering the meaning of the problem of "directive meaning". This problem has also engaged Opalek in his contribution to A l f Ross "The Problem of 'Directive Meaning'" as well as in his other writings, where he has offered his analysis and solution of the problem 1 . According to Opalek this solution also means that there is room for further research within jurisprudence and social science. Opalek's accomplishment has, if I am not mistaken, meant a great deal to his readers. What Opalek suggests by using quotation-marks around "directive meaning" is that the problem is a question about meaning, carrying the assumption that there is such a thing which will "encourage us in our search for 'the directive meaning', hinting, as it were, at its existence - an existence which sometimes is denied altogether" (406). Opalek affirms the existence of directive meaning, and I shall consider his solution in section 4. But I shall also wish to argue how this problem has emerged to face lawyers. My thesis is that the problem of "directive meaning" is generated by a specific theory of linguistic meaning, that is to say the positivist theory of meaning based upon the principle of verifiability. In order to substantiate this thesis, I submit it is necessary to consider the prevailing philosophical traditions at the time of Opalek's writings. This is a large subject, and I shall only present an account of what is known as "The Vienna Circle" or "Logical Positivism" in section 3. This philosophical movement is, in turn, important, not only for the problem of "directive meaning" but also for understanding the meaning of Opalek's article and his intentions in writing it. I shall try to present, in section 2, an account of the relation between an author's intention and the meaning of his
1 Kazimierz Opalek, The Problem of "Directive Meaning", in: Liber Amicorum in Honour of Professor A l f Ross (ed. Mogens Blegvad, Max S0rensen, Isi Foighel, J0rgen Trolle og. A Vinding Kruse), K0benhavn 1969, p. 405 - 422.1 shall refer to this article with pages in brackets in the text. This article forms the substance of Ch. 1, "Einführung in die Problematik der direktiven und normativen Bedeutung" in: Kazimierz Opalek, Theorie der Direktiven und der Normen, Forschungen aus Staat und Recht, 70, Wien 1986.
172
Jes Bjarup
text. This approach makes it possible to arrive at the conclusion that Opalek can be classified as belonging to a leading tradition within jurisprudence, that is legal positivism in one sense of that expression, viz. "the branch concerned with conceptual analysis of legal language used in legal rules or in legal writings about legal rules" 2 . A l f Ross also belongs to this tradition. What I wish to argue, in section 4, is that the solution offered by Ross and by Opalek to the problem of "directive meaning" is based upon a confusion between the meaning of legal norms and the effect of legal norms. It is a confusion between logic and psychology which leads to the view that legal norms is a matter not of argument but of psychological pressure, and legal discourse is a matter not of reasons but of efficacious manipulation. The implication for legal science is that it cannot be a study of the understanding and justification of legal norms, but rather that legal science is an empirical study of people's behaviour, aiming at establishing causal relations between legal norms and their effects on people. I wish to suggest, by way of conclusion, that there is room for another view of jurisprudence and legal science. I I . Intention and Understanding Opalek is concerned to present an analysis of the meaning of "directive meaning", his intention in writing is to further the understanding by presenting an adequate characterization of the meaning of the words "directive meaning". This raises the issue how this meaning of "directive meaning" may be established. It also raises the wider issue of how to establish the meaning of Opalek's text. As I see it, these issues are connected. There is, I submit, a connection between Opalek's intentions in writing an article about the problem of "directive meaning" and the meaning of his article. I shall try to substantiate this connection in what follows. Opalek's intentions and the meaning of his text raise the issue between an author's intentions and the meaning of his text. This issue is related to the use of the word "mean". There are many uses of this word, as my remarks in section 1 suggest. Following the analysis of J.L. Austin and John R. Searle I think it is important to distinguish between (a) the meaning of words and sentences which is a matter of linguistic rules, (b) the various acts performed by a speaker speaking and using a language, e.g. illocutionary acts and their force, as well as their propositional content, and finally (c) the effects such acts have on the actions, thoughts or beliefs of a listener, i.e. the perlocutionary acts and their force or effect 3. The importance of distinguishing between (a), (b), and
2 Cf. H.L.A. Hart , The Concept of Law, Oxford 1961, p. 253. And see Kazimierz Opalek , Der Begriff des positiven Rechts, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Bd. L X V I I I (1982), p. 448 - 462, for a discussion of other senses of this concept.
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
173
(c) is that this makes it possible to distinguish between at least three different senses of the word "mean" which have become entangled in the theoretical discussions about understanding the meaning of a literary text 4 . This may also be relevant for understanding the meaning of legal norms, which raise the issue of "directive meaning", considered in section 4. There is, first, the question "what do sentences, or specific words, mean in a given text?" In order to answer this question it is a moot point whether or not it is legitimate to consider the author's intentions. It is often claimed that to consider the author's intentions is tantamount to commit what is called the intentional fallacy of seeking the meaning of sentences and words in the motives and intentions of the author. This is a fallacy because it is not necessary to inquire into the author's motives or intentions in order to understand the meaning of his text. What is relevant is solely the text, which contains all the information we need to know. Indeed, the author's intentions are embedded in the text, so it is not legitimate to consider any factor outside the text, be it the author's intentions or motives for writing. The rule for interpretation underlying this approach is that any interpreter must focus on the text and only on the text 5 . According to this rule an understanding of Opalek's intentions in relation to the meaning of "directive meaning" is not relevant. I shall return to this in section 4. There is a second sense of the word "meaning", which is applied if the question is put "what does this work mean to me?" To answer this question it is clearly irrelevant to consider the author's intentions, since the question is concerned with the perlocutionary effects of the text, that is to say the reader's opinion, and this opinion can be settled independently of any consideration of what its author may have intended. Thus Opalek clearly intends his article as a work within philosophy to be taken seriously by students. Whether or not it is taken seriously by students is solely a matter of what they.believe. And it is obviously a mistake to suppose that a knowledge of Opalek's motives and intentions could ever supply a standard for judging the merit of his work. Its merit depends solely on whether it succesfully solves the problem it poses, or as Thomas Hobbes says, "It is not the credit of the Author, nor the newness of the work, nor yet the ornament of the style, but only the weight of Reason, which recommends any opinion to . . . Favour and Approbation" 6 . And, it
3 J.L. Austin , How to do Things with Words (ed. J.O. Urmson), Oxford 1962; John R. Searle , Speech Acts, 1969. - 1 have not been able to consult John R. Searle , Foundations of Illocutionary Logic, Cambridge 1985. 4 See Quentin Skinner , Motives, Intentions and the Interpretation of Texts, New Literary History, vol. 3 (1971), p. 393 - 408, to which I am indebted in what follows in the text. 5 See Julius Stone, Legal System and Lawyer's Reasonings, London 1964, p. 32f., for an application of this rule to understanding the meaning of legal norms. For a discussion of this rule and the difference, if any, between an author's motives and intentions, see Skinner (FN 4).
174
Jes Bjarup
may be added, whether Opalek's contribution means (i.e. implies or supports) other kinds of inquiries, is also an issue which can be settled independently of Opalek's intentions. Does Opalek's intention then matter at all? The answer to this question is affirmative. Opalek's intentions matter if the third sense of the word "meaning" is taken into account. This is the sense used to put the question "what does a writer mean by what he says in his text?" In order to answer this question it is relevant to consider the author's intentions. Thus, it is relevant to consider his illocutionary acts and their force, as distinct from the meaning of sentences and words used by the author (the first sense of the word meaning) to perform such illocutionary acts. Surely, it is important in trying to understand Opalek's article correctly that this article is meant (i.e. intended by Opalek) as a philosophical article which defends a particular philosophical position concerning the meaning of "directive meaning". Thus, there is an equivalence between Opalek's intentions, his illocutionary acts, in writing and the meaning of what he writes, and his published article as a jurisprudential contribution. If this is accepted, then the rule of interpretation mentioned above p. 173 must be modified. It is true that we must focus on the text, but it is not true that we must focus solely on the text. It is also necessary to focus on the author's intentions, i.e. his illocutionary acts, in order to be able to interpret and understand what the author means by what he writes in that particular way. This, in turn, raises the question whether there are any rules of interpretation concerning how to establish an author's intentions. This is a difficult question, and I shall only endorse Quentin Skinner's opinion that there is at least one such rule, to the effect of considering the prevailing conventions governing the treatment of the issues with which a given text is concerned. The foundation of this rule is to be found in the fact that any writer must be engaged in an illocutionary act, the force of which is to communicate something. This implies that whatever intentions a given writer may have, there are also, as a matter of fact, conventional intentions. These conventional intentions exist as recognizable intentions as to how to understand a given text or to contribute and treat some particular theme, how to conduct an argument, or to uphold some particular position. These conventional intentions are important for the interpretation and understanding what a specific writer may have been doing in using some particular way of expressing himself in writing, or again by using some particular concepts and arguments since the conventional intentions establish a framework within which an author may perform various illocutionary acts. Thus, to summarize this section: Opalek's intentions must be con-
6 Thomas Hobbes, De Cive (ed. Howard Warrender), Oxford 1983, The Epistle. Dedicatory, p. 27f.
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
175
sidered if a reader wishes to understand his article and, more generally, his works within jurisprudence. If we wish to interpret and understand what Opalek is doing when he considers the meaning of the concept of "directive meaning", then it is necessary to consider the nature and range of illocutionary acts performed by other writers using that concept. That is to say we need to consider the prevailing conventions governing the treatment of this concept. Thus, in other words, it is necessary to place Opalek's article within the context of the prevailing philosophical discussion. I I I . The Philosophical Context of Opalek's Article My claim is that what Opalek means in writing his article depends upon his intentions, that is to say the illocutionary acts he performs in writing, which structure his presentation and argument. The key to understanding his intentions is to consider the context of the prevailing conventions of philosophical argument. I leave aside that one of Opalek's intentions, or one of his illocutionary acts, is to offer a tribute to A l f Ross. This illocutionary act does not have any propositional content. Another of his intentions is to contribute to the philosophical debate, and this illocutionary act does have a propositional content, that is to say the propositions put forward by Opalek concerning the meaning of "directive meaning". The significance of this illocutionary act is that this makes it possible to establish that the article is to be understood as a philosophical article. And further that Opalek's illocutionary act is related to the prevailing conventions of how to perform illocutionary acts of philosophical argument at the time of his writing. This is important for Opalek, partly for the reason that these conventions may influence his decision as to what is the character of philosophical problems, partly for the reason that these conventions also may influence the way to solve such problems. It goes without saying that Opalek's decision as to what deserves to be studied, and by what methods, is his own decision. This is a common-place, and my point does not deny it. My point is rather that this decision is related to the current philosophical framework since it establishes as the criteria for communication and understanding. And it is important, finally, to consider this framework in order to understand Opalek's position. Thus, to understand Opalek's position as a philosophical position it is necessary to consider the framework or conventions concerning the nature of philosophical problems. This is a large subject-matter, but in the 20th century, one dominant trend was established in Vienna in the 1920s. This is known as the "Vienna Circle" 7 . Its leader was Moritz Schlick, who saw the goal of philoso-
7 See John Passmore, A Hundred Years of Philosophy, Harmondsworth 1968, for an overview of various philosophical trends, and especially Ch. 16. Logical Positivism.
176
Jes Bjarup
phy, not in the traditional way as acquiring knowledge and presenting this knowledge in a system of propositions, but rather as the application of a method, aiming at the understanding of the meaning of sentences and concepts, and the meaning of questions of the special sciences and of everyday life. Still philosophy, thus conceived, is related to a philosophical tradition, since it resembles the method of Socrates who strove to clarify the concepts and ordinary modes of expression in his conversations 8. In 1929 Schlick was welcomed back from a visit to the United States by a manifesto, prepared by Rudolf Carnap, Hans Hahn and Otto Neurath, bearing the title "Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis". Another name for this scientific world view is logical positivism. Rudolf Carnap stressed in his critique of traditional philosophy that philosophy must be seen only as a branch of logic. Carnap was followed by other logical positivists, and in a way they departed from Schlick, who thought that it was a mistake to set up a "scientific philosophy" and separate it from the philosophical tradition. The philosopher, in Schlick's view, is not a sage, but he is still a philosopher, actively engaged in seeking for meanings of expressions by applying the principle of verifiability as a means of clarification whether philosophical questions are answerable or not. By contrast, Carnap rejected all philosophical questions, whether of metaphysics, ethics or epistemology. The philosopher must be seen as a logician. What remains for philosophy "is not statements, nor a theory, nor a system, but only a method: the method of logical analysis"9. The negative application of this method is to eliminate meaningless words, sentences and pseudo-problems. The positive application is to serve to clarify meaningful concepts and propositions and lay the foundations for logics, mathematics and science. Thus philosophy is "scientific philosophy" to be defined in relation to science, as "the logic of science". It was this conception which prevailed, constituting a turning point in philosophy. Thus on the one hand logical positivism makes a break with the past philosophical traditions, especially of German idealism, and on the other hand it inaugurates a specific view concerning the nature of philosophical analysis in future. Philosophical analysis, thus conceived, is concerned with an investigation of the meaning of sentences using the principle of verifiability to establish the cognitive content of propositions expressed by using sentences as a vehicle of
8 Moritz Schlick, L'École de Vienne et la philosophie traditionelle, Paris 1937, quoted from Bela Juhos, Moritz Schlick, in: The Encyclopedia of Philosophy (ed. Paul Edwards), New York 1967, Vol. 7, p. 319. 9 Rudolf Carnap, Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache, 1932, quoted from The Elimination of Metaphysics through Logical Analysis of Language (transi. A . Pap), in: Logical Positivism (ed. A.J. Ayer), Glencoe 1959, p. 77.
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
177
communication. The principle says that the meaning of a sentence is given by the procedures of verification. Thus in order for us to distinguish between meaningful and meaningless sentences we should use this principle which refers to procedures for verification. There are two such procedures, which tally with whether the sentences are used to express analytical propositions or synthetic propositions. A n analytical proposition is meaningful and true in virtue of the logical form and the definition of the constituent words. This procedure is used within mathematics and logic. Mathematical and logical truths hold necessarily in every case, and consequently they say nothing about the way the world is. Thus these truths can be known a priori, and the procedure of verification is the appeal to self-contradiction. By contrast, sentences used to express synthetic propositions say something about the world. A synthetic proposition has, if meaningful, a factual content, and its truth-value is provided by applying the proper procedure of empirical inquiry, that is to say observing if there are possible, not necessarily actual but in principle, circumstances which, if they do occur, will definitely establish the truth of the proposition. Thus the meaning and the truth of synthetic propositions are related, making room for empirical science based upon the solid foundation of senseexperience, and excluding metaphysics as a string of sentences devoid of meaning. The battle against metaphysics is a prominent theme within logical positivism. A similar intrasigent attitude towards metaphysics has been adopted by other philosophers. Hobbes, for example, also proceeds on the basis of a theory of meaning of language, and rejects "Métaphysiques" 10 . The reason why is "that which is there written, is for the most part so far from the possibility of being understood, and so repugnant to naturale Reason, that whosoever thinketh there is any thing to bee understood by it, must needs think if supernaturall". This recalls, I think, Carnap's dismissal of Heidegger's philosophy as meaningless. Further Hobbes argues against the traditional schools of philosophy "set forth in senseless and insignificant Language" where "the Method of Reasoning is nothing else but Captions of Words, and Inventions how to puzzle such as should goe about to pose them". For Hobbes, this "Vain Philosophy" must be put aside in order to make room for "True Philosophy" or science that is to say a search after "generali, eternali, and immutable truth" acquired by reasoning as distinct from prudence as knowledge gained by experience. Hobbes also wishes to replace the prevailing "Morali and Civili Philosophy", which is nothing but "absurdities", by a true philosophy. Indeed, Hobbes claims that "politics and ethics (that is
10 Thomas Hobbes, Leviathan (ed. C.B. MacPherson), Harmondsworth 1968, Part I V . Ch. 46, "of Darknesse from Vain Philosophy, and Fabulous Tradition", Quotations in text are found at pp. 689, 686, 672.
12 Festgabe Opalek
178
Jes Bjarup
the sciences of just and unjust, of equity and inequity) can be demonstrated a priori, because we ourselves make the principles" 11 . In this respect, the logical positivists adopted a completely different position. It seems to me to be worth noticing that the theory of meaning adopted by the logical positivists is tied to bolster empiricism as a theory of knowledge. Thus the tautological character of logical and mathematical truths makes it possible, as Carnap writes, "for the first time to combine the basic tenet of empiricism with a satisfactory explanation of the nature of logic and mathematics" 12 . Moral propositions, however, present a difficulty. Any world of values existing apart from the world of experience must, of course, be rejected as another piece of metaphysics, since there is no possible way of verifying that there is, or there is not, another world independent of our experience. So we are left with the world of our experience, looking for values. Within this world it is, of course, possible to take an interest in moral and political questions, but science can offer no answers to the human predicament concerning values. This is so because moral sentences do not express propositions at all. Moral propositions are neither analytical nor synthetical (i.e. empirical) propositions, and since this dichotomy is exhaustive, moral sentences must be interpreted and understood as an expression of feelings or wishes. As Carnap writes concerning the value proposition "killing is wrong", it has "the grammatical form of an assertive proposition. . . . But actually a value statement is nothing else than a command in a misleading grammatical form. It may have effects upon the actions of men, and these effects may either be in accordance with our wishes or not; but it is neither true nor false. It does not assert anything and can neither be proved nor disproved" 13 . Moral philosophy can only be a genuine discipline if it is concerned with the analysis of moral sentences and moral concepts, i.e. a meta-ethical inquiry as distinct from empirical and historical inquiries into the phenomena of morality. The same holds for legal philosophy or jurisprudence, which is also a meta-inquiry which asks and provides answers to logical, epistemological and semantical problems. This is the prevailing convention of philosophical argument, if the position of logical positivism is adhered to. It is precisely this position which generates "the problem of 'directive meaning'", which is the subject-matter of Opalek's article, and which he says is "discussed in ethics (in connection with philosophy and logic sensu largo, including semiotics), and in legal theory" (405). This is true if the writer adheres to logical positivism. But 11
Thomas Hobbes, On Man, in: Man and Citizen (ed. Β . Gert) 1971, Ch. X , Sec. 5, p. 42. 12 Rudolf Carnap , Autobiography, in: The Philosophy of Rudolf Carnap (ed. P.M. Schilpp), London 1963, p. 47. 13 Rudolf Carnap, Philosophy and Logical Syntax, London 1935, p. 24.
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
179
there is not necessarily a problem for a writer who is not committed to logical positivism. Thus I believe I have substantiated my claim that in order to understand the meaning of Opalek's article it is necessary to consider the prevailing framework of philosophical arguments put forward by logical positivists. This framework is also important for the understanding of Opalek's position since it is possible, of course, for a writer to try to change the framework or prevailing conventions of philosophical argument, or working within a framework to present a novel solution. It is precisely by knowing and presenting the framework of logical positivism that it becomes possible to ask questions about Opalek's contribution to the jurisprudential discussion.
I V · The Problem of "Directive Meaning" I have considered what Opalek means, that is his intentions in writing, and the meaning of what he writes, that is what Opalek meant by writing, in relation to the framework of logical positivism which provides a form of explanation for why Opalek's article must be seen as a contribution within meta-legal thinking or legal positivism. And it also explains why he thinks that there is a problem concerning the meaning, i.e. the sense and reference, of legal - and moral - sentences, expressing "'norms', sometimes 'rules', 'directives', etc." (405). Thus, for Opalek, the inquiry is concerned with "the study of directives (or, more strictly, norms)" and "the semantic properties of these expressions" which he calls 'directive meaning' (406, 405). Although Opalek thus identifies the subject-matter of his study, he does not explicitly state the method to be used in the analysis. In this section I shall argue that Opalek - like Ross uses the method put forward by the logical positivists, that is to say the principle of veriflability. This principle of meaning is tied to support empiricism and one way of using sentences, that is to make factual propositions with a cognitive content which can be known to be true or false by observing the world. This is also the starting point for Opalek's analysis, based upon "the model of 'cognitive meaning'" he "confront(s) directive statements with the model of this meaning. It seems advisable, as most attempts at constructing other kinds of meaning (directive, evaluative, etc.) in some way or other refer to this model" (407). My question to Opalek is why it is advisable to use this model? As Opalek's own analysis shows, this model presents difficulties in relation to other uses of sentences, e.g. giving commands or asking questions. To illustrate by taking Opalek's own example: "The statement (1): "Directive 'Peter ought to be shutting the door' is true" is questionable as to its meaningfulness, contrary to the statement (2): "Statement 'Peter is shutting the door' is true" (408, my numbering). Why is this questionable? The answer is that statement (1) is a directive which lacks any truth-value, consequently its meaningfulness cannot 12*
180
Jes Bjarup
be a set of truth-conditions. By contrast statement (2) has a truth-value, consequently its meaningfulness can be said to be a set of truth conditions. Questions have no truth-value either. Thus by a similar argument, the statement (3): "Question 'Is Peter shutting the door?' is questionable (i.e. doubtful) as to its meaningfulness". According to Opalek's position, it is the knowledge of truth-conditions which constitutes the meaningfulness of statement (1). But, if this is the case, how is it possible to explain the obvious relation of meaning between statement (1) and the question put in statement (3)? The question has no truth-conditions, yet the meaning of the two statements is clearly related since anyone, knowing English and its grammar, will, if he understands the statement (2) as meaningfull, also understand the meaningfulness of statement (3). Why is it the case that the meaningfulness of statement (1) is doubtful? So far, as I can see, this statement (1) is not questionable as to its meaning, since it is easily understood by anyone speaking English. Its meaning is only questionable if the model of cognitive meaning put forward by logical positivists and adhered to by legal positivists, such as Opalek or A l f Ross, is adopted. And why is this model adopted? The answer is that this model is taken as the only framework for a proper philosophical discussion, cf. above section 3. This is, however, questionable, since this model of cognitive meaning is incapable of explaining and understanding the relations of the meaning (sense and reference) of words and sentences that pertain when sentences are used to perform various functions. Like any theory, a theory of meaning is acceptable on the basis of its explanatory utility. The question is: What is a theory of meaning supposed to explain? Putting a question implies, if it is a genuine question, that we want to find an answer, and this in turn implies, that we know what to look for, which will count as a relevant answer, and some idea of the method by which it can be established whether the relevant answer is true or false. According to the logical positivist, we wish to know which sentences are used to express propositions, which have truth-value based upon observation of the way the world is. The method to be used is the principle of verifiability, identifying the question: "What does the statement 'Peter is shutting the door' mean?" and the question: "What must one do to discover whether the statement 'Peter is shutting the door' is true?" The objection is that the meaning of a sentence is not identical with verification. The understanding of the meaning of sentence, i.e. what it is used to express, e.g. a proposition, must be prior to the investigation of whether the proposition has any truth-value, and cannot be defined in terms of the possibility of such an investigation. But it is true that the meaning of a sentence involves verification. Another question is whether this verification can be brought about only by observation. In this respect there may be a difference between (a) the meaning of sentences used by legal scientists to express propositions about legal norms (i.e. normative propositions) and (b) the meaning of sentences used by legal authorities to express legal norms or directives. Ross, for example,
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
181
makes this distinction between (a) and (b). I am not sure whether Opalek makes it. The distinction is important for Ross since he is primarily concerned with the analysis of (a) in contrast to (b). The legal norms (b) are for Ross to be analyzed as directives, defined as "utterances with no representative meaning but with intent to exert influence" 14 . To claim that legal norms have "no representative meaning" is equivalent to the claim that legal norms are "without logical meaning". Legal norms as directives are "metaphysical utterances devoid of any cognitive meaning". To be sure they have "normative", "directive" or "emotive" meaning. The only point, to use a remark by Opalek, "which is not clear is what it consists in" (418). The answer is "considerations about their functions", as Opalek suggests (416). This is Ross' position. What is clear then is that Ross, following Stevenson's analysis, commits the fallacy of confusing the question of the meaning of legal norms with the - quite different - question of the effect or function of legal norms. It is a confusion between the illocutionary force of a legal norm and its propositional content on the one hand and its perlocutionary effect on the other hand. This confusion is, in turn, important for the analysis of normative statements, made by legal scientists. Both Ross and Opalek adopt the logical positivists' view formulated by Carnap. For Carnap "the task of philosophy is semiotical analysis; the problems of philosophy concern - not the ultimate nature of being but - the semiotical structure of the language of science, including the theoretical part of everyday language. We may distinguish between those problems which deal with the activities of gaining and communicating knowledge and the problems of logical analysis. Those of the first kind belong to pragmatics, those of the second kind to semantics or syntax - to semantics, if designata ("meaning") are taken into consideration; to syntax, if the analysis is purely formal" 15 . As Ross writes "Philosophy is the logic of science, and its subject the language of science". Applied to law, it follows that "the subject of jurisprudence is not law, nor any part or aspect of it, but the study of law" 1 6 . The jurisprudential question is not "What is the nature of law?" This question is dismissed by Ross. Rather the question is "What is the meaning of sentences used by legal scientists?" And the answer is that these sentences are used to express normative propositions, to be understood as empirical propositions about the effect of directives in relation to the behaviour of officials. Since legal norms lack any cognitive meaning, it is of course an absurdity to think that normative propositions about legal norms can be used to provide information about the meaning of legal norms. This is the traditional view concerning propositions made by 14 Alf Ross, Om Ret og Retfaerdighed, 1953, translated into English: On Law and Justice, Copenhagen 1958, p. 8. - Ross follows the analysis offered by Charles L. Stevenson, Ethics and Language, London 1944, p. 59. A n d see Alf Ross, Directives and Norms, London 1968, p. 35, for a similar view. 15 Rudolf Carnap, Introduction to Semantics, Cambridge 1948, p. 250. 16 Ross, On Law and Justice (FN 14), p. 25.
182
Jes Bjarup
legal scientists, which is rejected by Ross. This is, however, often overlooked, since Ross talks about "normative meaning" or "directive meaning". What he means by these terms is easily answered since the meaning is introduced by Ross by a stipulative definition. Consequently, Ross constructs the normative meaning of legal norms to refer to feelings or volitions held by the legislator, issuing the norms to influence the behaviour of judges and thereby also the behaviour of citizens. Legal science is an empirical discipline concerned with an inquiry into whether the use of metaphysics, i.e. legal norms as ideological pronouncements, has any effect. This can only be expressed in empirical propositions, having cognitive meaning, since it is possible to state the truth-conditions of such propositions. Thus Ross turns legal science into a discipline of empirical sociology which, by the way, fits with the idea of the unity of science also held by logical positivists. This is Ross' position in "On Law and Justice". It may be added that Ross, in "Directives and Norms", advances the position that "in all cases the effective motivating force lies not in the utterance itself, but in the circumstances in which the directive is uttered" 17 . Thus it follows that legal norms are dispensable, but power relationships between people are indispensable. The governing authority can do without legal norms and achieve its object, that is, the pursuit of power by means of persuading people to do things, if necessary by using force. This is, in turn, the subject-matter of empirical science, making is-propositions which provides information as to what happens if people are doing, or not doing, those things which the authorities want them to do. Ross is led to underrate the importance of legal norms by confusing illocutionary and perlocutionary acts. Thus the problem of "directive meaning" arises out of Ross' epistemological position and his stipulative definition of "emotive meaning" rather than from a close examination of legal - and moral - discourse. Opalek holds in a similar way that the concept of directive meaning is a "theoretical construct" 18 . If so, there should be no problem concerning its meaning, since the meaning of this construct depends upon Opalek's intentions to introduce the construct and determine its meaning by a stipulative definition. If the stipulative definition is accepted, the problem is rather to ask and verify empirical questions concerning the behaviour of people. Clearly, considering the meaning of theoretical constructs, it is relevant to take the author's intention into consideration. But considering the meaning of legal - and moral - sentences and words used in actual discourse, the author's intentions are irrelevant. This is so because questions about what the words and sentences used mean cannot be equivalent to questions about people's intentions in using them. The meaning of legal - and moral - sentences and 17
Ross, Directives and Norms (FN 14), p. 35. Kazimierz Opalek, Law as Social Phenomenon, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Vol. L V I I (1971), p. 37 - 53, at p. 53. 18
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
183
words are determined by convention. This is why it is important to have a conceptual inquiry into the use of legal discourse, which is quite different from the inquiry into the effect of the use of such a discourse. Another consequence of the reliance on the logical positivisti framework of semiotical analysis, especially the concept of "pragmatics", is that effects of using directives (i.e. the perlocutionary acts and their force in Austin's terminology) are seen as constitutive of their meaning (i.e. the illocutionary acts and their propositional content of legal norms, in Searle's terminology). This is a confusion, and the result of this confusion raises difficulties for constructing a deontic logic. This is so because perlocutionary acts, and their effects, are not subject to logical rules, whereas this is the case with illocutionary acts and their propositional content. This raises the issue whether there is in this respect a specific deontic logic for legal norms or whether the ordinary logical rules of inference can be applied. This is a serious issue, which I shall not pursue. Nor shall I discuss the related issue whether legal norms are to be conceived as commands (imperatives) or rather as rules. I wish only to claim that deontic logic cannot be an issue for Ross if he is consistent. According to Ross, directives lack any informative content. It follows that it does not make sense to say that a judge has made a mistake, or made a wrong decision. It does not make sense to say that the judge or another judge is trying to correct it or has a good or bad reason for deciding the case in the way he did, or that the judge has any legal knowledge. In short, according to Ross' analysis of legal norms they have only "directive meaning", and there is no place for rational legal arguments. Consequently, there is no place for any deontic logic either. Ross claims that logic is irrelevant for legal decision-making, and this explains why Ross also claims that justification of legal decisions is just a sham. As Ross writes, it is merely "a facade of justification . . . often differing from that which in reality made him (i. e. the judge) decide the way he did" 1 9 . To judge is then not to act, but to react or be moved under the sole sway of causal influences, which makes it a mockery to follow legal norms as rules entering the area of right and wrong and justification by reasons. This is, in my opinion, a false view, since it is tantamount to a denial of that there is rationality in legal - and moral - discourse in favour of irrationality. Science, of course, is committed to rationality, which is shown in the expression of propositions. These propositions do not have any directive meaning. On the contrary, they have a factual or cognitive content about legal norms and their directive meaning in legal discourse. The subject-matter of legal science is, precisely, the legal discourse expressed in irrational behaviour. These propositions are based upon observation, and the aim of legal science is to establish causal relationship between words and behaviour. And no special logic - a deontic logic - is needed for
19
Ross, On Law and Justice (FN 14), p. 152, cf. p. 154.
184
Jes Bjarup
empirical propositions, which are what scientific legal propositions are, according to Ross' logical analysis. Opalek is more concerned with the problem of directive meaning in relation to legal norms than the problem of the meaning in relation to normative propositions made by legal scientists. In his meta-legal inquiry he accepts the method of logical positivism. And this is the reason why he has difficulties in solving the problem. Opalek, however, realizes "the way of treating directive meaning from the point of view of the relation language-reality (as something external which the language refers to) though very suggestive, is erroneous" (419). Nevertheless, he endorses the logical positivist view concerning the gap between cognitive meaning which is informative, and non-cognitive meaning which is influential (420). This dichotomy between information and influence cut across the division into cognitive and non-cognitive meaning. Legal norms have a propositional content, i.e. what kind of conduct is appropriate, just as propositions about legal norms have a propositional content, i.e. presenting an account of the appropriate conduct. This is to consider the information of legal norms and propositions about legal norms. By contrast, legal norms, as well as propositions about law may exert an influence on the conduct of people, but this is a purely empirical question in contrast to the normative and conceptual questions concerning information. Thus I think that Opalek, with respect, confuses the question of the illocutionary act and their propositional content with the quite different question of the perlocutionary acts and their effects. In his solution of the problem of "directive meaning" Opalek refers to verbal acts as "'productive' expressions which themselves create something by their meaning" (420). This is, I think, a promising way of analysis. It is also the approach made by Hobbes, referring to the sovereign's will and his laws as standards of what is right and wrong. It is the approach by John Locke and his way of ideas, appealing not to the sovereign's will but to mixed modes and relations as the workmanship of the mind. As Locke writes "we cannot doubt, but Law-makers have often made Laws about Species of Actions which were only the Creatures of their own Understanding" 20 . Opalek's approach, although promising, has a disappointing conclusion. His solution is that "directives are self-referring connoting and denoting themselves. They mean just what they are" (420). What do they mean? One answer is that directive meaning is directive meaning. This is true, but rather uninformative. Another answer is that their directive meaning has "a meaning of a peculiar kind" 2 1 . In order to explain this peculiar 20
John Locke , A n Essay Concerning Human Understanding (ed. P.H. Nidditch), Oxford 1975, Book I I I , Ch. V , § 5 (p. 430), cf. Book I V , Ch. I V . § 8. For a discussion see James Tully, A Discourse on Property. John Locke and his Adversaries, Cambridge 1980, Part. I. 21 Kazimierz Opalek, The Problem of the Validity of Law, in: Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. 3 (1970), p. 6 - 18, at p. 17.
The Problem of "Directive Meaning" Reconsidered
185
kind of meaning, Opalek refers to "'projecting' attitudes by means of deontic expressions on external objects (states of affairs) . . . being devoid of cognitive meaning" (421). Thus Opalek's solution is akin to Ross' solution. What Opalek stresses is the perlocutionary effects of legal norms, as "a conventionalized verbal act of influencing the behaviour of people". This is, of course, important. But it is also important to consider the illocutionary acts and their propositional content in legal norms as to what kind of conduct it is appropriate to maintain, and their justification. By confusing illocutionary acts with perlocutionary acts Opalek, in his conceptual inquiry into the meaning of "directive meaning", regards legal norms as expressions of feelings or volitions for which no justification in terms of reasons can be given. In my opinion, it is not "promising to adopt this direction" as Opalek claims (422). On the contrary, I should think it is more promising to abandon the method of logical positivism in favour of other methods in jurisprudential thinking. There is a connection between legal positivism as a conceptual inquiry and logical positivism as the method to be used in such an inquiry. But it is by no means a necessary connection, I hasten to add. Opalek - and Ross - are legal positivists and logical positivists as well. It is possible, however, to be a legal positivist, engaged in conceptual inquiries without being committed to that logical positivism offers the only method and philosophical framework for analysis. My point is that an inquiry based upon the logical positivist view of language and the principle of verifiability distorts the nature and use of legal language and legal discourse as an essential non-rational device. According to this analysis it is a matter not of reasons but of efficacious manipulation. Conceptional inquiries, based upon other methods, e.g. the linguistic analysis pursued by H.L. A . Hart, the method of paraphrasis advanced by Jeremy Bentham, or the contextualist approach by Quentin Skinner 22 , are more promising and relevant for understanding the meaning and use of legal - and moral - sentences and the justification of what sort of conduct we wish to maintain by issuing legal norms by verbal illocutionary acts with a propositional content. This conceptual approach is also important for understanding and learning legal rules. This is not just a way of "reacting to" legal rules as Opalek suggests (421). It is rather a mode of conduct, having reasons for actions, to be justified by reference to what is right and good. In this respect, legal science is a normative discipline concerned with offering information in terms of propositions as to what is - legally - the proper conduct to be observed and followed by officials as well as citizens. It is legal science, thus conceived, which matters for legal education, whereas the legal science, pursued by Ross - and Opalek as well, with respect - as an empirical discipline concerned with the causes of behaviour, although relevant, does not. And if this empirical legal science is 22 For Hart, see Neil MacCormick, H . L . A . Hart, London 1981. For Bentham, see Ross Harrison, Bentham, London 1983. For Skinner, see his The Foundations of Modern Political Thought, 2 vols., Cambridge 1978.
186
Jes Bjarup
taken to replace normative legal science, then the result is a distortion of legal thinking and legal discourse. This is a serious matter. Therefore, the method of logical positivism must be rejected. Hence, also the question of the meaning of legal - and moral - propositions can be reconsidered in the proper perspective of rules as to what is right and what is wrong.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit Von Arthur Kaufmann, München 1. Vorbemerkung Die Kernfrage aller Rechtsphilosophie ist von jeher die: Was sind, unabhängig von jedweder bestimmten positiven Setzung, Recht und Unrecht und wie unterscheiden sie sich voneinander? Gewiß ist nicht jedes rechtsphilosophische Bemühen auf diese Kernfrage gerichtet. Es gibt Zweige der Rechtsphilosophie - man nennt sie heute meist „Rechtstheorie" - , die sich mehr mit den formalen Eigenschaften und Strukturen des Rechts beschäftigen, wie z.B. die Analytische Rechtstheorie oder die Normentheorie. Es wäre töricht, sie als formalistisch oder rein technisch-rationalistisch abzutun, wie das heute gewisse irrationale Strömungen im Umkreis der Postmoderne tun. Aber es ist gewiß richtig, daß solche formalen Rechtstheorien nicht um ihrer selbst willen betrieben werden dürfen, denn sonst trifft der Vorwurf, den man ihnen macht, zu, daß sie nämlich keine Antworten auf die „eigentlichen Fragen" haben.1 Zumindest mittelbar müssen auch sie einen Beitrag zur Bewältigung der großen Aufgabe leisten, das Recht vom Unrecht zu scheiden. Sie sollten sich als das verstehen, als was sie schon Gustav Radbruch gekennzeichnet hat: „ein ungemein verdienstvoller Vorbau zu jeder möglichen Rechtsphilosophie, aber nicht das Gebäude selber". 2 Im folgenden soll vom Recht selber die Rede sein, vom „richtigen Recht" (was immer das sei), also letzten Endes von der Gerechtigkeit. Es geht, etwas nüchterner ausgedrückt, um die Frage nach der Wahrheit normativer Sätze bzw. um ihre Richtigkeit, wenn man sich an die heute übliche Terminologie hält und von wahr-unwahr nur im Bereich empirischer Aussagen (bei theoretischen Diskursen) spricht, bei normativen Aussagen (bei praktischen Diskursen) dagegen von richtig-unrichtig. Ich werde im folgenden aber keinen allzu strengen Gebrauch von dieser Unterscheidung machen.
1 Vgl. etwa P. Koslowski, Die postmoderne Kultur. Gesellschaftlich-kulturelle Konsequenzen der technischen Entwicklung, 1987, bes. S. 12ff. Sodann auch A. Kaufmann, Recht und Rationalität, in: Rechtsstaat und Menschenwürde. Festschrift für Werner Maihofer, 1988, S. 11 ff.; ders., Rechtsphilosophie in der Nach-Neuzeit, 2. Aufl. 1992, bes. S. 4ff. 2 G. Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Aufl. 1973, S. 113.
188
Arthur Kaufmann
Zur Vorabklärung sei noch gesagt, daß ich weder der klassischen Naturrechtslehre folge, wonach sich richtige Normen ebenso begründen lassen wie wahre Tatsachenaussagen, noch aber auch der Auffassung von Nominalismus und Empirismus, denen zufolge normative Aussagen überhaupt nicht wahrheitsfähig sind. Einerseits leuchtet mir nicht ein, daß, wie z.B. Richard M. Hare meint, die Universalisierung von normativen Aussagen wie „a ist gut" im gleichen Sinne möglich sei wie die von deskriptiven Aussagen der Art „a ist rot". 3 Andererseits halte ich dafür, daß es auch im normativen Bereich Kriterien der Evidierung, Einsichtigmachung und vor allem auch der Falsifizierung gibt, die es erlauben, hier von wahren Erkenntnissen zu sprechen. Allerdings wird es in Fragen des Normativen selten solche Argumente geben, die eine einzige Lösung als die allein richtige erweisen (das ist übrigens auch in der modernen Physik vielfach so). Der Jurist ist daran gewöhnt, daß es oft mehrere „vertretbare" Lösungen gibt, und die zeitgenössische Rechtstheorie macht nur noch einen kleinen Schritt, wenn sie darlegt, daß es in der Welt des Normativen mehrere richtige Antworten geben kann, wiewohl sie voneinander abweichen (nur am Rande sei vermerkt, daß diese Auffassung nicht identisch mit dem rechtsphilosophischen oder werttheoretischen Relativismus ist, für den es beim Werthaften überhaupt keine Erkenntnisse gibt). Weil es beim Normativen, wie gesagt, sehr oft nicht die eine und einzig richtige Antwort gibt, gebraucht man hier auch nicht die logischen Modalitäten wie „unmöglich", „notwendig", „zwingend", sondern vorzugsweise solche wie „plausibel", „stimmig", „triftig". Wenn ein logischer Schluß notwendig ist, kann es keinen anderen auch möglichen Schluß daneben geben. Aber „plausibel" können mehrere verschiedene Rechtsaussagen zu derselben Frage gleichermaßen sein (freilich nicht bei direkter Gegensätzlichkeit).4 2. Grundlagen der prozeduralen Theorien a) Die Abkehr vom Subjekt-Objekt-Schema in der Erkenntnis
Durch Jahrhunderte hindurch hat man das „richtige Recht", die Gerechtigkeit, als etwas Objektives angesehen, genauer: als ein Objekt, einen Gegenstand, der dem erkennenden Bewußtsein substantiell entgegensteht. Man hielt sich an das Subjekt-Objekt-Schema, wonach in der Erkenntnis das Objekt vom Subjekt streng getrennt ist, also nichts Subjektives in die Erkenntnis einfließt. Nur so glaubte man zu objektiv wahren, subjektfreien und damit auch zirkelfreien Erkenntnissen gelangen zu können - im normativen Bereich nicht
3 R. M. Hare , Die Sprache der Moral, 1983, S. 139ff., 144ff. 4 Näher dazu A. Kaufmann, Über die Wissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft. Ansätze zu einer Konvergenztheorie der Wahrheit, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 72 (1986), S. 425ff.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
189
anders als im empirischen. Zumeist hat man - von der Antike bis heute dieses Objektive, das der Rechtserkenntnis vorgegeben und von ihr unverfälscht zu erfassen ist, in der „Natur" gesucht, sei es nun die empirische oder die sittliche Natur des Menschen, sei es ein Gesetz über ihm (Logos, Ideen, Voluntas Dei) oder ein Gesetz in der eigenen Brust: Immer war diese Natur ein Objekt, das will sagen: etwas nicht vom Erkenntnissubjekt Gemachtes oder Gestaltetes, etwas, das es in seiner Gegebenheit zu belassen, auf das es nur hinzuhorchen hatte, oder so: das Objekt als das Maßgebende, das Subjekt als das Maßempfangende. Ich bin mir wohl bewußt, daß ich hier schrecklich vereinfache. Man kann aus der Geschichte leicht Gegenbeispiele bringen; z.B. hat schon Pio tin die „Natur" als etwas Prozeßhaftes angesehen, und eine ganz ähnliche Auffassung finden wir später bei Schelling. Aber für den von mir hier verfolgten Zweck stimmt das Gesagte cum grano salis. Hinzuzufügen ist aber noch, daß die von mir als „objektivistisch" gekennzeichneten Richtungen keineswegs nur diejenigen sind, die sich ausdrücklich als Naturrechtslehren ausgeben. Der Rechtspositivismus ist dem Subjekt-Objekt-Schema genau so verhaftet wie die Naturrechtslehre, denn nach ihm ist Rechtsanwendung nichts anderes als Subsumtion unter das Gesetz, dessen Positivität (die gewissermaßen die „Natur" des Rechts darstellt) etwas ganz und gar Objektives, vom Rechtsanwendenden unangetastet zu Lassendes ist. Der Richter ist „nur dem Gesetz unterworfen", heißt es noch heute in Art. 97 Abs. 2 des Grundgesetzes.5 Aber während in der juristischen Alltagspraxis das Subjekt-Objekt-Schema noch immer die Vorstellungswelt des Juristen bestimmt (vergleichsweise so wie in der physikalischen Alltagswelt das Vorstellungsbild des Physikers), ist es aus der modernen Rechtstheorie (ähnlich wie aus der modernen theoretischen Physik) längst verbannt. Die Wende brachte einmal die philosophische Hermeneutik seit Schleiermacher, zum anderen aber und vor allem die kritische Philosophie Kants (in der theoretischen Physik namentlich Einstein und Heisenberg). Inzwischen ist es, jedenfalls in der Theorie, ein Allgemeinplatz, daß Erkenntnis nicht einfach eine Abbildung des Objekts im Bewußt sein ist, daß vielmehr der Erkennende, zumal der Rechtserkennende, aktiv-gestaltend in die Erkenntnis eingeht. Ein Physiker hat den Satz geprägt, daß die Fälle gar nicht so selten sind, „in denen man erkennt, was man erkennen will". 6 Ein solcher Satz - er trifft für die Welt des Normativen, des Rechtlichen, noch weitaus mehr zu als für die Physik - macht deutlich, wie außerordentlich problematisch prozedurale Theorien sind, die davon ausgehen, daß Subjekt und Objekt in der Erkenntnis nicht fein säuberlich zu trennen sind. 5 Zur Problematik dieser Bestimmung siehe A. Kaufmann, Vierzig Jahre Rechtsentwicklung - dargestellt an einem Satz des Grundgesetzes, in: W. Bleek / H. Maull (Hrsg.), Ein ganz normaler Staat? Perspektiven nach 40 Jahren Bundesrepublik, 1989, S. 51 ff. 6 Stephan W. Hawking, Eine kurze Geschichte der Zeit, 1988, S. 50.
190
Arthur Kaufmann b) Kants transzendentaler Ansatz
Wie gesagt, die kopernikanische Wende kam durch Kant. In seiner „Transzendentalen Logik" 7 (aber auch anderen Stellen) hat er dargetan, daß uns Objekte nicht in ihrem reinen Ansichsein gegeben sind. Denn reine Anschauung enthält lediglich die Form, unter welcher etwas angeschaut wird, und reiner Begriff allein die Form des Denkens eines Gegenstandes überhaupt. „Rein" und demgemäß „a priori" kann eine Vorstellung nur sein, wenn ihr keine Empfindung beigemischt ist. Aber, so sagt Kant, „unsere Natur bringt es so mit sich, daß die Anschauung niemals anders als sinnlich sein kann". Der Verstand ist einer Anschauung nicht fähig; er ist einzig „das Vermögen, den Gegenstand sinnlicher Anschauung zu denken". Es eignet ihm somit keine schöpferisch-aktive Erkenntniskraft, sondern nur die „Spontaneität des Erkenntnisses", d.h. die Zusammenfassung des Mannigfaltigen zum Begriff. „Folglich ist uns keine Erkenntnis a priori möglich, als lediglich von Gegenständen möglicher Erfahrung." Und etwas weiter unten heißt es vom Verstand, „daß er die Schranken der Sinnlichkeit, innerhalb deren uns allein Gegenstände gegeben werden, niemals überschreiten" kann. Dieser transzendentale Ansatz Kants, daß wir reine Erkenntnis nicht von den Gegenständen an sich, sondern nur von Gegenständen möglicher Erfahrung haben, ist eine klare Absage an jedes substanzontologische Denken, damit zugleich eine Absage an das Naturrecht im herkömmlichen Verstände. Aber daß Kant damit zugleich das Fundament für den Rechtspositivismus gelegt hätte, ist ein Mißverständnis vieler seiner Epigonen, wie es eben auch ein Mißverständnis ist, er habe das Subjekt-Objekt-Schema einfach umgewendet. Kant denkt nicht objektivistisch und nicht subjektivistisch, sondern prozeßhaft. Das hat schon Arthur Schopenhauer ganz deutlich gesehen. In den „beiden Grundbegriffen der Ethik" sagt er: „Kants Begründung seines Moralgesetzes ist . . . keineswegs die empirische Nachweisung desselben als einer Tatsache des Bewußtseins noch eine Appellation an das moralische Gefühl noch eine petitio principii unter dem vornehmen Namen eines »absoluten Postulats4, sondern es ist ein sehr subtiler Gedankenprozeß." 8 Der kategorische Imperativ bedeutet denn auch gar nichts anderes als das Unterfangen, inhaltliche moralische Aussagen aus einem gedanklichen Verfahren abzuleiten. A m Anfang steht bei Kant nicht ein inhaltlich-moralisches Prinzip, sondern das Verfahren. 9 Darauf wird zurückzukommen sein. In der Zeit nach Kant konnte es eine wissenschaftliche Begründung für eine objektivistische, substanzontologische Rechtsauffassung, insbesondere für ein 7
Kant, Kritik der reinen Vernunft, A 50ff., 74ff. Schopenhauer, Die beiden Grundprobleme der Ethik, in: Sämtliche Werke, hrsg. von W. Frhr. v. Löhneysen, Bd. I I I , S. 667. 9 Vgl. G. Ellscheid, in: A . Kaufmann / W. Hassemer (Hrsg.), Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 5. Aufl., 1989, S. 175ff. 8
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
191
Naturrecht alter Art, nicht mehr geben. In den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg flackerte allerdings ein solches Naturrechtsdenken noch einmal für kurze Zeit auf, besonders drastisch in der frühen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der mehrfach ein vorgegebenes, objektives und unveränderliches Sittengesetz beschworen und daraus bestimmte rechtliche Konsequenzen abgeleitet hat. 1 0 Man kann für diese Naturrechtsrenaissance verständliche Gründe finden, aber daß sie Episode war, wird heute kaum noch bezweifelt. Der Weg hinter Kant zurück ist uns verbaut. Übrigens gab es schon vor dieser Zeit Naturrechtskonzepte, die an moderne Gerechtigkeitstheorien anklingen. Exemplarisch genannt sei das 1943 erschienene Buch des Schweizer Theologen Emil Brunner: „Gerechtigkeit". Für Brunner erfolgt die Begründung der Gerechtigkeit freilich nicht im Wege eines fiktiven Gesellschaftsvertrags und auch nicht im Wege einer fiktiven idealen Sprechsituation, aber doch auch in einem fiktiven Gedankenprozeß, indem er das Problem sub specie dei zu betrachten und zu lösen versucht. 11 c) Inhalte aus der Form?
Allein auf eine solche irgendwie prozeßhafte Weise kann man, geläutert durch Kant, das Problem der Begründung normativer Urteile angehen. Es wurde schon gesagt: Der kategorische Imperativ bedeutet nichts anderes als das Unterfangen, inhaltliche moralische Aussagen aus einem gedanklichen Verfahren abzuleiten. Inhalte, so sie aus der Erfahrung kommen, gelten nur a posteriori. Wenn dem aber so ist, sollte man dann nicht einmal versuchen, ob sich konsistentere Inhalte aus der Form gewinnen lassen? In der Tat hat dieser Gedanke, daß die „reine Form", das „reine Sollen", Inhalte und konkrete Verhaltensregeln gebären könnte, die dem Trug der Wahrnehmung entrückt sind, auf viele Denker Faszination ausgeübt.12 Heute werden diese Versuche meist als „prozedurale Theorien" der Wahrheit bzw. der Gerechtigkeit 10 Aufsehen erregt haben vor allem das Kuppelei- und das Selbstmordurteil des Bundesgerichtshofs, siehe Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, 6.Bd., 1954, S. 46ff. und S. 147ff. 11 E. Brunner, Gerechtigkeit. Eine Lehre von den Grundgesetzen der Gesellschaftsordnung, 1943, bes. S.29ff. 12 Dafür ließen sich viele Belege anführen. Ein Meisterstück ist G. Radbruchs Unterfangen, aus dem Prinzip des rechtsphilosophischen Relativismus „die sachlichen Forderungen des Naturrechts zu begründen: Menschenrechte, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Volkssouveränität"; siehe: Der Mensch im Recht, 1957, S.80ff., 87. Vgl. auch ders., Vorschule der Rechtsphilosophie, 3. Aufl., 1965, S. 26f., wo aus der formal verstandenen Idee der Gerechtigkeit inhaltliche Rechtssätze abgeleitet werden. - Ich selbst habe früher auch geglaubt, aus dem formalen und absoluten Schuldprinzip bestimmte Schuldinhalte gewinnen zu können: Das Schuldprinzip, 1961 (2. Aufl. 1976). Ich halte diese Inhalte nach wie vor für richtig, jedoch muß ich einräumen, daß sie weitgehend der Erfahrung entstammen. - Konsequent war hier immer Hans Kelsen, der seine „Reine Rechtslehre" nie zur Quelle von Rechtsinhalten gemacht hat.
192
Arthur Kaufmann
bezeichnet. Ich werde im folgenden die zwei wichtigsten Modelle vorstellen: das Vertragsmodell (dafür steht vor allem der amerikanische Rechtsphilosoph John Rawls) und das Diskursmodell (der wichtigste Gewährsmann dafür ist Jürgen Habermas). Beiden Modellen gemeinsam ist, daß der Konsens als das maßgebende Wahrheits- oder Richtigkeitskriterium angesehen wird. Ausklammern muß ich hier die auf Talcott Parsons zurückgehende, hierzulande hauptsächlich von Niklas Luhmann vertretene Systemtheorie, denn diese liegt auf einer ganz anderen Ebene. Für Luhmann gibt es so etwas wie „Richtigkeit", „Gerechtigkeit", „Wahrheit" überhaupt nicht; das sind vielmehr nur Symbole, mit deren Gebrauch man gute Absichten beteuert oder einen vorausgesetzten Konsens ausdrückt. 13 Denn nach dieser Theorie ist die Systemfunktion umfassend, eine Kritik am System von extrasystematischen Positionen aus ist daher unmöglich. Das System produziert sich und seine Anerkennung (durch Lernprozesse) selbst: „Legitimation durch Verfahren". Es kommt nicht darauf an, daß „Gerechtigkeit" verwirklicht wird (sie gibt es ja nicht), sondern daß das System funktioniert, indem es soziale Komplexität reduziert. 14 Ich bin der Meinung, daß dieser Entwurf Luhmanns aus sich selber heraus nicht widerlegbar ist. Er zeigt aber auch, daß eine konsequent durchgeführte rein prozedurale Theorie keine Inhalte mehr zuläßt. Es gibt überhaupt kein „Was", das aus dem „Wie" hervorgeht, es gibt nur das „Wie". Damit wird das Recht absolut fungibel. Und wenn auch dieser Funktionalismus theoretisch unanfechtbar erscheint (ähnlich wie der ganz konsequent durchgeführte Nominalismus), so muß er doch aus praktischen Gründen zurückgewiesen werden - gemäß der Devise des amerikanischen Pragmatisten Charles Sanders Peirce: „ A n ihren Früchten werdet ihr sie erkennen!" 15 Die Früchte des Funktionalismus sind dem Recht nicht bekömmlich. 3· Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit a) Das Vertragsmodell
Theorien des Gesellschafts- oder Staatsvertrags hat es schon viele gegeben: Hobbes, Rousseau, Beccaria, K a n t . . . 1 6 Die Idee ist bekannt: Die Vertragstheorie fingiert etwas als gesollt, weil es vernünftigerweise nicht nicht gewollt sein kann, weil es im wahren Interesse der Kontrahenten liegt. Mit anderen Worten: Die Vertragstheorie empfiehlt für die Prüfung der Gerechtigkeit 13 N. Luhmann, Positives Recht und Ideologie, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 53 (1967), S. 567 f. 14 Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 1969. 15 Ch. S. Peirce, Collected papers, 1931 ff., 5. Bd., S. 204, 464f. 16 Sehr klar dazu schon Radbruch, Grundzüge der Rechtsphilosophie, 1914, S. 106ff.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
193
eines jeden Rechtsverhältnisses ein Verfahren, das für die Untersuchung der Richtigkeit speziell des Rechtsverhältnisses Staat seit langem geübt wird: sich das Rechtsverhältnis als Resultat eines Gesellschaftsvertrags zu denken. Eigentlich sollte man annehmen, daß bei korrekter Beobachtung dieses Verfahrens allenthalben gleiche Ergebnisse erzielt werden. Daß dem aber nicht so ist, weiß man. Einer der härtesten Prüfsteine der Vertragstheorie war immer die Todesstrafe. Beccaria hielt sie für unvereinbar mit der Vertragstheorie, Rousseau dagegen für vereinbar. Erst recht Kant wandte sich gegen Beccarias „Sophisterei und Rechtsverdrehung", indem er mit einem für seine Denkweise charakteristischen Kunstgriff die Argumentation in eine transzendentale Ebene (heute würden wir vielleicht sagen: Meta-Ebene) verlegt und nicht fragt, was das empirische Individuum wirklich will, sondern was vernünftigerweise nicht nicht gewollt werden kann. Spätestens hier wird deutlich, daß die Vertragstheorie als Kontrahenten eines Staats- oder Gesellschaftsvertrags ein reines Vernunftwesen fingiert, das sein wahres Interesse kennt und sich dadurch bestimmen läßt. Es ist das sehr kluge und sehr eigennützige Individuum, das uns in der klassischen Nationalökonomie als der homo oeconomicus begegnet. Das Recht ist nicht für Schlafmützen gedacht: Iura semper vigilantibus. Kontrahent des Staatsvertrags ist also nicht das empirische Individuum mit seinem wirklichen Willen und den von ihm wirklich gehegten Interessen. In der Unterscheidung Rousseaus zwischen sujet und citoyen wie vor allem zwischen volonté des tous und volonté générale kommt das ebenso deutlich zum Ausdruck wie in Kants Gegenüberstellung des homo phainomenon und des homo noumenon. Es ist klar, daß bei einer solchen Strukturierung des Gesellschaftsvertrags der Bereich des Sozialen mehr oder weniger unter den Tisch fällt. John Rawls hat in seinem 1971 erschienenen Werk „ A Theory of Justice" 17 den Gedanken der Vertragstheorien wieder aufgenommen, indem er in einem Denkprozeß die grundlegenden Rechte und Pflichten herausdestillieren will, die in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft einem jeden zukommen müssen. Auch er will universalisierbare Normen dadurch gewinnen, daß sich die moralisch Urteilenden in einen fiktiven Urzustand („original position") versetzen. Das Neue bei seiner Theorie ist aber nun folgendes: Um auszuschließen, daß sich die Vertragspartner einseitige Vorteile verschaffen und parteiisch urteilen, breitet Rawls über sie den „Schleier des Nichtwissens", d. h., er läßt sie in Unkenntnis über ihre physisch-psychischen Eigenschaften und ihre soziale Rolle im wirklichen Leben, mit anderen Worten: In die „original position" gehen keine Macht- und Drohpotentiale ein. Zudem trifft Rawls die Entscheidung, daß sich alle Partner des Vertrags infolge ihrer Unwissenheit über die eigenen Positionen in einer künftigen Ordnung risikoscheu verhalten; sie wäh17 Deutsche Ausgabe: J. Rawls , Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1975; 5. (deutsche) Aufl. 1990.
13 Festgabe Opalek
194
Arthur Kaufmann
len entsprechend der Maximin-Regel für Entscheidungen unter Unsicherheit diejenigen Grundsätze, die das eigene Risiko im wirklichen Leben gering halten. Auf Details der Rawlsschen Theorie kann hier ebenso wenig eingegangen werden, wie auf eine Einzelkritik verzichtet werden muß. Es gibt manches, was nicht so ohne weiteres einleuchtet, beispielsweise warum sich die Kontrahenten unter Umständen nicht auch risikofreudig verhalten sollten (ganz abgesehen davon, daß es in unserer Welt ein Risiko sein kann, kein Risiko einzugehen). Insgesamt jedoch erscheinen die von Rawls erzielten Ergebnisse plausibel. Aber warum erscheinen sie uns plausibel? Oder so gefragt: Warum sind die Vertragspartner gerade zu diesen Regeln gelangt? Sie sind es deshalb, weil Rawls schon bestimmte Gerechtigkeitsvorstellungen unterstellt und natürlich seine eigenen bzw. die seiner Gesellschaft, genauer: der amerikanischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts (ein sowjetrussischer Rechtsphilosoph würde seine Vertragspartner im Urzustand andere Regeln finden lassen). Was Rawls vorlegt, ist das Konzept eines liberalen und sozialen Rechtsstaats, ist eine konstitutionelle Demokratie mit sozial-temperierter Marktwirtschaft, wobei das Moment des „Sozialen" in einem amerikanischen Konzept besonders sympathisch erscheint. Es ist übrigens der Bemerkung wert, daß der schon einmal genannte Schweizer Theologe Emil Brunner auf der Basis der von ihm gedanklich grundgelegten schöpfungsmäßigen Urordnung lange vor Rawls zu im wesentlichen gleichen Resultaten gelangt ist. So ist Otfried Höffe zuzustimmen, wenn er bemerkt: „Die Annahme des Urzustandes stellt eine Annäherung an unser intuitives Verständnis des moralischen Standpunkts dar. Wo dieses intuitive Verständnis aufhört und damit auch die Plausibilität, da endet auch Rawls' Sicherheit in der Begründung universalisierbarer Normen." 1 8 Dieser Befund wird von Rawls selbst bestätigt. Er teilt nämlich schon sogleich am Anfang seiner Untersuchung das von ihm intuitiv gewonnene Ergebnis mit, bevor er die Versuchsanordnung festlegt. Man kann eben Verfahrensregeln nicht bestimmen, ohne eine Ahnung zu haben, was dabei herauskommen soll. Ich mache Rawls diesen Zirkel nicht zum Vorwurf, um so weniger ihm, als er den Zirkel gar nicht in Abrede stellt. Doch wie auch immer, es hat sich gezeigt, daß die normativen Inhalte gar nicht, jedenfalls nicht allein, aus dem Verfahren gewonnen sind. Sie entstammen vielmehr wesentlich dem Wissen und der geschichtlich sowie gesellschaftlich geprägten Erfahrung eines hochgelehrten Philosophen unserer Zeit.
18 Nachweis bei P. Koller, Theorien des Sozialkontrakts als Rechtfertigungsmodelle politischer Institutionen, in: L. Kern / H. P. Müller (Hrsg.), Gerechtigkeit, Diskurs oder Markt? Die neuen Ansätze in der Vertragstheorie, 1986, S. 28, 33.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
195
b) Das Diskursmodell
Der Zirkel in der Argumentation ließe sich nur vermeiden, wenn es gelänge, rein aus dem Verfahren, ohne Vorgabe oder Vorwissen von empirischen Inhalten, zu reinen, nichtempirischen Inhalten zu kommen. Die Theorie des rationalen Diskurses (auch bei ihr ist nur das Wort „Diskurs" wirklich neu, der Sache nach gibt es das mindestens schon seit Einführung der elenktischen Methode in der von Piaton gegründeten Akademie) hält sich dazu imstande. Robert Alexy hat diesen Anspruch auf eine kurze Formel gebracht. Nach dieser Theorie, so sagt er, „ist eine normative Aussage r i c h t i g . . . , wenn sie das Ergebnis einer bestimmten Prozedur, der des rationalen Diskurses, sein kann". 1 9 Wie ist das zu verstehen? Jürgen Habermas hat gegen Rawls eingewandt, daß die Aufgaben, die in moralischen Argumentationen gelöst werden sollen, nicht monologisch bewältigt werden könnten, sondern eine kooperative Anstrengung erforderten. Moralisches Argumentieren diene dem Ziel, einen gestörten Konsens wiederherzustellen. Denn Konflikte im Bereich normengeleiteter Interaktionen gingen unmittelbar auf ein gestörtes normatives Einverständnis zurück. 20 Die Replik, daß dieser Einwand nicht zutreffe, weil in der Rawlsschen „original position" jeder Beteiligte es gegenüber jedem anderen rechtfertigen können muß, wenn er mit seiner Ordnung von Geltungsansprüchen ethische Priorität beansprucht, 21 leuchtet nicht ein. Gewiß muß er das rechtfertigen, aber er bleibt dabei doch in der „Rolle des Einzelgängers". 22 Allerdings wird man fragen müssen, ob Habermas' Einwand gegen Rawls nicht auch gegen ihn selbst gewendet werden muß, da ja auch bei ihm Diskurs und idealiter erzielter Konsens nicht real existieren, sondern fiktiv angenommen werden. Einen wirklichen Konsens gibt es auch nach dieser Theorie nicht. Die Konzeption einer freien Argumentationsgemeinschaft, die von Peirce grundgelegt wurde, hat nur den Charakter einer regulativen Idee, die der argumentativen Rekonstruktion beanspruchter Geltung dient. Ein behaupteter Konsens, eine behauptete Geltung, soll so behandelt werden, als ob erst der Konsens aller diese Behauptung bestätigen könnte. De facto eingeholt werden kann dieser Konsens nicht, er wird vielmehr in dem faktischen Anspruch auf Geltung unterstellt, also fingiert. Das kann hier nicht weiter verfolgt werden.
19 R. Alexy, Die Idee einer prozeduralen Theorie der juristischen Argumentation, in: RECHTSTHEORIE, Beiheft 2,1981, S. 177ff., 178. 20 J. Habermas, Moralbewußtsein und kommunikatives Handeln, 1983, S. 76f. 21 L. Kern, Von Habermas zu Rawls. Praktischer Diskurs und Vertragsmodell im entscheidungslogischen Vergleich, in: Kern / Müller (FN 18), S. 93. 22 So in etwas anderem Zusammenhang W. Hassemer, Juristische Argumentationstheorie und juristische Didaktik, in: Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, 2. Bd., 1972, S.474.
13*
196
Arthur Kaufmann
Habermas 23 selbst stellt sich die Aufgabe, wahre bzw. richtige Inhalte aus dem Prozeß rationaler Kommunikation zu gewinnen, wobei es bei dem theoretischen Diskurs um die Wahrheit von empirischen Aussagen, bei dem praktischen Diskurs um die Richtigkeit von normativen Aussagen geht. Habermas verkennt nicht, daß nur ein begründeter Konsens Wahrheits- bzw. Richtigkeitskriterium sein kann. Was aber legitimiert den Konsens? Eigentlich müßte die Antwort lauten: ein Konsens über den Konsens. Da dies jedoch zu einem infiniten Regreß führen würde, sucht Habermas einen anderen und sehr bezeichnenden Weg. Er stellt auf die „Kraft des besseren Arguments" ab, und diese kann allein durch die formalen Eigenschaften des Diskurses erklärt werden und nicht durch etwas, das entweder, wie die logische Konsistenz von Sätzen, dem Argumentationszusammenhang zugrunde liegt, oder, wie die Evidenz von Erfahrungen, von außen in die Argumentation eindringt. Und was sind nun diese formalen Eigenschaften des konsenserzielenden Diskurses, die ihn als Wahrheits- bzw. Richtigkeitskriterium ausweisen? Im Anschluß an Stephen Toulmin 2 4 erblickt Habermas diese Kriterien in den Bedingungen einer „idealen Sprechsituation": Chancengleichheit für alle Diskursteilnehmer, Redefreiheit, keine Privilegierungen, Wahrhaftigkeit, Freiheit von Zwang. In der Tat dürften hierin die wesentlichen formalen Bedingungen eines rationalen Diskurses liegen. Aber wieso erzeugt er die Wahrheit bzw. die Richtigkeit eines Etwas (empirischer Tatsachen, rechtlicher Normen), wo ihm doch gerade kein Etwas zugrunde liegt? Haben wir hier nicht wieder diese geheimnisvolle Urzeugung des Stoffs aus der Form, die schon bei Kant angeklungen ist? Daß auch das Modell von Habermas nicht aufgeht, nicht aufgehen kann, hat in eindrucksvoller Weise unlängst Lucian Kern wieder nachgewiesen. 25 Er zeigt zutreffend, daß das Prinzip des besseren bzw. besten Arguments zwar immer eine Lösung ermöglicht, aber da Habermas keinerlei Hinweis gibt, worauf das bessere (beste) Argument beruht, ist die Lösung beliebig. Anders als bei Rawls, aus dessen Differenzierungsprinzip sich eine ethische Priorität bestimmter Argumente vor anderen ableiten läßt (der schlechtergestellten Person ist das prioritätsentscheidende Argument zuzubilligen), gibt es bei Habermas kein Prioritätskriterium, und deshalb führt seine Konstruktion des praktischen Diskurses letztlich zu einem „leeren Prinzip". Habermas läßt es, sagt Kern, „dabei bewenden, daß es für jeden Diskurs aufgrund des besten Arguments eine Lösung gibt, ohne uns aber Hinweise darauf zu geben, wie diese Lösung im Einzelfall aussehen kann, d.h. genauer: warum welche individuelle Meta-Ordnung die höchste Priorität erhält". Um diese Unbestimmtheit in der Konstruktion des Diskurses zu beheben, wäre eine Theorie der Priorität erforderlich, die Habermas aber nicht vorlegt. 23 Vgl. zum folgenden Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, 1984, S. 127ff. 24 St. Toulmin , Der Gebrauch von Argumenten, 1978. 2 5 Kern (FN 21), S. 84.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
197
Die Grundannahme der Diskurstheorie, daß eine normative Aussage dann richtig ist, wenn sie das Ergebnis einer bestimmten formalen Prozedur darstellt, beruht auf einer Selbsttäuschung, die durch eine bestimmte Auffassung von Wahrheit nur notdürftig verdeckt wird. Danach soll das Kriterium, das „in letzter Instanz" (Habermas) entscheidet, ob eine Aussage wahr bzw. richtig ist, der korrekt gewonnene Konsens sein (Konsensustheorie der Wahrheit). Der Jurist würde hier von einem unerlaubten Insichgeschäft sprechen. Gewiß ist die von den Diskurstheoretikern (aber nicht nur von ihnen) bekämpfte Korrespondenztheorie der Wahrheit, die mit der alten Adäquatio-Formel arbeitet (veritas est adaequatio intellectus et rei) in gewissem Sinne naiv, nämlich soweit damit gesagt sein soll, wir würden die Welt genau so erfassen, wie sie an sich ist. Wir haben immer nur ein „Bild" von der Welt. Und wenn, um einen Blick in meine strafrechtliche Werkstatt zu werfen, den Aussagetatbeständen (Eidesdelikten) nach heute kaum noch bezweifelter Auffassung die objektive Eidestheorie zugrunde liegt, wonach es für die Wahrheit oder Falschheit einer Aussage auf ihre Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung mit der Wirklichkeit - und nicht mit der Vorstellung oder Überzeugung von Wirklichkeit (subjektive Eidestheorie) ankommt, dann geschieht das nicht aus Naivität, sondern mit der stillschweigenden Unterstellung, daß jeder sowieso nur „nach bestem Wissen" aussagen, nur das „Bild" wiedergeben kann, das er hat; jede Aussage, auch die wahrhaftigste, begleitet immer ein unausgesprochenes „Soviel ich weiß". Und weil dem so ist, daß jede Aussage nur das Vorstellungsbild des Aussagenden wiedergibt, besagt der Einwand, die Korrespondenztheorie beruhe auf einem Selbstwiderspruch, für die Kontroverse nichts. Gewiß ist die Korrespondenztheorie einseitig und ergänzungsbedürftig, aber die Konsensustheorie ist in sich unschlüssig, weil sie die Entstehung der Aussage (wichtig für ihren Beweiswert) mit ihrem Inhalt (wichtig für ihren Wahrheitswert) verwechselt. Wie ich mir die Vereinigung der richtigen Aspekte sowohl der Korrespondenz- wie auch der Konsensustheorie denke, nämlich zu einer Konvergenztheorie der Wahrheit, habe ich an anderer Stelle ausgeführt; darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. 26 Soweit die Diskurstheorie nur formale Regeln benennt, wie vernünftig zu argumentieren ist - die Bedingungen einer „idealen Sprechsituation" - , kann sie nur zu der Feststellung berechtigen, daß ein Konsens formal korrekt zustandegekommen ist, sie kann aber nicht die Erreichung der Wahrheit bzw. der Richtigkeit von einem inhaltlichen Etwas, z.B. von Normen, behaupten. Daß in einem Diskurs Wahrheit erzielt wird, hängt nicht nur und nicht einmal primär von dem Gegebensein einer idealen Sprechsituation ab, sondern vor allem von dem Sachwissen und der Erfahrung der Diskurspartner, also von etwas, das von außen in den Diskurs eingebracht wird. Der rationale, konsens26 Vgl. näher Kaufmann (FN 4), bes. S.440ff.; ders., in: Kaufmann / Hassemer (FN 9), S. 131 ff.; ders., Nach-Neuzeit (FN 1), S. 32ff., bes. S. 37f.
198
Arthur Kaufmann
erzielende Diskurs als solcher sagt uns nicht, was wahr oder richtig ist, und nicht, was wir tun sollen. Erst wenn man dem Diskurs einen Inhalt, ein „Thema", gibt, der nicht mit dem Diskurs ineinsfällt, kann die Diskurs- bzw. Konsensustheorie als Wahrheits- und Richtigkeitstheorie fungieren. Die Inhalte unserer Erkenntnis kommen - zumindest überwiegend - aus der Erfahrung. Wer glaubt, er habe sie einzig der Form, dem Verfahren, entnommen, täuscht sich. Allen diesen rein prozeduralen Theorien ist gemeinsam, daß die Inhalte erschlichen sind. Und es wird eine „Rationalität" vorgegaukelt, die so nicht besteht. Stammen die Inhalte vorzugsweise (wenn nicht gar allein) aus der Erfahrung, dann gelten sie nicht a priori und nicht absolut. Und das Konsensprinzip verbürgt keine „Letztbegründung" von Wahrheit, wie manche Diskurstheoretiker sie in Anspruch nehmen, 27 sondern niemals mehr als Plausibilität, als Wahrscheinlichkeit, als Entscheidung unter Risiko. Und wie die Inhalte erschlichen sind, so ist auch ihre angeblich zirkelfreie Gewinnung ein Trug. Es gibt keine inhaltliche Erkenntnis, ohne daß ihr unausgewiesene Annahmen zugrunde liegen, wie ja auch die Logik mit impliziten Definitionen arbeiten muß. Das besagt aber nichts gegen inhaltliche Begründungen an sich, sondern nur etwas gegen die Behauptung ihrer Letztgültigkeit und Absolutheit. Was leisten dann aber überhaupt die prozeduralen Theorien? Dazu ist zunächst zu sagen, daß sie als Denkmodelle durchaus sinnvoll und nützlich sind. Als solche haben sie einen heuristischen Wert. Man kann das mit der jedem Juristen geläufigen Condicio-sine-qua-non-Formel vergleichen, mit deren Hilfe man niemals einen unbekannten Kausalzusammenhang auffinden oder ausschließen kann, die aber sehr wohl geeignet ist, eine aus der Erfahrung gewonnene Bejahung oder Verneinung von Kausalität auf ihre Stimmigkeit zu überprüfen. Ähnlich können prozedurale Theorien der Stimmigkeitsoder Plausibilitätskontrolle dienen. Sodann und vor allem ist darauf hinzuweisen, daß die prozeduralen Theorien durchaus einen richtigen Aspekt aufweisen. Zwar entsteht Wahrheit bzw. Richtigkeit im Bereich des Normativen (ob auch in anderen Bereichen, bleibe dahingestellt) nicht einzig durch Verfahren, aber doch sehr wohl im Verfahren, das will sagen: nicht ohne Verfahren. Denn Erkenntnisse von Normativem sind immer auch Produkt des Erkennenden. Aber sie sind nicht einzig das Produkt des Erkennenden, soll der Wahrheitsprozeß nicht dem Unternehmen 27 So vor allem K.-O. Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral, 1988, S. 8, 117f., 143ff., 198ff., 347f. u. ö. Ähnlich, wenn auch nicht so pointiert, O. Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, 1987, S. 28. Auch Habermas (FN 23, S. 179) spricht von einer Begründung „in letzter Instanz". - Dazu (auch kritisch) neuerdings W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung. Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik, 1985.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
199
des Münchhausen gleichen, sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf zu ziehen (Münchhausendilemma oder -trilemma). Auch der praktische (normative) Diskurs muß einen „Gegenstand" haben. Richtig ist freilich, daß es bei normativen Diskursen keine substantiellen Gegenstände gibt. Falsch ist jedoch, wenn man daraus folgert, solchen Diskursen fehle überhaupt etwas, was, zumindest rudimentär, außerhalb des Diskurses besteht. Welcher Jurist wüßte nicht, daß es einen Prozeß ohne einen Prozeßgegenstand, der ihm Identität verleiht, nicht gibt. Er weiß aber auch, daß einerseits dieser Prozeßgegenstand als Prozeßgegenstand vor dem Prozeß nicht schon fertig gegeben ist, sondern erst im Prozeß seine genauen Konturen erhält, daß andererseits der Prozeßgegenstand aber auch nicht einzig das Produkt des Prozesses ist, sondern ihm als ein historisches Ereignis mit Rechtsverhältnischarakter vorausliegt. „Gegenstände" der normativen Wissenschaften Ethik, Normentheorie, Rechtswissenschaft - sind nie Substanzen, sondern Verhältnisse, Relationen, sie sind seinshaft und prozeßhaft, außerhalb wie innerhalb des Prozesses ihrer konkreten Gestaltwerdung - ihr Gegenstand ist letzthin der Mensch, aber nicht der Mensch als Substanz, sondern der Mensch als Person, verstanden als das Ensemble der Beziehungen (Relationen), in denen der Mensch zu anderen Menschen und zu den Dingen steht. Der Mensch als Person bestimmt den juridischen Diskurs, nicht nur das Procedere, sondern auch den Inhalt. Denn der Mensch als Person ist das „Wie" und das „Was" des normativen Diskurses in einem, „Subjekt" und „Objekt", „Aufgegebenes" und „Gegebenes", und zwar nicht in abstracto, sondern in seiner konkreten Geschichtlichkeit. Darum sagt schon Hegel: Das Rechtsgebot ist: „Sei eine Person und respektiere die anderen als Personen." 28 Und mit Peirce ist - gegen Kant - zu erinnern, daß Erkennen und Anerkennen miteinander korrespondieren. 29 Eine so verstandene personal (nicht substantiell, sondern relational) fundierte prozedurale Wahrheits- und Gerechtigkeitstheorie wird dies alles zu bedenken haben. 30 4. Ein prozedurales Modell auf der Grundlage der Philosophie Kants Was hat es nun aber mit Kants prozeduralem Ansatz auf sich, auf den zurückzukommen oben versprochen wurde? In einer nicht sehr bekannt gewordenen, sehr scharfsinnigen, aber auch sehr spekulativen Schrift über
28
Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 36. Eingehend L. Schulz, Das rechtliche Moment der pragmatischen Philosophie von Charles Sanders Peirce, 1988. 30 Näher A. Kaufmann, Vorüberlegungen zu einer juristischen Logik und Ontologie der Relationen. Grundlegung einer personalen Rechtstheorie, in: RECHTSTHEORIE 17 (1986), S.257ff.; ders., in: Kaufmann / Hassemer (FN 9), S. 139ff.; ders., Nach-Neuzeit (FN 1), S. 35ff. 29
200
Arthur Kaufmann
„Das Problem von Sein und Sollen in der Philosophie Immanuel Kants" hat Günter Ellscheid 31 den Nachweis zu erbringen versucht, daß sich im Bereich der kritischen Philosophie Kants eine inhaltlich erfüllte Ethik und Philosophie des Rechts ohne die Annahme materialer Werte im Sinne idealer Vorgegebenheiten erarbeiten läßt. Ellscheid will das Argument abwehren, eine Ethik sei ohne Annahme materialer Werte, wie sie in der Wertphilosophie erfolgt, nicht möglich. Ich kann Ellscheids Gedankengebäude hier nur in sehr geraffter Form wiedergeben. Seine Ausgangsbasis ist, daß für den Juristen nur eine solche Methode sinnvoll sein kann, die ihm erlaubt, sowohl die Sollensnorm als auch die Umstände des Falles zu berücksichtigen. Darum kann er, der Jurist, sich mit dem Methodendualismus der neukantischen Philosophie und Rechtsphilosophie, wonach Sein und Sollen getrennte Bereiche, verschiedene Welten sind, nicht zufrieden geben. Ellscheid meint, und ich denke, er hat recht, daß dieser Methodendualismus, entgegen verbreiteter Auffassung, in Kants Philosophie nicht angelegt ist, denn theoretische und praktische Philosophie stehen bei Kant in einer inneren Einheit. Der zentrale Begriff in der Untersuchung Ellscheids ist der des Sollens. Im Gegensatz zum Sein ist das Sollen nicht wirklich. Das Sollen ist die Negation der Realität. Das Denken des Sollens oder des Wertes ist ein reines Tun des Bewußtseins, das nicht vom Sein her determiniert ist. Werte sind nichts als eine reine Spontaneität des Ichs. Deshalb hat Kant die Wahrheit des Sollens in der reinen Form gesucht. Sein und Sollen zeigen sich zunächst im Verhältnis der Bedingtheit und der Unbedingtheit. Sein ist immer bedingt durch anderes Sein - ein unendlicher Regreß. Das Sollen ist das Unbedingte, 32 das keinen weiteren Grund hat, in sich selbst Grund ist, es ist reiner Begriff, der sich auf nichts richtet als auf sich selbst, und ist damit schlechthin wahr. Ellscheid übersieht durchaus nicht, daß es im Grunde das Gottesproblem ist, das er hier erörtert. Das Sollen ist nicht von bestimmtem Verhalten abstrahiert, denn das Verhalten enthält das Sollen nicht. Das Sollen kann nur aus sich selbst erklärt werden. Es ist nicht die Summe der Einzelnormen, sondern das schöpferische Prinzip, aus dem sich die Einzelnormen entfalten lassen. Das Sein ist Einheit durch Abstraktion aus der Mannigfaltigkeit, das Sollen gebiert eine Mannigfaltigkeit durch Deduktion aus der Einheit. 31 G. Ellscheid, Das Problem von Sein und Sollen in der Philosophie Immanuel Kants, 1968. 32 Vgl. dazu die Kritik Schopenhauers: „Die völlige Undenkbarkeit und Widersinnigkeit dieses der Ethik Kants zum Grunde liegenden Begriffs eines unbedingten Sollens tritt in seinem System selbst später, nämlich in der ,Kritik der reinen Vernunft' hervor; wie ein entlarvtes Gift im Organismus nicht bleiben kann, sondern endlich hervorbrechen und sich Luft machen m u ß . . . " : Die beiden Grundprobleme der Ethik (FN 8), S. 649.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
201
Das Sein ist Realität, das Sollen die sich darauf beziehende Negation. Die Absolutheit des Sollens kann nur negativ bestimmt werden : Verneinung der Zufälligkeit, Verneinung des Bedingten, Widerspruch zur grundlosen Faktizität (auch hier wieder die Parallele zum Gottesproblem; nach der „negativen Theologie" kann Gottes absolutes Wesen nur durch Negation gekennzeichnet werden : was und wie er nicht ist). Das Sollen ist aber nicht Vernichtung des Seienden, nicht das böse Nichts. Das Sollen negiert das Seiende nicht nur, sondern bewahrt es auch. Es ist Formung und Verarbeitung des Stoffes: Kultur. Doch gibt der Begriff der Verarbeitung allein keine Richtung an. „Soll die Rede von der Notwendigkeit des Sollens nicht leer bleiben, so muß das Sollen auf einen Inhalt führen, der ihm unauswechselbar zugehört, also auf bestimmte moralische oder rechtliche Geund Verbote, die unter sich in ursprünglichem Einklang stehen, weil sie alle aus der einen Idee des Sollens als ihrem Prinzip entspringen. Die gegenstandslose Unbedingtheit des Sollens muß sich, weil sie auf das mannigfaltige Seiende ihrem eigenen Begriff nach bezogen ist, äußern, d.h. es müssen bestimmte Handlungen, Zustände, Ziele oder Zwecke als die äußere Gestalt der unbedingten Notwendigkeit des Sollens aus der Idee des Unbedingten in ihrem Verhältnis zur Mannigfaltigkeit des Seienden geschöpft werden, und zwar in der Weise, daß dadurch das Sollen nicht der Zufälligkeit und Beliebigkeit der Realität verfällt, an der er erscheinen muß. Denn das Sollen drückt absolute Notwendigkeit aus." 33 Das Sollen ist Verarbeitung der Realität. Aber wie kann sich die Notwendigkeit des Sollens in der Konkretheit und Zufälligkeit des Seienden darstellen? Das ist, wie Ellscheid weiter ausführt, nur möglich, indem das Seiende in seiner Wiederholbarkeit und damit Gleichheit erfaßt und damit zu Tatbeständen vertypt wird (Ablehnung der Existenzphilosophie mit ihrer Negation der Allgemeinheit). Erforderlich ist also die Generalisierung und Schematisierung der Fälle. Das Medium ist der Allgemeinbegriff als Mittler zwischen dem ganz konkreten einzelnen und dem absoluten Sollen. Damit ist - nach Ellscheid - „in der Reflexion Kants erreicht, daß sich das Sollen nur im Rückbezug auf Realität im Modus gegebener Mannigfaltigkeit, wie sie die Natur darbietet, erfassen kann; daß das Sollen kein eigenes, inhaltlich erfülltes Reich neben der Realität darstellt, sondern nur im Rückbezug auf die gegebene Realität sich inhaltlich erfüllen und so sich selbst gewinnen kann". Und erreicht ist vor allem dies, den „Ansatz im Kantischen Denken, der sich an vielen Stellen zeigt, grundsätzlich zu entwickeln und den kategorischen Imperativ, der die Idee der Form eines allgemeinen Gesetzes überhaupt zum Richtpunkt des Handelns aufstellt, als Resultat der Entfaltung der Dialektik von Sein und Sollen zu begreifen". 34 33 Ellscheid (FN 31), S. 68f. 34 Ebd., S. 88f.
202
Arthur Kaufmann
Das alles besagt aber nicht, so führt Ellscheid seinen Gedankengang fort, daß Form Inhaltlosigkeit sei. Auch eine formale Ethik ist nicht ohne Inhalt. Das Verhältnis von Sein und Sollen bedeutet eine Verknüpfung von Verschiedenheit und Identität in der menschlichen Gemeinschaft. Das Prinzip der Gemeinschaft bestimmt den Inhalt der sittlichen und rechtlichen Postulate. Der Mensch in seiner „ungeselligen Geselligkeit" muß die Verschiedenheit so leben, daß dadurch die ursprüngliche Einheit nicht verstellt wird: Verbot der Tötung, tätige Liebe, Sorge um den Mitmenschen, Achtung, Würde. Das Recht muß die Freiheit sichern, in der allein die sittliche Pflichterfüllung möglich ist. Dabei sind die geschichtliche Situation zu berücksichtigen, die Verschiedenheit der Menschen, der historische Wandel. Das macht die Positivität der Rechts- und Sittenordnung nötig. Diese sind aber immer durch die Idee zu kritisieren. So bilden Naturrecht und positives Recht eine Einheit: Das Naturrecht erscheint im positiven Recht. Für das intentionale Denken, das sich nur auf die Realität im engeren Sinne richten kann, ist es unbegreiflich, wie man vom reinen Begriff des Sollens zu einem inhaltlichen Prinzip gelangen kann. Deshalb ist der Übergang vom direkten Denken zum reflexiven Denken erforderlich. „Das Sollen als das Unbedingte widersetzt sich seinem eigenen Begriff nach der intentionalen Erfassung und fordert eine andere Art der inhaltlichen Erfüllung. Diese Erfüllung kann nur so vor sich gehen, daß gefragt wird, was dem denkenden Wesen die Realität ist, wenn es die Idee des unbedingten Sollens schon vor aller inhaltlichen Erfüllung für wahr hält. Die sich dann ergebenden Schlußfolgerungen sind der einzige Inhalt des Sollens." 35 (Es sei nur angemerkt, daß auch hier bei Ellscheid ein Regreß auf einen fiktiven Ante-Zustand erfolgt.) Das Beispiel, an dem Ellscheid seine Konklusionen demonstriert, ist, wie bei Kant, das Verbot der Selbsttötung. 36 Dabei kommt es Ellscheid darauf an, daß das Sollen nicht aus der „Natur" des Menschen geschöpft wird. Die sittliche Idee ist nicht eine Eigenschaft des Menschen, sie wird nur im Denken durch Loslösung von aller Realität erfaßt. Das Begreifen des Sollens durch sich selbst hindert nicht die Entfaltung der Ethik, sondern ermöglicht sie. Die im Sollen gedachte Unbedingtheit bringt sich in der Welt der erfahrenen Antriebe, Strebungen, Zwecke und Gegenstände als ein apriorisches, aktiv strukturiertes Moment zur Geltung. Die Werte sind Resultate des Denkens. Einer wissenschaftlichen Ethik muß es darum gehen, diese Genesis zu begreifen und dadurch die Werte zu begrün-
35 Ebd., S. 124. 36 Entgegen Kant und Ellscheid ist zu sagen, daß das Verbot der Selbsttötung keineswegs aus dem reinen Begriff des Sollens folgt. Rational ist dieses Verbot nicht zu begründen. Wer nicht aus religiösen Motiven sein Leben als eine Gabe Gottes erachtet, verstößt nicht gegen die Vernunft, wenn er es für verfügbar hält. Für die Rechtsordnung muß gelten: Etiamsi daremus non esse Deum (Hugo Grotius).
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
203
den. Diesen Weg beschreitet die formale Ethik durch ihre Methode der dialektischen Reflexion. Reflektierendes und intentionales Denken sind konträr, aber doch aufeinander bezogen. Das intentionale Erkennen, das auf die Wirklichkeit gerichtet ist, führt bei der Verifikation zu unendlichen Regressen. Das Sollen, das sich nur dem reflektierenden Denken erschließt, bedarf keiner Verifizierung nach Art der Tatsachenwissenschaften, jedoch eines Abhorchens der Situation. Das Sollen ist eine wahre Idee - wahr freilich nicht im Sinne des gegenständlichen Bewußtseins. Es ist wahr für sich selbst. Es entspringt reiner Spontaneität des Denkens, es ist nicht rezeptiv, sondern schöpferisch. Das Sollen folgt notwendig aus der Struktur des Denkens, die allen Menschen wesentlich und gemeinsam ist. Die Idee des Sollens ist ein transzendentales Implikat des Denkens, der Idee der bei sich selbst bleibenden Vernunft. Die Notwendigkeit des Sollens ergibt sich somit aus der inneren Notwendigkeit der Reflexion. Das Sollen ist damit ein in sich wahrer Begriff. Für das ungegenständliche Denken ist der Begriff der Ort der Wahrheit, während für das intentionale Denken das Urteil der Ort der Wahrheit ist. „Die Idee des Sollens", sagt Ellscheid (und hier klingen Gedanken des Kritischen Rationalismus im Sinne von Karl R. Popper an), „ist jene kritische Idee, in der sich die Vernunft über ihr eigenes Wesen belehrt und den Sinn des Seienden kritisch entfaltet." 37 Und am Schluß heißt es, daß die Idee des Sollens als reine Form der Reflexivität „ein Analogon jenes göttlichen Verstandes" ist, „dem sich die Mannigfaltigkeit aus der Funktion der Einheit des Denkens ergibt". 38 Soweit Ellscheid. 5· Kritik und Ergebnis Man könnte Kritik und Ergebnis in einem Satz zusammenfassen: Sofern Ellscheid den Gottesbeweis zu führen imstande ist, ist seine Argumentation schlüssig. Ist doch, was er anruft, jenes „Wort", durch das alles geworden ist und ohne das nicht eines von dem ward, was geworden ist (Joh. 1, 1 - 3). Es ist ein imposanter Kraftakt, den Ellscheid uns vorgeführt hat. In der zeitgenössischen Rechtsphilosophie gibt es eine gewisse Parallele, nämlich in dem Streit zwischen H. L. A . Hart, dem Vater der Analytischen Rechtstheorie, und seinem Schüler Ronald Dworkin, dem die reine Analytik nicht mehr genügt. Hart sieht von seiner positivistischen Warte aus, daß Rechtsregeln unscharfe Ränder haben, und wenn ein schwieriger Fall (hard case) nicht eindeutig von seiner Rechtsregel abgedeckt wird, entscheidet der Richter nach seinem Ermessen; im Rahmen des Ermessensspielraums ist seine Entschei37 38
Ellscheid (FN 31), S. 187. Ebd., S. 190.
204
Arthur Kaufmann
dung stets „richtig". Dworkin macht demgegenüber die Unterscheidung zwischen Prinzipien, die eine Dimension des Gewichts oder der Bedeutung haben, und Regeln, die keinen Spielraum, sondern nur ein Entweder-Oder lassen (im Strafrecht entspricht dem der Streit zwischen Spielraum- und Punktstrafentheorie 39 ). Dworkin ist sich dabei im klaren darüber, daß dieser Standpunkt nur behauptet werden kann, wenn man einen Juristen mit übermenschlichen Fähigkeiten - Dworkin nennt ihn „Herkules" - fingiert, für den es immer nur eine Lösung, nie eine Wahl gibt. Hart meint dazu, diese Theorie müsse man durchaus ernst nehmen, wennschon Dworkin „the noblest dreamer of them all" zu nennen sei. 40 Ich meine, das paßt auch auf Ellscheid. Er ist dieser „Herkules", der alle Bedingtheit und Zirkelhaftigkeit in unserem Denken auflöst und zur Einheit bringt. Und gewiß muß man seine Theorie ernst nehmen, denn sie stellt, wie mir scheint, den äußersten Punkt dar, bis zu dem eine prozedurale Theorie der Wahrheit und der Gerechtigkeit getrieben werden kann. Er ist aber doch auch der „noblest dreamer", der im „Denken des Denkens" die irdische Realität weit unter sich gelassen hat. Nur am Rande sei angemerkt, daß Ellscheid, durchaus bewußt, die Philosophie Kants in mehreren Punkten verläßt. Kant geht davon aus, daß der Begriff auf ein in der Anschauung Gegebenes angewiesen ist. Ellscheid leugnet diese Angewiesenheit (jedenfalls in dem Sinne, wie sie Kant versteht). Nach Kant ergibt sich aus dem reinen Begriff als solchem keine Erkenntnis. Bei Ellscheid dagegen ist inhaltliche Erkenntnis aus reinem Begriff (dem reinen Sollen) möglich. Und während Ellscheid durch dieses Modell von „Form-Inhalten" eine zirkelfreie Begründung der Ethik erreichen will, erfolgt bei Kant die Materialisierung der Ethik durchaus zirkelhaft. Darauf hat vor allem Hans Welzel aufmerksam gemacht. Er hat dargetan, daß Kant in seiner Ethik, wiewohl er an die Stelle des objektiv-materialethischen Problems, das die ganze seitherige Naturrechtslehre beschäftigt hat, das Problem der subjektiven Moralität treten läßt, dabei doch immerfort eine objektiv-sittliche Ordnung der Dinge voraussetzt. Welzel bemerkt dazu, daß Kant „die selbständige Bedeutung verkennt, die dem materialethischen Problem (dem ,Was' der sittlichen Handlung) gegenüber dem subjektiv-moralischen Problem (dem ,Wie' der sittlichen Handlung) zukommt. Statt dessen glaubt er, aus dem „Wie" das „Was" entwickeln zu können, nämlich mittels des kategorischen Imperativs. 41 Wenn Welzel allerdings meint, es handle sich hier um einen vitiösen und vermeidbaren Zirkel, so irrt er. 39 Siehe dazu W. Grasnick, Über Schuld, Strafe und Sprache. Systematische Studien zu den Grundlagen der Punktstrafen- und Spielraumtheorie, 1987. Dazu A. Kaufmann, in: Neue Juristische Wochenschrift 1988, S. 2784f. 40 Vgl. dazu P.-M. Mazurek, in: Kaufmann / Hassemer (FN 9), S.302ff. 41 H. Welzel, Naturrecht und materielle Gerechtigkeit, 4. Aufl., 1962 (Nachdruck 1980), S.169.
Prozedurale Theorien der Gerechtigkeit
205
Auch Ellscheid entgeht diesem Zirkel des Denkens nicht. Seine Inhalte, so sie wirklich Inhalte sind, sind erschlichen, größtenteils aus den anthropologischen Zielsetzungen der Philosophie Kants. Sofern aber die Form-Inhalte als absolut gedacht werden, sind sie leer. Ich kann das hier nur an einem Beispiel deutlich machen. Wenn man das oberste Prinzip der Rechtsordnung, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, aus einem Begriff des reinen Sollens folgert, ist es leer. Allein unter dieser Voraussetzung, daß es leer ist, können im Streit um das Abtreibungsverbot zwei sich widersprechende Behauptungen nebeneinander bestehen, die beide mit dem Gebot der Achtung der Menschenwürde argumentieren: 1. Aus der Menschenwürde, der Autonomie der werdenden Mutter, folgt, daß sie frei über sich und „ihren Bauch" verfügen kann. 2. Die Menschenwürde kommt jedem menschlichen Lebewesen zu, auch dem ungeborenen Kind, und folglich kann die Schwangere über dieses Lebewesen in ihrem Schoß grundsätzlich nicht verfügen. Beide Aussagen können ersichtlich nur dann zugleich Gültigkeit haben, wenn „Menschenwürde" nicht inhaltlich gedacht wird, wenn sie ein leeres Wort ist. Wird sie aber inhaltlich gedacht, und natürlich wird sie immer inhaltlich, und das heißt: aus der Erfahrung gedacht, dann ist notwendig eines der beiden Urteile falsch (was nicht zwingend heißt, eines sei richtig - denn im deontischen Bereich gilt der Satz des ausgeschlossenen Dritten nicht mit der Stringenz wie im ontischen Bereich). Das Ergebnis meiner Überlegungen ist ernüchternd, aber keineswegs neu. Die prozeduralen Theorien ersparen uns nicht das mühsame Unternehmen der empirischen Wahrheitssuche: des Auffindens von Erfahrungen im Bereich des Werthaften, dem dann freilich auch die normative Beurteilung folgen muß. Es wäre zu schön, wenn man wahre Inhalte einfach durch Denkprozesse aus der Form gewinnen könnte. Aber bis jetzt hat es sich noch nicht ereignet, daß „Form an sich" Inhalte hervorbringt - es sei denn - wie gesagt - man versteht „reine Form" (und „reines Sollen") als Gott, der im Moment des Urknalls das Wort zum Sein werden ließ. Das ist indessen nicht mein Thema. In der Welt, in die wir Menschen hineingeboren worden sind - und das ist sehr lange Zeit nach dem Urknall geschehen, gibt es solche Ereignisse, solche Singularitäten, nicht. Diskurs ist nötig, jedoch nicht nur in der Form eines fiktiven Denkmodells, sondern vor allem in der Form tatsächlich existierender Argumentations gemeinschaften, bei denen wirkliche Erfahrungen und Überzeugungen über „Sachen" ausgetauscht werden. Ein solcher realer Diskurs bedarf eines empirischen Fundaments. Auch Philosophie und Rechtsphilosophie sind, wollen sie nicht im Spekulativen verharren, auf die Erfahrung und das Experiment angewiesen. Das Experiment der Philosophie ist ihr Auftreten in der Geschichte y und dieses Experiment hat den großen Vorzug, daß es nicht bloß fiktiv ist.
206
Arthur Kaufmann
Daß solches Denken, vor allem das hermeneutische Denken 43 , nicht den Zufälligkeiten des Augenblicks verhaftet ist, sondern aus dem „Erbe" der Tradition als dem gemeinsamen Boden der öffentlichen Welt, auf dem wir stehen, lebt, ist ein Gedanke, der. der modernen Philosophie wohlvertraut ist. 44 Und gegen alle formalistischen Rationalisten sei einmal mehr gesagt, daß zwischen so verstandener Tradition und Vernunft kein Gegensatz besteht. Zum Schluß: Was ist der Kern aller Rationalität bei der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit? Kant sagt es: 1. Selbst denken. 2. Sich (in der Mitteilung mit Menschen) in die Stelle jedes anderen zu denken. 3. Jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken. 45 [Ein Vorabdruck dieses Beitrages wurde zu Ehren von Professor Opaïek in den Sitzungsberichten der Bayerischen Akademie der Wissenschaften veröffentlicht. Für die Genehmigung zum Wiederabdruck dieser (geringfügig vermehrten) Version danken wir der Akademie und dem Verlag C. H. Beck. Die Herausgeber. ]
43 Die Literatur zur juristischen Hermeneutik ist in den letzten Jahren lawinenartig angewachsen und dies keineswegs nur in Deutschland. Sehr klar und objektiv behandelt Jerzy Stelmach in seiner Krakauer Habilitationsschrift „Die hermeneutische Auffassung der Rechtsphilosophie", 1991, die anstehenden Fragen. Außerdem seien noch genannt: W. Krawietz! K. Opatek!A. Peczenik!A. Schramm (Hrsg.), Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, in: RECHTSTHEORIE Beiheft 1, 1979; M. Frommel, Die Rezeption der Hermeneutik bei Karl Larenz und Josef Esser, 1981; G. Zaccaria, Ermeneutica e Giurisprudenza, 2 Bde., 1984; ders., L'arte dell'Interpretazione. Saggi sull'ermeneutica giuridica contemporaneo, 1990; J. Lamego, Hermenêutica e Jurisprudência, 1990; M. Pavënik, Argumentacija ν Pravù, 1991 (passim); A. Kaufmann, Beiträge zur Juristischen Hermeneutik, 2. Aufl. 1992. 44 Siehe vor allem H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, 5. Aufl., 1986, S. 270ff. 45 Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, B A 166.
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie Von Vladimir Kubes, Brno I. Einführung in den Fragenkomplex Das Interesse des prominenten Jubilars für die Thematik der Normen (und der Direktiven) ist wohlbekannt 1 . Hier möchte ich - zum Zwecke eines Vergleichs - nur die Grundlagen meiner Auffassung der modernen kritischen Ontologie, besonders der Ontologie des Rechts als des wichtigsten Teils der Rechtsphilosophie demonstrieren und an einigen wenigen, frei ausgewählten, aber sehr „praktischen" und immer von neuem heftig diskutierten Hauptfragen des rechtlichen Denkens zeigen, wie diese bisher nicht cum ratione sufficiente gelösten Fragen auf der kritisch ontologischen Basis leicht lösbar sind. Im zweiten Kapitel dieser Abhandlung möchte ich vier von solchen rechtlichen Hauptfragen bloß vorführen, und dann im dritten Kapitel, in welchem zuerst das Wesen der Ontologie des Rechts behandelt wird, die Möglichkeit der Lösung zeigen. Mein erster persönlicher Kontakt mit der kritischen Ontologie fällt in das Jahr 1932, als ich in Berlin an meinem Habilitationsbuch arbeitete und auf Anregung meines unvergeßlichen Lehrers Jaromir Sedlâéek die Vorlesungen des famosen Philosophen Nicolai Hartmann besuchte. Damals und noch später als Anhänger der Schule der Reinen Rechtslehre Franz Weyrs und Hans Kelsens war ich von der transzendentalen Philosophie Kants beherrscht. Mit der kritischen Ontologie befaßte ich mich literarisch gewissermaßen erst in meinem Buch „Pravni filosofie X X . stoleti" („Die Rechtsphilosophie des X X . Jahrhunderts"), 19472. Zu einer neuen Auffassung der Rechtsphilosophie, auf welche schon die kritische Ontologie Hartmanns einen großen Einfluß hatte, gelangte ich im Jahr 1968, und zwar in meinen Abhandlungen „IJkoly prâvni filosofie" („Die Aufgaben der Rechtsphilosophie") 3 , „Pravni védy a dnesek. Κ problematice prâvnèfilosofické zâkladny" („Die Rechtswissenschaften und der heutige Tag.
1 Kazimierz Opalek, Theorie der Direktiven und der Normen, 1986, und eine Reihe von Abhandlungen. 2 L. c.,S. 114f. 3 Prâvnik 1968; siehe auch Schulz, Prâvnik 1968, S. 927 f.
208
Vladimir KubeS
Zur Problematik der rechtsphilosophischen Grundlage") 4 und „Prâvni sociologie a prâvni filosofie" („Die Rechtssoziologie und die Rechtsphilosophie") 5 . Dann folgte eine im Ausland verbrachte Zeitperiode, während der ich in einigen Büchern 6 und vielen Abhandlungen meine neue Auffassung der Rechtsphilosophie einschließlich der Rechtsontologie klarstellte. I I . Einige auf der Grundlage der modernen Ontologie lösbaren Hauptfragen des rechtlichen Denkens 1. Zuerst möchte ich über das uralte Problem des Naturrechts sprechen. Das Naturrecht ist ein Inbegriff von Normen, die - wie man behauptet - aus der Natur, bzw. aus der Natur der Sache oder der göttlichen Offenbarung oder aus unserer Vernunft entspringen, die inhaltlich erkennbar sind, die absolut und unabhängig von unserem Willen gelten. Dabei wird das Axiom der Unabänderlichkeit und Ewigkeit von den einen nur für einige höchste Rechtsgrundsätze vindiziert, von anderen hingegen für das ganze System der Rechtsregel. Im Naturrecht begegnet man einerseits den primären, dem allgemeinen Wesen des Menschen angemessenen Grundsätzen, mit der Würde des Menschen an der Spitze, welche Grundsätze absolut, unveränderlich und jedem Gesetzgeber von- und aufgegeben sind, andererseits den sekundären, veränderlichen Grundsätzen oder Normen, die den konkreten Verhältnissen einer bestimmten Zeit entsprechen (Verdross). Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurden die Betrachtungen über das Rechtliche vor allem unter der Flagge des Naturrechts geführt und im Vordergrund stand die Frage, wie man das richtige Recht findet oder bildet 7 . Den Kampf gegen die naturrechtliche Doktrin begann die historische Rechtsschule Savigny's einerseits und Hegel andererseits. Der bedeutendste Gegner des Naturrechts war gegen Ende des 19. Jahrhunderts Karl Bergbohm8. Der Dualismus des Naturrechts und des positiven Rechts wurde von ihm so charakterisiert, als arbeite man mit einem „Doppelrecht", als gäbe es neben dem positiven Recht ein ihm übergeordnetes oder antagonistisches, mit ihm rivalisierendes anderes Recht, in welchem das erstere bald die Quelle und das Fundament seiner eigenen Herrschaft, bald aber seinen Vorläufer oder
4
Sbornik praci filosofické fakulty brnënské university, 1969, Β. 16, S. 77ff. Sbornik praci filosofické fakulty brnënské university, 1970, Β. 17, S. 95ff. 6 Kubes, Grundfragen der Philosophie des Rechts, 1977; ders., Die Rechtspflicht, 1981; ders., Ontologie des Rechts, 1986; ders., Theorie der Gesetzgebung, 1987. 7 Kubes, Das Naturrecht und die Reine Rechtslehre in neuer Auffassung, in: Ota Weinberger / Werner Krawietz (Gesamtredaktion), Reine Rechtslehre im Spiegel ihrer Fortsetzer und Kritiker, 1988, S. 279ff. 8 Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892. 5
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
209
seinen Stellvertreter und Korrektor, bald aber auch nur sein Vorbild oder Ideal zu respektieren hätte. Große Gegner des Naturrechts waren beide Begründer der Schule der Reinen Rechtslehre Franz Weyr (im Jahr 1908 und später) und Hans Kelsen (im Jahr 1911 und später), die einen streng positivistischen Standpunkt einnahmen. Ein wesentliches Merkmal der Schule der Reinen Rechtslehre war und ist immer noch die scharfe antiideologische Tendenz und damit auch eine absolute Negation aller naturrechtlichen Strömungen. Die Wissenschaft soll nur erkennen. „Wissenschaft ist nie Wollenschaft", „Wissenschaft ist stets nur Intellektualität" (Kelsen). Für die Schule der Reinen Rechtslehre war von Anfang an und bleibt immer die positivistische Tendenz charakteristisch. Auf dieser Linie liegt der Kampf gegen jedes Naturrecht. Von daher stammt das Bemühen dieser Schule, aus der rechtlichen Auslegung alle Elemente auszuschließen, die naturrechtlicher Provenienz sind, und sich ausschließlich auf das Erkennen des gegebenen, positiven Materials zu beschränken. Auf der Grundlage der kritischen Ontologie zeigt es sich aber, wie später demonstriert werden wird, daß das Naturrecht nichts anderes ist, als der objektive Geist (Rechtsgeist), der in die höchste Schicht des stufenförmigen Aufbaues der realen Welt gehört, und daher als etwas Reales erkennbar ist. Die Arbeit mit ihm und daher auch mit dem Naturrecht gehört in den Bereich der Wissenschaft. Es geht doch um Erkenntnis, um rechtlich kognitive und also um wissenschaftliche Tätigkeit. 2. Eine zweite solche Hauptfrage des Denkens über das Recht ist das Verhältnis des Rechts und der Revolution. Es gibt eine Menge von verschiedenen Lösungen des Verhältnisses des Rechts und der Revolution im Schrifttum, aber keine von ihnen bringt eine in jeder Hinsicht befriedigende Lösung. Meiner Überzeugung nach ist diese Lösung nur auf der Grundlage der kritischen Ontologie möglich. Und wieder - wie man später demonstrieren wird - spielt die entscheidende Rolle der objektive Geist (Rechtsgeist). Das Recht und die Macht, als ein immanenter und wesentlicher Bestandteil des Rechts, haben ein und dieselbe Quelle, haben dieselbe innere Gültigkeit, die der objektive Rechtsgeist darstellt. 3. Die dritte Hauptfrage des Denkens über das Recht ist, ob die Sollsätze, die Normen erkennbar und verifizierbar sind. Es wird von einer Gruppe der Rechtsgelehrten behauptet, daß die Sollsätze (Normen) sich wesentlich von den Aussagen unterscheiden, und daß ihnen, im Gegensatz zu Aussagen, weder Wahrheit noch Falschheit zukommt. Man sagt, daß der Sollsatz (die Norm) nicht verifizierbar ist; für die Sollsätze - so lautet die weitere Argumentation - gilt nicht principium exclusi tertii. - Die anderen behaupten das Gegenteil. 14 Festgabe Opalek
210
Vladimir Kube
4. Die vierte Hauptfrage ist die Frage der Norm bzw. der Rechtsnorm. In mehreren Büchern und Abhandlungen habe ich gezeigt, daß der Begriff der Norm im Schrifttum nicht einstimmig und klar demonstriert ist. Uns interessiert hier nicht der Begriff der Norm in der Seinsbedeutung, als etwas, was gewöhnlich geschieht, was „normal" ist, sondern in der Bedeutung der Pflicht, des Sollens. Es wird sich wieder zeigen, daß auch diese kardinale Frage auf der Grundlage der weiter entwickelten kritischen Ontologie ihre Lösung findet. I I I . Über Wesen, Begriff, Aufgaben und Kategorien der Rechtsontologie; Antwort auf die aufgeworfenen Hauptfragen 1. Den Terminus „Ontologie" hat - wie es scheint - zum erstenmal Coclenius im Jahr 1613 und dann Glauberg im Jahr 1656 verwendet, und zwar im eigentlichen Sinn „der Lehre vom Sein"; es handelte sich dabei um das Sein und um die allgemeinsten Bestimmungen und Begriffe 9 . Der Name „Ontologie" taucht im 17. Jahrhundert auch bei Du Hamel auf 10 . Wie Marcic erwähnt, kann man Ontologie und auch Metaphysik auf deutsch mit „Seinslehre" wiedergeben. Eine Schuldefinition der Ontologie bzw. Metaphysik findet man im Handbuch von Alexander Gottlieb Baumgarten 11, einem Schüler von Christian Wolff: „Metaphysica est scientia prima cognitionis humanae principia continens; ad metaphysicam referentur: ontologia, cosmologia, psychologia et theologia naturalis." Marcic meint 12 , in der Gegenwart empfehle sich für die Seinslehre der Gebrauch des Namens Ontologie, weil das Wort Metaphysik Vorstellungen „mystischer Transzendenz" wachrufe. Der Begründer der modernen kritischen Ontologie war Nicolai Hartmann. Er bestimmt die Ontologie als „die Wissenschaft vom Seienden" 13 . Die neue philosophische Wissenschaft vom Seienden (die kritische Ontologie) unterscheidet sich von allen Ontologien der alten metaphysischen Systeme vor allem dadurch, daß sie als Grundlage und Ausgangspunkt kein absolutes Sein in der Sphäre eines überzeitlichen Ideenzusammenhanges vor Augen hat, sondern das, was in der Welt der Erfahrung gegeben und erkannt worden ist 14 . Aus Hartmanns begrifflicher Bestimmung der Ontologie geht 9
Georg Klaus I Manfred Buhr, Philosophisches Wörterbuch, 11. Aufl., 2. Bd., S. 891 ff. 10 Dazu E. Coreth, Metaphysik, 1961, S. 17ff., 28; René Marcic, Um eine Grundlegung des Rechts, Existentiale und fundamental-ontologische Elemente im Rechtsdenken der Gegenwart, S. 509f. 11 Met. Ed. I I , § l f . , 1743; siehe Marcic, 1. c. 12 Marcic, 1. c., S. 510. 13 Nicolai Hartmann, Der Aufbau der realen Welt, 2. Aufl., S. 15. 14 Wilhelm Windelband / Heinz Heimsoeth, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 1936, S. 591; z.f. Valdimir Kubes, Ontologie des Rechts, 1986, wo auch die Werke von N. Hartmann angeführt sind.
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
211
vor allem hervor, daß man unter der kritischen Ontologie nicht irgendeine metaphysische Theorie über die allgemeinsten Formbeziehungen der Wirklichkeit, wie z.B. die Stoiker die Ontologie begriffen, versteht 15 . Die alte Ontologie, die auch eine Lehre vom Sein war, baute auf die These, daß das, was allgemein ist und in essentia in eine Formsubstanz konzentriert und im Begriff bestimmbar ist, das bestimmende und formende Innere der Sache sei ir \ Nach dieser alten Ontologie existiert neben der Welt, in die auch der Mensch eingeschlossen ist, eine Welt der Wesenheiten, die zeitlos und immateriell sind und ein Reich der Vollkommenheit und des höheren Seins bilden. Die extremen Vertreter dieser Lehre behaupteten, daß die eigene und echte Realität nur allgemeine Wesenheiten besitzen, und in solcher Weise die zeitlich sachliche Welt entwerteten. Das Verfahren der neuen, kritischen Ontologie setzt die ganze Breite der Erfahrung, und zwar sowohl der Erfahrung des praktischen Lebens, als auch der wissenschaftlichen Erfahrung voraus. Das Verfahren der neuen Ontologie setzt auch die philosophische Erfahrung, also die wissenschaftliche Erfahrung per eminentiam voraus, nämlich die, welche sich im geschichtlichen Verlauf der menschlichen Gedankenarbeit als eine lange Reihe von Versuchen, Irrtumern und Korrekturen darstellt. Die Summe dieser Gesamterfahrung bildet die Aussagenebene des Gegebenen. Im Sinne der neuen kritischen Ontologie umfaßt die gegebene Erfahrung, von der wir ausgehen müssen, sowohl das naive Wissen von der Welt, als auch alle Errungenschaften der Wissenschaft und so auch die philosophische Erfahrung 17 . In der neuen Ontologie handelt es sich um fundamentale Aussagen über das Sein als solches18. Solche Aussagen sind nichts anderes als die Kategorien des Seins. Der Weg der neuen kritischen Ontologie stellt sich also als eine kategoriale Analyse, als ein besonderes Verfahren, das sich weder in der Induktion noch in der Deduktion erschöpft und bei dem es sich weder um eine rein aposteriorische, noch um eine rein apriorische Erkenntnis handelt 19 . Das Gesamtphänomen der Welt zeigt unzweifelhaft einen Schichtungscharakter. Das bedeutet, daß es nicht ausreicht, nur von einer einzigen Seinsschicht auszugehen. Man muß vielmehr den grandiosen Aufbau aller einzelnen Schichten der realen Welt beachten. In der Schichtung liegt die Haupteigenart der Struktur der realen Welt. In der Tatsache, daß die Welt geschichtet ist, ist eine gesetzliche Ordnung ausgedrückt 20. 15
Vgl. z.B. Windelband / Heimsoeth, 1. c., S. 166. Dazu Hartmann, Neue Wege der Ontologie, in: Ν. Hartmann (Hrsg.), Systematische Philosophie, S. 204. 17 Hartmann, Neue Wege der Ontologie, S. 208f. 18 Hartmann, 1. c., S. 208; Windelband / Heimsoeth, 1. c., S. 591. 19 Hartmann, 1. c., S. 214f. 20 Hartmann, 1. c., S. 246. 16
14*
212
Vladimir Kube
Die reale Welt besteht aus vier Grundschichten - aus der Schicht des physisch-materiellen (anorganischen) Seins, aus der Schicht des organischen Seins, aus der Schicht des seelischen Seins und aus der Schicht des geistigen Seins (mit personalem, objektivem und objektiviertem Geist). Dabei ist die niedere Schicht des Seins immer ein tragendes Fundament für die höhere Seinsschicht, welche auf der niederen ruht, von ihr abhängig ist und trotzdem ihre eigene Autonomie hat. Neben diesem vierstufigen Aufbau der realen Welt existiert noch ein Reich der Idealität, ein Reich der Normideen. Der Gedanke der Normideen mit ihrem reinen Sollen folgt mit Notwendigkeit aus der fundamentalsten Voraussetzung des Denkens überhaupt, der Philosophie und jeder Wissenschaft, und zwar aus der optimistischen geschichtlichen Einstellung zur Welt, aus der immerwährenden Tendenz zur Vollkommenheit (Piaton, Aurelius Augustinus, Kant, Herder und die materialistische Geschichtsauffassung), aus der grundlegenden Voraussetzung, daß es sich nicht nur bei den Individuen im Durchschnitt um eine aufsteigende Tendenz auf dem unendlichen Weg zur Erreichung der Normideen und daher auch zur Erreichung der Normidee des Rechts handelt. Ohne diese Grundvoraussetzung ist jede menschliche, jede wissenschaftliche Tätigkeit undenkbar, ja widersinnig. Der einzige bekannte Vermittler dieser zwei Welten ist der Mensch als Subjekt und Person. Das Begreifen dieser Verbindung zweier Welten ist sehr bedeutend für die Begründung der abgeleiteten Normativität gewisser Sphären des geistigen Seins, vor allem der rechtlichen Sphäre. Die ursprüngliche, reine Normativität findet man, wie wir schon wissen, nur im Reich der Normideen. Was die höchste Schicht des realen Seins, nämlich das geistige Sein betrifft, weiß man schon, daß das geistige Sein ein reales Sein ist, was oft, ja regelmäßig vergessen wurde. Das geistige Sein wurde irrtümlich aus dem realen Sein eliminiert und in die ideale Welt eingereiht; das geistige Sein war etwas Irreales; Geist, Wert, Sollen, Norm - das alles wurde synonym benutzt und in die Welt der Idealität eingereiht. Klar kann man das an der Schule der Reinen Rechtslehre beobachten. Bei genauer Betrachtung zeigte sich, daß solche Gebiete des geistigen Lebens wie das Recht, die Moral, das Wissen, die Sprache usw. ihren geschichtlich zeitlichen Ursprung und Untergang haben und nur im geschichtlich realen Leben des Volkes (der Nation, der internationalen Gemeinschaft) einer gewissen Epoche existieren. Auch beim geistigen Sein handelt es sich um eine Autonomie dieser höheren Seinsschicht im Verhältnis zum seelischen Sein, trotzdem und gerade deshalb, weil das geistige Sein vom seelischen Sein abhängig ist. Jede Seinsschicht im stufenförmigen Aufbau der realen Welt hat ihre eigenen Prinzipien, Gesetze, Kategorien. Kategorien einer gewissen Seinsschicht können zwar weit in die Schichten des strukturellen höheren Seins eingreifen,
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
213
können dort aber nicht Kategorien von bestimmender Bedeutung sein, welche dieser höheren Schicht adäquat wären. Die Richtung der Dependenz im Reich der Kategorien ist eine solche, daß niedere Kategorien in den höheren als Elemente wiederkehren, die höheren stehen also in Abhängigkeit von den niederen, sie können deren Gefüge nicht durchbrechen, sondern nur überformen oder überbauen. In diesem Sinne sind die niederen Kategorien die stärkeren. Dieses „Gesetz der Stärke" ist das Grundgesetz der kategorialen Dependenz. Die höhere Schicht ist aber in ihrer besonderen Gestaltung und Eigenart autonom. Die niederen Kategorien sind zwar stärker (das Gesetz der Stärke), aber die höheren Kategorien sind über ihnen doch „frei" (das Gesetz der Freiheit). 21 Jede Schicht des realen Seins weist besondere Formen der Determination auf 22 . Von allen Typen der Realdetermination - uns interessieren unmittelbar nur drei - sind nach Nicolai Hartmann 23 nur zwei, nach uns drei zugänglich: der Kausalnexus im physischen und der Finalnexus und auch der normative (normologische) Nexus im geistigen Sein. Was den normativen Nexus betrifft, so tritt er in der realen Welt in seiner abgeleiteten Form auf, und zwar in einigen Sphären des geistigen Seins, besonders in den Sphären des Rechts, der Moral und der Sitte; in seiner reinen Form ist er nur in der idealen Welt, im Reich der Normideen gegeben. Was das geistige Sein betrifft, sind wir schon in der Ebene der Objektivität und des personalen Geistes24. Hier finden wir schon eine für das geistige Sein typische Form der Determination, nämlich den Finalnexus. Diese Determinationsform ist für das ganze Gebiet des bewußten Tuns, einschließlich des moralischen und rechtlichen Wollens und Handelns, entscheidend. Die Teleologie ist keine umgekehrte Kausalität, wie Wundt und Kelsen dachten, sondern der Bau des Finalnexus, des teleologischen Nexus, ist viel komplizierter als der Bau des Kausalnexus. Den teleologischen (finalen) Nexus kann man - wie Nicolai Hartmann darlegt - in drei Etappen zerlegen. In der ersten Etappe geht es um das Vorsetzen des Zwecks durch das Subjekt, um das Überspringen des Zeitlaufes, um das nur dem Bewußtsein gegebene Vorauseilen und Sichhinwegsetzen über die Zeitordnung. Die zweite Etappe besteht in der rückläufigen, eigentlich finalen Bestimmung der Mittel durch den Zweck, beginnend mit dem letzten, dem End21
Hartmann, Kategorialgesetze, Phil. Anzeiger I, Heft 2, 1926. Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, 1. Aufl., S. 15ff.; ders., Der Aufbau der realen Welt, S. 92. 23 Hartmann, Der Aufbau der realen Welt, S. 314. 24 Hartmann, Neue Wege der Ontologie, in: Ν . Hartmann (Hrsg.), Systematische Philosophie, S. 254. 22
214
Vladimir KubeS
zweck am nächsten stehenden Mittel, zurück bis zum ersten gegenwärtigen Mittel, an welchem das Subjekt ansetzt, wobei immer das vorhergehende (also im Rückgang das nachfolgende) Glied das nachfolgende (im Rückgang Vorhergehende) zum Zweck hat und von ihm bestimmt wird. In der dritten Etappe geht es um die Realisation des Zweckes, um sein reales Bewirktwerden durch die Reihe der Mittel, wobei das in der vorhergehenden rückläufigen Bestimmung durchgehende Verhältnis von Mittel und Zweck sich in ein ebenso durchgehendes, rechtläufig-kontinuierliches Verhältnis von Ursache und Wirkung umsetzt. Die ersten zwei Etappen spielen sich im Bewußtsein ab. Nur die dritte Etappe hat den Charakter eines realen Prozesses. Hier greift das Subjekt mit seiner Handlung in das kausale Weltgeschehen ein. Die kategoriale Form dieser dritten Etappe, und nur diese, hat also die Form der Kausalität. Der Mensch als Subjekt und Person mit seinem „organ du coeur " für die kategorische Stimme der Normideen schafft Jahrtausende hindurch besondere Sphären des personalen, objektiven und objektivierten Geistes. Hier geht es um ein abgeleitetes Sollen. Mit solchem abgeleiteten Sollen haben wir gerade in den Systemen der Rechtsnormen, der Moralnormen und in den Systemen der Sitte zu tun. Überall hier stehen wir vor dem Sollen des Rechts, vor dem Sollen der Moral und vor dem Sollen der Sitte, vor einem Sollen, welches im Verhältnis zum reinen Sollen der Normideen, die der Welt der Idealität angehören, ein abgeleitetes Sollen darstellen. Dieses Sollen gehört der Realität an. Das ist der echte Kern der Normativität des Rechts (und auch der Moral und der Sitte) und er erlaubt uns, die besondere Normativität dieser Normkomplexe zu entdecken und zu begreifen. Uns interessiert besonders der objektive Geist, bzw. der objektive Rechtsgeist. Wenn wir das Verhältnis des objektiven Geistes zum objektivierten Geist am Beispiel des Rechts veranschaulichen, können wir sagen: Der objektive Rechtsgeist ist das rechtliche Bewußtsein des Volkes der betreffenden Rechtsgemeinschaft einschließlich der wissenschaftlichen rechtlichen Weltanschauung. Der objektive Rechtsgeist prägt sich selbst in bestimmte Formen, in rechtliche Objektivationen, in den objektivierten Rechtsgeist, also in Gesetze, Verordnungen usw., die er im Fortleben dauernd umprägt. Sobald sich diese Objektivationen von ihm ablösen und aus dem objektiven Rechtsgeist heraustreten, leben sie ihr eigenes Leben als objektivierter Rechtsgeist. Der objektive Geist (Rechtsgeist) ist eine tragende Grundlage der personalen Spontaneität und der schöpferischen Kraft 2 5 . Das Verhältnis des personalen und objektiven Geistes besteht in der Tatsache, daß der eine Geist den anderen trägt und gegenseitig von ihm getragen wird. Der objektivierte Rechtsgeist 25
Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, 1. Aufl., S. 189 - 209.
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
215
ist die geltende Rechtsordnung. Und dieser objektivierte Rechtsgeist trägt wieder den objektiven und personalen Rechtsgeist und wird gleichzeitig und wechselseitig von ihnen getragen. Die geltende Rechtsordnung als gewisse Kodifikation, d.h. als Objektivation des objektiven Rechtsgeistes (d.h. des Rechtsbewußtseins der betreffenden Gemeinschaft) ist ein ungemein bedeutender Bestandteil des objektivierten Geistes. Man spricht folgerichtig vom objektivierten Rechtsgeist. In gewisser Zuspitzung kann man sagen: Das geltende Recht besitzt seine lebendige Kraft nur so lange, bis es - im ganzen genommen - den herrschenden Vorstellungen von Gerechtigkeit usw. entspricht. Die Rechtsordnung, welche beim Leben nur durch Gewalt aufrecht erhalten wird, ist in ihren Grundlagen untergraben und muß sich letzten Endes ändern in legaler oder revolutionärer Weise - um wieder in Einklang mit dem Rechtsbewußtsein des Volkes der betreffenden Rechtsgemeinschaft zu sein. Die Macht, die nicht auf dem Recht beruht, ist eine unrechtliche, ja rechtswidrige, ist bloße Gewalt. Das Recht, das nicht auf der Macht fußt, ist kein Recht. Der objektive Rechtsgeist ist es, der die Macht als den immanenten und wesentlichen Bestandteil des Rechts und das Recht, zu dessen Wesen die Macht gehört, vereinigt. Das Recht sowie die Idee und die Normidee des Rechts beinhalten schon immanent, in ihrem innersten Wesen die Macht. Das Recht und die Macht, als ein immanenter und wesentlicher Bestandteil des Rechts, haben ein und dieselbe Quelle, haben dieselbe innere Gültigkeit, die der objektive Rechtsgeist darstellt. Die innere Geltung des Rechts ist mit der Macht, die das Recht über die Menschen ausübt, identisch. Der objektive Geist (Rechtsgeist) ist eine aufweisbare reale Macht, eine Macht nicht nur im Leben des Individuums, sondern auch eine Macht nach außen gegen den fremden Geist, der mit ihm gleichzeitig koexistiert. Wie wir schon angedeutet haben, geht es um zwei Bestandteile des objektiven Rechtsgeistes. Der eine Bestandteil ist das allgemeine Bewußtsein des Volkes; der zweite Bestandteil ist die wissenschaftliche rechtliche Weltanschauung, die ein Querschnitt der rechtlichen Anschauungen der beste Kenner des Rechtlichen ist. 2. Jetzt kehren wir zu den Lösungen von den vier ausgewählten Hauptfragen, und zwar auf der Grundlage der weitergeführten kritischen Ontologie (Rechtsontologie), besonders auf der Grundlage des objektiven Rechtsgeistes, zurück. a) Zuerst ist da das Problem des Naturrechts und besonders sein Verhältnis zum sog. positiven Recht.
216
Vladimir Kube
Wir wissen schon, daß der objektive Rechtsgeist, d.h. das Rechtsbewußtsein des Volkes, sowohl der allgemeine, als auch der - kurz ausgedrückt - des Juristenstandes und die von beiden gebildete Gesamtheit, seine eigene Existenz hat, die zeitlich real und individuell ist, und daß alles, was real ist, erkennbar ist. Das Naturrecht ist nichts anderes als der zweite Bestandteil des objektiven Rechtsgeistes, also ein Querschnitt durch die rechtlichen Anschauungen der besten Kenner des Rechtlichen. Es handelt sich also beim Naturrecht um nichts anderes als um die Erkenntnis dieses zweiten Teiles des objektiven Rechtsgeistes. Die Sollsätze (Normen) sind mit soziologischen (rechtssoziologischen) Methoden und Techniken erfaßbar und verifizierbar; sie können als wahr oder unwahr charakterisiert werden. Der Unterschied zwischen der Erkenntnis des objektiven Rechtsgeistes (des Rechtsbewußtseins des Volkes einer bestimmten Rechtsgemeinschaft einschließlich der wissenschaftlichen rechtlichen Weltanschauung) und der Erkenntnis des objektivierten Rechtsgeistes (der Gesetze, Verordnungen, Urteile, Rechtsgeschäfte) ist nur quantitativ, nicht qualitativ, er ist relativ. Es handelt sich dabei nur um graduelle Unterschiede der „Gewißheit" der Erkenntnis. Und wenn wir an den zweiten Bestandteil des objektiven Rechtsgeistes, nämlich an die wissenschaftliche rechtliche Weltanschauung, denken, ist es vielleicht leichter, die erlassenen Gesetze zu erkennen, als diese wissenschaftliche rechtliche Weltanschauung. Die wissenschaftliche rechtliche Weltanschauung ist ein stufenförmiger Aufbau der einzelnen rechtlich relevanten Ideen. A n der Spitze des stufenförmigen Aufbaues der rechtlichen Weltanschauung steht die reale Idee des Rechtes, die eine Synthese der Gedanken der Gerechtigkeit, der Freiheit des konkreten Menschen, der Rechtssicherheit und der Zweckmäßigkeit ist 26 . Der Inhalt der wissenschaftlichen rechtlichen Weltanschauung, also der Inhalt des Naturrechts ist mittels gründlicher wissenschaftlicher Arbeit erkennbar und daher auch Gegenstand der Wissenschaft. Daraus folgt, daß die Tätigkeit der Rechtstheoretiker nicht nur auf das Erkennen der schlecht gemachten Gesetze beschränkt ist, sondern sie sind verpflichtet, auch an der Gesetzgebung selbst beteiligt zu werden, denn auch hier handelt es sich um das Erkennen eines gegebenen Gegenstandes, daher um eine wissenschaftliche Arbeit im strengen Sinn. b) Auch die Lösung der zweiten Grundfrage, die des Verhältnisses des Rechts und der Revolution, ist auf der Grundlage der kritischen Ontologie (Rechtsontologie) möglich. Und wieder spielt eine entscheidende Rolle der objektive Rechtsgeist. Dieser objektive Rechtsgeist ist es, der die Macht als den immanenten und wesentlichen Bestandteil des Rechts und das Recht, zu dessen Wesen die Macht gehört, vereinigt. Die Macht ist dadurch keine 26 Dazu Kubes (FN 7), 1. c., S. 279 - 296.
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
217
andere, als diejenige, die im objektiven Rechtsgeist enthalten ist, die im gemeinsamen Rechtsbewußtsein lebendig ist. Die Geltung des Rechts ist im objektiven Rechtsgeist verankert. Der objektive Rechtsgeist ist infolge seines Sichumbildens durch die Ideen und Normideen ein entscheidender Faktor. Auch die Revolution hat in ihm ihre innere Begründung: er verleiht ihr die Legitimation. Das ist der Grund, warum man mit vollem Recht von dem „Recht der Revolution" sprechen darf. Die Revolution steht im Recht, wenn sie den objektiven Geist (Rechtsgeist) hinter sich hat. Es ist der lebendige objektive Geist, der fortwährend bestrebt ist, sich eine neue Form zu geben, die ihm entspräche und im Einklang mit seiner Entwicklung wäre. Nur wenn man weiß, daß hinter dem Recht und der Macht als ihr immanenter und integrierender Bestandteil der objektive Rechtsgeist steht, kann man diese Problematik mit Erfolg lösen. Es ist dabei selbstverständlich, daß in jedem politischen Umschwung der Zufall eine große Rolle spielt. Was entscheidet? Die Notwendigkeit, deutlich zu erkennen, welches die wirklich existierende Tendenz des lebendigen objektiven Geistes (Rechtsgeistes) ist, und dann in dieser Richtung richtig zu entscheiden. Nur derjenige Revolutionsführer kann Erfolg haben, der zuerst auf wissenschaftlicher Grundlage erkennt und letzten Endes mit Hilfe einer genialen Intuition zum Schluß kommt, was wirklich bestehende Tendenz des objektiven Geistes und speziell des Rechtsgeistes ist. Ob der Revolutionsführer Hochverräter oder Gesetzgeber mit legitimer Macht wird, darüber entscheidet die Richtung, in welcher der objektive Geist und Rechtsgeist zur Zeit wirklich tendiere. c) Was die dritte Hauptfrage betrifft, nämlich ob die Sollsätze erkennbar und verifizierbar sind, muß man sich zuerst vergegenwärtigen, daß die Logik als eine Wissenschaft von den formalen Bedingungen des menschlichen Denkens und Erkennens fragt, wie kann man richtig urteilen und wie beweist man unsere Behauptungen, studiert die Form der Gedanken und setzt die Voraussetzungen fest, wie man unsere Gedanken bzw. Begriffe in ein System einreihen kann. Auf den ersten Blick ist es klar, was für eine bedeutende Rolle die Logik in der rechtlichen Sphäre spielt. Klar hat es Emil LaskP ausgedrückt. „Wenn man von der Wissenschaft selbst absieht, gibt es keine Kulturerscheinung, die sich als begriffsbildender Faktor auch nur annähernd mit dem Recht vergleichen ließe". Es ist unrichtig, wenn Kelsen lehrt, daß das ganze Recht etwas Alogisches ist und daß erst die Rechtswissenschaft aus diesem „alogischen Material" des Rechts die Rechtsnormen bildet 28 . 27
Lasky Rechtsphilosophie, 1905, S. 35.
218
Vladimir KubeS
Heute existiert eine große deontologische Literatur und besonders die Frage der Bewältigung der Sollsatzlogik steht im Mittelpunkt des Interesses. Alle mir bekannten Versuche, die manchmal im heftigen Widerstreit zueinander stehen, sind bis jetzt ohne einen bedeutenden Erfolg geblieben. Meiner Meinung nach handelt es sich - wie schon angedeutet wurde - bei allen diesen Versuchen um einen gemeinsamen Grundfehler, der in der Tatsache besteht, daß man zur Untersuchung dieser logischen Problematik ohne vorhergehendes gründliches Studium der kritischen Ontologie herantritt. Der Kern dieses Grundfehlers liegt in der Unkenntnis des objektiven Geistes, besonders seiner Sphären, welche die abgeleitete Normativität aufweisen, in erster Reihe der rechtlichen Sphäre. Sonst würde man wissen, daß der objektive Geist (Rechtsgeist) mit seiner abgeleiteten Normativität ebenso real ist und, wenn auch vielleicht mit größerer Schwierigkeit erkennbar ist wie die niedrigeren Schichten des stufenförmigen Baus der realen Welt (die anorganische, organische und seelische Schicht). In den Sollsätzen erkennen wir nämlich den objektiven Geist (Rechtsgeist) abgeleiteter Provenienz, ganz analog wie wir in den Seinsurteilen (in den Aussagen) das physisch-materielle (anorganische) Sein, das organische Sein und das seelische Sein erkennen. Es ist also nicht richtig, die Normen (Sollsätze) als Gebilde zu begreifen, bei denen man nach ihrer Wahrheit überhaupt nicht fragen darf und kann und bei welchen es sich um etwas wesentlich anderes handelt, als wenn man die Seinsurteile verifizieren will. Erst die auf das Rechtliche angewandte und weiterentwickelte kritische Ontologie hat bewiesen, daß ein objektiver Geist (Rechtsgeist), welcher real und erkennbar ist, existiert und daß im Rahmen dieses objektiven Geistes (Rechtsgeistes) Sphären, besonders die rechtliche und die moralische Sphäre (mit abgeleiteter Normativität) existieren. Es handelt sich also um die Erkenntnis dieses objektiven Rechtsgeistes. Die Antworten, die diesbezüglichen Normen (Sollsätze), in welchen wir zur Erkenntnis des objektiven Rechtsgeistes kommen, sind verifizierbar; sie können als wahr oder unwahr charakterisiert werden. d) Was die vierte Hauptfrage betrifft, d.h. die Frage der Rechtsnorm, kann man sagen:
28 Kelsen, Rechtswissenschaft und Recht. Erledigung eines Versuches zur Überwindung der „Rechtsdogmatik", 1922, S. 92; ders.. Norm und Logik, Forum 1965, S. 42Iff., 495ff.; Neues Forum, 1967, S. 39ff.; Neues Forum, 1968, S. 333ff.; W. Dubislav, Zur Unbegründbarkeit der Forderungssätze, Theoria I I I , 1937; Alfred Verdross, Two arguments for an empirical foundation of natural-law norms: A n examination of Johannes Messner's and Victor Kraft's approaches, Syracuse Journal of International Law and Commerce, 1975, Vol. 3, No 1, S. 151; Kubes, Die Logik im rechtlichen Gebiet, in: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 27, 1976, S. 271 -
286.
Die kritisch ontologischen Aufgaben der Rechtsphilosophie
219
Die Norm (Rechtsnorm) ist erstens eine Festlegung eines Sollens (einer Pflicht) zu etwas, zweitens aber ist sie auch ein Wertmaßstab, ein Kriterium für die Beurteilung eines Tatbestandes, ein normatives Werturteil. Wenn man sagt 29 , kein Imperativ ohne Imperator, dann ist es richtig. Wenn man aber feststellt 30 , daß eine Norm (Rechtsnorm) in erster Linie ein Befehl (Gebot oder Verbot) sei, und daß deshalb gilt: Keine Norm ohne Imperator, dann geht es um einen grundlegenden Irrtum. Ein Imperativ muß nicht ein Sollen (eine Pflicht) hervorrufen. Beim Imperativ als solchem geht es zunächst um das Müssen. Der Imperativ ist kein normatives Urteil mit der Funktion eines Maßstabes. Damit hängt auch die Erkenntnis zusammen, daß ein Imperativ kein Urteil ist, während die Norm ein Urteil (ein normatives oder normologisches) Urteil darstellt. Bei der Norm handelt es sich um ein Ergebnis der Wahl zwischen an sich möglichen Antworten auf die Frage, was sein soll, handelt es sich um eine Wahl, bei der es dem Erkennenden um die Verwirklichung einer allgemein geltenden Erkenntnis geht 31 . Diese Wahl ist eine Erkenntnis des objektiven Geistes (Rechtsgeistes), der real ist und erkannt werden kann und soll. Der Inhalt einer Norm kann Gegenstand eines Beweises der Wahrheit und Richtigkeit sein. Eine Norm kann genauso negiert werden, wie jedes Urteil negiert werden kann. Man muß streng zwischen dem Recht als einem Ganzen und der einzelnen Rechtsnorm unterscheiden. Sobald es sich um eine einzelne Rechtsnorm handelt, ist jede in den stufenförmigen Aufbau der Rechtsordnung einreihbare Norm eine geltende Rechtsnorm. Die einzelne Rechtsnorm braucht daher nicht mit einer Sanktion ausgestattet zu werden und braucht auch nicht die Faktizität aufzuweisen. Das einzelne Kriterium für eine einzelne Rechtsnorm ist ihre Einreihbarkeit in den Stufenbau von Rechtsnormen. Anderes gilt für die Rechtsordnung als ein Ganzes. Um Rechtsordnung zu sein, muß sie im Durchschnitt Exequierbarkeit und Wirksamkeit aufweisen 32.
29
Dubislaw, Zur Unbegründbarkeit der Forderungssätze, Theoria 3, 1937. Kelsen, Norm und Logik, Forum, 1965, S. 421 ff., 495ff.; Neues Forum, 1967, S. 39ff.; Neues Forum, 1968, S. 333ff.; Allgemeine Theorie der Normen, 1979, S. 2, 23. 31 Jaroslav Kailab, in: Casopis pro prâvni a stâtni védu X V I I , S. 337f.; Kubes, Prâvni filosofie X X . stoleti (Die Rechtsphilosophie des X X . Jahrhunderts), 1947, S. 337f. 32 Kubes , Nemoznost plnëni a pravni norma (Die Unmöglichkeit der Leistung und die Rechtsnorm), 1938, S. 223; ders., Pravni filosofie X X . stoleti (Die Rechtsphilosophie des X X . Jahrhunderts), 1947, S. 52. 30
The Ontology of Law By Wiesfaw Lang, Torim I. Considering the ontology of law we are dealing with the following questions: 1. Does law exist? 2. What kind of being is law? 3. What does the existence of law as a social phenomenon consist in? 1. These issues are to be discerned from two other questions: 1. What does the term "law" mean in the colloquial and juridical language or what should its proper meaning be? 2. What are the specific features of law which make law distinct from other similar phenomena? The first question relates to the meaning of the word "law" in colloquial or juridical discourse. The proper answer to that question is given by the linguistic definition of law. The second question concerns the object denoted by the term "law". The proper answer to this question is provided by the real (extralinguistic) definition of law. This definition of law involves an ontological characterization of law as an object, to which the word "law" relates. This object may belong to the linguistic or extralinguistic reality. The ontological featuring of law as an object of cognition is not equivalent to the definition of law (either linguistic or extralinguistic). It indicates only the category of beings to which law belongs but gives no indications as concerns the specific characteristics of law. But "law" is a polysemantic term which has many meanings in colloquial as well as in juridical discourse. The notion of law is a family notion 1 . Therefore the explanation of the ontology of law requires a tentative linguistic definition of law based on a clarification of the usage and meaning of this term. Such a definition implies a choice of a definite idea of law or of a definite kind of law, the ontology of which is to be explored. In this paper I will consider the ontology of the municipal law of the contemporary state2. This is a paradigm concept of law implied by the positivistic definition of law. I put apart in my considerations the ontology of public international law and of the laws of social organisations. II. The ontology of law is a meaningful problem only within the general framework of the ontology of the world in which law exists. 1 See L. Wittgenstein, Philosophical Investigations, transi. G. E. M . Anscombe, Oxford 1953. 2 Compare: J. Wróblewski, Ontologia y epistemologia del derecho, Mexico 1979.
222
Wieslaw Lang
The general concept of the ontology of the world limits the range of possible ideas concerning the ontology of law. Law as a being may belong to one or to many categories of imaginable beings which constitute the universe. It is not the aim of this paper to settle the philosophical controversies on the ontology of the universe. I will try to discuss a more modest and limited problem, namely the ontology of law on the ground of a materialist ontology of the world. III. The leading idea of the materialist outlook of the world consists in the view that everything what really exists has its time - space parameters. To put it in other words - the universe consists only of time-space units (or portions). The materialist philosophy presupposes a strict connection between ontology and epistomology. According to this view the object of cognition exists independently of the cognizing subject. The process of cognition is considered as a selective reflection of the objective time-space reality by the cognizing subject, which is also a part of that reality. The ontological contradistinction of the subject and object of cognition is a relative one. The ontology of the world determines to a great extent the ways and modes of its cognition. A l l existing beings are empirically perceptible time-space portions. But there is also a relative and marginal autonomy of epistemology in relation to ontology. Two possible versions of materialist ontology are to be discerned. 1. The universe is a collection of elementary things perceptible empirically in time and space dimension. The differentiating features and attributes of those elementary portions of the universe, their internal structure as well as their mutual relationships and connections are irrelevant from the ontological standpoint. Irrelevant are also the pecularities of the perception of material things determined by their features and functions performed in the environment. The things as elementary units of the universe move and change in the time run, but those changes are of no importance for the ontology concept. This is a static and mechanistic version of materialism. 2. The universe consists of different types of time-space portions and units having different features, attributes and structures. The world is material in its nature and essence but the matter has many existential forms and shapes, resulting from different levels of development and organisation of the distinguishable fragments of the material world. These fragments undergo evolutionary development, which results in different levels of their internal organisation and external functions. The evolution of the portions of the universe stimulated by their internal contradictions as well as by external factors brings into being the systems of material elements, having more or less complicated internal structure and fulfilling more or less
The Ontology of Law
223
differentiated functions in their environment. The structure of those organised fragments of material reality determines their specific features and attributes. Those attributes have no self dependent ontological standing. They are byproducts and functional features of the time-space units of the material world. They are not separate non material beings but only attributes of material things which have reached in the course of evolution a definite stage of their organisation. Such entities as life or thought do not really exist. There exist only living beings or thinking people 3 . It is reasonable within this world outlook to discern lower and higher fragments of reality (considered as structured systems) marked out by a different level of internal organisation. The higher fragments of reality are composed of portions marked by a lower level of organisation, but they are not reducible to mere collections of these portions. A more highly organised fragment of reality forms a new material systemic entity, which is not reducible to its elements. The highly organised systems are the products of the development of primitive (less organised) fragments of the material reality. But due to their structure, attributes and functions they can control the lower portions of the material world. Man is the most highly organized fragment of material reality and he is able to control all other fragments of this reality. Man is the only living being which produces an artificial environment, uses signs and symbols as means of communication and is able to think and to experience his psychic life as an object of internal subjective cognition. What differs the two distinguished versions of materialist philosophy is that within the first version the above mentioned differences of the level and degree of organisation of material reality are irrelevant from the point of view of ontology. According to the first version of materialism the higher organised fragments of reality may be reduced in ontological plane to lower forms of matter, similarly as the ontology of systems may be reduced to the ontology of their elements. Within the second version of materialism (dialectical materialism) these differences between the distinctive features of material reality are highly relevant for the ontology of the universe. According to this version of materialism, the higher fragments of reality cannot be reduced in the plane of ontology to the fragments marked by a lower degree of organisation, however the more highly organised beings have been developed from the primitive forms of matter. Within the second version of materialism two types of ontological contentions may be distinguished: 3 Compare T. Kotarbinski, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (The elements of the theory of cognition, formal logics and methodology of science), WroclawAVarszawa/Kraków 1961, pp. 72 - 75.
224
Wieslaw Lang
1. The contentions concerning the ontology of the totality of the universe and its existential nature. The ontological concept of this totality may be monistic, dualistic or pluralistic. According to the materialistic outlook, the universe exists in time and space dimensions as material reality. 2. The contentions concerning the categories of material entities singled out on account of their internal structure, functions or attributes. IV. The acceptance of the materialist ontology of the universe eliminates ex hipothesi the clearly idealistic concepts of law, namely: 1. The concept of law as a spiritual phenomenon existing in the realm of human spirit independent of material reality 4 . 2. The concept of law as a system of normative ideas which do not belong to the material (time-space) reality. They are neither linguistic nor behavioral nor psychological facts. This view implies a radical ontological opposition of the meaning and the material signs in the realm of language, of the psychic process and its ideal substantive content in the realm of psychology, and the human behaviors and their cultural meaning in the realm of sociology5. This concept of law has found its most sophisticated articulation in Hans Kelsen's theory of law based on the ontological and epistemological dualism of "be" and "ought". "Be" propositions relate to the material world, "ought" propositions relate to the world of ideas. The legal norms are specific ought-propositions, qualifying human conducts6. Similar idealistic ontological character have also the axiological concepts of law, regarding law as a set of objective values (such as justice) which do exist in the realm of ideas7. Materialist ontology implies a concept of law as an observable phenomenon, which has its time and space parameters. A t least some features of this phenomenon must be accountable in time and space dimension. V. In legal philosophies law has been considered as a linguistic, psychic or social fact, or as a complex of these three types of facts. A l l those concepts of law may be interpreted in terms of idealistic or materialist ontology, as different ontological concepts of a fact in the linguistic, psychological and sociological plane of discussion are arguable. 4 That is a traditional view concerning law and morality developed and emphasized particularly in the philosophy of Hegel and Savigny. (G. Hegel , The Philosophy of Right, transi. M . Nox, Oxford 1942, p. 155; F. Savigny , On the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence, transi. A . Hayward, London 1931, p. 30). 5 That is the point of view of kantian and neokantian natural law philosophy as well as of E. Husserl theory of cultural phenomenon (See E. Bodenheimer, Jurisprudence the Philosophy and Method of the Law, Harvard 1978 (Third Printing), pp. 134 - 140; W. Stegmüller, Main currents in Contemporary German, British and American Philosophy, Bloomington 1970). 6 H Kelsen, The Pure Theory of Law, transi. M . Knight, Berkeley 1967. 7 See G.Del Vecchio , La Justice et la Vérité, Paris 1953; Compare P. Amselek , Methode Phenomenologique du Droit, Paris 1964, p. 305.
The Ontology of Law
225
1. Law as a linguistic fact or as language. Here two ontological issues as starting points for discussion are possible, namely a nominalistic or a substantive one. a) According to the nominalistic approach to law the term "law" is simply a word, which has no frame of reference. Law as an object denoted by the term "law" does not exist. Theories about law as an existing objective phenomenon are to be considered simply as intellectual bias which has its source in an improper use of language. Such theories are simply illusions distorting the image of reality 8 . But this way of conceiving law (as well as social reality) does not seem to be prolific from the cognitive point of view. b) The substantive approach implies the view that the word "law" has its frame of reference in the realm of language, in the consciousness of people or in social reality. In the linguistic plane of discussion this view assumes that law is a linguistic fact signified by the term "law". There are two possible ontological interpretations of the linguistic concept of law, depending upon the accepted theories of language, particularly upon the theories of meaning9. (1) The meaning of a linguistic utterance is the content of psychic experiences, which are mental standard reactions of the users of the language to a set of signs used as means of interpersonal communication in a social group (mentalistic approach). (2) The meaning of a linguistic utterance is a pattern of standardized behavioral reactions of the users of the language to a set of material signs (behavioristic approach). Law as a psychic fact may be conceived in two ways depending upon psychological theories of psychic phenomena: (1) Psychic facts are the facts of a peculiar kind as concerns their cognition. They are perceptible only by the experiencing subject and can be communicated to other persons only by social means of communication (verbal or not verbal behaviors). The subjective experiences of the individuals are autonomous phenomena irreducible to the external behaviors of the subjects10. (2) The psychic experience is not a real fact and has no specific ontological status. The subjectivity of human experience has no ontological or epistological significance. The psychic processes may be reduced to verbal or not verbal behaviors 11 . 8
See T. Kotarbmski, op. cit. (FN 2). See W. Lang / J. Wróblewski / S. Zawadzki, Teoria panstwa i prawa (The Theory of State and Law), Warszawa 1986, pp. 24f., 39 - 41. 10 See T. Kotarbiùski y op. cit. (FN 2), pp. 389, 384. 11 Ibid., pp. 395 - 414. 9
15 Festgabe Opalek
226
Wieslaw Lang
Law as a social fact may have also a dual interpretation depending upon the sociological concept of the social fact. (1) A social fact is conceived as a set of external human behaviors and behavioral interactions. Such a concept of social fact has been developed by behavioral sociology. (2) A social fact is a complex phenomenon consisting of two different ontological elements: external human behavior and its meaning (i.e. meaning ascribed to the behaviors by people in the process of social communication). This is a concept of the "cultural fact" developed by the "understanding sociology" (Max Weber, F. Znaniecki) 12 . The above mentioned concepts of law as fact are compatible with a materialist ontology. The concepts (2), (2), (1) fit in the framework of the first version of materialism. According to these concepts the notion of law may be reduced to material signs (in official printed matters) and behaviors. The characterisation of law in terms of signs and behaviors make fuzzy and deprive of cognitive value the distinction between law as a linguistic fact, law as psychic fact and law as a social fact. These distinctions have been also challenged by the sociolinguistic approach to law and legal norms 13 as well as by the materialist version of the non linguistic concept of the norm (as a rule of conduct). According to this concept, the norms and directives are to be conceived as performatives (performative utterances) 14. Normative propositions are regarded as expressions of individual decisions. (The non linguistic concept of norm fits also in the framework of the first version of materialist ontology)· The concepts (1), (1), (2) may be interpreted in terms of the second version of materialist ontology. The meanings of signs and behaviors are not separate beings but have their ontological significance. They are the marks of a definite level of development and organisation of material fragments of the universe. The meanings of signs and behaviors and the subjectivity of psychic experiences are features and attributes of social and cultural phenomena considered as highly organised fragments of material world. The contentions concerning their ontological status belong to the second category of the ontological statements. 12
M. Weber , Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1925; F. Znaniecki, Social Actions, 1938. 13 See T. Gizbert-Studnicki, Jçzyk prawny ζ perspektywy socjolingwistycznej (Legal language from a sociolinguistic perspective), in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellotìskiego z. 26, Warszawa/Kraków 1986. 14 See Wolenski , Ζ zagadnien analitcznej filosofii prawa (Some problems of the analytical theory of law), in: Zeszyty Naukows Uniwersytetu Jagiellotìskiego ζ. 92, Warszawa/Kraków 1980, pp. 60 - 97; Κ. Opatek, Nielingwistyczna koncepcja normy (On the nonlinguistic concept of the norm), in: Studia Prawnicze, ζ. 1, Warszawa 1986.
The Ontology of Law
227
The concepts of law as fact, which meet the requirements of the second version of materialist ontology are of paramount importance for the cognition of the legal phenomenon. These concepts pave the way to epistemological and methodological distinction of the planes of law cognition corresponding to three concepts of law as fact, namely: the linguistic, the psychological and the sociological approach to law 15 . A relative autonomy of epistemology in relation to ontology makes feasible an analytical approach to law in the linguistic plane. This approach consists in the analysis of logical relationships among legal norms regarded as normative propositions (law as logic) 16 and implies an analytical definition of the meaning of the linguistic utterances (i.e. a definition formulated neither in psychological nor in behavioral terms) 17 . VI. The three distinguished ontological concepts of law considered as competetive views on the nature of law reduce the legal phenomenon to one of three singled out types of facts: linguistic (law as a set of normative propositions) , psychological (law as a specific individual psychic experience) or social (law as a social or cultural fact). But these ontological reductions are contrary to the usage of the term "law" in the colloquial as well in juridical language. Speaking about "law in books" or about the obligation to obey law we have in mind a set of normative propositions (commands, prohibitions or permissions) printed in official law textes. When we speak about "law living in the consciousness of the people", we mean by law a specific kind of psychic experiences. When we speak about law in action or law as a social practice, we mean by law a set of specific human behaviors. A l l these utterances concerning law make sense and I do not see any reason for eliminating any of them as meaningless. A l l singled out meanings of the term "law" are interdependent. A strict separation of the three concepts of law as fact is not possible. As I have already mentioned above, the behavioral psychology and sociology as well as the sociolinguistic approach to legal norms and the nonlinguistic theories of norms and directives challenge these conceptual distinctions or make them fuzzy. But also when we do not accept such strictly behavioristic or sociological interpretations of linguistic facts, the three concepts of law as fact remain, 15 See W. Lang / 7. Wróblewski / S. Zawadzki , op. cit. (FN 8); K. Opalek proposes to distinguish only two planes of law cognition, namely the plane of the meaning analysis and the plane of the phenomenon research. K. Opatek , Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. plaszczyzn badania prawa (The object of legal sciences and the problem of the so called planes of law cognition), Patìstwo i Prawo 1969. 16 See G.H.v . Wright, A n Essay in Deontic Logic and the Genral Theory of Action, Amsterdam 1973. 17 See K. Ajdukiewicz, Jçzyk i poznanie (Language and cognition), Vol. I, Warszawa 1985, pp. 145 - 174.
15*
228
Wieslaw Lang
mutually interdependent family notions. A pure normative, pure psychological or pure sociological concept of law is not feasible as a means of communication in the theoretical, juridical or colloquial discourse on law. A sociological as well as a psychological concept of law implies necessarily an idea of a system of norms regulating human conducts. Particularly law as a social fact is intrinsically bound to legal norms (as linguistic facts) because only the facts connected in some ways with legal norms are legally relevant facts and may be regarded as law in action or law as a means of social control. The following categories of legally relevant facts are to be distinguished: (1) Conducts motivated by law and qualified as conformable with law. (2) Decisions taking processes of creation, application and enforcement of law. (3) Decisions, actions and practices in the realm of private law such as contracts or marriages. (4) Conducts and practices implementing or enforcing legal decisions (public or private). (5) Conducts qualified as violations of law (delicts and criminal offences) . (6) Behaviors and events to which legal consequences are ascribed, although they do not fall under categories (1), (2), (3), (4), (5) for instance the birth of a child or a car accident. A l l these facts are linked causally and functionally with legal norms as linguistic facts. The facts (1), (2), (3), (4) are brought about by the impact of legal norms on the decision taking and conducts of people. (This impact is a necessary but not sufficient condition for the occurence of these facts). Facts (5) and (6) stimulate mental and behavioral reactions (verbal and non verbal) of the addressees of legal norms or persons fulfilling the roles of official check up functionaries within a legal order (prosecutors, attorneys, judges, policemen, barristers, civil servants etc.). These reactions consist in evaluating and qualifying the relevant facts and in decision taking processes and conducts listed in points (1), (2), (3) and (4). On the other hand, the concept of law as a system of norms, especially the concept of positive law and of valid law, assumes necessarily the coexistence of a situational and factual context, in which the rules considered as valid legal norms are created, interpreted, applied and enforced. Law as a system of valid norms cannot be perceived without a recourse to law in action, to the efficacy of legal regulations and to the real functioning of the legal order. This idea is intrinsic to all theories of positive law and concepts of valid law 18 . 18 Compare H. Kelsen's concept the "Grundnorm" (H. Kelsen, The pure theory of law, (FN 5)); H . L . A . Hart's concept of Rule of Recognition (H.L.A . Hart, The Concept of Law, Oxford 1961, pp. 97 - 106). Compare also W. Lang, Obowiazywanie prawa (The validity of Law), Warszawa 1962; A. Peczenik, The Concept "Valid Law",
The Ontology of Law
229
These are the reasons why the explanatory power of the concepts of law reducing the ontology of law to one single factor (language, psychological experience, social facts) is very limited. More prolific from the epistemological point of view seems to be the concept of law as a complex ontological structure encompassing three ontological planes of human existence: language as social communication, consciousness as psychic experiences and external conducts as actions and interactions of individuals 19 . These external behaviors may be verbal or non verbal, therefore the distinction between linguistic and extralinguistic reality is a fuzzy one. The singled out three planes of human activities constitute together an ontological basis of law as a social and cultural phenomenon, which may be the object of different theories concerning its different aspects. The concept of legal phenomenon as a complex ontological structure may be interpreted in terms of the second version of materialist ontology (assuming that all ontological elements of this structure may be comprehended in the conceptual framework of this philosophy). V I I . The ontology of law considered as a complex social and cultural phenomenon has also its historical dimensions. The ontology of modern law enacted and enforced by sovereign states is different from the ontology of customary feudal law. The ontology of law is linked with the ontology of the state. There are some features of the state and of law which have been changing and developing in the run of history and these changes bring about substantial changes in the ontology of law. The elements of the legal phenomenon which have undergone historical change modifying its ontological structure are: the language of law and the institutional and coercive character of law. The ontology of written law is different from the ontology of ancient oral law. A revolutionary change of the language of law and of the modes of legal communication was brought about by the invention of print 2 0 . Modern printed law differs substantially from the ancient and medieval handwritten law. Printed law texts have become the official sources of law and the ontological ingredients of the legal phenomenon. The quantity of these texts constitutes the quantitative dimension of contemporary law. It seems to be a reasonable prediction that the introduction of computer technologies into the decision taking processes in law creation and law application will also affect the ontology of law. Stockholm 1971; L. Nowak, Cztery koncepcje obowiazywania prawa (Four concepts of valut law), in: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Nr. 2/1965. 19 See Lang, Czy istnieje zjawisko prawne? (Does the legal phenomenon exist?), in: Przeglad Polski i Obey 1958; (FN 17); pp. 25 - 59. A different point of view on the concept of legal phenomenon develops K. Opatek, Problemy metodologiczne teorii prawa (Methodological problems of the theory of law), Warszawa 1962. 20 See Lang, Law and Jurisprudence in the Face of the "Revolution in Science and Technology", in: Archivum Iuridicum Cracoviense, Vol. V (1972).
230
Wieslaw Lang
The institutional character of law has also its history relevant for the ontology of law. A paramount impact upon the ontology of law has had the institutionalization of law creation and law enforcement, especially the institutionalization of the operations with the means of physical coercion. The technical means of physical coercion as well as the furnishings of law creating, law applying and law enforcing agencies (the accomodation and technical equipment of police stations, prisons, courts and other law offices) become also an important ontological constituent of the legal phenomenon. The institutional character of law and legal practices, the technical equipment of legal agencies, the printed law texts as means of legal communication - these are the factors that make possible a conceptual distinction of law and legal consciousness. A similar distinction of morality and moral consciousness is not feasible, because morality is not an institutional phenomenon. The ontology of law differs clearly from the ontology of morality. Exploring the ontology of law as a social and cultural phenomenon, we discover the ontology of human practices, which constitute a specific kind of social control.
Maß und Geltung des Rechts* Von Karl A . Mollnau, Berlin Kazimierz Opalek, Rechtstheoretiker und Politologe, hat in seinen Schriften und Aufsätzen zu vielen theoretischen Kernfragen des zeitgenössischen Rechtsdenkens Stellung genommen, so auch zur Geltung ( = Gültigkeit) von Rechtsnormen. In einer vor einiger Zeit erschienenen Arbeit hat er sich mit Aspekten im Werk Austins auseinandergesetzt und die angenommene Analogie zwischen der Dichotomie von Gültigkeit und Ungültigkeit der sogenannten performativen Akte sowie jener von Wahrheit und Falschheit konstativer Aussagen problematisiert 1 . Zum Schluß seiner Überlegungen merkt der Jubilar an, er habe sich in seinen früheren Schriften schrittweise in die Richtung einer Annahme der performativen Theorie in der Normentheorie bewegt, es bleibe freilich aber noch vieles zu überdenken 2. Dessen eingedenk, daß Wissenschaft ohne ein Mit- und Gegeneinander gleich, ob es sich explizit artikuliert oder nicht - kaum vorankommen dürfte, seien im folgenden einige Gedanken eingebracht, die - wenn man so sagen darf - die Rechtsgeltung vom anderen Ende der Problemskala und von entgegengesetzten Positionen her anleuchten. I. Lassen wir es dahingestellt sein, ob die Geltungseigenschaft des Rechts zu jenen Sachverhalten gehört, die innerhalb des Gegenstandsbereichs der Rechtswissenschaft, besonders der Rechtstheorie und Rechtsphilosophie, zu den Basisproblemen gezählt werden müssen und deshalb fortgesetzter grundlagentheoretischer Aufmerksamkeit der juristischen Forschung gewiß sein können. Die Fragestellungen jedenfalls, die in der juristischen Geltungsdiskussion bis auf den heutigen Tag aufgeworfen und erörtert werden, sind in
* Von der Vorbemerkung abgesehen, ist dieser Beitrag der Text eines Vortrages, den der Verfasser am 15. 12. 1988 an der Juristischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen gehalten hat. Für die Drucklegung wurde der Text um die Fußnoten ergänzt. 1 Kazimierz Opatek, Normen und performative Akte, in: W. Krawietz / W. Ott (Hrsg.), Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart, Berlin (West), S. 243ff. 2 Ebd., S. 256, FN 32.
232
Karl A. Mollnau
ihrem größeren Teil fundamentaler Natur. Dies hat nicht zuletzt etwas damit zu tun, daß die Geltungsdiskussion in der Rechtswissenschaft nicht abgekoppelt werden kann von den Legitimierungsbemühungen von Gesellschafts- und Staatsordnungen. Bei der Rechtsnormengeltung und ihrer Rechtfertigung geht es direkt oder indirekt um die Anerkennungswürdigkeit, oder besser: historische Berechtigung oder Obsoletheit respektive Überlebtheit gesellschaftlicher Zustände und politischer Machtstrukturen. Diese Zusammenhänge lassen sich anschaulich in Zeiten revolutionärer oder reformerischer gesellschaftlicher Umbrüche verfolgen, wenn die Rechtsforderungen einer aufsteigenden oder auf gesellschaftliche Erneuerung oder Regressionen drängenden sozialen Klasse oder Schicht die lex lata radikal in Frage stellen. Aber auch die Bemühungen jener Kräfte, die via juristische Geltungstheorien den sozialen und politischen Status quo einer Gesellschaft zementieren wollen, sind bei einer ideologiekritischen Analyse der Geltungsproblematik in der Rechtswissenschaft in Betracht zu ziehen. Kurzum: die Funktion der Geltung als einer Eigenschaft von Rechtsnormen ist von der Funktion der Theorien über die Rechtsnormengeltung zu unterscheiden. Erst auf dem Hintergrund dieser Unterscheidung werden die sozialen Ursachen und Bedingungen besser faßbar, die zu bestimmten Zeiten in der Rechtswissenschaftsgeschichte den Begriff der Rechtsgeltung zu einer rechtsphilosophischen Fundamentalkategorie avancieren ließen3. In der rechtswissenschaftlichen Geltungsdebatte bündeln und kreuzen sich Fragestellungen, die verschiedenen Ebenen angehören. Zum einen geht es um solche, die die Beziehungen einer Rechtsnorm zu anderen Rechtsnormen und juristischen Entscheidungen angehen, die alle demselben Rechtssystem angehören. Auf dieser Ebene bewegen sich alle Fragen und Antworten streng im rechtsintrasystemaren Bereich. Zum anderen wird unter dem Stichwort Rechtsgeltung nicht selten das weite Feld der Begründbarkeit oder Unbegründbarkeit von Rechtsnormen auszuschreiten versucht. Auf der zuerst genannten Ebene wird die Geltung von Rechtsnormen eines Rechtssystems an Maßstäben und Ansprüchen gemessen, die es sich selbst setzte. Ihr letztes Maß ist die jeweilige Verfassung, darüber hinaus gibt es auf dieser Ebene kein rational nachvollziehbar handhabbares Kriterium für Geltungsbeurteilung von Rechtsnormen. Die Geltung als Eigenschaft von Rechtsnormen aufgefaßt, in der ihre Beziehungen zu anderen Elementen eines Rechtssystems (Normen und anderen Rechtsentscheidungen) zum Ausdruck kommen, hat ihre rechtspraktische Bedeutung dort, wo sie zu den Voraussetzungen für Rechtssicherheit, Berechenbarkeit und Transparenz einer Rechtsordnung gehört. Dies sei angemerkt, um Auffassungen vorzubeugen, die diese 3 Hierzu Heinz Wagner, Normgeltung und Geltungsdiskussion, in: N. Paech / G. Stuby (Hrsg.), Wider die „herrschende Meinung". Beiträge für Wolfgang Abendroth, Frankfurt a.M. 1982, S. 209f.
Maß und Geltung des Rechts
233
intrasystemaren Beziehungen des Rechts als schlechthin bedeutungslos abwerten. Wie wichtig diese Beziehungen sein können, das weiß jeder praktizierende Jurist, denn zu seinem Arbeitsalltag gehört es, nach dem personellen, zeitlichen und sachlichen Geltungsbereich einer Rechtsnorm zu fragen, bevor er sie anwendet. Die zweite Ebene stellt sich als Gemengelage verschiedener Begründbarkeits- und Unbegründbarkeitstheorien des Rechts dar. Auf ihr wird das Problem thematisiert, woher das Recht seine Autorität und Verpflichtungskraft bezieht. Dabei gibt es wiederum zwei Varianten. Die eine rechtfertigt Legalität nach Gesichtspunkten und Kriterien, die ihr vorausgesetzt oder vorgelagert werden bzw. die sie determinieren oder überwölben; die andere propagiert die Legitimierung von Recht als dessen Eigenleistung. Ihre Kurzformel lautet: Legitimität durch Legalität. Einer ihrer speziellen Unterfälle ist die Legitimierung durch Verfahren nach Niklas Luhmann 4 . Die in Rede stehende zweite Ebene der rechtswissenschaftlichen Debatte um die Geltung von Recht erhält eine zusätzliche Differenzierung, als es nicht nur um die Begründung von einzelnen Normen, sondern auch um die Begründung von ganzen Rechtssystemen und -typen, ja des Rechts als geschichtlicher Erscheinung insgesamt geht. II. Überblickt man den spätbürgerlichen Rechtswissenschaftsbetrieb, so spielt die Geltungsfrage seit vielen Jahrzehnten eine nicht geringe Rolle 5 . Welchen Stellenwert sie in der Bundesrepublik einnimmt, läßt sich an den Symposien ablesen, deren Materialien W. Oelmüller Ende der 70er Jahre herausgegeben hat 6 . Ebenfalls muß auf die regelrechte Schwemme begründungstheoretischer rechtswissenschaftlicher Literaturproduktion verwiesen werden 7 . 4
Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 2. Aufl., Karlsruhe 1979 (1. Aufl. 1969). 5 Vgl. hierzu den instruktiven analytischen Überblick bei Wagner, Normenbegründungen. Einführung in die spätbürgerliche Geltungsdiskussion, Köln 1982. 6 Siehe W. Oelmüller (Hrsg.), Transzendentalphilosphische Normenbegründungen, Paderborn 1978; ders., Normenbegründung - Normendurchsetzung, Paderborn 1979; ders., Normen und Geschichte, Paderborn 1979. 7 H.M. Pawlowski, Rechtsstaat ohne Rechtsdogmatik? in: FS A . Troller, Berlin (West) 1987, S. 31 ff. spricht zwar richtig davon, daß das Recht der B R D heute in besonderem Maße der Legitimation bedürfe, weil es sich nicht mehr von selbst verstehe; seine Ursachenanalyse bleibt aber an der Oberfläche, wenn er dafür das Fehlen gemeinsamer überkommener christlicher Überzeugungen sowie neuer, allgemein verbreiteter Überzeugungen verantwortlich macht. Pawlowski wendet sich gegen R. Dreier, der dem einzelnen ein Widerstandsrecht gegenüber Normen geben will, wenn sie mit ihrem Widerstand gegen die Normen einem besseren Recht zum Siege verhelfen wollen (Juristenzeitung, 1985, S. 353ff.). Pawlowski beendet seine Überlegungen mit der Feststellung, es gäbe keine Garantie,
234
Karl A. Mollnau
Abgesehen von jener auf die technisch-formalen Seiten juristischer Geltungsbegründung zielenden Strömung, der es zuvörderst um die Technik einer Konsensherstellung geht, die gegenüber der Wahrheit gleichgültig ist - diese Strömung hat übrigens einen ihrer scharfsinnigen Meister vorläufig in Robert Alexy 8 gefunden - , lassen sich folgende Varianten zur Geltungsbegründung von Recht in der spätbürgerlichen Rechtswissenschaft ausmachen: 1. Die positivistisch-normativistische Geltungsbegründung. Sie geht von einer rechtsquellenorientierten Normenhierarchie aus, in der die rangniedere Rechtsnorm jeweils aus der ranghöheren deduziert wird und ihre Geltung bezieht. A n der Spitze bricht allerdings die Deduktionskette ab und man verliert sich in allerlei spekulativen Konstruktionen. Dieses Normgeltungskonzept setzt sich in der Rechtsanwendung in der These von der vollständigen und eindeutigen Determiniertheit der Einzelfallentscheidung durch die Rechtsnorm fort. Dieses Geltungskonzept gehört - verdeckt oder offen - zu den ideologischen Grundlagen der syllogistisch-subsumtiven Rechtsanwendungslehre aller Schattierungen. Der positivistisch-normativistischen Geltungsbegründung liegt ein Rechtsmodell zugrunde, das obrigkeitsstaatlich orientiert ist. Es setzt die Annahme eines allwissenden Gesetzgebers voraus und betrachtet die Rechtsnormenadressaten als unmündige Untertanen, die lediglich den Normeninhalt nachzuvollziehen und durchzusetzen haben. Bei Kelsen wird die von den Rechtsnormenadressaten zu erbringende Gehorsamleistung noch verschärft, indem sie unter einer Art logischen Sachzwang stehend vorgestellt wird, der seine Basis in der irrational vorausgesetzten Grundnorm als Geltungsgrund des Rechts findet 9 . Eine modernisierte Fassung der normativistischen Geltungsbegründung ist die der analytischen Rechtstheorie; sie faßt die Geltung von Normen als Ana-
daß die B R D weiterhin ein „freiheitlich-pluralistischer Staat" bleiben könne und werde. Er schreibt, eine Gesellschaft von Khomeni-Anhängern könne diesen Staat ebensowenig gewährleisten wie eine Gesellschaft von Anhängern der Friedensbewegung. 8 Siehe vor allem seine Schrift: Theorie der juristischen Argumentation, Karlsruhe 1978. Ferner das Komprimat seiner Konzeption: Juristische Argumentation und praktische Vernunft, in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, 1982, S. 29 ff. - Auf den Zusammenhang zwischen Konsens sowie Wahrheit und Gerechtigkeit im juristischen Entscheidungsprozeß - sei es in der Rechtssetzung oder in der Rechtsanwendung - kann hier nicht näher eingegangen werden. Jedoch sei angemerkt, daß Konsens in Rechtsfragen weder als Beweis für Wahrheit noch für Gerechtigkeit angesehen werden kann. Ob und inwieweit er als Indikator von Wahrheit und Gerechtigkeit einer Rechtsentscheidung dienen kann, kann nur über eine zusätzliche Inhaltsanalyse des Konsenses ermittelt werden. Außerdem darf nie unter den Tisch fallen, daß in einem juristischen Entscheidungsprozeß unter keinen Umständen ein sogenannter herrschaftsfreier Dialog stattfinden kann. 9 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1967, S. 196ff.
Maß und Geltung des Rechts
235
logon zur Wahrheit von Aussagen auf 10 . Der analytischen Rechtstheorie verdanken wir allerdings eine Reihe von wichtigen Einsichten in den semantischen Status von Rechtsnormen, Aussagen und anderen Denkformen, an denen eine wissenschaftliche Analyse der Rechtsstruktur nicht vorbei gehen kann. 2. Die soziologistisch-verhaltenstheoretisch orientierte Geltungsbegründung. Sie schreibt einer Rechtsnorm Geltung zu, wenn sie von allen Mitgliedern der Gesellschaft oder zumindest von ihrer Mehrheit beachtet wird. Es wird dabei oft eine faktische und juristische Geltung unterschieden. Dieses Konzept fragt nicht, warum eine Norm gilt und befolgt wird, sondern macht das Faktum ihrer Befolgung oder Nichtbefolgung zum Zentralpunkt ihrer Geltung oder Nichtgeltung. In der Rechtssoziologie Theodor Geigers ist dieses Konzept mit Vorstellungen zur Wirksamkeits- und Effektivitätsanalyse von Rechtsnormen verbunden und weiter differenziert worden. Nach Geiger ist die Wirksamkeit einer Norm disjunktiv. Sie besteht entweder in der Befolgung oder in der Nichtbefolgung, die eine Sanktion nach sich zieht. Demgemäß unterscheidet er eine Verhaltens· oder Verkehrsgeltung, eine Sanktionsgeltung und eine Nichtgeltung. Geltung ist für ihn eine Modalität der Normwirksamkeit und als solche eine meßbare Größe, die er als Effektivitätsquote bezeichnet. Eine Norm ist für ihn nicht schlechthin gültig oder geltungslos, sondern gilt in höherem oder geringerem Grade 11 . 3. Die psychologistische Geltungsbegründung. Sie ist eng mit der soeben genannten Konzeption verwandt, stellt aber auf psychische Sachverhalte der Rechtsnormadressaten ab. Ihr zufolge gilt eine Rechtsnorm, wenn sie vom überwiegenden Teil der Bevölkerung als verbindlich anerkannt wird, weshalb auch von Anerkennungstheorie gesprochen wird. Nach dieser Theorie wird der Rechtscharakter einer Norm in das Belieben der Meinung des Publikums gestellt, zumindest wird er von ihr abhängig gemacht. Diese Auffassung zu Ende gedacht, legt als Test der Rechtsgeltung eine Meinungsumfrage nahe. Wie die Anerkennung von Rechtsnormen bei ihren Adressaten zustande kam, ob sie auf der Einsicht in den Inhalt der Rechtsnorm, der Überzeugung von seiner Angemessenheit und Richtigkeit oder ob sie auf der Angst vor der zwangsweisen Durchsetzungsmöglichkeit des Rechts beruht, all das bleibt ausgespart. A n diesem Punkte gibt es gewisse Affinitäten zur aktuellen juristischen Diskurstheorie, der es darauf ankommt, das Recht und seine Geltung den Leuten plausibel zu machen. Die psychologistische Geltungsbegründung ist in der Geschichte der Rechtswissenschaft in vielfältiger Gestaltung aufgeVgl. hierzu Wagner (FN 3), S. 11. Th. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, Neuwied/Berlin 1964, S. 71 ff. 11
236
Karl A. Mollnau
treten, darunter auch in solchen, die sich als Einfallstore für Rechtsirrationalismus erwiesen 12. Als Beispiel sei eine Konzeption herangezogen, die kurz nach der Jahrhundertwende vorgelegt wurde und deren Autor Sturm kaum noch jemand kennt, die aber heute von ihrem Denkansatz her in den zu charakterisierenden biologistischen Geltungstheoreme wieder virulent geworden ist. Sturm hatte die Rechtsgeltung auf einen in Gestalt des Rechtsgefühls zum Ausdruck kommenden Rechtsinstinkt des Menschen sowie auf einen Rechtsgehorsam, der auf embryologisch bedingten ererbten Mechanismus beruhen sollte, zurückgeführt. Der Normengehorsam wurde als innerer psychischer Zwang, der im Gehirn wohne, interpretiert. Dieser Gehorsam bleibe als Rechtsinstinkt und Rechtstrieb immer derselbe, unabhängig vom konkreten historischen Rechtsinhalt 13 . 4. Die biologistische Geltungsbegründung. In ihrer modernen Form versucht sie Rechtsgeltung unter Ausnutzung und Mißbrauch gewisser Erkenntnisse der Soziobiologie, der Ethologie sowie bestimmter Wissenschaften vom Menschen zu begründen. Gegenwärtig werden folgende Varianten bevorzugt propagiert: a) die genetische Erklärung von Recht, die Geltung des Rechts und Rechtsverhaltens in eins setzt, indem sie Recht im genetischen Programm des Menschen angelegt glaubt. Beispiel: Erwin Quambusch mit seiner Schrift: Recht und genetisches Programm 14 ; b) die ethologisch orientierte Rechtsanalyse, die Geltung oder Nichtgeltung von rechtlichen Normen mit sogenannten angeborenen Trieben des Menschen in Verbindung zu bringen sucht und die Geltungschance von Recht um so höher beurteilt, je mehr die vom Gesetz vorgeschriebenen Verhal12 Vgl. etwa Franz Klein, Die psychischen Quellen des Rechtsgehorsams und der Rechtsgeltung, Berlin 1912, S. 15ff. Erich Fechner, Rechtsphilosophie, 2. Aufl., Tübingen 1962, S. 165ff.; partiell auch: Albert Ehrenzweig, Psychoanalytische Rechtswissenschaft, Berlin 1973. 13 A. Sturm, Die psychologischen Grundlagen des Rechts, Berlin 1909, S. 85f. Eine ähnliche, wenn auch weniger primitive Position vertrat Eugen Ehrlich, wenn er die Unterscheidbarkeit von Rechtsnormen und nichtrechtlichen Normen nicht als Frage der Gesellschaftswissenschaften begriffen wissen wollte, sondern von den verschiedenen Gefühlstönen abhängig machte, die verschiedene Arten von Normen bei ihren Adressaten auslösen. E. Ehrlich, Grundlegung der Soziologie des Rechts, 3. Aufl. (1. Aufl. 1913), Berlin 1974, S. 132: „Die Frage nach dem Gegensatz der Rechtsnorm und der außerrechtlichen Norm ist nicht eine Frage der Gesellschaftswissenschaft, sondern der gesellschaftlichen Psychologie. Die verschiedenen Arten von Normen lösen verschiedene Gefühlstöne aus und wir antworten auf Übertretung verschiedener Normen nach ihrer Art mit verschiedenen Empfindungen. . . . Der Rechtsnorm ist eigentümlich das Gefühl, für das schon die gemeinrechtlichen Juristen den so bezeichnenden Namen opinio necessitatis gefunden haben. Danach muß man die Rechtsnormen erkennen." 14 Frankfurt a.M./Bern/New York 1984.
Maß und Geltung des Rechts
237
tensweisen die angeborenen Triebe komplettieren. Diese Richtung versucht, sich dem Gesetzgeber als Effektivitätsberater zu empfehlen; eine ihrer Advokaten ist Margret Gruter 15 ; c) bestimmte Versuche, rechtsnormenkonformes bzw. abweichendes Verhalten aus hirnphysiologischen Prozessen zu erklären und dadurch der Rechtsgeltung eine physiologische Basis zu verschaffen 16. 5. Die dezisionistische Geltungsbegründung. Sie behauptet, für beliebige Inhalte könne legitime Rechtsgeltung gewonnen werden, und zwar durch eine Entscheidung, die Rechtsnormen in Geltung setzt und ihnen Geltung auch wieder nehmen kann. Recht gilt danach kraft Entscheidung. Dieses Konzept gibt sich auch nicht den geringsten Anschein, mit Hilfe dieser oder jener Konstruktion die Geltung einer Rechtsnorm zu stützen. Als Hochform eines irrationalen Subjektivismus in der Rechtswissenschaft verschleiert sie nicht nur den Bezug des Rechts zur Wirklichkeit, sondern stellt den Gesetzgeber von allen ökonomischen und kulturellen Determinanten und interessenspezifischen Zwängen frei. Damit wird das Recht in die vollständige Verfügbarkeit der staatlichen Macht- und Entscheidungsträger und ihrer Apparate gegeben; es wird zum Reflex von Macht. Einer der einflußreichen Protagonisten dieses Konzepts ist heute Niklas Luhmann, der schon vor längerer Zeit die „Institutionalisierung der Beliebigkeit von Rechtsänderungen" gefordert hat 1 7 und neuerdings durch autopoietische Anreicherung seiner Konzeption bei der These von der Positivität als Selbstbestimmtheit des Rechts angelangt ist 18 . Die dezisionistische Geltungskonzeption ist die ideale ideologische Basis für die totale Instrumentalisierung des Rechts. Dezionismus und Rechtsinstrumentalismus sind in der Rechtswissenschaft ein Zwillingspaar. 6. Die naturrechtliche Geltungsbegründung. Sie geht von der Existenz einer zweiten Rechtsebene aus, die gegenüber dem positiven Recht höherwertig sei 15 Vgl. ihre Arbeiten: Die Bedeutung der Verhaltensforschung für die Rechtswissenschaft, Berlin 1976; Soziobiologische Grundlagen der Effektivität des Rechts, in: Rechtstheorie 1980, S. 96ff. 16 Vgl. M. Gruter / M. Rehbinder (Hrsg.); Der Beitrag der Biologie zu Fragen von Recht und Ethik, Berlin 1983, Bes. S. 87ff. 17 Luhmann, Ausdifferenzierung des Rechts, Frankfurt a.M. 1981, S. 143f. Luhmann schreibt, vor diesem Anblick schrecke der Jurist und die Rechtstheorie zurück und erläutert seine Position im Hinblick auf die Rechtsgeltung wie folgt: „ I n der Ära des positiven Rechts kann das Bewegliche nicht mehr auf das Feste gegründet werden; es muß umgekehrt das Feste auf das Bewegliche gegründet werden. Recht, das jeweils gilt, hat sein Recht zu gelten daraus, daß es geändert werden könnte. Aus der Verfügbarkeit anderer Möglichkeiten ergibt sich erst die überzeugende Begründung für die jeweils gewählte Norm. Wenn man die Bedingungen sinnvoller Änderung erfassen kann, kann man erklären, weshalb die gegenwärtig geltende Problemlösung unter den gegebenen Umständen bis auf weiteres die beste ist. Das Recht gilt dann als momentan eingefrorene Präferenz." 18 Luhmann, Positivität als Selbstbestimmtheit des Rechts, in: RECHTSTHEORIE (1988), S. l l f f .
238
Karl A. Mollnau
und die deshalb die Geltungsgrundlage für das staatlich gesetzte Recht abgebe. Die Geltung des positiven Rechts wird in dieser Sicht nicht nur aus der Geltung eines Naturrechts - was dies auch immer sei - abgeleitet, sondern das Naturrecht ist auch das Maß für den Inhalt und die Geltung des positiven Rechts. Unterarten dieser Art Geltungsbegründung sind all jene Versuche, die Rechtsgeltung in der Moral, der Religion oder ganz allgemein in philosophischen Systemen und Prinzipien zu verankern wollen. Die naturrechtliche Geltungsbegründung mitsamt ihren Unterarten versteht sich als Antipode zu den positivistischen Geltungskonzepten, die eine Dichotomie von Sein und Sollen behaupten. Diese hier in ihrem Ansatz umrissenen Geltungskonzepte sollen nicht weiter auf ihren Konträr- und Komplementärcharakter untersucht werden. Auch soll nicht weiter erörtert werden, inwieweit partiell Fragestellungen in diesem oder jenem Konzept enthalten sind, die Aspekte der Rechtsgeltung als Realerscheinung zutreffend erfassen. Statt dessen soll im weiteren skizziert werden, wie die Geltungsfrage des Rechts aus marxistischer Sicht sich stellt. ΠΙ.
Zunächst: Wie kontrastreich im einzelnen die Rechtsgeltungsfrage von der marxistischen, verstanden als materialistische Rechtstheorie gegenüber den angeführten Konzepten beantwortet wird, es schwingen in ihren Antworten auch Saiten mit, die in der Rechtsphilosophiegeschichte auf diese oder jene Weise zum Klingen gebracht wurden. Dies gilt vor allem dort, wo es um den Zusammenhang zwischen dem Maß des Rechts und der Geltung des Rechts geht. Es war das Naturrechtsdenken, welches über Jahrhunderte hinweg den Gedanken wachhielt, Recht müsse nach einem Maß erzeugt werden, bevor es als Maß angewendet werden könne. Daß dabei das Naturrecht bei seiner sprichwörtlichen Ambivalenz mal nach der revolutionär-reformerischen und mal nach der konterrevolutionären sowie konservativen Seite hin wirkte, darf schon deshalb nicht unterschlagen werden, weil in der Geschichte nicht selten beide Komponenten gegenüberstanden. Beim Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus in Europa beispielsweise war das klerikale Naturrechtsdenken eine mächtige Stütze des feudalen Mittelalters, während das rationale Naturrechtsdenken der Durchsetzung kapitalistischer Interessen zusätzliche Schubkraft verlieh, indem es sie als allgemeinmenschliche Interessen, naturgegeben und mit Hilfe der Vernunft erkennbar, ausgab. Jedoch die Zugangsweise der marxistischen Rechtstheorie zur Geltungsfrage zeigt sich in ihrer radikalen Verschiedenheit auch gegenüber dem Naturrechtsdenken spätestens dort, wo es darum geht, sich darüber zu verständigen, was das Maß ist oder sein soll, nach dem das Recht und seine Eigenschaften zu gestalten sind.
Maß und Geltung des Rechts
239
Das Naturrechtsdenken behauptet, wie schon vermerkt, die Existenz einer zweiten Rechtsebene neben bzw. über dem positiven Recht. Naturrecht - wie es im einzelnen begründet werden mag und was immer man sich darunter vorzustellen habe - ist transpositives Recht und als solches Maß des positiven Rechts. Die Geltung von Rechtsnormen ist in dieser Sicht die mehr oder weniger gelungene Fortsetzung der Geltung des transpositiven Rechts. Lex legalis - lehrte Augustinus - sei nur jenes Gesetz, das nach dem Maß des Naturrechts geschaffen wurde und ihm entsprach, alles andere sei legis corruptio (De civitate dei, 19, 21). Demgegenüber geht die marxistische Rechtstheorie von einem kausalgesetzlichen Zusammenhang zwischen dem Recht und seiner Entwicklung sowie der Eigentums- und Sozialstruktur der Gesellschaft aus. Überall dort, wo in der Gesellschaft aufgrund des gegebenen Entwicklungsstandes der Produktivkräfte Widersprüche zwischen sozialer Gleichheit und Ungleichheit vorhanden sind, die sich in Gegensätzen und/oder Unterschieden von Klassen, Schichten, Gruppen, Individuen usw. zeigen, ist Recht unentbehrlich. Wie die Geschichte zeigt, wird es denn auch jeweils von solchen Gesellschaften hervorgebracht, d.h. es wird von Menschen gemacht. Oder - um eine Wendung des jungen Marx aufzugreifen - Recht ist eine besondere Weise der Produktion, die unter ihrem allgemeinen Gesetz steht 19 . Recht geht aus Nichtrecht hervor. Allerdings tritt es nicht als automatische Absonderung irgendwelcher gesellschaftlicher Sachverhalte an den Tag; sondern muß in einem verwickelten Prozeß der Erkenntnis, Bewertung und Entscheidung buchstäblich aus den gesellschaftlichen Verhältnissen herauskonstruiert werden. Nichts anderes meint die genuine marxistische Rechtstheorie, wenn sie vom Recht als Widerspiegelung gesellschaftlicher Verhältnisse spricht. Die Einsicht in den Widerspiegelungscharakter des Rechts verschafft uns den Zugang zu seinem Maß. Dieses Maß ist nichtrechtlicher Natur; es ist in den gesellschaftlichen Verhältnissen zu finden, die der rechtlichen Regelung bedürfen, also im rechtlichen Regelungsobjekt. Demzufolge ist es dem Gesetzgeber vorgegeben. In diesem Sinne gilt: die rechtlich relevante Natur der Sache kann sich nicht nach dem Gesetz, sondern das Gesetz muß sich nach der rechtlich relevanten Natur der Sache richten. Zwar ist die rechtliche Regelungsnotwendigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse nicht mit dem Maßstab gleichzusetzen, nach dem diese gesellschaftlichen Verhältnisse zu regeln sind, jedoch liegt beides dicht nebeneinander. Rechtliche Regelungsnotwendigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse und das Maß, nach dem die rechtliche Regelung zu erfolgen hat, sind zwei Seiten einer Medaille. Anders gesagt: das rechtliche Regelungsobjekt einer Gesellschaft - verstanden als Gesamtheit 19 M E W , Bd. 1,S. 126.
240
Karl A. Mollnau
der Sozialbeziehungen, die der rechtlichen Regelung bedürfen - liefert zugleich auch Maßstäbe seiner eigenen rechtlichen Regelung. Um diese Maßstäbe aufzufinden, ist zweierlei unerläßlich: Zum einen muß die Interessenstruktur des rechtlichen Regelungsobjekts in seiner inneren und äußeren Widersprüchlichkeit analysiert werden, denn nur so können die gemeinschaftlichen Interessen der ökonomisch und politisch Herrschenden herausgefunden, mit den Interessen der Gesamtgesellschaft und denen der einzelnen Individuen, Gemeinschaften und Gruppen harmonisiert und als Grundlage für Ansprüche definiert werden, die zum juristischen Gesetz erhoben, allgemeinverbindlich durchgesetzt werden können. Zum anderen sind die struktur-, funktions- und entwicklungsgesetzlichen Zusammenhänge aufzusuchen, die in einer gegebenen Gesellschaft herrschen, zu der das rechtliche Reglungsobjekt gehört 20 . Dabei spielen die sozialen Entwicklungsgesetze, deren Wirken den Fortschritt der Gesellschaft in Richtung auf Individualitäts- und Schöpferkraftentfaltung aller Menschen ermöglicht, eine besondere Rolle als Maß des Rechts. Werden die Entwicklungsmöglichkeiten - und zwar jene, die in einem Gesellschaftssystem stecken sowie die, die über dieses System hinausführen - ausgespart, tritt das Recht auf der Stelle und wirkt zementierend. Als Leitmotiv des analytischen Vorgehens in Richtung de lege ferenda kann dieser Satz dienen: „Es hilft nicht, daß, was wirklich ist, vernünftig ist, wenn sich herumgesprochen hat, daß nicht alles, was vernünftig, wirklich ist." 2 1 . Das Interesse der herrschenden Klasse, Gruppe oder Clique ist zwar ein, aber nicht der einzige Maßstab, an dem das Recht zu messen ist. Eigentliches Maß der juristischen Gesetze sind die bereits erwähnten objektiven sozialen Gesetze der Humanisierung der Gesellschaft. Die Apostrophierung objektiver Gesetze der Gesellschaft, die in deren materiellen Lebensbedingungen wurzeln, als Letztmaßstäbe des Rechts heißt nicht, die marxistische Rechtstheorie kenne keine ideellen Maße des Rechts. Wer dies annimmt, erliegt jenem Mißverständnis, demzufolge die letztinstanzliche ökonomische Determiniertheit . des Rechts Monokausalität und Unilinearität zwischen Ökonomie und Recht bedeuten müsse. Natürlich gibt es auch Kausalbeziehungen zwischen dem Recht und der Kultur oder anderen ideellen Erscheinungen. Wogegen sich die marxistische Rechtstheorie wehrt, ist dies: die materiellen Triebkräfte der ideellen Triebkräfte, die materiellen Wurzeln der ideellen Maßstäbe des Rechts unaufgedeckt zu lassen oder erst gar nicht nach ihnen zu fragen. 20 Näheres siehe den Beitrag des Verfassers: Notizen zur Relation zwischen objektiven und juristischen Gesetzen, in: W. Krawietz / Walter Ott (Hrsg.), Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart, Berlin 1987, S. 371 ff. 21 Volker Braun, Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie, Leipzig 1988, S. 9. Braun kritisiert Zustände in der D D R .
Maß und Geltung des Rechts
241
Und übrigens: Jene Ableitungstheoretiker, die für jede rechtliche Detailregelung und deren Maß eine Nabelschnur zur Ökonomie suchen, praktizieren einen Vulgärsoziologismus, der mit einer materialistischen und dialektischen Rechtsanalyse nichts zu tun hat. Außerdem verfehlen sie das Recht in seiner relativen Selbständigkeit. Leider war die Geschichte der marxistischen Rechtstheorie nicht frei von solchen Praktiken. Doch was hat all dies mit der Geltungsfrage des Rechts zu tun? Geltung ist eine systemimmanente Eigenschaft des Rechts. Eine Rechtsnorm ist in einem Rechtssystem dann gültig, wenn ihr Autor berechtigt war, sie zu setzen oder zu präjudizieren und wenn sie keiner höherrangigen Rechtsnorm widerspricht, die demselben Rechtssystem angehört 22 . Wiewohl aber die Geltung eine systemimmanente Eigenschaft des Rechts ist und folglich nach systemimmanenten Maßstäben eines Rechtssystems zu beurteilen ist 2 3 , liegen ihr dennoch außerrechtliche soziale Sachverhalte zugrunde. Dies ist der entscheidende Differenzpunkt zu all jenen Geltungskonzepten, die zwar auch die Geltung als systemimmanente Kategorie auffassen, sie jedoch streng rechtsintrasystemar analysieren. Erst die Anerkennung außerrechtlicher sozialer Sachverhalte als Grundlage der Rechtsgeltung macht es möglich, der Rechtsgeltung ein Maß zu geben, sie nach Maß zu gestalten und festzusetzen. Aber damit ist noch nicht unbedingt eine Geltungsanalyse materialistisch fundiert. Materialistisch wird die Anerkennung außerrechtlicher Sachverhalte als Maß der Geltung erst dann, wenn die Maßstäbe der Rechtsgeltung außerrechtlichen Sachverhalten entnommen werden, die dem gesellschaftlichen Sein angehören, respektive wenn die - wie das Recht selbst - dem Subjektbereich angehörenden Maßstäbe (Rechtsprinzipien, Gerechtigkeitsideen, Moralgrundsätze, religiöse Dogmen usw.) selbst nach objektiven Gesichtspunkten beurteilt werden. Der Geltungsmodus von Recht ist in keiner seiner Dimension eine blanke Formalie, die der gedankenlosen Laune des Gesetzgebers anheimgegeben werden könnte. Die Rechtsgeltung ist weder indifferent gegenüber dem Rechtsinhalt, noch gegenüber den zu regelnden sozialen Beziehungen und umgekehrt. Rechtsgeltung ist nicht maßlos; auch sie hat ein Maß. Geltung als systemimmanente Eigenschaft des Rechts spiegelt inhaltliche, strukturelle und funktionelle Aspekte von rechtlichen Regelungsnotwendigkeiten gesellschaftlicher Verhältnisse wider. Die Geltung des Rechts kann ebensowenig von ihrer Genese abgekoppelt werden wie die Verbindlichkeit
22 H. Klenner, Lenins „Empiriokritizismus" und die Grundfrage der Rechtstheorie, in: Staat und Recht, 1967, S. 1624f. 23 Zur Systemimmanenz der Rechtsgeltung und zum Verhältnis zwischen systemimmanenten und systemtranszendenten Beurteilungsmaßstäben des Rechts siehe ebenda.
16 Festgabe Opalek
242
Karl A. Mollnau
von Rechtsinhalten von ihrem gesellschaftlichen Kausalnexus. Damit erscheint die Geltung einer einzelnen Rechtsnorm nicht lediglich als separate und singuläre Beziehung zu einer oder zu mehreren anderen Rechtsnormen, sondern wird als Teilproblem jener gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge begreifbar, die Recht für eine Gesellschaft unentbehrlich und notwendig machen. Eine Rechtsgeltungsanalyse mit einem derartigen Ansatz unterschlägt keinesfalls die logischen, psychologischen und wirkungstheoretischen Aspekte, die partiell richtig in der modernen Geltungsdiskussion formuliert werden, sie bringt darüber hinaus aber weitere Dinge zur Sprache. Die Frage etwa, ob ein rechtsnormsetzendes Subjekt berechtigt ist, normierend tätig zu werden, wird nicht nur unter der verfassungsrechtlich festgelegten Rechtssetzungsbefugnis des betreffenden Subjekts und ihrer logischen Verträglichkeit mit anderen Kompetenzen erörtert, sondern das rechtsnormsetzende Subjekt wird in seiner gesellschaftlichen Qualität in die Analyse einbezogen. Damit kann die Rechtsgeltung auch als Ausfluß der ökonomischen und politischen Machtstellung des Rechtsetzers sichtbar gemacht werden. So fern der marxistischen Rechtsbetrachtung die Behauptung liegt, eine Rechtsnorm gelte, weil sie mit Zwang ausgestattet sei, so wenig blauäugig ist der Marxismus, um das Zwangsmoment aus der Geltung von Rechtsnormen zu eskamotieren. Richtig ist gesagt worden, für die marxistische Rechtskonzeption stelle sich nicht die Frage, die Rechtsgeltung ohne das Subjekt des Rechtszwanges, also ohne den Staat und die ihn tragenden sozialen Kräfte, zu konzipieren. Daß Recht gilt, habe auch etwas mit dem Sachverhalt zu tun, den der Logiker Walter Dubislav auf die Formel gebracht habe: „Kein Imperativ ohne Imperator." 24 . Die Geltung von Recht in dessen Widerspiegelungsrelation zu seinem Regelungsobjekt eingelagert zu sehen, bringt die Historizität des Geltungsbegriffs und seiner Beurteilungskriterien zum Vorschein und führt zu der Konsequenz, die Geltung von Recht nicht von den Werteigenschaften des Rechts zu trennen.
24
Wagner (FN 3), S. 114; W. Dubislav, Zur Unbegründbarkeit von Forderungssätzen, in: Theoria 3 (1937), S. 331 (zitiert nach Wagner, S. 120). Wagner führt weiter aus (S. 42): „Der Versuch, Imperative ohne Imperator zu konzipieren, indem man angeblich objektiv gültige Normen nachweist, hat in Ethik und Rechtsphilosophie eine lange Tradition. Schon Aristoteles fordert, daß nicht Menschen, sondern die Vernunft herrschen solle . . . Es spricht einiges für die Annahme, daß die Konstruktion objektiver, imperatorloser Imperative überwiegend in Zeiten versucht wird, in denen das überlieferte Weltbild und damit die traditionellen Wertvorstellungen (aus gesellschaftlich erklärbaren Gründen) angezweifelt werden; hierfür sei auf die Entstehung der platonischen Ideenlehre oder auf die „ewige Widerkehr des Naturrechts in Westdeutschland nach 1945 verwiesen".
Maß und Geltung des Rechts
243
Hier ist eine terminologische Zwischenbemerkung am Platze: Was ist untçr Werteigenschaft des Rechts zu verstehen? Im Unterschied zur Geltung, ist der Wert eine rechtssystemtranszendente Eigenschaft und wird demzufolge nach systemtranszendenten Kriterien im Prozeß der Rechtserzeugung gestaltet. Die Werteigenschaft des Rechts drückt demzufolge seine Relation zu anderen, dem Rechtssystem nicht angehörigen Elementen und Systemen der Gesellschaft aus 25 . Werteigenschaften des Rechts sind beispielsweise Gerechtigkeit und Effektivität. Die Kriterien, nach denen die Werteigenschaften des Rechts gestaltet und beurteilt werden, sind von gesellschaftssystembedingter Unterschiedlichkeit und/oder Gegensätzlichkeit, jedoch gibt es auch einzelne Kriterien von systemübergreifender Kontinuität. Dies zu vergessen, heißt jeden Gesellschaft- und Rechtsfortschritt leugnen. Unter Beachtung dieser beiden Gesichtspunkte, lassen sich folgende allgemeine Wertkriterien des Rechts formulieren: a) Aequifinalität, verstanden als Geeignetheit des Rechts, bestimmte soziale Ziele zu erreichen; b) Übereinstimmung mit den auf die weitere Humanisierung der Gesellschaft und des Menschen zielenden moralischen Wertungen und Wertorientierungen einer gegebenen Gesellschaft sowie jenen der geschichtlichen Epoche, in der eine Gesellschaft existiert; c) Konformitätsgrad mit den gesellschaftlichen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten, verstanden als tendenzielles Fortschreiten zu mehr Freiheitsgewinn und vielseitiger Produktivitätsentfaltung des Individuums. Der angedeutete Zusammenhang zwischen der Geltungs- und Werteigenschaft des Rechts eröffnet ein rechtstheoretisch wie rechtspolitisch gleichermaßen wichtiges Problemfeld. Man wird es aber kaum überblicken, geschweige denn beackern können, wenn man mit der abgestandenen Fragestellung aufwartet: Gilt Recht, weil es gerecht und effektiv ist; oder ist es gerecht und effektiv, weil es gilt? Vielmehr muß die alternativ-hierarchische Betrachtungsweise der beiden in Rede stehenden Eigenschaften des Rechts von einer dialektisch-komplementären Zugangsweise zu ihrer Analyse abgelöst werden. Dabei sollte die theoretisch-methodische These von der Notwendigkeit eines materialen Maßes für die Geltungs- und Wertgestaltung sowie Beurteilung des Rechts der wissenschaftliche wie politische nervus rerum sein. Weiter geht es um den notwendig aufzubringenden Realismus bei der Untersuchung des Zusammen- und/oder Gegenspiels zwischen der Geltung und dem Wert des Rechts; allein dies bedeutet, Geltung und Wert des Rechts auch in
25
16*
Klenner (FN 22), S. 1624.
244
Karl A. Mollnau
ihrem mehr oder weniger fortgesetzten Verhältnis von Spannung und Widerspruch zu sehen. Die vollständige, eindeutige und ideale Kongruenz zwischen Geltung, Gerechtigkeit und Effektivität des Rechts ist doch wohl mehr ein Wunsch der Rechtsidealisten aller Motivlagen! Damit endet dieser Beitrag mit einer Problemstellung. Es ist aber eine Problemstellung, in der sich in nicht geringem Maße Bedürfnisse artikulieren, die angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der Welt eine Weiterentwicklung der marxistischen Rechtstheorie in Kontinuität und Erneuerung unumgänglich machen. Soweit es dabei speziell um die Umbrüche im Weltsozialismus geht, fokussieren die angesprochenen Probleme in der Forderung nach sozialistischer Rechtsstaatlichkeit. Nachsatz, Anfang 1993: Als der Verfasser diesen Vortrag hielt, ging er noch von der Annahme aus, die realsozialistischen Systeme seien rechtsstaatlich reformierbar. Diese Annahme beruhte auf illusionären Prämissen, über die inzwischen die Geschichte ihr Urteil gesprochen hat. Die politbürokratischen Herrschaftsstrukturen, die sich hinter der Formel von der sogenannten führenden Rolle der Partei verbargen, ließen es nicht zu, rechtsstaatliche Verhältnisse zu schaffen. So wie die Zerstörung dieser Strukturen notwendig war und - auf lange Sicht gesehen - soziale Progression verspricht, so ist die rückhaltlose Offenlegung und Analyse der Funktionsweise dieser Strukturen unerläßlich.
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurally By Csaba Varga, Budapest The special medium and contexture in which the process called 'establishment of facts' is to take place is not usually given the importance it undoubtedly has in shaping the "establishment" of "facts" in a judicial process. Even institutional approaches do characterize the internal complexity of the operation in question, as well as the intermingledness of the selection and the determination of facts with the one of the law, as two sides of the same unity, mutually presupposing, and related to and shaped by, one another, within a conceptual framework that takes into consideration the institutional character of the points of reference of the intellectual game involved, but it does so without institutionalizing the game, i.e. the practice of reference, itself. In consequence, whatever we claim to be judicial must necessarily be actually quasijudicial. That is to say, the judge as an institution stands on the same footing as does the everyday user, student, doctrinal expert, or critique, of the law. For that matters, law provides not only for to what conditions what consequences shall be attached but also for the way of how to establish that the condition is met 1. Or, as it will be argued for later on, in law as a system formalized thoroughly to the end, the artificial making of how will necessarily result in the artificial making of what and why , too. I. The Constitutive Nature of the Establishment of Facts Since '[t]he actual events [ . . . ] do not walk into court' 2 , there is something in the procedure resulting in that, finally, 'the "facts" are what the judge thinks they are' 3 . This statement, being the recognition of the particular ontological character of law, has nothing to do with any pessimism, subjectivism or agnosticism. It is a statement of the fact that, by having formalized the operation in question, it has turned out that, any longer, 'it is not the "pure facts" but
1 Cf ., e. g., Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Zweite, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage, Wien 1960, p. 244. 2 Jerome Frank, Courts on Trial, Myth and Reality in American Justice, Princeton 1949, p. 15. 3 Frank, Law and the Modern Mind, Garden City 1930, p. X V I I I .
246
Csaba Varga
rather the factual premises that are the conditions of a certain decision'4. Thereby the presence of facts is reduced to their statement , i.e. to their representation claimed by their statement , assuming tacitly that, on the final account, facts will be substituted to by their statement. As a matter of fact, there is nothing new in it. As an underlying assumption, it has already been formulated by the analytical-doctrinal reconstruction of the system. O n l y by being first ascertained through a legal procedure are facts brought into the sphere of law or do they, so to speak, come into existence within this sphere. Formulating this in a somewhat paradoxically pointed way, we could say that the competent organ ascertaining the conditioning facts legally "creates" these facts.' And it is so because '[i]t is only by the ascertainment [of the fact of a delict, representing an entirely constitutive function of the court] that the fact reaches the realm of law [...], it is for the first time created as such in law [...] In juristic thinking the procedurally established fact replaces the fact taken in itself that in nonjuristic thinking is the condition for the coercive act. Only this ascertainment itself is a "fact" [...].' 5 . In this way, the procedural medium and context are by far not features outwardly added to a process running on its own way. Procedurality is a fundamental constitutive function. Due to it, from anything only that can be present what has been formulated by a procedural agent in a procedural situation. Even those models of procedural systems which formulate, and confront to each other, the ideals of formal justifiability and of material efficacity (conceptualized as subsumption-oriented and consequence-oriented approaches 6 as due process and efficient control model 7 , or, within the realm of the establishment of facts, as fight- and truth-theories 8), are in the final analysis relativized in the sense that all they are only varieties within the basic institutional determination - all
4
Hannu Tapani Klami, Anti-legalism, Five Essays in the Finalistic Theory of Law, Vammal 1980, p. 74 [Turun Yliopiston Julkaisuja, Sarja Β Osa 153]. 5 Kelsen , General Theory of Law and State, transi, by Anders Wedberg, Cambridge, Mass. 1946, p. 136 [20th Century Legal Philosophy Series: vol I], resp. Kelsen (FN 1), p. 244 - 246 in the translation of Max Knight [Pure Theory of Law, Berkeley 1967, p. 238 as corrected by Csaba Varga]. Cf. also, in the same sense, Kelsen , Allgemeine Theorie der Normen, hrsg. v. Kurt Ringhofer / Robert Walter, Wien"l979, p. 106. It is to be noted that this recognition could have sounded too revolutionary for the contemporary to an extent that, even several years later, the remarkable Swedish thinker dared repeat it only compromisingly: 'In so far as [the facts] are covered by the judgment, they have, so to speak, been replaced by the judgment... The judgement is now the relevant fact.' Karl Olivecrona, Law as fact, 2nd ed., London 1971, p. 204 [emphasis by Csaba Varga]. 6 E.g. Torstein Eckhoff / Knut Dahl Jacobsen, Rationality and Responsibility in Administrative and Judicial Decision-making, Copenhagen 1960. 7 E.g. Herbert L. Packer , Two Models of the Criminal Process, in: University of Pennsylvania Law Review, 113 (1964). » E.g. Frank (FN 2).
The Judicial Establishment of Facts and its Proceduraly
247
being based upon, instead of being confronted to, it. No matter how they are conceptualized, all they are procedural in a stronger or a weaker sense. Or, the definition of any one of their sides does, in principle, apply to both of them. Any of them is constructed in a way that, within the process of reaching efficiently the material target, it 'restricts procedure by in-built programmed conditions for justice in the interest of recognized values'9. That is to say that their specificity within their basic procedurality can only appear in the way and with the extent of limiting the process. 'An ideal procedure consists of a system of rules which tells us in precise and unambiguous language what to do from one moment to the next' 10 . Such a procedure is obviously ideal for guaranteeing the maximum of foreseeability and reliability of the repetition of the operations involved. Unfortunately, a procedure like this is only good for jobs with data to feed-in, and the operations to be done have entirely pre-codified a precondition which is, generally, by far not given. For in practice mostly either an externally defined alternative of decisions is to be built in the process or the program itself has to be transformed into a learning-program which is able to self-selection and self-determination in its adaptation to the nature of the job. A t the same time, by the definition of the procedure as a normative program, procedurality as a specific instrumental value will be built into the process. In consequence, the justifiability of the whole process and also its direction will be a function of, as defined by, the projections of the procedural order. This again turns up as a source of contradictions and inevitable discrepancies in view of the genuine issue of the process. On the one hand, each alternative decision is a switch that defines the direction of the whole process in a way that, by providing exclusive starting points for any further switch(es), it can, from the very start, determine the result of the whole process. This is to mean that the very first switch can reduce the chances of realization of the original target to less than the minimum. (Let's take, for instance, the alternative offered by routine answers of service regulations which can, with equal procedural value, cover all possibilities - from an answer to the merit via the minimalization of the question, the channelling of the answer to sideways, its rejection or negation, to the punishment of a mere formulation.) On the other hand, procedurality will filter all materially relevant factors (and considerations and standpoints), in order to accept as its own factors in procedure only those ones which it does select according to their procedurally evaluated and established conformity to the medium - which is a purely formal consideration, entirely alien to the materiality of the original target.
9
Niklas Luhmann, A Sociological Theory of Law, 1972, transi, by Elizabeth King / Martin Albrow, ed. by Martin Albrow, London 1985, p. 351, note 56. 10 George H. Kendal , Facts, Toronto 1980, p. 58.
248
Csaba Varga
These dite felicity conditions 11 making the entirety of the process apparently arbitrary. Notwithstanding, this is rather the otherness of the language, that is, of the medium in and by which we speak. And by speaking we do not tell (i. e. describe linguistically-logically) something here, but rather do something (i.e. establish an institution by the act, which is more specified than the act, of communication). In order that an institution comes into being by a performative utterance , some conditions are to have been met. Notably, 1) 'the convention invoked must exist and be accepted', and 2) 'the circumstances in which we purport to invoke [this procedure] must be appropriate for its invocation' 12 . Therefore, in contrast to the descriptive statements, either true or false, performative utterances can only be felicitous or infelicitous 13. Having in mind that the specific use of the performative utterance is to bring about something institutional, there is no relevance of interpreting it in a directly cognitive way. The only consideration that acts as a criterion in it is whether doing by the use of language is, in function of the linguistic act and the entirety of its contexture, able or not to bring about the institution in question. Or, this is nothing else than the basic principle of procedurality: to make a purely procedural mechanism to function in order to select what statements claiming to point to the issue can and shall be involved in the procedure. statement as object true statement
felicitous
act
infelicitous
false the only factor that matters
it doesn't matter
In consequence, if we are to describe felicity and truth as aspects crossing one another 14 , we have to emphasize at the same time that these are criteria 11 Cf. J. L. Austin , How to Do Things with Words, 2nd ed., 1955, by J. O. Urmson / Marina Sbisa, London / Oxford / New York 1976, p. 14. 12 Austin , Performative Utterances, in his: Philosophical Papers, Oxford 1961, p. 224. 13 Cf. Austin (FN 12), p. 224, Or, ' ( A . l ) There must exist an accepted conventional procedure having a certain conventional effect, that procedure to include the uttering of certain words by certain persons in certain circumstances, and further, (A.2) the particular persons and circumstances in a given case must be appropriate for the invocation of the particular procedure invoked. ( B . l ) The procedure must be executed by all participants both correctly and (B.2) completely.' Austin (FN 11), p. 14f.
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
249
entirely independent from each other, with no use of confronting them with one another. For felicity tells only and exclusively about the potentiality of a statement to establish an institution. Or, the other way round, it is in point of principle arbitrary for all other considerations. On the other hand, truth is purely epistemological a criterion, ideally independent from any human institution. The independence of the standpoint is to be particularly emphasized in the present context as the institutionalized procedure may itself make use - as the judicial establishment of facts traditionally does - of the notions of truth/falsity. However, "truth" and "falsity" in the sense of institutionalized procedure can at the most be related only nominally with truth/falsity in the epistemological sense, as a kind of their ideological substitution. For any statement of truth!falsity in procedure is itself procedural in character, meaning and impact here. 'What is said to be true by this procedure of the law is taken as an established truth for all the ulterior purposes of the law, unless and until it is quashed on appeal' 15 . It is why procedure can only be conceptualized as a 'truth certifying procedure' 16 only by assuming that what the procedure can prove within and for the sake of the same procedure is nothing more than procedural truth. A l l this is expressed by the random-like result of the procedure as well. For instance, the procedure is shaped along the lines of artificially introduced notional dichotomies 17 ; in contrast to the poly valency of cognitive processes, it is ruled by a bivalent logic according to dichotomized conceptual classes mutually excluding one another 18 ; in consequence, all motion and change are processualized in procedure, therefore '[a]ny failure to maintain the due form negates the whole process' in the same way as even the bare chance of the rejection of the procedural claim (e.g. 'police [ . . . ] knowledge is based on facts, cogent enough for moral certainty, but lacking possibility of proof by legal standards') can block the initiative to take an action at all 1 9 .
14
Cf. Tomas ζ Gizbert-Studnicki, Factual Statements and Legal Reasoning, in: Reasoning on Legal Reasoning, ed. by Aleksander Peczenik / Jyrki Uusitalo, Vammala 1979, p. 143f. 15 Neil MacCormick / Zenon Bankowski, Speech Acts, Legal Institutions, and Real Laws, in: The Legal Mind. Essays for Tony Honoré, ed. by Neil MacCormick / Peter Birks, Oxford 1986, p. 129. 16 Bankowski, The Value of Truth: Fact Scepticism Revisited, in: Legal Studies, I (1981), p. 265. 17 E.g. Henri Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire, Etude de sociologie juridique, Paris 1964, p. 33. 18 Vladimir Vodinelic, Valoszinûség és bizonyossâg a büntetö eljârâsban [Probability and Certainty in Criminal Procedure], in: Dolgozatok az âllam- és jogtudomânyok kôrébôl I V (Pécs 1974), p. 88f. 19 E.g. Eliot Slater, The Judicial Process and the Ascertainment of Fact, in: The Modern Law Review, 24 (1961), p. 722.
250
Csaba Varga
It is to conclude that, in the final analysis, truth in epistemological sense is neither enough nor strictly necessary to establish truth in procedural sense. What is more, we can only say that it is only the procedural establishment of the falsity of a claim to state facts as a true statement of facts that excludes from the very start, and within the same process, the procedural establishment of truth of the same statement of facts. (And we can see that even the use of criteria of absence of defense and defeasibility 20 , instead of the ones of felicity and infelicity, could not challenge the issue either, as the rejection of ascription would also be founded not by any falsity in epistemological sense21, but by its procedural establishment.) I I . Evidence and procedurality Evidence is a process in the course of which, if successful, brute facts get transformed into institutional ones by performing the action aiming that, "as a proven fact, it has been established". One may assume that there has ever been some connection between the philosophical world concept and the system of evidence in law 2 2 . Our arrangement of modern formal law puts a special emphasis on the whole series of its ideological foundations, including the cognitive model of its system of evidence 23 . As to its definition, from a légal point of view, 'to prove is nothing else than to make the court know the truth of a statement of fact from which legal consequences are to be drawn' 24 , while, from a philosophical one, it is 'an operation [...] guiding the mind to the acknowledgement of a previously doubted assertion in an indubitable and universally convincing manner" 25. Social embeddedness, psychological contexture and interpersonality are common features of evidence, to be found already in the elementary structure 20 H. L. A. Hart , The Ascription of Responsibility and Rights, in: Proceedings of the Aristotelian Society, New Series, vol. X L I X , London 1949, p. 189f. 21 As it is claimed by, e.g., Georges A. Legault, La structure performative du langage juridique, Montréal 1977, p. 183. 22 Cf. La preuve I - I V , Brussels 1963 - 1965 [Recueils de la Société Jean Bodin, Ns. 17 - 19] and La preuve en droit, pubi, par Chaïm Perelman / P. Foriers, Brussels 1981 [Travaux du Centre national de Recherches de Logique]. 23 Cf., e.g., A. /. Trusov, Osnovi teorii sudebnikh dokazatel'stv, Kratkii otsherk [Foundations of the Theory of the Judicial Evidence: A n Outline], Moscow 1960, ch. I; Lajos Nagy, Itélet a büntetöperben. A büntetöbiroi dôntési tevékenység problémâi [Judgement in the Criminal Procedure: Problems of the Judicial Decision-making], Budapest 1974, ch. I I , para. 5; and, as a statement of principle, William Twining, Evidence and Legal Theory, in: The Modern Law Review, 47 (1984), p. 269f. 24 A. Colin / H. Capitani, Cours élémentaire de Droit civil français, ed. par Julliot de la Morandière, No. 718, quoted by Perelman, La preuve en droit, essai de synthèse, in: La preuve en droit, p. 357. 25 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie [1926], 14th ed., Paris 1983, p. 822 [emphasis by Csaba Varga].
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
251
of taking a proof. And since the time of Charles Blondel it has been known that, instead of pure perception, one can at the most count with one interpreted within an affective and social contexture 26 ; furthermore, neither observation is else than processing the sensation in a social and intellectual process rooted in tradition 27 . In the final account, neither the judge can say anything more than ' A l l that I know is that the witness said what he said' - and everything what he gets therefrom in addition to it is based on his conventional reliance upon human fairness, preciseness and reliability, as well as on human conclusion 28 . Both historically and in its conceptual understanding, evidence is a practical procedure , in function of both its purposes set and the character and quantity of information available and adopted in the process 29. Or, as it has been formulated decades ago, in a procedural context, evidence is aimed at 'approving' the qualification of stated facts as legal facts, for 'it is aimed at getting the approbation by the social group rather than at searching purely the truth' 3 0 . A t the same time, the implementation of laws and the enforcement of rights are only two of the series of the possible ends of the process. For in competition, and not necessarily in a way harmonizable, with them, compromise, termination of conflict, redistribution of goods, focusing of public attention, political or legal change and many other ends can be equally set 31 . This is to say that finding the truth is only one of the values to be realized simultaneously a value that can be in conflict with other ones like speed, economy, public confidence, or ease in prediction and application 32 . It is why '[jJudicial finality and legal evidence go hand in hand' 33 . 'Proof and truth being nothing but means to realize what is regarded as justice in the given society' 34 . A l l this means that, running counter with traditional approaches considering evidence unequivocally and exclusively a process of cognitive nature and determination, legal evidence is only interpretable within a deeply social, and, at the same time, strictly legal, contexture from the very start, which imbues 26
Cf., e.g., Lévy-Bruhl (FN 17), p. 17. Cf. , e. g., John Mackie, The Nature of Facts, in: The Australasian Journal of Philosophy, X X X (1952), p. 118. 28 MacCormick , Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 1978, p. 89 [Clarendon Law Series]. 29 Cf., e.g., Joynt / Rescher, Evidence in History and in the Law, in: Journal of Philosophy, 56 (1959), p. 564, referred to by Philip Shuchman, Problems of Knowledge in Legal Scholarship, Hartford, Conn. 1979, p. 17. 30 Lévy-Bruhl (FN 17), p. 22 and 46. 31 E.g. Twining (FN 23), p. 278f. 32 E.g. Shuchman (FN 29), p. 60. 33 Morris D. Forkosch, The Nature of Legal Evidence, in: California Law Review, 59 (1971), p. 1376. 34 Perelman (FN 24), p. 364. 27
252
Csaba Varga
thoroughly its particularities and its particular determinations as well. Legal evidence is the component of a formally structured practical procedure, sharing also in its particularities. That is, both its targets, the context of its procedurally, and "the complex of fact and law", being apparently reduced to one of its aspects in the course of and for the sake of taking the proof, are normatively determined in it. In consequence, 'artificiali [...] reason' 35 that makes law a practical instrument, colors its ethos and draw the boundaries of its homogeneity, characterizes legal evidence as well. For instance, the law of evidence can institutionalize, as choices of fundamental strategic alternatives, procedures that could only qualify as the negation of evidence beyond the realm of law. It can permit that a decision is made without all-covering proof is taken 36 ; that proof is taken with pieces of information filtered through the procedure in a way that a possible reconstruction of the whole process could only reveal that the pieces kept back could have only been in genuine play 37 ; or that evidence is taken in a way that 'seeks to find truth by a process of competitive lying' 38 . It is also artificial reason that is present in the normative institutionalization of some specific aspects and ways of evidence (e.g. the burden of proof and the presumption), as well as in the bare fact that evidence is normatively regulated. The regulation of procedure has in point of principle nothing to do with any cognitive consideration; moreover, its canons and provisions are not valid or empirically interpretable 39 . Notwithstanding, the fact that they are «cognitive in their basic character is not a burden upon them; it is simply their underlying working principle. Seen from this aspect, the law of evidence is a set of rules formulating a practical answer to basic life situations and conflicts of interests in order to make the realization of values and value-preferences possible through a formalized procedure functioning uniformly in situations of a mass application as well. In order to achieve this, it builds into its institutions and procedures both the value-preference it seeks to realize and the constructions that are dictated by the requirement of mass application. As a practical category, its adequacy to the requirements of practice can be weighed ontologically and evaluated axiologically; however, its properly cognitive analysis would only be successful
35
(1608) 12 Co. Rep. 65. Cf. also William Holdsworth , A History of English Law, I, 6th ed. rev., London 1931, p. 207, note 7. 36 Cf., t.g., Andrew Sanders, Constructing the Case for the Prosecution, in: Journal of Law and Society, 14 (1987), p. 2. 37 Cf., e.g., Shuchman (FN 29), p. 40f. 38 Bay less Manning, If Lawyers were Angels: A Sermon in One Canon, in: The American Bar Association Journal, 60 (1974), p. 821. 39 Cf. Jerzy Wroblewski, Facts in Law, in: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, LIX(1973), p. 163.
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
253
within the context of cognition, and not within its own medium. So it is by far not by chance to have the crying out: 'the lawyers' rules in what is evidence are so fantastic that if a research worker were to follow them he would be rebuked for being silly and incompetent' 40 . For whatever is being added from the invention and techniques of the law to the ideal of cognition, 'this help is next to nothing. For both procedural rules and legal science and judicial practice are all patterned upon a rather authoritatively oriented evidence, instead of a logical justification substituting to it' 4 1 . Its normative contexture is expressed not only in practical considerations prevailing in the process and thereby denaturing its cognitive character, but also in that no matter in what way its system of evidence is dedicated to facts and nothing but facts, it can only do so by operating the fact and law complex within a united process, for each step in procedure carries a meaning, defined normatively as one of the potentialities of the institutionalized procedure. This is why there is no demonstration here, only argumentation, combined with logical operations 42. In such a way, in respect of the procedure and the evidence within it, it is the contingency of the paths followed and the results achieved, the homogenization of heterogeneous life situations (gained from their filtering through a normatively established conceptual framework, which can follow nothing but its own logic), and the expectation of a practical solution to a social problem that are, all at the same time, characteristic. It is the case when 'testimony is constantly dissected and contradicted and reshaped toward partisan ends. That is the essence of a trial; it is not a scientific or philosophical quest for some absolute truth, but a bitter proceeding in which evidence is cut into small pieces, distorted, analyzed, challenged by the opposition, and reconstructed imperfectly in summation' 43 . In consequence, even if one assumes that the end-result is not too much alienated from scientific truth 4 4 , it is not simply an existential statement but rather something to be conceived of as 'tools to solve legal problems' 45 that is
40
R. M. Jackson, The Machinery of Justice in England, 4th ed. (1964), p. 402, quoted by Shuchman (FN 29), p. 16. 41 Jenö Markó, A jogalkalmazâs tudomânyânak alapjai [The Foundations of the Science of Law-applying], Budapest 1936, p. 128f. [Magyar Jogâszegylet Könyvtara 17]. 42 Cf., e.g., Perelman, The Specific Nature of Juridical Proof, in his: The Idea of Justice and the Problem of Argument, London / New York 1963, p. 101 and Wróblewski, La preuve juridique: axiologie, logique et argumentation, in: La preuve en droit (FN 22), p. 355. 43 J. Marshall, Law and Psychology in Conflict, 1966, p. 94f., quoted by Shuchman (FN 29), p. 49. 44 As it is assumed by Wróblewski, The Problem of the So-called Judicial Truth, in: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 1975, p. 31. 45 Wróblewski (FN 39), p. 166.
254
Csaba Varga
involved, for, 'in the final account, it is only the relationship between the judge's [...] cognitive and evaluative positions that will matter' in it 4 6 . I I I . The Question of "Certainty" In theories of evidence, there has ever been a strong temptation to formulate the ideological assumptions of the legal order as sine qua non postulates, gained by theoretical reconstruction. In constrast to some realistic approaches (terming what is accepted as, e.g., 'probability next to certainty' [eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit] or that 'against which no reasonable, i.e. practically essential, doubt can be raised' 47 ), theories often impute the categoricity of judicial decision to the one of judicial cognition. It is imputed to a "jump" from a given quantity into a new quality; to an "objective" certainty; to the coherency of such a degree that makes any variety the "wonder of Eddington" (i.e. the case of monkey producing a sonnet by operating on keyboard 48 ). However, Eddington's wonder is just the statistical random which, albeit not excluded on principle, has no kind of reasonable probability. And to claim it to be a new kind of objectivity is mere verbality, which postulates something non-existing as existing. In proof in law, the case is not of objectivity but of decision, which is thoroughly practical and, in its alternatives, normatively pre-codified. That is, it is normatively patterned when the objective presence of facts can be established normatively (with reference to statements of facts brought before the court, processed through the judge's reasoning and reasserted as the judge's conclusion, within an individual procedure, in order that legal consequences aimed at by the procedure shall be drawn in procedure) and when it can be rejected. The bivalent polarization inherent in it - and I have in mind the prevalence of the principle of Aut-aut, tertium non datur here, notably the circumstance that the judge can only have the exclusive choice between two versions with the one completely negating the other - is certainly not drawn from our 'undissolubly unconditional' certainty 49 on the given version of facts, but from the circumstance that we can only proceed in legal procedure along the homogenizing lines of the dichotomic conceptual structure of the law. For I can speak about "brute" facts dialectically, with reservations, considering another configuration of them in another context, or acknowledging their falsity if something improbable is the case. Notwithstanding, as soon as they become "in4
* Wroblewski (FN 42), p. 355. Hermann Roeder, Lehrbuch des österreichischen Strafverfahrensrechts, Wien 1963, p. 139 [Rechts- und Staatswissenschaften 18] and M. A. Tsheltzow, Ugolovnii protsess [Criminal Procedure], Moscow 1948, p. 259, respectively. 48 Vodinelic's example (FN 18), p. 97. 49 Vodinelic's terms (FN 18), p. 89 - 93. 47
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
255
stitutional" facts established in such a procedure, instead of dialectics I have the alternative formally reduced to two : "he did / he didn't do", "he did that / he did something else", i.e., "he is guilty / he isn't guilty", "he is liable / he isn't liable". Bivalent formalization is carried through to the end in a way that even in case where a dialectic finding is forced out it shall form a dichotomic establishment projected into some formal category (e.g. judging in dubio pro reo in cases without "certainty" on factual establishment)50. 'What is possible is almost limitless and what is real is strictly defined, for only one of the numerous possibilities can turn into reality. The real is but a special case of the possible, and therefore it is imaginable in other ways as well. Or, it follows therefrom that only by imagining the real in another way can we reach the realm of the possible' 51 . Well, if the real is too narrow a field within the only slightly limited field of the possible (with the paradox of cognition expanding without the knowledge of where and when has reality been specified by it) 5 2 , what is getting expressed in the judicial decision? 'Due to the limited means of human cognition, nobody is in the position not even when observing a process directly - to get absolutely certain knowledge of any set of facts. One can at any one time conceive an abstract possibility of set of facts in which this set is not given. Nobody who understands the limits of human cognition may assume any longer that he can get conviction about any process with the exclusion of any doubt and the bare possibility of any mistake taken. Therefore, in practical life, we sense the high degree of probability which we have gained with the possibly most exhaustive adequate use of the means of cognition of reality, and the consciousness of the high probability so achieved, as conviction about reality' 53 . This means that not even the jurist may count with anything more than probability conclusion in the judicial process. In consequence, the judge's getting certainty on facts can only be interpreted as an operation aiming at a step by step approaching to the point which has been called, albeit in another context, "hermeneutical compression" by Fikentscher 54 . In the evidencing process, it is a two-way motion in twodirectioned senses that attempts, by weighing the pieces of information about facts, to increasing the probability of one configuration of facts while decreas50 Cf. Zygmunt Ziembinski, La vérification des faits dans un procès judiciaire, in: Logique et Analyse, V I (1963), No. 21 - 24, p. 388. 51 Friedrich Dürrenmatt, Justiz (1985). 52 T h e Truth is an end we can attain but we cannot know when we have attained it', Ilkka Niniluoto, 'Fallibilismista', in: Sosiologia, (1974), Nos. 5 - 6, p. 275f., quoted by Aulis Aarnio, On Legal Reasoning, Turku 1977, p. 235 [Turun Yliopiston Julkaisuja, Sarja B, Osa 144], 53 Albert Helwig, Moderne Kriminalistik, Leipzig 1914, p. 86 as quoted by Vodinelic (FN 18), p. 72. 54 Wolfgang Fikentscher, Methoden des Rechts, IV. Dogmatischer Teil, Tübingen 1977, p. 198 - 200.
256
Csaba Varga
ing any counter-probability , on the other hand. In the application of norms, the process ends with arriving at the hermeneutical "turning point". Here it ends by the possible maximum of believ ability, of fitting together and coherency achieved, when each and every kind of 'reasonable doubt' gets practically excluded 55 . In point of principle, even in optimum case the truth of a judicial establishment of facts is nothing else and more than a hypothesis which, under the conditions given, has no competitive alternative. Thereby, having in view our personal commitment at least, we have reached back at the tradition implied by the original usage of the term "the truth", standing for the notion of 'plighted faith' 56 . I V . The Role of the Legal Force Properly speaking, 'the legal rule does not say: " I f a certain individual has committed murder, then a punishment ought to be imposed upon him." The legal rule says: " I f the authorized court in a procedure determined by the legal order has ascertained, with the force of law, that a certain individual has committed a murder, then the court ought to impose a punishment upon that individual'" 5 7 . What is meant by "the force of law" here? Originally, by touching upon the status of the individual, Ulpian argued that anybody who has been declared to be free [ingenuus] by a judicial decision has to be regarded as free even if later on he would be revealed to have ever been liberated [libertinus] notwithstanding, because the thing that had been judged was to be accepted as true [res judicata pro veritate accipitur] 5S. By having abstracted from the individuality of the case, the principle involved was soon restablished in Justinian's Digests as one of the diversae regulae juris antiqui 59, which, through the sequence of its reception and ensuing reinterpretation during the Middle Ages, set the basis of one of the foundational procedural institutions of modern formal law. And in terms of its actual working we have to realize that, in a system built up and made to function by the means of formalized procedures, anything that is material is at the same time procedural. And it is also to say that, strictly speaking, it is the procedure that 'legally "creates" these facts' for the procedure. For 'the function of ascertaining facts through a legal procedure has always a specifically constitutive character' 60 . 55 E.g. MacCormick (FN 28), p. 89f. and MacCormick, The Coherence of a Case and the Reasonableness of Doubt, in: The Liverpool Law Review, I I (1980), p. 50. 56 The Oxford English Dictionary, X I , Oxford 1933, p. 435f., as well as S. O. E. D., 3rd ed., p. 2375. Cf. also Kendal (FN 10), p. 21. 57 Kelsen (FN 5), p. 240. 58 Cf. D. 1. 5. 25. 59 D. 50. 17. 207.
The Judicial Establishment of Facts and its Procedurality
257
Or, as it is reflected by both its normative regulation and the logic implied by it, the procedure is built upon the assumption of some formal requirements according to which: a) the judge is to make a decision within a reasonable and/ or a fixed span of time; b) his decision must involve a final and definite choice between one of the bivalent alternatives defined by the dichotomic categories of law (i. e. he must establish, as a fact, either that the case brought before him is a legal case, that is, one defined by a normative category of the law or that it is not the case); and, finally, c) the establishment in question will - either directly or indirectly, i.e., if there is an appeal institutionalized in procedure, by not appealing in time, or as this establishment has been restablished upon appeal - become authoritative , i.e. final , in the legal order, as long as it does prevail. A n order can only be based upon indubitable facts. These can either be axioms which are self-evident (as taught by Pascal and Descartes) or establishments forwarded by the order itself (and this is the reason why legal force has been institutionalized in law) 6 1 . A t the same time, their difference in the foundation of an order is to be seen not simply in the fact whether they lead to a "natural" or an "artificial" order but in the difference of the one only defining minimum conditions for the very start (without necessarily prejudicing the outcome) and of the other which transforms any result otherwise concluded (with no respect of the qualities it features) into a final one. Thereby it shortcircuits the whole process and transforms what can be a factor quite contingent from any extra-procedural point of view into a factor also asserting itself in and having an impact on extra-procedural life. Considering the issue, it seems to be by far not by chance that it is only legal formalism that has developed such an institution. It is not by chance therefore that in extra-juridical spheres, so 'in philosophy, there is no authority which would guarantee, to some of its theses, the status of res judicata' 62. As a matter of fact, there cannot even be, for such an authority, instead of contributing to the clarification of the starting points, is only to guarantee that the result achieved be freed from any doubt whatsoever. Its only job is to declare that the establishment in question belongs to the normative order definitively , that its status derives therefrom , and that it has the exclusive foundation on its being projected by, as a constitutive establishment within, the normative order (a feature that has become the proper form of existence of modern formal law both in its formation and functioning). And thereby it elevates irrevocably the 60
Kelsen (FN 5), p. 136. Perelman (FN 42), p. 105. 62 Perelman, What the Philosopher May Learn from the Study of Law, 1966, and, in the same sense, Perelman, Justice and Reason, 1964, both in his: Justice, Law, and Argument, Essays on Moral and Legal Reasoning, Dordrecht / Boston / London 1980, p. 173 and 75 respectively. 17 Festgabe Opalek
258
Csaba Varga
establishment of facts (which could otherwise be a pure statement) to become a member of the realm of ought-projections 63 .
63
Cf., for broader theoretical context, by the author: Häns Kelsens Rechtsanwendungslehre: Entwicklung, Mehrdeutigkeiten, offene Probleme, Perspektiven, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 76 (1990); Judicial Reproduction of the Law in an Autopoietical System?, in: Technischer Imperativ und Legitimationskrise des Rechts, hrsg. v. Werner Krawietz, Antonio A . Martino, Kenneth I. Winston, Berlin 1991 [RECHTSTHEORIE, Beiheft 11]; On Judicial Ascertainment of Facts, in: Ratio Juris 4 (1991); and A birói ténymegâllapitâs imputativ jellege [The Imputative Character of the Judicial Establishment of Facts], Allam- és Jogtudomâfiy , X X X I (1989).
I V . Normativismus und Positivismus in der modernen Normentheorie
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts 1 Von Ralf Dreier, Göttingen I. Problemstellung 1. Das Sohm-Problem Seit Sohms berühmter These, das Kirchenrecht stehe mit dem Wesen der Kirche in Widerspruch 2 , ist der Streit um das Kirchenrecht und den ihm angemessenen Rechtsbegriff nicht zur Ruhe gekommen. Man hat gesagt, Sohm vertrete einen positivistischen Rechts- und einen der spiritualistischen Kirchenbegriff, und beide seien grundsätzlich überwunden. 3 Der erste Teil dieses Satzes trifft, jedenfalls für den frühen Sohm, im Kern zu. 4 Man kann aber nicht sagen, der positivistische Rechtsbegriff und spiritualistische Kirchenbegriff seien grundsätzlich überwunden. Beide sind bleibende Möglichkeiten des juristischen bzw. des theologischen Denkens. Schon der Pluralismus der einschlägigen Theorien verbietet es, die genannten Positionen für „grundsätzlich" überwunden zu halten. Und auch wenn man einen nichtpositivistischen Rechtsbegriff vertritt, bleibt der Befund, daß das Kirchenrecht als (auch) zwangsbewehrte und auf Dauer angelegte Ordnung ein Pfahl im Fleisch der Kirche als Geist- und Liebesgemeinschaft ist. Die Versuche, Sohm zu „überwinden", bestehen im wesentlichen darin, das Kirchenrecht theologisch zu begründen und/oder zu interpretieren. Es ist oft bemerkt worden, daß diese Versuche, wie sie vor allem in den großen rechts1 Diesen Beitrag habe ich im November 1991 als Diskussionsgrundlage in der Kommission Kirchenrecht/Theologie der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg vorgetragen. Er wird in einer leicht überarbeiteten Form voraussichtlich 1993 in einem dreibändigen Sammelwerk dieser Kommission erscheinen. Ich freue mich, die Gelegenheit zu haben, ihn in der vorliegenden Fassung Kazimierz Opalek zu widmen. Ich möchte damit sowohl meine persönliche Verbundenheit mit dem Jubilar als auch die engen Beziehungen zum Ausdruck bringen, die - unbeschadet sachlicher Differenzen - zwischen der Rechtstheorie in Krakau und in Göttingen besteht. - Die Belege beschränken sich auf ein Minimum. Auf Opaleks opus magnum, seine „Theorie der Direktiven und der Normen" (1986), die in normtheoretischer Hinsicht hätte berücksichtigt werden sollen, weise ich nur an dieser Stelle hin. 2 R. Sohm, Kirchenrecht, Bd. 1, 1892, S. 1. 3 In diesem Sinne etwa E. Wolf, Ordnung der Kirche, 1961, S. 10ff. 4 Vgl. dazu und zum folgenden R. Dreier, Das kirchliche Amt. Eine kirchenrechtstheoretische Studie, 1972, S. 19ff.
262
Ralf Dreier
theologischen Konzeptionen von Johannes Heckel, Siegfried Grundmann, Erik Wolf und Hans Dombois vorliegen 5 , die kirchenrechtliche Praxis und die Dogmatik des Kirchenrechts weitgehend unberührt gelassen haben. Das ist nicht verwunderlich. Denn es handelt sich bei ihnen, auch wenn sie überwiegend von Juristen stammen, eben um Rechtstheologie, d.h. um Konzeptionen, die jedenfalls in ihren Basisthesen der Theologie und nicht der Rechtswissenschaft zuzuordnen sind. Ihnen liegt, zumindest in ihrem Kerngehalt, eine theologische, nicht eine juristische Sicht des Kirchenrechts zugrunde. 2. Das Sichtproblem Das Kirchenrecht kann, wie das Recht überhaupt, in verschiedenen Hinsichten zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung werden, z. B. in theologischer, philosophischer, historischer, soziologischer, linguistischer, ästhetischer, juristischer usw. Sicht. Nicht allen diesen „Sichten" (Perspektiven, Aspekten, Standpunkten) sind unterschiedliche Rechtsbegriffe zugeordnet. Doch hebt jede von ihnen aus der Fülle der Merkmale, die dem mit dem Ausdruck „Recht" oder seinen fremdsprachigen Äquivalenten bezeichneten Gegenstandsbereich zukommen, diejenigen hervor, die von dem gewählten Standpunkt aus als wichtig erscheinen. Und es dürfte sich zeigen lassen, daß jedenfalls diejenigen Forschungsaspekte, die in eigenständigen wissenschaftlichen Disziplinen institutionalisiert sind, zu unterschiedlichen Rechtsbegriffen führen. Bevor ich das Spezifische der juristischen Sicht erläutere, sei zunächst ein Seitenblick auf die soziologische Sicht geworfen. a) Die soziologische Sicht Der Soziologe untersucht das Recht - das weltliche wie das kirchliche - von einem externen Standpunkt aus. Er nimmt gegenüber ihm eine Beobachterperspektive ein. Ihn interessiert das Recht als Strukturelement von Sozialsystemen und seine Wirkungsweise. Dem entspricht der soziologische Rechtsbegriff - gleichviel, ob er auf die Sanktionierung abweichenden Verhaltens oder (aus der Beobachterperspektive) auf den Innenaspekt der Stabilisierung von Verhaltenserwartungen abstellt. Max Weber und Theodor Geiger z.B. definieren das Recht - im wesentlichen übereinstimmend - als Gesamtheit von Normen, die dadurch gekennzeichnet sind, daß normwidriges Verhalten verfahrensmäßig-organisiert sanktioniert wird - im Unterschied zur Sitte, für die eine gesellschaftlich-diffuse Sanktionierung abweichenden Verhaltens charakteristisch ist. 6 Demgegenüber stellt Niklas Luhmann, der das Recht als
5 Dazu W. Steinmüller, Evangelische Rechtstheologie. Zweireichelehre - Christokratie - Gnadenrecht, 1968 (mit Bibliographie).
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
263
Gesamtheit zeitlich, sachlich und sozial kongruent generalisierter Verhaltenserwartungen definiert, auf den Innenaspekt ab. 7 b) Die juristische Sicht Der soziologische Rechtsbegriff ist für juristische Zwecke nur begrenzt brauchbar. Der Grund hierfür liegt darin, daß der Jurist gegenüber dem Recht nicht auf einem externen, sondern auf einem internen Standpunkt steht. 8 Er nimmt ihm gegenüber eine Teilnehmerperspektive ein. Das gilt für den Rechtswissenschaftler wie für den Rechtspraktiker, und es gilt für den weltlichen wie für den kirchlichen Juristen. Da es hier um die Institutionalisierung von Forschungsaspekten in wissenschaftlichen Disziplinen geht, ist es sinnvoll, als spezifisch juristische Sicht des Rechts diejenige der Rechtsdogmatik auszuzeichnen. Denn die Rechtsdogmatik ist das Kernstück der Rechtswissenschaft und wird oft und mit Recht auch als Rechtswissenschaft im engeren und eigentlichen Sinne bezeichnet. Rechtsdogmatik ist Lehre vom geltenden Recht eines bestimmten Rechtssystems. Sie ist eine praxisbezogene Disziplin und untersucht das Recht unter dem Aspekt der Anleitung juristischen, insbesondere richterlichen, aber auch verwaltungsbehördlichen Entscheidens. Da im Kirchenrecht die Gerichtskontrolle eine geringere Rolle spielt als im weltlichen Recht, sind die Aussagen der Kirchenrechtsdogmatik traditionell eher an die Kirchenleitung und die kirchliche Verwaltung als an kirchliche Gerichte adressiert. Das sind aber Nuancierungen, die für die Theorie des Rechtsbegriffs außer Betracht bleiben können, zumal im Kirchenrecht die Rolle der Gerichte kontinuierlich zunimmt. Den verschiedenen partikularen Rechtsdogmatiken sind Grundbegriffe und Grundprobleme gemeinsam, zu deren Bearbeitung sich eine spezifisch juristische Grundlagendisziplin herausgebildet hat, für die in der weltlichen Rechtswissenschaft der Ausdruck „Rechtstheorie" gebräuchlich geworden ist. Sie kann als allgemeine juristische Theorie des Rechts und der Rechtswissenschaft definiert werden. 9 Sie teilt, in verallgemeinerter Form, die Forschungsper6
Vgl. M.Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (1921), Studienausg., hrsg. v. J. Winckelmann, 1964, S. 24; T. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (1947), Ausg. 1964, S. 339. 7 Vgl. N. Luhmann, Rechtssoziologie 1, 1972, S. 19. 8 Vgl. R. Dreier, Der Begriff des Rechts, in: Neue Juristische Wochenschrift 1986, S. 890 - 896; mit einem Nachtrag wieder abgedruckt in: ders., Recht - Staat - Vernunft. Studien zur Rechtstheorie 2, 1991 (stw 954), Kap. 4. Dieser Beitrag, auf den ich mich im folgenden mehrfach beziehe, wird hier nach dem stw-Band zitiert. Zum Sichtproblem s. a.a.O., S. 108ff. Im Nachtrag (ebd., S. 117) finden sich Hinweise auf Kritik, die namentlich Norbert Hoerster und Werner Krawietz an meinen Überlegungen zum Rechtsbegriff geübt haben.
264
Ralf Dreier
spektive der Rechtsdogmatik, und vor allem in ihr werden die Probleme eines spezifisch juristischen Rechtsbegriffs erörtert. Wenn im folgenden von „Kirchenrechtstheorie" die Rede ist, so ist damit nicht die Rechtstheologie, sondern - in Anlehnung an die weltliche Begriffsbildung - eine allgemeine juristische Theorie des Kirchenrechts und der Kirchenrechtswissenschaft gemeint, oder wenn man so will: ein allgemeiner Teil der Kirchenrechtsdogmatik. Nur am Rande sei bemerkt, daß die Rechtspraxis, auf die sich die Rechtsdogmatik bezieht, nicht nur die des Richters und des Verwaltungsbeamten, sondern auch die des Rechtsanwalts ist. Dies zu erwähnen, ist nicht überflüssig, weil sich auch aus den verschiedenen juristischen Berufsperspektiven Differenzierungen im Rechtsbegriff ergeben. Oliver Wendell Holmes' berühmte Voraussagedefinition des Rechts beispielsweise - „The prophecies of what the courts will do in fact - and nothing more pretentious - are what I mean by the law" 1 0 - bezieht ihre Plausibilität aus der Anwaltsperspektive. Denn für den Anwalt ist es Berufspflicht, seine Mandanten möglichst genau darüber zu informieren, wo die Grenzen rechtlich sanktionsfreien Verhaltens liegen und welche Erfolgschancen ein von ihnen angestrengter Prozeß hat. Daher stellt sich für ihn die Frage „Was ist Recht?" in erster Linie dahin, wie die Gerichte (und die Behörden), mit denen er es zu tun haben wird, voraussichtlich entscheiden werden. Allerdings nicht nur: Denn zum Beruf des Anwalts gehört auch, im „Kampf ums Recht" vor Gericht dafür zu streiten, daß sich unter mehreren möglichen Auslegungen des geltenden Rechts diejenige durchsetzt, die er für richtig hält (und die für seinen Mandanten günstig ist). Für den Richter jedenfalls ist die genannte Definition unbefriedigend. Ihn interessiert weniger, wie er entscheiden wird, sondern vielmehr, wie er entscheiden soll. Die Frage nach dem Rechtsbegriff ist für ihn im wesentlichen eine Frage seiner Bindung an Gesetz und Recht, oder anders ausgedrückt: nach den legitimen Bestimmungsgründen seines Entscheidens. Das gilt auch für den Verwaltungsbeamten (unabhängig von Art und Intensität einer etwaigen Gerichtskontrolle). Die Rechtsdogmatik und die Rechtstheorie haben sich diese Sicht - unbeschadet der relativen Berechtigung der Anwaltsperspektive - weitgehend zu eigen gemacht. Sie soll auch die Sicht sein, die hier als spezifisch juristische zugrunde gelegt wird. Das Hauptproblem des Rechtsbegriffs in juristischer Sicht ist das Problem des Rechtspositivismus. Bevor darauf eingegangen wird, sei noch ein Blick auf die theologische Sicht des Rechts geworfen.
9 Vgl. R. Alexy/R. Dreier, The Concept of Jurisprudence, in: Ratio Juris 3 (1990), S . l - 13. 10 O. W. Holmes, The Path of Law (1897), in: ders., Collected Papers, New York 1920, S. 167.
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
265
c) Die theologische Sicht Der Theologe „als solcher" (also nicht in seiner möglichen Rolle als Partei in einem kirchlichen oder weltlichen Rechtsstreit) ist am Recht auf andere Weise interessiert als der Soziologe und der Jurist. Auch er sieht, wie der Jurist, das Recht, insbesondere das kirchliche, aus einer Teilnehmerperspektive. Die ihn leitende Fragestellung ist aber nicht die der Rechtsdogmatik, sondern die der theologischen Legitimität und Deutung des Rechts. Spezifisch theologische Rechtsbegriffe formulieren z.B. die weiter unten anzusprechenden Definitionen des Kirchenrechts als geistliches, d.h. als geistgewirktes Recht und als Liebesrecht (s.u. I I I 2 a). Eine entsprechende Studie zu neueren theologischen Rechtsbegriffen hat Hans-Richard Reuter vorgelegt. 11 Auf ihr Verhältnis zum juristischen Rechtsbegriff wird zurückzukommen sein. A n dieser Stelle sei noch eine Bemerkung zum Verhältnis der Kirchenrechtswissenschaft zur Theologie angefügt. Selbstverständlich hat die Kirchenrechtswissenschaft (als Rechtsdogmatik wie als Rechtstheorie) einen Bezug zur Theologie und insbesondere zur Rechtstheologie - ebenso wie die weltliche Rechtswissenschaft zur Rechtsphilosophie. Aber sie ist eine juristische Disziplin, die nicht in Rechtstheologie aufgeht - ebensowenig wie die weltliche Rechtswissenschaft in Rechtsphilosophie. A m angemessensten - wenn auch unvermeidlich vage - dürfte das Verhältnis dahin zu bestimmen sein, daß die Kirchenrechtswissenschaft eine juristische Disziplin mit einer theologischen Dimension und die Rechtstheologie eine theologische Disziplin mit einer juristischen Dimension ist. 12 Auf die damit verbundenen kompetentiellen Probleme, auch im ganz pragmatischen Sinne einer soliden Beherrschung des einschlägigen Schrifttums (und, soweit vorhanden, der Rechtsprechung), sei nur am Rande verwiesen. 3. Das Positivismusproblem Das Problem des Rechtspositivismus bzw. des juristischen Positivismus besteht darin, ob und - wenn ja - in welchem Sinne ein notwendiger Zusammenhang zwischen positivem Recht und Gerechtigkeit besteht. Diese Frage ist in der weltlichen wie in der kirchlichen Rechtstheorie noch immer unausgetragen. Meine These hierzu lautet, daß sich das Problem des Rechtspositivismus im kirchlichen und im weltlichen Recht auf strukturell gleiche Weise stellt. Was im weltlichen Recht das Problem der Gerechtigkeit, d.h. der ethischen 11 H.-R. Reuter, Rechtsbegriffe in der neueren evangelischen Theologie. Versuch einer systematisch-theologischen Skizze, in: K. Schiaich (Hrsg.), Studien zu Kirchenrecht und Theologie I, 1987, S. 187 - 237. 12 Vgl. dazu R. Dreier, Methodenprobleme der Kirchenrechtslehre, in: ZevKR 23 (1978), S. 343 - 367, bes. 359ff.
266
Ralf Dreier
Legitimität des Rechts ist, ist im kirchlichen Recht das Problem seiner theologischen Legitimität (die das Gerechtigkeitsproblem einschließt). Und wie sich in der weltlichen Rechtswissenschaft die Frage nach dem Verhältnis von Rechtstheorie und Rechtsphilosophie stellt, so stellt sich in der kirchlichen Rechtswissenschaft die Frage nach dem Verhältnis von Kirchenrechtstheorie und Rechtstheologie. I I . Die Diskussion um den Rechtsbegriff in der weltlichen Rechtstheorie 1. Der positivistische Rechtsbegriff
Es gibt viele Spielarten des juristischen Positivismus. Gemeinsam ist ihnen die These, daß kein notwendiger Zusammenhang zwischen positivem Recht und Gerechtigkeit oder, wie man in Anlehnung an den angloamerikanischen Sprachgebrauch heute meist sagt, zwischen Recht und Moral besteht. Man kann diese sogenannte Trennungsthese auch dahin formulieren, daß es zweckmäßig sei, das Recht so zu definieren, daß es keine moralischen Elemente, also keine Elemente inhaltlicher Richtigkeit, enthält. 13 Als Begründung hierfür wird in der Regel auf die Pluralität und Relativität der Moralen sowie darauf hingewiesen, daß ethische Fragen rational unentscheidbar seien. Weiter wird geltend gemacht, daß es um der begrifflichen Klarheit willen geboten sei, so deutlich wie möglich zwischen dem Recht, wie es ist, und dem Recht, wie es sein sollte, zu unterscheiden. Dem juristischen Positivismus verbleiben danach für die Definition des Rechtsbegriffs im wesentlichen zwei Gruppen von Elementen: solche der autoritativen Gesetztheit (womit hier ausschließlich die Gesetztheit durch menschliche Instanzen gemeint ist) und der sozialen Wirksamkeit. Die meisten positivistischen Rechtsdefinitionen beruhen auf einer Kombination dieser Elemente. So definiert etwa John Austin (1790 - 1859), der Begründer der englischen „analytical jurisprudence", das Recht als Gesamtheit der sanktionsbewehrten Befehle eines Souveräns und den Souverän als jemanden, dessen Befehlen gewohnheitsgemäß gehorcht wird. 1 4 Hans Kelsen, der Begründer der „Reinen Rechtslehre", bestimmt das Recht als „normative Zwangsordnung menschlichen Verhaltens", deren Normativität auf einer vorausgesetzten Grundnorm beruht, „derzufolge man einer tatsächlich gesetzten, im großen und ganzen wirksamen Verfassung und daher den gemäß dieser Verfassung tatsächlich gesetzten, im großen und ganzen wirksamen Normen entsprechen soll". 1 5 Herbert Hart, der nach Kelsen bedeutendste positivisti13 Vgl. R. Alexy, Zur Kritik des Rechtspositivismus, in: R. Dreier (Hrsg.), Rechtspositivismus und Wertbezug des Rechts, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 9 - 32, 9. 14 Vgl. J. Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law, Bd. 1, 5. Aufl., London 1885, S. 88ff.
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
267
sehe Rechtstheoretiker dieses Jahrhunderts, verzichtet in seinem Werk „The Concept of Law" (1960) auf eine Rechtsdefinition. Er gelangt aber zu rechtsstrukturell ähnlichen Ergebnissen wie Kelsen - mit der Maßgabe, daß bei ihm an die Stelle einer (transzendentallogisch oder fiktiv) vorausgesetzten Grundnorm eine „rule of recognition" tritt (für das britische Recht z.B. als mögliche Kurzformel: „What the Queen enacts in Parliament is law"), deren Geltung auf der sozialen Anerkennung durch die Amtsträger des betreffenden Rechtssystems beruht. 16 2. Einwände gegen den positivistischen Rechtsbegriff
Gegen den positivistischen Rechtsbegriff werden in der gegenwärtigen Diskussion hauptsächlich zwei Einwände geltend gemacht, die man als „Unrechtsargument" und als „Prinzipienargument" bezeichnen kann. 17 Das Unrechtsargument besagt, daß es Normen und Normensysteme gibt, die in solchem Maße ungerecht sind, daß ihnen die Rechtsgeltung und/oder der Rechtscharakter abzusprechen ist. Das Prinzipienargument besagt, daß allen entwickelten Rechtssystemen Prinzipien immanent sind, die kraft ihrer Struktur und/oder ihres Geltungscharakters mit dem positivistischen Rechtsbegriff unvereinbar sind. Robert Alexy hat darauf hingewiesen, daß beiden Argumenten, gewissermaßen als Basisthese, ein weiteres Argument, das Richtigkeitsargument, zugrunde liegt. Dieses besagt, daß Rechtssysteme wie rechtliche Einzelnormen notwendig einen Anspruch auf Richtigkeit erheben. 18 Der Zusammenhang dieser Argumente kann dahin formuliert werden, daß Rechtssystemen und Einzelnormen, die diesen Anspruch auf unerträgliche Weise unterschreiten, der Rechtscharakter abzusprechen ist, und daß Rechtssysteme und Einzelnormen in ihrem Offenheitsbereich gemäß jenem Anspruch auszulegen und fortzubilden sind. Das Unrechtsargument ist eine modifizierte Form der alten lex corruptaLehre. Nach 1945 ist es insbesondere im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Rassengesetzgebung erörtert worden. Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht haben es, in einer von Gustav Radbruch vorgeschlagenen Fassung, übernommen. 19 In jüngster Zeit ist das Argument !5 H. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., Wien 1960, S. 45ff., 219. « Vgl. H L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford 1960, S. 92f., 97ff., 104. 17 Dazu und zum folgenden Dreier (FN 8), S. 99ff. (mit Belegen), und ergänzend ders., Zur gegenwärtigen Diskussion des Verhältnisses von Recht und Moral in der Bundesrepublik Deutschland, in: R. Alexy/R. Dreier/U. Neumann (Hrsg.), Rechtsund Sozialphilosophie in Deutschland heute. Beiträge zur Standortbestimmung, ARSP Beiheft 44 (1991), S. 55 - 67. !» FN 13, S. 18ff. 19 Vgl. z.B. BVerfGE 23, 98 sowie B. Schumacher, Rezeption und Kritik der Radbruchschen Formel, Diss. Göttingen 1985.
268
Ralf Dreier
im Zusammenhang mit der juristischen Bewältigung der DDR-Vergangenheit erneut aktuell geworden. Trotzdem ist seine praktische Bedeutung begrenzt. Es betrifft im wesentlichen den Ausnahmefall des Umgangs mit Unrechtssystemen. Im rechtsstaatlichen Normalfall tritt - in der Bundesrepublik Deutschland - an seine Stelle das Verfahren nach Art. 100 I GG, wonach der Richter, der ein Gesetz, auf das es in dem ihm vorliegenden Fall ankommt, für verfassungswidrig hält, das Verfahren auszusetzen und eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen hat. In der Rechtstheorie ist das Unrechtsargument nach wie vor umstritten. Ich meine, daß jedenfalls aus der Richterperspektive überwiegende Gründe dafür sprechen, es zu akzeptieren und den juristischen Rechtsbegriff dementsprechend zu modifizieren. Für die rechtsstaatliche „Normallage" wichtiger ist das Prinzipienargument. Es betrifft die Frage, wonach der Richter im Offenheitsbereich des positiven Rechts, also insbesondere im Bereich gesetzlicher und verfassungsrechtlicher Generalklauseln, zu entscheiden hat. Die positivistische Antwort hierauf lautet, daß er in diesem Bereich, soweit er nicht ausdrücklich auf objektivierbare Maßstäbe (etwa die Verkehrssitte) verwiesen wird, zur politisch-moralischen Eigenwertung ermächtigt ist. Den rechtstheoretischen Kernpunkt dieser Antwort hat auf klassische Weise John Austin formuliert: „So far as the judge's arbitrium extends, there is no law at all" 2 0 ; frei übersetzt: Wo die Abwägung beginnt, hört das Recht auf. Dem liegt ein Rechtsbegriff zugrunde, der als Recht nur anerkennt, was durch die zur Rechtssetzung berufenen Instanzen definitiv entschieden ist. Die Prinzipientheorie hält dem entgegen, daß der Richter auch im Offenheitsbereich des autoritativ gesetzten und/oder sozial wirksamen Rechts rechtlich, nämlich durch geltende Prinzipien, gebunden ist. 2 1 Basis der Prinzipientheorie ist die strukturelle Differenz zwischen Regeln und Prinzipien. Sie besteht darin, daß Regeln auf eine „Alles oder nichts"Weise anwendbar sind, während Prinzipien eine „Dimension des Gewichts" haben. M.a.W.: Regeln sind Normen, die dergestalt aus Tatbestand und Rechtsfolge bestehen, daß die Rechtsfolge stets Platz greift, wenn der Tatbestand erfüllt ist. Prinzipien sind Normen, die gebieten, daß ein Wert oder ein Ziel in einem möglichst hohen Maße realisiert wird. Oder noch kürzer: Regeln sind definitive, Prinzipien sind abwägungsfähige Normen. Ihre Anwendung vollzieht sich durch Abwägung und Bildung konkreter Vorrangrelationen für einzelne Fälle oder Fallgruppen. Nach Roland Dworkin, auf den die neuere 20
Austin (FN 14), Bd. 2, S. 687. Vgl. dazu und zum folgenden insbes. R. Dworkin, Taking Rights Seriously, 2. Aufl., London 1978 (dt. Ausg.: Bürgerrechte ernstgenommen, 1984), bes. Kap. 3 und 4; R. Alexy, Theorie der Grundrechte, 1985 (TB-Ausg. 1986, stw 582), bes. Kap. 4. Zur Diskussion s. a. J.-R. Sieckmann, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, 1990. 21
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
269
Diskussion der Prinzipientheorie zurückgeht, ist es für Prinzipien weiterhin charakteristisch, daß sich ihre Geltungs weise nicht durch ein grundnormfähiges Identifikationskriterium im Sinne der positivistischen Theorie fixieren läßt. Das mag dahinstehen. Doch dürfte es, im Blick auf Kodifikationsrechtsordnungen, nicht überflüssig sein, darauf hinzuweisen, daß ein und demselben Normsatz interpretativ sowohl Prinzipien als auch Regeln zugeordnet werden können. Im Beispiel: Art. 5 Abs. 3 S. 1 lautet: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei". Ordnet man diesem Satz, in bezug auf die Wissenschaft, ein Prinzip zu, so besagt dieses etwa, daß der Staat verpflichtet ist, für ein größtmögliches Maß an Wissenschaftsfreiheit Sorge zu tragen; ordnet man ihm eine Regel zu, so kann diese etwa lauten, daß immer dann, wenn eine Handlung eine Wissenschaftshandlung ist (und nicht höherrangige Rechtsgüter gefährdet), staatliche Eingriffe in sie definitiv verboten sind. Natürlich ist auch das Prinzipienargument nicht neu. Der Sache nach läßt es sich - als Differenz zwischen prinzipiellem und institutionellem Rechtsdenken - schon im römischem Recht nachweisen.22 Auch Savignys Suche nach „leitenden Grundsätzen" und Prinzipien, in denen sich die „sittliche Natur" des Rechts geltend macht und deren Herausarbeitung für ihn „eigentlich dasjenige (ist), was unserer Arbeit den wissenschaftlichen Charakter gibt", läßt sich im Sinne der in Rede stehenden Theorie interpretieren. 23 Die gegenwärtige Diskussion der Prinzipientheorie ist durch ein kompliziertes Gewebe von Thesen charakterisiert, die hier nicht im einzelnen wiedergegeben werden können und sollen. Im Kern geht es darum, daß die Prinzipientheorie in den Rechtsbegriff aufnimmt, was der juristische Positivismus, um der begrifflichen Klarheit und der Beschränkung auf „harte" Strukturen willen, aus ihm ausschließen will: jenes „weiche" Element von Argumenten und Gesichtspunkten, nach denen der Richter schwierige Fälle im allgemeinen tatsächlich entscheidet und vernünftigerweise entscheiden sollte - ein Element, in dem sich der Richtigkeitsanspruch des Rechts bekundet und geltend macht. Ich meine, daß auch das Prinzipienargument, obwohl (oder auch: gerade weil) es den Rechtsbegriff „flexibilisiert", jedenfalls im Rahmen eines dogmatik- und richterorientierten Rechtsbegriffs begründet ist. Zum Stand der Diskussion um den Rechtspositivismus überhaupt sei das Ergebnis einer Zählung mitgeteilt, die auf einer Auswertung der Karlsruher Juristischen Bibliographie beruht und sich auf deutschsprachige Monogra22 Vgl. O. Behrends, Institutionelles und prinzipielles Rechtsdenken im römischen Privatrecht, in: Z R G Rom. Abt. 95 (1978), S. 187 - 231. 23 Vgl. F. C. v. Savigny, Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (1814), Ausg. 1967, S. 22 (s. a. S. 28f., 48, 66,117f.); ders., System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 1, 1840, § 15; O. Behrends, Geschichte, Politik und Jurisprudenz in F. C. v. Savignys System des heutigen Römischen Rechts, in: ders./M. Dießelhorst/W. E. Voß (Hrsg.), Römisches Recht in der europäischen Tradition, 1985, S. 257 - 321, bes. 260ff.
270
Ralf Dreier
phien und Aufsätze beschränkt. Danach sind von 1970 bis einschließlich 1989 99 einschlägige Beiträge erschienen, die sich vom Titel her erkennbar mit Problemen des juristischen Positivismus befassen. 24 Von ihnen lassen sich 34 als positivistisch und 53 als nichtpositivistisch qualifizieren. Zwölf konnten nicht eindeutig zugeordnet und zwei nicht bearbeitet werden. Diese Zählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Repräsentativität (z.B. wurden nicht Autoren, sondern Beiträge gezählt). Sie ist aber doch ein interessantes Indiz dafür, daß in der gegenwärtigen Debatte die Nichtpositivisten offenbar mehr oder weniger deutlich in Führung liegen. Den Grund hierfür wird man nicht nur im fortwirkenden Schock der Erfahrung gesetzlichen Unrechts in totalitären Diktaturen, sondern auch und mehr noch darin zu erblicken haben, daß die politische Schwäche des parlamentarischen Gesetzgebers (seine „Flucht in die Generalklauseln") sowie die politisch-moralischen Herausforderungen, die in steigendem Maße an die Rechtspraxis und die Rechtswissenschaft herangetragen werden, die positivistische Begriffsstrategie (die nach wie vor möglich ist) zunehmend als inadäquat erscheinen lassen. 3. Ein rechtsethisch angereicherter Begriff des positiven Rechts Es bereitet erhebliche Schwierigkeiten, einen richterorientierten Begriff des rechtlich geltenden Rechts zu formulieren, der sowohl dem berechtigten Kern des positivistischen Rechtsbegriffs als auch den Einwänden gegen ihn gerecht wird. Ich habe dazu 1986 einen Definitionsvorschlag gemacht, der das Prinzipienargument nur in der Begründung und nicht in der Formulierung enthielt. 25 Robert Alexy hat diesen Vorschlag aufgenommen und um das Richtigkeits- und das Prinzipienargument ergänzt. Er gelangt so zu einer dreigliedrigen Definition, die zum Abschluß dieses Abschnitts mit dem Hinweis darauf zitiert sei, daß sie die Komplexität der Problemlage, der eine Theorie des Rechtsbegriffs aus juristischer Sicht Rechnung tragen sollte, präzise zum Ausdruck bringt. Recht ist danach „ein Normensystem, das (1) einen Anspruch auf Richtigkeit erhebt, (2) aus der Gesamtheit der Normen besteht, die zu einer im großen und ganzen sozial wirksamen Verfassung gehören und nicht extrem ungerecht sind, sowie aus der Gesamtheit der Normen, die gemäß dieser Verfassung gesetzt sind, ein Minimum an sozialer Wirksamkeit oder Wirksamkeitschance aufweisen und nicht extrem ungerecht sind, und zu dem (3) die Prinzipien und die sonstigen normativen Argumente gehören, auf die sich die Prozedur der Rechtsanwendung stützt und/oder stützen muß, um den Anspruch auf Richtigkeit zu erfüllen". 26 24 Vgl. dazu Dreier (FN 17), S. 55f. 25 FN 8, S. 116. 26 R. Alexy , Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg/München 1992, S. 201.
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
271
I I I . Das Kirchenrecht 1. Das Kirchenrecht als positives menschliches Recht Für den Kirchenjuristen ist kirchliches Recht in erster Linie positives menschliches Recht, d.h. von den dafür zuständigen kirchlichen Organen in der dafür vorgeschriebenen Weise gesetztes und im großen und ganzen sozial wirksames Recht (einschließlich des kirchlichen Gewohnheitsrechts). Das bedeutet nicht, wie Adalbert Erler meint, daß „der Jurist, welcher das Kirchenrecht darzustellen hat, gegen seinen Willen notwendig zum Positivisten wird". 2 7 Denn es sollte sich Einigkeit darüber erzielen lassen, daß auch das positive Kirchenrecht einen Anspruch auf Richtigkeit und auf theologische Legitimität erhebt und daß das Unrechts- und das Prinzipienargument im Kirchenrecht dasselbe, wenn nicht sogar ein stärkeres Gewicht haben als im weltlichen Recht. Was das Unrechtsargument betrifft, so hat spätestens die Debatte um den „Arierparagraphen" 1933/3428 deutlich gemacht, daß es auch im Kirchenrecht gesetzliches Unrecht geben kann, dem der Charakter als geltendes Kirchenrecht abzusprechen ist. Die Barmer Thesen vom Mai 193429 haben dies - in verallgemeinerter Form - auf eine Weise festgeschrieben, hinter die kaum zurückgegangen werden kann. Aber auch das Prinzipienargument spricht gegen einen kirchenrechtlichen Positivismus. Denn auch im Kirchenrecht sind rechtliche Prinzipien wirksam, die nach ihrer Struktur und ihrem Geltungscharakter mit einem positivistischen Rechtsbegriff unvereinbar sind. Sie stehen untereinander in Spannungsverhältnissen und erfordern Abwägungen wie im weltlichen Recht. Das gilt nicht nur für spezifisch kirchenrechtliche Prinzipien (z.B. Amtsprinzip vs. Gemeindeprinzip, Ökumenizität vs. Partikularität, Lehrfreiheit vs. Bekenntnisbindung), sondern auch für Prinzipien, die das kirchliche Recht mit dem weltlichen teilt (z.B. Willensprinzip vs. Erklärungsprinzip, Vertrauensschutz vs. Verkehrssicherheit, Freiheit vs. Gleichheit, ius strictum vs. ius aequum usw.). Eine Theorie kirchenrechtlicher Prinzipien wäre auch, wie ich meine, der Ort, in den der berechtigte Kern der Lehre vom ius divinum bzw. von den biblischen Weisungen in die Theorie des Kirchenrechts einzubringen wäre. 30 27
A. Erler, Kirchenrecht, 5. Aufl., 1983, S. 167. Dazu z.B. H. Hermelink (Hrsg.), Kirche im Kampf. Dokumente des Widerstandes und des Aufbaus der Evangelischen Kirche in Deutschland von 1933 bis 1945,1950, S. 51 ff. 29 Abgedruckt z.B. bei Hermelink, ebd., S. 107ff. 30 Vgl. dazu R. Dreier, Göttliches und menschliches Recht, in: ZevKR 32 (1987), S. 289 - 316. 28
272
Ralf Dreier
Ich verweise dazu auf den „Versuch einer Zusammenstellung" biblisch-neutestamentlicher Weisungen für die Ordnung des christlichen Gemeindelebens, die Albert Stein in seinem Kirchenrechtslehrbuch vorgenommen hat. 3 1 Die Zusammenstellung umfaßt erstens den Verkündigungs-, den Tauf- und den Herrenmahlsbefehl, zweitens die Weisungen zum Rechts verzieht, zum Dienen und zur nachgehenden Seelsorge, drittens die Weisungen zur Wahrung der Vielfalt der Gaben und Dienste, zur konziliaren Schlichtung und zur Freistellung der Beauftragten von hinderlicher Arbeit sowie zusammenfassend die Weisung zu ökonomischer Einigkeit. Strukturell lassen sich alle diese Weisungen, jedenfalls auch, als Prinzipien in dem Sinne auffassen, daß sie - unter angemessener Berücksichtigung anderer Prinzipien (etwa daß es in der Gemeinde geordnet zugehe und ein gewisses Maß an Rechtssicherheit und Rechtsgleichheit herrsche) - im größtmöglichen Maße realisiert werden sollten. Ähnlich wären auch kirchenverfassungsrechtliche und kirchengesetzliche Klauseln zu interpretieren, die eine Bindung kirchlicher Organe an „Schrift und Bekenntnis" oder eine Pflicht zum „brüderlichen Zusammenwirken" statuieren. Im Kontext einer Theorie kirchenrechtlicher Prinzipien können auch, besonders für das ökumenische Kirchenrecht, die rechtstheologischen Prinzipien berücksichtigt werden, die Hans Dombois in seiner Kohärenztheorie der Legitimität und seiner allgemeinen und speziellen Defizienztheorie des Kirchenrechts und der Kirchenverfassung entwickelt hat. 3 2 Gewiß gibt es nicht nur inhaltliche, sondern auch strukturelle Unterschiede zwischen kirchlichem und weltlichem Recht (geringere Bedeutung des Zwangselements und der Gerichtsbarkeit; größere Bedeutung appellativer Formulierungen). Im anderweit nicht behebbaren Konfliktsfall macht sich aber auch im Kirchenrecht der Rechtszwang in aller Schärfe geltend, und insgesamt treten, jedenfalls in juristischer Sicht, die Unterschiede gegenüber den strukturellen Parallelen eher zurück. Alles in allem wird man daher sagen können, daß zwischen kirchlichem und weltlichem Recht eine so weitgehende Strukturgleichheit besteht, daß es sinnvoll ist, für beide von einem einheitlichen Rechtsbegriff auszugehen. Das scheint inzwischen zumindest unter Juristen herrschende Meinung zu sein. Ich verweise dazu auf den grundlegenden Aufsatz von Klaus Schiaich über „Kirche und Kirchenrecht" aus dem Jahre 1983.33 Eine wesentliche Änderung der Gesprächslage ist seither nicht eingetreten.
31
A. Stein, Evangelisches Kirchenrecht, 1980, S. 24f. Dazu R. Dreier, Bemerkungen zum „Recht der Gnade", in: ZevKR 29 (1984), S. 405 -422, 416ff. (m.w.N.). Dieser Beitrag ist auch abgedruckt in: H. Folkers (Hrsg.), Zugänge zum ,Recht der Gnade', 1990, S. 9 - 31. 33 K. Schiaich, Kirche und Kirchenrecht, in: ZevKR 28 (1983), S. 337 - 369. 32
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
273
2. Das Kirchenrecht als eigengeartetes und eigenständiges Recht a) Eigengeartetheit Nach Karl Barth haben so ziemlich alle kirchenrechtlichen Irrtümer ihren Grund darin, daß sich die christliche Gemeinde immer wieder die weltliche Interpretation des Kirchenrechts zu eigen gemacht und „sich selbst nach Maßgabe des ihr von der Welt her widerfahrenden Mißverständnisses verstanden hat". 3 4 In der christlichen Gemeinde gehe es „um ein Anordnen, Befehlen, Verfügen des einen Heiligen, in welchem Alle geheiligt sind und also Jesu Christi auf der einen Seite - und auf der anderen um ein ihm gehorsames, ihm sich unterordnendes Verhalten der menschlichen Gemeinschaft der Heiligen. Dieses Verhältnis konstituiert die christliche Gemeinde. Dieses Verhältnis ist ihr Ordnungsprinzip, ihr Grundrecht". 35 „Rechtes Fragen nach dem, was in der Kirche Recht ist, wird also immer ein Fragen nach seinem Anordnen, Befehlen, Verfügen und nach dem ihm entsprechenden Gehorsam sein müssen. Kirchliches Recht muß von seinem Ansatz her und bis hinein in alle seine Verästelungen geistliches Recht sein, - ,geistlich4 im strengen Sinne des Begriffs: Recht, das in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes Jesu Christi aufzusuchen, zu finden, aufzurichten und zu handhaben ist. In diesem Charakter wird sich jedes geltende und jedes geplante Kirchenrecht - soll es rechtes Kirchenrecht sein - von allem, was sonst ,Recht' heißt, scharf und klar unterscheiden müssen. Rechtes Kirchenrecht entsteht (in großen und kleinen, in allen Dingen!) aus dem Hören auf die Stimme Jesu Christi. Solches, dieses Recht entsteht sonst nirgends in der Welt, formal nicht und dann auch nicht material." 36 Näherhin wird das Kirchenrecht dann als dienendes, liturgisches, lebendiges und vorbildliches Recht charakterisiert. 37 Ich habe diese bekannten Sätze hier etwas ausführlicher zitiert, weil in einem Beitrag, der für einen einheitlichen Rechtsbegriff plädiert, Veranlassung besteht, an sie zu erinnern. Karl Barth hat allerdings keine näheren Überlegungen zum Rechtsbegriff angestellt. Er bezieht sich in den kirchenrechtlichen Ausführungen seiner Kirchlichen Dogmatik, der die zitierten Sätze entstammen, auf zwei frühere Aufsätze Erik Wolfs. 38 In ihnen hatte Wolf, wenn auch nicht sehr klar, die These vom Kirchenrecht als Recht „sui generis" vertreten. Dennoch wird man ihn nicht als Vertreter eines doppelten Rechtsbegriffs ansehen können. Kirchenrecht ist für Erik Wolf eine Ordnung 34
K. Barth, Die Ordnung der Gemeinde ( = Kirchliche Dogmatik, Bd. I V 2, § 67 Abschn. 4), Separatdruck 1955, S. 22. 35 Ebd., S . l l . 36 Ebd., S. 14. 37 Ebd., S. 27ff. 38 Nachweise dafür und für das folgende bei Dreier (FN 4), S. 76ff. 18 Festgabe Opalek
274
Ralf Dreier
des Paradox und eine in sich paradoxe Ordnung. Es ist in dieser Welt und doch nicht von dieser Welt. Es ist durch die rechtstheologische Dialektik von Recht und Liebe charakterisiert. Diese Dialektik kennzeichnet nach Wolf aber nicht nur das kirchliche, sondern auch das weltliche Recht. Und für das kirchliche Recht gilt: „Die von der Rechtsontologie herausgearbeiteten Grundstrukturen des Rechtseins teilt auch die kirchliche Rechtsordnung sonst wäre sie keine". 3 9 Die Charakterisierung des Rechts als „Ordnung der Liebe" ist somit für Wolf kein Strukturmerkmal des kirchlichen Rechts, sondern ein an alles Recht zu richtendes rechtstheologisches Postulat. Und auch die biblischen Weisungen richten sich für ihn - abgesehen von denen, die inhaltlich speziell auf das Kirchenrecht bezogen sind - an alles Recht. Es ist dann eine nur noch terminologische Frage, ob man als kirchliches „Recht" nur noch die „geistlich geübte Ordnung der Liebe" 4 0 bezeichnen will. Diese Konsequenz hat nicht Erik Wolf, wohl aber Johannes Heckel und ihm folgend Siegfried Grundmann gezogen. Die Theorien Heckeis und Grundmanns brauchen hier nicht vorgestellt zu werden. 41 Der in ihnen vorgeschlagene Wortgebrauch - „Kirchenrecht ist Liebesrecht. Daran wird sich nichts mehr ändern" 42 - ist möglich, aber nicht zweckmäßig. Er koppelt die kirchliche Rechtstheorie auf eine Weise von der weltlichen ab, die der Praxis des Kirchenrechts nicht gerecht wird. Selbstverständlich sollte das Kirchenrecht (wie auch das weltliche Recht) im usus charitatis gesetzt und gehandhabt werden. Aber diesen usus zum Definitionsmerkmal des Kirchenrechts zu machen, heißt nicht nur, es zu überfordern, sondern auch, der Kirchenrechtspraxis einen inadäquaten Rechtsbegriff zu unterlegen. Eine Sonderstellung nehmen die Konzeption Dombois' und der ihr zugrunde liegende Rechtsbegriff ein. Zwar optiert auch Dombois für einen einheitlichen Rechtsbegriff: „ I m geistlichen Recht werden geistliche Dinge geistlich gerichtet, im weltlichen Recht weltliche Dinge weltlich. Der Rechtscharakter und deshalb Struktur und Form sind in beiden die gleichen". 43 Dombois' Rechtsbegriff weicht aber von dem hier vertretenen grundlegend ab. Eine nähere Auseinandersetzung mit ihm würde einen Aufsatz für sich erfordern. 44 A n dieser Stelle mögen einige Anmerkungen genügen. Dombois 39 E. Wolf (FN 3), S. 13. E. Wolf Ordnung der Liebe, 1963, S. 22. 41 Dazu z.B. Steinmüller (FN 5), S. 19ff., 239ff. 42 So z.B. 5. Grundmann, Art. Kirchenrecht I A - D , in: Ev. Staatslexikon, 2. Aufl., 1975, Sp. 1206 - 1224,1222. 43 H. Dombois, Das Recht der Gnade, Bd. 1, 2. Aufl., 1969, S. 880. Zum Rechtsbegriff Dombois' vgl. a.a.O., S. 90ff., 163ff., 815ff., 873ff. 44 Vgl. dazu Steinmüller (FN 5) y S. 613ff.; Dreier (FN 4), S. 80ff.; ders. (FN 32), S. 412ff.; Reuter (FN 11), S. 215ff.; H. Folkers, Der Rechtsbegriff in Hans Dombois' „Recht der Gnade", in: ders. (Hrsg.), Zugänge zum ,Recht der Gnade', 1990, S. 61 94. - Der Kritik von Horst Folkers (a.a.O., S. 67) räume ich gern ein, daß es zu kurz 40
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
275
gibt keine Definition seines Rechtsbegriffs. Doch ist deutlich, daß er das Recht nicht durch den Begriff der Norm, sondern durch die es konstituierenden Handlungen definiert. Als solche benennt er die Akte des Anspruchs und der Anerkennung sowie der Zuwendung und der Zuwendungsannahme, die zwei unterschiedliche Formenkreise, das Gerechtigkeitsrecht und das Gnadenrecht, konstituieren. Er gewinnt so ein Instrumentarium, daß es ihm ermöglicht, nicht nur instruktive Kategorien zur Untersuchung der Struktur und zur Beurteilung der Legitimität des Kirchenrechts zu erarbeiten, sondern auch juristische Begriffe zu analysieren, deren sich die Theologie bei der Formulierung zentraler theologischer Aussagen zu bedienen pflegt. Seine Reflexionen zum Rechtsbegriff sind - trotz mancher Unklarheiten - in hohem Maße fruchtbar. Das ändert aber nichts daran, daß es für die Kirchenrechtsdogmatik zweckmäßig ist, von einem norm-orientierten (nicht notwendig normativistischen!) Rechtsbegriff auszugehen. Aus der Sicht der Kirchenrechtsdogmatik wie der Kirchenrechtstheorie können alle Elemente, die neben dem der Norm als Grundelemente des Rechts in Betracht kommen (Relationen, Positionen, Institutionen, Dezisionen), durch den Begriff der Norm adäquat definiert oder auf ihn zurückgeführt werden. Zum Problem der Eigenart des Kirchenrechts läßt sich zusammengefaßt und zugespitzt folgendes sagen: Natürlich ist das Kirchenrecht eigengeartetes Recht - dies schon wegen der Eigenart seines Gegenstandsbereichs. Aber es unterfällt dem genus proximum des Rechts überhaupt. Natürlich kann es theologisch als geistliches Recht interpretiert werden. Aber das ändert, in juristischer Sicht, nichts an seiner Rechtsstruktur. Und natürlich sollte die Kirchenrechtstheorie der Eigenart ihres Gegenstandes gerecht werden. Aber sie darf dabei die Strukturmerkmale, die das Kirchenrecht mit dem weltlichen Recht teilt, nicht außer acht lassen. Zur Besonderheit des Kirchenrechts hat Klaus Schiaich mit seiner These zum „antwortenden Recht" Gedanken vorgelegt, die, wie ich meine, der Eigengeartetheit dieses Rechtsgebiets angemessen Rechnung tragen. 45 Hinzuzufügen wäre allenfalls, daß in gewisser Weise auch das positive weltliche Recht antwortendes Recht ist, nämlich insofern es auf die Anforderung der Gerechtigkeit und der Rechtsvernunft antwortet.
gegriffen ist, wenn man - anknüpfend an die Formel „Recht als Gefüge von Anspruch und Anerkennung" (Dombois, Recht der Gnade, Bd. 1, S. 169) - Dombois' Rechtstheorie der Gruppe der Anerkennungstheorien des Rechts zurechnet; so aber Dreier, Bemerkungen zum „Recht der Gnade", S. 413 ( = Nachdruck in: Folkers (Hrsg.), Zugänge zum ,Recht der Gnade 4 , S. 20). 45 Schiaich (FN 33), S. 353ff. 18*
276
Ralf Dreier b) Eigenständigkeit
Die These von der Eigenart des Kirchenrechts wird oft mit der These von seiner Eigenständigkeit vermengt. 46 Wenn die These der Eigenständigkeit einen präzisen juristischen Sinn haben soll, kann sie nur meinen, daß der Kirche eine originäre, von der Staatsgewalt unabhängige Hoheitsgewalt zukommt. Diese These ist im staatskirchenrechtlichen Schrifttum der letzten Jahrzehnte ausgiebig diskutiert worden. Für das innere Kirchenrecht sind die damit verbundenen Fragen solange zweitrangig, als der Staat der Kirche den zur Verwirklichung ihres Selbstverständnisses erforderlichen Freiheitsraum beläßt. Tut er dies nicht, so bleibt ihr ohnehin nichts als die ultima ratio des Widerstandes oder der Rückzug in die Katakombe. Dies zeigt freilich, daß sich die These von der Eigenständigkeit des Kirchenrechts und die sie stützende staatskirchenrechtliche Koordinationstheorie - trotz ihrer zeitweiligen Anerkennung in der deutschen Rechtsprechung der 50er Jahre - nicht halten lassen. Denn sie bedeuten nichts weniger als die Preisgabe der inneren Souveränität des Staates, d.h. dessen Verzicht auf die Letztentscheidung in strittigen Fragen - eine Annahme, die heute unrealistisch ist. Aber auch in dieser Frage muß man die Sichtweisen unterscheiden. Natürlich läßt sich das Kirchenrecht in theologischer (oder auch in rechtsphilosophischer) Sicht als eigenständig interpretieren, sei es im Sinne der societas perfecta-Lehre, sei es in dem Sinne, daß der Kirche durch Christus eine eigenständige Rechtsetzungsgewalt verliehen worden ist. Doch ändert dies nichts daran, daß die Kirchengewalt aus juristischer Sicht - in der Terminologie Georg Jellineks - heute eine nichtherrschende, d.h. nicht-souveräne Verbandsgewalt ist, d.h. eine solche, der sich die ihr Unterworfenen jederzeit durch Austritt entziehen können. Und jedenfalls sind Fragen der Eigenständigkeit des Kirchenrechts im Konfliktsfall stets auch Machtfragen. 3. Definitionsvorschlag Nicht jede Überlegung zum Rechtsbegriff muß mit einem Definitionsvorschlag enden. Ohnehin ist nicht die Definitionsformel entscheidend, sondern die Strukturüberlegungen, die ihr zugrunde liegen. Trotzdem kann nützlich sein, sich dem Zwang zu unterwerfen, der in der Notwendigkeit liegt, die vorgetragenen Hauptgesichtspunkte in einer Formel zusammenzufassen. Ich habe dies für das Kirchenrecht bereits früher versucht 47 und nehme diesen Versuch hier in einer einerseits vereinfachten und andererseits angereicherten
46
Dazu und zum folgenden Dreier (FN 4), S. 63ff., sowie Schiaich (FN 33), S. 339ff., jeweils m.w.N. ν Dreier (FN 30), S. 309.
Der Rechtsbegriff des Kirchenrechts
277
Form auf. Die Anreicherungen entnehme ich, leicht modifiziert, dem zitierten Definitionsvorschlag Alexys, dessen Struktur ich übernehme. Das Merkmal der äußerlichen Gerichtsfähigkeit von Normen, das ich früher hinzugenommen hatte, lasse ich beiseite, da es die Definition unnötig belastet. Kirchenrecht kann danach als ein Normensystem definiert werden, das (1) einen Anspruch auf Richtigkeit und theologische Legitimität erhebt, (2) aus der Gesamtheit der Normen besteht, die (a) zu einer geschriebenen oder ungeschriebenen, im großen und ganzen sozial wirksamen partikular kirchlichen oder zwischenkirchlichen Verfassung gehören, sofern diese ein Mindestmaß an theologischer Legitimität auf weist, und (b) gemäß dieser Verfassung gesetzt sind und ein Minimum an sozialer Wirksamkeit oder Wirksamkeitschance sowie ein Mindestmaß an theologischer Legitimität aufweisen, und zu dem (3) alle Prinzipien gehören, auf die sich die kirchliche Handhabung dieser Normen stützen muß, um dem Anspruch auf Richtigkeit und theologische Legitimität zu genügen.
Legal Language and Evidence By Hannu Tapani Klami, Johanna Kastinen and Minna Hatakka, Uppsala / Helsinki I. The Problem Legal norms connect legal consequences to facts. A problem into which we are not going to enter in this context is the ontological nature of law; we just state that we are representing a dualistic concept of the ontology of law where law is both norms and behaviour: legal norms come into existence through behaviour - legislative, judicial - but they are also set forth in order to regulate behaviour. On the other hand, norms are used in order to interpret behaviour: right or wrong? Norms are, moreover, used as interpretatory basis when lawyers are trying to assess the meaning of a certain behaviour - for this is an issue for every interpretation of law, whether legal texts or precedents, one is interpreting the behaviour of certain authorities with the help of normhypotheses1. Norms are for us meaning-contents of certain behaviour ; in most cases it is linguistically expressed, so for instance statutes or precedents 2. But language may steer behaviour and decision-making processes in different ways. The Polish analytical school - to make mention only of Kazimierz Opalek and Jerzy Wróblewski - has made important contributions to promoting the understanding of the relationship between language and decision-making. The authors of the present essay have been deeply influenced by their approach. The above has been said only in order to make certain philosophical background-assumptions clear, not to argue for our case. Our problem in this brief paper is the relationship between the truth about facts - in short, evidence - and the language which is used in order to denote legally relevant facts. How - if at all - does the expression of legal language influence problems of evidence? In judicial evidence one is dealing with sufficient truthfulness of certain alternative factual premises. When one is asking: Is the defendant guilty of mur1 On this ontological conception, see Hannu Tapani Klami , Dualism of Law, in: Objektivierung des Rechtsdenkens, Gedächtnisschrift für limar Tammelo, Berlin 1984, pp. 471 - 480. 2 Same, Three Essays on the Theory of Legal Norms, in: Ann. Acad. Scientiarum Fennicae Β 162, Helsinki 1986, Ch. I.
280
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
der? one is asking the question: "Is it beyond a reasonable doubt that X is guilty of murder?" What is "reasonable" in this context, depends of course of different kinds of normative reasoning. In the terms of decision theory one could say that it is rational to convict, if the probability of his guilt (P) surpasses the limit got from the formula 3 1 Ρ > Di
where Dg is the disutility of a false acquittal and D i is the disutility of convicting an innocent defendant. But as we have shown elsewhere, this disutility can be "measured" with the help of different criteria which can be weighed together using different techniques. It is, anyway, typical of evidential reasoning, that one is speaking about such things as truth and probability (i.e. subjective estimation of the truthfulness of certain factual premises) 4. The problem is now: what is the relationship between evidential truth and the linguistic expressions that are used in order to denote the legally relevant facts? The issue is not only theoretical. For the nature of facts in law has been subject to an intensive legal philosophical discussion5. Different philosophical conceptions have been present in the debate; the ontology and epistemology of facts in law presuppose taking stance in the discussion about the truth theories. What is the criterion of truth: correspondence between propositions and observations about facts, coherence between propositions and true propositions , consensus with in a certain audience - or, ultimately, wholly pragmatical reasons: something is true, if it is, generally speaking, advisable to hold it for true? The present theory of evidence has been to a remarkably great extent been unaffected by legal philosophy sensu stricto. One has been interested in the 3 J. Kaplan , Decision-Making Theory and the Factfinding Process, in: Stanford Law Review, 1968, p. 1072 et seq. 4 Mention should be made of the work of our Swedish colleagues Per Olof Ekelöf (e.g.: Β e weis wert, in: Festschrift Fritz Bauer, Tübingen 1981, ρ. 348 et seq. Same, My Thoughts on Evidentiary Value, in: P. Gärdenfors et al. (eds.), Evidentiary Value, Lund 1983, p. 12 et seq.) and Anders Stening, Bevisvärde, Diss. Uppsala 1975, esp. at p. 41 et seq. Much more wellknown is the work of L. J. Cohen (The Probable and the Provable, 1977) but Ekelöf and his colleagues (Sören Halldén, Martin Edman, Robert Goldsmith et al.) had earlier developed a theory based on subjective probability without the axiom P(T) 1 — P(~ T). Comments on this discussion: Hannu Tapani Klami, On Truth and Evidence, in: Pubi, of the Law Faculty of the Univ. of Turku, ser. A:59, Turku 1986, p. 44 et seq. 5 See, above all, Jerzy Wroblewski, Facts in Law, in: ARSP, 1973, p. 161 et seq., Same, The Problem of the So-Called Judicial Truth, in: Juridiska Föreningens Tidskrift (Finland), 1975, p. 19 et seq., with further references. (Reprinted in Same, Meaning and Truth in Judicial Decision, Helsinki 1983.)
Legal Language and Evidence
281
philosophy of probability, decision-making-theory, judicial psychology, etc. 6 . But we think that there are important links between ontological and epistemological stipulations on the one hand and the concept of probability on the other. Moreover, a closer scrutiny of the philosophical nature of facts in law may have certain practical implications, too. Hereby we mean the distinction between the so-called questions of fact and questions of law; there are in many countries important legal consequences connected with this classification. For example: About what has the jury to decide? What issues can be subject to appeal? What may a witness or an expert witness say? The distinction is also reflected in legal science: since the Roman lawyers it has been considered as a kind of faux pas, if scholars of law try to present scientific opinions about questions of fact 7 . Legal science is normative - so it is thought - but truth is a description of facts where there is no place for normative argumentation. But is this so? We do not say that discussion about the problem should have been wholly lacking. Our aim is only to combine certain perspectives in order to recommend a somewhat new approach - both theoretical and empirical. I I . Reductionism versus Contextuality There are two extreme points - which, however, may be somewhat differently formulated: (1) Reductionism: facts are facts, irrespective of the language used in order to denote them. (2) Contextuality (or: "relativism"): facts cannot in our consciousness be wholly separated from the linguistic context where we are speaking about them 8 . Logical empiricism at its early stage represented an analytical, reductionistic attitude to facts, partly due to the manner in which its logical tools presup6
See, e.g., Helmut Rüssmann, Zur Mathematik des Zeugenbeweises, in: Beiträge zum internationalen Verfahrensrecht..., Festschrift für Heinrich Nagel, Münster 1987, p. 329 et seq.; B. Hansson, Epistemology and Evidence, in: Evidentiary Value (η. 4); Kaplan, ibid (η. 3); Β. Grofman, Mathematical Models of Juror and Jury DecisionMaking, in: Bruce Dennis Sales (ed.), The Trial Process, New York/London 1980, esp. at p. 308 et seq.; Robert Goldsmith, Studies of a Model for Evaluating Judicial Evidence, in: Acta Psychologica, 1980; D. Kahneman / A. Tv er sky, On the Psychology of Prediction, in: Oregon Research Institute Bulletin, vol 12 (1972). 7 The famous jurist Servius is reported to have said to a client who wanted to have his opinion on certain questions of fact: "Nihil iuris, ad Ciceronem", i.e.: "Go to an advocate!" See, in general, R. Henrion, La preuve en droit romain, in: Perelman / Foriers (eds.), La preuve en droit, Bruxelles 1981. 8 A good discussion about these problems is presented by Bengt Lindell, Sakfrâgor och rättsfrägor (Matters of Fact and Matters of Law, with an English Summary), Diss. Uppsala 1987, esp. at p. 184 et seq.
282
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
posed the atomary nature of fact propositions. Its critics - for instance the Oxford school, the hermeneutical and structuralist philosophy - have promoted a more sophisticated attitude towards "brute" and interpreted facts. Also in legal philosophy juridical concepts have been subject to an intensive analysis starting from such things as the intertwinement thesis, the concept of institutional facts - which cannot at all be understood without their socionormative context, etc. 9 . In the field of evidence one is often, however, speaking about truth as if the normative contextuality of the facts would not exist. One is trying to distinguish between statements of facts and their normative and/or evaluative appraisal. Exceptionally witnesses are allowed to speak about their sensations and not only about their direct observations. A witness may say that there was a bad smell in the plaintiffs estate. A n expert witness may tell that this was due to two chemicals, indol and scatol which caused a smell, which is to most people unpleasant, and that his observations indicated that someone had brought the contents of a latrine on the plaintiffs estate. But in most countries pollution is defined by such terms as "harm", "damage", "risk", "negligence", etc. To these come other terms: "considerable", "gross". One can retort here: "The facts that are the object of proof are the basis of a further normative and evaluative appraisal. One must first lay down the facts." In "our" case this would mean that the witness only told about his own feelings: in his opinion the stink was bad, which did not decide whether it was legally bad. That he was allowed to express opinion was perhaps due to his unability to describe the stink in a greater detail. To our mind a far better approach to the problem is to take the contextuality of facts in law seriously, even as far as epistemology is concerned. For we think that it is impossible to keep apart the so-called facts and their appraisal. Questions of fact include, due to the nature of legal language, i. a., following operations: a) evaluations without any specific value system, e.g.: good/bad. b) evaluations based upon a value system, e.g. comparison of utilities, disutilities, interests and so on. c) evaluations based on assumptions about means —» goals-relationships, e. g. "expedient", "useful". d) measurements based on discretion, e.g. "gross", "considerable".
9
See Aulis Aarnio, The Rational as Reasonable, Dordrecht 1987, p. 26 et seq.
Legal Language and Evidence
283
Operations of different kinds may, moreover, be combined. A possible concept "considerable disutility" may involve more or less intuitive appraisal of environment - what kind of natural panorama is "beautiful" or "ugly"? But the assessment of disutility may be based on assumed causal relationships of the means —» goals-type - together with a comparison of different interests, using some kind of hierarchic equity and justice. In the classical case the object of proof is a real event in the past. Then the evidential problem is the sufficiency of the proof according to the following scheme10 rules of experience (RE)
evidential facts (EF)
evidential theme (ET)
The question is then: has the ET caused the EF (e.g. the observations of a witness)? How probable is this in the light of the RE? The evidentiary value of the different cooperating or contradicting EF's may then be statistically calculated. The problem is, however, that the alternative of an EF is not always a real logical negation of it. The concept of subjective probability is per se somewhat problematical, when one is dealing with unique events in the past 11 . Evidential problems include, however, also unique probabilities concerning future events, e.g. "What will the consequences of a planned pollution be?" Or: "What damage will the plaintiff in the future suffer on grounds of his injury?" But there are also questions that cannot be answered with certainty, due to the nature of the problem. In such situations both the requirement of causality between the EF and ET and the assumption of ~ ET as a real negation of the ET will fail. The difficulties or reductionism are clearly visible in the following case. A car-driver is accused of manslaughter and violation of the traffic laws: according to the prosecutor he had passed a bus at the bus-stop too nearly and without lowering his speed in a due manner. A school-boy had run cross the highway ahead of the bus and been hit by the car dying immediately of the injuries. There was some conflicting evidence about how the car was driven its speed and position. The Finnish Supreme Court stated, however, that the running of the boy ahead of the bus was so surprising and unforeseeable that the accident probably would have taken place, even if the car-driver had followed
10 On the role of the rules of experience as "evidentiary mechanisms" see Sören Halldén, Indiciemekanismer, in: Tidsskrift for Rettsvitenskap (Norway) 1973, p. 55 et seq.; Per Olof Ekelöf Rättegäng (The Trial) I V , 5. ed. Stockholm 1982, p. 17 et seq. 11 See our paper Original Probability and Evidentiary Value (forthcoming).
284
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
the traffic laws; consequently, he was acquitted for manslaughter and only convicted for negligent violation of the traffic laws. (Decision of the Finnish Supreme Court K K O 1987, 6). In criminal law and in the law of torts evidential problems often consist of a comparison between the (more or less proven) actual course of events and a hypothetical course of events that is construed (at least partly) with the help of certain normative assumptions: "What would have happened, if certain rules had been followed?" It is to our mind very problematical to speak about probability in connection with counter-factual events of the past; because they are non-real, they cannot be proven. But they do not really negate the actual course of events, either. The evidential mechanism in our case can be schematically presented as follows: Real:
1. The speed of the car 60 - 80 km/h 2. The position of the car A — C
—> the accident
So far we are speaking about facts. But there are different possibilities for construing alternative courses of events, starting from normatively assessed assumptions. They do not negate the actual course of events. For this reason the, formula of probability theory for contradiction of EF's resp. EF's is clearly not applicable. Hypothetical:
1. The speed of the car 50 km/h (lawful) ^ 2. The position of the car D (lawful)
- » the accident
There is some evidential uncertainty about the actual course of events, but it becomes in a way irrelevant, due to the construed hypothetical course of events. It is somewhat misleading to say that a causal connection between the conduct of the car-driver and the accident is lacking: of course the car has caused the accident even if legal responsibility is excluded by means of normative reasoning. Modern legislative techniques imply a growing tendency towards complicated fact-descriptions intertwined with normative and evaluative reasoning. In this situation the traditional concept of evidence, based upon the idea of probabilistic reasoning, needs some revision. I I I . Legal Language and the Concept of "Proof' Speaking within Kantian terms, the traditional concept of judicial evidence is based upon the idea of theoretical reasoning about truth. The intertwinement
Legal Language and Evidence
285
of description and evaluation stresses the role of practical reasoning - but does this imply that one should also adopt a wholly pragmatical notion of truth for all practical purposes? We don't think so. The method we are recommending is the following (1) A revision of such classical concepts as the evidentiary value, sufficient evidence and the burden of proof; one may speak about the degree of certainty and, on the other hand, about sufficient certainty based on evaluation of disutilities of possibly faulty decisions. (2) Empirical tests of the expressions of legal language: how do actual concepts function from the point of view of evidential problems? How do actual decision-makers react to these problems - and how to they use the discretion awarded to them by different vague concepts? Such tests may also precede new legislation; different formulation alternatives may be subject to experimental application. 1. Evidentiary Value. When one is speaking about relevant facts whose identification according to the expressions of legal language presupposes evaluation, it is rather problematical to apply purely probabilistic models. To take negligence, for example: can one say that it is more or less probable that someone should have been acting in a certain manner? Or causation: is it really probable that something would or would not have happened within a hypothetical, counter-factual course of events? For this reason we would recommend a more flexible concept for expressing the strength of evidence: one should rather speak about the degree of certainty. Then one can avoid the difficult philosophical problems connected with the notion of probability. Moreover, legal language and concrete problems involve modifications as far as the concept of truth and probability is concerned. We may illustrate this problem with certain examples. Probabilistic models for evidentiary reasoning presuppose certain dichotomies. The so-called theme method starts from the theorem of Bayes whereas the evidentiary value method does not accept the axiom P E T = 1 — P-ET- This calls for such dichotomies as the evidentiary theme > < its negation, true > < false, evidence > < counter-evidence. Legal language employs, however, often concepts that presuppose some kind of gradation , even if there may be some legally relevant point at the scale. A contract may be more or less equitable and at some point as inequitable that it may be adjusted. The value of a thing or the extent of a damage may be greater or smaller. From the point of view of formal logic a damage of £ 10000 is, of course, a negation of a damage of £ 12000. But the evidentiary value of an EF may depend on the concrete alternative of the ET. A n expert witness may estimate the damage between £ 10000 and 12000 - but the evidentiary value of this testimony may be different depending on the position of the
286
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
defendant - no damage at all, £ 5000 or £ 10000. The formula of evidentiary c o n t r a d i c t i o n o f t w o E F ' s w i t h different evidentiary values is E V E F I -
(EVEFI
Χ E V E F 2 ) . It starts from the assumption ~ (EFI & EF 2 ). But often the situation is that the ET and its negation are alternatives that do not wholly exclude each other but only "more or less". In such situations the contradiction formula is not directly applicable. Then it is also advisable to adopt the more cautious position of the evidentiary value method, according to which Ρ Ε Τ + P'~ ET < 1. Here, again, the structure of evidentiary reasoning depends on the structure of legal language. This does not mean, however, that one should adopt the pragmatical notion of truth. The consensus theory of truth is still suitable when one is really faced with problems about truth involving no or only very little interpretation. E. g.: A has been shot - was it Β who killed A? But already such problems as the criminal guilt involve interpretation that is not wholly probabilistic by nature. For example: Β has been so drunk that he does not remember anything about the events. The interpretation of his intentions becomes then more or less normative. What should - or must - he have thought? The use of the concept of certainty does not, however, exclude a cautious use of probabilistic models îor assessing the total value of cooperating or contradicting evidence. The use of such models started from empirical experiments that showed different shortcomings, including the so-called base-rate-fallacy (a tendency to leave out the original probability of the evidentiary theme) and different mistakes in treating cooperating or conflicting EF's. It is, however, clear that the evidentiary values of the single pieces of evidence are normally based upon intuition ; Ekelöf, who has recommended the use of probabilistic models, thinks that their value is only heuristical and that the total value of evidence is in the last analysis based upon intuition, too 1 2 . This is probably due to the criticism delivered by practical lawyers who say that mathematical models are too difficult to be used. But this has been said before lawyers became acquainted with computers that would even allow the application of the very complicated "unlimited" versions of probabilistic formulas, paying attention to the original probabilities, too. 2. Sufficient Evidence and the Burden of Proof. There are attempts to express the degree of the standard of proof by using different terms: "beyond a reasonable doubt" or "a fair preponderance of evidence" (Common Law in criminal and civil cases; respectively), "full evidence" (Finnish Law) and so on. There may be different degrees for certain types of cases; Ekelöf has tried to describe the present Swedish law of evidence in this respect with the help of the scheme "plausible - probable - proven - evident" 13 . A n empirical enquiry 12 13
Ekelöf ( FN 10), p. 32 et seq. Same (FN 10), p. 77 et seq.
Legal Language and Evidence
287
in Sweden and Finland indicated, however, that verbal expressions are understood by judges in a very heterogeneous manner 14 . And, indeed, American jurors may have very confused opinions about what is "reasonable" or "fair" when uncertainty is concerned 15. In this situation there is an obvious need for improving the tools of rational discussion about sufficient evidence. But here one should pay attention to a "fact about facts": problems about cognition of facts in law are heterogeneous and involve other than purely probabilistic reasoning. Our idea is that the criteria of sufficient certainty are based on the assessment of disutilities of a faulty decision in either direction. Moreover, the criteria of these disutilities must be somehow connected with the evidential uncertainty 16 . Now, when speaking about sufficient evidence one has always the rules about the burden of proof in mind, too. For the evaluation of evidence and the rules regulating it - above all the rules about sufficient evidence (that is a normative issue) and about the burden of proof form a functional unity. The rules about the burden of proof have been backed mainly by four types of argument. (1) The original probability (OP) of different facts (resp. their negations) in the light of the general experience of life; (2) The needs for securing evidence in advance and the possibilities for presenting evidence in a lawsuit (EP) ; (3) The goals of the material norms covered by different rules about the burden of proof (NG); (4) Reasons about the just and equitable incidence of the socio-economic risks of possibly faulty decisions (RA).
14 A report of the empirical results of the Swedish-Finnish project "Law and Truth" is included in: Hannu Tapani Klami / Mikael Marklund / Mar ja Rahikainen / Johanna Sorvettula, Ett rationeilt beviskrav - teori och empiri (Rationally Sufficient Evidence Theory and Reality), in: Svensk Juristtidning, 1988, (p. 589 et seq.). 15 Studies on American juries - and mock trials; the classic is H. Kalven / H. Zeisel, The American Jury, Boston 1966; an interesting English experiment was the use of a "shadow jury" in actual trials, see S. McCabe / R. Purves, The Shadow Jury of Work, Oxford 1974. See also Neil Vidmar, Effects of Decision Alternatives on the Verdicts and Social Perceptions of Simulated Jurors, in: Journal of Personality and Social Psychology, 1972, p. 211 et seq.; M. S. Saks, Jury Verdicts, Lexington, Mass. 1977. 16 See Hannu Tapani Klami / Marja Rahikainen / Johanna Sorvettula, On the Rationality of Evidentiary Reasoning - a Model, in: RECHTSTHEORIE 19 (1988), p. 368 et seq.; on the AHP-technique see T. Saaty, The Analytic Hierarchy Process, New York 1980. In Finland Liisa Uusitalo has in her study Suomalaiset ja ympäristö (Finns and the Environment), Helsinki 1985, in a highly interesting manner employed this technique in an extensive poll study.
288
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
These arguments may obviously (a) cooperate or (b) contradict in different situations. For instance: in a case of rape the risks of a faulty decision (RA) may speak for a high degree of the standard of proof, even if it is known that women very rarely announce rape without good reasons (a high OP of the guilt), and, on the other hand, the function of the criminalization is highly endangered if perpetrators are acquitted (NG). Moreover, it is in most cases very difficult for the victim to present evidence (EP). But it is possible to deduce both the criterion of the sufficiency or evidence and the direction of the burden of proof rule from the disutility formula presented above. This calls for an analysis of the relationship between the evaluation of evidence and the evaluation of its outcome, i. e. the degree of certainty. Schematically this can be presented as follows: Uncertainty about :
Evaluation of evidence
probability
+
goal reasoning
original
concrete
goals of norms
risk aspect
OP
EP
NG
RA
Sufficient certainty and the burden of proof
When evaluating evidence one is in fact evaluating uncertainty about facts but it may be different, due to the recognition operations that the expressions of the legal language presuppose. But when one is speaking about sufficient certainty (and the burden of proof) , one is evaluating the disutilities of this uncertainty , the criteria of this evaluation being intimately connected with the type of uncertainty. Instead of one unitarian disutility scale for the formula 1 Ρ > Di
we will now get four criteria of disutility. It is to be noted that the formula does not presuppose any general scale of disutility. It functions perfectly well, if one is able to lay down the disutilities of the concrete decision alternatives, related to each other within a certain numerical scale (e. g. 0 - 100). (Another observation is that possible disutilities of correct decisions do not pertain evidential uncertainty.)
Legal Language and Evidence
289
But how can one weigh the criteria of disutility and the disutilities themselves? We stated that the criteria - understood as arguments - may cooperate or contradict. Our proposal is the use of the Analytic Hierarchy Process (ΑΗΡ) technique where different goals are compared pacruise with the help of a scale ( 1 - 9 ) and asking, whether a goal is equally important as another one (1) or more important - and how much more. If a goal G i is three times as important as G 2 , Gi gets in this comparison the value 3A and G 2 Vi. The relativ weighing of a goal is got from the product of the weighings. I n our case we would get six comparison pairs, (1) OP/EP; (2) OP/NG; (3) O P / R A ; (4) EP/NG; (5) E P / R A ; (6) N G / R A . It is then easy - at least when a computer is vailable - to transform the relative weighings into percentages; by multiplying the disutilities by these percentages one gets disutility values that express the multigoal nature of the reasoning and the concrete hierarchy of the criteria of disutility. In this manner we may lay down the criteria of sufficient certainty (P). But if the evidentiary values of neither the evidence for the E T nor for ~ E T surpass Ρ or, respectively, 1 — P, there are two principal alternatives, a) resort to the traditional rules about the burden of proof b) begin to make comparisons between the concrete evidentiary values of the evidence for E T and ~ E T ( P E V / E T and P E V / ~ E T ) and the degree of sufficient evidence, assessed in the manner presented above ( P m i N / E T and 1
—
Pmin/~ET)·
Ρ EVI ET
Ρ EVI- ET
P mini ET
1 P mini— ET
> or
s), schematically:
It is obvious that these probabilities may greatly depend on the rules about evidence and the burden of proof. The "substituting operations" described above may greatly differ from the ideal situation that the legislator or the interpreter of a statute had in mind. The burden of proof rules are not based mainly upon assumptions about the general probability of facts, not to speak
17 See Theodor Geiger , Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, reprint, Neuwied 1964, p. 207 et seq.
19*
292
Hannu Tapani Klami / Johanna Kastinen / Minna Hatakka
about statistical studies. The same holds good for reasoning about equity or what people should know or do. Problems of language become problems of evidence and rational decision-making under uncertainty - but exactly for this reason we have recommended a method that combines the evaluation of uncertainty and other argumentation. We think that the relationship between the expressions of legal language, the operations they presuppose and the evidentiary problems is an important and hitherto grossly neglected object for studies where one has to combine a philosophical and a sociological approach. Theory and practice should walk here hand in hand. Our idea is that the fact-finding process is not exclusively a matter of truth , where one should compare expressions of legal language to observations from this point of view. The intertwinement of description and prescription is also reflected in evidence. But in this context we should like to warn for a common mistake. If the focus is solely or too exclusively attached upon the truth aspect of the factfinding process - where there is no certainty about truth - it is all too easy to replace a rational attitude towards uncertainty by "intuition" or similar "holistic reasoning". In most Civil Law countries the principle of a free evaluation of evidence prevails. In our opinion this principle can be misleading. First, one can imagine that there are no precise methods for the evaluation of evidence. But there are. Secondly, evidence is envisaged as a matter of truth. This is not so. If there is certainty about truth , everything is O.K. But this is seldom the case, apart from pure judicial routine. If there is no certain truth, the problem is the functional relationship between the degree of certainty and the acceptable risk. This relationship should not be a matter of intuition. Analyses of legal language may reveal the nature of evidentiary and other reasoning that the expressions used presuppose. But the substitution effect connected with uncertainty does not always come into appearance in the external justification of the decisions. For instance: environmental risks that are so uncertain that they are "fuzzy" decision parameters may be wholly neglected or their relevance may be assessed by guessing. Evaluations that are very difficult to undertake may be left aside or the decision-maker follows the opinion of some authority, etc. 18 . Problems of this kind can only be studied by combining a keen legal philosophical analysis with an empirical approach that includes both actual cases and experiments. How do decision-makers really react to expressions of actual or planned legal language? What kind of evidentiary problems will
18 A study on the substitution effect in Finnish environmental law: Klami , Law, Environment and Uncertainty, in: Pubi, of the Law Faculty of the Univ. of Turku, ser. A:58, esp. at p. 47 et seq.
Legal Language and Evidence
293
arise? W h a t is the substitution effect of too difficult questions, if the legal language presupposes them? O u r project group " L a w and T r u t h " hopes to be able to present some results of our research i n a near f u t u r e 1 9 .
19 The present paper is a result of research within a Swedish-Finnish research project "Law and Truth" at the law faculties of the University of Uppsala and the University of Turku, Thanks are due to the Foundation of the University of Turku, the Academy of Finland and the Swedish Council for Humanistic and Social Research (HSFR), who have financed the project.
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft? Von Viktor Knapp, Prag I. 1. Die Frage der Rechtslücken ist eine typische Frage des geschriebenen Rechts, der lex scripta. Im Wirkungsbereich des Richterrechts, insbesondere des anglo-amerikanischen Rechts, wird sie in dieser Weise nicht gestellt und kann auch nicht gestellt werden. Das System des Richterrechts ist nämlich, etwas paradox gesagt, gleichzeitig lückenhaft und lückenlos. Es ist lückenhaft, da der Richter immer die Möglichkeit hat, es zu ergänzen, es ist lückenlos, da für den Fall, daß es keinen Präzedenzfall gibt, der Richter das Recht durch seine Entscheidung ergänzen muß, so daß das Recht im Augenblick der rechtskräftigen Entscheidung lückenlos ist. Diese Schlußfolgerung zeigt deutlich, daß die Frage der Rechtslücken, obwohl sie praktisch nur im kontinentalen Rechtsbereich gestellt wird, mit einer allgemeinen theoretischen Frage, nämlich der der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit des Rechts, zusammenhängt1. Und von diesem allgemeinen Gesichtspunkt aus werde ich mich bemühen, zur Lösung dieser Frage beizutragen 2. 2. Anders als beim Richterrecht, ist die Frage der Rechtslücken mit Rücksicht auf das geschriebene Recht in der Literatur, insbesondere seit Karl Bergbohm3, unzählige Male behandelt worden 4 . Doch bleiben noch verschiedene Fragen offen, und zwar deshalb, weil niemals eindeutig definiert wurde, was
1 Ausdrücklich verbindet die Frage der Rechtslücken mit der Vollständigkeit des Rechts z.B. J. Wroblewski , Zagadnenia teorii wykladni prawa ludowego, Warschau 1959, S. 298ff., ähnlich P. Pescatore , Introduction à la science juridique, Luxembourg 1960, S. 299ff., u.a. vgl. auch V. Knapp, Antinomien der Vollständigkeit des Rechts, in: Einflüsse des Wirkens des Rechts und seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit auf den sozialistischen Rechtsbildungsprozeß, Berlin (DDR) 1982. 2 Ich habe mich mit dem Problem der Rechtslücken schon früher mehrmals befaßt, siehe insbesondere „Filosofické problémy ceskoslovenského prava", Prag 1967, S. 70ff. (einige dort angeführten Ansichten werden hier weiterentwickelt bzw. korrigiert), Antinomien der Vollständigkeit des Rechts, S. 176ff., usw. 3 K. Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, Leipzig 1892. 4 Siehe die geschichtliche Übersicht der Ansichten bezüglich Rechtslücken bei R. Zippelius, Das Wesen des Rechts, 2. Aufl., München 1969, S. 12, 47, 65 und passim; vgl. auch das ausführliche Literaturverzeichnis bei J. Wroblewski, 1. c., S. 299ff.
296
Viktor Knapp
unter dem Begriff der Rechtslücke zu verstehen ist 5 . Infolgedessen treten bei der Lösung dieser Frage gewöhnlich zwei Mißverständnisse auf, die darin bestehen, daß einerseits Lücken de lege lata und Lücken de lege ferenda und andererseits Lücken im Recht und Lücken im Gesetz nicht unterschieden und manchmal sogar vermengt werden 6. In der folgenden Abhandlung werden diese Unterschiede berücksichtigt und verschiedene Aspekte des mehr intuitiven als wissenschaftlichen Begriffs der Rechtslücken untersucht 7. II. 1. In der Gesetzgebung ist die Frage der Rechtslücken bei der Kodifizierung des Rechts, also insbesondere seit dem französischen Code civil, praktisch geworden und ihre gesetzliche Lösung war gewöhnlich von der rechtstheoretischen bzw. rechtsphilosophischen Auffassung des jeweiligen Gesetzbuches abhängig. Ich halte es daher für angebracht, kurz einen Blick auf die großen bürgerlichen Gesetzbücher des X I X . und des beginnenden X X . Jahrhunderts, nämlich auf den französischen Code civil (1804), das österreichische A B G B (1811), das deutsche BGB (1896) und das schweizerische ZGB (1907)8 zu werfen. Von diesen Gesetzbüchern behandeln die Frage der Rechtslücken ausdrücklich § 7 A B G B und § 1 des schweizerischen ZGB. Implicite spricht sie der Code civil in Art. 4 und 5 an. Das BGB, das sich bemühte, allem Theoretisieren auszuweichen, läßt sie gänzlich ungelöst. Zwischen der ersten Implicite-Lösung und der letzten Explicite-Lösung sind 103 Jahre verflossen, und dieser zeitliche Unterschied ist bei den verschiedenen Lösungen ganz deutlich
5
Vgl. G. Eörsi, Richterrecht und Gesetzesrecht in Ungarn, in: Rabeis Zeitschrift, 1966, No. 1, S. 132; und auch R. Zippelius, (FN 4). 6 Diese Vermengung kam oft in der sozialistischen Literatur vor. Vgl. z.B.: Marxistisch-leninistische Staats- und Rechtstheorie, Berlin (DDR) 1980, S. 581, Wróblewski, (FN 1), usw.; desgleichen aber auch Bergbohm und andere Positivisten, für die eigentlich Recht und Gesetz dasselbe ist. Wróblewski (1. c., S. 309) betrachtet Rechtslücken als einen Widerspruch zwischen der „positiven und negativen Entscheidung" des Gesetzgebers, also der teilweise ausdrücklichen Regelung einer Sache und des Schweigens des Gesetzgebers hinsichtlich derselben Sache. Demgegenüber spricht Pescatore (1. c., S. 300ff.) ausdrücklich über Gesetzeslücken, die er als „omission de la loi de résoudre une question qui devrait nécessairement être résolue" definiert (S. 300). 7 Rechtslücken werden aber auch anders klassifiziert und anders begriffen. Vgl. z. B. R. Zippelius, Rechtsphilosophie, München 1982, S. 169, der auch über „unechte Lükken" spricht, die dann entstehen, wenn Gesetzesnormen „den Erfordernissen der vorherrschenden Rechtsmoral nicht gerecht werden". Vgl. auch die Klassifikation der Rechtslücken bei Wróblewski, 1. c., S. 299ff. 8 Über diese Fragen habe ich an der Rechtshistorischen Konferenz über die Geschichte der Kodifizierung des Rechts („Große Kodifikationen"), die 1988 an der Karlsuniversität Prag stattgefunden hat, ausführlich gesprochen. (Velké kodifikace, I.Prag 1989, S. 273 ff.)
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
297
erkennbar (und noch offensichtlicher ist er bezüglich des österreichischen A B G B und des schweizerischen ZGB). Schließlich zeigt sich aber (zumindest versuche ich dies zu zeigen), daß alle diese Lösungen, einschließlich der Nichtlösung im BGB, sich auf einen gemeinsamen Nenner zurückführen lassen, der - ungeachtet der Verschiedenheit des Herangehens der angeführten Gesetzbücher an die gegebene Frage - nicht anders sein kann, als es tatsächlich der Fall ist. 2. Das älteste der angeführten Gesetzbücher, der französische Code civil, ist in seiner Auffassung sichtlich von Rousseaus Vorstellung des Naturrechts beeinflußt und verstrickt sich bei der Lösung der Frage nach Rechtslücken in einen inneren Widerspruch. In seinen berühmten Artikeln 4 und 5 bringt er einerseits den Grundsatz zum Ausdruck Judex ius dicit inter partesder sich aus dem ausdrücklichen Verbot ergibt, wonach der Richter über eine ihm zur Entscheidung vorgelegte Sache nicht allgemein und normativ entscheiden darf („par voie de disposition générale et réglementaire"), andererseits aber gibt er dem Bürger das Recht auf eine richterliche Entscheidung, was er zweifellos für eines der Grundrechte des Bürgers erachtet. Dieses Recht kennt keine Ausnahme. Der Richter ist verpflichtet, auch dann zu entscheiden, wenn das Gesetz unklar ist, wenn es ungenügend ist, ja auch dann, wenn das Gesetz schweigt. Sonst würde sich der Richter der abnegatio iustitiae („déni de justice") schuldig machen. Wenn wir nun dies alles zusammenfassen, dann ergibt sich daraus ohne Zweifel, daß der Richter auch dann entscheiden muß, wenn er im Gesetz eine Lücke sieht. Wonach soll er aber dann entscheiden? Das Gesetzbuch selbst läßt ihm keine andere Möglichkeit, als nach dem Gesetz zu entscheiden, was dazu führt, daß (übrigens so wie es in vielen anderen Ländern auch heute üblich ist) eine derartige Entscheidung als Entscheidung per analogiam legis betrachtet wird, und, wenn auch das nicht genügt, dann als Entscheidung per analogiam iuris. Eine Entscheidung per analogiam iuris ist allerdings in Wirklichkeit keine Entscheidung per analogiam9, sondern es ist dies eine Entscheidung nach Gutdünken des Richters, die auf den sehr vagen, allgemeinen Rechtsgrundsätzen beruht 10 . In einem solchen Fall geht es nicht mehr darum, daß iudex ius dicit inter partes, sondern darum, daß iudex ius facit inter partes. Der Richter erklärt hier nicht das Recht, sondern bildet es. Das so gebildete Recht gilt im Sinne des zit. Art. 4 des Code civil ratione personae lediglich zwischen den am Verfahren Beteiligten. Ratione causae gilt es zwar allgemein, jedoch bloß bezüglich der rechtsgültig entschiedenen Sache. Ob dies tatsächlich so ist, will ich kurz im weiteren erörtern.
9 Vgl. R. David, Le droit français, Bd. I, Paris 1960, S. 149. Der Versuch von F. Gény (Méthodes d'interprétation et sources du droit privé positif, Bd. 2, 2. Aufl., Paris 1919) den Gesetztext nach der „libre recherche scientifique" auszulegen, hatte keinen großen Einfluß und ist in Vergessenheit geraten. 10 Vgl. R. David, 1. c.,S. 174.
298
Viktor Knapp
3. Das österreichische A B G B , das ebenfalls durch die Naturrechtstheorie, allerdings durch ihre rationalistische Richtung, beeinflußt war, wählte eine, wenigstens scheinbar abweichende und vom Gesichtspunkt der Naturrechtstheorie ohne Zweifel konsequentere Lösung. Sein § 7, der die Stufenleiter der Rechtsquellen festlegt, gestattet dem Richter und trägt es ihm gleichzeitig auf, im Falle, daß er nicht nach anderen Quellen entscheiden kann, nach den „natürlichen Rechtsgrundsätzen" zu entscheiden. Diese Bestimmung hängt offenbar mit § 16 und offensichtlich auch mit § 19 A B G B zusammen, der seinem Geiste nach an den Art. 4 des französischen Code civil erinnert. Ein wahres Manifest der rationalistischen Naturrechtstheorie ist jedoch § 16 des A B G B , aus dem sich ableiten läßt, daß das Naturrecht keinerlei Lücken aufweist, und (im Zusammenhang mit § 7) auch, daß Lücken nur im geschriebenen Recht, d. h. im Gesetz, existieren können. Bei aller Konsequenz der Konzeption des A B G B ist dies allerdings ein wenig inkonsequent 11 . Wenn das A B G B , wie nach seinem Erscheinen behauptet wurde, „ratio scripta" war, wenn es das Spiegelbild des Naturrechts war, wieso gab es dann irgendwelche Lücken. Wenn das Gesetz sie aber zuließ, dann konnten allerdings die Lücken im geschriebenen Recht nicht anders ausgefüllt werden als durch das Naturrecht. Aus dem § 16 ergibt sich auch, wie der Richter das Naturrecht erkennt. Die Bestimmung des § 16 gibt ihm eine einfache Anleitung; er erkennt es „schon durch die Vernunft". Hier beginnt jedoch die Schwierigkeit. Unter Vernunft versteht der § 16 A B G B selbstverständlich nicht die individuelle Vernunft irgend jemandes, sondern eine gewisse Art abstrakter Vernunft (vielleicht im Sinne Kants) 12 . Nur verfügt der Richter nicht über diese abstrakte Vernunft, sondern über seine eigene sehr konkrete Vernunft (die vernünftiger oder weniger vernünftig ist), so daß in Wirklichkeit gilt, daß es so viele mögliche Naturrechte wie Richter gibt. Der Richter sieht sich also in der gleichen Situation wie bei der Anwendung der Art. 4 und 5 des Code civil. Der Unterschied besteht darin, daß das A B G B den Richter nicht dazu zwingt, eventuell etwas als Interpretation des Gesetzes auszugeben, was keine Interpretation ist. 4. Das schweizerische ZGB bestimmt im § 1, ähnlich wie das A B G B , die Stufenleiter der Rechtsquellen und gelangt so zum Problem der Rechtslücken, resp. der Lücken im Gesetz. Falls zur Entscheidung weder die Interpretation des Gesetzes genügt, noch das Gewohnheitsrecht, entscheidet der Richter „nach der Regel, die er als Gesetzgeber aufstellen würde". Diese Bestimmung 11
Konsequenz und gleichzeitig auch Inkonsequenz in der Behandlung des Naturrechts weist § 7 A B G B auch darin auf, daß er in der Stufenfolge der Rechtsquellen vor den „natürlichen Rechtsgrundsätzen" den „natürlichen Sinn des Gesetzes" anführt. 12 F. Zeiller, Commentar über das A B G B für die gesamten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie, Bd. I, Wien / Triest, 1811, S. 62ff.; E. Swoboda, Das A B G B im Lichte der Lehre Kants, Graz 1926, S. 150.
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
299
ist aus mehreren Gründen interessant, insbesondere jedoch deshalb, weil hier das ZGB als einziger der angeführten Kodexe, dem Richter ausdrücklich rechtsbildende Macht zuweist, sei es auch, wenigstens theoretisch, bloß mit der Wirksamkeit inter partes 13. 5. Das deutsche BGB macht sich kein Kopfzerbrechen in der Sache. Auch in Deutschland zweifelte nach der Herausgabe des BGB niemand daran, daß der Richter die Entscheidung nicht mit der Begründung non liquet ablehnen dürfte, daß er also entscheiden muß. Niemandem fiel es jemals ein, daß sich der deutsche Richter bei der Entscheidungstätigkeit nicht in ähnlicher Situation befinden könnte wie der französische Richter laut Art. 4 Code civil oder der österreichische laut § 7 A B G B oder der schweizerische laut § 1 ZGB. Es zeigt sich also, daß es vom praktischen und im erheblichen Maß auch vom theoretischen Gesichtspunkt gleichgültig ist, ob das Gesetzbuch die Frage der Entscheidungstätigkeit im Falle von Lücken im Gesetz explizit oder implizit löst oder sie überhaupt nicht löst. Auch der deutsche Richter konnte (und kann aufgrund des BGB, das in der BRD noch immer gilt) auf eine Gesetzeslücke stoßen und muß nichtsdestoweniger doch entscheiden. Wie tut er dies? Zweifellos ebenso wie in Frankreich, in Österreich und in der Schweiz. Vom theoretischen Gesichtspunkt wird die Sache so gelöst, daß auch der deutsche Richter, ähnlich wie der französische (oder eventuell auch der tschechoslowakische), seine Zuflucht in der analogia legis sucht, und zwar auch dann, wenn es in Wirklichkeit keine Analogie mehr gibt, oder in der analogia iuris, die, wie bereits gesagt wurde, per definitionem keine Analogie ist, oder endlich, was besonders nach dem zweiten Weltkrieg zur Praxis wurde, in den nebelartigen allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die der Gesetzgeber nicht in der Rechtsnorm konkretisierte 14 . 6. Die Situation der vier Gesetzbücher kann man, ungeachtet der unterschiedlichen positiv-rechtlichen Regelung (resp. des Mangels einer positivrechtlichen Regelung im BGB) auf einen gemeinsamen Nenner bringen, der allerdings nicht nur gemeinsamer Nenner der genannten Kodexe ist, sondern offensichtlich die allgemeine Lösung für die Entscheidungstätigkeit im Falle von Gesetzeslücken darstellt. Es scheint zweifellos so zu sein, daß in einem solchen Fall, d.h. dann, wenn eine ausdrückliche rechtliche Regelung nicht existiert, und diese nicht einmal als eine solche, die im gegebenen Fall per analogiam legis noch als Hilfsquelle des Rechts anzuwenden wäre (wie z.B. Gewohnheitsrecht u.s.w.), der Richter nach seinem Gutdünken, nach seinem Rechtsbewußtsein, bzw. seinem Rechtsempfinden, nach seiner Vorstellung 13 Die offizielle Auslegung von § 1 Z G B siehe in: Schweizerisches Civilgesetzbuch, Erläuterungen zum Vorentwurf, Erstes Heft, Bern 1901, S. 37. 14 Vgl. R. David, Les Grands systèmes de droit contemporain, 4. Aufl., Paris 1971, S. 153, der diesen Gedanken einer Entscheidung des Verfassungsgerichts der B R D entnimmt.
300
Viktor Knapp
von Gerechtigkeit, der Äquitas u. ähnl., entscheidet. Gleichgültig, ob er aber so oder so entscheidet, geht es nicht darum, daß er Recht im Gesetz findet. Er bildet es. Der herrschenden Meinung nach schöpft der Richter in einem solchen Fall das Recht nur inter partes. Es stellt sich nun die Frage, ob es auch wirklich so ist, ob es nicht doch ein „kontinentales" Richterrecht gibt. Diese Frage entfernt sich allerdings vom eigentlichen Thema dieser Abhandlung, so daß ich sie in den folgenden Erörterungen nur ganz kurz und nebenbei erwähnen werde. III. 1. Die angeführten historischen Beispiele sind auch von einem anderen Gesichtspunkt wichtig. Sie deuten den Unterschied zwischen den Rechtslükken und den Gesetzeslücken an. Die erste Frage ist also die, ob es Lücken im Recht, und zwar de lege lata, gibt. Die Antwort hängt in erster Linie davon ab, was unter dem Begriff „Recht" verstanden wird. Auch diese Frage kann natürlich verschiedenartig gestellt werden 15 . Sie kann naturrechtlich, positivistisch, neukantianisch, soziologisch, vom Gesichtspunkt der reinen Rechtslehre usw. und auch, so wie es in den gewesenen sozialistischen Ländern der Fall war, nämlich marxistisch, gestellt werden. Von diesem Gesichtspunkt aus wird das Recht, sehr vereinfacht gesagt, als der „zum Gesetz erhobene" Wille der in der gegebenen Gesellschaft herrschenden Klasse betrachtet 16 . Das Recht ist also, dieser Auffassung nach, eine formelle Äußerung des Klassenwillens und demnach eine spezifische Form der gesellschaftlichen Beziehungen. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheinen also Rechtslücken nicht als Lücken des Klassenwillens (des Inhalts des Klassenwillens), sondern vielmehr als Lücken der Form seiner Äußerung, die gewöhnlich mit dem Gesetz bzw. mit der Rechtsvorschrift, identifiziert wird. Später werde ich noch dazu kommen, ob dies die einzige richtige Auslegung der Marxschen Rechtsauffassung ist. In diesem Augenblick handelt es sich um etwas anderes. Diese Überlegung sollte zeigen, daß von keinem der erwähnten Gesichtspunkte aus die Frage der Rechtslücken inhaltlich, sondern nur mit Rücksicht auf das Recht als Form der gesellschaftlichen Beziehungen, gelöst werden kann. 2. Versuche, die Rechtslücken vom formellen Gesichtspunkt aus zu lösen, haben allerdings eine verhältnismäßig lange Geschichte, auf die wir kurz eingehen werden. 15 Vgl. z.B. die große Diskussion über den Begriff des Rechts, die in Moskau im Jahre 1978 geführt wurde (Kruglyj stol: Ο ponimanii sowetskogo prawa, Sowetskoe gossudarstwo i prawo, 1979, No. 6, 7). 16 Κ. Marx / F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Werke, Bd. 4, Berlin (DDR) 1983, S. 477.
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
301
Es war insbesondere der Rechtspositivismus, der die Idee der Rechtslücken aus formal-logischen Gründen abgelehnt hat. So kommt z.B. der bereits erwähnte Karl Bergbohm 17 (nach einer vom philosophischen Gesichtspunkt kaum haltbaren Argumentation) zum Schluß, daß es zwar Fragen gibt, die vom positiven Recht nicht geregelt werden, die aber keine Lücken im Recht, sondern einen rechtsleeren Raum bilden. In der tschechoslowakischen Literatur lehnte der Lehrer des Verfassers dieses Artikels Jan Krcmâr aus logischen Gründen den Begriff der Rechtslücken ab. Auch er war in seiner Konzeption des Rechts im wesentlichen Positivist. Dies ändert jedoch nichts daran, daß sein Argument interessant ist. Er isoliert zuerst die Pflicht und gelangt zur Schlußfolgerung, daß das Recht eine Pflicht auferlegt oder nicht, tertium non datur. „Und da das Auferlegen einer Pflicht und ihr Nichtauferlegen kontradiktorische logische Begriffe sind, kann ein grundlegender Tatbestand überhaupt nicht auftreten, bezüglich dessen laut Gesetz weder gilt, daß mit ihm irgendwelche Rechtsfolgen verbunden sind, noch, daß dies nicht der Fall ist, und daß hier gewissermaßen ein durch rechtliche Regeln nicht berührtes vacuum entstünde" 18 . Dadurch gelangt Krcmâr zur allgemeinen Schlußfolgerung und zum logischen Beweis des kontradiktorischen Charakters des Begriffs der Rechtslücken. (Lücken ergeben sich im Recht seiner Meinung nach nur scheinbar, und zwar besonders infolge des allzu arbiträren Charakters der Norm, oder im Gegenteil infolge ihres allzu kasuistischen Charakters, oder es kann die Vorstellung einer Lücke, was auch heute nicht uninteressant ist, aufgrund „einer gewissen Unzufriedenheit mit der Rechtsordnung, d.h., daß die rechtliche Regelung nicht gerecht ist und daß also in der Rechtsordnung etwas bestimmt sein sollte, was dort nicht bestimmt ist, geben" 19 . Diese Beweisführung (obzwar die von Krcmâr viel korrekter ist als die von Bergbohm) ist allerdings unvollständig. Sie zog nämlich die Tatsache nicht in Betracht, daß das Recht nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend geäußert werden kann. Eine solche stillschweigende rechtliche Regelung kommt bei der Erlaubnis vor. Die deontische Modalität „erlaubt" hat nämlich drei Varianten: „ausdrücklich erlaubt", „erlaubt, weil geboten" und „stillschweigend erlaubt" 20 . Die letztere Erlaubnis führt dann zu der soziologisch und auch logisch beweisbaren Regel, daß alles, was nicht verboten, erlaubt ist 21 . Vom logischen Standpunkt aus handelt es sich hier also um keine Kontravalenz, sondern um eine Implikation, daß immer, wenn etwas nicht verboten ist, es erlaubt ist. Diese Implikation läßt freilich keine Lücken zu, was der 17 K. Bergbohm, 1. c., S. 375ff.; vgl. auch R. Zippelius, (FN 4), S. 12, der sich mit der positivistischen Auffassung der Lückenlosigkeit der Rechtsordnung näher befaßt. 18 /. Krcmâr, Pravo obcanské, Bd. I., 4. Aufl., Prag 1946, S. 73. 19 Dortselbst. 20 V. Knapp / A. Gerloch, Logika ν prawowom sosnanii, Moskau 1987, S. 194 ff. 21 U m einen logischen Beweis dieser Regel habe ich mich in dem in FN 1. angeführten Buch, S. 249ff., bemüht.
302
Viktor Knapp
eigentliche logische Beweis der Unhaltbarkeit des Begriffes der Lücken im Recht de lege lata ist. IV. 1. Die Literatur, die übrigens zu dieser Frage keineswegs allzu umfangreich ist, beschränkt sich gewöhnlich auf die Frage der Lücken im Recht, ohne die Frage, ob es Lücken im Gesetz gibt, zu berücksichtigen. In der marxistischen Literatur war diese Vereinfachung wahrscheinlich die Folge der Vereinfachung des theoretischen bzw. des ontologischen Ausgangspunktes, nämlich des Begriffs des Rechts. Es ist oben gesagt worden, daß, der Marxschen Auffassung nach, das Recht eine Äußerung des zum Gesetz erhobenen Willens ist. Ist aber in diesem 140 Jahre alten Gedanken des jungen Marx der Ausdruck „Gesetz" im rechtstechnischen Sinn zu verstehen? Ist Recht und Gesetz dasselbe22, ist das Gesetz (die Rechtsvorschrift) die einzige Form der verbindlichen Äußerung des Klassenwillens? Ich glaube kaum. Der herrschende Klassenwille muß, um Recht zu werden, zwar formell und verbindlich geäußert werden, dies muß allerdings nicht unbedingt in der Form einer ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes erfolgen. Es ist schon oben erwähnt worden, daß eine rechtliche Regelung auch stillschweigend erfolgen kann, wie es bei der stillschweigenden Erlaubnis der Fall ist. Es gibt aber auch andere Fälle. So z.B. wenn es bekannt ist, daß alle Menschen entweder volljährig oder minderjährig sind, und das Gesetz ausdrücklich die Volljährigkeit definiert, so muß es (und aus rechtstechnischen Gründen soll es) nicht die Minderjährigkeit definieren, da sie ganz eindeutig stillschweigend per eliminationem bzw. a contrario, gesetzlich definiert ist. Ähnliches gilt, wenn die Rechtsnorm auf gute Sitten, Billigkeit, Treu und Glauben, die Grundsätze des redlichen Verkehrs usw. verweist. Auch hier geht es keinesfalls um die Ausfüllung von Rechtslücken durch diese Grundsätze oder Regeln u.ä., sondern um die Anwendung des Rechts, denn alle diese Grundsätze und Regeln können beim Judizieren benutzt werden, resp. alle diese Grundsätze und Regeln sind einzig und allein deshalb erheblich, weil das Gesetz sich auf sie beruft. Außerdem habe ich schon vor zwanzig Jahren darüber geschrieben, daß es auch in den gewesenen sozialistischen Ländern eine richterliche Rechtsfortbildung gab 23 . Das Recht ist also vollständig, das Gesetz kann dagegen unvollständig, also lückenhaft sein, so daß das Recht im gegebenen Fall vom Richter fortgebildet werden muß. Ein überzeugender Beweis dafür folgt aus dem in 22
Vgl. V. S. Nersesjanc, Prawo i sakon, Moskau 1983. V. Knapp, La création du droit par le juge dans les pays socialistes, in: lus Privatum Gentium, Festschrift für Max Rheinstein, Bd. I., Tübingen 1969, S. 67ff.; ähnlich Gy. Eörsi, Comparative Civil (Private) Law, Budapest 1979, S. 552ff. 23
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
303
allen zivilisierten Ländern geltenden Verbot der abnegatio iustitiae, von der schon im Zusammenhang mit dem Code civil die Rede war. Stellen wir uns einen Fall vor, der in der Gerichtspraxis nicht vereinzelt ist, nämlich daß der Richter weder nach der ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes, noch mit Hilfe einer extensiven Auslegung noch per analogiam entscheiden kann. Er muß aber doch entscheiden und er muß rechtmäßig entscheiden. 2. Es kann also geschlossen werden, daß das Recht zwar vollständig ist, seine Vollständigkeit aber nicht statisch, sondern nur dynamisch begriffen werden kann. Das Recht ist ein offenes System. Es wird ständig fortgebildet. Es handelt sich also nicht um die Ausfüllung der Rechtslücken auf Grund eines anderen „Rechts" (eines anderen, parallelen Rechtssystems), sondern um eine Fortbildung des Rechts durch richterliche Rechtsanwendungstätigkeit. Es gibt also Tatbestände, für deren Entscheidung der Richter im Gesetz keine Antwort findet, es gibt allerdings keinen Tatbestand, über den nicht rechtmäßig entschieden werden kann. Wir können uns das Verhältnis zwischen dem Recht und dem Gesetz (im Sinne einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung) als das Verhältnis von zwei Mengen vorstellen, von denen die größere das Recht und die in ihr enthaltene kleinere das Gesetz darstellen. Die sog. Rechtslücken befinden sich in der Untermenge, welche durch die Substraktion der Menge „Gesetz" von der Menge „Recht" entsteht. Dadurch sind aber die Rechtslücken (im Sinne der Lücken im Gesetz) nicht vollständig geklärt worden. Die erwähnten Schlüsse als solche würden eigentlich zu einer vom anderen Standpunkt unhaltbaren Schlußfolgerung, nämlich der, daß alles, was im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt wird, eine Gesetzeslücke (also eine Rechtslücke in diesem engeren Sinn) ist, führen. Zur Erörterung dieser Frage werde ich ein Beispiel des gewesenen tschechoslowakischen Rechts benutzen. Das ZGB bestimmt in dem inzwischen aufgelösten § 129 kurz und bündig, daß sich im persönlichen Eigentum nur ein Familienhaus 24 befinden kann. Diese Bestimmung wirft in der Praxis mindestens zehn vom Gesetz unbeantwortete Fragen auf (so z.B., wie wird das Eigentum qualifiziert, wenn jemand Miteigentümer von 3A eines und von Vz eines anderen Familienhauses ist, usw.). Des weiteren kennt das tschechoslowakische Recht keinen Begriff der Verlobung. Es gibt aber keinen Zweifel, daß die Verlobung zulässig ist, ohne aber rechtliche Folgen zu haben.
24 Persönliches Eigentum bedeutete im Recht der sozialistischen Länder das Eigentum an persönlichen Verbrauchsmitteln, zu denen auch das Familienhaus, d.h. ein Haus einer bestimmten Maximalgröße, das zum Wohnen der Familie des Eigentümers bestimmt ist, gehörte.
304
Viktor Knapp
Vergleichen wir nun die beiden Fälle. Handelt es sich in beiden Fällen um Rechtslücken (im obenerwähnten Sinn) oder nur im ersten Fall? Das gegenwärtige Rechtsempfinden gibt auf diese Frage eine ganz eindeutige Antwort: die Unvollständigkeit der Bestimmung des § 129 ZGB wurde allgemein als eine Rechtslücke empfunden, dagegen fällt niemandem ein, den Mangel einer rechtlichen Regelung der Verlobung als Lücke im Recht zu betrachten. Diese intuitiv unterschiedliche Einschätzung beider angeführten Fälle ist, meines Erachtens, auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus richtig. Warum aber? Die Antwort scheint nicht schwer zu sein. Sie kann allerdings aus dem System de lege lata selbst nicht abgeleitet werden, sondern nur aus der Vergleichung des Systems de lege lata und des de lege ferenda 25, und demzufolge kann sie nicht rechtslogisch, sondern nur rechtssoziologisch bewiesen werden. Von diesem Blickpunkt aus ist die Antwort ganz einfach und kann in einem Satz gegeben werden. Im Fall des § 129 ZGB wird in der Rechtspraxis das Bedürfnis einer näheren, ausführlicheren und klaren gesetzlichen Regelung empfunden, im Fall der Verlobung wird ein solches Bedürfnis nicht empfunden. Theoretisch ist die Frage etwas komplizierter, aber nicht einmal die theoretische Lösung dieser Frage bereitet viel Schwierigkeiten. Die Lösung hängt, wie gesagt, mit dem System de lege ferenda zusammen. Dieses System ist allerdings kein „zweites Recht", kein Naturrecht (mindestens im traditionellen Sinn des Naturrechts), sondern ein System, das dem Rechtsbewußtsein innewohnt und das das geltende Recht nicht ändern, sondern nur rechtspolitisch seine Änderung bzw. Ergänzung, Vervollkommnung, postulieren kann. Es folgt daraus, daß man über Gesetzeslücken, bzw. im übertragenen Sinn über Rechtslücken, nur dann sprechen kann, wenn es sich um Gesetzeslücken gleichzeitig de lege lata und de lege ferenda handelt oder, genauer gesagt, wenn die gegebene rechtliche Regelung einer Sache das Bedürfnis einer Ergänzung bzw. Vervollkommnung des Gesetzes hervorruft 26 .
V.
Zum Schluß kann noch darauf hingewiesen werden, daß Rechtslücken noch von einem anderen, und zwar vom semantischen Blickpunkt aus, betrachtet werden können 27 . (Es ist schon am Anfang gesagt worden, daß eine der Schwierigkeiten der Lösung der Frage der Rechtslücken darin besteht, daß
25
Vgl. auch P. Pescatore, 1. c., S. 300. Dortselbst. 27 So z.B. Gy. Eörsi, Richterrecht und Gesetzesrecht in Ungarn, S. 132; vgl. auch R. Zippelius, (FN 4) (im Kapitel über das kausale Rechtsdenken), S. 64. 26
Ist das Recht lückenlos oder lückenhaft?
305
fast jeder unter diesem Begriff etwas anderes versteht.) Bei der semantischen Auffassung der Rechtslücken handelt es sich eigentlich um keine Lücken im Recht und nicht einmal um Lücken im Gesetz (im oben erwähnten Sinn), sondern um eine Unvollständigkeit, und zwar manchmal auch um eine beabsichtigte Unvollständigkeit des sprachlichen Ausdrucks der Rechtsnorm. Eine solche „Lücke" kann aber durch die bereits erwähnte richterliche Rechtsfortbildung und oft durch die Interpretation „ausgefüllt" werden. Ich habe es schon, in einem anderen Zusammenhang, am Mangel der gesetzlichen Definition der Minderjährigkeit demonstriert. Als ein anderes, etwas komplizierteres Beispiel kann man die Bestimmung des § 131 des tschechoslowakischen ZGB anführen, welche dem Eigentümer die Pflicht auferlegt, in Ausnahmefällen zeitweilig und gegen Entschädigung zu dulden, daß seine Sache ohne seine Zustimmung im dringenden allgemeinen Interesse, das nicht anders befriedigt werden kann, benutzt wird. In einer ähnlichen Situation wie der Eigentümer laut § 131 ZGB kann sich aber auch der Besitzer einer Sache, der nicht ihr Eigentümer ist, befinden. Fraglich ist nun, ob auch der Besitzer, der nicht Eigentümer der Sache ist, dazu verpflichtet ist oder nicht verpflichtet ist, zu dulden, daß die Sache unter den Bedingungen des § 131 ZGB ohne seine Zustimmung benutzt wird. Das Gesetz sagt darüber nichts. Und dennoch ergibt sich hier mit logischer Notwendigkeit die Frage, ob das Gesetz durch sein Schweigen demjenigen, der auf die Sache ein schwächeres Recht hat als der Eigentümer, tatsächlich in Beziehung zum gesellschaftlichen Interesse bzw. in der Beziehung zu einer dritten Person laut § 131 ZGB ein stärkeres Recht gibt, als es der Eigentümer hat. Die Sache wird ganz einfach und eindeutig durch die logische Interpretation a maiori ad minus (a fortiori) gelöst: Wenn der Eigentümer der Sache eine solche Pflicht hat, hat sie umso eher ihr Besitzer bzw. jeder Inhaber derselben, auch wenn er nicht ihr Eigentümer ist. Mit dieser Lösung kehren aber die oben gestellten Fragen in veränderter Gestalt zurück. Vor allem die Frage, warum ist der Mangel einer ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzes darüber, daß der Besitzer die gleichen Pflichten hat wie der Eigentümer laut § 131 ZGB keine Lücke im Recht, und warum sollten Lücken im Recht durch den (heute nicht mehr geltenden) § 129 Z G B entstehen, wenn beide Fälle qualitativ insoweit gleich sind, als weder in diesem noch in jenem das Recht selbst die logisch notwendigerweise entstehenden Fragen eindeutig löst, der Richter aber in beiden Fällen dem Recht gemäß entscheiden muß. Die Frage hängt damit zusammen, daß im Unterschied zu § 129 ZGB die Bestimmung des § 131 ZGB nicht einmal als Lücke im Gesetz empfunden wird. Auch diese Antwort ist klar und einfach. Die Bestimmung des § 129 ZGB ist so unklar, daß sie ohne richterliche Rechtsfortbildung nicht anwendbar ist. Demgegenüber läßt § 131 ZGB ganz zweifellos die Auslegung a fortiori zu und erweckt demzufolge keine Unklarheit. 20 Festgabe Opalek
306
Viktor Knapp
Ich glaube also, daß nicht einmal die semantische Problematik der Rechtslücken zur Anerkennung der Lücken im Recht de lege lata führt. VI. Zum Abschluß möchte ich noch ein Wort zu der schon am Anfang erwähnten Verschiedenheit der theoretischen Auffassung der Rechtslücken hinzufügen. In der langen Geschichte des Problems der Rechtslücken (wie übrigens in vielem anderen) wurden viele Streitigkeiten dadurch hervorgerufen, daß jeder unter dem Begriff der Lücke im Recht etwas anderes verstand, so daß es nicht bloß einmal geschah, daß jemand durch Argumente für die Existenz von Lükken im Gesetz die Ansicht eines anderen über die Existenz von Lücken im Recht widerlegte, oder jemand mit Argumenten, die sich auf Lücken de lege ferenda bezogen, die Ansichten eines anderen bezüglich der Lücken de lege lata bekämpfte. Ich will also niemanden zwingen, Rechts- bzw. Gesetzeslücken so zu verstehen, wie ich sie verstehe. Dagegen fühle ich kein Bedürfnis, sie so zu verstehen, wie sie ein anderer versteht. Hier habe ich meine Auffassung der Rechtslücken dargelegt und zu begründen versucht, warum ich glaube, daß im System de lege lata der Begriff der Rechtslücken unhaltbar ist. Ich halte diesen Schluß auch vom praktischen Standpunkt für sehr wichtig, da er gegen jede willkürliche Rechtsanwendung und auch gegen die übel berüchtigte „Richtlinien"bzw. „Rundschreiben-Rechtsetzung" gerichtet ist, die überall sehr beliebt und deren Beliebtheit bisher bei weitem nicht vorüber ist.
Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus*1 Von Walter Ott, Zürich Im Jahre 1977 veröffentlichte R. Dworkin, Nachfolger von H . L . A . Hart auf dessen Lehrstuhl für Jurisprudence in Oxford, sein Buch „Taking Rights Seriously" 2 . Darin faßt er verschiedene, zum Teil schon früher erschienene Abhandlungen zusammen und unternimmt einen „allgemeinen Angriff auf den Positivismus" 3 , wobei ihm die Theorie seines Vorgängers als Zielscheibe dient 4 . I. Die drei Hauptthesen des Positivismus in der Sicht Dworkins Nach Dworkin bilden die folgenden drei Thesen das Gerüst des Positivismus: 1. Das Recht einer Gemeinschaft besteht ausschließlich aus Regeln, die nicht nach ihrem Inhalt, sondern nach ihrer Herkunft 5 (pedigree) identifiziert werden (z.B. aufgrund von Harts Erkennungsregel). Mit Hilfe dieses Herkunftstests kann man Rechtsregeln von anderen gesellschaftlichen Regeln, insbesondere denjenigen der Moral, unterscheiden 6. 2. Wenn ein Fall nicht eindeutig von einer solchen Regel abgedeckt wird, etwa weil sie vage ist, kann er folglich nicht durch „Anwendung des Rechts" entschieden werden. Der Richter ist in einem solchen Fall rechtlich ungebun* Es handelt sich bei dem vorliegenden Beitrag um einen Vorabdruck aus der 2. Aufl. meines Buches „Der Rechtspositivismus" (Berlin 1992). Der Verf. dankt dem Verlag Duncker & Humblot für seine Genehmigung. 1 Der Verf. dankt den Herren Alexy und Koch für die Überlassung der Manuskripte ihrer Vorträge, gehalten auf der Tagung der deutschen Sektion der I V R 1988 in Göttingen, so daß diese schon vor der Veröffentlichung hier berücksichtigt werden konnten. 2 I . A . , London 1977, 4. Α . , London 1984; auf deutsch erschienen unter dem Titel: Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt a.M. 1984. In Deutschland haben Alexy, RECHTSTHEORIE Beiheft 1 (1979), S. 59ff., sowie Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985, Kap. 3, und Dreier, NJW 39 (1986), S. 892f., die Theorie Dworkins aufgenommen und zum Teil modifiziert. Für Einzelheiten sei darauf verwiesen. 3 Dworkin, Bürgerrechte, S. 54. 4 Dworkin, S. 54. 5 Das deckt sich mit der von mir gegebenen Charakterisierung, daß die Rechtspositivisten den Begriff des Rechts durch empirische Merkmale bestimmen. Vgl. Ott, Der Rechtspositivismus, 2. Aufl., Berlin 1992, S. llOf. 6 Vgl. Dworkin, Bürgerrechte, S. 46f. 20*
308
Walter Ott
den. Er muß sein Ermessen (discretion) bestätigen, was bedeutet, daß er über das Recht hinausgeht und nach einem außerrechtlichen Maßstab greift 7 . 3. Eine rechtliche Verpflichtung existiert dann und nur dann, „wenn eine bestehende Rechtsregel eine solche Verpflichtung auferlegt. Hieraus folgt, daß es in einem schwierigen Fall - wenn sich keine solche Regel finden läßt erst dann eine rechtliche Verpflichtung gibt, wenn der Richter eine neue Regel für die Zukunft schafft. Der Richter kann die neue Regel auf die in diesem Fall Beteiligten anwenden; das aber ist eine Gesetzgebung ex post facto und nicht die Durchsetzung einer bestehenden Verpflichtung" 8 . I I . Die Kritik Dworkins an den drei Hauptthesen des Positivismus Dworkin hält alle drei Thesen des Positivismus für falsch: 1. In schwierigen Fällen (hard cases) müsse der Richter auf sog. Prinzipien zurückgreifen. Diese Prinzipien könnten nicht nur durch einen positivistischen Herkunftstest identifiziert werden. Dazu müsse der Jurist vielmehr moralische Erwägungen anstellen9. 2. Auch in schwierigen Fällen existiere eine allein richtige Entscheidung 10 . Diese Entscheidung sei zwar nicht aufgrund von Rechtsregeln, wohl aber aufgrund von Prinzipien gegeben. Der Richter habe kein Ermessen, sondern sei durch die Prinzipien gebunden. 3. Auch in schwierigen Fällen erfinde der Richter folglich seine Antwort nicht, sondern entdecke anhand der Prinzipien, welche Rechte die Parteien bereits haben 11 . I I I . Die Begründung dieser Kritik durch Dworkin 1. Die Unterscheidung zwischen Rechtsregeln und Prinzipien
Dworkin unterscheidet zwischen Rechtsregeln und Prinzipien als zwei Arten von Rechtsquellen 12 . Eine Rechtsregel wäre z.B. die Bestimmung, daß ein Testament zu seiner Gültigkeit der Unterschrift dreier Zeugen bedarf 13 . 7
Vgl. Dworkin , Bürgerrechte, S. 47. Dworkin, Bürgerrechte, S. 89. Vgl. auch S. 47. 9 Vgl. Dworkin, Bürgerrechte, S. 124. In der Abhandlung „Regelmodell I " (v.a. S. 54-90) betrachtet Dworkin die Prinzipien als Bestandteile des Rechts, während er im „Anhang: Entgegnung auf Kritiker", S. 549, sich nicht darauf festlegen will, ob Prinzipien dem Recht oder der Moral (in welchem Sinne auch immer) oder beiden zusammen angehören. Ich spreche daher im folgenden nur von Prinzipien, nicht von Rechtsprinzipien. 10 Unten I I I 3. 11 Unten I I I 3. 12 Dworkin, Bürgerrechte, S. 54ff., 130ff. 8
Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus
309
Ein Richter, der über die Gültigkeit eines Testaments zu entscheiden hat, kann ein von nur zwei Zeugen unterzeichnetes Testament unmöglich als gültig betrachten. „Regeln sind in der Weise des Alles-oder-Nichts anwendbar. Wenn die Tatsachen, die eine Regel als Bedingungen festsetzt, gegeben sind, dann ist die Regel entweder gültig - in diesem Fall muß die Antwort, die sie liefert, akzeptiert werden - , oder sie ist nicht gültig, und dann trägt sie nichts zur Entscheidung bei" 1 4 . Charakteristisch für Regeln ist auch ihr Kollisionsverhalten: „Wenn zwei Regeln miteinander in Konflikt stehen, dann kann eine von ihnen keine gültige Regel sein. Welche von ihnen gültig und welche aufgegeben werden oder umgeformt werden muß, muß durch Bezugnahme auf Erwägungen entschieden werden, die über die Regeln selbst hinausgehen 15 . Dies kann z.B. durch Bezugnahme auf eine andere Regel geschehen wie diejenige, daß neues Recht altes bricht. Ganz anders ist die Funktionsweise von Prinzipien: Ein Prinzip wie: „Niemand darf von seinem eigenen Vergehen profitieren" 16 verhindert nicht unter allen Umständen, daß jemand doch aus seinem eigenen Vergehen Nutzen ziehen kann. Dworkin erwähnt als Beispiel: „Wenn jemand unter Vertragsbruch eine Anstellung aufgibt, um eine besser bezahlte Stellung anzunehmen, kann es sein, daß er seinem ersten Arbeitgeber Schadenersatz bezahlen muß, aber er hat normalerweise den Anspruch, sein neues Gehalt zu behalten" 17 . Allgemein gesprochen gibt ein Prinzip einen Grund an, der ein Argument in eine bestimmte Richtung ist, der aber nicht eine bestimmte Entscheidung notwendig macht 18 . Auch in ihrem Kollisionsverhalten unterscheiden sich Prinzipien von den Regeln: Wenn zwei Prinzipien sich widersprechen, dann ist nicht wie im Falle von Regeln - nur das eine auf Kosten des andern gültig, sondern die Entscheidung muß aufgrund des „relativen Gewichts" beider Prinzipien zueinander erfolgen 19 . Alexy hat in Weiterführung des Dworkin'schen Gedankens aufgezeigt, daß Prinzipien etwas gebieten, was mehr oder weniger stark erfüllt werden kann 20 , 13
Dworkin , Bürgerrechte, S. 59. Dworkin , Bürgerrechte, S. 58. Zu Recht bemerkt Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 153, dazu einschränkend: „Einen derart abgeschlossenen und statischen Charakter haben auch die ,strikten' Rechtsnormen mit Wenn-Dann-Struktur bekanntlich nicht. Vielmehr ist es häufig nötig und möglich, angesichts neuer Fälle den gesetzlichen Tatbestand im Lichte des Normzweckes erweiternd oder einschränkend auszulegen." 15 Dworkin , Bürgerrechte, S. 62. Dazu ist allerdings nach Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 153, einschränkend zu sagen, daß ein Widerspruch zwischen Normen vielfach dadurch ausgeräumt werden kann, daß die eine Norm als Ausnahme der andern verstanden wird. 16 Dworkin, Bürgerrechte, S. 60 17 Dworkin, S. 60. 18 Dworkin, Bürgerrechte, S. 60. Hervorhebung durch Verf. 19 Vgl. Dworkin, Bürgerrechte, S. 62. 20 Alexy, RECHTSTHEORIE Beiheft 1 (1979), S. 79f. 14
310
Walter Ott
daß Prinzipien m.a.W. Optimierungsgebote enthalten. Demgegenüber kann einer Regel nur entweder gefolgt oder nicht gefolgt werden 21 . 2. Das Auffinden der maßgebenden Prinzipien
Weiter ist nun zu fragen, wie sich die maßgebenden Prinzipien nach Dworkin auffinden lassen. Zunächst erkennt auch Dworkin an, daß Prinzipien kodifiziert sein können 22 . Was gilt aber für die anderen Prinzipien, bei denen dies nicht der Fall ist? Nach Dworkin ist ein Prinzip „ein Rechtsprinzip, wenn es in der treffendsten Rechtstheorie, die sich als Rechtfertigung der expliziten festen und institutionellen Regeln der betreffenden Rechtsprechung angeben läßt, eine Rolle spielt" 23 . Die Prinzipien einer solchen Rechtstheorie müssen „die bestehenden Regeln dadurch zu rechtfertigen versuchen, daß sie die politischen oder moralischen Anliegen und Traditionen der Gemeinschaft auszumachen versuchen, die nach Meinung des Juristen, um dessen Theorie es sich handelt, die Regeln tatsächlich stützen. Dieser Rechtfertigungsprozeß muß den Juristen tief in die politische und moralische Theorie führen und über den Punkt hinaus, wo es richtig wäre zu sagen, daß ein ,Test' durch die ,Herkunft' existiert, mit dem sich bestimmen läßt, welche von zwei verschiedenen Rechtfertigungen unserer politischen Institutionen die überlegene ist" 2 4 . Hier nimmt Dworkin eine Differenzierung vor, weil eine bestimmte Rechtfertigung in zweierlei Hinsicht „besser" sein kann als eine andere: „Sie könnte sich als besser passend erweisen in dem Sinn, daß bei ihr weniger Material als ,Fehler' aufgefaßt werden müßte, oder sie könnte sich als moralisch zwingendere Rechtfertigung erweisen, weil sie einer Erfassung der richtigen politischen Moral näherkommt" 25 . In einem solchen Falle konkurrierender Rechtfertigungstheorien liefert die „moralisch stärkste" Theorie die beste Rechtfertigung, „obwohl sie mehr Entscheidungen als Fehler darstellt als die anderen" 2 6 . Darin liegt jedoch eine Schwachstelle in Dworkins Versuch, den Rechtspositivismus zu widerlegen 27 . Denn entweder rechtfertigt eine Theorie die bestehenden Institutionen, ohne sie zu kritisieren, d.h. sie paßt zum empirisch gegebenen Rechtsmaterial. Damit wäre jedoch lediglich (aber immerhin) eine Verbindung zwischen dem positiven Recht, wie es ist, und der Tiefenstruktur 21 Alexy, S. 79f. 22 Das geht aus seinen Ausführungen S. 63 hervor. Ein Beispiel wäre etwa GG 1 I Satz 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar." 23 Dworkin , Bürgerrechte, S. 122f. 24 Dworkin, Bürgerrechte, S. 124. 25 Dworkin, Bürgerrechte, S. 543. Hervorhebung durch Verf. 26 Dworkin , Bürgerrechte, S. 544. 27 Darauf macht Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 156f., aufmerksam.
Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus
311
dieses positiven Rechts, wie es ist, dargetan. So läßt sich mit Anspruch auf Objektivität und ohne moralische Eigenwertung feststellen, daß den Normen des schweizerischen Rechts über die Vertragsfreiheit 28 und das Eigentum 29 das Prinzip der Privatautonomie zugrundeliegt. Oder: Den modernen Strafrechtsordnungen liegt das Schuldprinzip zugrunde 30 ; zum Rechtssystem des Nationalsozialismus gehörten das Rassen- und das Führerprinzip als Prinzipien positiven Rechts 31 . - Diese Beispiele zeigen, daß der Positivist in solchen Fällen durchaus ein Herkunftskriterium anführen kann: Prinzipien lassen sich nicht nur direkt in positivierten Rechtsvorschriften oder in der Gestalt von rationes decidendi in Präjudizien nachweisen, sondern häufig auch indirekt durch Abstraktionen aus positiven Rechtsnormen und Präjudizien 32 . Erst wenn dies nicht möglich ist, muß nach positivistischer Auffassung eine explizite moralische Eigenwertung des Richters, die eine Ermessensentscheidung darstellt, Platz greifen. Die andere Möglichkeit besteht darin, daß eine Theorie die bestehenden Institutionen kritisch reflektiert, d.h. zum Teil in Frage stellt. Sie paßt also zum Teil nicht zum empirisch gegebenen Rechtsmaterial. In einem solchen Falle ist aber gerade die positivistische Trennungsthese wieder sinnvoll, d.h. die Unterscheidung zwischen dem positiven Recht, wie es ist, und dem Recht, wie es aufgrund einer solchen rechtfertigenden Theorie sein sollte. 3. Die These von der allein richtigen Entscheidung auch in schwierigen Fällen
Die Gesetzespositivisten, vorab Bergbohm, vertraten das Dogma von der Lückenlosigkeit des im Gesetz zum Ausdruck kommenden Rechtes 33 . Diese Auffassung darf schon seit langem als überwunden gelten 34 . Dworkin entwikkelt nun ebenfalls eine Art von Lückenlosigkeitsdogma, freilich auf der Ebene der Prinzipien. Er vertritt nämlich die Auffassung, daß die Rechtsordnungen moderner Industriestaaten auch in schwierigen Fällen stets eine richtige Ent28 OR 19 I. 29 B V 22ter und Z G B 641-729. 30 Vgl. Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 157, zum Strafrecht der BRD. 31 Alexy, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 22. Das Beispiel nationalsozialistischer Prinzipien zeigt, daß auch Prinzipien von einem höheren Standpunkt aus als höchst „unmoralisch" betrachtet werden können, was gerade für, nicht gegen die Trennungsthese spricht. 32 Vgl. Weinberger, Gedächtnisschrift für René Marcie, S. 500f. Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 157, spricht in solchen Fällen von einem Kriterium mittelbarer Herkunft. Nach MacCormick, Legal Reasoning, S. 233, gehören Prinzipien dann zum Recht, wenn sie sich als Gründe für die nach der Erkenntnisregel Harts identifizierten Regeln anführen lassen. Als Beispiel erwähnt er das Apartheid-Prinzip des südafrikanischen Rechts (S. 238f.). 33 Vgl. Ott (FN 5), S. 44f. 34 Vgl. Ott, ebd., S. 231 ff.
312
Walter Ott
Scheidung beinhalten 35 . Auf alle praktischen Fragen gibt es im nahtlosen Gewebe unseres Rechts eine richtige Antwort 3 6 . Auch in schwierigen Fällen bleibe es Pflicht des Richters herauszufinden, „welches die Rechte der beiden Seiten sind; und nicht rückwirkend neue Rechte zu erfinden" 37. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Wenn zwei Prinzipien im Widerstreit liegen, hat der Richter eine Abwägung vorzunehmen. Um zu einer Entscheidung zu kommen, muß er eine Präferenzrelation festlegen, d.h. er muß festlegen, unter welchen Bedingungen das eine Prinzip dem andern vorgehen soll. Und diese Festlegung kann nun nicht den Prinzipien selbst entnommen werden 38. Dabei handelt es sich um eine selbständige, von der Frage der Identifikation der maßgeblichen Prinzipien unabhängige Entscheidung. Zu Recht kritisiert Alexy: „Eine perfekte Theorie der Prinzipienrelationen wäre eine Theorie, die alle denkbaren Prinzipienrelationen einschließt. Diese Theorie enthielte die Lösung eines jeden Falles. Eine solche Theorie ist jedoch nicht nur faktisch nicht zu erstellen, sie wäre auch keine eigentliche Prinzipientheorie mehr, sondern ein /fege/system, das alles erfaßt, also ein 39 perfekter KodifikationswoxscYüdig" . Daß es eine allein richtige Antwort im Bereiche der Prinzipien nicht geben kann, liegt also gerade im Charakter der Prinzipien begründet, wie Dworkin ihn aufgezeigt hat 40 . Allerdings erkennt Dworkin durchaus an, daß Juristen in Prinzipienfragen verschiedener Meinung sein können 41 , ja er erkennt sogar an, daß selbst wenn eine Antwort die richtige ist, es „keine Möglichkeit gibt zu beweisen, daß sie die richtige ist" 4 2 . Trotzdem beharrt er auf seiner These von der allein richtigen Antwort, weil eine Aussage auch dann wahr sein könne, wenn es kein Verfahren gebe, mit dem sich die Wahrheit der Aussage beweisen lasse43. Dies wird man hinzunehmen haben, doch fragt es sich, ob es sinnvoll ist, eine Theorie auf so unsicherem Grund aufzubauen. Nehmen wir z.B. an, das Schweizerische Bundesgericht habe darüber zu befinden, ob ein bisher nicht anerkanntes Grundrecht in den Katalog der ungeschriebenen Grundrechte aufzunehmen sei. Es ist anzunehmen, daß einige Staatsrechtslehrer eine Theorie entwickeln werden, die dieses umstrittene Grundrecht enthält; andere Staatsrechtslehrer werden eine gegenteilige 35
Dworkin , Bürgerrechte, S. 449ff. Dworkin , Essays in Honour of H . L . Α . Hart, Oxford 1977, S. 84. 37 Dworkin, Bürgerrechte, S. 144. Hervorhebung durch Verf. 38 Vgl. Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 159. 39 Alexy, RECHTSTHEORIE Beiheft 1 (1979), S. 84. Hervorhebung durch Verf. 40 Koch, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 159. Auch MacCormick, Legal Reasoning, S. 251, kommt zu dem Schluß, eine allein richtige Lösung könne es in schwierigen Fällen nicht geben. 41 Dworkin, Bürgerrechte, S. 144, 449ff. 42 Dworkin, Bürgerrechte, S. 450. 43 Sinngemäß Bürgerrechte, S. 145, 453. 36
Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus
313
Theorie entwickeln, derzufolge dieses Grundrecht in der Schweiz nicht existiert. Nach Dworkins Theorie müßte man annehmen, daß die einen Staatsrechtslehrer sich irren, die anderen dagegen nicht, wobei aber nicht festzustellen wäre, welche Seite recht hat. Nehmen wir weiter an, das Bundesgericht erkenne in einer umstrittenen Beratung dieses neue Grundrecht an. Würde damit feststehen, daß die Richter, die in der Minderheit geblieben sind, sich geirrt haben? Mitnichten, denn auch jetzt bestünde die Möglichkeit, daß die Mehrheit sich geirrt hat und fälschlicherweise an die Existenz dieses Grundrechts „geglaubt" hat, während die Minderheit richtigerweise erkannt hat, daß es dieses Recht in der Schweiz gar nicht „gibt". Es fragt sich, ob eine solche Sicht der Dinge realistisch ist. Verkennt sie nicht die politische Funktion der Verfassungsrechtsprechung? Liegt hier nicht die positivistische Auffassung näher, derzufolge die Anerkennung eines neuen ungeschriebenen Grundrechtes ein gesetzgebungsähnlicher A k t ist und daß es folglich dieses Grundrecht vor der Anerkennung durch das Bundesgericht in der Schweiz nicht gibt? Ist es nicht eine alltägliche Erfahrung des Juristen, daß man in schwierigen Rechtsfragen in guten Treuen verschiedener Ansicht sein kann, ohne daß der einen oder anderen Seite ein eigentlicher „Irrtum" vorzuwerfen wäre? Erklärt diese Erfahrung nicht auf natürliche Weise die Meinungsverschiedenheiten der Staatsrechtslehrer und Richter? Hat nicht die Rechtsprechung in solchen Fällen die Funktion einer eigenständigen Rechtsquelle? I V . Widerlegung der positivistischen Trennungsthese? Zum Schluß sei die Frage aufgeworfen, ob es Dworkin gelungen ist, die positivistische Trennungsthese zu widerlegen. Als Anschauungsmaterial wähle ich das schweizerische Eherecht: Das Eherecht von 1907 enthielt eine gesetzliche Rollenverteilung, die „dem Mann den Vorrang und die Hauptverantwortung für die Gemeinschaft und der Frau eine Position relativer Unterordnung" zuteilte 44 . Dabei handelte es sich um ein Relikt eines patriarchalischen Familienrechts. In der Gesellschaft dagegen vollzog sich allmählich ein Wandel in Richtung einer Gleichstellung von Mann und Frau. A m 22. September 1985 nahmen die Stimmbürger und -bürgerinnen mit 921743 Ja gegen 762619 Nein ein neues Eherecht an 45 , welches die Gleichstellung der Geschlechter weitgehend verwirklicht und das am 1. Januar 1988 in Kraft getreten ist. Dieses Beispiel veranschaulicht, daß nach wie vor an der Trennungsthese in der Version einer Trennung zwischen dem positiven Recht, wie es ist, und dem Recht, wie es nach der positiven Moral, 44 45
C. Hegnauer, Grundriß des Eherechts, I . A . , Bern 1979, S. 93. C. Hegnauer / P. Breitschmid, Grundriß des Eherechts, 2. Α . , Bern 1987, S. 30.
314
Walter Ott
d.h. nach den in der Gesellschaft herrschenden moralischen Anschauungen sein sollte, festgehalten werden kann. Es läßt sich doch - trotz der Kritik Dworkins - nach wie vor unterscheiden zwischen dem positiven Eherecht (mit dem patriarchalischen Prinzip als Hintergrundstruktur), wie es bis zum 31. Dezember 1987 galt, und dem Eherecht (mit dem Gleichberechtigungsprinzip als Hintergrundsstruktur), wie es spätestens seit dem 22. September 1985 nach den herrschenden moralischen Anschauungen der Bevölkerung sein sollte. Diese Fassung der Trennungsthese ist also nicht widerlegt. Wie verhält es sich mit der Trennungsthese in der Version, daß zu unterscheiden sei zwischen dem Recht, wie es ist, und einem Naturrecht? Auch hier läßt sich doch nach wie vor unterscheiden etwa zwischen dem positiven Eherecht (mit dem Gleichberechtigungsprinzip als Hintergrundstruktur), in Kraft seit dem 1. Januar 1988, und dem Recht, wie es z.B. nach der aristotelischen Naturrechtslehre sein sollte. Nach Aristoteles sind überall in der Natur Herrschaftsverhältnisse anzutreffen. So herrsche im Menschen die Seele über den Leib, und unter den lebendigen Wesen sei der Mensch Herrscher der Tiere. „Ferner verhält sich das männliche Geschlecht so zum weiblichen. Das männliche ist von Natur das bessere, das weibliche das schlechtere, weshalb ersteres herrscht und letzteres beherrscht wird" 4 6 . - Auch diese Fassung der Trennungsthese scheint mit folglich nicht widerlegt zu sein. Worum es Dworkin beim Prinzipienargument geht, ist der Nachweis einer Verbindung zwischen dem positiven Recht und seiner Hintergrundstruktur, die weder mit einem Naturrecht 47 noch mit den herrschenden moralischen Anschauungen der Bevölkerung 48 identisch ist. Es ist vorne angedeutet worden 49 , was für eine Antwort man darauf vom positivistischen Standpunkt aus geben könnte. Die beiden herkömmlichen Fassungen der Trennungsthese beziehen sich jedenfalls nicht darauf und sind daher durch das Prinzipienargument nicht widerlegt.
46
Aristoteles, Politik, 1254b. MacCormick, RECHTSTHEORIE 11 (1980) S. 2 mit Nachweisen. 48 Dworkin, Bürgerrechte, S. 218: „Die Moral der Gemeinschaft ist . . . nicht die Summe oder Verbindung oder Funktion der konkurrierenden Behauptungen ihrer Mitglieder". Er umschreibt diese „community morality", ebd., S. 215, als die politische Moral, „die von den Gesetzen und Institutionen der Gemeinschaft vorausgesetzt wird." 49 Oben III.2. 47
Zur Kritik Ronald Dworkins am Rechtspositivismus
315
Literaturverzeichnis Alexy, R.: Zum Begriff des Rechtsprinzips, in: W. Krawietz / K. Opalek / Α . Peczenik / Α . Schramm (Hrsg.), Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz, RECHTSTHEORIE Beiheft 1 (1979), 58 ff. — Zur Kritik des Rechtspositivismus, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 9ff. Baurmann, M. / Kliemt, H.: Rechtspositivismus auf die leichte Schulter genommen?, in: Oesterreichische Zeitschrift für Soziologie 10 (1985), 121 ff. Bydlinski, F.: Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, Wien/New York 1982, 221 ff., 236ff., 248ff., 289f. — Fundamentale Rechtsgrundsätze. Zur rechtsethischen Verfassung der Sozietät, Wien/New York 1988. Dreier, R.: Der Begriff des Rechts, NJW 39 (1986), 890ff., 892f. — Neues Naturrecht oder Rechtspositivismus? In Erwiderung auf W. Krawietz, RECHTSTHEORIE 18 (1987), 368ff., 378f. Dworkin, R.: Bürgerrechte ernstgenommen, Frankfurt a.M. 1984. — No Right Answer?, in: P.M.S. Hacker / J. Raz (Hrsg.), Law, Society and Morality, Essays in Honour of H . L . Α . Hart, Oxford 1977, 58ff. Hart, H.L.Α.: 147 ff.
Legal duty and legal obligation, in: H . L . A . Hart, Essays on Bentham,
Hoerster, N.: Zur Verteidigung des Rechtspositivismus, NJW 39 (1986), 2480ff. Koch, H.-H.: Zur Methodenlehre des Rechtspositivismus. Das Prinzipienargument eine methodische Widerlegung des Rechtspositivismus?, ARSP Beiheft 37 (1990), S. 152 ff. Krawietz, W.: Neues Naturrecht oder Rechtspositivismus?, Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Begriff des Rechts bei Ralf Dreier und Norbert Hoerster, RECHTSTHEORIE 18 (1987), 209ff., 222ff. MacCormick, N.: Wie ernst soll man Rechte nehmen?, RECHTSTHEORIE 11 (1980), Iff. — Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford 19'78, ch. 9, zit. Legal Reasoning. Weinberger, O.: Die Naturrechtskonzeption von Ronald Dworkin, in: D. Mayer-Maly / P. M. Simons (Hrsg.), Das Naturrechtsdenken heute und morgen, Gedächtnisschrift für René Marcic, Berlin 1983, 496ff.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre Von Gregorio Robles, Madrid In der vorliegenden Abhandlung versuche ich, die immanente Kritik an der Reinen Rechtslehre weiter zu verfolgen und zu ergänzen 1. Dabei konzentriere ich mich auf vier Hauptprobleme, die sich hinsichtlich jeder Theorie stellen können. Es handelt sich um folgende: Das Problem der Legitimität, das Problem der Angemessenheit, das Problem der Kohärenz und das Problem der Idoneität. Sie alle sind für eine immanente Kritik der Reinen Rechtslehre unentbehrlich. I. Das Problem der Legitimität der Reinen Rechtslehre Eine Theorie ist dann gerechtfertigt, wenn sie den mit ihr intendierten Erkenntniszweck erfüllt. Um dies festzustellen, muß man prüfen, ob zwischen dem, was die Theorie als Methode und System tatsächlich leistet, und dem, was sie zu leisten vorgibt, eine Entsprechung besteht. Die Finalität, die der Reinen Rechtslehre von ihren Schöpfern (den Begründern der Wiener rechtstheoretischen Schule) zugewiesen wird, ist die Konstruktion einer allgemeinen Rechtstheorie, genau genommen: der vollkommensten, strengsten und überzeugendsten Theorie überhaupt, die den Juristen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen kann. Es war immer das ständige Bemühen Kelsens, den Juristen geeignetes theoretisches Werkzeug zu verschaffen, um die Rechtswissenschaft auf das Niveau der „echten" Wissenschaften in der Auffassung des Positivismus zu erheben. Das Problem der Legitimität der Reinen Rechtslehre besteht darin, ob sie tatsächlich eine allgemeine Rechtstheorie ist: Die Aufgabe ist nun herauszufinden, worin diese Allgemeinheit besteht, wenn man von dieser wissenschaftlichen Disziplin spricht, und ob man diese Allgemeinheit im Hinblick auf die zu überprüfende Theorie vertreten kann. Was eine allgemeine Rechtstheorie und welches ihre Problemgebiete sind, sind Fragen, die eine ausgedehnte Debatte aufwerfen können, sofern man das Wie zu spezifizieren versucht, d.h. den konkreten Weg, den man zurücklegen
1 Vgl. G. Robles, La teoria de la norma juridica en Hans Kelsen. Consideraciones criticas, in: G. Robles, Epistemologia y Derecho, Madrid 1982, S. 131 - 150.
318
Gregorio Robles
muß, um die Theorie aufzubauen. Geringere Schwierigkeiten stellt notwendigerweise das Was. Jeder Jurist hat das Recht, von einer allgemeinen Rechtslehre eine Antwort auf alle theoretischen Probleme zu erwarten, die den verschiedenen Funktionen, die er als Jurist erfüllt, zugrunde liegen. Dieses pragmatische Kriterium stellt den Schlüssel zu der Allgemeinheit dar. In diesem Sinn läßt eine echte allgemeine Rechtstheorie keine Gebiete außer acht, die zur Theorie gehörend mit den verschiedenen Funktionen der Juristen als solche direkt in Verbindung stehen. Man kann drei verschiedene Sprachebenen der Juristen unterscheiden, die wiederum drei verschiedenen intellektuellen Funktionen in Beziehung zum Recht entsprechen: Das Niveau der logisch-formalen Analyse, das Niveau der Rechtsdogmatik und das Niveau der Rechtsentscheidung2. Die Juristen wenden entweder die begriffliche und strukturelle Analyse des Rechts an, oder den dogmatischen Kommentar einer bestimmten Rechtsordnung, oder aber sie nehmen am Verfahren der Rechtserzeugung teil. Eine wirklich allgemeine Rechtstheorie muß die entsprechenden theoretischen Werkzeuge verschaffen, um diese drei Aufgaben auszuführen. Sollte sie die besagten Aufgaben nicht erfüllen können, ist sie eben keine echte allgemeine Theorie mehr, sondern eine Theorie, die nur Teilaspekte erklärt. Die logisch-formale Analyse des Rechts erfordert die formale Untersuchung der Rechtsregeln und des durch diese Regeln gebildeten Systems sowie die Untersuchung der juristischen Grundbegriffe. Die Theorie der Rechtsdogmatik hat zur Aufgabe, die Art zu bestimmen, in der die Juristen die juristischen Texte zu interpretieren haben, wobei der Ausdruck „Text" in einem weiteren Sinn zu verstehen ist 3 . Die Frage, ob die Rechtsdogmatik eine Wissenschaft ist oder nicht, hat hier keine spezielle Bedeutung, da den Rechtsdogmatiker ausschließlich eine möglichst genaue und strenge Behandlung des komplexen Rechtsstoffes interessiert. Eine Theorie der Rechtsdogmatik muß dem Juristen die notwendigen theoretischen Werkzeuge verschaffen, um diese Aufgabe entsprechend erfüllen zu können. Die Theorie der Rechtsentscheidung stellt das dritte Niveau dar. Dieses Niveau muß sich sehr genau von dem dogmatischen Niveau unterscheiden, da es nicht dasselbe ist, Recht zu erzeugen (und „anzuwenden"), wie es auszulegen. Die Entscheidungsprozesse im Rechtsbereich sind vielfältig und von sehr verschiedener Bedeutung. Daher muß sich die Theorie der Rechtsentscheidung sowohl mit den Problemen der sogenannten Gesetzgebungslehre als
2 Vgl. Robles, Las réglas del derecho y las reglas de los juegos, Palma de Mallorca 1984: dt.: Rechtsregeln und Spielregeln, Wien/New York 1987, S. 223ff. Robles, Introducción a la teoria del derecho, Madrid 1988, S. 151 - 169. 3 Robles, Sein, Müssen und Sollen im Recht, in: RECHTSTHEORIE 17 (1986), S. 279ff.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
319
auch mit denen der individuellen Rechtsentscheidung befassen. Es fällt deshalb nicht zuletzt in den Bereich einer Theorie der Rechtsentscheidung, sich über die Probleme der Entscheidungskriterien (Werte, Grundsätze) Gedanken zu machen. Eine echte allgemeine Rechtstheorie muß die drei genannten Zwecke erfüllen. Darin besteht die pragmatische Funktion und die Rechtfertigung ihres Anspruchs, den Juristen bei der Ausführung ihrer verschiedenen Funktionen nützlich zu sein. Jede allgemeine Rechtstheorie fächert sich also auf in: - eine Theorie der Rechtsregeln, - eine Theorie des Rechtssystems, - eine Theorie der Rechtsbegriffe, - eine Theorie der Rechtsdogmatik, - eine Theorie der Rechtsentscheidung. Es kommt nun aber häufig vor, daß Theorien, die sich selbst als „allgemeine Rechtstheorien" bezeichnen, die genannten Teilgebiete nicht abdecken. Das ist der Fall bei der Reinen Rechtslehre, die weder eine Theorie der Rechtsdogmatik, noch eine Theorie der Rechtsentscheidung beinhaltet. Die Reine Rechtslehre gehört zum ersten Niveau (das Niveau der logisch-formalen Analyse), vernachlässigt jedoch die anderen beiden Problemebenen. Sie stellt sowohl eine Theorie der juristischen Regeln und des Systems, als auch der Rechtsbegriffe dar, aber man würde in ihr vergeblich nach Lösungen für Fragen suchen, die sich dem Dogmatiker oder dem Praktiker stellen. Daher können wir sagen, daß die Reine Rechtslehre den Anforderungen der Juristen bei der Ausführung ihrer verschiedenen Aufgaben nicht gerecht werden kann. Wenn man, wie vereinbart, nur die Disziplin als allgemeine Theorie bezeichnen will, die sich mit all diesen Problemen beschäftigt, dann muß man akzeptieren, daß die Reine Rechtslehre keine allgemeine Rechtstheorie ist, obwohl sie sich selbst als solche darstellt bzw. als solche beurteilt wird. Das hier Gesagte darf nun nicht so interpretiert werden, als ob jegliche intellektuelle Annäherung an das Recht notwendigerweise „allgemein" sein müßte, um Wert zu haben, und deshalb einseitige Annäherungen nicht erlaubt waren. Es ist aber unzulässig, daß sich etwas als allgemein präsentiert, was nur einseitig ist. Einen Problembereich begrenzt zu analysieren, ist nicht nur erlaubt, sondern sogar die Vorbedingung für den späteren Gesamtüberblick. Aber die Beschränktheit der Analyse muß bewußt bleiben und darf nicht den Anspruch auf „Allgemeinheit" erheben. Eine bestimmte Rechtslehre kann sich auf die logisch-formale Analyse beschränken und es ist ihr Recht, das zu tun. Aber was sie nicht machen kann, ist, Ansprüche zu erheben, die ihr in keiner Weise zustehen. Das vorher Gesagte darf nicht in dem Sinn verstanden werden, als ob der richtige Weg durch andere Positionen erreicht werden kann, welche Kelsen selbst als „methodischen Synkretismus" bezeichnen würde, so wie es bei den
320
Gregorio Robles
sogenannten Dreidimensionalitätstheorien der Fall ist. Auch ich bin der Meinung, daß jeder methodische Synkretismus zu verwerfen ist, weil er lediglich zur Verwirrung führt. Meiner Ansicht nach besteht das Problem der allgemeinen Rechtstheorie darin, eine Methode zu finden, die, ohne synkretistisch zu sein, die Möglichkeit gibt, die genannten Problembereiche zu erfassen. Diese Problematik kann meiner Ansicht nach durch die von mir bezeichnete Analyse der Sprache der Juristen gelöst werden. Diese Analyse befaßt sich mit der Pluridimensionalität der juristischen Sprache, nicht mit der Pluridimensionalität der Rechtserscheinung. Diese Auffassung ermöglicht es, daß die allgemeine Rechtstheorie eine streng juristische Disziplin ist, d. h. eine eng mit den Aufgaben der Juristen verbundene Disziplin. In der Annahme, daß keine dieser Aufgaben vernachlässigt wird, und alle in der besagten Analyse ihren Platz finden können, erreicht man eine wirklich allgemeine Rechtstheorie. Das ist nicht der Fall bei der Reinen Rechtslehre, die, obgleich sie einen bewundernswerten Fortschritt bedeutet, aufgrund ihrer eigenen Stellungnahme die verschiedenen Aspekte, die mit der Sprache der Juristen verflochten sind, unberücksichtigt lassen muß. Die Reine Rechtslehre enthält weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Theorie der Rechtsdogmatik. Das weiß jeder Jurist, der versucht hat, auf die Reine Rechtslehre eine Methodologie zu gründen, die für seine spezifische dogmatische Disziplin nützlich wäre. Daher der häufige Vorwurf des „Formalismus" gegenüber der Reinen Rechtslehre. Dazu muß man erwähnen, daß dieser Vorwurf zwar einerseits zu Recht besteht (obgleich die Art und Weise, wie er vorgebracht wird, nicht sehr passend erscheint), aber andererseits im Hinblick auf die Erkenntnismöglichkeiten der formalistischen Sichtweise ungerecht und verwirrend ist. Der Vorwurf ist begründet, soweit man zu zeigen versucht, daß eine formalistische Theorie (oder eine im wesentlichen formalistische Theorie wie die Reine Rechtslehre) aufgrund der ihr immanenten Eigenschaften das Problem der Rechtsdogmatik nicht lösen kann. Im Bereich der Rechtsdogmatik verwendet man nicht direkt Begriffe eines hohen Abstraktionsniveaus (auch wenn man sie indirekt voraussetzt), sondern Sinninhalte von Rechtsregeln einer bestimmten Rechtsordnung. Der Vorwurf ist gerechtfertigt, wenn man damit sagen will, daß die Reine Rechtslehre als formalistische Theorie dem Juristen, der sich mit dem Rechtsstoff einer bestimmten Rechtsordnung befaßt, nicht genügend positives Werkzeug vermittelt. Die dogmatische Aufgabe setzt die formale Analyse voraus, denn jegliche Rechtsdogmatik beinhaltet, obgleich nicht ausdrücklich formuliert, eine bestimmte Auffassung der Struktur der Rechtsordnung. Aber von der formalen Analyse selbst ist nicht mehr zu erwarten. Die formale Analyse verschafft der Dogmatik die Grundstruktur des Rechts, deren Sinn sie zu erfüllen hat, aber sie versorgt sie nicht
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
321
mit den erforderlichen Interpretationsinstrumenten, gerade weil sie mit den Sinngehalten nichts zu tun hat. Aber mit dem genannten Vorwurf will man normalerweise mehr ausdrükken, nämlich, daß alle formalistischen Theorien, gleich welcher Prägart, zu verwerfen sind. Jede derartige Theorie - so das Argument - ist für den Juristen unbrauchbar, sofern er sich mit einem Rechtstext auseinandersetzen muß, der nicht einfach formalistisch expliziert und systematisiert werden kann. Dabei benutzt man dasselbe Argument, jedoch verschärft, da es nicht die Möglichkeit von formalistischen Stellungnahmen, die ihre Grenzen kennen, annimmt. Da der bloße Formalismus die Sinngehalte ausklammere, habe er in einer Disziplin, die immerzu mit Sinngehalten befaßt sei, nichts zu suchen. Diese Betrachtungsweise ist jedoch simpel und irreführend, da nur durch die formalistische Analyse die interne Rechtsstruktur erforscht werden kann. Aufgrund des Verständnisses der Struktur und der formalen Bestandteile des Rechts ist der Dogmatiker besser in der Lage, seinen konkreten Rechtsstoff zu ordnen. Die logisch-formale Analyse - darauf möchte ich noch einmal hinweisen - ist ein notwendiges und vorausgehendes Instrument für die Rechtsdogmatik, deren Aufgabe darin besteht, die Bedeutungen der sprachlichen Propositionen, die den Rechtsstoff ausmachen (den „Rohtext") in das vorherige Schema (die interne Struktur des Rechts) einzusetzen, das die besagte Analyse der Rechtsdogmatik verschafft. Ihre Wichtigkeit zu verneinen, bedeutet eine Kurzsichtigkeit, die die Rechtsdogmatik sehr tief und negativ betreffen kann. Es ist noch schlimmer, wenn man glaubt, daß die formale Analyse völlig unnütz ist. In diesem Sinn ist der Vorwurf nicht gerechtfertigt, wenn man damit jede Art von Formalismus überhaupt angreifen will. Die Reine Rechtslehre ist eine grundsätzlich formalistische Auffassung (ich werde später noch darauf eingehen, weshalb ich „grundsätzlich" sage und nicht nur formalistisch), da sie versucht, die interne und formelle Struktur ihres Gegenstands (des Rechts) zu beschreiben. Solange sie sich innerhalb des Formalismus gehalten hat, hat sie den Rechtswissenschaften sehr wichtige Erfolge gebracht. Aber ihr Mangel besteht darin, die Grenzen der formalistischen Analyse nicht erkannt zu haben und nicht gewußt zu haben, eine geeignete Methode zu prägen, in welcher diese ihren eigenen Platz, aber nicht eine Monopolsituation, hätte. Das ist auch der Fall bei der Theorie der Rechtsentscheidung, die in der Reinen Rechtslehre eine bemerkenswerte Abwesenheit aufweist. Kelsen beschränkt sich darauf, den politischen Charakter und deshalb „irrationalen" Charakter jeder Rechtsentscheidung zu unterstreichen, sowie aller möglichen Prinzipien oder Kriterien, die eine derartige Entscheidung beeinflussen können. Ohne Zweifel sind die Probleme, die die formale Analyse aufwirft, ganz anderer Natur als die des rechtspraktischen Diskurses. Man kann auch nicht 21 Festgabe Opalek
322
Gregorio Robles
bezweifeln, daß beide Gebiete verschiedenen Aspekten der Rationalität angehören. Was man aber nicht akzeptieren darf, ist der Stempel der Irrationalität und die praktische Folge desselben: wenn die Werturteile subjektiv sind, ist alles erlaubt. Diese Konsequenz, die wir als Entscheidungsnihilismus bezeichnen können, ist nicht nur gefährlich, sondern auch absurd. Denn welche Art von Spielzeug ist die Vernunft, wenn sie den Menschen nicht dazu dient, ihr Leben in seinen wichtigsten Aspekten zu orientieren? Außerdem erschöpft sich die Entscheidungstheorie nicht in der Auseinandersetzung um materielle Kriterien (Werte, Prinzipien), sondern sie erstreckt sich auch auf die Erforschung der formalen Aspekte der Entscheidung und die ihr zugrunde liegende Logik. Alle diese Probleme liegen außerhalb der Reinen Rechtslehre mit der „Rechtfertigung", daß sie in das Gebiet des Irrationalen fallen. Kelsen behandelt einen sehr engen Begriff der Wissenschaft, was ihm erlaubt, dasjenige außer acht zu lassen, was nicht in seinen Rahmen paßt. Und obgleich er das Recht hat, so zu verfahren, kann er doch nicht beanspruchen, eine allgemeine Rechtstheorie aufgebaut zu haben. Daher glaube ich sagen zu können, daß die Reine Rechtslehre das Problem ihrer Legitimität nicht löst, denn als allgemeine Rechtstheorie erfüllt sie nicht die theoretischen Anforderungen, welche die Juristen von der Dogmatik und Praxis her erwarten müssen. Gegen meine kritische Haltung wäre zu argumentieren, daß Kelsen ein anderes Kriterium der Allgemeinheit im Auge hat, wenn er von der „allgemeinen Rechtslehre" spricht, da sich für ihn diese Disziplin - dem Schema des Positivismus folgend - darauf beschränkt, einen Gegenstand in seiner Allgemeinheit betrachtend zu beschreiben. Besagter Gegenstand ist hier das Recht in toto y nicht eine konkrete Rechtsordnung. Die Betonung der Allgemeinheit liegt daher auf dem Gegenstand, d.h. dem Recht, was bei Kelsen damit gleichzusetzen ist, daß die allgemeine Rechtstheorie versucht, den Begriff des Rechts zu definieren und seine strukturellen Elemente zu erforschen. So betrachtet, verbirgt sich das eigentliche Problem der allgemeinen Rechtstheorie, bei der sich die Bezeichnung „allgemein" nicht auf das „Recht", sondern auf „Theorie" bezieht. Es ist die Theorie, die sich als allgemein erweisen muß, was nichts anderes bedeuten kann, als daß diese Disziplin alle theoretischen Probleme in ihrer Allgemeinheit entsprechend behandeln muß, welche die Juristen direkt betreffen, und daher nicht nur das Problem der Begriffsbestimmung oder eine Beschreibung seiner strukturellen Bestandteile. Wenn man die Beschränktheit der Reinen Rechtslehre erkennt, ist es auch einfach zu verstehen, weshalb in ihr juristische Probleme von großem theoretischen Gewicht und praktischer Relevanz keinen Platz finden 4 . 4 Vgl. Robles, Rechtsregeln (FN 2), S. 223ff. und ders., Introducción a la teoria del derecho, (FN 2), S. 166f.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
323
Um mich in diesem Absatz nicht zu sehr über diese Probleme auszulassen, beziehe ich mich nur auf drei, die in der Reinen Rechtslehre endgültig deplaziert bleiben. Ich beziehe mich auf das Problem der Auslegung, das Problem der Werte und das der Hilfestellung der Rechtssoziologie in bezug auf die Rechtsdogmatik. In der Auslegung liegt zweifellos die Hauptfunktion der Juristen. Sowohl der Rechtstheoretiker als auch der Dogmatiker praktizieren die Auslegung: der erste durch die hermeneutische Rekonstruktion der die sprachlich-logische Struktur des Rechts fundierenden Regeln, der zweite dadurch, das seine Hauptarbeit darin besteht, die juristischen Texte zu verstehen. Die Auslegung gehört aber auch zu den Aufgaben des Praktikers, der sich in seiner Funktion als Gesetzgeber, Richter oder Rechtsanwalt notwendigerweise mit dem Verständnis sowohl der anzuwendenden Texte als auch der Wirklichkeit, auf die sie angewendet werden, beschäftigt. In allen drei Fällen erfüllt der Jurist eine ähnliche Funktion: die des Verstehens, wobei die Auslegung unbedingt erforderlich ist. Es gibt kein Verstehen ohne Interpretation; jede Auslegung ergibt ein spezifisches Verständnis des Textes. In der Reinen Rechtslehre finden wir weder eine allgemeine Theorie des hermeneutischen Verstehens noch eine Theorie der Rechtsauslegung. So etwas wie eine Theorie der hermeneutischen Rekonstruktion der Regeln ist absolut unauffindbar, obgleich Kelsen erkennt, daß die selbständigen Rechtsnormen das Resultat eines Konstruktionsprozesses sind. Außer der Ambivalenz, die er bei diesem Thema zeigt, da er, wie wir später sehen werden, den Unterschied zwischen selbständigen und unselbständigen Normen nicht zufriedenstellend löst, hält er sich nie damit auf zu erklären, worin solche Konstruktion besteht und wie sie auszuführen ist. Das erklärt sich zum Teil damit, daß Kelsen beiläufig von der Notwendigkeit spricht, Rechtsnormen zu konstruieren, generell jedoch benutzt er einen Normbegriff, der keine Konstruktion benötigt. Entsprechend der Auffassung des Positivismus braucht die beschreibende Normenwissenschaft die Normen nicht zu konstruieren, sondern nur zu beschreiben. Da jedoch die Beschreibung nur in Hinblick auf Vorgegebenes möglich ist, im Prinzip also keine Rekonstruktion benötigt, müßten die Normen schon im „Rohtext" vollständig vorhanden sein, mit dem der Jurist arbeitet. Wenn Kelsen sich auf die Konstruktion der Norm bezieht, benützt er eine bequeme Lösung, um augenscheinlich erfolgreich eine Verlegenheit zu überwinden, mehr als um einen bestimmten Normbegriff oder eine Rechtssystemauffassung zu enthüllen. Das wird besonders offenkundig bei dem Unterschied zwischen selbständigen und unselbständigen Normen, wie wir später sehen werden. Auffallend schwach ist der Beitrag der Reinen Rechtslehre im Auslegungsbereich, sowohl auf dem Gebiet der Rechtsdogmatik als auch der Entscheidungsprozesse. Man kann sagen, daß, obgleich die Reine Rechtslehre eine 2*
324
Gregorio Robles
Theorie der Auslegung des Rechts bietet, diese Theorie rein negativ, oder anders ausgedrückt, skeptisch ist. Nach Kelsen ist die Norm ein offener Rahmen für verschiedene Auslegungsmöglichkeiten, und es ist die Aufgabe des Juristen, diese Möglichkeiten alle zu erwägen und darzustellen. Wie das zu machen ist und innerhalb welcher Grenzen, dazu schweigt Kelsen. Die sogenannten „Auslegungsmethoden" erscheinen ihm nur als juristisch-politische Hilfsmittel ohne irgendeinen erkenntnismäßigen Wert. Auf diese Weise vereitelt die Reine Rechtslehre den Weg zu jeglicher Bemühung, eine Methodologie der Rechtsdogmatik zu erarbeiten. Mehr noch, sie erwähnt nicht einmal die Notwendigkeit, eine solche Methodologie aufzubauen. Die Theorie Kelsens ist paradoxerweise unfähig, das methodologische Problem der Rechtsdogmatik zu erfassen, obgleich sie selbst das Erzeugnis einer betonten methodologischen Bestrebung ist. Die Reine Rechtslehre ist weder eine Methodologie der dogmatischen Rechtswissenschaft noch schließt sie diese ein, sondern sie ist allenfalls eine Methode der formalistisch-normativistischen Analyse. Die von ihr geprägte Methode befindet sich in dem ersten der vorhergenannten Niveaus, sie betrifft jedoch eigentlich weder das Niveau der Dogmatik noch der Entscheidung. Hinsichtlich der Entscheidung ist der methodische Nihilismus gleichfalls tonangebend. Das Problem der Rechtsentscheidung interessiert Kelsen im Prinzip nicht. Die Entscheidung ist seiner Meinung nach einfach irrational, weil sie in den Rahmen der Rechtspolitik fällt. Seine enge Rationalitätsauffassung und seine Beschränkung auf die strukturelle Analyse ermöglichen eine entsprechende Behandlung des Auslegungsproblems in den Entscheidungsprozessen nicht. Bezüglich der Werte hat die Reine Rechtslehre nichts zu sagen, auch gerade deshalb nicht, weil sie in dem ersten der erwähnten Niveaus liegt. Man muß in der Tat akzeptieren, daß innerhalb des Rahmens der rein formalen Analyse die Axiologie nicht in Erscheinung tritt. Wie ich schon an anderer Stelle ausgeführt habe 5 , muß man die Theorie der Gerechtigkeit unter entscheidungstheoretischen Gesichtspunkten entfalten. Die Kriterien oder materiellen Prinzipien der Gerechtigkeit sind nur sinnvoll, wenn man sie im Zusammenhang mit den Entscheidungsprozessen, die das soziale Leben der Menschen ordnen, betrachtet. Eine isolierte Diskussion über die Werte ist eine ziemlich sterile Angelegenheit. Und, da die Entscheidungen im Recht sowohl systemexterner als auch systeminterner Natur sind, muß man überdies die systemexterne Gerechtigkeit von der systeminternen Gerechtigkeit unterscheiden. Die Rechtsdogmatik arbeitet auch mit Werten, jedoch nicht in der Absicht, die „korrekten" oder den Entscheidungen angepaßten Werte zu erforschen. 5 Robles, Rechtsregeln (FN 2), S. 225, und ders., Introducción a la teoria del derecho (FN 2), S. 163.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
325
Insoweit sie eine schon festgesetzte Rechtsordnung interpretiert, greift sie auf die in dieser Rechtsordnung enthaltenen Werte zurück, - eine Aktivität, die wertfrei sein kann, oder zumindest vorgibt, es zu sein. Der Reinen Rechtslehre ist diese ganze Wertproblematik allerdings fremd. Es ist gerechtfertigt zu fragen, ob diese Ausschließung ohne weiteres legitim ist, oder ob sie im Gegensatz einer zu knappen und daher irrtümlichen Stellungnahme entspricht. Kelsens Einstellung zu diesem Punkt ist sehr deutlich: das Thema der Gerechtigkeit, sagt er, ist ein ideologisches Thema und als solches gehört es nicht zur Rechtswissenschaft, sondern zur Rechtsphilosophie. Nach Kelsens Auffassung beschränkt sich die Rechtsphilosophie praktisch auf eine Theorie der Gerechtigkeit. Und von dem Moment an, wo diese den Schlüssel zur Ideologie bedeutet, kann man auch den ideologischen Charakter der Rechtsphilosophie nicht verneinen. Hier zeigt sich wieder die positivistische Mentalität Kelsens. Für die positivistische Mentalität gibt es nur eine Art von Erkenntnisrationalität, und zwar diejenige, die durch die wissenschaftlichbeschreibende Vernunft vertreten ist. Auf dem Gebiet des Rechts betrachtet Kelsen seine Theorie als die vollendete Darstellung dieser Idee. Alles, was nicht innerhalb der Grenzen einer solchen Vernunft ist, ist Ideologie, d.h. Irrationalität. Alle Abhandlungen Kelsens über die Gerechtigkeit haben die Absicht, die Unbrauchbarkeit der Bemühungen der Theoretiker, die irrationale Illusion, die ihr unterliegt, zu zeigen. Die letzte Konsequenz daraus ist ganz klar: Die Rechtsphilosophie, so verstanden, besitzt keinen realen Wert, sondern ist nur Ausdruck irrationaler Ideale. Oder anders ausgedrückt: Über das Recht ist im Grunde genommen nichts anderes zu sagen, als was die Reine Rechtslehre sagt. Alles andere ist Illusion. Zunächst muß man sagen, daß Kelsen keinen Unterschied macht zwischen der bewertenden und wertfreien Behandlung der Werte, die jeweils dem Rahmen der Rechtsentscheidung und der Rechtsdogmatik angehören. Kelsen schließt sie einfach aus. Was kann man jedoch von einer allgemeinen Rechtstheorie erwarten, deren einzige Antwort auf das axiologische Problem die Ausschließung ist? Weder der Praktiker noch der Dogmatiker können auf die Werte verzichten. Kelsen würde wahrscheinlich damit argumentieren, daß der Theoretiker auf sie verzichten kann, worauf zu antworten wäre, daß der Theoretiker, von der Reinen Rechtslehre ausgehend, den zulässigen Argumentationsbereich eben schon vom Standpunkt dieser Lehre und deren Leistungsgrenzen vorweg entsprechend beurteilt. Ich meine nun aber keineswegs, daß die Werte in die formale Analyse des Rechts eingeführt werden müßten. A n anderer Stelle habe ich bereits gesagt, daß die Werte auf diesem Niveau der Analyse überhaupt keine Rolle spielen und die Theorie der Gerechtigkeit daher vollkommen ausgeschlossen ist. Die Werte gehören in das Gebiet des Entscheidungsniveaus und der Dogmatik, obwohl in beiden Fällen mit verschiedenem Sinn und Orientation.
326
Gregorio Robles
Innerhalb der Rechtsentscheidung nimmt die Wertdiskussion eine dominierende Rolle ein, da der eigentliche Zweck der Entscheidung die Durchführung der Werte ist. Die Auseinandersetzung de lege ferenda beinhaltet stets eine Bewertung der diskutierten Werte; deshalb ist es notwendig, die idealen Bedingungen der Rechtsentscheidung in bezug auf die betroffenen Rechtssubjekte und -verfahren zu spezifizieren, und auch die materiellen Kriterien der Entscheidung, also das, was man allgemein als Prinzipien der Gerechtigkeit bezeichnet, namhaft zu machen. Daß die Ideologie direkten Einfluß auf diese Problematik hat, scheint mir außer Zweifel. Es ist auch unzweifelhaft, daß die Notwendigkeit besteht, die größtmögliche Rationalität bei einer so wesentlichen Angelegenheit walten zu lassen. Eine apriorische Ausschließung des Wertproblems, wie sie die Reine Rechtslehre vollzieht, ist daher keinesfalls überzeugend. Bei der Dogmatik ist die Stellungnahme anders als auf dem Gebiet der Rechtsentscheidung, aber eine allgemeine Rechtstheorie kann dieses Problem ebenfalls nicht vernachlässigen, da sich der Dogmatiker, ob er will oder nicht, ihm stellen muß. Bei der Auslegung der Regeln, die die Rechtsordnung ausmachen, ist die Untersuchung der Wertinhalte, die die Entscheidungen beeinflussen oder lenken, wesentlich. Innerhalb dieser Wertinhalte treten besonders die sogenannten „höheren Werte" in der spanischen Verfassung hervor (welche das Bonner Grundgesetz als „Grundwerte" bezeichnet). Die höheren Werte sind der neuralgische Zentralpunkt der institutionalisierten Gerechtigkeitstheorie, und der Dogmatiker muß sie bei der Auslegung der juristischen Texte immer vor Augen haben. Wie die höheren Werte zu den niedrigeren Werten innerhalb der axiologischen Hierarchie einer Rechtsordnung stehen; welche Beziehung zwischen den Werten und den allgemeinen Rechtsgrundsätzen besteht; welcher Zusammenhang zwischen diesen Phänomenen und den verschiedenen Typen von Rechtsregeln herrscht - das sind Fragen, auf die eine allgemeine Rechtstheorie antworten muß, da sie entscheidende Fragen für den Dogmatiker ausmachen. Die Hauptfunktion des Dogmatikers besteht im Verstehen der Rechtsordnung als Ganzes - oder eines Teiles derselben, die er bearbeitet, ohne jedoch in diesem Fall das Ganze zu vergessen - wofür es unbedingt notwendig ist, die Gerechtigkeitsprinzipien, die die Rechtsordnung und deren eigentlichen Kern ausmachen, richtig einzuordnen. Der Dogmatiker bebandelt die institutionalisierten Werte wertfrei und versteht diese daher als etwas, was zum Rechtssystem gehört und in den Regeln zusammengefaßt ist, die dieses ausmachen. Das soll jedoch nicht heißen, daß der Dogmatiker nicht die Unzulänglichkeiten des Systems aufzeigen kann, sowohl innerhalb des Rechtssystems, als auch in Beziehung auf das soziale System. Der Dogmatiker ist besser geeignet, „technische Kritik" am positiven Recht auszuüben. Wir sehen daher, wie die Wertproblematik ihren geeigneten Platz finden muß, den ihr die Reine Rechtslehre aufgrund ihrer Eigenschaften nicht geben
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
327
kann. Auf dem Weg der Sprachanalyse der Juristen ist nicht nur die formalistische Stellungnahme „reiner" als in der Reinen Rechtslehre, sondern man kann den Überblick so erweitern, daß die axiologische Frage ihren entsprechenden Platz findet, ohne in die Gefahr der Naturrechtslehre zu kommen. Die Naturrechtslehre definiert das Recht als Wert, der Rechtspositivismus trennt den Begriff des Rechts von dem Wert, indem er diesen in den Limbus der Ideologie verdammt. Wenn man die allgemeine Rechtstheorie als Sprachanalyse der Juristen versteht, verzichtet man auf den Wert in dem Bereich der Rechtsdefinition (formale Analyse), aber nicht, wenn es sich darum handelt, die Vorgänge ihrer Schöpfung (Entscheidung) und nicht die bereits geschaffene konkrete Rechtsordnung (Dogmatik) zu verstehen. Ähnlich wie bei dem hinsichtlich der Werte Erwähnten geschieht es mit der Rechtssoziologie und, ganz allgemein, bei all den Ausgangspunkten, die man als kausalistisch oder genetisch bezeichnen kann - unter welche man neben den soziologisch-juristischen auch den der Rechtspsychologie, den der Anthropologie und (mit Nuancen) den der Rechtsgeschichte einordnen muß 6 . Kelsen hat einige seiner Schriften der Rechtssoziologie gewidmet, und, obgleich er sie keineswegs zu negieren sucht, so mißt er ihr doch nicht die geringste Bedeutung für die eigentlichen Aufgaben des Juristen bei. Ich bezweifle in keiner Weise, daß die Soziologie von den Soziologen gemacht werden muß, und somit auch die Rechtssoziologie. Was eine tiefere Ergründung erfordert, ist das Problem der Beziehung zwischen der Rechtssoziologie und den eigentlichen Aufgaben der Juristen. Auch hier hat die normativistische Methode nichts zu sagen hinsichtlich der Beschränktheit ihrer methodischen Stellungnahme. Kelsen meint, daß die Rechtssoziologie nicht nur eine Wissenschaft ist, die nicht zu dem eigentlichen Bereich des Juristen gehört, sondern daß sie ihm außerdem vollkommen fremd und für seine Funktion nutzlos ist. Die normativistische Methode, die auch auf dem Gebiet der Rechtsdogmatik konsequent angewandt werden muß (obgleich Kelsen nie erklärt wie), schließt die soziologische Betrachtung radikal aus. Von der Perspektive der Theorie der Rechtsdogmatik als Theorie der Rechtstexte aus versteht man das Problem ganz anders, als es Kelsen beschrieben hat. Wenn man den Begriff des „Textes" weit genug faßt, dann ist es leicht, die Beziehung zwischen dem Rechtstext und dem „sozialen Text" zu verstehen. Die Rechtssoziologie sucht das Verständnis der sozialen Tatsache, die mit den Rechtsregeln verbunden ist. Eine Soziologie, die entsprechend dem Kausalprinzip arbeitet, ohne sich um ein hermeneutisches Verständnis zu bemühen - und so begreift Kelsen die Soziologie - , kann man nur schwer akzeptieren, da die soziale Handlung - die den soziologischen Grundbegriff ausmacht - nur verständlich ist, wenn die Bewegungen, aus denen sie sich 6
Robles, Rechtsregeln (FN 2), S. 7f.
328
Gregorio Robles
zusammensetzt, innerhalb eines als relevant ausgewählten Sprachzusammenhanges (Diskurses) „gelesen" werden. Die soziologischen Kategorien sind Kategorien, die nur mittels der Hermeneutik der Lebenssituationen auf die Wirklichkeit angewandt werden können. In diesem Sinn treffen sich der Dogmatiker und der Soziologe, da beide in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen hermeneutische Funktionen ausüben. So wird eine Brücke zwischen dem Rechtssoziologen und dem Dogmatiker gespannt. Wenn letzterer sich nicht im „Himmel der Rechtsbegriffe" abkapseln will und versucht, eine offene Dogmatik zu erarbeiten, wird er versuchen, den Rechtstext in Verbindung mit der diesbezüglichen Wirklichkeit zu verstehen; oder mehr noch: er wird letztere als Teiltext des gesamten Rechtstextes verstehen. Die Rechtssoziologie wirkt auf diese Weise als direkte Hilfe für die Rechtsdogmatik, indem sie ihr das nötige Material (output) verschafft, welches der Jurist in System (input) verwandelt. Obwohl der Jurist sich nicht in einen Soziologen verwandeln darf, so kann er doch die Beiträge der Rechtssoziologie bei seiner Auslegungsfunktion integrieren. Außerdem muß man bedenken, daß der Rechtstext nicht immer ein geschriebener Text ist. Nur ein überholtes legalistisches Vorurteil kann heutzutage das Recht mit dem Gesetz identifizieren. Bekanntlich kann ein Rechtssystem lediglich aus Gewohnheiten bestehen. Welches die „Rechtstatsachen" sind, ist ein Problem, welches jede Rechtsordnung entscheiden muß und entscheidet, aber was klar ist, ist, daß die als „Rechtstatsachen" angenommenen Tatsachen juristische Regeln sind, die sich, wie alle Regeln, sprachlich formulieren lassen. Die Reine Rechtslehre ignoriert außerdem die Funktion, die die Rechtssoziologie in Verbindung mit der Rechtsentscheidung erfüllen kann. Die Erforschung der Wirklichkeit, an die sich die Entscheidung wendet, sowie das Studium der aus der jeweiligen Entscheidung resultierenden Folgen, sind Aufgaben soziologischer Natur, und tragen wesentlich zur Entscheidung bei. Eine Entscheidung zu treffen ohne Kenntnis der sozialen Wirklichkeit, ist wie ein Tappen im Dunkeln. Zusammenfassend können wir daraus schließen, daß die Reine Rechtslehre die Forderungen der Legitimität nicht erfüllt, da sie sich selbst als eine allgemeine Rechtstheorie versteht, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist. Dagegen könnte man einwenden, daß alles von der Auffassung abhängt, wie eine allgemeine Rechtstheorie sein sollte und daß folglich die Reine Rechtslehre eine auf ihre eigene Weise verstandene Rechtstheorie bilden kann. Auch wenn man letzteres annähme, müßte man auch in jedem Fall akzeptieren, daß sie den intellektuellen Anforderungen der Juristen nicht nachkommt. Außerdem scheint es offensichtlich, daß nur eine Disziplin, welche die besagten Anforderungen erfüllt, die Bezeichnung einer allgemeinen Rechtstheorie verdient. Ansonsten wird jegliche Auffassung über das Recht, die nur theoretische Teilaspekte behandelt, dieser Bezeichnung gerecht. Ich glaube, daß dieses Vor-
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
329
gehen nicht gerechtfertigt ist. Die gegenwärtige Rechtstheorie befindet sich vor einer klar gekennzeichneten Herausforderung, die die Reine Rechtslehre nicht einzulösen vermag, da sie sich innerhalb des engen Rahmens des Positivismus und Normativismus gehalten hat. I I . Das Problem der Angemessenheit der Reinen Rechtslehre Unter der Angemessenheit einer Theorie verstehen wir ihre systematische und methodische Angepaßtheit an das von ihr ausgewählte Objekt. Dieses darf nicht mit der Erscheinungswirklichkeit verwechselt werden. Das Objekt einer Theorie ist immer eine künstliche Begrenzung der Wirklichkeit von einer bestimmten Perspektive aus gesehen. Die Perspektive wird durch die Methode verschafft. Das System wird durch die Überlegung über das bestimmte Objekt geschaffen gemäß den vorgeschriebenen Richtlinien der Methode. Wenn die Methode und das System der Theorie sich dem Objekt anpassen, dann können wir sagen, daß die Theorie angemessen ist; man kann auch sagen, daß sie richtig eingestellt ist, um einen Vergleich aus der Physik zu benutzen, da es keine Unangemessenheit zwischen dem Aufgebauten und der Gegebenheit gibt. Das Gegenteil tritt ein, wenn sich die Theorie (Methode und System) nicht dem Objekt anpaßt. In diesem Fall ist die Theorie unangemessen oder falsch eingestellt. Man muß sich nun fragen, was das Objekt der Reinen Rechtslehre ist. In der ersten und zweiten Auflage der Reinen Rechtslehre (nachfolgend abgekürzt als RR\ und RR 2) können wir lesen: „Die reine Rechtslehre ist eine Theorie des positiven Rechts" 7 . Das positive Recht ist daher ein Objekt besagter Theorie, die versucht, wie Kelsen in seiner General Theory of Law and State behauptet, eine wissenschaftliche Definition des Rechts zu geben. In seiner Abhandlung Was ist die Reine Rechtslehre? macht er das Objekt noch deutlicher: „Das Wesen des Rechts, seine typische Struktur" 8 . Dasselbe wiederholt er in RR2, worin er behauptet: Die Reine Rechtslehre „betrachtet sich als Wissenschaft zu nichts anderem verpflichtet, als das positive Recht seinem Wesen nach zu begreifen und durch eine Analyse seiner Struktur zu verstehen 4 ^. Man kann daher behaupten, daß das Objekt der Reinen Rechtslehre die innere Struktur des positiven Rechts ist. Wenn man das Objekt einmal so spezi7 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufl., Leipzig/Wien 1934, 2. Aufl., Wien 1960, S. 1. 8 Kelsen, Was ist die Reine Rechtslehre?, in: Demokratie und Rechtsstaat, Festschrift für Zaccharia Giacometti, Zürich 1953, S. 143 - 161; wiederabgedruckt in: Hans Klecatsky / René Marcie / Robert Schambeck (Hrsg.), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross, Bd. I, Wien 1968, S. 611 - 629 (S. 611). 9 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., S. 112.
Gregorio Robles
330
fiziert hat, muß man sich fragen, ob sowohl die Methode als auch das System dem besagten Objekt angemessen sind und bejahendenfalls, um welche Art der Angemessenheit es sich handelt. 1. Angemessenheit der Methode an das Objekt
In RR 2 bestimmt Kelsen, welches das Objekt der Rechtswissenschaft ist: Das Recht, d.h. die Rechtsnormen 10 . Die Methode, mittels derer dieses Objekt zu untersuchen ist, ist die beschreibend-normativistische Methode, also die Methode, die die Struktur der Rechtsnormen ebenso beschreibt wie die typische Struktur des positiven Rechts (die auch bloß ein System beschreibbarer Rechtsnormen ist). Es ist aber offensichtlich, daß die Reine Rechtslehre hier eine petitio principii begeht: die normativistische Methode untersucht das Recht, welches per definitionem nur ein Normensystem ist und folglich allein mittels der normativistischen Methode untersucht werden kann. Auf diese Weise kann bewiesen werden, daß die Reine Rechtslehre bei der Untersuchung des Objekts (d.h. der Struktur des positiven Rechts) nicht vorurteilslos arbeitet. Sie ist keine offene Untersuchung, wie man es von einer streng wissenschaftlichen Haltung erwarten könnte. Im Gegensatz dazu enthält schon ihre Ausgangsposition von vornherein die Antwort: das Recht ist eine Gesamtheit von Normen, d.h. von Soll-Propositionen - und dies ist der Fall, weil die einzige angemessene Methode die normativistische ist. Da man das Recht nur normativistisch untersuchen kann, muß dieses gezwungenermaßen eine Gesamtheit von Normen sein. Vice-versa: Da das Recht ein Normensystem ist, kann es nur normativ untersucht werden. Man kann daher sagen, daß diese „gezwungene Angemessenheit" der (normativistischen) Methode an ihr Objekt (die Normen) das tatsächliche Problem verdeckt, welches die Reine Rechtslehre nicht löst: das Problem der sprachlichen Heterogenität der Regeln. Diese Heterogenität wird von vornherein ausgeschlossen, da für Kelsen das Recht „per definitionem" und ohne vorherige kritische Analyse aus Normen zusammengesetzt ist; und die Normen sind Ausdruck eines Sollens. Aber selbst wenn man von einer „normativistischen Methode" sprechen könnte (was freilich, wie wir später sehen werden, nicht möglich ist) und man mit dieser Methode etwas erkennen könnte, so wären dieses „Etwas" zwar Normen, aber ich verstehe nicht, weshalb diese unbedingt die Rechtsnormen sein müßten. Wenn die normativistische Methode möglich ist - und Kelsen glaubt das zweifellos - dann müßte die Wissenschaft, die eine solche Methode benutzt, eine Theorie der Normen sein, und nicht eine Theorie der Rechtsnormen. Dieser Dualismus unterliegt der bestehenden Spannung zwischen der Allgemeinen Theorie der Normen (1979) und der Reinen Rechtslehre (1934, 1960). 10
Kelsen, ebd., S. 72.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
331
Während das posthume Werk einen Versuch darstellt, eine allgemeine normative Wissenschaft aufzubauen, kann die Reine Rechtslehre nur als ein Kapitel einer solchen Wissenschaft angesehen werden. Diese Spannung unterliegt dem ganzen Werk Kelsens, obgleich sie nie ausdrücklich erklärt wird. Wenn er das getan hätte, so hätte er zugeben müssen, daß die Reine Rechtslehre keine autonome Rechtswissenschaft ist, sondern höchstens ein Teil der Normenwissenschaft oder der allgemeinen Theorie der Normen. Diese Spannung zeigt sich außerdem in der konstanten Unbestimmtheit und Ambivalenz, die Kelsen besonders in seinen reiferen Werken, hinsichtlich der Bestimmung der Rechtsnorm walten läßt (darauf kommen wir noch zurück). In diesem Sinn wäre zu sagen, daß die normativistische Methode eine verkehrt eingestellte oder unangemessene Methode ist, um die innere Rechtsstruktur zu erkennen, oder sie müßte ausreichend spezifiziert sein (soweit dies möglich ist), um sie an das juristische Objekt anpassen zu können. Ein weiterer auffallender Mangel erwächst aus dem Umstand, daß sich die normativistische Methode wohl kaum anwenden läßt, um die Positivität des Rechts zu erkennen, denn, wie Kelsen selbst zugibt, besteht diese darin, daß die Rechtsnormen durch eine Gesamtheit von Willensakten gesetzt worden sind. Bei der Setzung von Willensakten jedoch handelt es sich um Tatsachen, die für sich genommen überhaupt keine Normen und daher auch kein Teil der internen Rechtsstruktur sind. In dem Maße, wie Kelsen das Problem der Positivität des Rechts in seine Theorie einbezieht, kehrt er dem, was man im Prinzip als normativistische Methode versteht, den Rücken; ist es doch deren einzige Aufgabe - und zwar gemäß den eigenen Worten des Schöpfers der Reinen Rechtslehre - , die normative Struktur des Rechtssystems zu untersuchen. 2. Die Angemessenheit des Systems
Gerade das Thema der Positivität des Rechts verbindet uns mit der zweiten Gruppe von Problemen, die sich mit der Angemessenheit zwischen dem System der Theorie und dem Objekt befaßt. Ganz allgemein kann man sagen, daß das System der Reinen Rechtslehre sich aus drei Teilen zusammensetzt: aus der Theorie der Rechtsnorm, der Theorie des Rechtssystems (Nomodynamik) und der Theorie der juristischen Grundbegriffe (Nomostatik). Wenn man nun auf die internen Widersprüche verzichtet, die später behandelt werden, und auch darauf, ob die normativistische Methode geeignet sei oder nicht, kann man sehen, daß das von der Reinen Rechtslehre aufgebaute System versucht, sich innerhalb der Grenzen eines formalen oder strukturellen Systems zu halten, dessen Ziel es ist, die formale innere Struktur des Rechts zu beschreiben. Das theoretische System, das wirklich aufgebaut wurde, bleibt diesem Schema jedoch nicht treu, da es Elemente einführt, die der inneren Struktur des positiven Rechts fremd sind, wie z.B. der Begriff der Positivität, das Konzept der Wirksamkeit und das der Grundaorm.
332
Gregorio Robles
Sowohl die Positivität als auch die Wirksamkeit sind von Kelsen eingeführt worden, weil er behauptet, daß seine Reine Rechtslehre „eine radikale realistische Rechtstheorie, d.h. eine Theorie des Rechtspositivismus ist" 1 1 . Kelsen gibt sich nicht damit zufrieden, die interne Struktur des Objekts, d.h. des Rechts zu beschreiben, eine Aufgabe, die an sich wenig mit dem Positivismus zu tun hat oder wenigstens mit der Positivität einer Rechtsordnung, sondern er will weitergehen, indem er sie in die Untersuchung der wirklichen Bedingungen der Existenz des positiven Rechts einführt. Da das Recht eine bestehende Realität im Leben der Menschen ist, ist es logisch, sich zu fragen, welches die Bedingungen seiner Existenz in der Realität sind. Es ist jedoch offenkundig, daß diese Frage die Grenzen des Objekts der Theorie überschreitet, da ja die genannten Bedingungen ein anderes Problem betreffen als das der Struktur des positiven Rechts. Eine Sache ist es zu wissen, wie das positive Recht beschaffen ist, und eine ganz andere, wie es entsteht und welche Auswirkung es in der sozialen Wirklichkeit hat. Die Positivität bezieht sich auf die Tatsache, daß die Normen gesetzt worden sind, und die Wirksamkeit darauf, wenn sie einmal gesetzt worden sind, wie sie beachtet und befolgt werden. Erstere bezieht sich daher auf eine vorhergehende Bedingung, wogegen die zweite eine nachfolgende Eigenschaft ausdrückt. In beiden Fällen verweist man auf die Beziehung der Normen zu der psychosozialen Wirklichkeit der Menschen, und geht somit über das Problem der Beschreibung der inneren Struktur hinaus (bzw. oder bleibt zurück). Bei einer Theorie, die versucht, die typische Struktur des positiven Rechts zu beschreiben, ist sowohl die Behandlung der Positivität als auch die der Wirksamkeit überflüssig. Während die beiden hier gezeigten Aspekte einen klaren positivistischen Geschmack haben, so hat die Grundnorm einen klaren kantianischen Ursprung. Aber auch hier befinden wir uns vor einem überflüssigen Element, und das aus dem einfachen Grund, weil, wie Kelsen selbst sagt, die Grundnorm keine positive Norm ist und somit nicht dem positiven Recht angehört. Wenn es sich bei der Grundnorm um eine gedachte und vorausgesetzte Norm, oder sogar um eine Fiktion handelt, wie Kelsen in seiner Allgemeine Theorie der Normen 12 aussagt, und nicht um eine positive Norm, mit welchem Recht gehört sie dann zu einer Theorie, die für sich in Anspruch nimmt, die Struktur des positiven Rechts zu beschreiben? Wenn die Grundnorm keine positive Norm ist, dann ist es offenkundig, daß sie nicht einen Teil der Struktur des positiven Rechts ausmacht. Abschließend kann man daher sagen, daß diese drei genannten Elemente der Ausdruck eines Irrtums oder einer Unangemessenheit zwischen dem von der Reinen Rechtslehre aufgebauten System und ihrem Objekt sind. Die zwei
11 12
Kelsen, ebd., S. 112. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1979, S. 206.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
333
ersten Elemente, weil sie dem psychosozialen Bereich angehören, und die Grundnorm, weil sie eine dem positiven Recht fremde Fiktion ist. Bei allen drei Fällen haben wir es mit unbedeutenden Elementen zu tun, um die innere Struktur des positiven Rechts zu erkennen. I I I . Das Problem der inneren Kohärenz der Reinen Rechtslehre Eigentlich könnten die beiden vorherigen Abschnitte, die der Untersuchung des Problems der Legitimität und der Angemessenheit der Reinen Rechtslehre gewidmet sind, sich sehr wohl diesem Abschnitt untergliedern, da beide Fragen auf das Thema der Kohärenz der Theorie in ihrer Gesamtheit zurückzuführen sind. Das Problem der Legitimität könnte somit auch als Problem der Kohärenz behandelt werden, zwischen dem, was die Theorie vorgibt zu sein, und dem, was sie tatsächlich ist. Und das Problem der Angemessenheit könnte seinerseits als Kohärenzproblem zwischen der Methode und dem System der Theorie und dem Objekt derselben verstanden werden. Wenn wir behaupten, daß die Reine Rechtslehre vom Standpunkt der Legitimität aus gesehen unzulänglich ist, und daß sie bemerkenswerte Irrtümer hinsichtlich ihres Objekts aufweist, so behaupten wir damit auch, daß sie inkohärent ist. Trotzdem beziehen wir uns mit dem Wort „Kohärenz" hier nur auf die Kohärenz innerhalb des aufgebauten Systems. In diesem Sinn ist zu beachten, daß eine Theorie kohärent ist, wenn in dem von ihr aufgebauten System keine Widersprüche oder Verwirrungen auftreten. Ansonsten ist sie inkohärent. Die Inkohärenz kann verschiedene Grade erreichen, da sie Elemente betreffen kann, die für die Gesamtheit des theoretischen Systems nicht besonders relevant sind, aber auch dessen Schlüsselstellen betreffen kann. Man kann daher die reparablen von den irreparablen Widersprüchen unterscheiden. Reparabel sind diejenigen, die beseitigt werden können, indem man dieselben Prinzipien des theoretischen Systems anwendet, ohne fremde Hilfsmittel desselben zu benutzen. Diese Widersprüche gehen normalerweise auf Unvollständigkeiten in der Darstellung, auf einen punktuellen logischen Fehler zurück. Man kann sie als Irrtümer betrachten. Demgegenüber entspringen die im System irreparablen Widersprüche strukturellen Ungereimtheiten des Systems, in dem dieses auf Standpunkte verpflichtet wird, die dem Systemganzen nur schwer bzw. überhaupt nicht einzugliedern sind. Derartige Widersprüche verdienen die Bezeichnung „Inkohärenzen" im engeren und eigentlichen Sinne, da sie nicht berichtigt werden können, ohne die Grenzen des Systems zu sprengen, d.h. durch die Anwendung systemfremder Prinzipien. Inkohärenzen im eigentlichen Sinne treten meistens bei Elementen auf, die von der Theorie ausdrücklich entwickelt worden sind; sie können jedoch auch aufgrund des Fehlens von Systemelementen auftreten.
334
Gregorio Robles 1. Das Fehlen eines eindeutigen Rechtsnormbegriffes in der Reinen Rechtslehre
Die auffallendste systematische Lücke in dem theoretischen System, das die Reine Rechtslehre aufgebaut hat, ist das Fehlen einer Definition oder einer direkten Behandlung des Rechtsnormbegriffes. Vergeblich wird derjenige, der Kelsen studiert, in seinen reiferen Werken 13 einen Abschnitt finden, der besagten Begriff behandelt. Diese Tatsache verursacht große Verwunderung, da der Rechtsnormbegriff ohne Zweifel der Grundbegriff, der Eckstein, der Reinen Rechtslehre ist. So erkennt es Kelsen selbst in seiner General Theory of Law and State: „The concept of the legal rule (...) is the central concept of the jurisprudence" 14 . Trotz dieser Erklärung gibt es weder in RR 2 noch in der Allgemeine Theorie der Normen, die ein ausführliches Werk zur Untersuchung der Normen ist, einen Abschnitt unter der Bezeichnung „die Rechtsnorm"; auch ist in keiner dieser beiden Werke eine eigentliche Definition des Rechtsnormbegriffes zu finden. Man findet jedoch die Behandlung des Gattungsbegriffes der Norm. Daher behandelt Kelsen in der Allgemeine Theorie der Normen im ersten Kapitel den Normbegriff - was auch nicht zu verwundern ist - , da es logisch ist, daß eine allgemeine Theorie der Normen sich damit beschäftigt. Eine entsprechende Behandlung des Rechtsnormbegriffes allerdings fehlt. Und noch viel auffallender ist es, daß in RR 2, d.h. in der allgemeinen Rechtstheorie, von Kelsen ausgearbeitet, zwar ein ganzes Kapitel der Norm 1 5 , aber nicht der Rechtsnorm gewidmet ist. Man kann daraus ersehen, daß Kelsen, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, vermeidet, sich mit Klarheit über das Thema der Elemente, die die Rechtsnorm ausmachen, über ihre innere Struktur und Definition auszusprechen. Dieses Fehlen bedeutet eine schwerwiegende Inkohärenz der Reinen Rechtslehre, da es nicht zulässig ist, daß sich eine Theorie gerade zu ihrem theoretischen Kernbegriff nicht klar äußert. Was würde man von einer Biologie halten, die zwar davon ausginge, daß die Zelle die grundlegende biologische Wirklichkeit sei, sich jedoch nicht ausdrücklich mit den Komponenten der Zelle und ihrer Tätigkeit befaßt? Und welche Meinung würde man von einer Chemie haben, die dauernd, explizit und implizit, über die Atome spräche, die die Materie bilden, es aber vermeiden würde, direkt zu sagen, was ein Atom ist? Für die Reine Rechtslehre ist die Rechtsnorm die grundlegende Einheit des Systems, sozusagen die Zelle oder das Atom der Rechtsordnung, da sowohl die Nomostatik als auch die Nomodynamik in Verbindung mit dieser grundlegenden Einheit aufgebaut sind. Die juristischen Grundbegriffe 13 D.h. in Reine Rechtslehre, 2. Aufl., und nachfolgende Werke bis Allgemeine Theorie der Normen. 14 Kelsen, General Theory of Law and State, S. 50. 15 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., S. 3ff.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
335
können nur dann verstanden werden, wenn man sie mit dem Begriff der Rechtsnorm in Verbindung setzt. Der Stufenbau des Rechts ist seinerseits ein Stufenbau der Rechtsnormen. Wie man auf eine direkte Stellungnahme zum Rechtsnormbegriff verzichten kann, ist eine Frage, auf die man unter Berücksichtigung des vorher Ausgeführten keine Antwort erhält. 2. Die Unterscheidung zwischen selbständigen und unselbständigen Rechtsnormen
In der RR 2 führt Kelsen den Unterschied zwischen unselbständigen und selbständigen Rechtsnormen ein 16 . Er versteht unter selbständigen Rechtsnormen diejenigen, die alle Elemente der Rechtsnorm ausdrücken, d.h. die Rechtstatsache und die Rechtsfolge. Die selbständige Rechtsnorm kann daher auch als vollständige Rechtsnorm bezeichnet werden 17 . Ihr vollständiger Charakter erlaubt ihr, unabhängig zu sein, da, nachdem sie keine Ergänzung braucht, sie für sich allein bestehen kann. Das ist bei den unselbständigen Rechtsnormen nicht der Fall, die sich dadurch charakterisieren, daß sie nicht alle Elemente der selbständigen oder vollständigen Rechtsnorm vereinen. Die unselbständige Rechtsnorm ist eine unvollständige Norm; ihr abhängiger Charakter besteht gerade darin, daß sie Elemente benötigt, die einer oder mehreren unselbständigen Normen angehören. Nur so wandelt sich die unselbständige Rechtsnorm in eine vollständige und somit selbständige Rechtsnorm um. In RRi 1 8 hat Kelsen bereits von unvollständigen und vollständigen Normen gesprochen, jedoch weit weniger ausführlich als in RR 2, worin er eine viel eingehendere Analyse der Rechtsnormtypen macht, parallel zur Erweiterung der Bedeutung des Sollens. In RR 2 akzeptiert Kelsen neben der Existenz von Sanktionsnormen andere Typen von Normen, wie die berechtigenden, erlaubenden, auslegenden, derogierenden und die Organisationsnormen. Hinsichtlich dieser Normen ist es nicht möglich, die Existenz aller Elemente der vollständigen Norm festzustellen, da zumindest das Sanktionselement in keiner dieser Norm-Typen hervortritt. Um ein Beispiel zu geben: es ist nicht möglich, daß eine erlaubende Norm gleichzeitig eine Sanktionsnorm ist. Die besagte Unterscheidung ist ein glaubwürdiger Beweis für die Unfähigkeit der Reinen Rechtslehre, das Problem der Struktur der Rechtsnorm, und, somit des Begriffes derselben, zu lösen. Auf alle Fälle hätte Kelsen konkretisieren müssen, welches die notwendigen und ausreichenden Elemente jeglicher Rechtsnorm sind, gleich ob selbständig oder unselbständig. Beide Arten haben etwas gemeinsam: nämlich Rechtsnormen zu sein. Deshalb müssen
17 18
Kelsen, ebd., S. 55ff. Kelsen, ebd., S. 244. Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufl., S. 56.
336
Gregorio Robles
beide gemeinsame Elemente enthalten, die sie als solche definieren können. Welches die gemeinsamen notwendigen und ausreichenden Elemente sind, die die juristische Normativität definieren und die es ermöglichen, daß wir wissen, wann wir es mit einer Rechtsnorm zu tun haben, gleich ob selbständig oder unselbständig, das ist eine Frage, die Kelsen sich anscheinend nicht gestellt hat. Es ist nicht verwunderlich, daß Kelsen für das von ihm gestellte Problem keine Lösung gefunden hat, und zwar deshalb, weil für dieses Problem im Rahmen der Reinen Rechtslehre keine Antwort gefunden werden kann. Das Konzept der Rechtsnorm bleibt schleierhaft; man könnte fast sagen, daß für Kelsen jeglicher Satz, der in einem juristischen Text erscheint, schon ohne weiteres eine Rechtsnorm ist. Das wäre eine Lösung, mit der wahrscheinlich Kelsen selbst auch nicht einverstanden wäre. Mit der Unterscheidung zwischen unselbständigen oder unvollständigen Normen und selbständigen oder vollständigen Normen zeigt die Reine Rechtslehre ihre Unfähigkeit, ihren Kernbegriff, d.h. den Rechtsnormbegriff zu definieren, und sie begibt sich damit in den Bereich der Ambiguität. 3. Das die Rechtsnorm charakterisierende Sollen
Wie man weiß, geht Kelsen von dem neukantianischen Dualismus zwischen Sein und Sollen aus. Bei seinen ersten wissenschaftlichen Werken war diese Gegenüberstellung einfach und klar; mit dem Begriff Sein bezieht er sich auf das, was der Fall ist, während er mit dem Begriff des Sollens das ausdrückt, was geschehen soll, obwohl es in Wirklichkeit womöglich nicht geschieht. In RRi bedeutet „sollen" einfach sollen, im Alltagssinn, und aus diesem Grund ist der Begriff der Rechtspflicht der erste Grundbegriff, der sich direkt aus der Rechtsnorm ableitet 19 . Die Rechtspflicht ist nichts anderes als die individualisierte Rechtsnorm, wobei es charakteristisch ist, daß „jeder Rechtssatz muß notwendigerweise eine Rechtspflicht, er kann aber auch möglicherweise eine Berechtigung statuieren" 20 . Das subjektive Recht ist keine notwendige Technik des objektiven Rechts, sondern nur eine mögliche Technik, die nur in Verbindung mit der kapitalistischen Ideologie voll verständlich 21 , und nur in Verbindung mit der Rechtspflicht denkbar ist. Es ist anzunehmen, daß Kelsen sich nach und nach der Vielfalt des normativen Phänomens bewußt wurde, denn in RR 2 ändert er seine Meinung im Hinblick auf die Bedeutung des Sollens entscheidend. Unter dem Begriff „Sollen" versteht man in diesem Werk sowohl das Sollen als auch das Können und das 19 20 21
Kelsen, ebd., S. 47. Kelsen, ebd., S. 47f. Kelsen, ebd., S. 48.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
337
Dürfen. In der Allgemeinen Theorie der Normen bezieht er dann den Begriff des Sollens auch auf das Nicht-Sollen, das laut Kelsen für die derogierenden Normen charakteristisch ist 22 . Daher kann man drei verschiedene Bedeutungen des Sollens unterscheiden: 1. das Sollen im engsten Sinn, dessen Bedeutung ein einfaches Sollen ist, so wie man dieses Wort gewöhnlich versteht; 2. das Sollen im weiteren Sinn, demzufolge dieser Begriff das Sollen im engsten Sinn als auch das Können und das Dürfen umfaßt; und 3. das Sollen im weitesten Sinn, welches das Sollen im engsten Sinn, das Können, das Dürfen und das Nicht-Sollen einschließt. In RRi behandelt Kelsen das Sollen im engsten Sinn, in RR 2 das Sollen im weiteren Sinn und in der Allgemeinen Theorie der Normen behandelt er das Sollen im weitesten Sinn. Das Sollen im engsten Sinn ist charakteristisch für die auferlegende Norm der Pflicht oder imperative Norm, während sich bei dem Sollen im weiteren Sinn sowohl die imperative Norm als auch die berechtigende und erlaubende Norm ausdrücken; und bei dem Sollen im weitesten Sinn gehört außer dieser drei letzten Normentypen auch noch die derogierende Norm dazu. Das ist ein klares Zeichen für die Entwicklung, die die Reine Rechtslehre im Hinblick auf den Begriff des Sollens durchgemacht hat, d.h. wie sie ihre ursprünglichen Auffassungen aufgegeben hat, um nach und nach das semantische Feld des Sollens zu erweitern. Man muß sich nach dem Grund einer solchen Entwicklung fragen. Meiner Meinung nach kann dieser nur in der Notwendigkeit liegen, in die Analyse die verschiedenen deontischen Operatoren einzuführen. Kelsen ist es mehr und mehr klar geworden, daß nicht alle Rechtsnormen das Sollen ohne weiteres ausdrücken. Es ist ohne Zweifel lobenswert, daß er eine solche Vielfältigkeit von deontischen Arten eingeführt hat. Mit der Einführung solcher deontischen Operatoren treten jedoch auch im Bereich seiner Theorie Probleme auf, die schwierig zu lösen sind. Es ist nicht klar, wie es möglich wäre, die schließlich geforderte Vielfalt an deontischen Operatoren mit der grundlegenden Sein-Sollen-Dichotomie zu vereinbaren. Kelsen hat natürlich das Recht, Veränderungen in seine Theorie einzuführen; worauf es aber dabei ankommt ist die Art, in der er dies macht. Sollen kann nur sollen bedeuten, und auf keinen Fall können oder dürfen. Noch weniger kann es nicht-sollen bedeuten, so wie er es der derogativen Norm zuschreibt. Daß man all diese verschiedenen und sogar widersprüchlichen Bedeutungen unter dem Begriff des Sollens zusammenfaßt, ist etwas, was Kelsen nicht erklärt, da es ohne Zweifel keine einleuchtende Erklärung dafür gibt. Eine solche Erweiterung des semantischen Feldes des Sollens stellt einen terminologischen und begrifflichen Mißbrauch dar, der die internen Widersprüche der Reinen Rechtslehre widerspiegelt. Diese Widersprüche hätten sich nur aufheben können, indem man ein anderes 22
Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 76ff.
22 Festgabe Opalek
338
Gregorio Robles
Schema zuläßt als das strenge Schema des Normativismus, welches auf dem unbeugsamen Unterschied zwischen Sein und Sollen aufgebaut ist. Kelsen hat jedoch diesen Eckpfeiler der Reinen Rechtslehre nie aufgeben wollen; stattdessen hat er in die normativistische Theorie Elemente eingeführt, die mit der Theorie unvereinbar sind. Die Bearbeitung der verschiedenen deontischen Operatoren im Bereich der Reinen Rechtslehre (sollen, können, dürfen, nicht-sollen) steht im Widerspruch mit der neukantianischen Unterscheidung zwischen sein und sollen. 4. Der abhängige Charakter der hierarchischen-höheren Rechtsnormen
Die Grundidee der in der Reinen Rechtslehre entwickelten Nomodynamik ist, daß die Struktur der Rechtsordnung an eine Pyramide erinnert, an deren Spitze sich die Grundnorm befindet, aus der alle weiteren Normen des Systems ihre Geltung ableiten. Die der Grundnorm unmittelbar unterliegende Normschicht ist die Verfassung, die ihrerseits die hierarchisch höchste Schicht positiv rechtlicher Normen bildet. Hier kann man alle von Kelsen und Merkl eingeführten Bearbeitungen bezüglich der sogenannten Stufenbautheorie der Rechtsordnung voraussetzen. Hier interessiert uns nur folgendes zu fragen: zu welchen Normen, selbständigen oder unselbständigen, gehören die Rechtsnormen an der Spitze der Pyramide, d. h. die Grundnorm und die Verfassung? Die Grundnorm ist jene Norm des Systems, aus der entsprechend der Reinen Rechtslehre das ganze System seine Geltung ableitet, d.h. der Rest der Rechtsnormen, die es ausmachen (alle positiven Rechtsnormen) 23 . Sie heißt Grundnorm, gerade weil sie das ganze Rechtssystem in seiner Gesamtheit und auch die konkreten Rechtsnormen, die dieses ausmachen, begründet. Obwohl sie spezielle Charakteristiken hat (sie ist keine positive Norm, da sie nicht gesetzt worden ist, sondern, wie Kelsen sagt, eine „gedachte" Norm) stellt sie eine weitere Rechtsnorm des Systems dar. Als nicht gesetzte Norm hat sie den Charakter einer „vorausgesetzten" Norm. Man muß die Grundnorm notwendigerweise voraussetzen, wenn man die Rechtsordnung als eine Ordnung oder System gültiger Normen ansehen will 2 4 , da die Geltung einer Norm von einer hierarchisch höheren Norm abhängt. Sobald man bei der hierarchisch höchsten positiven Norm angekommen ist, d.h. der Verfassung, muß man annehmen, daß diese wiederum nur gültig sein kann, wenn man das Vorhandensein einer anderen hierarchisch höheren Norm voraussetzt. Diese Voraussetzung ist eine logische Bedingung für die Geltung des normativen Systems. Aber die Tatsache, daß sie eine von der Logik geforderte Bedingung ist, bedeutet nicht, wie man gewöhnlich behauptet, daß die Grundnorm keine wirkliche Norm ist, 23
Kelsen hat die Theorie der Grundnorm niemals verlassen. Vgl. Allgemeine Theorie der Normen (Kap. 59), S. 207ff. 2Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., S. 4.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
339
sondern nur eine Forderung des Denkens. Was eine Forderung des Denkens ist, ist das Vorhandensein einer solchen Norm, jedoch die Natur der Grundnorm ist es nicht, eine „logische Bedingung", sondern eine Norm zu sein. Kelsen hat die Grundnorm zunächst als Hypothese, später als Fiktion 2 5 im Sinne von Vaihingers Philosophie des Als-Ob (1911) qualifiziert. Dadurch hat er nicht gerade zur Klärung der Sachlage beigetragen. Auf die eine oder andere Weise - als Voraussetzung oder Hypothese oder als Fiktion, ist die Grundnorm eine weitere nicht positive Norm des Systems, hinsichtlich derer man alle die Fragen formulieren kann, die für jede Norm des Rechtssystems formulierbar sind, ausgenommen jene, die mit der Positivität von Normen zu tun haben. Die hier gestellte Frage ist einfach: ist die Grundnorm, wie jede Norm des Rechtssystems, eine selbständige oder unselbständige Norm? Die Formulierung der Grundnorm lautet bei Kelsen wie folgt: „man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt, d.h.: wie es dem subjektiven Sinn des verfassunggebenden Willensaktes, den Vorschriften des Verfassungsgebers, entspricht" 26 . Diese Formulierung drückt offensichtlich eine unvollständige und daher unselbständige Rechtsnorm aus, da wir in ihr einerseits einen Hinweis auf die Generalermächtigung der verfassunggebenden Gewalt und andererseits ein völliges Fehlen von Rechtsfolgen finden. Somit wäre der Mangel doppelt, da die Tatsache weder vollkommen formuliert wird, noch man, nicht einmal indirekt, die Rechtsfolgen betrachtet. Es handelt sich bei der Grundnorm um eine vom Inhalt her leere Formel, die auf jede positive Rechtsordnung gleichermaßen anzuwenden ist. Und obgleich jedes System seine eigene Grundnorm hat, kann man die eine von der anderen inhaltlich nicht unterscheiden, sondern nur insofern, als sie einem bestimmten System angehört. Das ist ein weiterer Grund, weshalb es absurd wäre, die Grundnorm als nicht zum System einer bestimmten Rechtsordnung angehörende Norm zu betrachten. Was also unabhängig von den Problemen, die in der eigenartigen Natur der Grundnorm wurzeln, klar hervortritt, ist ihre Eigenschaft als unselbständige bzw. unvollständige Norm. Man muß sich daher - genau wie bei jeder anderen unvollständigen Norm - fragen, auf welche Weise sie vervollständigt werden kann, um sich so in eine vollständige und selbständige Rechtsnorm zu verwandeln. Die Lösung kann nur im Hinweis auf den Rest der Normen bestehen, die das Rechtssystem ausmachen. Wenn die Formulierung der Grundnorm lautet, daß „man dasjenige machen soll, was die verfassunggebende Gewalt befiehlt", oder - was dasselbe ist - daß „man der Verfassung gehorchen soll" (die Verfassung ihrerseits entwickelt sich im restlichen Rechtssystem, in den konkreten Rechtsnormen, welche bestimmte Verhaltensweisen erfordern und 25 26
22*
Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, S. 206. Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., S. 205.
Gregorio Robles
340
bestimmte Rechtsfolgen auferlegen), so ist augenscheinlich, daß der wirkliche Inhalt der Grundnorm nur vollkommen aufgehellt werden kann, wenn man sie mit den übrigen Rechtsnormen des Rechtssystems zusammendenkt. Die Grundnorm verlangt dies. Damit werden die Widersprüche deutlich, die die Theorie der Grundnorm in sich birgt. Die Grundnorm kann prinzipiell nicht unvollständig oder unselbständig sein, denn, wenn sie selbst nicht autonom ist, kann sie kaum das System begründen, sondern ist gleichzeitig von etwas abhängig. Aber es wird noch widersinniger, bedenkt man, daß gerade das, was die Grundnorm begründen soll (d. h. das Rechtssystem selbst), gleichzeitig auch das ist, wovon sie selbst abhängt, um sich in eine selbständige und vollkommene Rechtsnorm zu verwandeln. Man kann daher daraus schließen, daß die Theorie, daß eine unselbständige und unvollständige Norm das übrige Rechtssystem begründet, von dem sie zu ihrer Vervollständigung wiederum selbst abhängt, einen offensichtlichen Widerspruch zeigt innerhalb der Reinen Rechtslehre; dies beweist folglich, wie schwach die Unterscheidung zwischen den unselbständigen und selbständigen Normen ist, und wie gekünstelt das Ideengerüst der Grundnorm. Ähnliche Überlegungen sind anwendbar und ähnliche Schlußfolgerungen erhält man, wenn man die Verfassungsnormen betrachtet. Kelsen selbst erkennt, daß es sich bei ihnen um unselbständige Rechtsnormen handelt, die durch andere Normen vervollständigt werden müssen - um sich in selbständige Normen zu verwandeln - , die die Auflegung von Zwangshandlungen erfordern 27 . Diese Normen, die die Verfassungsnormen vervollständigen, können keine anderen sein als jene, die den Rest der Rechtsordnung ausmachen. Somit muß die rechtlich positive Verfassung, die nach der Grundnorm die Norm ist, die das System begründet, ihrerseits gerade durch die Normen vervollständigt werden, deren Fundament sie zu sein hat. Wir sehen daher, wie die Stufenbautheorie der Rechtsordnung nicht aufrechterhalten werden kann, da sie einen inneren Widerspruch darstellt, der ihren Erklärungswert aufhebt, und zwar in dem Moment, wo man sie mit dem Rest der Überlegungen der Reinen Rechtstheorie in Verbindung bringt. Da eine Theorie in sich selbst konsequent sein muß, müßten die Anhänger der Reinen Rechtslehre entweder auf die Theorie der Grundnorm und der Verfassungsnormen als Grund des Rechtssystems verzichten oder aber auf den Unterschied zwischen den selbständigen und unselbständigen Normen (und in diesem Fall müßte man außerdem auf die Erweiterung des semantischen Feldes des Sollens verzichten, d.h. auf die Vielfalt der deontischen Operatoren, von denen Kelsen in RR 2 und in Allgemeine Theorie der Normen spricht). Das Problem ist nun, daß solche Verzichte undenkbar sind, da die analysierten 27
Kelsen, ebd., S. 52f., 244.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
341
Theorien grundlegenden Gedanken der Reinen Rechtslehre, ihrer eigenen inneren Entwicklung entsprechen. Sie sind keine zufälligen Theorien, die leicht zu ersetzen wären. 5. Geltung und Wirksamkeit
Auch bei diesem Problem (der Beziehung zwischen der Geltung der Rechtsnormen und ihrer Wirksamkeit in der gesellschaftlichen Wirklichkeit) hat Kelsen wesentliche Änderungen in seiner Theorie vorgenommen. In RRi betrachtet er die Wirksamkeit einer Rechtsordnung im großen und ganzen als Bedingung der Geltung derselben, so daß, wenn eine bestimmte positive Rechtsordnung, in ihrer Gesamtheit betrachtet, nicht wirksam ist, man akzeptieren muß, daß die Rechtsordnung ungültig ist, d.h. daß ihre Normen rechtlich nicht verbindlich sind. Letzteres bedeutet, daß diese sogenannte Rechtsordnung kein Recht ist, da eine nicht verbindliche Rechtsordnung eine solche Bezeichnung nicht verdient. Die Wirksamkeit ist daher die Bedingung der Geltung einer Rechtsordnung, in ihrer Gesamtheit betrachtet. Hinsichtlich der konkreten Normen, die das Recht ausmachen, ist die Lösung der Reinen Rechtslehre hingegen eine andere. Eine Rechtsnorm ist gültig, wenn sie einem Rechtssystem angehört, das im großen und ganzen wirksam und daher gültig ist. Ob die fragliche Einzelnorm selber wirksam oder unwirksam ist, sagt folglich über ihre Gültigkeit nichts aus 28 . Diese Theorie der Beziehung zwischen Geltung und Wirksamkeit ist widersprüchlich, da die Wirksamkeit (oder Unwirksamkeit) des Rechtssystems nur die Wirksamkeit (oder Unwirksamkeit) der konkreten Rechtsnormen, die sie ausmachen, sein kann. Wenn das System wirksam ist, so deshalb, weil die Normen, die es ausmachen, wirksam sind, oder, im Gegenteil, wenn es unwirksam ist, sind seine Normen ebenfalls unwirksam. Die Theorie Kelsens setzt voraus, daß die Idee der Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des Systems von dem Moment an besteht, in dem eine bestimmte Zahl (welche?) von Normen wirksam oder unwirksam sind. Auf diese Weise beschränkt sich die Wirksamkeit oder die Unwirksamkeit des Systems auf die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit einer bestimmten Anzahl von konkreten Normen des Systems. Da jedoch das System einzig die Gesamtheit seiner Elemente, d.h. der Normen ist, kann das System nicht von den Normen getrennt werden. Die Unbestimmtheit bezüglich der Anzahl der Normen, die wirksam (oder unwirksam) sein müssen, damit das System wirksam (oder unwirksam) ist, sowie auch die Unbestimmtheit darüber, welche Art der Normen relevant sind (ζ. B. ob Verfassungsnormen oder Normen, die die Verwaltung vorschreibt), das sind Fragen, die Kelsen sich nicht einmal stellt. Diese Widersprüche und ungelösten Probleme geben Anlaß, über die Gründe nachzudenken, die den Schöpfer der Reinen Rechtslehre dazu bewegt 28 Kelsen, Reine Rechtslehre, 1. Aufl., S. 69ff., 72f.
342
Gregorio Robles
haben, diese in seiner RR 2 zu verändern, obgleich die Veränderung ebenfalls Inkohärenzen aufzeigt. In RR 2 vertritt Kelsen die Idee, daß die Wirksamkeit die Bedingung der Geltung ist, und das sowohl hinsichtlich des Rechtssystems in seiner Gesamtheit betrachtet, wie auch der Rechtsnorm, individuell betrachtet 29 . Diese Auffassung löst den vorher erwähnten Widerspruch, da sie erlaubt, das System so zu betrachten, wie es wirklich ist, d.h. eine Gesamtheit von konkreten Normen. Wenn dieses System wirksam ist, so deshalb, weil eine große Anzahl dieser Normen es sind. Wenn hingegen das System unwirksam ist, so deshalb, weil die Normen, die es ausmachen (oder wiederum eine große Anzahl von ihnen) unwirksam sind. Diese Auffassung, die den Normativismus den realistischen oder soziologischen Theorien näher bringt, ist ebenfalls nicht einwandfrei. Wenn die Wirksamkeit der konkreten Rechtsnorm die Bedingung für ihre Geltung ist, ist es logisch, daß die Wirksamkeit vor der Geltung existieren muß, da sie ansonsten keine echte Bedingung sein kann. Die Wirksamkeit ist das bedingende Element, während die Geltung das bedingte Element ausmacht. Das Bedingende - die Wirksamkeit - muß zuerst bestehen, damit hinterher das Bedingte - die Geltung - bestehen kann. So müßte eine Norm zuerst wirksam sein, um dann gültig zu sein. Aber auf diesem Weg befindet man sich in einer Sackgasse, da in dem von der Reinen Rechtslehre vorgeschlagenen Schema die Geltung prinzipiell vor die Wirksamkeit gesetzt wird. Aber wie kann die Geltung vor die Wirksamkeit gesetzt werden, wenn die Wirksamkeit Bedingung für die Geltung ist?
I V . Das Problem der Idoneität der Methode Hinsichtlich jeder Theorie kann man immer eine letzte Frage stellen: herauszufinden, ob die von ihr ausdrücklich geprägte oder stillschweigend benutzte Methode zu zufriedenstellenden Resultaten führen kann, oder ob im Gegenteil eine solche Methode nicht dazu geeignet ist, die Wirklichkeit zu kennen. Es handelt sich letztlich darum herauszufinden, ob die Methode an sich, d.h. unabhängig von den erzielten Resultaten, eine Theorie aufstellen kann, die bei richtiger Anwendung die hier genannten Erfordernisse der Legitimität, Angemessenheit und Kohärenz erfüllt. In dieser kurzen Abhandlung ist es nicht möglich, eine ausführliche Analyse der Methode der Reinen Rechtslehre darzustellen. Ich werde nur einige grundlegende Züge skizzieren, die unter folgende Punkte zusammengefaßt werden können: a) Methodische Reinheit: die Reine Rechtslehre versucht, die Rechtswissenschaft von ihr fremden Elementen zu reinigen, wobei in diesem
29 Kelsen, Reine Rechtslehre, 2. Aufl., S. 10f., 48f., 215ff.
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
343
Sinne ihre beiden Gegner die Soziologie und die Naturrechtslehre sind; b) Formalismus: die Reine Rechtslehre ist im wesentlichen eine formalistische Theorie, da sie beansprucht, die Rechtsformen zu erforschen; dieses Charakteristikum tritt besonders bei den reiferen Werken Kelsens nuanciert in Erscheinung, und zwar bis zu dem Punkt, an dem man feststellen kann, daß die Reine Rechtslehre keine wirkliche formalistische Theorie mehr ist; c) Deskriptivismus: die Rechtswissenschaft hat entsprechend Kelsens Auffassung zum Ziel, die Rechtsnormen zu beschreiben, vorausgesetzt, daß die Normen als etwas Vorgegebenes existieren; der Deskriptivismus ist ein typisches Charakteristikum des Positivismus; d) Normativismus: was die Rechtswissenschaft beschreiben soll, sind ausschließlich Normen; die normativistische Methode ist diejenige, die das Recht adäquat erkennt, weil das Recht ausschließlich ein System von Normen ist; e) Positivismus: auch wenn die Vertreter des skandinavischen Realismus es verneinen, betrachtet sich die Reine Rechtslehre selbst als eine positivistische Theorie des Rechts, da ihr Objekt das Recht ist, so wie es im tatsächlichen Leben der Menschen existiert, d.h. als positives Recht, und nicht als transzendente Wirklichkeit. Das Schwergewicht, das diesen fünf Grundzügen in der Reinen Rechtslehre zukommt, variiert mit dem konkret behandelten Problem. Nehmen wir einmal an, wir könnten Kelsen fragen, welches Charakteristikum die Anforderungen des Ganzen am besten ausdrückt oder zusammenfaßt. Es ist höchstwahrscheinlich, daß Kelsen antworten würde, daß seine Theorie die normativistische Methode anwendet. Diese Idee wiederholt sich in seinem Werk vom Anfang bis zum Schluß, und hat seiner Auffassung den Namen gegeben, da häufig - und scheinbar zu Recht - von einer „normativistischen Theorie" oder einem „Normativismus Kelsens", oder einfach von einem „Normativismus" die Rede ist. Diese Methode bezeichnet Kelsen noch einfacher als „juristische Methode", da für ihn, wie wir wissen, das Recht mit den Rechtsnormen gleichzusetzen ist. Aus Kelsens Normativismus heraus lassen sich die anderen erwähnten Grundzüge erklären. Daher ist die methodische Reinheit lediglich eine Forderung, die Untersuchung der Normen beschränkt sich darauf, die Formen der normativen Struktur, die das Recht ist, zu erkennen; die Reine Rechtslehre ist deskriptiv, da sie zur Aufgabe hat, die Normen zu beschreiben; und schließlich konzentriert sich der Positivismus, der sie charakterisiert, auf die Idee, daß der positive Anhaltspunkt des Rechts kein anderer ist, als die Normen, die ihn bilden. Worin besteht dann also die normativistische Methode oder Rechtsmethode? Kelsen charakterisiert sie in folgender Weise: „Die Rechtswissenschaft sucht ihren Gegenstand ,rechtlich', d.h.: vom Standpunkt des Rechts aus zu begreifen. Etwas rechtlich begreifen kann aber nichts anderes bedeuten, als etwas als Recht und das heißt: als Rechtsnorm oder als Inhalt einer Rechts-
344
Gregorio Robles
norm, als durch eine Rechtsnorm bestimmt begreifen" 30 . In diesem Absatz verbirgt sich eine epistemologische Unmöglichkeit und eine petitio principii. Epistemologisch unmöglich ist die Behauptung: „Die Rechtswissenschaft sucht ihren Gegenstand ,rechtlich', das heißt: vom Standpunkt des Rechts aus zu begreifen". Entsprechend diesem Satz versucht die Rechtswissenschaft, das Recht vom Gesichtspunkt des Rechts aus zu verstehen. Somit ist das Recht nicht nur Erkenntnisobjekt, sondern auch Gesichtspunkt, methodische Perspektive. Das Recht ist das Objekt, welches die Rechtswissenschaft erkennt und gleichzeitig ist es der geeignete Gesichtspunkt, um jenes Objekt - sich selbst - zu erkennen. Wie ich an anderer Stelle 31 erwähnt habe, ist dieser Satz analog zu dem, der sagt: „Die Wissenschaft der Tiere (Zoologie) versucht, die Tiere vom Gesichtspunkt der Tiere aus zu erkennen." Und er ist auch analog zu folgendem Satz über die Astronomie: „Die Wissenschaft der Sterne kennt die Sterne aus der Sicht der Sterne." Jedoch, weder die Sterne noch die Tiere sind Gesichtspunkte, denen gemäß die Sterne oder die Tiere erkannt werden könnten. Und das gleiche gilt für das Recht. Beim Recht handelt es sich um ein Objekt, das erkannt werden kann, aber als Objekt ist es keine Perspektive des Erkennens. Auf jeden Fall ist es nicht - wie das Zitat von Kelsen suggeriert - beides zugleich. Die petitio principii wird deutlich, wo Kelsen die Ansicht vertritt, daß etwas rechtlich zu verstehen nur bedeutet, es als Rechtsnorm oder als Inhalt einer Rechtsnorm zu verstehen. Kelsen setzt als unanfechtbaren Ausgangspunkt als deutliches und unumstrittenes Dogma - voraus, daß das Recht eine Gesamtheit von Normen, oder, was dasselbe ist, ausschließlich eine Gesamtheit von Sollen-Propositionen ist, was jedoch zu beweisen wäre. Die normativistische Methode verwandelt sich somit in die Operation, die darin besteht, „normativ die Normen" zu erkennen. Es wird (a) vorausgesetzt, daß es nur Normen gibt, d.h. Soll-Sätze, und (b) auch, daß es eine „normative" Methode gibt, welche die Normen erkennt. Meiner Meinung nach bilden diese zwei Annahmen den klarsten Ausdruck der Beschränktheit der Reinen Rechtslehre. Die sprachliche Komplexität des Rechts kann man nicht auf die Existenz von deontischen Ausdrücken oder Soll-Sätzen reduzieren. Neben Regeln, die ein Sollen ausdrücken, gibt es andere Arten von Regeln, die man analysieren muß 32 . Andererseits ist es auch nicht möglich, normativ etwas zu erkennen, da die Normen - nochmals gesagt - in jedem Fall ein Objekt der Erkenntnis bilden und nicht gleichzeitig eine Perspektive des Erkennens.
30
Kelsen, ebd., S. 72. Robles, Epistemologia y Derecho (FN 1), S. 146. 32 Robles, Sein, Müssen und Sollen im Recht (FN 3) und ders., Rechtsregeln und Spielregeln (FN 2). 31
Die Grenzen der Reinen Rechtslehre
345
Diese kurze Analyse zeigt m.E. bereits die Unbrauchbarkeit der von Kelsen so genannten juristischen oder normativistischen Methode. Unter der scheinbaren Anschaulichkeit ist diese Methode nur ein widersprüchliches Instrument, welches sich selbst verneint. Die Reine Rechtslehre hat es auf diesem Weg weder verstanden, das Problem der sprachlichen Heterogenität der Regeln, noch das Problem der Entscheidung und der Rechtsdogmatik zu lösen.
Das Problem des „normativen Syllogismus" in Kelsens „Allgemeiner Theorie der Normen" Von Robert Walter, Wien I. Die Position, die Kelsen in seiner „Allgemeinen Theorie der Normen" (1979) zum Problem des sog. „normativen Syllogismus" eingenommen hat (179ff.), wirkt revolutionär und scheint die Rationalität der Rechtsanwendung (und der Rechtsbetrachtung) äußerst prekär zu machen. Opaîek hat sich in seinen „Überlegungen zu Hans Kelsens ,Allgemeine Theorie der Normen'" 1 mit dieser Problematik bereits befaßt (29ff.) und auch einen bestimmten Weg für die Fragen des Rechtsanwendungsprozesses gewiesen (34). Die vorliegenden Überlegungen beabsichtigen - unter Beachtung der Ausführungen Opaleks - , die Position Kelsens klarzustellen 2, allenfalls auf ihrer Basis etwas „weiterzudenken", und der Frage nachzugehen, inwieweit diese tatsächlich zu einer „irrationalen" Rechtsanwendung (und Rechtsbetrachtung) führen müßte 3 . II. 1. Beim „theoretischen Syllogismus" wird der Schlußsatz („conclusio") etwa der Satz „Sokrates ist sterblich" - aus einem Obersatz („Alle Menschen sind sterblich") und einem Untersatz („Sokrates ist ein Mensch") gewonnen. Es handelt sich also um eine Schlußregel für Sätze. 1
Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd. 4 (1980). Der Autor hat bereits versucht, Kelsens Position zu klären: vgl. Walter, Das Problem des Verhältnisses von Recht und Logik in der Reinen Rechtslehre, RECHTST H E O R I E 11 (1980), S. 299ff. Die vorliegenden Überlegungen versuchen die damals gemachten Aussagen zu verbessern. Deren Mangel liegt darin, daß nicht deutlich zwischen den Rechtsnormen und den Rechtssätzen unterschieden wird, was im vorliegenden Text zu vermeiden gesucht wird. 3 Weinberger, Normentheorie als Grundlage der Jurisprudenz und Ethik (1981) und Weinberger, Kelsens These von der Unanwendbarkeit logischer Regeln auf Normen, in: Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion, Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd. 7 (1982), S. 108ff. hat die Position Kelsens zunächst als „Normenirrationalismus" bezeichnet; inzwischen ist er von dieser - eine Wertung andeutenden - Terminologie abgerückt und bezeichnet die von Kelsen - wie auch von einer Reihe anderer Normtheoretiker - vertretene Position als „normlogischen Skeptizismus"; vgl. Weinberger, Der normlogische Skeptizismus, RECHTSTHEORIE 17 (1986), S. 13ff. 2
348
Robert Walter
Zu betonen ist, daß nicht aus einer Tatsache - etwa der Tatsache, daß alle Menschen sterblich sind - , sondern aus einem Satz über diese Tatsache und dem Satz über die Tatsache, daß Sokrates ein Mensch ist, der Schlußsaiz gezogen wird. Das Mensch-Sein des Sokrates ist etwas anderes als das erwähnte Urteil. Die Relevanz dieser Unterscheidung ergibt sich schon daraus, daß der Schluß auch dann logisch korrekt ist, wenn Ober- und Untersatz der Wirklichkeit nicht entsprechen. 2. Faßt man jene „Schlußfigur" ins Auge, die Kelsen den „angeblich normativen Syllogismus" nennt (184), so wird dabei als „Obersatz" eine generelle hypothetische Norm (z.B. „Wer stiehlt, soll mit Gefängis bestraft werden") verwendet, als Untersatz ein das Vorliegen der Bedingung bejahender Seinssatz ( „ A hat gestohlen"), und daraus eine individuelle Norm, wonach A ins Gefängnis soll, als „Schlußsatz" gewonnen. Daß diese „Vorgangsweise" für Kelsen ein Unding sein muß, ergibt sich aus der Überlegung, daß für ihn jede Rechtsnorm - individuelle wie generelle auf einem Willensakt beruht und Sinn dieses Willensaktes ist (Iff.) 4 5 . Geht man davon aus, so kann es im vorliegenden Zusammenhang keine logische „Ableitung" geben, weil keine „Sätze" („Aussagen") vorliegen, die in Beziehung zu setzen sind, sondern als „Obersatz" und als „Schlußsatz" Rechtsnormen eingesetzt sind (182ff.). Die weiteren Gründe Kelsens gegen den „normativen Syllogismus" brauchen daher nicht diskutiert zu werden. 3. Nun scheint Kelsen aber - inkonsequenterweise - eine Ableitbarkeit von Normen von geringerer Allgemeinheit aus Normen von größerer Allgemeinheit anzunehmen (201), somit in bestimmten Fällen mit Rechtsnormen doch wie mit Sätzen zu argumentieren 6. Dies ist aber nach der dargelegten Grund4
Alchourrón / Bulygin nennen eine solche Auffassung von den Normen eine „expressive Konzeption", nach der die Normen Befehle sind, die von den Propositionen über Befehle zu unterscheiden sind (dabei wird hier davon ausgegangen, daß mit dem Wort „Propositionen" im gegebenen Zusammenhang „Aussagesätze über Normen" gemeint sind. Es muß allerdings eingeräumt werden, daß das Wort „Proposition" in den hier bezogenen Ausführungen eine schillernde Bedeutung hat; vgl. dazu Thienel, Derogation, in: Walter (Hrsg.), Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre I I , Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd. 12 (1988), S. 16 FN 27); der expressiven Konzeption der Normen stellen Alchourrón / Bulygin die „hyletische Konzeption" gegenüber, nach der die Normen propositionsartige Entitäten, die Bedeutung normativer Sätze, darstellen (vgl. dazu Alchourrón / Bulygin, Expressive Konzeption von Normen, in: Bulygin / Valdes (Hrsg.), Argentinische Rechtstheorie und Rechtsphilosophie heute (1987), S. 15 ff.). 5 Für den vorliegenden Zusammenhang ist es irrelevant, ob man dies mit dem Hinweis darauf bestreitet, daß es nicht auf den „realpsychischen" Willensakt als solchen, sondern auf den Sprechakt mit normativer Bedeutung ankommt; vgl. dazu Jabloner, Kein Imperativ ohne Imperator. Anmerkungen zu einer These Kelsens, in: Walter (Hrsg.), Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre I I , Schriftenreihe des Hans KelsenInstituts, Bd. 12 (1988), S. 75ff. 6 Kelsen (S. 201) stellt u. a. folgende beiden „generellen Normen" zur Diskussion: 1. „Menschen sollen einander nichts Böses zufügen", 2. „Menschen sollen einander nicht
Das Problem des „normativen Syllogismus"
349
position nicht möglich, weil prinzipiell zwischen der erwähnten zugelassenen Ableitung und der strikt abgelehnten Ableitung individueller Normen aus generellen Normen kein Unterschied besteht7: Auch eine Norm von geringerer Allgemeinheit muß auf einem Willensakt beruhen und kann somit nur gesetzt, nicht abgeleitet werden: Eine „Durchführungsverordnung" - als Norm geringerer Allgemeinheit gegenüber dem allgemeineren Gesetz - liegt eben nur vor, wenn der Verordnungsgeber einen entsprechenden Willensakt gesetzt hat 8 . verleumden" und fügt dem bei: „Die generelle Norm (2) ist in der Tat in der generellen Norm (1) impliziert und kann im Wege der Interpretation explizit gemacht werden." Eine „Implikation" ist aber eine logische Beziehung und kann somit zwischen Normen nicht vorliegen. Auch ist die zur Anwendung kommende „Interpretation" „ein geistiges Verfahren, das den Prozeß der Rechtsanwendung . . . begleitet" (Reine Rechtslehre 2 (1960), S. 346). Faßt man dies ins Auge, so kann Kelsen nicht Normen meinen, die ins Verhältnis gesetzt werden, sondern Sätze, die diese Normen beschreiben. Man kann allenfalls sagen, im Satz „Menschen sollen einander nichts Böses zufügen" sei der Satz „Menschen sollen einander nicht verleumden" „impliziert"; er könne durch ein geistiges Verfahren gewonnen werden, das darin besteht, daß erkannt wird, daß die Verleumdung eines Menschen diesem etwas Böses zufügt. Dieses geistige Verfahren ist wie sich auch bei Kelsen (S. 202) zeigt - nichts anderes als ein syllogistisches. 7 Kelsen (S. 201) möchte freilich die generellen Normen untereinander und das Verhältnis von genereller und individueller Norm anders behandeln. Bezüglich der erwähnten generellen Normen meint er, Norm (2) statuiere „nichts, was nicht schon in Norm (1) statuiert" werde. Aber die individuelle Norm „Maier soll Schulze nicht dadurch verleumden, daß er die unwahre Behauptung macht, Schulze habe dem Schmidt 1000 gestohlen", statuiere mehr als die vorerwähnte generelle Norm (1). „Denn das Verhalten des Maier . . . ist nicht in dem Begriff des Verleumdens ... enthalten." U m logische Überlegungen anstellen zu können, muß man die generelle Norm und die individuelle Norm in Sätzen beschreiben und fragen, ob der individuelle Satz im generellen Satz enthalten (impliziert) ist. Da nun „Maier" und „Schulze" offenbar „Menschen" sind und eine unwahre Behauptung, ein Mensch habe 1000 gestohlen, eine Verleumdung, also etwas Böses, ist, ist der individuelle Satz im generellen ebenso enthalten, wie der Satz von geringerer Allgemeinheit. Freilich ist die individuelle Norm in der generellen Norm nicht enthalten, weil sie ja nicht durch eine Untersuchung der Implikationsverhältnisse gewonnen werden kann, sondern gesetzt werden muß. Im gegebenen Zusammenhang bringt Kelsen für seine Meinung das Argument, „man kann nur wollen, was man weiß" und man könne nicht annehmen, daß die normsetzende Autorität künftige Taten wisse. Demgegenüber ist einzuwenden, daß auch dann, wenn man für das Zustandekommen einer Norm einen Willensakt verlangt, es problematisch - weil zu psychologistisch - ist, dabei auf den - nicht leicht aufklärbaren Wissensstand des Normsetzers abzustellen (in diesem Sinne auch Aichourron / Bulygin (FN 4), S. 24). Aber ganz abgesehen davon ist, wenn jedermann von der Norm erfaßt werden soll, „Maier" „impliziert", und wenn „Verleumdung" in „Böses zufügen" impliziert ist, jeder A k t der Verleumdung „impliziert". Daß gerade bei einer individuellen Norm - Kelsen meint nach seinen Beispielen eher eine konkrete Norm - die Sachlage anders sein soll, ist nicht einzusehen. Auch dabei sind die die generelle Norm und die individuell-konkrete Norm jeweils beschreibenden Sätze (Rechtssätze) und die Implikation zu prüfen. So wie eben - vereinfacht ausgedrückt - die Verordnung als generelle Norm und Bescheid und Urteil als individuell-konkrete Normen darauf zu prüfen sind, ob sie auf das Gesetz zurückführbar sind, im Rechtssatz „impliziert" sind. 8 Kelsen (S. 202) sieht das Problem, daß eine Schlußfolgerung nicht zur Geltung einer neuen Norm führen kann, meint aber, die Norm, die als Schlußfolgerung „darge-
350
Robert Walter
4. Es fragt sich nun, weshalb es zu der dargestellten Inkonsequenz kommt und wie sie systemkonform zu beseitigen ist. Ausgangspunkt dieser Überlegungen kann der Hinweis Kelsens sein, daß Probleme durch die „überaus häufige Vermengung von . . . Recht und Rechtswissenschaft verdunkelt" würden (179). Die „Vermengung", die im gegenständlichen Zusammenhang das Problem verdunkeln könnte, ist jene zwischen Rechtsnorm und Rechtssatz. Kelsen unterscheidet zwar genau zwischen der - durch einen Willensakt gesetzten - Rechtsnorm und den diese Rechtsnorm beschreibenden Rechtssätzen, doch ist fraglich, ob diese Unterscheidung im vorliegenden Zusammenhang durchgehalten wird. III. Im folgenden wird versucht, den „angeblich normativen Syllogismus" als eine Schlußfigur anzusehen, bei der als Obersatz und als Schlußsatz nicht Rechtsnormen auftreten, sondern (norm-deskriptive) Rechtssätze. Dies müßte zulässig sein, weil die Anwendung des Syllogismus in der - die Rechtsnormen mittels Rechtssätzen beschreibenden - Rechtswissenschaft für Kelsen „außer Frage" (179) steht. 1. Geht man davon aus, daß ein - die Rechtsnorm zutreffend beschreibender - Rechtssatz vorliegt, wonach „wer stiehlt mit Gefängnis bestraft werden soll", so können keine Bedenken bestehen, ihn als Obersatz zu verwenden. Liegt nun weiter - als Untersatz - ein wahrer Seinsatz vor, daß A gestohlen hat, so ist logisch der wahre Schluß^iz zu gewinnen, daß A mit Gefängnis bestraft werden soll. Dieser Schlußsatz ist nun zweifellos keine Norm, und da der zuständige Richter keinen entsprechenden Willensakt gesetzt hat, auch kein - dieses Urteil beschreibender - Rechtssatz. Er ist allerdings ein Satz, der Normatives, das in der generellen Norm enthalten ist 9 , beschreibt. Dieser Satz muß wahr sein, wenn die Prämissen wahr sind, bringt allerdings - wie der Syllogismus stets - keine „neue Wahrheit, . . . sondern macht nur eine Wahrheit explizit, die schon in der Wahrheit der Prämissen impliziert ist" (Kelsen, 183). Wahr ist offenbar, daß A ins Gefängis soll- das ist es, was aus dem Rechtssatz generellen Inhalts abgeleitet werden kann - , nicht aber, daß ein spezifischer, ermächtigter Willensakt vorläge, A solle ins Gefängnis gesetzt werden. Ein solcher
stellt wird", gelte schon, weil sie in der Norm größerer Allgemeinheit „impliziert" sei. Aber da Normen gesetzt werden müssen, kann eine zweite Norm nicht vorliegen. Daß gerade in diesen Fällen „kein besonderer Willensakt erforderlich" (S. 201) sein sollte, ist nicht einzusehen; es würde das Normkonzept Kelsens sprengen. 9 Vgl. Lippold, U m die Grundlagen der Normlogik, in: Walter (Hrsg.), Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre I I , Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd. 12 (1988), S. 152, FN 61 u. 184.
Das Problem des „normativen Syllogismus"
351
Willensakt würde zu einer individuellen Norm des erwähnten Inhalts führen und wäre in einem - eigenen - Rechtssatz zu beschreiben. Das Verhältnis dieses Rechtssatzes zu dem gewonnenen Schlußsatz ist für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Urteils von entscheidender Bedeutung. Das Urteil des Richters ist nur gesetzmäßig, wenn der Rechtssatz, mit dem es beschrieben wird, dem gewonnenen Schlußsatz entspricht. 2. Es scheint fraglich zu sein, weshalb auf die zuletzt vorgenommene Unterscheidung Wert gelegt wird, obgleich jedenfalls wahr ist, daß A ins Gefängnis soll. Dies hängt mit der spezifischen Konstruktion des positiven Rechts zusammen: Die Rechtslage ist, was auf der Hand liegt, eine andere, je nachdem, ob A nur auf Grund der generellen Straf norm mit Gefängnis bestraft werden soll, oder ob mit Urteil ausgesprochen wurde, daß A (auf Grund der generellen Norm und seiner Tat) ins Gefängnis soll. Im letzteren Fall ist der Rechtsverwirklichungsprozeß durch einen Willensakt, das Urteil, um eine Stufe weitergeführt, ein „Mehr" an Voraussetzungen für den tatsächlichen Vollzug der Gefängnisstrafe geschaffen worden. Rechtliche Regeln, die den Vollzug betreffen, knüpfen nicht an die generelle hypothetische Norm, sondern an das richterliche Urteil an. 3. Betrachtet man den normativen Syllogismus in der dargelegten Weise als Ableitung eines Schlußsatzes aus einem Ober- und einem Untersatz (und nicht als Ableitung einer individuellen Norm aus einer generellen Norm und einem Seinsatz), dann wird auch klar, wie „das Verhältnis zwischen generellen Normen von unterschiedlicher Allgemeinheit" (Kelsen, 201) zu sehen ist: Nicht als ein Ableitungsverhältnis von Normen, sondern als eine Ableitung eines Rechtssatzes von geringerer Allgemeinheit aus einem Rechtssatz von größerer Allgemeinheit: aus dem Obersatz, daß alle, die stehlen, mit Gefängnis bestraft werden sollen - einem Rechtssatz von großer Allgemeinheit - , kann - über den Untersatz, daß Frauen zur Gruppe „aller" gehören - der Rechtssatz, daß alle Frauen, die stehlen, mit Gefängnis bestraft werden sollen, als Schlußsatz abgeleitet werden. IV. 1. Der normative Syllogismus ist - wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben und wie auch Kelsen betont - kein Vehikel zur Erzeugung von individuellen Normen. Er gehört vielmehr zu dem intellektuellen Instrumentarium der Interpretation, dem geistigen Prozeß, der die Rechtsanwendung begleitet. Er ist Teil der Überlegung, die der Setzung der individuellen Norm vorangehen muß. Soll das zur Fällung der individuellen Norm ( „ A soll ins Gefängnis") berufene Organ seine Aufgabe erfüllen, so muß es derart vorgehen, daß es sich die Frage vorlegt, was die generelle Norm besagt (es muß sie für sich im Rechtssatz „beschreiben"), feststellen, was tatsächlich geschehen ist (ob A
352
Robert Walter
gestohlen hat), um aus diesen beiden Sätzen zu erkennen, welches Urteil zu fällen ist. Dieses „ergibt" sich zwar nicht als Schlußsatz, aber der gebildete Schlußsatz zeigt, wie das Urteil „in Gemäßheit" des Rechtssatzes aussehen soll. Der Schlußsatz gibt somit den Rahmen an, innerhalb dessen das Urteil, soll es der generellen Norm entsprechen, zu lauten hat. Die Frage, die sich an dieser Stelle aufdrängt, ist die, weshalb das zur Vollziehung berufene Organ die dargestellten logischen Operationen vorzunehmen hat. Die Logik selbst fordert ihre eigene Anwendung nicht; soll der Richter verpflichtet sein, deren Regeln anzuwenden, so muß dies - wird nicht ein präpositives Gebot angenommen - als positivrechtlich statuiert angesehen werden. Nun ist die Situation zwar nicht die, daß die positiven Rechtsordnungen eine solche Regel aussprechen. Doch läßt sich ihre Geltung als positive Norm durch die Überlegungen begründen, daß die rechtlichen Regelungen als von Menschen und für Menschen erlassene Anordnungen die Regeln des menschlichen Denkens für ihr Verständnis vorausgesetzt und in sich aufgenommen haben 10 . Merkl hat davon gesprochen, daß sich die „primäre Rolle der grammatisch-logischen Interpretation" darauf gründet, „daß sie als nichts denn die Berücksichtigung der dem Gesetze eigenen Ausdrucksmittel erscheint! Tritt doch das Gesetz in der Sprach- und Denkform auf und schließt damit, was die Theorie der Sprache und des Denkens lehrt, stillschweigend wie selbstverständlich in sich ein" 1 1 . 2. Der normative Syllogismus erfüllt aber auch noch eine weitere Aufgabe, auf die Opalek (34) bereits aufmerksam gemacht hat. Im rechts wissenschaftlichen Bereich ist nämlich zu fragen, welche Entscheidung ein Rechtsanwendungsorgan fällen soll (insbes. wenn in dem betreffenden Rechtssystem die Entscheidung durch generelle Normen vorausbestimmt und die Vollziehungsorgane an diese gebunden werden), und - wenn es seine Entscheidung gefällt hat - ob diese zutreffend ist. Opalek spricht hier zutreffend von einer Betrach10 Über die mögliche Einbeziehung solcher Regeln in das positive Recht vgl. Nawiasky, Allgemeine Rechtslehre 2 (1948), S. 30; bezüglich der Interpretationsregeln insbes. Kunst, Zu Kelsens Rechtslehre und Walters „Aufbau der Rechtsordnung", OJZ 1965, S. 313. Für die positivrechtliche Geltung der logischen Regeln bei der Rechtsanwendung auch Klug, Juristische Logik 4 (1982), S. 155ff., in diesem Sinne auch Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts 2 (1990), Rz. 1920. In der Praxis werden die Denkgesetze (Gesetze der Logik) von den österreichischen Höchstgerichten angewendet, so vom österreichischen Verwaltungsgerichtshof (vgl. dazu Walter ! Mayer, Grundriß des österreichischen Verwaltungsverfahrensrechts 5 (1991), Rz. 325; VwSlgNF 1234 A , 1934 A , 5954 A , 8619 A , 9602 A ) und vom österreichischen Obersten Gerichtshof sowohl in Zivilsachen (vgl. dazu Fasching (FN 10); ArbSlg 7588; R Z 1967, S. 105) als auch in Strafsachen (vgl. dazu Bertel, Grundriß des österreichischen Strafprozeßrechts 3 (1990), Rz 734ff.; EvBl 1980/220; RZ 1981, S. 111). Kelsen (S. 103) geht davon aus, daß „der Gesetzgeber manches ausdrücklich zu normieren unterläßt, weil er es als selbstverständlich, stillschweigend voraussetzt". Derartige Regeln können als positive Normen angesehen werden. 11 Merkl, Zum Interpretationsproblem, Grünhuts Zeitschrift 1916, S. 552f.
Das Problem des „normativen Syllogismus"
353
tung „ex ante" und „ex post", für die ein - richtig verstandener - „praktischer" Syllogismus erforderlich sei 12 . 3. Kelsen hat das - oft angenommene - scheinbar „logische" Operieren mit Normen abgelehnt. Dies zu recht. Das, womit logisch zu operieren ist, sind die Sätze, mit welchen Normen beschrieben werden (Rechtssätze). Auf diese Weise sind logische Determinanten für zu fällende Entscheidungen zu finden. Die Position führt also nicht zu einer Irrationalität der Rechtsanwendung oder zu einer Irrationalität der Rechtswissenschaft, die ja nicht mit Normen, sondern Aussagen über Normen („Rechtssätzen") zu arbeiten hat 13 . 4. Nun ist es jedoch - um die Position Kelsens deutlich darzustellen - erforderlich, zu betonen, daß die hier gezeigte Möglichkeit des Einsatzes der Logik nicht dazu führt, daß die Überprüfung des Verhältnisses von genereller und individueller Norm zu der Lösung führen müßte, daß die jeweils erlassene individuelle Norm die einzige ist, die auf Basis der generellen Norm gebildet werden könnte. Vielmehr ist zu betonen, daß durch logische Überlegungen vielfach nur eine Grenze gewonnen werden kann, die angibt, welche individuellen Akte noch im Bereich der generellen Norm liegen. Soweit die generelle Norm unbestimmt ist - z.B. einen Strafrahmen enthält - kann in diesem Punkte durch ihre genaue Beschreibung nur die Grenze dafür gezeigt werden, innerhalb deren ein individuelles Urteil noch auf das Gesetz „zurückgeführt" werden kann. Es werden dies - abgestellt auf das vorliegende Beispiel - alle die sein, deren Strafausspruch im Strafrahmen des Gesetzes liegt. Dergestalt ist also ein eindeutiges Ergebnis nicht zu erzielen. Gleiches gilt, wenn die Unbestimmtheit in den Voraussetzungen für eine Strafe liegt. 12
Kelsen betrachtet die damit dargestellte Problematik an anderer Stelle und in besonderer Weise: Er nimmt nämlich eine als „Entsprechung" bezeichnete Beziehung zwischen Normen an, die „logischer Natur" sei (S. 208ff.). Die Entsprechung wird als logische Beziehung besonderer A r t angesehen (S. 214) und so erklärt, daß der Inhalt einer niedrigeren Norm unter die in der höheren Norm verwendeten Begriffe gebracht werden könne. „Begriffe" sind aber Elemente von Sätzen. Diese Sätze beschreiben die Normen; sie sind also Rechtssätze. Es erscheint nicht erforderlich, in diesem Zusammenhang eine spezifische Beziehung von besonderer logischer Natur anzunehmen. Kelsen (S. 213) spricht im gegebenen Zusammenhang selbst davon, daß „die generelle Norm in einem Satz ausgedrückt wird"; daher könne sie - richtig wäre freilich zu sagen: der Satz - „Begriffe enthalten, unter die in anderen Normen" - zutreffend wäre: in Sätzen, die andere Normen beschreiben - „enthaltene Begriffe . . . oder Vorstellungen . . . und Rechtsfolgen subsumiert werden können". 13 Für die expressive Auffassung der Normen führen Aichourron / Bulygin (FN 4), S. 22ff. zutreffend aus, daß, „da es keine logischen Beziehungen zwischen Tatsachen gibt . . . es folglich keinen Raum für eine Logik der Normen" gibt. „Dies schließt aber nicht die Möglichkeit einer Logik normativer Propositionen aus", mittels der die genannten Autoren Ableitungen vornehmen. Sie sprechen von einem „abgeleiteten Gebot", was freilich irreführend sein kann, weil - in einer expressiven Konzeption „Gebot" immer etwas ist, was geboten wurde. Es handelt sich jedoch dabei um kein „abgeleitetes Gebot", sondern um ein Explizitmachen des Inhalts des (bestehenden) Gebots. 23 Festgabe Opalek
354
Robert Walter
I m Ergebnis bedeutet dies, daß i m Rahmen der Reinen Rechtslehre die L o g i k sehr w o h l ihre Bedeutung hat (wie sie i n jeder wissenschaftlichen Lehre ihre Relevanz haben m u ß ) , daß ihre R o l l e aber nicht dahin überschätzt w i r d , daß sie eine vollständige Überprüfung des Vorgangs der Rechtserzeugung zuläßt. D e n n die „ A u s l e g u n g " , die den geistigen Prozeß darstellt, der die Rechtsanwendung begleitet, u n d i n deren R a h m e n auch logisch zu schließen ist, kann zu keiner individuellen N o r m , z . B . zum U r t e i l führen; hierzu bedarf es eines Willensaktes des berufenen Organs, das die generelle N o r m akzeptiert, beschreibt u n d auf ihrer Grundlage durch seinen Willensakt eine neue N o r m setzt, die sich nicht logisch ergibt, zumal es vielfach erforderlich ist, zwischen möglichen A l t e r n a t i v e n zu w ä h l e n 1 4 ' 1 5 .
V.
Es muß eingeräumt werden, daß Kelsens Überlegungen zum normativen Syllogismus nicht zu letzter Klarheit durchgedrungen sind, u n d es weiterer Überlegungen bedarf, u m zu einer allseitig zutreffenden Sicht zu gelangen. I m Gange der E n t w i c k l u n g der Reinen Rechtslehre mag dies damit erklärbar
14
Vgl. Kelsen, S. 192. Weinberger, Replik auf Robert Walters Bemrkungen, Interenationales Jahrbuch für Rechtsphilosophie und Gesetzgebung 1992, S. 383 (384), hat sich erst jüngst wieder gegen den Weg gewandt, logische Regeln auf die die Normen beschreibenden Sätze („Rechtssätze") anzuwenden und aus der sich dabei ergebenden Situation auf die Rechtslage zu schließen. Er hält eine solche „Ersatztheorie" für eine „Unmöglichkeit". Gegen die den normativen Syllogismus betreffende Position bringt Weinberger vor, daß, würde aus dem normativen Aussagesatz die generelle Norm „iVi ist Bestandteil von NO" der normativen Aussagesatz die individuelle Norm „N 2 ist Bestandteil von NO" gefolgert, gleichzeitig aber behauptet, daß diese Operation auf der Ebene der Rechtsnormen nicht gelte, folgende paradoxe Situation vorläge: „Es wird die Folgerungsbeziehung zwischen den Aussagen über das Normensystem als gültig hingestellt, dergemäß die Konklusion ,N 2 ist Bestandteil von NO' gewonnen wird. Da wir vorausgesetzt haben, daß die Prämisse wahr ist, d.h. daß Ν ι tatsächlich Bestandteil von NO ist, und gleichzeitig behaupten, daß der normenlogische Schluß von Ν ι auf N 2 nicht gilt (also N 2 nicht gefolgerter Bestandteil von NO ist), so hätten wir eine gültige Folgerung aus einer wahren Prämisse mit unwahrer Konklusion. Gemäß der Definition der Folgerung ist das aber gerade unmöglich." Tatsächlich jedoch ist die Position der Reinen Rechtslehre - wie Schmidt, Kelsens Lehre und die Normenlogik, in: Walter (Hrsg.), Schwerpunkte der Reinen Rechtslehre (1992), S. 96, FN 22, zutreffend darlegte - nicht die von Weinberger dargestellte. Sie folgert nicht auf der Ebene der Rechtssätze, daß, weil die generelle Norm Ν ι Bestandteil von NO ist, auch die individuelle Norm N 2 Bestandteil von NO ist. Ein solches Verfahren lehnt die Reine Rechtslehre ja gerade ab. Sie folgert aus der generellen Norm und der Ermächtigung an ein rechtsanwendendes Organ, daß dieses Organ unter bestimmten tatsächlichen Umständen die individuelle Norm N 2 setzen soll. Erst nach erfolgter Setzung kann sie die Aussage „ N 2 ist Bestandteil von NO" treffen. Unterbleibt diese Setzung, scTmuß auch die fragliche rechtswissenschaftliche Aussage unterbleiben. Wie Weinbergers Einwand die Position der Reinen Rechtslehre treffen könnte, ist nicht zu erkennen. 15
Das Problem des „normativen Syllogismus"
355
sein, daß Kelsen erst relativ spät die - zutreffende - Position bezogen hat, daß auf N o r m e n als spezifische „ n o r m a t i v e Gegenstände" logische Regeln ebensowenig anwendbar sind, wie auf Seinssachverhalte 16 . Obzwar daneben i m m e r unbestritten blieb, daß die L o g i k i n der Rechtswissenschaft u n d den anderen Normwissenschaf ten ihren Platz hat, wurde nicht i n allen Richtungen deutlich, wo zulässige logische Schlüsse der Wissenschaft m i t Sätzen, die Normatives beschreiben, vorliegen u n d wo - unzulässigerweise - logische Regeln auf N o r men (direkt oder indirekt) angewendet werden. Dies ist auch deshalb verwikkelt, weil die A n w e n d u n g der logischen Regeln auch rechtlich geboten sein kann, was verschiedentlich zielführend sein kann, aber nicht sein muß. Kelsen hat i n seiner Spätlehre den Diskussionen über diese Frage neue Impulse gegeben, auf die Opalek als einer der ersten kritisch reagiert und A n s t o ß zu weiteren Überlegungen gegeben hat.
16
Wie bereits erwähnt (II, 1) muß zwischen einer Seinstatsache und dem Urteil über diese unterschieden werden. Das Urteil „Kant lebte vom 22. 4. 1724 bis 12. 2. 1804" ist nicht ident mit dem Leben Kants vom 22. 4. 1724 bis 12. 2. 1804. Die Tatsache des Lebens Kants kann nicht wahr oder falsch sein, sondern nur das Urteil über diese Tatsache. Die hier exponierte Problematik ist hinsichtlich der Normen aus folgendem Grund schwieriger: Seinstatsachen treten regelmäßig nicht in Sprachform in Erscheinung. Daher ist es leichter, zwischen den Tatsachen selbst und den (sprachlichen) Aussagen über sie zu unterscheiden. Normen treten aber vielfach in Sprachform auf, so daß es schwer ist, zwischen der Normformulierung und der Formulierung des - die Norm beschreibenden - Satzes zu unterscheiden. Wenn ein zur Normsetzung befugter Mensch die Worte ausspricht „Menschen sollen einander nichts Böses zufügen", so ist dies Setzung einer Norm mit dem Mittel der Sprache. Wenn man die erwähnte Norm beschreibt, kann man sich derselben Worte bedienen. Aber der erste Wortgebrauch hat den Charakter des Befehls, wogegen der zweite einen normbeschreibenden Satz darstellt (der falsch oder richtig sein kann). Eine logische Ableitung kann nur aus dem (normbeschreibenden) Satz erfolgen, nicht aus dem Normausdruck. Dies mag deutlicher werden, wenn man sich vorstellt, daß nach einem Straßenverkehrsgesetz der hochgestreckte A r m eines Polizisten bedeutet, daß alle Beteiligten im konkreten Straßenverkehrsbereich stehenzubleiben haben. Daß auch der Verkehrsteilnehmer A stehen bleiben soll, können wir nicht aus dem hochgestreckten A r m ableiten, sondern nur aus einem Satz, mit dem das also Angeordnete beschrieben wird. Vgl. auch Opaìek / Wolenski, „Is", „Ought", and Logic, ARSP 73 (1987), S. 381 ff. 23*
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki* B y Jerzy W r ó b l e w s k i , L o d z I . Introductory Observations 1. L e o Petrazycki is the author of one of the most interesting positivist methodological conceptions and antipositivist theory of law, and state and morality during the t u r n of our century. T h e fortunes of his ideas taught at the universities of the tsarist Russia and published i n Russian and G e r m a n original editions is extremely complicated 1 . Petrazycki triggered vehement controversies i n the Russian and German science and has participated i n t h e m w i t h a deep involvement and even w i t h passion. A f t e r his return to Poland i n 1918 Petrazycki has not w r i t t e n works as significant for his theory, as i n the precedent period. Some of his lectures were published by the created " L . Petrazycki Association" of his pupils and followers. A f t e r the First W o r l d W a r i n Poland the theory of Petrazycki was accepted and developed by J. Lande who used it for attacking normativism following
* The present essay is a revised and adapted version of the Polish text published in "Studia prawnicze", 3 - 4, 1982, p. 3 - 36. 1 Leo Petrazycki born 1867 in Kofl^tajewo (near Witebsk) died in Warsaw (1931). After studies at the university of Kijów he had spent several years in Berlin where his master was Dernburg. There he was engaged inter alia in the problems of codification of private law, cf. his: Die Fruchtverteilung beim Wechsel der Nutzungsberechtigten. Vom Standpunkt des positiven Rechts und der Gesetzgebung. Drei civilrechtliche Abhandlungen, Berlin 1892; Die Lehre von Einkommen vom Standpunkt des gemeinen Zivilrechts unter Berücksichtigung des Entwurfes eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich, Berlin vol. 1 (1883), vol. 2 (1885). Back in Russia he got the doctors degree (1887) and was the professor of the encyclopedy and philosophy of law at the university of Petersburg (1887 - 1918). His main works in Russian were translated in Polish (see note 7). In 1918 he returned to Poland and was the professor of sociology at the university of Warsaw (1918 - 1931). For the biographical data concerning Petrazycki cf. / . Kowalski, Psychologiczna teoria prawa i paristwa Leona Petrazyckiego (Psychological Theory of Law and State of Leo Petrazycki), Warszawa 1963, p. 8 - 19; the bibliography there p. 217 sq. The general information concerning Petrazycki's theory in English cf. Κ. Opalek, The Leon Petrazycki Theory of Law, Theoria 3,1961; J. Wróblewski, Teaching Jurisprudence in Poland: From Petrazycki's to Marxist Theory, in: L'educazione giuridica, A . Giuliani and Ν . Picardi eds., II. Profili storici, Perugia 1979.
358
Jerzy Wróblewski
the antipositivistic line of his teacher 2. In the West-European literature Petrazycki had no followers and western literature knows very little about him 3 . The Scandinavian legal realism, which has many common points with Petrazycki's theory, has emerged and developed independently of his views. In the Russian marxist legal literature the principled criticism of non-marxist views favorised a total rejection of Petrazycki's ideas and of the attempts to combine it with marxism 4 . In the Polish legal theory the ideas of Petrazycki were and are discussed. Up to our days his theoretical views stimulate strong controversies like a distant echo of the passions from the beginning of our century. The present essay is neither a description of the Petrazycki's theory and his detailed critical analysis, nor a presentation of his general, and especially political, biography. The former has been given in the critical analysis started from the partisans positions by J. Lande, and from a marxist position in the monography of J. Kowalski, and in several studies and contributions 5 and, of course could be continued in the future. The political biography of Petrazycki is made on the occasion of an analysis of his theory, and is used sometimes as the basic argument in criticism 6 . This essay aims at presenting the chosen based issues of Petrazycki's views from the point of view of fundamental problems of legal theory. The perspective of the essay is determined by the opposition of the dual features of Petrazycki's thinking, viz. his positivist attitude in methodology, philosophical and methodological conceptions, and his anti-positivistic position in the legal science. This basic opposition is, however, blurred by the way in which Petrazycki treats natural law and the ambivalence of his axiology· 2
Cf. J. Lande, Norma w zjawisko prawne. Rozwazania nad podstawami teorii prawa na tie krytyki systemu Kelsena (Norm and Legal phenomenon. A n Essay on the Foundations of Legal Theory Based on the Critique of the System of Kelsen, 1925) repr. in: J. Lande, Studia ζ filozofii prawa (Studies in Legal Philosophy), Warszawa 1959. 3 There is R. Babb's translation L. Petrazycki, Law and Morality, Cambridge 1955. A note concerning the essays on Petrazycki is given in: Opatek (FN 1). Cf. Kowalski (FN 1), chapt. VII.7: Sociology and Jurisprudence of Leon Petrazycki, J. Gorecki ed., Urbana/Chicago/London 1975. 4 Cf. Kowalski (FN 1), chapt. VII.5 and lit.cit. 5 Cf. Lande, Studia . . . (FN 2), passim; Kowalski (FN 1), passim. Cf. also collective volume dealing with the ideas of Petrazycki. Ζ zagadnieó teorii prawa i teorii nauki Leona Petrazyckiego (The Problems of the Theory of Law and the Theory of Science of Leo Petrazycki) Warszawa 1969; the studies in special issues of Studia Filozoficzne (Philosophical Studies) 5, 1981; Annales Universitatis Mariae Curie Skiodowska further cited as Annales UMCS sec. G. lus, X X V I I I , 1981, For general information cf. Kowalski (FN 1), chapt. VII.6. 6 J. Émiaìowski, Spoieczno-polityczne uwarunkowanie recepcji doktryny Leona Petrazyckiego w Polsce Ludowej (Sociopolitical Factors Influencing the Reception of Leo Petrazycki's Doctrine in the People's Poland), Krakowskie studia prawnicze I X , 1979 and cit. lit.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
359
The philosophico-methodological views of Petrazycki are discussed in two parts of this essay dealing with his philosophy (part II) and his views concerning logic and methodology (part III). Legal antipositivism of Petrazycki is presented in his psychologism (part IV), conception of sociology and of theory of progress (part V), and in the idea of legal policy (part VI). Concluding remarks describe the position of Petrazycki towards these two kinds of positivism and his way of dealing with natural law ideas (part V I I ) . The scope of this essay where it does not concern the general methodological issues is restricted to the law. I leave out, therefore, the problems of morality which, according to Petrazycki, together with law belong to the wider area of ethics. I do not consider the problems of the state power and of the sociopolitical and economical systems, which are dealt within Petrazycki's theory. For the same reasons I am not dealing with the historical development of the ideas of Petrazycki. Moreover I am using rather selectively the works of Petrazycki 7 and the literature concerning his theory. This is why I cannot fulfill the well-founded postulate of an historical and functional analysis of his theory, but this would mean to prepare not an essay but a monography 8 . 2. The special place of the Petrazycki's theory in the Polish literature is due to many factors. He was and still is one of the most outstanding legal scholars in the formative years of our legal science. He was one of the most original thinkers within the framework of the European legal sciences, morality and general methodology. The development of the Polish legal theory has been influenced by many trends, but his was the most original one. Last not least his ideas are still stimulating and even provocative by the radicalism of their position and sometimes by their ambivalence too. The growing impact of the marxist thinking in the legal sciences in Poland after the Second World War created a new situation and the question of the attitude towards the theory of Petrazycki 9. The interpretations of marxist 7 The abbreviations of the principal works of Petrazycki cited in the text are: Ν No we podstawy logiki i klasyfikacja umietjçtnosci (The New Basis of Logic and the Classification of the Humanities) Warszawa 1939; Ο - Ο ideale spolecznym i odrodzeniu prawa naturalnego (On Social Ideal and the Revival of Natural Law), Warszawa 1925; Ρ - Wstçp do nauki polityki prawa (Introduction to the Science of Legal Policy), Warszawa 1968; Τ - Teoria prawa i padstwa w zwi^zku ζ teoria moralnosci (Theory of Law and State in Relation with the Theory of Morality), Warszawa 1959 vol. I, Warszawa 1960 vol. I I ; W - Wstçp do nauki prawa i moralnosci. Podstawy psychologii emocjonalnej (Introduction to the Science of Law and Morality, Foundations of the Psychology of Emotions), Warszawa 1959. After the abbreviation the number indicating the volume, if any, and the page are given. 8 The unique Polish monography is that by Kowalski (FN 1). 9 Cf. J. Kowalski / J. Wróblewski , Zagadnienia krytyki i recepcji teorii Leona Petrazyckiego w Polsce (Problems of the), Reception and Criticism of Leo Petrazycki's Theory in Poland Krakowskie Studia Prawnicze X I , 1978; Wróblewski , Teaching . . . (FN 1), passim.
360
Jerzy Wróblewski
theory, based on historical materialism, was the corollary of this discussion. It was in some degree influenced by the developments of the theory of state and law in the Soviet Union in which Petrazycki's theory was opposed to historical materialist approach to law as economically dependent class phenomenon, and its political implications were denounced. The attitude to Petrazycki's theory is, however, the case of the more general problem of the relation between different legal theories. The three types of this relation are identified: reception, holistic negation and critical analysis. The first means an acceptation of a theory as giving the generally right answers, and this reception is thought of either in terms of orthodoxy or allows for some development and modification not touching, however, its basic insights. The second appears as a total rejection of a theory thought of as essentially wrong because of its general features and not worth, therefore, of a careful examination of its details. The third relation assumes that any theory is a complex whole, and, therefore, even a basic difference between compared theories does not exclude the relevance of a critical analysis of their elements because there are various degrees of the dependence of these elements on the basic assumptions of the theories in question. The attitudes towards Petrazycki's theory exemplify these three types perfectly. The reception of the theory in question appears in the works of L. Lande 10 . The holistic negation is strongly marked in some marxist criticism, when the theory is rejected as totally wrong on the cognitive level, and functionally harmful in its political functions linked with Petrazycki's political activities as a social democrat and "kadet" in Russia 11 . The critical attitude prevails in contemporary Polish literature in which Petrazycki's ideas are critically analyzed in detail without accepting the underlying conception of law as a psychical phenomenon. In my opinion the third attitude is wholly justified, and the still growing number of studies concerning Petrazycki's theory clearly demonstrates that this attitude is widely shared 12. 3. In spite of the limited scope of the present essay some general observations concerning the context in which Petrazycki formulated his views, attacked other theories and defended his own theory, are necessary to analyze his methodology, philosophy and legal theory. There are three basic contexts in question: methodology of the sciences, and the humanities; legal sciences, and social ideological context. The general context of the methodology of the sciences and the humanities is rather complex and differentiated. Methodology is under strong impact of 10
Lande, Studia . . . (FN 2), passim and esp. p. 559 - 910. The recent and most elaborated holistic criticism has been formulated by Smiatowski (FN 6), and for polemics cf. Kowalski / Wróblewski (FN 9). 12 Cf. note 5. 11
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
361
the philosophical positivism. The scientific method is the method of cognizing the real or empirical facts. Facts are cognized in various forms of experience and generalized by the induction founding scientific theories. These theories are verified by deductively inferred predictions confronted with experimentally prepared experience. The accumulated knowledge serves the practive as the basis of the proper technique as an effective action using the instrumental knowledge. The standards and models of the sciences should be applied to the humanities. The humanities are based on an empirical psychology or biology, or on both of them. The psychologism, however, dominates, and has some support in a biologism influenced by the ideas of Darwin and Spencer. Psychology seems to offer the universal instrument not only for all humanities, but also for logic and ethics traditionally included within the scope of philosophy. The context of the legal sciences relevant to Petrazycki's ideas contains three basic trends in legal thought: legal positivism, natural law and interests theory of R. von Jhering. Legal positivism in question appears as the German legal science. Petrazycki, giving a lip-praise to this science (0.34), attacks it without respite. Positivist theory of the law in force cannot be scientifically constructed. The positivists preparing the draft for the codification of the German civil law stimulated the Petrazycki's criticism and his idea of the policy of law. When Petrazycki wrote about "the contemporary non-empirical and anti-empirical science of law" (0.16) he thought about the legal positivism. The second element of the legal science context has been the natural law theory. The position of Petrazycki is ambivalent. On the one hand he criticizes the absolutist natural law by affirming the historical relativity of values and the changeability of "intuitive law" expressing these values; rejects the ideas of R. Stammler demonstrating at the same time that his views are not original (cf. 0 chapt. II). On the other hand, however, Petrazycki states that natural law has performed the functions of the policy of law (cf. points 25,28), which is the new branch of the legal sciences created by himself . This ambivalence is related with the fact that legal positivism has been thought of as the negation of natural law, and Petrazycki is an anti-positivist. The third element of the legal science context is the "practicism" of the R. von Jhering's theory of interests. Jhering has passed through a highly significant evolution from legal positivism to the creation of his own theory, which influenced the German Interessenjurisprudenz and the sociological jurisprudence of R. Pound. Jhering is, thus, eventually an anti-positivist like Petrazycki. Petrazycki, however, criticizes strongly Jhering when discussing the legal policy issues and the drafting of the German civil code (cf. Ρ
362
Jerzy Wróblewski
chapt. 6, 13 and passim; T.I., 431 - 441; T.II.75 sq., § 47) 13 . Petrazycki qualifies Jhering's trend as "shallow utilitarian, practical in the vulgar meaning of this term, without general principles and ideals", and ascribes to it "a pernicious influence on the law-making and state's policy in general, and on the law-making and state's policy in general, and on the administration of justice . . . " and states that "it poisons and demoralizes the social life and social psychology" (W. 12). It is because of this Petrazycki is for replacing " . . . a superficial position of the private, procedural etc. interests proper to Jhering and his followers" by the "economic and social point of view" (0.17 cf. 11). The antipositivism of Petrazycki is, thus, inconsistent with the Jhering's antipositivism. The description of the ideological· and political context of the Petrazycki's conceptions requires an analysis of the socio-political forces and ideologies operative of the turn of the century in Russia and Germany. It is impossible, of course, to include this in the present essay. In the works of Petrazycki one sees clearly the conflicts between the ideology of liberalism, of socialdemocracy and marxism. Petrazycki prefers the position of moderate socialdemocracy: he opposes the private capitalist system and socialist system, he sympathizes with the latter stressing that social psyche is still not ripe for it, he polemizes with the vulgar economism and materialism. The political attitude of Petrazycki is clearly expressed in his political activity before the October Revolution and by his leaving the SSSR for Poland in 1918. The separate problem is, however, whether and, eventually, to what degree Petrazycki's political activity is expressed in his theory or, in other words, whether a determined socio-political ideology can be ascribed to his theory 14 . I do not deal with this rather complicated issue here. I I . Philosophy 4. The analysis of the relation of philosophy and legal theory singles out the theories expressing the philosophical and the aphilosophical attitude. The former ist explicitly based on certain philosophical theses thought of as its assumptions; the latter has no such reference. In my opinion it is always possible to ascribe to the aphilosophical theory some philosophical theses using simple methodological instruments, i.e. an alternative ascription or an ascription by minimal assumption15. The legal theory of Petrazycki is an aphilosophical theory. It would be interesting to identify a philosphy which could be ascribed to this theory, but this 13
Cf. also Petrazycki , Prawo a sad (Law and the Court), Warszawa 1936, p. 5 - 9. Cf. Kowalski FN 1), chapt. V , §§ 4 - 7; chapt. V I I , § § 4 - 6 ; Émiafowski (FN 6), passim; Kowalski / Wroblewski (FN 9), ρ. 11 - 22. 15 Wróblewski , Law and Philosophy, in: Oesterr. Zft. f. öffentl. Recht 22 (1977).
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
363
transcends the scope of the present essay16. I will, however, point out the philosophical assumptions of Petrazycki's conceptions without trying to reconstruct his philosophy as a whole. These conceptions refer to an ontology of reality (point 5), epistemological problems of cognition and "practice" (point 6), axiological views (point 7) and practical philosophy (point 8). 5. The ontology of Petrazycki can be qualified as a dualist or materialist empirism and psychologism. The object of the science are "phenomena existing in reality" (T.I, 101). But what is this reality? The position of Petrazycki interpreted as dualism does not accept the platonic "world of ideas" but only an existence material and psychical phenomena. In this sense Petrazycki writes that "the legal phenomena and their elements are the phenomena not of material but of spiritual world", and they ought to be analyzed " . . . not in the external world but in the psyche of the individuals who experience the proper psychical processes" (T.II, 134 135). Because of that the rights and duties are not "real" phenomena but "the projections" of psychical processes (T.I, 112). The spiritual world is the world of psychical experience constituting the psychical reality. If the materialist ontology accepts the opposition of physical and psychical phenomena, then the position of Petrazycki is materialist. This is not, however, a materialism of the kind of the reism of T. Kotarbinski 17 , but a materialism which can be shared with a marxist conception. The ontology of Petrazycki stimulates the question whether the "projections" of psychical phenomena are their content or their product. For the first interpretation one can use the argument that the psychical experience is a real phenomenon and, thus, the law is treated as a psychical phenomenon and as a real phenomenon. The scientific cognition of law replaces the "naive projection conception" by the "scientific psychological conception" in which one explains the phenomena by "real psychological" procedures. (T.I, 346, 261, cf. 293). The additional argument is Petrazycki's psychological conception of logic (cf. point 10) and a criticism of "naive constructivism" (cf. point 15).
16 Kowalski (FN 1), chapt. I ; Κ Pteszka / J. Wolenski, Ontologia Leona Petrazykkiego (Ontology of Leo Petrazycki), Studia filozoficzne 5, 1981; P. J. Smoczynski, Filozoficzne i aksjologiczne podstawy psychologicznej teorii prawa i moralnosci Leona Petrazyckiego (Philosophical and Axiological Foundation of Leo Petrazycki's Psychological Theory of Law and Morality), in: Annales UMCS, G, X X V I I I - 1981; J. Zajkowski, Wykladnia ustaw wedlug Petrazyckiego i wedlug jego teorii (Legal Interpretation According to Petrazycki and to his Theory), Wiledski przegl^d prawniczy 1936,
p. 1 - 20).
17 Cf. Γ. Kotarbinski , Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk (Elements of Epistemology, Formal Logic and Methodology of Sciences), Wroclaw/ Warszawa/Kraków 1961, p. 493 - 514.
364
Jerzy Wróblewski
For the second interpretation, i.e. for treating "projection" as a result of psychological experience, there is the following argument: Petrazycki sees the possibility of exploring law from a "critical projection point of view", viz. as a result of the psychical legal experience (cf. point 22). He writes about other products of psychical experience and deals with their social functions. Petrazycki, however, does not reply to the question how these products of psychical experience exist, and this is typical for any aphilosophical legal theory. The concentration of philosophy on the problems of psychical experience is peculiar for psychologism (cf. point 16). The judgements and reasonings are treated as psychical phenomena (cf. point 10). Instincts and drives, traditionally discussed within the categories of biology, are explained by Petraczycki as the kinds of psychical processes, and especially as emotions (W. §§ 13,14,19). The social phenomena such as law, morality or power, are treated as a product of the mass psychical experience and are explained as psychical phenomena (cf. point 20 - 23). The criticism of the Petrazycki's ontology must be a philosophical criticism. Some levity in treating ontological problems by Petrazycki is characteristic for all aphilosophical legal theories which are fleeing from philosophy to empirical reality thinking that in this way they can stand close to facts (without any philosophical commitment). 6. One of the crucial philosophical problems is the relation of cognition and practice. In the context of Petrazycki's theory we are interested not in practice as a criterion of truth in the meaning, e. g. of marxist or pragmatic philosophy, but in the problem concerning the relation of cognition to evaluation and normativity. This relation is expressed in the opposition of theoretical and practical problems (T.I., 423), and in the difference between the theoretical and practical attitude which should not be mixed (T.I., 152; T.II. 335, 366). Epistemologically there is an opposition between (theoretical) cognition and (practical) evaluation or regulation, but two types of these activities are parts of the philosophy 18 . The philosophy of law, according to Petrazycki, is constituted by legal theory (cognition) and legal policy (practice) (T.II, 501, cf. W. § 5). The opposition of theory and practice, last not least, is expressed in the difference of the theoretical and practical judgements (statements, "positions", sciences), and this is the basic opposition in the logic and methodology of Petrazycki (cf. points 10, 12). The opposition in question was essentially relevant in the history of human thought and deals with basic conceptions of truth, semantic and pragmatic 18 A. Delorme, Uwagi ο filozofii praktycznej Leona Petrazyckiego (Comments on the Practical Philosophy of Leo Petrazycki), in: Z zagadnieù . . . , p. 25 - 27.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
365
features of language, the scope of science, the basis of methodology, and is connected with axiology (cf. point 7). The attitude of the kind accepted by Petrazycki is rather widely shared in contemporary philosophy from several versions of analytical trends to materiastically oriented noncognitivism. Petrazycki, however, treats these highly complicated and problematik issues as solved in an evident manner, and even he does not justify the position he accepts. Petrazycki, opposing the cognition, evaluation and regulation, does no^ eliminate their connection: The "practice" depends on phenomena of reality, and this is the basis of his sociological conception (cf. points 20 - 21); he postulates a rational practical activity, i.e. activity based on a cognition of reality, and this is the basis of his conception of legal policy (cf. point 24). 7. It seems that the axiology of Petrazycki is shaped under the influence of three sometimes conflicting conceptions: the emotivist theory of values linked with the theory of "projections", the historical sociopsychological conception of values, and the concept of the social ideal. In axiology there are many versions of emotivism. The extremely radical version refuses the thesis, that evaluative statements (and norms) have any sense, and treat them as a mere expression of emotions. The moderate version treats evaluative statements (and norms) as linguistic signs which not only express psychical phenomena, but also have a sense in a determined language and, because of that, can influence human behaviour. In my opinion this second version is acceptable, and the views of Petrazycki could be ascribed to this kind of emotivism. Petrazycki did not know, however, about the present sophistication of this point of view, which separates language and speech, semantics and pragmatics, and deals with the pragmatical multifunctionality of language used in different contexts 19 . Petrazycki states that adjectives such as "nice", "dear" etc. are not "correlates" of any real features, because are only procuded by the psychical experiences of a person using them (T.I, 122). Psychical experiences, and especially emotions singled out by Petrazycki (point 18), ascribe to the objects they are referring to some features, which in reality are not their characteristics. This ascribed feature is defined as a "projection" (e.g. T.I, 55 sq.; 266 sq.; T.II, 97 sq., 164) or "emotional phantasy" (T.I, 55 sq.; T.II.21, 162, 266, 328). There are esthetical "projections" ("beautiful", "ugly"), moral "projections" ("good", "bad"), and legal ones ("just", "entitled"). Some "projections" are spurious objects which do not exist in the ontological meaning of this term, e.g. commands, duties, obligations, rights, jural relations. 19 Cf. e.g. Wróblewski , Evaluative Statements in Law. A n Analytical Approach to Legal Axiology, Rivista inter, di filosofia del diritto 4 (1981), p. 605 - 508 and lit. cit.
366
Jerzy Wróblewski
The conception of "projection" goes beyond the axiological emotivism when it asserts that it does not exist in the sense in which the psychical experience exists. The acceptance of noncognitivism and a version of the emotivist theory of values, connected with the acknowledgement of their conditioning by some phenomena, does not commit to any extrapolation of the theory of "projections" in the way Petrazycki did. That the norm is a "projection" of emotion does not commit to deny its existence. It is highly symptomatic that J. Lande, accepting the fundamental role of emotions, acknowledges the existence of their two correlates, i.e. norms and behaviour 20 . The second component of Petrazycki's axiology is historical sociopsychologism of values. He rightly sees that ethical evaluations (including legal and moral ones) are socially conditioned and historically changing. This opposes him to any asociological and ahistorical emotivism. The assertion, however, of a general thesis of historical sociopsychologism of values is accepted in many constructions: besides the Petrazycki's theory there is the historical materialism and various versions of axiological relativism common e. g. in the sociology of morality, and of culture. Petrazycki notes the historical differentiation of cultures, and singles out more and less developed cultures (e.g. T.I., 139, 155, 166). The criteria of this qualification are determined by the conception of progress, which is " . . . socially confirmed . . . for the particular nations and for the whole mankind" (P. 25, cf. point 21). The third element of Petrazycki's axiology is the concept of the social deal presupposed in his legal policy (cf. point 25). This ideal is thought of in two ways: as the terminal of historical evolution, and as "the axiom of practical reason". These two presentations of the ideal in question lead to some difficulties in emotivistic axiology connected with an assertion of historical and social dependence of evaluations, and rises the problem of natural law too (cf. point 28). 8. Essentially relevant for practical philosophy are two lines of thinking, which in some conceptions are antithetical, but are linked together by Petrazycki. The one line is the tendency to break with the monopoly of teleological explanation of human activity, and on the other, the tendency to rationalize this activity in general, and to make legal policy scientific in particular. Petrazycki criticizes the psychology of his time for explaining human behaviour by will, directed to achieve determined ends. According to Pet20 Lande, Studia (FN 2), p. 674 - 677. About the multidimensional understanding of Petrazycki's theory cf. e.g. Opatek, Teoria Petrazyckiego a wspóiczesna teoria prawa (Petrazycki's Theory and Contemporary Legal Theory), in: Ζ zagadnieri . . . p. 123 126; t. I. Podgorac, Aktualnoéé myéli Leona Petrazyckiego w zwi^zku ζ wieloaspektowo£ci$ jego twórczoéci (Actuality of Leo Petrazycki's Thought Related with the Plurality of Its Aspects), in: Annales UMCS G, X X V I I (1981), p. 46 - 50.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
367
razycki the "real" motives of behaviour are emotions, and the teleological behaviour is only a mariginal phenomenon (cf. point 19). The rationality, however, is commonly understood as a behaviour consisting in a justified selection of means for achieving referred ends, and based on the proper knowledge and the accepted axiology. The behaviour, however, is not to be explained in terms of a rational teleology, but rather in terms of irrational emotions which sociologically are the product of an unconscious social and/or biological adaptation. The anti-teleological argument in this context can be thought of as an irrationalist tendency. One can see here an analogy with a psychoanalytical approach, which explained the wide areas of human activity not in the sphere of the conscious and, at least in part of the rational, but in the sphere of subconscious irrationality. The second line of Petrazycki's argument in practical philosophy consists in an affirmation of the relevance of rationalization of human behaviour by scientific cognition. The scientific data are necessary for any choice of means adequate for implementation of the assumed end. The postulate of rationality concerns the legal science: Petrazycki aims at scientific approach to law and to rational research (e.g. T.I., 200). This postulate concerns also "the practice": Petrazycki aims at the creation of a scientific legal policy (or the science of legal policy) (cf. point 24), which is the important element of the "rational social pedagogy" of the future (e. g. 0.40). The theory should prepare the basis for a rational practical behaviour. This is the master idea of Petrazycki expressing the fundamental relation of the theory of law and the legal policy. The rational legal policy should replace the unconscious adaptative social processes. Petrazycki links these two different lines of argument of practical philosophy. The irrationality of human behaviour is not restricted to the pathological cases, and it determines the scope within which a teleological explanation of human behaviour is possible. In our culture the postulate of rationality is accepted: the practice and practical discourse should be rational at least in the sense of their justifiability 21 .
21 Cf. Kotarbinski, Traktat ο dobrej robocie ( A Treatise on Good Work), Wroclaw 1973, 5 ed., p. 134 - 136. About relations between rationality and justification cf. Wróblewski, Justification of Legal Decisions, in: Revue intern, de philosophie 127 - 128, 1979, p. 277 - 282. The variety of the contemporary conceptions of rationality are presented in Rationality Today, in: La rationalité aujourd'hui, ed. T.F. Geraets, Ottawa 1979.
368
Jerzy Wróblewski
I I I . Logic and Methodology 9. One of the striking features of Petrazycki's works is the criticism of the ideas of his time which express his ambitions and the faith in his own potentialities. This results in the originality of his ideas and in the relatively coherent set of own ideas reaching far outside the theory of law and state and morality, and extending even beyond the humanities. Petrazycki deals extensively with logic and methodology, and changes psychology, and constructs legal theory which stimulates even to our days. The development of the science and the humanities has made several of his ideas obsolete, but this does not tarnish the systemicity of this thought. In the present essay I can only mention chosen problems relevant for the systemic character of his ideas. There are: psychological conception of logic (point 10); linguistic issues (point 11); typology of statements, sciences and humanities (point 12); the construction of scientific theories (point 13); methods of research (point 14), and the criticism of science (point 15). 10. Petrazycki asserts that psychology deals with thinking, judgements and reasoning, and that " . . . the psychological nature of these phenomena in psychology is controversial and cannot be defined with the concepts the psychologists are using" (W. 442). This is together a criticism of the current psychology and expression of a psychological approach to logic. In his criticism Petrazycki was rather original, but the psychological approach to logic was one of the trends, and perhaps even the dominant trend, in the logic of that time. Today this approach belongs only to the history of logic and can be qualified as a "naive" approach, using the preferred Petrazycki's term used his critical arguments. Petrazycki asks where is the subject of a statement from the logical and/or grammatical point of view. He answers saying that the subject is situated " . . . in the judgements (in the consciousness of the men experiencing these judgements), as their constitutive part, and not somewhere in a space outside these judgements " . . . " (W. 54; cf. 0.15; T.II, 135). The search for this subject in a reality as a reference of the corresponding name (or description) is, according to Petrazycki, a case of "naive realism" ("the servant is in the hall"); a negation of its existence is a "naive nihilism" ("Zeus is the king of Olympian gods"); a construction of the subject in some sphere of realm of special reality is a "naive constructivist theory" ("The treasury has a big wealth") (W. 53 - 55). "The assertive judgements, assertions of something about something (...) are emotional apulsive acts; negative judgements . . . are emotional repulsive acts" and Petrazycki proposes also their symbolization (W. 442). Inference is " . . . a representation of a new emotional cognitive relation, a new links of emotion an idea" (W. 448).
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
369
These views express an extreme psychologism which in the context of the whole theory seems to be the proper interpretation (cf. point 16). Sometimes, however, Petrazycki writes about psychological point of view and psychological inference, sometimes about "logic" or "grammar" (W. 451). And one can ponder over Petrazycki accepting also a different conception of logic when he uses the elementary logic e.g. dealing with the correctness of definitions (T.I, 398, 425; W. 160 sq., 193 sq.). It would be hard today to accept Petrazycki's views concerning logic. The contemporary formal logic is not consistent with emotional psychologism of Petrazycki, who has known only elementary classical logic in its traditional not modernized version. In the referred texts Petrazycki deals with logic in terms of judgements, psychological experience and their elements. In later period of his research Petrazycki makes an important innovation by introducing a new category called "position". He asserts that the logic using the categories of judgement and sentence is faulty (N. 14 sq.). The proper logic has to be constructed using the concept of "position" defined as " . . . simple, not divisible sense or contents of judgements or propositions . . . (or) of other things having similar senses" (N. 17), as perceptions and ideas (N. 24, 29). It is rather difficult to reconstruct the concept of "position" using only the notes from Petrazycki's lectures 22 . If we restrict the use of "positions" to the basic elements of propositions, then one can interpret them as the identification of their basic component parts taking into account their existential assumptions when using quantifiers 23 . 11. The problems of the language are highly relevant in the contemporary philosophical and methodological reflection, and in the theory of law too. The acknowledgement of the role of language in cognition is the common denominator of all versions of analytical philosophy from its neopositivistic beginnings to the current trends 24 . Petrazycki is interested in language on the level of methodology, and especially of the legal methdology. In spite that he often errs according to our present conceptions he manifests quite striking insight by intuitively grasping the problems actual today. 22 T. Kwiatkowski, Kilka uwag ο pogl^dach logicznych Leona Petrazyckiego (Some Comments on the Leo Petrazycki's views on Logic), in: Studia Filosoficzne 5 (1981), p. 87 - 94. 23 Wróblewski , Jçzyk a nauka w teorii Petrazyckiego (Language and Science in Petrazycki's Theory), in: Ζ zagadnietì . . . , p. 180. 24 Cf. e.g. J. Wolenski, Ζ zagadnieri analitycznej filozofii prawa (Some Problems of the Analytical Legal Theory), Warszawa/Kraków 1980, chapt. I I and cit. lit.; Wróblewski, Jçzyk a nauka . . . (Fn 23), passim; Diritto e analisi del linguaggio, U. Scarpelli, ed., Milano 1976.
24 Festgabe Opalek
Jerzy Wróblewski
370
According to Petrazycki "not the thought should be adapted to the terms, but the terms to the thought. This is true for any thought, and especially for the scientific thought" (W. 159). This aspect of language influences the identification of various languages connected with law and a preference for reconstruct!vism. Petrazycki singles out the following languages: the common language; the language in which the texts of "official law" are formulated (I use further the term "legal language); the language (or terminology) used professionally legal (I use the term "the juridical dogmatical language"); the language of a scientific theory. Today, notwithstanding the discussions concerning the identification and typology of the languages connected with law (jural languages)25, we can heuristically accept their identification for a logico-semiotical research in law and use them for the analysis of Petrazycki's conceptions. First of all, rather important is the difference between the common language and various "practical terminologies" to which the legal language and the juridical dogmatic language belong to. The common language, or the "ordinary common speech" (W. 88), is treated by Petrazycki in the same manner as we actually do. Petrazycki does not treat the common language as less important than other languages. The most relevant and at the same time typical case is that of the term "law": "there are no reasons for treating the common scope of using the term «law» as erroneous . . . " (W. 90). The common language is developing spontaneously in a society, has some "unconscious wisdom" (W. 88 sq., 101 sq), and one can characterize this language in the way Petrazycki described custom as "an unconscious result of the collective social experience, containing the instinctive social wisdom coming from experience" 26 . s
Petrazycki wants to be free, however, not only from the legal language and juridical dogmatic language, but also from the intuitions of the common language connected with the faulty "projection conception" of ethics (T.I, 61 sq.) and of law (T.I, 123 sq.). Notwithstanding this general orientation his conception of ethics according to him " . . . approaches . . . to the unconscious classification inherent in the common language of the large masses of men" (T.I, 190). 25 E.g. B. Wroblewski, Jçzyk prawny i prawniczy (Legal Language and Juridical Language), Kraków 1948, part. I I , I I I ; K. Opatek / J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa (Problems of Legal Theory), Warszawa 1969, chapt. II. 1.1; Z. Ziembinski, Le langage du droit et le langage juridique, in: Archives de philosophie du droit 19 (1974); W. Lang / J. Wróblewski / S. Zawadzki, Teoria paristwa i prawa (Theory of State and Law) Warszawa 1980, 2 ed., chapt. 16.1 - 16.3; Z. Ziembiùski, Problemy podstawowe prawoznawstwa, (Fundamental Problems of the Legal Sciences), Warszawa 1980, chapt. 2.2.2. T. Gizbert-Studnicki, Die Rechtssprache aus soziolinguistischer Sicht, in:
RECHTSTHEORIE 15 (1984), S. 69 - 81. 26 L. Petrazycki, Zagadnienia prawa zwyczajowego (Problems of Customary Law), Warszawa 1938, p. 8.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
371
Petrazycki often contrasts the common language and the "professional terminologies" shaped according to the practical purposes (W. 93). The special case is the "professional legal language" (T.I, 191) and especially the concept of law defined in it as "the law in the sense of juridical speech" (T.II, 238), "in the legal sense" (T.II, 303), "in the legal meaning" (T.I., 330, 333) and so on. "The habits of naming in the legal profession" (T.II, 98) are adapted to practical needs (W. 96). Petrazycki does not challenge the value of juridical language, because practical terminologies " . . . do not rise accidentaly and are not deprived of some proper «wisdom»" (W. 104). Petrazycki, however, rejects the concept of law in the legal sense as the basis of the theoretical cognition of law. The theoretical concept should serve " . . . the cognition and explanation of phenomena, and not to determine what lawyers . . . call «the law»" (T.I, 330). The only proper language for cognition of law is the language constructed by Petrazycki himself. I will call it "the juridical theoretical language". Petrazycki analyzes the legal language because this is the language in which "normative facts" of the official law are formulated, it is the language of the law in the legal meaning of this term. This law, however, cannot constitute the object of the Petrazycki's theory, because it cannot serve as the basis of an "adequate theory" (point 13). Petrazycki sees the difference between the norm and a provision formulated in a legal text. He singles out the "complete formulation" and "shortened formulation" of a legal norm, i.e. an attributive, imperative, and neutral formulation. The understanding of a legal norm demands its complete formulation using proper interpretation (T.I, 87 - 89). These ideas correspond with the widely accepted difference of a legal norm and a legal provision, and accept the conception of a norm as a constructed rule which is widely shared in many theories having no affiliation with the ideas of Petrazycki 27 . Petrazycki is for the clarity and precizesness of the legal language (T.I, 327) fearing an uncertainty of an application of law: "The court should implement the tendencies for unification and safeguarding peace and order" (T.I, 305). The use of undetermined terms is not consistent with this function of the courts (T.I, 305), and, moreover, this use in some situation could lead to decisions against the economically weak parties (P. 189 - 192) Petrazycki's postulates for the legal language could be ascribed to the ideology of the legal and rational judicial decision 28 .
27 E.g. from the Polish Littérature Lang I Wróblewski I Zawadzki (FN 25), chapt. 17; Ziembinski (FN 25), chapt. 3.5. 28 J. Wróblewski, Idéologie de l'application judiciaire du droit, in: Oesterr. Zft. f. öffentl. Recht 25 (1974), p. 56 sq. Idem, Sadowe stosowanie prawa (Judicial Application of Law), Warszawa 1972, chapt. XII.2.
24*
372
Jerzy Wróblewski
Last not least there is the juridical theoretical language specific to constructed Petrazycki's theory of law, and opposed to any language of practice. Criticism of the juridical dogmatic language pushed Petrazycki towards the common language (W. 105 sq., 144) but in principle Petrazycki is the reconstructionist in the present understanding of this term 29 : the naming of the theoretically singled out classes cannot be determined by the existing language (W. 159 - 177; T.I, 195 sq.). The construction of theoretical classes and of the corresponding concepts follows only the methodology of scientific theories (cf. point 13). The existing language can be used if he contains " . . . the terms used in practice in a way corresponding with the scope of our concept", i.e. of a theoretically properly constructed concept (W. 164). But if there is no such needed term in the existing language "we should invent it" (W. 171). This is a call for a synthetic definition without, however, neglecting dangers linked with any creation of "the substitutes of the natural common language" (0.56). Notwithstanding these remarks the basic position of Petrazycki is formulated in a way which can be treated as the motto of reconstructivism: "Names, which are the freely determined signs for scientific (adequate) concepts created independently of any linguistic expressions used under the influence of any linguistic, professional or other habits for denoting some classes or sets of objects, we will call scientific terms" (W. 176). This definition, taking into account the Petrazycki's use of the term "scientific", is a persuasive definition. The language used by Petrazycki in his theory in general, and especially in his polemics, includes a very strong persuasive element. He uses often such words as "scientific", "lame", "jumping", "unconscious", "strange" as adjectives for the conceptions he was criticizing, and "scientific" for his own conceptions, and this clearly demonstrates that he did not leave out the functions of language which are restricted to description and cognition. It is worth mentioning that in spite of all his reconstructivism and fear of the pernicious impact of the deep-rooted linguistic habits, Petrazycki was willing to use extensively linguistic arguments for supporting his own conceptions. He demonstrates that the authoritative and mystic features of legal psychical experience are reflected in common language (T.I, 50), identifies the linguistic corollaries of the imperative-attributive features of legal emotions (T.I, 86 sq., 345 sq.), and of the legal psyche (T.I, 229 sq.) or of the psychological conception of a right (T.I, 75 - 79). 12. Petrazycki in an interesting manner deals with the problem of typology of the sciences and humanities. He sees the chaos reigning in this area and 29 Wolenski , Metodologiczne d^zenia Petrazyckiego a wspóiczesna teoria nauki (Methodological Tendencies of Petrazycki and Contemporary TTieory of Science), in: Ζ zagadnieó . . . , p. 169 sq.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
373
aims at ordering it by imposing a scientific typology quite different from accidental classifications. He aims not only at typology of the already existing sciences and humanities, but he wishes to identify those which do not exist but should be created according to the postulate of the completeness. The typology should be based on the features of the "positions" and judgements they contain or are formulated with. To simplify my analysis I will deal mostly with judgements. The judgements are divided into theoretical, referring to cognition, and practical, connected with evaluation and regulation or in other words - with "practice" (cf. point 6). Theoretic judgements denote either classes of objects ("class judgements") or concrete individuals ("singular judgements") in a historical descriptive or prognostic way. The theoretical judgements are composed of "objective cognitive positions". The practical judgements are composed of "subjective relational positions" and among them there are evaluations or postulates; the postulates refer either to human behaviour ("practical judgements") or to other objects. Practical judgements are either teleological or "basic" judgements (normative judgement), which are further divided into positive (dogmatic) referring to a normative fact of their creation, or non-positive (intuitive) without such reference (N. 32 - 59). This typology is very elaborated, and it stimulates some critical comments. Using a somewhat modern terminology it should be noted, that not only "practical judgement" but also "evaluations" are either teleological (i.e. instrumentally relativized statements) or "basic", and Petrazycki treats evaluations in a less detailous way than practical judgements. The subjective character of the instrumentally relativized statements is highly controversial, but Petrazycki simply did not see the underlying problems. The "basic" normative judgements and evaluations do not constitute an uniform group: they are either systemically relativized or not relativized 30 , and their devision in positive and intuitive does not cover this distinction. From the contemporary conceptions point of view one should make a difference between norms and expressions about norms, and the latter are either propositions, or norms, or evaluations formulated in the second level language. The typology of judgements has its corollary in the classification of the sciences and humanities. Following the interpretation of Petrazycki's ideas given by J. Lande and limiting ourselves to the legal sciences, one should single out the following types of the legal sciences: (1) theory of law and the theories of the particular kinds of law; (2) descriptive sciences; (3) historical sciences; (4) dogmatic sciences; (5) general legal policy and particular legal policies, e.g. of private law or of penal law 3 1 . 30 Cf. J. Wróblewski, Evaluative Statements . . . (FN 19), passim; Idem, Systemically Relativized Statements, Logique et analyse 81, 1978.
374
Jerzy Wróblewski
The typology of the sciences and humanities presented by Petrazycki stimulates two critical comments. Firstly, Petrazycki opposes theoretical sciences and practical sciences but he does not refuse a scientific character to the latter postulating their rationality. This is a justified tendency, but there is the question why the scientific legal policy is possible, whereas the scientific character of legal dogmatics is at least rather dubious according to Petrazycki's views. Secondly, the zeal of systematization expressed in Petrazycki's conception cannot be accepted neither from the descriptive nor from the prescriptive methodology. In the former the existing legal sciences are sets of linguistic expressions ("judgements" or "positions") which belong to the various areas of Petrazycki's typology. In the latter the postulate to construct a legal science consisting solely of the one type expressions seems neither justified not practically possible. For the argument supporting this criticism it is sufficient to list the linguistic expressions of various legal sciences and the problems they are dealing with 3 2 . One can, however, try to defend Petrazycki arguing that he has in mind only "essential" types of expressions and not accidental ones (N. 60), or that he acknowledges the existence of "mixed" sciences and humanities (N. 41, 59), but this defence seems rather weak. 13. In methodology the term "theory" is notoriously ambigous and fuzzy. This is also the case of Petrazycki: "theory is a single linguistic expression or a set of expressions fulfilling certain conditions" (W. 122). The criterium of a scientific character of a theory is called "adequacy". For Petrazycki "adequate scientific theories" are " . . . theories in which what is asserted (the logical predicate which is its justification) is true for the class of (referred to - JW) objects . . . " (W. 124); and what is asserted " . . . is referred to the class which is neither to narrow nor to wide, but the adequate class, i.e. class whose scope is logically adequate for the predicate (W. 153). The "adequacy" of theory, thus replace the criterium of truth of a theory (N. 13): only adequate theories are "completely proper theories and perfect ones" (W. 153). The conception of the adequate theory is clear if applied to linguistic expressions having a subject-predicate structure: then it means the equivalence of the subject and predicate. This is simply a postulate of a proper definition concerning the scope of definienduma and definiens 33. The necessary condition for constructing an "adequate theory" is an identification of "adequate classes" i.e. of classes having "adequate predicates" 31 Lande, Studia (FN 2), p. 369 - 342. Cf. Lang / Wróblewski / Zawadzki (FN 25), chapt. 1.1. 33 Zajkowski (FN 16), p. 23 sq.; J. Wróblewski, Metodologia etyki Leona Petrazykkiego (Leo Petrazycki's Methodology of Ethics, in: Studia filosoficzne 2 - 3 (1960), p. 272 sq. 32
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
375
(W. 94,155 sq.). Such class is constituted according to the formula "all objects having the characteristic a". Then one should demonstrate that "everything having the characteristic a, has also further characteristics b or characteristics b, c, d etc." (W. 157, T.I, 192,195, 336 sq., 350). "Aiming at creation and justification of a proper theory is it not sufficient to state an existence of some fact, but one has to state a necessary logical or causal... relation between the differentia specifica of the class of objects (the theoretical subject) and something else, (the logical predicate)" (W. 185). The additional act is to give a name for the singled out adequate class. The construction of "adequate theories" is essential not only for cognitive purposes, but has also a systematizing value in methodology: it points out what types of theories ought to be constructed and what should be their hierarchy (W. 148 sq., 154 sq.). The idea of "adequate theories" has some historical antecedents34 but Petrazycki's thought can be treated as quite original. This idea, in spite of its persuasiveness, stimulates fundamental doubts. The criteria of "adequacy" are adapted to define some terms, but not to construct sets of assertions, and their observation in constructing a theory is operatively impossible. The open problem is whether one could treat the "adequacy" not in opposition of truth, but as a directive of constructing the theories, and how to avoid the doubts concerning the logical and causal relations between the characteristics of subject and predicate . . . It seems that no adequate theory has been built by anyone including Petrazycki himself. One can argue that some deductive theories could fulfill the Petrazycki's postulates if treated as interpreted formal calculi, but this is not the case Petrazycki had in mind. 14. In methodology one analyzes the scientific heuresis of assertions and their verification, Petrazycki deals with the methodology of empirical research, because law is an empirical phenomenon of psychic experience (point 17). The assertions concerning fact are formulated on the basis of empirical methods. The research of facts is the necessary condition of the scientific character of assertions: "scientific results (are) truthful, based on facts" (T.II, 100). The basic method of research is, thus, a "simple" or "experimental" observation, analyzed by Petrazycki in detail as a method of psychology (T.II, 100, 102, 259, 594, 609). The general statements concerning facts are made inductively, according to the ideas of Mill cited explicitly by Petrazycki (W. 200 sq.; T.I, 322). From 34
T. Kotarbiùski, Petrazyckiego koncepcja twierdzenia adekwatnego na tie dawniejszych doktryn pokrewnych (Petrazycki's Conception of Adequate Statement on the Background of the Former Similar Doctrines), in: Ζ zagadnien . . . and former Works of Kotarbinski cited there notes 1,2; Kwiatkowski (FN 22), p. 82 - 86.
376
Jerzy Wróblewski
adequate theories the deductively inferred statements are confronted with empirical data. The "deduction" is highly relevant in Petrazycki's methodology 35 - one the fundamental arguments supporting his theory is that its consequences are confirmed by the observation of reality. Relatively often Petrazycki uses historical arguments (e.g. T . I I , 252 sq., 311 sq., 379, 676; 0.22; P. 53). It would be hard not to agree with the view that "one not only could but one should search in the past for materials and directives for research concerning the present and determining the future", (P. 163). Petrazycki, however, uses the historical data usually in a rather general way as if they concerned the phenomena universally known and generally acknowledged. 15. Petrazycki criticizes extensively conceptions in all areas bearing upon his research. Without going into details I will enumerate the main types of critical arguments he uses. Petrazycki attacks the mixing of the theoretical and practical point of view (cf. point 6), of the statements about "the Is" and those, dealing with "the Ought", he criticizes the arguments where the borderline between cognition, evaluation and regulation is blurred (W. 99; T.I, 422 sq.). This error is fundamental, but one can discuss whether it is, as Petrazycki claims, an unavoidable consequence of any theory of the law in force. The further critical argument is the contradiction with reality which is peculiar to the "absolutely erroneous theories" (W. 150 sq., T . I I , 355). This is, of course, the evident argument for criticism in the area of empirical sciences, but the problem is what is the reality referred to (cf. point 5). For Petrazycki the reality in question relevant for legal theory is psychical experience. He argues that when someone defines this reality in a different way is taking a "naive realistic" standpoint (T.I, 276; T.II, 45, 55, 94,135; W. 54), or "naive nihilist" (T.II, 35, 135, 137 sq., 145; W. 54) or "naive constructivist" one (T.I, 264, 276, 362; T.II, 135, 146; W. 55). Petrazycki willingly uses the argument that a criticized theory is not "adequate". The non-adequate theories, besides the "absolutely erroneous theories", are "limping theories", "jumping theories" and theories linking the features of these two groups (W. 187 - 189; T.II, 81, 91, 149). The theories concerning the law in force are erring between the Scylla of lameness and the Charybda of jumping (T.I, 431 sq.): "each theoretical statement concerning what the lawyers call 'the law', inevitably is an unscientific theory . . . and in the best case, if it is not an absolutely erroneous theory, then it is an either
35 Cf. also L. Petrazycki, k Ο dopelniaj^cych pr^dach kulturalnych i prawnych rozwoju handlu (On the Supplementary Cultural and Legal Trends of the Trade Development), Warszawa 1937, p. 11,28; Wolenski, Metodologiczne . . . (FN 29), p. 165 sq.
Philosohical Positivism and L e a l Antiositivism of Leo Petrazcki
377
limping or jumping theory" (T.I, 338). This assertion of Petrazycki is highly problematic and seems not to be justified, but the discussion implies the analysis of basic problems of legal theory which could not be made in the present essay36. The types of Petrazycki's criticism referred to above are based on his ontological, epistemological and methodological assumptions. He uses, however, other arguments which are commonly accepted in methodology and in elementary logic. E.g. he points out that an assertion has been falsified (T.II, 84, 125), that a theory is based on false assumptions (T.II, 366) or does not observe the logical postulates (T.I, 367, 369, 377 sq., 403 sq.; T.II, 405). The typical arguments of this last case are the errors in defining, such as "ignotum per ignotum" (T.II, 93 sq.), regresses ad infinitum (T.II, 330), or "idem per idem" (T.II, 331). Last not least Petrazycki criticized the language of other theories: the use of unclear and metaphorical terms (e.g. T.I, 399) and he is for a "simple language" in which "the things are referred to by their names" (0.55). Petrazycki is rather persuasive in his criticism. His choice of terminology, sometimes on the borderline of epithets, could serve as an example in the theory of argumentation. No wonder because he writes about the "theoretical emotions" in judgements, which are particularly strong in the situation of controversy (W. 443). I V . Psychologism and Psychology 16. The conceptions of Petrazycki are treated rightly "as undoubtedly the most consequent and the most ingenious from the psychologistic interpretations of ethics" 37 . It is worth while to analyze in what sense we are talking about psychologism in reference to Petrazycki's ideas. Firstly, Petrazycki is a representative of psychologism thought of as a view according to which the social sciences and the humanities deal with the facts of psychical experience and with phenomena related with them. Psychology appears, thus, as their common basis. Petrazycki asserts that his criticism and his reform of psychology have a significance " . . . covering . . . all sciences called the humanities, and among them the social and political sciences . . . These sciences are dealing either directly with the phenomena of the human spirit, with objects and absolutely psychological concepts . . . , or with 36 Cf. W. Lang, Leon Petrazyckiego krytyka "prawa w rozumieniu prawniczym" (Leo Petrazycki's Criticism of "Law in Legal Sense"), in: Ζ zagadnieó . . . , p. 57 sq.; Opatek, Teoria . . . (FN 20), p. 132 sq.; J. Wroblewski, Jçzyk . . . (FN 23), p. 186 188. 37 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii (History of Philosophy), Warszawa 1950, vol. I l l , p. 500.
378
Jerzy Wróblewski
phenomena causally connected through causality with the psychical processes . . . " (W. 213). It would be hard to find any more explicitly stated credo of psychologism determining the paradigm of the social sciences and the humanities. Secondly, Petrazycki is a representative of psychologism in the theories of particular fields, e.g. logic (cf. point 10) or legal sciences (cf. point 22). Here we are dealing not with a general paradigm, but with a comparison between various theories. On this level Petrazycki's psychologism is opposed to the legal positivism (cf. point 27). Thirdly, psychologism can be treated as a way of defining the fundamental concepts of the given area of science. If this way of defining is presented as a consequent theory, then the definitions are the instrument of psychologism in the second, above mentioned, dimension. Petrazycki defines law as a psychical phenomenon: "through law in the meaning of a class of real phenomena we will understand such psychical experiences which are imperative-attributive emotions" (T.I, 123). The conceptions of Petrazycki are psychologism in the three meanings of this term. There is also a question whether Petrazycki is a radical or moderate in his psychologism. His views are interpreted in different ways and it seems that this is one of the consequences of an ambivalence of his theory. A choice between these interpretations tells not only about what is interpreted but also about an attitude of the interpreter or critic. A n interpretation of Petrazycki's theory towards a radical psychologism leading to solipsism and subjective idealism 38 , is, as a rule, correlated with a holistic critique. Interpretation of this psychologism as moderate and stressing some elements of multidimensional approach to law is proper either to a critical analysis or to reception 39 . The analysis of Petrazycki's psychologism calls for a description of the methods of psychological research (point 17), the main trends of reformation of psychology and theory of emotions (point 18), and the description of motivation of human behaviour (point 19). 17. Psychology is for Petrazycki "the theory of psychical phenomena, of the phenomena of consciousness" (W. 212). It is an empirical science and his fundamental method is introspection. Petrazycki follows the psychology of his time, but is not satisfied with the traditional research, because he aims at "criticism and reform of traditional psychology" (W. 212 sq.). He is interested
38 E.g. G. L. Seidler, Doktryny prawne imperializmu (Legal Doctrines of Imperialism), Warszawa 1957, p. 62 sq.; J. P. Smoczynski, Filozoficzne i aksjologiczne . . . (FN 16), passim. 39 Cf. note 20 and Kowalski (FN 1), chapt. II.4; J. Wróblewski, Metodologia . . . (FN 33),. p. 277 and cit. lit.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
379
in analyzing not the well known elements of psychical experience (will, feeling, cognition) but in "emotion" as the identified by him new element of this experience. The emotions should be identified and described (W. § 16; T.I, 10 sq., 91 sq., 156 sq.). Since the emotions are hidden for a simple and direct introspection, the more sophisticated forms ought to be used, viz. the experimental and recording introspection. Moreover one can strengthen the emotions by special experimental techniques, by the "method of counteraction" and "method of irritation". Introspection, moreover, can not only be used as a tool of a "subjective diagnosis", but also for an "objective diagnosis", as an inference of an observation of emotionally conditioned behaviour, i.e. of the "actions of emotions" (W. 131). This somewhat summary outline is sufficient for justifying the thesis that Petrazycki in his ideas concerning the methods of introspective research had rather advanced ideas and was a forerunner of the later development of this tool of psychological research. He sees the limitations of introspection (W. 429) and this pushes him to invent the mentioned above new tools of experimental introspection and of linking this self-observation with an observation of the behaviour of others. 18. Petrazycki's psychology is based on the empirical research (point 17) and on the criticism of the deficiencies of traditional psychology (W. §§ 8 12), which cannot explain commonly known phenomena (e.g. hunger W. §§ 13, 14) or the motives of behaviour (W. § 11). It is no place here to describe this criticism. But its result is briefly summarized by Petrazycki: "elements of psychological experience contain: (1) two-sided, passive-active emotions (impulsions); (2) one-sided elements divided into (a) one-sided passive experiences of cognition and feelings, and (b) one-sided active element of will" (W. 402 sq.). Cognition, feeling and will are three basic elements of the traditional psychology (W. §§ 8 - 10) and all of them are explained through the new element, i. e. the emotion (W. §§17-19). The twofold, passive-active, stimulative-effective character of emotions is biologically founded: " . . . it corresponds with the essence of the function performed by psychical experience in the economy of life" (W. 404) by adapting the organism to situation of his existence (T.I, 15). This link between psychology and biology by appears as a correlate of the links of psychology with sociology (point 20), and is a relevant argument against subjectivist and individualist, and even solipsist, interpretation of Petrazycki's psychologism (cf. point 16). Petrazycki introduced numerous types of emotions which suggest a kind of universal emotivism (W. 414 sq.): emotions are operative in almost every psychical experience and in any behaviour. This can stimulate some doubts, but
380
Jerzy Wróblewski
the criticism belongs to psychology. Our interest is centered on the ethical emotions in general, and on legal emotions in particular (cf. point 23). 19. One of the consequences of discovered emotions is a new explanation of the motives of human behaviour. According to Petrazycki " . . . real motives of our behaviour are never those identified by the existing theories: these motives are emotions . . . " (T.I, 13). This thesis prima facie sounds too radical, but it serves for useful criticism of a reduction of the motives to a teleological explanation, as in theory of egoism (e.g. W. 147, 308 sq.; T.I, 11 sq.), of hedonism (W. 146, 310 sq., 320; T.I, 11, 25, 36 sq.) or of utilitarianism (W. 146 sq.; T.I, 416 sq., 427 sq.). The teleological motivation, exemplified by hedonism and utilitarianism, appears only as one kind of an "intellectual-emotional motivation" in which the stimuli of emotions are psychological representations. But there are also other stimuli like e.g. feeling of pleasure or pain ("the feelings-emotional motivation") (T.I, 23 - 26) or "independent motivation" when a representation of an action is linked directly with an apulsive or repulsive emotion for or against certain behaviour. The practical judgements based on such motivations are "basic (normative) judgements" and their content appears as "principles of behaviour, or norms" (T.I, 34). The importance of this theory of motivation is clear: the motivations connected with law cannot be reduced to the teleological motives of gain or avoiding of pain. Petrazycki successfully attacks the simplification of teleologism and rational instrumentalism as universal theories explaining human behaviour, and motivations are far richer und more complex phenomena. Petrazycki, however, does not deal with the spheres of subconsciousness discovered by psychoanalysis in spite of the fact that emotions demand special techniques to rise them to the level of consciousness enabling their analysis. V . Sociology and Legal Theory 20. Petrazycki projected an "emotional sociology" as a general theory, but has not realized this rather ambitious idea (T.II, 682). The elements of this sociology are, however, inherent in his theory of law 40 . Law is thought of as a product and as a factor of social life and of culture (P. 44; 0.231), and, taking
40
Lande (FN 2), p. 843 - 908; Opatek , Metodologia . . . , p. 128 sq.; M. BoruckaArctowa, Pogl^dy socjologiczne Leona Petrazyckiego (Sociological Conceptions of Leo Petrazycki), in: Studia socjologiczne 1 (1974); A. Pilniqzek / P. Tefelski, Wpolyw teorii Leona Petrazyckiego na wspolczesn^ socjologiç prawa (Influence of Leo Petrazycki's Legal Theory of Contemporary Sociology of Law), in: Annales UMCS, G, X X V I I I (1981). A. Podgórecki, Unrecognized Father of Sociology of Law: Leon Petrazycki, in: Law and Society Review 1 (1981).
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
381
this into account, his theory of law can be thought of as a theory subordinated to the "theory of selection and emotional development" (T.II, 681). Petrazycki's sociology is evidently psychological. The interpersonal relations consist of social interaction which is an emotional and intellectual "infection" (T.II, 679 sq.). The motivational experience in the mass dimension results in social phenomena: "the operation of the regularities (tendencies) of the legal psychological experience and its development result in a durable and coordinated system or order of social behaviour stimulated by law " . . . (T.I, 258). Law is, thus, one of the factors of creation of a social system, is one of the means of social adaptation which can be its "unconsciously genial product" (T.II, 681). The properly developed psychical legal experience is, thus, a highly significant social phenomenon (T.I, 117, T.II, 311), similar to the state power. This power is based on the imperative-attributive emotions, viz. on legal emotions (T.I, 287 sq.). These emotions are the basis of identification of singling out "independent social groups" linked with the supreme social power, and the state appears as a group of this type (T.I, 292, 295) 41 . Such psychological and juridical approach to sociology is hardly acceptable, but shows the consequent way of Petrazycki's thinking. 21. Petrazycki's formulating sociological regularities is fully aware that they are not "laws" in the sense of the (natural) sciences, and, therefore, he writes about "tendencies" or "law-tendencies" fulfilled, if contrary factors are not present (W. 181 sq.). "The basic general tendency of the historical process of the creation and change of law consists in such adaptation of the legal motivation and pedagogy to the given state of the social consciousness that because of the impact of the proper legal system the individual and mass behaviour and development of this consicousness tend towards a common good" (T.II, 676). Law, thus, directs men towards the good and shapes their character by imposing the habits of behaviour. This is the "subjective power of the good" which "crystalizes" itself in an emergence of such social institutions as law, group ethics, or religion. This crystalization is " . . . the essence of the progress and culture in the dynamic sense" and its products shape the culture in the static sense of this word (P. 32 - 42). The "common good" referred to is thought of as the "ideal of love" and is the product and the criterium of the social progress (point 25). The conception of tendencies of development is the basis of Petrazycki's sociopsychological historicism in axiology and leads to some conflicts in it (cf.
41 Cf. L. Leszczynski, Psychologiczna teoria wîadzy paóstwowej Leona Petrazykkiego (Leo Petrazycki's Psychological Theory of the State's Power), in: Annales UMCS, G, X X V I I I (1981).
382
Jerzy Wróblewski
point 7). There is a question whether these tendencies are a product of historical research of facts (cf. point 14) or are rather a loose historiosophical vision linked with the faith in the spontaneous adaptation and unconsciously genial biological and psychological processes. Is this adaptation the factor defining the progress or development? What are the criteria of the appraisal of adaptation on the mass dimension in the history of the human culture? Petrazycki did not answer these questions, but it seems that they had stimulated his own conception. And these questions are still relevant as we see in the philosophy, sociology and cultural anthropology of the present day, and for any form of the morality of progress 42. 22. Petrazycki's theory of law is the top achievement of the psychologism independently of the appraisal of the psychologism and how one interprets its radicalism. In reality according to Petrazycki there exist no laws, rights, prohibitions, commands and so on, but only psychological experiences. He rejects "the faith in something named duties" (T.I, 69) because in reality the duties are only "projections" (T.I, 72 - 74; T.II, 96 sq., 226). Only emotions connected with some psychical representations of behaviour do really exist (T.I, 59, 61 sq., 121 sq.) (cf. point 5). The Petrazycki's definition of law explicitly expresses his psychologism (point 16). The definition of law is methodologically necessary (T.II, 665, 673; W. 29, 33, 40) because the concept of law is the "absolutely legal concept" is referred to by all remaining "relatively legal concepts" (W. 29, 32). Law is defined as the ethical psychical experience whose emotions are imperative-attributive (T.I, 123). Imperative-attributive legal emotion is a species of ethical emotion, the second species is morality as an imperative emotion. The definition of law answers the question "what is law?" and not the question "what do lawyers call law?" (W. 95). This is, thus, a real and essentialist definition, and not a philological analytical definition with a rather limited importance (W. 92, sq., 119, 179) which is not fit to be the starting point for any legal theory because of its dependence on the practical juridical language (cf. point 11, 13). Using his definition of law Petrazycki consequently states the existence of legal pluralism. The law of the legal positivism is only one of various sorts of law - it is an "official law" as a kind of "positive law". Official law is socially highly important and Petrazycki analyzes it too (T.I, § 13, T . I I §§ 44, 45), but the adequate theory of this law is not possible because of the theoretical and methodological reasons explained above. One can speak about "positive law" as a reality in the sense of emotional psychical experience in which there are "representations of the normative acts as ground of their validity" (T.II, 303). 42 J. Wróblewski , Morality of Progress-Social Philosophy of Leo Petrazycki, in: ARSP 3, 1982.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
383
Law exists as imperative-attributive emotions, and, thus, is present in games, in the sphere of most intimate coexistence, in savoir-vivre, in criminal organizations, and in the strictly individual experiences of a subject (T.I, 128 150). Moreover there is a large area of the psychical experience of intuitive law in which there are no representations of normative facts. This is often the case of conceptions of justice or of the natural law (T.II, §§ 35 - 38) 43 . 23. There are many sorts of positive law: statutory law, customary law, law of judicial practice, prejudicial law, etc. (T.II, 39 - 43). Petrazycki formulates many pertinent observations concerning several kinds of positive law, which can be still used in analysis of statutory law and common law, and of their functioning. Psychologism is, thus, no obstacle for Petrazycki, to an apt analysis of the law in the meaning of lawyers. The psychologism of Petrazycki, somewhat paradoxically, is hardly related with the contemporary interest in the legal consciousness. He thinks that the term "legal consciousness" is ethymologically not precize because it refers to "the unconscious and naive legal postulates" (P. 200). This is not a contemporary conception of legal consciousness at least in the Polish literature, because it is restricted to the evaluation and postulates of law and leaves out the knowledge of law 44 . Actually legal consciousness research is dealing with the knowledge and evaluative attitudes concerning concrete legal rules, whereas Petrazycki deals with legal emotions as "emotions in bianco" or "abstract emotions" defined by their psychical properties and not by their content (T.I, 19 sq.). The correlate of legal consciousness in Petrazycki's theory seems to be frequently used but never defined term "legal psyche". "Law is a psychical phenomenon of the social life and acts psychically" (0.21) with " . . . mutual causal relation with other processes of social psychical life" (T.II, 664). Because of its "motivational function" and "cultural-educational, pedagogical function" law is the "school of socialization of a national character, of its adaptation to the rational coexistence" (T.II, 575, cf. 572). "Rational law is the school of morality, an institution of education of a nation and of the whole mankind" (P. 29). To analyze the shaping of character through law one should create a new science of "legal pedagogy" (P. 50).
43 Cf. / . Nowacki, Ο stosunku prawa intuicyjnego do prawa pozytywnego w teorii Leona Petrazyckiego (On the Relation of Intuitive Law to Positive Law in Leo Petrazycki's Theory), in: Ζ zagadnieó . . . ; Idem, Koncepcja sprawiedlinoéci Leona Petrazykkiego (Conception of Justice of Leo Petrazycki), in: ibidem; M. Smoltka, Leon Petrazycki ο sprawiedliwym prawie (Leo Petrazycki on the Just Law), in: Annales UMCS, G, X X V I I I (1981). 44 E. G. A. Gryniuk, Swiadomoéc prawna (Legal Consciousness) Τοηιή 1979, chapt. 1; Lang / Wróblewski, / Zawadzki (FN 25), chapt. 24; Borucka-Arctowa, Swiadomoéé prawna a planowe zmiany spoïeczne (Legal Consciousness and Planned Legal Changes), WrociawAVarszawa/Kraków/Gdansk/Lódz 1981, chapt. I , I I , V I I .
384
Jerzy Wróblewski
This Ospology of the functions law appears an idealization, especially if we take into account the role of law in the safeguarding of a determined socioeconomical structure of society in the situation of the class and other groups antagonisms, and the various conflicts of interests. Petrazycki evidently is here far from the positions of historical materialism. The accent put on rather idealized educational function of law is stressed by Petrazycki stronger than his interesting observations concerning the allocative function of law, and especially of private law in the distribution of a national income (P. 100 sq., 135) and his comparative analysis of the economical centralized and decentralized systems, of the liberal-capitalist and socialist systems (0.63 - 65). Writing about property and its functions he states that the most important is " . . . its ethical cultural and moral mission. From the point of view of legal philosophy this is even the unique essential function of this institution" (P. 429). We see here, thus, the ideas which are well fitted in the idea of the revival of natural law (points 25, 28). In this context the analysis of law as an instrument of controlling the economics (0.80) within a society and in the whole mankind (P. 100) are treated rather marginally 45 . And this analysis is more stimulating in the early works of Petrazycki (T.I, §§ 11, P. chapt. 16 - 18) than the singling out of an obvious organizational function of law (T.I, § 12). Petrazycki looks backwards and forwards in the development of law. The general regularity of evolution is the "law of the decreasing progression of the motivational pressure" (0.72). There are also other tendencies, but will limit my observations to this one because of its farreaching consequences for coercion as the defining element of law in positivist thought. The degree of "brutality" of coercion depends on historical stage of human development (P. 330 333). This fact opens the perspective of reaching the stage of a "socially ideal psyche" which excludes "any need and importance of any coercitive means, and even of psychical pressure, and of the possibility of an existence of law" (0.69). This is the thesis of the withering away of law. This thesis goes much further than the prognostic assertions of marxism, which present a vision of a society without state and law, but preserving elementary norms of social coexistence. And Petrazycki writes not only about the withering away of law but also of the end of morality as well (0.74, 76). It seems that this is almost a reductio ad absurdum of Petrazycki's psychological sociology. In spite of acute observations concerning the plurality of normative systems in a society 46 , which gravitates in fact towards the
45 Cf. L. Matraszek, Ekonomiczne aspekty teorii Leona Petrazyckiego (Economical Aspects of Leo Petrazycki's Theory), in: Annales UMCS, G, X X V I I I (1981). 46 Cf. e.g. S. Ehrlich, Ο wieloéci systemów normatywnych (on the Plurality of Normative Systems, in: Paùstwo i prawo 3 (1979).
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
385
dichotomy of law and morality in comparison of their social functions (T.I, §§ 7 - 1 0 ) , Petrazycki ends with the prognosis (or prophecy) of a society without imperative emotions, viz. without experience of duty. This extrapolation of historical tendencies transfers us from the realm of the theory "of causal functioning of law" (T.II, 666) in the realm of utopia. V I . Policy of Law 24. Petrazycki is the pioneer of the legal policy in the contemporary sense of this term 47 . He sets for himself the task of " . . . justifying the possibility and of scientific preparation of the creation of law-making policy and of legal policy in general" (0.9). There was no idea of such policy, even one doubted the possibility of its existence (0.13), and the two drafts if codification of German private law were qualified by Petrazycki as "the selection of private-law errors" (P. 213) - the qualification which after Petrazycki evaluated as too strong (0.35). Today nobody challenges the importance of a rational law-making, but this does not mean that there are no doubts that there is "a scientific method of solving the problem of legal policy" as claimed Petrazycki (0.84). I am somewhat sceptical towards Petrazycki's optimism, because not all de lege ferenda problems can be solved in the way corresponding with our conception of the tasks of the science in formulating evaluative statements, especially concerning the law-making purpose and the choice of means of their implemenation 48 . The postulate of rationality of law-making is not synonymous with the postulate of scientificity, because the area of the former is larger than that of the latter. Petrazycki does not treat himself as the founder of legal policy, because the functions of legal policy thinking were performed before by natural law doctrines (P. 79). Petrazycki, however has tried to construct legal policy in a scientific way stating that its task consists in: " . . . (1) rational controlling of individual and mass behaviour with the proper legal motivation, (2) bettering of 47 BoruckaArctowa, Ο spolecznym dziaianiu prawa (On the Social Functioning of Law), Warszawa 1967, chapt. I; Lang / Wróblewski / Zawadzki (FN 25), chapt. 20.4; J. Wróblewski , Teoria racjonalgeno tworzenia prawa (Theory of a Rational LawMaking) WroclawAVarszawa/Kraków/Gdaósk/Lódi 1985, chapt. 3; T. /. Podgorac , Pravna politika L. Petrazickog (Petrazycki's Legal Policy), Beograd 1983; Kowalski (FN 1), rozdz. V ; Idem, Filozofia prawa i polityka prawa w ujçciu Leona Petrazyckiego (Philosophy of Law and Legal Theory in the Leo Petrazycki's Conceptions), in: Studia filozoficzne 5 (1981); H. Groszyk / A. Korybski, Ο programie tworzenia nauki polityki prawa Leona Petrazyckiego (On Leo Petrazycki's Program of Forming the Legal Policy Science), in: Annales UMCS, G, X X V I I I (1981). 48 Cf. J. Wróblewski, Law and Cognition of Reality, in: ARSP Supplements vol. 1, part. 1 (1982); Idem, A Model of a Rational Law-Making, in: ARSP 2, 1979; Idem, Einführung in die Gesetzgebungstheorie, Wien 1984, chapt. 4; Idem, Teoria racjonalnego . . . , chapt. 8, 9.
25 Festgabe Opalek
Jerzy Wróblewski
386
human psyche . . . " (0.22). This formulation, stressing the motivational and cultural-educational functions of law makes plain the relation between legal policy and psychological legal theory (T.II, 607; 0.14, 17, 23). The contemporary legal theory singles out two versions of legal policy: the minimalist ("technical") and the maximalist ("evaluative"). For the former the tasks of legal policy is the determination of alternative legal instruments for the implementation of presupposed ends linked with an analysis of the instrumental features of these means. The latter contains also the determination of the ends of law-making activities and a non-instrumental evaluation of the used means 49 . Petrazycki's position in respect to these two versions of legal policy seems ambivalent. He writes that legal policy is based on two basic assumptions, viz. on the cognition of the "nature of law", which includes the science concerning the ideal of law, and the knowledge of the psyche and ethics of the society and of man. From these two premisses, using syllogistic reasoning, one infers the legal policy propositions (P. 54 - 56). But he writes also about two "axioms" or "dogmas" of legal policy: "the first (states) that love is the supreme good, is the ideal and the last purpose of development (axiom of the practical reason). The second: the law of causality (axiom of theoretical reason) which from our point of view is an subsidiary axiom of practical reason" (P. 58). These two formulations can be interpreted either in the minimalist or in the maximalist version of legal policy. Petrazycki is clearly a partisan of the maximalist version when he compares legal policy with technics (P. 55) or when he excludes " . . . the so-called social problems, limited (legal policy - J. W.) to the bettering of the system of private law, as a decentralized system where it exists and within the scope of its functioning. The other attitude would be a methodological error" (P. 103). The maximalist version of legal policy, however, seems to be supported by the conception of the social ideal as the purpose which ought to be accepted. The axiological features of this ideal are not clear and his role in legal policy could have various interpretations (cf. points 7, 25, 28). Petrazycki in a rather limited way analyzes the role of cognition and evaluation in legal policy, and almost leaves out any analysis of the features of policy decisions and their justification. Science is reduced to the psychological theory of law, he mentions only that "the natural sciences and other sciences are not properly used by the lawyers" (P. 375), but he does not analyze their function, and the persuasively chosen examples demonstrate even a disregard of their role (P. 376, 381). Petrazycki stresses the importance of "deduction" in legal policy in the verification of its results (0,17; P. 56 sq., 107 sq., 143 sq.) by 49
Cf. e.g. Borucka-Arctowa,
O spolecznym . . . (FN 47), chapt. 1.3.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
387
comparing the deductively reached prognosis with the reality. This is today a method of controlling legal policy measures and proves the insight Petrazycki had in constructing the theory of legal policy. He is also right when besides the general legal policy, he singles out also legal policy proper for the particular branches of law, and especially of the private law policy (P. part I I , III). He compares also the legal policy of statutory law and customary law (P. chapt. 14). 25. The social ideal of Petrazycki stimulates several comments. He uses somewhat archaic terminology naming it as "the love of mankind" (P. 51) or "ideal psyche" (P. 53), but also describes it as such values as "the totally social character" of man (0.22), his "moral development, or dominance of totally rational ethics" (P. 25), "solidarity, ability and readiness to serve the common cause" (0.37). Behind this rather differentiated terminology one can discover the values almost commonly accepted till our times, but which are understood in different manners, are justified in various ways, and there are relevant varieties of the ways of their implementation. Taking this into account we can treat Petrazycki's social ideal as one of these general formulas which, like the formula of formal justice, could be universally accepted because of their formal character 50. The "mission" of legal policy consists in "conscious leading of the humanity in the direction in which it has moved till now by the unconscious empirical adaptation, and in acceleration and bettering of this movement towards light and the great ideal of the future" (0.23). This is the idea common to all conceptions of the necessity of historical development when its end is evaluated positively as the ideal of the morality of progress 51. The difference between the marxist and Petrazycki's conception is inter alia the different analysis of the features of historical development process and of its ultimate end. The social ideal of Petrazycki is also described by him in the Kantian terminology. This ideal is the axiom of practical reason which "does not require any proof "and cannot be demonstrated (P. 25). This ideal is " . . . the supreme truth . . . and the culmination of theoretical reason" (P. 44). This explanation of the nature of social ideal is difficult to accept within the general framework of Petrazycki's thinking. The axiomatic approach is plainly inconsistent with the sociopolitical historism of Petrazycki's axiology, and even he sees the difficulty in putting together the theoretical reason with the role of emotions (0.37). The social ideal is "supra legal" and "supra-moral" (0.75, 77) because its implementation in the future will make law and morality superfluous. "Law 50
J. Wróblewski, Natura a reguîy postçpowania (Nature and Rules of Conduct), in: Metaetyka, I. Pawlowska ed., Warszawa 1975, p. 587 sq. 51 Wróblewski, Morality of Progress . . . (FN 42), p. 369 sq. 2*
388
Jerzy Wróblewski
exists as a product of the unsatisfactory adaptation of the human psyche to the needs of the new social life, and its task is to make itself dispensable and to wither away" (0.73 sq.). This conception appears as the psychological analogy with the marxist theory of the withering away of the law, coupled with a rather Utopian vision of the withering away of morality too (cf. point 23). Social ideal performs basic functions of legal policy: it determines its purposes and is the criterium of evaluation legal changes according to the level of social development (0.67). V I I . Concluding Remarks 26. Petrazycki's conceptions, roughly speaking, are close to positivist ontology, epistemology and methodology, are ambivalent in axiology, and are antipositivist in the legal sciences. The convergence with the tendencies of philosophical positivism is expressed in Petrazycki's preference for empiricist and materialist positions, in the opposition of cognition and evaluation, and in the acknowledgement of the instrumental role of cognition for (rational) praxis. The same convergence is seen in Petrazycki's interest in the properly constructed scientific theories based on the verified factual data, in the stress laid upon methods and techniques of empirical research, in the role ascribed to inductive generalization and deductive prognoses in their verification. 27. The Petrazycki's attitude in the legal science could be roughly described as anti-positivsm. This antipositivism is manifested in four basic dimensions. Firstly, the positivistic conception of law as a norm (provision, rule) is contrary to Petrazycki's conception of law as a real psychical fact. Positivism accepts in Petrazycki's terminology the "naive projection attitude" and is a theory of the positive official law. Petrazycki affirms that the construction of such theory is methodologically impossible, and that the practical juridical language does not afford any identification of law which could be a starting point for a scientific theory. Petrazycki accepts the possibility of taking the "critical projection attitude" to law, when thought of as a "projection of psychical experience" (T.I, 62, 268) but it results in quite different conclusions than the positivistic approach to law (T.I, 125). Petrazycki's definition of law as fact is the first sit venia verbo realist approach to law. Petrazycki's approach is quite different from that of Jhering who treated interests also as real phenomena (cf. point 3), but has some analogies with the views of A . Hägerström, the founder of Scandinavian realism 52 . 52
Cf. e.g. K. Olivecrona, Law as Fact, 2 ed., London 1971, p. 63, 67, 171.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
389
Secondly, legal positivism restricted the law to the rules enacted or recognized by the State, accepted the legal monism 53 , and was not interested in other social norms. Petrazycki treats the law accepted in legal positivism as "official law", which appears as one of many laws. He asserts the legal pluralism which corresponds with the contemporalily asserted pluralism of social normative systems. Thirdly, for legal positivism the unique object of research is lex lata. Legal positivism was not interested in de lege ferenda problems, although practically positivists drafted legal acts, and according to Petrazycki, drafted them in completely erroneous way. Petrazycki developed the ideal of legal policy science, and sees the difference between the legal and political point of view opposing the research of the positive law system and the system which ought to be constructed (P. 102). Fourthly, legal positivsm has reduced legal theory to the generalized legal dogmatics54. Petrazycki opposed theoretical and practical point of view. In theory he breaks with juridical language and uses the independently shaped concept of law. He is right writing that "contemporary legal science in general and overwhelmingly is the science of official law; it has emerged and has been shaped on the basis of an analysis and application of official law" (T.I, 342). He criticizes the dogmatic jurisprudence (T.I, § 14) but he acknowledges its "naive unconscious social adaptation" (T.I, 328) and relevant functions especially in the unification of law (T.I, 314, 319 sq.). He does not, thus, reject dogmatic jurisprudence 55 , but fights against any construction of legal theory based on the practical needs of this dogmatics. This complex situation explains conflicts in some Petrazycki's ideas. On the one hand he cares for the strict maintenance of the official law within the positivistically determined limits of its interpretation and dislikes all manifestations of judicial discretion, and both are proper for the positivistic ideology of a legal judicial decision (P. 69, 75, 187 sq., 192) 56 . On the other hand he states that it is not important by whom the statute is enacted (and this positivistically determines its validity), but what matters is whether it gets the "force of a normative fact, i.e. whether it creates a proper imperative - attributive consciousness"(T.II, 334). The former ideas express the evaluation of the legality and the rule of law (P. 75), the latter appears as the theoretical consequence of the definition of law as a psychical fact. 53 This conception is aptly described as "concezione statualistica del diritto" cf. Ν. Bobbio, Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Milano 1965, p. 108 sq. 54 About the relations of legal dogmatics, eta-dogmatics, legal methodology and Grundlagenforschung cf. W. Krawietz , Juristische Entscheidung und wissenschaftliche Erkenntnis, Wien/New York 1978, part. I I I . 55 Cf. Α. Peczenik, Petrazycki ο dogmatyce prawa - krytyka czy obrona (Petrazycki on Legal Dogmatics - Criticism or Defense?), in: Ζ zagadnieó . . . 56 Cf. Wróblewski, Idéologie . . . (FN 28), p. 50 - 52; Idem, S^dowe . . . chapt. X I I , 2.
390
Jerzy Wróblewski
28. The anti-positivism in the legal sciences appear not only in psychologism, but also in various sociologizing trends from Jhering's jurisprudence of interests to various other conceptions treating law as a social phenomenon or as a complex phenomenon. The traditional opponent of legal positivism were the natural law doctrines. The history of this opposition is well known and widely discussed because of the variety in defining both trends. It seems that the basic differences in accepted axiology are at the basic of the opposition in question 57 . The ambivalence of the axiological position of Petrazycki (cf. points 7, 25) influences the ambiguity of the relation of his antipositivism to natural law 58 . Petrazycki, in principle, denies any existence of absolute values and of absolute ought, which is a plain consequence of the emotivist axiology. He writes that the natural law conceptions are " . . . reflections and manifestations of the intuitive-legal processes existing in the psyche of their authors" (T.II, 298). "Natural law" is not any law, but only a "draft of law" (T.II, 245). He rejects the fashionable at his time conception of the natural law with changing content and treats it as a contradictio in adiecto (0.25). Notwithstanding Petrazycki's criticism of natural law one can ask whether the "social ideal", as the basis of legal policy, does not have any features of natural law construct. This ideal determines the Ought and the value in the area regulated by the "official positive law", this ideal is not any result of purposeful human activity but of independent of him objective processes of development, this ideal is valid or true independently of the content of this "official law" .. . 5 9 . The axiological conceptions of Petrazycki are ambivalent because of his justification of the social ideal: it is justified as the historical thesis of the development of the development of human psyche, and as the axiom of practical and theoretical reason. The first justification commits the typical naturalistic fallacy inferring, roughly speaking, values from facts 60 . The second justification directly presupposes the values in a way proper to the absolutist versions of natural law. Petrazycki asserts that the natural law school in an unscientific way " . . . in some degree performed the function of legal policy" (T.II, 243, cf. 302). Even more revealing is the observation that "the term 'science of natural law' in fact 57 K. Opatek / J. Wróblewski , Axiology: Dilemma between Legal Positivsm and Natural Law, in: Oesterr. Zft. f. öffentl. Recht 2 - 3,1968. 58 Borucka-Arctowa, Teoria Petrazyckiego a koncepcje prawno-naturalne (Petrazykki's Theory and Natural Law Conceptions), in: Z zagadnien . . . , p. 9 sq., passim. 59 Opatek / Wróblewski , Axiology . . . (FN 57), p. 355. 60 Cf. G. Carcaterra, I l problema della fallacia naturalistica, Milano 1969 passim; J. Wróblewski , BÌ^d naturalistyczny (Zarys zagadnien) (The Naturalist Fallacy. A n Outline of Problems), Ruch Filozoficzny 1 - 2, 1982 - 1983.
Philosophical Positivism and Legal Antipositivism of Leo Petrazycki
391
better will be replaced by the 'science of legal policy' (P. 81). Petrazycki wishes that his work " . . . serves the common great issue of revival of natural law and, thus, of the revival of legal philosophy and generally of the social practical idealism" (0.8). These statements express a very strong antipositivism, but in the context of Petrazycki's theory cannot be treated as a simple declaration of his acceptance of natural law doctrine. The natural law doctrine was a form of legal policy, but an acknowledgement of the need of de lege ferenda issues commits neither to a "revival of natural law" nor to an acceptance of natural law axiology. This is clear today, but is was not clear at all in the context of Petrazycki's antipositivism and within the framework of his ambivalent axiology.
y . Ontologie versus Soziologie des Rechts?
Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural Perspective1 By André-Jean Arnaud, Paris Professor Opalek is well known among the legal theoreticians and philosophers of law as a logician. French legal scholars know him overall from the publication, in 1972, of a paper on norms in the journal Archives de Philosophie du droit 2. Until he published his Theorie der Direktiven und der Normen 3, he did never cease from focusing patiently on a coherent theory with epistemic, normativist and linguistic concerns. Since I am neither a logician nor a linguist, I will not tread awkwardly in Professor Opalek's footsteps. But it does exist a way to celebrate this birthday insofar as his works wind around a concern common to both of us: the formal approach to law in hope to contribute to elaborate a science of Law. It never has been spoken about epistemology of law more thàn nowadays. It still remains that it is very difficult to settle as scientifical, a part of knowledge in what the one fact of setting apart, among the social, political, economical phenomena, these one that seem constitute the specificity of law, chiefly leads to produce classifications, and does never allow to forknow crises. The scholars who make so, even critical ones, are building corpora of scientific enunciations through the description of the established order, and are not able to find answers to what disturbs it but in a class of enforcement which, in virtue of the hypotheses, shuts out any scientific character. However, jurists do not renounce. Indeed, the importance of the part they may play (i.e. the power / control they are able to get at the detriment of the technocratic „politologues") is bound to their quality of engineers. Someones are taking the sociology of law as their battlefield. About them, I have spoken elsewhere 4. Others turn back to the pluridisciplinary approaches. A perfect sample of such a traditional way of argue is to be found in the works of a Scottish legan theoretician: Alan Watson has choosen of struggling in a specifically 1 Je remercie mon ami le Professeur B. S. Jackson pour son aide dans la traduction de ces pages. 2 In: Archives de Philosophie du Droit, vol. 17, pp. 35 sq. 3 Wien, 1986. 4 From my Critique de la Raison juridique, 1. Où va la sociologie du droit?, Paris 1981, until today: Droit et société: un carrefour interdisciplinaire, in: Revue Interdisciplinaire d'Etudes juridiques, Bruxelles 1988/21: 7 - 32; Droit et Société: du constat à la construction d'un champ commun, in: Droit et Société, 20/21, 1992: 17 - 38.
396
André-Jean Arnaud
juridical ground in two books not absolutely recent, but very expressive 5. He propounded there an acute theory of „legal transplants". It would result of this theory that the observation according to what a rule of law may be sometimes without inconvenience carried out from a legal system into another legal system established in the view of loading the wants of a very different society, would authorize to settle the autonomy of law. Then, it would be possible to establish law as a science, and to believe in the existence of a common language, to hope peace6, to think that law is unifiable - how much precious conclusion in our way to Europe! Moreover, the word „transplant" may be used only in an approximative sense. A transplant or a graft can succeed only if three conditions are get together: the quality of the insertion, the quality of the plants and the quality of the ground. The interest of such researches would be to be seeked in the proof - which is not yet established - of the possibility of the transplant of a legal rule from a system into another system whatever the discordance of these systems may be. Presently, the secret of such a pure transplant seems to me far from being found. It would suppose at least the existence of two conditions which are needful (it is not useful to prove now their sufficiency) . It would be necessary to prove the autonomy of legal systems, and the possibility of the legal transplant from a system into anyone else. Otherwise, the concept of transplant cannot be used to establish the principle of the autonomy of law § 1. But I think it is very useful to understand what may be shown when the word „autonomy" is used in the legal language § 2, chiefly if the transplant is looked on in the fields of creating or changing legal norms § 3. 1. It is necessary to observe ab initio that some assumptions must be provisionally set when speaking about „transplants". The word „legal system" will indicate only a system of positive law 7 . Moreover, inside these systems, the observed transplants belong to rules; and these rules are elements of these systematical legal ensembles. The specificity of the problem of legal transplants lies in the removal from a system into another one. Indeed, the possibility of such a true interaction between legal systems supposes the autonomy of every system, while the concept of transplant cannot be used to prove any autonomy whatever. 1.1. The success of a few transplants is not sufficient to prove the autonomy of each system. It is only possible to infer from it some insensibility of the legal 5 A. Watson, Legal Transplants. A n Approach to Comparative Law, Edinburgh 1974; Same, Society and Legal Change, Edinburgh 1977. 6 Peace, that is to say order : cf. e.g. my Essai d'analyse structurale du Code civil français. La règle du jeu dans la paix bourgeoise, Paris 1973; and yet le droit trahi par la philosophie, Rouen 1977, pp. 51 - 80. 7 Cf. Système juridique in: Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et de Sociologie du Droit, Paris/Bruxelles 1988.
Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural Perspective
397
systems - in particular conditions which do not authorize the emergence of a general theory - to an interaction with the social, political, economical systems in the very point of the transplantation. There is, in this case, an outward show of autonomy; there is not an actually autonomy. Any designation of a legal autonomy runs against contradictions that Alan Watson did not succeed to solve. He only asserts that one legal rule is less bound to the environment than it is generally said8. And when the author suggests that private law has (would have!) nothing to do with politics 9 , he curbs that assertion in many other pages of his book 1 0 . However, we may set as an hypothesis that law is autonomous. What is the meaning of that word? Self-governing? Or indépendant? Is law actually conceived by an inner breath? Was Montesquieu and his climate system wrong? Are all the sociologists of law mistaken? If each legal system lives autonomously, how is it possible that each law, each statute, each judicial decision, each jurisprudence be open to changes without bearing on the only upholding of their formal coherence 11? Indeed, the creation of a legal rule is not always deep-rooted in the political, social, economical actuality 12 . Moreover, the distance between law and society is often so important that a real autonomy of law seems to appear 13 . A legal language does exist 14 . Many useless and inoperative rules are retained only by the inertial force 15 . Several transplants take place without any social or economical reason 16 , but only on account of the current character of the terms 17 , or the value of the authority of the texts 18 , or the quality of the interpretation 1 9 . It would be possible to add the importance of belief and religion in the choice of legal rules.
8 Society and Legal Change (FN 5), p. 111. 9 Ibid., p. 115 f.i. 10 Ibid., p. 125 f.i. and overall p. 130. 11 We deal here only with a theory from jurists; it is not the matter for a discussion of the Luhmanian theses about which my opinion can be found in the journal Droit et Société, 11/12, 1989. 12 Watson, Society and Legal Change (FN 5), p. 7; Same, Legal Transplants (FN 5), pp. 21 sq. et passim, p. 64 sq. 13 Same, Society and Legal Change (FN 5), pp. 7, 115 f.i. 14 Ibid., p. 96. 15 Ibid., p. 29 f.i. 16 Ibid., p. 98 f.; Watson, Legal Transplants (FN 5), pp. 79 sq. 17 Same, Society and Legal Change (FN 5), p. 44; Same, Legal Transplants (FN 5), pp. 82 sq. 18 Same, Legal Transplants (FN 5), pp. 88 sq. 19 Same, Society and Legal Change (FN 5), p. 119. A l l these quotes are only for information: this paper is not dedicated to Alan Watson himself.
398
André-Jean Arnaud
Let us now carry matters to extremes. Then, we must come to speak about law as an entity, different from the sum of all legal prescriptions which form the set (or legal system). The patchwork of positive laws seen all around the earth would be only an external aspect, owing to historical causes: at first, for instance, loneliness of primitive peoples; or, nowadays, exacerbation of nationalisms. This law-entity would be liable to be studied scientifically, according to logical rules defining outlines of one science of law. The concept of transplant would be thus able to lay the foundations of a scientific law according to what rules would be interchangeables inside the law-entity from a society into another one, on some conditions sheltered from no-legal systems. Conditions of a successful grafting can be known. Inside of a legal system, it is always possible logically to find a rule fitted to supply with an answer to a lack 20 . Our problem is not quite irrelevant to that hypothesis: the reasoning is the same when the question is of applying a rule which belongs to a legal system, to the gap in another legal system. In a way, the main difference is the place where is found the rule of substitution: in that case, outside the system where there is a gap. 1.2. But there is just the core of the problem. Even if the autonomy of the two legal systems is established, the autonomy of the providing one and the autonomy of the receiving one, the success of some transplants does not allow to infer that anyone transplant may be successful or even possible. It would be necessary to stipulate scientifical rules for a transplant, whatever be the grafted rule, from any legal system into anyone else. Besides, it would be a basic research to know if the successful transplants shown as the proof of the autonomy of law, happen between actually different legal systems. Such a success will be challenged whether positive laws regarded as setting up different systems, belong actually to the same one. Two cases may be distinguished. A t first, it may be had to deal with two systems which are not without any likeness. Colonial laws are a characteristic illustration. What is the state which has not entrusted its best jurists with doing laws for colonies, protectorates or well-disposed states considered as being „in childhood"? These law-writers were seeing placed at one's disposal two kinds of references: on the one hand customs or local legislations, on the other hand legal rules belonging to their own legal system, the „very gift of their civilization". What is yet in force, a few decades later? These laws were either swept away, or kept by new leaders having embraced the old system. This kind of grafting must not be seen as a success. Moreover, it shows that the interference between political and juridic systems only explains some kinds of creation, maintenance or change of legal 20 With regards to Statutory Law, cf. my paper Le médium et le savant, in: Archives de Philosophie du Droit, Paris 1972; cf. also Analyse structurale . . . (FN 6), pp. 42f.
Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural Perspective
399
systems. The alleged autonomy of the legal science is not able to evacuate these one. On another hand, among the successful legal transplants between two very distinct systems, someone are not real grafts. I have shown, for instance, how the signification of the „occupation" has changed from the roman legal system into the romanistic legal system of our „modern" history 21 . It will be replied that it is a very general rule, the success of the transplant proving the autonomy of law. But it is not true. The only enunciation of the rule was maintained. Moreover, the new enunciation was created and the new institution built from a definition which did not actually exist in Roman law. The substance of the rule was changed so that it provides for economical needs of the modern age: needs of the rising bourgeoisie. The modern romanists put the appropriation of fields and lands in the place of the capture of game, bees, doves, fish. So is born the subjective right of property. The problem of the transplant of a rule from a system into another system must be exposed otherwise. The equivalence required in the grafting supposes that the introduced element be strictly according to the structuro-functional rules of the receiving system. Let us take the example of a clock-mechanism: it is theoretically possible to replace one piece of the first one by the same piece from the second one. To make it, it is sufficient to obey some rules according to the type of clock. What would be not possible, is to repair a watch with pieces from an alarm-clock, or pendulum with pieces from a cuckoo. It is the same thing for law, about transplants. Someone succeed, that Alan Watson, for instance, has well shown. But it does not mean that law is absolutely autonomous. Law is autonomous as a clock-mechanism, because it is a system. But how much time can a clock function without an external energy? If law seems to function - be born and change - with some autonomy, is it not because its existence and action are indépendant, inside from a legal,reason' 22 and outside from an interaction with external systems? Cases of successful transplants do exist; but they are not current hypotheses, in such a manner that it is possible to say that laws are autonomous systems, or even that legal science would get its autonomy. It is not possible to infer that a transplant is always possible. However, the concept of transplant is important in the study of legal systems, because so it is possible to know what is the autonomy of law. 2. The concept of transplant can be useful to surround the notion of the autonomy of law. 21
Cf. Le droit t r a h i . . . (FN 6), pp. 19 sq. On this concept, cf. Arnaud , Fact as Law, in: Semiotics, Law and Social Science, Roma/Liverpool 1985, pp. 129 - 144. 22
400
André-Jean Arnaud
2.1. If any transplantation is available, that is to say that several conditions were fulfilled. The transplant gives satisfaction in the original system; it is able to be integrated to the system in receipt; more and chiefly the structure of each ground has been homogeneous. That homogeneity may be due to an homogeneous structure which is often apparent. But it is very important to know that a successful transplantation means a homogeneity of the basic and subjacent structures. If one transplantation seems to be successful while a divergence appears between two homogeneous apparant structures, the only logical conclusion is that one: either the homogeneity is not genuine or this transplantation is not real. Heterogeneity shuts out transplantation at the structural level. Legal transplants do not overlay the whole field of law. So that the autonomy of law does only exist if law is considered as a structured system and if the considered matter is the formal aspect of that system. Moreover, the analysis of subjacent structures sometimes denies one heterogeneity or homogeneity. It may be that a distance appears between an apparent structure and the subjacent pertaining structure 23 . Now, the semantical study supposes a reinsertion of rules in the environment from where they are born and that they are supposed to govern. In this way, law appears like an output: like the work of a "law-teller". Legal scientists mostly well know it; but they dismiss these observations as sociological ones 24 . Then, they can be said to dispute not about law, but about a parody of law. The scholar who hides or neglects the actual structures which are at the ground of law, can only catch shapes. Devoting all one's energies to establish the validity of pure transplants inside of a systemic theory of law, supposes a starting disposition of mind which adjusts the subsequent study according to first principles. Thereafter, the scientific neutrality that claims this one who will talk about autonomy of law, is challenged. Besides it is not possible thereby to render a complete account of the legal phenomenon in its complexity. That point of view is a reducing kind of analysis; it is chiefly a way towards party quarrels. Actually, law gets a self-governing life not from the moment when it is officially settled, but as soon as two conditions are filled: to bound people and to be a system having its own 'rationality'. Then, the word "autonomy" only means that law is an ensemble liable to answer any question put in its own language, and to move and develop itself without any reference to an external system. It does not mean that law is born outside specific social, political and 23
Cf. Same, Une méthode d'analyse structurale en histoire du droit, in: Vorstudien zur Rechtshistorik, hrsg. v. J.M. Scholz, Frankfurt 1977, pp. 263 - 346. I show in this paper how the critical work of every legal scholar deals with shaping legal systems, and finding their actual meaning through the distance existing between their apparent and their subjacent structure. 24 Cf. f.i. Watson, Society and Legal change (FN 5), p. 124f.
Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural P e r s p e c t i v e 4 0 1
economical circumstances. It does not mean that there is no interaction between juridical and political, social, economical systems. However, it means that if law is moving only inside its own system, jurists can only talk about law in descriptive terms and cannot use a scientifical way of analysis about a rootless phenomenon. 2.2. Talking about autonomy of law is not necessarily untrue. But precautions must be taken. It must be clearly said that the research centres on the observation of law as a system. And it is necessary to be aware of the fact that there is in this way only one kind of approach, which is to be confronted with the outputs resulting from other kinds of analysis. A t the beginning of each system are philosophical premises which cut out the principle of legal autonomy. Each national Law may be considered as an autonomous system. But all of them loose that character assuming that they are considered as bearing in mind the social, political, economical conditions of the whole in which law is acting. Even philosophical principles are bound with economical relations which are settling unyielding adopted positions: for instance faith in the liberal capitalism versus faith in the class-war. To deny the complexity of the network or interactions whose product the rule of law is, leads to a skindeep work. The so found autonomy is proving superficial and the scientific laws which the scholar is drawing out are unusable outside his restricted outlook, one law delimited as a field of binoculars. Useful provided that it be said that work is done with blinkers of which it will be agreed to clear out at the stage of understanding. In other respects, the concept of autonomy drives out the problem of the legal experimentation. Now the development of contemporary laws aims to prove that the varied attempts of legal systems to move by themselves, without any regard towards external systems, never stop increasing the gap between law and social hankerings. This fact leads to rough breakings, which are very far from peace hoped by these one who hold for a legal autonomy. A t last, the principle of autonomy of law is a recently born concept. Moreover, legal history shows that it was capable of life only by self-betrayal. The fact was obvious, for instance, in the French "Commune de 1871". Judges, in the name of autonomy of law, stood up for a political party, that one of their own class, the "bourgeoisie versaillaise" 25 . And that is seen each day: the choice for the "pure law" (as much upright as be grounds of that choice) actually means less to remain neutral than to opt for a system issuing forth accurate political, social, economical choices. In that view, to specify the concept of transplant shows its inmost boundaries. Transplants constitute legal technics very useful between structurally isomorphous systems which function under an identical legal 'reason'. The 25
Cf. Arnaud, La paix bourgeoise, in: Le droit trahi (FN 6).
26 Festgabe Opatek
402
André-Jean Arnaud
accurate word to characterize other cases is "imitation", or "adjustment", but certainly not "transplantation". "Transplant" applies to elements of a systematical ensemble, and does not to a whole ensemble. The legal systems keep one's identity; if the process would change it, there would not be an actual grafting. A transplant can take place outside any no-legal consideration, but its analysis cannot take in account anything else than the ordering of the elements inside the giving or inside the receiving system. It never allows to give an explanation of the legal phenomenon; it never allows to cross over from an interaction between systems. To talk autonomy about a legal system is allowed. But it is not possible to spread that concept over the interaction between the legal system and the other systems (social, political, economical ones). To do it makes an amagalm and breaks down the scientific character of the issues. Now, what is the function of the jurist? Must he be an engineer with technics able to give answers in every crisis? Must he not be all ears and watch on life as a sociologist or a psychologist or a psychoanalyst or an economist, a logician, a linguist . . . and undertake trans- or interdisciplinar approaches? Must he be a critic? Everyone will pick out, but one's choice is inevitably a political one. I have shown how even an a-political choice is a way of saying what are one's philosophical and political grounds 26 . The most difficult thing, for a jurist, is to grant that truth: a jurist does not get a power; a lawyer is a servant, a prince's servant or the servant of an ideal or a god's servant or a ruling pick's servant or the servant of masses - as he wants it; but a servant. I had talked about the lawyer of the future as a man with overalls, a legal worker. This one would have taken off the ideology which lies under our law, and tacked down his own one to summon it permanently. So, he would create by the way of a scientifical interpretation, grounded on the whole complexe actuality, called in question and checked, and if necessary rectified, a striding system of legal interactions - even if it is only transitory . . . But we are very far from that scheme. 3. The analysis of the legal transplant is a good introduction to the concept of legal grafting considered as a phenomenon of legal interpretation. 3.1. The interest of the concept of legal transplant is clearful in the stage of legal rationality. Because of the fact that every legal system gets one's own rationality, a graft between two systems belonging to a same class of legal 'reason', is not problematical. From a rule of game to another one, effective borrowings can be made out of harm's way, provided that games get an identical structure, the same function, the same aims. Now, if the grafting confronts
26 Same, Le médium et le savant (FN 20); cf. yet Same, Politique et droit dans l'œuvre écrite de Mao Tse-toung, in: Le droit trahi . . . (FN 6).
Legal Grafting as a Formal Problem in a Structural P e r s p e c t i v e 4 0 3
systems belonging to classes getting diverging legal 'reasons', the problem is acute. It is very interesting indeed, to insert it among the various questions about the legal interpretation. A legal grafting can be needful at the stage both of the original interpretation (creation of the legal norm) and of the secundary one (the "legal interpretation" stricto sensu), aiming to a legal change. So, transplant is not only a concept, but very useful technics. Then, the legal grafting takes in account the reactions of a legal system over against an inedaquation of individual and collective status or institutions, which are together the static structure of the legal system. A borrowing is made in hopes of saving, in the borrowing system, the issues as looked for in the giving system. Since a rejection is out of question, the accurate problem here is to know how two divergent legal 'reasons' react one upon another. Will it be an alteration of one reason, and which? What will be the outcomes? 3.2. Four instances are suitable, according to the shock of the alteration: alteration:
+ (yes),
-
(no.)
the giving system
+
+
-
-
the borrowing system
-
+
+
-
(2)
(3)
instance n°
(1)
(4)
A name can be given to each instance: (1) Recuperation. The borrowing 'reason' is not altered, but alters the meaning of the borrowed element which so looses one's genuineness without loosing however its specific function. (2) Innovation. Here is the creation of a new legal 'reason' different from both reason. A good instance is the institution of "occupation" (see supra). In the modern age (16 th - 18 th c.), the theory of "occupation" was very useful to ground the subjective right of property, and so to create a new legal system. We are in a case of "cultural coalition" as said Claude Lévi-Strauss, the roman law and the modern thought, which is making progress. (3) Vaccination. This case is not far from the first, only it is the reversing of which. The borrowed element alters the 'reason' of the borrowing system. That alteration is similar to the deviance which partly contributes to have the whole system acted. Such a vaccination does nowadays exist in the crossing from the "paix bourgeoise" to the "pax americana". That last one structurally is the same that the first, but it is formally put up-to-date 27 . However, the 27
26*
Cf. Same, Le paix bourgeoise (FN 25).
404
André-Jean Arnaud
alteration does not change the legal 'reason' itself. Such a changing would come down to a revolutionary innovation, because of the capitulation before the 'reason' of a divergent legal system. (4) Adjustment. No 'reason' is altered during the process of legal grafting. That takes place when a legislator borrows an element liable to a plain technical removal, or when the difference established between the systems is not real. That paper is not an epistemological study. But the study of the rule of law requires the analysis of the legal 'reason' of each system, when it deals with processes of creation and change of legal norms owing to borrowings between laws. That kind of analysis supposes the study of the subjacent structures and their genuine meaning. I don't hope the agreement of every legal scientist. But I let them talk away about the myth of legal autonomy. I do prefer to open my eyes wide.
Rechtssoziologie gestern und heute* Von Vincenzo Ferrari, Mailand I. Einleitung Im folgenden geht es mir um die Auseinandersetzung mit einigen Problemen, deren Analyse mir wichtig erscheint, um die jüngste Entwicklung der Rechtssoziologie zu verstehen und vor allem, sofern dies überhaupt möglich ist, um ihre Zukunft vorzustellen und vorzubereiten. Meine Argumente beziehen sich im wesentlichen auf die theoretische und begriffliche Ebene, ohne dabei die Beziehungen zur jüngsten Geschichte des Fachs zu vernachlässigen oder gar die Ereignisse zu ignorieren, die sie am meisten beeinflußt haben. Mein Vorhaben ist somit vor allem theoretischer und, wie ich hinzufügen sollte, in bestimmter Hinsicht auch normativer Natur. Ich möchte nämlich, von meiner Analyse ausgehend, einige Vorschläge unterbreiten darüber, wie sich meiner Auffassung nach die Rechtssoziologie in der heutigen Kultur gestalten sollte. Selbstverständlich werde ich dabei gelegentlich schon früher behandelte Fragen wieder aufnehmen 1 in der Absicht, meine Gedanken weiter zu klären, zusammenzufassen und fortzuführen. I L Zwei vermeintliche metatheoretische Dilemmas In den letzten Jahren, ich beziehe mich dabei auf die Zeit, die ich persönlich, auch als Wissenschaftler, miterlebt habe - und das sind mehr als zwanzig Jahre - , haben die Rechtssoziologen viele ihrer Energien damit verschwendet, * Diese Untersuchung ist dem von mir sehr verehrten Kollegen Prof. Dr. Kazimierz Opalek gewidmet, der durch seine rechtstheoretischen und rechtsphilosophischen Studien maßgeblich zur Kärung des Begriffs des Rechts und zur Unterscheidung zwischen dem juristischen und dem soziologischen Rechtsbegriff beigetragen hat. Es handelt sich hier um die überarbeitete und ins Deutsche übertragene Version eines Vortrags, den der Verf. erstmals im September 1987 in Puebla zur Feier des 50. Jahrestages dieser Universität gehalten hat. 1 Vgl. besonders: V. Ferrari, Riflessioni sulla sociologia del diritto in Italia, in: Sociologia del diritto 1983/3, S. 7ff.; ferner ders., Brevi osservazioni su funzionalismo e legittimazione, in: Sociologia del diritto 1984/1, S. 43 ff.; ders., I soggetti e la sociologia del diritto. Una nuova ,Methodenstreit', in: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto 1985/4, S. 551 ff. und im Bereich einer umfangreicheren, allgemeinen Abhandlung ferner auch: ders., Funzioni del diritto. Saggio critico-ricostruttivo, Roma/Bari 1987.
406
Vincenzo Ferrari
zwei miteinander eng verflochtene Dilemmas einander gegenüberzustellen und zu diskutieren: dasjenige zwischen Theorie und empirischer Sozialforschung und dasjenige zwischen Makrosoziologie und Mikrosoziologie des Rechts. Es handelt sich dabei um zwei sehr wichtige, auch geschichtliche Gegensätze, die nicht nur die Rechtssoziologie, sondern mit ihr die gesamte Sozialwissenschaft - schon seit ihrer Begründung als Wissenschaft im letzten Jahrhundert - bedingt und beschäftigt haben. Eine Geschichte des soziologischen Denkens im allgemeinen wie auch im besonderen, d.h. als Geschichte seiner jeweiligen Fachrichtungen zu schreiben, ist nicht möglich, ohne - um eine etwas veraltete Terminologie zu benutzen - zwischen Soziologie und Soziographie zu unterscheiden. Das heißt zugleich, bei der Interpretation der Rolle des Soziologen zwischen denjenigen zu unterscheiden, die sich mit der Formulierung von Gesetzen, allgemeinen Erklärungen und Grundbegriffen befassen, und denen, die real beobachtete Erscheinungen sammeln und klassifizieren. Natürlich handelt es sich dabei auch um psychologisch verschiedene Haltungen und Einstellungen, obwohl damit nicht gemeint ist, daß die erste sozusagen automatisch mit Arroganz und Anmaßung zusammenfällt, während die zweite der Bescheidenheit entspricht. Deswegen ist es unvermeidbar, daß dieser Unterschied in den historischen Arbeiten oder in denen einer, wie man zu sagen pflegt, „Soziologie der Soziologie" 2 registriert wird. Um die Überzeugung zu gewinnen, daß diese Dilemmas nicht zutreffen, genügt eine kurze Überlegung rein - man verzeihe das ambitiöse Wort epistemologischer Natur. Es ist selbstverständlich, daß auch der Soziologe, der darauf bedacht ist, sich auf die Sammlung von „externen" Tatsachen zu beschränken, in der Tat zumindest Hypothesen bildet, das heißt: Tatsachen und Maßstäbe ihrer Sammlung nach allgemeinen, der Beobachtung gegenüber präexistierenden Absichten und Annahmen auswählt. Außerdem darf man dabei auch nicht den Einwand verschweigen, der gewöhnlich gegen die sog. „empirische" Soziologie gerichtet wird, nämlich den Hinweis, daß die Option für die bloße Sozialforschung nicht eben selten derartige Annahmen vor sich selbst und den anderen verbirgt. Weniger selbstverständlich ist es allerdings, daß auch der
2 Vgl. besonders: R. Treves, Introduzione alla sociologia del diritto, 2. Aufl., Torino 1980, der - gegenüber der 1. Aufl. 1977 - zwischen einer „theoretischen Rechtssoziologie" und einer „empirischen Rechtssoziologie" unterscheidet, denen zwei verschiedene Teile des Buches entsprechen. In seinem neuen Buch: Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi, Torino 1987 (2. Aufl. 1988), führt derselbe Autor - seine eigenen, bisherigen Auffassungen wesentlich modifizierend - Theoretisierung und Forschung zur Einheit zurück und identifiziert sogar die Entstehung der reifen Rechtssoziologie mit denjenigen Autoren - Weber, Geiger, Gurvitch - , die die mikrosoziologische Beobachtung mit der makrosoziologischen als erste zu integrieren gewußt haben. Hierzu erlaube ich mir auf meinen Aufsatz: Svolte e continuità nella sociologia del diritto di Renato Treves, in: Contratto e Impresa 1988/1, §. 204ff., zu verweisen.
Rechtssoziologie gestern und heute
407
reine Theoretiker seinerseits in der Tat nie von der Beobachtung absieht, da auch die abstrakteste Theoretisierung immer eine Art von Reaktion ist, mit der das Denken die Umwelt aufnimmt, die verschiedenen, von ihr ausgehenden Botschaften verarbeitet, um sie zu verstehen, ihnen einen Sinn zu geben, und schließlich, um für die Zukunft die eigene und die fremde Beobachtung der Umwelt selbst oder des Lebens in der Umwelt zu steuern. Es ist nicht von ungefähr, daß ich hier auf die Begriffssprache von Niklas Luhmann, dem spekulativsten und antiempirischsten Soziologen unserer Tage, zurückgreife. Der streng empirische Forscher wird in solchen Fällen versuchen, die nicht kontrollierte und episodische Beobachtung/Reaktion als nicht wissenschaftlich bzw. als zu phantasievoll zu bewerten und die daran anknüpfenden Theoretisierungen als „sinnlos" zu qualifizieren. Ich glaube aber, daß eine soziologische Theorie als Theorie, die sich auf das soziale menschliche Handeln bezieht, immer eine persönliche Überarbeitung von Wahrnehmungen und Antrieben zum Ausdruck bringt und sich daher nicht einer reinen Ekstase verdankt. Theorie und empirische Sozialforschung sind also immer miteinander verflochten, selbst wenn sie sozusagen nichts davon wissen. Dies ist nämlich der erste wesentliche Schritt, um zu behaupten, daß die eine nicht ohne die andere existieren kann und daß die Verbindung zunächst einmal explizit anerkannt werden muß, um dann kontrolliert werden zu können. Der empirisch arbeitende Sozialforscher wird richtig handeln, wenn er die Quellen, aus denen seine theoretischen Annahmen stammen, kontrolliert, um sie zunächst deutlich zum Ausdruck zu bringen. Andererseits wird der reine Theoretiker richtig handeln, wenn er die von seiner Beobachtung der menschlichen Tatsachen angeregten Eindrücke kritisch prüft. Um das zweite vermeintliche, in Wirklichkeit so aber gar nicht bestehende Dilemma zu demonstrieren, das heißt in unserem Fall dasjenige zwischen Makro- und Mikrosoziologie des Rechts, kann man sich ganz ähnlicher Argumente bedienen. Wie schon beobachtet wurde 3 , beruht das Dilemma in Wirklichkeit auf einer terminologischen Zweideutigkeit. Spricht man nämlich von „Makro" und „Mikro", so ist es leicht, die Tragweite der Hypothesen, die sich auf das Diskursobjekt beziehen, zu verwechseln mit der Trag- und Reichweite der Beobachtungseinheit, auf der der Diskurs aufbaut und an der die Hypothese empirisch kontrolliert wird. Die Menge an Beobachungseinheiten, d.h. die Anzahl an Beobachtungen, auf die man sich stützt, kann sehr gering sein. Es ist sogar bekannt, daß man wegen materieller Schwierigkeiten, die z. B. das Budget betreffen können, heute dazu neigt, sie immer mehr zu reduzieren. 3
Vgl. A. Baratta, Criminologia critica e diritto penale, Bologna 1982, S. 18ff., der, obwohl innerhalb einer ganz auf strenge metatheoretische Unterscheidung zwischen „theoretischer" und „empirischer" Soziologie fundierten Abhandlung, diese Verwechslung aufzeigt.
408
Vincenzo Ferrari
Die Stichproben von Befragten sind oft sehr klein und geographisch auf kleine Gebiete konzentriert, so daß die direkte Beobachtung sich häufig auf winzige Ausschnitte des menschlichen Lebens richtet, d.h., die Forschung umfaßt gewöhnlich nur eine geringe Zahl von Fällen und ist außerdem „Mikro" von Natur. Trotzdem wendet man oft solche Methoden an, um Hypothesen von beträchtlicher theoretischer Abstraktion und Tragweite zu kontrollieren. Obwohl von begrenztem Umfang, befaßten sich z.B. die sog. KOL-Forschungen, die sich am Anfang der 60er Jahre verbreiteten 4 , mit Themen sehr allgemeiner Natur, wie dem Ansehen des Rechts, die aber mit hochproblematischen Variablen, wie beispielsweise der Machtverteilung, der sozialen Stratifikationen und Kultur verbunden waren. Demgegenüber kann man bekanntlich Tausende von Subjekten befragen, die auch auf ein ganzes nationales Gebiet verteilt sind, aber ihnen gleichwohl Fragen stellen, die ohne Verbindung mit theoretischen Hypothesen sind und jegliche Abstraktion entbehren. Das Problem besteht also nicht so sehr in dem Gegensatz zwischen „Mikro" und „Makro", als vielmehr in der methodologischen Notwendigkeit, die eigenen Hypothesen oder Behauptungen Beobachtungsebenen anzupassen, die auch quantitativ angemessen sind. Es ist also leicht einzusehen, daß das Verhältnis zwischen „Makro" und „Mikro" in der Tat nichts anderes ist als das Verhältnis zwischen Theorie und empirischer Sozialforschung. Dieses Verhältnis kann daher im folgenden umformuliert und aufgelöst werden in einfachere Fragestellungen, wie: „Welche Theorie?", „Welche Hypothesen?", „Welches Beobachtungsobjekt?", „Welche Methoden?", für eine einheitliche Rechtssoziologie. Auch die Frage: „Welche Soziologie?" wird in diese komplexe Form eingebracht. Bevor ich mich in bezug auf die Rechtssoziologie näher mit ihr befasse, möchte ich hinzufügen, daß man die große Gefahr läuft, die Soziologie selbst zu opfern, wenn man sich auch nur einer dieser Fragen zu entziehen oder einige den anderen zu opfern versucht. Außerdem bin ich immer davon überzeugt gewesen, daß das Verweilen bei den erwähnten, so gar nicht gegebenen Dilemmas sehr oft einen unausgesprochenen antisoziologischen Skeptizismus zum Ausdruck bringt. Seltsam dabei ist festzustellen, daß man - von entgegengesetzten Fronten ausgehend - zu diesem antisoziologischen Ergebnis kommt. Sowohl diejenigen, die eine selbständige soziologische Theorie verachten, indem sie als einzige Aufgabe des Soziologen anerkennen, Daten zu sammeln, als auch jene, die die Datensammlung verachten und die Theoretisierung preisen - ich erwähne Croce und Gentile, um zwei fast paradigmatische italienische Etiketten zu verwenden - landen am gleichen Punkt. Beide 4
Als bedeutendes Beispiel jener Forschungen, die in verschiedenen Ländern mehrere Jahre dauerten, können die vergleichenden Untersuchungen von A. Podgóreckif W. Raupen!J. van Houtte/P. VinkelB. Kutschinsky, Knowledge and Opinion about Law, London 1973, betrachtet werden.
Rechtssoziologie gestern und heute
409
Haltungen führen nämlich dazu, den Anspruch auf das Vorrecht, über den Menschen und sein Handeln in der Gesellschaft zu theoretisieren, anderen Wissenschaftlern - metaphysisch orientierten Philosophen, den Spezialisten der einzelnen Disziplinen und Ideologen unterschiedlicher Tendenz - zu überlassen. Dies ist ohne viele Worte einzusehen, da eine derartige Theoretisierung so alt ist wie der Mensch selbst und gewiß nicht erst mit der Soziologie entstanden ist, die nur versucht hat, jene Theoretisierung zu verwissenschaftlichen und von metaphysischen Hypotheken zu befreien. I I I . Theorie und Forschung in der Rechtssoziologie: Von den 60er zu den 70er Jahren Der methodologische Empirismus, der vor allem die amerikanische Soziologie in den 30er Jahren und in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg kennzeichnete, hatte sich bekanntlich als Streben nach faktischer Konkretheit ausgedrückt. Dies hatte die empirische Forschung im hohen Maße gefördert, aber sicher nicht - ich möchte das unterstreichen - auf Kosten der Theoretisierung. Ganz im Gegenteil! Das bekannteste hyperfaktische Manifest - „Who gets what, when, how" von Harold D. Lasswell 5 - stammt von einem Autor, der sich mehr als jeder andere in der theoretischen Arbeit auszeichnete und dessen Arbeit durch den analytischen Weg der stipulierenden oder erklärenden sprachlichen Definitionen 6 , den Aufbau von theoretischen Begriffen hoher Allgemeinheit, Abstraktion und gleichzeitig, was durchaus kein Widerspruch zu sein braucht, von großer Konkretheit gekennzeichnet war. „Power is participation in the making of decisions"7 ist eine Formel, die die verschiedensten Ausdrücke „realer" Macht in bewundernswerter Weise auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringt. Scheinbar ein reiner Begriff, hilft sie aber neben der Theoretisierung auch die Beobachtung zu steuern, da sie in empirische Hypothesen umsetzbar ist, die z.B. verstehen helfen, wie bei der Schaffung und Vertiefung von sozialen Abhängigkeitsbeziehungen und Schich-
5 H. D. Lasswell, Politics: Who Gets What, When, How, New York 1936 (The Free Press, New York 1951). 6 H. D. Lasswell/ A. Kaplan , Power and Society, New Haven 1950, erklären einleitend, daß sie in der Tat einmal von „nominalen", sodann von „realen" Definitionen Gebrauch machen (Introduction, S. X X ) . Sie präzisieren jedoch ihre Auffassung dahingehend, daß letztere „are intended to make clear and explicit the content embodied in more or less established usage, and thus to constitute analysis of the concept signified". In diesem Zusammenhang spricht man heute übereinstimmend von „erklärenden" Definitionen, da „eine erklärende Defini ton innerhalb der geschichtlich erworbenen Bedeutungen eines Wortes und seiner Synonyme bleibt, aber versucht, eine für theoretische Zwecke nützliche Bedeutung genau zu erklären und zu bestimmen". Vgl. U. Scarpelli , Etica, linguaggio e ragione, in: Rivista di filosofia 67 (1976), S. 5, jetzt auch in: ders., L'etica senza verità, Bologna 1982, S. 51. 7 Lasswell/ Kaplan (FN 6), S. 75.
410
Vincenzo Ferrari
tungsphänomenen die ungleiche Verteilung von Entscheidungsmacht ein allgemeinerer und sehr viel entscheidenderer Faktor ist als andere (z.B. die ungleiche Reichtums- oder Eigentumsverteilung). Infolgedessen ist der Hyperfaktizismus also nicht von großer, undifferenzierter Natur gewesen, sondern er hat eine Theorie geschaffen und theoretische Erkenntnisinteressen und Ziele verfolgt. Dasselbe ist auf dem Gebiet der Rechtssoziologie im eigentlichen Sinne geschehen.8 Wie bekannt, können wir auf den Anfang der 60er Jahre das Datum der Neubegründung dieses schon traditionsreichen Fachs - man denke an Durkheim , Ehrlich, Weber, Geiger, Gurvitch - auf empirischer Basis festlegen. Die im Laufe des vierten soziologischen Weltkongresses in Washington (1962) vorgenommene Begründung des „Research Committee on Sociology of Law" der „International Sociological Association" ist in gewissem Sinne ein symbolisches Ereignis gewesen, aus dem sich ein Aufschwung in der internationalen Zusammenarbeit ergeben hat. Dabei handelte es sich um eine theoretische und empirische Zusammenarbeit (1) bei der Bestimmung der spezifischen Aufgaben, Grenzen, Ziele, Bereiche und Unterbereiche des Fachs, (2) bei der Erörterung von Hypothesen mittlerer und auch größerer Reichweite, (3) bei der Sammlung von in verschiedenen Zusammenhängen vergleichbaren Daten. Hervorheben möchte ich hier, wie tief dieses Bedürfnis nach einer Osmose zwischen Datensammlung und Theoretisierung damals empfunden wurde. Dafür gibt es viele Beispiele. Vilhelm Aubert, ein großer empirischer Forscher, hat aus der Beobachtung den Anlaß für theoretische Beiträge gewonnen, die immer noch als tragende Stützpunkte der rechtssoziologischen Analyse gelten: so z.B. die (ganz und gar nicht starre) Anwendung der Mertonschen Dichotomie manifest-latent in der Studie der Gesetzgebungsfunktionen 9 und die - nicht minder bedeutende - Unterscheidung zwischen Wertstreitigkeiten und Interessenstreitigkeiten 10, aufgrund welcher sich noch heute viele ifts/?wft>zg-Forschungen artikulieren. Andererseits hat Werner Goldschmidt innerhalb eines Bereichs von Forschungen, die in Grönland mit unterschiedlichen Methoden durchgeführt wurden, unter denen die ethnographische Beob8 Ich habe Lasswell· nicht von ungefähr zitiert. Tatsächlich besitzt seine analytische Arbeit über die Begriffe der politischen Theorie unmittelbare Relevanz für die soziologische Analyse des Rechts, da es eine selbstverständliche Korrelation zwischen Recht und Macht gibt (sei es auch nur in dem weiteren Sinne, den Lasswell vorschlägt, nach dem die Macht nicht auf die Spitzen einer Gesellschaft konzentriert ist, sondern weit verbreitet und multidirektional sein kann). Hierzu erlaube ich mir auf mein Buch: Funzioni del diritto (FN 1), S. 76ff., zu verweisen. 9 Vgl. V. Aubert, Priskontroll og rasjonering. En rettsosiologisk forstudie, Oslo 1950; V. Aubert!T. Eckhoff/ K. Sveri/ P. Norseng, En lov i sökelyset. Socialpsykologisk undersökelse av den norske huisjelplov, Oslo 1952. Vgl. auch Aubert, Some Social Functions of Legislations, in: Acta Sociologica 10 (1966), S. 99 - 110. 10 Aubert, Competition and Dissensus: Two Types of Conflict and of Conflict Resolution, in: Journal of Conflict Resolution 7 (1963), S. 26ff.
Rechtssoziologie gestern und heute
411
achtung vorherrschte, stark überfeinerte und eher traditionelle Hypothesen über die Rechtskodifikation, bei denen man an Savigny denken könnte, durch eine streng empirische Beobachtung umrissen und überprüft. 11 Das kulturelle Feld, aus dem in jener Zeit die theoretischen Hauptannahmen stammten, war vor allem das funktionalistische, aber eher in der Mertonschen Fassung, die auf die Probleme der Klarheit und Überprüfbarkeit der Hypothesen achtete, als in der Parson'schen Version, die vor allem für begriffliche Reinheit sensibel war. Es fehlte allerdings auch nicht der Einfluß verschiedener Schulen, angefangen bei der Weberschen Tradition bis hin zu der marxistischen und der klassischen positivistischen Schule. Wesentlich war aber ein, wie ich sagen würde, metatheoretisches Element, das jene Kultur bis zu einem gewissen Punkt vereinte, nämlich die Tatsache, daß sie an ein empirisch überprüfbares Theoriemodell, das heißt an eine aufgrund von Beobachtungen orientierbare und deshalb auch umorientierbare Theorie dachte. In seiner ins Extreme getriebenen Version wird jenes Modell dann transformiert in die Idee, daß es möglich sei, die Theorie unmittelbar zu induzieren 12, d.h. abzuleiten von der Beobachtung und der Datensammlung. Dies wurde gleichzeitig zum Höhe- und Krisenpunkt dieses Modells. In der Tat wissen wir schon seit Kant, daß die Beobachtung nicht von aprioristischen Begriffen absehen kann. Man braucht auch kaum zu erwähnen, daß dieses kritische Motiv die ganze Geschichte der neueren Philosophie durchlaufen hat, auch diejenige, die weniger den idealistischen und rationalistischen Suggestionen zuneigte. Um den wesentlich wissenschaftlichen Charakter jener soziologischen und rechtssoziologischen Kultur zu retten, hätte es aber genügt, den eingeschlagenen Kurs nach allgemein bekannten Kenntnissen zu verbessern. Historisch gesehen, durchwanderte man jedoch damals eine Zeit politischen Protests und heftigen Wiederaufkommens der Ideologien. Deswegen war die Kritik, am Anfang wenigstens, vernichtend. Indem sie Priorität mit Absolutheit verwechselte, begnügte sie sich nicht damit, ein gesteigertes Bewußtsein für den vorrangigen Charakter einiger Begriffswerkzeuge jeder einzelnen Forschungsarbeit gegenüber in Anspruch zu nehmen. Vielmehr for-
11 Vgl. W. Goldschmidt, The Greenland Criminal Code and its Sociological Background, in: Acta Sociologica 1 (1956), S. 217ff.; ders., Retlig Adfaerd, in: Meddeleser om Grönland, vol. 90, N. 3, Kobenhavn 1957; ders., Udvalget for Samfundsforskning i Grönland, in: Kriminalloven og de verstgronladske samfund, vol. 1, Samfundsvidenskabelige udersogelser, Kobenhavn 1962. 12 Der glaubwürdigste und begründetste Anspruch in diesem Sinne stammt von A . Podgórecki, der versucht hat, die empirische Forschung mit hoch verfeinerten theoretischen Apparaten zu integrieren - die er aus dem Unterricht von L. Petrazycki weitgehend abgeleitet hatte - , um schließlich die Rechtssoziologie als eine „empirische Alternative zur jurisprudence " zu bezeichnen: vgl. A. Podgórecki, Jurisprudence Empirically Tested, in: R. Hood (Hrsg.), Crime, Criminology and Public Policy: Essays in Honour of Sir Leon Radzinowicz, 1974, S. 297 - 317; ders., Law and Society, London 1974.
412
Vincenzo Ferrari
derte sie für die theoretischen Begriffe den Charakter ihrer Unbestreitbarkeit in aeternum. Die theoretischen Begriffe wurden in dieser Fassung nicht mehr als bloße methodologische Werkzeuge angesehen, sondern unmittelbar als Ausdruck von Wahrheiten verstanden. Sie wurden somit zu ideologischen Wahrheiten, die unvermeidlich mit der Ideologie derjenigen übereinstimmten, die sie proklamierten. Dies scheint mir das Motiv zu sein, das hinter der rechtssoziologischen Kultur der 70er Jahre steckte, die - wie bekannt - nicht so sehr Pnraärcharakter als Autonomiechzrakter der Theorie gegenüber der empirischen Forschung forderte. Der empirischen Sozialforschung wurde bestenfalls die bescheidene (und letzten Endes nutzlose) Arbeit und Aufgabe zugeteilt, die nicht falsifizierbaren Annahmen zu bestätigen, die von dem die Forschung beherrschenden und befehlenden Theoretiker auferlegt wurden. Wenn dieser Perspektive nach die Beobachtung der Theorie widerspricht, bedeutet dies notwendigerweise, daß man falsch beobachtet hat. Es ist wichtig zu bemerken, daß diese ausgesprochen antiempiristische und antifunktionalistische methodologische Richtung in der Tat lieber mit dem abstrakten und begriffstheoretischen Funktionalismus von Talcott Parsons als mit dem empiristischen und methodologischen Funktionalismus von Robert K. Merton abgerechnet hat. Die für lange Zeit besonders in Italien, Frankreich und England (im letzten Fall auch vermöge der im Grunde eklektischen Lehren von Alvin Gouldner) vorherrschende Kritik der marxistischen Richtungen strebte vor allem danach, den homöostatischen Gleichgewichtsformen, die man Parsons zu Recht oder Unrecht zuschreibt, die sie zerbrechende, aus der eigenen Analyse der bürgerlichen Gesellschaft gewonnenen Ungleichgewichtsformeln entgegenzusetzen: eine Tendenz, die gerade von Gouldner sehr gut vertreten worden ist. Funktionalismus und „Konflikttheorie" werden in dieser Zeit zu entgegengesetzten und symmetrischen Begriffen. Dies ist zugleich ein Beweis dafür, daß man in dieser Perspektive unter „Funktionalismus" gewiß nicht jene Methode versteht, die viele hervorragende Forschungen mittlerer Reichweite getragen hat, sondern vielmehr die hohe Spekulation, die „große Theoretisierung", von der bei Wright Mills die Rede war. 1 3 Als Niklas Luhmann um die Wende der 60er und 70er Jahre auftrat, um seinerseits den Funktionalismus zu verteidigen, bewegte er sich als legitimer 13
Besonders die englische Schöpfung ist in dieser Tendenz, im weiteren Sinne marxistischer Prägung, emblematisch: vgl. z.B. A. Hunt , The Sociological Movement in Law, London 1978; M. Cain , Optimism, Law and the State: a Plea for the Possibility of Politics, in: B. M . Blegvad/C. M . Campbell and C. J. Schuyt (Hrsg.), European Yearbook in Law and Sociology, The Hague 1977, S. 20 - 41; M. Cain/ K. Kulscâr, Thinking disputes: an Essay on the Origins of the Dispute Industry, in: Law and Society Review 16 (1981/82), S. 375ff.
Rechtssoziologie gestern und heute
413
Nachfolger von Parsons auf demselben allgemein-theoretischen Boden. Im Vergleich mit dem Harvarder Soziologen drückt er sogar eine noch tiefere Verachtung der empirischen Forschung gegenüber aus: auf dem Gebiet des Rechts scheint ihm letztere unfähig, das Rechtsphänomen „in seiner Gesamtheit, in seiner Komplexität" zu verstehen. 14 Gerade indem Luhmann sich zu höchsten Abstraktionsgipfeln erhebt, kann er versuchen, sich den Kritiken zu entziehen, die die neopositivistische Philosophie schon längst gegen den Funktionalismus in den Sozialwissenschaften gerichtet hatte. 15 Auf diese Weise vereinigen sich in einer coincidentia oppositorum sowohl die marxistische Kritik als auch ihr neofunktionalistischer Gegner bei dem Aufbau einer antiempirischen und antiempiristischen, ausschließlich deduktiv-theoretischen Soziologie - in unserem Fall des Rechts - , in der sie Hypothesen, die ex definitione der falsifizierenden Kritik der Tatsachen und der gegnerischen Theorien unterliegen, durch ausschließlich logische und auf begrifflichem Gebiet zu beweisende Thesen ersetzen wollen. Es geht dabei um Thesen, die in ihrem letzten Grund - wie Luhmann es symptomatisch sagen wird - wie „l'art pour l'art" zu wählen sind. 16 Eine gewisse Abkehr, die zwischen diesen kulturellen Ausdrücken und ihren erklärten historischen Bezügen besteht, darf man dabei jedoch nicht außer acht lassen. Luhmann vernachlässigt nämlich Merton und die kritische Leistungsfähigkeit der funktionalen Analyse auf empirischem Gebiet. Die marxistischen Schulen ihrerseits sind Marx gegenüber selbst nicht mehr kohärent. Bei dem Aufbau einer aphoristischen, wesentlich ideologischen Wissenschaft vergessen sie nämlich, daß die Wissenschaft im marxistischen Sinne deswegen keine Ideologie ist, weil sie eben Ideologiekritik ist: eine Kritik des falschen Bewußtseins, das die konkreten Tatsachen mit einem täuschenden Schleier verkleidet. Hier geht es mir aber nicht so sehr darum, die Kohärenz dieser Auffassungen (die in Italien die coincidentia oppositorum auch auf akademischem Gebiet realisiert haben) in bezug auf ihre jeweiligen Traditionen zu hinterfragen, sondern vielmehr festzustellen, daß man durch diesen Weg zu einer fast traumatischen Trennung zwischen Theorie und empirischer Sozialforschung, zur Abwertung der letzteren und in gewissen Fällen zur Umwandlung der Rechtssoziologie in einen unendlichen Methodenstreit gekommen ist, der Gefahr läuft, durch vitiöse Zirkelschlüsse vorzugehen.
14
N. Luhmann, Rechtssoziologie, Reinbek bei Hamburg 1972, S. 2. Vgl. besonders C. G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, New York/London 1966, S. 297 - 330. 16 Vgl. Luhmann, Risposta dell'autore all'Introduzione di D. Zolo, in: ders., Illuminismo sociologico (s. italienische Übers, v. R. Schmidt), Milano 1983, S. X L I . 15
414
Vincenzo Ferrari
I V . Vorschläge für heute und morgen Gibt es einen Ausweg aus diesem Methodenstreit? U m diese Frage zu beantworten, möchte ich mich auf ein von mir sehr geschätztes Buch beziehen 17 , das den bekannten, in neuerer Zeit geführten sozialwissenschaftlichen Methodenstreit belegt. Ich meine hier den Streit zwischen „Positivisten" und „Dialektikern" - es handelt sich zwangsläufig um unscharfe Formeln - , der 1961 in Tübingen mit der direkten Auseinandersetzung zwischen Adorno und Popper begann. Er wurde dann via Dahrendorf mit der Auseinandersetzung zwischen den jeweiligen Anhängern Habermas und Albert weitergeführt und diente tatsächlich als unmittelbare historische Voraussetzung für die bekannte Habermas-Luhmann-Debatte. 18 Ich greife oft auf diesen Streit zurück, nicht so sehr, um Stellung zu nehmen, sondern um daran zu erinnern, daß die großen Gegner der ersten Diskussion, Adorno und Popper - die die entgegengesetzten Auffassungen einer durch holistische Formeln bzw. durch Versuch und Irrtum vorgehenden Sozialwissenschaft vertraten - wenigstens in einem Punkt übereinstimmten. Er bestand, wie Adorno zugab, darin, daß die in der Sozialwissenschaft zum Ausdruck gelangenden holistischen Formeln durch die Beobachtung kritisch umorientiert werden können. 19 Es scheint mir daher, daß - wenn wir das Vertrauen in eine den Wissenschaftscharakter beanspruchende Soziologie lebendig erhalten wollen - wir dieses mühsame Gleichgewicht schwerlich wieder aufgeben können. Der Punkt, in dem wir zu einem Gleichgewicht gelangen, kann als derjenige einer kritisch-relativistischen Epistemologie angesehen werden. Dies ist mein erster Anspruch an die Rechtssoziologie von heute und morgen! Einerseits sollten wir zugeben, daß der spezifischen Beobachtung ständig begriffliche Annahmen vorausgehen, die mit vorrangigen Generalanschauungen - mit „Paradigmen", wenn Sie so wollen - verbunden sind. Andererseits sollten wir aber gleichzeitig darauf bestehen, daß diesbezügliche Annahmen 17 H. Maus/F. Fürstenberg (Hrsg.), Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, Neuwied/Berlin 1969 (ital. Übers.: Dialettica e positivismo in sociologia, Torino 1972). 18 J. Habermas/ Ν. Luhmann, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt 1971. 19 Vgl. T. W. Adorno, Sulla logica delle scienze sociali, in: Dialettica e positivismo in sociologia (FN 17), passim. Besonders wichtig ist die Erkenntnis, daß der Soziologe (wie der Philosoph selbst) sich nicht „von der Sache entfernen", aber sich „ihr auch nicht ausliefern" darf. Trotzdem ist der Versuch Adornos deutlich, die Popperschen Thesen in einer Weise zu „lesen", die dem holistisch-dialektischen Lager zum Vorteil gereicht. Vgl. bes. die Stellen, wo er behauptet, daß „die Widerlegung nur als immanente Kritik ergiebig ist" und seine Bedenken gegenüber dem Experimentalismus des trial and error erklärt: ebd., S. 132 - 133 der ital. Ubersetzung.
Rechtssoziologie gestern und heute
415
nicht anders als in theoretisch-empirischen, d.h. in falsifizierbaren Hypothesen wissenschaftlich ausdrückbar sind. Dieser Perspektive nach erscheinen uns dann die Paradigmen selbst nicht als Postulate, von denen aus sichere und unbestreitbare Korollarien abzuleiten sind, sondern als Annahmen, die insofern allgemeine und all-embracing sind, als sie noch nicht falsifiziert wurden. Ähnlich war übrigens die Haltung der modernen, galileischen Wissenschaft gegenüber dem ptolemäischen „Paradigma". Es ist zwar wahr, daß die Soziologie sich deswegen von der Astronomie unterscheidet, weil ihr eigenes Objekt, die Gesellschaft, sich selbst auf eine nicht mechanische Weise wandelt. Es stimmt aber auch, daß uns die größere, an die Unbeständigkeit der menschlichen Handlungen gebundene Unwägbarkeit angesichts unserer Eindrücke von der Gesellschaft, d.h. über uns selbst, zu einer kritischen Epistemologie zwingt. Argumentativ und gedanklich an die Lehre von Renato Treves anknüpfend 20 , werde ich diese Epistemologie als „relativistisch" bestimmen, indem ich meine Auffassung dahingehend präzisiere, daß ich unter „Relativismus" nicht nur die Haltung verstehe, die dazu neigt, alle entgegengesetzten Theorien, die nicht falsifiziert worden sind, als hypothetisch wahr zu tolerieren, sondern auch die bescheidene Haltung derjenigen, die in Betracht ziehen, daß die eigenen Theorien selbst falsifiziert werden können, und die daher - eben als Wissenschaftler - mit Methoden vorgehen, die selbst die Falsifikation eigener Theorien zulassen. Von diesem ersten, epistemologischen Anspruch möchte ich nun zu einem metatheoretischen Anspruch übergehen. Ich bin davon überzeugt, daß die Rechtssoziologie vor allem eine analytische Metatheorie benötigt. 21 Die analytische Revolution gleicht hier ein wenig der protestantischen Reformation. Die Bevölkerungen jener Länder, die keine Reformation erlebt haben - mein Land zuallererst - , sind sehr empfänglich für und beeinflußbar durch Impulse der Einstimmigkeit und daher auch der Poesie, so daß der Kommunitarismus hier durch menschliche Wärme geprägt wird. Diese Länder leiden jedoch daran, daß sie nie mit der elementaren, unentrinnbaren strukturellen Dimension der Probleme gerechnet haben. Niemand kümmert sich um die nackten Tatsachen und Probleme, in die keiner von außen eingreifen und die niemand lösen wird, um das in Verwirrung geratene Gewissen durch eine Barmherzigkeitstat zu beschwichtigen. 20 Dies ist ein wiederkehrendes Motiv im Werk dieses Autors. Vgl. jedoch besonders R. Treves, Spirito critico e spirito dogmatico, Milano 1954. 21 Ich nehme eine „analytische Metatheorie" für die Rechtssoziologie in demselben Sinne in Anspruch, wie z.B. Scarpelli eine als Sprachanalyse verstandene „analytische Meta-ethik" beim Aufbau von ethischen Theorien als vorrangig in Anspruch nimmt. Vgl. U. Scarpelli, La meta-etica analitica e la sua rilevanza etica, in: Rivista di filosofia 71 (1980), S. 319ff., jetzt auch in: ders., L'etica senza verità (FN 6), S. 73ff.
416
Vincenzo Ferrari
Zwar ist die Wissenschaft ganz anders als das Gewissen, doch erscheint die Analogie berechtigt. Jene Wissenschaften, die die Problembestimmungen nicht angemessen gepflegt haben, indem sie die Suggestion der unbestimmten Formeln und der mehrdeutigen und konnotativen Worte und Begriffe vermeiden - eine Leistung, die man nur durch eine selbstkritische Haltung und durch die Reinigung des eigenen Vokabulars erbringt - , laufen ständig Gefahr, verführerischen und sogar künstlerischen Ausdrücken zu erliegen. Obwohl die Rechtssoziologie fast überall durch den Impuls der philosophischen Gründerväter des Rechts entstanden ist, hat sie diese Revolution, die in Wahrheit - ohne Kuhn böse zu sein - die erste wissenschaftliche Revolution ist, noch nicht ganz vollendet. Dies erscheint mir besonders gefährlich, da die Rechtssoziologie auf einer materiellen Grundlage operiert, die zugleich Gegenstand einer spezifischen und hochverfeinerten analytischen Begrifflichkeit ist, nämlich der juristischen, die aber durch recht verschiedene Objekte, Perspektiven und Ziele bestimmt wird. Sie empfiehlt normative Wortgebräuche und Begriffsverwendungen im Hinblick auf praktisch-interpretative oder theoretisch-systematische Probleme. 22 Anders steht es hingegen mit der Forschung über den wechselseitigen Einfluß zwischen normativen und nicht normativen Variablen, welche die Eigentümlichkeit des rechtssoziologischen Diskurses ausmachen. Anstatt eine eigene Begrifflichkeit auszubilden, schwankt die Rechtssoziologie ständig zwischen einer mechanischen Verwendung der rechtsdogmatischen Terminologie und der unüberlegten Aufnahme gemeiner Wortgebräuche. Die Definitionswillkür, in die sie dabei verfällt - und ich möchte darauf hinweisen, daß dies ganz unvermeidlich ist - , ist gefährlich, weil sie nicht erklärt werden kann und manchmal das Ergebnis eines unpassenden Synkretismus ist. Ohne viele Beispiele anzuführen, genügt es, sich zu überlegen, daß viele soziologische Gesetzgebungstheorien sich des juristischen Begriffs „Gesetzgeber" bedienen, der eine reine (aber notwendige) fictio ist, hinter der soziologisch eine Mehrheit von Entscheidungsgewalten steckt, die nicht unbedingt zu den mit formeller gesetzgeberischer Gewalt ausgerüsteten agencies gehören. Desgleichen ist es wahr, daß man soziologisch über das Recht theoretisiert, indem man jene formelle Rechtsdefinition unreflektiert verwendet, die von den offiziellen Rechtsquellen präskriptiv gegeben wird. Zu einer noch niedrigeren Ebene übergehend, glaube ich ferner, daß die Rechtssoziologie, wie ich schon gesagt habe, nach empirisch orientierbaren 22 Die Auffassung, derzufolge die Rechtswissenschaft wesentlich praktischer Natur und daher eher Rechtspolitik ist als Wissenschaft, wurde in Italien von G. Tarello sehr radikal vertreten: vgl. z.B. Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto, Bologna 1974. Seiner Meinung nach sind die aus den kontingenten Wahlen und Zwecken der Juristen stammenden Bedingungen im Vergleich zu jeder vermutlichen Begriffsbestimmung vorherrschend.
Rechtssoziologie gestern und heute
417
theoretischen Hypothesen operieren sollte. Dabei befinden wir uns in einem äußerst umstrittenen Feld, in dem ich nur auf drei wesentliche Punkte jener Theorie hinweisen kann, die mir heute am annehmbarsten erscheint. Hier glaube ich, daß eine semiotische Konflikttheorie der offenen Systeme überzeugender als andere Theorien ist. Wenn ich hier von Konflikttheorie spreche, berufe ich mich auf die allgemeine Annahme (die sowohl Konflikttheoretiker als auch Theoretiker der sozialen Integration billigen: Marx und Parsons, damit wir uns richtig verstehen), daß es eine notwendige, gleichsam endemische, wechselseitige Beziehung zwischen Recht und Konflikten gibt. Mit anderen Worten: Das Recht ist dem sozialen Konflikt funktional, und das gilt auch, wenn das Wort „funktional" in seiner neutraleren, d.h. mathematischen Bedeutung verwendet wird. Es gäbe kein Recht, wenn es keine Konflikte gäbe. In der Tat ist aber bemerkenswert, daß gewisse Konflikttheorien am Ende die integrative Utopie von konfliktund rechtlosen Gesellschaften wachrufen. Selbstverständlich gibt es viele Möglichkeiten, den Konflikt zu erklären und zu interpretieren. Ohne eine Wahl zwischen den verschiedenen Ideologien zu treffen, möchte ich - obwohl ich der Überzeugung bin, daß der Konflikt in der wie auch immer organisierten menschlichen Gesellschaft endless ist - nur darauf hinweisen, daß die Sozial Wissenschaft durch den symbolischen Interaktionismus und durch ihre Verbindung mit einer an Status- und Rollenbegriffe gebundenen strukturfunktionalistischen Methodologie ein ziemlich genaues Konfliktbild wiedergegeben hat. In seiner elementaren Dimension besteht der Konflikt im Kampf um die Ausdehnung der jeweiligen Autonomiebereiche, das heißt, der sozialen Freiheit. Der Konflikt ist Anlaß und Ergebnis einer sozialen Handlung - ob und wie weit sie individueller oder kollektiver Natur ist, mag hier dahingestellt bleiben - , das heißt mit Marxschen Worten: Er ist das Ergebnis der Handlungen konkreter menschlicher Subjekte. Das Recht ist den Plänen der Subjekte oder Handelnden funktional, da sie im Verlauf eben dieser Konflikte - wie Weber sagt - im Hinblick auf konkrete Ziele (mehr oder weniger intelligent) handelt. 23 23
Gegen rein objektivistische Anschauungen reagierend - obwohl sie passend auf interaktionistische und funktionalistische „offene" Voraussetzungen gründen, wie es diejenige von Luhmann ist - , habe ich in meinem Buch: Funzioni del diritto (FN 1) versucht, die funktionale Methode mit einer konflikttheoretischen Vorstellung der sozialen Handlung in Einklang zu bringen. Diese Auffassung ist stark auf die Subjekte konzentriert, da sie - unter anderem - den Handlungen und den sie strukturierenden Systemen Sinn geben. Mehr oder weniger in derselben Zeitspanne sind in Italien verschiedene Werke erschienen, die gleichfalls ihre Aufmerksamkeit auf die sozial Handelnden lenken: vgl. z.B. L. Gallino , L'attore sociale. Biologia, cultura e intelligenza artificiale, Torino 1987; M. Livolsi, Identità e progetto. L'attore sociale nella società contemporanea, Scandicci 1987; A. Ardigò, Per una sociologia oltre il post-moderno, Bari/Roma 1988; G. Palombella , Soggetti, azioni, norme. Saggio su diritto e ragion pratica, Milano 1988. Ferner vgl. auch A. Touraine, Le retour de l'acteur. Essai de sociologie, Paris 1984. 27 Festgabe Opalek
418
Vincenzo Ferrari
Außerdem spreche ich von einer „semiotischen Theorie", da ich glaube, daß man zu einer Darstellung des Rechts als Zeichen oder Symbol nicht nur durch die Rechtstheorie, sondern auch durch die reine Soziologie gelangen kann. Das ist besonders dann der Fall, wenn man die Annahmen des symbolischen Interaktionismus mit denjenigen integriert, die von der Methode der Funktionsanalyse angeregt werden. Von diesem Standpunkt aus kann das Recht als eine relativ koordinierte und „institutionelle" Gesamtheit 24 von normativen Messages heteronomer Herkunft, hypothetischer Struktur und mit persuasivem Ziel (oder Funktion) dargestellt werden. Das Recht ist ein Mittel interindividueller Persuasion, die im Versprechen oder Androhen einer Sanktion besteht als der Folge eines Verhaltens, das bei den Gesprächspartnern hervorgerufen wird in der Form eines normativen Symbols und gestützt wird von der Möglichkeit einer „richterlichen" Intervention. 25 Es ist leicht zu bemerken, daß diese Definition, die dem eigenen Gebiet der Soziologie entnommen ist, sich nicht sehr von jenen Bestimmungen unterscheidet, die gewöhnlich von bekannten rechtstheoretischen Abhandlungen vorgeschlagen werden. 26 Bisher aber hat die Rechtssoziologie sowohl in ihren „theoretischen" als auch in ihren „empirischen" Fassungen den semiologischen Status des normativen Stoffs nur selten zur Kenntnis genommen und sich infolgedessen auch nicht auf theoretische oder metatheoretische Optionen festgelegt, zu denen sie eigentlich verpflichtet wäre. 27 Zuletzt spreche ich von einer Theorie der offenen Systeme. Nicht nur das Recht ist eine korrelative oder korrelierbare Gesamtheit normativer Symbole, sondern auch das „Handeln durch Recht" erreicht seinerseits Ergebnisse, die auf andere Handlungs- und Wissenssysteme zurückwirken. Die Korrelation
24
Nach dem Beispiel von S. Romano, L'ordinamento giuridico (1918), Firenze 1962, verwende ich diesen Ausdruck, um mich sowohl auf die notwendige Zugehörigkeit der Rechtsnormen zu einem System zu beziehen als auch die natürliche Fähigkeit des Rechtssystems - jedem anderen Normensystem gegenüber - zu kennzeichnen, die jeweiligen Lebensbereiche eines gesellschaftlichen Aggregats zu regeln. 25 Daß die Rechtsnormen einem eventus judicii unterliegen und daher die Gestalt des Richters - letzterer als institutionell „zweifelndes und entscheidendes" Subjekt verstanden - derrt Recht koessential ist (in dem Sinne, den die antiformalistische Tradition, wie z.B. Kantorowicz, bezeichnet), ist eine notwendige soziologische Folge des im Kelsenschen Sinne hypothetischen Chrakters der Rechtsnormen. 26 Man denke z.B. an: H. L. A. Hart, The Concept of Law, London 1961, und A. Ross, On Law and Justice, London 1958. 27 In der Rechtstheorie wird ständig auf die Notwendigkeit einer vorrangigen Wahl unter den semiotischen Theorien hingewiesen. Vgl. z.B.: B. S. Jackson, Semiotics and Legal Theory, London 1985, und M. Jori, Semiotica e teoria del diritto, in: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto 1987/4, S. 196 - 239. Ziemlich überraschend ist es hingegen, daß es keine Wesensverbindung gibt - mit Ausnahmen, zu denen gewiß Niklas Luhmann zu zählen ist - zwischen Rechtssoziologie und Semiotik, auch nicht auf den „natürlichen" Gebieten der Kommunikationssoziologie und der Theorie sozialer Kommunikation.
Rechtssoziologie gestern und heute
419
dieser externen u n d internen Elemente - die, dies möchte ich betonen, das spezifische
O b j e k t der Rechtssoziologie ausmacht, die sich insoweit v o n der
Rechtswissenschaft unterscheidet - ist eine „systemische". Soziologisch kann man also das Recht nicht anders als systembezogen begreifen. A b e r man muß sich sofort daran erinnern, daß w i r es, wenn es sich u m menschliche H a n d lungs- u n d Wissenssysteme handelt, i m wesentlichen mit Symbolen zu t u n haben, m i t einem Stoff also, dessen Schaffung, Interpretation u n d Systematisierung fundamental m i t den Handlungen u n d Entscheidungen der sozialen A k t e u r e zusammenhängt, die durch ihre eigene H a n d l u n g auf die Systeme wirken und sie beeinflussen. Selbstverständlich muß man deutlich hervorheben, daß der Bereich für die Variabilität v o n Eingriffen, die v o n den Subjekten auf die Systeme ausgeübt werden, nicht unbegrenzt ist, sondern die M ö g l i c h k e i t besteht, i h n gemäß einer relativ voraussehbaren Modalitätsskala statistisch und stochastisch darzustellen. Das „Rechtssystem" erscheint daher sozusagen relativ offen 2 8 : Es hat eigene Begriffe u n d Bedeutungen 2 9 , prüft, „prozessiert" und setzt ferner nach eigenen Bedeutungskriterien sogar Begriffe durch, die aus anderen „Systemen" s t a m m e n . 3 0 Schließlich überläßt es die W a h l „rechtl i c h " relevanter Bedeutungen sehr oft j e n e n anderen „ S y s t e m e n " . 3 1 D i e Rechtspraktiker streiten sich außerdem permanent darüber, welcher der drei
28 Dies sowohl im kognitiven als auch im normativen Sinne: In der Tat nimmt das Rechtssystem auch die normativen Bedeutungen oft von außen auf, indem es sich mit Lemmata anreichert, die aus keiner vorkodifizierten Bedeutung ableitbar sind. Unter anderem vgl. die Ausdrücke: „Absentismus", „diffuses Interesse", „biologischer Schaden", „Subversionsnest". In hohem Maß dringen solche Ausdrücke in das Rechtssystem ein, die von verschiedenen Kommunikationssystemen stammen, nicht zuletzt aus dem Jargon (und der eigenen Kultur) der mass media. 29 Selbstverständlich sind Ausdrücke, wie „Anfechtung", „Zustellung", „aufschiebende Bedingung", „Depot" und tausend andere juristische Fachausdrücke und gewinnen ihre Bedeutung allem Anschein nach auf eine „selbstreferentielle" Weise. Aber jeder gute Rechtspraktiker weiß, daß auch derartige Begriffe für semantische, durch konkrete Handlungen vorgenommene Manipulationen offen sind, die ihre Bedeutung so ausdehnen oder einschränken, bis sie jene ursprünglich anerkannte entstellen. 30 Man betrachte die Norm des Art. 41 Abs. 2 des italienischen StGB über den kausalen Zusammenhang zwischen Tat und Erfolg, die unter anderem bestimmt, daß „das Zusammentreffen von vorherbestehenden, gleichzeitigen oder später hinzugetretenen Ursachen, mögen sie auch unabhängig von der Handlung oder Unterlassung des Täters sein, den Kausalzusammenhang zwischen der Handlung oder Unterlassung und dem Erfolg nicht ausschließt". Man kann die Meinung vertreten, daß - was das Zusammentreffen von Ursachen angeht - diese Norm, die auf die allgemeinen Auffassungen des Kausalzusammenhangs verweist, eine unausweichliche und generelle Vorschrift diktiert, indem sie über diesen spezifischen Punkt einen künstlichen und präskriptiven Kausalbegriff stellt. 31 Es ist vernünftig, die Meinung zu vertreten, daß sich das Recht in der Bedeutung des Wortes „Tod", das z.B. bei der Anwendung der die Tötung bestrafenden Norm bedeutsam ist, auf die Biologie bezieht. Aber nichts verbietet, wie F. Cordero, Riti e sapienza del diritto, Roma/Bari 1981, S. 245, scharfsinnig bemerkt, daß der Gesetzgeber eine unter Umständen extensive verbindliche Bedeutung dieses Wortes präskriptiv vorschreibt.
27*
420
Vincenzo Ferrari
angeführten hermeneutischen Maßstäbe, die alle gleichzeitig in den offiziellen Vorschriften und Ideologien enthalten sind, im Bereich der jeweiligen sinngebenden Operation anzuwenden ist. A l l dies trägt dazu bei, daß das System innerhalb seiner (selbst veränderlichen) Wandelbarkeitsbereiche schwankt und „offen" wird. Deshalb kann man nicht davon absehen zu fragen, ob der Begriff „System" selbst - sofern man ihn in seinem „externen" und „idealen" Sinn versteht 32 - nicht metaphorisch ist. In der Tat scheint das Recht nichts anderes zu sein als ein Lemmatasystem 33 , eine Ausdrucksweise oder eine Sprache, ein „System" in demselben Sinne wie jede Gesamtheit von Sprachsymbolen, wie diese wandelbar und „verfügbar", wenn auch nicht der bloßen Willkür der Mächtigeren unterworfen, wie die Dezisionisten à la Schmitt behaupten. Letztere begehen den Fehler nicht deswegen, weil Normen und die normativen Bedeutungen nicht manipulierbar sind, sondern weil sie nicht zugeben, daß eine Vielzahl miteinander in Konflikt stehender Interessen mitspielen, um jene zu beeinflussen. Gleichzeitig bemerken sie nicht, daß erst, wenn sich solche Interessen auf wenige verringern, das Recht dazu tendiert, eindeutig und „objektiver" zu werden. 34 V . Schlußbemerkungen über das Objekt und seinen möglichen Aufstand Dieses cahier von Forderungen wäre nicht vollständig, wenn wir nicht eine spezifischere hinzufügen würden, die das eigentümliche Objekt der Rechtssoziologie, d.h. das Recht selbst, noch näher betrifft. Bekanntlich kann das Objekt sich gegen den Wissenschaftler wenden. 35 Dies nicht so sehr im metaphysischen Sinne, in dem - wie man in der alltäglichen Umgangssprache oft sagt - die Natur an denjenigen „Rache nimmt", die sie manipulieren, sondern vielmehr, da es sich um humane Wissenschaften 32 Siehe diese Begriffe bei: M. G. Losano, Einleitung zu Sistema e struttura del diritto, Vol. I: Dalle origini alla scuola storica, Torino 1968. 33 Vgl. J. Wróblewski, Semantica e interpretazione giuridica (1963), in: U. Scarpelli (Hrsg.), Diritto e analisi del linguaggio, Milano 1978, S. 363, nach dem die juristische Sprache, die „mitten zwischen der natürlichen und der künstlichen Sprache" steht, vielleicht der ersteren näher ist als der zweiten. Vgl. aber auch: A. G. Conte, Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, Torino 1962, S. 177ff., der die Künstlichkeit der juristischen Sprache entschiedener geltend macht. 34 Man bedenke, daß - wie die Krise kodifizierten Rechts in den heutigen „pluralistischen" Gesellschaften beweist - die eindeutigsten Kodifikationen (vor allem des substanziellen Rechts) oft von ideologisch sehr einheitlichen politischen Klassen stammen. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie autokratisch oder demokratisch sind. In diesem Sinne soll die bekannte Wechselbeziehung Tarellos zwischen Kodifikation und Absolutismus verstanden und teilweise umformuliert werden: vgl. G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I: Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna 1976. 35 Der Ausdruck stammt von dem sardischen Anthropologen M. Pira, La rivolta dell'oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano 1978.
Rechtssoziologie gestern und heute
421
handelt, in dem Sinne, in dem das Objekt mit dem Wissenschaftler interagiert und auf seine Weise, das Studium und die Forschung zu behandeln, positiv oder negativ reagiert. Wie die ganze Geschichte dieses Fachs und seiner mühsamen Institutionalisierung beweist, ist dieses Problem für die Rechtssoziologie zentral, da sie sich mit dem regelgerichteten Verhalten konfrontiert sieht, dessen Interpretation zugleich das spezifische Objekt einer „jahrhundertealten Wissenschaft" ausmacht, welche zu self-conscious ist, um auf das Kulturmonopol ihres Stoffs zu verzichten, den sie oft in einer verfeinerten und esoterischen Weise betrachtet. 3 6 Und tatsächlich tritt auch unter den „offenen" Juristen immer wieder die Tendenz auf, den Rechtssoziologen die reine Hilfsaufgabe der Sammlung bloßer Daten über die Institute zu reservieren bzw. sich diese Aufgabe selbst zu reservieren, indem sie zu Rechtssoziologen werden. Dabei möchte ich unterstreichen, daß diese „Soziologie im Recht" 3 7 die soziologische Theorie zwar aus den Augen verliert, aber dennoch oft durchaus plausibel ist und sehr anregend sein kann. 38 Solche Verhaltensweisen finden oft ihren Ursprung in der Unduldsamkeit gegenüber der soziologischen Denkweise, aber auch in der geringen Vertrautheit der Soziologen mit dem Recht und den Rechtsbegriffen. Darauf hat die Rechtssoziologie - in der großen Theorie Trost suchend - stolz reagiert. Auch seines Erfolgs wegen kann hier der Fall Luhmann als emblematisch angesehen werden, aber er ist nicht der einzige! So stoßen wir in der Tat überall auf Theoretisierungen großer Reichweite, die sich wirklich den juristischen Theoretisierungen ehrgeizig entgegenstellen und bei den Juristen einander widersprechende Gefühle bald der Unduldsamkeit, bald des ehrfurchtsvollen Interesses wecken. Dagegen gäbe es nichts einzuwenden, wenn das theoretisierende Streben dabei nicht mit dem empirischen Boden oft auch den Boden der Rechtsinstitute selbst verlassen hätte. Liest man z.B. die rechtssoziologischen Veröffentlichungen, kommt man spontan dazu, sich zu fragen, wohin das Recht eigentlich geraten ist: die Rechtssoziologie scheint endgültig ein anderes Objekt als die Rechtswissenschaft zu haben. 36
Zur Frage der schwierigen Zusammenarbeit zwischen Juristen und Soziologen vgl. Treves , Sociologia del diritto (FN 2), S. 218ff. 37 Über die Verwendung von soziologischen Methodologien für die Zwecke der Rechtswissenschaft vgl. z.B. die Diskussion zwischen Treves (Tre concezioni e una proposta, und Considerazioni conclusive, in: Sociologia del diritto 1 (1974), S. 66f. und S. 289 ff.) und Tar elio (La sociologia nella giurisprudenza, in: Sociologia del diritto 1 (1974), S. 40ff.). 38 Man darf dabei das soziologische Interesse, das von juristischen Veröffentlichungen geweckt wird, die sich z. B. mit der außergesetzlichen (rechtswissenschaftlichen und „privaten") Rechtsbildung beschäftigen, nicht vernachlässigen. In Italien vgl. z.B. die viermonatige, von F. Galgano herausgegebene Zeitschrift: Contratto e impresa.
422
Vincenzo Ferrari
Das hängt jedoch mit dem Mißverständnis zusammen, das auf die eingangs erörterten Dilemmas zurückzuführen ist: nämlich, daß die Erforschung der Rechtsinstitute „weniger theoretisch" sei oder sowieso aus einem niedrigeren Theoretisierungsbereich schöpft als die allgemeine Theoretisierung über das Recht. Dies ist aber ganz falsch. Karl Marx ist von dem Institut des Eigentums ausgegangen - ohne jedoch über analytische Unterschiede zu reflektieren, die gewiß angebracht gewesen wären - , um eine derart hohe und allgemeine Theorie aufzubauen, die legitime und immer wiederkehrende Zweifel an ihrer Falsifizierbarkeit erweckt. Außerdem hegten schon vor Marx die Schüler von Saint-Simon ähnliche Bestrebungen, als sie über die gefährlichen sozialen Wirkungen der Erbfolge mortis causa theoretisierten. Und so kann man sagen: Auch die neuere Geschichte der Rechtssoziologie bietet bemerkenswerte Beispiele einer Verbindung zwischen Fachbeobachtung und der auch abstrakteren Theoretisierung. Lawrence Friedman zum Beispiel geht von den einzelnen Instituten aus, um Hypothesen über die „zuteilende" Funktion des Rechts zu bilden oder um die Grundunterscheidung zwischen „Wirkung" und „Wirksamkeit" des Rechts aufzuzeigen. 39 Dasselbe Verfahren wird auch von Jean Carbonnier befolgt, um zu Schlüssen über das „flexible Recht" oder die „Internormativitätsphänomene" zu gelangen.40 Diese Beispiele sind, wie alle Beispiele, heftig umstritten, erweisen sich jedoch als sehr nützlich auf dem Wege der Integration zweier Fachkulturen der soziologischen und der juristischen - auf dem Gebiet der Rechtssoziologie, in dem der wissenschaftliche Charakter dieser Disziplin durch die Interdisziplinarität selbstverständlich noch gesteigert wird. 4 1 (Aus dem Italienischen übertragen von F. Belvisi und G. Romen)
39
Vgl. L. M. Friedman, The Legal System. A Legal Science Perspective, New York
1975. 40
Vgl. J. Carbonnier, Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris 1971; ders., Les phénomènes d'internormativité, in: Β . M. Blegvad/C. M. Campbell/C. J. Schuyt (Hrsg.), European Yearbook in Law and Sociology (FN 13), S. 50 ff. 41 Vgl. Treves, Insegnamento interdisciplinare, diritto e sociologia del diritto, in: Sociologia del diritto 4 (1977), S. 305ff.
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology By Tomasz Gizbert-Studnicki, Kraków The concept of norm is a central category for legal theory. In analytical as well as in empirical theories of law statements about legal norms play an important role. As is often the case in the humanities, this central category of legal theory is notoriously ambigous. The legal theorists do not share a common concept of norm. The word "norm" denotes in its various meanings in legal theory objects of different ontological status. There exists no common core in all these various meanings which could be taken for a concept of norm. The elaboration of the concept of norm is therefore an urgent task for legal theory. This task is by no means easy. The concept of norm cannot be introduced by means of a mere stipulation. It should take into account juristic intuitions. The problem is that these intuitions are not uniform. The criteria of adequacy for the concept of norm are thus difficult to grasp. The question must be answered; which of the juristic intuitions concerning the concept of norm are basic and therefore must be accounted for and which can be neglected as being contingent? It is obvious that each answer to this question must be, at least to some extent, arbitrary. The aim of this paper is a critical examination of the concept of norm, elaborated by Kazimierz Opalek in a series of recent works. The problem of the ontological status, logical structure and meaning of norm has always been one of the main topics of his research 1. In his recent papers (partly written in collaboration with J. Woletìski) a radicalisation of his views can be observed 2. Opalek does not consider his conception as a finished and closed theory. He stresses that there are still many points which need further consideration and he is fully aware of the fact that his assumption may be questioned. In one of
1 K. Opatek , Theorie der Direktiven und der Normen, Wien 1986, passim. This book is a kind of summa of Opalek's numerous works on this topic written before 1986. 2 Same, Normen und performative Akte, in: W. Krawietz / W. Ott (eds.), Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart, Berlin 1987, pp. 243 - 256; Same, Dwoistosc ujçcia normy w nauce prawa (Two Concepts of Norm in Legal Science), in: Patìstwo i Prawo (State and Law), 1988, no 6, pp. 3 - 12; Κ. Opatek I J. Woleûski, Is, Ought and Logic, in: ARSP L X X I I I (1987), pp. 373 - 385; Opatek / Wo lens ki, Logika i interpretacja powinnosci (Logic and Interpretation of Ought), in: Krakowskie Studia Prawnicze (Cracow Studies in Law), vol. X X I (1988), pp. 13 - 29.
424
Tomasz Gizbert-Studnicki
his recent papers Opalek invites discussion about what he calls "non-linguistic conception of norm" 3 .1 would like to take up this invitation. Opaiek's starting point is a taxonomy of the existing conceptions of norm. The criterion for this taxonomy is the ontological status of norms. It is a fundamental criterion, because it concerns the very concept of a norm. It can be said that persons who ascribe different ontological statuses to norms are making use of different concepts of norm, and not only of different conceptions falling within one and the same concept. In Opalek's taxonomy, linguistic and non-linguistic concepts of norms are distinguished4. On the basis of the former, norms are a certain kind of linguistic entities. On the basis of the latter norms are identified with extra linguistic entities. This dichotomy is fundamental, but by no means sufficient. Various conceptions fall under both linguistic and non-linguistic concepts of norm. As far as the linguistic concept of norm is concerned, a norm can be identified either with an utterance (or sentence) having some special features, distinguishing it from other utterances (sentences) or with the meaning of some kind of utterances (sentences). Further, there exist various conceptions as to the question of which features distinguish norms from other kinds of utterances (sentences). As far as the non-linguistic concept of norm is concerned, there exists a wide range of different conceptions. Norms can be identified with some social or psychological facts, with decisions or some other human acts. There also exist hybrid conceptions, according to which norms are complex phenomena, having both linguistic and non-linguistic components5. In jurisprudence (in the broad sense of the word) various concepts and conceptions of norms co-exist. Roughly speaking, the adoption of the linguistic concept can be ascribed to legal dogmatics and to the analytical theory of law, whereas the adoptance of the non-linguistic concept is characteristic of the sociology of law and various branches of the empirical theory of law. The fact that different branches of jurisprudence make use of different concepts of norm need not be considered a handicap. The different tasks and different methodological statuses of branches of jurisprudence may justify the adoption of different concepts of norm 6 . 3
Opatek, Normen und performative Akte (FN 2). p. 255. Same, Dwoistosc (FN 2), p. 3. For the contemporary discussion on the concept of norm comp, also O. Weinberger, Normentheorie als Grundlage der Jurisprudenz und Ethik, Berlin 1981; C. Alchourron / E. Bulygin, The Expressive Conception of Norms, in: R. Hilpinen (ed.), New Studies in Deontic Logic, Dordrecht 1981; E. Bulygin, Norms and Logic, in: Law and Philosophy 4 (1985); Weinberger, The Expressive Conception of Norms - A n Impasse for the Logic of Norms, in: Law and Philosophy 4 (1985). For the general overview see W. Lang / J. Wróblewski / S. Zawadzki, Teoria paóstwa i prawa (Theory of State and Law), 3d ed., Warszawa 1986, pp. 341 - 347. 5 For the detailed discussion see Opatek, Theorie der Direktiven (FN 1), p. 136ff. 6 On the status of legal science comp. R. Dreier, Recht - Moral - Ideologie, Frankfurt a.M. 1981, p. 48ff. 4
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
425
Opalek is fully aware of the fact that different branches of jurisprudence have different tasks and different methodological statuses7. Nevertheless he is of the opinion that jurisprudence as a whole needs one common concept of norm. A norm must be either a linguistic or an extra-linguistic entity. It cannot be both 8 . One concept cannot cover such different things as linguistic items on the one hand and complexes of social facts on the other. I do not find this argument convincing. The point is that, as a matter of fact we are not dealing with one concept of norm, but with two (or more) different concepts, coined for different purposes. It is not the case that one and the same concept covers both linguistic items and social facts. It is rather that one concept of norm (in particular the one used in analytical legal theory and in legal dogmatics) denotes some kind of linguistic entities, whereas the other one (used in empirical branches of legal science) denotes social facts. It would probably be better if one could coin new word for one of these two concepts, but as long as we are aware of the fact that different branches of jurisprudence use different concepts of norm there is nothing wrong. There is of course certain price to be paid. In particular the dualism of the concept of norms implies that there is no such thing as one legal science, having different branches. In fact we are faced with two quite different sciences, having different objects of inquiry and different methodological statuses. The only link which exists between them is of an institutional nature. This consequence of the dualism of the concept of norm in legal science is probably for psychological and historical reasons not easy to accept, but nevertheless it seems quite realistic and, what is more important in the context of this discussion, close to Opalek's ideas on the difficulties in integration between legal research and social science9. In order to refute the linguistic concept of norm it is not sufficient to show that it is inapplicable in the empirical science of law. It must be shown that it is wrong for both the analytical and the empirical branch of jurisprudence. Opalek is aware of this and he furnishes arguments against the linguistic concept of norm relating to both kinds of research. Opalek's arguments against the linguistic concept of norm in the analytical theory of law play a crucial role. Let us examine briefly these arguments.
7
See for example Opatek, Analytical and Empirical Theory of Law: Their Relation to Legal Positivism and Analytical Jurisprudence, in: ARSP Supplementa, vol. 1 (1980), passim. Comp, also J. Wróblewski, Norma prawna jako przedmiot prawoznawstwa (Legal Norms as the Object of Jurisprudence), in: Paùstwo i Prawo (State and Law), 1970, no 5, passim. 8 Opatek, Dwoistosc (FN 2), p. 3. 9 Opatek, Integration between Legal Research and Social Science, in: A . Peczenik and al. (eds.), Theory of Legal Science, Dordrecht 1984, p. 541 ff. Comp, also H. Rottleuthner, Legal Theory and Social Science, in: Theory of Legal Science (FN 9), p. 521 ff.; Wolenski, Empiricism, Theory and Speculation in the General Study of Law, in: Archivum Iuridicum Cracoviense, vol. I l l (1970).
426
Tomasz Gizbert-Studnicki
The first argument can be called "the argument from ordinary language" 10 . It was used originally by Max Black 11 . This argument runs as follows. It is perfectly right to say: I always follow this norm or X has broken the legal norm. On the basis of the linguistic concept a norm is a kind of utterance (or sentence). Let us substitute "utterance" for "norm" in those examples. It seems absurd to say I always follow this utterance or X has broken the legal utterance. This proves, according to Black that a norm cannot be identified with its formulation. Opalek uses this argument in order to show that norms cannot be defined as some kind of linguistic entities (sentences or utterances) without breaking with ordinary language. The refutation of the argument from ordinary language requires a refining of the linguistic concept of norm. First of all it must be stressed that it would be absurd to identify norms with utterance-tokens. My utterance One should not kill and your utterance One should not kill are not two different norms but one and the same norm. Therefore, a norm is rather an utterance-type then an utterance-token. Secondly, a norm cannot be identified with a certain string of words uttered by a definite person on a definite occassion. For the very concept of norm it is unimportant what words and what syntactic constructions are used. My utterance One should pay taxes and your utterance one should not abstain from paying taxes are not two different norms but one and the same norm. Norms are not therefore linguistic formulations (strings of words constructed according to the syntactic rules of the language) but rather meanings of semantically equivalent formulations 12 . Two different formulations express one and the same norm provided that they have the same meaning. Max Black anticipates this reformulation of the linguistic concept of norm. He argues that it does not refute his argument from the ordinary language. It makes no sense to say I follow the meaning of the utterance ox X has broken the meaning of the legal utterance. In my opinion Black's argumentation is based on misinterpretation of the linguistic position. From the definition of the concept of norm as the meaning of certain class of utterances it does not follow that any particular norm can by conceived of as a meaning. It cannot be said that the norm Ν is the meaning of the utterance Ui. It should be rather said that the norm Ν is what is meant by the utterance U i (or by uttering U). Or any other utterance, synonymous with Ui. The argument from ordinary language does not apply to the linguistic concept of norm in this reformulation. It makes perfect sense to say I always follow that what is meant by U (for example by a certain provision of a statute ) or X has broken what was meant by U. My point is that grammar of the ordinary language does not prevent us from defin-
10 11 12
Opatek / Wolenski , Logika i interpretacja (FN 2), p. 26. M. Black , Models and Metaphors, Ithaca 1962, p. lOOff. Comp. R. Alexy , Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985, p. 42ff.
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
427
ing norm as the meaning of a certain class of utterances and from identifying particular norms as what is meant by some particular utterances. The concept of norm does not violate the ordinary language and norms preserve their nature as linguistic entities. The separate problem is how to delimit this class of utterances (sentences), by which norms are meant. A n objection can be rised that the concept of norm as the meaning of a certain class of utterances is no longer, as a matter of fact, a linguistic one. One could defend the thesis that meanings, as opposed to utterances or sentences, are extralinguistic entities, existing independently of any language. This is a fundamental question of the ontology of meanings, which cannot be discussed here in all its details. I would like to stress that I share Weinberger's concept of meaning as a construct of our intellect which produces concepts and other meaningful structures from the language which underlie our reasoning and discourse 13. Meanings are thus not Platonic entities, but language-dependent constructs of our mindes, ergo in some sense linguistic entities. The second argument against the linguistic concept of norm can be called "the argument from logic" 14 . This argument runs as follows. Let us assume that norms are linguistic entities, that is either utterances or meanings of some class of utterances. The point of controversy is whether norms as linguistic entities have truth value, that is whether they can be true or false. The positive answer to this question (cognitivism) has been rejected for many important reasons. If we assume that norms have no truth-value a new difficulty arises, namely the question, what is the semantic foundation for the logic of norms? A l l attempts to build specific semantics for norms, not founded on the notion of truth have failed. The linguistic concept of norm therefore poses the following dilemma: either we must accept cognitivsm (which in face of the arguments formulated against it is impossible), or no logic of norms is possible - that is, normative reasonings are not logically valid. It is not quite clear what this argument is intended to prove. One can distinguish a strong and weak interpretation of it. In its strong interpretation the argument from logic could be intended to demonstrate the impossibility of the linguistic concept of norm. The argument would run as follows: (1) If norms are linguistic entities then no logic of norms is possible . (2) The logic of norms is possible . (3) Therefore norms are not linguistic entities. This reasoning is formally valid as an instance of modus tollens but nobody argues in that way. If one accepts premise (2) one is bound to reject premise (1). If one accepts conclusion (3), one is bound to reject premise (2). Therefore the only acceptable interpretation of the argument from logic is the weaker one. In this interpretation the argument is intended to demonstrate that the linguistic concept 13 14
Weinberger, The Expressiv Conception (FN 4), p. 70. Opatek / Wolenski, Logika i interpretacja (FN 2), p. 15 ff.
428
Tomasz Gizbert-Studnicki
of norm does not help us to overcome the difficulties connected with normative reasonings (the Jorgensen dilemma). Therefore this concept should be abandoned in favour of the non-linguistic concept. The value of the argument from logic in its weak interpretation is relative. The non-linguistic concept of norm excludes explicitly the possibility of a logic of norms. Its followers maintain that legal and moral reasonings can be logically valid, because their premises and conclusions are not norms but propositions (sentences) about norms, that is sentences, which have truth-value. This observation is, in my opinion true, but it is compatible with the linguistic as well as with the non-linguistic concept of norm. On the basis of the linguistic concept of norms it can be also argued that legal and moral reasoning has proposition (sentences) about norms (and not norms as such) as its premisses and conclusions. The argument from logic does not definitely refute the linguistic concept of norm. I was trying to show that neither argument against the linguistic concept of norm is decisive. I do not wish to argue that I have managed to demonstrate the priority of the linguistic concept. A l l I wish to say is that the advantages of the non-linguistic concept cannot be demonstrated by showing the disadvantages of the linguistic one. Let us turn to a closer examination of the non-linguistic concept of norm, elaborated by Opalek. This concept is based on the theory of performatives. It must be stressed, however, that Opalek does not accept the original version of L. J. Austin's theory. For many reasons which cannot be discussed here his own theory of performative differs in important respects from J. L. Austin's one 15 . Let us start with the observation that Opalek is not quite consequent in determining the ontological status of norms. In one of his recent papers he states that "Die Normen bilden eine der Arten der performativen Akte" 16. In other papers he distinguishes: (a) the act of norming (norm-giving), (b) norm as the result of this act and (c) normative utterance as the expression of a norm 17 . Norms as acts and norms as results of these acts are two different, although related concepts. We shall refer to the former as concept (1) and to the latter as concept (2). Concept (1) seems at first sight much simpler than the concept (2). The ontological status of norms is clear on the ground of this concept. Norms are 15 Comp. Opatek , Theorie der Direktiven (FN 1), Chapt. V I , and K. Grzegorczyk, L'impact de la theorie des actes de langage dans le mode juridique; essai de bilan, in: P. Amselek (ed.), Theorie des Actes de Langage, Ethique et Droit, Paris 1986, pp. 165 - 190. 16 Opatek , Normen und performative (FN 2), p. 247. 17 Opatek , Dwoistosc (FN 2), p. 10.
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
429
characterised as a subclass of human acts, and in particular as a subclass of performative acts. In other words norms belong to the sphere of "doing things with words". Some objections which could be raised against this concept are easy to refute. In particular one could maintain that each act must necessarily be performed by a definite person, whereas there exist some norms (for example norms of morality or norms of customary law) which come into existence spontaneously and therefore cannot be identified with acts of a definite person. But on the other hand, this does not commit us to the conclusion that these norms are not acts. It can be said that the performers of these acts are impossible to identify 18 . Secondly it can be noticed that the argument from ordinary language also applies to the concept of norms as acts. It seems odd to say " X has broken an act". Norms as performative acts share some common characteristics of all performative acts. In particular, performative acts can be performed only on the basis of certain procedure which specify validity (felicity) conditions for a certain class of acts. A n act which fulfills the requirements of this procedure is felicitous (valid), one which does not is infelicitous (invalid). According to Opalek, however, felicity and infelicity are not qualities of performative acts which are felicitous (valid) and some which are infelicitous (invalid). Opalek identifies felicity of performative acts with their very existence. "Die Gültigkeit bedeutet also die Existenz des Aktes und Ungültigkeit seine Nicht-Existenz" 19. Applied to norms this thesis is equivalent to the statement that there exist only valid norms. If we say that a certain norm is invalid, we state its non-existence. This thesis needs closer examination. Opalek is perfectly aware of a certain assymmetry between existence and validity. Something may exist or may not exist, tertium non datur, whereas, at least in the language of law there is no dichotomy of validity and invalidity. There are many sorts of invalidity (infelicity) of legal acts. It would be absurd to say that there are many sorts of non-existence. Opalek rejects this objection by saying that all sorts of infelicity, distinguished by juristic practice is "eine provisorische Kategorie, die entweder positiv durch Validation der Akte oder negativ durch ihre Invalidation eliminiert wird" 20. Opalek's position can be interpreted in the following way. If one says that some legal act is infelicitous, but not definitely invalid one is saying, as a matter of fact that one is not sure whether the act in question exists or not. The adjective "infelicitous" does not therefore refer to the act in question, but to our opinion as to its existence. It must be noted, however, that Opalek's understanding of the validity invalidity opposition differs from the one commonly adopted by jurists. In is Ibid., p. 12. 19 Opatek , Normen und performative (FN 2), p. 248. 20 Ibid., p. 249.
430
Tomasz Gizbert-Studnicki
juristic language, at least in legal systems based on the tradition of Roman law, it cannot be said that the invalidity of a legal act is equivalent to its nonexistence. In particular the distinction between negotium non existent and negotium nullum is made. It seems to me that the proper criterion for the existence of legal acts is the answer to the question whether a given act has some legal consequences. It can be said that those acts which have some legal consequences exist and those which have no legal consequences do not exist. Negotium non-existens is an act which has no legal consequences at all. On the other hand negotium nullum has some legal consequences, although not those intended by the performer. That is the reason for distinguishing existence from validity in the language of law. Secondly it should be noted that jurists use the notion of existence is a specific sense. When they say for example that a given act of marriage is non-existent ( matrimonium non existens) all they wish to say is that the basic requirements of certain conventional procedure for acts of marriage have not been fulfilled and therefore what the parties have done has no legal consequences at all. Thus, their statement refers to some conventional and not to any natural act. The act in question does not legally exist, but it can be perfectly true that some social fact has by this act come into existence. A n invalid act, on the other hand exists both legally and socially. It exists legally in the sense that it has some legal consequences. Thus, when jurists talk about existence, the mean existence in the relative and not in an absolute sense. They are interested not in answering any ontological question, but in some practical legal question, and in particular in the question of whether some act should be accounted for in determining one's rights and duties. The existence of legal acts in this sense is relative to the legal order, because one and the same act may have legal consequences on the basis of one legal order and have no consequences on the basis of the other. It seems to me that two different questions relating to the existence of norms must be distinguished. The first question concerns the existence of norms in the absolute, ontological sense. When we ask this question we do not refer to any particular normative system. The second question concerns existence in the relative sense. That is the question of which norms exist within a given normative system. The latter and not the former question is roughly equivalent to the question of validity. It can be said that only those norms which are valid according to the criteria of validity adopted by a given normative system exist within that system. The objection formulated above, which concerns the distinction of negotium non existens and negotium nullum , can be neglected here, because juristic conceptions concerning the validity of norms do not contain any counterpart to this distinction, which is characteristic rather of juristic theories of legal acts in private law. Thus, the thesis of the identity of existence and validity does not solve the problem of the existence of norms in the absolute sense.
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
431
It seems to me further that the concept of norm should imply some answer to the question of existence in an absolute, and not in a relative sense only. We must first know what norms are in order to answer the question of whether they are valid in some normative order. The question of validity presupposes some answer to the question of existence. If jurists specify some criteria of validity, these criteria may apply only to existing norms. The identification of existence and validity leads to consequences, which are difficult to accept. For example it would be absurd to say This norm is not valid , because the subject of this sentence would refer to a non-existing object. On the other hand the sentence This norm is valid would be tautologous. Some of the existing norms are valid according to criteria, adopted by the jurists, and some are not 2 1 . Therefore, one cannot avoid the question of the existence of norms in absolute sense. Thus, the jurists, while speaking about validity, must presuppose some concept of norm, which does not identify existence and validity. After having rejected the identification of existence and validity let us examine more closely the ontological status of norms on the basis of both concepts adopted by Opalek. As was said above, concept (1) defines norms as acts, whereas concept (2) defines norms as results of some class of acts. In particular, according to concept (1) norms are a subclass of performative acts. While discussing the ontological status of norms we need not discuss the question of how norms are distinguished from other sorts of performative acts. The question is whether the ontological characteristics of human acts is adequate to our juristic intuitions attached to the concept of norm. It seems to me that the ontological characteristics of human acts must take into account at least the following features: (a) there must exist some actor (a person who has performed the act in question), who, at least in principle is possible to be identified, (b) the act is momentary, or, in other words its existence is limited to a definite time. It is, at least in principle, possible to determine when (in what moment of the time) an act has been performed. A n act is an event. It happens but it does not last. In this respect acts differ ontologically from objects, which are not momentary, but persistent, which do not happen, but last. It is doubtful whether, at least on the ground of juristic intuitions, norms share these two features of acts. Firstly, if norms were acts, each norm would have to have a personal source (an actor, whose act a given norm is). Just this problem has been widely discussed recently, in connection with Kelsen's thesis Kein Imperativ ohne Imperator 22. This problem cannot be discussed here in all details. 21 On the criteria of validity comp. Wroblewski, S^dowe stosowanie prawa, 2nd ed., Warszawa 1988, p. 93ff. 22 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, Wien 1979.
432
Tomasz Gizbert-Studnicki
As far as the latter ontological features of acts is concerned that is their momentarity, it can easily be seen that norms do not share this feature. This is especially conspicious in the case of those norms, which are objects of juristic inquiry. A n act happens; a legal norm does not happen but lasts. It is not momentary but persistent. A legal norm is rather an object then an event. This was probably the reason Opalek modified his concept of norm and adopted the concept (2). This concept is based on the distinction between: (a) an act of norm-giving, (b) a norm as the result of this act, (c) a normative utterance which expresses the norm 23 . On the basis of this distinction a norm is identified neither with an act nor with an utterance; however, norms are necessarily related to both acts and utterances. When I say "Taking part in my courses is obligatory for all students " neither the act of saying it nor my utterance is the norm. The norm is the result of my act of saying it. This result is expressed (or declared) by the utterance in question. The acts of normgiving are psychophysical actions, belonging to the class of performative acts. Normative utterances are characterised by Opalek as twofold: as utterances expressing the result of the act of normgiving or as utterances declaring the performance of such an act. In my opinion these two characteristics are not equivalent. It is possible to declare the performance of an act without expressing its result. When I say I have issued new regulations for my students concerning seminar papers I declare the performing of some act of norm-giving but my utterance does not express the result of this act. On the other hand when I say The seminar papers should be distributed one week before the session I express the result of some (at least possible) act of norm-giving, but I do not necessarily declare the performing of this act. It may be the case that I am describing (or expressing) the content of a norm, which has not been issued by anybody. Anyhow, from the ontological point of view the status of two elements in the Opalek's distinction, namely of act of normgiving and of normative utterance, is quite clear. Some difficulties arise, however, as far as the ontological status of the third element, that is of norm, is concerned. According to Opalek norms are results of certain class of performative acts. The question is how those results can be ontologically characterised. Opalek concentrates on the logical problems and therefore does not pay much attention to ontological questions. He contents himself with characterising norms as decisions24. I do not think that this characterisation is sufficient from the ontological point of view. First of all the word "decision" does not seem to be appropriate in this context. This word has psychological connotation and denotes an act rather than the result of an act. If norms are character23 24
See FN 17. Opatek / Wolenski,
Logika i interpretacja (FN 2), p. 27.
The Non-Linguistic Concept of Norm and Ontology
433
ised as decisions the question of the ontological status of a norm remains still open. As has been said above, the reason for modifying the previous concept of norm as act was that it did not fit the prevailing intuition, according to which the ontological feature of norm is its persistent character (a norm does not happen, as an act, but it lasts). Therefore, while characterising norms as decisions Opalek does not mean decisions as acts. The question arises of how decisions exist, separately from acts of deciding. It seems to me that there is no reasonable answer to this question. A l l possible answers reducing the existence of norms (in our case - decisions) to psychological or sociological facts have been rejected by Opalek in his previous work and he does not seem willing to withdraw his criticism 25 . It seems to me that a more plausible answer to the question of what is the result of an act of normgiving is the following. When I say: Participants in my seminar should come to the next meeting the result of my saying it is a certain meaning. This meaning cannot be identified with my utterance, because it could also be expressed by other utterances, for example by Participants in my seminar are not allowed not to come. The set of meanings which can be expressed in any language is infinite. By our acts of speaking, some of these meanings are actualised. So, by my act of saying Participants in my seminar should come to the next meeting , one of the meanings possible to express in the language has been actualised. My act of saying it is momentary, but the meaning produced by it is persistent. In this sense something new has come into existence in the world. The meaning produced by me is not a psychological entity. The conditon for its existence is neither the psychological fact that somebody is aware of it, nor is it a social fact that somebody is carrying out that what I have said. The meaning that I'have expressed is also not equivalent to the duty of my students to come to the meeting. This duty exists only if what I have said is valid. The existence of that what I have said cannot thus be identical with validity. The question of whether somebody actually has the duty based on my saying it presupposes that I have expressed some meaning. Using J. L. Austin's terminology it can be said that norms exist as results of locutionary acts26. A locutionary act is an act of saying something with a certain meaning attached to it. The question of whether a locutionary act has been performed is a question which concerns purely linguistic matters. It is a question of whether the rules of language have been observed by the speaker. If this is the case, a certain meaning is actualised. Another question is whether in saying something I have performed a felicitous illocutionary act. In the case of norms this is equivalent to the question whether the norm which is a result of my locutionary act is valid. That is an extralinguistic question. The rules of
25 See FN 5. 26 J. L. Austin, How to Do Things with Words. Oxford 1962, passim. 28 Festgabe Opalek
434
Tomasz Gizbert-Studnicki
language alone (that is, syntactic and semantic rules) do not decide the felicity of illocutionary acts. There must exist some extralinguistic procedure, the rules of which specify the conditions of the felicitous performance of illocutionary acts (for instance the rules of lawgiving procedure or rules for performing legal acts such as contrast or last will). Thè question of validity is thus a question which concerns illocutionary acts. This question presupposes the performance of the respective locutionary act. If no locutionary act has been performed the question of the felicity (validity) of illocutionary act does not arise. The relation between the existence of a norm and its validity can thus be described in terms of the relation between a locutionary and a respective illocutionary act. Norms exist as results of locutionary acts. They are valid or invalid as results of illocutionary acts. Since the performance of an illocutionary act presupposes the performance of respective locutionary acts, the validity of a norm presupposes its existence.
Der semantische, der juristische und der soziologische Normbegriff Von Ota Weinberger, Graz Der Titel dieser Abhandlung möge nicht in dem Sinne verstanden werden, als vertrete der Autor die Meinung, es gäbe drei verschiedene Normbegriffe, einen semantischen, einen juristischen und einen soziologischen. Mit dem Titel sollte auch der Normbegriff nicht als Familienbegriff hingestellt werden, der in drei, irgendwie verwandte, Begriffe der Norm aufgespalten werden kann. Der Autor will in dieser Abhandlung gerade im Gegenteil dafür plädieren, daß es nur einen Normbegriff gibt, den die Semantik und - auf ihr aufbauend - die Logik zu charakterisieren haben. Die Betrachtungen der Jurisprudenz und der Soziologie müssen den Normbegriff als unabdingbar erforderliches Instrument der juristischen und soziologischen Analysen akzeptieren, wobei allerdings zusätzliche Aspekte und Probleme ins Blickfeld gelangen. Beide - die Jurisprudenz und die Soziologie - befassen sich mit den pragmatischen Funktionen der Norm und haben die Aufgabe, Normen - vor allem gesellschaftliche Normen - als soziale Realität zu erfassen. Sie müssen erklären, was ,Existenz' (Dasein) einer Norm bedeutet, wie Normen in der Gesellschaft entstehen, institutionalisiert werden und wie sie wirken. Damit hängt auch die erkenntnistheoretische Problematik zusammen, nämlich die Fragen, (a) wie gesellschaftliche Normen zum Gegenstand der Erkenntnis gemacht werden können, und (b) wie man Behauptungen über die Wirkung von Normen auf das Handeln der Menschen und beim Aufbau von Institutionen erklären kann. I· Der Normsatz (die Norm) als semantische Kategorie Es ist zweifellos die Aufgabe der Bedeutungslehre (Semantik), den Begriff der Norm zu erörtern. Die Bestimmung der sprachlichen Strukturen und Begriffe, d.h. im wesentlichen die Konstitution der Sprachkategorien, ist Sache der Semantik und kommt in erster Linie in der zweckmäßigen Festsetzung der semantischen Kategorien zum Ausdruck. Der Bau der Sprache und des begrifflichen Grundgerüstes hängt im wesentlichen von der Problemsituation ab, in der die Sprache mit ihren semantischen Kategorien zum Einsatz kommen soll. Pragmatische Erfordernisse - die vorschwebenden Informations- und Denkaufgaben - sind die Determinanten der sprachlichen (struktu28*
436
Ota Weinberger
rellen und begrifflichen) Charakteristiken des Sprachsystems. Die kategorial adäquate Sprachkonstitution ist für die Möglichkeiten der philosophischen Analyse und für die Entwicklung einer entsprechenden Methodologie (inklusive der passenden logischen Operationen) essentiell. Die Art der Konstitution der Sprache hängt von anthropologischen Momenten ab und von dem Feld der intendierten Anwendung des Sprachsystems. Wenn man davon ausgeht, daß der Mensch ein handlungsfähiges und institutionenbildendes Gemeinschaftswesen ist, dann muß man zu der Konsequenz gelangen, daß für die handlungsbezogenen Bereiche eine solche Semantik erforderlich ist, die der handlungsbestimmenden und handlungslenkenden Informationsverarbeitung entspricht. Handlungserwägungen können nur in einem solchen sprachlichen Rahmen dargestellt werden, der rein beschreibende Informationen ebenso wie stellungnehmende Informationen auszudrücken erlaubt. Dem entspricht in der sprachlichen Ebene die Unterscheidung beschreibender (deskriptiver, theoretischer) und praktischer Sätze. Analog ist auch bei den Begriffselementen der Sprache ihr deskriptiver und ihr praktischer (stellungnehmender) Charakter zu unterscheiden. Dies schließt aber nicht aus, daß es Begriffe gibt, die gleichzeitig aus deskriptiven und praktischen Begriffselementen aufgebaut sind. Ich habe eine Semantik, die deskriptive und praktische Sätze (Begriffe, Begriffselemente) kategorial unterscheidet,,erkenntnismäßig differenzierte Semantik' genannt1. Eine Handlungserwägung ist prinzipiell nur auf der Basis von diesen beiden Kategorien von Informationen möglich, denn Voraussetzungen der Möglichkeit von Handlungen sind (a) Wissen (kognitive Informationen: Situationsinformationen, Informationen über nomische Kausalbeziehungen, die Kenntnis von Handlungsprogrammen, Feed-back-Informationen) und b) Informationen von stellungnehmendem Charakter, d.h. praktische Informationen. Es ist nämlich dann und nur dann sinnvoll von Handlungen zu sprechen - sonst kann es nur Verhaltenstransformationen (eventuell mit gewissen Regelmäßigkeiten im Ablauf) geben - , wenn Alternativen möglicher Verhaltensabläufe (d.h. Gabelungen der zukünftigen Verhaltenstrajektorie existieren) und wenn die Entscheidung, welche der möglichen Alternativen des Verhaltensspielraums realisiert wird, durch einen stellungnehmenden Informationsprozeß bestimmt wird. Zwischen diesen beiden Elementen der handlungsbestimmenden Informationen besteht eine semantische Zäsur. Die beiden Kategorien von Informationen haben im Prozeß der Handlungsbestimmung prinzipiell verschiedene Funktionen. 1 O. Weinberger, Eine Semantik für die praktische Philosophie, in: R. Haller (Hrsg.), Grazer Philosophische Studien, Vol. 20 (1983), S. 219 - 239; ders., Rechts2 logik, Berlin 1989 .
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
437
Für das Denken in jenen Bereichen, die irgendwie mit der Bestimmung von Handlungen zu tun haben, und in denen daher praktisches ( = handlungsbezogenes) Denken zur Anwendung kommt, muß eine Sprache verwendet werden, die sowohl beschreibende (theoretische) Sätze als auch praktische Sätze umfaßt, und sie als einander ausschließende Bedeutungskategorien behandelt. Die Funktion der beschreibenden Sätze ist es, ein Instrument für die Darstellung von Sachverhalten zu sein; die Funktion praktischer Sätze ist es dagegen, eine gewisse Stellungnahme auszudrücken, durch die Handlungsentscheidungen bestimmt werden können. Deskriptive Sätze können sowohl Tatsachen als auch mögliche Tatsachen oder Untatsachen2 ausdrücken. Sie können Behauptungen über Einzeldinge, Allsätze oder nomische Allsätze sein. Auch kontrafaktuale Sätze (z.B. ,Wenn Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte, hätte er die slawischen Völker aus Mitteleuropa ausgesiedelt.') sind rein deskriptive Sätze. Für die Erklärung des Unterschieds der Bedeutung beschreibender und praktischer Sätze und ihrer unterschiedlichen pragmatischen Funktion ist Searles 3 Überlegung über die verschiedene Richtung der Anpassung, die zwischen den Ausdrücken der Sprache und der Welt vor sich geht, wichtig. Searle zeigt, daß bei manchen Ausdrücken eine Anpassung der sprachlichen Äußerung an die Welt [,word-to-world direction of fit'] vorausgesetzt wird. Eine Aussage muß die Wirklichkeit so beschreiben, wie sie ist; wenn sich herausstellt, daß die Wirklichkeit anders ist, als in der Aussage behauptet wird, dann muß die Aussage geändert werden. Bei den direktiven und kommissiven Sprechakten, wie Anordnungen, Befehlen, Aufforderungen, Versprechen, Gelübden, ist dagegen die Welt den Worten anzupassen [,world-to-word direction of fit']. In der Searleschen Darlegung wird die prinzipielle Verschiedenheit der pragmatischen Rolle von Informationen vor Augen geführt: die eine Art von Ausdrücken stellen Sachverhalte dar, und sie sind daher der Welt anzupassen, die anderen sind „praktisch" (im philosophischen Sinne), sie sind Elemente der Handlungsbestimmung; daher muß - bildlich gesprochen - die Welt ihnen angepaßt werden. Praktische Sätze sind immer als systemrelativ anzusehen. Die praktischen Sätze sind von verschiedener Art, und die ihnen entsprechenden verschiedenen Arten praktischer Informationen haben unterschiedliche Funktionen im Prozeß der Handlungsdetermination. Es scheint mir angemessen, folgende Arten praktischer Sätze zu unterscheiden: 2
Die Untatsachen können mögliche, aber konsistent denkbare Sachverhalte (z.B. ,In Graz gibt es einen goldenen Berg') sein; oder sie haben den Charakter von unerfüllbaren Beschreibungen (z.B. ,Er ist ein verheirateter Junggeselle' - eine aus semantischen Gründen unerfüllbare Behauptung; oder ,Dieser Punkt ist rot und nicht-rot' eine logisch unerfüllbare These). 3 J. R. Searle, Expression and Meaning, Cambridge et al. 1981 (19791), S. 3f.
438
Ota Weinberger
1. Normsätze, bei denen unterschieden werden kann, ob sie Sollen (Gebote, Verbote) oder Dürfen (Erlaubnis oder Indifferenz) ausdrücken. 2. Forderungssätze, die teleologische Bestimmungen (Zwecke) ausdrücken, 3. Wertsätze, die gewissen Gegenständen oder Sachverhalten Wertprädikate zusprechen oder Präferenzen (relative Wertungen) ausdrücken. Die semantische Trennung von Aussagesatz und praktischem Satz (vor allem Normsatz), muß durch die Unableitbarkeit von Normsätzen aus rein deskriptiven Prämissen und den Aussagesätzen aus nicht-deskriptiven Prämissen sichergestellt werden 4 . Meiner Ansicht nach ist die kategoriale semantische Trennung von Aussagesatz und praktischem Satz (bzw. Normsatz) auch die notwendige Basis, auf der eine Normenlogik geschaffen werden kann. Sie zu entwickeln - neben anderen Systemen des handlungsbezogenen Denkens - wird zu einer Notwendigkeit 5 . Der Streit um die Normenlogik und die Art und Weise des adäquaten Aufbaues dieser und anderer logischer Systeme des handlungsbezogenen Denkens können in dem engen Rahmen dieser Abhandlung nicht näher erörtert werden 6 . Die Norm (resp. der sie ausdrückende Normsatz) als semantische Kategorie umfaßt individuelle Normen (Normsätze) ebenso wie allgemeine Normen (Normsätze) und normative Regeln. Die logisierte Darstellung des Rechts erfordert diese allgemeine Konzeption der Norm (des Normsatzes). Im Gegensatz zu dieser Festsetzung gebrauchen manche Autoren den Terminus ,Norm' nur im Sinne von ,normative Regel·. I I . Die juristischen Konzeptionen des Normbegriffes Sowohl in der juristischen als auch in der soziologischen Sicht erscheint die Norm nicht bloß als Normgedanke und der Normsatz (d.h. als sprachlicher
4
Genauer müßte man von informativen Konklusionen sprechen, denn nicht-informative (tautologische) Aussagesätze folgen auch aus einer leeren Prämissenmenge, und Analoges kann man für nicht-informative Normsätze [z.B. ,(p ν n p ) soll sein'] voraussetzen. Gegen die These, daß (informative) Sollsätze nur aus solchen Prämissenmengen gewonnen werden, die wenigstens einen Normsatz enthalten, läßt sich einwenden, daß Schlüsse möglich sind, bei denen unter den Prämissen andere praktische Sätze als Normsätze auftreten. (Aus Zielfestsetzungen und Kausalerkenntnissen lassen sich Normsätze begründen.) Siehe O. Weinberger, Rechtslogik (FN 1). 5 Es sei nicht verheimlicht, daß diese Meinung, für die ich immer eingetreten bin, seit der Veröffentlichung von Kelsens „Allgemeiner Theorie der Normen" (wo Kelsen wesentliche Argumentationen von Karel EngliS übernimmt) wieder umstritten ist. (Vgl. Weinberger, Der Normenlogische Skeptizismus, in: RECHTSTHEORIE 17 (1986), S. 13 - 81. K. Englis, Die Norm ist kein Urteil, in: ARSP, L/1964, S. 305 - 316. 6 Ich verweise auf meine Darlegungen in: Rechtslogik (FN 1).
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
439
Ausdruck des Normgedankens), also nicht nur als ideelle Entität oder ihr sprachlicher Ausdruck mit logischen Beziehungen und als Element logischer Operationen, sondern immer gleichzeitig auch als real existentes Moment der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Die Norm ist in dieser Perspektive gleichzeitig ein verstehbarer und sprachlich darstellbarer Gedanke spezifischer Art, nämlich ein Gedanke mit normativem Sinn und eine daseiende gesellschaftliche Tatsache. In der Terminologie des Institutionalistischen Rechtspositivismus ist die Norm eine institutionalisierte handlungsbezogene Idealentität. Die Rechtstheorien unterstreichen in der Regel eines der für das Recht wesentlichen Momente des gesellschaftlichen Realseins der Rechtsnormen bzw. des Rechtsnormensystems. Die Liste der Dasein konstituierenden Momente des Rechts umfaßt im wesentlichen folgende Momente 7 . 1. Die Rechtsnorm ist real durch ihren Bezug zum (autorisierten) Befehl, ggf. zu kompetenten Befehlsakten. 2. Das Realsein des Rechts gründet sich auf den gesellschaftlichen Prozeß ihrer Erzeugung. 3. Recht ist gesellschaftlich existent, wenn es im gesellschaftlichen Durchschnitt erfüllt wird, oder wenn bei Nichtbefolgung im gesellschaftlichen Durchschnitt Sanktionen gesetzt werden. 4. Die Existenz eines Rechtsstabs, dem soziale Lenkung (wenigstens in gewissen Bereichen, und zwar durch Normen oder/und Maßnahmen) obliegt, wird als konstitutives Merkmal des modernen Staates und des Rechts angesehen. 5. Recht ist ein System realen gesellschaftlichen Sollens, indem es Unrechtsfolgen (Sanktionen) statuiert und diese mittels eines organisierten Apparats realisiert. 6. Das soziale Dasein des Rechts ist gesellschaftliche Akzeptanz, Anerkennung als Verhaltensanleitung, als Maßstab und als Lebensform der staatlichen Gemeinschaft. Die Anerkennungskonzeption umfaßt zwei Typen von Daseinskriterien des Rechts: 6.1 Anerkennung als soziale Existenz des Rechtsbewußtseins im allgemeinen. 6.2 Anerkennung und Anwendung (de facto und als Prognose für die Zukunft) durch den Rechtsstab. 7. Die Realität des Rechts wird in gewisser Weise mit der Rechtfertigung des normativen Inhalts verbunden, entweder in der Weise, daß Rechtfertigung 7 Ich bin nicht sicher, ob diese Liste vollständig ist und verbinde daher mit dieser Aufzählung nicht die Behauptung, daß genau diese Elemente die Institutionalisierung des Rechts begründen.
440
Ota Weinberger
den Geltungsgrund der Rechtsnorm abgibt, oder in der Weise, daß inhaltlich gerechtfertigt zu sein ein Bestandteil der Geltungsbedingungen des Rechts ist. 8. Das Recht ist insoweit gesellschaftlich existent, als es die Erwartungen der Menschen bestimmt. Zu diesen verschiedenen Merkmalen des Realseins des Rechts sind einige Erörterungen erforderlich. Die normativistisch-institutionalistische Theorie kennt ein Globalkriterium des Realseins von Normen (von Rechtsnormen): die Institutionalisierung, die genau dann besteht, wenn das Normensystem den Kern der betreffenden Institution bildet, das bedeutet: wenn ein beobachtbares Zusammenspiel zwischen Normen und den entsprechenden Institutionen besteht, wenn also das in Betracht stehende Normensystem der Handlungsrahmen der Institution ist und ihr Funktionieren bestimmt. Die aufgelisteten Daseinskriterien des Rechts betrachtet diese Theorie als Momente bzw. als Indikatoren des realen Bestehens der Rechtsordnung. 1. Die Imperativtheorie der Rechtsnorm
Wenn man bei der Imperativtheorie der Rechtsnorm von der BefehlsGehorchens-Relation ausgeht, dann zeigt diese Theorie zwar ein Moment des Rechts in adäquater Weise an - nämlich den Soll-Charakter und dessen Zusammenhang mit dem Wollen (mit der praktischen handlungsbestimmenden Einstellung), ist aber insoweit falsch, als es offenbar rechtliches Sollen gibt, das nicht Ausfluß von Willensakten von Befehlsgebern ist (z.B. das Gewohnheitsrecht), und das nicht klargestellt wird, daß die Autorisation des kompetenten Normerzeugers (des Befehlsberechtigten - Befehlsverpflichteten) normativ fundiert ist und nur so Zustandekommen kann. Und diese ermächtigende Norm ist durch Befehlsrelationen nicht begründbar. Wenn man die Imperativkonzeption als befehlsaktrelatives Dasein der Norm konstruiert - wie es Kelsen in der Spätlehre tut 8 - , dann wird die Imperativtheorie ganz inadäquat. Es wird die Möglichkeit einer analytischen Rechtstheorie zerstört, es gibt dann keine gültigen logischen Beziehungen im Recht, ebensowenig normenlogische deduktive Operationen. Es gibt dann nur Befehlsakte ohne Begründungszuammenhang 9. Daß der Inhalt des Willens-
8 H. Kelsen, Allgemeine Theorie der Normen, hrsg. von K. Ringhofer / R. Walter, Wien 1979, S. 21 ff. Vgl. auch Weinberger, Normentheorie als Grundlage der Jurisprudenz und Ethik. Eine Auseinandersetzung mit Hans Kelsens Theorie der Normen, Berlin 1981; ders., Kelsens These von der Unanwendbarkeit logischer Regeln auf Normen, in: Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion, Bd. 7, Wien 1982, S. 108 121.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
441
aktes des delegierten Normerzeugers als Norm des Systems gilt (als Willensresp. Soll-Inhalt dem System zugerechnet wird) ist auf aktrelativer Basis kaum erklärbar. 2. Dasein und Stammbaum des Rechts
Das Dasein des Rechts gründet sich auf Erzeugungsregeln und Erzeugungsprozesse. Es ist offensichtlich, daß der Stammbaum kein selbständiges Daseinskriterium des Rechts darstellen kann. Dies zeigt sich klar und deutlich in den zwei berühmtesten Theorien dieser Art, sowohl in der Kelsenschen Grundnormtheorie als auch in der Hartschen Lehre, die mit Sekundärregeln, vor allem mit der ,Rule of Recognition' arbeitet. Bei Hart ist das Bestehen - ich würde sagen: das institutionalisierte Bestehen - einer Rechtsnorm fundiert auf etablierten Praktiken (practices). Dies sind in der Gesellschaft eingeführte Handlungs- und Verhaltensformen, die eine reale gesellschaftliche Basis der Geltung gesellschaftlicher Normen bilden und die in den Erkennungsregeln zum Ausdruck kommen. Kelsen mit seiner wichtigen Theorie der Rechtsdynamik - sie stützt sich in wesentlicher Weise auf Weyrsche und Merkeische Überlegungen 10 - gelangt notwendigerweise zur Frage der letztinstanzlichen Begründung der dynamisch erzeugten Kette der Rechtsnormen. Hier stößt Kelsen auf einen Zwiespalt zwischen dem Reinheitspostulat seiner Lehre und der Notwendigkeit, die Geltung (Existenz) des Rechtssystems auf beobachtbare soziale Tatsachen zu stützen. Daß ein solcher Zwiespalt es nicht gestattet, eine adäquate und konsistente Konzeption zu erstellen, ist beinahe selbstverständlich. Die meisten Autoren stützen ihre Kritik der Grundnormtheorie darauf, daß ihnen der Abschluß einer Begründungskette durch eine hypothetische Annahme unbefriedigend erscheint. Kelsen würde wohl replizieren: Es gibt in keinem Bereich eine voraussetzungslose Wissenschaft. Auch die mathematischen Beweise greifen auf letzte axiomatische Festsetzungen zurück. Diese Antwort
9 Kelsen selbst bezeichnet im Rahmen seiner aktrelativen Konzeption der Normen seine Grundnorm als fiktive Norm, weil kein solcher realer Willensakt einer Person existiert, dessen Inhalt die Grundnorm wäre. In Wirklichkeit kann auf dem Boden dieser Theorie, die Grundnorm überhaupt keine Norm sein, denn eine Entität (hier: die Grundnorm) kann kein Element eines Begriffsumfanges (hier: des Begriffes ,Norm') sein, dessen einziges konstitutives Merkmal die Entität nicht aufweist (hier: Sinn eines realen Willensaktes zu sein). 10 Vgl. F. Weyr, Zâklady filosofie prâvni (Grundlagen der Rechtsphilosophie), Brünn 1920. Deutsche Übersetzung eines Teiles dieses Buches „Die Souveränität der Rechtsordnung", in: V. Kubes / O. Weinberger (Hrsg.), Die Brünner rechtstheoretische Schule (Normative Theorie), Wien 1980, S. 68f. A. Merkl, Prolegomena zu einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: A . Verdross (Hrsg.), Gesellschaft, Staat und Recht. FS für Hans Kelsen zum 50. Geburtstag, Wien 1931, S. 252 - 294; ders., Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923.
442
Ota Weinberger
zur Verteidigung der Grundnormtheorie scheint mir nicht befriedigend, obwohl die als Argument vorgebrachte These wahr ist. Die aus axiomatischen Festsetzungen gewonnenen Konklusionen - z.B. in einer axiomatisch dargestellten Geometrie - gelten als Thesen über einen real existierenden Gegenstandsbereich dann und nur dann, wenn die Axiome in dem Bereich tatsächlich wahr sind, d.h. empirisch als wahr festgestellt sind. Sonst sagen sie aber über den Gegenstandsbereich als realer Entität gar nichts aus. Durch die Axiome der euklidischen Geometrie wird nicht bewiesen, daß der Raum, in dem wir leben, euklidisch ist, sondern nur, soweit die Raumerfahrung mit den axiomatischen Festsetzungen und ihren logischen Konsequenzen in Übereinstimmung steht, gilt im Raum diese Geometrie. Allgemein gesagt: Tatsachenfragen, seien es Fragen über die Eigenschaften des Raumes, seien es Fragen quantitativer Relationen von Gegenständen oder die Frage des gesellschaftlichen Daseins einer Normenordnung, lassen sich durch Festsetzungen allein nicht beantworten 11 . Der Tatsachenbezug wird durch den Begriff der Wirksamkeit der Rechtsordnung und die Forderung, daß durch die Grundnormannahme eine wirksame Ordnung erfaßt werden muß, hergestellt. Die Reine Rechtslehre sagt einiges über den Begriff der Wirksamkeit. Eine Norm ist wirksam, wenn sie im allgemeinen erfüllt wird und wenn ihre Verletzung im gesellschaftlichen Durchschnitt zur Anwendung von Sanktionen gegen den Rechtsbrecher führt. Man kann natürlich einwenden, daß derartige Begriffsbestimmungen sehr ungenau und schwankend sind. Ob eine Norm (oder eine Ordnung) wirksam ist, kann nach der gegebenen Begriffsbestimmung nicht immer eindeutig entschieden werden. Dies halte ich aber für keinen Mangel dieser Theorie. Es geht nämlich hier um Tatsachenfeststellungen, und Tatsächliches ist in der Regel nur ungenau bestimmbar; eine Rechtsordnung kann tatsächlich mehr oder weniger wirksam sein, z.B. in einer Bürgerkriegssituation. Eher stört es mich, daß das reale Dasein der Norm als gesellschaftlich wirksamer Faktor zu einseitig gesehen wird, nämlich unter den Gesichtspunkten „Befolgung Nichtbefolgung", „Eintreten oder Nichteintreten der Sanktion". In Wirklichkeit sind Wirksamkeitsmomente wesentlich differenzierter: es kommen verschiedene Grade des Sollbewußtseins und der Erwartungen, der Verhaltensgewohnheit, der Motivation zu einem solchen Verhalten, durch das man den Auswirkungen der Norm ausweicht, und anderes mehr in Frage. Dies sind rechtssoziologisch betrachtet - wichtige Momente der Perspektive, in der wir 11 Man könnte - was Kelsen aber nirgends explizit tut - die Grundnorm als echte Hypothese ansehen, die der Bewährungsprüfung ausgesetzt wird. Kriterium der Bewährung wäre die Frage, ob die vorausgesetzte Grundnormannahme es erlaubt, ein tatsächlich wirksames Normensystem als einheitliches normatives System zu erfassen. Die Feststellung der tatsächlichen Wirksamkeit wäre also der Test für die Grundnormhypothese. Eine solche Konstruktion hat Kelsen nie vorgelegt; er konnte zu ihr nicht kommen, denn sie widerspricht eklatant dem Reinheitsprinzip, wie die Analyse des Wirksamkeitsbegriffs eindeutig zeigt.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
443
die Wirksamkeit beurteilen müssen. Für die Beurteilung der inneren Konsistenz einer reinen Rechtstheorie ist folgendes M o m e n t entscheidend: Was auch i m m e r die K r i t e r i e n der Wirksamkeit sein mögen, ob hier psychologische, behavioristische oder andere M o m e n t e das entscheidende
Gewicht
haben, muß nicht präzis festgelegt werden; jedenfalls aber handelt es sich bei allen diesen K r i t e r i e n u m Tatsachen, die nur durch soziologische Beobachtung festgestellt werden können. Daraus folgt - m . E . unwiderlegbar - , daß auch immanent betrachtet, d . h . auch wenn man von der Kelsen sehen hypothetischen G r u n d n o r m ausgeht, eine reine Theorie der Rechtsgeltung ein D i n g der U n m ö g l i c h k e i t ist. Dies ist direkt einsichtig: O b eine gedachte Normenordnung gilt, ist eine Frage über soziale Tatsachen, die offenbar ohne Tatsachenerfahrung und Beobachtung nicht beantwortet werden kann. Wirksamkeit ist zweifellos ein empirisch-soziologischer Begriff 1 2 .
3. Die Wirksamkeit der Rechtsnorm als Kriterium der Geltung N o r m e n werden gesetzt, u m das menschliche H a n d e l n zu beeinflussen. E i n Normensystem kann nur dann als real existent gelten, wenn es wirksam ist. N u n gehört es aber z u m Wesen der N o r m , daß sie befolgt oder nicht befolgt werden kann, und daß es i n W i r k l i c h k e i t möglich ist, daß eines oder das andere eintritt. M a n k a n n zu den Bedingungen der Wirksamkeit hinzufügen, 12 Die Unmöglichkeit, das Reinheitspostulat in der Rechtstheorie einzuhalten, zeigt sich nicht nur beim Begriff der Wirksamkeit, sondern auch in der Theorie der Rechtsdynamik selbst. Die Rechtsdynamik beruht auf dem Zusammenspiel zwischen gegebenen Normen und Tatsachen bzw. tatsächlichen Willensakten. Kelsen versucht, die Rechtsdynamik als rein normativen Prozeß zu deuten, indem er nur die normative Voraussetzung als wesentlich (als „conditio per quam"), die Tatsachen aber nur als „conditio sine qua non" deutet. Das ist aber eine logisch unhaltbare Unterscheidung. Vgl. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, Wien I960 2 , S. 196f. „Daraus, daß etwas ist, kann nicht folgen, daß etwas sein soll; sowie daraus, daß etwas sein soll, nicht folgen kann, daß etwas ist. Der Geltungsgrund einer Norm kann nur die Geltung einer anderen Norm sein. Eine Norm, die den Geltungsgrund einer anderen Norm darstellt, wird figürlich als die höhere Norm im Verhältnis zu einer niederen Norm bezeichnet." . . . „Allerdings bildet in dem Syllogismus, dessen Obersatz der die höhere Norm aussagende Soll-Satz ist: man soll den Geboten Gottes (oder den Geboten seines Sohnes) gehorchen, und dessen Schlußsatz, der die niedere Norm aussagende Soll-Satz ist: man soll den Zehn Geboten (oder dem Gebot, seine Feinde zu lieben) gehorchen, der eine Seins-Tatsache feststellende Satz: Gott hat die Zehn Gebote erlassen (oder der Sohn Gottes hat befohlen, die Feinde zu lieben) als Untersatz ein wesentliches Glied. Obersatz und Untersatz sind beide Bedingungen des Schlußsatzes. Aber nur der Obersatz, der ein Soll-Satz ist, ist conditio per quam im Verhältnis zum Schlußsatz, der auch ein Soll-Satz ist; das heißt, die im Obersatz ausgesagte Norm ist der Geltungsgrund der im Schlußsatz ausgesagten Norm. Der als Untersatz fungierende Seins-Satz ist nur conditio sine qua non im Verhältnis zum Schlußsatz; das heißt: die im Untersatz festgestellte Seins-Tatsache ist nicht der Geltungsgrund der im Schlußsatz ausgesagten Norm." Vgl. Weinberger, Reine oder funktionalistische Rechtsbetrachtung?, in: O. Weinberger / W. Krawietz (Hrsg.), Reine Rechtslehre im Spiegel ihrer Fortsetzer und Kritiker, Wien/New York 1988 (Forschungen aus Staat und Recht, 81), S. 217 - 252, insbes. S. 232f.
444
Ota Weinberger
daß bei Nicht-Erfüllung der Rechtsnorm eine Sanktion eintreten soll 13 , und in der Regel auch tatsächlich gesetzt wird. In dieser Weise kann das Problem der Erfüllung von der Verhaltensnorm auf die Erfüllung der Sanktionsnorm übertragen werden. Es bleibt offen, welches Ausmaß der faktischen Realisation für die Existenz der Rechtsordnung (oder einer einzelnen Norm in ihr) erforderlich ist. Die folgende umgekehrte Argumentationsweise ist jedenfalls unzulässig: Die Norm Ν wurde sehr häufig verletzt, sie gilt ( = existiert rechtlich) daher nicht. Die Wirksamkeit - das Ausmaß der Erfüllung oder Nichterfüllung - der Rechtsnorm ist zwar ein nicht unwesentliches Moment der institutionellen Tatsächlichkeit der Norm, aber nicht alleiniges Kriterium des institutionellen Bestehens der Norm. 4. Rechtsstab und Recht
Der Rechtsstab - Menschen, deren Beruf es ist, der Erzeugung, Anwendung und Realisation des Rechts zu dienen und hierdurch eine gewisse soziale Lenkung und Kontrolle des Staates und der Gesellschaft sicherzustellen, - ist ein wesentlicher Bestandteil des modernen politischen Lebens. Ob eine Rechtsordnung denkbar wäre, die keinen professionellen Rechtsstab hätte und in der diese Aufgaben - oder wenigstens ein Teil von ihnen - von Bürgern als Funktionen, aber nicht als Broterwerb wahrgenommen werden würde, kann hier offen gelassen werden. Ich glaube jedoch, man sollte diese Möglichkeit begrifflich nicht ausschließen (obwohl ich nicht an die Realisierbarkeit einer solchen Organisationsform einer modernen Gesellschaft glaube). Wichtig ist es aber, daß die Institutionalisierung des Rechtsstabs selbst (oder solcher Einrichtungen, die an seine Stelle treten würden) durch Rechtsnormen eingeführt und sein Funktionieren normativ fundiert sein muß. Der Rechtsstab kann also nicht die Quelle und der Grund des Daseins der Rechtsnormen sein, ist er doch im Gegenteil selbst ein Produkt der Rechtsordnung. 5. Sanktion als Merkmal der Rechtsnorm und des Realseins des Rechts
Die Versuche, die Rechtsnorm prinzipiell als Sanktionsnorm zu charakterisieren und sie dadurch von anderen gesellschaftlichen Normen zu unterscheiden, halte ich nicht für überzeugend 14. Folgende Gründe sprechen gegen die Sanktionstheorie der Rechtsnorm: a) Die Sanktionstheorie der Rechtsnorm betont zu sehr das Zwangsmoment des Rechts und unterschätzt die organisierende Rolle des Rechts und ver13 14
Soweit die verletzte Norm keine lex imperfecta ist. Extrem bei Kelsen (FN 8), S. 135.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
445
drängt sie aus der Betrachtung. Zur Charakterisierung des Rechts und zur begrifflichen Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen Normensystemen genügt es, daß das System - aber nicht notwendig jede einzelne Norm mit einem institutionalisierten Zwang verbunden ist. b) Sanktionslose Normen treten nicht nur tatsächlich in den Rechtsordnungen auf, sie sind auch durchaus nicht wirkungslos. c) Aus der Form der Sanktionsnormen ,Wenn A, soll Β sein4, d.h. einem hypothetischen Sollsatz, kann das Verbotensein von A logisch nicht gefolgert werden. Es würde niemandem einfallen zu schließen ,Es ist verboten, Einkommen zu haben4, weil die Norm gilt ,Wer ein Einkommen hat, soll Einkommensteuer zahlen4, obwohl dieser Schluß dieselbe Struktur hat wie die Kelsensche Folgerung auf die Rechtspflicht aus der hypothetischen Sanktionsnorm. Aus der Sanktionsnorm kann auf das Verbot dann und nur dann geschlossen werden, wenn man weiß, daß Β als Sanktion gesetzt ist. Der Begriff der Sanktion enthält implizite den Hinweis auf eine (primäre) Verhaltensnorm, deren Verletzung die Bedingung der Sanktion ist. Die primäre Verhaltensnorm ist also keineswegs überflüssig (wie Kelsen meint), und die Rechtsordnung kann daher nicht als System angesehen werden, das nur Sanktionsnormen enthält. Kelsen ist sich dessen wohl bewußt, daß neben dem rechtswidrigen Verhalten noch andere Momente, nämlich Verfahrensschritte der Staatsorgane, Bedingung des Strafvollzugs sind 15 . Wenn man die Rechtsnorm entsprechend erweitert formuliert, lautet sie: ,Wenn (das rechtswidrige Verhalten) A und (Prozeßakte der hierzu ermächtigten Staatsorgane) Β, dann soll (Sanktion) C gesetzt werden. 4 Würde man hier das, was Bedingung der Sanktion ist, als das Verbotene erschließen, wäre verboten: (A und Β), d.h. entweder es wäre geboten non-Α (d.h. das rechtswidrige Verhalten zu unterlassen) oder/und es wäre verboten, die zur Bestrafung führenden Prozeßakte Β zu vollziehen. Eine reichlich absurde Konsequenz der Auffassung, daß das rechtliche Sollen nur den Zwangsakt betrifft. Der Schluß von der Strafnorm auf das Verbot des Verhaltens A allein ist nach dem auch Prozeßakte berücksichtigenden Schema jedenfalls nicht ableitbar. d) Das Rechtssystem als Ganzes läßt sich, wie auch Kelsen erkannt hat, nicht als Menge sanktionierter Normen auffassen, denn die Grundnorm, welche die Begründungskette des Rechtssystems abschließt, kann nur ermächtigen, nicht aber durch Sanktionen zwingen. Die Ermächtigungsnormen sind Bestandteile der Rechtsordnung und wesentlich für den Aufbau der Struktur der Institutionen. Diese sanktionslosen Normen gelten, auch wenn aufgrund 15
Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 57f.
446
Ota Weinberger
der Ermächtigung noch keine Sekundärnormen geschaffen wurden (also wenn die problematische These, daß Ermächtigungsnormen unvollständige Normen seien, gar nicht anwendbar ist.) e) Wird also Recht nur in Form von Sanktionsnormen ausgedrückt, dann erscheint das Gebot und Verbot ein und desselben Verhaltens nicht als ein logischer Widerspruch, nicht als logischer Mangel des Systems. Kelsen gibt sich damit zufrieden 16 ; ich sehe darin ein ernstes Argument gegen die Sanktionstheorie der Rechtsnorm. Sicherlich ist die Rechtsordnung auch ein Zwangssystem; sie ist aber vor allem ein System praktischer Informationen des Aufbaues von Institutionen und deren Organisationsstruktur. Hierbei kommen Ermächtigungsnormen zur Geltung, die keine Sanktionsnormen sind 17 . Die Existenz eines institutionalisierten Zwangsapparats ist allerdings ein wesentliches Moment der institutionellen Realität des Rechts, aber wieder nur ein Element neben anderen.
6. Akzeptanz und das Dasein des Rechts
Es ist eine berechtigte demokratische Forderung, daß nur das Inhalt der Rechtsordnung sei, was von den Rechtsgenossen allgemein als Rechtens akzeptiert wird. Die Akzeptanz ist eine im einzelnen schwer meßbare Größe der psychischen Einstellungen. Das, was als beobachtbares Merkmal verwendet werden kann, ist die faktische Reaktion auf die Norm, die akzeptiert oder nicht akzeptiert wird. Für das gesellschaftliche Dasein des Rechts ist die Frage der Akzeptanz keine rein statistische Problematik - wie viele Menschen akzeptieren eine Norm, und in welchem Maße tun sie dies? - , sondern die Relevanz der Akzeptanz des Rechts für die Existenz des Rechts ist rollenspezifisch differenziert. Vor allem ist die Akzeptanz durch den Rechtsstab entscheidend, dem die Anwendung des Rechts obliegt, daneben allerdings auch die Annahme des Rechts durch die Allgemeinheit der Rechtsgenossen, d.h.
16
Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 26f. Kelsens Versuch solche Normen als unvollständige Normen zu charakterisieren, die erst nach Vervollständigung Sanktionsnormen seien, ist gar nicht überzeugend. (Vgl. Kelsen, Reine Rechtslehre, S. 52, 54f.). Kelsen sagt: „Die Norm der Verfassung, die zur Erzeugung dieser generellen Norm ermächtigt, bestimmt eine Bedingung, an die die Sanktion geknüpft ist." Die Ermächtigungsnorm ist selbst eine gültige Rechtsnorm, hat aber keine Sanktion. Sie ist ein Gegenbeispiel, das den notwendigen Sanktionscharakter der Rechtsnorm widerlegt. Kelsen verwechselt fälschlich die Bedingung der Geltung der erzeugten Strafnorm mit der von dieser festgesetzten Bedingung der Strafe. Direkt die Bedingung der Ermächtigung in die Klasse der Bedingung der Strafe einzusetzen, ist falsch, denn es wird der faktische Erzeugungsakt, der erst die Entstehung der Strafnorm bewirkt, einfach ausgelassen. 17
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
447
die Bereitschaft, das Recht als gerecht anzusehen und im Durchschnitt rechtgemäß zu handeln. Beide Arten der Akzeptanz - das Rechtsbewußtsein und die Anwendung durch den Rechtsstab - sind Momente der Realität des Rechts, aber als alleinige Daseinskriterien kaum akzeptabel.
7. Akzeptabilität und Existenz des Rechts
Recht ist nicht nur Anordnung im Sinne eines willkürlichen Befehls. Das Recht ist ein System, das rational und in gewisser Weise funktionell aufgebaut ist. Die rechtlichen Strukturen und die einzelnen Bestimmungen werden Begründungsüberlegungen unterworfen. Recht soll gerechtfertigt sein; es soll nicht nur faktisch akzeptiert werden, sondern es soll auch als akzeptabel gerechtfertigt sein. Die inhaltliche Rechtfertigung kann als naturrechtliches Geltungskriterium aufgefaßt werden. Diese Funktion könnte die Rechtfertigung nur dann erfüllen, wenn es objektive kognitive Kriterien richtigen Rechts gäbe. Aber auch unabhängig von naturrechtlichen Voraussetzungen muß man einsehen, daß Recht inhaltlich gerechtfertigt wird und daß es ein demokratisches Postulat ist, das Recht einer rechtfertigenden bzw. kritischen Analyse zu unterziehen, damit Akzeptanz auf Akzeptabilität gestützt werden kann. 8. Recht und Erwartung
In seinem Aufsatz „Der soziologische Begriff des Rechts" 18 , unterstreicht Werner Krawietz die Bedeutung normativer Erwartung für die realistische Bestimmung des Rechts und weist auf, daß in den soziologisch orientierten Lehren das Moment der Erwartungen als für das Dasein des Rechts konstitutiv angesehen wird. Sicherlich ist die gesellschaftliche Existenz von Rechtsnormen eng verstrickt mit dem Aufbau von Erwartungen der Menschen in der Gesellschaft. M . E . sind aber Erwartungen eine sehr komplexe Folge des Bestehens von Normen, die Normen selbst aber nicht auf Erwartungsstrukturen reduzierbar. Die Erwartungszusammenhänge, in denen gesellschaftliche Normen stehen, sind natürlich ein wesentliches Moment der Institutionalisierung von Recht.
18 W. Krawietz y Der soziologische Begriff des Rechts, Rechtshistorisches Journal 7/ 1988, S. 157 - 177.
448
Ota Weinberger Anmerkung
Die analytische Jurisprudenz, die versucht, die allgemeine Struktur der Rechtsnorm, der Rechtsordnung und der Gedankenprozesse im Rechtsleben formal zu charakterisieren, hatte sich in der ersten Phase ihrer Entwicklung die Aufgabe gestellt, die Grundstruktur der Rechtsnormen darzustellen 19. In der zweiten Phase ihrer Entwicklung trat die Aufgabe hinzu, auf die Differenzen zwischen verschiedenen Normsatztypen einzugehen. Anzuführen sind vor allem die Gegenüberstellungen von Rechtsnormen und Rechtsprinzipien, von Verhaltens- und Ermächtigungsnormen, daneben auch jene von Verhaltensund Aufgabennormen, von Verhaltens- und Maßstabnormen. Diese Unterschiedlichkeiten müssen natürlich von einer Normensemantik berücksichtigt werden. In diesem Aufsatz kann diese Problematik aber nicht eingehend erörtert werden 20 . I I I . Der Normbegriff in der Soziologie Die soziologischen Theorien sind so verschiedenartig und die philosophischmethodologischen Auffassungen so unterschiedlich, daß es kaum möglich ist, eine wohlfundierte Kategorisierung der soziologischen Normkonzeptionen zu erstellen. Ich werde nur in sehr simplifizierender Weise von Meinungstendenzen sprechen, die sich m. E. in den soziologischen Lehren bemerkbar machen. Der Begriff der Norm (und jener der Werte) spielt in den soziologischen Theorien eine sehr bedeutende - in vielen sogar eine zentrale - Rolle. Aber sowohl die Art der Explikation der Norm als auch die Auffassung der Funktion von Normen in der sozialen Wirklichkeit sowie die Einschätzung der Bedeutung des Normbegriffes für die Soziologie sind verschieden. Für meine Betrachtungen sind folgende Momente wesentlich. 1. Es gibt sehr starke - implizite oder explizite - Tendenzen in der Soziologie, die Aufgabe der Soziologie in Verhaltensbeschreibungen und der Feststellung von Regelmäßigkeiten des Verhaltens zu sehen. Wenn man nur Verhalten ins Auge faßt, ist die Betrachtung insoweit eine in sich geschlossene Sichtweise, daß keine anderen Momente als Zustände von Systemen und Zustandsabfolgen in der Betrachtung auftreten können. Wenn man strikt im Geiste einer solchen verhaltenstheoretischen Konzeption den Begriff der Norm anwenden wollte, dann wäre dies nur als vereinfachte Dar19 Markant kommt dies z.B. schon im Titel des ersten Hauptwerkes von Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen 1911, zum Ausdruck. 20 Siehe O. Weinberger, Recht, Institution und Rechtspolitik, Grundprobleme der Rechtstheorie und Sozialphilosophie, Stuttgart 1987; ders., Rechtslogik, Berlin 19892.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
449
Stellung möglich, wobei die Norm selbst auf Verhaltensbeziehungen reduzierbar sein müßte. 2. Der Normbegriff (der Begriff der Werte, in meiner Terminologie: praktische Informationen') ist ein unreduzierbares Element der Erklärung gesellschaftlicher Phänomene. Da Normen nicht durch Verhaltensbeobachtung erkannt und nicht als Sachverhaltsdeskriptionen ausgedrückt werden können, ist die Erkenntnis und die Erklärung gesellschaftlicher Tatsachen immer auch abhängig vom Verstehen der involvierten praktischen Informationen. 3. In manchen Konzeptionen wird das System der Normen und Werte als Bauplan (/. Blake und K. Davis sprechen von einer ,blue print theory of society') 21 angesehen, nach dem das Handeln der Menschen, die gesellschaftlichen Beziehungen und Strukturen entstehen. In Wirklichkeit geht es aber um ein Zusammenspiel von Normen (und anderen praktischen Informationen) mit anderen Faktoren der gesellschaftlichen Prozesse und der individuellen Handlungen. Die Normen, oder adäquater gesagt, eine Pluralität von verschiedenen Normensystemen (Recht, Brauch, Religionsnormen, Standesnormen, persönliches Ethos) bestimmen zusammen mit Utilitätsüberlegungen der Person oder des Kollektivs die Handlungsentscheidungen und das Verhalten. 4. Im wesentlichen scheinen mir zwei Wege der Reduktion des Normativen auf Verhaltensrelationen beachtenswert: a) Das Wesen der Normen wird als soziale Realität erklärt, die eine Folge des sozialen Drucks (hervorgerufen durch angedrohte und tatsächliche Maßnahmen) ist, die einen Typus von Verhaltensweisen, nämlich: das sanktionsvermeidende Verhalten, als Normalverhalten in der Gesellschaft erzwingen. Eine adäquate Konzeption des Normativen ist m.E. nur dann möglich, wenn man zwar die soziologische Bedeutung von Motivatoren in Rechnung zieht, diese Relation aber nicht als Reduktionstheorie der Norm konzipiert. Der Hinweis auf Sanktionen macht es keineswegs überflüssig, das Sollen als Element der gesellschaftlichen Realität zu sehen. Außerdem gibt es soziologisch wichtige Normen, nämlich Ermächtigungsnormen, die für den Aufbau von Institutionen und gesellschaftlichen Strukturen erforderlich sind, bei denen es sicherlich nicht sinnvoll ist, eine Reduktion aufgrund von Sanktionsbeziehungen zu versuchen. b) Als dus -Wohl wichtigste Beispiel einer reduktionistischen Theorie des Normbegriffs mittels des Begriffes der Erwartung kann man Luhmanns Explikation ansehen22. 21 Vgl. J. Blake / K. Davis , Norms, Values, and Sanctions, in. R. E. L. Faris (Hrsg.), Handbook of Modern Sociology, Chicago 19683, S. 462. Zum Problem der Normen in der Soziologie siehe M. Haller, Soziale Normen und Gesellschaftsstruktur, in: T. Meleghy et al. (Hrsg.), Normen und soziologische Erklärung, Innsbruck/Wien 1987, S. 39 - 64.
29 Festgabe Opalek
450
Ota Weinberger
„Normen sind kontrafaktisch stabilisierte Erwartungen." Es gibt nach Luhmann im wesentlichen zweierlei Erwartungen: kognitive und normative; ihre Grenze ist nicht scharf. „Kognitive Erwartungen sind mithin durch eine nicht notwendig bewußte Lernbereitschaft ausgezeichnet, normative Erwartungen dagegen durch die Entschlossenheit, aus Enttäuschungen nicht zu lernen." Entscheidend ist also die Art und Weise, wie die Enttäuschung der Erwartung behandelt wird. Aufgrund dieser Konzeption gibt es natürlich keine klare Grenze zwischen kognitiver und normativer Erwartung, also zwischen Sein und Sollen. Wenn man mit dem Begriff der Erwartung arbeitet, sollte man immer klarstellen, um wessen Erwartung es geht. Im Prinzip haben Erwartungen nur einzelne Menschen, man kann jedoch im abgeleiteten Sinn auch von den in einer Gruppe vorherrschenden Erwartungen sprechen. Erwartungen sind im wesentlichen Ergebnisse von Lernprozessen, obwohl nicht ausgeschlossen werden sollte, daß es auch genetisch verankerte Erwartungen gibt. Es ist zwar möglich, daß ein und dasselbe Subjekt mit größerer oder kleinerer Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis erwartet, normalerweise wird aber immer eine bestimmte Erwartungseinstellung vorhanden sein. Wenn jemand ein Ereignis erwartet, und es nicht eintritt, wird er je nach Umständen seine Vorstellungen von der Regelmäßigkeit der Welt korrigieren oder die enttäuschende Erwartung durch eine Hilfshypothese erklären. Der Gedanke einer kontrafaktischen Stabilisierung von Erwartungen ist m. E. ein Unding. Sich zu entschließen, aus Erfahrung nicht lernen zu wollen, hat mit Normen nichts zu tun, sondern ist einfach der Ausdruck von Unvernunft und im Widerspruch zum lerntheoretischen Ansatz. Daß zwischen der gesellschaftlichen Existenz von Normen und den Erwartungen der Menschen durchaus keine solche Beziehung besteht, wie sie Luhmann voraussetzt, läßt sich durch folgende Überlegungen zeigen: Wenn eine Norm gilt, so kann die Erwartung, ob die Norm erfüllt wird, weitgehend schwanken, ohne daß dies einen Einfluß auf die Geltung der Norm hätte. Wenn ζ. B. in Kriegszeiten freier Handel mit einem gewissen Gut untersagt ist, wird doch wohl niemand behaupten, daß diese Norm nicht gilt, weil zu erwarten ist, daß Schwarzhandel existieren wird. Es gibt zweifellos Erwartungen, daß sich die Menschen in einer gewissen Weise verhalten werden, ohne daß man deswegen schließen dürfte, daß eine entsprechende Norm existiert. Man erwartet z.B., daß die Menschen die Wahrheit im Sinne ihrer Interessen verzeichnen, doch folgt daraus nicht, daß sie dies tun sollen. Diese Unabhängigkeit der vernünftigen Erwartung und der Geltung von Normen beweist, daß die Norm nicht durch den Begriff der Erwartung definiert werden kann. 22 Vgl. N. Luhmann, Normen in soziologischer Perspektive, in: Soziale Welt, Jahrgang 20/1969, Heft 1, S. 28 - 48, und vor allem ders., Rechtssoziologie, Bde. 1 und 2, Opladen 19873.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
451
Es läßt sich kaum daran zweifeln, daß in einer modernen komplexen Gesellschaft verschiedene gesellschaftliche Normensysteme nebeneinander bestehen. Wenn man den Begriff der Norm auf eine zugeordnete Erwartung stützt, wird es unmöglich, die Normensysteme voneinander zu trennen, denn die Erwartung ist sozusagen eine einzige Resultante aus verschiedenen Faktoren. Ein ganz wesentlicher Mangel der Luhmannschen Konzeption der Norm ist die Tatsache, daß man auf dieser Basis das soziologisch wichtige Problem der Beziehung zwischen gesellschaftlich geltender Norm und der Abschätzung der Wahrscheinlichkeit ihrer Erfüllung begrifflich gar nicht durchführen kann. Prof. Luhmann hat selbst in einem Gespräch mit mir ein sehr interessantes Argument gegen die Reduktion der Norm auf Erwartungen angeführt: Die Norm wird auch auf Vergangenes angewendet (nämlich als Wertmaßstab und als Grund von Rechtsfolgen); dies wäre nicht möglich, wenn die Norm nichts anderes als eine Art von Erwartung wäre. Trotz dieser Kritik an der lerntheoretischen Konzeption der Norm möchte ich unterstreichen, daß es natürlich sehr verdienstvoll ist, daß Luhmann auf die Frage der Erwartungen im Zusammenhang mit Normen hingewiesen hat und daß er klarstellt, daß im Handlungskontext nicht nur die Erwartungen der Akteure relevant sind, sondern auch die Erwartungen bezüglich der Erwartungen der Partner, die man in Interaktionsverhältnissen hat. Man kann über die Erwartungen m.E. eine sehr starke These aussprechen: Der Mensch hat immer - mehr oder weniger bestimmte - Erwartungen; er kann nicht rein feststellend und ohne Erwartungsausblick denken und erkennen. Aber zwischen Erwartungen (inklusive komplexer Erwartungsstrukturen, z.B. Erwarten des Erwartens) und gesellschaftlicher normativer Geltung besteht keine eindeutige und fixe Relation. Verfehlt ist es auch, wenn man zwischen tatsächlicher Regelmäßigkeit des Verhaltens und dem Gesollten des Verhaltens eine direkte Beziehung annimmt. Es scheint mir auch nicht berechtigt, daß Normen nur dann als existent anzusehen sind, wenn sie als etablierte Dauereinrichtungen auftreten. Es gibt auch Sollbeziehungen, deren Wirkung und Dasein nur für Einzelsituationen gegeben sind. Die Soziologie muß sich einer Sprache mit erkenntnismäßig differenzierter Semantik bedienen, da die mit dem Handeln verknüpften Informationsprozesse nur dann dargestellt werden können, wenn man deskriptive und praktische (stellungnehmende) Informationen ausdrücken und voneinander begrifflich scharf trennen kann. Der behavioristische Reduktionismus ist abzulehnen. 29*
452
Ota Weinberger
D i e Soziologie befaßt sich m i t allen A r t e n v o n Institutionen, deren Genesis, F u n k t i o n e n u n d Wandel. I n dieses Untersuchungsfeld fallen auch A d - h o c Institutionen ebenso wie Dauereinrichtungen u n d Prozesse der Institutionalisierung, inklusive die Fragen der Destabilisierung v o n Institutionen. Z u r Institutionenanalyse gehört auch die Untersuchung von R o l l e n u n d die Gesamtheit der institutionellen Realien (der institutionellen Tatsachen, des personalen Sachsubstrats der Institutionen usw.). Institutionen u n d R o l l e n können nicht adäquat erfaßt u n d erklärt werden, wenn m a n den Begriff der N o r m nur als Verhaltensnorm versteht (wie i n der Soziologie w e i t h i n üblich), denn sie werden auch durch Ermächtigungsnormen bestimmt, die sich v o n den Verhaltensnormen wesentlich unterscheiden.
Literaturverzeichnis J. Blake / K. Davis, Norms, Values, and Sanctions, in: R. E. L. Faris (Hrsg.), Handbook of Modern Sociology, Chicago 19683, S. 456 - 486. Κ Englis, Die Norm ist kein Urteil, ARSP, L/1964, S. 305 - 316. M. Haller, Soziale Normen und Gesellschaftsstruktur, in: T. Meleghy et al. (Hrsg.); Normen und soziologische Erklärung, Innsbruck/Wien 1987, S. 39 - 64. H. Kelsen, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze, Tübingen 1911. — Reine Rechtslehre, Wien I960 2 . — Allgemeine Theorie der Normen, hrsg. von K. Ringhofer / R. Walter, Wien 1979. W. Krawietz, Der soziologische Begriff des Rechts, Rechtshistorisches Journal 7/1988, S. 157 - 177. N. Luhmann, Normen in soziologischer Perspektive, in: Soziale Welt, Jahrgang 20 (1969), Heft 1, S. 28 - 48. — Rechtssoziologie, Bd. 1/2, Opladen 19873. A. Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, Wien 1923. — Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues, in: A . Verdross (Hrsg.), Gesellschaft, Staat und Recht, FS für Hans Kelsen zum 50. Geburtstag, Wien 1931, S. 252 - 294. J. R. Searle, Expression and Meaning, Cambridge et al. 1981, (19791), S. 3f. Ο. Weinberger, Der Begriff der Sanktion und seine Rolle in der Normenlogik und Rechtstheorie, in: H. Lenk (Hrsg.), Normenlogik, Grundprobleme der deontischen Logik, München 1974, S. 89 - 111. — Normentheorie als Grundlage der Jurisprudenz und Ethik. Eine Auseinandersetzung mit Hans Kelsens Theorie der Normen, Berlin 1981.
Der semantische, juristische und soziologische Normbegriff
453
— Kelsens These von der Unanwendbarkeit logischer Regeln auf Normen, in: Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion (Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Bd. 7), Wien 1982, S. 108 - 121. — Eine Semantik für die praktische Philosophie, in: R. Haller (Hrsg.), Beiträge zur Philosophie von Stephan Körner, Grazer Philosophische Studien, Vol. 20 (1983), S. 219 - 239. — Der normenlogische Skeptizismus, RECHTSTHEORIE 17 (1986), S. 13 - 81. — Recht, Institution und Rechtspolitik. Grundprobleme der Rechtstheorie und Sozialphilosophie, Stuttgart 1987. — Rechtslogik, Berlin 19892. F. Weyr, Zâklady filosofie prâvni (Grundlagen der Rechtsphilosophie), Brünn 1920. Deutsche Übersetzung eines Teiles dieses Buches „Die Souveränität der Rechtsordnung", in. V. Kubes / O. Weinberger (Hrsg.), Die Brünner rechtstheoretische Schule (Normative Theorie), Wien 1980, S. 60 - 69.
Reflections on Model Institutions By Kenneth I. Wpston, Boston In 'The Open Society and Its Enemies', Karl Popper urges us to reject the classical formulation of the fundamental question of politics, "Who should rule?," in favor of the question, "How can we so organize political institutions that bad or incompetent rulers can be prevented from doing too much damage?"1 Popper made this suggestion during the Second World War, when much of the world was defending itself against the prédations of rulers who were causing as much destruction to human life as the world had ever previously witnessed. Yet the question he posed is essentially identical to the question the framers of the U.S. Constitution put to themselves in designing institutions for the first large-scale democratic republic in the modern world. They, too, were animated by a distrust of holders of political office, by apprehensions about the corrupting effects of political power. And, like Popper, they believed that the solution to the problem of power lay not in reliance on the (to be hoped for) goodness of political leaders but a framework of good institutions. In this way, they placed the question of institutional design at the core of normative political inquiry. Yet, despite the centrality of institutional relationships in our common moral life, few political philosophers today take institutional design as the core of normative inquiry. Whatever the reasons for this neglect, my aim in this paper is to contribute to re-focusing our attention in the direction indicated by the Framers. In doing this, I shall introduce - or borrow, rather, from John Stuart Mill - the term model institution , which emerges at the center of analysis. Although I am not yet able to elaborate this notion with as much clarity as I would like, I shall attempt to provide support for three propositions: (1) that model institutions serve the epistemic function of providing criteria for identifying and assessing political and legal action; (2) that these models are simultaneously rooted in the conventional life of societies and yet provide a reflective basis for criticizing conventional practice; and (3) that these models constitute, in part, structures of moral relationships and to that extent provide a warrant for the forms of authority made possible by the institutions in which they are embodied.
1 Karl Popper , The Open Society and Its Enemies, Princeton 1966, vol I, p. 121. See also Popper , Conjectures and Refutations, New York 1963, p. 344.
456
Kenneth I. Winston
I. Institutions and principles Let me begin, however, with a possible objection to this enterprise. It may be argued that problems of institutional design are subordinate to matters of principle, and only matters of principle raise questions of philosophical interest. This objection reflects a prevailing view of what is fundamental and what is derivative in political theory, a view that Mill expressed when he made his decisive break with Bentham. A t first Mill was unsure what system would replace the one he had abandoned, but he was convinced that, whatever it turned out to be, "its office was to supply, not a set of model institutions, but principles from which the institutions suitable to any given circumstances might be deduced" 2 . Whereas Mill had previously regarded certain institutions, such as a representative assembly, as fixed elements of his theorizing, he came to see commitments to institutions as relative to circumstances, not absolute, and allowed that different societies, and even the same society at different stages in its history, could legitimately adopt different institutions. What remains constant are the abstract principles. However, for this view to be defensible, it must be possible to settle upon warranted abstract principles independently of available model institutions. Such a strategy would be plausible for a theory that either regards the determination of principles as an exercise of practical reason or proposes to deduce political principles from a conception of human nature. Whether or not Kant may be fairly characterized as presenting a theory of the former sort, it is clear that Mill entertained the latter idea. However, a theory rejecting that premise would be required to reject Mill's view. The point is illustrated by Ronald Dworkin's recent effort to reconstruct liberal theory. Dworkin shares Mill's picture of the structure of a political theory. " A comprehensive political theory," he says, "is a structure in which the elements are related more or less systematically, so that very concrete political positions . . . are the consequences of more abstract positions . . . that are in turn the consequences of [still] more abstract positions" 3 . Thus, within a specific theory, the constitutive elements are those highly abstract propositions formulating whatever ultimate political aims someone committed to the theory values for their own sake. The derivative elements are models of institutional design, legislative proposals, political strategies, and other devices valued only to the extent that they serve to realize the constitutive commitments. Applying this picture to liberalism, Dworkin argues that the constitutive element is an abstract statement of fundamental rights valued for their own sake, or, as he would have it, a single abstract right - the right to equal concern and respect 2
John Stuart Mill, Autobiography, New York 1924, p. 113. Ronald Dworkin, Liberalism, in: Stuart Hampshire (ed.), Public and Private Morality, Cambridge 1978, p. 116n. 3
Reflections on Model Institutions
457
to which all other rights are subordinate. The derivative elements include a market economy, judicial review of legislation, a progressive income tax, welfare programs, government efforts to secure racial equality, and so on. Now, in the absence of a conception of human nature, how does a theorist locate "the most abstract principle" constitutive of an entire theory? Since by hypothesis it cannot be derived from any other element of the theory, it seems that it must be treated as an axiomatic first principle. But not just any arbitrarily selected abstract normative proposition could reasonably be regarded as the foundation of "liberalism," so the axiomatic principle must be rooted somehow in (liberal) history. Dworkin suggests - indeed, stipulates as a condition of the adequacy of any reconstruction of liberal theory - that the principle^) identified as constitutive of liberalism must have been held by people committed historically to liberal positions. In other words, his actual point of departure is a set of positions composing what he calls "the last clear liberal settlement," that is, the New Deal. Dworkin refers to these positions as touchstones of the abstract principles articulating a distinctive liberal political morality. But these touchstones, of course, are precisely those model institutions, proposals, and strategies that Dworkin previously identified as the derivative elements of the theory. The touchstones are "uncontroversially liberal," as they must be to serve as touchstones. But if they are uncontroversially liberal, surely they have more claim to be regarded as the definitive elements of liberalism than some theorist's corrigible - and inevitably controversial - formulation of abstract principle 4 . In general, I am inclined to say that, to the extent anything is foundational in political theorizing, it is a set of concrete political facts, historically given, including existing institutional arrangements. In relation to these elements, the formulation of an inclusive principle is a heuristic device for assessing the coherence of existing arrangements and for providing a springboard to the reasoned elaboration of new policies and programs, as refinements or modifications of what is given. It is in this respect not constitutive but regulative , a guiding hypothesis. The principle carries no special weight for being abstract and inclusive; it facilitates reflection on the concrete political facts, and hence is a secondary element of the theory. I realize, of course, that the term given in this context carries the connotation of epistemic priority. While I am not entirely uncomfortable with that connotation, I hope to avoid the dangers, especially the historicist traps, of such a notion by a sufficiently complex understanding of the relation between institutional arrangements and their models.
4 For an elaboration of this argument, see Winston, Principles and Touchstones: the Dilemma of Dworkin's Liberalism, in: Polity 19:1 (1986), pp. 42 - 55.
458
Kenneth I. Winston
I I . Institutions and their models Popper offers an apt starting point for analysis, since he has said both (1) that "only a minority of social institutions are consciously designed, while the vast majority have just 'grown' [naturally] as the undesigned results of human action" and (2) that institutions are not "concrete natural entities" but "abstract models [consciously] constructed to interpret certain selected abstract relations between individuals" 5 . Regarding the first point, the range of philosophical debate could be represented by Montesquieu on the one side and Bentham on the other. For Montesquieu, human institutions are seldom deliberately made and are often not even understood by the people whose lives they shape. Bentham, on the other hand, characteristically speaks of institutions either as deliberately made or at least as having emerged to satisfy definite needs6. Fortunately, I need not take sides in this debate. My particular concern, as I have suggested, is with political and legal arrangements for authoritative decision making, and it is a requirement of the theory (or tradition) of constitutional democracy to regard these institutions as more subject to human direction than not. Indeed to rest government on a foundation of consent would be an empty exercise if its institutions could not be molded to the bent of the sovereign will. As to Popper's second point, it is precisely the abstract models he alludes to that I wish to focus on, but I think we can do that while holding on to the distinction between an institution as a social or 'natural' entity (an existing, ongoing practice) and the model conception which it more or less embodies. The claim I shall make is that, for institutions functioning effectively in a society, members hold model conceptions specifying, more or less articulately, the public purposes they serve, the structural design they embody, and the forms of authority they justify. So conceived, a model institution is a conceptual representation - a Gedankenbild, a mental picture - of a domain of social activity, constructed by abstracting certain features of that activity and carrying them to a limit, viewing them as perfected. Model institutions "are, thus, fictions; fictions, in the sense that they are 'something made', 'something fashioned' - the original meaning of fictio - not that they are false, unfactual, or merely 'as if' thought experiments" 7 . I shall identify presently some of the characteristic constituent elements of such a representation, but for the moment I offer only a few examples: in the domain of economic activity, there is the idea of a perfectly competitive market or the idea of a free contract; in the domain of legal or political activity, there is the idea of a court (as an adjudicative body) or the idea of a representative assembly. Of course the boundaries between these domains are not sharp. 5 6 7
Popper, The Poverty of Historicism, New York 1964, pp. 65, 140. John Plamenatz, Man and Society, New York 1963, vol. 1, p. 264. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1973, p. 15.
Reflections on Model Institutions
459
In general, a model institution is both a heuristic and an expository device. To say it is heuristic means it provides aid in understanding social activity. In this respect, it bears a strong resemblance to Max Weber's ideal type*. It is not itself a hypothesis about the nature of the social world but guides the construction of hypotheses. It is not itself a description of social reality, in the sense of corresponding exactly to an existing state of affairs, but a vehicle for such descriptions. And it is not a formulation of traits common to, or derived as an average from, a class of concrete things. In its conceptual purity it is not found anywhere in reality. Rather, it is a limiting case by which real situations and actions are measured. It is thus a principle of order, a method of putting things in order, of categorizing them so that they may be cognized and assessed. To understand a model institution in its expository aspect, it is helpful to distinguish exposition and explanation. A n expository device elucidates or interprets a phenomenon, in the sense of setting forth its meaning or purpose. It does not provide a causal account, whether of origins or sustaining conditions. Therefore, to say that a model institution is expository is to say that it sets forth the animating purpose - or, in Weber's language, the practical significance - of the activity being modelled. (It is worth repeating that the characterization of institutions as purposive is required by the practice and theory of constitutional democracy. The very idea of limited government is that only definite and articulated aims can justify governmental power.) This purposive element is the principal epistemic requirement, as with any artifact, for being able to state the existence conditions of the institution - and hence for knowing what properly belongs to the institution and what does not. The consequence is a sorting out of "essential" and "accidental" properties, though without entailing a commitment to essentialism. Of course I do not deny that one could describe a model political institution - focusing, for example, only on its structural features - without reference to its purpose, just as one could describe a pencil without saying it is designed for writing or drawing. But it would be an impoverished description, making the very existence of the artifact mysterious. A t the same time, it is worth emphasizing that identification of institutional purpose, in the appropriate sense, is a difficult undertaking. And since this identification is the principal condition of the intelligibility of a model institution, it is not surprising that the other constituent elements the institutional structure and its characteristic ideals - often remain unclarified. Brief as this account is, I think I have said enough to indicate a basic point of difference with Weber, by asking why the use of ideal types should be, as Weber claims, peculiar to social scientists. Wouldn't any member of society wishing to apprehend the practical significance of an institutional arrangement 8 Max Weber, The Methodology of the Social Sciences, trans, by E. A . Shils / H. A . Finch, New York 1949, pp. 90ff.
460
Kenneth I. Winston
find it necessary to employ an appropriate mental representation? In a revealing passage, Weber notes that social scientists sometimes regard the features selected in constructing an ideal type as, in their view, what is (or should be) of enduring value in the phenomenon under study. When this happens, the ideal type has not only a logical but a practical function; it becomes what Weber calls a model type. But if the conjunction can occur in the mind of the social scientist, cannot (and does not) it also occur in the mind of the ordinary person? Weber admits that it does: The ideal type, abstracted from existing practice, "might - and this is indeed quite often the case - have also been present in the minds of the persons living in that epoch as an ideal to be striven for in practical life or as a maxim for the regulation of certain social relationships" 9 . Weber insists that this "historically determinable idea" governing people's conduct is not to be confused with the historical reality from which the type is abstracted, and the two (idea and reality) may relate to each other in different people's minds in different ways. But he also acknowledges that ideal types are often model types, and vice versa. Weber suggests just such a coincidence of types, for example, when he discusses the concept of the state. He notes that the scientific concept of the state, the ideal type, is a synthesis constructed for heuristic purposes, but it is also abstracted from "the unclear syntheses which are found in the minds of human beings," i. e., the members of the state. Thus, he allows that ordinary people perform the same synthetic act that social scientists do, only not with the same self-consciousness and, hence, without achieving the same degree of clarity. The consequence is that the model type of the ordinary person and the ideal type of the social scientist "approach each other very closely and constantly tend to merge with each other" 1 0 . The same point is made by Claude Lévi-Strauss when he notes the continuity between the models of social structure devised by social scientists and the "home-made models" of ordinary members of society. Unlike Weber, however, Lévi-Strauss allows that home-made models can be just as sophisticated and revelatory as those of social scientists. "After all," he says, "each culture has its own theoreticians whose contributions deserve the same attention as that which the anthropologist gives to colleagues"11. It could be instructive to speculate on the conditions that give rise to home-based theoreticians in the case of a specific institution. For example, the degree of self-consciousness with which the synthetic act is carried out may depend on the extent to which the institution has a practical importance in a person's life. Perhaps judges and lawyers have a more pressing need than others to develop a model
9 Ibid., p. 95. 10 Ibid., p. 99. 11 Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology, Garden City 1967, p. 274.
Reflections on Model Institutions
461
type of the adjudicative process; regular clients of the courts have a more pressing need than occasional clients; and so on. However that may be, the synthetic act of an individual should not be understood as idiosyncratic; it is carried out in a context of shared and ongoing social interaction. It reflects the reality in which it is rooted, even as it shapes and orders that reality. In this respect, we can say that the type is, simultaneously, both a model of and a model for reality. Clifford Geertz observes that to speak of a model of is to stress the representation of pre-existing relationships, the structure of which the model expresses "in synoptic form - as to render them apprehensible." To speak of a model for is to stress giving form or order to relationships in accordance with a fabricated conceptual construct. Model institutions conjoin both elements. "Unlike genes, and other nonsymbolic information sources, which are only models for, not models of culture patterns have an intrinsic double aspect; they give meaning, that is, objective conceptual form, to social and psychological reality both by shaping themselves to it and by shaping it to themselves" 12 . We need to add only that the localization of model construction in cultural settings is not inconsistent, as Geertz thinks, with the identification of common structural forms across cultures - or inconsistent with, to use his description of one task of anthropology, "the discovery of natural order in human behavior" 13 . I I I . Model institutions Thus, the testimony of social theorists supports the hypothesis that a model type or home-made model or, as I prefer, model institution emerges ineluctably in the course of one's participation in institutional life and is a condition of the intelligibility of institutional activity. Needless to say, much work remains to be done to elucidate this hypothesis. In what follows, I shall attempt only to contribute to our understanding of one aspect of it. Specifically, I shall suggest that, in the construction of model institutions, there are definite criteria regulating the process of abstraction. To develop this claim it will be helpful to draw an analogy to a commonly recognized feature of moral discourse. This feature is the difference, often noted by philosophers (and other theorists), between the beliefs actually accepted and shared by the members of a particular society or group - what, without reaching for precision, I shall call the conventions or conventional morality of the group - and the beliefs that are, or would be, arrived at after due deliberation and reflection, sometimes referred to as warranted beliefs or the principles of a critical morality. Typically, a convention is said to exist if, 12 Geertz (FN 7), p. 93. 13 Ibid., p. 14.
462
Kenneth I. Winston
and only if, a determinate body of people generally and self-consciously conform themselves to a certain mode of conduct. The requisite self-consciousness involves employing the convention as a standard for assessing the propriety of one's own conduct and that of others in the group. What distinguishes a conventional from a critical self-consciousness, in this view, is the specific type of support offered for the conforming conduct. The conventional view looks only to the existence of pervasive expectations that an action be done (or not done), or that a state of affairs exist (or not exist); it does not seek or require any further reason for the expectations. In other words, it is enough that everyone generally believes that everyone should act as everyone else does. In contrast, among the principles characteristic of a critical self-consciousness are certain formal criteria employed to determine what counts as a warranted (substantive) moral belief. These range from such obvious criteria as sincerity and consistency of reasoning to less frequently articulated, but no less powerful, conditions such as eliminating the bias of self-interest, refraining from visceral or purely emotive reactions as a basis of decision, and grounding one's beliefs on warranted statements of fact. These criteria of course do not dictate any particular outcome to deliberation but rather define the range of acceptable moral debate. Particularly noteworthy is that they are not peculiar to some philosopher's construction of a theoretical point of view but are integral features of ordinary discourse about moral matters. Herbert Hart makes this point when he observes that the formal criteria "are learnt in conforming to the morality of some particular society," even though their status as criteria is not derived from the mere fact that they are generally accepted or from the basis of pervasive expectations regarding moral discourse. Hart suggests, rather, that "they are vital for the conduct of any cooperative form of human life" 1 4 . If Hart is right about the formal criteria, not only do they serve in fact as standards of acceptable moral discourse but they do so ineluctably, as a kind of natural necessity. Whether or not that is correct, it seems clear that the outcomes of a conventional and a critical self-consciousness will converge only to the extent that the formal criteria have been successfully applied to conventional practice. Now, what I want to propose is that discourse about (model) political and legal institutions is analogous in important respects. This discourse, too, is marked, I think, by an awareness of certain formal criteria, themselves based on practical exigencies, learned in the course of participating in the institutional life of a particular society, and the force of these exigencies is not derived from their general acceptance but from the nature of institutions themselves. If this claim is correct, certain objective features of institutions have argumentative weight as against conventional beliefs, to the degree that the two are inconsistent with one another, in assessing forms of authority 14
H. L. A. Hart, Law, Liberty, and Morality, New York 1966, p. 71.
Reflections on Model Institutions
463
made possible by those institutions. But what would count as formal criteria in the case of institutions? I suggest that there are at least two sets of criteria. The first set I shall call conditions of ecological fit; the second, conditions of institutional integrity. (1) The most interesting situations, if they exist, would be those where the material circumstances of life determine, with a kind of natural necessity, which model institutions will emerge and prevail. Here, again, Hart has prepared the way. In his defense of "the minimum content of natural law," Hart has proposed that (a) given certain basic human aims, such as survival; and (b) given certain salient and pervasive features of human life, such as the scarcity of natural resources, the limited altruism of persons and their vulnerability to bodily harm; then (c) there are compelling reasons for any legal order to include certain rules - such as rules protecting persons against violence, securing their property, imposing liability for breach of promise, and so on - in order to ensure the voluntary conformity and cooperation upon which social life depends15. If this argument is sound, however, the conclusions compelled in the third step are not limited to rules embodying a certain content, but also include public agencies , that is, institutional forms of decision making for facilitating social interactions 16 . And since human beings are disposed to think about what they are doing (i.e., to develop a critical self-consciousness), they would construct models of possible public agencies. Initially, one might speculate, model institutions arise as the expression of a spontaneous free play of the mind. But some, and not others, survive because they guide people in practical ways. The models that survive would be those that are responsive to real features of an existing situation. To use pragmatist vocabulary, we could say that the situation is problematic and evokes a desire for resolution. This gives rise to the reflective formation of possible ideal states. (Thus, the import of a model is the purposive direction it gives to conduct in relation to a problematic situation.) The features of the problematic situation - the conditions of the environment - narrow the range of workable resolutions. In the limiting case, the material circumstances are such that a single model institution naturally prevails. So, for example, a large and heterogeneous political society subject to fairly rapid change may be naturally inclined toward a centralized lawmaker, whether in the form of one person or an organized body. And, if the society is in addition deeply committed to self-regulative activity - let's say because of the dominance of a market economy - the inclination may be specifically toward a representative assembly. Alternatively, in a small, static, and homogeneous political culture marked by relations of strong interdependence, the natural 15
Hart, The Concept of Law, London 1961, pp. 189ff. For an elaboration of this argument, see Winston, Introduction, in: The Principles of Social Order: Selected Essays of Lon L. Fuller, Durham 1981, pp. 24 - 29. 16
464
Kenneth I. Winston
form of authority may be an arbiter or mediator whose efforts are continually directed to the re-establishment of harmonious relations between all members 17 . The full story of the practical exigencies involved in the emergence of model institutions would undoubtedly be much more complicated than my simple speculations indicate. Nonetheless, the point remains that, if the natural facts of life do operate roughly in the way I have described, they yield a set of formal criteria which play a crucial role in understanding and assessing institutional life. (2) The conditions of institutional integrity constitute an altogether different set of criteria. In essence they are generated from the fact that the constituent elements of a model institution are systematically connected, in the sense that "none of [them] can undergo a change without effecting changes in all the other elements" 18 . The elements, in other words, are mutually supportive and reinforcing. As a consequence, the institution is (best) able to fulfill its purpose if, and only if, its characteristic structure is in place, its specific competences unimpaired. It thus becomes a duty incumbent on participants in the institution to act, when necessary, so as to preserve the institution's distinctive integrity, which means appealing to the model as a ground of decision making - even when that runs counter to prevailing beliefs. Elsewhere I have illustrated this point by arguing that, in the distinctive setting of institutions of higher education, it would be inappropriate, indeed selfdefeating, for a college tribunal to allow students accused of rules-violations to invoke the privilege against self-incrimination 19 . I won't repeat that argument here, but the main point is that, because of the larger social context in which they exist, these quasi-judicial bodies often elicit certain expectations regarding the proper way to proceed in conducting a hearing. Specifically, many people think that, since accused students are liable to suffer severe penalties for rules-infractions, including expulsion, they should enjoy the same protections as defendants in a criminal trial, including the privilege against self-incrimination. It seems to me, however, that the privilege is inconsistent with the educational aims of a college. The task of a college tribunal, I suggest, is less punitive than corrective, that is, the goal should be less to punish an offender than to attempt reintegration into the academic community. So the focus of inquiry should be the capacity and willingness of the accused to sustain continuing relationships with persons engaged in intellectual or academic pursuits. This concern of the tribunal would only be hindered by a refusal of
17
See Lloyd Fallers, Law Without Precedent, Chicago 1969, p. 312. Lévi-Strauss , ibid., p. 271. 19 Winston, Self-incrimination in Context, in: Southern California Law Review 48:4 (1975), pp. 813 - 851. 18
Reflections on Model Institutions
465
the accused to speak at a hearing. So I think it is warranted to override prevailing expectations regarding the authority of the people sitting as tribunes, by appeal to the relevant model of the institution. In this way, the aims of the institution, the structure of the tribunal, and the duties of participants become mutually reinforcing. Whatever the merits of this argument about the privilege against selfincrimination, I trust it makes clear how considerations of institutional integrity can be applied in a specific case. I V . Institutional life The general conclusion I draw from these brief reflections is that the structural aspects of institutions have as much moral significance, and therefore are of equal philosophical interest, as the more obvious moral rules that regulate political life. In general, the choice of an institutional arrangement is a choice of moral relationships, because institutions even in their structural aspects embody moral ideals and aspirations. One need not claim that a person's moral life consists only in participation in public institutions, and hence that the good person is able to be virtuous only as a citizen, to acknowledge that participation in public institutions is a principal activity of the moral person and that certain institutional arrangements make that activity possible. They make it possible not simply in the weak sense that the institutions set a framework within which the moral life* might or might not occur, but in the strong sense that participation in the institutions constitutes the moral life. That is what is at stake, I believe, in problems of institutional design.
30 Festgabe Opalek
Bibliographie Kazimierz Opalek A . Selbständige Veröffentlichungen
467
I. Monographien II. Herausgegebene Werke
467 468
B. Beiträge zu Lexika, Sammelwerken und Zeitschriften
468
C. Vorworte, Rezensionen, Übersetzungen und sonstige kleinere Veröffentlichungen 482
A . Selbständige Veröffentlichungen I. Monographien 1. Znaczenie i rozwój nauki polskiej w X V I I I wieku (Importance and Development of the Polish Science in the 18th Century), Warszawa: Wiedza Powszechna, 1951. 51 S. 2. Nauka polskiego OSwiecenia w walce o postçp (Science of Polish Enlightment in the Fight for Progress). Von K. Opalek und B. Leénodorski. Warszawa: Czytelnik, 1951. 105 S. - 2 . Aufl., 1951, 105 S. 3. Hugona Koll^taja pogl^dy na panstwo i pr^wo (The Views on the State and Law of Hugo Koll^tj). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1952. 268 S. 4. Prawo natury u polskich fizjokratów (Natural Law of Polish Physiocrats). Warszawa: Ksi^zka i Wiedza, 1953. 160 S. 5. Myél Oéwiecenia w Krakowie (Thought of Enlightment in Cracow). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1955. 255 S. 6. Podstawowe prawa i obowi^zki obywatelskie w swietle Konstytucji PRL (Basic Rights and Duties of Citizens in the Constitution of Polish People's Republic). Warszawa: Paristwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. 151 S. 7. Prawo podmiotowe (Subjective Law). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. 523 S. 8. System prawa socjalistycnego (The System of Socialist Law). Scriptum. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1957. 40 S. Unter dem Titel: System prawa (The System of Law). Scriptum. 3. Aufl., Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1958. 40 S. 9. Z zagadnien praworz^dnoéci socjalistyczney (Some Problems of the Rule of Law in Socialist State). Von K. Opalek und W. Zakrzewski. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1958. 250 S. *
468
Bibliographie Kazimierz Opalek
10. Problemy metodologiezne nauki prawa (Methodological Problems of Legal Science). Warszawa: Paùstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. 337 S. 11. Wspólczesna teoria i socjologia prawa w USA (Contemporary Theory and Sociology of Law in USA). Von K. Opalek und J. Wróblewski. Warszawa: Paùstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. 320 S. 12. Zagadnienia teorii prawa (Problems of Legal Theory). Von K. Opalek und J. Wróblewski. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. 385 S. 13. Ζ teorii dyrektyw i norm (Problems of the Theory of Directives and Norms). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. 272 S. 14. Überlegungen zu Hans Kelsens „Allgemeiner Theorie der Normen". Wien: Manz Verlag, 1980. 43 S. 15. Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki (Problems of Theory of Law and Theory of Politics). Warszawa: Paóstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 334 S. - 2 . Aufl., 1985, 329 S. 16. Theorie der Direktiven und der Normen. Wien, New York: Springer Verlag, 1986. 234 S. 17. Prawo. Metodologia, filozofia, teoria prawa (Law. Methodology, philosophy, theory of law). Von K. Opalek und J. Wróblewski. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. 302 S.
II. Herausgegebene Werke 18. Hugo Kolî^taja - Wybór pism naukowych (Hugo Koll^taj - Selected Scientific Writings). Warszawa: Paùstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. 469 S. 19. Hugo Kolî^taja - Porz^dek fizyczno-moralny (Hugo Kolî^taj - Physico-moral Order). Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. X X X V I , 497 S. 20. Józef Wybicki - Listy patriotyczne (Józef Wybicki - Patriotic Letters). Wroclaw: Ossolineum, 1955. C X X I I , 335 S. 21. Jerzy Lande - Studia ζ filozofii prawa (Jerzy Lande - Studies in Legal Philosophy). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. 1006 S. 22. Ζ zagadnien teorii nauki i teorii prawa Leona Petrazyckiego (Problems of the Theory of Science and of the Legal Theory of Leon Petrazycki). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. 283 S. 23. Metodologiezne i teoretyczne problemy nauk politycznyh (Methodological and Theoretical Problems of Political Sciences). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. 470 S.
B. Beiträge zu Lexika, Sammelwerken und Zeitschriften 24. Zarys dziejów filozofii prawa w Polsce ( A n Outline of the History of Legal Philosophy in Poland). Von K. Opalek und W. Wolter. In: Historia filozofii prawa i nauki prawa karnego w Polsce (History of Legal Philosophy and Study of Criminal
Bibliographie Kazimierz Opalek Law in Poland), Historia nauki polskiej w monografiach X V I I b . Krakow: P A U , 1948, S. 1 - 19. 25. Ο niektórych kierunkach wspólczesnej filozofii prawa (On some Trends in the Contemporary Legal Philosophy). In: Zycie Nauki 1949, S. 109 - 117. 26. Doktryny i historia nauki (Doctrines and History of Science). In: Zycie Nauki 1950, S. 415 - 441. 27. Wspólczesna burzuazyjna teoria prawa w Skandynawii (The Contemporary Bourgeois Theory of Law in Scandinavian Countries). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 6 (1951), S. 192 - 213. 28. Wolnosc i wlasnosc w prawie natury polskiego Oswiecenia (Liberty and Property in the Natural Doctrines of Polish Enlightment). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 6 (1951), S. 813 - 830. 29. Ζ zagadnieó historii nauki (Some Problems of the History of Science). Von K. Opalek und Β . Lesnodorski. In: Zycie Nauki 1951, S. 356 - 380. 30. Fizjokratyzm francuski i polski (French and Polish Physiocratism). In: Ekonomista I I (1951), S. 132 - 150. 31. Podstawowe koncepcje Koll^taja w naukach spolecznych (Basic Conceptions of Kofl^taj in Social Sciences). In: Mysl Wspólczesna 1951, S. 266 - 288. 32. Problemy historii nauki polskiego Oswiecenia (Problems of History of Science of Polish Enlightment). In: Przegl^d Historyczny 42 (1951), S. 182 - 189. Wieder abgedruckt in: Hugona Kolî^taja pogl^dy na paristwo i prçwo (The Views on the State and Law of Hugo Koll^taj). Warszawa: Patìstwo we Wydawnictwo Naukowe, 1952, S. 237 - 244. 33. Hieronim Stroynowski - przedstawiciel postçpowej mysli prawniczej polskiego Oswiecenia (Hieronim Stroynowski - A Representative of the Progressive Legal Thought of Polish Enlightment). In: Patìstwo i Prawo 7 (1952), S. 9 - 34. 34. Badania nad historic nauki. Ich Charakter, zakres, organizacja (Research in the History of Science. Its Character, Scope, and Organization). In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej I (1953), S. 5 - 28. 35. Niektóre problemy teorii patìstwa i prawa w swietle pracy J. Stahna: „Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" (Some Problems of Theory of State and Law in the Light of Stalin's: „Economic Problems of Socialisms in the Soviet Union"). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 8 (1953), S. 16-41. 36. Certains aspects des droits et des liberies démocratiques en Pologne Populaire. In: Revue de l'Association Internationale des Juristes Démocrates 1954, S. 50 - 58. 37. Pozytywizm prawniczy (Legal Positivism). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 9 (1954), S. 5 - 4 2 . 38. W pracowniach nauki krakowskiej (In the Studies of the Scholars of Cracow). In: Na szlakach wielkich przemian (On the Trail of Great Changes). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954, S. 491 - 547. 39. Porz^dek fizyczno - moralny Hugona Kolî^taja (Physico-moral Order of Hugo KoH^taj). In: Mysl Filozoficzna 4 (1954), S. 98 - 120.
47C
Bibliographie Kazimierz Opalek
40, Podstawowe prawa i obowi^zki obywatelskie w éwietle Konstytucji PRL (Basic Rights and Duties of Citizens in the Constitution of Polish People's Republic). In: Zagadnienia prawne Konstytucji PRL, Bd. 2. Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954, S. 139 - 168. 41. Fizjokratyczna „nauka moralna" w Krakowie (The Physiocratic „Moral Science" in Cracow). In: Zeszyty Naukowe UJ, Prawo I I (1954), S. 3 - 35. 42. Juridiczeskij pozitiwizm (Legal Positivism). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Protiv ideologii imperialisma, Moskwa 1955, S. 133 - 180. 43. Niemiecka szkola historyczna w teorii prawa (The German Historical School in Legal Theory). In: Przegl^d Nauk Historycznych i Soplecznych V (1955), S. 237 317. 44, Historia nauki jako przedmiot wykladu uniwersyteckiego (History of Science as the Subject of Lectures in Universities). In: Zycie Szkoly Wyzszej 1955, S. 619 630. 45, Ο metodzie formalno-dogmatycznej. Uwagi dyskusyjne (On the Formal-Dogmatic Method. Remarks in the Discussion). In: Paùstwo i Prawo 10 (1955), S. 710 718. 46. Prof, dr Jerzy Lande (Professor Dr. Jerzy Lande). In: Paóstwo i Prawo 10 (1955), S. 260 - 261. 47. Profesor dr Jerzy Lande 1886 - 1954. In: Zeszyty Naukowe UJ, Prawo I (1955), S. 12 - 19. 48. Stan badan nad nauk^ polskiego Oswiecenia. Pròba oceny i wnioski (State of Research on the Science of Polish Enlightment. Attempt at Evaluation and some Conclusions). In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej I V (1956), S. 183 -
206.
49. Monteskjusz w Polsce okresu miçdzywojennego (Influence of Montesquieu in Poland between Two World Wars). In: Paóstwo i Prawo 11 (1956), S. 17 - 26. 50. Rola Monteskjusza w rozwoju myéli spolecznej (The Role of Montesquieu in the Development of Social Thought). In: Mysl Filozoficzna 6 (1956), S. 29 - 57. 51. Monteskjusz w Polsce (Montesquieu in Poland). In: Monteskjusz i jego dzielo (Montesquieu and his Work). Wroclaw: Ossolineum, 1956, S. 239 - 291. 52. Benjamin Franklin jako mysliciel i dzialacz spoleczny (Benjamin Franklin's Social Thought and Activities). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1957, S. 241 250. 53. Praworz^dnoéc (The Rule of Law). In: Encyklopedia Wspólczesna 1957, S. 402. Psychologizm (Psychological Trends in the Study of Law). In: Encyklopedia 54. Wspólczesna 1957, S. 451. Teoria panstwa i prawa (Theory of State and Law). Hrsg. von S. Ehrlich. War55. szawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, S. 3 - 68. Jan Sniadecki jako historyk nauki (John Sniadecki as a Historian of Science). In: 56. Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej V I (1958), S. 63 - 80.
Bibliographie Kazimierz Opalek 57. Krytyka ogólnej teorii patìstwa i prawa ( A Criticism of the General Theory of State and Law). In: Paùstwo i Prawo 13 (1958), S. 767 - 785. 58. Opracowanie zarysu dziejów nauki polskiej (Planning the Work on the History of Science in Poland). In: Nauka Polska 6 (1958), S. 85 - 103. 59. System prawa (The System of Law). In: Sprawozdania ζ prac naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych P A N 1958, S. 36. 60. Pi^ty Miçdzynarodowy Kongres Prawa Porównawczego (5 t h International Congress of Comparative Law). In: Paristwo i Prawo 13 (1958), S. 1070 - 1076. 61. Praworz^dnoéc (The Rule of Law). In: Zagadnienia prawa karnego i teorii prawa. Ksiçga pami^tkowa dia uczczenia Prof. W. Woltera (Problems of Criminal Law and Legal Theory. Essays in Honour of Prof. W. Wolter). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1959, S. 123 - 133. 62. Spór o pojçcie praworz^dnoéci (Contentions on the Concept „Rule of Law"). In: Panstwo i Prawo 14 (1959), S. 519 - 535. 63. Uwagi ο koncepcjach filozoficzno - prawnych Alfa Rossa (Remarks on the Legal Philosophical Conceptions of A l f Ross). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Panstwo i Prawo 15 (1960), S. 485 - 498. 64. Ζ problematyki podzialu nauk prawnych (On the Problem of Classification of Legal Sciences). In: Zeszyty Naukowe UJ - Prace Prawnicze 1960, S. 25 - 45. 65. Prawo a moralnoéc. Uwagi dyskusyjne (Law and Morals. Remarks in the Discussion). In: Paùstwo i Prawo 15 (1960), S. 93 - 98. 66. The Leon Petrazycki Theory of Law. In: Theoria - A Swedish Journal of Philosophy and Psychology 27 (1961), S. 129 - 150. 67. Filosofia prawa - jurysprudencja analityczna - teoria prawa. Porównanie i wnioski (Philosophy of Law - Analytical Jurisprudence - Theory of Law. Comparison and Conclusions). In: Panstwo i Prawo 16 (1961), S. 3 - 19. 68. Fizjokratyzm i jego rola w rozwoju nauki i kultury w Polsce okresu Oswiecenia (Physiocratism and its Role in the Development of Science and Culture in Poland in the Period of Enlightment). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1961, S.196 - 203. 69. Feliks Slotwmski (1788 - 1863). In: Sprawozdania ζ prac naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych P A N 1962, S. 23. 70. Einige Bemerkungen über die deutsch-polnischen Wissenschaftsbeziehungen im 18. Jahrhundert. In: Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volksdemokratischen Länder Europas 7 (1963), S. 422 - 430. 71. Les Physiocrates et leur role dans le renouveau culturel au X V I I I siecle en Pologne. In: Utopie et institutions au X V I I I e siecle. Le pragmatisme des Lumières. Paris: Monton et Co., 1963, S. 169 - 184. 72. Teoria Petrazyckiego jako program integracji prawoznawstwa i nauk spolecznych (Petrazycki's Theory as a Program of Integration of the Study of Law and Social Sciences). In: Problemy kultury i wychowania. Zbiór studiów (Problems of Culture and Education. Collected Studies). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963, S. 164 - 176.
472
Bibliographie Kazimierz Opaek
73. The rule of Law and Natural Law. In: Festkrift tillägnad Karl Olivecrona. Stockholm: Almquist and Wiksell, 1964, S. 497 - 507. 74. Nauka prawa w Uniwersytecie Jagiellotìskim w okresie Oswiecenia (The Study of Law in the Jagiellonian University in the Period of Enlightment). In: Studia ζ Dziejów Wydzialu Prawa UJ (Studies in History of the Law Faculty of the Jagellonian University) Kraków: Wydawnictwa UJ, 1964, S. 49 - 71. 75. U schylku szkoly prawa natury. Feliks Slotwinski 1788 - 1863 (At the Decline of Natural Law School. Feliks Slotwmski 1788 - 1863). In: Studia ζ Dziejów Wydzialu Prawa UJ (Studies in History of the Law Faculty of the Jagellonian University) Kraków: Wydawnictwa UJ, 1964, S. 79 - 102. 76. Glowne prçdy krakowskiej filozofii prawa. Prawo natury - normatywizm - psychologizm (Main Trends of the Legal Philosophy in Cracow. Natural Law - Normativism - Psychological Theory). In: Studia ζ Dziejów Wydzialu Prawa UJ (Studies in History of the Law Faculty of the Jagellonian University) Kraków: Wydawnictwa UJ, 1964, S. 72 - 78. 77. Kierunek psychologiczny w teorii prawa. Jerzy Lande 1886 - 1954 (Psychological Trend in Legal Theory. George Lande 1886 - 1954). In: Studia ζ Dziejów Wydzialu Prawa UJ (Studies in History of the Law Faculty of the Jagellonian University) Kraków: Wydawnictwa UJ, 1964, S. 117 - 128. 78. Formalne i materialne pojçcie praworz^dnoéci (The Formal and Material Concept of Rule of Law). In: Ksiçga pami^tkowa dia uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybylowskiego (Book in Honour of the Scientific Work of Casimir Przybylowski). Krakow, Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, S. 200 207. 79. Polemika w zwi^zku ζ recensja A . Podgóreckiego pracy „Wspólczesna teoria i socjologia prawa w U S A " (Polemics with the Review by A . Podgórecki of the book „Contemporary Theory and Sociology of Law in U.S."). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 19 (1964), S. 836 - 844. 80. Prêdpoklady a faktory rozwoje vêdy w Polsku w dobe Oswiecenské (Conditions and Factors of Science's Development in Poland in the Period of Enlightment). In: Zaprawy Komise pro dejiny prirodnych, lekarskych a technickych vêd Ceskoslovenske Akademie Vêd 1965, S. 1 - 13. 81. Altalânos Jugtudomâny (Öszehasonlito megjegyzedélo). In: Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 1965, S. 3 - 20. 82. Warunki i czynniki rozwoju nauki w Polsce okresu Oswiecenia (Conditions and Factors of Science's Development in Poland in the Period of Enlightment). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1965, S. 545 - 560. 83. Niekotoryje osnownyje naprawlenja sowremiennoj tieorii i socjologii prawa w SSzA. Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo 1966, S. 63 - 72. 84. Die Rechtsphilosophie in Polen am Anfang des 19. Jahrhunderts. Vom Naturrecht der Physiokraten zum Kantianismus und Historismus. In: Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. Festschrift für Edward Winter zum 70. Geburtstag. Berlin: Akademie Verlag, 1966, S. 454 466.
Bibliographie Kazimierz Opalek 85. The Restrictions Brought to Individual Rights and Liberties by the Law. In: V I I e Congres du Droit Comparé - Rapports Polonais. Wroclaw: Ossolineum, 1966, S. 206 - 222. 86. Über Probleme der Normentheorie des sozialistischen Rechts. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und Sprachwissenschaftliche Reihe 3, 15 (1966), S. 453 - 462. 87. The General Science of Law. Main Approaches and their History. In: Organon 1966, S. 79 - 94. 88. Swoistosc prawoznawstwa a problem integracji (Peculiarity of the Study of Law and the Problem of Integration). In: Panstwo i Prawo 21 (1966), S. 428 - 441. 89. Historyzm i inné kierunki w polskim prawoznawstwie pocz^tków X I X w. (Historicism and other Trends in the Study of Law in Poland at the Beginning of the X I X t h Century). Von K. Opalek und J. Wroblewski. In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej I X (1966), S. 177 - 193. 90. Aksjologia - dylemat pomiçdzy posytywizmem prawniczym a doktryn^ prawa natury (Axiology - Dilemma between Legal Positivism and the Natural Law Doctrine). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Patìstwo i Prawo 21 (1966), S. 251 263. 91. Praworz^dnosc i demokracja (The Rule of Law and Democracy). In: Prawo i Zycie X I (1966), S. 5. 92. Some Problems of the Contemporary Natural Law Doctrines in USA. Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Co-existence I V (1967), S. 187 - 197. 93. Perspektywy rozwoju nauk prawnych w Polsce (Perspectives of the Development of Legal Sciences in Poland). In: Patìstwo i Prawo 22 (1967), S. 3 - 17. 94. Prognoza rozwoju nauk prawnych w Polsce do roku 1985 (Prognosis of the Development of Legal Sciences in Poland till 1985). In: Perspektywy rozwoju humanistyki polskiej do roku 1985 (Perspectives of the Development of Humanities in Poland till 1985). Warszawa: Wydawnictwa PAN, 1967, S. 83 - 121. 95. Z zagadnieù teorii norm prawa socjalistycznego (Some Problems of the Theory of Norms of Socialist Law). In: Studia Prawno-Ekonomiczne I (1967), S. 33 - 48. 96. The Peculiarities of the Study of Law and the Question of Integration. In: Archivum Juridicum Cracoviense I (1968), S. 7 - 2 4 . 97. Axiology: Dilemma between Legal Positivism and Natural Law. Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht 18 (1968), S. 353 - 366. 98. Systematik der Rechtswissenschaft. In: Aktuelle Probleme der marxistisch-leninistischen Staats- und Rechtstheorie. Budapest: Akademioi Kiada, 1968, S. 192 216. 99. Le developement de la pensée sociale et humaniste et l'essor des sciences exactes en Pologne au siècle des Lumières. In: X I I e Congres d'Histoire des Sciences - Travaux Polonais. Wroclaw: Ossolineum, 1968, S. 102 - 120. 100. Wlasciwosci rozwojowe nauk spolecznych i humanistycznych w Polsce okresu Oéwiecenia (Pecularities of Development of Social and Humanistic Sciences in
Bibliographie Kazimierz Opalek
474
Poland of the Period of Enlightment). In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej X I I (1968), S. 185 - 194. 101. Problemy „wewnçtrznej" i „zewnçtrznej" integracji nauk prawnych (Problems of „Internal" and „External" Integration of the Study of Law). In: Krakowskie Studia Prawnicze I (1968), S. 7 - 29. 102. Jedenaécie roczników Kwartalnika Historii Nauki i Techniki (Eleven Annals of the Quarterly of History of Science and Technology). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1968, S. 623 - 636. 103. Obszczaja Charakteristika sowremiennoj tieorii prawa w SSzA. In: Probliemy Prawoznawstwa 1969, S. 144 - 153. 104. The Problem of „Directive Meaning". In: Festkrift til Professor Dr. Jur. et Phil. A l f Ross. Copenhagen: Juristforbundets Follag, 1969, S. 405 - 422. 105. The Complexity of Law and of the Methods of Its Study. In: Sciencia - Revue Internationale de Synthese Scientifique X I V (1969), S. 279 - 291. Auch abgedruckt in Franz. in Supplement. 106. Some Problems of the Theory of Norms. In: Logique et Analyse 12 (1969), S. 87 -
111. 107. The Motivational Operation of the Law. In: Archivum Juridicum Cracoviense I I (1969), S. 29 - 45. 108. State and Law: an Attempt at Integration of the Juristic with the Sociological Approach. In: Polish Round Table I I (1969), S. 87 - 96. 109. Przedmiot prawoznawstwa a problem tzw. plaszczyzn prawa (Subject of the Study of Law and the Problem of the so-called Plans of Law). In: Patìstwo a Prawo 24 (1969), S. 983 - 995. 110. Teoria Petrazyckiego a wspólczesna teoria prawa (Petrazycki's Theory and the Contemporary Theory of Law). In: Ζ zagadnietì teorii nauki i teorii prawa Leona Petrazyckiego (Some Problems of Leon Patrazycki's Theory of Science and Theory of Law). Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969, S. 113 135. 111. A jog motivaciós hatasa. In: Studia Juridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata 1970, S. 49 - 72. 112. The Problem of the Existence of the Norm. In: Festschrift für Adolf J. Merkl. Hrsg. von Max Imboden, Friedrich Kujer u. a. München, Salzburg: Wilhelm Fink Verlag, 1970, S. 285 - 300. 113. Oéwiecenie (Enlightment). In: Historia nauki polskiej (History of Science in Poland). Bd. 2,1. Teil. Wroclaw: Ossolineum, 1970, S. 233 - 463. 114. The Problem of the Validity of Law. In: Archivum Juridicum Cracoviense I I I (1970), S. 7 - 19. 115. On the Logical-Semantic Structure of Directives. In: Logique et Analyse 1970, S.169 - 196.
Bibliographie Kazimierz Opalek 116. The Relations between the Social and Economic Development and Development of Law. In: Rapports Polonais présentées au huitième Congrès International du Droit comparé. Varsovie: Paùstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970, S. 133 - 145. 117. Wielcy uczeni krakowskiego Oéwiecenia na tie epoki (Great Scientists of the Enlightment in Cracow against the Background of their Time). In: Krakow i Maîopolska przez dzieje (Cracow and Little Poland in History). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970, S. 279 - 300. 118. Problem organiczen podstawowych praw i wolnoéci obywatelskich przez ustawy (Problem of Statutory Restrictions of Fundamental Rights and Liberties of Citizens). In: Ksiçga pami^tkowa ku czci Prof. K. Grzybowskiego (Book in Honour of Prof. K. Grzybowski). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970, S. 131 - 143. 119. Nauki polityczne (Political Sciences). In: Raport ο stanie nauk humanistycznych i perspektywach ich rozwoju w krakowskim oérodku naukowym do roku 1990 (Raport on the State of humanistic Sciences and on the Perspectives of their Development in the Cracow Scientific Centre till 1990). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1970, S. 107 - 120. 120. Law as Social Phenomenon. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 57 (1971), S. 37 - 55. 121. Norm and Conduct. The Problem of the Fulfillment of the Norm. In: Legal Reasoning. Proceedings of the World congress for Legal and Social Philosophy. Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles 1971, S. 107 - 119. Wieder abgedruckt in: Logique et Analyse 1971. 122. Law and Integration of Social Sciences. In: Archivum Juridicum Cracoviense I V (1971), S. 7 - 24. 123. Ogólne problemy metodologiezne teorii prawa (General Methodological Problems of Legal Theory). Von K. Opaïek und J. Wroblewski. In: Paùstwo i Prawo 26 (1971), S. 999- 1011. 124. Nauka w Polsce okresu Oéwiecenia (Science in Poland in the Period of Enlightment). In: Polska w epoce Oéwiecenia. Paùstwo - spoîeczeùstwo - kultura (Poland in the Period of Enlightment. State - Society - Culture). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971, S. 241 - 273. 125. Bogusiawski Konstanty Józef. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 27. 126. Czochron Sebastjan Jan Kanty. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Worclaw: Ossolineum, 1971, S. 67. 127. Zarycki Bonifacy. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Worclaw: Ossolineum, 1971, S. 93 - 94. 128. Karpowicz Micha! Franciszek. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 165 - 166. 129. Kîodzmski Jan. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 173. 130. Konarski Hieronim. In: Filozofia w Polsce. Sîownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 182 - 184.
476
Bibliographie Kazimierz Opalek
131. Lande Jerzy. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 214. 132. Peretiatkowicz Antoni. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 312 - 313. 133. Poplawski Antoni. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 322 - 324. 134. Skrzetuski Józef Kagetan. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 350 - 351. 135. Skrzetuski Wincenty. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 351. 136. Slotwmski Feliks. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 352. 137. Soltykowicz Józef. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 361 - 362. 138. Stroynowski Hieronim. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 373 - 375. 139. Zaluski Andrzej Stanislaw. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 442. 140. Zaluski Józef Andrzej. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 442. 141. Znosko Jan. In: Filozofia w Polsce. Slownik pisarzy (Philosophy in Poland. Dictionary of Writers). Wroclaw: Ossolineum, 1971, S. 451. 142. Les normes, les énoncés sur les normes et les propositions déontiques. In: Archives de Philosophie du Droit 17 (1972), S. 355 - 372. 143. De la speculation à la science dans la théorie du droit. In: Archivum Juridicum Cracoviense V (1972), S. 7 - 21. 144. Charakterystyka nauk politycznych. Stan i perspektywy ich rozwoju (Characterization of Political Sciences. Their State and Perspectives of Their Development). In: Studia Nauk Politycznych 1972, S. 11-31. 145. Sporne zagadnienia pojçc teoretyczno-prawnych (Controversial Problems of Concepts of Legal Theory). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 1972, S. 91 - 102. 146. Prospects of Integration and Development of Political Science in Poland. In: Res Publica. Revue de l'Institut Belge de Science Politique 15 (1973), S. 13 - 25. 147. Die Rechtstheorie in Polen im 20. Jahrhundert. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 59 (1973), S. 551 - 570. 148. Leon Petrazycki's Theory and the Contemporary Theory of Law. In: Archivum Juridicum Cracoviense V I (1973), S. 59 - 82. 149. Internal and External Integration of the Study of Law. In: Srpska Akademija Nuaka i Umetnosti. Medunarodni Simpozjum ο Metodologiji Prawnich Nauka. Beograd: Serbian Academy of Sciences and Arts, 1973, S. 251 - 272.
Bibliographie Kazimierz Opalek 150. Directives, Optatives, and Value Statements. In: Logique et Analyse 1973, S. 221 - 258. 151. Axiologia: Dilema entre iuspositivismo y iusnaturalismo. Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Centro de Estudios de Filosofia del Derecho Luz - Facultad de Derecho, Cuaderno de Trabajo nr 2. Maracaibo 1973, S. 31. 152. On Weak and Strong Permissions. Von K. Opalek und J. Woletìski. In: RECHTSTHEORIE 4 (1973), S. 169 - 182.
153. Problem aksjomatyzacji prawa (The Problem of the Axiometization of Law). Von Κ . Opalek und J. Woletìski. In: Patìstwo i Prawo 28 (1973), S. 3 - 14. 154. Problem integracji w naukach politycznych (The Problem of Integration in Political Sciences) In: Nowe Drogi 1973, S. 87 - 100. 155. A lengyel jogelmelet a X X . szazadban. In: Pecsi Tudomanyegyetem. Dolgozatok az allam - es jogtudomanyok körebol I I I . 1973, S. 191 - 216. 156. Directive Discourse. In: Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto 51 (1974), S. 227 - 245. 157. The Conception of Human and Civil Rights and Duties: Its Origin and Character. In: Archivum Juridicum Cracoviense V I I (1974), S. 47 - 63. 158. Geneza i rozwój koncepcji podstawowych praw, wolnosci i obowi^zków czlowieka i obywatela (The Origin and Development of the Conception of Fundamental Rights, Liberties, and Duties of Man and Citizen). In: Prawa i obowi^zki obywatelskie w Polsce i Swiecie (Citizen's Rights and Duties in Poland, and in the World). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, S. 11 - 28. 159. Bogdan Suchodolski jako historyk nauki (Bogdan Suchodolski as Historian of Science). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1974, S. 2 - 8. 160. Nauki polityczne w Polsce. Wybrane problemy (Political Sciences in Poland. Selected Problems). In: Studia Nauk Politycznych 1974, S. 11 - 24. 161. Ο tzw. slabych i mocnych dozwoleniach (On the so-called Weak and Strong Permissions). Von K. Opalek und J. Woletìski. In: Studia Filozoficzne 18 (1974), S.115 - 124. 162. Prawo a zmisna i rozwój (Law, Change, and Development). In: Historyka I V (1974), S. 3 - 2 1 . 163. Zum Begriff der Rechtsverwirklichung. In: Karl-Marx-Universität Leipzig. Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft II. 1975, S. 22 - 33. 164. Doing Things with Words and the Law. In: Annuario de Filosofia del Derecho (Madrid) 17 (1975), S. 233 - 244. 165. Sodobna politiòna znanost. In: Teoria in Praksa 12 (1975), Ljubliana, S. 992 999. 166. Wladyslaw Wolter - cinquantenaire du travail scientifique. Von Κ . Opalek und M . Cieélak. In: Archivum Juridicum Cracoviense V I I I (1975), S. 2 - 9. 167. Das Problem der Axiomatisierung des Rechts. Von K. Opalek und J. Woletìski. In: Rechtstheorie und Rechtsinformatik. Wien: Springer Verlag, 1975, S. 51 - 66.
478
Bibliographie Kazimierz Opalek
168 Problematyka pojçciowo-terminologiczna nauk politycznych (The ConceptualTerminological Problems of Political Sciences). In: Metodologiezne i teoretyczne problemy nauk politycznych (Methodological and Theoretical Problems of Publical Sciences). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, S. 9 - 31. 169 Pojçcia „kultury" i „stylu" w nauce o polityce i w prawoznawstwie (The Concept „Culture" and „Style" in Political Science and Study of Law). In: Centralny Oérodek Metodyczny Studów Nauk Politycznych. Warszawa 1976, S. 52. 170, Prawo i polityka w czasie i przestrzeni (Law and Politics in Time and Space). In: Studia Nauk Politycznych 1976, S. 41 - 57. 171, Wartoéci i normy w polityce (Values and Norms in Politics). In: Ζ badan nad kultury polityezn^ (Studies in Political Cultures). Hrsg. von M . Sobolewski. Centralny Oérodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. Warszawa 1977, S. 57 76. 172, Law and Politics in Time and Space. In: Politukka 1977, Helsinki, S. 10 - 23. 173, The Concept of Participation. In: Equality and Freedom: International and Comparative Jurisprudence Vol. 1. New York, Leiden: Oceana Publications, Inc., A . W. Sijthoff, Dobbs Ferry, 1977, S. 255 - 276. 174, Law and Politics. In: Archivum Juridicum Cracoviense X (1977), S. 16 - 29. 175. Pojçcie „kultury" w burzuazyjnej filozofii prawa i politologi! (The Concept „Culture" in the Bourgeois Legal Philosophy and Political Science). In: Studia Nauk Politycznych 1977, S. 75 - 92. 176. Pod znakiem refleksji - ο Konstantym Grzybowskim (Reflections on Konstanty Grzybowski). In: Konstanty Grzybowski, piçcdziesi^t lat 1918 - 1968 (Konstanty Grzybowski, Fifty Years 1918 - 1968). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977, S. 5 - 26. 177. Przedmiot nauk politycznych: nauki polityczne (Subject of Political Sciences: Political Sciences). In: Podstawy nauk politycznych (Elements of Political Sciences). 2. Aufl. Warszawa: Ksi^zka i Wiedza, 1978, S. 11 - 75. 178. Der Begriff der Rechtsphilosophie. In: Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht 29 (1978), S. 233 - 250. 179. The Concept „Culture" in Legal Theory and in Political Science. In: Archivum Juridicum Cracoviense X I (1978), S. 5 - 22.
180. Present Status of Legal Philosophy. In: Recueil des Travaux du Symposium International sur la Philosophie du Droit de lAcademie Serbe des Sciences et des Arts. Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umietnosti, 1978, S. 104 - 117.
181. Sadoszni status prawne filozofije. In: Recueil des Travaux du Symposium International sur la Philosophie du Droit de l'Academie Serbe des Sciences et des Arts. Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umietnosti, 1978, S. 525 - 538.
182. Positüvisen oikenden käsitteestä. In: Lakimies - Lehdesta 1978, S. 851 - 870. 183. The Concept of „Positive Law". In: X e Congrès du Droit Comparé. Travaux Polonais. Wroclaw: Ossolineum, 1978, S. 9 - 24.
Bibliographie Kazimierz Opalek 184. Marksistowska teoria polityki. Kolejny etap prac polskich uczonych (Marxist Theory of Politics. Successive Stage of Works of Polish Scholars). In: Ζ zagadnien teorii polityki. System polityczny, interesy, wartoéci, normy polityczne, decyzje polityczne (Problems of Theory of Politics. Political System, Political Interests, Values, Norms, and Decisions). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, S. 5 - 19. 185. Problematyka tzw. uczestnictwa w burzuazyjnej socjologii i nauce politycznej (Problems of so-called Participation in Bourgeois Sociology and Political Science). In: Z zagadnieù teorii polityki. System polityczny, interesy, wartoSci, normy polityczne, decyzje polityczne (Problems of Theory of Politics. Political System, Political Interests, Values, Norms, and Decisions). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, S. 178 - 199. 186. Geneza i rozwój koncepcji podstawowych praw, wolnoSci i obowi^zkow czlowieka i obywatela (The Origin and Development of the Conception of Fundamental Rights, Liberties and Duties of Man and Citizen). In: Prawa i obowi^zki obywatelskie w Polsce i Swiecie (Citizen's Rights and Duties in Poland and in the World). 2. Aufl. Warszawa: Paóstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, S. 13 - 29. 187. Pojçcie prawa pozytywnego (The Concept of Positive Law). In: Patìstwo i Prawo 33 (1978), S. 3 - 16. 188. Norms and Values in Politics. In: Archivum Juridicum Cracoviense X I I (1979), S. 5 - 18. 189. Sprachphilosophie und Jurisprudenz. In: Argumentation und Hermeneutik in der Jurisprudenz. Hrsg. von W. Krawietz, K. Opalek, A . Peczenik, A . Schramm. Berlin: Duncker & Humblot, 1979 (RECHTSTHEORIE, Beiheft Nr. 1), S. 153 -
161. 190. Marxist Theory of Politics - the Development of Research in Poland. In: Political Sciences in Poland. Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1979, S. 389 - 407. Auch in Russisch abgedruckt. 191. Przedmiot nauk politycznych: Nauki polityczne (Subject of Political Sciences: Political Sciences). In: Podstawy nauk politycznych (Elements of Political Sciences). 3. überarb. und erw. Aufl. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, S. 9 - 65. 192. Marksistowska teoria polityki. Rozwój badan w Polsce (Marxist Theory of Politics. Development of Research in Poland). In: Studia Nauk Politycznych 1979, S.113 - 129. 193. Szkoly w teorii prawa (Schools in Legal Theory). In: Szkoîy w nauce (Schools in Science). Wroclaw: Ossolineum, 1980, S. 115 - 136. 194. Pod znakiem refleksji - ο Konstantym Grzybowskim (Reflections on Konstanty Grzybowski). In: Konstanty Grzybowski, Piçcdziesi^t lat 1918 - 1968 (Konstanty Grzybowski, Fifty Years 1918 - 1968). 2. Aufl. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980, S. 5 - 26. Siehe Nr. 181. 195. Le norme ed ennunciati su norme. In: Problemi di teoria del diritto. Hrsg. von R. Guastini. Bologna: I l Mulino, 1980, S. 237 - 246.
480
Bibliographie Kazimierz Opalek
196. Petrazycki Leon. In: Polski Sîownik Biograficzny (Polish Biographical Dictionnary). Wroclaw: Ossolineum, 1980, S. 683 - 688. 197. Kasparek Franciszek. In: Polski Sîownik Biograficzny (Polish Biographical Dictionnary). Wroclaw: Ossolineum, 1980, S. 176. 198. Lande Jerzy Wîadysîaw. In: Polski Sîownik Biograficzny (Polish Biographical Dictionnary). Wroclaw: Ossolineum, 1980, S. 467. 199. Philosophy of Law and Social Philosophy. In: Filosofia del Derecho y Problemas de Filosofia Social. Mamoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofia del Derecho y Filosofia Social, Vol. I V , Mexico City: Universidad Nacional Autonoma de Mexico, 1981, S. 37 - 48. 200. Das Recht und die Veränderung und Entwicklung. In: Rechtstheoretische Probleme der rechtlichen Regelung im Sozialismus. Schriftenreihe Methodologie der marxistisch-leninistischen Rechtswissenschaft. Heft 9. Leipzig: Karl-Marx-Universität, 1981, S. 143 - 169. 201. Analytical and Empirical Theory of Law: Their Relation to Legal Positivism and Analytical Jurisprudence. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Supplements, Band 1,1981, S. 109 - 122. 202. Kelsens Kritik der Naturrechtslehre. In: Ideologiekritik und Demokratietheorie bei Hans Kelsen. Hrsg. von W. Krawietz, E. Topitsch, P. Koller. Berlin: Duncker & Humblot, 1982 (RECHTSTHEORIE, Beiheft 4), S. 144 - 168. 203. Norm, Wert und Werturteil. In: Die Reine Rechtslehre in wissenschaftlicher Diskussion. Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts. Wien: Manz Verlag, 1982, S. 6 6 - 8 1 . 204. Der Begriff des positiven Rechts. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 68 (1982), S. 448 - 462. 205. Poland. In: International Handbook of Political Science. Westport, London: W. G. Andrews, Greenwood Press, 1982, S. 291 - 299. 206. Reine Rechtslehre in Polen. In: Der Einfluß der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern. Teil II. Schriftenreihe des Hans KelsenInstituts. Wien: Manz Verlag, 1983, S. 35 - 61. 207. Rechtsnormen und sozialer Wandel. In: Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag. Hrsg. von W. Krawietz, H. Schelsky u. a. Berlin: Duncker & Humblot, 1984, S. 55 - 67. 208. Integration between Legal Research and Social Science. In: Theory of Legal Science. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1984, S. 531 - 549. 209. Filozofia prawa a filozofia spoîeczna (Philosophy of Law, and Social Philosophy). In: Problemy teorii i filozofii prawa. Ksiçga pami^tkowa ku czci Prof. G. L. Seidiera (Problems of the Theory and Philosophy of Law. Book in Honour of Prof. G. L. Seidler). Skîodowskiej, Lublin: Uniwersytet M . Curie, 1984, S. 189 - 201. 210. Problems of Schools in Legal Theory. In: Man, Law, and Modern Forms of Life. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1985, S. 161 - 183. 211. Interdyscyplinarne zwi^zki prawoznawstwa (Interdisciplinary Relationships of Jurisprudence). In: Studia Filozoficzne 29 (1985), S. 17 - 30.
Bibliographie Kazimierz Opalek 212. On Weak and Strong Permissions once more. Von K. Opalek und J. Woletìski. In: RECHTSTHEORIE 17 ( 1 9 8 6 ) , S. 83 - 8 8 .
213. Argumenty za nielingwistyczn^ koncepcj^ normy (Arguments for Non-linguistic Conception of the Norm). In: Studia Prawnicze 1986, S. 195 - 212. 214. Ζ zagadnietì nauki ο polityce (Some Problems of Political Science). In: Historyka X V I (1986), S. 121 - 126. 215. Normen und performative Akte. In: Formalismus und Phänomenologie im Rechtsdenken der Gegenwart. Festgabe für Alois Troller zum 80. Geburtstag. Hrsg. von W. Krawietz und W. Ott. Berlin: Duncker & Humblot, 1987, S. 243 256. 216. Is, Ought, and Logic. Von Κ . Opalek und J. Woletìski. In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 73 (1987), S. 373 - 385. 217. Normativism against the Background of Methodological Inquiries in Polish Legal Theory. In: Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law. Hrsg. von Z. Ziembitìski. Amsterdam: Rodopi, 1987, S. 15 - 31. 218. Logika i interpretacje powinnoSci (Logic and Interpretations of Ought). Von K. Opalek und J. Woletìski. In: Krakowskie Studia Prawnicze X X I (1988), S. 13 - 29. 219. Directives, Norms, and Performatives. In: Normative Structures of the Social World. Hrsg. von G. di Bernardo. Amsterdam: Rodopi, 1988, S. 183 - 204. 220. DwoistoSc ujçcia normy w nauce prawa (Dualistic Conception of Norm in Legal Science). In: Patìstwo i Prawo 43 (1988), S. 3 - 13. 221. Teoria patìstwa i prawa. In: Encyklopedia Powszechna PWN. Suplement. Warszawa: Patìstwo we Wydawnictwo Naukowe, 1988, S. 504 - 505. Auch in: Doktryny prawne kapitalizmu, S. 91. 222. Jeszcze raz ο praworz^dnosci (Once more on Legality). In: Konstytucja w spoleczetìstwie obywatelskim (Constitution in Civic Society). Festgabe für Professor Witold Zakrzewski. Hrsg. von K. Dzialocha et al. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989, S. 143 - 154. 223. Der Dualismus der Auffassung der Norm in der Rechtswissenschaft. Der Versuch seiner Überwindung. In: RECHTSTHEORIE 20 (1989), S. 433 - 447. 224. Normatywizm w Polsce (Normativism in Poland). In: Krakowskie Studia Prawnicze X X I I (1989), S. 3 - 24. 225. Wartosci i oceny w Swietle dwóch teorii norm (Values and Value-judgments in the Light of two Theories of Norms). In: Szkice ζ teorii prawa i szczególowych nauk prawnych (Studies in Legal Theory and Legal Dogmatics). Festgabe für Professor Zygmunt Ziembitìski. Hrsg. von S. Wronkowska und M. Zielitìski. Poznatì: Wydawnictwo Naukowe U A M , 1990, S. 307 - 321. 226. Prawo jako przedmiot kulturowy (Law as cultural object). In: Elementy socjologii prawa (Elements of Sociology of Law). Bd. 3. Hrsg. von A . Kojder et al. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, S. 25 - 28. 227. Charakterystyka prawnej kontroli patìstwa (Characteristics of Law as Means of Social Control). Von K. Opalek und J. Wróblewski. In: Elementy socjologii
31 Festgabe Opatek
482
Bibliographie Kazimierz Opaek prawa (Elements of Sociology of Law). Bd. 3. Hrsg. von A . Kojder et al. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1990, S. 68 - 72.
228. Problematyka padstwa w prawoznawstwie (Problems of the State in the Study of Law). In: Historia - prawo - polityka (History - Law - Politics). Festgabe für Professor Franciszek Ryszka. Hrsg. von J. Baszkiewicz et al. Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, S. 150 - 160. 229. Ο podziale doktryn na postçpowe, konserwatywne i reakcyjne (On the division of Doctrines into Progressive, Conservative and Reactionary). In: Idee - paristwo prawo (Ideas - State - Law). Festgabe für Professor Marek Sobolewski. Hrsg. von J. Majchrowski. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloriskiego, 1991, S. 219 - 227. 230. Law and Revolution. In: Revolutions in Law and Legal Thought. Hrsg. von Z. Bankowski. Aberdeen 1991, S. 1 - 10. 231. Statisches und dynamisches Normensystem. In: Staatsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift Robert Walter zum 60. Geburtstag. Hrsg. von H. Mayer et al. Wien: Manz Verlag, 1991, S. 507 - 518. 232. I l campo dello studio del diritto. In: Analisi e diritto 1991. Ricerche di giurisprudenza analitica. Hrsg. von P. Comanducci und R. Guastini. Torino: G. Giappichelli Editore, 1991, S. 245 - 255. 233. Problemi dello Stato nello studio del diritto. In: Analisi e diritto 1991. Ricerche di giurisprudenza analitica. Hrsg. von P. Comanducci und R. Guastini. Torino: G. Giappichelli Editore, 1991, S. 256 - 265. 234. Filosofia del diritto, problemi filosofici nello studio del diritto, filosofia sociale. In: Analisi e diritto 1991. Ricerche di giurisprudenza analitica. Hrsg. von P. Comanducci und R. Guastini. Torino: G. Giappichelli Editore, 1991, S. 266 - 275. 235. Riesame della distinzione tra sistemi normativi statici e dinamici. In: Sistemi normativi statici e dinamici. Analisi di una tipologia Kelseniana. Hrsg. von L. Gianformaggio. Torino: G. Giapichelli Editore, 1991, S. 19 - 37. 236. Normative Systems, Permission and Deontic Logic. Von K. Opaîek und J. Woleóski. In: Ratio Juris, Bd. I V , No. 3 (1991), S. 334 - 348. 237. Problematyka projekcji w teorii Leona Petrazyckiego (Problematik der Projektion in der Theorie von Leon Petrazycki). In: Prawo w zmieniaj^cym siç spoleczenstwie. K§iega Jubileuczowa Profesor Marii Boruckiey-Arctowey. Kraków 1992, S. 15-41.
C. Vorworte, Rezensionen, Übersetzungen und sonstige kleinere Veröffentlichungen 238. Sesja Poéwiçcona Polskiemu Oéwieceniu (Session on Polish Enlightment). In: Zycie Nauki 1951, S. 412 - 414. 239. Vorwort. Hugo Koltqtaj: Wybór pism naukowych (Hugo Koîîataj: Selected Scientific Writings). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953, S. 7 - 70.
Bibliographie Kazimierz Opalek
483
240. Anmerkungen. Hugo Koftqtaj: Wybór pism naukowych (Hugo Kofl^taj: Selected Scientific Writings). Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953, S. 441 - 469. 241. Rez. Waclaw Brzezinski: Prawo mieszkaniowe (Housing Law). In: Patìstwo i Prawo 9 (1954), S. 1076 - 1081. 242. Rez. Bohdan Suchodolski: Nauka polska w okresie OSwiecenia (Polish Science in the Period of Enlightment). In: Kwartalnik Historyczny 1954, S. 526 - 535. 243. Rez. Z. Salwa: Wychowawcza rola prawa Polski Ludowej (Educational Consequence of Law in Polish People's Republic). In: Patìstwo i Prawo 10 (1955), S. 774 - 776. 244. Rez. J. Kolasa : Prawo narodów w szkolach polskich wieku Oswiecenia (Law of Nations in the Polish Schools in the Period of Enlightment). In: Patìstwo i Prawo 10 (1955), S. 837 - 841. 245. Vorwort. Hugo Koftqtaj: Porz^dek fizyczno-moralny (Hugo KoH^taj: PhysicoMoral Order). Warszawa: Patìstwo we Wydawnictwo Naukowe, 1955, S. V I I X X X V I u. 3. 246. Anmerkungen. Hugo Kottqtaj: Porz^dek fizyczno-moralny (Hugo Koll^taj: Physico-Moral Order). Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955, S. 473 - 497. 247. DzialalnoSc naukowa Zespolu Katedr Teorii Patìstwa i Prawa oraz Prawa Patìstwowego w latach 1945 - 1954 (Scientific Activities of the Chairs of Theory of State and Law, and of Constitutional Law in the Years 1945 - 1954). Von K. Opal ek, M. Borucka-Arctowa und Κ . Grzybowski. In: Zeszyty Naukowe U. J., Prawo 1955, S. 155 - 168. 248. Vorwort. Józef Wybicki: Listy patriotyczne (Józef Wybicki: Patriotic Letters). Wroclaw: Ossolineum, 1955, S. I I I - C X V I I I . 249. Anmerkungen. Józef Wybicki: Listy patriotyczne (Józef Wybicki: Patriotic Letters). Wroclaw: Ossolineum, 1955, S. C X I X - C X X I I u. 330 - 335. 250. Sprawozdanie ζ prac zespolu do badan nad nauk$ polskiego OSwiecenia (Report on the Collective Research on the Science of Polish Enlightment). In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej 1955, S. 670 - 673. 251. Prof. dr Jerzy Lande 1886 - 1954. Wspomnienie poSmiertne (Prof. Dr. Jerzy Lande 1886 - 1954. Obituary Notice). In: Studia i Materialy ζ Dziejów Nauki Polskiej 1955, S. 681 - 683. 252. Sprawozdanie ζ prac zespolu do badatì nad nauk$ polskiego OSwiecenia (Report on the Collective Research on the Science of Polish Enlightment). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1956, S. 447 - 450. 253. Übersetzung (Engl./Poln.). Social Sciences. In: J. D. Bernal Science in History. Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, S. 655 - 794, Teil V I Kapitel 12 u. 13. 254. La régie du droit. Referat na V Miçdzynarodowym Kongresie Prawa Porównawczego, Bruksela 1958 (Report at the V t h International Congress of Comparative Law). Vervielfältigt, Brüssel 1958. 23 S. 31*
484
Bibliographie Kazimierz Opalek
255. Odpowiedz autorska na recenzjç Prof, dr Czeslawa Znamierowskieg z pracy „Prawo podmiotowe" (Author's Reply on the Review of Prof. Dr. Czesîaw Znamierowski, concerning the book „The Subjective Law"). In: Ruch Prawniczy i Ekonomiczny 20 (1958), S. 254 - 261. 256. Anmerkungen. Jerzy Lande: Studia ζ filozofii prawa (Jerzy Lande: Studies in Legal Philosophy). Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. 257. Übersetzung (Engl./Poln.). A l f Ross: Scandinavian Law, Continental Law and Common Law. Some General Reflections. In: Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze 1960, S. 5 - 24. 258. Rez. Bohdan Suchodolski: Studia ζ dziejów polskiej mysli filozoficznej (Studies on History of Polish, Philosophical Thought). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1960, S. 703 - 709. 259. Rez. Bohdan Suchodolski: Studia ζ dziejów polskiej mysli filozoficznej (Studies on History of Polish, Philosphical Thought). Wieder abgedruckt. In: Archives d'Histoire des Sciences 1961. 260. Rez. I. Stasiewicz : Ζ pocz^tków teorii nauki w Polsce (Some Problems of the Beginnings of Science's Theory in Poland). In: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1964, S. 395 - 397. 261. Übersetzung (Deutsch/Poln.). Fryderyk Karol von Savigny: Ο powolaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa (Friedrich Carl von Savigny: Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. 185 S. 262. Vorwort. Fryderyk Karol von Savigny: Ο powolaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa (Friedrich Carl von Savigny: Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Warszawa: Paùstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, S. 5 - 46. 263. Anmerkungen. Fryderyk Karol von Savigny: Ο powolaniu naszych czasów do ustawodawstwa i nauki prawa (Friedrich Carl von Savigny: Vom Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, S. 172 - 183. 264. Doktryna tzw. uczestnictwa (participation) w burzuazyjnej socjologii i nauce politycznej (The Doctrine of so-called Participation in Bourgeois Sociology and Political Science). Vervielfältigt, Kraków 1974. 24 S. 265. Pojçcia „kultury" i „stylu" w nauce o polityce i prawoznawstwie (The Concept „Culture" and „Style" in Political Science and Study of Law). Vervielfältigt und Poznan: Wydawniectwa Universytetu, 1975, 52 S. 266. Vorwort. Metodologiezne i teoretyczne problemy nauk politycznych (Methodological and Theoretical Problems of Political Sciences). Warszawa: Patìstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, S. 5 - 6. 267. Present Status of Legal Philosophy. Referat na Miçdzynarodowym Sympozjum Serbskiej Adkademii Nauk i Sztuk, poéwiçconym problemom filozofii prawa, Belgrad 1976 (Report at the International Symposium of Serbian Academy of Sciences and Arts, concerning the Problems of Philosophy of Law). Vervielfältigt, Beograd 1976.
Bibliographie Kazimierz Opalek 268. Law and Politics in Time and Space. Referat w X I I I Sekcji Swiatowego Kongresu International Political Science Association. Edynburg, V I I I , 1976 (Report at the X I I I t h Section of International Congress of IPSA, Edinburgh, V I I I , 1976). Vervielfältigt, Brüssel 1976. 269. The Concept „Culture" in Legal Theory and in Political Science. Referat w I Komitecie Badwczym Swiatowego Kongresu International Political Science Association, Edynburg, VIII, 1976 (Report at the I Research Committee of International Congress of IPSA, Edinburgh, V I I I , 1976). Vervielfältigt, Brüssel 1976. 270. Norms and Values in Politics. Referat w X X Grupie Specjalistów Swiatowego Kongresu International Political Science Association, Edynburg, V I I I , 1976 (Report at the X X Group of Experts of International Congress of IPSA, Edinburgh, V I I I , 1976). Vervielfältigt, Brüssel 1976. (Stand: 31. Dezember 1992)
Verzeichnis der Mitarbeiter Aarnio, Aulis, Prof. Dr., Director, University of Tampere, Research Institute for Social Sciences, P.O. Box 607, SF-33101 Tampere Arnaud , André-Jean, Prof. Dr., Scientific Director, International Institute for the Sociology of Law, A . P. 28, E-20560 Onati Bjarup, Jes, Lektor, Dr., Institut for Retslaere, Aarhus Universitet, Universitetsparken 350, DK-8000 Àrhus C Broekman, Jan M . , Prof. Dr., Centrum voor Grondslagenonderzoek van het Recht, Katholieke Universiteit Leuven, Tiensestraat 41, Β-3000 Leuven Dreier, Ralf, Prof. Dr., Lehrstuhl für Allgemeine Rechtstheorie, Universität Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 6, D-37073 Göttingen Ferrari, Vincenzo, Prof. Dr., Università degli Studi di Milano, Istituto di Filosofia e Sociologica del Diritto, Via Festa del Perdono, 7,1-20122 Milano Galindo, Fernando, Prof. Dr., Universidad de Zaragoza, Facultad de Derecho, E-50009 Zaragoza Garzón Valdés, Ernesto, Prof. Dr., Hohenzollernstraße 19, D-53173 Bonn Gizbert-Studnicki,
Tomasz, Prof. Dr., ul. Szlak 16a/8, PL-31-161 Kraków
Hatakka, Minna, c/o Prof. Dr. Hannu Tapani-Klami, Keinutie 11149, SF-00940 Helsinki J0rgensen, Stig, Prof. Dr., Institut for Retslaere, Aarhus Universitet, Universitetsparken 350, DK-8000 Ârhus C Kastinen, Johanna, c/o Prof. Dr. Hannu Tapani-Klami, Keinutie 11149, SF-00940 Helsinki Kaufmann, Arthur, Prof. Dr. Dr. h.c., Longinusstraße 3, D-81247 München Klami, Hannu Tapani, Prof. Dr., Keinutie 111 49, SF-00940 Helsinki Klenner, Hermann, Prof. Dr., Gubitzstraße 40, D-10408 Berlin Knapp, Viktor, Prof. Dr. Dr. Dr. h.c., Institute of Law, Czechoslovak Academy of Sciences, Nové Mèsto, Nârodni Trida 18, 116 91 Praha Krawietz , Werner, Prof. Dr. Dr. Dr. h. c., Lehrstuhl für Rechtssoziologie, Rechts- und Sozialphilosophie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Bispinghof 24/25, D-48143 Münster Kubes, Vladimir, Prof. Dr., Charvatskâ 17, 612 00 Brno Lang, Wiesîaw, Prof. Dr., ul. Hanki Sawickiej 7. m. 7., PL-87-100 Tonm
488
Verzeichnis der Mitarbeiter
Mollnau, Karl Α . , Prof. Dr., Stubenrauchstraße 85, D-15732 Eichwalde Ott, Walter, Prof. Dr., Rechtswissenschaftliches Seminar der Universität Zürich, Wilfriedstraße 6, CH-8032 Zürich Paulson, Stanley L., Prof. Dr., Washington University in St. Louis, School of Law, Campus Box 11 20, One Brookings Drive, St. Louis, Missouri 63130, USA Peczenik, Aleksander, Prof. Dr., Juridiska Institutionen vid Lunds Universitet, Box 11 65, S-221 05 Lund Robles, Gregorio, Prof. Dr., Principe de Vergara 208-B, 1°A, E-28002 Madrid Troper, Michel, Prof. Dr., Université de Paris X - Nanterre, U . F . R. de Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, 200, Avenue de la République, F-92001 Nanterre (Cedex) Varga, Csaba, Prof. Dr., Political Adviser, Office of the Prime Minister, Republic of Hungary, P.O. Box 2, H-1357 Budapest Vernengo, Roberto J., Prof. Dr., Teodoro Garcia 3030,1425 Buenos Aires, Argentinien Walter, Robert, Prof. Dr. Dr., Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, Universität Wien, Schottenbastei 10 -16, A-1010 Wien Weinberger, Ota, Prof. Dr. Dr., Institut für Rechtsphilosophie, Karl-Franzens-Universität Graz, Universitätsstraße 27/11, A-8010 Graz Winston, Kenneth I., Prof. Dr., Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 79 John F. Kennedy Street, Cambridge, Massachusetts 02138, USA Wróblewski, Jerzy, Prof. Dr., Katedra Teorii Patìstwa i Prawa, Wydziaï Prawa i Administracji, Universytet Lódzki, ul. Narutowicza 59a, PL-90-131 Lódz Ziembinski, Zygmunt, Prof. Dr., ul. Nad Potokiem 27 D/9, PL-60-639 Poznan Zirk-Sadowski,
Marek, Prof. Dr., ul? Narutowicza 25/17 B, PL-90-125 Lódz

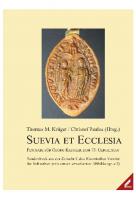


![Herausforderung Umweltmanagement: Zur Harmonisierung des Spannungsfeldes zwischen Ökonomie und Ökologie. Festgabe für Gert von Kortzfleisch zum 75. Geburtstag [1 ed.]
9783428488544, 9783428088546](https://dokumen.pub/img/200x200/herausforderung-umweltmanagement-zur-harmonisierung-des-spannungsfeldes-zwischen-konomie-und-kologie-festgabe-fr-gert-von-kortzfleisch-zum-75-geburtstag-1nbsped-9783428488544-9783428088546.jpg)

![Ontologie des Rechts [1 ed.]
9783428459858, 9783428059850](https://dokumen.pub/img/200x200/ontologie-des-rechts-1nbsped-9783428459858-9783428059850.jpg)
![Systemmanagement und Managementsysteme: Festgabe für Gert v. Kortzfleisch zum 70. Geburtstag [1 ed.]
9783428472529, 9783428072521](https://dokumen.pub/img/200x200/systemmanagement-und-managementsysteme-festgabe-fr-gert-v-kortzfleisch-zum-70-geburtstag-1nbsped-9783428472529-9783428072521.jpg)

![Privatautonomie, Eigentum und Verantwortung: Festgabe für Hermann Weitnauer zum 70. Geburtstag [1 ed.]
9783428446490, 9783428046492](https://dokumen.pub/img/200x200/privatautonomie-eigentum-und-verantwortung-festgabe-fr-hermann-weitnauer-zum-70-geburtstag-1nbsped-9783428446490-9783428046492.jpg)
![Sprache, Performanz und Ontologie des Rechts: Festgabe für Kazimierz Opaƚek zum 75. Geburtstag [1 ed.]
9783428473908, 9783428073900](https://dokumen.pub/img/200x200/sprache-performanz-und-ontologie-des-rechts-festgabe-fr-kazimierz-opaek-zum-75-geburtstag-1nbsped-9783428473908-9783428073900.jpg)