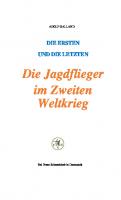Sachsenspiegel: Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift. Kommentarband 9783050069098, 9783050023595
239 22 45MB
German Pages 418 [424] Year 1995
Polecaj historie
Citation preview
Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels Aufsätze und Untersuchungen Kommentarband zur Faksimile-Ausgabe
Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels Aufsätze und Untersuchungen
Kommentarband zur Faksimile-Ausgabe Herausgegeben von Ruth Schmidt-Wiegand
Akademie Verlag
Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme Eike (von Repgow): Sachsenspiegel : die Wolfenbütteler Bilderhandschrift / Eike von Repgow. Hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. Berlin : Akad.-Verl. ISBN 3-05-002358-9 NE: Schmidt-Wiegand, Ruth Faks.-Bd. - 1993 Eike (von Repgow): Sachsenspiegel : die Wolfenbütteler Bilderhandschrift / Eike von Repgow. Hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. — Berlin : Akad.-Verl. ISBN 3-05-002358-9 NE: Schmidt-Wiegand, Ruth Textbd. - 1993 Eike (von Repgow): Sachsenspiegel : die Wolfenbütteler Bilderhandschrift / Eike von Repgow. Hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. — Berlin : Akad.-Verl. ISBN 3-05-002358-9 NE: Schmidt-Wiegand, Ruth Kommentarbd. - 1993
Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels : Aufsätze und Untersuchungen / hrsg. von Ruth Schmidt-Wiegand. Berlin : Akad.-Verl., 1993 ([Sachsenspiegel / Eike von Repgow] ;#Kommentarbd.) ISBN 3-05-002359-7 NE: Schmidt-Wiegand, Ruth [Hrsg.] © Akademie Verlag GmbH, Berlin (1993) Der Akademie Verlag ist ein Unternehmen der VCH-Verlagsgruppe Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form - durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren — reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Gedruckt auf säurefreiem und chlorarm gebleichtem Papier Satz: Hubert & Co., D-37079 Göttingen Druck: Colordruck, Kurt Weber GmbH, D-69181 Leimen Bindung: IVB Heppenheim GmbH, D-64646 Heppenheim Printed in the Federal Republic of Germany
Vorwort Dieser Band ist kein Kommentarband im üblichen Sinne. Er braucht dies auch nicht zu sein, da bereits im Textband dieser Ausgabe - parallel zur diplomatischen Umschrift, zum zitierfähigen Text und zur neuhochdeutschen Übersetzung - ein Text-BildleistenKommentar enthalten ist, der die Aufgabe einer von Bild zu Bild fortschreitenden Kommentierung erfüllt. Er beruht auf den Kommentaren zur Dresdener Bilderhandschrift und zur Heidelberger Bilderhandschrift, die Karl von Amira und Walter Koschorreck ihren Ausgaben beigegeben haben, wie auf den Untersuchungen, die im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 231 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ,Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter' von einem Team in acht Jahren durchgeführt worden sind, das sich mit den deutschsprachigen Rechtsbüchern befaßte. In dem vorliegenden Band konnte deshalb auf einen Kommentar dieser Art verzichtet werden. Die hier abgedruckten Arbeiten von Wissenschaftlern, die der Münsteraner Gruppe angehörten oder ihr nahestanden, haben eine andere Aufgabe. Anknüpfend an frühere Veröffentlichungen, die aus Kolloquien des Projekts , Rechtsbücher als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit' mit auswärtigen Gelehrten hervorgegangen sind, werden hier Text und Bild übergreifende Sachthemen wie die Werk- und Wirkungsgeschichte des Sachsenspiegels, die Ikonographie und Rechtssymbolik der Codices picturati, die Gebärden, Wappen und Gewänder, Sprache und Stil u. a. m. behandelt. Der Benutzer der Ausgabe soll dadurch zu einem gezielten Lesen und Betrachten von Text und Bild und damit zu einem vertieften Verständnis der Uberlieferung geführt werden, damit er sich das historische und soziokulturelle Umfeld, in das sie gehört, besser erschließen kann. Die Register der Rechtswörter und Namen haben den gleichen Zweck. Dem Band sind auch die Blätter der Dresdener Bilderhandschrift mit Abbildungen, zitierfähigem Text und Ubersetzung beigegeben worden, die dem Wolfenbütteler Codex fehlen. Ziel war es, auf die-
se Weise dem Benutzer einen Eindruck von dem ursprünglichen Uberlieferungsstand der verlorengegangenen Stammhandschrift und damit von der funktionalen Gruppe der Codices picturati zu vermitteln. Eine Synopse der vier Bilderhandschriften mit der gängigen Zählung der Bestimmungen des Land- und Lehnrechtes soll den Vergleich mit der übrigen SachsenspiegelUberlieferung erleichtern. Allen Beiträgern, die zur Verwirklichung dieses Zieles durch ihren Einsatz und ihr Engagement beigetragen haben, sei auch an dieser Stelle gedankt. Zu danken ist aber auch der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die durch die Förderung des Teilprojekts die Entstehung dieser Ausgabe mit Faksimile, Textund Kommentarband ermöglicht hat. Hier sind besonders Dr. Briegel und Dr. Funk zu nennen. In diesem Zusammenhang ist auch an die Kolloquien zu erinnern, die in regelmäßigen Abständen stattgefunden haben, um die Mitarbeit des Teilprojekts bei der Herstellung und Einrichtung der Ausgabe mit Rat und Tat zu unterstützen. Dieser Dank gilt vor allem Prof. Dr. Hans Fromm/München, femer Prof. Dr. Friedrich Ebel/ Berlin, Prof. Dr. Hans Holzhauer/Münster, Prof. Dr. Thomas Klein/Bonn, wie auch den Kollegen im Sonderforschungsbereich Prof. Dr. Klaus Grubmüller, Prof. Dr. Peter Johanek, Prof. Dr. Christel MeierStaubach und dem langjährigen Sprecher des Sonderforschungsbereichs, Prof. Dr. Hagen Keller. Wie bei dem Textband habe ich auch hier meinen Mitarbeitern zu danken: Bärbel Müller M.A., Dr. Werner Peters, Dr. Friedrich Scheele und Dr. Dagmar Hüpper. An den Schreibarbeiten und Korrekturen haben sich dankenswerterweise Marlies Peters, Petra Menke M.A. und Dr. Ulrike Schowe beteiligt. Unser Dank gilt auch dem Verlag, besonders Dr. Gerd Giesler, Christa Becker und Max Denk, die die oft schwierige Drucklegung dieses Bandes mit Verständnis begleitet haben.
Münster, im Juli 1993
Die Herausgeberin
Inhalt Vorwort
V
Ruth Schmidt-Wiegand Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
1
Clausdieter Schott Der Sachsenspiegel als mittelalterliches Rechtsbuch
25
Rolf Lieberwirth Die Entstehung des Sachsenspiegels und Landesgeschichte
43
Rolf Lieberwirth Die Wirkungsgeschichte des Sachsenspiegels
63
Roderich Schmidt Kaiser, König und Reich in der Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels
87
Klaus Naß Die Wappen in der Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels
97
Gernot Kocher Die Rechtsikonographie
107
Norbert H. Ott Rechtsikonographie zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Der , Sachsenspiegel' im Kontext deutschsprachiger illustrierter Handschriften
119
Dagmar Hüpper Die Bildersprache. Zur Funktion der Illustration
143
Dagmar Hüpper Kleidung
163
Ulrike Lade-Messerschmied Die Gebärdensprache der Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels
185
Ruth Schmidt-Wiegand Sprache und Stil der Wolfenbütteler Bilderhandschrift
201
Ruth Schmidt-Wiegand Der Rechtswortschatz
219
Brigitte Janz Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. Anmerkungen zur Kodikologie und zur ,Aussagekraft' der Textlücken
233
Anhang Glossar der Rechtswörter Werner Peters und Friedrich Scheele unter Mitarbeit von Bärbel Müller
249
Namenregister Friedrich Scheele
327
Synopse. Uberblick über die in den Bilderhandschriften illustrierten Textstellen des Sachsenspiegels . . . Rolf Lieberwirth
333
Ergänzungsblätter aus der Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels
357
Ruth Schmidt-Wiegand
Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels Als Karl von Amira im Jahre 1902 seine FaksimileAusgabe der Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels der Öffentlichkeit übergab, hatte er seine Einleitung mit einem Handschriftenstemma versehen', das auf einem subtilen Vergleich der vier erhaltenen Bilderhandschriften des Rechtsbuches beruhte 2 . Dieses Stemma hat bis auf den heutigen Tag die wissenschaftliche Diskussion über die Handschriftenverhältnisse der Codices picturati bestimmt 3 , obwohl ihm in mancher Beziehung die Grundlagen längst entzogen sind. Wenn dieses Stemma dennoch auch diesem Kommentarband vorangestellt wird, so steht dahinter der Gedanke, daß es für das interdisziplinäre Gespräch über die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, das erfreulicherweise seit einigen Jahren wieder in Gang gekommen ist, als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen wie als Basis für das gegenseitige Verständnis hilfreich sein kann. In diesem Sinne wird es auch an anderer Stelle in diesem Kommentarband verwendet 4 . An der Spitze der Uberlieferung steht danach eine verlorene Stammhandschrift (X), der Archetypus der Überlieferungsgruppe ,Bilderhandschriften' oder C o dices picturati', auf den sich die erhaltenen Handschrif-
ten 5 aus Oldenburg (O), Heidelberg (H) und Dresden (D) über die ebenfalls verlorenen Zwischenglieder (Y und N) zurückführen lassen. Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift (W) erscheint in diesem Stemma als
X
/ H
2 KARL VON AMIRA, D i e G e n e a l o g i e d e r B i l d e r h a n d s c h r i f t e n
des Sachsenspiegels, Abhandlungen der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1. Kl., Bd. X X I I , II. Abt., M ü n c h e n
1 9 0 2 , S. 3 2 7 - 3 8 5 .
\
N
D
O
W Tochterhandschrift oder Kopie des Dresdener Codex picturatus. Die „eigentliche Kraft der Erfindung" 6 lag danach bei dem Illustrator der Stammhandschrift. Er entschied sich nicht allein für eine durchgehende Illu5 Nähere Einzelheiten über die Codices picturati in der ,Einführung in die Ausgabe', Textband, S. 2 f., ferner Gott ist selber Recht. Die vier Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Oldenburg, Heidelberg, Wolfenbüttel und Dresden (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek
1 Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, hg. von KARL VON AMIRA, Erster Band, Facsimile der H a n d schrift, Neudruck der Ausgabe von 1902, Osnabrück 1 9 6 8 , S. 1 9 .
Y
N r . 67) hg. von
RUTH SCHMIDT-WIEGAND
-
WOLFGANG MILDE, 2. verb. Aufl. Wolfenbüttel 1993. 6 VON AMIRA (wie Anm. 2) S. 80. In diesem Zusammenhang sei auf das Autorenbild zum Epilog (fol. 85 recto) aufmerksam gemacht, eine geniale Erfindung des Illustrators d e r S t a m m h a n d s c h r i f t ; vgl. KARL VON AMIRA, D i e D r e s -
dener Bilderhandschrift, Zweiter Band, Erläuterungen, Teil 1 u. 2, Leipzig 1925/26, hier II, 2, S.33: „Von diesem Bilde weiß man nicht, was man mehr bewundern soll, die Unbefangenheit und Verwegenheit des Meisters
Bilderhand-
o d e r seine T r e f f s i c h e r h e i t . " RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
schrift des Sachsenspiegels. Kommentar zum Faksimile von Cpg 164, F r a n k f u r t / M a i n 1970, S. 161.
Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 22, 1988, S. 357-387, insb. S.365f.
3 WALTER KOSCHORRECK, D i e
Heidelberger
4 Vgl. in d i e s e m B a n d e BRIGITTE JANZ, S. 2 3 4 .
2
Ruth Schmidt- Wiegand
stration des Textes, wie sie nur wenige deutschsprachige Werke wie z. B. den Willehalm' Wolframs von Eschenbach 7 oder den ,Welschen Gast' Thomasins von Zirclaire 8 auszeichnet. Er schuf auch die Typisierung von Sachen und Personen wie die Einführung von Stereotypen, Chiffren, Zeichen und Symbolen, eine „Sprache in Bildern" 9 , die das konkrete Geschehen wie die abstrakte Begrifflichkeit des Textes angemessen zu veranschaulichen vermochte 1 0 . Die jüngeren Illustratoren haben das Zeichensystem ihrer Vorlagen mehr oder weniger genau übernommen, vernachlässigten aber auch gelegentlich besondere Umstände und Einzelheiten; sie aktualisieren aber auch den Text-Bild-Zusammenhang durch neue Zeichen und Symbole, unter Umständen jeder auf seine Weise. Diese Modifikationen oder Varianten auf der Bildseite sind für die Geschichte der illustrierten Handschriften des Sachsenspiegels, um die es schließlich auch bei diesem Stemma geht, höchst aufschlußreich. Drei Beispiele mögen das Ausgeführte verdeutlichen. 1. In der Wolfenbütteler wie in der Dresdener Bilderhandschrift ist die Prologseite mit einem Autorenbild geschmückt 11 . Es zeigt die christlichen Könige
7 WOLFRAM VON ESCHENBACH, W i l l e h a l m . D i e B r u c h s t ü c k e
der ,Großen Bilderhandschrift'. Bayerische Staatsbibliothek München Cgm 193, III; Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, Graphische Sammlung H z 1104-1105 Kapsel
1607. I m F a k s i m i l e h g . v o n ULRICH MONTAG,
Stuttgart 1985; dazu WERNER SCHRÖDER, Text und Bild der ,Großen Bilderhandschrift' von Wolframs „Willehalm", in: Zeitschrift f ü r deutsches Altertum 116, H e f t 4, 1 9 8 7 , 4. Q u a r t a l , S. 2 3 9 - 2 6 8 .
8 Heidelberg, Universitätsbibliothek Cpg. 389; dazu NORBERT H . OTT, Vorläufige Bemerkungen zur ,Sachsenspiegel'-Ikonographie, in: Text-Bild-Interpretation. Untersuchungen zu den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, h g . v o n RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
I. T e x t b a n d ,
II.
Ta-
felband (Münstersche Mittelalter-Schriften 5 5 / 1 u. II) München 1986, S. 33-43, insb. S . 3 6 f . 9 SCHMIDT-WIEGAND (wie A n m . 6 ) S. 3 6 8 ; z u m G r u n d s ä t z -
lichen auch GEORG KAUFFMANN, Sprache und bildende Kunst, in: Kunst als Bedeutungsträger. Gedenkschrift f ü r Günter Bandmann,
h g . v o n WERNER BUSCH -
HAUSHERR - EDUARD TRIER, B e r l i n
REINER
1 9 7 8 , S. 5 4 1 - 5 4 9 .
10 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Text und Bild in den Codices picturati des , Sachsenspiegels'. Überlegungen zur Funktion der Illustration, in: Text-Bild-Interpretation (wie A n m . 8) S. 1 1 - 3 1 ;
CLAUSDIETER S C H O T T ,
Zur
bildlichen
Wiedergabe abstrakter Textstellen im Sachsenspiegel, in: e b d . S. 1 8 9 - 2 0 3 .
11 W fol. 9 verso; D fol. 3 verso; zur Interpretation Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S.58 u. Abb. 11.
Konstantin und Karl auf einem Kastenthron sitzend, wie sie dem vor ihnen knienden Eike das Recht gleichsam diktieren 12 . Hinter dem linken Arm des Autors zieht sich ein leeres Spruchband in die Höhe 1 3 . Sehr viel weiter unten im Text heißt es entsprechend von Gottes Recht und Gebot, das uns [...] ouch cristine kunige habin gesaczt, Constantin und Karle, in Sachsinlande noch sines rechtis nucz. In der Oldenburger Bilderhandschrift 1 4 sind das Bild des Autors und das Doppelbild der Herrscher 1 5 voneinander getrennt, indem das Herrscherbild erst auf der nächsten Seite bei dem Text erscheint, zu dem es gehört. Hier heißt es von Gottes e vnde bot, daß es kerstene cuninge gesät hebbet, constantin vnde karl, an den süssen lant noch ires regtes tud Die Zusammenführung des Herrscher- und des Autorenbildes in D und W ist zweifellos sekundär. Hier hat O den älteren Zustand bewahrt, wenn Eike in der Pose des Schreibers mit Schreibutensilien und mit dem Codex gezeigt wird, wie er, unter dem Wappenschild des Herzogs von Oldenburg sitzend 1 6 , von dem Heiligen
12 Zum theologischen Gehalt vgl. ULRICH DRESCHER, Geistliche D e n k f o r m e n in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 12) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1989, S. 69-78 u. 110-119; SCHOTT (wie Anm. 10) S. 191. 13 Zur Rolle unbeschriebener Spruchbänder vgl. MICHAEL CURSCHMANN, Pictura laicorum litteratura ? Überlegungen zum Verhältnis von Bild und volkssprachlicher Schriftlichkeit im H o c h - und Spätmittelalter bis zum Codex Manesse, in: Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter, Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, hg. von H A G E N KELLER - KLAUS GRUBMÜLLER - NIKOLAUS STAU-
BACH (Akten des Internationalen Kolloquiums 17.-19. Mai 1989, Münstersche Mittelalter-Schriften 65) M ü n chen 1992, S. 211-229. 14 O fol. 6 recto; zur Interpretation Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 34 u. Abb. 1; Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, hg. von der Kulturstiftung der Länder in Verbindung mit der Niedersächsischen S p a r k a s s e n s t i f t u n g d u r c h RUTH SCHMIDT-WIEGAND
(Patrimonia 50) Berlin - H a n n o v e r Abb. 1.
1993, S. 86 f. u.
15 O fol.6 verso; Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 38 u. Abb. 3; Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 8 8 f. u. Abb. 2. 16 Zu dem Auftraggeber, Graf Johann III. von Oldenburg, und zu dem Schreiber, Hinricus Gloyesten, DAGMAR HÜPPER, Auftraggeber, Schreiber und Besitzer von Sachsenspiegel-Handschriften, in: D e r Sachsenspiegel als B u c h , h g . v o n R U T H SCHMIDT-WIEGAND - DAGMAR H Ü P -
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
Geist in Form einer Taube mit Nimbus zu seinem Werk inspiriert wird (Abb. 1). Dieses Bild steht ganz in der mittelalterlichen Tradition des Autoren- bzw. auch des Evangelistenbildes 17 , was ebenfalls dafür spricht, daß der Illustrator von O hier der verlorenen Stammhandschrift näher steht als die Handschriften D und W. Die Heidelberger Bilderhandschrift fällt an dieser Stelle wegen Lagenverlustes aus. Sie hat zu Beginn des Lehnrechtes ein sogenanntes Lehrer-Schüler-Bildnis 18 , das in diesem Fall einem Autorenbild zu vergleichen ist (Abb. 2). Denn in dem rutenschwingenden, bärtigen Lehrer, vor dem ein Schüler in Herrentracht und mit Unfähigkeitsgestus sitzt, wird man dem Text nach Swer lenrecht kunnen wil, der volge dis buches lere Eike von Repgow zu sehen haben. Die Dresdener und Wolfenbütteler Bilderhandschrift haben den Lehrer u n d / o d e r Autor durch einen König ersetzt, wahrscheinlich Friedrich II., auf den nach gelehrter Uberlieferung das sächsische Lehnrecht zurückgehen soll 19 . Diese, wiederum sekundäre Veränderung des magistercum-discipulis-Büdes entspricht einem allgemeinen Trend, die Rechtsspiegel, die ursprünglich „private" Rechtsaufzeichnungen waren, an das Kaiserrecht heranzuführen und sie damit zu legitimieren 20 . Die Plazierung des Mainzer Reichslandfriedens von 1235 an den Anfang von W und D, geschmückt mit einem Kai-
17
PER (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 1) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1991, S.57-104, insb. S.57-61; DIES., D e r Kolophon. Ein Schreiber und sein Postskriptum, in: Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 77-83. P E T E R B L O C H , Autorenbild, in: Lexikon der christlichen Ikonographie, hg. von E N G E L B E R T K I R S C H B A U M , 1, Rom - Freiburg - Basel - Wien 1968, Sp. 232-234; W O L F G A N G MILDE, Mittelalterliche Handschriften der H e r z o g August Bibliothek, F r a n k f u r t / M a i n 1972, Frontispiz und S. 26 Nr. 13; B U R G H A R T W A C H I N G E R , Autorschaft und Uberlieferung, in: Autorentypen, hg. von W A L T E R H A U G
Tübingen 1 9 9 2 , S . 1 - 2 8 , insb. f. 18 H fol. 1 recto; zur Interpretation Gott ist selber Recht -
BURGHART WACHINGER,
S. 11
(wie
A n m . 5)
S. 6 8
A b b . 1;
SCHMIDT-WIEGAND
(wie
Anm. 6) S. 364 f.; P E T E R B L O C H , Lehrer, Lehrszenen, in: Lexikon der christlichen Ikonographie (wie Anm. 17), 3, 1971, Sp. 8 6 - 8 8 .
19 W fol. 59 recto, D fol. 57 recto; VON AMIRA, Erläuterungen II, 2 (wie Anm. 6) S. 148 f. 2 0 W I N F R I E D T R U S E N , Die Rechtsspiegel und das Kaiserrecht, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung f ü r deutsche Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 102, 1985, S. 1 2 - 5 9 .
3
serbild 21 , die diese Bilderhandschriften vor den beiden anderen auszeichnet, ist auch vor diesem Hintergrund zu sehen. 2. Ldr III 63 § 2 äußert sich Eike zum Verhältnis von Acht und Bann, ein in seiner Zeit brennendes Thema, bei dem es u. a. darum ging, ob auf die Exkommunikation von kirchlicher Seite notwendig die Reichsacht zu folgen habe 2 2 . Der Autor des Sachsenspiegels ist hier anderer Meinung: Ban schadit der sele unde ennimt doch nimande den lip noch enkrenkit nimande an lantrechte unde an lenrechte da envolge des kuninges achte noch. Das dazugehörige Bild in der Wolfenbütteler wie Dresdener Bilderhandschrift 2 3 zeigt den Kaiser auf dem Richterstuhl sitzend, wie er die Reichsacht über den Gebannten verhängt, aus dessen Mund die Seele in Gestalt eines Kindes entflieht, das vom Teufel geholt wird. Diese Fassung des Bildes in W und D ist nicht die ursprüngliche, wie ein Vergleich mit der Heidelberger und der Oldenburger Bilderhandschrift nahelegt 24 . In H ist an der Stelle des Königs oder Kaisers ein Priester mit Alba und Stola zu sehen, der einen stabartigen Gegenstand zu Boden schleudert, während er mit dem linken Zeigefinger auf den Teufel deutet (Abb. 3). Den ursprünglichen Zustand aber hat auch hier wiederum der Oldenburger Codex bewahrt 2 5 . D a r gestellt ist ein Geistlicher, der eine brennende Kerze verkehrt herum in der H a n d hält, während er eine andere bereits weggeworfen hat (Abb. 4). Beide Darstellungen ( H und O) knüpfen an einen Exkommunikationsritus an, bei dem brennende Kerzen fortgeworfen und gelöscht zu werden pflegten, ein Brauch, der sich
21 W fol. 1 recto bis 3 verso, D fol. 1 recto und 1 verso; B R I G I T T E J A N Z , Wir sezzen unde gebiten. D e r , M a i n z e r Reichslandfriede' in den Bilderhandschriften des S a c h senspiegels', in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 112, 1990, S. 242-266. 22 E D U A R D E I C H M A N N , Acht und Bann im Reichsrecht des Mittelalters, Paderborn 1909; DERS., Kirchenbann und Königswahlrecht im Sachsenspiegel, in: Historisches J a h r b u c h 31, 1910, S. 323-333; F R I E D R I C H M E R Z B A C H E R , Bann, kirchlich, in: H a n d w ö r t e r b u c h zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. von A D A L B E R T E R L E R - E K K E H A R D K A U F M A N N , Bd. 1, Berlin 1971, Sp. 306-308. 23 W fol. 52 verso, D fol. 48 verso; S C H M I D T - W I E G A N D (wie A n m . 6 ) S. 3 7 5 f.; VON AMIRA, E r l ä u t e r u n g e n I I , 2 (wie
Anm. 6) S . 7 5 f . 24 H fol. 22 recto, O fol. 82 recto; W A L T E R K O S C H O R R E C K , Die Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. Kommentar, F r a n k f u r t / M a i n 1970, S. 122. 25 VON AMIRA, E r l ä u t e r u n g e n I I , 2 (wie A n m . 6 ) S. 75.
Ruth Schmidt-
4 z. B. auch in der Redewendung mit Kerzen den Bann verschießen26 verfestigt hat. Hier ist also mündliche Tradition mit ins Bild eingegangen und in H , wo der Priester die Kerze zerbrochen hat, sogar mit einer anderen Redewendung wie über jemanden den Stab brechen kontaminiert worden, wenn man die Vorstellung vom Lebenslicht hinzunimmt 2 7 . Auf jeden Fall handelt es sich um ein Stück „Volksfrömmigkeit", das in das Bild eingegangen ist, in O und H stärker als in D und W, die rationalisiert bzw. auch aktualisiert haben. Denn der Bann, in den Bildern der Codices picturati verstanden als eine kirchliche Maßnahme in Form der Exkommunikation, war durch seine Verbindung mit der vom König verhängten Acht im politischen Leben längst zu einem Faktor ersten Ranges geworden. So verfügte Friedrich II. in der mit den geistlichen Fürsten geschlossenen Confoederatio cum principibus ecclesiasticis 1220, daß sechs Wochen nach der Verhängung auf den kirchlichen Bann die Reichsacht zu folgen habe, - eine Verfügung, die sich in der Öffentlichkeit anfangs nur schwer durchzusetzen vermochte. Auch Eike von Repgow hat sich gegen eine generelle Regelung dieser Art gewendet, wenn er die Möglichkeit, daß die Acht nicht notwendig auf den Bann folgen müsse, weiterhin bestehen läßt. Die Illustratoren von D und W, wo an die Stelle des Priesters, der „mit Kerzen" den Bann verschießt, der Kaiser getreten ist, der den Gebannten mit der Acht zu belegen hat, haben hier dem Autor wie dem Illustrator der Stammhandschrift gegenüber aktualisiert, war doch inzwischen die Meinung vom Zusammenhang zwischen Acht und Bann längst zum Allgemeingut der Zeit geworden, wie z. B. auch die programmatischen Worte des Spruchdichters Bruder Wernher 2 8 , eines geistigen Nachfahren Walthers von der Vogelweide, zeigen: Der ban und cechte sint ein tot / des libes und der sele gar. In diesem Fall spiegelt also die Bildgeschichte von O, H , D und W zugleich ein Stück Mentalitätsgeschichte wider. 3. Als drittes und letztes Beispiel sollen hier noch die Gerichtsbilder zu Ldr III 69 §§1.2 angeführt wer-
2 6 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, K e r z e ,
in:
Handwörterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichte 2, Berlin 1978, Sp.703706, insb. Sp.705. 2 7 EKKEHARD KAUFMANN, S t a b b r e c h e n , e b d . B d . 4,
Berlin
1990, Sp. 1 8 4 4 - 1 8 4 6 .
28 ANTON E. SCHÖNBACH, Beiträge zur Erklärung altdeutscher Dichtwerke. Viertes Stück: Die Sprüche des Bruder Wernher II. Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien, Philos.-Hist. Klasse 150, Wien 1 9 0 4 , S. 1 2 ff.
Wiegand
den. Im ersten Bildstreifen des Blattes 29 , dessen Text eine für die Kleiderordnung der Schöffen im Gericht wichtige Bestimmung enthält 3 0 , dingt der Graf, begleitet vom Schultheißen, bei Königsbann, was in D und W durch eine Krone, die auf einem Ständer liegt, veranschaulicht wird. Die Schöffen sind, wie es der Text vorschreibt, im Gegensatz zu dem Grafen und Schultheißen barhäuptig und haben Mäntel über ihre Schultern gelegt. Dies trifft auch für die Männer im Bildstreifen darunter zu, die betend unter den vier Urteilsrosen knien. Durch ihre Kleidung sind sie ebenfalls als Schöffen charakterisiert. Wie im Text ausgeführt, haben sie das Urteil nüchtern zu finden. Anders in der Heidelberger Handschrift; die Oldenburger Bilderhandschrift ist in diesem Fall wegen der mangelnden Farbgebung der Umrißzeichnungen 3 1 weniger aussagekräftig. In H handelt es sich bei den dargestellten Personen 3 2 unter den Urteilsrosen um diejenigen, über die Urteil gefunden wird und die duzch oder wendisch oder eigen oder vri sein können, was durch die Kleidung wie besondere Attribute deutlich gemacht wird 3 3
29 W fol.54 recto, D fol.50 recto. 30 Textband S. 270; Wo man dinget bi kuniges banne, da ensal noch schepphin noch richter kappin anhabin, hut, hutelin, hubin noch hanzchen. Mentele suln si uf den schulderin habin, ane wapin suln si sin. Dazu RUTH SCHMIDTWIEGAND, Kleidung, Tracht und Ornat nach den Bilderhandschriften des .Sachsenspiegels', in: Terminologie und Typologie mittelalterlicher Sachgüter: Das Beispiel der Kleidung. Internationales Round-Table-Gespräch Krems a.d. Donau, 6. Oktober 1986. Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs Nr. 10, Wien 1988, S. 143-145, insb. S. 144f. und Abb. 1. 31 Von den rund 600 Bildzeilen in O sind nur 44 Bildzeilen = 14 Seiten vollständig koloriert. Die Bildzeilen der übrigen 148 Seiten zeigen in der Regel nur Umrisse der Figuren, meist unter Vernachlässigung der Gesichter. Hierz u FRIEDRICH SCHEELE, K o d i k o l o g i s c h e
Anmerkungen
zum Codex picturatus Oldenburgensis, in: Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 37-58, insb. S. 49f.; doch dürfte fol. 84 recto in der Anlage (s.u. Anm. 32) auch hier eher H als D / W entsprechen. Das Lnr ist in O ohne Illustrationen geblieben. 32 H fol. 24 recto; KOSCHORRECK, Kommentar (wie Anm. 3) S. 128. 33 VON AMIRA, E r l ä u t e r u n g e n II, 2 (wie A n m . 6 ) S. 93. D e r
Sachse mit einem Messer, dem sog. Sax, vertritt hier den Deutschen; der Franke mit dem Fehkragen steht für den Freien. Der Wende hat die f ü r ihn charakteristischen Beinbinden und kurzgeschnittene Haare. Der Unfreie trägt ein braunes Arbeitskleid.
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
5
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
(Abb. 5). Die Heidelberger Bilderhandschrift steht hier nicht nur dem Text, sondern vermutlich auch der Stammhandschrift näher als die Dresdener und Wolfenbütteler, deren Illustratoren, primär der Illustrator von D oder von einer gemeinsamen Vorlage von D und W, die aber nicht mit Y identisch sein kann, eine Umdeutung oder Uminterpretation des ursprünglichen Bildes vorgenommen haben. Dies gilt auch für die Krone auf dem Ständer, gegenüber den beiden anderen Uberlieferungszeugen ( H und O) ein zusätzliches Zeichen für das Königsgericht, - wie denn die Freude der Illustratoren von D und W an Symbolen und Zeichen auch an den beiden Urteilsrosen deutlich wird, die im folgenden dritten Bildstreifen, der eine Illustration sogenannter Urteilsschelte enthält, gegenüber H und O eingeführt sind. Erwähnt sei in diesem Zusammenhang auch die Darstellung des Wenden im vierten und fünften Bildstreifen des Blattes mit einem rot-blau quergestreiften Rock, eine gewisse Abmilderung gegenüber H , wo der Wende im braunen Arbeitskleid und wiederum mit den charakteristischen Beinbinden und dem kurzen Haarschnitt gezeigt wird. Aus den drei Beispielen, die hier angeführt wurden, ergibt sich, daß die Wolfenbütteler Bilderhandschrift mit der ihr besonders nahestehenden Dresdener Handschrift am Ende einer Entwicklung der Codices picturati steht, f ü r die mental bedingte Umdeutungen, zeitbedingte Aktualisierungen wie Modernisierungen in bezug auf Kleidung und Haartracht und eine wachsende Vorliebe für Zeichen und Symbole charakteristisch sind. H a n d in Hand damit geht ein Rückgang drastischer Darstellungsmittel (Dreiarmigkeit, blutende Wunden etc.) 34 wie auch eine Verkümmerung der Gebärdensprache 3 5 , was an dieser Stelle über die bereits genannten Punkte hinaus zu ergänzen ist. Soziale wie stammesbedingte Unterschiede und Züge sogenannter
Volksfrömmigkeit sind besonders gut in der Heidelberger Bilderhandschrift wie im Oldenburger Codex bewahrt, die damit beide der Stammhandschrift näher stehen, als es im Stemma Karl von Amiras zum Ausdruck kommt, bei dem H , D und O auf einer Ebene liegen und W als direkter Abkömmling von D erscheint. Gewisse Modifikationen des Stemmas, das Karl von Amira erstellt hat, sind also heute unumgänglich. Sie ergeben sich nicht zuletzt aus der Datierung und Lokalisierung der verlorenen Stammhandschrift wie der uns erhaltenen Codices picturati des Sachsenspiegels. Ein in dieser Beziehung ergänztes Stemma findet sich in diesem Band an anderer Stelle 36 . Ein weiteres, das im Vorfeld dieser Ausgabe entstanden ist, wird hier eingerückt (vgl. S. 6). Bei ihm wird die Filiation der Handschriften mit den Angaben zu ihrer Datierung und Lokalisierung nach den älteren und jüngeren Forschungsergebnissen 37 zusammengefaßt und dadurch zugleich ein Überblick über den Gang wie den Stand der wissenschaftlichen Diskussion vermittelt. Nach Karl von Amira ist die Stammhandschrift X in die Mark Meißen zu lokalisieren, u. a. weil sie „obersächsische Texte" enthielt 38 . Diesem Ansatz hat schon 1943 aus der Sicht des Landeshistorikers Rudolf Kötzschke 3 9 widersprochen. Nach ihm ist die Stammhandschrift im östlichen Harzvorland, wahrscheinlich im Bistum Halberstadt, entstanden, - ein Ansatz, der von Klaus N a ß durch eine umfassende Untersuchung sämtlicher Wappen in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels 40 bestätigt worden ist. Die Zwischenstufe Y, auf die alle mitteldeutschen oder obersächsi36
KLAUS NASS s . u . S . 1 0 3 ; FRIEDRICH SCHEELE, di sal
man
alle radebrechen. Todeswürdige Delikte und ihre Bestrafung in Text und Bild der Codices picturati des Sachsenspiegels, Bd. I: Textband, Bd. II: Tafelband, Oldenburg 1992, hier I, S.35. 37 KLAUS NASS, D i e W a p p e n in d e n B i l d e r h a n d s c h r i f t e n d e s
3 4 Z u d i e s e n D a r s t e l l u n g s m i t t e l n RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels und ihr Verhältnis zum Text Eikes von Repgow (Wolfenbütteler Hefte 13) Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 1983, S.38. 35 Zur Gebärdensprache in W vgl. fol. 34 recto und verso sowie die Interpretation bei SCHMIDT-WIEGAND (wie
Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 8) S.229-264, insb. S.251-264; vgl. auch seinen Beitrag in diesem Bande, S. 97-105. 38 VON AMIRA, Genealogie (wie Anm. 2) S. 377 zur obersächsischen Sprachform von X. Unserer Meinung nach ist X n i e d e r d e u t s c h a b g e f a ß t g e w e s e n : RUTH SCHMIDT-
terlichen Recht, in: Frühmittelalterliche Studien 16, 1982,
WIEGAND, Die niederdeutsche Stammhandschrift der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Niederdeutschesjahrbuch 116, 1993, S. 1-18 u. unten DIES., Sprache und Stil, S.201-218, insb. S.206f.
S . 3 6 3 - 3 7 9 ; KARL VON A M I R A , D i e H a n d g e b ä r d e n i n d e n
39 RUDOLF KÖTZSCHKE, D i e H e i m a t d e r m i t t e l d e u t s c h e n Bil-
Bilderhandschriften des Sachsenspiegels (Abhandlungen der Königl.-Bayer. Akademie der Wiss., 1. Kl. 23. Bd. 2. Abt.) München 1905; vgl. auch in diesem Bande den Bei-
derhandschriften des Sachsenspiegels (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Kl. Bd. 96, H . 2 ) Leipzig 1943.
A n m . 34) S. 1 6 - 2 3 ; DIES., G e b ä r d e n s p r a c h e im m i t t e l a l -
t r a g v o n ULRIKE L A D E - M E S S E R S C H M I E D , S . 1 8 4 - 2 0 0 .
40
NASS ( w i e A n m . 3 7 ) S . 2 3 6 F .
u.ö.
Ruth Schmidt- Wiegelnd
6 X um 1291/95 (v.A.) / 1292/95 (Na.) nordöstlicher Harzraum Y um 1300 Obersachsen
H um 1300/15 (v. A.)\ 1295/1304 (Na.) Thüringen
N 1308/23 (1313) (v.A.) 1314/20 (Na.) Lüneburg
N 1
\
° 1336
\ \
Rastede
Lüneburg aus dem 2. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts geführt haben dürfte 4 2 , wird allein durch den Oldenburger Codex picturatus vertreten, den einzigen mittelniederdeutschen Text, der heute noch erhalten ist. Aufgrund eines Kolophons 4 3 ist dieser Text in das Jahr 1336 zu datieren. Der Vergleich aller Codices picturati untereinander bzw. ihrer Schilde und Wappen hat nun ergeben, daß von dem Illustrator der Dresdener Bilderhandschrift in einigen Fällen heraldische Wappen negativ redigiert worden sind, indem an die Stelle der historischen Wappen Leerschilde traten. Die Dresdener Bilderhandschrift kann also nicht als Leithandschrift für die Lokalisierung der Stammhandschrift herangezogen werden 44 . Hierfür ist H sehr viel eher geeignet, obwohl die Lokalisierung dieser Handschrift nach Obersachsen oder Thüringen nicht sicher bestimmt werden kann 4 5 . Immerhin dürfte sie mit den Wappen der Grafen von Wernigerode 46 und der Herren von Heimburg 4 7 , eines mit Halberstadt verbundenen Ministerialengeschlechts, der Stammhandschrift ähnlich nahestehen wie O, die an vergleichbarer Stelle ebenfalls das Wappen der Grafen von Wernigerode und das der Herren von Berwinkel zeigt, eines um Magdeburg und Halberstadt begüterten Ministerialengeschlechts 48 . Die Ersetzung des Wappens der Herren von Heimburg durch das Wappen der Her-
D um 1350 (v.A.) 1295/1363, näher an 1363 (Na.) Raum Meißen W um 1350/75 (v.A.) 3. Viertel 14.Jhd. (vor 1365) (Na.) Raum Meißen (Leisnig) sehen Bilderhandschriften zurückgehen, gehört nach Karl von Amira an den Anfang des 14. Jahrhunderts, nach neuerer Forschung möglicherweise auch noch in das letzte Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, da H in die Jahre 1295 bis 1304 datiert wird. Auch D kann - theoretisch gesehen - zwischen 1295 und 1363 geschrieben worden sein, wobei die Mitte des 14. Jahrhunderts das meiste für sich hat 4 1 . Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift gehört in das dritte Viertel des 14. Jahrhunderts. Die niederdeutsche oder niedersächsische Tradition, die über eine verlorene Bilderhandschrift am Weifenhof in
42
NASS
(wie
Anm. 37)
S. 2 3 0
und
SCHEELE
(wie
A n m . 36)
S. 35f. sowie Kap. I. 5.2., S. 38-45. 43 O fol. 1 3 3 verso und 1 3 4 recto, dazu H Ü P P E R (wie Anm. 16): Anno domini MCCCXXX sexto. Completus est liber iste, qui dicitur speculum saxonum, per manum hinrici monachi de rastede dicti gloyesten, quem librum iohannes comes in oldenborch scribi fecit [...]. Zum Oldenburger Codex auch E G B E R T K O O L M A N , in: Gott ist selber Recht (wie A n m . 5 ) S . 3 2 f . 44 N A S S (wie Anm. 37) S. 243, der den Archetypus von den W a p p e n der nordöstlichen H a r z r e g i o n geprägt sieht und in die Zeit zwischen 1292 und 1295 datiert, h a t darauf aufmerksam gemacht, d a ß sich König Adolf von Nassau von September 1294 bis J a n u a r 1295 und von September 1295 bis Juni 1296 in Sachsen und Thüringen aufhielt. 45 H i e r z u W I L F R I E D W E R N E R , Die Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels - Anmerkungen zu ihrer Geschichte und Kodikologie, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 8) S.213-218, insb. S . 2 1 7 f . 46 Zwei einander zugewandte silberne Fische auf rotem G r u n d , N A S S (wie A n m . 3 7 ) S.241 ff. u . ö . 4 7 R U T H G E S A H Ü B B E , Der f ü n f t e Heerschild in der Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, in: T e x t - B i l d - I n t e r p r e t a t i o n (wie A n m . 8) S . 2 7 1 - 2 7 6 .
41 Vgl. hierzu auch MILDE, in: Gott ist selber Recht A n m . 5 ) S.66.
(wie
48 O fol.7 verso; dazu Die Oldenburger Bilderhandschrift ( w i e A n m . 1 4 ) S. 9 2 u . A b b . 4 ; NASS ( w i e A n m . 3 7 ) S. 2 4 3 ;
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
ren von Colditz in D und W 4 9 , und darüber hinaus in W das Wappen der Burggrafen von Leisnig 50 , das dem Burggrafen Heinrich (1341-1394) zugeordnet werden kann, spiegeln den Weg wider, den die handschriftliche Überlieferung der Codices picturati genommen hat, einen Weg, der vom nordöstlichen Harzvorland bis in die Mark Meißen führte. Wie hat sich dieser Weg auf die Geschichte des Textes, seine Veränderung und seine Sprache ausgewirkt? Dabei ist zunächst nach dem Umfang und Aussehen der Stammhandschrift zu fragen. Die Stammhandschrift enthielt das gesamte Landund Lehnrecht, wahrscheinlich bereits mit der Einteilung des Rechtsbuches in vier Bücher, die möglicherweise eigens für diese Überlieferungsgruppe geschaffen worden ist 5 '. Der Text dieser Stammhandschrift war gegenüber der bisherigen Sachsenspiegeltradition durch Zusätze stark erweitert, enthielt aber auch ältere Stücke, die durch Auslassungen verkürzt waren. Sie besaß schon die Vorrede von der herren geburt52, den Prosa-Prolog und Textus prologi, mit denen der Sachsenspiegel in den Bilderhandschriften begann 5 3 . Auch ein Inhaltsverzeichnis war schon vorhanden, das in W vollständig und in D bruchstückhaft überliefert ist. Als Bestandteil von X ist dieses Inhaltsverzeichnis durch Übereinstimmungen seines Textes mit den entsprechenden Landrechtsbestimmungen von H gesichert 54 . In O hat das Register eine stark abweichende Form, die zu
49
G A B R I E L E VON O L B E R G , Auffassungen von der mittelalterlichen Gesellschaftsordnung in Text und Bild des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 8) S. 155-170, insb. S. 162 f. Ein geteilter Löwen-Balkenschild, vgl. N A S S (wie A n m . 37)
S.245.
fol. 5 2 recto, dazu N A S S (wie Anm. 3 7 ) S . 2 5 5 f.; M I L D E , in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 56. 51 Hierzu und zum Folgenden VON AMIRA, Genealogie (wie Anm. 2 ) ; ferner jetzt auch U L R I C H D I E T E R O P P I T Z , Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd. 1: Beschreibung der Rechtsbücher, Bd. 2: Beschreibung der Handschriften, Köln - Wien 1 9 9 0 ; F R I E D R I C H E B E L , Sachsenspiegel, in: H R G 4, Berlin 1 9 9 0 , Sp. 1 2 2 8 - 1 2 3 7 . 52 Hierzu jetzt auch R O L F L I E B E R W I R T H , Die Sachsenspiegelvorrede von der herren geburt, in: Der Sachsenspiegel als Buch (wie Anm. 16) S. 1-18. 5 3 Zu den Prologen des Sachsenspiegels D R E S C H E R (wie Anm. 12) insb. S. 88 ff. zu den Illustrationen der Prologseite. 54 BÄRBEL M Ü L L E R , Kapitelverzeichnisse und „Sachregister" zum Sachsenspiegel in Mgf 10 und in der Wolfenbütteler Bilderhandschrift, in: Der Sachsenspiegel als Buch (wie Anm. 16) S. 143-168. 50
W
7
einer besonderen Textfassung gehört, der diese H a n d schrift folgt. Das Register der Wolfenbütteler Bilderhandschrift hatte vor allem für die Rekonstruktion des Umfangs der Stammhandschrift Bedeutung, der sich von hier aus auf 950 bis 960 Bildstreifen berechnen läßt 5 5 , während von H 310, von O 578, von D 924 und von W 776 Bildstreifen erhalten sind. Der Stammhandschrift fehlte die Reimvorrede, in der sich Eike von Repgow über seinen Mäzen, den Grafen Hoyer von Falkenstein, und die Intention seines Werkes geäußert hat 5 6 . Es fehlte ihr noch der Mainzer Reichs landfriede in seiner deutschen Fassung, der in D fragmentarisch und in W so gut wie vollständig erhalten ist. Alles in allem wird man wohl festhalten können, daß sich die Wolfenbütteler Bilderhandschrift gegenüber den anderen Codices picturati, einschließlich der Dresdener Bilderhandschrift, durch eine besonders reiche Mitüberlieferung auszeichnet. Erst durch den Vergleich aller überlieferten Bildstreifen in den H a n d schriften O, H , D und W und der zu diesen Bildstreifen gehörigen Texte wird man zu einer Revision des Stemmas kommen können, die auf sicheren Grundlagen steht. Für diese Ausgabe war dies insofern nicht möglich, als die Oldenburger Bilderhandschrift, die sich bis vor kurzem in Privatbesitz befand, nicht zugänglich gewesen ist. Erst durch ihre Veräußerung Ende des Jahres 1991 hat sich dies geändert 5 7 . Zu diesem Zeitpunkt aber war der Druck der vorliegenden Ausgabe schon so weit vorangeschritten, daß die Einarbeitung einer auf Autopsie beruhenden Überprüfung der Handschrift O nicht mehr zu bewerkstelligen war. Entsprechendes gilt grundsätzlich auch für den Kommentarband dieser Ausgabe. Doch wird der heute mehr denn je notwendig gewordene Vergleich zu gegebener Zeit an anderer Stelle nachgeholt werden: Die Forschung wird an diesem Punkt weiterzugehen haben. In welche Richtung, mögen die folgenden Beobachtungen verdeutlichen, die indessen aus den bereits genannten Gründen nur vorläufigen Charakter haben können. Schon jetzt wird man sagen können, daß die Oldenburger Bilderhandschrift in einigen Fällen der verlorenen Stammhandschrift nähersteht und die ursprünglichen Motive besser bewahrt hat als die übrigen Codices
55 VON AMIRA, G e n e a l o g i e (wie A n m . 2) S. 327.
Vgl. in diesem Bande bei S C H M I D T - W I E G A N D , Sprache und Stil, S. 202. 57 Vgl. hierzu die Ausführungen von D I E T R I C H H . H O P P E N STEDT, in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 7 f. und Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 5 f. 56
Ruth
8 picturati, besonders die Handschriften D und W. Bei den bereits besprochenen Illustrationen waren es die Trennung von Autoren- und Herrscherbild, das Wegwerfen der Kerzen beim Exkommunikationsritus, die Charakterisierung der Stände und Bevölkerungsgruppen vor Gericht, die diesen Schluß nahelegten. Auch die Darstellung des Höllenrachens auf der Prologseite gehört in diesen Zusammenhang. Als Teil des Weltgerichtsbildes 58 gehört sie einer weitverbreiteten ikonographischen Tradition an. Auch D und W sind Vorstellung und Bild bekannt, wie ein Blick auf die Illustrationen zu Ldr III 42 § 1 zeigt, wo über den Text hinausgehend, bei der Erlösung der Menschheit durch den Kreuzestod Christi das Bild des Jüngsten Gerichts mit der Andeutung des Höllenrachens in eben diesen Handschriften assoziiert wird 5 9 . H und O gehen hier einen anderen Weg, indem sie ein Gebäude bzw. einen Torbogen als Abbreviatur der Vorhölle ins Bild bringen 60 . Auf der Prologseite dürfte O auch in diesem Punkt den ursprünglichen Zustand am besten bewahrt haben. Doch ist der Illustrator auch eigene Wege gegangen, wobei immer zu prüfen ist, ob er diese Besonderheiten seiner Vorlage entnommen hat oder ob sie auf seiner eigenen Erfindung beruhen. So könnte Origines als Verkünder der Weltalterlehre 61 oder der wissaghe , Rechtskundige' neben den Königen Konstantin und Karl 6 2 schon in der Vorlage vorhanden gewesen sein und auf die Stammhandschrift zurückgehen. In beiden Fällen sind die Figuren nur in O überliefert. Wenn aber
Schmidt-Wiegelnd
die Schlange auf dem Bild vom Sündenfall 6 3 sieben Kreise auf dem Rücken hat, möglicherweise ein Symbol der sieben Todsünden, und im Kontext von Ldr II 66 §§1.2 über den Sonderfrieden des Königs, den bestimmte Personen, Orte und Zeiten genießen, ein Kelch mit einer darin zur Hälfte versenkten Hostie erscheint 64 , so kann es sich hier um Zusätze des Illustrators handeln, die der geistigen Auseinandersetzung des 14. Jahrhunderts um die Eucharistiefeier entstammen. Generell wird man festhalten können, daß von den Bildern geistlich-theologischen Inhalts, die in ganz bestimmten Bildtraditionen stehen, die Bilder rechtlichen Inhalts zu unterscheiden sind, für die sich Vorbilder und Parallelen in dieser Weise bisher nicht haben nachweisen lassen. Man nimmt deshalb auch an, daß sie die „Rechtswirklichkeit" mehr oder weniger zutreffend wiedergeben, was bereits für die Stammhandschrift einen sachkundigen Illustrator voraussetzt. Unterschiede zwischen den Codices picturati können deshalb auch einem Wandel der Institutionen entsprechen. Hier ist auf die Illustrationen zu Ldr I 2 §§ 1-4 zu verweisen 65 , die mit der steigenden Zahl der Schöffen von vier auf sieben in O einerseits und D / W andererseits und mit dem Wechsel des Wortführers von einem Laien in O zu einem Geistlichen in D / W , räum- und zeitbedingt, eine Entwicklung in den Schöffenkollegien widerspiegeln können 6 6 (Abb. 6). Wenn im letzten Bildstreifen der Seite von O vor dem von der Bevölkerung gewählten Gaugrafen (mit Glockenhut) ein Schwert im Boden
58 O fol.6 recto, s. o. Anm. 14. Artikel ,Hölle', in: Lexikon der christlichen Ikonographie (wie Anm. 17) Bd. 2, 1970, Sp. 312-321, insb. Sp.317ff. 59 D fol. 42 verso 2, W fol. 46 verso 2. Dazu VON AMIRA, Erläuterungen II, 2 (wie Anm. 6) S. 20. 60 O fol. 74 recto 3, H fol. 18 verso 2. 61 O fol. 7 verso 1. Das Bild bestätigt in gewisser Weise die im Mittelalter verbreitete Meinung, daß die herkömmliche Weltalterlehre auf den Kirchenvater Origines zurückgeht und Sachsenspiegel Ldr I 3 § 1 mithin dieser und nicht die Origines oder Etymologien des Isidor von Sevilla gemeint ist; vgl. RODERICH SCHMIDT, Origines oder Etymologiae? Die Bezeichnungen der Enzyklopädie des Isidor von Sevilla in den Handschriften des Mittelalters, in: Fs. Adolf Hofmeister, hg. von URSULA SCHEIL, Halle 1955, S. 223-232.
63 O fol.6 verso 1, in: Die Oldenburger Bilderhandschrift
62 O fol. 6 verso 2. Zur Interpretation vgl. Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S.88 u. Abb. 2; DRE-
BRIELE VON OLBERG, A u f f a s s u n g e n v o n d e r m i t t e l a l t e r -
SCHER (wie A n m . 12) S. 107 f.; DERS., G e i s t l i c h e D e n k f o r -
men und ihre Wiedergabe in der Oldenburger Bilderhandschrift, in: Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 23-36.
(wie A n m . 14) S . 8 8 u. A b b . 2 ;
DRESCHER ( w i e A n m . 1 2 )
S. 107 f.; OTT (wie Anm. 8) S.41f. 64 O fol.61 verso 4, in: Die Oldenburger Bilderhandschrift ( w i e A n m . 1 4 ) S. 1 0 0 u. A b b . 8; DRESCHER ( w i e A n m . 1 2 )
S. 2 2 2 - 2 2 8 ; KARL KROESCHELL, R e c h t s w i r k l i c h k e i t
und
Rechtsbücherüberlieferung - Überlegungen zur Wirkungsgeschichte des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interp r e t a t i o n ( w i e A n m . 8 ) S. 1 - 1 0 ; RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels als Quelle der Kulturgeschichte, in: Der Sachsenspiegel als Buch (wie Anm. 16) S.219-260, insb. S.237f. 65 O fol. 7 recto 1-5; D fol. 4 recto 3-6, W 10 recto 3-6, vgl. Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 90 u. Abb. 3. 66 VON AMIRA (wie Anm.6) II, 1, S. 140f. Vgl. auch GAlichen Gesellschaftsordnung in Text und Bild des Sachsenspiegels (wie Anm. 48) S. 155-170; SCHMIDT-WIEGAND, Text und Bild in den Codices picturati des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 8) S. 11-31, insb. S. 17-24.
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
steckt, auf das der rügende Bauermeister (mit Strohhut) hinweist, so wird damit sinnfällig zum Ausdruck gebracht, daß vor diesem Gericht auch Gewalttaten zu verhandeln gewesen sind, wenn diese noch nicht im Grafending anhängig gemacht worden waren. In D und W sind Symbol und Gebärde, die wahrscheinlich auch schon in X vorhanden gewesen sind, fortgefallen. Umgekehrt läßt O im Bildstreifen darüber, der vom Schultheißending handelt, den Fronboten vermissen, der gerade den Amtseid leistet 67 , - eine Zeremonie, die über den Text hinausgehend in D und W berücksichtigt wird und deshalb hier sekundär sein wird. Auch hier hätte dann O den ursprünglichen Zustand besser bewahrt. Es gilt also, die Varianten zwischen den Codices picturati gegeneinander abzuwägen, wobei bei der Auswertung in bezug auf Bewahrtes und Gestaltetes, Tradition und Innovation, Altes und Neues für den Interpreten immer ein gewisser Ermessensspielraum bestehen bleiben wird. Gerade dies aber macht die Beschäftigung mit den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels immer wieder aufs Neue interessant: die Offenheit des Befundes für neue Wege der Interpretation. Unumkehrbare Schlußfolgerungen sind hier verhältnismäßig selten, wenn sie auch im Blick auf eine endgültige Klärung der Uberlieferungsverhältnisse grundsätzlich immer angestrebt werden müssen. So wird man z. B. eigene Wege des Illustrators von O dann ausschließen können, wenn die Oldenburger Bilderhandschrift mit der Heidelberger zusammengeht und wenn sich in bestimmten Punkten beide gemeinsam von der Dresdener und der Wolfenbütteler Bilderhandschrift unterscheiden. Dies ist einige Male durchaus der Fall, wobei freilich die Lücken der Heidelberger Bilderhandschrift wie die Tatsache, daß im Oldenburger Codex das Lehnrecht überhaupt nicht illustriert ist, Schlußfolgerungen dieser Art auf weite Strecken hin unmöglich machen. Dort, wo H und O übereinstimmen, spricht dies für die verlorene Stammhandschrift und ihren Bestand. Beispiel hierfür ist die Illustration zu Ldr II §3 6 8 , wo die Fälle behandelt werden, bei denen das Gerichtsverfahren durch Gerüfte oder Zetergeschrei eröffnet werden mußte. Das waren die Kla-
ge um Notzucht oder Vergewaltigung wie um handhafte Tat, nämlich Totschlag oder Diebstahl, wenn der Unrechtstäter noch bei der Tat, also in flagranti, gefaßt worden war 6 9 . Wenn hier H und O in gleicher Weise den Richter oder Grafen mit dem Gerichtsschwert zeigen, das in D und W an dieser Stelle fehlt, obwohl es der Sachlage wie sonstiger Illustrationstechnik entspräche 7 0 , so sind H und O hier nicht nur genauer, sondern stehen auch X näher als D und W. Das gleiche gilt in bezug auf den Dieb, der nur in H und O mit dem Diebsgut auf dem Rücken und an ein Seil gebunden vorgeführt wird 7 1 , wie auch für den Toten im Vordergrund des Bildes, der in H noch deutlich sichtbar aus mehreren offenen Wunden blutet. Die schrittweise Vernachlässigung von Darstellungsmitteln, Motiven, Gebärden, Gegenständen zeichenhaften Charakters u. ä. im Zuge der Text- und Bildgeschichte hat an und für sich nichts Uberraschendes. Sie konnte aber zu Unscharfen in der Bildaussage und dadurch zu Uminterpretationen des Bildgehaltes im Gang der Überlieferung führen. Für beides gibt es in den Codices picturati Beispiele. Bei der Illustration zu Ldr III 64 §1 7 2 ist z.B. die Königsurkunde, mit der hier geladen wird, in H mit einer gültigen Aufschrift versehen und das Siegel wie in O mit einem Bildnis des Königs ausgestattet. Beides fehlt in D und W 7 3 , die dafür den Grafen am linken Bildaußenrand zusätzlich bringen. In W ist außerdem das Zepter des Königs weggelassen - also ein schrittweiser Ab- und Umbau des Bildes, wobei die Hinzufügung des Grafen nach von Amira auf den Meister der Dresdener Bilderhand-
69
70 71
72 6 7 WERNER PETERS,
Bezeichnungen
9
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
und
Funktionen
des
Fronboten in den mittelniederdeutschen Rechtsquellen (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 20) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1991, S. 88-145, vgl. auch Gott ist selber Recht (wie Anm.5) S.68 u. Abb. 15. 68 W fol.40 verso 5, D fol.34 verso 5, H fol. 10 verso 5, O fol. 61 recto 1.2.
73
Vgl.
auch
SCHEELE
(wie
Anm.36)
S. 177F.;
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND, Mord und Totschlag in der älteren deutschen Rechtssprache, in: Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde 10, 1988, S. 4784, insb. S. 78. Vgl. z.B. W fol. 40 verso 1.2. Vgl. auch EKKEHARD KAUFMANN, Artikel ,Binden', in: H R G 1 (wie Anm.22) Sp. 437-439. Danach ist das dem Dieb auf den Rücken gebundene Diebesgut seit fränkischer Zeit notwendiger Bestandteil des Handhaftverfahrens gewesen. W fol. 52 verso 2, D fol. 48 verso 2, H fol. 22 verso 2, O fol. 82 verso 2. Vgl. auch ALEXANDER IGNOR, Inhalt und Integrität - Anmerkungen zum Gerichtsverfahren des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm.8) S. 77-91. VON AMIRA, Erläuterungen II, 2 (wie Anm.6) S. 76 f. Vgl. auch W fol. 81 verso 2, wo die Urkunde ebenfalls ohne Schrift geblieben ist wie auch das Siegel ohne Bild, desgl. D fol. 87 verso 2.
10
Ruth Schmidt- Wiegand
schrift zurückgehen soll. Zu Ldr. III 64 §§3.4 7 4 sind wiederum nur die Illustrationen in H und O ganz genau, indem nur hier dem zutreffend dargestellten Herzog das Strafgeld oder Gewette auch ganz konkret ausgezahlt wird. In D und W wird im Bild davor fälschlich der Vogt mit dem Schultheißen verwechselt. Ldr II 54 75 hat die Befugnisse des Dorfhirten zum Gegenstand. In diesem Zusammenhang werden auch die Voraussetzungen für die Haltung eines eigenen bzw. privaten Hirten, u. a. Grundbesitz von mindestens drei Hufen, behandelt. Während in H und O der Dorfhirt zu einer Gruppe von Dorfnachbarn herübergezogen wird, - wohl um seine Stellung im Dorf zu dokumentieren - verweigert in D und W ein Bauer, der wohl über den notwendigen Landbesitz verfügt und sich von daher einen eigenen Hirten leisten kann, dem Dorfhirten die Anerkennung. Für die Geschichte der Text-Bild-Uberlieferung in den Codices picturati sind schließlich die Illustrationen zu Ldr II 58 §2 in H , O, D und W 7 6 besonders aufschlußreich. Schon der Illustrator der Stammhandschrift X hat sie in die Form eines „Bauernkalenders" gebracht, in dem die Tage, an denen Zins und Abgaben fällig waren, zunächst der Reihenfolge des Textes entsprechend, zusammengefaßt waren. Allein der Illustrator von H ordnete das Bild nach der zeitlichen Abfolge der Termine um (Abb. 7). In bezug auf die Symbole der Heiligen und die Zeichen für die zu leistenden Abgaben stehen sich H und O wieder besonders nahe (Abb. 8). Auch die Nutztiere und -pflanzen sind weitgehend die gleichen. In H und O werden, volkstümlichem Brauchtum entsprechend, grüne Zweige und Kräuterbüschel für den Walpurgistag (1. Mai) und Mariä Himmelfahrt (15. August) verwendet 7 7 . Und wenn O auf diese Weise im Bild Mariä Krautweihe zitiert,
74 W fol. 52 verso 4, D fol. 48 verso 4, H fol. 22 verso 4, O fol. 82 verso 3 / 4 , dazu VON AMIRA, Erläuterungen II 12 (wie Anm.6) S.78f. 75 W fol.38 verso 1, D fol.32 verso 1, H fol.8 verso 1, O fol. 57 recto 3; ULRIKE LADE, Dorfrecht und Flurordnung in den Illustrationen der Sachsenspiegel-Bilderhandschriften, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 8) S. 1 7 1 - 1 8 7 , insb. S. 181; GERNOT KOCHER, S c h u l d r e c h t -
liches in mittelalterlichen Illustrationen, in: ebd., S. 117128, insb. S. 124. 76 W fol. 39 recto 4-8, D fol. 33 recto 4-8, H fol.9 recto 4-10, O fol. 58 verso 2-5; dazu Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 52 u. Abb. 9 (H), S.76 u. Abb. 19 (D); Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 98 und Abb. 7. 77 Am Tag der Hl. Walpurga wurden Zweige an die Türen gehängt; das Fest von Mariä Himmelfahrt war auch Tag
obwohl diese Partie im Text fehlt, so ist dies u. a. ein Indiz dafür, daß Text und Bild im Oldenburger Codex aus verschiedenen Vorlagen stammen. Der Johannistag (24. Juni) wird in H und O durch eine Johanniskrone 7 8 symbolisiert. In figürlichen Darstellungen werden hier überhaupt nur die Hl. Margarete (13. Juli), wie sie den Teufel bindet, gezeigt und der Hl. Bartholomäus (24. August), der in Erinnerung an sein Martyrium die Haut, die ihm abgezogen worden war, über eine Stange gelegt, mit sich führt. Während der Illustrator von H und O bzw. ihrer gemeinsamen Vorlage für den Tag des Hl. Urban (25. Mai) 7 9 noch mit einem Arbeitskleid für Winzer bzw. einer Mütze davon auskommen, ist in D und W ein Bischof mit Mitra, Alba, Dalmatica und Kasel an ihre Stelle getreten. Handelte es sich ursprünglich um den päpstlichen Märtyrer Urban I., so wurde sein Kult sekundär mit dem des gleichnamigen Bischofs von Langre verbunden, der auch in der Mark Meißen als Schutzpatron der Winzer und Weingärtner verehrt worden ist. D und W, die damit auf eine speziell obersächsische Fassung der Codices picturati zurückgehen, weisen hier eine für sie recht bezeichnende Vermehrung der Heiligenfiguren auf. Nicht allein, daß das Arbeitskleid des Märtyrers durch die Person des bischöflichen Patrons ersetzt worden ist, auch die Johanniskrone verschwand zugunsten des Heiligen, der in D und W eine Agnus Dei-Scheibe mit dem Lamm Gottes trägt 8 0 . Und an die Stelle der Zweige zu St. Walpurgis wie der Kräuterbündel zu Mariä Himmelfahrt sind nun hier die Bildnisse der Hl. Walpurga und der Mutter Gottes mit dem Kind getreten. Der steigende Einfluß des Heiligenkultes anstelle und in Verbindung mit einem eher volkstümlichen Brauchtum mit Zweigen, Kräutern, Schmuckkronen u. a. m. wird auch an diesem Wandel in der Darstellung greifbar.
der Kräuterweihe, vgl. Lexikon der christlichen Ikonographie (wie Anm. 17) Bd. 8, Sp. 585-588 (Walburga) und ,Kräuterweihe', in: Handwörterbuch des deutschen Aberg l a u b e n s ( H W D A ) , h g . v o n HANNS BÄCHTHOLD-STÄUBLI
u n t e r M i t w i r k u n g v o n EDUARD HOFFMANN-KRAYER, B e r -
lin 1927 ff., Nachdruck 1987, Sp. 440-446. 78 So auch KOSCHORRECK (wie Anm. 24) S. 68. Zur Johanniskrone vgl. ,Johannistag', in: Wörterbuch der deuts c h e n V o l k s k u n d e v o n OSWALD A . E R I C H u n d
RICHARD
BEITL, 3. A u f l . u n t e r M i t w i r k u n g v o n KLAUS BEITL b e -
sorgt von RICHARD BEITL, Stuttgart 1974, S. 410-416, insb. S. 414. 79 H W D A Bd. 8, Sp. 1494-1500 (Urban); Lexikon der christlichen Ikonographie Bd. 8, Sp. 513-516. 80 Ebd. Bd.7, Sp. 164-190, insb. Sp. 167 und Bd.3, Sp.7-14 (Lamm).
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
Geht man von der Wolfenbütteler Bilderhandschrift aus, was im Zusammenhang mit dieser Ausgabe naheliegt, so sind es einzelne Artikel des zweiten und dritten Buches wie der Anfang des Lehnrechts, bei denen mehr oder weniger bemerkenswerte Unterschiede zum Heidelberger Codex festzustellen sind. Durchgängig sind Abweichungen bei den Illustrationen zu Ldr II 54 §§ 16, 64 §§1-3, III 89-91, Lnr 4 §§1-3, 8 §§ 1.2 81 zu beobachten. Einige von ihnen sind bereits besprochen worden; andere bedürfen noch künftiger Interpretation. Vollständigkeit konnte auch hier nicht angestrebt werden. Denn im Zusammenhang mit dieser Ausgabe interessiert noch eine ganz andere Frage, die gegenüber den bisher behandelten sogar einen gewissen Vorrang hat: Ist die Wolfenbütteler Bilderhandschrift tatsächlich eine Kopie von D oder geht diese Handschrift mit D nur auf eine gemeinsame Vorlage (Y2) zurück? Bei der Besprechung des „Bauernkalenders" ist dieses Problem bereits gestreift worden. Hier sind noch einmal generell die Unterschiede zwischen dem Dresdener und dem Wolfenbütteler Codex zu prüfen, und zwar auf der Bild- wie auf der Textseite. Auffälligster Unterschied zwischen D und W ist zweifellos die besondere Form der Tiara. Der Papst trägt sie bei allen Gelegenheiten, auch beim Ausritt 82 , als sichtbares Zeichen seines Amtes und seiner Würde. In H und O hat die Tiara noch immer die Form des älteren Phrygiums mit knaufartigem Abschluß, während in D und W schon drei Kronreifen zu erkennen sind, wie sie nach 1315/16 üblich wurden 8 3 . Nur W steht der älteren Form noch erstaunlich nahe, während D mit konischer Form, Farbgebung und einer phantasievollen Kreuzblume (Lilie?) an der Spitze deutlich von den anderen Darstellungen abweicht. Der Illustrator
81 Abweichungen zwischen W und H sind auf folgenden Blättern nachgewiesen: Fol. 38 verso 1 - 4 , 40 verso 4.5, 42 recto 4, 42 verso 6, 43 verso 4, 45 verso 1, 47 recto 5, 52 verso 1, 54 recto 1, 56 recto 3, 57 verso 1-6, 59 recto 1 - 5 , 59 verso 4.5, 60 recto 2.3, 61 verso 1.2.3. 82 So auf dem Bild zu Ldr I 1: W fol. 10 recto 1.2, D fol.4 recto 1.2, O fol. 6 verso 4; Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 88 u. Abb. 2; Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 15 u. Abb. 15 (D). 83 VON AMIRA, E r l ä u t e r u n g e n II, 1 (wie A n m . 6 ) S. 42 f. N u r
in D und W entspricht die Kopfbedeckung des Papstes in bezug auf Form und Farbe in etwa dem triregnum der Zeit um
1315 ( d r e i G o l d r e i f e n ) , vgl. HARRY KÜHNEL,
von W - sollte er D gefolgt sein - müßte deshalb seine Vorlage bewußt korrigiert haben, was indessen bei der Konsequenz, mit der er verfahren ist, wenig wahrscheinlich ist. Der Illustrator hätte sich nicht einmal geirrt. Der Beweis einer direkten Abhängigkeit von D läßt sich in diesem Fall einfach nicht führen. Dabei steht seine Form der Tiara den Darstellungen von H und O sehr viel näher als D. Es gibt in W zahlreiche Beispiele für Unterschiede von D, die einfach auf Nachlässigkeit des Illustrators zurückzuführen sind, wie z.B. das Fortlassen von Personen (fol. 85 recto 4) oder Gegenständen (fol. 30 recto 1), wie des Herrenschapels (fol. 49 recto 6 oder 69 recto 4). D ist hier meist vollständiger, wie z. B. bei der Illustration zu Ldr II 15 § 1 8 4 , wo die Strafen, die an Hals und Hand oder H a u t und H a a r gingen, durch bestimmte Strafwerkzeuge wie Schwert, Schere, Rute und Halseisen, veranschaulicht werden. In W fehlt das Richtschwert, das durch D und O für X gesichert ist. Auch mit der Unfertigkeit einer Darstellung muß hier wie in anderen Fällen gerechnet werden, z. B. wenn wie auf der Illustration zu Ldr II 26 § 1 8 5 dem Münzmeister der Schemel fehlt, auf dem er zu sitzen pflegt. Wie dieser Schemel auszusehen hätte, ist nicht allein D zu entnehmen, sondern auch einer Bildparallele in W fol. 39 verso 1 links. Von diesen eher „zufälligen" Abweichungen in W sind die Varianten zu unterscheiden, hinter denen eine bestimmte Absicht des Künstlers steht. Das Bild zu Lnr 14 §4 8 6 drückt so in W eine von H und D abweichende Auffassung des Geschehens aus. Der in W abgebildete Lehensmann, der seine rechte H a n d in die Tasche seines Gewandes gesteckt hat, bringt damit sinnfällig zum Ausdruck, daß er kein Gut von seinem Herrn erhalten hat, während er in D und H - höchst mißverständlich - nach den Ähren oder Halmen greift, die für gewöhnlich das Gut, sei es Erbe oder Lehen, bezeichnen. Hier könnte der Illustrator von W bewußt gebessert haben - wenn er nicht überhaupt eine andere Vorlage als D besaß. Dies legen auch die Lücken von D nahe, die der Illustrator von W selbständig ausgefüllt haben müßte, hätte er D kopiert. Das ist denkbar, wo dem Bild in D bestimmte Gegenstände, die wie Herrenschapel oder Schwert häufiger vorkommen, fehlen; z.B. das Schapel über der Mütze der Fürsten fol. 51 verso 1, das in D fol. 47 verso 1 kein Gegenstück hat. Oder auch das 84 W fol. 30 recto 1, D fol.26 recto 1; O 45 recto 1; VON
Bildwörterbuch der Kleidung und Rüstung, Stuttgart
AMIRA, E r l ä u t e r u n g e n II, 1 (wie A n m . 6 ) S. 356 ff.
1992, S. 2 6 4 ; SCHMIDT-WIEGAND, K l e i d u n g (wie A n m . 3 0 )
85 W fol. 32 verso 2, D fol. 28 verso 2. 86 W fol.64 recto 1, D fol.62 recto 1, H fol.4 recto 1.
S. 1 7 3 f.
11
12
Ruth Schmidt- Wiegand
Schwert, das auf der Illustration zu Ldr III 23 87 dem Verfesteten zum Zeichen seiner Achtung durch den Hals gestoßen ist. Es fehlt D fol. 39 verso 3. Hier kann der Illustrator von W aufgrund seiner Kenntnis anderer Bildstreifen wie z.B. fol.45 recto 1.2.388 seiner Vorlage gegenüber das Bild selbständig weiter ausgeführt haben, zumal dieses Zeichen zum Verständnis des Text-BildZusammenhangs an dieser Stelle unverzichtbar ist. D a ß der Illustrator von W damit auch in der Tradition der Uberlieferungsgruppe der Bilderhandschriften steht, während sich der Illustrator von D außerhalb dieser Tradition befindet, zeigt der Vergleich mit H und O, die beide an der entsprechenden Stelle das Schwert im Hals des Verfesteten haben, - eine Stereotype, die sich schon in der Stammhandschrift X befunden haben dürfte. Für W aber bedeutet dies, daß dem Illustrator auch hier eine andere Handschrift als D zur Abschrift vorgelegen haben kann. Dieser Schluß liegt besonders dann nahe, wenn D und W in bezug auf die Auslegung des Textes völlig getrennte Wege gehen. Dies ist z. B. bei fol. 62 recto 4 der Fall, einer Illustration zu Lnr 11 §1 8 9 , wo es um Lehnserneuerung bzw. auch Vererbung eines Gutes bei einem Lehensträger auf dessen Sohn geht, - also um einen vielschichtigen Vorgang, der nicht ganz einfach in ein Bild umzusetzen gewesen ist. Voraussetzung für das Geschehen ist, daß der alte Lehensherr verstorben war. Nur der Illustrator von W hat diesem Umstand Rechnung getragen, wenn er den Verstorbenen, wie sonst auch im Vordergrund des Bildes, durch seine Herrenkleidung und das Schapel als den verstorbenen Lehensherrn charakterisierte, während in D der Tote ohne Schapel als Lehensträger zu verstehen ist, dessen Sohn (in D und W deutlich in kleinerer Gestalt) die H ä n d e zur Lehenserneuerung emporhält. H und O fallen an dieser Stelle für den Vergleich leider aus. Doch dürfte auch hier wieder W in einer anderen Bildtradition stehen als seine angebliche Vorlage. Dies legen jedenfalls ähnlich gestaltete Bilder nahe, was wiederum bedeutet, daß die Wolfenbütteler Bilderhandschrift nicht einfach als Kopie der Dresdener Bilderhandschrift anzusehen ist. Die Beobachtungen, die bisher gemacht werden konnten, lassen sich in drei Punkte zusammenfassen: 1. Die niederdeutsche Oldenburger Bilderhandschrift
(O), obwohl erst 1336 geschrieben, repräsentiert in vieler Beziehung einen archaischen Typ, welcher der ebenfalls niederdeutschen Stammhandschrift (X) relativ nahezustehen scheint. Dies gilt nicht allein für die Illustrationstechnik und den Text, der noch der ältesten Textklasse des Sachsenspiegels angehört 9 0 , sondern auch gerade in bezug auf Motive, Symbole, Gebärden u. a. m. 2. Die mitteldeutsch geschriebene Heidelberger Bilderhandschrift (H), die zeitlich der verlorenen Stammhandschrift besonders nahesteht, teilt mit O nicht allein den archaischen Stil der Illustrationen, sondern vor allem auch Stoffe und Motive, Gebärden und Symbole. Sie unterscheidet sich dadurch von den beiden anderen mitteldeutschen Bilderhandschriften D und W, denen sie meist pauschal zugeordnet wird. 3. Auch die Dresdener (D) und die Wolfenbütteler Bilderhandschrift (W) gehen in bezug auf den besonderen Vorwurf und die Illustration einige Male getrennte Wege, was den Schluß zuläßt, daß die Annahme nicht zwingend ist, W sei eine Kopie von D. Denkbar ist vielmehr auch, daß W auf eine andere (verlorene) Handschrift, möglicherweise eine gemeinsame Vorlage (Y2), zurückgeht. D und W wären dann einander besonders nahestehende Schwesterhandschriften. Diese Überlegungen bedürfen freilich noch der Bestätigung von der Textseite her. Dabei ist die starke Textgemeinschaft 9 1 zwischen D und W nicht zu übersehen. Fast jede Kolumne der beiden Codices fängt mit dem gleichen Wort an 92 . Und doch gibt es einige Varianten, die keine direkte Abhängigkeit der Wolfenbütteler Bilderhandschrift von der Dresdener erkennen lassen. So teilt z. B. W einige Auslassungen und Fehler von D nicht 93 . Sollte der Schreiber von W auf D beruhen, so hätte er hier - ähnlich wie der Illustrator an anderer Stelle, aber unabhängig von ihm - seine Vorlage selbständig ergänzt. Dies kann im Einzelfall wie bei Lnr 22 § 3 9 4 durchaus der Fall sein, wo in dem zu erwartenden Satz der man sal behalden95 in D sal fehlt und W statt dessen der man behalde bietet. Es kann
90 Zur Textklasse Ib, Fünfbüchereinteilung wie in der Bremer
Sachsenspiegelhandschrift von
1342, vgl.
SCHEELE,
in: Die Oldenburger Bilderhandschrift (wie Anm. 14) S. 4 0 f . ; O P P I T Z ( w i e A n m . 5 1 ) B d . 1, S. 2 3 ; E G B E R T K O O L -
MAN, in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S.32f. 9 1 VON AMIRA (wie A n m . 2 ) S . 3 4 5 f .
87 W O 88 W 89 W
fol.45 fol. 69 fol. 62 fol. 71
verso verso recto recto
3, D fol.39 verso 3, H fol. 15 verso 3, 2. 4, D fol. 60 recto 4. 2.
92 Ebd. S. 345 und jetzt auch MILDE, Kodikologische Einführung, Textband, S.LL. 9 3 N a c h w e i s bei VON AMIRA, S. 346.
94 W fol. 65 verso 4, D fol. 63 verso 4. 95 H 5 verso 4: Der man sal behalden daz gut [...].
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
im Kreis der Codices picturati
aber auch dem Schreiber von W eine andere Handschrift als D vorgelegen haben. Letzte Sicherheit in der Beurteilung solcher Fragen wird aber erst dann zu erzielen sein, wenn nach abgeschlossener Restaurierung der Dresdener Bilderhandschrift 96 diese in bezug auf den Text und seine sprachliche Form umfassend ausgewertet werden kann. Zur Interpretation der Bilder in den Codices picturati wurde bisher meist der Sachsenspiegel in seiner heute noch immer maßgeblichen Ausgabe von Karl August Eckhardt 97 herangezogen. Bei ihr handelt es sich um einen mittelniederdeutschen Text, der auf der Grundlage der mitteldeutschen Quedlinburger Handschrift des Sachsenspiegels 98 bzw. ihrer niederdeutschen Reliktwörter erstellt wurde. Auf philologischer Seite stieß diese Ausgabe bald nach ihrem Erscheinen auf Kritik 99 . Eine Ausgabe des Sachsenspiegels, die nicht so sehr wie diese auf einer mehr oder weniger mechanischen Egalisierung des handschriftlichen Befundes beruht 100 , sondern der sprachgeschichtlichen Stellung des Rechtsbuches Rechnung trägt, gehört deshalb noch immer zu den besonderen Aufgaben der niederdeutschen Philologie 101 .
96 DAG-ERNST PETERSEN, Zum Erhaltungszustand des Dresdener Sachsenspiegels und die Möglichkeiten der Konservierung, in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 5) S. 80 f. 97 Sachsenspiegel Land- und Lehnrecht, hg. von KARL AUGUST ECKHARDT (MGH fontes iuris Germanici antiqui, n. s. t. I) Hannover 1933; 2. Bearb. von DEMS. (Germanenrechte, Neue Folge, Land- und Lehnrechtsbücher) Landrecht, Göttingen 1955, Lehnrecht ebd. 1956; jetzt 3. Aufl. (MGH, Fontes iuris antiqui n. s. t. I, p. I u. II) Göttingen - Berlin - Frankfurt/Main 1973. 98 Halle (Saale), Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen und Anhalt, Quedlinburg Cod. 81, OPITZ (wie Anm. 51)
Bd. 2,
Nr. 6 5 7 ,
S. 5 4 5 f.; JUTTA FLIEGE,
Die
Handschriften der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, 1982, S.58f. 99 Wichtig besonders die Besprechung der 2. Bearbeitung: KARL BISCHOFF, in: Anzeiger für deutsches Altertum 69, 1 9 5 6 / 5 7 , S. 1 5 3 - 1 6 0 ( L a n d r e c h t ) und ebd. 7 1 , 1 9 5 8 / 5 9 , S. 2 2 - 2 6 (Lehnrecht); ERIK ROOTH, in: N i e d e r d e u t s c h e
Mitteilungen 13, 1957, S.55. 100 Der Sprachstand der Reliktwörter in der Quedlinburger Handschrift wurde auf den übrigen Text übertragen. Für die Entscheidung in bezug auf die gewählten Formen war ihre Häufigkeit ausschlaggebend. Zu den Problemen dieses Vorgehens auch RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Der Sachsenspiegel. Uberlieferungs- und Editionsprobleme, in: Der Sachsenspiegel als Buch (wie Anm. 16) S. 19-56, insb. S. 36-45. 101
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Die
überlieferungskritische
Ausgabe des Sachsenspiegels als Aufgabe der mittelnie-
des
Sachsenspiegels
13
Die hier vorgelegte Ausgabe kann und will nicht in diese Lücke treten, obwohl auch sie einen benutzbaren Text bieten möchte: Der diplomatischen Umschrift der mitteldeutschen Handschrift ist deshalb ein zitierfähiger, leicht normalisierter Text 102 beigegeben, der so verständlich sein soll, daß der mit der Überlieferung gegebene Zusammenhang von Text und Bild dem Benutzer deutlich wird, ohne daß er sich auf einen Text beziehen muß, der nun einmal nicht zu diesen Illustrationen gehört. Bei der Bedeutung, welche die mitteldeutschen Handschriften in der Sachsenspiegel-Uberlieferung ganz allgemein haben, dürfte dies ein legitimes Anliegen gewesen sein. Obwohl das Faksimile zunächst einmal nicht mehr soll, als die Handschrift möglichst getreu wiedergeben 103 , um quasi das Original selbst zu sein, das es zu ersetzen hat, ergab sich von der Intuition der Herausgeberin aus, den Typus der Bilderhandschriften als eine besondere Uberlieferungsform des Rechtsbuches zu präsentieren, eine Beschäftigung mit den Problemen der Textgeschichte und Edition von Rechtsbüchern im allgemeinen wie des Sachsenspiegels im besonderen, die in verschiedenen Aufsätzen ihren Niederschlag gefunden hat 104 . Es kann nur einiges Wenige, was die Grundlagen der vorliegenden Edition der Wolfenbütteler Bilderhandschrift betrifft, daraus zusammengefaßt werden. Von den Arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten zur Editionstechnik mittelalterlicher Texte erschienen sind 105 , ist das Programm der Würzburger Forscher-
derdeutschen Philologie, in: Franco-Saxonica. Münstersche Studien zur niederländischen und niederdeutschen Philologie, Fs. Jan Goosens, Neumünster 1990, S. 1-13. 102 Zu den Prinzipien s. im Textband die ,Einführung in die Ausgabe', S. 4 - 9 . 103 OTTO MAZAL, Das Faksimile und die Wissenschaft, in: C o d i c e s manuscripti 9, 1 9 8 3 , S. 1 3 3 - 1 3 6 ; HANS ZOTTER,
Bibliographie faksimilierter Handschriften, Graz 1976, S. 1 1 - 2 2 .
104 Zusammenfassend zuletzt: RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Überlieferungs- und Editionsprobleme deutscher Rechtsbücher, in: Methoden und Probleme der Edition mittelalterlicher deutscher Texte, hg. von ROLF BERGMANN KURT GÄRTNER (Beihefte zu editio Bd. 4) Tübingen 1993, S. 6 3 - 8 1 .
105 Es sollen hier nur einige wenige genannt werden. Im übrigen kann auf den oben genannten Sammelband (Anm. 104) verwiesen werden. KARL STACKMANN, Mittelalterliche Texte als Aufgabe, in: Fs. für Jost Trier, hg. v o n WILLIAM FOERSTE - KARL HEINZ BORCK, K ö l n - G r a z
1964, S. 240-267; DERS., Grundsätzliches über die Methode der altgermanistischen Edition, in: Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation, hg.
14
Ruth Schmidt- Wiegand
gruppe „Spätmittelalterliche Prosaforschung" 1 0 6 für das Teilprojekt des Sonderforschungsbereichs 231 über „Rechtsbücher als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit" 1 0 7 , in dem diese Ausgabe erarbeitet worden ist, von besonderer Bedeutung gewesen. Dies überrascht an sich nicht, hat doch auch der Sachsenspiegel als ein Prosawerk, mit dem das Mittelniederdeutsche im 13. Jahrhundert innovativ geworden ist 1 0 8 , erst im 14./15. Jahrhundert seine eigentliche Verbreitung gefunden. Ohne daß die Prinzipien, die in Würzburg bei der Edition der ,Rechtssumme' Bruder Bertholds 1 0 9 aufgestellt worden sind, unbesehen übernommen worden wären, jede Quelle verlangt schließlich die Erarbeitung besonderer, ihr adäquater Prinzipien 110 - kam dem Editionsvorhaben der Wolfenbütteler Bilderhandschrift doch die
v o n GUNTER MARTENS -
S. 2 9 3 - 2 9 9 ;
HANS ZELLER,
GEORG STEER, S t a n d u n d
München
1972,
Methodenreflek-
tion im Bereich der altgermanischen Editionen, in: ebd. Editionsprinzipien
für
deutsche Texte des Früh- und Hochmittelalters,
S. 1 3 1 - 1 4 2 ;
WERNER
SCHRÖDER,
in:
Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, hg. von WERNER B E S C H - O S K A R R E I C H M A N N - STEFAN S O N D E R E G G E R ,
1. Halbd., Berlin - New York 1984, S. 6 8 2 - 6 9 2 ; OSKAR REICHMANN, Editionsprinzipien für deutsche Texte des späten Mittelalters, in: ebd. S. 6 9 3 - 7 0 3 . 106 Spätmittelalterliche Prosaforschung. DFG-Forschergruppe - Programm am Seminar für Deutsche Philologie der Universität Würzburg, ausgearbeitet von KLAUS GRUBMÜLLER
-
MATZEL -
PETER JOHANEK KURT RUH -
-
KONRAD
KUNZE
-
KLAUS
GEORG STEER, in: J a h r b u c h
für
Internationale Germanistik 5, 1973, S. 156-176. 107 Träger, Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue Sonderforschungsbereich 231 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, hg. von HAGEN
KELLER
-
FRANZ J O S E F
WORSTBROCK,
Münster
Blickrichtung der Würzburger Gruppe zugute: Die Wendung von der autornahen zur überlieferungskritischen Ausgabe, die in diesem Kreis vollzogen worden ist, ist für Gebrauchstexte des Mittelalters in jedem Fall bedenkenswert. Grundsätzlich sind an die überlieferungskritische Ausgabe die gleichen Anforderungen zu stellen wie an die historisch-kritische im herkömmlichen Sinne. Doch steht hier nicht mehr der Autor im Mittelpunkt der Bemühungen, sondern die Wirkung, die von seinem Werk ausgegangen ist 1 1 1 . Die überlieferungskritische Ausgabe hat die Wirkungsgeschichte des Textes mitzuerfassen. Dabei sind alle Textzeugen prinzipiell gleichwertige Belege für den Prozeß der fortschreitenden Textentwicklung. Diese Form der Edition bietet sich bei allen Texten an, die - wie der Sachsenspiegel - durch ihren vielfältigen Gebrauch zahlreichen Mutationen ausgesetzt gewesen sind und die so aufgrund ihrer besonderen Gebrauchsfunktionen eine offene Uberlieferungsform haben. Ziel der Edition ist es, einen historischen Text so darzustellen, daß er das Rezeptionsfeld des Denkmals im ganzen erschließt 112 . Der Wolfenbütteler Codex picturatus des Sachsenspiegels ist ein historischer Text, der sich am Ende einer Text- und Bildgeschichte befindet und dabei deutlich zwischen Gebrauchshandschrift und Prachthandschrift steht 1 1 3 . An ihm läßt sich der Prozeß der Verschriftlichung des Rechts durch eine Verbindung mit den anderen Gliedern der funktionalen Uberlieferungsgruppe der Bilderhandschriften verdeutlichen 114 . Dies sollten der Apparat unter dem zitierfähigen Text wie die Hinweise auf O, H und D im Text-Bildleisten-Kommentar ermöglichen. Dabei konnte aus Raumgründen nur eine begrenzte Anzahl von Text- und Bildvarianten berücksichtigt werden. Wenn so die Idealvorstellung einer überlieferungskritischen Ausgabe hier nur ansatzweise umgesetzt worden ist, so liegt dies aber auch an der besonderen For-
1988, insb. S. 18f. Vgl. auch in: Frühmittelalterliche Studien 22, 1988, S . 3 8 8 - 4 0 9 , insb. S . 4 0 2 f . 108
KARL HYLDGAARD-JENSEN, D i e T e x t s o r t e n des M i t t e l n i e -
derdeutschen, in: Sprachgeschichte (wie Anm. 105), 2.
111 Zum Folgenden: KURT RUH, Votum für eine überliefe-
Halbbd., Berlin - New York 1985, S. 1 2 4 7 - 1 2 5 1 , insb.
rungskritische Editionspraxis, in: Probleme der Edition
S. 1 2 4 8 - 1 2 4 9 .
mittel- und neulateinischer Texte, hg. von LUDWIG HÖDL
109 Die ,Rechtssumme' Bruder Bertholds. Eine deutsche abe-
- D I E T E R W U T T K E , B o p p a r d 1 9 7 8 , S. 3 5 - 4 0 ; KLAUS G R U B -
cedarische Bearbeitung der ,Summa Confessorum' des
MÜLLER, Edition, in: Reallexikon der Germanischen Al-
Johannes von Freiberg. Synoptische Edition der Fassun-
t e r t u m s k u n d e 6 , hg. v o n HEINRICH BECK - HERBERT JAN-
gen
B,
A
und
C,
hg.
von
G E O R G STEER -
KUHN - K U R T R A N K E - R E I N H A R D W E N S K U S , B e r l i n -
WOLFGANG
H E I N Z SÜDEKUM, B d . 1 - 4 , 6 u. 7 , T ü b i n g e n
1987-1991.
110 Vgl. auch GEORG STEER, Textkritik und Textgeschichte.
112 RUH (wie A n m . l l l ) S.35. 113 MILDE, Kodikologische Einführung, Textband S. 1 1 - 3 0 , insb. S. 28ff. (Zur Funktion).
Editorische Präsentation von Textprozessen: Das N i b e lungenlied'. Der ,Schwabenspiegel'. Die ,Predigten' Tau-
New
York 2 1986, S. 4 4 7 - 4 5 2 .
KLIMANEK - DANIELA KUHLMANN - F R E I M U T L Ö S E R - K A R L
114
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Die
Bilderhandschriften
des
lers, in: Methoden und Probleme der Edition mittelal-
Sachsenspiegels als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit,
terlicher Texte (wie Anm. 104) S. 107-119.
in: Frühmittelalterliche Studien 22, 1988, S. 3 5 7 - 3 8 7 .
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
schungssituation, in der sich das Rechtsbuch Sachsenspiegel' mit seinen Bilderhandschriften zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. In einer Zeit, in der das Verhältnis von Text und Bild auf den verschiedensten Gebieten problematisiert wird 1 1 5 und in der Diskussion um die Verschriftlichung des Lebens im Mittelalter längst einen festen Platz hat 1 1 6 , ist auch die Frage nach den Parallelen zu den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels neu belebt worden. Es sind die Bilder zu Wolframs von Eschenbach ,Willehalm', die sich in mehreren Fragmenten einer „großen Bilderhandschrift" finden 1 1 7 . Karl von Amira hat sie erstmals herausgegeben 1 1 8 und dabei die These vertreten 1 1 9 , daß es der Illustrator der Willehalm-Handschriften gewesen sei, der den besonderen Stil der durchgehenden Illustration mit den Initialen auf der Text- wie Bildseite begründet habe und der von dem Illustrator der Stammhandschrift des Sachsenspiegels dann aufgegriffen worden sei. In der Tat sind die Parallelen zwischen beiden Werken überraschend, bis in die Einzelheiten hinein wie z. B. die
115 Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und früher Neuzeit, hg. von C H R I STEL M E I E R - U W E R U B E R G , Wiesbaden 1980, insb. S.9-18. 116 Zum Grundsätzlichen auch H A G E N K E L L E R , Die Entwicklung der europäischen Schriftkultur im Spiegel der mittelalterlichen Uberlieferungen, in: Geschichte und Geschichtsbewußtsein, Fs. Karl-Ernst Jeismann, hg. von P A U L L E I D I N G E R - D I E T E R M E T Z L E R , Münster 1990, S. 171-204; DERS., vom ,Heiligen Buch' zur B u c h f ü h rung'. Lebensfunktionen der Schrift im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche Studien 26, 1992, S. 1-31; K L A U S G R U B M Ü L L E R , Mündlichkeit, Schriftlichkeit und Unterricht. Zur Erforschung ihrer Interferenzen in der Kultur des Mittelalters, in: Der Deutschunterricht, Jg. 41, H e f t 1, 1989, S.41-54. Zur besonderen Rolle des Bildes in diesem Zusammenhang M I C H A E L C U R S C H M A N N , H ö r e n Sehen - Lesen. Buch und Schriftlichkeit im Selbstverständnis der volkssprachlichen literarischen Kultur Deutschlands um 1200, in: Beitrag zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 106, 1984, S.218-257. 117
118
119
Hierzu und zum Folgenden W E R N E R S C H R Ö D E R , Text und Bild in der ,Großen Bilderhandschrift' von Wolframs ,Willehalm', s. o. Anm. 7. K A R L VON A M I R A , Die Bruchstücke der großen Bilderhandschrift von Wolframs Willehalm. Farbiges Faksimile in zwanzig Tafeln nebst Einleitung, München 1921. K A R L VON A M I R A , Die große Bilderhandschrift von Wolframs Willehalm, Münchner Sitzungsberichte Jg. 1903, II. Teil: Abhandlungen, München 1 9 0 3 , S. 2 1 3 - 2 4 0 ; D E R S . , Die große Bilderhandschrift von Wolframs Willehalm, ebd. Jg. 1917, 6. Abh., München 1917.
15
Kennzeichnung der Fürsten durch eine besondere Form der Kopfbedeckung mit Herrenschapel, die Charakterisierung von Nichtbesitz duch die Ausgrenzung von Gebäuden oder Ähren aus dem Bildzusammenhang mittels einer Ellipse u.a.m. 120 . Eine Beziehung zwischen der Epenhandschrift und den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, die bis auf die Stammhandschrift zurückgehen muß, ist unverkennbar, wobei immer zu fragen bleibt, wo „die Kraft der Erfindung" lag - bei dem oder den Miniatoren der Epenhandschrift oder bei dem Schöpfer der Stammhandschrift der Codices picturati des Sachsenspiegels? Karl von Amira, der davon ausging, daß die Epenhandschrift als Muster für die Sachsenspiegel-Illustrationen gedient habe, dachte auch an einen schulmäßigen Zusammenhang bzw. an eine thüringisch-sächsische Malerschule; doch hat sich diese Ansicht unter kunsthistorischem Aspekt nicht bestätigen lassen 121 . Erst Anfang der achtziger Jahre wurde Karl von Amira auch von rechtshistorischer Seite widersprochen. Julianus B. M. van Hoek, der das Verhältnis von Text und Bild im Sachsenspiegel untersuchte 1 2 2 und sich dabei ganz besonders auf die Oldenburger Bilderhandschrift bezog, kam zu dem Ergebnis, daß die juristischen Elemente in den Bildern der Großen Willehalm-Handschrift aus dem Sachsenspiegel und seinen Illustrationen entlehnt sind und nicht umgekehrt. Werner Schröder hat ihn durch eine eingehende Untersuchung des Text-Bild-Zusammenhangs in den Willehalm-Fragmenten 1 2 3 überzeugend bestätigt. Danach müssen die Darstellungen der Epenhandschrift, bei denen der Bezug auf den Text sehr viel lockerer und um einiges unschärfer ist als in den Co-
120
SCHMIDT-WIEGAND, Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels und ihr Verhältnis zum Text Eikes von Repgow (Wolfenbütteler Hefte 13) Wolfenbüttel 1983, insb. S.32ff. und Abb. 11 u. 12; H E L L A F R Ü H M O R G E N - V O S S , Text und Illustration im Mittelalter. Aufsätze zu den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und bildender Kunst, hg. und eingel. von N O R B E R T H . OTT, München 1975. Darin: Mittelhochdeutsche weltliche Literatur und ihre Illustration. Ein Beitrag zur Überlieferungsgeschichte, S. 44-47. 121 V O N A M I R A (wie Anm. 119) 1903, S.240. A R T H U R H A S E LOFF, Eine thüringisch-sächsische Malerschule des 13. Jahrhunderts (Studien zur deutschen Kunstgeschichte 9) Straßburg 1897, S. 107. Zusammenfassend D R E S C H E R (wie Anm. 12) S.31. 122 J U L I U S B.M. VAN H O E K , Eike von Repgow's Rechtsboek in Beeld. Observaties omtrent de Verluchting van de Saksenspiegel, Ijsselstein 1982. 123 S.o. Anm. 117. RUTH
16
Ruth Schmidt- Wiegand
dices picturati des Sachsenspiegels, nicht nur dann, wenn es um rechtliche Dinge geht 124 , als abgeleitet oder sekundär gegenüber den Illustrationen der Rechtshandschriften bzw. ihrer Stammhandschrift gelten. Allein, bei dieser Umkehrung des Verhältnisses von Rechtshandschrift und Epenhandschrift machen die bisher üblichen Datierungen Schwierigkeiten. Da der paläographische Befund eine Datierung der WillehalmFragmente in die siebziger Jahre des 13. Jahrhunderts nahelegt 125 , müßte die Stammhandschrift X schon vor diesem Zeitpunkt vorhanden gewesen sein. Dies widerspricht nicht nur den hier aus sachlichen Erwägungen
heraus vertretenen Datierungen, sondern auch den Ansätzen Karl August Eckhardts, die freilich in letzter Zeit in mehr als nur einer Beziehung ins Wanken geraten sind 126 . Seiner Meinung nach ist die vierte deutsche Fassung, auf welche die mitteldeutschen Codices picturati mit ihrer niederdeutschen Stammhandschrift zurückgehen, erst zwischen 1261 und 1270 in Magdeburg entstanden 127 . Das Beispiel zeigt einmal mehr, daß es notwendig ist, Lokalisierung und Datierung der Klassen und Fassungen der uns überlieferten Rechtsbücherhandschriften erneut zu prüfen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu überdenken.
126 Mitbedingt durch die Tatsache, daß die ,Sächsische Weltchronik' nicht mehr als ein Werk Eikes von Repgow gilt: HUBERT HERKOMMER, Eike von Repgows S a c h s e n spiegel' und die ,Sächsische Weltchronik'. Prolegomena zur Bestimmung des Sächsischen Weltchronisten, in: Niederdeutsches Jahrbuch 100, 1977, S. 7-42. Zusammenfass u n g d e r D i s k u s s i o n bei RUTH SCHMIDT-WIEGAND, V o n
der autornahen zur überlieferungskritischen Ausgabe des ,Sachsenspiegels', in: Deutsches Recht zwischen Sachsenspiegel und Aufklärung, Fs. Rolf Lieberwirth, hg. von 124 Vgl. die Beispiele S.247 u. 251, 255 und die Zusammenfassung S. 263 f. 125 E b d . S. 2 4 4 m i t B e r u f u n g auf KARIN SCHNEIDER, G o t i s c h e
Schriften in deutscher Sprache, Bd. 1. Vom späten 12. Jahrhundert bis um 1300, Text- und Tafelband, Wiesbaden 1 9 8 7 .
G E R H A R D LINGELBACH - H E I N E R L Ü C K ,
Frankfurt/Main
- Bern - New York - Paris 1991, S. 13-25. 127 Nach SCHRÖDER (wie Anm. 7) S. 242 spricht gegen diese Datierung, daß in der Magdeburger Rechtsweisung für Breslau aus dem Jahre 1261 die ältere zweite deutsche Fassung, und nicht die vierte zitiert worden ist.
Die Wolfenbütteler
Bilderhandschrift
im Kreis der Codices picturati des Sachsenspiegels
¿ ^ g "öir i r ö c t ' C i i r c i W I l
^
J |
vgk i
n
_
fycy$el
Inligfim g t r f l r e
n
n
c
trltatemi
WrTicfmnt.irafiUralif
• f l l ^ S ^ f e ; n n ö m t r h t t e r ßif J p i öc feit n a gotre l i i ü i m . v n f r ^ * • tia
frnwnltr
uromcn. ö c s tit
11 fcan !d}fll c n c n t t h t gtfc ton. Dar
, i
v m t n e M r i ä ) dio hrtfeitllc g o t r j p f
hitrttitdit®gtneö.oftcnimidill
jj n t c b c i e t h m t . l t m m ö ü m c f m |
n r a m r i r . a a r ö l t M t i i d i t a f tie
,
iirndit. ö a t feöat n a rnfttr t r f t r
j
i t n n a i r m c ftnnc. fo e e t m b t
m
if i w i c n . " \ ) a n t t ö i t r n c i ä ! n t m a f i
p
?
1
t i f w j f t r i laic.Tiodi l e i r . t o j n nodi äfft,. ß
o b » (Hn'en«jt;aar
y
M
* u n w n e i s e m t i r g t t t f a n Dar ictt f r f i d i alle ttoie. taiengt« n d j t r : J E van gotrs lialwcn t w o l m
fi.öat
f
f c a l f t ntbtcn.alft gotrstmn.itö *
fingtntfrtt
g^ncöStlirnoucrictr
gan m o d j t . r i f S S ö ' t e f a r » üe g m v n b e n t t aller goten t m i t g t 4 t r mattete a n t r e f f t - h r m c t w ö
Abb. 1: Oldenburg, Landesbibliothek, fol. 6 r : Autorenbild.
17
Ruth Schmidt- Wiegand
wsfìcnttdjtforaixrn m i è bafeé , ìnsÌiudjcsictt^In'ft-fuiiDimci* P fesiòflz ò"(iiffflf|iir t ìii amcfeunigcS ciil/iKÌten (l'ii ( r d j H p n Ö n I n n i n i "ff» " W UMM^UUI »((III UliniiM n u l i HlU|l g l 'j£
-c zu beobachten; gevencnisse (fol. 1 recto 18) aber gevengnisse (ebd.), mac ,kann' (fol. 10 recto 13), aber
36 Ebd. §24, S. 55 ff. 37 Ebd.
38 Siehe den Textband dieser Ausgabe, Einleitung S. 6. 39 P A U L - M O S E R - SCHRÖBLER (wie Anm. 8) §62, S.90f.
8.
Synkope
212
Ruth Schmidt- Wiegand
mag (fol. 1 recto 13), dinc (fol. 10 recto 36) aber ding (fol. 10 recto 27, 29), mag ,Verwandter' (fol. 28 recto 4), mag ,muß' (fol. 28 recto 14), gnug (fol. 28 recto 23), irslug (fol. 46 verso 22), mag (fol. 59 recto 17, 20, 85 recto 9, 21 usw.). Nicht selten stehen Formen ohne Auslautverhärtung und solche mit Auslautverhärtung auf einem Blatt zusammen. Dies spricht dafür, daß sich die Auslautverhärtung, die sich im Ubergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen vollzogen hat, im Mitteldeutschen noch nicht voll durchgesetzt hatte und deshalb in der Schreibung der Handschrift unterschiedlich wiedergegeben wurde. Diese Schwankungen in der Schreibweise sind im zitierfähigen Text mit ganz wenigen Ausnahmen, die zu Mißverständnissen hätten führen können, beibehalten worden. Die Fälle verlangen aber eine besondere Erklärung. Denn wenn bang (fol. 54 recto 10) für hanc ,Bank' steht und dang (fol. 48 verso 14, 56 recto 11) für danc ,Dank' , dazu der Gen. dankis (fol. 48 verso 14), so liegt hier ein stimmloser Laut zugrunde, der im Auslaut durch einen stimmhaften Laut ersetzt worden ist. Es handelt sich also um einen Lautwandel, der dem der Auslautverhärtung in bezug auf das Ergebnis entgegengesetzt ist
10.
Konsonantenschwächung
Man bezeichnet diesen Wandel auch als binnendeutsche Konsonantenschwächung 40 oder Lenisierung. Hier werden die stimmlosen Verschlußlaute p, t, k zu den stimmhaften Verschlußlauten b, d, g gewandelt. Bezeichnend hierfür ist in den Texten von W das Wort babist ,Papst' (fol. 49 recto 23) mit den flektierten Formen babiste (fol. 10 recto 11 u.ö.) u.a., denen nur ein einziges Mal pabist (fol. 50 recto 3) gegenübersteht. Ein vergleichbarer Fall, wenn auch nicht mit dieser Belegdichte, ist tumprobiste (fol. 10 recto 24/25). Für den Wandel von k > g im Silbenauslaut bzw. im Wortinnern sei bagovene (fol. 38 recto 14) genannt, ferner im Auslaut lantvolg für lantvolc (fol. 25 recto 13 ff.). Zweifellos gibt es noch sehr viel mehr Beispiele in den Texten von W. Erwähnt sei nur, daß die Ersetzung von stl. f durch sth. v im Anlaut bei vogele (fol. 6 verso links 5, 40 recto 18) etc. auch als Teil der Konsonantenschwächung gilt. Sie scheint auch in W, dem Schriftbild nach zu urteilen, so gut wie vollständig durchgeführt zu sein. Einzige Ausnahmen sind hier fliehtet (fol. 38 recto 20) zu flechten gegenüber vlichtet (fol. 5 verso rechts 10) und fruchtbere (fol. 33 recto 22) gegenüber vrucht (fol. 39 verso 11). 40 Ebd. §63, S.91 f.
11. Doppelte
Verneinung
Aus der gesprochenen Sprache, wie auch an Mundartsprechern zu beobachten, kommt auch die doppelte Verneinung in einem Satz, die für den Ssp wie für den MRLF charakteristisch ist: Der des nicht tun enwil (fol. 1 recto 22 f.), Wer deme andirn ebinburtig nicht enis, der enmag sin erbe nicht genemen (fol. 14 verso 22 f.). Hier sind zwei verschiedene Formen der Negation nebeneinander getreten: nämlich die Negationspartikel en < frühmhd. ne, ahd. nie,41 die nach Verlust des Stimmtons eine Verbindung mit dem Verb eingegangen ist, und das Indefinitpronomen oder unbestimmte Fürwort nicht42 aus älterem niewiht, niht ,nichts' . Während auf diese Weise ein ganzer Satz negiert wird, kann mit den Pronomina kein und niemand^ ein Wort oder ein Satzabschnitt verneint werden. Auch hier kann durch zusätzliches en- und nicht darüber hinaus der ganze Satz negiert werden: Kein wip enmag ouch irs gutis nicht vorgeben ane irs mannes willen ... (fol. 18 recto 32f.), Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin (fol. 15 verso 33 f.). In der neuhochdeutschen Ubersetzung fällt diese doppelte Verneinung, die eine Verstärkung enthält, modernem Sprachgebrauch entsprechend fort: „Keine Frau kann auch ihr Gut ohne Einwilligung ihres Mannes veräußern" (fol. 18 recto 32) bzw. „Leibzucht kann den Frauen niemand streitig machen" (fol. 15 verso 33). Die doppelte Verneinung bedeutet hier also nicht, daß Minus x Minus = Plus ergibt, sondern es handelt sich um eine Redundanz oder Uberbestimmung des Ausdrucks durch die mehrfache Markierung der gleichen Bedeutung. Dabei hat nicht gegenüber en- zweifellos die Führung, wie an folgenden Beispielen zu erkennen ist: Der phaffe teilt mit deme brudere unde nicht der munch (fol. 17 verso 7/8); Man sait, das kein kint siner muter kebeskint ensi, des is doch nicht (fol. 21 verso 3/4) und Elich man noch elich wip ennimt och uneliches mannes erbe nicht (fol. 21 verso 2). In dem an letzter Stelle genannten Beispiel findet sich als eine weitere Variante möglicher Negationen das Präfix un- in uneliches, auf das an anderer Stelle noch einmal zurückzukommen sein wird. Doch mit diesem Punkt haben wir uns bereits auf die benachbarten Gebiete von Wortbildung und Syntax begeben.
41 Ebd. §10 Nr. 5, S.27. 42 Ebd. §151 Nr. 8, S. 181. 43 Ebd. §151 N r . 2 u. 5, S. 179f.
Sprache und Stil der Wolfenbütteler
III. Syntax 1.
213
Bilderhandschrift
Kurzsätze
Über den ganzen Text des Sachsenspiegels verteilt finden sich kurze Sätze, die eine Rechtsregel oder ein Rechtsprinzip in knapper, bündiger Form enthalten, wie etwa Ldr I 31 § 1: Man unde wip enhaben kein gezweiet gut zu irme libe (fol. 18 recto 28/29) oder Ldr I 21 §2 Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin (fol. 15 verso 34/16 recto 1). Es sind Sätze normativen Charakters, die - abgezogen von einem konkreten Einzelfall - in Form einer Feststellung oder Festsetzung etwas Allgemeingültiges oder allgemein Verbindliches zum Ausdruck bringen 44 . Diese Allgemeinverbindlichkeit wird in den beiden angeführten Fällen grammatisch durch Artikellosigkeit (lipgedinge) 45 , generalisierende Paarformeln {man unde wif), durch das Präsens der 3. Pers. {enkan Sg., enhaben PI.), durch die Verwendung unbestimmter Pronomina (nieman) 4 6 ausgedrückt. Die doppelte Verneinung {enhaben/kein und enkan/nieman) weist sie als Sätze gesprochener Sprache aus. Die Spitzenstellung der Kernbegriffe, die im wesentlichen den rechtlichen Inhalt des Satzes ausmachen, - die generalisierende Formel man unde wip auf der einen Seite, auf der anderen der Rechtsterminus lipgedinge ,das auf Lebenszeit zur Nutznießung ausbedungene und/oder übertragene Gut' - spricht ebenfalls für Herkunft der Wendungen aus der Mündlichkeit vor Gericht.
2. Der Umlaufcharakter der Kurzsätze Es gibt etwa 180 derartiger Sätze 47 , die auch isoliert auftreten können und so unabhängig vom Ssp in anderen Rechtsbüchern und Rechtsquellen vorkommen, wohl aufgrund einer bereits vorhandenen breiten mündlichen
Überlieferung. Sie wird Ldr I 51 §2 ausdrücklich bezeugt: Man sait, das kein kint siner muter kebeskint enis (fol. 21 verso 3/4). Indem Eike aber fortfährt: des is doch nicht setzt er sich ausdrücklich von dieser weitverbreiteten Meinung ab, die sich in den Satz fassen läßt: Kein kint is siner muter kebeskint. Solche Sätze mit „Umlaufcharakter" oder „Volksläufigkeit" haben sich in einigen Fällen zu Rechtssprichwörtem 48 verfestigt, die sich bis auf den heutigen Tag einen gewissen Gebrauchswert erhalten haben, wie bei Ldr II 59 § 4: De er zu der mul kumt, der melt e (fol. 40 recto 4), „Wer zuerst kommt, der mahlt zuerst" 49 , oder Ldr III 29 §2: Der eldiste sal teiln, der iungiste sal kiesen (D fol. 40 recto 30), „Der Alteste teilt, der Jüngere wählt". Für die Herkunft dieser Sätze aus der Sprache des Gerichts bzw. für ihre Weitergabe auf mündlichem Wege 50 spricht auch die Variantenbildung, die sich bei einigen von ihnen feststellen läßt. Gleiche oder ähnliche Aussagen zu einem Sachverhalt tauchen so an verschiedenen Stellen des Rechtsbuches in leicht abgewandelter Form wieder auf: so Ldr II 12 §13 sizzende sal man urteil vinden (fol. 29 recto 2 / 3 ) noch einmal Ldr III 69 §2 sizzende suln si urteil vinden (fol. 54 recto 8/9); oder Ldr I 16 § 2 Wo das kint is vri unde echt, das behelt sins vater recht (fol. 14 verso 7/8), das Ldr III 72 Echt kint unde vri behelt sins vater schilt (fol. 54 verso 7 / 8 ) und Lnr 21 § 1 Der son behelt des vater schilt zu lenrechte (fol. 65 verso 3 / 4 ) variiert worden ist. Oder Ldr I 62 § 8 Welches Urteils man von erst vraget, das sal man von erst vinden (fol. 24 verso 10/11) mit Lnr 67 §7 Swer aber urteiles vraget vor den anderen, des urteil sal man erst vinden (fol. 76 recto 31/76 verso 1). Codices picturati (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 13) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1989. 48 Zu den Begriffen „Volksläufigkeit" und „Umlaufcharakter" vgl.
44 RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
Rechtssprichwörter
und
ihre
Wiedergabe in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Text und Bild, Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und früher Neuzeit, hg. von
RÖHRICH
-
WOLFGANG
MIEDER,
Sprichwort
STEPHAN BUCHHOLZ u . a . , P a d e r b o r n
1993,
S.277-296.
4 9 JANZ (wie A n m . 4 7 ) S. 8 9 f f . ; ANDREAS WACKE, W e r z u e r s t
CHRISTEL M E I E R - U W E RUBERG, W i e s b a d e n 1 9 8 0 , S . 5 9 3 -
kommt, mahlt zuerst - Prior tempore potior iure, in: Ju-
629; jetzt auch DIES., Wissensvermittlung durch Rechtssprichwörter. Das Beispiel des Sachsenspiegels, in: Wissensliteratur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache, hg. von HORST
ristische A r b e i t s b l ä t t e r 1981, S. 9 4 - 9 8 ; ALBRECHT FOTH,
BRUNNER - NORBERT W O L F , W i e s b a d e n 45
LUTZ
(Sammlung Metzler 154) Stuttgart 1977, S. 1. RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Sprichwörter und Redensarten aus dem Bereich des Rechts, in: Fs für Ekkehard Kaufmann, hg. von
1 9 9 3 , S. 2 5 8 - 2 7 2 .
PAUL - M O S E R - SCHRÖBLER ( w i e A n m . 8 ) § 2 9 1 ,
S.344.
46 Ebd. §289 4.5, S.399f. 47 So nach BRIGITTE JANZ, Rechtssprichwörter im Sachsenspiegel. Eine Untersuchung zur Text-Bild-Relation in den
Gelehrtes römisch-kanonisches Recht in deutschen Rechtssprichwörtern (Juristische Studien 24) Tübingen 1971, insb. S. 186 ff. 50 Vgl. hierzu jetzt auch BRIGITTE JANZ, „Dan nach Sprichwortten pflegen die Bauren gerne zu sprechen": Überlegungen zur Rolle von Rechtssprichwörtern im spätmittelalterlichen Gerichtsverfahren, in: Proverbium 9, 1992, S. 8 1 - 1 0 5 .
214 3.
Ruth
Rhythmus
Viele dieser Sätze beziehen sich auf das Erbrecht oder das eheliche Güterrecht, also auf den zentralen Bereich des überkommenen Gewohnheitsrechtes. Sie gehören zum ältesten Bestand des Rechtsbuches überhaupt. Auch von hier aus liegt ihre Herkunft aus der Spruchpraxis der heimischen Gerichte nahe, wo sie für die Urteilsfindung wie Urteilsverkündung ihren Wert hatten und neben dem schriftlich fixierten Recht auch noch immer behielten. Dieser pragmatische Bezug auf die Mündlichkeit des Rechts bei Beratung und Verkündung, wo Sätze dieser Art zitiert werden konnten oder mußten, wird nicht allein an den Reflexen gesprochener Sprache (s.o. II.) deutlich, sondern auch an der Tatsache, daß sie wie Ldr I 6 §4 Man sal ouch deme erbin geldin, was man deme totin schuldig was (fol. 12 recto 32/33) rhythmisch gestaltet sind oder wie Ldr III § 3 Musteil unde morgengabe enerbit kein wip bi ires mannes libe (D fol. 41 verso 18/19) eine stabreimende Formel aufzuweisen haben. Auch die Verwendung von Endreim begegnet nicht selten: Ldr 151 § 1 Is ist manch man rechtelos, der nicht enis echtelos (fol. 21 recto 32) oder Lnr 76 §6 Herren unde mannes valsche rat glichen wol untruwere tat (fol. 84 recto 5/6). Rhythmus und Reim, Stabreim und Endreim helfen, Sätze wie die hier genannten im Gedächtnis zu befestigen. Sie haben also die Funktion mnemotechnischer Hilfsmittel. In einer der besten Handschriften des Ssp in seiner mnd. Fassung, in der Berliner Hs. Mgf 10, 51 die C. G. Homeyer seiner Ausgabe des Sächsischen Land- und Lehnrechtes zugrunde gelegt hat, ist so der an letzter Stelle genannte Satz Herren und mannes valsche rat... mit der Randnotiz Merke dat (fol. 110 verso) versehen worden, was den Charakter dieses Satzes als eines Merksatzes, also eines mnemotechnischen Hilfsmittels, deutlich macht. Entsprechendes gilt prinzipiell auch für die übrigen Rechtsregeln dieser Art, die sich im Text des Rechtsbuches finden 52 .
man ane manschaft (fol. 52 verso 30), auch Ldr III 63 § 2 Ban schadit der sele unde ennimt doch nimande den lip (fol. 52 recto 31/32). Die Spitzenstellung der Kernbegriffe war auch Lnr 76 § 6 Herren unde mannes valsche rat . . . (s. o.) zu beobachten. Ferner Ldr II 12 § 13 Sizzende sal man urteil vinden (fol. 29 recto 2 / 3 ) bzw. Stende sal man urteil scheiden (ebd.). Die Fälle ließen sich leicht vermehren. Bei den bisher genannten Beispielen läßt sich neben der Verwendung der 3. Pers. Präs. Indik. der reichliche Gebrauch sog. Modalverben beobachten. Unter diesem Begriff versteht man Verben wie wollen, sollen, können, müssen, dürfen und mögen, die in Verbindung mit einem Vollverb (meist Infinitiv) die Modalitäten oder Bedingungen des verbalen Geschehens zum Ausdruck bringen. Im Rechtstext des Ssp sind es die Modalverben sal/suln, mus/musen, mag/mugen und kan/kunnen. Die folgenden Belege, die hier stellvertretend für eine sehr viel größere Menge stehen, sind ihrer relativen Belegdichte entsprechend angeordnet: Ldr III 69 §2 Stende sal man urteil scheiden (s.o. fol. 29 recto 2); Ldr II 71 §3 Wapen mus man ouch wol vuren, wen man deme gerufte volget (fol. 41 verso 33/34); Ldr I 31 § 1 Kein wip enmag ouch irs gutis nicht vorgeben ane irs mannes willen (fol. 18 recto 32/33); Ldr I 21 §2 Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin (fol. 15 verso 34/16 recto 1). An den Stilmerkmalen der Kurzsätze ist schließlich die Tendenz zur unpersönlichen Ausdrucksweise durch die ist- oder «»¿/-Konstruktionen bzw. die Verwendung unpersönlicher oder verallgemeinernder Pronomina wie man, manech, nimant, kein usw. zu beobachten; so in Sätzen wie Ldr 1 5 1 § 1 Is ist manch man rechtelos, der nicht enis echtelos (fol. 21 recto 32), Lnr 21 §3 Is enerbit nimant kein len wen der vater uf den son (fol. 65 verso 10/11); Ldr 49 § 1 Is enmus nimant sine obese hengen in eins andern mannes hof (fol. 38 recto 5/6).
5. Satzgefüge (Relativ4. Struktur der Merksätze Die Struktur dieser Kurz- oder Merksätze, die aus der Spruchpraxis der Gerichte stammen, ist grundsätzlich die gleiche, wie bei den eingangs (III.l.) genannten Beispielen. Die Artikellosigkeit wie die Spitzenstellung der Kernbegriffe bei gleichzeitiger Auflösung der Satzklammer finden sich häufig, z. B. Ldr II 64 § 5 Ban liet
51 S.o. Anm.2. 52 S C H M I D T - W I E G A N D , Wissensvermittlung sprichwörter, S. 257 ff.
durch
Rechts-
Schmidt-Wiegand
und
Konditionalsätze)
Einige der bisher genannten Beispiele zeigen, daß die Kurzsätze normativen Charakters auch durch einen Glied- oder Nebensatz ergänzt werden können, mit dem bestimmte Teile des Hauptsatzes relativiert oder spezifiziert werden bzw. auch Voraussetzungen und Bedingungen genannt werden, an welche die Norm gebunden gewesen ist. Je nachdem spricht man von Relativ- oder Konditionalsätzen, zwei Typen, die im Text des Ssp häufig vertreten sind. Bei den Relativsätzen 53
53
PAUL 434
ff.
-
MOSER
-
SCHRÖBLER,
§§342
u.
352,
S. 4 2 0 f f .
u.
Sprache und Stil der Wolfenbütteler
überwiegen die Sätze, die durch das ursprüngliche Demonstrativpronomen der, die, daz eingeleitet werden, eindeutig. Nur wenige Beispiele können hier angeführt werden: Ldr I 51 § 1 Is ist manch man rechtelos, der nicht enis echtelos (fol. 21 recto 32); Ldr II 59 §4 Der er zu der mul kumt, der melt e. Im mittelalterlichen Deutsch war die Verwendung der verallgemeinernden Pronomina swer, swelch < so wer, so welch54 ,wer immer' weit verbreitet. Auch im Ssp der nieder- wie mitteldeutschen Handschriften finden sich zahlreiche Beispiele. Doch läßt sich in W ein leichter Rückgang zu Gunsten der einfachen Fragepronomen wer, welch vor allem im Landrecht feststellen. So heißt es Lnr 67 §7 Swer aber urteiles vraget vor den anderen, des urteil sal man erst vinden (fol. 76 recto 31/verso 1) oder Ldr II 59 §3 in der nd. Fassung Swelk wagen erst op de brugge kumt, de scal erst over gan; aber in W Welch wagen er uf di brücke kumt, der sal er ubergen (fol. 40 recto 3/4). Hier ist also das verallgemeinernde Pronomen swelch durch das einfache Fragepronomen welch ersetzt worden. Entsprechendes gilt für die Relativsätze, die durch relative Adverbien eingeleitet werden, wie etwa Ldr I 16 §2 Svar it kint is vri unde echt, dar behalt it sins vader recht, - eine Stelle, die in W wie folgt lautet: Wo das kint is vri unde echt, das behelt sins vater recht (fol. 14 verso 7/8). Auch hier ist an die Stelle des verallgemeinernden swar ,wo immer' 5 5 das einfache Fragepronomen wo getreten. Entsprechend hieß es Ldr II 7 §3 im mnd. Text: Wapen mut men wol vuren, swenne man dem geruchte volget, während es in W lautet: Wapen mus man ouch wol vuren, wen man deme gerufte volget (fol. 41 verso 33/34). Hier freilich hat man es mit einem Satz temporal-konditionaler Bedeutung 56 zu tun, wo die Konjunktion swanne, swenne ,wann immer, wenn' auch auf dem Wege lautlicher Vereinfachung zu md. wen geworden sein kann.
6. Anordnungs-und Konjunktiv
Bedingungssätze (Ldr 36 §2),
Im Text des Ssp gibt es auch längere Satzgefüge, in denen dem Benutzer oder Leser verschiedene Möglichkeiten der Modifizierung oder Ergänzung vor Augen gestellt werden: etwa besondere Voraussetzungen und Bedingungen des rechtlichen Geschehens, wie z. B. im Zusammenhang mit dem Anevangsverfahren, bei dem
54 Ebd. S§281, 282, S.332f. u. 333 f. 55 Ebd. S 342, S.420f. 56 Ebd. §351, S.430.
215
Bilderhandschrift
es um die Beschlagnahme des gestohlenen Gutes durch den Geschädigten bzw. auch um den Widerspruch des Angesprochenen wie in Ldr II 36 §2 geht: Spricht aber iener da wider, ab is gewant is, he habe is lasen wirken, oder ab is phert sin oder ander vie, he habe is in sime stalle gezogen, he mus is mit mereme rechte behalden, ienir, der is in den geweren hat, ab hes selb dritte siner nakebure gezugen mag, denne iener, der is geanevangit hat (fol. 34 recto 31-35 verso 1/2). Hier sind mehrere, mit ab = ob ,wenn' eingeleitete Konditional- oder Bedingungssätze 57 der indirekten Rede eingefügt bzw. nachgestellt, deren Inhalt selbst im Konjunktiv erscheint (habe is lasen wirken, habe is in sime stalle gezogen), völlig zutreffend, ist doch das vom Sprecher Ausgesagte möglich, aber nicht erwiesen. Eine andere im Ssp reichlich vertretene Verwendung des Konjunktivs betrifft die Fälle, in denen zu einem bestimmten Handeln aufgefordert wird 5 8 . Im Text über das Anevangsverfahren sind mehrere Beispiele vorhanden; ein Satz sei hier wenigstens angeführt: Weigert hes, he schrie im das gerufte nach unde grife en an vor sinen dip, als ab di tat hanthaft si, wen he sich schuldig hat gemacht mit der vlucht (fol. 34 recto 26/29). Bedingungs- und Aufforderungssätze stehen hier in einem Wechsel und machen das Satzgefüge aus.
7. Satzgefüge im Mainzer
Reichslandfrieden
Ausführungen mit längeren Satzperioden, die vorgelesen werden mußten, um bei den betroffenen H ö rern und ihrem Umstand richtig anzukommen, sind meist in einer bestimmten Kanzlei (wie etwa der Reichskanzlei) formuliert worden und damit charakteristisch für einen kanzleimäßigen Sprachstil 59 . Der sprunghafte Anstieg solcher Schriftstücke während der Rechtsbücherzeit hing zweifellos mit der Verschriftlichung des Rechtswesens im 13. Jahrhundert zusammen, für die auch die Aufzeichnung des Ssp ein Beispiel ist. Für das Verhältnis von Deutsch und Latein sind hier die Urkunden besonders aufschlußreich, für die es lat.-dt. Parallelfassungen gibt 60 . In den Kreis
57 Ebd. §352, S.434f. 58 Ebd. §312, S.375f. 5 9 Sachwörterbuch der Mediävistik, hg. von P E T E R D I N Z E L BACHER, Stuttgart 1992, S.411 f. (Kanzleisprache, Kanzleistil). 6 0 URSULA SCHULZE, Lateinisch-deutsche Parallelurkunden des 13. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Syntax der mittelhochdeutschen Urkundensprache (Medium Aevum 30) München 1975.
216
Ruth Schmidt- Wiegand
dieser Parallelüberlieferung gehört auch der in D und W überlieferte Mainzer Reichslandfriede, aus dem in diesem Zusammenhang nur eine ganz besonders lange Satzperiode des Eingangs (fol. 1 recto 5/17) zitiert werden soll: Swelch son sinen vater von ¡inen bürgen oder von anderen sinem gute vorstozet oder vorburnet oder roubit oder zcu sines vatir viendin sichert mit truwen oder mit eiden, das uf sines vater ere get oder uf sine vorterpnisse, bezuget in des sin vater zcu den heiligen vor sime richtere mit zcwen seintbaren mannen, di nimant mit rechte vorwerfin mag, der son sal sin vorteilt egenes unde lenes unde varndis gutes unde werlichen alles gutes, des he von vater oder von muter erbin solde eweclichen, also das im wedir richter noch vater nimmer wider gehelfin mag, das he kein recht zu dem seibin gute immer gewinnen muge. Dies vielgliedrige Satzgefüge folgt im Grundsätzlichen dem lat. Vorbild, was aber nicht ausschließt, daß es auch, bedingt durch die innere Sprachform des Deutschen und den Usus der heimischen Rechtssprache, Abweichungen von der Vorlage enthält. Im Kern des Gefüges steht ein Aufforderungssatz: der son sal sin vorteilt egenes unde lenes unde varndis gutes. Ihm vorausgestellt sind die in Gliedsätze gefaßten positiven und negativen Bedingungen. Diese Sätze, die im lat. Text meist durch si oder nisi eingeleitet werden, sind im dt. Text durch konjunktionslose Konditionalsätze oder verallgemeinernde Relativsätze ersetzt: Swelch son sinen vater von sinen bürgen oder von anderen sinem gute vorstozet bzw. bezuget in des sin vater zcu den heiligen... Außerdem enthält dieses Gefüge mehrere erläuternde Relativsätze wie das uf sines vater ere get. Gemeint ist hier das verräterische Bündnis Heinrichs (VII.) gegen seinen Vater, Friedrich II., also ein ganz bestimmtes konkretes Ereignis. Durch die Wiederaufnahme des eingangs genannten Subjekts {swelch son) im Haupt- oder Kernsatz (der son) wird die Fernstellung von Subjekt und Prädikat umgangen und auf diese Weise vermieden, daß dem H ö r e r der Sinnzusammenhang des Ganzen über eine lange Kette von Gliedsätzen hinweg verlorengeht 61 . Der Aufbau des Satzgefüges ist also in diesem Fall hörer- oder empfängerorientiert. Mit anderen Reflexen gesprochener Sprache zusammengenommen, lassen Beispiele wie diese Schlüsse auf die besondere Gebrauchssituation, die Verkündung oder Verlesung zu, für die dieser Text im ganzen bestimmt gewesen ist 62 .
8.
Passivvermeidung
Für die dt. Fassung des MRLF ist gegenüber dem lat. Vorbild die Vermeidung des Passivs besonders bemerkenswert, - eine Stileigentümlichkeit des Gesetzestextes, die sich tendenziell auch am Text des Ssp feststellen läßt. Bei dem Ersatz von Passivformen durch Aktivformen ist den Modalverben wie suln und mugen offensichtlich eine besondere Rolle zugefallen. Formelhafte Wendungen wie cogatur iudice wurden mit den sal der richter dar {zu) twingen (fol. 1 recto 23) wiedergegeben; entsprechend ministeriales vero in causis ministerialium ... admittantur durch ein dinstman mag is ouch bezugen mit andern dinstmannen (fol. 1 verso links 15/16). Man kann Passiwermeidungen wie diese, die für die dt. Fassung des MRLF ganz allgemein typisch sind, damit erklären, daß für den Übersetzer das Interesse an dem Vorgang und seinem Träger im Vordergrund gestanden hat 6 3 , - und man möchte hinzufügen: zumindest unbewußt. Dies wird z. B. auch daran deutlich, daß von ihm Nominalformen von Verben meist durch Sätze mit eigenem Prädikat wiedergegeben worden sind. Ein Beispiel mag dies belegen: Precepimus autem omnes stratas publicas observari et coactus stratas cessare entspricht im deutschen Text Wir sezcin unde gebiten, das man di rechten lantstrasen vare unde nimant den anderen mit gewalt twinge von der rechtin strase (fol. 2 recto links 30/33). Das geringe Auftreten von Passivformen im Text des Ssp ist auch vor dem Hintergrund dieser Tendenz zu sehen.
9. Paarformeln Obwohl im MRLF das vielgliedrige Satzgefüge vorherrscht, gibt es auch in ihm eine Reihe von Kurzsätzen, bei denen man annehmen kann, daß sie aus der gesprochenen Sprache kommen, besonders dann, wenn es sich inhaltlich um altes Gewohnheitsrecht handelt, wie etwa bei der Regel Di nideren enmugens den hogern nicht gehelfin (fol. 1 verso links 21/22). Die Verbindlichkeit solcher Rechtsregeln wie auch der Gebote oder Verbote, die in diesem Gesetzestext enthalten sind, wird nicht allein durch die Modalverben suln, musen, mugen unterstrichen, sondern auch durch die Verwendung von Paarformeln, wie hier durch die legislative Formel Wir sezzen und gebiten, die im Text des MRLF häufiger vorkommt, um Bestimmungen einzuleiten, mit denen der Kaiser als Gesetzgeber bestehenden Miß-
61 Ebd. S. 18 f. u. S. 46. 6 2 SCHMIDT-WIEGAND 351
ff.
(wie
A n m . 25)
insb.
S. 3 4 6 - 3 4 9
u.
63 SCHULZE (wie Anm.60) S.88-103, insb. S . 8 6 f .
Sprache und Stil der Wolfenbütteler
217
Bilderhandschrift
ständen im Reich wirksam entgegentreten wollte. Formal gesehen handelt es sich bei dieser Paarformel 6 4 um eine tautologische Formel, bei der die beiden Glieder sezzen und gebiten in semantischer Beziehung zwar nicht völlig gleich sind, sich aber doch weitgehend decken. Diesen tautologischen Paarformeln, die in Rechtstexten besonders reichlich vertreten sind, stehen kontrastive Formeln wie uf wassere oder uf lande, di sullen den wegen und den brücken (fol. 2 recto links 15/16), durch liebe noch leide (fol. 3 recto links 23/24) gegenüber. Schließlich kommen als dritte Gruppe die differenzierenden Formeln wie recht unde gewonheit (fol. 2 verso links 13/14), recht unde gebot (fol. 3 verso links 9/10) hinzu, mit denen zwischen Gewohnheitsrecht und Satzungsrecht unterschieden wird. In beiden Texten von W ist die Stilform der Paarformel nahezu gleich häufig vertreten. Im Gegensatz zur Dichtung haben diese Paarformeln aber hier, im Rechtstext, nicht allein schmückende Funktion. Sie dienen vielmehr unmittelbar der Verdeutlichung des Wortlauts, indem sie die Umschreibung eines abstrakten Begriffs enthalten, der selbst nicht genannt zu werden braucht. Das gleiche leisten grundsätzlich auch die drei- oder mehrgliedrigen Wortreihen. Zwei Beispiele mögen dies belegen. Mit der Paarformel bevriden unde beleiten (fol. 2 recto links 19) ist,Schutz' gemeint; mit der Wortreihe egenes unde lenes unde varndis gutes , Besitz' , dessen Vollständigkeit durch den Zusatz unde werlichen alles gutes (fol. 1 recto 15) noch unterstrichen wird.
10. Herkunft der Paarformeln Paarformeln wie die eben genannten gehören zum Stil mittelalterlicher Urkunden und Rechtstexte hinzu und lassen sich seit den Anfängen einer Aufzeichnung des Rechts nachweisen. Man hat deshalb bezweifelt, daß sich die Zwillingsformeln aus der heimischen Spruchpraxis herleiten, sondern an das Urkundenwesen und die Kanzleien als Herkunftsort gedacht 6 5 . Der Blick auf den MRLF und auf den Ssp in W kann hier zu einer Klärung beitragen. Wir sezzen und gebiten als ein analytischer Ausdruck ist im dt. MRLF mehrfach an die Stelle einer synthetischen Formel des lat. Textes
6 4 RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Artikel
,Paarformeln',
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte Anm.6) 3, Berlin 1984, Sp. 1387-1393. 65 KARL SIEGFRIED BADER, R e c h t - G e s c h i c h t e -
getreten wie statuimus (fol. 1 recto) oder precepimus (fol. 2 recto links). Ein Zwang zur zweigliedrigen Formel bestand also von der Vorlage aus gesehen nicht. Mit der Entscheidung für die Zweigliedrigkeit folgte der Ubersetzer vielmehr einer in seiner Sprache angelegten Tendenz. Im Ssp gibt es die legislative Formel Wir sezzen und gebiten nicht. Hier unterscheiden sich Gesetz und Recht, von denen nur das eine ausgesprochenen Satzungscharakter hat. Doch finden sich außerdem zwischen den Paarformeln des Landfriedens und des Rechtsspiegels Parallelen, die nur mit der gemeinsamen Herkunft dieses Formelgutes aus einer mündlichen Tradition erklärt werden können. Wenigstens einige dieser Parallelen sollen im Folgenden genannt werden. Die mit dem Begriff der Hehlerei verbundene Paarformel dubig oder roubig (fol. 3 verso links) begegnet im Text des Ssp Ldr II 36 §4 mit der Variante duplich oder rouplich (fol. 34 verso 10) bzw. auch Ldr II 29 mit Negation undiuplich unde unrouplich (fol. 33 verso 14); die Formel egenes unde lenes (fol. 1 recto 14) hat Ldr II 21 §3 in an eigen oder an lene (fol. 31 recto 21) ihre Entsprechung, und die Formel erlös und rechtlos, die im MRLF allein fünfmal begegnet, ist im Ssp Ldr II 13 §1 als erlös unde rechtelos (fol. 29 recto 23) überliefert, wobei es sich hier um eine allgemein weitverbreitete differenzierende Formel handelt, indem die Unechtheit (z.B. durch uneheliche Geburt) oder die Unehrlichkeit (aufgrund bestimmter Berufe) zwar Rechtsminderung, aber keine völlige Rechtlosigkeit nach sich zog 6 6 . Der Ssp läßt eine Entwicklung erkennen, die von der Formel echtlos und rechtlos bzw. echt und recht zu erlös unde rechtlos geführt hat. Bezeichnend für diese Entwicklung ist die Aufnahme der Paarformel echtlos und rechtlos in den Ldr I 51 § 1 enthaltenen Merksatz Is ist manch man rechtelos, der nicht enis echtelos (fol. 21 recto 32). Mit ihm wird der Meinung entgegengetreten, daß es sich bei rechtlos und echtlos bereits um synonyme Begriffe handelt. Eine gewisse Unsicherheit in bezug auf die Semantik der beiden Bezeichnungen läßt sich im Ssp ohnehin feststellen. Sie führte schließlich zum Ersatz der Formel echtlos und rechtlos durch das Wortpaar erlös und rechtlos67. Der MRLF, in dem echtlos als mnd. Reliktform
in:
(wie
Sprache.
Rechtshistorische Betrachtungen über Zusammenhänge zwischen drei Lebens- und Wissensgebieten, in: Historisches Jahrbuch 93, 1973, S. 1-20.
66 ROBERT SCHEYHING, Artikel ,Ehre', in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (wie Anm.6) Sp.846-849; ADALBERT ERLER, Artikel Rechtlosigkeit, Rechtsminderung', in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (wie Anm.6) 4, Berlin 1990, Sp.258-261. 6 7 JANZ (wie A n m . 4 7 ) S. 2 6 2 ff.
218 ohnehin keinen Platz gehabt hätte, spiegelt zusammen mit dem Ssp einen Prozeß wider, der sich in der gesprochenen Sprache abgespielt hat. Mag auch der Kanzleistil die Zwei-, Drei- und Mehrgliedrigkeit des Ausdrucks in den deutschsprachigen Rechtstexten ge-
Ruth Schmidt- Wiegand fördert haben, so lassen MRLF und Ssp doch eine mündliche Tradition erkennen, die neben dem Schriftgebrauch weiterhin bestanden und auf die Texte eingewirkt haben muß.
Ruth Schmidt-Wiegand
Der Rechtswortschatz Der Gegenstand der folgenden Ausführungen ergänzt den Beitrag , Sprache und Stil der Wolfenbütteler Bilderhandschrift' 1 in bezug auf die Lexik. Eine gesonderte Behandlung des Rechtswortschatzes empfahl sich aus mehreren Gründen. Vor allem ist es das Eigengewicht der Lexik, die als „Fachwortschatz" in der gegenwärtigen Diskussion um Fachtexte und Fachsprachen 2 eine eingehende Behandlung erfordert. Sie hätte den Rahmen der Abhandlung über , Sprache und Stil' rein umfangmäßig gesprengt Zum anderen bedarf das Glossar der Rechtswörter einer Einführung, in der seine Anlage begründet wird und verschiedene Aspekte seiner Benutzung dargelegt werden können. Beides ist für die Erschließung der Wolfenbütteler Bilderhandschrift als einem Instrument künftiger Arbeit am Text notwendig. Daß der Befund dieser Handschrift exemplarischen Charakter für die Sachsenspiegelforschung wie die Rechtsbücherforschung überhaupt besitzt, bedarf nach dem, was bisher ausgeführt worden ist, keiner weiteren Begründung.
oder den Quellentyp , Rechtsbücher' innovativ geworden ist 4 , sollte das althergekommene, angewandte Gewohnheitsrecht für die Entscheidungen im Gericht „verfügbar" machen. Denn der Gerichtsspruch der Schöffen im Ding, das Urteil, das von ihnen gefunden und von dem Richter verkündet wurde, war immer auf den konkreten Einzelfall bezogen. Das Rechtsbuch hingegen hatte die allgemeinen, abstrakten, vom Einzelfall abgezogenen Regeln festzuhalten, die den jeweiligen Entscheidungen zugrunde zu legen waren. Es besaß von hier aus Modellcharakter, der sich auch auf die sprachliche Gestalt ausgewirkt hat. Einige charakteristische Züge des Textes wie das Vorherrschen der Modalverben, die Verwendung des Konjunktivs, die unbestimmten und verallgemeinernden Pronomina sind bereits behandelt worden 5 : Sie bringen die Verbindlichkeit wie die Allgemeingültigkeit der Rechtssätze zum Ausdruck. Nachzutragen bleibt hier eine Charakterisierung des Wortschatzes, der praktisch Kernstück einer Fachsprache ist.
1. Der Sachsenspiegel als Fachbuch
Dabei ist der Rechtswortschatz generell von der Lexik anderer Fachsprachen deutlich unterschieden 6 . Wie sich das Recht auf die ganze Breite des Lebens bezieht,
Beim Sachsenspiegel handelt es sich um ein Werk mittelalterlicher Fachliteratur 3 . Seine Aufzeichnung, mit der das Mittelniederdeutsche in bezug auf die „Textsorte"
4 KARL HYLDGAARD-JENSEN, D i e T e x t s o r t e n d e s M i t t e l n i e -
derdeutschen, in: Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung, 1 S.o. S.201 -218. Für die Mitarbeit bei der Erstellung der Belegsammlung sei Petra Menke M. A. an dieser Stelle gedankt.
h g . v o n W E R N E R BESCH - OSKAR REICHMANN - STEFAN S O N -
2 Vgl. d e m n ä c h s t RUTH SCHMIDT-WIEGAND, D e r W o r t s c h a t z
Prolegomena zu einer Texttypologie des Mittelniederdeutschen, in: Aspekte der Germanistik. Fs. für Hans-Friedrich
des Sachsenspiegels, in: Fachsprachen. Ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft (HSK = Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
hg. von HUGO
STEGER -
HER-
BERT ERNST WIEGAND) Berlin - N e w Y o r k (im D r u c k ) . 3 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, D e r , S a c h s e n s p i e g e l ' E i k e s v o n
Repgow als Beispiel mittelalterlicher Fachliteratur, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (Lili), Jg. 13, H e f t 51/52, Fachsprache und Fachliteratur, 1983, S. 2 0 6 - 2 2 6 .
DEREGGER. Zweiter Halbbd., Berlin - New York 1985, S. 1 2 4 7 - 1 2 5 1 ,
insb.
S. 1248;
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
R o s e n f e l d , h g . von WALTER TAUBER ( G ö p p i n g e r - A r b e i t e n z u r
Germanistik 521) Göppingen 1989, S.261-283, insb. S.262f. 5 S.o. S.214ff. Sprache und Stil III.4.ff. 6 RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Artikel
,Rechtssprache',
in:
Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, hg. von ADALBERT ERLER - EKKEHARD KAUFMANN, B e r l i n
1971 ff.,
4 , B e r l i n 1 9 9 0 , S p . 3 4 4 - 3 6 0 ; EBERHARD FRHR. VON KÜNSS-
BERG, Die deutsche Rechtssprache, Deutschkunde 44, 1930, S. 379-389.
in: Zeitschrift für
220
Ruth Schmidt- Wiegand
so ist auch der Rechtswortschatz nicht auf eine bestimmte Berufsgruppe wie etwa die der Juristen beschränkt 7 , sondern bezieht sich auf alle Sprachträger, die mit dem Recht in Berührung kommen können, eben auch auf die berufsmäßig nicht vorgebildeten Personengruppen wie Richter, Schultheißen, Schöffen, Fronboten oder die Dinggenossen, also die unstudierten Laienkreise. Rechtssprache ist von hier aus die Sprache des Rechtslebens überhaupt. Der Eindeutigkeit, welche den Wortschatz einer Fachsprache auszeichnet, steht deshalb hier eine gewisse Vagheit der Begrifflichkeit gegenüber, die aus ihrer Nähe zur Allgemeinsprache, in diesem Fall des Mittelnieder- und Mittelhochdeutschen, kommt und vor allem die Bedeutung, also die semantische Komponente der Wörter, betrifft. Die verschiedenen Darstellungen zur mittelalterlichen Fachliteratur und Fachsprache berücksichtigen zwar den Sachsenspiegel 8 , ohne indessen auf die Problematik, die seinen Wortschatz betrifft, einzugehen. Mit den folgenden Ausführungen soll versucht werden, diese Lücke zu schließen. Dazu ist es notwendig, etwas weiter auszuholen.
2. Rechtswörter
im engeren und weiteren
Sinne
Die Lexikographie, wie sie am ,Deutschen Rechtswörterbuch' praktiziert wird 9 , unterscheidet bei einem Rechtstext Rechtswörter in einem engeren Sinne von Rechtswörtern in einem weiteren Sinne und Nicht-
7 Eine juristisch orientierte Berufsausbildung gab es in Deutschland erst zu Ende des 14. Jahrhunderts, also nach dem Sachsenspiegel, vgl. GERHARD KÖBLER, Artikel J u r i stenausbildung', in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (wie Anm.6) 2, Berlin 1978, Sp. 484-488. 8 GERHARD EIS, Mittelalterliche Fachliteratur, Stuttgart 2 1967, S. 49 f.; PETER ASSION, Altdeutsche Fachliteratur (Grundlagen der Germanistik Bd. 15) Berlin 1973, S.40; WALTHER VON HAHN, F a c h k o m m u n i k a t i o n .
Entwicklung.
Linguistische Konzepte. Betriebliche Beispiele (Sammlung Göschen 2223) Berlin - New York 1983, S. 19. 9 Vgl.
zum
Folgenden
GÜNTHER
DICKEL -
HEINO
SPEER,
Deutsches Rechtswörterbuch. Konzeption und lexikographische Praxis während acht Jahrzehnten (1897-1977), in: Praxis der Lexikographie. Berichte aus der Werkstatt, hg. von
HELMUT
HENNE,
Tübingen
1979,
S. 2 0 - 3 7 ;
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND, Das ,Deutsche Rechtswörterbuch'. Geschichte und Struktur, in: Wörter und Namen. Aktuelle Lexikographie. Symposium Schloß Rauischholzhausen, 25.-27.9.1987 (Marburger Studien zur Germanistik Bd. 13 = Schriften der Brüder Grimm-Gesellschaft 23) Marburg 1990, S. 155-168, insb. S. 158 f.
rechtswörtern. Rechtswörter in einem engeren Sinne wie rechtelös ,rechtlos', richter und gerichtet bezeichnen per se eine rechtsspezifische Sache und sind ohne diesen Zusammenhang nicht denkbar. Ihre Bedeutung liegt von hier aus relativ fest. Meist handelt es sich bei diesen Wörtern um Zusammensetzungen wie bei rechtelös oder um Ableitungen, Prä- und Suffixbildungen, wie bei gerichte und richter von richten, das eine zentrale rechtliche Tätigkeit bezeichnet. Bei Rechtswörtern im weiteren Sinne wird eine außerrechtliche Erscheinung rechtlich gewertet. Es sind meist Wörter, bei denen eine allgemeinsprachliche Bedeutung von einer spezifisch rechtssprachlichen Bedeutung zu unterscheiden ist, wie z. B. bei klagen. In der Wolfenbütteler Bilderhandschrift meist mit der kontrahierten Form clait belegt, meint dieses Wort außerrechtlich und allgemeinsprachlich ,sich klagend gebärden'; in spezifisch rechtssprachlicher Bedeutung aber wird damit die Klage vor Gericht im Sinne von , beklagen' oder , anklagen' gemeint". Ahnlich bedeutet geloben12 im allgemeinsprachlichen Bereich zunächst ,loben' bzw. ,preisen'. Mit der Bedeutung ,geloben, versprechen' wird das Wort zu einem Rechtswort im weiteren Sinne. Im Sachsenspiegel ist geloben mit dieser rechtssprachlichen Bedeutung belegt, hingegen nicht mit der weitergehenden Spezialisierung in der Wendung eine geloben ,sie zu ehelichen versprechen' bzw. ,verloben'.
3. Rechtswortschatz
und
Gemeinsprache
Die Nähe des Rechtswortschatzes zum Wortschatz der Gemeinsprache, wie sie z. B. bei geloben versprechen' zu beobachten ist, wie die Vagheit der Begriffe sind auch von Eike gesehen worden, wie gelegentliche Definitionen, die er dem Benutzer seines Buches an die Hand gibt, verraten. Der Autor versucht, die notwendige Eindeutigkeit zu erreichen, wenn er z. B. den Begriff gut , Besitz an Grund und Boden', dort wo er sich auf das ,Vermögen' im allgemeinen oder ,die Hinterlassenschaft eines Mannes' im Ganzen bezieht, wie folgt erläutert: Mit welchem gute der man stirbit, das heist alles erbe (fol. 12 recto 16). Oder dann, wenn die
10 GERHARD KÖBLER, Richten - Richter - Gericht, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung 87, 1970, S. 57-113. 11 GERHARD BUCHDA, Artikel ,Klage', in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 2, Berlin 1978, Sp. 837845. 12 MATTHIAS LEXER, M i t t e l h o c h d e u t s c h e s
Bd. 1, Leipzig 1872, Sp.8226
{geloben).
Handwörterbuch,
Der
221
Rechtswortschatz
Begriffe laster und schaden im Text gebraucht werden. Laster hatte im allgemeinsprachlichen Bereich die Bedeutungen ,Schmähung, Schimpf', eben ,was die Ehre kränkt', auch lasterhaftes Verhalten'. Für die Anwendung des Rechts mußte diese Vieldeutigkeit oder Polysemie eingeschränkt und genau gesagt werden, was als Verletzung des Rechts zu gelten hatte: Zu lästere spreche ich darumme, ab he slet durch des herren schult unde nicht durch des knechtes oder durch ire beider schult (fol. 33 verso 34, 34 recto 1/1 a). Auch schade S c h a den, Schädigung, körperliche Schwächung', das im Ssp in eben dieser letzten Bedeutung gebraucht wird, glaubt der Autor durch eine besondere Definition verdeutlichen zu müssen: Zu schaden Sprech ich, ab he en geslagen hat, das he sins herren dinst nicht volbrengen mag (fol. 34 recto 2 f.). Eine andere Möglichkeit, Vagheit auszuschalten und Eindeutigkeit zu erreichen, besteht darin, wie bei schade und laster die konkreten Fälle im einzelnen zu benennen, die dem Begriff zu subsumieren sind, wie dies etwa bei dem Begriff hanthafte tat (fol. 34 recto 12 ff.) der Fall ist: Die hanthafte tat ist da, wo man einen man mit der tat begrift oder in der vlucht der tat oder ab he dube oder roup in sinen gewern hat, da he selbe den slussil zu treit. Immer geht es um die Festlegung der spezifisch rechtssprachlichen Bedeutung.
vorhanden, ferner des nches not , Heeresdienst, Reichsdienst' (fol. 85 recto 19): Wen is im des riches not benimt, das di not werde bewiset noch rechte. Von dem semantisch eingeengten, rechtssprachlichen Begriff not , Notzucht' aus sind dann durch Zusammensetzung und Ableitung weitere, mehr oder weniger eindeutige Begriffe, Rechtswörter im engeren Sinne, gebildet worden. So gehören zu not , Notzucht, Vergewaltigung' die verbalen Ableitungen nötigen n o t züchtigen, vergewaltigen': Swer ... unechte wip notiget oder den vriden an en brichet (fol. 48 recto 34) und notzogen - in W mit der Lesart notzagen (fol. 42 verso 19) - mit gleicher Bedeutung. Hinzu kommt die Zusammensetzung nötnunft ,Frauenraub' bzw. ,Notzucht' (fol.42 verso 25), dazu nötnunftig in der Wendung in notnunftigerclage ,bei einer Klage um Notzucht' (fol. 20 recto 22). Auch für den Begriff der ,Notwehr' gibt es eine Abstraktbildung mit dem Suffix -ung: das hes in notwerunge tete (fol. 40 verso 12), in notwerunge sines libes (fol. 56 recto 9). Dazu im Mainzer Reichslandfrieden das Verb: das he sinen Up da unde sin gut notwerende si (fol. 1 verso rechts 6).
So bedeutet not im allgemeinsprachlichen Bereich ,Drangsal, Notwendigkeit' und ,Kindesnot'. Rechtssprachlich wurde das Wort auf , Nötigung, Vergewaltigung' bzw. auch , Notwehr' eingeengt. Im Ssp der Wolfenbütteler Bilderhandschrift und im Mainzer Reichslandfrieden ist das Wort in seiner allgemeinsprachlichen Bedeutung belegt: durch not sinen vienden widersagen (fol. 1 verso rechts 13) und he lidet darumme keine not (fol. 28 verso 25, ähnlich 20 verso 3, 28 verso 25). Auch die Bedeutung ,Kindesnot' ist vorhanden: zu irre not ,in ihren Kindesnöten' (fol. 18 verso 20). Daneben begegnet aber auch die spezifisch rechtssprachliche Bedeutung , Nötigung, Vergewaltigung' in Wendungen wie von der not maget oder wibes (fol. 6 recto links 4, 7 recto links 18, 40 verso 24). Ferner ist not mit der Bedeutung , Notwehr' belegt: Slet ein man den andern tot durch not (fol. 29 verso 15). Phraseologische Wendungen wie echte not (fol. 5 recto rechts 13), ehafte not (fol. 1 verso links 2) meinen die ,rechtlich anerkannte Notlage oder den Hinderungsgrund, vor Gericht zu erscheinen', als da sind: Krankheit, Heeresdienst bzw. Reichsdienst und Gefangenschaft. Außer dem mhd. ehafte not sind Varianten zu dem Begriff der echten not (fol. 5 recto rechts 13, 27 verso 14, 36 recto 27, 80 recto 2) wie rechte not bzw. äne rechte not ,ohne rechtlichen Hinderungsgrund' (fol. 13 verso 15)
Mit der Einteilung des Rechtswortschatzes in Rechtswörter im engeren und weiteren Sinne und in Nichtrechtswörter ist ein heuristisches Prinzip gegeben, das der Ordnung und Bewältigung des Rechtswortschatzes dient, aber kaum sprachhistorischen und linguistischen Ansprüchen genügt. Sprachhistorisch gesehen sind Erb- und Lehnwörter zu unterscheiden, denen eine kleine Zahl von Fremdwörtern gegenübersteht. Sieht man einmal von den lateinischen Zwischenüberschriften wie Incipit Uber tertius capitulum I (fol. 42 verso 16) oder Liber tertius (fol. 6 recto links 3) ab, die das Muster lateinischer Rechtsbücheraufzeichnungen deutlich erkennen lassen, so sind es nur ganz wenige Fremdwörter, die der Text enthält und die ausnahmslos in die höfische Sphäre des Rittertums gehören: Es ist die amie, die Freundin oder Geliebte, von der im Register Von not der amien (fol. 6 recto rechts 32) und im Text des Ssp gesprochen wird: An varnden wiben unde an siner ameien mag der man not tun unde sinen lip vorwirken, ab he si ane danc belegit (fol. 48 recto 36f.). Und es ist das turnei ,Turnier' 1 3 , das im Zu-
4.
13
Fremdwörter
ULRICH
Das
Philologische Aspekte des Turniers, in: Turnier im Mittelalter, hg. von J O S E F Göttingen 1985, S. 163-174.
MÖLK,
ritterliche
FLECKENSTEIN,
222
Ruth Schmidt- Wiegand
sammenhang mit den gebundenen Tagen, den Friedenstagen, erwähnt wird: Binnen geswomen vride ensal man keine wapen vuren, wen zu des riches dinste unde zu turnei sunder swert (fol. 41 verso 28). Als ein Rechtswort im engeren Sinne kann man voitie ,Vogtei' (fol. 19 recto 16 u.ö.) 1 4 mit voit ,Vogt' (fol. 10 verso 6 u. ö.) bezeichnen, wobei zu fragen ist, ob sich voit < voget von mlat. vocatus im Ssp nicht bereits auf dem Wege zum Lehnwort befindet. Bei der Endung -ie handelt es sich jedenfalls um ein Lehnsuffix aus dem Französischen, das hier zusammen mit dem Wort übernommen worden ist.
5. Lehnwörter Ungleich größer als die Zahl der sogenannten Fremdwörter ist die der Lehnwörter, d. h. solcher Bezeichnungen, die in bezug auf die Wortbildungselemente (insb. Suffixe), Schreibung, Flexion und Betonung dem Mittelhochdeutschen bereits weitgehend angeglichen sind. Auch sie beziehen sich gelegentlich auf die Umwelt ritterlicher Kultur wie allem voran das aus dem Niederländischen entlehnte ritter, mnd. riddere, das seinerseits eine Lehnübersetzung von frz. chevalier ist und ursprünglich die Bedeutung , Reiter' hatte 1 5 . Im Ssp ist
14
F R I E D R I C H K L U G E , Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 21. unveränderte Aufl. Berlin - N e w York 1975, S. 823 (Vogt, Vogtei), 22. völlig neu bearb. Aufl. von E L M A R S E E B O L D , Berlin - New York 1989, S.767f. N a c h K L U G E ist Vogtei zufrühest bei Berthold von Regensburg belegt. Indessen hat schon die mnd. Fassung des Ssp vogedie ,Vogtei'. Zur Wortgeschichte von Vogt vgl. auch G A B R I E L E VON O L B E R G , Anwalt, Vogt und ihre Synonyme in den Schriften des Bauernkrieges und der Voraufstände (15./16. Jh.), in: Text- und Sachbezug in der Rechtssprachgeographie, hg. von R U T H S C H M I D T - W I E G A N D , Redaktion G A B R I E L E VON O L B E R G (Münstersche Mittelalter-Schriften 52) München 1985, S. 70-103; K L A U S G R U B M Ü L L E R , Advocatus: fürsprech - vogt - advokat, Beobachtungen an Vocabularien II., in: Sprache und Recht. Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters. Fs f ü r Ruth Schmidt-Wiegand, hg. von K A R L H A U C K - K A R L K R O E SCHELL -
STEFAN S O N D E R E G G E R -
BRIELE VON
OLBERG,
DAGMAR HÜPPER -
GA-
2 Bde., Berlin - New York 1986,
S. 158-171. 15
K L U G E (wie Anm. 14) S.602f., K L U G E - S E E B O L D (wie Anm. 14) S. 602; vgl. auch K A R L O T T O B R O G S I T T E R , Miles, chevalier und ritter, in: Sprachliche Interferenz, Fs f ü r Werner Betz, hg. von H E R B E R T K O L B - H A R T M U T L A U F F E R in Verbindung mit K A R L O T T O B R O G S I T T E R - W O L F G A N G H U B E R - H A N S H . R E I C H - H A N S S C H O T T M A N N , Tübingen 1977, S. 421-435.
ritter (fol. 33 recto 1 f.) - Phaffen unde rittere und ir gesinde sullen wesin zolvri (vgl. auch fol.49 recto 13) - eindeutig Standesbezeichnung, was auch die Wendung von ritters art (fol. 15 recto 24, 18 recto 1) beweist. In diesem Zusammenhang wäre auch wäpen (fol. 6 recto links 1, 41 verso 27, 42 verso 32, 75 verso 23), die mnd. Entsprechung zu mhd. wäfen ,Waffen' (fol. 41 verso 13, 42 verso 35), zu nennen, die mit der Lehnbedeutung ,Waffenzeichen' ebenfalls aus dem Mittelniederländischen entlehnt worden ist 16 , im Ssp aber mit dieser Bedeutung nicht erscheint (zu vergleichen wapin fol. 54 recto 5). Ein Wort ritterlicher Standeskultur ist auch die Bezeichnung für die Rüstung des freien Mannes, insbesondere des Ritters, hamasch17, das in Zusammenhang mit dem hergewete18, dem Vorbehaltsgut des Mannes, belegt ist: Gibit der vatere sime sune kleider und ros unde phert unde hamasch (fol. 13 recto 31) bzw. So sal di vrouwe zu hergewete gebin irs mannes swert und das beste ros oder phert gesatilt unde das beste hamasch (fol. 16 verso 7). Mhd. hamasch bzw. auch hämisch wurde Mitte des 12. Jahrhunderts aus dem Altfranzösischen mit der Bedeutung ,Ausrüstung des Kriegers' entlehnt und wird hier im Ssp mit der eingeschränkten, bereits auch bei Wolfram von Eschenbach belegten Bedeutung ,Waffenhemd' gebraucht: Nicht zuletzt die Abbildungen im Bildteil von W bestätigen diesen Sprachgebrauch. Die Masse der im Text des Ssp enthaltenen Lehnwörter ist indessen vor der höfischen Zeit entlehnt worden; das zeigt u. a. die Tatsache, daß eine Anzahl von ihnen bereits an der zweiten oder althochdeutschen Lautverschiebung teilgenommen hat, also vor dem 8. Jahrhundert entlehnt sein muß. Genannt sei hier kamph ,Zweikampf' < l a t . campus ,Schlachtfeld' 1 9 , das im Ssp
16
K L U G E ( w i e A n m . 1 4 ) S. 8 3 0 u . 8 3 8 ; K L U G E - SEEBOLD A n m . 14) S . 7 7 2 u.
(wie
777.
17
K L U G E (wie Anm. 14) S.290; K L U G E S E E B O L D (wie Anm. 14) S. 294; E M I L P L O S S , Zur Wortgeschichte von harnasch, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 81, Tübingen 1959, S. 107-110. 18 Dazu R U T H S C H M I D T - W I E G A N D , Kleidung, T r a c h t und O r nat nach den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Terminologie und Typologie mittelalterlicher Sachgüter: Das Beispiel der Kleidung. Internationales Round-TableGespräch Krems an der D o n a u , 6. O k t o b e r 1986 (Veröffentlichungen des Instituts f ü r mittelalterliche Realienkunde Österreichs Nr. 10 = Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Phil.-Hist. Kl. 511. Band) Wien 1988, S. 143-175, insb. S. 147f. 19
KLUGE
(wie
Anm. 14)
S.
A n m . 14)
350;
S. 3 4 4 ;
KLUGE
DAGMAR HÜPPER-DRÖGE,
-
SEEBOLD
(wie
D e r gerichtliche
Der
Rechtswortschatz
223
mit Bezug auf den gerichtlichen Zweikampf verwendet wird, z. B. in dem Satz: Lame lute suln ouch entwortin unde clagen ane Vormunden, is ensi, das di clage zu kamphe ge, d. h. „es sei denn, die Klage läuft auf einen gerichtlichen Zweikampf hinaus" (fol. 20 verso 33-21 recto 1). Es ist meistens anlautendes p-, das zu ph (pf bzw. f ) verschoben ist 20 : phaffe, phalburgere, phalenze ,Pfalz', phant/phenden, phenning, phert, phlage ,Pflege' und phlechafte, phlicht, phule, phunt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang phlug21, ein Wort der Alltagskultur, das im Ssp mehrfach belegt ist (z.B. fol. 19 recto 12, 29 recto 31, 39 verso 30). Die Abbildungen in W 2 2 , vergleicht man sie mit entsprechenden Illustrationen in anderen mittelalterlichen Handschriften 2 3 , scheinen der Realität der Sachsenspiegelzeit mit ihrer Sachkultur besonders nahezustehen 2 4 . Den Wörtern, die von der ahd. Lautverschiebung betroffen sind, stehen unverschobene, also später entlehnte Bezeichnungen wie pabist, paradis, pine, pristere gegenüber. Sie beziehen sich wie die älteren Lehnwörter bischof und
Zweikampf im Spiegel der Bezeichnungen für ,Kampf', ,Kämpfer', ,Waffen', in: Frühmittelalterliche Studien 18, 1984,
S. 6 0 7 - 6 6 1 ;
HEINZ HOLZHAUER, D e r
gerichtliche
Zweikampf, in: Sprache und Recht (wie Anm. 15) S. 263283. 20 S.o. S.204. 21 WOLFGANG
P.
SCHMID,
Zur
Etymologie
des
Wortes
„Pflug", in: Untersuchungen zur eisenzeitlichen und frühmittelalterlichen Flur in Mitteleuropa und ihrer Nutzung. Bericht über die Kolloquien der Kommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1975 und
1 9 7 6 , h g . v o n H E I N R I C H BECK -
DIETRICH
DENECKE
phaffe auch auf die kirchliche Hierarchie und Organisation oder wie kelch und kresam , Salböl' auf liturgische Gegenstände und Utensilien. Hinzu kommen im Ssp Bezeichnungen, die schon früh mit den betreffenden Sachen im Zuge eines römisch-deutschen Kulturaustausches in das Deutsche übernommen worden sind: möle ,Mühle', münze ,Münze', sträze und nicht zuletzt spigel mögen hier genannt werden. Spezifisch Rechtliches findet sich kaum darunter, was bei dem geschlossenen Charakter, den das deutsche Recht zur Zeit Eikes noch hatte, nicht überrascht 2 5 . Eine Ausnahme macht hier pine ,peinliche Strafe, Leibesstrafe' 26 , das für die Anfänge einer „peinlichen" Strafjustiz im Ssp aufschlußreich ist: Swelch man einen beclageten man umme ungerichte geweldiclichen deme gerichte enphurt, wirt he gevangen, he lidet pine ieme (fol. 44 recto 21 f.). Erwähnt werden mögen hier auch noch wette und phant Wette27, das heute auch in wett ,quitt' weiterlebt, meinte im Mhd. den , Pfandvertrag, die Rechtsverbindlichkeit, den Ein- oder Ersatz', dazu mlat. vadium ,Verpfändung beweglicher Habe' < germ. wadja - ,Pfand'. Das Wort, das eine weitgespannte Wortfamilie im Deutschen und seinen Nachbarsprachen entfaltet hatte, ist im Laufe des Mittelalters von pfant < frz. pand ,Tuch, Fetzen' bzw. lat. pannus ,Stück Tuch' oder ,das dem Schuldner abgenommene Besitzstück' an die Seite gedrängt worden. Im Ssp ist wette bzw. gewette (fol. 77 verso 13 u. ö.) auf die Summe eingeschränkt, die bei einem verlorenen Prozeß außer der Buße an den Gerichtsherrn abzuführen war, während phant mit phenden im auch heute üblichen Sinn verwendet wird: Is ensal kein zinsman vor sinen herin phant dulden poben sinen zcins, den he jerlich geldin sal (fol. 22
- HERBERT JANKUHN, Teil II (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-Hist. Kl. III. Folge, N r . 116) Göttingen
1980,
S. 7 7 - 8 1 ;
H E I N R I C H BECK,
Zur
Terminologie von Pflug und Pflügen - vornehmlich in den nordischen und kontinentalen germanischen Sprachen, in: e b d . S. 8 2 - 9 8 .
22 Fol. 19 recto 3 links, 29 recto 5 links, 39 verso 4 links, vgl. auch 41 recto 19 und ebd. Bildstreifen 4. 23 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Wörter und Sachen. Zur Bedeutung einer Methode für die Frühmittelalterforschung. Der Pflug und seine Bezeichnungen, in: Wörter und Sachen im Lichte der Bezeichnungsforschung, hg. von RUTH SCHMIDT-WIEGAND (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung Bd. 1) Berlin - New York 1981, S. 1-41, Abb. 3-7. 24
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Die
Bilderhandschriften
des
Sachsenspiegels als Quelle der Kulturgeschichte, in: Der
25 D e r Sachsenspiegel liegt zeitlich vor der Übernahme des römischen Rechts. Zur Problematik auch RUTH SCHMIDTWIEGAND, Fremdeinflüsse auf die deutsche Rechtssprache, in: Sprachliche Interferenz (wie Anm. 15), S. 226-245. 26 Z u W o r t u n d Begriff FRIEDRICH SCHEELE, Di sal man
alle
radebrechen. Todeswürdige Delikte und ihre Bestrafung in Text und Bild der Codices picturati des Sachsenspiegels, Bd. I: Textband, Bd. II: Tafelband, Oldenburg 1992, insb. S. 61 ff. 27
KLUGE
(wie
A n m . 14)
S. 8 5 5 ,
KLUGE
-
SEEBOLD
(wie
A n m . 14) S . 7 8 9 ; HEINRICH TIEFENBACH, S t u d i e n z u W ö r -
tern volkssprachiger H e r k u n f t in karolingischen Königsurkunden. Ein Beitrag zum Wortschatz der Diplome Lothars I. und Lothars II. (Münstersche Mittelalter-Schriften
S a c h s e n s p i e g e l als B u c h , h g . v o n RUTH SCHMIDT-WIEGAND
15) M ü n c h e n 1 9 7 3 , S. 1 0 3 - 1 0 5 ; RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
- DAGMAR HÜPPER ( G e r m a n i s t i s c h e A r b e i t e n z u S p r a c h e
Sprache und Geschichte im Spiegel historischer Bezeichnungen, in: Frühmittelalterliche Studien 19, 1985, S. 3147, insb. 40 f.
und Kulturgeschichte Bd. 1) Frankfurt/Main - Bern - New York - Paris 1991, S. 219-260 insb. S.237f. und Abb. 12.
224
Ruth
verso 6 f.) und Der herre mag wol phendin uf sime gute vor sin gelt, das man im von sime gute gelobit hat. (ebd. 20 f.). Diese Beispiele, die leicht zu vermehren wären, mögen an dieser Stelle genügen. Mehr der Kuriosität halber sei hier erwähnt, daß auch die ältesten Lehnwörter des Deutschen überhaupt, die wahrscheinlich aus dem Keltischen entlehnt worden sind, nämlich Amt2i und Reich29, in W mit den Formen ammechte, ammecht (fol.3 recto links 7, 3 recto rechts 28) und ammechtman (fol. 7 verso rechts 33) bzw. riche ,Reich' und , Herrscher, König' vertreten sind: Das riche [ = der König] und der Swabe enmugen sich nimmer vorswigen an irme erbe, die wile sis gezugen mugen.
6. Erbwörter Auch unter den sogenannten Erbwörtern, die aus der heimischen Volkssprache, dem Deutschen oder seinen Vorstufen, kommen, finden sich viele Rechtswörter im engeren Sinne, die ein hohes Alter besitzen, wie der Vergleich mit ihren außerdeutschen, ja außergermanischen Entsprechungen zeigt. Dies überrascht an sich nicht, gehört doch die Rechtssprache zu den ältesten „Fachsprachen" überhaupt, die mit ihrem Grundwortschatz bis in das Germanische beziehungsweise Indogermanische zurückreicht. So gehört mhd. bani0 , Gebot unter Strafandrohung, Verbot, Gerichtsbarkeit und deren Gebiet' mit dem Verb bannen ,unter Strafandrohung ge- oder verbieten' zu einer Wortfamilie, die - wie auch ags. ban ,Acht, Aufgebot' und an. bann ,Verbot' zeigen - bereits im Germanischen einen ausgesprochenen Rechtswortcharakter besaß. Die Übernahme des Wortes in das Altfranzösische mit ban öffentliche Verkündigung' und arban , Heerbann' bestätigt diesen Sachverhalt 31 . Im Ssp wird ban vor allem in Wendungen wie bi des kuniges banne (fol. 40 recto 24) für die königliche Banngewalt gebraucht; ferner für den Kirchenbann: Ban schadet der sele unde ennimt doch nimande den lip (fol. 52 recto 31 f.); die höchste, vom König verliehene Gerichtsbarkeit: ...unde ouch deme voite, der under kuniges banne dinget, ab he den ban von deme kunige hat (fol. 52 verso
Schmidt-Wiegand
21); beziehungsweise auch für das Hochgericht selbst: Swo man dinget bi kuniges banne (fol. 6 verso links 32). Hinzu kommt die Zusammensetzung banvorst Doch sin dri stete binnen Sachsen, da den wilden tiren vride geworcht is bi kuniges banne, ...dis heisen banvursten (fol.40 recto 24). Was hier für Bann ausgeführt worden ist, gilt in vergleichbarer Weise auch für Bußei2, mhd. buoze, md. büze, deren germ. Vorform *böto ,Besserung' schon früh die spezielle Bedeutung , rechtliche Genugtuung' hinzugewonnen haben muß. Dies legt jedenfalls die Rolle des Wortes im Zauberspruch wie seine Übertragung in den religiös-sittlichen Bereich, in dem es noch heute seinen Platz hat, nahe. Im Ssp ist mit buse u.ä. das Strafgeld gemeint, das der im Prozeß Unterlegene zu zahlen hat: he sal den schaden gelden uf recht unde ouch sine buse geben (fol. 37 recto 3). Entsprechendes ließe sich an ächte ,Verfolgung, Friedlosigkeit' 33 , diube ,Diebstahl', ding ,Gericht', erbe, vride, munt ,Schutz' und ,Vormundschaft' mit vormunt, roub, sache Streitsache', schult und süne u. a.m. zeigen, die samt und sonders zu einem Rechtswortschatz des Germanischen oder Vordeutschen gehören, dabei aber noch immer im Ssp vertreten sind, ja bis zum heutigen Tage zum Kernbereich der Rechtssprache gehören. Es zeichnet sich darin ein Konservatismus ab, der die Rechtssprache ganz allgemein auszeichnet, der aber gerade auch für den Ssp und seine Wortwahl gilt 34 .
7.
Komposition
Aus den Erb- und Lehnwörtern rechtlichen und nichtrechtlichen Inhalts sind durch Zusammensetzung oder Zusammenrückung meist zweier Wörter, also durch Wortkomposition, Rechtswörter im engeren Sinne wie z. B. baimunden ,für einen schlechten Vormund erklären' gebildet worden 3 5 . Man spricht hier auch von 32
K L U G E ( w i e A n m . 1 4 ) S . 1 1 4 , K L U G E - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 ) S. 1 1 6
33
f.;
JOSEPH WEISWEILER,
Buße, Halle
1930.
K L U G E - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 ) , S . 8 ; E B E R H A R D F R H R . VON
Acht, Weimar 1 9 1 0 und Deutsches Rechtswörterbuch (DRWB), Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache Bd. 1 , bearb. von R I C H A R D S C H R Ö D E R - E B E R H A R D F R H R . VON K Ü N S S B E R G , Weimar 1 9 1 7 , S . 3 6 1 - 3 7 0 . KÜNSSBERG,
28
KLUGE S. 2 6
29
(wie
A N M . 1 4 ) S . 2 0 ; R L U G E - SEEBOLD
(wie Anra.
14)
f.
K L U G E ( w i e A n m . 1 4 ) S. 5 9 1 , K L U G E - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 )
34
S. 5 9 0 . 30
31
RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Studien z u r historischen Rechtswortgeographie. D e r Strohwisch als Bann- und Verbotszeichen. Bezeichnungen und Funktionen (Münstersche Mittelalterschriften 18) München 1978, S . 7 6 f . K L U G E ( w i e A n m . 1 4 ) S . 5 0 , K L U G E - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 ) S. 5 9 ; EDUARD WIESSNER,
Twing und Bann, Baden
1935.
Beispiele wie phlege bei R U T H S C H M I D T - W I E G A N D , Textsorte und Rechtsquellentyp in ihrer Bedeutung f ü r die Rechtssprachgeographie, in: T e x t - und Sachbezug (wie A n m . 14),
35
S.21-37.
H i e r z u und zum Folgenden W A L T E R H E N Z E N , Deutsche Wortbildung, Tübingen 2 1 9 5 7 ; J O H A N N E S E R B E N , E i n f ü h rung in die deutsche Wortbildungslehre, in: G r u n d l a g e n der Germanistik 1 7 , Berlin 1 9 7 5 , S . 5 7 - 6 6 .
Der
IIb
Rechtswortschatz
Univerbierung. Diese Rechtswörter konnten, wenn sie ein hohes Alter hatten, zur Sachsenspiegelzeit den Sprechern nicht mehr verständlich gewesen sein und bedurften dann einer Erklärung: man sal en baimunden, das is, man sal im vorteilen alle Vormunde Schaft (fol. 19 verso 32). Baimunden wie hantgemal , Stammgut' und morgengabe ,das, was der Ehemann seiner Frau am Morgen nach der Brautnacht schenkt', sind schon in den Stammesrechten bezeugt und gehen damit in die vordeutsche oder germanische Zeit zurück - ein Zeichen dafür, wie verbreitet es schon in frühester Zeit war, durch Wortkomposition Rechtsbegriffe neu zu bilden. Neben der äußerst produktiven Wortfamilie von dinc , Gericht' mit dincphlichtic, dincstat, dincvluchtig, goudinc und tedinc < tagedinc, dingen und getedingen, dinczale, lipgedinge konnte sich das ältere W o r t f ü r ,Gericht', nämlich mal< mahal nur vereinzelt in W o r t kompositionen wie malboum (fol. 33 recto 23f.) erhalten: Immerhin ein bezeichnender o d e r signifikanter Fall, sind doch in Wortkompositionen häufig W ö r t e r erhalten geblieben, die im aktiven Wortschatz bereits veraltet oder ausgestorben gewesen sind. Baimunden (fol. 19 verso 33) war bereits ein Beispiel hierfür. Meineid zu mein ,falsch', im Ssp mit meineide (fol. 57 verso 21) belegt, ist ein anderes. Auch die Wortkompositionen mit misse-, das fast die Funktion eines Präfixes hat, mit dem das Verkehrte oder Verfehlte eines T u n s wie bei missetat angezeigt wird, sind hier zu nennen. Im Ssp sind missetüt (fol. 63 verso 12) und missetet (fol. 61 verso 30) zu missetün sowie missetat (fol. 14 verso 27 u.ö.), missebarte zu missebarn ,sich schlecht aufführen', misse spricht (fol. 23 verso 31, 76 verso 24f.) belegt, - nach Ausweis der diplomatischen Umschrift bei verbalen Bildungen noch meist mit Getrenntschreibungen, bei missetat (vgl. auch fol. 41 recto 9 u. 41 verso 3) bereits mit Zusammenschreibung. O f t stößt hier die wissenschaftliche Erkenntnis an ihre Grenzen, wenn die Etymologie von Wörtern wie kebes- in kebeskint (fol. 21 verso 6) 3 6 oder bier- in birgelden (fol. 48 recto 4), biergelden (fol. 53 recto 3 f., 54 verso 11) nicht mehr eindeutig zu bestimmen ist. Zu den sprachhistorisch wie rechtshistorisch gleicherweise bemerkenswerten Bezeichnungen gehören neben den bereits genannten Komposita hüsgenöze (fol. 74 verso 16f. u.ö.), lantrecht (passim.) und lantrichtere (fol. 83 verso 3) 3 7 ,
lipgedinge (s.o.), musteil (fol. 55 recto 26 u.V., u.ö.), Schultheis (passim), swertmag (fol. 18 recto f., 30 recto 18), mortbrant (fol. 29 verso 1) und totslac (fol. 30 recto 16) 38 , wergeld (passim) und wikbilde39 (fol. 56 verso 26) und viele andere mehr. Im Rahmen dieses Beitrages konnte aus der Vielzahl der Zusammensetzungen, bei denen auch die Fälle der Getrenntschreibung in der diplomatischen Umschrift stets mitzubedenken sind, nur eine kleine Zahl exemplarischer Beispiele behandelt werden. Erwähnt werden müssen hier noch die Zusammensetzungen mit Präpositionen bzw. Adverbien, die eine lokale Bedeutung haben: ab-, ane-, ent-, über-, üf-, um-, under-, wider-, zü-. Einige wenige Belege mögen genügen: ab(e)gewinnen ,im Rechtsstreit abgewinnen, absprechen' (fol. 32 recto 23), anevangen ,etwas durch Angreifen als sein Eigentum ansprechen' (fol. 34 recto 23), entreden ,sich verteidigen, freischwören, durch Eid reinigen' (fol. 45 verso 18), ubirzügen ,mit Zeugen überführen' (fol. 3 verso links 27), üßieten ,vor Gericht bekanntmachen' (fol. 33 verso 6), üfläzen ,vor Gericht auflassen' (fol. 20 verso 10), üzwisen gerichtlich ausweisen' (fol. 27 recto 33), widersprechen ,rechtlich wirksam widersprechen' (fol. 22 recto 11). Die Präpositionen bzw. Adverbien haben in diesen Fällen fast schon die Funktion von Präfixen, deren ursprüngliche oder eigentliche Bedeutung dem Sprecher nicht mehr voll bewußt gewesen ist. Besonders deutlich ist dies bei den Zusammensetzungen mit ent-, bei denen die ursprüngliche Bedeutung von anti- ,auf etwas hin, von etwas weg' weitgehend verlorengegangen ist: entworten ,sich vor Gericht verantworten' (fol. 29 verso 32) mit entworte ,Antwort, Verteidigung des Beklagten' (fol. 46 recto 2) sind hier als besonders zentrale Begriffe zu nennen. Die häufige Ersetzung von ent- durch unt- in unphan (fol.69 verso 28), untreden (fol.2 verso rechts 15), untschuldigen (fol.67 verso 10) u.a.m. zeigt, d a ß
38
R U T H S C H M I D T - W I E G A N D , Mord und Totschlag in der älteren deutschen Rechtssprache, in: Forschungen zur Rechtsarchäologie und Rechtlichen Volkskunde 10, 1988, S. 1 4 3 - 1 7 5 .
39
R U T H S C H M I D T - W I E G A N D , Wik und Weichbild. Möglichkeiten und Grenzen der Rechtssprachgeographie, in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Ger-
manistische
Abteilung
95,
1978,
S. 121-157;
DIES.,
37 REINER HILDEBRANDT, S u m m a r i u m H e i n r i c i : D e r R a c h i n -
Rechtssprachgeographie als Sonderfall historischer Wortgeographie, in: Ergebnisse und Aufgaben der Germanistik am Ende des 20. Jahrhunderts, Fs für Ludwig Erich
burgius ist ein Landrechter, in: Sprache und Recht (wie
S c h m i t t , h g . v o n ELISABETH FELDBUSCH, H i l d e s h e i m - Z ü -
A n m . 1 4 ) S. 2 4 6 - 2 6 1 .
rich - New York 1989, S.39-95, insb. S.66f.
36
K L U G E - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 )
S.364.
226
Ruth Schmidt- Wiegand
diese Partikel bereits zu einem Präfix geworden ist. In diesen Fällen liegt denn auch Zusammenschreibung vor, wie mit einem Blick auf die diplomatische Umschrift leicht festzustellen ist. 8.
Präfixbildungen
Eine Möglichkeit, „Fachwörter" bzw. „Rechtswörter im engeren Sinne" zu bilden, war mit den Affixen, den Prä- und Suffixen, gegeben, mit denen Nomen und Verben zusätzlich ausgestattet werden konnten 4 0 . Uber ent- (s.o.) wurde bereits gesprochen. Vergleichbar sind ir- in irloiben ,erlauben von Seiten des Richters' (fol. 25 verso 30), dazu urlop ,Erlaubnis des Richters' (ebd. 32) mit gleichbedeutendem orlop (fol. 19 recto 26 u. ö.). In Rechtstexten häufig verwendet wird auch das Negationspräfix un- in "Wörtern wie unverhaln (fol. 34 recto 18) bzw. unverholn (fol. 43 verso 29, 57 verso 5), unverstoln (fol. 43 verso 29), das durch Assimilation (s.o. S.210) auch zu um- wie in umbescholden (fol. 83 recto 1) verändert sein kann. Dies ist am diplomatischen Text leicht nachzuprüfen. Das Präfix ver- wird in W fast immer durch vor- wiedergegeben, so in vorlouken ,verleugnen, ableugnen' (fol. 16 recto 25) und vorrethere (fol. 29 recto 32); doch schwanken die Texte. Was die Häufigkeit angeht, so stehen die Präfixe beund ge- eindeutig an der Spitze. Durch sie werden Bezeichnungen spezifisch rechtssprachlicher Bedeutung und Funktion gebildet, die sich darin von den Bezeichnungen allgemeinsprachlicher Art ganz spezifisch unterscheiden. Aufgrund der Vagheit ihrer Bedeutung bzw. Multifunktionalität, diese bei be-, jene bei ge-, waren sie dazu besonders gut geeignet. Wieder brauchen nur einige wenige Beispiele genannt zu werden.
9, 13) neben erben ,vererben' und ,Erbe nehmen' (fol. 62 recto 21). Das Präfix ge- hat bei Verben ursprünglich den Bezug auf Eintritt oder Abschluß einer Handlung wiedergegeben. Es hatte also eine „perfektivierende" wie „futuristische" Funktion. In der Rechtssprache folgert daraus eine Verstärkung oder Intensivierung wie bei gebiten ,gebieten, befehlen, auffordern' gegenüber biten ,anbieten', ,erbieten'; gebrechen ,streitig machen, entziehen' neben brechen ,brechen, widerrufen, verlieren' usw. Das Präfix ge- tritt aber auch bei Substantiven mit kollektivierender Funktion auf wie bei genöz ,Standesgenosse' (fol. 21 recto 30), gesinde ,Dienerschaft, Gesinde* (fol. 33 recto 1), geverte ,Genosse, Gefährte' (fol. 13 verso 22). Von beiden Aspekten aus, dem der Kollektivierung wie dem der Intensivierung, sind mit ge- eine Fülle von Rechtswörtern gebildet worden, die in ihrer Zeit und zum Teil bis heute ihre rechtliche Bedeutung bewahrt haben wie gebot , Gebot, Vorschrift, Befehl', im Ssp auch ,Verbot' und beschlagnahme' (fol. 58 recto 10f.), gedinge ,Nutzungsrecht', Rechtsanspruch auf ein Gut' (fol. 18 verso 22), geleite ,Geleitrecht' (fol. 2 recto links 25) bzw. ,Geleitschutz' (fol.33 recto 7), gerade ,Aussteuer, Frauengut' (fol. 12 recto 8 u.ö.), gerichte (passim), geruchte (fol. 10 verso 7) und gerufte (fol. 24 recto 26), gesetze ,Gesetz, Festsetzung, Bestimmung', gewalt (fol. 10 recto 16 u.ö.), gewette ,Geldbuße, die man dem Richter zahlen muß' (fol. 22 recto 26), gewerfe) Rechtskräftig gesicherter Besitz' (fol. 15 verso 20), ,Besitzrecht' (fol. 36 verso 11) und ,Gewährschaft' (fol. 30 recto 16).
9.
Suffixbildungen
Das Präfix be-, das von seiner Etymologie her mit der Präposition bei in eins gesetzt werden kann, hat als ein typisches Verbalpräfix seine ursprüngliche Bedeutung verloren. In rechtssprachlichen Texten dient es zur Bildung von ,Rechtswörtern im engeren Sinne', d.h. zur Bedeutungsspezialisierung und -differenzierung. So tritt neben klagen nun beklagen ,vor Gericht klagen, Anklage erheben, verklagen' als ein besonderer Terminus der Rechtssprache, der sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat; beleiten ,Geleitschutz gewähren' (fol. 2 recto links 19) neben leiten ,führen'; belenen ,belehnen im Sinne des Lehnrechts' neben lenen ,leihen' (fol. 22 verso 30 u.ö.); beerben ,Erbe erhalten, beerben' (fol. 65 recto
Die Rechtssprache als Fachsprache wie als Sprache des Rechtslebens von erheblichem Alter benötigt seit jeher Abstrakta, die in der Regel mittels bestimmter Suffixe 41 gebildet worden sind. Einzelne von ihnen wie -schaft, -heit und -tum sind aus selbständigen Nomen hervorgegangen, wie noch im Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen belegtes schaft , Beschaffenheit', heit ,Wesen, Beschaffenheit, Stand' und tuom V e r hältnis, Stand, Würde' beweisen. Andere Formen der Abstraktbildung wie der Femina auf -e und -t reichen hinter das Deutsche, in das Germanische und Indogermanische, zurück. In der Gruppe der Femininabstrakta auf -e sind Ableitungen von Eigenschaftswörtern wie hulde (fol.50 recto 28 u.ö.) zu hold und
40
41
HENZEN
S. 66 ff.
(wie
A n m . 35)
S. 9 8 ff.;
ERBEN
(wie
Anm.
35)
HENZEN
S. 76 ff.
(wie A n m . 3 5 ) S. 109ff.;
ERBEN
(wie A n m . 3 5 )
Der
227
Rechtswortschatz
Ableitungen von Verben wie süne zu sünen, suonen zusammengefallen. Meist handelt es sich wie bei vare, volge usw. um Bezeichnungen für eine rechtlich gewertete Tätigkeit. Mit dem Suffix -t bzw. -ti wurden bereits im Idg. Verbalabstrakta, besonders Nomina actionis von starken Verben, gebildet. Im Ssp gehören in diese Gruppe Femininabstrakta wie macht (fol. 2 recto links 19) zu mac/mugen, phlicht (fol. 42 recto 3) zu phlegen, geburt/gebort (fol. 25 recto 30 u.ö., 56 recto 17 u.ö.) zu bern ,tragen', notnunft (fol.42 verso 25) mit Gleitlaut - / - zu nemen, schult (fol. 66 verso 4 u. 6) und unschult (fol.45 verso 18) zu sal/suln, vorgift ,Gift' (fol. 29 verso 8) zu geben, vlucht (fol. 34 recto 14) zu vliehen usw. Auch schafi zu schaffen gehört in diesen Zusammenhang. Während die Femininabstrakta auf -t in mittelhochdeutscher Zeit nicht mehr recht produktiv gewesen sind, entfaltete -schuft als Suffix eine reiche Produktivität. Von seiner Grundbedeutung Beschaffenheit' aus eignet es sich nicht allein wie bei botschaft (fol.29 recto 33), Wissenschaft (fol. 12 recto 30) und unwissenschaft (fol. 73 recto 8) zu Ableitungen von Verben, sondern auch für Ableitungen von Nomen. Diese Ableitungen bezeichnen wie bei eigenschaft ,Knechtschaft, Unfreiheit' (fol. 46 verso 21) häufig einen rechtlich-sozialen Zustand oder eine dementsprechende Institution wie bei burmeisterschaft (fol. 84 verso 1), geburschaft (fol. 56 verso 10 f.), gouschafi (fol. 23 recto 3), graveschaft (fol.23 recto 21 u.ö.) und lantgraveschaft (fol. 52 recto 5), manschaft (fol. 8 recto links 1 u.ö.) und vormundeschaft (fol. 18 verso 3). Eine vergleichbare Funktion haben offensichtlich die Suffixe -heit und -tum gehabt. Die Ableitungen mit -tüm, -tuom, das selbst eine Abstraktbildung zu dem Verb mhd. tuon ist und das als selbständiges Wort mit as. afries. dorn ,Urteil, Gericht' ein Rechtswort von zentraler Bedeutung gestellt hat 4 2 , sind im Ssp noch herzogtum (fol. 52 recto 3) und schultheistum (fol. 79 verso 17) belegt. Besonders produktiv scheint also dieser Typ zur Sachsenspiegelzeit nicht gewesen zu sein. Entsprechendes gilt auch für die Ableitungen mit -heit, die erst in der Mystik so recht Mode geworden sind.
42
KARL FREDRIK FREUDENTHAL,
Arnulfingisch-karolingische
Rechtswörter, Göteborg 1949; HUGO MOSER, Deutsche Sprachgeschichte der älteren Zeit, in: Deutsche Philologie im Aufriß, hg. von WOLFGANG STAMMLER, Berlin 2 1957, Nachdruck Berlin 1966, Bd.I Sp.621-854, insb. Sp.728f. u. 846. Jetzt auch RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Artikel ,Urteil', in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 5, Sp. 610 f.
Dieses Suffix tritt besonders häufig an Eigenschaftswörter wie gewis, gewon ,gewohnt', kranc, stetig, unkiusch, war und warlös an und ist in W in gewisheit (fol. 3 recto rechts 11), gewonheit (fol. 25 verso 10), krancheit (fol. 17 recto 4), Stetigkeit (fol. 10 verso 33), unküscheit (fol. 12 recto 1), wärheit (fol. 20 verso 24) 4 3 und warlösekeit (fol. 5 verso links 22) belegt. Auch ein zentraler Begriff wie vnheit , Stand der Freien' ist hier zu nennen: Vriheit is abir drierhande (fol. 10 recto 22): Schöffenbarfreie, Pfleghafte und Landsassen, heißt es Ldr I 2 §1. Von Substantiven wie kint, kristen, mensch und tör aus sind mit -heit zentrale, ja universale Begriffe wie kintheit (fol. 17 recto 4), kristenheit (fol. 41 recto 26), menscheit (fol. 41 recto 9) und torheit (fol. 17 recto 4) gebildet, die freilich mehr der Allgemeinsprache als der Rechtssprache zuzurechnen sind. Weitaus am produktivsten ist das Suffix -unge gewesen, das wahrscheinlich mit älterem -inge identisch ist. Es war in allen westgerm. Dialekten zur Ableitung von Verben verfügbar; ursprünglich diente es aber, wie die Verwandtschaft mit - inge nahelegt, zur Bildung von Denominativa. Im Ssp überwiegen die Deverbativa besonders da, wo es um z.T. zentrale Rechtsbegriffe geht, die neu gebildet werden mußten. Hier sind etwa zu nennen: absunderunge ,Abfindung bzw. Auszahlung künftiger Erben' (fol. 4 verso links 14), besserunge A u s besserung' (fol. 2 recto links 17), bewisunge ,Einweisung in ein Gut' (fol. 62 recto 12) und inwisunge ,dass.' (fol. 27 verso 1), ladunge ,Vorladung vor Gericht' (fol. 77 verso 26), lenunge ,Belehnung' (fol. 61 recto 14) und Hunge ,dass.' (fol. 71 verso 14), lösunge Freilassung' (fol. 47 recto 9), marcscheidunge ,Gemarkungsgrenze' (fol. 79 verso 4), nötwerunge ,Notwehr' (fol. 40 verso 12), saczunge ,Verpfändung' (fol. 69 verso 5), samunge ,Versammlung des Heeres' (fol. 60 recto 16), sinnunge ,Lehensbegehren' (fol. 64 verso 29), sizzunge ,Festsetzung, Verurteilung' (fol. 57 recto 12), statunge ,Erstattung, Vergütung' (fol. 62 verso 14), teilunge ,Erbteilung' und erbeteilunge (fol. 14 recto 2) ,Erbteilung, Erbtrennung', vorvestunge ,Gerichtliche Achtung, Bezirksacht' (fol. 22 verso 22), zcweiunge ,Halbbürtigkeit' (fol. 11 recto 10). Ein besonderer Fall sei seiner Kuriosität halber hier noch erwähnt. Die mit den -ung-Ableitungen später konkurrierenden Bildungen auf -nis, -nisse sind im Ssp nur spärlich vertreten. Die Ableitungen von Verben bezeichnen meist das Ergebnis einer Tätigkeit, die nomi-
43 KARL KROESCHELL, Wahrheit und Recht im frühen Mittelalter, in: Sprache und Recht (wie Anm. 14) S. 455-473.
228
Ruth Schmidt- Wiegand
nalen Ableitungen meist einen Zustand. Im Ssp sind bedütnis ,Bedeutung' zu diuten ,deuten' (fol. 10 recto 10), gevencnisse ,Gefangenschaft' zu vähen, vangen (fol. 46 recto 24 u. ö.), vengnisse ,dass.' (fol. 67 verso 10) und kentnisse ,Kenntnis' (fol. 61 recto 4) belegt. In dieser Gruppe, die zunächst Abstrakta umfaßte, läßt sich bei einigen Bezeichnungen wie Verzeichnis, Zeugnis, Hindernis eine Entwicklung zum Konkreten hin beobachten. Auch Gefängnis, das im Ssp noch ganz abstrakt für ,Gefangenschaft' als Ergebnis der Gefangennahme gebraucht wird, hat an dieser Entwicklung teilgenommen.
10. Adjektiv
+
Substantiv
Für den Autor des Ssp war die Bildung der einschlägigen Rechtsbegriffe offenbar noch im Fluß. Manche Entwicklungen wie das Wuchern der Bildungen auf -tum und -heit sowie -nisse, -nis setzten erst später ein. Die Bildungen auf -unge scheinen hier eine Ausnahme zu machen. Insofern kam dem Adjektiv als einem zusätzlichen Merkmalspender für die Unterscheidung der Rechtswörter von den Wörtern der Allgemeinsprache eine besondere Bedeutung zu. Eike verwendete Fügungen aus Adjektiv + Substantiv besonders häufig und definierte auch zusätzlich die auf diesem Wege gewonnene Begrifflichkeit. Ein Beispiel wurde bereits genannt: hanthafte tat mit allgemeinsprachlichem tat (fol. 22 verso 31), das durch das Adjektiv hanthaft rechtssprachlich auf die Bedeutung ,frische Tat, bei der der Täter die Waffen noch in der Hand hat', festgelegt wird. Ein anderes Beispiel ist echte bzw. ehafte not, d.i. der ,rechtlich anerkannte Hinderungsgrund, vor Gericht zu erscheinen', nämlich Krankheit, Gefangenschaft, Heeres- oder Reichsdienst (fol. 67 verso 10). Die besondere Funktionalität, die Adjektive in einem Rechtstext haben können, läßt sich auch daran ablesen, daß einige von ihnen durch Konversion, d. h. Wortartenwechsel, zu Substantiven geworden sind. Das gilt gerade auch für so zentrale Begriffe wie recht, gut und eigen, die, der Bedeutung dieser Begriffe entsprechend, im Text der Wolfenbütteler Bilderhandschrift mit einer Fülle von Belegen und mancherlei Bedeutungsvarianten, in Ableitungen und Zusammensetzungen vertreten sind. Dies gilt besonders für Recht, das sich von dem Adjektiv recht ,gerade gerichtet, richtig' herleitet 44 . Das
Wort ist im Ssp häufig vertreten und kann hier die Bedeutungen ,Recht', ,Gericht', Rechtsspruch' und Rechtsanspruch' haben. Es sei hier an den Kernsatz des Prologs Got is selber recht, dar umme is im recht lip (fol. 9 verso 16f.) erinnert. Ohne auf die Begriffsgeschichte des Wortes einzugehen, die einer eigenen Studie wert wäre, sei angemerkt, daß recht als Bezeichnung des objektiven wie subjektiven Rechts älteres e < ewa ,Recht, Gesetz, Bund' abgelöst hat, das in W nur in bezug auf den Bund Gottes mit den Menschen, also im Blick auf die heilsgeschichtliche Entwicklung (fol. 9 verso 31, 15 recto 8, 41 recto 28, 47 recto 6 a), gebraucht wird sowie mit der noch heute bei Ehe gebräuchlichen semantischen Einengung auf den Rechtlichen Bund der Ehe' (fol. 19 recto 25). Über die Ableitung ehaft/echt ,rechtmäßig, ehelich' wurde bereits an anderer Stelle gesprochen. Auch elich ,ehelich* (fol. 11 recto 8) als Möglichkeit einer jüngeren Ableitung wäre hier zu nennen. Das Adjektiv eigen ,hörig, leibeigen', auch in Wortverbindungen wie eigenman (fol. 1 verso links 16 f.) und eigenkint (fol. 21 verso 6), aber von eigenen luten, kann für sich stehend als Substantiv mit der Bedeutung , H ö riger' bzw. , Hörige' gebraucht werden: is si eigen, man mag si vrilasin (fol. 21 verso 6). Auch die Bezeichnung der Unfreiheit als eigenschaft (fol. 46 verso 21 u. ö.) wurde bereits erwähnt. Unabhängig von dieser Entwicklung ist eigen als Substantiv eine Bezeichnung für ,Eigentum', besonders an Liegenschaften: der son sal sin vorteilt egenes unde lenes (fol. 1 recto 14). Mit dieser Bedeutungsspezialisierung ist das substantivierte Adjektiv sowohl im MRLF wie im Ssp belegt. Entsprechend häufig ist substantiviertes gut mit den Bedeutungen ,Gut, Lehensgut', ,Besitz' und ,Vermögen' in beiden Texten vertreten. Der Multifunktionalität, die Adjektive bzw. Adverbien im Rechtstext haben können, entspricht die Vielfalt ihrer Formen durch Ableitung 45 . Neben den einfachen Formen oder Simplicia wie arm und rieh, lang und kurz, alt und elter stehen Ableitungen mit Präfixen wie be-, ge-, un- oder Suffixen wie -ig/-ic, -lieh, -haft und -lös, Rechtswörter im engeren Sinne. Die wohl größte Gruppe bilden die Adjektive auf -ig/-ic, die auch
bindung
mit
STACKMANN
44
RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
Reht und ewa. Die Epoche des
Althochdeutschen in ihrer Bedeutung f ü r die Geschichte der deutschen Rechtssprache, in: Althochdeutsch, in Ver-
HERBERT -
HEINRICH
KOLB
-
KLAUS
TIEFENBACH
-
MATZEL LOTHAR
-
KARL VOETZ,
Bd. 2: Wörter und Namen, Forschungsgeschichte, Heidelberg 1987, S. 937-958. 45 HENZEN (wie A n m . 3 5 ) S.
94 ff.
S. 1 9 5 f f . ; ERBEN (wie
Anm.35)
Der
Rechtswortschatz
heute noch am häufigsten sind. Mit ihrer Hilfe werden Ableitungen von Abstrakten wie Konkreten gebildet: von den abstrakten Bezeichnungen, Vorgangs- und Zustandsbezeichnungen, von den konkreten Bezeichnungen für eine Eigenschaft. Im Text des Ssp überwiegen hier eindeutig die Ableitungen von abstrakten Bezeichnungen wie ebenbürtig (fol. 13 recto 3), hervluchtig (fol. 19 verso 25), miselsuchtig ,aussätzig' (fol. 50 recto 8), phlichtic (fol. 13 recto 2), schuldig (fol. 12 recto 33), wegevertig (fol. 35 recto 25 f.), ungloubig ,ketzerisch, heidnisch' (fol. 29 verso 7) usw. Ahnlich häufig sind die Adjektive auf -lieh vertreten, - ein Suffix, das wiederum auf ein selbständiges Wort mit der Bedeutung ,Leib, Körper' zurückgeht. Wie bei den Adjektiven auf -igl-ic handelt es sich auch hier um Ableitungen von Substantiven, Personen- und Gegenstandsbezeichnungen, zu denen eine gewisse Zugehörigkeit oder Ähnlichkeit besteht; hinzu kommen Ableitungen von anderen Adjektiven und Verben, die dann einen Vorgang oder Zustand fixieren. Es mögen hier nur keiserlich (fol.41 recto 13) und kuniclich (fol. 19 verso 1 f.), schedelich (fol. 3 recto rechts 13) usw. genannt werden. Besonders häufig werden aus dieser Gruppe die notwendigen Adverbien genommen, von denen einige so fest geworden sind, daß sie auch heute noch - freilich mit abweichender Bedeutung - gebraucht werden: bescheidelich festgesetzt, bestimmt, bedingt' (fol. 69 verso 12), gemeinlichen gemeinschaftlich' (fol. 2 verso rechts 30), gewislichen ,zuverlässig, auf sicherstellende Art und Weise', redelich (fol. 51 recto 28), offenlichen (fol.2 verso links 25), vrevelichen (fol. 1 recto 17), willecliche (fol. 3 recto links 32) und wissinlich (fol. 14 verso 31) usw. Die Grenzen zwischen den Adjektivgruppen auf-igl-ic und -lieh sind fließend, - möglicherweise auch bedingt durch dialektale Unterschiede: -ig/-ic gehört eher in das Mitteldeutsche, -lieh ist stärker im Oberdeutschen vertreten. In W hat man es jedenfalls mit einem Mischtext zu tun. In ihm steht dubig (fol. 33 verso 9, 35 recto 2) neben duplich (fol. 34 verso 10) und roubig (fol. 3 verso rechts 10) neben rouplich (fol. 16 verso 29); auch dubish ,diebisch' (fol. 3 verso rechts 6) ist belegt. Von diesem Schwanken zwischen verschiedenen Möglichkeiten der Ableitung ist auch billich betroffen gewesen, wie seine Wortgeschichte zeigt. Im Ssp ist das Wort in der genannten Form und mit der Bedeutung ,angemessen, zu Recht, billiger Weise' (fol. 15 verso 23, 63 recto 26) belegt 46 , hinzu kommt die negierte Form unbillich (fol. 84 verso 23 f.). Hier
4 6 KLUGE - SEEBOLD ( w i e A n m . 1 4 ) S. 8 5 .
229 könnte billich auch zu einer Gruppe -isch/-ich gehören, zu der auch dubish ,diebisch' zu zählen ist. Ursprünglich bezeichneten Adjektive dieser Art die Abstammung oder Herkunft, wie im Ssp auch bei wendisch (fol. 54 recto 7 u. 55 recto 3). Bei -haft handelt es sich um ein ursprünglich selbständiges Adjektiv mit der Bedeutung ,verbunden mit', das schon im Voralthochdeutschen zum Suffix geworden ist. Hier ist es in hanthafte tat (s.o.) bereits begegnet. Zu ergänzen sind nun libhaft , lebend' im erbrechtlichen Zusammenhang (fol. 18 verso 26), schadehaft (fol. 56 verso 21), werhaft (fol. 43 verso 37), wettehaft ,zur Zahlung eines Gewettes verpflichtet' (fol. 46 recto 5), wissenthaft (fol. 48 verso 5), hier substantivisch im Sinne von ,ohne sein Wissen' gebraucht, wonhaft (fol. 4 recto links 15). Eine besondere Stellung hat phleghaft ,zur Abgabe = Phlege verpflichtet'. Im Text des Ssp ist dieses Adjektiv wieder substantiviert: Der phleghafte ist der ,Abgabenpflichtige' (fol. 10 recto 24 u. ö.). Ahnlich ist schephinbäre mit dem Suffix -bär, -beere in schephinbare lute (fol. 10 recto 23) und schephinbarvri (fol. 49 verso 27) zu einem festen Standesbegriff geworden. Das Suffix -bär, das auf ein Adjektiv ,tragend' zurückgeht und im Neuhochdeutschen zur Zeit eine große Produktivität entfaltet, ist in W nicht allzu häufig belegt: seintbar < sentbär ,gerichtsfähig' (fol. 1 verso links 12) und schephinbar sind als Belege im MRLF und im Ssp zu nennen. Auf dem Wege zum Suffix war zweifellos schon in der Sachsenspiegelzeit das Adjektiv lös ,frei, ledig', das mehrfach in Kompositionen wie echtelos (fol. 21 recto 33), erbelos (fol. 18 recto 7), erlös (fol. 29 recto 23), rechtelos (fol. 21 recto 33), sinnelos (fol. 43 recto 3) und truwelos (fol. 19 verso 24) zur Bildung von Begriffen rechtlichen Inhalts benützt worden ist. Hier ist noch kurz über die Präfixe bei Adjektiven zu sprechen. Das kollektivierende oder soziierende geist bei gemeine ,gemeinsam' bzw. ,allgemein' belegt: das ist der gebure gemeine zu trinkene (fol. 53 recto 10), ferner bei getrüwe (fol. 59 verso 12); auch die adjektivisch gebrauchten Partizipien mit ge-, bei denen die perfektivierende Funktion des Präfixes nachwirkt, ist hier anzumerken. Beispiele im Ssp sind geboren/geborn ,geboren, abstammend, herkünftig' (fol. 11 recto 11 u. ö.), gelobt ,versprochen' (fol. 44 verso 1) und gezweiet , geteilt, getrennt' in bezug auf die eheliche Gütergemeinschaft (fol. 18 recto 28). Auch die Präfixbildungen auf be- (s. o.) haben diese Entwicklung geteilt, wie bescholden (fol. 29 recto 10) mit unbescholden (fol. 29 recto 10) zeigt. Andere Adjektive aus Partizipien, die in der Rechtssprache ihren festen Platz haben, sind abgesundert (fol. 13 verso 31 f.), angeborn (fol. 14 verso
230
Ruth Schmidt- Wiegand
1 f.), usgeradet (fol. 11 verso 32), vorkouft (fol. 6 verso rechts 21). Der Aspekt der Abgeschlossenheit des Vorgangs unterstreicht hier die notwendig damit verbundene Verbindlichkeit des Zustands. Eine relativ große Gruppe bilden die Adjektive mit Präfix un-, das eine Negation ausdrückt; außer den bereits genannten unbillich (fol. 84 verso 23f.), unbescholden (fol. 29 recto 10), unecht (fol. 48 recto 32) sind unelich (fol. 19 recto 28 u. ö.), ungezweit (fol. 6 verso rechts 9), ungetruwelich (fol. 46 verso 1) und ungewaldig (fol. 20 recto 2) zu nennen. 11. Sachsenspiegelwortschatz
und
Sprachausgleich
Auf das Ganze gesehen hat der Sachsenspiegel einen eher konservativen als innovativen Rechtswortschatz, vergleicht man ihn mit anderen Rechtsquellen des 13./14. Jahrhunderts, vor allem mit dem Wortschatz der Urkunden 4 7 . Eike von Repgow hat altertümliche Rechtswörter wie hantgemal, die schon von seinen Zeitgenossen nicht mehr verstanden worden sind, benützt, ohne ihnen eine Erklärung beizugeben 48 . Als Bezeichnung für die regelmäßige Abgabe der zinspflichtigen Bauern hat er das „altmodische" plege/phlege beibehalten 49 , das durch die Standesbezeichnung der pleghaften/phleghaften gestützt wurde. Rein zahlenmäßig aber überwiegt das Lehnwort tins/zins < lat. census50. Für den Begriff der ,beweglichen Habe' werden im Ssp die Begriffe varnde guot oder varnde habe gebraucht, obwohl die städtischen Urkunden längst zu dem jüngeren Begriff bzw. seiner Bezeichnung übergegangen sind 51 . Wie denn überhaupt der Sprachgebrauch der Urkunden
47 KARL BISCHOFF, Zur Sprache des Sachsenspiegels von Eike von Repgow, in: Zeitschrift f ü r M u n d a r t f o r s c h u n g 19, 1943/44, S. 1 - 8 0 , insb. S.43f. 48 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, hantgemcelde
(Parzivat
6,19).
Rechtswort und Rechtssinn bei W o l f r a m von Eschenbach, in: Studien zu Wolfram von Eschenbach, Fs f ü r Werner S c h r ö d e r , h g . v o n K U R T GÄRTNER - J O A C H I M H E I N Z L E , T ü -
bingen 1989, S. 333-342. 49 Zu as. plegan verantwortlich sein, einstehen für' vgl. KLU-
50
innovativer gewesen ist als der der Rechtsbücher gleicher oder auch jüngerer Zeit. Dieser konservative Grundzug in der Sprache des Rechtsbuches schloß nicht aus, daß der Ssp in bezug auf den Rechtswortschatz zum niederdeutsch/hochdeutschen Sprachausgleich 52 beigetragen hat, der Grundlage der neuhochdeutschen Schriftsprache wurde. Die Tatsache, daß mit diesem Rechtsbuch die hochdeutsch/niederdeutsche Sprachgrenze überschritten worden ist 53 , wird dabei meist mit den oberdeutschen Fassungen des Deutschen- und des Schwabenspiegels 54 in Zusammenhang gebracht. Es ist aber auch an die Umsetzung des ursprünglich niederdeutschen Textes 55 in das Mitteldeutsche zu denken, die schon sehr früh eingesetzt hat. Denn bei einer der ältesten Handschriften des Ssp überhaupt, bei der Quedlinburger Handschrift 56 , die noch dem 13. Jahrhundert angehört, handelt es sich bekanntlich um einen mitteldeutschen Text mit besonders vielen niederdeutschen Reliktwörtern. Dieser Bestand an nd. Reliktwörtern geht im Laufe der Zeit in den md. Texten zurück, wie ein Vergleich mit jüngeren Hss., z.B. einer Merseburger Hs. des 15. Jahrhunderts, zeigt 57 . Auch die md. Bilderhandschrif-
52 Zum Grundsätzlichen vergleiche WERNER BESCH, Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. J a h r h u n d e r t . Studien zur Erforschung der spätmittelhochdeutschen Schreibdialekte und zur Entstehung der neuhochdeutschen S c h r i f t s p r a c h e , M ü n c h e n 1967; ULRICH KRIEGESMANN, D i e
Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache im Widerstreit der Theorien (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte Bd. 14) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1990, insb. S. 213-241. 53 Hierzu auch RUDOLF GROSSE, Die mitteldeutsch-niederdeutschen Handschriften des Schwabenspiegels in seiner Kurzform. Sprachgeschichtliche Untersuchung (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-hist. Kl. Bd. 56, H e f t 4) Berlin 1964, insb. S. 118. 54 Zu den verschiedenen Rechtsbüchem jetzt ULRICH-DIETER OPPITZ, Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Bd.I, Beschreibung der Rechtsbücher, Köln - Wien 1990, insb. S.34ff. 55 RUTH SCHMIDT-WIEGAND, D e r S a c h s e n s p i e g e l . Ü b e r l i e f e -
rungs- und Editionsprobleme, in: D e r Sachsenspiegel als
GE ( w i e A n m . 1 4 ) S . 5 4 5 ; E R I C H M O L I T O R , D i e P f l e g h a f t e n
B u c h , h g . v o n R U T H S C H M I D T - W I E G A N D - DAGMAR H Ü P -
des Sachsenspiegels im Sächsischen Stammesgebiet (Forschungen zum deutschen Recht IV, 2) Weimar 1941; HANS THIEME, Artikel ,Pfleghafte', in: H a n d w ö r t e r b u c h zur deutschen Rechtsgeschichte (wie Anm. 6) 3, Sp. 1733-1736.
PER (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte Bd. 1) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - N e w York - Paris 1991, S. 19-56. 56 ULRICH-DIETER OPPITZ, D e u t s c h e R e c h t s b ü c h e r des M i t -
telalters, Bd. II, Beschreibung der Handschriften, Köln Wien 1990, Nr. 657, S.545f.; JUTTA FLIEGE, Die H a n d schriften der ehemaligen Stifts- und Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, H a l l e / S . 1982, S. 58-59.
KLUGE ( w i e A n m . 1 4 ) S . 8 8 5 .
51 Mit weiteren Beispielen RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Textsorte und Rechtsquellentyp in ihrer Bedeutung f ü r die Rechtssprachgeographie, in: Text- und Sachbezug (wie Anm. 14) S. 21-37, insb. S.30.
57
OPPITZ ( w i e A n m . 56).
231
Der Rechtswortschatz ten des Ssp stehen in dieser Entwicklung, wie die nd. Reliktformen der Wolfenbütteler Hs. beweisen 58 . Zu dem Bestand der Wörter, die mit dem Ssp aus dem Niederdeutschen in das Hochdeutsche vorangetragen worden sind und heute noch weiterleben, indem sie ihre spezifisch rechtliche Bedeutung aufgegeben haben, gehören Gerücht, echt und billig. Mit typisch rechtssprachlicher Bedeutung und Funktion aber hat sich Vormund59 erhalten. In Bamberger Urkunden des 12. Jahrhunderts ist zwar die latinisierte Form foramundus schon belegt, doch erst mit dem Ssp hat sich md. voremunde, das auch im Mühlhäuser Reichsrechtsbuch begegnet, gegenüber den konkurrierenden Bezeichnungen im deutschen Sprachraum voll durchsetzen können 60 . Die gleichbedeutenden Bezeichnungen wurden damit an den Rand gedrängt bzw. auf landschaftlich begrenzte Sprachräume beschränkt: Gerhab auf das BairischÖsterreichische, Momber auf den fränkischen Westen, Vogt auf das Umland des Rheins, Träger auf den deutschen Südosten, Pfleger auf die Schweiz und Schwaben, Treuhaider auf Hessen.
12. Das Verzeichnis
des
Rechtswortschatzes
Das Verzeichnis der Wortformen und Wortbedeutungen des Rechtswortschatzes, das man auch als Glossar 61 bezeichnen kann, enthält die Rechtswörter im engeren und weiteren Sinne. Die Nichtrechtswörter werden nur dann berücksichtigt, wenn sie durch den Kontext eine rechtliche Konnotation erhalten haben,
58
RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Die mitteldeutschen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels und die sprachgeschichtliche Stellung des Elb-Saale-Raums im 14. Jahrhundert, in: Fs für Rudolf Große, hg. von SABINE H E I M A N N GOTTHARD LERCHNER - ULRICH MÜLLER -
INGO
REIFFEN-
(Stuttgarter Arbeiten zur GermaniStuttgart 1 9 8 9 , S. 9 3 - 1 0 1 .
STEIN - U T A S T Ö R M E R
stik Nr. 2 3 1 ) 59
KLUGE
(wie
A n m . 14)
S. 8 2 6 ,
KLUGE
-
SEEBOLD
A n m . 1 4 ) S . 7 6 9 ; G R U B M Ü L L E R ( w i e A n m . 1 4 ) ; VON
(wie
OLBERG
(wie Anm. 1 4 ) ; ferner E B E R H A R D F R H R . VON K Ü N S S B E R G , Rechtssprachgeographie (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. KL. Jg. 1 9 2 6 / 2 7 , 1 . Abh.) Heidelberg 1 9 2 6 , S. 3 8 - 4 2 u. Deckblatt 10-14.
60
RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Rechtssprachgeographie als Sonderfall historischer Wortgeographie, in: Ergebnisse und Aufgaben der Germanistik am Ende des 20. Jahrhunderts, Fs Ludwig Erich Schmitt, hg. von E L I S A B E T H F E L D BUSCH, Hildesheim - Zürich - New York 1989, S. 39-95, insb. S. 70-103. 61 S. unten S.247-331.
wie dies etwa bei banc ,Schöffenbank' oder stül .Schöffenstuhl' bzw. lant ,Territorium' u. a. der Fall ist. Die Stichwörter sind alphabetisch und nach Wortarten (Substantive, Adjektive, Adverbien, Verben) angeordnet, wobei die durch Ableitung von Adjektiven gebildeten Adverbien bei diesen erscheinen; nur dann, wenn sie, wie z. B. bestimmte Partizipien, bereits voll lexikalisiert sind, haben sie einen besonderen Artikel erhalten. Substantivierte Infinitive haben ein eigenes Stichwort, erscheinen aber nach dem Verb. Das Lemma wird durch Fett- und Kursivdruck hervorgehoben. Es erscheint grundsätzlich in der mitteldeutschen Form des Textes, also gut für guot, biten für bieten usw. Können sich daraus für den Benutzer etwa durch den besonderen Stammsilbenvokalismus Schwierigkeiten der Zuordnung ergeben, so ist die hochdeutsche bzw. oberdeutsche Form beigegeben, die jederzeit ein Nachschlagen im Mittelhochdeutschen Handwörterbuch von Matthias Lexer 62 ermöglicht. Neben Vollformen wie enphähen werden auch die im Text verwendeten Kurzformen wie enphän im Kopfteil der Wortartikel aufgeführt. Auf das Stichwort folgt die Angabe der Wortklasse und die der Bedeutungen, die sich aus dem Kontext belegen läßt. Bei Rechtswörtern im engeren Sinne wie bei gerichte führt die Reihe von der am häufigsten belegten Bedeutung ,Gericht' zu den Spezialisierungen , Gerichtsgewalt', ,Urteilspruch', ,Gerichtsverfahren'. Die allgemeinsprachliche Bedeutung ,Mahlzeit' wird hier angehängt. Anders bei den Rechtswörtern im weiteren Sinne wie nöt: Hier geht die allgemeinsprachliche Bedeutung ,Drangsal, Notwendigkeit' mit der daraus abgeleiteten Bedeutung ,Kindesnot' voraus. Es folgen darauf die rechtssprachlichen Bedeutungen , Nötigung, Vergewaltigung' und , Notwehr'. Phraseologische Wendungen wie echte nöt, rechte nöt ,rechtlich anerkannter Hinderungsgrund, vor Gericht zu erscheinen' schließen sich an. Für jede Bedeutung wird ein Beleg angeführt; manchmal sind es auch mehrere. Grundlage ist der zitierfähige Text, also ein leicht geglätteter Text ohne Längenzeichen, der dem Textband dieser Ausgabe entnommen ist. Der Paralleldruck der diplomatischen Umschrift dort ermöglicht dem Benutzer jederzeit eine Nachprüfung der handschriftlichen Grundlage. In den Bedeutungsgruppen werden die übrigen nachgewiesenen Belege nach ihrer grammatischen Form (Nominativ bis Akkusativ beim Substantiv, Präsens, Präteritum, Partizip beim Verb usw.) aufge-
62
M A T T H I A S L E X E R , Mittelhochdeutsches Handwörterbuch, Bd. 1-3, Leipzig 1872-1878, Nachdruck Stuttgart 1965.
232 führt. Bei den Stellenangaben bezieht sich die erste Zahl auf die Blattzählung der Handschrift (z. B. 40 r = folio 40 recto); die nachgesetzten Zahlen, in dem angeführten Fall 22/23, beziehen sich auf die Zeilenzählung der Ausgabe und die darin enthaltene Wendung bi kuniges banne. Will man nach den Titeln und Artikeln des Ssp zitieren (Ldr II 61 §2), so sind die Angaben hierzu dem Text-Bildleistenkommentar bzw. auch der Synopse am Ende dieses Bandes zu entnehmen. Mit Verweisen auf Hilfsmittel und Literatur wurde im Rechtswortverzeichnis verhältnismäßig sparsam um-
63 Deutsches Rechtswörterbuch (DRWB). Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache, hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 1-8, Weimar 1914-
1991 (Mahlgenosse). 64 Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte ( H R G ) , h g . v o n ADALBERT ERLER - EKKEHARD KAUFMANN, B d . 1 b i s
4 f., Berlin 1971-1993 (Untereigentum). 65 Wörterbuch der Mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU) auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum J a h r 1300. Unter Leitung von BETTINA KIRSCHSTEIN u n d URSULA S C H U L Z E , e r a r b e i t e t v o n
Ruth
Schmidt-Wiegand
gegangen. Regelmäßig eingesehen wurden das Deutsche Rechtswörterbuch 6 3 , das Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte 6 4 , das Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache 6 5 , der Lexer, das Grimmsche Wörterbuch 6 6 , Trübners Deutsches Wörterbuch 6 7 und das Etymologische Wörterbuch von Friedrich Kluge 6 8 . Dies ist aber am Fuß der Wortartikel nur dann angemerkt worden, wenn sich aus diesen Werken weitere neue Aspekte für die Wortgeschichte, besonders für die Semantik, ergeben. Querverweise wie z. B. von mag, mac ,Verwandter' nach swertmac beschließen die Wortartikel.
SIBYLLE O H L Y
und
PETER SCHMITT,
Berlin 1986 ff. (gesen-
den). 66 D e u t s c h e s W ö r t e r b u c h ,
begr. v o n JACOB u n d WILHELM
GRIMM, Bd. 1-16, Quellenverzeichnis, Leipzig 1854-1971. 67 Trübners Deutsches Wörterbuch, im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft für deutsche Wortforschung, hg. von ALFRED G Ö T Z E ( B d . 1 - 4 ) u n d WALTHER MITZKA, in
Zusammenar-
b e i t m i t E D U A R D BRODFÜHRER - ALFRED SCHIRMER GOTTSCHALD - GÜNTER H A H N ( B d . 5 - 8 ) B e r l i n
68 S.o. Anm. 14.
MAX
1939-1957.
Brigitte Janz
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels Anmerkungen zur Kodikologie und zur ,Aussagekraft' der Textlücken Mit der Faksimile-Ausgabe 1 der Dresdener Bilderhandschrift 2 des Sachsenspiegels ( = D) und mit den im Umfeld dieses Projektes entstandenen Arbeiten 3 hat 1 Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, hg. von K A R L VON A M I R A , I (Facsímile) Leipzig 1902, Neudruck Osnabrück 1968, 11,1 u. 11,2 (Erläuterungen) Leipzig 1925/26, Neudruck Osnabrück 1969. 2 Vgl. zu D zuletzt U L R I C H - D I E T E R O P P I T Z , Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften, I. Beschreibung der Rechtsbücher, II. Beschreibung der Handschriften, Köln - Wien 1990, I I I / l . u. 2. Abbildungen der Fragmente, Köln - Wien 1992, Nr. 450; W O L F GANG M I L D E , Die Dresdener Bilderhandschrift Mscr. Dr. M 32, in: Gott ist selber Recht. Die vier Bilderhandschriften des Sachsenspiegels. Oldenburg - Heidelberg - Wolfenbüttel - Dresden. Ausstellung in der Schatzkammer der Bibliotheca Augusta vom 12. Februar bis 11. März 1992, Ausstellung und Katalog: R U T H S C H M I D T - W I E G A N D und W O L F G A N G M I L D E , hg. von der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel in Verbindung mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung (Ausstellungskataloge der Herzog August Bibliothek 67) Wolfenbüttel 1992, S.66f. Vgl. auch RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels im Vergleich, in: ebd., S. 9-30. 3 V. a. K A R L VON A M I R A , Die Genealogie der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Abhandlungen der Kgl. Bayer. Akademie derWiss., I . Kl. X X I I . Bd. I I . Abt., München 1902, S. 325-385; K A R L VON A M I R A , Die grosse Bilderhandschrift von Wolframs Willehalm, in: Sitzungsberichte der Kgl. Bayer. Akademie der Wiss., Philos.-philol. Kl., Jg. 1903, H e f t 2, München 1903, S. 213-240 und K A R L VON AMIRA, Die Handgebärden in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Abhandlungen der Kgl. Bayer. Akademie der Wiss., I . Kl., X X I I I . Bd., I I . Abt., München 1905, S. 163-263 sind hier zu nennen.
Karl von Amira für lange Zeit die Voraussetzungen für die weitere wissenschaftliche Beschäftigung mit den Codices picturati geschaffen. Den ersten Band seiner Edition eröffnet er mit einer ausführlichen kodikologischen Beschreibung 4 von D, von der hier nur diejenigen Punkte erneut aufgegriffen werden sollen, in denen von Amira heute als überholt gilt bzw. konkretisiert wurde oder bei denen der Ist-Zustand des Codex Korrekturen erzwingt. Damit sind zunächst die Aspekte , Datierung und Herkunft' der Handschrift, ihre ,Stellung in der Uberlieferung' sowie ihr E r h a l tungszustand' im allgemeinen, der der Farben im besonderen, avisiert. Im Anschluß daran stehen die in D bzw. in der Wolfenbütteler Handschrift ( = W) fehlenden Blätter, vor allem die 28 Seiten aus D, die der nun vorliegenden Faksimile-Ausgabe von W in diesem Band beigegeben sind, um deren Lücken in bezug auf Text und Bild zu schließen und so den mitteldeutschen Überlieferungstyp der Codices picturati ganzheitlich zu präsentieren, mit ihren Besonderheiten und Auffälligkeiten und mit der Frage nach den möglichen Gründen für die Verluste gerade dieser Blätter im Zentrum dieses Beitrages. Karl von Amira datiert D nach sorgfältiger Erwägung zahlreicher Anhaltspunkte - Gestalt der Initialen, Textinhalte, Mundart, Besonderheiten der Kostüme, der Waffen u.a.m. - auf ca. 1350-1375 5 und lokalisiert ihre Heimat in dem Raum, „wenn nicht gar in der
4 Vgl. Die Dresdener Bilderhandschrift (wie Anm. 1) I, S.7-13. 5 V g l . e b d . , S. 12 u n d VON AMIRA, G e n e a l o g i e (wie A n m . 3)
S. 373.
234
Brigitte Janz
Stadt Meissen selbst" 6 . In den 40er Jahren unseres Jahrhunderts modifiziert der Historiker Rudolf Kötzschke von Amiras Ergebnisse 7 . In bezug auf D denkt er eher an den Anfang des bei von Amira umrissenen Entstehungszeitraums, ermittelt als Auftraggeber einen wettinischen Fürsten - Friedrich III., der Strenge, Markgraf von Meißen und Landgraf von Thüringen (* 1332, t l 3 8 1 ) , oder dessen Bruder Wilhelm I., Markgraf von Meißen (*1343, t l 4 0 7 ) - und betont, „daß die Herstellung der Hs. einer Zeit angehört, in der wesentliche Reformen in der wettinischen Landesverwaltung mit gesteigerter Verwendung schriftlicher Buchungen durchgeführt wurden" 8 . Zuletzt hat Klaus Naß - ausgehend von den Wappen - die durch von Amira und Kötzschke aufgestellten Thesen zur Datierung und Lokalisierung der Codices picturati überprüft 9 . Für D bestätigt er die Herkunft aus dem Raum Meißen, verlegt aber den Terminus ante quem des Entstehungszeitraums vor auf 1363, da der Illustrator - bei grundsätzlicher Neigung zur Aktualisierung der Territorialwappen - das zu diesem Zeitpunkt bezeugte, neue Lausitzer Stierwappen offensichtlich nicht kannte 10 . Behält man den durch von Amira ermittelten Terminus post quem von 1350 bei, ist der für die Entstehungszeit in Frage kommende Zeitraum nunmehr auf 13 Jahre (1350-1363) enger eingegrenzt. Die von Karl von Amira angenommene zentrale Bedeutung von D für die Lokalisierung der Stammhandschrift weist Naß als ,Uberschätzung' zurück 1 Während ,Datierung und Lokalisierung' der einzelnen Handschriften also regelmäßig diskutiert und dabei konkretisiert wurden, sind die stemmatologischen Er-
gebnisse Karl von Amiras oft zitiert, aber lange nicht in Frage gestellt worden. Danach hat man „von mindestens drei grossen und überaus werthvollen [...] verschollenen Codices picturati" 12 und insgesamt vier Handschriftengenerationen auszugehen: X N H
D O W
Den vier erhaltenen Handschriften liegt ein gemeinsamer Archetyp (X) zugrunde, aus dem über die ebenfalls verlorenen Zwischenglieder Y und N zwei Uberlieferungsgruppen entstanden: eine niederdeutsche aus N, die heute nur durch die Oldenburger Handschrift ( = O) vertreten ist, und eine mitteldeutsche aus Y, der D, W und der Heidelberger Codex ( = H ) angehören. H und D sind Schwesterhandschriften, W ist eine Kopie von D. In letzter Zeit finden sich erste vorsichtige Distanzierungen von dieser herrschenden Auffassung und die Aufforderung, die Genealogie der Bilderhandschriften „neu zu überdenken" 13 . Karl von Amiras Angaben zum Erhaltungszustand des Dresdener Codex 14 bedürfen sicher der Korrektur. Da die diesbezüglichen Äußerungen in der Literatur
12 VON AMIRA, G e n e a l o g i e (wie A n m . 3) S. 373. 13 Vgl. RUTH SCHMIDT-WIEGAND, D i e m i t t e l d e u t s c h e n Bilder-
6 Die Dresdener Bilderhandschrift (wie Anm. 1) I, S. 12.
handschriften des Sachsenspiegels und die sprachgeschichtliche Stellung des Elb-Saale-Raums im 14. Jahrhundert, in: Festschrift für Rudolf Große zum 65. Geburtstag, hg. von
7 V g l . RUDOLF KÖTZSCHKE, D i e H e i m a t d e r m i t t e l d e u t s c h e n
SABINE HEIMANN - GOTTHARD LERCHNER - ULRICH MÜLLER
Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Berichte über die Verhandlungen der Sachs. Akademie der Wiss. zu Leipzig, Phil.-hist. Kl., 95, 2, 1943, S. 1-80. 8
KÖTZSCHKE ( w i e A n m . 7 ) S . 3 6 .
9 KLAUS NASS, D i e W a p p e n in d e n B i l d e r h a n d s c h r i f t e n d e s
Sachsenspiegels. Zu Herkunft und Alter der Codices picturati, in: Text-Bild-Interpretation. Untersuchungen zu den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, I. Textband, hg.
von
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Redaktion
DAGMAR
HÜPPER, II. T a f e l b a n d , h g . v o n RUTH SCHMIDT-WIEGAND, R e d a k t i o n DAGMAR H Ü P P E R - ULRIKE LADE
(Münstersche
Mittelalter-Schriften 55/1 u. II) München 1986, I, S.229270.
10 V g l . NASS (wie A n m . 9) S . 2 5 5 .
11 Vgl. ebd., S. 231 u. 255.
- INGO REIFFENSTEIN - UTA STÖRMER ( S t u t t g a r t e r A r b e i t e n
zur Germanistik 231) Stuttgart 1989, S. 93-101, S.94: „Die Wolfenbütteler Bhs. [...] wahrscheinlich eine Kopie von D"; DIES., Die Bilderhandschriften des Sachsenspiegels als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit, in: Frühmittelalterliche Studien 22, 1988, S.357-388, S.369: „Indem die Illustratoren die Wappendarstellungen der Stammhandschrift ihrer eigenen Umgebung angepaßt und damit aktualisiert haben, liefern sie zugleich dem modernen Interpreten die Indizien für die Einordnung der Uberlieferung in den historischen Kontext. Die Genealogie der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels' ist von hier aus neu zu überdenken." Zu den Bedenken im einzelnen und zum neuesten Forschungsstand vgl. jetzt RUTH SCHMIDT-WIEGAND in diesem Band. 1 4 V g l . VON AMIRA ( w i e A n m . 1 ) I , S . 7 f f .
235
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels stark divergieren 15 , sei dieser hier ausführlich beschrieben 16 . Tatsächlich ist „die Erhaltung der Handschrift keine tadellose" 17 . Das Pergament ist leicht wellig. Wasserränder findet man aber nur vereinzelt, vorwiegend in der Mitte des Codex. Durch Nässe, möglicherweise ,nur' durch extrem hohe Luftfeuchtigkeit hat die
15 1970 schreibt Walter Koschorreck in seinem Kommentar zur Faksimile-Ausgabe der Heidelberger SachsenspiegelHandschrift über D: „Die Handschrift [...] hat während des Zweiten Weltkrieges leider erhebliche Beschädigungen durch Wassereinwirkung erlitten. Die Illustrationen müssen bis auf wenige Seiten als zerstört gelten." Vgl. Die Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. Faks i m i l e a u s g a b e u n d K o m m e n t a r , h g . v o n WALTER KOSCHOR-
RECK, F r a n k f u r t / M a i n 1970, Nachdruck neu eingeleitet von
WILFRIED
WERNER,
Frankfurt/Main
1989,
S. 161
Anm. 4. Die Einschätzung Koschorrecks zieht sich seitdem durch die Literatur, wird immer wieder unbesehen zitiert, aber auch großzügig zur „weitgehenden Zerstörung" und zur „weitgehenden Unbrauchbarkeit" der Handschrift gesteigert. Solche Gesamteinschätzungen sind grundsätzlich problematisch, liegen nicht der Standort und die Intention des Gutachters offen. Geht es um die ,Brauchbarkeit' der Handschrift für eine repräsentative Ausstellung oder um die Rechtfertigung der veranschlagten Kosten zur Restaurierung bzw. Konservierung? Wird sie beurteilt im Hinblick auf ihre ,Brauchbarkeit' als Quelle für eine kunstgeschichtliche oder für eine rechts- oder sprachwissenschaftliche Arbeit? 16 An dieser Stelle sei der Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel und der Sächsischen Landesbibliothek, Dresden für Unterstützung und Entgegenkommen gedankt. Außer auf eigene Anschauung stützt sich die kodikologische Beschreibung auf ein am 15.9.1989 von den Leitern der Restaurierungswerkstätten der HAB und der SLB, Dag-Ernst Petersen und Dr. Antje Tautmann, erstelltes Gutachten zum „Erhaltungszustand des Dresdener Sachsenspiegels und seiner Restaurierung". Mit den erforderlichen Untersuchungen wurde inzwischen begonnen, vgl. DAG-ERNST PETERSEN, Zum Erhaltungszustand des Dresdener Sachsenspiegels und die Möglichkeiten der Konservierung, in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 2) S. 80 f. 17 So VON AMIRA (wie Anm. 1) I, S. 12, aber auch schon DERS., Genealogie (wie Anm. 3). Neben den Seitenverlusten führt er dort auf: „Das Pergament ist stellenweise vergilbt und abgegriffen oder auch angerissen und durchlöchert [...]. Wurmstiche gehen durch den Falz der Lagen. Mehrfach finden sich Spuren von Feuchtigkeit, die den Abdruck der Schrift auf der gegenüberliegenden Seite bewirkte. [...] Die Farben der Bilder sind oft nachgedunkelt oder ausgeblasst. Am meisten gelitten hat der Goldbelag in Bildern und Initialen. An mehreren Stellen ist er abgefallen oder durch Oxydation geschwärzt."
schwarz-braune Eisengallustinte 18 Säure entwickelt, ist auf die jeweilige Rückseite durchgedrungen, hat sich teils gelöst, wurde vom Pergament aufgesogen und hat es insgesamt durchgehend bräunlich verfärbt. Dadurch ist der Kontrast zwischen Schriftträger und Tinte nur noch gering. Das Lesen des Textes ist teils mühsam, aber nicht unmöglich, da der Prozeß noch nicht so weit fortgeschritten ist - durch zurückliegende erste Restaurierungsmaßnahmen möglicherweise auch gestoppt wurde - , daß Teile des Textes verlorengegangen wären. Größer ist der durch Feuchtigkeitseinwirkung ausgelöste Schaden auf der Seite der Bilder. Hier findet sich vereinzelt Tintenfraß, d. h. die Tinte hat - für die Umrisse der Figuren offensichtlich stärker aufgetragen als beim Schreiben - die Membran zerstört, so daß gelegentlich Fensterchen die Zeichnungen konturieren. Problematisch wird es bei den Farben der Illustrationen: In diesem Punkt ist man, was den ursprünglichen Zustand anbelangt, auf die Beschreibung Karl von Amiras angewiesen, da auch die sechs der FaksimileAusgabe zusätzlich beigegebenen Farbtafeln 1 9 wegen technischer Schwierigkeiten wohl nicht ganz dem Original entsprachen 2 0 . „Mit Lasurfarben und Gold sind die Zeichnungen bemalt. Die Farben, die mit sicherer Pinselführung aufgetragen wurden, sind: Mennige, vielleicht mit Zinnober gemischt [...], brauner und violetter Oker, ein dem Saftgrün ähnliches Chromgrün, Permanentgrün, Smalte, Sepia, Schwarz. [...] Von allen Farben mit Ausnahme von Schwarz gewann der Illuminator durch Verdünnung verschiedene Töne, so daß er z. B. Sepia bis zum lichten Gelb, violetten Oker bis zum hellsten Rosa abschwächte." 21 Von dieser Farbskala ist nur wenig geblieben. Die Farben haben an Intensität verloren und gehen ins Bräunliche. Im Zusammenspiel mit dem nachgedunkelten Untergrund fehlen nun die Kontraste. Einer der
18 Zu den mittelalterlichen Tintenrezepten vgl. BERNHARD BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters (Grundlagen der Germanistik 24) 2., überarbeitete Aufl. Berlin 1986, S. 32 ff. und OTTO MAZAL, Lehrbuch der Handschriftenkunde (Elemente des Buch- und Bibliothekswesens 10) Wiesbaden 1986, S.75. 19 Das sind die Seiten D 4 recto, 17 verso, 19 verso, 49 recto, 57 recto und 65 recto. 20 Vgl. VON AMIRA (wie Anm. 1) I, S. 10. Außerdem haben Farbuntersuchungen ergeben, daß zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert an einigen Stellen nachgebessert' worden ist. Den Hinweis verdanke ich Herrn Dr. Manfred Mühlner, SLB Dresden, schriftliche Mitteilung vom 20.06.1990. 2 1 V O N AMIRA ( w i e A n m . 1 ) I , S. 1 0 .
236
Brigitte Janz
Grüntöne, das leuchtende Permanentgrün, hat sich zum Schriftspiegel hin verstärkt - bräunlich-grau verfärbt, nun ähnlich dem bei der Kleidung häufig verwendeten Rot-Braun. Der dunklere, auf den Farbtafeln der Faksimile-Ausgabe ins Olive gehende Grünton ist jetzt blau, mit unterschiedlicher Intensität von leuchtend Azuritblau 22 (z.B. der Spitzhut des Schultheißen am Bildrand in D 4 recto 5) bis eher ins Gräuliche gehend (z.B. die Dalmatika des Papstes in D 4 recto 1,2). Die Rot- und Grüntöne der Illustrationen sind in der Regel am äußeren Blattrand, in der untersten Bildzeile, wie überhaupt im Lehnrecht etwas besser erhalten. Zahlreiche v. a. bei den Text-Bild-Buchstaben pastos aufgetragene Farben haben die Feuchtigkeitseinwirkung wohlbehalten überstanden, fallen in der recht farblosen Umgebung um so deutlicher auf und geben einen Eindruck von der ursprünglichen Leuchtkraft der Farben. Auch Mennige, bis zur jetzigen neunten Bogenlage 23 nur für die Initialen, dann auch f ü r die Kleidung eingesetzt, und den Vergoldungen konnte die Feuchtigkeit offensichtlich weniger anhaben. Insgesamt sind die erlittenen Wasserschäden also nicht annähernd so gravierend, wie manche Angaben in der Literatur vermuten ließen. Auch der Vergleich mit anderen, ehemals völlig durchnäßten Pergamenthandschriften der Sächsischen Landesbibliothek zeigte deutlich, daß D von einem solchen Schicksal verschont geblieben ist. Der Text ist vollständig erhalten, und auch die Bilder des Originals bieten noch immer weit mehr als ihre Schwarz-Weiß-Reproduktionen in der Faksimile-Ausgabe. Da jedoch, wo die Farben für die Interpretation von Text und Bild von besonderer Bedeutung sind, ist D als alleinige Quellenbasis völlig unzureichend. Keine der erhaltenen drei mitteldeutschen Bilderhandschriften des Sachsenspiegels ist ohne Blatt- bzw. Lagenverluste geblieben 24 . Dabei bietet D mit nur acht (von
22 Laut Gutachten (wie Anm. 16) könnte hier der Farbumschlag einer Kupferverbindung stattgefunden haben. Allerdings stimmen schon die Farbangaben von Amiras im Kommentar der Bilder nicht ganz mit den Farbtafeln übere i n , v g l . z . B . VON AMIRA ( w i e A n m . 1 ) 1 1 , 1 , S . 1 3 5 ( z u
D
4 recto 1) und S. 144 (zu D 4 recto 5). 23 Mit dieser Bogenlage beginnt D 57 recto das Lehnrecht. Am Rande sei hier angemerkt, daß von Amiras Angaben zu den Kustoden korrigiert werden müssen: Von den römischen Ziffern sind die III, VII und X I ganz weggeschnitten, IUI, V, VI und VIII teilweise, I, II, I X und X ganz erhalten. Vgl. dagegen VON AMIRA (wie Anm. 1 ) 1 , S. 7. 24 Die mittelniederdeutsche Oldenburger Handschrift ist unvollendet, aber ohne Verluste geblieben. Sie überliefert den
100) fehlenden Blättern die vollständigste Überlieferung. Die bruchstückhafteste findet sich in H , der bei nur noch 30 (von wahrscheinlich 92 2 5 ) vorhandenen Blättern auch das gesamte erste Buch des Landrechts fehlt. Fragen drängen sich auf: Wie kam es zu diesen Verlusten? Wer hat die Blätter genommen? Und vor allem zu welchem Zweck? Erlauben diese Lücken Aussagen über die Funktionsbereiche der Bilderhandschriften? Da dann die Entnahme in Zusammenhang mit der Thematik der Seiten stehen müßte, soll der Frage nach den Inhalten und Besonderheiten der in D und W fehlenden Seiten im folgenden nachgegangen werden 2 6 . Zur besseren Übersichtlichkeit seien deren Lücken gegenübergestellt und jeweils durchnumeriert:
gesamten Text, die Illustrationen brechen jedoch fol. 88 recto mit Ldr III 81 §1 ab. Für die Bilder vgl. die N a c h z e i c h n u n g e n v o n GEORG SELLO ( S t a a t s a r c h i v O l d e n b u r g ,
Best. 271-25, N r . 5 1 ) , f ü r den Text: D e r Sachsenspiegel, Landrecht und Lehnrecht. N a c h dem Oldenburger Codex p i c t u r a t u s v o n 1336 h g . v o n AUGUST LÜBBEN. M i t A b b i l -
dungen in Lithographie und einem Vorwort zu denselben v o n FRIEDRICH VON ALTEN, O l d e n b u r g 1879, Amsterdam
1970.
Zur
Nachdruck
H a n d s c h r i f t TIMOTHY
SODMANN,
Zur Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie A n m . 9 ) I, S.219-228; JÜRGEN GOYDKE, D i e O l d e n b u r g e r B i l d e r h a n d s c h r i f t d e s
Sachsenspiegels aus dem Kloster Rastede, in: 175 J a h r e Oberlandesgericht Oldenburg, Köln - Berlin - Bonn München
1 9 8 9 , S . 5 9 7 - 6 4 0 ; W E R N E R PETERS, D i e
Olden-
burger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels als Textzeuge, i n : N i e d e r d e u t s c h e s W o r t 2 9 , 1 9 8 9 , S . 1 3 - 2 6 ; BRIGITTE JANZ,
Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, in: Die Beredsamkeit des Leibes. Zur Körpersprache in der Kunst, Katalog zur Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina in Wien vom 13. Mai - 12. Juli 1992, hg. von ILSEBILL BARTA
FLIEDL -
CHRISTOPH
GEISSMAR,
Salzburg
1992, S. 55-58 und Die Oldenburger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, hg. von der Kulturstiftung der Länder in Verbindung mit der Niedersächsischen Sparkassenstiftung durch
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND,
Redaktion
FRIEDRICH
SCHEELE (Patrimonia H e f t 50) Berlin - Hannover 1993. 25 Vgl. WILFRIED WERNER, D i e
Heidelberger
Bilderhand-
schrift des Sachsenspiegels - Anmerkungen zu ihrer Geschichte und zur Kodikologie, in: SCHMIDT-WIEGAND (wie A n m . 9 ) S.213-218, S.216. 26 H wird aufgrund ihres stark fragmentarischen Charakters, der f ü r meine Fragestellung kaum mehr Aussagen ermöglicht, nur am Rande berücksichtigt. Die Stellenangaben (Buch, Kapitel und Paragraphen) beziehen sich - zum besseren Vergleich mit den gängigen Textausgaben - immer auf die Zählung der Vulgata. Auf Textstellen der Bilderhandschriften wird mit Folio- und bei kürzeren Zitaten auch mit Zeilenangaben verwiesen.
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels Hs
Lücke
Position zwischen
Textstelle/ Inhalt
Blätter/ Ergänzung Seiten durch
D
1
lr/2r
MRLF, Von d. Herren Geburt, Inhal tsverz., Glossar
6/12
W 2r-7v
D
2
29v/30r
II 32 § 2 II 40 §5
2/4
W 34r-35v
W
1
27v/28r
I 71 I I II 11 §3
2/4
D 22r-23v
W
2
45v/46r
III 25 § 3 III 39 §2
2/4
D 40r-41v H 16r-17v
W
3
55v/56r
III 77 § 2 III 84 §2
2/4
D 52r-53v H 26r-27v
W
4
74v/75r
Lnr 48 § 2 Lnr 65 §21
8/16
D 73r-80v
Dabei gibt es qualitativ unterschiedliche Lücken: solche, die durch Herausnahme von einem (D 2, W 1 und W 3) oder mehreren (D 1) Bögen, einmal einer ganzen Lage (W 4), im ungebundenen Zustand der Handschrift entstanden sind, und eine, die auf Ausschneiden einzelner Blätter im gebundenen Zustand (W 2) zurückzuführen ist. Von den zwei Lücken in D liegt die erste und größere außerhalb des Sachsenspiegel-Textes. Mit Ausnahme des ersten und letzten Blattes ( = D 1 recto und D 2 recto) fehlt mit den drei inneren Bogen der Lage fast die gesamte vorgeschaltete Mitüberlieferung. Wieviel und was verlorengegangen ist, weiß man aufgrund des ursprünglichen Lagenumfangs von vier Doppelblättern (Quaternio) und durch den Vergleich mit den entsprechenden, dort komplett vorhandenen Seiten in W 2 7 . Beide Handschriften beginnen auf ihrer jeweils ersten Recto-Seite 28 mit dem deutschen Text des Mainzer Reichslandfriedens Friedrichs II. von 1235. Aus der Tatsache, daß in D die Lagenbezeichnung und deren tatsächliche Reihenfolge nicht übereinstimmen - auf der letzten Verso-Seite der jetzigen zweiten Lage ( =
27 W liefert in bezug auf den Mainzer Reichslandfrieden eben keinen „bruchstückhaften Text", so U R S U L A S C H U L Z E , Lateinisch-deutsche Parallelurkunden des 13. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Syntax der mittelhochdeutschen Urkundensprache (Medium aevum 30) München 1975, S. 34. 28 Da die noch heute gültigen Foliierungen beider H a n d schriften aus dem 18./19. Jahrhundert über die Lücken hinwegzählen, stimmt die Zählung von D und W schon ab fol. 2 recto nicht mehr überein.
237 D 10 verso) findet sich die Kustode I -, folgert Karl von Amira, daß „die jetzige No. 2 die erste Lage, No. 1 hingegen die jüngste oder zwölfte" 2 9 war. Konsequent weitergedacht, hat diese Folgerung weitreichende Konsequenzen: Da die erste Lage ja keinen Sachsenspiegel-Text, sondern die sog. Mitüberlieferung - Mainzer Reichslandfrieden, den Text Von der herren gehurt, Inhaltsverzeichnis und Register - enthält, bedeutet das, daß der Aufbau der Handschrift bei den Vorarbeiten vor dem Schreiben noch nicht feststand bzw. daß die Mitüberlieferung ursprünglich nicht an den Anfang der Handschrift gestellt werden sollte 30 . D hat dann ganz offensichtlich als erste der Bilderhandschriften Mitüberlieferung und SachsenspiegelText in der vorliegenden Form zusammengestellt. Bei der unmittelbaren Vorlage von D - der nicht mehr erhaltenen und seit Karl von Amira 3 1 so genannten Handschrift Y - wird die Kombination noch nicht vorgelegen haben, wären sonst die Lagen von D gleich entsprechend numeriert worden. D a f ü r spricht auch, daß die zweite von Y abhängende Handschrift H eine eigene Textorganisation präsentiert. Koschorreck nimmt, wenn er von einem ursprünglichen Umfang von 92 Blättern ausgeht, offensichtlich an, daß H die Mitüberlieferung, die nur in W noch vollständig vorhanden ist und acht Blätter umfaßt, nicht enthalten hat 3 2 . Dies
29
V O N A M I R A (wie Anm. 1 ) 1 , S. 7. Auf Folio D 2 verso, der letzten Verso-Seite der ehedem zwölften Lage, findet sich keine Kustode XII, ohne daß entschieden werden kann, ob sie nie vorhanden war oder weggeschnitten wurde. 30 D a sowohl stilistische (Bild) als auch paläographische (Text) Kriterien die beiden Lagen eindeutig als zusammengehörig erweisen, darf aus diesen Beobachtungen in bezug auf die Lagenfolge nicht auf eine spätere Kompilation der Rechtstexte geschlossen werden. Vgl. dazu B R I G I T T E J A N Z , Wir sezzen unde gebiten. Der Mainzer Reichslandfriede in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels, in: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 112, 1990, S. 242-266, S.243f.
31 Vgl. VON AMIRA, Genealogie (wie Anm.3) S.352f. u. S. 373 ff. 32 Vgl. K O S C H O R R E C K (wie Anm. 15) S. 14 und D E R S . , Über den Cpg 164 der Universitäts-Bibliothek Heidelberg, in: Heidelberger Jahrbücher 15, 1971, S.57-72, S.57. So auch W E R N E R (wie Anm. 25) S.216; D E R S . (wie Anm. 15) S.72 und DERS., Die Heidelberger Bilderhandschrift, in: Gott ist selber Recht (wie Anm. 2) S. 46 f. Van H o e k geht dagegen davon aus, daß H den Mainzer Reichslandfrieden enthalten habe, und zwar „achteraan". Dies begründet er mit dem Fehlen von Ldr II 71 § 1 Wer den vride bricht, das sal man richten, als hi vor gesprochen ist (W 41 verso). D a hi
238
Brigitte Janz
mag für Mainzer Reichslandfrieden, Inhaltsverzeichnis und Register stimmen, ist jedoch auch aufgrund der Lagenfolge und mit Hilfe der erhaltenen Kustoden nicht sicher auszuschließen, wenn man wie in D für die Mitüberlieferung mit einer Lage ohne Bezeichnung rechnen muß. Sie könnte dann sowohl mit dem Anfang des Landrechts 3 3 als auch mit dem Ende des Lehnrechts 34 verlorengegangen sein. Der Text Von der herren geburt jedenfalls ist in H vorhanden. Während er sich in W ohne Absatz an den Mainzer Reichslandfrieden anschließt (W 3 verso/4 recto), füllt er in H ( H 30 verso) die sonst (D 56 verso, W 58 verso) leergebliebene Verso-Seite am Ende des dritten Buches, also zwischen Land und Lehnrecht. Aus der unterschiedlichen Anordnung in D / W und H ist zu folgern, daß zumindest eine der beiden Handschriften sich von der gemeinsamen Vorlage Y gelöst hat. D a ß die Mitüberlieferung in D entgegen der ursprünglichen Planung dem eigentlichen Rechtsbuch vorausgeschickt wurde, wird repräsentative und autoritative Gründe gehabt haben. Der Sachsenspiegel-Text beginnt ja mit den Prosa-Vorreden 3 5 (Prologus und
vor bei angehängtem Mainzer Reichslandfrieden nicht mehr gepaßt habe, sei der Satz weggelassen worden. Vgl. JULIANUS BONIFATIUS MARIA VAN H O E K , E i k e v a n
Repgow's
rechtsboek in beeld. Observaties omtrent de verluchting van de Saksenspiegel, Zutphen 1982, S. 134. D a ß sich dieser Satz in D und W tatsächlich auf den vorgeschalteten Mainzer Reichslandfrieden bezieht, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Er gehört zur Vulgat-Fassung des Sachsenspiegels, kommt also in zahlreichen Handschriften ohne Mainzer Reichslandfrieden vor. Sicher bezieht er sich auf den Strafenkatalog in Ldr II 13, wo in §5 für den Friedebrecher bestimmt wird, den sal man das houpt abeslan (W 29 verso). Zudem fehlt in H an dieser Stelle nicht nur II 71 § 1, sondern auch das vorhergehende Kapitel II 70 mit gänzlich anderer Thematik. 33 Setzt erst mit Ldr II 19 §2 ein. 34 Bricht mit Lnr 24 §4 ab. 35 Die Reimvorreden fehlen in den Codices picturati. Auch wenn diese bei der Abschrift von Rechtstexten häufig weg-
Textus prologt) auf einer Verso-Seite ( = D 3 verso). Das war zwar gängige Handschriften-Praxis 3 6 - wohl zum Schutz der ersten Seite -, hatte aber eine unattraktive Eröffnung des Codex zur Folge. Schlug man ihn auf, sah man zunächst auf eine wenig schöne, leere Recto-Seite ( = D 3 recto), auf der Schrift und Bilder der Rückseite stellenweise durchscheinen. Bei vorgeschalteter Mitüberlieferung fällt der Blick dagegen sofort auf eine in mehrfacher Hinsicht herausragende Seite ( = D 1 recto). Es ist die einzige Seite der Handschrift, die nicht in zwei Kolumnen aufgeteilt und deren Text entsprechend über die ganze Breite in Langzeilen geschrieben ist 37 . Nur oben links blieb ein Rechteck ausgespart, in das ohne Konkurrenz durch weitere Bilder auf der Seite wie sonst ja immer - die Titelminiatur zum Mainzer Reichslandfrieden gezeichnet ist 38 . In im Detail besonders aufwendiger und sorgfältiger Ausführung zeigt sie den Kaiser (Friedrich II.) mit Ornat, Krone, Zepter und Reichsapfel, frontal mit übereinandergeschlagenen Beinen in einer reich verzierten Thronarchitektur sitzend. Es ist dies die gebietende Stellung, die ihm als Gesetzgeber - und damit auch der Handschrift, die dieses Recht tradiert - zusteht. So erhielt die H a n d schrift eine adäquate Anfangsseite mit Titelminiatur, Uberschrift (Dys recht saczte der keyser zcu mencze myt der vorsten wyllekor), W-Initiale aus der die einzelnen Textabschnitte stereotyp einleitenden subjektiven Ver-
Reichslandfrieden gibt, spiegelt doch der ,Austausch' hier „den Weg des Rechtsbuches von einer ,Privatarbeit' zu einem Text ,mit Gesetzeskraft' wider", SCHMIDT-WIEGAND (wie Anm. 13) S. 361 f.; vgl. dazu auch JANZ (wie Anm. 30) S.263. Zuletzt ausführlich zu den Reimvorreden des Sachsenspiegels: ALEXANDER IGNOR, Über das allgemeine Rechtsdenken Eikes von Repgow (Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft, N.F. 42) Paderborn - München - Wien - Zürich 1984, S. 63-92; vgl. aber auch ULRICH DRESCHER, Geistliche Denkformen in den Bilderhandschriften des Sachsenspiegels (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 12) Frankfurt/Main - Bern - New York - Paris 1989, bes. S.71ff.
gelassen w u r d e n ( Z a h l e n a n g a b e n bei RUTH SCHMIDT-WIE-
3 6 V g l . BISCHOFF ( w i e A n m . 1 8 )
GAND, Artikel ,Reimvorreden', in: Handwörterbuch zur
37 Geplant war auch das offensichtlich nicht von vornherein, da die zwei senkrechten Linien zur Kolumneneinteilung wie auf allen anderen Seiten vorhanden waren, dann aber einfach überschrieben wurden. Bei der Vorbereitung des Wolfenbütteler Codex wurden diese, da sie sinnlos waren und das Gesamtbild eher störten, wohlweislich weggelassen.
d e u t s c h e n R e c h t s g e s c h i c h t e , h g . v o n ADALBERT ERLER EKKEHARD KAUFMANN. R e d a k t i o n D I E T E R WERKMÜLLER, a b
Bd. 2 u n t e r p h i l o l o g i s c h e r M i t a r b e i t von RUTH SCHMIDT-
WIEGAND, 4, Berlin 1990, Sp. 823-829, Sp. 824), kann doch im Falle der Bilderhandschriften des Sachsenspiegels (D und W) vermutet werden, daß es einen Zusammenhang zwischen fehlenden Reimvorreden und ergänztem Mainzer
S.40.
38 Vgl. dazu auch SCHMIDT-WIEGAND (wie Anm. 13) S. 361 f. u n d JANZ ( w i e A n m . 3 0 ) S . 2 4 4 m i t A n m . 8.
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels ordnungsformel 3 9 Wir sezzen unde gebiten und geschlossenem Text 4 0 . Auf der Rückseite des ersten Blattes wird dieser zweispaltig fortgeführt. Auf den leergebliebenen Linien am jeweiligen Kolumnenende sind vom Rubrikator 4 1 zur Gliederung des Textes und damit zu dessen leichterer Handhabung Überschriften' 4 2 in roter Farbe nachgetragen: Dys recht ys do von das sych nymant selbe reche (D 1 verso links) und Dys ys von den zcollen (D 1 verso rechts). Damit bricht der Text des Mainzer Reichslandfriedens in D ab. Es fehlen die folgenden sechs Blätter, zunächst mit weiteren 7 1/2 Kolumnen mit den restlichen Bestimmungen des Reichsgesetzes 4 - 5 . Dem folgt in W ohne Absatz in direktem Anschluß die Vorrede Von der herren geburt, eine Auflistung zu Herkunft und Geburtsrecht der Herren(geschlechter) in Sachsen 44 . Der
39 Zu den unterschiedlichen Legislativwendungen in den deutschen Handschriften des Mainzer Reichslandfriedens v g l . SCHULZE ( w i e A n m . 2 7 ) S . 4 3 u n d J A N Z ( w i e A n m . 3 0 ) S. 2 4 5 .
40 Ganz ähnliche Motive vermutet WERNER (wie Anm. 25) S. 217 als Grund dafür, daß im Heidelberger Codex das Lehnrecht an den Anfang der Handschrift gestellt ist. 41 Dieser ist durch Orthographie und Duktus deutlich von dem Schreiber zu unterscheiden. Zur Rubrizierung in antiken und mittelalterlichen Handschriften vgl. MAZAL (wie Anm. 18) S.75f. 42 Beide sind in D an den Rändern klein als Randnotiz vorgeschrieben. Auch in W stehen sie am Ende der Kolumnen. 43 Dis is von dem orlouge (W 2 recto links); Dis is von den strasen (W 2 recto links); Dis is von stetin unde von bürgen (W 2 recto rechts); Dis is von munczen (W 2 recto rechts); Dis ist von den, dt gerichte haben (W 2 verso links); Von des keisers hoferichtere (W 3 recto links); Dis is von den geistlichen Sachen (W 3 verso links); Dis is von den voitin der gotishusere (W 3 verso links); Dis is, wer do roub koufi (W 3 verso rechts). In der Mitte dieser Kolumne endet dann der Text des Mainzer Reichslandfriedens. 44 Der Text stammt nicht von Eikes, sondern von späterer H a n d und ist in zahlreichen jüngeren Handschriften überliefert, vgl. HOMEYER (wie Anm. 1) S. *6 und Sachsenspiegel, L a n d - u n d L e h n r e c h t , h g . v o n KARL AUGUST ECK-
HARDT ( M G H Font. iur. Germ. ant. N. S. 1,1 u. 1,2) Göttingen - F r a n k f u r t / M a i n 3 1973, 1,1, S.53. Zur „Vorrede von der Herren Geburt" jetzt ausführlich ROLF LIEBERWIRTH, Die Sachsenspiegelvorrede von der herren geburt, in: Der Sachsenspiegel als Buch. Vorträge und Aufsätze,
hg.
von
RUTH
SCHMIDT-WIEGAND
-
DAGMAR
HÜPPER (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 1) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1991, S. 1-18.
239 Rest der folgenden Seite ( = W 4 recto rechts) bleibt frei, sicher weil mit dem Inhaltsverzeichnis auf einer neuen Seite ( = W 4 verso) begonnen werden sollte. Dieses erstreckt sich in W - inklusive des Stellenregisters am Ende des Inhaltsverzeichnisses für das Landrecht (W 7 recto links) und Lehnrecht (W 8 recto rechts) - über acht Seiten bis folio W 8 recto. Die Entsprechung zu dieser letzten Seite ist auch in D wieder vorhanden ( = D 2 recto). Den Seitenanfang um vier Zeilen verschoben, stimmen Zählung und Text (wörtlich) beider Handschriften überein. Die fehlenden Seiten der ersten Lücke in D enthalten also einen Großteil des Mainzer Reichslandfriedens ( « 65%) und des Inhaltsverzeichnisses ( « 87%). Damit trennt die Lücke willkürlich inhaltlich eng Zusammengehörendes, was sicher gegen eine gezielte Entnahme der verlorenen Seiten spricht. Der eigentliche Sachsenspiegel-Text ist in D mit Ausnahme nur der zweiten Lücke von zwei Blättern - das ist der innerste Bogen der 5. Lage - im zweiten Landrechts-Buch (zwischen 29 verso und 30 recto) vollständig erhalten. Auch diese Lücke ist mit Hilfe von W zu schließen ( = W 34 recto-35 verso). Es fällt auf, daß die Bilderhandschriften gerade an dieser Stelle von der Reihenfolge und Zählung der Vulgatfassung abweichen. Auf II 31 §3 4 5 folgt in allen drei Handschriften 4 6 II 34 § l 4 7 . Ungefähr in der Mitte dieses Paragraphen bricht der Text in D mitten im Wort spre[che] ab. Die fehlenden Artikel 32 §§ 1-3 und 33 sind wenige Seiten später zwischen Art. 39 und 40 der Vulgatzählung zu finden 48 . Diese Umstellung hatte natürlich Konsequenzen für die Zählung. Während der Schreiber von D die neue reduzierte Kapitelzählung - Art. 32-39 mußten um zwei erniedrigt, dann die zwei ausgelassenen eingefügt werden, so daß die Zählung ab Art. 40 wieder paßt - ,richtig' am Rand vorschrieb 49 und der Rubrikator diese auch entsprechend übernahm, hat eine jüngere Hand die erniedrigte .XXXII. in .XXXIIII verbessert 50 , also
45 Nimant enmag vorwirken eins andern mannes gut, ab hes under im hat, dennoch ab he sinen lip vorwirket (W 33 verso). 46 Vgl. D 29 verso, W 33 verso und O 50 recto. 47 Wer so eins mannes knecht slet . . . (W 33 verso). 48 Vgl. W 35 recto/verso und O 52 verso (LÜBBEN [wie Anm.24] S.53). 49 XXX, XXXI, XXXII auf D 29 verso. 50 Das ging ja leicht durch Hinzufügung von zwei Strichen. Zu erkennen ist dies ganz deutlich, da der erste ergänzte Strich durch den Punkt verläuft und sich beide durch Breite und Federführung unterscheiden. WERNER (wie Anm. 15)
240 die ursprüngliche Vulgat-Zählung des Artikels Wer so eins ma[n]nes knecht slet... (D 29 verso) wieder eingeführt. Karl von Amira übersieht, daß es sich bei der Zählung XXXIIII um eine nachträgliche Korrektur handelt, und folgert fälschlich: „Der Miniator [...] hat die Nummern der Vulgata beibehalten. Sie müssen also in Y und X noch vorhanden gewesen sein." 51 Es ist jedoch wohl recht unwahrscheinlich, daß eine gleiche Umstellung der Artikelfolge unabhängig voneinander in beiden Uberlieferungszweigen Y und N durchgeführt wurde, was ja, da D und W einerseits, O andererseits gleichermaßen von der Vulgat-Zählung abweichen, der Fall sein müßte. Statt dessen wird sie wohl schon in der Stammhandschrift X vollzogen worden sein. Ein späterer Benutzer der Dresdener Handschrift, dem offensichtlich parallel ein Text mit Vulgat-Zählung vorlag, entdeckte die Diskrepanz und korrigierte die Zählung entsprechend 5 2 . In W dagegen ist die veränderte Zählung durchgehend nicht korrigiert worden 5 3 . Es bleibt zu fragen, ob diese Textumstellung in den Bilderhandschriften inhaltlich motiviert ist und was genau in D verlorengegangen ist. Auf den fehlenden Seiten werden drei jeweils geschlossene Themenbereiche behandelt: 1. Thema: , H e r r und Knecht' = II 32 § 1 - 34 §2 2. Thema: ,Verfahren bei Diebstahl und Raub' = II 35 - 39 §2 3. Thema: ,Tierschaden' = II 40 §§1-5. In der Reihenfolge der Vulgatfassungen wird Thema 1 logisch und durchdacht - vom allgemeinen V e r a n t wortung, Lohn und Kündigung' (Art. 32 und 33) zum
S. 72 fragt grundsätzlich, „ob die Markierungen der Buchanfänge und die Artikelzählungen [...] wirklich unmittelbar nach der Niederschrift des Textes entstanden sein müssen". Von derselben Hand wurde die Korrektur mit einem A möglicherweise abgezeichnet. Zur kritischen Behandlung von Handschriften vgl. W I L H E L M W A T T E N B A C H , Das Schriftwesen im Mittelalter, 3., vermehrte Auflage, Leipzig 1896, S. 317ff. und B I S C H O F F (wie Anm. 18) S.66. 51 V O N A M I R A (wie A n m . l ) 11,1, S.393. 52 D a ß er das außer bei Art. 32 auch bei Art. 33-39 durchführte, läßt sich leider nicht feststellen, da diese in D ja fehlen. 53 Auch wurde hier die Kapitelzählung nicht am Rand vorgeschrieben, sondern wohl gleich übertragen. Das Inhaltsverzeichnis zu W hat - deckungsgleich mit dem Text - die veränderte Reihenfolge. Vgl. W 5 verso links von XXXII Swer eins mannes knecht slet oder swer einen gevangen hat bis XXXIX Swelch knecht elich wip nimt.
Brigitte Janz besonderen ,Verletzung und Gefangennahme des Knechtes' (Art. 34) - aufgerollt. Es gibt also vom Inhaltlichen her keine Erklärung dafür, warum dieser Themenkomplex in den Bilderhandschriften auseinandergerissen und der einleitende Teil an späterer Stelle - im Anschluß an den ,Tierschaden' und vor einem ganz neuen Thema ,Beschlagnahmung eines Gutes' (Art. 41 §§1,2) - , ohne daß er dort noch ,paßt', eingefügt wird. Den weitaus größten Teil der fehlenden vier Seiten füllt Thema 2: ,Verfahren bei Diebstahl und Raub'. Das sind im einzelnen: II 35 II 36 §§1-8
II 37 §§1-3
II 38 II 39 §§1,2
Die handhafte Tat (W 34 recto) Verfahren bei der Rückforderung gestohlenen oder geraubten Gutes (W 34 recto/verso) Verfahren bei gefundenen oder dem Dieb abgenommenen Sachen (W 35 recto) Haftung für aus Unachtsamkeit entstandenen Schaden (W 35 recto) Korndiebstahl, Pferdefütterung auf Reisen (W 35 recto)
Mit Handhaft-, Anefangs- und Dritthandverfahren (Zug auf die Gewähren) sind die wichtigsten „Mittel der gerichtlichen Fährnisverfolgung" 54 und die Möglichkeiten zur Reinigung von einem Diebstahlsvorwurf thematisiert. Dabei handelt es sich um äußerst komplizierte, an Formen und Fristen gebundene, je nach Rechtslage variable, besondere Verfahrensarten, die minuziös durch die einzelnen (möglichen) Verfahrensschritte hindurch beschrieben werden. Entscheidend für den genauen Verlauf ist vor allem die Aussage des Beklagten. So besteht dieser Text über lange Passagen ausschließlich aus Sätzen vom Typ 5 5 : 54
D I E T E R W E R K M Ü L L E R , Artikel ,Anefang', in: H R G (wie Anm. 35) 1, Berlin 1971, Sp. 159-163, Sp. 159; vgl. auch J U L I U S W . P L A N C K , Das deutsche Gerichtsverfahren im Mittelalter. Nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen, 2 Bde., Braunschweig 1879, Nachdruck Hildesheim - New York 1973, 1, S. 694 ff., 757 ff. und 824 ff.; D I E T E R W E R K M Ü L L E R , Artikel , H a n d h a f t e Tat', in: H R G (wie Anm. 35) 1, Berlin 1971, Sp. 1965-1973 und G U N T E R G U D I A N , Artikel ,Gewährschaftspflicht', in: ebd., Sp. 1642.
55 Zur Bedeutung der Verwendung bestimmter Satztypen für die Textsorten-Problematik im allgemeinen vgl. W E R N E R K A L L M E Y E R - R E I N H A R D M E Y E R - H E R M A N N , Artikel .Textlinguistik', in: Lexikon der germanistischen Linguistik, hg. von
HANS
PETER ALTHAUS -
HELMUT HENNE -
HERBERT
241
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels SPRICHT ABER IENER da wider, ab is gewant is, he habe is lasen wirken, oder ab is phert sin oder ander vie, he habe is in sime stalle gezogen, he mus is mit mereme rechte behalden, ienir, der is in den geweren hat, ab hes selb dritte siner nakebure gezugen mag, denne iener, der is geanevangit hat. SPRICHT ABER IENER, he hab is gekouft uf deme markte, he wisse nicht widir wen, so is he dube unschuldig, das he bewise unde sin recht dar zu tu di stat. SPRICHET ABER IENER, is si im gegeben oder he habe is gekouft, so mus he benennen sinen gewern, wider den hes gekouft hat, unde di stat, da hes inne koufte. He mus aber swern, das [...] (W 34 recto/verso, II 36 §§3,4, Hervorhebungen von Verf.). Immer wieder eingeleitet durch stereotypes spricht aber iener, steht - häufig an zahlreiche weitere Bedingungen 5 6 geknüpft - eine mögliche Aussage des des Diebstahls Verdächtigten in der indirekten Rede 5 7 am Anfang der Sätze, wobei der genaue Wortlaut der Angaben wichtig ist. Dem folgt die sich daraus ergebende rechtliche Konsequenz - oft wiederum an Konditionen gebunden - als detaillierte Handlungsanweisung, deren illokutionärer Charakter und imperativischer Anspruch durch das Modalverb (he mus) unterstrichen wird. Der
ERNST WIEGAND, 2., vollst, neu bearb. u. erw. Aufl. Tübingen 1980, S. 242-258, S . 2 5 5 f . , f ü r die des Mittelniederdeutschen RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Prolegomena zu einer Texttypologie des Mittelniederdeutschen, in: Aspekte der Germanistik, Fs. f ü r Hans-Friedrich Rosenfeld zum 90. G e b . , h g . v o n WALTER TAUBER ( G ö p p i n g e r A r b e i t e n z u r
Germanistik 521) Lorch 1989, S . 2 6 1 - 2 8 3 , S . 2 7 8 f f . 56 Zu den mit Konjunktion ab eingeleiteten konditionalen
Informationsgehalt dieser an zahlreiche Bedingungen geknüpften, ins Detail gehenden instruktiven Sätze ist besonders hoch. Sie sind schwer zu merken, müssen aber wörtlich genau genommen werden. W hat mit 86 (von 100) Pergamentblättern 5 8 Verluste sowohl im Land- als auch im Lehnrecht. Insgesamt verteilen sich die 14 fehlenden Blätter/28 Seiten 59 auf vier Lücken zu dreimal vier und einmal 16 Seiten. Bei der ersten zwischen 27 verso und 28 recto fehlt das innerste Doppelblatt der 4. Lage, das durch D 22 recto-23 verso zu ergänzen ist. Es handelt sich hier um die ersten vier Seiten des zweiten Buchs des Landrechts, das auf D 22 recto in der vierten Zeile mit roter Kapitelüberschrift in lateinischer Sprache 60 Incipit liber secundus, cap. / u n d einer dreizeiligen, mennigumrissenen goldenen W^-Initiale einsetzt. Wieder geht es auf den verlorenen Seiten, die die ersten elf Kapitel des zweiten Buchs beinhalten, um den Gang des Gerichtsverfahrens. Das Generalthema, das in Kap. 2 grundlegend eröffnet 6 1 und in Kap. 11 abgeschlossen wird 6 2 , ist das ,Erscheinen und Ausblei-
58 Vgl. die Übersicht zu Lagenfolge, Inhalt und Ausstattung d e r H a n d s c h r i f t bei WOLFGANG MILDE, Z u m W o l f e n b ü t -
teler Sachsenspiegel, in: Text-Bild-Interpretation (wie A n m . 9 ) I, S . 2 0 7 - 2 1 1 , S . 2 0 7 f f . und DERS., Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift, in: G o t t ist selber Recht (wie Anm. 2) S . 5 6 f . 59 Vgl. den Abdruck d e r entsprechenden Seiten von D (in diesem Bande). 60 Direkt daneben ist diese als Randnotiz f ü r den Rubrikator - wie auch im folgenden die Kapitelzählung - vorgeschrieben. In den Bilderhandschriften findet sich „erstmals die dann vulgat gewordene Drei-Bücher-Einteilung des Land-
MASCHECK,
r e c h t s " , FRIEDRICH EBEL, A r t i k e l , S a c h s e n s p i e g e l ' , in: H R G
Z u r Syntax d e r Bedingungssätze im Landrecht des Sachsenspiegels, Diss. Weida 1913, S. 38 ff. 57 Es fällt auf, d a ß sich gerade in den Satzabschnitten in indirekter Rede Relikte gesprochener Sprache häufen, so z.B. apokopiertes he hab oder häufig kontrahiertes hes. Eine Ubersicht über die Erscheinungen des gesprochenen Mittelniederdeutschen in den Schriftquellen gibt KARL BISCHOFF, Ü b e r gesprochenes Mittelniederdeutsch (Abhandlungen der Akademie der Wiss. u. d e r Literatur, Mainz. Geistes- u. Sozialwissenschaftliche Kl., 1981, H e f t 4) Wiesbaden 1981, S. 7 ff. und DERS., Reflexe gesprochener Sprache im Mittelniederdeutschen, in: Sprachgeschichte. Ein H a n d b u c h z u r Geschichte der deutschen Sprache und
(wie Anm. 35) 4, Berlin 1990, Sp. 1228-1237, Sp. 1230. Vgl. d a z u jetzt auch RUTH SCHMIDT-WIEGAND, Die überlieferungskritische Ausgabe des Sachsenspiegels als Aufgabe der mittelniederdeutschen Philologie, in: Franco-Saxonica. Münstersche Studien z u r niederländischen und niederdeutschen Philologie. J a n Goossens zum 60. Geburtstag, hg. von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Niederländischen Seminars und d e r Niederdeutschen Abteilung des Germanistischen Instituts und d e r Kommission f ü r M u n d art und N a m e n f o r s c h u n g Westfalens, N e u m ü n s t e r 1990, S. 1 - 1 3 , S . l l .
Nebensätzen
im Sachsenspiegel
v g l . WALTER
i h r e r E r f o r s c h u n g , h g . v o n W E R N E R BESCH - OSKAR R E I C H MANN - STEFAN SONDEREGGER, 2 H a l b b d e . , B e r l i n -
New
Y o r k 1984 f., 2., S. 1263-1268. Zu den sprachlichen Besonderheiten von W , aufgezeigt am Beispiel von W 34 rect o , v g l . S C H M I D T - W I E G A N D ( w i e A n m . 1 3 ) S. 9 6 f f .
61 Vorsumet der greve sin echte ding, das alleine vorluset der cleger; vorsumet he der dinge eins, di um ungerichte uz geleit werdin, man mus der clage beginnen als von erst (D 22 recto, Z. 9 ff.; II 2). 62 In II 12 § § 1 - 1 5 geht es dann um die Modalitäten der Urteilsfindung, in II 13 folgt der mit einem Rechtssprichw o r t e r ö f f n e t e Strafenkatalog, vgl. d a z u BRIGITTE JANZ
242
Brigitte Janz
ben (Säumnis) vor Gericht' 6 3 . Im einzelnen werden behandelt: II 2 II 3 §§ 1 - 3 II 4 § 1
II 4 §2 II 6 § 3 II 7 II 4 § 3 II 8 II II II II II
9 §1 9 §2 11 § 1 11 § 2 11 §3
Säumnis des Richters (D 22 recto) Termine und Fristen zur Antwort (D 22 recto) Aufhebung der Bezirksacht und Erscheinen des Verfesteten vor Gericht (D 22 recto) Erneute Verfestung wegen Abwesenheit (D 22 verso) Fehlen des Gerichtspflichtigen (D 22 verso) Hinderungsgründe (echte Not) (D 23 recto) Nachweis der echten N o t (D 23 recto) Klage bei Abwesenheit des Beklagten (D 23 recto) Säumnis des Beklagten (D 23 recto) Bürgschaft für das Erscheinen (D 23 recto) Säumnis bei gelobtem Eid (D 23 verso) Ausbleiben des Gläubigers (D 23 verso) Empfangsverzug bei Geldschuld (D 23 verso)
Auf den fehlenden Seiten geht es um die Voraussetzungen, Bedingungen, Modalitäten und Konsequenzen bei Nichterscheinen vor Gericht. Dabei wird differenziert zwischen der gedachten Abwesenheit der verschiedenen Personen (Richter, Verfesteter, Gerichtspflichtige, Beklagter und Kläger), mögliche Gründe werden diskutiert (echte Not oder nicht), die Art der Klage (um Schuld, auf Gut, um Ungerichte) ist entscheidend, und die präzise Form der Rechtshandlungen - verbunden mit zahlreichen Zeitangaben für Terminlichkeiten und Fristen - , vor allem die möglichen Beweismittel und die daran geknüpften Bedingungen werden beschrieben. Damit ist der Themenkomplex - was das Landrecht angeht - nahezu vollständig und zusammenhängend
63
Rechtssprichwörter im Sachsenspiegel. Eine Untersuchung zur Text-Bild-Relation in den Codices picturati (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 13) F r a n k f u r t / M a i n - Bern - New York - Paris 1989, S. 458 ff. Zum Ungehorsamsverfahren vgl. P L A N C K (wie Anm. 5 4 ) 2 , S. 2 6 8 ff. und G E R H A R D B U C H D A , Artikel ,Contumacia', in: HRG
(wie A n m . 3 5 )
1, Berlin
1971, S p . 6 3 6 - 6 3 7 .
Daß
Säumnis im Strafprozeß, anders als in zivilrechtlichen Streitigkeiten, „als ein Mangel an persönlicher Glaubwürdigkeit gewertet wurde", betont A L E X A N D E R I G N O R , Indiz und Integrität. Anmerkungen zum Gerichtsverfahren des Sachsenspiegels, in: Text-Bild-Interpretation (wie Anm. 9) I, S. 7 7 - 9 1 ,
S. 89.
behandelt. Das reicht vom Fehlen des Richters/Grafen, was beim echten Ding dem Kläger zum Nachteil gereicht und bei der Klage um ungerichte zur Folge hat, daß von vorn begonnen werden muß (II 2), bis hin zu der Regelung, daß der Empfänger einer Geldschuld, erscheint er nicht wie vereinbart, nur den Termin, nicht den Anspruch auf das Geld verliert (II 11 §3). Im Vergleich zur Vulgatfassung fällt wieder eine Textumstellung auf: II 4 §3 mit der Bestimmung, daß der Bürge die Gründe des durch echte N o t Verhinderten benennen und durch Eid auf die Reliquien bekräftigen muß, folgt im Anschluß an II 7, wo erst ausgeführt wird, was überhaupt als echter Hinderungsgrund anerkannt wird und dann das Ausbleiben vor Gericht entschuldigt 64 . Der Artikel ,paßt' also in der Reihenfolge der Bilderhandschriften 6 5 durchaus besser, sind doch in Kap. 4 die Voraussetzungen zum Verständnis von Art. 3 noch nicht gegeben. Das Thema ,Abwesenheit bei Gericht' stellt besonders hohe Anforderungen an den Illustrator. Sollen seine Bilder der Thematik gerecht werden, muß er - entgegen sonstiger Gewohnheit, das, was nicht ist oder sein darf, im Bild zu vernachlässigen 66 - den Nichtanwesenden, der ja im Text immer wieder am Ausgangspunkt der Überlegungen steht, integrieren. Dazu drei Beispiele: In D 22 recto 3 ist die Abwesenheit des Grafen durch das Davonreiten desselben ausgedrückt. D a ß er dadurch einen Gerichtstermin versäumt, ist dem Bild allerdings nicht zu entnehmen 6 7 . In D 22 recto 4 bitten
64 Dazu zählen: Gefangenschaft, Krankheit, Wallfahrt und Reichsdienst, in dieser Reihenfolge in D 23 r 1,2 durch einen an eine Säule gefesselten, sitzenden Mann, durch einen Bettlägerigen mit Ablehnungsgestus, durch einen Pilger mit Stab, H u t und Wegzehrung auf dem Rücken und durch einen Reiter mit der Königskrone in der Linken ausgedrückt. Zur echten N o t vgl. P L A N C K (wie Anm. 54) 2, S. 326ff. und W O L F G A N G S E L L E R T , Artikel ,Not, echte', in: H R G (wie Anm. 35) 3, Berlin 1984, Sp. 1040-1042. 6 5 Auch in O folgt II 4 § 3 erst auf II 7 . Vgl. LÜBBEN (wie Anm. 2 4 ) S. 39 f. 66 Vgl. W I L H E L M M E S S E R E R , Einige Darstellungsprinzipien der Kunst im Mittelalter, in: Deutsche Vierteljahresschrift f ü r Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 36, 1962, S. 157-178, S. 163; D E R S . , Z U einer Grammatik der mittelalterlichen Kunstsprache, in: Mitteilungen der Gesellschaft f ü r Vergleichende Kunstforschung in Wien, 29. Jg., N r . 3 / 4 , 1977, S. 1-6, S.2 und J A N Z (wie Anm.62) S.74f. und 527. 67 Der Zeichner von O hat durch einen aufwendig verzierten, leeren Richterstuhl neben der Szene einen Hinweis darauf zu geben versucht (O 38 recto 4).
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels
243
ein zum Zweikampf aufgeforderter Schöffenbarfreier und ein Dienstmann vor Gericht um Aufschub, damit sie gehen und sich rüsten können. Ihr Anliegen wird durch ihre vom Geschehen vor Gericht abgewandte Körperhaltung, die ihnen zustehenden Fristen werden durch Zahlzeichen VI und II für sechs bzw. zwei Wochen, je nach Geburtsstand, ausgedrückt. In D 23 recto 3 nennt ein Bürge dem Richter den Grund für die Abwesenheit desjenigen, f ü r dessen Erscheinen er gebürgt hat, und bestärkt seine Angaben durch Eid auf die Reliquien. Dennoch ist der Säumer direkt neben der Gerichtsszene im Bild zu sehen: Er hält sich in seinem Haus auf und ist bettlägerig. So ist über den Text hinaus, der ,nur' von ehafie not spricht, ein Exempel geschaffen. Die mündliche Aussage des Bürgen wird im Bild sichtbar. Diese Beispiele mögen genügen, um zu zeigen, mit welchem Einfallsreichtum der Illustrator das schwierige Thema meistert. Zu berücksichtigen sind immer auch die Handgebärden 6 8 der Figuren, denen ja in der Rechtsikonographie eine besondere Bedeutung zukommt 6 9 . Der Zeichner nutzt sie sowohl zur Vertiefung der Bildaussage als auch als Interpretations- und Verständigungshilfe für den Benutzer. Besonders häufig findet man Redegebärden 7 0 , denn entscheidend für die sich aus der Abwesenheit ergebenden Konsequenzen sind die Angaben/Aussagen der Säumer bzw. ihrer Bürgen. Auch der Text dieser Seiten hat mit zahlreichen synkopierten, apokopierten und kontrahierten Formen 7 1 noch viel von der dieser Materie eigenen Mündlichkeit erhalten, die an einer Stelle sogar in wörtlicher Rede gipfelt: Beclait man einen
68 Seit VON AMIRA, Handgebärden (wie Anm. 3) werden im Sachsenspiegel drei Arten von Handgebärden unterschieden: die objektiven aus dem Bereich „der Symbolik des Rechts" (S. 166), die subjektiven aus dem Bereich „der Symbolik des Künstlers" (ebd.) und diejenigen, die „dem Vorrat, der in älteren Werken der zeichnenden Kunst überliefert war (S. 262), entnommen sind. 69 Zur Gebärdensprache im mittelalterlichen Recht vgl. den g l e i c h n a m i g e n A u f s a t z v o n RUTH SCHMIDT-WIEGAND,
in:
FMSt (wie Anm. 13) 16, 1982, S.363-379; DIES., Artikel ,Gebärden', in: H R G (wie Anm. 35) 1, Berlin 1971, S p . 1 4 1 1 - 1 4 1 9 u n d BRIGITTE JANZ, H a n d in H a n d .
Hand
und Handgebärde im mittelalterlichen Recht, in: Die Beredsamkeit des Leibes (wie Anm.24) S. 195-197. 7 0 V g l . VON AMIRA, H a n d g e b ä r d e n
( w i e A n m . 3 ) S. 1 7 0 - 2 0 3
und Tafel 1 a - 2 b. 71 So z.B. allein auf D 22 recto in den ersten drei Kapiteln des zweiten Buches: kern, ¡wem, eins, geleit, beclait, gewern, neisten, is, andern, gebn, habn, hes (Zeile 5-22).
[man] in sine keginwertikeit umme eigen oder umme len, das he in rechten gewern hat, man sal im tedingen zu dem neisten dinge, ab he spricht: herre, mir is hir umme nicht her getedinget (D 22 recto, Z. 14 ff., II 3 § 1). Der gedachten, an eine bestimmte Voraussetzung geknüpften Situation (Beclait man...) folgt unmittelbar die Handlungsanweisung (man sal...), jedoch gebunden an eine - unter anderem in der wörtlichen Genauigkeit liegenden - Bedingung (ab he spricht...). Präzise Formulierungen und Formen von Rechtshandlungen hatten auch und gerade im Falle von Säumnis tragende Bedeutung. Die zweite Lücke in W liegt im dritten Buch des Landrechts zwischen fol. 45 verso und 46 recto. Hier sind zwei (halbe Doppel-)Blätter - nämlich das letzte der 6. und das erste der 7. Lage - mit relativ unsauberem Schnitt, wie die stehengebliebenen Kanten zeigen, ausgeschnitten. Die so fehlenden Seiten des dritten Buchs des Landrechts (III 25 §3-39 §2) sind in D (40 recto-41 verso) und H (16 recto-17 verso) erhalten. Inhaltlich erweisen sich diese Artikel nicht als zusammengehörig. Die Themen wechseln häufig und fallen in die verschiedensten rechtlichen Bereiche 72 . Es findet sich nur ein etwas längerer zusammenhängender Themenkomplex: , Beweis von Freiheit und Unfreiheit' 73 . Da dieser auf D 40 verso beginnt und dort in der letzten Zeile abgeschlossen wird - sich also nicht über beide Blätter erstreckt und diese thematisch verbindet kann auch diese Textpassage nicht den Grund für das Ausschneiden der beiden Blätter liefern. Auf der der Lücke in W folgenden Seite ( = W 46 recto) hat sich die Tinte der Schrift gelöst und ist stellenweise ausgelaufen, was als Ursache Feuchtigkeit vermuten läßt. Sollten hier die beiden Blätter ,nur' herausgetrennt
72 In eben dieser Reihenfolge:,Richtergewalt des Königs' und ,Rechte und Pflichten der Schöffenbarfreien' (III 26 §§ 1-3), ,Kinder aus ungültiger Ehe' (III 27), ,Nachweis der Rechtlosigkeit' (III 28 §§ 1,2), ,Handgemal' und ,Kürrecht' (III 29 §§1,2), .Antwort vor Gericht' und ,Pflichten des Richters' (III 30 §§ 1,2), , H a f t u n g des Erben und dem Erben gegenüber' (III 31 §§1,2), .Beweis von Freiheit und Unfreiheit' (III 32 §§2-9), ,Gewette' (III 32 §10), ,Recht vor dem König' (III 33 §§1-5), ,Acht und Oberacht' (III 34 §§ 1-3), . H a n d h a f t e Tat und Gewährenzug' (III 35 § 1), ,Vom Friedebruch' (III 36 §§1,2), .Ausschluß vom Gerichtszeugnis', ,Eintreiben fremden Viehs' und ,Schneiden fremden Korns' (III 37 §§2-4), .Rechte Gewere', ,Bleiberecht der schwangeren Witwe', ,Musteil und Morgengabe' und , Recht des Witwers aus der Niftelgerade' (III 38 §§ 1 - 3 , 5 ) , . H a f t u n g des Schuldners' (III 39 § § 1 , 2 ) .
73 III 32 §§ 2-9. § 1 fehlt in D und H.
244
Brigitte
worden sein, weil sie verderbt waren? Das allerdings wäre dann ein starkes Indiz f ü r eine weniger sachliche, sondern eher repräsentative Funktion der H a n d s c h r i f t . Für eine ganz konkrete Benutzung gerade einer dieser Seiten spricht jedoch eine Besonderheit auf D 40 recto: Wie sonst auch gelegentlich erkennt man am äußeren rechten Rand noch deutlich die auf der H ö h e der jeweiligen Zeile klein vorgeschriebene Artikelzählung ( X X V I - X X X I ) , die in einem späteren Arbeitsgang mit roter Farbe durchgehend an entsprechender Stelle in den Text übertragen wurde. Das Besondere an dieser Seite ist nun eine zusätzliche Redaktion, was die Zählung angeht. Mit schwarzer Tinte wurden von einer späteren H a n d 7 4 Korrekturen vorgenommen: Die XXIX (Zeile 21) hat diese gestrichen und drei Zeilen tiefer am Rand neu geschrieben, die XXX (Zeile 29) setzte sie eine Zeile herunter, vergaß aber, erstere zu streichen, so d a ß sie nun doppelt vorhanden ist. In beiden Fällen wie auch bei der XXVI in der zweiten und der XXXI in der letzten Zeile zog sie mit ,rücksichtsloser' H a n d unsaubere Verweisstriche in den Text hinein. Solche Korrekturen werfen ein deutliches Licht auf ihren Urheber: Für diesen w a r die H a n d s c h r i f t sicher kein Repräsentationsobjekt, sondern Gebrauchsgegenstand 7 5 . Ihm ging es um den Inhalt bzw. um dessen Erschließbarkeit. Er war, so Karl von Amira, „mit der alten Kapiteleinteilung unzufrieden" 7 6 . Das setzt voraus, d a ß er damit zu arbeiten versucht hat, d a ß er sie benutzt hat. Tatsächlich läßt sich die Frage nach dem W a r u m seiner Unzufriedenheit leicht beantworten: Er hatte eine Unstimmigkeit zwischen der Zählung des zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch vollständig vorhandenen - Inhaltsverzeichnisses und der des Textes bemerkt 7 7 . Bei der Behebung des Fehlers ging es
74 So auch VON AMIRA (wie Anm. 1) I, S. 8.
75 Inhaltsverzeichnis und Register machen sie ja zu einer Art ,Nachschlagewerk'. Neben der Benutzung im praktischen Rechtsleben ist so als Gebrauchsraum auch an Schule und Studium, also an eine theoretische Auseinandersetzung mit der Materie, zu denken. Vgl. KARL KROESCHELL, Rechtsaufzeichnung und Rechtswirklichkeit. Das Beispiel des Sachsenspiegels, in: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v o n PETER CLASSEN ( V o r t r ä g e u n d F o r s c h u n g e n Sigmaringen
1977,
S. 3 4 9 - 3 8 0 ,
XXIII)
S. 3 6 7 f f . u n d JANZ
(wie
Anm. 3 0 ) S. 2 6 2 ff. 7 6 VON AMIRA (wie A n m . 1) I , S. 8.
77 Der entsprechende Teil des Inhaltsverzeichnisses fehlt mit Lücke D 1. Da jedoch die in D und W erhaltene letzte Seite (vgl. D 2 recto und W 8 recto) übereinstimmt, kann
Janz
ihm ausschließlich um die Korrektheit der Angaben und nicht um die Ästhetik der Seite. Bei der dritten Lücke zwischen W 55 recto und 56 recto - ebenfalls im dritten Buch des Landrechts - fehlt das innerste Doppelblatt der 8. Lage. Es enthielt III 77 § 2 - 8 4 §2 und ist in D (52 recto-53 verso) und in H (26 recto-27 verso) erhalten. Auch hier ist keine inhaltliche Zusammengehörigkeit zu erkennen. Die Themen wechseln häufig 7 8 , das der ,Treuepflicht', das einzige, das ausführlich über gut eine Seite (D 52 rect o / v e r s o ) behandelt wird, verbindet die Blätter nicht. Auch sonst geben Text und Bilder der Seiten kein Indiz f ü r eine möglicherweise gezielte Entnahme. Bei der vierten, letzten und größten Lücke zwischen W 74 verso und 75 recto fehlt zwischen der 10. und 11. eine komplette Lage. Bei ehemals gut 70 ist mit diesen 16 Seiten (Lnr 48 § 2 - 6 5 §21) nahezu ein Viertel ( « 22,7%) des Lehnrechts abhanden gekommen. Glücklicherweise können die Blätter auch hier aus D (73 recto-80 verso) ergänzt werden. Gegenstand ohne auffallenden Unterschied zu den vorherigen Artikeln/Seiten ist das gemeineme Unrechte79 mit den ihm eigenen Institutionen und Bestimmungen, hier (D 73 recto-78 recto, Lnr 48 § 2 - 6 4 § 2 ) z.B. Belehnungsarten und -fristen, Lehnserneuerung, -pflichten, -gebrauche, -treue, -erbrecht und -anwartschaft. D a n n findet sich jedoch ein deutlicher thematischer Einschnitt, dem äußerlich bei der Gestaltung der Seite D 78 recto über Bildbuchstabe V hinaus keine Rechnung getragen wurde. Mit Lnr 65 § 1 setzt hier der dritte Teil 8 0 des allgemeinen Lehnrechts in Zeile 15
auch hier auf W zurückgegriffen werden: XXIX Kein schephinbare man darf sin hantgemal bewisen, XXX Vorsprechin sal he darben..., XXXI Swas ein man dem andern schuldig is (W 6 recto rechts). 78 Dazu gehören ,Treuepflicht' (III 78 §§1-9), ,Dorfgründungen' und ,Gerichtsort' (III 79 §§ 1-3), ,Erbloses Eigen' und ,Dienstmannenrecht' (III 80 § 1 - 82 §2), Rechtlosigkeit' und ,Vergabe und Besitzen von Gut' (III 82 § 1 83 §1), ,Gewährspflicht' (III 83 §§2,3) und ,Vergehen gegen den Erblasser' (III 84 §1). 79 D 85 verso, W 79 verso (Lnr 71 § 1). Dieses erstreckt sich, gegliedert in drei Teile, von Art. 1-70. Zur Gliederung des Sachsenspiegels, die in bezug auf das Lehnrecht „aus dem Text selbst hervorgeht", vgl. GERHARD THEUERKAUF, Lex, Speculum, Compendium iuris. Rechtsaufzeichnung und Rechtsbewußtsein in Norddeutschland vom 8. bis zum 16. Jahrhundert (Forschungen zur deutschen Rechtsgeschichte 6) Köln - Graz 1968, S. 117 ff., Zitat S. 119. 80 Vgl. die Übersichten bei THEUERKAUF (wie Anm. 79) S. 116
(nach Molitor) u. S. 132 f.
Die Dresdener Bilderhandschrift des Sachsenspiegels der Seite mit dem Thema ,Lehngericht' ein, der sich über das Ende der Lücke W 4 hinaus bis Lnr 69 §12 erstreckt 8 1 . Zunächst wird der Gang des Verfahrens im Lehngericht minuziös behandelt: „der Angeklagte mußte unter Einräumung einer 14tägigen Frist vor Gericht geladen werden und bei Nichterscheinen wurde die Ladung noch zweimal wiederholt; falls wiederum vergeblich, erfolgte die Absprechung des Lehens, sofern keine , echte Not' als Entschuldigungsgrund vorlag" 82 . Der gesamte Prozeß wird ausführlich im Hinblick auf das Wofür, Wann, Wo und vor allem Wie des Verlaufs - von der Ladung bis zum Schlußurteil - beschrieben. Besonders breiten Raum nimmt das Verfahren bei Nichterscheinen des Geladenen, das dreimalige Heischen und der Ladungsbeweis durch Befragung, ein.
245 Zentrales Beweismittel neben dem Eid ist „die Aussage der Mannen, die ja gerade deshalb bei Lehnsgeschäften als Handlungszeugen fungierten" 8 3 . Weiß der Mann um die Sache, so hat er mit einer feststehenden Formel zu antworten: Alse der herre des dritten tages sines mannes gewartit, bis di sunne nidirwert get, SO VRAGE HE, WAS da rechtis umme si; SO VINT MAN, DAS he sine teding gezugen sal, das erste, das andere unde das dritte, ir icliche mit zewen sunderlichen mannen; dirre gezug SAL ALSUS LUTEN: Herre, ich verphlege mich des bi uch, daz ir N getedinget habt an dise stat unde sin da gewartet, alse lenrecht is; das sach ich unde hortes unde bin is uwer gezug. Noch icliches mannes gezuge VRAGE DER HERRE, AB he mit im volkumen si, als iz im helfende si zu sime rechte. Swen der gezug bi des herren hulden SAGET, DAS he weiz von der rede, der he GEVRAGETiz, odir bi des herren hulden sich vorphlege, das he dar ab nicht enwisse, so ensal man nicht vorbas VRAGEN; der herre muz wol VRAGEN, swi manchen sinen man he wil, wen bis he sinen gezug volbrenge. Swen der herre gezuget alsus dri siner tedinge, SO VRAGE HE, WAS da rechtis umme si, das der beschuldigete man nicht vorkumen is; SO VINT MAN, DAS man im sin gut vorteile, das he vonme herren hat; SO VRAGE DER HERRE, WEDIR he das tun sulle odir ein sin man; SO VINT ALSUS: MAN im, einer sin man; DER SPRECHE Alse mime herren zu rechte iz vunden, also virteile ich N so getan gut, alse he von mime herren gehabit hat; so vrage der herre, was he mit deme gute tun sulle, das sime manne virteilt is. SO VINT MAN IM ... (D 80 recto/verso, Lnr 65 §18, Hervorhebungen von Verf.).
Vor mittage muz der herre sins tedinges wol beginnen, alse im di tedinges zeit irteilt is unde he vorsprechen genomen hat, SO VRAGE HE, ab he icht muze lazin heischen zu lenrechte einen sinen man, den he dar getedinget hat umme schuldegunge. Alz iz gevunden wirt, SO VRAGE HE, wer en sulle heischen; SO VINT MAN, ein sin böte, das iz hören zewene sine man uf dem ende des hoves, da der herre tedinget, UNDE SPRECHE ALSUS: Ich heische vor minen herren N zeu einem male, zeum andir male, zeum dritten male umme so getane schuldegunge, als im her getedinget is; enis he denne da nicht, so kume der böte wider zeume herren UNDE SAGE: herre, he was da nicht noch niemant, der sine not bewiset. Alse des der böte bekennet, SO VRAGE DER HERRE, was da rechtes umme si; SO VINT MAN zu rechte, das man en anderweide heische unde sint zeum dritten male (D 79 verso/80 recto, Lnr 65 §15, Hervorhebungen von Verf.).
81 Das Gerichtslehen fällt nicht unter das allgemeine Lehnrecht, sondern zählt neben Lehen an Eigengut und Burglehen zu den besonderen Lehnsarten: noch sal ich uch dri lenunge bescheiden unde sagen, wo si zeweien von gemeineme lenrechte (W 79 verso, Lnr 71 § 1). 8 2 K A R L - H E I N Z S P I E S S , Artikel ,Lehnsgericht', in: H R G (wie Anm.35) 2, Berlin 1978, Sp. 1714-1717, Sp. 1715. Zum Verfahren im Lehnsgericht vgl. Des Sachsenspiegels Zweiter Theil, nebst den verwandten Rechtsbüchern, 2., Der Auetor vetus de benefieiis, das Görlitzer Rechtsbuch und das System des Lehnrechts, hg. von C A R L G U S T A V H O MEYER, Berlin 1844, S. 581 ff. - Der Verlust des Lehens ist die weitestgehende Strafe, die ein Lehnsgericht verhängen konnte. Zur sachlichen Begrenzung der Gerichtsgewalt im Lehnrecht vgl. P L A N C K (wie Anm. 54) 1, S. 15 ff.
Der Themawechsel vom ,materiellen Lehnrecht' zum , Lehngericht' hat deutlich auch einen Wechsel auf der sprachlichen Ebene des Textes zur Folge. Der besonderen Bedeutung, die der Aussage der Mannen im Lehngericht zukommt, entsprechend, drängt sich diese Mündlichkeit sprachlich immer mehr in den Vordergrund. Sie wird schon durch den gehäuften Gebrauch illokutionärer Verben aus dem Bereich der ,Rede' 8 4 selbst zum Thema. Der regelmäßige Wechsel von in-
83
SPIESS ( w i e A n m . 8 2 ) S p . 1 7 1 6 .
84 Allein in den zwei hier zitierten Textpassagen: irteilen ,Urteil sprechen', vragen ,sich erkundigen', vinden ,ein Urteil ermitteln und aussprechen', hören , hören', sprechen ,reden', sagen ,vortragen', bekennen ,erklären'und luten ,ausrufen'.
246 direkter und direkter Rede trägt dem Stellenwert der Zeugenaussage als Beweismittel im Lehnrecht Rechnung. Jede sprachliche Äußerung hat - je nach Wortlaut - direkte Konsequenzen für die ihr folgende (Sprech-) Handlung. In indirekter Rede präsentiert der Text Instruktionen in bezug auf die Inhalte der Fragen und Antworten, in den Passagen in direkter Rede diktiert er Aussagen, gibt wörtlich genau zu nehmende sprachliche Handlungsanweisungen, die dann wohl auswendig gelernt oder abgelesen werden mußten. Auch in den entsprechenden Bildern wird die Bedeutung der Rede im Gang der Verhandlung immer wieder hervorgehoben: Redegebärden treten gehäuft auf, besonders wichtige Redehandlungen werden durch Fingerzeig auf den Mund betont (D 78 verso 1). Das Vorfordern des Beschuldigten erledigt der Bote mit weit geöffnetem Mund, also besonders laut rufend (D 79 verso 5). Ohrenzeugen zeigen zum Zeichen, daß sie etwas gehört haben, auf ihr Ohr (D 78 recto 4, 79 recto 3, 79 verso 5, 80 recto 1,2), wer etwas nicht hören will, hält sich die Ohren zu (D 79 recto 2). Bei der Urteilsfindung wird mit verschiedenen Schweigegebärden unterschieden zwischen ,nicht können' und ,nicht (mehr) müssen'. Im ersten Fall verdeckt die Handfläche das Kinn (D 79 verso 1), im zweiten den Mund (D 79 verso 3) 85 . Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die bei der Fragestellung angenommenen Zusammenhänge zwischen Inhalt und denkbaren Einsatzbereichen der fehlenden Seiten bei drei der insgesamt sechs Lücken in D und W vorhanden sind. Hier haben sich auffällige Gemeinsamkeiten ergeben: Bei D 2, W 1 und W 4
85 Zu den Redegebärden, „insbesondere bei prozessualen Geschäften", vgl. VON AMIRA, Handgebärden (wie Anm. 3) S. 194 ff., zu den Schweigegebärden ebd. S. 235.
Brigitte Janz beinhalten die fehlenden Textpassagen relativ geschlossene Themenkreise zum Gang des Gerichtsverfahrens, dem bei Diebstahl und Raub (D 2), dem bei Säumnis (W 1) und dem des Lehngerichts (W 4), wobei wiederum das Nichterscheinen des Geladenen eine besondere Rolle spielt. Schritt für Schritt werden die einzelnen, komplizierten, an Voraussetzungen, Formen, Fristen und Bedingungen geknüpften Verfahrensabschnitte entwickelt und Konsequenzen aufgezeigt. Instruktive Sätze, sprachliche Handlungsanweisungen mit hohem Informationsgehalt dominieren. Der illokutionäre Charakter der Textpassagen wird immer wieder in indirekter und sogar direkter Rede greifbar. Das verwundert nicht, sind doch z. B. die Aussagen des Beklagten bei der Fahrnisverfolgung, die des Bürgen bei Säumnis und die der Mannen im Lehngericht von entscheidender Bedeutung. Präzise Formulierungen und wörtliche Genauigkeit in der Aussage sind von großer Relevanz für den Verlauf und unabdingbare Voraussetzungen für den reibungslosen Ablauf des jeweiligen Verfahrens. Da, wo es um Inhalt und sprachliche Gestalt der Rede geht, häufen sich in apokopierten, synkopierten und kontrahierten Formen Relikte gesprochener Sprache, wird Mündlichkeit im Recht zum Thema. Die Sätze sind schwer zu merken, müssen aber wörtlich genau genommen werden. Bleibt nur die Möglichkeit, sie auswendig zu lernen oder abzulesen, d.h. sie abzuschreiben, den Codex als Ganzen vor Ort zu benutzen oder eben die entsprechenden Seiten zu entnehmen. In diesem Sinne ist es durchaus denkbar, daß es sich bei diesen drei Lücken tatsächlich um „Gebrauchsspuren" 86 handelt.
86 Neben „Verschmutzungen, Abreibungen und sonstige[n] Fingerspuren" zählt WERNER (wie Anm. 25) S.215 auch die Beschneidung der Ränder, das regelmäßige Einbinden und den fragmentarischen Charakter der Handschrift zu den Gebrauchsspuren. Auch nach SCHMIDT-WIEGAND, Die mitteldeutschen Bilderhandschriften (wie Anm. 13) S. 371 sprechen „Blatt- und Lagenverluste wie Lagenverschiebungen" für die tatsächliche Benutzung der Handschriften.
Anhang
Glossar der Rechtswörter Werner Peters und Friedrich Scheele unter Mitarbeit von Bärbel Müller A ab(e)brechen st.V. 1. 'abbrechen, abreißen': Ortbant von den swertscheiden suln si abbrechen 25v31, Was der man buwet ..., das mus he wol abbrechen 38r28; 2. 'entziehen, wegführen': Sidir haben en di keisere beide, vorsten unde vanlen, abegebrochen 49vl2, Wirt ein wip mit rechte von irme manne gescheiden ..das enmus aber si nicht abbrechin noch dannen vuren 55rl3/14. ~> brechen 5 ab(e)eren sw. V. 'ackern, pflügen': Swer siner gebure gemeine aberet 6vr2 7, Swer siner nakebure gemeine abeerit 56v3. ab(e)gelden st.V. 'zahlen, entgelten': Swas zinses oder phlege in des wibes gute was, da man ir abgeldin solde 55v20, he enis da nicht phlichtig, ab zu geldene phlege noch zins 55vl8. -> gelden 1 ab(e)gen unr. V. 'verlorengehen, lossagen': oder ir ein des andern nicht abe enget 24rl7. ab(e)genemen st.V. 'befreien': Wirt aber beide, vater unde sun, beclait um eine tat, da enmag he en nicht abegenemen 30v21/22. ab(e)nemen st.V. 'rückgängig machen, aufheben': Wir gebiten aber alle di zcolle, di gehoget sint, andirs denne si zu dem erstin gesazt wurdin, das man di irhounge abeneme 2rl9. ab(e)gewinnen st.V. 'im Rechtsstreit abgewinnen, absprechen, entziehen': Man ensal nimande von sinen geweren wisen, si ensi im mit rechte abgewunnen 72v4, abegewunnen 32r23, 36vl9/20. -> angewinnen; gewinnen 1 ab(e)gezügen sw.V. 'durch Zeugen abgewinnen, durch Zeugenbeweis aberkennen': Dar umme enmus nimant
mit rechte sine gewer abegezugen iener, der di gewer hat 32r22. ab(e)jagen sw.V. 'abjagen, bei der Verfolgung wegnehmen': Was der man vint oder dibin oder roubern abejait 35r3, so behelt hes das dritte teil, der is den dieben oder den roubern abegejaget hat 3 5 r l l , abejaget 5vl21. ab(e)lien st.V. 'als Lehen weitergeben, weiterverleihen': ir kein enmag ane den anderen keinen teil ablien noch lasen 71r3. -> gellen ; lìen ; vorlien 1 ab(e)rouben sw.V. 'durch Raub entreißen, einem etwas rauben, jemanden berauben': wirt si im vorstoln oder abgeroubet 40rl0, abgeroubet 43r28/29, abgeroubit 43vl2. ab(e)slàn st.V. 'einen Schlag geben, schlagen, abschlagen': den sai man das houpt abeslan 29v3/4, man slet im di hant ab 30r20. ab(e)sundem sw.V. 'sondern, absondern, trennen, abfinden': al das gut, da si mite abegesundirt warin 13v31/32. -> sundem ab(e)sunderunge s t F. 'Absonderung, Trennung, Unterscheidung, Abfindung': Von absunderunge der kindere 4vll4. abeswich st. M., in der Verbindung abeswich tün 'im Stich lassen, Abstand nehmen von etwas, von etwas lassen': unde tut he im abeswich siner werschaft 36r23, abeswich tut 81v22/23. ab(e)wisen sw.V. 'vor Gericht abweisen, zurückweisen': unde wirt si dar abegewiset mit rechte 18vl2a, unde enmag he ... ienen nicht abegewisen mit rechte 30r6, oder ir ein enwise den andern ab Vorgerichte mit rechte 44v27. -> gewìsen 1
250 abrunnig Adj. 'entlaufen, flüchtig', zu mnd. afrunnich, mhd. aberinnec: Wirt aber he abrunnig 35v22. abt st. M. 'Abt': Swen man kuset bischove oder epte 6vll7, epte 10v27, 46vl2, 51r21. ächte st. F. 1. 'öffentlich gebotene Verfolgung, gerichtliche Rechtloserklärung, Acht': Doch ensal man nimande vorteiln sinen Up mit der vorvestunge noch mit der achte, da he mit namen nicht inkumen is 26v22, man tut zu hant in di achte alle, di sie viengen 51 vi 8, achte lr31, 2vl25, 2vl26, 2vl32, 2vrl, 3rll8, 3rl30, 3rl30b, 3rr3, 3rr4, 3rr6, 3rr7, 3rrl6, 3vl28, 3vl29, 8rr9, 19vll, 19vl2, 62v23, 79v28; 2. des riches ächte 'Reichsacht': Von des riches achte 4vrl2, riches achte 7rl20/21, 19r31, 19vl0, 40v21/22, 41v9, 66rl8; 3. des kimiges ächte 'dass.': Unde wer mit vestunge in des kuniges achte kumt 6rrl6, kuniges achte 52v2. -» W M U 1, S. 40 f.; DRWB 1, S. 361 ff.; H R G 1, S.25ff.; Lexer I, Sp.30; Grimm, DWB 1, Sp. 166f.; Trübner 1, S. 47 f.; Kluge/Seebold, S. 8 -*• kunig; riche 1; vorächten adelkint st. N. 'freigeborenes Kind, adeliges Kind': Ein wip mag gewinnen elich kint, adelkint, eigenkint unde kebiskint 21v5. altvil sw. M. 'Schwachsinniger, Blöder, Zwitter, der im rechtlichen Sinne erbunfähig ist': Uf altvilen unde uf getwerge irstirbit noch len noch erbe noch uf kropilkint 11 v7. amie sw. F. 'Geliebte, Buhle': Von not der amien 6rr32, An varnden wiben unde an siner ameien 48r36. ammecht st. N. 'Amt, dienstliche Stellung': Der sal bi dem ammechte bliben zcum minsten ein jar 3rl9, durch keiner hande ding schribe noch tu an sime ammechte 3rr28. ammechtman st. M. 'Verwalter, Amtmann, Dienstmann': Nimant enmag sime herren gut enphuren, des ammechtman he is 7vr33. ane sw. M.F. 'Ahn, Großvater, Großmutter': Von den vier anen 4vr32, anen 21v9, 21vl6. anersterben st. V. 1. 'vererben': Wer aber ein gut in geweren hat, das im anirstorben is 36vl6, anirstirbt llv33; 2. 'durch Sterbefall auf jemanden kommen, von Todes wegen zufallen': Welch knecht ... eine vormundeschaft anirsterbit von kindern 35v4. -» ersterben 1, 2 anegevelle st. N. 1. 'Anwartschaft auf ein Erbe, Nutzungsanfall': An anegevelle enis keine volge 7vll2, ab
Glossar dem kinde odir im selbe das anegevelle geligen is 68v27, anegevelle 69rl, 69r25, 69r27, 69vl, 80vl8; 2. 'Einkünfte': Also entut der herre deme kinde noch des kindes erben, wen he das anegevelle nimt 39v21. anevang st. M. 'Beschlagnahmung eines gestohlenen Gutes, Zurückfordern durch Anfassen': Von dem anevange 5vl20. anevangen sw. V. 'etwas durch Anfassen als sein Eigentum ansprechen': Wen mit des richters urlobe mus he sin gut wol anevangen mit rechte 34r23, geanevanget 34v23, geanevangit 34v29, gevangit 34v31, anvanget 43rl2, anevangin 57v6. W M U 1, S. 122f.; DRWB 1, S.624; H R G 1, S. 159ff.; Lexer I, Sp.64; Grimm, DWB 1, Sp. 325 f.; Trübner 1, S.78; Kluge/Seebold S.29 angebom Part.Prät. 'angeboren, von Geburt an etwas besitzen': Man mus den man schuldigen in der spräche, di en angeboren is 6vr3, das kint behelt sulch recht, als im angeborn ist 14vl0, so gebricht im der buse, di im angeborn is 77v 13, angeborn 54r27. angesprechen -* ansprechen angest st. F.M. 'Angst, Furcht, Besorgnis': vor sins libes angiste 'aus Angst um sein Leben' 29vl7. angewinnen st.V. 'erlangen, im Rechtsstreit abgewinnen, entziehen, absprechen': im enwerde di gewere mit rechte angewunnen 41v23, angewinnen 29v27, angewunnen 34v33, angewinnet 53vl2/13. -* ab(e)gewinnen; gewinnen 1 angrifen st.V. 1. 'angreifen, H a n d anlegen': Swelch son an sins vatir lip retet oder vrevelichen angrift I r l 7 , angrifet 2rl26, 2vr20; 2. 'den Besitz ergreifen, fassen': Saget aber der herre, he wolles den man geweren unde hes heist in angrifen 71r27; 3. 'fassen, ergreifen, gefangennehmen': he ... grife en an vor sinen dip 34r27. anspräche st. F. 'Anspruch, Rechtsanspruch': Sprechen zwene man ein gut an mit glicher ansproche 45r35, das he sin gut vorste und des obirsten herren ansprache irlege mit'rechte 64r9, ansprache 70v7, 70v8/9, 73r25, 75r2/3, 75vl3, ansproche 82r3. anspreche Adj. 'angesprochen, angefochten, angeklagt, eingeklagt': Is ein gut von zwen mannen anspreche 44v33. ansprechen st.V. 1. 'anklagen': Mag sich der selbe, der da angesprochin ist, nicht unschuldigen zu den heiligen lvr26; 2. 'einklagen': da enmag he denne keine gäbe angesprechin 22r5; 3. '(gerichtlich) auffordern': Der richtere
Glossar enmag nimande ansprechen mit Vormunde noch ane Vormunde 7rl7, angesprechin 58r6/7; 4. 'beanspruchen, Ansprüche geltend machen': Ab zcwene ein gut gliche ansprechen 7vrl, Spricht der man gut an 7vrl6, anspricht 61r3, 75v30, Wollen si... ir erbeteil ansprechen 13v28, ab si is beide sunder gewer ansprechen 36rl8, Sprechen zwene man ein gut an mit glicher ansproche 45r35/36, ansprechen 59r22, 61rl2, 72v24; 5. 'herausfordern (zu einem gerichtlichen Zweikampf)': alleine enhabe he en mit kemphin von erst nicht angesprochen 2 1 r l l / 1 2 , anspricht 25r31, ansprach 26rl7, Spricht ein gewunt man den zu kamphe an 21rl8, ansprichit 21vl5, he enhabe en denne kemphlich angesprochen 24r31. -> W M U 1, S. 105 f.; Lexer I, Sp.63; Grimm, DWB 1, Sp. 467 ff.; Trübner 1, S.99 -* kamph; kemphlich 1 anvechten st.V. 'angreifen': des landes not, ab is ein anderlant anvechte 67vl2. arc Adj. 1. 'schlecht, von geringem, niederen Wert': weder he di wisunge vorspreche mit der ergeren geburt 85v5; 2. 'unbillig': So clage he vor bas ..., das is nicht ergir ensi 25r9/10. art st. F. 1. 'Stand, Herkunft, Abstammung': Iclich man unde wip von ritters art 4vl33, art 5vl5, 15r24, 15v25, 18rl, 18r4, 3 I r l 6 , 59rl 1; 2. 'Gebiet, Land, Boden': wenne der kunig uf sechsiche art kumet 19r8, Is aber der herre us deme lande ..., swen he erst widerkumt an duzche art 78vl6, art 15rl7, 28r30, 32v3, 52vl0. W M U 1, S. 131; Lexer I, Sp.98; Grimm, DWB 1, Sp. 568 ff.; Trübner 1, S. 128; Kluge/Seebold, S.41f. -> laut 1; ritter 2; swebisch
B bähest st. M. 'Papst': Zwei swert lies got in ertriche, czu beschirmene di cristenheit: dem babiste das geistliche, dem keiser das werltliche 10r4, is ensi, das en der pabist schuldige, das he an deme rechtin gloubin zwivele 50r3, Den keiser enmus der babist noch nimant bannen ... ane umme dri sache 50v22, babiste 6vl23, 52r21/22, babist l l v 3 , 1 lv5, 49r23, babistis 50r9, babeste 60r9. W M U 1, S. 134 f.; Lexer I, Sp. 107; Grimm, DWB 7, Sp. 1448 f.; Trübner 5, S. 53 f.; Kluge/Seebold, S. 526 -> ban 6 baimunden sw. V. 'für einen ungetreuen, schlechten Vormund erklären oder halten': man sal en baimunden, das is, man sal im vorteilen alle vormundeschaft 19v32. Vormunden
251 ban st. M. 1. 'Gebot, Verbot unter Strafandrohung': ban 8rr9; 2. 'die Strafe selbst': der sal wetten des kuniges ban, das sin sechzig Schillinge 40r27; 3. 'die dem Richter vom König verliehene Gewalt bzw. das Recht, diese Gewalt im Namen des Königs auszuüben': Ban liet man ane manschaft 52v30, ban 23r32, 23r33, 23v4, 52v22, 52v25; 4. 'Kirchenbann': ban 6vl23, 22v3, Ban schadit der sele unde ennimt doch nimande den Up 52r31, banne 40v23; 5. des kuniges ban 'dass.': Unde was der brichit, der bi kuniges banne dinget unde des nicht enhat 5rll2, kuniges banne 6vl32, 6vrl, 10r28/29, 23r30/31, 23r31, 23v3/4, 23v6, 2 5 r l 8 / 1 9 , 26v30, 28rl0, 29r3, 40r22/23, 45rl7, 52v32, Wo man dinget bi kuniges banne, da ensal noch schepphin noch richter kappin anhabin 54rl, kunigis ban 15v33, 52v29, kuniges ban 23v2/3, 28rl3, 28v6, 52v22/23, 53r4, kunigis banne 52v21; 6. des bäbestes ban 'Kirchenbann, Bann des Papstes': der in des babistis banne is mit rechte, den enmus man zu kunige nicht kisen 50r9. -*• W M U 1, S. 138 f.; DRWB 1, S p . l l 9 2 f f . ; H R G 1, Sp. 306 ff.; Lexer I, Sp. 118 f.; Grimm, DWB 1, Sp. 1113 f.; Trübner 1, S.226; Kluge/Seebold, S.59 banc st. F.M. 'Bank, Gerichtsbank': Der aber zu den benken nicht gebom is 29r4, Schildit ir urteil ein irgenos, he sal der banc bitten, ein andirs zu vindene 54rl0. W M U 1, S. 140; Lexer I, Sp. 140; Grimm, DWB 1, Sp. 1105ff.; Trübner 1, S.224f.; Kluge/Seebold, S. 58 bannen st.V. 'in den Kirchenbann tun, exkommunizieren': Den keiser enmus der babist noch nimant bannen 50v23, bannen 6vll3. -> vorbannen banvorst st. M. 1. 'Forst, in dem nur dazu Berechtigte jagen und Holz hauen dürfen': Doch sin dri stete binnen Sachsen ... dis heisen banvursten 40r24, banvorst 40r28, banvorsten 5vr20, 40vl3. barhaftig Adj. 'schwanger, ein Kind tragend': ein wip, di kint treit ... unde sich barhaftig bewiset 18vl5/16. bedingen sw.V. 'verhandeln, durch Verhandlung festsetzen und bestimmen, versprechen, vereinbaren': wen alse he wider sinen herren bedinget hat 82vl6. bedorfen unr.V. 'bedürfen, nötig haben': Ein man sal zugen sine lenunge, ab hes bedarf 7 r r l 2 / 1 3 , Welch schephinbare vri man einen sinen genos zu kamphe ansprichit, der bedarf wol zu wissene sine vier anen 21vl5, bedorfen 68vl2, bedarf lOrl7, 12vl7, 13r32, 20r5, 25v2, 2 6 v l l , 33r4, 36r33, 39v29, 45rl7, 48r8, 60vl2, 62r3, 74vl8,
252 8 0 r l 0 / l 1, 8 I r l 1, 84rl5, 84v24, enbedarf 31vl, 60vl8, enbedorfte 54v21/22. beerben sw.V. 1. 'vererben, Erben bestellen, einsetzen': 2.u der selbn wis nimt das wip man unde gewinnet eliche kindere ..., unde si beerbit mit irme rechte unde mit erme gute 32r6; 2. 'beerben, Erbe erhalten, zufallen': Swenne der son noch des vater tode..., so is he beerbet mit sins vater lene 65r9, beerbit 65rl3. begeben Adv. 'in ein Kloster gehen, eintreten': Hat aber he sich begeben an sins elichen wibes willen 17v20, begeben 4vl31, 17vl6, 31vl9, 31v21, begibet 4vl32, 5vl6, begibit 31vl3, begibt 1 7 v l l / 1 2 , 17v26. begraben st.V. 'vergraben, eingraben, begraben': Alle schacz in der erdin begraben 19rl2, Wirt ein man gemordit..., wer den begrebit uf dem velde 57vl3, begrabeneme 4vr8, begrabin 57v20. begrifen st.V. 1. 'ergreifen, fassen': Begeint aber eine hanthafie tat ..., da der man mite begriffen wirt 22v32, begriffen 29v3, 43vl8/19, 52v4, begrifi 34rl3; 2. 'in Worte fassen, mit Worten geltend machen': Ab is mit clage vor gerichte nicht begriffen is 10vl4, begriffen 60r23, begrift 72rl9; 3. 'einschließen, umfassen': di mit des kuniges tegeliche vride begriffen sin 42v36; 4. das Unrecht begrifen 'das Lehensgericht eröffnen, beginnen': Alse der herre sin lenrecht begriffen habe 76r6. W M U 1, S. 157f.; Lexer I, S p . l 4 7 f . ; Grimm 1, Sp. 1307ff.; Trübner 1, S.261; Kluge/Seebold, S.69 behalden st.V. 1. 'beherbergen, bewirten, bei sich aufnehmen': Wir sezcin unde gebiten, das nimant einen echter behalde 2vrl2, behalden 2vr25, 2 4 r l l , beheldit 2vr33, behelt 3vr7; 2. 'behalten, im Besitz bewahren, aufbewahren, erhalten': di ir recht behalden habin 'die im Besitz ihrer Rechte sind' 2rr23, der man behalde das gut, da he sine manschaft umme bot 65v29, behalde 14rl2, 14rl6, 18v31, behalden 3vll7, 4vr5, 7rr32, 33v23/24, 34r34, 36v8, 66r4, 71v21, 71v25, 79v24, 80vl3/14, behaldene 6rl9, 42vl3, 43rl8, 43r28, behaldin 17v22, 18v9, 50rl2, beheldet 14v5, 36vl, beheldit 16rl0, 20v5, 31r29, 36v38, behelt 4vll8, 6vr4, 14v7, 14v9, 15v21, 17vl 1, 18v20, 34v6, 35r9, 35rl3, 35v6, 35v29, 36rl6, 37rl, 39vl3, 43v31, 45v4, 48vl6/17, 54v8, 55rl6, 55v7, 61rl5, 62rl5, 63r6, 65r26, 65v3, 69vl6, 70vl3, 70v29, 83r27, 83vl4, behilt 54vl9, behilden 14v28, 15r7, 49v9, enbehalde 19r2/3; 3. 'beweisen, beschwören, vor Gericht durch Zeugen bzw. Eid erhärten': is ensi denne, das ... der belente man das behalde noch rechte binnen siner jarzcale 60v23, Morgengabe behelt das wip ufden heiligen 15vl9/20, des musen
Glossar si wol uf den heiligen behalden 16r27, behalden 45vl, 64v2, 67r26, 7 3 r l l , 77v20, 82v24, behaldene 14r27, 15vl8, 29r8, 63r23/24, 64v24, 72v25/26, 72v29, behaldin 15v29, 22vl4a, behelt 73r23; 4. 'vor Gericht erstreiten, mit Zeugenbeweis erringen, gewinnen': der man ... envorliese dar mite nicht, ab is sin herre dar noch behalde 64rl4, das behalde he mit gezuge al zu hant 66vl9, behalden 43r8/9, 61r22, 6 3 r l l , 63r25, 63r28/29, 64v2, 73r6, 74v6, behaldene 7rrl9, 71 vi2, behaldin 15r6, 28vl8/19, beheldit 36v34, behelt 7vll9, 28v27, 61r5, 67v5, 72rl0, 75v7, enbehald 63rl9, 63vl9/20; 5. 'zurückbehalten, aufbehalten': Di dube behalden oder roup 29v4, in enstet aber in des herren willen nicht, welche dri he behalde 76vl7; 6. 'Recht behalten': Swelch irme di meiste menie volget, der behelt 78rl4, behelt 79v7, behalde 78r32, behaldene 68vl8, 81r2/3; 7. ledig behalden 'vorbehalten': das dinst mag der herre ledig behalden 82vl0, behaldin 3 r l l 7 / 1 8 ; 8. 'verhalten': ab he sich wol unde recht beheldet 3rll0; 9. 'verbergen, verstecken': Ab der herre ... sich behelt 7vrl4, behelt 75rl2. W M U 1, S. 159 f.; Lexer I, Sp. 151; Grimm, DWB 1, Sp. 1321 ff. behüren sw.V. 'Ehebruch treiben, außerehelich beschlafen': Wer eins mannes wip behuret 4vrl0, behuret 19r24. bekennen sw.V. 1. 'anerkennen': Spricht der man gut an, des im der herre nicht bekennet 7vrl7, bekennet 67rl5, enbekennet 61rl0, 68v24, 7 1 v l 0 / l l , 74v6, enbekenne 71vl8; 2. 'eingestehen, zugeben, bekennen': Der schult, di der man schuldig is, der darf man en nicht inren, he sal bekennen oder louken 12r34/12vl, bekennen 12r30/31, 25rl5, 33v8, 7 6 v l 0 / l l , bekennet 25rl6, 29vl8, 43rl3, 43rl5, 66vl9, bekenne 20v24. bekentnisse st. F. N. 'Zustimmung, Anerkennung': mit deme bekentnisse des herren behelt der man sin gut kegen deme herren ane gezug 61r4. beklagen sw.V. 'klagen gegen, beklagen, anklagen, verklagen': der sal vor sinen richtervam unde sal en beclagin lvr23, Unde weis he des vridebrecheris namen nicht, he beclage en ungenant 24r33, vor gerichte beclagen 83r30, beclagin 57v7, beclagen 48v3, beclaget 5vr28, 6rl21, 6vr29, 41vl 1, 42r29/30, beclagit 5rr5/6, 56vl3, 66r20, 74r3, 83v5, beclait 3rl29, 6vll, 25v34, 26v24, 27v21, 30v20, 3 1 r l / 2 , 32r24, 36vl2, 42v7, 44r7, 44r28, 44r30, 44v21, 45vl2, 50v21, 56v7, 56vl4, 56vl8, 56v25, 60v2, 72vl5, beclaiten 6rll6, beclageten 44r21. -» klagen 1
Glossar beköstigen sw. V. 1. 'beköstigen': Di sal der richter beköstigen: brot unde bier sal he en gnug geben 28r22, beköstigen 78vl, beköstiget 39v9; 2. 'die Kosten bestreiten, bezahlen': Dis selbe sal ouch ein herre tun, ab ein man gut kegin im beköstiget 13r9. beleiten sw.V. 'geleiten, führen': Wir vorbiten bi unsen hulden, das imant den anderen beleite durch das lant durch kein gut 2vr9, beleiten 2rll9. belemen sw.V. '(mit bleibender Lähmung) verletzen': Wer den andern belemt oder wundet, wirt hes beredet, man slet im di hant ab 30rl9, Belemt ein vie das andere vor dem hirten oder wirt is getret oder gebeist 38vl4, belemt 5rr25, 5rr27, 6vl2, 30r31/32, 30v3, 35vl0, 41r3, 48vl5, 48v20. -> lernen belenen sw. V. 'belehnen, verleihen': Swelch bischof von dem riche belent is mit vanlene binnen deme lande zcu Sachsen 4rll7, Dar umme enmag kein gesaczt man richter sin noch nimant, he ensi gekorn oder belent richter 22v30, Der belente man enmus dar über keinen kunigis ban haben 52v28, belent 7rr9, 36rl9, 59r33, 59v27, 61v5/6, 62v3, 62vl2, 65r30, 67r24, 68r21, 69rl8, 71r9, 71vl, 72vl, 78rl0, 79r7, 81v4, belente 7vl25, 23rl2, 27v32, belenten 23r2, 61v23, 70rl5, 79vl8, belentin 53r4, belene 64r28, 70rl9, belenen 66r3, 70r21. WMU 1, S. 178; Lexer I, Sp.172; Grimm, DWB 1, Sp. 1442 benemen st.V. 1. 'hindern, verhindern': deme das echt not benimet, das he nicht kumen enmag 67v23, benimt 67r2, 85rl9, benam 67v29, enbeneme 19v3/4, 27vl3/14, 36r27, 73vl2, 80rl, 82r8/9, enbenemen 41v36; 2. 'berauben, wegnehmen, entziehen': so das im mit der achte nimant sinen Up benemen mag 19vl3, benumen 24rl6; 3. 'einer Anklage entziehen, entlasten': he enbeneme sich uf den heiligen 76v22, enbenemes 70r27. benennen sw.V. 1. 'nennen, namentlich benennen, bezeichnen': di not benennen lvl29, dar zu alle di vri herren unde schephin ..., sundir di hie vor benant sint 4rll6, noch groser recht hat der dar an, deme is geligen unde benant wirt 62r7, benennen 15rl8/19, 34vl2, 38vl6, 63v22, 66v23, 81vl2, benante 17v4, benennene 21vl7, benennet 67rl4; 2. 'bestimmen, festsetzen': Unde dem andern benant gut 7rr8, beide sulln si benennen di zeit der lenunge 61rl3, benennen 64rl7, 66vl5, 67r27, benant 60v28, benennene 64r26, 66vl3, 69v2/3, benennet 66vl7, 66vl8, enbenennet 64rl6. berech(en)en sw.V. 'Rechenschaft ablegen, berechnen':
253 so sal hes en widergebn, dazu allir ir gut, he enkunne si berechen 16v27, Wer aber des kindis erbe is, den sal des kindis Vormunde berechin 17r6, wo aber der Vormunde ouch erbe ist, da endarf he nimande berechenen 17rl2. bereden sw.V. 1. 'vor Gericht vorgehen, vor Gericht verteidigen': Der vater mag aber uf di lute, si sin dinstman oder eigen, nicht beredin lr28, beredin 2rr31; 2. '(als Friedebrecher) überführen': Swer truwelos beredit wirt 4vrl4, 19v24, unde en zu eime vridebrechere beredin wil 21r26, beredet 27r28, 30rl9, bereden 27r27; 3. 'beweisen, nachweisen, (durch Eid) beschwören': unde sal der mag beredin lvl26/27, das der gewislichen uf den heiligen beredin muge 2rl5, beredin 19r5/6, bereden 71vl8, beredit lvl30, 2rr32, 56rl0; 4. 'beanspruchen, sein Recht geltend machen': kein recht enmag he mer an deme gute bereden 64vl6, bereden 82v5; 5. mit kamphe bereden 'durch Zweikampf überführen': Wil man aber di bürg beredin mit kamphe 42r32, beredin 21rl0; 6. mit kemphen bereden 'mit einem Lohnkämpfer überführen': mit kemphin enmag aber he einen unbescholdin man an sime rechte nicht bereden 2Irl7. WMU 1, S. 189ff.; Lexer I, Sp. 187; Grimm, DWB 1, Sp. 1492 ff. berouben sw.V. 'berauben': So clage he vor bas, das he en beroubit habe sins gutis 25r8, beroubet 40v33. besachen sw.V., mnd. besaken, 'abstreiten, leugnen': Wer deme andern sine varnde gut liet..., wil is im iener da nach besachen 14r25, besacht gutes 62v28. -> vorsachen bescbeideliche Adv. 'festgesetzt, bestimmt, bedingt': Lest man aber ein vorligen gut eime kinde uf also bescheidelich, das hes eime anderen lie 69vl2, bescheidelichen 69vl7, 71v24. bescheiden st.V. 1. 'Auskunft geben, deutlich berichten, belehren, erklären, benachrichtigen': Das ich recht unde unrecht der Sachsen bescheide 9v5, noch sal ich uch dri lenunge bescheiden 79vl3, bescheidene 84vl9; 2. 'entscheiden, bestimmen, bescheiden': Zcweiet man aber an deme gezuge also sere ..., so bescheide man das, alse hi vor geredit is in dem lantrechte 79v9, bescheiden 9vl3/14, 29rl, 44v35, 45v2, 45v6, 46vl4, 61vl3/14, 68v25, 70rl4, 72v28, 73rl3, 79rl3, enbescheidet 61rl8. bescheiden Part.Adj. 'bestimmt, verabredet, bezeichnet, festgesetzt': zu bescheiden tagen 'auf bestimmte Zeit' 4 5 v l 0 / l l , bescheiden 39v3, 46rl7, 46r20, 56r30, 62rl3, bescheidene 37vl5, 81vll, bescheidenen 44r27, 55v25, 81v29, bescheidener 10r7, 23r6, 47r33, 84vl2/13.
254 bescheidunge st. F. 'Unterscheidungszeichen, unterscheidende Bezeichnung': Nimant ensal ouch phenninge slan andern phenningen glich, si enhaben denne sunderlich bescheidunge 32v26. bescheit st. M. N. 'Festsetzung, Bestimmung': umme bescheit oder ane bescheit 'auf bestimmte oder unbestimmte Zeit' 14r24/25. bescheiden st.V. 'anfechten, tadeln, schelten, für ungültig erklären': Wen das wip man nimt, gewint si ein kint e irre rechtin zeit, das das kint leben muge, man mag is bescheiden an sime rechte 19rl9, Welch man von sinen vier anen ... unbescholdin is an sime rechte, den enkan nimant bescheiden an siner geburt 21 vi2, Umme ein bescholden urteil sal man keiner volburt vragen 29rl 0, bescheidin 24r4, 54rl7/18, bescholden 28v29, 61v27, bescheiden 53rl4, beschulden 78v25, beschuldene 79rl4. -» WMU 1, S.205; Lexer I, Sp.205; Grimm, DWB 1, Sp. 1562 beschem st.V. 'die Haare abschneiden, scheren': Phaffen unde juden, di da wapen vuren unde nicht beschorn ensin 42v32, beschome 8rrl3. beschirmen sw. V. 'beschützen, verteidigen': Zweiswert lies got in ertriche, czu beschirmene di cristenheit 10r3, beschirmen 3vll5. beschrien st. sw.V. 'beschreien (eines Missetäters), Klagegeschrei erheben': Kumt aber he hinweg, man vorvestit en zu hant, ab he in der tat mit deme gerufte beschriet is 44r25, beschriet 38vl2, beschriete 25rl4. beschuldigen sw.V. 'beschuldigen, anklagen': Is he beschuldiget umme ungerichte, man sal en zu hant vorvesten 36v28, So sal der man vorkumen, der beschuldiget was, zu entwortene 78vl9, beschuldeget 6rl3, beschuldiget 34rl 1, beschuldigit 36v32, 54r25. -> schuldigen besessen Part.Adj. 'bewohnt, ansässig': Disen gezug suln di ummesessin bescheiden, di in deme dorfe besessin sin 45v3. besetzen sw.V. 'besetzen, in Besitz nehmen, erobern': Kam besas Africam Abvlit, Jafet, unse vordere, besazte Europam 46v28, besasen 47vl3, besasin 47vl4. besigelen sw.V. 'besiegeln, durch Siegel bekräftigen': mit eineme offen brive besigelt 36r29. besizzen st.V. 1. 'besitzen, in Besitz haben': doch enheist das keine rechte gewer, das der man mit gewalt besiezt 63vl3, besieze 65v30, besizeen 80v6, besizt 72rl4; 2.
Glossar 'besiedeln, eine Siedlung anlegen': Swo gebure ein nuwe dorf besiezen von wilder worzeln 6vrl6. besprechen st.V. 'sich über etwas beraten': Dar umme mus he sich wol besprechen unde weiger es mit rechte, ab he mag 76rl0. bessern sw.V. 1. 'bessern, verbessern': Doch mus der man sine clage wol bessern 25r21, bessern 31r25; 2. 'Genugtuung leisten, büßen, wiedergutmachen': so musen si bessern das gerufte 33rl5, bessern 6rll5, 34r4, 41r4, 44r7, 44rl 1, 44v23, 52r24/25, besserne 27r9, bessim 37rl7, 38r8, bessere 42vl, bessirt 56vl0, gebessert 61v29; 3. mit büze bessern 'als Wiedergutmachung eine Buße leisten': Das sal he deme herren ... mit buse ... bessern 34r5/6; 4. 'entschädigen, bezahlen': man sal en bessern alse eime leien 42v34, bessert 5rr26, 30v4, besseren 5vrl5, bessern 8rrl8, 30r32, 33rl2, 35vl2, 35v25, 39rl7, 45vl2, bessim 30v7, 45r29. WMU 1, S.245f.; Lexer I, Sp.261; Grimm, DWB 1, Sp. 1647 ff. -»• büze 3 besserunge st. F. 'Ausbesserung': di sullen den wegen ... ir recht haldin ... mit besserunge 2rll7. bestaten sw.V. 1. 'eine Stätte geben, jemandem einen Wohnsitz, Aufenthalt anweisen': Unde man sal si halden bis an den drisegisten, das si sich mugen bestaten 16r22; 2. 'zu Lehenrecht vergeben, verleihen': Cins mus der herre oder sin böte, der das lant bestadet, bas behaldin ... 22vl4, bestatene 62v5, bestatet 62v7/8, 82vl3, bestatten 47vl8. bestetigen sw.V. 1. 'festnehmen, ergreifen': ab he in der hanthaften tat bestetiget is 42rl2, bestetiget 33rl4, bestetigit 35v23, bestetigen 44vl4, 50v3; 2. 'bestätigen': man enmuge gezugen, das das gelubde vor deme gerichte bestetigit si 33vl9, bestetiget 12v29. besweren sw.V. 'einen Eid zumuten': Di sal man vragen bi des ersten herren hulden unde ensal si nicht besweren 74v8. bete st. F. 1. 'Bitte, Ansinnen': Etliche lute sagen, das man kein gedinge lien muse, ane iens bete 62rl, bete 3rl24; 2. 'Abgabe': vordirt imant zu deme dinst, bete oder herberge 82vl5. betedingen sw.V. 'vor Gericht verklagen': Kinderejarzcale is driezen jar unde sechs wochen von irre geburt; doch bedorfen si des dar noch, ab si imant betedingen wil 68vl3, enbetedingen 70v4. beteilen sw.V. 'aufteilen': In einer sache von eime lene
Glossar enmugen si zcwene nicht gezug sin, di wile si an deme lene nicht beteilt ensin 61v5. beten sw.V. 'bitten': Ab ein man an sins vorsprechen wort nicht enjet ..., he enswere da vor, das he anders nicht gesprochen habe, wen alse iener bete 65r3. betwingen st.V. 1. 'bezwingen, unterwerfen': Mit irre helfe hatte he betwungen al Asiam 47v8, betwingen 10rl2, betwungen 49v9; 2. 'zu etwas zwingen': unde man en von gerichtis halbin des mit phande nicht betwingen enmag 57r4. bevelen st.V. 'übergeben, anbefehlen': Dar umme sen si sich alle vor di, den gerichte von gotis halbin bevolin si 9vl9. bevriden sw.V. 'Frieden und Schutz verschaffen': Unde von weme si den zcol nemen, di sullen si bevriden 2rll9. bevrönen sw.V. .'beschlagnahmen': Wo der richter sin gewette nicht usgephenden enmag uf eins mannes eigen, das also kleine gilt, das sal der vronebote bevronen 36rl, bevronen 50v4. bewaren sw.V. 1. 'verhindern, bewahren': Werne aber he geleite gibet, der sal den schaden bewaren in sime geleite 33r7, beware 16rl4; 2. 'absichern': Unde wartet he denne des zendin nicht, der man vorczende im selbe, alse he sinen eit dar an beware 3 7 v l l ; 3. 'beschützen, behüten, aufpassen auf': Welch dorf bi wassere lit unde einen tarn haben, der si bewart vor der vlut 39rl, bewaren 38rl6, 38vl; 4. 'einhegen': Der man sal gelden den schaden, der von siner vorwarlosekeit geschit andern luten ..., den he nicht bewart enhat 35rl7. W M U 1, S. 237; Lexer I, Sp.253; Grimm, DWB 1, Sp. 1762 ff.; Trübner 1, S.318f. beweren sw.V. 'beschwören': das musen si sweren, er si gezugen, odir den gezug uf den heiligen beweren 7 4 v l l / 1 2 , beweret 67rl6. bewera sw.V. 'verweigern, verwehren': Kamphes mag ouch ein man sime mage bewerin 25v3/4. bewirken sw.V. 'einzäunen, umhegen': Menlich sal ouch bewirken sin teil des hoves 38r6, bewirkene 5vr7, bewerken 38rl9, beworchten 40vl4. bewisen sw.V. 1. '(mit Schwur) beweisen, nachweisen, vorweisen, zeigen': Kein schephinbare man darf sin hantgemal bewisen 6rrl0, Is iz aber ander gut, das man bewisen mag 13v33, Di not sal man aber bewisen, als recht is 19v5, alleine muge man sinen rechtin Vormunden bewisen 21r9, unde bewisen czwen sinen geburen 37vl2, Ouch sal der kunik durch recht sinen hanczchen dar sen-
255 den zu bewisene, das is sin wille si 32v23, bewisen 21v24, 25r6, 32r27, 40v36, bewise 34v4/5, 36r27/28, 37rl5, 67vl6, bewiset 27r7, 31rl 1/12, 37rl0, 37r31, 43r35/36, 67r4, 73vl2, 85r20, bewist 18v25, bewisin 14r32, 16vl 8; 2. 'einweisen in ein Gut, anweisen auf, belehnen mit': Swen aber ein herre weigert zu bewisene 7rrl3, 6 2 r l 0 / l l , das man im des vater gut bewise 60vl9, Swen ein herre sime manne gut bewisen let 62r8, bewistes gutes 'Gut, in das eingewiesen wurde' 62vl7, bewiset 62r20, 74v27; 3. 'sich erweisen, sich zeigen': ein wip, di kint treit ... unde sich barhaftig bewiset zu der bigraft 18vl6. -» W M U 1, S. 239 f.; Lexer I, Sp.257; Grimm, DWB 1, Sp. 1778ff.; Trübner 1, S.320f.; Kluge/Seebold, S. 82 gewisen 2; Inwisen ; unbewiset ; wisen 3, 5 bewisunge st. F. 'Einweisung auf ein rechtlich zugesprochenes Gut oder Lehensgut': swo is im ledig si, sunder bewisunge 62rl2. -» inwisunge; wisunge bezügen sw.V. 1. 'durch Zeugnis beweisen, bezeugen': Ein dinstman mag is ouch bezugen mit andern dinstmannen l v l l 5 / 1 6 , bezeugen lvll4, 2rrl2, bezeugit 2rr20; 2. 'überführen': Swer mer zcolles nimet, denne he zeu rechte sal, ... wirt he des bezeugit vor sime richtere 2rll2. -»• gezügen 1, 2; zügen bigraft st. F. 'Begräbnis': Mit sime rate sal och di vrouwe di bigraft unde den drisegesten tun 16rl6, bigraft 18vl6. birgelde st. M. 'Abgabenpflichtiger, Biergelde': Nimt aber ein vri schephinbare wip einen biergelden 5 4 v l l , birgelden 48r4, biergeldin 53r3/4. bischof st. M. 'Bischof : Swelch bischof von dem riche belent is mit vanlene 4rll7, bischof 50v27, 52rl0, 52rl3, 52rl4, 52rl6, 54vl8, 60r6, bischove 3vl8/9, 6vll7, 6vl22, 7rr31, 10r23, 10v27, 10v29, 46vl2, 51r20, 51r25, 59r7, 65r28, bischoves 54v25/26, bischoven 49r20, bischhove l l r 2 / 3 . bischtüm st. N. 'Bistum': sint he zu sinen tagen kumen is, in dem bischtum, da he inne gesessin is 10r21. bisorge st. sw. F. 'Fürsorge, Seelsorge': Swen man kuset bischove odir epte ..., das lien suln si vor enphan unde di bisorge nach 51r22/23. bìten st. V. 1. 'anbieten': Unde swer sich zu gezuge buit 6rr20, Der man endarf nicht anderweit biten sine manschaft 66r6, biten 72v25, bieten 73rl8, buet 85v24, buit 7rrl9, butet 15r33, butit 25r22, bot 26vl3, 65v30, but 46rl4, 66rl0, bite 65vl3, biete 65v24, bietene 66rl4,
256 bitene 68rl, 71vl6; 2. 'Gewährschaft leisten': So bite iener der gewere, di sal man im tun 25rl9; 3. 'erbieten': Welch urteil iener denne vint, das bite he zu behaldene mit sime rechte 29r8, Buit aber ein des toten mac, ... en vorzustene mit kamphe 26r24, but 29vl9, 63r23, 64v24, bot 29v30, biten 71 vi 1; 4. 'auffordern': Wil aber iener sin gut werin mit rechte ..., so bite he en widerkeren vor gerichte 34r25; 5. 'aufbieten': Ab zcwene man ein gut ansprechen gliche unde gezug dar zu biten 59r23; 6. 'fordern': Swen man aber einen vorvestin man ane hanthafte tat vor gerichte vuret unde bitet der sizzunge über en 57rl2; 7. zu rechte biten 'zu Recht erweisen': Is enmag kein greve, der bi kuniges banne dinget, kein echt ding gehabn ane sinen schultheisen, vor deme he sich zu rechte biten sal 23v8, but 44rl6; 8. zu kamphe biten 'zum Kampf erbieten': Kumt he zu der dritten ladunge nicht vor, der cleger sal ufsten unde sich zu kamphe biten 26rl4, biten 26r24; 9. 'wegnehmen': swer gezug buit 8rrl2; 10. 'verleihen': Des mannes jarzcale beginnet..., alse ... iener das im buit 74v25; 11. 'ausgeben': Buitet der munczer einen valschen phenning us 32v6. W M U 1, S. 252; Lexer I, Sp.286; Grimm, DWB 2, Sp.4ff.; Trübner 1, S.332f.; Kluge/Seebold, S.84 -» gebiten 2, 4, 5; üfbiten; vorbiten 1 bitten st. V. 1. 'bitten': Dar umme bitte ich czu helfe alle gute lute 9v9, Wer kemplich grusen wil einen sinen genos, der sal bitten den richter 24v21, biten 24v33, bitten 29r5, 76v6, 78r29, bittet 84r6, bitte 29r9, 44v21, 75rl8, 7 6 r l 6 / 1 7 , 78r27, bite 68r3, gebeten 79r23; 2. 'erbitten': Schildit ir urteil ein ir genos, he sal der banc bitten, ein andirs zu vindene 54rl0, bittet 23vl9. blütgerüchte st. N. 'Blutgerüft, Hilferuf, Notgeschrei aus Anlaß einer Bluttat': Umme blutgeruchte wettit man ubir sechswochen volkumen 5rl20. blutig Adj. 'blutig': Mit der blutigen wunden ane vleischwundin 27rl0. blutrünstig Adj. 'blutig wund, mit Blutergüssen versehen': oder wer den andern blutrünstig macht 27r4. blütwunde st. sw. F. 'blutende Wunde': unde iclich burmeister rügen sal das gerückte unde menschen blutwundin, di im ein ander hat geslain 10v8. borge st. F. 'Bürgschaft': man sal en da vor phendin unde das phant zu borge tun 27v9, borge 27vl0. borgen sw. V. 1. 'sich verbürgen, für etwas oder jemanden bürgen': Swer borget einen man umme ungerichte 5rl25, Wer icht borgit odergelobit, der sal is gelden 12v2, borget 26vl, geborget 26v4, borgit 44rl7; 2. 'borgen,
Glossar jemandem anvertrauen, als Pfand geben': das hes im liet oder borget 47r32. böte sw. M. ' (Gerichts-)Bote, Bevollmächtigter, Vertreter': Dem sal der richter selber vor gebiten oder sin böte lvr25, Der richter sal zwene boten geben 25v8, böte 22vl4, 67vl7, 67vl8, 81v26, boten 28rl6, 28rl8, 28vl, 29rl0, 36r36, 42r24, 45v8, 51vl8, 67vl5, 67v21, 67v25, 74v27, 78r30, 78vl, 85rl4, boteme 46rl6, botin 51vl3. botschaft st. F. 'Vollmacht': oder di ire botschaft werbin czu irme vrumen 29r33. brant st. M. 'Brand, Feuerbrand, Feuersbrunst': Der man sal gelden den schaden, der von siner vorwarlosekeit geschit andern luten, is si von brande oder von burnen 35rl6. -> m ort brant brechen st.V. 1. 'brechen, zerbrechen, zerstören': Is ensi also vil, das he mit totslage den vride breche 2rr29, so enmag man uffe di bürg keine clage getun, da man si mit rechte umme brechin sulle 53vl7, brichet 2rl21, 48r34, bricht 29v2, 39r3, brach 9v25, 41v21, bricht 41v24, 44r3, 44rl2, 53v8, 79r28, enbreche 22v2, 23r8, gebrochen 2rrl9, 2rr24, 2vl3, 25rl, 42r4, 43v21, 53v8, 79r31, 82rl7, gebrochin lvr22, 2rr25/26; 2. 'widersprechen, widerrufen': geloben is aber di kindere bin iren jaren, das mugen si brechen unde nicht der herre 70vl9, mit rechte gebrochen 'vor Gericht widerrufen' 69vl9, 71r22/23, bricht 14r29a, 66rl3, 69vl5, enbreche 32rl0, 71r8, gebrochen 55r23, 60v9/10, gebrochin 13r25; 3. 'herausbrechen, abbauen': Von begrabeneme schazce. Unde silber zu brechene 4vr8, bricht 39r8; 4. 'verlieren, verwirken': Unde was der brichit, der bi kuniges banne dinget unde des nicht enhat 5 r l l l , Unde stirbit is da noch, is ... brichet alle gedinge an des vatir lene 18v22, enbricht 65rl4; 5. 'abbrechen, abreißen, pflücken': oder bricht he sin obis oder houwet he malboume 33r23. W M U 1, S. 283 ff.; Lexer I, Sp. 343 ff.; Grimm, DWB 2, Sp. 342ff.; Trübner 1, S. 421 ff.; Kluge/Seebold, S. 104 -*• ab(e)brechen 1; gebrechen 1, 2, 3; niderbrechen brif st. M. 1. 'Urkunde': Doch mugen di vursten gewern einen man mit eineme offen brive besigelt 36r29, brif 36r31, brive 3rr23; 2. mit brif unde ingesigel 'mit Brief und Siegel': Der kunig mus wol tedingen zu lenrechte einen vorsten über sechs wochen mit sime brive unde mit sime ingesigele in eine bescheidene stat 81 v i 0 / 1 1 , mit sinen briven unde ingesigele 52v8. -» W M U 1, S. 289 f.; Lexer I, Sp. 352; Grimm, DWB
Glossar 2, Sp. 379 f.; Trübner S. 105
257 1, S. 431 ff.;
Kluge/Seebold,
bruch st. M. 'Mangel, Schaden': ab ieme bruch wirt an deme gewern 34v30, bruch 36v24, 77r24, 78rl6. brüder st. M. 1. 'Bruder': Bruder unde swester nemen erbe ires ungezweiten bruder 5vl3, 5vl4, bruder 1 I r l 5 , 1 l r l 8 , 1 lr22, 12r9, 13v28, 14vl3, 14vl4, 31r5, 46v22, 56r6, brudir 31r7, brudere 4vl30, l l r l 4 , 13vl2, 13vl9, 13v22, 13v29, 14v20, 17v8, 31r3, 31r4, 31r8, 46v35, 70vl, 82v20, bruderen 7vl22, 70v20, brudern 13vl, 14rl2, 14rl8, brudirn 12r5, 13vl6; 2. 'Klosterbruder, Klostergeistlicher': man mag is wol uf en gezugen ane gerichte ... mit den brudern, da he sich begeben hatte 31v21. brukzol st. M. 'Brückenzoll, Abgabe, die für die Benutzung einer Brücke zu entrichten ist': Wer so brukzol oder wassirzol enphurt, der sai en viervalt gelden 32v31, brukczolle 32v35. brustwer st. F.N. 'Brustwehr, Schutzwall': czinnen unde brustwere ensal da nicht an sin 53v5. buch st. N. 'Buch': Nu last uch nicht wundirn, das dis buch so luzzil sait von dinstlute rechte 46v9, buch 9vl2, 85rl, buche 77v 11, 85r3, bucher 43v25, buchere 17r28. burnite st. F. 'Heiratszins': Man sait, das alle Wendinnen vri sin ..., des enis nicht, wen sie gebin ire burnite irme herrin 55r5. bürg s t F. 'Burg, befestigte Gebäudeanlage': Uf swelcher bürg man den vridebrecher helt 6rl2, Man saget, das vursten unde bürge keinen vride enhaben 6rll3, Swert enmus man ouch nicht tragen an bürgen noch an steten noch an dorfen 41v31, Ab si volgen vor eine burk, dri tage suln si da bliben 41v38, bürg 2rr3, 6rl3, 6vl30, 6vl31, 42rl8, 42r21, 42r22, 42r26, 42r30, 42r32, 42r35, 42v3, 42v7, 42vl0, 42vl3, 42vl4, 51vl9, 53r20, 53v6, 53v9, 53vl2, 53vl4, 53vl6, 53v20, 75rl2, 8 0 v l l , 80vl7, 80v25, 80v29, 81r2, 81r8, 81rl0, 81v22, 82r4, 82rl6, 82v2, 82v5, bürge 43v35, 80v27, bürgen lr6, 2rrl, 42r8, 81rl4. bürge sw. M. 'Prozeßbürge, Beweisbürge': Kein cleger endarf bürgen seczin, er di clage getait wirt 24r9, Swer da bürge wirt eins mannes, in vor gerichte zu brengene 44r4, bürge 6rll4, 12r22, 35r30, 44rl4, 44rl7, 44rl8, 44r32, 44r35, 44vl, 56r26, 56r29, 78r9, bürgen 3rr8, 5rll7, 5rr9, 5rrl6, 6rll9, 13r29, 17rl3, 24r4, 24r9, 24rl0, 26r30, 42rl5, 44rl5, 44r36, 44v2, 44v9, 44vl5, 45r8, 45rl0, 56r25, 56r28, 61v23, 6 9 r l 5 / 1 6 , 78r7. W M U 1, S. 323f.; DRWB 2, Sp.579ff.; Lexer I,
Sp. 395; Grimm, DWB 2, Sp.536; Trübner 1, S.473; Kluge/Seebold, S.115 sezzen 4 burger st. M. 'Bewohner einer Burg, Burgmann, Burglehensmann': Schuldiget man di bürg umme den roup, ... das mus wol entschuldigen der bürg herre oder sin burger uf den heiligen 42r28, Wil man aber di bürg beredin mit kamphe, das mus wol entredin der herre oder di bürgere 42r33, burger 80r23, 80v20, 81r4/5, 81v22, 82r3, 82r9, 8 2 r l 7 / 1 8 , bürgere 80vl2, 80v27, 80v30, 81rl, 81r3, 81v21, 81v23, 81v24, 81v28, 82rl, 82r6, 82r28, 82vl. burggreve sw. M. 'Burggraf: Also is derphalczgreve ubir den keiser unde der burggreve ubir den markgreven 49v4, burcgreven 4rll. bürg herre sw. M. 'Burgherr, Lehensherr': Uber wen man claget, das he von einer bürg gesucht habe, den mus der bürg herre vorbrengen 42vl, bürg herre 42r28, 42v5. burglen st. N. 'Lehen, das für Wachdienste auf einer Burg gegeben wird': In burglene is gedinge unde wette als in anderme lene 80rl5, Liet ein burger sin burglen eime zu lene, he enkan is im mit lenrechte nicht gebrechen 80v20, burglen 59v4/5, 80rl7, 80r20, 80r28, 80v25, 81r5, 81r7, 81rl5, 81rl9, 81v24, 82rl, 82r8, 82rl 1/12, 82rl4, 82rl9, 82r25, 82r27, 82vl, burclen 80rl8, burglene 8rll5, 63rl 1, 80vl3, 80vl8, 80v24, 81r8, 8 1 r l 6 / 1 7 , 82rl3, burglenes 82rl8/19. W M U 1, S.316f.; DRWB 2, Sp.628f.; H R G 1, Sp. 562 f.; Lexer I, Sp. 391; Grimm, DWB 2, Sp.543 burgrecht st. N. 1. 'Burggericht': Burgrecht enmag der herre niergen gehaben me, wen uf sinen bürgen 8 I r l 2 / 1 3 , burgrechte 81rl2, 81v25, 81v29; 2. 'Burgrecht': Di burgetore suln offen sin, da der herre zu burgrechte inne tedinget 81 vi 7. burgsäze st. F. 'Wohnung auf der Burg, rechtliche Verpflichtung, auf der Burg zu wohnen': wenne is ist denne ir recht len, sint si der burgsase dar ab ledig sin 82r30. burgtor 81vl6.
st. N. 'Burgtor': Di burgetore suln offen sin
burgwere st. F. 'Befestigung einer Burg, Burgbezirk': Sint da aber dorf oder hove, di in eine burgwere oder in einen hof gehöret 75r6, burgwere 75r9. bürmeister st. M. 'Bauermeister, Vorsteher einer Dorfgemeinde': Dar under ein iclich voit dingin sal unde iclich bürmeister rügen sal das geruchte 10v7, bürmeister 5vrl3, 29r21, 29r24, 38v32, 42r9, 56vl4/15, 84v2, burmeistere 56v4, 56v6/7, burmeistire 53r8, burmester 27r6. -> gebürmeister
258 bürmeisterschaft st. F. 'Bauermeisteramt, Amt des Dorfvorstehers': Len zu bürmeisterschaft geligen erbet der burmeister uf den son 84vl, bürmeisterschaft 8rl22. burne sw. M. 'Brunnen': Der man salgelden den schaden, der von siner vorwarlosekeit geschit andern luten, is si von brande oder von burnen 35rl7. bumen sw. V. 'brandschatzen, niederbrennen, anzünden': Wir vorbiten bi Unsen hulden, das imant ... der gotishuser gut ... wedir burne noch roube noch phende 3vl25, Ist di stat ungemuret, si sal der richter burnen 3rl2, burnen 29v9, 53v23, burnet 29vl. mortbrant; mortbumer büsem st. M. 'Nachkommenschaft, die direkt ab- und aufsteigende Verwandtschaft': Is enget nicht us dem buseme, di wile der ebinburtige buseme da is 14v21, 14v22. butel st. M. 'Büttel, Gerichtsdiener': Der butel sal zu minnesten haben eine halbe huve eigens 51v26. buwen sw.V. 1. 'mit Bauten befestigen': Wir sezcen unde gebiten, swelch herre sine stat oder sine bürg buwen wil 2rr3, buwin 2rr4; 2. 'bauen, aufbauen, ein Gebäude errichten': Wo man buwen mus ane des richters orlop 6vl29, Man enmus keinen markt buwen deme andirn einre milen nae 53rl8, buwen 53r26, buwin 53r20, 53v7, 53vl 1, buwet 5 v r l l , 38r26, gebuwit 82r21. büze st. F. 1. 'rechtliche Wiedergutmachung, die jemand leisten muß, sowohl im weltlichen als auch im geistlichen Bereich': Des vronenbotin ... buze is ouch zwivalt 12vl8, Der mus wettin zu geistlichem rechte unde zu werltlichem unde gebit eine buzse ieme, den he geseret hat 22v5, he mus dar umme wettin deme richtere unde ieme sine buse geben, des urteil he gescholden hat 28r3, he mus das gut mit gewette unde mit buse lasen 34v20, buse 2vl21, 2vl22, 5rl3, 21v20, 24r6, 26r6, 31v32, 33v31, 33v34, 34v24, 36v3, 37r3, 3 7 r l l , 42v9, 44v32, 47r30, 48r31, 48vl6, 48v20, 48v24, 48v32, 56v23, 78r9, buzse 22r30, buze 28v20, 30r22, 47v32; 2. 'rechtliche Buße, die jemandem zusteht, Leistung an den widerrechtlich Geschädigten': Nu vormemt aller lute buse unde wergelt 6rr31, da der man sine buse mite gewinnet 22r25, Ein iclich man hat buse noch siner geburt 30r22, Ein iclich vinger unde czen hat sine sunderliche buse 30r34, Vol wergelt unde volle buse sal haben iclich man 31r9, buse 20rl3, 22r29, 30v9, 30vl3, 47v23, 47v24, 47v27, 47v36, 47v38, 48r6, 48rl2, 48r22, 48r25, 48r26, 48r29, 49vl4, 49vl6, 49vl7, 54vl3, 77v9, 77vl0, 77vl3, 77vl4, 79vl, 79v3; 3. mit büze bessern 'als Wiedergutmachung eine Buße leisten': Das sal he deme herren bessern ... unde mit buse im bessern 34r5/6.
Glossar ^ W M U 1, S.310f.; DRWB 2, Sp.655ff.; Lexer I, Sp. 389; Grimm, DWB 2, Sp.570f.; Trübner 1, S.479f.; Kluge/Seebold, S. 116f. bessern 3; werbüze büzen sw.V. 'Entschädigung leisten, im rechtlichen Sinne büßen, abgelten': he sal im gelden den schaden uf recht unde busen mit drin Schillingen 37r6, he mus im wetten unde den geburen mit drisig Schillingen busen 56v9, busen 56vl6, buzen 60r22.
C ^ K, Z D danc st. M. 'Wille, Absicht': ab he si ane danc belegit 48vl, Swer des andern vie totit..., dankis oder ane dang 48vl4, danckis 48vl9, danc 5 6 r l l . darben sw.V. 'fehlen, entbehren, nicht haben': Rechtelose lute darben Vormunden 4vr26, Alle len ane gewere darben der volge 7vr25, alle, di des herschildes darbin 59rl8, Swelch man aber des sons darbit 60v20, darbit 6rl25, 60vl6, 61r23, 65rl7, 66rl8, 78rl, 83r6, darben 6rrl 1, 7rr2, 59rl2, 61rl3, 71vl3, 72v6, 75r23, 82rl9, 83v20, darbe 31rl0, 62r25, 84v2/3, darbet 59r28, 65v2, 66rl0, 72rl 1, 80v22, 83r24, darbin 59r9, 59rl5, endarbe 64vll. diep s t M . 'Dieb': man sal ubir en richten alse ubir einen dip 3vrl 5, Was der man vint oder dibin oder roubem abejait 35r3, dip 3vr6, 5rl7, 23r9, 29rl8, 34r27, diep 43rl4, 43v28, dieben 35rl0, dibes genos 21r30, diebes genos 43rl4. ding st. N. 1. 'Gericht, Gerichtsversammlung': Di plechaften sint ouch phlichtig, des schultheizin dinc czu suchene 10r36, Ane erben gelubde unde ane echt ding enmus nimant sin eigen noch sine lute vorgebn 21v21, gougreven dinge 23rl9, greven ding 23r20, richters ding 29vl2, dinges zit 23v9, dinc 10v5, ding 10r27, 23v6, 48r5, 49r35, 51v21, dinge 5rll4, 10r30/31, lOvlO, 15rl9/20, 22r21, 22r28, 23rl9, 36r22/23; 2. 'Gerichtstag, Gerichtstermin': Vorsumet der greve sin echte ding 5rr5, Uber achzcen wochen sal der greve sin ding uslegin 6vl21, ding 10r29, dinge 20v27, 22r20, 24v4, 26v25, 29v25, dingen 5rl32, 19v30, 27v3; 3. 'Gerichtspflicht': Einen man von iclicheme dorfe mus he wol dinges irlasin 50v20, das is allis dingis von im ledic is 10r35; 4. 'Sache, Gegenstand, Ding': durch keiner hande ding lr22, Got, der da is begin unde ende aller guten dinge 9v22, Alle
Glossar lebende ding, das in der notnunft was, das sal man enthoubeten 42v25, ding lr30, 2vl8, 3rr28, 16vl3, 17v4, 2 5 v l l , 46r35, 58r5, dinge lr27a, lvr2, 16vl5, dingen 2vr29, 26r21, 40r20, 62v3, 75vl0, dinges 7rll, 18r7, 43v28, 62r29. W M U 1, S. 380 ff.; Lexer I, Sp.433f.; Grimm, DWB 2, Sp. 1152 ff.; Trübner 2, S.60f.; Kluge/Seebold, S.144f. echt 3; gouding; tag 3; teding 1 dingen sw.V. 1. 'richten, Gericht halten': Bi kuniges banne ensal kein man dingen 23r32, An gebundenen tagen enmus man nicht dingen 28rl, dinget 5rll2, 6vl32, 6vrl, 23v4, 23v6, 52v21/22, 52v31, 53r2, dingit 5 3 r l l , dinget 54rl, 81vl3, dingin 10v6, endinget 54rl5, gedingen 79vl8; 2. 'Leibgedinge aussetzen, bestellen': Dinget ein man sime wibe gut 7vl21, dinget 70vl4; 3. 'jemandem etwas versprechen, zusichern': unde stirbet iener, der das gedinget hat 13rl. W M U 1, S.384f.; Lexer I, Sp.437f.; Grimm, DWB 2, Sp. 1169 ff.; Kluge/Seebold, S. 145 -» tagen 2; tedingen 3; vordingen dingphlichte sw. M. 'Dingpflichtiger, Gerichtsbeisitzer bei den unteren Gerichten': Das gezuget he selbe dritte der dingphlichten, di da urteil vinden 31v4, dingphlichten 57r9. dingphlichtig Adj. 'gerichtspflichtig, verpflichtet, vor Gericht zu erscheinen': Clait man aber umme schult über den, der da nicht dingphlichtig enis 27v5, dingphlichtig 51v28/29. dingstat st. F. 'Gerichtsstätte': di hoestin dingstat 15r20, zcu rechter dingstat 23r30, zu echter dingstat 26v31, czu echter dingstat 51v23. dingvluchtig Adj. 'gerichtsflüchtig, sich der Verpflichtung, vor Gericht zu erscheinen, entziehend': Swer dingvluchtig wirt 5vrl, dingvluchtig 36v27. dingzal st. F. 'Gerichtstermin, festgesetzter Gerichtstag': Rechtis weigirt der richter, wen he nicht richten wil oder rechten dingzale nicht enhelt 56v31 dinen sw.V. 1. 'dienen, in Dienst stehen, Dienst erweisen': Wer uf gnade gedient hat 16r27, Wil aber der erbe, si suln vol dinen 16r23, dinet 8rl8, 75v9, dinen 17r2, 49rl2, 60rl8, 60v3, 69r21, dinene 60r29, 71v2, 81r9; 2. 'jemandem etwas schulden': da ein man deme riche nicht phlichtig enis ab zu dinende 59v7; 3. 'jemandem etwas leisten': Des riches dinst ..., das sal he dinen bi phlicht binnen duzchir zungen 59v24. dinst st. M.N. 1. 'Dienst als Tätigkeit oder persönliche
259 Leistung für einen Herrn': Wirt aber im sin phert ... vorstoln oder abgeroubit in des herren dinste 43vl2, dinst 34r3, dinste 34r5, 60r27, 75vl4, 77rl2, dinstes 61vl4; 2. 'Dienst als persönliche Verpflichtung': Das selbe dinst is ouch der man phlichtig von sime eigene sime herren zu tunde 79r2, dinst 65r26, 69r21, 82v9, 82vl4, 83vl5, dinstes 82v8; 3. des riches dinst 'Waffendienst für das Reich': Gebut der kunig des riches dinst oder hof 6vl25, des riches dinst 59v20, 60rl, 6 7 v l l , 74rl7, 74r26, 74vl, 85r24, des riches dinste 7rr4, 19v25, 41v27, 8 5 r l l , 85r22; 4. gotes dinst 'Dienst als gottesdienstliche Handlung': schapile, seltere unde alle buchere, di zu gotis dinste gehom 17r28, gotis dinste 18rl5, gotes dinste 41vl; 5. üs sines dinst kumen 'aus jemandes Diensten scheiden': Welch knecht aber elich wip nimt..., der mus wol us sins herrren dinste kumen 35v5; 6. 'Abgabe': He enmus ouch kein gebot noch herberge gebiten noch dinst 58rl 1; 7. 'Arbeitseinsatz': Wo brudere oder andere lute ir gut zusamne haben, getan si das ... mit irme dinste 13vl4. -> W M U 1, S. 374 ff.; Lexer I, Sp.426; Grimm, DWB 2, Sp. 1115 ff.; Trübner 2, S.56; Kluge/Seebold, S. 142 f. dinstlüte st. Subst.Pl. 'Dienstleute': Doch wechseln di herrin wol ire dinstlüte ane gerichte 21v23, dinstlüte 46vl0, dinestlute 54v21. -> dinstman dinstman st. sw. M. 'Dienstmann': Hat der vater dinstman oder eigene lute lr24, Vrie lute unde des riches dinstman musen wol vor deme riche gezug sin 45r20, dinstman lr27a, lr29, lvll5, lvl20, 6rl28, 14v8, 36r30, 46vl5, 54vl8, dinestmannen 54v22, dinstmannen lvll6, dinstmanne 19v5/6. -*• dinstlüte dinstwip st. N. 'Dienstmagd': Ist aber der vater dinstman oder di mutir dinstwip 14v8. dime st. F. 'Dienerin, Magd': Di heilige schrift heist Ismahele der dirnen son 46v31. dorf st. N. ' D o r f : Swelch dorf bi wassere ligen 5vrl4, Swo gebure ein nuwe dorf besiezen von wilder worzeln 6vrl6, dorf 8rll3, 38v8, 38vl0, 38v36, 39rl, 41rl8, 62rl3, 62r27, 72\27, 75r5, 79v5, dorfe 7rrl5, 25r2, 29rl9, 37r35, 37v9, 38v22, 42r7, 45v2/3, 50v20, 53r22, 56v27, 57vl4, 57v23, dorfes 5vrl3, 38v33, dorfern 3vl7, dorfen 23rl, 41v32. dorfer st. M. 'Dorfbewohner, Bauer': Phaffen, dorfere 59r9.
kouflute,
dorfgebüwe st.N. 'Dorfgebäude': Umme kein ungerichte ensal man ufhouwen dorfgebüwe 42vl8.
260 drìsegeste sw. M. 'der dreißigste Tag nach dem Begräbnis, Termin für die Seelenmesse': als ir man stirbit, binnen sechswochen noch dem drisegesten 15r31/32, Ab zwene man uf ein gut sprechen noch dem drisegisten 6rl23, drisegisten 16rl3, 16r21, 16v2/3, 18rl0, 18vl6/17, 44v25, 44v30, drisegesten 16rl6, drisigisten 16rl8. WMU 1, S. 404; HRG 1, Sp.785f.; Lexer I, Sp. 468; Grimm, DWB 2, Sp.1394 dübe st. F. 1. 'Diebstahl': Di ir recht mit roube oder mit dube vorlorn haben 19vl8, dube 8rrl3, 12rl9, 19r28, 22v31, 26r20, 29r20, 32v9, 33vll, 34v4, 34v21, 43r20, 48r28, 57v7; 2. 'Diebesgut, gestohlenes Gut': Di dube behalden 29v4, Diube oder roup 33v22, dube 34rl4, 34rl6, 34r21, 40v27. dübig Adj. 'aus einem Diebstahl herrührend, gestohlen': swer wissentlichen roup koufet oder dubish gut 3vr6, Was iemant vint, loukent hes, ab man da nach vraget, so ist is dubig 35r2, dubig 3vrl0, 3vrl4, 33v9. -»• däplich 2 dümelle, -eine st. sw. F. 'Maß von der Spitze des Daumens bis zum Ellenbogen': von eime steine oder stocke einer dumeln ho 21v32, das sint czwene unde drisig siege mit einer grünen eichinen gerten, di zweier dumeln lang sin 30r28, dumeln 37vl8. dunerstag st. M. 'Donnerstag': Heilige tage unde gebundene tage, di sin allen luten zu vridetagen gesazt, dar zu in iclicher wochen vier tage, dunrstag ... 41r24, Des dunrstages wiet man den kresem 41r25, dunrstagis 41r27, 41r28/29. düptich Adj. 1. 'auf diebische Weise, wie ein Dieb': wen hes diuplich gehalden hat 33vll; 2. 'aus einem Diebstahl herrührend, gestohlen': das is im duplich oder rouplich genumen si 34vl0. -* dübig
E e st. F. 1. 'Gesetz, Bund': nu halde wir sine e unde sin gebot 9v31, was wider der cristenheit e ... enwas 15r8, e 41r28, 47r6a; 2. 'der rechtliche Bund der Ehe': Wer eins mannes wip behuret ..nimt he si da noch zu e 19r25. ebenbürtig Adj. 'ebenbürtig, von gleichem Stand': di musen wol sin unde irrer muter erbe nemen, wenne si en ebenbürtig sin 21vla, ebinburtig l l r l 7 , llv22, 13r3/4,
Glossar 13v3, 14v23, 16v24, 17rl5, 18v22, 20r28, 20vl, 20v7, 21r34, 28r9, 54v9, 54vl3, 65rl8, 65v4, ebenbürtige 14v22, ebinburtige 21rl/2, ebenbürtigen 18r2. echt Adj. 1. 'ehelich': Der kunig sal sin vri unde echt geborn 50rll, echt 4vll8, 6vr4, 12r26, 14v7, 54v7; 2. echte not, ehaite not 'rechtlicher Hinderungsgrund': doch mag iren iclichen echt not untschuldigen: vengnisse, suche, des riches dinst unde des landes not 67vl0, Ist aber, das der vatir ... von ... ehafter not das recht nicht gevordern mag lvl24, ehafte not lvl27/28, 19v4, echten not 5rrl3, echt not 27vl4, 36r27, 41v37, 67r2/3, 73vl2, 80r2, 82r9; 3. echt ding 'rechtmäßig eröffnetes und abgehaltenes Gericht': Ane erben gelubde unde ane echt ding enmus nimant sin eigen noch sine lute vorgebn 21v21, echteme ding 5rll4, echte ding 5rr5, echtin dinge 10r30/31, echteme dinge 15rl9/20, echt ding 23v6, 49r35; 4. echt unde recht 'Ehr- und Rechtsfähigkeit': Wer jar unde tag in des riches achte is, unde im noch der jarzcal vorteilt wird echt unde recht 19vll; 5. 'rechtmäßig': Ubir schephinbare lute ... enmus nimant richten wen der echte vronebote 50r25, Clait man ungerichte über einen vrien schephinbaren man, den sal man tedingen ...zu echter dingstat 26v31, echter 51v23, echte 51v32/33. WMU 1, S. 419 f.; Lexer I, Sp.513; Grimm, DWB 3, Sp. 20; Trübner 2, S. 126 f.; Kluge/Seebold, S. 164 -» echtlich; geborn 3; not 8; recht 5 echtelös Adj. 'rechtsunfähig: Is ist man aber echtelos, unde nicht rechtelos 4vr31, echtelos 21r32. rechtelös 3 echter st. M. 1. 'der Geächtete, der Verfolgte': Swas iclichem richter gewettit wirt, das he den echtere us der achte läse 2vl32, unde sal man ubir en richten als ubir einen echter 2vrl5, echtere 2vrl8, echter 2vrl2, 2vrl9, 2vr24, 3rll, 3vr7/8; 2. des riches echter 'derjenige, der sich in der Reichsacht befindet, der im gesamten Reich geächtet ist': Des riches echtem unde vorvesten luten endarf nimant entworten, ab si clagen 45r2. echtlich Adj. 'rechtmäßig, gesetzmäßig': In dem houpte is beczeigit man unde wip, di elich unde echtlich zusamne kumen sin llr8. -*• echt 5 edelman st. M. 'Adliger, Edelmann': Dem herzogen wettit iclich edil man zen phunt 52vl5. eigen Adj. 'hörig, leibeigen': Von anegenge was recht, das vri wip nimmer eigen kint gewinne 6vr6, Orteil suln si vindin vastende ubir iclichen man, he si duzch oder wendisch oder eigen oder vri 54r8, eigenen man 5vl2,
261
Glossar 6rrl4, eigine man 14v5, eigenen man 30v33, eigene Iute lr24, von eigenen luten 7rl30, eigen 54v25, 67vl9. -> elgenman
eldirvater erbe glich iren vettern an irs vater stat 1 lv25, eldirvater llv29, eldervetern 21vl0, eldirvatir 59rl 1/12, eldervater 85v6a, 85vl5.
eigen st. N.M. 1. 'Eigen, Eigentum (bes. an Liegenschaften)': der son sai sin vorteilt egenes unde lenes Irl4, Swer an lene oder an lipgedinge eigen saget 5vl31, eigen 4vl8, 5vl30, 8ri 15, 10r34, 10v4, 12r5, 12v9, 15v30, 15v32, 18rl9, 18r31, 18vl2, 18vl3, 18v30, 19rl, 19r5, 19r7, 19r33, 19v6, 20r32, 20v9, 23r27, 24v3, 31r21, 35v35, 36v4, 36v6, 36v8, 38v4, 48rll, 49r25, 50vl7, 55v9, 78v28, 80rl2, 80v25, 81r8, 83vl0, 83vll, eigene 4vr2, 5vl30, 6vr8, 16rll, 18v4, 18v9, 55rl2, 79r3, 79r5, 79r7, eigenes 56r7, eigens lvl6, 19v29, 51v27; 2. 'Leibeigene(r), Hörige(r)': Der vater mag aber uf di Iute, si sin dinstman oder eigen, nicht beredin mit disen dingen lr27b, Is si eigen, man mag si vrilasin 21v6, eigen 30v35, 47r5, eigene 47r2.
elich Adj. 'ehelich, durch Ehe rechtsgültig': Wi manch elich wip ein man haben mag 5vl8, In dem houpte is beczeigit man unde wip, di elich unde echtlich zusamne kumen sin llr8, elich 21r33, 21v2, 21v5, 32r3, 35v3, 50v25, eliche 19r25, 19v8, 32r5, elichen 17v20, 21v7.
WMU 1, S. 426 f.; Lexer, Sp. 518; Grimm, DWB 3, Sp. 96; Trübner 2, S. 139 ff. eigenkint st. N. 'leibeigenes Kind': Ein wip mag gewinnen elich kint, adelkint, eigenkint unde kebiskint 21v6. elgealich Adj. 'eigentümlich, eigen': eigenliche gewer 'Eigentumsbesitz' 36v23. eigenman st. M. 'Leibeigener, Höriger': Ein dinstman mag is ouch bezugen mit andern dinstmannen, ein eigenman mit sinen genosin 1 vi 16/17 eigen eigenschaft st. F. 'Leibeigenschaft, Unfreiheit': Wo man saget, das sich eigenschaft irhube 6rr28, eigenschaft 21vla, 46v21, 46v24, 46v26, 46v36, 47rll.
ellebogen sw. M. 1. 'Geschwisterkinder (in der bildlichen Darstellung der Verwandtschaftsgrade)': Dis is di erste sippe zcu tale, di man zu magen rechint: bruder kint unde swestir kint. In deme ellebogin stet di andere 1 lr23; 2. 'Ellenbogen': Si habn drier hande kore: das gluende isen zu traine oder in einen sidenden kessil zu grifene bis an den ellebogen 19v23. enbem st.V. 'nicht haben, entbehren, verzichten': Haben si aber ir erbeteilunge dar an vorlobit, der suln si enpern 14r3, enpem 20r5. ende st. N.M. 'Ende': Got, der da is begin unde ende aller guten dinge 9v22, Alle lenrecht habe ich zu ende bracht 84vl0, an manchen enden 'manchmal, ab und zu' 37vl4/15, ende lvr4, 46vll, 69r29, endin 60r24. enden sw. V. 'enden, aufhören': Nu merket, wi odir wo di sippe beginne unde ende l l r 7 , endit llr29, enden 79rl8. enig Adj. 'los, frei von etwas, ledig': Ein iclich man mag sins rechten gutes wol enig werdin mit rechte 32rl6.
eldeimüter st. F. 'Großmutter': Welch man von sinen vier anen, das is von zwen eldervetern unde von zwen eldirmutern ... unbescholdin is an sime rechte 21vl0, eldermuter 1 lv29/30.
enphangen, enphän st.V. 1. 'empfangen (von Lehen), erhalten': Hat aber he len vor der suche enphangen l l v l 9 , he enhabe den ban von deme kunige enphangen 23r33, enphangen 2vl2, 23v4, 46v5, 51r23, 68v6, 69v30, 71r5, 80rl, 83rll, enphangin l l v l 5 , enphet 4vr3, 18r24, 19r2, 23r33, 51rl6, 64rl7, 64vll, 68vl, 68v2, 72r5, 81r27, enphing 12r22, 18v8, 51rl8, 63r2, 80r29, enpha 8rll9, 13rl5, 51rl5, 83r4, enphaen 56r22, enphan 7rr24, 7vll, 7vll7, 16r23, 20v20, 20v22/23, 23vl, 51r22, 64v8, 65vl, 66rl2, 70r2, 70rl0, 70rl2, 70v22, 80r2, 80r31, 81r6, 81r26, 82rl5, enphande 70r25, enphane 65rl9/20, 69r20, unpha 59v2, unphan 69v28, enunpha 84r29; 2. 'annehmen, übernehmen, aufnehmen': Ab der herre weigert mit unrechte, das he en zu manne nicht enphet 65v29, enphet 66r25, enphan 7v 12, 66r24, 66v3; 3. 'ein Kind empfangen, gebären': Des kindes jar sal man nicht rechenen von der zeit, das is di muter enphing 68v20/21. - » W M U 1, S. 464 f.; Lexer I, Sp.562; Grimm, DWB
eldervater st. M. 'Großvater': di sune nemen teil in ires
3, Sp. 421 f.; Trübner 2, S. 181 f.; Kluge/Seebold, S. 177
éhaft
echt
eit st. M. 1. 'Eid, eidliches Versprechen als Rechtsbehauptung bei gerichtlichen Verhandlungen': Ir eide sullen si selbe tun 4vr24, Swer eide gelobet vor schult 5rrl 8, alse he sinen eit dar an beware 37vll, eit 44r37, 44vl, 50r3, 50r7, 57v6, 76v24, eide 6rll9, 12v5, 13v31, 19v3, 31v27, 43v32, 44r36, 48v9, 49rl7, 57r9, 85v21, eiden lr9, 20vl7; 2. 'Reinigungseid des Beklagten': Wenne di gewere getan is, so butit iener sine unschult, das is ein eit 25r23, eit 48v24, 57r21, eide 42v8. -> meineide
262 enphellen sw. V. 'entziehen aus, sich entziehen': Nimt der herre dem manne gut oder enphellit he im der werschaft 7 v r l 0 / l 1. enphlrren sw.V. 'entziehen, wegnehmen, entfernen': das sis im rechten erben mite enphirre noch irrne tode 18v6, alleine lebit der son noch des vater tode, he envernt nimande kein gedinge an vorligeneme gute sins vater 65r21, enphirre 22r2, enphirren 63rl7, envimet 80v8. enphüren sw.V. 1. 'entziehen, wegnehmen': Nimant enmag sime herren gut enphüren, des ammechtman he is 7vr32/33; 2. 'entführen, fortschaffen': Unde swer einen beclaiten man deme gerichte enphuret 6rll6, enphurt 44r22, envuert 35r27; 3. 'eidlich für unwahr oder ungültig erklären': he enphurt is im mit sime eide 12v4; 4. 'hinterziehen': Wer so brukzol oder wassirzol enphurt 32v31a, enphurt 32v32. ensprechen st.V. 'entziehen': der man mus bas sich selben unde sin gut deme herren mit gezuge ensprechen 86r2. enthalden st.V. 'vorenthalten, zurückhalten': Wo man aber dem hirten Ion gelobit von der huven unde nicht von deme vie, das Ion sal nimant enthalden 38v7. enthoubeten sw. V. 'enthaupten': Alle lebende ding, das in der notnunft was, das sal man enthoubeten 42v26. entreden sw.V. 1. 'vor Gericht mit Eid widerlegen, sich von einer Anklage durch Beweis vor Gericht freimachen': Untredit he abir sich, alse recht ist 2vrl5, Die inwisunge mag der man entreden binnen der jarzal 27vl, Da sal man über richten oder man entrede is noch rechte 42v20, ab iener ... der not entredet 42v22, entredit 27vl2, 46r3, entredin 27vl3, 42r33, entrede 27v7, entreden 35v26, 74r5, entredete 42v23/24; 2. 'sich verteidigen, freischwören, durch Eid reinigen': das he bessere oder di bürg entrede 42v2, enweis hes aber nicht, he entredit das gewette mit siner unschult 45vl8, entredene 27r9, entredet 30v22, entredit 45vl8. WMU 1, S. 471; Lexer I, Sp.578; Grimm, DWB 3, Sp. 582 entsagen sw.V. 1. 'verneinen, durch Eid widerlegen': Bin der jarzale mag der man alle gewette untsagen 7vrl 5, Haben si aber ir erbeteilunge dar an vorlobit, der suln si enpem, si entsagen sich des uf den heiligen 14r3, entsage 31v28, entsages 77rl6; 2. 'aufkündigen': Unde wi ir ein dem anderen untsagen sal 8rl21, Swenne ein man sime herren gutes loukent unde is im entsaget vor sinen mannen 64r3, entsage 83v28, 84r4, 84r9, 84rll, entsagen 83v23, 84r7, entsaget 65r23, 73rl9/20, 83vl8, 83v28,
Glossar 84rl7, 84rl8, 84r21, entsagit 73vl7, untsaget 7rr30, 82vl, 83v6, 83v8, 83vl7. entsagen s t N . 'Aufkündigung': Dis entsagens sal der man gezug haben an zcwen des herren mannen 84rl3. entschuldigen sw.V. 1. 'freischwören, lossagen, durch Eid von der Schuld befreien': des mus he sich enschuldigen noch rechte 34v22, entschuldigit he sich uf den heiligen 57v9, enschuldigen 42r30/31, entschuldigen 42r28, 76v28, entschuldiget 42r31, unschuldigen lvr26; 2. 'entschuldigen': doch mag iren iclichen echt not untschuldigen: vengnisse, suche, des riches dinst unde des landes not 67vl0. entweldigen sw.V. 'berauben, aus dem Besitz setzen, entziehen': Clait mait oder witewe zu lantrechte über iren vormundin, das he si entweldige eigens oder lenes 19v29. entworte st. F.N. 1. 'Antwort, Verteidigung des Beklagten': wem der richter zu entworte gebut 6rr25, entworte 46r2, 76rl6, 76v9; 2. 'Gegenwart, Anwesenheit': Swelches mannes gut der herre vorliet in sin entworte 7rr25, entworte 32r23, 36v26, 44vl2, 64vl3, 72vl0, 74rl0, 84r21. entworten sw.V. 1. 'antworten, sich verantworten': Nimant entwortet vor sinen knecht 5vl24, Bin marktin darf nimant entworten 6rr6, he mus entworten umme sinen hals 29v32, der mus entworten iclichem sime herren 34r9, entworte 27v5, entworten 6rr25, 34vl8, 35v21, 36r26, 40v20, 42v3, 43vl6, 44r34/35, 44v5, 45r3, 45v34, 62v25, 62v26, 75v2, 76r22, entwortit 6 r r l l , 7rr26, 54v5, entwortene 5rrl5, 44v7, 54r26, 63v25/26, 64vl9, 76r3, 77rl7, 78v20, entwertene 8rl7, geentwortit 54v3, geentwortet 76r20/21, enentwortit 22rl4, 30vl4, 46r3, 46r6, 53rl4, 74rl; 2. 'überantworten, übergeben': der sal si entworten 17v28, das sal man entwortin dem richten 18r9, Den brif sal man entworten 36r32, entworten 42rl2, 44v34, 46rl7, 63vll, entworte 44v36, entwortene 44rl8, geentwortit 44rl9; 3. 'frei machen, überlassen': das he sin bürgten bin sechswochen entworte 80r21. enrem -> enphirren enzweien sw.V. 'unterscheiden': Swebisch recht enzweit nicht von sechsicheme rechte 15r21, enzweien 21v2. eptissin st. F. 'Äbtissin': Undir iclicheme bischove unde epte unde eptischinnen haben dinstlute sundirlich recht 46vl2/13, eptischinnen 10v28, 51r21. erbe st. sw. N. 1. 'Erbe, Erbschaft, Erbgut': swo is get an iren lip odir an ir recht oder an ire ere, an ir erbe odir an ir len oder andir hoe sache 3rll6, Erbe enphet
Glossar man noch des landis rechte 4vr3, erbe 4vl4, 4vl5, 4vl6, 4vll9, 5vl3, 7rl9, 7rr6, l l r l 7 , l l r 3 3 , l l v l , l l v 8 , 1 lv24, 1 lv25, 1 lv30, 12r3, 12r5, 12rl0, 12rl3, 12rl7, 12rl9, 14vl 1, 14vl 5, 14vl9, 14v24, 14v25, 15rl0, 15r22, 16rl8, 17v5, 17v33, 18r2, 18r6, 18r8, 18rl6, 18rl7, 18r23, 18r24, 18vl0, 18v20, 19r5, 21vl, 21v3, 22v26, 28r8, 3 0 r l l , 31r4, 31r8, 33vl5, 36r7, 39r6, 44v29, 46v5, 54v8, 54vl6; 2. 'Grundeigentum': Burgen mus he aber seczen, da he kein erbe hat, vor des richters gewette unde vor buse 24r5, erbe 24rl0. erbe sw. st.M. 'Erbe, Erbberechtigter': Wirt ein kint geborn stum oder handelos oder vuoselos oder blint, das is wol erbe zu lantrechte unde nicht zcu lenrechte 11 vi4, erbe 12r23, 14r26, 16r2, 16rl2, 16r22, 17r5, 1 7 r l l , 18rl3, 20vl3, 21v26, 31r29, 31r31, 36r6, 39r20, 39v26, 44r33, 44r37, 47r3, erben l l v 9 / 1 0 , 16r31, 18v5, 19vl, 21v21, 21v29, 31rl5, 33v22, 38r29, 39v21, 40rl5, 55v27, 80v28, erbin 4vl26, 12r32, 12v30, 13r5, 13v2, 15r26, 15v4, 15v31, 18v30, 21v25, 55v22, 55v29, 57v25, erbn 16r28, 16vl, erbis llv32. -> ganerbe; lenerbe erbeeigen st.N. 'Erbeigentum, ererbtes, vererbliches Eigentum': Erbeeigen mus ein man bas behalden den ein ander gekouft eigen oder gegeben eigen 36v7, erbeigen 5vl29. erbegüt st.N. 'Erbschaft, Erbgut': Mag aber iener, der is in gewern hat, sine gezug dar an gezugin oder sin erbegut 14r29. erbeit st. F. 'Arbeit, Arbeitsertrag': Gejaret sich das kint aber vor, der herre hat vorlom sin erbeit 39vl9, erbeit 36v33, 36v36, 49r9. erbeiten sw. V. 'bebauen, bestellen, bearbeiten': Erbeitet ein herre ... garten odir boumgarten 39v7, erbeiten 55vl3, geerbeitet 5 5 v l l / 1 2 . erbelen st. N. 'in Erbleihe vergebenes Gut': Lest der vater sime sone gut uf von sime herren, erbelen enhat der son da nicht an 72r2. erbelös Adj. 1. 'ohne Erben, erblos': Erbelos irstirbet hergewete oder gerade 4vrl, erbelos 6vrl 7, 18r7, 50vl5; 2. 'ohne Erbrecht': Der Swabe enmag ouch von wiphalbin kein erbe genemen, wenne di wip in irrne gesiechte alle erbelos sint gemacht durch irre vordirn missetat 14v26. erben sw.V. 'vererben': Bin des herrin teding mag der man gut lien unde erben 7vr5, erben 62r21, 83r21, erbin l r l 5 , 73v27, enerbin 59rl4, enerbit 18r30, 31r22/23, 65vl0, 69r28, erbet 4vl33, 5vl4, 18rl, 31rl4, 62r24,
263 66r2, 80v24, 83vl5, 84v2, erbit 17v31, 18v21, 55r27, 60vl7, 60v20, 62r31, 62v4, 73vl4, geerbit 69v9, 72r4, geerbet 69vl0. eibeteil s t M . N . 'Erbteil, Erbe': Wollen si noch des vater tode... ir erbeteil ansprechen 13v28. erbeteilunge st. F. 'Erbteilung, Erbtrennung': Haben si aber ir erbeteilunge dar an vorlobit 14r2. erde st. sw. F. 'Erde, Erdboden': Got, der da is begin unde ende aller guten dinge, der machte alrest himel unde erde 9v23, binnen sechswochen noch dem drisegesten sal si mit dem gebu rumen, so das si di erde nicht enwunde 15r33, erde 15v3, 41r33, erden 35rl8, 53vl, erdin 19rl2, 39vl5, 53r25. -> ertliche ere st. F. 'Ansehen, Ruf, Ehre': Wip mag mit unkuscheit ires libes ir wiplich ere krenken 12r2, Wer truwelos beredit wirt..., deme vorteilt man sine ere 19v26, ere lr9, 3rll6, 28r5, 28r8, 33vl2, 45r25, 56rl. eren sw.V. 'Ehre erweisen': he sal ouch sinen herren mit Worten unde mit tat eren 59vl7, eren 68r4, eret 47v25. eren sw.V. 'ackern, pflügen': Swer eret eins andern lant unwissende 5vr2, Swer des andern lant eret 6rl30, Wer da erit eins andern mannes lant unwissende 36v30, di wile hes erit 36v32/33, Wer da besaeten acker eins andern mannes anderweide erit, he sal im den schaden gelden uf recht 37r2, eret 7rl29. ergern sw.V. 'verschlechtern, im Wert mindern': Wen ein iclich man mus wol sin gebu bessern unde ergern uf sime lene wider sins herren willen 31r25, geergert 37vl4, geergirt 45vl3. erheben st.sw.V. 1. 'entstehen, beginnen, anfangen': Doch sagen sumeliche lute, di der warheit irre gen, das sich eigenschaft irhube an Kaine 46v21, Zu Babilonie irhup sich das riche 47r35, irhub 6rr30, irhube 6rr28; 2. 'Klage erheben': Zu glicher wis, als man di clage irhebin mus in allen stetin 45r7; 3. 'errichten, erbauen': Nimant ensal markt noch muncze erhebin ane des richters urlop 32v21; 4. 'sich erheben, auftauchen': Welch wert sich erhebet binnen eime vlusse 39rl0; 5. 'aufbrechen': In drin tagen sullen sich di boten irheben 7 8 v l l / 1 2 . erholen sw.V. 'wiederholen, eine Prozeßhandlung erneut vornehmen': ab he sich vorspricht, des he sich nicht irholen mag 23vl6, Der Stammemde man, missespricht he, he mus sich wol irholn 23v32, irholen 67rl3. H R G 1, Sp. 1001 ff.; DRWB 3, Sp.204f; W M U
Glossar
264 1, S. 504; Lexer I, Sp.637f.; Grimm, DWB 3, Sp.853 ff.; Trübner 2, S.224f.; Kluge/Seebold, S. 185 erläsen st. V. 'jemandem etwas erlassen': Einen man von iclicheme dorfe mus he wol dinges irlasin 50v20. erlegen sw.V. 1. 'entgegentreten, widersprechen': das he sin gut vorste unde des obirsten herren ansprache irlege mit rechte 64r9; 2. 'niederlegen, fallen lassen': unde vorteilin im sin gut, ab he di ansprache nicht irleget 70v9. erlös Adj. 'ehrlos, ohne Ansehen (und damit eides- und lehensunfähig)': erlös unde rechtelos sin lr28, erlös unde rechtelos l r l 9 , lr26, lvr28, 2vll, 29r23, rechtelos unde erlös 31r2. -> rechtelös 2 erlösen sw.V. 'erlösen': das he uns irloste mit siner marter 9v28, Got hat den man noch im gebildit unde mit siner martir irlost 46v7. erlouben sw.V. 'erlauben, gestatten': Di sippe went an dem sibendin, erbe zcu nemene, ab der babist hat irloubit l l v 3 / 4 , irloiben 25v30. ermüte st. F. 'Armut': oder let si der herre zugen mutwillen odir durch ermute 53vl0.
von
erslagen st.V. 'niederschlagen, erschlagen, töten': Doch sagen sumeliche lute, di der warheit irre gen, das sich eigenschaft irhube an Kaine, der sinen bruder irslug 46v22, Wirt ouch eineme manne sin mag oder sin vrunt irslagen 57vl6/17. -> slagen, slan 3; tötslagen erstaten sw.V. 'ersetzen, erstatten': Wer is im aber getan hat, der sal im irstaten sinen schaden 36v35, irstaten 7lr25, 71r28, irstate 80rl2. ersterben st-V. 1. 'vererben': Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin, weder nageborn erbe noch nimant, uf den das gut irstirbit 16r3, irstirbet 12rl3, irsterben 17v29, irstirbit 18r7/8, 55vl5, irstorben 69v6; 2. 'durch Sterbefall auf jemanden kommen, von Todes wegen zufallen, erben': Noch der, uffe den das gerichte irstirbit 79v31, irstirbet 6vrl7, 1 lvl8, irsturbe 12r8, irstorben 22rl6, irstirbit 64v22, 80rl3; 3. 'erblos bleiben': Unde wo ein gut erbelos irstirbit von manne oder von wibe 50vl5. anersterben 1,2 erteilen sw.V. 1. 'Urteil sprechen, urteilen, richten über': unde swas uns über den irteilt wirt, des wolle wir nicht lasin 2vll8, irteilt 2vl23, 3rl26, 5rr30; 2. 'durch Urteil zusprechen, zuerkennen': Wen im das mit urteiln irteilt wirt 24v24, oder ab sime herren gewette irteilt si uf sin
gut 74r4, irteilt 25rl8, irteiln 29v21; 3. 'erteilen, auferlegen': im ensi alrest mit urteilen der geczug irteilt 30v28. ertliche st.N. 'Erde, Erdreich': Got ... machte ... den menschin in ertriche 9v24, Zwei swert lies got in ertriche 10r2, ertriches 33r34. -> erde ertstadelich Adj. 'die Bodenlage des eingebrachten Korns': Unde wo ein gut erbelos irstirbit von manne oder von wibe, das ertstadelege korn is sin 50vl6. ervarn st.V. 1. 'ausmachen': Wen si den kunig von erst irvarn binnen sechsischer art 28r29; 2. 'in Erfahrung bringen, erfahren': so der man das erst irvert bin der jarczale, das he volgen sal 85r28. ervolgen sw.V. 'einklagen, auf dem Rechtsweg verfolgen': Swelch gut man aber nimt deme manne mit gewalt, unde hes irvolget mit rechter clage 62r23, irvolget 63vl4, irvolge 71rl9, enirvolgit 77r3. ervollen sw.V. 'ersetzen, den Anspruch erfüllen, vollständig leisten': di wile sal der herre den mannen irvollen iren schaden 62v8/9. ervreischen sw.V. 'vernehmen, erfahren, von etwas hören': Is aber der herre us deme lande ..., swen he erst widerkumt an duzche art ..., unde he sine kunst irvreischet 78vl7, irvreischt 80rl9. erweln sw.V. 'erwählen, wählen, auswählen': Di zu deme ersten an der kore sin genant, di ensuln nicht kisen noch irme mutwillen, wen swen di vorsten alle zu kunige irweln 5 I r l 1. h> kisen erwerben st.V. 'erwirken, erwerben, erlangen, gewinnen': Erwerbin ander recht 4vll7, Niemant enmag irwerbin ander recht, wen als im angebom is 14vl, Disen vride irwarp ein jude 43v22, irwerbe 12v35, 13rl3, irwerbin 13rl7, 13rl9, irwirbet 27v33a, irwirbit 66v7. erzbischof st. M. 'Erzbischof: Deme erzbischove Bremen is undertan der von Lubeke 52rl8.
von
erzbistüm st. N. 'Erzbistum': Ouch sin zwei erzebischtum zu Sachsen in dem lande unde vunfzen andere 52r7/8. erzpriester st. M. 'Erzpriester': Wir gebiten, das man in stetin unde in dorfern allenthalben in unsem riche an geistlichen sachen halde der bischofe, der erczpristere 3vl9, erczpristere 10r25.
Glossar
G gäbe st. F. 1. 'Gabe, Geschenk': Dar umme enmag kein wip irme manne gegeben gäbe 18v4, gäbe 43r7a; 2. 'Ubergabe, Veräußerung': Swelche gäbe der man siet 5rrl2, Wer aber den andirn gelobet, ein eigen zu gebene vorgerichte ..., stirbit ienir denne, er im di gäbe bestetiget wirt 12v29, gäbe 19r2, 22r5, 22rll. -> morgengäbe gäe Adj. 'schnell, jäh, ungestüm': da mus man wol umme kisen einen gougreven zu minnesten von dren dorfen, di gaen tat zu richtene 23rl, gaen 23r5. tat galgen sw. M. 'Galgen': Wer des nachtis korn stilt, der vorschult den galgen 35r24. ganerbe sw.M. 'Miterbe, Gesamterbe': alle, di sich gliche na zu der sippe gestuppin mugen, di nemen glich teil dar an, is si wip oder man. Dise heisin di Sachsen ganerbin 14vl8.
265 disse sint alle gebome Swabin 4rll 1/12, von welcheme lande he gebom si 4rl20, geborne 4rll3, 25r29, gebom 4vr9, 1 Irl 1, l l v l 2 , 18vl7, 19r20, 19r22, 25r28, 51v25, 54v9, 65v2, 77rl3, 80v9/10; 2. 'durch Geburt (zur Erbschaft) berechtigt sein': das der man im von swerthalbin zu gebom si 15rl2, Wo zwene man oder dri zu eime hergewete gebom sin 16v20/21, gebom 16r5, 29r4, 39v23, 45rl, 47v38, 59r23/24, 59r27, 85vl7; 3. echt gebom 'ehelich, frei geboren': di alle schephinbar sin oder echt gebom sin 12r26, echt gebom 50rll; 4. unélich gebom 'unehelich, unfrei geboren': Kemphin unde ir kindere, spillute unde alle, di unelich gebom sin 19r28, unelich gebom 20v29, 21r29, 48r21/22, 59rl0. gebot st.N. 1. 'Gebot, Vorschrift, Befehl': Swer das gebot zu drin malen brichet 2rl21, gebot 3vll0, 9v31, geböte 3rl21; 2. 'Verbot, Beschlagnahme': He enmus ouch kein gebot noch herberge gebiten 5 8 r l 0 / l l .
gebrechen st.V. 1. 'brechen': Man sait, das bürge unde vorsten keinen vride ensuln haben, den man an in gebrechen muge 43v36, gebrechen 60v30, 85v26; 2. 'streitig magare st. F. 'Kleidung, Rüstung': einen rok ane ermele über chen, absprechen, verlieren': Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin 16rl, gebrechen 63r7, 69v9, der gare 25v20. 70vl7, gebricht 77v 12/13, gebrochen 30rl3/14; 3. gast st. M. 1. 'Gast': Di muter is gast in des suns gewern 'rückgängig machen': swas aber he dar ab liet oder lest, 15v24; 2. 'Fremder': Andere vrie lute ... kumen unde das enmag he selbe nicht gebrechen 71r7; 4. 'entziehen': varn in gastis wise 4 8 r l 0 / l l , gaste 82vl4. Liet ein burger sin burglen eime zu lene, he enkan is im mit lenrechte nicht gebrechen 80v21/22, gebrechin gebiten st.V. 1. 'gebieten, befehlen, auferlegen': Wir 55r21/22; 5. 'fehlen': Gebricht da aber icht an 27vl8, sezzen unde gebiten lr3, Vride sal man dem kreize gegebricht 30rl3, 43v33, 62v6. biten bi deme halse 25v21, Gebuit der kunig des riches -» brechen 1, 2, 4 dinst 52v5, He enmus ouch kein gebot... gebiten 58rl 1, Der herre mus wol sinen mannen gebiten mit urteiln gebü st. M.N. 'Bau, Gebäude, Bauwerk': Der zcinsman 61vl2, gebiten lvrl, 2rll, 2rl6/7, 2rl28, 2rr2, 2rr8, erbet sin gebu, he ensi von ritters art 5vl5, gebu 15r32, 2rrl7, 2vl4, 2vll0, 2vll4, 2vl20, 2vl24, 2vl30, 2vr4, 31rl4, 31r25, 31r30, 53v20, 55rl2, 55rl5, 55v8, 80vl6, 2vrl 1, 3vl6, 3vll2, 3vr5, 27v5, 58rll, 74r27, 74vl/2, 82v4, gebiu 15r30, gebues 31r33. 77r6, 80rl9/20, 85r8/9, gebotin 25v29, gebot 47r8, 74r28, geboten 59v20/21, 74v3, 85rl7, gebut 6vl25, gebùlén st.N. 'Gebäudelehen': unde gebulen ende, alse 85r6, gebuit 78rl3, 82r4; 2. 'auffordern': Unde wem der der man da nicht ujfe ensiczt 84vl4. richter zu entworte gebut 6rr25, gebut 46r2/3, gebite 76rl6; 3. 'vorladen': Dem sal der richter selber vor gebiten gebunden Part.Adj. 'befriedet, gebunden, auf bestimmlvr25; 4. 'aufbieten': dise hervart sal man gebiten sechs te Handlungen beschränkt', in der Verbindung gebunwochen 60rl4/15, Gebuit aber der herre sine samenunge dene tage 'Tage, an denen Recht und Gericht auf geuf den man 83v26, geboten 69r22, 74rl7, gebiten wisse Handlungen beschränkt sind': Wo man richtet in 74i27-, 5. 'anbieten': ab iener im sine manschaft also ge- gebundenen tagen 5rrl7, An gebundenen tagen enmus man nicht dingen 28rl, Heilige tage unde gebundene boten habe 66v2, geboten 66r28. tage, di sin allen luten zu vridetagen gesazt 41r22, ge-» WMU 1, S. 563 f.; DRWB 3, Sp. 1238 ff.; Lexer I, bundenen tagen 51v22, 60r20, 60r21/22, 60r24/25, Sp. 574; Grimm, DWB 4.1.1, Sp. 1752; Trübner 3, 79rl7/18, 81vl4. S. 37 f. HRG 1, Sp. 1424ff.; Lexer I, Sp.763; Grimm, biten 1, 4, 5; sezzen 3 DWB 4.1.1, Sp. 1900f. gebom Part.Adj. 1. 'geboren, abstammend, herkünftig': tag 5
266 gebär st. sw. M. 'Bauer, Nachbar, Dorfgenosse': Ein dinstman mag is ouch bezugen mit andern dinstmannen ..., ein gebur mit sinen genossin lvll7, nach der gebure kore 'nach Schätzung der Nachbarn' 15vl, gebur 14r7, 47vl7/18, gebure 6vrl6, 37rl0, 38r31, 38v34, 42r9, 53rl0, 58r2, 73rl, geburen 21 vi, 35r4, 37r31, 37vl2, 56v8, 56vl6. gebürmeister st. M. 'Bauermeister, Vorsteher einer Dorfgenossenschaft': Der gebürmeister is wol gezug über den gebur in sime gerichte 14r6, gebürmeister 50v21. -> bürmeister geburn sw.V. 'rechtlich zufallen, zukommen, gebühren': noch deme das en geburt an der teilunge 14rl3, me wen also vil, alse menlicheme gebort 56rl7, geburt 16r20, 30vl, 35v6, 40rl6, 4 9 r l l , 78v8, geborit 55v31/32.
Glossar halden hat 51r28; 3. 'behalten': Dube oder roubis ... entschuldigit he sich uf den heiligen, ab hes gezug hat, das hes unhelingen gehalden habe 57vl0, gehalden 34rl 8/19; 4. 'ein Tier halten': einen glumenden hunt oder einen czamen wolf... gehalden 40v8. gehören sw.V. 1. 'gehören': Gemeste swin gehören zu dem musteile 17r20, Is he aber duzch, so gehört is noch der muter 55rl, gehört 16vl4, 17rl7, 17r23, 17v4/5, 19rl3, 39rl2, 75r9, gehöret 54v30, 75r6/7, 79v21, 82r25, 83vl2, gehorit 49v22, gehom 17r29, 45v22/23, gehören 54v27, gehörten 54v20; 2. 'hören': Uf welcher bürg man di vridebrechere helt wider recht, ... unde man si ... heischet, als recht is, das man das gehören muge 42r21. gehörsam Adj. 'gehorsam': dem babiste gehorsam czu sine 10rl4/15, gehorsam 52r29/30.
gebürschaft st. F. 'Bauerschaft, Dorfgenossenschaft': Zu dirre seibin wis bessirt eine gebürschaft der andern 56vl0/l 1.
gehörsam st. F.M. 1. 'Gehorsam': Der brach den gehorsam, uns allin czu schaden 9v25/26; 2. 'geistliches Gelübde': He hab gehorsam getan oder nicht 31v21.
geburt st. sw. F. 1. 'Geburt, Geburtsstand': sine buze is ouch zwivalt unde sin wergelt nach siner geburt 12vl9, geburt 20v5, 21 vi 3, 25r30, 30r22/23, 37v24, 37v26, 53rl6, 54v7, 68vll/12, 77v9, 85v5, 85vl0, 85v28, geburte 10v23/24, engeburt 17v3; 2. 'Abstammung, Herkunft': Nu vomemet umme der herren geburt von deme lande zcu Sachsen 3vrl7, geburt 50rl4. HRG 1, Sp. 1426 ff.; DRWB 3, Sp. 1322 ff.; WMU 1, S. 573 f.; Lexer I, Sp. 765; Grimm, DWB 4.1.1, Sp. 1902ff.; Trübner 3, S.34f.; Kluge/Seebold, S.249
geist st. M. 'der Heilige Geist': Des heiligen geistis minne, der Sterke mine sinne 9vl, Got rugete den sibinden tag, ... unde uns sante sinen geist 47r7.
gedinge st. N. 'Nutzungsrecht, Anwartschaft, Rechtsanspruch auf ein Gut': Von gedinge an eins andern gute 7rr5, noch gedinges rechte 61rl/2, 71vl4/15, 84r30, gedinge 7vr22, 18v22, 55r24, 60v6, 60v8, 60v9, 60vl4, 60v22, 60v28, 60v29/30, 61rl, 64v23, 65rl4, 70v27, 79v26, 80rl6, 80v5, 80v6, 80v9, 80vl9, 82v25, 83v20, 84r25, 84r28, gedinges 65rl6. WMU 1, S. 580; Lexer I, Sp.772; Grimm, DWB 4.1.1, Sp. 2025 -> lipgedinge; recht 9
geläsen st. V. 'auflassen': des enmag he keinen teilgelien noch gelasin 71r6.
gegelden -» gelden gegenöte st. F. 'Gegend, Landschaft': Der gegenote is doch gnug binnen deme herzogetume, di sundirlich recht wollen haben 52vl6. gehalden st. V. 1. 'unterschlagen': wen heS diuplich gehalden hat 33vll; 2. 'verhalten': Wo man bischove ... nicht enkuset binnen sechswochen, da di lenunge an den keiser get, he liet is, weme he wil, der sich redelich ge-
geistlich Adj. 'geistlich, fromm': So sal di geistliche gewalt helfen dem werltlichen gerichte 10rl5, geistlich 4vl2, 52r27, geistliche 9v32/33, 10r4/5, 41rl6, 47v5, 51r29, geistlichen 3vl5, 3vl8, 6vll8, 52r23, geistlichem 6vr28, 10rl2, 22v4, 40v22, geistlicheme 79r30. -> gerichte 1; swert 2
gelden st.V. 1. 'entgelten, bezahlen, ersetzen, zu einer Zahlung bzw. Leistung verpflichtet sein': zcu hant sal he zcwivalt gelden ienem sin gut 3vr9, Swer schult vorderet uf den, der nicht gegelden enmag 6rr24, man mus is im gelden mit eime halben wergelde 30r33, unde he im sine kost gelde noch gutir lute kure 33v5, gegeldin 48v29, gelde 26v9, 27v6, gelden 5rrl9, 12rl8, 12r31, 12v3, 26v9, 28vl, 32v28, 33r7, 35rl4, 35r22, 37r3, 37r5, 37r9, 37r25, 38vl0, 38vl3, 38v20, 38v28, 40v5, 41r5, 43r32, 43vl3, 46rl3, 48v20, 49rl6, 80vl7, 82v4, geldin lvr9, 5vl22, 6rr26, 12r23, 12r32, 16rl9, 22v7, 26v7, 26v8, 46rl0, 46rl6, 46r20, 46r21, 48v7, 48v9, 48vl5, 48v28, 56r23, 56vl7, 57r2, 57v26, geldene 5rl26, 12r21, 26vl2/13, 35r29, 39v2/3, 43v9/10, 56r21, 56r30, engelde 3vl30, engelden lr32, engilt 22r22, 37r28, 39vl9, 42v23, 43vl, 47r32, 57r2, gildet 33r20, gilt 4vl6, 12v35, 39v27, 46r27, 48vll, 48vl5,
Glossar 48v21, 48v24, 48v34, 49rlO, 56vl2; 2. 'gelten, für etwas halten': Wo der richter sin gewette nicht usgephenden enmag uf eins mannes eigen, das also kleine gilt, das sai der vronebote bevronen mit eime krucze 36rl. ^ W M U 1, S. 626 f.; Lexer I, Sp.827; Grimm, DWB 4.1.2, Sp. 3066 ff.; Trübner 3, S.84; Kluge/Seebold, S. 255 -> ab(e)gelden ; vorgelden geleistea sw.V. 'leisten, erfüllen, erbringen': Swas so ein man swert unde en truwen gelobit ..., unde enmag hes nicht geleisten, is enschadet im zu sime rechte nicht 46r32. -» leisten geleite st. N. 1. 'Geleitrecht': Wo zcwene mit ein ander urlogen, der einer oder beide geleite haben 2rl25, geleite 2vrl0; 2. 'Geleitgeld': Werne aber he geleite gibet, der sai den schaden bewaren in sime geleite, oder he sai en im gelden 33r6, geleites 33r4; 3. 'Geleitschutz': der sai den schaden bewaren in sime geleite 33r7, Bittet der man geleites den herren 84r6. gellen st.V. '(ver)leihen, als Lehen geben': des enmag he keinen teil gelien noch gelasin 71r6, bin den tedingen enmag der man des gutes nicht gelien 74r9, gelien 80rl 7. -» lien\ vorlìen 1, 2 geligen st.V. 1. 'sich lösen von': Begibt sich aber ein man, der zu sinen jaren kumen is, he hat sich von lantrechte unde von lenrechte geleit 17vl4; 2. 'aufgehoben sein, erledigt sein, ruhen': Wen der greve kumt zu des gougreven dinge, so sai des gougreven ding nider sin geleit 23r20; 3. 'liegen, sich befinden': Die erste is Gruna. Di andere Werle, di ist zu Gosler geleit 51v34. geloben sw.V. 'versprechen, geloben': Swer eine gewere globet vor gerichte 5rr24, Wer aber den andirn gelobet, ein eigen zu gebene vor gerichte 12v26, sin bürge mus den eit vor en tun zu gelobter czit 44vl, geloben 20vl9/20, 30r3, 46r36, 68vl8, 70v2, globen 5rr4, 6vr26, 79v2, globin 56rl3, 56r20, gelobet 5rrl8, 12v26, 13rl 1, 13r29, 26r30, 30r5, 30rl0, 35r34, 44v3, 47r34, 55rl9, gelobit 12v3, 12v34, 22v22, 30r3, 38v6, 46rl9, 46r30, 56rl9, 56r25, 56r29/30, 74rl5, gelobt 16r30, globet 4vll0, 39v28, 44r2, 44rl3, globit 46r25, 46r28, globt 44rl2, gelobete 30r9/10, 56rl9, globe 79v3. gelt st. N.M. 1. 'Gewinn, Ertrag': swer is in nuzce odir in gelde hat 63v9, das gelt des gutes 69r2; 2. 'Geld, Preis': man sai en abir phenden also lange, bis ienir sin gelt habe 27v20, gelt 5rl26, 6vr26, 43vl, 56rl4, geldes 62vl7, 78r4; 3. 'Abgabe, Zahlung, Schuldforderung, Geldschuld': Der herre mag wol phendin uf sime gute vor sin gelt 22v21, gelt 39r35, 39v6, 46rl, 46rl3, 46v2; 4.
267 'Entschädigung, Schadenersatz': he enmag da kein hoer gelt an gevordern wen sine buse 30vl2. -> wergelt; zinsgelt gelubde st. F.N. 1. 'Versprechen, Gelöbnis': Wer im so erbe zusagit... von gelubdes halben 33vl7, Eines iclichen gevangenen gelubde ensal durch recht nicht stete sin 46r23, gelubde 5vll5, 33vl8, 43v2, 44r20, 46rl5, 46v2, 46v4, 50r6/7, 56r22, gelubede 6rr27; 2. 'Zustimmung, Erlaubnis': Ane erben gelubde ... enmus nimant sin eigen noch sine lute vorgebn 21v21, gelubde 15v31, 18v30/31, 21v26, 21v29, 70vl5. gemannet Adj. 'verheiratet': di gemannete tochter 13v29. gemechte st.N. 'männliches Geschlechtsteil': Welch man an munde, an nasen ... unde an des mannes gemechte ... belemt wirt 30r30/31. gemeine Adj. 1. 'gemeinsam': Derne burmeistire wettit man ... dri Schillinge vor hut unde vor hare, das is der geburegemeine zu trinkene 53rl0, Zcwene man enmugen in eime gerichte kein gemeine lenrecht gehaben 79v26, gemeine 13vl9/20, 13v23, 71r8, 71vl9, gemeinen 38v3; 2. 'allgemein': Welches wassir stramm vluzt, das is gemeine zu varne 33r32, gemeine 16vll/12, 37r20, gemeineme 79vll, 79vl3/14; 3. 'gewöhnlich': gemeiner gewere si gezug ein iclich unbeschulden man an sime rechte 72vl; 4. 'gemeingültig': Dar umme sin dise vier tage gemeine vridetage 41v7. gemeine Adv. 'allgemein': Der kunig is gemeine richter über al 6rr7. gemeine st. F. 'Gemeindeland, Grundeigentum einer Gemeinde': Swer siner nakebure gemeine abeerit... mus wettin dri Schillinge 56v2, gemeine 6vr27. gemeinliche Adv. 'gemeinschaftlich': Beheldit en eine stat gemeinlichen unde wissenlichen 2vr30. gemiten sw.V. '(be)lohnen, dingen': Stirbet ouch der gemitte man 16r29, oder wen he mit phenningen gemiten mag 2\T7. gen unr.V. 1. 'gehen, sich begeben': Vor deme richter suln si beide gegerwit gen 25v33, gen 17rl9; 2. 'hinauslaufen auf, zur Bestrafung führen': Rechtelose lute darben Vormunden unde lame lute, is enge zu kamphe 4vr27, da is en an den lip odir in di hant nicht enget 4rl24, enget 31v3; 3. 'reichen, sich erstrecken': Siner boume este ensuln ouch über den zun nicht gen 38r25; 4. 'gegen jemanden gehen, zu jemandes Lasten gehen': di clage, di enge denne uf den kunig 23r23/24, gieng 42v24; 5. 'sich ereignen, geschehen': das über ienen solde gen
268 29vll; 6. 'abführen, herausgehen, weggehen': Is enget nicht us dem buseme 14v21. geneinen st.V. 1. 'nehmen': Wer deme andirn ebinburtig nicht enis, der enmag sin erbe nicht genemen 14v24, genemen 14v25; 2. 'Ehepartnernehmen, heiraten': He is ouch der witewin Vormunde, bis das si man genimt 17rl4. -> nemen 1, 3 genenden sw.V. 'wagen, aufs Spiel setzen': unde mit rechte si he geleites vri, wo he sins gutes oder des libes genenden wil 33r5. genge unde gebe Adv. 'gang und gäbe', zu genge Adj. 'gängig, gültig, im Umlauf befindlich' und gebe Adj. 'annehmbar, willkommen, gut': mit silbere oder mit phenningen, di genge unde gebe da woren 26vl3/14, genge unde gebe 46r21, 77v6/7. genös st. sw. M. 'Standesgenosse': AI si ein man spilleman ..., he enis doch ... dibes genos nicht 21r30, Kegin sinen genosin enmag he ... mit gezuge nicht volkumen 67rl, genos 5rl23, 20v2, 21 vi4, 24v21, 43rl5, 54r9, 85v22, 85v27, genosen 17vl7, 28vl7, 31vl9, 42r33/34, genosin lvll7, 6vl28, genossin lvll8, 53rl5. -*• hüsgenös; undergenös; zinsgenös genösinne st. F. 'Standesgenossin, Ebenbürtige': Das wip is ouch des mannes genösinne, swen si in sin bette trit 48r2. gensezende sw. M. 'Gänsezehnt': In Sente Walpurgetage is der lemmerzende vordinet, zu wurzmesse der gensezende 39r25. gephenden sw.V. 'pfänden': di man nicht gephenden mag 35v31. phenden; üsgephenden gephlegen st.V. 'erfüllen, leisten': der richter sal en halden, bis he rechtis gephlege 45rl0. phlegen 3 gerade st. F. 'Aussteuer, weibliche Geräte und Kleider als Erbe': Wo man erbe unde gerade nemen sal 4vl5, Erbelos irstirbet hergewete oder gerade 4vrl, gerade 6rr23, 7rlll, 12r8, 12rl2, 13v33, 15vl4, 15v21/22, 17r22, 17r32, 17v31, 18r8, 18r31, 30rl2, 44v29, 55rl5/16, 55vl/2, 55v8. HRG 1, Sp. 1527 ff.; DRWB 4, Sp.255f.; Lexer I, Sp. 870; Grimm, DWB 4.1.2, Sp. 3554 ff.; Trübner 3, S. 107 -» rade; ungeradet; üsgeradet
Glossar mit urteiln richtet 24vl4, gerichte 2rl20, 2vll2, 2vll5, 2vl21, 3rll 1, 4vr30, 5rl31, 5rr24, 5vll6, 6rll5, 6rll6, 6rl27, 6rrl8, 6vll0, 6vrl9, 6vr32, 7vr30, 8rll4, 9vl8, 9v20, 10vl4, 12v5, 12v6, 12v21, 12v23, 12v27, 14r4, 14v2, 14v31, 15rl5, 19r29/30, 20r31/32, 20vl6, 20v27, 21r25, 21v24, 24vl6, 26vl7/18, 26v24, 27r20, 27r23/24, 27r26, 27v21, 27v28/29, 29rl4/15, 29rl8, 29r24, 29vl6, 29vl8, 29v31, 30rl, 30vll, 31rll, 31vl8, 33vl8/19, 34r24/25, 34r25, 36r6, 36v26, 40v28, 40v30, 41vl2, 42rll, 42rl5, 42v29/30, 44r5, 44rl4, 44r27/28, 44vll, 44v31, 45r3a, 45v31, 46rl, 46rl8, 46v2, 47r34, 49vl8, 51v5, 51v26, 52v26, 53v28, 54r21, 54v4, 57r6/7, 5 7 r l l / 1 2 , 57rl6/17, 57r24, 57r26, 57vl9, 62r28, 65r6, 69r26, 79r30, 79vl5, 79v20, 79v21, 79v25, 79v29/30, 82vl7, 83r29, gerichten 45v22, gerichtis 29vl0, geistlich gerichte 4vl2, 52r27, vor geistlichem gerichte 6vr28, 40v22, mit geistlichem gerichte 10rl2, geistlicheme gerichte 56vl9, 79r30, werltlich gerichte 22v27, 52r27, werltlichem gerichte 79r30, werblichen gerichte 10rl6/17, uswendigem gerichte 6vr29, 56v26/27, uswendigene gerichte 45v34, von gerichtis halben 20r2, 20v21, 33vl9, 56rl8, von gerichtis halbin 20r8, 27v6, 32rl2/13, 57r3, von gerichtes kalbin 32r9; 2. 'Gerichtsbezirk, Gerichtssprengel': Der geburmeister is wol gezug über den gebur in sime gerichte 14r7, gerichte 2vr31, 6rr4, 15v32, 23r26, 23v22, 27v25, 32v22, 35r9, 40v20/21, 41v9, 42r5, 45r6, 45v21, 49vl3, 62v21/22, 66rl9; 3. 'Gerichtsbarkeit, Gerichtsgewalt': In di vierde hant ensal kein len kumen, das gerichte si ubir hals unde ubir hant 49r32, gerichte 23rl 1, 79v21; 4. 'Urteil, Urteilsspruch': Der richter sal swem zeu den heiligen, das he von nimande ichein gut neme umme kein gerichte 3rl23, gerichte 3rrl; 5. 'Gerichtsverfahren': Wen sine vormundeschaft, di wert nicht lenger wen alse das gerichte wert 20v27; 6. 'Mahlzeit, angerichtete Speise': brot unde bier sal he en gnug geben unde dri gerichte zu dem essene 28r24, gerichte 28r25, 78v2/3, 78v4. HRG 1, Sp. 1551 ff.; DRWB 4, Sp.299ff.; WMU 1, S.655ff.; Lexer I, Sp.880f.; Grimm, DWB 4.1.2, Sp. 3635 ff.; Trübner 3, S. 110 ff.; Kluge/Seebold, S. 260 gerichten sw.V. 'richten, Gericht halten': Des enmag he nicht gerichten wen zeu rechter dingstat 23r29, gerichten 49r28, 79v29. -> richten 1
gern, geren sw.V. 1. 'begehren, bitten um etwas, verlangen': Swen der man in den obirsten herren volget sime gute unde ... der wisunge an en gert 64r25, dises sullen si geren bin irre jarczale 71vl0, gert 25v26, 27vl0, gerichte st.N. 1. 'Gericht': der richter, in des gerichte das 66r30, gern 25v30, gegert 68r9; 2. 'auswählen': sinen gesehen is lr32, In allen stetin is gerichte, da der richter gezug sal aber he zu hant benennen ...; der sal der herre
269
Glossar sibene brengen, der der man gert 66v25; 3. 'streben nach': Dar umme bitte ich czu helfe alle gute lute, di rechtis gern 9 v l l , gern 84v20. gerte st. sw. F. 'Gerte, Rute': des kuniges malder, das sint czwene unde drisig siege mit einer grünen eichinen gerten 30r28. geruchte -* gerufte gerufte st. N. 'Hilferuf, Klagegeschrei zur Festnahme eines Missetäters': Umme blas gerufte wettit ein man dri Schillinge 24r26, Wip oder mait, di not vor gerichte claget, di suln clagen mit gerufte durch di hanthafte tat 40v25, gerufte 6rl5, 22rl7, 24r21/22, 24r23, 25rl4/15, 27v21, 32r28, 33rl5, 34r26, 38vl2, 39r4, 40v28, 40v32, 40v35, 40v37/38, 41v34, 4 2 r l / 2 , 42r8, 42rl9, 42v26, 44r25, 50vl0, 53v30, 54r21, 67vl3, geruchte 5vr25, 10v7. H R G 1, Sp. 1583; DRWB 4, Sp.401 ff.; W M U 1, S. 660; Lexer I, Sp.891; Grimm, DWB 4.1.2, Sp. 3751 ff.; Trübner 3, S. 117; Kluge/Seebold, S. 117 -> blütgeruchte; schrien gerwen, gerea sw.V. 'sich bereiten, rüsten': Vor deme richter suln si beide gegerwit gen 25v33, gere 25v9/10, gerwit 26r9. gesament Adj. 'versammelt, vereinigt': mit gesamenter hant 'gemeinschaftlich, gesamthänderisch' 70v21. geschuldigen sw.V. 'beschuldigen': Wer ... sine dube ... under eime manne vindet, der is offenbar gekouft hat..., den enmag man keiner hanthaften tat geschuldigen 34r20, geschuldiget 16r8. h> schuldigen gesetze st. N. 'Gesetz, Festsetzung, Bestimmung': Unde an welcher me dis gesezce gebrochin wirt lvr22. gesigen sw.V. 'siegen': wo di meiste menie gesiget, di haben das urteil behaldin 15r6. gesinde st. N. 'Dienerschaft, Gesinde': Phaffen unde rittere unde ir gesinde sullen wesin zolvri 33rl, gesinde 4vl27, 82r4, 82rl3, gesindes 35v20/21. gesinnen st. V. '(Lehenserneuerung) begehren, verlangen': Is ouch sin herre us deme lande odir gevangen, das he sins gutes nicht gesinnen enmag 68r27, gesinnen 66rl, gesunnen 70r22, 73r29/30. -» sinnen gesiechte st. N. 'Geschlecht, Stamm, Abstammung': Di herzcogen von Lüneburg unde sin gesiechte sint alle geborne Sachsin 4rll3, gesiechte 14v26, 46v22.
gesprèche st. N. 'Beratung, Besprechung': Der cleger unde uf den di clage get, di musen wol gespreche haben um icliche rede driens 24vl2, gespreche 76v7, 76vl2, 76vl8, 77v24, 77v28, gespreches 24vl9, 76rl7, 76v6, 76v9, 76vl0, gesprechis 24v32. gesprechen st.V. 'absprechen': also enmag deme kunige nimant an sinen lip gesprechen 50rl8/19. gestén st.V. 1. 'eingestehen, bekennen': Wil aber, der den hantvride gemachit hat oder enphangen, nicht gesten des rechten 2vl2; 2. 'stehen, stehen bleiben': enmag he nicht lenger gesten, he lege sich 77v 18, gesten 77v21. gestètegen sw.V. 'bestätigen': Nu vomemt den alden vride, den die keiserliche gewalt gestetiget hat in Sachsenlande 41rl3. gestuppen mnd. sw.V. 'mit den Fingern tupfend zählen, rechnen': Wenne aber ein erbe vorswestirt unde vorbrudirt, alle, di sich gliche na zu der sippe gestuppin mugen, di nemen glich teil dar an 14vl6/17. gesunt Adj. 'gesund, geheilt von etwas': Disen vride irwarp ... Josaphus, wider den kunig Vespesianum, da he sinen son Titum gesunt machte von der gicht 43v24. gesunt nimant 50r21, 45r25,
st. F. 'Gesundheit': Ubir der vorsten lip enmus richter sin unde ubir iren gesunt wen der kunig gesunt 12vll, 23v25, 28r4, 33vl3, 35r21, 40r20, 45r33, 46r31.
geswem st.V. 1. 'abschwören': Is iz aber ander gut, das man bewisen mag, da mugen si nicht vor geswern 14rl ; 2. 'freischwören': Wer aber sins vies vormisset unde zu hant zu dem hirten get, unde en dar umme schuldeget..., so mag der hirte da vor nicht geswem 38v27. geswom Part.Adj. 'geschworen': In geswornen vride sai man keine wapen vuren 6rll, geswornen 41v26. getédingen sw.V. 'vor Gericht laden': so das im kein sin herre zu lenrechte getedingen enmag 60rl, getedingen 85rl0. tédingen 2 geteilen sw.V. 1. 'teilen': Swen aber sis geteilen, ir kein enhat recht an des anderen gute, ab ir ein stirbit 70v25; 2. 'einteilen, ins Erbe einsetzen': Nimt der son wip bi des vatir libe, di im ebinburtig is, unde gewint he sune bi ir unde stirbit he da nach, e sin vater in geteilt von deme erbe 1 lv24. -»• teilen 1 geteling st. M. 'Verwandter': Wer von gerichtis halben den lip vorlust, sin neiste geteling nimt sin erbe 33v20.
270
Glossar
getrösten sw.V. 1. 'auf sich nehmen': Ane vorsprechen mus ... ein man ... entwortin, ab he sich des schaden getrosten wil, der im da von begeinen mag, ab he sich vorspricht 23vl4/15; 2. 'trösten': Swer zu allen dingen gerne rechte spricht, he gewinnet dar ab manchen has, des sai sich der vrume man getrosten durch got 84v31. getrüwe Adj. 'treu': Der man sai phlichtig sime herren hulde tun unde sweren, das he im ... getruwe ... si, alse durch recht ein man sime herren sulle 59vl2, getruwe 80v31, getruwin lr5. getrüwen sw.V. 'glauben': Ab der herre nicht getruwen enwil, das das kint zu sinen jaren si kumen, das mus geweren ... das kint 69r5, entruwe 67vl7, entruwit 74v9. getwang st. M.N. 'Zwang': In willen unde in Worten so enis kein getwang, da envolge di tat 72vl8, getwange 47r24/25. getwerg st. N.M. 'Zwerg': Uf altvilen unde uf getwerge irstirbit noch len noch erbe l l v 7 / 8 . getwingen st.V. 'zwingen': getwingen halben 56rl7.
... von gerichtis
gevän st.V. 'gefangennehmen, ergreifen': Ab he san in ein ander gerichte vlut, mugen si en gevaen uf deme velde 42r5/6. gevaagene sw. M. 'Gefangener': Wen der kunig in das lant kumt, so sin im alle gevangen ledig 6vl20, gevangen 5rl31, 27r26, 40v27/28, gevangenen 6rr27, 8rrl, 46r23, 51v9. gevellen st.V. '(durch Erbschaft) zufallen, fallen an': durch das he beware, das des icht vorloren werde, des an en gevellit 16rl5, das lose, he wil, deme is zu rechte gevellit 17v7, ieme, an den das gut gevellet 39v29. gevencm'sse, gevengnisse st.F.N. 1. 'Gefangenschaft': ... oder in keiner hande bant legit, das gevengnisse heisit I r l 9 , gevengnisse 46r24, 47r25, 67v24, gevencnisse lvl23, vengnisse 67vl0; 2. 'Gefangennahme': Swelch son an sins vatir lip retet oder vrevelichen angrift mit wundin oder mit gevencnisse I r l 8 . gevernen sw.V. 'entfernen, entziehen': wen he enmag, di wile nicht sime herren an dem gute gevernen mit der lenunge, di he tut, ander he wirt mit rechte zu getwungen 68v8/9. geverte st. M. 'Genosse, Gefährte': Den schadin, den he da nimt, sai sin eines sin unde nicht ... siner gevertin 13v22.
gevolgen sw.V. 1. 'folgen, nachfolgen': Der man ensal sin vie da heime nicht lasen, das deme hirten gevolgen mag 38r34; 2. 'verfolgen': Is aber he gewundet, das he nicht gevolgen mag, so suln di Iute volgen biphlicht 42r3; 3. 'einholen, festnehmen': das si im gevolget haben in der hanthaften tat 42rl4; 4. 'nachfolgen (mit einem Lehensgut)': Swelch gut der man an sinen geweren nicht enhat ..., deme enmag he nicht gevolgen an einen anderen herren noch erben an sinen son 62r21, gevolget 64v3, gevolgen 65r27, 7 1 r l l , 83r5. -> ervolgen; volgen 2, 3 gevordern sw.V. 'rechdich vor Gericht fordern, stellen': Ist aber, das der vatir von gevencnisse odir von suche oder von andine ehafter not das recht nicht gevordern mag lvl25, he enmag da kein hoer gelt an gevordern wen sine buse 30vl2/13, gevordim 43v8, gevordirt 15rl5. -> vordem 1 gewaldig Adj. 'Gewalt habend, mächtig': Lasit den keiser sines bildes gewaldig unde gotis bilde gebit gote 47rl 9. gewalt st. F. 1. 'Gewalt, Macht': Wir sezzen unde gebiten mit unser keiserlichen gewalt lr4, gewalt 3rl6, 10rl6, 19rl3, 19vl, 19v2, 19v6, 19v7, 2 4 r l l , 40rl7, 41rl3, 47r26, 49r22, 50v3; 2. 'Verfügungsgewalt': Hat der seibin ichein len von dem vatere ..., liet hes im wider, so sai he dem richtere sins eigens odir sins lenes also vii in sine gewalt lien oder brengin lvl7, gewalt 16rl7, 36vl3, 62v7, 63vl3, 63vl4, 72vl5/16, 82r25; 3. 'Anwendung von Gewalt': Wir sezcin unde gebiten, das man di rechten lantstrasen vare unde nimant den anderen mit gewalt twinge von der rechtin strase 2rl30, gewalt 3 v l l l , 7 r r l 4 / 1 5 , 42v33, 48v5, 62r23, 66r8, 82rl7. gewandeln sw.V. 'etwas rückgängig machen, jemandem etwas entziehen': behelt he das gut... ane rechte widerspräche sins herren, der herre enmag im das nicht gewandelen 62rl8. geweigem sw.V. 1. 'sich weigern, sich widersetzen': Swo der son deme vatere nicht ebinburtig is unde di man geweigeren mugen ir gut von im zcu enphane 65rl9, geweigern 52v25, 59r27, 7 6 r l l / 1 2 , weigern 7vl4, 54r25/26, 66v3; 2. 'verweigern, verwehren, versagen': Vorspreche enmag nimant geweigem zu wesene in dem gerichte 23v21, geweigern 63v23, 80r8, geweigim 14rl9. -*• weigern 1, 2 geweldicüch Adj. 'gewaltsam': Swer deme andern sine bürg angewinnet mit unrechte, clait iener dar uf zu rechte, unde helt man im di bürg geweldiclich vor 53vl4, geweldiclichen 44r22.
Glossar geweidigen sw.V. 'Vollmacht geben, die Verfügungsgewalt übertragen': der richter... geweidige si von gerichtis halben irs gutes 20rl, geweidigen 27r32, 32r32, geweidiget 43r23. gewer(e) st. F. 1. 'rechtskräftig gesicherter Besitz, Gewere': Alle len ane gewere darben der volge 7vr25, Morgengabe behelt das wip uf den heiligen, di gewer aber mit gezuge 15v20, Lenis geweren mus man gezugen mit sechs mannen des herren 82v28, gewer 5vll0, 7vr26, 13r20/21, 13r21, 13r24, 15vl6, 18v7, 30v27, 32rl4, 32r26, 32r32, 35vl2, 36rl8, 36r20, 60v5, 60vl6, 60v21, 61rl3, 61r23, 63vl0, 63vl3, 72v6, 73r2, gewere 7vl32, 7vr2, 7vr27, 18v2, 36rl7, 61r8, 62r9, 62r26, 63r3, 63r7, 63r24, 63v8, 63v30, 6 4 v l l , 66rl0, 69v4, 70v22, 71vl3, 71vl7, 71v20, 72r9, 7 2 r l l , 72r22, 72r29, 72r30, 72v20, 72v26, 72v28/29, 73r3, 73r6, 73rl7, 73v5, 82v22, 82v30, geweren 5vl9, 5vrl5, 6rr21, 7vl33, 8rll7, 32r8, 34r35, 36vl6, 45v5, 57v25, 60v7, 60v9, 6 0 v l l , 60v31, 61rl 1, 62rl, 62rl9, 63rl, 63rl2, 63rl6, 63v26, 64r6/7, 70vl3, 71v6, 72r27, 72v3, 74r7, 80r24, 82vl8, 82v20/21, 82v27, 83r20/21, 83r23, gewern 14r28, 15v24, 16r6, 16v4, 16v8, 2 0 v l l , 33vl4, 3 4 r l 4 / 1 5 , 34v32, 36vl0, 40r8, 40r9, 40vl4, 41v23, 43v27, eigenliche gewer 'Eigentumsbesitz' 36v23, lediclichir gewer 'freier Besitz' 39rl7, lediclichen gewern 19r3, gemeiner gewere 'gewöhnlicher Besitz' 72vl; 2. 'Besitzrecht': Welch man ein gut in gewern hat jar unde tag ane rechte widerspräche, he hat dar an eine rechte gewer 3 6 v l l , gewer 22r4a, 32r20, 32r22, 36r25, 60vl7, gewern 20vl 1, gewere 5vl32, 6vr20, 20v22, 36vl4, 41v23, 57r27/28, 63r4/5, 69v8; 3. 'Gewährschaft': Gewere sai iclich man tun umme totslag unde umme lemden unde umme wunden vor sinen herren 30rl6, gewere 5rr24, 7rl25/26, 7vl32, 25rl9, 25r21, 25r22, 30r2, 44v21, 68vl7, 79v2, gewer 20vl9, 30r5, 30r9, 3 0 r l 0 / l l , 30rl3, 43rl5, 44v22, geweren 6vr22, 7vl33, 71rl4, gewerde 46rl4. H R G 1, Sp. 1658 ff.; DRWB 4, Sp.635ff.; Lexer I, Sp. 994f.; Grimm, DWB 4.1.3, Sp. 4785 ff.; Trübner 3, S. 159 -> lèti ; were gewer(e) sw.M. 'Bürge, Gewährsmann': Der jude enmus des kristen mannis gewer nicht sin 43vl6, gewer 36r22, 43rl3, gewern 3 2 v l l , 32vl5, 34vl2, 34v25, 34v30, gewere 6 r l l l , 34vl7, 36rl6, 39v30, 71r23, geweren 14r29, 14r29b, 36rl5, 43rl0, 63v21/22. geweren sw.V. 1. 'schwören, beschwören': Ab derherre nicht getruwen enwil, das das kint zu sinen jaren si kumen, das mus geweren uf den heiligen das kint 69r7,
271 geweren 30v34, 85rl4, gewere 25v5, gewerin 58r4, gewern 4 0 v l l , 41rl0, gewert 48vl2; 2. 'etwas gewähren, zugestehen': Wirt hes gewert, als recht is, der gewere mus entworten an siner stat vor das gut 34vl7, geweret 3 6 r l 5 / 1 6 ; 3. 'Gewährschaft für einen oder etwas leisten': Saget aber der herre, he wolles den man geweren 71r26, geweren 71r28, gewern 36r28, gewert 83r26; 4. 'jemandem etwas überlassen': Tut ein man sin lant besait us zu zinse ..., zu welcher zit he undir des stirbit, man sal is den erben besäet widerlasin, wen he is en nicht lenger geweren enmochte, wen di wile he lebete 55v28; 5. 'zulassen': Wer das erbe nimt, der sal di schult gelden also verre, alse das erbe gewert an der vamdin habe 12rl9; 6. 'betragen, sich belaufen auf': Nimant is ouch phlichtig, vor sinen knecht zu geldene vorbas wen als sin Ion gewert 35r29/30. gewette st. N. 'Geldbuße, die man dem Richter zahlen muß': Der richter sal nemen alle di gewette, di im gewettit werdin unde vor im beclait werdin 3rl28, gewette 3rl31, 5rl3, 5rrl0, 5rr26, 5vl27, 7vrl5, 22r26, 22r30, 24r5/6, 26r5, 28v28, 29v21/22, 29v23, 31v3, 33vl0, 34v20, 34v24, 35vl8, 35v34, 3 6 r l l , 44rl0, 45vl8, 48r31, 48v32, 49vl3, 52r22, 52vl9, 74r3/4, 77r22, 77v7, 78r8/9, 78rl5, 79r25, gewetti 56vl5, gewettis 76v22. H R G 1, Sp. 1674f.; DRWB 4, Sp.757ff.; Lexer I, Sp. 989; Grimm, DWB 4.1.3, Sp. 5698 ff. wette gewetten sw.V. 'ein Strafgeld an den Richter bezahlen': Ab ein man an sines vorsprechen wort nicht enjet unde aber der herre den vorsprechen schuldiget des, he mus dar umme gewetten 65rl, gewettet 78r20. -> wetten gewinnen st. V. 1. 'überführen, erobern, im Kampf oder im Rechtsstreit besiegen': wirt he dingvluchtig, he is in der clage gewunnen 36v28, gewunnen 44r8, 46r7, 75v6, gewinnen 26r27; 2. 'in den Besitz von etwas kommen, erhalten, erlangen': Dis buch gewinnet manchen vient 85rl, gewinnet 40v2, 84v29; 3. 'Buße, Frist, Schuld erhalten, erstreiten': unde umme alle schult, da der man sine buse mite gewinnet 22r25/26, gewinnet 22r30, 28vl2, gewunnene 22r22/23, gewunnen 26v6, 36r9, 44v2, 46rl3, 77v7, 85v4, engewinnet 79vl; 4. 'etwas oder jemanden gewinnen': Nimant enmag eine rechte gewere gewinnen mit lenunge 69v4, gewinnen lrl7, l v r l l , 18v7/8, 4 3 r l l , gewinnet 21r5, gewinne 3 1 r l 2 / 1 3 , engewinnet 36vl4, 79r24; 5. 'ein Kind bekommen, zur Welt bringen': Ein wip mag gewinnen elich kint 21v5, gewinne 6vr6, gewint llv22, 19r20, 54vl2, gewinnen 19v9, 21r34, 21v8, gewinnet 32r5,
Glossar
272 37r32, 80v8, gewunne 54v25, gewan 68v21; 6. 'Land bearbeiten, bestellen': Unde ab man vert über gewunnen lant 5vll2, gewunnen 3 3 r l 0 . -> ab(e)gewinnen; angewinnen gewis Adj. 'zuverlässig, sicher': sunder gewisse zal 'ohne Gewißheit über die D a u e r ' 10v25. gewis Adv. 'sicher, fest': Wer aber des kindis erbe is, den sal des kindis Vormunde ... gewis machin, das hes zu unphlicht nicht vortu \7t7. gewisen sw. V. 1. 'vor Gericht abweisen, zurückweisen, von Gerichts wegen versagen': Der richter enmag nimande von siner clage gewisen 6rl25, den man ... enmag man von der volge nicht gewisen 80rl 5; 2. 'weisen, zum Zweck der Belehnung verweisen an, einweisen auf ein Gut': der obirste herre enmag sine kindere mit deme gute an den herren nicht wider gewisen 56r5; 3. 'beweisen vor Gericht, schwören': das mus der böte gewisen uf den heiligen 67vl9. -» ab(e)wisen; bewisen 2; inwisen; wisen 3, 5 gewisbeit st. F. 1. 'Gewißheit': he neme di gewisheit, das dem clegere gerichtet werde noch des landis gewonheit 2vl27; 2. 'Bürgschaft, P f a n d ' : Unde sal anscriben di gewisheit, di man dem clegere tut noch des landis gewonheit 3rrl 1. gewisliche Adv. 'zuverlässig, auf sicherstellende Art und Weise': gewislichen uf den heiligen beredin 2rl5. gewonheit st. F. 'Rechtsgewohnheit, H e r k o m m e n ' : he neme di gewisheit, das dem clegere gerichtet werde noch des landis gewonheit 2vl28, gewonheit 3 r r l 2 , noch rechtir gewonheit 25vl0, noch rechter gewonheit 37v20/21, an unrechter gewonheit 4 7 r 2 6 / 2 7 , noch des landis gewonheit 55r9. gewunt Part.Adj. 'verwundet, verletzt': Swer ouch den anderen gewunt vor gerichte vurt 4vr30, gewunt 4vr29, 2 1 r l 8 , gewundet 25v25/26, 42r2, gewundete 3 8 v l 8 / 1 9 , gewundeten 27r26. gezien s t V . 1. 'zu etwas gehören, zu etwas zählen': Di zcwischin deme naile unde deme houpte sich zcu der sippe geczien mugen an glicher stat l l r 3 2 , gezcien l l v l ; 2. 'bezichtigen, zeihen': di wile enmag he nimande valsches geczien, da iener wandil umme tun dürfe 32vl8, gezien 43r20; 3. 'ziehen, fortbewegen': Phaffenkindere unde di unelich geborn sin, den gibt man zu buse ein vuedir houwes, alse zwene jerige ochsin gezien mugen 48r23; 4. 'hinhalten': der herre mochte anders an der schulde gezogen den man 64v28; 5. 'sich worauf beziehen, berufen': Dar
noch sal he gezug sin allir dinge, di man an en gezuit bi des riches huldin 50r6. -» zien 7 gezüg(e) st. sw. M . N . 'Zeugnis, Beweis': Alle, di der vatir nennet zu gezuge lr20, Swas aber ein man weis, des endarf man en nicht inren mit gezuge 12r28, gezuge 6rr20, 15v21, 26r22, 31v33, 36r32, 36v6/7, 43v33, 4 5 r l 3 , 45v3/4, 5 9 r l 6 , 61r22, 66v20, 6 7 r l / 2 , 71vl2, 73v2, 77r25, 85v9, 85vl9, 85v29, 86r2, 86r4, 86r7, gezug 19rl0, 26r26, 2 6 v l l , 31v24/25, 32v4, 45v2, 51vl7, 59r20, 61r6, 62v21, 6 3 r l l / 1 2 , 6 7 r l 7 , 67v8, 71vl2, 72r26, 72v25, 7 3 r l 8 , 73v2, 7 4 r l 8 , 7 4 v l l , 85v24, 85v25, 85v27, geczug 18vl8, 30v28, gezcug 86r4, 86r5, gezcuge 64v2, gezcugene 8 6 r 9 / 1 0 , gezugene 73rl8, 82v26/27, gezuges 12r28, 24vl, 31vl, 31v7, 31v25, 31v30, 49v30, 5 7 r l 7 , 64v6, gezugen 5rr30, 60vl4, gezuk 63vl8, getuch 14r29a, getug 15v29/30. Grimm, D W B 4.1.4, Sp. 6981 ff. gezüg(e) st. sw. M. 'Zeuge': Unde der herre buit mit gezuge zinsgut zu behaldene 7 r r l 9 , unde tut he das unde kundiget hes ieme mit gezuge 13rl4, gezuge 8 r r l 0 , 31v6, 4 3 r l 6 , 4 5 r l 8 , 56r31, 63r23, 63r25, 65v27, 6 7 r l 3 , 73r3, 74vl2, 7 5 r l 4 , 79v6, 79v8, 80r27, 85v20/21, gezug 7 r r l 7 , 8 r r l 3 , 12vl5, 12vl6, 14r6/7, 14r28, 1 7 v l 5 / 1 6 , 18v28, 27v27, 3 4 r l 9 , 40v20, 45r21, 45r24, 50r5, 5 7 r l 6 , 57vl0, 59r22, 59r24a, 59vl6, 61v4, 66r7, 66v22, 67r3, 67r6, 6 7 r l 9 , 67r26, 6 9 r l 0 , 70vl8, 72r30, 73r3, 78r31, 79v6/7, 8 1 r l 4 , 8 1 r l 7 , 81r20, 81v4, 81v6, 8 2 r l 6 , 83vl, 8 4 r l 4 , 84v8, geczug 38vl3, gezcug 78r5, 81r23, gezcuge 8 r r l 6 , gezugen 6rl28, 1 5 v l 8 / 1 9 , 43r9, 6 7 r l 4 , 71vl4, gezuk 31v9/10, 31vl2. Lexer I, Sp. 1005; Grimm, D W B 4.1.4, Sp. 6981 ff. gezugen sw.V. 1. 'zeugen, durch Zeugnis beweisen, den Zeugenbeweis erbringen': Des vronenbotin gezug stet vor zwene man, ab man is bedarf, da man mit siben mannen gezugen sal 12vl7, gezugen 12v24, 15rl3, 15vl7, 18r23, 1 8 v l l , 21v25, 23v30, 24v3, 27v23, 30v28, 31r36, 31vl8, 31v23, 33vl8, 34vl, 35v24, 36r8, 3 6 r l 0 , 36vl5, 36v24, 38v29, 40v7, 4 1 v l 9 / 2 0 , 4 2 r l 3 , 4 3 r l 9 , 43v30, 4 4 r l 6 , 44r26, 4 5 r l 6 , 46r9, 57r7, 5 7 r l 4 , 60vl2, 6 1 r l , 62v25/26, 63r4, 63r8, 63vl5, 63v28, 72r22, 73r24, 7 4 r l 3 , 7 4 v l l , 82v24/25, 8 5 v l 5 / 1 6 , gezcugen 5vl7, 7vl6, 8 5 v l l , gezeuget 7vl32, 62r2, gezuget 7vr6, 27v33, 31v3, 62r26, 64v4/5, gezugin 14r28/29, gezugit 12v22, 26v20, 34v28, 54r22, gezuigen 6 5 r 5 / 6 , gezugene 5rl27; 2. 'überführen': Wo man aber eigen gibit oder sezt oder eime manne gezugen wil an sin recht 12vl0. -> bezügen 1, 2; zügen gezweit
Adj. 1. 'halbbürtig (innerhalb der Verwandt-
Glossar
273
schaftsgrade)': Brudere unde swestere nemen irs ungeczweiten brudere unde swestere erbe vor den bruder unde vor di swester, di geczweit von vater unde von muter sin 31r5, geczweiten 3 lr8; 2. 'getrennt, geteilt': Man unde wip enhaben kein gezweit gut 4vr4, gezweiet 18r28, 82r27. gift st.N. 'Gabe, Geschenk': Von rechte ensal nimant wisen liebe noch leide, zcorn noch gift 9vl6, gift 13vl 8, 75vl0. gischen sw. V. 'gähnen': Ab der man sich wischet... gischet ..., dar umme enwettet he nicht 77r26.
odir
glich Adj. 'gleich, in gleicher Weise': Der phaffe nimt glich teil der swester in der muter rade 12r4, Phenninge sal der munczer halden phundisch unde ebene, swer unde gliche wit 32v20, Vorsten unde vrie herrin, ... di sin glich in buse unde in wergelde 47v24, glich l l r 3 3 , 1 lv25, 12rl0, 14rl7, 14vl7, 32v25, 57r31, gliche 7vrl, 1 l r l 6 , 1 lv28, 14vl6, 16v22, 26r3, 31r7, 37v6, 44r23, 45v9, 59r22, 70v22, 72v24, 7 3 r l l , 73rl2, glichen 48vl2, 72v25, glicher l l r 3 2 , 36v5, 45r6, 45r36, 8 0 r l l , glichir 10r25/26, glicheme 45vl, geliche 71v20. glichen st.V. 'gleichen': herren unde mannes valsche rat glichen wol untruwere tat 84r5, glich 7rll, glichen 48vl2. glit st.N. 1. 'Glied, Gelenk': Nu merket, wi odir wo di sippe beginne unde ende ...In des halsis glide ire kindere, di an zcweiunge von vatir unde von mutir geborn sin l l r 9 , Wundet man einen man an dem glit, das im vorgolden is vorgerichte 30vl0, glide l l r l 2 , l l r 2 4 , l l r 2 5 , 1 lr26, 1 lr27, glit l l r l 3 , l l r 2 8 , glides 31rlO; 2. 'Knoten, Gliedknoten': noch der czit, das das korn glide gewinnet 40v2. gloube sw. M. 'Glaube': Da zu behilden si allir ir aldis recht, was wider der cristenheit e unde wider deme rechtin gloubin nicht enwas 15r8, gloubin 50r4, 50v25. gnäde st. F. 1. 'Gnade, Gnadenlohn, Gunst': Wer uf gnade gedient hat, der mus den erbn gnadin manen 16r27, 16r28, gnaden 69r31; 2. zu gnaden vam 'in den Himmel auffahren': Der suntag was der erste tag, der je gewart unde wirt der lezte, alse wir ufsten suln von deme tode unde varn zu gnaden mit libe unde mit sele 41v5. golt st. N. 'Gold': Alle tuch gesniten zu vrouwenkleidem, golt noch silber ungeworcht, das engeburt den vrouwen nicht 17v3, golde 47v26, goldis 47v29. got st. M. 'Gott': Got is selber recht, dar umme is im recht Up 9vl6, Des vritagis machte got den man 41r31, gotes dinst 41vl, gotes urteil 73rl3, got 9v21, 9v30, 10r2, 26rl, 40rl6, 41r27, 41r29, 41v6, 46v6, 47r6, 47rl7, 75r24, 84v31, gotis 9vl9, 9v20, 10v23, 17r28, 18rl5,
47rl9, 47r20, 47r21, gote 3vll6, 40rl9, 41v3, 47r20, 47r23, 52r24, 85r2. -» dinst 4; hulde goteshüs st.N. 'Gotteshaus, Kirche': Wir vorbiten bi unsen hulden, das imant durch keines voites schulde noch im zcu leide der gotishuser gut, das sine voitie ist, wedir burne noch roube nochphende 3vl24/25, gotishus 83vl2, gotishusere 3vll4, gottishusere 50v26, gotishusern 3vll7/18, gotishuseren 3vll4, gotishuse 3vl31, gotshus 80rl3/14. gouding st. N. 'Gericht des Gaugrafen': sus getane ding sal man abir zu goudingen rügen 58r5. gougreve sw. M. ' G a u g r a f : Wen is ist der lantlute vrie kore, das si gougreven kisen zu iclicher gaen tat 23r5, gougreve 2 3 r l l , 27v31, gougreven 5rl5, 5rll0, 10v5, 22v33, 23rl2a, 23rl8, 23rl9, 53r6. gouschaft st. F. 1. 'Amt des Gaugrafen': An gouschafi is mit rechte kein len noch volge 23r3, gouschafi 5rl6; 2. 'Bezirk, Gaugrafensprengel': Dis selbe mus tun ein lantman dem andern, ab he en beclait in wikbilde ..., ab si beide in ... einer gouschaft siezzen 56v27/28. graben st.V. 1. 'abbauen, ausgraben': Silber enmus he nicht graben uf eins andirn mannes gute 19rl4; 2. 'graben, anlegen': Kein zinsman enmus steingruben noch leimgrubin grabin 22v24, grabin 53r23, gegraben 33r21. gräveschaft st. F. 'Grafschaft, Verwaltungsbezirk des Grafen': Vorliet ein greve siner graveschaft ein teil oder ein voit siner voitie, das is unrecht 52v27, graveschaft 23r21, 28rl9, 28v3, 28v4, 49r30, 49r34, 49v21/22, 52r6, 79v22. greve sw. M. 'Graf, Verwaltungsbeamter des Königs': Der greve sal haben sinen schultheisen an echteme dinge 5rll3, Uber achzcen wochen sal der greve sin ding uslegin 6vl21, greve 5rl9, 5rr5, 23rl8, 23v5/6, 28v4, 49r30, 49r34, 51v21, 52v26, 52v32, 79vl8, greven 5rl9, 10r27, 23r20, 27v32, 27v33a, 49r29, 49vl. gougreve; lantgreve; markgreve; phalenzgreve grüsen sw.V. 1. 'herausfordern, ansprechen': Swer kemphlich sinen genos wil grusen 5rl23, also vorwint man den ouch, der zu kamphe gevangen unde gegrusit ist 26r30, gegrusit 25r24, grusen 24v20, grusit 25r32; 2. 'antreiben': volgen im di hunde in den vorst, der man mus wol volgen, so das he ... di hunde nicht gruse 40r34. -» kemphlich guldin Adj. 'golden, aus Gold bestehend': Doch eret man di vorsten unde vrie herren mit golde zu gebene unde gibet en zwelf guldine phenninge zu buse 47v27.
274
Glossar
gurtel st. sw. F.M. 'Gürtel': ouch tu he von im vingerlin, vorspan unde alle iserin ringen unde gurtele 75v26. gurten sw.V. 'gürten': di wile ...he swerte 21v29.
gegurt mit eime
gut st. N. 1. 'Gut, Besitz': Man unde wip enhaben kein gezweit gut 4vr4, Kein wip enmag ouch irs gutis nicht vorgeben ane irs mannes willen 18r32, Wer sich selbe ouch von deme libe tut, sine erben nemen sin gut 33v22, gut lvr6, 3rl23, 3rrl, 3vl25, 3vrl3, 4vl32, 5rl32, 5vl28, 5vl29, 5vrl5, 5vrl6, 6rll0, 6rll2, 6rl23, 6rl32, 6 v r l l , 6vr23, 7rrl4, 7vr21, 7vr28, 7vr32, 8rll, 8rl5, 8rll6, 8rll9, 12v28, 12v33, 13r9, 13rl2, 13r20, 13r24, 13r25, 13v8, 13vl2, 13vl7, 13vl9, 13v23, 13v31, 13v32, 13v33, 16r2, 16rl3, 16v27, 17rl3, 18r29, 18v2, 19r3, 19vl7, 20r31, 22rl5, 23v22, 27r30, 27v2, 30v27, 31r24, 33v27, 34r23, 34r24, 34v7, 34vl8, 34v20, 34v31, 34v32, 35r9, 36r31, 36vl0, 36vl2, 36vl6, 36vl9, 39rl4, 39rl7, 39v25, 39v29, 4 3 r l l , 43r22, 43r24, 43r25, 43r27, 43v3, 43v7, 4 3 v l l , 44v24, 44v33, 45r36, 45v4, 45v35, 50v4, 50v7, 55v6, 55vl4, 55v21, 55v22, 55v31, 56rl, 57r27, 57v3, 57v26, 59v3, gute l r l 6 , l v r l 7 , lvr20, 2rr4, 2rr5, 5 v r l l , 5vr32, 6vrlO, 13v4, 13v25/26, 15v6, 15 v7, 15vl0, 15vll, 15vl5, 15vl7/18, 16r4, 16r5, 16rl7, 16v33, 18v7, 22vl6, 22v21, 22v22, 30v31, 31r34, 32r6, 36r20, 38r27, 39rl6, 40rl4, 41r6, 41rl7, 41v22, 52r26, 55r29, 55v2, 5 5 v l l , 55v20, 56r4, gutes 6vr25, 20r2, 32rl6, 33r5, 39v6, 55rl8, 60r26, gutis 17r7, 20v9, 25r8/9, 30v27, 34r30, 36rl7, 36r25, 36r34, 45vl4, varnde gut 4vll6, 13v32, 14r23, varndis gutes l r l 4 , bischove gut 7rr31, 65r28, riches gut 60rl2, 79r7/8, 80r6, riches gute 5 9 v l / 2 , 79r4a, 80rl2, 81r7, dubish gut 3vr6; 2. 'Lehensgut': Nimant endorf anderweide gut enphan 7rr24, Swelch man ... des sons darbit, der erbit uf den herren di gewer des gutes 60v21, gut 5vl28, 5vl29, 7rr7, 7rr8, 7rr21, 7rr25, 7vll, 7vl5, 7 v l l l , 7vll5, 7vll7, 7vll8, 7vll9, 7vl20, 7vl21, 7vl22, 7vl26, 7vl27, 7vl28, 7vl30, 7vrl, 7vr4, 7vr5, 7vr8, 7vr9, 7vrl0, 7vrl2, 7vrl6, 7vrl8, 7vr20, 7vr23, 8rll7, 31r32, 36rl3, 36v3, 39r21, 59rl3, 59r22, 59vl4, 6 0 v l l , 60vl9, 60v25, 61r3, 61r5, 61r7, 61rl2, 61rl5, 61rl9, 61r20, 61r23, 61vl2, 61vl7, 61v21, 62rl, 62r8, 6 2 r l l , 62rl3, 62rl5, 62rl8, 62r22, 62r24, 6 2 v l l , 62vl6, 63r6, 63rl2, 63v6, 63vl6, 63v25, 63v28, 63v30, 64r4, 64r6, 64r8, 64r22, 64r26, 64v9, 64vl3, 64vl4, 64v23, 65rl5, 65rl9, 65r26, 65v29, 66r5, 66r8, 6 6 r l l , 66r26, 66r29, 6 6 v l l , 67r8, 67rl5, 67r27, 67v8, 68r2, 68r3, 6 8 r l l , 68r23, 68v2, 68v4, 69rl5, 69rl9, 69v2, 69vl2, 69v28, 69v29, 69v30, 70r2, 70r5, 70r9, 70rl2, 70rl7, 70r23, 70r25, 70v6, 70v8, 70vl5, 70v21, 70v30, 71rl, 71r22, 71v5, 71vl5, 71v21, 71v24, 72rl, 72rl2, 72rl6, 72rl9, 72r24,
72r25, 72r27, 72v5, 72v8, 72v9, 72vl4, 72vl9, 72v24, 72v28, 73r22, 73v4, 73v8, 73vl4, 73v23, 73v27, 74r2, 74r4, 74rlO, 74vl8, 74vl9, 74v24, 7 5 r l l , 75rl6, 75r20, 75r22, 75r26, 75v7, 75vl3, 75vl5, 77rl, 77rl4, 78v23, 7 9 r l l , 80rl0, 80r24, 82v7, 8 2 v l l , 82vl2, 82vl4, 82vl8, 82v20, 82v27, 83r4, 83rl3, 83r22, 83v4, 83v7, 83v9, 83vl4, 83vl9, 84rl3, 84r22, 84r23, 84r27, 86rl, 86r3, 86rl0, gute 7rr5, 7rr9, 7vr7, 8rl28, 39v23, 39v27, 59rl4, 59v3/4, 60vl8, 61v8, 61vl0, 63rl3, 63rl7, 63r21, 63v4, 63vl8, 64rl3, 64rl5, 64r24, 64vl6, 65rl7, 65r22, 67v30, 68r6, 68rl6, 68rl8, 68r21, 68v8, 68v30, 69r9, 69v6, 70r2, 70v23, 70v26, 71r9, 71r24, 7 l v l 6 , 71v20, 72r7, 72r8, 72r9, 74v3, 74v22, 75r3, 75r30, 77rl2, 77r23, 80r8, 80r25/26, 80v3, 80v5, 80v7, 83r7, 83v21, 85rl3, 85r26, gutes 7rrl8, 7rr22, 8rl2, 60vl7, 61r9, 61v6, 62r9, 6 2 r l l a , 62vl7, 62v28/29, 63rl5, 64r2, 65v21, 65v23, 67r21, 68rl2, 68r26, 69r2, 70r29, 70v2/3, 71rl7, 71r20, 71v9, 71\11, 72v20, 73rl7, 73rl9, 73r26, 73r28, 73v6, 73vl8, 74r9, 74v5, 74v26, 75r4, 77r24, 78r29, 79rl3, 83r27; 3. 'Vermögen': Mit welchem gute der man stirbit, das heist alles erbe 12rl6, gut 2vr9, gute 1 2 r l l ; 4. 'Ertrag': Ab das kint sine jarzal behelt er den zinstagen, das das gut vordint is, is sal den zins usnemen 39v4, gutes 39v6. DRWB 4, Sp. 1286 ff.; Lexer I, Sp. 1122; Grimm, DWB 4.1.6, Sp. 1353ff.; Kluge/Seebold, S.283 -* zinsgüt
H habe st. F. 1. 'Habe, Eigentum': Wer in siner suche sine habe vorgibt oder usseczt zu der zit, so hes nicht getun mag, das wip ... sal dar umme nimande schuldigen 22r7, habe 30rl5; 2. vamde habe 'Fahrhabe, bewegliche H a be': Stirbit ein kint oder begibt man is binnen sinen jaren, wer sine vamde habe under im hat, der sal si entworten deme, uf den si noch sime tode irsterben mochte 17v27, Stirbit aber das wip bi des mannes libe, si enerbit keine varnde habe wen gerade unde eigen 18r30/31, vamde habe 5vrl9, 7rl32, 12v32/33, 21v28, 29r27, 3 0 r l 2 / 1 3 , 33v3, 40r7, 43r7, 49rl5, vamdin habe 12rl9, 55v8, vamden habe 18v5, varnder habe 18rl8. h» DRWB 4, Sp. 1362 ff.; Lexer I, Sp. 1129 f.; Grimm, DWB 4.2, Sp. 42 ff. hafte st. F. 'Haft, Gefangenhaltung': Wer einen man gevangen hat, der mus entworten iclichem sime herren ..., wirt he dar umme beschuldiget, di wile he en in der hafte hat 34rl1.
Glossar
275
hals st. M. 'Hals, Leben': Buitet der munczer einen valschen phenning us, das he da mite koufen wil, is get im an den hals 32v8, hals 29v20, 29v29, 29v33, 35r25, 44rl3, 49r32, 78v28, halsis l l r 9 , bi deme halse 'bei Strafe des Hängens' 25v21. handelös Adj. 'ohne Hände': Wirt ein kint geborn stum oder handelos oder vuoselos oder blint, das is wol erbe zu lantrechte unde nicht zcu lenrechte l l v l 2 / 1 3 . hant st.F. 'Hand': der richter ... sal en nimmer us der achte gelasin ane des clegers willen, oder he vorlise di hant dar umme 2rr28, hant 2vl8, l l r 2 4 , 25vl5, 25vl7, 30r9, 32vl0, 49r31, 50r30, 79vl7, 80r5, 8 3 r l l , hende 65vl7, 65v20, henden 25vl3, 30r31, 65vl4, lip oder hant 4rl24, 5rl24, 10vl2/13, 26r32, 27rl, 48v30, sine vordirn hant 'seine Schwurhand' 15r3, vordere hant 28vl5, mit gesamenter hant 'gemeinschaftlich, gesamthänderisch' 70v21, zu hant 'sofort' lvl4, 14rl5/16, 20r6, 20r26, 22r32, 24v2, 24v31, 27v24, 27v33b, 32r29, 32r31, 36v29, 37rl0, 38v25, 44r24/25, 45vl2, 51vl8, 62r8, 66rl2, 66vl3, 69rl9, 72v20, 85r30, zcu hant 3vr9, 67v22, in keiner hande 'in irgendeiner Art' I r l 8, durch keiner hande ding 3rr27, aller hande 'alles, irgendetwas' 3rl27, 83v20, manchirhande 'mancherlei, einige' 17r32, zcweier hande 'zweierlei' 7 9 r l l , drier hande 'dreierlei' 10r22, 14v28, 19v21, 7 9 r l l , welcherhande 'irgendeine' 35v9, 40r6. H R G 1, Sp. 1960ff.; DRWB 5, Sp.58; Lexer I, Sp. 1170 ff.; Grimm, DWB 4.2, Sp. 324 ff.; Trübner 3, S. 309 ff.; Kluge/Seebold, S.290 lip hantgemal st. N. 'Stammgut': Kein schephinbare man darf sin hantgemal bewisen 6rrl0, hantgemal 21vl6. H R G 1, Sp. 1960ff.; DRWB 5, Sp.58f.; Lexer I, Sp. 1173; Grimm, DWB 4.2, Sp.409 hanthaft Adj. 'offenkundig': Die hanthafte tat is da, wo man einen man mit der tat begrift oder in der vlucht der tat 34rl2, Der ouch mit dube oder mit roube einen gevangen vor gerichte brenget, der sal clagen mit gerufte durch di hanthafte tat, di si mit den luten vorbrengit 40v29, hanthaft 34r28, hanthafte 5rl27, 22v31, 32r27, 40v25/26, 40v32, 40v36, 40v37, 5 7 r l l , hanthaften 5vll9, 6rrl7, 6vr31/32, 7rl24, 20r25, 2 3 r l 3 / 1 4 , 26vl6, 34r20, 35v24, 41v8, 42rl2, 42rl4, 50rl6, 54r20, 57r24, hanthafter 5rl5. H R G 1, Sp. 1965ff.; DRWB 5, Sp.57f.; Lexer I, Sp. 1180; Grimm, DWB 4.2, Sp.397 tat 2 hantvride
st. M.
'durch
Handschlag
geschlossener
Friede': Wil aber, der den hantvride gemachit hat oder enphangen, nicht gesten des rechten, das he an im gebrochen si, dem sal der richter gebiten bi des keisers hulden, das her im sins rechtis gehelfe 2vl2, hantvride 2rrl9, 2rr21. DRWB 5, Sp. 47 f.; Lexer I, Sp. 1180; Grimm, DWB 4.2, Sp. 388; Trübner 3, S.309ff. har st. N. 'Haar': Swelches mannes alder man nicht weis, hat he har an dem barte ..., so sal man wissen, das he zu sinen tagen kumen is 20rl4, Man ensal über kein wip richten, di lebinde kint treit, hoer wen zu hut unde zu hare 43r2, har 19r30, 33r31, hare 29r22, 53rl0. hüt hamasch sime sune bedarf..., mit sinen
st. N.M. 'Harnisch, Rüstung': Gibet der vater kleidere ... unde hamasch zu der zeit, als hes stirbet sint der vater, he endarf des nicht teiln brudern 13r31, harnasch 16v7.
has st. M. ' H a ß , feindliche Gesinnung': Swer zu allen dingen gerne rechte spricht, he gewinnet dar ab manchen has 84v30, has 14v30, 47vl0. hegen sw.V. 1. 'hegen, pflegen, aufbewahren': Swer wilde tir hegen wil 5vr23, hegen 40vl3; 2. 'umzäunen, mit einem Zaun umgeben': Ungewunnen lant, wer dar über vert, is ensi denne eine gehegete wise, der blibet is ane wandil 37r23. heil Adj. 'gesund, heil': So sal he wisen di wunde odir di narwe, ab si heil is 25r7. heilig Adj. 'heilig': Des heiligen geistis minne 9vl, von der heiligen schrift 10vl9/20, heilige schrifi 46v30, heilige tage 41r21. -» schrift heilige sw. M. 'Reliquie, Heiligenstock': Ab der man aber vor den herren kumt, he bitte aller erst vorsprechen, da noch der heiligen unde des stebers, das he sin gut uszeie 75rl9, heiligen 50vl, 75r21, 75r24, uf den heiligen 2rl5, 14r3, 15v20, 15v29, 16r27, 25v5, 27v2, 30vl9, 30v34/35, 33v32, 34r7, 34v8, 36r7, 4 0 v l l , 41rl0, 42r28/29, 48vl3, 57v9, 58r4, 63r5, 63v3, 67rl6, 67r26, 67vl6, 67vl9, 69r7, 70r27/28, 7 3 r l l , 74vll, 76v22/23, 77rl6, 77vl9/20, 78r20, 82v24, 8 5 r l 3 / 1 4 , zu den heiligen lr23, lr26, lvl27, lvr26/27, 3rr25/26, zcu den heiligen I r l 1, 2rr20, 2vl5/6, 2vrl7, 3rl21/22. DRWB 5, Sp. 575 f.; Lexer I, Sp. 1214; Trübner 3, S. 384ff. heischen sw.V. 'fordern, auffordern': das sal man entwortin dem richtere oder dem vronenboten, ab hes heischet noch dem drisegisten 18rl0, heische 22vl2, heischen
Glossar
276 42rl 1, heischet 42r20, heischit 44v33, 5 1 v l 2 / 1 3 , geAewcAi 5 1 v l 6 / 1 7 . vorheischen; widerheischen helfe st. F. 'Hilfe, Unterstützung': Z)i ¿/«¿e behalden oder roup oder di si mit helfe dar zu Sterken, werdin si des vorwundin, man richtet über si als über iene 29v4, helfe l v l l , 9vl0, 21v32, 47v8, rate oder helfe lr24, lr29, ratis unde helfe 48v3. helfen st.V. 1. 'helfen, beistehen': Wo der man recht vordert, da sal he rechtis phlegen unde helfen 24r7, Welch man sin eigen gibt unde das wider zu lene enphet, den herrin hilft di gäbe nicht 19r2, helfe 26r2, 75r24, helfin lvll4, 53v21, 53v29, hilfet l v l l 8 , lvl20, 39r5, hülfen 18vl9, enhilf 63r24; 2. 'nützen': Wen im das mit urteiln irteilt wirt, das he tun muse, so vrage he, wo he sich sin undirwinden sulle, das is im helfinde si zu sime rechte 24v26, helfende 61v28, 85v6c. hengen sw.V. 'hängen, aufhängen': Den dip sal man hengen 2 9 r l 9 , hengen 38r5. her st. N . ' H e e r , Kriegsheer': Unse vorderen, da di herquamen unde di Doringe vortriben, di waren in Allexanders her gewest 47v7. herberge st. sw. F. 1. 'Herberge, U n t e r k u n f t ' : Swert enmus man ouch nicht tragen an bürgen ..ane alle, di dar inne wanunge oder herberge haben 41v33, herberge 57v30, 5 8 r l l , 82vl5; 2. 'Stall': Ein iclich vie, wen is sine jungen gewinnet, wo is des abindes zu herbergen kumt, da sal man das vie vorzenden 37r33. herbergen sw.V. 'beherbergen, jemandem U n t e r k u n f t geben': Wir sezcin unde gebiten, das nimant einen echter behalde oder herberge 2vrl2, herberget 6rr2, herbergit 7rl5, 45vl6, 57v28. hergewete st. N. 'Heergewäte, Kriegsausrüstung': Wo zwene man oder dri zu eime hergewete gebom sin, der eldiste nimt das swert zu vor 16v20, hergewete 4vl2 7, 4vrl, 15rl5, 16v5, 16vl2, 16v25, 17rl6, 18r3, 18r6, 18r8, 30rl 1, 44v29, 44v37. H R G 2, Sp. 29f.; D R W B 5, Sp.520ff.; Lexer I, Sp. 1256; Grimm, D W B 4.2, Sp.757 herphül st. M. 'Feldbett': So sal di vrouwe zu hergewete gebin irs mannes swert unde das beste ros ... unde ... einen herphul 16v9. herre sw. M. 1. ' H e r r , Gebieter': oder sine bürg buwen wil, der sal oder mit siner lute gute unde nicht 2rr2, Von deme erbe sal man allir
swelch herre sine stat buwin mit sime gute von der lantlute gute erst geldin dem inge-
sinde ir vordiente Ion, als en geburt bis an den tag, da ir herre starb 16r20, herre 6vrl2, 7rr26, 7vl6, 7vl8, 7vr3, 7vr6, 7vrl 9, 8rl6, 13rl6, 30v32, 32v5, 35r31, 35vl0, 39v8, 3 9 v l l , 39vl2, 39vl3, 39vl8, 39v20, 42r28, 42r33, 42v5, 43vl3, 46v34, 48v28, 53v9, herren 5rr4, 6rll0, 6vll6, 6vrl4, 19v7, 3 0 r l 8 , 3 4 r l , 34r3, 34r4, 34r5, 34r7, 3 4 r l 0 , 35r33, 35v5, 43vl2, 43vl4, herrin 51 r l 3 ; 2. 'Lehensherr': Ab der herre mus wol usnemen sinen eigenen man 5vll, Wil ein herre vorwisen sinen zcinsman rechte 5vrl7, herre 7rr7, 7 r r l 3 , 7 r r l 5 , 7 r r l 8 , 7 r r l 9 , 7rr22, 7rr25, 7rr30, 7vl2, 7vl8, 7 v l l l , 7vll5, 7vll7, 7vl23, 7vl26, 7vl34, 7vr2, 7vr4, 7vr8, 7vr9, 7vrl0, 7 v r l l , 7vrl3, 7vrl6, 7vrl8, 8rl3, 14r9, 2 2 v l l , 22vl4, 22v20, 23r6, 31r32, 38r31, 39v22, 39v28, 56r2, 5 9 r l 2 , 5 9 r l 9 , 59v32, 60vl, 60v4, 60v22, 60v25, 6 1 r 3 / 4 , 61r7, 61r9, 6 1 r l 6 , 61r30, 6 1 v l l , 61vl7, 62r7, 6 2 r l 0 , 6 2 r l l a , 6 2 r l 2 , 6 2 r l 7 , 62r27, 62v4, 6 2 v 6 / 7 , 62v8, 62v9, 62v28, 6 3 r l 3 , 6 3 r l 9 , 63r22, 63r27, 63vl8, 63v27/28, 64r6, 6 4 r l l , 6 4 r l 4 , 64r20, 6 4 v l , 64v9, 64vl3, 64vl7, 64v25, 64v27, 64v31, 65r22, 65vl4, 65v22, 65v27, 6 6 r l l , 6 6 r l 3 , 6 6 r l 6 , 66r20, 66r23, 66r25, 66r28, 66r32, 66v5, 66v8, 6 6 v l l , 66vl6, 66vl9, 66v24, 66v27, 66v30, 67r5, 67r7, 67r9, 6 7 r l 4 , 6 7 r l 7 , 6 7 r l 8 , 67r22, 67v3, 67v8, 67vl6, 6 8 r l / 2 , 68r7, 6 8 r l l , 68r21, 68r23, 68r24, 68r25, 68v2, 68v3, 68v6, 68v25, 68v29, 69r5, 69r9, 6 9 r l 7 , 69r23, 69v3, 70r8, 7 0 r l 3 , 7 0 r l 6 , 7 0 r l 9 , 70r23, 70r27, 70v6, 70vl7, 70vl9, 7 1 r l 2 , 7 I r l 3 , 71r20, 71r21, 71r26, 71v5, 7 1 v l l , 71vl3, 71vl8, 71v25, 72v9, 72vl3, 72v23, 73r4, 7 3 r l 6 , 73r21, 73r24, 73r27, 73v3, 73v5, 73v8, 73vl6, 7 4 r l 3 , 7 4 r l 6 , 7 4 r l 8 , 74r20, 74r22/23, 74vl, 74v5, 74vl2, 74vl9, 74v23, 75r3, 75r7, 7 5 r l 2 , 75r20, 75r25, 75r26, 75r27, 75vl, 75vl2, 75vl5, 75v28, 76r2, 76r5, 76r7, 7 6 r l 2 , 7 6 r l 5 , 76r28, 76vl2, 76v23, 76v26, 77r6, 77vl9, 7 8 r l 3 , 78r30, 78vl, 78vl4, 79r24, 80r9, 80r30, 8 0 v l l , 8 1 r l 3 , 81v7, 81vl7, 81v20, 81v24, 82rl, 82r5, 8 2 r l 2 , 82vl, 82v5, 82v6, 82vl0, 83r4, 83r22, 83r24, 83r26, 83vl, 83v8, 83vl6, 83v22, 83v26, 84r2, 8 4 r l 6 , 84r20, 84r22, 84r26, 84vl6, 85r5, 85rlO, 8 5 r l 7 , 85r30, 85v6b, 85vl8, 85v21, 86r3, 86r5, 86r7, herren 5rr20, 7rr3, 7 r r l l , 7rr21, 7rr23, 7vl4, 7vll3, 7vll6, 7vl27, 7vl30, 7vr32, 8rl6, 8rl8, 8rl9, 8 r l l l , 8rl20, 8rl27, 8rl29, 22v24, 23v23, 28r3, 3 1 r l 8 , 31r26, 31r35, 3 2 r l 8 , 33v33, 3 6 r l 4 , 3 7 r l 6 , 39v26, 55r7, 56r4, 5 9 r l 6 , 59r29, 59r34, 59v4, 59v9, 59vl 1, 59vl3, 59vl7, 59v29, 6 0 r l l , 6 0 r l 8 , 60r29, 60vl2, 60v21, 61r2, 61r5, 6 1 r 5 / 6 , 61r9, 6 1 r l 9 , 61r27, 61v2, 61vl8, 61v21, 61v23, 62r4, 62r9, 6 2 r l 7 , 62r21, 62r25, 62vl5, 63r2, 6 3 r l 7 , 63r26, 63v3, 63v5, 63v6, 63vl6, 63vl7, 63v22, 63v25, 6 4 r l , 64r2, 64r4, 64r7, 64r9, 6 4 r l 2 , 6 4 r l 6 , 6 4 r l 9 , 6 4 r 2 3 / 2 4 , 64r26, 64r27, 64v2, 64v5, 64v6, 64v21, 64v23/24, 64v26,
Glossar 65r24, 65vl3, 65vl7, 66v23, 66v31, 67r21, 67r22, 67r24, 67v21, 68rl, 68r3, 68r5, 68rl3, 68v4, 68v8, 68vl6, 69r8, 69rl3, 69r21, 70rl, 70rll, 70rl2, 70rl5, 70r20/21, 70r29/30, 70v2, 70v3, 70vl0, 70v24, 71rll, 71v8, 71vl6, 71v22, 71v23, 72r2, 72rl2, 72rl3, 72r21, 72r23, 72r25, 72r26, 72r28, 72r31, 72v7, 72vl5, 72vl9, 73rl9, 73v2, 73v20, 73v23, 73v26, 74rl, 74r3, 74r26, 74v4, 74v5, 74v7, 74v8, 74v9, 74vl6, 74v20, 74v27, 75rl0, 75rl4, 75rl7, 75rl8, 75v2, 75v8, 75vll, 75vl8, 75v21, 75v30, 75v31, 76r2, 76r8/9, 76rl8/19, 76r20, 76vl6, 76vl9, 76v21, 77r2, 77r4, 77r5, 77rll, 77rl4, 77rl5, 77rl8, 77v9, 77vl5, 77vl7, 77v22, 78r5, 78rl0, 78rl 1, 78r29, 78v24, 79r3, 79rl2, 80r26, 80r28, 80v2, 80vl9, 81 r l , 81r9, 81rl2, 81rl6, 81vl, 81v3, 81v8, 82rl4, 82r26, 82v3, 82vl6, 82v21, 82v30, 83rlO, 83rl4, 83rl7, 83r28, 83v5, 83v7, 83vl0, 83vll, 83vl8, 83v22, 83v27, 84r3, 84r5, 84r6, 84rl2, 84rl4, 84rl8, 84r24, 84v4, 84v5, 84v6, 85rl2, 85r25, 85r27, 85r30, 85vl7, 85v22, 85v27, 86r2, 86r5, 86rll, herin 12v35, 22v6, herrin 7v131, 7vr5, 13v2, 17rl, 18v24, 19r2, 19r33, 21v23, 39v28, 49rl2, 61v9; 3. 'Adliger, vornehmer Herr': Von der herren gehurt 3vrl5, Under den vrien herren sin Swaben di von Hakenburne 3vr22, herren 3vrl7, 47vl7, vri herren 4rll4, vrie herren 47v25/26, vrie herrin 47v23/24, vrien hern 10v30, vrien herrin 10v31. DRWB 5, Sp. 781 ff.; Lexer I, Sp. 1259; Grimm, DWB 4.2, Sp. 1124 ff.; Trübner 3, S.418f.; Kluge/Seebold, S. 3 06 f. herschilt st. M. 1. 'Heerschild, Schild als Zeichen des Kriegsaufgebots, Heerbann': ein man mus wol sinen herschilt niderlegin ane sins wibes willen 17v24, herschilt 4rll9, 8rr5, llr4, 17vl5, 31v22, 53rl7, 59v2, 65v7, 78r3, 83r7/8, herschilde 10v26, 59r23, 59r24a/25, 59r26, 59r31, 74vl5, 81r21, 81v3, 84v9, 85vl6, 85v22/23, 85v28, herschilden 4vl3, herschildes 7rr2, 18r5, 59rl8, 59r28, 59r30, 59r32/33, 59v8, 66rl7, 78rl, 83r6, 83r23; 2. 'Symbol der lehensrechtlichen Ständegliederung, Heerschildrecht': Swen man kuset bischove odir epte odir eptischinnen, di den herschilt haben, das lien suln si vor enphan unde di bisorge nach 51r21, Alrest sul wi merken, das der herschilt an deme kunige begint unde in deme sibendin lent 59r4, Len zu burmeisterschaft geligen erbet der burmeister uf den son, alleine darbe he des herschildes 84v3, herschilt 10v36, 79rl. -» H R G 2, Sp. 1731 f. (Lehn(s)recht, Lehnswesen); DRWB 5, Sp. 530ff.; Lexer I, Sp. 1263; Grimm, DWB 4.2, Sp. 760 schilt 1 herstüre st. F. 'Kriegssteuer, Heersteuer': Belent wip oder mait ensin nicht phlichtig, hervart zu dinene, mer
277 hersture sullen si geben noch gesazteme rechte 71v3, herestuire 74r29. hervart st. F. 'Heerfahrt, Kriegszug': dise hervart sal man gebiten sechs wochen unde ein jar unde dri tage vor er der samenunge 60rl4, hervart 60rl6, 71v2, 81rl0, des riches hervart 8rl26, 85rl5. hervluchtig Adj. 'fahnenflüchtig': Wer truwelos beredit wirt oder hervluchtig us des riches dinste, deme vorteilt man sine ere 19v25. herzöge sw. M. 'Herzog, dem König verantwortlicher Beamter mit den Rechten eines Grafen, aber größerem Amtsbereich': Dem herzogen wettit iclich edil man zen phunt 52vl5, herzöge 51r3, 60r7/8, herzogen 49v8, herzcogen 4rll2. himel st. M. 'Himmel': Des dunrstagis vurte got unse menscheit zu himele unde offente uns den weg hin, der uns beslossen was 41r29, himel 9v23, 41r33. hö, hoch Adj. 'hoch': Wi ho ein man bürgen sezcin sal 5rrl5, Man ensal über kein wip richten, di lebinde kint treit, hoer wen zu hut unde zu hare 43r2, Schilt man ein urteil, des sal man czien an den hogem richter 28rl5, ho 21v32, 35rl8, 74vl5, hoch lvll3, 53v3, hogem lvl22, hoer 30vl2, 31v2, 31v5, 36rl0, 58r9, hoget 7rr33, hogisten 53r6, hoe lute 3rl 15, hoe sache 3rll7, in deme hoestin gerichte 45v21, das hoeste gerichte 29r24, das hoeste gewette 29v21/22, di hoestin dingstat 15r20. höchzit st. F.N. 'Feiertag': Der sal alle tage zcu gerichte siezen ane an deme suntage unde an anderin grosen hochzeiten 3rll2/13. hof st. M. 1. 'Hof, Lehenshof: Iclichen hof unde worte ... vorzendit man mit eime hune an Sente Mertinstage 37v2, hof 5vr7, 37vl6, 38r6, 38rl3, 38rl8, 53v2, 75r6, 75r9, 81v27, 82v2, hove 38rl9a, 38r21, 43r26, 51vl4, 78v23, hoves 38r7, 75r7; 2. 'Hoftag': Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen in dem lande, da der kunig echte hove haben sal 51v33, hof 6vl25, 52v6; 3. 'kaiserlicher H o f : Wir sezcin, das unse hof habe einen hoverichter, der ein vri man si 3rl7; 4. 'königlicher Hof': Wen si den kunig von erst irvam binnen sechsischer art, so suln si zu hove varn unde da noch über sechswochen das urteil widerbrengen 28r30; 5. 'Gerichtshof, Gerichtsplatz': swo he offenbar dinget, das is der hof 81 vi 3, hof 75vl7, 81v29, hove 77v27. DRWB 5, Sp. 1162 ff.; Lexer I, Sp. 1320 f.; Grimm, DWB 4.2, Sp. 1654 ff.; Trübner 3, S.459f.; Kluge/Seebold, S. 313 hofvart st.F. 'Hoffahrt, Zug zum Hof des Lehensherrn':
278 Von burglene enis he nicht phlichtig, sime herren zu dinene noch hofvart noch hervart me 8 I r l 0 , hofoart 85rl5. hören sw. V. 'hören': Swenne der son noch des vater tode lebet alse lange, das man sine stimme hören mag 65r8, Dise dri sache mus der herre bas gezugen mit zcwen sinen mannen, di is sagen unde horten 74r24, horten 22vl8, 60vl5, 74rl9, hört 18v28, gehört 18vl9, 3 1 v l 0 / l l , hören 23v29, 28rl7, 36vl, 59v23/24, 73r4, 77v27, 81v28, 82r7, 84rl0. hört st. F. 'Scheiterhaufen': Welch cristenman oder wip ungloubig is unde mit czouber ummeget... unde des vorwunden wirt, di sal man uf der hört burnen 29v9. houbt, houpt st. N. 1. 'Kopf, Haupt': In dem houpte is beczeigit man unde wip 1 lr7, Der den man slet oder vet oder roubet oder burnet..., den sal man das houpt abeslan 29v3, houpte 11 r31, houbt 25vl2; 2. 'Oberhaupt': Noch hat Rome das werltliche swert unde von Sente Petirs halben das geistliche, da von heist si houbet allir werlde 47v5. houwen sw. V. 1. 'niederreißen, zerhauen, zerschlagen': Da suln di lantlute zu helfin mit houwin unde mit rammen 53v22; 2. 'abmähen, abschlagen, abernten': Wer des nachtis gehouwen gras oder gehouwen holcz stilt 33r28/29, 33r29, houwen 22v25, 39vl7, houwet 33rl7, 33r21, 33r23; 3. 'abhauen, abtrennen': Wundet man einen man an dem glit, das im vorgolden is vor gerichte, houwit man is im suber ab, he enmag da kein hoer gelt an gevordem wen sine buse 3 0 v l l . üfhouwen hoverichter st. M. 'Hofrichter': Wir sezcin, das unse hof habe einen hoverichter, der ein vri man si 3rl8, hoferichtere 3rl6. hulde st. F. 'Treue, Treuversprechen, Huldigung': Der man sal phlichtig sime herren hulde tun 5 9 v l l , bi des keisers hulden 2vl4, bi des riches huldin 50r6, bi des kuniges hulden 57r7/8, gotis hulden 9v6, hulde 3vll6/17, 8rr9, 45r22, 49v28, 50r28, 74vl0, hulden 2vll 1, 2vr8, 3vl23, 49v29, 53rl2, 73r5, 74v8, 85vl9; huldin 53r2. hüs st. N. 'Haus, Wohnung': Ubir den wirt, der en beheldit, sal man richten als über einen echter unde sin hus zcuvuren 3rll, Di tochter, di in deme huse is unbestat, di teilt nicht irre muter rade mit der tochter, di usgeradet is 1 lv30, hus 37rl6, 37v3, 38r30, 84rl0, huse 3vr7, 22vl3, 26r9, 37r35, 37v24, 43v26, 43v30, 46rl2, 51vl4, 77vl5, 78v23, huses 65r9. hüsgenös s t s w . M . 'Mitvasall, Gefolgsmann, Lehensge-
Glossar nosse': Ein man mag sinen husgenos mancher sache bas vorzeugen den der herre den man 72v22, husgenose 74vl6/17, husgenosen 76vl2, 77r9, husgenosin 61r6/7, 75rl3/14. husten sw.V. 'husten': Ab der man ... snuzeet ... oder hustet ..., dar umme enwettet he nicht 77r26/27. hüt st. F. 'Haut': zu hut unde zu hare 'zu Haut und Haar, Züchtigungsstrafe' 43r2, zu hüte unde czu hare 29r22, zu hüte unde zu har 33r31, vor hut unde vor hare 53r9/10, hut unde har 19r30, hut 44r35. H R G 2, Sp. 1787 (Leibesstrafe); DRWB 5, Sp. 489ff.; Lexer I, Sp. 1408 f.; Grimm, DWB 4.2, Sp. 701 ff.; Trübner 3, S. 363 ff.; Kluge/Seebold, S. 363 ff. -» hir hüten sw.V. 'achthaben, achtgeben': sich an den gotishusern hüten 'auf die Kirchen achtgeben' 3vll8. hüve st. sw. F. 'Hufe, Landstück von bestimmter Größe': Der butel sal zu minnesten haben eine halbe huve eigens 51v27, halbe huve 18v31, 62vl6, 78r3, huven 18rl9, 37vl5, 38v6, 48r8, 75r8, Hove 75r5.
I ingebom Part.Adj. 'von Geburt an': Doch sten gewern einen man mit eineme offen also das si da mite senden irn ingebornen das gut vorste an ire stat 36r30, ingebom
mugen di vurbrive besigelt, dinstman, der 30v35.
ingesigel st. N. 'Siegel': Der kunig mus wol tedingen zu lenrechte einen vorsten über sechs wochen mit sime brive unde mit sime ingesigele in eine bescheidene stat 8 1 v l l , ingesigele 52v8. ^ brif 2 ingesinde st. N. 'Dienerschaft im Haus des Herrn': Von deme erbe sal man allir erst geldin dem ingesinde ir vordiente Ion 16rl9, ingesinde 22r9. inkumen Part.Adj. 1. 'eingewandert, zugezogen': Ein iclich inkumen man enphet erbe in dem lande zu Sachsin noch des landes rechte 18r24; 2. 'hineingekommen': Doch ensal man nimande vorteiln sinen lip mit der vorvestunge noch mit der achte, da he mit namen nicht inkumen is 26v23. inladen sw. st. V. 'einladen, vorladen, vorfordern': Der cleger unde uf den di clage get, di musen wol gespreche
Glossar haben um icliche rede driens, also lange, bis si der vronebote wider inlade 24vl4. -*• laden 1; vorladen inren sw.V. 1. 'erinnern, den Erinnerungsbeweis führen': Der schult, di der man schuldig is, der darf man en nicht inren 12r34, inren 12r27, geinret 12r24; 2. 'überzeugen': swenne he mit der schephin gezuge der warheit geinret wirt 45v33. inriten st. N. 'Einreiten, Hineinreiten in ein Gut, das Gut in Besitz nehmen': he is von im ledig des inritens unde nicht des uflasens 13rl8. DRWB 2, Sp. 1441; Lexer I, Sp. 1442; Grimm, DWB 4.2, Sp. 1087, 1421 intragen st. V. 'hineintragen, nach Hause tragen': Vellit ein man oder wirt he gewundit..., wer den intreget, unde stirbit he denne binnen sinen geweren, he blibit is ane schadin 57v24. inwisen sw.V. 'einweisen in ein rechtlich zugesprochenes Gut, anweisen auf, belehnen mit': man sal en dar inwisen unde sal is en geweidigen 27r31. -» bewisen 2; gewisen 2; wisen 5 inwisunge st. F. 'Einweisung auf ein rechtlich zugesprochenes Gut oder auf ein Lehensgut': Die inwisunge mag der man entreden binnen der jarzal uf den heiligen 27vl. -* bewisunge; wisunge Ir-
er-
irregen unr.V. 'irregehen, sich täuschen': di der warheit irre gen 46v20, ginge ... irre 9v26/27. irren sw. V. 'verhindern, behindern': Swen echt not irret, das he zu lenrechte nicht enkumt, der sende dar sinen boten, der sine not da bewise uf den heiligen 67vl4, irren 25v24, irret 67v24, 79rl4. isen st. N. 'Eisen': das heise isen tragen 'Form des Gottesurteils' 4vrl3, das gluende isen zu traine 19v22. iserin Adj. 'eisern': di pukele, di mus wol iserin sin 25vl9, iserin 75v26.
J jagen sw.V. 1. 'jagen, auf der Jagd sein, ein Wild jagen': Jaget man ein wilt busen deme vorste 40r31, Nimant enmus di saet tretin durch jagen noch durch hezzen 40vl; 2. 'jagen, verfolgen, hetzen (eines Verbrechers)': unde jaget man einen ritenden oder zu vuse 40rl. ab(e)jagen
279 jär st. N. 1. 'Jahr': Der sal bi dem ammechte bliben zcum minsten ein jar, ab he sich wol unde rechte beheldet 3rll0, Ubir ein unzcwenzig jar, so is der man zu sinen tagen kumen 20r9, Uber sechzcig jar, so is he über sine tage kumen 2 0 r l l , jar 37v26, 39r27, 47r9, 47rl3, 47rl4, 60rl4, 63rl, 63r20, 6 4 v l l , 66r9, 6 8 v l l , 68vl9, 74r31, 78r4, 79v24, jare 10r20, 16r26, 17r6, 17r7, 17vl9, 36rl9, 37v23, 37v24, 68rl9, jaren 10vl8, 18r20, 49rl0, 55v25; 2. jär unde tag 'Jahresfrist, die genau ein Jahr, sechs Wochen und drei Tage beträgt': dise hervart sal man gebiten sechs wochen unde ein jar unde dri tage vor er der samenunge 60rl5, jar unde tag 6rr21, 1 8 r l l , 18r21, 19r4, 19r31, 19vl0, 33v24, 36r20/21, 36vl0, 51v2, 62rl6, 63rl4, 7 2 r l 4 / 1 5 , jar unde tage 19v2, 49v25, jare unde tage 36r4, 61r29/30, 65vl2, 68r8; 3. binnen sinen jären sin 'volljährig sein, mündig sein (vom 21. bis 60. Lebensjahr)': bin sinen jaren 8rr7, 68v23, 69r3/4, 6 9 r l l , 69rl8, 69 v7, binnen sinen jaren 17vl0, 17v26/27, 41rl, binnen iren jaren 16v23, 70vl, binnen iren jarin 15r28; 4. zu sinen jären kumen 'volljährig werden, das Erreichen der Mündigkeitsgrenze von 21 Jahren': zu sinen jaren kumen 16v31/32, 17r9, 17vl2, 31 vi 4, 68r29/30, 69r6, 70r28/29, 80r3, zu sinen jaren kumet 69r30, zu sinen jaren kumt 20rl7, 69vl4, 69vl5/16, 69v24, zu iren jaren kumen 16v26, 41v35, kumen zcu iren jaren 70v4/5. DRWB 6, Sp. 398 ff.; Lexer I, Sp. 1472; Grimm, DWB 4.2, Sp. 2230 ff.; Trübner 4, S.36f.; Kluge/Seebold, S. 338 tag 4 jären sw.V. 'volljährig werden, mündig werden': unde enhat sich das kint noch nicht gejaret 3 9 v l l , gejare 39vl3. -> vorjären järzal st. F. 1. 'Jahresfrist, die Zeit eines Jahres': Die inwisunge mag der man entreden binnen der jarzal uf den heiligen 27v2, jarzcale 7vll4, 60v24, 72rl8, 72v7, 72vl6, 73v7, 73vl3/14, jarczale 7 4v22, jarzcal 19vl 0/11; 2. 'Mündigkeit': Ab das kint sine jarzal behelt 39v3; 3. 'Belehnungsfrist': Swas ein herre von mutwillen liet sineme manne, des he en nicht geweren enmag, he sal is im irstaten, also das sich der man in siner jarczale nicht vorsume 71rl6, jarczale 71vl0, 71v22, 73vl, 85r28, jarzcale 7v 19, 68rl4, 68rl5, 68rl7, 68r20, 68vl0, 69v27, 70rl, 70rl8, 70r26, 71r31, 73r25, 73v26, 74v23, 75r2, 80r26, jarzale 7vr9, 7vrl5, 68rl4, 69rl9, jarzcal 66rl3. DRWB 6, Sp. 469 ff.; Lexer I, Sp. 1475 f.; Grimm, DWB 4.2, Sp. 2249; Trübner 4, S.36f.
280 jen st. V. 'gutheißen, zustimmen, für wahr erklären': Der richter sal immer den man vragen, ab he an sins vorsprechen wort je 24v6, je 76r24, 76v5, jet 7rr27, enjet 6rl22, 64v31, 76r26, engtet 23vl8, 44vl9. jerig Adj. 'ein Jahr alt, einjährig': Phaffenkindere unde di unelich geborn sin, den gibt man zu buse ein vuedir houwes, alse zwene jerige ochsin gezien mugen 48r23. jerlich Adv. 'jährlich': Is ensal kein zinsman vor sinen herin phant dulden poben sinen zcins, den he jerlich geldin sal 22v7. juncherre sw. M. 'junger Herr, junger Adliger': Swen der herre stirbit, der sone hat, der man ensal sines gutes an den obersten herren nicht sinnen bin des juncherren jarzcale 68rl3. jude sw. M. 'Jude': Von phaffen unde juden, di wapen vuren 6rl6, Der jude enmus des kristen mannis gewer nicht sin 43vl5, jude 43vl7, 43v22, 43v25, juden 41rl6/17, 42v31, 43v20, 47r6a.
K(C) kamph st. M.N. '(gerichtlicher) Zweikampf': Kamphes mag ... ein man sime mage bewerin, ab sie beide mage sin 25v2/3, Welch ungerichte man ... ufden man beredet mit kamphe, das get im an den Up 30r21, kamph 21r20, 21r23, 24r29, 25rl2, 25r23, 25r26, 26r27, 27r28, kamphe 4vr27, 4vr29, 5rr7, 6rrl8, 7rl21/22, 20r23, 20v32, 21rl, 21r3, 21rl8, 21vl5, 21vl9, 22rl8, 25v22, 26rl3/14, 26rl8, 26r23, 26r25, 26r29, 27rl3, 27r27/28, 42r32, 53rl4, kamphes 25r27, 25r31, kamphi 26r2, kamphis 21vl7/18. DRWB 6, Sp. 1013 ff.; Lexer I, Sp. 1506; Grimm, DWB 5, Sp. 138 ff.; Trübner 4, S. 88 f.; Kluge/Seebold, S. 350 ansprechen; bereden 5; biten 8; vangen, vähen 3 kamphwart st. M. 'Kampfvormund': Wen das kint zu sinen jaren kumt, so mus is wol Vormunde sins wibes sin ... unde san zu kamphwarte 20rl9/20, kamphewart 20x27, 58r8. kamphwerdig Adj. 'würdig, einen gerichtlichen Zweikampf auszufechten': So clage he vor bas, das he en beroubit habe sins gutis unde des genumen so vil, das is nicht ergir ensi, is ensi wol kamphwerdig 25rl0. kebes st. sw. F. 'die in einem außerehelichen Verhältnis (Konkubinat) lebende Frau': Is si kebis, si mag elichen
Glossar man nemen unde mag immer kindere dar binnen gewinnen 21 v7. DRWB 7, Sp. 681 f.; Lexer, Sp. 1533; Grimm, DWB 5, Sp. 373; Trübner 4, S. 115; Kluge/Seebold, S. 364 kebeskint sL N. 'uneheliches Kind': Ein wip mag gewinnen elich kint, adelkint, eigenkint unde kebiskint 21v6, kebeskint 21v4. keiser st. M. 'Kaiser': Der phalenzgreve richtet ubir den keiser 6vl7, Der keiser liet alle geistliche vorstenlen mit deme sceptrum, alle werltliche vanlen mit deme vanen 51r29, keiser I r l , 2rl2, 2rl22, 2rrl0, 2vl8, 2vl29, 3rl5, 6vll8, 10r5, 10r8, 10rl3, 47rl8, 47v3, 49r26, 49v4, 50v22, 51r27, keisere 49vll, keisers 2vl4, 3rl6, 6vll4, 19vl5, 50v26. -» hulde; riche 2 keiserlich Adj. 'kaiserlich': Mag das der richter nicht getun, so sal man is dem keiser kundigen, unde sal hes tun mit siner keiserlichen gewalt 3rl6, keiserliche 4 I r l 3, keiserlichen lr3, keisirlichen 49r24. kemerer st. M. 'Kämmerer, Schatzmeister': Undir den leien is der erste an der kore der phalenzgreve von deme Rine ..., der dritte, der kemerer, der markgreve von Brandenburg 51r4. kemphe sw. M. 'Berufskämpfer, Lohnkämpfer, der für Miete einen gerichtlichen Zweikampf ausficht': Kemphin unde ir kindere ..., di sint alle rechtelos 19r27, kemphe 8rrl3, kemphen 19v23, kemphin 4vr28, 21r9, 21rl0, 21rl 1, 21rl4/15, 21rl5/16, 21r31, 48r25. bereden 6 kemphlich Adj. 1. 'kampfbereit': kemplich grusen 'zum gerichtlichen Zweikampf herausfordern' 24v20, kemphlich ... grusen 5rl23, kemphlich angesprochen 'dass.' 24r31; 2. 'zum Kampf gehörig': mit kemphlichen Worten mag ein man den andern zu kamphe van 27rl2. -h> ansprechen; grusen 1 kessel st. M. 'Kessel': Si habn drier hande kore: das gluende isen zu traine oder in einen sidenden kessil zu grifene bis an den ellebogen oder dem kemphen sich zu werne 19v22. kint st. N. 'Kind': Kein kint mag sinen lip vorwirken 5vr26, Kint mag kinde gut lien 7vr23, Ein wip mag gewinnen elich kint, adelkint, eigenkint unde kebiskint 21v5, Echt kint unde vri behelt sins vater schilt 54v7, Kindere jarzcale is driczen jar unde sechs wochen von irre geburt 68vl0, kint 3vr28, 4vl32, 4vr6, 6rl7, 6vr4, 6vr6, 7vi 11, 1 I r l 8 , 1 lr20, l l r 2 2 , l l v l 2 , 14v7, 14v9, 14vll,
281
Glossar 14vl9, 16v31, 17r9, 17v9, 17v26, 18vl4, 18vl7, 18v20, 18v25, 19rl8, 19r21, 19r26, 2 0 r l 7 , 21v3, 31r7, 39v3, 39vl 1, 39vl7, 39vl8, 39vl9, 4 1 r l , 41r7, 41r8, 43r2, 54v25, 54v30, 66r3, 6 8 r l 4 , 68v23, 68v30, 69r3, 69r4, 69r6, 69r7, 6 9 r l 2 , 6 9 r l 8 , 69r29, 69r31, 69v9, 69v23, 69v26, 70v29, 80v4, 80v28, 83r21, 83vl6, kinde 39v20, 68v27, 69r20, 69vl2, 70r23, 70vl0, kindes 7vll0, 17rl, 17r7, 39vl2, 39vl6, 39v21, 41r6, 68vl9, 68v25, 68v25/26, 68v26, 68v29, 69r9, 69r23, 69v6, 6 9 v l l , 82v20, kindis 17r2, 17r5, 17r6, kinder 16v25, kindere 3vr30, 4vll2, 4vll4, 7vl9, l l r l O , 1 l r l 5 , 13v5, 15vlO, 17rl0, 19r27, 19v8, 21r34, 21v8, 32r5, 54vl2, 55r3, 56r4, 5 9 r l 5 , 6 9 r l 6 , 7 0 r l 8 , 70v5, 70vl7, 71v8, 71vl9, kinderen 4vl23, 4vr9, 48r26, 55r30, 55v5, 7 0 r l 6 , 71v5, kinderin 4vl28, 23r7, kindem 6vrl0, 7vl26, 15v4, 35v4. H R G 2, Sp.717ff.; Lexer I, Sp. 1575f.; Grimm, D W B 5, Sp. 707 ff.; T r ü b n e r 4, S. 144 ff.; Kluge/Seebold, S. 370 -» adelkint; eigenkinf, kebeskint; kropelkinf, phaffenkint kintheit st. F. 'jugendliche Unerfahrenheit, Unverstand': Ab wol ein kint zu lenrechte zu sinen jarett kumen is, sin rechte Vormunde sal is doch an sime gute vorsten ..., di wile is sich selbe nicht vermag noch bedenkin enkan von siner kintheit oder vor torheit oder vor krancheit des libes 17r4. kirche sw.F. 1. 'Kirche, Kirchengebäude': An gebundenen tagen unde in allen steten, ane in kirchen, mus der kunig sin lenrecht wol haben 81 vi 5, kirchen 18v27, 2 9 r 3 1 / 3 2 , 35r4, 4 1 r l 7 , 66r30; 2. 'Kirchenbesitz, Kirchenlehen': Di ungeradete swester, di teilt nicht irre muter rade mit deme phaffen, der kirche oder phrunde hat 12rl5, kirchen 59v5. klrchenere st. M. 'Küster, Mesner': Deme suln durch recht volgen alle, di zu iren jaren kumen sin ... sunder phaffen unde wip unde kirchenere 41v37/38. kirchove st. M. 'Kirchhof, der ummauerte Raum einer Kirche': Alle mordere unde di den phlug rouben ... oder kirchove ..., di sal man alle radebrechen 29r32, kirchove 4 1 r l 8 , kirchoven 66r30. kisen st.V. 'wählen, auswählen': Di duzchen sullen den kunig kisen 6vl6, kisen 10v2, 22v33, 23r5, 48r7, 48r9, 4 9 r l 9 , 5 0 r l 0 , 51r7, 5 1 r 9 / 1 0 , 5 1 r l 2 , 60r3, kiesin 67vl, kise 38r3, kuset 5rl5, 5rl8, 6vll7, 2 3 r l 3 , 2 3 r l 5 , 49v31, 51r20, kusit 4 9 r 2 4 / 2 5 , enkuset 51r26, gekorn 12v20, 22v30, 50r27, 78v27, gekorne 27v31. H R G 2, Sp. 714 ff.; D R W B 7, Sp. 801 ff.; Lexer I,
Sp. 1568 f.; Grimm, D W B 5, Sp. 692 ff.; T r ü b n e r 4, S. 143, 312; Kluge/Seebold, S.369 -> erweln klage st. F. 'Klage vor Gericht, gerichtliche Klage': he enclage alrest deme richtere unde volge siner clage zu ende lvr4, clage lvrlO, l v r l l , 3rr4, 3vll9, 3vl20, 5rll7, 5rll9, 6rl25, 7vr4, 10vl3, 20r22, 20r26/27, 20r31, 20vl4, 20v31, 21 r l , 2 2 r l 7 , 22r29, 23r25, 23v24, 23v30, 24r9, 2 4 r l 2 , 2 4 r l 4 , 2 4 r l 8 / 1 9 , 24r23, 24r28, 24vl2, 25r21, 2 6 r l 6 , 26v33, 27r33, 27v27, 29r26, 29v27, 32rl 1, 32r33, 32v4, 36r33, 36v27, 36v36, 44r8, 44v8, 44vl0, 44v23, 45r7, 45v7, 53vl7, 57v21, 62r26, 63r7, 63vl4, 66r9, 7 I r l 9 , 72r20, 73v4, 77r3, clagen 36vl5. klagen sw. V. 1. 'klagen, gegen jemanden eine gerichtliche Klage erheben': so sal siner mage einer clagen 2rr30, unde sal allen luten richten, di im clagen 3rll3, Klagen vil lute uf einen man ungerichte 44v6, clagen 5rll5, 6rl20, 14r20, 20v33, 23vl3, 2 5 r l l , 40vl6, 40v20, 45r3, 57r5, 62v24, 83v2, clage 23vl2, 25r3, 25r7, 27v26, 50vl2, claget 4vrl5, 5rl32, 5vl28, 2 4 r l 5 , 3 6 r l 2 , 40v24, 42r35, 42v3, 43vl4, clagit 27r5, 81v23/24, clait 5rl28, 5rl32, 5 r r l , 5 r r l 4 , 19v27, 20r29, 23r27, 2 4 r l 2 , 26v28, 27v3, 27v4, 29vl9, 29v32, 36r32, 40v30, 43r23, 44v4, 44vl7, 45r3, 49vl, 53vl3, 5 7 r l , claine 2 4 r l 5 , geclaget 54v3, geclait 3rr24, 27r30, claite 29v30/31, enclage lvr3; 2. klagen mit gerufte 'mit Hilferuf klagen': Wer mit geruchte clagen sal 5vr25, di suln clagen mit gerufte 40v25, clagen mit gerufte 40v28, 40v31/32, clage mit gerufte 40v35, ane gerufte clagen 40v37/38. beklagen;
vorklagen
kleger st. M. 'Kläger (bei Gericht), der Klagende': Kein cleger darf bürgen sezcin, er di clage getagit wirt 5rl 17, cleger 6vl9, 2 2 r 2 8 / 2 9 , 24r8, 2 4 v l l , 26r6, 2 6 r l 3 , 26vl8, 27v22, 42r24, 42v27, 44vl3, 44v22, 4 5 r l 5 , 45v7, 46r9, 49vl4, 54v2, 5 7 r l 6 , 5 7 r l 8 , 57r22, 58r8, 73v5, 7 3 v l l , clegere 2vl27, 3rr9, 3 r r l l , 32r29, 36r26, 44r9, 49vl6, 73vl0, clegers 2rr27. knecht st.M. 1. 'Knecht, Bediensteter': Nimant entwortet vor sinen knecht 5vl24, Nimant is ouch phlichtig, vor sinen knecht zu geldene 35r28, knecht 5vll7, 5vl25, 6rll0, 15r27, 33v29, 34r4, 35r28, 35r31, 35r33, 35v2, 43v3, knechte 28r28, 78v9, knechten 78v4, knechtin 2 8 r 2 5 / 2 6 , knechtes 3 4 r l a , knechtis 34r7, 35v20, 4 3 v l 2 / 1 3 ; 2. 'Ritter, Krieger': Nu vornemt den alden vride, den die keiserliche gewalt gestetiget hat in Sachsenlande mit der guten knechte willekor des landis 4 1 r l 4 , di guten knechte 4 2 r l 0 . DRWB
7,
Sp. 1141 ff.; Lexer
I,
Sp. 1644 ff.;
282 Grimm, DWB 5, Sp. 1380 ff.; Trübner 4, S. 197 ff.; Kluge/Seebold, S. 383 knie st.N. 'Knie': eins knies ho 'kniehoch' 35rl7/18, eins knies hoch 53vl. knien sw.V. 'knien, auf die Knie fallen': Noch des vater tode der son kume hinnen jare unde tage zu sime herren unde bite im. di manschaft mit gevaldenen henden unde ge im also nae, ab der herre ste, das he en gereichen muge, siezt he aber, so sal he vor en knien 65vl6, kniet 65vl9. knutein sw.V. 'mit Knüppeln schlagen': Wer aber den andirn knutelit, so das im di siege swellin ..., man sal en vorvesten 27r3. knuttel st. M. 'Knüttel, Prügel': Swen man mit knutteln slet 5rl29.
Glossar fen wil 32v7, koufen 2vr27, 2vr28, koufet 3vr5/6, koufit 43v28, koufi 3vr3, 5vl30, 43v24, koufte 34vl4, koifi 32v29, gekouft 34rl8, 34vl2, 34vl3, 36v8, 82v8. -> vorkoufen kouflüte PI. von koufman st. M. 'Kaufmann': Phaffen, kouflute, dorfere ... sullen Unrechtes darben 59r8/9. krancheit st. F. 'Krankheit, körperliche Schwäche': vor krancheit des libes 17r4. kreis st.M. 'eingehegter Kampfplatz in Kreisform': Vride sal man dem kreize gebiten bi deme halse 25v20/21, kreis 26r7, 29rl6, kreise 25v28, kreises 25v29. DRWB 7, Sp. 1417 f.; Lexer I, Sp. 1718 f.; Grimm, DWB 5, Sp. 2144 ff.; Trübner 4, S.266f.; Kluge/Seebold, S.411
köre st. F. 1. 'Wahl, Auswahl': Unde von des keisers kure 6vll4, In des keisers kore sal der erste sin der bischof von Menze 50v27, kore 19v21, 22v28, 23r9, 25vl6, 51r9, 59v2, 60r5, 67v21, 70r21; 2. 'Prüfung, Schätzung': Butet si aber is zu losene nach der gebure kore 15vl, kore 37rl0, 38r31, 53r7, kure 33v6; 3. 'Wille, Überlegung, Erwägung': Wen is ist der lantlute vrie kore, das si gougreven kisen 23r4; 4. 'Wahlrecht': Der schenke des riches, der kunig von Bemen, enhat keine kore 51r6. DRWB 8, Sp. 126 ff.; Lexer I, Sp. 1790 f.; Grimm, DWB 5, Sp. 1794 f.; Kluge/Seebold, S.420
krenken sw.V. 'schmälern, schwächen, verletzen': der babist enmag kein recht geseezen, da he unse lantrecht oder lenrecht mitte krenke 1 lv7, Wip mag mit unkuscheit ires libes ir wiplich ere krenken 12r2, krenkit 20rl2, enkrenkit 52r32, gekrenkit 53rl7.
körn st.N. 1. 'Korn, Getreide': Wer des nachtis kom stilt, der vorschult den galgen 35r23, kom 5vl23, 35r26, 35v30, 37r26, 37v7, 40v2, 41vl5, 50vl6; 2. 'Kornfeld': Swer sin vie tribit uf eins andern korn oder gras 5vr3, korn 37r5.
kristen st.M. 'Christ': Slet ouch der kristen einen juden 43v2 0.
komzende sw. M. 'Kornzehnt, Steuer, Abgabe von Korn': Wo man komzendin gibt, da sal das seil, da di garbe mite gebundin is, einer dumeln lang sin 37vl7, komzende 39r30. kost st. F. 1. 'Aufwand, Ausgaben, Kosten': Sechs Wochen sal der man dinen sime herren bi siner kost 59v29, kost 13vl3, 13vl8, 28vl, 33v5, 35r7, 57v26, 57v28; 2. 'Speise, Beköstigung': Sundert der vater oder di muter einen iren sun oder eine ire tochter von in mit irme gute, si zweien sich mit der kost oder nicht 13v26.
krigen st.V. 'streiten, kämpfen': Ien aber, si des gutis, da si umme engen 36r34. kristen Adj. 'christlich': Cristine kunige 9v33, kristen mannis 43vl5, kristens mannes 43vl7, kristenes mannes 6rl 11.
kristenheit st. F. 'Christenheit, Menschen christlichen Glaubens': Zwei swert lies got in ertliche, czu beschirmene di cristenheit 10r3/4, cristenheit 10v32/33, 15r8, 41 via, kristenheit 41r26. kristenman st.M. 'Christ': Ein iclich cristenman is phlichtic, sint czu suchene lOrl8, cristenman 29v6. kristenwìp st. N. 'Christin': Welch cristenman oder wip ungloubig is 29v6. kropelkint st.N. 'verkrüppeltes Kind': Ufaltvilen unde uf getwerge irstirbit noch len noch erbe noch uf kropilkint 1 lv9.
kouf st. M. 'Geschäft, Verkauf: Dis selbe gerichte get über unrecht mas unde unrechte wage unde über valschen kouf 29r30, koufes 43r7, 43rl3, 43rl5.
krüze st.N. 'Kreuz': Wo der richter sin gewette nicht usgephenden enmag uf eins mannes eigen, das also kleine gilt, das sal der vronebote bevronen mit eime krueze 36rl/2.
koufen sw. V. 'kaufen, Handel treiben': Spricht aber iener, he hab is gekouft uf deme markte 34v3, Buitet der munezer einen valschen phenning us, das he da mite kou-
künde st. F. 'Kunde, Kenntnis': wen da man der warheit mit keiner Wissenschaft in künde enmag kumen 73rl5, künde 84v26.
283
Glossar kündig Adj. 'bekannt, kund': unde di mir sint kundig bi miner zeit 4rll5, Nu is uns kundig von der heiligen schrift 10vl9, kundig 47r20. kundigen sw. V. 'verkündigen, bekannt machen, darlegen': so sal man is dem keiser kundigen 3rl5, kundigen 24v30, 37v8, 39v24, 43r24, 52v7, 73vl0, kundegen 81v26, kundiget 13rl3, 74v23, gekundiget 59v22/23, 78v21/22, 8 2 r 5 / 6 , enkundeget 71x2. kunig st. M. 'König': Der kunig is gemeine richter über al 6rr7, Den kunig enmus nimant bannen 6vll3, Di duzehen sullen den kunig durch recht kisen 4 9 r l 8 , kunig 5rl8/9, 6vl6, 6 v l l l , 6vll9, 6vl25, 14v29, 19r8, 19vl5, 23r21, 23r23, 23r24, 2 3 v l , 2 8 r l 6 , 32v2, 43v23, 49r24, 49v24, 49v31, 5 0 r l 0 / l l , 5 0 r l 2 , 50r22, 51r5, 5 1 r l 3 , 51v2/3, 51v7/8, 51vl2, 51v32, 52r21, 52v5, 52v24, 60r2, 6 0 r l 7 , 65r28, 78v27, 79v28, 81vl, 81v8, 81vl5, kunik 32v22, kunic 10v26, kunige 6 r r l 5 , 7rl31, 9v33, 23r33, 2 8 r l 8 , 2 9 r l , 49v28, 5 0 r l 0 , 5 0 r l 8 , 5 1 r l l , 5 1 r l 5 / 1 6 , 52vl2, 52v22, 59r4, 6 8 r l 7 , 77v5, 79r5, 7 9 v l 5 / 1 6 , kuniges 5rll2, 5vrl8, 6 r r l 6 , 6vll0, 6vl32, 6vrl, 10r28, 23r30, 23r31, 23v2/3, 23v3, 23v6, 25r2, 26v30, 28rlO, 2 8 r l 3 , 28v6, 29r3, 39v31, 4 0 r 2 2 / 2 3 , 40r27, 4 1 r l 9 , 42v35, 43v21, 4 5 r l 7 , 51vl7, 52v22/23, 53r4, 5 4 r l , 5 4 r l 5 , 6 0 r l 0 , kunigis 15v33, 52v21, 52v29, des kuniges malder 30r26, des kuniges achte 52v2, kuniges banne 52v32, kuniges hulden 57r7. -» ächte 3; ban 5; huldc kuniglich, kuniclich Adj. 'königlich': Alle schacz in der erdin begraben, tifer den ein phlug get, der gehört zu der kuniclichengewalt 19rl3, kunicliche 1 9 r 3 3 / 1 9 v l , 19v6, kunigliche 49r21, kuniclichen 1 9 v l / 2 , 49r22. kunigriche st. N . 'Königreich': Sachsen, Beiern unde Vranken unde Swaben, das waren allis konigriche 49v7, kunigriche 6vl8. kunst st. F. 'Ankunft': Is aber der herre us deme lande, an den man des orteiles zut, swen he erst widerkumt an duzehe art, ... unde he sine kunst irvreischet, so sal man das orteil widerbrengen über sechs wochen 78vl7. kure -> kore
L laden st.sw.V. 1. 'einladen, vorladen': he enwerde ... zu sinen rechten tedingen geladen 32r24, he lade in mit gerufte 40v35, laden 42r9, ladin 2 6 r l l , 50vl0, enlade 3 2 r l 2 , geladen 77v26, geladin 32r28, 53v29/30, 67vl3;
2. 'bitten, zu etwas laden, zusammenrufen': Is aber das vie so getan, das man is nicht ingetriben mag ..., so lade he da zu zwene man 3 7 r l 4 , geladin 9v30, ledit 39r3, 67r5, ledet 7 6 v l l ; 3. 'beladen': Der lere wagen salrumen deme geladen 39v33, geladen 32v34, 40r4, 4 2 r l 9 / 2 0 , geladenen 3 3 r 8 / 9 , geladene 39v33. D R W B 8, Sp.255ff.; H R G 2, S p . l 3 3 6 f f . ; Lexer I, Sp. 1811; Grimm, D W B 6, Sp.45ff.; Kluge/Seebold, S. 424 f. -* inladen;
vorladen;
widerladen
ladunge st. F. 'Vorladung': Kumt he zu der dritten dunge nicht vor 2 6 r l 2 , ladunge 77v26.
la-
lam Adj. 'lahm, verletzt': Blibit aber ein vie tot oder lam von eins mannes schulden ane sinen willen ..., he gilt is ane buse 48v22, Rechtelose lute darben Vormunden unde lame lute 4vr26, Lamen man unde miselsuchtigen ..., den enmus man zu kunige nicht kisen 50r8, lame lute 5vl4, 20v32, lame man 21r3, lamen man 30v5. lant st. N . 1. 'Land, Gebiet': Wir vorbiten bi unsen hulden, das imant den anderen beleite durch das lant durch kein gut 2vr9, Wen der kunig in das lant kumt, so sin im alle gevangen ledig 6vll9, lant 3rr21, 47r36, 51v4, 51v8, 5 8 r l 2 , 5 8 r l 3 , 67vl2, lande 2rl3, 2rll5, 3 r r l 4 , 3vrl8, 4rll8, 7vrl3, 10v4, 18r25, 24r2, 46vl6, 47vl0, 47vl5, 48rl 1, 51v32, 52r3, 52r8, 5 2 r l 3 , 68r25/26, 78vl4, landen 49r27, landes 18rl5, 47vl0, landis 4 1 r l 5 , 53r22, noch des landes rechte 18r25, noch des landis rechte 4vr3, des landes richtere 66r21, 8 4 r l l / 1 2 , des landis recht... unde gewonheit 2 v l l 3 / 1 4 , des landis gewonheit 2vl28, 3 r r l 2 , 55r9, des landes not 6 7 v l l ; 2. 'Acker, Feld, Landstück': Unde ab man vert über gewannen lant 5vll2, lant 5vr2, 5vr6, 6rl30, 7rl29, 22vl4, 3 3 r l 0 , 36v30, 3 7 r l , 3 8 r l l , 39r8, 39vl2, 45r26, 45r28, 45r30, 45r34, 55vl6, 55v24, lande 6rl31, 35r26, 39r7, 45r30, landes 39r9; 3. 'Landvolk, Einwohnerschaft eines Landes': mit deme gerufte sal he das lant dar zu ladin 50vl0, lande 42r6. -» art 2 lantgräveschaft st. F. 'Landgrafschaft': Siben vanlen sin ouch in deme lande zu Sachsen:... di lantgraveschaft zu Doringen 52r5. lantgreve sw. M. 'königlicher Richter und Verwalter eines Landes, Landgraf: Phalenzgreve unde lantgreve dinget undir kuniges banne alse der greve 52v31, lantgreven 3vr31. lantlüte st.M. PI. 'Landbewohner, Landgenossen': Gouschaft is der lantlute willekore 5rl6, lantlute 2rr5, 23r8, 49v20/21, 53r7, 53v21.
284 lantman st. M. 'Landbewohner, Landgenosse': Dis selbe mus tun ein lantman dem andern, ab he en beclait in wikbilde oder in eime uswendigem gerichte 56v25. lantrecht st. N. 'Recht eines Landes (im Gegensatz zum Lehenrecht)': Wirt ein kint geborn stum oder handelos oder vuoselos oder blint, das is wol erbe zu lantrechte unde nicht zcu lenrechte 11 v i 4 , Wen der babist enmag kein recht geseczen, da he unse lantrecht oder lenrecht mitte krenke l l v 6 , lantrecht 8rrl6, 1 4 r l l , 14rl4, 14r20, 17vl 1, 17v22, 53rl6, 78v29, 85r23, lantrechte 4rl22/23, 4rl25, 12r29, 14r20/21, 17vl3, 19v28, 20r29, 24r3, 31r32, 32rl9, 39r20, 52vl, 56v22, 69v7, 7 7 v l l , 79vl0, 80v28, lantrechtes 85r21. DRWB 8, Sp. 547 ff.; H R G 2, Sp. 1527 ff.; Lexer I, Sp. 1827; Grimm, DWB 6, Sp.128 lantrichter st. M. 'Landrichter, Vorsteher des Landgerichtes': Roubet aber der herre den man, he mus is wol unde iclich ungerichte uf en clagen vor sime lantrichtere 83v3. lantsesse, lantseze sw. M. 'Landsasse': Di lantsezin, di kein eigen habin in deme lande, di suln suchin ires gougreven dinc über sechs wochen 10v3/4, Andere vrie lute, di lantsesin heisen, di kumen unde varn in gastis wise unde enhaben kein eigen in deme lande 48rl0, lantsezin 10r25, lantsessin 14v6, 5 4 v l l / 1 2 . DRWB 8, Sp. 574 ff.; H R G 2, Sp. 1547 ff.; Lexer I, Sp. 1828; Grimm, DWB 6, Sp. 130 lantsträse st. sw. F. 'öffentlicher Weg durchs Land, Landstraße': Wir sezcin unde gebiten, das man di rechten lantstrasen vare 2rl29. lantvolc st. N. 'Einwohner eines Landes, Gerichtsgemeinde': Unde bekennet hes nicht, ich wil is en beredin mit alle dem rechte, das mir das lantvolg irteilt 25rl7. läsen, län st.V. 1. 'lassen': Der man ensal sin vie da heime nicht lasen 38r34, Lasit den keiser sines bildes gewaldig unde gotis bilde gebit gote 47rl8, lasen 26r8, 34r32, 39vl7, läse 37vl2, lasin 47rl0, 59vl9, last 46v9, lest lvl28, 4vll7, 7rl2, 13r21, 16r6, 18r5, 26r5, 37r25, 40r8, 42r23, 46r25, 63rl2, let 37r30, 46r34, 52v7, 62r8, liesin 47vl7; 2. 'entlassen, freilassen, loslassen': Swen der kunig och aller erst in das lant kumt, so suln im ledig sin alle gevangenen uffe recht, unde man sal si vor en brengin ..., oder mit rechte lasen 51 vi 1, unde das ichein richter nimande us der achte läse 2vl26, läse 2vl32, lasin 21v20, gelasin lr32, 2rr26/27, 24v29, lan 3rll9, 3vl29; 3. 'ablassen, aufgeben': Der is ouch vunden hat, der mus da nicht abe lasen ane iens willen 29rl2, he mus das gut mit gewette unde mit buse lasen 34v20, läse
Glossar 61v25, 78r9, lasi 2vr5; 4. 'auflassen': Stirbet aber iener, der das lasen solde 13r27, lasen 22r4a, 71r3, 83v4, läse 72vl4, 84rl2, lasene 4vll0, 13r3, 13r5, 83r20, lasin 7rrl0, 13r6, 13rl2, 22r2, lest 70vl2, 71r7, let 60v8, lies 72v21, enlies 69v22, gelasen 72v8, 72vl0, 80vl6, gelasin 60vl0, 69vl6, 72rl9, 72vl2, 74v24; 5. 'verlassen, zurücklassen': Dis selbe sal der man tun, ab hes gut lasen wil 39v25, läse 76vl9, lest 50v26, 55r6, 70r7; 6. 'erlassen': unde swas uns über den irteilt wirt, des wolle wir nicht lasin 2vll8, lasin 2vr2, 3rl30a, läse 2vl33, lan 2vl23; 7. 'überlassen': Zwei swert lies got in ertliche 10r2, lasin 55rl7, 56vl0, lest 8 0 v l l , 82v20; 8. 'verlieren': si wetten deme richtere dar umme unde lasen di habe mit buze 30rl5, laze 54rl4; 9. 'unterlassen': Lest he das durch manschaft oder durch icheiner slachte ding 2vl6; 10. 'zurückgeben': Swes sich der man mit unrechte underwint..., he mus is mit buse lasin 47r30; 11. 'abhalten, durchführen': Unde wo hes beginnet unde wo hes let 8rl4. DRWB 8, Sp.719ff.; Lexer I, Sp.l843f.; Grimm, DWB 6, Sp.213ff.; Trübner 4, Sp.380ff.; Kluge/Seebold, S.429 üfläsen; widerläsen läsen st. N. 'Auflassung, Rücküberlassung': swen di liunge mit rechte gebrochen wirt..., so enis ouch das lasen nicht 69v21, Der son enmus ouch des mannes gut nicht zcweien mit lasene 70r5, lasene 4vr7, 13r28. laster st. N. 'Schmähung, Schmach, Schande': Wer so eins mannes knecht slet oder vet oder roubet ..., noch rechte sal he en beiden buse geben, he enturre denne das uf den heiligen swem, das hes deme herren weder zu lästere noch zu schaden habe getan 33v33, lastirs 34r6, lästere 76v26. leben sw.V. 'leben, lebendig sein': Der son envirnet ouch nimande kein gedinge, he enwerde lebinde geborn unde lebe noch des vater tode 80vl0, leben 19rl9, lebet 7rr29, 65r7, 83r26, lebete 55v29, lebit 18v23, 65r20. leben st. N. 1. 'Ordensleben, Klosterleben': sibin mannen siner genosen, di en in dem lebene haben gesen 17vl8, Hat aber he sich begeben an sins eliehen wibes willen, unde vordert si en zu seintrechte us deme lebene, sin lantrecht hat he behaldin unde nicht sin len 17v22, lebene 31v20; 2. 'Leben': Wirt is abir zu der kirchen brächet offenbar, wer is siet unde hört, der mus sins lebins wol gezug sin 18v28. lip 1 lebende Part. Adj. 'lebend': Alle lebende ding, das in der notnunft was, das sal man enthoubeten 42v25, lebende
Glossar urkunde 'lebender Beweis' 66r2, lebinde 18vl7, 43rl, 80v9. lebendig Adj. 'lebendig': Des kindes jar sal man nicht rechenen von der zeit, das is di muter enphing, mer den von der zit, das si is gewan, unde lebindig in di werlt quam 68v22. ledicliche Adv. 'frei': Welch man sin eigen gibt unde das wider zu lene enphet, den herrin hilft di gäbe nicht, he enbehalde das gut in sinen lediclichen gewern 19r3, lediclichir 39rl7. ledig Adj. 'frei, ledig': Wen der kunig in das lant kumt, so sin im alle gevangen ledig 6vl20, So solde man ledig lasin unde vri alle, di gevangen waren 47rl0, Das wip is ouch des mannes genosinne ..., noch des mannes tode is si ledig von des mannes rechte 48r3, ledig lvl4, 2rl23, 7rr7, 7vrl2, 13rlO, 17vl4, 18v24, 19r33, 20v4, 23v20, 31r24, 33v34, 38v24, 44rl7, 44v8, 44v36, 46rl5, 46r28, 47rl2, 47rl5, 49v23, 49v24, 51vl, 51v3, 51v5, 51v9, 60v26, 61 rl7, 61rl9/20, 61r24, 61r27, 61r30, 61v2, 62r5, 62rl2, 62r30, 64r4, 67r22, 67v27, 70r27, 71v4, 73vll, 79v24, 82r26, 82r30, 82vlO, 82v26, 83r24, 83v7, 85r22, ledic 10r35, lediges 73vl8. behaldea 7 ledigen sw.V. 1. 'einlösen': Lest man en aber uf sine truwe riten zu tage, he sal durch recht widerkumen unde sine truwe ledigen 46r27; 2. 'befreien, auslösen, loskaufen': Swer lip oder hant lediget 5rl24, lediget 19r30a, geledigit 56r28. legen sw.V. 1. 'niederlegen, lagern': Der man enmus nicht siezeen bin lenrechte ane des herren orlop, enmag he nicht lenger gesten, he lege sich 77vl8; 2. 'gefangensetzen, festsetzen': Swelch son an sins vatir lip retet oder vrevelichen angrifi ... oder in keiner hande bant legit, das gevengnisse heisit, ... der selbe ist erlös unde rechtelos ewiclichen Irl 8. niderlegen; üsgelegen; üsgeleget; üslegen; vorlegen ; widerlegen
285 gerichte beclaget 6vr28, Undir den leien is der erste an der kore der phalenzgreve von deme Rine 5Irl, leie 56vl8, leien 6vll5, 42v34, 56vl8, 81vl. leienvurste, -rorste sw.M. 'weltlicher Fürst, Laienfürst': Zu der seibin wis sint di herschilde usgeleit, den der kunic den ersten hat ..., di leienvursten den dritten 10v28, leienvursten 1 Irl, leienvorsten 59r6. leisten sw.V. 'leisten, erfüllen (bes. ein Versprechen)': Beide, buse unde wette, sal man leisten über vierzcennacht zu des herren nesten huse 77vl4, leisten 12v30, 20v20, 46r29, 46r36, leistet 56r23, leistene 56rl4, geleist 56r24. geleisten leiten sw.V. 'führen, erbringen': gezug leiten 'ein Zeugnis beibringen' 67r22, kemphin uf en leiten 'einen Lohnkämpfer gegen jemanden führen, vorschicken' 21r31. lemde st. F. 'Lähmung, körperliche Verletzung': vor lemde den kamph volbrengen 25r25, Gewere sal iclich man tun umme totslag unde umme lemden unde umme wunden vor sinen herren unde vor sinen swertmag 30rl7, lemde 31rll. lernen sw.V. 'lähmen, verletzen': Ane vleischwundin mag man ouch einen man toten oder lernen mit siegen oder mit stosen 27rl5. belemen lemmerzende sw.M. 'Lämmerzehnt, steuerliche Abgabe von Lämmern': In Sente Walpurgetage is der lemmerzende vordinet 39r24.
len st. N. 1. 'geliehenes Gut, Lehen': Uf altvilen unde uf getwerge irstirbit noch len noch erbe llv8, das lien suln si vor enphan unde di bisorge 51r22, len lvl2, lvl3, lvllO, 3rll6, 5vl28, 6vll0, 6vll8, 7rr6, 7vll0, 7vr25, 7vr30, 8rll5, 8rl22, l l v l 5 , l l v l 8 , l l v l 9 , 14rll, 17vl4, 17v23, 18v24, 19r33, 23r3, 38v4, 49r25, 49r32, 49vl9, 49v26, 51r23, 55r24, 55r25, 55r26, 55vl0, 60vl3, 61r27, 63rl 1, 63r21, 63r22, 63r25, 64vl6, 64v23, 65r25, 65vl, 65vl0, 68v23, 69rl7, 69r26, 70vll, leide st. F. 1. 'Feindseligkeit, Mißgunst, Boshaftigkeit': 71vl7, 73rl0, 73v24, 74r6, 77r5, 78v29, 79r5, 80r6, Wo zewene mit ein ander urlogen, der einer oder beide 80r30, 80vl6, 81rl8, 81v2, 82rl4, 82r20, 82r30, 82v2, geleite haben, swer deme di lute zu leide angrifet..., ubir 82v5, 82v23, 84vl, lene 4vll5, 5vl31, 8rll4, 14rl5, den sal man richten als ubir einen strasrouber 2rl26, leide 18v23, 19rl, 31rl9, 31r21, 31r26, 31r30, 36rl3, 36v4, 3vl27; 2. 'Leid, Schmerz': noch durch libe noch durch 36v7, 36v21, 39r21, 51rl7, 55r22, 59r33, 60v29, 61v3, leide 'weder aus Liebe noch aus Leid' 3rl23/24, 3rr26, 61v4, 61v5, 62r30, 62v3, 62v6, 63r28, 64rl8, 65rl0, liebe noch leide 9vl5/16. 65rl3, 72rl4, 77rl4, 79r4, 79r8, 79vl5, 79v27, 80r4, liebe, libe 80rl4, 80rl6, 80v20, 81rl9, 81r29, 84v7, lenes l r l 4 , leie sw. M. 'Nichtgeistlicher, Laie': Der selbe schriber sal lvl7, 19v29, 56r7, 62v7, 69rl4, 77r9, lien 59v5, 68vl3, ein leie sin 3vl3, Swelch leie den andern vor geistlichem liene 73r20; 2. lenes gewere 'Lehensgewere': lenes ge-
286 were 7v132, 63r4/5, lenes geweren 63v21/22, 80r24, lenis gewere 72r29, 72r29/30, lenis geweren 82v27, 82v28. DRWB 8, Sp. 880 ff. u. Sp.935 (Lehnsgewähr); Lexer I, Sp. 1859f.; Grimm, DWB 6, Sp. 537ff.; Trübner 4, S.418; Kluge/Seebold, S.434 burglen; gebülen; gewer(e); schiltlen; van(en)len; vorstenlen lenerbe sw.M. 'Lehenserbe': iener is das phlichtig zu lasene sinem lenerbin, he si im ebinburtig oder nicht 13r3, lenerbe 31r28, 65rl2, lenerben 5vl5, 39rl9, 60v7, lenerbin 13r3. ¡engen sw. V. Verlängern, zeitlich aufschieben': wen der herre bricht im sine jarzcal mit dem bietene, alse si der man lenget mit deme sinnene 66rl4. lenrecht st. N. 'Lehenrecht, Gericht, wo das Lehenrecht gesprochen wird': Swer lenrecht kunnen wil 7 r r l , Muncht man ein kint binnen sinen jaren, das ... behelt lantrecht unde lenrecht 17vll, Alse der herre sin lenrecht begriffen habe 76r5/6, lenrecht 8rl9, 8rrl7, 10v36, 1 lv6, 14r9, 19v26, 51r24, 59r2, 59rl4, 59rl9, 62r6, 64v21, 64v25, 68r27, 69r25, 69v23, 74vl6, 75v4, 79rl, 79v26, 80r27, 80v3, 81v30, 83r9, 83rl5, 83rl9, 83vl6, 84vl0, lenrechte 4rl22, 4rl26, 7vl7, l l v l 5 , 12r30, 14rl9, 16v31, 17vl3/14, 32rl9, 52vl, 59rl7, 59r24, 59vl6, 60rl9, 61vl7, 62vl9, 63v23, 64vl7, 65v4, 67rl 1, 67v7, 67vl4, 68vl6, 6 9 r l l , 69v7, 70v6, 71r21, 71v4, 72r25, 72v5, 73v22, 74rl4, 75v2, 76r3, 76r9, 76v3, 77vl, 78r24/25, 79rl0, 79vl4, 80v21, 80v29, 81v9, 83r27, 84vl8, 85r6, 85rl8, lenrechtes 59rl2, 60r29, 80r8, 85rl2, lenrechtis 23r7, 60v3. ^ DRWB 8, Sp.970ff.; H R G 2, Sp. 1714ff. u. Sp. 1725ff.; Lexer I, Sp. 1861; Grimm, DWB 6, Sp.542 lenten sw.V. 'ans Ziel bringen, enden, beenden': das he wol richten mus al di clage, di vor gerichte nicht enbegunt noch gelent ensin 51v7, Alrest sul wi merken, das der herschilt an deme kunige begint unde in deme sibendin lent 59r5, lent 60rl6. lenunge st. F. 1. 'Belehnung': Ein man sal zugen sine lenunge, ab hes bedarf 7rrl2, lenunge 7vr27, 8rl27, 51r26/27, 61r4, 61rl4, 61r26, 62r3, 6 2 v l 0 / l l , 64r24, 68v9, 69v4/5, 80r5, 81r28; 2. 'Form der Belehnung': noch sal ich uch dri lenunge bescheiden unde sagen, wo si zcweien von gemeineme lenrechte 79vl2. Iiden st.V. 'dulden, ertragen, erleiden': Was man uf zcinsgute liden sulle 5rl4, liden 18vl, 20v23, 43r30, 49v21, 54r23, 59r20, 85r23, lidet 28v24/25, lidit 44r23, enlieden 42v28/29.
Glossar liebe, Übe st. F. 'Liebe, Gunst': Der richter sal swern zcu den heiligen, das he von nimande ichein gut neme umme kein gerichte, noch durch libe noch durch leide ... anders richte, wen noch rechte 3rl24, durch libe noch durch leide 3rr26, Von rechte ensal nimant wisen liebe noch leide, zcorn noch gifi 9vl5. -*• leide 2 lien st. V. 'verleihen, leihen, als Lehen geben': Der herre endarfis ouch nicht lien me wen eime irs vatergut 7vll8, Der kunig enmag mit rechte nicht geweigern, den ban zu liene, deme das gerichte gelien is 52v26, lien lvl8, 7 v l l l , 7vr5, 7vr21, 7vr23, 13rl0, 19r5, 22r2, 52v23, 59v3, 60v5, 61v31, 65r29, 66r29, 6 8 r l l , 69rl5, 69r27, 70v21, 71v26, 73v27, 79v20, 81r7, 86r8, liene 4vr7, 13rl6/17, 52v25, 59r28, 60rl2, 66r26, 68r25, 70rl7, 71v28, 83rl9, liet lvl5, 4vll6, 5vrl9, 6rl9, 6rrl, 6vll8, 7rr7, 7rrl5, 7vl22, 7vl23, 7vl26, 7 v r l l , 7vrl8, 7vr20, 14r23, 23r6, 31r32, 40r6, 43rl8, 43r32, 45vl0, 47r32, 49r28, 51r27, 51r29, 52v30, 59rl3, 60v25, 60v27, 61r7, 61rl6, 62r8, 62r27, 62v9, 6 6 v l l , 68vl, 69vl3, 70r22, 70vl2, 71r6, 71rl3, 71v5, 72v9, 80rl0, 80rl7, 80v20, 81r28, 83rl4, 83rl8, 84r26, lies 69vl7, leich 40rl2, lige 69vl8, 69v22, lege 62rl0, enlie 14rl0, gelien lvl5, 68r23, geligen 7vr26, 8rll, 13r2, 36vl7, 49v20, 60r26, 60vl5, 61r21, 62r6a, 6 2 r l l , 62rl4, 64v9, 65rl7, 65v9/10, 68r23, 68r29, 68v28, 69v3, 70rl3, 70v27/28, 71rl7, 71v9, 74v25/26, 79v20, 80v6, 80v26, 83rl0, 84r25, 84r29, 84vl, geliget 6 2 r l l a . -*• ab(e)licn; gelien; vorlien 1, 2; weglien liep, lip Adj. 'lieb, teuer': Got is selber recht, dar umme is im recht lip 9vl 7, im was der arme also liep alse der riche 46v8, lip 25rl5. lip st. M. 1. 'Leben': Swelch son an sins vatir lip retet Irl7, ab he andirs tu, denne recht ist, das is im an den lip ge 3vl4, Swer lip oder hant lediget 5rl24, Wer sich selbe ouch von deme libe tut, sine erben nemen sin gut 33v21, lip lvr6, 3rll5, 4rl24, 4vl8, 5vll6, 5vr26, 6vl4, 10vl2, 12vl 1, 19r30, 19vl3, 23v24, 26r32, 26v21, 27rl, 27rl7, 27r21, 28r4, 28r8, 30r22, 33vl3, 33vl9, 33v28, 35r21, 40r20, 41r2, 44r8, 45r25, 45r32, 46r8, 48r36, 48v30, 49r26, 50rl5, 50rl8, 50r20, 50r23, 50v6, 52r32, 52v3, 56rl, libe l v r l 7 , l v r l 9 , 41rl7, 52r25, libes 29vl7, 33r5, 56r9; 2. 'Körper, Leib': vorkrancheit des libes 17r5, von unkraft sins libes 21r20, mit libe unde mit sele 41v5, wen alse der man get, da he stet, odir kniet vor en, da he siezet, so weget sich al sin lip 65v20; 3. 'Lebenszeit': Morgengabe unde eigen zu irme libe 4vl24, bi des vater libe 7vl26, libe llv21, 15vl2, 16v8, 17v6, 18r29, 18r30, 18vl2, 20r33, 55r22, 55r27,
Glossar 65r26, 71v6, 83vl5, 84vl7; 4. 'Lebenswandel, Lebensführung': Wip mag mit unkuscheit ires libes ir wiplich ere krenken 12rl. -> hant ; leben 2 lipgedinge st. N. 'auf Lebenszeit zur Nutznießung ausbedungenes und übertragenes Gut, Leibrente': Kein wip mag behalden zu eigene lipgedinge 4vr5, lipgedinge 5vl31, 6vr8, 15v33, 16r6, 16rl0, 18v9/10, 18vl3, 20vl0, 31r21, 31r27, 36v21/22, 55r20, 55vlO, lipgedinge s 19v29. DRWB 8, Sp. 1076ff.; H R G 2, Sp. 1805 ff.; Lexer I, Sp. 1932; Grimm, DWB 6, Sp.600; Kluge/Seebold, S. 435 -> gedinge liphait Adj. 'lebensfähig': So werdin di len den herrin ledig, ab das kint bewist wirt unde gesen also gros, das is liphaft mochte gesin 18v26. lön der Ion nes
st. M.N. 'Lohn, Entlohnung, Verdienst': Wil aber erbe, si suln voi dinen unde voi Ion enphan 16r23, 16r20, 16r29, 35r29, 35r32, 38v3, 38v6, 38v7, lo16r24, 35v6, lonis 16r25, 16r31.
Iòsen sw.V. 1. 'ablösen, auslösen, abkaufen, einlösen': Sin recht is ouch der zende man, den man vorteiln sai, das he en zu losene tu 50vl4, Wer lip oder hant loset, das im mit rechte vorteilt is, der is rechtelos 26r32, lose 17v6, 48v31, 77r7, losene 15vl, 29r23, 37v31, losen 32v28, 38r31, 60rl2, enlost 39r28; 2. 'verlorengehen, verlieren': Vortopilt he aber sins selbis gut, oder zu welcher wis hes gelosit mit willen 43v7, gelosit 13v9, geloset 32r20, 71r30, gelost 16v30/31. lòsunge st. F. 'Befreiung, Freilassung': das sibinde jar, das heist das jar der losunge 47r9. louken(en) sw.V. 'bestreiten, leugnen': he salbekennen oder louken 12vl, louken 12r31, 31vl7, 74rl5, loukenen 22vl9/20, 7 6 v l l , 84rl8, loukent 33v8, 35rl, 43r7, 43r7/7a, 4 3 r l 5 / 1 6 , 57rl3, 64r2, 64rl5, gelouken 22vl5. -» vorlouken lugener st. M. 'Lügner': Wen man, ane vleischwunden, slet oder schilt lugener, deme sai man buse geben noch siner geburt 30v8. Iute st. M.N. PI. 1. 'Menschen, Leute, Personen': Aller slachte ander Iute, di des vatir dinstman oder eigen nicht sin ..., der richter ... sai di seibin Iute in di achte tun lr29, lr31, Ab Iute ir gut zusamne habin 4vll3, Rechtelose Iute darben Vormunden 4vr26, noch gutir Iute kure 'nach Schätzung ehrenhafter Leute' 33v5, Iute lr27a,
287 2rl26, 2vl33, 3rll5, 4vl31, 4vr26/27, 5vl4, 6rl20, 6rl28, 6rr31, 6rr32, 6vr26, 7rl5, 8rl23, 9vl0, 9v33, 10r23, 10v31, 12vl4, 13vl2, 16r4, 16vl3, 20v32, 28r5, 34v9, 37r4, 37r26, 41rl6, 42r3, 42vl0, 44rl, 44v6, 45rl, 45rl9, 46vl6, 46v20, 47v23, 48rl0, 48r29, 48r32, 48v3, 50r22, 51vl9, 52vl3, 56rl2, 56r21, 57r32, 61v30, 65vl6, 75vl8, 75v27, 77v3, 84v25, 85vl6, luite 28r21, 47v24, 56r22, 57v28, 8 4 v l l , luiten 47v32, luten lvr27, 3rll4, 3rrl3, 4 v r l l , 6vrl7, 7rll9, 7vl22, 35rl6, 40v29, 41r22, 41v8, 45r3, 83rl; 2. 'Mannen, Lehensleute': swelch herre sine stat oder sine bürg buwen wil, der sal buwin mit sime gute oder mit siner lute gute 2rr4, lute 21v22, 71r9; 3. 'Einwohner, Bewohner': Sezcit sich di stat da wider, stat unde lute sint rechtelos 3rl3; 4. eigen lute 'Eigenleute, Hörige': Hat der vater dinstman oder eigene lute lr24, Von eigenen luten 7rl30. lätepiister st. M. 'Pfarrer, Weltgeistlicher': Wirgebiten, das man ... an geistlichen sachen halde der bischove, der erezpristere unde der lute pristere recht unde gebot 3vl9.
M mäc st. M., mäge sw. M. 'Blutsverwandter, blutsverwandte Person in der Seitenlinie': Dis is di erste sippe zeu tale, di man zu magen rechint l l r 2 1 / 2 2 , Kamphes mag ouch ein man sime mage bewerin, ab sie beide mage sin 25v3, 25v4, Buit aber ein des toten mac, wer he si, en vorzustene mit kamphe, der vorleget alle gezug 26r25, mag lvl26, 18r2, 28r4, 81v8, mage lvl26, 2rr30, llvlO, 23v23, 25v6, 31r23, 34rl0, magen 29v23. DRWB 8, Sp. 1574 ff.; Lexer I, Sp.2001; Grimm, DWB 6, Sp. 1435 f.; Kluge/Seebold, S.454 nailmäg(e); swertmäg(e) macht st. F. 'Vermögen, Kraft, Macht': Unde von weme si den zeol nemen, di sullen si bevriden unde beleiten noch irre macht 2rll9. maget, mait st. F. 1. 'Mädchen, Jungfrau': Von der not maget oder wibes 6rl4, magit 4 v r l l , mait 4vrl5, 19r24, 19v27, 20r29, 20vl3, 29v2, 40v24, 42vl8, 47v37, 71vl, meide 4vr23, 2 0 v l l , 41rl6; 2. 'Dienerin, Magd': Des morgens, als he mit ir zu tische gat vor essin, an erbin gelubde, so mag he ir gebn einen knecht odir eine mait 15r2 7. mälboum st. M. 'Grenzbaum': Vischit he aber in tichen ... oder houwet he malboume ..., he gibet drisig Schillinge 33r23/24, malboume 38rl0. man st. M. 1. 'Lehensmann': des riches getruwin
mannen
288 lr5, Wirt ein man sins genosin man 6vl28, Liet ein herre zcwen mannen gut 7vrl2, Doch behilden si di vorsten zu mannen 49vl0, man 5vl2, 6rrl4, 6vrl2, 6vrl4, 6vr24, 7rr3, 7 r r l l , 7rrl2, 7rrl6, 7rr20, 7rr23, 7rr28, 7vll, 7vl4, 7vll3, 7vll6, 7vl22, 7vl27, 7vl28, 7vl30, 7vl34, 7vr2, 7vr3, 7vr5, 7vr6, 7vr7, 7vrl4, 7vrl5, 7vrl6, 7vr26, 8rl2, 8rl6, 8rl8, 8rl9, 8rll7, 8rll8, 8rl20, 10v29, 1 lr3, 13r9, 1 3 r l l , 14v5, 22vl2, 22vl5, 22vl6, 22vl7, 23v24, 28r3, 30v33, 39rl9, 49rl2, 51vl5, 51vl7, 52v28, 53rl6, 56r3, 59r7, 59r21, 59r26, 59r31, 59v6, 59vl0, 59vl3, 59vl4, 59v23, 59v28, 6 0 r l l , 60rl7, 60v20, 60v23, 61r5, 61rl0, 61rl2, 61rl8, 61r21, 61r24, 61vl8, 61v23, 61v25, 62r2, 62r4, 62r9, 6 2 r l l , 62rl4, 62rl9, 62r31, 62v3, 62vl5, 63r3, 63rl3, 63r21, 63r22, 63r26, 63v2, 63vl5, 63vl9, 63v21, 63v24, 63v27, 63v28, 64r2, 64r6, 64rl2, 64r22, 64r23, 64r28, 64v28, 64v30, 65r4, 65r24, 65r25, 65v7, 65vl8, 65v21, 65v27, 65v29, 66r4, 66r6, 66vl, 66v4, 66v6, 66vl6, 66v30, 67rl0, 67rl2, 67rl3, 67rl4, 67rl9, 67r23, 67vl, 67v2, 67v4, 67v7, 67v24, 67v30, 68rl2, 68rl5, 68v3, 68vl6, 69r8, 69v26, 70r2, 7 0 r l l , 70vl4, 71r4, 7 l r l 5 , 71r26, 71r28, 71v23, 72r6, 72rl9, 72r24, 72r27, 72v7, 72vl3, 72vl8, 72v21, 72v23, 73r5, 73rl6, 73r21, 73r29, 73vl, 73v9, 73vl3, 73v20, 73v27, 74r6, 74r8, 74r9, 74rl3, 74rl4, 74r24, 74r25, 74v3, 74v6, 74vl3, 74vl7, 74vl8, 74v21, 75rl, 75rl0, 75rl3, 75rl7, 75r25, 75r26, 75r28, 75v2, 75v8, 75vl8, 75vl9, 75v24, 75v30, 76rl, 76r2, 76r5, 76r7, 76rl7, 76r20, 76r23, 76r25, 76v2, 76v7, 7 6 v l l , 76vl7, 76v20, 76v24, 77r5, 77r9, 77r22, 77r25, 77v3, 77v9, 77vl6, 77v21, 77v23, 7 8 r l l , 78r21, 79r2, 79r20, 79v25, 80rl4, 80r23, 80r28, 80v2, 80v4, 80v23, 81r20, 81v2, 81v7, 82rl5, 82vl8, 82v20, 82v22, 82v27, 83rl, 83r3, 83r6, 83rl0, 83r28, 83vl, 83v7, 83v9, 83vlO, 83vl3, 83vl5, 83vl7, 83v21, 83v27, 84r3, 84r6, 84r9, 84rl4, 84rl8, 84rl9, 84r23, 84vl4, 85v2, 85v4, 85v6, 85vl4, 85vl7, 85vl8, 85vl9, 85v21, 86rl, manne 7rrl4, 7rrl8, 7rr26, 7rr30, 7vl2, 7vrl0, 7vr20, 8rll, 8rl3, 8rl6, 23r7, 31r33, 34rl7, 59v20, 60vl, 60v25, 61r2, 61r7, 61rl6, 61r21, 61r26, 61 v7, 61v8, 61v22, 62r7/8, 62r22/23, 62r27, 62v28, 63r24, 63vl8, 64v3, 64vl7, 64vl9, 64v22, 65rl5, 65r23, 65v28, 66r8, 66rl 1, 66r24, 66r25, 66r28, 66v2, 6 6 v l l , 71rl4, 71r25, 73r28, 73v3, 74rl6, 74r20, 74v2, 74vl4, 74vl7, 75r4, 75vl, 75vl3, 76r2/3, 76r27, 76r30/31, 77rl, 77rl8, 80rl 1, 80r30, 83rl8, 83v8, 83vl7, 84r2, 84rl7, 84vl6, 85r5, mannen 2vrl7, 8rl25, 60v2, 60v4, 60vl3, 61vl2, 62v6, 62v8, 64r3, 66v23, 68v26, 69v24, 73r25, 73r27, 74rl8, 74r23, 74v7, 74v24, 77rl9, 82v29, 83r31, 83v5, 84rl5, 85r6, mannes 7rr22, 7rr25, 7vll5, 7vr4, 7vr8, 7vrl3, 7vrl8, 31r34, 61rl7, 63r28, 64rl5, 64vl2, 64vl4, 65v9, 67vl7, 67v22, 68r20, 70r4/5, 70r8/9,
Glossar 70r28, 71r23, 72v21, 73rl8, 73v4, 73v24, 74vl9, 74v20, 74v22, 79r9, 83r25, 84r5, 85v25; 2. 'Ehemann': Ab ein wip kint treit na des mannes tode 4vr6, man 4vr4, 4vr20, 5vl8, 7vl21, l l r 8 , 13vl5, 15r30, 15v8, 15v22, 16r9, 16vl9, 17rl4, 18r28, 18vl, 18v6, 19rl7, 20r32, 20vl, 21v7, 32r5, 47v38, 55r6, 55r28, 55v4, 55v7, manne 6vr7, 18v4, 5 5 r l 0 / l l , 5 5 r l 7 / 1 8 , mannes 4vr22, 6rr22, 6vrl0, 15v4, 15v9, 15vl3, 15vl5, 15v23, 16v3/4, 16v5/6, 17v6, 18r30, 18r33, 18vl5, 19r21, 19r23, 20v7, 20v8, 22rl5, 47v36, 48r2, 48r3, 48r4, 55rl8, 55r24, 55r25, 55r29, 55vl7, 55v22; 3. 'Mann, männliche Person, Mensch': bezuget in des sin vater zeu den heiligen vor sime richtere mit zcwen seintbaren mannen Irl2, Swelch bischof von deme riche belent is mit vanlene ... mag wol orteil vinden ... ubir iclichen man 4rl23, Got hat den man noch im gebildit 46v6, man der werlde 'Laie' 31 vi 4, man 4vl7, 4vl33, 4vrl6, 4vr28, 4vr29, 4vr33, 5rll, 5rl25, 5rr6, 5rr7, 5rrl2, 5rrl5, 5rrl9, 5rr23, 5rr26, 5vl6, 5vl7, 5 v r l l , 6rll6, 6rll7, 6rl21, 6rl22, 6rl23, 6rl26, 6rl32, 6rr2, 6rrl0, 6rrl2, 6rrl5, 6rr21, 6rr29, 6vll, 6vl28, 6vr2, 6 v r l l , 6vr31, 7rr3, l l v l 7 , 12rl6, 12r27, 12r28, 12r33, 12vl2, 12vl6, 12v21, 13vl 1, 13vl7, 14r30, 14vl0, 14vl8, 1 5 r l l , 15r23, 16r29, 16vl8, 16v20, 17vl2, 17v24, 17v33, 18rl, 18r4, 18r24, 18v29, 19rl, 19r7, 19v9, 20r4, 20rl0, 21r3, 21rl5, 21rl6, 21rl8, 21r28, 21r32, 21r33, 21v3, 21v9, 21vl4, 21v29, 22rl8, 22r25, 22v29, 22v32, 23r28, 23r32, 23vl3, 23v26, 23v31, 23v32, 24rl, 24r7, 24rl3, 24r26, 24v2, 24v5, 24vl6, 25r20, 25r27, 25r31, 25v3, 25v23, 26vl, 26vl9, 26v29, 27rl3, 27rl4, 27rl9, 27r26, 27r30, 27vl, 28r6, 28rl0, 28v23, 28v30, 29rl4, 29rl6, 29r34, 29vl4, 29v28, 30rl, 30rl0, 30rl6, 30r20, 30r21, 30r22, 30r29, 30v2, 30v5, 30vl0, 31rl0, 31rl6, 31r24, 31r28, 31r36, 31v7, 31v24, 31v25, 31v26, 32rl, 32rl5, 33r2, 3 3 r l l , 34r9, 34rl3, 35r3, 35rl4, 35r21, 35v25, 35v30, 36r29, 36v9, 37rl4, 37r25, 37r30, 37v7, 37vl0, 38r26, 38r33, 39v25, 39v28, 40r5, 40r33, 40v7, 40v9, 40vl9, 41r3, 41r6, 41r8, 41r31, 42v3, 43r3, 43rl0, 43rl 1, 43r27, 43vl8, 4 4 r l l , 44rl2, 44rl5, 44rl8, 44r20, 44r21, 44r27, 44v6, 4 4 v l l , 44vl8, 45r4, 45r8, 45r24, 45r36, 45vl7, 46rl9, 46r30, 47r28, 48rl8, 48r36, 48v2, 48v30, 50r8, 50v4, 50v7, 50vl3, 50vl9, 52vl5, 53rl2, 53rl5, 53r24, 53v4, 54rl6, 54r25, 55r26, 55v9, 55v24, 56r5, 56v32, 57r6, 5 7 r l l , 57rl7, 57r23, 57r26, 5 7 v l l , 57v22, 57v28, 63r9, 63v2, 63vl0, 63vl3, 72v2, 78vl9, 81r2, 81r24, 84v7, 85r22, manne 5vr30, 12vl0, 12v24, 24v7, 26r22, 36vl2, 38v26, 41vl4, 43rl8, 43r32, 50vl5, 52v3, 56r21, 57vl6, 78r22, 79r26, 79r28, mannen 2rr23, 5vl7, 12r25, 12v8, 12vl7, 12v23, 17vl7, 18vl8, 26vl2, 31v23, 36v24, 38v30, 42rl3, 44v33, 45rl5, 63r4, 63r8, 72r22, mannes 4vrl0, 5vll7,
Glossar 6rl 11, órli4, lOvlO, llv27, 18r26, 20rl4, 21v3, 21v32, 22rl0/11, 24r24, 30r30, 31vl9, 33vl4, 33v27, 33v29, 35vl9, 35v23, 35v35, 36v30, 37r2, 38r6, 38rl7, 38rl9a, 39rl4/15, 39r33, 42rl5/16, 43vl7, 44r4, 44rl4, 48r25, 48v23, 49r26, 49v28, 50r29, 50vl7, 62vl9, 77vl0, 78v28, mannis 43vl5. DRWB 9, Sp. 116 ff.; Lexer I, Sp. 2021 ff.; Grimm, DWB 6, Sp. 1553ff.; Trübner 4, S. 547 ff.; Kluge/Seebold, S. 460 -> gemannet ; ¡antman ; muntman ; vriman ; zinsman manen sw.V. 'erinnern, auffordern, ermahnen': Wer uf gnade gedient hat, der mus den erbn gnadin manen 16r28, mit urteilen manen 'gerichtlich auffordern' 64r7/8, manen 62vl4. mmschaft st F. 'Lehenspflicht, Abhängigkeitsverhältnis des Lehensmanns gegenüber seinem Herrn': Swen der herre sinen schilt mit manschaft nideret 7vrl9, Ban liet man ane manschaft 52v30, manschaft lr22, 2vl7, 8rl2, 52v30, 65v5, 65vl3, 65v24, 65v30, 66r7, 66rl6, 66r27, 66vl, 68rl, 71vl6, 85vl3. marke st. F. 1. 'Gemarkung, abgegrenzter Bezirk einer Gemeinde': Swer vie tribit uf andere marke 5vr5, marke 37r20; 2. 'Markgrafschaft': geschit is aber in einer marke, so mogens wesin allerhande luite, wer si sin, vollenkumen an irme rechte 28r20, di marke zu Brandenburg 52r4, marke 28v4, 79v22. markgrève sw. M. 'Markgraf, königlicher Richter und Verwalter eines Grenzlandes': di markgreven von Missene ... sin alle Swabin 3vr20, markgreve 23rl6, 51r4, 53rl 1, 60r8, markgreven 6vl27, 28v5, 49v5, 53rl. markscheidunge st. F. 'Markgrenze, Gemarkungsgrenze': Ab zcwei dorf umme eine margscheidunge sich zcweien 79v4, margscheidunge 8rll3. markstein s t M . 'Grenzstein': Swer marksteine sezt 5vr8, marksteine 38rl0, marksteinen 33r24/25. markt st. M. 1. 'Markt, der auf dem Marktplatz getriebene Handel': Von valschenphenningen, von markte, von münzen 5vlll, Nimant ensal markt noch muncze erhebin ane des richters urlop 32v20, markt 53rl8, markte 34v3; 2. 'Marktort': Binnen markte oder binnen uswendigene gerichte endarf nimant entworfen 45v33, marktin 6rr6. DRWB 9, Sp. 242 ff.; HRG 3, Sp.324ff.; Lexer I, Sp. 2049; Grimm, DWB 6, Sp. 1644 ff.; Trübner 4, S. 559 f.; Kluge/Seebold, S.463 marktzol st.M. 'Marktzoll, Abgabe für die Handelser-
289 laubnis auf dem Markt': Wer so marketzol enphurt, der sai drisig Schillinge geben 32v31a. marschalk st. M. 'Marschall, Aufseher über das Gesinde bei Reisen und Heereszügen': der marschalk, der herzöge von Sachsin 51r3. matter st. F. 'Martyrium, Marter': Got hat den man noch im gebildit unde mit siner martir irlost 46v7, marter 9v29, martir 41r35. martern sw.V. 'kreuzigen': Des vritagis machte got den man unde wart des vritages gemarterit durch den man 41r31/32. mäs st. N. 'eine bestimmte Menge zum Messen, Maß': Dis selbe gerichte get über unrecht mas 29r29. meineide Adj. 'meineidig': danoch sai swerin sin gezug, das sin eit reine unde nicht meineide si 57r21. mem'e, menige st. F. 'Vielheit, Menge, Schar': di meiste menie 'die Mehrheit' 15r4, 28vl6, 28vl8, 45v3, 78rl4, der meisten menie 38v34, di meiste menige 73r2. mensche sw.M., mensch st.M. 'Mensch, das menschliche Geschlecht': Da bi is uns kundig von gotis wortin, das der mensche gotis bilde is 47r21, Got... machte den menschin in ertriche 9v24, menschen 10v8, 40rl6/17. menscheit st. F. 'Menschheit, Gesamtheit aller Menschen': Des dunrstagis vurte got unse menscheit zu himele 41r29. meren sw.V. 'das Abendmahl feiern': Des dunrstagis merte got mit sinen jungern in deme kelche 41r27. merken sw.V. 'verstehen, erkennen, begreifen': Nu merket, wi odir wo di sippe beginne unde ende 1 lr6, merken 59r3/4. messer st. N. 'Messer': Er he ouch vor den herren kume, he sai swert, messer ... unde alle wapen von im tun 75v22. mìden st. V. 'meiden, fernbleiben': Im sai nimant icht odir nicht zu koufen geben ..., unde sai en miden an allen dingen 2vr29. mile st F. 'Längenmaß, Meile': Man enmus keinen markt buwen deme andirn einre milen nae 53rl9. minne st. sw. F. 1. 'Liebe, Freundschaft, Wohlwollen, Güte': Des heiligen geistis minne, der sterke mine sinne 9vl/2, si envorebenen sich mit minnen 44v27; 2. mit minnen sizzen 'sich gütlich einigen': wo man ieme leistet, deme man geldin sai, oder mit sinen minnen sizt, da hat man en allen geleist 56r23/24.
290
Glossar
-> H R G 3, Sp. 582 ff.; Lexer I, Sp. 2144 ff.; Grimm, DWB 6, Sp. 2238 ff.; Trübner 4, S. 630 ff.; Kluge/Seebold, S. 480 -> sizzen 4 miselsuchtig Adj. 'aussätzig': Lamen man unde miselsuchtigen ..., den enmus man zu kunige nicht kisen 50r8, missilsuchtigen 11 v 17. missebären sw.V. 'sich ungebärdig benehmen, betragen': Das vorlos in allen Calefornia, di vor deme riche missebarte von czorne 40vl7. missesprechen st.V. 'sich versprechen': Der Stammemde man, missespricht
he, he mus sich wol irholn 2 3 v 3 1 ,
mis-
sespricht 76r24/25. -> vorsprechen 3 missetät st. F. 'Vergehen, Missetat': di wip in irme gesiechte alle erbelos sint gemacht durch irre vordim missetat 14v27, missetat 41r9, 41v3. missetün unr.V. 'Schaden anrichten, unrecht handeln': kein urteil enmus he me scheidin, he enhabe gebessert, das he an den dren orteiln missetet 61v30, missetut 63vl2, enmissetut 40r34, 57vl5. mite st. F. 'Lohn, Belohnung': das he durch libe noch durch leide noch durch mite ... schribe noch tu an sime ammechte 3rr27. -» bümite mittag st. M. 'Mittag (als Frist bei Rechtshandlungen)': Kamphes mag ein man wol weigern, ab man en grusit noch mittage 25r32, Gerichtis suln alle warten, di dingphlichtig sin, von der zit, das di sunne ufget, bis zu mittage, ab der richter da is 51v30, mittage 60r21, 60r24. morden sw.V. 'morden, ermorden': Wirt ein man gemordet uf dem velde 7rl3, gemordit 5 7 v l l . morder st. M. 'Mörder': Alle mordere unde di den phlug rouben ..., di sal man alle radebrechen 29r30/31. morgen s t M . 'Ackermaß, Morgen': Eine wurte oder ein morgen 7rr20, morgen 63vl. morgengäbe st. F. 'Geschenk des Mannes an die Frau am Morgen nach der Hochzeitsnacht, das Vermögen der Frau im weiteren Sinne': Was man gibt zu morgengabe 4vl22, morgengabe 4vl24, 4vl29, 7rll6, 15r24/25, 15vl3/14, 15vl9, 15v28, 17rl7, 31r32, 55rl5, 55vl. -» H R G 3, Sp. 678 ff.; Lexer I, Sp.2200f.; Grimm, DWB 6, Sp. 2567f. mortbrant
st. M. 'Brandstiftung': Der den man slet oder
vet oder roubet oder burnet, sunder mortbrant..., man das houpt abeslan 29vl. mortbumere st. M. 'Mordbrenner': mortburnere 29r32/33.
vorrethere
den sal
unde
munch st. M. 1. 'Mönch': Derphaffe teilt mit deme brudere unde nicht der munch 17v8, munchen 17vl6; 2. gräwer munch 'Zisterzienser': grawer munche recht 17vl9. munchen sw. V. 'zum Mönch machen, ins Kloster schicken': Muncht man ein kint binnen sinen jaren, das mus wol binnen sinen jaren usvaren unde behelt lantrecht unde lenrecht 17v9. munchskleit st. N. 'Mönchskleidung, Kutte': Begibit sich ein man der werlde, der zu sinen jaren kumen is, unde tut he munchscleidere an 31 vi5. mundelin st. N. 'Mündel': Wen alse he sich selbe mus vorsten, als mus he sine mundeline vorsten 20r21. munt st.M. 'Mund': Welch man an munde ... belemt wirt..., man mus is im gelden mit eime halben wergelde 30r29, munde 68r9, von munde zu munde 74r21/22. muntman st. M. 'der sich in den Schutz eines anderen begibt, Schützling, Klient': Wir vorbiten vesteclichen, das imant icheinen muntman habe 2vr3. münze st. F. 1. 'Münze, geprägtes Geldstück bzw. das Recht, die Münze zu prägen, Währung': Nimant ensal markt noch muncze erhebin ane des richters urlop 32v21, münze 51v4, munzce 77v6, munczen 39vl, 62vl, münzen 5vlll, 7rrl5; 2. 'Münzstätte': Wir sezcin unde gebiten, das alle di munzcen, di sint unsers vatirs, des keiser Heinriches gezciten, gemacht sint, das di abe sint 2rr9, munczen 2rr7, munzcen 2rrl7. H R G 3, Sp. 770 ff.; Lexer I, Sp.2236; Grimm, DWB 6, Sp. 2703 ff.; Trübner 4, S. 704 ff.; Kluge/Seebold, S. 493 -» phenning-, phunt; schilling munzer st. M. 'Münzmeister, der das Recht besitzt, die Münzen zu prägen': Buitet der munczer einen valschen phenning us, das he da mite koufen wil, is get im an den hals 32v6, munczer 32vl9, munzer 32v29. müsteil st. N. 'die Hälfte der bei der Erbteilung vorhandenen Speisevorräte, die an die Frau fällt': Von morgengabe, musteil unde gerade 4vl29, Gemeste swin gehören zu dem musteile unde alle di gehovete spise in iclichen hove irs mannes 17r20, musteil 15vl4, 55rl6, 55v2. H R G 3, Sp. 798 f.; Lexer I, Sp.2241
Glossar müsteilen sw.V. 'die bei der Erbteilung vorhandenen Speisevorräte zur Hälfte teilen': Dar noch mus di vrouwe mit den erbn musteilen alle gehovete spise 16vl/2. müter st. F. 'Mutter': Helt der vater oder di muter kindere in Vormunde 4vll2, muter I r l 5 , llv31, 12r4, 12rl4, 13v6, 13v8, 13v24, 14vl2, 14vl3, 14v20, 15vl5, 15vl7, 15vl8, 15v23, 18v21, 21vl, 21v4, 2 1 v l l , 31r6, 36v22, 54vl5, 55rl, 68v20, mutir 1 I r l 1, 13v27, 14v8/9, 54v28. mütwille sw. M. 1. 'freier, eigener Wille, Gutdünken': Swas ein herre von mutwillen lief 7vl23, Vragit he noch sime mutwillen unde nicht noch rechte, das enschadet noch envromt irme kein 24v8, mutwillen 51rl0, 71rl3, 76r29; 2. 'böse Absicht': Entket der knecht den herren von mutwillen, he sal deme herren also vil geben, als im der herre gelobet hatte 35r33, mutwillen 53vl0.
N nacht st. F. 'Nacht': Unde wirt der dip oder der rouber binnen tage unde binnen nacht nicht vorwunden, so hat der gougreve kein gerichte dar an 23rl0, Wer des nachtis korn stilt, der vorschult den galgen 35r23, binnen drin tagen unde nacht 4 2 v l l , nacht 28r27, 78v7, 82rl0, 83v25, nachtis 33r28. -> vierzennacht nägebom Part.Adj. 'nachgeboren, zweitgeboren': Lipgedinge enkan den vrouwin nimant gebrechin, weder nagebom erbe noch nimant, uf den das gut irstirbit 16r2. nail st. M. 1. 'Nagel, Verwandtschaft des siebten Grades': An deme sibindin stet ein nail unde nicht ein glit l l r 2 8 , naile l l r 3 0 ; 2. 'Nagel, Schraube, um etwas daran zu befestigen': Icliche rute sal haben zwelf naile ufwert 48rl7, nail 48rl7, 48r20, naile 4 8 r l 9 / 2 0 , 48r20. nailmäg(e) sw. M. 'Nageimage, Verwandter im siebten Grad': Dar umme endit sich da di sippe unde heisin nailmage l l r 3 0 . näkebüre sw.st. M. 'Anwohner, Dorfgenosse, Nachbar': Unde swer sich zu gezuge buit unde siner nakebure vie intribet 6rr20, nakebure 34vl, 35v30, 38r25, 56v2, 57vl4, nakebures 38r24. name sw. M. 'Name, Benennung': Unde sal schriben alle di namen, di zcu schedelichen luten dem lande besait werdin 3rrl3, Unde weis he des vridebrecheris namen nicht, he beclage en ungenant 24r32, mit namen 'namentlich' 26v23, namen 49r24, 49v8, 51rl2, 78r22/23.
291 narwe sw.st.F. 'Narbe': So sal he wisen di wunde odir di narwe, ab si heil is 25r7, narwen 2 7 r l l . nase sw. st. F. 'Nase': Welch man an munde, an nasen, an ougen ... belemt wirt ..., man mus is im gelden mit eime halben wergelde 30r29. nemen st. V. 1. 'nehmen': Der richter sal nemen alle di gewette, di im gewettit werdin 3rl28, Noch dem hergewete sal das wip nemen ir morgengabe 17rl6, Swebisch recht enzweit nicht von sechsicheme rechte, wen an erbe zu nemene unde urteil zu scheldene 15r22, nemen 2rll8, 3rr23, 4vl4, 4vl5, 5vl3, 6vrl8, l l r l 3 , l l r 3 2 / 3 3 , llv26, I lv28, 14vl7, 15v8, 31r3, 33v22, 39r21, 50r30, 55v3, 68vl5, 69r2, 69rl0, 84vl2, neme 2vl32, 3rl23, 3rrl, 14rl8, 20r31, 36rl2, 67v22, 76rl9, nemene l l r l 7 , 18r6, 26vl5, 29v24, 31r8, 76rl4, nimt 2rr6, 4vl6, 4vll9, 7rl9, llv21, 12r3, 12rl0, 12rl7, 13vl6, 13v21, 14vl 1, 14vl4, 15r9, 15v6, 15vl3, 16v21, 16v24, 17r22, 24rl3, 31rl8, 31r23, 33v20, 35rl2, 35vl3, 36vl9, 37v22, 37v30, 3 9 v l l , 39v21, 43v25, 48v4, 52v3, 54v8, 55vl, 57v4, 62r22, 63v9, 70vl3, 76vl8, nimet 2rll0, II v i , nam 47v29, ennemen 54vl5, ennimt 37r29, genumen 15rl6, 22r4, 22r7, 25r9, 34vl0, 76r6/7, genomen 55v4/5; 2. 'wegnehmen, entwenden': Swo aber dem manne sin gut mit gewalt genumen wirt 66r9, nimt 6vll, 6vr23, 7rll, 7rrl4, 7vrl0, 71rl8, 77rl, nemen 7vl20, 38vl 1, ennimt 6rrl3, 21v2, 52r31, 69r28/29, ennimet 36vl8; 3. 'Ehepartner nehmen, heiraten': Di wile der man ane wip nicht wesen wil oder enmag, so mus he wol elich wip nemen 32r3, nemen 21v7/8, nemene llv4, nimt 5vl25, 6rr8, 15vll, 18vl, 19rl7, 19r25, 32r4, 35v3, 54vl0, 55r5, 55v9; 4. 'erhalten': he neme di gewisheit, das dem clegere gerichtet werde noch des landis gewonheit 2vl26/27, enneme 2vrl0; 5. 'erleiden': si engelden dem vater sinen schadin zcwivalt, den he von en oder von irre helfe genomen hat lvll; 6. 'freischwören': Das sal he deme herren bessern ..., he enneme sich ab des lastirs unde des schaden uf den heiligen 34r6; 7. 'leisten': he mus deme richtere wettin unde ieme sine buse geben unde us deme schaden nemen 56v24. Lexer II, Sp. 52 ff.; Grimm, DWB 7, Sp. 521 ff.; Trübner 4, S. 772 ff.; Kluge/Seebold, S.501 -* genemen 1, 2; üsnemen; widememen nennen sw.V. 'bestimmen, nennen': Alle, di der vatir nennet zu gezuge vor dem richtere ..., di suln des nicht uberig werdin durch manschaft noch durch keiner hande ding lr20, nenne 17r33. niderbrechen s t V . 'niederreißen, niederbrechen': Beheldit en eine stat gemeinlichen unde wissenlichen, ist si
292 ummemuret, der richter, in des gerickte das ist, der sal si niderbrechin 2vr32. nidere st. F.M. 'Person niederen Standes': Di nideren enmugens den hogern nicht gehelfin lvl21. nideren sw. V. 'erniedrigen, herabsetzen': Swen der herre sinen schilt mit manschaft nideret 7vrl9, das man imande mit sime gute nidere 68r6, genidert 53rl7, 85v6, erwideret 65v5/6. niderlegen sw.V. 'niederlegen, ruhen': Wen der greve kumt zu des gougreven dinge, so sal des gougreven ding nider sin geleit 2 3 r l 9 / 2 0 , wen ein man mus wol sinen herschilt niderlegin ane sins wibes willen 17v24, nidergeleit 31v22/23. niftele sw. F. 1. 'Schwestertochter, Nichte': So behelt ouch ir niftele ir gerade noch irme tode 15v21, nifteln 36v22; 2. 'Verwandte im weiteren Sinne': Iclich wip erbit zweier wege: ir gerade an ir nehiste niftele, di ir von wiphalben zugehorte 17v32. nöchkumeling st. M. 'Nachfolger im Amt': Stirbet ein richter, swas bi sinen geziten gesehen is, das sal sin nöchkumeling an deme gerichte gezug wesin 45v30. not st. F. 1. 'Drangsal, Bedrängnis': durch di not sinen viendin widersagin l v r l 3 , unde di not an im getan 25r5, des landes not 6 7 v l l ; 2. 'Nachteil, Schaden': unde sider keine not dar umme liden 20v23, he lidet dar umme keine not 28v25, not 42v29, 43r30; 3. 'Notwendigkeit, Bedürfnis': sin rechte Vormunde sal is doch an sime gute vorsten zu siner not 17rl; 4. 'Kindesnot': zu irre not 'in ihren Kindesnöten' 18v20; 5. 'Nötigung, Vergewaltigung': Von der not maget oder wibes 6rl4, Von der not 7rll7, Wip oder mait, di not vor gerichte claget 40v24; 6. 'Notwehr': Slet ein man den andern tot durch not 29vl5, unde di not uf den totin beredit werde 56r9; 7. 'Vergehen': unde sich der not entredet 42v22; 8. echte, ehafte, rechte not 'rechtlich anerkannte Notlage, Hinderungsgrund, vor Gericht zu erscheinen (Gefangenschaft, Krankheit, Reichsdienst, N o t des Landes)': Von der echten not 5rrl3, echt not 27vl4, 41v37, 67r2/3, 67r4, 67vl0, 67vl3/14, 67vl5, 67v23, 73vl2, echt not, di he bewise 36r27, is enbeneme im echt not 80r2, 82r9, ehafter not lvl24, lvl29, ehafie not 19v4, 19v5, ane rechte not 'ohne rechtlichen Hinderungsgrund' 13rl5; 9. des riches not 'Reichsdienst, Heeresdienst': wen is im des riches not benimt, das di not werde bewiset noch rechte 85rl9, 85r20. Lexer II, Sp. 103 f.; Grimm, DWB 7, Sp.905ff.; Trübner 4, S. 816 ff.; Kluge/Seebold, S.507 -» echt 2; recht(e) 1; liehe 1
Glossar nötigen, nötegen sw.V. 'notzüchtigen, vergewaltigen': swer... unechte wip notiget unde den vride an en brichet 48r34, notiget 4 v r l l , 19r25, noteget 29v2, genotiget 42vl9. -> nötzagen nötnunft st. F. 1. 'gewaltsamer Raub, besonders Frauenraub und Notzucht': Alle lebende ding, das in der nötnunft was, das sal man enthoubeten 42v25. nötnunftig Adj. 'gewaltsam': in notnunftiger einer Klage um Notzucht' 20r22.
clage 'bei
nötweren sw.V 'Gewalt abwehren, sich notwendigerweise verteidigen': das he sinen Up da unde sin gut notwerende si lvr6. nötwerunge st. F. 'Notwehr, Abwehr von Gewalt': das hes in nötwerunge tete 40vl2, in nötwerunge sins libes 56r9. nötzagen sw.V. 'vergewaltigen, notzüchtigen': Umme kein ungerichte ensal man ufhouwen dorfgebuwe, is ensi, das da mait oder wip genotzaget inne werde 42vl9. -» nötigen, nötegen nuz st. M. 1. 'Gebrauch, Nutzung': Ab sich dar under nimant noch rechte zu enezut, der richter ker is an sinen nocz 33v26, nuez 18rl3, nuzce 63v8, 72r28; 2. 'Nutzen, Vorteil': nu halde wir sine e unde sin gebot..., in Sachsinlande noch sines rechtis nuez 9v35, nuez 16v29, nuzce 68r28. nuzze Adj. 'nützlich, brauchbar': Das habe wir dar umme gesezeit, wen is uns nuzce dunkit 3rr31. nuzzen sw.V. 'gebrauchen, benützen, sich bedienen': des herren husgenose si nuezen di man in der manne stat, swo he ir bedarf 74vl7, nuezen 13r32, nuzzen 33r34.
o offen Adj. 'offen, geöffnet, unverhohlen': Doch mugen di vursten gewern einen man mit eineme offen brive besigelt 36r29, Di burgetore suln offen sin, da der herre zu burgrechte inne tedinget 81vl6. offenbar Adv. 'öffendich, deutlich sichtbar': Wirt is abir zu der kirchen brächet offenbar, wer is siet unde hört, der mus sins lebins wol gezug sin 18v27, offenbar 19r24, 24vl5, 3 4 r l 7 / 1 8 , 43rl8, 81vl3, offenbare 76v2. offenliche Adv. 'öffentlich, allen wahrnehmbar und ver-
293
Glossar ständlich': Wir sezcin unde gebiten, das ichein richter nimande in di achte tu wen offenlichen 2vl25. ör st.sw.N. 'Ohr': Welch man an munde, an nasen ... unde an orn ... belemt wirt ..., man mus is im gelden mit eime halben wergelde 30r30. orlop
urlop
orlouge st. N. 'Streit, Fehde': Dis is von dem orlouge 2rl23. -» urlögen
phalzen heisen, ligen zu Sachsen in dem lande, da der kunig echte hove haben sai 51v31, phalenze 52r4, phalencz 6vl22. Lexer II, Sp. 224; Grimm, DWB 7, Sp. 1601; Trübner 5, S. 82 f.; Kluge/Seebold, S.538f. phalenzgreve sw. M. 'Pfalzgraf, Richter am kaiserlichen H o f : Der phalenzgreve richtet ubir den keiser 6vl6/7, phalczgreve 49v3/4, phalenzgreve 51rl/2, 52v31, 60r7. phalz -* phaleaze
ortbaat st. N. 'eisernes Band an der Spitze der Schwert- pbant st. N. 1. 'Pfand': Is ensal kein zinsman vor sinen scheide': Ortbant von den swertscheiden suln si abbrechen herin phant dulden poben sinen zcins 22v6, das phant zu borge tun 27v9, phant 27vl5, 32v28, 33rl4, 46rl, phan25v30. de 43v25, 57r3; 2. phandes recht 'Pfändungsrecht': orteil -» urteil Wem si das phant wider recht ..., so musen si ... doch phandis recht tun 33rl6. orvede st. F. 'Urfehde, Verzicht auf Rache': Sune aber unde orvede, di der man vor gerichte tut, di gezugit man phenden sw. V. 'pfänden': Man mus wolphenden uf sime mit dem richtere unde mit zwen mannen 12v21, orvede lande 6rl31, der vronebote sai en da vor phenden 22r32, 4vl9, 46r28. phenden 22r34, 27vl9, 33rl3, 83r29, phendin 5vr4, Lexer II, Sp.2016f.; Grimm, DWB 11.3, 22v20, 27v8, 33r27, 45r30, 50v3, phende 3vl26, 3vrl, Sp. 2409 ff.; Trübner 2, S. 310; Kluge/Seebold, S.753 gephant 37r8, 37rl8, 37r21. -> gephenden; üsgephenden orvuadig, zu mhd. vündic Adj. 'überführt, nachgewiesen': Dis selbe gerichte get über unrecht mas unde unrechte phenning st. M. 'Münze, Geld, Pfennig': Wer so unrechwage unde über valschen kouf, ab man des orvundig wirt ten weg slet über gewunnen lant, vor iclich rat sai he 29r30. geben einen phenning 33rll, di vrischen phenninge 'Ferouge sw. N. 'Auge': belemt hes aber in eime ougen, he gilt is mit deme halben teile 48v21.
P päbest -> bähest paradis s t N . 'Paradies': Got ... machte den menschin in ertriche unde saczte en in das paradis 9v25. phaffe sw. M. 'Priester, Geistlicher, Weltgeistlicher': Der phaffe teilt mit deme brudere 4vl30, Phaffen unde rittere unde ir gesinde sullen wesin zolvri 33rl, phaffe 12r3, 17v7, 59vl, 59v7, phaffen 41rl6, 41vl, 41v37, 42v31, 59r8, 59r32, phaffin 12rl0, 51r8. phaffenkint st. N. 'Kind eines Priesters, Pfaffenkind': Phaffenkindere unde di unelich geborn sin, den gibt man zu buse ein vuedir houwes 48r21. phälburger st. M. 'Bürger, der außerhalb der Stadtmauer wohnt': Wir sezcin unde gebiten, das man di phalburgere allenthalben lasi 2vr4/5. phaleaze st. F. 'Pfalz, Hof eines Fürsten': Vunf stete, di
sengeld, Fersenpfennig' 55r7, phenning 32v6/7, 32vl0, 32v33, 37v27, 37v29, 47v28, 47v28/29, phenninge 2rrl4, 6rr26, 29r26, 29v22, 32v4, 32vl3, 32vl6, 32vl9, 32v24, 32v26, 34v5, 37rll, 37r21/22, 37v33, 43v31, 43v33, 46rl3, 46rl9, 47rl7, 47v27, 47v30, 47v33, 47v35, 48v35, 48v35/36, 53r8, 77v6, phenningen 5vlll, 21r7, 26vl3, 32v25, 32v28, 37v32, 39r27. -» vrisch 2 phert st. N. 'Pferd, Reitpferd': Gibit der vater dem sone ros unde phert 4vlll, phert 5vr30, 6rrl, 13r31, 15v27, 16v6, 34r32, 35r8, 35vl9, 35v23, 35v27, 37rl3, 40r6, 41vl4, 43r34, 43vll, 44r34, 45vl0, 49rl3, 60r25, 78v4, pherde 10r8, 28r26, 28r28, 78v8. -> ritepherti ros ; runzit ; zeiter phläge st. F. 'Obhut, Fürsorge, Pflege': Wer denne di erben sint unde ir nehisten mage, di suln si haldin mit phlage l l v l l , phlage 38vl9. phlege st. F. 'Pachtzahlung, Abgabe': In Sente Bartholomeustage is allerhande zins unde phlege vordinet 39r23, phlege 55vl9. phlegen sw. V. 1. 'pflegen, betreiben, mit etwas umgehen': di vrouwen phlegen zu lesene 17r29, phliet 29v22;
294 2. 'geben, gewähren, stellen': Der richter sal ouch phlegen eins schildes unde eins swertis deme, den man da schuldigit, ab hes bedarf 25vl; 3. (len)recht phlegen 'der (Lehens-)Pflicht nachkommen, einer (lehens)rechtlichen Verpflichtung nachkommen': Liet si aber ein herre, he sal da lenrechtis sinem manne ... phlegen 23r7/8, rechtes phlegin 18v33/34, rechtis phlegen 24r7, rechtis zu phlegene 19v31/32, 52r30, rechtis ... czu phlegene 29vl2/13, Unrechtes zu phlegene 60r29/30, lenrechtis phlegen 60v3. -» Lexer II, Sp.252f.; Grimm, DWB 7, Sp.l736ff.; Trübner 5, S.lOOf.; Kluge/Seebold, S.541 phleghafte sw. M. 'Zinspflichtiger': Di phlechaften sint ouch phlichtig, des schultheizin dinc czu suchene 10r35, phlechaftin 10r24, phleghaften 48r4/5. phücht(e) st. F. 'Obliegenheit, Pflicht': Is aber he gemundet, das he nicht gevolgen mag, so suln di lute volgen bi phlicht, di wile si ienen sen, der den vride gebrochen hat 42r3, bi phlicht 'pflichtgemäß' 59v24, 74vl3, biphlichte 10r32. phlichtig Adj. 'verpflichtet, schuldig': Stirbet ouch der gemitte man, er den he sin Ion vordient, das im gelobt was, man enis sinen erben nicht me lonis phlichtig zu gebene, wen als he vordient hatte, da he starp 16r31, phlichtig 7rr3, 7vl25, lOvll, 12r20, 13r2, 13r5, 13r28, 22vl2, 29vl 1, 35r28, 43v9, 44r2/3, 55vl7, 56rl4, 59v6, 59vl0, 60r28/29, 63v24, 64r25, 64vl9, 66vl3, 69v2, 70rl6, 71v2, 7 5 v l l , 76rl, 77rl7, 79r4, 80vl2, 81r9, 82v9, 86r9, phlichtic 10rl8. phründe st. F. 'Pfründe, geistliches Amt bzw. die Einkünfte daraus': Di ungeradete swester, di teilt nicht irre muter rade mit deme phaffen, der kirche oderphrunde hat 12rl5. phundisch Adj. 1. 'ein Pfund wiegend': Phenninge sal der munczer halden phundisch unde ebene, swer unde gliche wit 32vl9; 2. 'das rechte Gewicht habend, vollwichtig': Den schepphinbaren vrien luiten gibit man drisig Schillinge zu buze phundischir phenninge, der sullen zwenzig Schillinge eine marg wegin 47v33, phundischer 47v35. phunt s t N . 'Pfund Geldes, Münzeinheit': Ir wergelt sin ächzen phunt phundischer phenninge 47v35, Zcen phunt wettit der man sime herren 77v3, phunt 48r6, 52vl2, 52vl3, 52vl5, 74r30, 77v5, 77v8, phunde 49rl2, 60rl3, 62r5. pine st. F. 'Strafe, Leibesstrafe': Swelch man einen beclageten man umme ungerichte geweldiclichen deme ge-
Glossar richte enphurt, wirt he gevangen, he lidit gliche pine ieme 44r23. puckel st. M. 'halbrund erhöhter Metallbeschlag in der Mitte des Kampfschildes': di pukele, di mus wol iserin sin 25vl8.
R rade st. F. 'Aussteuer, weibliche Geräte und Kleider als Erbe': Di tochter, di in deme huse is unbestat, di teilt nicht irre muter rade mit der tochter, di usgeradet is 1 lv31, rade 12r4, 1 2 r l l , 12rl4/15. -> gerade radebrechen sw.V. 'auf bzw. mit dem Rad brechen, hinrichten, rädern': Alle mordere unde di den phlug rouben oder mulen oder kirchen oder kirchove, unde vorrethere unde mortburnere ..., di sal man alle radebrechen 29r34. rammen sw.V. 'einstoßen, niederstoßen': Da suln di lantlute zu helfin mit houwin unde mit rammen 53v22. rat st. M. 'Rat, Unterstützung': Wir sezzen unde gebiten mit unser keiserlichen gewalt unde mit der vursten rate lr4, rat 84r5, rate 16rl5, 84r3, ratis 42v9, 48v3. -*• tat 5 raten st.V. 'in feindlicher Absicht auf etwas sinnen, nach etwas trachten': Swelch son an sins vatir lip retet lrl7. rechen st.V. 'rächen, Rache nehmen': Dis recht is do von, das sich nimant selbe reche lvl32, reche lvr3, richit lvr7. rechenen sw.V. 'zählen, rechnen': Des kindes jar sal man nicht rechenen von der zeit, das is di muter enphing, mer den von der zit, das si is gewan, unde lebindig in di werlt quam 68v20. recht st. N. 1. 'Recht, rechtliche, gesetzliche Anordnung, gesetzliche Bestimmung': Dis recht saezte der heiser zeu Mencze mit der vursten willekor I r l , Dis recht is do von, das sich nimant selbe reche lvl31, Got is selber recht, dar umme is im recht lip 9vl7, durch recht 'von Rechts wegen, dem Recht entsprechend' 18vl, sunder recht 'ohne rechtliche Legitimation, unrechtmäßig' 34r5, uf recht 'dem Recht entsprechend' 42v8, mit rechte 'zu Recht, dem Recht entsprechend' l r l 2 / 1 3 , von rechte 'dass.' 2rll0, noch rechte 'dem Recht gemäß' 3rl25/26, recht lvr5, 2rll3, 2rll6, 2rl23, 2rl27, 2vll3, 2vll7,
295
Glossar 2vrl6, 2vr21, 3rr29, 3vl4, 3vll3, 3vl28, 3vr8, 3 v r l l , 6vr5, 9v3, llv5, 12r25, 14v28, 14v30, 15r7, 15r20, 17vl9, 21v25, 22r22, 25v6, 28v9, 28v32, 29r9, 31vl2, 31v27, 31v35, 32v23, 33rl4, 33rl6, 33r20, 33v4, 34vl7, 36r7, 37r6, 41v35, 42rl9, 42r20, 43v6, 46r23, 46r26, 46vl3, 47r27, 49rl9, 49v32, 51v9, 52vl7, 54rl2, 54rl3, 54v24, 54v26, 55r6, 56vl3, 59vl3, 63rl5, 63rl9, 64rl0, 64rl7, 64v4, 67r6, 69r23, 70r7, 71v26, 75r23, 76rl3, 76rl4, 78r26, 83rl5, 83v23, 84vl8, 85r4, rechte 2 r l l l , 2rrl3, 2rrl8, 4vl21, 4vr3, 7vl24, 9vl3, 9vl5, 10rl4, 13r25, 14r29a, 15r21, 16r9, 17v7, 18rl2, 18r26, 18vl2a, 21vl8, 21vl9, 22rl3, 22rl7, 22rl9, 22v4, 23r3, 23v8, 23v20, 24rl6, 24r22, 24r27, 24r28, 24v9, 24v23, 24v26, 24v27, 25rl7, 25r24, 25v29, 26r33, 27v7, 29vl9/20, 29v30, 30rl4, 30v23, 30v26/27, 32rl5, 32r20, 32r21, 33r4, 33v25, 33v31, 34r23, 34r24, 34r31, 34v22, 34v33, 36r35, 36vl3, 40rl5, 41v23, 42r22, 42v21, 43v5, 44rl6, 44vl4, 44v34, 44v36, 45r29, 45v7/8, 47rl, 47r29, 50rl, 50v2, 51vlO, 5 1 v l l , 51vl3, 51vl6, 53vl4, 53vl7, 53v25/26, 54rl4, 55rl0, 58rlO, 60v23/24, 61rl5, 61v24, 63v29, 64r9, 64v24, 64v25, 65v23, 66r4, 66r26, 66r30, 66v3, 66vl2, 67r4, 67r8, 68vl0, 69rl4, 69r31, 69vl5, 70r22, 70r24, 71r22, 71v4, 73rl0, 74r5, 7 6 r l l , 76r30, 78r8, 78r28, 79v24, 79v29, 84r27, 84v21, 84v26, 84v27, 84v28, 85r2, 85v6c, 85v8, rechtin 4vl20, rechtes 29vl3, 78rl8, rechtis 2vr2, 9vl0, 9v35, 24r7, 45rl0, 50v9, 52r30, 54v24, 56v6, 56vl3, 56v32, 76r28; 2. 'Besitzrecht, rechtlicher Anspruch': kein recht zu dem seibin gute ... gewinnen I r l 6 , Welch man im ander recht zusagit 7v 129, Sin recht is ouch der zende man 50vl3, mit mereme rechte 'mit größerem rechtlichen Anspruch' 14vl2/13, recht lvl2, 15v7, 22r6, 23v23, 24r7, 36r5, 58rl2, 62r6, 63vl9, 64vl5, 70v26, 72r6, 72r8, rechte lr20, lr27, lvr30, 3rrl6, 15vl3, 31 r31, 34r34, 45vl4, 72rl0, rechtes 66r5, 66vl7/18, 75r25/26, 77rl9, 77r21, 83rl3, 83r30, 83v6, rechtis 6vr30, 36v20/21, 45r31, 56v28, 57r5, 60vl; 3. 'Geburtsrecht, Rechtsstatus einer Person, Gesamtheit der Rechte und Pflichten einer Person': Mag ein iclich seintbare vriman, der sin recht hat, dem vatir ... helfin das bezeugen lvll2, mannen, di ir recht behalden habin 2rr23, is get an iren lip odir an ir recht 3rll6, Niemant enmag irwerbin ander recht, wen als im angeborn is 14vl, recht lvl25, 3vl9, 4vl8, 4vll7, 4vll8, 6rrl5, 6vr4, 6vrl9, 12r2, 12vl 1, 14v2, 14v3, 14v6, 14v8, 14v9, 19vl3, 19vl6, 19vl8, 20v3, 20v5, 21vl3, 32v8, 48r28, 50rl3, 50rl7, 52v4, 54vl4, 54vl7, 54v20, 55v7, 58rl2, 77vl2, rechte 6vll2, 17r2, 18r26, 19rl9/20, 19v8, 20v5, 21rl2, 21rl7, 24r4, 26v4, 27r24, 29r8, 30r25, 32r6, 34v9, 42v33, 45r22, 46r32, 46vl0, 47rl2, 47v21, 48r4, 49v29, 52vl9, 53rl3, 64r21, 81r4, 83r2, 83r7, 85vl2, rechtis
2vi5, 19v31, 29vl2, 59r9; 4. 'Reinigungseid': doch stet is in des herren kore, weder he des boten recht zeu hant neme oder des mannes zu deme tage 67v21, rechte 46r4, 64v3; 5. echt unde recht 'Recht und Gesetz, Ehr- und Rechtsfähigkeit': Wer jar unde tag in des riches achte is, unde im noch der jarzeal vorteilt wirt echt unde recht, us der achte mag he sich den noch zein 19vll; 6. sin recht dar zu tun 'sein Recht ausüben, seinen Reinigungseid leisten': Enmag der lame man ... sins rechtin Vormunden nicht gehaben, unde tar he sin recht dar zu tun, he gewinnet zu Vormunden, wer das vor en tun wil 21r5, sin recht dar zu tu 34v5, sin recht dar zu tun 38v23, tut he sin recht da vor 43r30/31, tut he sin recht dar zu 43r36; 7. vollenkomen an sime rechte sin Voll rechtsfähig sein': Busen kuniges banne mus iclich man über den andern urteil vinden unde urteil scheiden, der da vollenkomen is an sime rechte 28rl2, vollenkumen an irme rechte 28r21/22, an sime rechte volkumen 3 2 v l l / 1 2 , mugen si des mit rechte volkumen 66v5, he envolkume des rechtes 72r7/8, envolkumt he nicht mit rechte 79r20/21; 8. vrides recht 'Friedensrecht': man sal über en richten noch vrides rechte 48r35; 9. gedinges recht 'Gedingrecht, Recht auf die Anwartschaft auf ein Gut': Iener mus aber sin gedinge gezugen noch gedinges rechte vor deme herren kegin dem manne, der sin gut anspricht 6 1 r l / 2 , gedinges rechte 71vl4/15, 84r30. Lexer Trübner 5, -*• biten seintrecht;
II, Sp.377ff.; Grimm, DWB 8, Sp.364ff.; S. 334 ff.; Kluge/Seebold, S.586 7; echt 4; lantrecht", lenrecht; sechsisch; swebisch; vrenkisch; zinsrecht
recht(e) Adj. Adv. 1. 'rechtmäßig, rechtskräftig, dem Recht entsprechend': Unde welch ein recht gewere si 5vl32, An eigene is recht lipgedinge der vrouwen 6vr8, Stirbet aber iener rechtis todis odir unrechtis 'Stirbt jener aber eines natürlichen oder unnatürlichen Todes' 40rl3, rechte richten 'dem Recht gemäß richten' 2vll2/13, rechte not 'rechtsgültiger, gesetzlicher Hinderungsgrund, vor Gericht zu erscheinen' 13rl5, rechte gewer 'rechtmäßiger Besitz' 63vl2/13, binnen sinen rechten tedingen 'innerhalb seines festgesetzten Gerichtstermins' 27r8/9, recht 15rl, 16vl2, 19v5, 2 2 r l l , 68r6, 69vl4, 79r26, 80vl6, 81rl8, 82rl4, 82r29, 82v5, rechte 2vl22, 3rll0, 5vrl7/18, 16v32, 20vl9, 32v29, 36r20, 36vl0, 3 6 v l l , 36vl4, 42rl6, 55r25, 62rl7, 63rl4, 64vl4, 67vl7, 69v4, 72rl5, 7 2 v l l , 74rl0, 80r24, 80vl4, 82r20, 82v2, 84v29, 85v8, rechtem 4 2 r l l , rechteme 3 5 v l l , rechten 2vl3, 6rr21, 18v5, 20r25, 2 2 v l l , 32rl3, 36vl5, 37v4, 39v6, 55v21, 56v31, 63r3, 63v5, 64rl9, 69v8, 71rl9, 72r9, 79rl7, 80r26, rechtin 13r5, 15r8, 16r7, 19rl8, 20r30, 21r4, 21r8, 22r31, 22v8, 23r8, 26r32, 50r4, 62r26,
296 rechter 14r21, 23r30, 27r33, 32rll, 37v21, 46r2, 62r23, 63r6/7, 63vl4, 7lrl9, 76rl6, 77r3, 85rl7, rec/m'r 18v2, 25vl0, 34vl5, 47r23; 2. 'von Rechts wegen zugänglich, öffentlich': Wir sezcin unde gebiten, das man di rechten lantstrasen vare 2rl29, rechtin 2rl31; 3. 'rechts': Werbuse, das is sine rechte hant 30r9, von deme rechten Stade 'auf das rechte Ufer' 33vl. not 8 rechtelös Adj. 1. 'gerichtsunfähig, ohne Recht': Kemphin unde ir kindere, spillute unde alle, di unelich geborn sin ..., di sint alle rechtelos 19r30a, rechtelos 3rl4, 20v29/30, 21r32, 26r33, 54rl7, rechtelose 4vr26, 21r33, 45rl, rechtelosen 4vrll, 7rll9; 2. erlös unde rechtelös 'ehrlos und gerichtsunfähig': Swelch son an sins vatir lip retet..., der selbe ist erlös unde rechtelos ewiclichen Irl9, erlös unde rechtelos lr26, lr28, lvr28, 2vll, 29r23, rechtelos unde erlös 31r2; 3. echtelös unde rechtelös 'rechtsund gerichtsunfähig': Is ist mancher echtelos unde nicht rechtelos 4vr31, Is ist manch man rechtelos, der nicht enis echtelos 21r32. -» echtelös; erlös
Glossar riche st. N. 1. 'Reich, Herrschaft, beherrschtes Land': Wir vorbiten bi unsen hulden, das imant den anderen beleite durch das lant durch kein gut, he enneme das geleite von deme riche 2vrl0, des riches getruwin mannen lr4, romischeme riche 59v25, 78vl6, riche 3rr32, 3vl7/8, 6rr30, 47r35, 47r37, 47vl, 49v31, 50rl, 51v3, 59v6, 78v26/27, 80rl3, riches 3vr24, 4vrl2, 6rl28, 6vll5, 7rl20, 7rr4, 8rl26, 19r31, 19vl0, 40v21, 41v27, 45r2, 45r20, 45r23, 49r23, 50r6, 51r2, 51r5, 51r7, 51rl2, 51rl9, 51v2, 52v6, 59vl, 59v20, 59v30, 60rl, 60rl2, 66rl8, 67vll, 74rl7, 74r26, 74vl, 79r4a, 79r7, 80r6, 80rl2, 81r7, 81r24, 81r25, 85rll, 85rl2, 85rl9, 85r22; 2. 'Reichsoberhaupt, Kaiser': Swer mer zcolles nimet, denne he zeu rechte sal ..., wirt he des bezeugit vor sime richtere oder vor deme riche, alse recht ist, den sal man vor einen strasrouber haben 2rll3, riche 2rrl2, 4rll7, 18r21, 28v22, 40vl7, 45r22, 50rl9, 54v6, riches 18rl4; 3. 'Gericht, Königsgericht': das dritte is das, das man kein urteil so recht vor dem riche binnen Sachsin envint 15rl, riche 6rl29, 45r21. Lexer II, Sp.417f.; Grimm, DWB 8, Sp. 573 ff.; Trübner 5, S. 352 ff.; Kluge/Seebold, S.590 -» ächte 2; dinst 3; hulde; keiser; nöt 9
rechtste Adv. 'am besten, zutreffend': Dar umme bitte ich czu helfe alle gute lute, di rechtis gern ..., so sis rechste rìche st.M. 'der Reiche': Got hat den man noch im gewissen 9vl4, rechste 28v24. bildit ...; im was der arme also liep alse der riche 46v8. rede st. F. 1. 'rechtlicher Zweck, rechtliche Absicht': Unde sal schriben alle di urteile, di von grosen Sachen vor uns gesament werdin uf di rede, das man an sulchen Sachen di selben orteile stete habe 3rrl9; 2. 'Rechtssache': Dar umme bitte ich czu helfe alle gute lute, di rechtis gern, ab keine rede begeine, di min tumme sin vormide 9vll; 3. 'Erklärung, Rede vor Gericht': Der richter sal immer den man vragen, ab he an sins vorsprechen wort je, unde sal urteil vragen zcwischen zwier manne rede 24v7, rede 24vl3, 76r23, 76r28, 76vl0, 77v23, 85v6b; 4. 'Rede, Überredung, Uberzeugung': Durch das bedarf man manchvaldir rede, er man di lute des in künde brenget, wor an man rechte tu 84v25. redelich Adv. Adj. 1. 'ordnungsgemäß, rechtmäßig': Wer in deme nidirsten vorvest is, he enis in dem hoesten nicht vorvest, he enwerde da rede liehen inbracht 45v24, redeliche kore 'rechtmäßige Wahl' 60rl0; 2. 'rechtschaffen, redlich': he liet is, weme he wil, der sich redelich gehalden hat 51r28. reine Adj. 'wahr, ehrlich, lauter': danoch sal swerin sin gezug, das sin eit reine unde nicht meineide si 57r21. remen sw. V. 'zielen nach': Der man sal gelden den schaden ..., alse he remet eins vogels 35rl9.
richten sw.V. 1. 'Recht sprechen, richten, verurteilen': Unde swen hes beredit, so sal man im richten über di sache an des vater stat lvl30, Der ... sal allen luten richten, di im clagen 3rll3, Alle clage unde alle ungerichte mus der richter wol richten in sime gerichte 23r26, richte 3rl25, 3rl32, 29vl7, richten 2rl28, 2vll3, 2vl22, 2vl29, 2vrl5, 2vr23, 2vr33, 3vl20, 3vr2, 3vrl5, 5rlll, 5rr29, 6rl7, 9v20, 23rl2, 26rl7, 27r29, 28rl3, 29r21, 29r25, 29r27/28, 30v24, 30v26, 32r29, 32v2, 41v25, 41v29, 42rl6, 42v20, 43rl, 43r4, 44r3, 45v25/26, 48r34/35, 51v5/6, 56v31, richtene 23rl/2, richtet 3vrl3, 5rrl7, 5rr22, 6vl7, 6vl31, 24vl5, 26r4, 29v5, 42r34, 43v20, richtit 43vl9, 43v27, gerichtet lvrl3, 2vl27/28, 42v21, gerichtit 10r32/33, enrichtet 6vlll, 29v9/10, 32vl; 2. 'nachrichten, die Todesstrafe vollziehen': scherflichen richten 2vll7, Wer des nachtis gehouwen gras oder gehouwen holcz stilt, das sal man richten mit der wit 33r30, Ubir schephinbare Iute, wenne di iren lip vorwirkin unde vorteilt sin, so enmus nimant richten wen der echte vronebote 50r24; 3. 'vorbringen, richten an': Swer aber sine clage richtit ..., wirt im nicht gerichtet, so mus he durch di not sinen viendin widersagin l v r l l . Lexer II, Sp.433ff.; Grimm, DWB 8, Sp.867ff.; Trübner 5, S. 390 ff.; Kluge/Seebold, S.599 -> gerichten; scherfliche-, volrichten
29 7
Glossar richter st. M. 'Richter': Der richter sai nemen alle di gewette, di im gewettit werdin 3rl28, Wenne der richter vrouwen Vormunden sai 4vrl9, Der kunig is gemeine richter über al 6rr7, Dar umme enmag kein gesaczt man richter sin noch nimant, he ensi gekorn oder belent richter 22v29, 22v30, des landes richtere 'Landrichter' 66r21, des hoesten richters 45v28, oberste richter 45v26, niderste richter 45v25, richter l r l ó , lr23, lr31, lvl2, lvr23, lvr24, 2rr24, 2vl8, 2vl24, 2vl26, 2vl29, 2vl31, 2vr31, 3rl2, 3rl4, 3rl21, 3rr2, 5rll, 5 r l l l , 5vl27, 6rl24, 6rr5, 6rr25, 6v|8, 6vl9, 12v8, 1 8 r l l , 18rl3, 19r6, 19rl0, 20rl, 20v28, 22r26, 23rl2, 23vl8, 23v27, 24v5, 24vl5, 24vl7, 24v21, 25r33, 25v23, 25v30, 25v32, 26r8, 26rl7, 27v25, 27v32, 28rl6, 28r22, 29v9, 31v7, 31v9, 31vl2, 32r28, 32r29, 32vl, 33v23, 35rl3, 35v34, 36r8, 36r36, 40v34, 42rl9, 44vl6, 44v34, 45rl0, 45v8, 45v29, 46r2, 48r9, 49v3, 49vl2, 49vl4, 49vl4/15, 50r21, 50r29, 51v30, 53vl8, 54r2, 54v2, 56v20, 56v30, 57r7, 58r6, richtere I r l i , l r l 9 , lr21, lr23, lr26, lvl6, lvr4, lvr28, 2rll3, 2rr21, 3rl31, 5vl6, 7rl6, 10r34, 12v22, 18r9, 18v33, 19r9, 22r24, 22r27, 23v28, 24r20, 25v28, 25v32, 27r5, 28r34, 28vl, 29v21, 30r8, 30rl4, 30r24, 31r36, 31v32, 35vl8, 36v2, 40rl5, 44rl0, 44v36, 45rl3, 49r25, 50r26, 50vl2, 56v7, 56vl4, 56v22/23, 57rl5, 78v27, 84rl2, richteres 45rl5, 45r31, richters 3vrl, 4vr25, 6vl29, 14r8, 18v29, 22v22, 23r2, 23r22, 24r5, 24r25, 27v27, 29vl2, 31vl, 31v6, 32v21, 33r28, 34r22, 42r23, 46rl2, 48r31, 53r22, 53v6, 5 3 v l l , 57v20. -> Lexer II, Sp.431; Grimm, DWB 8, Sp.888ff.; Trübner 5, S.392f. -> hoverichter; lantrichter
von ritters art 5vl5, 15r23/24, 31rl6, 59rl 1.
15v25, 18rl,
18r4,
ros st. N. 'Roß, Streitroß': Gibit der vater dem sone ros unde phert 4 v l l l , ros 13r30, 16v6, 21v30, 49rl3, rosse 53v4. roub
roup
rouben sw.V. 'rauben, berauben, ausrauben': Swelch son sinen vater von sinen bürgen oder von anderen sinem gute vorstozet oder vorburnet oder roubit lr7, roube 3vl26, rouben 29r31, roubet 29vl, 33v30, 48r33, 83vl, geroubit 42v4. -> ab(e)rouben-, berouben rouber st. M. 'Räuber': über den sal man richten als ubir einen roubere 3vr3, rouber 3vr6, 3vrl4, 23rl0, 32r30, 42vl4, rouberen 5vl21, roubern 35r3, 35rl0, roubers 21r30, roibere 3 8 v l l . -» sträsrouber roufen sw.V. 'raufen, jemanden bei den Haaren ziehen, die Haare ausreißen': Swer den andern slet oder rouft 6rrl9, Schilt aber ein man ein kint oder rouft hes 41r8. roup st. M. 1. 'Beute, Raubgut': swer wissentlichen roup koufet 3vr5, Di dube behalden oder roup 29v4, roup 33v23, 34rl4, 34rl7, 40v34, 42r25, 42vl2, 42vl4, roub 3vr3, roube 40v27; 2. 'Räuberei': Ab man di bürg beschuldeget umme den roup 6rl3, ab man si dube oder roubis anderweide schuldiget 19vl9, roup 8rrl2, 12r20, 32r30, 42r26, 66r21, roube 19vl8, 22v32, 26r20, 32v9, 48r28, roubes 34v21, 43r20, roubis 57v8.
rìten st. V. 1. 'reiten, ausreiten, voranreiten': Wer so durch den banvorst rit, sin böge unde sin armburst sai ungespannen sin 40r28, Ein iclich man sai ouch wesin czolvri, he vare oder rite oderge 33r3, riten 42v9, 46r25, ritende 78v9, ritene 10r6/7, ritet 42rl; 2. der ritende man 'Reiter, Berittener': Vier vusgenger geben einen phenning, ein ritende man einen halben 32v33, ritende man 33rl 1. -> inriten
rügen sw.V. 'ruhen': Got rugete den sibindin tag 47r6, rugete 41r32, 41r34.
ritene, ritende sw.M. 'Berittener, Reiter': Di ritenen wichen deme wagen unde di genden den ritenden 39v34, 39v35, ritenden 40rl.
rünen sw.V. 'flüstern, raunen, leise reden': Offenbare enmus der man nicht sprechen in lenrechte, me den runen stillichen zu sime vorsprechen 76v3.
ritephert st. N. 'Reitpferd': das ritephert, da der man sime herrin uffe dinen sai 49rl 1.
runzk st. N. 'kleines Pferd, Klepper, Mähre': Rittere phert, ros unde czelder unde runziten enis kein wergeld gesazt 49rl3.
ritter st. M. 1. 'Ritter, Streiter zu Pferde': Phaffen unde rittere unde ir gesinde sullen wesin zolvri 33rl, rittere 49rl3; 2. von ritten art 'von ritterlichem Stand': Iclich man unde wip von ritters art erbet zcweier wegene 4vl33,
rouplich Adj. 'räuberisch, auf räuberische Weise': Von rouplicher gewer 5vll0, rouplich 16v29, 34vl0, 53v24, roupliche 32r26, roubig 3vrl0, 3vrl3. rügen sw.V. 'tadeln, rügen': Ab is mit clage vorgerichte nicht begriffen is, andirs endarf hes nicht rügen 10vl5, rügen 10v7, 58r5, gerugit 56v5.
rüte st. sw. F. 'Stange, Längenmaß': sin wergelt is ein bark vol weisis von zwelf ruten, als icliche rute von der anderen ste eins vadems lang 48rl5, rute 48rl6.
298
s sache st. F. 1. 'rechtliche Angelegenheit, Streitsache, Rechtshandel': Alle, di der vatir nennet zu gezuge vor dem richtere über alle di sache, di hi vor geschriben sint, di suln des nicht uberig werdin durch manschaft noch durch keiner hande ding lr21, Unde swen hes beredit, so sal man im richten über di sache an des vater stat lvl30, mancher sache 'in mehreren Fällen' 72v22, sache 3rll7, 3rr4, 3rr6, 14r8, 22v2, 28rl3, 30r2, 50v24, 61v3, 64v20, 74rl2, 74r22, 76rl6, 79r29, 79v3, 81v20, Sachen lvllO, 3vi5, 3vl8, 7vr6, 22r24; 2. gröse sache 'Hochgerichtssache': Unde sal schriben alle di urteile, di von grosen Sachen vor uns gesament werdin 3rrl8. sachwalde sw. M. 'Streitgegner, Gegenpartei vor Gericht': Was he aber vor gerichte tut, des vorzugit en der sachwalde mit zwen mannen, unde der richter sal der dritte sin 12v7, sachwalden 73r9. samenen sw. V. 'vereinigen, versammeln': Unde sal schriben alle di urteile, di von grosen Sachen vor uns gesament werdin 3rrl9. samenunge st. F. 'bewaffnete Schar, Aufgebot, Heer': dise hervart sal man gebiten sechs wochen unde ein jar unde dri tage vor er der samenunge 60rl6, samenunge 83v26, 84rl. sazzunge st. F. 'Verpfändung, Ubergabe eines Pfandes': Nimant enmag eine rechte gewere gewinnen mit lenunge oder mit saczunge 69v5, sazzunge 43r34. schade sw. M. 'Nachteil, Schaden': Man sal geldin den schaden, der von warlosekeit geschiet 5vl22, Wer da besaeten acker eins andern mannes anderweide erit, he sal im den schaden gelden uf recht 37r3, Wo keine hanthafte tat nicht is, da mus man ane gerufte clagen, ab man is ane schaden bliben wil 40v38, us deme schaden nemen 'entschädigen' 56v24, schaden 5rl2, 6vl3, 6vrl4, 7rl27/28, 9v26, 23vl4, 24r20, 24r24/25, 33r6, 33rl2, 33r27, 33v33, 34r2, 34r7, 35r27, 35vll, 35vl7, 35vl9, 35v29, 36v35, 37r5/6, 37r8/9, 37rl5, 37vl3, 38rl8, 38r25, 38vl7, 40v5, 40v6, 40v9, 41r5, 43r26, 44v20, 62v9, 67rl0, 72vl5, 76r4, 76v26/27, schadin lr32, l v r l , 3vl30, lOvlO, 13v20/21, 24r30, 35vl6, 56vl2, 56vl7, 57v25, 58r2, schade 13vl5, 35vl3, 38r8, 38r9, schaden tun 'schädigen' 42vl0, tut ... schaden 48v27, schadin tun l v r l 6 / 1 7 , lvr21, schadin ... tut lvr8. Lexer II, Sp.625f.; Grimm, DWB 8, Sp. 1969ff.; Trübner 6, S.20f.; Kluge/Seebold, S.622 schadehaft Adj. 'geschädigt': unde brengit he en in scha-
Glossar dehaft ..., he mus deme richtere wettin unde ieme sine buse geben unde us deme schaden nemen 56v21. schaden sw. V. 'Schaden verursachen, Schaden anrichten': Slet ein man einen hunt zu tode ..., binnen des is im schaden wil, he blibet is ane wandil 40vl0a, Ban schadet der sele 6vl24, schaden 38vl, 83v25, 84r4, 84rl6, schadin lvr8, 84rl, schade 61vl0, schadet 5vl26, schadit 52r31, enschadit 21rl2, 26v3/4, enschadet 24v9, 46r32, 70r24, 70vl2, 76r26, 76r30, enschade 48v27, geschat 37r8. schapel st. N. 'Kranz von Laub, Blumen als Kopfschmuck, bes. bei Jungfrauen': Alle schof unde gense ..., schapile, seltere ... unde alle gebende; dis gehört zu vrouwen gerade \7r27. schar st. F. 'Gefolge des Königs, Abteilung, Schar': An sin recht enkan aber he nicht widerkumen, he enzcuschtire vor des keisers schar, da he einen andirn kunig mit strite bestet 19vl5. Schate st. sw. M. 'Schatten': Spillute unde alle, di sich zu eigen geben, den gibet man zu buse den schaten eins mannes 48r25. schatröwe st. F., mhd. schaftruowe, 'Schaftruhe, Ruhe vom Lanzendienst, Zeit der Befreiung vom Heerdienst': Sechs wochen sal der man dinen sime herren bi siner kost, sechs wochen vor unde sechs wochen nach sal he des riches vride haben unde schatröwe 59v31. schaz st. M. 'Schatz, Reichtum': Alle schacz in der erdin begraben, tifer den ein phlug get, der gehört zu der kuniclichen gewalt 1 9 r l l , schazce 4vr8. schedelich Adj. 'schädlich, Schaden bringend': Swer helt schedeliche tir 5vr21, Unde sal schriben alle di namen, di zcu schedelichen luten dem lande besait werdin 3rrl3. scheiden sw.V. 'trennen': Heldet ouch der vater sine kindere in Vormundeschaft noch irre muter tode, wen si sich von im scheiden 13v7, scheidet 4vl23, 15v6, gescheiden 6vr7, 16rl0, 5 5 r l l . -*• üsscheiden scheiden st.V. 1. 'entscheiden': doch mus der herre wol scheiden zcweier siner manne ansprache 75vl2, gescheiden 79rl6/17; 2. 'sich auseinandersetzen mit': wollen aber si sich scheiden mit deme gute 70v23. scheiden st.V. 1. 'schelten, tadeln, schmähen': Wen man, ane vleischwunden, slet oder schilt lugener 30v8, Schilt aber ein man ein kint 41r7; 2. '(ein Urteil) schelten, anfechten, verwerfen': Stende sal man urteil scheiden 29r2, scheiden 2 8 r l l , 29rl5, 61v22, 76v7, 78r5,
Glossar 85v7/8, scheid 78r25, scheide 28v31, 78r22, scheldene 5rr21, 8rll2, 15r22, scheldin 15r2, 15rl6, 28r9, 61v29, schalt 78vl2, enschalt 7 8 r l 7 , schildet 28v29/30, schildit 54r9, ìcAì'/ì 2 8 r l 4 , 28vl4, 28v32, 61v26, 78r6, 7 8 r l 7 , 7 9 r l 9 , geschelden 78r2, gescholden 28r32, 28r35, £escholdenen 28v2, geschulden 79r9, 85v3. schenke sw.M. 'Schenke, Mundschenk': Der schenke des riches, der kunig von Bemen, enhat keine kore 51r5. schephe sw. M . 'Schöffe, beisitzender Urteilssprecher': Wo ein man sins gezuges volkumt mit deme schultheisen ... unde mit den schephen, da sai der richter ouch gezuk sin 31v9, das sai der vronebote bevronen mit eime krucze, das sai he steken uf das tor noch der schephin urteile 3 6 r 2 / 3 , Swer aber under kuniges banne vorvest wirt, der bedarf zweier schephin unde des richteres zu gezuge, swen he sich uszut 4 5 r l 8 , des riches schephen 3vr24, schephin 4rll4, 2 5 r l 8 , 2 6 r l 0 , 45v32, 50r27, 51v23, 57r8, schepphen 48r9, schepphin 36v6, 54r2, schepfin 10r27. -> Lexer II, Sp.679f.; Grimm, D W B 9, Sp. 1441 ff.; T r ü b n e r 6, S. 193 f.; Kluge/Seebold, S.650 schephenbär Adj. 'zum Schöffenamt geboren': Kein schephinbare man darf sin hantgemal bewisen 6 r r l 0 , mannen ..., di alle schephinbar sin 12r25, Schephinbare vrie Iute musen wol urteil vinden über iclichen man 28r5, Die boten suln wesin schephenbare vrie 2 8 r l 8 / 1 9 , Doch enmus des riches dinstman über den schepphin vrien man weder orteil vinden noch gezug wesin 4 5 r 2 3 / 2 4 , schephinbare Iute 10r22/23, 10v30/31, 50r22, schepphinbare luite 47v24, schepphinbaren vrien luiten 47v31/32, schephinbare vri man 21 v i 4 , schephinbare vrien man 23r28, vrien schephinbaren man 26v28/29, vri schephinbare wip 5 4 v l 0 / l l , schephinbare 5rr20, schephinbarvri 49v2 7. Lexer II, Sp. 681; Grimm, D W B 9, Sp. 1444 -» vri 2 scherfüche Adv. 'scharf, mit der Schärfe des Beils': Swer das nicht tut, ubir den wolle wir scherflichen richten 2vll6. Schilling st. M. 'Münzeinheit, Schilling (aus Gold = 40 Pfennige, aus Silber = 12 Pfennige)': Wer an sime rechte volkumen is, vint man bi im einen Schilling valscher phenninge, di phenninge hat he vorlorn unde nicht me 32vl2, Schilling 49r4, 53r7, 74r30, Schillinge 8rr5, 29r20, 32v32, 3 3 r l 9 / 2 0 , 33r25, 40r27, 47v31, 47v32, 47v33/34, 48r6, 4 8 r l 2 , 48r21, 50vl9, 52r23, 52v20, 5 3 r l , 53r3, 53r5, 53r9, 55r8, 56v5/6, 56vl6, 62vl7, 78r4, Schillingen 29r22, 3 3 r l 6 , 37r6, 49r6, 49r7, 49r7a, 4 9 r l 0 , 56v9, 5 6 v l l , 77v8.
299 schilt st. M. 1. 'Heerschild, Symbol der lehensrechtlichen Ständegliederung': Alse di cristenheit in der sibinden werlt keine stetikeit enweis, wi lange si sten sulle, also weis man ouch an deme sibindin Schilde nicht, ab he lenrecht oder herschilt gehabin muge 10v35, schilt 7rr32, 7rr33, 7vrl9, l l r 2 , 54v8, 59r6, 65v4, 65v9, 6 8 r l 6 , schilde 84vl4; 2. 'Kampfschild, Schutzschild': Alle varnde habe gibit der man ane erben gelubde, di wile das he gegurt mit eime swerte unde mit eime schilde uf ein ros kumen mag 21v30, schilt 25vl7, schildes 25vl, schildis 48r26. Lexer II, Sp.737ff.; Grimm, D W B 9, Sp. 109ff.; T r ü b n e r 6, S. 76 f.; Kluge/Seebold, S.633 -» herschilt 1, 2 schiltlen st. N . 'Schildlehen, Lehen, w o f ü r der Belehnte Kriegsdienste leisten m u ß ' : Doch sagen sumeliehe luite, das me liunge sin, di ende nemen zu bescheidener zeit, alse schiltlen, das ende mit deme schilde 84vl3. schinbar Adj. 'offenkundig, sichtbar, deutlich': Der ouch toten vor gerichte brenget unde clait das ungerichte, das an im getan is, di suln clagen mit gerufte durch di hanthafte tat, di da schinbar is 40v32/33, schinbar 85r4a. schönen sw.V. 'schonen, Rücksicht nehmen auf': swas uns über den irteilt wirt, des wolle wir nicht lasin unde dar an nimande ubirsen noch nimandes schonen 2vl20, schonen 3vl22. schriber st. M . 'Schreiber, N o t a r ' : Der selbe richter sal haben einen schriber, der anschribe alle, di in di achte kumen 3rr2, schriber 3rr23, 3rr25, 3vl3. sehnen st. V. 'rufen, schreien': Wer nicht volgit, als man gerufte schriet 2 2 r l 7 , schrie 34r26, schriet 24r21, geschriet 42r2. -> beschrien schrift st. F. 'Schrift, schriftliche Quelle': Nu is uns kundig von der heiligen schrift, das an Adame di erste werlt began 10v20, di heilige schrift 46v30. -> heilig schuldig Adj. 1. 'verpflichtet, etwas zu geben bzw. zu zahlen': Man sal ouch deme erbin geldin, was man deme totin schuldig was 12r33, schuldig 6 r r l 2 , 12r33, 46v3a, 46v5; 2. 'schuldig (eines Vergehens)': Weigirt hes, he schrie im das gerufte nach unde grife en an vor sinen dip, als ab di tat hanthaft si, wen he sich schuldig hat gemacht mit der vlucht 34r28, schuldig 2vl9, 29vl0, 42vl5, 57rl9. schuldigen sw.V. 'beschuldigen, anschuldigen, anklagen': Man mus den man schuldigen in der spräche, di en
300 angeboren is 6vr2, schuldigen 22rl0, 24v33, 48v4, 57vl0a, 76v23/24, schuldige 25r4, 37rl6, 50r4, 76rl5, schuldeget 38v25a/26, 77vl9, 7 8 r l 7 / 1 8 , schuldiget 7vr3, 12r29, 14r30, 19v20, 36v26, 42r26, 44v31, 54r28, 64v20, 65rl, 66v8, 73r21, 76v25, schuldigit 25v2, 38vl5, 38v21, 46r2, 57v8, enschuldige 54r26. beschuldigen; geschuldigen schuldigunge st. F. 'Anschuldigung, Anklage, Beschuldigung': Aller schuldegunge enket der man 7rr28, schuldigunge 31v2, 44vl5, 64v26, schuldegunge 65r4/5, 75v29, 76rl9. schult st. F. 1. 'Schuld, Verfehlung, Vergehen': Umme welche schult der man vorvest wirt, wirt he in der vorvestunge gevangen unde vor gerichte bracht, is get im an den Up 27rl8, gewunnen in der schult 'der Schuld überführt' 46r7, schult 5rrl, 13v9, 27v4, 33v31, 34rl, 34rla, 43r31, 43r35, 43vl3, 44r30, 44v2, 46r8, 49v3, 56v20, 57v29, 66v4, 66v6, 67r9, 75v6, 76v21, 76v24, 83r29, schulde 3vl24, schulden 2vrl4, 48v23, schuldin 2vr23; 2. 'Beschuldigung, Anklage, Anschuldigung': der herre mochte anders an der schulde gezogen den man, wen bis he sich vorjarete an siner sinnunge 64v27, schult 25v34, 31v5, 81v25, schulden 3rrl5; 3. 'Geldschuld, Verpflichtung, etwas zu geben': Swer das erbe nimt, der gilt di schult 4vl6, schult 5rrl0, 5 r r l l , 5rrl8, 6rr24, 12rl8, 12r21, 12r23, 12r33, 16vl7, 22r23, 26v6, 36r8, 36rl0, 56r21, 57r2. Lexer II, Sp.810f.; Grimm, DWB 9, Sp. 1870ff.; Trübner 6, S.230, Kluge/Seebold, S.655 schultheise sw. M. 'Schultheiß, wörtl. derjenige, der Verpflichtungen und Leistungen befiehlt': Der greve sal haben sinen schultheisen an echteme dinge 5 r l l 3 / 1 4 , Di birgelden unde phleghaften heisen unde des schultheisen ding suchen, den gibet man vunfzen Schillinge zu buse 48r5, schultheise 49v2/3, 51v23, schultheisen 23v7, 23v8/9, 31v5, 31v8, 45rl4, 49r30, 49r35/49vl, 49v2, 53r3, 79vl9, schultheizin 10r36. schultheistüm st. N. 'Schultheißenamt': Dar umme liet he den vorsten vanenlen unde di vorsten den greven di graveschaft unde der greve den schultheisen das schultheistum 49r31, schultheistum 49r33, 79vl7. sechsisch Adj. 'sächsisch': Swebisch recht enzweit nicht von sechsicheme rechte 15r21, uf sechsiche art 19r8, binnen sechsischer art 28r30, in sechsiche art 32v3. sechswochen Kompositum aus sechs Num. card. und woche sw. F. 'rechtliche Frist von sechs Wochen': Wo der vrouwen di stat nicht enis mit deme gebiu, als ir man stirbit, binnen sechswochen noch dem drisegesten sal si
Glossar mit dem gebu rumen 15r31, Gezuges sal man ubir sechs wochen volkumen, des sich der man vormessin hat, oder zu hant, ab he willAvl, sechswochen lOvl, 10v5, 28r31, 33v7, 35r5, 35rl2, 36r35/36, 42v6, 51r26, 52v8, 62v29, 79rl8, 80r20, 82r2, 82r7, 82rl0, sechswochin 53rl2, sechs wochen 2 7 v l l , 59v21, 60rl5, 61vl3, 64rl0, 64vl 1, 68rl9, 6 8 v l l , 77r7, 78vl3, 78vl8, 81vl0, 84rl6, sechs wochin 26v30. seinen sw.V. 'segnen, bekreuzigen': Noe seinte zwene sone 46v25, Jacob wart geseint von sine vatere 46v33. seint st. M. 'Sendgericht, geistliches Gericht': gerichte aber unde seint sal he dar ab suchen 82vl7, sint 10r23. seintbäre Adj. 'gerichtsfähig, berechtigt, am Sendgericht teilzunehmen': bezuget in des sin vater zcu den heiligen vor sime richtere mit zcwen seintbaren mannen, di nimant mit rechte vorwerfin mag, der son sal sin vorteilt egenes unde lenes I r l 2 , mit siben seintbaren luten lvr27, seintbaren mannen 2rr22/23, 2 v r l 6 / 1 7 , seintbäre lvll2. seintrecht st. N. 'geistliches Recht': Hat aber he sich begeben an sins elichen wibes willen, unde vordert si en zu seintrechte us deme lebene, sin lantrecht hat he behaldin unde nicht sin len 17v21. selb dritte Adv. 'selbst mit zwei Helfern': bezuget en des sin vater vor sinem richtere selbe dritte zu den heiligen lr26, selb dritte 14r27, 22vl8, 34r35, 34v8, 40v8, 43rl9, 43v30/31, 44r33, selp dritte 34v28, 35r6, 36r9, 85vl6, selbe dritte 31v3, 43r8. selb sibende Adv. 'selbst mit sechs Helfern': Kamphes mag ouch ein man sime mage bewerin, ab sie beide mage sin, also das hes selb sibende gewere uf den heiligen, das si also nae mage sin, das si durch recht nicht zu samne vechten suln 25v5, selb sibende 26vl8, 27v23, 28vl7, 31vl8, 41vl9, 46r9, selp sibende 8 5 v l l , selb sibinde 12v24, 15r5. sele st. sw. F. 'Seele': Ban schadet der sele 6vl24, mit libe unde mit sele 41v6, sele 52r31. ^ Up 2 senden st. V. 'schicken, übermitteln, senden': Swen echt not irret, das he zu lenrechte nicht enkumt, der sende dar sinen boten, der sine not da bewise 67vl5, senden 32v23, 36r30, 36vl, 73r5, ensent 67v25, gesant 67vl8. seren sw. V. 'versehren, verletzen, verwunden': Der mus wettin ... unde gebit eine buzse ieme, den he geseret hat 22v5. sezzen sw.V. 1. 'setzen, stellen, legen': So sal en der richter nemen bi der hant unde sezzen en uf ein kussin
Glossar 50r30, Wer malboume oder marksteine seczsit 3 8 r l 0 / l l , sezt 5vr8, sezzin 5 4 r l l / 1 2 , seczin 16vl2, sezcin 3rl7, sezce 65v26, gesazt 33r25; 2. 'bestimmen, festsetzen, anordnen': Dis recht saczte der keiser zcu Mencze I r l , sazte 46vl5, gesaczt 9v34, 10r6, gesazt 2rl8, 41r23, 48r30, 49r20, 57r25, gesazteme 71v3, gesazten 38v21, 48vl5, geseczen l l v 5 / 6 , gesezcet 2rl3, gesezcit 3rr9, gesezt 2rll2, gesezzen 58rl2; 3. sezzen unde gebiten 'zu Recht festsetzen und anordnen': sezzen unde gebiten lr3, sezcen unde gebiten 2rll, 2rr2, sezcin unde gebiten l v r l , 2rl30, 2rr8, 2vll0, 2vl23/24, 2vl30, 2vr4, 2 v r l l , 3vll2, 3vr4/5; 4. bürgen sezzen 'Bürgen festsetzen, Bürgen bestimmen': bürgen sezzen 42rl5, 44v9, 45r9, bürgen sezze 44vl5, bürgen sezt 6rll9, 44r36, 56r25, bürgen sezcen 6 9 r l 5 / 1 6 , 78r7, bürgen sezcin 5rll7, 5rr9, 5rrl6, bürgen seczen 17rl3, 24r4/5, bürgen seczin 24r9, bürgen seczt 26r30, bürgen ... gesazt 13r29, he ensezce bürgen 61v22/23; 5. 'versetzen, verpfänden': Wo man aber eigen gibit oder sezt 12v9, sezt 40r6, 43r32, saczte 9v24/25, sazte 40rl3, seczt 14r23; 6. 'einsetzen': Dar umme enmag kein gesaczt man richter sin 22v29; 7. 'gefangensetzen': Swen aber der man gesazt wirt 57rl8; 8. 'widersetzen': Sezcit sich di stat da wider 3rl3; 9. 'zugestehen, zusagen': al habe he im sin vorliesin gesazt 43vl0.
301 sinnen st. N. 'Lehensbegehren': wen der herre bricht im sine jarzeal mit dem bietene, alse si der man lenget mit deme sinnene 66rl5, sinnene 66\7, sinnende 73r22. sinnunge st. F. 'Lehensbegehren': der herre mochte anders an der schulde gezogen den man, wen bis he sich vorjarete an siner sinnunge 64v29. sippe st. F. 'Blutsverwandtschaft, Verwandtschaft': Also der herschilt in deme sibendin zuget, also czuget di sippe an dem sibenden glide l l r 5 , erste sippe zcu tale 'erster Verwandtschaftsgrad' l l r 2 1 , sippe 4vl3, l l r 6 , l l r 2 9 , 1 lv2, 14vl6, 15rl0, 33vl6.
Lexer II, Sp. 894 ff.; Grimm, DWB 10.1, Sp. 643 ff.; Trübner 6, S. 343 ff.; Kluge/Seebold, S. 669 f. üssezzen; vorsezzen
sizzen st.V. 1. 'zu Gericht sitzen': Wir sezcin, das unse hof habe einen hoverichter... Der sal alle tage zcu gerichte siezen ane an deme suntage 3rll 1; 2. 'sich aufhalten, sich befinden, ansässig sein': Lest abir eine herre einen man siezen mit sime gute jar unde tag 63rl3, Swer in unrechter gewere sizet sunder lenunge 7vr27, sizzen 47vl8, siezzen 56v28, siezt 2 0 v l l , 22vl6, 83r21, ensiezt 84vl5, gesessen 39r4, gesessin 10r21, 53v28; 3. 'sitzen, niedersitzen': Der man enmus nicht siezeen bin lenrechte ane des herren orlop 77v 16/17, sizzende sal man urteil vinden under kuniges banne 29r2, siezet 65vl9, siezt 65vl5, sizzende 53v4, 54r8; 4. mit minnen sizzen 'sich gütlich einigen': wo man ieme leistet, deme man geldin sal, oder mit sinen minnen sizt, da hat man en allen geleist 56r23/24; 5. dä mite sizzen 'in Besitz behalten': Kumen si denne nicht vor, he sal da mitte sizzen, bis das sis im mit clage angewinnen 29v26.
slcherliche Adv. 'sicher, ungefährdet': Sint mag hes sichtlichen ieme lien, so das he noch eigen noch erbe dar an beredin mag 19r4.
Lexer II, Sp.944f.; Grimm, DWB 10.1, Sp. 1280 ff.; Trübner 6, S. 382 ff.; Kluge/Seebold, S.675 -» minne 2
sichern sw.V. 'eine Zusage eingehen, ein Versprechen leisten, geloben': Swelch son sinen vater von sinen bürgen oder von anderen sinem gute vorstozet oder vorbumet oder roubit oder zcu sines vatir viendin sichert mit truwen oder mit eiden lr8.
sizzunge st. F. 'Festsetzung, Verurteilung': di vorvestunge sal man gezugen er der sizzunge mit deme richtere unde mit den dingphlichten 57rl4, sizzunge 57rl2.
sie, sige st. M. 'Sieg': Wo di meiste menie sige vichtet, di behaldin das urteil 28vl8, sige 26r5. silber st. N. 'Silber': Swer silber gelden sal 5rrl9, Swer phenninge geldin sal oder silber 6rr26, silber 4vr8, 17v3, 19rl3, 46rl3, 46rl9, 46r21, silbere 26vl3, silbers lvl9, 47v28, silbirs 47v30, silbir 12v28. sinnen st. V. 'verlangen, begehren': Der man sal icliches gutes sinnen mit manschaft 8rl2, di wile he sins gutes sinnen sal odir is uszeien sal 63rl 5, sinnen 68rl3, 69v25, 80vl, sinnet 8rl27, 64v24, 65v21, 69rl4, 70r28, 85r26. -> gesinnen; vorsinnen
slag st. M. 'Schlag, Schlag mit der H a n d , mit einem Werkzeug oder mit einer Waffe': Wer aber den andirn knutelit, so das im di siege swellin 27r3, siegen 27rl5, siege 26rl4, 30r27, 53vl9. sJagen, slän st.V. 1. 'einen Schlag geben, schlagen, schlagen mit einem Werkzeug oder einer Waffe': Swen man mit knutteln slet 5rl29, der cleger sal ufsten unde sich zu kamphe biten unde sla zwene siege 26rl4, Der richter sal... mit einem bile dri siege slan an eine bürg 53vl9, slet 5vll7, 5vr26, 6rrl9, 30v8, 33v29, 34rl, 41r8, geslain 10v9, geslagen 34r2, ensluge 4 1 r l l , geslagin 57v22; 2. 'schlagend gestalten, anfertigen, schmieden, prägen': Unde swer uf imandis phenninge keiner slachte valsch slet, den sal man haben vor einen
302
Glossar
velschere, unde den alsam, der si da heiset slan 2rrl5, 2rrl6, slan 32v24; 3. 'erschlagen, totschlagen': Wirt ein man gemordet uf dem velde oder ein sin vrunt geslagen 7rl4, Sus sal man ouch vorwinden einen toten, ab man en an dube oder an roube oder in sogetanen dingen geslagen hat 26r21, slet 5rr23, 5vr21, 7rl5, 29r34, 29vl4, 40v9, 41r2, 41r6, 43vl7, 43v20, 57v28, singen 47vl7; 4. 'eine Richtung nehmen, einen Weg einschlagen': Wer so unrechten weg slet übergewunnen lant 33rl0; 5. 'herausschlagen, ausschlagen, hinaustreiben': Slet hes aber us unde enhovet is 35vl3. -> ab(e)slän; erslagen; tötslagen; schen
ungeslagen ; vel-
smächeit st. F. 'Schmach, Schimpf, verächtliche Behandlung': tut he im smacheit mit Worten oder mit tat ..., dar umme mus he deme herren wetten 77rl0. snüzen sw. V. 'sich schneuzen': Ab der man sich wischet odir snuzcet..., dar umme enwettet he nicht, alleine wenen is tumme lute 77 r26. son, sün, mhd. sun, st. M. 'Sohn': Swen der son lebet noch des vater tode 7rr29, Vatir unde muter, swester unde bruder erbe nimt der son unde nicht di tochtir 14vl4, son lr5, l r l 3 , l r l 7 , lr25, lr28, lr30, 5rr28, 7vll3, 1 lv21, 13r27, 14rl4, 15vll, 15vl7, 30vl4, 30vl6, 30vl9, 30v30, 30v31, 31r28, 46v31, 54vl9, 60vl7, 62r24, 65r7, 6 5 r l l , 65rl8, 65r20, 65v3, 65v6, 65vl 1, 69r28, 70rl, 70r4, 70r28, 72r2, 73vl5, 73v22, 73v28, 74rl, 74v5, 80v8, 84v2, sone 4vlll, 5vll, 7rr32, 7vll3, 7vl28, 14rl0, 16v23, 46v25, 54v27, 6 8 r l l / 1 2 , 69v27, 69v28, 70rl2, 70vl5, 72rl, sonen 80v24, sones 14vl9, sons 15vl2, 15vl9, sun 13v24, 15vl2, 30v20, suns 15v24, sune llv24, 13r30. -> Lexer II, Sp. 1302 spilman st. M. 'Spielmann, fahrender Sänger, Gaukler': AI si ein man spilleman oder unelich geborn, he enis doch roubers noch dibes genos nicht 21r29, spilman 8rrl5, spillute 19r27, 48r24.
22r21, 34vl 1, 76v20, sprachen 76vl4, sprach 47rl8, gesprochen 65r2, 76v27; 2. 'beanspruchen, Anspruch erheben': Ab zwene uf ein gut sprechen noch dem drisegisten, iener, der is under im hat, der ensal is ir keime entworten 44v24, sprechen 45r35, spricht 63r22, 68v22, 82v23, 83r22, gesprechen 29v29; 3. 'behaupten, aussagen': Spricht aber iener, he hab is gekouft uf deme markte 34v2, spricht 22vl6, 38v28, sprechen 7vr26; 4. 'herausfordern': Spricht ein gewunt man den zu kamphe an, der en gewundet hat 21rl8, sprichit 4vr29; 5. 'klagen': Wirt aber he vorwundin, uf den man sprichit, man richtet über en 26r4, spricht 74r6; 6. 'widersprechen': Spricht aber iener da wider, ab is gewant is 34r31. ansprechen 4; missesprechen; dersprechen
vorsprechen 1; wi-
stat st. F. 1. 'Stelle, Ort, Stätte': Di zcwischin deme naile unde deme houpte sich zcu der sippe geczien mugen an glicher stat, di nemen das erbe glich llr32, Der geburmeister is wol gezug über den gebur in sime gerichte an des richters stat um sulche sache 14r8, an des vater stat 'anstelle des Vaters' lvl30, lenes stat 'Lehensstätte' 62v4/5, stat 2 r l l l , llv26, 17rl, 26v9, 27v27, 31v7, 34v4, 36r31, 39v26, 43vl7, 45rl5, 45v28, 53r7, 54rl2, 62r30, 62vl2, 65v6, 68v25, 70v29, 73v22, 74r2, 74r5, 74vl7, 81vl 1, 84rl3, stete 40r21, steten 66r29, 81vl4, stetin 7v13, 24vl4, 45r5; 2. 'Stadt, bewohnter Ort': Wir sezcen unde gebiten, swelch herre sine stat oder sine bürg buwen wil, der sal buwin mit sime gute oder mit siner lute gute 2rr3, stat 2vr24, 2vr30, 3rll, 3rl3, 51v2, 62rl3, stete 51v31, steten 41v31/32, 42r7a, stetin 2rrl, 2vr6, 3vl6; 3. 'Boden, Stätte, Grundstück': Wo der vrouwen di stat nicht enis mit deme gebiu, als ir man stirbit, binnen sechswochen noch dem drisegesten sal si mit dem gebu rumen 15r29, stat 15v2, 19rl5, 33r26. statunge st.F. 'Erstattung, Vergütung': di sullen den herren irer statunge manen 62vi 4.
spräche stsw.F. 'Sprache': Man mus den man schuldigen in der spräche, di en angeboren is 6vr2, spräche 54r27, 54r29.
steber st. M. 'Eidvorsprecher': Ab der man aber vor den herren kumt, he bitte aller erst vorsprechen, da noch der heiligen unde des stebers, das he sin gut uszcie 75rl9, steber 75r21/22.
sprechen st.V. 1. 'sagen, sprechen': Wer den vride bricht, das sal man richten als hi vor gesprochen ist 41v25/26, Mait ... musen Vormunde haben an iclicher clage, durch das man si nicht Vorzügen mag, des si vor gerichte sprechen 20vl6, sprechen 6rl23, 24rl4, 24vl9, 36v5, 65vl6, 76v2, 76v5, sprechin 24vl6, spreche 25rl3, 28v30, 33v34, 65v21, 76rl2, 78r21, Sprech 34r2, spricht 7vrl6, 9vl3, 18vl2, 76r21, 84v29, sprichit 74rl4, sprichet
stegereif st.M. 1. 'Steigbügel': Alle varnde habe gibit der man ane erben gelubde, di wile das he gegurt mit eime swerte unde mit eime Schilde uf ein ros kumen mag, von eime steine oder stocke einer dumeln ho, ane mannes helfe, das man im das ros unde den stegereif halde 21v33; 2. den stegereif halden 'den Steigbügel halten zum Zeichen der Lehensuntertänigkeit': Swelches tages der man sime herren den stegereif helt..., des tages enis he nicht phlich-
Glossar tig, sime herren zu lenrechte zu stende 75v9, stegereif 10r9. Lexer II, S p . l l 5 8 f . ; Grimm, DWB 10.2.1, Sp. 1386 ff.; Trübner 6, S.553f.; Kluge/Seebold, S.698 stelen st. V. 'stehlen': Wer des nachtis gehouwen gras oder gehouwen holcz stilt, das sai man richten mit der wit 33r29, stilt 5vl23, 35r23, 35r24. vorstoln sterben st.V. 'sterben': Unde stirbet des mannes wip, von der gerade berichtit man im sin bette 6rr22, stirbet 4vr20, 13rl, 13rl 1, 13r27, 13r33, 15vl2, 15vl7, 16r28, 23v2, 40rl3, 43r29, 44r34, 45v29, 80r22, 80v4, 80v27, 82v21, 83r4, stirbit 6rll7, 6rr5, 7vll3, 10v3, llv23, 12rl6, 12v28, 13rl6, 13vl0, 14vl0, 15v22, 17v26, 18r6, 18r29, 18v21, 20v4, 31r22, 35r21, 38v20, 39v25, 39v27, 44r29, 44r31, 55r28, 55v6, 55vl2, 55v27, 57v24, 57v27, 60v30, 65rl2, 68r2, 6 8 r l l , 68v3, 69r29, 69v26, 70rl, 70v26, 70v28, 71rl2, 73vl3, 73vl6, 73v23, gestirbet 30vl5, starb 15v8, 16r21, 16v8, starp 16r32, 47v9, 55v20, sterbe 60v7, 6 0 v l l , 66r7/8, enstirbit 30v2. ersterben 2 Sterken sw. V. 1. 'stärken, kräftigen': Des heiligen geistis minne, der Sterke mine sinne 9v2, Alse man den kunig kuset, so sai he dente riche hulde tun unde swern, das he recht Sterke unde unrecht krenke 49v32; 2. 'unterstützen, behilflich sein': Di dube behalden oder raup oder di si mit helfe dar zu Sterken, werdin si des vorwundin, man richtet über si als über iene 29v5; 3. 'bekräftigen': des lenes gewere sterkit he alleine uf den heiligen 63r5. stete Adj. 'beständig, fest, anhaltend': kirchen unde kirchove unde iclich dorf..., di suln steten vride haben 41r20. stète Adv. 1. 'beständig, dauerhaft, stets': Unde sai schriben alle di urteile, di von grosen Sachen vor uns gesament werdin uf di rede, das man an sulchen Sachen di selben orteile stete habe 3rr21, stete halden 'gewährleisten' 12v3, 68v2, stete 69vl3; 2. 'bindend': Eines iclichen gevangenen gelubde ensal durch recht nicht stete sin, das he in dem gevengnisse globit 46r24. stètikeit st. F. 'Gewißheit, Sicherheit': Alse di cristenheit in der sibinden werlt keine stetikeit enweis, wi lange si sten sulle, also weis man ouch an deme sibindin schilde nicht, ab he lenrecht oder herschilt gehabin muge 10v33. stören sw.V. 'zerstören, vernichten': Den keiser enmus der babist noch nimant bannen ..., ane umme dri sache:
303 ab he an deme gloubin zwivelt odir gottishusere störet 50v26.
oder sin elich wip lest
stöz st. M. 'Stoß, Stich': Ane vleischwundin mag man ouch einen man toten oder lernen mit siegen oder mit stosen 27rl5. sträse st. sw. F. 'Straße, Landstraße': Wir sezcin unde gebiten, das man di rechten lantstrasen vare unde nimant den anderen mit gewalt twinge von der rechtin strase 2rl33, des kuniges strase 25r2, 39v31, 41rl9/20, strasen 2rl29. sträsrouber st. M. 'Straßenräuber': Swer mer zcolles nimet, denne he zcu rechte sal ..., den sal man vor einen sträsrouber haben 2rll4, sträsrouber 2rl29. streben sw.V. 'sich gegen etwas stellen, Widerstand leisten': alle, di wider gote unde wider deme rechte streben, di werden disem buche gram 85r2. strit st. M. 'Streit, Kampf': An sin recht enkan aber he nicht widerkumen, he enzcuschtire vor des keisers schar, da he einen andirn kunig mit strite bestet 19vl6. stül st. M. 1. 'Schöffenstuhl': Stende sal man urteil scheiden, sizzende sal man urteil vinden under kuniges banne, menlich uf sime stule 29r4, stul 29r6, stules 29r5; 2. 'Thron, Kaiserthron': Swen der gewiet wirt von den bischoven, di da zu gesazt sin, unde zu Ache uf den stul kumt, so hat he kunigliche gewalt unde kuniclichen namen 49r21; 3. 'Stuhl, Sitz': So sal en der richter nemen bi der hant unde sezzen en uf ein kussin unde uf einen stul kegin im 50r31. stum Adj. 'stumm': Wirt ein kint geborn stum oder handelos ..., das is wol erbe zu lantrechte unde nicht zcu lenrechte 11 vi 2. suche st. F. 'Krankheit, Seuche': Ist aber, das der vatir von gevencnisse odir von suche ... das recht nicht gevordem mag lvl24, suche 7vl20, l l v l 9 , 22r7, 67vll. suchen sw.V. 1. 'aufsuchen, besuchen': Binnen tedingen enmag man keine teding den mannen gelegen, das si suchen sullen me den des riches hervart 8rl25, Czu glichir wis suln si werltlich gerichte suchen 10r27, suchen 48r5, 52v9, 67v28, 82vl7, suchin 10r23/24, 10r31, 10v5, suchene 4vl2, 10rl9, lOvl, 29vl2, 85r9; 2. 'suchen, nachforschen': Lest man aber dar uf des richters boten sechse unde den cleger, di suchen di vridebrechere unde den roup 42r24; 3. 'feindlich aufsuchen, mit kriegerischer Absicht gegen jemanden ziehen': Uber wen man claget, das he von einer bürg gesucht habe 42r35. sümen sw.V. 'zaudern, zögern': Ab der andere zu lange
304
Glossar
sumet, der richter sal en lasen vorheischen den vronenboten in deme huse, da he sich inne gerwit 26r7. -> vorsümen
38vl8, 45v7, 45v9, 46r35, 49v32, sweret 67rl8, 72rl7, swerene 14r27a, swere lr23, 2vl6, 30vl9, 75r21, sweme 80v31, enswere 65r2.
sunibent st. M. 'Sonnabend, Samstag': Heilige tage unde gebundene tage, di sin allen luten zu vridetagen gesazt, dar zu in iclicher wochen vier tage, dunrstag unde vritag, sunabint unde suntag 41r24, sunabindes 41r32, 41r34, sunabindis 41r35.
swert st. N. 1. 'Kampfschwert': Wo zwene man oder dri zu eime hergewete geborn sin, der eldiste nimt das swert zu vor, das andere teiln si gliche undir sich 16v21, Wer sin swert zuit uf eins andern mannes schaden, das swert is des richters 24r24, 24r25, swert 5rll9, 10v9, 16v6, 25vl4, 41v28, 41v36, 50v8, 57r30, 75v22, swerte 21v30, swertis 25vl; 2. 'Sinnbild der weltlichen bzw. geistlichen Gewalt': Noch hat Rome das werltliche swert unde von Sente Petirs halben das geistliche 47v4, swert 10r2, swertin 4vll.
sunderlich Adj. 'besonder, eigen, jedes einzelne': Nimant ensal ouch phenninge slan andern phenningen glich, si enhaben denne sunderlich bescheidunge 32v25, sunderlich 37v3, 79v20/21, sunderliche 30r34, 38v2, 38v5, 49v21, sunderlichen 20v28, 82r26, sundirlich 46vl3, 52vl7, sundirlicheme 3rl20/21. sunderliche Adv. 'im einzelnen, für sich, insbesondere': Der herre underwinde sich des gutes, das dem manne vorteilt is, sunderlichen swo is lit 75r4/5, sunderlichen 75v20, sundirlichen 16vl7, 17vl. sundem sw.V. 'mit einem Gut oder Lehen absondern, trennen, abfinden': Sundert der vater oder di mutereinen iren sun oder eine ire tochter von in mit irme gute 13v24, sundirt 14rl5, sundern 30v30. -*• ab(e)sundem; ab(e)sunderunge süne st. F. 'Sühne, Versöhnung': Sitne aber unde orvede, di der man vor gerichte tut, di gezugit man mit dem richtere unde mit zwen mannen 12v20, sune 4vl8, 19r29. sunne sw. st. F. 'Sonne (als Fristsymbol)': Sweme man icht geldin sal, der mus is warten, bis di sunne underget, in sins selbes huse oder in deme neisten huse des richters, da das gelt gewunnen is 46rl 1, Gerichtis suln alle warten, di dingphlichtig sin, von der zit, das di sunne ufget, bis zu mittage, ab der richter da is 51v29, sunne 26r2, sunnen 48r27. suntag s t M . 'Sonntag': Der suntag was der erste tag, der je gewart unde wirt der lezte, alse wir ufsten suln von deme tode 41v3, suntag 41r24, suntage 3rll2, suntagis 41v2. swebisch Adj. 'schwäbisch': Von swebischeme rechte 4vl21, das swebissche recht 14v29/30, swebisch recht 15r20, binnen swebischer art 15rl7. swem st.V. 'schwören, durch Eid versichern': Der richter sal swern zcu den heiligen, das he von nimande ichein gut neme umme kein gerichte 3rl21, unde sin gelubde sal he tun vor den eit, da man vride swerit 50r7/8, sweren 48v6, 57r22, 5 9 v l l , 73r9, 74vl0, 80r27, swerin 57rl9, 57r20, swem 3rr25, 12r31, 25v33, 33v32, 34vl4,
swerthalben Adv. 'von männlicher Seite, von väterlicher Seite (bei der Verwandtschaft)': Swer so hergewete vordirt, der sal von swerthalben dar zu geborn sin 44v37, swerthalbin 15rl2. swertmäg(e) st. sw. M. 'Verwandter von der väterlichen Seite': Ein man is Vormunde sins wibes. Alse he stirbet, so ist is ir swertmag 4vr21, swertmag 18r3/4, 30rl8, swertmage 16v24, 20r28, 20v7, 21r2. swertscheide st. F. 'Schwertscheide': Ortbant von den swertscheiden suln si abbrechen, si enhabens denne urlop von deme richtere 25v31. swester st. sw. F. 'Schwester': Bruder unde swester nemen erbe ires ungezweiten bruder 5vl3, swester l l r 2 0 , 12r4, 12rl4, 14vl3, 31r5, swestere 31r3, 31r4, swestern 13v30, swestir l l r 2 2 , swestire 14v20, swestirn l l r l 4 . swigen st.V. 'verschweigen': Menlich mus sins schaden wol swigen, wi lange he wil 24r21. -» vorswigen 2
T tag st. M. 1. 'Tag, Zeitspanne eines Tages': bis an den vierdin tag sal he im keinen schadin tun l v r l 6 , tag 16r20, 34rl6, 41v3, 47r6, 75rl, tage l v r l 4 , l v r l 5 , lvrl 8, 3rll 1, 5rl7, 23rl0, 28r26, 41rl5, 41r21, 41r23/24, 41v7, 42v6, 60rl5, 78v6, 83v25, tagen 42vl 1, 45vl 1, 7 8 v l l , tages 8rl8, 23rl4, 27v30, 28r24, 29rl9, tagis 33r30, 35r24/25; 2. 'Frist, Termin': Der lezte gewinnet is tag also lange, als ieme getedinget is, uf den das urteilget 28vl3, tage 20r7, 22vl0, 26v8, 59v22, tagen 22v8, tages 22v9, tagis 3rr7/8, 27v28, tagin 22r31; 3. 'Gerichtstag': Den tag sal aber kundigen, der das gut under im hat, ieme, des das gut is 43r24, tag
Glossar 78v21, tage 44r32, 46r26, 66v29, 67rl8, 67vl, 67v23, 67v26, 74vl2/13, 75r29, 75vl6, 77v22, 78v21, tagen 44r27, tages 75v8, 75vl0; 4. jär unde tag 'gesetzliche Frist von einem Jahr, sechs Wochen und drei Tagen': jar unde tag 6rr21, 1 8 r l l , 19r31, 19vl0, 33v24, 36r20/21, 36vl0, 51v2, 62rl6, 63rl4, 72rl4/15, jar unde tage 7vl8, 19v2, 49v25, jare unde tage 36r4, 61r29/30, 65vl2, 68r8; 5. gebundene tage 'befriedete Tage, Tage, an denen Recht und Gericht gebunden, d.h. auf gewisse Handlungen beschränkt sind': Heilige tage unde gebundene tage, di sin allen luten zu vridetagen gesazt 41r22, gebundenen tage 79rl5/16, 79rl7/18, gebundenen tagen 5rrl7, 28rl, 51v22, 60r20, 60r21/22, 60r24/25, 81 vi4; 6. zu sinen tagen kümen 'einundzwanzig Jahre alt werden, volljährig werden': Ein iclich cristenman is phlichtic, sint czu suchene driins in dem jare, sint he zu sinen tagen kumen is 10r20, tagen 20r3, 20r4, 20rl0, 20rl6, 68vl4; 7. über sine tage kämen 'älter als sechzig Jahre sein': Uber sechzcig jar so is he über sine tage kumen 20rl 1. Lexer II, Sp. 1384ff.; Grimm, DWB 11.1.1, Sp. 27 ff.; Trübner 7, S. 3 ff.; Kluge/Seebold, S.718 -> ding 2; gebunden; jär 2; teding 1; vridetag-, zinstag tagen sw.V. 1. 'das Gericht vertagen': Ab ... das lenrecht mit orteilen getaget wirt, swelchir ir da nicht enkumt, der is gewunnen in der schult 75v4/5, getagit 44v8/9; 2. 'einen Gerichtstag anberaumen, auf einen bestimmten Tag festlegen': Kein cleger darf bürgen sezcin, er di clage getagit wirt 5rll8, getait 24r9. -> dingen 1; tedingen 2; Vortagen tageworchte sw. M. 'Tagewerker, Tagelöhner': Von den lasin, di sich vorworchten an irme rechte, quamen di tageworchten 47v21, Zwene wolline hanzchen unde ein mistgabele is des tageworchten buse 48rl4. tat st. F. 1. 'Missetat, Vergehen, Verbrechen': Is ensi also vil, das he mit totslage den vride breche, so sal siner mage einer clagen umme di selbe tat 2rr30, tat 22v3, 27r7, 27r21, 27v30, 30v21, 31rl, 34rl3, 35vl8, 42vl5, 44r25, 57rl9, 84r6; 2. hanthafte tat 'frisches, offenbares Verbrechen': Swer mit der hanthaften tat gevangen wirt 6rrl7, Die hanthafte tat is da, wo man einen man mit der tat begrift oder in der vlucht der tat oder ab he dube oder roup in sinen gewern hat 34rl2, hanthafte tat 5rl27, 22v31, 32r27, 40v25/26, 40v29, 40v32, 40v36, 40v37, 57rl 1, hanthaften tat 5vll9, 6vr31/32, 7rl24, 20r25, 23rl3/14, 26vl6, 34r20, 35v24, 41v8, 42rl4, 50rl6, 54r20, 57r24, 57vl0a, hanthafter tat 5rl5; 3. gäe tat 'jähes, ungestümes Verbrechen, Affekthandlung':
305 Wen is ist der lantlute vrie kore, das si gougreven kisen zu iclicher gaen tat 23r5, gaen tat 23rl; 4. mit worten unde mit tat 'mit Wort und Tat': he sal ouch sinen herren mit worten unde mit tat eren 59vl 7, In willen unde in worten so enis kein getwang, da envolge di tat 72vl8, mit worten oder mit tat 7 7 r l 0 / l l ; 5. mit rät unde tät 'mit Rat und Tat': he tut ungetruwelich, wen der herre sime manne noch der man sime herren mit rate noch mit täte nicht schaden ensal 84r3. -> Lexer II, Sp. 1408; Grimm, DWB 11.1.1, Sp. 307 ff.; Trübner 7, S.22f.; Kluge/Seebold, S.722 -> rät-, wort 2 teding st. N. 1. 'Gerichtstag, auf einen Tag anberaumte Gerichtsverhandlung': Bin des herrin teding mag der man gut lien unde erben 7vr5, teding 8rl24, 73v9, 81v27, 84rl2, tedingen 7rr26, 16r7, 27r31, 32rl3, 44vl4, 66r23, 85r7, tedinges 85rl 8/19; 2. 'Gerichtstermin': Wer nicht vorenkumt zu dem dritten tedinge, den vorvestet man 26v32, tedingen 26r32, 32r24, 64rl9; 3. 'Gerichtsverfahren': bin deme tedinge enis he nicht phlichtig, dem manne zu entwortene 64vl8, tedinge 85rl0, tedingen 8rl24, 64v26, 73v26, 74r8; 4. 'Ladung zum Gerichtstag, Vorladung': keine worte endarf he benennen in sinen tedingen 81 vi 2. -» Lexer II, Sp. 1387 f.; Grimm, DWB 11.1.1, Sp. 233 f.; Trübner 7, S.39f.; Kluge/Seebold, S.725 -»• ding 2; tag 3 tedingen sw.V. 1. 'Frist geben, einen Termin setzen': Der lezte gewinnet is tag also lange, als ieme getedinget is, uf den das urteilget 28vl3, tedingen 21r22; 2. 'einen Gerichtstag setzen, vor Gericht laden': Wirt ein man durch ungerichte vor gerichte beclait ..., unde wirt im vor getedinget 44vl3, getedinget 66r22, 75vl6, 75v29, 75v31, 76r7/8, 77v28/29, 79rl0, 85rl7/18, tedingen 26v25, 26v27, 26v29, 66vl6, 67r7, 73v8/9, 75r26a, 75r27/28, 81v9, 81v20, 85vl/2, tedinget 8rl3, 64vl7/18, 74r7, 74rl9/20, 85r5; 3. 'Gericht halten': Di burgetore suln offen sin, da der herre zu burgrechte inne tedinget 81 vi 7. -*• dingen 1; getedingen; tagen 2; unbetedinget; tedingen
vor-
teil st. N.M. 'Teil, Anteil': Der phoffe nimt glich teil der swester in der muter rade 12r4, teil 3vl31, 3vl32, llv24, llv27, 1 lv28, 12rl0, 13rl, 14rl7, 14vl7, 30v2, 33rl, 33r9, 35rl0, 35rl3, 38r7, 38v35, 39rl, 52v27, 61v6, 70r7, 70r9, 71r3, 71r5, 79rl2, teile 48vl6, 48v22. teilen sw.V. 1. 'teilen, zerteilen': Man enmus ouch keine gerichte teilen 49vl9, teilen 70v23/24, teiln llv33, 13vl, 16v22, 45v9, teilne 4vll5, teilt 4vl30, llv31,
306
Glossar
12rl4, 13vl6, 17v7; 2. 'durch Urteil entscheiden, durch Urteilsspruch erklären': Der och jar unde tag in des riches achte is, den teilt man rechtelos 19r32, teilt 46r4; 3. 'verteilen': Swo si sich beide zusagen unde gliche uf den heiligen behalden, das sal man en gliche teilen oder mit wasserorteilen si bescheiden 73rl2, teiln 49vl9; 4. 'zuteilen': Di sunne sal man en gliche teiln, wen si erst zusamne gen 26r3; 5. 'gerichtlich freisprechen': Kumt iener vor unde der cleger nicht, man teilt en ledig, is enbeneme im echt not 7 3 v l l . -* geteilen 1; unbeteilt; vorteilen 1 teilunge st. F. 'Teilung, Trennung': Sundert der vater oder di muter einen iren sun oder eine ire tochter von in mit irme gute ..., si musen en di teilunge brengen mit irme eide al das gut, da si mite abegesundirt warin 13v30, teilunge 14rl3.
tötbiesen st. V. 'totbeißen': Vrezzit ein man siner nakebure kom ... mit swinen oder mit gensen ..., hezzit man si denne mit hunden, biesin si di hunde tot oder wunden si sie, man blibit is ane wandil 35v32/33. töte sw. M. 'Toter, Leichnam': Alsus wert man einen toten 4vr27, Swer einen toten unde gevangen vor gerichte vuret 5rl31, toten 5rl24, 2 I r l 3 , 26rl9, 26r22, 29v31, 29v33, 40v30, totin 12r32, 29vl8, 56rl0, 57vl9. töten einen 6vl2, 56r3,
sw.V. 'töten': Ane vleischwundin mag man ouch man toten oder lernen 27rl5, tötet 5vll6, 5vr31, 6vr24, 35vl0, totit 21r25, 41vl8, 48r33, 48vl8, 56r5.
tötslag(e) st. M. 'Totschlag': Gewere sal iclich man tun umme totslag ... vor sinen herren unde vor sinen swertmag 30rl6, totslage 2rr29.
tochter unr.F. 'Tochter': Di tochter, di in deme huse is unbestat, di teilt nicht irre muter rade mit der tochter, di usgeradetis llv30, llv32, tochter llv27, llv29, 13v25, 13v29, 14vl9, 54v20, tochtir 14vl4/15, tochtere 54v27.
tötshgen st.V. 'töten, erschlagen': Slet ein man den andern tot durch not 5rr23, Slet... tot 5vr21/22, 7rl5/6, 29vl4/15, 41r6/7, 57v28/29. erslagen; slagen, slän 3
topelspel st. N. 'Würfelspiel, Glücksspiel': Dube noch roup noch topilspel is he nicht phlichtig zu geldene 12r20.
toufe st. F. 'Taufe': Des dunrstages wiet man den kresem, da man uns alle mite zeichent zu der kristenheit in der toufe 41r27.
tör(e) sw. M. 'Narr, Tor, Geisteskranker': Uber toren unde über sinnelosen man ensal man ouch nicht richten 43r3, toren 6rl7. tdrheit st. F. 'Torheit, Geisteskrankeit, Verrücktheit': Ab wol ein kint zu lenrechte zu sinen jaren kumen is, sin rechte Vormunde sal is doch an sime gute vorsten ..., di wile is sich selbe nicht vermag noch bedenkin enkan von siner kintheit oder vor torheit 17r4. torwarte st. M. ' Türhüter, Torwächter': Nimant enmag recht len uf einer bürg bereden, da der herre torwarten unde wechtere beköstiget 82v5/6. tot Part. Adj. 'tot, gestorben': Gibt hes wider recht ane erbin gelubde, der erbe underwinde sichs mit urteiln, als ab iener tot si, der is da gab, so hes nicht geben enmochte 21v27, Di wile der man ane wip nicht wesen wil oder enmag, so mus he wol elich wip nemen, alleine sin im dri wip tot oder viere oder me 32r3, tot 44r29, 48v22, toten 27r25, totin 17v6. tot st. M. 'Tod': Swer dem andern gut nimt wen tot 6vr23, tot 44r33, 70vl3, 71v7, 82v28, tode 4vr6, 7rr29, 7 v l l l , 12rl2, 13v6, 14rl7, 14r26, 17v29, 18v6, 18vl0, 18vl5, 18v24, 19r21, 22r3, 39r20, 40vl0, 41v5, 48r3, 55r25, 61rl7, 65vl 1/12, 69rl2, 7 0 r l 7 / 1 8 , 71v7, 71v21, 82r26, 83rl2, 83r25, todis 40rl3.
an iens 2rr33, 15v22, 38r29, 65r7, 80vl0,
trugsesse sw. M. 'Hofbeamter, der die Speisen aufsetzt, Truchseß': Undir den leien is der erste an der kore der phalenzgreve von deme Rine, des riches trugsesse 51r2. trüwe st. F. 1. 'Treue': Wen swer den vorsten vride globet unde en truwe phlichtig is, bricht he den vride, man sal über en richten 44r2, truwe 7vr20, 46r25, 46r34, truwen 46r30, 46r35; 2. 'Treuwort': Lest man en aber uf sine truwe riten zu tage 46r25, truwe 46r27, truwen lr8; 3. 'Treuepflicht': Was ein herre unde iclich man mus wol tun, das nicht ensi wider sinen truwen 6vrl3. trüwelös Adj. 'wortbrüchig, treulos': Wer truwelos beredit wirt..., deme vorteilt man sine ere 19v24, truwelos 4vrl4. truwen sw.V. 1. '(zur Ehe) antrauen': Der man is ouch Vormunde sins wibes, alse si im getruwet wirt 48rl; 2. 'glauben': Wil ouch der herre gezug leiten uf den man unde getruwit des der man nicht 67r23. tum Adj. 'töricht, dumm': Dar umme bitte ich czu helfe alle gute lute, di rechtis gern, ab keine rede begeine, di min tumme sin vormide 9 v l l / 1 2 , tumme lute 'törichte Leute' 77v3, durch tummer lute wan 'nach Meinung törichter Leute' 75v27. tümprobest st. M. 'Domprobst': Vriheit is abir drierhan-
307
Glossar de: Schephinbare lute, di der bischove sint suchin suln. Phlechaftin der tumprobiste, lantsezin der erczpristere 10r24/25.
üfhouwen sw. V. 'abhauen, abschlagen, niederreißen': Umme kein ungerichte ensal man ußiouwen dorfgebuwe 42vl7.
tümvoget 4rl9.
üflasen st.V. 'auflassen, in eine andere Hand übergeben': Ein wip enmag ane irs mannes willen nicht ... lipgedinge uflasen 20vl0, Lest man aber ein vorligen gut eime kinde uf 6 9 v l l / 1 2 , uflase 13r21, uflasin 61v9, uflesit 32rl7, uflest 14rl6, 68r2, 68v3, 72r4, 72rl2, 72v6, 73vl6, 74vl9, 83vl8, uflet 7vl30, 7vr8, 64vl0, 65rl6, ufgelasen 71v27, 80r30/31, ufgelasin 13r22, 63v28/29, 72r26, ufzulasene 12v34, lest ... uf 71v23/24, 72rl, let... uf 7vl27, 7vl28, enlase uf 84vl7. Lexer II, Sp. 1695 f.; Grimm, DWB 1, S.681 -> geläsen; läsen 4; widerläsen
st. M. 'Domvogt': der tumvoit von
Halbirstat
tumei st. M. 'Turnier': Binnen geswornen vride ensal man keine wapen vuren, wen zu des riches dinste unde zu turnei sunder swert 41v28. twingea st.V. 1. 'zwingen': Unde clagen si über en zu lantrechte, si twingen en da zu wol mit urteiln zu rechter teilunge 14r21, Man sal nimande twingen zu keiner clage, der he nicht begonst enhat vor dem richtere 24rl8, twingen lr23, 2vl21, 5rll9, twingene 52r24, twinge 10rl4, 46v2, 52r26, 52r29, twinget 7v134, 72vl3, getwungen 7vl24, 68vl0, 71r21; 2. 'verdrängen': Wir sezcin unde gebiten, das ... nimant den anderen mit gewalt twinge von der rechtin strase 2rl33.
u ubel st. F. 'Böses, Bosheit, Schlechtigkeit': In welche stat der echter kumt, den sal man nicht behalden, unde swer im ubil tut, das sal nimant wem 2vr25. uberhür st. N.M.F. 'Ehebruch': Der ... den vride bricht unde di in ubirhure begriffen werdin, den sal man das houpt abeslan 29v2/3. ubemechtig Adj. 'eine Nacht überdauernd, worüber eine Nacht vergangen ist': Vor dem gibt man achte, der mus ouch wol ubemechtig ungerichte richten 23rl7, über nechtig 29r25/26, ubimechtig 5rr2. Überzügen sw. V. 'mit Zeugen überführen': Swer is dar über tut, dem voite zcu leide, wirt he sin ubirzcuget ..., den sal man zu achte tun 3vl27/28, ubirzcuget 3vr8. üfbiten st.V. 'bekanntmachen, proklamieren': Was der man vint oder dibin oder roubem abejait, das sal he üfbiten vor sinen geburen unde zu der kirchen 35r4, ufbieten 33v6. üfgeben st.V. 'aufgeben, niederlegen': Begibt sich aber ein man, der zu sinen jaren kumen is, he hat sich von lantrechte unde von lenrechte geleit, sine len sint von im ledig, wen he den herschilt hat ufgegeben 17vl5. üihalden st.V. 'festnehmen, verhaften': Vint man in in der stat, man mus en wol phendin oder uflialden vor den schaden ane des richters urlop 33r27.
üiläsen st. N. 'Auflassung, Überlassung': Nimant enmag eine rechte gewere gewinnen mit lenunge oder mit saczunge noch mit uflasene 69v5, he is von im ledig des inritens unde nicht des uflasens 13rl9. üfzien st.V. 'an sich ziehen, beanspruchen': Zcut ein man sin gut us kegen sinen herren, das im vorteilt was, der hat alle gedinge, das im was geligen, damite ufgezcogen 84r26. -> üsgezien ; üszien 2 ummesesse sw. M. 'Nachbar, Anwohner': Disen gezug suln di ummesessin bescheiden, di in deme dorfe besessin sin 45v2, ummesessen 73rl, 73r8, ummesessin 45v4, 56vl2. unbegraben Part. Adj. 'unbegraben, nicht beerdigt': Brengit man aber den toten vor gerichte unbegraben unde clait uf in, he mus entworten umme sinen hals oder he mus den toten bereden 29v31/32. unbekümmert Part. Adj. 'unbehindert, unbeeinträchtigt': Alle schult mus man wol geldin, dem man si geldin sal, vor deme tage, das man si geldin solde, also das man si gelde an der stat, da si iener, dem man si gelden sal, unbekümmert von dennen muge brengen 26vl0. unbescheiden Part. Adj. 'nicht zugewiesen, ungeteilt': Ab me lute den einer mit eime gute belent sin unde sint si unbescheiden dar an, ir kein enmag gevolgen an einen anderen herren, ab ir herre stirbit, er wen ir ein 71rl0. unbeschulden, -scholden Part. Adj. 'unbescholten, nicht gemindert, unangefochten': gemeiner gewere si gezug ein iclich unbeschulden man an sime rechte 72v2, mit unbescholdenen luten an irme rechte 'mit an ihrem Recht unbescholtenen Leuten' 83rl, unbeschuldene gewer 'unangefochtener Besitz' 15vl6, unbescholdin 2 I r l 6, unbeschuldener 8 5 v l l .
308 unbestatet Part. Adj. 'unausgestattet, unverheiratet': Di tochter, di in deme huse is unbestat, di teilt nicht irre muter rade mit der tochter, di usgeradet is 11 v31, unbestatte 13v29/30. uabetedinget Part. Adj. 'gerichtlich unangefochten, unbehelligt': man sai abir im bürgen sezcen, ab der kindere mer is den eins, das der herre unbetedinget blibe umme das len 69rl 7. unbeteilt Part. Adj. 'unaufgeteilt, ungetrennt': Ab zcwene mit eime lene belent sin unde des gutes ein teil vorlien eineme manne, ir keiner enmag an den anderen an deme gute sinen manne nicht vorteilen noch uflasin sime herrin ..., di wile si an deme gute unbeteilt sin 61 vi 1, unbeteilt 80v29. unbetwungen Part. Adj. 'ohne Zwang, freiwillig': Ein iclich man mag sins rechten gutes wol enig werdin mit rechte, ab hes vorkoufi oder vorseczzit... oder zu welcher wis hes anget unbetwungen 3 2 r l 9 / 2 0 . unbewiset Part. Adj. 'nicht eingewiesen, ohne Einweisung': Swelch unbewiset gut, das deme manne geligen wirt, sai der man behalden mit gezuge, wen is im geligen wirt, da he der gewer an darbit 61r20. unbilliche Adv. 'ungemäß, nicht rechtgemäß': wen is enist nimant so ungerecht, is endunke in unbillich, tut man im unrecht 84v23/24. undergenös st. sw.M. 'der weniger ist als seinesgleichen, der von niederer Herkunft ist': ein dinstman hilfet des ouch wol deme, der sin undirgenos is lvl21. genòs underscheìt st. M. 'Vorbehalt, Bedingung': Liet ouch ein herre ein gut eineme manne ane underscheit, was da gebues uffe is, das is des mannes allis mit deme gute 31r33. undertän Part. Adj. 'untertänig, untergeben': Dem von Meideburg is undirtan der bischof von Nuwenburg unde der von Merseburg ... unde der von Havelberg 52r9/10, undertan 52rl9, 78vl6, undirtan 5 2 r l 7 / 1 8 , 59v26. undertàn st. M. 'Untertan, Untergebener': Der bischof von Mencze hat vier undirtanen zu Sachsen in dem lande 52rl3. underwinden st.V. 1. 'in Besitz nehmen, sich bemächtigen, aneignen': Swes sich der man underwint mit unrechte 6rr29, Wer kemplich grusen wil einen sinen genos, der sai bitten den richter, das he sich underwinden muse eins sines vridebrecheres zu rechte, den he da se 24v22, underwinden 34r30, 45vl3, 61r24, underwinde 21v26, 35vl6, 6 2 r l l a , 75r3, underwint 5rl3, 47r28, 47r30,
Glossar 62rl6, 75r7, 77r8, underwunden 75r8, undirwinden 24v25, undirwint 64r5, 68r28, 74v26, undirwant 47v3, undirwunden 24v31, enunderwinde 7Irl6; 2. 'jemanden zum Zweikampf herausfordern': Wer sich undirwindet des andirn zu kamphe, enket he im mit rechte, he mus en mit buse lasin 21vl8. Lexer II, Sp. 1811 f.; Grimm, DWB 11.3, Sp. 1907ff; Trübner 7, S. 333 f. -» vorwinden undiupliche Adv. 'ohne Diebstahl, nicht diebisch': wen hes undiuplich unde unrouplich us iens mannes gewern brockte 33vl4. unecht Adj. 'rechtlos': Ane wergelt sint unechte lute 6rr32, unechte 48r32. -> echt 5 unecht st. N. 'Rechtlosigkeit': Swem man unecht saget 6rr9, unecht 8rrl2. unelich Adj. 1. 'unehelich, außerhalb der Ehe': Kemphin unde ir kindere, spillute unde alle, di unelich geborn sin 19r28, unelich 20v29, 21r29, 48r21/22, 59rl0; 2. 'gesetzlos, rechtlos': Eliche kindere enmag der uneliche man sider nicht gewinnen 19v9, Unelicher lute buse gibet luzil vrumen 48r29, uneliches 21v2/3. -» ¿lieh; gebom 4 ungelobet Part. Adj. 'nicht gelobt, nicht versprochen': Di wile di gewer ungelobit is 44v22. ungelucke st. N. 'Unglück': Heldet ouch der vater sine kindere in vormundeschaft noch irre muter tode, wen si sich von im scheiden, he sal in widerlasin ... alle irre muter gut, is ensi im von ungelucke unde ane sine schult gelosit 13v9, ungelucke 16v30. ungemannet Part. Adj. 'unverheiratet': Meide unde ungemannete wip, di vorkoifen ir eigen an irs Vormunden willen, he ensi denne da erbe zu 2 0 v l l / 1 2 , ungemannet 47v37. ungenos st. M. 'Ungenosse, jemand, der von geringerem Stand ist': Swer an den obersten herren siner liunge oder wisunge mit sime gute sinnet, wiset he en denne an sins herren ungenos, so der man das erst irvert bin der jarczale, das he volgen sal, so Widerrede he di wisunge vor dem obersten herren 85r27, ungenos 8rl29, ungenosen 53rl5, 80vll/12. ungerädet Adj. 'unausgestattet, nicht ausgesteuert': Di ungeradete swester, di teilt nicht irre muter rade mit deme phaffen 12rl3/14. ungerecht Adj. 'ungerecht': wen is enist nimant so un-
Glossar
309
gerecht, is endunke in unbillich, tut man im unrecht 84v23. ungerichte st. N. 'Verbrechen, Vergehen, Unrecht': Swer borget einen man umme ungerichte 5rl25, ungerichte 5rrl4, 5vr28, 6rl21, 10r30, 10vl2, 23rl3, 23rl7, 23r25, 23r28, 24rl2, 25rl 1, 26vl, 26v28, 27v20, 29rl7, 29v9, 30r20, 30vl7, 36v28/29, 40v31, 41vl0, 42r29, 42vl7, 43vl8, 44r21/22, 4 4 v l l , 44v20/21, 45v36, 48v31, 49r27, 50v6, 52vl4, 53v7, 54r20, 57r23, 57v30, 66r22, 82rl7, 83v2, ungerichtis 21r27/28, 30vl5. ungescheiden Part.Adj. 'unabgefunden, unabgesondert': he is von sime vatere ungescheiden mit sime gute 13v4, ungescheiden 15 v 11. ungeslagen Part.Adj. 'nicht geschlagen, nicht erschlagen, am Leben gelassen': da liesin si di gebur sizzen, ungeslagen unde bestatten en den ackir 47vl8. ungetrüwelich Adj. 'treuwidrig, treulos': Twinget der herre sinen man ungetruwelich 7vl34, ungetruwelich 46r33, 46v.l, 72vl3, 84r2. ungevangen Part.Adj. 'frei, nicht gefangen': Zut aber he sich us der vorvestunge unde kumt her ungevangen vor gerichte, he kumt zu sime rechte, also ab he nie vorvestet wurde 27r23, ungevangen 38vll. ungewaldig Adj. 'nicht in Gewalt habend, der Gewalt, des Besitzes oder Gebrauchs von etwas beraubt': der richter ... geweidige si von gerichtis halben irs gutes, des si ungewaldig was 20r2, ungewaldig 53vl5. ungezweit Part.Adj. 1. 'vollbtirtig (innerhalb der Verwandtschaftsgrade)': Ungezweite brudir kint sint ouch gliche na deme geczweiten brudere, an deme erbe czu nemene 31r6/7, ungeczweiten 31r4, ungezweiten 5vl3, ungezcweiter 1 Irl8; 2. 'ungeteilt, ohne Teilung': Blibit di witewe ungezcweiet mit den kindern in des mannes gute 6vr9, ungezcweit 15v5, ungezweit 55r30. ungloubig Adj. 'ungläubig': Welch cristenman oder wip ungloubig is ... unde des vorwunden wirt, di sal man uf der hört burnen 29v7.
unlust st. F. 'Unruhe, Lärm vor Gericht': Dar umme sal he den schultheisen des ersten Urteils vragen, ab is dinges zit si, unde da noch, ab he vorbiten muse unrecht unde unlust 2 3 v l l . unphlicht st. F. 'Pflichtverletzung, Pflichtwidrigkeit': Wer aber des kindis erbe is, den sal des kindis Vormunde berechin von jare zu jare des kindes gutis unde im gewis machin, das hes zu unphlicht nicht vortu, sint das kint zu sinen jaren kumen is 17r8. unrecht Adj. 'unrecht, ungerecht, unrichtig': Vraget man einen man Urteils unde vint he noch sime sinne, so hes rechste weis, ist is wol unrecht, he lidet dar umme keine not 28v24, Vorliet ein greve siner graveschaft ein teil oder ein voit siner voitie, das is unrecht 52v28, unrecht 22vl2, 28v31, 29r28/29, 78r25, 84vl5, unrechte 29r29, unrechten 33r9/10, unrechter 7vr27, 47r25, unrechtis 40rl4. unrecht st. N. 'Unrecht, Ungerechtigkeit': Des heiligen geistis minne, der Sterke mine sinne: Das ich recht unde unrecht der Sachsen bescheide, noch gotis hulden unde noch der werlde vrumen 9v4, mit unrechte 'zu Unrecht' 6rr29, 19r6, 22r4, 22rl2, 26vl5, 32r9/10, 44v30, 45vl5, 47r28, 53vl3, 65v28, 68r24, 69vl0, 77r9/10, 80vl, 84r8/9, zu unrechte 'dass.' 7rr30, 1 9 r l 0 / l l , 65r23, unrecht 2 3 v l 0 / l l , 33vl7, 49v32, 77rl2, 82vl5, 84v24, 84v27, 85r4, unrechtes 84vl9/20. unroupliche Adv. 'nicht räuberisch, ohne Raub': wen hes undiuplich unde unrouplich us iens mannes gewern brochte 33vl4. unschuldig Adj. 'unschuldig, schuldlos': Untredit he abir sich, alse recht is, mit siben seintbaren mannen zcu den heiligen, das he nicht enwisse, das he ein echtere was, he sal unschuldig sin 2vrl8/19, unschuldig 14r5, 19v20, 26rl, 30vl9/20, 31rl, 34v4, 35vl6, 38v31, 40v7, 42v9, 42vl3, 74r25, 82rl8, 84rl9.
unhelinge Adv. 'unverhohlen, nicht heimlich': Dube oder roubis ... entschuldigit he sich uf den heiligen, ab hes gezug hat, das hes unhelingen gehalden habe 57vl0.
unschult st. F. 'Reinigungseid, den der Beklagte zu leisten hat': Schuldiget man den man umme das, des he nicht enhat, des enket he mit siner unschult 14r31, unschult 14r33, 14v32/33, 16vl9, 24r29/30, 25r23, 43rl2, 45vl8, 58r9, 61vl, 65r5, 66vl0, 72vl2, 73r23, 85v26. -» Lexer II, Sp.1934; Grimm, DWB 11.3, Sp. 1345 ff.
unkraft st. F. 'Schwäche, Kraftlosigkeit': von sins libes 'aus körperlicher Schwäche' 21r20.
unkraft
untrüwe Adj., zu ungetrüwe 'untreu, treulos': herren unde mannes valsche rat glichen wol untruwere tat 84r5.
unküscheit st. F. 'unreine Begierde, Unkeuschheit': Wip mag mit unkuscheit ires libes ir wiplich ere krenken, ir recht vorlusit si da mite nicht noch ir erbe 12rl.
unvolent Part. Adj. 'unvollendet, noch anhängig (bei einer gerichtlichen Angelegenheit)': Ab der herre sinem manne zu lenrechte tedinget, bin deme tedinge enis he
310 nicht phlichtig, dem manne zu entwortene, ab he en ichtes schuldiget, di wile sin sache unvolent is 64v21. unvorclait Part. Adj. 'unangeklagt': Was he so seit unvorclait, he beheldit di saet unde gibt sinen zins ieme, der das lant behelt 36v37. unvorgolden Part. Adj. 'nicht bezahlt, nicht erstattet': Swo me lute den einer zusamne globin ein wergelt oder ander gelt, alle sin sie das phlichtig zu leistene, di wile is unvorgoldin is 56rl5, unvorgolden 60r28. unvorholn Part. Adj. Adv. 'nicht verborgen, nicht heimlich': Swas he andirs dinges koufit unvorholn unde unvorstoln bi tagislichte unde nicht in beslosseneme huse, mag hes gezugen selb dritte, he behelt sine phenninge dar an 43v28/29, unvorholn 57v5, unvorhaln 34rl8. unvorstoln Part.Adj. Adv. 'unverstohlen, öffentlich': unvorholn unde unvorstoln 43v28/29. unvortän Part. Adj. 'unveräußert': Dis sal der richter haldin jar unde tag unvortän 1 8 r l l , unvortan 2 7 v l l / 1 2 , 33v6. unvorterbet Part. Adj. 'unbeschädigt': Was man aber deine manne liet oder sezt, das sal he gelden noch sime werde, oder he sal is unvorterbet widerbrengen 43r33. uavorvest Part. Adj. 'nicht in der Verfestung befindlich, nicht gerichtlich geächtet': Sus sal ouch der cleger unde sin gezug sweren uf einen unvorvesten man, der durch ungerichte in der hanthaften tat wirt gevangen unde vor gerichte mit orteiln gesazt 57r23. unwissende Adv. 'unwissend, unbewußt, unabsichtlich': Wer da erit eins andern mannes lant unwissende ..., wirt he dar umme beschuldigit, di wile hes erit, sin erbeit vorlust he dar an, ab is ienre beheldit 36v31, unwissende 5vr2, 45r26/27, 5 6 r l l . unwissenschaft st. F. 'Unwissenheit, Unkenntnis': Welche gewere man nicht bescheiden enmag durch di zcweiunge der ummesessen oder durch ir unwissenschaft, so sal man di sachwalden heisen sweren, das si wisen nach rechte sulch len alse ir si 73r8. unzucht st. F. 'Ungezogenheit, ungebührliches Verhalten': Doch wettit man deme richtere dicke umme unczucht, di man tut in deme dinge 22r27/28. urkunde st. N.F. 'Zeugnis, Beweis': mit urkunde zweier manne 38v26, urkunde 40rl9, 43r25, 46vl9, 47rl7, 66r2, urkundes 47r5/6. urlögen sw. V. 'streiten, Krieg führen': Wo zcwene mit ein ander urlogen, der einer oder beide geleite haben, swer
Glossar deme di lute zu leide angrifet..., ubir den sal man richten als ubir einen strasrouber 2rl25. -> orlouge urlop st. M.N. 'Erlaubnis, Genehmigung': Wo man buwen mus ane des richters orlop 6vl29, orlop 19rl6, 53r23, 53r27, 5 3 v l l , 77vl7, 82rl4, urlop 3vr2, 22v22/23, 25v27, 25v32, 32v21, 33r28, 45r31, 53r22, 53v6/7, 57v20/21, 70v24, 77r5, urlob 18v29, urlobe 24v29, 34r22. ursale st. F. 'rechtlich andauerndes Eigentum': unde da ir ir man gibt eigen in ursale oder zu irme libe 20r33. urteil st. N. 'Urteil, Urteilsspruch, richterliche Entscheidung': Doch enmus des riches dinstman über den schephin vrien man weder orteil vinden noch gezug wesin 45r24, Orteil suln si vindin vastende ubir iclichen man 54r5, gotes orteil 73rl3, orteil 4rl21, 5rrl9, 5rr21, 7vl4, 54r8, 61v21, 61v25, 75r26, 75v9, 76vl5, 78r5, 78r6/7, 78r8, 78rl 1, 78rl7, 78r22, 78r25, 78r32, 78vl2, 78vl3, 78v24, 79r6, 79r9, 79rl6, 79rl9, 79r20, 79r22, 81rl4, 81rl7, 81r20, 81r23, 81v4, 81v6, 84v8, 85v3, orteile 3rr20, 3rr22, orteilen 74v2/3, 75v4, 77v25, 78v21, 85rl6, orteiles 5rl21/22, 78r27, 78vl5, 85v3, 85v6b, orteiln 8rll2, 53v20, 57r25, 61v30, 66r22, 74rl7, 74r22, 74r27, 76vl4, 77r6, 80rl9, 82rl2, 82r24, 86r4, orteils 28v8, urteil 12vl4/15, 15rl, 15r4, 15r6, 15rl6, 15r22, 24v6/7, 28r2, 28r6, 28r7, 28r9, 2 8 r l l , 28rl4, 28r32, 28r35, 28vl4, 28vl5, 28vl9, 28v21, 28v27, 28v29, 28v30, 28v33, 29r2, 29r3, 29r6, 29r7, 29rl0, 29rl3, 29rl5, 31v4, 53rl3, 54r8, 54r9, 5 4 r l l , 54rl6, 54r23, 54v4, 5 9 r l 7 / 1 8 , 59r20, 60rl9, 61v28, 66v4, 76vl, urteile 3rrl8, 36r3, urteilen 30v28, 64r7, 64v22, urteiles 4rl21, 66r32, 76r31, urteiln 14r21, 21v26, 22vl 1, 24vl5, 24v24, 29r5, 50rl9, 50v5, 52v6, 53v8, 59v21, 60r22/23, 61vl2, 67v27, 75r27, 75r28, Urteils 23v9, 24vl0, 28v2, 28v23. -> Lexer II, Sp.2014f.; Grimm, DWB 11.3, Sp. 2569 ff.; Trübner 7, S. 360 ff.; Kluge/Seebold, S. 753 -» bescheiden; scheiden 2; vinden 2; wasserurteil, -orteil; widervinden üsbescheiden s t V . 'aussondern, ausnehmen': Vorliet der herre ein gut, da di zinsgelden zu geboren sin oder sich in das zinsgelt gekouft haben, unde eczwas dinstes dar ab sin phlichtig zu tune, das dinst mag der herre ledig behalden, ab hes usbescheidet, als he das gut vorliet 82vl0. üsdingen sw.V. 'vorbehalten, ausbedingen': he endinge is denne us 31r35. üsgelegen sw.V. 'ansetzen, anordnen, festsetzen': Swen ein herre tedinget sime manne zu lenrechte ..., bin den
Glossar tedingen enmag he kein ander usgelegen, das he en gebiten muge zu suchene 85r8. usgeleget Part.Adj. 'anberaumt, festgesetzt': Zu deme usgeleiten tage sal der man kiesin sibene, di man vrage umme sinen gezug 67vl. üsgephenden sw.V. 'auspfänden': Swo der richter sin gewette nicht üsgephenden mag 5vl2 7, üsgephenden 35v34/35.
311 der man aber vor den herren kumt, he bitte aller erst vorsprechen, da noch der heiligen unde des stehen, das he sin gut uszcie 75r20, uszcien 8rl5, 63rl6, 73vl4, 73v21, 73v23, 7 5 r l l , 82r2, uszcuet 75vl5, uszuzciene 73v7, usgezcogen 73vl9, usgezogen 79v30, zcuet... us 75r26, zcut... us 84r23, zut... us 7 5 r l 5 / 1 6 , 75r26a/27, zuet ...us 73v8, enzcut ... us 75rl. üfzien; üsgezien; zien 2, 3
üsgerädet Part. Adj. 'ausgestattet, ausgesteuert': Di tochter ..., di teilt nicht irre muter rade mit der tochter, di usgeradet is 1 lv32.
üsziende sw. M. 'das Ansichziehen, Inanspruchnahme': Ab der herre den man schuldiget, das he sin gut habe an sinnende vorjaret oder an uszciende, das behelt mit siner unschult der man 73r22/23.
üsgezien st. V. '(ein Gut) an sich ziehen, beanspruchen': Sweme man sin gut in sine entworte vorteilt ane rechte widerspräche, der enmag is nicht me usgezcien 7 4 r l l .
V
üslegen sw.V. 'ansetzen, anordnen, festsetzen': Uber achzcen wochen sal der greve sin ding uslegin 6vl21, uslegin 51v22, usgeleget 85rl6, usgeleit 10v26, 20r8, usgeleitem 22rl9, legit ... us 10r29. üsnemen st.V. 1. 'befreien, auslösen': Der herre mus ouch wol usnemen eins sinen eigenen man, swen he vorteilt is 30v33, usnemen 5rr28, 5vll/2; 2. 'erheben': Ab das kint sine jarzal behelt er den zinstagen, das das gut vordint is, is sal den zins usnemen 39v5; 3. 'auswählen': Iener aber, des das vie is, der sal zu vor usnemen czwei under sechsen, dri under nuinen, e den der zendener kise 38rl. üsscheiden st.V. 'ausschließen, ausscheiden': Swer da koufes bekennet, der sal is gewer sin, des he vorkouft hat, wen he is diep oder diebes genos, der des koufes bekennet unde der gewer loukent, he enhabe si usgescheiden mit gezuge, da he si vorkoufte 43rl6. üssezzen sw.V. 'versetzen, verpfänden': Wer in siner suche sine habe vorgibt oder usseczt 22r8, Sezt ouch ein man sin len us ane sins herren urlop 77r4. üswendig Adj. 'auswärtig': Binnen markte oder binnen uswendigene gerichte endarf nimant entworfen, he enhabe da wanunge oder gut binnen 45v34, uswendigem gerichte 6vr29, 56v26/27. üswisen sw.V. 'verdrängen aus, ausweisen, verweisen (von einem zugesprochenen Gut)': da enmus en nimant uswisen, he entu is mit rechter clage 27r33. üszien st.V. 1. 'befreien, freimachen, herausziehen': Ein vorvest man mus sich wol usczien in allen stetin in deme gerichte, da he inne vorvest is 45r5, uszcien 6rl26, uszien 45r8, usgezogen 6rl27, uszut 45rl8, zut ... us 27r22; 2. '(ein Gut) an sich ziehen, in Anspruch nehmen': Ab
valsch Adj. 'falsch, unredlich, betrügerisch': herren unde mannes valsche rat glichen wol untruwere tat 84r5, valschen 5 v l l l , 29r29, 32v6, valscher 32vl2/13. valsch st. M. 1. 'Betrug, Unredlichkeit': Der richter sal swern zcu den heiligen, das he von nimande ichein gut neme umme kein gerichte ... unde he von sinen sinnen aller beste kan ane aller hande valsch 3rl28; 2. 'Fälschung': Unde swer uf imandis phenninge keiner slachte valsch slet, den sal man haben vor einen velschere 2rrl5, valsches 32vl7/18. vane sw. M. 'Fahne': Der keiser liet alle geistliche vorstenlen mit deme sceptrum, alle werltliche vanlen mit deme vanen 51r31. van(en)len st. N. 'Fahnenlehen, vom König einem Fürsten mit symbolischer Übergabe einer Fahne verliehenes Lehen': Der keiser enmag aber in allen landen nicht gesin unde alle ungerichte nicht gerichten zu aller zit. Dar umme liet he den vorsten vanenlen 49r29, vanenlen 49vl0, vanlen 6vl22, 7rr31, 49vl2, 51rl4, 51r31, 51vl, 52r2, 52vl 1, 65r28, 65r30, 65v9, 77v4, 79v22/23, 81r22, 81r30, 81v2, vanlene 4rll8, vanlenes 65v2. DRWB 3, Sp. 354 f.; H R G 2, Sp. 1725; Lexer III, Sp. 19; Grimm, DWB 3, Sp. 1242 vangen, vähen st.V. 1. 'gefangennehmen, ergreifen': Swer mit der hanthaften tat gevangen wirt 6rrl7, gevangen 34r8, 34r9, 41v8, 41v30, 46r34, 54r24, 57r24, vehit 6rrl3, vieng 47rl2, viengen 51vl9; 2. 'gefangenhalten': Swer eins mannes knecht slet oder swer einen gevangen hat 5vll7; 3. zü kamphe van 'durch Anfassen zum Zweikampf herausfordern': also vorwint man den ouch, der zu kamphe gevangen unde gegrusit ist 26r29, zu kamphe van 27rl3.
312 var st. F. 'Heerfahrt, Kriegszug': Belent wip oder mait ensin nicht phlichtig, hervart zu dinene, mer hersture sullen si geben noch gesazteme rechte, vare sullen si ledig sin bin lenrechte 7 lv4. -> hervart vare st. F. 'nachteilige Rechtsstellung, erniedrigende Behandlung': Dise vare ensal nimant haben ane der, deme der herre dar getedinget hat umme sine schuldegunge 75v28, vare 76rl. vater st. M. 1. 'Vater': Gibit der vater dem sone ros unde phert 4 v l l l , Vri unde echt behelt des vater recht 4vll8, vater lr6, lr9, I r l i , l r l 5 , lr24, lr25, lr27a, lr30, lr32, lvl27, lvl30, lvl31, 2rl2, 5rr28, 5vll, 6vr4, 7rr29, 7rr32, 7 v l l l , 7vll8, 7vl26, 7vl28, llv23, llv26, 13r30, 13r33, 13v2, 13v5, 13vl0, 13vll, 13v24, 13v27, 1 4 r l l , 14rl4, 14rl7, 14v8, 14v20, 18v20, 2 1 v l l , 30vl4, 30vl6, 30v20, 30v29, 31r6, 54v8, 54vl4, 54v28, 54v30, 56r6, 59rl 1, 60vl7, 60vl9, 65r7, 6 5 r l 4 / 1 5 , 65r20, 65r22, 65v3, 65v6, 6 5 v l l , 69rl2, 70rl7, 70v29, 70v30, 71v5, 71v6, 71v7, 71vl6, 71vl9, 71v21, 72rl, 72r3, 73v22, 73v23, 74r2, 80vl0, 85v6a, 85vl5, vatere lr22, lvl3, 13v3, 46v34, 55r3, 65rl2, 65rl8, vatir lr8, l r l 7 , lr20, lr29, lvl23, l l r l O , llv21, 14vll, 14vl2, 14vl3, 18v23, 18v23/24, 69v30, 74r5, vatirs 2rrl0. vechten st. V. 1. 'erkämpfen': Wo di meiste menie sige vichtet, di behaldin das urteil 28vl8, vichtet 26r5; 2. 'kämpfen, fechten': Umme urteil sai man nirgen vechten 28v21/22, vechten 25v7, 29rl6, vechtin 25v9, 28vl7, gevochten 28v21. velschen sw.V. 'fälschen, falsche Münzen schlagen': Velschit der munczer sine phenninge unde enhelt he si nicht nach irme rechte, di wile enmag he nimande valsches geczien, da iener wandil umme tun dürfe 32vl5. -> slagen, slän 2 velschère st. M. 'Falschmünzer': Unde swer uf imandis phenninge keiner slachte valsch slet, den sai man haben vor einen velschere 2rrl6. vemen sw.V. 'entziehen, entfernen': Swer sime herren oder sime kinde oder imande, der des wartende is, sin len vernen wil 7 0 v l l , gevernt 61r8, 69v29, gevirnt 65rl0, virne 71r4. enphirren vest -» vestuage vestunge st. F. 'Verfestung, gerichtliche Achtung, Bezirksacht': Swer sich us der vestunge zcien wil 5rr8, Der niderste richter enmus nicht richten di vestunge, di der
Glossar oberste richter getan hat 45v26, vestunge 6rrl6, 27v33a, vest 8rr9, 8rrl5. -> vorvestunge vetter sw. M. 'Bruder des Vaters, Vetter': Nimt der son wip bi des vatir libe, di im ebinburtig is, unde gewint he sune bi ir unde stirbit he da nach, e sin vater in geteilt von deme erbe, di sune nemen teil in ires eldirvater erbe glich iren vettern an irs vater stat 1 lv25, vetteren 70v30. vient st. M. 'Feind': Dis buch gewinnet manchen vient, wen alle, di wider gote unde wider deme rechte streben, di werden disem buche gram 85rl, viendin lr8, lvrl3/14. viertag st. M. 'Feiertag, Festtag': Der man sal ouch sime herren dinen da mite, das he im urteil vinde zu lenrechte vor mittage unde buzen gebundenen tagen unde buzen viertagen 60r20/21, viertagen 60r22, 60r25. vierzennacht st. F. 'vierzehn Nächte, die Frist eines halben Monats': Dries über virzennacht sal man ienen vorladen, vorzustene sin gut, ab he wil 43r21, zuet hes aber us, der herre sal im tedingen vor sine man unde sal das teding deme clegere kundigen vierzcennacht vore 73vl0, vierczennacht 34vl6, vierzcennacht 77vl4/15, vierzennacht 66vl5, 66v21/22, virczennacht 32v27, virzcennacht 10r31, 26v27, virzennacht 27v6/7, 27v9. vinden st. V. 1. 'finden': Diube oder roup, di man under im vindet, di sal der richter behalden under im jar unde tag 33v23, vindet 33v9, 34rl7, vint 5vl21, 32v9, 33r26, 34r21, 35rl, 35r3, 43v26; 2. ein urteil vinden 'ein Urteil finden, die sich aus der Verhandlung jeweils ergebende Entscheidung ermitteln und aussprechen': Welches Urteils man von erst vraget, das sal man von erst vinden 24vl 1, sizzende sal man urteil vinden under kuniges banne 29r3, Vrie lute ... musen ... vor deme riche gezug sin unde orteil vinden 45r21, vinden 4rl21, 5rr29, 28r2, 28r7, 28rl 1, 28v9, 28vl0, 30v23, 30v26, 31v4, 45r24, 54r8, 54r9, 5 4 r l 6 / 1 7 , 61v20, 76vl, 76vl5, 78rl2, 79r6, 8 l r l 2 , 81rl4, 81rl7, 81r20, 81r23, 81v4, 81vl9, 84v8, vindene 7vl4/5, 29r6, 54rl0, 59rl8, 66v4, 81v6, vinde 54rl2, 60rl9, vindin 54r6, vint 5rrl9, 24v27, 28v23, 28v26, 29r7, 53rl2, 75v9, 77vl0, 7 8 r l l , 78r28, vant 29r7, 54rl 1, 78vl2, 79r22, vunden 28v30/31, 2 9 r l l , 78r25, vundin 2 3 v l l , gevunden 29rl3, 54v4, envint 15r2. DRWB 3, Sp. 539 ff.; Lexer III, Sp.354; Grimm, DWB 3, Sp. 1641 ff.; Trübner 2, S.346ff; Kluge/Seebold, S. 215 vire st. F. 'Feiertagsruhe, Ausruhen von der Arbeit': Swer an einem manne den vride unde di vire bricht, der
Glossar mus zcwies wetten durch eine suche, deme unde geistlicheme gerichte 79r28.
313 werltlichem
vleischwunde sw. st. F. 'Fleischwunde, blutige Wunde': Ane vleischwundin mag man ouch einen man toten oder lernen 27rl4, vleischwunden 30v8, vleischwundin 27r5, 27rl 1. vleischzende sw. M. 'Fleischzehnt, Abgabe von Tieren': In Sente Johanstage allerhande vleischzende, da man mit phenningen den zenden alle jar losit 39r26. vlucht st. F. 'Flucht': Die hanthafte tat is da, wo man einen man mit der tat begrift oder in der vlucht der tat 34rl4, vlucht 41v20. vluchtsal st. F. 'betrügerische Ubergabe eines Gutes an einen anderen': Von der vluchtsale 7vr24. voit st. M. 1. 'Landesherr, Fürst': Under des riches schephen sin Swaben di von Tubule ..., der voit Albrecht von Spandouwe 3vr26, voit 52v27; 2. 'höherer weltlicher Richter, Gerichtsbeamter': Dar under ein iclich voit dingin sal unde iclich burmeister rügen sal das geruchte 10v6, voite 52v21; 3. 'Schirmherreines Gotteshauses': Wir sezcin unde gebiten alse recht ist unde vil vesteclichen, das aller der gotishusere voite den gotishuseren vorsin unde si beschirmen uf ir voitien 3vll4, voit 3vl21, voite 3vl27, 3vl32, voitin 3vi 11, voites 3vl23/24. voitie st. F. 1. 'Vogtei, Amtsbezirk des Vogtes': Binnen einer voitie enmag kein kuniges ban gesin wen einer 23v2, voitie 3vll8, 3vl25, 52v27, voitien 3vll5; 2. 'Schutzherrschaft, Schirmherrschaft': Gibt aber hes orlop, di voitie is sin dar ubir 19rl6.
Is aber das vie so getan, das man is nicht ingetriben mag ..., so lade he da zu zwene man ... unde volge deme vie in sins herren hus 37rl5, volgen 6rl5, 34vl5, 40r32, 40r33, 41v35, 42r3, 42v26, volge 40v34, 48r31, volget 41v34, 48v28, 70r7, volgit 22rl6, gevolget 42rl4, envolgit 24r27; 3. 'Lehensfolge leisten': Weigert aber der herre, des zu tunde wider recht, der man volge an den obirsten herren sime gute 64rl2, volgen 7vr22, 59r30, 59r35, 59v9, 64rl, 68rl, 70r2, 71vl5, 73v21, 80vl5, 82r28, 83vl4, 85r29, 85vl, volge 64rl8, 74v21, 82v2, 83r6, 83vl0, volgene 68rl8, 80vl3, volget 7vr7, 61vl7, 62r30, 62v3/4, 63v5, 64r24, 74v3/4, 77r23, 80r25, 80v24, 84v3, volgit 7rr23, 62r24, 73vl5, gevolget 64v3; 4. 'befolgen, zustimmen': Swer lenrecht kunnen wil, der volge dis buches lere 59r2, orteiles volgen 'einem Urteil zustimmen' 4rl21, volgen 76vl6, volget 78rl4, volgeten 79r23, envolget 78rl2; 5. 'hinterherkommen, folgen': was im volget, das is sin, was andersit blibet, das is sins nakebures 38r23, envolge 52vl, 72vl8. DRWB 3, Sp. 607 ff.; Lexer 3, Sp. 441 f.; Grimm, DWB 3, Sp. 1875ff.; Trübner 2, S.409ff.; Kluge/Seebold, S. 225 geroigen 1, 2, 4 volkumen st. V. 'vor Gericht nachweisen, beweisen, mit etwas durchdringen': Vorsinet aber he sin recht vor gerichte unde sait he im zu ein ander recht, des he nicht volkumen kan, he vorlusit beide 14v4, volkumen 24vl, 31vl3, 57r27, 63r27, 66v5, 67r2, 73vl, volkume 28rl7, 61v24, 78r8, 85v9, volkumt 8rll2, 28r32/33, 31v8, 45rl3, 57rl7, 67v4, envolkume 72r7/8, envolkumt 79r20/21.
volbort, volburt st. F.N. 'Zustimmung der Dinggenossen zum Urteilsvorschlag': Widersprichet einer di volbort unde vint he ein ander urteil, welchir di mere volge hat, der behelt sin urteil 28v26, volburt 5rr21, 2 9 r l l , 79r24.
volleist st.M. 'Helfer, Mithelfer': Wirt abir ein man beclait umme roupliche gewer ..., der richter sal... richten ... über den rouber unde über sine unrechte volleist allirerst zu hant 32r31.
volge st. F. 1. 'Lehenserneuerung, Lehensnachfolge': An anegevelle enis keine volge 7vll2, Alle len ane gewere darben der volge 7vr25, volge 23r4, 49v20, 59rl5/16, 60v8, 69r26, 69r27/28, 77r23, 80r7, 80v22, 83rl8, 84v6; 2. 'rechtliche Zustimmung bei der Abfassung eines Urteils': Widersprichet einer di volbort unde vint he ein ander urteil, welchir di mere volge hat, der behelt sin urteil 28v2 7.
vo!(Ien)kumen, vollenkomea Part.Adj. 'vollkommen, vollständig': Wer an sime rechte volkumen is 'Wer unbescholten und voll rechtsfähig ist' 32vll/12, volkumen 59r24, 59v31, 81r21, 81v3, 84v9, vollenkumen 28r21, vollenkumener 34v8/9, vollenkomen 28rl2. -> recht 7
volgen sw.V. 1. 'gerichtlich verfolgen, nachgehen': swas schadin imande an keiner slachte dinge gesche, das hes selbe nicht reche, he enclage alrest deme richtere unde volge siner clage zu ende lvr4, volgen 32r29, 81v28, volge 2 2 v l l , envolget 45r27; 2. 'hinterhergehen, verfolgen':
volrichten sw.V. 'zu Ende Recht sprechen, ein abschließendes Urteil fällen': Wo im der richter nicht enrichtet oder nicht volrichten enmag, da sal im der kunig richten 3 2 v l / 2 . volvordern sw. V. 'eine Klage vor Gericht zu Ende führen': Volvordert he aber sine clage noch rechte ane kamph
314
Glossar
unde enket im iener mit unschult, he blibet is ane schadin 24r28. vorächten sw.V. 'in die Acht erklären, ächten': Des ... vorachteten mannes ... gezug mag man wol vorlegen in deme gerichte, da he ... in di achte getan is 62v20. vorbannen st.V. 'in den Bann tun, von Seiten des Gerichts bestrafen': Des vorbannen mannes ... gezug mag man wol vorlegen in deme gerichte, da he vorbannen ... is 62vl9, 62v22. vorbiten st.V. 1. 'verbieten, untersagen': Wir ... vorbiten alle valsch 2 r r l 8 , vorbiten 2vr2, 2vr7/8, 3vl22, 3vrl, 23vl0, vorbutet 32v26/27; 2. 'den Aufenthalt an einem O r t untersagen': Swo man den echter vorbutet odir angrifet, den sal nimant weren 2vrl9. vorbören sw.V. 'verwirken': Burgen mus he aber seczen, da he kein erbe hat, vor des richten gewette unde vor buse, ab he si vorboret, unde nicht er 24r6, envorboret 77r22. vorbrengen unr.V. 'vor Gericht bringen, vorführen': Wer da borget, einen man umme ungerichte vorzubrengene, ab he en nicht vorbrengen enmag, he mus sin wergelt geben 2 6 v l / 2 , 26v2, vorbrengen 42vl, 44r6, vorbrengit 40v29/30, vorzubrengene 51vl6. vordere sw. M. ' V o r f a h r , Ahne': Jafet, unse vordere, besazte Europam 46v27, vorderen 8 r r l 8 , 47v6, vordem 46vl6, vordirn 14v27. vordem sw.V. 1. 'vor Gericht fordern, stellen, bringen': Schriet aber he das gerufte, das mus he wol vordem mit rechte, wen das gerufte is der clage begin 24r22, vordem 3 0 r l 2 , 43v5, vordere 2 2 r l 3 , vorderen 70v5, vorderet 6rr24, vorderit 48v8, vordert 17v21, 23v23, 24r7, 3 0 r l , 3 0 r l l , envordere 79v3, envordert 2 2 r l 8 ; 2. 'fordern, verlangen': Swer so hergewete vordirt, der sal von swerthalben dar zu geborn sin 44v37, vordirt 46v3, 82vl4. -> gevordem vorderunge st. F. 'rechtliche Forderung, Verlangen': Welch man vor gerichte vordert so getane sache ..., he mus sine vorderunge lasen mit einer werbuse unde mus deme richtere wetten 30r7, vorderunge 40rll/12, 48v7/8. vordingen sw. V. 'vertraglich zusichern, sich vertraglich verpflichten': Wer ouch den andirn sin gut vordinget..., unde stirbet iener, der das gedinget hat, er is im geligen wirt, iener is das phlichtig zu lasene sinem lenerbin 12v33. -»• dingen 3 vorgeben
st.V. 1. 'veräußern, vergeben': Wen ein man
sin gut vorgeben mag 4vr33, vorgeben 18r32/33, 18v30, 20v9, 43r6, vorgebin 4vr22, vorgebn 21v22; 2. 'schenken, hingeben': Im sal nimant icht odir nicht zu koufen geben noch vorgebin 2vr27/28. vorgelden st.V. 'zurückerstatten, bezahlen': Wundet man einen man an dem glit, das im vorgolden is vor gerichte, houwit man is im suber ab, he enmag da kein hoergelt an gevordem wen sine buse 3 0 v l 0 / l l , virgelde 12v31, vorgelde 13r6/7, vorgalt 26vl2, vorgolden 22vl7, 3 1 r l 3 , 35vl, 56r27, vorgoldin 22vl9, 56r20, 56r32, vorgulden 5 r r l l . -> gelden 1 vorgift st. F.N.M. 'Gift, Giftmischerei': Welch cristenman oder wip ungloubig is unde mit czouber ummeget oder mit vorgift unde des vorwunden wirt, di sal man uf der hört bumen 29v8. vorheischen sw.V. 'zum gerichtlichen Zweikampf auffordern': Ab der andere zu lange sumet, der richter sal en lasen vorheischen den vronenboten in deme huse, da he sich inne gerwit 26r8. -> heischen vorjären sw.V., mhd. verjxren 'die Belehnungsfrist verstreichen, verjähren lassen': Ab der herre den man schuldiget, das he sich vorjaret habe 7vr3, vorjaren 68v5, 69v25, vorjaret 3 2 r l 7 / 1 8 , 6 3 r l 8 , 66v9, 68v7, 73r22, vorjarete 64v28, virjaret 69v31. vorjären sw.V., mhd. verjären 'mündig werden, ein bestimmtes Alter erreichen': Vorjart is sich aber noch den rechten zinstagen, das gelt des gutes hat is vorlorn 39v5. vorklagen sw.V. 'anschuldigen, verklagen': Wo ein man sinen herren vorclagen sal 8rl20. vorkoufen sw.V. 'verkaufen': Meide unde ungemannete wip, di vorkoifen ir eigen an irs Vormunden willen, he ensi denne da erbe zu 20vl2, vorkoufen 22r32/33, 2 7 v l 5 / 1 6 , vorkouft 6rl8, 6vr21, 3 2 r l 6 / 1 7 , 40r8, 43r6, 4 3 r l 4 , 43v4, 64vl0, 73vl7, vorkoufte 4 3 r l 6 . vorkamen st.V. 1. 'vor Gericht erscheinen': Alse hi vor gesait is, also vorwint man den ouch, der zu kamphe gevangen unde gegrusit ist unde gelobet unde bürgen seczt vorzukumene, unde nicht vorenkumt zu rechtin tedingen 26r31, Wer nicht vorenkumt zu dem dritten tedinge, den vorvestet man 26v31, vorkumen 19v4, 78vl9, vorkume 45r9, vorkumt 41vl2, 42v22, kumt ... vor 19v31. vorladen sw.V. 'vor Gericht laden': Di sal man vorladen, ir wergelt zu nemene, czu den neestin dinge 29v24, vorladen 43r21, vorledit 44vl7, vorgeladin 19v30. -» inladen; laden 1
315
Glossar vorlegen sw.V. 1. 'widerlegen, abweisen, zurückweisen': Welch man zu deme herschilde nicht geborn is, der enmag ... keinen sinen herren vorlegen, ab he an in volgen sal, dennoch he des herschildes nicht enhat 59r29, vorlegen 25r30, 5 9 r l 7 , 62v21, 67v20, 71vl3, 85v30, vorleget 26r26, 7 7 r 2 3 / 2 4 , 72r26, vorlegit 59r25; 2. 'beseitigen, vermeiden': Durch das bedarf man manchvaldir rede, er man di lute des in künde brenget..., wi si unrecht mit rechte vorlegen unde zcu rechte brengen 84v27/28, vorleget 86r5, 86r7, vorlegit 73v2. vorlien st.V. 1. 'als Lehen geben, als Lehen verleihen': Swelches mannes gut der herre vorliet in sine entworte 7rr25, vorlien 61v6, 73vl8, 79v23, 84v4, vorligen 64r5, 69r24, 69vl 1/12, 80v5, 84r22, vorlegen 60v22, virligen 61r20, vorligeneme 65r22, envorlies 49v25, unvorligen 69rl; 2. 'verleihen': iener, der si vorleich oder vorsazt hat, der mag keine vorderunge dar uf gehaben, ane uf den, dem he si leich oder sazte 4 0 r l l . -> gellen; lien vorliesen st.V. 1. 'verlieren, verwirken, abhanden kommen': Das vorlos in allen Cale/ornia, di vor deme riche missebarte von czorne 40vl6, he vorlise di hant dar umme 2rr27, vorliesen 7 2 r l 7 , vorlisen 2rl20/21, 16r9, vorlisens 19v3, vorlust 34v5/6, 36r24, 36v33, 37r24/25, 39r9, vorluset 4vl25, 3 6 r l 7 , vorlusit l l v 2 0 , 12r2, 43v33, vorlos 4 9 r l 6 , vorlorn 18vl3, 32vl3, 37vl4, 3 9 r 7 / 8 , 39v7, 43vl, 48v8, 56r8, 7 2 r 8 / 9 , 75v6, 83v9, vorloren 16rl4, 60r27, envorlisen 70r3, envorliese 6 4 r l 3 , envorluset 65r25, 6 7 r 4 / 5 , 73vl3, 7 8 r l 5 ; 2. 'vor Gericht verlieren': Swer sinen Up vorluset vor gerichte oder sich selber tötet 5vll6, vorliese 78r32, vorliesene 68vl9, vorlust 33v20, 36v2, vorluset 6vrl9, 34v22, 36vl, 67v6, vorlusit 14v4, vorlorn lvrlO, 19vl8, 2 5 r l 2 / 1 3 , 34r22, 84r27. vorliesen st.N., Substantivierung von vorliesen st.V. 'Verlust': Vortopilt he aber sins selbis gut ..., der herre enmag da nicht uf gevordirn, wen he enist is im nicht phlichtig zu geldene, al habe he im sin vorliesin gesazt 43vl0. vorlouken sw.V. 'absprechen, bestreiten, in Abrede stellen': Ab der herre vorloukent sinem manne gutes 7 r r l 8 , vorloukent 7rr22, 16r25. -*• louken(en) Vormunde sw. M. 'Vormund, rechtmäßiger Fürsprecher': Wen man den vrouwen Vormunde gebin sal 4vrl 8, Ein man is Vormunde sins wibes 4vr20, Vormunde 7rl7, 7 r l 7 / 8 , 13vl 1, 16v26, 16v32/33, 17r6, 17rl0, 1 7 r l l , 17rl4, 2 0 r l , 2 0 r l 8 , 20r27/28, 20v2, 20vl4, 2 0 v l 8 / 1 9 ,
20vl9, 20v21, 2 1 r l , 41r3, 43r4, 4 8 r l , 68v29/30, 69r8, 6 9 r l 3 , 69r23, Vormunden 4vl28, 4vrl5, 4vrl6, 4vr23, 4vr26, 6rl25, 20r4, 20r6, 2 0 r l 2 , 20r26, 20r30, 20vl2, 20v28, 20v31, 20v33, 21r4, 21r6, 21r8, 21 r21, 3 1 r l 2 , 40vl6, 45r2, 68vl5, 68v26, vormundin 19v28, 20r24, 58r7, 5 8 r 7 / 8 . Lexer III, Sp.476f.; Grimm, D W B 12.2, Sp. 1322 ff.; T r ü b n e r 7, S. 750 ff.; Kluge/Seebold, S. 769 Vormunde sw. F. 'Vormundschaft': Helt der vater oder di muter kindere in Vormunde 4vll2. Vormunden sw. V. 'bevormunden, Vormund sein': Wenne der richter vrouwen Vormunden sal 4vrl9, Vormunden 20r32. -» baimunden vormundeschaft st. F. 'Vormundschaft': Wie lange des richters vormundeschaft wert 4vr25, vormundeschaft 7rll5, 8rll7, 13v5/6, 18v3, 19v33, 20v25/26, 35v3/4, 82vl9. vorphlegen st. V. 'sich verpflichten': Disen gezug sal der herre hören oder zcwene sine man dar senden, di sich vorphlegen bi sinen hulden 73r5, vorphlegin 57r8, vorphlege 49v29. vorreter st. M . 'Verräter': Alle mordere ..., unde there ..., di sal man alle radebrechen 29r32.
vorre-
vorsachen sw.V. 'bestreiten, leugnen': Ab ein man vorsachet, des man en zciet 4vl7, vorsachen 72v7. -» besachen vorschulden sw.V. 'verdienen, verschulden, schuldig werden': Wer des nachtis korn stilt, der vorschult den galgen 35r24, vorschulde 22v3, vorschult 2 7 r l 8 . vorsezzen sw. V. 'versetzen, verpfänden': Wer gewette unde buzse nicht engibt zu rechtin tagin, der vronebote sal en da vor phenden unde sal is zu hant vorseczin oder vorkoufen vor di schult 22r32, vorsezzen 27vl5, vorsezzin 27vl6, vorsezt 40r9, vorseczzit 3 2 r l 7 , vorsazt 40rl 1. vorsinnen sw.V. 'falsch sinnen, verleugnen': Vorsinet aber he sin recht vor gerichte unde sait he im zu ein ander recht, des he nicht volkumen kan, he vorlusit beide 14v2. vorspreche sw. M . 'Vorsprecher, Verteidiger vor Gericht, Anwalt': Ab ein man an sines vorsprechen wort nicht enjet unde aber der herre den vorsprechen schuldiget des, he mus dar umme gewetten, he enswere da vor, das he anders nicht gesprochen habe, wen alse iener bete, deme he zu vorsprechen gegeben si 64v30, 64v31, 65r3, vorspreche 4rl22, 5rll6, 5vr24, 7 r r l l , 7 r r l 7 , 23v20, 23v33,
316 24r2, 40vl5, 40vl9, 54vl, 61vl9, 76r25, 81v6, vorsprechen 5rll5, 6rl22, 7rr27, 23vl3, 23vl7, 23vl8/19, 24rl, 24vl7, 24vl8, 40vl8, 44vl8/19, 44v20, 62v23, 75rl8/19, 76r6, 76rl7, 76rl7/18, 76rl9, 76r21, 76r24, 76v4, 76v5, 76vl8, 77r28, vorsprechin 6 r r l l , 23vl2. -» Lexer III, Sp.610; Grimm, DWB 12.2, Sp. 1625 ff.; Trübner 7, S. 763 vorsprechen st. V. 1. 'widersprechen, abstreiten': so mus der man sagen, weder he di wisunge vorspreche mit der ergeren geburt oder mit manschaft, da sich iener mitte genidert habe 85v5, vorsprochen 85vlO; 2. 'verweigern, ablehnen, zurückweisen': Der herre ensal nimandes manschaft vorsprechen ane des, der des herschildes darbit 66rl7, vorsprechen 84v6, vorspricht 5 r r l l , 83rl7; 3. 'versprechen, falsch sprechen': Der herre mag sich vorsprechen unde vorswigen an sime rechte unde nicht sine man, ab si das gut vorsten noch rechte 64r20, vorspricht 23vl6. -> missesprechen-, sprechen 6 vorste sw. M. 'Fürst, derjenige, der allen voransteht': Vorste heist durch das vorste des riches, das sin vanlen, da he vorste ab wesen sai, nimant vor im enphan ensal 81r24, 81r24/25, 81r25, des riches vorste 'Reichsfürst' 51rl9, vorste lvll3, 51rl5, 65v2, 77v4, 81r22, 81r30, vorsten 2vlll, 3rll4, 3vr21, 6vlll, 6vll5, 6vll8, 43v35, 44rl, 44r2, 47v23, 47v25, 49r29, 49vl0, 4 9 v l l , 49vl7, 50r20, 51r8, 51rl2, 52vll, 60r4, 65r30, 81r22, vursten lr2, lr4, 6rll3, 36r28. -» leienvurste, -vorste vorsten unr.V. 'vorstehen, vertreten, einstehen für etwas': Doch mugen di vursten gewern einen man mit eineme offen brive besigelt, also das si da mite senden im ingebornen dinstman, der das gut vorste an ire stat 36r31, vorsten 7vr9, 13r22, 16v33, 20r21, 63v31, 64r22, vorste 50rl, 64r8, 68vl6, vorzustene 26r25, 43r22. vorstenlèn st. N. 'Fürstenlehen': Der keiser liet alle geistliche vorstenlen mit deme sceptrum 51r29, vorsten len 81v2. vorstoln Part.Adj. 'gestohlen, heimlich weggenommen': iener behelt sin gut, das im vorstoln was, ab he sich dar zu czut 34v7, vorstoln 40rl0, 43r28, 43vll. vorsümen sw.V. 1. 'verlieren, Verlust erleiden': Bin sinen jaren enmag das kint sich nicht vorsumen zu lenrechte 69r4, an sime erbe ... vorsumen 'sein Erbe verlieren' 18r 18; 2. 'versäumen, verstreichen lassen': Swas ein herre von mutwillen liet sineme manne, des he en nicht geweren enmag, he sai is im irstaten, also das sich der man in siner jarczale nicht vorsume 71rl6, Vorsumet der greve sin
Glossar echte ding 5rr5, vorsumet 22r21, 30r25, 68rl4, 70r26, 71r29; 3. 'vergessen': Er he ouch vor den herren kume, he sal swert, messer ... unde alle wapen von im tun, ab der man an disen dingen sich vorsumet, he wettet dar umme 75v24; 4. 'benachteiligen': Vorsumit he ouch kein man, des vorspreche he is, he mus sich wol irholn mit eime andern vorsprechen 23v32; 5. 'Nachteil erleiden durch Versäumnis': Wenne im das vundin wirt, so clage menlich, das im werre, mit vorsprechin, durch das he sich nicht enversume 23vl2a, vorsumit 66rl2. -> sümen vorswestem unde vorbrüdem sw.V. 'unter Schwestern und Brüdern ein Erbe teilen': Wenne aber ein erbe vorswestirt unde vorbrudirt, alle, di sich gliche na zu der sippe gestuppin mugen, di nemen glich teil dar an 14vl5/16. vorswigen st. sw. V. 1. 'durch Schweigen den Anspruch verlieren, Schaden erleiden': Bis swenne man sich vorswigen mag an eigene 4vr2, vorswigen 18r20; 2. 'verschweigen, nicht nennen': Der herre mag sich vorsprechen unde vorswigen an sime rechte unde nicht sine man, ab si das gut vorsten noch rechte 64r21, vorswigit 25rl2. -> swigen Vortagen sw.V. 'einen Gerichtstermin ansetzen': He sal nimande Vortagen, he tu is mit unseme sundirlicheme geböte 3rl20. vortedingen sw.V. 'vor Gericht laden': Brechen dis di kindere unde vorderen si das gut zu lenrechte, der herre sal beide ... vortedingen 70v7. vorteilen sw.V. 1. 'durch Urteil absprechen, entziehen': Clait mait oder witewe zu lantrechte über iren vormundin ..., unde kumt he nicht vor zu deme dritten tage rechtis zu phlegene, man sal en baimunden, das is, man sal im vorteilen alle Vormundeschaft 19v33, vorteilen 61v8/9, vorteilin 70v8, vorteiln 26v21, 29v20, 80r22, vorteile 67r8, vorteilt l r l 3 / 1 4 , 7vr4, 12vl3, 19r32, 19vll, 19vl7, 19v26, 26r33, 32rl4, 32rl8, 35r20, 36r4, 45r34, 50rl7, 61vl6, 63v29, 65rl6, 68r2, 72r25, 72v5, 73r26, 73r28, 73v3, 73v6, 74rl0, 75r4, 75r22, 75r29, 75vl5, 76rl8, 79v30, 82rl, 82r2, 82r8, 83vl9, 84r24, 84vl8; 2. 'verurteilen': Sin recht is ouch der zende man, den man vorteiln sal, das he en zu losene tu 50vl3/14, vorteilt 6vl31, 30v34, 50r23, 53v20/21. Lexer III, Sp.482; Grimm, DWB 12.1, Sp.2051 ff. -*• teilen 2 vortopeln sw.V. 'durch Würfelspiel verlieren, verspielen': Vortopelt ein knecht sins herren gut 6rll0, vortopilt 43v3, 43v6.
317
Glossar vortriben st. V. 'wegtreiben, vertreiben': Unse vorderen, da di herquamen unde di Doringe vortriben, di waren in Allexanders her gewest 47v7, vortribet 35r31.
23rl 1, 29v8, 30v25, 42v28, vorwundin 2 6 r l 8 , 29v5. -*• underwinden 2
voruntrüwen sw. V. 'treulos handeln, durch Treulosigkeit schädigen': Nicht wen durch dri sache mag der herre tedingen sime bürgere, ab he sich voruntruwit kegin im ... oder ab ein bürgere uf den anderen clagit umme bürgten 81v21.
vorwirken sw.V. 'verwirken, verlieren': Kein kint mag sinen lip vorwirken 5vr26, vorwirken 33v26, 40r20/21, 45r33, 48r29, 48r36, 50v7, vorwirkin 5 0 r l 5 , 50r23, vorwerkin 19v7/8, vorwirke 41r2, vorwirket 27rl7, 33v28, 48v31, vorwirkit 56r2, vorworcht 21vl3, 30r23, 32v8, 39r5, 77vl2, vorworchten 47v21, envorwirke 45v35/36, envorwirkes 16r3.
vorrare sw. M. ' V o r f a h r , Ahne': Der Swabe nimt wol hergewete unde erbe bobin der sibenden sippe, alse verre ..., alse hes gezugen mag, das ein sin vorvare ienes vorvaren oder ienes vorvare sins vorvaren hergewete gevordirt habe vor gerichte oder genumen 15rl3, 15rl4, 15rl4/15. vorvest Part. Adj. 'gerichtlich geächtet': Swen man aber einen vorvesten man in der hanthaften tat vor gerichte vuret 6vr31, vorvest 6rl26, 26r28, 26v20, 2 7 r l 9 , 40v21, 41v9, 45r3a, 45r4, 45r6, 4 5 r l 7 , 45v21, 45v22, 45v23, 45v24, 5 7 r l , 57r20, 62v22, 6 6 r l 9 , vorvesten 26vl9, 4 5 r 2 / 3 , 45vl6, 62v20, vorvestin 6rr2, 5 7 r l 0 / l l . -»• un vorvest vorvesten sw.V. 1. 'verfesten, gerichtlich ächten': Umme andirs keine clage sal man den man vorvesten ane umme di, di an den Up oder an di hant get 2 7 r l , vorvesten 2 7 r l 0 , 36v29, 42r25, vorvestet 26v32, 27v29, 27v33, 42r22, vorvestit 27v23, 42r34, 44r24; 2. 'eintreten für, vertreten': He mus aber das gut vorvestin drin dingen, ab man dar uf clait 27v3. Lexer III, Sp.287f.; Grimm, D W B 25, Sp.330f. vorvestunge st. F. 'Verfestung, gerichtliche Achtung, Bezirksacht': Doch ensal man nimande vorteiln sinen Up mit der vorvestunge noch mit der achte, da he mit namen nicht inkumen is 26v22, vorvestunge 5rl27, 2 7 r l 7 / 1 8 , 2 7 r l 9 / 2 0 , 2 7 r 2 2 / 2 3 , 27v33, 4 5 r l 2 , 4 5 r l 6 , 45v20, 52v2, 5 7 r l 3 . -=• un vorvest; vestunge; vorvest; vorvesten vorwerfen st.V. 'vor Gericht zurückweisen, abweisen': bezuget in des sin vater zcu den heiligen vor sime richtere mit zcwen seintbaren mannen, di nimant mit rechte vorwerfin mag, der son sal sin vorteilt egenes unde Ienes lrl3. vorwinden st.V. 'vor Gericht überführen, besiegen': Enwirt der dip bin tage nicht vorwunden 5rl7, Man enmag nimande mit vestunge vorwinden in eime andern gerichte 6 r r 3 / 4 , vorwinden 2 6 r l 9 , 2 6 r 2 2 / 2 3 , 45v20, 5 1 v l 0 / l l , vorwint 26r28, 72vl7, vorwunden 19r30, 21r27,
26r4, 2 6 r l 6 ,
vorwisen sw.V. 'verweisen von, ausweisen, verbannen': Wil ein herre vorwisen sinen zeinsman rechte 5vrl7, oder Iute von dem gute vorwise, di zu dem gute geborn sin 16r5. -» wisen vorzènden sw.V. 'den zehnten Teil als Abgabe leisten': Iclichen hof unde worte unde sunderlich hus vorzendit man mit eime hune an Sente Mertinstage 37v3, vorzenden 37r33/34, vorzendet 37r34, vorezende 37vl0, vorczendit 38r3. vorzien st.V. 'verzichten auf, aufgeben': Sinnet eins mannes son, der zu sinen jaren kumen is, gutes an sinen herren unde hat he brudere, di binnen iren jaren sin, he mus deme herren geloben, das sine brudere des gutes sich vorzeien 70v3. Vorzügen sw. V. 'durch Zeugnis vor Gericht beweisen, mit Zeugnis beweisen': Wo man den eigenen man vorzeugen sal 6 r r l 4 , vorzeugen 72v23, 7 4 r l 6 , 7 4 r l 9 , vorzeuigen 84r20, Vorzügen 14r5, 14v33, 20vl5, 2 6 v l 8 / 1 9 , 54v5, vorzuget I r l 9 , vorzugit 12v7, 27r22. vrenkisch Adj. 'fränkisch': Der kunig sal habin vrenkisch recht, swen he gekom is, von welchir geburt he si 5 0 r l 3 , vrenkisch 50rl7. vrevelltche Adv. 'auf vermessene, das Recht verletzende Weise': Swelch son an sins vatir lip retet oder vrevelichen angrift mit wundin oder mit gevenenisse ..., der selbe ist erlös unde rechtelos ewiclichen Irl7. vii Adj. 1. 'freigeboren, nicht leibeigen': Vri kint unde echt behelt des vater recht 6vr4, vries mannes rechte 49v28, 50r29, vri 6vr5, 14v5, 14v7, 46vl6, 5 0 r l l , 51v25, 54r7, 54v8, 54v24, 55r2, 67vl9, vrie 6rl28, 48r9, vrien 6vrl7, vrier 14v6; 2. 'adlig': Wir sezein, das unse hof habe einen hoverichter, der ein vri man si 3rl8, vri herren 4rll4, vri 21vl4, 36v24, 54vl0, vrie 28r5, 2 8 r l 9 , 4 5 r l 9 , 47v23, 47v25, vrien 3vr22, 10v30, 10v31, 23r28, 26v28, 45r24, 47v31/32; 3. 'frei von etwas, ledig, unbeschränkt': mit rechte si he geleites vri, wo he
318 sins gutes oder des libes genenden wil 33r5, vri 8rl 16, 82vl2, vrie 23r4; 4. 'nicht gefangen, freigelassen': So solde man ledig lasin unde vri alle, di gevangen waren 47rl0, vri 47rl2, 47rl5. DRWB 3, Sp. 683 ff.; Lexer III, Sp.507; Grimm, DWB 4.1, Sp. 94 ff.; Trübner 2, S. 430 ff.; Kluge/Seebold, S. 230 echt 1 ; geborn 3 ; recht 5 ; schephenbär vride st.sw.M. 1. 'Friede, Sicherheit, Schutz': Unde von dem tage, alse he im widersait hat, denne bis an den vierdin tag sai he im keinen schadin tun, weder an libe noch an gute; so hat he dri ganzce tage vride l v r l 8 , geswomen vride 6rll, 41v26, des kuniges tegeliche vride 42v35, des kuniges vride 43v21, des riches vride 59v30/31, vride wirken 'rechtlichen Schutz gewähren, etwa bei der Ausübung eines Amtes' 50v2, noch vrides rechte 'nach Friedensrecht' 27r29, 48r35, vride 2rr24, 6rll3, 22v2, 25rl, 25v20, 25v28/29, 29v2, 29v28, 40r22, 41v21, 41v24, 42r4, 43v22, 43v35, 44r3, 44rl2, 44vl6, 45r34, 48r34, 50r7, 50vl8, 79r31; 2. 'Friedensregelung, Friedensordnung': Nu vornemt den alden vride 5vr27, vride 41 r 12; 3. 'Friedensbruch': Unde wi man vride bessern sai 6rll5, vride 4 4 r l l . -> hantvride; recht 8 vridebrecher st. M. 'Friedensbrecher': Swer tötet oder wundet einen vridebrecher 5vr31, vridebrecher 6rl2, 58r2/3, vridebrechere 21r26, 27r27, 41vl8, 42rl8, 42r24, 42v27, vridebrecheres 24v22/23, vridebrecheris 24r32. vridetag st. M. 'Tag, an dem von Rechts wegen Frieden geboten ist': Heilige tage unde gebundene tage, di sin allen luten zu vridetagen gesazt 41r22/23, vridetage 41 v7. vriheit st. F. 'Freiheit': Vriheit is abir drierhande: Schephinbare Iute, di der bischove sint suchin suln. Phlechaftin der tumprobiste, lantsezin der erczpristere 10r22. vrìlàsen st. V. 'freilassen': Is si eigen, man mag si vrilasin 21v7, vri lest 4vll7. rrìman st. M. 'freier, nicht leibeigener Mann': ein iclich vriman hilfet des ouch wol einem dinstmanne lvll8, -uriman lvll2, lvll3. vrisch Adj. 1. 'frisch, jung': in der vrischen tat 'auf frischer Tat' 27r7; 2. vrische phenninge 'Fersenpfennige, Fersengeld': Lest si ouch iren man, alse wendisch recht is, si musen irme herren di vrischen phenninge geben, das sin dri Schillinge unde andreswo me, noch des landis gewonheit 55r7.
Glossar Lexer III, Sp.225f.; Grimm, DWB 3, Sp. 1546 f.; Trübner 2, S.328; Kluge/Seebold, S.210. vrist st. F. 1. 'Frist, festgelegter Zeitraum': ab he nicht enmag, so habe he vrist vierzennacht 66v21; 2. 'Vertagung, Verschiebung': Wil he aber, he mag im tedingen vor sine man, eins unde nicht mer, da enwerde orteil geschulden oder orteiles vrist mit rechte gewunnen 85v3. DRWB 3, Sp. 949 ff.; Lexer III, Sp.520; Grimm, DWB 4.1, Sp. 204 ff.; Trübner 2, S.451; Kluge/Seebold, S. 233 vristen sw.V. 1. 'hinhalten, aufschieben, vertagen': Wirt aber des herren lenrecht gevrist mit urteilen 64v21/22; 2. 'erhalten, bewahren, retten': Swas so ein man swert unde en truwen gelobit, sinen lip mite zu vristene ..., is enschadet im zu sime rechte nicht 46r31. vritag st. M. 'Freitag': Des vritagis machte got den man unde wart des vritages gemarterit durch den man 41 r31, vritag 41r24. vromen sw.V. 'nützen, förderlich sein': Vragit he noch sime mutwillen unde nicht noch rechte, das enschadet noch envromt irme kein 24v9. vröne sw. M. 'Fronbote, Gerichtsbote': Wer keine bürgen hat, da he ouch kein erbe enhat, den sal di vrone gewalt behalden, ab he umme ungerichte clait oder di clage uf en get 2 4 r l l . vrönebote sw.M. 'Fronbote, Gerichtsbote': Wer gewette unde buzse nicht engibt zu rechtin tagin, der vronebote sal en da vor phenden unde sal is zu hant vorseczin oder vorkoufen vor di schult 22r31, vronebote 10v3, 24vl3/14, 30r24, 36rl, 50r25, 50r26, 50v2, 51v24, vroneboten 31v6, 31v8/9, 45rl4, vronenboten 5rr25/26, 6vll2, 12v20, 18r9, 26r8/9, 27r6, 27v26, 48r7/8, vronenbotin 10v2/3, 12vl5. vroude sw. st. F. 'Freude, Frohsinn': Ubir siben mal siben jar quam das vunfczigeste jar, das hies das jar der vrouden 47rl5. vrouwe sw. F. 1. 'Frau': So aber di vrouwe keinen bruder enhat wen einen phaffin, si nimt im glich teil in erbe als in der rade 12r9, vrouwe 83r5, 83r25, 83r27, vrouwen 4vrl8, 4vrl9, 7vr21, 8rll8/19, 17r29, 17v4, 20rl, 20vl7, 30rl 1/12, 83r3, 8 3 r l l , 8 3 r l 7 / 1 8 , 83r22, vrouwin 20r24; 2. 'Ehefrau, Gemahlin': Mit sime rate sal och di vrouwe di bigraft unde den drisegesten tun, andirs ensal he keine gewalt habn an deme gute bis an den drisigisten 16rl5/16, vrouwe 16vl, 16v5, 18vl8, 31r27, 55vl, vrouwen 6vr8, 15r29, 55r21, vrouwin 15v30, 16rl.
Glossar vrum Adj. 'rechtschaffen, ehrbar': Swer zu allen dingen gerne rechte spricht, he gewinnet dar ab manchen has, des sal sich der vrume man getrosten durch got unde durch sin ere 84v30. vrume, vrome sw. st. M. 'Nutzen, Gewinn, Vorteil': Wo brudere oder andere lute ir gut zusamne haben, getan si das mit irre kost oder mit irme dinste, der vrome is ir algemeine 13vl4, vrumen 5vrl3, 9v7/8, 29rl3, 38v33, 48r30, 84v20. vrünt st. M. 1. 'Freund': Wirt ouch eineme manne sin mag oder sin vrunt irslagen, he mus en begrabin, ab hes wol weis, wer is getan hat 57vl6, vrunt 7rl4; 2. 'Verwandter': Is is gut, das ein man der vrouwen vrunt ir gut mit ir enpha 8rll9, vrunt 83r3. vurste -* vorste
w wifen, wäpen st. N. 'Waffe, Bewaffnung': Wer so umme ungerichte beclaget wirt, he enmus nicht me wen drisig man vuren vor gerichte, wen he vorkumt, di ensuln keine wafen tragen ane swert 41vl3, wafen 42v35, wapen 6rl6, 41v27, 41v28, 41v33, 42v32, 75v23, wapin 54r5. wäge st. F. 'Gewicht, Waage': Dis selbe gerichte get über unrecht mas unde unrechte wage ..., ab man des orvundig wirt 29r29. wän st. M. 'unbegründete Meinung, Vermutung': ouch tu he von im vingerlin, vorspan unde alle iserin ringen unde gurtele unde Spangen durch tummer lute wan 75v27, wane 57r32, 57v5. wandel st. N.M. 'Buße, Strafgeld als Schadenersatz': Wer holcz houwet oder gras snit oder vischet in eines andern mannes wassere an wilder wage, sin wandil, das sin dri Schillinge 33rl9, wandil 32vl8, 35v7, 37r24, 38r9, 40vl 1, 41r9/10, 41vl9, 45r27, 47r34. wanen sw.V. 'wohnen, sich aufhalten': Vorspreche enmag nimant geweigern zu wesene in dem gerichte, da he wanet oder gut inne hat 23v22, wanen 8 1 r l l . wanunge st. F. 'Wohnung, Aufenthalt': Swert enmus man ouch nicht tragen an bürgen noch an steten noch an dürfen, ane alle, di dar inne wanunge oder herberge haben 41v32/33, wanunge 45v35. wärheit st. F. 'Wahrheit, Wirklichkeit '.• An minen sinnen enkan ich is nicht usgenemen nach warheit, das iemant
319 des andern sulle sin 46vl8, warheit lr22, 20v24, 31vl0, 45v32, 46v20, 47r24, 73rl4. wärlösekeit st. F. 'Unachtsamkeit': Man sai geldin den schaden, der von warlosekeit geschiet 5vl22. warten sw.V. 1. 'abwarten': Dis sai der richter haldin jar unde tag unvortan unde wortin, ab sich imant dar zu mit rechte zcie 1 8 r l l / 1 2 ; 2. 'warten auf, erwarten': So mus he sin warten mit deme erbe, bis he widerkume 18rl6, warten 4 6 r l 0 / l l ; 3. 'wahrnehmen': Gerichtis suln alle warten, di dingphlichtig sin, von der zit, das di sunne ufget, bis zu mittage, ab der richter da is 51v28, wartet 37v9; 4. 'rechnen auf etwas, Anwartschaft haben': Tötet ein man sinen herren oder imant den andern, di sines gutes wartende is 6vr25, wartende 56r7, 7 0 v l l , wartinde 22r3. wartunge st. F. 'Anwartschaft': Totit ouch ein man sinen vater odir sinen bruder odir sinen mag oder imande, des eigenes oder lenes he wartende is, al sine wartunge hat he vorlorn 56r8. wasserurteil, -orteil s t N . 'Form des Gottesurteils durch Wasser': Enis das den ummesessin nicht wisselich, wer das in geweren habe, so mus man das wol bescheiden mit eime wasserurteile 45v6, wasserorteilen 73rl2. wasserzol st. M. 'Wasserzoll, Fährzoll': Wer so brukzol oder wassirzol enphurt, der sai en viervalt gelden 32v31, wasserzolle 32v35. Wechsel st. M. 'Wechsel, Tausch, Austausch': Da enbedorfte man keiner wechsele under den dinestmannen 54v22, wechsele 8 0 r l l . wechseln sw.V. 'wechseln, tauschen, austauschen': Doch wechseln di herrin wol ire dinstlute ane gerichte, ab man das widerwechsil bewisen unde gezugen mag 21v23. wechter st. M. 'Wächter': Nimant enmag recht len uf einer bürg bereden, da der herre torwarten unde wechtere beköstiget 82v6. weglien st.V. 'anderweitig verleihen, jemand anderem als Lehen geben': Swelches mannes gut der herre wegliet in sine entworte, des das gut is, ane des mannes rechte widerspräche, kein recht enmag he mer an deme gute bereden, des len is er was 64vl3. weigern sw.V. 1. 'sich weigern, sich widersetzen': Nimant enmag ouch weigern, zu lenrechte orteil zu vindene 81v5, weigern 7vl4, 54r25/26, 66v3, weigert 7rrl3, 44v30, 62rl0, 6 4 r l l , 65v27, 69v23, weigirt 13rl5, 31 vi 1, 34r26, 51vl5, weigerte 26vl4; 2. 'verweigern, verwehren, versagen': Ein iclich man mag kamphes wei-
320 gern deme, der wers gebom is 25r27, weigern 25r32, 56vl3, 66r26, weiger 76rl0, weigert 6vr30, 21vl7, 56v6, 60vl, 75r20, 84r8, weigirt 13rl6, 56v30, 56v32, geweigert 19rl0, 29vl3, 66r5, 68r24/25, 77rl9, 83r30, 83v6, geweigirt 56v28, enweigere 75r25, enweigert 36v21. Lexer III, Sp.743; Grimm, DWB 14.1, Sp.635ff.; Trübner 8, S.84; Kluge/Seebold, S.783 -> ge weigern 1, 2 wendisch Adj. 'wendisch': Orteil suln si vindin vastende ubir iclichen man, he si duzch oder wendisch oder eigen oder vri 54r7, wendisch 54v29, 55r6, wendischen 55r3. wetben s t V . 'einsetzen, benutzen': Alle mordere ... unde mortburnere oder di ire botschaft werbin czu irme vrumen, di sal man alle radebrechen 29r33. werbüze st. F. 'Strafe für mißbräuchliche Leistung der Gewährschaft, Gewährschaftsbuße': Werbuse, das is sine rechte hant, da he di gewer mitte gelobete oder sin halbe wergelt 30r8, werbuse 30r7. Grimm, DWB 14.1, Sp.218 -> büze were st. F. 'Gewere, rechtskräftig gesicherter Besitz': Wer ein gut im zusait zu lene unde ein ander sait, is si sin eigen, sprechen si is mit glicher were an, iener mus is bas zu eigen behalden mit zweier schepphin gezuge den der andere zu lene 36v5, were 8rr20. gewer(e) were st. F. 1. 'Wehrbefestigung': Man sait, das bürge unde vorsten keinen vride ensuln haben, den man an in gebrechen muge, durch di were, di di bürge haben 43v37; 2. 'Waffe zur Verteidigung': Swert ensal he nicht voren noch keine were 50v9. -*• brustwer
Glossar liunge, di der herre dem manne tut, sal weren zu sime libe 84vl6, wert 4vr25, 20v26. wergelt st. N. 'Geldbuße für einen Totschlag, Manngeld': sine buze is ouch zwivalt unde sin wergelt nach siner geburt sint der zeit, das he zu vronenboten gekorn wirt 12vl8/19, Ane wergelt sint unechte lute 6rr32, wergelt 5rl26, 5vl4, 6rr31, 6vl5, 6vr26, 20rl3, 26v3, 26v5, 29v23, 29v24, 30rl0, 31r9, 35r22, 3 6 r l l , 41r7, 42rl6, 44r9, 44vl0, 47v23, 47v34, 47v36, 48rl2, 48rl4, 48r32, 48v34, 49rl4, 56rl3, wergelde 30r33, 30vl, 30v4, 35vl 1, 38v21, 41r4, 47v25, 48r7, 48vl5, 48v20, 54vl3/14. Lexer III, Sp. 779; Grimm, DWB 14.1, Sp.320ff.; Trübner 8, S. 121; Kluge/Seebold, S.788 werhaft Adj. 'kampfbereit, zum Kampf gerüstet': Man sait, das bürge unde vorsten keinen vride ensuln haben, den man an in gebrechen muge, durch di were, di di bürge haben, unde durch di werhaften lute, di di vorsten suln vuren 43v37. werliche Adv. 'glaubwürdig, wahrhaft': wen ab en der herre dar nach schuldiget, das he sich kegen im vorjaret habe, da he sin unschult da vor deste werlicher getun mag 66vl0. werit st. F. 1. 'Weltalter, Zeitalter': Origenes wissaite hi vor, das sechs werlde solden sin, di werit bi tusent jaren ufgenumen, in deme sibinden solde si czugen 10vl7, werit 10v20, 10v33, werlden 4vl3; 2. 'Menschheit, die Gesamtheit aller Menschen': Kains gesiechte wart vortiliget, da di werit mit wassere zuging 46v23, werlde 9v7, 47v6; 3. 'Welt, Erde als Lebensraum': Des kindes jar sal man nicht rechenen von der zeit, das is di muter enphing, mer den von der zit, das si is gewan, unde lebindig in di werit quam 68v22; 4. 'weltliches Leben': man der werlde 'Laie' 31vl4. Lexer III, Sp.782ff.; Grimm, DWB 14.1, Sp. 1456ff.; Trübner 8, S. 111 ff.; Kluge/Seebold, S. 786
wer(e)n sw.V. 1. 'zur Wehr setzen, verteidigen, schützen': Swo man den echter vorbutet odir angrifet, den sal nimant weren 2vr20, weren 4vr28, 8 I r l 1, 83v3, wem 2 I r l 4 , 2 I r l 5 , werne 19v23, wert 2vr20, werit 21r9, geweret 2vr22; 2. 'abwehren, verhindern': In welche stat der echter kumt, den sal man nicht behalden, unde swer im ubil tut, das sal nimant wem 2vr26, weret 76r22; 3. 'verweigern, verwehren': Wil aber iener sin gut werin mit rechte, er is vor gerichte kumt, so bite he en widerkeren vorgerichte 34r24, wem 3rl3, 33rl3, wert 19r6; 4. sinen Up weren 'sein Leben verwirken': Swo der duzche sinen lip weret 6vl4.
werren st.V. 'in Zwietracht bringen, durcheinander bringen, verwirren': Wenne im das vundin wirt, so clage menlich, das im werre, mit vorsprechin, durch das he sich nicht enversume 23vl2.
wer(e)n sw.V. 'dauern, währen, Bestand haben': alle
werschaft st. F. 'Gewährschaft, Bürgschaft': Nimt
werltlich Adj. 'weltlich, im Gegensatz zu geistlich': Geistlich gerichte unde werltlich zu suchene 4vl2, werltlich 10r26, 22v27, 52r22, 52r27, werbliche 10r5/6, 47v4, 51r30, 56v20, werltlichem 10rl3/14, 22v4, 79r30, werltlichen 10rl6. gerichte 1; swert 2
der
Glossar
321
herre dem manne gut oder enphellit he im der werschaft 7 v r l l , werschaft 8rr20, 13r23, 36r23. gewer(e) 3
Wir haben ouch noch in unseme rechte, das nimant sich selbe zu eigene gegeben mag, is widerlege sin erbe wol 47r2.
wert Adj. 'Wert habend, wert': Geschiet aber in deme dorfe des tages eine dube, di minre denne drier Schillinge wert is, das mus der burmeister wol richten des selben tages zu hüte unde czu hare 29r20, wert 35v27, 47v31, 57v27, 76v22.
widernemen st. V. 'zurücknehmen, wieder an sich nehmen': Der selbe herre, der is gut liet, mus is wol widernemen, ab hes bedarf, das hes dem manne mit glicher wechsele an des riches gute irstate 80rl0, widerneme 80r21.
wert st. N.M. 'Wert, Kaufpreis': Wes hunt oder ber oder ochse oder welcherhande vie das si einen andern tötet oder belemt oder ein vie, sin herre sal den schaden noch rechteme wergelde oder noch sime werde bessern 35vl2.
Widerrede st. F. 'gerichtlicher Widerspruch, rechtliche Antwort': Lest abir eine herre einen man siezen mit sime gute jar unde tag ane rechte Widerrede ..., mit den geweren enmag he sime herren an deme gute nicht enphirren 63rl4. widerspräche
wette st. N. 'Strafgeld, das bei einem Vergehen als Gebühr an den Richter zu zahlen ist': Beide, buse unde wette, sal man leisten über vierzcennacht zu des herren nesten huse, da si gewunnen werde 77v 14, wette 80rl6, 80vl8/19. -> gewette wetten sw.V. 1. 'als Strafe bezahlen, zur Strafe verwirken': Wer bi kuniges banne dinget, der den ban nicht enphangen hat, der sal wetten sine zcunge 23v5, wetten 40r26/27, wette 79r27, wettet 30r26; 2. 'ein Strafgeld an den Richter zahlen': Wor umme man deme richter wettit 5rll, he mus ... deme richtere wetten 30r8, wetten 30rl4, 31v32, 44v32, 56v8, 75vl9/20, 76v29, 77rl5, 79r29, wettin 22v3, 28r33, 45vl7, 5 2 v l 0 / l l , 52vl2, 52vl3, 56v5, 56vl5, wettet 8 r l l l , 28vl9, 75v24/25, 77r8, wettit 5rl20, 6vl26, 22r24, 24r26, 30r24, 36v2, 52vl5, 52v20, 52v32, 53r3, 53r8, 76v21, 77r4, 77v3, enwettet 76v25, 77v21, enwettit 22vl, 52vl4, gewettit 2vl31, 3rl29; 3. 'als Pfand geben, einsetzen': Unde ab gut wettet 6rll2. Lexer III, Sp.809f.; Grimm, DWB 14.1, Sp.690ff. widerheischen sw.V. 'zurückfordern, wiederverlangen': Swer da widerheischet, das he vorgeben oder vorkouft hat, unde loukent he des koufes ..., iener, der si under im hat, mus si selbe dritte wol behalden mit den, di is sagen 43r5. widerladen sw. V. 'zurückrufen, erneut vor Gericht rufen, laden': Ledet der man sine husgenosen in sin gespreche, di sal der herre im geben alle sunder dri, durch das, ab si zu lange sprachen, das he si mit orteiln widerlade 76vl4/15. widerläsen st.V. 'erneut überlassen, zurückgeben': wen si sich von im scheiden, he sal in widerlasin unde widirgeben alle irre muter gut 13v7, widerlase 55v26, widerlasin 55v27/28. widerlegen sw.V. 'sich widersetzen, Widerstand leisten':
Widerreden sw.V. 'vor Gericht widersprechen, Einspruch erheben': Swer an den obersten herren siner liunge oder wisunge mit sime gute sinnet, wiset he en denne an sins herren ungenos, so der man das erst irvert bin der jarczale, das he volgen sal, so Widerrede he di wisunge vor dem obersten herren 85r29, widirredin 38v35, enwiderredit 32r33. widersagen sw.V. 'Frieden und Freundschaft aufkündigen, Feindschaft ankündigen': Swer aber sine clage richtit, als da vor geschriben stet, wirt im nicht gerichtet, so mus he durch di not sinen viendin widersagin lvrl4, widersait lvrl5, lvr21, widersagit l v r l 8 / 1 9 . widerspräche st. F. 'gerichtlicher Widerspruch, Einspruch vor Gericht': Welch man ein gut in gewern hat jar unde tag ane rechte widerspräche, he hat dar an eine rechte gewer 36vll, widerspräche 62rl7, 63r2/3, 64vl4/15, 67r20, 71r30, 72rl5, 72vll, 7 4 r l l , 80r25, widersproche 36r21. Widerrede widersprechen st.V. 'widersprechen, verweigern': Wer in siner suche sine habe vorgibt oder usseezt..., das wip unde das ingesinde sal dar umme nimande schuldigen, wen si musin des mannes gäbe nicht widersprechin, si sie recht oder unrecht 2 2 r l l , widerspricht 5rr21, widersprichet 28v25. widerstän, -sten unr.V. 'widerstehen, sich widersetzen': Sus sal werltlich gerichte unde geistlich ubereintragen, swas so deme einen widerstat, das man is mit deme andern twinge, gehorsam zu wesine unde rechtis zu phlegene 52r28, widirste l O r l l , widirstet 50v9. widerstatunge st. F. 'Entschädigung, Wiedergutmachung': Dube noch roup noch topilspel is he nicht phlichtig
322 zu geldene, noch keine schult wen di, der he widerstatunge enphing oder bürge wurden was 12r22. widervechten st.V. 'anfechten': widervichtit he das urteil selb sibinde wider andere sibene, wo di meiste menie gesiget, di haben das urteil behaldin 15r4. widervinden st. V. 'ein Urteil erneut finden, wieder finden': Swelch man dries orteil schilt, unde im das widervunden wirt, das hes nicht also bescholden enhabe, als is im helfende si, kein urteil enmus he me scheidin 61v26. -> vinden 2 widerwechsel s t M . 'Austausch': Doch wechseln di herrin wol ire dinstlute ane gerichte, ab man das widerwechsil bewisen unde gezugen mag 21v24. wikbilde st. N. 'städtischer Gerichtsbezirk': Dis selbe mus tun ein lantman dem andern, ab he en beclait in wikbilde oder in eime uswendigem gerichte 56v26. wille sw. st. M. 1. 'Wille, Entscheidung, Entschluß': Ouch sal der kunik durch recht sinen hanczchen dar senden zu bewisene, das is sin wille si 32v24, wille 40vl8, 82v21, willen 70r23, 72vl7, 76vl6, durch rechtes willen 7 8 r l 8 / 1 9 ; 2. 'Zustimmung, Einwilligung': Vorspricht aber der herre der vrouwen volge unde liet hes dem manne alleine, he hat vol lenrecht dar an zu liene unde zcu lasene mit der vrouwen wille 83r20, willen 2rr27, 4vl20, 4vr22, 14v29, 17v21, 18r33, 19rl5, 20v8, 29rl2, 31r26, 40r8, 47r31, 48v23, mit willen 'freiwillig, aus freien Stücken' 34r29, 43v7/8. -> Lexer III, Sp.888f.; Grimm, DWB 14.2, Sp. 137 ff.; Trübner 8, S. 168 ff.; Kluge/Seebold, S.793 -» mutwille 1 willeclich Adj. 'bereitwillig, freiwillig': Dise gewette gebe wir deme richtere, das he deste willeclicher richte 3rl32. willekor st. F. 'Zustimmung, Einwilligung, freier Wille': Dis recht saczte der keiser zcu Mencze mit der vursten willekor lr2, willekor 38v33, 41rl4, willekore 5rl6, 70rl8/19. Lexer III, Sp.890f.; Grimm, DWB 14.2, Sp.204ff.; Trübner 8, S. 175f.; Kluge/Seebold, S.793 wip st. N. 1. 'Frau': Iclich man unde wip von ritters art erbet zcweier wegene 4vl33, wip 4vr23, 5vr24, 6rl7, 6vr5, 7vl25, 7vr31, 12rl, 14vl8, 14v26, 17v31, 17v33, 21v5, 29v6, 40vl5, 40v24, 41rl6, 41v37, 42vl9, 43rl, 47v37, 48r33, 54v24, 59r9, 59vl, 63vl0, 71vl, 81r2, 84v7, wibe 14v30, 50vl6, 59r32, wibes 6rl4, wiben 18vl9, 48r35; 2. 'Ehefrau': Man unde wip enhaben kein gezweit gut 4vr4, Ein man is Vormunde sins wibes 4vr20, wip 4vr5, 4vr6, 4vrl0, 5vl8, 5vl25, 6rr8, 6rr22, 6vr5,
Glossar 1 lr8, 1 I r l 5 , l l v 4 , llv21, 13vl0, 15vl2, 15v20, 15v28, 16vl4, 16vl9, 17rl6, 18r28, 18r29, 18r32, 18vl, 18v3, 18v9, 18vl4, 19rl7, 19r24, 19r25, 20v8, 21r33, 21v2, 22r9, 31rl9, 31r21, 32rl, 32r3, 32r4, 35v3, 48r2, 50v25, 55rl0, 55r26, 55r27, 55v4, 55v7, 55vl2, 55vl5, 80v4, wibe 7vl21, 13vl6, 15r24, 16rl0, 20vl, 3 1 r l 6 / 1 7 , 34rl0, 55r28, 70vl5, wibes 17v25, 18v7, 20rl8, 48rl, 55v7, 82vl9, wiben 15v26. wiphalben Adv. 'weiblicherseits, mütterlicherseits': Iclich wip erbit zweier wege: ir gerade an ir nehiste niftele, di ir von wiphalben zugehorte, unde das erbe an den nehisten, is si wip oder man 17v33, von wiphalbin 14v25. wiplich Adj. 'weiblich, was einer Frau schicklich ist': Wip mag mit unkuscheit ires libes ir wiplich ere krenken, ir recht vorlusit si da mite nicht noch ir erbe 1 2 r l / 2 , wipliche 17r26. wirken sw.V. 1. '(Friede) erwirken, schaffen': unde man sal im vride wirken 29v28, wirken 50v2, wirkit 50vl8, wirket 44vl6, geworcht 40r22, 45r34; 2. 'ein Kleidungsstück wirken, fertigen': Spricht aber iener da wider, ab is gewant is, he habe is lasen wirken 34r32; 3. 'bearbeiten': den ackir ... gewirken 47vl6. wisen sw.V. 1. 'weisen, verweisen von, ausweisen': Man ensal nimande us sinen geweren wisen 5vl9, Man sal nimande wisen von sime gute 5vr32, Wil ein herre wisen sinen zinsman von sime gute, der zu deme gute nicht gebom is 39v22, wisen 7vl33/34, 32r8, 41v22, 72v4; 2. 'sich von etwas abbringen, wegführen lassen': Von rechte ensal nimant wisen liebe noch leide 9vl5; 3. 'beweisen, vorzeigen, vorweisen': dise wiset von gezuge 8rrl5, So sal he wisen di wunde odir di narwe, ab si heil is 25r6, das si wisen nach rechte sulch len alse ir si 73r9/10, wiset 8rr9; 4. 'hinweisen auf, unterrichten': das si rechte wisen 'daß sie zu Recht darauf hingewiesen haben' 45v8; 5. 'einweisen in, zum Zweck der Belehnung verweisen an, belehnen mit': Ab he en denne wiset in sins herren ungenos 8rl29, Wil en ouch der herre wisen 64vl, Swen der herre binnen jare unde tage nirgen enwiset 68r8, wisen 64v4, 68rl0, 73v5, 84v5, 86r8, wiset 64v7, 85r26, 85v6a, 85vl4, 85v22, enwiset 7vl8, wise 64r28, 68r4, 70rl4. -> Lexer III, Sp. 941 f.; Grimm, DWB 14.1, Sp. 1078 ff.; Trübner 8, Sp.97f.; Kluge/Seebold, S.785 bewisen 1, 2; gewisen 2, 3; in wisen-, üswisen; vorwisen wisliche Adv. 'bewußt, bekannt': Der niderste richter enmus nicht richten di vestunge, di der oberste richter getan
Glossar hat, is ensi im also wislich, das he ir selbe gezug wolle wesin in des hoesten richters stat 45v27, wislich 60r9. wissen unr.V. 'wissen, kennen': Swelches mannes alder man nicht weis, hat he har an dem harte unde da nidene unde under iclichem arme, so sal man wissen, das he zu sinen tagen kumen is 2 0 r l 4 , 2 0 r l 6 , wissen 9vl5, 34v9, 60vl3, wissene 21vl6, 72r20, wisse 34v3, weis l v l l 5 , 10v34, 12r27, 24r32, 28v24, 40v33, 57vl7, 66vl4, 7 7 r l l , enweis 10v34, 3 1 v l l , 42v4, 45vl7, 57vl2, 66vl4, 7 2 r l 5 , enwisse lr24, 2 v r l 7 / 1 8 , 31v29, enwoste 7 2 r l 8 , 61v2, 80r29. wissen(t)liche Adv. 'bekannt, bewußt, wissentlich': Zuet ein man sins gezuges uf den seihen man, uf den der gezug get, der sal durch recht sagen bi sime eide, was im wissenlich si dar umme 31v27/28, Beheldit en eine stat gemeinlichen unde wissenlichen, is si ummemuret, der richter ... sal si niderbrechin 2vr30, wissenlich 45vl6, wissinlichen 2vr22, wissinlich 14v31, wisselich 45v5, wissentlichen 3vr6. wissen(t)schaft st. F. 'Wissen, Kenntnis': Das ein man sinem herren schaden tut ane sine wissinschaft 6vrl5, Wissenschaft 31v35, 7 3 r l 5 , 74v20, 82v21, wissinschaft 5 7 v l 4 / 1 5 , wissentschaft 12r30, wissenthaft 48v5. unwissenschaft
323 wonhaft Adj. ' w o h n h a f t , ansässig': Di herzcogen von Lüneburg unde sin gesiechte sint alle geborne Sachsin; dar zu alle di vri herren unde schephin, di zu Sachsen sint wonhaft 4rll5. wort st. N. 1. ' W o r t , Rede': Ab der man an des vorsprechen wort nicht enjet 6rl22, wort 7rr27, 23vl8, 2 4 r l 4 , 24v6, 24vl8, 64v30, 76r24, 76r26, 76v5, worte 44v20, Worten 2 7 r l 2 , 72vl7, wortin 4 7 r 2 0 / 2 1 ; 2. mit Worten unde mit tat 'mit W o r t und T a t , mit Reden und H a n deln': he sal ouch sinen herren mit Worten unde mit tat eren, wo he bi im is, unde ufsten kegen im unde en lasin vorgen 59vl7, mit Worten oder mit tat 7 7 r l 0 / l l . wunden sw.V. 'verletzen, verwunden': hezzit man si denne mit hunden, biesin si di hunde tot oder wunden si sie, man blibit is ane wandil 35v33, Swer den anderen belemt oder wundet 5rr25, wundet 5vr31, 21r24, 3 0 r l 9 , 30v3, 30vl0, 48r33, wundit 41vl8, wundete 41v20, gewundet 2 I r l 9 , gewundit 2 5 r 4 / 5 , 57v22. wurf st. M. 'Wurf beim K a m p f : Ane vleischwundin mag man ouch einen man toten oder lernen mit siegen oder mit stosen oder mit würfen 2 7 r l 6 .
wisunge st. F. 'Einweisung auf ein rechtlich zugesprochenes G u t oder auf ein Lehensgut': Swer an den obersten herren sinnet lenunge oder wisunge mit sime gute 8rl28, alleine darbe he der wisunge 62r31, Swer aber di wisunge mit gezuge vorleget 8 6 r 6 / 7 , wisunge 64r25, 6 4 v l / 2 , 68r9, 80v2, 85r25/26, 85r29, 85v4/5. -> bewisunge; inwisunge
wurte, worte st. F. 1. 'erhöhte Hofstätte, erhöht angelegter Platz zum Hausbau': Ane des richters urlob mus ein man sin eigen wol vorgeben in erbingelubde, das hes behalde eine halbe huve unde eine wurte, das man einen wain dar u f f e wendin muge 18v32, wurte 7rr20, 63vl; 2. 'Gerichtsstätte': Der kunig mus wol tedingen zu Unrechte einen vorsten über sechs wochen ..., keine worte endarf he benennen in sinen tedingen, den swo he offenbar dinget, das is der hof 81 vi2.
wit st. F. 'Strang, Strick zur Vollstreckung des Todesurteils': Wer des nachtis gehouwen gras oder gehouwen holcz stilt, das sal man richten mit der wit 33r30.
Z (C, CZ, Z, ZC)
witewe st. sw. F. 'Witwe': Blibit di witewe ungezcweiet mit den kindern in des mannes gute 6vr9, witewe 4vl23, 4vrl5, 15vl9, 19v27, 20r29, wittewe 15v9, 55v9, witewin 16rl2, 17rl4. wiünge st. F. 'Weihe, kirchliche Segnung': Swen aber di Duzehen einen kunig kisen unde he zu Rome vert noch der wiunge, so sintphlichtig sechs vorsten mit im zu varne, di di ersten an der kore sin 6 0 r 3 / 4 . woche sw. F. 'Woche': Uber achzcen wachen sal der greve sin ding uslegin 6vl21, woche 47r6a, wochen 24vl, 26v5, 2 7 v l l , 41r23, 59v21, 6 0 r l 5 , 61vl3, 6 4 r l 0 , 64vl 1, 6 8 r l 9 , 6 8 v l l , 77r7, 78vl3, 78vl8, 81vl0, 8 4 r l 6 , wochin 10r28, 26v30, 51v21. -> sechswochen
zelder st. M. 'Paßgänger, Zelter': Rittere phert, ros unde czelder ... enis kein wergelt gesazt 49rl 3. zen Num.card. 'zehn': Sin recht is ouch der zende man 50vl3, sin czende teil 30v2, das czende schog 37v6, czende garbe ?>7vb/7, czen phunt 48r6, zen phunt 52vl3, 52vl5, zeen phunt 77v3, das zeende phunt 74r30, zeenden phunde 6 0 r l 3 , den zeendin Schilling 74r29. zende sw. st. F.M. 'der zehnte Teil, Zehnt, bes. als Abgabe von Vieh und Früchten': Icliches vies gibet man czenden, sunder hunre 37v2, Wer den czenden noch rechter gewonheit gibt, der hat en wol gegeben 37v20, zeendin 5rl4, 5vr6, 7rl23, 22vl5, 62r28, 62v2, czenden
324 37r29, zendin 37vl0, zenden 37vl5, 37v23, 39r27, zende 39r31. -» gensezende; komzende; lemmerzende; vleischzende zendener st. M. 'Zehnteinnehmer, Zehntherr': Das selbe tut man umme czenden, ab en der zcendener nicht ennimt 37r29, zendener 37v23, 37v31, 38r3. zepter st. M.N. 'Zepter': Der keiser liet geistlichen vorsten len mit dem ceptre 6vll9, sceptrum 51r30. zerbrechen st.V. 'zerbrechen, entzweibrechen': Wer aber da mite koift boben di rechte zit, der munzer mus si wol im zubrechen 32v30. zervüren sw. V. 'zerstören, verwüsten, vernichten': Ubir den wirt, der en beheldit, sal man richten als über einen echter unde sin hus zcuvuren 3rll, zuvorte 47r36/37. zien st.V. 1. 'bringen': Keins gescholdenen Urteils mus man nicht czien us einer graveschaft 28v3, zien 29r9, 54rl3, 86r3, czien 28v8, 28v32, zie 28v31, 54rl3, czie 29r9; 2. 'Anspruch erheben auf, beanspruchen': Kumt aber nimant binnen sechswochen, der sich dar zu czie 35rl2, zien 34v29, 35r6, zie 33v4, 36r6, czie 40rl4, 43v6, zcie 18rl2, zut 53v25, czut 34v8, enzuit 61r28, enczut 33v25; 3. 'ziehen, herausziehen': Swer so swert zut 5rll9, Unde wer sich us der vorvestunge zcut 5rl30, so mus im iener volgen über vierczennacht, wo he zuet 34vl6, zcien 5rr8, 78r26, 78r28, 78v27, czien 28rl5, zuit 24r24, zut 78vl5, zcie 78r26, zie 38r22, gezogen 45rl2, gezcogene 10v9; 4. 'sich berufen auf: Schilt ouch ein Sachse ein urteil unde czut hes an sine vordere hant 28vl5, zcien 15rl7, zut 15r3, zuit 49v30; 5. 'befreien': Wer jar unde tag in des riches achte is ..., us der achte mag he sich den noch zcin 19vl2, enzut 36r3; 6. 'bezichtigen': Wirt aber im bruch an deme geweren ..., unde ziet man en dube oder roubes dar an 34v20, zciet 4vl7; 7. 'sich beziehen auf: Man mus sich wol zien uf manchen gewem 34v24/25, zuet 31v25; 8. 'aufziehen': oder ab is phert sin oder ander vie, he habe is in sime stalle gezogen 34r33, gezogen 34v27; 9. 'sich ziehen, begeben in': di gevangen waren unde in eigenschaft gezogen 47rll; 10. zü rechter zucht zien 'mit Recht zum Eigentum erklären': He mus aber swern, das hes zie czu rechtir czucht 34vl4/15. Lexer III, Sp.ll03ff.; Grimm, DWB 16, Sp.258; Kluge/Seebold, S.812 -» gezlen 5; üfzien-, üszien 1, 2 zinne sw. st. F. 'Zinne, Mauerbefestigung': czinnen unde brustwere ensal da nicht an sin 53v5.
Glossar zins st. M. 'Abgabe, Zins, Zinsforderung': Wer sinen zins zu rechtin tagen nicht engibet 22v8, Cins mus der herre ... bas behaldin den is der man gelouken muge 22vl3, Swo man alle jar zcins abegibit 63r20, zins 22vl3, 36v38, 38r27, 39r23, 39v5, 39v28, 55vl3, 55vl8, 55v30, zcins 22v7, 63v9, zcinse 6vrll, 7vr28, 7vr29, zinses 55vl9, zinse 55v24. -> Lexer III, Sp. 1126; Grimm, DWB 15, Sp. 1479 f.; Trübner 8, S.412; Kluge/Seebold, S.814 zinsgelde sw. M. 'Zinsgeber, Zinszahler': Doch enis der herre nicht phlichtig zu entwortene ... sime zcinsgelden 77r20, zinsgelden 82v7. zinsgelt st. N. 'Zinsgeld, Zins': Vorliet der herre ein gut, da di zinsgelden zu geboren sin oder sich in das zinsgelt gekouft haben 82v8, zinsgelt 55vl8/19. zinsgenös st. M. 'Zinsgenosse, jemand, der den gleichen Zins entrichten muß': he enhabe im er rechtes geweigert vor sinen czinsgenosen 77r21. zinsgut st.N. 'zinspflichtiges Gut, Gut, welches als Zins gegeben wird': Was man uf zcinsgute liden sulle 5rl4, zinsgut 7rrl9, 22v26, 55vl0, 63r28, zcinsgut 63r23, zinsgute 22v26, 3Irl5. zinsman st. M. 'Zinsmann, Zinspflichtiger': Der czinsman, wer he si, he erbet sin gebu uf sinen erben uf zinsgute 31rl4, zcinsman 5vl4, 5vrl7, 22v25, zinsman 22v6, 22v23, 39v22. zinsrecht st.N. 'Zinsrecht, Recht, den Zins zu erheben': Is aber ein vri gut, da nimant zinsrecht an enhat 82vl2, zinsrecht 8rll6. zinstag st. M. 'Tag, an dem der Zins zu entrichten ist': Gelt von mulen unde von zollen ... is vordint, wen der zinstag kumt 39v2, zinstagen 39v4, 39v6, 55v21. zit st. F.N. 'Zeit, Zeitraum, Zeitpunkt': Swen man kuset zu langer zeit 5rl8, Wen das wip man nimt, gewint si ein kint e irre rechtin zeit 19rl8, Ab zewene man ein gut ansprechen ..., beide suln si benennen di zeit der lenunge 61rl4, zu bescheidener zeit 10r7, 84vl2/13, zu bescheidener zit 47r33, noch irre rechtin zit 19r21/22, boben di rechte zit 32v29, zu gelobter czit 44vl/2, bin siner rechten zit 71rl8/19, bin siner rechten zeit 79rl7, zu rechter zeit 85rl7, zeit 4rll6, 7vll, 12vl9, 13r31, 21r23, 67v27, 68r20, 68v20, 80v7, zit 22r8, 23rl5, 23vl0, 26v6, 35v7, 35vl3, 40v8, 41rl5, 42v6, 49r28, 51vl2, 51v29, 55v3, 55v26, 66r29, 68v21, ziten 22r20. zitig Adj. 'der Tageszeit entsprechend': Di sal der richter
Glossar
325
beköstigen: ... dri gerichte zu dem essene, di des tages czitig sin 28r24.
gehören': Iclich wip erbit zweier wege: ir gerade an ir nehiste niftele, di ir von wiphalben zugehorte 17v32.
zogen st. sw. N. 'Verzögern der Gerichtsverhandlung, Prozeßverschleppung': Swer ein orteil schilt, schuldeget man en, das hes nicht durch rechtes willen tu, wen durch zcogen, des mus enken uf den heiligen, oder he gewettet dar umme 78rl9.
zunge st. sw. F. 1. 'Zunge': Wer bi kuniges banne dinget, der den ban nicht enphangen hat, der sal wetten sine zcunge 23v5, zungen 30r30; 2. 'Sprache': binnen duzchir zungen 59v25, di gewere mit vingeren unde mit zcungen geloben 68vl8.
zol st. M. 1. 'Zoll, Abgabe': Ein itel wagen gibet halben czol wider eime geladenen 33r8, zcol 2rl9, 2rll5, 2rll8, 2rl23, 2rr6, zcolle 2rll, 2rl7, zcolles 2rll0, zcoln 5vll2; 2. 'Recht, den Zoll zu erheben': In welche stat des riches der kunig kumet binnen deme riche, da is im ledig czol unde münze 51v4, zcollen 62vl, zollen 39vl. Lexer III, Sp. 1147; Grimm, DWB 16, Sp.37ff.; Trübner 8, S.425f.; Kluge/Seebold, S.816 -» brukzol; marktzol; wasserzol
züphlichten sw.V. 'zustimmen, beipflichten': Vorspilt aber ein man sin gut ..., da sine brudere oder di ir gut mit im gemeine haben, nicht zugephlicht haben 13v20.
zolvri Adj. 'zollfrei': Phaffen unde rittere unde ir gesinde sullen wesin zolvri 33r2, czolvri 33r3.
züvüren
zubrechen
zerbrechen
zucht st. F. zu rechter zucht zien 'mit Recht zum Eigentum erklären': He mus aber swern, das hes zie czu rechtir czucht 3 4v 14/15. zien 10 zügen unr.V. 'untergehen, zerfallen, enden': Also der herschilt in deme sibendin zuget, also czuget di sippe an dem sibenden glide llr4, llr5, czugen 10vl9, zuging 46v23. zügen sw.V. 'Zeugnis ablegen, bezeugen': Ein man sal zugen sine lenunge, ab hes bedarf 7rrl2, zugen 7rrl0, zugene 7rll2. ab(e)gezügen; bezügen 1; gezügen 1; uberzügen; Vorzügen zuhören sw.V. 1. 'gehören': Kumt iener bin sechswochen, deme das zuhört 35r5; 2. 'verwandt sein, zu jemandem
züsagen sw.V. 'Anspruch erheben auf etwas': Ab der herre unde der man eines gutes gewere en zusagen unde das bieten zu gezugene, des mannes gezug get vor 73rl7, zusagen 7 3 r l 0 / l l , zusagete 63v20, zusagit 7v 129, 33vl6, 47r22, zusait 36v3, 45r28. zervüren
zweien sw.V. 1. 'teilen, trennen': Der herre enmus des mannes gut nicht zcweien 7vll5, zcweien 65r29, 70r5, zweien 13v26, 55r31; 2. 'streiten, sich entzweien': Ab zwei dorf sich zcweien umme margscheidunge 8rll3, zcweien 79v5; 3. 'sich unterscheiden': noch sal ich uch dri lenunge bescheiden unde sagen, wo si zcweien von gemeineme lenrechte 79vl3, zcweiet 79v7, zweiet 28v7. -> enzweien; gezweit 2; ungezweit 2 zweiunge st. F. 1. 'Entzweiung, Uneinigkeit, Streit': Welche gewere man nicht bescheiden enmag durch di zcweiunge der ummesessen ..., so sal man di sachwalden heisen sweren, das si wisen nach rechte sulch len alse ir si 73r7; 2. 'Halbbürtigkeit, Verschiedenheit eines Elternteils': In des halsis glide ire kindere, di an zcweiunge von vatir unde von mutir geborn sin llrlO, zcweiunge 1 Irl 1/12. Lexer III, Sp. 1208; Grimm, DWB 16, Sp. 1079f. -» gezweit 1; ungezweit 1
Namenregister Friedrich Scheele Aachen, Pfalz: Swen der gewiet wirt von den bischoven, di da zu gesazt sin, unde zu Ache uf den stul kumt, so hat he kunigliche gewalt 49r21.
enphet erbe in dem lande zu Sachsin noch des landes rechte unde nicht noch des mannes rechte, he si Beier oder Swab oder Franke 18r27.
Abraham: Nu is uns kundig von der heiligen schrift, das an Adame di erste weit began. An Noe di andere. An Abrahame di dritte 10v21/22.
Böhmen, 1. König von: Der schenke des riches, der kunig von Bemen 51r6; 2. Land: Alle, di aber in osterhalp der Sale belent sin, di suln dinen zu Wenden, zu Bemen unde zu Polen 59v27.
Adam: Nu is uns kundig von der heiligen schrift, das an Adame di erste weit began 10v20, Des suntagis worde wir vorsunet mit gote umme Adams missetat 41v3. Afrika: Kam besas Affricam
46v26/27.
Alexander der Große: Den vorsigete Allexander unde kerte das riche an Kriche 47vl, di waren in Allexanders her gewest 47v7, Allexander 47v9.
Biesenrode, Landgrafen von: . . . unde di von Besenrode ..., disse sint alle geboren Swabin 4rl8. Blankenburg, Landgrafen von: Di lantgreven von Düringen sin Vranken, unde di von Regenstein unde von Blankenburg 4rll.
Alstedt, Pfalz: Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen in dem lande, da der kunig echte hove haben sal. Di erste is Gruna. Di andere Werle, di ist zu Gosler geleit, Walhusen is di dritte, Alstete di vierde 52rl.
Brandenburg, 1. Markgrafen von: . . . unde di von Brandinburg ..., dise vorsten sin alle Swabin 3vrl9, ... der markgreve von Brandenburg 60r8/9; 2. Markgrafschaft: ... di marke zu Brandenburg 52r4; 3. Bischof von: Dem von Meideburg is undirtan der bischof von Nuwenburg ... unde der von Brandenburg 52rl 1.
Altenhausen, Landgrafen von: . . . unde di von husen sint Swabin 4rl6.
Braunschweig, Landgrafen von: Di lantgreven ... von Brunswig 4rl4.
Die
Brehna, Markgrafen von: . . . unde di markgreven Missene unde di von Bren 3vr21.
von
Anhalt, Fürst von: Der von Anehalt
Alden-
3vrl8.
Arnstein, Landgrafen von: Unde di von Werningenrode unde di von Arnstein ..., disse sint alle gebome Swabin 4rl 7. Aschersleben, Grafschaft: Siben vanlen sin ouch in deme lande zu Sachsen:..., di graveschaft zu Asschirsleve 52r7. Asien: Sem bleip in Asia 46v27, Mit irre helfe hatte he betwungen al Asiam 47v8/9.
Bremen, Erzbischof von: Deme erzbischove von Bremen is undirtan der von Lubeke 52rl9. Calefurnia: Das vorlos in allen Calefomia, di vor deme riche missebarte von czorne, da ir wille an vorsprechen nicht muste vorgen 40vl6/17.
Babylon: Czu Babilonie irhub sich das riche 6rr30, Babilonie 47r35.
Cyrus: Zu Babilonie irhup sich das riche, das was gewaldig über alle lant, da zuvorte is Zyrus unde wandilte das riche in Persiam 47r37.
(Sankt) Bartholomeustag, 24. August: In Sente Bartholomeustage is allerhande zins unde phlege vordinet 39r22/23.
Darius III.: ... da zuvorte is Zyrus unde wandilte das riche in Persiam; da stunt is bis an Darium den lezten 47r38.
Bayern, 1. Königreich: Sachsen, Beiern waren kunigriche 6vl8, Beiern 49v6; 2. der Bayer: Ein iclich inkumen man
David: Origines wissaite hi vor, das sechs werlde solden sin, .... An Davide di vunfte 10v23.
328
Namenregister
Deutsch(en), 1. der/die Deutsche(n): Di duzchen sullen den kunig kisen 6vl6, Swo der duzche man sinen lip oder sine hant vorwirket mit ungerichte 48v30, duzch 51r7, 54v29, duzchen 49rl8, 60r2; 2. in deutschen Landen: Gebuit der kunig des riches dinst oder sinen hof..., den sullen si suchen binnen duzcher art 52v9/10, duzche art 78vl5/16, binnen duzchir zungen 59v25.
tumvoit von Halbirstat..., 4rll0.
Dobin, Herren von: ... unde di von Obin, disse sint alle geborne Swabin 4rl 11.
Havelberg, Bischof von: Dem von Meideburg is undirtan der bischof... von Havelberg 52rl2.
Dröbel, Herren von: Under des riches schephen sin SWaben di von Tubule 3vr25.
Heinrich VI., Kaiser: Wir sezcen unde gebiten, das alle di zcolle, di von unses vater gezciten keiser Heinriches sint gesezcet uf wassere oder uf lande, das di abe sin 2rl2/3, des keiser Heinriches gezciten 2rrl0.
Elsdorf, Herren von: Under des riches schephen sin Swaben ..., di von Edeleresdorf 3vr25. Einersieben, Herren von: ... unde di von Emersleve ..., disse sint alle geborne Swabin 4rl8. Esaù: So sait man ouch, is queme von Esaù 46v33, Esaù 46v35. Europa: Jafet, unsere vordere, besazte Europam 46v28. Franken, 1. Königreich: Sachsen, Beiern unde Vranken unde Swaben, das waren allis konigriche 49v6; 2. der/die Franke(n): Di lantgreven von Düringen sin Vranken 3vr32, . . . unde di von Druzke unde di von Kotebus, di sint alle Vranken 4rl3, Vranke 50rl4, Franke 18r2 7. Gersleben -» Schrapen Giebichenstein, Burggrafen von: ... unde di burcgreven von Gevekenstein ..., disse sint alle geborne Swabin 4rl9.
disse sint alle geborne
Swabin
Ham: Ouch sait man, das eigenschaft queme von Noe sone 46v24, Kam besas Affricam 46v26.
Kamme,
Harz, Bannforst: ... dis heisen banvursten. ..., di andere der Harcz 40r25.
Hildesheim, Bischof von: Der bischof von Mencze hat vier undirtanen zu Sachsen in dem lande, ... den von Hildensheim 52rl4. Holstein, Landschaft: Der gegenote is doch gnug binnen deme herzogetume, di sundirlich recht wollen haben, alse Holtsessin 52vl8. Isaak: Wi mochte da Noe oder Isaac einen andern zu eigene gegeben, sint sich selbe nimant zu eigen gegeben mag 47r3. Ismahel: Man sait ouch, eigenschaft queme von Ismahele 46v30, Ismahele 46v30/31. Jakob: Jacob wart geseint von sineme vatere unde hies en herre wesin bobin sime brudere Esau 46v33. Japhet: Jafet, unse vordere, besazte Europam 46v27.
Gneiz, Herren von: Under den vrien herren sin Swaben ... di von Gnercz 3vr23.
Jerdingshof, Anno von: Under des riches schephen sin ..., Anne von Irkesdorf 3vr29.
Goslar, Pfalz: Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen in deme lande, ... di ist zu Goslergeleit 51v34.
(Sankt) Johannstag, 24. Juni: In Sente Johanstage allerhande vleischzende 39r26.
Griechen(land): ...da stunt is bis an Darium den lezten. Den vorsigete Allexander unde kerte das riche an Kriche 47vl/2.
Josephus, röm. Geschichtsschreiber: Disen vride irwarp ein jude, der his Josaphus 43v22/23.
Grone, Pfalz: Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen in deme lande, ... Die erste is Gruna 51v33. Hadeln, Landschaft: Der gegenote is doch gnug deme herzogetume, ... unde Hedelere 52vl8.
binnen
Hakeborn, Herren von: Under den vrien herren sin Swaben di von Hakenburne 3vr23. Halberstadt, 1. Bischof von: Der bischof von Mencze hat vier undirtanen zu Sachsen in dem lande, den bischof von Halberstat... 52rl4; 2. Domvogt von: ... unde der
Julius Caesar: Da stunt is so lange, bis is sich Rome undirwant unde Julius keiser wart 47v3. Kain: Doch sagen sumeliche lute, di der warheit irre gen, das sich eigenschaft irhube an Kaine, der sinen bruder irslug 46v21, Kains geschlechte wart vortiliget, da di werlt mit wassere zuging 46v22. Karl der Große: Von den rechtin wider Karies willen 4vl20, ... nu halde wir sine e unde sin gebot, das uns sine wissagin gelart habin unde gute geistliche lute unde ouch cristine kunige habin gesaczt, Constantin unde Karle
Namenregister
329
9v34, Drierhande recht behilden di Sachsin widir Karies willen 14v29. Koine, Bannforst: ... dis heisen banvursten. das is di heide zu Koine 40r25.
kunig
Das eine,
Klöden, Landgrafen von: Di lantgreven ... von Clodene 4rl2. Köln, Erzbischof von: In des keisers kore sal der erste sin der bischof von Menze, der andere von Triere, der dritte von Koine 50v28, . . . sint undirtan dem von Koine 52rl7, Koine 60r6. Konstantin der Große: Constantin gap dem babiste Silvestre 6vl23, ... nu halde wir sine e unde sin gebot, das uns ... ouch cristine kunige habin gesaczt, Constantin unde Karle 9v34, Constantin 52r21. Kottbus, Burggrafen von: ... unde di burcgreven von Vinni unde di von Clodene unde di von Druzke unde di von Kotebus 4rl3. Krautweihfest, Fest der Maria Himmelfahrt (15. August): ...zu wurzmesse der gensezende 39r25. Krosick, Burggrafen von: . . . unde di burcgreven ... von Druzke 4rl2/3. Lausitz, Markgrafschaft: . . . di marke zu Lusiz 52r6. Lichtenberg, Herren von: ... unde di von Lichtenberg unde di von Obin, disse sint alle geborne Swabin 4rl 10/11. Lichtmeß, 2. Februar: Wil ein herre wisen sinen zinsman von sime gute, der zu deme gute nicht geborn is, das sal he im kundigen zu Lichtemesse 39v24. Lüneburg, Herzöge von: ... unde di von Lüneburg ... sint Swabin 4rl4, Di herczogen von Lüneburg unde sin gesiechte sint alle geborne Sachsin* 4rll2. Lübeck, Bischof von: Deme erzbischove von Bremen is undirtan der von Lubeke 52rl9. Magdeburg, 1. Erzbischof von: Dem von Meideburg is
undirtan der bischof von Nuwenburg ... 52r9; 2. Wichmann, Erzbischof von: Dis selbe recht bilden ouch di dinstman bis an den bischof Wichman von Meideburg 54vl8/19. Mainz, Erzbischof von: In des keisers kore sal der erste sin der bischof von Menze 50v27, Der bischof von Mencze hat vier undirtanen zu Sachsen 52rl2, Menzce 60r6. (Sankt) Margaretentag, 13. Juli: In Sente Margaritentage alle ander kornzende 39r29. (Sankt) Martinstag, 11. November: Iclichen hof unde worte unde sundirlich hus vorzendit man mit eime hune an Sente Mertinstage 37v4. Mehringen, Hermann von: Under des riches schephen sin Swaben ..., Herman von Meringe 3vr29. Meißen, 1. Markgrafen von: ... unde di markgreven von Missene 3vr20; 2. Markgrafschaft: ... di marke zu Misne 52r6; 3. Bischof von: Dem von Meideburg is undirtan ... der von Misne 52rl 1. Merseburg, Bischof von: Dem von Meideburg is undirtan der bischof von Nuwenburg unde der von Merseburg 52rl0. Minden, Bischof von: Der bischof von Osenbrucke unde der von Minden unde der von Munstre sint undirtan dem von Koine 52rl7. Moses: Origines wissaite hi vor, das sechs werlde solden sin, di werlt bi tusent jaren ufgenumen, in deme sibinden solde si czugen. ... An Moisi di vierde 10v22. Mosigkau, Bannforst: ... dis heisen banvursten dritte di Magitheide 40r26.
...
di
Mücheln, Herren von: Under den vrien herren sin Swaben ... di von Mochele 3vr24. Münster, Bischof von: . . . unde der von Munstre undirtan dem von Koine 52rl7.
sint
Naumburg, Bischof von: Dem von Meideburg is undirtan der bischof von Nuwenburg ... 52rl0. *
Lesart nach W fol. 4rll2: Di herzcogen von Limborch ...; vgl. hierzu Lieberwirth, Sachsenspiegelvorrede, S. 17: „Es beeindruckt doch sehr, wie eng der Verfasser dieser Vorrede mit den Familienverhältnissen der schwäbischen, fränkischen, nordschwäbischen und sächsischen Adelsgeschlechter vertraut war, obwohl ihm mit der Einordnung des Herzogs von Lüneburg und seinem Geschlecht in die Gruppe der gebornen Sachsen möglicherweise eine Ungenauigkeit unterlaufen war."
Noah: Origines wissaite hi vor, das sechs werlde solden sin, di werlt bi tusent jaren ufgenumen, in deme sibinden solde si czugen .... An Noe di andere 10v21, Ouch sait man, das eigenschaft queme von Kamme, Noe sone 46v24, Noe 46v25, 47r3. Origines: Origines wissaite hi vor, das sechs werlde solden sin 10vl6.
330
Namenregister
Orlamünde, Markgrafen von: Der von Anehalt unde di von Brandinburg unde di von Orlamünde 3vrl9/20. Osnabrück, Bischof von: Der bischof von Osenbrucke Kolne unde der von Minden ... sint undirtan dem von 52rl6. Osterburg, Herren von: ... unde di von sint Swabin 4rl5.
Ostirburg
...
Paderborn, Bischof von: Der bischof von Mencze vier undirtanen zu Sachsen in dem lande ..., den Padilburne 52rl5/16.
hat von
Persien: . . d a zuvorte in Persiam 47r37.
is Zyrus unde wandilte
das
riche
Petrus, Apostel: Noch hat Rome das werbliche swert unde von Sente Petirs halben das geistliche, da von heist si houbet allir werlde 47v4. Polen: Alle, di aber in osterhalp der Sale belent sin, di suln dinen zu Wenden, zu Bemen unde zu Polen 59v27a. Poppenburg, Herren von: unde di von Poppenburg sint Swabin 4rl6.
...
Preußen: ... unde schiften mit drinhundirt kielin. Di vorturbin alle bis uf vierundevunfzig, der quamen ächzen zu Prusen ... 47vl3. Ratzeburg, Bischof von: Derne erzbischove is undirtan ... der von Ratisburg 52r20.
von
Bremen
Regenstein, Landgrafen von: Di lantgreven von Düringen sin Vranken, unde di von Regenstein ... 3vr32. Rhein, Pfalzgraf von: Undir den leien is der erste an der kore derphalenzgreve von deme Rine 51r2, ... der phalenzgreve von deme Rine 60r7. Rom, Rome 47v4; unde 49v9.
1. Weltreich/Stadt: Da stunt is so lange, bis sich undirwant unde Julius keiser wart 47v2, Rome 2. die Römer: ... sider wandilte man en di namen heist si herzogen, sider si di Romere betwungen
Rügen, Insel: ... unde schiften mit drinhundirt kielin. Di vorturbin alle bis uf vierundevunfzig, ... zwelve besasin Ruian 47vl4. Saale, Fluß: Alle, di aber in osterhalp 59v2 7.
der Sale belent
sin
Sachsen, 1. Land: Nu vomemet umme der herren geburt von deme lande zcu Sachsen 3vrl8, ... dar zu alle di vri herren unde schephin, di zu Sachsen sint wonhaft 4rll4/15, Sachsen 4rll8, 40r21/22, 51v32, 52r3/4,
52r8, Sachsin 15r2, 18r25, 24r2, Sachsenlande 41rl4, Sachsinlande 9v35; 2. Königreich: Sachsen, Beiern unde Vranken unde Swaben, das waren allis konigriche 49v6, Sachsen 6vl8; 3. Herzog von: ... der marschalk, der herzöge von Sachsin 51r3, der herzöge von Sachsen 60r8; 4. der/die Sachse(n): Di herczogen von Lüneburg unde sin gesiechte sint alle geborne Sachsin 4rll3, Das ich recht unde unrecht der Sachsen bescheide 9v5, Sachse 15r2, 18rl9/20, 28vl4, 28v33, 54rl8, 54rl9, 54r21, Sachsen 4rll9, 14vl8, 28v33, Sachsin 14v28, 54rl8, 54r22/23. Seedorf, Herren von: Under des riches schephen ben ... di von Sedorf 3vr30.
sin
Swa-
Sem: Sem bleip in Asia 46v27. Silvester I., Papst: Constantin gap dem babiste 6vl23, ... deme babiste Silvestre 52r22.
Silvestre
Spandau, Vogt Albrecht von: Under des riches sin Swaben ..., der voit Albrecht von Spandouwe
schephen 3vr26.
Stormarn, Landschaft: Der gegenote is doch gnug binnen deme herzogetume, di sunderlich recht wollen haben, alse Holtsessin unde Stormere ... 52vl8. Suselitz, Herren von: ... unde di von Suselicz sint alle geborne Swabin 4rll0.
...,
disse
Schneidlingen, 1. Heinrich Judas von: Under des riches schephen sin Swaben ..., Heinrich Judas von Snetlinge 3vr25/26; 2. Alberich und Konrad von: ... unde Alverig unde Cunrat von Snetlinge 3vr27. Schrapen, Junker von Gersleben: Under des riches schephen ..., unde Strapen, kint von Jersleve, ... di sint alle Swabin 3vr28. Schwaben, 1. Land: Di Swabin scheidin wol urteil under en selbe binnen swebischer art unde zcien des an di eldem Swabe 15rl8; 2. Königreich: Sachsen, Beiern unde 49v6; Vranken unde Swaben, das waren allis konigriche 3. der/die Schwabe(n): Der von Anehalt unde di von Brandinburg ..., dise vorsten sin alle Swabin 3vr21/22, Under den vrien herren sin Swaben 3vr22, Swabe 14v24, 15r9, 18r22, 28v33, Swaben 3vr24, 4vll9, Swabin 3vr31, 4rl6, 4rll2, 15rl6, Swab 18r27. Schwerin, Bischof von: Deme erzbischove is undertan ..., der von Zwerin 52r20.
von
Bremen
Thüringen, 1. Landgrafen von: Di lantgreven von Düringen sin Vranken 3vr32, Doringe 47v7, di doringeschen herren 47vl6/17; 2. Landgrafschaft: ... di lantgraveschaft zu Doringen 52r5. Titus, Sohn des Kaisers Vespasian: ... wider den
kunig
Namenregister
331
Vespesianum, da he sinen son Titum gesunt machte von der gicht 43v24. Trier, Erzbischof von: In des keisers kore sal der erste sin der bischof von Menze, der andere von Triere 50v28, ... der bischof..., von Trire 60r6. (Sankt) Urbanustag, 25. Mai: In Sente Urbanustage sint wingarten unde boumgarten vordint 39r31/32, Sente Urbanustag 39vl0. Verden, Bischof von: Der bischof von Mencze hat vier undirtanen zu Sachsen in deme lande, ... den von Werdin 52rl5. Vespasian, Kaiser: Disen vride irwarp ein jude, der his Josaphus, wider den kunig Vespesianum 43v23. Wettin, Burggrafen von: . . . unde di burcgreven Vinni ..., di sint alle Vranken 4rl2.
Wenden, 1. Land: Alle, di aber in osterhalp der Sale belent sin, di suln dinen zu Wenden, zu Bemen unde zu Polen 59v27; 2. der/die Wende(n/-innen): Swo man nicht endinget under kuniges banne, da mus iclich man wol urteil vinden über den andirn, den man rechtelos nicht bescheidin mag, ane der Went uf den Sachsin unde der Sachse uf den Went 54rl8, Went 54rl9, 54r22, 54v30, . . . unde der Wendinnen kint gehöret noch deme vater, ab he ein Went is 54v29, Wendinnen 55r2. Werla, Pfalz: Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen in dem lande, ... Di andere Werle 51v34. Wernigerode, Herren von: Unde di von Werningenrode unde ..disse sint alle geborne Swabin 4rl7. Wichmann
Magedeburg
von
Wallhausen, Pfalz: Vunf stete, di phalzen heisen, ligen zu Sachsen ..., Walhusen is di dritte 51v34. (Sankt) Walpurgistag, 1. Mai: In Sente Walpurgetage is der lemmerzende vordinet 39r24.
Winningen, Heidolfs Kinder von: Under des riches schephen sin Swaben ..., Heidolves kindere von Winninge 3vr30. Wurzmesse Zyrus -» Cyrus
Krautweihfest
Synopse Überblick über die in den Bilderhandschriften illustrierten Textstellen des Sachsenspiegels Rolf Lieberwirth Textstelle
O
H
6r 1, 6v 2 I, 1 I, 2 § 1 § 2 § 3 § 4 I, 3 § 1 § 2 § 3 Forts. I, 4 I, 5 § 1 Forts. § 2 Forts. § 3 I, 6 § 1,2 § 3,4 § 5 I, 7 I, 8 § 1, 2 § 3 I, 9 § 1 §2 Forts. § § § §
3 4 5 6
I, 10 Forts. 1,11 Forts. I, 12 Forts.
7r 7r 7r 7r 7v 7v 8r 8r 8r 9v
1,2 3 4 5 1-4 4,5 1,2 3 4, 9v 1 2
9v lOr lOr lOr lOv lOv lOv lOv llr llr llr llv llv llv llv 12r 12r 12r 12r 12r 12v 12v
3 1 2,3 4 1 2 4 5 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 + 3
D 3v 4r 4r 4r 4r 4v 4v 4v 5r 5v 5v 5v 5v 5v 6r 6r 6r 6r 6r 6v 6v 6v 6v 6v 7r 7r 7r 7r 7r 7r 7v 7v 7v 7v 7v
W 1-4 1,2 3,4 5 6 1 2-4 5,6 1,2,3 1 2,3 4 5 6 1 2,3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 21 2 r 3 4
9v lOr lOr lOr lOr lOv lOv lOv llr llv llv llv llv llv 12r 12r 12r 12r 12r 12v 12v 12v 12v 12v 13r 13r 13r 13r 13r 13r 13v 13v 13v 13v 13v
1-4 1,2 3,4 5 6 1 2-4 5,6 1,2,3 1 2,3 4 5 6 1 2,3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 21 2 r 3 4
Rolf Lieberwirth
334 O
Textstelle I, 13 § 1 § 2 I, 14 § 1
1,15 I, 16 I, 17
I, 18 I, 19
§ 2 Forts. §1 §2 §1 § 2 §1 Forts. § 2 § 1-3 §1
§ 2 I, 20 § 1 § 2 § 3 § 4 3 •> § 6 § 7 § 8 sfr yQ 1,21 § 1 § 2 I, 22 § 1 § 2 Forts. Forts. § § I, 22 § I, 23 §
3 4 5 1
§ 2 Forts. 1,24 § 1,2 § 3 Forts. s 4 I, 25 § 1 § 2 § 3 § 4 fr i; I, 26 I, 27 § 1 § 2 Forts.
H
D
W
7v 8r 8r 8r 8r 8r
5 1 2 3 4 5
13v 14r 14r 14r 14r 14r
5 1 2 3 4 5
14r 1 14r 2 14v 1 14v 2 14v 3 15r 1 15r 2 15v 1 15v 2 15v 3,4 16r 1 16r 2 16r 3
8v 8v 8v 8v 8v 9r 9r 9r 9r 9r 9v 9v
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
14v 14v 14v 14v 14v 15r 15r 15r 15r 15r 15v 15v
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
16v 1 16v 2
9v 3 9v 4
12v 13r 13r 13v 13v
4 1 2 + 3 1 2
15v 3 15v 4
17r 1 17r 2,3 17v 1 17v 2 17v 3 17v 4,5 18r 1 18r 2,3 18v 1 18v 2 18v 3 19r 1 19r 2 19r 3-5 19v 1
9v lOr lOr lOr lOr lOr lOv lOv lOv lOv llr llr llr llr llv
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4-6 1
15v 16r 16r 16r 16r 16r 16v 16v 16v 16v 17r 17r 17r 17r 17v
5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4-6 1
19v 1 19v 2 19v 3 20r 1
llv llv llv llv
2 3 4 5
17v 17v 17v 17v
2 3 4 5
20r 2 20r 3 20v 1
llv 6 llv 7 12r 1
fr A
17v 6 17v 7 18r 1
335
Synapse Textstelle I, I, I, I,
O 28 29 30 31 § l , S a t z 1 Satz 2 § 2
I, 32 I, 33 Forts. I, 34 § 1 §2 § 3 I, 35 § 1 S l I, 36 I, 37 I, 38 § 1 §2 Forts. I, 38 § 3 I, 39 I, 40 1,41 I, 42 § 1 § 2 I, 43 I, 44 I, 45 § 1 § 2 I, 46 I, 47 § 1 §2 I, 48 § 1 §2 § 3 I, 49 I, 50 § 1 § 2 1,51 § 1 Forts. § 1,2 Forts. Forts. § 2,3 § 4,5 I, 52 § 1 § 2 S •> % 4
H
D
W
20v 20v 21r 21r 21r 21r 21v 21v 22r 22r 22r 22r 22v
2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1,2
12r 12r 12r 12r 12r 12v 12v 12v 12v 12v 13r 13r 13r
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 r
18r 18r 18r 18r 18r 18v 18v 18v 18v 18v 19r 19r 19r
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3
22v 22v 23r 23r 23r 23v 23v 23v 24r 24r 24v 24v 24v 24v 25r 25r 25r
3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
13r 13r 13r 13v
31 4 5 1
19r 19r 19r 19v
3 4 5 1
13v 13v 13v 13v
2 3 4 5
19v 19v 19v 19v
2 3 4 5
14r 14r 14r 14r 14v 14v 14v
1 2 3 4 1 2 3
20r 20r 20r 20r 20v 20v 20v
1 2 3 4 1 2 3
25v 25v 26r 26r
1 2 1 2
14v 14v 15r 15r
4 5 2 1
20v 20v 21r 21r
4 5 2 1
26v 26v 26v 26v 27r 27r 27r 27v 2 7v
1 2 3 4 1 2 3 1,2 3
15r 15r 15r 15v 15v 15v 15v 15v 16r
3 4 5 1 2 3 4 5,6 1
21r 21r 21r 21v 21v 21v 21v 21v 22r
3 4 5 1 2 3 4 5,6 1
28r 1
16r 2
22r 2
Rolf
336 O
Textstelle Forts. I, 53 § 1 Xl % 3 § 4 1,54 § 1,2 I, 54 § 3 § 4 § 5 1,55, 56 I, 57 I, 58 § 1 §2 Forts. I, 59 § 1 Forts. § 2 I, 60 § 1 § 2 I, 61 § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 I, 62 § 1 §2 § 3 §4 § 5 § 6 § 7 K 88 S
§ 9 § io § 11 I, 63 § 1 Forts. Forts. Forts. §2 § 3 I, 63 § 3 Forts. § 4 Forts. Forts. Forts. § 5 Forts. I, 64
H
Lieberwirth
D
W
28r 2 28r 3
16r 3 16r 4
22r 3 22r 4
28v 28v 29r 29r 29v 29v 29v 30r
1 2 1 2 1 2 3 1
16r 16v 16v 16v 16v 16v 17r 17r
5 1 2 3 4 5,6 1 2
22r 22v 22v 22v 22v 22v 23r 23r
5 1 2 3 4 5,6 1 2
30r 30r 30v 30v 30v
2 3 1 2 3
17r 17r 17r 17v 17v
3 4 5 1 2
23r 23r 23r 23v 23v
3 4 5 1 2
31r 1 zusammen mit I, 62 § 1 (s. d.) 31r 2 31v 1 31v 2 31v 3 32r 1
17v 3
23v 3
17v 4 18r 1 18r 2
23v 4 24r 1 24r 2
32r 2
18r 3 18r 4 18r 5
24r 3 24r 4 24r 5
32r 3
18v 1
24v 1
32v 1
18v 2
24v 2
32v 32v 33r 33r 33r 33v 33v 33v 34r 34r 34v 34v 34v 35r 35r
18v 18v 19r 19r 19r 19r 19r 19v 19v 19v 19v 20r 20r 20r 20r
24v 24v 25r 25r 25r 25r 25r 25v 25v 25v 25v 26r 26r 26r 26r
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2
3 4 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4 1 2 3 4
3 4 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4 1 2 3 4
337
Synapse O
Textstelle
H
D
W
I, 65 § 1 § § § I, 66 §
2 3 4 1
§ 2 § 3 I, 67 § 1 Forts. §2 I, 68 § 1
35v 35v 35v 36r
1 2 3 1
20r 20v 20v 20v
5 1 2 3
26r 26v 26v 26v
5 1 2 3
36r 2 36r 3
20v 4 20v 5
26v 4 26v 5
36r 4 36v 1,2
20v 6 21r 1,2
26v 6 27r 1,2
36v 3
21r 3
27r 3
37r 37r 37r 37r 3 7v 37v 3 7v 38r 38r 38r 38r
1 2 3 3,4 1 2 3 1 2 3 4,5
21r 21r 21r 21v 21v 21v
4 5 6 1,2 3 4
27r 27r 27r 27v 27v 27v
21v 22r 22r 22r
5,6 1 2 3
27v 5,6
38v 38v 39r 39r 40r 39r 39r 39v 39v
1 2 1 2 1 3 4 1 2
22r 4 22r 5 22v 23r 22v 22v 22v 22v
1 3 2 3 4 5
II, 7 II, 8 II, 9 § 1,2
39v 39v 40r 40r
3 4,5 2 3
22v 23r 23r 23r
6 1,2 4 5
§ 3 II, 10 § 1
40v 1
23v 1
40v 40v 41r 41r 41v
23v 2 23v 3
§ § § §
2 3 4 5
I, 69 I, 70 § 1 Forts. § 2 Forts. § 3 Forts. 1,71 I, 71 Forts. II, 1 II, 2 II, 3 § 1 § 2,3 II, 4 § 1
II,
§ 2 § 3 5 § 1
§ 2 Forts. II, 6 § 1,2 § 3 § 4
§ 2 § 3 § 4 11,11 § 1 §2 § 3
2 3,4 1 2 1
23v 4 23v 5
4 5 6 1,2 3 4
338
Rolf
Textstelle
O § 4 12 § 1 § 2 § 3 § 4 Forts. Forts. § § § § § § § § 12 §
5 6 7 « 9,10 H 12 13 13 Forts.
§ 14 § 15 13 § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 8 ft S Ö 14 § 1 Forts. Forts. § 2 15 § 1 Forts. §2 16 § 1 § § § § § § § 17 § 18 §
2 3 4 5,6 7 8 9 1,2 1
§ 2 19 § 1 § 2 20 § 1 Forts. § 2
H
Lieberwirth
D
W
41v 2 41v 2
24r 1 24r 1
28r 1 28r 1
41v 41v 42r 42r 42r
24r 24r 24r 24r 24v
28r 28r 28r 28r 28v
3 4 1,2 3 4
2 3 4 5,6 1
2 3 4 5,6 1
42v 1 42v 2 43r 1
24v 2 24v 3 24v 4
28v 2 28v 3 28v 4
43r 2 43r 3 43r 4
24v 5 25r 1 25r 2
28v 5 29r 1 29r 2
43v 1 43v 2
25r 3
29r 3
43v 3 44r 1 44r 3,4
25r 4 25r 5,6 25v 1
29r 4 29r 5,6 29v 1
44r 5,6
25v 2
29v 2
44v 1 44v 2 44v 3
25v 3 25v 4 25v 5
29v 3 29v 4 29v 5
45r 1 45r 2
26r 1 26r 2
30r 1 30r 2
45r 3
26r 3
30r 3
45r 45v 45v 45v
26r 26r 26v 26v
30r 30r 30v 30v
4 1 2 2
4 5,6 1 2
4 5,6 1 2
45v 3 46r 1
26v 3 26v 4
30v 3 30v 4
46r 46r 46r 46r
26v 26v 27r 27r
30v 30v 31r 31r
2 3 4 5
7r 1 7r 2
5 6 1 2
5 6 1 2
339
Synopse
O
Textstelle
H
D
W
11,21 § 1 §2 11,21 § 3 Forts.
46v 1
7r 3
27r 3
31r 3
46v 2
7r 4
27r 4
31r 4
§ 4 § 5 II, 22 § 1
46v 3
7r 5
27r 5
31r 5
47r 1
7v 1
2 7v 1
31v 1
§ 2 § 3 §4
47r 2 47r 3
7v 2 7v 3
2 7v 2 2 7v 3
31v 2 31v 3
47v 1
7v 4
2 7v 4
31v 4
§ 5
7v 5
II, 23
47v 2 47v 3
27v 5 28r 1
31v 5 32r 1
II, 24 § 1
47v 4
28r 2 28r 3
32r 2 32r 3
28r 4 28r 5
32r 4 32r 5
§ 2 Forts. II, 25 § 1 § 2 II, 26 § 1 § 2 § 3,4 49r 1 § 5,6 II, 27 § 1 § 2 § 3,4
48r 1 48r 2 48r 3 48v 1
28v 1
32v 1
48v 2 48v 3
28v 2 28v 3
32v 2 32v 3
48v 4
28v 4
32v 4
49r 2
28v 5
49r 3
29r 1 29r 2 29r 3
32v 5 33r 1 33r 2 33r 3
29r 4
33r 4
§ 2
49r 4,5 49v 1 49v 2
§ 3 II, 29 11,30 5
49v 3 50r 1,2 Or 3
29r 5
33r 5,6
29v 1,2 29v 3
33v 1,2 33v 3
11,31 § 1,2
II, 28 § 1
50r 4
29v 4
33v 4
§ 3 1 K1 S
50r 5
29v 5
33v 5
II, 32 § 2
52v 2
35r 6
II, 33 II, 34 § 1
52v 3 50v 1
35v 1 34r 1
§2 II, 35 11,36 § 1,2
50v 2
34r 2
50v 3
34r 3
50v 4
34r 4 34r 5
§ 3
§ 2 § 3 § 4 § 5,6 II, 37 § 1 Forts.
51r 1 51r 2 51v 1
34v 1
51v 2,3 52r 1
34v 2-4
52r 2
35r 2
52r 3
35r 3
35r 1
§ 2 § 3 II, 38
340
Rolf O
Textstelle 1 §2 II, 40 § 1 § 2 § 3 II, 39
11,41 II, 42
II, 43 II, 44
§ § § § § § § § § §
11,45 II, 46 § § § § II, 47 § § §
4 5 1 2 13 4 1, 1 2
1 2 3 4 1,2 3 4
11,48 § 1 § 2,3 § 4 § 5 § 6 § 7,8 §9 § 10 § H § 12 Forts. II, 49 § 1,2 II, 50 11,51 § 1 § 2 § 3 II, 52 § 1,2 II, 53 II, 54 § 1
II, 55
§ 2 § 3,4 § 5 §6
H
D
Lieberwirth W
52r 52v 52v 53r
4 1 4 1
35r 35r 35v 35v
4 5 2 3
53r 53r 53v 53v
2 3 1 2
30r 1 30r 2
35v 35v 36r 36r
4 5,6 1 2
53v 54r 54r 54r
3 1,2 3 4
30r 30r 30v 30v
36r 36r 36v 36v
3 4,5 1 2
3 4,5 1 2
54v 1 54v 2 54v 3,4
30v 3 30v 4 30v 5
36v 3 36v 4 36v 5
55r 55r 55r 55r 55v 55v 55v 55v 55v 55v
31r 31r 31r 31r
1 2 3 4
37r 37r 37r 37r
31r 31r 31r 31v 31v
5 6 7 1 2
37r 5 37r 6 37r 7 3 7v 1 37v 2
55v 7
31v 3
37v 3
56r 56r 56r 56v
8r 1 8r 2
31v 31v 32r 32r
3 7v 4 37v 5,6 38r 1 38r 2
56v 2,3
8r 3
32r 3
38r 3
57r 1
8r 4
32r 4
38r 4
57r 2 57r 3
8r 5,6 8v 1
57v 1,2 5 7v 3
8v 2,3 8v 4
32r 32v 32v 32v 32v
38r 38v 38v 38v 38v
1 2 3 4,5 1 2 3 4 5 6
1 2 3 1
4 5,6 1 2
5,6 1 2 3 4
1 2 3 4
5,6 1 2 3 4
341
Synopse H
O
:lle II, 56 § 1
D
W
58r 1
9r 1
33r 1
39r 1
58r 2 58v 1
9r 2 9r 3
33r 2 33r 3
39r 2 39r 3
58v 59r 59r 59r 59r 59v
2 ff 1 2 3 4 1,2
9r 9v 9v 9v 9v 9v
4-10 1 2 3 4 5,6
33r 33v 33v 33v 33v 33v
4-8 1 2 3 4 5,6
39r 39v 39v 39v 39v 39v
4-8 1 2 3 4 5,6
59v 59v 60r 60r 60r 60v 60v 60v 60v 61r 61r 61r 61v 61v 62r 62r 62v 62v 62v
3 4,5 1 2 3 1 2 3 4 1,2 3 4 1,2 3,4 1,2 3 1 2 3
lOr lOr lOr lOr lOr lOv lOv lOv lOv lOv llr llr llr llr
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3,4 5,6
34r 1 34r 2 34r 3 34r 4 34r 5 34v 1 34v 2 34v 3 34v 4 34v 5 35r 1 35r2 35r 3,4 35r 5,6
40r 40r 40r 40r 40r 40v 40v 40v 40v 40v 41r 41r 41r 41r
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3,4 5,6
11 v llv llv llv
1 2 3 4
35v 35v 35v 35v
41v 41v 41v 41v
1 2 3 4
1
5 § 3 II, 57 II, 58 § 1 § 2 Forts. § 3 II, 59 § 1 § 2 § 3
§ 6 fr 7 S ' § « §9 Forts. Forts. Forts. III, 46 § 1 §2 III, 47 § 1 § 2 III, 48 § 1 § 2 Forts. Forts. § 3 §4 III, III, III, III,
49 50 51 52 § 1 Forts. Forts. § 2
fr
III, 53 § 1 §2 § 3 III, 54 § 1 § 2 III, 54 § 3
%
4
H
D
Lieberwirth W
74v 74v 75r 75r 75r 75r
2 3,4 1 2 3 4
18v 18v 19r 19r 19r 19r
5 r 51 1 2 3 4
42v 42v 43r 43r 43r 43r
5 r 51 1 2 3 4
46v 46v 47r 47r 47r 47r
5 r 51 1 2 3 4
75v 75v 75v 76r 76r 76r
1 2 3,4 1 2 3
19r 19v 19v 19v 19v 19v
5,6 1 2 3 4 5
43r 43v 43v 43v 43v 43v 43v
5 1 2 3 4 5 6
47r 47v 47v 47v 47v 47v 47v
5 1 2 3 4 5 6
76v 1
20r 1
44r 1
48r 1
76v 2
20r 2 1
44r 2 1
48r 2 1
76v 77 r 77r 77r 77r 77r 77r 77r 77v
3,4,5 1 3 2 3 4 5 6 1
77v 77v 77v 77v 77v 78r 78r 78r 78v 78v 78v 79r
3 2 4 r 41 5 1 2 3-7 1-3 4 5 4,5
20r 20r 20r 20r 20r 20r 20v 20v 20v 20v 20v 20v 20v
2 r 3 41 4 r 5 r 51 1 2 3 r 41 31 4 r 5 r
44r 44r 44r 44r 44r 44r 44v 44v 44v 44v 44v 44v 44v
2 r 3 41 4 r 5 r 51 1 2 3 r 41 31 4 r 5 r
48r 48r 48r 48r 48r 48r 48v 48v 48v 48v 48v 48v 48v
2 r 3 41 4 r 5 r 51 1 2 3 r 41 31 4 r 5 r
20v 5 1 20v 6
44v 44v 45r 45r 45r 45r 45v
51 6 1-5 6 7 8 1
48v 48v 49r 49r 49r 49r 49v
51 6 1-5 6 7 8 1
79r 1 79r 2 79r 3
45v 2 45v 3 45v 4
49v 2 49v 3 49v 4
79v 1,2 79v 3
46r 1,2 46r 3
50r 1,2 50r 3
Synopse
345 O
Textstelle III, 55 § 1 § 2 III, 56 § 1
III,
III, HI, III,
§ 2 § 3 Forts. 57 § 1 §2 Forts. Forts. 58 59 § 1,2 60 § 1 Forts. §2
§ 3 III, 61 § 1-3 § 4 III, 62 § 1 § 2 § 3 III, 63 § 1 Forts. § 2 § 3 III, 64 § 1 §2 § 3,4 § 5 Forts. § 6 § 7 III, 64 § 8 § 9 III, 64 § 10 § H III, 65 § 1,2 III, 66 § 1 § 2,3 Forts. §3 § 4 III, 67 III, 68 § 1 K 9 III, 69 § 1 §2 Forts, u. § 3 III, 70 § 1 § 2
H
D
7 9v 4 80r 1 80r 2 80r 3 80r 4 80r 5 80v 1 80v 3 80v 4 80v 5
21r 1 21r 2 21r 3
46r 46r 46v 46v 46v 46v 46v 47r 47r 47r
81r 1 81r 2 81r 3 81r 4 81r 5 81v 1 81v 2 81v 3 81v 4,5 82r 1 82r 2 82r 3 82r 5 82r 4 82v 1 82v 2 82v 3,4 82v 5 83r 1 83r 2 83r 3 r 83r 3 1 83r 4 83r 5 83r 6 83r 7 83v 1,2 83v 2 r 83v 3 83v 4 83v 5 84r 1,2
21r 4 21r 5 21v 1 21v 2 21v 3 21v 4 21v 5 22r 1 22r 2 22r 3 22r 4 22r 5 22v 1 1 22v 1 r 22v 2 22v 3 22v 4 22v 5 r 22v 5 1 6 23r 1 23r 2 r 23r 2 1 23r 3 r 23r 3 1 23r 4 1 23r 4 r 23r 5 23r 6 23v 1 23v 2 23v 3 23v 4,5
47r 4 47r 5 47v 1 47v 2 47v 3 47v 4 47v 5 48r 1 48r 2 48r 3 48r 4 48r 5 48v 1 1 48v 1 r 48v 2 48v 3 48v 4 48v 5 r 48v 5 1 6 49r 1 49r 2 r 49r 2 1 49r 3 r 49r 3 1 49r 4 1 49r 4 r 49r 5 49r 6 49v 1 49v 2 49v 3 49v 4,5
51r 4 51r 5 51v 1 51v 2 51v 3 51v 4 51v 5 52r 1 52r 2 52r 3 52r 4 52r 5 52v 1 1 52v 1 r 52v 2 52v 3 52v 4 52v 5 r 52v 5 1 6 53r 1 53r 2 r 53r 2 1 53r 3 r 53r 3 1 53r 4 1 53r 4 r 53r 5 53r 6 53v 1 53v 2 53v 3 53v 4,5
84r 84r 84r 84v 84v
24r 24r 24r 24r 24r
50r 50r 50r 50r 50r
54r 54r 54r 54r 54r
3 4 5 1 2
1 2 3 4 5
W 4 5 1 2 3 4 5,6 1 2 3
1 2 3 4 5
50r 50r 50v 50v 50v 50v 50v 51r
4 5 1 2 3 4 5,6 1
51r 3
1 2 3 4 5
346
Rolf Lieberwirth
Textstelle
H
O
III, 71 § 1 § 2 III, 72 III, 73 § 1 § 2 Forts. § 3 III, 74 III, 75 § 1,2 § 3 III, 76 § 1 § 2 § 3 § 4 III, 77 § 1 §2 III, 78 § 1 § 2 III, 78 § 3 § 4 § 5 §6 § 7 §« § 9 III, 79 § 1 §2 eS> r3 III, 80 § 1 Forts. Forts. § 2 III, 81 § 1 § 2 III, 82 § 1 Forts. § 2 III, 83 § 1 § 2 § 3 III, 84 § 1 § 2 Forts. Forts. § III, 85 § § §
3 1 2 3
D
W
84v 84v 84v 85r 85r 85r 85r 85r 85v
3 4 5 1 2 3 4 5,6 1
24v 24v 24v 24v 24v 25r 25r 25r 25r
1 2 3 4 5 1 2 3 4
50v 50v 50v 50v 50v 51r 51r 51r 51r
1 2 3 4 5 1 2 3 4
54v 54v 54v 54v 54v 55r 55r 55r 55r
1 2 3 4 5 1 2 3 4
85v 85v 85v 85v
2 3 4 5,6
25r 25v 25v 25v
5 1 2 3
51r 51v 51v 51v
5 1 2 3
55r 55v 55v 55v
5 1 2 3
86r 86r 86r 86r 86r 86v 86v 86v 86r 86v 87r 87r 87r
1 2 4 3 5 1 2 3 V 4 5,6 1,2 3 4,5
25v 25v 26r 26r 26r 26r 26r 26r 26v 26v 26v 26r 26v
4 5 1 1 1r 2 3 4 5 1 2 3 4 5,6
51v 51v 52r 52r 52r 52r 52r 52r 52v 52v 52v 52v 52v
4 5 1 1 1r 2 3 4 5 1 2 3 4 5,6
55v 4 55v 5
27r 1 r 27r 1 1 27r 2 27r 3 27r 4 27r 5 27r 6 27v 1 27v 2 2 7v 3 r 2 7v 3 1 27v 4 27v 5 27v 6 28r 1 28r 2 28r 3 28r 4 28r 5 28r 6
53r 53r 53r 53r 53r 53r 53r 53v 53v 53v 53v 53v 53v 53v 54r 54r 54r 54r 54r 54r
1r 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 r 31 4 5 6 1 2 3 4 5 6
87v 1 87v 2 87v 3
56r 56r 56r 56r 56r 56r
1 2 3 4 5 6
Synopse
347
Textstelle
O
§ 4 III, 86 § 1 § 2 III, 87 § 1 § § III, 88 § III, 88 §
2 3 4 1
§ 2,3 §4 § 5 III, 89 Forts. III, 90 § 1 §2 § 3 III, 91 § 1 Forts. § 2,3
Lnr.
1 Forts. 2 § 1 § 2 Forts. Forts. R T, §4 § 5 §6 Forts. § 7 3 4 § 1 Forts. Forts. §2 § § § 4 § 5 §
3 4 5 5 Forts. 1
§2 6 § 1 §2 7 § 1 Forts.
H
D
28v 28v 28v 28v 28v 29r 29r 29r 29r 29r 29v 29v 29v 29v 29v 29v 30r 30r
W
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2
54v 54v 54v 54v 54v 55r 55r 55r 55r 55r 55v 55v 55v 55v 55v 55v 56r 56r
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2
56v 56v 56v 56v 56v 57r 57r 57r 57r 57r 57v 57v 57v 57v 57v 57v 58r 58r
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2
lr lr lr lr lr lr
11 1 r 2 r 21 3 r 31
57r 57r 57r 57r 57r 57r
1 1 1 r 2 r 21 3 r 31
59r 59r 59r 59r 59r 59r
1 1 1 r 2 r 21 3 r 31
lr lr lr lv lv lv lv lv 2r 2r 2r 2r 2r 2v 2v 2v 2v 2v 2v 3r
4 r 41 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 41 4 r 5 1
57r 4 r 57r 4 1 57r 5 57v 1 57v 2 5 7v 3 57v 4 57v 5 58r 1 58r 2 58r 3 58r 4 58r 5 58v 1 58v 2 58v 3 58v 4 1 58v 4 r 58v 5 59r 1
59r 59r 59r 59v 59v 59v 59v 59v 60r 60r 60r 60r 60r 60v 60v 60v 60v 60v 60v 61r
4 r 41 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 41 4 r 5 1
348
Äo/f Lieberwirth
Textstelle
O § § § § § § § § 8 §
2 3 4 5 6 7 8 9 1
§ 2 9 § 1 § 2 10 § 1
H
D
W
3r 2
59r 2
61r 2
3r 3 3r 4
59r 3 59r 4
61r 3 61r 4
3r 3v 3v 3v
59r 59v 59v 59v
61r 61v 61v 61v
5 1 2 3
3v 4
§ 2 § 3 § 4 § 5 11 § 1 Forts. § 2 § 3 § 4 § 5 12 § 1 §2 13 § 1 Forts. § § § 14 §
§ 2 § 3 § 4 Forts. 15 § 1 §2 § 3 16 17 18 Forts. 19 § 1 §2 20 § 1 Forts. § 3 § 2 S4
5 1 2 3
59v 4
61v 4
60r 1 60r 2
62r 1 62r 2
60r 60r 60r 60v
3 4 5 1
62r 62r 62r 62v
3 4 5 1
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
62v 62v 62v 63r 63r 63r 63r 63v 63v 63v 63v 64r 64r 64r 64r 64v 64v 64v 64v 64v 65r
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
2 31 3 r 41 4 r
65r 65r 65r 65r 65r
2 31 3 r 41 4 r
4r 4r 4r 4r 4v 4v 4v 4v 4v 5r
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1
60v 60v 60v 61r 61r 61r 61r 61v 61v 61v 61v 62r 62r 62r 62r 62v 62v 62v 62v 62v 63r
5r 5r 5r 5r 5r
2 31 3 r 41 4 r
63r 63r 63r 63r 63r
2 3 4 1
5 1 2 3
349
Synopse
O
Textstelle
D
W
§ 5 Forts.
5r 5v 5v 5v
5 1 2 r 21
63r 63v 63v 63v
5 1 2 r 21
65r 65v 65v 65v
5 1 2 r 21
§ 1,2
5v 5v 6r 6r 6r
3 4 1 2 3
63v 63v 64r 64r 64r
3 4 1 2 3
65v 65v 66r 66r 66r
3 4 1 2 3
6r 6v 6v 6v 6v
4 1 2 3 4
64r 64v 64v 64v 64v 65r 65r 65r 65r 65v 65v 65v 65v 66r 66r 66r 66r 66r 66v 66v 66v 66v 67r 67r 67r 67r
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 r 21 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
66r 66v 66v 66v 66v 67r 67r 67r 67r 6 7v 67v 67v 67v 68r 68r 68r 68r 68r 68v 68v 68v 68v 69r 69r 69r 69r
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 r 21 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
67v 6 7v 67v 67v 68r 68r 68r
1 2 3 4 1 2 3
69v 69v 69v 69v 70r 70r 70r
1 2 3 4 1 2 3
21 § 1,2 § 2 Forts. § 3
22
H
§ 3 Forts. § 4 23 § 1
§2
§ 3 24 § 1 Forts. § 2,3 §4 24 § 5 Forts. §6 Forts. § 7 Forts. § 8 § 9 § 1 25
§2
§ 3 Forts. §4 Forts. § 5 26 § 1 §2
Forts. § 3 § 4,5 § 6 § 7 § 8 § 9 § 10
§ H 27 § 1 § 2 28 § 1
§2
29 § 1 § 2 § 3,4
68r 4 68r 5
70r 4 70r 5
350
Rolf Lieberwirth O
Textstelle § 5 30 § 1 § 2 31 § 1 §2 32 § 1,2 § 3 §4 33 § 1 § 2,3 34 35 § 1 § 2 36 37 § 1 §2 § 3 38 § 1 Forts. § 2 § 3,4 39 § 1 § 2 § 3 §4 40 § 1 Forts. §2 41 42 § 1 §2 43 § 1 § 2 44 § 1 § 2 § 3 45 § 1 § 2 § 3 § 4 46 § 1 Forts. Forts. §2 § 3 47 § 1 § 2 48 § 1 Forts.
H
D
W
68v 1 68v 2
70v 1 70v 2
68v 3
70v 3
68v 69r 69r 69r 69r 69v 69v 69v 69v 70r 70r 70r 70r 70r 70r 70v 70v 70v 70v
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 r 21 3 4 5 1 2 3 4
70v 71r 71r 71r 71r 71v 71v 71v 71v 72r 72r 72r 72r 72r 72r 72v 72v 72v 72v
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 r 21 3 4 5 1 2 3 4
70v 71r 71r 71r 71r 71v 71v
5 1 2 3 4 1 2
72v 73r 73r 73r 73r 73v 73v
5 1 2 3 4 1 2
71v 3 71v 4
73v 3 73v 4
72r 72r 72r 72r 72r 72r
1 2 r 21 3 4 5
74r 74r 74r 74r 74r 74r
1 2 r 21 3 4 5
72v 72v 72v 72v 72v
1 2 3 4 5
74v 74v 74v 74v 74v
1 2 3 4 5
351
Synopse Textstelle
O § 2 Forts. 49 § 1 § 2 50 § 1 Forts. Forts, u. § 2 § 3 § 4 Forts.
H
D
W
73r 1 73r 2 73r 3 73r 73r 73v 73v 73v 73v
4 5 1 2 3 4
73v 74r 74r 74r 74r 74r 74v 74v
5 1 2 3 4 5 1 2
51 52 53 53 Forts. 54 § 1 § 2 55 § 1 Forts. § 2 § 3 § 4 § 5 §6 § 7 Forts. § 8 55 § 9 56 § 1 § 2 § 3 § 4 Forts. Forts. § 5 57 § 1 Forts. § 2 § 3 § 4 § 4,5
74v 74v 74v 74v 75r 75r 75r 75r 75r
3 4 5 6 1 2 3 4 5
75r 75v 75v 75v 75v 75v 75v 76r 76r 76r
6 1 2 r 21 3 4 5 1 2 3
58 § 1 Forts. § 2 Forts. 59 § 1 Forts. § 2 § 3 § 4
76r 76r 76v 76v 76v 76v 76v 77r 77r
4 5 1 2 3 4 5 1 2
Rolf Lieberwirth
352 Textstelle
O Forts. 60 § 1 § 2 Forts. 61 § 1 § 2 62 § 1 § 2 63 § 1 Forts. § 2 64 § 1 § 2 65 § 1-3 Forts. § 3 Forts. § 3 § 4 § 5 Forts. § 6 § 7 § 8 § 9 Forts. Forts. § 10 § 11 § 12 § 13 § 14 § 15 Forts. Forts. Forts. § 16 Forts. § 16 § 17 § 18 Forts. § 19 § 20 § 21 § 22 Forts. 66 § 1 § 2 § 3 § 4
H
D
W
77r 3 77r 4,5 77v 1 77v 2 77v 3 1 77v 3 r 77v 4 1 77v 4 r 77v 5,6 78r 1 78r 2 78r 3 78r 4 78r 5,6 78v 1 78v 2 78v 3 78v 4 78v 5 78v 6 79r 1 79r 2 79r 3 79r 4 79r 5,6 79v 1 79v 2 79v 3 79v 4 79v 5,6 80r 1 80r 2 80r 3 80r 4 80r 5 80v 1 80v 2 80v 3 80v 4 80v 5 8 lr 1 81r 2 81r 3 81r 4 81r 5,6 81v 1
75r 1 75r 2 75r 3 75r 4 75r 5,6 75v 1
353
Synopse Textstelle
O § 5 67 § 1 Forts. §2 § 3 § 4 § 5 Forts. § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 Forts. 68 § 1 § 2 § 3 § 4 § 5 § 6 § 7 § 8 Forts. § § § § 69 §
9 io 11 12,13 1
§ 2 § 3 Forts. § 4 § 5 §6 Forts. Forts. 69 Forts. § 7 Forts. § 8 Forts. Forts. §9 § 10 § 11 § 12 70 Forts. 71 §K 11
H
D
W
81v 81v 81v 81v 82r 82r 82r 82r
2 3 4 5 1 2 3 4
75v 75v 75v 7 5v 76r 76r 76r 76r
2 3 4 5 1 2 3 4
82r 82v 82v 82v 82v 82v 83r 83r 83r 83r
5 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4
76r 76v 76v 76v 76v 76v 77 r 77r 77r 77r
5 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4
83r 5,6 83v 1 83v 2
77r 5,6 77 v 1 77v 2
83v 83v 83v 84r 84r 84r 84r
3 4 5,6 11 1 r 2 3
77v 77v 77v 78r 78r 78r 78r
3 4 5,6 11 1 r 2 3
84r 84r 84v 84v 84v 84v 84v 84v 85r 85r 85r 85r 85r 85r 85v 85v
4 5,6 1 2 31 3 r 4 5 1 2 3 4 5 6,7 1 2
78r 78r 78v 78v 78v 78v 78v 78v 79r 79r 79r 79r 79r 79r 79v 79v
4 5,6 1 2 31 3 r 4 5 1 2 3 4 5 6, 7 1 2
354
Rolf Lieberwirth
Textstelle
O § 2 § 3 § 4 § 5 Forts. §6 Forts. Forts. § 7 § 8,9 § 9 Forts. § 10 § H § 12 § 13 § 14,15 § 16 Forts. § 17 § 18 § 19 § 20 Forts. 71 § 2 1 § 22 § 23 72 § 1 Forts. Forts. § 2 § 3 § 4 § 5 Forts. § 6 § 7 § 8 § 9 § 10 73 § 1 § 2 74 § 1 § 2 75 § 1 Forts. § § 76 § §
2 3 1 2
H
D
W
85v 85v 85v 85v 86r 86r 86r 86r 86r 86r 86r 86r 86v 86v 86v 86v 86v 87r
3 4 5 6 1r 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5,6 1
79v 3 79v 4 79v 5 79v 6 80r 1 r 80r 1 1 80r 2 80r 3 80r 4 8 Or 5 80r 6 80r 7 80v 1 80v 2 80v 3 80v 4 80v 5,6 81r 1
87r 87r 87r 87r
2 3 4 5
81r 81r 81r 81r
2 3 4 5
87v 87v 87v 87v 87v 87v 87v 88r 88r 88r 88r 88r 88r 88v 88v 88v 88v 88v 88v 89r 89r 89r 89r 89r 89v
1 1 1r 2 31 3 r 4 5,6 1 2 31 3 r 4 5,6 1r 1 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4 5,6 1
81v 81v 81v 81v 81v 81v 81v 82r 82r 82r 82r 82r 82r 82v 82v 82v 82v 82v 82v 83r 83r 83r 83r 83r 83v
1 1 1r 2 31 3 r 4 5,6 1 2 31 3 r 4 5,6 1r 1 1 2 3 4 5,6 1 2 3 4 5,6 1
355
Synopse
Textstelle
O § 3 Forts. § 4 § 5 § 6 §7 Forts. Forts. § 8
77 78 § 1 § 2 § 3 Forts. 79 § 1 § 2 § 3 80 § 1 Forts. §2 Forts. Forts. § 3 § 4 Forts.
H
D
W
89v 2 89v 3 89v 4 89v 5 90r 1 90r 2 90r 3 90r 4 90r 5 90v 1,2 90v 3 90v 4 90v 5 91r 1 91r 2 91r 3 91r 4 91r 5 91v 1 91v 2 91v 3 91v 4 91v 5 92r 1 92r 2
83v 2 83v 3 83v 4 83v 5 84r 1 84r 2 84r 3 84r 4 84r 5 84v 1,2 84v 3 84v 4 84v 5 85r 1 85r 2 85r 3 85r 4 85r 5 85v 1 85v 2 85v 3 85v 4 85v 5 86r 1 86r 2
Ergänzungsblätter aus der Dresdener Bilderhandschrift N a c h 27v in W sind D 2 2 r - 2 3 v (Ldr. I 71 § 1 - II 11 § 3 ) zu ergänzen; hinter 45v in W folgen D 40r-41v (Ldr. III 25 § 3 - III 39 §2); nach 55v in W sind D 52r-53v (Ldr. III 77 § 2 - III 84 § 2 ) einzufügen; hinter 74v in W folgen D 7 3 r - 8 0 v (Lnr. 48 § 2 - 65 §21). D e r Landesbibliothek D r e s d e n ist f ü r die Erteilung d e r A b d r u c k g e n e h m i g u n g und die Überlassung d e r D r u c k vorlagen zu danken.
Die Herausgeberin
358
Ergànzungsblàtter
aus der Dresdener
Bilderhandschrìft
v c O u n t c t t i t t m !imanti!Ctt-nmi r a»
b w t l ^ e ^ S S ? ! ^ ' t f f "1° fissiti M w t e t w J Ì i i e m s i t «metteflv
;h
tìMerfiniscro® "X "ifltóncMKlu dwttficctowwt
ICO'WUK ivracntfr
fictttttft vtitcbtTdttdDur fti l te i w w t r a f i iianr tHoutoi f ? m g | B
D folio 22 recto
-,
D folio
22 recto
359
II. vestunge vor dem greven, he irwirbet des greven vestunge über ienen al zu hant. Sus irwirbet ouch der greve mit siner vestunge des kuniges achte. Incipit über secundus. 5
Cap. I. W o vursten oder hern zu samene swern mit eiden, si ennemen denne das riche uz, so haben si wider das riche getan.
25
C.II. Vorsumet der greve sin echte ding, das alleine vorluset der cleger. Vorsumet he der dinge eins, di um ungerichte uz geleit werdin, man mus der clage beginnen als von erst. Beclait man einen in sine keginwertikeit umme eigen oder umme len, das he in rechten gewern hat, man sal im tedingen zu dem neisten dinge, ab he spricht: herre, mir is hir umme nicht her getedinget. Zu der andern clage, bitte he des dinges, das sal man im gebn, sint sal he entwortin. C.III. Graset man einen man zu kamphe, der ungewarnt dar kumen is unde im umme di sache dar nicht bescheiden is, he sal tag habn noch siner geburt, ab hes bittet, das he sich dar zu gewarne, wen der kamph gelobt is, unde nicht er: D e r vrie schephinbare man über sechs wochen, der dinstman über virzennacht unde
30
andere vrie lute. Umme alle andere sache, da man den man umme beschuldiget, sal he entwortin zu hant, ober bekennen oder louken. C . I V . W e r sich uz der vorvestunge zin wil, dem sal der richter vride wirken vor zu kumen, ab
10
15
20
man is von siner wege. Wen he sich uf den heiligen uz gezut, so sal en der richter uz der vestunge lazen unde das lant mit vingern unde mit Zungen, als man en in di vorvestunge tet. Weigert man im
4 achte O Horn., fehlt D. 5 swern] sekeret O Horn. 6/7 si - uz] se ne bescheden dat rike dar unbuten O, se ne besceiden dat rike dar buten Horn. 7/8 das riche] dat rike O, deme rike Horn., das me riche D. 31 siner wege] sinent halven gheret O, sinent halven geret Horn. 34 en] ene O, ine Horn., fehlt D.
. . . Verfestung vor dem Grafen, so erwirkt er des Grafen Verfestung über jenen sofort. Ebenso erwirkt auch der G r a f mit seiner Verfestung die Reichsacht des K ö nigs. Kapitel I. W o immer sich Fürsten oder Herren mit Eiden untereinander verbünden, wenn sie das Reich nicht davon ausnehmen, so haben sie gegen das Reich gehandelt. Kapitel II. Versäumt der G r a f sein echtes Ding, so verliert daran einzig der Kläger. Versäumt er (der G r a f ) irgendeinen der Gerichtstermine, die wegen eines Verbrechens anberaumt waren, so muß man die Klage von vorne beginnen. Beklagt man einen' Mann in seiner Gegenwart um ein Grundeigentum oder um ein Lehen, das er in rechtmäßiger Gewere hat, so soll man ihm bis zum nächsten Gerichtstermin Frist geben, wenn er erklärt: „Herr (Richter), mir ist hierfür kein Verhandlungstermin gesetzt." Wenn er auch bei der zweiten Klage um Vertagung 1 bittet, so soll man ihm auch diese geben, danach muß er aber antworten. Kapitel III. Fordert man einen Mann zu einem gerichtlichen Zweikampf, der unvorbereitet 2 ist und wegen dieser Sache nicht dorthin vorgeladen ist, so soll er, wenn er darum bittet, Aufschub 3 seinem Geburtsstand entsprechend erhalten, damit er sich dafür rüste 4 , und zwar wenn der Zweikampf gelobt worden ist, und nicht eher: D e r freie schöffenbare Mann über sechs Wochen, der Dienstmann über vierzehn Nächte, und ebenso die anderen freien Leute. Zu allen anderen Sachen, deren man den Mann beschuldigt, soll er sofort antworten, bekennen oder bestreiten. Kapitel IV. W e r sich aus einer Verfestung befreien will, dem soll der Richter Frieden erwirken, um vor Gericht zu kommen, wenn dies von seiner Seite 5 (gewünscht wird). Wenn er sich mit einem Eid auf die Reliquien befreit, so sollen ihn der Richter und das Landvolk mit Fingern und Zungen aus der Verfestung entlassen, genauso wie man ihn in die Verfestung tat. Verweigert man ihm
1 ding st. N. 'Gericht, Gerichtstermin', hier 'Vertagung des Gerichtstermims'; 2 ungewamet Part. Adj. 'unvorbereitet, überrascht'; 3 tac st. M. 'auf einen Tag anberaumte Gerichtsverhandlung', hier 'Aufschub der Gerichtsverhandlung'; 4 warnen sw. V. refl. 'vorbereiten, rüsten, versehen mit'; 5 sinerwegen Adv. 'seinetwegen, von seiner Seite'.
360
Ergänzungsblätter aus der Dresdener
Bilderhandschrift
a#mrvitttritrc-vii air iicfafc jg af ora taltgt itiUC'VttlvilvS: WittK9'fß Wmä tm cndi wiic twrüc^tt licGìlteSi iteci w : su tomcntai ortnöl3C3a?u aròaciicab Burnirvi* curia
ctu tttätß 1 ve* « f t u ß t tm ö f l p a i ctrnwc atdrcii sciobtr vn ü s s e r i i e t o i u e i w mimmatc-vii tetltctiiciir w n o a g ter ab {^ai wiD^moi ADI wftilcccruriileijcgi M / W é m m f ^ ' ¡Beai j W \)lH|3F&aBbflTiTli5 tßUtCfi*! t M $ d r iticotic i s m à t c icr cti o m f t m t b r a s c a f e s n t s b ttiö ö i ücrifcrvrmttC'ragTHdja' 1nag swurncr m w rd^tisodiöi-te; i w i t ó w w i M vsrHStmft#ffOJrtraicr#imà fmcltèf
üÄ®md«citar i & t r a i t t ß n j t e i ! ^ • f b y c t i f saimét f^tiì
AOlUitgfti l'ffsiliiS^f
D folio 22 verso
D folio
22
361
verso
des mit unrechte, unde zut he sich uz uf den heiligen, he is ein unvorvest man. So sal man im ouch vride wirken, unde he sal bürgen sezzen, vor zu kumene zu 4
drin dingen, ab man is von im heischet,
da zu
4a entwortene, ab imant über en cla5
10
15
20
25
30
gen wolle, so sal man ein man uz nicht enis, zu kumene
unde clait nimant über en zu drin dingen, en ledig teiln von der clage. Zut sich aber der vorvestunge, da der cleger zu entworte unde gelobit unde sezzet he bürgen vor zu rechte, unde kumt he nicht vor, das bur-
gezok hat der richter gewunnen unde nicht der kleger, ab he en wider in die vorvestunge tut, als he zu rechte sal. C.V. W e r eigens also vil hat, das besser is denne sin wergelt in deme gerichte, der endarf keine bürgen sezzen, ab man en beclait umme ungerichte. Uber virzzennacht sal man schult geldin, di man gewinnet vor gerichte, gewette über sechs wochen, buze noch deme gewette über virzzennacht. Gewinnet aber der man sine buze er dem gewette, man sal si leisten über sechs wochen, unde das gewette da noch über virzzennacht. Zu des huse sal man das gelden, deme man iz schuldig is, bi sunnenschine, ab he hus in deme gerichte hat, odir zu des richters neiste» huse, ab iener da unbehuset is. C.VI. W e r sine rechte buze vorsprichet vor gerichte, der enhat keine buse me. Alle vorgoldene schult sal der man volbrengen selb dritte, dis saen unde horten. W e r zu dinge nicht enkumt, den teilt man wettehaft, ab he phlichtig is dar zu kumene, he enmuge is denne mit rechte widerredin. Welch gäbe der man siet,
4 ab - heischet] ofte men it uan erne eschet O, of man't von
ime eschet Horn., fehlt D. 9 zu rechte] to rechte O Horn., fehlt D. 24 neisten] nesten Horn., neiste D, fehlt O. 31 is O Horn., fehlt D.
dies zu Unrecht, und befreit er sich durch den Eid auf die Reliquien, so ist er ein unverfesteter Mann. Dann soll man ihm auch Frieden erwirken, und er soll einen Bürgen dafür stellen, daß er zu drei Gerichtstagen erscheint, wenn man dies von ihm fordert, und dort zu antworten, wenn jemand gegen ihn klagen will. Klagt aber niemand gegen ihn innerhalb dreier Dingtage, so soll man ihn von der Klage freisprechen. Befreit sich aber ein Mann aus der Verfestung, wenn der Kläger nicht anwesend ist, und gelobt oder stellt er Bürgen dafür, daß er vor Gericht erscheint, kommt er dann aber nicht, so erhält der Richter das Bürgengeld und nicht der Kläger, wenn er (der Richter) ihn nämlich wieder in die Verfestung tut, wie er dem Recht entsprechend soll. Kapitel V. Wer soviel Grundeigentum in dem Gerichtsbezirk besitzt, daß es mehr wert ist als sein Wergeid, der braucht keinen Bürgen zu stellen, wenn man ihn eines Verbrechens anklagt. Innerhalb von vierzehn Nächten soll man die Schuld begleichen, die jemandem vor Gericht zugesprochen worden ist; das Gewette binnen sechs Wochen und die Buße nach dem Gewette während vierzehn Nächten. H a t aber der Mann (der Kläger) seine Buße vor dem Gewette zugesprochen bekommen, so soll man sie innerhalb von sechs Wochen bezahlen und das Gewette danach binnen vierzehn Nächten. Man soll es im Hause desjenigen bezahlen, dem man es schuldig ist, (und zwar) bei T a geslicht 1 , wenn er sein Haus innerhalb des Gerichtsbezirks hat, oder in dem nächstgelegenen Haus des Richters, wenn jener selbst hier ohne Haus ist. Kapitel VI. W e r seine ihm rechtmäßig zustehende Buße vor Gericht ablehnt, der hat keinen Bußanspruch mehr. J e de geleistete Schuld soll ein Mann selbdritt beweisen, (und zwar mit denjenigen,) die es sahen und hörten. Wer zum Ding nicht erscheint, obwohl er zu kommen verpflichtet ist, den verurteilt man zu einem Strafgeld, es sei denn, er kann zu Recht Einspruch erheben. Welche Übergabe man sieht
1 sunnenschin
st. M. 'Sonnenschein, Tageslicht',
362
Ergänzungsblätter
D folio 23 recto
aus der Dresdener
Bilderhandschrift
D folio 23 recto
363
II.
5
10
15
20
25
30
oder welch orteil he vinden höret, widerredet hes zu hant nicht, dar noch mag hes nicht wederreden. C.VII. Vier Sachen sint, di ehaft not heisen: gevenknis, suche, gotis dinst uzwendig landes unde des riches dinst. Welche dirre sache den man irret, das he zu dinge nicht enkumt, wirt si bewiset, als recht is, von eime sime boten, wer he si, he blibt is ane schaden unde gewinnet tag bis an das neiste ding, alse he von der echten not ledig wirt. Wer abir bürgen sezzit vorzukumene, benimt is im ehafte not, das he nicht vorkumen mag, di not sal sin bürge benennen unde swern uf den heiligen unde anders kein sin böte. C.VIII. Wer so ungerichte clait uf einen, der da zu kege nwert nicht enis, kumt he sider vor, unde enclait iener uf en nicht, he mus dem richtere wetten und ieme sine buse gebn, ouch teilt man ienen der clage ledig. Volvorderet he aber sine clage, unde ab he im enket mit rechte, he enlidet dar umme keine not, he enhabe en denne kemphlich vorgeladen. C.IX. Wer so ouch beginnet zu enwortene, unde wirt im ein ding geleit mit urteiln, kumt he nicht vor, he is in der clage gewunnen. Der richter sal ouch bürgen habn von deme cleger unde uf den di clage get, das si zu rechte vorkumen, si suln ouch irs rechtes uf das gerichte seen. Wen di clage mit urteiln gevristet wirt bis an einen andern tag umme den gevangenen man, so sal man en zu borge gebn, he ensi denne in der hanthaften tat gevangen. C.X. Den vorvesten man mus man wol bestetigen binnen gebundenen tagen, nicht enmus
1 he D O, die man Horn. 2 dar noch] seder O, d a r na Horn. 4/5 uzwendig] buten O Horn. 7 bewiset] bescheneghet O, besceneget Horn. 10/14 W e r - bote] Horn. II 4 § 3. 12 di not] de echte not O, die echten not Horn. 13 swern] beholden O, beweren Horn. 15 so O Horn., fehlt D. 15/16 kegenwert] ieghenwart O, jegenwarde Horn., kenwert D. 23 so] wie 15.
oder welches Urteil man finden hört, erhebt man nicht auf der Stelle dagegen Einspruch 1 , so kann man es später nicht mehr bestreiten 1 . Kapitel VII. Vier Gründe 2 gibt es, die als echte Hinderungsgründe bezeichnet werden: Gefangenschaft und Krankheit, Aufenthalt außer Landes im Dienst Gottes und der Reichsdienst. Welche dieser Ursachen 2 jemanden hindert, zum Gericht zu kommen, werden sie, so wie es Recht ist, von einem seiner Bevollmächtigten, wer immer er sei, dargelegt, so entstehen ihm keine Nachteile daraus, und er erhält Frist bis zum nächsten Gerichtstermin, an dem er von der echten N o t frei ist. Wer aber einen Bürgen dafür stellt, daß er vor Gericht erscheint, und er wird durch echte N o t daran gehindert, so daß er nicht kommen kann, so soll sein Bürge diese Gründe benennen und durch Eid auf die Reliquien beschwören und kein anderer als sein Beauftragter. Kapitel VIII. Wer einen anderen, der nicht anwesend ist, wegen eines Verbrechens anklagt, erscheint dieser später vor Gericht und jener klagt nicht gegen ihn, so muß er dem Richter das Strafgeld und jenem (dem von ihm Beklagten) die Buße bezahlen; außerdem spricht man jenen von der Klage frei. Führt er (der Kläger) aber seine Klage durch und entgeht er (der Beklagte) ihm zu Recht, so hat er (der Kläger) keinen Nachteil daraus, es sei denn, er hat den anderen zu einem gerichtlichen Zweikampf herausgefordert. Kapitel IX. Wer so auch damit beginnt, sich zu verantworten und ihm wird durch ein Urteil der Gerichtstag bestimmt und er erscheint nicht (vor Gericht), so ist er mit der Klage überführt 3 . Der Richter soll ferner von dem Kläger und von demjenigen, gegen den die Klage geht, einen Bürgen dafür haben, daß sie dem Recht gemäß (vor Gericht) erscheinen. Sie sollen ferner darauf achten, daß sie vom Gericht auch ihr Recht erhalten. Wenn die Klage wegen eines gefangenen Mannes bis auf den nächsten Tag durch Urteil ausgesetzt wird, so soll man ihn gegen Bürgschaft entlassen, es sei denn, er sei in handhafter Tat ergriffen worden. Kapitel X. Einen verfesteten Mann darf man wohl während der gebundenen Tage festnehmen, doch man darf
1 Widerreden sw.V. 'Einspruch erheben, bestreiten, widersprechen'; 2 sache st. F. 'Ursache, G r u n d ' ; 3 in der clage gewunnen sin 'mit der Klage ü b e r f ü h r t sein', zu gewinnen st. V. 'vor Gericht überwinden, ü b e r f ü h r e n ' .
364
Ergänzungsblätter
aus der Dresdener
Bilderhandschrift
t a l til> ® E t t e a a t n ü fiiitamitafieraf. jimtärampljlitiiariloön'tuitgcsiiiisi nCDOiimidittxitra ötfc fia n ccitucfiiuiircauicüebcric dö m m"n!dttc af tttdipavcrnwctt cm inti-vn otidi ttf fi berte etti völtöin^r Iwöcttcritömicr finirmi aiuc ¿tur enpltàsiaoiltc Itar «intuite vii cm i\atdttlrfi ton» frtùc itimgcvtus M6ctt»t|2 «rein linrmbc tm ttimic (tvamiic öti cm« nimtcßitutcffttrurtt t a r p i & k tttiitwctcliptt^ w a » itttee tf< r iiiutet ttft örtifrm
tßfttttoi-wiötr¡tMitóftw vnd osa bf . fthfiff-At» derma ü tea e t t e (turisi % m tfuMuffni>b ìiariföäitfiteßP-ötimtö . tßfm wimiCiWDtiigiB^fitóiin [m?a %tt ¡Iii mtvab lice tttdttTß b c t a i t f t a f t o r redtft Liìrcztìlc-tiur mwtci mani Scatti . DtatltiigrfäSiti un hörn* im «tc • oemetttadv Äfwcu aTftntHsttti'aii " öct'SäPiurtttffeiwctöiKtr-dlitentuß • üdt m \ vtiduntiiraab ()d> ful( m ù : r | i - gi vßifv»ncr-&aß iic DAß cnsrntgi1 m 4 C* vraksvUitf-Mbe W ~ »? , !
D folio 75 verso
393
D folio 75 verso
5
Lest abir hez, odir wirt iz im vorteilt mit lenrechte, si enverluset da mite nicht, wen si in den geweren siezt. Lien enmac he ouch nicht dar an wider der vrouwen willen, ane das en vorligen ankumt unde da he mit lenrechte zu getwungen wirt. Swas dar ledig an wirt, das is der vrouwen
ledig unde nicht dem herren noch dem manne, der das mit ir enphing. C.LVIII. Gedinge an vorligeneme gute mag 10 he wol vorlien mit der vrouwen willen, unde swas dar ledig an wirt, durch das si beide ein vol lenrecht haben mit gesamenter hant an deme gute enphangen. H e hat di liunge unde den herschilt, si hat di selbe 15 liunge unde di gewere. Liet ein herre wibe oder manne gedinge an eins mannes gute, stirbit iener dar noch, der iz in geweren hat, di gewer des gutes is irstorben uffe den, dem das gedinge dar an geligen was. Er was 20 is sin len undir gedinge unde under dem bescheide, ab der man ane lenerben stürbe. Der is in geweren hatte, da he starp, da was is sin len ane gedinge. Das hes den herren inre, ab hes nicht enbekennet, bin siner 25 rechten jarczale, mit zeweier manne gezuge, di di liunge sagen unde horten, da hes im ane gewere leich. Swen der stirbit ane erben, der das gut in geweren hat, der herre mus is sich wol underwinden, ab hes sich nicht 30 vorsumet, das he das gedinge dar an iemande geligen habe.
6 Swas - wirt] Svat dar ledich an wert Horn., fehlt D O. 12 lenrecht D Horn., recht O. 23 ane D O, sunder Horn. 26 ane] wie 23. 27 erben] eruen O, lenerven Horn. 30 vorsumet] uorsint O, versint Horn.
Läßt er es aber auf oder wird es ihm im Lehengericht abgesprochen, so verliert sie damit nichts, weil sie (das Gut) in Besitz hat. Weiterverleihen kann er es nicht ohne Einwilligung der Frau, ausgenommen wenn ihnen ein verliehenes Gut wieder anfällt oder wenn er durch das Lehengericht gezwungen wird. Was davon frei wird, das ist der Frau frei und nicht dem Herrn oder dem Mann, der es mit ihr empfing. Kapitel LVIII. Eine Anwartschaft an verliehenem Gut kann er wohl mit Einwilligung der Frau verleihen, und ebenso, was davon ledig wird, weil sie beide ein volles, mit gesamter Hand empfangenes Lehenrecht an dem Gut haben. Er hat das Lehenrecht und den Heerschild, sie hat dasselbe Lehenrecht und den Besitz. Verleiht ein H e r r einer Frau oder einem Mann eine Anwartschaft am Gut eines Mannes und stirbt danach jener, der es in Besitz hat, so fällt der Besitz des Gutes dem zu, dem die Anwartschaft geliehen war. Zuerst war es sein Anwartslehen unter der Bedingung 1 , daß der ohne Lehenserben stirbt, der es in Besitz hatte. Als dieser starb, wurde es sein Lehen ohne Anwartschaft. Wenn dies der H e r r nicht anerkennt, so soll ihn der Mann innerhalb seiner rechten Jahresfrist durch das Zeugnis zweier Mannen überführen, die die Belehnung sahen und hörten, als er (der Herr) es (das Gut) ohne Besitz verlieh. Wenn derjenige ohne Lehenerben stirbt, der das Lehengut in Besitz hat, so darf sich der Herr des Gutes bemächtigen, wenn er sich dessen nicht bewußt ist, daß er die Anwartschaft daran verliehen hat.
1 bescheide st. F. 'Bedingung, Bestimmung',
394
Ergänzungsblätter
D folio 76 recto
aus der Dresdener
Bilderhandschrift
D folio
395
76 recto
IV.
5
10
15
20
25
30
Bemächtigt sich ferner jener des Gutes, dem ein Warterecht 1 oder eine Anwartschaft daran geliehen ist, bevor es der Herr tut, so begeht er kein Unrecht, wenn er nur das Gut sofort vertritt und sein Recht daran gegenüber dem Herrn wahrnimmt, wenn dieser ihn darum beschuldigt oder vor Gericht lädt. Denn wie er (der Mann) seine Lehensfrist durch das Lehensbegehren verlängert 2 , so verkürzt sie ihm der Herr, wenn er ihm das Recht (auf das Lehengut) anbietet. Stirbt ein Herr oder läßt er das Anwartschaftsgut seines Mannes innerhalb der Belehnungsfrist auf, nachdem es dem Mann bereits angefallen ist und dieser wegen der Belehnung den Erinnerungsbeweis führen soll, so verlange er die Lehenserneuerung für sein Gut nicht als Anwartschaft, sondern als rechtes Lehen, wenn er an den Herrn mit Recht verwiesen wird. Gegenüber dem ersten Herrn soll er sich aber erbieten, das Gut mit Zeugenbeweis gerichtlich zu erringen. Widerspricht dieser dem zu Unrecht, so hat er (der Mann) das Gut mit Recht errungen, da ihm das Recht darauf verweigert wird, und hat daran (bei Herrenwechsel) das Recht auf Lehenserneuerung. War es aber aufgelassen zu Lebzeiten dessen, der es in Besitz hatte, und war er redlich und recht an jenen verwiesen, dem es der Herr verlieh, oder hatte er es von ihm empfangen, so ist die ganze Anwartschaft unwirksam 3 , die der erste Herr an dem Gut verliehen hatte. Kapitel LIX. Ein Kind kann einem Kind Lehengut leihen, solange sie beide noch binnen ihren Jahren sind, und ebenso das Angefälle, wenn es dem Kind vorher selbst geliehen worden ist. An Angefälle besteht aber kein Recht auf Lehenserneuerung, wenn der Herr stirbt, der es geliehen hat. Von seinem Mann nimmt der Herr das Angefälle ebenso wie von seinem eigenen Gut,
Undirwint es sich ouch iener, dem eine wartunge oder ein gedinge dar an geligen is, er den der herre, he enmissetut nicht, das hez zu hant vorste unde sin recht dar an berede kegin sinen herren, swen he en dar umme beschuldiget odir dar umme betedinget. Keiner jarzcale ensal he damite beiten, wen alse he sine jarzcale mit sinnende lenget, also kurzcet si der herre, ab he im da von recht buit. Stirbit ein herre odir lest he uf sins mannes gut bin der jarzcale, alse iz den man anirstorben is unde he den herren der liunge inren sal, he volge sime gute nicht vor ein gedinge mer vor ein recht len, alse he an en gewist mit rechte wirt. Dem ersten herren sal aber he biten, das gut zu behaldene mit gezuge. Widerspricht hes mit unrechte, so behelt he das gut mit rechte, da im rechtes ab geweigert is, unde hat da rechte volge an. Was is aber gelasin bi ienis libe, der is in geweren hatte, unde was he redelich unde rechte an ienen gewist, dem is der herre lest, odir hatte hes von im enphangen, so is alle gedinge gebrochen, das der erste herre geligen hatte in deme gute. C . L I X . Kint mag kinde gut lien, di wile si beide binnen iren jaren sin, unde anegevelle, ab iz im selbir erst geligen is. In deme anegevelle enis aber keine volge, ab der herre stirbit, der is geligen hat. Von sime manne nimt der herre anegevelle, alse in sines selbes gute,
3 das] erste O, deste Horn. 30 vor manne] mannes
Horn.
6 odir - betedinget] fehlt
O.
1 wartunge
st.F. 'Erwartung, Anwartschaft',
hier 'Warte-
recht'; 2 lengen sw.V. 'verlängern, aufschieben'; chenez gedinge 'unwirksame Anwartschaft'.
3
gebro-
396
Ergänzungsblätter aus der Dresdener Bilderhandschrift
/ , j ¡jr 'X
füßurteiüuiurfirttiic-itfümß Wtmu' wetten (miciiiwii-lif cniü{d(iii£i5ti' fidi«! tiadutdiff-mtcciitu? ^ wodtl'H ßpli
Ä j,,, W t | gp: |
tmfmöiir- " i
•
ibidifftlc liörrftOÄö a'mdUiKTätiHÄt I iiclc flif l i t o m fiap òtoreie $j§ Ér ntßumÄiÄaiilicßnit^flä^iif'humr
f
licititiguutó'ÈGKViiò'nnCK'tdirDn»
t m
m a x finca « f b i q g K ?{!«f.aiiife tiff töliolr-vtiffßmntu'f ?a w^bc-Voi
s
fo •i
t
« a i t w f a j g f f i k f f a& ;f
![Sachsenspiegel: Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift Cod. Guelf 3. 1. Aug 2° [Reprint 2018 ed.]
9783050069074, 9783050023588](https://dokumen.pub/img/200x200/sachsenspiegel-die-wolfenbtteler-bilderhandschrift-cod-guelf-3-1-aug-2-reprint-2018nbsped-9783050069074-9783050023588.jpg)





![Der Patriot: Band 4 Kommentarband [Reprint 2018 ed.]
9783110854336, 9783110099317](https://dokumen.pub/img/200x200/der-patriot-band-4-kommentarband-reprint-2018nbsped-9783110854336-9783110099317.jpg)
![Der Fronbote im Mittelalter nach dem Sachsenspiegel und den verwandten Rechtsquellen: Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte [Reprint 2020 ed.]
9783112361900, 9783112361894](https://dokumen.pub/img/200x200/der-fronbote-im-mittelalter-nach-dem-sachsenspiegel-und-den-verwandten-rechtsquellen-ein-beitrag-zur-deutschen-rechtsgeschichte-reprint-2020nbsped-9783112361900-9783112361894.jpg)