Rosmini und die deutsche Philosophie - Rosmini e la filosofia tedesca [1 ed.] 9783428526031, 9783428126033
Antonio Rosmini (1797-1855) gilt in vielerlei Hinsicht als "Dialogfigur" und "Brückenbauer" zwischen
142 116 56MB
German Pages 560 Year 2007
Polecaj historie
Citation preview
MARKUS KRIENKE (Hrsg.)
Rosmini und die deutsche Philosophie Rosmini e la filosofia tedesca
Philosophische Schriften Band 71
Rosmini und die deutsche Philosophie Rosmini e la filosofia tedesca Herausgegeben von
Markus Krienke
Duncker & Humblot . Berlin
Bibliografische Infonnation der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten © 2007 Duncker & Humblot GmbH, Berlin Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin Printed in Gennany ISSN 0935-6053 ISBN 978-3-428-12603-3 Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier entsprechend ISO 9706 €9
Internet: hup://www.duncker-humblot.de
Vorwort des Herausgebers Das Jahr 2005 rückte das philosophische Rampenlicht auf einen Denker, der bislang ins Abseits der europäischen Geisteswelt gedrängt worden ist: Der Todestag Antonio Rosminis (1797-1855) jährte sich zum 150. Mal. Die Frage nach der philosophisch-systematischen Einordnung seines Denkens ist indes nach wie vor offen. Glaubt man den Zeugnissen der großen italienischen Neoidealisten Bertrando Spaventa und Giovanni Gentile, ist Rosmini der erste emstzunehmende Rezipient der Philosophie Kants und des deutschen Idealismus in Italien - ein Urteil, das ihn implicite unter die bedeutenden Rezipienten dieser "deutschen Philosophie" der damaligen Zeit im Ausland überhaupt macht. Einen deutschen Experten Kants und des Idealismus mag diese Behauptung dagegen höchstens verwundern, ist der Name Rosmini hierzulande doch soweit überhaupt bekannt - entweder mit der Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts assoziiert oder als Beispiel für das "katholischen Denken" Italiens oder den beginnenden "Neothomismus" bekannt. Was macht also seine Rezeption und Kritik der "deutschen Philosophie" zu einer besonderen, was sie von derjenigen der anderen großen Interpreten und Kritiker Kants und des Idealismus unterscheidet? Dieser Frage fiihlte sich die internationale Tagung "Rosmini und die deutsche Philosophie - Rosmini e la filosofia tedesca" verpflichtet, zu der vom 27. April bis zum 1. Mai 2005 etwa vierzig Experten des Denkens Rosminis, Kants und des deutschen Idealismus im deutsch-italienischen Zentrum "Villa Vigoni" am Corner See (Loveno di Menaggio) zusammenfanden 1. Ziel der 1 Vgl. die erschienenen Berichte der Tagung: Gabriele De Anna, Rosmini als Interpret Kants und des Deutschen Idealismus. Bericht zur Tagung "Rosmini und die deutsche Philosophie", 27. April- 1. Mai 2005, Villa Vigoni, Corno, Italien, in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 6 (2007) 209-215; ders., Come leggere Rosmini, fiIosofo e interprete dei pensiero tedesco, in: Rassegna di Teologia 47 (2006) 281-286; Giovanni Grandi, Die Intuition des Seins bei Rosmini und Maritain. Marginalien zur Tagung "Rosmini und die Deutsche Philosophie", in: Aufgang. Jahrbuch für Denken, Dichten, Musik 3 (2006) 511-520; ders., Prospettive sull'intuizione dell'essere tra Rosmini e Maritain. Suggestioni e scorci a margine dei convegno intemazionale "Rosmini e la fiIosofia tedesca", in: Divinitas, N. S. 49 (2006) 149-164; Markus Krienke, Rosmini und die deutsche Philosophie. Zur Aktualität der Kant- und Idealismusrezeption Antonio Rosminis, in: Theologie und Philosophie 80 (2005) 566-574; ders., Rosmini in discussione. Convegno intemazionale di "Villa Vigoni" (Corno) su "Rosmini e la fiIosofia
6
Markus Krienke
Tagung war es, die Thematik "Rosmini und die deutsche Philosophie" als eine zentrale Herausforderung der neuzeitlichen Philosophie zu erweisen. Den Erweis, dass sich dieses Ziel keiner "philosophischen Laune" verdankt, sondern sich aus dem Studium der diesbezüglichen Quellen ergibt, werde ich im einleitenden Beitrag dieses Bandes unter dem Titel "Rosmini und die deutsche Philosophie. Stand und Perspektiven der Forschung" erbringen. Die Umsetzung dieser Intention verlangt jedoch zunächst eine Vorausreflexion über die Frage, warum dieses Thema bislang keine Aufmerksamkeit in der deutschsprachigen Geisteswissenschaft hervorgerufen hat. Es ist zu erwarten, dass die Beantwortung dieser Frage auch die nötigen Hinweise dafür gibt, mit welcher Methodik das Thema "Rosmini und die deutsche Philosophie" anlässlich dieser Tagung wie auch in der zukünftigen Forschung angegangen werden kann. Es ist das bleibende Verdienst der Rosminiforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die theoretischen Grundlagen dafür ausgearbeitet zu haben, Rosminis Denken aus jenen engen Schranken zu befreien, die der Erforschung seines Denkanliegens ein Jahrhundert lang von Motivationen her auferlegt wurden, die diesem äußerlich waren. Diese Schranken waren sowohl philosophischer als auch theologischer Natur. In der Philosophie wurde Rosmini lange Zeit vom italienischen Neoidealismus als "italienischer Kant" bzw. "italienischer Hegei" rezipiert. Wurde er dank dieser Kategorialisierungen auch einhundert Jahre lang in der Philosophie beachtet und geschätzt, so stellte sich diese Vereinnahmung des Rosminischen Denkens insofern als verhängnisvoll heraus, als das Ende des Neoidealismus folgerichtig auch das Versiegen des philosophischen Interesses für Rosmini in Italien mit sich brachte. Gerade weil Rosmini nicht in seinem eigenständigen und authentischen Kern erkannt worden ist, konnte er nach dem Ende dieses Interpretationsparadigmas auch nicht selbstständig in der Philosophie verbleiben. Theologischerseits bestand die "äußere Grenze", welche eine positive Rezeption Rosminis in Deutschland im Keim erstickte, in der Verurteilung durch das Heilige Uffizium aus dem Jahr 1888. Seine philosophischen und theologischen Thesen wurden von der Kirche als durch die modeme Subjektphilosophie mit deren Relativismus, Psycholotedesca" (27 Aprile - 1 Maggio 2005), in: Giornale di Metafisica, N. S. 27 (2005) 789808; ders. / Gian Luca Sanna, Zu einer neuen Erforschung des Verhältnisses zwischen Rosmini und der deutschen Philosophie, in: Quaestio 5 (2005) 658-661; Salvatore Muscolino, Rosmini e la filosofia tedesca, in: Rivista di filosofia neo-scolastica 98 (2006) 151-155; Gian Luca Sanna, "Rosmini und die deutsche Philosophie". Internationales Symposium im deutsch-italienischen Zentrum Villa Vigoni, in: Trierer Theologische Zeitschrift 115 (2006) 167-171; ders., Rosmini e la filosofia tedesca, in: Rivista di storia della filosofia, N. S. 61 (2006) 751-754; FedericoSkodler, Antonio Rosmini a 150 anni dalla morte in un convegno italo-tedesco, in: Sapienza. Rivista di Filosofia e di Teologia 59 (2006) 99-103. Vgl. Näheres zu Programm und Durchfiihrung der Tagung auf der Seite www.antoniorosmini.eu.
Vorwort
7
gismus, Ontologismus und Pantheismus kompromittiert erkannt und aus den in der Kirche geduldeten Lehren verbannt. Der größte Erfolg der Rosminiforschung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dürfte es indes sein, vor vier Jahren die Aufhebung der offiziellen Verurteilung aus dem Jahr 1888 erreicht zu haben, die das bislang größte Hindernis einer philosophisch-theologischen Rezeption Rosminis im Umfeld christlicher Philosophie darstellte. Dieser offizielle Akt des jetzigen Papstes Benedikt XVI. - damals noch Präfekt der Glaubenskongregation - konstituiert damit fast eineinhalb Jahrhunderte nach Rosminis Tod erstmals das Terrain für eine geistesgeschichtlich angemessene Auseinandersetzung mit dem Denken Rosminis. Die Überwindung der genannten "äußeren" Grenzen war mithin das Ziel der genannten jüngeren Rosminiforschung. Dabei war diese in ihrem kulturellen Aktionsradius jedoch gänzlich auf sich selbst zurückgeworfen. Ein Rückzug von der philosophischen und theologischen Diskussion, in der sie das Rosminibild verzeichnet und verzerrt sah, und eine systematische Interpretation und Ausarbeitung des Rosminischen Denkanliegens von seinem eigenen Ansatz bzw. von der Exegese seiner eigenen Schriften her waren der einzig gangbare Weg, um Rosmini aus jenen Vorurteilen, die sich in dem Jahrhundert nach dessen Tod in Philosophie und Theologie sukzessive aufgebaut hatten, zu befreien. Damit den Rosministudien über den Verlust des philosophischen Terrains nach dem Untergang des Neoidealismus hinaus nicht auch theologisch jeder Boden entzogen würde, war man weiterhin tendenziell zu einer Interpretation gezwungen, die auf die Herausstellung der vollständigen Konvergenz Rosminis mit Thomas von Aquin hinzielte und zugleich dessen Distanz zu Kant und den Idealisten größere Bedeutung beimaß als dem neuzeitlichen Charakter seiner Denkform. Der Wegfall der "äußeren" Grenzen - insbesondere der kirchenamtlichen Verurteilung - markiert die neue geistesgeschichtliche Situation, in welcher sich die Tagung "Rosmini und die deutsche Philosophie" situiert. Dabei war es deren Intention, zum ersten Mal überhaupt Rosmini mit dem deutschen Denken selbst ins Gespräch zu bringen und damit nun auch jene "inneren" Grenzen abzubauen, die in wesentlichen Aspekten kulturelle Grenzen darstellen. Eine grundlegende Fremdheit des katholischen Milieus Italiens der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts für das deutschsprachige Denken war schließlich von Anfang an der Hauptgrund der Nichtbeachtung der Rosminischen Denkform in Deutschland. Die Auseinandersetzung um "Rosmini und die deutsche Philosophie" bedeutet somit in erster Linie auch einen kulturellen und geistesgeschichtlichen Dialog: Experten Rosminis als Kenner der philosophischtheologischen Situation Italiens der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten in Auseinandersetzung mit Spezialisten des Denkens Kants und der Idealisten als der Exponenten der deutschen philosophischen Kultur jener Zeit. Damit wurde ein deutsch-italienischer kultureller Dialog initiiert, der Rosmini als "Dialogfi-
8
Markus Krienke
gur" bzw. "Brücken bauer" europäischen Ranges herausstellt. Gerade dieser Dialog verspricht für die aktuellen philosophisch-theologischen Probleme und Herausforderungen neue Lösungsmöglichkeiten, denn er entdeckt im Denker Rosmini in charakteristischer Weise das Aufeinandertreffen von Tradition und Modeme, von scholastischem Denken und neuzeitlicher Philosophie. Rosmini stellt sich mit seiner Denkform an die Stelle jenes zentralen europäischen Umbruchs, der sich heute einmal mehr als Zentralfrage europäischer Identität erweist. Die Beschäftigung mit der rosminischen Rezeption der "deutschen Philosophie" vollzog sich während der Tagung methodisch in drei Etappen: In einem ersten Anlauf wurde die Bedeutung Rosminis für das deutschsprachige Denken herausgearbeitet, indem die Präsenz Kants und der Idealisten im Rosminischen Werk kritisch unter die Lupe genommen wurde. Damit wurden die aktuellen Forschungstendenzen der Rosminiforschung nach dem "Rezipienten" Rosmini befragt. Denn Voraussetzung jeder wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist zunächst die materiale Basis. Die einzelnen Beiträge der ersten Sektion verstehen sich damit als Vorarbeiten und erste Sondierungsversuche für die noch anzugehende umfassende Exegese der Rosminischen Schriften, deren Ziel es ist herauszustellen, nicht nur welche Werke Rosmini von Kant und den Idealisten gekannt hat, sondern vielmehr, welches tatsächliche Verständnis er von diesen erlangte. Denn bereits aus einer kurzen Durchsicht der Indizes der Rosminischen Schriften ergibt sich durchaus eine breite Kenntnis, die dieser von den Werken der "deutschen Denker" seiner Zeit besaß; um jedoch sein reales Verständnis zu ermitteln, müssen darüber hinaus alle direkten und indirekten Verweise auf diese interpretiert werden, wie sie sich aus seinen Schriften ergeben. Im nächsten Schritt folgte am zweiten Sitzungstag eine kritische Interpretation dieser Bestandsaufnahme aus der Sichtweise der "deutschen Philosophie"; als Kriterium diente das Denken Kants und der Idealisten. Hier ging es um den "Interpreten" Rosmini, sodass die Ebene der reinen Interpretation am Rosminischen Text verlassen und die deutschsprachige Geisteswelt mit einbezogen wurde. Über die "objektive" Bestandsaufnahme des ersten Schrittes hinaus ist diese zweite Frage damit weiterführender und wertender Art, ob nämlich eine solche Rezeption auch unter heutigen systematischen Ansprüchen noch als relevant bezeichnet werden kann. Auch hier geht es in den Beiträgen um die Eröffnung eines zukünftigen Dialogfeldes, das in die Frage nach Rosminis "Verständnis" Kants und des Idealismus auch stets die kulturelle Situation wie auch das eigene Denkanliegen Rosminis mit einbezieht. Das dritte Anliegen der Tagung, das den dritten und letzten Tag der Arbeiten beschäftigte, bestand in einer nochmaligen Ausweitung des Diskussionsthemas: Ausgehend von den kritischen Interpretationen wurde nach der Relevanz der "Autorität" Rosmini für das gegenwärtige Denken sowie nach weiterreichenden Perspektiven gefragt. Wie steht es um die Möglichkeiten der Versuche einer
Vorwort
9
Neubegründung von "Metaphysik" im Rahmen einer "christlichen Philosophie" des 21. Jahrhunderts? Es geht mithin darum, in der zukünftigen Diskussion stets den aktuellen Bezug der Fragestellung wachzuhalten, ob nämlich der spekulative Versuch Rosminis für die "christliche Philosophie" und die Theologie der Modeme argumentativ tragfahige Grundlagen bereitzustellen vermag. Anhand dieser Themenstellung soll damit die mittlerweile fast zum "Allgemeinplatz" gewordene Formel, nach der Rosmini ein vorwärts gerichteter Denker ist, der nicht nur wesentliche Errungenschaften der Theologie des 20. Jahrhunderts vorweggenommen hat, sondern auch als Denker des 21. Jahrhunderts 2 oder des dritten Jahrtausends 3 apostrophiert wird, einer kritisch-nüchternen Überprüfung unterzogen werden. Es gilt zu betonen, dass sich die drei Perspektiven nicht rigoros voneinander trennen lassen, sondern vielmehr stets ineinander greifen. Gerade in dieser Zusammenführung der drei Dimensionen bestand das Interesse der Tagung. Damit die in den drei Sitzungstagen erarbeiteten Ergebnisse als Grundlage für eine neue deutsch-italienische Diskussion herangezogen werden können, wird der Tagungsband in Kürze auch in italienischer Sprache erscheinen. Als Organisator der Tagung und Herausgeber dieses Tagungsbandes ist es mir an dieser Stelle ein Anliegen, in erster Linie Frau Dr. Christiane Liermann, Vizeleiterin der "Villa Vigoni", für ihre tatkräftige Mithilfe bei der Organisation und Durchführung des Symposiums zu danken. Über die Gewährleistung des Ablaufes "vor Ort" hinaus stand sie mir von Anbeginn der Planung an mit Rat und Tat zur Seite. Als weitere "Mentoren", die mich in diesem Unternehmen unterstützt haben, danke ich Herrn Priv.-Doz. Dr. Martin Thurner als zwischenzeitlicher Lehrstuhlvertreter und Herrn Prof. Dr. Christian Schäfer als Lehrstuhlinhaber des Lehrstuhls für Christliche Philosophie der LudwigMaximilians-Universität München herzlich. Herrn Prof. Dr. Aldo Venturelli, dem Leiter der "Villa Vigoni", danke ich für die Gastfreundschaft während der Konferenz. Herrn Dr. Tommaso Perrone, Herrn Dr. Johannes Gierlich und Frau Anne Gierlich bin ich für ihre tatkräftige Hilfe bei der "technischen" Gewährleistung des Symposiums zu Dank verpflichtet (Übersetzungen, Grafik, Internet). Viele weitere Helfer standen mir mit Rat und Tat zur Seite: Frau Eleni Gaitanu (Sekretariat des Lehrstuhls für Christliche Philosophie), Herr Dr. Salvatore Muscolino (Universität Palermo), Herr Dr. Gian Luca Sanna (Universität Cagliari). 2
Vgl. Rosmini - Wegbereiter für die Theologie des 21. Jahrhunderts, Themenheft
112005 der Münchener Theologischen Zeitschrift, Jg. 56, 1- 96.
3 Vgl. Iva Höllhuber, Antonio Rosmini: Der Philosoph des Dritten Jahrtausends, in: ders., Philosophie als Prae-Eschatologie, Innsbruck 3 1999, 348-382; Peter-Hans Kalvenbach, Rosmini: un prophete pour le 3e millenaire?, in: Filosofia oggi 20 (1997) 417421.
10
Markus Krienke
Für die finanzielle Sicherstellung des Ablaufs der, Tagung sowie der Publikation dieses deutschsprachigen Tagungsbandes danke ich den Sponsoren Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fritz Thyssen Stiftung, Pfarrer-Elz-Stiftung (Kath.-Theol. Fakultät der LMU München), der Münchener Universitätsgesellschaft und dem Lehrstuhl für Christliche Philosophie der LMU München. Weiterhin bin ich den Übersetzern Frau Dr. Christiane Liermann, Frau Dr. Ines Antulov-Konrad, Herrn Dr. Raimund Senoner, Herrn P. Plazidus Hungerbühler OSB und Herrn Giovanni Spandri zu Dank für die Übertragung der italienischsprachigen Beiträge ins Deutsche verpflichtd. Für die Verwirklichung dieses Tagungsbandes danke ich dem Verlag Duncker & Humblot, der diesen Band dankenswerterweise in die Reihe "Philosophische Schriften" aufgenommen hat. Im Besonderen möchte ich Herrn Dr. Florian R. Simon, Frau Brose und Herrn Hartmann für die Zusammenarbeit bei der Veröffentlichung hervorheben. Alle Freunde, Förderer und Unterstützer dieses Projekts tragen einen bedeutenden Anteil an dem Bestreben, das Interesse an Rosmini in Deutschland weiter zu befördern, bezüglich dessen bereits im Jahr 1839 der Rezensent in den Historisch-politischen Blättern geäußert hat: "So wünschte ich sehr, daß die Werke Rosminis, dieses christlichen Denkers, dessen philosophische Werke wohl den Höhepunkt der heutigen italienischen Literatur in diesem Gebiete bilden, in unserem, fiir geistige Anregungen so empfanglichen Deutschlande bekannter werden mochten"s.
MünchenNenezia, im Januar 2007
Markus Krienke
4 Die Übersetzungen wurden im Einzelnen angefertigt von: Ines Antulov-Konrad (Artikel Paolo De Lucia, Maria Luisa Facco, Giuseppe Lorizio), Plazidus Hungerbühler (Artikel Fulvio De Giorgi, Pier Paolo Ottonello), Christiane Liermann (Artikel Francesco Traniello) Markus Krienke (Artikel Juan Francisco Franck, Umberto Muratore, Salvatore Muscolino, Giulio Nocerino, Franco Percivale, Silvio Spiri), Raimund Senoner (Artikel Carlo Maria Fenu, Gaetano Messina, Anna Maria Tripodi), Giovanni Spandri (Artikel Luciano Malusa). Alle Übersetzungen wurden vom Herausgeber zweitbearbeitet. Die Übersetzungen der Rosmini-Zitate wurden, soweit die Rosminischen Werke noch nicht ins Deutsche übertragen sind, von den Übersetzern in Zusammenarbeit mit dem Herausgeber angefertigt. Für die Methodik der Übersetzung sei verwiesen auf Markus Krienke, Antonio Rosmini in Deutschland, in: Michele Dossi, Antonio Rosmini. Ein philosophisches Profil (= Ursprünge des Philosophierens, Bd. 6), Stuttgart 2003, 939, hier 31 - 39. S [0. Verf], Notiz, in: Historisch-politische Blätter fiir das katholische Deutschland 3 (1839) 127 f., hier 127 f.
Inhaltsverzeichnis
Markus Krienke
Rosmini und die deutsche Philosophie. Stand der Forschung und Perspektiven
15
Bibliographie . . . . . . . .. . .. .
77
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
87
Erster Teil: Die Präsenz Kants und der deutschen Idealisten im Rosminischen Werk
FuMo De Giorgi
Der junge Rosmini: sein Interesse für die deutsche Kultur und für Kant .
97
Gaetano Messina
Die Definition der analytischen und synthetischen Urteile in der Kritik der reinen Vernunft Kants und im Nuovo Saggio Rosminis . . . . . . . . 111
Umberto Muratore
Der Einfluss Kants auf die Rosminische Moralphilosophie. . . . . . . . . . . . 147
Carlo Maria Fenu
Die "kritische Rezeption" Kants und des deutschen Idealismus von den Jugendwerken bis zur Teosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Pier Paolo Ottonello
Kant und der deutsche Idealismus in der Teosofia und im Saggio storico critico sulle categorie Rosminis . . . . . . . . . . . . . 197
Franeo Percivale
Rosminis Bezugnahmen auf die deutsche Philosophie im Epistular . . . . . . . 209
Maria Luisa Facco
Leibniz im Denken Rosminis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
12
Inhaltsverzeichnis
Zweiter Teil: Kritische Diskussion der Rosminischen Rezeption
Giovanni B. Sala
Rosmini als Kritiker der Erkenntnislehre Kants. . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Friedo Ricken
Freiheit und Gesetz. Rosminis Kritik an Kants Moralphilosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
luan Francisco Franck
Der Rosminische Begriff der Moral zwischen Autonomie und Heteronomie. Kants Selbstkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Harald Schändorf
Rosminis Kritik an Fichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
Wilhelm G. lacobs
Das "Ich" in Schellings Philosophie und in Rosminis Rezeption . . . . . . . . . 325
SiJvjo Spiri
Rosminis und Hegels Begriff der Dialektik. Eine Gegenüberstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Luciano Malusa
Der Vorwurf der Kompromittierung durch das modeme und insbesondere durch das deutsche Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Dritter Teil: Die Bedeutung Rosminis für das nachhegelianische Denken
Salvatore Muscolino
Person und Staat bei Rosmini und Kant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Francesco Traniello
Die Wundmale des Gekreuzigten als Paradigma für die Geschichte der Kirche . 403
Giuseppe Lorizio
Die Offenbarung zwischen Theologie und Philosophie: Rosmini und Schelling. "Offenbarendes Denken" und "intellektuelle Anschauung". . . . . . . . . . . . 415
lanRohls
Rosmini, Hegel und die Metaphysik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Klaus Müller
Etwas " ... für die starken Intellekte". Metakritische relecture zu Rosminis Hegelkritik . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Inhaltsverzeichnis
13
Michael Schulz
L'essere iniziale. Antonio Rosminis Auseinandersetzung mit Hegels erstphilosophischem Ansatz und die begrundungstheoretische Notwendigkeit der Ontologie für christliches Denken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Giulio Nocerino
Ist Metaphysik nach Hegel möglich? Die Kritik Rosminis an der Hegeischen Seinslehre . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Anna Maria Tripodi
Die Kraft der Wahrheit, der Mut der Vernunft - Rosmini nach Kant und Hegel. 519
Paolo De Lucia
Das Ich zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. Rosmini nach Hegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Autorenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Rosmini und die deutsche Philosophie Stand der Forschung und Perspektiven Von Markus Krienke
I. Die Fragestellung im Rahmen ihrer Wirkungsgeschichte An der Frage der Verhältnisbestimmung zwischen der philosophischtheologischen Gesamtspekulation Rosminis und dem Kantischen Transzendentalismus bzw. dem deutschen Idealismus scheint sich die Bedeutung von Denken und Werk Antonio Rosminis überhaupt zu entscheiden. Diese Behauptung basiert auf drei Indikationen - Beobachtungen -, welche die Rosminiforschung der letzten Jahrzehnte zwar sukzessive ans Licht gebracht hat, deren Bedeutung sie sich allerdings noch nicht bis ins Letzte bewusst geworden ist: nämlich dass zunächst (I) Kant und der Idealismus bereits wesentliche Referenzpunkte Rosminis bei der Herausbildung und auch Weiterentwicklung seines Denkens - bis hin zur Teosofia - darstellen; dass sie dadurch (2) im ganzen Rosminischen Werk an den wesentlichen Stellen präsent sind und nicht nur marginal auftauchen; und dass es aus diesem Grund nicht verwunderlich ist, sondern geradezu die philosophiegeschichtliche Konsequenz darstellt, dass (3) die Verhältnisbestimmung des Rosminischen Denkens zu den Hauptvertretern des "deutschen Denkens" seiner Zeit die zentrale Fragestellung der nunmehr ISO-jährigen Wirkungsgeschichte Rosminischer Philosophie bildet. Während die beiden ersten Teilfragen die Bedeutung der Problemstellung "Rosmini und die deutsche Philosophie" begründen und somit ihre "Wirkungsgeschichte" evozieren, ist es die dritte Teilfrage - diejenige nach der "Wirkungsgeschichte" selbst -, die den systematischen Ort dieser Tagung bestimmt, da sie nämlich historisch erklärt, warum diese Frage überhaupt zu einem philosophischen Problem geworden ist und dies auch heute noch darstellt. Aus den soeben angedeuteten Überlegungen heraus möchte ich mit der Erörterung der wirkungsgeschichtlichen Teilfrage die Tagung eröffnen. Die beiden erstgenannten Teilprobleme werden dann Gegenstand der folgenden Beiträge der ersten Tagungseinheit sein. Die Standortbestimmung dieser Tagung mittels der Analyse und Interpretation der verschiedenen Positionen, die im Lauf der letzten ISO Jahre zu dieser Thematik eingenommen worden sind, werde ich im Folgenden unter Zugrunde-
16
Markus Krienke
legung eines vierphasigen Schemas vorzunehmen versuchen, wobei die einzelnen Phasen weniger durch exakte Jahreszahlen voneinander abgegrenzt werden können, sondern eher fließend ineinander übergehen 1. Es versteht sich, dass fur die Rechtfertigung eines Phasenübergangs keine quantitativen Erwägungen ausschlaggebend sein können, sondern ein wirklicher Paradigmenwechsel in der Interpretation der Stellung Rosminis zum Denken Kants und des Idealismus gefordert ist. Daher wird sich die folgende Untersuchung gerade um die Herausarbeitung und gegenseitige Abgrenzung solcher Interpretationsparadigmata bemühen. Diese wiederum finden ihre Anhaltspunkte in der philosophiehistorischen Untersuchung der entsprechenden Texte. Je nach dem, wie man die vorgeschlagene wirkungsgeschichtliche Interpretation wertet, mag sich natürlich die Bedeutung der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" unterschiedlich entscheiden. Wer allerdings dieser Interpretation etwas abgewinnen kann, dem wird sich die Dringlichkeit der Thematik dieser Tagung auf völlig neue Weise erschließen. Die erste Phase meiner vorgeschlagenen Schematisierung bezieht sich auf die Auseinandersetzungen noch zu Lebzeiten Rosminis. Etwa zeitgleich mit seinem Tod hebt die zweite Phase an, die bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts reicht, also ca. ein ganzes Säkulum umfasst. Diese geht dann peu apeu in die dritte Phase über, die sich kontinuierlich bis in unsere Tage hinein fortentwickelt hat. Wirkungsgeschichtlich präsentiert sich die Tagung selbst an der Schwelle eines Epochenübergangs, der sich in seinen systematischen Anzeichen seit dem Rehabilitierungsdokument aus dem Jahr 2001 beobachten lässt, wobei sich entsprechende Tendenzen m. E. in einer kritischen Durchsicht durch die neuesten Studien verifizieren lassen. Indem die Tagung diese Anzeichen aufgreift, sie kritisch auf den Begriff bringt und sie im Dialog mit der "deutschen Philosophie" neu zu beantworten versucht, erarbeitet sie für die zukünftige Forschung eine neue konzeptionelle Basis und realisiert gewissermaßen selbst diesen Epochenwechsel. Um diesem Anspruch zu genügen, muss es allerdings gelingen, eine neue Methodik und Zugangsweise zur Problematik "Rosmini und die deutsche Philosophie" herauszustellen und als in Ansätzen praktikabel zu erweisen. Keiner geringeren Herausforderung sehen die kritischen Beiträge dieser Tagung entgegen.
1 Angesichts der Fülle der Probleme und Lösungsmöglichkeiten, die im Lauf der letzten eineinhalb Jahrhunderte ausgearbeitet worden sind, muss ich mich in dieser historischen Nachzeichnung der großen Interpretationslinien der Problematik von "Rosmini und die deutsche Philosophie" auf die signifikantesten Repräsentanten eines jeden Stadiums beschränken.
Rosmini und die deutsche Philosophie
17
11. Systematische Analyse der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" 1. Erste Phase: Die Auseinandersetzungen um das Denken Rosminis zu seinen Lebzeiten Bereits die Veröffentlichung seines ersten philosophischen Hauptwerkes, des
Nuovo Saggio sulJ'origine delle idee (1830), erbringt Rosmini den vollberech-
tigten Eintritt in die zeitgenössische philosophische Diskussion. Nach dieser Veröffentlichung ist er nicht deswegen in aller Munde und erregt in der italienischen Geisteswelt großes Aufsehen, weil er Augustinus und Thomas von Aquin - deren Bedeutung für das Rosminische Denken hier keineswegs geschmälert sein soW - darin mehr zitiert als alle anderen Autoren, sondern weil sich seine Interpretation gegen die noch in den Kinderschuhen steckende Lesart Kants und des Idealismus seines kulturellen Umfeldes Italiens in dem wohl entscheidenden Punkt absetzte, eine tendenziell sensualistische Auslegung Kants endgültig hinter sich zu lassen 3. Es sei an diesem Punkt nur andeutend darauf hingewiesen, dass das Kantische Denken in Italien auf eine noch weitgehend vom französischen Sensualismus des 18. Jahrhunderts geprägte Philosophie traf'. 2 Vgl. zu den zahlreichen Stellen, in denen Rosmini Augustinus und Thomas seine Hochachtung entgegenbringt, nur die folgende Aussage, in der er rückblickend zu seinem Verhältnis zu dem Aquinaten bemerkt: "Ich sage zu dem, was Sie meinen, nur, dass ich nicht in allem Thomas folge. Wenn ich den heiligen Doktor als meinen maßgeblichsten Lehrer verehre, bin ich noch lange nicht dazu verpflichtet, ihm auch in allem zu folgen. Dennoch folge ich ihm auch manchmal dort, wo es aufgrund der verschiedenen Ausdrucksweise nicht so scheint" (Brief an A. Dadone vom 13.01.1848, in: ECX, 223). 3 Mit dem Erscheinen des Nuovo Saggio wird daher ein Epocheneinschnitt erkannt: Miche!e Federico Sciacca, 11 pensiero italiano nell'eti dei Risorgimento (= Opere complete di Micheie F. Sciacca, Bd. 19), Milano 2 1963, 119; Franeo Zambelloni, Le origini dei kantismo in Italia (= Studi sul pensiero filosofico e religioso dei secoli XIX e XX, Bd. 20), Milano 1971,268, Anm. 176. 4 Vgl. hierzu exemplarisch die Kantrezeption Francesco Soaves (1743-1806) und Pasquale Borellis (1782-1849): Soave, mit dem an der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert die Kantrezeption in Italien einsetzt, lehnte die Kantische Philosophie als eine "philosophische Poesie oder Phantasterei" ab, da er die empirische Wahrnehmung auf die reine "subjektive Form" zurückfiihre und damit den subjektiven "Illusionen" preisgebe: "Die empirische [sperimentale] Philosophie ruht auf soliden und realen Fundamenten auf. So ist nur sie die wahre Philosophie; und die Transzendentalphilosophie Kants findet einzig in der Logik der Träume oder Chimären einen Anhaltspunkt" (Francesco Soave, La filosofia di Kant esposta ed esaminata, Modena 1803,69,60, 106; zu den Rezeptionsversuchen vor Soave, die allerdings nicht "nennenswert" seien, vgl. Emi!io Chiocchetti, La critica della "ragion pura" nella filosofia dei Galluppi edel Rosmini (Note), in: Agostino Gemelli [Hg.], Immanuel Kant (1724--1924). Volume commemorativo deI secondo centenario della nascita [= Pubblicazioni della Universiti Cattolica dei Sacro Cuore, Bd. 1,7], Milano 1924, 59- 95, hier 61). Borelli sah in seiner philosophisch wie philologisch anspruchsvollen Kantkritik das apriorische Instrumenta-
18
Markus Krienke
Rosrninis Studienaufenthalt arn Paduaner Atheneurn machten ihn jedoch nicht nur bereits früh mit der deutschsprachigen Kultur vertraut, sondern ermöglich-
rium Kants flir die Erklärung der menschlichen Erkenntnis als letztlich überflüssig an und verwies auf die stringenteren Erklärungsmöglichkeiten, die diesbezüglich der Empirismus biete (vgl. Pirro Lallebasque [Pasquale Borelli), Introduzione alla filosofia naturale dei pensiero, Lugano 1824, 57-59), gleichwohl über Locke darin hinausgehend, eine eigene Urteilskraft zu fordern, die dem Menschen als solchem, als autonome Kraft zukomme. Soave, Tamburini und Borelli, die das Paradigma der italienischen Kantrezeption in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts verdeutlichen, sind nur pars pro toto und so mag zwar die berühmt gewordene Behauptung Melchiorre Gioias, "J'Italia non s 'inkanta" (1822) (zit. in: Gaetano Capone Braga, La filosofia francese e italiana dei Settecento. Parte seconda, 2 Bde. [= Problem i d'oggi, Bd. 8], Padova 1942, 215, Anm. 1) insofern als "unzutreffend" (Gisela Schlüter, Die Anfange der italienischen Kant-Rezeption: Forschungsbilanz mit einem Exkurs zu Vincenzo Mantovanis KantÜbersetzung (1820/22), in: Peter Ihring 1 Friedrich Wolfzettel [Hg.], Deutschland und Italien. 300 Jahre kultureller Beziehungen, Berlin 2004, 64-93, hier 73) gekennzeichnet werden, als in den ersten Jahrzehnten das Kantinteresse in Italien sprunghaft anstieg, doch behält diese nach einer sorgfältigen Durchsicht der italienischen Kantrezeption bis 1830 insofern ihre Berechtigung, als man in Rechnung stellt, dass dieses Interesse noch weitgehend von einer sensualistischen Kritik an Kant geprägt war. In diesem Sinne scheint Zambelloni im Erscheinungsjahr des Nuovo Saggio Rosminis (1830) gewissermaßen das Wendejahr von einer sensualistischen hin zu jener spiritualistischen Kantrezeption, wie sie dann das Risorgimento kennzeichnete, zu erkennen (vgl. Zambelloni, Le origini, 268, Anm. 176, mit Verweis auf Giovanni Gentile, der in seinem Werk Rosmini e Gioberti formuliert: "Mit den erkenntnistheoretischen Fragestellungen bzw. mit dem Problem des Bewusstseins, wie es von Kant formuliert worden war, lebt nun auch in Italien die Philosophie wieder auf, hauptsächlich dank des Nuovo Saggio Rosminis" [Rosmini e Gioberti. Saggio storico critico sulla filosofia dei Risorgimento {= OC, Bd. 25}, Firenze 31958, S. 56]). Bis dahin habe man die Linie Aristoteles-Bacon-GalileiLocke als die Fortflihrung der authentischen ital(ien)ischen Tradition betrachtet (vgl. Zambelloni, Le origini, 265), welche Interpretation bei Vincenzo Cuoco grundgelegt wird und auch bei Paolo Costa zum Ausdruck kommt. Das Paradigma dieser Rezeption kann als ein fundamentaler Empirismus, der zur Beschreibung des geistigen Vermögens und der Ideen durch platonische Elemente "veredelt" wird, bezeichnet werden (vgl. ebd. 106--112,264 f.). Rosmini, so Gentile und Zambelloni, sei es gelungen, dieses Paradigma wirksam zu überwinden und damit zu einer der Zentral figuren einer neuen Kantinterpretation in Italien zu werden. Die Übergänge sind gleichwohl fließend und so finden sich Anklänge an das erstere Interpretationsparadigma auch noch im Nuovo Saggio wieder, wenn man beispielsweise an Rosminis Kommentierung des Beginns der Kritik der reinen Vernunft (B 1) denkt, die er in NS 302, Anm. 91 durchführt. Als Vorläufer von Rosminis neuer Kantrezeption können in gewisser Weise Gioia, Baldinotti, Romagnosi und selbstverständlich Galluppi angesehen werden (ebd. 270), wenn es diesen auch nicht gelang, den Sinn der Kantischen Synthetizität des Intellekts zu erfassen (vgl. Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana, 3 Bde., Torino 31966, III, 1070; vgl., insbes. zu Galluppi, ebd. 1078-1089). Galluppis Ausrichtung an Condillac löst bei dem calabresischen Denker jedoch die Phase einer intensiven Kantrezeption ab; wenn aber, wie Garin analysiert, "dieser Antikantismus [empiristisch-sensualistischer Art] nicht
Rosmini und die deutsche Philosophie
19
ten es ihm auch, mit einem der damals angesehensten Rezipienten des Kantisehen Denkens, Cesare Baldinotti, in näheren Kontakt zu treten 5 • Die Auseinjenen vorausgehenden Kantismus ausschließt", dann kann nicht nur "das Galluppische Apriori nicht identisch [sein] mit jenem der Empiristen und seine Synthetizität nicht mit jener der Lockianer" (ebd. 1085; vgl. auch das Urteil Bertrando Spaventas, La filosofia di Kant e la sua relazione colla filosofia italiana, in: ders., Opere, 3 Bde. [= Classici della filosofia, Bd. 12], hg. von Giovanni Gentile, Firenze 1972, I, 173-255, hier 192), sondern dann ist auch die Frage nach dessen Erfassung der Kantischen Synthetizität zu stellen. Für Galluppi geht die Analyse der Synthese voraus; die "ideale Synthesis" (sintesi ideale) beruht stets auf der "realen Synthesis" (sintesi reale). Der Kantische Transzendentalismus ist somit nicht in die Grundstruktur seines Denkens eingegangen, wie durch die immer wieder zitierte autobiographische Notiz Galluppis bestätigt wird: ,,[ ... ] die Kenntnis dieser Philosophie [Kants] beeinflusste also nicht den Gang meiner Studien" (Pasquale Galluppi, Note autobiografiche [Tropea, 15.08.1822], in: ders., Lettere filosofiche su le vicende della filosofia relativamente a' principii delle conoscenze umane da Cartesio a Kant inclusivamente, hg. von Giulio Bonafede, Palermo 1974,389-391, hier 390). Stellt man dem das Kantverständnis Rosminis gegenüber, so mag man mit Spaventa zu dem Schluss kommen: "Rosmini hat die Problemstellung wesentlich besser erfasst und gelangte so, genauso wie Kant, zur Erkenntnis, dass ein Intellekt ohne Form kein wirklicher Intellekt ist. Wäre darüber hinaus seine Darstellung des philosophischen Prinzips bei Kant richtig, müsste man sagen, dass er ihn mit einem höheren Prinzip kritisiert hat. Da Rosmini eine Form im Intellekt annahm, nahm er zwangsläufig auch synthetische Urteile apriori an, denn das eine ist vom anderen nicht zu trennen [00']' Doch sagt er, sie in einem anderen Sinn als Kant anzunehmen, d. h. im wahren Sinn. Dies gilt es aber erst noch zu zeigen" (Spaventa, La filosofia di Kant, 193; vgl. 239). Im Gegensatz zu Galluppi habe Rosmini, so das Urteil Gentiles, das "wesentliche Prinzip des neuzeitlichen Idealismus" eingesehen, und somit sei der Nuovo Saggio als "eines der Bücher" zu bewerten, "die - um es mit den Deutschen zu sagen - epochemachend sind", insofern es die "neue italienische Philosophie" grundlege (Giovanni Gentile, Il pensiero italiano dei secolo XIX, in: ders., Frammenti di filosofia, [= Bd. 51-52], Firenze 1994, I, S.59-79, hier 72). Wenn sich auch die italienischen Neoidealisten dessen bewusst waren, was Garin in seiner Analyse herausstellt (und worin er sein Urteil wiederholt, das er bezüglich aller vorausgehenden italienischen Kantrezeptionen gefällt hat; vgl. Garin, Storia, III, 1119), nämlich dass Rosmini einem grundlegenden Missverständnis der Kantischen Synthesis aufliege, so erkennen sie doch in der Rosminischen Interpretation etwas fundamental Neues - etwas, das so fundamental ist, dass bei Rosmini der eigentliche Beginn der italienischen Kantrezeption zu erkennen ist. Ein weiterer Denker, der zur Bewertung der Rosminischen Kantrezeption berücksichtigt werden muss, ist Giandomenico Romagnosi, dessen Denken als der "Höhepunkt der italienischen ideologischen Philosophie der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts" bezeichnet wurde (lvo Höllhuber, Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfängen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, München/Basel 1969, 30). Rosminis Auseinandersetzung mit diesem im Rinnovamento ist weitgehend von Polemik geprägt - dennoch kann eine nähere Betrachtung derselben einige interessante Ergebnisse zeitigen, wie z. B. dass bereits bei Romagnosi die Unterscheidung von "Notionen, die aus Mangel oder aus Übertreibung fehlgehen" auftaucht (Gian Domenico Romagnosi, Della suprema economia deli' umano sapere in relazione alla mente sana, Milano 1828, 136 [II, par. 32]; vgl. NS 221 i. V. m. 26). Romagnosi siedelt die Erkenntnis zwischen reiner Rezep-
oe,
20
Markus Krienke
andersetzungen mit Baldinotti wie auch seine rudimentäre Kenntnis der deutschen Sprache ermöglichten ihm in der Folgezeit seine im damaligen Kontext
tivität und absolutem Schaffen bzw. absoluter Setzung an. Erkenntnis sei demzufolge ein drittes Moment synthetischer Natur, das zwischen den beiden vorausgehenden Momenten der Natur und des Geistes anzusiedeln sei. Vor diesem Hintergrund konstatierte bereits Capone Braga, dass Romagnosi "die besten Voraussetzungen besaß, um die Kantische Lehre zu verstehen" (Capone Braga, La filosofia francese, II, 215). Doch blieb er mit diesen Analysen ob seines Interesses an einer "Gesellschaftsphilosophie" (civile filosofia) und dem "tatsächlichen Menschen" (uomo di fatto) an der Oberfläche (vgl. Romagnosi, Della suprema economia, 122-130 [II, par. 29 f.], hier 123, 127). Ein letzter Blick sei auf die Situation der zu Rosminis Zeit in Italien verfügbaren Kantübersetzungen geworfen. In den Jahren 1796- 98 veröffentlichte Friedrich Gottlob Born die vierbändige Sammlung Immanuelis Kantii Opera ad philosophiam criticam, Leipzig, deren erster Band die lateinische Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft enthält. Diese Übersetzung spiegelt den philosophischen Hintergrund, auf den die Kantische Philosophie in dieser Zeit in Italien traf, wieder, woraus sich auch ein entsprechendes Kantverständnis Rosminis vor 1827 erklärt. Die erste italienische Übersetzung der Kritik der reinen Vernunft von VincenzoMantovani (1820-1822), die Rosmini ebenfalls benutzte, kann, wie Credaro gegen Werner (vgl. Kar] Werner, Kant in Italien, Wien 1881, 3) nachweist, jedoch keinesfalls als Beginn eines authentischen Kantverständnisses in Italien angesehen werden. Diesen erkennt Credaro vielmehr in der Rezeption Tissots durch Alfonso Testa (vgl. Luigi Credaro, Alfonso Testa e i primordi dei kantismo in Italia, Catania 1913,89-91, 147; a. A. freilich Capone Braga, La filosofia francese, II, 215, Anm. 2; zur Konfrontation Rosmini-Testa vgl. unten Anm. 20). Dabei äußert er die Vermutung, dass Testa überhaupt durch das Studium des Nuovo Saggio die Bedeutung des Kritizismus verstand (ebd. 80, 111). Rosmini bedeute seinerseits gegenüber Galluppi in der Kantinterpretation einen wirklichen Fortschritt (vgl. ebd. 98). Und auch wenn Rosmini, Credaro zufolge, die Epoche machende Bedeutung Kants im Grunde nicht verstanden habe (ebd.), hebt dieser ihn dennoch aus jener in Italien verbreiteten Interpretation heraus, die aufgrund der sensualistischen Lesart überhaupt nicht zum Verständnis des Kantischen Kritizismus gelangt sei und somit auf eine "dogmatische" Kantrezeption hinauslaufe (vgl. ebd. 101 f.). 5 Wiewohl Baldinottis Rezeption wesentlich an dem auch seinen Vorlesungen zugrunde liegenden Werk Francesco Soaves, Istituzioni di Logica, Metafisica ed Etica (6 Bde., Napoli 1800; vgl. 5 Bde., Venezia 2 1811), entlang ausgerichtet war, resultierte Kant auch in dessen Urteil skeptisch und dogmatisch (vgl. Cesare Baldinotti, Tentaminum metaphysicorum libiri tres, Patavii 1817, Bd. 1. Oe Metaphysica generali, § 921 [396]) - in dieser Kritik übrigens mit Galluppi übereinkommend (vgl. Garin, Storia, 1079), was soviel bedeutet, wie dass Kant nicht wirklich die Synthese aus Empirismus und Rationalismus gelungen sei; oder aber, dass weder Baldinotti noch Galluppi wirklich die Kantische Synthese verstanden haben (vgl. auch Garin, Storia, 1089; Credaro, Alfonso Testa, 96). Zu diesem Urteil gelangte bereits Chiocchetti, der nach einer kurzen Durchsicht des Tentaminum metaphysicorum bemerkte: "Die Kritik ist kurz und arm" (Chiocchetti, La critica, 63, Anm. 2). Erst auf dieser sensualistischen Ausgangsposition konzipiert er die Vernunft, die für ihn - platonisch - auf das Mögliche, die universalen,
Rosmini und die deutsche Philosophie
21
als fortschrittlich angesehene Kantinterpretation, welche ihm sogar die Anerkennung Vincenzo Giobertis einbringt, der sich mit Rosminis Kantinterpretation gänzlich übereinstimmend erklärt6 . notwendigen und ewigen Ideen ausgerichtet ist (Cesare Baldinotti, De recta humanae
mentis institutione Libri IV, Ticini 1787, IV, 174-188 [cap. II: "De Ratione"J). Dies begründet, nach der sensualistischen Kritik der transzendentalen Ästhetik, eine platonisierende Interpretation der transzendentalen Logik, Von Interesse könnte sich in diesem Zusammenhang Rosminis Austausch mit Luigi Bonelli (1797-1840), der am Seminario Romano Physik und Philosophie lehrte, erweisen. Gerade in den Jahren, die der Abfassung des Nuovo Saggio vorausgehen und in denen Rosmini seine für dieses Werk entscheidenden Kantstudien durchführt, steht er mit Bonelli in brieflichem Kontakt (vgl. den für die Genese der Rosminischen Philosophie wichtigen und in die Introduzione alla filosofia aufgenommenen Brief vom 1.10.1825 [in: IFS. 337-351]; vgl. zu Bonelli auch Luciano Malusa, Galluppi eRosmini: La storia della filosofia come necessario "complemento", in: Giovanni Santinello / Gregorio Piaia (Hg.), Storia delle storie genera li della filosofia, Bd. IV/2, Roma 2004, 275-386, hier 302-308). Wenn Bonelli in seinem Werk Della filosofia tedesca da Leibniz fino ad Hegel, Roma 1837, den Kant vorgeworfenen Skeptizismus auf jener "dogmatischen" Haltung Kants begründet, die reinen und subjektiven Formen nicht weiter zu begründen, sondern vorauszusetzen (vgl. ebd. 1820), dann findet sich dieses Argument bereits im Nuovo Saggio Rosminis (vgl., zum Vorwurf des Dogmatismus, NS 302, Anm. 91; zum "Beweismangel" Kants vgl. Rinnov 348). Vgl. dieses Paradigma noch bei Caviglione: "Rosmini machte sich die zeitlosen Wahrheiten Platons und des authentischen Kant zueigen, doch kann man ihn nicht bereits deswegen einen Platoniker oder Kantianer nennen, wenn er auch unzweifelhaft gewisse Analogien zu diesen aufweist" (Carlo Caviglione, Il vero Rosmini. Saggio e interpretazione, Voghera 1912, 50). M. E. ist somit zu erklären, dass Rosmini einerseits die Kantische Grundunterscheidung zwischen transzendentaler Ästhetik und transzendentaler Logik und die zentrale Bedeutung der urteilenden Synthesis deutlich erkannt hat (vgl. Spaventa), dann aber mit der Interpretation zweier integrierender Momente der Kritik der reinen Vernunft Probleme hatte, und zwar mit der spekulativen Durchdringung der Kantischen Synthesis einerseits und mit der Bedeutung der transzendentalen Ästhetik im Ganzen der Kritik andererseits, welche nicht als eigenständiger, der transzendentalen Dialektik vorgeordneter Teil zu verstehen ist, sondern für diese selbst integrative Bedeutung besitzt. Die Bedeutung Baldinottis für die Herausbildung der Rosminischen Denkform bezeugen beispielsweise Malusa, Galluppi eRosmini, 352 f.; oder auch Fulvio De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L'educazione dell'uomo moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833) (= Storia, Bd. 2), Brescia 2003, 91-93. Zur Beurteilung der Rosminischen Kantrezeption gegenüber Soave, Galluppi, Baldinotti und Testa vgl. auch Giovanni Gentile, Rosmini e Gioberti. Saggio storico sulla filosofia italiana dei Risorgimento (= Oe, Bd. 25), Firenze 31958, S. 205. 6 Von Gioberti ist der Ausspruch überliefert, in Rosmini sei jene philosophia prima, auf der die "sekundären Teile" (parti secondarie) der modemen Philosophien beruhten und die natürlich nicht die überkommene Metaphysik, sondern die "Psychologie zusammen mit jenem Teil der Ontologie, den man nicht von dieser scheiden kann", sei -, jene, die mit Pythagoras anhebe und von Cicero, Ficino, Bruno und Vico weitergeführt worden sei, "schließlich vervollkommnet" worden (Brief von V. Gioberti an C. Verga vom 23.12.1831, in: Vincenzo Gioberti, Epistolario, hg. von Giovanni Gentile und Gustavo Balsamo-CrivelJi, I1 Bde., Firenze 1927-1937, I, 72 f.).
22
Markus Krienke
Zentral für das Verständnis der Rosminischen Kantinterpretation ist die Kenntnis seiner Konzeption der idea deIJ'essere, die als der Schlüssel zum Erkenntnis- und Urteilsverständnis des Roveretaners angesehen werden muss. Die gleichzeitige Übereinstimmung wie auch grundlegende Differenz der idea dell 'essere und der sintesi primitiva zur Kantischen Kategorientafel und dessen synthetischen Urteilen apriori wurde in den ersten Reaktionen auf den Nuovo Saggio fast folgerichtig in genau jener Ambivalenz verstanden, welche diese schwierige Verhältnisbestimmung auf den ersten Blick zu evozieren scheint: So konnte die Grundstruktur Rosminischer Gnoseologie sowohl als eine Spielart der Kantischen Transzendentalphilosophie als auch als Missverständnis Kants seitens Rosminis interpretiert werden. In der Tat lassen sich die ersten Reaktionen auf den Nuovo Saggio diesen beiden Richtungen zuordnen. Auf der einen Seite steht stellvertretend zunächst Terenzio Mamiani della Rovere: Nachdem dieser von Gioberti selbst über die Rosminische Gnoseologie instruiert worden war, widmete er das elfte Kapitel seines Werkes DeI rinnovamento della filoso{ja antica italiana7 der Kritik an Rosmini. Unter dem Titel DeIJa forma unica e indeterminata di nostra mente concepita daIJ'Abate Rosmini individuierte er den seiner Meinung nach zentralen Rosminischen Fehler im Apriorismus dessen Form (idea delJ'essere), d. h. im "selben Fehler, der alle Systeme belastet,
7 Paris 1834. Mamiani hatte Gioberti während seines Exils in Paris kennen gelernt. Sciacca fasst das philosophische Profil dieser "berühmtesten aller politisch und philosophisch mittelmäßigen Gestalten des letzten Jahrhunderts" (Sciacca, Il pensiero italiano, 411) zwischen dessen Empirismus als Grundlage und Ausgangspunkt seines Denkens und dessen späterer Übernahme des Platonismus zusammen. Damit konfiguriert sich dieses in gewisser Weise exemplarisch für das italienische Denken der damaligen Zeit, das auf jenen "zwei Hauptwegen der Philosophie der Erfahrung [filosofia dell' esperienza] und der Seinsphilosophie [filosofia dell' essere], Empirismus und Ontologie" beruhte (ebd. 413; vgl. auch das Urteil Garins, Storia, 1107, bzw. bereits Werners, Kant in Italien, 58 f.). In diesem Zusammenhang sei auf die interessante Entwicklung V. Cuocos verwiesen, der in einer ersten, mit Soave gleichzeitigen Phase seines Denkens (1803) noch die charakteristisch empiristische Kantinterpretation aufwies: Kant, so Cuoco, habe nichts gesagt, was über den Lockeschen Empirismus hinausgehe (vgl. Vincenzo Cuoco, Nuovo principi di ideologia. Frammento (a proposito della Critica delJa ragion pura di Emanuele Kant) (1803), in: ders., Scritti vari, 2 Bde., Bari 1924, I, 297-302, bes. 299: "Kant hat also nichts [Neues] gesagt"). In einer späteren Phase ordnet er Kant jedoch in jene "antike" Tradition ein, die im Gefolge Platons "geistige und ewige Wahrheiten" aufgedeckt habe (ebd., I, 262 f. [Rezension aus dem Jahr 1805], hier 263; vgl. auch seine Rezension von 1807 an Pietro Ruggeri, in: ebd., II, 263 f., worin er diese Konsequenz der Philosophie als von der Lockeschen Theorie "weiter entfernt, als man glaubt", bezeichnet [264]). Zu dessen Kritik vgl. Umberto Tavianini, Una polemica filosofica dell' '800. T. Mamiani - A. Rosmini. Contributo alla Storia della Filosofia Italiana nel Secolo XIXo (= Il pensiero moderno, Bd. II,2), Padova 1955, 14-51 (freilich aus Sicht Mamianis und Rosmini einer platonisierenden Interpretation unterziehend).
Rosmini und die deutsche Philosophie
23
die von Fonnen des Geistes ausgehen, oder m. a. W. [in] der Unfahigkeit dieser [Systeme], jene Fonnen auf ein Außerhalb von uns zu beziehen"s. Daraus, dass Rosmini diese Fonn als eingeboren ansähe, missachte er das Lockesche Prinzip der Reflexion9 • Den daraus resultierenden Kantismus bzw. S Mamiani, Dei rinnovamento, 390. An dieser Stelle verwechsle Mamiani, so die Interpretation Carcuros, "die verschiedenen , Verstandesfonnen' transzendentaler und Kantischer Natur mit der einzigen objektiven Form" (Vita Carcuro, Polemiche filosofiehe antirosminiane. Terenzio Mamiani e Donato Jaja, Napoli 1982,23). 9 Vgl. Mamiani, Dei rinnovamento, 388; vgl. hierzu auch die nochmalige Bekräftigung seiner Kritiken in der Replik auf das Rinnovamento Rosminis, Sei lettere dei Mamiani all' Ab. Rosmini intorno al libro intitolato: 11 Rinnovamento della filosofia in Italia proposto dal C. T. Mamiani della Rovere ed esaminato da Antonio Rosmini-Serbati, Paris 1838, bes. 71-96. Seine Kritik ruht auf seiner Gesamtkonzeption auf, die italische Tradition der Philosophie der Erfahrung als Antithese zur platonischen Tradition zu interpretieren (vgl. Mamiani, Dei rinnovamento, 10-12). Rosminis umfassende Antwort auf Mamiani in den ersten drei Büchern seines Rinnovamento (vgl. Rinnav 1-444) besteht dabei einerseits in der Analyse und Kritik dessen Denkens als sensualistischen (ebd. 22, 116s. et al.) Skeptizismus' (ebd. 49s. et al.; zum Ganzen ebd. 514-519). Andererseits präsentiert der Roveretaner eine eigene philosophiegeschichtliche Rekonstruktion (ebd. 332-358, 445-473, 520-540): "Dies ist nun eine italienische Wahrheit; sie bildete die Grundlage der ersten eigenen Philosophie unseres Vaterlandes. Es ist offenkundig, dass ich die nationale Wissenschaft auf ihre Prinzipien zurückbesinnen lassen möchte, dass ich bis zum Ruhm der Magna Grecia zurückgreife. 0 Pythagoras, wie wahrscheinlich ist es, dass die ihm vorausgehenden Weisen, bei denen er in die Schule ging, erkannten, dass es an wirklich unwandelbaren Dingen nur die Ideen gibt [ ... ] und dass alles Übrige hier unten veränderbar und zum Untergang bestimmt ist" (ebd. 446). Rosminis Intention ist dabei nicht das den entsprechenden Versuch Giobertis leitende Interesse, eine nationale Philosophie zu begründen. Der Roveretaner zielt vielmehr darauf hin, die verschütteten und in der gesamten empiristischen Tradition abgelehnten Grundlagen der abendländischen Philosophie gleichsam "archäologisch" ans Licht zu heben: "Man glaube aber nicht, dass der Schule der Philosophen, über die wir handeln und die von allen gewiss die bekannteste ist, jene Unterscheidung zwischen der Idee (dem möglichen Sein, dem allein die Unwandelbarkeit zukommt) und dem kontingenten und akzidentellen Akt unserer Vernunft, welche diese anschaut, entgangen sei" (ebd. 447). Erbe dieser von Pythagoras grundgelegten Unterscheidung sei v. a. Platon gewesen; Aristoteles zeige an einigen Stellen Unsicherheit, was diese Differenz angeht (vgl. ebd. 334), weswegen sich die Nominalisten und Konzeptualisten aller Zeiten, bereits im Mittelalter wie auch im neuzeitlichen Empirismus wie Rationalismus, auf ihn als Autorität haben stützen können (vgl. ebd. 452; vgl. auch AristoteIe esposto ed esaminato [= Ediz. Crit., Bd. 18], hg. von GaetanaMessina, Roma 1995, 12, Anm. 20; 30, 43 f., 46-48). Eine solche Konsequenz ergäbe sich jedoch keineswegs per se aus Aristoteles; und im Gegenteil sei die gesamte antike Philosophie entgegengesetzter Meinung gewesen (Rosmini fUhrt als Beispiel Cicero an; vgl. Rinnav452). Dennoch bleibe der Stagirite in der gesamten, von Rosmini als ,jonischen Ursprungs" gekennzeichneten Tradition, die eben die grundlegende Unterscheidung der "italischen Tradition" zwischen den Ideen und den Akten der Geistseele nicht in gleicher Konsequenz durchfUhre, geschichtlich wirksam (v gl. ebd. 334). Schließlich kommt Rosmini zum Schluss: "Es scheint also,
24
Markus Krienke
Idealismus Rosminis lehnte Mamiani ob der fur ihn unvermeidlichen subjektivistischen Konsequenzen ab. Rosmini verteidigte sich gegen diese Kritik mit einer Schrift, die er zwar einerseits durchaus in direkter Reaktion auf die Kritik Mamianis verfasste - was sich schon in deren Titel ausdrückt lO -, die er andererseits aber gleichzeitig zur Gelegenheit nahm, die wesentlichen Grundzüge des Nuovo Saggio nochmals zu vertiefen: Auf das Rosminische Rinnovamento, das sich daher auch nicht exklusiv als Verteidigungsschrift versteht, sondern in weiten Teilen bedeutende Weiterentwicklungen gegenüber dem Nuovo Saggio beinhaltet, antwortete der "überzeugte Aristoteliker,,11 Mamiani mit einer weials könne man Aristoteles selbst - sowie die gesamte italische und die Athener Schule, Letztere als verehrte Schule der Ersteren - unter jene Weisen einordnen, welche die Existenz einiger Seiender eigener Art annahmen, die die Erkennbarkeit der Dinge begründen und die als Mögliche, Wesen, Begriffe, Ideen oder mit irgendwelchen anderen Namen bezeichnet werden; es scheint ferner, dass er die alte Unterscheidung zwischen den wahren und den nur scheinbaren Seienden teilte" (ebd. 456). Gleichwohl bleibe der "italischen" Tradition das gegenteilige Extrem einwohnen, das immer wieder zu philosophischen Fehlschlüssen ruhre, nämlich, "die Ideen vom Geist zu trennen und jeder eine eigene Subsistenz zu geben [ ... ]: So vergöttlichten sie die Ideen" (ebd. 336). Die mittelalterlichen Denker, allen voran Augustinus und Thomas, haben dann diese rur die Philosophie grundlegende und essenzielle Unterscheidung weiter vertieft und von den noch bei den Griechen vorhandenen Fehlern befreit (vgl. ebd. 458). In der neuzeitlichen Philosophie seien dann diese Fehler wieder durchgebrochen; Schelling sei so als Erbe des "platonischen" Fehlers, Hegel als Erbe des "pythagoreischen" Fehlers anzusehen (vgl. ebd. 348). Vgl. die Wiederaufnahme und Weiterentwicklung dieser Konzeption bei Gioberti, der diese Geschichte nun in sechs Phasen unterscheidet: (1) pythagoreische; (2) römische; (3) patristische; (4) scholastische; (5) klassizistische; (6) "ausländische" Philosophien, die sich an Luther und Descartes ausrichten (vgl. Vincenzo Gioberti, Dei primato morale e civile degli Italiani, 2 Bde. [= Edizione Nazionale delle opere edite e inedite di Vincenzo Gioberti, Bd. 2-3], hg. von UgoRedano, Milano 1938-39, II, 3745). Diese Konzeption ist jedoch, wie bereits bemerkt, durch eine deutliche "nationale" Ausrichtung charakterisiert. Von Interesse erweist sich, dass während Gioberti hier Galluppi durchaus positiv interpretiert, er Rosmini der letzteren Gruppe zurechnet und ihm vorwirft, Galluppi als "italienischen Reid" ("Reid dell'Italia") abgelöst zu haben: "Die Vernunft Rosminis und Kants ist offensichtlich subjektiv, wie sie auch im Einzelnen bezeichnet und beschönigt werden mag [ ... ]. Wären aber sein Urheber [sc. des Rosminianismus] und seine Verfechter weniger fromm und gewissenhaft, als sie es sind, würde man in Italien sofort den Pantheismus Fichtes und Hegels erstehen sehen, zu dem die Rosminischen Prinzipien, wie auch jene des Kritizismus, zwangsläufig ruhren, um letztlich auf den absoluten Skeptizismus und den Nullismus hinauszulaufen" (ebd. 44 f.). Dies ist der Hintergrund, warum Gioberti positiv auf Mamiani zurückgreift: Dieser habe durch seine empiristische Interpretation in positiver Anknüpfung an Vico den grundlegenden "italischen" Realismus wieder zum Ausdruck gebracht (ebd. 46 f.). 10 Il Rinnovamento della Filosofia in Italia dei Conte Terenzio Mamiani della Rovere esaminato da Antonio Rosmini-Serbati a dichiarazione e conferma della Teoria Ideologi ca esposta nel "Nuovo Saggio sull'Origine delle Idee". 11 Tavianini, Una polemica, 18.
Rosmini und die deutsche Philosophie
25
teren Untermauerung seiner Vorwürfe, die Rosmini allerdings unbeantwortet ließ - einmal, weil diese Diskussion mittlerweile ihre spekulative Relevanz eingebüßt hatte, aber auch, da er sich bereits der nächsten Kritik ausgesetzt sah, die er mit seinem Werk Rinnovamenta provoziert hatte l2 • Autor dieses neuerlichen Einwandes ist ein Schüler des in diesem Werk kritisierten Soziologen G. D. Romagnosi, nämlich Carlo Cattaneo 13 • Nachdem Rosmini das Kritierium von Wahrheit und Gewissheit bei Romagnosi als "ein natürliches Erzeugnis" interpretiert hatte l4 , weswegen letztlich die Frage der Wahrheit unter das Faktum des Interesses untergeordnet werde, was aber letztlich die Moralität jeder Basis beraube l5 , verteidigte Cattaneo den sozial-psychologischen Ansatz seines Lehrers und rechnete Rosminis Philosophie im Gegenzug den "Idealisten" 12 Vgl. Rinnov 374-413. "Romagnosi setzt der Vernunft also dieselbe Grenze wie Mamiani" (ebd. 374). 13 Seine Schrift trägt den Titel Delle censure de\\'abate Antonio Rosmini Serbati contro la dottrina religiosa di G. D. Romagnosi, Milano 1843; vgl. auch Carlo Cattaneo, Scritti filosofici, hg. von Noberto Bobbio, Firenze 1960, I, 19- 71, 81 - 94; vgl. zu Cattaneo Noberto Bobbio, Una filosofia militante. Studi su Carlo Cattaneo, Torino 1971. 14 Der Gegensatz der Ansätze Rosminis und Romagnosis lässt sich in einer ersten Annäherung an ihrer unterschiedlichen Auffassung über das Verhältnis zwischen Spekulation und praktischer Philosophie festmachen (vgl. Antonio Tarantino, Natura delle co se e societa civile. Rosmini e Romagnosi, Roma 1983, 103, 106). Gegen den Programmsatz Romagnosis: "Wir müssen nicht den spekulativen Menschen kennen, sondern den tatsächlichen" (Della suprema economia, 127 [H, par. 30]), argumentiert Rosmini : "Die hauptsächliche geistige Voreingenommenheit Romagnosis ist eben die vorausgesetzte Unmöglichkeit, dass es ein ideales Seiendes geben könne, das vom Geist getrennt und mit diesem verbunden ist und mit dem wir die Dinge sehen. Daraus resultiert seine unbewiesene und ungeprüfte Annahme, dass die Erkenntnis nichts anderes als eine einfache Modifikation der Seele ist" (Rinnov408; vgl. 409, 518). Wie rur Mamiani, so seien auch rur Romagnosi die intelligiblen Seienden nichts anderes als "Modifikationen unserer Seele" (ebd. 480). Deswegen rechnet er ihn zu den sensualistischen Ansätzen (vgl. ebd. 484, Anm. 2). Diese unterschiedliche philosophische Ausrichtung bewirkt auch eine grundlegend verschiedene Kantrezeption. Um Romagnosi - gegen Rosmini in die Genese eines authentischen Kantverständnisses in Italien einreihen zu können, muss Testa dessen Ansatz als kryptotranszendental erweisen: ,,[ ... ] er ist Transzendentalist, wenn auch ein wenig malgre luf' (zit. in: Garin, Storia, 1054). Dementgegen kann Romagnosi, so das Ergebnis Garins, wohl kein authentisches Kantverständnis zugeschrieben werden (zur Kantrezeption Romagnosis vgl. bereits Werner, Kant in Italien, 4-10). 15 "In diesem System ist die Wahrheit nominell dem Interesse untergeordnet. Die Moralität ist damit unmöglich: Von ihr bleibt einzig der Name, der zur Lüge wird. [ ... ] Dieses Interesse - man kann sagen, was man will- ist nur dann kohärent, wenn es gänzlich privat aufgefasst wird: Das Interesse ist seinem Wesen nach privat; wie kann es aber wirkliche Wohltätigkeit geben ohne Tugend? Die Gesellschaftsphilosophie [filosofia civile] Romagnosis ist selbst ein geteiltes und trostloses Reich: Eine Gesellschaft, weIcher der Körper genussvoll der Nächste ist, deren Seele aber barbarisch ist" (Rinnov 518).
26
Markus Krienke
("nostri idealisti") ZU I6 . Mit der Kritik Mamianis hat dieser Einwand gemein, von einem streng aposteriorischen Verständnis her Rosmini wegen seines aprioristischen (d. h. "Kantischen") Ansatzes zu kritisieren. Eine weitere Kritik aus dem sensualistischen Klima der italienischen Philosophie stammte von G. A. Abba, der in seiner Abhandlung Delle cognizioni umane ausdrücklich den philosophischen "Anfang" bei Rosmini beanstandete und in exemplarischer Weise das vorherrschende Klima verdeutlichte, auf welches das Rosminische Inauguralwerk traf17 • Damit ist auch das übereinstimmende Motiv aller drei Kritiker (Mamiani, Cattaneo und Abba) benannt, nämlich die Ablehnung der apriorisch-
16 "Unsere Idealisten machen dasselbe; indem sie scheinbar den Skeptizismus verdammen, stürzen sie die offenkundige und rur alle zugängliche [popolare] Gewissheit, und so steuern sie wirklich auf den Skeptizismus zu. Dieser Irreleitung wird keine große Dauer beschieden sein; dennoch werden in der Zwischenzeit dadurch die Studien vieler zunichte gemacht und verdorben. Diese Worte verstehen wir als Antwort auf den Sophisten, der sich auf den Stelzen seiner kleinen und schwachen Metaphysik emporreckte, um das Ansehen Romagnosis zu beschädigen" (Cattaneo, Scritti filosofici, I, 42 f.). Cattaneo mag sich diese Interpretation wohl aus dem Grund nahe gelegt haben, dass Rosmini von der "eingeborenen Idee" ("idea innata") spricht und auch Romagnosi das Kantische Apriori als "feste und eingeborene Formen" ("forme stabili ed innate") gekennzeichnet hat (vgl. Gian Domenico Romagnosi, Esposizione storico-critica dei kantismo e delle consecutive dottrine, in: ders., Opere di G. D. Romagnosi, hg. von Alessandro De Giorgi, 3 Bde., Milano 1841, Bd. I. Scritti filosofici, 575-605, hier 577). Dadurch erscheint Rosmini rur Cattaneo alles andere als einer, der "Kant unwiderlegbar auseinander genommen hat", wie Rosmini sich selbst zuschreibe, sondern eher als einer, der "unbewusst Spinoza wieder aufgerichtet hat" (Brief an A. Rosmini vom 29.10.1836, in: Carlo Cattaneo, Opere edite ed inedite, hg. von Agostino Bertani, 6 Bde., Firenze 1908, VI, 161-173, hier 173). 17 So betitelt Testa das fünfte Kapitel seines Werkes Delle cognizioni umane, Torino 1835, mit den Worten: "Auf welche Weise der anonyme Autor des Nuovo Saggio sull'origine delle idee [!] versuchte, das genannte Problem zu lösen: Einige Fragen und Reflexionen zu seiner Theorie" (ebd. 122-199). "AlI diese vergeblichen Versuche des Anonymus [sc. Rosmini], uns vom Idealen zum Subsistenten zu führen, zeigen uns die Unmöglichkeit dieses Übergangs in seinem System auf - genauso wie dies rur das System Platons galt, das von ihm im Gefolge der Deutschen angenommen wurde, die aber nach all den vielen Bemühungen die Schwierigkeit so beließen, wie sie bereits zuvor bestand. So ist im Rationalismus alles Idealismus" (ebd. 160 f.; vgl. 189). Vgl. auch das Zeugnis des Rosmini-Biographen Paoli: "Der naive und brave Theologe Abba konnte beim ersten Erscheinen eines Nuovo Saggio sull'origine delle idee nicht anders, als den Verstand des Autors zu bewundern, und so spricht er am Ende seiner Abhandlung viel von diesem. Dennoch legte er auch seine Zweifel über die Wahrheit des Systems, über die Existenz der eingeborenen Idee und über die von ihm gesehene Gefahr linker Konsequenzen dar. Dies war ganz normal: Auch in den Schulen der Turiner Universität dominierte noch zu sehr der Lockismus" (Francesco Paoli, Bibliografia rosminiana, Rovereto 1884, 28).
Rosmini und die deutsche Philosophie
27
"eingeborenen" Natur der Rosminischen idea dell'essere I8 . Den Eindruck, dass es bei diesen Einwänden gegen Rosmini einzig um diese Natur der Rosminisehen Form gehe, bestätigte bereits im Jahr 1838 Niccolo Tommaseo, der auch aus seiner persönlichen Einschätzung der philosophischen Qualität dieser Kritik keinen Hehl machte: ,,[ . .. ] einige Philosophien, die in gewissen Begriffen denken, scheinen das Denkvermögen zu verlieren, wenn ihnen jene abhanden kommen, und so laufen sie dann gegen diese Theorie an, nur weil in dieser diese sechs Buchstaben vorkommen: inna-
to,,19.
Eine besondere Bedeutung scheint in der Reihe dieser Kritiker Alfonso Testa einzunehmen. Während dessen Kritik an Rosmini von einigen als unfundiert und somit als gänzlich jeder philosophischer Relevanz entbehrend eingeschätzt wurde 20 , verdient sie im Gegenteil eine eigene Aufmerksamkeit, sofern Testa 18 Mit der Charakterisierung der idea dell'essere als "eingeboren" (innata; vgl. NS 467 f.) greift Rosmini auf den Cartesianischen Begriff zurück, um dadurch seine
Distanzierung zum Sensualismus zum Ausdruck zu bringen. 19 Niccol6 Tommaseo, Esposizione dei sistema filosofico dei Nuovo Saggio sull'origine delle idee di Antonio Rosmini-Serbati, Torino 1838, 17. 20 "Auf die Polemik des Ersteren, welcher die Ideologie des ,Nuovo Saggio' zu den philosophischen Romanzen rechnete, brauchte Rosmini kaum ernstlich einzugehen" (Franz Xaver Kraus, Antonio Rosmini, in: ders., Essays. Erste Sammlung, Berlin 1896, 85- 251, hier 145). Dabei bezieht sich Kraus möglicherweise auf jene Stelle des Il Nuovo Saggio sull'Origine delle Idee dell'abbate Antonio Rosmini-Serbati, Piacenza 1837, an der Testa die Rosminische Seinsidee zu den "metaphysischen Träumen" zählte ("Daher gestanden wir ihr nicht einmal eine hypothetische Existenz zu, um zu sehen, ob sie wenigstens rur eine Phantasiegeschichte von der menschlichen Erkenntnis tauge" [ebd. 140]). Bestätigung findet diese Einschätzung auch von anderer Seite her: "Es scheint seltsam: Diejenigen, die am ehesten dem Denken des Piacenzer Denkers [sc. Testa] hätten Aufmerksamkeit widmen müssen, d. h. Rosmini und Gioberti, gegen welche sich nämlich die Kritik Testas richtete, scheinen diesen kaum zu bemerken" (Brief von Alessandro Casati an Luigi Credaro, in: Credaro, Alfonso Testa, 9). Ihren wohl wichtigsten Anhaltspunkt findet diese Einschätzung indes wohl im Rosminischen Epistular selbst, wenn der Roveretaner an G. Baylo schreibt: "Herr Testa fragt, warum ich nicht auf sein Buch antworte? Ich möchte ihm darauf mit der Gegenfrage antworten, warum ich denn antworten muss? Übrigens werde ich immer gerne seine Äußerungen zur Moral zur Kenntnis nehmen" (Brief vom 13.05.1838, in: EC VI, 628). Eine erste Skepsis bezüglich der schnellen Degradierung der Rosminikritik Testas stellt sich jedoch durch die Beobachtung ein, dass Rosmini selbst dieses Schweigen wohl nicht durchhielt; zumindest ist uns eine solche "Antwort" im ersten "Dialog" der Sammlung Diario filosofico di Adolfo*** überliefert (in: Rivista Rosminiana 2 [1907/08]289-294, 369-374, 437-450, 505- 512, 569-573,633- 644; 3 [1908/09] 1-8). Von dieser zeigt sich Credaro jedoch nicht überzeugt; hatte bereits der Herausgeber der Untersuchung Credaros, Pascal, diese Entgegnung als "zu vorschnell und [ ... ] die Abneigung ist zu affektiert" gekennzeichnet (Carlo Pascal, Vorwort, in: Credaro, Alfonso Testa, 7- 15, hier 14). So gelangte Credaro schließlich zu dem Urteil: "Wiewohl Testa nicht einem eigenen System verpflichtet
28
Markus Krienke
mit Rosmini in der Intention der Überwindung des Sensualismus übereinkommt, dies aber auf eine der idealistischen Manier Rosminis, wie sie in seiner "schrecklichen Idee des universalen Seins' zum Ausdruck komme 21 , entgegengesetzte Weise versuchf 2 • Nicht nur philosophisch-systematisch überzeugender, sondern auch unter wirkungsgeschichtlichem Gesichtspunkt bedeutender erwies sich die Kritik aus dem Lager der Denker des italienischen Risorgimento, unter denen Vincenzo Gioberti weit hervorragt. Lässt sich die Kritik der ersten Gruppe auf das sensualistische Argument zusammenfassen (Rosmini selbst legte diesem Argument ob dessen geringer spekulativer Relevanz konsequenterweise wenig Bedeutung bei)23, verbindet Rosmini mit der zweiten Gruppe grundlegende spekulative Grundanliegen, weswegen diese Kritik ihn nicht so äußerlich traf wie die Erstewar, konnte er besser als Galluppi und auch als Rosmini den Geist der Kantischen Unterscheidung erfassen und deren große Bedeutung rur die Wissenschaften schätzen. So sah er richtig, dass die analytischen Urteile eine rein regulative Bedeutung haben und dass es notwendig ist, gewisse apriorische Synthesen anzunehmen, die nicht auf die sinnliche Anschauung zurückruhrbar sind" (Credaro, Alfonso Testa, 128). Nimmt man die Einschätzung Werners hinzu, demzufolge Testa als der einzige "wirkliche[] Kantianer" Italiens der damaligen Zeit anzusehen sei, dann wird wohl nochmals auf die Kritik Testas an der Rosminischen Kantrezeption zurückzukommen sein. In diesem Zusammenhang scheint dann auch eine Neubewertung der Rosminischen Kantrezeption möglich, denn wirkungsgeschichtlich muss "Testa's Kantianismus als eine völlig isolirte und von der Zeit überholte Erscheinung" angesehen werden, insofern es ihr nicht gelang, neben Rosmini und Gioberti Fuß zu fassen (vgl. Werner, Kant in Italien, 4), welchen nicht an einer neutralen Darstellung des Kantismus gelegen war, sondern die vielmehr von Anfang an über Kant hinauszugehen suchten. 21 Testa, Il Nuovo Saggio, 20. Daher sei Rosmini Vertreter eines "nicht offen dargelegten ultra-idealistischen Systems" (ebd. 43). 22 Gentile bezeichnete das Werk Testas als "eine der scharfsinnigsten kritischen Arbeiten, die über den Rosminianismus geschrieben worden sind" (zit. in: Credaro, Alfonso Testa, 10). Für Testa ist Rosmini eindeutig Subjektivist: "In der Tat behauptet Testa, dass Rosmini, um zur Idee des universalen Seienden zu gelangen und sie von den partikularen [Seienden] abzulösen - damit sie so rein in ihrer vollen Allgemeinheit erscheint -, ein logisches Vorgehen wählte, das demjenigen Hegels ähnelt. Mit der Ruhe eines tiefgründigen Denkers erhob er sich zum Absoluten, zur wahren Wirklichkeit. [ ... ] Die Subjektivität, so Testa, mache das Wissen zunichte und kein Scharfsinn könne Kant vom Skeptizismus befreien. So verstanden ihn Fichte, Hegel und Schelling gut, die, um der Subjektivität zu entkommen, bei den ontologischen Abstraktionen ansetzten, die sie als Grundlage jeder Realität verstanden. Testa ordnete diesen direkt den Roveretaner Priester bei, dessen universales Seiendes von ihm mit dem ,kosmogonischen Ei' vergleichen wird, ,das, von der Wahrnehmung ausgebrütet, uns die Welt geben muss'. Doch kümmerte sich bereits Prof. Ferri um die Entgegnung unseres Autors gegen Rosmini" (Credaro, Alfonso Testa, 79,113 f.). Vgl. auch Testa, 11 Nuovo Saggio, 152 f. 23 Vgl. nochmals zusammenfassend, Valeriana Giardana, Le principali interpretazioni dell'ideologia rosminiana, in: Giornale di Metafisica 12 (1957) 590-604; 13 (1958) 83-111, 6 I 9-633, 766-789 (vgl. Torino 1958), hier 590-597.
Rosmini und die deutsche Philosophie
29
re, sondern ihn in dieser Kritik gleichermaßen in die Reihe der bedeutenden Vertreter des italienischen Risorgimento aufnahm 24 . In seinem Werk DeI Primato moraIe e civiIe degli Italiani, welches bereits im Titel das sich im Entstehen befindende neue philosophische Selbstvertrauen Italiens ausdrückt, wandte Gioberti gegen Rosmini ein, durch die Anwendung der Kantischen Methode das notwendige Apriori aller menschlicher Erkenntnis psychologisiert zu haben: Rosmini sei Ausgangspunkt von "eine[r] Sekte, die ausgehend von den Worten und den Theorieelementen in einfallsreicher Weise die Forderungen und die Fehler des deutschen Cartesianismus, d. h. des Kantismus, emeuert"25. Der Roveretaner habe im Grunde lediglich die Kantischen Kategorien auf eine einzige reduziert, die er "Idee des Seins" nannte; deren qualitative Bedeutung der Grundlegung eines modemen Psychologismus habe er aber übemommen26 . In der Introduzione a110 studio de11a filosofia führte er diesen Vorwurf des Psychologismus weiter aus; so erkannte er dessen Methode, "das Intelligible vom Sinnlichen und die Ontologie von der Psychologie abzuleiten", im Rosminischen Denken vollgültig vorliegen 27 • Die Tatsache, dass Gioberti auch 24 Nur aus diesem Grund konnte die Auseinandersetzung zwischen Rosmini und Gioberti auch als eine der "dramatisch lebendigsten Episoden", welche die "fruchtbarste an nützlichen Ergebnissen" war, in die Geschichte des italienischen Denkens eingehen (Angelo Custodero, Una lettera inedita di Antonio Rosmini, in: Giomale critico della filosofia italiana 5 [1924] 73-78, hier 73). Vgl. auch Domenico Intini, La controversia fra Rosmini e Gioberti (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 25), Stresa 2002; Dante Morando, Gioberti eRosmini, in: Giornale di Metafisica 7 (1952) 559- 581. 25 Vincenzo Gioberti, DeI Primato, 1I, 44; vgl. auch ders., Introduzione allo studio della filosofia, 2 Bde. (= Edizione Nazionale delle opere edite e inedite di Vincenzo Gioberti, Bd. 4--5), hg. von Giovanni Cala, Milano 1939-1941, II, 324, 327. Zwar ist die Betonung des "nationalen" Charakters und Eigenwerts der ital(ien)ischen Philosophie auch Rosmini ein Anliegen; doch ist es das philosophisch-systematische Argument, das ihn der zweiten Gruppe und nicht der ersten annähert (vgl. hierzu oben, Anm. 9). 26 "Psychologist [Psicologista] ist derjenige, der das erste Prinzip des Wissbaren in etwas Geschaffenem erkennt, gehöre dies dem menschlichen Geist zu oder sei es diesem äußerlich. Denn alles Geschaffene ist hinsichtlich des wirklich Absoluten subjektiv und kann niemals einen wirklich objektiven Wert annehmen, auch wenn es außerhalb des Geistes bestehe. Rosmini erkennt nun das erste Prinzip des Wissbaren in einem Objekt oder in einer geschaffenen Form. Also ist er Psychologist" (Vincenzo Gioberti, Degli errori filosofici di Antonio Rosmini, 3 Bde. [= Edizione Nazionale delle opere edite e inedite di Vincenzo Gioberti, Bd. 8-10], hg. von Ugo Redana, Milano 1939, I, 222). 27 Gioberti, Introduzione, II, 63. Diesem Psychologismus stellt Gioberti seine Konzeption des "Ontologismus" entgegen. Vergegenwärtigt man sich die ablehnende Haltung, die Rosmini und Gioberti dem Sensualismus gegenüber verbinden, dann wirkt die folgende, gegen den Roveretaner gerichtete Aussage geradezu polemisch: ,,[ ... ] Psychologismus und Sensualismus sind identisch: Der eine ist ein auf die Methode angewandter Sensualismus, der andere ist ein auf die Prinzipien adaptierter Psychologismus" (ebd. 101). Dem folgen, dem polemischen Stil der Zeit gemäß, weitere apologetische Spitzen: ,,[ ... ] das System Rosminis ist ein Nominalismus, ein erneuerter Cartesianismus, ein
30
Markus Krienke
in seinem Werk Teoria die Gelegenheit nutzte, diesen Vorwurf weiter auszuformulieren, zeigt, dass er dieser Auseinandersetzung höchste Bedeutung beimaß. So ließ er hinter der Polemik deutlich hervorscheinen, worin er den systematischen Aspekt seiner Rosminikritik erkannte: Denn die kritisierte "psychologische Reduktion" Rosminis, d. h. das Resultat der Rosminischen Kantrezeption, stelle in sich einen fundamentalen Fortschritt für die italienische Philosophie dar: ,,[ ... ] die psychologische Rückfiihrung aller Ideen auf ein einziges grundlegendes Element, wie dies der Abt Antonio Rosmini durchgefiihrt hat, ist m. E. der bedeutendste Fortschritt, den die Philosophie seit vielen Jahren genommen hat. Ich werde nicht zögern, die einmütige Zustimmung aller Freunde der spekulativen Wissenschaften zu erhalten,,28.
Diesen Fortschritt anerkennend, aber auch gleichzeitig kritisierend und für seine eigene Philosophie nutzbar machend, warf er Rosmini vor, damit auch den Konsequenzen des Kantischen Denkens verfallen zu sein, nämlich die Psychologie der Ontologie als deren notwendige Bedingung und Voraussetzung vorangestellt bzw. Letztere der Ersteren untergeordnet zu haben29 . Von dieser Basis ausgehend, könne Rosmini jedoch, so die Kritik Giobertis weiter, pantheistische Konsequenzen in der ontologischen Frage nicht vermeiden. So lässt sich ausgehend von diesem Einwand das Interesse der Philosophie Giobertis einsehen. Weiterhin zeigt diese Auseinandersetzung, dass der Pantheismusvorwurf an Rosmini mithin ursprünglich nicht aus der theologischen, sondern aus der philosophischen Kritik stammt. Er wird bei Gioberti in der folgenden Version begründet: "Rosmini sagt, dass das ideale Sein, das von Natur aus im menschlichen Geist aufscheint, eine Abkunft Gottes ist - Doch ist jede Abkunft Gottes Gott - Also ist das ideale Sein Gott"30. Wäre Gioberti mit seiner Rosminikritik im Recht, dann wäre Rosmini folglich Kantianer, der den Kantismus in einem Detail variiert bzw. weiterentwiverkleideter Sensualismus, der, sobald er einmal in den katholischen Schulen und Akademien eingeführt ist, früher oder später seine Auswirkungen zeitigt" (BriefV. Giobertis an G. Baracco vom 7.09.1841, in: Gioberti, Epistolario, 111, 248). 28 Vincenzo Gioberti, Teorica dei sovrannaturale 0 sia discorso sulle convenienze della religione rivelata colla mente umana e col progresso civile delle nazioni, 3 Bde. (= Edizione Nazionale delle opere edite e inedite di Vincenzo Gioberti, Bd. 24-25), hg. von Alessandro Cortese, Padova 1970-1972, II, 212, Anm. 13. 29 Vgl. Gioberti, Teorica, 11, 211 f., Anm. 12. 30 Rosmini gibt die Difficulta che I' Abate Vincenzo Gioberti move alla filosofia di Antonio Rosmini ridotte a sillogismo, die zuerst in der Imparziale (Faenza), Nr. 49 und 50 des Jahres 1845, erschienen waren, "mit den entsprechenden Antworten" im Anhang zu seinem Werk Vincenzo Gioberti e il panteismo. Saggio di lezioni filosofiche wieder; vgl. hg. von Pier Paolo OttonelJo (= Ediz. Crit., Bd. 21), Roma 2005, S. 209-213, hier 209.
Rosmini und die deutsche Philosophie
31
ckelt habe und somit eine Spielart des Kantismus vertrete. Diese Weiterentwicklung in Richtung eines Theismus sollte sich dann Gioberti selbst zunutze machen und im Sinne des Versuches einer Hegelrezeption auf realistischer Basis weiterführen. Hier wird jedoch eine folgenreiche Interpretation der Rosminischen Kant- und Idealismusrezeption grundgelegt, nach welcher Rosminis Denken m. a. W. in der philosophischen Entwicklung zwischen Kant und Fichte einzuordnen see!. Rosmini erkennt die Gefahr, die von einer solchen kategorialisierenden Interpretation ausgeht und streitet eben wegen derart "schneller Konsequenzen" nicht nur ab, dem "Idealismus" zugerechnet werden zu können32 , sondern ermahnt auch Gioberti direkt, nicht einzelne Elemente aus seinem Denken zu extrapolieren und sie damit im Sinne eines interpretativen Paradigmas zu verabsolutieren, sondern stets "das Ganze" seiner Philosophie im Blick zu behalten, das ihm eigentlich eine wesentlich ausgewogenere Sichtweise auf diese vermitteln sollte33 . Auch wenn sich der Roveretaner in der Deutung Giobertis zu Recht nur einseitig interpretiert sah, sollte dennoch diese es sein, welche die Bewertung des Rosminischen Denkens für ein ganzes Jahrhundert bestimmte. Vielleicht liegt dies daran, dass es Gioberti gelang, auf den für die italienische Philosophie entscheidenden Punkt bei Rosmini zu verweisen. So berechtigt diese Interpretation demzufolge auch sein mag - so verhängnisvoll musste sich die einseitige
Vgl. Gioberti, Degli errori filosofici, I, 274; II, 77-82. Selbst in dem Rosmini unterbreiteten Versuch, ihn als "objektiven Idealisten" zu bezeichnen - ein Versuch, der übrigens ein Jahrhundert später von Sciacca wieder aufgegriffen werden sollte - erkennt Rosmini eine solch gefährliche Einordnung seines Denkens: "Was nun das Wort Idealismus betrifft, welches Sie meinem System beilegen: Wer weiß nicht, dass es immer verwendet wurde, um jene Systeme zu bezeichnen, welche die äußere Realität oder auch den äußeren Wert der Verstandesbegriffe ablehnen? Wie kann es also einen objektiv-realen Idealisten geben, wie Sie mich gerne nennen, während doch diese Bezeichnung im gemeinen Gebrauch mit dieser anderen des Idealisten-Nicht-Idealisten [Idealista-non-Idealista] gleichgesetzt wird?" (Brief an B. Poli vom 6.02.1837, in: ECVI, 144). 33 Rosmini bemerkt bereits in seiner Verteidigung gegen die Kritiken Giobertis - als ob er die zukünftigen voraussähe und diesen bereits eine Warnung mit auf den Weg geben wollte: ,,[I]ch meine, auch bei Herm Gioberti erkennen zu können, was ich bereits bei so vielen anderen tüchtigen Männern bemerkt habe, die für oder gegen meine Philosophie schrieben, dass sie nämlich zu schnell glauben, meinen Geist erkannt und die gesamte Lehre, die ich zu betrachten vorschlage, erfasst zu haben. Doch genügt es keineswegs, sich an einigen Sätzen festzuklammern, es ist nicht ausreichend, einige Auszüge aus meinen Büchern verstanden zu haben. Im Gegenteil - man muss den Geist auf alles richten, das Gesamt des Systems durchdringen, bis zu seinem Grund zu gelangen, zu dem ich bislang noch nicht viele habe vordringen sehen - inklusive derjenigen, die es durchaus hätten schaffen können, wenn sie nicht gemeint hätten, bereits dorthin gelangt zu sein" (Brief an G. Avogadro vom 10.05.l839, in: ECVII, 124). 3!
32
32
Markus Krienke
Betonung dieses Elements unter Ausschluss des Blicks "auf das Ganze" auswirken. Darauf sei bereits jetzt im Hinblick auf spätere "Phasen" verwiesen. Die Rosminiinterpretation Giobertis wurde ihrerseits von Pasquale Galluppi vorbereitet, der selbst zu den bedeutendsten Kantrezipienten der damaligen Zeit zählte 34 • Wie mit Gioberti unterhielt Rosmini auch mit Galluppi einen regen 34 So konnte Rosmini gegen diesen im Grunde einen ähnlichen Einwand vorbringen, wie er gegen Kant formuliert hatte: "Wäre die Erkenntnis im Grunde nur eine Handlung des Subjekts, die im Subjekt terminierte [terminante], warum sollte sie dann nicht etwas gänzlich Relatives, etwas Scheinbares sein, bzw. - um es auf deutsch zu sagen - eine transzendentale Illusion? [... ] Nach meinem DatUrhalten kann keine Philosophie mit der katholischen Theologie vereinbart werden und demzufolge tUr diese unschädlich sein, wenn sie nicht in Gott selbst, und nicht im Menschen, den Grund der natürlichen Erkenntnis und der Gewissheit sucht, zu der sie fähig ist. Empfängt der Mensch nicht in sich etwas Absolutes, etwas Göttliches, dann ist in ihm alles relativ, ungewiss, flüchtig. Es trifft zu, dass eine subjektive Philosophie nicht sofort ihre schädlichen Konsequenzen zeitigt, da diese vom Prinzip weit entfernt sind bzw. weit entfernt zu sein scheinen. Was folgt aber daraus? Wenn man diese nicht gleich zieht, wird man diese eines Tages ziehen; oder besser, sie sind bereits gezogen, wir können sie überall sehen, wenn wir nur die Augen öffnen. Der Hermesianismus, das ganze Schwanken Deutschlands, das vom rechten Weg abkommt, ist nichts anderes als dieses; dieses ist heutzutage das Schwanken der Welt, die vom rechten Weg abkommt" (Brief an G. Mazio vom 3.06.1840, in: EC VII, 381 f.; zur Kantrezeption Galluppis vgl. oben Anm. 4). Damit scheint offenkundig, dass die Differenz zwischen Rosmini und Galluppi nicht sosehr in der Kantkritik (Skeptizismus, Vernachlässigung der Erfahrung), sondern in der Bestimmung des Apriori zu sehen ist. Rosmini erkennt den Kantischen Kritizismus im Nuovo Saggio als eine spezifische Weiterentwicklung der schottischen Philosophie des common sense (Stewart, Reid; vgl. NS 99-210, 301-324, was in der Behauptung kulminiert: "Kant ist im Grunde die weiterentwickelte Reidsche Theorie" [ebd. 364]). Diese Ausgangsbasis scheint wesentlich zu seiner im damaligen Italien innovativen Kantinterpretation beizutragen, wohingegen Galluppi diesen Schritt noch nicht geht und gegen den Kritizismus noch auf eine grundlegend auf die empirische Erfahrung basierte Erkenntnistheorie rekurriert. So muss es ihm als ein unüberwindlicher Widerspruch Kants erscheinen, dass einerseits die Perzeptionen sich "akzidentell zusammensetzen", andererseits aber die Erfahrung auf der "alleinigen Vorstellung der notwendigen Verbindung der Wahrnehmungen" beruhe (Pasquale Galluppi, Saggio filosofico sulla critica della conoscenza 0 sia analisi distinta deI pensiero umano con un esame delle piu importanti quistioni dell'ideologia, deI kantismo, edella filosofia trascendentale, 6 Bde., Napoli 21833, III, 253): "Es gibt kein Mittel: Entweder verbinden sich die Wahrnehmungen akzidentell in der Erfahrung, womit es falsch ist, dass diese die notwendige Verbindung der Wahrnehmungen voraussetzt; oder die notwendige Verbindung der Wahrnehmungen stellt eine Möglichkeitsbedingung der Erfahrung dar, womit sich die Wahrnehmungen in dieser nicht akzidentell verbinden können, sondern sich mit Notwendigkeit verbinden müssen" (ebd.). Da tUr ihn klar ist, dass die Verbindung der Wahrnehmungen in der Erfahrung akzidentell ist, ist der Kritizismus tUr ihn "irreparabel ruiniert" (ebd. 254). Deswegen kennt er einzig die "reale Synthese": "Ist die erste Handlung des Verstandes [ ... ] die Analyse [und nicht die Synthese], muss man eine reale Synthese annehmen. [ ... ] ist die Verbindung zwischen der Existenz kein empirisches Datum, so ist Wissen-
Rosmini und die deutsche Philosophie
33
Briefwechsel 35 . Auf diesen geht die ebenso folgenreiche These zurück, Rosmini sei es gelungen, in seiner idea dell'essere den Plural der Kantischen Formen auf eine konzeptionelle und numerische Einheit zurückzufiihren36 • Da sich Galluppi im Gegensatz zu Gioberti durchaus als Kantianer verstand, gelang ihm auch die konsequentere Interpretation Rosminis vor dem Hintergrund des Kantischen Transzendentalismus. Die Auswirkungen dessen Rosminilektüre auf den späteren italienischen Idealismus können nicht unterschätzt werden 37 • Dass Rosmini jedoch keineswegs mit einer Kantischen Lesart, wie sie Galluppi vorschlug, erfasst werden kann, zeigt die Rosminikritik Giobertis selbst, wenn dieser - explizit - einige gültige nicht-kantische Elemente des Rosminischen Denkens anerkenne 8 bzw. wenn dessen Kritik - indirekt - nur unter der Vor-
schaft nicht möglich. [ ... ] Aus diesen Beobachtungen können wir schließen, dass die Transzendentalphilosophie zurückzuweisen ist und man von der Philosophie der Erfahrung [filosofia della esperienza] ausgehen muss" (ebd. 256). Auch Gentile ordnet Galluppi noch jenen Denkern zu, welche zweifelsohne die Fundamente gelegt haben, auf denen jedoch dann Rosmini und Gioberti weitergebaut hätten: "Zusammenfassend befreit er [sc. Galluppi] sich also mit seinen Kantischen Inspirationen und seinen scharfsinnigen Studien über die gesamte neuzeitliche, nach-cartesianische Erkenntnislehre von den Engführungen des Sensualismus und des dogmatischen Spiritualismus und leitet somit in Italien eine neue spekulative Ära ein. In dieser erhebt sich unser Denken, indem es den Kontakt mit dem neuzeitlichen europäischen Denken wahrt, mit Rosmini und Gioberti auf ein nach den großen Denkern der Renaissance und nach Vico nicht mehr erreichtes Niveau" (Giovanni Gentile, Storia della filosofia italiana dal Genovesi al Galluppi, 2 Bde. [= oe, Bd. 18-19], Firenze 22003, II, S. 109). 35 Der erste Brief, den das Epistolario Filosofico als von Rosmini an Galluppi gerichtet verzeichnet, ist vom 11.11.1827; insgesamt befinden sich darin noch weitere sieben; deren letzter trägt das Datum des 7.11.1839 (vgl. Antonio Rosmini, Epistolario filosofico, hg. von Giulio Bonafede, Trapani 1968); vgl. zum Briefwechsel, Vito FazioAllmayer, Il carteggio tra Pasquale Galluppi ed Antonio Rosmini (1827-1839), in: Giornale critico della filosofia italiana 2 (1921) 23-32; Giovanni Pusineri, P. Galluppi e A. Rosmini nelloro carteggio, in: Rivista Rosminiana 19 (1925) 92-108. 36 Vgl. Galluppi, Lettere filosofiche, 275-278 (lett. XIV); vgl. auch Abba, Delle cognizioni umane, 152; vgl. die Verteidigung Rosminis in: Diario filosofico di Adolfo***,505. 37 So formulierte er in seinen Lettere filosofiche: "Der tiefgründige und ehrenwerte Rosmini wandte hinsichtlich des ersten Teils der Erkenntnistheorie, d. h. hinsichtlich der Genese der Erkenntnis, die Lehren Reids und Kants an. Er forderte m. a. W., dass die Erkenntnis durch das apriorische Element zustande kommt. Ich weiß sehr wohl, dass er glaubte, alle apriorischen Elemente auf ein einziges zurückgeführt zu haben, das er in der Notion des Seienden erkannte. Dies bewirkt aber nicht, dass die Erkenntnis sich nicht dem apriorischen Element verdanke" (ebd. 275 f. [lett. XIV]). 38 "Man beachte: Er zieht den Kantismus stets zur Bewertung einer Philosophie heran - in dem Sinn, dass dessen mehr oder weniger offenkundiger Einfluss ein Anklagepunkt darstellt" (Zambelloni, Le origini, 371).
34
Markus Krienke
aussetzung einer grundsätzlichen Inkompatibilität des Rosminischen und des Kantischen Transzendentalismus einen Sinn ergibt39 • Auch in die Debatte mit der zweiten Gruppe schaltete sich Rosmini selbst nur sporadisch und gezielt ein - in diesem Fall jedoch nicht aus Desinteresse, sondern aus dem einfachen Grund, viel zu sehr mit Herausforderungen auf kirchenpolitischer Ebene, wo er sich schwerwiegenden Vorwürfen ausgesetzt sah, und der Veröffentlichung weiterer Schriften beschäftigt zu sein. Statt Streitschriften zu verfassen, antwortete er vorzugsweise im Rahmen weiterer Werke und berücksichtigte damit die Kritik seiner Gegner am systematisch richtigen Ort. Zudem konnte er auch auf einige Verteidiger zählen, welche die direkte Diskussion mit Gioberti suchten. So war es der in Turin lehrende Michele Tarditi, der in seiner Verteidigung den rationalistischen Vorwurf Giobertis an Rosmini gegen dessen Autor zurückwandte40 • In der umfassenden Verteidigung durch Pestalozza41 erhält man dagegen einen guten Eindruck, unter welchen Stichwörtern die damaligen Anschuldigungen gegen Rosmini rangieren: "Ist einmal die Objektivität des idealen Seienden bewiesen - was ich in den beiden vorausgehenden Dialogen unternommen habe -, dann fallen auch die Anschuldigungen des Nominalismus, des Sensualismus, des Idealismus und des Skeptizismus wie von selbst in sich zusammen,,42.
Weiterhin finden sich unter denjenigen, die Rosmini davor in Schutz nahmen, subjektivistischen, pantheistischen oder nihilistischen Konsequenzen des
39 ,,[W]äre die Philosophie Rosminis nichts anderes als eine Variante des Kantischen Transzendentalismus, dann wäre die gesamte Kritik Giobertis (wie auch jene Mamianis) in der Tat ohne jeden Sinn: ein reines Sophisma der ,ignoratio elenchi' , wie die Scholastiker sagen würden" (pietro Prini, Introduzione a Rosmini [== I Filosofi, Bd. 71], Roma/Bari 21999, 62 f.). 40 Dieser suchte zu erweisen, dass nicht Rosmini, sondern Gioberti selbst in den Fehler der "Rationalisten Deutschlands" gerate, die "nicht bemerken, dass jenes absolute Denken bzw. jene Möglichkeit der Dinge, zu der sie mit ihrem Missbrauch der Abstraktion gelangen, [ ... ] eine reine Abstraktion ist und demzufolge jenes Mögliche weder ist noch sein kann, dem - nach unserer Erkenntnisweise - das absolute Sein und das absolute Existierende unterliegen" (Micheie Tardj(i, Lettere d'un Rosminiano a Vincenzo Gioberti, Torino 1841, 106). 41 "Das Rosminische System ist vor diesem Fehler derart immun, denn es stellt geradezu den direkten Widerspruch zu diesem dar. Rosmini war der erste neuzeitliche Denker, der diesen frontal angegriffen hat. Er hat ihn in allen Spielarten widerlegt, als Sensualismus Lockes oder Condillacs, als Kritizismus Kants oder als falscher Objektivismus der gesamten deutschen Schule" (Alessandro Pestalozza, Dialoghi filosofici in risposta alle piu gravi obbiezioni mosse al sistema filosofico delI' Ab. A. Rosmini, Perugi na 1845,6). 42 Pestalozza, Dialoghi filosofici, 96, Anm. 1.
Rosmini und die deutsche Philosophie
35
neuzeitlichen Denkens verfallen zu sein, die Namen Paolo Barone43 , Niccolo Tommaseo 44 und Gustavo Benso di Cavour - Letzterer der Bruder des Staatsmannes Camillo de Cavour. Insgesamt wird man konstatieren müssen, dass Rosmini die Auseinandersetzung mit seinen philosophischen Kritikern weitgehend anderen überlassen hat. Seine Kräfte und Aufmerksamkeit werden dagegen zunehmend von der "theologischen" Auseinandersetzung absorbiert, die zeitversetzt einsetzte, für Rosmini als Priester, Ordensgründer und "Kirchenpolitiker" jedoch von unmittelbarer Dringlichkeit war. Wiederum auf die Herausstellung einer groben Linie zielend, wird man für die "theologische" Auseinandersetzung zunächst konstatieren können, dass dem Nuovo Saggio zunächst große Anerkennung entgegengebracht wurde; so zollte kein geringerer als der damalige Jesuitengeneral Roothaan der Rosminischen Theorie zum "Ursprung der Ideen" großes Lob45 • Dass kritische Reaktionen zunächst ausbleiben, bestärkt die Vermutung, dass man zu diesem Zeitpunkt die theologische Tragweite der Rosminischen Gnoseologie noch nicht überblickte. Damit geht die Beobachtung konform, dass die Auseinandersetzung mit der Erscheinung des ersten theologischen Werkes Rosminis, des Trattato della coscienza morale, im Jahr 1841 einsetzt und peu apeu eine eminent kirchenpolitische Dimension annimmt46 • Die erste Kritik eines Theologen an der philosophischen Konzeption des Nuovo Saggio und der Principi della scienza morale stammte von dem Jesuitenpater J. A. Dmowski aus dem Jahr 1840: Die Rosminische idea dell'essere sei subjektivistischer Natur, weswegen sie insbesondere für die Moral jeden übersubjektiven, d. h. göttlichen "Gesetzgeber" ausklammere47 • Der darin implizit enthaltene Vorwurf des "Kantismus" wird dann konsequenterweise zwei Jahre später bei F. Rothenflue ausgesprochen48 • Die erste systematische Analyse und Kritik des Nuovo Saggio stammt Paolo Barone, Su\1e dottrine filosofiche di Vincenzo Gioberti, Torino 1843. Niccol6 Tommaseo, Studi critici, Venezia 1843. 45 Brief von G. Roothaan an Rosmini vom 6.08.1831, zit. in: Giovanni Battista Pagani, Vita di Antonio Rosmini. Scritta da un Sacerdote dell'Istituto della Carita riveduta 43
44
ed a~giomata dal Prof. Guido Rossi, 2 Bde., Rovereto 1959, I, 555. 4 Vgl. hierzu und im Folgenden Krienke, Die "rosminische Frage" als Exemplar kirchenpolitischer Auseinandersetzungen im 19. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 116 (2005) 173-203, insbes. 188-191. 47 "Die notio des Geistes ist per se etwas Subjektives und schließt keinen Verweis des Gesetzes auf den Gesetzgeber ein" (Institutiones philosophiae, 2 Bde., Romae 1840, H. Continens institutiones ethicae sive philosophiae moralis, 85, Anm. 1 [par. 57]). Gegen Dmowski verfasste Rosmini die Entgegnung Sulla teoria dell'essere ideale, risposta al R. P. L. Dmowski della C. d. G., Milano 1842, in: Antonio Rosmini, Opuscoli morali, 2 Bde. (= Ediz. Naz., Bd. 31-32), hg. von Remo Bessero Beiti, Padova 1965, S.413-443. 48 Institutiones philosophiae theoreticae in usum praelectionum, 4 Bde., Friburgi Helvetiorum 1842-43, H, 220.
36
Markus Krienke
gar erst aus dem Jahr 1843 aus der Feder von S. Sordi49 • Die nicht zu unterschätzende historische Bedeutung der Kritik Sordis liegt darin, genau jenen zentralen Kritikpunkt individuiert zu haben, der dann die gesamten posthumen, von Seiten des Neothomismus betriebenen Auseinandersetzungen um die Rosminisehe Lehre bestimmen sollte: Vor dem Hintergrund einer extrem aristotelischen Thomasinterpretation, wie sie in der Theologie des 19. Jahrhunderts vorherrschte, kann die Rosminische idea dell'essere nur die Vermutung nahe legen, ihr Autor vertrete den Standpunkt des Psychologismus, Ontologismus, Pantheismus oder Nihilismus, da ihr als aprioristisches Element keine intentionale Realität in der Außenwelt entspricht50 • Im Grunde zielt diese Kritik auf die bereits durch Gioberti aufgezeigte Konsequenz eines radikalen Beginns bei der Erkenntnistheorie und nicht bei der Ontologie ("Psychologismus"), der insbesondere die klassischen Gottesbeweise in die Krise stürzt51 • Außer Gioberti und Sordi erkannten nur wenige, welche Auswirkungen dieser Rosminische Neuansatz in der Philosophie für die Theologie zeitigen würde. Signifikativ dafür ist die Tatsache, dass man 1849 zwei politische Werke Rosminis indizierte. Die nachfolgenden Bemühungen seitens einiger Jesuiten, diese Indizierung zu einem Verbot des gesamten Rosminischen Werkes auszudehnen 52 , führte zur Einsetzung einer Examinierungskommission seitens Pius IX., die allerdings
49 SerafinoSordi, Lettere intomo al Nuovo Saggio sull'origine delle Idee dell'Abate Antonio Rosmini-Serbati, Modena 1843. Zu dieser Kritik vgl. die bei den Abhandlungen von Lorenzo Pozzi, La filosofia neotomista deli' '800: la critica di Serafino Sordi ad Antonio Rosmini, in: Studia Patavina 12 (1965) 304-313; bzw. Serafino Sordi e l'intuito rosminiano dell'essere, in: ebd. 14 (1967) 132-137. 50 "Es ist abzulehnen, dass die Idealität die erste Idee sei, denn wenn die Idee ,est simplex apprehensio', wie es Rosmini an mehreren Orten nahe legt, so widerspricht es dem, dass es dort eine Idee gibt, wo es kein verstandenes Objekt, ,res apprehensa' gibt. Somit gilt: Entweder repräsentiert diese Identität, welche man widerspiegeln möchte, so wie die erste eingeborene Idee des Menschen, irgendein Objekt (und ein Objekt der Substanz wegen des soeben angewandten Grundes) oder es repräsentiert es nicht 00 .. Im zweiten Fall ist der Widerspruch klar. Wenn man im ersten Fall nicht in bestimmter Weise hinzufügt, welche Sache sie repräsentiert, bedeutet dies dasselbe, wie nichts zu sagen" (Sordi, Lettere intomo al Nuovo Saggio, 70). 51 So kommentiert Bonafede Giobertis Einwand: "[00'] eine Erkenntnislehre ohne ein ontologisches Prinzip, das dieser als Grundlage und als Rechtfertigung dient, ist ein Traum und ein Widerspruch. Wird das Rosminische System so verstanden, kann es natürlich weder einen strengen Beweis der Existenz Gottes garantieren noch einen unerschütterlichen Erkenntnisprozess der Realität begründen noch in irgendeiner Weise die Grundlage der Enzyklopädie bereitstellen. Das Nichts ist per definitionem nicht in der Lage, irgendeine Positivität zu begründen oder zu stabilieren" (Giulio Bonafede, V. Gioberti, Palermo 1942,370). 52 Vgl. Luciano MaJusa, Le opposizioni a Rosmini durante la sua vita e dopo la sua morte fino ai giomi nostri, in: Lia De Finis (Hg.), Antonio Rosmini e il suo tempo. Nel bicentenario della nascita, Trento 1998, 205-221, hier 207.
Rosmini und die deutsche Philosophie
37
1854 zu dem Ergebnis des "Freispruchs" der Rosminischen Werke kam (Dekret
Dimittantur opera)53.
So findet man sich auch bei der Betrachtung der theologischen Auseinandersetzung in dieser "ersten Phase" der Wirkungsgeschichte auf die philosophische Auseinandersetzung zurückverwiesen. Diese kann man bezüglich der ersten Phase schematisch den Einwänden der beiden analysierten Gruppen um Mamiani auf der einen und Gioberti auf der anderen Seite zusammenfassen. In diesem Sinn resümiert Rosmini im Jahr 1851 die sich mittlerweile seit zwei Jahrzehnten entwickelnde Diskussion: "Über die Auseinandersetzungen in der Philosophie bin ich unterrichtet; nicht so sehr, weil sie obskur sind, sondern vielmehr, weil sie im Grunde religiöser Natur sind. Leider will man rur den Rationalismus eintreten. Es gibt drei Gruppen gegen mich, und alle drei sind in ihrem Grund rationalistisch: jene Mamianis, die einer oberflächlichen Philosophie folgt, und die ich somit als moderat bezeichne; jene Bestinis, der sich mit Gioberti und Nallino verbündet und ein übertrieben mystischer Rationalismus ist; schließlich jene Spaventas und der anderen Neapolitaner, die dem Hegelianismus bzw. zusammen mit diesem dem systematischsten Unglauben anheim gefallen sind, man könnte auch sagen, sie hingen dem schamlosesten und materiellsten Pantheismus an. Ich weiß, diese vollbringen große Taten, doch wird ihre Rauferei von kurzer Dauer sein, denn es ist unmöglich, dass sich die Wahrheit nicht durchsetzt - dabei meine ich jenen Teil an Wahrheit, der in den derzeitigen Umständen der Menschheit notwendig geworden ist und der der Vorhersehung anheim gegeben ist,,54. Mit der dritten hier genannten Gruppe sieht Rosmini bereits jene Phase am Horizont aufziehen, welche die philosophische Diskussion um "Rosmini und 53 Dieser "Freispruch" wird nur unter Annahme der These verständlich, dass unter den kirchlich maßgeblichen Personen zwar ein weitgehendes Misstrauen gegen die "liberalisierenden" Ideen Rosminis herrschte, die Meinung, dass diese auf einem philosophisch-theologisch folgereichen Ansatz begründet seien, sich jedoch noch nicht ausreichend durchgesetzt hatte. 54 Brief an F. Puecher vom 10.06.1851, in: EC XI, 294. Vgl. auch die beiden Briefe an P. Bertetti vom 19.06.1851, in: EC XI, 301, und vom 6.05.1852, in: ebd. 571. Von der anderen Seite betrachtet, sieht dies im Jahr 1836 folgendermaßen aus: "Ihr habt Alfieri Niedertracht vorgeworfen, Foscolo geistigen Diebstahl und Tobsucht, Kant und Rousseau geistigen Diebstahl, krankhafte Trägheit und Phantasievorstellungen; ihr habt Bentham einen Sophisten, Hobbes einen Sophisten und Gioia einen üblen Sophisten genannt; ihr bezeichnetet Condillac eine anmaßende Person und Locke ein Kind; rur euch ist Romagnosi ein Plagiator, ein Lügner, ein spöttischer und unlauterer Mensch; Benjamin Constant nanntet ihr Verfälscher von Tatsachen, Plagiator, abergläubisch und gottlos, dabei war er ein äußerst redegewandter Verteidiger des Prinzips der Religion. Gegen Benjamin Constant habt ihr ein Buch mit dem Titel Geschichte der Gottlosigkeit geschrieben; weiterhin habt ihr gegen Foscolo und gegen den Grafen Mamiani ein Buch geschrieben sowie vier Bücher gegen Gioia gerichtet. Euer schriftstellerisches Leben ist eine kontinuierliche unversöhnliche Invektive" (Brief C. Cattaneos an A. Rosmini vom 29.10.1836, in: Cattaneo, Opere, VI, 161 f.).
38
Markus Krienke
die deutsche Philosophie" nach seinem Tod ein Jahrhundert lang beschäftigen sollte - allein deren Tragweite sollte sich in unerwartbarem Ausmaß entwickeln.
2. Zweite Phase: Rosmini aJs "italienischer Kant" und italienisches" Pendant" zu HegeJ Wie die soeben zitierte Einschätzung Rosminis selbst erweist, hebt die "zweite Phase" in ihrem historischen Ursprung bereits zu Beginn der l850er Jahre an 55 . Die Abhandlungen des Philosophen Bertrando Spaventa Studi sopra Ja filosofia di HegeJ (1850), Frammenti di studii suJJa filosofia italiana deJ sec. XVI (1852) und La filosofia di Kant e Ja sua reJazione colJa filosofia italiana (1860) markieren aus dem Grund einen Paradigmenwechsel in der Wirkungsgeschichte der Problematik "Rosmini und die deutsche Philosophie", da sie nicht lediglich eine Radikalisierung der Kritik und Vorwürfe der ersten Phase bedeuten, sondern qualitativ, d. h. philosophisch-systematisch, eine völlig neue Ebene der Auseinandersetzung begründen. Im Zuge der nationalen Einigungsbewegung entwirft Spaventa eine geschichtsphilosophische Gesamtkonzeption, welche darauf hinausläuft, in der italienischen "filosofia nazionaJe"56 wieder jene philosophische Hegemonie in Europa auf die italienische Halbinsel zurückzuholen, die diese in der Renaissance innegehabt, danach aber an die entstehenden nationalen Philosophien außerhalb des späteren Italiens abgegeben habe. Mit Kant und Hegel sei diese Philosophie in der Neuzeit an ihren Höhepunkt gelangt. Spaventa erkennt seinerseits in Galluppi, Mamiani, Rosmini und Gioberti die Protagonisten des italienischen Risorgimento, d. h. nach seinem Verständnis dieser Epoche diejenigen philosophischen Persönlichkeiten, welche die italienische Philosophie wieder spekulativ auf die Ebene der europäi55 Zur "zweiten Phase" kann zusammenfassend auf die folgenden Studien verwiesen werden: Paolo De Lucia, L'istanza metempirica dei filosofare. Metafisica e religione nel pensiero degli hegeliani d'Italia (= Collana di Studi e Ricerche, Bd. 38), Genova 2005; Giovanni Formichella, La critica gentiliana dei sistema di Rosmini, in: Giuseppe Beschin I Alfeo Valle I Silvano Zucal (Hg.), Il pensiero di Rosmini a due secoli dalla nascita, 2 Bde., Brescia 1999, I, 93-106; Pier Paolo OUonello, Il mito di Rosmini "Kant italiano", in: ders., Rosmini. L'ideale e il reale (= Pier Paolo Ottonello Scritti, Bd. 10), Venezia 1998, 53-66; Maria Adelaide Raschini, Validita e limiti dell'interpretazione spaventiana dei Rosmini edel Gioberti, in: Giomale di Metafisica 21 (1966) 265-269; MicheIe Federico Sciacca, Rosmini nella storiografia italiana, in: ders., Interpretazioni rosminiane (= Opere di Micheie Federico Sciacca, Bd. 1,5), Palermo 1997, 33-44; Ugo Spirito, Le interpretazioni idealistiche di Rosmini, in: MicheIe Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso intemazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957, 3--45. 56 V gl. Luciano Malusa, L 'idea di tradizione nazionale neJla storiografia filosofica italiana dell'Ottocento, Genova 1989.
Rosmini und die deutsche Philosophie
39
sehen Philosophie zurückgeführt und dadurch - gleichsam die "Zirkelbewegung" vollendend - Letztere dem Land ihres Ursprungs zurückerstattet haben 57 • Die Bedeutung dieser Protagonisten des Risorgimento ist dieser Systematisierung der Genese der "filosofia nazionale" gemäß danach zu bemessen, inwieweit es ihnen gelungen sei, die Entwicklung der deutschen Philosophie "von Kant bis Hegei" in Italien zu reproduzieren und zu überbieten. Das interpretative Interesse, mit dem Spaventa an Rosmini herantrat, bestand somit in der Frage, inwiefern Rosmini nicht nur Kant mehr oder weniger exakt in Italien rezipiert hat, sondern ob es ihm auch gelungen sei, diesen auf der systematischspekulativen Ebene des idealistischen Denkens weiterzuentwickeln. Vereinfacht könnte man sagen, dass die Interpretation Spaventas an Rosmini einzig das Interesse hegte, inwieweit er für eine Weiterentwicklung des Kantismus im 57 Diese These brachte Spaventa selbst im Jahr 1861 in seinem Werk La filosofia italiana neIle sue relazioni con la filosofia europea auf das folgende Schema: "Italien stößt die Tür der modemen Zivilisation mit einer Phalanx von heldenhaften Denkern auf. Pomponazzi, Telesio, Bruno, Vanini, Campanella und Cesalpino scheinen Söhne mehrerer Nationen zu sein. In ihnen klingen bereits mehr oder weniger aIle späteren Richtungen an, welche die Periode der Philosophie von Descartes bis Kant konstituieren. So haben Bacon und Locke ihre Vorläufer in Telesio und CampaneIla, Descartes wiederum in CampaneIla, Spinoza in Bruno und gleichzeitig findet sich bei Bruno selbst ein Stück des Monadismus Leibniz', des Gegners Spinozas. Schließlich entdeckt Vico die neue Wissenschaft und nimmt das Problem des Erkennens vorweg, indem er eine neue Metaphysik. die zu den menschlichen Ideen übergeht, fordert. Indem er das Wort und den Mythos auf deren Begriff bringt, gründet er die Philologie, er intuiert die Idee des Geistes und schafft somit die Geschichtsphilosophie. Vico ist der wahre Vorläufer ganz Deutschlands. [ ... ] Nach Vico scheint die origineIle Kräftigkeit des italienischen Geistes versiegt. Unsere Philosophen empfangen ihre Anregungen aus anderen Ländern. Lediglich Vico hat eine eigene Originalität. GaIluppi, Rosmini und Mamiani entnehmen bei Kant das Problem des Erkennens; ihr Mangel ist, sich darin zu erschöpfen. Sie bemerken nicht, dass die wirkliche Bedeutung dieses Problems die Notwendigkeit einer neuen Philosophie ist: der Philosophie des Geistes ansteIle des Seins. Nur Gioberti, in welchem man die Rückkehr der Spontaneität des italienischen Geistes erkennen kann, bemerkt, dass die Psychologie Mittel und nicht Ziel ist; sie ist Mittel, um ein neues Prinzip grundzulegen, nicht aber um das alte zu bestätigen. [ ... ] So faIlt der letzte Grad, zu dem sich die italienische Spekulation erhoben hat, mit dem letzten Resultat der deutschen Spekulation zusammen. [ ... ] Wie in Kant erkennt man also auch in Rosmini den Begriff der Einheit des Geistes [... ]; doch ist dieser Begriff noch dunkel und undurchdrungen. Die Klarheit des Kantischen Begriffs ist die deutsche Philosophie nach Kant; dies ist eine klare, schrittweise und folgerichtige Genese. Die Klarheit des Rosminischen Begriffs in Italien ist gewissermaßen eine plötzliche Erscheinung, eine Explosion. Daher ist sie keine wirkliche Klarheit. [ ... ] Gioberti vollendet Rosmini, wie Fichte, Schelling und Hegel Kant vollenden" (Bertrando Spaventa, La filosofia italiana neIle sue relazioni con la filosofia europea, hg. von Alessandro Savorelli [= Temi e testi, Bd. 45], Roma 2003, 23, 117; zum "nationalen Charakter" der Philosophie des italienischen Neoidealismus vgl. Vito Fazio-Allmayer, Il problema della nazionalitä nella filosofia di B. Spaventa, in: Giornale Critico della Filosofia Italiana 1 [1920] 173-190).
40
Markus Krienke
hege Ischen Sinn tauge. Diesem Paradigma gemäß, muss Spaventa allerdings zu dem Ergebnis kommen, dass Rosmini hier im idealistischen Sinn keinen besonderen Hinweis bietet, um über Kant hinauszugehen; im Gegenteil habe er, so Spaventa, von Kant eher die Mängel als die Verdienste geerbt58 • Somit bleibt Rosmini "Kant" und findet seinen "Hege I" in Gioberti 59 • Dieser interpretativen Systematisierung Rosminis als "italienischer Kant"60 gemäß, steht für Spaventa der Nuovo Saggio im Vordergrund, d. h. jenes Rosminische Werk, in welchem der Einfluss Kants auf die Rosminische Gnoseologie deutlich wird. Das Paradigma Spaventas, das folglich die weitere Denkentwicklung Rosminis bis hin zum Saggio storico critico und zur Teosofia - und damit auch die im Nuovo Saggio bereits selbst angelegten Entwicklungslinien ausblendet, sollte ein ganzes Jahrhundert lang die philosophische Bewertung 58 Vgl. Spaventa, La filosofia italiana, 116. "Nochmals: In Kant sind zwei Menschen und sozusagen zwei Philosophien. Rosmini bedenkt von diesen nur eine, d. h. die schlechte" (ders., La filosofia di Kant, 240 f). 59 Vgl. Spaventa, Kant e la filosofia italiana, 176; vgl. auch das Urteil Gentiles: "Nachdem Rosmini und Gioberti das genannte Prinzip [sc. das Prinzip der ursprünglichen konstruktiven Tätigkeit des Denkens] des modemen Idealismus wiederentdeckt hatten, entwarfen sie eine Philosophie, in welcher der erste jedoch auf halbem Weg stehen blieb, da er jenem Pantheismus misstraute, aufweIchen seiner Meinung nach die idealistische Philosophie in Deutschland hinausgelaufen sei. Der Zweite schritt jedoch beherzt voran und schloss mit fester Hand den gesamten Zyklus des universalen Lebens in den menschlichen Geist ein" (Gentile, Il pensiero italiano, 72 f). Der systematische Ort dieses Stehenbleibens "auf halbem Weg" ist jedoch nicht leicht zu bestimmen. Wenn Rosmini für Spaventa und Gentile auch in einigen Punkten hinter Kant zurückblieb (Synthesis apriori) - zumal auf der Ebene des Buchstabens, auf der er ihn nur allzu deutlich des Verlassens metaphysisch-realistischer Konzeptionen bezichtigt -, so hat er doch (aus der Sicht Spaventas und Gentiles) einen wichtigen Ausgangpunkt für die Entwicklung des italienischen Neoidealismus über Kant hinaus gelegt, und zwar die apriorische Synthesis nicht aus der Analyse der Verstandesurteile zu gewinnen, sondern sie im ursprünglich-ontologischen Sinn als Konstitution des menschlichen Bewusstseins anzusehen. In diesem Sinn ist der "halbe Weg", auf dem Rosmini halt gemacht habe, für Spaventa "zwischen Kant und Fichte" anzusiedeln (Spaventa, Kant e la filosofia italiana, 220 f). 60 Der geistesgeschichtliche Hintergrund dieser "Formel" lässt sich bis zu Pasquale Galluppi zurückverfolgen (vgl. oben Anm. 37). Auch bei Gioberti findet sie Anhalt, der davon spricht, Rosmini habe Kant "italienisiert" [italianeggiato] (vgl. Gioberti, Dei Primato, II, 44); sodann begegnet sie wieder bei Donato Jaja: "Rosmini glaubte, in seiner Gnoseologie die apriorische Synthesis Kants zu bekämpfen. So wurde er am Ende tatsächlich, ich sage nicht Kantischer als Kant, wie er selbst glaubte [I], erreichte aber dennoch gewiss Kant selbst" (Donato laja, Studio critico sulle categorie e forme dell'essere di A. Rosmini, hg. von Pier Paolo Ottonello [= Collana del bicentenario, Bd. 5], StresaiRoma 1999 [vgl. Bologna 1 1878], 16), womit dieser allerdings treffend die Spaventasche Interpretation Rosminis zusammenfasst. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Pantaleo Carabellese, La teoria della percezione intellettiva di A. Rosmini. Saggio critico, Bari 1907, 156.
Rosmini und die deutsche Philosophie
41
der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" bestimmen. Diese Lesart Rosminis wurde sicherlich durch das historische Faktum begünstigt, dass gerade die beiden genannten Werke, in denen Rosminis Weiterentwicklung über seine Auseinandersetzung mit Kant hinaus deutlich wird, erst posthum, nämlich 1859/74 bzw. 1881 erschienen sind - also zu dem Zeitpunkt, als Spaventa seine Theorie ausarbeitete, von diesem gar nicht berücksichtigt werden konnten. Bestätigung - nicht Relativierung - findet diese Beobachtung durch einen Aufsatz Spaventas mit dem Titel "Die Widerlegung Hege\s durch Rosmini" aus dem Jahr 1855: Wiewohl dieser die Teosofia nicht kannte (kennen konnte), basierte er seine Analysen ganz auf der Rosminischen Hegelrezeption des Rinnovamenta bzw. zusätzlich auf seinem Paradigma des "Kantischen" Rosmini. Konkret wirft er in dem genannten Aufsatz Rosmini vor, "Hege1 durcheinander gebracht, ihn verstellt zu haben, Lektürefehlem unterlegen zu sein, in der Übersetzung Worte ersetzt zu haben und so in offenkundiger Weise das Hegeische Denken mit seinem eigenen durchsetzt zu haben"61. Einmal mehr wird in dieser Abhandlung deutlich, dass sich für Spaventa gerade im Vergleich mit Hegel der Rosminische Kantismus erweist. So steht nach dieser Untersuchung als Ergebnis fest, was Spaventa bereits bei anderer Gelegenheit formuliert hatte: Rosmini "entdeckt die wirkliche Natur der intellektiven Perzeption [percezione intellettiva]: Diese Entdeckung ist sein wahrer Ruhm"62. Zentrales Interpretament der These Spaventas ist das "synthetische Urteil apriori" bei Rosmini und Kant63 . Diese interpretative Vorentscheidung zeigt deutlich das konkrete Vorgehen Spaventas, nämlich die Reduktion der Rosminischen Erkenntnistheorie unter Ausklammerung ihrer ontologischen Dimension auf das Kantische Urteilsverständnis 64 . Überhaupt wird der durch Spaventa 61 Bertrando Spaventa, Hegel confutato da Rosmini, in: ders., Da Socrate a Hege\. Nuovi Saggi di critica filosofica, hg. von Giovanni Gentile, Bari 1905 (vg\. in: Il cimento 3 [1855] 881-906), 151- 191. 62 Spaventa, La filosofia di Kant, 194; vg\. ebd. 210 f. Er spricht diesbezüglich auch von einer "engen Verbindung [ .. . ] zwischen Kant und Rosmini" (ebd. 214 f.). 63 So urteilt Francesco Fiorentino wenige Jahre später: "Konzentriert man sich eher auf die innere Substanz der Lehre und die eiserne Notwendigkeit der Logik statt auf die orthodoxen Äußerlichkeiten oder die subjektiven Ziele des Autors, sah sich Spaventa nach einem detaillierten und findigen Vergleich zwischen den beiden Philosophien zur unumstößlichen Schlussfolgerung in der Lage, dass Kant und Rosmini dasselbe sagen, dass sie - zumindest formell - die synthetischen Urteile apriori im sei ben Sinn annehmen und dass sie beide denselben Begriff von dem grundlegenden Problem der Philosophie besitzen. Kant und Rosmini stimmen darin überein, nicht von einer ursprünglichen Einheit, sondern von einer Zweiheit auszugehen; Kant von der Spontaneität und Rezeptivität des Geistes; Rosmini von der Idee des Seins und von der Sinneswahrnehmung" (Francesco Fiorentino, La filosofia contemporanea in Italia, Napoli 1876,23 0 . 64 Und wieder kann Fiorentino zusammenfassend feststellen: "Rosmini dagegen erfasste den Kantismus in seinem wahren Gehalt, nämlich in der Verknüpfung der bei den
42
Markus Krienke
begründete italienische Idealismus die begründungstheoretisch-ontologische Dimensionalität der "Formen" Idealität und Realität des Nuovo Saggio als zu übelWindendes Residuum klassisch-metaphysischen Denkens bei Rosmini ansehen, das diesem nicht gelungen sei, gänzlich hinter sich zu lassen. Gravierender jedoch als der ausgeklammerte ontologische Charakter der "Formen" elWeist sich in der Interpretation des Idealismus, dass dadurch die Rosminische Denkform zwangsläufig verkannt werden musste: In der Tat präsentiert sich die Intention eines Denkers in völlig anderer Weise, wenn man annimmt, es sei ihm nicht gelungen, ontologische "Traditionalismen" zu übelWinden, als wenn man davon ausgeht, dass er sich mit der ontologisch-metaphysischen Dimension menschlichen Erkennens als klassischem Paradigma bewusst vom neuzeitlichen Standpunkt aus auseinandersetzt. Seine entscheidende Bedeutung als zentrale Figur des Risorgimento und Vordenker des italienischen Idealismus erhält Rosmini somit als "italienischer Kant" - eine Bezeichnung, welche ihm Donato Jaja, sich an Galluppi orientierend, verleihen sollte. In dem Maße, wie aber Kant rur den (deutschen) Idealismus nur den Ausgangspunkt darstellt, wurde auch Rosmini vom Hegelianer Spaventa als letztlich übelWunden erkannt, und zwar durch den eigentlichen Rezipienten Hegels in Italien - nämlich Gioberti - einerseits bzw. nachgerade durch die Denker des italienischen Idealismus andererseits. Diese unmissverständliche Schematisierung - man könnte sie auch als "Konstruktion" auffassen - ist in seiner letztlichen Ausformulierung F. Fiorentino zu verdanken, der nach der Ausarbeitung des idealistischen Paradigmas dieses in mehreren Schriften nicht nur untermauerte, sondern es damit rur die weitere Entwicklung des Idealismus in griffige Formeln brachte. So äußerte er in aller Deutlichkeit im Jahr 1876: "Man kann sagen, dass die italienische Philosophie dieses Jahrhunderts unter den Vorzeichen Kants geboren wurde und sich entwickelte, auch wenn es so scheint, als wolle sie sich entschlossen von diesem wegentwickeln. Nach Galluppi ist Antonio Rosmini der Beweis für diesen unausweichlichen Einfluss. [RosminiJ ist der subtilste, tiefgründigste und gelehrteste Geist, den Italien gegenwärtig in den philosophischen Wissenschaften hervorgebracht hat. Ohne die unbequemen Zügel seiner streng religiösen Erziehung wäre er zum kräftigsten unserer Denker avanciert"65.
Damit war das weitere Programm formuliert, aus den erkenntnistheoretischen Schriften Rosminis, insbesondere dem Nuovo Saggio, jenen "vero Rosminf' zu extrapolieren, der - befreit von seinen metaphysischen Überresten der philosophischen Tradition - durch seine Entdeckung der Kantischen "SubErkenntnisvermögen, der Sinnlichkeit und des Verstandes; und im Nuovo Saggio wirft er das Kantische Problem explizit wieder auf' (Fiorentino, La filosofia contemporanea, 205). 65 Fiorentino, La filosofia contemporanea, 6.
Rosmini und die deutsche Philosophie
43
jektivität" ftir die weitere Entwicklung des Idealismus den Grundstein gelegt habe. Eine solche Interpretation war natürlich dazu gezwungen, weite Teile seines Denkens als Überreste der religiösen, metaphysischen bzw. allgemein objektivistischen Tradition anzusehen, von denen er allerdings befreit werden müsse 66 . In diesem Sinn deutet Fiorentino das Projekt Spaventas: "Spaventa taute die ersten Bewegungen der Rosminischen Spekulation auf und entdeckte einen Philosophen und einen Kantianer, wo andere einen Orthodoxen und einen Theologen gesehen hatten"67. In ihrer spezifischen Verkürzung der gnoseologischen Problematik des Nuovo Saggio, welche in der idea dell 'essere und nicht im giudizio primitivo ihre
letztliehe - und das heißt: ontologische - Grundlegung erfährt, auf das reine Faktum, dass der Mensch "erste Urteile" und somit die Synthesis apriori vollzieht, bzw. mithin das Erkannte in der Erkenntnis, d. h. im Urteilsvorgang, selbst konstituiert, stellten Spaventa und Fiorentino jedoch ein Faktum heraus, von welchem es an diesem Punkt fast unverständlich erscheinen muss, wenn es im 20. Jahrhundert wieder deutlich in den Hintergrund treten sollte: dass Rosmini nämlich Kant "in seinem wahren Kern" erfasst und die Auseinandersetzung mit der Mitte der Kantischen Gnoseologie zum Grundanliegen seines Nuovo Saggio macht. Ihre vollständigste Ausführung erhält die Rosminiinterpretation des italienischen Idealismus wohl durch Donato Jaja. Von Spaventa und Fiorentino nahm dieser die kantianische Lesart des Nuovo Saggio auF 8, um sodann aber in einer 66 In diesem Sinn spricht Lombardo-Radice von einem "schreienden Gegensatz zwischen den beiden Rosmini : dem dogmatischen, der das objektive Apriori setzt, und dem Kant italiano, wie er in den kritischen und in der Tat interpretativen Darlegungen Spaventas, Jajas und Gentiles zum Ausdruck kommt, die über den Buchstaben und über die historischen Bedingungen hinausgehen, die Rosmini - Rosmini selbst und den Rosminianern - antikantianisch und platonisch scheinen ließen" (Recensione, in : La Critica 4 [1906] 218-221, hier 219). Interessant, aber für die weiteren Ausführungen nicht wesentlich, sind die folgenden Überlegungen, denen zufolge die genannte "Verschiebung" des "vero Rosmini" letztlich auf Manzoni zurückgehe, der schlichtweg aus philosophischer Unkenntnis die Rosminische Lehre platonisch "verdorben" habe. 67 Fiorentino, La filosofia contemporanea, 26. "Als Rosmini den NuovoSaggio abfasste, hatte die Kantische Kritik seine gesamte Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So spiegeln auch die Probleme, die er darin anging, diesen Einfluss wider: Nach und nach beeinflussten ihn auch die Lehren seiner Nachfolger und Fortführer, die ihm in kurzer Zeit in Deutschland nachfolgten" (ebd. 24). Rosmini, so Fiorentino weiter, habe vielleicht durchaus die Intention besessen, Kant und die Hegeische Dialektik zu bekämpfen, sei allerdings gegen diesen seinen Willen den Lehren seiner ursprünglichen Gegner verfallen und habe sich - wenn auch im Glauben, sie bekämpft zu haben - diese zueigen gemacht (vgl. ebd. 24 f.). 68 "Es war Kant selbst, der darüber hinausging und - vom Beginn zum Zentrum seiner neuesten kritischen Untersuchung fortschreitend - zeigte (und dies nicht erkannt zu
44
Markus Krienke
Klarheit wie keiner der beiden ihm vorhergehenden Exponenten des Idealismus die effektive Auswirkung dieser Rosminiinterpretation ftir die spekulative "Bedeutung" Rosminis selbst zu formulieren: "Es ist mittlerweile ein halbes Jahrhundert her, dass unser Rosmini, der über diesen Punkt - ohne sich dessen bewusst zu sein - eine der bedeutendsten Seiten des Kantischen Kritizismus erklärt hat und somit die Aufmerksamkeit der Philosophen darauf gelenkt hat. Wer beachtet aber bei uns in Italien Rosmini? Er wurde überholt - und dies genügt,,69.
In diesen Worten ist eine der deutlichsten Aussagen zur "Bedeutung" des "italienischen Kant" ftir die idealistische Philosophie enthalten, die beim Studium der Texte begegnet: die nämlich nicht darin besteht, Gesprächspartner oder kritische Instanz zu sein, sondern einzig die historische Bedeutung zu besitzen, dieses Denken in Italien durch seine Kantrezeption initiiert zu haben, ansonsten aber von einer mittlerweile überholten Aktualität ftir die Philosophie selbst zu sein. Zweifelsohne hat Jaja auf diese Weise entscheidend zur Formulierung des idealistischen Selbstverständnisses beigetragen. Und noch ein weiterer Aspekt zeichnet seine Position als zentral aus: Während nämlich Spaventa auch nach dem Erscheinen der Teosofia diese nicht mehr in seiner Rosminideutung berücksichtigte, da sie sein interpretatives Schema zu sprengen drohte - Fiorentino kommt in der Rosminiinterpretation durchaus keine eigene Originalität zu -, vollzog Jaja durch seine Analyse der Teosofia die längst vom Idealismus geforderte Verifikation seiner Rosminiinterpretation anhand einer Analyse desjenigen Werkes, in welchem sich Rosmini zentral mit der Hegeischen Wissenschaft der Logik auseinandersetzte. Für Jaja ist nicht Kant, sondern Hegel der eigentliche Gesprächspartner Rosminis, denn erst aus der Rosminischen Beschäftigung mit Hegel - "am Grund der unsterblichen Seiten seiner Teosofia schlägt das neuzeitliche Denken" - erwachse ftir Rosmini die Möglichkeit, dass der "kantianische Widerspruch" zwischen Subjekt und Objekt "seine endgültige Lösung findet'oo. In dieser "Hege Ischen" Perspektive erscheint das Verdienst Rosminis haben, ist der Schwach punkt Rosminis), dass die Erkenntnis in allen ihren Graden und Erscheinungsweisen nichts anderes als reine Synthesis ist" (Donato Jaja, L'unita sintesistica kantiana e l'esigenza positivista, in: ders., Saggi filosofici, Napoli 1886, 151179, hier 153 f.). 69 Jaja, L'unita sintesistica, 165. 70 Jaja, Studio critico, 106-116, hier 107, 115. In diesem Sinn ist auch rur Jaja der "halbe Weg", auf dem Rosmini in seiner Rezeption des Idealismus halt gemacht habe (vgl. oben 59), deutlich weiter "hinten" angesiedelt als rur Spaventa. Hat Letzterer Rosmini noch weitaus "Kantischer" interpretiert; so resümiert Giordano di Jajasche Interpretation: "Wie Rosmini tatsächlich in seiner Erkenntnistheorie, in direktem Widerspruch zu Kant beginnend, am Ende ein vollkommenerer Kantianer wurde, als Kant selbst dies war, so auch in der Ontologie: antihegelianisch zu Beginn, fand er sich am Ende inmitten des Hegelianismus wieder" (Giordano, Le principali interpretazioni, 87). In den Worten Jajas lautet diese Interpretation folgendermaßen: "Er [sc. Rosmini] über-
Rosmini und die deutsche Philosophie
45
gegenüber Kant im Nuovo Saggio - die Reduktion der Kantischen Formen auf eine einzige - in seiner gesamten Deutlichkeit und in einer spekulativen Relevanz, wie sie selbst bei dem Kantianer Galluppi, der die These von der "Reduktion" der Formen als erster formuliert hatte, nicht zum Ausdruck kam 71 • Und wenn es Jaja zudem gelingt, die bei Gioberti bereits hervortretende Finalisierung der Problematik des Nuovo Saggio auf die Seinsfrage in ihrer vollen dialektischen Relevanz zu verdeutlichen, dann ist dies kein historischer Zufall, sondern dient ihm als Bestätigung seiner Argumentation vom teosofischen (Rosminischen) bzw. hegelianischen Horizont her - sowie als Interpretation des Denkens Giobertis selbst im Idealismus, der im Bezug zu Rosmini eher als der "italienische Hegei" angesehen wurde. Jajas großes Verdienst besteht demnach zweifelsohne in der nach ihm für lange Zeit in Vergessenheit geratenen Einsicht in die ontologische Begründungsdimension der Gnoseologie bei Rosmini. Mit dieser Intuition, die wohlgemerkt aus der Auseinandersetzung Jajas mit der Teosofia erwachsen ist, erweist er sich der Rosminirezeption zu seiner Zeit weit vorauseilend 72 • Und an diesem Punkt wird ebenso das Verdienst dieser "zweiten Phase" deutlich, denn es waren die italienischen Hegelianer, die erstmals konzeptionell in der Lage waren, den Wert der Rosminischen Spekulation zu erfassen - selbst dem größten Interpreten der "ersten Phase", d. h. zu Lebzeiten Rosminis, Gioberti, fehlten dazu noch die theoretischen Instrumente 73 • Die wand die einfache Entgegensetzung Fichtes, um zur absoluten und indifferenten Identität Schellings zu gelangen". Somit finde sich, so Jaja weiter, die "Vollendung des teosofischen Seins Rosminis" im "absoluten Idealismus Hegels" (Jaja, Studio critico, 115 f.). In diesem Sinne affirmiert dann auch der Gentilianer Varisco: "Die Rosminische Gnoseologie bildet daher hinsichtlich der Kantischen einen wirklichen und großen Fortschritt; wenn auch nicht ganz in dem Sinn, den R. voraussetzte. Die Erkenntnisfunktionen werden nicht, wie noch bei K., aus der Untersuchung der Urteile der gewöhnlichen Logik gewonnen, sondern aus demjenigen [sc. Urteil] des ursprünglichen und grundlegenden Faktums der Erkenntnis" (Bernadino Varisco, Tra Kant eRosmini, in: Rivista di Filosofia 1 [1909] 74-83, hier 76). 71 Jaja, Studio critico, 4l. 72 "Das Mineral ist affirmiert, es ist ein Existentes. Die Existenz, das Sein des Minerals, stammt nicht aus dem körperlichen Anblick; es besteht nicht ohne den körperlichen Anblick, stammt aber nicht aus diesem. Dies hat Rosmini in zeitlosen Überlegungen luzide aufgezeigt. Vor ihm hatte dies bereits Kant ausgesagt, als er die Anschauung ohne die Kategorie als blind bezeichnete" (Donato Jaja, L'intuito nella conoscenza, in: Atti della reale Accademia di Scienze morali e politiche 26 [1893/94] 483-525, hier 510). 73 So verweist Ottonello auf das Faktum, dass noch jene theoretisch-spekulative Problematisierung der Fragestellung des essere iniziaJe fehlte, die erst zu einer adäquaten Erfassung der "spekulativen Bedeutung der Problematik des initialen Seins" führe, welches das im Rosminischen Denken präsente "Korrelat zur Spekulation Hegels" bilde. "Und so musste man in der Rosminikritik des 19. Jahrhunderts vor Gentile auf zwei Hegelianer vom Format Spaventas und Jajas warten, um diese spekulative Ebene bewerten zu können. Denn so wahr es einerseits ist, dass sich Gioberti selbst den erfolgversprechendsten Weg verbaute, da er in jener Polemik verfangen war, die in der Dialektik
46
Markus Krienke
Kehrseite der Medaille der idealistisch-hegelianischen Interpretation der Teoso[ja bestand - analysiert man diesen Einwand stellvertretend anhand der Interpretation Jajas - darin, dass die Hegelianer die ontologische Bedeutung der Seins formen bei Rosmini selbst nicht individuieren konnten, da eben die "ontologische" Dimension bei Rosmini rur ein hegelianisches Verständnis von "Ontologie" nicht in den Blick geräe4 • Jaja wie den übrigen Vertretern des italienischen Idealismus konnten die Rosminischen "Formen" somit nur als primordiale Zerstörung und Verunmöglichung jeglicher Einheit des Seins erscheinen, weswegen sie die Ontologie Rosminis letztlich tout court ablehnten 75 • Der Hegelianer Jaja gelangt damit zu dem rur den weiteren (Neo-)Idealismus fundamentalen und mit der bisherigen idealistischen Interpretation völlig konformen Ergebnis, dass Rosmini der Konfrontation mit Hegel nicht standhalte und mithin auf der spekulativen Bedeutungsebene Kants verbleibe. Damit kommt Rosmini nach wie vor die einzige Funktion zu, den Kantischen Grund für die Entwicklung des Idealismus gelegt zu haben - seine Ambitionen der Auseinandersetzung mit Hegel werden mithin rur gescheitert erklärt. Die Zentzwischen Ontologismus und Pantheismus den spekulativen und lebendigen Kern der Rosminischen Spekulation - obgleich nur um ein Geringes - verfehlte, so blieb auch andererseits genauso Mamiani auf seinem Weg, auf dem er gleichwohl viel weniger Kraft entfaltete, isoliert. Ebenso widerfuhr es dann auch Galluppi in seiner unpräzisen Aufnahme des Rosminischen Profils, das dieses vielmehr entstellte" (Pier Paolo Dttonello, L'Ontologia di Rosmini [= Categorie Europee, Bd. II,22], L'AquilaJRoma 1989, 114 f.). Dies gilt auch, wie Ottonello weiter ausfUhrt, fUr Galluppi, Buroni und Benzoni. 74 "Das Sein leuchtet aus sich selbst heraus; das Denken, das erst dann ein solches ist, wenn es von diesem Licht getroffen wird, entsteht in dem Moment, da es von diesem berührt wird, als Schau und als Denken. [ ... ] Wir sind sicher, dass Rosmini wie auch jeder, der - auch ohne Rosminianer zu sein - mit ihm in der Annahme der reinen Objektivität des Seins übereinkommt, auf diese Weise sehr gut das große und wundersame Phänomen der Erscheinung des ersten Akts der Erkenntnis beschreibt; sagen sie aber gleichzeitig auch genügend, um es - über die Beschreibung hinaus - auch zu verstehen? Beschreiben ist notwendig; ist aber die Wissenschaft bzw. erst recht das, was deren erste und am weitesten zurückliegende Basis bildet, Beschreibung? [... ] Begründet die Schau des Seins wirklich das Denken? Diese Frage ist zuerst zu stellen [ ... ]. Die Schau konstituiert also nicht das Denken, sondern hebt dieses auf. [ ... ] Kant bereitete dazu den Weg, als er mit seiner Kritik - die in ihren Grundlagen immer noch nicht gänzlich verstanden ist - den neuen Begriff des Denkens als ursprüngliche synthetische Einheit fasste. [ ... ] Immanuel Kant und Antonio Rosmini, welche die Vergangenheit würdig zur Grundlage ihres tiefgreifenden erforschenden Denkens gemacht haben, sagen uns - jeder auf seine Weise -, dass sich das Problem nur durch die Analyse der Konstitution des Denkens lösen lässt" (laja, L'intuito, 521-525). Vgl. diesbezüglich bereits die Aussage Spaventas: "Die Frage ist fUr Kant also nicht - wie Rosmini glaubt - einfach jene nach den apriorischen Begriffen (nach den Kategorien), sondern diejenige nach der ursprünglichen Aktivität, die jedem Urteil zugrunde liegt, d. h. nach der ursprünglichen synthetischen Einheit des Bewusstseins" (Spaventa, La filosofia di Kant, 207). 75 Jaja, Studio critico, 85 f., 104--106.
Rosmini und die deutsche Philosophie
47
ralität dieser Rosminiinterpretation Jajas rur den italienischen Idealismus wurde bereits im 19. Jahrhundert in ihrer Tragweite erkanne6 und auch von den jüngsten Forschungsergebnissen bestätige7 . Die grundlegende Funktion, welche der (Neo-)Idealismus der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" beimaß, ist auch noch im 20. Jahrhundert in der Weiterentwicklung des Idealismus zum "Aktualismus" Giovanni Gentiles greifbar. Die Eckdaten seines philosophischen Wirkens können dabei symbolisch durch die erste und zweite Auflage seines Werkes Rosmini e Gioberti gekennzeichnet werden C1898, 21943). Zentrale Aussage seiner Bewertung des Idealismus seit dem Risorgimento ist, dass die Rosminische Objektivität mit der Kantischen Subjektivität identisch sei bzw. die percezione intelJettiva Rosminis mit dem synthetischen Urteil apriori Kants übereinstimme. Indem er seine kritische Rekonstruktion der spekulativen Leistung Rosminis zur Basis seiner eigenen Weiterentwicklung des italienischen Neoidealismus zu seinem eigenen "Aktualismus" macht, rückt er den Roveretaner dadurch in eine vorher nicht konzipierte Sonderstellung: "Rosminianismus bedeutet Risorgimento des italienischen Geistes und damit Wiederherstellung des religiösen Geruhls: Idealismus in der Philosophie, Romantizismus in der Literatur, Liberalismus in der Politik: also all des Lebendigen und Fruchtbaren, was das italienische Bewusstsein zwischen 1815 und 1860 bewegte. [ ... ] Der große Philosoph dieses Rosminianismus ist er, Rosmini, der Dichter ist Manzoni und Gioberti ist der Politiker. Alle drei sind indes Äste eines und desselben Stammes; und wenn die Philosophie das Gewissen und das Zentrum jeder Handlung des Geistes ist, 76 Vgl. Lorenzo Michelangelo Billia, Lo studio critico di Donato Jaja sulle categorie e forme dell' essere di A. Rosmini esaminato da Lorenzo Michelangelo Billia, Venezia 1891, 34. Mit dieser Interpretation sollten dann auch, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Mancini und Cristallini übereinkommen (vgl. Alessandro Cristallini, Il pensiero filosofico di Donato Jaja, Padova 1970; vgl. hierzu die Studie von Paolo De Lucia, Donato Jaja e il significato teoretico e storico della fiIosofia rosminiana, in: Filosofia oggi 25 [2002]339-373; zu Mancini vgl. unten Anm. 88). 77 "Gentile zielt immer eindeutiger darauf hin, Rosmini mit Gioberti zu ,überlagern', um am Ende Rosmini theoretisch zu ,überspringen'. Die eindeutige Voraussetzung dazu bildete die anfängliche und dann endgültige Marginalisierung der Teosofia. Dabei suchte er ihn solange zu ,bewahren', als er ihm rur das Argument des Risorgimento diente. Die ethisch-politische Lesart ,überwindet' in dieser Dynamik also definitiv die metaphysische. Hätte Gentile letztere, in der Formulierung Rosminis, in ihrer Ganzheit aufgenommen, dann hätte sie die Dialektik der Immanenz, die bei Gentile bereits herausgebildet war, von innen her aufgesprengt. So sah sich der eigentliche und enthusiastische, fast leidenschaftliche, Risorgimentalismo Gentiles, der die gewundene ,Verwirklichung' Rosminis umging bzw. vielmehr übersprang, notwendigerweise der wesentlich dringlicheren , Verwirklichung' des Kantischen Transzendentalismus und der viel zwingenderen ,Reform' der Hegeischen Dialektik ausgeliefert - jene als eindeutige Übertragungen der theoretisch viel subtileren ,Operation' Rosminis, nach dessen ,Auslassung'" (Ottonello, Rosmini. L'ideale, 22).
48
Markus Krienke dann ist dies ein ausreichender Grund, die Schule als Rosminianismus zu bezeichnen, die andere vielleicht diejenige Manzonis oder Giobertis nennen würden" 78.
Ohne näher auf den Aktualismus Gentiles selbst eingehen zu können, ist doch deutlich, dass in diesem die Ineinssetzung der Rosminischen Objektivität mit der Kantischen Subjektivität bzw. der intellektiven Perzeption Rosminis mit der Synthese apriori Kants theoretisch vollendet wird 79 • Rosmini zeichne einerseits eine fundamentale, über Kant hinausweisende, Einsicht aus 80 , doch dann sei er stehen geblieben, ohne diese weiter auszuführen 81 • Im Vergleich zu den Idealisten von Spaventa bis Jaja besteht das für die Wirkungsgeschichte der Problematik "Rosmini und die deutsche Philosophie" Wesentliche und in seinem spekulativen Gehalt nicht Überschätzbare der Inter78 Giovanni Gentile, Albori della Nuova Italia. Varieta e documenti (= OC, Bd. 202 I), Firenze 21969, 11, S. 22. Diesen Ausdruck vom "Morgenrot" ("albore") greift wiederum Carabellese auf: "In Rosmini erkennen wir daher das Morgenrot der neuen Philosophie, während wir in Hegel die grandiose und feierliche Krönung jener Philosophie sehen, welche die neuzeitliche war" (Pantaleo CarabeIJese, L'idealismo italiano. Saggio storico-critico, Roma 21946, 198). 79 ,,[ .•. ] was wir behauptet haben - dass nämlich die Rosminische Objektivität eine und dieselbe Sache wie die Kantische Subjektivität ist" (Rosmini e Gioberti, S. 248). Bereits einige Seiten zuvor hatte er dies auf die Formel gebracht: "Die intellektive Perzeption Rosminis ist mithin die wahre apriorische Synthese Kants" (ebd. S. 192). Gentiles Fortschritt in der Rosminiinterpretation besteht darin, die Rosminische "Form" nicht mehr univok mit den Kantischen Formen zu vergleichen und diese so implizit "gleichzustellen", sie mithin als deren einfache Vereinigung anzusehen, sondern das systematische Element, diesbezüglich ein solcher Vergleich stattfinden müsse, in der "ursprünglich synthetischen Einheit Kants" und der "percezione inteIJettiva" Rosminis erkannt zu haben (vgl. ebd. S. 173 f.). Vor diesem Hintergrund weist Gentile die Interpretation Spaventas der Rosminischen Synthese in den Begriffen einer "Anwendung der Kategorie auf die Sinneswahrnehmung" als "rein mechanische Angelegenheit" zurück, "denn Rosmini fasst ausdrücklich [ ... ] jene ursprüngliche Einheit des Geistes (im Grundernpfinden), welches - gemäß der treffenden Aussage Spaventas selbst - als Übergang [ponte di passoj zwischen dem Sinn und dem Intellekt dient; jenen Übergang, den er weder in Kant noch in Rosmini entdeckt" (ebd. S. 191 f.). Diesbezüglich stellt Gentile v. a. die Rosminische percezione inteIJettiva der Konzeption Malebranches gegenüber und urteilt: "Man könnte sagen, dass Rosmini mit geringfügigen Variationen MaIebranche wiederholt hat [ ... ]. Doch zwischen Malebranche und Rosmini liegt ein tiefgreifender Unterschied - jener Unterschied zwischen dem alten Idealismus und dem Kantischen Idealismus" (ebd. S. 213). 80 Weswegen er für Gentile zum Ausgangspunkt des "neuen Subjektivismus", des "wirklichen Subjektivismus Kants" wurde (Rosmini e Gioberti, S. 213). 81 "An dieser Stelle wird Rosmini also von einem dem Rosminianismus bzw., besser gesagt, dem Kantismus unterlegenen Prinzip überfUhrt, das von ihm aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Dies, weil er jenen ursprünglichen Synthesismus des Geistes nicht bedenkt, den auch er gesehen und als notwendige Bedingung der Erfahrung ausgemacht hatte" (Gentile, Rosmini e Gioberti, S. 237).
Rosmini und die deutsche Philosophie
49
pretation Gentiles darin, Rosmini von jener allzu starken Beziehung auf Kant und Hegel, wie sie bei Spaventa, Fiorentino und Jaja analysiert worden ist, befreit zu haben. Letztere erkannten das Verdienst Rosminis in all jenen Aspekten seiner Philosophie, in denen er diese sozusagen "nachahmte" bzw. sich ihnen anglich. Gentile bricht mit diesem Paradigma - und dies stellt fur die Rosminiforschung ein nicht zu unterschätzendes Verdienst dar. Er legt bei Rosmini m. a. W. auf all jene Argumente wert, in denen dieser auf Kant und Hegel kritisch reagiert hat, um somit das proprium des italienischen (Neo-) Idealismus nicht auf der Grundlage der Rezeption, sondern der kritischen Auseinandersetzung und Absetzung zu begründen. Gentile interessiert so nicht, wie und in welcher Weise sich Rosmini mit Kant und Hegel rezeptiv auseinandergesetzt hat, sondern wie er diese konkret umformte und somit für den italienischen Idealismus wirksam wurde 82 . Rosminis Denken sei ausgezeichnet durch das "Erfordernis einer Philosophie, die sowohl Kant als auch Hegel fortsetzt, jedoch im Sinne einer radikalen Reform"83. Diese "radikale Reform" beinhaltet natürlich für Gentile, Rosmini von seinen historischen Verhaftungen in der metaphysischen (d. h. "katholischen") Tradition zu befreien, um jenen Aspekt 82 So fährt Giovanni Gentile seine allseits zitierte Meinung, dass Rosmini "einer der allerersten" gewesen sei, "die die HegeIschen Werke im Original lasen, sie durchdachten und deren Lehren ausführlich kritisierten. Als er 1836 in seinem Rinnovamento [... ] die Lehre Hegels über das Kriterium der Gewissheit darlegte, gab es in Italien unter denen, die Philosophisches publizierten, keinen, der die Wissenschaft der Logik gelesen hätte, mit der er eine gewisse Vertrautheit an den Tag legte" (Giovanni Gentile, Le origini della filosofia contemporanea in Italia, Bd. 3. I Neokantiani egli Hegeliani, Erster Teil Bd. 33), hg. von VitoA. Bellezza, Firenze 21957, S. 182 f.), fort mit der Konsta(= tierung: "Doch was er im Rinnovamento sagt, wie auch das, was er im Vorwort zur Logica äußern wird [ ... ] und dann nochmals ausführlicher im posthumen Saggio storico-critico sulle categorie [... ], ist Teil eines gegenüber dem HegeIschen Denken solch abgeneigten, tauben und verschlossenen Geistes, dass es einen scharfsinnigen und gewissenhaften Geist wie denjenigen Rosminis in die offenkundigsten und nachweisbarsten Missverständnisse führte, wie Spaventa aufzeigte [ ... ]. Die Rosminischen Kritiken am Hegelismus erleuchten nicht diesen, sondern den Rosminianismus und so gehören sie eigentlich nicht der Geschichte des Ersteren zu" (ebd. S. 183 f.). So erklärt sich auch, warum bereits die Konstatierung, Rosmini sei als einer der ersten Hegelrezipienten anzusehen, mit einem "zwar" ("bensl') eingeleitet wird und dem Ganzen der Halbsatz "In eine Geschichte des Hegelianismus können auch Autoren von der Kraft Rosminis nicht eingehen" vorausgeht. Und auch in seinem Kommentar zum bereits zitierten Spaventa-Artikel Hegel confutato da Rosmini, wo er gegen Spaventa die Rosminische Kenntnis der Wissenschaft der Logik feststellt, schließt er unmittelbar an: "Er [sc. Rosmini] war im Endeffekt ein schlechter Kritiker, der sich nicht darum mühte, das Denken eines Autors von dessen Geist und dessen System her zu erfassen. Stattdessen klammerte er sich an Sätzen und aus dem Kontext genommenen Begriffen fest, und äußerte oft, in gutem Glauben, falsche und ungerechtfertigte Kritiken" (ebd. S. 159, Anm. I). 83 Augusto DeI Noce, Gentile e la poligonia giobertiana, in: Giomale critico della filosofia italiana 48 (1969) 222- 285, hier 245.
oe,
50
Markus Krienke
herauszustellen, in welchem für ihn der eigentlich spekulative Gehalt dessen Philosophie besteht: nämlich in der Fortführung der Ansätze seit Bruno, Campanel la und Vico und in der Einbettung in das Risorgimento die Grundlegung des italienischen Neoidealismus und Aktualismus geleistet zu haben 84 . Diesbezüglich müsse man "die Wesentlichkeit [l'essenzialita] des Rosminischen Denkens von seiner Zufalligkeit [accidentalita] trennen"85 - gerade seinen objektivistischen Gehalt als "accidentalita" interpretierend. In der internen Spannung der Kriterien "spekulative Intention" und "historisch-kontingente Verwirklichung"86 optiert Gentile für Erstere und findet gerade darin seinen "vero Rosmini" - im Bewusstsein, dass "wir eine Perspektive wählen, die nicht mit der von Rosmini gewollten übereinstimmt"87. Somit erhält mit Gentile das idealistisch-neoidealistische Projekt seine vollendete Ausformung in der endgültigen Eliminierung und Überwindung der ontologischen Dimension der "Anschauung", weswegen diese Positionen unter dem Stichwort des "Problem[s] der Kantischen Verwirklichung Rosminis" beschrieben werden können 88 . 84 "Der neue Idealismus, welcher nun folgen musste, und wie er durch jene Spekulation der ersten lahrhunderthälfte bereits ausgearbeitet wurde, sollte als Rechtfertigung und Bewertung der Erfahrung, der Geschichte sowie der menschlichen Hervorbringungen, wie sie sich in der Aktualität des menschlichen Geistes mühevoll entwickeln, erscheinen. Diesem antimetaphysischen Idealismus bereitete der Positivismus den Weg. Heute können wir unseren Gegnern von gestern Gerechtigkeit widerfahren lassen; heute, da Rosmini und Gioberti wiedererstanden, interpretiert und im selben Geist Manzonis und Mazzinis gewürdigt werden; aber in Rückbindung an eine Tradition, welche die Romantiker der vorbereitenden Ära wieder ins Gedächtnis riefen bzw. wieder neu zu studieren begannen: Bruno, Campanella, Vico. So erschien jene Philosophie, welche die Italiener glaubten, von anderen borgen zu müssen, nun, da sie in ihren Prinzipien vertieft, von ihrer Schlacke befreit und in ihrer ursprünglichen Inspiration wieder ins Leben gerufen wurde, als die notwendige Entwicklung der ursprünglichsten italienischen Philosophie, als der geeignetste Ausdruck unseres spekulativen Genius" (Gentile, 11 pensiero italiano, S. 78 f.). 85 Del Noce, Gentile e la poligonia giobertiana, 244. So fasst DeI Noce das Programm Gentiles zusammen und antwortet auf die seinerseits angefügte Frage: ,,[Wjas bleibt von der Philosophie Rosminis, nachdem die Theorie von der intellektuellen Anschauung eliminiert ist"?: ,,[Wjenn wir die Philosophie Rosminis von der ,dogmatischen' Lehre der Anschauung und somit von allem, was sein Überdauern sicherte [ ... j; wenn wir sie mithin von all dem trennen, weswegen er sich für den hielt, der nach der Aufklärung die große Tradition des katholischen Denkens wieder behauptete; wenn wir uns dafür auch noch der Hilfe der Kritiken Giobertis bedienen, die er im Namen desselben Ideals der Philosophie der Restauration vorbrachte - dann werden wir zu einer neuen Philosophie gelangen, welche die Schwierigkeiten der klassischen deutschen Philosophie selbst überwindet und alle Kommentare, die seitdem über Kant erschienen sind - mit Ausnahme desjenigen Spaventas -, auf eine bescheidene Bedeutung reduziert" (ebd. 244 f.). 86 Gentile, Rosmini e Gioberti, S. 42, 65, 70. 87 Gentile, Rosmini e Gioberti, S. 211. 88 Del Noce, Gentile e la poligonia giobertiana, 239. Zusammenfassend kann man mit Mancini also resümieren: "Die drei einschlägigen Punkte [der neoidealistischen Inter-
Rosmini und die deutsche Philosophie
51
Theologischerseits bzw. kirchlicherseits ist - und damit berühren wir den eigentlich skurrilen Punkt der "zweiten Phase" der Wirkungsgeschichte der Problematik "Rosmini und die deutsche Philosophie" - eine spiegelbildliche Entwicklung zu beobachten: Auch diese Kritik setzt praktisch unmittelbar nach dem Tod Rosminis ein, als nämlich Matteo Liberatore die Rosminische Erkenntnislehre als "in geradem Widerspruch" zu den Lehren des Thomas bezeichnete89 . Rosmini sei letztlich deshalb zu seinen verwerflichen Lehren gelangt, da er das subjektivistische Denken der Neuzeit vertrete und in seiner Erkenntnistheorie und Ontologie mehr Kant und den deutschen Idealisten denn dem Aquinaten folge 90 . Der sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum System ausformende Neothomismus begriff immer deutlicher im Rosminianismus einen seiner innerkirchlichen Hauptgegner. Nach der Papstwahl Leos XIII. und dessen Enzyklika Aeterni patris formulierte Comoldi die zentrale antirosminische These des Neothomismus, dass der Rosminianismus "auf diesen Syllogismus hinausläuft": "Zurückzuweisen ist jene Philosophie, welche auf Ontologismus und Pantheismus basiert; eine solche ist aber jene Rosminis, welche in seiner Teosofia dargelegt ist; somit ist diese Philosophie zurückzuweisen"91.
pretation Rosminis] sind: das Argument Spaventas, nämlich des europäischen ,Kreislaufes' im neuzeitlichen Denken; des Weiteren die Anerkennung Rosminis als neuer Kant bzw. als ,italienischer Kant' seitens Jaja (Rosmini e Gioberti, 1898, S. V und 62; vgl. 86 [vgl. jedoch in der dritten Auflage die Korrektur gerade dieser Stellen, Rosmini e Gioberti, S. 61, vgl. 81; M. K.]); sowie letztlich die historiographische Interpretation des 19. Jahrhunderts durch Gentile bezüglich der Entwicklung und Reifung unserer Philosophie des Risorgimento, die er dem Kantischen Hintergrund und der Anwesenheit des synthetisch-idealistischen Prinzips zuschreibt" (Italo Mancini, II giovane Rosmini, Bd. 1. La metafisica inedita, Urbino 1963 [ohne Fortsetzung], 28 f.). 89 "Gewiß kann es keinen größeren Gegensatz zwischen zwei Theorien geben, als wenn die einzelnen Sätze der einen denen der anderen gerade widersprechen. So aber verhält sich die Sache in unserm Fall" (Matteo Liberatore, Die Erkenntniß-Theorie des heiligen Thomas von Aquin. Aus dem Italienischen übersetzt von E. Franz, Mainz 1861, 67 [vgl. Della conoscenza intellettuale, 2 Bde., Roma 1857-1858, H, 101]). 90 Sich dieser Interpretation anschließend, bemerkt der Herausgeber der deutschen Ausgabe von Della conoscenza intellettuale Liberatores in seiner Einleitung: "Rosminis Theorie, welche in dem vorliegenden Buche so vielfach bekämpft wird, hat eine merkwürdige Aehnlichkeit mit einer in Deutschland höchst verbreiteten Anschauung; sie ist der Reflex derselben rationalistischen Richtung der Philosophie des vorigen Jahrhunderts, weIche auch in Deutschland nach schwingt und nicht selten sehen wir in den Erörterungen Liberatores gegen Rosmini deutsche Gelehrte betroffen" ({o. Verf.), Einleitende Bemerkungen, in: Matteo Liberatore, Die Erkenntniß-Theorie (vgl. Della conoscenza intellettuale, Bd. 2. Teorica di S. Tommaso, Roma 1858), III- XXII, hier XX). 91 II rosminianismo sintesi deli 'Ontologismo edel Panteismo, Roma 1881, III; vgl. 263-432.
52
Markus Krienke
Dazu stützen sich die neothomistischen Gegner insbesondere auf die posthum erschienene Teosofia, womit sie ein doppeltes Ziel verfolgen: Einerseits konnte dieses Werk als posthum veröffentlichtes gar nicht zu jenem corpus der Rosminischen Schriften zählen, die mit dem bereits genannten Dekret von 1854 (Dimittantur opera) offiziell als von Fehlern frei anerkannt worden sind92 • Der Versuch, bereits im Nuovo Saggio Rosminis Ontologismus oder Pantheismus nachzuweisen, war durch dieses Dekret mithin blockiert. Es kam den neothomistischen Gegnern Rosminis zusätzlich entgegen, dass gerade in den Rosminischen Auseinandersetzungen mit Hegel in den posthum veröffentlichten Werken die deutlichsten Anhaltspunkte rur den Nachweis dieser neuzeitlichen "Häresien" enthalten waren. Die neothomistischen Interpreten begriffen insofern besser als die Vertreter des Idealismus das wirkliche spekulative Gewicht der Teosofia und die reale Bedeutung der Rosminischen Hegelrezeption rur die Genese seines Denkens. Als "skurril" kann diese historische Konstellation bezeichnet werden, da dieser positive Beitrag des Neothomismus zur Wirkungsgeschichte der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" nicht aus dem Interesse heraus erreicht wurde, den Denker Rosmini zu würdigen, sondern im Gegenteil, um letztlich dessen Verurteilung durchsetzen zu können: Einen Rosmini der Teosofia als Rezipienten Hegels konnte man leichter des gewünschten Ontologismus und Pantheismus, also der Infizierung durch die neuzeitliche Philosophie, überführen als den "italienischen Kant" des Nuovo
Saggio.
In eigenartiger Parallelität glaubte man sich übrigens durch die Rosminiinterpretation des Neoidealismus bestätigt. In fast wörtlichem Einklang, nur einige Jahrzehnte früher als Gentile, resümierte G. De Lucchi in der Civi]ta Cattolica: "Der Rosminianismus ist Liberalismus in der Politik, Jansenismus in der Ethik, Pantheismus in der Philosophie"93. Hierin begegnet ein merkwürdiges historisches Zusammenwirken von Klerikalismus und Laizismus, von Neothomismus und Neoidealismus, von jenen beiden Polen mithin, die in ihrem Antagonismus der politisch-ideengeschicht-
92 Zu der hier verfolgten Strategie vgl. Krienke, Die "rosminische Frage", 198 f.; bzw. zur gesamten Phase der "Rosminischen Frage" zwischen Dimittantur und Post obitum, Luciano Malusa, L'ultima fase della questione rosminiana e il decreto "Post obitum" (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 9), Stresa 1989. 93 Diese Aussage veröffentlichte De Lucchi unter dem Pseudonym Clama neben anderen antirosminischen Stellungnahmen im Foglietto Religioso im Jahr 1881. Das nicht auffindbare Original ist zitiert in: Giovanni Mantese, La cultura religiosa egli studi teologici a Vicenza negli anni deli 'unificazione italiana, in: R. Aubert / Alberto M. Ghisalberti / Ettore Passerin d'Entreves (Hgg.), Chiesa e Stato nell'Ottocento, 2 Bde. (= Italia Sacra, Bd. 3-4), Padova 1962, II, 391-418, hier 406.
Rosmini und die deutsche Philosophie
53
lichen Entwicklung Italiens in dem Jahrhundert der "zweiten Phase" ihr charakteristisches Gepräge verliehen 94 . Für die Interpretation der Beobachtung, dass diese vehemente Anklage des Ontologismus und Pantheismus noch nicht zu Lebzeiten Rosminis vorgetragen wurde, ja dass sie noch unter dem gesamten Pontifikat Pius' IX. noch nicht zum systematisch ausgestalteten, ostentativ wiederholten Desiderium des Neothomismus wurde, sondern diese eigentliche Phase erst mit der Papstwahl G. Peccis im Jahr 1878 und der Enzyklika Aeterni Patris ein Jahr darauf einsetzte, können kirchengeschichtlich valide Erklärungen gefunden werden95 • Erst mit der Ausgestaltung des Neothomismus nach allen Regeln neuzeitlicher Systematik wurde das Rosminische Denken als wirklicher "Antipode"96, ja als letztes und entscheidendes theoretisch-spekulatives Hindernis für dessen eigene Durchsetzung begriffen. Diese Geisteshaltung lässt sich in Verhandlung und Durchführung der Verurteilung verfolgen 97 - und auch darüber hinaus, nämlich bis hin zum finalen Aufatmen, dass nun endlich das "Ende des Rosminianis-
94 "Die hauptsächliche historische Verfonnung und Verstümmelung von Person und Werk Rosminis geht wesentlich auf seine Einreihung in ein laizistisch interpretiertes Risorgimento seitens Spaventas und Gentiles zurück. Die andere große Verfonnung und Verstümmelung wurde von dem historischen Siegeszug des entgegengesetzten klerikalistischen Pols in der kurialen Politik über die erneuernde Kontinuität innerhalb der christlichen Tradition bewirkt" (Ottonello, Rosmini. L'ideale, 24). 95 Vgl. Krienke, Die "rosminische Frage", 181-187, 194-203. 96 Matteo Liberatore, Rezension zu: Petri Antonii Corte in R. Taurinensi Athen. Antehac Professoris, in usum Seminariorum Vol. I, Logica, Vol. IL Metaphysica, Vol. IIL Ethica. Taurini, 1875, in: La Civilta Cattolica, SeT. IX, Bd. 8 (26 [1875]) 58- 63, 61. 97 Vgl. Giovanni Domenico Bertolotti, Il rosminianismo ossia la filosofia moderna di fronte all'enciclica Aeterni Patris Unigenitus Filius dalla Santita di Leone XIII indirizzata all'episcopato cattolico, Genova 1885, 199-236. ,,[ . . .] der heilige Doktor bahnt sich seinen Weg mit den Attributen des Zeugnisses der Natur und der Erfahrung. Um bei der Entwicklung der menschlichen Erkenntnis zu bleiben, wäre so in der Tat nichts einfacher als der Beweis, dass während der hl. Thomas diesbezüglich ständig auf das Zeugnis der Fakten rekurriert, jene venneintlichen Meister [dagegen] im Namen der modemen Philosophen die Scholastiker anklagten, die Erfahrung vernachlässigt zu haben, um alles in jenem ungeordneten und verwirrten Wust von Meinungen jedweden Typs, welche sie unter dem scheinbaren Titel der Erkenntnislehre verbreiteten, der Überlegung anzuvertrauen. All diese, von Descartes bis Rosmini, von Leibniz bis Hegel gingen chimärenhaft und mit abstrakten Theorien vor, die mit den Lektionen, die uns der innere Sinn und die natürliche Ordnung der Seienden vennittelt, nichts zu tun haben. Diese stehen mit dem von dem hl. Thomas verfochtenen und von den Scholastikern allgemein befestigten Weg in Widerspruch . Hier sieht man, wie [wenig] die Einwände solcher - eher unverschämter denn gelehrter - Zensoren geprüft sind, welche gegen die Christliche Philosophie vorgebracht werden" (ebd. 220).
54
Markus Krienke
mus" gekommen sei 98 • Um dieses Ende wirklich zu untermauern, wurde nach der Verurteilung in langen Abhandlungen zu zeigen versucht, dass mit den vierzig verurteilten Sätzen wirklich der vom Autor intendierte Sinn getroffen und somit Rosmini selbst aus den Lehrbüchern und katholischen Schulen zu verbannen sei99 . Auch diese Interpretation, so klang bereits an, stellte ein Faktum berechtigterweise heraus, das im Rahmen einer systematischen Ergründung der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" rur die heutige Fragestellung festgehalten werden sollte: Rosminis Philosophie wurde seitens des Neothomismus eine denkerische Universalität zuerkannt - nur ein Ansatz, der sich im 19. Jahrhundert von seiner konzeptionellen wie thematischen Universalität als dem des Thomas von Aquin im Mittelalter ebenbürtig erwies, konnte von dieser Hauptströmung "christlicher Philosophie" des 19. Jahrhunderts als eine derartige Bedrohung empfunden werden 100. Die akribischen Studien der Betreiber der Verurteilung förderten zutage, dass gerade in der Teosofia und in der dortigen Auseinandersetzung mit Hegel der rur eine abschließende Bewertung der Rosminischen Philosophie entscheidende Punkt gefunden werden muss, der wohlgemerkt den vorhergehenden Denkweg (der gemeinhin als "regressiv", d. h. vom Späteren zum Früheren fortschreitend, bezeichnet wird) nicht überflüssig macht, sondern vielmehr das entscheidende Bindeglied rur eine adäquate Bewertung des von Rosmini selbst angemahnten "Ganzen" bildet. Rosmini wurde also, so könnte man resümieren, in dieser "zweiten Phase" in einem doppelten Sinn verkürzt, einmal in einer systematisch-präjudiziellen Interpretation seiner Philosophie und einmal durch das kirchenamtlich auferlegte Dekret - beide Verkürzungen griffen dabei, wie gesehen, in entscheidenden Punkten ineinander lol • Dieser doppelte Stempel, der dem Rosminischen Denken 98 Vgl. Giovanni Maria Cornoldi, Soluzione della questione rosminiana, in: La Civilta Cattolica, Ser. XIII, Bd. 10 (39 [1888]) 257-278; Jules Didiot, La fin du rosminianisme, in: Revue des sciences ecclesiastiques, Ser. VI, Bd. 7 (1888) 400--440. 99 So betont auch die sog. Trutina theologica, ein kurz nach Post obitum erschienener, ausführlicher Kommentar zu den verurteilten Sätzen: "Da die Propositionen nun wahrhaft verurteilt sind, genügt es nicht, sie in sich als verworfene, verurteilte und geächtete zu haben, sondern es ist darüber hinaus notwendig, sie in dem vom Autor intendierten Sinn verurteilt zu haben" (Camillo Mazzella, Rosminianarum propositionum quas S. R. U. Inquisitio approbante S. P. Leone XIII reprobavit proscripsit damnavit Trutina theologica, Romae 1892, VI). 100 F. X. Kraus bezeugt in diesem Zusammenhang die Aussage des Münchener Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger, "seit Thomas von Aquin sei in den Reihen des katholischen Klerus kein größerer Denker aufgestanden als Antonio Rosmini" (Kraus, Antonio Rosmini, 88). 101 Diese doppelte Verkürzung stellt sich in einer rezeptionsgeschichtlichen Untersuchung gleichzeitig als Grund dafür heraus, dass Rosmini im ersten Jahrhundert nach
Rosmini und die deutsche Philosophie
55
damit aufgedrückt wurde, sollte in Philosophie und Theologie noch lange nachwirken. Die direkte Folge war jedoch, dass Rosmini in der Philosophie mit dem Niedergang des Neoidealismus seit der Mitte des 20. Jahrhunderts auch konsequenterweise seine Legitimation verlor und in Vergessenheit geriet. Theologischerseits wurde seinem Denken durch den noch lange nachwirkenden Neothomismus und die bis 2001 aufrecht erhaltene Verurteilung vorerst keine Rehabilitationsmöglichkeit eingeräumt. Die zweite Phase endete damit mit einer praktischen Marginalisierung Rosminis aus der europäischen Kultur. An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage in den Vordergrund, ob nicht aus den Kreisen der "Rosminianer" selbst hätten positive Impulse fiir eine fruchtbare Rosminirezeption ausgehen können. In diesem Zusammenhang mag darauf hingewiesen werden, dass Rosmini natürlich auch seine posthumen Verteidiger hatte, die sein Denken sowohl gegenüber den neoidealistischen Angriffen als auch vor den kirchlich-neothomistischen Anschuldigungen zu verwahren suchten lO2 . Doch waren ihre Kräfte zu gering, um eine wirklich eigene, positive Interpretation des Verhältnisses Rosminis zur "deutschen Philosophie" konzipieren zu können . Durch die kirchenamtliche Verurteilung Rosminis waren die Rosminianer an den Rand der Kirche gedrängt, von wo aus es ihnen unmöglich war, sich in der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" gegenüber dem Neoidealismus und dem Neothomismus einen eigenen theoretischen Standpunkt zu erarbeiten. War ihnen durch das Verurteilungsdekret jede Eigeninitiative in dieser Frage versagt, zogen sie sich im Geist des von ihrem Begründer formulierten "Prinzips der Passivität' auf einen "Quietismus" seinem Ableben (d. h. in der "zweiten Phase") im deutschsprachigen Denken nahezu unbeachtet blieb. Diese Situation perennierte gleichwohl auch noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (welche im Folgenden als "dritte Phase" gekennzeichnet werden wird). Vgl. zu dieser doppelten Verkürzung als "doppeltes Hindernis" der Rosminirezeption in Deutschland, Markus Krienke, Rosmini und die deutsche Philosophie. Zur Aktualität der Kant- und Idealismusrezeption Antonio Rosminis, in: Theologie und Philosophie 80 (2005) 566- 574; ders. , Studi rosminiani in Germania. Indagine storicocritica sulla ricezione di Rosmini in Germania dal 1830 fino ad oggi, in: Rivista di filosofia neo-scolastica 97 (2005) 373-405. In diesen Untersuchungen wird das genannte "doppelte Hindernis" näherhin als "äußeres" gekennzeichnet, im Gegensatz zu jenem "inneren Hindernis" einer generellen kulturellen Fremdheit der Rosminischen "Denkform" gegenüber dem deutschsprachigen Umfeld. Vgl. hierzu auch Pier Paolo Oltonel10, L'Enciclopedia di Rosmini (= Categorie Europee. Sezione II - Studi Critici, Bd. 29), L' Aquila/Roma 1992, 17 f. 102 Vgl. GiuseppeBuroni, Dell 'essere edel conoscere. Studii su Parmenide, Platone e Rosmini (= Atti della Regia Accademia delle Scienze, Bd. 39), Torino 1877; Roberto Benzoni, La dottrina dell'essere nel sistema rosminiano (Genesi, forma e discussione deI sistema), Fano 1888; Pietro Maria Ferre, Degli universali secondo la teoria rosminiana confrontata da Pietro Maria Fem~ vescovo di Casal Monferrato colla dottrina di San Tommaso d' Aquino e con quella di parecchi tomisti e filosofi moderni con appendice di nove opuscoli di argomento affine, II Bde., Casale 1880-1886.
56
Markus Krienke
zurück, durch welchen sie die Bedeutung Rosminis nunnehr in seiner Inaktualität erkennen konnten 103.
3. Dritte Phase: Die Suche nach dem wahren Anliegen Rosminis Die wirkungs geschichtlich zentrale "zweiten Phase" - die ob ihrer auch heute noch die Interpretation beeinflussenden Paradigmata eine etwas ausruhrlichere Behandlung notwendig machte - begründete am Beginn des 20. Jahrhunderts eine "dreifachen Inaktualität" Rosminis, nämlich auf Seiten der Neoidealisten, der Neothomisten wie auch - gezwungenennaßen - der Rosminianer. Eine Überwindung dieser Situation war weder aus dem kirchenpolitisch siegreichen Neothomismus noch aus dem bezwungenen Rosminianismus zu erwarten. Der notwendige Aufbruch aus dieser Pattsituation, welcher schließlich das Anheben einer neuen, "dritten Phase" bedeuten sollte, konnte sich nur aus dem potenten Neoidealismus bzw. Aktualismus heraus ergeben, der zur damaligen Zeit die größten Rosminiexperten in sich versammelte und dem in seiner Interpretation 103 ,,[M]an kann sagen, dass Rosmini in Italien keinen wirklichen Einfluss ausgeübt hat. Wenn man vom Einfluss eines großen Denkers spricht, dann meint man einen von der Art, wie ihn Hegel auf Denken und Praxis hatte, oder - um in Italien zu bleiben von der Art Vicos. [ ... ] Die Rosminianer, welche für ihren Ernst und die Verehrung, die sie ihrem großen Meister entgegenbringen, lobenswert sind, haben ihre Kräfte v. a. dafür eingesetzt, ihn vor den Angriffen zu verteidigen und ihn von der Verurteilung zu befreien: Daraus entsprang ein ganzes Schrifttum, okkasioneller und ungeeigneter Natur, das (außer einigen guten scholastischen Studien) kein Ergebnis brachte, das bleiben würde und endete somit in der langen und lästigen, weil vergeblichen, Polemik mit den Thomisten. In anderer Hinsicht ist ein mehr oder weniger lebendiger Einfluss auf Denker wie Bonatelli, Acri oder Varisco zu konstatieren, doch unterblieb der große Einfluss auf die gesamte Kultur. Warum? Wenn es einen Denker gab, welcher die Notwendigkeit verspürte, die Aufmerksamkeit auf alle Probleme des Seins, auf das ganze Sein, zu richten, dann war es eben er [sc. Rosmini]. Er machte es sich zur Aufgabe, das Denken mit allen Problemen des Lebens ohne Ausnahme zu messen - mit dem Anspruch der Konkretheit und Umfassendheit, die im modernen Denken (mit Ausnahme Hegels) seinesgleichen sucht" (Giuseppe Capograssi, Per Antonio Rosmini, in: ders., Attualita e inattualita di Rosmini (= Collana dei bicentenario, Bd. 10), hg. von Vincenzo Lattanzi, Roma 2001,9-18, hier 13 f.). Die Verurteilung und sein katholischer Glaube können es, so Capograssi auf seiner Ursachensuche weiter, nicht alleine sein, denn "in jedem großen Denker ist die lebendige Spekulation unter der harten Kruste der Sprache und der doktrinellen Konstruktion versteckt" (ebd. 15). Und er findet diese Ursache in der Struktur seines Denkens selbst: "Inkonstruktivität, Passivität, Erwarten, Geduld, Unparteilichkeit des Geistes, Reinheit des Willens, spekulatives Desinteresse, Vertrauen in das Denken und in die Dinge, Respekt für das Werthafte und v. a. für das Existente, franziskanische Haltung gegenüber den Dingen und dem Leben, Erfahrung der Heiligkeit: Hier [sc. im Rosminischen Denken] findet man zu viel, um den modernen Leser abschrecken zu können" - kurz also die "Inaktualität" seines Denkens (ebd. 18).
Rosmini und die deutsche Philosophie
57
keine "äußeren Schranken" auferlegt waren. Dabei sollte es - auch dies stellt wieder eine Ironie der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" dar - gerade die radikale Hinterfragung des für den gesamten Idealismus tragenden Fundaments, nämlich der Theorie des Kant italiano, sein, welche die letzte Phase des Idealismus kennzeichnet, in der seine "Rosminischen" Ausläufer eine Verbindung mit dem Rosminianismus selbst eingehen sollten. Verbunden mit dem Vorwurf an den Neothomismus, dass ausgerechnet dasjenige denkerische Milieu, das Rosmini am ehesten hätte rezipieren sollen, diesen verurteilte und vernachlässigte, hebt kein Geringerer als der Gentile-Schüler Ugo Spirito diesen Zusammenhang anlässlich des bislang wohl bedeutendsten Kongresses in der Geschichte der Rosminischen Wirkungsgeschichte im Jahr 1955 hervor: ,,[D]ie Geschichte des katholischen Denkens kommt ohne Rosmini aus. [ ... ] vom Neothomismus bis zum Modernismus, zur Neoscholastik und zum katholischen Existentialismus [ ... ]. Als man in den Reihen des christlichen Spiritualismus, v. a. durch Sciacca, auf Rosmini zurückkam, dann war dies dadurch möglich, dass die Spiritualisten vom Aktualismus herkamen und durch den Aktualismus lernten, die Bedeutung der Rosminischen Philosophie bis ins Letzte zu erkennen und zu erfassen. Wenn dann Sciacca gegen die idealistische Interpretation polemisierte, dann auf einer Ebene, auf der die Polemik wirklich konstruktiv ist und [sich] nicht als unmittelbare Abneigung und aprioristisches Unverständnis [geriert)"104.
Doch waren es bereits die Gründerfiguren dieser Phase selbst, die als die neuen "Rosminianer" sich in erster Linie gegen die neoidealistische Rosminiinterpretation wandten und darin die neue Identität der "dritten Phase" begründeten: Zentrale Figur dieses Neuaufbruchs war der von Spirito in den Mittelpunkt gestellte Micheie Federico Sciacca. Selbst Gentile-Schüler, vollzog dieser in seinen Schriften seit den 1930er Jahren eine Abkehr von der neoidealistischen Rosminiinterpretation seines Lehrers und verhalf stattdessen einer neuen Entwicklung zu ihrem endgültigen historischen Durchbruch, welche seit Beginn des Jahrhunderts Unruhe in die angedeutete Pattsituation brachte, nämlich die bereits genannte Neubesinnung über den "Rosmini vero". Angestoßen wurde diese Reflexion von unerwarteter Seite, nämlich einem Rosminianer, der mit seiner 1903 erschienenen Schrift 11 rimorso wohl alles andere als einen Richtungswechsel in der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" intendierte. Und so kam die Auseinandersetzung auch erst dadurch in Gang, dass in der Zeitschrift B. Croces, der Critica, G. Lombardo Radice drei Jahre später in ganz neo idealistischer Manier gegen Caviglione einwandte, dieser verkenne die kantisch-idealistische Grundausrichtung des Rosminischen Denkens und stelle dieser jene akzidentelle "objektiv-ontologische" Dimension voran, die ihm in 104 Spirito, Le interpretazioni idealistiche, 7 f. Damit bestätigt dieser dann auch die bereits angesprochene These, dass die idealistische Interpretation noch vor den "Idealisten" von den "Katholiken" vorgebracht worden sei (ebd. 8).
Markus Krienke
58
Wirklichkeit doch "äußerlich" und "seiner wirklichen Lehre aufgesetzt" sei, deren "größter Verdienst in der Kantischen Subjektivität besteht,,105. Der Rezensierte antwortete in der darauffolgenden Ausgabe der Critica mit einem bahnbrechenden Artikel, Qual e il vero Rosmini?, flankiert von einer Postille Gentiles l06 : In dieser doppelten Stellungnahme lässt sich der Keim einer neuen Diskussion individuieren: Caviglione seinerseits unterstellte dem Neoidealismus eine präjudizielle Herangehensweise an Rosmini sowie ein Nichtbeachten der Rosminischen Intention, eine Alternative zum neuzeitlichen Subjektivismus zu statuieren. Deutlich formulierte er: ,,[E]s ist nicht statthaft, [Rosmini] als den subjektivistischen italienischen Kant zu bezeichnen"107 - und fand darin Unterstützung von dem Rosminianer G. Morando lO8 • Gentile vertrat in seiner Postille freilich die Ansicht, nicht eine akzidentelle Komponente seines Denkens könne über die Bedeutung eines Denkers entscheiden, sondern nur, wie sich das Wesen seines Denkens in seiner Wirkungsgeschichte präsentiere. Diese Auseinandersetzung wurde in den darauffolgenden Jahren mit mehreren Artikeln in der Critica bzw. der Rivista Rosminiana weitergeführt, bis schließlich Benedetto Croce, gestützt auf die Postille Gentiles wie auch dessen Werk Rosmini e Gioberti die Kontroverse im dialektischen Begriffspaar des "vero Rosmint' bzw. des "Rosmini vero" auf den Punkt brachte: Während man sich in der Philosophie um den" vero Rosmini" streite, d. h. um seine philosophische Personalität als "Subjektivist" oder "Objektivist", als Kantianer oder Antikantianer, zähle für den Philosophiehistoriker das, was sein Denken effektiv bewirkt hat - unabhängig selbst von der Einschätzung, die der historische Rosmini möglicherweise von sich selbst hatte. Der "Rosmini vero" einer geschichtsphilosophischen Betrachtungsweise erschließe sich nur einer Betrachtung der "wirklichen Philosophie, welche der Philosoph R. das Verdienst hat, gegen Kant begründet
Lombardo-Radice, Recensione, 219. Carlo Caviglione, Qual e il vero Rosmini?, in: La Critica 4 (1906) 328-331; Giovanni Gentile, Postilla, in: ebd. 331 f (v gl. auch in: Rosmini e Gioberti, 325-327; vgl. ebd.327-332). 107 Caviglione, Qual e il vero Rosmini?, 331. 108 "In unserer Erkenntnis kann weder das gänzlich Absolute und Objektive noch das gänzlich Relative und Subjektive sein. Das Erstere nicht, weil auch die absoluteste Wahrheit von unserem relativen Geist aufgenommen werden und durch unser Subjekt hindurchgehen muss. Das Zweitere nicht, weil das gänzlich Relative und Subjektive weder Erkenntnis noch Wahrheit konstituieren kann. [ ... ] Die Lehre, die sich in der Mitte von diesen bei den Unmöglichkeiten bewegt, ist die Lehre Rosminis, der eine reale Synthese zwischen unserem relativen Geist und der absoluten Wahrheit setzt, die wahre Natur jedes der beiden achtet und uns so vor dem Skeptizismus auf der einen und vor dem Dogmatismus auf der anderen Seite bewahrt" (Giuseppe Morando, Note e commenti aHa filosofia contemporanea, in: Rivista Rosminiana I [1906/07] 54 f, hier 55; vgl. auch dessen Note e commenti aHa filosofia contemporanea, in: ebd. 2 [1907/08] 554 f). 105
106
Rosmini und die deutsche Philosophie
59
zu haben,,109. Damit werde jener eigentliche Kern seiner Spekulation ans Licht gebracht, dessen dieser sich selbst historisch nicht einmal bewusst gewesen sei. Zwischen diesen beiden Lagern der "orthodoxen Rosminianer" und der "Neoidealisten" entspann sich daraufhin bis ins Jahr 1914 eine lebhafte Diskussion, in welche die einzelnen Protagonisten mit unterschiedlicher Vehemenz eingriffen. Als zentral darin erweist sich der Titel Cavigliones aus dem Jahr 1910/11, der die Streitfrage des "Rosmini vero" aufgriff und in dieser Überblicksstudie nochmals die Argumente für seine These der Verzeichnung Rosminis durch den Neoidealismus zusammenstellte I 10. Auch wenn in den Folgejahren diese Auseinandersetzung spürbar abebbte, so sollte diese Problematisierung des "Rosmini vero" I I I zur Überwindung der unbeweglichen Pattsituation am Ende der "zweiten Phase" ursprünglich beitragen.
109 Gentile, Postilla, 332. So betont Croce die "nunmehr allseits bekannten Dinge über Rosmini und Gioberti - welche die Historiker zwangsläufig in doppelte Persönlichkeiten analysieren und aufteilen müssen: in eine katholische und nationalistische einerseits und in eine philosophische andererseits. So unterscheiden sie den vero Rosmini und den vero Gioberti von jenen Rosmini und Gioberti, die in die historischen Umstände ihrer Zeit verwickelt bleiben. Mir ist bewusst, dass sich gegen dieses Kriterium Einwände und Entgegnungen erhoben haben; fiir den Philosophiehistoriker aber, der seine Kunst beherrscht, wird es einen Rosmini und einen Gioberti geben, die von denen zu unterscheiden sind, welche der Historiker der Politik und der Kulturgeschichte kennen: Für ihn werden der wahre Rosmini und der wahre Gioberti immer und ausschließlich - um es in anderen Worten auszurücken - Rosmini und Gioberti veri sein" (Benedetto Croce, Note sulla letteratura italiana nella seconda meta deI secolo XIX. XXV. Ruggero Borghi e la scuola moderna, in: La Critica 6 [1908] 81-104, hier 81 f.). 110 "Der Rosminianismus entdeckt den Fehler des Kritizismus darin, dass dieser von der Vernunft ausgeht, die sich selbst kritisiert; doch dann rehabilitiert er den Kritizismus selbst, in anderer Hinsicht, mit jener Intuition, die auf einer genaueren Analyse der Universalität der Begriffe beruht. Genauso wenig lässt er die kritische Erkenntnistheorie gänzlich hinter sich, sondern korrigiert und vervollständigt sie lediglich. Und so trifft es erst recht zu, dass der Rosminianismus den Kritizismus nicht fiir eine neue Form von Dogmatismus hinter sich lässt, sondern dass Kant und Rosmini als zwei sich in Entwicklung befindende Momentaufnahmen anzusehen sind" (Caviglione, Il vero Rosmini, 134 f.). Diese Streitfrage ist hernach - bis heute - zu einem Topos der italienischen Philosophie geworden, wie beispielsweise Garin bezeugt: Eugenio Garin, La filosofia come sapere storico, Roma/Bari 21990, 10. 111 "Schaut man genauer hin, dann ist dieses terminologische Oszillieren [zwischen dem ,vero R.' und dem ,R. vero'] - jenseits der verwendeten Begriffe - der Ausdruck rur jene Frage, die den Streitpartnern wirklich am Herzen lag, und die im Grunde nur eine ist, nämlich die nach dem ,R. vero'. Dies wird durch die Beobachtung bestätigt, dass die Argumentationen, die nach und nach vorgebracht wurden, dazu in den Raum gestellt wurden, um die Positionen jedes der Streitpartner zu diesem Punkt zu bestätigen" (Paolo De Lucia, Essere e soggetto. Rosmini e la fondazione dell'antropologia ontologica [= Biblioteca di filosofia, Bd. 4], Pavia 1999,27).
60
Markus Krienke
Die für die "dritte Phase" relevante Auflösung des Patts ist in der Tatsache zu erkennen, dass diese Auseinandersetzung mithin die erstmalige Formulierung einer eigenständigen Position der Rosminianer in der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" ermöglichte. Zudem ist von Bedeutung, dass diese nicht im Dialog mit dem Neothomismus ausgebildet worden ist (zeigte sich doch dieser ob der Erlangung seines Zieles im Jahr 1888 als einem solchen Dialog nicht zugänglich), sondern mit dem Neoidealismus. Damit werden in dieser Auseinandersetzung zwischen 1903 und 1914 die notwendigen Grundlagen für die zwei Jahrzehnte später beginnende "dritte Phase" gelegt. Doch war für das Anheben dieser neuen Phase die Zeit noch nicht reif. Wurde auch von Caviglione und Morando formuliert, was die Rosminianer zuvor nur mit äußerster Vorsicht vertreten konnten, so verbesserte dies ihre innerkirchliche Position keineswegs. Der Neothomismus hatte immer noch die Oberhand, weswegen von den Rosminianern keineswegs die Forcierung einer wirklichen Neuinterpretation der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" ausgehen konnte. Auf der anderen, philosophischen, Seite war die klassische neo idealistische Interpretation, trotz der Diskussion um den "Rosmini vero", immer noch vorherrschend. Noch 1943 konnte Gentile die zweite Auflage seines Rosmini e Gioberti veröffentlichen. Die philosophische Reichweite dieser Interpretation wird in den zahlreichen Rosminiinterpretationen im Gefolge des Neoidealismus deutlich, sei es in der Variante des "kritischen Idealismus" von B. Varisco l12 , P. Martinetti und G. Galli l13 (auch die zu diesem komplementäre Bewegung des "kritischen Realismus" F. De Sarlos und G. Capone-Bragas muss, was die Rosminiinterpretation angeht, hier eingeordnet werden), oder aber in jener des "kritischen Ontologismus" ("Ontokonszientalismus") P. Carabelleses l14 und T. Moretti-Costanzis lls • Zogen diese aus der 112 Tra Kant eRosmini, in: Rivista di Filosofia 1 (1909) 74--83; ders., Kant e Rosmini,1914. 113 "Die Lehre Rosminis stellt eine Überwindung der Kantischen Lehre dar, und zwar eine vollständigere und näher an der Wahrheit liegende, als wir sie der nachkantischen deutschen Philosophie und, allgemein, dem absoluten Subjektivismus, verdanken" (Gallo Galli, Kant eRosmini, Citta di Castello 1914, 5). 114 "Die Seinsidee R.s ist im Gegenteil, wie wir zeigten, zwar auch Form, aber von einer gänzlich andersartigen Natur als diese funktionelle Kantische [Form], wie auch und weil - dieselben Ideen für Rosmini eine andere Natur haben, als Kant ihnen beimaß. So kann diese Seinsidee nicht als Rosminische Entsprechung zu den Kantischen Kategorien gelten. Was ist aber nun diese Entsprechung? Unserer Meinung nach stammt die wirkliche Form der Wahrnehmung und somit der Erkenntnis in der Rosminischen Theorie aus den Ideen der Substanz und der Ursache. die daher unseres Erachtens die wahren Rosminischen Kategorien im Kantischen Sinn sind. [ ... ] Dies ist die eigentliche und große Deduktion der Kantischen Kategorien seitens Rosminis" (La teoria della percezione intellettiva, 160, 163). Und nach der Analyse des Vermögens dieser Kategorien hält
Rosmini und die deutsche Philosophie
61
Auseinandersetzung um den "vero Rosmini" bereits die Konsequenz, ihre Standpunkte im Gefolge des Neoidealismus mit einer größeren Berücksichtigung der "objektiven" Elemente des Rosminischen Denkens zu vermitteln l16 , wird man dennoch an der Einschätzung festhalten müssen, dass sie Rosmini letztlich noch in neoidealistischer Manier der jeweiligen, an ihrem philosophischen Standpunkt ausgerichteten Kategorialisierung der Philosophiegeschichte unter- und einordneten. Insbesondere in der Retrospektive wird dabei deutlich, dass ihre Methode deutlich enger am Neoidealismus ausgerichtet ist, als dass sie bereits entscheidende Merkmals der späteren sog. "Rosminirenaissance" trüge. Einer ebenso zu dieser Gruppe gehörenden Strömung aus dem Neoidealismus, die gleichzeitig eine neue Vermittlung mit dem christlichen Denken suchte, sollte die endgültige Durchbrechung des Paradigmas des Kant italiano gelingen. Dabei handelt es sich um den "Spiritualismus" Carlinis und Sciaccas ll7 • Ihren charakteristischen Neuansatz verdanken sie dem Dialog mit den Rosminianem selbst, und so ist es der rege Austausch Sciaccas mit dem damaligen General der Rosminianer, Giuseppe Bozzetti, dem fiir die Herausbildung der Position Sciaccas entscheidende Bedeutung zukommt 11 8. Mit dem Werk Sciaccas eröffnet sich dann die eigentlich "dritte Phase" der analysierten Wirkungsgeschichte. So formulierte dieser in jenem Werk, in dem er erstmals seinen Carabellese sein Ergebnis fest: "So gelangen wir zu dem Schluss, dass für Rosmini die Entsprechung der genannten apperzeptiven Einheit Kants [ ... ] das Grundempfinden darstellt, insofern es synthetische Aktivität ist, d. h. insofern es in der grundlegenden
und ursprünglichen körperlichen Wahrnehmung besteht. bzw. insofern es Vernunft {ragione] ist' (ebd. 167). Die Einordnung Carabelleses in diese Linie geht hervor aus
ebd. 173-175, wo er der Rosminischen Position eine gewisse philosophische Schizophrenie zu unterstellen scheint: "In Wirklichkeit ist R. das Ergebnis zweier entgegengesetzter Persönlichkeiten, die - wenn sie sich auch letztlich gegenseitig umfassen und miteinander übereinkommen - stets ihre grundlegende Unvereinbarkeit zeigen" (ebd. 175f.). 115 V gl. hierzu die kurzen Charakterisierungen der Rosminiinterpretationen dieser Strömungen, deren minutiöse Analyse den hier zu Verfügung stehenden Rahmen überschreiten würde, Karl-Heinz Menke, Vernunft und Offenbarung nach Antonio Rosmini. Der apologetische Plan einer christlichen Enzyklopädie (= Innsbrucker theologische Studien, Bd. 5), Innsbruck/WienlMünchen 1980, 25-28. 116 Vgl. Paolo De Lucia, Rilevanza e attualita della "Iinea ontologica" dei rosminianesimo, in: RRFC 99 (2005) 438--444, hier 443. 117 So steht am Anfang dieser neuen Phase auch eine Studie Sciaccas über Rosmini im Hinblick auf den Spiritualismus, nämlich die zunächst im Archivio di Storia della Filosofia italiana der Jahre 1937/38 und dann 1938 als eigener Band veröffentlichte Studie La filosofia morale di Antonio Rosmini (= MFS, Bd. 1,2), Palermo 1990. 118 Vgl. zur Systematik, Sciacca, Interpretazioni rosminiane, 63-86; vgl. zum geistigen Hintergrund Francesco Pistoia, La filosofia rosminiana come "charitas" nella Corrispondenza Bozzetti-Sciacca, in: RRFC 99 (2005) 475--479.
62
Markus Krienke
Skeptizismus bezüglich der neoidealistischen Interpretation formulierte und darlegte, Rosmini habe ,,[ ... ] als erster gegen den Gnoseologismus der neuzeitlichen Philosophie gesehen, dass eine Sache das Problem der ,Objektivität des Denkens' bzw. der ,Intelligibilität' oder des ,Prinzips der Objektivität' ist, etwas anderes jedoch das des ,objektiven Erkennens': Das Erstere ist ontologisch-metaphysisch und liegt dem Zweiteren zugrunde. Die Metaphysik in Erkenntnistheorie aufzulösen, wie dies der Idealismus von Fichte bis Gentile durchgefiihrt hat, bedeutet, den metaphysischen Sinn des Bewusstseinsprinzips zu verlieren und so die tiefgründigsten und unüberwindlichsten Forderungen des menschlichen Geistes zu opfern" 119. Diese Bewertung der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" beruht auf einem zur vorangegangenen Phase diametral konträren interpretativen Kriterium, nämlich Rosmini nicht in Korrespondenz, sondern aus einer entgegengesetzten Position zum neuzeitlichen Denken der "deutschen Philosophie" zu sehen. Man verstand diese Phase als ein "Demaskieren" des Neoidealismus, der, so die Meinung der dritten Phase, Rosmini mit einem "falschen Paß" ausgestattet hatte 120. Die Frage, warum sich diese radikal allen damaligen Paradigmata entgegengesetzte These dermaßen rasant durchsetzen konnte, dass sie innerhalb kurzer Zeit die neoidealistische Interpretation praktisch überwand und ein potentes Gegenargument gegen den kirchenpolitisch unangreifbaren Neothomismus entwickelte, lässt sich mit dem Hinweis auf eine neu entfachte Aktivität der Studien des Rosminischen Originaltextes beantworten, wie sie in der Wirkungsgeschichte Rosminis zuvor noch nicht entfaltet worden ist. Bezeichnenderweise begründete Sciacca selbst im Jahr 1934 die Opera omnia 119 Sciacca, La filosofia morale, 43; vgl. auch Antimo Negri, MicheIe Federico Sciacca. Dall'attualismo alla filosofia dell'integralita, Forli 1963,59-108; Franco Percivale, M. F. Sciacca e il Rosminianesimo, GenovaiStresa 1986; Maria Adelaide Raschini, Sciacca e iI rosminianesimo, in: dies., La dialettica dell'integralita (= Scritti di Maria Adelaide Raschini, Bd. 4), Venezia 22000, 95-106. 120 Vgl. Sciacca, Interpretazioni rosminiane, 44; Ivo Höllhuber, Antonio Rosmini: Der Philosoph des Dritten Jahrtausends, in: ders., Philosophie als Prae-Eschatologie, Innsbruck 3 1999, 348-382, hier 352; ders., Geschichte, 67; ebd., 44, spricht Höllhuber auch von der "falsche[n] Etikette". Gegen "die Kantisch-idealistische Interpretation eines Rosmini, fiir den einzig das Erkenntnisproblem als Problematik des Urteilens und der Suche nach einem formal-apriorischen Element als Garant der Objektivität des Erkennens selbst bzw. des Urteilens bestand", formuliert Sciacca: ,,[D]as erste und eigentliche Problem Rosminis - nach dem Empirismus, dem Rationalismus und Kant ist nicht jenes des ,Erkennens' , sondern des ersten und grundlegenden Prinzips des geistbegabten Seienden als solchen. Es ist mithin ein metaphysisches Problem, das demjenigen des Erkennens und seiner Grundlage vorausgeht" (Michele Federico Sciacca, I principi della metafisica rosminiana, in: den., lnterpretazioni rosminiane, 87-110, hier 88; Sciacca hielt diesen Vortrag anlässlich des genannten Kongresses von 1955, weswegen er sich auch im Tagungsband Atti deI Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957,47-100, befindet).
Rosmini und die deutsche Philosophie
63
Rosminis. So wurde erst ein Jahrhundert nach Rosminis Tod überhaupt damit begonnen, die in Frage stehende Problematik ausgehend von Rosmini selbst, von seinem eigenen Denkanliegen her anzugehen. Eine einseitige Konzentration auf den Nuovo Saggio wurde zugunsten einer Gesamtbewertung des Rosminischen Werkes v. a. unter Einbeziehung der spekulativ zentralen Werke der Teosofia und des Saggio storico critico sulle categorie aufgebrochen. Rosmini wird nicht länger als das Bindeglied zwischen zwei "Idealismen" gesehen nämlich zwischen dem "deutschen" und dem "italienischen" -, sondern als Alternative zum idealistischen Denken als solchem 121. Bezeichnenderweise ist es ein weitere Schüler Gentiles, der neben Sciacca zum zweiten Grundpfeiler dieser hier als "dritte Phase" bezeichneten Epoche der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" avancieren sollte, nämlich Augusto DeI Noce, der Rosminis Entgegensetzung zum modernen Denken herausstellte: Die "Rosminianer" präsentieren sich in dieser "dritten Phase", wie deutlich wird, mit einer eigenen starken These zur Bedeutung Rosminis und seiner Konfrontation mit Kant und dem Idealismus in der Neuzeit 122 • DeI Noce stellte grundlegend heraus, dass Rosmini erst in einer Epoche, in welcher die objektivtranszendente und kant- bzw. idealismuskritische Dimension seiner Theorie nicht als uneigentlicher Ballast seines Denkens abgetan, sondern als wesentlicher Bestandteil seiner eigenen kritisch-neuzeitlichen Position anerkannt wird, die umfassende Bedeutung seines Denkansatzes entfalten kann. Dies sei nach dem historischen Ende des Neoidealismus der Fall 123 • Signifikant dafiir ist die 121 Das neue Selbstverständnis der Rosministudien kommt in folgender These Sciaccas zum Ausdruck: "Rosmini stellte der neuzeitlichen Philosophie von Descartes bis Hegel die entschiedene und unmissverständliche Frage: Entspräche der ursprünglichen Anschauung der Idee die Erfahrung einer unendlichen Realität, dann wäre unsere Wissenschaft vollkommen und allumfassend, es bedürfte keines Gottes und keiner Offenbarung mehr. Doch fehlt eine solche Entsprechung. Somit ist der Mensch nicht zu einer Erkenntnis fähig, die durch Absolutheit und Vollkommenheit ausgezeichnet ist; und somit ist die Idee in ihrer Präsenz im menschlichen Geist und existenzbegründenden Bedeutung jene unbezwingbar Vagabundierende, welche unablässig ihr absolutes Objekt bzw. Gott selbst sucht. [ .. .] Der ambitionierten ,kopernikanischen Revolution' Kants setzt Rosmini eine gänzlich christliche Gegenrevolution entgegen: Es ist nicht die Wahrheit, die um uns kreist, sondern wir bewegen uns in der Wahrheit, von der her wir sind und von der in uns eine Form gegeben ist" (Micheie Federico Sciacca, Introduzione, in: ders., Interpretazioni rosminiane, 17-30, hier 26). 122 "Das Scheitern der hegelianischen Überwindung Rosminis durch den Aktualismus stellt somit heute von Neuem das wesentliche philosophische Problem Rosmini und HegeI: Es stellt es jedoch befreit von der immanentistischen Voraussetzung" (DeI Noce, Gentile e la poligonia giobertiana, 285; vgl. ders., II problema dell'ateismo, Bologna, 1990, 549-577). 123 "So können wir in der Tat sagen, dass der Sinn des Rosminischen Denkens in seiner ganzen Tiefe und Bedeutung erst nach der Kritik jenes Aktualismus hervorgetreten ist, der ihn zu vereinnahmen trachtete. Erst zu diesem Zeitpunkt nahm die Philosophie Rosminis ihre weltweite Bedeutung an und wurde jenes Bild überwunden, das sie als
64
Markus Krienke
Befreiung Rosminis aus seiner Kategorialisierung als "italienischer Kant", was erst die Neubewertung seiner Auseinandersetzung mit Hegel in der Teosofia ermöglichte l24 • Dementsprechend wird, so wie sich die zweite Phase durch die "Rosmini-Kant"-Studien auszeichnete, in der "dritten Phase" die Erforschung des Verhältnisses "Rosmini-Hegel" einen zentralen Stellenwert fiir die Problematik "Rosmini und die deutsche Philosophie" einnehmen. Hob die "dritte Phase" mit den beiden grundlegenden Denkern Sciacca und Dei Noce auch mit vielversprechenden Thesen an, so wurde in der Folgezeit deutlich, wie wenig die "Rosminianer" die grundlegenden Konzepte dafiir besaßen, diese Thesen - die Rosmini zweifelsohne einen entscheidenden Platz in der neuzeitlichen Philosophiegeschichte zu sichern versprachen - inhaltlich zu bestimmen. Für eine solch schwierige Konzeption der gleichzeitigen Auseinandersetzung, Rezeption und Absetzung Rosminis von Kant und Hegel waren m. a. W. die wichtigen konzeptionellen Vorarbeiten am Rosminischen Text selbst noch nicht geleistet bzw. hatten in den Wirren der vorangegangenen Epoche gar nicht geleistet werden können. Ohne diese Voraussetzungen aber fiihrten die Impulse Sciaccas und Dei Noces nachgerade entweder zu einer kurzschlüssigen Vereinfachung dieser Frage l25 oder aber - auch als Gegenreaktion zur idealistischen Interpretation der "zweiten Phase" - zur völligen Ablehnung Kantischen oder Hegeischen Einflusses auf Rosmini und einer gänzlichen Erklärung seines Denkens aus dem mittelalterlichen Weltbild heraus, wie dies Prini exemplarisch formulierte: "Das einzig wirkliche Zugeständnis, das Rosmini tatsächlich den Anforderungen der ,kritischen Philosophie' - wie überhaupt der gesamten neuzeitlichen Gnoseologie gegenüber machte, war die Annahme des methodologischen Primats der Erkenntnislehre. Analysiert man sie in ihrem ursprünglichen Sinn, dann können alle Thesen des Nuovo Saggio auf das generelle Umfeld eines klassischen - und damit nach Kant und den Kantianern ,dogmatischen' oder, vorkritischen' - Objektivismus zurückgeruhrt werden. Der ,formale' Charakter der Seinsidee - die wahre crux der Rosminiinterpreten - kann nur, soviel ist mittlerweile klar, in einer platonisch-augustinischen, nicht Kantischen, Lesart erfasst werden"l26.
Diese These - welche ein halbes Jahrhundert zuvor noch kaum Anhänger gefunden hätte - machte nun Karriere und wurde beinahe zur Überschrift fiir tendenziell provinzielle Resistenz gegen den Geist der neuzeitlichen Philosophie, die in einen anthropometrischen Subjektivismus sophistischer Manier degenerierte, betrachtete" (Augusto Dei Noce, Giovanni Gentile. Per una interpretazione filosofica della storia contemporanea, Bologna 1990,82 f.). 124 Vgl. Capograssi, Per Antonio Rosmini, 14. 125 Ein Beispiel rur eine solche Vereinfachung ist die These Siro Contris in seiner Abhandlung Parallelo fra Hegel eRosmini, Palermo/Roma 1967. 126 Pietro Prini, Rosmini postumo (= Collana del bicentenario, Bd. 2), Stresa 31999 (vgl. Roma 11960), 11 .
Rosmini und die deutsche Philosophie
65
die gesamte "dritte Phase". Denn in ihr findet jenes neue interpretative Paradigma seinen authentischen Ausdruck, sozusagen in Umkehr des neoidealistischen historiographischen Programms (Gentile, Croce) den vero Rosmini wieder hinter der nun als Konstruktion erscheinenden neoidealistischen Auffassung des Rosmini vero hervorscheinen zu lassen: Die Entwicklung der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" wird gewissermaßen als eine Verzeichnung des Rosminischen Anliegens angesehen, weswegen man wieder hinter die historischen Auswirkungen, die Rosmini in der italienischen Philosophie zwischen 1850 und 1950 gezeitigt hatte, zurück müsse, um am Rosminischen Text selbst die Frage nach der "Aktualität" oder "Inaktualität" Rosminis in der Neuzeit zu beantworten. Die betonte Herausstellung klassischer, antimoderner Motive bei Rosmini - die zweifelsohne seinem Denken genauso zugehören wie Kantische oder Hegeische Elemente - birgt in diesem Unternehmen den Vorteil, jene Interpretationen der "zweiten Phase" leichter überwinden zu können. So ist für die gesamte "dritte Phase" charakteristisch, dass man eine tendenziell entkontextualisierte Interpretation des Rosminischen Textes anstrebt. Werden seinem Denken auch neuzeitlich-charakteristische Methoden durchaus nicht abgesprochen, so erblickt man in Wesen und Inhalt des Rosminischen Denkens doch letztlich die Wiederaufnahme der christlichen Philosophen des Mittelalters, insbesondere Augustins und Thomas'l27. Dadurch entzieht sich die Rosminiinterpretation den neothomistischen wie den neoidealistischen Paradigmata und wähnt, unter Absehung dieser Auseinandersetzung den "vero Rosmini" nun schrittweise aus seinen Texten entnehmen zu können. Dies schließt zudem nicht die Möglichkeit aus, die Wichtigkeit Rosminis im Kontext des Risorgimento und des christlichen Spiritualismo des 20. Jahrhunderts zu sehen l28 . Jedenfalls gelingt es dadurch positiv, den Rosminischen Ansatz aus 127 "In der Tat kann man sagen, dass eine Philosophie wie diejenige Rosminis den Versuch unternimmt, ganz auf der Linie Suarez' und Wolffs eine christliche Summe des neuzeitlichen wie klassischen Denkens zu erstellen, und dass Rosmini, ursprünglicher als viele seiner Gegner, der erste der Neoscholastiker gewesen ist. Dabei handelte es sich jedoch um eine Summe, die mit derselben Freiheit ausgearbeitet wurde, mit der bereits Thomas Aristoteles und das antike Denken neu durchdacht hatte. In diesem Sinn findet sich im philosophischen und theologischen Werk Rosminis neben den großen Themen der neoplatonischen, neopatristischen und scholastischen Tradition auch die einheitlich-systematische Darstellung der Fragestellungen, welche das letzte Jahrhundert von Leibniz, von Malebranche und von Vico ererbt hatte" (Prini, Rosmini postumo, 14 f.) . 128 "Eine umfassende Geschichte des Spiritualismus in der Romantik wurde noch nicht geschrieben. Dies wäre jedoch von großem Wert, um jene bei den Entwürfe des italienischen und französischen Denkens des 19. Jahrhunderts ins rechte Licht zu rücken und ihre engen theoretischen Berührungspunkte aufzuzeigen, die eine bezeichnende Analogie von Perspektiven und Lösungsansätzen bieten und so beispielsweise die Namen Galluppi, Rosmini, Gioberti, Gino Capponi und Lambruschini einerseits sowie Maine de Biran, Cousin, Ravaisson, Vacherot, Lachelier und Lagneau andererseits
66
Markus Krienke
jener Engführung zu befreien, die eine Verkürzung seines Denkens auf die kantisch-idealistischen Elemente notwendigerweise mit sich bringt. Bei allen positiven Aspekten wurde jedoch hinsichtlich der hier im Mittelpunkt stehenden Frage nach der Verhäitnisbestimmung von "Rosmini und die deutsche Philosophie" bald eine Schwierigkeit dieser neuen Methode deutlich. Denn durch die Ablehnung aller in dem Jahrhundert zuvor erarbeiteten Elemente, die zu dieser Klärung hätten positiv beitragen können, wurde bald das Fehlen einer solcher Kategorialisierung bewusst. Zunehmend deutlicher wird auch die Unsicherheit dieser Interpreten, wie Rosmini überhaupt in der Neuzeit lokalisiert werden sollte. Auf der Suche nach neuen Formeln klassifiziert beispielsweise Brancaforte den Rosminianismus "als Überwindung der neuzeitlichen Antithese zwischen Subjektivismus und Objektivismus"l29. In seinen Analysen stützt er sich auf das für diese Epoche zentrale Werk Carlo Giacons, L 'oggettivita in Antonio Rosminpo, und folgert schließlich: "R. ist ein Denker, der sich einer präzisen Einordnung entzieht. Seine Herangehensweise an die Probleme ist so individuell, dass sie nicht unter eines der gewohnten Schemata subsumiert werden kann, ohne Schaden zu nehmen"l3l. Hier wird deutlich, wie der notwendige Rückzug auf Rosmini den Blick für die Verankerung dieses Denkers in der Neuzeit im Allgemeinen und hinsichtlich der "deutschen Philosophie" im Besonderen verlieren lässt. Ist Rosmini aber weder eindeutig der klassischen Metaphysik noch der neuzeitlichen Subjektphilosophie zuzuordnen, sucht man sich mit antithetischen Einordnungsversuchen zu behelfen. So griff beispielsweise Sciacca zu der von Rosmini selbst abgelehnten Bezeichnung eines "objektiven Idealisten"132; Giacon spricht von der "Phänomenologie der Objektivität" - entgegen der "Phänomenologie der Subjektivität", wie sie sich im 20. Jahrhundert in kritischem Rückbezug zur kantisch-hegelschen Linie entwickeln sollte. Höllhuber greift seinerseits auf einander zuzuordnen. Diese Namen konnten unter den kategorialen Vorgaben der neukantianischen und idealistischen Historiographen der neuzeitlichen Philosophie nicht zugeordnet werden, weswegen sie entweder übersehen wurden - wie dies zumeist im Fall der Italiener geschah - oder ihnen ein gänzlich marginaler Ort zugewiesen wurde, ausgeklammert aus einer Polemik, welche ein halbes Jahrhundert zwischen Idealismus und Positivismus gefiihrt wurde" (Prini, Rosmini postumo, 14). 129 Antonio Brancaforte, Discussioni rosminiane (= Bibliotheca Siciliana di Cultura, Bd. 13), Giannotta 1968,7. 130 MilanolGenova 1960. 131 Brancaforte, Discussioni rosminiane, 27. 132 Diese Interpretation, so Brancaforte, "droht nunmehr zu einem Allgemeinplatz zu werden", doch könne man sie "nicht einmal nach den ,Interpretazioni rosminiane' M. F. Sciaccas als erschöpfend" betrachten, was "die komplexe Position Rosminis, die so problematisch wie nie zuvor ist", anbelangt (Brancaforte, Discussioni rosminiane, 41).
Rosmini und die deutsche Philosophie
67
Brancaforte zurück und spricht von der "Überwindung der modernen Antithese von Subjektivismus und Objektivismus"133. Dabei entspringen diese Ansätze keineswegs waghalsigen Konstruktionsversuchen, sondern sind vor dem soeben gezeichneten Hintergrund einer neuen Ernsthaftigkeit des Studiums des Rosminischen Textes und dem Verlust der allzu sicheren Kategorialisierungen der "zweiten Phase" zu verstehen. Doch wiewohl mit dem Neoidealismus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch das Projekt einer spekulativen Geschichtsphilosophie verabschiedet worden ist, offenbaren solch neue Versuche einer theoretischkonzeptionellen Einordnung Rosminis in die "großen Strömungen" der neuzeitlichen Philosophie ihre grundsätzliche Grenze. Dieser neuen Skepsis spekulativ-absoluter Kategorialisierungen begegnen eine Reihe historisch ausgerichteter Studien, die in der Verankerung Rosminis in die geistesgeschichtlichen Strömungen der damaligen Zeit die einzige Möglichkeit einer "objektiven" Ortsbestimmung des Roveretaners erkennen. In diesem Sinn suchten v. a. Bulferetti 134 und Traniello l35 die Frage nach "Rosmini und die deutsche Philosophie" von historisch-kulturellen Untersuchungen des Umfeldes des Rosminisehen Denkens aus anzugehen und Rosmini in die Restaurationszeit selbst einzuordnen. Dabei konnten sie sich auf einen namhaften Begründer dieser Studien zurückbeziehen, nämlich Zambelloni. Dieser hatte seinerseits bereits herausgestellt, dass die "Bereitschaft zur Rezeption Kants immer schon an den politischen und ideologischen Zielen der Restauration bemessen war,,136. Von dieser Prämisse ausgehend, formuliert er die grundlegende These dieser Gruppe von Rosminiinterpretationen: "Von den italienischen Interpreten, die wir analysiert haben, übergeht fast niemand stillschweigend die Tendenzen bzw. offenkundigen Konsequenzen des Kritizismus hin zum Idealismus oder Skeptizismus. Diese Kritiken, zusammen mit derjenigen, die Irreligiosität zu begünstigen und das moralische Verhalten der Willkür des Individuums zu unterstellen, geiten rur Rosmini nicht weniger als rur die ihm vorhergehenden Interpreten - rur Rosmini vielleicht noch mehr als rur diese. Hieraus versteht sich seine Wahl der transzendentalen Problemstellung, um aus ihr Konsequenzen abzuleiten, die der Kantismus nicht kennt: nämlich den Versuch, sie in einem Prinzip absoluter Objektivität zu begründen, die allein die Lehre vom Seienden sicherstellen kann,,137. 133 HöJ1huber, Geschichte, 56; er zitiert dabei den Titel einer Abhandlung Brancafortes, 11 rosminianesimo come superamento dell'antitesi modema di soggettivismo e oggettivismo, in: RRFC 61 (1967) 117-129. 134 Vgl. Antonio Rosmini nella Restaurazione (= Studi e documenti di storia dei Risorgimento, Bd. 25), Firenze 1942. 135 Vgl. Societa religiosa e societa civile in Rosmini, Bologna 1966. 136 Zambelloni, Le origini, 275. 137 Und er fragt kritisch: "Ist dies nun aber eine Neufassung des Kantismus? Die Entwicklung des theoretischen Denkens hat bei Rosmini eher die Tendenz einer Vertiefung
68
Markus Krienke
Analog zur Abwendung der systematischen Studien von der primären Auseinandersetzung Rosminis mit Kant und den Idealisten hin zur Beschäftigung mit den antiken und mittelalterlichen Quellen des Roveretaners wurde damit auch Rosmini eher zur "Restauration" denn - wie noch zuvor - dem "Risorgimento" zugehörig erkannt. Es kennzeichnet die diversen Neuansätze der "dritten Phase", dass ihr Hauptinteresse nicht mehr wie dasjenige der bei den großen Systeme der "zweiten Phase", d. h. des Neoidealismus und des Neothomismus - und damit auch des Rosminianismus dieser Zeit -, auf die Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" hinzielte, sondern diese nurmehr als Konsequenz der in erster Linie angestrebten Neuinterpretation des Rosminischen Textes im Kontext seiner traditionellen Quellen oder auch der Restaurationszeit in den Blick bekam. Obgleich kein Forscher mehr die Frage nach "Rosmini und der deutschen Philosophie" seiner Beschäftigung mit dem Rosminischen Text interpretativ voranstellte, kristallisierte sich auch in der "dritten Phase" eine charakteristische Einordnung und Bewertung dieser Fragestellung heraus, die von einer Gruppe von Experten ausgearbeitet wurde, die sich zumeist direkt - als Schüler - oder auch indirekt auf den Neuanfang M. F. Sciaccas beriefen. Diesbezüglich sind die Studien von M. T. Antonelli, M. A. Raschini und P. P. Ottonello zu erwähnen: Als erste griff Maria Teresa Antonelli im Jahr 1955 138 den Impuls Sciaccas auf und stellte die Problematik in den Begrifflichkeiten der "Äußerlichkeit" bzw. "Innerlichkeit" der Rosminischen Kant- und Idealismusinterpretation auf eine neue interpretative Basis. Insbesondere wird in dieser Studie das Desiderat deutlich, gegenüber der "zweiten Phase" die Rosminische Hegelrezeption in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen 139 . In Ergänzung zu Anto-
persönlicher Fragestellungen, welche in der Fonn eines eindringlichen Dialogs mit Kant entwickelt werden, sodass gewiss etwas von der kritischen Philosophie in jene des Roveretaners übergeht - doch ist sie dort gleichennaßen absorbiert und erlangt gewiss kein Übergewicht" (Zambelloni, Le origini, 276). Neuerdings scheint De Giorgi diesen Faden weiterzuführen (v gl. Rosmini e il suo tempo). 138 Studi rosminiani (Prospettive e problemi d'una ontologia intrinsecistica) (= Collana di studi filosofici rosminiani, Bd. 8), DomodossolaiMilano 1955. 139 ,,[D]as Verhältnis der bei den Autoren war von Ablehnung geprägt. Deswegen konnte Gentile die Widerlegung Hegels mit seinem interpretativen Paradigma leicht als dem Hegeischen Horizont äußerlich abtun. Dennoch war diese Widerlegung hier und dort - widersprüchlicherweise - äußerst intelligent, intelligenter als sie an der Oberfläche zu sein schien. [ ... ] In einem überraschenden und bedeutenden Punkt stimmen jedoch Rosmini und Gentile überein: nämlich in der Darlegung einiger schwacher Motive des Hegelismus, die allesamt dann als schwach resultieren, wenn man sie rücksichtlich der Wertung und des Maßstabes interpretiert, dass Hegel nicht zufrieden stellt und in diesen Punkten deutlich zeigt, seinen eigenen Maßstäben nicht zu genügen. Diese Bewertung, die bei Gentile und Rosmini oft gleiche Züge annimmt, präsentiert sich etwa
Rosmini und die deutsche Philosophie
69
nelli entwickelt Maria Adelaide Raschini ihre Analysen ausgehend von der Darstellung des gemeinsamen Problemhorizonts Hegels und Rosminis und erkennt bei Rosmini einen Lösungsansatz für das SubjektivismusObjektivismus-Problem, das nicht nur gewisse Hegeische Antinomien zu überwinden helfe, sondern bereits, ante litteram, auch ein begriffliches Instrumentarium zur Entgegnung auf Gentile bereitstelle l40 . Pier Paolo Ottonello kommt seinerseits das Verdienst zu, die neuen Studien zu "Rosmini-Hegel" durch eine sukzessive Aufarbeitung der antirosminischen Kritik des Neoidealismus wie auch des Neothomismus flankierend zu begleiten und damit den "Rosminianismus" der "dritten Phase" wieder dialektisch-kritisch an die Auseinandersetzungen der "zweiten Phase" rückzukoppeln, wodurch es in neuer Weise gelingt, dessen historische Bedeutungsdimension aufzuzeigen l41 . Dieser Interpretation der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" in der dritten Phase schließen sich auch die Studien Gianninis l42 , Tilliettes l43 , Negris l44 , Muratores l45 und Ferronis l46 sowie in jüngster Zeit Carlo Maria Fenus l47 , Paolo De in denselben Begriffen und wird mit analogen Gründen belegt" (Antonelli, Studi rosminiani,27). 140 "Rosmini [ ... ] beschränkt sich jedoch nicht, wie Gentile, darauf, die Identität zwischen Denkendem und Gedachtem als die Lösung der oben dargelegten Schwierigkeit [sc. der Definierbarkeit des Anfangs der Wissenschaft] vorzuschlagen, weil eben diese Identität die kategoriale Identifikation von Subjektivität und Objektivität voraussetzt, deren Unterscheidung nicht nur maximal ist - nämlich kategorial -, sondern auch die Bedingung der gemeinsamen kritischen Entgegnung auf Hegel seitens Rosminis und Gentiles selbst darstellt, dass das Konkrete nicht ableitbar ist" (Maria Adelaide Raschini, Studi sulla "Teosofia" [= Scritti di Maria Adelaide Raschini, Bd. 9], Venezia 42000, 92). 141 Für Ottonello sei auf die bereits angeführten Zitate verwiesen. Vgl. weiterhin ders., II mito di Rosmini; ders., Gentile, la religione come morale, in: Filosofia Oggi 14 (1991) 387-394; vgl. auch die sonstigen Beiträge in seinem Sammelband L'ideale e il reale. 142 Vgl. Giorgio Giannini, La critica di Rosmini a Hegel in un recente studio, in: Aquinas 1 (1958) 268- 274; ders., La metafisica di Rosmini, in: RRFC 91 (1997) 5-88; ders., Rosmini critico di Hegel, in: ders., Scritti su Rosmini (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 16), Stresa 1994, 177-179. 143 Vgl. Xavier TilJjette, Antonio Rosmini e l'idealismo tedesco, in: Umberto Muratore (Hg.), Da Cartesio a Hegel 0 da Cartesio a Rosmini?, Stresa 1997, 113-126. 144 Vgl. Antimo Negri, Rosmini legge 1a hegeliana dottrina dell'essere, in: Umberto Muratore (Hg.), La forma morale dell' essere. Veritä e libertä nel mondo contemporaneo, Stresa 1995, 133- 152; ders., Hegel eRosmini filosofi della politica tra rivoluzione francese e restaurazione, in: Peppino Pellegrino (Hg.), Rosmini e la cultura della rivoluzione francese, Stresa/Milazzo 1990, 205-243. 145 Vgl. Rosmini di fronte al nichilismo contemporaneo, in: [0. Hg.}, Theologia & Historica. Annali della Pontificia Facoltä Teologica della Sardegna, Bd. 8, Cagliari 1999,77- 91; Rosmini di fronte all'illuminismo, in: Alfeo Valle(Hg.), La formazione di Antonio Rosmini nella cultura deI suo tempo, Brescia 1988,291-304.
70
Markus Krienke
Lucias l48 , Massimo DOOllS 149 sowie Giulio Nocerinos 150 an. Ergänzt werden diese durch die Untersuchungen Faccos l51 , Tripodis l52 , Messinas 153 und Dossis l54 • Signifikant rur diese Tradition ist - zusammenfassend - die Zentralstellung der Rosminischen Auseinandersetzung mit Hegel und die eingehenden Studien der Teosofia - jenes Projekt mithin, das von Sciacca selbst noch angedacht, nicht aber mehr ausgeruhrt werden konnte. Die genannten Autoren trugen mit ihrem Rückgang zum Rosminischen Text und der Aufarbeitung der Frage "Rosmini und die deutsche Philosophie" von dieser Seite her gewissermaßen die in der "zweiten Phase" vernachlässigte Seite der Auseinandersetzung nach. Dadurch trat der "Rosminianismus" der "dritten Phase" die Nachfolge des "Neo idealismus" der "zweiten Phase" an. Trotz der Tatsache, dass diese Phase zu einer Erforschung und Kenntnis des 146 V gl. Lorenzo Ferroni, La critica di Rosmini a Hegel nella "Teosofia" (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 7), Stresa 1987. 147 Vgl. Le fonti idealistiche dei pensiero rosminiano, in: RRFC91 (1997) 571-634; Rosmini e !'encic1opedia di Hege1, in: Pier Paolo Ottonello (Hg.), Rosmini e ! 'encic1opedia delle scienze, Firenze 1998, 117-145. 148 Vgl. neben den bereits erwähnten Untersuchungen L'istanza metempirica dei filosofare und Donato Jaja e il significato teoretico e storico della filosofia rosminiana auch die Studie Paolo De Lucia, Bertrando Spaventa interprete di Rosmini, in: Francesco Mercadante / Vincenzo Lattanzi (Hg.), Elogio della filosofia, Roma 2000, 216-227. 149 Vgl. Massimo Dona, L'uno, i molti. Rosmini-Hege1 un dialogo filosofico, Roma 2001; ders., Per un'onto1ogia dell'arte nell'ottica della teologia rosminiana, in: MicheJe Dossi / Micheie NicoJetti (Hg.), Antonio Rosmini tra modemita e universalita, Brescia 2007,143-154. 150 Vgl. Giulio Nocerino, Coscienza e ontologia ne1 pensiero di Rosmini (= Biblioteca di Studi Rosminiani, Bd. 27), Stresa 2004, 15-35; ders., La tensione ontologica della morale nella Teosofia di Antonio Rosmini, in: Dossi/NicoJetti (Hg.), Antonio Rosmini, 155-178. 151 Vgl. Maria Luisa Facco, La logica di Rosmini e !'encic1opedia delle scienze, in: Ottonello(Hg.), Rosmini e l'enciclopedia, 173-190; dies., Rosmini e Leibniz, in: RRFC 93 (1999) 127-165. 152 Vgl. Anna Maria Tripodi, I1 Rosmini «metafisico» nella cultura italiana dell'Ottocento, in: Luciano MaJusa (Hg.), I filosofi e la genes i della coscienza culturale della "nuova Italia" (1799-1900). Stato delle ricerche e prospettive di interpretazione, Napoli 1997, 85-91; dies., Rosmini e Descartes, in: Maria Adelaide Raschini (Hg.), Rosmini. Pensatore europeo, Mi1ano 1989,375-386; dies., Rosmini, Löwith e il "dopo Nietzsche", in: BeschinIValle/ZucaJ (Hg.), I1 pensiero di Antonio Rosmini, 141-151; dies., Rosmini. La forza della verita, Genova 2005. 153 Gaetano Messina ist Herausgeber der wichtigen systematischen Werke Nuovo Saggio, Aristotele esposto ed esaminato und 11 Rinnovamento innerhalb der kritischen Gesamtausgabe Rosminis. 154 Vgl. MicheJe Dossi, Antonio Rosmini. Ein philosophisches Profil, Stuttgart 2003, 118- 128, 343-354; ders. / MicheJe NicoJetti (Hg.), Antonio Rosmini tra modemita e universalita, Brescia 2007.
Rosmini und die deutsche Philosophie
71
Rosminischen Textes gelangte, wie sie für die vorangehenden Phasen nicht einmal annähernd angenommen werden kann, steht am Ende dieser Phase die Konstatierung, dass Rosmini aus der philosophischen Diskussion, d. h. aus seinem "Metier" der "zweiten Phase" nahezu völlig verschwunden ist. Dies kann gewissermaßen als die notwendige Folge dessen angesehen werden, dass Rosmini aus dem Paradigma des "italienischen Kant" befreit werden musste, was aber Grundlagenarbeiten notwendig machte, die zunächst seine Bedeutung innerhalb der neuzeitlichen Philosophiegeschichte unsicher werden ließen. Dies bedingte einen kontinuierlichen Rückzug aus der philosophischen Auseinandersetzung selbst. War er in der "zweiten Phase" noch Referenzpunkt der großen italienischen Philosophen, so gab es in der "dritten Phase" immer weniger Denker, die mit seiner Position noch etwas anfangen konnten. Das "Nachholen" der berechtigten klassisch-ontologischen Aspekte seines Denkens hatte zudem die Folge, dass Rosmini nun als rückwärtsgewandter Ontologist erschien, von dem man sich keine Impulse für die philosophische Diskussion mehr erhoffte. Ist nun aber der "Rosminianismus" an die Stelle des "Neoidealismus" gerückt, stellt sich zum Abschluss der Betrachtung dieser Phase die Frage, welches Verhältnis sich daraus zum "Neothomismus" ergibt. Eine pauschale Antwort kann an dieser Stelle nur das Nichtvorhandensein einer produktiven Auseinandersetzung konstatieren. Trotz des Bedeutungsverlusts in der philosophischen Debatte, jener ehemals "neoidealistischen" Domäne, revidierte der Neothomismus seine ablehnende und verurteilende Haltung nicht und hielt somit auch dies nicht ohne philosophiehistorische Ironie - nun als Einziger taut court an der (neo-)idealistischen Reduktion Rosminis fest. Bestand für offene Angriffe seit der Verurteilung 1888 auch kaum noch Anlass, hielt sich die feindselige Haltung dennoch durch und verschaffte sich insbesondere im Jubiläumsjahr von Post obitum 1988 wieder Luft: Auf seine Recherchen in den geheimen Verurteilungsakten gestützt, veröffentlichte Cornelio Fabro ein Jahr darauf seine Studie L 'enigma Rosmini: Hierin wartet er mit der klassischen und mittlerweile über ein halbes Jahrhundert untergegangenen These auf, Rosmini habe die 17 kantischen apriorischen Elemente (Fabro spricht gar von 17 "Kategorien") auf eine einzige reduziert. Und er fragt provokativ: "Haben die Rosminianer jemals über diese Gemeinsamkeit Rosminis mit Hegel reflektiert?,,155. Wenn er daraufhin das ganze Rosminische Denken als eine "einzige grandiose Erkenntnislehre" bezeichnet l56 , dann wird endgültig klar, dass er sich zumindest nicht auf den damaligen Stand der Rosminiforschung beruft. So blieben ver-
155 Cornelio Fabro, L'enigma Rosmini. Appunti d'archivio per la storia dei tre processi, 1849, 1850- 1854, 1876--1887, Napoli 1988,259. 156 Fabro, L'enigma, 276.
72
Markus Krienke
ständnislose Reaktionen aus dem mittlerweile erstarkten und systematisch gefestigten Lager der Rosminianer nicht aus l57 • Kritik an der Charakterisierung Rosminis als "modemen" Denker übten allerdings nicht nur diejenigen, welche dessen Verurteilung und Ausschluss aus den theologischen Lehrbüchern und Studienordnungen befürworteten, sondern sie formierte sich auch in einem Kreis ausgesprochener Anhänger des Denkens Rosminis, die sich auf einige Autoritäten des "orthodoxen Rosminianismus" der "zweiten Phase" zurückberiefen und in der Individuierung neuzeitlicher Formen und Inhalte im Denken Rosminis dessen eigene Denkform verfälscht sahen. Für sie ist Rosmini ein Denker, der gegen die Modeme die klassischmittelalterliche Weltanschauung verteidigt. In diesem Sinn äußerte Giovanni Dei Degan: "Der Roveretaner ,stimmte' mithin nicht für die Kantische Konzeption des synthetischen Urteils; im Gegenteil war er ein beständiger und strenger Kritiker derselben. [ ... ] Der Rosminische Apriorismus ist wesenhaft objektiv, während der Kantische wesenhaft subjektiv ist"l58.
Es ist bezeichnend, dass genau die Auseinandersetzung, die in der "zweiten Phase" noch im Mittelpunkt gestanden hatte, nunmehr - philosophisch gesehen - nur noch von Randpositionen vertreten wurde, obgleich sie sich theologischkirchlich als von höchster Bedeutung erwies. So kann die "dritte Phase" als die Verlagerung dieser Auseinandersetzung der "zweiten Phase" nach anfänglicher reger Auseinandersetzung mit Neoidealismus und Aktualismus (Sciacca, Spiri) auf die kirchlich-theologische Auseinandersetzung gelesen werden. Mit dem Abebben des Neoidealismus war, wie bereits angedeutet, auch der philosophische Dialogpartner ausgefallen. Und kirchlicherseits konnte man nicht an dem dringlicheren Bemühen vorbei, auf die Befreiung Rosminis von der Verurteilung zu drängen, was aber alle Bewegungen verbot, die im Gegenteil eine endgültige Beendigung des Dialoges auch auf kirchlicher Ebene zu riskieren drohten. Denn in diesem Fall wären die Rosministudien ganz auf sich gestellt - mit dem Ergebnis einer totalen Marginalisierung sowohl im philosophischen als auch im theologisch-kirchlichen Kontext. Die konzentrierten Arbeiten der "dritten Phase" erlangten ihren Erfolg in der Aufhebung der Verurteilung im Jahr 2001, womit die Rehabilitierung des Denkens Rosminis in der Theologie verbunden ist, d. h. die offizielle Erklärung, dass die Verurteilung aus dem Jahr 1888 nicht mehr das Denken Rosminis selbst trifft. Damit ist nach der Überwindung des neoidealistischen Paradigmas 157 Vgl. beispielsweise Giorgio Giannini, Un enigma insolito, in: ders., Scritti su Rosmini, 10 1-129 (v gl. zuvor in: RRFC 83 [1989] 415-444). 158 Giovanni DeI Degan, A. Rosmini e l'ontologia dei giudizio, in: ders., In difesa dei vero Rosmini, hg. von DaniIo Castellano, Udine 1982, 393- 398, hier 396 (ursprünglich in: Atti dei V convegno intemazionale di studi italo-tedeschi, Bolzano 1968, 43-48).
Rosmini und die deutsche Philosophie
73
in der Philosophie auch theologischerseits jene bereits angedeutete "äußere Schranke" überwunden, die den Rosministudien seit der "zweiten Phase" auflastete. Zum Abbau der "inneren Schranke", d. h. des Fehlens einer wirklichen interkulturell-interdisziplinären Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Verhältnis "Rosmini und die deutsche Philosophie", konnten allerdings - wie bereits deutlich wurde - nichts weiter als die Grundlagenarbeiten geleistet werden: die Erforschung des Rosminischen Texts und die Darstellung seines theoretischen Zusammenhanges. Damit ist zweifelsohne die Basis für einen "neuen Dialog" mit der Philosophie selbst gelegt, den es selbst allerdings erst noch zu führen gilt. Zur Überwindung dieses Hindernisses und für eine effektive Neubewertung ist jedoch eine neue Methode nötig, die als eine Methode der "Öffnung" bezeichnet werden kann. Eine solche "Öffnung" vermag aber nicht einseitig zu geschehen, sondern nur im Dialog. Scheinen auch die Tendenzen der Forschung in diese Richtung zu weisen, so ist gleichwohl dieser Dialog selbst noch nicht in Angriff genommen worden. Vor dem Hintergrund einer historisch erstmaligen Konstitution dieses Dialogs während der Tagung "Rosmini und die deutsche Philosophie" ist daher die Frage mehr als berechtigt, ob wir uns nicht nun, nach den grundlegenden Studien der "dritten Phase" und der Rehabilitierung 2001 vor einer "neuen Phase" befinden?
III. Ausblick oder "vierte Phase": Neue Perspektiven für die Frage "Rosmini und die Deutsche Philosophie"? "Er [sc. Rosmini] hatte eine tiefgründige Intuition und machte, wie Manzoni bemerkte, eine große philosophische Entdeckung: Sie auszuarbeiten, wird die Aufgabe von ganzen Generationen sein. Aus diesem Grund genügt es nicht, Rosmini darzustellen und zu lehren, was man immer noch nicht in ausreichendem Maße tut; man muss ihn dagegen in Diskussion bringen".
So die Worte Camillo Viglinos, Direktor der Rivista Rosminiana, im Jahr 1930 159 • Nach der soeben durchgeführten Analyse der Interpretationsgeschichte "Rosmini und die Deutsche Philosophie" erscheint diese Aussage in ihrer ganzen Berechtigung; seine Aufforderung, "Rosmini zur Diskussion" zu stellen, erweist sich gar erst jetzt, 75 Jahre später, möglich - bzw. vielmehr geboten -, nachdem nämlich in der "dritten Phase" die nötige Ausgangsbasis dazu erarbeitet worden ist. Damit bietet sich nun erstmals in den 150 Jahren nach dem Ableben Rosminis eine historische Gelegenheit, die Frage nach "Rosmini und die deutsche Philosophie" mit einer neuen Methode und aus einer neuen Perspekti159 CamjJJa Viglina, Confusione dell'idea dell'essere con l'idea dell'ente, in: RRFC 24 (1930) 21-26, hier 26.
74
Markus Krienke
ve, die frei von Voreingenommenheiten und Polemiken ist, anzugehen. Diese neue Herangehensweise an das Denken Rosminis he deutet vom heutigen Standpunkt aus dabei nichts Geringeres als den Dialog mit der europäischen Kultur. Als Basis für diesen Dialog der Rosminiforschung mit der europäischen Philosophie und Theologie dient der Rosminische Dialog mit Kant und dem Idealismus selbst. Bis an seinen historisch-systematischen Grund zurückverfolgt, bedeutet dieser eigentlich nichts anderes als die Überwindung des seit der Aufklärung sich immer weiter vertiefenden Grabens zwischen der neuzeitlichen subjektivitätstheoretischen Philosophie und dem Festhalten an einem ontologisch-scholastischen Verständnis der Metaphysik seitens der Theologie. Im Denken Rosminis selbst nahm diese Auseinandersetzung, wie im Voraufgehenden dargestellt wurde, eine konkrete Form an. Doch fiel der Roveretaner, der es als das zentrale Ziel seines intellektuellen Schaffens angesehen hatte, diesen Graben zu überwinden, der Konfrontation zum Opfer. Ist dem aber so, dann präsentiert sich in der nunmehr erstmals möglichen Situation der Rosminischen Wirkungsgeschichte die Gelegenheit, diese Denkintention Rosminis in all ihren Facetten und Bedeutungsvariationen herauszustellen. Damit ist deutlich, dass wir uns mit gutem Grund am Beginn einer "neuen Phase" der Wirkungsgeschichte "Rosmini und die deutsche Philosophie" befinden. Am Beginn einer jeden neuen Phase steht explizit oder implizit die Frage nach dem methodischen bzw. tatsächlichen Vorgehen. Soll sich die "neue Phase" aber in einem lebendigen Dialog zwischen italienischer und deutscher Kultur, zwischen Experten Rosminis auf der einen und denjenigen Kants und der Idealisten auf der anderen Seite, realisieren, dann kann ein solcher Beginn nirgends anders als in einem lebendigen Austausch der verschiedenen Standpunkte wie auch der unterschiedlichen Vorstellungen über Möglichkeiten und Perspektiven eines solchen Dialoges liegen. In diesem Sinn vermag die Tagung "Rosmini und die deutsche Philosophie", einen solchen Neubeginn zu konstituIeren. Zwei historische Zeugnisse zu den Problematiken und Perspektiven dieses Dialogs mögen dem Beginn dieser Phase zugrunde gelegt sein: Das erste besteht in einem Passus aus einer der ersten Rezensionen des Nuovo Saggio in deutscher Sprache, nämlich aus der Feder C. H. Weißes im Jahr 1856. Er schreibt in der 28. Nummer der Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik: "In diesem Grundtypus, in der Form der Bildung, in die sein Geist hineingegossen, ist er den neueren Philosophen, die er namentlich im ersten Bande seines Werkes ausfiihrlich bekämpft und auf die er vielfach auch in den nachfolgenden zurückkommt, und unter den Philosophen des Alterthums dem Aristoteles, dem er nicht zwar in der Weise unserer deutschen Gelehrsamkeit ein philologisch genaues, aber sichtlich doch ein sachlich eingehendes Studium zugewandt hat, ungleich näher ver-
Rosmini und die deutsche Philosophie
75
wandt, als jenen mittelalterlichen, wie weit er auch sachlich von ihnen Allen oder von den Meisten unter ihnen abweicht,,160.
Dies zeigt, dass es immer schon, auch ftir die deutschen Interpreten seines Denkens, sehr schwer war, das hier zur Verhandlung stehende Verhältnis zu bestimmen. Die grundlegende Schwierigkeit der Rosminischen "Denkform" besteht in jenem Spagat, im neuzeitlichen Paradigma die Aussagen der mittelalterlichen Philosophen neu verständlich und einsichtig zu machen. Es ist, wie der anonyme Rezensent in den Historisch-politischen Blättern schreibt: Rosmini habe ,,[ ... ] durch die Aufnahme der scholastischen und kirchlichen Philosophie in sein System und in seine Darstellung den Wunsch des großen Leibniz, daß einmal ein tüchtiger Mann uns die Scholastiker durch Überarbeitung ihrer Gedanken und Übersetzung in unsere Sprache zU~änglich machen möchte, theilweise erfiillt (ein gewiß dankenswerthes Verdienst!)"1 I.
Das zweite Zeugnis ist das Rehabilitierungsdekret aus dem Jahr 2001. Dieses stellt heraus, dass die Verurteilung von 1888 auf "Auslegungen nach einem idealistischen, ontologistischen und subjektivistischen Schlüssel [basiere], die von nichtkatholischen Denkern gemacht wurden, vor denen das Dekret Post obiturn objektiv warnt,,162. Die Verurteilung des Rosminischen Denkens behalte somit auch nach der Nota in jenem Fall ihre Gültigkeit, dass das Rosminische Denken in nämlichem Sinn interpretiert werde. Was Rosmini ausdrücklich nicht mehr unterstellt wird, ist, dass dieser Sinn die Intention seines Denkens und den Inhalt seiner Schriften bildet l63 . Steht es aber - nun auch amtlich - um das Rosminische Denken in dieser Weise, so resultiert als Konsequenz, dass es Rosmini in bestimmter Weise gelungen sei, diese Verbindung zwischen traditionellem und neuzeitlichem
160 Christian Hermann Weiße, Rezension zu: Nuovo Saggio sull'origine delle idee, di Antonio Rasmini-Serbati, prete Roveretano. 3 Vol. Ed. 5. Torino 1851, in: Zeitschrift rur Philosophie und philosophische Kritik 28 (1856) 288-301, hier 290. 161 {a. Verf}, Rezension zu: Opere edite e inedite di Antonio Rosmini-Serbati. Nuovo Saggio sull'origine delle idee. III vol. Milano, 1839, in: Historisch-politische Blätter rur das katholische Deutschland 6 (1840) 243-256, 298-306, hier 247-249. 162 Notifikation zur Bedeutung der lehramtlichen Dekrete bezüglich des Denkens und der Werke des Priesters Antonio Rosmini Serbati, Nr. 5. 163 Vgl. das klare Urteil, zu dem diesbezüglich die Rosminiforschung der "dritten Phase" gelangt ist: "Rosmini war weder ein idealistischer Philosoph malgre sai noch ein ,moderner' Katholik, der rur die Immanenz des Denkens offen gewesen wäre. Ihm sind die Positionen der italienischen und ausländischen Idealisten wie auch der Historiker, die sich an ihnen inspirieren, fremd" (Malusa, Galluppi eRosmini, 285).
76
Markus Krienke
Denken in einer nicht-idealistischen, nicht-ontologistischen und nichtsubjektivistischen Weise zu bewerkstelligen l64 . Beide Aussagen stehen für die Überwindung der klassischen Hindernisse einer positiven Auseinandersetzung mit dem Thema "Rosmini und die deutsche Philosophie", nämlich erstens des philosophisch-neoidealistischen und zweitens des theologisch-kirchenpolitisch-neothomistischen. Die "dritte Phase" hat mit exakten Arbeiten zur Rosminischen Denkform ausgehend von seinem Text die Aufsprengung dieser beiden Hindernisse erlangt. Nach deren Überwindung stellt sich die Frage nach dem Verhältnis Rosminis zu Kant und Hegel in einem ganz neuen Licht: Mit einem Rosmini als Pseudo-Kant oder Pseudo-Hegel können weder die Rosminiforschung noch die auf Kant und dem Idealismus basierende Subjektphilosophie etwas anfangen. Dies hat die Geschichte erwiesen. Sie hat aber auch erwiesen, dass die Bedeutung Rosminis nicht an dieser Frage nach dem Verhältnis Rosminis zur "deutschen Philosophie" vorbei gefunden werden kann. Nur auf einer vorurteilsfreien Basis hat der deutschitalienische Dialog, auf dem in Zukunft die Frage "Rosmini und die Deutsche Philosophie" fußt, einen Sinn. Auf der einen Seite hat man Rosmini in der zweiten Phase zu schnell zu einem Kantianer und einem Idealisten gemacht; auf der anderen hat man in der dritten Phase aber auch die berechtigte Bedeutung Rosminis innerhalb der neuzeitlichen Philosophiegeschichte zu früh aufgegeben und den Eindruck hinterlassen, als sei die Rosminische Kritik an Kant und den Idealisten außerhalb der Rosministudien nicht von Interesse. Beide Interpretationen fanden berechtigte Anhaltspunkte im Rosminischen Text. An der Oberfläche ist die Rosminische Kritik an Kant und den Idealisten deutlich und hart. Doch steht er diesen von seiner Denkweise manchmal gar an den Stellen am nächsten, an denen er diese am stärksten kritisiert. Auf der anderen Seite erweisen sich oftmals geradezu offensichtlich scheinende inhaltliche Parallelen oder identische Begriffe als trügerisch, sodass Rosmini unter diesen etwas ganz anderes versteht, als sie vor einem kantisch-idealistischen Verstehenshorizont suggerieren. Diese Problematik gilt es auszubalancieren. Gibt es auch schon wertvolle Studien in diese Richtung, so stellt es noch ein Desiderat dar, diese Balance in den Griff zu bekommen. Nach der zweiten und dritten Phase scheint nun, in der Aufbruchstimmung des Jubiläumsjahres 2005, der Augenblick gekommen, in dem dieses bewerkstelligt werden könnte.
164 Vgl. Markus Krienke, Hinftihrung: Zur Aktualität und Bedeutung des rosminischen Neuansatzes, in: Münchener Theologische Zeitschrift 56 (2005) 4-8, hier 7.
Bibliographie I. Einführungen in das Rosminische Denken Cioffi, Mario: Rosmini filosofo di frontiera, Firenze 2001. De Giorgi, Fulvio: Rosmini e il suo tempo. L'educazione dell'uomo moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833) (= Storia, Bd. 2), Brescia 2003.
Dossi, MicheIe: Profilo filosofico di Antonio Rosmini (= Biblioteca Rosminiana,
Bd. 10), Brescia 1998 / Antonio Rosmini. Ein philosophisches Profil. Aus dem Italienischen übers. und bearb. von Markus Krienke (= Ursprünge des Philosophierens, Bd. 6), Stuttgart 2003.
Krienke, Markus: Theologie - Philosophie - Sprache. Einführung in das theologische Denken Antonio Rosminis (= ratio fidei, Bd. 29), Regensburg 2006.
- (Hg.), Rosmini - Wegbereiter für die Theologie des 21. Jahrhunderts, St. Ottilien 2005 (= Münchener Theologische Zeitschrift 56 [2005], Nr. I).
Lorizio, Giuseppe: Antonio Rosmini Serbati 1797-1855. Un profilo storico-teologico.
II edizione riveduta e corretta pubblicata in occasione deI 1500 anniversario della morte di A. Rosmini, Roma 22005.
Menke, Karl-Heinz: Vernunft und Offenbarung nach Antonio Rosmini. Der apologeti-
sche Plan einer christlichen Enzyklopädie (= Innsbrucker theologische Studien, Bd. 5), Innsbruckl Wien/München 1980 / Ragione e rivelazione in Rosmini. Il progetto apologetico di un'encic\opedia cristiana, übers. von Carlo Maria Fenu (= Bibliotheca Rosminiana, Bd. 9), Brescia 1997.
Muratore, Umberto: Conoscere Rosmini. Vita, pensiero, spiritualita, Stresa 22002. Prini, Pietro: Introduzione a Rosmini, RomaiBari 1997. Sgarbossa, Mario: Antonio Rosmini. Genio filosofico - profeta scomodo, Roma 1996. Zovatto, Pietro (Hg): Introduzione a Rosmini, StresaiTrieste 1992.
78
Bibliographie
11. Überblicksdarstellungen zur deutschen Rosminiforschung Krienke, Markus: Ein Denken zwischen Tradition und Moderne. Zum 150. Todestag Antonio Rosminis (1855- 2005), in : Philosophischer Literaturanzeiger 57 (2004) 369-394; 58 (2005) 43-70.
- Studi rosminiani in Gennania. Indagine storico-critica sulla ricezione di Rosmini in Gennania dal 1830 fino ad oggi, in : Rivista di filosofia neo-scolastica 97 (2005) 373405.
Liermann, Christiane: "Begriffe" della filosofia della politica di Antonio Rosmini, in: Giuseppe Beschin / Alfeo Valle / Silvano Zucal (Hg.), I1 pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, Brescia 1999, 511-528.
Menke, Karl-Heinz: Die theologische Rosmini-Forschung. Eine Bilanz zum 200. Geburtstag von Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855), in: Theologische Revue 93 (1997) 267-280.
111. Zur Erkenntnistheorie und Metaphysik Rosminis Brugiatelli, Vereno: I1 sentimento fondamentale nella filosofia di Rosmini, in: RRFC 90 (1996)221-429,431-454;92(1998) 153-169;94(2000)39-73.
De Lucia, Paolo: Essere e soggetto. Rosmini e la fondazione dell'antropologia ontologica (= Biblioteca di filosofia, Bd. 4), Pavia 1999.
DeI Degan, Giovanni: In difesa dei vero Rosmini, hg. von DaniIo Castellano, Udine 1982.
Fenu, Carlo Maria: Il problema della creazione nella filosofia di Rosmini (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 19), Stresa 1995.
Franchi, Attilio: Saggio sul sistema ontologico di Antonio Rosmini (= Collana di Studi filosofici rosminiani, Bd. 4), Domodossola/Milano 1953 .
Franck, Juan Francisco: From the nature of the mind to personal Dignity. The significance ofRosmini's Philosophy, Washington 2006.
- Las Categorias dei Ser segun Rosmini, in: RRFC 97 (2003) 7-29.
Giacon, Carlo: L'oggettivita in Antonio Rosmini, Milano/Genova 1960. - Rosmini fra trascendentale e metafisica, in: RRFC71 (1977) 1-16.
Giannini, Giorgio: La metafisica di Rosmini, in: RRFC91 (1997) 5-88. Gomarasca, Paolo: Rosmini e la fonna morale dell'essere. La "poiesi" dei be ne come destino della metafisica (= Collana della Facolta teologica di Lugano, Bd. 2), Milano 1998.
Bibliographie
79
Grandis, Giancarlo: Principio ebene in Antonio Rosmini, m: Il nuovo areopago 6 (1987) 132-150.
Krienke, Markus: Il Concetto di Verita in Rosmini. Cenni per un nuovo tentativo di interpretazione, in: RRFC99 (2005) 377-395.
-
Soggetto ed esistenza. Akune riflessioni sulla modemita dei pensiero di Antonio Rosmini, in: Studia Patavina 53 (2006) 141-157.
Manferdini, Tina: Essere e verita in Rosmini (= Philosophia, Bd. 15), Bologna 2 1994. Mirri, Edoardo: L'essenza metafisica dei pensare rosminiano, in: Edoardo Mini / Furia VaJori (Hg.), La ricerca di Dio (= Universita degli Studi di Perugia. Quademi dell'Istituto di Filosofia, Bd. 14), Napoli 1999, 103-120.
NebuJoni, Roberto: L'oggettivismo etico rosminiano, in: Rivista di Filosofia neoscolastica 82 (1990) 623-630. -
Ontologia e morale in Antonio Rosmini, Milano 1994.
Nocerino, Giulio: Coscienza e ontologia nel pensiero di Rosmini (= Biblioteca di Studi Rosminiani, Bd. 27), Stresa 2004.
Ottonello, Pier Paolo: L'Enciciopedia di Rosmini (= Categorie Europee. Sezione II Studi Critici, Bd. 29), L'AquilaiRoma 1992. -
L'essere iniziale e I'esemplare dei mondo nell'ontologia dialettica di Rosmini, in: RRFC71 (1977) 108-118.
-
L'Ontologia di Rosmini (= Categorie Europee. Sezione II - Studi Critici, Bd.22), L'AquilaiRoma 1989.
-
Ontologia e mistica (= Collana del dipartimento di studi sulla storia dei pensiero europeo "Micheie Federico Sciacca". Sezione "saggi filosofici", Bd.22), Venezia 2002.
-
Rosmini "inattuale" (= Categorie Europee. Sezione II - Studi Critici, Bd.25), L ' AquilaiRoma 1991.
-
Rosmini. L'ideale e il reale (= Collana dei dipartimento di studi sulla storia dei pensiero europeo "Micheie Federico Sciacca". Sezione "saggi filosofici", Bd. 9), Venezia 1998.
PercivaJe, Franeo: Il fondamento e la funzione metafisica dei "trascendentale" rosminiano, in: RRFC 72 (1978) 207-231.
-
Illuminazione e astrazione, in: RRFC 73 (1979) 385--402; 74 (1980) 105-131, 337362.
-
L'ascesa naturale a Dio nella filosofia di Rosmini (= Pubblicazioni dell'Istituto di Filosofia. Facolta di Magistero dell'Universita di Genova, Bd. 11), Roma 22000.
80
Bibliographie
Petrini, Francesco: Sentire e intendere in Antonio Rosmini, in: RRFC 58 (1964) 1-15, 84--111. -
Sull'intuizione dell'essere, in: RRFC53 (1959) 74--79.
- Volizione primitiva, obbligazione e relazione a Dio nella morale di A. Rosmini, in: RRFC77 (1983) 317-327.
Pfurtscheller, Friedrich: Von der Einheit des Bewußtseins zur Einheit des Seins. Zur Grundlegung der Ontologie bei Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855), Frankfurt a. M. 1977. Piemontese, Filippo: La dottrina dei sentimento fondamentale nella filosofia di A. Rosmini (= Studi sul pensiero filosofico e religioso dei secoli XIX e XX, Bd. 1), Milano 1966. - Validita psicologica e ontologico-metafisica della teoria rosminiana dei sentimento fondamentale, in: RRFC 62 (1968) 113-125.
Prini, Pietro: Il concetto della Metafisica come Sistema della Verita secondo A. Rosmini, in: RRFC 43 (1949) 248-261. -
Rosmini postumo (= Collana dei bicentenario, Bd. 2), Stresa 31999.
Radice, Gianfranco: II "Piano generale delle Scienze" ovvero 10 schema di tutta la speculazione di Antonio Rosmini, in: RRFC62 (1968) 294--302. Raschini, Maria Adelaide: Attualita della tematica della "Teosofia" di Antonio Rosmini, in: RRFC62 (1968) 127-142. -
Dialettica e poiesi nel pensiero di Rosmini (= Collana deI dipartimento di studi sulla storia dei pensiero europeo "MicheIe Federico Sciacca". Sezione "saggi filosofici", Bd. 5), Venezia 1996.
-
Prospettive Rosminiane (= Maria Adelaide Raschini. Scritti, Bd. 12), L'AquilaiRoma 11987.
- Rosmini oggi e domani, hg. von Pier Paolo Ottonello (= Scritti di Maria Adelaide Raschini, Bd. 8), Venezia 1999. -
Studi sulla "Teosofia", hg. von Pier Paolo Ottonello (= Scritti di Maria Adelaide Raschini, Bd. 9), Venezia 42000.
Schiavone, MicheleL'etica dei Rosmini e la sua fondazione metafisica (= Collana di Studi filosofici rosminiani, Bd. 16), Venezia 1962. Sciacca, Micheie Federico: Atto ed essere (= MFS, Bd. m,2), Palermo 51991/ Akt und Sein (= Symposion, Bd. 16), Freiburg/München 1964. -
Antonio Rosmini, in: Grande Antologia filosofica, hg. von Micheie Federico Sciacca und Micheie Schiavone, Bd. 20. Il pensiero moderno (Prima meta dei secolo XIX), Milano 1973, 501-820.
Bibliographie
81
- Die Eroberung des Menschen, in: Zeitschrift fiir philosophische Forschung 7 (1953) 533- 553. -
Filosofia e antifilosofia (= MFS, Bd. III,3), Palermo 1998.
-
Filosofia e metafisica (= MFS, Bd. III,II), Palermo 2002 .
-
Interpretazioni rosminiane (= MFS, Bd. 1,5), Palermo 4 1997 .
-
L'oscuramento dell'intelligenza (= MFS, Bd. I1I,5), Palermo 2000.
-
La filosofia morale di Antonio Rosmini (= MFS, Bd. 1,2), Palermo 1990.
-
L'interiorita oggettiva (= MFS, Bd. III, I), Palermo 1989 / Objektive Inwendigkeit, übers. von Kari Huber nach der dritten ital. Ausgabe Mailand 1960 (= Horizonte, Bd. 10), Einsiedeln 1965.
-
Ontologia triadica e trinitaria. Discorso metafisico teologico (= MFS, Bd. I1I,4), Palermo 1990.
Spiri, Sivlio: Essere e sentimento. La persona nella filosofia di A. Rosmini, Roma 2004.
IV. Zur Kant- und Idealismusinterpretation Rosminis
Battaglia, Fiorella: Antonio Rosmini e il "soggettivismo" kantiano, in: Giuseppe Beschin / Luca Cristellon (Hg.), Rosmini e Gioberti. Pensatori europei, Brescia 2003, 211-219.
Boyer, Carlo: La refutation de Kant par Rosmini, in: Micheie Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957, 461466.
Bozzetti, Giuseppe: Rosmini eHegei, in: RRFC26 (1932) 186-188. -
Rosmini e Kant, in: RRFC 26 (1932) 255- 256.
Brunello, Bruno: Razionalismo e legge morale in Rosmini, in: RRFC 62 (1968) 196200.
Caramella, Santino: Hegel eRosmini, in: Micheie Federico Sciacca (Hg.), Atti del Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957, 509-516.
Cheuia, Pietro: Il noumeno kantiano e I'idea dell'essere rosminiana, in: Micheie Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957, 531-534.
Cirell Czerna, Renato: Intorno al concetto di logos in Schelling eRosmini, in: Micheie Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957,567-580.
Contri, Siro: Parallelo fra Hegel eRosmini, Palermo/Roma 1967.
82
Bibliographie
De Gennaro, Antonio: Un problema storiografico: diritto e persona in Rosmini e Kant, in: RRFC 62 (1968) 247-260. De Lucia, Paolo: Bertrando Spaventa interprete di Rosmini, in: Francesco Mercadante / Vincenzo Lattanzi (Hg.), Elogio della filosofia, Roma 2000,216--227. -
Donato Jaja e il significato teoretico e storico della filosofia rosminiana, in: Filosofia oggi 25 (2002) 339-373.
-
L'istanza metempirica dei filosofare. Metafisica e religione nel pensiero degli hegeliani d'Italia (= Collana di Studi e Ricerche, Bd. 38), Genova 2005.
Dona, Massimo: L'uno, i molti. Rosmini-Hegel un dialogo filosofico, Roma 200l. Evain, Fran90is: Antonio Rosmini e I' "oscuramento" dell'illuminismo, in: La Civilta Cattolica 139 (1988) H, 30-35.
-
Antonio Rosmini-Serbati (1797-1855) und der Rosminianismus im 19. Jahrhundert, in: Emerich Coreth / WalterM. Neidl/ Georg Plligersdorffer (Hg.), Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 1. Neue Ansätze im 19. Jahrhundert, Graz/Wien/Köln 1987,596--618.
-
Etre homme apres Kant: L'anthropologie d'Antonio Rosmini et la restauration ontologique de la personne, in: Les Cahiers de Fontenay 39/40 (1985) 141-150.
Facco, Maria Luisa: Rosmini e Leibniz, in: RRFC93 (1999) 127-165. Fenu, Carlo Maria: Le fonti idealistiche dei pensiero rosminiano, in: RRFC 91 (1997) 571-634.
-
Rosmini e I'encic\opedia di Hegel, in: Pier Paolo Ottonello (Hg.), Rosmini e I'encic\opedia delle scienze, Firenze 1998, 117-145.
Ferroni, Lorenzo: La critica di Rosmini a Hegel nella "Teosofia" (= Biblioteca di studi rosminiani, Bd. 7), Stresa 1987.
Franchi, Attilio: Rosmini critico di Hegel, in: Giomale di Metafisica 10 (1955) 597611.
Galantino, Nunzio / Lorizio, Giuseppe (Hg.): Sapere I'uomo e la storia. Interpretazioni rosminiane, Cinisello Balsamo 1998.
Galli, Dario: Giudizi di Rosmini su Hegel, in: Micheie Federko Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso intemazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957, 699-713.
-
Kant nel giudizio di Rosmini, in: ders., Studi rosminiani, Padova 1957, 165-189.
Giannini, Giorgio: La critica di Rosmini a Hegel in un recente studio, in: Aquinas I (1958) 268-274.
-
Rosmini critico di Hegel, in: Giorgio Giannini, Scritti su Rosmini, Stresa 1994, 177179.
Bibliographie
83
Jolivet, Regis: Morale et eudemonologie selon Rosmini et Kant, in: RRFC 53 (1959) 63-73 .
Krienke, Markus: Denken und Sein. Zur Hegelkritik Antonio Rosminis, in: Theologie und Philosophie 80 (2005) 56-74.
-
La Denkform rosminiana co me altemativa modema alla modemita. Sull'attualita dei confronto di Rosmini con Kant eHegei, in: MicheIe Dossi I MicheIe Nicoletti (Hg.), Antonio Rosmini tra modemita e universalita, Brescia 2007,95-125.
-
Ri-fondazione metafisica dell'oggettivita dopo Kant. Dei concetto di oggettivita in Antonio Rosmini, in: Gian Luigi Brena (Hg.), L'Oggettivita nella filosofia e nella scienza (= La filosofia e il suo passato, Bd. 6), Padova 2002, 129-147.
-
Rosmini in der Letztbegründungsdiskussion? Eine Replik, in: Theologie und Philosophie 81 (2006) 577- 584.
-
Wahrheit und Liebe bei Antonio Rosmini (= Ursprünge des Philosophierens, Bd. 9), Stuttgart 2004.
La Spisa, Mauro: Introduzione, in: Mauro La Spisa (Hg.), Antonio Rosmini. Hegel e la dialettica. Estratti dal V libro della Teosofia (= Collana di filosofia e pedagogia, Bd. 12), Firenze 1965,7-12.
Lenner, Luciano: Soggettivita e diritto in Hegel eRosmini. Elementi per un confronto attuale, in: Giuseppe Beschin I Alfeo VaIle I Silvano Zucal (Hg.), Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, Brescia 1999,403-419.
Liermann, Christiane: Rosminis politische Philosophie der zivilen Gesellschaft (= Rechts- und Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft,
Bd. 108), Paderbom 2004.
L6pez-Riob6o, Blanca: La critica de Rosmini a la gnoseologia de Kant, Madrid 1977. Lorizio, Giuseppe: Filosofia e teologia della rivelazione in Gioberti eRosmini, in: Giuseppe Beschin I Luca Cristellon (Hg.), Rosmini e Gioberti. Pensatori europei, Brescia 2003, 219-260.
-
La querelle rosminiana tra vecchie e nuove polemiche, in: Cristianesimo nella storia 14 (1993) 125-141.
- Ricerca della verita e "metafisica della carita" nel pensiero di Antonio Rosmini, in: Rassegna di Teologia 36 (1995) 527- 552.
Mancini, Italo: La "Critica della Ragion Pura" nella forrnazione di Antonio Rosmini, in: Alfeo Valle (Hg.), La forrnazione di Antonio Rosmini nella cultura dei suo tempo, Brescia 1988, 131- 204.
Manferdini, Tina: Genesi e critica dei nichilismo hegeliano secondo Rosmini, in: Giuseppe Beschin IAlfeo VaIle I Silvano Zucal (Hg.), Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, Brescia 1999,217- 235.
Bibliographie
84
Mathieu, Vittorio: Cartesio: verso Hegel 0 verso Rosmini?, in: Umberto Muratore (Hg.), Da Cartesio a Hegel
0
da Cartesio a Rosmini?, Stresa 1997,39--44.
- L'idea dell'illuminismo in Kant ein Rosmini, in: Peppino PeIlegrino (Hg.), Rosmini e l'Illuminismo, Stresa 1988,81-95.
Menke, Karl-Heinz: "Das ganz beim Du seiende Ich". Christozentrische Frömmigkeit
und Identifikation mit der verwundeten Kirche in Leben und Werk des Antonio Rosmini-Serbati, in: Die Kirchenkritik der Mystiker. Prophetie aus Gotteserfahrung, Bd. 3. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart, hg. von Mariano Delgado und Gotthard Fuchs, Stuttgart 2005, 43-64.
Morando, Dante: L'attualita di Rosmini nella crisi dell'idealismo. II. Idealismo assoluto e idealismo rosminiano, in: RRFC 28 (1934) 186-210. Muscolino, Salvatore: Osservazioni rosminiane alla concezione giuridica di Kant, in: Rassegna Siciliana di Storia e Cultura 14 (2001) 143-163.
Muzio, Giuseppe: L'idea dell'essere in S. Tommaso, in Rosmini, in Hegel, in: RRFC 50 (1956) 6-12.
Nebuloni, Roberto: Kant, Rosmini e la fondazione dell'etica, in: Humanitas (Brescia) 45 (1990) 137-153.
Negri, Antimo: Hegel eRosmini filosofi della politica tra rivoluzione francese e restaurazione, in: Peppino PeIlegrino (Hg.), Rosmini e la cultura della rivoluzione francese, StresaIMilazzo 1990, 205-243.
Rosmini legge la hegeliana dottrina delI'essere, in: Umberto Muratore (Hg.), La forma morale dell'essere. Verita e liberta ne1 mondo contemporaneo, Stresa 1995, 133- 152.
Nicolaci, Giuseppe: La propedeutica metafisica hegeliana al prob1ema deI pensare e 1a 1ettura rosminiana di Siro Contri, in: Theorein 6 (1969-1972) 155-189.
OttoneIlo, Pier Paolo: Il mito di Rosmini "Kant italiano", in: RRFC 89 (1995) 229-240. - Rosmini e il Risorgimento, in: RRFC92 (1998) 115-119. - Rosmini e la prima ricezione di Fichte e Schelling in Ita1ia, in: RRFC 88 (1994) 201203. - Rosmini e I'Europa, in: RRFC 91 (1997) 267-273.
Paolini Merlo, Silvio: Sulle modeme origini deI problema normativo. Questioni di deontologia trascendenta1e in Kant eRosmini, in: Idee 40--41 (1999) 155- 187.
Peccorini, Francicsco L.: Rosminism versus Kantism?, in: RRFC 81 (1987) 1-31. Petrini, Francesco: Giovanni Gentile e I'intuito rosminiano dell'essere, in: Giomale di Metafisica 19 (1964) 519- 531.
Bibliographie
85
Piemontese, Filippo: Di alcune obiezioni rosminiane al criticismo kantiano, in: Michele Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957,995-1003.
- Il problema critico in Rosmini e in Kant, in: Studium 51 (1955) 332-344.
Pignoloni, Emilio: Appercezione pura di E. Kant e sintesi originaria di A. Rosmini, in: RRFC53 (1959) 161-172. - Rosmini e il gnoseologismo moderno, in: RRFC55 (1961) 205-211.
Piovani, Pietro: Hegel nella filosofia dei diritto di Rosmini, in: ders., La filosofia dei diritto come scienza filosofica, Milano 1963,285-332.
Raschini, Maria Adelaide: La critica di Rosmini alla morale kantiana, in: Antonianum 64 (1989) 98-120.
- Riflessioni su filosofia e cultura (Kant, Hegel, Rosmini, Gentile) (= Pubblicazioni dell'Istituto di Filosofia. Facolta di Magistero dell'Universita di Genova, Bd. 2), Milano 1968. Validita e limiti dell'interpretazione spaventiana dei Rosmini edel Gioberti, in: Giornale di Metafisica 21 (1966) 265-269.
Redano, Ugo: Il problema dei conoscere in Kant eRosmini, in: Michele Federico Sciacca (Hg.), Atti dei Congresso internazionale di filosofia Antonio Rosmini, Firenze 1957,1011-1022.
Riconda, Giuseppe: Antonio Rosmini e la critica dei razionalismo, in: Giuseppe Beschin / Luca Cristellon (Hg.), Rosmini e Gioberti. Pensatori europei, Brescia 2003, 15-45.
- Ateismo, nichilismo e pensiero religioso. Due momenti: Rosmini e Schelling, in: Francesco Mercadante / Vincenzo Lattanzi (Hg.), Eiogio della filosofia, Roma 2000, 248-263. - La via franco-italiana come risposta al nichilismo, in: [0. Hg.}, La filosofia dopo il nichilismo, in: RRFC95 (2001) 15-36.
Rossi, Roberto: Il superamento del particolare: il limite come relazione. Hegel e Rosmini, in: Maria Adelaide Raschini (Hg.), Rosmini. Pensatore europeo, Milano 1989, 395-402.
Salmona, Bruno: Giorgio Hegel e Antonio Rosmini interpreti di Plotino (con una discussione di passi esemplari plotiniani sul problema della liberta), Genova 1973.
Sciacca, Micheie Federico: Il kantismo di Rosmini e il problema della metafisica, in: Tijdschrift voor philosophie 17 (1955) 306-318.
- Il pensiero italiano nell'eta dei Risorgimento (= Opere complete di Micheie F. Sciacca, Bd. 19), Milano 2 1963 .
Bibliographie
86
- Rosmini e Kant: le probleme de la metaphysique, in: Les etudes philosophiques 10 (1955) 255-259.
Solo Badilla, Jose Alberto: Antonio Rosmini. Critico dei idealismo trascendental (KantFichte-Schel\ing-Hegel), San Jose 1982.
- Antonio Rosmini y la unidad corno exigencia en los sistemas dei idealismo trascendental (Fichte y Schelling), in: Rivista de filosofia de la universidad de Costa Rica 15 (1977) 85-98. - Rosmini: critico dei "a priori" logico en Hegel, in: Rivista de filosofia de la universidad de Costa Rica 18 (1980) 155-163.
Spanio, Davide: Idealismo e metafisica. Coscienza, realUI e divenire nell'attualismo gentiliano, Padova 2003.
Tripodi, Anna Maria: Rosmini, Löwith e il "dopo Nietzsche", in: Giuseppe Beschin / Alfeo Valle / Silvano Zucal (Hg.), Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, Brescia 1999, 141-151.
Trollo, Erminio: La critica di Antonio Rosmini aHa filosofia tedesca postkantiana, in: RRFC28 (1934) 161-186.
Zambelloni, Franco: Le origini dei kantismo in Ita1ia (= Studi sul pensiero filosofico e religioso dei secoli XIX e XX, Bd. 20), Milano 1971.
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
I. Antonio Rosmini-Serbati
1. Edizione Critica Ediz. Crit.
Opere edite e inedite di Antonio Rosmini Serbati. Edizione Critica, hg. von Micheie Federico Sciacca, Roma 1975ff.
Dabei werden folgende SigeJ verwendet: AS
Antropologia soprannaturale, 2 Bde. (== Ediz. Crit., Bd. 39---40), hg. von Umberto Muratore, Roma 1983.
DN
DeI divino nella natura (== Ediz. Crit. Bd. 20), hg. von Pier PaoJo OttoneJJo, Roma 1991.
IF
Introduzione alla filosofia (== Ediz. Crit., Bd. 2), hg. von Pier PaoJo OttoneJ1o, Roma 1979.
IF, DSA
Degli Studi deli' Autore, Introduzione alla filosofia (== Ediz. Crit., Bd. 2, S. 11-194), hg. von Pier Paolo OttoneJ1o, Roma 1979.
IF, SF
Sistema filosofico, in: Introduzione alla filosofia (== Ediz. Crit., Bd. 2, S. 223-302), hg. von Pier PaoJo Ottonello, Roma 1979.
L
Logica (== Ediz. Crit., Bd. 8), hg. von Vincenzo Sala, Roma 1984.
NS
Nuovo Saggio sull'origine delle idee, 3 Bde. (== Ediz. Crit., Bd. 3-5), hg. von Gaetano Messina, Roma 2003-2005.
PsicoJ
Psicologia,4 Bde. (== Ediz. Crit., Bd. 9-10A), hg. von Vincenzo Sala, Roma 1988.
PSM
Principi della scienza mora1e (== Ediz. Crit., Bd. 23), hg. von Umberto Muratore, Roma 1990.
SCC
Storia comparativa e critica de' sistemi intomo al principio della morale, in: Principi della scienza morale (== Ediz. Crit., Bd. 23, S. 161---469), hg. von UmbertoMuratore, Roma 1990.
SSCC
Saggio storico critico sulle categorie (= Ediz. Crit., Bd. 19), hg. von Pier Paolo OttoneJ1o, Roma 1997.
88
T
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis Teosofia, 6 Bde. (= Ediz. Crit., Bd. 12-17), hg. von Maria Adelaide Raschiniund Pier Paolo Ottonello, Roma 1998-2002.
2. Edizione Nazionale Ediz. Naz.
Opere edite e inedite di Antonio Rosmini Serbati. Edizione Nazionale, hg. von Enrico Castelli, Roma (Milano, Padova) 1934ff.
Dabei werden folgende Sigel verwendet: FD
Filosofia dei diritto, 6 Bde. (= Ediz. Naz., Bd. 35--40), hg. von Rinaldo Orecchia, Padova 1967-69.
Rinnov
Il Rinnovamento della Filosofia in Italia del Conte Terenzio Mamiani della Rovere esaminato da Antonio Rosmini-Serbati a dichiarazione e conferma della Teoria Ideologica esposta nel "Nuovo Saggio sull'Origine delle Idee", 2 Bde. (= Ediz. Naz., Bd. 19-20), hg. von DanteMorando, Milano 1941.
3. Epistular EC
Epistolario completo, 13 Bde., Casale Monferrato 1887-1894.
4. Zitierweise Diejenigen Werke, welche bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Untersuchung noch nicht innerhalb der Edizione Critica erschienen sind, werden nach der Edizione Nazionale zitiert. Zur Frage nach den mannigfaltigen Ausgaben der Rosminischen Werke vgl. die Bibliografia degli scritti editi di Antonio Rosmini, welche Cirillo Bergamaschi in drei Bänden zusammenstellte (Milano 1970 [Bd. 1-2], Stresa 1989-1999 [Bd. 3--4]); mit regelmäßigen Aktualisierungen in der Rivista Rosminiana di filosofia e di cultura. Zitiert werden die Rosminischen Schriften - soweit möglich - nach Paragraphen, da somit eine die verschiedenen Ausgaben übergreifende Objektivität ermöglicht wird. Besitzt ein Werk keine Paragraphierung oder würde eine solche Zitation missverständlich resultieren, wird unter entsprechender Kennzeichnung die Seitenzählung herangezogen. Die Übersetzungen der Rosminischen Texte stammen, wenn nicht anders angegeben, von dem Autor bzw. Übersetzer des jeweiligen Beitrages selbst und wurden vom Herausgeber nochmals kritisch überprüft.
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
89
11. Immanuel Kant
1. Kritik der reinen Vernunft KrV
Die Kritik der reinen Vernunft wird nach der Seitenzählung der ersten bzw. zweiten Auflage (A: 1781 / B: 1787) zitiert.
2. Werke AA
Kant's gesammelte Schriften, hg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900-1955, 1966ff.
Dabei werden folgende Sigel verwendet: AA VI
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (= AA, Bd. 6, S. 1-202), hg. von Georg Wobbermin, Berlin 1907 (Nachdruck 1969).
AA VII
Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (= AA, Bd. 7, S. 117-334), hg. von Os wald Külpe, Berlin 1907 (Nachdruck 1968).
GMS
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (= AA, Bd. 4, S. 385--464), hg. von Paul Menzer, Berlin 1911 (Nachdruck 1968).
KpV
Kritik der praktischen Vernunft (= AA, Bd. 5, S. 1-164), hg. von Paul Natorp, Berlin 1908 (Nachdruck 1974).
MS
Die Metaphysik der Sitten (= AA, Bd. 6, S. 203--494), hg. von Paul Natorp, Berlin 1907 (Nachdruck 1969).
111. lohann GottIieb Fichte GA
Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hg. von Reinhard Lauth, Hans Jacob, Erich Fuchs und Hans Gliwitzky, Stuttgart/Bad Cannstatt 1962ff.
IV. Friedrich Wilhelm loseph von Schelling
1. Werke AA
Historisch-kritische Ausgabe, im Auftrag der Schelling-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hg. von Hans Michael Baumgartner, Wilhelm G. Jacobs, Jörg Jantzen, Hermann Krings, Francesco Moiso und Hermann Zeltner, Stuttgart 1976ff.
90
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
Dabei werden folgende Sigel verwendet: AAL2
Vom Ich als Princip der Philosophie (= AA, Bd. 1,2, S. 67-175), hg. von Hartmut Buehner und Jörg Jantzen, Stuttgart 1980.
AAL9
System des transzendentalen Idealismus (= AA, Bd. 1,9,1), hg. von Harald Korten und Paul Ziehe, Stutgart 2005.
2. Sonstige Ausgaben SW XIII-XIV
Philosophie der Offenbarung (= F. W. 1. von Schellings sämmtliche Werke, hg. von Karl Friedrich August Sehelling, Abteilung 2, Bd. 3-4), StuttgartlAugsburg 1858.
V. Georg Friedrich Wilhelm Hegel 1. Werke CW
Gesammelte Werke, hg. von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg 1968ff.
Dabei werden folgende Sigel verwendet: Enzyklopädie
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830) (= Cw, Bd. 20), hg. von Wolfgang Bonsiepen und Hans-Christian Lueas, Hamburg 1992.
PhC
Phänomenologie des Geistes (= Cw, Bd. 9), hg. von Wolfgang Bonsiepen und Reinhard Heede, Hamburg 1980.
WdLI/1
Wissenschaft der Logik. Erster Teil. Die objektive Logik. Erster Band. Die Lehre vom Sein (1832) (= Cw, Bd. 21), hg. von Friedrieh Hogemann und Walter Jaesehke, Hamburg 1985.
WdLI/1
Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die objektive Logik. Erstes Buch. Das Seyn (1812/1813) (= Cw, Bd. 11, S. 11-232), hg. von Friedrich Hogemann und Walter Jaesehke, Hamburg 1978.
WdLI/2
Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die objektive Logik. Zweytes Buch. Die Lehre vom Wesen (1812/1813) (= Cw, Bd. 11, S.233409), hg. von Friedrieh Hogemann und Walter Jaesehke, Hamburg 1978.
WdLII
Wissenschaft der Logik. Zweiter Band. Die subjektive Logik (1816) (= Cw, Bd. 12), hg. von Friedrieh Hogemann und Walter Jaesehke, Hamburg 1981.
(1832)
(1812/13)
(1812/13)
(1816)
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
91
2. Vorlesungen Vorlesungen. Ausgewählte Manuskripte und Nachschriften, Hamburg 1983ff.
VI. Sonstige Quellen
1. Platon Werke in acht Bänden, hg. von Gunther Eigler, übers. von Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Hieronymus Mülleru. a., Darmstadt 21990.
2. Aristoteles Aristotelis opera, ex recensione Immanuelis Bekkeri, hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1831-70 (Nachdruck Berlin 1960--61).
3. Thomas von Aquin Ed. Leonina
Sancti Thomae Aquinatis doctoris angelici Opera omnia iussu impensaque Leonis XIII P. M. edita, Romae 1882ff. (vgl. teilweise: Taurini/Romae 1948ff.).
Dabei werden folgende Sigel verwendet: In XII Metaph.
In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis exposJtIO (Ed. Leonina), hg. von Raimundus M Spiazzi, Taurini/Romae 1964.
ScC
Liber de Veritate Catholicae Fidei contra errores Infidelium seu "Summa contra Gentiles" (Ed. Leonina), 3 Bde., hg. von Ceslao Pera, Taurini/Romae 1961.
5Th
Summa Theologiae.
4. Gottfried Wilhelm Leibniz PS
Philosophische Schriften, hg. von Hans H. Holz, Darmstadt 1985ff.
5. Gotthold Ephraim Lessing LW
Werke, hg. von Herbert C. Cöpfert, München 1970ff.
92
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
6. Friedrich Heinrich Jacobi JGA
Werke. Gesamtausgabe, hg. von Klaus Hammacher und Walter Jaeschke, Hamburg/Stuttgart/Bad Cannstadt 1998.
7. Ludwig Feuerbach FGW
Gesammelte Werke, hg. von WemerSchuffenhauer, Berlin 1967ff.
8. Giovanni Gentile OC
Opere Complete di Giovanni Gentile, hg. von der Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Firenze 1932ff.
9. Micheie Federico Sciacca MFS
Opere di Micheie Federico Sciacca, hg. von Nunzio lncardona, Palermo 1997ff.
VII. Sonstige Hilfsmittel ASIC
Manuskripte aus dem Rosmini-Archiv m Stresa (Archivio Storico
CE
CirjJ]o Eergamaschi (Hg.), Bibliografia rosminiana, 9 Bde., Milano 196774 (Bde. 1-4), Genova 1981-82 (Bde. 5-6), Stresa 1989-2005 (Bde. 710); mit regelmäßigen Aktualisierungen in der Rivista Rosminiana di filo-
dell'Istituto della Carita).
sofia e di cultura.
DH
Heinrich Denzinger, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, hg. von Peter Hünermann, Freiburg u. a. 4°2005.
RAnt
CirjJ]o Eergamaschi (Hg.), Grande dizionario antologico dei pensiero di Antonio Rosmini, 4 Bde., Roma 2001.
RRFC
Rivista rosminiana di filosofia e di cultura 1 (1906/07) ff.
VIII. Hinweise zur Zitation Nur diejenigen Werke der jeweiligen Autoren, auf welche sich mehrere Artikel dieses Tagungsbandes beziehen, wurden in das Quellen- und Abkürzungsverzeichnis auf-
Quellen- und Abkürzungsverzeichnis
93
genommen. Durch die dadurch ermöglichte Zitierung mittels der eingeführten Sigel entfallt die Vollzitation bei der jeweils ersten Nennung in den betreffenden Beiträgen. Die nicht in dieses Quellen- und Abkürzungsverzeichnis aufgenommenen Titel der hier aufgeführten Autoren werden dagegen jeweils bei der ersten Nennung vollständig in den Fußnoten angegeben. Weiterhin beziehen sich die Zitate der im Voraus genannten Autoren nicht auf die Seitenzahlen des jeweiligen Bandes, sondern auf die Paragraphierung (die bisweilen die Seitenzahl der Originalausgabe aufgreift). Dies ermöglicht eine die konkret gewählte Ausgabe übergreifende Objektivität der Zitation. Wo eine solche aufgrund fehlender Paragraphierung nicht möglich ist, wird auf die Seitenzahl, unter entsprechender Kennzeichnung ("S."), zurückgegriffen.
Erster Teil: Die Präsenz Kants und der deutschen Idealisten im Rosminischen Werk
Der junge Rosmini: sein Interesse für die deutsche Kultur und für Kant Von Fulvio De Giorgi In einer meiner neueren Arbeiten habe ich ein biographisches Profil Rosminis bis Anfang der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts zu erstellen versucht. Dabei verfolgte ich die ehrgeizige Absicht, die Persönlichkeit Rosminis vollständiger und präziser, als dies in bisherigen Untersuchungen geschehen war, in die unterschiedlichen kulturellen und sozialen Zusammenhänge seiner Zeit hineinzustellen 1. Ich untersuchte darur den existenziellen und intellektuellen Werdegang Rosminis von klein auf bis zum frühen Erwachsenenalter, mit besonderem Augenmerk auf seine Kindheit sowie seine Erziehung und Ausbildung in Rovereto und an der Universität Padua. Es ist nicht meine Absicht, an dieser Stelle alle potenziellen Hinweise auf deutsche Autoren in den Schriften des jungen Rosmini aufzuspüren und in mikroanalytischer Weise zu besprechen, um in diesem Sinn die verschiedenen Einzelaspekte und theoretischen Kemgedanken zu beurteilen, bei denen man eine solche Abhängigkeit, einen eventuellen Einfluss oder auch nur eine leise Andeutung auf diese Philosophen nachweisen könnte. Für alle diese Einzelheiten darf ich auf die genannte Studie bzw. die dortigen bibliographischen Angaben verweisen. Dagegen stelle ich mir hier die Aufgabe, die grundlegenden Elemente aufzuzeigen, die nach meiner Ansicht das Denken Rosminis in seiner Anfangsphase prägen, um dann die umfassendere Frage nach der Rolle aufzuwerfen, welche die kulturellen und philosophischen Anregungen aus dem deutschen Sprachgebiet im Gesamtgeruge und an den entscheidenden Schnittstellen seines Denkens gespielt haben. Es geht also darum, zusammenfassend die Bedeutung der Beziehung zur deutschsprachigen Kultur rur die Grundlagen des Rosminischen Denkens in seiner allmählichen Gestaltwerdung aus einer einheitlichen Sicht zu charakterisieren.
1 Vgl. Fulvio De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L'educazione dell'uomo moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833), Brescia 2003.
98
Fulvio De Giorgi
Dieses Ziel verlangt rur die Analyse in gewisser Weise eine Umkehrung der methodologischen Voraussetzungen und so scheint es angebracht, diese wenigstens kurz in Erinnerung zu rufen und bewusst zu machen. In der Tat wird es nicht um eine biographische Annäherung gehen, rur die der traditionelle methodische Rahmen gelten würde, sondern näherhin um den Übergang von der Biographie zur Kulturgeschichte der Intellektuellen. Dazu wird auf Forschungsansätze und Interpretationsfilter zurückgegriffen, die in den letzten Jahrzehnten im Gefolge des sog. cultural turn und durch die neuerliche Forderung nach weiteren innovativen Entwicklungen erarbeitet wurden. Solche Hinweise auf eine "neue Kulturgeschichte" führen ihrerseits wiederum auf das Thema der Intellektuellen. Dieses unterscheidet sich damit einerseits von den soziologischen Ansätzen, die auf die soziale Herausbildung der Geistesströmungen aus den wechselseitigen Beziehungen von "Klassen" abheben, sowie andererseits von der bloßen NebeneinandersteIlung von individuellen Lebensläufen, die ohnehin nach idealistischem Muster konstruiert sind, d. h. nach Art eines rein innerlichen Selbstbezugs oder teleologischen Prozesses von theoretischen Überlegungen, die die wesentlichen Elemente für das historische Verständnis ihrer Entwicklung bereits voraussetzen. Von einer Kulturgeschichte der Denker zu sprechen, bedeutet allerdings gewiss genauso wenig, den Gesichtspunkt einer Sozialgeschichte oder der intellektuellen Biographie auszuschließen; ganz im Gegenteil wird sie diese in die problematischen Zusammenhänge einbeziehen, die man mit den unterschiedlichen Szenarien einer historisch situierten Intelligenz, die tief in die Dynamiken des kulturellen Lebens eingelassen ist und somit an der interdisziplinären Kreuzung zwischen Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften steht, abwägend vergleicht. Bezüglich des Denkers, der im Mittelpunkt dieser Tagung steht, Antonio Rosmini, erlaubt dieser methodologische Ansatz, eine Art von interpretativer Sehstörung zu korrigieren, die seit langem die Auseinandersetzungen mit ihm belastete und auch heute noch belastet. Tatsächlich wurde er nach den allgemeinen historischen Mustern gesehen und interpretiert, welche die traditionelle Historiographie in den Auseinandersetzungen mit dem nationalen italienischen Risorgimento konstruiert hatte. Diesbezüglich stand häufig die Idee eines historischen Prozesses institutioneller Erneuerung Pate, der vom Zeitalter der Restauration ausgehen und sich im Zeichen einer politisch-nationalisierten und zur nationalen Einheit tendierenden Kultur entwickeln würde, sodass die Interpretation selbst ganz auf die historische Bewegung verlagert wird, die zielstrebig zur Einigung Italiens ruhrt. Wie erwähnt wurde Rosmini in dieses InterpretationsParadigma eingeordnet: Ausgehend von seiner Stellung im Zeitalter der Restauration und von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Ultramontanismus, wird sein persönliches und intellektuelles Leben gleichsam als Parallele zum italienischen Risorgimento mit seinem progressiven Sich-annähern an ein katholischliberales und neuwelfisches Gefühl verstanden - wenn auch mit seinen eigenen Besonderheiten. Dieses Darstellungsmuster ist im Kern der kulturellen, geisti-
Der junge Rosmini
99
gen und politischen Kämpfe nach der italienischen Einigung entstanden und hat sich in dessen Gefolge verfestigt. So machte die führende politisch-liberale Klasse, die im Stile Cavours dem Christentum nicht feindlich, sondern tendenziell vermittelnd gegenüber stand, aus dem Rosminianismus ein fundamentales Element nationaler Kultur und Erziehung des geeinten Italiens, während im Gefälle des intransigenten Katholizismus sich die Verdächtigungen und Kritiken bis zum Dekret Post obitum im Jahr 1887 verstärkten. Schließlich sah man von beiden Seiten her - wenn auch verschieden bewertet - Rosmini in jene Prozesse involviert, die allesamt im Zeitalter der Restauration oder allgemein in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts anhoben und in die auf die Einigung Italiens folgende Periode - jedenfalls in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts - einmündeten. Dort erreichten sie ihren Höhepunkt, in dem sie ihren eigentlichen historischen Existenzgrund verankerten. Dieses Interpretationsmuster scheint vom heutigen Standpunkt allerdings allzu sehr mit der kulturellen Dynamik des nation building verbunden zu sein, um noch auf wissenschaftlicher Ebene akzeptiert werden zu können. Eben um solche hermeneutische und ideologische Verkrustungen zu überwinden, ist wie schon erwähnt - eine methodologische Wende notwendig. Man muss sozusagen wie ein Archäologe kulturelle Grabungen bezüglich des sozialen und kulturellen Kontextes Rosminis vornehmen - was wir mit einem kurzen Schlagwort als die Suche nach dem "Rosmini vor Rosmini" bezeichnen könnten. In einem breit angelegten historisch-kulturellen Projekt, das auf eine längere Zeit angelegt ist und analytisch vorgeht, scheint es so möglich, dass sich neue Interpretationsmuster herausbilden. Christophe Prochasson bemerkte in Bezug auf seine eigenen Forschungen und methodologischen Überlegungen, die wir auch für unser Rosminisches Projekt grundsätzlich übernehmen können: "Sieht man sich die einzelnen Orte genau an, an denen sich die Anfangsphasen der intellektuellen Gestaltwerdung entwickelten, dann wird es möglich, sich den mikroskopisch kleinen Gliedern jener Kette zu nähern, auf denen gleichsam die Atome der Ideen ruhen. Die Kulturhistoriker und die Historiker der Politik sind noch viel zu wenig Genetiker. Sie halten sich allzu sehr an das Leben des Ganzen, an die Endresultate und an die starren Etiketten. Das Studium der vorausgehenden Stadien jedoch - wenn möglich der Anfangsphasen verleiht den Werken eine andere Bedeutung als die für gewöhnlich an genommene"2. Nach diesen theoretischen Vorausbemerkungen richtet sich die Aufmerksamkeit dieser Untersuchung auf die Charakteristika jener kulturellen Tradition des 18. Jahrhunderts in Rovereto, die den unumgänglichen intellektuellen back2 Chrisophe Prochasson, Una storia culturale della politica, in: Mario Gervasoni (Hg.), Mappe dell'immaginario. Per una storia culturale dell'eta contemporanea, Milano 1999,29-64, hier 36.
100
Fulvio Oe Giorgi
ground der Bildung, aber auch der reifen Einstellung Antonio Rosminis bilden.
Die Gestalt Rosminis ist in ihrer lebendigen und bedeutsamen Beziehung zur der komplexen kulturellen Umwelt in Rovereto des 18. Jahrhundert praktisch noch nie (oder nur unvollständig und oberflächlich) dargestellt worden. Demgegenüber kann man die Persönlichkeit Rosminis - wenn man meinem Interpretationsvorschlag folgt - als Intellektuellen, Philosophen, Erzieher und Pädagogen niemals vollständig verstehen, wenn man ihn nicht in der Beziehung zur Kulturgeschichte Roveretos sieht, die vom 18. Jahrhundert bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts reicht. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die intellektuellen Anregungen sowie die erzieherischen, bürgerlichen und geistlichen Ideale gerichtet sein, die - zusammen mit anderen "genetischen" Elementen - das Denken Rosminis insgesamt ausmachen. Rovereto eignet sich im Übrigen sehr gut dazu, Kulturgeschichte zu studieren: Die Stadt ist tatsächlich eines der bedeutendsten italienischen Reformzentren des 18. Jahrhunderts, wie schon Franco Venturi zu seiner Zeit bemerkte. In diesem Sinn ist die Betrachtung der Ideen-Geschichte stets methodologisch mit den Ereignissen und dynamischen Formen der kulturellen Vergesellschaftung verwoben. Der bereits zitierte Prochasson bemerkte dazu: "Das intellektuelle Leben organisiert sich nach Zugehörigkeitsschichten, die jeder individuell mit materialen und symbolischen Funktionen anreichert. So schien es mir möglich zu sein, Ort(e) [... ] und Umgebung(en), die sich rund um einige Orte organisieren, sich aber nicht auf die Orte selbst reduzieren lassen, wahrzunehmen, und schließlich eher immaterielle Netz(e), deren Bedeutung einerseits in der Gewährleistung gegenseitiger Unterstützung und Hilfe (Veröffentlichungen in einer Zeitschrift oder in einem Verlagshaus, Erlangung gewisser Positionen usw.) oder andererseits in der Ermöglichung intellektuellen Austauschs liegt, zu individuieren. Isoliert betrachtet, schöpft keine dieser unterschiedlichen Ebenen für sich allein das Verständnis der intellektuellen Verhaltensformen aus, welche mehrere Faktoren regeln"3. Auch in der Gesellschaft und Kultur Roveretos finden wir im 18. Jahrhundert wichtige Orte (wie die Accademia degli Agiati oder später die Freimaurerlogen), bedeutende Umgebungen (wie die Kreise der Aristokratenfamilien oder die spirituellen und frommen Umgebungen, die eng mit der ausgeprägten kirchlichen Struktur verbunden waren) und schließlich Netzwerke (wie der rege Briefwechsel, der aus Rovereto einen "Mittelpunkt" der Gelehrtenrepublik des 18. Jahrhunderts machte). Diese "Zugehörigkeitsschichten" waren nicht nur unterschiedlich miteinander vemetzt bzw. entwickelten und modifizierten sich mit der Zeit; sie müssen auch als innerlich dynamisch erkannt werden und nicht in der statischen Rolle einer Identitätszugehörigkeit. Eine solche Dynamik war vor allem durch die Dimension der "Erziehung" bestimmt, die überall und stets 3
Prochasson, Una storia culturale, 34.
Der junge Rosmini
101
- wenn auch in unterschiedlichen Formen und in unterschiedlicher Intensität in den Orten, Umgebungen und Netzwerken des kulturellen Lebens von Rovereto präsent war. Die Themen im Bereich der "Erziehung" waren somit generell in die Ereignisse der Kulturgeschichte - nicht nur der lokalen - eingefügt, zeigen also aufgrund genauer Nah-Analysen dialektische Zusammenhänge, komplexe Einflüsse, intellektuelle Bindungen, innovative oder - im Gegenteil konservative Schübe. All dies erklärt gut die Einordnung Roveretos in die Kultur der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die der Erziehung und Pädagogik eine sehr große Bedeutung zumaß. Die besondere ,geopolitische' Lage Roveretos, das kirchlicherseits zur Diözese Trient, politisch betrachtet jedoch zum Habsburgerreich gehörte, lässt sich als kultureller Umschlagplatz zwischen Italien (besonders Venetien) und den deutschsprachigen Ländern charakterisieren. Das eindeutigste Zeichen und gleichzeitig der bedeutendste intellektuelle Nährboden dieser Grenzsituation ist jedoch die Beziehung der Intellektuellen Roveretos zur Gelehrtenrepublik Muratoris wie auch zu den verschiedenen Formen, in denen das Gedankengut Muratoris Verbreitung fand. Dieses Gedankengut erreichte das Trentino recht früh und verbreitete sich, dank verschiedener Intellektueller aus dem Trentino, im ganzen Reich, wo es gerade im Bereich der Studienorganisation eine historisch bedeutsame kulturelle Rolle spielte. Die bekanntesten Namen dieses ersten kulturellen Netzwerkes waren Giambenedetto Gentilotti, Pantaleone Borzi und Giambattista de Gaspari 4 • Das bewusste Wahrnehmen der Zusammenhänge mit der muratorianischen Gelehrtenrepublik bewirkte also eine bemerkenswerte intellektuelle Lebendigkeit, die gerade in Rovereto ein bedeutsames Zentrum besaß. Grund und gleichzeitiger Erfolg dieser kulturellen Blüte war die intensive Tätigkeit der Roveretaner Buchhändler Giuseppe Goio, Pierantonio Berno, Pietro Galvano sowie Francescantonio und Luigi Marchesani; sie konnten Werke von großem Interesse veröffentlichen und begründeten weitere Stätten für die Verbindung von Kultur und Gesellschaft. Einschneidend waren jedoch die vierziger Jahre des 18. Jahrhunderts, in denen sich die Reformbestrebungen der Kaiserin Maria Theresia, das aufgeklärte Pontifikat Benedikts XIV. und die Veröffentlichungen wichtiger Werke Muratoris überschnitten. In diesem Zusammenhang darf auch die immer bedeutender
4 Vgl. Claudio Donati, Ecclesiastici e laici nel Trentino dei Settecento (1748-1763), Roma 1975, 30--35; Giuseppina Bordato, Gianbenedetto Gentilotti e la sua biblioteca. Prima parte, in: Civis. Studi e testi 10 (1980) 193-217.
102
Fulvio De Giorgi
werdende Verbreitung des Muratorischen Gedankengutes in Österreich5 - insbesondere bei den Reformen im Bereich der Rechtspflege6 und des kirchlichen Lebens 7 - nicht vergessen werden. Diese sog. "muratorianische Epoche" Italiens 8 strahlte - gerade im und durch das Trentino - über die nationalen Grenzen hinaus und fand in Österreich und in den deutschsprachigen Ländern ein großes Echo. Diese Periode dauerte bis in die 50er Jahre fort, als sich die Bedeutung Genovesis und dessen Versuch der philosophischen Synthese9 mit dem Einfluss Muratoris verband. Dies löste eine Richtung aufgeklärten Denkens aus, die im Trentino bis zum Ende des Jahrhunderts ohne Unterbrechung weiterlebte lO und für den kulturellen Aufbau der gebildeten Gesellschaftsschicht wie auch der politisch konservativen, jedoch intellektuell nicht rückschrittlichen Kreise, bedeutsame Anregungen zu geben vermochte ll . 5 Vgl. Eleanore Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Österreich, Innsbruck 1970; ders., L. A. Muratori und Österreich, in: [0. Hg.], La fortuna di L. A. Muratori, Firenze 1975, 109-142; Elisabeth Garms-Cornides, Lodovico Antonio Muratori und
Österreich, in: Römische Historische Mitteilungen 13 (1971) 333-351; vgl. darüber hinaus Grete Klingenstein, Staatsverwaltung und kirchliche Autorität. Das Problem der Zensur in der theresianischen Reform, Wien 1970, 88-130. 6 Vgl. Maria Rosa Di Simone, Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento, Roma 1984. 7 V gl. Donati, Ecclesiastici e lai ci; Alphonse Dupront, L. A. Muratori et la societe des pre-Iumieres, Firenze 1976. 8 Mario Rosa, L' "eta muratoriana" nell'Italia dei '700, in: ders., Riformatori e ribelli nel '700 religioso italiano, Bari 1969,9-47. 9 Vgl. Paola Zambelli, La formazione filosofica di Antonio Genovesi, Napoli 1972; Giuseppe Galasso, 11 pensiero religioso di Antonio Genovesi, in: Rivista Storica Italiana 82 (1970) 800-823. 10 Vgl. seine Werke Lusitanae Ecclesiae Religio in administrando Poenitentiae Sacramento, et Decretalis ea de re Sanctissimi Patris Benedicti XIV Pontificis, propugnata a Ludovico Antonio Muratorio Serenissimi Ducis Mutinae Bibliotecae Praefecto, Roboreti 1769; ders., Trattato sopra la Santa Messa il suo valore e i doveri dei popolo che vi assiste, tratto dall'opera della Regolata divozion de' cristiani di Lamindo Pritannio, Roveredo 18002. Vgl. aber auch Lettera di N. N. al Signor Proposto Gian-Francesco Soli Muratori intomo al giudizio che vien dato nel Tomo V dei libro dei Padre Vittorio da Cavalese Minor. Osserv. Riformato in difesa dei voto sanguinario, Bologna/Roveredo 1755. 11 Vgl. Maria Rosa Di Simone, Legislazione e riforme nel Trentino dei Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, Bologna 1992. Bezüglich des Katalogs von Barbacovis Bibliothek bemerkt die Autorin richtig: "Nicht zufällig sind die am häufigsten im Verzeichnis genannten italienischen Autoren Muratori und Genovesi, die aufgrund ihrer Rechtgläubigkeit eine Brücke darstellten, die rur die Verbreitung der Reformbestrebungen im bischöflichen Fürstentum besonders geeignet war. Während Ersterer eine entscheidende Rolle bei der Initiierung einer methodisch angelegten VeIjüngung der Kultur im Trentino spielte, indem er der Kritik an den scholastischen und aristotelischen Systemen den Weg ebnete, verdankt Barbacovi viele Anregungen und Impulse rur den rationalistischen Ansatz im philosophischen und reli-
Der junge Rosmini
103
Die 40er Jahre begannen im Kaiserreich mit einer rege geführten Diskussion über die Erziehung. Die Protagonisten dieser Diskussion waren die Benediktiner der Universität Salzburg und die jungen Mitglieder einer vom muratorianischen Gedankengut inspirierten Akademie (unter ihnen sind Giambattista de Gaspari, Giovanni Andrea Cristiani, ein Onkel Carlantonio Pilatis und Giuseppe Maria von Thun zu nennen). Mit diesen jungen Leuten, besonders mit den schon erwähnten de Gaspari und Thun (Thun wurde später Bischof von Gurk, wo er sich energisch für eine bessere Bildung des Klerus einsetzte), war Girolamo Tartarotti-Serbati durch die Mitgliedschaft bei der Societas Eruditorum verbunden. Die Kontroverse in Salzburg (im Jahr 1740) und die daraus resultierende Studienreform, mit der Tartarotti offenbar einverstanden war, machte aus der Stadt ein Zentrum der katholischen deutschen Aufklärung im Sinne Muratoris. Übrigens stand gerade Tartarotti-Serbati, ein entfernter Verwandter und Freund der Familie Rosmini (den Antonio später sehr verehrte), nicht nur in direktem Kontakt mit Muratori, sondern trat auch in Rovereto für dessen Denken ein und bildete dadurch auch die Brücke für die Rückkehr der muratorianischen Kultur aus Deutschland nach Italien, angereichert mit den Inhalten der deutschen Aufklärung. Hinter Tartarotti standen die besondere Tradition des Humanismus im Trentino, der von der deutschen Mystik beeinflusst war 12 , und das Denken des Cusanus. Dies geht deutlich aus seinem gegen den Hexenglauben gerichteten Werk hervor, das auch im Kaiserreich eine große Verbreitung fand. Zudem drang ein kultureller Strom von Wissenschaft, Theosophie, Alchimie und Mathematik sowie Platonismus und Esoterik ebenfalls über Österreich bis in das Herz des Roveretaner und Trentiner Denkens des 18. Jahrhunderts vor 13 • Dieser Kulturstrom verband sich letztlich mit jenen geistigen Fundamenten der Habsburgermonarchie und Mitteleuropas (welche sich übrigens von jenen Frankreichs und Osteuropas recht unterschieden), die sich durch den charakteristischen Kompromiss der katholischen Kultur mit der gelehrten Magie und den Kampf gegen die volkstümliche Magie auszeichnete l4 • giösen Bereich, für die Stützung der Naturrechtsphilosophie und für die wissenschaftliche Annäherung an die ökonomischen Problemstellungen, eben Genovesi" (ebd. 71 f.). 12 V gl. Anton Zingerle, Der Humanismus in Tirol unter Erzherzog Sigmund dem Münzreichen, Innsbruck 1890; Giulio Briani, Il carteggio inedito fra Bernardo di eies ed Erasmo di Rotterdam, in: Studi trentini di scienze storiche 25 (1946) 24-39, 112130; 26 (1947) 25--43, 151-164; Ezio Franceschini, Discorso breve sull'umanesimo nel Trentino, in: Aevum 35 (1961) 247-272. 13 V gl. Otto Brunner, Vita nobiliare e cultura europea, Bologna 1972, 264. 14 In seiner Untersuchung über die Habsburgerrnonarchie erörtert Evans ausführlich, "welches das entscheidende Problem der barocken Weltanschauung in den Ländern der Monarchie war". Und er findet als Antwort: "der Okkultismus. Die Naturphilosophie bildete ohne Zweifel die offene Flanke der geltenden katholischen Rechtgläubigkeit, die sich zum eigenen Schutz und zur eigenen Verteidigung einem Wissenstyp zuwandte, der
104
Fulvio Oe Giorgi
Diese komplexe intellektuelle Bewegung, ihr inneres Beziehungsgeflecht und ihre Verbindungen zu Autoren und Werken, zu Themen und Forschungen stellte das kulturelle Umfeld des jungen Antonio Rosmini dar. Man kann einen roten Faden erkennen, der das ganze Werk Rosminis durchzieht und nur beiläufig, bzw. gleichsam unmerklich, zum Vorschein kommt. Dieser ist jedoch bislang noch wenig bekannt und kaum erforscht, auch wenn sich zahlreiche und bedeutsame Hinweise ausfindig machen lassen. Von größter Bedeutung für den jungen Rosmini war der Einfluss des Platonismus (ebenso des Neuplatonismus der Renaissance, d. h. insbesondere von Marsilio Ficino und Pico della Mirandola), und mit Sicherheit hinterließ auch die frühe Lektüre der "Kritischen Geschichte der Philosophie" Jacob 1. Bruckers deutliche Spuren. Brucker zeichnete sich seinerseits durch seine betonten Hinweise auf Pythagoras aus und stellte die Kabbalisten als Philosophen vor. In den Manuskripten des jungen Rosmini finden sich Notizen zu Phantasie und Wahnsinn, zur Ekstase und bereits während der Spätrenaissance gepflegt worden war und zu Ehren kam" (Robert 1. W Evans, Felix Austria. L'ascesa della monarchia absburgica: 1550-1700, Bologna 1981, 431). Evans zufolge "wurden alle diese Strömungen okkultistischen Gedankenguts von bereits eingewurzelten Denktraditionen und geheimen Weisheitslehren genährt. Mehr noch: Je älter eine Tradition war, umso esoterischer gestalteten sich [ ... ] ihre Ausdrucksformen. Dies gilt beispielsweise rur den Platonismus und den Neuplatonismus, mit dessen Hilfe viele Denker der Renaissance einen diffusen, wenn auch nicht fassbaren Einfluss auf die Kultur und Mentalität des 17. Jahrhunderts ausübten. Zudem konnte sich jener Einfluss aufgrund der inneren Anpassungsflihigkeit der katholischen Kultur in manchen Fällen in das Kleid vollkommener Rechtgläubigkeit hüllen" (ebd. 451). Evans beharrt dabei auf der Bedeutung verschiedener Formen und Aspekte der Alchimie. "J. B. van Helmont, Autor von Büchern über Alchimie, von hoher Intelligenz und Originalität, übte in Österreich durch seine mystische Philosophie einen größeren Einfluss [ ... ] als durch die Neuheit seiner Experimente aus. [ ... ] Diese Beobachtung erweist sich von größter Wichtigkeit, weil sie einen weiteren Hinweis auf den Unterschied zwischen der mitteleuropäischen und der westeuropäischen Kultur in sich birgt. In Letzterer gab es durchaus noch einige, die auf dem Studium der Alchimie beharrten, während aber gerade die Alchimie aus dem geschützten Raum der Ehrenhaftigkeit trat. [ ... ] Schließlich zeigt die Alchimie in einzigartiger Klarheit, sowohl welches die Privilegien waren, welche die soziale Elite (mit ihrer Dynastie an der Spitze) genoss, als auch, wie sich die Toleranz des gegenreformistischen Katholizismus bezüglich jener Magie gestaltete, welche ihrer Meinung nach zur Unterstützung der christlichen Lehre eingedämmt werden konnte. Im Gegensatz zu den vielen Verurteilungen, die in protestantischen Ländern gegen die Alchimie und ihre Betreiber ausgesprochen wurden, nahm die katholische Kirche eine Haltung großzügiger Nachgiebigkeit ein" (ebd. 456). Schließlich war der Okkultismus nicht nur "der beachtenswerteste dynamische Faktor des hohen Bildungsstandes", sondern auch "das Hauptinstrument, um die Kultur der unteren Schichten und des Volkes unter strenger Kontrolle zu halten. So bediente man sich des Geheimwissens, um das Ausmaß des Aberglaubens zu kontrollieren. Wie schon im Fall der politischen und sozialen Entwicklungen, gelangte man um das Jahr 1700 auch diesbezüglich dank der Verflechtung der Kontrollen von oben mit den autonomen Vorgängen unten zu einem relativen Gleichgewicht" (ebd. 402).
Der junge Rosmini
105
physiognomischen Themen, zu Vorurteilen und zur Natur der Seele. Dabei ist Muratori der wichtigste Bezugspunkt. Besonders die Werke Muratoris, die in der deutschsprachigen Welt größeres Echo fanden, beeinflussten Antonio Rosmini auf entscheidende und weitreichende Art. Neben Tartarotti waren für das Rovereto des 18. Jahrhunderts die Persönlichkeiten Giuseppe Valeriano Vannetti zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn Clementino von großer Bedeutung. Giuseppe Valeriano Vannetti war Mitglied verschiedener Akademien in Italien; vor allem muss erwähnt werden, dass er zusammen mit seiner Frau Bianca Laura de' Saibanti 15 am 27. Dezember 1750 die Accademia degli Agiati begründete, die auch das Wohlwollen Maria Theresias fand und seit ihren Anfängen vom Geist Muratoris geprägt war l6 . Zur Akademie gehörten auch die beiden Ordensleute aus Rovereto, Gottardo Antonio Festi und Giuseppe Felice Giovanni; im Lauf der Zeit wurden Gian Battista Graser, Giuseppe Francesco Frisinghelli, Francesco Simone Festi, Clemente Baroni di Cava\cabo und Valeriano Malfatti aufgenommen. Tartarotti selbst blieb hingegen außen vor - wahrscheinlich vor allem aufgrund persönlicher Schwierigkeiten. Joseph von Sperges, der in dieser Zeit nach Rovereto gekommen war, nahm mit der Akademie Kontakt auf, wurde deren Mitglied und damit Mittelsperson für die Aufnahme vieler deutschsprachiger Denker, die meist in Wien tätig waren. Dazu zählten de Gaspari und Joseph von Sonnenfels. Dank Malfatti und der Kontakte von Sperges' wurde die Accademia degli Agiati zu einem Zentrum der philosophischen Kultur Wolffscher Prägung. Dadurch wurde sie zu einem wichtigen Bindeglied für die Beziehungen Roveretos mit der österreichischen und deutschen Kultur. Zwischen 1750 und 1795 zählte ihre Mitgliederschaft zu 18 Prozent Deutsche 17 • Diese Kontakte gingen allerdings mit dem Tod Giuseppe Vannettis merklich zurück.
15 Über Bianca Laura de' Saibanti (1731-1798), die lediglich ein Jahr vor ihrem Sohn Clementino starb, schrieb Antonio Cesari: "Was ihre Bildung anbelangt - diese pflegte sie mit großem Ehrgefühl. Die besagte Akademie errichtete sie mit ihrem Gemahl zusammen; sie schrieb Verse und Prosa in elegantem Stil - viel mehr als man es sich bei einer Frau erwarten würde; ferner war sie Mitglied mehrerer Akademien Italiens" (Vita dei cav. Clementino Vannetti [1795], in: ders., Biografie, elogj, epigrafi e memorie italiane e latine (= Opere minori, Bd. 2), hg. von Giuseppe Guidetti, Reggio Emilia 1908, 8- 99, hier 16). 16 Le costituzioni, e 'I catalogo degli Accademici Agiati di Roveredo sotto i felicissimi Sovrani Auspicj di Maria Teresa Augustissima Imperatrice ... L'Anno IV della fondazione, Roveredo 1753. Vgl. auch Rosa, Riformatori e ribelli, 39. 17 Vgl. Stefano Ferrari, L' Accademia Roveretana degli Agiati e la cultura di lingua tedesca (1750-1795), in: Alberto Destro / Paola Maria Filippi (Hg.), La cultura tedesca in Italia 1750-1850, Bologna 1995, 217-276.
106
Fulvio De Giorgi
Jedenfalls kann man feststellen, dass mit der Akademie auch in deutschen Landen gewisse bedeutende Persönlichkeiten verbunden waren, die der Freimaurerei nahe standen l8 . Hiermit betritt man den Bereich ,jener komplexen sektiererischen Bewegung, die am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert im Trentino eine sehr große Bedeutung hatte"19. Es scheint, als wären verschiedene Intellektuelle Roveretos von der Loge aufgenommen worden. Die von ihnen vertretene Richtung war jedoch weniger diejenige der esoterischen Rosenkreuzer und auch keinesfalls der rationalistischen Illuminaten Bayerns. Vielmehr verband sich Rovereto mit der Freimaurerloge in Wien, die verschiedene kulturelle Strömungen aufgriff und zu gemeinsamer intellektueller und erzieherischer Verpflichtung im Zeichen der Aufklärung verflocht: "Freimaurerei und Aufklärung, Jansenismus und liberaler Katholizismus scheinen sich hin und wieder in derselben Person zu vermischen, um denselben Kampf gegen dieselben Gegner zu führen"20, d. h. gegen die jesuitische Form der Pädagogik, den Traditionalismus einer schon längst müde gewordenen Scholastik, den Aberglauben des Volkes wie auch gegen Hexerei oder Geisterbeschwörung. An der Spitze dieser Gruppe aufklärerischer Freimaurer stand anfangs der Hofarzt Gerhard van Swieten. Als er den Auftrag erhielt, die österreichischen Einrichtungen auf wissenschaftlichem und schulischem Gebiet zu reformieren, entfaltete er einen entschieden liberalisierenden Reformeifer. Diesen bekämpften ihrerseits die Jesuiten, die jedoch gegen die Rosenkreuzer keinerlei Missfallen hegten. Unter den Wiener Freimaurern waren mithin zahlreiche Trentiner, so Baron Carlo Antonio Martini, der seit 1754 Römisches Recht an der Wiener Universität lehrte. Er begründete die Schule des Naturrechts, verbreitete die Gedanken Muratoris in Österreich und war Erzieher der künftigen Herrscher Joseph und Peter Leopold. An seiner Seite finden wir auch den bereits erwähnten Tiroler von Sperges, der als Sekretär in der geheimen Hofkanzlei auch Gönner von de 18 Tatsächlich schreibt Ferruccio Trentini: "Um dies zu belegen, genügt es, daran zu erinnern, dass neben vielen anderen auch einige aufrichtige Muratorianer als Mitglieder eingeschrieben waren, wie z. B. Giuseppe und Gregorio Fontana, der Bürgermeister von Trient, Graf Giovannelli, der Abt G. B. Graser, Giampietro Baroni, Gian Vigilio Giannini, Carolo Antonio Pilati und der Freidenker Giuseppe Sonnenfels" (Duecent'anni di vita deli' Accademia degli Agiati. Sintesi storica, in: Atti deli' Accademia degli Agiati, SeT. V, Bd. I [1952] 5- 27, hier 24 f.). 19 Franeo Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino 1969,368. Vgl. auch Antonio Zieger, I franchi muratori dei Trentino, Trento 1925; ders., Bagliori unitari ed aspirazioni nazionali (1751-1797), Milano 1933; ders., Penombre massoniche settecentesche, in: Archivio per l'Alto Adige 29 (1934) 316-382; ders., II tramonto di Cagliostro: il processo e la difesa, Trento 1970. 20 Carlo Franeovieh, Storia della massoneria in Italia dalle origini alla rivoluzione francese, Firenze 1974, 241. Zu van Swieten vgl. Frank T Brechka, Gerard van Swieten and his World. 1700-1772, Den Haag 1970.
Der junge Rosmini
107
Gaspari war sowie als Freund und Protektor der Intellektuellen in Rovereto angefangen von Tartarotti bis hin zu Clementino Vannetti und der Accademia degli Agiati firmierte. Auch diese freimaurerischen Formen kultureller Vergesellschaftung wirkten somit auf die Verbreitung der Muratorischen Gedanken hin, wobei sie sich oft mit dem Wolffschen Denken und mit den Zielen der Aufklärung verbanden. Nicht nur auf der kulturellen Ebene war der Einfluss Muratoris bemerkenswert - selbiges gilt für den geistlichen und pastoralen Bereich, nachdem im Jahr 1748 Leopold Ernst von Firmian Koadjutor der Diözese Trient wurde. Man könnte die darauf folgenden Jahre geradezu als die "muratorianische Periode" der Kirche von Rovereto bezeichnen. Auch die Gedanken Benedikts XIV?), insbesondere zum typisch Muratorischen Thema der Reduzierung der gebotenen Feiertage, fanden in diesem Zug große Verbreitung: Tartarotti zitierte ihn in seinen Schriften, die einen großen Einfluss auf das geistliche und religiöse Leben ausübten, zusammen mit Muratori und Pascal. Graser widmete seinerseits ein besonderes Augenmerk der Regelung der Frömmigkeitsformen und entfaltete eine Zeit lang in Rovereto eine bedeutsame Aktivität geistlicher Leitung. Genau in dieser Situation wurde in Rovereto der Hirtenbrief des Erzbischofs von Wien, Johann Joseph Graf von Trautson, veröffentlicht22 • Auf den 1. Januar 1752 datiert, war dieser - übrigens im Besitz auch von Tartarotti - in besonderer Weise an die Prediger gerichtet und kann mit gutem Recht als Manifest des "österreichischen Reformkatholizismus der Jahre 1750-1760"23 bezeichnet werden. Der Erzbischof verurteilte darin in scharfer Weise die Übertreibungen im Heiligenkult, in den barocken Frömmigkeitsformen und in der salbungsvoll frommen, aber leeren Predigtsprache. Er trat für eine entschiedene Regelung der Frömmigkeit ein, die christologisch orientiert sowie auf den Kult der Anbetung und auf eine theologisch fundierte Verkündigung ausgerichtet sein sollte. Eine solche erneuerte Frömmigkeit sollte dann zu einem moralischen Leben und zur christlichen Liebestätigkeit hinführen. Weiterhin sollte dadurch das Einvernehmen und die harmonische Zusammenarbeit des Klerus mit den zivilen Autoritäten zur Förderung des öffentlichen Wohles ermöglicht 2) Vgl. seine Werke Scrittura ehe si trasmette d'ordine di Sua Santita composta sopra l'istanza di sminuire le feste di precetto, Roveredo 1747; ders., Motivi proposti da nostro signore Benedetto XIV Per termin ar la quistione intomo la capacita dei Canonici Regolari di ottener Benefizj Ecclesiastici Secolari. Costituzione dell'istesso Regnante Sommo Pontefice sopra il medesimo soggetto, Roveredo 1747; ders., Epistola S. S. D. N. Benedicti Papae XIV ad Clerum Gallicarum, Romae et Roboreti 1756. 22 Epistola Pastoralis Celsissimi et Reverendissimi Proesulis Joannis Josephi Archiepiscopi Viennensis, et S. R. I. Principis ex inclita gente Trautsoniorum ad suum Clerum & praecipue Sacros Oratores de recta, & apostolica concionandi ratione, Roboreti 1752; vgl. auch lohann loseph GrafTrautson, Hirtenbrief an die Prediger in der Wiener Erzdiözes, gegeben den 1 länner 1752, Wien 1782. 23 Donati, Ecclesiastici e laici, 88 f.
108
Fulvio De Giorgi
werden. Hier sind ohne Zweifel die tiefen Wurzeln der Rosminischen Spiritualität zu finden. Im Übrigen ist es nicht unwahrscheinlich, dass gerade diese in Rovereto wirksamen spirituellen Neuakzentuierungen das Interesse einiger Roveretaner an der geistlichen, pastoralen und pädagogischen Lehre Sailers verstärkten - insbesondere nachdem in der napoleonischen Zeit Rovereto zusammen mit Tirol an Bayern angegliedert worden war. Das Ineinander der verschiedenen Verbindungen und Einflüsse des kulturellen Austausches sowie seiner Rückwirkungen bildeten den vielgestaltigen Hintergrund für das, was ich anfanglich mit der Frage nach dem "Rosmini vor Rosmini" zu umschreiben versucht habe. Gerade dieser Hintergrund erlaubt es, die bislang an die Herausbildung des Rosminischen Denkens angelegten Paradigmen in neuer Weise zu artikulieren. Die Jugendzeit Rosminis, von den Anfangen in Rovereto bis zum Universitätsstudium in Padua sowie weiterhin bis in die 20er Jahre des 19. Jahrhunderts, wird aus dieser Perspektive - die inzwischen von einer bestimmten historiographischen Tradition bestätigt und rezipiert worden ist - in der Begrifflichkeit eines doppelten Einflusses, oder besser: einer doppelten Auseinandersetzung, verständlich. Auf der einen Seite steht das langsame Heraustreten aus dem im 18. Jahrhundert vorherrschenden Sensualismus und dessen langsame, aber stetige und schließlich eindeutige Überwindung; auf der anderen Seite kann man dagegen ein großes Interesse für das gegenrevolutionäre politische Denken und für den Traditionalismus von de Maistre und Bonald bis hin zu Haller ausmachen. Um jedoch die äußerst komplexe Position Rosminis in den 20er Jahren - in ihren kulturellen Wurzeln wie auch in ihrer allmählichen Herausbildung - zu verstehen, genügen die bei den Hinweise auf die Überwindung des Sensualismus und auf den Ultramontanismus meines Erachtens nicht. Diese Aspekte sind zwar durchaus bedeutsam, bleiben aber dennoch an der Oberfläche. Stattdessen sollte man eine andere grundlegende Dialektik zwischen zwei verschiedenen bzw. divergierenden Perspektiven in den Blick nehmen, die durchaus in ihrem Ziel der Reform auf religiöser und pastoraler Ebene sowie in ihrer vorrangigen Aufmerksamkeit für die Problematik der Erziehung übereinkommen. Diese beiden Tendenzen, die Rosmini zu harmonisieren und auf in eine einheitliche Perspektive zu bringen suchte, lassen sich auf spiritueller Ebene in der augustinischen Spielart einer "regulierten Frömmigkeit" (Muratori, die italienischen Augustiner des 18. Jahrhunderts bzw., noch früher, Pascal) und im Einfluss Philipp Neris ausmachen. In theoretisch-philosophischer Hinsicht standen sich dagegen das intellektuelle Erbe der christlichen Aufklärung und des "aufgeklärten" Katholizismus (für diese Richtung wären Kant und Gerdil zu zitieren) einerseits und der Einfluss des gegenrevolutionären katholischen Denkens (eher Hallers als De Maistres) andererseits entgegen - wobei Letzteres stets vor dem Hintergrund der kulturellen und spirituellen Sensibilität der römischen Eiferer zu verstehen ist.
Der junge Rosmini
109
Es geht also einerseits um die Tradition des Muratorischen Denkens, die, wie gesagt, im 18. Jahrhundert im Habsburger Reich und in den deutschsprachigen Ländern weit verbreitet war. Diese floss in die religiösen und pastoralen Ausdrucksformen der katholischen Aufklärung und der episkopalistischen Tendenzen ein. Rovereto war, wie wir sahen, ein muratorianisches, aufgeklärtes und reformatorisches Zentrum des 18. Jahrhunderts geworden ~ und gerade deswegen ein Ziel der Aufmerksamkeit für Italien wie auch für die deutschsprachige Welt. Diese Tradition ~ wenn auch gezeichnet durch die aus der neuen romantischen Sensibilität herrührenden Veränderungen ~ war zur Zeit der sog. Restauration noch lebendig, verband sich zeitweise mit den neojosephinischen Bestrebungen der Wiener Regierung und distanzierte sich auch wieder von ihnen. Die andere Perspektive hingegen kann in einer ersten Annäherung mit dem Schlagwort des römischen Zelantismus (zelantl) und mit den ihm nahestehenden kulturellen Ausdrucksformen ~ wobei an erster Stelle an die Accademia di Religione Cattolica zu denken ist ~ bezeichnet werden. Antonio Rosmini, der im Klima der erstgenannten Tradition erzogen worden war, übernahm schrittweise auch die zweite Perspektive ~ freilich nicht ohne den inneren Widersprüchlichkeiten zu unterliegen, die sich gerade aus dem Nebeneinander dieser bei den Einflüsse ergeben mussten. Erst als er sich nach und nach dieses Zwiespaltes bewusst wurde, vermochte er auch, eine eigenständige Position zu gewinnen. Diese erhielt ihre charakteristische Prägung dadurch, dass Rosmini zu beiden Tendenzen einen inspirierenden Bezug wahrte, wodurch es ihm gelang, aus ihren gemeinsamen Aspekten die dynamischen und grundlegenden Eckpunkte seines eigenen Denkens zu formen. Schließlich kann doch gerade in der aufgezeigten Doppelperspektive die grundlegende Bedeutung des Interesses an der deutschen Kultur und an Kant festgemacht werden, wodurch die theoretische Position Rosminis erst heranreifte. Gerade in dieser ambivalenten Position kann nun auch der eigentliche Grund dafür erkannt werden, dass die ersten philosophischen Hauptwerke Rosminis sofort nach ihrer Veröffentlichung eine große Resonanz erfuhren und den Verfasser zu einem der größten europäischen Denker der damaligen Zeit werden ließ. Auf der anderen Seite jedoch zeigte sich die ~ wenn auch noch in ihren Anfangsstadien steckende ~ Artikulierung eines potentiellen politischen Denkens, das Freiheit und katholischen Glauben nicht in den Formen des "liberalen Katholizismus" zu versöhnen sucht, sondern die Grundrechte der Person durch einen Konstitutionalismus absicherte, der sich von der französischen Tradition bedeutend unterschied. Der interpretative Schlüssel rür die hier betrachteten und nicht anders als intensiv zu bezeichnenden Lebensjahre Rosminis muss mithin in der pädagogisch-erzieherischen Dimension seines Denkens gefunden werden: In dieser Perspektive fügen sich die unterschiedlichen Tendenzen organisch ineinander und verbinden sich zu einer wirklichen Einheit ~ was etwas grundlegend ande-
110
Fulvio De Giorgi
res ist als eine reine NebeneinandersteIlung. Auf dieser Grundlage konnten sich sowohl die Einflüsse des pädagogischen Denkens der Aufklärung als auch der grundlegend erzieherisch ausgerichtete Horizont des reformatorischen Zelantismus wie schließlich auch das neue pastorale, erzieherische und spirituelle Gespür eines Sailer innerlich miteinander verbinden, mithin das neuzeitliche kritische Denken einerseits wie auch den auf die Neuzeit selbst applizierten Kritizismus andererseits - und dies in der Perspektive der Erziehung des konkreten Menschen.
Die Definition der analytischen und synthetischen Urteile in der Kritik der reinen Vernunft Kants und im Nuovo Saggio Rosminis Von Gaetano Messina I. Ziel dieser Studie ist es, die sieben Abschnitte der Einleitung der Kritik der reinen Vernunft einer Interpretation zu unterziehen, indem wir sie mit der
negativen Exegese in Beziehung setzen, die Rosmini im dritten Kapitel des vierten Teils des Nuovo Saggid vorlegt. Der Vergleich zwischen den beiden Philosophen erfordert es, ihre Systeme jeweils vor dem respektiven historischen Kontext zu betrachten und die Lehre Rosminis nicht bereits deswegen als Überwindung der Kantischen Theorien zu deuten, weil sie chronologisch später erfolgte. Eine genauere Überprüfung der jeweiligen Position der beiden Denker hinsichtlich des vorliegenden Themas wird mithin auf einer exemplarischen Auswahl von positiven und negativen Reaktionen aus jenen kulturellen Umfeldem basieren, die im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts immer wieder die zentralen Stellen der Philosophie Kants aufgegriffen und bewertet haben. Trotz einiger gegenteiliger Bedenken3 erweist die Lehre des Philosophen aus Königsberg eine überraschende Aktualität und bietet auch den zeitgenössischen Studien noch nützliche Anregungen rur Vergleiche und Diskussionen. Wenden wir I Die HauptsteIlen der Kritik der reinen Vernunft wurden mit den folgenden italienischsprachigen Übersetzungen verglichen: Giovanni Gentile / Giuseppe LombardoRadice, überarbeitet von Vittorio Mathieu, RomalBari 7 1993; Pietro Chiodi, Torino 1967 (Neudruck 1995); Giorgio Colli, Milano 1976, 32001 ; Anna Maria Marietti, 2 Bde., Milano 1998. [Die italienischsprachige Fassung dieses Beitrages, die sich im Band Rosmini e la filosofia tedesca (im Erscheinen) findet, fUhrt in den Anmerkungen einen textkritischen Vergleich dieser Übersetzungen durch; Anm. d. Hg.]. 2 Vgl. NS 301-384. 3 Vgl. beispielsweise Maurizio Ferraris, Goodbye, Kant! Cosa resta oggi delle Critica della ragion pura, Milano 2004, der eine negative Bewertung der Philosophie Kants vornimmt und sie als unaktuell bezeichnet: Sie sei ungeeignet, heute noch ein Bezugsmodell darzustellen. Ferraris hat seinen Standpunkt an einem Runden Tisch ("Goodbye Kant! Hello Einstein!", Bologna, 3. Februar 2005) gegen die Argumentationen der "Kantianer" Umberto Eco (Kant e l'ornitorinco, Milano 32002) und Piergiorgio Odifreddi (Le menzogne di Ulisse: L'avventura della logica da Parmenide ad Amartya Sen, Milano 42005) verteidigt.
112
Gaetano Messina
unseren Blick auf die Wirkungsgeschichte Rosminis in Europa, so hat dieser eine weitaus geringere Anziehungskraft ausgeübt: In eine Schattenzone zurückgedrängt, blieb sein Denken lange Jahre auf einen engen Kreis eingeschränkt, aus dem es erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entschieden herausgetreten ist4 , um sodann im Jahr 1997 anlässlich der zahlreichen Tagungen zur Feier des 200. Jahrestages seiner Geburt den Gipfel internationaler Bekanntheit zu erreichen. 2. Schon in der Vorrede der zweiten Ausgabe der Kritik hatte Kant die Mathematik und Physik als "die bei den theoretischen Erkenntnisse der Vernunft" erklärt, "welche ihre Objekte apriori bestimmen sollen"5 und hatte von der Metaphysik als "einer ganz isolierten spekulativen Vernunfterkenntnis, die sich gänzlich über Erfahrungsbelehrung erhebt"6, gehandelt. Diese erste Definition der Metaphysik ist das theoretische Vorspiel des ersten Abschnitts der Einleitung ("Von der Unterscheidung zwischen reiner und empirischer Erkenntnis"), in der Kant von vornherein behauptet, dass "alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anfange, daran ist gar kein Zweifel [00 .]. Der Zeit nach geht also keine Erkenntnis in uns vor der Erfahrung vorher, und mit dieser fangt alle an. Wenn aber gleich alle unsere Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspricht darum doch nicht eben alle aus der Erfahrung


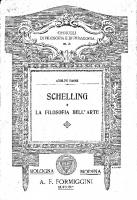



![Die Klassische Deutsche Philosophie und ihre Folgen [1 ed.]
9783737006651, 9783847106654](https://dokumen.pub/img/200x200/die-klassische-deutsche-philosophie-und-ihre-folgen-1nbsped-9783737006651-9783847106654.jpg)
![Herder und die Klassische Deutsche Philosophie [1 ed.]
3772827128, 9783772827129](https://dokumen.pub/img/200x200/herder-und-die-klassische-deutsche-philosophie-1nbsped-3772827128-9783772827129.jpg)


![Rosmini und die deutsche Philosophie - Rosmini e la filosofia tedesca [1 ed.]
9783428526031, 9783428126033](https://dokumen.pub/img/200x200/rosmini-und-die-deutsche-philosophie-rosmini-e-la-filosofia-tedesca-1nbsped-9783428526031-9783428126033.jpg)