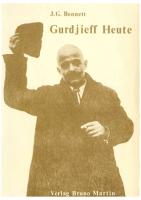Religionsphilosophie heute: Stimmen - Schauplätze - Systeme 3495998306, 9783495998304
Der Band "Religionsphilosophie heute. Stimmen - Schauplatze - Systeme" bietet einen Einblick in die vielfaltig
148 11
German Pages 540 [549] Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Cover
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
Vorbemerkung
A. Philosophie im Ausgang von PhilosophInnen
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus nach Nicolaus Cusanus
1. Zur Relevanz und religionstheoretischen Verortung des Themas
2. Religionspluralität – spezifisch neuzeitliche Herausforderungen
3. Zu Problemwahrnehmung, möglichen Strategien und humanistisch inspirierten Ansätzen bei Cusanus
4. Philosophische Grundlagen reifer Religion: Diskursivität, Konjekturalität und Perspektivität endlicher Erkenntnis nach Cusanus
5. Religionsphilosophische Folgerungen für interreligiöse Beziehungen und Auseinandersetzungen
6. Zusammenfassung
1. Zur Relevanz und religionstheoretischen Verortung des Themas
2. Religionspluralität – spezifisch neuzeitliche Herausforderungen
3. Zu Problemwahrnehmung, möglichen Strategien und humanistisch inspirierten Ansätzen bei Cusanus
4. Philosophische Grundlagen reifer Religion: Diskursivität, Konjekturalität und Perspektivität endlicher Erkenntnis nach Cusanus
5. Religionsphilosophische Folgerungen für interreligiöse Beziehungen und Auseinandersetzungen
Hegel und das Offene der Gottesfrage mit einem Ausblick auf Lacans Register des Imaginären, des Symbolischen und des Realen
1. Hegels Religions- und Gotteskonzept
1.1. Der Streit um Hegel
1.2. Vom Sein zum Urteil
1.3. Verzeihung, Anerkennung und der erscheinende Gott
1.4. Der Tod der Substanz
1.5. Tod Gottes I: Der Tod des Subjekts
1.6. Tod Gottes II: Der Tod des Todes
1.7. Gott als körperliche Erfahrung und als Exerzitium
2. Einige hegelsche Motive in Lacans Psychoanalyse und deren Konsequenzen für die Bedeutung des Absoluten
2.1. Einleitende Bemerkungen zu Lacans Psychoanalyse
2.2. Lacans drei Register
2.3 Hegels »Tod Gottes« und die »Inkonsistenz des großen Anderen«
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
Einleitung
1. Die Formel und die attention – Simone Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht
2. »Aspektwechsel« in der Philosophie Ludwig Wittgensteins – gelesen als Beitrag zu einem Verständnis von Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht
3. (Religiöse) Bekehrungen bei Wittgenstein
4. Religiöse Weltsicht bei Weil – im Kontrast zu Wittgenstein
5. Hintergründe und Synthesen
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Der Ort einer ganz anderen Erfahrung
(a) Das Unerhörte ist ein »Zwischen« als Schwelle zum Metaphysischen
(b) Das Unerhörte als »An-Sich«
Ad a) (Als Schwelle)
Ad b) (Als An-Sich)
Rettung der Metaphysik im Dialog mit Levinas?
B. Geographisch oder zeitlich verortbare Ausgangspunkte
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Hinführung
1. Achsenzeitliche Religionen und Philosophien im »Streit der Schulen«
a) Sokrates: das Göttliche und die Unbedingtheit der Moral am Grund endlicher Vernunft
b) Platon – politische Theologie und Soteriologie
c) Aristoteles – philosophische Theologie als Letztbegründung der Kosmologie
d) Plotin – negative Philosophie des Absoluten
2. Nachachsenzeitliche Großreiche und die Übermächtigungen zwischen Philosophie und Theologie
3. Moderne als Zweite Achsenzeit – ein Ausblick
a) Entsakralisierung politischer Macht
b) Die Wiederkehr achsenzeitlicher Religionsphilosophien und der Streit über die Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates
Schlussbemerkung
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Einführung
1. Traditionelle und philosophische Göttervorstellungen
2. Gott als Prinzip. Die Theologie der Philosophen
3. Gott als Muster menschlichen Lebens
Schluss
Konversion statt Konsens?
1. Bekehrungen im säkularen Zeitalter
2. Bekehrung statt Übersetzung?
Theopoetik und Anatheismus
1. Einführung: Ein Gott ohne Sein
2. Caputo: Ein Gott ohne Religion
3. Kearney: Ein Gott ohne Macht
C. In Religionsgemeinschaften verortbare Philosophie
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
1. Der klassische Islam und die Religionsphilosophie
2. Die Muslime und ihre Konfrontation mit der Modere
3. Religionsphilosophien des Islam heute
4. Denker des Arabischen Erbes (heritage thinkers) und Islamische Religionsphilosophien heute
5. Religionsphilosophie im heutigen Indonesien
6. Eine zeitgenössische Shi’i Religionsphilosophie
Schlussbemerkung
Eine radikale Theologie des Kreuzes
1. Methode: 1 Korinther 1:19: Destructio (Apolo)
2. Ta Me Onta (1 Kor 1:28)
3. Ein verwundbarer Gott
4. Von metaphysischer Theologie zu radikaler Theologie
5. 1 Korinther 2: Die Umkehrung
6. Überwindung der Metaphysik, Entmythologisierung des Neuen Testaments
7. Der Ruf (call): Wie Gott Gott ist in der radikalen Theologie
8. Weder Paulus noch Apollos noch Kephas (1 Kor 1:12): Die Entmythologisierung des Rufs
9. Auf der Straße nach Damaskus
10. Konklusion
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Vorbemerkung
1. Dem Fortschreiten der Zeit entgegen
2. Die Annahme von Inexistenz, Irrealität oder Ewigkeit der Zeit als Formen ihrer Bewältigung
3. Gott und der Zeitpunkt der Schöpfung (sṛṣṭikāla) im theistischen Vedānta
4. Madhva über die Beziehung von Gott und Schöpfungszeit
5. Veṅkaṭanātha über das Verhältnis Gottes zur Zeit
6. Gottes Erkennen (dharmabhūtajñāna) und seine zeitlichen Bestimmungen
7. Der Unterschied zwischen den mentalen Eindrücken
Schlussfolgerungen
D. Wechselwirkungen von Religion mit einem Außen/Soziale und politische Dimensionen von Philosophie
Ökofeministische Theologie der Interdependenz – ein konstruktiver philosophischer Ansatz zur gegenwärtigen ökologischen Krise
Einführung
1. Was ist Ökofeminismus?
2. Ökologische Vernetzung, Interdependenz und die Darstellung (»enacting«) des Göttlichen
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
1. Eine konzeptuelle Gratwanderung
2. Zur Kontextualisierung des Problems: Das Unbehagen am Säkuarismus
3. Der Umweg einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Souveränität des Leids
1. Das Leid und das Böse
Politische Theologie und die Souveränität des Leids
2. Souveränität: theologisch und politisch
3. Offener Theismus
Offener Theismus
Omnipotenz und Macht
Allwissenheit und Wissen
Offener Theismus and Prozesstheologie
4. Schwache Theologie
Derrida und die schwache Kraft
Caputo und die Schwache Theologie
Vattimo und »Weak Thought«
Konklusion
E. Systematische Überlegungen zu Religion bzw. Religionsbegriff
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
1. Einleitung: Widersprüche in der Theologie
2. Zum Verhältnis von theologischen Paradoxien, klassischer Logik und ihren Alternativen in Antike, Mittelalter, Renaissance und früher Neuzeit
3. Zur gegenwärtigen Debatte: Dialetheistische Theologie und parakonsistente Logik
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
1. Der Religionsbegriff der Theologie der Religionen
2. Religion als Kommunikation
3. Theologie im religiösen Pluralismus
Rückkehr zu Gott nach Gott
1. Das Lévinas’sche A-Dieu
2. Derridas Messianismus
3. Ricœurs nach-religiöser Glaube
4. Letzte Testamente
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
1. Die drei Vorurteile der Phänomenologie der Religion
2. »Hier bin ich, ich antworte«
3. Ich bin jener, der sagt Ich bin
4. Der Rufname und das Vergessen der Vokabel
5. »Wenn du an ihn glaubst«
6. Den Fremden empfangen
Citation preview
Esther Heinrich-Ramharter | Michael Staudigl [Hrsg.]
Religionsphilosophie heute Stimmen – Schauplätze – Systeme
Esther Heinrich-Ramharter | Michael Staudigl [Hrsg.]
Religionsphilosophie heute Stimmen – Schauplätze – Systeme
Onlineversion Nomos eLibrary
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. ISBN 978-3-495-99830-4 (Print) ISBN 978-3-495-99831-1 (ePDF)
1. Auflage 2023 © Verlag Karl Alber – ein Verlag in der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Baden-Baden 2023. Gesamtverantwortung für Druck und Herstellung bei der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier (säurefrei). Printed on acid-free paper. Besuchen Sie uns im Internet verlag-alber.de
Inhaltsverzeichnis
Michael Staudigl Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen Eine Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Vorbemerkung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
A. Philosophie im Ausgang von PhilosophInnen . . . .
27
Markus Riedenauer Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus nach Nicolaus Cusanus . . . . . . . . .
29
Kurt Appel, Martin Eleven Hegel und das Offene der Gottesfrage mit einem Ausblick auf Lacans Register des Imaginären, des Symbolischen und des Realen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Esther Heinrich-Ramharter Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr« Konzeptionen religiöser Weltsicht bei Simone Weil und Ludwig Wittgenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Gerhard Weinberger Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
127
5
Inhaltsverzeichnis
B. Geographisch oder zeitlich verortbare Ausgangspunkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
Hans Schelkshorn Religion, Vernunft und Politik im Abendland Eine geschichtsphilosophische Skizze im Licht der Theorie der Achsenzeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
145
George Karamanolis Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen . . .
181
Michael Kühnlein Konversion statt Konsens?
Charles Taylor über die Vernünftigkeit der Moderne . . . . . . . . .
Christina M. Gschwandtner Theopoetik und Anatheismus
213
Französische Religionsphilosophie auf Amerikanisch . . . . . . . .
231
C. In Religionsgemeinschaften verortbare Philosophie
253
Carool Kersten Islamische Religionsphilosophien damals und heute . . . .
255
John D. Caputo Eine radikale Theologie des Kreuzes . . . . . . . . . . . . .
283
Marcus Schmücker Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
317
D. Wechselwirkungen von Religion mit einem Außen/ Soziale und politische Dimensionen von Philosophie
351
Nadja Furlan Štante Ökofeministische Theologie der Interdependenz – ein konstruktiver philosophischer Ansatz zur gegenwärtigen ökologischen Krise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353
6
Inhaltsverzeichnis
Michael Staudigl Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt« Eine kritische Intervention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jason W. Alvis Souveränität des Leids
371
Offener Theismus, schwache Theologie und politische Theodizee . . .
411
E. Systematische Überlegungen zu Religion bzw. Religionsbegriff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451
Joachim Bromand Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie Negative Theologie, Robert Holcot, Nikolaus von Kues, Descartes und die neuere Entwicklung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Christian Danz Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen Überlegungen zur religionsphilosophischen Grundlegung einer pluralismusoffenen Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481
Richard Kearney Rückkehr zu Gott nach Gott Levinas – Derrida – Ricœur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503
Jacob Rogozinski Den gott anrufen, den Fremden empfangen . . . . . . . .
527
7
Michael Staudigl
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen Eine Einleitung
Der vorliegende Band präsentiert zentrale Positionen, innovative Entwicklungen und kritische Debatten rezenter Religionsphilosophie. Die Umbrüche, die in diesem Bereich der Philosophie nun schon seit längerem zu verzeichnen sind, gemahnen in ihrer weit reichenden Relevanz für angrenzende Diskurse dabei durchaus an die größeren turns, die in anderen Kontexten Schule gemacht haben. Wenngleich in diesem Falle auch nicht dieselbe Publikumswirksamkeit wie etwa im Falle des linguistic turn zu verzeichnen ist, so ist die Tragweite dieser Entwicklung1 doch keineswegs zu unterschätzen. Denn im Hintergrund steht im vorliegenden Fall nicht vorrangig nur eine Transformation der diskursiven Landschaft. In der Tat geht es hier vielmehr und vor allem um eine tiefgreifende soziokulturelle Verän derung, ja um eine materielle Erosion traditioneller gesellschaftlicher Leitvorstellungen, die »unsere« Auffassung »der Religion«, die ihr zugeschriebene Lebensbedeutsamkeit, gesellschaftliche bzw. soziale Funktion sowie politische Relevanz betreffen. Dass diese Entwick lung sich wiederum in den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen reflektiert findet und hier insbesondere im Fraglichwerden klassischer disziplinärer Grenzen niederschlägt, dokumentiert anschaulich, wie tief sie bereits greift. Dies zeigt sich nicht zuletzt daran, dass in diesem Rahmen festgefahrene disziplinäre Ordnungen, über die traditionell 1 Dieser Befund trägt gleichwohl nur für den deutschen Sprachraum. Im angloameri kanischen Raum kann ein »religious turn« insbesondere im Kontext der continental philosophy of religion bereits als etabliert gelten. Dafür spricht nicht zuletzt eine breite akademische Institutionalisierung, die sich in Form neu gegründeter Buchreihen (vgl. bspw. Reframing Continental Philosophy of Religion / Rowman & Littlefield; Intensi ties. Contemporary Continental Philosophy of Religion / Routledge), Journals (Journal for Continental Philosophy of Religion / Brill) und wissenschaftlichen Vereinigungen (International Network for Philosophy of Religion / Paris) dokumentiert findet.
9
Michael Staudigl
aufmerksam bis eifersüchtig gewacht wurde, zusehends überschritten werden. Was sich hier anbahnt, ist ein dynamischer, zusehends weniger vorbelasteter und mithin konstruktiver Austausch insbeson dere zwischen Philosophie und Theologie, die sich im Zeichen der Veränderung dessen, was unter »Religion« verstanden wird, heute selbst neu zu positionieren gezwungen sehen.2 Die Sprengkraft dieser Debatten lässt sich nicht zuletzt an der Karriere von Schlagworten wie jenem von der Destruktion der »ontotheologischen Verfassung der Metaphysik« (Hegel, Heidegger) oder dem eines »nach-christlichen« (Patočka, Derrida, Vattimo) bzw. »nachmetaphysischen Zeitalters« (Habermas) ablesen. Freilich fan gen diese Formeln nur sehr rudimentär ein, was umgreifend besehen in diesen Entwicklungen wirklich auf dem Spiel steht.3 Die vielfach gehörte Rede von einer so genannten »Wiederkehr der Religion« zeugt davon in viel greifbarer Weise – und sie tut es vor allem deswegen, weil sie uns die Offenheit der Situation, in der wir uns befinden, vor Augen führt. Denn ob es sich bei diesem Phänomen nun um ein soziologisches Faktum, ein philosophisches Artefakt oder womöglich ein theologisches Desiderat handelt, ob es Geltung nur für den »Sonderfall Europa« hat oder noch undeutlich ein sich anbahnen des globales Phänomen anzeigt, all dies erscheint grundsätzlich noch offen.4 Es ist, um mit Derrida zu sprechen, mehr als unklar, was hier »wiederkehrt«, im Grunde zutiefst fraglich, ob es sich um überhaupt Tonangebend für diese mittlerweile breite Debatte über das traditionell so belastete Verhältnis ist die prägnante Reflexion von E. Falque, Den Rubikon überschreiten. Philosophie und Theologie. Ein Versuch über ihre Grenzen (französ. Orig. 2013). Die notorisch wiederkehrende Frage freilich, ob die philosophische und insbesondere die phänomenologische Beschäftigung mit »der Religion« nicht weniger eine Wende der Aufmerksamkeit zu den Phänomenen der Religion, als vielmehr eine nicht offen so genannte »theologische Wende« sei, steht seit D. Janicauds Polemik Die theologische Wende der französischen Phänomenologie (französ. Orig. 1991) unabgeschlossen zur Debatte. 3 Vgl. diesbezüglich Heideggers viel zitierten Satz: »Zu diesem Gott kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern. Vor der Causa sui [sc. der sachgerechte Name für den Gott in der Philosophie] kann der Mensch weder aus Scheu ins Knie fallen, noch kann er vor diesem Gott musizieren und tanzen.« (M. Heidegger, »Die ontotheo-logische Verfassung der Metaphysik«, S. 70) 4 Die Publikationslage, die die Konturen dieser »Rückkehr« vermisst, ist zu umfäng lich, um hier dokumentiert zu werden. Der Einsatz philosophischer Reflexion setzt dabei relativ spät ein, das Sensorium von Religionssoziologie und -psychologie, religious studies, cultural studies, Kulturanthropologie, Historiographie und auch Theologie realisierte tendenziell bereits früher diese Entwicklung. 2
10
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
um eine Wiederkehr handelt. Ja es wäre zu fragen, ob hier wirklich wiederum ein Gespenst sein Unwesen treibt, oder ob die »Logik der Spektralität und des Gespenstischen« vielleicht tiefer in unsere modern social imaginaries (Taylor) eingeschrieben ist, als wir »gute Europäer« (Nietzsche), die wir unter einem »Schleier der Vernunft« bequem uns eingerichtet haben, uns das noch eingestehen mögen.5 Wie auch immer man sich in dieser Frage nun positionieren mag – entscheidend bleibt in jedem Fall, dass »die Religion« im Zeichen des Niedergangs der Säkularisierungsthese und d.h. angesichts eines sich vertiefenden »Unbehagens an der Moderne« aktuell verstärkt in den Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit tritt6 – sei es nun als Stein des Anstoßes, sei es als Heilmittel für fehlgehende Prozesse der Modernisierung, Rationalisierung und Funktionalisierung moderner Gesellschaften. Da individuell wie kollektiv verschärfte Probleme von Kontingenzbewältigung angesichts neuer Erfahrungen von End lichkeit und Verletzlichkeit, das Desiderat existenzieller Sinnsuche oder auch die Schwäche unserer moralischen Verbindlichkeiten dem transformativen Potential religiöser Praxen und Semantiken7 heute immer neue Wege bahnen, erscheint es in der Tat dringlicher denn je, ihre sozio-kulturelle Relevanz und politische Virulenz angesichts der irreduziblen Ambivalenz dieser Potentiale ebenso scharf wie nachhaltig ins Auge zu fassen. Mit einem Blick auf die bleibende Rolle der Religion in der neueren politischen Philosophie wird der immense Problemraum, der sich damit auftut, rasch etwa klarer. Wenn etwa Anfang der 80er Jahre Claude Lefort in diesem Kontext von der »Permanenz des Theologisch-Politischen« handelte8, so war noch keineswegs umfäng lich absehbar, welch tektonische Bruchlinien sich an den Grenzen einer sich säkular zu verstehen gewohnten (oder muss man sagen: gezwungenen?) Moderne, die das Schlüsselereignis der so genannten »demokratischen Revolution« (und mithin den Abweis aller »unbe dingten Ansprüche«, wie sie etwa aus einer Offenbarung herrühren sollen) in sich aufzunehmen begonnen hatte, in Kürze auftun sollten. J. Derrida, »Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der ›Religion‹ an den Grenzen der bloßen Vernunft«. 6 M. Reeder, Religion in säkularer Gesellschaft. Über die neue Aufmerksamkeit für Religion in der politischen Philosophie 7 Zur Kategorie der Ambivalenz als Konstitutivum des Religionsbegriffs vgl. S. Appleby, The Ambivalence of the Sacred. 8 C. Lefort, Fortdauer des Theologisch-Politischen? 5
11
Michael Staudigl
Denn in der Tat wurden diese Bruchlinien erst spürbar, sobald uner bittlich zutage zu treten begann, dass das »Projekt der Moderne« zu »entgleisen« droht9, da ihr zusehends prozedural ausgesteuertes Selbstverständnis das so genannte, oft über Gebühr strapazierte »soziale Band« nicht mehr nachhaltig zu sichern vermöchte.10 Eben dies wurde jedoch rasch merklich, sobald nicht nur jene traditionellen Sinnklammern brüchig wurden, die Peter L. Berger in religionsso ziologischer Hinsicht etwa trefflich als sacred canopy beschrieben hatte11, sondern zuletzt auch noch der Fortschrittsmythos säkularer Modernität kritisch desavouiert und in seiner gemeinschaftsbilden den Relevanz in Frage gestellt wurde.12 Diese kritische Einsicht in die Fragilität, ja im Grunde Bodenlosigkeit des Sozialen trifft aktuell nun aber nicht mehr nur auf den innergesellschaftlichen Rahmen »diskursi vierter Vernunft« (Habermas) zu. An dessen Abhängigkeit von bloß verwunden geglaubten Herrschaftsstrukturen (Webers »charisma tische Herrschaft«) und sozialpathologischen »Fehlentwicklungen« (die vielleicht mehr über das normale – bzw. normativ verklärte – Funktionieren unserer Gesellschaften aussagen, als uns lieb ist), hatte die Sozialtheorie die Philosophie auch immer gemahnt.13 Darüber hinaus verweist diese kritische Einsicht uns heute vor allem auf den Problemraum der Globalisierung, »multipler Modernitäten«14 und die damit verbundenen Herausforderungen einer sog. post-kolonia len Konstellation15, deren verheerende Erblasten noch keineswegs ansprechend aufgearbeitet wurden. Nicht nur im Blick also auf das liberal imaginary westlicher Demokratievorstellungen und die ihm (bzw. seinen universalistisch legitimierten Exportpraxen) innewoh 9 Die Fomulierung von einer »entgleisenden Modernisierung« geht auf J. Habermas (Zwischen Naturalismus und Religion, S. 218) zurück, lässt sich aber ebenfalls in der Globalisierungskritik wiederfinden, wenn A. Appadurai etwa das Bild eines »Mahl stroms« der Globalisierung zeichnet (A. Appadurai, Fear of Small Numbers), der mehr als bloß dysfunktionale Effekte zeitigt und nicht zuletzt jene von Habermas immer wieder beschworene Solidarität oder auch andere kosmopolitische Visionen untermi niert. 10 Zu diesem Themenkreis vgl. die Beiträge in J. W. Alvis, M. Staudigl (Hg.), The Bonds of Separation: Religion – Community – Violence. 11 P. L. Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological Theory of Religion 12 Vgl. J. M. Greer, After Progress: Reason and Religion at the End of the Industrial Age 13 Vgl. umfassend B. Liebsch, Einander ausgesetzt – Der Andere und das Soziale, 2 Bde. 14 S. N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities 15 Vgl. hierzu bspw. P. Bilimoria, A. B. Irivine (Hg.), Postcolonial Philosophy of Reli gion
12
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
nenden, vielfach unsichtbaren Ausschließungsmechanismen16, son dern insbesondere im Blick auf globale soziale Verwerfungen wird es aktuell denn auch immer fraglicher, ob das Konzept »Religion« ohne Reflexion auf die (keineswegs nur epistemische) Gewaltsamkeit okzidentaler Kategorisierungspraxen überhaupt noch zu verwenden sei – bzw. unter Zuhilfenahme welcher hermeneutischen Vorsichts maßnahmen.17 Der Einsatz der damit angezeigten Fragestellung ist daher in der Tat enorm. Denn nicht weniger steht auf dem Spiel als die »der Reli gion« allzu oft normativ beigesellten »Eigenschaften« von Opazität, Andersartigkeit und insbesondere Gewaltaffinität, »Marker« mithin, die ihrerseits vielfach zur selbstgerechten Legitimierung und Ver brämung säkularer Herrschaftsmodelle herangezogen wurden und werden. Wenn Charles Taylor in seiner groß angelegten Bestandsauf nahme des so genannten »säkularen Zeitalters« die historische Rolle der Religion heute systematisch neu zu vermessen ansetzte18, so tat er dies gerade auch angesichts entsprechender empirischer Befunde, an denen sich ablesen lässt, welch ambivalente Potentiale eine sich viel fach die Bahn brechende Re-Sakralisierung impliziert, sofern sie näm lich diese uns habituell leitenden Wahrnehmungs- und Handlungs schemata (vgl. etwa das so genannte »TINA-principle«) erschüttert – dadurch aber Aversion und sich legitim dünkende Gegen-Gewalt seitens der hegemonialen Herrschaftsordnungen motiviert.19 Und fraglos trifft es ja auch zu, dass wir solche Potentiale in der Tat – bspw. im Kontext wieder erstarkender »politischer Theologien«, religiöser Extremismen und insbesondere im Zeichen spektakulärer Ereignisse sog. »religiöser Gewalt« – zumindest medial kennen (und fürchten) gelernt haben.20 Die in sich ebenso vielgestaltige wie unklare Proble matik »religiöser Gewalt« wäre so gesehen der Lackmustest einer sich im Zeichen ereignishaft »wiederkehrender Religion« – und der mit 16 Vgl. zu den entsprechenden Verwerfungen eines so genannten »religösen Ande ren« bspw. B. Goldstone, »Secularism, ›Religious Violence‹, and the Liberal Imagi nary« 17 Siehe zu dieser Problematik geradezu klassisch T. Fitzgerald, The Ideology of Religious Studies 18 C. Taylor, A Secular Age 19 Vgl. dazu exemplarisch W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict 20 Vgl. zu diesen Themenkreisen beispielhaft H. de Vries, L. E. Sullivan (Hg.), Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World; H. G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung.
13
Michael Staudigl
ihr einhergehenden Infragestellung der Autonomie säkular sich ver stehender Vernunft – neu zu orientieren gezwungenen Philosophie. Allgemeiner gesprochen besagt dies, dass eine solche Reflexion nicht nur die genannte Erosion und die damit einhergehende »Krise der Immanenz«21 zu bezeugen hat, in der sich neue Formen gelebter Religion22 oder auch neue Chiffren von Transzendenz entwickeln23, die vielfach als soziale Reaktion auf die Schattenseiten einer zu entgleisen drohenden Spätmoderne und eines »ideologischen Säkularismus« entstehen – handle es sich nun um subalterne Praktiken zur Schaffung kollektiver Handlungsmacht oder um performative Liturgien zur Wiedergewinnung individueller Sinnressourcen. Darüber hinaus hat sich solch eine Reflexion vor allem auch der Notwendigkeit, sich in dieser Situation selbstreflexiv der eigenen Position zu vergewissern, zu stellen. Dies ist angesichts der genannten »Wiederkehr der Reli gion« fraglos ein entscheidendes Gebot. Denn es gilt tunlichst zu vermeiden, dass die aktuell sich entwickelnden Konzeptionen einer »post-säkularen Vernunft«, die das Verhältnis von Glauben und Wis sen neu zu verstehen ansetzen, zuletzt in einer Neuauflage der »Dia lektik der Aufklärung« letztlich wiederum gegenteilige Wirkungen zeitigen, indem sie die Religion als bloße Etappe eines (dialektischen) Entwicklungsprozesses, als kontingente Dysfunktion oder auch als im Modus »rettender Übersetzung« normativ verwertbares Material etc. integrieren. Um dieser Tendenz zu entgehen, kann der Rückgriff auf noch eine (andere) Geschichte der Philosophie, wie J. Habermas sie zuletzt vorgelegt hat, uns fraglos gewichtige Impulse liefern.24 Entscheidend bleibt es für die Religionsphilosophie in deren Lichte gleichwohl, »ihre Zeit in Gedanken zu fassen« (Hegel). Entscheidend ist dabei die Aufgabe, bei solch einem Unterfangen nicht der Illusion anzuhängen, dass die Begriffe, die sie dafür verwendet, neutral und unschuldig wären. Sofern sich zeigt, dass unsere Konzeptualisierungen von »Reli gion« vielmehr konstitutiv in die normative Grammatik säkularer Ordnungen eingelassen sind, bezeichnet diese Aufgabe entsprechend eine mehr als entscheidende Herausforderung. Ihr hat sich ein Dis kurs über »die Religion« zu stellen, der in der Arbeit an neuen Begriffen, die das traditionell so genannte »Andere der Vernunft« 21 22 23 24
14
H. J. Höhn, Krise der Immanenz. Religion an den Grenzen der Moderne H. Knoblauch, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft Vgl. hierzu bspw. J. D. Caputo, M. Scanlon (Hg.), Transcendence and Beyond J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, 2 Bde.
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
weder dialektisch negieren, noch es als »Unabgegoltenes« diskursiv eingemeinden oder es prozedural schlicht abzuarbeiten vorgeben, erfinderisch sein muss. Dieses Ansinnen ist in der Tat zentral, wenn ein solcher Diskurs sich nicht nur differenzsensibel geriert (d.h. aber Levinas‘ zufolge letztlich einer vorgegebenen Totalität verhaftet bleibt), sondern einer tiefgreifenderen Alteritätsvergessenheit entge genarbeiten will, wie sie in den Übersetzungsarbeiten zwischen Athen und Jerusalem immer wieder kritisch aufblitzte. Im Lichte solcher Überlegungen drängen nun freilich noch andere Problemlagen neben den bereits angesprochenen in den Vor dergrund, die neue Formen »unbedingter Ansprüche«, wie sie tradi tionell vor allem mit Fragen des bekennenden Glaubens verbunden waren, ins Spiel bringen – und so klassische Demarkationen zwischen Ethik, Politik und Religion in Unruhe zu bringen.25 Genannt seien hier nur die Gender-Problematik26 oder die Frage der Ökologie27, zwei in der Tat kardinale Themen, die den religionsphilosophischen Diskurs erst seit kurzem überaus produktiv »heimzusuchen« begon nen haben, ja ihn konstruktiv ent-setzen. Dass es angesichts dieser (und anderer) Problemlagen nicht um die Konfrontation mit einem ganz Anderen geht, dessen drohende Heterologie letztlich jeglichen Anspruch auf Autonomie verunmögliche, dürfte auch im Lichte des hier Gesagten mittlerweile klar geworden sein.28 Wenn neuere Tendenzen in der Religionsphilosophie aktuell die Verletzlichkeit, Schwäche und Leidensfähigkeit eines post-metaphysischen »Gottes« in den Vordergrund rücken und die Anerkennung solcher Prädikate als Möglichkeitsbedingung einer (bei Kearney ana-theistisch genannten) »Rückkehr zu Gott nach Gott« postulieren29, steht damit vielmehr 25 Zur Problematik »unbedingter Ansprüche« (auf bspw. Würde, Respekt, Anerken nung, ein »lebbares Leben« etc.), denen im Kontext der ethischen und politischen Artikulation religiöser Erfahrung ein besonderes Gewicht zukommt, aber auch ein abgründiges Gewaltpotential innewohnt, vgl. B. Liebsch & M. Staudigl (Hg.), Bedin gungslos? Zum Gewaltpotential unbedingter Ansprüche im Kontext politischer Theorie 26 Vgl. exemplarisch R. Braidotti, »In spite of the times: The post-secular turn in feminism« 27 Vgl. als Überblick etwa S. Bouma-Prediger, The Greening of Theology 28 Vgl. R. Kearney, Strangers, Gods, and Monsters: Interpreting Otherness 29 Vgl. leitmotivisch die Überlegungen zu einem verletzlichen, leidensfähigen »Gott ohne Souveränität« bei J. Derrida, Schurken. Zwei Essays über die Vernunft, S. 158 u. ö; zum Topos der Schwäche siehe dann J. D. Caputo, The Weakness of God; zur daraus resultierenden Bewegung der Rückkehr wiederum R. Kearney, Anatheism. Returning to God after God.
15
Michael Staudigl
noch ganz anderes auf dem Spiel: In den Fokus rückt damit die Exposition jener internen Verwerfungen und »zensierten Kapitel« (Lacan), durch die der (abendländische, patriarchalische und das ist gewaltsame) Habitus eines im Kern autonomen und handlungs mächtigen Subjekts, das sich am imago göttlicher Souveränität und Allmacht selbst verstand bzw. erfand (von den »maîtres et possesseurs de la nature«, von den in Descartes Discours de la méthode die Rede ist, hin zu Freuds »Prothesengott«), erst Gestalt annehmen konnte. Dass sich an diesem Punkt die schon lange erkannte Abgründig keit der Subjektphilosophie mit den neuerdings verschärft hervortre tenden Herausforderungen der Religionsphilosophie trifft und im Grunde verflicht, ist dabei jedoch nicht nur als ein Hinweis auf die zufällige Konvergenz zweier Schlagwörter – dem vom »Tod des Subjekts« und jenem vom »Tode Gottes« – zu verstehen. Dieses Zusammentreffen rührt vielmehr an oft vergessene Filiationen und an sich überkreuzende Genealogien – und führt damit einen anderen Grundton ein, der die oft geäußerte Kritik an Absolutheits- und Letzt begründungsansprüchen nachhaltig konkretisiert. Doch wie auch immer man die solcherart in ihrer Notwendigkeit deutlich angezeigte Neuausrichtung der Philosophie am Leitfaden von Pathos und Ver letzlichkeit, die damit unwiderruflich eingeläutet scheint, motivisch auch in Szene setzen mag, für die Worte des »tollen Menschen« in Nietzsches Die Fröhliche Wissenschaft sollten wir auch angesichts eines solchen Paradigmenwandels empfänglich bleiben. Sie nämlich lassen die Gefahr der Hybris schon dort erahnen, wo man sich ihr zu entziehen wähnte, freilich nur, um sie aufs Neue zu verschleiern, wie es etwa an rezenten Diskursen über den so genannten Posthumanis mus oder neuen Materialismus bspw. deutlich wird30: »Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen?«31 Und in der Tat, stehen wir nicht immer vor der Versuchung, mit einem solchen (vielleicht nicht nur hermeneutischen) Gewaltstreich zuletzt nicht wiederum in eine Philosophie einschwenken, wie Jan 30 Inwiefern der offenbare Nihilismus dieser Positionen nicht »wertlos« ist, sondern für die Religionsphilosophie in seiner Ereignishaftigkeit geradezu eine Gnade bereit halten könnte, die sie von ihren Kantischen Erblasten befreit, und sie im Hegelschen Sinne auf die produktive Rolle der Negativität stößt, zeigen die Beiträge in C. Crockett, B. K. Putt, & J. W. Robbins (Hg.), The Future of Continental Philosophy of Religion. 31 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, S. 481
16
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
Patočka anmahnte, die letztlich – auch nach dem verhängnisvollen 20. Jahrhundert – wieder nur um gegenüber der Sterblichkeit »indif ferente Fortschrittsideen«32 kreist? Religionsphilosophie nach dem »Tod Gottes«, nach dem Holocaust und dem »zwanzigsten Jahrhun dert als Krieg« (Patočka), in einem radikal nach-metaphysischen Kon text und das heißt im Zeichen der Dekonstruktion der »Onto-theoego-logie«, wie Heidegger exakter formulierte, zu betreiben, erweist sich damit als ein eminent kritisches Geschäft. Es lässt jedoch, das ist klar, manch lieb gewonnene Konstante des philosophischen Diskurses der Moderne nicht unangetastet zurück. Dies betrifft zuletzt nicht nur die Kategorie des Subjekts, sondern – wie oben schon angedeutet – gerade auch die Kategorie des Diskurses selbst oder die Konzeption einer »diskursivierten Vernunft«. Gerade in dieser hängt nämlich der »zwanglose Zwang des besseren Arguments« (Habermas) noch vom prekären Status eines elementaren, nicht-indifferenten Ange sprochenwerdens und mithin vom guten Glauben an eine basale (Ver‑)Antwortlichkeit ab, die nie erzwungen werden kann – einer »Beziehung ohne Beziehung«, der Levinas exakt den Namen Reli gion gibt.33 Religionsphilosophie erscheint in diesem Sinne damit aber heute dringender denn je und darf nicht einfach an eine (oft ideologisch grundierte) Religionskritik abgetreten werden, sofern diese sich allzu rasch in scharfen Frontstellungen verschanzt, ohne – phänomenolo gisch gesprochen – dem Anspruch der »Sache selbst« noch zu entspre chen.34 Zeitgemäßen Religionsphilosophien kommt dem gegenüber die Aufgabe zu, in diesem noch kaum vermessenem Terrain Fuß zu fassen. Ihre Herausforderung muss es sein, sich in einem abgründigen Terrain zu orientieren, das sich jenseits der klassischen Dichotomien von Glauben und Wissen, Religion und Säkularität, Mythos und Aufklärung, … auftut – und als bleibende Unruhe jede metaphysische Schließung dieser Strukturen verhindert. Wie diese ebenso kursorischen wie kontingent motivierten Überle gungen andeuten möchten, ist das Feld, das im vorliegenden Band in einigen Hinsichten durchforscht wird, in Bewegung und dynamisch; Fragen, die auftauchen, zeugen von der Notwendigkeit einer radi J. Patoka, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, S. 153 E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit, S. 34 Zur produktiven Verschränkung dieser beiden Stränge siehe aber die Zusammen schau bei M. Kühnlein (Hg.), Religionsphilosophie und Religionskritik. Ein Handbuch
32
33
17
Michael Staudigl
kalen Historisierung des »Gegenstandes«; konstruktive Antwortan sätze, die aktuell erprobt werden, erscheinen ebenso interdisziplinär ausgerichtet wie intersektional verfasst. Der damit angesprochenen Vielfalt von Herausforderungen zu entsprechen, bedeutete folglich auch eine Herausforderung für die Komposition eines Bandes, der den Status des Feldes zu reflektieren intendiert, ohne dabei auch nur ansatzweise Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit – sei es nun Themen, Methoden oder auch anderes betreffend – erhebt. Wie die zunächst womöglich eigenwillig anmutende Ordnung der Beiträge im Untertitel – der Stimmen, Schauplätze und Systeme ins Spiel bringt –, anzeigt, ging es der Herausgeberin und dem Herausge ber darum, dieses lebendige Forschungsfeld in seinen inneren Span nungen und angesichts scheinbar externer Herausforderungen eben dieser Einsicht zufolge nicht im Blick auf vereinheitlichte Schulen, klar begrenzte Disziplinen oder wohl verfügte Methoden einfach zu vermessen. Systematisierende Bände und klassifizierende Arbei ten zu bspw. analytischer Gotteslehre und Metaphysik, philosophi scher Theistik, transzendentalpragmatischer Religionsphilosophie oder Phänomenologie der Religion etwa liegen mittlerweile vielfach vor, vor allem im anglo-amerikanischen Raum auch Handbücher zu einzelnen thematisch diversifizierten Schwerpunkten. Wiewohl es zutreffen mag, dass sich viele Beiträge womöglich entsprechend einordnen lassen, so entziehen sich andere doch, nicht nur aufgrund einer innovativen thematischen Stoßrichtung, ihres methodischen Selbstverständnisses oder des gewählten interdisziplinären Theorie designs einem solchen vermessenden Ansinnen ganz grundsätzlich – und lassen damit andere Einordnungen im Gegenzug auch als fraglich erscheinen. Der vorliegende Band unternimmt daher auch explizit den Versuch, klassische Einordnungen und Kategorisierungen solcher Forschungen zu unterlaufen. Es geht ihm im Gegenzug darum, Stim men zu Wort kommen zu lassen, die sich bislang – etwa unter dem Druck epistemischer Rahmenordnungen des Diskurses über Religion oder im selektiven Zeichen spätmoderner social imaginaries – nicht angemessen artikulieren konnten. Sei es also, weil deren zeitliche oder geographische Ferne ihren Anschluss von den gängigen diskursiven Schauplätzen verhindert hatte; weil die notorische Schwierigkeit, »Religion« überhaupt zu definieren, manche Debatte verunmöglicht hatte; oder weil die avisierte Thematik traditionelle Systeme des Wahrnehmens, Einordnens und Urteilens überfordert – und nach
18
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
neuen verlangt, ohne im Zeichen des hermeneutischen Respekts damit noch einer systematisierenden Geste das Wort zu reden. Im Blick auf diesen Versuch, die Darstellung eines dermaßen dynamischen Feldes doch ein wenig zu gliedern, zeichneten sich in der Zusammenstellung des vorliegenden Bandes fünf Schwerpunkte ab. In diesem Sinne versammelt Teil I Ansätze der Religionsphilosophie, wie sie »im Ausgang von Philosoph*innen« aktuell konzeptualisiert werden. Hier werden nicht nur scheinbar unzeitgemäße Stimmen auf den Plan gerufen, die im Konzert der neueren Religionsphilosophie bislang nicht (Cusanus) – oder zumindest nicht mit Solopart – vertre ten waren, auf aktuelle Problemlagen aber womöglich zeitgemäßere Antworten zu geben erlauben, als dies festgefahrenen Positionen möglich ist. In anderen Fällen werden Kontrapunkte moniert und einstudiert, die bisherige Diskurse zu verschieben erlauben, indem zunächst polyphonisch anmutende Stimmlagen zusammengespannt werden (so etwa in den Duetten von Hegel und Lacan bzw. Wittgen stein und Weil). Was sich hierbei ausspricht, ist ein erfinderischer und mitunter auch improvisatorischer Umgang, der das neu zu denken erlaubt, was sich in seiner Ereignishaftigkeit oder Absolutheit einer eintönigen Bestimmung so nachhaltig entzieht, weil es im geradezu wörtlichen Sinne unerhört bleibt (Jullien). Abschnitt II geht einigen »Geographisch oder zeitlich verortbaren Ausgangspunkten« im religionsphilosophischen Diskurs der Gegen wart nach. Hier findet man sich auf einer Spurensuche in anderen Geschichten (von der Antike bis zur achsenzeitlichen Revolution), Erzählungen (von einer anderen, herausgeforderten Moderne und ihrem anderen Verhältnis zur Religion), an anderen Schauplätzen und nach sich erst langsam abzeichnenden Rezeptionslinien (wie der Rezeption und Entfaltung französischer Theorieelemente in der Continental Philosophy of Religion) wieder. Was sich auf der Suche nach solchen teils vergessenen, teils ausgeblendeten Schauplätzen und marginalisierten Narrativen dabei herausstellt, ist, dass die Vor aussetzungen einer Beschäftigung mit Religion als Phänomen in diesen oft anders gelagert sind – eine Einsicht, die uns im Zeichen dieser Verfremdung des eigenen Standpunkts Einsichten in neue, ebenso mögliche Konturierungen des Feldes zu gewinnen erlaubt. In einem III. Teil sodann werden einige Ansätze zur Religionsphiloso phie, sofern sie explizit als »in Religionsgemeinschaften verortbare«
19
Michael Staudigl
verstanden werden können, vorgestellt. Die hier womöglich beson ders selektiv anmutende Auswahl, die dem Desiderat einer heute notwendigerweise interkulturell sich exponierenden Religionsphilo sophie zu widersprechen scheint, eröffnet gleichwohl Einblicke in zentrale religionsphilosophische Theoreme, die in eins interreligiöse Anschlusspunkte zumindest dort explizit mit ins Gespräch bringen, wo es um die konfliktuelle Topologie »der Religion« im Kontext globaler Wissens- und Machtverhältnisse geht (wie in Bezug auf die Frage einer genuin islamischen Religionsphilosophie), oder eher implizit dort, wo philosophisch-theologische Grundbegriffe (Opfer, Zeit und Kontingenz) auf der Grundlage einer religiösen Tradition als existenziale Armaturen herausgearbeitet werden – und so kompara tive Analysen gleichsam herausfordern. Abschnitt IV diskutiert in der Folge »Wechselwirkungen von Religion mit einem Außen«. Es handelt sich hierbei nicht nur um »Soziale und politische Dimensionen«, die eine Philosophie der Religion ins Auge fassen muss, möchte sie die Stellung der Religion in unseren spätmodernen social imaginaries auch nur annährend verstehen. Diese Dimensionen lassen sich insbesondere im Blick auf kardinale gesellschaftliche Fragen wie unseren Umgang mit Leid und Gewalt nachvollziehbar aufschließen, die gerade dadurch bleibende Probleme einer nachmetaphysischen Religionsphilosophie ausmachen, dass sie nicht mehr einseitig als »religiös« oder »säkular« motiviert ver standen werden können, sondern uns im kritischen Blick auf ihre Rechtfertigungen auf manch untergründig verlaufende Verflechtun gen dieser Register zurückwerfen. Daneben treten hier aber auch neue entscheidende Problemlagen in den Fokus (Ökologie, Feminis mus). Eben deren Berücksichtigung vermag jedoch in vielleicht noch stärkerem Maße eine erneuerte Selbstreflexion der Religionsphiloso phie zu motivieren, weil sie deren traditionell ausgeblendete innere Spannungen und doktrinäre Verwerfungen ganz direkt aufgreift – die Konfrontationen, die sie ad extra ereilen, also durch einen Blick auf ausgeblendete, ja teils verfemte Frontstellungen ad intra zu korrigie ren ansetzt. Die in Abschnitt V versammelten Beiträge gehen unter dem Titel »Systematische Überlegungen zu Religion bzw. Religionsbegriff« schließlich einer Problematik bzw. einem Anliegen nach, das sonst gerne an den Anfang solcher Bände gestellt wird. Die Nachträglich
20
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
keit, die mit dieser Positionierung unterstrichen wird, möchte in Rechnung stellen, dass die nötige Kritik am (okzidentalen) Religions begriff und den dahinter vermuteten epistemischen und universalis tischen Regimen es uns nicht ersparen sollte, weiterhin Arbeit an den Begriffen zu leisten, da es diese schlichtweg braucht, um unsere Zeit und ihre so ambivalente Stellung zur Religion auf den Begriff zu bringen. Gerade dort, wo es auch um (noch) unausdrückliche Erfahrungen und ein Begehren, solche zu artikulieren, geht, ist die Arbeit am Begriff ebenso Pflicht, wie auch jene anders gelagerte Erinnerungspflicht nicht vergessen werden darf, die deren abgeblen dete Genealogien in Rechnung zu stellen hat. Dass dabei ganz unter schiedliche philosophische Begründungsansprüche mit theologischen Herangehensweisen konfrontiert werden (von der negativen und para-konsistenten bis hin zu einer pluralismusoffenen Theologie), aber auch verschiedene philosophische Aneignungen deutungsoffe ner Theologoumena (Ana-Theismus, Gastlichkeit, die Namen gottes) vorgelegt werden, bezeugt hier abschließend jene schon genannte produktive Durchlässigkeit traditioneller disziplinärer Grenzen, die ein neues Gespräch über »die Religion« heute anzubahnen erlauben.
Literaturverzeichnis J. W. Alvis, M. Staudigl (Hg.), The Bonds of Separation: Religion – Community – Violence, New York: Columbia University Press 2023 (im Erscheinen) A. Appadurai, Fear of Small Numbers. An Essay in the Geography of Anger, Durham: Duke University Press 2006 S. Appleby, The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence and Reconciliation, London et al.: Rowman & Littlefield 1999 P. L. Berger, The Sacred Canopy. Elements of a Sociological theory of Religion, New York: Anchor 1980 P. Bilimoria, A. B. Irivine (Hg.), Postcolonial Philosophy of Religion, Dordrecht et al.: Springer 2009 S. Bouma-Prediger, The Greening of Theology: The Ecological Models of Rose mary Radford Ruether, Joseph Sittler, and Jürgen Moltmann, Atlanta: Scholars press 1995. R. Braidotti, »In spite of the times: The post-secular turn in feminism«, in: Theory, Culture & Society 25/6 (2008), 1–24 J. D. Caputo, The Weakness of God. A Theology of the Event, Bloomington: Indiana University Press 2006 J. D. Caputo, M. Scanlon (Hg.), Transcendence and Beyond: A Postmodern Inquiry, Bloomington: Indiana University Press 2007
21
Michael Staudigl
W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict, Oxford: Oxford University Press. 2009 C. Crockett, B. K. Putt, & J. W. Robbins (Hg.), The Future of Continental Philosophy of Religion, Bloomington: Indiana University Press 2014 J. Derrida, »Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der ›Religion‹ an den Gren zen der bloßen Vernunft«, in: ders., G. Vattimo (Hg.), Die Religion, Frank furt/M.: Suhrkamp 2001, S. 9–106 –, Schurken. Zwei Essays über die Vernunft, Frankfurt/Main: Suhrkamp 2004 H. de Vries, L. E. Sullivan, Political Theologies: Public Religions in a Post-Secular World, New York: Fordham University Press 2006 S. N. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities, Leiden: Brill 2003 E. Falque, Den Rubikon überschreiten. Philosophie und Theologie. Ein Versuch über ihre Grenzen, Münster: Aschendorff (französ. Orig., Passer le Rubicon. Philosophie et théologie. Essai sur les frontières, Paris: Lessius 2013) T. Fitzgerald, The Ideology of Religious studies. Oxford: Oxford University Press 2000 J. M. Greer, After Progress: Reason and Religion at the End of the Industrial Age, Gabriola Island: New Society Publishers 2015. B. Goldstone, »Secularism, ›Religious Violence‹, and the Liberal Imagi nary«: in: M. Dressler, A. Mandair (Hg.), Secularism and Religion-Mak ing. Oxford: Oxford University Press, 2011, pp. 104–124 M. Heidegger, »Die onto-theo-logische Verfassung der Metaphysik«, in: ders., Identität und Differenz, Pfullingen: Neske 1957, S. 35–73 J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2005 –, Auch eine Geschichte der Philosophie, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2019, 2 Bde. H. J. Höhn, Krise der Immanenz. Religion an den Grenzen der Moderne, Frank furt/M.: Fischer 1996 D. Janicaud, Die theologische Wende der französischen Phänomenologie, Wien: Turia + Kant 2014 (französ. Orig., Le tournant théologique de la phénoménologie française, Paris: L’Éclat 1991) R. Kearney, Strangers, Gods, and Monsters. Interpreting Otherness, London et al.: Routledge 2003 –, Anatheism. Returning to God after God, New York: Columbia University Press 2009 H. G. Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung, München: Beck 2008 H. Knoblauch, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, Frankfurt/M. & New York: Campus 2009 M. Kühnlein (Hg.), Religionsphilosophie und Religionskritik. Ein Handbuch, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2018 C. Lefort, Fortdauer des Theologisch-Politischen? Wien: Passagen 1999 E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Frei burg/München: Alber 1980
22
Religionsphilosophie unter neuen Vorzeichen
B. Liebsch, Einander ausgesetzt – Der Andere und das Soziale, Freiburg/München: Alber 2018, 2 Bde. B. Liebsch & M. Staudigl, Bedingungslos? Zum Gewaltpotential unbedingter Ansprüche im Kontext politischer Theorie, Baden-Baden: Nomos 2015 F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft, in: Sämtliche Werke. Kritische Studien ausgabe, Bd. 3, hg. v. G. Colli und M. Montinari, München: dtv 1980, S. 481 J. Patočka, Ketzerische Essays zur Philosophie der Geschichte, Frankfurt/M.: Suhr kamp 2010, S. 153 M. Reeder, Religion in säkularer Gesellschaft. Über die neue Aufmerksamkeit für Religion in der politischen Philosophie, Freiburg & München: Alber 2013 C. Taylor, A Secular Age, Camden: Belknap Press 2007
23
Vorbemerkung
Die Breite der aktuellen Debatten im Bereich der Religionsphilo sophie in Ansätzen zu dokumentieren und ein weiterführendes Gespräch anzubahnen, ja es vielleicht auch teils schon auf den Weg zu bringen, all dies waren übergreifende Intentionen des nun gedruckt vorliegenden Bandes. Dieser entstand auf der Basis einer im Sommersemester 2019 an der Fakultät für Philosophie und Bildungs wissenschaft der Universität Wien von den Herausgeber*innen orga nisierten Ring-Vorlesung mit dem Titel »Religionsphilosophie heute: Themen, Probleme, Perspektiven«. Nicht alle damals vertretenen Teilnehmer*innen konnten zuletzt an diesem Projekt teilnehmen, für die geplante Veröffentlichung haben dann aber dankenswerterweise andere zugesagt und so geholfen, ein weiteres thematisches Spektrum abzudecken und ergänzende Debatten beizusteuern. Die Realisierung der Ring-Vorlesung und die Drucklegung des vorliegenden Bandes wäre ohne vielfältige institutionelle und ins besondere auch finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen: Wir danken der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft (Universität Wien), dem Forschungszentrum »Religion and Transfor mation in Contemporary Society« (Universität Wien) sowie dem öster reichischen Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung (FWF P 29599; I 2785) für die entsprechende finanzielle Unterstützung. Ein großer Dank für die Unterstützung in der Vorbereitung des Bandes gebührt Magdalena Sedmak und David Gamsjäger, die uns bei der Realisierung des Projekts so tatkräftig zur Seite standen, sowie dem Verlag und seinen Mitarbeiter*innen, insbesondere Herrn Trabert, mit dem das Projekt vor langer Zeit bereits auf den Weg gebracht worden war. Esther Heinrich-Ramharter & Michael Staudigl
25
A. Philosophie im Ausgang von PhilosophInnen
Markus Riedenauer
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus nach Nicolaus Cusanus
1. Zur Relevanz und religionstheoretischen Verortung des Themas Religionsphilosophie hat sich heute auch mit den Spannungen zu befassen, die aus der Vielfalt von Religionen, welche durch globale Migration auch lokal viel stärker zum Tragen kommt, und aus Ausein andersetzungen ihrer Angehörigen und Vertreter vermehrt entstehen – bis hin zu fundamentalistischer Gewalt. Das Philosophische dabei ist nicht nur das Bemühen um ein tieferes Verstehen jenseits von Deskription und Analyse, sondern auch die normative Fragestellung – dies wiederum in zweifacher Weise: Unstrittig dürfte die philosophi sche Aufgabe der Begründung moralischer Normen für den Umgang mit andersreligiösen Menschen sein, aber vielleicht stellt sich sogar die Frage nach vernünftigen Kriterien für eine reife Religion selbst, welche, sowohl ihrer kindlichen Naivität als auch ihrer trotzigen Selbstbehauptung entwachsen, mit Pluralität und Auseinanderset zungen in produktiver Weise zurechtkommt. Was sind interreligiöse Auseinandersetzungen? Sie reichen von respektvollen Dialogen zwischen Vertretern verschiedener Religio nen, die sich über ihre differenten Sichtweisen verständigen (»agree to disagree«), über diskursive Auseinandersetzungen im politischen Feld, wo es um Gestaltungsmacht geht, bis hin zu Religionskriegen. Dabei spielen freilich viele geschichtliche Faktoren eine Rolle und kulturelle Manifestationen der Religionen – aber tiefer noch verschie dene Weltdeutungen, normative Ordnungsvorstellungen in Ethik und Politik und konfligierende Wahrheitsansprüche. Dass interreligiöse Auseinandersetzungen ein wichtiges Thema für die praktische und politische Vernunft sind, dürfte weithin akzep tiert sein – inwiefern aber auch für die theoretische Vernunft, für Reli
29
Markus Riedenauer
gionsphilosophie und natürliche oder philosophische Theologie? In welcher Weise können und sollen die tragenden religiösen Deutungen »hinter« oder »unter« den rituellen und kulturellen Manifestationen thematisiert werden? Hat Philosophie vielleicht auch eine kritische Aufgabe gegenüber den theologischen Modellen für interreligiöse Beziehungen und Argumentationen? Traditionell befasste sich Philosophische Theologie mit der Frage nach einem göttlichen Ursprung (arche), mit der sog. Gottesfrage und sog. Gottesbeweisen, mit Atheismus und m.E. muss sie sich auch mit den geistesgeschichtlichen Wurzeln von religiösem Fundamentalis mus befassen1. Darüber hinaus thematisiert die Philosophie der Reli gion(en) die Religionskritik, allgemeine Strukturen im Feld religiöser Phänomene, anthropologische, hermeneutische und kommunikati onstheoretische Grundlagen, Bedingungen des Religionsdialogs und Fragen der Hermeneutik religiöser Texte und Praktiken. Schließlich kann – wie angedeutet – im Bereich praktischer Philosophie die politische Philosophie immer weniger umhin, sich auch mit Religionen zu befassen, mit ihrer Rolle in der Öffentlichkeit, ihrem disruptiven Potenzial, ihren Sinnpotenzialen und deren Über setzung in säkulare Sprache, mit Fragen nach religiöser Toleranz (im günstigsten Fall) bis hin zu Fragen nach legitimer Gewaltanwendung und gerechtem Krieg (im schlechtesten Fall). Samuel Huntington sah in »The Clash of Civilizations« von 1996 die Bruchlinien zwischen den Zivilisationen der Welt von den großen Religionen bestimmt und erntete mit seinem Ansatz heftige Kritik. Diese Diskussion muss in der Auseinandersetzung mit antiliberalen, ethnopluralistischen und gegen universale Menschenrechte auftre tenden Kräften weitergeführt werden. Indessen sah sich die Welt bereits fünf Jahre später mit brutaler Wucht mit religiös motivierter Gewalt konfrontiert; seit dem 11.9.2001 und vielen weiteren Terror anschlägen, auch antijüdischen, antiislamischen und weiteren gegen verschiedene Religionsgemeinschaften gerichteten Attentaten, verlor eine einfache Säkularisierungsthese an Plausibilität und sieht sich auch die Philosophie neu herausgefordert. Angesichts des religiösen oder mit Religion verbindbaren Aggressionspotenzials scheinen sich neue und radikalere Fragen zu stellen, was wohl die Rede von einem Umbruch rechtfertigt. Verdankt sich nicht die Schärfe religiöser Aus einandersetzungen – jenseits von Interessen und psychologischen 1
Siehe M. Riedenauer, »Fundamentalismus«.
30
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
Faktoren – den unvereinbar erscheinenden Wahrheitsansprüchen hinter den kulturellen Manifestationen? Anscheinend gilt: Je mobiler und pluraler Gesellschaften sind, desto mehr Potenzial für interreli giöse Spannungen entsteht, während die Hoffnungen mancher auf gewissermaßen automatische Säkularisierungsprozesse und Margi nalisierung der Religionen geschwunden sind. Theologien verschiedener Religionen befassen sich mit Möglich keiten, diese Pluralität wie auch verschiedene Lösungsoptionen zu reflektieren. Jedenfalls im Rahmen der christlichen Theologien wur den dafür exklusivistische, inklusivistische und pluralistische Religi onstheorien entwickelt, diskutiert und verfeinert2. In abgewandelter Weise sind diese Grundmodelle auch philosophisch relevant und können die nötige Radikalität der Reflexion auf sich miteinander auseinandersetzende Religionsformen veranschaulichen.
Modell 1a zeigt, was geschichtlich nicht mehr möglich ist: Die Kreise symbolisieren verschiedene Religionen, die als nebeneinan der stehend und einander ausschließend verstanden werden (ange deutet durch die Doppelpfeile). Das veranschaulicht eine vielleicht früher vorherrschende oder noch mögliche weitgehende Trennung der Einflusssphären verschiedener Religionen. Der inhaltlichen Aus einandersetzung wird in solchem Denken ausgewichen, was immer weniger plausibel erscheint, sobald hinreichende Kenntnisse anderer Religionen verbreitet sind und die Frage unabweisbar wird, ob ihre Kerngehalte nicht im eigenen Glauben als enthalten zu denken sind – womit wir von der exklusivistischen zur inklusivistischen Religions theorie übergehen.
Vgl. M. Riedenauer, Pluralität und Rationalität, S. 31–41; R. Bernhardt, »Prinzipi eller Pluralismus« und R. Schenk, »Die Suche«.
2
31
Markus Riedenauer
Das Modell 2 könnte als Veranschaulichung eines radikal inklu sivistischen Denkens dienen, wenn als Symbol für die eigene Reli gion die äußere Kreislinie angenommen wird, welche die kleineren Kreise umschließt, die ihrerseits andere Religionen symbolisieren. Für kritischere Inklusivismen müssten deren Kreise teilweise über den Umfang des größten Kreises hinausragen, womit die damit bezeichnete Tradition nicht alles, was in anderen gelebt wird, als im Eigenen inkludiert sähe, sondern nur deren (besseren, wichtigeren oder wahren) Teil. Dieser Anspruch ist sehr hoch – zu hoch für die kritische Ver nunft, die sich dem Gebot der Universalisierbarkeit verpflichtet und nicht zu erkennen vermag, wie darin die Vertreter anderer Religionen deren Selbstverständnis sollen wiederkennen können. Auch für pluralistische Religionstheorien ist der starke inklusi vistische Anspruch zu hoch, sodass der umfassende große Kreis in Modell 2 nicht die eigene Religion symbolisieren dürfe, sondern höchstens das göttliche Geheimnis, innerhalb dessen verschiedene Religionen ihre gleichberechtigten und nicht harmonisierbaren Arti kulationen und Deutungen entwickelt haben. Damit wird die negative Theologie – oft in Verbindung mit vernunftskeptischen philosophi schen Annahmen – zur Grundlage3.
Zum Pluralismus siehe R. Bernhardt, »Prinzipieller Pluralismus«, besonders S. 17– 23, und die Zusammenfassung der Kritik daran: »Auf der Suche nach dem gemein samen Nenner ignorierten die ›Pluralisten‹ das jeweilige Proprium der anderen Reli gionen, selektierten das ihrem System konformierbare, reduzierten damit die Selbst 3
32
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
In der europäischen Geistesgeschichte wurde zuerst eine Vari ante des ersten Modells als religionsphilosophische Lösung für die Probleme religiöser Pluralität vorgeschlagen:
Modell 1b
Modell 1b unterscheidet sich dadurch von den anderen beiden, dass es eine allgemeine Vernunftreligion oder gar eine im Kern nichtreli giöse Weltdeutung einführt bzw. eine autonome Moral, welche allen Religionen als Fundament unterlegt wird. Nur dieses verbindet dem nach die konkurrierenden Traditionen. Religiöse Wahrheitsansprüche an sich werden nicht miteinander vermittelt, sei es mit agnostizisti scher Begründung, sei es – pragmatisch – aufgrund frustrierender Erfahrungen wie im konfessionellen Zeitalter. Insoweit beinhaltet es einen undogmatischen Exklusivismus. Stattdessen werden alle Religionen oder eher alle Individuen unabhängig von ihrem reli giösen Bekenntnis auf das allgemeine Fundament verpflichtet, wel ches Gewalt zwischen den Gruppen verhindern soll. Dieses Schema mag grob die Position der Aufklärung skizzieren, welche aus den geschichtlichen Erfahrungen der verheerenden Konfessionskriege mit den entsprechenden kontroverstheologischen Verhärtungen und Exklusionsstrategien die Folgerung zog, dass nur ein von außen den Religionen kritisch gegenübertretendes Denken und ein säkulares Recht deren Konfliktpotenzial eindämmen könnte. Das (freilich ideal typisch simplifizierende) Schema macht allerdings augenscheinlich, worin die Problematik besteht: in der vorausgesetzten Trennung
aussagen der Religionen auf eine vermeintliche, den Religionen aber fremde Gleichheitsgrundlage und vereinnahmten sie damit.« (ebd. S. 20 f.).
33
Markus Riedenauer
dieses rationalen und universalistischen Fundaments von allen reli giösen Traditionen, was nicht nur für Menschen innerhalb eines die ser Horizonte ein Akzeptanzproblem verursacht, sondern überhaupt als ungeschichtliches und hermeneutisch naives Konstrukt kritisiert wird. Habermas sieht in der Täuschung der rationalistischen Aufklä rung über ihren partikularen Ursprung in der westlichen Tradition eine Ursache für die Gewalttätigkeit von Modernisierungsprozessen. »Dieser verstockte, sich auf sich selbst versteifende Rationalismus hat sich in die stumme Gewalt einer kapitalistischen Weltzivilisation umgesetzt, die sich fremde Kulturen angleicht und eigene Traditionen dem Vergessen preisgibt.«4 Auch dieses Modell scheint gescheitert zu sein. Die Annahme, eine allgemeine menschliche Vernunft würde von allen geteilt und akzeptiert, die nicht dumm oder böswillig seien und sich so selbst aus dem Diskurs ausgeschlossen hätten, erscheint nicht mehr plausi bel, aufgrund der oben angedeuteten globalen Pluralisierungserfah rungen und aufgrund von Entwicklungen in der Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine bessere Verhältnisbestimmung von religiösen Weltdeutungen und damit verbundenen Wahrheitsansprü chen ist erfordert. Meines Erachtens ist es nun wichtig und hilfreich, zu sehen, dass die skizzierten Fragen im Prinzip nicht so neu sind und dass darum Religionsphilosophie heute von früheren Denkansätzen lernen kann. Das deutet die Formulierung »nach Nicolaus Cusanus« im Titel dieses Beitrags an, welcher dessen Texte, die viele Fragen aufwerfen, nicht im Detail interpretiert, sondern daraus Einsichten und Anregungen für die heutigen Fragen erarbeitet. Bei einem Umbruch kommt auch Tieferliegendes zum Vorschein und auf der Grundlage einer Untersu chung des innovativen, paradigmatischen und potenzialreichen Reli gionsverständnisses des Denkers am Anfang der Neuzeit können die gegenwärtig drängenden systematischen Fragen womöglich besser beantwortet werden. Kriege um Territorien und Macht auch mit religiösen Rechtfertigungsversuchen werden freilich schon lange (oder gar immer) geführt – aber im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit entstand ein neues Bewusstsein, eine weitere und tiefere Sicht auf interreligiöse Verhältnisse, eine neue Konzeption von Religion und Kultur. Erhellende Parallelen zur heutigen Lage sehe ich zunächst in 4
J. Habermas, Vom sinnlichen Eindruck, S. 99.
34
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
der Problemwahrnehmung5. Darum werden im folgenden zweiten Teil vergleichbare situative Faktoren und Themen identifiziert. Was Religionsphilosophie, die sich heute mit gewaltträchtigen interreligiösen Auseinandersetzungen befasst, aus einer Analyse und Systematisie rung des cusanischen Religionsdenkens lernen kann, ist nicht zuerst eine Lösung, sondern sind zunächst einige Unterscheidungen: von praktischen und theoretischen Diskursen, Themen und Perspektiven. Religionen und Kulturen, »civilizations« sind komplexe Gebilde – zur sachgemäßen Differenzierung beizutragen, wäre schon ein wichtiger Dienst der Philosophie. Im dritten Teil systematisiere ich die nötigen Schritte zur Bewusstwerdung und dann möglichen Bewältigung der Problematik gewaltträchtiger religiöser Pluralität im Blick auf die neuen, humanis tisch inspirierten Ansätze bei Cusanus. Im vierten Teil werden dann erkenntnistheoretische Grundlagen seiner Arbeit zur Bewältigung religiöser Pluralität skizziert. Im fünften Teil entwickle ich daraus religionsphilosophische Folgerungen für ein vernünftiges, diskursoffenes religiöses Selbstver ständnis einer reifen Religion.
2. Religionspluralität – spezifisch neuzeitliche Herausforderungen Zur Lebenszeit des Cusanus konnte man bereits auf acht Jahrhun derte der Auseinandersetzungen zwischen Christentum, Islam und natürlich Judentum zurückblicken: kriegerische incl. der Kreuzzüge, missionarische und apologetische im Sinn der Begründung, warum die eigene Religion die bessere oder wahrere sei, aber auch eine kurze geschichtliche Phase des gedeihlichen Zusammenlebens im frühmit telalterlichen Spanien. In der Geschichte der theoretischen Auseinan dersetzung mit dem Islam insbesondere lassen sich – vergröbert – folgende Perioden unterscheiden: 1. Apologetik des Christentums und Polemik gegen einen kaum gekannten Islam, 2. eine vernunftoptimis tische Phase vor allem im 13. Jahrhundert, wobei sich die Ebenen der Hermeneutik von religiösen Texten und einer religionsphiloso Siehe M. Riedenauer, »Religiöse und kulturelle Pluralität als Konfliktursache« und im Blick auf die Rezeption von De pace fidei ders., Pluralität und Rationalität, S. 25 f.
5
35
Markus Riedenauer
phischen Argumentation herausbilden, 3. Desillusionierung, aber auch visionäre Neuansätze im 15. Jahrhundert. Entsprechend müssen verschiedene Diskurse mit je verschiedenen Adressaten und Metho den differenziert werden, was hier nicht dargelegt werden kann6. Den Anlass für die intensive Auseinandersetzung des Cusanus mit religiöser Pluralität brachte das Jahr 1453, als die Türken unter Mehmet II. Konstantinopel einnahmen, was im Westen als äußerst grausame Eroberung geschildert wurde und eine Welle antiislami scher Polemik hervorrief7. Sie war das Motiv für Nicolaus, gleich darauf den Dialog De pace fidei (Vom Frieden im Glauben) zu verfas sen, wie er im ersten Satz betont: Bei der Eroberung Konstantinopels ließ kürzlich der Sultan der Türken die schlimmsten Grausamkeiten geschehen. Auf die Kunde davon entbrannte ein Mann, der jene Stätten aus eigener Anschauung kannte, zu einem solchen Eifer für Gott, dass er den Erschaffer des Alls unter inständigen Seufzern darum bat, Er möge in seiner Güte doch der Verfolgung Einhalt gebieten...8
Nach einigen Tagen des Betens und Grübelns empfing dieser Mann eine Schau (visio) eines interreligiösen Weisenrats. Wir dürfen ihn mit Cusanus selbst identifizieren, der am Konzil von Basel mitgewirkt hatte, wo es vor allem um die Machtverhältnisse von Papst und Konzil ging und um die Hussitenfrage, der sich dabei um innerchristliche Konkordanz sowie um eine Lösung des Schismas mit der Ostkirche bemüht hatte und der sich auch nach seinem Wechsel in päpstliche Dienste für die Wiedervereinigung von Ost- und Westkirche enga
Zu den Phasen siehe ausführlicher R. W. Southern, Western Views of Islam, und M. Riedenauer, »Das mittelalterliche Christentum in der Auseinandersetzung mit dem Islam« sowie M. Riedenauer, »Konfrontation«. Der obigen groben Skizze liegt eine bestimmte Interpretationsperspektive zugrunde, für deren ausführliche Erklärung auf Riedenauer, Pluralität und Rationalität verwiesen werden muss. Im Druck ist mein Beitrag »Plurality as a Challenge to Rationality. Cusanus‘ Strive for Concordance and Peace«. 7 Siehe E. Meuthen, »Der Fall von Konstantinopel«, zu verschiedenen »images« der Muslime allgemein D. R. Blanks, M. Frassetto (Hg.), Western Views of Islam. Einen kurzen Überblick zum Thema Cusanus und der Islam bietet W. A. Euler, »Cusanus‘ Auseinandersetzung mit dem Islam« (S. 72–85) auf Grundlage seines Buches Unitas et pax. 8 De pace fidei 1 n.1, kritisch ediert in h VII p. 3 Z. 3–8; zitiert in der Übersetzung von R. Haubst. 6
36
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
gierte (u.a. in Konstantinopel)9. Er erschaute eine Art himmlisches Konzil mit einem viel weiter reichenden Ziel: Alle Religionen der Welt sollten zu einer inhaltlichen Übereinstimmung gelangen und so die Ursachen für religiöse Gewalt ausmerzen, indem Weise aus 17 ver schiedenen Nationen, Kulturen und Religionen – wir dürfen sagen: 17 Religionsphilosophen – eine inhaltliche Konkordanz erarbeiten10. Da der Cusaner eine Hauptursache für Unterdrückung, Verfol gung und Morden in der Religionsverschiedenheit sah11, suchte er Frieden, pax, durch die Etablierung einer gemeinsamen Religion bei bestehender und tolerierter Vielfalt im Bereich der Riten. Seine berühmte Formel religio una in rituum varietate zeigt sein Ziel an, verschiedene Religionen auf dialogisch-theoretischem Weg zu einen. Man könnte kurz sagen: »Dialog statt Gewalt!« Das ist freilich ein anderer Ansatz als im Verlauf der Neuzeit, als man in den divergie renden substanziellen Überzeugungen keine Möglichkeit zu einer inhaltlichen Einigung mehr sah und Bewältigungsformen entwickelte wie politische Toleranz, Trennung von staatlichen und kirchlichen Kompetenzen und Etablierung rechtlicher Verfahren zur Konfliktbe wältigung. Insofern ist De Pace Fidei ein vormodernes Projekt, noch getragen von rinascimentalem Konkordanzoptimismus, explizit in der Form einer Vision. Dahinter stehen folgende nicht selbstverständliche Annahmen: 1. Religion ist prinzipiell wahrheitsfähig. 2. Wahrheit ist grundsätzlich erkennbar, wenngleich nie vollständig. 3. Ein wahrheitsorientierter Diskurs ist darum sowohl möglich als auch notwendig, was 4. die Frage nach Bedingungen der Möglichkeit für die diskursive Suche nach Wahrheit und Konkordanz hervorruft. 9 Vgl. zu seinem Wirken die neuere Zusammenfassung von Th. Woelki, »Nikolaus von Kues (1401–1464)«, S. 15–33. 10 Nikolaus von Kues, De pace fidei 3 n. 9, h VII p. 10 Z. 12–19 (zitiert in der Übersetzung von R. Haubst): »Der Herr, König des Himmels und der Erde, hat das Seufzen der Ermordeten und Gefesselten und der in Knechtschaft Geführten gehört, die um der Verschiedenheit ihrer Religionen willen leiden. Und da alle, die solche Verfolgung ausüben oder erleiden, aus keinem anderen Grund dazu bewegt werden als dem, dass sie so ihr Heil zu fördern und ihrem Schöpfer zu gefallen glauben, hat sich der Herr des Volkes erbarmt. Es ist ihm recht, dass alle Verschiedenheit der Religionen durch gemeinsame Zustimmung aller Menschen einmütig auf eine einzige Religion zurückgeführt werde, die fortan unverletzlich sein soll.« 11 Siehe M. Riedenauer, »Religiöse und kulturelle Pluralität als Konfliktursache« sowie ders., Pluralität und Rationalität, S. 74–80 und S. 173–181.
37
Markus Riedenauer
Wir treten also mit Cusanus in einen ambitionierten theoreti schen Wahrheitsdiskurs ein, nicht in einen pragmatisch orientierten Toleranzdiskurs; das Verb tolerare kommt nur einmal in De pace fidei vor und bezieht sich auf rituelle Differenzen, nachdem die (erkennbar christlichen) Kerngehalte der universalen Religion vereinbart sind12. Dennoch ist in den letzten Jahrzehnten das internationale Inter esse an Cusanus stark gestiegen, sodass sich die Vorfrage erhebt: Wie lässt es sich verstehen, dass seine Schriften insbesondere zum interreligiösen Dialog als aktuell relevant betrachtet werden? Was kann der Denker an der Schwelle zur Neuzeit beitragen zu einer konstruktiven Bewältigung der Erfahrung eigener religiös-kultureller Partikularität und des Konfliktpotenzials der Pluralität, die heute als eine globale Herausforderung wahrgenommen wird? Meine Ausgangsthese ist, dass zwischen unserer Situation und der Problemwahrnehmung heute mehr Parallelen zum 15. Jahrhun dert auffindbar sind, als es auf den ersten Blick erscheinen mag: 1. Heute wie damals scheint der geschichtliche Kontext jeweils eine Umbruchssituation zu sein, einerseits das Ende des Mittelalters und der Übergang zur Neuzeit, andererseits nun das »Ende der Moderne«, die »Postmoderne« oder bereits eine Zeit danach – mit entsprechender Unsicherheit, die wohl mit verschärften Pluralisie rungserfahrungen zusammenhängt. 2. Wie damals steht heute die Konfrontation von Christentum und Islam im Vordergrund, dadurch eine neue Aufmerksamkeit auf De pace fidei 16 n. 60 (h VII p. 56, Z. 19). Karl Jaspers kritisierte diese Art Toleranz heftig (Nikolaus Cusanus, S. 185–188), ging allerdings am Kern des cusanischen Frie densprojektes vorbei. Toleranz als eine individuelle Tugend kommt schließlich erst dann in Betracht, wenn verlässliche politische und rechtliche Bedingungen herrschen, unter denen von andersgläubigen und anders lebenden Menschen keine Existenzbe drohung ausgeht. Trotz des anspruchsvollen Ziels interreligiöser Konkordanz ist nach J. Stallmach (»Einheit der Religion«, S. 63) das Werk »auch eine Toleranzschrift«; kri tischer M. Watanabe, »Nicholas of Cusa and the Idea of Tolerance« und A. Moritz, »Die Andersheit des Anderen«. D. Monaco kontrastiert aufklärerische Toleranz und cusanische Hermeneutik, Nicholas of Cusa, S. 102–117. I. Bocken erläutert, wie Cusa nus »Toleranz systematisch als Wahrheitsproblem« präsentiert (»Toleranz und Wahr heit«, S. 242), vgl. auch J. Schneider, »Nikolaus von Kues«. Zu Geschichte und Systematik des Toleranzbegriffs siehe R. Forst, Toleranz, der aller dings das Potenzial von De pace fidei zu verkennen scheint (vgl. hierzu S. 107–110), insofern Cusanus die »Forderung nach einer Relativierung ohne Relativismus« (S. 37, vgl. S. 531) durchaus begründen kann, und zwar aus einer philosophisch-theologi schen Sicht. Zur Diskussion siehe M. Riedenauer, Pluralität und Rationalität, S. 451– 455. 12
38
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
die »große« Ökumene nach fast fünf Jahrhunderten der Konzentration auf binnenchristliche Pluralität im neuzeitlichen Europa. Von der Zentralität der Herausforderung durch den Islam her versteht sich, dass Nicolaus sieben Jahre nach De pace fidei eine Detailauseinander setzung mit dem Koran schrieb: Cribratio Alkorani (1460–61). In die sen drei Büchern der »Siebung« oder »Sichtung« der heiligen Schrift der Muslime leistet er die hermeneutische Arbeit, welche am Ende von De pace fidei nur gefordert wird (wir kommen darauf zurück). Das erscheint mir wichtig, denn Religionsphilosophie muss sowohl die Prinzipien reflektieren als auch konkret hermeneutisch arbeiten. 3. Die heute starke Aufmerksamkeit auf die Inkulturiertheit von Religion findet sich durchaus in einer frühen Form bei Nicolaus, insbesondere insoweit mit dem Thema friedlicher Koexistenz ver schiedener Religionen weit mehr als deren dogmatische Inhalte zur Debatte stehen, also auch Formen des Ritus und Ethos (darunter Fragen nach der Legitimität von Gewalt) sowie diverse politische Ordnungsvorstellungen und Gesellschaftsformen. 4. Im Hintergrund standen und stehen relativistische Versuche, religiös-kulturelle Pluralität zu entschärfen (z.B. bei Gemisthos Ple thon und abgewandelt bei anderen Denkern der Renaissance und frühen Neuzeit13), heute in kontextualistischen und vernunftskepti schen Philosophien, die sich seit dem Historismus und der Herme neutik sowie seit Wittgensteins Sprachspieltheorie besonders in der Postmoderne entwickelten. Während hierfür der Philosoph Richard Rorty paradigmatisch ist, haben pluralistische Religionstheologen wie John Hick, Perry Schmidt-Leukel, Paul F. Knitter, Raimundo Panikkar, Leonard Swidler ebenfalls den klassischen Wahrheitsbegriff und die Prätention, prinzipiell zwischen Wahrem und Falschem (auch in religiösen Fragen) unterscheiden zu können, aufgegeben14. Damit entsteht ein neuer Raum für interreligiöse Dialoge, ohne einen inklu siven Rahmen oder ein allgemein zugrundeliegendes Fundament annehmen zu müssen.
13 14
Vgl. K. Flasch, Nikolaus von Kues, S. 229 f. Vgl. M. Riedenauer, Pluralität und Rationalität, S. 56–57.
39
Markus Riedenauer
Das pluralistische religionstheoretische Modell 3 verzichtet auf eine Integration anderer Religionen und auf religionsphilosophische oder vernunftreligiöse Annahmen, behauptet aber eine teilweise Deckung ihrer pluralen Wahrheiten, die in der Schnittmenge in der Mitte sym bolisiert ist. Für unser Thema wichtig ist diese Vorstellung, insofern sie manche Bemühungen um einen Religionsfrieden charakterisiert: Dann bezeichnen die Kreise etwa die ethischen Regeln der verschie denen Religionsgemeinschaften, die in einem gemeinsamen oder fundamentalen Kern übereinkommen, zumal im Reziprozitätsprinzip der Goldenen Regel (das auch Cusanus für universal verbreitet hält) und in einigen Grundrechten. Die erste Phase von Hans Küngs »Projekt Weltethos« läßt sich diesem Modell zurechnen15. Er geht von der Einschätzung aus, dass der »Wahrheitsabsolutismus« (besonders des Christentums) interreligiöse Gewalt beförderte16. Viele Zeitge nossen zweifeln wohl an der Möglichkeit, einen nicht partikularen intellektuellen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus verschiedene Religionen verglichen werden könnten. Möglicherweise macht genau das den cusanischen Ansatz interessant. Damit ist die vernunfttheoretische Problematik hinter unserem Thema angesprochen und die Aufgabe, die epistemologischen Bedin gungen der Möglichkeit für einen interreligiösen und interkulturel len Dialog zu klären. Verschiedene Religionen haben jeweils eine bestimmte, kulturell verwurzelte Sicht auf das Ganze der Wirklich keit, auf Göttliches und Menschliches, Vergangenheit und Zukunft, Zur Diskussion siehe R. Schenk, »Die Suche«, S. 69 f. Zusammengefasst in H. Küng, »Weltfrieden – Weltreligionen – Weltethos«, in: K.-J. Kuschel (Hg.). 15
16
40
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
Schuld und Erlösung, Tod und Leben, Natur und Geschichte und kon stituieren so unterschiedliche Horizonte der »Weltanschauung« oder divergierende Paradigmen. Wie ist es überhaupt möglich, dass sie miteinander in ein sinnvolles Gespräch kommen? Die Religionsphi losophie steht vor der Aufgabe, eine Theorie des interreligiösen Dis kurses zu entwickeln in der Spannung zwischen der faktischen Parti kularität jeder Weltdeutung und dem jeweils gemeinten Ganzen, ihrem universalen Ausgriff. Die klassische ontologische Frage nach Einheit und Vielheit kehrt unter dem Problemdruck einer gewalttäti gen Welt wieder, in der sich Partikularismen und universalistische Ansprüche vielfach kreuzen. Aus der offenen Spannung zwischen Partikularität und Universa lität lässt sich m.E. bereits ein wichtiges Kriterium für eine vernünf tige Religionstheorie gewinnen, nämlich inwieweit eine solche diese Spannung selbst reflektiert. Cusanus leistet das in seinem Verständnis von Religion und Religionen.
3. Zu Problemwahrnehmung, möglichen Strategien und humanistisch inspirierten Ansätzen bei Cusanus Ich systematisiere zunächst die nötigen Schritte zur Bewusstwerdung und dann möglichen Bewältigung der Problematik gewaltträchtiger religiöser Pluralität im Blick auf die Fortschritte, welche Cusanus hierbei machte. Ohne diese Differenzierungen können die verschie denen Teilziele und Argumentationsebenen bei keinem Werk zum Themenbereich richtig verstanden werden: 1.
Am Anfang steht die Wahrnehmung, dass religiöse Differenzen (trotz aller missionarischen Bemühungen) hartnäckig sind und sich noch dazu vermehren – was sich ja für Nicolaus schon inner christlich erwiesen hatte17. Ich nenne das eine Pluralisierungs erfahrung, deren stärkste interreligiöser Art war: die türkische Eroberung Konstantinopels.
17 Abgesehen von altbekannten Problemen mit Schismatikern, mit Gegenpäpsten und entsprechenden Spaltungen, sind im persönlichen Erfahrungsbereich des Nico laus vor allem die Hussitenfrage und das morgenländische Schisma zu nennen, um deren Lösung er sich intensiv bemühte.
41
Markus Riedenauer
2.
3.
a)
b)
Die zweite realistische Einsicht ist demnach, dass religiöse Dif ferenzen gefährlich sind und im Zusammenwirken mit sozialen und psychologischen Faktoren18 ein Gewaltpotenzial enthalten. Diese Sicht setzt voraus, dass der klassische Begriff von religio als einer individuellen Tugend und Praxis der Gottesverehrung ergänzt wird durch einen neuen, am Anfang der Neuzeit sich eröffnenden Blick auf Religionen als soziale und kulturelle Sys teme, also eine Außenperspektive19. Dieser empirische Begriff von Religion setzte sich später so weit durch, dass heute die alte Bedeutung von religio eher unter dem Begriff »Spiritualität« gefasst wird. Aber diese Differenzierung, die bereits bei Cusanus zu erkennen ist, stellt einen bedeutenden Fortschritt dar. Denn so wird es möglich, die Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit von Religionen wahrzunehmen. Aus den beiden ersten Schritten folgt, dass Wege zur Bewälti gung religiöser Differenzen gefunden werden müssen. Dafür bieten sich prinzipiell verschiedene Möglichkeiten an: Die klassische christliche Strategie zur Minimierung religiöser Pluralität selbst ist Mission, wobei zu beachten ist, dass diese angesichts der ersten Wahrnehmung und insbesondere der Aus breitung des Islam ja gerade in Frage gestellt worden war. Gewalt soll ja eigentlich – insbesondere nach der Bergpredigt Jesu – nicht sein, aber im Zuge einer Selbstverteidigung (z.B. gegenüber den angreifenden Türken) kann sie als bedingt erlaubt angesehen werden, was klassischerweise unter dem Thema des gerechten Krieges (bellum iustum) diskutiert wurde – allerdings
Nicolai de Cusa, De pace fidei 1 n. 4 (h VII p. 5 Z. 11–18) nennt in beachtlicher Weise Daseinssorgen und politische Unterdrückung als Ursachen für mangelnde Selbstund Gotteserkenntnis: Cusanus lässt hier einen Engel zu Gott sprechen: »Du weißt jedoch, o Herr, dass eine große Menge nicht ohne viel Verschiedenheit sein kann und dass fast alle ein mühsames und mit Sorgen und Nöten volles Leben führen und in knechtlicher Unterwerfung den Königen, die herrschen, untertan sein müssen. Daher kam es, dass nur wenige von allen so viel Zeit und Muße haben, dass sie im Gebrauch ihrer Willensfreiheit zur Selbst-Kenntnis gelangen können. Durch viele körperliche Sorgen und Dienste werden sie davon abgelenkt. Dich, den verborgenen Gott, können sie daher nicht suchen.« 19 Der moderne, eher soziologische Religionsbegriff zeigt sich bei Cusanus, auch wenn er in anderen Worten wie secta oder lex ausgedrückt werden mag, jedoch kommt auch religiones im Plural vor – z.B. gleich in De pace fidei 1 n. 1 (h VII p. 4 Z. 2). Zum gemeinsamen Ursprung von Religion und Kultur nach Cusanus vgl. M. Thurner, »Cultura«. 18
42
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
c)
d)
praktisch nicht von Cusanus, der die eigentliche Herausforde rung anderswo sah. Er stritt die mögliche Legitimität eines Verteidigungskrieges nicht ab, aber interessierte sich viel mehr für die theoretische Bewältigung religiöser Pluralität. Ein anderer Weg sind Verhandlungen auf praktischer Ebene mit dem Ziel eines modus vivendi, woraus sich die Frage nach deren Gestaltung ergibt, d.h. nach gerechten Diskursbedingungen. In dieser Hinsicht hatte Ramon Llulls »Buch vom Heiden und den drei Weisen« (entstanden 1274–1276) schon mehr geboten als De pace fidei20. In längerer Perspektive wird sich hier die Entwicklung rechtsförmiger Beziehungen anschließen. Besonders interessant und lehrreich ist die bei Cusanus erkenn bare neue Bewertung: Die hartnäckige Pluralität der Religionen stellt über ihre akute Gefährlichkeit hinaus eine theoretische Herausforderung dar: Zuerst wird eine naive Überzeugtheit von der Wahrheit der eigenen, hergebrachten Religion erschüttert und jene in Frage gestellte Wahrheit muss nun erwiesen und erläutert (oder auch geläutert) werden. Als Antwort auf solche Relativierungserfahrungen gab es schon in der Antike und im Mittelalter die Folgerung, dass alle besonderen religiösen Über zeugungen unwahr seien oder wenigstens unerweisbar oder theoretisch irrelevant21. Damit ist die Aufgabe, welche ein gereif tes Religionsverständnis leisten muss, abgesteckt.
Für eine sachgerechte Interpretation ist bei jedem Autor, der sich mit interreligiösen Auseinandersetzungen befasste, zu fragen, welchen Zwecken seine Argumente dienen und welche Art von Diskurs er mit wem führen will. Bei Cusanus ist d) außergewöhnlich stark entwickelt, womit sich apologetisch-missionarische Argumente (a) mischen. Hinzu kommt jedoch eine weitere Dimension: 4.
Die jeweils gewählte Strategie zur Bewältigung religiöser Vielfalt muss intern, für die eigene Glaubensgemeinschaft begründet und plausibilisiert werden. Für die theoretische Auseinander setzung (3d) bedeutet das ein Mehrfaches:
Siehe M. Riedenauer, »Zur Bewältigung religiöser Differenz« und ders., Pluralität und Rationalität, S. 137–157. 21 Raimundus Lullus, eine erstrangige Inspirationsquelle für Cusanus, sah im Aver roismus einen solchen Skeptizismus, den er angreifen musste. 20
43
Markus Riedenauer
a)
b) c)
Gegen relativistische und agnostizistische Theorien muss vertei digt werden, dass die Wahrheit des Christentums vernünftig erweisbar ist und dass sich die inhaltliche Auseinandersetzung überhaupt lohnt. Die anderen Religionen müssen der eigenen in plausibler Weise zugeordnet werden, d.h. die Entwicklung einer integrativen Reli gionsphilosophie wird nötig. Dafür sind – gegen fundamentalistische Selbst(miss)verständ nisse – interne Differenzierungen erforderlich: – Das Verhältnis von Vernunft und Glauben muss geklärt werden. – Es braucht eine Differenzierung von dogmatischem Kern und von ihm aus graduell abgestuften Bereichen des Heils wissens, also eine »Hierarchie der Wahrheiten«, – dementsprechend eine Unterscheidung von nötiger Einheit mit Andersgläubigen (z.B. grundsätzlicher Monotheismus) und möglicher Verschiedenheit, die zu tolerieren ist. – Dahinter steht ein Bewusstwerden der kulturellen Dimen sion jeder Religion (wie oben genannt), was eine Ausdif ferenzierung ihrer moralischen und rituellen Regeln, die Unterscheidung von Lehre, Ethos und Kult, erlaubt. Letzt lich führt diese Entwicklung zu einer pluralitätsfähigen, reifen Religion mit der Entfaltung sozialethischer und recht licher Normen für die Eindämmung des Konfliktpotenzials aufgrund inhaltlicher religiöser Differenzen.
Diese von mir systematisierten Schritte der Problemwahrnehmung lassen sich im Leben und Wirken des Cusanus aufweisen, der seit seiner Mitwirkung am Konzil in Basel die Konkordanz nicht nur als Lebensaufgabe verstand, sondern sie auch philosophisch begründete als Einheit in der Vielheit und so seinen umfassenden Begriff von Frie den bildete22. Ohne die geschichtlichen Aspekte und die persönlichen Kontakte des Nicolaus mit Theologen, Philosophen, Mathematikern und Künstlern der Renaissance hier entfalten zu können23, ist auf die Bedeutung des humanistischen Hintergrunds hinzuweisen, welcher 22 Die cusanische pax beinhaltet ontologische, trinitätstheologische, christologische und praktisch-ethische Dimensionen. Siehe M. Riedenauer, Pluralität und Rationali tät, S. 163–164, zu Konkordanz und Konsens, ebd. S. 157–162. 23 Siehe ausführlich K. Flasch, Nikolaus von Kues, S. 197–247 und M. Riedenauer, »Spielraum«, sowie ders., »Perspektive«. Zum konfessionellen und humanistischen
44
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
in seinem Entwurf zur Herstellung religiöser Konkordanz durch Dia log impliziert ist. Die Erfahrung von innerchristlicher Pluralität und die wachsende Kenntnis von andersreligiösen Weltdeutungen und Lebensweisen führten zu einer Relativierungserfahrung. Zunächst machte die humanistische Geschichtsdeutung seit Petrarca die Wand lungen kultureller Phänomene bewusst24, zu denen auch religiöse Praktiken und Regeln zählen. Der dogmen- und kirchengeschicht lich sehr belesene Kanonist Cusanus partizipierte an dieser neuen Wahrnehmung diachroner Relativität25. Ihm war bewusst, dass sich der Glaube in seinen Formulierungen und äußeren Formen immer wandelt, sodass auch in der Gegenwart eine Vielfalt von Kulturen und Riten nicht überraschen kann. Ich nenne das eine synchrone Relativie rung durch Bewusstwerden der rituellen Pluralität, die sich auch in De pace fidei widerspiegelt26. Die im Humanismus neu akzentuierte Geschichtlichkeit menschlicher Existenz ermöglichte und erforderte, soziale und auch religiöse Verhältnisse nicht als einfach gegeben anzunehmen, sondern sie aktiv und kreativ zu gestalten. Das tat Nicolaus in seinem lebenslangen kirchenpolitischen Engagement (unabhängig von der Frage, wie dieses zu evaluieren ist). Geschichtlich Gegebenes konnte als eine Aufgabe gedeutet wer den. Wie ließ sich das aus christlicher Sicht verantworten? Nach einer typisch rinascimentalen Deutung von Genesis 1, 26–27 verwirklicht sich im geschichtlichen Gestalten nichts weniger als die Gottebenbild lichkeit des Menschen, der nun als ein partizipativ schöpferisches Wesen verstanden wurde, als ein betont lebendiges Bild des Schöpfers (viva imago Dei)27. Im Entwerfen von Deutungen und im Ausgestal ten auch von Religion antwortet demnach der Mensch auf einen erfahrenen Anspruch des Göttlichen, der in geschichtlichen Heraus forderungen gehört werden kann. In einer solchen spirituellen Sicht ist das Bemühen, geschichtliche Herausforderungen zu bewältigen, keine erzwungene Reparaturmaßnahme, sondern würdigt das ent sprechende Handeln als Teilhaben am göttlichen Tun. Hintergrund vgl. die diskurstheoretische Deutung von Schrödter, »Religion zwischen Diskurs und Gewalt«. 24 Vgl. H. Baron, »Das Erwachen«, A. Buck, Geschichtsdenken. 25 Vgl. seinen Prolog zu De concordantia catholica n. 2 (h XIV, p. 2) und seine Briefe an die Böhmen (h XV, p. 53–98). 26 Für eine ausführliche Darlegung muss auf M. Riedenauer, Pluralität und Rationa lität, S. 182–212 verwiesen werden. 27 Vgl. das Kosmographengleichnis aus Nicolai de Cusa, Compendium 8 n. 22–24 (h XI p. 17–20) und De visione Dei 11 (h VI, p. 15).
45
Markus Riedenauer
Entscheidend ist dann der nächste Schritt: Weil die menschlichen kreativen Antwortversuche indes grundsätzlich natürlichen und kul turellen Bedingungen unterliegen, sind sie je partikular eingeschränkt und benötigen zu ihrer Komplementierung und Vertiefung den Dialog mit anderen Interpretationen. So wird die geschichtlich erfahrene Relativierung der eigenen Weltdeutungen und Wahrheitsansprüche fruchtbar gemacht und aufgehoben in einer aktiven Relativierung: einer ausdrücklichen Ausarbeitung der Beziehung der Antworten auf den göttlichen Anspruch und der vergleichenden Bezugnahme auf die Antworten in anderen Religionen, also sowohl vertikal, auf das Ziel der Religion bezogen, als auch horizontal. Selbstkritische, aufgeklärte, dialogfähige und konkordanzoffene Religion weist nach Cusanus mehrere Bedingungen und Merkmale auf, die hier thesenartig zusammengefasst werden. 1. 2. 3.
4. 5.
6.
7.
46
Es ist unmöglich, Gott als unendlichen rational zu erfassen. Daraus folgt bereits, dass Dogmatismus und Fundamentalismus nicht zu rechtfertigen sind. Die Reflexion des Geistes auf seine innere Differenziertheit und eigene Aktivität als ein Antworten auf erfahrene Ansprüche stellt einen entscheidenden Zugang zum Göttlichen dar. Aus dem epistemologisch reflektierten Verständnis der Geistak tivität als entwerfend und konjektural ergibt sich die Notwendig keit des Dialogs zur Verbesserung der jeweiligen Entwürfe, zur Bereicherung und Erweiterung der Perspektiven. Der geschichtlichen Pluralisierungserfahrung ist nicht auszuwei chen – vielmehr ist die Relativität der eigenen Standpunkte und Sichtweisen anzuerkennen. Dies ist als eine theoretische Herausforderung aufzugreifen, ohne in einen der Vernunft widersprechenden Relativismus zu verfallen. Eine perspektivische Erkenntnistheorie und Metaphy sik leistet das und kann zu einer Offenheit für Wahrheit in fremden Traditionen führen. Das Gewaltpotenzial, das aus religiöser Vielfalt entsteht und die damit verbundene praktische Herausforderung sind wahrzuneh men. Die verschiedenen Ebenen der Bewältigung von Pluralität können sich ausdifferenzieren. Die menschliche Freiheit und Verantwortung bei der Gestaltung der kulturellen Welt sind zu sehen. Das bildet eine Bedingung dafür, dass Kultus, Moral und auch Recht sich aus dem kulturellreligiösen Gesamtphänomen ausdifferenzieren können.
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
8.
9.
Intern ist eine integrative Religionstheorie zu entwickeln, um das Verhältnis zu anderen Religionen und Kulturen auf der Basis der obigen Prinzipien für eine theoretische Neuorientierung unter pluralen Bedingungen zu klären. Maßnahmen zur Beförderung obiger Erkenntnisse und Deutun gen, also zu einer Aufklärung, sind zu entwickeln – zunächst für die eigene Glaubensgemeinschaft und Kultur, in weiterer Folge im Dialog mit anderen.
4. Philosophische Grundlagen reifer Religion: Diskursivität, Konjekturalität und Perspektivität endlicher Erkenntnis nach Cusanus Bisher wurde skizziert, wo und wie religiöse Pluralität und ihre praktische Gefährlichkeit philosophisch relevant wird. Ferner wurden die Herausforderung für die theoretische Vernunft und der mögli che Beitrag des Cusanus verortet sowie der geistesgeschichtliche Hintergrund am Beginn der Neuzeit beleuchtet. Nun ist in den wichtigsten Zügen die Frage zu beantworten, wie Cusanus seinen Versuch, religiöse Pluralität theoretisch zu bewältigen, ausarbeitet. Das Fundament seines Denkens bildet seine philosophische Theolo gie in der Tradition negativer Theologie. Seit De docta ignorantia geht er von dem Axiom der Unendlichkeit und Inkommensurabilität des Absoluten oder Gottes aus28: Die Wahrheit selbst als Ursprung aller möglichen wahren Aussagen, der absolute Maßstab für alles relative, mehr oder weniger Wahre, transzendiert endliches Begreifen. Von daher sind grundsätzlich alle (auch religiösen) Explikationen als endliche defizitär. Zugleich erfährt der Mensch ein Streben nach Wis sen und Weisheit und – unbestritten im Bereich der Welterkenntnis – die Möglichkeit von Erkenntnisfortschritten. Es ist ja prinzipiell möglich, bessere von schlechteren Theorien zu unterscheiden. Dieses Fortschreiten im Erkennen hat diskursiven Charakter, entsteht im Durchlaufen (so die wörtliche Bedeutung von discursus) verschiede ner Perspektiven. So wie beim sinnlichen Sehen ein und dasselbe von verschiedenen Blickwinkeln aus verschieden erscheint, während »Das Unendliche als Unendliches ist unerkennbar, da es sich aller Vergleichbarkeit entzieht.« (Nicolai de Cusa, De docta ignorantia I,1 n. 3 Z. 2–3; vgl. Kap. I,3 n. 9–10).
28
47
Markus Riedenauer
jede solchermaßen eingeschränkte Ansicht an der Wahrheit des Gese henen partizipiert, ohne sie erschöpfend zu repräsentieren, so ist es auch beim Einsehen des Verstandes29. Das sukzessive Durchlaufen verschiedener Standpunkte erlaubt, die Einsicht vergleichend (kom parativ) zu verbessern. Weil wir erfahren, dass Erkenntnis komparativ besser oder schlechter sein kann, ist Wahrheit also graduiert30. Sie ist immer relativ, aber in einem bestimmten Sinn: bezogen auf die Sache und auf die vorauszusetzende absolute Wahrheit und von ihr in Anspruch genommen. Cusanus fasst das in seinem epistemologischen Zentralbegriff der coniectura, meist mit Mutmaßung übersetzt; »Entwurf « erscheint mir noch überzeugender31. Endliches Erkennen hat die Merkmale des kreativen Entwurfscharakters, der Diskursivität und Perspektivität, dadurch der Vorläufigkeit und Unvollständigkeit – und zwar jegliches Erkennen, nicht nur die Gotteserkenntnis. Eine solche Mutmaßung meint weder bloßes Vermuten noch rationalistisches Feststellen auf grund der falschen Annahme, dass Begriffe die Wirklichkeit erfassen könnten, sondern einen Vollzug, in dem trotz der Partikularität und Vorläufigkeit seines Ergebnisses der Anspruch der Wahrheit selbst wahrgenommen und beantwortet wird. Die Metaphysik der Perspektivität, die Nicolaus nicht zufälligerweise im Jahrhundert der malerischen Zentralperspektive entwickelt32, begründet den sukzes siven und dialogischen Charakter jeder endlichen Erkenntnis und ihre (vertikale und horizontale) Relativität im vollen Wortsinn. Dem im dynamischen Bezug auf Wahrheit erfahrenen Anspruch im göttlichen 29 D. Monaco wendet die in der cusanischen Metaphysik zentrale Dialektik zwischen dem Einen und dem Vielen (complicatio/explicatio), zwischen der einen Wahrheit und ihren vielen Expressionen auf den interreligiösen Dialog an und geht von derselben Grundannahme aus wie meine Interpretation: »Cusanus‘ position towards interfaith dialogue can only be fully grasped if it is thought of in the wider context of his philo sophy« (D. Monaco, Nicholas of Cusa, S. 88). 30 Von daher ist es grundsätzlich möglich, religiöse Deutungen zu kritisieren, wie es Nicolaus vor allem in der Cribratio Alcorani tut, worin man mit A. A. Akasoy (»Zur Toleranz«, S. 113) R. Forsts »Zurückweisungs-Komponente« der Toleranz erkennen kann. 31 Vgl. die Entfaltung dieses im zweiten philosophisch-theologischen Hauptwerk De coniecturis (h III) erklärten Zentralbegriffs in M. Riedenauer, Pluralität und Rationa lität, S. 272–287. 32 Siehe die im engen Zusammenhang mit De pace fidei verfasste Schrift »Vom Sehen Gottes« (Nicolai de Cusa, De visione Dei; h VI); hierzu u.a. N. Herold, Menschliche Perspektive und Wahrheit, M. Riedenauer, »Perspektive« und ders., Pluralität und Rationalität, S. 287–329.
48
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
Logos kann nur auf solchermaßen diskursive Weise entsprochen wer den. Das trifft insbesondere auf die mittlere von drei Stufen mensch licher Erkenntnis- oder Unterscheidungsfähigkeit (vis discretiva) zu: die ratio, was meist und treffend mit Verstand übersetzt wird. Von ihr unterscheidet Cusanus die vorausgesetzte Ebene sinnlichen Wahr nehmens (sensus). Der Verstand verarbeitet zunächst die Sinneswahr nehmung und korrigiert ihre Defizite mithilfe der Kategorien und der Logik, indem er vergleichend Begriffe bildet, dann Urteile und Folgerungen. Doch beide transzendiert der intellectus (die Vernunft), womit Nicolaus die klassische Unterscheidung von dianoia und nous ausarbeitet: Der Intellekt dynamisiert die rationale Erkenntnis durch Einsicht in ihre Grenzen. Er reicht über den Geltungsbereich der Logik hinaus in den Bereich der Koinzidenz der Gegensätze im Unendlichen; er ist offen für die coincidentia oppositorum (wie vor allem in De docta ignorantia I entwickelt), womit alle rationalen Konstrukte und Entwürfe, wie notwendig und richtig sie auf ihrer Ebene auch sind, noch einmal relativiert werden33. Er kann damit den höchsten, an sich nicht erkenn- und aussagba ren göttlichen Bereich, »berühren«. Diese sehr häufige Metapher will eine Relation des menschlichen und des göttlichen Geistes bezeichnen jenseits des kategorialen Begreifens mit seiner Eingeschränktheit; »Berühren« ist eher ein Ergriffenwerden oder Erleuchtetwerden in einer Schau. Dieser Transzendenzbezug ist dem Menschen als Geist wesen wesentlich und fundiert seine angeborene Religiosität34. Diese intellektuale Dimension menschlicher Einsichtsfähigkeit erlaubt dann deren Selbstkritik, zuhöchst die docta ignorantia, das Wissen um die Grenzen des Wissbaren und des Verstandes von seinen Funktionsbedingungen her. Sie relativiert alle Aussagen der affirmativen Theologie, ohne sie zu vergleichgültigen und ohne alle Wahrheitsansprüche pauschal für uneinlösbar zu erklären35. Auch W. Heinemann erläutert des Cusaners »Konzept eines intellektuellen Reli gionenfriedens« auf der Grundlage seiner (Ontologie und) Erkenntnistheorie, vgl. Einheit in Verschiedenheit, vor allem S. 145–163. 34 Vgl. zur connata religio: Nicolai de Cusa, Idiota de mente 15: h V2 n. 159; De coniecturis II,15 n. 147. 35 Vgl. Nicolai de Cusa, De docta ignorantia I,24, n. 78 – I,25 n. 84, wo chaldäische, hebräische und römische Gottesnamen ausdrücklich gewürdigt werden, bevor in I,26 n. 86 festgestellt wird, dass jede Gottesverehrung mit affirmativen Gottesnamen anfangen müsse, aber von einem Glauben in Verbindung mit docta ignorantia geleitet 33
49
Markus Riedenauer
Aus dieser Erkenntnistheorie folgt, dass religio als menschlicher Transzendenzbezug eine »Außenseite« hat in allen geschichtlichen religiones mit ihrer Variabilität, mit ihren moralischen, sozialen, prak tischen, emotionalen und kognitiven Aspekten, welche durch Über schreiten der rein rationalen Ebene kritisiert und aufgeklärt werden können. Die cusanischen Vorschläge zur interreligiösen Konkordanz in De pace fidei verstehe ich nun als ein Experiment der Anwendung von intellectus-Prinzipien auf den rationalen Diskurs aufgrund der Einsicht in den tieferen (oder höheren) Grund der Notwendigkeit zur Relativierung aller Verstandeskategorien. Das angesprochene Streben des Menschen nach Erkenntnis, das Nicolaus letztlich mit dem Streben nach Glück und Heil gleichsetzt, die Dynamik des geistigen Ausgreifens des lebendigen Bildes Gottes nach dem unend lichen Urbild, darf von konkreter Religion ebensowenig eingeschränkt werden wie die unendliche Lebendigkeit und Größe Gottes selbst. Unter Menschen, die demgegenüber in der Religion vornehmlich eine handhabbare und endgültige Anweisung für ihr geistiges und soziales Leben suchen, die sich an Formulierungen festmachen und sich absichern wollen, ist keine Konkordanz möglich – kein Friede im höheren Sinn. Eine Stärke des cusanischen Religionsverständnisses ist, dass er in den diversen Religionen als kulturellen Gebilden einen Kern von Religiosität annimmt, der im Menschen gründet, der als antwortendes und kreativ gestaltendes Wesen verstanden wird. Dazu gehört sein Streben nach umfassendem Gelingen des Lebens oder nach Glück und seine Wahrnehmung eines göttlichen Anspruches in der Vernunft. Dessen Deutung als logos, der sich in der gesamten Wirklichkeit ausspricht, auch in der eigenen Geisterfahrung (mens) und der reli giösen Tradition sowie in geschichtlichen Herausforderungen, bricht naturreligiöse Identifikationen des Göttlichen mit Naturphänomenen auf, verhindert aber zugleich einen unvernünftigen Offenbarungs positivismus oder gar fundamentalistische Selbstmissverständnisse. Die Deutung des Vernunftanspruchs als universaler Logos vermittelt Immanenz und Transzendenz des Göttlichen in einer Weise, die Raum schafft für eine Würdigung der menschlichen Antworten, die theoretisch und praktisch erfolgen. Soweit diese rationalen und sym werden müsse: »cultura dei, qui adorandus est ›in spiritu et veritate‹, necessario se fundat in positivis deum affirmantibus ... semper culturam per fidem, quam per doctam ignorantiam verius attingit, dirigendo«.
50
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
bolischen Explikationen des Bezogen- und Angesprochenseins als frei gedacht werden müssen, eröffnet sich eine dialogische Deutung allen menschlichen Denkens und Handelns – und Raum für verantwortli che Gestaltung auch der interreligiösen Verhältnisse. Im Unterschied zum heute gängigen Begriff von Religionen, der dogmatisch und soziologisch recht starre Gebilde meint, begreift Cusanus sie zuerst als dynamische Weltdeutungen, die sich zu erkenntniskritisch aufgeklärten, dem Absoluten angemesseneren, zu komparativ wahreren Einsichten fortentwickeln können und sollen. Dem dient die visionäre Religionskonkordanz von De pace fidei, welche damit die Funktion einer regulativen Utopie erfüllt.
5. Religionsphilosophische Folgerungen für interreligiöse Beziehungen und Auseinandersetzungen Im ersten Teil dieses Beitrags deutete sich an, welche Aufgaben sich heute jedem religiösen Selbstverständnis stellen – zunächst eher von außen, durch geschichtliche Entwicklungen und Erfahrungen. In den beiden folgenden Teilen zeigten sich Ansatzpunkte und Res sourcen am Anfang der Neuzeit aus einer humanistisch inspirierten, christlichen Perspektive. Die philosophischen Fundamente der cusa nischen Religionstheorie wurden im vierten Teil skizziert; aus diesen erkenntnistheoretischen Grundlagen ergaben sich Kriterien für reife Religion und Prinzipien für vernünftige interreligiöse Auseinander setzungen. Der Weg von solchen philosophischen Überlegungen zu interreligiöser Verständigung und letztlich interkulturellem Frieden auf Erden scheint weit zu sein. Die Vision von De pace fidei endet denn auch damit, dass zunächst im Bereich des religionsphilosophischen Verstehens der Voraussetzungen aller Religionen, in coelo rationis die prinzipielle Konkordanz aller Religionen festgestellt wird36 – die nötige hermeneutische Durcharbeitung der Quellen der verschiede nen Traditionen sowie die konkrete Umsetzung der interreligiösen Nach den vom Visionär geschilderten Erörterungen der 17 Weisen über den in allen Religionen vorausgesetzten einen Glauben, die hier nicht Thema sind (siehe die Zusammenfassung in: M. Riedenauer, Pluralität und Rationalität, S. 75–90), schreibt Cusanus: »Es wurde also im Himmel der Vernunft auf die geschilderte Weise Eintracht unter den Religionen beschlossen« (De pace fidei 19 n. 68, h VII p. 62 Z. 19 f.; Über setzung von Haubst), wobei ratio eher mit Verstand zu übersetzen wäre. 36
51
Markus Riedenauer
Harmonie wird auf der letzten Seite nur angedeutet (ebenso wie die Notwendigkeit sozialer Verbesserungen zur Stärkung der religiö sen Mündigkeit am Anfang von De pace fidei)37. Doch kann das Werk so verstanden werden, dass es den Ansatz aus der eigenen Religion heraus und für sie vorführt (siehe oben im Teil 3 den vierten Schritt)38. In konsequenter Weise verleugnet Cusanus also nicht seine eigene spezifisch christliche Perspektive, will sie aber ausweiten und aufklären. Modell 4 veranschaulicht diesen Prozess einer religionsphilosophischen Öffnung und Erweiterung in Richtung auf das inkommensurable Unendliche, das Unaussprechliche und Uneinholbare, worauf sich die ursprünglichen Gründungsintuitionen und mystischen Erfahrungen beziehen. Das ist verbunden mit einem Transparentwerden der zuvor klar gezogenen Außengrenzen und impliziert eine relative Selbstrelativierung. Das Wesen des cusani schen Entwurfs besteht in einer solchen Entgrenzung der eigenen Explikationen, einer Selbstrelativierung im Sinn einer vertieften Bezugnahme auf das göttliche Geheimnis und Selbsttranszendierung partikularer christlicher Interpretationen.
37 Nicolai de Cusa, De pace fidei 19 n. 68, siehe auf der Grundlage der Problembe schreibung in De pace fidei 1 n. 4 oben Anmerkung 18. 38 D. Monaco konstatiert auch, dass der partikulare, christliche Ausgangspunkt von De pace fidei sowohl dem Charakter des Dialogs als auch der cusanischen Epistemo logie entspricht: »Dialogue can only be achieved when it originates from a concrete and resolute position« (Nicholas of Cusa, S. 92). »Cusanus‘ perspective, therefore, is the Christian answer to interfaith dialogue. The addressees of his work are Christians« (ebd.).
52
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
Modell 4
Was sich aus seiner Religionstheorie an Merkmalen für eine reife und aufgeklärte Religion ergibt, versucht Nicolaus durch religionsphi losophische Reformulierung (und teilweise durchaus auch kritische Selbstrelativierung39) des christlichen Glaubens zu befördern. Es entspricht genau seiner Erkenntnismetaphysik, dass er nicht einen Standpunkt prätendiert, der über jeder besonderen Perspektive läge, weil es innerhalb des Ganzen keinen Blick auf das Ganze geben kann, der nicht von der je spezifischen Binnenperspektive bestimmt wäre. Niemand kann darauf hinsehen, indem er von der Perspektivität seines Blickwinkels absieht. Dabei entwickelt Cusanus in Antwort auf die geschichtliche Pluralisierungs- und Relativierungserfahrung ein erkenntnistheoretisches und metaphysisches Paradigma, das Wahr heitsansprüche perspektiviert und relativiert, ohne sie zu vergleich gültigen, für irrelevant oder ganz uneinlösbar zu erklären. Damit ist
39 Vgl. De pace fidei zum höchsten christlichen Glaubensgeheimnis der Trinität: »Gott als Schöpfer ist dreifaltig und einer. Als unendlicher ist er weder drei noch einer noch irgendetwas von dem, was gesagt werden kann. Denn die Namen, die Gott zugeteilt werden, werden von den Geschöpfen genommen, da er selbst in sich unaussprechlich und über allem ist, das genannt oder gesagt werden kann« (Nicolai de Cusa, De pace fidei 7 n. 21). »Manche nennen die Einheit ›Vater‹, die Gleichheit ›Sohn‹ und die Verknüpfung ›Heiliger Geist‹, da jene Benennungen, auch wenn sie nicht im eigentlichen Sinne gelten, die Dreifaltigkeit dennoch zutreffend bezeichnen« (De pace fidei 8 n. 24), ähnlich schon De docta ignorantia I,24 n. 80.
53
Markus Riedenauer
bereits exklusivistischen und gewaltträchtigen religiösen Selbstmiss verständnissen der Boden entzogen. Das Bemühen um Verständigung und Konkordanz wird vor allem von innen heraus begründet, aus dem vernünftigen Selbstver ständnis der Religion, mit allen ihren Vollzügen auf einen nicht zuerst erhobenen, sondern erfahrenen Absolutheitsanspruch (im genitivus subjectivus) zu antworten – in konsequenter Anerkennung der epistemologischen Grundsituation perspektivischer Einschrän kung. Ich sehe hierin zwei transzendentale Relativierungen: Die Entgrenzung (interminatio) des Verstandes durch die Vernunft und die Relativierung des Ausgreifens der Vernunft selbst durch das sie herausfordernde Absolute. Durch die Konfrontation mit konkurrie renden Weltdeutungen wird eine Religion zu einer Reifung herausge fordert, die ihre Identität zu vertiefen und zu erweitern geeignet ist. Eine Abgrenzung verschiedener kulturell-religiöser »Zivilisationen« in voneinander zu isolierenden geistigen Biotopen erscheint nicht nur als utopisch (heute mehr denn je), sondern auch als dem geschichtli chen Wesen von Kultur und Religion unangemessen. Das Phänomen der Religion kann in Analogie zur persönlichen Identität eines Menschen interpretiert werden, die sich ebenso dyna misch entwickelt durch Konfrontation, Abgrenzung und Assimila tion. Das vermeidet einen Grundfehler, der Samuel Huntingtons Pro gnose eines »clash of civilizations« zugrunde liegen dürfte, während eine Religion letztlich kein Subjekt sein kann, da es nur das mensch liche Individuum ist, das religiös ist und in diesem Sinn Religion hat. Hier zeigt sich die Stärke des klassischen Begriffs von religio als Pflege des persönlichen Transzendenzbezugs, welchen Nicolaus als einer der ersten mit der Wahrnehmung von Religionen als sozio-kulturell und inhaltlich-dogmatisch identifizierbaren Einheiten verbindet. So wie nun nach De docta ignorantia kein eingeschränktes Individuum die Maximität der Spezies-Potenz erfüllen kann40, wird auch keine fak tische Religion vollendet sein und benötigt die Auseinandersetzung mit den anderen Ausdeutungen der Wirklichkeit zu ihrer Weiterent wicklung. Diese Notwendigkeit des Diskurses ist begründet in dem Charakter menschlicher, d.h. endlicher konjekturaler und perspektivi scher Vernünftigkeit, immer auf dem Weg zu sein. Religion impliziert eine Gesamtdeutung der Wirklichkeit aus einer bestimmten Perspektive, die aufgrund ihres absoluten »Gegen 40
54
Siehe Nicolai de Cusa, De docta ignorantia III (h I), n. 184.
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
standes« a fortiori prinzipiell konjekturalen Charakter hat. Als Inter pretation ist sie weder eine idiosynkratische oder willkürliche Kon struktion noch eine erschöpfende oder endgültige Ausformulierung. Ihre integrative Kraft, die sich in geschichtlichen Herausforderungen zu bewähren hat, ist Kriterium ihrer Reife. Das schließt begründete Kritik anderer Deutungen (vgl. die Cribratio Alcorani) und Selbstkri tik ein. Nicolaus erkannte, dass in der geschichtlichen Konfrontation mit anderen Religionen eine Aufgabe lag, die zu einem höheren und integrativeren Selbstverständnis herausforderte. Dies wollte er für seine Religion leisten. Zu kritisieren ist, dass sich kaum eine Andeutung findet, dass auch umgekehrt das Christentum durch eine positive, integrative Deutung in anderen religiösen Paradigmen gewinnen können müsste, dass so tatsächlich weitere Aspekte des in ihm Angelegten im Diskurs zum Vorschein kommen könnten. Sein epistemologisch fundamentierter Inklusivismus geht nicht zu einem mutuellen Inklusivismus41 weiter, bildet aber auch dafür eine ver nunfttheoretische Grundlage. Die philosophische Selbstrelativierung ermöglicht einen realen Dialog mit anderen Religionen, sofern sie ähnliche Prozesse der Übersetzung und Transformation ihrer wahren Gehalte durchlaufen, sowie m.E. auch eine begründete Anerkennung von späteren rechtlichen Strukturen jenseits der mittelalterlichen Verflechtung von Kirche und Reich. Soweit auch andere Religionen Ähnliches leisten, wie es Nicolaus für die seine unternahm, entsteht im Überschneidungsbereich der erweiterten und aufgeklärten religiö sen Horizonte ein Dialograum: Modell 5 symbolisiert diese mögliche Überschneidung der »Vorhöfe«, jenseits partikularer Verständnisund Ausdrucksweisen im Kern, welche den Eindruck von Unverein barkeit erwecken:
41
Wie von R. Bernhardt entwickelt in »Prinzipieller Inklusivismus«.
55
Markus Riedenauer
Die Beschränkung eines derartigen Dialogs gemäß Modell 5 könnte freilich sein, dass sich so keine Gemeinsamkeit in den engeren Kernbereichen der verschiedenen Religionen (wie das Modell 3 es darstellt) ergibt. Das kann innerhalb einer Tradition ein Akzeptanz problem verursachen und den praktischen, friedensethischen Zweck des Dialogs sabotieren. Außerdem stellt sich die Frage, ob eine solche Erweiterung nach Modell 4 nicht wiederum eine spezifisch christliche – oder »europäische« – Dynamik darstellt, die von anderen Religio nen nicht in analoger Weise gewünscht, akzeptiert und vollzogen würde. Doch darf das zunächst einmal der faktischen Entwicklung überlassen bleiben, möglicherweise auch einer langfristig überzeu genden »Sogwirkung« eines solchen Vorgangs. Ein Vertreter eines aufgeklärten Christentums könnte dieses Modell interreligiöser und interkultureller Begegnung aus seiner Sicht als gemeinsame Basis, die eines Versuches wert wäre, vorschlagen, und so wird Nicolaus hier verstanden. Er beschränkt sich allerdings nicht darauf, sondern sein Versuch scheint mir letztlich auf ein erweitertes integratives Modell zuzusteu ern, das Modell 6 skizzieren möchte: Der Dialog ist sowohl in einem Überschneidungsbereich der theologischen Positionen selbst (gemäß Modell 3) als auch in einem Überschneidungsbereich der erweiterten Horizonte (gemäß Modell 5) zu entwickeln. Als Ziel könnte eine gemeinsame Annäherung an den größtmöglichen Horizont, das alles transzendierende maximum selbst, definiert werden. Da dies aller dings nach Cusanus unendlich und unnennbar ist (und überdies mit dem nach De docta ignorantia II,12 n. 162 dezentrierten Zentrum des Universums zusammenfällt), geht der göttliche Horizont über
56
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
die bildhafte Darstellbarkeit definitiv hinaus. Die anzustrebende wachsende Überschneidung sowohl von inhaltlichen Kernbereichen als auch von kritischen philosophischen Reformulierungen macht auch den möglichen Gewinn eines solchen Prozesses für die eigene Religion anschaulich. Dabei wird nicht nur das Eigene im Anderen wiedergefunden, sondern werden idealerweise auch neue Ansichten dessen, wovon man sich gemeinsam in Anspruch genommen sieht, gewonnen. Daraus ergibt sich eine wechselseitige Bereicherung und Vertiefung – über die Annahmen des Nicolaus hinaus.
Modell 6
Zu bemerken ist, dass Cusanus keine Antwort gibt auf die spätere, seit dem 19. Jahrhundert virulent werdende Frage nach dem Atheismus und nach Dialogmöglichkeiten zwischen Atheisten und Gläubigen. Man könnte einwenden, dass das eine andere Frage als die nach interreligiösen Auseinandersetzungen sei, allerdings ist auch der Kampf gegen jedwede Religion potenziell gewaltträchtig (wie der Staatsatheismus ab 1917 in vielen Ländern bewies). Ein Zusammen hang besteht schließlich mindestens darin, dass religiöser Streit und Gewalt ein Motiv für Atheismus waren und sind. Religion ist die explizierte Weise, wie je ich als Mensch, d.h. als endliches Vernunftwesen, gegründet in natürlicher Zentralität mit einem gemeinschaftlich vermittelten Verständnishorizont und in partikular universalisierendem Ausgriff mich aus dem Ganzen der Wirklichkeit und ihrem Grund verstehe, indem ich mich dazu verhalte. Religionen sind zugleich geschichtlich eingebettete, sprach
57
Markus Riedenauer
lich und symbolisch, d.h. auch rituell vermittelte Interpretationen von bestimmten, selbst geschichtlich ereigneten Erfahrungen, von denen ein Wahrheitsanspruch ausgeht. Notwendigerweise sind sol che Explikationen der ratio kategorial beschränkt, als Fest-Stellungen des wesentlich Dynamischen und Akthaften, das im intellectus zu ständigem Transzendieren und Integrieren aufruft. Religion, sowohl als persönliche religio wie auch als kulturelles Gebilde, besteht gera dezu in dieser hermeneutischen Konkretion und Vermittlung. Ein Bestand an Glaubenswahrheiten, sprachlich fixiert und dogmatisch formuliert, ist als Objektivation eines solchen kreativen Deutungs prozesses selbst wieder Ausgangspunkt für die unvertretbar eigene Verarbeitung. Die in ihnen enthaltene Wahrheit will bewahrheitet und bewährt werden in einem unablässigen Ringen: in (kreativem, nicht nur reproduktivem) Verstehen des Gegebenen, im Ausdruck und Leben des Verstandenen und Erfahrenen unter dessen Anspruch. Damit wird Religion überhaupt dialogisch verstanden, als fortwäh rendes Angesprochenwerden und Antworten. In dieser fundamenta len Dialogizität von Religion an sich hat der interreligiöse Diskurs seinen nicht politisch oder von äußeren Ereignissen oktroyierten, sondern ureigenen Grund und seinen Raum. Der friedliche Dialog ist die kultivierte Form des Widerspruchs gegen sich aufspreizende, unaufgeklärte, mitunter fanatisch univer salisierende Geltungsansprüche. Sich real zusammenzusetzen, um sich mit Wortgewalt auseinanderzusetzen, ist die einzige Chance für endliche Wesen, die aus einer Position natürlicher Zentralität heraus einen unabschließbaren Ausgriff der Vernunft vollziehen, um die integrale Wahrheit, derer Menschen immer nur perspektivisch ansichtig werden können, nicht von vornherein zu verfehlen. Ja, mehr noch, um die Wahrheit gewaltfrei in der Praxis zu verwirklichen.
6. Zusammenfassung 1. Zur Relevanz und religionstheoretischen Verortung des Themas Die Vielfalt der Religionen und deren Konfliktpotenzial sind ein Thema für die praktische Philosophie, aber auch für die theoretische Philosophie: wegen unvereinbar erscheinender Wahrheitsansprüche und Weltbild-formender Grundannahmen der Religionen. Die glo
58
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
bale kulturelle Entwicklung der jüngsten Zeit deplausibilisiert einfa che Säkularisierungstheorien und radikalisiert die Herausforderung der Philosophie durch gewaltträchtige religiöse Pluralität. Religionstheologische Modelle können auch die philosophische Problematik von religiöser Pluralität und von Versuchen, diese zu ordnen, veranschaulichen und zugleich helfen, die zugrundeliegenden Annahmen zu reflektieren. Exklusivistische, radikal inklusivistische und rein vernunftreligiöse Zuordnungen erscheinen heute nicht mehr plausibel. Am Anfang der Moderne sah Nicolaus Cusanus schon die wesentlichen Probleme interreligiöser Beziehungen und nahm die Herausforderung der Vernunft an, darum können aus seinem Werk Kriterien für pluralitätssensible Religionstheorien und reife Formen von Religion gewonnen werden.
2. Religionspluralität – spezifisch neuzeitliche Herausforderungen De pace fidei, des Cusaners Lösungsvorschlag für die gefährliche Spannung zwischen Islam und Christentum, will – weit über den geschichtlichen Anlass hinausgehend – eine inhaltliche Konkordanz aller Religionen entwickeln, welche religiöse Gewalt unterbinden soll. Ein ambitionierter Diskurs über religiöse Wahrheit scheint weit weg zu sein von gegenwärtig plausiblen und verbreiteten Vorannahmen, jedoch zeigen sich einige Parallelen zwischen der aktuellen Situation und dem cusanischen Verständnis von Religion. Dieses reflektiert die vernunfttheoretische Spannung zwischen geschichtlich-kultureller Partikularität und universalem Anspruch von Religionen.
3. Zu Problemwahrnehmung, möglichen Strategien und humanistisch inspirierten Ansätzen bei Cusanus Nötige Schritte zur Bewusstwerdung der Problematik religiöser Pluralität und dem entsprechende mögliche Bewältigungsstrategien werden zuerst systematisiert, dann in Bezug zum humanistischen Hintergrund und Wirken des Nicolaus gesetzt. Zentral ist hierbei das Bewusstwerden geschichtlicher Wandelbarkeit diachroner und syn chroner Pluralität sowie menschlicher Gestaltungsverantwortung, die bei Cusanus als Teilhabe an göttlicher Kreativität gedeutet wird.
59
Markus Riedenauer
4. Philosophische Grundlagen reifer Religion: Diskursivität, Konjekturalität und Perspektivität endlicher Erkenntnis nach Cusanus Wesentlich für die Interpretation des religiösen Konkordanzprojekts in De pace fidei ist das cusanische Verständnis menschlicher Erkennt nis als Fortschreiten im Entwerfen: coniectura bedeutet, dass der Verstand Begriffe, Urteile und Theorien bildet, welche als perspekti vischer und diskursiver Natur erkannt und relativiert werden von der höheren Einsichtsfähigkeit der Vernunft. Diese Relativierung ver dankt sich einem Bezug des menschlichen Geistes zum unendlichen Göttlichen, was auch alle religiösen Explikationen dynamisiert und verbesserbar macht. Daraus lassen sich Kriterien und Merkmale reifer Religion ableiten.
5. Religionsphilosophische Folgerungen für interreligiöse Beziehungen und Auseinandersetzungen De pace fidei wird interpretiert als religionsphilosophische Refor mulierung und Selbstrelativierung des Christentums im Sinn einer vertieften Bezugnahme auf das unaussagbare göttliche Geheimnis. Durch eine doppelte transzendentale Relativierung entsteht ein Dia lograum mit anderen Religionen im Bereich dieses transzendierenden Transzendenzverständnisses, sofern jene sich auf ähnliche Aufklä rungs- und Entgrenzungsprozesse einlassen. Unbeschadet der Möglichkeit, dass Religionen auch über ihre Kerngehalte einen Dialog führen, wird im Überschneidungsbereich derartiger Religionsphilosophien eine konkordante und folglich nicht-exklusivistische, anti-fundamentalistische, Gewalt delegitimie rende Deutungsmöglichkeit religiöser Pluralität eröffnet. Die ver schiedenen Problematiken von Religionstheorien, die exklusivistisch oder einseitig inklusivistischer Natur sind, oder die unvermittelt rationalistisch universalisieren, werden überwindbar.
Literaturverzeichnis Akasoy, A. A., »Zur Toleranz gegenüber dem Islam bei Lullus und Cusanus«, in: E. Bidese, A. Fidora, P. Renner (Hg.), Ramon Llull und Nikolaus von Kues, S. 105–124
60
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
Baron, H., »Das Erwachen des historischen Denkens im Humanismus des Quat trocento«, in: Historische Zeitschrift 147, (1933), S. 5–20 Bernhardt, R., »Prinzipieller Pluralismus oder mutualer Inklusivismus als her meneutisches Paradigma einer Theologie der Religionen?«, in: P. Koslowski (Hg.), Die spekulative Philosophie der Weltreligionen, Wien: Passagen 1997, S. 17–31 Bidese, E., Fidora, A., Renner, P. (Hg.), Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der Toleranz, Turnhout: Brepols 2005 Blanks, D. R., Frassetto, M. (Hg.), Western Views of Islam in Medieval and Early Modern Europe. Perception of Other, New York: St. Martin’s 1999 Bocken, I., »Toleranz und Wahrheit bei Nikolaus von Kues«, in: PhJB 105 (1998), S. 241–266 —. (Hg.), Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicholas of Cusa, Leiden– Boston: Brill 2004 Buck, A., Das Geschichtsdenken der Renaissance, Krefeld: Scherpe 1957 Euler, W. A., Unitas et Pax. Religionsvergleich bei Raimundus Lullus und Nikolaus von Kues, Altenberge: Oros, 21995 —, »Cusanus‘ Auseinandersetzung mit dem Islam«, in: I. Mandrella (Hg.), Niko laus von Kues, S. 72–85 Flasch, K., Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung. Vorlesungen zur Einführung in seine Philosophie, Frankfurt a. M.: Klostermann 1998 Forst, R., Toleranz im Konflikt. Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstritte nen Begriffs, Frankfurt: Suhrkamp 2003 Habermas, J., Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophi sche Essays, Frankfurt: Suhrkamp 1997 Haubst, R. (Hg.), Der Friede unter den Religionen nach Nikolaus von Kues. Akten des Symposions in Trier vom 13. bis 15. Oktober 1982 (Mitteilungen und For schungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 16), Mainz: Grünewald 1984 (=MFCG 16) Heinemann, W., Einheit in Verschiedenheit. Das Konzept eines intellektuellen Reli gionenfriedens in der Schrift »De pace fidei« des Nikolaus von Kues, Altenberge: CIS 1987 Herold, N., Menschliche Perspektive und Wahrheit. Zur Deutung der Subjektivität in den philosophischen Schriften des Nikolaus von Kues, Münster: Aschen dorff 1975 Jaspers, K., Nicolaus Cusanus, München: Piper 1964 Huntington, S., The Clash of Civilizations, New York 1996 Koslowski, P. (Hg.), Die spekulative Philosophie der Weltreligionen, Wien: Passa gen 1997 Küng, H., »Weltfrieden – Weltreligionen – Weltethos«, in: K.-J. Kuschel (Hg.), Christentum, S. 155–171 Kuschel, K.-J. (Hg.), Christentum und nichtchristliche Religionen, Darmstadt: WBG 1994 Mandrella, I. (Hg.), Nikolaus von Kues (Das Mittelalter Bd. 19/1), Berlin: de Gruyter 2014
61
Markus Riedenauer
Meinhardt, H., »Konjekturale Erkenntnis und religiöse Toleranz«, in: MFCG 16, S. 325–332 Meuthen, E., »Der Fall von Konstantinopel und der lateinische Westen«, in: MFCG 16, S. 35–60 Monaco, D., Nicholas of Cusa: Trinity, Freedom and Dialogue, Münster: Aschen dorff 2016 Moritz, A., »Die Andersheit des Anderen – noch einmal zum Problem der Tole ranz in Nikolaus von Kues’ Dialog De pace fidei«, in: Litterae Cusanae 6/1 (2006), S. 1–17 Nicolai de Cusa, Opera omnia, iussu et auctoritate Academiae Litterarum Hei delbergensis ad codicem fidem edita, Leipzig-Hamburg: Meiner 1932 ff. (=h mit Bandangabe in römischer Ziffer, p. =Seite, n. = Nummer, Z. = Zeile) Nikolaus von Kues, De pace fidei. Der Friede im Glauben, übersetzt von R. Haubst, Trier: Paulinus 32003 —, Vom Frieden zwischen den Religionen, hgg. von Klaus Berger und Christiane Nord, Frankfurt: Insel 2002 Ramon Lull, Das Buch vom Heiden und den drei Weisen, hgg. von Theodor Pindl, Stuttgart: Reclam 1998 Riedenauer, M., »Spielraum der Welt: Perspektivität im Quattrocento«, in: R. Esterbauer (Hg.), Orte des Schönen. Phänomenologische Annäherungen, Würz burg: K&N 2003, S. 351–379 —, »Religiöse und kulturelle Pluralität als Konfliktursache bei Nikolaus Cusa nus«, in: I. Bocken (Hg.), Conflict and Reconciliation, S. 131–159—, »Zur Bewältigung religiöser Differenz bei Raimundus Lullus und Nikolaus Cusa nus«, in: E. Bidese, A. Fidora, P. Renner (Hg.), Ramon Llull und Nikolaus von Kues, S. 83–103 —, »Das mittelalterliche Christentum in Auseinandersetzung mit dem Islam«, in: M. Thurner, C. Schäfer (Hg.), Mittelalterliches Denken. Debatten, Ideen und Gestalten im Kontext, Darmstadt: WBG 2007, S. 105–125 —, Pluralität und Rationalität. Die Herausforderung der Vernunft durch religiöse und kulturelle Vielfalt nach Nikolaus Cusanus, Stuttgart: Kohlhammer 2007 —, »Aufgeklärte Religion als Bedingung interreligiösen Diskurses nach Nikolaus Cusanus«, in: Polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philosophieren 21 (2009), S. 21–34 —, »Perspektive. Malerische Nachahmung natürlichen Sehens in der philosophischen Reflexion«, in: A. Moritz, F.-B. Stammkötter (Hg.), Ars imitatur naturam. Transformationen eines Paradigmas menschlicher Kreativität im Über gang vom Mittelalter zur Neuzeit, Münster: Aschendorff 2010, S. 129–143—, »Fundamentalismus als ›kritische Reaktion‹? Hypothesen zu einer Archäolo gie des Fundaments«, in: JRaT (Interdisciplinary Journal for Religion and Trans formation in Contemporary Society) 3 (2016), S. 86–106 (http://www.v-r.de/ de/religious_fundamentalism/c-3074) —, »Konfrontation – Konfirmation – Konversion – Konkordanz. Auseinander setzungen des lateinischen Christentums mit dem Islam im Mittelalter«, in: Chr. Ratkowitsch, E. Ersan Akkiliç (Hg.), Das Christentum und der Islam in der Geschichte. Zwischen Bewunderung und Polemik, Berlin: Springer (im Druck)
62
Reife Religion im Zeitalter von Pluralität und Fundamentalismus
—, »Plurality as a Challenge to Rationality. Cusanus‘ Strive for Concordance and Peace«, in: A. Moritz (Hg.), Brill‘s Companion to Nicholas of Cusa, Leiden: Brill (im Erscheinen) Schenk, R., »Die Suche nach einer widerspruchsfähigen Ambivalenz: Wahr heitsparadigmen als ein Unterscheidungsmerkmal von Religionstheologien christlicher Provenienz«, in: P. Koslowski (Hg.), Die spekulative Philosophie der Weltreligionen, S. 59–90 Schneider, J.: »Nikolaus von Kues: De Pace Fidei – Religionsfriede?«, in: N. Brieskorn, M.Riedenauer (Hg.), Suche nach Frieden. Politische Ethik in der frü hen Neuzeit I, Stuttgart: Kohlhammer 2000, S. 15–39 Schrödter, H., »Religion zwischen Diskurs und Gewalt: Diskurstheoretische Ele mente bei Nikolaus von Kues – Anfragen an die Diskurstheorie«: in: M. LutzBachmann, A. Fidora (Hg.), Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, Darmstadt: WBG 2004, S. 221–238 Southern,. W., Western Views of Islam in the Middle Ages, Cambridge/MA: Harvard U.Pr. 1962 Stallmach, J., »Einheit der Religion — Friede unter den Religionen. Zum Ziel der Gedankenführung im Dialog ›Der Friede im Glauben‹«, in: MFCG 16, S. 61–81 Thurner, M., »Cultura agri intellectualis. Der gemeinsame Ursprung von Religion und Kultur nach Nikolaus von Kues« in: Jahrbuch für Religionsphilosophie 3 (2004), S. 59–83 Watanabe, M., Concord and Reform: Nicholas of Cusa and Legal and Political Thought in the Fifteenth Century, hg. v. G. Christianson, Th. Izbicki, Aldershot etc.: Ashgate Variorum 2001 —, »Nicholas of Cusa and the Idea of Tolerance«, Neudruck in ders.: Concord, S. 217–228 Woelki, Th., »Nikolaus von Kues (1401–1464). Grundzüge seiner Lebensge schichte«, in: I. Mandrella (Hg.), Nikolaus von Kues, S. 15–33
63
Kurt Appel, Martin Eleven
Hegel und das Offene der Gottesfrage mit einem Ausblick auf Lacans Register des Imaginären, des Symbolischen und des Realen
Der folgende Beitrag setzt sich mit Hegels Position zur Gottesfrage auseinander, die in der Geschichte der Philosophie bekanntlich äußerst kontrovers diskutiert wurde. Dieser Teil kann auch für sich gelesen werden. Ein kürzerer zweiter Teil stellt eine Verbindung zur Psychoanalyse von Lacan her. Dabei soll anhand eines in den letzten Jahrzehnten stark rezipierten Denkweges angedeutet werden, wie fruchtbar Hegels Religionskonzeption auch in zeitgenössischen reli gionsphilosophischen Diskussionen, die vielfach die Psychoanalyse einbeziehen, verwendet werden kann. Außerdem wird damit implizit ein Bezug zu Žižeks Religionskritik hergestellt, die Hegels Religions konzept im Lichte der lacanschen Psychoanalyse liest und umgekehrt Lacans Denken durch Hegels Dialektik interpretiert. Dabei entwickelt sie zweifelsohne große interpretatorische Kraft in Bezug auf gegen wärtige kulturelle, soziale und religiöse Phänomene. Umso mehr ist allerdings darauf zu achten, dass Hegels differenzierte Sicht der Got tesfrage nicht einseitig theistisch oder atheistisch kurzgeschlossen, sondern das Offene seiner Sichtweise gewürdigt wird.
1. Hegels Religions- und Gotteskonzept1 1.1. Der Streit um Hegel An der Einschätzung Hegels scheiden sich die Geister ganz besonders auf zwei Ebenen: Erstens wird seit Jahrzehnten zunehmend über Die Ausführungen über Hegel folgen weitgehend K. Appel, »Hegel und das Offene der Gottesfrage«.
1
65
Kurt Appel, Martin Eleven
die Frage diskutiert, ob Hegel ein Feind der offenen Gesellschaft ist und sein Systemdenken einen zumindest potenziell totalitären und geschlossenen Charakter aufweist. P. Ricoeur gibt trotz der bei ihm üblichen Vorsicht das Motto aus, sich vom Hegelianismus zu verabschieden,2 um utopische Potentiale der Geschichte offenzuhal ten, wenngleich er allerdings auch einräumt, dass philosophische Aussagen über Hegels Denken nahezu immer auf Momente inner halb der hegelschen Philosophie selber rückführbar sind.3 Deshalb verwundert es nicht, dass gerade in Frankreich, wo Hegels Philosophie als zu überwindende Ontotheologie galt, etwa durch Malabous Werk The Future of Hegel4 neue Zugänge zu Hegels Dialektik eröffnet werden, die Hegel als Genossen eines Denkens der Revolution und der Zukunft in Anspruch nehmen. Auch diese Interpretationslinie kann mittlerweile viele prominente VertreterInnen vorweisen, von Butler5 über Žižek6 bis Comay und Ruda7, sodass heute die Frage nach Hegels Stellung zum System und zur Ontotheologie, wenn man so eine Philosophie nennen wollte, die im Absoluten fundiert ist, offener denn je ist. Damit sind wir beim zweiten sich in Hegel fokussierenden Streit punkt angelangt, der noch wesentlich älter als der erste ist, nämlich bei der Frage nach der Existenz Gottes. Wenn Hegels Stellung zur Gottesfrage, die bereits bald nach seinem Tod die Scheidung in Rechtsund Linkshegelianer in Gang setzte, in jüngster Zeit wenig diskutiert wird – auch nicht von prominenten HegelianerInnen wie Butler, Hon neth oder Brandom (eine Ausnahme bildet hier wie bereits angedeutet Žižek) –, so liegt dies vor allem daran, dass die akademischen Eliten unserer Zeit die Gottesfrage als obsolet erachten oder sie allenfalls den privaten Befindlichkeiten des Einzelnen zuweisen. In der Theologie gilt Hegel weithin als Pantheist, ohne dass wirklich klar ist, was damit genau gemeint ist.8 Man könnte vielleicht 2 Dies ist der Titel des sechsten Abschnittes des zweiten Teils des Schlusskapitels »Die erzählte Zeit« aus Ricoeurs Hauptwerk Zeit und Erzählung. Vgl. P. Ricoeur, Zeit und Erzählung III. Die erzählte Zeit, S. 312–333. 3 Vgl. ebd., S. 332. 4 C. Malabou, The Future of Hegel. 5 Vgl. J. Butler, Subjects of Desire. 6 Vgl. S. Žižek, Weniger als Nichts. 7 Vgl. R. Comay, F. Ruda, The Dash – The Other Side of Absolute Knowing. 8 Für eine differenzierte Darstellung der hegelschen Gotteskonzeption vgl. M. Pagano, »Alle radici della modernità: la lotta dell’illuminismo contro la fede«; F.
66
Hegel und das Offene der Gottesfrage
einen gewissen Konsens dahingehend finden, dass Hegels Gott als Selbstbewusstsein des menschlichen Geistes aufgefasst wird, der in der Geschichte zu sich selbst kommt.9 Gott »ernährt« sich quasi vom menschlichen Geist wie der Vampir vom Blut und letztlich scheint sich die hegelsche Gottesbestimmung Feuerbach anzunähern, wenn Hegel dahingehend verstanden wird, dass es ohne den Menschen auch keinen Gott gibt. Wenn der Mensch aber, wie heute allgemein ange nommen, ein Produkt der Evolution ist, dessen Auftritt und Abtritt innerhalb der kosmischen Geschichte weitestgehend kontingent ist, dann liegt der nächste Schritt nahe, auch in Gott ein Produkt der evolu tionären Zufälligkeit zu sehen,10 der in einer bestimmten geschichtli chen Phase das menschliche Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt. In diesem Sinne überwiegen heute nicht nur in der Philosophie – da, wo sie überhaupt noch die Gottesfrage für legitim erachtet –, sondern auch in der Theologie linkshegelianische Hegel-Interpretationen.11 Hegels Religionsauffassung hat in dieser Sicht zwar noch immer gewisse pädagogische Funktionen,12 insofern der Mensch sich in Gott Wagner, Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel. Ferner: K. Ruhstorfer, »Die Heilige Schrift in Hegels ›Vorlesungen über die Philosophie der Religion‹“, sowie: »Gott als Person bei Hegel«. Für eine umfassende Untersuchung zum hegelschen Religionsverständnis siehe ferner W. Jaeschke, Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels. Zur Bestimmung des Absoluten aus hegelscher Sicht vgl. ferner A. Arndt, »Wer denkt absolut? Die absolute Idee in Hegels ›Wissenschaft der Logik‹“, sowie: »Das vollendete Bewusstsein der Freiheit«. 9 In den Vorlesungen über die Philosophie der Religion schreibt Hegel programma tisch in der Einleitung: »[…] Gott ist gegenwärtig, allgegenwärtig und als Geist in allen Geistern«. Siehe: G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion I (= Werke 16), S. 40. Das Zitat folgt wie die anderen Hegel-Zitate (mit Ausnahme der Jugendschriften) der Suhrkamp-Ausgabe, da diese die bestzugängliche Ausgabe dar stellt und gerade für Hegels Hauptwerke einen ausgezeichneten Text bietet. Siehe: G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden. Im Folgenden zitiert als Hegel, Werke I-XX. 10 Für Hegels Position zur Evolutionslehre vgl. den sehr informativen Band von O. Breidbach und W. Neuser (Hg.), Hegels Naturphilosophie in der Dritten Moderne, darin besonders T. Posch, »Hegel und Haeckel über Evolution und Gradualismus«, S. 101– 118. 11 Daher ist es wohl nicht nur dessen völlig enigmatischer Sprache geschuldet, dass einer der wichtigsten Kommentare zu Hegels Hauptwerken, nämlich B. Liebrucks monumentales Werk »Sprache und Bewußtsein«, weitgehend in Vergessenheit gera ten ist. Vgl. B. Liebrucks, Sprache und Bewußtsein. 12 Vgl. L. Siep, Der Weg der Phänomenologie des Geistes; aber auch P. Stekeler-Weit hofer, Hegels Phänomenologie des Geistes. Bei Brandom verbleibt nicht einmal das. Vgl. R. Brandom, A Spirit of Trust: A Reading of Hegel’s Phenomenology.
67
Kurt Appel, Martin Eleven
seiner eigenen Freiheitsbestimmung bewusst werden kann; letztlich ist die Religion aber eine unvollkommene Stufe, die dem absoluten Wissen einer Philosophie weichen muss, die wiederum das Göttliche in intersubjektiven Anerkennungsverhältnissen oder im reflexiven Freiheitsbewusstsein des Menschen verankert. Man kann vermuten, dass viele der hier angedeuteten Interpre tationen in Hegel eine metaphysische Restauration Kants sehen, die die Gottesfrage entweder positiv oder aber negativ gegenüber den kritischen Differenzierungen Kants beantwortet. In den folgenden Ausführungen über Hegel soll ein etwas anderer Weg gegangen werden: Die leitende Frage ist die Frage nach dem Offenen des Systems Hegels. Kants kritische Philosophie öffnet das Sein für einen Freiheitsgedanken, der nicht mehr in der Unendlichkeit Gottes verankert ist, sondern in der praktischen Vernunft. Hegel wiederum löst den Freiheitsgedanken aus dem transzendentalen Akosmismus und der fichteschen Reduktion auf ein transzendentales Ich und begründet – Schelling ähnlich – eine Art transzendentalen Materia lismus. Im Gegensatz zu Schelling aber vermeidet Hegel jede Form von Reontologisierung der Freiheit und damit des Absoluten, indem er sie radikaler als Schelling – damit kantischem Erbe treu bleibend – an erkenntniskritische Überlegungen rückbindet. Die Gottesfrage ist bei Hegel untrennbar mit der Frage des Offenen des Systems und der Freiheit nicht als Kontingenzbewältigung, sondern als Trans formation des Zufälligen wie Notwendigen verbunden. Sie steht damit im Zentrum hegelschen Denkens; wie sie allerdings theologisch auszudeuten ist und ob sie theistisch, atheistisch, pantheistisch oder im Sinne einer radikalen Kritik an all diesen Positionen zu deuten ist, stellt bis heute eine der anspruchsvollsten Herausforderungen philosophischer Interpretationsarbeit dar, da dazu ein tiefgreifendes Verständnis der hegelschen Hauptwerke, sprich der Phänomenologie des Geistes (PhdG) und der Wissenschaft der Logik (WdL) notwen dig ist. In den folgenden Ausführungen zu Hegel soll ein exemplarischer Blick auf neuralgische Stellen innerhalb der offenbaren Religion der PhdG geworfen werden. An den Rande gerückt werden dabei sowohl die hegelsche Enzyklopädie als auch die Vorlesungen über die Philoso phie der Religion, da in beiden Schriften die für Hegel so essentielle Verbindung von Methode/Form und Inhalt weniger stringent durch gehalten ist als in der PhdG (und der WdL, die in den folgenden Aus führungen zwar mitschwingt, aber aus Gründen des beschränkten
68
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Umfangs der Darstellung nur am Rande zur Sprache kommt). Bereits in der PhdG steht die Darstellung des spekulativen Satzes, der im 17. Absatz der Vorrede zum Ausdruck gebracht wird, im Zentrum: »Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtfertigen muss, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen und auszudrücken« (PhdG, S. 22f.). Die Substanz als Subjekt aufzufassen ist die Voraussetzung eines Verständnisses des Offenen des Systems und damit verbunden der Gottesfrage, die in Verbindung steht mit einer Kritik der gerade auch heute dominierenden, vom Urteil ausge henden Wissensauffassung. Diese Wissensauffassung wird nicht zuletzt am Ausgang des Gewissenskapitels der PhdG thematisch, wie im Folgenden gezeigt werden soll.
1.2. Vom Sein zum Urteil Der Ausgang des Gewissens hat auch zentrale Bedeutung für ein Ver ständnis des hegelschen Religionskapitels. Er steht in der Dichotomie von handelndem und urteilendem Gewissen. Das Gewissen bezeich net den Abschluss einer Bewegung, die bereits am Anfang der PhdG ersichtlich war und deren tieferer Gehalt ab dem Rechtszustand bzw. ab dem Bildungskapitel zutage getreten ist: Ausgangspunkt der PhdG ist das Bewusstsein, welches die »Wahrheit der Gewissheit seiner selbst« (PhdG, S. 137) anvisiert. Diese (Selbst-)Gewissheit sucht es mittels des ihm gegenübertretenden Gegenstandes, der zum Medium seines Selbstverhältnisses wird, d.h. es versucht sich in der ihm begeg nenden Welt zu verorten. Dabei muss es sich von Anfang an auf einen »Weg der Verzweiflung« (PhdG, S. 72) begeben, da es sich in »seiner« Welt nicht findet, sondern einen permanenten Verlust von Veror tungsmöglichkeiten und damit auch seiner selbst erleidet (vgl. PhdG, S. 72), der zu einer »Umkehr des Bewusstseins« (PhdG, S. 79) zwingt, in der ihm sowohl die Welt als auch das eigene Selbst abhanden zu kommen drohen. Hegel beschreibt, wie sich das Selbst in seiner Wis sensauffassung weder im Sein (das Einzelne der sinnlichen Gewiss heit, das Ding der Wahrnehmung, die physikalische Welt der Kräfte) noch in der Reflexion über dieses Sein (in der theoretischen und prak tischen Vernunft) finden kann. Entgegen verbreiteter Einschätzungen kann das Selbst auch nicht in der Sittlichkeit aufgehoben werden und ist damit nicht auf intersubjektive, symmetrische Anerkennungsver
69
Kurt Appel, Martin Eleven
hältnisse (von Hegel auch Geist genannt) rückführbar, vielmehr steckt in ihm eine Negativität, ein Antagonismus zwischen Einzelheit und Allgemeinheit, die ein Aufgehoben-Sein des lebendigen Subjekts in der Familie oder im sittlichen Gemeinwesen als Ausdruck solcher Anerkennungsverhältnisse verunmöglichen. Gerade weil sich das Selbst im Verlust seiner Welt, die im Verlust seiner Sittlichkeit (Kultur, Anerkennung) kulminiert, immer weniger inhaltlich bestimmen kann, zieht es sich auf zunehmend abstrakter werdende Geltungsanspruche und Urteile zurück. Philosophiege schichtlich könnte daran erinnert werden, dass bis hin zu Spinoza und Leibniz der Versuch unternommen wurde, die Welt und auch das Selbst ontologisch in einem absoluten, d.h. zureichend begründeten Sein zu fundieren. Besonders Leibniz (oder zumindest Leibniz in einer ontotheologischen Lesart13) hält daran fest, dass nur eine in sich geschlossene, zureichend begründete Welt die Einheit und damit auch die moralische Handlungsfähigkeit des Subjekts gewährleisten kann. Kant dagegen verweist den Gedanken eines die Welt fundierenden unendlichen Gottes in die Sphäre einer Vernunftidee, die unseren Verstandesgebrauch reguliert, ohne dass ihr (kategoriale) Existenz zugesprochen werden könnte. Das Sein, seines Fundaments beraubt, fällt in die Sphäre der Erscheinung und an dessen Stelle tritt das die Welt strukturierende Urteil, fundiert in der Reflexion des transzen dentalen »Ich denke«, dessen Gültigkeitsbereich nun untersucht wer den muss. In Hegels PhdG sieht sich demgemäß das dem Sein ent fremdete Ich, beginnend mit dem Rechtsanspruch, vor die Notwendigkeit gestellt (vgl. PhdG, S. 355), sich in den Geltungsan sprüchen seines Urteils und damit in seiner Reflexion zu finden. 13 Leibniz geht zwar klar davon aus, dass die Einheit unseres Selbst nur in einer zureichend begründeten Welt möglich ist, allerdings liegt der zureichende Grund in der Liebe Gottes, die sich in der Freiheit des Menschen manifestiert. Leibniz hat des halb keine statische Sicht des Absoluten, vielmehr könnte man durchaus sagen, dass es der transzendentale Ermöglichungsgrund der Freiheit ist. Die prästabilierte Har monie von Natur und Gnade, vom Gottesstaat der moralischen Welt und der natür lichen Welt (Monadologie § 86f.) geht bereits ganz massiv in die Richtung der kanti schen Unterscheidung von Natur und Moralität. Vgl. dazu K. Appel, Tempo e Dio: Aperture contemporanee a partire da Hegel e Schelling. Eine bis heute herausragende Leibniz-Interpretation bietet E. Cassirer, »Einleitung«; sowie: Leibniz‘ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen. Den dynamischen Aspekt der Monade, deren zurei chender Grund nie gegeben ist, sondern sich in ständig verändernden Konfigurationen erschließt, weist ganz besonders Deleuze auf. Vgl. G. Deleuze, Die Falte. Leibniz und der Barock.
70
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Eine Konsequenz daraus ist hier festzuhalten, da sie den gegen wärtigen Wissenshaushalt bestimmt: Der Ausgangspunkt auch unse rer Weltauffassung findet sich im Urteil (die »Likes« sind dafür die letzte und banale Bestätigung) und die reflexive Vermittlung des Seins (in Hegels PhdG etwa im Kapitel über die Einsicht ausgeführt) bestimmt den Weltzugang des Ichs. Dieses urteilende, alles auf seine Reflexion beziehende Selbst wiederum begibt sich permanent auf die Suche nach Unmittelbarkeiten, weil es sich – als konkret materiell und verletzbar Existierendes – auch nicht in seinem Reflexionsapparat definitiv verorten kann. Das Selbst befreit sich zwar von allen natur haften Einbettungen und Anerkennungsverhältnissen, gleichzeitig ist aber die daraus resultierende Freiheit eine reine Abstraktionsbewe gung, in der jeder Inhalt, der ihm Substanz gegeben hat (Kultur, Tra dition, Religion, Familie, Sittlichkeit etc.), vernichtet wird. Übrig bleibt ein geisterhaftes, seine Welt aufgehoben habendes Selbst, sei ner Geschichte und Kultur ebenso wie seines Körpers und der Sache des Anderen beraubt. Hegels Auffassung nach hat also die Europäi sche Moderne und ihr Freiheitspathos, deren geistiger Gehalt in der PhdG thematisiert wird, auch eine absolut nihilistische, alles auflö sende Dimension.
1.3. Verzeihung, Anerkennung und der erscheinende Gott Die in der PhdG das Geistkapitel abschließenden Abschnitte, nämlich die Moralität und das Gewissen, bilden die letzten beiden Versuche des Subjekts, ein positives Selbstverhältnis im Sinne einer Selbstfin dung im Gegenstand zu entwickeln. In der moralischen Weltanschau ung ist es der sublimierte Terrorismus, der jeden Inhalt zerstört habenden absoluten Freiheit und ihres nihilistischen Schreckens, der sich im moralischen Urteil zum Ausdruck bringt, dessen Größe aller dings darin besteht, dass es den Gedanken des (wenngleich abstrak ten) Allgemeinen gerade deshalb fassen kann, weil es nicht mehr auf unverrückbare sittliche Inhalte, wie sie in der Familie oder der Polis gegolten haben, fixiert ist. Allerdings vermag sein Geltungsanspruch, so die Auffassung Hegels, nicht der Kontingenz des Begegnenden Rechnung zu tragen und kann zu keiner Anerkennung derselben füh ren. Das Gewissen als höchste geistige Stufe ist der internalisierte moralische Terror und hin und her geworfen zwischen sich als urtei
71
Kurt Appel, Martin Eleven
lendem und sich als handelndem Gewissen, d.h. zwischen allgemei nem Geltungsanspruch und der Kontingenz des Singulären. Zu einem Ausgleich wird das Gewissen erst dadurch geführt, dass es von seinem sich im Urteil ausdrückenden Geltungsanspruch ablässt (Hegel spricht vom »Brechen des harten Herzens« (vgl. PhdG, S. 492) und die Kontingenz des Einzelnen nicht mehr verurteilt. Dieses Urteil setzt immer schon die Instanz eines sich von der Welt distanziert, d.h. sich über seine Umwelt erhoben habenden »absoluten«, in die Got tesrolle tretenden Selbst voraus. Dieses erkennt im Verzicht auf seine Geltung, mit Worten der WdL ausgedrückt (die sich am Übergang von Wesens- und Begriffslogik finden14), dass sein Anundfürsichsein ein Gesetztsein ist, dass also auch seine vorgeblich absolute Position, die es im Urteil beansprucht hat, durch Dynamiken und Konstella tionen bestimmt ist, die es nicht zu beherrschen vermag, dass es also in letzter Konsequenz auf kontingentes Anderes in seinem Urteil angewiesen ist. Die Verzeihung dieser Kontingenz des Anderen – dem also verziehen wird, nicht Gott zu sein –, darf allerdings nicht wieder zu einer Reflexionsfigur werden, in der sich das verzeihende Selbst findet (etwa im Genuss seiner Güte, Weisheit und Barmherzigkeit) – dies wäre ein Rückfall in das urteilende Gewissen, auch wenn dieses scheinbar noch so freundlich und mild urteilt –, sondern verziehen werden kann durch das von seinem Urteil ablassende Bewusstsein nur das, was schon an und für sich verziehen ist, wobei es hier keine posi tivierbare Instanz mehr gibt, aus der die Verzeihung, in der sich die Anerkennung von Alterität zum Ausdruck bringt, hervorginge. Der »erscheinende Gott« (PhdG, S. 494) als Ort der Anerkennung des Anderen muss Erscheinung bleiben und entzieht sich jeder wie immer gearteten Repräsentanz. Mit anderen Worten: Am Ende des Geistka pitels der PhdG endet das Subjekt, insoweit es sich von seinem Wissen (Urteil) her konzipiert, in Gott, der selber wiederum keinerlei positi ves Bestehen hat. In seinen Jugendschriften schreibt Hegel den Satz: »Das Ideal können wir nicht außer uns sezen, sonst wäre es ein Objekt, – nicht in uns allein, sonst wäre es kein Ideal«15, was auch den Sach verhalt am Ende des Gewissenskapitels gut zum Ausdruck bringt, insofern Gott weder aus dem urteilenden Bewusstsein (d.h. aus dem Selbst) abgeleitet werden noch als äußere Instanz fungieren 14 15
72
Vgl. z.B. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II (= Werke 6), S. 246. G.W.F. Hegel, Frühe Schriften II, S. 97.
Hegel und das Offene der Gottesfrage
kann. Der erscheinende Gott, der am Ende des Gewissenskapitels der PhdG auftritt, fungiert als Signatur für die Offenheit des Sub jekts. Diese besteht darin, dass das Subjekt nicht von seinen sich im Dasein manifestierenden Repräsentationen her zu verstehen ist (von der Sinnlichkeit bis zur Moralität) und damit keinen letztgültigen Ausdruck auf der gegenständlichen Seite erhält. Keine Prädikation, kein Urteil, keine Einordnung in ein kategoriales, noetisches oder moralisches Beziehungsgefüge vermag das Selbst zum Ausdruck zu bringen. Es fällt in dieser Sicht niemals mit sich selbst zusammen, es entspricht niemals einem Bild, ist also um eine Alterität strukturiert, die sich dem (moralischen) Urteil entzieht, eine Alterität, die ihm »vorgängig« verziehen ist. Aus dieser Differenz des Selbst mit seiner Repräsentation erwächst eine Kontingenz allen Handelns und Urtei lens, deren Anerkennung den Weg zu dem bahnen wird, was Hegel Freiheit nennt. Auch das spekulative Ich=Ich (d.h. das sich in seiner Welt suchende Selbst), welches den Ausgangspunkt der PhdG bildet, kann nur dann richtig gelesen werden, wenn die Differenz innerhalb der Kopula entsprechend berücksichtigt wird.
1.4. Der Tod der Substanz Kant entwickelt in der dritten Kritik den erstaunlichen Gedanken einer ästhetischen Idee – die Vorstellungen der Einbildungskraft (also wenn man so will kreative Sinnlichkeit) –, welche von keiner Sprache völlig erreicht werden kann.16 Sie stellt damit sozusagen die Umkehrung der Vernunftideen dar, deren Begriff jede Anschauung übersteigt. Hegels Überlegungen im Religionskapitel der PhdG zielen auf eine Vereinigung von Vernunftidee und ästhetischer Idee. Wenn im Geist nämlich die positive Selbstbeziehung des Ichs zum Ausdruck kommen soll, d.h. der Versuch des Selbst, sich im Gegenstand seines Weltumgangs (reflexiv) zu repräsentieren, so ist die Religion das Ende aller Repräsentationen und dem Selbst bleibt nur der Bezug auf das Andere seiner Repräsentation. In Umkehrung zu Feuerbach kann festgehalten werden, dass jede Anthropologie im Bereich der Selbstprojektion verbleibt, während erst die Religion deren Ende dar stellt, womit – wie noch anzudeuten ist – auch Formen an Sinnlichkeit 16
Vgl. I. Kant, Kritik der Urteilskraft, § 49, S. 167f.
73
Kurt Appel, Martin Eleven
freigegeben werden (quasi im Sinne der kantischen ästhetischen Idee), die nicht mehr unmittelbar reflexiv einholbar sind. Bemerkenswerterweise spricht Hegel im Religionskapitel nicht mehr von Geltungsansprüchen des Subjekts, wie sie im Geist leitend waren. Tatsächlich kann sich das Ich in der Religion zunächst einmal nicht zur Geltung bringen, es ist nicht mehr auf Objekte seiner selbst bezogen, in denen es sich spiegelte. Es verschwindet die auf es bezogene Substanz, in der sich der Wissenscharakter des Selbst manifestierte. An deren Stelle tritt die Negativität der Substanz auf, also das Subjekt, welches das dem Selbst (der Reflexion) Entzogene ist. Das Subjekt ist also nicht wiederum als irgendeine (andere) Substanz zu verstehen, an der sich das Selbst finden könnte, sondern das Ende jeder objekthaften Bezüglichkeit. An der Entzogenheit des Subjekts erfährt das Selbst den Aufgang des Anderen als Tod seiner eigenen Selbstkonzeption. Gerade die Befremdlichkeit dieser Todeserfahrung gestaltet sich in der Religion: zunächst in symbolischen Formen wie dem Totemtier oder der Pyramide, dann in Götterskulpturen (im Gott erblickt das Selbst seine Endlichkeit, d.h. das Antlitz des Todes), im Kultus (der das Sterben der Natur feierlich begeht) und schließlich in der Sprache, die die tiefste Ausprägung der Negativität des Selbst darstellt, insofern die Sprache die Unmittelbarkeit der Gegenständlichkeit unserer Welt aufhebt. Das gesprochene Wort ist der Tod des unmittelbaren Dinges. Das Bemerkenswerte an dieser Sprachauffassung Hegels, wie sie sich in seiner Interpretation des Epos und dann vor allem der Tragödie und der Komödie zeigt, besteht darin, dass die Sprache nicht dazu dient, die Welt zu repräsentieren (und damit dem Ich als Medium seiner positiven Selbstvermittlung zu dienen), vielmehr repräsentiert die Sprache die aufgehobene Welt, d.h. den Untergang der Substanz. So heißt es bereits in den Passagen über das Epos: »Das Dasein dieser Vorstellung, dieser Sprache, ist die erste Sprache, das Epos als solches, das den allgemeinen Inhalt […] enthält. Der Sänger ist der Einzelne und Wirkliche, aus dem als Subjekt dieser Welt sie erzeugt und getra gen wird.« (PhdG, S. 531) Entscheidend ist dabei, dass in der Sprache die Welt vollkommen neu geschaffen wird unter Aufhebung der bis herigen substanziellen Wirklichkeit. Die Götter bringen dabei den Tod der denotatierbaren Realität (Substanz) zum Ausdruck. Die Religion weiß daher im Gegensatz zum Geist, dass die Substanz niemals positiv (und damit repräsentierbar) gegeben ist, also nicht mit sich zusammenfällt (ihre Gegenstände, die Götter,
74
Hegel und das Offene der Gottesfrage
heben jeden objekthaften Zugang auf), aber erst die Tragödie führt dem religiösen Selbstbewusstsein vor Augen, dass das notwendige Schicksal der Welt darin besteht, dass die Substanz, und zwar alle Substanz – das Weltliche und dessen Differenz, welche sich als Göttliches gestaltet hatte –, untergeht. Die Komödie am Ausgang des Religionskapitels17 zelebriert diesen Untergang, indem sie den Satz ausspricht, dass das Selbst – als Negation der Substanz – das absolute Wesen ist,18 indem es die Welt und deren Anderes, nämlich deren letzten und mächtigsten Gott, den Tod (als Negativität der Substanz) und dessen schicksalhafte Notwendigkeit, zerlacht.
1.5. Tod Gottes I: Der Tod des Subjekts Man könnte meinen, dass das anarchische Lachen das letzte Wort Hegels wäre und somit ein komödiantischer Übermensch im Sinne Nietzsches die Stelle des Absoluten besetzte. Bei näherer Sicht fällt zunächst einmal auf, dass die Komödie in unmittelbare Nähe zu Bewusstseinsgestalten rückt, die in den ersten Abschnitten der PhdG ausgeführt (und aufgeführt) wurden, nämlich in die Nähe des unglücklichen Bewusstseins (welches im Selbstbewusstseinskapitel begegnete) und des Rechtszustandes (der im Geistkapitel auftrat). Das unglückliche Bewusstsein wollte sich selbst in der Vereinigung mit dem Absoluten finden und vereinigte sich doch nur mit seinem eigenen melancholischen Begehren nach dem verlorenen und uner reichbaren Unwandelbaren. Im Rechtszustand wiederum bildete das Selbst sein abstraktes Gelten (als inhaltslose Person) aus. Die Komö die ist zwar im Unterschied zum unglücklichen Bewusstsein und zum Rechtszustand keine selbstreflexive Figur (die mit dem melancholi schen Begehren oder dem eigenen Geltungsanspruch zusammen fiele), allerdings ist damit auch angezeigt, dass der komödiantische Gestus überhaupt keine positive Gestalt mehr, weder welthaft (als Eine sehr interessante und differenzierte Darstellung der Komödie unter Berück sichtigung psychoanalytisch-lacanscher Analysen gibt A. Zupančič, Der Geist der Komödie. Darin zeigt sie sehr schön, wie in den zentralen Abschnitten des geistigen Kunstwerkes die Repräsentation sukzessive außer Kraft gesetzt wird (man könnte dies freilich bereits auch in den ersten Stufen der Religion verorten). Vgl. besonders A. Zupančič, Der Geist der Komödie, S. 29–34. 18 Eine äußerst lesenswerte Interpretation dieses spekulativen Satzes findet sich in T. Auinger, Das absolute Wissen als Ort der Ver-Einigung. 17
75
Kurt Appel, Martin Eleven
positive Reflexion des eigenen Wissens) noch religiös (als negative Symbolisierung des Todes), hervorbringen kann, da er keinen Gegen stand gegenüberstehen hätte, durch den und in dem er sich (positiv oder negativ) finden könnte. Vielmehr vermag die Komödie nur ihren eigenen Untergang, in dem auch alle Substanz aufgehoben ist, zu zelebrieren, womit sie unmittelbar in das unglückliche Bewusstsein zurückfällt, dessen Melancholie die Erfahrung des Verlustes von allem, d.h. vom Selbst, von der Welt und vom Absoluten war. Dieser wahrhaft umfassende Untergang sowohl der Substanz (Welt/Geist) als auch des Subjekts (Religion) fasst Hegel in das »harte Wort […], dass Gott gestorben ist« (PhdG, S. 547). Die daraus erfolgende Stufe ist zunächst nur negativ zu beschreiben: Die Welt des Geistes, die die Projektionsfläche des sich selbst erfassen wollenden Selbst war, ist ebenso tot wie die Götterwelt der Religion, die aus dem Untergang der (geistigen) Substanz hervortrat. Wollte man das hier Ausgeführte an die Spitze treiben, so müsste man sagen, das Unglück der zunächst beglückten Komödie besteht darin, dass die Welt und Gott und sogar der Tod (als letzter Ausweg aus dem Leben und Entzug des Anderen) gestorben sind.
1.6. Tod Gottes II: Der Tod des Todes Damit tritt die (Götter-)Welt, wie Hegel poetisch in den Abschnitten 6 und 7 der offenbaren Religion der PhdG ausführt,19 als verhüllte Erinnerung gegenüber, als definitiv fremd gewordene Welt. Das Selbst findet sich nicht mehr in der anfänglichen Sinnlichkeit und den darauffolgenden »weltlichen« Stufen zurecht (bis hin zur Sittlichkeit, Bildung und Moralität), doch ebensowenig kann diese Fremde durch die religiöse Welt der Götter kompensiert werden. Was sich gewis sermaßen zeigt, ist eine nicht mehr im Letzten einordbare und reprä sentierbare »hyper«objektive Welt, durch deren Repräsentationen ein Riss geht und die daher nicht mehr (im wahrsten Sinne des Wortes) bei sich ist. Hegel sieht allerdings in dieser ebenso entzauberten wie entfremdeten und »gerissenen« Welt überraschenderweise die G.W.F. Hegel, PhdG, S. 547f.: »Die Bildsäulen sind nun Leichname […], die Tische der Götter ohne geistige Speise und Trank […]. Den Werken der Muse fehlt die Kraft des Geistes, dem aus der Zermalmung der Götter und Menschen die Gewißheit seiner selbst hervorging […]«. 19
76
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Geburtsstätte des Hervorgangs »des als Selbstbewusstsein werden den [absoluten] Geistes« (PhdG, S. 549).20 Um diesen Gedankengang näher zu verstehen, soll noch einmal kurz auf die Bedeutung der Sprache in Hegels PhdG verwiesen wer den:21 Erwähnenswert ist dabei die schöne Seele des Gewissenskapi tels, in der sich die Mitglieder einer (scheinbar) idealen Gemeinde gegenseitig ihrer Anerkennung versichert hatten.22 Die darin ver wendete Sprache blieb allerdings leer, weil sie der Differenz (dem Anderssein) des Subjekts, dessen Singularität und kontingenter Alte rität, nicht gerecht wurde. Sie brachte eine »vollkommene«, in sich geschlossene symmetrische Anerkennung einer »idealen« Kommu nikationsgemeinschaft zum Ausdruck, die auf Kosten der Alterität erschlichen war. Auf der Ebene der Religion entspräche dem eine immanente Trinität, die den Gegensatz nur als scheinbaren an ihr hat. Doch auch wenn die schöne Seele im Gewissenskapitel nur ein defi zientes Durchgangsstadium zum Ausdruck bringt, taucht sie doch wieder im Kapitel über das Absolute Wissen auf (vgl. PhdG, S. 580). Denn der spekulative Sinn der weltlosen Sprache, die die schöne Seele im Gewissenskapitel gekennzeichnet hat, liegt darin, dass in ihr der Zusammenhang von Sprache und repräsentiertem Objekt, von Signi fikant und Signifikat zerbricht, was bedeutet, dass die Sprache nicht mehr auf ihre denotative Funktion rückführbar ist. Wie bereits eingangs erwähnt, wird Hegel immer wieder unter stellt, dass er gegenüber dem kritischen Denken Kants (und Humes) die traditionelle Metaphysik restaurieren will. Hegel selber spricht Vgl. dazu auch S. Žižek, Die Puppe und der Zwerg, S. 77: »Gerade die radikale Trennung des Menschen von Gott verbindet uns mit Gott, denn in der Figur Christi ist Gott völlig von sich selbst getrennt. Es geht nicht darum die Kluft zu überwinden, die uns von Gott trennt, sondern uns darüber klar zu werden, daß diese Kluft Gott selbst innewohnt«. Allerdings wäre an Žižek die Frage zu richten, ob die atheistischen Konsequenzen, die er aus diesen Überlegungen zieht, mit Hegel vereinbar sind. 21 Die Sprache stellt ein Leitmotiv der Auslegung dar in B. Liebrucks, Sprache und Bewußtsein. Band 5. 22 Vgl. G.W.F. Hegel, PhdG, S. 481: »[…] sie ist das Selbst, das als solches in der Sprache wirklich ist, sich als das Wahre aussagt, eben darin alle Selbst anerkennt und von ihnen anerkannt wird. […] das Aussprechen des Gewissens aber setzt die Gewißheit seiner selbst als reines und dadurch als allgemeines Selbst; die anderen lassen die Handlung um dieser Rede willen, worin das Selbst als das Wesen ausge drückt und anerkannt ist, gelten.« Vgl. weiters PhdG, S. 484, wo Hegel die durch sichtige Reinheit dieser schönen Seele bestimmt als »gestaltloser Dunst, der sich in Luft auflöst.« 20
77
Kurt Appel, Martin Eleven
dagegen in der Einleitung der Enzyklopädie der philosophischen Wis senschaften23 von drei Stellungen des Gedankens zur Objektivität.24 Die erste Stellung ist ohne Zweifel die metaphysische griechische Welt, in der Sprache und Welt zusammenfallen. Gott ist darin der Logos, der sowohl Sprache als auch Welt fundiert und vermittelt.25 Allerdings deutet sich bereits in Epos, Tragödie und Komödie an, dass die Negativität der Sprache die kategoriale Welt aufhebt und damit das Ende der objekthaften Wirklichkeit bedeutet. Gott erweist sein Wesen in der Religion zunehmend als Tod der (symbolischen und objekthaften) Welt. Die zweite Stellung des Gedankens zur Objekti vität manifestiert sich im kritischen Denken Humes und Kants, in dem die Sprache nicht mehr in der Lage ist, die Welt zu repräsentieren, wenngleich eine außersprachliche Welt, auf die sich die Sprache bezieht, vorausgesetzt wird. Gott kommt in dieser Beziehung von Sprache und Welt entweder wie bei Kant die Funktion eines Grenz begriffs unseres Wissens zu oder er ist Ausdruck des nicht Repräsen tierbaren, dem damit zumindest in der empiristischen Lesart keine Relevanz mehr für den Wahrheitswert von Aussagen innewohnt (die negative Theologie zieht die genau umgekehrte Konsequenz, insofern für sie das Nicht-Repräsentierbare das einzig Wahre ist). Die dritte Stellung des Gedankens zur Objektivität ist in der spekulativen Phi losophie Hegels zu finden, in der die Sprache nicht die Welt abbildet, sondern den Bruch zwischen Sprache und Welt, zwischen Subjekt und Objekt bezeichnet. Insofern nun aber innerhalb des Ich=Ich, des Bewusst-Seins, von dem Hegel im Gefolge der transzendentalen Überlegungen Fichtes ausgeht, jedes Subjekt in Wahrheit SubjektSubjekt-Objekt ist, d.h. ein gegenseitiges Vermittlungsverhältnis zwischen Subjekt und Subjekt sowie (in derselben Bewegung) zwi schen Subjekt und Objekt darstellt,26 manifestiert sich dieser Bruch 23 Vgl. G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse I (= Werke 8), S. 13–20. 24 Dem entsprechen auch die drei Schlüsse der Philosophie am Ausgang von Hegels Enzyklopädie. Vgl. dazu den noch unveröffentlichten Artikel K. Appel, »Der Schluss von Hegels Encyklopädie«. 25 Auf grandiose Weise wird diese Funktion Gottes in Bezug auf die Sprache von G. Agamben auf den Punkt gebracht. Vgl. G. Agamben, Das Sakrament der Sprache. 26 Streng genommen gibt es bei Hegel keine strikte Trennung mehr zwischen Subjekt und Objekt bzw. zwischen Subjekt und Subjekt, vielmehr stehen Subjekte und Objekte in einer ständigen dynamischen Konfiguration, die immer Asymmetrien aufweist, die in derselben Bewegung vergegenständlicht (objektiviert) und entgegenständlicht (entobjektiviert, versprachlicht) werden.
78
Hegel und das Offene der Gottesfrage
sowohl inmitten des Subjekts als auch inmitten des Objekts selbst, wie Hegel innerhalb der Phänomenologie in den Absätzen 27–33 (vgl. PhdG, S. 563–568) der offenbaren Religion (Reich des Sohnes) aus führt, in denen es darum geht, dass das »Selbst sich selbst ein Anderes wird« (PhdG, S. 562).27 Als Konsequenz daraus gibt es weder eine äußerliche, bewusstseinsunabhängige sprachlose Wirklichkeit (zweite Stellung des Gedankens zur Objektivität) noch eine in der Sprache repräsentierte und repräsentierbare Welt innerhalb des Bewusstseins (erste Stellung), sondern nur eine in sich gebrochene Realität sowohl des Subjekts als auch der Substanz, die in und mit der Sprache zum Ausdruck gebracht wird; dabei entsubstantiviert (und subjektiviert) sich die Substanz und entsubjektiviert (und substanti viert) sich das Subjekt permanent um diesen »Riss« herum, den man auch als die in jeder Negation (Vermittlung28) beiherspielende dop pelte Negation (Unmittelbarkeit der Vermittlung29) bezeichnen könnte. In dieser Erfahrung einer gerissenen Welt und einer gebrochenen Sprache geschieht es, dass »das Selbstbewußtsein sich seiner entäußert und zur Dingheit oder zum allgemeinen Selbst macht« (PhdG, 549). Im Vollzug dieses Bruches, der Subjekt und Substanz (je) trennt, ist die Menschwerdung des Absoluten, d.h. dessen Entäußerung, die Hegel in der offenbaren Religion der PhdG beschreibt, zu verorten. Die Inkarnation Gottes in Jesus30 ist nach Hegel gerade keine direkte Präsenz des Göttlichen in der endlichen Welt (!), wie dies herkömm liche Dogmatik annimmt. Für Hegel wäre eine solche Präsenz am ehesten noch in der Kunstreligion anzusetzen, in der der Gegenstand, gerade weil er nicht mehr mit seiner Repräsentation zusammenfällt, als begeistet erfahren wird, wobei in diesem Untergang der Substanz (Repräsentation) das (göttliche) Subjekt hervorgeht. Dagegen erkennt das Bewusstsein der offenbaren Religion Gott im unmittel baren Dasein (vgl. PhdG, S. 551), weil für es das Absolute ebenso wie Das genaue Zitat lautet: »Dass es [das Selbst] in der Tat Selbst und Geist sei, muß es ebenso, wie das ewige Wesen sich als die Bewegung, in seinem Anderssein sich selbst gleich zu sein, darstellt, zunächst sich selbst ein Anderes werden.« 28 Der Negation kommt die Seite der Vermittlung zu, insofern jede Bestimmtheit Negation ist. 29 In dieser doppelten Negation negiert sich die Vermittlung selbst, in deren Zentrum daher stets etwas Unvermitteltes und Unvermittelbares bleibt, das allerdings nie positiv festzuhalten ist. 30 Hegel nennt den Namen Jesu in der PhdG (und in der Logik) an keiner Stelle explizit, da es ihm um den Vorgang als solchen geht. 27
79
Kurt Appel, Martin Eleven
das eigene Selbst als gebrochen erfahren wurde, weil also jede mög liche Vermittlungsinstanz zugrunde gegangen ist (und eine zweite Form der Unmittelbarkeit als Negation der Negation hervortritt). Damit wenigstens angedeutet ist, dass es sich bei diesen Bestimmun gen Hegels um höchst aktuelle Einsichten handelt, sei nur kurz darauf verwiesen, dass geistiges (An-)erkennen erst dann möglich ist, wenn die Sphäre der Sinnlichkeit das Urteil und die Aneignung ebenso transzendiert hat, wie kulturelle, soziale und wirtschaftliche Vermitt lungsinstanzen (so unhintergehbar diese sind). Jesus ist auf alle Fälle in dieser Sicht nicht die Inkarnation (eines ontotheologischen und unendlichen) Gottes, sondern sein Körper (der corpus domini) ist der Riss des Absoluten selbst, welcher, weil es nicht mehr mit irgendwel chen Repräsentationen (und damit Reflexionen) zusammenfällt, in seinem sinnlich-materiellen »Rest« erkennbar wird. Um dies noch einmal zu verdeutlichen: Jesus ist nicht der Repräsentant des Ewigen, sondern der Repräsentant des Bruches im Absoluten, welcher ver hindert, dass dieses Absolute vollkommen mit sich identisch ist und mit sich zusammenfällt. In den ersten Stufen der Religion (natürliche Religion; Kunstre ligion) ist das Absolute auf jeder Erkenntnisstufe der nicht repräsen tierbare göttliche Begleiter des Objekts, das Subjekt (»Ich«), das jede Substanz (»Reflexion«) begleiten können muss und damit deren Offenheit, die verhindert, dass die Substanz mit sich selbst koninzi diert; in der offenbaren Religion hat sich das Absolute dagegen auch als dieser Begleiter aufgehoben. Wenn Hegel von der Dingheit spricht, zu der sich das Selbst entäußert (vgl. PhdG, S. 549), dann will er damit sagen: Die religiöse Glorie des Gegenstandes und damit das Heilige ist dahin, 31 ebenso aber auch der Gegenstand selbst als Projektions fläche des Selbst. Die Entäußerung des Selbst, die in der Verzeihung am Ende des Gewissenskapitels noch bloßer Gedanke geblieben ist, wird nun in der geoffenbarten Religion Gegenstand, d.h. sie wird angeschaut. Doch was heißt das konkret? Entscheidend ist ein Rückbezug auf das Spezifische der bisherigen Religionsstufen: Sie kulminierten darin, 31 In unüberbietbarer Prägnanz drückt Agamben den hegelschen Gedanken der Offenbarung in seiner kleinen Schrift Die kommende Gemeinschaft aus (ohne sich direkt auf Hegel zu beziehen): »Der Satz, dem zufolge sich Gott nicht in der Welt offenbart, lässt sich auch anders ausdrücken: dass die Welt Gott nicht offenbart, ist das eigentlich Göttliche.« Vgl. G. Agamben, Die kommende Gemeinschaft, S. 84.
80
Hegel und das Offene der Gottesfrage
dass der Tod immer stärker als das eigentliche Movens der Götterwelt hervortrat, der sich hinter der Maske der Religion (wie hinter den Gestalten des Geistes) verbarg. Die angeschaute Entäußerung des Selbst wird erst vor diesem Hintergrund verständlich: Jesus32 ist derjenige, der gleich dem Komödianten den Tod als Herrensignifikan ten, als Absolutes vom Thron stößt – in seinem Leben und seiner Lehre, die eben nicht von Todesfurcht und Kontingenzbewältigung geprägt ist; im Unterschied zur Komödie ist dies aber nicht nur ein Tun des (lachenden) Selbst, sondern Tun des Absoluten selbst, was sich in seiner letzten Radikalität auf völlig paradoxe Weise am Kreuz offenbart, an dem der Tod nur scheinbar ein letztes Mal seine Macht erweist. Die hegelsche Auffassung des Todes (des Todes), in dem sich das Absolute auf neue Weise offenbart, besteht darin, dass alle traditionel len Konzeptionen des Gottesgedankens letztlich auf den Tod hinaus laufen: Der absolute Herr, die reine Reflexion, der pantheistische und absolute Gott, der große Andere – all dies sind in Wahrheit Chiffren für einen Todeskult, für eine Inthronisation des Todes, die im geistigen Bewusstsein ihre Entsprechung in der Familie und der Polis hatten (die das kontingente Selbst in das unlebendige Selbst eines die Alterität des Einzelnen aufhebenden, scheinbar unsterblichen Allgemeinen – die Familie, die Nation – aufgehoben haben). Die Selbstreflexion des Ichs, die den Geist kennzeichnete, und die religiöse Aufhebung des Subjekts als Manifestation der Götterwelt laufen jeweils auf einen absoluten Herrn hinaus, der sich in letzter Konsequenz als Nichts erweist, sei es in der Form des jeden kontingenten Inhalt aufhebenden selbstreflexiven Urteils (als Schrecken abstrakter Freiheit, als Morali tät oder als Gewissen), oder sei es als Religion, die in Wahrheit die Allmacht des Todes anbetet. Das Ergebnis ist jeweils das Gleiche, nämlich die Totalität des Nihilismus. Was also am Kreuz stirbt, ist das Symbol des Absoluten als allumfassende, bruchlose, monolithische, abgehobene, abstrakt unendliche Instanz, die in Wirklichkeit Symbol des Nichts bzw. des Todes ist. Die moderne Weltgeschichte kommt damit zu einem unwiderruflichen Ende. Paradoxerweise erkennt also Hegel nennt den Namen nicht in der PhdG, aber die Bezüge der offenbaren Religion deuten natürlich stark auf Jesus hin. Allerdings bewahrt Hegel auch hier einen Rest an Offenheit, weil es ihm eben gerade nicht um die Positivierung von Vollzügen geht, auch nicht um den Vollzug, der als »positives« Selbst gegenübertritt. Jesus ist in diesem Sinne nicht austauschbar, aber seine Entäußerung besteht eben auch darin, Raum zu geben für Anderes. 32
81
Kurt Appel, Martin Eleven
das Bewusstsein der offenbaren Religion, dass in der Todesmaschine, die im Kreuz kulminiert, diese Maschine selber an ihr Ende gelangt, der Tod (der tote Gott) selber stirbt und das Absolute seine Wohnstatt im Gekreuzigten genommen hat, der den Bruch (den überschüssigen Signifikanten, die Negation) innerhalb des Absoluten (zwischen der Totalität und dem kontingenten Körper Jesu) selber offenbart. Hegel bringt diese Bewegung in der WdL auf großartige Weise im Kapitel über das Absolute zum Ausdruck: Dieses ist die sich auf sich beziehende Totalität, womit nicht zuletzt der Status des Spino zistischen Gottes, der Essenz aller Metaphysik ist, eingeholt wird. Alle bisherigen Kategorien (Qualität, Quantität, Maß, Reflexionsbestim mungen, Grund, Existenz etc.) der Seins- und Wesenslogik gehen in dieses Absolute zurück, welches sich als absolute Identität (die also nichts von außen empfängt) bestimmt. Die besondere Pointe Hegels besteht nun darin, dass auch die Identität, in der sich das Absolute darstellt, am Absoluten aufgehoben wird (d.h. dass das Absolute sich selbst äußerlich bleibt). Das Absolute ist auf diese Weise sein eigener Verlust, die »sich selbst auflösende Reflexion«,33 »der Schein als Schein«34 bzw. sein eigenes Verschwinden. Das Absolute als absolute Totalität hebt sich an ihm selbst auf, was die Konsequenz mit sich führt, dass es keine Totalität mehr gibt, sondern nur den Bruch (Riss) im Absoluten selbst. In Termini der PhdG ausgedrückt: »Das Nied rigste ist also zugleich das Höchste; das ganz an die Oberfläche her ausgetretene Offenbare ist eben darin das Tiefste.« (PhdG, S. 553f.) Auf das bisher hier Ausgeführte zurückkommend zeigt sich somit, dass auch der Tod als der letzte Gott, der alles in sich aufgeho ben hat, keine absolute Konsistenz mehr aufweist, was ebenso auch für alle anderen Totalitäten unserer Reflexion gilt. Das Wissen ist als Folge davon mit einem »Realen« konfrontiert, das nicht mehr rein sprachlich-reflexiv vermittelbar ist. Die singuläre Präsenz Jesu, das »positive Selbst«, wird, auch wenn dessen Sein in Gewesensein über gegangen ist (vgl. PhdG, S. 555), nicht einfach ausgelöscht, sondern intensiviert seine Präsenz als abwesender Körper.35 Das Selbst und dessen symbolische Ordnung konfiguriert sich um die A-Präsenz des G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, S. 193. Ebd. 35 Vgl. dazu auch die Überlegungen von Michel de Certeau, der darauf aufmerksam macht, wie die christliche Tradition auf den abwesenden Körper Jesu aufbaut. Vgl. M. de Certeau, Mystische Fabel: 16. bis 17. Jahrhundert, S. 127. 33 34
82
Hegel und das Offene der Gottesfrage
gebrochenen, nicht mehr in ein Ganzes integrierbaren Absoluten, das sich als abwesender Körper in das Selbst der Gemeinde einschreibt. Deren Selbst ist nicht eine bloße Erinnerungsgemeinschaft, in der das Gedächtnis Gottes erhalten bleibt und die sich als wie immer gearteter Träger eines göttlichen Geistes erfasst, wie eine vergleichs weise banale Hegellektüre nahelegen könnte. Vielmehr ergibt sich die gemeinschaftliche Dimension aus dem Riss des Absoluten, der zur Vermittlung von Allgemeinem (Totalität) und Einzelnem (der ergänzungsbedürftige, sich aus Verweisen konstituierende Körper) wird. Die Körper können in ihrer Verwiesenheit (auf Anderes) und Situiertheit hervortreten, weil sie weder mehr (wie etwa in der sinn lichen Gewissheit oder der Wahrnehmung) Projektionsfläche eines entkörperten reflektierenden Selbst sind noch die vergöttlichte Natur einer in die Sprache aufgehobenen Materialität und Endlichkeit zum Ausdruck bringen. Ferner zeigt sich, dass die Sprache, insofern sie nicht mehr bloß von ihrer denotativen Funktion her zu verstehen ist, auf einen Riss/Rest/Überschuss sowohl des Bezeichnenden als auch des Bezeichneten verweist, der sich in der offenbaren Religion als Körper gestaltet, welcher nichts anderes ist als die absolute Offenheit,36 insofern er sich jeder abschließenden semantischen, repräsentativen oder reflexiven Einordnung entzieht, also das Andere der Totalität darstellt. Dieser Überschuss an sinnlicher Präsenz zeigt sich in dessen Abwesenheit, durch welche das Selbst der Gemeinde (der offenbaren Religion) bzw. das allgemeine Selbst überhaupt konstituiert ist. Die unendliche Offenheit des Risses treibt das Selbst über seine sich selbst abschließende Besonderung hinaus und verbindet sich zu einem All gemeinen, welches doch nie ein Ganzes oder ein Zusammen einzelner Elemente bildet.
Hegel könnte von daher in enge Nähe zu M. Merleau-Ponty gerückt werden, wenn dieser im Gefolge von Husserl (und Malebranche) darauf abhebt, »dass die Welt stets ein ›unvollendetes Werk‹ bleibt« und der »Leib nie vollständig konstituiert« ist. (M. Merleau-Ponty, Phänomenologie der Wahrnehmung, S. 462). Es wäre wohl ein Desi derat, Hegels PhdG mit Merleau-Pontys Phänomenologie der Wahrnehmung weiter zudenken und umgekehrt, was vielleicht auch ein Programm von Nancy darstellt. Vgl. J.-L. Nancy, Corpus. 36
83
Kurt Appel, Martin Eleven
1.7. Gott als körperliche Erfahrung und als Exerzitium Hegel kritisiert an der offenbaren Religion, dass sie noch in der Form der Vorstellung verbleibt. Der Riss des abwesenden Körpers konstituiert sich nicht zuletzt als Text, als Offenheit des Kanons,37 der aber von der Gemeinde dahin abgeschlossen wird, dass sie anstelle des Risses ein vorgestelltes Versöhnungsgeschehen setzt, welches den ursprünglichen Riss schließen soll, sei es durch ein Einholen des Ursprungs mittels historischer Versicherung, sei es durch die Erwartung eines zukünftigen Abschließens desselben. Hegels Auffas sung nach liegt gerade in der Unabgeschlossenheit des Selbst / des Körpers dessen wahrhafte Bestimmung. Die Sprache ist damit gerade nicht in sich kreisend (wie in der schönen Seele des Gewissens), son dern wiederholt in unendlicher Kreativität das begegnende Offene. Der Körper als Abwesender und Gebrochener, der im Zentrum der christlichen Eucharistiefeier steht, manifestiert seine Offenheit in der Erfahrung je neuer Begegnungen des Anderen, der – gerade in seiner Verletzbarkeit – nicht auf den Gedanken des Anderen reduzierbar ist. Die in der offenbaren Religion aufgezeigte Körpererfahrung kommt in unübertroffener Weise im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde von Kolossä zum Ausdruck: »Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch, und ich fülle auf das Fehlende in den Bedrängnissen des Christus in meinem Fleisch für seinen Leib, der ist die Kirche […]« (Kol 1,24). Wichtig ist die Dialektik zwischen höchster Präsenz und Abwesenheit/Offenheit des Körpers. Der abwesende Körper Christi, der Riss und Zusatz des Absoluten, wird nicht zuletzt durch die Briefe des Paulus ergänzt, die sowohl textlich-sprachlicher Art sind als auch (2 Kor 3,2: »Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unseren Herzen…«)38 in »fleischlicher« Natur in Gestalt der Gemeinde begeg nen. Der Textkörper (Kanon) und der soziale Körper (Gemeinde) sind dabei Realitäten, die die körperliche Erfahrung der offenbaren 37 Eine genaue Ausführung des Gedankens des Kanons als offener Körper des Abso luten liegt vor in K. Appel, Tempo e Dio, besonders S. 147–211. 38 Der volle Wortlaut der Textstelle, die ihre Bedeutung auch daran zeigt, dass hier die Verheißungen der Propheten Ezechiel und Jeremia zusammengeführt werden (Ex 36,22–28; Jer 31,31–34), lautet folgendermaßen: »Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unseren Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen, offenbar gemacht, dass ihr seid ein Brief des Christus, besorgt von uns, eingeschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht in steinernen Tafeln, sondern in Tafeln fleischener Herzen.« (2 Kor 3,2f.).
84
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Religion im Innersten prägen. Sie verweisen in der Verletzbarkeit und Kontingenz des Begegnenden auf eine tiefe Schicksalsgemeinschaft, in der die Präsenz des gemeinsamen Bandes nie in eine Totalität und Fusion führt, sondern immer etwas offen hält… Was ist daraus aber die Konsequenz für die Gottesfrage bei Hegel? Die übliche Hegel-Lektüre, dass Gott mittels der Geschichte zu sich kommt, verkennt letztlich die Radikalität des Gottesgedankens Hegels: Gott als an sich seiende Totalität, als Reflexionsabsolutes (d.h. als der fiktive Punkt, von dem alles urteilsmäßig überblickbar wäre) ist tot (bzw. dieser Gott ist der Tod), der lebendige Gott ist rückgebunden an eine körperliche Erfahrung der Gemeinde, an deren Hingabe, Empathie und Überwindung der Todesfurcht. Allerdings wäre es ein Missverständnis, daraus kausale Hierarchien im feuerbachschen Sinne abzuleiten, demzufolge das menschliche Bewusstsein die Ursa che Gottes ist. Denn auch die Selbstreflexion des Subjekts, in der es sich findet (und wäre es auch eine Selbstfindung in Gott wie z.B. im Glauben, der im Bildungskapitel der PhdG abgehandelt wird), bietet keinen Ausgangspunkt und kein Fundament. Das transzenden tale Ich=Ich, das im Absoluten Spinozas (und im transzendentalen Spinozismus des frühen Schelling) seinen tiefsten Ausdruck gefunden hat, hebt sich Hegel zufolge an ihm selbst auf – und gibt Raum für den Riss, für das Offene, für eine (in Jesus) angeschaute Empathie und Körperlichkeit (man könnte sie mit Hegels Jugendschriften Liebe nennen), die vor aller Reflexion, die vor jedem »Ich denke« kommt, die auch über den Tod als Absolutes hinausreicht.39 Vielleicht sollte man, wenn man Hegels Stellung zur Gottesfrage bedenkt, die letzten Zeilen seiner Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften heranziehen, wo er an die drei Schlüsse der Philo sophie, die auf spekulative Weise noch einmal die drei Stellungen des Gedankens zur Objektivität wiedergeben, mit einem Zitat aus der Aristotelischen Metaphysik anschließt (1072 b 18–30). Hier ist die Rede vom Leben, welches in der göttlichen, tätigen sich selbst denkenden Vernunft steckt. Womit Hegel also eigentlich endet, ist eine Art Exerzitium. »Gott« ist ein Exerzitium, sowohl theoretischer (Denken des Denkens) als auch praktischer Natur (Selbstentäuße rung), welches sich in der Anerkennung des Offenen und im abwesen 39 Den Tod als letztes Absolutes der abendländischen Geistesgeschichte gilt es mit Hegel zu verabschieden. Vielleicht kommt dies in keinem Buch schöner zum Ausdruck als in H.D. Bahrs Den Tod denken.
85
Kurt Appel, Martin Eleven
den Körper manifestiert. Darin zeigt sich eine überraschende (oder vielleicht bei näherem Bedenken nicht so überraschende) Ähnlichkeit mit dem biblischen Gottesnamen YHWH, der ebenfalls als Tätigkeit zu verstehen ist, die in Leben, Tod, Auferstehung und Geistsendung Jesu dazu einlädt, das Fehlende seines Körpers aufzufüllen.
2. Einige hegelsche Motive in Lacans Psychoanalyse und deren Konsequenzen für die Bedeutung des Absoluten 2.1. Einleitende Bemerkungen zu Lacans Psychoanalyse Es stellt kein leichtes Unterfangen dar, Jacques Lacans Stellung zur Religion in einem kurzen Abriss zu skizzieren, zumal vor dem Hin tergrund, dies mit Bezug auf die vielschichtigen Gedankengänge von Hegels Religionsphilosophie zu leisten. Man müsste weit ausholen und mehr als dreißig Jahre seiner Lehrtätigkeit berücksichtigen, um ein Werk, das bis zum Schluss einer nicht enden wollenden Umarbeitung ausgeliefert war, auch nur einigermaßen verständlich darzulegen. Was daher hier versucht werden soll, ist eine erste Standortbestimmung vorzunehmen, die Konvergenzpunkte im Den ken von Hegel und Lacan anzeigt, ganz besonders hinsichtlich der Bestimmung des Menschen und dessen Verhältnis zu Sprache und Welt unter Inblickname der Gottesfrage. Dies erlaubt die Relevanz lacanscher Theorien für eine Re-Lektüre von Hegels Religionsver ständnis jenseits ontotheologischer Engführungen hervorzuheben. Hegel mit Lacan gelesen könnte eine andere Sichtweise auf die Religion eröffnen, die nicht hinter das Erbe der Aufklärung und deren Religionskritik zurückfällt, im Umkehrschluss aber auch nicht Religion als bloße Illusion zurückweisen muss.40 40 Was bei all der in diesem Artikel evozierten Nähe zwischen diesen Denkern nicht vergessen werden darf, ist, dass es sich bei Lacan um einen Psychoanalytiker handelt. Und das heißt auch, nicht zu vergessen, dass die Psychoanalyse seit ihren Anfängen, auch wenn dies vielleicht für Lacan nicht im selben Maße zutrifft, ein kritisches und distanziertes Verhältnis zur Religion unterhält; gleiches ließe sich natürlich auch über ihr Verhältnis zur Philosophie sagen. Es soll hier nur an Freuds Überlegungen erinnert werden, denen zufolge religiöse Praktiken analoge Züge zum Verhalten Zwangskranker aufweisen und die Philosophie, vor allem diejenige, die einer strengen Systematizität folgt, dem Zerrbild eines paranoischen Wahns sehr nahekommt. Einer weiteren psychoanalytischen Auffassung zufolge, wird Religion
86
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Um eine Annäherung an Hegel mit Lacan zu skizzieren, orien tiert sich dieser zweite Teil des Artikels an den drei Registern, mit welchen Lacan das Subjekt und die Psychoanalyse zu denken ver sucht: dem Imaginären, dem Symbolischen und dem Realen. Ergänzt werden diese Register um die Begriffe des anderen/Anderen sowie des Ichs, des Subjekts und den des Genießens. Der erste Abschnitt des zweiten Teils »Lacans drei Register« thematisiert dabei den Begriff des anderen/Anderen, wie er jeweils innerhalb eines der drei genannten Register auftaucht, und welcher Weltumgang des Ichs/Subjekts damit einhergehend zum Ausdruck gebracht wird. Der zweite Abschnitt »Hegels ›Tod Gottes‹ und die ›Inkonsistenz des großen Anderen‹“ setzt dann einige der herausgearbeiteten Aspekte des Ichs/Subjekts mit den Reflexionen zu Hegels Religionsphilosophie in Beziehung. Konkret heißt das, dass dabei auf den sogenannten »Tod Gottes« Bezug genommen wird, wie er in der Religionsphilosophie Hegels thematisiert wird, sowie auf die Inkonsistenz des großen Anderen im lacanschen Sinne.
2.2. Lacans drei Register Die Dimension des Imaginären stellt seit den Anfängen von Lacans Lehrtätigkeit einen zentralen Bezugspunkt seines Denkens dar. Es ist neben dem Register des Symbolischen und des Realen eines der drei Glieder des sogenannten borromäischen Knotens, das von Lacan dazu verwendet wird, Auskunft über die Subjektgenese (und die Struktur der Psyche) zu geben, insofern sie sich im Rahmen der Bildlichkeit abzeichnet. Damit ist auch bereits das charakteristischste Moment der Dimension des Imaginären genannt: Es geht um das Bild, das sich das Ich von sich selbst und seinem Körper macht. Lacan hatte sich am Anfang seines Denkweges, geprägt von den theoretischen Überlegungen der im damaligen Frankreich vorrangig zumeist als infantiler Überrest archaischer Weltauffassungsweisen verstanden. Freud hatte beispielsweise in seinen kulturtheoretischen Schriften eine ähnliche Sichtweise vertreten und Religion als Illusion verstanden: als ein imaginäres Supplement, um die Beschwernisse des Lebens leichter erträglich zu machen. Siehe dazu: S. Freud, »Die Zukunft einer Illusion«. Dass es sich hierbei nicht um das letzte Wort Freuds das Thema Religion betreffend handelt, wird besonders deutlich in: M. Balmary, Das verbotene Opfer. Freud und die Bibel.
87
Kurt Appel, Martin Eleven
rezipierten Philosophen Hegel, Husserl und Heidegger,41 wiederholt auf Passagen in Hegels PhdG bezogen, um seiner Theorie des Spie gelstadiums,42 welche als eine erste Ausformulierung der Dimension des Imaginären angesehen werden kann, eine philosophische Illus tration zu geben. Mit der Theorie des Spiegelstadiums versuchte Lacan darzustellen, dass es für die Herausbildung des Ichs ein Gegen über braucht. Mit der in der Entwicklungspsychologie beobachteten Frühzeitlichkeit des Menschen (d.h., dass der Mensch bei seiner Geburt noch nicht so vollständig entwickelt ist wie andere Säuge tiere) geht eine motorische Unkoordiniertheit und Unvollständigkeit des infantilen Körperschemas einher. Dieser Überlegung liegt die Annahme zugrunde, dass dem Menschen zu Anfang seines Lebens eine vollständige Einbettung in seine Umwelt fehlt. Seine Unruhe, sein Schreien und seine unkoordinierten Bewegungen weisen darüber hinaus insgesamt auf eine Instinktarmut hin, welche die Biologie dem Menschen gegenüber anderen Säugetieren attestiert.43 Für Lacan stellt deshalb das Streben des Ichs nach Herstellung einer Einheit seiner selbst einen wesentlichen Impuls bei der Entwicklung des Bewusstseins dar. Dieses Streben, so Lacan, ist die Energiequelle seines mentalen Fortschritts, eines Fortschritts, dessen Struktur vom Vorwalten der visuellen Funktionen bestimmt wird. Wenn die Suche nach einer affektiven Einheit beim Subjekt die Gestalten zutage fördert, die ihm seine Identität repräsentieren, so wird die intuitivste dieser Gestalten vom Spiegelbild geliefert. Was das Sub jekt in ihm begrüßt, ist die ihm inhärente Einheit. Was es im Spiegelbild wiedererkennt, ist das Ideal der Imago des Doppelgängers.44
Die Pointe des Spiegelstadiums besteht darin, dass das Bild, genauer gesagt das Körperbild, welches das Ich empfängt, stets ein entfremde tes ist und doch zugleich ein einheitsstiftendes Moment aufweist. Ent fremdet ist das Ich, da es sich nur in seinem Gegenüber als Bild wahr nehmen und dabei doch nie ganz als Selbst erfassen kann (es bekommt Vgl. V. Descombes, Das Selbe und das Andere: Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich. Zur geschichtlichen Situierung von Lacans Psychoanalyse, vgl.: E. Roudinesco, Jacques Lacan. 42 Siehe dazu: J. Lacan, »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion«. 43 Vgl. P. Widmer, Subversion des Begehrens, S. 28f. 44 J. Lacan, »Die Familie«, S. 59. Lacan spielt mit dem Begriff der Imago (in der Antike bezeichnete Imago eine Art Wachsmaske) nicht nur auf den bildlichen Moment der Identifizierung an, sondern auch auf C.G. Jungs Lehre von den Archetypen. 41
88
Hegel und das Offene der Gottesfrage
eben nur sein Spiegelbild zu sehen). Lacans Überlegungen folgen hier implizit dem in der PhdG dargestellten dynamischen Wechselprozess zwischen Bewusstsein und Gegenstand, der sich, ausgehend vom Abschnitt über die sinnliche Gewissheit und bis zum Gewissenskapi tel fortschreitend, in unterschiedlichen Gestalten ausdrückt. Lacans Konzeption des Spiegelstadiums charakterisiert insbesondere eine Form der imaginären Identifizierung, die als eine Kristallisation von verinnerlichten Selbstbildern, die vom anderen zurückgeworfen wer den, zu verstehen ist. Dieses dialektische Moment der Spiegelung bleibt jedoch wesentlich von Rivalität und Aggression durchzogen und durch äußerste Ambivalenz gekennzeichnet.45 Das Ich misst sich beständig an seinem Gegenüber und Vorbild, auf das es ein Bild der Ganzheit projiziert. Dabei eifert es diesem nach und trachtet zugleich nach dessen Vernichtung, was ihm zwar dabei hilft, mittels des anderen (Lacan nennt diesen den »kleinen anderen«) seiner selbst gewahr zu werden, dies jedoch nur um den Preis einer gleichzeitigen Verkennung. In psychoanalytischen Termini könnte man hier von der Spannung des Ich zu seinem Ideal-Ich sprechen, welche herkömmli cherweise im Feld der Narzissmus-Theorien verhandelt wird. Hieran anknüpfend ist auch Lacans massive Skepsis gegenüber jedweder Form einer sogenannten Ich-Psychologie zu verstehen, die auf eine Stärkung des Ichs zielt, da die Pointe seiner Überlegungen darin besteht, dass das Ich gleichzeitig der Ort der eigenen Verkennung ist.46 Lacan sah eine unverkennbare Parallele zwischen Theorien, die das Ich zum höchsten Maßstab erheben, und den Geboten religiöser Traditionen, besonders jenen, die das Thema der Nächstenliebe zum Inhalt haben: Mehrmals hat sich Lacan darüber geäußert – und hierin folgte er einer bereits von Freud angebrachten Kritik47 –, dass das Gebot der Nächstenliebe, sofern dieses im Register des Imaginären und der Selbstbespiegelung verbleibt, nichts anderes bedeutet als sich selbst im anderen zu lieben. Altruismus und Narzissmus rücken daher für Lacan in eine enge Nähe. Lacan dazu in einem Vortrag, der später unter dem Titel »Diskurs an die Katholiken« veröffentlicht wurde:
Die Aggression kann so weit führen, dass der Wunsch nach der Zerstörung des anderen überhandnimmt. 46 Weiterführend zu Lacans Kritik an der behavioristischen Psychologie amerikani scher Prägung: E. Roudinesco, Jacques Lacan, S. 262f. 47 Vgl. S. Freud, »Das Unbehagen in der Kultur«, S. 468f. 45
89
Kurt Appel, Martin Eleven
Nichts Erstaunliches dabei, daß ich nichts als mich selbst in meinem Ebenbild liebe. Nicht nur in der neurotischen Aufopferung, womit ich auf das hinweise, was die Erfahrung uns lehrt, sondern ebenso in der extensiven und utilisierten Form des Altruismus, sei er erzieherisch oder familial, philanthropisch, totalitär oder liberal, bei dem man es gern öfters sehen würde, wie ihm das Beben des prächtigen Hinterteils des unglücklichen Tieres entspricht, läßt der Mensch nichts durchge hen als seine Eigenliebe. Zweifellos ist diese Liebe seit langem in ihren Extravaganzen, selbst den ruhmreichen, durch die moralistische Erforschung ihrer vorgeblichen Tugenden aufgedeckt worden. Aber die analytische Erforschung des Ichs erlaubt es, sie mit der Gestalt […] der Maßlosigkeit des Schattens, dem der Jäger zur Beute fällt, mit der Vanitas einer visuellen Gestalt zu identifizieren. Solcher Art ist das ethische Gesicht dessen, was ich, um es verständlich zu machen, unter dem Ausdruck des Spiegelstadiums artikuliert habe.48
Das Ich fällt seinem Spiegelbild zum Opfer, es bleibt verstrickt in den imaginären Identifizierungen, die, wie bereits erwähnt, durch Rivalität und Aggression gekennzeichnet sind. Um diesen Prozess zu überwinden – oder im hegelschen Sinne aufzuheben – bedarf es, wie noch auszuführen sein wird, des Registers des Symbolischen, der Dimension der Sprache, die eine ebenfalls wesentliche Rolle bei der Herausbildung des Subjekts spielt. Ein weiteres entscheidendes Moment im Rahmen dieses Pro zesses besteht für Lacan darin, dass nicht alles völlig in diesem Körperbild integriert werden kann: Das im Spiegelstadium vermit telte Körperbild vermag nicht alle Gefühle und Affekte, Lüste und Unlüste zur Gänze aufzunehmen. Diesen Aspekt der Offenheit und Lebendigkeit des Körpers, der auch eng mit Freuds Überlegungen zum Lustprinzip und dem, was darüber hinausgeht, also dem »Jenseits des Lustprinzips« verknüpft ist, hat Lacan unter dem Begriff jouissance zu fassen versucht.49 Jouissance ließe sich als »Genießen« übersetzen und J. Lacan, »Diskurs an die Katholiken«, S. 41f. Freud hatte darauf hingewiesen, dass es eine Dimension der Lust gibt, die sich nicht dem Dienst des Realitätsprinzips unterordnen lässt und vom Subjekt als Unlust erfah ren wird. Für Freud steht diese (Un)Lust in enger Verbindung mit dem Wiederho lungszwang und er sieht diese Erfahrung in den Symptomen seiner Patienten bestätigt, die zwar unter diesen leiden, jedoch auch eine seltsame Art der Befriedigung daraus ziehen. Für Lacans Theorie sind diese Überlegungen von enormer Tragweite; sie kön nen hier aber aufgrund des beschränkten Umfangs nicht weiterverfolgt werden, es werden lediglich einige Aspekte beleuchtet. Vgl. S. Freud, »Jenseits des Lustprinzips«, S. 3–69. 48
49
90
Hegel und das Offene der Gottesfrage
bleibt bei Lacan zwar stets mit der Dimension des Imaginären und den Bildern des Körpers verbunden, verweist jedoch ebenso bereits auf das Register des Realen, das über das bildlich Manifestierbare und das Symbolische hinausgeht und sich diesem querstellt. Festgehalten kann somit werden, dass das Spiegelstadium zwar über einen zentralen Aspekt der Genese des Subjekts Auskunft gibt, jedoch noch nicht das letzte Wort Lacans diesbezüglich darstellt. Leiten wir daher zur Dimension des Symbolischen, genauer gesagt zum symbolischen Anderen über. Die zuvor beschriebene ima ginäre Beziehung, aus der es zunächst keinen anderen Ausweg als die Zerstörung des anderen gibt, wie Hegel dies in der PhdG im Kapitel über Herr und Knecht zum Ausdruck gebracht hat,50 und die durch keine direkte Interaktion zu befrieden ist, benötigt eine dritte Instanz: eine Instanz, die in ihrem Sprechen Anerkennung zu geben vermag und als eine Art »Richter« fungiert. Diese dritte Instanz, der »Andere mit großem A«, stellt die Position eines Allwissenden dar. Das Ich seinerseits versucht diesem Anderen zu gefallen und glaubt an ihn, da es von ihm auch seine (symbolische) Anerkennung erfährt (der große Andere wird hier der Einfachheit der Darstellung halber synonym zum Begriff der symbolischen Ordnung verwendet). Wesentlich dabei ist, dass nach Lacan der Mensch durch den Eintritt in die symbolische Ordnung nicht nur eine Anerkennung und Beglaubigung erfährt, sondern auch eine tiefgehende Entfremdung; eine Entfremdung seines Begehrens durch die Sprache. Durch den Eintritt in die Sprache – Lacan nennt diesen Verlust an Unmittelbar keit auch symbolische Kastration – lernt das Ich, sich gegenüber dem Begehren dieses großen Anderen und seiner diversen Anrufungen zu positionieren. Dabei geht die symbolische Ordnung mit all ihren poli tischen und gesellschaftlichen Institutionen dem Subjekt immer schon voraus. Die »Andersheit der Struktur« der symbolischen Ordnung lässt das Subjekt erst durch eine dialektische Bewegung entfremdet wieder Siehe dazu: J. Lacan, Das Seminar Buch 1. Freuds technische Schriften (1953–1954), S. 218: »Bevor das Begehren nicht lernt, sich – sagen wir nun dieses Wort – durch das Symbol anzuerkennen, wird es nur im andern gesehen. Am Ursprung, vor der Sprache, existiert das Begehren nur auf der einzigen Ebene der imaginären Beziehung des Spiegelstadiums, projiziert, entfremdet im andern. Die Spannung, die es erzeugt, ist dann jeden Auswegs beraubt. Das heißt, sie hat keinen anderen Ausweg – wie Hegel uns lehrt – als die Zerstörung des andern. Das Begehren des Subjekts kann sich in dieser Beziehung allein durch absolute Konkurrenz bestätigen, allein durch absolute Rivalität mit dem anderen, wenn es um das Objekt geht, dem es zustrebt.« 50
91
Kurt Appel, Martin Eleven
zu sich kommen, was Lacan dazu veranlasste – den Grunderkenntnis sen Freuds folgend –, das Unbewusste, welches sich erst durch den Eintritt in die Sprache generiert, nicht als intimen, sondern als extimen Ort zu verstehen. Aus dieser Einsicht heraus muss man auch die oft zitierte Sentenz Lacans verstehen: »Das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen.«51 D.h., das Unbewusste ist in diesem Sinne stets durch den Anderen strukturiert und sprachlich verfasst.52 Da die symbolische Ordnung dem Subjekt vorhergeht und es mit dem Eintritt in diesen Verweisungszusammenhang den mannigfachen Anrufungen dieser »Struktur der Andersheit« ausgeliefert ist, befindet es sich immer auch in einer latent hysterischen Position (es fragt sich beständig, was der Andere von ihm möchte und welches seine eigene Position in diesem Verweisungszusammenhang ist) und findet letztlich keinen sicheren Halt mehr in seinen imaginären Selbstbespiegelungen; es ist somit radikal de-zentriert. Aus Gründen des beschränkten Umfangs müssen an dieser Stelle alle konzeptuellen Anknüpfungspunkte zu den wichtigen Begriffen Ödipuskomplex oder Namen-des-Vaters beiseitegelassen werden, die für eine umfassendere Darstellung der Subjektgenese ebenso von Bedeutung wären.53 Stattdessen soll in diesem Zusammenhang nur darauf verwiesen werden, dass jenes Moment der symbolischen Kas tration, das den Eintritt in die Sphäre der Sprache und des Symboli schen zum Ausdruck bringt, die Entfremdung, die bereits auf der Ebene des Spiegelstadiums ersichtlich wurde, nicht beseitigt, sondern im Gegenteil noch einmal vertieft. Denn ähnlich wie bei Hegel ist die Sprache auch für Lacan Ausdruck eines Verlustes an Unmittelbarkeit (die Benennung ist der Mord am Ding), der dem Ich die Möglichkeit versperrt, sich selbst einen absoluten Ort zuzusprechen. Dies bedeutet 51 Interessant ist Lacans Formulierung vor allem deshalb, stellt sie doch unmiss verständlich heraus, dass die Konzeption des Unbewussten in der Psychoanalyse kein bloß individuelles Phänomen wiederzugeben versucht. Natürlich wäre weiter zu fragen, ob nicht gerade unsere Zivilisationsgeschichte eine Geschichte der vor anschreitenden Verinnerlichung des Unbewussten darstellt und zwar einer soweit vorangeschrittenen Verinnerlichung, dass die »neuen Symptome«, wie sie gegenwär tig in der Klinik der Psychoanalyse anzutreffen sind, nur noch wenig Auskunft über das »Außen« des Unbewussten geben. Siehe auch: K. Heinrich, Der Gesellschaft ein Bewußtsein ihrer selbst zu geben. 52 Vgl. J. Lacan, »Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psycho analyse«, S. 71–169. 53 Für eine detaillierte Darstellung siehe: B. Fink, Das Lacan’sche Subjekt.; M. Recal cati, Jacques Lacan.
92
Hegel und das Offene der Gottesfrage
im Umkehrschluss aber nicht die Auflösung aller Bilder, die das Ich von sich selbst hat, sondern dass diese Bilder von der Operation der Sprache, d.h. vom Spiel der Signifikanten (der symbolischen Ordnung) erfasst werden. Durch den Eintritt in die Sprache kann das Ich niemals mehr gänzlich bei sich selbst sein; man müsste eigentlich sagen, dass es für immer an seinem Platz fehlt und ausschließlich als dynamisch-energetisches Übergehen von einem Signifikanten in einen anderen ex-istiert. Deshalb spricht Lacan ungeachtet der jeweils auftretenden theoretischen Neuerungen seiner Lehre von einem gespaltenen Subjekt als Effekt der Sprache.54 Der große Andere kann als ein virtueller Fluchtpunkt gedacht werden, der subjektkonstituierend ist, da das Partikuläre immer auf eine Art Totalisierung ausgerichtet ist. Zu erwähnen wären in diesem Kontext auch Hegels drei Stellungen des Gedankens zur Objektivität, besonders die erste Stellung, die für Hegel ein unbefangenes Verfah ren darstellt, „ […] welches noch ohne das Bewußtsein des Gegensat zes des Denkens in und gegen sich, den Glauben enthält, dass durch das Nachdenken die Wahrheit erkannt, das, was die Objekte wahrhaft sind, vor das Bewusstsein gebracht werde.«55 Der große Andere wäre also gewissermaßen im Sinne der Metaphysik Gott oder das höchste Sein im Sinne eines Garanten und Bürgen der Identität von Sprache und Sein. Dahinter steht eine Art Realismus, der insgesamt etwas mit der befriedenden Instanz des großen Anderen zu tun hat (die Kehr seite dieses großen Anderen, das Über-Ich, wird hier beiseitegelassen werden). Aus hegelscher Perspektive könnte man sagen, dass es in dieser Perspektive darum geht, dass das Ich den Anspruch erhebt, äußere Sachverhalte als Ansichsein direkt so zu erfassen, wie sie sind. Dies meint im Kontext von Lacans großem Anderen wiederum nichts anderes als dass dieser zumeist unhinterfragt als Medium nicht nur das gesamte Beziehungsgeflecht des Subjekts strukturiert, sondern auch das alltägliche Denken und Handeln ordnet und bestimmt. Er ist in dieser Hinsicht die unhinterfragte Bedingung der Etablierung eines homogenen »Raums der Gründe« und kommt als virtueller Fluchtpunkt dem sehr nahe, was Hegel unter dem objektiven Geist oder der zweiten Natur versteht. Man kann hier auch an Lacans bekannten Ausspruch denken, demzufolge ein Signifikant das ist, was das Subjekt für einen anderen Signifikanten repräsentiert. Vgl. J. Lacan, »Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freudschen Unbe wußten«, S. 195. 55 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie, § 26, S. 93 [kursiv i. O.].
54
93
Kurt Appel, Martin Eleven
Ebenso muss man im großen Anderen aber auch die Instanz sehen, aus deren Perspektive das Subjekt auf sein Leben schaut und sich selbst beurteilt, unter der Voraussetzung, dass diese Abläufe nicht auf einer bewussten Ebene angesiedelt sind. Oft glaubt das Subjekt gemäß vernünftiger (selbst gegebener) Regeln zu handeln, dabei liegen den Handlungen größtenteils rudimentäre Begründungsstruk turen zugrunde, die ihm selbst nicht einsichtig sind, was Hegel auf seine Weise zum Ausdruck bringt, wenn er das Anundfürsichsein als Gesetztsein versteht, also zum Ausdruck bringt, dass jeder absolute Ort des Selbst auch als ein kontingent gesetzter zu verstehen ist. Noch einige zusammenfassende Bemerkungen bevor zum realen Anderen übergegangen wird: Wie bereits bei der Behandlung des Spiegelstadiums angesprochen, gibt es den kleinen anderen, d.h. den Mitmenschen und Nachbarn, mit dem das Ich in spiegelbild lichen Verhältnissen des Wettbewerbs, der Anerkennung und des Austauschs steht und der ihm ähnlich ist. Weiters gibt es den symbo lischen großen Anderen, der diese Art der Beziehung auf die Ebene der Sprache hebt. Er ist der virtuelle Fluchtpunkt und die Substanz unseres gesellschaftlichen Lebens. Es handelt sich, mit Hegel gesprochen, um unsere »zweite Natur«, die letztlich aber ihre Konsistenz nur dadurch erhält, dass das Subjekt an sie glaubt und mit ihr im Austausch ist. Man könnte auch sagen, dass durch Sprechen und Handeln dieses Feld des Anderen beständig neu belebt und aufrechterhalten wird. In seiner subjektivierten Form erscheint der große Andere dabei als jemand, dem ein (All-)Wissen unterstellt und der gleichzeitig ohne Mangel gedacht wird gleich einem höchsten Gott, der über das Leben richtet. Er verkörpert sich aber ebenso in autoritären Figuren und Strukturen sowie als Bezugspunkt souveräner Machtansprüche. Um sich dem realen Anderen zu nähern, sei an dieser Stelle nochmals auf das Problem des Mitmenschen verwiesen: Nach Lacan sieht sich das Ich entweder auf narzisstische Weise selbst in ihm oder das Verhältnis zu ihm ist schon über die symbolische Ordnung und ihre normativen Strukturen, Werte und Gesetze vermittelt. Was aber, so kann weiter gefragt werden, wenn dieser Mitmensch ein Unmensch ist, im Sinne von abgründig, an dem sich etwas Monströses zeigt, also etwas, das sich nicht in die Register des Imaginären und Symbolischen einfügen lässt? Wie bereits zuvor erwähnt, hegte Lacan eine Skepsis gegenüber dem Liebesgebot der jüdisch-christlichen Tradition. Diese Skepsis bringt Slavoj Žižek gut auf den Punkt:
94
Hegel und das Offene der Gottesfrage
[F]ür Lacan ist dieses Gebot zutiefst problematisch, da es die Tatsache verschleiert, daß hinter dem Nächsten als meinem Spiegelbild, hinter demjenigen, der mir ähnlich ist und in den ich mich einfühlen kann, immer der unermeßliche Abgrund der radikalen Andersheit lauert, der Abgrund von jemanden, über den ich letztlich nichts weiß. Kann ich mich wirklich auf ihn verlassen? Wer ist er?56
Es gibt einen guten Grund für Lacan, den Nächsten nicht schlichtweg als den freundlichen, harmlosen Mitmenschen zu betrachten. Zuvor wurde bereits erwähnt, dass bei der Herausbildung eines Ichs als Körperbild ein Rest übrigbleibt, der nicht völlig in der Beziehung von Ich und dem kleinen anderen aufgeht und auch nicht durch den Eintritt in die Sprache beseitigt werden kann (im Gegenteil, das Einwirken der Sprache auf den Körper verschränkt das Genießen mit derselben). Dieser Rest wurde als jouissance benannt und gerade dieses Genießen stellt mit Blick auf den realen Anderen einen Abgrund dar. Žižek gibt auf die Frage, welche Auswirkungen auf die zwischenmenschliche Begegnung diese Zusammenhänge haben, folgenden Hinweis: Wann begegne ich tatsächlich dem Anderen ›jenseits der Mauer der Sprache‹ im Realen seines oder ihres Seins? Nicht, wenn ich ihn oder sie beschreiben kann, noch nicht einmal, wenn ich seine oder ihre Werte, Träume usw. kennenlerne, sondern nur, wenn ich dem Anderen im Augenblick seiner oder ihrer jouissance begegne, wenn ich an ihm oder ihr ein winziges Detail entdecke (eine zwanghafte Geste, einen exzessiven Gesichtsausdruck, einen Tick), der mir die Intensität des Realen der jouissance anzeigt. Diese Begegnung mit dem Realen ist immer traumatisch, es hat immer etwas zumindest andeutungsweise Obszönes, ich kann es nicht ohne weiteres in mein Universum integrieren. Jouissance ist also der ›Ort‹ des Subjekts, man ist versucht zu sagen, sein ›unmögliches‹ Da-Sein, und aus eben diesem Grund ist das Subjekt im Bezug hierauf immer-schon disloziert und ›aus-den-Fugen-geraten‹.57
Wie bereits dargelegt, ist nach Lacan das Subjekt ein Effekt der vom symbolischen Anderen kommenden Sprache. Dies hat aber auch zur Folge, dass es seine Identität alleine über diesen entfremdenden und verkennenden Prozess generiert, ohne sich selbst vollkommen verob jektivieren oder restlos mit sich selbst identisch werden zu können; S. Žižek, Lacan. Eine Einführung, S. 62. Siehe dazu auch: S. Žižek, Das fragile Absolute, S. 159f. 57 S. Žižek, Liebe deinen Nächsten? S. 87f.
56
95
Kurt Appel, Martin Eleven
es ist eingewoben in das Spiel der Signifikanten und selbst als eine Art Leerstelle aufzufassen, dessen einzige existenzielle Gewissheit in seinem Genießen, diesem »Stückchen an Realem«, das sich nicht in den symbolischen Bezugsrahmen integrieren lässt, liegt. Gemäß dem psychoanalytischen Diskurs zeigt sich dieses »Stückchen an Realem« in Form von Symptomen, mit denen der Mensch seine unbewussten Spannungen zwischen Lust und Unlust zu äußern vermag. Dies stellt gewissermaßen die Kehrseite der Wirkung der Sprache auf den Körper dar. Der Andere in der Dimension des Realen zeigt, dass nicht nur das Subjekt von einem Riss durchzogen ist, sondern auch der Mit mensch von »Etwas« heimgesucht wird, das sich diesem querstellt. Hieraus wird auch eine der von Lacan bevorzugten Beschreibungen des Realen verständlich: Das Reale in Form des Genießens hat absolut nichts mit dem zu tun, was herkömmlicherweise Realität genannt wird, denn diese ist bei Lacan durch die Bilder und die Sprache vermittelt. Das Reale ist vielmehr als eine Art Störfaktor aufzufassen, eben als ein »Etwas«, das sich der Dimension des Imaginären und des Symbolischen entzieht und sich nicht innerhalb von deren Regis tern beschreiben lässt. Dieses unheimliche und exzessive Moment bewohnt Lacan zufolge jedes Subjekt. Der andere/Andere lässt sich also weder auf seine Ebenbildlichkeit noch auf seine symbolische Dimension festlegen. In ihm zeigt sich vielmehr ein Abgrund, den Lacan auch mit dem Begriff des Dings benannt hat, ein Bereich, der aus Sicht der Psychoanalyse nicht nach dem Lustprinzip funktioniert. Diesen Bereich kennzeichnet nach Lacan etwas Unerträgliches. Ihm nahe zu kommen, bedeutet mit etwas konfrontiert zu sein, das der Symbolisierung widersteht und sich nicht in unseren Sinnhorizont einfügen lässt, was letztlich etwas Traumatisches an sich hat. Lacans abgründiger realer Anderer darf aber nicht vorschnell mit dem Ande ren im Sinne von Levinas und der jüdischen Tradition verwechselt werden, dessen ethischer Anruf zur Verantwortlichkeit das Subjekt immer schon erreicht hat. Der reale Andere im Sinne Lacans lässt sich gerade nicht mehr in eine derartige Kategorie einfügen, er ist nicht der Verursacher eines ethischen Rufes, der uns anspricht und dem gegenüber wir irreduzibel in einer Schuld stehen oder dem gegenüber wir verantwortlich sind.58 Weit davon entfernt hinzuweisen, den 58 Siehe dazu: S. Žižek, Das fragile Absolute, S. 165. Žižeks Ausführungen bleiben hier sicherlich weit hinter Levinas‘ Intentionen zurück. Sie werden hier ausschließlich zur vereinfachenden Illustration herangezogen. Für eine tiefergehende Auseinander
96
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Nächsten nicht zu vergessen, geht es vielmehr darum, »den Nächsten auf Distanz zu halten, uns gegen die Monstrosität von nebenan abzu schirmen.«59 Es gibt im Anderen also »Etwas«, das mehr ist als er selbst und das sich weder im Register des Imaginären noch im Register des Symbolischen gänzlich erfassen lässt, wenngleich es auch mit die sen Dimensionen in Verbindung steht und durch beide hindurch scheint und sie gewissermaßen verzerrt.60
2.3 Hegels »Tod Gottes« und die »Inkonsistenz des großen Anderen« Im Anschluss dieser Annäherung an Lacans drei Register soll nun der Versuch unternommen werden, das bisher Gesagte mit Hegels Gedankengängen zur Religion, wie sie im ersten Abschnitt des Arti kels dargelegt wurden, in Verbindung zu setzen und zu zeigen, worin sich zwischen beiden Konzeptionen einige Konvergenzpunkte ausmachen lassen. Hegels PhdG lässt sich als eine Art Metareflexion über den Versuch des Ichs lesen, sich in seiner Weltauslegung Beständigkeit zu verleihen, indem es sich in seinem Gegenüber, in seinen Objekten festmachen möchte und zu erkennen meint. Das Wissen, das das Ich dabei gewinnt, bleibt allerdings negativ, d.h. es ist in seiner positiven Form bis zu einem bestimmten Moment des Umschlags lediglich ein gespiegeltes Wissen. Jene Passagen der PhdG, die die Selbstspie gelungen des Ichs als eine Form des verzerrten Wissens darstellen, ließen sich hierbei in eine Nähe zu Lacans Dimension des Imaginären rücken. Lacans Spiegelstadium kann als eine Art Verdichtung einiger Passagen aus Hegels PhdG gelesen werden, vor allem, wenn man die Stationen der Selbstfindung des Ichs von der sinnlichen Gewissheit bis hin zum Abschnitt über die Begierde zusammenfassen wollte. Vielleicht könnte man überhaupt sagen, dass die PhdG aus lacan scher Perspektive als eine große Symptomatologie verstanden werden setzung mit der Frage der Alterität bei Levinas und Lacan, siehe D. Brody, Levinas and Lacan: Facing the Real. 59 S. Žižek, Lacan. Eine Einführung, S. 63. 60 Hier wäre an Lacans Beschreibung der Anamorphose zu denken. Das Reale als jenes X, das unsere Sicht auf die Realität verzerrt. Siehe dazu: J. Lacan, Das Seminar Buch XI.
97
Kurt Appel, Martin Eleven
kann, gewissermaßen als ein Pendant zur Klinik der Psychoanalyse, die die existenziellen Strukturen der Neurose, Perversion und Psy chose heranzieht, um den je bestimmten Weltumgang des Ichs auf der Suche nach sich selbst darzustellen.61 Das Ich, welches dabei zu Tage tritt – bevor es den entscheidenden Erfahrungsschritt am Übergang vom Gewissens- zum Religionskapitel macht, durch welchen es einen Verlust an Selbstrepräsentierbarkeit erfährt – ist Folge des Versuchs absoluter Selbstrepräsentierbarkeit im Spiegel des eigenen unermess lichen Begehrens und findet einen seiner Kulminationspunkte im Ausdruck des Kampfes um Anerkennung, wie ihn Hegel an den Gestalten von Herr und Knecht ausgeführt hatte und auf welchen Lacan in seinen persönlichen Überlegungen zum Spiegelstadium zurückgriff. Jedoch scheitert der Versuch des Ichs, sich seiner selbst ansichtig zu werden: In allen Gestalten, angefangen von der sinnli chen Gewissheit über die Gegenständlichkeit der Wahrnehmung bis hin zur praktischen Vernunft, zur Familie, zum Gemeinwesen der Sittlichkeit und zur Moralität kann es sich nicht adäquat reflektieren. Es findet nicht sich selbst in diesen phänomenalen Gestaltungen, sondern seinen eigenen Entzug, was, wie im ersten Teil gezeigt wurde, die traumatische Erfahrung am Ausgang des Gewissenskapitels in Gange setzt, welche zur Religion überführt. Insofern das Religions kapitel der PhdG den vorläufigen Abschluss der Wissenskritik dar stellt, muss man den entscheidenden Erfahrungsschritt des Ichs darin sehen, dass diesem jeder Gegenstand abhandengekommen war, in dem es sich zu verorten suchte – zuletzt auch seine gewissenhafte Selbstvergewisserung in der Verurteilung des Anderen. Religion ist bei Hegel also nicht Ausdruck einer Selbstprojektion des Ichs, kein imaginäres Supplement oder ein Himmel, der ersehnt wird. Vielmehr entspringt das religiöse Selbstverhältnis dem Verlust des Ichs, sich einen absoluten Ort zusprechen zu können – es erfährt sich nicht mehr durch seine Gegenstände und deren Bespiegelungen, sondern erfährt sich und die Welt als Negativität. Die Welt und der andere können nicht mehr als schlicht referenzielle Wirklichkeit betrachtet werden; das Sein tritt als das Andere des Bewusstseins zutage. Hieran anknüpfend ließe sich ebenso die Frage stellen, ob sich nicht Hegels Motiv eines Denkens in Gestalten (wie für die PhdG ausschlaggebend) auf Lacans Ausarbeitung seiner Diskursmatheme niedergeschlagen hat. Weiterführend dazu: J. Lacan, Le Séminaire XVII: L'envers de la psychanalyse. Sowie: W. Bergande, »Dialektik und Subjektivität«. 61
98
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Die Stufe der Religion bleibt allerdings trotz des bedeutsamen Erfahrungsschrittes, den das Ich gemacht hat, von einem ambivalen ten Moment durchwaltet. Sie stellt zwar auf der Ebene der Erfahrung des Ichs den Verlust an unmittelbarer Selbstrepräsentierbarkeit dar, jedoch versucht es, diesen Verlust nochmal mittels sprachlicher Sym bolisierungen einzuholen: Sprache und Symbolisierung müssen hier allerdings selbst schon als Ausdruck dieses Verlusts betrachtet wer den. Hierbei lässt sich eine Nähe zu Lacans Register des Symbolischen festmachen. Wie gezeigt wurde, stellt auch für Lacan die Sprache den entscheidenden Schritt in der Subjektgenese dar. Nur durch den Eintritt in die Sprache, die vom Anderen kommt und die sich der Verfügungsgewalt eines Ichs und seinen Selbstbespiegelungen entzieht, bildet sich ein Subjekt. Dieses Subjekt war allerdings nur als negativer Selbstbezug zu denken, wie letztlich als Subjekt des Unbewussten. Das Zusammenspiel der Signifikanten, in dem das Subjekt eingewoben ist, erweist sich bei näherer Betrachtung als dem sehr nahe, was Hegel gerade im Religionskapitel als Sprache versteht: Zwar haben die Signifikanten keine unmittelbare empirische Referenz mehr (sie referieren nicht mehr auf Gegenstände, sondern auf deren Negativität), doch bleibt ihr Verweisungszusammenhang durch die Funktion des großen Anderen garantiert. Im Tode Gottes bringt Hegel den Verlust eines Gottes der Meta physik als Garanten der Sprache und der Welt zum Ausdruck und hebt dadurch die Stellung des als absoluten Geistes verstandenen biblischen Gottes gegenüber dem griechisch-philosophischen Gottes verständnis hervor. Dieser soll gerade nicht als absolute Einheit mit sich selbst und als das ursprünglich All-Eine am Anfang des Seins verstanden werden. Vielmehr geht aus der Fülle des Seins der sich entäußernde Menschensohn hervor, welcher am Kreuz stirbt und dadurch dieser Fülle selbst einen Riss zufügt oder anders gewendet, selbst als ein Ausdruck dieses Risses im Sein verstanden werden muss. Damit ist im Sein selbst ein Moment der Alterität und Hete rogenität eingeschrieben, das jede lineare Positivierung des großen Anderen, sogar in seiner letzten Form als Tod verbietet. Wie Hegel führt auch Lacan diverse Figuren von Alterität und deren Zerbrechen vor Augen. Der imaginäre kleine andere würde bei beiden noch ein Festhalten am symmetrisch verstandenen Gegen über bedeuten. Diese Art der verobjektivierenden Beziehung verrät etwas über den je spezifischen Weltumgang und den Stand des Wissens des Ichs. Sie bleibt vom Anspruch nach einem absoluten
99
Kurt Appel, Martin Eleven
Ort seitens des Ichs durchzogen, von dem aus die Welt begriffen und in Besitz genommen werden kann. Vielleicht darf man aber das entscheidende Moment für eine Annäherung zwischen Hegel und Lacan in der Begegnung mit dem realen Anderen ausmachen. Am Übergang des Gewissens- zum Religionskapitel in der PhdG wird das Ablassen des Ichs von seinen Geltungsansprüchen beschrieben. Dies hängt mit der bereits erwähnten Erkenntnis zusammen, dass sowohl das eigene Anundfürsichsein als auch das des anderen immer schon Gesetztsein ist. Aus lacanscher Sicht hieße dies gerade, dass das Ich seinem Gegenüber nicht mehr spiegelbildlich oder symbolisch gegenübertritt, sondern ihn in seiner realen Dimension erfährt. Der andere und die Welt stellen keine Projektionsfläche mehr dar, was aus Sicht Lacans geradewegs als eine Begegnung mit dem Realen zu verstehen ist. Den Leitgedanken in diesem Geschehen muss man darin sehen, dass hierbei keine symbolische Vermittlung (im lacanschen Sinne) mehr greift, d.h. dass der große Andere als letzter Bezugsrahmen in diesem Erfahrungsschritt »außer-Kraft-gesetzt« wird: »Außer-Kraft-gesetzt« meint dabei nicht gänzlich vernichtet, vielmehr erfährt das Ich/Subjekt die Inkonsistenz des großen Ande ren. Das Subjekt erkennt den anderen/Anderen als ebenso von der Sprache geprägt und deshalb auch gespalten (bewusst/unbewusst). Lacan umschrieb diese Begebenheit mit dem Begriff des Mangels im Anderen (Ⱥ). Zum einen ist damit zum Ausdruck gebracht, dass es für das Ich/Subjekt keinen letzten Bezugspunkt mehr im großen Anderen gibt (er ist in seiner Funktion als Garant des letzten Sinns brüchig). Zum anderen wird damit aber auch die Erfahrung angezeigt, dass die Dimension des Symbolischen selbst von einem Entzugsmo ment/Exzess erfasst wird: In dem Moment, in dem der große Andere als brüchig erfahren wird, löst sich das bisher als fixiert angenommene Verhältnis von Sprache und Welt auf. Auf der Ebene der konkreten Begegnung mit meinem Mitmenschen bedeutet dies, dass er als Ding erscheint, als ein unergründlicher Abgrund, vor dem es entweder zurückzuweichen oder zu versuchen gilt, dem »Unergründlichen« in ihm wieder einen symbolischen Ausdruck zu geben, da seine Anwesenheit etwas Unerträgliches hat. Anzudenken wäre hierbei, ob nicht Hegel im Religionskapitel ein ähnliches Moment zu beschreiben versucht hat. Denn hat nicht das Ich, zumindest bis zum Abschnitt über die »Offenbare Religion«, den Versuch unternommen, sich den Entzug des Anderen – die Entäußerung der Substanz als Aufgang des Absoluten – mittels Symbolisierungen ansichtig zu machen?
100
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Im Religionskapitel zeigt sich demnach, dass am Übergang zur Offenbaren Religion das Verhältnis des Ichs zur sich entäußernden Substanz noch höchst ambivalent bleibt, so wie sich auch das Ich Lacans gleichzeitig vom realen Anderen angezogen wie abgestoßen fühlt. In beiden Momenten zeigt sich das Ding ausgelagert und bedrohlich. In der offenbaren Religion hingegen stirbt mit Gott auch der Tod als letzte unheimliche Gestalt des Herrensignifikanten. Damit endet nicht nur der große Andere, vielmehr offenbart sich darin die Nicht-Koinzidenz des Absoluten mit sich selbst.62 Die Inkarnation Gottes ist daher keine direkte Präsenz des Göttlichen in der endlichen Welt, sondern die Anschauung einer Negation jener Negation, in der der gesamte Signifikantenzusammenhang aufgehoben war. Für Žižek steht der Kreuzestod genau für diese Transformation der angespro chenen Kluft: Christus führt vor, dass Gott selbst in seinem Innersten gespalten ist, und er ist der Name für diese rein negative Geste. Gott zeigt sich darin selbst als geteilt, indem er seine Selbst-Identität aufgibt und seinen höchsten Ausdruck im Sich-selbst-anders-Werden findet (ähnlich wie Lacans gespaltenes Subjekt der Sprache, welches sich nie selbst restlos fassen kann). In Bezug auf die Figur Christi schreibt Žižek: Christus ist daher nicht ›Mensch plus Gott‹, sondern das, was in ihm sichtbar wird, ist einfach nur die göttliche Dimension im Menschen ›als solchem‹. Also weit davon entfernt, das Höchste im Menschen zu sein, die rein spirituelle Dimension, die alle Menschen anstreben, ist die ›Göttlichkeit‹ eher eine Art Hindernis, die ›Gräte im Hals‹ – jenes unergründliche X, aufgrund dessen man nie völlig Mensch, nie ganz selbst-identisch werden kann.63
Christus verkörpert demnach den Exzess, der den Menschen erst zum Menschen macht. Dieser Exzess (die Gräte im Hals) steht unmittelbar mit dem zuvor beschriebenen Genießen in Verbindung, welches sich weder mittels des Registers des Imaginären noch des Registers des Symbolischen völlig fassen lässt und das Subjekt disloziert. Vielleicht findet sich im hegelschen Denken, im Durchgang durch die christliche Lehre vom »Tod Gottes« sowie in der Psychoanalyse Lacans nicht nur ein wesentliches Moment menschlicher Existenz zum Ausdruck gebracht – der Mensch/das Subjekt ist mehr als nur seine diskursive 62 63
Vgl. S. Žižek, Die Puppe und der Zwerg, S. 89. S. Žižek, Die gnadenlose Liebe, S. 125.
101
Kurt Appel, Martin Eleven
Manifestation in der symbolischen Ordnung, er ist selbst gespalten und von der Kraft des Negativen durchwaltet –, sondern auch eine noch zu entdeckende politische Kraft. Mit Christus am Kreuz enden letztlich alle menschlichen Projektions- und Repräsentationsversu che, einer positivier- und besetzbaren Alterität letztgültige Allmacht zuzuschreiben (eine solche Zuschreibung mündete in den Tod bzw. in das absolute Nichts als ultimativen Herrensignifikanten). Aus dieser Perspektive heraus hieße dann Mensch zu sein nicht, aufgrund einer sterblichen und sündigen Natur nie ganz göttlich sein zu können, sondern aufgrund eines göttlichen Funkens (Genießen) in sich nie ganz Mensch sein zu können; nicht mit sich selbst restlos identisch sein zu können, setzt auch den Allmachtsphantasien erst wirklich eine Grenze. Diese Erfahrung findet ihren Niederschlag in der kon tingenten Begegnung mit dem Anderen (Ⱥ).64 Wahre menschliche Begegnungen, so könnte man vorsichtig formulieren, finden für Hegel und Lacan nicht in einem vorstrukturierten (und positiv sprachlich vermittelten) homogenen Raum statt, wo sich Subjekte, vermittelt über eine positivierbare Transzendenz (großer Anderer, objektiver Geist), ihrer gegenseitigen Anerkennung vergewissern können, son dern dort, wo der Mitmensch in seiner Offenheit, Verletzbarkeit und letztlich Exzessivität und Gespaltenheit erscheint. Darf man darin aus lacanscher Perspektive nicht auch gerade die Pointe der Nachfolge Christi sehen? Vielleicht könnte in einer Mystik der Nachfolge,65 wel che sich am Ereignis des Todes Christi (Gottes) orientiert, nicht nur das Zerbrechen absoluter Machtansprüche gesehen werden, sondern auch am (individuellen und sozialen) Körper der Riss des Absoluten Vgl. S. Žižek, Die Puppe und der Zwerg, S. 79–93. Siehe weiterführend: M. de Certeau, Glaubensschwachheit; ebenso: M. de Certeau, Mystische Fabel, S. 7–25, sowie S. 482–490. De Certeau, Gründungsmitglied der von Lacan 1964 ins Leben gerufenen École freudienne de Paris (EFP), kann als ein origi närer Denker bezeichnet werden, der versucht hat, psychoanalytische Theorien auf das Feld der (christlichen) Mystik anzuwenden. Als Historiker war er sich darüber gewahr, dass sich Fragen, die sich einst an einem bestimmten Ort gestellt haben und einem klar definierten Bedeutungskontext entsprungen waren, durchaus verschieben können und erst in anderen Bereichen wieder lesbar werden; dies gilt auch für die Theologie als vormalige Leitwissenschaft. Das Religiöse sowie die Gottesfrage hat sich, aus der Sicht de Certeaus, in andere Disziplinen verschoben und die Mystik stellt gerade einen der Bereiche für ihn dar, die dem Gründungsereignis des Christentums (den Tod Gottes, Christus abwesender Körper) jenseits dogmatischer Engführen die Treue halten und versuchen, diesem Ereignis in immer neuen Anläufen einen perfor mativen Ausdruck zu verleihen. 64
65
102
Hegel und das Offene der Gottesfrage
selbst entdeckt werden (mit Lacan gesprochen, die Erfahrung der Inkonsistenz des Anderen gemacht werden). »Gott« wäre dann viel leicht im Ausgang von Lacan nicht mehr der virtuelle Fluchtpunkt unseres Beziehungsgeflechtes (als großer Anderer und höchstes Sein), vielmehr wäre der Ort seiner Offenbarung das auch am Ende der Ausführungen über Hegel begegnende »Exerzitium«, welches der Exzessivität des Mitmenschen und Nachbarn nicht mehr zu entfliehen trachtet, sondern der Offenheit der Körper und damit auch deren Kontingenz und Endlichkeit Rechnung trägt. Es war das Anliegen des zweiten Teils dieses Artikels aufzuzei gen, dass eine mögliche Annährung an Hegels Religionsphilosophie mittels der Psychoanalyse Lacans ihren Ausgangspunkt über die Figur des anderen/Anderen nehmen kann (im Hinblick auf die drei Register). Mögen deren theoretische Ausformulierungen auch noch so verschieden sein, zeigen sich doch gewisse Konvergenzen zwischen beiden Denkern, gerade wenn es um die Kritik des großen Anderen geht. Aus dieser Perspektive eröffnet der christliche Diskurs eine antimetaphysische Wende, dem beide Denker auf ihre je eigene Art einen Ausdruck zu geben versuchen. Lacan kann mit seiner Variation der Psychoanalyse einen erheblichen – wenn auch von ihm nicht intendierten – Beitrag zu einer Neuartikulation von Hegels Religions philosophie leisten, indem er die Position des positivierbaren großen Anderen offen lässt und den Blick für die Exzessivität des Menschen schärft. Das hier einiges noch offenbleiben muss, ist bei einer solchen ersten Skizzierung klar. Lohnenswert wäre ein genauerer Blick auf die Dimension des Affektiven, die in beiden Theoriegebäuden nicht immer unmittelbar ersichtlich ist, um gerade der Rolle des Körperli chen und dessen Exzessivität in Bezug auf Religion Rechnung zu tragen. Dies muss aber auf eine kommende Ausarbeitung warten.
Literaturverzeichnis Agamben, G., Il tempo che resta. Un commento alla lettera ai romani, Turin: Bollati Boringhieri 2000 Agamben, G., Die kommende Gemeinschaft, übers. a. d. Italienischen von A. Hiepko, Berlin: Merve 2003 Agamben, G., Das Sakrament der Sprache. Eine Archäologie des Eides (Homo Sacer II.3), übers. a. d. Italienischen von S. Günthner, Frankfurt/M.: Suhr kamp 2010
103
Kurt Appel, Martin Eleven
Appel, K., »Hegel und das Offene der Gottesfrage«, in: A. Langenfeld, S. Rose nauer (Hg.), Menschlicher Geist – göttlicher Geist. Beiträge zur Philosophie und Theologie des Geistes, Münster: Aschendorff 2021, S. 229–248 Appel, K., Tempo e Dio: Aperture contemporanee a partire da Hegel e Schelling, Brescia: Queriniana 2018 (= Biblioteca di teologia contemporanea 187) Arndt, A., »Das vollendete Bewusstsein der Freiheit: Die absolute Idee«, in: ders., Geschichte und Freiheitsbewusstsein. Zur Dialektik der Freiheit bei Hegel und Marx, Berlin: Eule der Minerva 2015, S. 134–147 Arndt, A., »Wer denkt absolut? Die absolute Idee in Hegels »Wissenschaft der Logik«“, in: Revista Eletrônica Estudos Hegelianos 16 (2012), S. 22–33 Auinger, T., Das absolute Wissen als Ort der Ver-Einigung. Zur absoluten Wis sensdimension des Gewissens und der Religion in Hegels Phänomenologie des Geistes, Würzburg: Königshausen und Neumann 2003 Bahr, H.-D., Den Tod denken, München: Fink 2002 Balmary, M., Das verbotene Opfer. Freud und die Bibel, übers. a. d. Französischen von E. u. J. Landrichter, Wien: Turia+Kant 2012 Bergande, W., »Dialektik und Subjektivität«, in: Deutsche Zeitschrift für Philo sophie Sonderband 8, 2004, S. 83–97 Brandom, R., A Spirit of Trust: A Reading of Hegel’s Phenomenology, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 2019 Breidbach, O., Neuser, W. (Hg.), Hegels Naturphilosophie in der Dritten Moderne. Bestimmungen, Probleme und Perspektiven, Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung 2010 (= Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 13) Brody, D., »Levinas and Lacan: Facing the Real«, in: S. Harasym (Hg.), Levinas and Lacan. The Missed Encounter, New York: State University of New York Press 1998, S. 56–78 Butler, J., Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France, New York: Columbia University Press 1987 Cassirer, E., »Einleitung«, in: ders. (Hg.), Gottfried Wilhelm Leibniz. Hauptschrif ten zur Grundlegung der Philosophie, Hamburg: Meiner 1996, S. XV-CIII Cassirer, E., Leibniz‘ System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen, hg. von B. Recki, Hamburg: Meiner 1998 (= Ernst Cassirer Werke, Hamburger Aus gabe 1) Certeau, M. de, Glaubensschwachheit, hg. von L. Giard, übers. a. d. Französischen von M. Lauble, Stuttgart: Kohlhammer 2009 Certeau, M. de, Mystische Fabel: 16. bis 17. Jahrhundert, übers. a. d. Französischen von M. Lauble, m. e. Nachwort von D. Bogner, Berlin: Suhrkamp 2010 Comay, R., Ruda, F., The Dash – The Other Side of Absolute Knowing, Mas sachusetts, London: MIT Press 2018 Deleuze, G., Die Falte. Leibniz und der Barock, übers. a. d. Französischen von U.J. Schneider, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000 Descombes, V., Das Selbe und das Andere: Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich; 1933–1978, übers. a. d. Französischen von U. Raulff, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981 Fink, B., Das Lacan’sche Subjekt. Zwischen Sprache und Jouissance, übers. a. d. Amerikanischen von T.C. Boehme, Wien: Turia+Kant 2006
104
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Freud, S., »Jenseits des Lustprinzips«, in: Gesammelte Werke. Band XIII, Frank furt/M.: Fischer 1999, S. 3–69 Freud, S., »Das Unbehagen in der Kultur«, in: Gesammelte Werke. Band XIV, Frankfurt/M.: Fischer 1999, S. 419–506 Freud, S., »Die Zukunft einer Illusion«, in: Gesammelte Werke. Band XIV, Frank furt/M.: Fischer 1999, S. 323–380 Hegel, G.W.F., Hegel, G.W.F. (1986) Werke in 20 Bänden (stw 601–620), auf der Grundlage der Werke von 1832–1845 neu edierte Ausgabe. Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1970. Hegel, G.W.F., Frühe Schriften II, bearbeitet von Friedhelm Nicolin, Ingo Rill und Peter Kriegel, herausgegeben von Walter Jaeschke, (G.W.F. Hegel, Gesam melte Werke in Verbindung mit der deutschen Forschungsgemeinschaft, her ausgegeben von der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste und dem Hegel-Archiv der Ruhr-Universität Bochum, Band 2), Hamburg: Meiner 2014. Heinrich, K., Der Gesellschaft ein Bewußtsein ihrer selbst zu geben, Reden und kleine Schriften 2, Freiburg, Wien: ça-ira-Verlag 2020 Jaeschke, W., Die Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religi onsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1986 (= Spekulation und Erfahrung. Texte und Untersuchungen zum Deutschen Idealismus 4) Kant, I., Kritik der Urteilskraft (PhB 39a), Meiner: Hamburg 1993. Lacan, J., »Funktion und Feld des Sprechens und der Sprache in der Psychoana lyse«, in: Schriften 1, übers. a. d. Französischen von N. Haas, Olten [u.a.]: Walter-Verlag 1973, S. 71–169 Lacan, J., »Das Spiegelstadium als Bildner der Ichfunktion«, in: Schriften 1, übers. a. d. Französischen von N. Haas, Olten [u.a.]: Walter-Verlag 1973, S. 61 – 70 Lacan, J., »Subversion des Subjekts und Dialektik des Begehrens im Freudschen Unbewußten«, in: Schriften 2., übers. a. d. Französischen von N. Haas, Olten [u.a.]: Walter-Verlag 1975, S. 165–204 Lacan, J., »Die Familie«, in: Schriften 3, übers. a. d. Französischen von N. Haas, Freiburg i. Br.: Walter-Verlag 1980, S. 39–100 Lacan, J., Das Seminar Buch 1. Freuds technische Schriften (1953–1954), hg. von N. Haas, H.-J. Metzger, übers. a. d. Französischen von W. Hamacher, Weinheim, Berlin: Quadriga 21990 Lacan, J., Le Séminaire XVII: L'envers de la psychanalyse, Paris: Seuil 1991 Lacan, J., »Diskurs an die Katholiken«, in: Der Triumph der Religion, welchem vorausgeht: Der Diskurs an die Katholiken, hg. von J.-A. Miller, übers. a. d. Französischen von H.-D. Gondek, Wien: Turia+Kant 2006, S. 9–60 Lacan, J., Das Seminar Buch XI. Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse, übers. a. d. Französischen von N. Haas, Wien: Turia+Kant 2015 Liebrucks, B., Sprache und Bewußtsein, 7 Bde., Frankfurt/M.: Akademische Verlagsgesellschaft 1964–1979 Liebrucks, B., Sprache und Bewußtsein. Band 5. Die zweite Revolution der Den kungsart. Hegel: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M.: Akademische Verlagsgesellschaft 1970
105
Kurt Appel, Martin Eleven
Malabou, C., The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialectic, London, New York: Routledge 2005 Merleau-Ponty, M., Phänomenologie der Wahrnehmung, übers. a. d. Französi schen von R. Boehm, Berlin: de Gruyter 1966 Nancy, J.-L., Corpus, übers. a. d. Französischen von N. Hodyas, T. Obergöker, Berlin: Diaphanes 2003 Pagano, M., »Alle radici della modernità: la lotta dell’illuminismo contro la fede«, in: F. Michelini, R. Morani (Hg.), Hegel e il nichilismo, Mailand: Franco Angeli 2003. Posch, T., »Hegel und Haeckel über Evolution und Gradualismus«, in: O. Breid bach, W. Neuser (Hg.), Hegels Naturphilosophie in der Dritten Moderne, Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung 2010 (= Ernst-Haeckel-Haus-Studien, 13), S. 101–118 Recalcati, M., Jacques Lacan. Desiderio, godimento e soggetivazione, Mailand: Raffaello Cortina Edizione 2012 Ricoeur, P., Zeit und Erzählung III. Die erzählte Zeit, übers. a. d. Französischen von A. Knop, München: Fink 1991 Roudinesco, E., Jacques Lacan. Bericht über ein Leben, Geschichte eines Denksys tems, übers. a. d. Französischen von H.-D. Gondek, Wien: Turia+Kant 2011 Ruhstorfer, K., »Die Heilige Schrift in Hegels,Vorlesungen über die Philosophie der Religion‘“, in: ders., W. Metz (Hg.), Christlichkeit der Neuzeit – Neuzeit lichkeit des Christentums. Zum Verhältnis von freiheitlichem Denken und christ lichem Glauben, Paderborn, Wien: Schöningh 2008, S. 95–117 Ruhstorfer, K., »Gott als Person bei Hegel«, in: F. Meier-Hamidi, K. Müller (Hg.), Persönlich und alles zugleich? Theorien der All-Einheit und christliche Gott rede, Regensburg: Pustet 2010, S. 47–66 Siep, L., Der Weg der Phänomenologie des Geistes. Ein einführender Kommentar zu Hegels »Differenzschrift« und »Phänomenologie des Geistes«, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000 Stekeler-Weithofer, P., Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein dialogischer Kommentar, Hamburg: Meiner 2014 Wagner, F., Der Gedanke der Persönlichkeit Gottes bei Fichte und Hegel, Gütersloh: Gütersloher Verlags-Haus Mohn 1971 Widmer, P., Subversion des Begehrens. Eine Einführung in Jacques Lacans Werk, Wien: Turia+Kant 2012 Žižek, S., Liebe deinen Nächsten? Nein, danke! Die Sackgasse des Sozialen in der Postmoderne, übers. a. d. Englischen von N.G. Schneider, Berlin: Volk & Welt 1999 Žižek, S., Das fragile Absolute. Warum es sich lohnt, das christliche Erbe zu vertei digen, übers. a. d. Englischen von N.G. Schneider, Berlin: Volk & Welt 2000 Žižek, S., Die gnadenlose Liebe, übers. a. d. Englischen von N.G. Schneider, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001 Žižek, S., Die Puppe und der Zwerg, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2003 Žižek, S., Lacan. Eine Einführung, übers. a. d. Englischen von K. Genschow, A. Roesler, Frankfurt/M.: Fischer 42013
106
Hegel und das Offene der Gottesfrage
Žižek, S., Weniger als Nichts. Hegel und der Schatten des dialektischen Materialis mus, übers. a. d. Englischen von F. Born, Berlin: Suhrkamp 2016 Zupančič, A., Der Geist der Komödie (morale provisoire #4), übers. a. d. Englischen u. m. e. Nachwort von F. Ruda, J. Völker, Berlin: Merve 2014
107
Esther Heinrich-Ramharter
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr« Konzeptionen religiöser Weltsicht bei Simone Weil und Ludwig Wittgenstein
Einleitung Den Ausgangspunkt dieses Aufsatzes bildet eine Passage aus einem Brief von Simone Weil an ihren geistlichen Mentor Joseph-Marie Perrin, in dem sich eine gewisse religiöse Weltsicht zeigt. Einerseits erläuternd, andererseits kontrastierend werden einige Überlegungen Wittgensteins zum Aspektwechsel und zur Religion herangezogen. Wittgenstein und Weil dürften einander nicht zur Kenntnis genom men haben,1 allerdings hat Peter Winch mit seinem Buch Simone Weil. »The Just Balance« bereits eindrucksvoll bewiesen, dass eine Weil-Lektüre mit Wittgenstein sehr erhellend sein kann.
1. Die Formel und die attention – Simone Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht In einem Brief an Pater Perrin schreibt Simone Weil, in Hinblick auf ihren Glauben: Ich fühlte, daß ich, nachdem ich mir so viele Jahre hindurch immer nur gesagt hatte: »Vielleicht ist das alles nicht wahr«, nun nicht etwa aufhören sollte, mir dies zu sagen – ich befleißige mich, es mir auch jetzt noch sehr oft zu sagen –, sondern dieser Formel die entgegenge setzte Formel: »Vielleicht ist das alles wahr« hinzufügen und beide miteinander abwechseln lassen sollte.2 1 2
Siehe dazu P. Winch, Simone Weil. »The Just Balance«, S. 4. S. Weil, Briefe an Pater Perrin, S. 97.
109
Esther Heinrich-Ramharter
Wie aus dem Kontext ersichtlich – Weil thematisiert ihre Verweige rung, sich taufen zu lassen –, handelt es sich um die Wahrheit des Christentums, die hier verhandelt wird. Nach einer ersten Lektüre des Briefs mag man sofort zu verstehen meinen, worum es in etwa geht. Anstatt gewisse Glaubensinhalte als »vielleicht nicht wahr« zu erachten, gehe es Weil nun darum, sie – zeitweise – als »vielleicht wahr« anzusehen, gewissermaßen von der anderen Seite auf sie zu blicken. Dass sich diese Passage weit weniger leicht verstehen lässt, als man zuerst meinen könnte, wird sich noch zeigen; bereits in dieser ersten Lesart lässt sich allerdings eine Ähnlichkeit mit jenem Perspektivenwechsel feststellen, den Iris Murdoch in einer vielzitierten Passage aus »The Idea of Perfection« beschreibt: A mother, whom I shall call M, feels hostility to her daughter-in-law, whom I shall call D. M finds D quite a good-hearted girl, but while not exactly common yet certainly unpolished and lacking in dignity and refinement. D is inclined to be pert and familiar, insufficiently ceremonious, brusque, sometimes positively rude, always tiresomely juvenile. M does not like D’s accent or the way D dresses. […] Thus much for M’s first thoughts about D. Time passes, and it could be that M settles down with a hardened sense of grievance and a fixed picture of D […]. However, the M of the example is an intelligent and well-intentioned person, capable of self-criticism, capable of giving careful and just attention to an object which confronts her. M tells herself: ›I am old-fashioned and conventional. I may be prejudiced and narrow-minded. I may be snobbish. I am certainly jealous. Let me look again.‹ Here I assume that M observes D until gradually her vision of D alters […]. D is discovered to be not vulgar but refreshingly simple, not undignified but spontaneous, not noisy but gay, not tiresomely juvenile but delightfully youthful, and so on.3
Murdoch wird zu dieser Überlegung tatsächlich von Weil angeregt, aber ausgehend von einem anderen Begriff: I have used the word ›attention‹, which I borrow from Simone Weil, to express the idea of a just and loving gaze directed upon an individual reality. I believe this to be the characteristic and proper mark of the moral agent.4
3 4
I. Murdoch, »The Idea of Perfection«, S. 17 f. Ebd., S. 34.
110
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
When M is just and loving she sees D as she really is […] I would like on the whole to use the word ›attention‹ as a good word and use some more general term like ›looking‹ as the neutral word. Of course psychic energy flows, and more readily flows, into building up convincingly coherent but false pictures of the world, complete with systematic vocabulary (M seeing D as pert-common juvenile, etc.) Attention is the effort to counteract such states of illusion.5
Auf Murdoch und ihre Moralphilosophie gehe ich hier nicht ein; aufgreifen möchte ich lediglich ihren Hinweis auf Weils Begriff der »attention«6 als eine spezielle Sichtweise auf andere Menschen. Um die Relevanz dieses Begriffs für die obige Aussage Weils einschätzen zu können, muss man sich das Umfeld dieser Aussage genauer anse hen. Weil berichtet, sie habe, da sie um ihre »Liebe auf seiten des Glaubens« wusste, eine »Verpflichtung [zur intellektuellen Redlich keit] nur immer gegen den Glauben empfunden«.7 Als gläubiger Mensch habe sie sich, so könnte eine Paraphrase vielleicht lauten, immer in der Verantwortung gesehen, kritisch gegenüber den Inhal ten und vermeintlichen Sicherheiten dieses Glaubens zu bleiben. Die neue Verantwortung, die sie als Reaktion auf eine Äußerung Perrins hin verspürte, verpackte sie in die Formel »vielleicht ist alles wahr«. Wie aber genau sollte diese Formel verwendet werden? Dafür gibt es meines Erachtens zwei Möglichkeiten: (1) Anstelle des Glaubens sollte nun das Nicht-Glauben hinter fragt werden. Als Gläubige hatte Weil hypothetisch unterstellt, dass alles nicht wahr wäre. Das Nicht-Glauben mit Skepsis zu versehen, würde nun bedeuten, zunächst hypothetisch anzunehmen, dass sie nicht-gläubig wäre, und auf dieser Basis dann, gleichsam doppelthypothetisch, davon auszugehen, dass die Glaubensinhalte doch wahr sein könnten. Es ist nicht auszuschließen, dass Weil das gemeint hat, und in einem solchen Wechsel zwischen Positionen könnte man tat Ebd., S. 37. Rush Rhees thematisiert das Verhältnis von attente und attention (siehe R. Rhees, Discussions of Simone Weil, S. 146–148), allerdings ist mir nicht klar, auf welche Texte er sich bezieht, denn in jenen Überlegungen, in denen die Auseinandersetzung mit attention hauptsächlich stattfindet, kommt das Wort attente nur höchst selten vor. (Der Titel des Buchs Attente de Dieu stammt nicht von Simone Weil.) Zu Weils Begriff der attention siehe etwa auch P. Roberts, »Attention, asceticism, and grace: Simone Weil and higher education«. 7 S. Weil, Briefe an Pater Perrin, S. 97. 5
6
111
Esther Heinrich-Ramharter
sächlich eine Hoffnung auf Erkenntnis vermuten. Dennoch tendiere ich eher zu einer anderen – gegenläufigen – Deutungsmöglichkeit für Weils Aussagen: (2) Der Ausdruck »vielleicht ist alles wahr« könnte meinen, dass Weil, zeitweise, die Skepsis gegenüber dem Glauben hintanstellen wollte. Diese Formel würde dann nicht dazu dienen, etwas (einen hypothetischen Unglauben) kritisch zu beleuchten, sondern ganz im Gegenteil probeweise ohne Vorbehalte gegenüber dem Glauben zu denken bzw. zu leben, stärker die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass wirklich alles, was der Glaube ihr nahelegt, wahr sein könnte. Es würde also nicht eine weitere Reflexionsebene dazugefügt, sondern eine vorhandene gelegentlich suspendiert werden. Dieses Verständnis von Weils Überlegungen wird vor allem durch jene Aussage von Pater Perrin gestützt, die Weil als den Grund für ihren Sichtwechsel nennt: Sie haben einmal, zu Beginn unserer Beziehungen, ein Wort zu mir gesprochen, das bis auf den Grund meiner selbst gegangen ist. Sie haben zu mir gesagt: »Geben Sie wohl acht; denn wenn Sie aus eigener Schuld an etwas Großem vorbeigingen, so wäre das sehr schade.«8
»Vielleicht ist alles wahr« würde also dafür stehen, die Wahrheiten des Glaubens ernster zu nehmen, das »Große«, das darin zum Vorschein kommen könnte, nicht zu verpassen. Diese zweite Interpretation legt auch eine Verbindung mit Mur dochs Weil-Lektüre nahe, die sich im Begriff der »attention« manifes tiert. Weil selbst legt ja Pater Perrin das Vokabel »achtgeben« (faire attention) in den Mund. Wenn Murdoch formuliert »Attention is the effort to counteract such states of illusion« (siehe oben) bringt das einerseits zum Ausdruck, dass hier eine persönliche (subjektive) Initiative und Beteiligung gefragt ist (»effort«) – ein Ernster-Nehmen –, und andererseits auch, dass auf diese Weise eine Wahrheit gegen über einer Illusion zum Durchbruch gelangen kann, dass also die Dinge sich quasi von selbst in das richtige Licht rücken, wenn man sie nur lässt. Man soll sich, so der Aufruf der attention, von den Tatsachen, Menschen und auch von Gott, darüber belehren lassen, wie sie wirklich sind. Weil drückt das einmal in einer Form aus, die man sogar als Definition lesen könnte: Die Aufmerksamkeit besteht darin, das Denken auszusetzen, den Geist verfügbar, leer und für den Gegenstand offen zu halten, die 8
Ebd., S. 96.
112
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
verschiedenen bereits erworbenen Kenntnisse, die man zu benutzen genötigt ist, in sich dem Geist zwar nahe und erreichbar, doch auf einer tieferen Stufe zu erhalten, ohne daß sie ihn berührten. Der Geist soll hinsichtlich aller besonderen und schon ausgeformten Gedanken einem Menschen auf einem Berge gleichen, der vor sich hinblickt und gleichzeitig unter sich, doch ohne hinzublicken, viele Wälder und Ebenen bemerkt. Und vor allem soll der Geist leer sein, wartend, nichts suchend, aber bereit, den Gegenstand, der in ihn gegeben wird, in seiner nackten Wahrheit aufzunehmen.9
Weil unterscheidet sich dabei von Murdoch insofern, als attention bei ersterer globaler gefasst wird: Es geht, überspitzt formuliert, nicht nur um die Schwiegertochter (»an individual reality«, ein moralisches Subjekt), sondern um das ganze Leben. Die Breite des Spektrums dessen, worauf attention zielen kann, lässt sich an zahlreichen Beispie len belegen. In dem 1941 oder 1942 entstandenen Aufsatz »Betrach tungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe« setzt Weil den Begriff ins Zentrum: Die Aufmerksamkeit (attention) ist nicht nur der wesentliche Gehalt der Gottesliebe. Auch die Nächstenliebe, von der wir wissen, daß sie die gleiche Liebe ist, ist aus dem gleichen Stoff gemacht.10 So ist es wahr, obgleich es paradox erscheint, daß eine Übersetzung aus dem Lateinischen, eine Geometrieaufgabe, selbst wenn sie uns mißraten sind, vorausgesetzt nur, man habe die angemessene Art von Anstrengung (attention) auf sie verwandt, uns eines Tages, später, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, besser in den Stand setzen können, einem Unglücklichen im Augenblick der höchsten Not genau die Hilfe zu bringen, die seine Rettung bewirkt.11
Aber auch in dem 1942/43 entstandenen Buch Die Verwurzelung12, das man – obgleich nie fertiggestellt – als Weils Hauptwerk, bezeich
S. Weil, »Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe«, S. 50. 10 Ebd., S. 52. 11 S. Weil, »Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe«, S. 53. 12 Ich zitiere aus der deutschen Übersetzung, greife aber bei der Identifizierung der Vorkommnisse von »attention« auf das französische Original zurück: S. Weil, L'Enra cinement. 9
113
Esther Heinrich-Ramharter
nen könnte, finden sich über 30 Vorkommnisse allein des Nomens »attention«, wie etwa: Den beiden Problemen [der Entwurzelung des Bauernstands und der Entwurzelung der Arbeiter] ist dieselbe Aufmerksamkeit (attention) zu widmen.13 Unerlässlich für diese Aufgabe [einen aufnehmenden Organismus in Frankreich zu bilden, E. R.] sind: ein leidenschaftliches Interesse an den Menschen, wer auch immer sie sind, und an ihrer Seele, die Fähigkeit sich an ihre Stelle zu versetzen und auf die Zeichen der unausgesprochenen Gedanken zu achten (faire attention), ein intuitives Verständnis der geschichtlichen Ereignisse, die im Moment im Gang sind, und die Fähigkeit, feine Nuancen und vielschichtige Verhältnisse schriftlich auszudrücken.14 Das Unglück der Schwachen ist nicht einmal Gegenstand der Aufmerk samkeit; wenn es nicht sogar ein Gegenstand der Abscheu ist.15 Die Inspiration ist eine Anspannung der seelischen Fähigkeiten, die jenen Aufmerksamkeitsgrad ermöglicht, der für eine Komposition auf mehreren Ebenen unerlässlich ist. Wer nicht zu einer solchen Aufmerksamkeit fähig ist, wird die Fähigkeit eines Tages erreichen, wenn er mit Demut, Ausdauer und Geduld aus harrt und von einem unveränderlichen, heftigen Verlangen getrieben wird. […] Die Politik ist ebenfalls eine Kunst, die von einer Komposition auf mehreren Ebenen beherrscht wird.16 Die Geschichte beruht auf Dokumenten. […] [Man] muss [...] in den Dokumenten zwischen den Zeilen lesen, sich vollkommen selbstver gessen in die berichteten Ereignisse versenken, sehr lange aufmerksam bei den kleinen, bedeutenden Dingen verweilen (attarder l'attention) und deren ganzen möglichen Sinn zu erkennen versuchen.17
Die letzten beiden Zitate lassen deutlich erkennen, dass Simone Weil auch beim Abfassen der Verwurzelung noch jenen Begriff von attention
13 14 15 16 17
S. Weil, Verwurzelung, S. 75. Ebd., S. 184. Ebd., S. 203. Ebd., S. 200. S. Weil, Verwurzelung, S. 207.
114
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
im Sinn hatte, der in dem Aufsatz über den Schulunterricht elaboriert worden war.18 Über diese Stellen hinaus gibt es auch noch solche, die den umfassenden Charakter von »attention« besonders deutlich zeigen, wenngleich das Wort selbst nicht vorkommt: Indem wir uns aber die Welt besser ansehen, als sie es tun, werden wir größeren Mut fassen, wenn wir nämlich bedenken, dass etwas, das wir nicht begreifen, aber lieben und Schönheit nennen, die unzähligen, blinden Kräfte begrenzt, zu einem Gleichgewicht miteinander verbin det und dahin führt, sich zu einer Einheit zusammenzufügen.19
Die möglichen Gegenstände der attention reichen also bei Weil vom Nächsten, dem Unglück der Schwachen und den Kompositionen in der Kunst wie im Politischen über Geometrieaufgaben, Übersetzungen aus dem Lateinischen und historischen Dokumenten bis zu Gott und der Welt als ganzer. Das Aufbringen von attention geht offensichtlich mit einer Ände rung von Einstellungen und Sichtweisen einher, es bleibt aber noch zu zeigen, dass die Änderung, die Weil mit ihrer neuen »Formel« anspricht, mit dem Aufbringen von attention zusammenhängt. Von der Brief-Passage ausgehend lässt sich die Verbindung, wie schon gesagt, durch die Aussage, die sie Perrin zuschreibt, herstellen; hier nun im französischen Original: »Faites bien attention, car si vous pas siez à côté d'une grande chose par votre faute, ce serait dommage.«20 Aber auch bei den Überlegungen zur attention ansetzend, findet man Verbindungen zu jenem Wechsel der Einstellung, der durch die Formel ausgedrückt wird, denn auch in Bezug auf attention beschreibt Weil ein »so verhalten wie wenn«: Die Gewißheiten dieser Art beruhen auf Erfahrung. Aber wenn man nicht schon vorher daran glaubt, noch ehe man sie empfunden hat, wenn man sich nicht zumindest so verhält, als ob man daran glaube,
18 Überlegungen von Weil zur attention findet man auch in »Étude pour une Décla ration des obligations envers l'être humain«, abgedruckt in S. Weil, Écrits de Londres et dernières lettres, S. 74–84. Vgl. dazu auch V. G. Morgan, Weaving the World. Simone Weil on Science, Mathematics, and Love, S. 166–168 und S. 174–75. 19 S. Weil, Verwurzelung, S. 15. 20 S. Weil, Attente de Dieu, S. 41.
115
Esther Heinrich-Ramharter
wird man niemals die Erfahrung machen, die den Zugang zu solchen Gewißheiten ermöglicht.21
Und zum politisch motivierten Appell an gewisse Triebkräfte (im Umgang mit demokratischen Institutionen) notiert sie: Man muss aufmerksam jeden einzelnen Punkt und alle Punkte zusam men betrachten; einige Augenblicke lang jede Neigung zu einer Wahl ausschalten; sich dann entscheiden; und wie bei jeder menschlichen Entscheidung, einen Irrtum riskieren.22
In dem Brief an Pater Perrin lässt sich somit in nuce eine Konzeption einer religiösen23 Weltsicht erkennen, die durch Simone Weils ander weitige Überlegungen ergänzt werden kann: Eine Person wechselt ihre Voreinstellungen – sie wechselt zwischen zwei Sichtweisen hinund her, von denen die eine skeptisch den Glaubenswahrheiten gegenüber ist, die andere bejahend (macht sich so von Vorurteilen frei) –, bringt attention auf und ändert so ihre Einstellungen, oder vielleicht besser gesagt: lässt sich so in ihren Einstellungen ändern.
2. »Aspektwechsel« in der Philosophie Ludwig Wittgensteins – gelesen als Beitrag zu einem Verständnis von Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht Ludwig Wittgensteins Bemerkungen zu »Aspektsehen« und »Aspekt wechsel« in den Philosophischen Untersuchungen (Teil 2, XI) nehmen ihren Ausgang von der wohlbekannten Darstellung eines HasenEnten-Kopfs und anderen Kippbildern, aber auch von gewöhnlichen Erfahrungen, wie z.B.: Ich betrachte ein Gesicht, auf einmal bemerke ich seine Ähnlichkeit mit einem anderen. Ich sehe, daß es sich nicht geändert hat; und 21 S. Weil, »Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe«, S. 46. 22 S. Weil, Verwurzelung, S. 187. 23 Es ist wichtig, das Wort »religiös« hier richtig einzuordnen: Weil versteht diese Weltsicht nicht als a priori religiös in dem Sinn, dass die Person schon zu Beginn religiös sein müsste; Weil ist allerdings der Ansicht oder zumindest der Hoffnung, dass sie es dann schon werden wird.
116
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
sehe es doch anders. Diese Erfahrung nenne ich ›das Bemerken eines Aspekts‹.24
Die Verwendung der Phrase »auf einmal« bedeutet, dass es sich nicht um einen längeren Prozess, sondern um ein plötzliches Geschehen handelt, nach dem man etwas anders sieht. Was dabei unter »(anders) sehen« verstanden werden kann, bildet den Gegenstand mannigfa cher Diskussionen.25 Unabhängig von der Positionierung in dieser Angelegenheit werden Fragen rund um das Aspektsehen hauptsäch lich in Zusammenhang mit ästhetischen Themen diskutiert.26 Dabei macht Wittgenstein allerdings deutlich, dass er nicht nur an das Sehen denkt: »Aspektblindheit wird verwandt sein mit dem Mangel des ›musikalischen Gehörs‹.« (PU II, S. 552) Auch eine Ausdehnung der Konzeptionen von Aspektsehen und Aspektwechsel auf diskursive Bereiche, findet sich in Andeutungen wie: Die Wichtigkeit dieses Begriffs liegt in dem Zusammenhang der Begriffe ›Sehen eines Aspekts‹ und ›Erleben der Bedeutung eines Wor tes‹. Denn wir wollen fragen: ›Was ginge dem ab, der die Bedeutung eines Wortes nicht erlebt?‹ Was ginge z. B. dem ab, der die Aufforderung, das Wort ›sondern‹ auszusprechen und es als Zeitwort zu meinen, nicht verstünde […]?27 Wenngleich also Wittgensteins Fokus auf ästhetischen Phänomenen liegt, so sieht er doch auch die Möglichkeit der Erweiterung auf andere Arten von Aspektwechseln.
Was lässt sich nun aus diesen Überlegungen für ein Verständnis von Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht gewinnen? An Weils Konzeption mag seltsam erscheinen, wie eine punktuelle Änderung – ein einzelner Entschluss – die gesamte Weltsicht verändern kön nen soll, wenn man annimmt, dass die Person danach nicht mehr aktiv etwas ändert (außer insofern das Aufbringen von attention als Aktivität verstanden werden kann). Die Welt, könnte man sagen, ist doch davor und danach dieselbe, wieso sollte eine solche singuläre Änderung sich gegen die Erfahrungen des Lebens durchsetzen und L. Wittgenstein, PU, II, S. 518. Für einen Überblick zum Thema »Aspektsehen bei Wittgenstein« siehe etwa V. Munz, »Wittgenstein‘s seeing as« und St. Mulhall, »Seeing Aspects«. 26 Explizit z.B. in M. Lüthy, »Das Medium der ästhetischen Erfahrung. Wittgensteins Aspektbegriff, exemplifiziert an Pollocks Malerei«. 27 L. Wittgenstein, PU II, S. 553. 24
25
117
Esther Heinrich-Ramharter
eine Veränderung des Erlebens im Großen ermöglichen können? Dafür liefert Wittgensteins »Aspektwechsel« zumindest ein Modell. Wenn man in einem Kippbild nach langer Zeit, in der man darin einen Hasen gesehen hat, plötzlich eine Ente sieht, dann ist das ein punk tuelles Ereignis, das dennoch grundsätzlich und umfassend ändert, was man sieht. Dabei bleibt das, was man sieht, aber doch andererseits das Gleiche. In Wittgensteins Worten: »Der Ausdruck des Aspekt wechsels ist der Ausdruck einer neuen Wahrnehmung, zugleich mit dem Ausdruck einer unveränderten Wahrnehmung.«28 Dabei sieht man zwar mit einem Schlag alles anders, bis man aber dieses Andere im Detail erfassen kann – bis man das Unmittelbare in etwas Artikuliertes umwandeln kann –, braucht es seine Zeit. Es fällt auch nicht immer leicht zu sagen, was sich geändert hat. Witt genstein äußert dazu: »Aber was ist anders: mein Eindruck? meine Stellungnahme? – Kann ich's sagen? Ich beschreibe die Änderung wie eine Wahrnehmung, ganz, als hätte sich der Gegenstand vor meinen Augen verändert.«29Dieses Zitat lässt sich auch als Aussage zum Verhältnis von Aktivität und Passivität in dem Vorgang lesen. Übertragen auf Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht besagt es: Eine aktive Rolle spielt die Person in dem Prozess auch später noch, insofern sie die Welt, wie sie sich ihr dann präsentiert (das ist das passive Moment), beschreibt, also diskursiv erfasst.
3. (Religiöse) Bekehrungen bei Wittgenstein Eine andere Art von Sichtwechsel mag man auch in gewissen Überle gungen Wittgensteins identifizieren, die man in Über Gewißheit fin det: Menschen haben geglaubt, sie könnten Regen machen; warum sollte ein König nicht in dem Glauben erzogen werden, mit ihm habe die Welt begonnen? Und wenn nun Moore und dieser König zusammenkämen und diskutierten, könnte Moore wirklich seinen Glauben als den richtigen erweisen? Ich sage nicht, dass Moore den König nicht zu seiner Anschauung bekehren könnte, aber es wäre eine Bekehrung
28 29
Ebd., S. 522–523. L. Wittgenstein, PU II, S. 522.
118
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
der besonderen Art: der König würde dazu gebracht, die Welt anders zu betrachten.30
Die »Bekehrung« des Königs weist gewisse gemeinsame Merkmale mit jenem ästhetischen Aspektwechsel auf, den Wittgenstein im zweiten Teil der Philosophischen Untersuchungen thematisiert. Wenn Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen fest gehalten hat (siehe oben), dass der »Ausdruck des Aspektwechsels […] der Ausdruck einer neuen Wahrnehmung, zugleich mit dem Ausdruck einer unveränderten Wahrnehmung [ist]«, dann lässt sich eine klare Parallele zu dem bekehrten König im skizzierten Szenario erkennen. Auch der König blickt, nach seiner Bekehrung, auf dieselbe Welt, und doch ist diese Welt für ihn eine andere geworden. Und auch der König könnte, mit dem Wittgenstein der Philosophischen Untersuchungen, kommentieren, was in ihm vorgegangen ist: »Aber was ist anders: mein Eindruck? meine Stellungnahme? – Kann ich's sagen? Ich beschreibe die Änderung wie eine Wahrnehmung, ganz, als hätte sich der Gegenstand vor meinen Augen verändert.« Insbesondere das Religiöse ist nun bei Wittgenstein von genau einem solchen Unterschied in der Sichtweise bzw. Einstellung gekennzeichnet. Wittgenstein konstatiert das z.B. anhand einer Frage, die sich ein Glaubender (und übrigens auch ein Nicht-Glaubender) stellen kann: »Wenn der an Gott Glaubende um sich sieht und fragt ›Woher ist alles, was ich sehe?‹ […], verlangt er keine (kausale) Erklärung […]. Er drückt […] eine Einstellung zu allen Erklärungen aus.«31 Diese Einstellung mag sehr fest oder vielleicht sogar die Grundlage anderer Einstellungen sein,32 dennoch ist sie veränderbar. Zunächst erwerben Kinder sie – oder sie erwerben sie nicht: Ist das nicht ganz so, wie man einem Kind den Glauben an einen Gott, oder daß es keinen Gott gibt, beibringen kann, und es je nachdem für das eine oder andere triftige Gründe wird vorbringen können?33
L. Wittgenstein, ÜG, § 92. L. Wittgenstein, VB, S. 570. 32 Vgl. dazu etwa C. Barrett, Wittgenstein on Ethics and Religious Belief, S. 178–208, und C. Diamond, »Wittgenstein on Religious Belief«, S. 128–129. Kritisch gegenüber der vorhandenen Sekundärliteratur ist G. Graham, Wittgenstein and Natural Reli gion, S. 60–68. 33 L. Wittgenstein, ÜG, § 107. 30 31
119
Esther Heinrich-Ramharter
Aber auch sonst ist ein Einstellungswechsel hinsichtlich religiöser Überzeugungen möglich: Das Leben kann zum Glauben an Gott erziehen. Und es sind auch Erfahrungen, die dies tun; aber nicht Visionen, oder sonstige Sinneser fahrungen, die uns die ›Existenz dieses Wesens zeigen‹, sondern z. B. Leiden verschiedener Art. […] Erfahrungen, Gedanken, – das Leben kann uns diesen Begriff aufzwingen.34
Während beim »ästhetischen Aspektwechsel« ein schneller und häu figer Hin- und Her-Wechsel in vielen Fällen möglich ist, scheint das in einem Wittgensteinianischen Verständnis des Religiösen aus geschlossen. Es sind durchwegs lange Prozesse – das Leben –, die Einstellungswechsel im Religiösen induzieren. Iakonos Vasiliou hält fest: »Religious Belief is something you can have only ›as a result of life‹ and requires a commitment to a Bezugssystem. The nature of the commitment is not a rational one, in the specific sense that it has not been arrived at on the basis of the most plausible evidence.«35 Damit ist nicht nur ein Unterschied zwischen dem Aspektwechsel und dem Einstellungswechsel bei Wittgenstein benannt, sondern auch der entscheidende Punkt des Unterschieds zwischen Weils Konzeption einer religiösen Weltsicht und jener Wittgensteins.
4. Religiöse Weltsicht bei Weil – im Kontrast zu Wittgenstein Ein Wechseln »nach Belieben«, wie es Wittgenstein nur im ästheti schen Bereich beschreibt, sieht Weil auch in religiösen Deliberationen als möglich an, ja fordert es für sich selbst sogar als Methode. Dass man den Einstellungswechsel im Bereich des Religiösen nach Wittgensteins Auffassung nicht arbiträr ablaufen lassen kann, liegt daran, dass es umfassendere Vorgänge und gravierendere Einschnitte sind, die eine solche Bekehrung bewirken. Die Welt respektive das Leben muss, so Wittgenstein, den Menschen – gleichsam in einem Kraftakt – eines Besseren belehren. Die Bekehrung ist quasi objektiv. Die Bekehrung »der besonderen Art« bei Wittgenstein betrifft die gesamte Weltsicht. Nicht in der Globalität aber liegt der Unterschied 34 35
L. Wittgenstein, VB, S. 571. I. Vasiliou, »Wittgenstein, religious belief, and On Certainty«, S. 35 f.
120
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
zu Weil, denn beide DenkerInnen haben umfassende Prozesse mit bedeutenden Konsequenzen für das ganze Leben vor Augen – auch bei Weil geht es immerhin darum, »nicht an etwas Großem vorbei zugehen« und die attention richtet sich in ihrer Konzeption auf das Leben in seiner gesamten Breite –; vielmehr ist es die Initialisierung des Prozesses, hinsichtlich derer die Auffassungen variieren: Bei Weil startet das – aktive – Subjekt einen Prozess,36 während es bei Wittgenstein am Ende eines Prozesses seine eigene Bekehrung hinnehmen muss. Wenngleich die objektive Seite die Instanz ist, die über die Überzeugung – über wahr und falsch – entscheidet, geht die entscheidende Initiative bei Weil vom Subjekt aus. Nicht zufällig spricht Weil von sich, Wittgenstein allgemein. Weil sieht des religiöse Leben tendentiell als etwas, das man selbst in der Hand hat und das der Rationalität zumindest initial zugänglich ist. Joachim Klose merkt an: »Weil vollzieht gleichsam an sich selbst das Experiment der Pascalschen Wette.«37 Wittgenstein dagegen beschreibt die religiöse Einstellung mehr als etwas, das einem widerfährt und das sich dem Denken in gewisser Hinsicht entzieht: »[U]nerschütterliche[r] Glaube […] zeigt sich nicht durch Vernunftschlüsse oder durch Anruf von gewöhnlichen Glaubensgrün den, sondern vielmehr dadurch, daß er sein ganzes Leben regelt.«38 Zusammenfassend und zuspitzend könnte man sagen: Weil ent wirft – im besprochenen Kontext39 – einen Zugang zum Religiösen, dessen Ursprung das Subjekt mit einer Entscheidung ist, das sich dann von der Welt belehren lässt. Dieses Moment der Entscheidung fehlt in der Kennzeichnung des Religiösen bei Wittgenstein. In seinen
Als Einwand könnte man formulieren, dass in Gestalt der Äußerung von Pater Perrin auch ein äußerer Anlass, nicht ein subjektiver Beschluss am Anfang steht. Das ist aber gewiss kein äußerer Einfluss von dem Ausmaß, das Wittgenstein vorschwebt. Pater Perrins Aussage ist sicher nicht »das Leben«. 37 H. Seubert, »Zuhause sein im Leib? Überlegungen zu Gender und Sexualität«, S. 287. 38 L. Wittgenstein, Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und reli giösen Glauben, S. 76. 39 Keineswegs übersehe ich, dass Weil in anderen Zusammenhängen selbstverständ lich auch das Numinose, Überwältigende in der Religion thematisiert, etwa wenn es um (ihre) mystische(n) Erfahrungen geht. 36
121
Esther Heinrich-Ramharter
Darstellungen ist es immer die Welt, die bekehrt, das Leben, das einen Menschen zu einem Gläubigen oder Ungläubigen macht.40
5. Hintergründe und Synthesen Man mag darin einen Unterschied zwischen den philosophischen Hintergründen der beiden DenkerInnen erkennen – Weil ist stark von Descartes geprägt, Wittgensteins religiöse Lektüre umfasst Schriftsteller wie Kierkegaard oder Tolstoi – oder die Diskrepanz zwischen ihnen gerade ihren individuellen philosophischen Leistun gen zuschreiben (Weil sucht nach Rationalität in ihrem »unfreiwil lig« durch Mystik geprägten Leben, Wittgenstein stellt sich gegen gewisse Grundannahmen der Analytischen Philosophie seiner Zeit); feststeht, dass es sich um zwei Positionen handelt, hinter denen noch ein ganzer Kosmos an Dichotomien ausgemacht werden kann, deren Auswirkungen eine Erläuterung wert wären: Erlangt der Mensch Erlö sung durch Gnade und Werke41oder sola gratia? Gibt es eine subjektive und eine objektive Seite der Entscheidung zwischen Glauben und Wissen (Kant)? – um nur zwei Beispiele zu nennen. Im Fehlen eines Moments der Entscheidung mag man aus der Sicht Weils einen Mangel vermuten. Interessanterweise findet man bei ihr allerdings eine Stelle, in der sie Wittgensteins Auffassung als eine Art von Ideal präsentiert: Wenn man das Problem auf diese Weise lösen würde, hörte die Religion hoffentlich nach und nach auf, etwas zu sein, für oder gegen das man sich entscheidet, wie man sich in der Politik entscheidet. […] Die Berührung mit der Schönheit des Christentums, einfach als Schönheit dargestellt, die man genießen soll, würde die Masse der Bevölkerung, wenn sie dazu imstande ist, unmerklich mit spirituellem Leben erfül len, und zwar viel wirksamer als alle streng dogmatischen Glaubens lehren.42 Hier könnte man einwenden, dass im Beispiel des Königs ja Moore derjenige ist, der überredet – der ist aber Teil der Welt, es ist nicht das später bekehrte Subjekt, von dem die Initiative ausgeht. 41 Kai Nielsen schreibt: »What Wittgenstein saw as important in religion is that if one could have faith […] then that will turn around one's life. He took faith without works to be utterly vain.« (K. Nielsen, »Wittgenstein and Wittgensteinians on religion«, S. 148). 42 S. Weil, Verwurzelung, S. 88.
40
122
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
Neben dieser vielleicht überraschenden und nur antizipierten Konver genz der beiden Auffassungen im Werk Weils selbst, findet man eine – invertierte – Zusammenführung in den Analysen Charles Taylors. Jeder Art von einsinniger Säkularisierungsthese hält Taylor eine Ausdifferenzierung von »Säkularisierung« entgegen. Der für seine Auffassung wohl wichtigste Begriff von Säkularisierung versteht diese als das Entstehen einer Möglichkeit, zwischen verschiedenen religiösen Auffassungen frei zu wählen: Der Wandel, den ich bestimmen und nachvollziehen möchte, ist ein Wandel, der von einer Gesellschaft, in der es praktisch unmöglich war, nicht an Gott zu glauben, zu einer Gesellschaft führt, in der dieser Glaube auch für besonders religiöse Menschen nur eine menschliche Möglichkeit neben anderen ist.43
Die Vermittlung zwischen Weil und Wittgenstein erfolgt hier nicht inhaltlich, sondern über eine historische Entwicklung: Religion, wie sie Wittgenstein denkt – also als etwas, das unter allem liegt, was man frei wählt – wurde im letzten Jahrhundert abgelöst durch reli giöse Auffassungen, die dem persönlichen Disponieren unterliegen. Folgende Formulierung weist sehr deutlich auf die Weltsicht Weils, wie sie in dem Brief an Pater Perrin angelegt ist (vor allem wenn man das Zitat in der von mir vorgestellten Variante (2) liest): [J]etzt begreifen alle die eigene Option als eine unter mehreren. Jeder von uns lernt, zwischen zwei Standpunkten zu manövrieren: zwischen dem ›engagierten‹ Standpunkt dessen, der sich nach besten Kräften an die durch den eigenen Standpunkt ermöglichte Realitätserfahrung hält, und dem,distanzierten` Standpunkt dessen, der sich als Vertreter eines Standpunkts unter mehreren sehen kann […].44
Eine wiederum andere Möglichkeit der Vermittlung, oder hier eigent lich eher: des Mittelwegs, mag man im Begriff der Praktiken, wie Michel Foucault ihn in der Histoire de la sexualité entwickelt, sehen. Weils Verwendung des Ausdrucks »Formel« kontextualisiert ihr Vor haben in ähnlicher Weise: Institutioneller Charakter und individueller Gebrauch werden darin vereint. Die genannten Vermittlungsversuche sind bloß Beispiele und es könnten dergleichen mehr gefunden werden. Sie sind aber jedenfalls schon ausreichend, um kenntlich zu machen, dass man gegenüber 43 44
Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 15. Ebd., S. 30–31.
123
Esther Heinrich-Ramharter
den Auffassungen des Religiösen von Weil und Wittgenstein zwei verschiedene Optionen hat: Man kann sie entweder als einander konfrontierend oder als Abbilder unterschiedlicher Phasen einer Ent wicklung erachten.
Literaturverzeichnis Barrett, C., Wittgenstein on Ethics and Religious Belief, Oxford – Cambridge (Mass.): Blackwell 1991 Diamond, C., »Wittgenstein on Religious Belief: The Gulfs Between Us«, in: D. Z. Phillips, M. von der Ruhr (Hg.), Religion and Wittgenstein's Legacy, Elder shot – Burlington: Ashgate 2005, S. 99–137 Graham, G., Wittgenstein and Natural Religion, Oxford: Oxford University Press 2014 Lüthy, M., »Das Medium der ästhetischen Erfahrung. Wittgensteins Aspektbe griff, exemplifiziert an Pollocks Malerei«, in: G. Koch, K. Maar, F. McGovern (Hg.), Imaginäre Medialität – Immaterielle Medien, München: Fink 2012, S. 125–142 Morgan, V. G., Weaving the World. Simone Weil on Science, Mathematics, and Love, Notre Dame: University of Notre Dame Press 2005 Mulhall, St., »Seeing Aspects«, in: H.-J. Glock (Hg.), Wittgenstein: A Critical Reader, Malden: Blackwell 2001, S. 246–267 Munz, V., »Wittgenstein’s seeing as: a survey of various contexts«, in: G. Kemp, G. Mras (Hg.), Wollheim, Wittgenstein and Pictorial Representation. Seeing-as and Seeing-in, London – New York: Routledge 2016, S. 101–114 Murdoch, I., »The Idea of Perfection«, in: dies., The Sovereignty of Good, London: Routledge & Kegan Paul 1970, S. 1–45 Nielsen, K., »Wittgenstein and Wittgensteinians on religion«, in: R. L. Arrington und M. Addis (Hg.), Wittgenstein and Philosophy of Religion, New York: Rout ledge 2001, S. 137–166 Rhees, R., Discussions of Simone Weil, Albany: State of New York University Press 1999 Roberts, P., »Attention, asceticism, and grace: Simone Weil and higher educa tion«, in: Arts and Humanities in Higher Education 10/3 (2011), S. 315–328 Seubert, H., »Zuhause sein im Leib? Überlegungen zu Gender und Sexualität«, in: J. Klose. (Hg.), Heimatschichten: Anthropologische Grundlegung eines Welt verhältnisses, Wiesbaden: Springer VS 2013, S. 257–290 Taylor, Ch., Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2009 Vasiliou, I., »Wittgenstein, religious belief, and On Certainty«, in: R. L. Arring ton, M. Addis (Hg.), Wittgenstein and Philosophy of Religion, London: Rout ledge 2004, S. 29–50
124
Die neue Formel »Vielleicht ist das alles wahr«
Weil, S., Attente de Dieu, Paris: Éditions Fayard 1966 —, »Betrachtungen über den rechten Gebrauch des Schulunterrichts und des Studiums im Hinblick auf die Gottesliebe«, in: dies., Zeugnis für das Gute, München: dtv 1990, S. 45–53 —, Briefe an Pater Jean-Marie Perrin, in: dies., Zeugnis für das Gute, München: dtv 1990, S. 75–115 —, Die Verwurzelung. Vorspiel zu einer Erklärung der Pflichten dem Menschen gegenüber, Zürich: diaphanes 2011 —, Écrits de Londres et dernières lettres, Paris: Gallimard 1957 —, L'Enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, Paris: Gallimard 1943 Winch, P., Simone Weil. »The Just Balance«, Cambridge: Cambridge University Press 1989 Wittgenstein, L., Philosophische Untersuchungen, in: ders., Werkausgabe, Bd. 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989 (=PU) —, Über Gewißheit, in: ders., Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984 (=ÜG) —, Vermischte Bemerkungen, in: ders., Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1984 (=VB) —, Vorlesungen und Gespräche über Ästhetik, Psychoanalyse und religiösen Glau ben, Frankfurt am Main: Fischer 2005
125
Gerhard Weinberger
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
François Julliens Denkweg ist ein Weg der Erarbeitung ständig neuer, sich aufeinander beziehender und aufeinander aufbauender Konzepte. Das »Unerhörte« ist nicht nur das jüngste dieser Konzepte, sondern erhebt auch einen nicht unbescheidenen Anspruch. Das Unerhörte kann philosophisch für Jullien nicht weniger als den Begriff Gott ersetzen. Und es ermöglicht eine Erklärung, wie, warum und bis wohin der Mensch aus sich selbst heraustreten, sich selbst überschrei ten – transzendieren – muss, um Mensch zu werden, ohne den (aus Julliens Sicht billigen) Weg des Glaubens an ein Jenseits zu beschreiten, der dem Menschen das mitunter verstörende, jedenfalls immer beunruhigende Fragen nach einem sinnvollen und erfüllten Leben im Diesseits erspart. Spätestens seit Platons Welt der Ideen ist ein Jenseits, ein »Anderswo«, Inbegriff dessen geworden, wonach der Mensch hier unten streben muss, um nicht an den bedrückenden Lasten des Lebens zu verzweifeln, ihm (und gerade auch diesen Lasten) einen Sinn zu geben. Wonach er transzendieren muss. Jullien will weder Denkwege ersparen, noch beruhigende Kon zepte vorlegen. In »Das Unerhörte« versucht er nicht weniger als dem, was traditionell etwas verharmlosend »Transzendenz in der Imma nenz« genannt worden ist (verharmlosend, weil die höchste Heraus forderung philosophischen Denkens unter einem scheinbar simplen Paradoxon verdeckend), konkrete Konturen zu verleihen.1 Dieses Transzendieren zu beschreiben und seine Grenzen, und damit die Grenzen von Metaphysik, abzustecken, darum geht es Jullien.Dazu Der Text »L’inoui« ist 2019 bei Grasset in Paris erschienen. Es gibt noch keine publizierte Übersetzung. Ich übersetze daher selbst aus dem französischen Original, folge dabei aber teilweise einer mir vorliegenden Übersetzung des erfahrenen JullienÜbersetzers Erwin Landrichter. Ich werde unter dem Sigle »IN« zitieren. 1
127
Gerhard Weinberger
versetzt uns Jullien gleich zu Beginn des Textes in eine Situation, die grundsätzlich jeder kennt oder kennen kann, die jedoch von ihm ins Ungewöhnliche umgestülpt wird: das Meer bei Sonnenaufgang. Jullien holt sich diese an sich gewöhnliche Erfahrung auf ungewöhn liche Art. Er begibt sich, immer wieder an einen Strand (in der Nähe der Rhônemündung in Südfrankreich), aber zu einem Zeitpunkt, als die Massen der Touristen dabei sind, diesen mit Sack und Pack zu verlassen. Nach einer Nacht in den Dünen dann: »In der ersten Mor gendämmerung, beim ersten Lichtschimmer, gehe ich zum Meer. Die ersten Farbtöne, aus dem Dunkel steigend, zeichnen sich ab, immer deutlicher und schneller: ein erstes Farberwachen im physischen Sinn. Das ist das Meer, sage ich zu mir«.2 Aber was ist dieses Meer? Ist es mehr als ein Wort, das ich »wie ein erstes Netz auswerfe, um das einzufangen, von dem ich plötzlich überwältigt werde?«3 Kann ich mir dieses Meer ohne dieses Wort, außerhalb dieses Wortes, losgelöst von diesem Wort, vorstellen? Das Wort ist jedenfalls, davon ist Jullien überzeugt, eine ständig vorhandene Stütze, um mich in dem, was ich erlebe (hier: sehe oder höre) zu Recht zu finden. Vielleicht die einzige Stütze. Aber bedeutet diese Stütze, das Aussprechen oder Denken dieses Ausdrucks, für mich eine Orientierungshilfe, oder ist es nicht bereits ein Hindernis, indem es sich mit in all seiner Offensichtlichkeit aufdrängt? Indem es mit all dem in Schlepptau daherkommt, was ich irgendwie damit verbinde, was ich mit-verbinde? Indem es mit den unvermeidlichen mit-gemeinten Horizonten daherkommt? Wird nicht dadurch bereits das, was das Phänomen »Meer« in mir auslösen könnte, eingeengt, zugeschüttet mit Bedeutungen, die eine ganze Palette anderer Möglichkeiten ausschließen? Jullien bezieht sich, ohne sie zu nennen, auf die Husserl’schen »Horizonte«, die die Lebenswelt des Subjekts immer schon mitbestimmen und die als Feld gedacht werden müssen, das über das jeweilig Bewusste hinausreicht (oder von außen hereinreicht). Aber für Jullien sind sie negativ konnotiert. Was Jullien sucht, ist dieser »entscheidende Moment«, ein Hier und Jetzt, ein »Hier-Jetzt«, in dem meine Welt noch nicht von den vorge gebenen Rahmen umfasst, vorbestimmt, ist. Wo ich etwas erleben, spüren, hören, tasten kann, wie ich es vorher noch nie erlebt habe: etwas ganz und gar Unerhörtes, weil Ungehörtes.
2 3
IN, S. 9. IN, S. 10.
128
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Dazu muss ich mich von der Sprache lösen, von den Wörtern der Sprache, von deren Ansprüchen und Horizonten (Konnotationen), in die diese Sprache, wie jede Sprache, mich bereits eingemauert hat. Und damit mein Leben bereits in Vorgegebenes integriert hat. Jullien sucht nach diesem »ersten Mal«, in dem ich dieser sprachlichen Abdeckung, Verschleierungen, entkommen kann. Aber das ist schlicht nicht möglich – oder doch? Zunächst hält Jullien die Prozesshaftigkeit des Sehen-Lernens fest, und was diese bewirkt: Als ich zum ersten Mal meine Augen öffnete, als ich in die Welt kam, war mein Blick ein vager, unbestimmt, tastend. Später, jetzt, da ich mein Sehen bestimmt gestalte, bewusst erlebe, muss ich eingestehen, dass ich immer schon geschaut habe, dass ich hier und jetzt in meinem Sehen schon vorbestimmt bin von all dem, was ich vor-gesehen, vor-gehört, habe, als ich »Meer« dachte, dass ich jetzt, da ich das Meer sehe, es schon in mir vor-gesehen ist. Meine Sinne haben es vor mir und für mich, geradezu »an meiner statt«, vor-gesehen. Und so ist sozusagen vor-gesehen, wie ich es sehe. Ausweglos? Ist es möglich, sich als bereits Sehender, zu sehen gelernt Haben der, loszulösen von dem Vorgegebenen, durch die Sprache Einge schlossenen, und sich so Neuem zu öffnen? Sehe ich tatsächlich die Welt nur, und ständig, durch das Prisma dessen, was mir durch meine Sprache mitgegeben wurde? Bleibe ich unentrinnbar im letztlich nicht von mir bestimmten, ja nicht einmal mit-bestimmten Rahmen meiner Vorstellungen gefangen? Liegt jeder Anfang schon hoffnungslos in einem »Vorher« meines Daseins? Kann es einen »ersten Anfang« nochmals geben? Jullien sucht (und findet) ihn in einem freilich unerreichbaren, aber anstrebbaren, jedenfalls erahnbaren, absoluten »Hier-Jetzt«, einen Moment lang nur, in einem Augenblick einer von allem Rund herum losgelösten, abgelösten Erfahrung. Am frühen Morgen, noch bevor das Meer seine Konturen angenommen hat, die mit dem Wort verbunden sind. »Denn am frühen Morgen hat das Rauschen der sich brechenden Wellen noch nicht begonnen. Das Meer ist ein ruhiger See……es rauscht wie ein Fluss«4, es »nimmt erst nach und nach Farbe an«5. Dieses Meer ist nicht mein Meer, es ist See oder Fluss oder irgendwas dazwischen. Es ist Element, elementar, vor jeden Erkennbaren und Benennbaren. Es weicht von dem, was man von ihm 4 5
IN, S. 10. IN, S. 20.
129
Gerhard Weinberger
weiß und von ihm gesagt hat, ab – es »de-konzidiert«: Ich kann mir noch sooft sagen: ›Das ist das Meer‹ – es passt nicht mehr zusammen mit dem, was es in meinen Gedanken und in meiner Wahrnehmung abgelagert, sedimentiert hat. Es strahlt eine Fremdartigkeit aus, über die keine Folie von mir bekannten, früher gehörten Begriffen passt. Es ist plötzlich ein Abstand da, als unüberbrückbar spürbar, zu allem bisher von mir Wahrgenommenen und Gedachten. Was ich in diesem Augenblick verspüre, kann und darf ich nicht mit einem (wieder einem) Ausdruck formalisieren. Jullien versucht dennoch eine Annä herung durch ein Konzept: Das Unerhörte6. Denn Jullien will nicht auf die Sprache verzichten, sondern in der Sprache dem nachspüren, das aufdecken, was diese seit unvordenklichen Zeiten als Erfahrung gespeichert hat, um »zu dem vorzudringen, was noch nicht geordnet und kanalisiert worden ist«, was sie noch nicht in ihrer Funktion als die Phänomene erklärend zugedeckt hat. Um dieses Abgedeckte wieder freizulegen, über die Sprache hinaus, oder hinter die Sprache zurückgehend, die »Bedingtheit der Worte« und ihre »unvordenkliche Familiarität mit der Welt« durchbrechen7. Mit dem Konzept des Unerhörten will Jullien also eine Erfahrung erfassen, die Erfahrung bleibt, und sie dennoch überschreitet. Mit diesem Konzept soll die Möglichkeit einer Erfahrung eingefangen werden, die aus ihrer Alltäglichkeit ausbricht, diese transzendiert, über sich selbst hinaustreibt, aber nicht in die lichten Höhen eines Jenseits, von dem jede Erfahrung notwendigerweise fehlt. Sondern in ein Unergründliches, wofür mir die Begriffe fehlen, dessen Erfahrung ich jedoch im Hier und Jetzt ganz konkret machen kann. Jullien kommt dabei nicht umhin, dieses Überschreiten zur Entdeckung des Unerhörten als metaphysischen Vorgang zu bezeichnen, allerdings, da es kein Überschreiten in ein Jenseits ist, nur als »minimal meta physisch«. Und er spricht von diesem Überschreiten als von »dem Metaphysischen« (le métaphysique) im Gegensatz zu »der Metaphy sik« (la métaphysique). Er widmet der Erörterung ein eigenes Kapitel (»Minima metaphysica«), das ich im Folgenden kommentieren werde. Zunächst aber umkreist er schon in seinem Werk »Vivre en exis tant – Une nouvelle Ethique« (Existierend leben – eine neue Ethik) aus dem Jahre 2016 – also noch bevor er das Konzept des »Unerhör 6 Im französischen »Inoui« steckt sowohl im buchstäblichen Sinn das »Ungehörte«, »Nicht-Gehörte«, als auch im übertragenen Sinn das »Unerhörte«. 7 IN, S. 18.
130
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
ten« als zentralen Begriff seines Denkens ausgearbeitet hatte – diese Problematik. Hier entwickelt Jullien die wichtige Unterscheidung zwischen la métaphysique und le metaphysique, und betitelt das vor letzte Kapitel präzise als das, wonach er sucht: »Immanenz/Existenz – was nicht von dieser Welt ist, aber auch nicht von einer anderen«8 In diesem Text geht Jullien der Frage nach, wie es möglich (und warum es notwendig) ist, dass wir zwar immer im Hier und Jetzt leben, und von diesem Leben eine Erfahrung haben, dass wir uns aber von diesem Leben gleichzeitig lösen und es gewissermaßen »von außen« betrachten können. Dass wir einen Abstand zwischen uns und unserem Leben einziehen, der es uns erlaubt, aus dem bloß Lebensnotwendigen herauszutreten und Möglichkeiten zu erkennen – »nouveaux possibles« nennt es Jullien –, die uns erst in die Lage versetzen, eine Entscheidung darüber zu treffen, wohin wir in unserem Leben – abgesehen von dem, was vorgegeben ist – gehen wollen. In »Vivre en existant« spricht Jullien noch nicht vom »Unerhörten«, aber der Grundstock dazu wird gelegt. Es geht ihm um ein »Außen« (»Hors«), das in der Erfahrung angelegt ist, und das es dem Subjekt erlaubt, aus einem rein immanenten Daseinsmodus ins Existieren zu kommen. Dazu muss ein irgendwie von einem Außen kommender Anstoß gegeben sein, ohne dass dieses Außen von der Erfahrung völlig losgelöst wäre. Eben wie es im erwähnten Untertitel heißt: nicht von dieser Welt, aber auch nicht von einer anderen. In dieser Gratwanderung ist eine Spannung angelegt, in der Jullien sein »Unerhörtes« suchen wird. Eine Spannung, die aus einem Abstand entsteht, einem Sich-Loslösen vom Vorgegebenen, die jedoch nie zu einem Bruch mit diesem führt, sondern in die ser Spannung verbleibt und aus ihr heraus lebt. Zwischen einem »moment rousseauiste« (in dessen »Konfessionen«), in dem »das Exil des Bewusstseins noch nicht begonnen hat (kurzer Augenblick des Paradieses)«,9 und einem »moment cartesien«, der »das Bewusstsein seiner Autonomie öffnet« und dadurch »die Möglichkeit einer Initia tive innerhalb der Vorbestimmtheit (détermination), die diese Welt ausmacht, entstehen lässt«.10 Die Suche gilt dem, was es erlaubt, ganz dicht an der Erfahrung bleibend das zu entdecken, was diese Erfahrung rissig macht und ihre Grenzen sprengt, was sie als »wesent 8 9 10
F. Jullien, Vivre en existant – une nouvelle éthique, S. 191, im folgenden »VE«. VE, S. 118. VE, S. 200.
131
Gerhard Weinberger
lich zwiespältig« ausweist, und aus dem die Freiheit entsteht. Jullien nennt es noch nicht das »Unerhörte«, sondern bleibt bei einem recht unbestimmten »Außen«, das aber schon als »maßlos« beschrieben wird, und das er ohne Zögern als »unendlich«11 bezeichnet. Es ist ein Außerhalb des Metaphysischen«, ein befreiendes Außen, ein fruchtba res und letztlich »unbekanntes Außen«.12 Es ist kein Außen außerhalb dieser Welt, kein »Außen-Ort«, nicht das »große Anderswo«13 der Metaphysik, die daraus ein Alibi ableitet, diese Welt zu verlassen durch Verschieben auf ein Später, welches aber das Leben hier und jetzt in seiner Farblosigkeit und Freudlosigkeit, in seiner Eintönigkeit ohne Suche nach neuen Möglichkeiten, sozusagen im immer Glei chen, belässt, ohne Heraustreten aus dem alltäglichen Trott. Zurück zum Text »Das Unerhörte«. »Nun kann es tatsächlich passieren«, schreibt Jullien gleich zu Beginn das Kapitels Minima metaphysica, »dass das von uns Wahrgenommene sich nicht mehr in seiner Wahrnehmung einfangen lässt, sondern diese übertrifft und übersteigt, wie an diesem Morgen angesichts des Meeres, oder sei es nur angesichts der Farbe«.14 Das Meer war See und Fluss, jetzt ist es Farbe. Alles Versuche, sich diesem Anblick anders zu nähern als durch bereitstehende Denkkategorien, ja gerade durch diese abweichenden Metaphern das Meer jenseits aller Zuschreibungen, die in meinem Kopf darüber vorherrschen, »auf den Begriff« zu bringen. Es ist klar, dass dabei das ins Spiel kommt, was weder mit Wahrnehmung noch mit Denken zureichend erfasst werden kann: das Affektive, die Emo tionen. Jullien setzt denn auch fort: »Genauso wir es alles Affektive in uns, das sich nicht mehr in seiner Gefühlsbewegung erfassen lässt, das Fassungsvermögen der Gefühle überflutet«. Was hier, in diesen Augenblicken, spürbar wird, ist nicht eine bloß psychologisch erklär- und beschreibbare Reaktion auf ein Phänomen, sondern etwas dahinter (oder davor, oder darunter) Liegendes: etwas »Bodenloses« (sans-fond) nennt es Jullien.15 Etwas, das das Fassungsvermögen unserer Erfahrung, jedenfalls der bisher gemachten Erfahrungen, übersteigt. Von dem man es sich jedoch zu leicht macht, wenn man es als »übersinnlich« abtut oder aufbauscht. Das wäre für Jullien lediglich der Versuch, den Schwierigkeiten des Nachspürens auszuweichen. 11 12 13 14 15
VE, S. 200. VE, S. 275. »grand Ailleurs«, VE, S. 201. IN, S. 106. IN, S. 107.
132
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Indem man es auf ein Jenseits verschiebt und es so aus dem Bereich der Erfahrung verbannt in einen Bereich, wo straflos alles und sein Gegenteil behauptet werden kann. Wir nähern uns dem entscheidenden Punkt der Jullienschen Analyse, vielleicht des Jullienschen Denkens überhaupt. Es gibt eine Erfahrung, die jeder Mensch macht oder machen kann, sofern er nur darauf achtet: dass diese (jede) Erfahrung eine Dimension ent hält, die alles Bisherige überschreitet. Bei der ich mich nicht mehr damit begnüge, ein Sehen und ein Hören zur Kenntnis zu nehmen und darauf zu reagieren, indem ich es (für mich) beschreibe und verstehe. Sondern die etwas in mir anspricht, das den Rahmen meiner bisherigen Erfahrungen sprengt. Aber dieses Sprengen sprengt nicht eine Erfahrung auf, um sie durch etwas Übersinnliches zu ersetzen. Im Gegenteil: dieses Überschreiten verbleibt in meinem sinnlichen Erleben. Aber dieses sinnlich Erleben ist ein »gereinigtes« Erleben, ein direktes, unmittelbares, ohne die bisher mit jeder Erfahrung verbundenen Horizonte, v.a. sprachlichen Vorbestimmungen, die es mir ermöglichten, alle Erfahrung in einen beruhigenden Rahmen stellen zu können, nämlich denjenigen des zumindest im Prinzip Alles-einordnen-Könnens. Um es damit in einen wohlbekannten Ablauf bringen zu können.
Der Ort einer ganz anderen Erfahrung Aber wo liegt dieses Überschreiten, diese ganz andere Erfahrung, wenn es nicht in eine andere Welt, in eine andere Seinsdimension hineinreicht, sondern in der Immanenz der Erfahrung verbleibt? Wenn ein Eintreten in ein radikales Anderswo, das die Immanenz völlig hinter sich gelassen hat, nicht möglich ist, oder nur eine Flucht, einen billigen Ausweg darstellt? Was ist diese andere Dimension der Erfahrung, die mich aus allem Bisherigen herausführt, aber in nichts völlig Anderes hinein? Wo liegt dieses Unerhörte, das uns aus dem Bekannten herausholt und uns in ein Abenteuer verstrickt, das wir offenbar anstreben, das uns aber gleichzeitig Angst macht? Jullien gibt zwei Antworten darauf.
133
Gerhard Weinberger
(a) Das Unerhörte ist ein »Zwischen« als Schwelle zum Metaphysischen Zum einen ist es ein »Zwischen« und als solches nichts anderes als der Übergang selbst vom Wahrnehmen und Denken des Vorgegebe nen zu einem Zustand des von diesem gereinigten Wahrnehmens. Es ist damit einerseits ein Überschreiten, ein Hinter-sich-Lassen dieses Vorgegebenen, Wohlbekannten, aller durch die Sprache vor gegebenen Horizonte. Es ist aber gleichzeitig ein Zurückkommen auf ein Wahrnehmen, auf eine Sensibilität, die vor den später erst mitgedachten Horizonten liegt, also eher ein Unterschreiten als ein Überschreiten. Eine Art Rück-Transzendieren. Das Unerhörte beginnt genau an dem Punkt, an dem diese Über- oder Unterschreitung stattfindet. Es ist diese Schwelle (»seuil«). Und es endet auch an dieser Schwelle. Es ist eine ständige Gratwanderung entlang dieser Schwelle, Bergwanderer würden von einer Kammwanderung sprechen.
(b) Das Unerhörte als »An-Sich« Zum anderen ist aber das Unerhörte stabiler als eine Gratwanderung, denn es hat eine sozusagen solide Basis: »Das Unerhörte besagt das So in seinem reinen Erscheinen, in seiner lebendigen Gegenwärtigkeit, und in diesem Sinne das An-Sich des noch nicht durch Wahrneh mung und Verstandesvereinnahmung integrierten Wirklichen: daher stets überbordend (den Ausruf »Unerhört! hervorrufend), weil die Auf nahme- und Wahrnehmungsfähigkeit übersteigend, in deren Rah men man sich bewegt und sich beruhigt«. Zusammengefasst: »Das Unerhörte ist das So des Wirklichen, berührt in seinem noch nicht von unseren Zuschreibungen zugedeckten, noch nicht in Ähnlichen einge wickelten, sondern in seinem Hervorquellen begegneten An-Sich.«16 Wir haben es also mit zwei Hinweisen darauf zu tun, was das Unerhörte ausmacht und wo es zu »erwischen« ist, und warum es eine Herausforderung ist. Es lauert im Übergang zwischen dem Immer-Schon und dem Noch-Nie der Erfahrung. Es liegt also gewis sermaßen schon jenseits der Erfahrung, jedenfalls der je bestimmten Erfahrung. Es ist in diesem Sinne der Beginn eines hinter der Erfahrung Liegenden, eines Metaphysischen. Gleichzeitig liegt es aber tief im 16
IN, S. 88 f.
134
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Diesseits begraben als das An-Sich der Dinge, das es freizulegen gilt, um das an ihm zu entdecken, das man in seinem Immer-Schon der Erfahrung, welches uns der Dinge hat überdrüssig werden lassen, übersehen hat. Also auch hier: ein Ausgraben, das ein Jenseits alles Bisherigen freilegt. Mit diesen Annäherungen klopft Jullien an der Metaphysik an, ohne in sie hineinzugleiten. Er versucht, das zu beschreiben, was unbewusst immer schon angestrebt wird, um dem langweilig gewordenen Alltäglichen zu entkommen und ein Konzept dafür zu entwickeln.
Ad a) (Als Schwelle) Julliens Grundannahme ist dabei offensichtlich: dass es für den Men schen in seinem bloßen Dasein auf dieser Welt, in seinem alltäglichen Spüren und Denken, ein »Mehr« gibt, dass das bloße Dasein, so wie es ist, ihm nicht genügt. Und dass er nach einem solchen »Mehr« sucht, meist ohne eine Ahnung zu haben, was das sein könnte. Dieses »Mehr« kann auch einfach als das »Andere« gesehen werden, das Streben nach einem »Anderen«, durchaus im Sinne des Neutrums. Das wiederum ist die notwendige Konsequenz der Grundtatsache des Lebens: »das Leben lebt« heißt nichts anderes, als dass es, in Jullien scher Diktion, ständig mit sich selbst de-koinzidiert, auseinanderfällt, sich aufspaltet, weitertreibt, nie stillsteht. Diese Dekoinzidenz hat Jullien in seinem 2017 erschienen Buch mit diesem Titel eingehend als Grundtatsache des Lebens beschrieben.17 Und zwar als Grundtatsache jedes Lebens, des menschlichen wie des tierischen, oder jeder anderen Form. Der Mensch hat jedoch die Besonderheit, dass ihm das gelebte Leben, wie es aus dem Dekoinzidieren mit dem Früheren, Vorgegebe nen, das für das Überleben Voraussetzung ist, entsteht, nicht genügt. Es reicht zwar im Allgemeinen für das Weiterleben, für die dafür notwendigen Besorgungen und Aktivitäten, wird jedoch in seiner prinzipiellen Wiederholbarkeit langweilig. Es entsteht der Drang, aus diesem »ersten Leben«, das man als das bloße Dahinleben bezeichnen könnte, auszubrechen, neue Wege zu gehen. Für Jullien ist dieser Drang, insofern der Mensch ihm nachgibt und nach etwas Anderem zu streben beginnt, der Übergang vom »Leben« zum »Existieren«, mit 17
F. Jullien, Dé-coincidence; deutsch »De-Koinzidenz«.
135
Gerhard Weinberger
dem das wahrhaft menschliche Leben, das seine Möglichkeiten spürt und Neuem nachspürt, erst beginnt. In »Dekoinzidenz« bleibt dieses Neue noch, wie in »Vivre en existant«, als Konzept unbestimmt. In »Das Unerhörte« bekommt dieses Streben nach etwas ganz Anderem einen Grund, und als Konzept einen Namen. Es bleibt nicht mehr einfach ein »Anderes«, ein Außen. Das Streben nach einem Austreten aus der Banalität, dem Überwinden des Alltagslebens und seiner Enge, ist möglich, weil Leben ständig mit sich selbst dekoinzidiert, weil jede Erfahrung als zu eng empfunden werden kann. Das muss nicht notwendigerweise (und wird im Regelfall nicht) zu etwas anderem als zu weiteren Etappen im bloßen Dahinleben führen, weil dieses als »gewohnt« hingenommen wird. Aber der Schritt weg aus dieser Banalität, heraus aus der Wieder kehr des ewig Gleichen, wird gesetzt, wenn die Ahnung davon, dass es ein solches »ganz Anderes« des Lebens geben kann, konkret und dringend wird. Dass es »hinter« der immer schon gelebten Erfahrung eine andere, neue, liegen könnte, nach der es mich, stumm und unbestimmt, verlangt. Diese Erfahrung ist nicht nur eine andere als alle bisherigen es waren. Sie hat eine völlig neue Qualität. Sie ist, obwohl sie Erfahrung bleibt, nicht mit dem zu vergleichen, was bisher an Erfahrung erlebt wurde. Es ist aber gleichzeitig keine Erfahrung, die sich in einer anderen, vom Diesseits völlig getrennten Welt abspielen würde. Es ist keine Erfahrung der radikalen Transzendenz, kein mystisches Erleb nis. Hingegen ist es eine durchaus »schwindelerregende (»vertigi neux«) Erfahrung. Schwindelgefühl (»vertige«) ist der Begriff, der das Gefühl beschreibt, das einen bei der Annäherung an das Unerhörte, wohl auch schon beim Versuch des Ausbrechens aus der Banalität des ewig Gleichen, befällt. Wie eben auf einer Gratwanderung, bei der es rundum steil abfällt: nach hinten, von wo man gekommen ist, und nach vorne, wo man hinstrebt. Es ist kein fester Boden unter den Füßen. Das gilt auch für den Ort, wohin ich strebe. Es sind keine lichten Höhen. Das Schwindelgefühl, das meine Annäherung an diese gänzlich neue Erfahrung des Unerhörten in mir auslöst, entsteht gerade dadurch, dass ich gewohntes Terrain verlassen habe, dass ich mich auf völlig ungesichertem Terrain bewege, weder gleich mäßig noch berechenbar. Ich stehe, wohin ich auch blicke, vor einem Abgrund (»abime«). Ob links, ob rechts, vorne oder hinten. Es geht von hier aus nur mehr abwärts. Deshalb das Schwindelgefühl, der
136
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Taumel, die Euphorie oder Angst, die mich befällt, und wovon ich mich nicht durch den Sprung in ein anders Dasein (wie durch den Luther schen »Sprung in den Glauben«) retten kann, weil meine Bindung an das Leben nicht aufgehoben werden kann, ohne diese Aufhebung als Flucht zu empfinden. Es ist leicht zu sehen, dass ein dauernder Aufenthalt auf solchen Gipfeln nicht vorstellbar ist – aus Julliens Sicht auch gar nicht vorgesehen, schon gar nicht planbar. Ein solcher längerer Aufenthalt würde unweigerlich vom Taumeln ins Straucheln, ins Aufgeben, zum Einknicken, führen. Denn sobald ich mich an einem Ort einrichte, beginnt die Banalität, die Langeweile, die Wiederholung des bereits Bekannten – und vorbei ist es mit dem Unerhörten. Um im Bild zu bleiben: Ich kann mich vor dem Straucheln nur retten, indem ich entweder brav in die Ebenen des Tals zurückkehre (in die Banalität), oder durch den Versuch des Übertretens (Hinübertretens) in die lichten Höhen und Gipfeln der Metaphysik, die mit der Erfahrung bricht und sie verdeckt. Das Unerhörte ist daher nur ein Fluchtpunkt, eine Öffnung, ein Riss in der Erfahrung. Dieser Riss entsteht durch das Gefühl einer unerträglichen Enge, einer Beschränkung, welches die Gleichförmigkeit der Erfahrung in mir auslöst, und das nach »Erlö sung« verlangt. Nach zumindest vorübergehender Erlösung durch etwas, was – vom Hier und Jetzt aus gesehen – jenseits der Erfahrung, der bereits von mir gemachten Erfahrungen liegt, also meta-physisch ist. Wenn und solange ich auf der Schwelle bleibe. Dort aber kann es nur als Angepeiltes erscheinen, im besten Falle gestreift werden.
Ad b) (Als An-Sich) Aber warum bedeutet dies keinen Eintritt in die Metaphysik, was ja die Begriffe Schwindelgefühlt, Taumel, Überschreitung, nahelegen würden? Jullien hält die klassische Metaphysik für überwunden und als solche nicht mehr wiederbelebbar. Sie hat durch die Moderne ausgedient, ist nicht mehr glaubwürdig. Denn »nur das Phänomenale existiert« sei der Slogan der Moderne geworden, einer »Moderne, die für immer dem Darüberhinausgehenden der Metaphysik misstrauen wird«.18 Das Phänomenale erweist sich aber als »unerträglich eng« für die Möglichkeiten, die im Menschen angelegt sind. Und mit dieser 18
IN, S. 118.
137
Gerhard Weinberger
Enge »sieht man sich eines Tages – oder wäre es nicht täglich? – konfrontiert, ob man will oder nicht (selbst wenn man alles tut, um es zu vergessen)«.19 Das Phänomenale, das einzig Existierende, Grundlage aller unserer Erfahrung, lässt sich nicht einfach einfan gen und eingrenzen auf das, was wir täglich erfahren und was wir ständig bestimmen und benennen. Es bleibt immer ein »Rest«, eine »Leerstelle« (»un restant, un lieu vide«), das jeglicher Bestimmung und Festlegung widersteht, was sich »dem Prinzip des zurreichenden Grundes, jener Krönung der klassischen Philosophie, entzieht«.20 Diese Leerstelle wird traditionell durch die Metaphysik (durch ihren Begriff von Transzendenz alias Gott) ausgefüllt. Das kann und will Jullien nicht akzeptieren. Die Existenz einer solchen Leerstelle hingegen schon. Er versucht, diese zu orten, nicht in einem Jenseits, sondern in dem, was unsere Erfahrung ursprünglich ausmacht: in den Phänomenen selbst, die allerdings zugedeckt sind durch die Festlegungen der Sprache und des Denkens, was sie eben zu einer Leerstelle, zu etwas nicht Erkanntem, nicht Gesehenen macht. Diese hinter (unter) der Sprache liegende Schicht der Phänomene ist nichts anderes als das An-Sich der Dinge, das für Kant einfach als unerkenn bar galt, dem Jullien jedoch glaubt sich nähern zu können durch dessen Abdeckung, Freilegung von den überkommenen (sprachli chen) Rahmen. Um zum So-Sein der Dinge vorzudringen, das sich jenseits der sprachlichen und erfahrungsbedingten Verdeckungen als Unerwartetes, Neuentdecktes, noch-nicht-Erfahrenes, eben Unerhör tes, präsentiert. Dieses Andocken an das So-Sein des An-Sich ist für Jullien der Garant dafür, dass es zu keinem Hinübergleiten in die reine Ideen welt der Metaphysik kommt. Genauer: es ist sein Vorschlag, wie man die klassische Metaphysik in ihrem zusehends bedeutungslos werdenden Entschlafen belassen kann, und ihr ihre traditionellen Alibis nimmt, ohne das menschliche Dasein auf seine bloß diesseitigempirische Dimension zu reduzieren. Es ist ganz im Gegenteil eine Erklärung (und gleichzeitig ein Anreiz) für die Sonderstellung des Menschen in Natur und Geschichte, für seine Fähigkeit, sich alles und jedes »Andere« zu unterwerfen durch das ständige Hinauswachsen über sich selbst, die ständige Weiterentwicklung, die der ständigen Unruhe, d.h. Unzufriedenheit mit dem Gegebenen entspringt. Eine 19 20
IN, S. 118. IN, S. 46.
138
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Erklärung, die jedoch auch – im Gegensatz zur Metaphysik – bemüht ist, die geschichtlichen Erfahrungen, die Folgen dieser Selbstüber schreitung zu berücksichtigen und deren Auswüchsen einen Riegel vorzuschieben. Indem der unvermeidliche Hang des Menschen zur Metaphysik mit seinen unkontrollierbaren Folgen von Willkür und Beliebigkeit in den Beziehungen zwischen den Menschen und zwi schen Mensch und Natur (Kosmos) an die Realität gebunden wird, strebt Jullien nicht zuletzt eine Grundlage für eine Ethik an, die den Anderen, die Anderen, das Andere als genauso erdgebunden wie das eigene Selbst ansieht.
Rettung der Metaphysik im Dialog mit Levinas? Um sein Konzept des Unerhörten in Abgrenzung zu der Metaphysik zu erläutern, setzt sich Jullien (wie schon in einigen der vorangegange nen Texte) mit Emmanuel Levinas auseinander. Mit Levinas verbin det ihn die ständige Bezugnahme auf die Alterität und die Bedeutung, die dem »Anderen« im Denken beider zugemessen wird. Und damit eine Diskussion über den Begriff des »Antlitzes« (»visage«).21 Das Antlitz ist für Levinas diejenige Kategorie, die den Übergang zum Unendlichen markiert. Es bezeichnet genauer ein Hereinreichen des Unendlichen, des unendlich Anderen, in das Diesseits. Dadurch stört es die Ruhe und Selbstgefälligkeit des Ich, indem es in dessen Selbst genügsamkeit, in dessen Egoismus, einfällt, es also beunruhigt. Wie Jullien dies für sein »Unerhörtes« in Anspruch nimmt. Jullien spricht den gemeinsamen Ausgangspunkt direkt an: »Jedes Antlitz ist in seinem bloßen Erscheinen unerhört«.22 Warum? Weil es zwar als sehr physisches Phänomen erscheint in seiner Physi onomie und Motorik. Aber es kann nicht auf diese Erscheinungsweise reduziert werden. Hinter ihm erscheint etwas »Unermessliches« (»incommensurable«). Es ist, so zitiert Jullien zustimmend Levinas an dieser Stelle, »nicht von dieser Welt«, es »gehört nicht der Ordnung dieser Dinge an – insofern rührt es ans Metaphysische«. Aber: »das 21 Der zentrale Begriff »visage« wird in den diversen Levinas-Übersetzungen manch mal mit »Gesicht«, manchmal mit »Antlitz« übersetzt. Beides ist natürlich möglich. Ich bevorzuge »Antlitz«, weil es den starken metaphysischen Aspekt, den »visage« bei Levinas zweifelsohne hat, besser zum Ausdruck bringt. 22 IN, S. 116.
139
Gerhard Weinberger
Unermessliche, das das Antlitz durchzieht und kennzeichnet, existiert nur in diesem Antlitz, weshalb es für die Metaphysik ungeeignet ist«.23 Es ist nur die Spur von etwas Anderem, von einem nicht oder noch nicht Bekannten, etwas ganz Anderem, das mich aus meinem gewöhnlichen Leben herausreißt, mich konfrontiert mit einem »Phä nomen«, das ich nicht wie alle anderen ohne weiteres in meine Welt integrieren kann. Das mich aufweckt, weil meine üblichen Strategien, damit fertig zu werden, nicht greifen. Das mich in diesem Sinne »erweckt«, zum Nachdenken bringt, ja mich in Frage stellt. Mich über mich selbst hinaustreibt. In dieser Hinsicht ist das Antlitz durchaus die Levinassche Entspre chung des Jullienschen Unerhörten. Aber für Jullien schießt Levinas übers Ziel, indem er die Überschreitung des Phänomenalen einem transzendenten Objekt zuordnet, anstatt es in einem im Prinzip konkret Zugänglichen zu belassen. Indem Levinas zwar sage, das Antlitz sei »nicht das Zeichen eines versteckten Gottes«, es aber andererseits als »Spur des Unendlichen« interpretiere,24 verleihe er dieser Transzendenz einen jenseitigen Unterbau, ein jenseitiges Fundament, und weiche damit in das nicht mehr wirklich fassbare Feld der Metaphysik aus. Das Antlitz wird damit zum Ort einer »metaphy sischen Wahrheit«,25 also einer (versuchten) Wiederbelebung einer Kategorie, die historisch Schiffbruch erlitten hat. Genau vor dieser »Gefahr« schützt das Konzept des Unerhörten. Jullien versucht denn auch, das Antlitz unter dem Gesichtspunkt seines Unerhörten zu betrachten und es so vor dem Abdriften ins Theologische zu retten. Dabei zeigt sich, dass das Antlitz dadurch, dass es über das rein Phänomenale hinausweist, ebenso wie das Unerhörte dazu aufruft, den vorgegebenen Rahmen des Daseins zu überschreiten, hinter sich zu lassen, und das Neue, noch nicht Assimilierte, nicht Langweilende, zu suchen – aus der Banalität auszubrechen. Andererseits kann das Antlitz als physische Erschei nung, als Körperteil, das es auch ist, assimiliert werden wie andere Phänomene auch, und solcherart ebenso »langweilig« werden. Es kann von mir in meine Erfahrung ebenso wie alles andere absorbiert werden und so Teil dessen werden, was ich als meine Welt immer schon kenne oder kennen kann, was mich in keiner Weise antreibt, mein Dahinleben zu verlassen. 23 24 25
IN, S. 117, Hervorhebung »nur in diesem Antlitz« von mir. IN, S. 117. IN, S. 161.
140
Das Unerhörte – François Julliens »minimale Transzendenz«
Denn, sagt Jullien: »Seit wir unsere Augen offen hatten, stets Antlitze vor uns hatten, bereits als über den engen Aufblick unserer Wiege gebeugt, haben wir nicht aufgehört, diese Antlitze in uns aufzunehmen und zu integrieren«26. Im Antlitz steckt zwar die Mög lichkeit, mich auf neue Wege zu führen, mich weg vom Alltäglichen zu bringen. Aber nur wenn es (für mich) zum Unerhörten wird, d.h. wenn ich es aus seiner Gebundenheit an das Vorgegebene her auslöse. Wenn ich die Schritte zur Entschleierung unternehme, die ich bei allen anderen Phänomenen, z. B. dem Meer, auch setzen kann. Damit wird die Sonderrolle des Antlitzes hinfällig. Außer man löst es überhaupt von seiner konkreten Erscheinungsform, sieht in ihm eine (übersinnliche) Erscheinung, was ja Levinas für Jullien mit seinem Ausdruck »Epiphanie« anzudeuten scheint. Dann aber ist es bereits der »Durchbruch«27 zum Göttlichen und wird Element der klassischen Metaphysik. Demgegenüber bietet sich das Unerhörte als Ausweg an. Es ermöglicht es, »die absolute Fremdheit des Anderen zu respektieren, d.h. den Anderen als Anderen, in seinem abgrundtiefen Abstand, anzuerkennen, ohne ihn in eine Banalisierung als Gleichem herunter zuzerren, ihn vor jeder Assimilation bewahrend. Ohne deshalb gleich seiner Alterität eine theologische Perspektive zu verpassen.28 Anders gesagt: Das Unerhörte ermöglicht es, eine Transzendenz zu denken die – als Suche nach dem sehr diesseitigen An-Sich der Dinge – dem Überschreiten, Hinausgreifen über die unmittelbar sinnliche Erfahrung hinaus Raum lässt für bisher völlig Ungedachtes, Unbeachtetes. Eine Transzendenz, die den Menschen nicht eingemau ert bleiben lässt in dem, was er immer schon erlebt und gedacht hat, ohne sich in Spekulationen über ein Jenseits zu verlieren und zu verirren. Es ermöglicht das Erahnen von Erlebnissen jenseits des Physischen, bleibt aber dabei »minimal metaphysisch«, weil immer rückgebunden an das Leben im Hier und Jetzt. Es ist diese Rückbiegung, oder Rückbindung, des Überschrei tens zum Immer-schon-Dagewesenen, wenn auch nicht Gesehenen, zum An-Sich, das den entscheidenden Unterschied des »minimal Metaphysischen« gegenüber der Metaphysik ausmacht. Keineswegs eine Ablehnung eines radikalen Anderswo, eines Außen. Daher auch 26 27 28
IN, S. 126. »trouée«, eigentlich Schneise, Loch, IN, S. 181. IN, S. 181 f.
141
Gerhard Weinberger
keine Ablehnung des Begriffs »Metaphysik« an sich, aber ohne ihre »idealistischen Phantastereien«, die diese Metaphysik »kompromit tiert« haben. Jullien will trotz dieser historischen Vorbelastungen den Versuch unternehmen, das Metaphysische zu retten, ihm einen neuen Stellenwert zuzusprechen. Was, so fragt er, muss man als »minimalst metaphysisch annehmen – oder wie sonst soll man es nennen? –, um zu einer Ethik zu gelangen«29, die sich nicht mit Moralisieren und Erstellen von Vorschriften begnügt, ohne diese aus dem Leben, dem diesseitigen, dem einzigen das wir haben, begründen zu können? Das Streben nach diesem Anderswo ist dem Menschen zutiefst eigen, ja es charakterisiert das Menschliche schlechthin. Jullien belässt nicht nur diesem Streben seinen Platz, sondern er fordert es ein. Damit möchte er, so meine ich, unter die Verurteilung der Meta physik durch die moderne Philosophie (oder einen beträchtlichen Teil davon) einen Schlussstrich ziehen, und eine gewisse Form der Trans zendenz (wieder) denkmöglich machen. Seine »minima metaphysica« sind im Grunde nichts anderes als das Bemühen, dem menschlichen Subjekt jene Transzendenz wieder zu erlauben, oder zu ermöglichen, ohne die es offensichtlich – auch das u.a. eine Lehre aus einer kriti schen Aufarbeitung der Aufklärung – nicht auskommt. Man muss das Konzept des »Unerhörten« als konzentrierten Ausdruck und Ergebnis dieses Bemühens nicht unbedingt als solches akzeptieren, um diese Jullienschen Umkreisungen einer neuen Form von Transzendenz als einen der wichtigen Denkanstöße der Gegenwartsphilosophie anzu erkennen.
Literaturverzeichnis Jullien, F., Dé-coincidence, Paris: Ed. Grasset 2017 (deutsch: De-Koinzidenz, Wien: Turia und Kant 2019) —, L’inoui, Paris: Ed. Grasset 2019 (=IN) —, Vivre en existant – une nouvelle éthique, Paris: Ed. Gallimard 2016 (=VE)
29
Alles IN, S. 99 f., Hervorhebung von mir.
142
B. Geographisch oder zeitlich verortbare Ausgangspunkte
Hans Schelkshorn
Religion, Vernunft und Politik im Abendland Eine geschichtsphilosophische Skizze im Licht der Theorie der Achsenzeit
Hinführung Seit dem »Einbruch der Geschichte« (Foucault), der im 18. Jahrhun dert auch die innersten Bereiche der Philosophie wie die Subjekt- und Rationalitätstheorie erfasst, ist die Klärung philosophischer Fragen unumgänglich mit einer geschichtlichen Selbstvergewisserung der Gegenwart verwoben. Dies gilt auch für die Frage nach der Bedeu tung von Religion. So wie Hegel seine philosophische Theologie mit einer Theorie der Weltgeschichte verbindet, so präsentieren Feuerbach, Marx und auch Nietzsche ihre Religionskritik jeweils als geschichtlich vermittelte Diagnosen der je eigenen Gegenwart. Die in der neuzeitlichen Philosophie etablierte Synthese von Zeitdiagnose, geschichtlicher Rückblende und philosophischer Selbstreflexion kann mit Jürgen Habermas und Michel Foucault rückblickend als »Diskurs über die Moderne« bezeichnet werden.1 Da die Moderne ein global ausgreifendes Phänomen ist, stehen heute auch Religionen unter dem Zwang einer kritischen Selbstver ortung in der modernen Weltgesellschaft. Religionsphilosophie hat allerdings keinen Stammplatz im globalen Diskurs über die Moderne. Im Gegenteil, seit der Religionskritik des 19. Jahrhunderts themati siert die westliche Philosophie Religion weitgehend als eine überholte Gestalt des »objektiven Geistes« (Hegel). In jüngerer Zeit hat jedoch die Säkularisierungstheorie ihr Monopol verloren. In der gegenwär tigen religionssoziologischen Debatte erscheint das säkulare Europa zuweilen als erklärungsbedürftiger Ausnahmefall in der globalen J. Habermas, Der philosophische Diskurs, S. 11–33; M. Foucault, »Was ist Aufklä rung?«. 1
145
Hans Schelkshorn
Moderne, die weithin von religiös orientierten Kulturen geprägt ist. Darüber hinaus verwischen sich aus der Außenperspektive des globalen Südens die innereuropäischen Frontlinien zwischen Religion und säkularer Moderne. Denn aus der Sicht der Opfer des europä ischen Imperialismus erscheinen die universalistischen Ansprüche der europäischen Zivilisation als Säkularisierungen christlicher Ideen. Vor diesem Hintergrund steht eine interkulturell orientierte Religionsphilosophie vor einer doppelten Herausforderung: Einer seits ist der rationale Status von Religion gegenüber den Strömun gen eines atheistischen Säkularismus zu klären. Andererseits – und darin liegt der Schwerpunkt der folgenden Skizzen – bedarf es eines geschichtsphilosophischen Rahmens, in dem abseits des langen Schattens säkularistischer Fortschrittstheorien die Vielfalt religiöser Traditionen angemessen reflektiert werden kann. Zu diesem Zweck knüpfe ich an Jaspers’ Theorie der Achsenzeit an, in der unter dem Schock des Zweiten Weltkriegs und der Shoa der Monopolanspruch der europäischen Philosophie aufgebrochen wird. Die Achsenzeit markiert nach Jaspers einen epochalen Aufklärungsschub, in dem zwischen 800 und 200 v. Chr. nicht nur im Abendland, sondern auch in Indien und China die mythischen Weltbilder, insbesondere die sakralen Monarchien, in den Sog radikaler Kritik geraten.2 Im Konkreten verweist Jaspers auf Homer, die Tragiker, Parmenides, Heraklit und Platon, weiters auf die Propheten des Alten Testaments, Konfuzius, Mo-Ti, Buddha und Zarathustra.3 Der Achsenzeit ordnet Jaspers daher geistige Aufbrüche zu, die in der Neuzeit in religiöse und philosophische Bewegungen unterteilt werden. Die Achsenzeit ist für Jaspers allerdings bloß ein, wenn auch wichtiges Element einer umfassenden Geschichtsphilosophie, in dessen Zentrum eine bestimmte Deutung der Neuzeit steht. Daher bewegt sich auch Jas pers’ Geschichtsdenken im »Diskurs über die Moderne«.4 Jaspers‘ Theorie der Achsenzeit ist – von der Philosophie vorerst jahrzehntelang weitgehend ignoriert – in den 1970er Jahren zunächst durch die Makrosoziologie und Religionshistorie aufgegriffen und
2 3 4
K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 17 f. Ebd., S. 28. Vgl. dazu H. Schelkshorn, »Die Moderne als zweite Achsenzeit«, S. 83–86.
146
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
fortgeführt worden.5 In diesem Kontext ist allerdings die empirische Basis von Jaspers’ Geschichtsphilosophie auch auf vehemente Kritik gestoßen.6 Nach Jan Assmann subsumiert die Theorie der Achsenzeit völlig heterogene geistige Entwicklungen wie Konfuzius, Buddha, die griechischen Philosophen oder die alttestamentlichen Propheten, was unweigerlich zu gewaltsamen Nivellierungen führe. So hat sich nach Assmann der achsenzeitliche Übergang vom Mythos zum Logos nur im antiken Griechenland ereignet;7 die biblische Exoduserzählung hingegen begründet, worauf Assmann alles Gewicht legt, eine reli gionsgeschichtlich einzigartige Gestalt von Religion, nämlich einen auf göttliche Offenbarung gestützten exklusiven Monotheismus der Treue, dessen Gewaltpotentiale bis heute im Christentum und im Islam fortwirken.8 Gewiss: Die qualitativen Unterschiede zwischen den achsenzeitlichen Aufbrüchen dürfen nicht verwischt werden. Zugleich bleibt jedoch befremdlich, dass Assmann in seiner Kritik am exklusiven Monotheismus Israels den philosophischen Monothe ismus in der griechischen Philosophie von Xenophanes über Platon, Aristoteles bis zu Plotin nur marginal in den Blick nimmt. Dies überrascht umso mehr, als gerade die von Assmann kritisierten abrahamitischen Religionen sich von früher Zeit an auf die griechische Philosophie eingelassen haben. Vor diesem Hintergrund möchte ich im Licht der Theorie der Achsenzeit zentrale Stränge der abendländischen Religionsphiloso phie9 neu situieren. Im Unterschied zu kultursoziologischen oder religionshistorischen Studien hat eine philosophische Reflexion ihren 5 Vgl. dazu S. N. Eisenstadt, Kulturen der Achsenzeit; J. P. Arnason, S. N. Eisenstadt, B. Wittrock (Hg.), Axial Civilizations; R. Bellah, Religion in Human Evolution; R. Bellah, H. Joas, The Axial Age and its Consequences. 6 Manche Kritikpunkte an Jaspers wie die chronologische Festlegung der Achsenzeit oder die undifferenzierte Deutung vorachsenzeitlicher Kulturen werden inzwischen von den Verteidigern der Theorie der Achsenzeit konstruktiv aufgenommen. Auf die Kritik an der Theorie der Achsenzeit kann hier nicht näher eingegangen werden. Ich greife Jaspers’ Geschichtsphilosophie, in der die Achsenzeit ein Element bildet, als heuristischen Rahmen auf, weiche jedoch in der Deutung der Moderne von Jaspers ab. Vgl. dazu H. Schelkshorn, »Die Moderne als zweite Achsenzeit«. 7 J. Assmann, Achsenzeit, S. 191: »Der Schritt ›vom Mythos zum Logos‹ kennzeichnet die Entstehung der griechischen Philosophie und Geschichtsschreibung, und nur diese.« 8 Vgl. dazu J. Assmann, Exodus. 9 Das »Abendland« umfasst nach Jaspers sowohl die griechische Philosophie als auch die religiösen Aufbrüche im Vorderen Orient, neben Zarathustra vor allem die alttes tamentlichen Propheten. Vgl. dazu K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 63 f.
147
Hans Schelkshorn
Fokus naturgemäß in der systematischen Zuordnung von Vernunft und Religion. Da die Theorie der Achsenzeit bereits bei Jaspers als Hintergrundfolie für eine bestimmte Deutung der Moderne dient, zielt auch die hier vorgestellte geschichtsphilosophische Skizze über achsenzeitliche Konstellationen zwischen Vernunft, Religion und Politik auf eine Reflexion über die Selbstverortung der Religionen in der globalen Moderne. In diesem Sinn haben in jüngerer Zeit auch Hans Joas und Jürgen Habermas die Theorie der Achsenzeit als historisches Scharnier aufgegriffen, mit dem die Stellung der Religion in der gegenwärtigen Moderne näher bestimmt werden kann. Hans Joas sieht im gemein samen Ursprung der Philosophie und der Weltreligionen eine Stütze für seine Kritik an der säkularistischen These der Überwindung von Religion durch moderne Rationalisierungsprozesse. So wie in der Achsenzeit biblische und griechische Aufklärungsprozesse nebenei nander existieren, so bleibt auch in der späten Moderne eine reflexiv gewordene Religion neben den säkularen Strömungen eine legitime Gestalt des objektiven Geistes.10 Für Jürgen Habermas ist hingegen die Achsenzeit, die auf die Genese religiös-metaphysischer Weltbilder reduziert wird, eine Vorstufe der säkularen Moderne. Während die achsenzeitlichen Weltbilder trotz aller Kritik an mythischen Traditio nen noch einen Rest an Dogmatismus bewahren, setzt sich nach Habermas in der Moderne das Prinzip universeller Kritik durch.11 Beide Versuche, mit der Theorie der Achsenzeit den Ort von Religion in der Moderne zu bestimmen, führen jedoch, wie in den folgenden äußerst groben Skizzen gezeigt werden soll, auf schiefe Bahnen. Hans Joas überschätzt die biblische, Habermas hingegen unterschätzt die griechische Aufklärung.
1. Achsenzeitliche Religionen und Philosophien im »Streit der Schulen« Die Achsenzeit markiert nach Jaspers einen epochalen Aufklärungs schub, in dem die polytheistischen Mythologien und die archaische H. Joas, Die Macht des Heiligen, S. 279–354. Vgl. dazu J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie. In den Spuren von Feuerbach dechiffriert Habermas die holistischen Sinnhorizonte der religiös-meta physischen Weltbilder als Projektionen der Lebenswelt. Vgl. ebd., S. 461–480.
10 11
148
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Institution des Gottkönigtums in den Sog radikaler Kritik geraten, sei es durch die griechische Philosophie, durch Buddha oder die alttestamentlichen Propheten. Da Jaspers auch religiöse Bewegungen in die Theorie der Achsenzeit integriert, ist vor allem von Shmuel N. Eisenstadt die Idee der Transzendenz (Platons Idee des Guten, das Tao des chinesischen Denkens, der biblische Schöpfergott) bzw. die Spannung zwischen transzendenter und weltlicher Ordnung ins Zen trum der makrosoziologischen Studien über die Achsenzeit gerückt worden.12 Jaspers selbst schränkt jedoch die geistigen Aufbrüche der Achsenzeit keineswegs auf religiös-metaphysische Weltbilder ein. Im Gegenteil: In der Achsenzeit werden, wie Jaspers ausdrücklich betont, »alle philosophischen Möglichkeiten« von der Metaphysik »bis zur Skepsis und bis zum Materialismus, bis zur Sophistik und zum Nihilismus« ausgelotet.13 Kurz: Die inneren Antriebskräfte der Achsenzeit sind Reflexion und Kritik, die jeweils eine Pluralität an Denkformen freisetzen.14 Nicht religiös-metaphysische Weltbilder, sondern der »Streit der Schulen« prägt daher nach Jaspers die Signatur der Achsenzeit. Nicht zufällig beschreibt denn auch die chinesische Historiographie die Zeit von Konfuzius bis zur Qin- und Han-Dynas tie als die »Zeit der 100 Schulen«.15 Auch wenn unter dem Dach der Achsenzeit sowohl philoso phische als auch religiöse Aufbrüche subsumiert werden, dürfen gerade im Blick auf das Abendland die qualitativen Unterschiede achsenzeitlicher Bewegungen nicht nivelliert werden. Um die innere Vielfalt der abendländischen Achsenzeit, in der vor allem griechische Philosophien und die jüdisch-christliche Religion aufeinandertreffen, angemessen deuten zu können, müssen die Kriterien des achsenzeit lichen Durchbruchs – Bewusstwerdung, Reflexion, Vernunft – näher geklärt werden. »Das Neue dieses Zeitalters« liegt, wie Jaspers zunächst betont, darin, »daß der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenzen bewußt wird […] Er stellt radikale Fragen. Er drängt vor dem Abgrund auf Befreiung und Erlösung.«16 Die Frage S. N. Eisenstadt, »Allgemeine Einleitung«, S. 11–13. K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 17 (Hvh. H.Sch.). 14 Darin sieht auch Björn Wittrock den Kern der Achsenzeit. Vgl. dazu B. Wit trock, »Cultural Crystallization«. 15 Zu China vgl. vor allem H. Roetz, Die chinesische Ethik; ders., »Karl Jaspersʼ Theorem der ›Achsenzeit‹“. 16 K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 18. 12
13
149
Hans Schelkshorn
nach der Beziehung des Menschen zum Sein im Ganzen und einem Weiterleben nach dem Tod ist jedoch bereits Thema zahlreicher Mythen. Die Achsenzeit ist daher, wie Jaspers ergänzt, durch eine bestimmte Gestalt des Selbstbewusstseins geprägt. Die Bewusstwer dung des Seins im Ganzen »geschah in Reflexion. Bewußtheit machte noch einmal das Bewußtsein bewußt, das Denken richtete sich auf das Denken.«17 Jaspers’ Präzisierung des achsenzeitlichen Bewusstseinswandels bedarf allerdings noch weiterer Klärungen. Denn Reflexion kann ers tens als Kritik an inhaltlichen Deutungen von Welt und Gesellschaft, die selbst bereits aus Reflexionsprozessen hervorgegangen sind, ver standen werden. In diesem weiten Sinn gibt es auch in mythischen Weltbildern bereits Ansätze von Kritik, wie z. B. Hesiods Kritik an der homerischen Welt.18 Zweitens können sich Reflexionsprozesse, was Jaspers zu Recht hervorhebt, zu einer Selbstreflexion des Denkens verdichten. Diese beiden Ebenen aufklärerischer Vernunft sind eng miteinander verwoben. Denn die inhaltliche Kritik erweitert das Spektrum an Perspektiven, die zur Selbstreflexion zwingen; die Refle xion auf verschiedene Gestalten des Denkens erweitert wiederum den inhaltlichen Horizont der Kritik. Aus diesem Grund bewegen sich geschichtliche Aufklärungsprozesse jeweils auf unterschiedlichen Ebenen der Fraglichkeit und Reflexivität. Denn nur was fraglich geworden ist, kann überhaupt Gegenstand kritischer Prüfung wer den. Umgekehrt erschließt die Kritik auch neue Gewissheiten, die in der Folge selbst wieder fraglich werden können. Aufklärung ist daher ein dynamischer Prozess, der weder auf bestimmte Inhalte noch bestimmte Epochen festgelegt werden kann. Dennoch sind Aufklärungsprozesse nicht beliebig, denn jede Fraglichkeit ist in gewissem Sinn irreversibel. Aus diesem Grund ist jeder Versuch der Rückkehr zur früheren fraglosen Selbstverständlichkeit potentiell mit Gewalt verbunden. Vor diesem Hintergrund möchte ich in einigen groben Strichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der achsenzeitlichen Durchbrü che im antiken Griechenland und Israel grob umreißen. In beiden Ebd. Hesiod beansprucht Wahres zu künden, im Gegensatz zu denen, die Lügen verbreiten. Vgl. dazu ders., Theogonie, V 27. In die Weltalterlehre fügt Hesiod das Zeitalter der homerischen Helden ein, das eine weitere Etappe im sittlichen Verfall der Menschheit bildet. Vgl. dazu ders., Werke und Tage, VV 110–200.
17
18
150
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Kulturen vollziehen sich – darin ist Jaspers recht zu geben – spek takuläre Aufklärungsprozesse. Wie die frühgriechischen Denker so entlarven auch die Propheten Israels die polytheistischen Mytholo gien als menschliche Setzungen. Nach Xenophanes entwerfen die verschiedenen Völker ihre Götter jeweils nach ihrem eigenen Bild; Deuterojesaja verachtet hingegen die Götterstatuen als bloße Pro dukte menschlicher Handwerkerkunst.19 Auf der Ebene der Selbstreflexion zeigt sich hingegen zwischen griechischen und biblischen Aufklärungsprozessen eine qualitative Asymmetrie.20 Im frühgriechischen Denken stellt Parmenides bereits den alltäglichen Weltbezug, d. h. die Welt der Meinungen (doxai), in toto in Frage, um den Menschen in das Denken des Seins einzuführen. Heraklit unterscheidet eine Trias an Erkenntnisformen, nämlich die Einsicht in den universalen Logos, die Vielwisserei und das Wissen der Vielen.21 Die griechische Sophistik schließlich dechiffriert sämt liche Sinnhorizonte, einschließlich der Moral, Politik und Religion, als menschliche Setzungen (thesis). Nach Kritias sind die Götter als Schreckmittel für die Befolgung moralischer Normen erfunden wor den; Kallikles führt hingegen – wie später Nietzsche –Forderungen nach moralisch-politischer Gleichheit auf die Rache der Schwachen gegenüber den Vornehmen und Starken zurück.22 Die Sophistik voll zieht daher eine vollständige Entsakralisierung der politischen Macht. Auch im alten Israel kommt es zu einer dramatischen Entsakrali sierung politischer Herrschaft. Die alttestamentlichen Propheten und nicht zuletzt die von Assmann inkriminierte Exoduserzählung destru ieren die Idee des Gottkönigtums. Darin liegt neben der Entzauberung des Kosmos durch die Idee eines transzendenten Schöpfergottes ein wesentlicher Beitrag Israels für die achsenzeitlichen Aufklärungs Xenophanes DK 88 B 15;16. Nach Halfwassen entwickelt Xenophanes bereits einen exklusiven Monotheismus. Vgl. dazu J. Halfwassen, »Der Gott des Xenophanes«. Im Unterschied zu den Propheten Israels vollzieht Xenophanes allerdings noch keine Ethisierung des Gottesbildes. 20 So auch R. Bellah, Religion in Human Evolution, S. 283: »Although everyone who has seriously discussed the axial age has included ancient Israel as an axial case, it is clear that theory, if we define it narrowly as ›thinking about thinking‹ was not an Israelite concern. The wisdom tradition, already present in archaic Mesopotamia and Egypt, was well developed in Israel, but only incipiently engaged in logical argument as compared, say, to Greek philosophy.« 21 Parmenides DK 28 B 1; Heraklit DK 22 B 1; 2; 40. 22 Vgl. dazu Kritias, Sisyphos (Satyrspiel?), in: T. Schirren, T. Zinsmaier (Hg.), Die Sophisten, S. 279 ff.; Platon, Gorgias 483a-484b. 19
151
Hans Schelkshorn
prozesse. Entsakralisierungen sind jedoch kein einliniger Prozess, sondern gehen immer wieder mit neuen Sakralisierungen einher. Die Propheten Israels berufen sich in ihrer Kritik am Götzendienst und am Gottkönigtum auf eine göttliche Offenbarung; das Gesetz, d. h. die moralisch-politische Ordnung, gründet unmittelbar im göttlichen Willen. In Israel kommt es daher – darin ist Jan Assmann recht zu geben – zu einer Sakralisierung des Rechts, das im Alten Ägypten unter dem sakralen Schirm des Pharao einen vergleichsweise profa nen Charakter innehatte.23 Erst recht heben sich die sakralen Stützen der alttestamentlichen Aufklärungsprozesse von der sophistischen Profanisierung von Moral und Politik ab. Die sophistische Aufklärung droht allerdings in einen radikalen Relativismus abzugleiten, eine Herausforderung, die zunächst von manchen Sophisten,24 in der Folge jedoch von Sokrates bis Aristoteles ins Zentrum des Denkens gestellt wird. Die griechische Metaphysik tritt daher nicht unmittelbar das holistische Erbe der mythologischen Weltbilder an, wie aufklärerische Geschichtsphilosophien bis heute suggerieren, sondern bearbeitet die »Sinneskrise«, die durch die sophistische Aufklärung ausgelöst worden ist.25 Die Metaphysik ist – so könnte man pointiert im Blick auf Habermas festhalten – bereits eine Reaktion auf das »nachmetaphysische« Denken der Sophistik. In diesem Kontext entstehen in der griechischen Philosophie zumindest vier Paradigmen philosophischer Theologie.
a) Sokrates: das Göttliche und die Unbedingtheit der Moral am Grund endlicher Vernunft Da in der Sophistik bereits sämtliche Sinnhorizonte fraglich geworden sind, kennt auch Sokrates, der der Rhetorik den argumentativen Dialog entgegenstellt, keine Reservate dogmatischen Denkens. Bei Sokrates bricht daher bereits die Idee universeller Kritik auf, die Habermas als Vorzug der Moderne reklamiert. »Die wichtigste Ent deckung der griechischen Aufklärung des 5. Jahrhunderts bestand« J. Assmann, Exodus, S. 253–265. Nach dem Zeugnis von Aristoteles hat Lykophron bereits eine vertragstheoretische Begründung moralisch-politischer Normen entwickelt Aristoteles, vgl. dazu Aristote les, Politik 1280b10–1280b12. 25 Vgl. dazu K. Reinhardt, »Die Sinneskrise bei Euripides«. 23
24
152
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
– so Yehuda Elkana – »darin, daß nichts mehr als selbstverständlich aufgefaßt wurde.«26 In den Frühdialogen schildert Platon, wie Sokrates moralische und religiöse Grundhaltungen auf den Prüfstand argumentativer Vernunft stellt. Das verbreitete Vorverständnis von Frömmigkeit, nämlich jeweils das zu tun, »was den Göttern lieb ist«, scheitert nach Sokrates an der Uneindeutigkeit der religiösen Tradition. Denn dieselbe Handlung kann, wie Sokrates im Dialog Eutyphron betont, Zeus und Hephaistos wohlgefällig, Kronos oder Uranos hingegen verhasst sein, »und ebenso auch mit andern Göttern, wenn etwa noch sonst einer mit einem andern hierüber uneins ist.«27 Denn die Vieldeutigkeit der religiösen Überlieferung wirft nach Sokrates-Platon die Menschen auf ihre endliche Vernunft zurück, in der sich, wie im Dialog Eutyphron weiter ausgeführt wird, ein unbe dingter moralischer Anspruch meldet. Dass Menschen, die ungerech terweise Unschuldige töten, zu bestrafen sind, darüber müssen, wie Eutyphron und Sokrates gemeinsam festhalten, Götter und Menschen übereinstimmen.28 Das Fromme ist daher nach Sokrates untrennbar mit der Gerechtigkeit verbunden; die Gerechtigkeit im Sinne der Selbstzweckhaftigkeit von Moral verdichtet sich schließlich in der Maxime »Unrechttun ist schlimmer als Unrechtleiden«.29 Darüber hinaus stößt Sokrates in der Selbstreflexion endlicher Vernunft auf einen Unbedingtheitsanspruch, der in der Vernunft selbst liegt, genauer auf den Imperativ zur lebenslangen argumentati ven Prüfung sämtlicher Lebensfragen. Die Pflicht zur argumentativen Prüfung ist nicht bloß ein Argument in einem rationalen Dialog, das durch neue Argumente revidiert werden könnte, sondern das tragende Fundament der argumentativen Praxis als solcher. Obwohl im Dialog Ion jede Berufung auf eine göttliche Inspiration als Strategie Y. Elkana, »Die Entstehung des Denkens«, S. 75. Elkana verortet allerdings die universelle Kritik primär in der Sophistik, ohne die sokratische Klärung der Spezifika argumentativer Vernunft in den Blick zu nehmen. 27 Platon, Eutyphron 7ab. 28 Ebd., 8b: »Eutyphron: Allein ich glaube, o Sokrates, dass hierüber kein Gott mit dem andern uneins ist, dass nämlich der nicht Strafe leiden müsse, der einen Andern ungerechter Weise getötet hat. Sokrates: Wie doch, Euthyphron? Hast du etwa von Menschen jemals einen gehört, welcher das bezweifelt hätte, ob wer ungerechter Weise einen Andern getötet, oder irgend sonst etwas ungerechter Weise getan, auch wohl Strafe leiden müsse?«. 29 Platon, Gorgias 468e-470c. 26
153
Hans Schelkshorn
einer Diskursverweigerung strikt abgelehnt wird, beruft sich Sokrates in der Verteidigung der unbedingten Pflicht zur argumentativen Rechtfertigung plötzlich auf einen göttlichen Befehl. Die Menschen durch argumentative Prüfung über ihr Unwissen aufzuklären, ist, wie in der Apologie betont wird, ein Gottesdienst.30 Dies bedeutet: Die Selbstreflexion endlicher Vernunft, die sakrale Autoritätsansprüche restlos der argumentativen Prüfung unterwirft, erschließt in ihrem Innersten einen neuen »sakralen« Kern, in dem Rationalitätsver pflichtungen und moralische Unbedingtheitsansprüche miteinander verwoben sind.
b) Platon – politische Theologie und Soteriologie Platon entwirft ohne Zweifel das komplexeste Paradigma philosophi scher Theologie in der Antike. Ich kann hier nur die wichtigsten Themenfelder und Reflexionsebenen kurz benennen. Da die Unbe dingtheit der Moral, wie der Tod des Sokrates zeigt, im Extremfall das Lebensopfer impliziert, verbindet Platon die Ethik mit einer politischen Philosophie. Im Idealstaat der Politeia wird eine gesell schaftliche Ordnung entworfen, in der die Hinrichtung der Gerechten, d. h. der Tod des Sokrates, definitiv ausgeschlossen werden soll.31 Die geistige Grundlage der idealen Polis liegt in einem philosophischen Monotheismus, in dem das Göttliche bzw. Gott ethisiert ist: Gott ist gut und Ursache des Guten.32 Da nicht alle Menschen Zugang zur philosophischen Einsicht in den göttlichen Grund der kosmischen Ordnung haben, müssen, wie Platon in der Politeia fordert, für die übrigen Stände der Polis (Wächter, Handwerker und Bauern) künstliche Mythen entworfen werden, die die normativen Grundlagen der Polis narrativ vermitteln. Darüber hinaus entwirft Platon auch Mythen, die allen Ständen der Polis, d. h. auch den Philosophenkönigen, anempfohlen werden. Da auch eine ideale Polis unmoralisches Handeln nicht restlos unterbin den kann, wirft die Unbedingtheit der Moral, die im Extremfall das Vgl. dazu Platon, Apologie 30a. Zu den Verbindungslinien zwischen dem Dialog Eutyphron und der Apologie vgl. E. Heitsch, »Frömmigkeit als Hilfe«, S. 19–21. 31 Vgl. dazu Platon, Politeia 376e-379e. 32 Zur Eigenart von Platons philosophischem Monotheismus vgl. M. Bordt, Platons Theologie, S. 79–94.
30
154
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Opfer des eigenen Lebens fordert, die Frage nach einem Weiterleben des Menschen nach dem Tod auf. In mehreren Dialogen, konkret im Gorgias, Phaidon und in der Politeia, stellt Platon daher unter schiedliche Mythen über das Schicksal der Seelen im Jenseits vor, die allerdings vom Bereich des rational Einsehbaren sorgfältig abgegrenzt werden. Die Jenseitsmythen sind, wie Platon im Phaidon hervorhebt, ein »schönes Wagnis«33, das Hoffnung geben soll. In inhaltlicher Hinsicht greift Platon in den Jenseitsmythen eine ethische Version der Seelenwanderungslehre auf, die mit Elementen der ägyptischen Vorstellung eines Endgerichts verbunden wird.34 Mit dem Projekt, die Polis auf einem philosophischen Mono theismus aufzubauen, wird Platon zum Begründer der politischen Theologie. Während in der Politeia die Philosophenkönige in Orien tierung am Göttlichen die Polis lenken, sichert Platon in den Nomoi die monotheistische Fundierung der Polis durch Gesetze gegen Atheisten ab. Für die verschiedenen Typen von Atheisten sind jeweils eigene Gefängnisse vorgesehen.35 Darüber hinaus gibt Platon umfassende Anweisungen für die religiösen Feste und Riten.36 Die Nomoi sind – wie Henning Ottmann zurecht konstatiert – der »eigentliche Geburts ort der politischen Theologie […] Das erste Wort der Nomoi lautet theos, ›Gott‹. Ihr letztes Wort sind scharfe Gesetze gegen Asebie.«37 Jan Assmann hätte in seiner ursprünglichen Kritik der Gewalt förmigkeit des Monotheismus daher eher bei Platon als in der Exo duserzählung ein paradigmatisches Modell finden können. Denn die Unterscheidung von wahr/falsch im Bereich der Religion und die Strategie einer gewaltsamen Durchsetzung des Monotheismus finden sich zuallererst in Platons philosophischer Theologie.38 Nichtsdesto trotz unterläuft Platon zugleich die Mauern einer theokratischen Ord nung. Denn in der Frage der Erkennbarkeit des göttlichen Urgrunds Platon, Phaidon 114b. Zu den Quellen und den Versionen der Seelenwanderungslehre bei Platon vgl. T. McEvilley, The Shape of Ancient Thought, S. 98–156. Zum Motiv des Endgerichts, in dem die Opfer den Mördern vergeben müssen, um ihre Seelen zu bewahren vgl. Phaidon 113e-114b. 35 Vgl. dazu Platon, Nomoi 907 ff. 36 Vgl. dazu vor allem Platon, Nomoi VIII. Dazu H. Ottmann, »Platon als Begründer der Politischen Theologie«, S. 57–60. 37 Ebd., S. 54. 38 Vgl. dazu J. Assmann, Die mosaische Unterscheidung, S. 19–47. Dem biblischen Monotheismus liegt, so Assmann in seiner Selbstkorrektur, nicht die Unterscheidung von »wahr/falsch«, sondern ein bestimmtes Treueverhältnis zugrunde. 33
34
155
Hans Schelkshorn
schillert Platons Denken. Einerseits betont Platon, dass Gott in der Polis dargestellt werden muss, wie er ist;39 andererseits finden sich bei Platon auch skeptische Aussagen über die Erkennbarkeit des Göttli chen, die auf Plotin vorausweisen.40
c) Aristoteles – philosophische Theologie als Letztbegründung der Kosmologie Aristoteles baut trotz aller Kritik an der Ideenlehre in der Ersten Philosophie auf dem platonischen Denken auf. Die erste Philosophie fragt nach dem Ursprung des Seins im Ganzen. In der Ausdifferen zierung unterschiedlicher Wirklichkeitsbereiche und ihrer jeweils entsprechenden Wissenschaften entwickelt Aristoteles jedoch gegen über Platon ein eigenständiges Paradigma philosophischer Theologie. Die Ordnung der Polis stützt sich nicht mehr unmittelbar auf einen philosophischen Monotheismus, sondern konstituiert sich durch die öffentliche Beratung der Bürger über das Gute und Gerechte. Das Göttliche kommt erst in der Frage nach dem Ursprung der teleo logisch verfassten Kosmologie in den Blick. Jenseitsspekulationen erteilt Aristoteles von vornherein eine entschiedene Absage. Dennoch beschränkt auch Aristoteles die philosophische Theologie nicht auf Grenzprobleme der Naturphilosophie. Da der Mensch durch seinen Geist (nous), d. h. durch seine Fähigkeit zur Suche nach Wahrheit und nach dem Gerechten und Guten, am Göttlichen teilhat, sind die beiden Gestalten der Eudaimonia, nämlich der bios theoretikos und der bios politikos, zumindest indirekt mit der philosophischen Theologie verbunden.
d) Plotin – negative Philosophie des Absoluten In der Spätantike entsteht mit dem Neuplatonismus noch ein viertes Paradigma philosophischer Theologie. In Anknüpfung an Platons Idee des Guten entwickelt Plotin eine negative Philosophie des Absoluten, in der das unerkennbare und unaussagbare Prinzip von 39 40
Platon, Politeia 379a. Platon, Timaios 28a.
156
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Denken und Sein nur mehr »berührt« werden kann.41 Dennoch ist Plotins negative Theologie nicht leer. Denn der Überstieg in das unerkennbare Eine (hen) baut auf einer Synthese der platonischen und aristotelischen Metaphysik auf. Sowohl im antiken Griechenland als auch im alten Israel mündet der Übergang zur Achsenzeit – dies kann als Zwischenergebnis festgehalten werden – in einen Monotheismus mit einem ethisier ten Gottesbild. Trotz aller Überschneidungen bewegen sich jedoch die philosophische und prophetische Kritik an den polytheistischen Mythologien auf völlig unterschiedlichen Reflexionsniveaus. Wäh rend in Griechenland seit der Sophistik sowohl moralische als auch religiöse Sinnhorizonte gleichsam in toto in den Sog der Fraglich keit geraten, stützt sich die Autorität der Propheten auf eine göttli che Offenbarung. Nach dem Alexanderfeldzug dringt allerdings die griechische Philosophie verstärkt in den Vorderen Orient ein. Aus diesem Grund flacht sich auch in Israel die ursprüngliche Asymmetrie zur griechi schen Kultur der Selbstreflexion etwas ab. Die alttestamentliche Weis heitsliteratur setzt sich bereits mit den griechischen Philosophenschu len auseinander, ein Prozess, der in Israel einerseits die Aufspaltung in verschiedene religiöse Gruppen und Schulen, andererseits vorsichtige Ansätze einer Reflexion auf unterschiedliche Erkenntnisweisen beför dert.42 Der Reflexionsschub im Zeitalter des Hellenismus, der seinen Höhepunkt in Philo von Alexandrien findet, darf jedoch nicht bloß im Sinne einer nachholenden Rationalisierung gedeutet werden. Denn eine systematische Selbstreflexion impliziert nicht per se – dies ist der Kurzschluss einliniger Rationalisierungstheorien – einen Fortschritt auf inhaltlicher Ebene. So sind etwa im Bereich der Moral manche sophistischen Ideen der Gerechtigkeit wie etwa Kallikles’ These vom natürlichen Vorrecht der Starken der sozialen Botschaft der Prophe ten, in der der Schutz der Armen, Witwen und Waisen im Zentrum steht, keineswegs überlegen. Die alttestamentliche Weisheitsliteratur entwickelt zwar noch keine systematische Philosophie menschlicher Erkenntnis, setzt jedoch inhaltlich die prophetische Idee der Gerech tigkeit fort. Vgl. dazu J. Halfwassen, Der Aufstieg zum Einen. Vgl. dazu A. Schellenberg, Erkenntnis als Problem. Im Alten Testament gibt es nach Schellenberg zwar vielfältige Problematisierungen menschlicher Erkenntnis, jedoch noch keine Erkenntnistheorie. Ebd., S. 25. 41
42
157
Hans Schelkshorn
2. Nachachsenzeitliche Großreiche und die Übermächtigungen zwischen Philosophie und Theologie Der achsenzeitliche »Streit der Schulen« hat nach Jaspers ganze Weltregionen mit in die soziale Anarchie getrieben. Am Ende [der Achsenzeit] erfolgte der Kollaps. Große politische und geistige Einheitsbildungen, dogmatische Gestaltungen beherrschten seit etwa 200 v. Chr. das Feld. Die Achsenzeit endete mit großen Staatsbildungen, welche die Einheit gewaltsam verwirklichten (Chi nesisches Einheitsreich des Tsin-Shi-Huang-Ti, Maurya-Dynastie in Indien, römisches Imperium).43
Die nachachsenzeitlichen Großreiche leiten nach Jaspers eine Zeit der Nivellierung und Repression geistigen Lebens ein. Religiöse Sekten und flache Lebensphilosophien kompensieren den Verlust an politischer Partizipation mit übersteigerten Idealen individueller Unabhängigkeit (apathia, ataraxia). »Die Verwandlung ist überall außerordentlich: Der freie Kampf der Geister scheint still zu stehen. Ein Bewußtseinsverlust ist die Folge […] Es ist, als ob durch Jahrhun derte ein Schlaf der Welt begänne, mit absoluter Autorität der großen Systeme und Einsargungen.«44 Dennoch ist der Geist der Achsenzeit nicht einfach erloschen. Die großen achsenzeitlichen Aufbrüche wurden nach Jaspers vielmehr »Inhalt von Schule und Erziehung (die Han-Dynastie konstituierte den Konfuzianismus, Asoka den Buddhismus, das Augusteische Zeitalter die bewußte hellenisch-römische Bildung).«45 Ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. legitimieren – so Jaspers weiter – die Imperien ihre Herrschaft durch dogmatische Religionen, so dass sich die Kriege in Religionskriege verwandeln.46 K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 183. Jaspers’ Unterscheidung zwi schen Achsenzeit und neuen Großreichen wird von Eisenstadt, der die Achsenzeit in die Epoche von 500 v. Chr. bis zum Aufstieg des Islam verschiebt, übergangen. So revisionsbedürftig die chronologischen Festlegungen von Jaspers’ Geschichtsphiloso phie sind, so scheint mir die Unterscheidung zwischen den achsenzeitlichen Aufbrü chen und den nachachsenzeitlichen Großreichen heuristisch äußerst fruchtbar zu sein. Vgl. dazu S. Pollock, »Axialism and Empire«. 44 K. Jaspers, Ursprung und Ziel der Geschichte, S. 183. 45 Ebd., S. 21. 46 Ebd., S. 65. 43
158
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Inmitten der imperialen Herrschaftsstrukturen entstehen aller dings in Indien, China und dem Abendland neue Schulen und geistige Strömungen. Mehr noch: Im Umkreis der politischen Machtzentren bilden sich institutionelle Räume, in denen wie im spätantiken Alex andria, im Haus der Weisheit in Bagdad oder den Universitäten im lateinischen Christentum, der Streit der Schulen neu entfacht wird. Im Abendland ist der Kampf der Geister in den neuen Groß reichen vor allem durch die Spannungen zwischen griechischer Auf klärung, polytheistischen Mythologien und den monotheistischen Religionen des Vorderen Orients geprägt. Denn die philosophischen Theologien von Xenophanes bis Aristoteles haben die polytheistische Welt der Antike keineswegs beseitigt. Im Gegenteil, die Mythenkritik blieb selbst in Griechenland Sache einer geistigen Elite. Dennoch war die polytheistische Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Auch in der römischen Elite wird unter dem Einfluss der griechischen Philosophie bereits im 3. Jahrhundert v. Chr. der altrömische Poly theismus fraglich.47 Im 1. Jahrhundert v. Chr. stellt sich Cicero in aller Offenheit dem Problem einer philosophischen Prüfung der polytheistischen Mythologien und Kulte des expandierenden Reiches. Im Blick auf die Stabilität des Imperiums scheut Cicero allerdings – trotz seiner Sympathie für Platon und die antike Skepsis – vor einer radikalen Kritik an den polytheistischen Traditionen zurück. Cicero übernimmt zwar die platonische Idee, den Staat in einem philosophischen Monotheismus zu fundieren. Zu diesem Zweck greift Cicero jedoch nicht auf die Idee des Guten, sondern auf den göttlichen Logos des stoischen Naturrechts zurück.48 Cicero setzt sich daher bereits mit dem heiklen Problem auseinander, wie die anderen Schu len ohne offene Repression politisch neutralisiert werden können. Da nur das stoische Naturrecht die Selbstzweckhaftigkeit des Sitten gesetzes bewahrt, fordert Cicero vor allem die epikureische Schule zur politischen Enthaltsamkeit auf.49 Auch in der Frage, welche Mythen für das Volk angemessen sind, grenzt sich Cicero von Platon ab. Statt künstlicher Mythen schlägt Cicero eine philosophische Reinterpreta tion der polytheistischen Kulte vor. In der philosophisch instruierten Kontrolle des religiösen Lebens werden zwar manche Praktiken wie
47 48 49
Vgl. dazu J. Rüpke, Religion in Republican Rome, S. 144–151. Vgl. dazu M. T. Cicero, De legibus I. Vgl. dazu M. T. Cicero, De legibus II, 13,36–13,39.
159
Hans Schelkshorn
z. B. die Verehrung von mythisch personifizierten Lastern verboten.50 Insgesamt bewahrt jedoch Cicero den Grundbestand der römischen Religion, einschließlich die Weissagung durch Vogelschau und andere Zeichen und den Opferkult.51 Mit auffälliger Schärfe wendet sich Cicero hingegen gegen die Einführung neuer Kulte, die nicht von den Vätern übernommen worden sind. So mündet die philosophische Reinterpretation der überlieferten Religion paradoxerweise in eine Verteidigung der Tradition.52 Mit dem Übergang zum Kaisertum setzt in Rom eine Sakrali sierung politischer Herrschaft ein. Zugleich intensiviert sich unter dem Dach des Imperiums der Streit der Schulen. In der Frühzeit des römischen Kaisertums entfaltet sich eine betörende Vielfalt an Lebensphilosophien und religiösen Bewegungen. Auch in Israel führt der achsenzeitliche Durchbruch zu einer Aufspaltung des religiösen Lebens. Aus diesem Grund steht die jesuanische Bewegung in einer Konkurrenz zu anderen religiösen Gruppen, insbesondere zu den Sadduzäern, Pharisäern und Essenern. Die Konstellation zwischen Imperium und dem achsenzeitlichen Kampf der Geister ist allerdings keineswegs konfliktfrei. Im Gegen teil, da die Institution des Gottkönigtums der archaischen Reiche ent zaubert ist, suchen die nachachsenzeitlichen Großreiche nach neuen Legitimationsquellen ihrer imperialen Machtansprüche. In dieser Situation erheben die Imperien immer wieder eine achsenzeitliche Bewegung zum geistigen Fundament des Reiches. In China setzt die Qin-Dynastie vor allem Ideen des Legalismus um; die Han-Dynastie macht hingegen den Konfuzianismus zur Reichsdoktrin. In Indien Ebd. II, 11,38. Die spätantike Abschaffung der Opfer und der Aufstieg der Buch religionen markieren nach G. G. Stroumsa einen epochalen Einschnitt in der Religi onsgeschichte. Stroumsa verlegt daher die Achsenzeit in die Zeit von Jesus bis Mohammed. G. G. Stroumsa, Das Ende des Opferkults, S. 26. Ich sehe hingegen in der Spätantike die realgeschichtliche Durchsetzung der achsenzeitlichen Opferkritik, ins besondere bei Platon und den Propheten Israels. 51 Vgl. dazu M. T. Cicero, De legibus II, 1,32. Allerdings relativiert Cicero zugleich die philosophische Würdigung der Weissagung mit dem Hinweis, dass diese Kunst heute nicht mehr lebendig sei. Ebd. II, 1,33. Auch die Opfer werden nicht verboten, entscheidend ist jedoch die innere Reinheit der Opfernden. Ebd. II, 10,24. 52 Vgl. dazu ebd. II, 10,25 f.: »Wenn man seine eigenen, neue oder fremde, Götter ver ehrt, so bedeutet dies eine Gefährdung ordnungsgemäßer Religionsausübung und ver langt religiöse Zeremonien, die unseren Priestern unbekannt sind. Die von den Vätern übernommenen Götter dürfen nämlich nur dann verehrt werden, wenn auch schon die Väter diesem Gesetz gehorcht haben.« 50
160
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
wiederum greift Ashoka auf den Buddhismus zurück. Das römische Imperium stabilisiert hingegen seine Herrschaft zunächst vor allem durch die Integration fremder Kulte und einen neuen Herrscherkult.53 Dennoch ist auch in Rom durch den Einfluss der hellenistischen Kultur die Wiederkehr einer vorachsenzeitlichen sakralen Monarchie nicht mehr möglich. Der Sakralisierung imperialer Macht stehen daher achsenzeitliche Philosophenschulen als zwar ohnmächtiges, aber kri tisches Korrektiv gegenüber. Manche Kaiser wie Marc Aurel machen sich sogar eine bestimmte Philosophie wie die Stoa persönlich zu eigen. Allerdings erhebt Marc Aurel die Stoa nicht, wie Cicero zumin dest angedacht hatte, zum geistigen Fundament des Reiches. Die fragile religionspolitische Konstellation der frühen Kaiserzeit wird jedoch durch monotheistische religiöse Bewegungen, insbesondere durch das Judentum und das Christentum, radikal in Frage gestellt. Das Christentum ist eine nachachsenzeitliche religiöse Bewe gung, die in besonderer Weise vom Geist der alttestamentlichen Propheten inspiriert ist. Mit der Ausbreitung in den Mittelmeerraum stößt das Christentum auf die Reflexionskultur der griechischen Philosophie. Obwohl in hellenistisch-römischer Zeit die Grenzen zwischen Philosophie und Religion fließend sind, wird bereits in früher Zeit die skizzierte Asymmetrie der Reflexionsebenen zwischen den griechischen und altisraelitischen Durchbrüchen zur Achsenzeit virulent. Das Christentum lässt sich zwar auf die griechische Philoso phie ein. Seit Clemens von Alexandrien reinterpretiert sich das Chris tentum auch im Medium der Selbstreflexion menschlicher Vernunft, genauer durch eine erkenntnisphilosophische Differenzierung zwi schen Gnosis und Pistis.54 Zugleich bringen jedoch die Kirchenväter den Offenbarungsanspruch biblischer Schriften gegen die griechische Philosophie zur Geltung. Justin und seine Nachfolger präsentieren das Christentum zwar als »wahre Philosophie«, ersticken jedoch zugleich mit der Berufung auf eine göttliche Offenbarung den sokra tischen Geist der Wahrheitssuche. »Wir indes bedürfen seit Jesus Christus des Forschens nicht mehr, auch nicht des Untersuchens, seitdem das Evangelium verkündet wurde.«55 Clemens von Alexan drien nennt die Philosophie Christi in aller Offenheit die »Herrin
53 54 55
Vgl. dazu H. Cancik, Die Praxis der Herrscherverehrung. Vgl. dazu L. Honnefelder, Woher kommen wir?, S. 29–32. Tertullian, De praescriptione haereticorum, 7,9–13.
161
Hans Schelkshorn
der Philosophie«56. Die ersten Kritiker des Christentums (Celsus, Porphyrios) weisen daher den »vernunftlosen Glauben (alogos pistis)« der Christen zurück.57 Allerdings setzen sie zugleich Ciceros Strate gie einer philosophischen Rehabilitierung der überlieferten Religion fort. In diesem Kontext bildet sich eine komplexe religionsphiloso phische Konstellation: Hellenistisch-römische Philosophien werfen den Christen die Einführung neuer Götter vor. Christliche Autoren hingegen fordern die Toleranz, die das Reich fremden polytheistischen Kulten gewährt, auch für den eigenen Glauben.58 Mehr noch: Im Bann von Ciceros Verteidigung der Religion der Väter entsteht zwischen hellenistisch-römischen Philosophen und Christen ein Disput über die Frage des Alters der je eigenen Tradition, konkret ob Platon von Mose oder Mose von Platon abhängig sei und welches Denken die Urphilosophie der frühen Menschheit unverfälscht bewahrt habe.59 Die Suche nach einer achsenzeitlichen Legitimation des Imperi ums spitzt sich am Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. in der Alternative zwischen einem philosophisch reinterpretierten Polytheismus und dem Christentum zu. Nach Konstantin versucht Julian Apostata noch einmal die philosophisch fundierte Religion der Väter zu installie ren. Warum sich in der Spätantike zuletzt das Christentum durchge setzt hat, ist bis heute Gegenstand zahlreicher Spekulationen. Zwei Aspekte dürften den Aufstieg des Christentums zur Reichsreligion zumindest begünstigt haben. Im Unterschied zum Polytheismus, der trotz aller Rückbindungen an einen philosophischen Henotheismus seine Lebendigkeit letztlich aus lokalen Kulten bezieht, enthält das Christentum eine originär universalistische Orientierung, die dem imperialen Anspruch auf Weltherrschaft zumindest extensional kor reliert.60 Darüber hinaus erfasst das Christentum im Unterschied zu den elitären Philosophenschulen alle gesellschaftlichen Gruppen. Das Christentum bildete allerdings von Anfang an ein fragiles Fundament für das römische Imperium. Denn wie jede achsenzeitli che Bewegung so spaltet sich auch das Christentum bereits in früher Zeit in verschiedene Strömungen auf, ein Prozess, der die Einheit des Reiches immer wieder bedroht. Darüber hinaus bleibt in den christ Clemens von Alexandrien, Teppiche/Stromateis I, 30,1. Vgl. dazu W. Schröder, Athen und Jerusalem, S. 88–103; M. Fiedrowicz, Apologie im frühen Christentum, S. 298–301. 58 Vgl. dazu Tertullian, Apologeticum, 24,5–6. 59 Vgl. dazu M. Fiedrowicz, Apologie im frühen Christentum, S. 212–219. 60 Dies ist die These von G. Fowden, Empire to Commonwealth, S. 37–60.76–93. 56 57
162
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
lichen Theologien die neutestamentliche Kritik an imperialer Macht präsent. So legt Eusebius zwar den Grundstein für eine Reichstheolo gie, auf der über ein Jahrtausend lang die christlichen Reiche aufbauen werden; ein Jahrhundert später entwickelt jedoch Augustinus in De civitate Dei eine radikale Kritik an irdischer Herrschaft, in der das römische Reich mit einer Räuberbande verglichen wird. Wie immer das Verhältnis zwischen Imperium und christlicher Gemeinde näher bestimmt wird, seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. erweitert sich die christliche Theologie zu einer politischen Theologie, in der die Möglichkeiten, Platons Fundierung der Polis in einem phi losophischen Monotheismus auf das römische Reich zu übertragen, kritisch diskutiert werden. An dieser Stelle eröffnet sich – worauf hier bloß hingewiesen werden kann – die Möglichkeit für eine geschichtsphilosophische Verortung des Islam, der auf der arabischen Halbinsel den achsenzeit lichen Übergang von der Stammesmoral zu einem individualistisch und zugleich universalistisch orientierten Monotheismus befördert.61 Da das Wirken von Mohammed in die Epoche der nachachsenzeitli chen Großreiche fällt, ist die Genese des Islam von vornherein mit der Reichsbildung verwoben. Dies bedeutet nicht, dass im Islam Religion und Politik nicht differenziert werden. Auch in den islamischen Reichen ist wie in den anderen nachachsenzeitlichen Großreichen des Abendlandes, einschließlich des Iran, die Religion nicht nur Legitima tionsgrund, sondern zugleich kritisches Korrektiv imperialer Macht. Byzanz, das lateinische Christentum und die islamischen Reiche sind daher Varianten eines imperialen Monotheismus, die trotz aller Dif ferenzen letztlich demselben Modell politischer Herrschaft folgen.62 Kurz: Der Islam bewegt sich gleichsam von Anfang an auf der Ebene der von Eusebius grundgelegten christlichen Reichstheologie.63 Christentum und Islam leiten ihre Autorität jeweils aus dem Offenbarungsanspruch sakraler Schriften her, ein Anspruch, der, wie erwähnt, in der griechischen Aufklärung bereits fundamental in Frage gestellt worden ist. Aus diesem Grund bricht in den christlichen und islamischen Theologien immer wieder der Konflikt zwischen Ver 61 Zur Debatte über »Islam und Achsenzeit« vgl. die Beiträge J.A. Arnason, S. Armando S., G. Stauth, Islam in Process. 62 Dies ist die These von A. Höbert, Kaisertum und Kalifat. 63 Dies bedeutet selbstverständlich nicht, dass der Islam für immer auf einen impe rialen Monotheismus festgelegt ist. Denn achsenzeitliche Religionen bilden ihre Traditionen durch je neue, auch kontroverse Reinterpretationen aus.
163
Hans Schelkshorn
nunft und Offenbarung auf, ein Konflikt, der im Kontext der religiös fundierten Imperien unumgänglich zum Nährboden für politische Kämpfe wird. In den unterschiedlichen Wegen einer Selbstaufklärung greifen die monotheistischen Theologien jeweils das gesamte Spektrum der philosophischen Theologien des griechischen Denkens auf. Augusti nus orientiert sich vor allem an Platon, Dionysius Areopagita begrün det die Tradition eines christlichen Neuplatonismus; Thomas von Aquin ist hingegen maßgeblich von Aristoteles geprägt. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der islamischen Theologie. In der heiklen Frage des Offenbarungsanspruchs können in den christlichen und islamischen Theologien zwei grundlegende Strategien unterschieden werden, einerseits Abgrenzungen zwischen Philosophie und Offenbarungsreligion, andererseits Versuche einer Aufhebung der Offenbarung durch die Philosophie. In der christlichen Theologie versucht Thomas von Aquin den Konflikt zwischen Vernunft und Offenbarung durch eine vermittelnde Position zu entschärfen. Die christliche Theologie ergänzt die natür liche Gotteserkenntnis durch Inhalte, die allein durch die Offenba rung zugänglich sind, insbesondere die Lehren über die Trinität, die Inkarnation und die leibliche Auferstehung der Toten. Der Ver mittlungsversuch von Thomas von Aquin ist allerdings bereits im Spätmittelalter zugunsten der Vernunft aufgelöst. Nikolaus von Kues reinterpretiert sämtliche Gehalte des Christentums im Rahmen einer negativen Philosophie des Absoluten.64 Die islamische Philosophie hebt bereits in früher Zeit die gött liche Offenbarung durch die Philosophie auf. Der Kern des Islam, nämlich der Monotheismus, ist, wie al-Farabi und Averroes mit Blick auf Platon erläutern, philosophisch einsehbar. Da Philosophie stets Sache einer geistigen Elite bleibt, braucht es nach al-Farabi den Koran, um dem Volk den Monotheismus in narrativer Weise zu vermitteln. Der Koran ist für al-Farabi das Substitut für die künstlichen Mythen, die Platon in der Politeia für die unteren Stände vorgesehen hatte.65 Averroes warnt sogar davor, die philosophisch-theologischen Debat ten über den Islam ins Volk zu tragen.66 Philosophische Aufhebungen der Religion lösen sowohl im Islam als auch im Christentum immer wieder heftige Gegenreaktio 64 65 66
Vgl. dazu K. Flasch, Philosophie hat Geschichte, S. 115–121. N. German, »Natural and Revealed Religion«, S. 351 f. F. Schupp, »Einleitung«, LXXXIV f.
164
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
nen aus, einerseits dogmatische Bekräftigungen der göttlichen Offen barung, die den Streit der Interpretationen still zu stellen versuchen, andererseits eine inhaltliche Kritik an den philosophischen Auslegun gen religiöser Gehalte. Die erste Reaktion ist, so geschichtswirksam sie bis heute ist, sachlich inkonsistent. Denn die autoritäre Bekräfti gung des Offenbarungsanspruchs kann eine bereits aufgebrochene Fraglichkeit nicht mehr ungeschehen machen. Die zweite Reaktion ist hingegen legitim. Denn jede philosophische Reinterpretation erschließt und verliert zugleich Inhalte der jeweiligen Religion, ein Umstand, der wiederum neue Auslegungen provoziert. Die spezifische Dialektik philosophischer Reinterpretationen religiöser Traditionen zeigt sich an einigen prominenten Gestalten der islamischen und christlichen Theologie. Al-Ghazali stellt sich zunächst auf den Standpunkt der Vernunft und kritisiert das Prinzip der Nachahmung, d. h. der kritiklosen Übernahme der jeweiligen religiösen Sozialisation. Zugleich wendet sich al-Ghazali gegen die Übernahme bestimmter philosophischer Inhalte, wie z. B. die aristo telische These von der Ewigkeit der Welt, die im Widerspruch zur Schöpfungslehre des Koran steht. In einem dritten Schritt verteidigt al-Ghazali die Offenbarung des Propheten Muhammad. Doch im Gegensatz zu orthodoxen Kreisen ist sich al-Ghazali der Irreversibi lität von Fraglichkeiten voll bewusst. So vergleicht al-Ghazali eine einmal aufgebrochene Fraglichkeit mit einem zerbrochenen Glas, das sich nicht mehr zusammensetzen lässt. »Seine Splitter kann man« – so al-Ghazali – »nicht durch Zusammensammeln und Umwickeln wieder zusammenleimen, sondern sie allein durch Feuer schmelzen und in eine neue Form gießen.«67 Als Schmelztiegel für die Umfor mung des Islam dient al-Ghazali die Mystik des Sufismus. Darüber hinaus sieht sich jedoch al-Ghazali zu einer Rechtfertigung des Offenbarungsanspruchs des Propheten genötigt.68 Auf diese Weise wird jedoch der Offenbarungsanspruch de facto von menschlichen Rechtfertigungen abhängig, eine Einsicht, die al-Ghazali abblendet. Eine ähnliche Konstellation zeigt sich im christlichen Denken. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Augustinus korrigiert gleichsam in sich selbst problematische Assimilationen seiner frühen Theologie an den Platonismus, in denen zentrale Gehalte wie die paulinische Dia lektik von Sünde und Gnade marginalisiert worden sind. In der mittel 67 68
al-Ghazali, Der Erretter, S. 12. Vgl. dazu ebd., S. 50–55.
165
Hans Schelkshorn
alterlichen Theologie verteidigt hingegen Duns Scotus das christliche Liebesethos gegenüber einem christlichen Aristotelismus, in dem an der Theoria als höchstem Existenzideal festgehalten werde.69 Wie alGhazali entwickelt auch Duns Scotus eine eigene Rechtfertigung des Offenbarungsanspruchs der Bibel.70 Die theologische Zurückweisung bestimmter Inhalte der Phi losophie mündet zuweilen in eine Polemik gegen Philosophie als solcher. Die pauschale Absage an die Vernunft verstrickt sich jedoch in einen Selbstwiderspruch. Denn Christentum und Islam sind als nachachsenzeitliche Religionen konstitutiv mit Reflexionsprozessen verbunden. Augustinus trägt den spätantiken Streit der Schulen gleichsam in seiner eigenen Biographie aus. Auch al-Ghazali setzt sich intensiv mit den philosophischen und theologischen Schulen seiner Zeit auseinander. Angesichts der Uneindeutigkeit religiöser Überlieferungen sind auch christliche bzw. islamische Theologien wie Sokrates unentrinnbar auf die menschliche Vernunft zurückgeworfen. Aus diesem Grund bewegt sich jede offenbarungstheologische Kritik an der Philosophie als solcher bereits im Medium der Philosophie.
3. Moderne als Zweite Achsenzeit – ein Ausblick Die Moderne entsteht – dies ist meine These – aus der Erosion nachachsenzeitlicher Großreiche. Dieser Prozess setzt zunächst im lateinischen Christentum ein, in dem der Aufbau eines nachachsen zeitlichen Großreichs stets prekär blieb. »Im Gegensatz zu reinen Imperien wie China oder Byzanz bildete sich in Europa« – so Shmuel N. Eisenstadt – »eine Vielzahl von Zentren und Kollektiven, und das Einwirken der Peripherie und der Unterzentren auf ihr Zentrum war hier stärker als dort.«71 In dem zerklüfteten Machtgefüge des lateinischen Christentums, in dem der Kaiser bloß ein Machtzentrum neben rivalisierenden Monarchen und dem Papst bildet, entstehen seit dem 16. Jahrhundert selbständige Territorialstaaten, die nach den religiös motivierten Bürgerkriegen das Modell nachachsenzeitlicher Großreiche hinter sich lassen. 69 70 71
Vgl. dazu O. Boulnois, Duns Scotus, S. 19 f. Ebd., S. 63–67. Vgl. dazu S. N. Eisenstadt, Die Vielfalt der Moderne, S. 40.
166
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Im Zuge der Urbanisierung seit dem 13. Jahrhundert bricht im lateinischen Christentum ein neuer Kampf der Geister auf, der einerseits durch christliche Reformbewegungen,72 andererseits durch die Renaissancekultur entfacht wird, die das gesamte Spektrum anti ker Schulen, einschließlich der materialistischen und skeptischen Denkformen, wieder zugänglich macht. Mit der Gründung von Uni versitäten erhält der Streit der philosophischen und theologischen Schulen auch eine institutionelle Basis. Die mittelalterlichen Reform bewegungen und die Innovationen der Renaissancephilosophie ebnen den Weg für die moderne Wissenschaft und die Reformation, die das Tor zu einer neuen Zeit aufstoßen. Nicht zuletzt sprengt die transozeanische Expansion der iberischen Mächte im 15. und 16. Jahrhundert den politischen und auch den geistigen Horizont des Abendlandes irreversibel auf. Mit der Entdeckung Amerikas und der Öffnung nach Ostasien ist Europa mit bislang unbekannten Kulturen konfrontiert. So mischen sich in den abendländischen Streit der Schulen immer öfter außereuropäische Stimmen, angefangen von den ersten Religionsgesprächen mit aztekischen Weisen bis zur Auseinandersetzung mit den Traditionen Indiens nach der Entde ckung der Sanskritliteratur im 19. Jahrhundert. Da die Auflösung der Idee eines nachachsenzeitlichen Großreiches einen entfesselten und zugleich global erweiterten Streit der Schulen auslöst, bezeichne ich die Moderne als eine Zweite Achsenzeit.73 In der Moderne kommt es zwar zu dramatischen Entsakralisie rungsprozessen, die im 20. Jahrhundert zum Stoff unterschiedlicher Säkularisierungstheorien werden. Dennoch bricht in der Moderne nicht einfach ein atheistisches Zeitalter an. Neben dem Atheismus, der erst im 19. Jahrhundert zu einem Massenphänomen wird, vollzie hen auch die religiösen Traditionen in Europa einen tiefgreifenden Strukturwandel, in dem die Beziehungen zwischen Religion, Vernunft und Politik neu bestimmt werden, eine Entwicklung, die hier nicht mehr ausführlich behandelt werden kann.74 Im Licht der Skizzen zur Achsenzeit und den nachachsenzeitlichen Reichen möchte ich abschließend jedoch zumindest einige religionsphilosophische Kon Vgl. dazu C. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 51–378 (Teil I. Reformwerk). Vgl. dazu H. Schelkshorn, »Anbruch einer Zweiten Achsenzeit. Zur Genese der Moderne«. 74 Zur Deutung der Renaissance und der Reformationszeit im Kontext unterschied licher Modernetheorien vgl. H. Schelkshorn, »Anbruch einer Zweiten Achsenzeit. Renaissance-Humanismus und ›christliche Reform‹“. 72
73
167
Hans Schelkshorn
stellationen zwischen Vernunft, Religion und Politik in der Moderne grob umreißen.
a) Entsakralisierung politischer Macht In der Moderne kommt es zu einem epochalen Rückbau der Resa kralisierungen politischer Macht durch die nachachsenzeitlichen Imperien, ein Prozess, der in der Französischen Revolution einen realgeschichtlichen und auch symbolträchtigen Höhepunkt erreicht. Die neuzeitliche Entsakralisierung der Politik fällt allerdings nicht einfach vom Himmel, sondern kann sich sowohl auf die politische Philosophie der Antike als auch auf die herrschaftskritischen Stränge der Bibel stützen. Bereits im späten Mittelalter unterminiert das Vernunftprinzip der griechischen Philosophie, in der seit der Sophistik Politik bereits vollständig entsakralisiert war, die christlich verbrämten Herrschafts ideologien. In den oberitalienischen Stadtstaaten, die strukturell den antiken Poleis nahe stehen, erwacht die aristotelische Idee einer repu blikanischen Selbstregierung zu neuem Leben. Wilhelm von Ockham und Marsilius von Padua eröffnen der Autonomie politischer Ver nunft durch eine Selbstbegrenzung der Theologie neue Freiräume.75 Mit Machiavelli kehrt sogar die von der Sophistik angedachte Gestalt einer entmoralisierten politischen Vernunft wieder. Trotz aller aufklärerischen Tendenzen und der chronischen Schwäche des Kaisers gegenüber rivalisierenden Mächten, einschließ lich des Papstes, bleibt jedoch im lateinischen Christentum die Idee eines christlichen Reiches weiterhin aufrecht. Mehr noch: Im 15. und 16. Jahrhundert explodieren im lateinischen Christentum gera dezu die Gewaltpotentiale des imperialen Monotheismus, und zwar innerhalb und außerhalb Europas. Mit der Eroberung der amerindischen Reiche führt Spanien die Idee eines christlichen Weltreichs zu einem zuvor noch ungeahnten Höhepunkt. Denn im Unterschied zum antiken Rom, das bloß eine Hegemonie in der Ökumene innehatte, strebt das spanische Impe rium nicht weniger als die Erdherrschaft an.76 Unter dem Schock der Gewaltexzesse gegenüber den Völkern Amerikas bricht jedoch im 75 76
Zu Marsilius von Padua vgl. B. Bayona Aznar, Religión y poder. Vgl. dazu F. Bosbach, Monarchia Universalis, S. 45–63.
168
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Inneren des neuen Machtzentrums zugleich eine radikale Kritik an der Idee der Weltherrschaft auf. Francisco de Vitoria, das geistige Haupt der Schule von Salamanca, destruiert in radikaler Weise die Herr schaftsansprüche der universalpolitischen Mächte des Abendlandes. Die Schule von Salamanca überwindet daher die Reichstheologie, die seit Konstantin die Legitimationsbasis für die nachachsenzeitlichen christlichen Imperien bildete. Mehr noch: Francisco de Vitoria legt zugleich den Grundstein für eine Theorie des Völkerrechts, die eine spektakuläre Innovation gegenüber der griechischen Aufklärung dar stellt. Denn die politische Philosophie von Platon und Aristoteles blieb auf den engen Horizont der Polis beschränkt; die Stoa nahm hingegen das römische Weltreich weithin kritiklos hin.77 Die Gewalt des imperialen Monotheismus eskaliert im 16. Jahr hundert nicht bloß in den kolonialen Peripherien, sondern auch in den Kernzonen des lateinischen Christentums. So wie der achsenzeitliche Kampf der Geister nach Jaspers in die soziale Anarchie geführt hat, so befördert auch die frühneuzeitliche Entfesselung des Streits der Schu len eine Orgie der Gewalt, die große Teile Europas verwüsten. Die religiös motivierten Bürgerkriege werden einerseits durch das poly zentrische Machtgefüge des lateinischen Christentums, andererseits durch die Aporien der Legitimationsstruktur nachachsenzeitlicher Großreiche entfacht. Da auch die rivalisierenden Territorialstaaten ihre Herrschaft jeweils auf eine achsenzeitliche Bewegung stützen, führen die religiösen Spaltungen der Reformationszeit unmittelbar zu innerstaatlichen Konflikten. Die Lutherische Reformation setzt zwar die frühneuzeitliche Entsakralisierung politischer Macht durch die Zwei-Reiche-Lehre fort. Darüber hinaus verabschieden die Reforma toren – wie die Schule von Salamanca – die christliche Reichstheolo gie. Mit dem Prinzip des Augsburger Religionsfriedens »cuius regio, eius religio« bleiben jedoch sowohl die Reformatoren als auch die Katholiken noch dem imperialen Modell der Herrschaftslegitimation, das bloß auf die entstehenden Territorialstaaten übertragen wird, verhaftet. Die Durchsetzung konfessionell reiner Staaten führt daher in Europa zu Bürgerkriegen und Vertreibungen ganzer Bevölkerungs gruppen. Dies bedeutet: Die innerchristliche Entsakralisierung politischer Macht blieb letztlich auf halbem Wege stehen. Da der Wahrheitsan spruch des Christentums weithin noch unhinterfragt blieb, konnten 77
Zum Folgenden vgl. H. Schelkshorn, Entgrenzungen, S. 205–298.
169
Hans Schelkshorn
die christlichen Staaten weder in den Kolonien noch im Inneren die Logik der Gewalt wirksam eindämmen. Trotz der spektakulären Inter ventionen von Las Casas und Erasmus für religiöse Toleranz blieben sowohl ungläubige Barbaren als auch Häretiker weiterhin religiös sanktionierter Gewalt ausgesetzt. Aus diesem Grund werden in der frühen Neuzeit die religiösen Legitimationsquellen politischer Macht erst durch die materialistische Philosophie ausgetrocknet. Thomas Hobbes befreit den Staat von aller Heilssorge und beschränkt seine Aufgabe rigoros auf die Sicherung des irdischen Friedens.78 In der frühen Neuzeit bricht noch eine weitere Säule des impe rialen Monotheismus weg, nämlich die auf Platon zurückgehende Hierarchie zwischen der geistigen Elite und dem Volk, das auf nar rative Vermittlungen der normativen Grundlagen der Gesellschaft angewiesen ist. Die frühchristlichen Gemeinden hatten zwar bereits die Schranken sozialer und auch geistiger Hierarchien partiell außer Kraft gesetzt. In den Rechtfertigungen des imperialen Monotheismus folgen jedoch, wie erwähnt, sowohl christliche als auch islamische Theologien jeweils Platons Idee einer Herrschaft der Wissenden. So leitet erst der Buchdruck, der eine Literalisierung breiter Bevölke rungsschichten ermöglicht, die realgeschichtliche Überwindung des platonischen Modells einer geistigen bzw. religiösen Aristokratie ein, eine Entwicklung, die sowohl in theologischen als auch philoso phischen Diskursen der frühen Neuzeit ihren Niederschlag findet. Während die Reformatoren mit dem biblischen Motiv des allgemei nen Priestertums der Laien die egalitären Tendenzen des frühen Christentums erneut zur Geltung bringen, baut Hobbes die politi sche Philosophie auf dem kontraktualistischen Prinzip der Gleichheit auf. Die Legitimation staatlicher Ordnung gründet nach Hobbes in einem fiktiven Gesellschaftsvertrag zwischen allen Bürgern. Der Hobbessche Staat ist – von der sakralen Aura entkleidet – daher ein »sterblicher Gott«, dessen Autorität sich restlos der vertraglichen Selbstbindung der Bürger verdankt.
78
Vgl. dazu ebd., S. 490–496.
170
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
b) Die Wiederkehr achsenzeitlicher Religionsphilosophien und der Streit über die Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates In der frühen Neuzeit verschieben sich zwar – wie der Blick auf die politische Philosophie zeigt – die Gewichte zwischen den ach senzeitlichen Bewegungen. Während in der Antike religiöse und metaphysische Strömungen dominieren, treten in der Neuzeit seit dem 17. Jahrhundert materialistische und radikal skeptische Denk formen ins Zentrum intellektueller Debatten. Auch wenn seit dem 19. Jahrhundert der Atheismus zu einem Massenphänomen wird, bricht mit der Moderne nicht einfach ein Zeitalter des Atheismus an. Denn die Fragen nach der Stellung des Menschen im Kosmos, die Religion und Metaphysik seit jeher zugrunde lagen, sind auch in der Moderne nicht einfach erledigt. Da die letzten Sinnfragen des Menschen die Kompetenzen moderner Wissenschaft übersteigen, ist die Moderne – so Max Webers berühmte Diagnose – durch einen Polytheismus der Werte geprägt.79 Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass in der Moderne neben atheistischen und agnostischen Strömungen auch die religionsphilosophischen Paradig men der Achsenzeit in neuen Varianten, Modifikationen und auch Kombinationen wiederkehren. Das aristotelische Paradigma, das Gott als Letztbegründung einer teleologischen Naturphilosophie ins Spiel bringt, gerät zwar mit dem Aufstieg der modernen Wissenschaften unter enormen Druck. Im mechanistischen Weltbild der frühen Neuzeit überlebt Gott zunächst im Refugium einer deistischen Theologie, das im 19. Jahrhundert zu einem bevorzugten Objekt der Religionskritik wird. Allerdings bleibt auch nach dem Abschied vom Lückenbüßergott die aristotelische Frage nach dem Ursprung der Intelligibilität des Universums und der menschlichen Vernunft, wie Einsteins Konzept einer kosmischen Religion80 zeigt, auch im Kontext der modernen Astronomie virulent. Das platonische Paradigma ist mit dem Niedergang der achsen zeitlichen Großreiche in seinen Grundfesten diskreditiert. Die politi sche Philosophie der Neuzeit begründet die politische Ordnung nicht mehr in einem philosophischen oder religiösen Monotheismus. Im 79 80
M. Weber, »Der Sinn der ›Wertfreiheit‹«, 271 ff. A. Einstein, Cosmic Religion.
171
Hans Schelkshorn
Gegenteil, mit dem komplizierten Konstrukt eines menschenrechts basierten demokratischen Rechtsstaates gelingt der neuzeitlichen Philosophie Europas eine epochal bedeutsame Innovation. Der Streit der Schulen, der sowohl in der Achsenzeit als auch in der frühen Neuzeit ganze Weltregionen in die soziale Anarchie getrieben hat, erhält im demokratischen Rechtsstaat, genauer in den Foren öffentli cher Debatten, einen breiten und zugleich eingehegten Raum. Der Kampf der Geister ist nicht mehr unmittelbar Nährboden für die Delegitimation der politischen Ordnung. Dennoch ist das Gewaltpotential des Streits der Schulen auch in der Moderne nicht einfach neutralisiert. Einerseits kehrt das Modell, den Staat auf eine achsenzeitliche Bewegung zu gründen, auch in der Moderne in zahlreichen Varianten wieder, und zwar sowohl in religiöser als auch atheistischer Form. Vom Absolutismus über den Konservativismus des 19. Jahrhunderts bis zum katholischen Faschis mus findet das Modell eines religiös fundierten Staates immer wieder neue Fortsetzungen. Angesichts der wachsenden Macht aufkläreri scher Kräfte muss allerdings jede neue Welle einer Resakralisierung politischer Macht auf immer stärkere Mittel der Repression zurück greifen. Seit dem 19. Jahrhundert entstehen mit dem Positivismus und Marxismus Ideologien, in denen nun umgekehrt der Atheismus zur Staatsdoktrin erhoben wird. Andererseits verlagert sich in der Moderne der Kampf der Geister auf den Streit über die normativen Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates. Atheistische Philosophien eliminieren zwar mit einem Streich sämtliche Modelle theokratischer Herrschaft; aus den natura listischen Ontologien lässt sich jedoch nicht per se die anspruchsvolle normative Textur der modernen Grund- und Freiheitsrechte herlei ten. Im Gegenteil, manche Strömungen materialistischen Denkens stellen wie Nietzsche selbst die Grundnormen der Moral in Frage. An dieser Stelle kehrt in der politischen Philosophie der Neuzeit Ciceros Problem, nämlich wie eine moralisch gehaltvolle Begründung der politischen Ordnung ohne Repression gegenüber alternativen Schulen möglich ist, in neuer Form wieder. Cicero sah im stoischen Naturrecht das normative Fundament des Römischen Reiches. Auch in der Moderne lösen die relativistischen Tendenzen materialisti scher Philosophien Reflexionen über die Unbedingtheit moralischer Ansprüche aus, eine Dialektik, die gewisse Parallelen zum achsen zeitlichen Streit zwischen Sophistik, Sokrates und Platon aufweist. In diesem Kontext hat vor allem Kant das sokratische Modell einer
172
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
systematischen Verknüpfung von Moral und Religion in der Moderne erneuert. Wie Sokrates so sieht auch Kant den Menschen angesichts der Vieldeutigkeit des »göttlichen Willens« auf die endliche Vernunft zurückgeworfen. »Daher ist auch nöthig, daß man den Willen Gottes nicht zum Princip der Vernunftmoral macht; denn auf solche Art bin ich freilich unsicher, was Gott mit der Welt vorhabe.«81 Wie Sokrates versucht auch Kant den »Dissens der Götter« durch einen Rekurs auf die Unbedingtheit der Moral zu überwinden. Das transzendentalphi losophisch begründete Sittengesetz dient Kant zugleich als Maßstab für philosophische Reinterpretationen religiöser Traditionen. Die sokratische Skepsis ist, wie gezeigt, in der Achsenzeit von Platon und vor allem Plotin in eine Philosophie des Absoluten überführt worden. In analoger Form überbietet in der Neuzeit der Deutsche Idealismus die Kantsche Ethik durch ein Denken des Abso luten, in dem zwei Säulen neuzeitlichen Denkens, nämlich Freiheit und Geschichtlichkeit, integriert werden. Im frühen 19. Jahrhundert verschärft sich allerdings das Problem der Auslegung des unerkenn baren Einen. Vor allem Hegels Versuch, Plotins negative Theologie in eine positive Philosophie des Absoluten zu überführen, provoziert im 19. Jahrhundert eine neue Welle der Religionskritik. Bereits Feu erbach entlarvt Hegels geistphilosophische Deutung des Absoluten als Projektion des menschlichen Geistes. Nietzsche wendet in der Fabel vom tollen Menschen Elijas Verspottung der Baalspriester auf das platonische Christentum an.82 Mit der Konzeption eines leiblich verfassten Subjekts leiten Feuerbach und Nietzsche zugleich den Prozess der De-transzendentalisierung des Kantschen Subjekts ein. Die Religionskritik vom Positivismus über Marx bis hin zu Nietzsche destruiert nicht nur religiös-metaphysische Sinnhorizonte, sondern auch die aufklärerische Idee eines rationalen Subjekts. Universale Geltungsansprüche auf Wahrheit und moralische Richtigkeit werden den Imperativen der Selbstbehauptung biologischer Organismen bzw. des Willens zur Macht untergeordet. 81 I. Kant, AA 28, S. 1116. In ähnlicher Weise begründet auch John Stuart Mill den Primat der Vernunft in der Ethik. Nach Mill ist die Vernunftautonomie in der Offen barung, genauer in der Lehre, dass der Mensch vom Geist erfüllt sei, selbst enthalten. Daher ist der Mensch dazu befähigt, »für sich selbst herauszufinden, was das Rechte ist«. Für diese Aufgabe bedürfen wir jedoch nach Mill »einer sorgfältig durchgeführten ethischen Theorie … um den Willen Gottes zu deuten.« J. S. Mill, Utilitarismus, S. 38 (Hvh. von J. S. Mill). 82 Vgl. dazu H. Schelkshorn, Wahrheitsregime und die Verschiebung sakraler Kerne, S. 258.265.
173
Hans Schelkshorn
So geschichtswirksam die atheistischen Strömungen des 19. Jahrhunderts sind, so wenig besiegeln sie das Ende der Religion. Vielmehr konstituiert sich im späten 19. Jahrhundert von Kierke gaard über William James und Henri Bergson eine neue Welle von Religionsphilosophien, die sich an den Fraglichkeiten, die vor allem durch den Historismus und die Evolutionstheorie aufgebrochen sind, abarbeiten. In diesem Sinn entwickeln Henri Bergson und Georg Simmel neue Begründungen von Metaphysik und Religion. Auch der Neukantianismus und Husserl setzen in ihren transzendentalphiloso phischen Ansätzen Kants religionsphilosophische Perspektiven unter neuen Bedingungen fort. Da seit dem Historismus heilige Schriften definitiv entsakrali siert sind, können religiöse Traditionen nur mehr im Medium philo sophischer Selbstreflexion artikuliert werden. Dies ist keineswegs, wie jüdische, christliche, aber auch neohinduistische Religionsphilo sophien des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll bezeugen, eine Anomalie des europäischen Säkularismus. So verteidigte z. B. Mahatma Gandhi den Primat der Vernunft gegenüber einem dogmatischen Offenba rungsbegriff in unmissverständlicher Weise: Ich fälle mein Urteil über jede Schrift, einschließlich der Gita. Kein geschriebener Text kann an die Stelle meiner Vernunft treten. Auch wenn ich die bedeutendsten Bücher als Offenbarungen anerkenne, so weiß ich doch, dass sie unter dem Vorgang doppelter Destillierung leiden. Als erstes werden sie durch einen menschlichen Propheten übermittelt und dann von Exegeten kommentiert. Nichts kommt direkt von Gott.83
Umgekehrt ist im 20. Jahrhundert auch ein dogmatischer Atheismus in die Krise geraten. Nach dem Ersten Weltkrieg, in dem der Glaube an säkularistische Fortschrittstheorien irreversibel erschüttert worden ist, werden sowohl im Neomarxismus als auch in der Existenzphilo sophie agnostische Tendenzen mächtig. In dieser Perspektive hielt Jean-Paul Sartre in seinem Nachruf auf André Gide unmissverständ lich fest: Ich kann mir nicht vorstellen, daß heute ein einziger Gläubiger durch die Argumente des heiligen Bonaventura oder des heiligen Anselm zum Christentum geführt worden wäre; aber ich denke ebenso wenig, daß ein einziger Ungläubiger durch die entgegengesetzten Argumente 83
M. Gandhi, Was ist Hinduismus?, S. 46.
174
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
vom Glauben abgebracht worden wäre. Das Gottesproblem ist ein Menschenproblem, das die Beziehungen der Menschen untereinan der betrifft, es ist ein totales Problem, dem jeder durch sein ganzes Leben eine Lösung gibt, und die Lösung, die er ihm gibt, spiegelt die Haltung, die man den anderen Menschen und sich selbst gegenüber gewählt hat.84
Schlussbemerkung Angesichts der nihilistischen Strömungen der späten Moderne hoffte Jaspers auf eine zweite Achsenzeit, in der analog zu Sokrates, Jesus und Buddha neue spirituelle Meister auftauchen. Diese Hoffnung war wohl zu überschwänglich. Mit und zugleich gegen Jaspers deute ich daher die Moderne selbst als Zweite Achsenzeit. In der Moderne ist zwar der atheistische Materialismus im Streit der Schulen dominant geworden, dennoch bleiben religiöse Traditionen in neuen Transformationen präsent. Die Zerspaltung des Geistigen, die in der Achsenzeit einsetzt, unterminiert in der Moderne auch die Festungs mauern religiöser und atheistischer Strömungen. Aus diesem Grund stehen sich im 20. Jahrhundert, wie die Beratungen im Umkreis der UN-Deklaration der Menschenrechte anschaulich zeigen, sowohl in religiösen als auch in säkularen Welten jeweils demokratisch und autoritär orientierte Gruppen gegenüber. Denn die Deklaration der allgemeinen Menschenrechte, die sich gegen den Totalitarismus athe istischer und religiös-faschistischer Systeme wandte, ist zugleich von atheistischen und religiös orientierten Denker_innen aus verschiede nen Weltregionen entworfen worden.
Literaturverzeichnis al-Ghazali, Der Erretter aus dem Irrtum, Hamburg: Meiner 1988 Arnason, J. P., »The Axial Age and its Interpreters. Reopening a Debate«, in: ders., S. N. Eisenstadt, B. Wittrock (Hg.), Axial Civilizations and World His tory, Leiden, Boston: Brill 2005, S. 19–49 —, Armando S., Stauth G. (Hg.), Islam in Process – Historical and Civilizational Perspectives (Yearbook of the Sociology of Islam. Vol. 7), Göttingen: tran script 2006 84
J.-P. Sartre, »Lebendiger Gide«, S. 120 f.
175
Hans Schelkshorn
Bellah, R., Religion in Human Evolution. From the Paleolithic to the Axial Age, Cambridge: Harvard University Press 2011 —, Eisenstadt S. N., Wittrock B. (Hg.), Axial Civilizations and World History, Leiden, Boston: Brill 2005 Assmann, J, Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus, München: Beck 2003 —, »Cultural Memory and the Myth of the Axial Age«, in: R. N. Bellah, H. Joas (Hg.), The Axial Age and its Consequences, Cambridge, London: Harvard University Press 2012, 366–407 —, Achsenzeit. Eine Archäologie der Moderne, München: Beck 2018 —, —, Exodus. Die Revolution der Alten Welt, München: Beck 2019 Bayona Aznar, B., Religión y poder. Marsilio de Padua: ¿La primera teoría laica del Estado?, Madrid: Biblioteca Nueva 2007 Bellah, R. N., Religion in Human Evolution. From Paleolithic to the Axial Age, Cambridge, London: Harvard University Press 2011 Bellah, R. N., Joas, H., The Axial Age and its Consequences, Cambridge, London: Harvard University Press 2012 Bosbach, F., Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1988 Boulnois, O., Duns Scotus. Die Logik der Liebe, Stuttgart: Kohlhammer 2014 Bordt, M., Platons Theologie, Freiburg i. Br., München: Alber 2006 Cancik H. (Hg.), Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen, Tübingen: Mohr Siebeck 2003 Cicero, M. T., De legibus/Über die Gesetze. Paradoxa Stoicorum/Stoische Para doxien. Lat.-dt., übers. u. hg. v. R. Nickel, München, Zürich: Artemis und Winkler 1994 Clemens von Alexandrien, Teppiche: Wissenschaftliche Darlegungen entsprechend der wahren Philosophie (Stromateis), a. d. Griechischen übers. von O. Stäh lin (Bibliothek der Kirchenväter, 2. Reihe, Band 17–20), München: Kösel 1936–1938 Einstein, A., On Cosmic Religion and Other Opinions and Aphorisms, New York: Dover Publications 2009 Eisenstadt, S. N. (Hg.), Kulturen der Achsenzeit, 2 Bde., Frankfurt/M.: Suhr kamp 1987 —, »Allgemeine Einleitung: die Bedingungen für die Entstehung und Institutio nalisierung der Kulturen der Achsenzeit«, in: ders. (Hg.), Kulturen der Ach senzeit. Ihre Ursprünge und Vielfalt. Teil 1: Griechenland, Israel und Mesopota mien, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987, S. 43–51 —, Die Vielfalt der Moderne, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2011 Elkana, Y., »Die Entstehung des Denkens zweiter Ordnung im antiken Griechen land«, in: S.N. Eisenstadt (Hg.), Kulturen der Achsenzeit. Ihre Ursprünge und ihre Vielfalt. Teil 1: Griechenland, Israel, Mesopotamien, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987, S. 52–88
176
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Fiedrowicz, M., Apologie im frühen Christentum. Die Kontroverse um den christ lichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten, Paderborn u.a.: Schö ningh 22000 —, Christen und Heiden. Quellentexte zu ihrer Auseinandersetzung in der Antike, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2004 Flasch, K., Philosophie hat Geschichte. Bd. 1: Historische Philosophie. Beschreibung einer Denkart, Frankfurt/M.: Klostermann 2003 Foucault, M., »Was ist Aufklärung?«, in: D. Defert u. F. Ewald (Hg.), Michel Fou cault. Schriften in vier Bänden. Dits et Ecrits. Schriften, Bd. IV, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2005, S. 687–707 Fowden, G., Empire to Commonwealth. Consequences of Monotheism in Late Antiquity, Princeton: Princeton University Press 1993 Gandhi, M., Was ist Hinduismus?, Frankfurt/M.: Suhrkamp-Insel 2006 German, N., »Natural and Revealed Religion«, in: L. X. López-Farjeat, R. C. Taylor (Hg.), The Routledge Companion to Islamic Philosophy, London, New York: Routledge 2015, S. 346–359 Habermas, J., Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1985, S. 17–33 —, Auch eine Geschichte der Philosophie, 2 Bde., Berlin: Suhrkamp 2020 Halfwassen, J., Der Aufstieg zum Einen. Untersuchungen zu Platon und Plotin, Saur: München, Leipzig 22006 —, »Der Gott des Xenophanes. Überlegungen über Ursprung und Struktur eines philosophischen Monotheismus«, in: Archiv für Religionsgeschichte 10 (2008), S. 275–284 Heitsch, E., »Frömmigkeit als Hilfe. Bemerkungen zum Eutyphron«, in: M. von Ackeren (Hg.), Platon verstehen. Themen und Perspektiven, Darmstadt: Wis senschaftliche Buchgesellschaft 2004, S. 11–21 Hesiod, Werke und Tage, griechisch/deutsch, übers. von O. Schönberger, Stutt gart: Reclam 1996 —, Theogonie, griechisch/deutsch, übers. von O. Schönber ger, Stuttgart: Reclam 1999 Höbert, A., Kaisertum und Kalifat. Der imperiale Monotheismus im Früh- und Hochmittelalter, Frankfurt/M.: Campus 2015 Honnefelder, L., Woher kommen wir? Ursprünge der Moderne im Denken des Mittelalters, Berlin: Berlin University Press 2008 Janka, M., Schäfer, C. (Hg.), Platon als Mythologe. Interpretationen zu den Mythen in Platons Dialogen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 22014 Jaspers, K., Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, München: Piper 1983 (Erst auflage 1949) Joas, H., Die Macht des Heiligen. Eine Alternative zur Geschichte von der Entzau berung, Berlin: Suhrkamp 2019 Kant, I., Sämtliche Werke, hg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaf ten, Berlin: de Gruyter 1910 ff. Abgek.: AA McEvilley, T., The Shape of Ancient Thought: Comparative Studies in Greek and Indian Philosophies, New York: Allworth Press 2002 Mill, J. S., Der Utilitarismus, übers. von D. Birnbacher, Stuttgart: Reclam 1976
177
Hans Schelkshorn
Ottmann, H., »Platon als Begründer der Politischen Theologie«, in: M. Knoll, F. L. Lisi (Hg.), Platons Nomoi. Die politische Herrschaft von Vernunft und Gesetz, Baden-Baden: Nomos 2017, S. 49–64 Platon, Sämtliche Werke, nach der Übersetzung von F. Schleiermacher, hg von W. F. Otto u. a., 6 Bde., Reinbek: Rowohlt 1957 ff. Pollock, S., »Axialism and Empire«, in: J. P. Arnason, S. N. Eisenstadt, B. Wittrock (Hg.), Axial Civilizations and World History, Leiden, Boston: Brill 2005, S. 397–450 Reinhardt, K., »Die Sinneskrise bei Euripides«, in: Die Neue Rundschau 68 (1957), S. 615–646 Roetz, H., Die chinesische Ethik der Achsenzeit, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992 —, »The Axial Age Theory. A Challenge to Historism or an Explanatory Device of Civilization Analysis? With a Look at the Normative Discourse in Axial Age China«, in: R. N. Bellah, H. Joas, The Axial Age and its Consequences, Cam bridge, London: Harvard University Press 2012, S. 248–273 —, »Karl Jaspersʼ Theorem der ›Achsenzeit‹ und die klassische chinesische Ethik«, in: Deutsche China Gesellschaft-Mitteilungsblattt 59 (2016), S. 21–37 Rüpke, J., Religion in Republican Rome. Rationalization and Ritual Change, Philadelphia: University of Pennsylvania Press 2012 Sartre, J.-P., »Lebendiger Gide«, in: ders.: Schriften zur Literatur, Bd. 4: Schwarze und weiße Literatur. Aufsätze zur Literatur 1946–1960, Reinbek: Rowohlt 1986, S. 118–121 Schelkshorn, H., Entgrenzungen. Ein europäischer Beitrag zum philosophischen Diskurs über die Moderne, Weilerswist: Velbrück Wissenschaft 2009 —, »Wahrheitsregime und die Verschiebung sakraler Kerne. Betrachtungen an den Grenzen diskursiver Reflexivität in der globalen Moderne«, in: B. Liebsch, M. Staudigl (Hg.), Bedingungslos. Zum Gewaltpotenzial unbedingter Ansprüche im Kontext politischer Theorie, Baden-Baden: Nomos 2014, S. 251–273 —, »Die Moderne als zweite Achsenzeit. Zu einer globalen Geschichtsphiloso phie mit und gegen Jaspers«, in: Polylog. Zeitschrift für interkulturelles Philo sophieren 38 (2017), S. 81–102 —, »Anbruch einer Zweiten Achsenzeit. Renaissance-Humanismus und ›christ liche Reform‹ im Diskurs über die Moderne«, in: ders., H. Westerink (Hg.), Reformation(en) und Moderne. Philosophisch-theologische Erkundungen, Göt tingen: Vienna University Press/Vandenhoek & Ruprecht unipress 2017, S. 11–44 —, »Anbruch einer Zweiten Achsenzeit: Zur Genese der Moderne durch religiöse Reformen und philosophische Innovationen im Kontext des lateinischen Christentums«, in: M. Pohlig, D. Pollack (Hg.), Die Verwandlung des Heiligen. Die Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion, Berlin: Berlin academic press 2020, S. 271–306 Schellenberg, A., Erkenntnis als Problem. Qohelet und die alttestamentliche Diskussion um das menschliche Erkennen, Freiburg/Schweiz, Göttingen: Van denhoeck & Ruprecht 2002 Schirren, T., Zinsmaier, T. (Hg.), Die Sophisten. Ausgewählte Texte, grie chisch/deutsch, Stuttgart: Reclam 2003
178
Religion, Vernunft und Politik im Abendland
Schröder, W., Athen und Jerusalem. Die philosophische Kritik am Christentum in Antike und Neuzeit, Stuttgart-Bad Cannstatt: frommann-holzboog 2011 Schupp, F., »Einleitung«, in: Averroes, Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsfähigkeit über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie, arabischdeutsch, übers. von F. Schupp, Hamburg: Meiner 2009 Stroumsa, G. G., Das Ende des Opferkults. Die religiösen Mutationen der Spätan tike, Berlin: Verlag der Weltreligionen/Insel Verlag 2011 Taylor, C., Ein säkulares Zeitalter, a. d. Englischen von J. Schulte, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2009 Tertullian, Apologetische, Dogmatische und Montanistische Schriften, übers. von H. Kellner (Bibliothek der Kirchenväter, 1. Reihe, Band 24), Kempten & München: Kösel 1915 Weber, M., »Der Sinn der ›Wertfreiheit‹ in den Sozialwissenschaften«, in: M. Weber (Hg.), Soziologie. Universalgeschichtliche Analysen, Stuttgart: Kröner 1973, S. 263–310 Wittrock, B., »Cultural Crystallization and Conceptual Change: Modernity, Axiality, and Meaning in History«, in: K. Palonen, J. Kurunmäki (Hg.), Zeit, Geschichte und Politik, Jyväskylä: Universität von Jyväskylä 2003, S. 105–134
179
George Karamanolis
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Einführung Ein hervorstechendes Merkmal der gesamten griechisch-römischen Antike, vom archaischen Zeitalter bis in die Spätantike, ist die starke Präsenz von Göttern in allen Aspekten des Lebens.1 Mehr noch: »Alles ist voll von Göttern«, wie Thales sagt.2 Die Götter sind in der griechisch-römischen Antike schlicht allgegenwärtig. Als Gründer und Beschützer der Städte wurden sie durch gewaltige Tempel und die aufwendigen Feste der antiken Städte verehrt. Ebenso sind sie in jeder Gattung der antiken Literatur sowie in den Schriften aller Philosophen der Antike thematisch – von den Vorsokratikern bis zu den letzten Neuplatonikern. Gott und das Göttliche sind gleichzeitig Gegenstand der Götterverehrung und Gegenstand der Philosophie in der Antike. Im Unterschied zu mittelalterlicher und moderner ist die antike Theologie – d.h. die Rede über das Göttliche – ein Bereich der Philosophie und keine eigenständige Disziplin. Das hat den Grund, wie wir sehen werden, dass die Götter und das Göttliche für alle antiken Philosophen ein zentrales Thema darstellen. Eine
Ich habe diesen Aufsatz mit Till Jesinghaus, Nikoletta Kanavou und Michael Konaris besprochen. Ich bin beiden dankbar für ihre Bemerkungen. Till Jesinghaus hat meinen Text sprachlich verbessert und dafür bin ich besonders dankbar. Für weitere Vorschläge und Korrekturen bin ich auch den Herausgebern des Bandes dankbar. Die Literatur zur antiken Religion ist sehr reich. Hier seien nur die folgenden einschlä gigen Standardwerke genannt: M. P. Nilson, Geschichte der griechischen Religion; W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche; P. Easterling, J. Muir (Hg.), Greek Religion and Society; S. Price, Religions oft the Ancient Greeks; R. Parker, On Greek Religion; E. Eidinow, J. Kindt (Hg.), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion. 2 Fr. A22 Diels/Kranz (DK); Aristoteles, De anima 411a8. 1
181
George Karamanolis
wichtige Frage, die ich aufwerfen möchte, ist, wie die Philosophen den traditionellen Göttern gegenüber eingestellt sind. Ich werde die folgende These vertreten: obwohl die antiken Philosophen manchmal die populäre Götterverehrung kritisieren und als Ziel setzen, die wahre Natur des Göttlichen zu untersuchen, streichen sie die antike Religion trotzdem nicht ganz durch; eher betrachten sie traditionelle Religion und philosophische Theologie als Stufen der menschlichen Suche nach dem Göttlichen. Bevor ich auf die Zentralität des Göttlichen für die antike Philosophie zu sprechen komme, möchte ich an drei Grundaspekte erinnern, die auf die allge meine Bedeutung und starke Präsenz der Götter und des Göttlichen in der griechisch-römischen Antike hinweisen. Erstens war das antike Theater, d.h. die Aufführungen von Tragödien und Komödien, sehr eng mit der Verehrung von Göttern verbunden, insbesondere mit der Dionysosverehrung im Rahmen der Dionysien.3 Für die Athener der klassischen Zeit hatte die Aufführung von Tragödien und Komödien sowohl einen politischen als auch einen religiösen Charakter. Genauer besehen, lässt sich zwischen politischem und religiösem Charakter kaum unterscheiden. Denn es handelt sich um Feste der Polis-Religion, die wichtig waren für die gesellschaftliche Kohäsion der Polis und konstitutiv für deren politische Identität. Natürlich waren solche Aufführungen nicht Teil eines Kultus oder einer Verehrung des Dionysos im engeren Sinne, doch fanden sie im Rahmen der Feste zu Ehren des Dionysos statt und oft spielten dabei Dionysos und andere Götter sowie ihre Taten eine bestimmende thematische Rolle in den dramatischen Texten – so z.B. in der Orestie, an deren Ende Athene die entscheidende Rolle für die Beurteilung des Orestes spielt.4 Dabei ist bei näherer Betrachtung die Frage, was genau das antike Theater mit Religiosität und religiöser Praxis zu tun hat, nicht leicht zu klären und unterschiedlich beantwor tet worden. Wie auch immer eine Antwort ausfällt, kommt m. E. der Tätigkeit des Spielens und Nachahmung (mimêsis) anderer Personen sowie dem Tanz und Gesang eine zentrale Rolle zu. Tanzen und Singen wurden in der Antike als außerordentliche Tätigkeiten erachtet und als dem Dionysos zugehörig aufgefasst. D. h. sie wurden als göttliche 3 Hierzu Α. W. Pichard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, C. SourvinouInwood, »Tragedy and Religion: constructs and readings«, C. Sourvinou-Inwood, Tra gedy and Athenian Religion und R. Parker, Polytheism and Society in Athens, Kap. 7. 4 Vgl. S. Price, Religions of the Ancient Greeks, Kap. 2 »Gods, myths and festivals‟.
182
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Tätigkeiten angesehen und damit als Tätigkeiten, deren Gelingen göttlicher Hilfe und Förderung bedarf. Die Aufnahme einer neuen Person in ein Schauspiel z. B. ist nur mit göttlicher Billigung möglich. Deswegen wurden die Schauspieler in der Antike als »Künstler des Dionysos« (dionysiakoi technitai) bezeichnet.5 Die Tatsache, dass das Schauspiel auf die göttliche Hilfe angewiesen ist, bedeutet natürlich nicht, dass hier von einem Wirken eines allmächtigen Gottes, wie im Christentum etwa, die Rede ist; im Gegenteil handelt es sich bei Dionysos um alles andere als ein allmächtiges Wesen, wie die Parodien in Aristophanes‘ Frösche belegen.6 Für uns heute ist eine solche Parodie nur schwer mit dem Gedanken der Götterverehrung vereinbar, weil wir Gott anders begreifen (dazu mehr unten). Doch dass die Dionysien z. B. einen einschlägig religiösen Charakter hatten, ist unbestreitbar. Und wie die antiken Inschriften zeigen, gilt das auch für viele andere bedeutende Ereignisse des sozialen, politischen und geistigen Lebens.7 Aufgrund dieses einheitsstiftenden religiösen Charakters ermutigte die Stadt alle Bürger ins Theater zu gehen und sich an den Festen zu beteiligen.8 Zweitens waren, abgesehen von den dramatischen Aufführun gen, auch die antiken Sportveranstaltungen eng mit der Götterver ehrung verbunden, wie die Pythischen, die Nemeanischen, oder die Olympischen Spiele zeigen. Es gab natürlich im engeren Sinne keinen Sport in der Antike, der Sport ist eine englische Erfindung.9 Doch in der Antike gab es Spiele oder Wettbewerbe (agônes), die wie die Theaterspiele eng mit Zeremonien zu Ehren von Göttern verbunden waren und nach der starken Konkurrenz im Wettkampf der Beteiligten bezeichnet wurden, z. B. die Spiele zu Ehren des Gottvaters Zeus. Auch die olympischen Spiele hatten einen solchen religiösen agonistischen Charakter.10 Derartige Spiele wurden nicht von oder für eine bestimmte Stadt organisiert, sondern von und für Vgl. Pichard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, S. 278–305. Vgl. P. Easterling, »Greek Poetry and Greek Religion«, bes. 37–39. 7 Deshalb ist die Rede von Polis-Religion. S. dazu C. Sourvinou-Inwood, »What is Polis Religion?«. 8 Die antiken Theaterspiele hatten natürlich auch eine wichtige erzieherische Dimen sion, die ich hier nicht besprechen kann. 9 »Sport« bedeutet ursprünglich »sich unterhalten«, während agôn »Konkurrenz spiel« bedeutet. 10 Es ist nicht ganz klar, warum der agonistische mit dem religiösen Aspekt verbun den worden ist. Manchmal sind Götter als Gründer der Spiele betrachtet, aber die Frage bleibt, warum sie es sind. Vgl. L. Drees, Olympia: Gods, Artists, Athletes. 5
6
183
George Karamanolis
alle griechischen Städte gemeinsam, d.h. Bürger aller Städte konnten an den Spielen teilnehmen (panhellenische Spiele). Das ist wichtig in folgender Hinsicht: Alle griechischen Städte teilen dieselben Götter, was die Teilnahme der Bürger aller hellenischen Städte ermöglicht. Die Götterverehrung hatte einen panhellenischen Charakter. Wie Herodot bemerkte, haben die Griechen der verschiedenen Städte drei Dinge gemeinsam: die Sprache, den Stamm, und die Götterverehrung (Herodot VIII.144.2). Trotzdem hatte jede Stadt eine ihr eigens zuge ordnete Gottheit (poliouchos, wie z.B. Athene, Poseidon, Herakles usw.). Und deshalb förderte jede Stadt die Verehrung bestimmter Gottheiten. Antike Mythen einer gewissen Gattung erklären, warum eine Gottheit als die bevorzugte Gottheit einer Stadt gilt. Drittens gab es in der Antike keine Krankenhäuser. Es gab lediglich bestimmte Tempel, die auf die Heilung von Krankheiten spe zialisiert waren, die sogenannten Asklepeia – Tempel des Asklepios.11 Solche Tempel finden sich überall und waren stark frequentiert.12 Wir besitzen viele Inschriften, die uns von Heilungswundern des Askle pios berichten.13 Die Sorge um den Körper sowie um die Gesundheit des Körpers und der Seele waren in der Antike mindestens teilweise eine religiöse Angelegenheit. Gleichzeitig kann man auch eine Ent wicklung der antiken Medizin zu einer Wissenschaft feststellen. Die hippokratischen Ärzte versuchen, die Physiologie des menschlichen Körpers und die Natur der Krankheiten zu verstehen. Dem entspre chend kritisieren sie den Glauben einiger, dass Krankheiten von den Göttern gesendet werden, heftig.14 Sie argumentieren dagegen, dass alle Krankheiten spezifische natürliche Ursachen haben. Die Koexistenz von Religiosität und wissenschaftlicher Forschung ist ein interessantes Merkmal des antiken Geisteslebens und sagt nicht zuletzt auch etwas über die antike Religion aus. Die Institution der Asklepeia, der Tempel des Asklepios, war kein Hindernis in der Vgl. S. B. Aleshire, The Athenian Asclepeion. The People, their Dedications, and the Inventories; Price, Religions of the Ancient Greeks, Kap. 6; Parker, Polytheism and Society at Athens, S. 410–415. 12 Die ersten griechischen Tempel sind datierbar um 800 V. Chr. Vgl. dazu J. N. Coldstream, »Greek Temples: Why and Where«. 13 Vgl. die Sammlung der Testimonien von E. Edelstein und L. Edelstein, Asklepius. A Collection and Interpretation of the Testimonies. 14 Siehe hierzu P. van der Eijk, »The ›Theology‹ of the Hippocratic Treatise On the Sacred Disease«; P. van der Eijk, »›Airs, Waters, Places‹ and ›On the Sacred Disease‹: Two Different Religiosities?«; J. Jouanna, Hippocrate: La maladie sacrée; H. W. Nörenberg, Das Göttlich und die Natur in der Schrift Über die Heilige Krankheit. 11
184
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Entwicklung der wissenschaftlichen Untersuchung der Krankheiten. Wissenschaft und Religion sind nicht antagonistisch in der Antike, wie so oft heute. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in der Antike drei wichtige Lebensbereiche, das Theater, sportlicher Wettkampf und die Sorge um die Gesundheit einen eindeutig und stark religiösen Charakter hatten, trotz der Tatsache, dass zur gleichen Zeit die Medi zin, die Wissenschaft im Allgemeinen wie auch die Philosophie (d.h. die vernünftige Betrachtung und Untersuchung der Welt) viele Fort schritte machten und sich eines regen und breiten Interesses erfreuten. Dieselben Bereiche des Lebens haben heute in den westlichen Gesell schaften nichts mit der Religion zu tun. Darüber hinaus gab es in der Antike viele andere religiöse Feste, wie die der Panathinaea oder der Thesmophoria in Athen, die besonders für Frauen gedacht waren und eine zentrale Rolle in der antiken Polis hatten.15 Damit stellt sich die Frage, ob es stimmt, wie Thales behauptet, dass das Leben der Menschen in der Antike voll von Göttern war oder ob die antike Lebenseinstellung vielleicht besonders religiös war. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass die antiken Grie chen kein Wort für »Religion« hatten. Das lateinische Wort religio weist ursprünglich auf die Verbindung des Menschen mit Gott hin, darüber hinaus auf die Pflicht der Menschen, die Götter zu verehren. Ein solches Wort fehlt im Griechischen. Umgekehrt bedeutet das nicht, dass die Griechen der Antike keinen Begriff von Religion hatten. Wir müssen hier, wie sonst auch, achtsam sein und zwischen Wort und Begriff unterscheiden. Denn auch wenn es kein entsprechendes Wort gibt, hatten die Griechen zweifellos einen Begriff von Religion. Sie sprechen z.B. oft von der Sorge um die Götter (epimeleia theôn) oder von der Frömmigkeit (eusebeia, theosebeia), der Tugend also, die Götter zu ehren und die Götter zu akzeptieren (theous nomizein).16 Es bleibt jedoch offen, wie genau diese Begriffe mit unserem (stark vom Christentum beeinflussten) Begriff der Religion vergleichbar sind. Schon bei Homer und Hesiod finden wir den Begriff der Frömmigkeit
Hierzu s. Parker, Polytheism and Society at Athens, S. 155–289. Zu der antiken religiösen Terminologie s. Burkert, Griechische Religion der archai schen und klassischen Epoche. 15
16
185
George Karamanolis
und der Gottesverehrung, aber es ist unklar, ob und inwieweit diese Begriffe dem modernen Begriff der Religion völlig entsprechen.17 Platon spricht z.B. im Euthyphron und den Gesetzen ausführlich über die Gottesverehrung, besonders über die richtige Einstellung der Menschen den Göttern gegenüber. Platon ist aber nicht der erste, der diese Themen bespricht. Einerseits reagiert er auf bestimmte Ten denzen im Geistesleben seiner Zeit. Die Sophisten sprechen von der Religion als einer menschlichen Erfindung. Andererseits greift er auf die antiken Dichter, insbesondere Homer und Hesiod, zurück, die als Gründer der antiken Vorstellungen von den Göttern gelten, insoweit sie den Göttern bestimmte Attribute zuschreiben. Hier zeichnet sich also ein dialektischer Übergang zwischen allgemein-traditioneller und spezifisch-philosophischer Thematisierung der Religion ab, die bereits vor Platon ihren Anfang nimmt. Wenn ich von traditioneller Religion spreche, meine ich die Religion der antiken Dichter, Homer und Hesiod, wie auch später die Polis-Religion. Im folgendem möchte ich genau auf diese Dialektik zwischen den traditionellen Vorstell ungen von den Göttern und der philosophischen Einstellung zu der Religion und dem Göttlichen eingehen. Besonders wichtig ist es zu klären, wie die Vorsokratiker die traditionelle Religion aufgreifen und weiterentwickeln und was sie zu dem Begriff der Frömmigkeit beizutragen haben.
1. Traditionelle und philosophische Göttervorstellungen Kritische Reaktionen auf die traditionellen Vorstellungen von den Göttern finden sich bereits bei den ersten Vorsokratikern. Xeno phanes (570–475 B.C.) z.B., ein Vertreter des ionischen Geistes der Untersuchung (historiê), ist berühmt für seine hexametrischen Gedichte, in denen er die Urheber falscher Gottesvorstellungen kri tisiert und eine neue Gottesidee vorgestellt hat. Auch Xenophanes Natürlich ist Religion heute, wie in der Antike, ein extrem facettenreiches und vielschichtiges Phänomen. Einen guten Überblick und Darstellung der Problematik bietet E. Lawson-R, McCauley, Rethinking Religion. Connecting Cognition and Cul ture, S. 12–44. S. auch B. Russell, Why I am not a Christian, S. 27–42. Ich meine besonders den Begriff der Religion der abrahamitischen Religionen. Ein wichtiges Merkmal dieser Religionen ist, dass sie Positionen zu wichtigen Fragen vertreten, manchmal Fragen philosophischer Natur. 17
186
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
schildert ein Gastmahl, bei dem »die wohlgesinnten Männer dem Gotte lobsingen mit frommen Geschichten und reinen Worten« (Xenophanes Fr. B1 Diels/Kranz). Xenophanes zufolge gibt es »rich tige« und »falsche« Arten von Dichtung, im Gastmahl zu singen und damit die Götter zu verehren. Als falsch bezeichnet er die Gedichte Hesiods über den Kampf zwischen Götter und Titanen (Fr. B1.21 – 24 DK),18 die nicht die Tugend fördern (Fr. B1.20 DK). Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Anthropomorphismus: Xenophanes kritisiert scharf Vorstellungen, nach denen die Götter menschliche Züge tragen, besonders wenn ihnen menschliche Schwächen zugeschrieben wer den: »Aber die Menschen nehmen an, die Götter seien geboren, sie trügen Kleider, hätten Stimme und Körper, wie sie selbst« (Fr. B14 DK; Primavesi/Mansfled Übers.) Und er bemerkt weiter: Wenn aber die Rinder und Pferde und Löwen Hände hätten, und mit diesen Händen malen könnten und Bildwerke schaffen wie Menschen, so würden die Pferde die Götter abbilden und malen in der Gestalt von Pferden, die Rinder in der von Rindern, und sie würden solche Statuen meißeln, ihrer eigenen Körpergestalt entsprechend. (Fr. B15 DK; Primavesi/Mansfled Übers.)
Und noch weiter fügt er hinzu: »Die Äthiopier behaupten, ihre Götter seien stumpfnasig, und schwarz, die Thrakier, blauäugig und blond.« (Fr. B16 DK; Primavesi/Mansfled Übers.) Mit Aufdeckung dieser projektionalen Zusammenhänge kritisiert Xenophanes nicht nur eine sehr verbreitete und populäre Vorstellung von Göttern; vor allem kritisiert er die Quelle dieser Vorstellung – namentlich Homer und Hesiod. Seiner Meinung nach sind sie verantwortlich für eine falsche Gottesvorstellung und in Konsequenz auch für eine falsche Gottesverehrung. Das folgende Zitat von ihm ist berühmt: »Homer und Hesiod haben die Götter mit allem belastet, was bei Menschen übelgenommen und getadelt wird: stehlen und ehebrechen und einander betrügen.« (Fr. B11 DK) Xenophanes konzentriert sich dabei auf einen Hauptaspekt: Homer und Hesiod haben die antike griechische Vorstellung der Götter begründet, insoweit sie die Genealogien, die Tätigkeiten und die Gewohnheiten der antiken Götter auf eine anthropomorphische Weise beschreiben. Wir wissen, dass Homer und Hesiod für die 18 Vgl. hierzu P. Easterling, »Greek Poetry and Greek Religion«, bes. 40f., und S. Broadie, »Rational Theology«.
187
George Karamanolis
antiken Vorstellungen von den Göttern grundlegend waren, nicht nur für die der Griechen, sondern auch für die der Römer. Ebenso wissen wir, dass die Römer durch die sogenannte interpretatio romana ihren eigenen lokalen Göttern viele Merkmale der griechischen Göt ter zugeschrieben haben und am Ende die griechischen Götter der römischen Religion einverleibt haben.19 Römische Dichter wie Virgil in der Aineis haben die homerische Dichtung und dazu auch die Dar stellung der homerischen Götter nachgeahmt. Xenophanes kritisierte bereits genau diese von den antiken Dichtern her stammende anthro pomorphe Darstellung der Götter und dass den Göttern Handlungen zugeschrieben werden, die nicht tugendhaft sind. Xenophanes ist jedoch kein Atheist, d.h. er lehnt nicht die Existenz Gottes und die Rolle des Göttlichen ab. Im Gegenteil will Xenophanes, wie später Platon, für wahre Frömmigkeit plädieren, da er der Meinung ist, dass die traditionelle anthropomorphische Darstellung der Götter die richtige Frömmigkeit zerstört, nicht zuletzt weil die Götter als untugendhaft dargestellt werden. Seiner Meinung nach ist eine solche Dichtung keine gute Erziehung für die Bürger. Deshalb will Xenophanes, wie später Platon, die populären, aber seiner Meinung nach falschen Vorstellungen von den Göttern durch andere ersetzen, nämlich durch philosophische Vorstellungen des Göttlichen. Wie die folgenden Fragmente belegen, spricht Xenopha nes für einen einzigen Gott, der anderer Natur als die Menschen ist: Ein einziger Gott ist unter Göttern und Menschen der Größte, weder dem Körper noch der Einsicht nach den sterblichen Menschen gleich. (Fr. B23 DK) Als ganzer sieht er, als ganzer versteht er, als ganzer hört er (Fr. B24 DK) Immer verbleibt er am selben Ort, ohne irgendwelche Bewegung, denn er geziemt sich für ihn nicht, bald hierhin, bald dorthin zu gehen, um seine Ziele zu erreichen. (Fr. B26 DK) Sondern ohne Anstrengung des Geistes lenkt er alles mit seinem Verständnis. (Fr. B25 DK)
Die Tatsache, dass Xenophanes ebenso von »Göttern« im Plural wie auch von »Gott« im Singular spricht, weist darauf hin, dass er offensichtlich annimmt, dass der Bereich des Göttlichen hierarchisch 19
Vgl. C. Ando, »Interpretatio Romana«.
188
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
geordnet ist; er spricht von einem Gott an der Spitze der Götterhier archie, der der Größte ist und sich auch durch andere Merkmale auszeichnet: er bewegt sich nicht, er kann alles vollbringen (ohne sich zu bewegen), und lenkt alles (bzw. die Welt), ohne etwas zu tun. Wie nicht unüblich für das Griechische und spätestens seit Platon und Aristoteles terminologisch, ist mit »Bewegung« jede Art von Veränderung gemeint. Xenophanes zufolge ist Gott also unveränderlich, anders als die Götter bei Homer und Hesiod, die z.B. von starken Affekten und Begierden bestimmt werden. Vielleicht ist dies der wichtigste und produktivste Beitrag des Xenophanes zur philosophischen Theologie. Das Thema der Unveränderlichkeit Gottes ist bestimmend für die weitere Tradition.20 Es ist auch wichtig zu bemerken, dass Xenophanes Gott als ein geistiges Wesen vorstellt: als eine denkende und wahrnehmende Entität, die allein durch ihr Denken alles zu lenken vermag. Entsprechend wirft Xenophanes den Anhängern der traditionellen Vorstellungen von den Göttern schlicht Unfrömmigkeit (asebeia) vor. Sie verkennen die Natur Gottes. Die richtige Gottesvorstellung, für die Xenophanes plädiert, ist die eines geistigen Wesens, das, obwohl selbst unveränderlich, eine veränder liche Welt gut und nützlich eingerichtet hat. Xenophanes zufolge ist diese Gottesvorstellung Voraussetzung und Ausgangspunkt wahrer Frömmigkeit.21 Daher ist es auch kein Zufall, dass die frühen Christen systematisch die xenophanischen Aussagen zitieren und sich zunutze machen, um die Falschheit der antiken Religion zu beweisen.22 Xenophanes ist der erste, aber nicht der einzige Vorsokratiker, der über die Natur Gottes spricht. Hier ist auch Heraklit zu nennen, der beispielsweise behauptet, dass die Natur Gottes nicht einfach zu erkennen ist, wie die meisten glauben (Fr. B93 DK). Jedoch verbindet Heraklit die Vorstellung eines schwierig zu erkennenden Gottes, der über alles waltet, mit der traditionellen Gottesvorstellung, wie das folgende Fragment belegt: »Eins, das allein Weise, will nicht und will doch mit dem Namen des Zeus benannt werden.« (Heraklit, Fr. B32 DK) Es ist unter anderem dieser Brückenschlag zu traditionellen religiösen Vorstellungen, der Heraklits Aussage so sehr interessant macht. Typisch dunkel-paradox formuliert, ist Zeus nicht der einzige Vgl. S. Broadie, »Rational Theology«, bes. S. 210. Vgl. weiters W. Jaeger, The Theology of the Early Greek Philosophers, S. 38–54. 22 Wie die Aufgabe der Diels-Kranz belegt, ist es bemerkenswert, dass viele Frag mente des Xenophanes von christlichen Quellen überliefert sind, wie Clement von Alexandrien. 20 21
189
George Karamanolis
Gott – Heraklit zufolge. Auch wenn Heraklit – anders als Xenophanes beispielsweise – nicht explizit gegen den Anthropomorphismus der antiken Religion argumentiert, weist er dezidiert darauf hin, dass wir wenig über die wahre Natur Gottes wissen – mit der Konsequenz, dass die entsprechenden blumigen Erzählungen der Dichter irrelevant sind und nichts über die wahre göttliche Natur aussagen. Auch andere Vorsokratiker reden über die Natur Gottes und das Göttliche. Im 6. Jh. bezeichnet Anaximander das Unbegrenzte (ape iron) als göttlich (Aristoteles, Phys. III, 203b10–15), Diogenes von Apollonia, der eineinhalb Jahrhunderte später lebte, sagt ähnliches über die intelligente Luft: »Und, wie mir scheint, ist das, was die Geisteskraft hat, die von den Menschen sogenannte Luft, und von diesem Stoff werden alle gelenkt und alle beherrscht er. Denn gerade dies, scheint mir, ist Gott.« (Diogenes von Apollonia, Fr. 5 DK) Zur selben Zeit spricht auch Anaxagoras von einem Geist (nous), der alles lenkt und alles ordnet (Fr. B12 DK, Arist., Met. 984b15), eine These, die natürlich an den Gott von Xenophanes erinnert. Doch interessanterweise spricht Anaxagoras nie von diesem Geist als göttlich oder Gott. Für ihn ist es wichtiger, die Leistung dieses geis tigen Prinzips zu erläutern. Vielleicht steckt dahinter der Gedanke, dass die Attribute »Gott« und »göttlich«" dem nichts Wesentliches hinzufügen.23 Es ist bemerkenswert, dass Socrates in Platons Phaidon seine hohe Einschätzung dieser Theorie äußert, er gesteht jedoch, dass Anaxagoras eigentlich die Leistung des Geistes nicht genauer erklärt (Phaidon 97b-98d). Empedokles hingegen spricht explizit von einem Gott, Sphairos. Er wird von ihm mit einer harmonischen Mischung und Versöhnung identifiziert. Es handelt sich um zwei Prinzipien, die, wenn er sie als »Liebe« und »Streit« bezeichnet, Namen von Göttern erhalten. Liebe wird dabei mit Aphrodite und Streit mit Ares, dem Gott des Krieges identifiziert (Fr. B17, B22 DK). Wahrscheinlich hat Empedokles tradi tionelle Götter wie Zeus und Hera mit einigen von den vier Elemen ten identifiziert (Hippolytus, Refutatio omnium haeresium VII.29). Darüber hinaus hat er auch von kleineren Göttern, d.h. Dämonen, gesprochen, die zwischen den höchsten Göttern und den Menschen zu verorten sind und die als Pflanzen, Tiere oder Menschen leben können
Vgl. dazu Broadie, »Rational Theology«, S. 206 und A. Laks, »Mind’s Crisis: On Anaxagoras’ NOUS«.
23
190
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
(Fr. B115, 142, 146 DK).24 Es ist wichtig hier zu bemerken, dass Empe dokles in dieser Hinsicht der Vorstellung Hesiods (Werke 122, 314) folgt. Anders als Xenophanes und Heraklit versucht Empedokles die traditionelle und mythologische Göttervorstellung mit einer neuen philosophischen Konzeption des Göttlichen zu versöhnen. Wie ist all dies zu interpretieren? Zusammenfassend – und im Unterschied zur späteren Theologie – lässt sich vielleicht folgendes sagen: Die Vorsokratiker interessieren sich nicht für die Frage nach der Existenz Gottes oder des Göttlichen (die ist unbestreitbar und mit Thales gesprochen allgegenwärtig), sondern für die Frage nach dem Wesen Gottes. Sie wollen wissen, worin das Göttliche besteht. Das ist jedenfalls ein Hauptgegenstand ihrer Untersuchungen. Sie sind auch der Auffassung, dass die traditionelle Götterverehrung und Formen der Frömmigkeit, die auf populären Konzeptionen der Götter fußen, wie sie auf Homer und Hesiod zurückgehen und u. a. durch die panhellenischen Feste verbreitet und institutionalisiert wurden, schlicht falsch oder, mindestens, nicht ausreichend sind. Sie kritisie ren jedoch die antike Volksreligion nicht durchwegs, und sie wollen sie nicht streichen. Sie bemerken nur, dass die populären Konzeptionen der Götter oft die echte Natur des Göttlichen verunklaren. Doch kritisieren die Vorsokratiker nicht nur die populären Konzeptionen der Götter, sondern auch Aspekte der antiken Religion, antike Feste und Kulte. Heraklit ist das vielleicht eindeutigste Beispiel: Sie reinigen sich vergebens, indem sie sich mit Blut beschmutzen, wie wenn einer, der in Schmütz getreten, sich mit Schmütz abwaschen wollte. Für verrückt muss er gehalten werden, bemerkt man nur, dass er so tut. Und sie beten zu den Götterbildern um uns herum, so wie wenn einer sich mit Tempeln unterhielte, ohne auch nur im geringsten von Götter und Heroen zu wissen, was sie sind. (Fr. 5 DK; Primavesi/Mansfeld Übers. leicht modifiziert).
Heraklit kritisiert hier seine Zeitgenossen dahingehend, dass sie nichts von der Natur der Götter verstehen, trotz der Tatsache, dass sie oft an religiösen Festen teilnehmen. Diese Teilnahme an sich ist nicht zu kritisieren. Sie trägt aber nicht zum Wissen über die Natur der Götter bei (vgl. Fr. 15 DK). Heraklit argumentiert nicht gegen die Existenz der Götter. Im Gegenteil spricht er über den unüberwindba ren Unterschied zwischen Göttern und Menschen, denn selbst der Vgl. C. Rowett, »Love, Sex and the Gods: Why Things Have Divine Names in Empedocles’ Poem, and Why They Come in Pairs«.
24
191
George Karamanolis
weiseste Mensch ist verglichen mit den Göttern ein Affe (vgl. Fr. 83 DK). Ebenso spricht Heraklit über Gott im Singular (Fr. 67 DK). Es ist eine Kraft, die die Welt regiert und logisch durchwirkt (Fr. 41 DK). Andere Denker wie Empedokles und Parmenides argumentie ren nicht spezifisch gegen anthropomorphe Vorstellungen von den Göttern, obwohl auch sie oft von Gott im Singular sprechen. Empe dokles betont aber beispielsweise, dass der Gott Sphairos weder Kopf, Hände noch Beine habe (Fr. B134 DK), aber wie wir gesehen haben, hat er auch einiges aus der traditionellen Theologie Hesiods übernommen. Im Lehrgedicht des Parmenides ist die Göttin, die den Dichter empfängt, führt und ihm die Wahrheit offenbart, eine Frau, was auf die Dichterweihung bei Homer und Hesiod hinweist. Anthropomorphistisch ist vielleicht auch die Metapher des Besitzens der Wahrheit: Die Göttin Dikê, Gerechtigkeit, besitzt die Schlüssel des Hauses von Nacht und Tag (Fr. 1.11 – 14 DK). Alle diese frühen Denker wollen m. E. darauf hinweisen, dass das Göttliche nicht darin aufgeht oder sogar bestimmt ist, was Homer und Hesiod in ihren Gedichten beschrieben haben. Doch lehnen sie die traditionellen Vorstellungen nicht völlig ab und sie streichen die antike Religiosität nicht zur Gänze durch. Eher ergänzen sie dieses Bild. Sie verweisen oft auf die Götter der traditionellen Religion, aber gleichzeitig wollen sie das Verständnis ihrer Zeitgenossen bezüglich der Natur der Götter hinterfragen und berichtigen. Doch die Suche der Vorsokratiker nach der wahren Natur des Göttlichen ist Teil eines allgemeineren tieferen Interesses: der Suche nach dem Grund, dem Fundament des Universums, was Aristoteles später Prinzip (archê) genannt hat. Die Vorsokratiker verstehen dieses Prinzip auf radikal unterschiedliche Weise, sei es als unbegrenzten Stoff, Logos oder Geisteswesen. Doch wie auch immer sie dieses Prinzip begreifen, teilen sie die Meinung, dass es sich um ein höchstes Prinzip handelt, das alles in der Welt bestimmt sowie lenkt und leitet. Darin sehen sie etwas Göttliches, insoweit von einem solchen Prinzip eine kosmologi sche Kraft ausgeht, der entsprechend die Welt nicht nur irgendwie ver nünftig geordnet ist, sondern auf fundamentaler Ebene vollkommen von Vernunft geprägt ist. Dies ist die Basis der vorsokratischen Kritik an der traditionellen Religion und Gottesvorstellung. Wie sollen wir diesen Umstand verstehen, und ist diese Form der Kritik nicht letzten Endes inkonsequent? Eine erste vorläufige Antwort scheint mir klar: Die antiken Götter stellen keine fixierte Gruppe mit festen Eigenschaften dar.
192
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Vielmehr handelt es sich um eine offene Gruppe, die erweitert und ergänzt werden kann. Die Polis kontrollierte natürlich die lokalen religiösen Kulte und Feste, es gab jedoch Raum für private Initia tiven und für alternative dichterische Göttervorstellungen. Diese Möglichkeit ist durch die abstrakten Begriffe gegeben, die für die göttlichen Attribute eintreten und mit denen sie selbst benannt werden wie Sieg (nikê), Überzeugung (peithô), Liebe (erôs), Neid (phthonos) usw. Die Vergöttlichung von abstrakten Begriffen war ein Hauptmerkmal der antiken traditionellen Religion. Abstrakte Begriffe werden nicht von den Philosophen als Götter dargestellt. Im Gegenteil folgen die Philosophen dieser Tendenz der traditionellen Religion. Dies ermöglicht den Vorsokratikern (und auch späteren antiken Philosophen) vom Unbegrenzten, Feuer, oder dem Geist zu sprechen, ohne den theologischen Sprachgebrauch zu verletzen. Das Merkmal abstrakt-begrifflicher Vorstellungen von den Göttern ermöglicht auch, dass Götter existieren können, von denen wir noch keine Kenntnis haben. Weil also die antike Religion ein offenes und flexibles System darstellt, könnten auch Naturkräfte wie das Feuer, komplexe intersubjektive Einstellungen wie die Liebe oder Tugenden und Prinzipien wie Gerechtigkeit problemlos als göttlich betrachtet werden. Die gleichzeitige Annahme von traditionellen Göttern und Prin zipien, d.h. die Koexistenz der traditionellen und philosophischen Theologie, ist möglich, weil die Griechen der Antike, wie auch später die Römer, sicherer und routinierter als wir heute zwischen göttlichen Namen auf der einen und Kräften und Leistungen auf der anderen Seite unterscheiden, ohne dass dies einer sprachlichen Differenzie rung oder Erklärung bedürfte. Der Verfasser der Papyrus von Derveni, der früheste überlieferte Papyrus der Antike (Mitte-Ende 4. Jh.), behauptet genau das: Die himmlische Aphrodite und Zeus und die Überzeugung und die Harmonie sind Namen desselben Gottes (Pap. Derveni col. XXI.5 – 7) Die Erde und die Rea und die Hera sind dieselbe Göttin (Pap. Derveni col. XXII.7)
Natürlich möchte der Verfasser des Derveni Papyrus hier nicht die Existenz der vielen traditionellen Götter verneinen. Vielmehr plädiert er lediglich dafür, dass alle diese Götter Fassungen oder Aspekte desselben Gottes sind: des Zeus als einer aktiven göttlichen Kraft z. B.
193
George Karamanolis
oder der Erde, Hera, als einer zweiten göttliche Kraft, mit der Zeus sich auseinandersetzt.25 Heraklit vertritt eine ähnliche These, wenn er behauptet: »Eins, das allein Weise, will nicht und will doch mit dem Namen des Zeus benannt werden« (Fr. 32 DK). Heraklit weist hier darauf hin, dass die Welt von Weisheit gelenkt und geleitet ist, und es ist egal, wie wir diese Weisheit nennen, d. h. ob wir sie mit einem besonderen Gott identifizieren. Eine vergleichbare These findet sich auch im Chor von Aischylos‘ Agamemnon: Zeus, wer er auch sein mag, ist ihm dies Lieb als Name und steht ihm an. Ruf ich so ihn betend an Nicht beut mir sich sonst Vergleich Alles wäg ich prüfend ab. außer Zeus selbst, wenn ich Grübelns vergebliche Last soll Wälzen mir von Seel und Herz (Aeschylus, Agamemnon 160–166) Heraklit, der Verfasser der Derveni-Papyrus und auch Aischylos unterscheiden zwischen dem Namen des traditionellen Gottes Zeus und den mit ihm assoziierten göttlichen Kräften. Wir finden diese Unterscheidung später wieder bei den Stoikern, insbesondere in Kleanthes‘ berühmter Zeus-Hymnus, auf die ich später zu sprechen komme. Es ist sichtbar, wie der Gedanke abstraktiv-prinzipieller Got tesvorstellungen hier mehr und mehr eine systematische Ausprägung erfährt. Auf der einen Seite finden wir eine Kritik der Vorstellungen von den Göttern bei Homer und Hesiod, wie wir sie von Xenophanes kennen. Platon zufolge erwecken die Dichter einen falschen Eindruck, wenn sie über die Götter sprechen, als ob sie die Schwäche der Menschen teilen würden.26 Und dies ist der tiefere Grund, weshalb Platon die Dichtung aus seinem idealen Staat verbannen möchte (Staat II, III, X). Auf der anderen Seite hingegen verteidigt Platon die traditionelle Religion und argumentiert in den Gesetzen insbesondere gegen den Atheismus (Buch X). Des Weiteren beruft sich Platon in der Kosmologie seines Spätwerks ausdrücklich auf einen Gott, der Zur Theologie des Derveni Papyrus vgl. G. Betegh, The Derveni Papyrus: Cosmo logy, Theology and Interpretation. 26 Zu Göttern bei Platon vgl. F. Solmsen Plato’s Theology, und bes. G. Van Riel, Plato’s Gods. 25
194
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
das Universum erschaffen hat. Der berühmte Demiurg des Timaios erfüllt dabei unzweifelhaft Funktionen, die seit den Vorsokratikern mit dem Göttlichen verbunden sind; er gilt als Prinzip des Universums und als Gott.27 Darüber hinaus spricht der Timaeus auch von den niedrigen Göttern (40D-E), offensichtlich den traditionellen Göttern (40E-41A), vor denen der Demiurg eine Rede hält (41Af.).28 Versucht also auch Platon, die traditionelle Religion zu ergänzen und zu bereichern? Und wie ist es ihm möglich, die Götter der traditionellen Religion und ein Prinzip der Welt (den Schöpfergott) miteinander zu versöhnen?
2. Gott als Prinzip. Die Theologie der Philosophen Dies sind keine einfachen Fragen und in der Forschung werden sie kontrovers diskutiert. Sollte man zwischen der Theologie und Gottes vorstellung der Philosophen und der gemeinen Theologie und den Gottesvorstellungen der traditionellen Religion scharf unterscheiden? Die Theologie der Philosophen wird von vielen Autoren als ein Teil der Metaphysik gesehen, die mit der populären Gottesvorstellung und traditionellen Theologie wenig bis nichts zu tun habe. Eine Anfangsplausibilität erhält diese Position durch die Bestätigung, die man für sie bei Aristoteles finden kann. Er unterscheidet zwischen der Theologie der Dichter (theologêsantas, Met. A, 983b29) und der Theologie der Physiologen (philosophêsantas, 983b2, b6, b9), d. h. der (Natur)philosophen, die nach den Prinzipien (archai) suchen. Aristoteles unterscheidet noch eine weitere Kategorie, die der Dichter, die »gemischt haben‟ (Met. N, 1091b8) und das traditionelle Bild der Götter mit einer Untersuchung nach den Prinzipien verbinden, wie die Philosophen (Met. N, 1091a33–35). Ein solcher Dichter war Pherekydes (1091b9), der Lehrer des Pythagoras. Nach der Meinung einiger Forscher hat Platon versucht, dieses Projekt weiterzuführen. Die These lautet weiter, dass Platon die populäre Theologie der alten Dichter durch eine philosophische Theologie, d. h. Metaphysik, zu ersetzen versucht habe. Aber trifft dies auch zu? Wenn er einem »gemischten Ansatz‟ folgt, wollte er dann nicht vielmehr traditionelle Theologie 27 28
S. hierzu C. O’Brien, The Demiurge in Ancient Thought. S. hierzu L. Brisson, »What is a God according to Plato?«.
195
George Karamanolis
und Metaphysik verbinden? Wie wir soweit gesehen haben, war es möglich, populäre Theologie und philosophische Theologie zu verbinden, weil der Übergang eher fließend als trennscharf war. Man kann diese Frage folglich nicht einfach mit »ja« oder »nein« beantworten. Welche Elemente Platon verbindet respektive ersetzt, müsste man im Detail betrachten. Fest steht: Platon ist der Erste, der eine synthetische Darstellung über Gott und Religion anbietet. Was hat ihn dazu veranlasst? Mit seiner Einstellung zur Religion reagiert Platon auf eine besondere Herausforderung. Die Sophisten argumentierten für die These, dass Religion konventionell und eine menschliche Erfindung sei. Denker wie Prodikos und Protagoras sind die Ersten, die für eine anthropologische Erklärung der Religion eintreten. Ihre These lautet, die Menschen seien zu Göttervorstellungen gekommen, auf Grund vieler unerfüllter, nie enden wollender Wünsche, Begierden und Bedürfnisse. Für sie sind die Götter ein fiktives Mittel im all täglichen Kampf um die Erfüllung ihrer Hoffnungen und Wünsche sowie Bewältigung ihrer Sorgen. Prodikos zufolge sollten wir auf alle diese Geschichten über die Götter verzichten. Doch warum? Es ist für uns schwer zu beurteilen, inwieweit die alten Griechen den Göttergeschichten der Mythen Glauben schenkten.29 Doch wir wissen, dass sie sie akzeptierten, und, wie ich oben ausgeführt habe, waren diese Geschichten nicht nur Teil ihres Alltags, sondern durch ziehen tragende Aspekte der hellenischen Kultur. Vielleicht ist es diese Inkonsistenz unkritisch in Kauf genommener Überzeugungen, die Prodikos kritisiert. Jedenfalls ist durch viele Quellen belegt, dass Prodikos eindeutig die These vertreten hat, dass die Götter menschliche Erfindungen sind. Prodikos wurde in der Antike ein Werk mit dem Titel Über Götter (Peri theôn) zugeschrieben (wie auch Protagoras).30 Wichtigste Quelle dieser Zuschreibung ist Philodem, ein Epikureer, der im 1. Jh. v. C. lebte und ein Werk Über Frömmigkeit (Peri eusebeias) geschrieben hat. Philodems Interesse an Prodikos Werk rührt vielleicht daher, dass auch die Epikureer eine den zeremoniellen Praxen kritisch gestimmte Auffassung der Religion vertreten. Sie behaupten, dass die Götter keine Rolle im menschlichen Leben spielen oder spielen können; dass Vgl. P. Veyne, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?. Zu Prodikos vgl. R. Mayhew, Prodicus the Sophist: Texts, Translations, and Com mentary.
29
30
196
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
es sich mit der Annahme, es gäbe eine solche Rolle der Götter für die conditio humana, um eine menschliche Erfindung handle. Die Epiku reer behaupten aber nicht, dass die Götter an sich menschliche Erfin dungen sind, nur dass die ihnen zugeschriebene Rolle eine Erfindung ist. Doch hier geht Prodikos weiter als die Epikureer. Er behauptet nicht nur, dass Menschen ihre Beziehungen zu den Göttern fingieren, sondern vertritt – modern gesprochen – eine Projektionstheorie: Der Mensch hat seine Einstellungen vergöttlicht – Begierden, Naturkräfte wie das Meer, soziale Institutionen wie die Liebe oder Ideale wie die Gerechtigkeit. Und auf diese Weise seien die Götter entstanden:31 »Prodikos sagte, dass die Götter, an die die Menschen glauben, nicht existieren und er selbst sie nicht akzeptiert, und er meint, dass die älteren Generationen die Früchte der Erde und alle nützlichen Sachen vergöttlicht haben.« (Philodem, Über Frömmigkeit, S. 71 Gomberz) Obwohl Prodikos in der Antike als Atheist galt, ist alles andere als sicher, ob das stimmt. Setzte Prodikos vielleicht Xenophanes‘ Kritik an den traditionellen Vorstellungen von den Göttern einfach fort? Das Phänomen des Atheismus ist jedenfalls in der Antike eigentlich sehr selten. Um die These von Prodikos‘ Atheismus zu erhärten, müsste man bestimmen, was man hier genau unter »Atheis mus« versteht.32 Als Atheist wurde in der Antike beispielsweise auch Protagoras bezeichnet (Fr. 4 DK). Doch heute würden wir Protagoras wohl eher als Agnostiker einstufen. Und im Unterschied zu Prodikos, der lediglich behauptet, dass die Götter Erfindungen seien, vertritt Protagoras eine skeptische, agnostische Position. Laut den antiken Quellen war für ihn weder sicher, ob Götter existierten noch ob wir Kenntnis von ihnen erlangen können: Über die Götter allerdings habe ich keine Möglichkeit zu wissen, weder dass sie sind, noch dass sie nicht sind, noch, wie sie etwa an Gestalt sind; denn vieles gibt es, was das Wissen hindert: die Nichtwahrnehmbarkeit und dass das Leben des Menschen kurz ist. (Fr. 4 DK)
Auch Platon stellt Protagoras als Relativist und Skeptiker dar. In dem nach ihm benannten Dialog Platons erzählt Protagoras einen berühmten Mythos über Prometheus.33 Laut dieser Geschichte hat Prometheus das Feuer von den Göttern gestohlen und den Menschen Vgl. Sextus Empiricus, Adv. Math. IX.39. Vgl. dazu M. Winiarczyk, »Methodisches zum antiken Atheismus«; J. N. Bremmer, »Atheism in Antiquity«. 33 Vgl. Cicero, De nat. deorum I.63. 31
32
197
George Karamanolis
gebracht – ein Geschenk, das den Menschen ermöglicht, Künste zu entwickeln und besser zu leben. Trotzdem bleiben die Menschen schwächer als die Tiere und müssen deshalb zusammen in Gemein schaften leben. Doch selbst das reicht nicht aus, die Schwäche und Not der Menschen zu überwinden. Aus Mitleid schenkte Zeus ihnen deshalb die politische Kunst und beteiligt die Menschen auf diese Weise an den Vorteilen der göttlichen Natur. Das hat zur Folge, dass die Menschen nun denken, sie seien wie die Götter weise und von derselben Natur. Darin wiederum gründet laut Protagoras ihr Glaube an die Götter. Also hat die Religion und der Glaube an die Existenz von Göttern Protagoras zufolge seine Wurzeln im politischen Zusammenleben der Menschen und daraus erwachsenen Überzeugungen im Hinblick auf die menschliche Natur. Wie deutlich sein sollte, bedeutet das nicht, dass Protagoras mit den traditionellen Vorstellungen von den Göttern übereinstimmte. Im Gegenteil bietet er eine genealogische und deflationäre Auffassung an. Obwohl, wie ich gesagt habe, die Phänomene in der Antike wenig verbreitet sind, argumentiert Plato in den Gesetzen stark gegen Atheismus und Agnostizismus.34 Um dies zu erklären, muss man sich daran erinnern, dass Sokrates der Unfrömmigkeit angeklagt wurde (Apologie 24B-D, 27C-D). Der Vorwurf lautete, dass »er an Götter glaubt, die die Stadt nicht verehrt und dass er neue Götter in die Stadt einführt« (Apologie 24B). In den Gesetzen will Platon zeigen, worin Frömmigkeit besteht, was als Atheismus zu verstehen ist und zu welchen Konsequenzen beide führen. Die Gesetzgeber dürfen ihm zufolge die religiösen Traditionen der Stadt nicht ändern, weil der Bereich der Götterverehrung nicht zur Politik gehört. Dessen ungeachtet ist die Götterverehrung von entscheidender Bedeutung für die Glückseligkeit der Bürger und das Wohl der Stadt insgesamt. Deshalb stellt Platon in den Gesetzen einen engen Zusammenhang zwischen Religiosität und Sittlichkeit auf der einen und Atheismus und Immoralität auf der anderen Seite her: Und so mag denn folgende leidenschaftslose Vorerinnerung an die Leute ergehen, deren Gemüt so verderbt ist, und wir wollen allen Zorn unterdrücken und in aller Sanftmut, als ob ein Einzelner von ihnen vor uns stände, ihn folgendermaßen anreden: Mein Sohn, du bist noch jung, und der Fortschritt der Zeit wird dich lehren über viele Dinge ganz anders, ja gerade entgegengesetzt zu denken als jetzt. Warte also 34
Vgl. weiters R. Mayhew, »The Theology of the Laws«.
198
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
doch so lange bevor du über die allerwichtigsten aburteilst. Denn das Wichtigste ist gerade da, was du jetzt für Nichts achtest, nämlich eine richtige Vorstellung vom Göttlichen, weil ihr Besitz allein die wahre Glückseligkeit und ihr Mangel das wahre Elend hervorbringt (Gesetze 888AB; Übers. Schleiermacher-Hülser)
Wie aus dem Passus deutlich wird, ist Platon zufolge die Glückselig keit eng mit der richtigen Vorstellung vom Göttlichen verbunden. Doch wie genau, sollte man fragen. Bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich hier unterstreichen, dass Platon gegen den Atheismus und den Skeptizismus bezüglich der Götter argumentiert, trotz der Tatsache, dass er die traditionelle Theologie der antiken Dichter im Staat kritisiert hat. Wir verstehen jetzt, dass diese Kritik Platons keine atheistische oder skeptische Einstellung impliziert. Im Gegenteil, plädiert Platon, wie früher Xenophanes und Heraklit, für eine richtige Vorstellung vom Göttlichen. Darüber hinaus spielt das Göttliche für Platon eine wichtige Rolle in der Erreichung der Glückseligkeit, wie die oben zitierte Stelle zeigt, und die Frage, die ich schon aufgeworfen habe, ist aus welchen Gründen. Die Antwort ist m. E. im Zusammenhang seiner Auffassung dessen zu suchen, was Menschen zum guten Handeln bewegt. Die richtige Vorstellung vom Göttlichen ist die, die uns zu tugendhaften Tätigkeiten motiviert. Das Leben der Tugend ist für Platon nicht weniger als das Wesen der Glückseligkeit. Was wir demgemäß an den Göttern verehren sollten, sind nicht die Liebesgeschichten, die wir von Homer hören, sondern die Tatsache, dass sie verantwortlich für Ordnung und Schönheit der Welt sind. In dem Maße also, in dem die Tugend der Götter für Menschen zum Vorbild werden kann, fördern richtige Vorstellungen von den Göttern Moralität und Glückseligkeit. Platons Auffassung nach impliziert Moralität Götterverehrung, aber nicht umgekehrt. Z. B. ist der Euthyphron des gleichnamigen Dialogs religiös, nicht aber tugendhaft. Seine Auseinandersetzung mit Sokra tes über die Natur der Frömmigkeit zeigt, dass er jedenfalls keine Ahnung hat, was Frömmigkeit eigentlich ist. In den Gesetzen erhalten wir eine Antwort auf diese Frage: Frömmigkeit ist das rechte Maß zu kennen, d. h. sich der Tatsache bewusst zu sein, dass Gott das Maß ist und nicht der Mensch – wie Platon das protagoreische »Maß aller Dinge« richtigstellt. Denn die Welt wird durch Gott verwaltet und gelenkt, und die Menschen müssen nach dieser göttlichen Weis heit streben.
199
George Karamanolis
Kern dieser Aussage ist es, dass es das Ziel des menschlichen Lebens ist, Gott zu ähneln. Explizit finden wir dies auch im Theätet (176b) und Timaios (90b) formuliert.35 In dem sogenannten »Exkurs« des Theätet finden wir auch die direkte Zurückweisung der These des Protagoras: nicht der Mensch ist das Maß (aller Dinge), sondern Gott. Von der richtigen Vorstellung der Götter hängt also nicht weniger als unser Glück ab, in dem Maße, in dem wir uns die Götter zum Vorbild nehmen und ihnen durch die Tugenden ähnlich werden.
3. Gott als Muster menschlichen Lebens Dieses von Platon formulierte Ideal finden wir auch bei Aristoteles und den Stoikern sowie später bei den Neuplatonikern wieder. Die Frage ist aber, was genau damit gemeint sein könnte. Das ist insofern wichtig, als diese theologische Dimension und der religiöse Aspekt der antiken Ethik in zeitgenössischen Interpretationen kaum Beach tung finden. Auch die systematisch an Aristoteles und die Stoiker anknüpfende Tugendethik äußert sich kaum dazu. Ein Grund dafür ist sicher, dass sich die moderne Ethik als säkular und von Religion und Theologie unabhängig verstehen und rechtfertigen will. Aus diesem modernen Erbe eines normativen Distinktionsbedürfnisses fokussieren sich Tugendethiker auf die Rolle, die die Tugend in Hinsicht auf das menschliche Handeln spielt. Doch vielleicht ist diese Einschränkung auf eine handlungsimmanente Dimension der Tugenden voreilig. Denn die Angleichung an Gott (homoiôsis theô) hat keinen direkten Nexus mit Gott oder Göttern und gefährdet damit auch nicht die Unabhängigkeit von Religion und Theologie. Angleichung an Gott bedeutet in der Antike, dass die Menschen nach der Weisheit der Götter streben sollen – das heißt, sie in tugendhaften Eigenschaften nachahmen. Für Platon und die Stoiker ist die Weisheit der Inbegriff der Tugend. Das Ideal der Angleichung des Menschen an Gott, insofern es als Streben des Menschen nach der Weisheit verstanden ist, bedeutet ein Zugeständnis der Überlegenheit Gottes als Maßstab der Weisheit. Damit bleibt es erst einmal frei von weiteren theologischen Bestim 35
Vgl. hierzu D. Sedley, »The Idea of Godlikeness«.
200
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
mungen – auch wenn sich die bei Platon und anderen Vertretern der Angleichung an Gott finden. Der Schöpfergott in Platons Timaios fungiert u.a. als Personifizierung von Weisheit und Wissenschaft. Er instanziiert alle Wissenschaften, die er für die gute Ordnung der neugeborenen Welt verwendet. Auch darin zeigt sich: Gutheit und Weisheit sind für Platon (aber auch Aristoteles und die Stoiker) untrennbar miteinander verbunden. So argumentiert Sokrates bei spielsweise im Euthydemus, dass Gutheit ohne Weisheit unmöglich ist (280a-281e). Die Stoiker übernehmen diese Idee und behaupten, dass Gott gut ist, insoweit er weise ist.36 Weisheit und Gutheit sind – das wird im Fall Gottes besonders deutlich – untrennbar. Das Wesen der Weisheit und der Wissenschaft besteht in der Kenntnis des Guten. Der Schöpfergott des Timaios hat eine gute Welt erschaffen, d. h. eine geordnete und schöne Welt. Dieser Aspekt praktischer Güte des Schöpfungswissens erinnert an die Position des Sokrates aus dem Gorgias. Dort behauptet er, als Wissenschaftler könne gelten, wer ein Wissen gut, d. h. für das Gute der anderen Bürger, anwendet. Das trifft exakt und als Hauptmerkmal auf den Schöpfergott im Timaios zu. Nicht nur hat er die Welt und alles in ihr erschaffen, sondern er hat alles so erschaffen, dass es zum Wohl der Welt und der Lebewesen in ihr ist. Ähnlich ist der Punkt des Verfassers der ps.-aristotelischen De mundo. Er meint, dass die Philosophie nichts mehr als Theologie ist, weil das Wichtigste in der Philosophie für ihn ist, die Hauptursache des Universums zu verstehen, nämlich Gott, d. h. wie Gott durch seine Weisheit alles zum Wohl der Welt und der Lebewesen organisiert und bewahrt hat.37 Ferner wirft Plotin den Gnostikern vor, dass ihre falsche Gottesvorstellung die Betrachtung Gottes und die Angleichung an Gott behindert. (Enn. II.9. 17.24 – 27, vgl. II.9.15.32 – 40). Für die Gnostiker ist der Schöpfergott nicht von Weisheit und Gutheit gekennzeichnet. Das Ideal der Angleichung des Menschen an Gott ist demnach genau genommen ein Streben nach Weisheit und Gutheit. Auch wenn damit ein transformatorisches Ideal formuliert wird, bedeutet ein solches Streben nach Vervollkommnung nicht, dass die Menschen zu Seneca Epist. 66.12: »si ratio divina est, nullum autem bonum sine ratione est, bonum omne divinum est‟. Diese Idee übernehmen weiter die frühen christlichen Philoso phen: vgl. Karamanolis, The Philosophy of Early Christianity, S. 68 f. 37 Hierzu P. Gregoric-G. Karamanolis (Hg.), Pseudo-Aristotle De mundo (On the Cos mos).
36
201
George Karamanolis
Gott selbst werden sollen. Es ist eine Nachahmung von Eigenschaften, kein Streben nach Identität. Wenn Platon und Aristoteles von der Angleichung des Menschen an Gott sprechen, spezifizieren sie nicht, über was für einen Gott sie sprechen. Wie ich früher bemerkt habe, kann Platon mit dem Wort »Gott« ebenso gut auf einen der Götter der traditionellen Religion wie auf den Schöpfergott des Timaios Bezug nehmen, oder auch auf die Welt selbst. Im Timaios lesen wir, dass die Welt ein neuer Gott ist (33b1). In welchem Sinn ist die Welt ein Gott?38 Meines Erachtens ist die Identität hier durch den Begriff der Güte zu explizieren: Die Welt ist ein Gott, insoweit sie ein gutes, weises, denkendes Lebewesen ist, das ewig währt. Mein Punkt hier greift die allgemeine Charakterisierung der griechischen Religion auf: Gott im traditionellen Sinn und Gott im philosophischen Sinn haben so abstrakte und inklusive Merkmale (der Güte) gemeinsam, dass man problemlos über die Angleichung an Gott sprechen kann, ohne präzisieren zu müssen, über welchen Gott man spricht. Oder die Philosophen wollten die traditionellen Götter so transformieren. Sokrates im besonderem hat angeblich für die These argumentiert, dass die Götter essenziel gut sind (Staat 379BC, Apol. 40C). Denn wir wissen, dass die antiken Götter manchmal als böse dargestellt worden sind. In der Tragödie Der gefesselte Prometheus z.B. ist Zeus als böse und gewaltsam präsentiert, während Prometheus, der auch ein Gott ist, als gut und wohlwollend. Wir bemerken also von der Seite der Philosophen eine inklusive Tendenz eines Brückenschlags zwischen traditioneller Religion und philosophischer Theologie. Es ist genau diese Tendenz, die gegen eine Konkurrenz zwischen den beiden spricht und die eher eine Versöhnung der beiden in einer hierarchischen Beziehung erlaubt. Eine solche inklusive Tendenz finden wir auch bei Aristoteles und später prononcierter bei den Stoikern. Aristoteles behauptet, dass der Glaube der Menschen an die Götter bestimmte Ursachen hat, z.B. die Einsicht, dass die himmlischen Körper sich ewig bewegen (vgl. Cicero, De nat. deorum II.95 – 96). Aristoteles weder kritisiert noch verachtet die antike Religion. Im Gegenteil ist er z.B. der Meinung, dass sie eine wichtige politische Rolle spielt (Politik 1322b18f.), und er behauptet, dass die Ablehnung der Götterverehrung in der Polis bestraft werden soll (Topik 105a5–6).39 Zugleich finden wir 38 39
S. dazu L. Brisson, »What is a God according to Plato?«. S. dazu M. Segev, Aristotle on Religion, S. 25–27.
202
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
im Buch Lambda der Metaphysik einen dezidiert philosophischen Kandidaten für die Rolle des höchsten Gottes – Aristoteles‘ berühmten unbewegten Beweger. Ein Geist, der sich selbst denkt, der aber durch seine Anwesenheit und sein Denken, die ganze Welt vernünftig und wohlgeordnet macht. Dieser Gott ist kein Schöpfergott wie der Gott des Timaios, aber auch er ist begriffen als ein Intellekt, der wesentlich gut ist und durch seine Präsenz die Welt in eine Ordnung bringt. Wir bemerken also auch hier in der Betonung der Güte des Göttli chen dieselbe Tendenz bei Aristoteles, die Götter der traditionellen Religion zu integrieren. Gleichzeitig und ohne, dass es Anzeichen für einen Konflikt gäbe, erweitert er diese Position mit seinem eigenen metaphysischen Prinzip des unbewegten Bewegers. Im Unterschied zu Platon oder Empedokles identifiziert Aristoteles also nicht die Götter der traditionellen Religion mit dem Prinzip des Universums. Doch er integriert die traditionelle Religion, indem er ihr vor allem eine politische Rolle zuschreibt. Bei den Stoikern finden wir erneut die Tendenz, die Götter der traditionellen Religion mit dem als göttlich aufgefassten Prinzip des Universums zu identifizieren. Die Stoiker unterscheiden zwei Prinzipien, ein aktives und ein passives Prinzip. Das passive Prinzip identifizieren sie mit der Materie und das aktive Prinzip mit Gott, der die Materie formt. Wie sie betonen, ist ihr Gott nicht transzendent, sondern der Welt und allen sich in ihr befindenden Dingen imma nent.40 Diesbezüglich übernehmen die Stoiker viel von Heraklit. Wie bei Heraklit ist der Gott der Stoiker eine aktive, herstellende Kraft, die verantwortlich ist für die logische, harmonische Zusammenfügung aller Entitäten der Welt. Die Stoiker aber nennen diesen Gott häufig auch Zeus, Athene, Demeter, oder nutzen andere Bezeichnungen der traditionellen Religion. So spricht Chrysipp: Gott sei ein unsterbliches Lebewesen, vernunftbegabt oder ein voll kommenes Geistwesen in Glückseligkeit, das alles Böse abweist, von Fürsorge für den Kosmos und die Dinge im Kosmos erfüllt. Allerdings habe er keine menschliche Gestalt. Gott sei der Schöpfer aller Dinge und gleichsam der Vater vor allem. Das trifft sowohl im Allgemeinen auf ihn zu als auf den Teil von ihm, der alles durchdringt, das seinen Wirkungen entsprechend mit vielen Namen bezeichnet wird. Denn man nennt ihn Dia, weil durch ihn (di‘ hôn) alles ist, Zena, weil er Urheber des Lebens (zên) ist oder das Leben durchdrungen hat, 40
Zur Theologie der Stoiker vgl. K. Algra, »Stoic Theology«.
203
George Karamanolis
Athena, weil das Hegemonikon [der führende Teil der Seele] bis in den Äther ausstrahlt, Hera, weil er in der Luft (aêr), Hephaistos, weil er im schaffenden Feuer, Poseidon, weil er im Wasser und Demeter, weil er in der Erde wirksam ist. Auf ähnliche Weise haben sie ihm auch die anderen Bezeichnungen gegeben, indem sie diese aus irgendeiner besonderen Wirkungsweise herleiten. (Stoicorum Veterum Fragmenta [SVF] II.1071)
Auch für Zenon von Kition, den Begründer der Stoa, finden wir ähn liche Belege: »Gott sei eine Einheit, sei Vernunft und schicksalhafte Vorbestimmung und werde ›Zeus‹ genannt und sonst noch mit vielen Namen bezeichnet. Darüber spricht Zenon in seiner Schrift ›Über das All‹.« (SVF II.1021). Locus classicus für die stoische Gottesauffassung ist der ZeusHymnus des Kleanthes, den ich früher erwähnt habe. Bei Kleanthes zeigen sich deutliche Parallelen zu Heraklit, der den höchsten Gott und das höchste Prinzip ebenfalls bereits »Zeus« nennt (Fr. B 32 DK): Erhabenster, aller Unsterblichen, mit vielen Namen Gerufener Allmächtiger für alle Ewigkeit, Zeus, Schöpfer der Natur, der du alles mit deinem Gesetz lenkst, dich grüße ich. (SVF I.537) Wie diese wichtigen Stellen belegen, ist also die Tendenz, die tradi tionellen Götter mit den göttlichen Prinzipien des Universums zu verbinden, bei den Stoikern besonders ausgeprägt. Dahinter steht ein systematischer Gedanke: Götter(namen) mit entsprechenden Leistungen zu korrelieren. Der Stoiker Cornutus (1. Jh. n. Chr.) hat ein Werk zur griechischen Theologie abgefasst, in dem er versucht die Namen der antiken Götter mit ihren angeblichen Leistungen vereinheitlichend zu verbinden. Cornutus zufolge ist Zeus z.B. der Gott des Lebens, wobei er davon ausgeht, dass Zeus von dem Verb zên (=leben) abzuleiten ist. Er vertritt eine Art sprachlichen Naturalismus, demzufolge die Namen der traditionellen Götter Rückschlüsse auf ihre Leistungen zulassen.41 Diese Tendenz, traditionelle Götter mit göttlichen Prinzipien des Universums zu verbinden, wird besonders deutlich in der letzten Phase der antiken Philosophie, bei den sogenannten Neuplatonikern. 41 Vgl. G. Boys-Stones, L. Annaeus Cornutus: Greek Theology. Fragments and Testimo nia.
204
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Hier verzeichnen wir das interessante Phänomen, dass die traditionel len Götter philosophisch uminterpretiert werden. Die Neuplatoniker erarbeiten eine philosophische, oft allegorische Interpretation der Dichtung, insbesondere von Homer und Hesiod.42 Ein bekanntes Beispiel ist Porphyrius‘ De antro nympharum in der er, wie der Titel ankündigt, die Nymphengrotte aus dem 13. Buch der Odyssee (Buch 13) aufgreift und als eine Allegorie auf die Seelenwanderung versteht. Die Vermutung liegt nahe, in solchen und anderen Umdeu tungen den Versuch seitens der Neuplatoniker zu sehen, den Geist der antiken Kultur gegen das erstarkende Christentum zu verteidi gen. Daher liegt der Fokus nicht wie bei Platon auf einer Kritik Homers, sondern darauf, durch eine allegorische Interpretation den Wert der homerischen Tradition herauszuarbeiten. Die Neuplatoniker sind der Auffassung, dass auch Homer richtig interpretiert einen philosophischen Punkt zur Natur der Götter zu machen hat, den es interpretatorisch zu entdecken gilt. Im Hintergrund steht damit die Annahme, dass auch die traditionellen Vorstellungen von den Göt tern, wenn richtig interpretiert, richtig sind. Demgegenüber stehen christliche Autoren, die das Gegenteil behaupten und ihre Kritik der traditionellen Vorstellungen von den Göttern auf Vorsokratiker wie Xenophanes und Heraklit stützen. Sie behaupten, dass die paganen Vorstellungen der Götter falsch sind und erst die neue christliche Religion eine wahre Gottesvorstellung ermöglicht. Schließlich lohnt es sich, die epikureische Auffassung von Göt tern mit der christlichen Einstellung zu kontrastieren. Die Epikureer behaupten, wie die Christen, dass die traditionellen Vorstellungen über die Götter falsch sind. Wie ich früher bemerkt habe, plädieren sie für die These, dass die Götter keine kausale Rolle in der Welt spielen können, deshalb sollen wir keine Angst vor den Göttern haben. Trotzdem lehnen die Epikureer weder die Existenz der Götter ab, noch sprechen sie gegen die traditionellen religiösen Feste und Kulte. Im Gegenteil bestätigen sie die Existenz der Götter, und sie versuchen auch ihren Alltag zu beschreiben.43 Auch in diesem Fall ist die philosophische Theologie nicht in Konkurrenz zu der antiken Religion. Auch die Epikureer versuchen, die traditionellen Göttervor stellungen zu integrieren. S. dazu Lamberton, R., Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition. 43 S. dazu H. Essler, Glückselig und unsterblich. Epikureische Theologie bei Cicero und Philodem. Mit einer Edition von PHerc. 152/157 kol. 8–10. 42
205
George Karamanolis
Ich habe für die These argumentiert, dass philosophische Theo logie und Religion zwei unterschiedliche, aber kompatible Bereiche bestimmen. Dies ist aber nicht immer der Fall. Die meisten antiken Philosophen haben versucht, die traditionelle Religion zu integrieren und transformieren und gleichzeitig nach dem wahren Wesen des Göttlichen zu suchen. Es ist aber wahr, dass die Philosophen oft als Gegner der antiken Religion und der antiken Polis betrachtet worden sind. Die Verurteilung Sokrates‘ wegen Unfrömmigkeit ist exempla risch (Apol. 24B, Xenophon, Mem. 1.1.1). Angeblich hat Sokrates behauptet, dass er die Existenz der Götter akzeptiert, aber er hat nicht bestimmt, welche diese Götter sind. Xenophon stellt Sokrates in seiner Apologie als einen guten Götterverehrer dar (Apol. 11, vgl. Mem. 1.1.2).44 Aristophanes hingegen präsentiert Sokrates in Wolken nicht nur als einen Sophisten, sondern auch als Gegner der traditionellen Götter (247–8) und als Verehrer von neuen Göttern, wie Chaos, die Wolken, die Zunge (Wolken 427, 627, 814, 1150). Auch Aristoteles wurde für Unfrömmigkeit verurteilt und ist deswegen aus Athen nach Chalkis umgezogen, obwohl wir die Einzelheiten dieser Geschichte nicht gut kennen.45 Diese Tatsachen weisen darauf hin, dass die Polis sich der Transformation der traditionellen Religion durch eine philo sophische Theologie manchmal entgegengestellt hat, wahrscheinlich weil die Polis traditionelle Religion und philosophische Theologie als Konkurrenzunternehmen wahrgenommen hat.
Schluss Ich möchte mit drei Bemerkungen schließen, die aus der Diskussion folgen. Erstens erweist sich die antike Religion als relativ flexibel und tolerant und das in mehrerer Hinsicht. Wie wir gesehen haben, kennt sie keine fixierte Gruppe von Gottheiten; weitere Gottheiten könnten jederzeit anerkannt und integriert werden. Es ist hier bemerkenswert, dass der römische Kaiser Maximin Daia (308–313), verantwortlich für heftige Verfolgungen gegen die Christen, am Ende den christlichen Gott akzeptierte und ihm Ehre gab (Eusebius, Historia Ecclesiastica S. hierzu R. Parker, Athenian Religion, Kap. 10 mit dem Titel »The Trial of Socrates: And a Religious Crisis?«, S. 199–218. 45 Die relevante Quellen sind Diogenes Laertius V.5 – 6, Athenaeus, Deipnosophistai XV, 696A.
44
206
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
IX.10.6). Ebenso war die antike Religion nicht mit einer bestimmten Lehre oder systematischen Ansichten über das Göttliche verbunden. Im Allgemeinen hat die antike Religion eher den Charakter einer offenen Form der Götterverehrung, die keinen Anspruch auf Verbind lichkeit des Credos und der Orthodoxie hegt (auch wenn einige Gruppen wie die Orphiker hier eine Ausnahme darstellen). Deshalb können selbst noch die radikal skeptischen Pyrrhoneer ohne Religi onskritik auftreten, weil religiöse Überzeugungen mit keinem Wahr heitsanspruch einhergehen – es kostet nichts sie zu akzeptieren.46 Das hat den großen Vorteil, dass die antike Religion die Entwicklung von philosophischen Ansichten über Gott und das Göttliche nicht nur erlaubt, sondern geradezu heraufbeschwört. Man kann hier von zwei Einstellungen reden, eine doxastische und eine reflektive, die miteinander nicht nur kompatibel, sondern auch komplementär sind. Die Tatsache, dass die antiken Philosophen abstrakte und kompli zierte Theorien über Gott, seine Leistung und seine Natur formuliert haben, die aber in keinem Konflikt mit der traditionellen Religion standen, ist dafür der beste Beweis. Vielmehr beobachten wir, dass Philosophen wie Empedokles, Platon, die Stoiker und viele Neuplato niker systematisch versuchen, die traditionelle Theologie mit eigenen philosophischen Theologien zu versöhnen oder zu überformen. Egal wie unterschiedlich dieses Projekt verwirklicht wurde, ist es wichtig, dass die antike Religion kein Hindernis für die Entwicklung der Phi losophie darstellte, sondern ihre Entwicklung beförderte. Die antike Religion lässt philosophische Fragen offen und unbeantwortet. Ferner könnte man behaupten, dass die antike Religion und die Begrün der ihrer kanonischen, panhellenischen Formulierung, Homer und Hesiod, in ihren Schriften vielmehr eine Reihe von Fragen implizit stellen, aber nicht beantworten. In diesem Sinne unterscheidet sich die antike Religion stark von dem modernen und zeitgenössischen Begriff der Religion. Der Philosophie eröffnet so Leerstellen, die es auszufüllen gilt. Zweitens lässt sich festhalten, dass die antike Religion nicht einfach als eine polytheistische Religion klassifiziert werden sollte, sondern eine Religion, die die Götter hierarchisiert. Schon in den homerischen Gedichten spielt Zeus eine eminente Rolle. Er entschei det in letzter Konsequenz, was sich ereignen wird, und andere Götter können lediglich intervenieren, soweit er zustimmt. In der Entwick 46
S. hierzu A. Long, »Scepticism about Gods«.
207
George Karamanolis
lung tritt dieser hierarchische Aspekt der Götterwelt immer deutlicher zutage: Aeschylus, der Derveni-Papyrus, aber beispielsweise auch der Stoiker Kleanthes machen deutlich, dass es an der Spitze der Hierarchie nur einen Gott geben kann, egal wie wir ihn nennen. Es handelt sich hier um einen Topos und eine populäre Ansicht, die von Philosophen übernommen werden konnte. Von Beginn an sprechen alle Philosophen von einem Gott als Hauptursache oder -prinzip. Das ist aber vereinbar mit der Existenz von weiteren Göttern.47 Das Christentum hingegen sieht einen starken Kontrast und betont die Unvereinbarkeit von Poly- und Monotheismus. Doch das Beispiel der antiken Religion zeigt vielmehr, dass dieser Kontrast überzeichnet ist und dazwischen eine Reihe von Möglichkeiten liegen. Auch auf Basis verschiedener philosophischer Auffassungen finden sich in der Spätantike Anhänger verschiedener Ausprägungen des Monotheis mus. Um diesem Unterschied zum christlichen bzw. adamitischen Monotheismus gerecht zu werden, ist die antike Religion auch als henotheistisch bezeichnet worden. Der zentrale Punkt ist, dass es sich hier um eine Religion handelt, die zwar eine Vielheit und Hierarchie von Gottheiten annimmt, an deren Spitze allerdings ein Gott steht – ein für die Philosophie produktives Ausgangsmuster. Drittens ist auffallend, dass die antike Götterverehrung eine irreduzible ethische und politische Dimension hat. Das Göttliche gilt als ein Maßstab der Weisheit und des Guten für die Menschen. D. h. es hat den Charakter eines Musters oder Ideals, dem die Menschen folgen und das sie in ihrem Verhalten imitieren sollten. Natürlich sind die Götter in Homer oder auch in der Tragödie manchmal als böse dargestellt. Es ist genau diese Vorstellung der antiken Religion, die die Philosophen transformieren wollen, und deshalb weisen sie auf göttliche Prinzipien hin, die verantwortlich für die Gutheit und Ordnung des Universums sind. Aus diesem Grundgedanken heraus versteht sich auch, wie Frömmigkeit als eine Art Tugend zu verstehen ist, die eng mit Weisheit verbunden ist. Gott exemplifiziert die Verbindung von Weisheit und Güte. Und dies ist das Ideal, das die Menschen erstreben, um ein glückliches Leben zu führen. In diesem Sinne ist Gott für die antiken Philosophen das Muster des guten Lebens und der Glückseligkeit. Bei dieser Auffassung haben die Christen große Anleihen gemacht. Doch haben sie, anders als die 47 S. dazu die Aufsätze des Bandes von M. Frede, P. Athanassiadi (Hg.), Monotheism in Late Antiquity.
208
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
antiken Philosophen, begonnen, Gott mit dem Ideal zu identifizieren, während die Besonderheit der antiken Religion und Philosophie darin bestand, zugleich die Differenz von Gott und Ideal in der Funktion eines Musters, das die Menschen inspirieren kann, präsent zu halten.
Literaturverzeichnis Aleshire, S. B., The Athenian Asclepeion. The People, their Dedications, and the Inventories, Amsterdam: J. C. Gieben 1989 Algra, K., »Stoic Theology«, in: B. Inwood (Hg.), The Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge: Cambridge University Press 2003, S. 153–178 Ando, C., »Interpretatio Romana«, in: Classical Philology 100 (2005), S. 41–51 Athanassiadi, P., Frede, M. (Hg.), Pagan Monotheism in Late Antiquity, Oxford: Oxford University Press 1999 Bremmer, J. N. »Atheism in Antiquity«, in: M. Martin (Hg.), The Cambridge Companion to Atheism, Cambridge: Cambridge University Press 2006, S. 11–26 Brisson, L., »What is a God according to Plato?«, in: K. Corrigan, J. Turner (Hg.), Platonisms Ancient, Modern and Postmodern, Leiden: Brill 2007, S. 41–52 Boys-Stones, G., L. Annaeus Cornutus: Greek Theology. Fragments and Testimo nia, Atlanta: SBL Press 2018 Broadie, S., »Rational Theology«, in: A. Long (Hg.), The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press 1999, S. 205–224 Burkert, W., Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, 2., überarb. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer 2011 Coldstream, J. N. »Greek Temples: Why and Where«, in: P. Easterling, J. Muir (Hg.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press 1985, S. 67–97 Drees, L. Olympia: Gods, Artists, Athletes, London: Pall Mall Press 1968 Easterling, P., Muir, J. (Hg.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press 1985 Easterling, P., »Greek Poetry and Greek Religion«, in: P. Easterling, J. Muir (Hg.), Greek Religion and Society, Cambridge: Cambridge University Press 1985, S. 35–66 Edelstein, E., Edelstein, L., Asklepius. A Collection and Interpretation of the Testimonies, Baltimore: Johns Hopkins Press 1945 Eidinow, E., Kindt, J. (Hg.), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, Oxford: Oxford University Press 2015 Essler, H., Glückselig und unsterblich. Epikureische Theologie bei Cicero und Philodem. Mit einer Edition von PHerc. 152/157 kol. 8–10, Basel: Schwabe 2011 Frede, D., Laks, A. (Hg), Traditions of Theology: Studies in Hellenistic Theology, its Background and Aftermath, Leiden: Brill 2002
209
George Karamanolis
Gregoric, P., Karamanolis, G. (Hg.), Pseudo-Aristotle De mundo (On the Cosmos), Cambridge: Cambridge University Press 2020 Jaeger, W., The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford: Clarendon Press 1947 Karamanolis, G., The Philosophy of Early Christianity, London: Routledge 2021, 2. Aufl. Laks, A., »Mind’s Crisis: On Anaxagoras’ NOUS«, in: The Southern Journal of Philosophy 31 (1993), S. 19 – 38 Lamberton, R., Homer the Theologian: Neoplatonist Allegorical Reading and the Growth of the Epic Tradition, Berkeley: University of California Press 1986 Lawson E., McCauley, S., Rethinking Religion. Connecting Cognition and Culture, Cambridge: Cambridge University Press 1990 Lloyd, H. L., The Justice of Zeus, Berkeley: University of California Press 1983 Long, A., »Scepticism about Gods«, in: A. Long, From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Oxford: Clarendon Press 2006 Mayhew, R., »The Theology of the Laws«, in: C. Bobonich (Hg.), Plato’s Laws. A Critical Guide, Cambridge: Cambridge University Press 2010, S. 197–216 Mayhew, R., Prodicus the Sophist: Texts, Translations, and Commentary, Oxford: Oxford University Press 2011 Nilson, M. P., Geschichte der griechischen Religion, Bde. I-II, München: C.H. Beck 1955-1961 Nörenberg, H. W., Das Göttlich und die Natur in der Schrift Über die Heilige Krankheit, Bonn: Habelt 1968 Parker, R., On Greek Religion, Ithaca: Cornell University Press 2011 Parker, R., Polytheism and Society in Athens, Oxford: Oxford University Press 2007 Pichard-Cambridge, Α. W., The Dramatic Festivals of Athens, Oxford: Clarendon Press 1988, 2. Aufl. Price, S., Religions of the Ancient Greeks, Cambridge: Cambridge University Press 1999 Rowett, C., »Love, Sex and the Gods: Why Things Have Divine Names in Empe docles’ Poem, and Why They Come in Pairs«, in: Rhizomata, 4 (2016), S. 80–100 Russell, B., Why I am not a Christian, London: George Allen & Unwin 1957 Sedley, D., »The Idea of Godlikeness«, in: G. Fine (Hg.), Plato 2: Ethics, Politics, Religion, and the Soul, Oxford University Press 1999, S. 309–328 Segev, M., Aristotle on Religion, Cambridge: Cambridge University Press 2017 Solmsen, F., Plato’s Theology, Ithaca: Cornell University Press 1942 Sourvinou-Inwood, C. »Tragedy and Religion: constructs and readings‟, in: C. Pelling (Hg.), Greek Tragedy and the Historian, Oxford 1997, S. 161–186 Sourvinou-Inwood, C., »What is Polis Religion?«, in: R. Buxton (Hg.), Oxford Readings in Greek Religion, Oxford: Oxford University Press 2000, S. 13–37 Sourvinou-Inwood, C., Tragedy and Athenian Religion, Lanham: Lexington Books 2003 Winiarczyk, M. »Methodisches zum antiken Atheismus«, in: Rheinisches Museum für Philologie 133 (1970), S. 1–15
210
Gott und Religion im Denken der antiken Philosophen
Van der Eijk, P., »The ›Theology‹ of the Hippocratic Treatise On the Sacred Disease«, in: Apeiron 23 (1990), S. 87–119 Van der Eijk, P., „›Airs, Waters, Places‹ and ›On the Sacred Disease‹: Two Diffe rent Religiosities?«, in: Hermes 119 (1991), S. 168–176 Van Riel, G., Plato’s Gods, Surrey: Ashgate Publishing 2013 Veyne, P., Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, Paris: Editions du Seuil 1983
211
Michael Kühnlein
Konversion statt Konsens? Charles Taylor über die Vernünftigkeit der Moderne
Philosophiegeschichten entwickeln ihren begrifflichen Reiz vom Ende her. Denn erst zum Schluss zeigt sich, ob die erzählte Geschichte denn nun wirklich zu jener gegenwartsbestimmenden Vernunft hinführt, deren Wirklichkeit genealogisch immer schon unterstellt wird. Dieser Zusammenhang von Genealogie und Geltung ist das dramaturgische Lebenselixier, von der jede Philosophiegeschichte zehrt: Wie aberwit zig wäre auch eine Vorstellung, dass Geschichten von transzendentalhermeneutischer Reichweite in Geltungskonstellationen mündeten, die zugleich die Logik ihrer Herkunftserzählung außer Kraft setzten? Das kann narrativ nicht funktionieren; es gibt keinen argumentativen Nullpunkt, keinen »Blick von nirgendwo« (Nagel). Sicherlich gab es in der Philosophiegeschichte immer wieder Ver suche, diesen Zirkelvoraussetzungen des Verstehens durch Überhö hung zu entkommen, etwa durch eine Onto-Theologie der Wahrheit, die ihr ganzes Vertrauen auf die prozessuale Einheit von göttlichem und menschlichem Selbstverstehen setzte, wie das in den Hochzeiten des absoluten Idealismus z.B. von Hegel in den Himmel geschrieben worden ist. Damit sollte jeder Zirkel dialektisch verflüssigt werden und Genealogie und Geltung in eins fallen, weil ihre Identität jetzt an der Selbstbewusstwerdung des absoluten Geistes gekoppelt wurde. Die Abfolge der Geschichte entsprach dann in ihrer Entwicklungslogik einer Stufenpräsenz des Absoluten. Doch brachte die ontologische Einebnung der Differenz zwischen Vernunft und Wirklichkeit die Philosophie letztlich nur dazu, ihre eigene Erzählung über das zu Grunde gelegte Geschichtsmaterial triumphieren zu lassen. Denn wenn selbst Widersprüche in den Entwicklungsdynamiken einzelner Epochen als Manifestationen des Guten und Wahren aufgefasst wer den konnten, war jegliche Negativität von vornherein entschärft. Und deshalb musste auch bei Hegel die Geschichte genau dort zu
213
Michael Kühnlein
ihrem notwendigen Ende kommen, wo von einem philosophischen Standpunkt des Absoluten aus der »Endzweck der Vernunft«, also die institutionelle und habituelle Verwirklichung der Freiheit innerhalb einer bürgerlich-republikanischen Gesellschaft,1 erreicht worden ist – ein teurer Preis für eine Philosophiegeschichte, die das Begreifen der Gegenwart Gottes metaphysisch so auflädt, dass Geschichte danach bedeutungslos wird. Nun kann man mit einigem Recht behaupten, dass Hegels onto-theologische Sicht auf Geschichte nicht mehr die unsrige ist; überhaupt hat das Bewusstsein für teleologisch dichte Erklärungsan sätze nachgelassen – auch dort nämlich, wo Hegels metaphysische ›List der Vernunft‹ vollständig säkularisiert worden ist, schwindet das Vertrauen in die Erklärungskraft emanzipatorischer Fortschrittsmo delle: Der Zweifel an einem analytischen Geschichtsverlauf, welcher aus unvordenklichen Anfängen heraus eine Erzähllinie entwickelt, die Motivlagen religionskritisch vereindeutigt und auf eine säkulare Moderne hin verschlankt, ist heute spürbar gewachsen, die Faszina tion für den »Tod Gottes« und die morbide Begeisterung für die Rationalisierung (Nietzsche, Weber) zum Erliegen gebracht.2 Philosophisch hat diese neue Vorsichtigkeit im Umgang mit den »Subtraktionstheorien«3 der Moderne im Wesentlichen wohl zwei Gründe: Zum einen gibt es eine verstärkte Aufmerksamkeit gegenüber den versiegenden Resonanzquellen einer »defätistisch« gewordenen Vernunft (Habermas); zum anderen stellt das gegen wärtige Erstarken der Religion den exklusiven Vernunftanspruch des Säkularen radikal in Frage. Vor diesem Hintergrund ist es wenig verwunderlich, dass gegenwärtige Philosophiegeschichten die Herausforderungen der Vernunft eher in ein postsäkulares Zeitalter überführen wollen, in dem nicht mehr der Abstand zur Religion die Epochenzugehörigkeit entscheidet, sondern vielmehr Normati vität und Geltung über komplementäre Lernprozesse ausgesteuert Vgl. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, S. 29. Vgl. ferner die Hegel-Meditationen von F. Fukuyama über Das Ende der Geschichte. 2 Aus religionssoziologischer Sicht vgl. die exemplarischen Arbeiten von J. Casanova, Public Religions in the Modern World und Europas Angst vor der Religion. 3 Unter ›Subtraktionstheorien‹ versteht Charles Taylor z.B. Deutungen der Moderne, die von einer scheinbar neutralen Beobachterperspektive aus eine naturalisierende Fortschrittsphilosophie entwerfen, in der Vernunft und Säkularität als gemeinsamer Zielpunkt der sozial-evolutionären Entwicklung zusammenfallen. Vgl. Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 48. 1
214
Konversion statt Konsens?
werden. Das ist in etwa die These von Habermas: Freiheit ist nur dann vernünftig, wenn sie die Überzeugungen des Glaubens nicht ›vernichtet‹, sondern für sich ›übersetzt‹. Eine solche Genealogie der Freiheit ist ihrer Struktur nach ›rettend‹ und nicht abwertend wie bei Nietzsche. Aber diese rettende Kritik bleibt bei Habermas auf die kommunikative Vernunft bezogen, denn sie legt zugleich auch die methodischen Bedingungen für den Diskurs zwischen Glauben und Wissen fest.4 Der Glaube ragt zwar in das Wissen hinein und bricht so die Verhärtungen einer säkularistischen Metaphysik auf, doch bleibt er selbst von der Übersetzungsarbeit der Vernunft nicht unberührt und seine ursprünglichen Bedeutungsgehalte wandern ins Allgemeine ab. Säkularisierungskritik ist also auch bei Habermas wei terhin nur im Weltinnenraum einer übersetzenden Vernunft möglich. Ihre Legitimität ist aber eine andere geworden: Sie baut auf eine befreiende, eine rettende Kritik der Religion auf, die ihre Maßstäbe nicht unter den Laborbedingungen einer naturalistischen Genealogie, sondern aus der semantisch-kulturellen Osmose mit einer vorgängi gen Traditionsschuld gewinnt. Ganz anders hingegen sieht die religiöse Verteidigungslinie bei Taylor aus. Er spricht nicht von komplementären Lernprozessen zwischen Glauben und Wissen, sondern er geht von spirituellen ›Optionen‹ aus, die in ihrer Bedeutungsvielfalt miteinander konkur rieren und einander ablösen, nicht aber ineinander übersetzt werden können, gerade weil es sich hier »um Bezugnahmen handelt, die das spirituelle Leben bestimmter Menschen wirklich berühren, das ande rer hingegen nicht«.5 Taylor kritisiert damit einen spezifisch ›postsäkularen‹ Ansatz, der das Verhältnis von Vernunft und Religion in eine Übersetzungshierarchie bringen will, um die bleibende religiöse Irritation unter rationale Kontrolle zu bringen. Doch Taylor lehnt eine solche »Sonderbehandlung« der Religion strikt ab – und das gleich in einem doppelten, umfänglichen Sinne: So plädiert er zum einen für eine strikte Neutralität der öffentlichen Ordnung, die gegenüber allen spirituellen Optionen, seien sie ›religiöser‹, ›säkularer‹ oder generell »Eine Genealogie nachmetaphysischen Denkens, die in der Einstellung eines methodischen Atheismus durchgeführt wird, kann […] als eine Empfehlung verstan den werden, dass sich die Philosophie gegenüber diesem Anregungspotential lernbe reit verhalten solle, ohne allerdings dafür Abstriche am autonomen Gebrauch der Vernunft zu machen.« Vgl. J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Band I, S. 15, Fußnote. 5 Ch. Taylor in »Diskussion. Jürgen Habermas und Charles Taylor«, S. 94. 4
215
Michael Kühnlein
weltanschaulicher Natur, eine prinzipiengeleitete Distanznahme an den Tag legen muss, um »zwischen den verschiedenen Weltanschau ungen ein Höchstmaß an Freiheit und Gleichheit« zu garantieren.6 Ein politisch gleichsam ›von oben‹ verordneter gesellschaftlicher Atheis mus wäre hier also fehl am Platz (von einer sich öffentlichkeitswirk sam in Szene setzenden politischen Theologie ganz zu schweigen). Zum anderen macht Taylor aber auch moraltheoretisch deutlich, dass zwischen Vernunft und Religion keine epistemologisch scharfen Trennlinien verlaufen. Beide Einstellungen drücken nämlich in ihrer Sinnverfasstheit, so Taylor, ›starke Wertungen‹ aus, die ihren Legiti mitätsanspruch nicht aus sich selbst heraus begründen können und deshalb in den expressiven »Bereich des vorgreifenden Vertrauens« führen.7 In dieser Perspektive der transzendental-hermeneutischen Erfahrungskonstitution ist weder Religion noch Vernunft neutral: Religion nicht in Bezug auf Gott, die Vernunft nicht in Bezug auf die Vernünftigkeit ihrer selbst. Modallogisch spricht Taylor daher lieber von Glaubensdispositiven, die in der Moderne frei flottieren – und die einen Wahrheitsapriorismus einzelner Vernunftoptionen erst gar nicht aufkommen lassen, denn es gibt schlichtweg keinen Diskurs, der über eine neutrale Sicht der Dinge verfügte oder ein solches Begriffspanorama im Ergebnis objektiv produzieren könnte.8 Der Standpunkt von nirgendwo (Nagel) ist uns eben nicht zugänglich. Das 6 Ch. Taylor, »Für eine grundlegende Neubestimmung des Säkularismus«, S. 85. An anderer Stelle heißt es bei Taylor klärend: »[W]enn wir unsere Grundrechtecharta aus verschiedenen Quellen zusammenstellen, dann kann sie nicht einfach in einer Bent hamschen oder kantischen Sprache abgefaßt sein, sie kann aber auch nicht in einer christlichen Sprache abgefaßt sein.« Ebd., S. 99. 7 Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 917 f. 8 Transzendental-hermeneutisch ist nämlich auch der Säkularismus auf eigentümli che Weise in die willenstheoretische Expressivität bedeutungsvoll handelnder und die Welt interpretierender Subjekte verstrickt: Auch hier geht es »nur« um eine Ethik, in der der Glaube an die Methodologie der modernen Naturwissenschaften den Gottes glauben ablöst und an seiner Stelle die Rolle der Rechtfertigung übernimmt. Der Szi entismus könne deshalb, wenn man nach Taylor die Begründungsfrage radikalisiert, auch retorsiv widerlegt werden: »Wie kam es, daß sie [die Atheisten, MK] so sicher waren? […] Und was hat diese Menschen dazu veranlasst, das zu glauben? Zwingende Gründe waren es nicht, denn dergleichen gibt es nicht. Es gibt keine Gewähr dafür, daß sich alle Streitfragen, mit Bezug auf die wir ein Credo formulieren müssen, in dieser Weise entscheiden lassen. Der Szientismus selbst setzt einen auf nichts als Glau ben basierenden Sprung voraus.« (Hervorhebung MK). Ch. Taylor, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, S. 704; vgl. Ch. Taylor., Ein säkulares Zeit alter, S. 939 ff.
216
Konversion statt Konsens?
bedeutet im Umkehrschluss, dass wir auch nicht an der Anschauung gehindert werden dürfen, »Gott oder das Gute […] für die beste Erklärung der moralischen Welt des Menschen« zu halten.9 Auf diese in sich verwinkelte Argumentation Taylors habe ich bereits an anderen Stellen aufmerksam gemacht.10 Das will ich hier nicht wiederholen, denn in diesem Beitrag geht es mir vor allem um die daraus resultierenden konzeptionellen Konsequenzen für das Verständnis der Moderne. Im Blick auf Habermas ist ja das Offen sichtliche nicht zu leugnen: Obwohl er sich wie Taylor von der klassischen Säkularisierungsteleologie verabschiedet, ist das Ende seiner Philosophiegeschichte in Bezug auf Religion gerade nicht offen. Im Gegenteil – Habermas Erzähllinie ist ganz auf die Rekonstruk tion eines nicht-metaphysischen Universalismus getrimmt, dessen begründungsfähiges Wissen, im Unterschied zu früher, jetzt auch ›dichte‹ Übersetzungsleistungen von religiösen und metaphysischen Inhalten anerkennen möchte. Diese motivische Verschlingung von Genealogie und Geltung ist von einem besonderen erzählerischen Raffinement, weil sie Habermas dazu befähigt, die Kritik am Säkula rismus mit einer (schwächeren) Teleologie nachmetaphysischen Den kens zu verknüpfen, ohne dafür Religion apriorisch marginalisieren und Vernunft historisch verabsolutieren zu müssen.11 Völlig anders hingegen argumentiert Taylor am Schluss seiner Säkularisierungsgeschichte: Ihm geht es nicht um eine prästabilierte Vernunftharmonie zwischen übersetzendem Medium und übersetz tem Milieu, sondern um die bleibende Herausforderung der Religion für die Moderne, um den Stachel im Fleisch der Vernunft. Die Moderne bleibt fragilisiert, in sich widersprüchlich und spannungsge laden, eben weil es in der Vielfalt der Optionen keine erkenntnistheo retische Beruhigung, keinen übergeordneten Ereignishorizont gibt. Ch. Taylor, Quellen des Selbst, S. 142. Vgl. M. Kühnlein, »Religion als Auszug der Freiheit aus dem Gesetz? Charles Taylor über die Vermessungsgrenzen des säkularen Zeitalters«; ders., »Immanente Ausdeutung und religiöse Option. Zur Expressivität des säkularen Zeitalters (Tay lor)«. 11 Gleichwohl zeigt sich auch Habermas darüber besorgt, wie es um die innere Aus gewogenheit und Unabhängigkeit des nachmetaphysischen Denkens tatsächlich bestellt ist, wenn er danach fragt, ob »es nicht die bekannte imperiale Machtpolitik des Westens nur mit anderen Mittel fort[setzt], wenn es sich auf diese Weise mit einem Neutralitätsanspruch über die Diskursvoraussetzung symmetrischer Beziehungen zwischen gleichberechtigten Teilnehmern hinwegsetzt?« (J. Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie, Band I, S. 134). 9
10
217
Michael Kühnlein
Die Moderne kreist also bei Taylor nicht um ein inneres Zentrum, sondern sie ist immer in Bewegung, dehnt sich nach unterschiedlichen Richtungen ›wellenartig‹ aus und zieht sich wieder zurück, wenn es zu spirituellen Verwerfungen kommt.12 Sie generiert permanent neue Möglichkeiten des ›Sehens‹ in einem expressivistischen Kraftfeld mit einander konfligierender Selbstinterpretationen. In diesem Welten kosmos der schieren Alternativenpluralität, so Taylors feste Überzeu gung, ist aus Beobachtersicht keine normative Hierarchie zwischen Vernunft und Religion apriorisch zu erkennen, denn das würde das interpretatorische Kunststück erfordern, gleichzeitig innerhalb und außerhalb von starken Wertungen argumentieren zu können – doch das ist nach Taylor eine hermeneutische Unmöglichkeit: Der homo narrans kann nicht in ganzheitlichen Bedeutungszusammenhängen eingebunden sein und sie zugleich im Voraus definieren wollen.13 Beachtlich ist aber, dass diese konstitutive ›Verstehensunschärfe‹ in Taylors Beschreibung der Moderne zu keiner Verwässerung oder Relativierung der spirituellen Optionen führt. Vielmehr geht der »Kampf der Glaubensmächte« (Weber) für Taylor ungehindert weiter. Er zeichnet dafür ein kraftvolles Panorama der Moderne, in dem nicht Relativismus und Abgestumpftheit herrschen, sondern in dem die Vielfalt der verfügbaren spirituellen Optionen einen gegenseitigen Resonanzraum bilden, der durchlässig genug ist, um zur Auseinan dersetzung mit der eigenen Position anzuregen. Fragilisierung ver hindert also Relativierung – nur durch den offenen Austausch mit anderen Ideen und Wertüberzeugungen, also durch die Dauerpräsenz starker Wertungen, kann nämlich der Glaube nach Taylor ›bedeu tungsvoll‹ sein. Wird er hingegen durch selektive Wahrnehmungen des Guten verkürzt, wie das im Atheismus oder im Fundamentalismus häufig der Fall ist, wird die hermeneutische Basis der Erfahrungskon stitution gerade dünner – und gegen diese Entsubstanzialisierung der Wirklichkeit des Glaubens, deren Ursprünge er in der Religionssozio Zur Metapher der ›Welle‹ vgl. H. Joas, »Wellen der Säkularisierung«. Grundsätzlich spricht Taylor hier auch von einer unhintergehbaren »Wahl«, bei der man angesichts der Totalität der jeweils zu treffenden Entscheidungen »nicht wirklich neutral bleiben« könne, »weil sie in dem Moment, in dem man mit ihnen von der einen Einstellung zur anderen überwechselt, eine andere Bedeutung annehmen, die sie in ihrer neuen Umgebung ihrer Überzeugungskraft beraubt«. Man könne daher »den wesentlichen Charakteristika der beiden konkurrierenden Bedeutungen nicht gleichzeitig« zustimmen, da »man zum Weiterleben irgendeine Deutung dieser Cha rakteristika braucht« (Ch. Taylor, Die Formen des Religiösen in der Gegenwart, S. 52). 12
13
218
Konversion statt Konsens?
logie Peter L. Bergers vermutet14, zieht Taylor besonders energisch ins Feld. Größten Wert legt er dabei auf die Feststellung, dass das, was ich (in meiner Terminologie) als ,Fragilisierung‘ bezeichne, nicht das Gleiche ist wie das, was Berger meint. Bei mir geht es darum, dass die größere Nähe der Alternativen eine Gesellschaft hat entstehen lassen, in der mehr Menschen ihre Positionen verändern, also im Laufe ihres Lebens ,konvertieren‘ [Hervorhebung MK] oder sich eine andere Position als die ihrer Eltern zu eigen machen. Die Zahl der Positionswechsel im Laufe eines Lebens und von einer Generation zur nächsten nimmt zu. Das hat aber nichts damit zu tun, dass der schließlich angenommene (oder beibehaltene) Glaube fragiler wäre, wie Berger anzunehmen scheint. Im Gegenteil, der Glaube, der aus dieser prekären Gegenwart hervorgeht, kann gerade deshalb stärker sein, weil er sich der unverzerrten Alternative gestellt hat.15
In dieser Kritik fällt nun ein für meine weiteren Überlegungen wich tiger Schlüsselbegriff Taylors, nämlich der der Konversion. Er rückt ordnungstheoretisch an die Stelle von Habermasʼ Metaphysik-Kritik und Bergers sozialpsychologischem Relativismus: Das bedeutet, dass die narrative Erzähllinie Taylors von komplementären Lernprozessen und spirituellen Entsubstanzialisierungen begrifflich wegführt und eine alternative Prosa der Moderne entwirft, in der sich das Ver nünftige (auch) durch die Möglichkeiten zur Bekehrung, d.h. durch grundlegende Wandlungsmöglichkeiten in den Artikulationsformen des Guten, bestimmt. Pointiert gesprochen ist also die Moderne nach Taylor nur dann angemessen ›rational‹, wenn sie durchlässig ist für spirituelle Erweckungserlebnisse – und eine Gesellschaft nur dann gerecht, wenn ihre Institutionen und politischen Repräsentationssys teme die Chancen auf expressive Selbstverwirklichung dauerhaft offenhalten. Den Sinn der Moderne in ihrer Konversionsfähigkeit zu erblicken, setzt daher einen hermeneutisch originellen KontraPunkt zu den üblichen Fortschrittserzählungen. Allerdings gelingt das Taylor nur, weil er mit dem Moment der Fragilisierung die Erzäh lung der Vernunft selbst verändert: Sie wird zeitlich und räumlich verendlicht, die sozio-kulturellen Dispositive ihrer Hervorbringung dadurch sichtbar gemacht. In einer solchen Perspektive gibt es keine übergeordneten Übersetzungsziele mehr, sondern Rationalität drückt sich in der grundlegenden Möglichkeit aus, unsere Glaubensvor 14 15
Vgl. z.B. P. L. Berger, Sehnsucht nach Sinn. Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 928 (Fn.).
219
Michael Kühnlein
aussetzungen jederzeit tiefgreifend transformieren zu können. Mit anderen Worten: Das Erzeugen von vielstimmigen Resonanzräumen ist nach Taylor der Trumpf der Genealogie; und eine nach ihrem Bilde geformte Moderne macht nur Sinn, wenn sie diese existenzielle Optionenvielfalt im menschlichen Selbstverständnis nicht nur zulässt, sondern auch nach besten Kräften zu fördern weiß. Diesen Gedanken möchte ich im Folgenden in Auseinandersetzung mit Tay lors opus magnum näher entwickeln (I) und die daraus resultierenden Konsequenzen für eine religionssensible Theorie der Moderne erör tern (II).
1. Bekehrungen im säkularen Zeitalter Es gehört Mut dazu, eine an originellen Wendungen gewiss nicht arme Genealogie der säkularen Moderne ausgerechnet mit der Aus sicht auf »Bekehrungen« zu beschließen.16 Taylor bringt nun diese gedankliche Souveränität auf, indem er klarmacht, dass das Freiheits versprechen der Moderne stark gefährdet ist, wenn man es von seinem Resonanz-Verlangen immanent abschottet.17 Doch diese Entropie ist für Taylor nicht unabwendbar; vielmehr sucht er die Moderne nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten des Guten ab, in denen der Sinn des Ganzen nicht mehr vernunftkritisch zurückweicht, sondern sich epiphanisch als erfüllende Erfahrung des Selbst zur Sprache bringt. Es ist nämlich genau diese spirituelle »Unruhe«,18 die den Menschen nach Taylor immer wieder über sich hinaustreiben lässt auf der Ebd., S. 1205–1279. Da sich die Legitimität der Welt nicht neutral übersteigen lässt, unterliegt auch der Säkularismus bei Taylor einer permanenten Sinn-Kritik. Und diese fällt bei ihm recht harsch aus, gilt ihm doch das säkulare Zeitalter als »schizophren«, weil er das neu zeitliche Subjekt in seinem Artikulationsvermögen korsettiert und einem »gegenläu figen, doppelten Druck« aussetzt: »Die Leute scheinen auf sichere Distanz zur Religion zu gehen, und dennoch rührt es sie zutiefst, daß es tiefgläubige Menschen wie Mutter Teresa gibt. Die Welt der Ungläubigen war es gewohnt, Pius XII nicht zu mögen, doch das Auftreten von Johannes XXIII überrumpelte sie. Es genügte, daß sich der Papst anhörte wie ein Christ, und schon schmolzen uralte Widerstände dahin. Man mußte nur drauf kommen. Hier gewinnt man den Eindruck, daß viele Menschen, die nicht bereits sind, Christus zu folgen, trotzdem seine Botschaft hören wollen beziehungs weise wünschen, daß diese Botschaft draußen irgendwo verkündet wird. Die Reaktion auf den vorigen Papst hat diese Paradoxie deutlich gemacht.« Ebd., S. 1204. 18 Ebd., S. 1203. 16 17
220
Konversion statt Konsens?
Suche nach moralischen Quellen, die den universalen Anforderungen der Gerechtigkeit selbst gerecht zu werden vermögen. In diesem spirituellen Sinn-Aufstieg des Individuums ist kein Platz mehr für die regulativen Konstruktionen der Vernunft. Insofern ist »unsere Zeit« nach Taylor auch »sehr weit davon entfernt, es sich in einem bequemen Unglauben gemütlich zu machen«.19 Taylor läutet damit zum Ende hin einen Perspektivenwechsel ein, der die Moderne nun aus der Sicht derer bestimmt, »die aus dem immanenten Rahmen ausgebrochen sind und so etwas wie eine ›Bekehrung‹ erlebt haben«.20 Die hermeneutischen Vorzeichen des klassischen Säkularisierungsparadigmas drehen sich hier also vollends um: Nicht mehr die Religion, sondern – so Taylors Nar rativ – die Ordnung der Moderne ist jetzt dafür verantwortlich, dass ein unheilvoller Konformitätsdruck auf die kreativ-expressiven Selbststeigerungskräfte des Individuums lastet. Der Mensch wird dadurch von seinen moralischen Quellen abgeschnitten; er entfernt sich von sich selbst, weil der persönliche Zugang zu einem Ort der Fülle a priori beschränkt wird: An einem solchen Ort ist Metaphysik nämlich nur noch denkbar, wenn zugleich ihre existenziellen Anliegen vernunftkritisch nicht allzu ernst genommen werden. Doch eine solche Philosophie des stringenten Ausdrucks fordert ihren Preis: Sie macht jeglichen Direktkontakt mit Evidenzerlebnissen der Wahrheit zunichte, eben weil diese Erfahrungen von vornherein als hermeneu tisch unzuverlässig bzw. als irrational gelten.21 Taylors Wende zur Bekehrung ist somit keine Flucht aus der Realität, sondern der Versuch, überhaupt erst in einen erfüllenden, Ebd., S. 1204. Ebd., S. 1205. 21 Adorno hätte Taylor in dieser Kritik sicherlich zugestimmt, denn für ihn war Wahr heit im Letzten objektiv und nicht intersubjektiv; so empfand er es auch stets »als seine Aufgabe, mit der Kraft des Subjekts den Trug konstitutiver Subjektivität zu durch brechen«. Gegen eine »in Furcht vor der Wahrheit erstarrenden Aufklärung«, die eli miniert, was sie nicht versteht, verteidigte Adorno zeit seines Lebens die ideologie kritische Evidenz der Wahrheit: »Kriterium des Wahren ist nicht seine unmittelbare Kommunizierbarkeit an jedermann. Zu widerstehen ist der fast universalen Nötigung, die Kommunikation des Erkannten mit diesem zu verwechseln und womöglich höher zu stellen, während gegenwärtig jeder Schritt zur Kommunikation hin die Wahrheit ausverkauft und verfälscht. An dieser Paradoxie laboriert mittlerweile alles Sprachli che. Wahrheit ist objektiv und nicht plausibel.« (Th. W. Adorno, Negative Dialektik, alle Zitate: S. 8 und 49 f.) Vgl. dazu auch H. Schnädelbach, »Dialektik und Diskurs«, S. 151–171; bes. S. 170 f. 19
20
221
Michael Kühnlein
ja vibrierenden Sinnkontakt mit ihr zu treten. Säkularistische Philoso phien indes, deren positivistische Hintergrundannahmen uns gerade von diesen Möglichkeiten der epiphanischen Wahrheitserfahrung abschotten wollen, können nach Taylor nicht eigentlich rational sein, eben weil sie uns daran hindern, mit einer Wirklichkeit in Berührung zu kommen, die erst durch den Glauben an sie konstituiert wird. Taylor stellt sich damit in seinen Gifford-Lectures von 199922 an die Seite von William James, der die Sinnwidrigkeit einer Rationali tät erkannte, sollte sie diese zuvorkommende Logik der Wahrheit erkenntniskritisch außer Kraft setzen: Es gibt also Fälle, wo eine Tatsache nicht eintreten kann, wenn nicht im voraus ein Glaube an ihr Eintreten vorhanden ist. Und wo der Glaube an eine Tatsache bei der Hervorbringung dieser Tatsache mitzwirken vermag, da wäre doch das eine unsinnige Logik, welche sagen wollte, ein Glaube, welcher dem wissenschaftlichen Beweise vorausläuft, sei die ›tiefste Unsittlichkeit‹, zu der ein denkendes Wesen herabsinken könne. […] Uns den Skeptizismus als eine Pflicht zu predigen, bis hinreichende Beweisgründe für die Religion gefunden seien, heißt also: uns sagen, daß es der religiösen Hypothese gegenüber weiser und besser ist, unserer Furcht nachzugeben, sie möchte ein Irrtum sein, als unserer Hoffnung, daß sie der Wahrheit entspricht. Es ist also nicht so, daß der Intellekt auf der einen Seite steht und alle Gefühle auf der andern; sondern der Intellekt, verbunden mit einem einzigen Gefühle, errichtet dieses Gesetz. Und wodurch wird denn nun eigentlich die höchste Weisheit gerade dieses Gefühls gewährleistet? Täuschung um Täuschung! – was für einen Beweis gibt es, daß Täuschung durch Hoffnung soviel schlimmer ist als Täuschung durch Furcht? Ich für meine Person sehe keinen Beweis dafür; und ich weigere mich einfach, dem Wissenschaftsmann zu gehorchen, wenn er mir befiehlt, seine Art von Option nachzumachen, in einem Falle, wo mein eigener Einsatz wichtig genug ist, um mir das Recht zu verleihen, mir meine eigene Form des Risikos auszusuchen. […] Ich vermag mich nicht dazu zu entschließen, die Willensseite meines Wesens aus dem Spiele zu lassen. Aus dem einfachen Grunde kann ich es nicht tun, weil eine Denkregel, die mich vollständig verhinderte, gewisse Arten von Wahrheit, wenn diese Arten von Wahrheit wirklich beständen, anzuerkennen, eine vernunftwidrige Regel wäre.23 Vgl. Ch. Taylor, Die Formen des Religiösen in der Gegenwart, insbes. S. 33–56. W. James, »Der Wille zum Glauben«, alle Zitate: S. 152, 154 und 156. Auf die tiefe Wahlverwandtschaft zwischen James und Taylor hat als einer der ersten hierzulande Hans Joas aufmerksam gemacht: »Ein Pragmatist wider Willen?«. Vgl. ferner das 22
23
222
Konversion statt Konsens?
Auf den Spuren dieser Traditionslinie wandelnd, bringt das Paradigma der Konversion bei Taylor die willenstheoretische Vorpositionierung des Glaubens zum Ausdruck. Hier ist epistemisch nichts mehr unab hängig, sondern die Freiheit zur Bekehrung wird zu einem kreativen Fanal der Wahrheitssuche, die sich nicht mehr mit Prinzipien richtigen Schließens zufriedengibt. Sie geht vielmehr hermeneutisch auf das Ganze, indem sie eher den möglichen Irrtum in Kauf nehmen als den tatsächlichen Verlust an Evidenz riskieren will.24 Taylor begreift diesen spirituellen Wandel in Analogie zu einem wissenschaftlichen Paradigmenwechsel, »nur daß dieser Wechsel die zentralen Lebens fragen betrifft«. Bekehrungen setzen nämlich Transformationen des »Rahmens voraus, in dem die Menschen bis dahin gedacht, gefühlt und gelebt haben. Sie machen etwas sichtbar, das jenseits dieses Rahmens liegt und zugleich den Sinn aller Elemente des Rahmens verändert. Jetzt erhalten die Dinge einen völlig neuen Sinn.«25 Was also die Bekehrung zu einem spezifischen Phänomen der Moderne macht, ist ihre Furchtlosigkeit, mit der sie herkömmliche Gewissheiten des Denkens, Handelns und Glaubens zertrümmert und an ihre Stelle resonanzkräftigere Wertüberzeugungen bzw. subtilere Sprachen des Guten setzt: Die Einsichten des Bekehrten durchbrechen die Grenzen der herr schenden Lesarten der immanenten Ordnung, sei es im Hinblick, sei es im Hinblick auf die akzeptierten Theorien oder die moralische und politische Praxis. […] Dazu ist es vielleicht erforderlich, daß man eine neue Sprache oder einen neuen literarischen Stil erfindet. Man bricht
James-Kapitel in meiner Dissertation: Religion als Quelle des Selbst. Zur Vernunft- und Freiheitskritik von Charles Taylor, S. 172–179; über den Religionspragmatismus von James im Allgemeinen informiert auch die gut sortierte Studie von Ch. Seibert, Reli gion im Denken von William James. 24 Diese Argumentation besitzt eine gewisse Ähnlichkeit mit Blaise Pascals bekann ter Wette. Auch er wägt darin zwei Erkenntnisrisiken, die des Glaubens und die des Unglaubens, miteinander ab, um dann in der Gotteswahl die bedeutungsvollere Option zu erkennen. James, den der aufsteigende Weihrauch in Pascals Überlegungen ziemlich ›juckt‹, argumentiert in Form einer gewissen pragmatischen – und nicht katholischen – Unumgänglichkeit: »Es wird angenommen, daß wir ein gewisses wichtiges Gut durch unseren Glauben gewinnen und durch unseren Nichtglauben verlieren.« (W. James, »Der Wille zum Glauben«, S. 153). 25 Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 1208 f.
223
Michael Kühnlein
aus der immanenten Ordnung aus und gelangt in eine größere, umfas sendere Ordnung, die jene enthält, während sie sie durchbricht.26
Das entscheidende strukturelle Merkmal der von Taylor beschriebe nen Konversionen drückt sich somit in einem Gefühl der spirituellen »Reichweitenvergrößerung« (Rosa) aus; man bricht aus einem vorge gebenen, als einengend empfundenen Werterahmen aus, um sich in einem umfassenderen Sinn mit den Quellen der Natur oder der Moral zu verbinden, eine Verbindung, die schließlich »die Dinge auf eine andere Weise zu deuten erlaubt«. Bekehrungen bringen uns daher zu Bewusstsein, »wieviel wir immer ausklammern«;27 sie rütteln »in einem gewissen Sinn an den Grenzen der allgemein akzeptierten Sprache« und »erregen Argwohn«.28 Gleichwohl hält Taylor diese Erschütterungen für notwendig, damit die Vernunft ihre erkennt niskritische ›Exkarnation‹ überwinden kann. Unter diesem Begriff versammelt Taylor ›objektivierende‹ Vorstellungen des Menschen, die seinen Handlungen einen deterministischen Bezugsrahmen geben und damit Aussagen über den möglichen Grad der Transformations bedürftigkeit »verfälschen«.29 In Fragen der zeitgemäßen Lebensführung ist ein Paradigmen wechsel für Taylor also nur in Form der Bekehrung denkbar. Struktu rell entsprechen deshalb ihre Phänomene einer modernen Taxonomie; sie stellen keine rückwärtsgewandte Nostalgie dar. Konversionen und Re-Konversionen bleiben deshalb auch im säkularen Zeitalter konstitutive Bestandteile der modernen Identität. Aber wie verhält es sich eigentlich in umgekehrter Blickrichtung? Wie verändert sich die Perspektive auf die Moderne, wenn Bekehrungen zu ihren Beweg gründen gehören sollen? Auch dafür entwickelt Taylor in seinem Schlusskapitel ein mögliches Zukunftsszenario, dessen Grundüber Ebd., S. 1212. Ebd., S. 1272. 28 Ebd., S. 1211. 29 Ebd., S. 1220. – Taylor knüpft mit diesem Sprachgebrauch an die Theologie von Ivan Illich an, der eine grundlegende spirituelle Korrumpierung in der historischen Entwicklung der Kirche beklagt: Sie verwandle nämlich das mystische Geheimnis einer grenzenüberwindenden Liebe in eine dienstbare Leistung der bloßen Regeltreue. Diese ›Perversion‹ baue die Kirche als sakramentaler Ort der Fülle ab. Vgl. ebd., S. 1219–1231. Zur Illich-Deutung Taylors vgl. insgesamt auch die systematisch gehalt vollen Betrachtungen von Karl Kardinal Lehmann, »Entsteht aus dem verfälschten Christentum die Moderne? Zur Begegnung von Charles Taylor und Ivan Illich«; vgl. M. Kühnlein, bes. S. 398–400. 26 27
224
Konversion statt Konsens?
zeugung sich von der Annahme herleitet, dass die Vernünftigkeit der Moderne von der spirituellen Durchlässigkeit ihrer Optionen ›lebt‹. In dieser (nahen) Zukunft wird die Moderne nicht mehr nur von ausgrenzenden Humanisten bevölkert werden; vielmehr avanciert sie zu einem Ort der allgemeinen Fülle, der die vielfältigsten Erfah rungen mit einer transzendenten Realität anerkennt und in ihren authentischen Ausdrucksformen fördert; nichts wird hier verdrängt werden können, bloß weil der ›Mensch nicht zu viel Realität ertragen will‹ (Eliot). An diesem Ort haben wir nämlich alle eine unmittelbare »Ahnung« von jener Evidenz, »die zum Vorschein kommt, wenn wir eine Form der ›Fülle‹ identifizieren, anerkennen und zu erreichen versuchen«.30 Wir operieren nicht mehr von gedanklichen »Null punkten« aus,31 die uns ein falsches Bild von der Fülle vermitteln und sie an die Kette immanenter Erlebnisvermögen legen, sondern wir versuchen, das »Tor zu weiteren Entdeckungen aufzustoßen«.32 In dieser Vision erzählt die Moderne von der »Zukunft« einer »religiösen Vergangenheit«,33 die nicht mehr durch die Weigerung definiert ist, »Transzendenz als Sinn dieser Fülle in Betracht zu ziehen«.34 Gleichwohl wird auch diese Zukunft ihrer allgemeinen Struktur nach nicht ausschließlich auf Religion beschränkt sein. Konversio nen dichten nämlich Erfahrungsräume nicht ab und bringen sie in eine vertikale Hierarchie, sondern sie horizontalisieren das Gute und bilden so ein fragiles Netzwerk aus möglichen gemeinsamen Entdeckungen und Überraschungen ab: »Manche werden […] weiter ›nach innen‹ rücken und sich auf eine stärker immanentistische Posi tion zubewegen wollen, andere hingegen werden das gegenwärtige Gleichgewicht einengend, ja erdrückend finden und sich hinausbe geben wollen.«35 Konversionen werden von Taylor also nicht deswe gen verteidigt, weil sie sich per se auf die Logik der Offenbarung verstehen;36 vielmehr ermöglichen sie alternative Weltsichten, die Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 1272. Ebd., S. 1273. 32 Ebd. 33 Ebd., S. 1275. 34 Ebd., S. 1273. 35 Ebd., S. 1274. 36 Taylor warnt hier eindringlich vor den politischen Unsicherheiten, die eine Philo sophie der Bekehrung bei allen Beteiligten auslösen würde, wenn sie gleich einem andauernden Ersetzungsprozess den ausgrenzenden Humanismus gegen einen reli giösen Fanatismus eintauschte. Vgl. ebd., S. 1272 f. 30 31
225
Michael Kühnlein
uns in einen inspirierend- konstitutiven Bezug zu neuen Formen des Sinnerlebens bringen – einerlei, ob diese Formen der Fülle epiha nisch-transfigurativ, literarisch-poetisch, immanent-humanistisch oder eben religiös-praktisch gedeutet werden.37 Eine solche Sicht der Moderne unterscheidet sich daher in wenig stens drei Hinsichten von den gebräuchlichen Vorstellungen eines ›säkularen Zeitalters‹: Erstens verlagert sie das normative Gleich gewicht der Kultur von den Weltinnenräumen der Immanenz auf multiperspektivische Erfahrungen der Transzendenz; zweitens ist sie radikal dialogisch verfasst, weil es keine Meta-Sprache oder MetaDiskurse gibt, die die spirituelle Optionenvielfalt in eine apriorische Ordnung bringen könnten; drittens schließlich muss sich eine solche Kultur der eigenen Vernunftdialektik stärker öffnen und speziell den Stimmen der Religion wieder mehr Vertrauen schenken. Oder in anderen Worten: Die Moderne ist nach Taylor erst dann volljährig und vernünftig, wenn sie spirituell durchlässig geworden ist.
2. Bekehrung statt Übersetzung? Setzt man Taylors Überlegungen zur Zukunft der Moderne in Bezie hung zur jüngst erschienenen Philosophiegeschichte von Habermas, dann tun sich gerade in Bezug auf Fragen der Religion bei beiden deutliche Unterschiede auf. Fast ist man gewillt zu sagen, dass sich auch heute noch am Probierstein der Religion anscheinend ganze Phi losophiegeschichten entscheiden. Nun ist hier nicht der Ort, in einen Vergleich zwischen zwei wirklich umfänglichen Büchern mit ihren gedanklich verschwenderischen Inhalten einzutreten. Doch im Sinne einer heuristischen Verdichtung ist der Blick auf Habermas wertvoll, denn sein Vorschlag eines komplementären Lernumgangs mit der Religion lässt die Stärken und Schwächen von Taylors Philosophie der Bekehrung gleichsam wie in einem Brennglas konzentriert her vortreten. Von wenigstens einer zentralen Stärke und einer zentralen Schwäche soll daher im Folgenden die Rede sein. Im Unterschied zu Habermasʼ Modell des komplementären Ler nens geht Taylors Philosophie der Konversion offenbar von ›zweck 37 Vgl. dazu auch: E. Arens, »Sinnsuche, Verlusterfahrungen und Bekehrungserleb nisse«, bes. S. 209 f.
226
Konversion statt Konsens?
freien‹ semantischen Energien des Religiösen aus. Darin drückt sich die Einsicht aus, dass die Erfahrungen spirituell verwandelter Menschen nicht universell diskursivierungsfähig sind, weil es sich hier nach Taylor, wie er in einem Gespräch mit Habermas selbst sagt, »um Bezugnahmen handelt, die das spirituelle Leben bestimm ter Menschen wirklich berühren, das anderer hingegen nicht«.38 Diese intrinsische, aus sich selbst sprechende Qualität der Religion offenbart nun, wie ich finde, eine nicht unerhebliche Schwäche in Habermas‘ Vernunftphilosophie einer rettenden Übersetzung. Denn eine solche Konzeption setzt zwingend voraus, dass sich die Inhalte der religiösen Tradition auch übersetzen lassen, ohne ihnen gleich hermeneutische Gewalt anzutun. Mit anderen Worten: Es muss schon viel Vernunft in der Religion vorhanden sein, damit Übersetzungen narrativ klappen können. Aber aus stillschweigenden Voraussetzun gen lässt sich wiederum nichts Spezifisches lernen. Hier verwickelt sich das postsäkulare Denken in sich selbst, gerade weil durch die Vorgabe der Übersetzbarkeit Wahrheit auf das Niveau intersubjekti ver Gültigkeit heruntergedrückt wird. Doch »die Konstruktion der Wahrheit nach Analogie der volonté de tous […] betröge im Namen aller diese um das, dessen sie bedürfen«.39 Gleichwohl ist aber auch eine Philosophie der Bekehrung nicht ohne gedankliche Tücken. Es ist eine Sache, auf »Zonen der Unüber setzbarkeit« (MacIntyre) hinzuweisen; doch damit ist noch nicht erklärt (und noch weniger verstanden), warum uns manche Eviden zen elektrisieren, andere hingegen nicht. Bekehrungen sind nicht austauschbar. Sie ergreifen immer nur einzelne Subjekte, auch wenn der Kontext wie am Beispiel der Kirche durchaus ein sakramentalgemeinschaftlicher sein kann. Doch diese Erfahrungen leben im Letz ten (oder performativ, wie die Sprachpragmatik formuliert) von dem Zutrauen darauf, dass wir sprachlich in der Lage sind, Epiphanien der Fülle von Epiphanien des Todes und der Gewalt zu unterscheiden40 – d.h. ohne Identitätsverlust Fülle erfahren können; denn ansonsten J. Habermas, Ch. Taylor, »Diskussion. Jürgen Habermas und Charles Taylor«, S. 94. 39 Th. W. Adorno, Negative Dialektik, S. 49. Zur Kritik an der nachmetaphysischen Sprachpragmatik der Übersetzung vgl. auch M. Kühnlein, »Zwischen Vernunftreligion und Existenztheologie. Zum postsäkularen Denken von Jürgen Habermas«. 40 Vgl. E. Arens, »Sinnsuche, Verlusterfahrungen und Bekehrungserlebnisse«, S. 209; zu dieser Problematik ganz allgemein: D. Hervieu-Léger, Pilger und Konver titen. Religion in Bewegung. 38
227
Michael Kühnlein
bliebe jeder Akt der Welterschließung ein Drahtseilakt der hermeneu tischen Willkür. Konversionen können also scheitern, aber das macht sie eben noch nicht sprachlos.41 Diesen Eindruck will Taylor selbst verständlich vermeiden; doch bisweilen lässt er fahrlässig das Bild entstehen, als ob die richtige Deutung der Konversion bereits aus dem organischen Kontakt mit den transzendierenden Fülle-Vorstellungen des Guten, Wahren und Schönen natürlicherweise folgen würde – ohne auf das normative Vermittlungsrepertoire einer intersubjek tiv geteilten Sprache achten zu müssen, die diese Erfahrungen für uns überhaupt erst nachvollziehbar und begreiflich machen. Dieses Begriffsdefizit macht sich auch an dem Umstand bemerkbar, dass Taylor Fragen der Veralltäglichung und Routinisierung dieser Bekeh rungserlebnisse weitgehend ignoriert und ihre Folgen auf eine Ethik der modernen Lebensführung völlig ausblendet – so als ob nur das für sich isolierte Momentum der ›Konversion‹ bzw. der ›Epiphanie‹ allein ein Leben gelingend machte. Die Moralität solcher Erfahrungen steht
41 Nach Habermas könne man aus solchen Konversionen gerade nichts lernen, wie er in einer anderweitigen Replik auf MacIntyre deutlich macht: »Der Witz dieser Beschreibung besteht darin, daß sich die rationale Diskreditierung der eigenen Tra dition noch nach Maßgabe der eigenen Rationalitätsstandards vollzieht, während das Lernen von einer rational überlegenen, fremden Tradition den Vorgang einer Kon version, nämlich die Unterwerfung unter neue Rationalitätsstandards voraussetzt. Wenn verschiedenen Überlieferungskontexten verschiedene Rationalitäten innewoh nen, kann es zwischen ihnen keine Brücke geben. Der Wechsel zwischen einander ausschließenden Totalitäten erfordert die Veränderung der Identität der lernenden Subjekte. Diese müssen sich im Moment des Übergangs von sich selbst entfremden und im Zuge einer Konversion des Selbst- und Weltverständnisses ihre eigene Ver gangenheit im Lichte einer anderen, als überlegen anerkannten Tradition verstehen lernen.« Doch damit verwickeln sich Theorien der Konversion nach Habermas in einen performativen Lernwiderspruch: »Die Anerkennung der rationalen Überlegenheit einer fremden Tradition läßt sich ja aus der Sicht der eigenen Tradition nur dann hin reichend motivieren, wenn die lernenden Subjekte die Erklärungskraft beider Tradi tionen im Hinblick auf dieselben Probleme vergleichen können. Genau das ist ihnen verwehrt, weil die Kontexte beider Überlieferungen ohne eine Zone rationaler Über lappung inkommensurabel sind.« (J. Habermas, »Erläuterungen zur Diskursethik«, S. 213 f.).
228
Konversion statt Konsens?
jedoch noch aus – wenn sich Taylors Philosophie der Bekehrung nicht dauerhaft von Philosophie verabschieden möchte.
Literaturverzeichnis Adorno, Th. W., Negative Dialektik, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1966 Arens, E., »Sinnsuche, Verlusterfahrungen und Bekehrungserlebnisse«, in: M. Kühnlein (Hg.), Charles Taylor: Ein säkulares Zeitalter, Berlin: De Gruyter 2019, S. 197–211 Schnädelbach, H., »Dialektik und Diskurs«, in: ders., Vernunft und Geschichte. Vorträge und Abhandlungen, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987, S. 151–171 Berger, P. L., Sehnsucht nach Sinn, Frankfurt/M.: Gütersloher Verlagshaus 1999 Casanova, J., Public Religions in the Modern World, Chicago: The University of Chicago Press 1994 —, Europas Angst vor der Religion, Berlin: Berlin University Press 2009 Fukuyama, F. Das Ende der Geschichte, München: Kindler 1992 James, W., »Der Wille zum Glauben« [1897], in: Pragmatismus. Ausgewählte Texte, hg. von Ekkehard Martens, Stuttgart: Reclam 1997, S. 128–160 Habermas, J., Auch eine Geschichte der Philosophie, zwei Bände, Berlin: Suhr kamp 2019 —, »Erläuterungen zur Diskursethik«, in: ders., Erläuterungen zur Diskursethik, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1991, S. 119–226 Habermas, J., Taylor, Ch., »Diskussion. Jürgen Habermas und Charles Taylor«, in: E. Mendieta, J. VanAntwerpen (Hg.), Religion und Öffentlichkeit, Berlin: Suhrkamp 2012, S. 89–101 Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke 12, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986 Hervieu-Léger, D., Pilger und Konvertiten. Religion in Bewegung, Würzburg: Ergon 2004 Joas, H., »Ein Pragmatist wider Willen?«, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 44 (1996), S. 661–670 —, »Wellen der Säkularisierung«, in: M. Kühnlein, M. Lutz-Bachmann (Hg.), Unerfüllte Moderne? Neue Perspektiven auf das Werk von Charles Taylor, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2011, S. 716–729 Kühnlein, M., »Immanente Ausdeutung und religiöse Option. Zur Expressivität des säkularen Zeitalters (Taylor)«, in: Th. M. Schmidt, A. Pitschmann (Hg.), Säkularisierung und Religion. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart: J. B. Metzler 2014, S. 127–139 —, »Religion als Auszug der Freiheit aus dem Gesetz? Charles Taylor über die Vermessungsgrenzen des säkularen Zeitalters«, in: ders., M. Lutz-Bachmann (Hg.), Unerfüllte Moderne? Neue Perspektiven auf das Werk von Charles Tay lor, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2011, S. 388–445 —, Religion als Quelle des Selbst. Zur Vernunft- und Freiheitskritik von Charles Taylor, Tübingen: Mohr Siebeck 2008
229
Michael Kühnlein
—, »Zwischen Vernunftreligion und Existenztheologie. Zum postsäkularen Den ken von Jürgen Habermas«, in: Theologie und Philosophie 84 (2009), S. 524–546 Lehmann, Kardinal K., »Entsteht aus dem verfälschten Christentum die Moderne? Zur Begegnung von Charles Taylor und Ivan Illich«, in: M. Kühn lein, M. Lutz-Bachmann (Hg.), Unerfüllte Moderne? Neue Perspektiven auf das Werk von Charles Taylor, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2011, S. 327–349 Seibert, Ch., Religion im Denken von William James. Eine Interpretation seiner Philosophie, Tübingen: Mohr Siebeck 2009 Taylor, Ch., Die Formen des Religiösen in der Gegenwart, Frankfurt/M.: Suhr kamp 2002 —, Ein säkulares Zeitalter, übers. v. J. Schulte, Berlin: Suhrkamp 2009 —, »Für eine grundlegende Neubestimmung des Säkularismus«, in: E. Mendieta, J. VanAntwerpen (Hg.), Religion und Öffentlichkeit, Berlin: Suhrkamp 2012, S. 53–88 —, Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen Identität, übers. v. J. Schulte, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994
230
Christina M. Gschwandtner
Theopoetik und Anatheismus Französische Religionsphilosophie auf Amerikanisch
Amerikanische Philosophie – und besonders amerikanische Reli gionsphilosophie – steht vorwiegend, wenn nicht ausschließlich, in der analytischen Tradition. Existentialismus, Phänomenologie, Hermeneutik und andere europäische Strömungen werden in Ame rika als »kontinentale Philosophie« bezeichnet und sind nur an wenigen philosophischen Fakultäten vertreten. Zudem ist selbst kontinentale Philosophie oft vorwiegend atheistisch eingestellt und legt den Schwerpunkt auf sozial-kulturelle oder politische Themen.1 Religionsphilosophie kontinentaler Richtung in Amerika ist daher ein relativ marginales Phänomen, zumindest verglichen mit dem Einfluss analytischer Philosophie in den Vereinigten Staaten und in Kanada. Gleichwohl hat sie sich in den letzten drei Jahrzehnten einen nicht unwichtigen Platz erkämpft und eigene Orientierungspunkte entwickelt. Dieser Beitrag wird kurz den Werdegang dieser ame rikanischen »kontinentalen Religionsphilosophie« beleuchten und dann zwei repräsentative Denker vorstellen: John D. Caputo und Richard Kearney.
1. Einführung: Ein Gott ohne Sein Das Interesse an religiös-philosophischem Denken, insbesondere angeregt von neueren Strömungen in Frankreich, begann in den 90er 1 Die beiden »kontinentalsten« Philosophiefakultäten, an der Penn State University und DePaul University, sind dafür gute Beispiele. Diese stark politische Färbung ist auch deutlich an den jährlichen Tagungen der »Society for Phenomenology and Existential Philosophy« (SPEP), der Hauptorganisation wissenschaftlicher Art für kontinentale Philosophie in Amerika.
231
Christina M. Gschwandtner
Jahren mit Jean-Luc Marions jährlichen Besuchen in Chicago, der Gründung der »Society for Continental Philosophy and Theology« (SCPT) im Jahre 1997, deren erste eigenständige Tagung zum Thema der »Phänomenologie des Gebets« im Frühjahr 2003 an der Villanova Universität (Philadelphia) stattfand2, und mit den Konferenzen zu »Religion und Postmoderne«, die John Caputo und Michael Scanlon alle zwei Jahre in Philadelphia organisierten (1997, 1999, 2001, 2003), fortgesetzt wurde.3 Zu diesen Tagungen lud Caputo stets Jacques Derrida ein, der, obwohl er starke Bedenken gegen den Ausdruck »Postmoderne« hegte, auch stets teilnahm und dadurch eine große Zuhörerschaft sicherte, weit zahlreicher (oft mehrere Hundert Teilnehmer), als dies bei solchen akademischen Veranstaltungen sonst der Fall war. Die vermutlich bekannteste und einflussreichste war die erste dieser Tagungen, an der Derrida und Marion über die »Gabe« debattierten, moderiert von Richard Kearney, der ein beson deres Talent dafür besitzt, »Gegner« an einen Tisch zu bringen.4 Diese Debatte trug vielleicht mehr als irgendetwas anderes dazu bei, dass insbesondere Jean-Luc Marion in den Vereinigten Staaten bekannt wurde. Dies wurde durch intensive Übersetzungsprojekte von franzö sischem Gedankengut von Verlagen wie Fordham University Press unterstützt, insbesondere auch durch die weitsichtige Leitung und das intensive Engagement von Helen Tartar. Marions, Michel Henrys, und Emmanuel Falques Werke sind heute zum großen Teil, Jean-Yves Lacostes und Jean-Louis Chrétiens Arbeit mit repräsentativen Bei trägen ins Englische übersetzt. Merold Westphal (Fordham), John Caputo (Villanova, dann Syracuse), Kevin Hart (Notre Dame, jetzt Virginia), Richard Kearney (Boston College) und andere lehr(t)en
2 B. E. Benson,N. Wirzba (Hg.), The Phenomenology of Prayer. Spätere Tagungen behandelten die Themen der Liebe, des religiösen Pluralismus, der Schöpfung, der Endlichkeit, usw. Hauptsprecher waren Merold Westphal, John Caputo, Richard Kearney, Kevin Hart, Jean-Yves Lacoste, Norman Wirzba und andere. 3 J. D. Caputo, M. J. Scanlon (Hg.), God, the Gift, and Postmodernism; J. D. Caputo, M. Dooley, M. J. Scanlon (Hg.), Questioning God; J. D. Caputo, M. J. Scanlon (Hg.), Augustine and Postmodernism; J. D. Caputo,M. J. Scanlon (Hg.), Transcendence and Beyond. 4 J. D. Caputo, M. J. Scanlon (Hg.), God, the Gift, and Postmodernism, S. 54–78. Siehe auch R. Kearney, Debates und P. Gratton, J. P. Manoussakis (Hg.), Traversing the Ima ginary für Interviews mit Derrida, Marion, Ricœur, Lévinas, Marcuse, Breton, Lyotard, Kristeva, Gadamer, Taylor, Chomsky und anderen.
232
Theopoetik und Anatheismus
deren Texte intensiv und betreu(t)en Dissertationen, die sich mit ihnen befassten.5 Diese »theologische« Phänomenologie aus Frankreich erregte besonderes Interesse an katholischen Universitäten. Man muss daran erinnern, dass die allerwenigsten Universitäten in Amerika staatlicher Natur sind; fast alle sind auf privater Basis entstanden und werden meist von kirchlichen oder religiösen Organisationen unterhalten, oft evangelikaler Art. In der »kontinentalen Philosophie« hingegen spielen die katholischen Universitäten eine wesentliche Rolle: die bekanntesten Universitäten mit zumindest teils »kontinentalen« Fakultäten – wie z.B. Villanova, Boston College, Fordham, Duquesne, DePaul, oder Loyola Chicago – sind katholisch.6 Staatliche Univer sitäten in den USA haben keine theologischen Fakultäten sondern »Departments of Religious Studies«, die meist stark soziologisch geprägt sind und wenig Interesse für die theologische Orientierung der französischen Phänomenologen aufbringen. Marions Lehrstuhl an der Universität Chicago, um nur ein Beispiel zu nennen, ist an der »Divinity School« angesiedelt und war vorher mit dem bekannten katholischen Theologen David Tracy besetzt.7 Marions theologische und religionsphilosophische Texte sind fast alle in Amerika entstan den, zuerst dort unterrichtet worden und haben dort weitreichen den Einfluss.8 Gott ohne Sein (Dieu sans l‘être) ist ein besonders markantes Beispiel für den Werdegang der französischen Religionsphilosophie in Amerika. Obwohl das Werk seinen Ursprung in einer Tagung hatte, die von Richard Kearney und Joseph O‘Leary in den späten siebziger Jahren am irischen Kolleg in Paris organisiert wurde und 5 In Amerika sind selbst Doktoranden verpflichtet, mindestens zwei oder drei Jahre Seminare zu belegen, bevor sie mit der Doktorarbeit beginnen können. 6 Zwei Studien untersuchen die Geschichte der katholischen Rezeption der Phänome nologie: G. P. Floyd, S. Rumpza (Hg.), Catholic Reception; C. Dickinson, H. Miller, K. McNutt (Hg.), Challenge of God. Siehe auch J. D. Caputo, »Continental Philosophy of Religion«. 7 Ursprünglich handelte es sich um den Lehrstuhl Paul Ricœurs. Ricœurs Einfluss in den Vereinigten Staaten, v.a. seine Vorträge und Texte zur biblischen Hermeneutik, sollte selbstverständlich auch nicht vergessen werden, doch dieser Einfluss war mehr auf Theologie und Bibelwissenschaft beschränkt und weniger in der Religionsphilos phie zu bemerken. 8 Marion beschreibt diese Rezeption und kommentiert auch den Unterschied in den Universitätssystemen auf beiden Seiten des Atlantiks in seinen Gesprächen mit Dan Arbib in Rigueur des choses, S. 56–70.
233
Christina M. Gschwandtner
ursprünglich spezifisch auf die französische Heidegger-Interpretation der Gruppe um Jean Beaufret kritisch reagierte, fand es in Amerika eine weite Leserschaft. Das erste Buch Marions, das ins Englische übersetzt wurde (1991) (und lange Zeit das einzige), gab den Ton für die amerikanische Rezeption des neuen französischen Denkens über Gott an. Zusammen mit einer Diskussion über Derridas angebliche »negative Theologie« (1992 erschienen)9 und Derridas Sauf le nom (1995 übersetzt) förderte es das Interesse an der »negativen« oder »mystischen Theologie« und bot Alternativen für ein theologisches Denken, das dem Thomismus, aber auch der naturwissenschaftlichen Kritik und insbesondere der klassischen »Onto-Theologie« zu ent kommen suchte. Die Diskussion im Jahre 1997 über die »Gabe« trug das ihrige dazu bei. Hier schien ein Weg gebahnt zu einer großzügi geren, weniger hierarchischen und offeneren Theologie, die Gott mit Geben und Lieben verbindet, statt mit metaphysischen Attributen (Sein). Mindestens für die folgende Dekade kreisten fast alle Debatten in der amerikanischen kontinentalen Religionsphilosophie um diese miteinander verbundenen Themen. Marions »Phänomenologie der Gabe« sorgte dafür, dass das Thema nicht nur zirkulierte, sondern immer mehr als eine genuin theologische Alternative zum metaphy sischen Denken interpretiert wurde.10 Dazu kommt, dass auch Derrida – nicht zuletzt aufgrund seiner Freundschaft mit Caputo, der ihn immer mehr in theologische Diskus sionen verwickelte und seine Texte verstärkt in religiöse Richtungen interpretierte – in Amerika viel von TheologInnen, Bibelwissenschaf terInnen und auch anderen ReligionswissenschafterInnen gelesen wird. Kevin Hart war in diesem Zusammenhang einer der ersten, der Derrida als theologischen Denker vorstellte, in seinem einfluss reichen, erstmalig 1989 veröffentlichen The Trespass of the Sign: Deconstruction, Theology, and Philosophy. Hent de Vries, Mark Taylor und natürlich Caputo trugen auch zur Popularität Derridas in theolo gischen und religionswissenschaftlichen Kreisen bei.11 Auch Derrida selbst verstärkte den Drift zur Theologie, teils durch sein Interesse an der sogenannten »negativen« Theologie und gewisse Parallelen
H. Coward,T. Foshay (Hg.), Derrida and Negative Theology. J.-L- Marion, Étant donné (2002 übersetzt). 11 H. de Vries, Philosophy and the Turn to Religion; Taylor, Errings; Caputo, Prayers and Tears.
9
10
234
Theopoetik und Anatheismus
zwischen ihr und seiner eigenen Methode der Dekonstruktion,12 teils durch den Text »Circonfession«, in dem er sich mit Augustinus vergleicht und von seinen »Tränen und Gebeten« berichtet (Caputo nahm diese Redewendung zum Titel für sein Buch über Derridas angebliche Religionsphilosophie).13 Andere Texte wie Donner la mort beschäftigen sich intensiv mit biblischen Texten oder philosophischen Interpreten solcher Texte wie z.B. Kierkegaard in Furcht und Zittern.14 Derridas Vorträge zur Gastfreundschaft, Vergebung und dem Kosmo politismus in den späten neunziger Jahren weisen auch oft auf die jüdischen und christlichen Wurzeln dieser Ideen hin.15 Eingeladen von der »Society for Biblical Literature« war Derrida 2002 Haupt redner an der »American Academy of Religion«, einer der größten akademischen Veranstaltungen der Welt mit jährlich Tausenden von TeilnehmerInnen (normalerweise um die 14.000 – 15.000). Etwa zur gleichen Zeit, im Jahre 2000, erschien die englische Übersetzung eines »Berichts« über die Lage der gegenwärtigen fran zösischen Philosophie, in dem Dominique Janicaud (französ. 1991) eine »theologische Kehre« im französischen Denken beklagte, für die er besonders Emmanuel Lévinas, aber auch Michel Henry, JeanLuc Marion and Jean-Louis Chrétien verantwortlich machte.16 Die Genannten würden, so Janicaud in oft polemischem Tonfall, eine »maximalistische« oder »exzessive« Phänomenologie betreiben, die auf unausgesprochenen theologischen Voraussetzungen beruhe. Ein weiterer Text beschäftigte sich detaillierter mit Marions und Henrys neueren Werken, die er einer »geborstenen Phänomenologie« bezich tigte. Die Texte Janicauds, v.a. der erste über die sog. »theologische Kehre«, hatten in den Vereinigten Staaten einen weit stärkeren Ein fluss als in Frankreich, wo sie kaum zur Kenntnis genommen wurden. Vgl. z.B. J. Derrida, »Différance« und Sauf le nom. J. Derrida, »Circonfession« (in G. Bennington, Jacques Derrida). 14 J. Derrida, Donner la mort. Die ersten beiden Kapitel interpretieren und kritisieren Kierkegaards Interpretation der biblischen Geschichte von Abrahams Opfer Isaaks; in den letzteren zwei Kapiteln geht es um die Bergpredigt, insbesondere das Versprechen, dass das Geben zwar »im Geheimen« geschehen solle, im Himmel aber belohnt werde. Derrida interpretiert dies als eine »höhere Wirtschaft«, die die »irdische Ökonomie« zwar beseitigt, aber dennoch mit Belohnungen hantiert. Vgl. auch die Sammlung von Texten in Acts of Religion. 15 Vgl. J. Derrida, De l‘hospitalité; Cosmopolitanism and Forgiveness; Parjure et pardon. 16 D. Janicaud, La phénoménologie; dieses neuere französische Buch enthält beide Texte, den zum »tournant théologique« und den nachfolgenden über die sog. »phéno ménologie éclatée«. 12
13
235
Christina M. Gschwandtner
In den Diskussionen über diese angebliche Kehre, insbesondere in den USA, steht die Grenze zwischen Philosophie oder Theologie bis heute immer wieder zur Debatte und kaum eine Tagung geht zu Ende, ohne dass der Streit zwischen den Fakultäten von neuem aufgenommen wird. Dazu kommt, dass diese Texte oft weit eifriger von TheologIn nen als von PhilosophInnen konsumiert werden und die Diskussionen immer auf dem Hintergrund der analytisch-kontinentalen Scheidung ausgetragen werden.17 Nicht nur für Derrida, sondern zusehends auch für Marion und andere französische Denker, lief dies paradoxerweise darauf hinaus, dass sie oft in den Staaten bekannter wurden, oder zumindest auf andere Weise bekannt wurden, als im eigenen Land. Und oft bedeutet dies, dass ihre religiösen oder theologischen Texte mehr gelesen wurden und werden als ihre philosophischen. Hinzu kommt, dass der strenge französische Grundsatz der »laïcité«, insbesondere im akademischen Bereich, »rein« philosophischen Texten weit größeren Wert beimisst und »theologisch«-gefärbte Texte für Berufungen oder akademische Promotionen nicht zählen. Diese Werke bleiben daher in Frankreich in der Tat eher unbekannt, während sie in Amerika wiederum meist mehr gelesen werden als die rein philosophischen. Marion wurde in den USA und Kanada daher zunächst nicht als Descartes-Spezialist, sondern als der Theologe eines »Gottes ohne Sein« bekannt. Blieb Derrida auch immer dabei, dass er »zu Recht als Atheist gelte« (eine Formulierung, die Caputo fast in jedem Vortrag und Text zitierte und interpretierte), ist Marion eindeutig Katholik und kann in gewissem Sinne sogar als Apologetiker des katholischen Glaubens gelesen werden, auch wenn dies eine Apologetik der »nega tiven Theologie« ist und keine »natural theology«, die von Beweisen handelt oder auch die Naturwissenschaft zum Beistand aufruft.18 Marions Überlegungen zur Gabe, zur Ontotheologie, zur »ontologi schen Differenz«, zur Liebe und zum »saturierten Phänomen« werden Die analytische Philosophie wird auch in Theologie immer einflussreicher. Parado xerweise hat »kontinentale Philosophie« die weiteste Verbreitung und den größten Einfluss in Amerika in der Literaturwissenschaft (besonders der Branche von »com parative literature«), allerdings trifft dies nur auf Dekonstruktion, Strukturalismus, Psychoanalyse und ähnliche Richtungen zu, nicht auf Phänomenologie oder Religi onsphilosophie. 18 Vgl. J.-L. Marion, Visible et révélé und Croire pour voir. Fast alle Artikel in diesen Sammlungen wurden ursprünglich als Beiträge zu der katholisch-theologischen Zeit schrift Communio veröffentlicht, deren französischen Zweig Marion auf Verlangen Hans Urs von Balthasars mitbegründete und den er jahrelang leitete. 17
236
Theopoetik und Anatheismus
an zahlreichen theologischen und philosophischen Tagungen disku tiert. Besonders relevant war in diesem Rahmen Marions Behauptung, dass Gott »ohne Sein«, d.h. ohne Metaphysik verstanden werden müsse. »Liebe« und »Freigiebigkeit« »definieren« Gott besser als das Sein. Allerdings solle man Gott Marion zufolge gar nicht defi nieren, denn das Göttliche ist genau dadurch gekennzeichnet, dass es nicht definiert werden kann, sondern jeder Definition entkommt und sie sozusagen »durchstreicht«19. Gott gibt Gott selbst in völliger kenotischer Großzügigkeit und Freigiebigkeit. Gott kann also nicht verstanden werden, besonders nicht anhand metaphysischer Prinzi pien, sondern Gott offenbart sich uns. Da Marions Descartes-Schriften in Amerika so gut wie unbekannt geblieben sind, wird diese Metaphy sikkritik nun aber oft missverstanden. Marion begründet sie nämlich nicht nur im Rückgriff auf Heideggers Definition der Metaphysik als »Ontotheologie«, sondern insbesondere auch mit Blick auf die frühmoderne Debatte über die Schöpfung der »ewigen Wahrheiten« der Logik, Mathematik und Geometrie, die immer mehr auch auf Gott angewendet wurden und daher das Göttliche der Logik untertan machten (wie in Galileo, Kepler und Mersenne) oder das Sein in Gott und Kreatur auf gleiche Weise verstanden (wie in Bérulle, Suárez und Vasquez).20 Mit Descartes (und Pascal) verwehrt sich Marion gegen diese Tendenzen, die er im Grunde als Blasphemie und Gottes lästerung ansieht. Gott müsse frei und jenseits aller menschlichen Logik und allen menschlichen Verstehens bleiben, solle weder in einer natürlichen oder rationalen »Theologie«, noch in einer »Ontologie« gefangen werden – und schon gar nicht im Sinne der causa sui verstan den werden. Der »mystischen Theologie« der Patristik folgend, müsse jede Bezeichnung Gottes nicht nur bejaht, sondern auch verneint In Gott ohne Sein verwendet Marion eine Methode der Durchstreichung für das Wort »Gott« in dem er ein »Andreaskreuz« über das Wort schreibt. Dies symbolisiere gleichzeitig, dass der »alte« Gott, der Gott der Idolatrie und der Aufklärung, im Sinne Nietzsches »tot« sei und dadurch Platz mache für einen wirklichen Gott, der nicht sterben könne und keiner aufklärerischen Definition unterliege. Der Tod dieses blasphemischen »Gottes« (eigentlich nur einer falschen Idee Gottes) sei zu feiern, nicht zu betrauern. Vgl. auch L‘idole et la distance und »La fin de la fin«. 20 Marion entwickelte die Grundsätze seines Denkens in so wichtigen frühen Texten wie Théologie blanche, bis heute leider unübersetzt (die wenigsten amerikanischen Studenten haben die Sprachfähigkeiten, philosophische Texte in der Originalsprache zu lesen). 19
237
Christina M. Gschwandtner
werden, weil keine solche Definition oder Beschreibung je adäquat sein könne; Gott entkomme sowohl der Affirmation als auch der Negation, könne also nicht ins Sein eingeschlossen werden.21 In Gott ohne Sein beschreibt Marion dies vermittels der Symbolik von Idol und Ikone. Beide sind »Bilder« Gottes, im materiell-wörtli chen und im theoretisch-übertragenen Sinne, doch das Idol errichtet einen Götzen, der dem Betracher gleicht und wie ein Spiegel das eigene Bild zurückwirft. Ein Idol sieht in Gott nur, was man in sich selbst sehe. In der Ikone geht der Blick stattdessen durch das »Bild« hindurch und wird von einem Gegenblick zurückgeworfen. Durch die Ikone findet sich der Betrachter von Gott in den Blick genom men.22 Hier offenbare sich Gott selbst und zwar auf göttlichem Wege, d.h. ohne menschlichen Definitionen unterworfen zu sein. Marion führt diese Analyse fort in der Phänomenologie des »saturierten Phänomens«. Eine Phänomenologie der Gabe entkommt, so seine Argumentation, der Husserlschen Phänomenologie des Objekts und Heideggers Phänomenologie des Seins.23 Ein saturiertes Phänomen »ist« nicht, sondern gibt sich und zwar von sich selbst her, auf seine eigene Weise.24 Wir können ein solches Phänomen nicht vorhersa gen, uns nicht darauf vorbereiten, es nicht verstehen, wir können es nur annehmen und selbst das nur unter größter Anstrengung, weil es so überraschend, beeindruckend und »blendend« ist. Wie die Ikone bestimmt das saturierte Phänomen uns, statt dass wir es bestimmen oder definieren.25 Obwohl Marion seine Phänomenologie der Gabe strikt philoso phisch entwickelte, wird v.a. das saturierte Phänomen oft vornehmlich theologisch interpretiert. Während für Marion geschichtliche oder kulturelle Ereignisse, Gemälde, unser Leib und der geliebte Andere alle als saturierte Phänomene zählen,26 bezieht die Sekundärliteratur – nicht ganz unrichtig – diese Kategorie häufig auf religiöse Phäno mene und besonders auf Gottes Selbstoffenbarung.
Zuerst in Marions Vortrag für die erste Villanova-Tagung ausgearbeitet und später Kapitel 6 in De surcroît. 22 Siehe J.-L. Marion, Dieu sans l‘être und La croisée du visible. 23 Zuerst argumentiert in J.-L. Marion, Réduction et donation, dann systematischer in Teil 1 und 2 von Étant donné. 24 Teil 4 von J.-L. Marion, Étant donné. 25 Siehe auch J.-L. Marion, D’ailleurs, la Révélation. 26 Siehe Kapitel 2–5 in J.-L. Marion, De surcroît. 21
238
Theopoetik und Anatheismus
Marion ist natürlich nicht der einzige französische Philosoph, der in Amerika gelesen wird. Auch von den Texten Jean-Yves Lacostes und Jean-Louis Chrétiens liegen zumindest teilweise Übersetzungen vor, obwohl sie lange nicht so einflussreich sind, wie diejenigen Marions. In den letzten Jahren ist Emmanuel Falque, ein ehemaliger Student Marions, häufig für wissenschaftliche Besuche und als Gast dozent in den Vereinigten Staaten gewesen und seine Bücher sind extrem schnell übersetzt worden. Zusammen mit Kevin Hart, Richard Kearney, und Jeffrey Bloechl (Boston College) hat er die französischamerikanische Zusammenarbeit im »International Network for the Philosophy of Religion«, das sich alle zwei Jahre zu einer größeren Tagung trifft (bisher in Paris) und auch eigenständige, mehr lokale Workshops für jüngere Wissenschaftler und Studenten organisiert, institutionalisiert. Falque arbeitet mit großem Enthusiasmus uner müdlich an der Verbreitung katholisch-phänomenologischen Den kens auf beiden Seiten des Atlantiks. Da er am »Katholischen Institut« in Paris unterrichtet, unterliegt er nicht den gleichen Auflagen der »laïcité« wie Lévinas, Marion und andere Philosophen, die an der Sorbonne tätig waren. Er vermischt Philosophie und Theologie viel auffälliger und freier in seinen phänomenologischen Analysen von Tod und Auferstehung, Leib und Eucharistie, Schmerz und Heilung, Endlichkeit und Sünde.27 Der »Rubikon« zwischen Philosophie und Theologie müsse überquert werden: Hierbei handelt es sich um eine Botschaft, die im interdisziplinären Amerika vielleicht eher Anklang findet als in den europäischen Gefilden traditioneller wissenschaftli cher Enklaven.28 Kevin Harts, John Caputos, Merold Westphals und Richard Kearneys führende Rolle in dieser kurz skizzierten Rezeption der französischen Religionsphilosophie kann nicht genug betont werden. Nicht nur Marion, sondern auch Lacoste, Chrétien, Henry, Falque, Stanislas Breton und Jean Greisch wurden und werden nach Amerika eingeladen und ihre Werke dort gelesen aufgrund der unermüdlichen Arbeit und enthusiastischen Unterstützung insbesondere Caputos und Kearneys. Betreuungen von Doktorarbeiten, die Herausgabe Siehe die Trilogie: E. Falque, Passeur de Gethsémani, das Jesu‘ Gebet im Garten als Ausgangspunkt für eine Analyse des Todes im Sinne Heideggers nimmt, Méta morphose de la finitude, ein philosophisch-theologischer Aufsatz über Geburt und Auferstehung, und Noces de l’Agneau, das sich dem Thema von Leib und Eucharis tie widmet. 28 E. Falque, Passer le Rubicon. 27
239
Christina M. Gschwandtner
einschlägiger Reihen (bei Verlagen wie Indiana University Press und Fordham University Press durch Caputo und Westphal z.B.), zahlrei che Interviews (v.a. von Kearney organisiert und publiziert) und diverse Veranstaltungen, sowohl eigenständige Tagungen als auch in Kooperation mit wissenschaftlichen Organisationen wie SPEP (»Society for Phenomenology and Existential Philosophy«), ACPA (»American Catholic Philosophical Association«) und AAR (»Ame rican Academy of Religion«), tragen das ihre dazu bei. Darüber hinaus begannen John Manoussakis, ein ehemaliger Student Richard Kear neys, und Brian Becker 2019 mit der Herausgabe einer wissenschaft lichen Zeitschrift für kontinentale Religionsphilosophie (Journal for Continental Philosophy of Religion), um so bessere Publikationsmög lichkeiten für entsprechende Forschung zu ermöglichen. Caputo, Westphal, Hart, Kearney und andere führten in französi sches Gedankengut aber keineswegs nur ein. Sie passten es auch dem spezifisch amerikanischen Kontext konstruktiv an, einem Kontext, der stark durch die Pluralität und Diversität existierender kultureller und religiöser Richtungen gekennzeichnet ist.29 Caputos und Kear neys Weiterentwicklungen der französischen Ideen sind vermutlich die bekanntesten und einflussreichsten – und werden daher hier in der Folge etwas genauer beleuchtet.
2. Caputo: Ein Gott ohne Religion John Caputo, im italienisch-amerikanischen Katholizismus aufge wachsen, argumentiert besonders gegen den politisch einflussreichen evangelikalen Fundamentalismus in Amerika und gegen das katho lische Hierarchiedenken, die er zu schwächen sucht. Wir brauchen eine »Religion ohne Religion«, in der »Gott« nur noch der Name für Liebe oder für das »Ereignis« ist. Der »Name Gottes« stehe für neues Schaffen, das Caputo »Theopoetik« nennt, einen Ausdruck, den Kear ney später auch verwenden wird.30 Vor allem von Derridas Methode
Kevin Hart ist Australier und Richard Kearney Ire, beide unterrichten aber seit Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten. 30 J. D. Caputo, Weakness of God, S. 101–12; Insistence of God, S. 59–86; Folly of God, S. 103–28. 29
240
Theopoetik und Anatheismus
der »Dekonstruktion« inspiriert,31 dekonstruiert Caputo die traditio nellen theologischen Dogmen von Gottes Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwärtigkeit, und creatio ex nihilo.32 (Kearney wird ihm auch hier in gewissem Sinne folgen.) Mit Kierkegaard kämpft Caputo gegen Christentum ohne christliche Praxis, kirchliche Theologie ohne Nächstenliebe, dogmatische Engstirnigkeit ohne Leidenschaft. Obwohl Caputo damit begann, Heidegger und Thomas von Aquin miteinander ins Gespräch zu bringen, wendet sich sein Den ken früh der Philosophie Derridas zu. Er interpretiert Derrida als Hermeneut, sieht Dekonstruktion als eine radikale Hermeneutik, die Gadamers noch zu romantische Hermeneutik hinter sich lässt und die Folgerungen hermeneutischen Denkens konsequenter zieht.33 Wie später auch bei Kearney spielen in dieser »dekonstruktiven« Interpretation oft ethische Gründe und Interessen mit, aber dies ist keine Ethik im Sinne Kants, sondern eine radikalere, postmoderne, postmetaphysische Ethik, die nicht rationalen Grundsätzen folgt, sondern sie eschatologisch »umkehrt« und prophetisch mit der radi kalen Kontingenz aller Dinge »spielt«.34 Sie gibt uns keine universal gültigen Vorschriften und Maßregeln, untergräbt alle Systeme und Institutionen, lebt ohne Grund und Ende. Trotz aller Kritik an Justiz und Politik bedeutet für Caputo die Dekonstruktion nicht Anarchie oder Verantwortungslosigkeit. Nichts kann ungedeutet, uninterpre tiert, unkritisiert bleiben, aber nicht nur ist diese Kritik selbst bereits ein ethisches »Prinzip«, sondern es »spricht« das »Unmögliche« der Gerechtigkeit und der radikalen »messianischen« Demokratie noch jenseits aller praktischen Grenzen und Kompromisse, ruft uns immer neu zu Verantwortung und Offenheit auf. Radikale Hermeneutik bedeutet, dass alles Feste, Determinierte, Geschriebene, Unterschrie bene, Gesetzte dekonstruiert werden muss, eben im Namen des Unentscheidbaren, Ungeschriebenen, Unmöglichen, des Gerechten als solchem.35 Er lud Derrida zur Inauguration des Doktorprogrammes 1994 an der Villanova Universität ein und beschreibt Derridas Methode in J. D. Caputo, Deconstruction in a Nutshell. 32 J. D. Caputo, Weakness of God, S. 23–41, S. 55–83, S. 84–97. 33 J. D. Caputo, Radical Hermeneutics, S. 187–206; More Radical Hermeneutics, S. 84– 124, S. 193–64; Hermeneutics, S. 115–88. 34 J. D. Caputo, Radical Hermeneutics, S. 236–67; More Radical Hermeneutics, S. 172– 90; Insistence of God, S. 136–64; Against Ethics. 35 J. D. Caputo, Hermeneutics, S. 191–215. 31
241
Christina M. Gschwandtner
Postmoderne bedeutet für Caputo nicht nur allgemein das Ende der Moderne, sondern auch das Ende des Triumphs der Säkularisation und daher einen Neubeginn des von der Aufklärung verworfenen Religiösen. Dies ist allerdings keine Rückkehr zum Mittelalter: Reli gion ist zu Recht in der Krise und die Entmythologisierung und Kritik der Transzendenz, der Autorität und des Aberglaubens hat ihr gutes Werk getan, das wir nicht rückgängig machen sollten.36 Und doch öffnet die Postmoderne die Tür für den prophetischen Geist des PostReligiösen. Caputo definiert diese »Religion« als »Liebe Gottes«, der Frage Augustinus‘ folgend: »Was liebe ich, wenn ich Gott liebe?«37 In Gottes Liebe und Liebe für Gott geht es um »das Unmögliche«, um das Offene, um die »absolute« oder radikale Zukunft. Caputo kritisiert, was er »bestimmte« Religionen nennt, die Konfessionen, die strengen Regeln folgen, auf Doktrinen aufbauen und von ihren Anhängern Loyalität und strikten Gehorsam fordern. Stattdessen brauchen wir eine Religion »der leidenschaftlichen Liebhaber des Unmöglichen«,38 viel gefährlicher, als wir uns die Religion normalerweise vorstellen und zwar nicht als Heraufbeschwören eines neuen Fundamentalis mus, sondern als das genaue Gegenteil: völlige Freiheit von Bestim mungen und Regeln, reine Leidenschaft der Liebe, totale Offenheit für was auch kommen mag, eine »Religion ohne Religion«.39 Der Name Gottes steht für »Aufforderung, Einladung, Ansuchung«; Gott kann nicht festgehalten oder definiert werden, sondern ist »mannigfaltig, polyvalent, unverminderbar, unhaltbar«.40 In Gegensatz zu Marion allerdings, dem es darum geht, Gottes Transzendenz und Andersheit zu bewahren, liegt Caputo nicht an Gott per se, sondern an den Auswirkungen auf das menschliche Miteinander. Religion ist daher zuerst Lieben und dann auf jeden Fall Handeln. Kein Glaube hat Hand und Fuß, wenn er nicht in konkrete Taten umge setzt wird. In Anlehnung an das »Social Gospel« mit seiner Frage »Was würde Jesus tun?« formuliert Caputo sie neu als »Was würde Jesus dekonstruieren?« und antwortet: die Kirche, die Hierarchie, die theologischen Dogmen, unsere Sicherheiten und festen Überzeugun gen. Derridas Dekonstruktion kann als eine »glückliche Hermeneutik 36 37 38 39 40
J. D. Caputo, Hermeneutics, S. 275–303. J. D. Caputo, Religion, S. 1. J. D. Caputo, Religion, S. 92. J. D. Caputo, Religion, S. 109–41. J. D. Caputo, Religion, S. 140–41.
242
Theopoetik und Anatheismus
des Reichs Gottes« interpretiert werden durch den quasi-biblischen Ruf zur Gerechtigkeit, der die Reichen und Einflussreichen von ihren bequemen Sesseln schubst und stattdessen die Armen und Ausgesto ßenen willkommen heißt.41 In der heutigen Pluralität gibt es keinen eindeutigen Weg zu Gott oder ins Himmelreich, und Dekonstruktion kann uns lehren, in dieser Unsicherheit zu leben.42 Das Ereignis nimmt uns in Anspruch; es hat die »Struktur des Rufs«, ein Ruf der Hoffnung, der Unmöglichkeit, der offenen Zukunft.43 Wir müs sen Gesetzgebung und Regierung dekonstruieren, damit wirkliche Gerechtigkeit und die »Demokratie der Zukunft« aufblühen können. Derrida, die hebräischen Propheten und Jesus werden hier als ähnliche Revolutionäre und Gegner des status quo vorgestellt.44 Das Geschenk der Dekonstruktion an die Religion ist radikale Gastfreundschaft und Vergebung, eine Erinnerung an die prophetische Verheißung und messianische Hoffnung für Frieden, Ende der Armut und Not, radikaler Gerechtigkeit und Liebe. Das ist »Theopoetik« und religiöse Praxis im Sinne Jesu, wie besonders deutlich ausgedrückt in der Berg predigt.45 Für Caputo ist Gott nicht das »höchste Wesen« oder der Grund alles Seins als solchem. Gott ist das Unbegründete, das Überra schende, das Unvorhersehbare, das Undekonstruierbare.46 Akademi sche Theologie, priesterliche Hierarchie, traditionelle Religion müs sen gestürzt werden. Der Tod Gottes ist daher eine gute Nachricht, denn er signaliert den Tod der alten Dogmen, der Praktiken von Exklu sion und Verdammnis, der »starken« Theologie, die heute nicht mehr haltbar ist.47 Der Name Gottes, der im Ereignis anklingt und neue Möglichkeiten (und Unmöglichkeiten) eröffnet, verwirft trockene Theologie und steife Rechtsgläubigkeit. Sattdessen brauchen wir eine »schwache« oder sogar »anarchische« Theologie, die inklusiver, freier und offener ist.48 Das Reich Gottes ist diese »Schwachheit« Gottes, nämlich die Hoffnung des Ereignisses. Caputo argumentiert, dass Gott nicht »existiert« sondern »insistiert«, d.h. mit Nachdrücklichkeit 41 42 43 44 45 46 47 48
J. D. Caputo, What would Jesus Deconstruct?, S. 35. J. D. Caputo, Deconstruct?, S. 42. J. D. Caputo, Deconstruct?, S. 59–60. J. D. Caputo, Deconstruct?, S. 63–69. J. D. Caputo, Deconstruct?, S. 81–90. J. D. Caputo, Folly of God, S. 7–34. J. D. Caputo, Folly of God, S. 51–52. Hier ist Marion sich mit Caputo einig (s.o). J. D. Caputo, Weakness of God, S. 84–97, S. 127–78; Folly of God, S. 53–64.
243
Christina M. Gschwandtner
ruft oder anspricht.49 Hier geht es nicht um Wissen oder Sicherheit, sondern um die »Torheit« der Liebe.50 Doch wenn »Gott« tot ist und traditionelle Religion nicht mehr befriedigt, warum sollten wir dann überhaupt noch von Gott sprechen? Für Caputo klingt etwas im »Namen Gottes« an, das nicht reduziert oder dekonstruiert werden kann. Der Name Gottes spricht von absoluter Liebe, völliger Freiheit, unbegründeter Weisheit, irdischer statt himmlischer Hoffnung. Der Name Gottes dekonstruiert alle Sicherheiten, feste Doktrinen, dog matische Überzeugungen, machtvolle Hierarchien und macht so die Letzten und Kleinsten zu den Ersten: »Die einzige Logik im Reich Gottes ist die törichte Logik vom Kreuz, und die einzige Macht ist die machtlose Macht von Barmherzigkeit und Vergebung, und die einzige Regel ist die Regellosigkeit einer verdrehten Welt.«51 Theopoetik krempelt die Ärmel hoch und macht sich die Hände dreckig mit dem Elend unserer Mitmenschen: »Der Ruf ruft. Er ruft von den Leibern der Hungrigen und Nackten und Eingesperrten und erinnert an den Leib des Gekreuzigten.«52 Wir können nicht erwarten, dass Gott plötzlich kommt und alles zurechtbiegt, sondern müssen selber handeln ohne Erwartung von himmlischer Belohnung. Caputo beruft sich auf die Mystiker, besonders Meister Eck hart, der darum betete, dass Gott ihn von Gott befreien möge.53 Laut Eckhart stehe Martha für eine radikale Theologie der Aktion, gegenüber der passiven Kontemplation der Maria.54 Theologie als Dogmengeschichte und Religion als bestimmte Glaubenssätze und konkrete Praktiken verschiedener Konfessionen würden vom Ereignis beiseite geschoben.55 Unsere Begierde nach irdischen oder himmli schen Gütern müsse einem Verlangen nach Gerechtigkeit und einer radikalen Theologie des Namen Gottes weichen.56 Caputo betont: »In der Theopoetik ist ›Gott‹ ein paradigmatisches Wort, das in einer halb durchsichtigen Weise Echo wird für die Ereignisse, die auf der Ebene des Immanenten stattfinden, Ereignisse, die ich unter dem leitenden Symbol des ›Möglichen‹ hervorgerufen habe«. Er gibt dies an als 49 50 51 52 53 54 55 56
J. D. Caputo, Folly of God, S. 83, 106; Insistence of God, S. 74–82. J. D. Caputo, Folly of God, S. 90. J. D. Caputo, Folly of God, S. 109. Vgl. Insistence of God, S. 262–63. J. D. Caputo, Folly of God, S. 128. J. D. Caputo, Insistence of God, S. 63. J. D. Caputo, Insistence of God, S. 39–55. J. D. Caputo, Insistence of God, S. 83. J. D. Caputo, Insistence of God, S. 86.
244
Theopoetik und Anatheismus
Grund »warum Religion ein paradigmatisches, vielsagendes, ›offen barendes‹ Phänomen ist, und warum es eine wirkliche ›Offenbarung‹, eine ›religiöse‹ Offenbarung vorstellt, das Wahrwerden der Wahrheit, das eine bestimmte nach-phänomenologische Poetik des Ereignisses vom Wahrwerden der Wahrheit mit sich bringt«.57 Dieses »Mögliche« sei die Spanne zwischen Gut und Böse, die Distanz zwischen ihnen. Es sei nicht »indifferent«, sondern der ursprüngliche Geburtsort aller Möglichkeiten, sogar noch vor der Schöpfung.58 In Caputos Händen wird Dekonstruktion zu einer radikalen Hermeneutik der ethischen Umstürzung aller Werte im Namen mes sianischer Gerechtigkeit, der Rebellion gegen alle kirchliche und poli tische Obrigkeit, des Willkommenheißens aller Unterdrückten und Abgeschobenen. Dies ist eine Religionsphilosophie, in der Religion nur noch in einem postmodernen, post-theologischen Sinne tätig ist, als Symbol oder Inspiration einer Poetik der Hoffnung, eines Gottes, »den selbst Nietzsche lieben könne«.59
3. Kearney: Ein Gott ohne Macht Wie Caputo ist auch Richard Kearney stark von Derrida beeinflusst, jedoch spielen Lévinas und Ricoeur eine mindestens so große Rolle in seiner Philosophie. Er ist auch noch mehr von der Hermeneutik, zumindest im traditionellen Sinne, geprägt als Caputo. In The God who may be, einer Hermeneutik der Religion, beantwortet Kearney Ricœurs bekannte Frage »D’où parlez-vous?«: »... ich stamme aus der katholischen Tradition, aber mit dem Proviso: wenn Katholizismus die Liebe und Gerechtigkeit beleidigt, dann würde ich mich lieber einen jüdisch-christlichen Theisten nennen; und wo diese Tradition so beleidigt, nenne ich mich lieber religiös im Sinne von Gott-Suchen auf eine Art und Weise, die andere Religionen nicht ausklammert oder behauptet, letzte Wahrheit gefunden zu haben. Und wo das Religiöse auf diese Weise beleidigt, nenne ich mich einen Sucher von Liebe und Gerechtigkeit tout court.«60 Er lehnt wie Caputo die Lehre der Allmacht Gottes ab, die nach der Shoah keine Gültigkeit mehr 57 58 59 60
J. D. Caputo, Insistence of God, S. 116. J. D. Caputo, Insistence of God, S. 259 f. J. D. Caputo, Hermeneutics, S. 319. R. Kearney, God Who May Be, S. 5 f.
245
Christina M. Gschwandtner
haben könne.61 Wenn Gott allmächtig wäre, hätte er wenigstens dort eingreifen müssen. Dass er es nicht getan hat, zeige, dass er verhindert war oder zumindest nicht allmächtig. Gott sei aktiv in der Welt nur durch uns; Gott »wird« Gott durch unser Tun; wir müssen Gott helfen (vgl. Etty Hillesum). Für Kearney bedeutet dies wie für Caputo radikale Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft, Offenheit für den Anderen. Kearney interpretiert das göttliche »posse« nicht als starke »potentia« im Sinne von Macht oder Kraft, sondern als schwächere »possibility«, als Möglichkeit und Versprechen, das wir selber in die Tat umsetzen müssen. Auf diese Weise sucht er einen Mittelweg zwischen Ontotheologie und Poetik. Diese Methode des »Mittelwe ges« (»metaxu«) ist charakteristisch für seine Philosophie.62 Selbst in seinen frühesten Werken über Poetik, Einbildungskraft und »erzäh lende Phantasie« imitiert er Ricœurs Versuch der Balance zwischen extremen Positionen.63 In diesem Sinne folgt Kearney auch Derrida und Caputo nicht bis zur völligen Offenheit und Untentscheidbarkeit. Mit Ricœur betont er, dass wir immer zu entscheiden haben, dass Weisheit und Einsicht (phronesis) vonnöten seien, um solche Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel seien Gott und khora nicht identisch, wie das oft bei Derrida oder Caputo den Anschein habe, und zu einem Terroristen oder Diktator brauche man nicht gastfreundlich sein.64 Kearney argu mentiert auch gegen eine Verherrlichung der Extreme oder des Nihi lismus, wie er sie bei Lyotard, Baudrillard, Žižek und manchmal auch bei Derrida vermutet.65 Der Terroranschlag vom 11. September 2001, die Feindschaften zwischen Protestanten und Katholiken in Nordir land, die Unterdrückung von Minderheiten überall, der Hass und Extremismus, der den Wellen von Flüchtlingen entgegengebracht wird, in Europa und auch in Amerika, verlange von uns ethisches Handeln und inklusiveres Denken, das solche Differenzen überbrü cken könne. Obwohl wir keine endgültigen Antworten haben und totalitäres Denken – im Sinne Lévinas – vermeiden sollten, hilft es nicht, gar keine Entscheidungen zu treffen oder völlige Alterität jeg licher Art zu glorifizieren. R. Kearney, God Who May Be; Anatheism, S. 57–81. R. Kearney, Strangers, S. 3–20. 63 R. Kearney, Wake of Imagination, S. 359–97; R. Kearney, Poetics of Imagining, S. 218–40. 64 Siehe besonders R. Kearney, Strangers, S. 83–108, S. 191–211. 65 R. Kearney, Strangers, S. 109–37. 61
62
246
Theopoetik und Anatheismus
Hierfür entwickelt Kearney seine »diakritische Hermeneutik«, eine Interpretationsmethode, die die Pluralität von Möglichkeiten und Bedeutungen offenhält, während sie doch ethisch verantwortlich ist.66 Er unterstreicht fünf Dimensionen dieser »Diakritik«: Erstens habe sie eine »kritische« Funktion in der Nachfolge Kants und der »kritischen Theorie« Habermas‘ und Benjamins im Sinne von Kritik an Hierarchie, Macht, Autorität. Zweitens sei sie »kriteriologisch« im Sinne von Kriterien, die zwischen gegensätzlichen Deutungen unter scheiden vermögen und besonders ethische Richtlinien entwickeln können. Drittens sei sie eine »dia-krisis« im linguistischen Sinne von Akzenten oder graphischen Siglen für Aussprache und Bedeutung; Kearney identifiziert dies mit Derridas Methode der Dekonstruktion. Viertens meint er Diakrise im medizinischen oder therapeutischen Sinne als Diagnose von Merkmalen und Symptomen, die Behandlung und Heilung ermöglichen. Diese vier Elemente werden kombiniert in was er, fünftens, eine »karnale« oder leibliche Hermeneutik nennt. Odysseus‘ Hund Argos ist hier das Standardbeispiel: Erkennen durch Gespür und Empfindung. Sprachliche Verständigung und Offenheit zum Gespräch verlange daher immer Takt und Fingerspitzengefühl. Das ist hier ganz wörtlich zu nehmen, im musikalischen und leib lichen Sinne, denn Hermeneutik steckt immer auch im Leib -- in den Ohren und den Fingern -- und nicht nur im Kopf. Wir spüren und verstehen durch leibliche Empfindungen, die uns anleiten, eine körperliche Sensibilität zu entwickeln.67 Kearney steht oft inmitten der Konflikte, im Gespräch mit beiden Seiten, nicht nur in Nordirland und Südafrika, sondern in Krisenher den auf der ganzen Welt (sein »Gästebuch-Projekt« ist ein gutes Beispiel dafür; er war auch aktiv am Friedensprozess in Nordirland beteiligt). Er leitet verfeindete Gruppen an, ihre Geschichte zu erzäh len und auf die der Gegner zu hören. Geschichten und Erzählungen haben einen zentralen Platz in Kearneys Schriften als Werkzeug, das tiefe Abgründe überbrücken und zu Heilung und Verständnis führen könne.68 Erzählen und Zuhören öffnen uns für die Perspektiven Anderer, lehren uns Weisheit, gegenseitiges Verständnis und das ethische Miteinander. In einer Erzählung können wir uns mit dem Anderen identifizieren, die Perspektive Anderer verstehen, in dem wir 66 67 68
R. Kearney, »What is Diacritical Hermeneutics?«, »Diacritical Hermeneutics«. Siehe auch R. Kearney, B. Treanor (Hg.), Carnal Hermeneutics; R. Kearney, Touch. R. Kearney, On Stories, S. 125–56.
247
Christina M. Gschwandtner
sie sympathisch mitempfinden, vielleicht sogar die Welt aus der Sicht der Anderen betrachten.69 Erzählungen haben Übersetzungswert, im wörtlichen und übertragenen Sinne; sie erlauben uns, uns gegenseitig zu berühren und die Hände offen auszustrecken als riskante Geste des Willkommens, ohne die Antwort der Anderen zu kontrollieren oder vorhersagen zu können. Das ist Kenose im philosophischen Sinne.70 Kearney spricht als Theist, aber als »ana-theistischer« Theist, als Theist, der offen ist für den Atheismus, der Atheisten und den Anhängern anderer Religionen als der eigenen offen zuhört und sie ernst nimmt. Nur so könne man heute noch zu Gott »zurückkehren« (ana = zurück, wiederum): durchs offene Gespräch, durch Humor, durch Zuhören, durch Phantasie, durch Gastfreundschaft.71 Dadurch finden wir nicht den allmächtigen, allwissenden, allgegenwärtigen Gott, sondern stattdessen den Gott der kleinen und alltäglichen Dinge: »Heiligkeit in einer Tasse Tee« oder das Spenden »eines Trunks Wasser«.72 Gott sei nur in unserer Schwachheit mächtig, und Glaube an Gott gehe nicht ohne Zweifel oder Phasen des Unglaubens. Dieser Gott wird entdeckt durch Poesie, Kunst, Musik, Literatur -- und natürlich Erzählungen.73 Abraham, der Engel oder vielleicht Gott selbst bewirtet, Maria, die dem Engel vertraut und Ja zu Gott sagt, Mohammed, der auf den Engel hört, der ihm den Koran offenbart, Rublevs Ikone der Dreieinigkeit als gemeinsames Mahl oder der göttliche »Tanz« der Perichorese werden oft als Beispiele angeführt, aber auch Babettes festliches Mahl und Molly Blooms »I said yes I will yes« in Joyces Ulysses, oder die praktische Gastfreundschaft und das karitative Engagement Jean Vaniers, Ghandis, Dorothy Days und vieler anderer.74 Hier treffen sich Caputo und Kearney wieder, denn beide spre chen von Gott im »theopoetischen« Sinne: poetisch sowohl im R. Kearney, Poetics of Imagining, S. 241–57. R. Kearney, »Linguistic Hospitality«; R. Kearney, Radical Hospitality; M. E. Little john (Hg.), Imagination Now. 71 In zweiten Kapitel von Anatheism beschreibt er eine »fünffache Bewegung« von »imagination, humor, commitment, discernment, and hospitality« (Phantasie, Humor, verpflichtende Hingabe, Einsicht/Urteilsvermögen, Gastfreundschaft), S. 40. Vgl., Reimagining, S. 6–18. 72 Formulierungen, die Kearney oft verwendet. Siehe z.B. in J. P. Manoussakis (Hg.), After God, S. 3–20, S. 39–54; Reimagining, S. 240–58. 73 R. Kearney, Art of Anatheism, S. 3–28; siehe auch C. D. van Troostwijk, M. Cle mente, Anatheistic Wager. 74 R. Kearney, Anatheism, S. 17–39, S. 101–130, S. 152–65. 69
70
248
Theopoetik und Anatheismus
Sinne von Poesie und Kunst als auch im Sinne der Kreation, des (Er-)Schaffens. Und für beide ist diese Theopoetik sozial und politisch engagiert, gilt für die Unterdrückung und Armut Leidenden, die aus der Gesellschaft Ausgeschlossenen, die am Rand oder an der Grenze Stehenden. Obwohl beide die »traditionellen« Dogmen der Allmacht und Allwissenheit Gottes kritisieren, geht Kearney jedoch lange nicht so weit wie Caputo. Nicht nur argumentiert er, dass Caputos und Derridas völlige Regellosigkeit und Unbestimmtheit, sich genauso leicht für Ungerechtigkeit und Terrorismus öffne wie für die positiven Effekte, die besonders Caputo betont, und drängt auf bessere Kriterien, um solche Entscheidungen mit Weisheit zu treffen, sondern seine Religionsphilosophie ist auch theologisch kohärenter. Er verwendet oft biblische Erzählungen und Symbole, er wirft auch nicht sämtliche theologischen Dogmen aus dem Fenster, sondern öffnet sie stattdessen für die freie Unterhaltung mit Andersgläubigen (und Nicht-Gläubigen): »Statt unsere jeweiligen Überzeugungen zu schnell aufzugeben, im Namen einer globalen Religion oder Mora lität, wäre es nicht weiser anzuerkennen, was uns unterscheidet? Denn in der gegenseitigen Anerkennung vom Anderssein im Anderen können wir gemeinsam den Überfluss von Bedeutung bezeugen, der all unsere unterschiedlichen Glaubensrichtungen übersteigt.«75 Wäh rend Caputo aufzurütteln und zu provozieren sucht, zieht Kearney das gemeinsame Gespräch und größeres Verständnis vor. Sowohl für Caputo also auch für Kearney dürfen Hermeneu tik und Phänomenologie nicht voneinander getrennt werden, wenn es auch für Caputo eine radikale, dekonstruktive Hermeneutik im Sinne Derridas und für Kearney eine großzügige, dialektische Her meneutik im Sinne Ricœurs ist. Hier tritt vielleicht der Unterschied zu den französischen Philosophen am Deutlichsten hervor: Stehen Marion, Henry, Lacoste (und auch Lévinas) der Hermeneutik eher kritisch gegenüber und ziehen, wenn auch aus recht unterschied lichen Gründen, eine »reinere« Phänomenologie vor, so glauben Westphal, Caputo und Kearney, dass Phänomenologie ohne Herme neutik unmöglich sei.76 Wir sehen Phänomene immer aus einer bestimmten Perspektive, die nicht ausradiert werden kann; völlige Unmittelbarkeit, Horizontlosigkeit oder Vorurteilslosigkeit ist Illu R. Kearney, Anatheism, S. 178. Interessanterweise ist Westphal besonders von Gadamer beeinflusst, obwohl auch er Hermeneutik und Phänomenologie zusammenbringt. 75
76
249
Christina M. Gschwandtner
sion, und oft eine sehr gefährliche Illusion. Diese Betonung der spezifischen Perspektiven, die all unser Denken und Tun, selbst unser philosophisches Denken und Tun, beeinflussen, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die Charakterisierung unserer Zeit und der gegenwärtigen philosophischen Bemühungen als »postmodern« in der amerikanischen Religionsphilosophie viel gängiger ist und heut zutage als Faktum vorausgesetzt wird. Die Pluralität und Diversität, vielleicht sogar die Faszination für Technik und soziale Medien im sogenannten »amerikanischen Experiment« tragen sicher das ihrige dazu bei. Caputo und Kearney fachsimpeln nicht und ihre Texte sind selten »wissenschaftlich« im strikten Sinne. Sie bemühen sich um allgemeine Verständlichkeit und sprechen damit nicht nur zu Akade mikern, sondern auch zum interessierten Laien. Vielleicht haben sie auch deshalb einen so weitreichenden Einfluss.
Literaturverzeichnis Benson, B. E., Wirzba, N. (Hg.), The Phenomenology of Prayer, New York: Fordham University Press 2005 Caputo, J. D., Radical Hermeneutics, Bloomington: Indiana University Press 1987 —, Against Ethics: Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference to Deconstruction, Bloomington: Indiana University Press 1993 —, The Prayers and Tears of Jacques Derrida: Religion without Religion, Blooming ton: Indiana University Press 1997 —, (Hg.), Deconstruction in a Nutshell: A Conversation with Jacques Derrida, New York: Fordham University Press 1997 —, More Radical Hermeneutics, Bloomington: Indiana University Press 2000 —, On Religion, London: Routledge 2001 —The Weakness of God, Bloomington: Indiana University Press 2006 —, What Would Jesus Deconstruct? The Good News of Postmodernism for the Church, Grand Rapids: Baker Academic 2007 —, »Continental Philosophy of Religion: Then, Now, and Tomorrow«, in: Journal for Speculative Philosophy 26.2 (2012), S. 347–60 —, The Insistence of God, Bloomington: Indiana University Press 2013 —, The Folly of God: A Theology of the Unconditional, Salem, Oreg.: Polebridge Press 2016 —, Hermeneutics: Facts and Interpretation in the Age of Information, London: Pelican 2018 —, Scanlon, M. J. (Hg.), God, the Gift, and Postmodernism, Bloomington: Indiana University Press 1998 —, Dooley, M., Scanlon, M. J. (Hg.), Questioning God, Bloomington: Indiana University Press 2001
250
Theopoetik und Anatheismus
—, Scanlon, M. J. (Hg.), Augustine and Postmodernism: Confessions and Circum fession, Bloomington: Indiana University Press 2005 —, Scanlon, M. J. (Hg.), Transcendence and Beyond: A Postmodern Inquiry, Bloomington: Indiana University Press 2007 Coward, H., Foshay, T. (Hg.), Derrida and Negative Theology, Albany: SUNY Press 1992 Derrida, J., »Différance«, in: La Voix et le phénomène, Paris: Presses Universitaires de France 1967 —, »Circonfession«, in: G. Bennington, Jacques Derrida, Paris: Seuil 1991 —, Donner la mort, Paris: Transition 1992 —, Sauf le nom, Paris: Galilée 1993 —, De l‘hospitalité, avec A. Dufourmantelle, Paris: Calmann-Lévy 1997 —, On Cosmopolitanism and Forgiveness, London: Routledge 2001 —, Acts of Religion, hg. v. G. Anidjar, London: Routledge 2002 —, Le parjure et le pardon, vol. I: Séminaire 1997–1998, Paris: Seuil 2019 Dickinson, C., Miller, H., McNutt, K. (Hg.), The Challenge of God: Continental Philosophy and the Catholic Intellectual Tradition, London: T&TClark 2020 Falque, E., Le passeur de Gethsémani. Angoisse, souffrance et mort. Lecture existentielle et phénoménologique, Paris: Cerf 1999/2004 —, Métamorphose de la finitude. Essai philosophique sur la naissance et la résurrection, Paris: Cerf 2004 —, Les noces de l‘agneau. Essai philosophique sur le corps et l‘eucharistie, Paris: Cerf 2011 —, Passer le Rubicon. Philosophie et théologie: Essai sur les frontières, Paris: Lessius 2013; übersetzt von M. Kneer als Den Rubikon überschreiten. Philosopie und Theologie: Ein Versuch über ihre Grenzen, Münster: Aschendorff 2020. Floyd. G. P., Rumpza, S. (Hg.), The Catholic Reception of Continental Philosophy in North America, Toronto: University of Toronto Press, 2020 Gratton, P., Manoussakis, J. P. (Hg.), Traversing the Imaginary: Richard Kearney and the Postmodern Challenge, Evanston: Northwestern University Press 2007 Hart, K., The Trespass of the Sign: Deconstruction, Theology, and Philosophy, New York: Fordham University Press 2000 Janicaud, D., La phénoménologie dans tous ses états, Paris: Gallimard 2000 Kearney R., The Wake of Imagination, London: Routledge 1988 —, Poetics of Imagining: Modern to Post-modern, New York: Fordham University Press 1998 —, On Stories, London: Routledge 2002 —, Strangers, Gods and Monsters, London: Routledge 2003 —, The God who May Be: A Hermeneutics of Religion, Bloomington: Indiana University Press, 2001 —, Debates in Continental Philosophy: Conversations with Contemporary Thin kers, New York: Fordham University Press 2004 —, Anatheism: Returning to God After God, New York: Columbia University Press 2010 —, Radical Hospitality: From Thought to Action, New York: Fordam University Press 2021
251
Christina M. Gschwandtner
—, Touch: Recovering Our Most Vital Sense. New York: Columbia University Press 2021 —, »What is Diacritical Hermeneutics?«, in: Journal of Applied Hermeneutics (2011), S. 1–14 —, »Diacritical Hermeneutics«, in: M. L. Protocarrero, L. A. Umbelino, A. Wier cinski (Hg.), Hermeneutic Rationality, Berlin: Lit Verlag 2012, S. 177–196 —, »Linguistic Hospitality—The Risk of Translation«, Research in Phenomenology 49 (2019), S. 1–8 —, Zimmermann, J. (Hg.), Reimagining the Sacred: Richard Kearney Debates God, New York: Columbia University Press 2016 —, R., Treanor, B. (Hg.), Carnal Hermeneutics, New York: Fordham University Press 2015 —, Clemente, M. (Hg.), The Art of Anatheism, London: Rowman & Littlefield International 2018 Littlejohn, M. E. (Hg.), Imagination Now: A Richard Kearney Reader, London: Rowman & Littlefield International 2020 Manoussakis, J. P. (Hg.), After God: Richard Kearney and the Religious Turn in Continental Philosophy, New York: Fordham University Press 2006 Marion, J. L., L‘idole et la distance. Cinq études, Paris: Grasset 1977/1989/1991 —, Sur la théologie blanche de Descartes. Analogie, création des vérités éternelles, fondement, Paris: Presses Universitaires de France 1981/1991/2009 —, Dieu sans l‘être, Paris: Fayard 1982; Paris: Presses Universitaires de Fran ce1991/2002/2010. —, »La fin de la fin de la métaphysique«, in: Laval théologique et philosophique 42.1 (1986), S. 23–33 —, Réduction et donation. Recherches sur Husserl, Heidgger et la phénoménologie, Paris: Presses Universitaires de France 1989/2004 —, La croisée du visible, Paris: Éd. de la Différence 1991; Paris: Presses Universi taires de France 1996/2007 —, Étant donné. Essai d‘une phénoménologie de la donation, Paris: Presses Universitaires de France 1997/1998/2005 —, De surcroît. Études sur les phénomènes saturés, Paris: Presses Universitaires de France 2001/2010 —, Le phénomène érotique. Six méditations, Paris: Grasset 2003/2004 —, Le visible et le révélé, Paris: Éditions du CERF 2005 —, Le croire pour le voir. Réflexions diverses sur la rationalité de la révélation et l‘irrationalité de quelques croyants, Paris: Parole et Silence 2010 —, La Rigueur des choses. Entretiens avec Dan Arbib, Paris: Flammarion 2012 —, D’ailleurs, la Révélation, Paris: Grasset 2020. Taylor, M., Erring: A Postmodern A/Theology, Chicago: University of Chicago Press 1984 Troostwijk, C. D. van, Clemente, M. (Hg.), Richard Kearney’s Anatheistic Wager: Philosophy, Theology, Poetics, Bloomington: Indiana University Press 2018 Vries, H. de, Philosophy and the Turn to Religion, Baltimore: John Hopkins Press 1999
252
C. In Religionsgemeinschaften verortbare Philosophie
Carool Kersten
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Seit der klassischen Ära der großen Kalifate (661–1258), haben Wissenschaftler*innen und Gelehrte*n der Islamischen Welt, aber auch in jüngerer Zeit, Philosoph*innen und Intellektuelle verschie denster akademischer Hintergründe einen Beitrag dazu geleistet, was man* Formen der Islamischen Religionsphilosophie nennen könnte. Bevor ich mich aber den modernen philosophischen Reflexionen über Religion zuwende, ist es notwendig noch etwas über die generellintellektuelle Geschichte der muslimischen Welt zu sagen. Durch die Aufbereitung des historischen Kontextes soll man* sich einerseits ein Bild machen können, andererseits ist der Grund der Notwendigkeit viel konkreter: So wie in der westlichen Philosophie Fußnoten auf Platon zurückreferieren, haben auch muslimische Philosoph*innen ihre Ideen durch die Auseinandersetzung mit ihren Vorgänger*innen entwickelt. So haben sich manche Neigungen in der fernen Islami schen Vergangenheit gebildet, wurden dann immer wieder entstaubt, und wiederaufbereitet oder haben neue Verwendungen im heutigen Muslimischen Religionsdenken erlangt. Deshalb werde ich kurz auf die klassische Periode des Islam zurückgehen, die Schlüsselmomente herausgreifen, um in die zentra len Figuren in der Entwicklung des Islamischen Philosophie- und Religionsdenkens einzuführen. Anhand von drei Beispielen werde ich meine Überlegungen zu der sogenannten frühen Islamischen Religionsphilosophie veranschaulichen. Dann werde ich zum 19. und 20. Jahrhundert übergehen, die den mehr unmittelbaren Kontext für das (Nach-)Denken über Religion und die modernen Muslime bilden. Insbesondere möchte ich erklären, wie die Konfrontation mit der Moderne jenes Denken geformt hat: Meistens kommt es auf die Resultate an, die zustande kamen, als Europa zur Islamischen Welt vordrang, sie gar einschnitt. Ein Ergebnis jener Schnittstellen ist der Islamische Reformismus (islāḥ). Besondere Aufmerksamkeit
255
Carool Kersten
sei dem ersten modernen, europäisch-geprägten Philosophen der muslimischen Welt, Muhammad Iqbal (1877–1938) geschenkt; seine Beiträge haben die Religionsphilosophie der nachfolgenden Genera tionen muslimischer Intellektueller inspiriert. Ich werde die Entwicklungen, die in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts und im frühen 21. Jahrhundert vonstatten gegangen sind, aufzeigen.
1. Der klassische Islam und die Religionsphilosophie Teil der Prägung des klassischen Islams war das Erbe des antiken Hellenismus, das aus der Eroberung der Gebiete im Nahen Osten durch das Byzantinische Reich resultierte. Durch das persönliche Patronat der Kalifen wurde – den Erbschatz erkennend – eine Über setzungsschule, die als bayt al-hikma oder auch: Haus der Weisheit, bekannt ist, gegründet.1 Auf diesem Weg wurden Texte, die sich mit den Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin beschäftigen – aber auch philosophische Werke – aus dem Griechischen ins Arabi sche übersetzt. Das gab der Islamischen Zivilisation eine Starthilfe, mithilfe derer sie das mittelalterliche Christentum rasch überholte. Manch umsichtiger Religionswissenschaftler* sah Vorteile darin, Elemente der aristotelischen und neoplatonischen Philosophie in theologische Diskussionen miteinzubringen. Ein Beispiel dafür ist die theologische Schule von Muՙtazila. Sie verwendete rationale Argumente in der Glaubenslehre, zum Beispiel versuchte sie, den Koran als ein erschaffenes, und nicht als ewiges Werk zu denken, und dabei die allegorische Interpretation über die wortwörtliche zu stellen, wenn es um die anthropomorphischen Aspekte des Göttlichen geht. Durch den Einfluss des Kalifen al-Ma’mūns’ (r. 813–833CE) erhielt die Muՙtazilite Lehre viele Jahre lang dogmatischen Status.2 Sie geriet allerdings in Vergessenheit, sobald orthodoxere Schulen den theolo gischen Diskurs zu dominieren begannen. In jüngster Zeit findet sie doch wieder mehr Anklang.3 Die Mu’tazila bewirkte die Entwicklung dessen, was im traditionell islamischen Lernen ijtihād heißt. D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture. J. A. Nawas, Al-Ma'mun, the Inquisition, and the Quest for Caliphal Authority. 3 R. M. Frank and D. Gutas, Early Islamic Theology; R. C. Martin, M. Woodward and D. S. Atmaja, Defenders of Reason in Islam. 1
2
256
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Der Begriff stammt von derselben Wortwurzel wie jihād und heißt wortwörtlich »Mühe« oder »sich anstrengen e«. In den Rechts wissenschaften, den Theologischen Studien, und auch in der Phi losophie allerdings bedeutet er »eigenständiges Denken« – zur Interpretation überkommenen Wissens aus dem Koran und in den Traditionen der Propheten. Bei der Vorstellung des Konzepts ijtihād sollte festgehalten werden, dass jenes in der modernen und heutigen Muslimischen Welt wieder Anklang findet. Einer der ersten, dessen Nachdenken über Religion sowohl in eine philosophische, als auch in eine theologische Richtung ging, war Ibn Sina (980–1037). Seine Beiträge zur Metaphysik und Erkennt nistheorie wurden über die muslimische Welt hinaus rezipiert. Das Faktum, dass dieser Philosoph auch in Europa bekannt wurde, bestä tigt das. In Europa nennt man* ihn Avicenna.4 Seine Definition der sogenannten konstituierenden Ideen des philosophischen Denkens – Welt, Gott, und Menschlichkeit – war von großer Relevanz.5 Ihr anhaltender Effekt ist nach wie vor in Immanuel Kants Philosophie erkennbar. Kant fasste sie in seinen Fragestellungen zusammen, und stellte fest, dass Philosophie auf drei grundlegende Fragen reduziert werden kann: Was können wir wissen? Dazu gehören Welt und Erkenntnistheorie. Was dürfen wir glauben? Gott oder Metaphysik. Und: Was müssen wir tun? Menschlichkeit, Ethik. Der nächste bedeutende Moment im klassisch-islamischen Reli gionsdenken ist das Auftreten von Ibn Sinas schärfstem Kritiker Abu Hamid al-Ghazali (1058–1111), der ein polemisches Traktat namens Tahafut al-Falasifa oder Die Inkohärenz der Philosophen schrieb, in dem er einige von Ibn Sinas philosophischen Aussagen als häretisch hinstellte oder als Instanzen des Unglaubens anfocht. Im Gegensatz zu Ibn Sina, der nicht nur Philosoph – sondern auch ein Physiker und Autor eines Standardwerkes über Medizin, das bis zum 19. Jahrhundert einflussreich wirkte – war, ist al-Ghazali eine viel frommere Figur, im Besitz eines beeindruckenden Geistes, und doch höchst misstrauisch dem spekulativen Denken gegenüber. Tatsächlich formten al-Ghazali’s Schriften viele Jahrhunderte lang die sunnitisch-islamische Orthodoxie, was ihn zum meist zitiertesten Muslim nach dem Propheten Mohammed macht(e).6 4 5 6
L. E. Goodman, Avicenna; D. Gutas, Avicenna and the Aristotelian Tradition. A. Anzenbacher, Einführung in die Philosophie, S. 119. F. Griffel, Al-Ghazālī’s Philosophical Theology.
257
Carool Kersten
Sowohl Ibn Sina, als auch al-Ghazali stammten aus dem per sisch-sprechenden Teil der Muslimischen Welt. Trotzdem kam die provokativste Antwort auf seine Philosophie aus dem westlichsten Eck der Muslimischen Welt: in Form des spanisch-marokkanischen Wissenschaftlers und Philosophen Ibn Rushd.7 Im mittelalterlichen Europa wurde er unter dem latinisierten Namen seines Alter Ego Averroes bekannt, und zwar vor allem für seine Kommentare zu Aristoteles. So hatte er großen Einfluss auf die Entstehung der Wissenschaft des 12. und 13. Jahrhunderts. Bei Muslimen beruht seine Bekanntheit besonders auf zwei Werken. Ers tens, einer Kritik an al-Ghazalis Einwände gegen die Philosophie von Ibn Sina, die unter dem Titel Tahafut al-Tahafut oder die Inkohärenz der Inkohärenz bekannt ist – ein Titel, der die bestehende Polemik zwischen Theologen und Philosophen reflektiert.8 Für unser heutiges Thema viel relevanter ist aber das zweite Werk: Fasl al-Maqal oder Die entscheidende Abhandlung oder Die Bestimmung des Zusammen hangs zwischen religiösem Gesetz und Philosophie.9 Dieser Text wurde auch von Leo Strauss in seinem Werk Verfolgung und die Kunst des Schreibens rezensiert, um die Regeln und Tricks aufzuzeigen, die sich Autoren* und Denker* in der Vergangenheit zur Nutze gemacht haben, wenn sie in repressiven Umständen arbeiteten.10 Ibn Rushd arbeitete als Richter bei den Almohaden-Sultanen, die im 12. Jahrhundert über Marokko und das muslimische Spanien herrschten. Nach heutigem Verständnis würden die Almohaden Sala fis genannt, weil sie dieselbe wortwörtliche Interpretation des Islam befürworteten, wie es die Wahhabiten in Saudi-Arabien tun. Natür lich war ein Philosoph wie Ibn Rush dadurch in vielerlei Hinsicht eingeschränkt. Seine Meinung als Rechtwissenschaftler war jedoch gefragt, und er wurde oft gebeten, zu gewissen Themen Stellung zu beziehen. Die entscheidende Abhandlung wurde in einem FatwaFormat verfasst, was Ibn Rush ermöglichte, seine philosophischen Ansichten in Form eines juristischen Exposés zu veröffentlichen. So konnte er eine Stellungnahme zur Religion abgeben, die seine Unterstützer ansonsten nicht nur für kontrovers, sondern geradezu für verwerflich befunden hätten. D. Urvoy, Ibn Rushd (Averroes). Averroes (Ibn Rushd), Tahafut Al Tahafut (The Incoherence of the Incoherence). 9 J. Colville, »The Definitive Statement Determining the Relationship between Divine Law & Human Wisdom by Abu’l Walid Muhammad ibn Rushd«, S. 76–110. 10 L. Strauss, Persecution and the Art of Writing. 7
8
258
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Um es kurz zu fassen: In Die entscheidende Abhandlung behaup tet Ibn Rushd, dass die Frömmigkeit der Massen der gewöhnlichen Gläubigen am besten geschützt werden kann, indem man sie nur dem offenbarten Text, dem Koran, aussetzt, und Predigten auf der Grund lage ausgewählter Elemente der Tradition des Propheten. In Bezug auf die gebildete Segmentierung der muslimischen Gesellschaft sind Wissenschaftler, die sich auf die traditionelle islamische Lehre spezia lisiert haben, am besten dran, wenn sie sich auf Abhandlungen auf der Grundlage der heiligen Schriften wie al-Ghazali beschränken. Der arabische Begriff, der von Ibn Rushd verwendet wird, um diese Art des religiösen Denkens zu qualifizieren, lautet: Bayani-Denken – was mit »diskursiver Theologie« übersetzt werden kann. Demnach ist der Gebrauch der Vernunft eng gefasst und beschränkt sich im Wesentlichen auf analoges Denken in aristotelischen Syllogismen. Nach Ibn Rushd wäre es reine Energieverschwendung, solche Reli gionswissenschafler in die wahre Philosophie einzuführen. Das Bur hani-Denken im Vokabular von Ibn Rushd besagt, dass nur der intelli genteste, für den sich Ibn Rushd offensichtlich hielt, auf der Grundlage demonstrativer Beweise in jegliche Argumentation eingeführt wer den kann. Die zugrunde liegende Botschaft ist aber auch, dass die Schrift und die Vernunft dieselbe Wahrheit meinen, allerdings in verschiedenen Sprachen sprechen. Ibn Rushd spricht außerdem über mystisches oder irfanisches Denken. Hier bekommt der intellektuelle Elitismus, der in Die entscheidende Abhandlung ganz offensichtlich ist, auch eine chauvinistische Wendung. Ibn Rushd lehnt die Mystik als Obskurantismus, als eine Erfindung des muslimischen Ostens – d. h. der persischen Welt, in der auch Ibn Sina und al-Ghazali lebten – ab. Tatsächlich haben beide mystische Vorstellungen als Teil ihres Denkens über Religion berücksichtigt. Ich erwähne die drei von Ibn Rushd identifizierten Stränge religiösen Denkens, weil sie von zeitgenössischen muslimischen Philosophen aufgegriffen wurden und in ihren eigenen Religionsphi losophien eine neue Anwendung und Aktualität erhalten haben – die ich später diskutieren werde. Bevor ich den Überblick über die klassische Ära beende und mich der modernen und zeitgenössischen muslimischen Welt zuwende, möchte ich zwei weitere, etwas frühere Texte aus dem 12. Jahrhundert erwähnen, die meines Erachtens als Religionsphilosophien bezeichnet werden können und die auch den Grad der Raffinesse veranschauli chen, der in den Reflexionen dieser Zeit über religiöse Fragestellungen
259
Carool Kersten
zu finden ist. Kitab al-Milal wa'l-Nihal oder Das Buch der religiösen und philosophischen Sekten des persischen Gelehrten Muhammad al-Shahrastrani kann ebenfalls als eine der frühesten bekannten vergleichenden Studien zu Religionen oder zur Phänomenologie von Religionen angesehen werden. Weiters gibt es noch Die Geschichte von Hayy ibn Yaqzan.11 Obwohl Die Geschichte bereits von Ibn Sina erwähnt wird, ist ihre berühmteste Version die, die von Ibn Tufayl in Umlauf gebracht wurde.12 Wie auch Ibn Rushd wurde Ibn Tufayl im muslimischen Spanien geboren und starb auch am selben Ort: in der marokkanischen Stadt Marrakesch.13 Der Name Hayy ibn Yaqzan bedeutet übersetzt – es klingt, zugegebenermaßen, etwas komisch – »Lebendig, Sohn des Erwachten«. Die Geschichte erreichte ein Publikum über die muslimi sche Welt hinaus und wurde in Europa unter dem Namen Philosophus Autodidactus bekannt“, weil es die Geschichte eines Kindes erzählt, das sich auf einer einsamen Insel wiederfindet, wo es von einem Hirsch aufgezogen wird. Als das Kind heranwächst, stellt sich heraus, dass menschliche Wesen auch in dieser völligen Isolation, nur durch Beobachten und Anwenden ihrer rationalen Fähigkeiten, dieselben absoluten Wahrheiten (für sich) entdecken, wie diejenigen, die in einer Gesellschaft aufgezogen werden. Dass dies auch für grundle gende religiöse Fragestellungen gilt, zeigt sich dann, als die besagte Person gerettet wird und sich herausstellt, dass sie ein Konzept des Göttlichen entwickelt hat, das den absoluten Wahrheitsansprüchen der historischen Religionen nicht ganz unähnlich ist. Im Jahre 1711 erschien das Werk erstmals auf Englisch, übersetzt von Simon Ockley, unter dem Titel: The Improvement of Human Reason: Exhibited in the life of Hai Ebn Yokdhan. Zusammen mit der späten Lateinischen Übersetzung im siebzehnten Jahrhundert von Hayy ibn Yaqzan durch einen anderen Engländer, Edward Pococke, inspirierte der Text Daniel Dafoes Roman Robinson Crusoe, aus dem Jahr 1719.
2. Die Muslime und ihre Konfrontation mit der Modere Nun sind wir also in der Zeit angelangt, in der sich die Welten wechselseitig beeinflussen. Die muslimischen Reiche der türkischen 11 12 13
M. al-Shahrastani, The Book of Religious and Philosophical Sects. L. E. Goodman (trans.) Ibn Tufayl’s Hayy ibn Yaqzan. T. Kukkonen, Ibn Tufayl.
260
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Osmanen, der persischen Safawiden und der indischen Mogulen begannen Europäische Militärtechnologien und Strategien für die Rekrutierung von Armeen zu importieren. Bald schon wurden die Europäer in ihrer Beziehung zu der muslimischen Welt um einiges zudringlicher, wie am Beispiel von Napoleon Bonapartes Einzug in Ägypten 1798 gut zu erkennen ist. Dies geschah in der Phase der Industriellen Revolution und fiel in die Zeit, als die europäische Expansion nach Übersee sich von der merkantilistischen Kolonialisie rung zum hohen Imperialismus des 19. Jahrhunderts entwickelte. Eine der Reaktionen auf diese Entwicklung war das Aufkommen des Islamischen Reformismus. Die ersten muslimischen Reformer wie der Inder Sayyid Ahmad Khan (1817–1898) und Jamal al-Din al-Afghani (1838–1897), der – trotz seines Namens – ein iranischstämmiger Shi’ite war und eine Hass-Liebe-Beziehung mit Europa hatte: Einerseits widersetzten sie sich der Okkupation der muslimi schen Länder durch Ungläubige; andererseits waren sie schlichtweg fasziniert von den wissenschaftlichen Fortschritten der Europäer.14 Sir Sayyid Ahmad Khan – 1888 zum Ritter geschlagen – kam aus einer langen Linie von Religionswissenschaftlern. Als aber die Briten die Kontrolle über Indien übernahmen, erfand er sich als Publizist und Pädagoge neu. Er gründete Magazine und eine Universität, und versuchte auch den Koran mit der Wissenschaft in Einklang zu bringen, indem er wundersame Ereignisse pragmatisch als Allegorien natürlicher Phänomene interpretierte. Außerdem war er ein selbstbe wusster Mensch. Ein Beispiel dafür ist sein Kommentar zur Bibel als Antwort auf eine Biographie des Propheten Muhammad durch einen christlichen Theologen.15 Im Unterschied zu den freundlichen Beziehungen, die Khan mit den Briten pflegte, ist al-Afghanis Lebensgeschichte voller politischer Intrige und Polemiken. Sein Name kommt immer wieder in den Akten von Geheimdiensten vor, nämlich jenen des britischen Indien, Russlands, Persiens und des Osmanischen Reiches. Aber er war auch ein Intellektueller. Er gründete ein zwar kurzlebiges, aber dennoch einflussreiches Magazin, als er im Exil in Paris war. Außerdem verfasste er einen Traktat, der Sayyid Ahmad Khan in Frage stellte, indem er ihm vorwarf ein naives und unangebrachtes Vertrauen N. Keddie, Sayyid Jamal ad-Din »Al-Afghani«; idem, An Islamic Response to Imperialism; C. W. Troll, Sayyid Ahmad Khan. 15 C. W.Troll, C. M. Ramsey, M.B, Mughal, The Gospel according to Sayyid Ahmad Khan (1817-1898). 14
261
Carool Kersten
gegenüber den wissenschaftlichen Erkenntnissen des Westens zu haben. Al-Afghani sah sie tatsächlich als Bedrohung für die Integrität der Islamischen Lehre an. Al-Afghani setzte sich auch mit einem der einflussreichsten Orientalisten und Philosophen Frankreichs seiner Zeit auseinander: Ernest Renan (1823–1892). Ein besonderes Problem ist Renans nega tive Darstellung von Menschen aus dem Nahen Osten, die heutzutage sowohl als antisemitisch als auch als islamfeindlich angesehen wird. Als Reaktion auf die folgende Aussage in seinem Antrittsvortrag am College de France entspann sich eine Debatte zwischen Al-Afghani und Ernst Renan: Wir verdanken der semitischen Rasse weder politisches Leben, Kunst, Poesie, Philosophie noch Wissenschaft. Was schulden wir ihnen dann? Wir schulden ihnen Religion. Die ganze Welt – wenn wir Indien, China, Japan und Stämme, die insgesamt wild sind, ausnehmen – hat die semitischen Religionen angenommen. Die zivilisierte Welt besteht nur aus Juden, Christen und Muselmännern. Insbesondere die indogermanische Rasse, mit Ausnahme der brahmanischen Familie und der schwachen Relikte der Parsees, ist vollständig dem semitischen Glauben übergegangen.16
Sowohl Khan als auch al-Afghani haben noch eine traditionelle islamische Ausbildung erhalten. Es wird noch zwei Generationen dauern, bis wir einem muslimischen Philosophen begegnen, der in der westlich-akademischen Tradition ausgebildet ist: dem in Punjabi geborenen, aber ursprünglich aus Kaschmir stämmigen, Muhammad Iqbal (1877–1938). Muhammad Iqbal gilt als geistiger Vater Pakistans, aber in der weiteren muslimischen Welt beruht sein Ruhm hauptsächlich auf seinem Ruf als Dichter, der sowohl auf Urdu als auch auf Persisch schrieb.17 Er war aber auch ein in Großbritannien ausgebildeter Anwalt, der als solcher erst Philosophie studierte und schließlich als erster Muslim an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit einer Dissertation mit dem Titel Die Entwicklung der Metaphysik in Persien promovierte. Diese Arbeit verfolgte die Entwicklung von Zoroaster bis zur Entstehung des Baha'i-Glaubens, im Mittelpunkt aber stand Ibn Sina. Damit leistet er auch eine Pionierarbeit für das akademische Studium der Philosophie Avicennas in der westlichen 16 17
E. Renan, »The Share of the Semitic People in Civilization«. J. Majeed, Muhammad Iqbal.
262
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
akademischen Welt. Wieder in Britisch-Indien konzentrierte sich Iqbal auf literarische Schriften. 1930 wurde eine philosophische Vorlesungsreihe aus Großbri tannien publiziert, die den Titel The Reconstruction of Religious Thought in Islam (Die Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam)18 trug. Wie schon vom Titel impliziert, wollte Iqbal mit seinem Buch das Nachdenken über Religion wiederbeleben, um die Relevanz des Islam für Muslime in der Moderne zu betonen. Um das zu ermöglichen, erkundete Iqbal neue Wege, um den islamischen Urtext, den Koran, neu zu lesen und neu zu interpretieren, und nutzte dabei Erkenntnisse, die er aus dem Studium der westlichen philosophischen Tradition gewonnen hatte. Selbst ein kurzer Überblick über die sieben Kapitel des Buches zeigt, dass dieses auch die Fortschritte moderner westlicher Philosophen beinhaltete.
3. Religionsphilosophien des Islam heute Seit seiner ersten Veröffentlichung hat Iqbals Wiederbelebung in der gesamten islamischen Welt einen enormen Einfluss ausgeübt und das Denken von akademischen Philosophen und anderen Intellektuellen mit muslimischem Hintergrund geprägt. Nicht nur in seiner Heimat Südasien oder der arabischen Welt, sondern auch in Ländern, die so weit voneinander entfernt sind wie Indonesien, Senegal und Süd afrika. Ein kürzlich erschienenes Buch über die Auswirkungen von Iqbals philosophischer Arbeit auf das zeitgenössische muslimische Denken über Religion zeigt Einflüsse von Henri Bergson und Charles Peirce auf.19 Souleymane Bachir Diagne (*1955), ein senegalesischer Philosoph, der an der Columbia University in New York lehrt, weist darauf hin, dass Iqbal den von Bergson entwickelten Intuitivismus und die neue Auffassung von Zeit als geeignetes Mittel betrachtet, um das islamische Denken nicht nur von seiner eigenen versteinerten religiösen Orthodoxie zu befreien, sondern auch um die statischen Denkweisen zu vermeiden, die Philosophen wie Descartes, Hume und Kant charakterisieren. Stattdessen möchte Iqbal beide Denkweisen durch ein dynamisches Wieder-Lesen des Korans ersetzen. 18 19
M. Iqbal, The reconstruction of Religious Thought in Islam. C. Hillier, B. B. Koshul (Hg.), Muhammad Iqbal.
263
Carool Kersten
Die Grenzen, die die Vernunft dem menschlichen Denken auf erlegt, und die Bedeutung der Intuition für die Bildung der mensch lichen Persönlichkeit spiegeln nicht nur Bergsons Einfluss wider, son dern stimmen auch mit dem überein, was Heidegger in Sein und Zeit und Brief über den Humanismus unternommen hat. Sie helfen Iqbal dabei, eine moderne Neuinterpretation der Vorstellung von Insan Kamil zu formulieren, des perfekten Menschen, der in der islamischen Mystik eine so zentrale Rolle spielt. Diagne hat vorgeschlagen, dass diese Transformation auch in Iqbals eigenem Denken erkennbar ist, wenn man* seine Dissertation Die Entwicklung der Metaphysik in Persien von 1908 mit Die Wieder belebung des religiösen Denkens im Islam, zwei Jahrzehnte später, vergleicht, zum Beispiel, wenn wir uns die Idee des ijtihad ansehen, die vorhin vorgestellt wurde. Laut Iqbal muss sie von der technischen Bedeutung befreit werden, die sie sowohl im juristischen als auch im theologischen islamischen Denken hat. Als alternative Bedeutung führt Iqbal den Begriff »Bewegung« ein, d.h. eine Denkweise, die für eine ständige Erneuerung offen ist und somit die vollständige Entfaltung der menschlichen Person und ihrer Existenz ermöglicht.20 Damit hat Iqbal Diagne zufolge eine dynamische Ontologie ausgearbeitet.21 Ein anderer muslimischer Intellektueller von heute, der sich weiterhin mit Iqbal beschäftigt, ist Ebrahim Moosa (*1957). Dieser ursprünglich südafrikanische Islamwissenschaftler arbeitet jetzt an der Notredame University in den USA. Er hat einen Vergleich zwi schen Iqbal und Gilles Deleuze gezogen, in dem Sinne, dass es in der Philosophie nicht um die Wahrheit an sich geht, sondern um neue Perspektiven des Denkens. Moosa schreibt: »Iqbal war sich völlig bewusst, dass Ideen und Konzepte und die Lebenswelten, in denen Menschen leben, keine Gegebenheiten waren, sondern ständig kon struiert wurden. […] Daher könnte Iqbal die Muslime zuversichtlich zum Bauen auffordern.«22
20 21 22
M. Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, S. 116 ff. S. B. Diagne, »Achieving Humanity«, S. 33–55. E. Moosa, »The Human Person in Iqbal’s Thought«, S. 12.
264
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
4. Denker des Arabischen Erbes (heritage thinkers) und Islamische Religionsphilosophien heute Ein weiterer Philosoph, der das Buch von Muhammad Iqbal aufgegrif fen hat, war der ägyptische Philosoph Hasan Hanafi (1935-2022): Obwohl er den Ruf hat, ein Einzelgänger, ein Solist zu sein, ist Hanafi Teil eines zeitgenössischen islamischen intellektuellen Trends, der sich in der arabischen Welt entwickelt und als heritage thinking bezeichnet wird.23 Diese Gedankenbewegung hat sich seit den 1970er Jahren paral lel, aber sehr entgegengesetzt zum Aufstieg des radikalen Islamismus (oder dem, was damals als islamischer Fundamentalismus bezeichnet wurde) entwickelt. Wenn ich über das Denken arabisch-islamischen Erbes spreche, stelle ich Hanafi normalerweise als Teil eines Quartetts vor, zu dem außerdem gehören: der französisch-algerische Historiker Muham mad Arkoun (1928–2010), der marokkanische Philosoph Muham mad Abid al-Jabri (1935–2010), und Hanafis ehemaliger Student, der Literaturwissenschaftler und Koranstudienexperte Nasr Hamid Abu Zayd (1943–2010). Da sich dieses Buch mit zeitgenössischen Religionsphilosophien befasst, werde ich nur etwas über Hanafi und sein marokkanisches Gegenstück al-Jabri sagen.24 Während jeder von ihnen seinen eigenen Ansatz hat, verbindet die heritage thinker ein intellektuelles Profil, das durch eine enge Ver trautheit mit der islamischen Tradition geprägt ist, auf der aufbauend sie sich solide Kenntnisse über Fortschritte in den Geisteswissenschaf ten der westlichen akademischen Welt im Rahmen eines Studiums angeeignet haben, meist an säkularen staatlichen Universitäten und auch im Ausland. Im Fall von Hanafi führte dieser zweifache intellektuelle Hinter grund zu einem lebenslangen philosophischen Projekt, das er Erbe und Erneuerung nannte.25 Er betrachtete dies als einen Beitrag zu der seiner Meinung nach dritten Phase des modernen islamischen Reformismus, die mit einer von Jamal al-Din al-Afghani eingeleiteten Diagnosephase begonnen hatte, gefolgt von den ersten wirklichen intellektuellen Reformen des ägyptischen Religionswissenschaftlers 23 24 25
C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 29 ff. C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 20. H. Hanafi, Al-Turath wa’l-Tajdid.
265
Carool Kersten
Muhammad Abduh (1849–1905) und seines syrisch-libanesischen Nachfolger Rashid Rida (1865–1935). Muhammad Iqbals Wiederbe lebung des religiösen Denkens im Islam kündigte dann die dritte Phase dessen an, die für eine echte intellektuelle Reform des islamischen religiösen Denkens erforderlich war.26 Iqbals Einfluss ist in einigen Untertiteln von Hasan Hanafis vielen Büchern, die unter dem Titel »Erbe und Erneuerung« veröffentlicht wurden, explizit sichtbar: Sie enthalten die Phrase »ein Versuch wiederzubeleben« – islamisches philosophisches, theologisches und mystisches Denken. Neben Iqbal gehören auch die zuvor erwähnte rationalistische theologische Schule der Muʿtazila und der Philosoph Ibn Rushd zu Hanafis intellektuel lem Stammbaum.27 Wie seine Vorgänger möchte Hanafi das übermit telte Wissen, in diesem Fall das über den Koran und die Traditionen des Propheten, mit der Vernunft in Einklang bringen. Das »Erbe und Erneuerung«-Projekt ist aber auch von Hanafis Begegnungen mit der westlichen Philosophie und Theologie geprägt. Es schlägt vor, was Hanafi eine allgemeine islamische Methodik der philosophischen Untersuchung nennt, in der die a priori deduktive Methode der klassischen Rationalisten mit der a posteriori induktiven Methode der Empiristen zusammengeführt wird.28 Abgesehen vom kantischen Ton kann Hanafis philosophische Disposition auch als hegelianisch angesehen werden, da das Projekt »Erbe und Erneue rung« aus dem Triptychon besteht, das Folgendes analysiert: (1) die Art und Weise, wie Muslime mit ihrem islamischen Erbe in Beziehung stehen, (2) wie sie in Bezug zu der westlichen Zivilisation stehen, und (3) wie sich diese beiden auf eine emanzipatorische Agenda für den Umgang mit der heutigen Realität auswirken.29 Abgesehen von Kant und Hegel ist dieses binäre System auch stark von einem der beliebtesten romantischen Philosophen Hanafis beeinflusst: Johann Fichte, den er Faylusuf Muqawama oder Wider standsphilosophen nennt. Hanafi beruft sich auch auf einen anderen philosophischen Rebellen: Baruch Spinoza, den er bei seinen Lektü ren von Henri Bergsons Vitalismus angetroffen hatte: Von Bergson entlehnte Hanafi die Beobachtung, dass jeder Philosoph zwei Philo
26 27 28 29
C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 127. C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 128, 157, 172. C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 110, 113, 118. C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 158 ff.
266
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
sophien hat: seine eigene und die von Spinoza.30 Hanafi hat auch Spinozas Tractatus Theologico-Politicus ins Arabische übersetzt und eine Reihe von Fichtes Texten. Am wichtigsten für Hanafis intellektuellen Werdegang war die Begegnung mit der Phänomenologie Edmund Husserls. Dies war vor allem einem der Doktorväter von Hanafi zu verdanken: Paul Ricœur.31 Obwohl Hanafi sich direkt mit Husserls Werk befasst hat, ist es wichtig zu verstehen, dass auch dies durch die Brille von Ricœurs Fähigkeit zu wohlwollenden oder großzügigen Interpretationen gese hen ist: seiner Fähigkeit, scheinbar unvereinbare philosophische Posi tionen in Einklang zu bringen, in diesem Fall: den mathematischen Ansatz von Husserls Ideen mit der Intersubjektivität der Cartesischen Meditationen, und, was Ricœur Husserls existentialistische Wendung in Die Krisis der europäischen Wissenschaften genannt hat, wo dieser den Begriff »Lebenswelt« einführte.32 So finden wir die Ursprünge des »Erbe und Erneuerung«-Pro jekts in Hanafis Doktorstudium an der Sorbonne. Hanafi erinnerte sich an das, was Muhammad Iqbal über den ijtihad gesagt hatte: dass er von seinen legalistischen Wurzeln befreit werden musste, und beschloss, die erste Doktorarbeit einem Experiment zu widmen: der Umwandlung einer Subdisziplin im Studium des islamischen Rechts in eine allgemeine philosophische Methode. Da das Recht im Mittelpunkt des traditionellen islamischen Lernens steht, verfügt es über die fortschrittlichste wissenschaftliche Werkzeugkiste, ein Teil gebiet, das als Usul al-Fiqh (oder Grundlagen der Rechtsprechung) bekannt ist.33 In einer Dissertation mit dem Titel Methoden der Exegese wird das technische juristische Vokabular von Usul al-Fiqh in eine allgemeinere philosophische Sprache umformuliert – oder umgewandelt, wie Hanafi es nennt.34 Es ist auch erwähnenswert, dass Hans-Georg Gadamer während Hanafis Studien in Frankreich sein Werk Wahrheit und Methode (1960) veröffentlichte. Das »Erbe und Erneuerung«-Projekt spiegelt Gadamers Bemerkung wider, dass Hermeneutik im Wesentlichen eine Phänomenologie ist. Gleiches gilt für sein Plädoyer für eine Rehabilitation der Tradition unter Berücksichtigung der Auswirkun 30 31 32 33 34
C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 114. C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 106. C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 119. C. Kersten, »Bold Transmutations«, S. 22–38. H. Hanafi, Les Méthodes d’Exégèse.
267
Carool Kersten
gen des wirkungsgeschichtlichen Bewusstseins und der Horizontver schmelzung. Vielleicht noch wichtiger ist Gadamers Idee, dass von einem prozeduralen Standpunkt die philosophische Hermeneutik in den Geisteswissenschaften im Lichte der Beiträge sowohl der juristischen als auch der theologischen Hermeneutik neu definiert werden muss. Angesichts des Vertrauens von Hanafi in die europäische Philo sophie stellt sich die Frage, ob Hanafi nicht in die Falle geraten ist, die so viele islamische Reformer traditionellen islamischen Gelehrten vorwerfen: Der Vorwurf von Taqlid oder »blinder Nachahmung«. Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist: Hanafi ist kritisch gegenüber dem westlichen Denken über Religion. Dies geht aus seinen beiden anderen Doktorarbeiten, einem Überblick über das Gebiet der Phäno menologie der Religion und einer existentialistischen Hermeneutik des Neuen Testaments,35 hervor. Gleiches gilt für eine einführende Geistesgeschichte des Westens, die als Einführung in die Wissenschaft des Okzidentalismus veröffentlicht wurde.36 Trotz seines Ehrgeizes, die westliche Philosophie zurechtzuschneiden, bleibt Hanafis Sicht weise kurzsichtig und in den monotheistischen Perspektiven der Religionsphilosophie von Kant und Hegel verfangen. Trotz Hanafis Interesse an Henri Bergson erreicht er nicht die kritische Distanz, die potentiell im letzten Teil des Werks Die beiden Quellen der Moral und der Religion vorhanden ist. Die Echos von Bergsons »Mechanik und Mystik« sind in den Befragungen des Religiösen zu hören, die in Jacques Derridas Glaube und Wissen zu finden sind, insbesondere in den Begriffen »Mundialatinisierung« und »tele-techno-kapitalis tisch-wissenschaftliches Treuhänderisches«.37 Ein weiterer Kritikpunkt: Mir scheint, dass Hasan Hanafis dia lektischer Zugang in einem binären Denken eingeschlossen bleibt, das auch Muhammad Iqbals Wiederbelebung beeinflusst: Auch sind Hanafis Untersuchungen muslimischer Sichtweisen auf ihr islami sches Erbe immer noch durch Iqbals Dichotomie von »Krankheit des
C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 101; H. Hanafi, L’Exégèse de la Phéno ménologie; idem, La Phénoménologie de l’Exégèse. 36 C. Kersten, Cosmopolitans and Heretics, S. 156, 158, 163 ff; H. Hanafi, Muqaddima fi ›Ilm al-Istighrab. 37 J. Derrida, Acts of Religion, S. 28, 50, 81. 35
268
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Gehirns im Osten« und »Krankheit des Herzens«, die den Westen befällt, beeinträchtigt.38 In seiner Evaluation von Iqbals Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam, schlägt Ebrahim Moosa vor, dass es dem Islami schen Denken seit dem Propheten inhärent ist, der bereits aufgezeigt hatte, dass, »induktives Urteilen einen selbst zum Herrn über die Umwelt macht. Inspiration und Intuition ermöglichen, die Limitatio nen von (Zeit und) Raum zu transzendieren«.39 Nicht alle muslimischen Religionsphilosophen teilen heute diese Wertschätzung verschiedener Epistemologien. Ein Beispiel wäre der marokkanische Philosoph Muhammad Abid al-Jabri.40 In seinem Werk Kritik der Arabischen Vernunft zeigt er eine sehr skeptische Haltung. In zwei einführenden Studien Wir und unser Erbe und Arabischer Diskurs der Gegenwart deutet al-Jabri auf die Mängel vie lerlei Interpretationen des arabisch-islamischen Denkens hin. Funda mentalistische und traditionelle, liberale und marxistische Lesearten greifen alle zu kurz hinsichtlich Methode und Vision – Liberale und Marxisten wegen ihrer falschen linear-teleologischen Projektionen in die Zukunft, Fundamentalisten wegen ihrer mangelnden Fähigkeit, mehr als ihre eigene Tradition zu berücksichtigen. Al-Jabri distanziert sich von der Moderne als linear-progressiv, als eine notwendigerweise historisch-determinierte Zeitschiene, die alle Zivilisationen durchlaufen müssen, eine Chronologie, die aus sukzessiven Phasen der Renaissance, der Aufklärung, Moderne und Postmoderne besteht. Stattdessen ist es realistischer für Muslime, ihre momentane Situation als gleichzeitig existente und ineinander greifende Phasen zu sehen. Laut al-Jabri bedeutet das, dass wir keine einzelne Moderne fassen sollten, sondern, dass es angemessener ist, von einer Pluralität von Modernen zu sprechen. Moderne ist außer dem eng verknüpft mit »kritischem Denken«, mit einer Veränderung der Mentalität. Nach al-Jabri besteht jede Art des Wissens, jede Episteme aus zwei Elementen: einem sogenannten kognitiven Bereich und einem ideologisch determinierten Inhalt. Der kognitive Bereich wiederum besteht aus materiellem Wissen oder einer Substanz und C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 16. E. Moosa, »The Human Person in Iqbal’s Thought«, S. 28. 40 Für eine deutsche Einleitung in al-Jabri’s Denken siehe: M. Gaebel, Von der Kritik des arabischen Denkens zum panarabischen Aufbruch. Für eine kurze Einleitung in al-Jabri’s Philosophie auf Englisch siehe: M. A. al-Jabri, Arab-Islamic Philosophy. 38
39
269
Carool Kersten
einem denkenden Apparat oder einer Episteme.41 Aus heutiger Per spektive scheint die Essenz der philosophischen und wissenschaft lichen Erkenntnis über die arabische Vergangenheit nur historisch wertvoll zu sein, ansonsten ist sie veraltet und obsolet. Dennoch interessiert sich al-Jabri in seiner Kritik für den Denkapparat, oder die systemischen und methodologischen Aspekte. Arabische Muslime müssen sich außerdem von der ideologi schen und emotionalen Konzeptualisierung der Tradition und ihrer Inhalte als absolute Wirklichkeit befreien. Stattdessen sollten sie sich mit dem Faktum versöhnen, dass Traditionen relativ sind, gerade weil sie historisch determiniert sind. Der Weg, das zu erreichen, wird von Gaston Bachelard als »epistemologischer Bruch« bezeichnet. Es ist kein Brechen mit der Tradition, sondern ein Ausbrechen aus dem Gefangensein in einer Tradition. Im Zuge der 1980er begann al-Jabri seine »Kritik der Arabischen Vernunft« auszubauen. Ursprünglich bestand das Projekt aus einer Trilogie: Die Formation der Arabischen Vernunft (1984), Die Struk tur der Arabischen Vernunft (1986), Die Arabisch-Politische Vernunft (1990).42 Nach einiger Zeit erschien außerdem eine vierte Ausgabe über die arabisch-islamische ethische Vernunft. Um zurückzukehren zur originalen Trilogie, lässt sich sagen, dass – – –
Teil 1 eine historische Studie der Entwicklung des arabisch-isla mischen Denkens ist, im 2. Teil al-Jabri die epistemologische Ordnung der Arabischen Kultur untersucht, in Teil 3 die ideologischen Dimensionen des arabisch-islami schen Denkens beschrieben und analysiert werden.
Der erste Teil, die historische Studie, konzentriert sich auf die soge nannte Asr al-Tadwin oder »Ära der Kodifizierung«, während der die »zu akzeptierenden« Arten des Denkens, sowohl inhaltlich als auch methodisch, determiniert und fixiert wurden.43 Darauf folgte eine Zeit des Verfalls, in der die arabisch-islamische Tradition nur bereits existentes Wissen reproduzierte, anstatt neue Weisen des Denkens und alternative Diskurse zu entwickeln. C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 30. M. A. al-Jabri, Takwin al-›Aql al-›Arabiyya; idem, Bunya al-›Aql al-›Arabiyya; idem, Al-›Aql al-Siyasi al-›Arabiyya. 43 C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 31.
41
42
270
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
In seiner strukturellen Analyse unterscheidet al-Jabri zwischen drei Arten des Denkens oder epistèmes – Systemen des Wissens: Dafür verwendet er dieselben arabischen Termini, die wir bereits bei Ibn Rushd angetroffen haben, nämlich: – – –
Bayani oder diskursives Denken, das von islamischen Theolo gien wie al-Ghazali ausgeführt wird, ʿirfani: der Gnostizismus oder die Intuition, auf die sich die Mystiker berufen, und schließlich Burhani, ein Denken basierend auf demonstrativem Beweis.44
Bayanisches Denken besteht aus Textinterpretationen, basierend auf der arabischen Grammatik und Rhetorik, die dem literarischen Erbe der Araber aus vor-islamischer Zeit und dem Koran entstammen. Verwendet wird es in der arabischen Philologie, den Exegesen des Koran, und im juristischen und theologischen Denken. Es schränkt ijtihad oder unabhängiges Überlegen stark ein. Im bayanischen Denken ist die Verwendung der Vernunft auf eine Vernunft beschränkt, die sich nur auf Analogien berufen kann. Al-Jabri behauptet, mit Rückverweis auf seine historische Studie, dass das bayanische Denken unter dem Einfluss der Grammatiker, Juristen, und Theologen die dominante Episteme wurde. Als Maßstab für die richtige Denkweise über Religion im traditionell-islamischen Studium gilt insbesondere die Arbeit von al-Ghazali. Auch Irfani oder das gnostische Denken kann auf vor-islami sche Zeiten zurückgeführt werden, es wurde aber weiterentwickelt, nachdem der Islam aufkam. Nach al-Jabri zieht es sich nicht nur durch die Pseudo-Wissenschaften, wie Astrologie, Alchemie, Magie, Theosophie und Illuminationismus, sondern bestimmt auch vielfach das Shi’itische Denken und Ibn Sinas Philosophie. Als eine Islami sche Form von Gnosis unterscheidet es manifeste und verborgene Bedeutungen der Realität und der heiligen Schriften, einschließlich des Koran. Al-Jabri urteilt eher harsch und negativ, indem er erklärt, dass der gemeinsame Einfluss von Ibn Sina und al-Ghazali verantwortlich ist für die Dominanz des irrationalen Denkens in den östlichen Teilen der muslimischen Welt. In der fernen Vergangenheit ist es möglich auch Beispiele eines rationalen oder burhanischen Denkens im muslimischen Osten zu finden, zum Beispiel in der Schule der 44
Ebd.
271
Carool Kersten
Muʿtazila im mittelalterlichen Irak. Dem islamischen Westen, Anda lusien und Marokko, dagegen schreibt al-Jabri ein rettendes und zu einem gewissen Grad auch restaurierendes rationales Denken zu. Zu seinen Helden der späteren klassischen Ära zählen: der spanische Jurist Ibn Hazm en Al-Shatibi, der tunesische Historiker Ibn Khaldun, und insbesondere Ibn Rushd.45 Al-Jabri schätzt Ibn Rushd für seine kritische und realistische Rationalität: Diese finden wir in seinen Kommentaren zu Aristoteles’ Philosophie und in seiner konsistenten Anwendung des Kausalgeset zes in seinen wissenschaftlichen und philosophischen Schriftem. Dies gilt vor allem auch für religiöse und metaphysische Fragen. So schaffte es Ibn Rushd, die diskursive Vernunft in offenbarten Texten mit der demonstrativen Vernunft in Einklang zu bringen und philosophische Wahrheiten zu beweisen. Damit wollte Ibn Rushd zeigen, dass Phi losophie keine Bedrohung für die Lehren des Islam darstellt. Al Jabiri bevorzugt das epistemologische System von Burha nis Denken gegenüber dem weniger rigorosen Bayani-System, und natürlich gegenüber dem seines Erachtens irrationalen Irfani-Den ken. Klarerweise bevorzugt er auch individuelle Denker aus dem muslimischen Spanien und Marokko. Die Bedeutung, die er den intellektuellen Erfolgen des islamischen Westens beimisst, wird auch betont durch Hinweise auf den Bedarf nach einem »andalusisches Wiederaufleben«, um das islamische Denken wiederzubeleben, und darauf, dass die Zukunft nur averroistisch sein kann.46
5. Religionsphilosophie im heutigen Indonesien Dass al-Jabri sich in seiner Kritik auf die arabisch-islamische Welt beschränkt und in seinem Lob der marokkanischen und andalusischen Denker eher chauvinistisch ist – ganz zu schweigen von seinen negativen Darstellungen eines irrationalen Ostens –, machen es umso mehr beachtlich, dass sein Denken in einem Land wie Indonesien so wohlwollend rezipiert wird.47 Ich habe umfangreich über al-Jab ris Einfluss auf moderne indonesische muslimische Intellektuelle geschrieben, also werde ich zur Veranschaulichung nur ein Beispiel 45 46 47
Ebd., S. 32. Ebd., S. 29. C. Kersten, »Al-Jabri in Indonesia«, S. 149–169.
272
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
anführen: die Anwendung von al-Jabri’s Kritik der arabischen Vernunft in Teilen durch den Philosophen M. Amin Abdullah. Abdullahs Ausbildung erfolgte teils in der Türkei, wo er einen PhD durch eine vergleichende Studie von Al-Ghazali und Kant erlangte.48 Seitdem war er Professor für Philosophie und Rektor einer der wichtigsten staatlichen islamischen Universitäten von Indone sien. Er war auch Vorstandsmitglied der Muhammadiyah, der größten modernistisch-reformistischen islamischen Massenorganisationen, die von fast fünfzig Millionen Muslim*innen unterstützt wird. Dies macht sie nicht nur zur größten Reform-Organisation in Indonesien, sondern auch der gesamten muslimischen Welt. Amin Abdullah wandte Elemente von al Jabris Kritik an, um eine neue Religionsphilosophie für das islamische staatliche Universitäts system in Indonesien zu entwickeln.49 Er hat seine Theorie in zwei Büchern entfaltet, die nur auf indonesisch erschienen sind: Das erste trägt den Titel Das Studium der Religion und beinhaltet das normative und historische Studium von Religionen. Im zweiten, Das Hochschul studiums des Islam: Ein integrativer, verbindender Zugang, legt er eine neue Philosophie der Erziehung dar und entwirft einen Plan für die Ausarbeitung von Curricula.50 Abdulla bevorzugt einen breitgefä cherten Zugang zum Studium von Religionen, das ein offenes und interdisziplinäres Gebiet sein sollte, und in dem der Islam als eine lebendige Religion und eine Zivilisation angesehen wird. In der For schung sollten sowohl die traditionellen islamischen Religionswis senschaften herangezogen werden als auch moderne, säkulare aka demischen Disziplinen, in Kombination mit ethischen Überlegungen, die nicht vorgeben, wert-frei zu sein. Zu diesem Zweck bezieht Amin Abdullah sich auf al-Jabris bayani, burhani und irfani epistèmes.51 Nach Abdullah sieht al Jabris Kritik der arabischen Vernunft sehr nach westlicher Wissenschafts philosophie aus, und daher schlägt er etwas für die Islam-Studien Neuartiges vor: die Anwendung von Ideen der Wissenschaftsphiloso phen wie Karl Popper, Thomas Kuhn und Imre Lakatos. Er formuliert eine neue Philosophie der Erziehung und folgt dabei dem, was er Imre Lakatos’ dialektisch-historiographische Meta-Methode nennt; C. Kersten, Islam in Indonesia, S. 59–60. Ebd., S. 266. 50 Ebd., S. 265; M. A. Abdullah, Studi Agama; idem, Islamic Studies di Perguruan Tinggi. 51 C. Kersten, Islam in Indonesia, S. 270. 48
49
273
Carool Kersten
dabei positioniert er sich zwischen Karl Poppers Auffassung, dass wir Wissen nur durch einen Falsifikationsprozess erlangen, und Thomas Kuhns Idee des Paradigmenwechsels. Ein wesentlicher Punkt in Lakatos‘ dialektisch-historiographi sche Meta-Methode besteht in der Unterscheidung zwischen dem harten Kern eines Forschungsprogramm, entsprechend Kuhns Para digma, und einem Schutzgürtel aus Hilfshypothesen, die dazu dienen, eine Subversion – oder, um Poppers Terminus zu verwenden: Falsi fikation – zu verhindern. Wenn wir diese wissenschaftsphilosophi schen Konzepte auf das Studium des Islam übertragen, dann bildet den harten Kern der »normative Islam«, der in den traditionellen islamischen Wissenschaften bewahrt wird, während der »historische Islam« als Schutzgürtel dient.52 Eine Vermischung dieser beiden oder die Missachtung dieser Unterscheidung behindern ein kritisches Studium des Islam. Amin Abdullahs Philosophie zur religiösen Bildung hat nicht nur erkenntnistheoretische Vorzüge, sondern auch ein axiologisches Ziel: die Bestimmung der Grundwerte, die der islamischen Lehre zugrunde liegen. Die Anwendung der Erkenntnisse der Wissenschaftsphiloso phie und die Berücksichtigung der zugrunde liegenden Werte erfor dern ein neues Forschungsprogramm, das philologisch-historische, anthropologisch-soziologische und philosophisch-theologische Bei träge kombiniert. Laut Amin Abdullah ist dies genau das, was die historische, strukturelle und ideologische Analyse von al-Jabris Kritik der arabischen Vernunft bietet. Die größte Herausforderung für Amin Abdullahs neues For schungsprogramm besteht darin, die absoluten Wahrheitsansprüche des traditionellen islamischen Lernens mit der Skepsis in Einklang zu bringen, die die modernen Geistes- und Sozialwissenschaften kenn zeichnet. In anderen Worten: Wie hängt absolutes religiöses Wissen mit dem relativen Wissen über Religion als soziales Phänomen zusammen? Laut Abdullah muss dies durch einen absolut-relativen Ansatz ausgehandelt werden. Um diese Polarität zwischen Religion und Wissenschaft als zwei getrennte Bereiche mit jeweils eigenen formal-materiellen Belangen, Methoden und Kriterien für Wahrheit und Gültigkeit zu überwinden, ist eine neue Grundlage erforderlich, auf der die erkenntnistheoretische Wiedervereinigung von religiösem und positivistisch-säkularem Wissen aufbauen kann. Ich denke, auch 52
C. Kersten, Islam in Indonesia, S. 267.
274
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
hier hören wir wieder ein Echo von Ibn Rushds Konklusion, dass sich wissenschaftlich-philosophische und religiöse Werte nicht unbedingt gegenseitig ausschließen.
6. Eine zeitgenössische Shi’i Religionsphilosophie Ein weiterer Intellektueller, der sich mit diesen Fragen befasst und auch die Wissenschaftsphilosophie von Popper und Kuhn verwendet hat, ist Abdolkarim Soroush (*1946). Als ein schiitischer Muslim aus dem Iran, ein in Großbritannien ausgebildeter Pharmakologe und Wissenschaftsphilosoph, ursprüng lich involviert in der Islamischen Revolution im Jahre 1979 wurde er zu einem der bekanntesten Regierungskritiker, was ihn zu einem selbstauferlegten Exil in Europa und Amerika zwang.53 Soroush scheut sich nicht vor Provokationen und hat sich selbst in einem Interview als Neo-Muʿtazilit beschrieben.54 Als Wissenschaftsphi losoph wurde Soroush von Poppers Falsifikationsprinzip und dem transzendentalen Idealismus Kants beeinflusst. Aus diesem Grund wurde er auch als »Neopositivist«, »kritischer Rationalist und Realist« und »Skeptiker« charakterisiert. In Bezug auf das Verhältnis von Wissen und Religion wurde sein Denken jedoch auch von philoso phisch gesinnten Historikern wie Robin Collingwood und Arnold Toynbee geprägt.55 Für Soroush sollte eine Erkenntnistheorie deskriptiv, nicht prä skriptiv und teleologisch sein: »Sie muss zeigen, wie die Gegenwart – mit all ihren Problemen – so wurde, wie sie ist, nicht wie die Zukunft sein muss.« Er hat nicht nur den a-historischen Idealismus traditio neller schiitischer Religionswissenschaftler verworfen, sondern auch bestimmte Denkrichtungen in der westlichen Philosophie kritisiert, darunter den Hegelianismus und den Marxismus. In islamischen Begriffen hat er sie als shirk, als Götzendienst, qualifiziert. Aus ähn lichen Gründen lehnt er den politischen Islam oder den Islamismus als utopische Ideologie ab. Soroushs erkenntnistheoretische Bücher über Religion sind eine außergewöhnliche Mischung westlicher Wissenschafts- und 53 54 55
C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 20. Ebd., S. 53, Fn. 2. Ebd., S. 47.
275
Carool Kersten
Geschichtsphilosophien, schiitischer und sunnitischer Theologie und Philosophie und beinhalten einen Abstecher zur Sufi-Dichtung von Rumi.56 Das wichtigste Buch in diesem Gebiet wurde zwischen 1988 und 1990 verfasst, der persische Titel könnte folgendermaßen über setzt werden: Theoretische Kontraktion und Expansion der Religion. Die ursprünglich arabischen Begriffe, die Soroush für Kontraktion (qabḍ) und Expansion (basṭ) verwendet, stammen aus dem Koran und sind auch Teil der Sufi-Sprache – sie beziehen sich auf die Kontraktion und Expansion des Herzens des Mystikers. Auch der Untertitel des Buches ist aufschlussreich: Eine Theorie der Entwicklung des religiösen Wissens. Dies bezieht sich auf die wichtige Unterscheidung, die Soroush zwischen Religion als solcher (dīn) und religiösem Wissen (maʿrifat dīnī) macht.57 Soroush schrieb dieses Buch aus Frustration über die Versuche früherer islamischer Reformer wie al-Afghani und Iqbal, um den Islam mit Modernisierung in Einklang zu bringen. Die Ursache seiner Unzufriedenheit besteht in Folgendem: Diese Reformer über sahen die erkenntnistheoretischen Konsequenzen des Unterschieds zwischen den unveränderlichen Aspekten des islamischen Glaubens und der historischen Bestimmung religiöser Traditionen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln – was sie kontingent macht. Der mensch liche Zugang zu den ewigen Wahrheiten der Religionen ist immer vermittelt, niemals direkt. Daher diese Unterscheidung zwischen Religion und religiösem Wissen: Der Mensch könne nur behaupten, letzteres zu haben, aber niemals ersteres. An diesem Punkt möchte ich auf eine Parallele zwischen Hasan Hanafis Behauptung hinweisen, dass sein Erbe- und Erneuerung-Pro jekt eine Fortsetzung von Muhammad Iqbals Wiederbelebung des religiösen Denkens im Islam und Abdolkarim Soroushs Erweiterung des Begriffs ijtihad als »Rekonstruktion«, »erneuertes Verständnis« und »neue Konzeptualisierung« darstellt. Dasselbe gilt auch für die Bedeutung, die Hanafi und Soroush dem rechtlichen Denken beim Entwickeln einer modernen islamischen Religionsphilosophie bei messen.58 Für Soroush wirft dies die Frage auf, ob der Islam in erster Linie als externe Praxis gesehen werden muss – oder als amal auf Arabisch A. Soroush, Qabḍ wa Bast-̣i Te’orik-i Shariʿ¯at; idem, The Expansion of Prophetic Experience. 57 C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 48. 58 Ebd., S. 49. 56
276
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
und Persisch. Oder als innerer Glaube (iman)? So könnte man sich fragen, ob Muslime sich in erster Linie mit den formalen Aspekten ihrer Religion verkörpert in der Umsetzung der shariʽa – was nicht als Gesetz im herkömmlichen Sinne des Wortes zu verstehen ist, sondern als moralischer Kompass oder ethische Richtlinie – befassen sollten. Oder ist die angeborene menschliche Fähigkeit zu glauben, Glauben zu haben – im Koran fitra – noch wichtiger? Nach Soroushs Ansicht ist diese Fähigkeit zur Religiosität wichtiger, um den Geist des Islam zu erfassen. Die erkenntnistheoretischen Dimensionen von Soroushs Reli gionsphilosophie zeigen sich auch in der Bedeutung, die er dem menschlichen Verstand zuschreibt: Soroush zeigt die Binarität der menschlichen Rationalität auf, in (1) reinem oder theoretischem und praktischem Denken, (2) angeborenen und erworbenen Fähigkeiten, (3) besonderen und universellen Gedanken und Ideen. Soroush denkt also über das Individuelle hinaus. In Bezug auf religiöses Wissen erkennt er sicherlich die Bedeutsamkeit dessen an, was im Arabischen ʿaql-i jamʿī genannt wird und als kollektives Bewusstsein übersetzt werden kann. Im islamischen Denken wurde dies unter anderem von Ibn Sina entwickelt. Es kann aber auch aus offenbartem Wissen, aus heiligen Schriften oder heiligen Büchern abgeleitet werden.59 Soroush befasst sich auch ausführlich mit den spirituellen Dimensionen des religiösen Glaubens und zieht es vor, das Voka bular und Idiom der mystischen Tradition des Islam, des Sufismus, beizubehalten, statt die religiöse Tradition Derridas Methode der Dekonstruktion von Texten entsprechend zu entkleiden. Dies wird auch aus der Terminologie deutlich, die Soroush zur Beschreibung der Erkenntnis religiöser Angelegenheiten verwendet. Diese sind eindeutig von Sufi-Kategorien abgeleitet und unterscheiden zwischen shariʿa (den Worten des Propheten), tariqa (seinem Verhalten) und haqiqa (seinem Geisteszustand).60 Soroush kann in der Mitte zwischen foundationalism und Dekon struktion eingeordnet werden. Er glaubt nicht an die Formulierung einer einzigen Wahrheitstheorie, aus dem einfachen Grund, weil es keine Möglichkeit gibt, eine einzige Wahrheit zu bestimmen, und die Bandbreite möglicher Interpretationen endlos ist und daher niemals eindeutig sein kann. Eine Theorie kann besser sein als eine andere, 59 60
C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 49 f. C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 49 f.
277
Carool Kersten
aber als die beste im absoluten Sinne kann sie nicht bezeichnet werden. In Bezug auf religiöse Themen zeigte Soroush sich kritisch gegenüber der Instrumentalisierung von Vernunft, d.h. gegenüber der Sichtweise des Geists als Speicher, der bestimmte Wahrheiten enthält, die verwendet werden können. Stattdessen schlägt er ein dynamisches Verständnis von Vernunft vor, das Raum für Fragen und Zweifel lässt. Das Studium der Religion erfordert die gleiche Freiheit, die in den Naturwissenschaften oder in der empirischen sozialwissenschaft lichen Forschung gebraucht wird. Nur diese Freiheit schafft die Art von Autonomie, die Individuen brauchen, um sich dafür zu entscheiden, an religiöse Wahrheiten zu glauben. Das macht Freiheit selbst zu einer Wahrheit, die zu dem beitragen wird, was er als »veredelndes Verständnis von Religion« bezeichnet.61 Zugleich bleibt Soroush dem Islam und dessen Erbe insofern sehr verbunden, als seine Interpretationen auf ijtihad, Mu’tazila-Theologie und islamischer Philosophie beruhen. Essentialistische Interpretatio nen dessen, was man als »authentischen Islam« erachten kann, lehnt er jedoch ab. Als jemand, der sowohl in den modernen Naturwissen schaften ausgebildet ist, als auch sehr vertraut mit dem traditionellen islamischen Lernen, sieht Soroush den Westen nicht als »das Andere«. Im Gegenteil, die zeitgenössische iranische Kultur setzt sich aus Elementen vor-islamischer persischer, islamischer und westlicher Zivilisationen zusammen.
Schlussbemerkung Ich beende meine Ausführungen mit einer sehr vorläufigen Konklu sion: Muslime haben vielerlei Möglichkeiten gefunden, Philosophien der Religion auszuformulieren, sowohl im Rahmen ihres spezifisch islamischen Erbes als auch indem sie Erkenntnisse nützen, die aus dem westlichen Denken stammen. Obwohl sie sich angemessen und kreativ zwischen ihren eigenen Traditionen und denen des Westens bewegt haben und wir auf Parallelen, Ähnlichkeiten und fruchtbaren Austausch zwischen islamischem und europäischem Denken hinwei sen können, dürfen wir keine identischen intellektuellen Trajektorien zeichnen und müssen außerdem vorsichtig und kritisch sein, wenn wir Begriffe und Ideen von einer Zivilisation auf eine andere übertragen. 61
C. Kersten, Contemporary Thought in the Muslim World, S. 50.
278
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Übersetzt aus dem Englischen von Magdalena Sedmak
Literaturverzeichnis Abdullah, M. A., Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Inter konektif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010 [2006] —, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011 [1996] al-Jabri, M. A., Al-›Aql al-Siyasi al-›Arabiyya, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahda al-Arabiyya 1990 —, Arab-Islamic Philosophy: A Contemporary Critique, Austin: The Center for Middle Eastern Studies, The University of Texas at Austin 1996 —, Bunya al-›Aql al-›Arabiyya, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahda al-Ara biyya 1986 —, Takwin al-›Aql al-›Arabiyya, Beirut: Daral-Tali’a 1984 al-Shahrastani, M., The Book of Religious and Philosophical Sects, hg. v. William Cureton, Piscataway NJ: Gorgias Press 2002 Anzenbacher, A., Einführung in die Philosophie, Wien: Herder 1992 Averroes (Ibn Rushd), Tahafut Al Tahafut (The Incoherence of the Incoherence) 1 & 2, übers. v. Simon van den Bergh, k.O.: Gibb Memorial Trust 2008 Colville, J., »The Definitive Statement Determining the Relationship between Divine Law & Human Wisdom by Abu’l Walid Muhammad ibn Rushd«, in: J. Colville (Hg.), Two Andalusian Philosophers, London: Kegan Paul Interna tional 1999, S. 76–110 Derrida, J., Acts of Religion, hg. u. mit einer Einl. versehen v. Gil Anidjar, London & New York: Routledge 2002 Diagne, S. B., »Achieving Humanity: Convergence between Henri Bergson and Muhammad QIbal«, in: C. Hillier, B. B. Koshul (Hg.), Muhammad Iqbal: Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, Edinburgh: Edin burgh University Press 2015, S. 33–55 Frank, R. M, Gutas, D., Early Islamic Theology: The Muՙtazilites and al-Ashՙarī, Aldershot: Routledge 2007 Gaebel, M., Von der Kritik des arabischen Denkens zum panarabischen Aufbruch, Berlin: Klaus Schwarz Verlag 1995 Goodman, L. E. (Übers.), Ibn Tufayl’s Hayy ibn Yaqzan: A Philosophical Tale, Chicago: University of Chicago Press 2009 Goodman, L. E., Avicenna, London and New York: Routledge 1992 Gutas, D., Avicenna and the Aristotelian Tradition, Leiden: Brill 2014 Griffel, F., Al-Ghazālī’s Philosophical Theology. Oxford and New York: Oxford University Press, 2009
279
Carool Kersten
Gutas, D., Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco-Arabic Translation Move ment in Baghdad and Early ›Abbasid Society, London & New York: Rout ledge 1998 Hanafi, H, La Phénoménologie de l’Exégèse: Essai d’une Herméneutique Existen tielle à Partir du Nouveau Testament, Cairo: Anglo-Egyptian Bookshop 1988 Hanafi, H., Al-Turath wa’l-Tajdid: Mawqifuna min al-Turath al- Qadim, Cairo: al-Markaz al-›Arabi li’l-Bahth wa’l-nashr 1980 —, L’Exégèse de la Phénoménologie: l’État Actuelle de la Méthode Phénomé nologique et son Application au Phénomène Religieux, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi 1980 —, Les Méthodes d’Exégèse: Essai sur la Science des Fondementsde la Compréhen sion “›Ilm Usul al-Fiqh«, Cairo: Conseil Supérieur des Arts, des Lettres et des Sciences Socials 1965 —, Muqaddima fi ›Ilm al-Istighrab, Cairo: Al-Dar al-Fanniyya li’l-Nashr wa’lTawzi‹ 1991 Hillier, C., Koshul, B. B. (Hg.), Muhammad Iqbal: Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, Edinburgh: Edinburgh University Press 2015 Iqbal, M., The reconstruction of Religious Thought in Islam, mit einer Einl. v. J. Majeed, Stanford: Stanford University Press 2013 Keddie, N., An Islamic Response to Imperialism: Political and Religious Writings of Jamal ad-Din »Al-Afghani«. Berkeley & Los Angeles: University of California Press 1983 Keddie, N., Sayyid Jamal ad-Din »Al-Afghani«: A Political Biography, Berkeley & Los Angeles: University of California Press 1972 Kersten, C., »Al-Jabri in Indonesia: The Critique of Arab Reason Travels to the Land Below the Winds«, in: Z. Eyadat, F. Corrao, M. Hashas (Hg.), Islam, State and Modernity: Mohammed Abed Al Jabri and the Future of the Arab World, London: Palgrave 2017, S. 149–169 —, »Bold Transmutations: Rereading Hasan Hanafi’s Early Writings on Fiqh«, in: Journal of Comparative Islamic Studies 3 (2007) 1, S. 22–38 —, Contemporary Thought in the Muslim World: Trends, Themes, and Issues. London & New York: Routledge 2019 —, Cosmopolitans and Heretics: New Muslim Intellectuals and the Study of Islam, London & New York: Hurst Publishers & Oxford University Press 2011 —, Islam in Indonesia: The Contest for Society, Ideas and Values, London & New York: Hurst Publishers & Oxford University Press 2015 Kukkonen, T., Ibn Tufayl: Living the Life of Reason, London: Oneworld 2014 Majeed, J., Muhammad Iqbal: Islam, Aesthetics, Postcolonialism, New Delhi: Routledge India 2009 Martin, R. C., Woodward, M., Atmaja, D. S., Defenders of Reason in Islam: Mu'tazilism from Medieval School to Modern Symbol, Oxford: Oneworld 1997 Moosa, E., »The Human Person in Iqbal’s Thought«, in: C. Hillier, B. B. Koshul (Hg.), Muhammad Iqbal: Essays on the Reconstruction of Modern Muslim Thought, Edinburgh: Edinburgh University Press 2015 Nawas, J. A., Al-Ma'mun, the Inquisition, and the Quest for Caliphal Authority, Atlanta: Lockwood Press 2015
280
Islamische Religionsphilosophien damals und heute
Renan, E., »The Share of the Semitic People in Civilization«, inaugural lecture on assuming the Chair in Semitic Language, College de France, in: C. D. Warner a.o. (Hg.) The Library of the World’s Best Literature. An Anthology in Thirty Volumes 1917, verfügbar unter https://www.bartleby.com/library/pr ose/4265.html, letzter Zugriff: 28. November 2019 Soroush, A., The Expansion of Prophetic Experience: Essays on Historicity, Contin gency and Plurality in Religion, übers. v. N. Mobasser, hg. v. F. Jahanbakhsh, Leiden: Brill 2009 —, Qabḍ wa Bast-̣i Te’orik-i Shariʿ¯at: Nazạ rīyat-i Tak¯amul-i Maʿrifat-i dīnī, Tehran: Mo’assesseh-ye Farhangi-ye Serat 1991 Strauss, L., Persecution and the Art of Writing. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1952. Reissued Chicago: University of Chicago Press, 1988 Troll, C. W., Sayyid Ahmad Khan: Reinterpretation of Theology. Noida, Uttar Pradesh: Vikas Publishing House 1978 Troll, C.W., C.M. Ramsey, M.B. Mughal. The Gospel According to Sayyid Ahmad Khan (1817-1898): An Annotated Translation of Tabyīn al-Kalām. Leiden & Boston: Brill 2020 Urvoy, D., Ibn Rushd (Averroes), London & New York: Routledge 1991
281
John D. Caputo
Eine radikale Theologie des Kreuzes1
Eine radikal verstandene theologia crucis verlangt die Kreuzigung des Gottes des Seins am Kreuz des Nichtseins, des Gottes der Weisheit am Kreuz der Torheit, des Gottes der Macht am Kreuz der Schwäche (1 Kor 1:20–25). Der Theologie wird alles zugemutet, bis hin zum härtesten Verzicht, zum erschreckendsten Entzug ihrer Privilegien, ihres Herrschaftsanspruchs als Königin der Wissenschaften, ihrer eigenen besonderen Kenntnisse, Offenbarungen und Inspirationen. Es wird von ihr erwartet, arm und umherziehend, nackt und gehorsam zu sein, sogar bis zum Tod. Mehr noch, dasselbe wird von Gott in der Höhe verlangt. Selbst die bisherige (so genannte) Theologie des Kreuzes – in deren Schuld dieses Werk eindeutig steht –2 hat die Ewigkeit, Transzendenz und Souveränität Gottes bewahrt, so dass Gott nur deshalb leidet, weil Gott stark genug ist, das Leiden auf sich zu nehmen, das Leiden zu absorbieren in die Eminenz und Unermess lichkeit, in das Geheimnis und den Abgrund, in die souveräne Macht der Gottheit. Aber nach der hier vertretenen radikaleren Auffassung eines verletzlichen und nicht-souveränen Gottes ruft der Ruf, der in und unter dem Namen (von) »Gott« ergeht, nach noch mehr. Er verlangt, dass wir noch weiter gehen, so dass das Kreuz die Souveränität der Gottheit des Gottes in der Höhe berührt und das, was in den großen Monotheismen »Gott« genannt wird, der Schwäche und dem Nichtsein ausgesetzt wird. Diese Kreuzigung, diese Entäußerung, Entblößung, Dekonstruktion und Verödung Gottes widerspricht nicht der Eminenz oder der Macht des Namens Gott(es); sie konstituiert einen Gott, der dieses Namens würdig ist (digne dicitur). Gottes Macht Gekürzte und modifizierte Übersetzung des 1. Kapitels von Cross and Cosmos: A Theology of Difficult Glory. 2 Mein Dank gebührt Christopher Chalamet, an dem diese Schuld deutlich wird und der mir geholfen hat, die überarbeitete Version dieses Aufsatzes herzustellen. Siehe sein »God’s Weakness and Power«. 1
283
John D. Caputo
wird durch Ohnmacht und Nicht-Herrschaft konstituiert, Gottes Emi nenz dadurch, dass er das Geringste und Niedrigste unter uns ist. Andernfalls ist der Name Gottes ein Machtspiel, ein strategischer Schachzug der Theologie gegenüber ihren Gegnern, ein Spiel, das Gott zum Mitspieler im Machtspiel der Welt macht, in dem die Theo logie und ihr Gott alle Karten in der Hand hält, in dem der Gott der Herrlichkeit unweigerlich gewinnt (theologia gloriae) und in dem es der Theologie letztlich nur um das Gewinnen geht – was Gott und der Theologie unwürdig ist. Ich beginne mit einer Exegese, lasse es dabei aber nicht bewen den. Was uns in 1 Korinther 1–2 zu denken gegeben wird, verfolge ich über das hinaus, was sein Autor beabsichtigt haben könnte, um einer Sache auf der Spur zu bleiben, die gedacht werden soll. Ich versuche, Paulus dorthin zu folgen, wohin er nicht geführt hat, indem ich die Kraft dessen sondiere, was Paulus in dem explosiven Ausdruck »die Schwachheit Gottes« (to asthenes tou theou) erfasst hat, nicht um eine radikale Philosophie des Heiligen Paulus zu konstruieren, wie es Stanislas Breton3 tut, sondern eine radikale Theologie des Kreuzes. Wir folgen dem Weg des Kreuzes bis zum bitteren Ende, indem wir die Theologie ihrer Herrlichkeiten berauben und die Schwäche und das Nichtsein in die Tiefen der Gottheit einschreiben. Wir verfolgen die Torheit des logos des Kreuzes bis hin zu einem nüchternen Glauben, der, ungeschmückt von Ornamenten der Religion und entkleidet der Gewänder der Doktrin, durch den Tod zu neuem Leben und durch die Kreuzigung zu einer überraschenden Auferstehung und einer unwahrscheinlichen und schwierigen Herrlichkeit drängt.
1. Methode: 1 Korinther 1:19: Destructio (Apolo) Es ist klar, dass ein solcher Entwurf einige Erklärungen seine Methode betreffend erfordert: ich übernehme diese von Derrida, aber nicht ohne Rückgriff auf Heidegger und Bultmann. Alle drei Denker ver dichten ihr Werk in einen Kunstausdruck, der semantisch negativ ist – Destruktion4, Entmythologisierung5, déconstruction –, auch wenn ihre Arbeit eine affirmative Ausrichtung hat. Um diesen sprachlichen 3 4 5
S. Breton, Saint Paul; S. Breton, A Radical Philosophy of Saint Paul. Anm. d. Übers.: Im Original deutsch. Anm. d. Übers.: Im Original deutsch.
284
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Eindruck zu vermeiden, spreche ich oft von einer »Hermeneutik« – aber einer radikalen, was bedeutet, dass dieser Hermeneutik nicht das Herz für die herzlose Operation des Kreuzes fehlt, für die durch die negative Vorsilbe bezeichnete Demontage. Die so konstruierte Hermeneutik folgt, auf ihrem eigenen Weg, entlang (meta) dem Weg (hodos) des Kreuzes. Die theologia crucis, die daraus folgt, stellt einen hermeneutischen Karfreitag dar – eine Theologie des Kreuzes, des Gekreuzigten, und auch eine gekreuzigte Theologie, selbst dem Kreuz unterworfen, nackt ausgezogen, gedemütigt und ihrer Macht und ihres Ansehens beraubt. Das Absterben in diesen Methoden ist real und unaufhörlich, aber es ist weder morbide noch nihilistisch. Es dient immer dem Zweck des Lebens, nicht des Todes – eines neuen Lebens geboren aus dem Durchschreiten des Todes. Aber es ist immer ohne Kompromiss, ohne Ökonomie, ohne Doketismus, der Schwäche und Torheit zu einer die Mächtigen überrumpelnden Strategie machen würde. Was Heidegger Destruktion nennt, gehört zu einer Arbeit der »Wiederherstellung« oder »Wiederholung«6, die in Vergessenheit Geratenes zurückruft. Die Wiederherstellung erfordert hermeneuti sche Gewalt oder Abbau7, um das Wiederherzustellende aus seinem sedimentierten Zustand herauszulösen. Sie kommt in Kontakt mit etwas, das in der Geschichte der Metaphysik vor sich geht, das die Metaphysik als solche nicht zu denken vermag. Das bedeutet nicht, die Metaphysik dem Erdboden gleichzumachen, sondern zum Boden der Metaphysik als dem Schatzhaus des zu Denkenden durchzubre chen. Die »Überwindung der Metaphysik« setzt in der Metaphysik etwas Unbändiges frei. Die Entmythologisierung folgt einer analogen Regel. Sie ist nicht die Zerstörung des Mythos, sondern seine Hermeneutik, die Interpre tation des mythologischen Schemas, damit wir verstehen können, was er für unser Leben heute bedeutet, wenn das mythologische Schema selbst obsolet ist. Im Neuen Testament wird, nicht unähnlich wie in einer griechischen Tragödie oder einem Shakespeare-Stück, unser Leben auf die Bühne gebracht, eingefügt in ein großes kosmi sches Drama mit einer göttlichen dramatis personae, übernatürlichen Akteuren, die in dramatischer (mythopoetischer) Zeit und ebensol chem Raum handeln. Gott wohnt oben, im siebten Himmel, Satan 6 7
Anm. d. Übers.: Im Original deutsch in Klammern. Anm. d. Übers.: Im Original deutsch in Klammern.
285
John D. Caputo
unten, in den dunklen und abstoßenden Nischen unter der Erde. Auf der Erde dazwischen kämpfen Legionen von Engeln aus der Höhe mit Dämonen in einem Stellvertreterkrieg zwischen Gott und Satan. Die Paulinische Verheißung des neuen Seins, des Lebens statt des Todes, wird umschrieben als ein neues »Zeitalter«, als die kommende Zeit, herbeigeführt durch den auf die Erde herabgekommenen Gott, der die Mächte und Gewalten besiegt. In der »Endzeit« wird der Gott kommen, um zu richten – in einer großen apokalyptischen Konfrontation werden die Feinde des Gottes zerschmettert und der Tod besiegt. Aber natürlich gehen, wie die Geschichte bezeugt, Tod und Zerstörung, Leid und Böses unvermindert weiter; die Endzeit kommt nicht, seit mittlerweile zweitausend Jahren und länger. Der hastige Befehl, sich vorzubereiten, entpuppt sich als Fehlalarm. Es gibt keine Dämonen, sondern Viren und Bakterien; keinen Garten Eden, sondern Evolutionsbiologie; keinen »Himmel oben« und kei nen »Hades unten«, sondern Sonnensysteme und Galaxien in einem sich immer weiter ausdehnenden Universum, die »oben« und »unten« radikal relativieren. Was jetzt gebraucht wird, ist eine hermeneuti sche Gewalt, die die Verkündigung von der mythischen Zeit und dem mythischen Raum, in die sie eingeschrieben war, loslöst. Was gekommen ist, ist die Zeit der Entmythologisierung, das Zeitalter der Interpretation, was bedeutet, diese Mythen neu zu lesen, nicht sie lächerlich zu machen. Was Heidegger Zerstörung und Bultmann Entmythologisierung nennt, hängt von dem ab, was Derrida die Struktur der »Spur« nennt, die Fähigkeit des Signifikanten, in Abwesenheit dessen, was er bezeichnet, zu funktionieren. Aufgrund dieser Fähigkeit ist die Spur »iterierbar«, wiederholbar, aus ihrem ursprünglichen Kontext herausnehmbar und in der Lage, in einem neuen Kontext neues Leben zu gewinnen. Andernfalls wäre Bezeichnung an die unmittelbare Anwesenheit des Bezeichneten gebunden, die Kommunikation wäre an Händen und Füßen gefesselt, und die Traditionen wären nicht in der Lage, über ihre Inauguration hinauszugehen. In der Tat, wenn eine Spur nicht wiederholbar ist, kann sie nicht einmal beim ersten Mal verwendet werden; sie wäre keine Spur, sondern ein sinnloser Klang oder ein Zeichen, eine stumme Präsenz in sich selbst gefangen. Die Dekonstruktion ist die allgemeine Theorie der Spur (gramme, Grammatologie), ihrer notwendigen Kontextualität und Rekontext ualisierbarkeit – das meint Derrida mit »Text« und darum sagt er,
286
Eine radikale Theologie des Kreuzes
dass es keine Bezeichnung außerhalb der Textualität von Kontext und Rekontextualisierbarkeit gibt. Ohne ein solches »Spiel« – Rekontextualisierbarkeit – wäre die Spur einer Zukunft beraubt, und der eigentliche Punkt der Dekon struktion ist gerade diese Zukunft. Ihr Motiv und Wunsch ist es, das Risiko der Wiederholung, der Stimmung, der Ambiguität und der Polyvalenz der Spur auf sich zu nehmen, gerade um ihre Verheißung zu erfahren, der die Dekonstruktion in jedem Fall zugewandt ist, so wie der logos des Kreuzes der Verheißung der Auferstehung zugewandt ist. Passenderweise ist das erste Wort der Dekonstruktion, »komm«, viens, oui, oui, die Affirmation der Verheißung des Kommenden – das Derrida das »Ereignis« (événement) nennt – das letzte Wort des Neuen Testaments (Offb. 22:20). Aber das Kommende ist nicht zu verwechseln mit einem eschaton, einem »kommenden Zeitalter« oder zukünftigen Geschehen, das er als »zukünftige Gegenwart« bezeich net. Das »Kommende« (à venir) ist kein kommendes Zeitalter, son dern eine »schwache messianische Kraft«, die sich in die gegenwärtige Konstruktion hineindrängt, um ihr eine Zukunft zu ermöglichen, eine Verheißung, die nie frei von Risiko ist.8 Dekonstruktion ist die Affirmation des Herein-Kommens (invention) des Ereignisses, die Wiedererfindung des Ereignisses, immer und immer wieder. So sehen wir in jedem Fall denselben logos oder ana-logos – Zerstörung ist Wiedergewinnung, Entmythologisierung ist Reinter pretation, Dekonstruktion ist Wiedererfindung –, der der logos des Kreuzes ist: Kreuzigung ist Wiederauferstehung. Wie wir oben gese hen haben, handelt es sich dabei nicht um eine seltsame Assoziation, sondern um eine Angelegenheit strenger Philologie. Mit dem Geist und dem Buchstaben des Wortes déconstruction im Hinterkopf wollen wir lesen, was Paulus in 1 Korinther 1–2 sagt.
2. Ta Me Onta (1 Kor 1:28) Paulus sagt uns, dass er Jesus nicht leibhaftig begegnet ist; das erklärt zumindest zum Teil, warum sich in den Briefen so selten Verweise darauf finden, was Jesus gesagt und getan hat. Dennoch 8 J. Derrida, Marx’ Gespenster, S. 96: »zukünftige Gegenwart«; zur »schwachen Kraft« vgl. ders., Schurken, S. 12.
287
John D. Caputo
denke ich, dass er im ersten Kapitel des 1. Korintherbriefs den Kern der Evangelien herausdestilliert hat, und insbesondere das, was ich gerne die Poetik der Reich-Gottes-Sprüche nenne. Mit Poetik meine ich die Konstellation von Metaphern und Metonymien, Parabeln und Paradoxien, Bildern und Erzählungen, die kumulativ die gelebte Erfahrung des Reiches Gottes, seine Lebensform, hervorrufen. Eine beunruhigend andere semantische Performanz, die Poetik des Reiches Gottes ist die auf den Kopf gestellte Dynamik dieser Sprüche, die Umkehrungen, die Paradoxien, die schockierende Logik, aufgrund derer die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sind, die Verlorenen die Geretteten, die Außenstehenden innen sind und die Innenstehenden außen, die Schwachen die Starken und die Törichten die Weisen. In der Tat ist diese Logik oder Alogik in der neutes tamentlichen Wissenschaft eines der Kennzeichen von Sprüchen, hinter denen eine authentische Tradition steht. Eine Poetik erfordert immer eine Interpretation, eine Hermeneutik. Paulus konfrontiert die korinthische Elite mutig und kühn, ohne die Gefühle der Heiligen zu schonen, und erinnert sie eindringlich an die Niedrigkeit ihres Zustands, wenn auch im Geist brüderlicher Liebe.9 Paulus ist absolut offen: Sie sind nicht wohlgeboren, nicht gebildet, nicht weise oder mächtig in dem Sinn, wie die Welt Weisheit und Macht versteht. Sie sind in der Tat niedriggeboren und verachtet, tief gesunken und unbedeutend. Um die wunderbare englische Übersetzung von John Dominic Crossan zu verwenden, sind sie »nuisances and nobodies« (ta me onta).10 Kein Philosoph kann die Pointe von ta me onta übersehen, wenn Paulus, von dem wir annehmen können, dass er Heidegger nie gelesen hat, nicht so sehr »die Metaphysik überwindet«, sondern sie mit Ironie und Spott überwältigt. Was er sagt, soll die korinthi sche Elite schockieren, indem er eines der meistverehrten Wörter aus ihrem philosophischen Vokabular, to on, aufgreift, während er – eindringlich, polemisch, ironisch, spöttisch – für das Gegenteil Stellung bezieht. Gegen alle Vernunft, alle Logik, alles Ontologische, alles Onto-Theologische zieht er das Nichtsein dem Sein vor, das Nichts-Sein dem Selbst-Sein. Die triefende Ironie, der Sarkasmus, erinnert nicht an Heideggers schwerfälliges Deutsch, sondern an die Mehr zur Soziologie der Korinther findet man in J. Barclay, »Crucifixion as Wis dom«. 10 J. D. Crossan, Jesus: A Revolutionary Biography, S. 54–74.
9
288
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Spitzen und den bissigen Witz, die Kierkegaard gegen Hegel und Luther gegen Aristoteles richtete. Das griechische Wort ousia, das die Philosophen mit »Substanz« übersetzen, als ob ihnen das Wort vom Mond in den Schoß gefallen wäre, bezieht sich im gewöhnlichen Sprachgebrauch auf den eigenen Besitz, auf irdische Besitztümer, ja sogar auf Grundbesitz – ein Sprachgebrauch, der eine nicht ganz so subtile Übertragung von dem, was man besitzt, auf das, was man ist, vom Haben auf das Sein vollzieht. Die Vermittlung zwischen den beiden Bedeutungen, der hohen und der gewöhnlichen, zeigt sich im modernen Englisch in Ausdrücken wie »a person of substance« oder »the powers that be«, wo die ontologische Ordnung in den Dienst der soziologischen Ordnung gestellt wird. Ousia bedeutete, ein großes Haus, viele Sklaven und schöne Kleider zu haben, all die Insignien von Macht, Besitz und Prestige. Das Haben schwillt zum Sein an; das Nicht-Haben schrumpft zum Nicht-Sein. Paulus verspottet also die Logik des Seins, der Macht und der Weisheit der korinthischen Elite und bezieht Stellung für die Logik des Nichtseins, der Schwäche und der Torheit, indem er strategisch die Logik des Seins in den Logos des Kreuzes verkehrt, in seine Alogik oder Poetik. Er versucht, die Schichtung in der blühenden griechisch-römischen Stadt Korinth, die sich auch auf die Gemeinschaft der Heiligen übertragen hat, mit der verwirrenden Logik des Kreuzes zu vermischen, die die Wege der »Welt« in Verwirrung stürzt.11 In diesen Texten, so argumentiere ich, ist die Schwäche der stärkste Punkt des Paulus.
3. Ein verwundbarer Gott Um ein Verständnis der »Torheit« des logos des Kreuzes zu gewinnen, lassen Sie uns die hypothetische Frage stellen: Hätte Jesus vom Kreuz herabsteigen können, wenn er es so gewollt hätte? Könnte er mit einem einzigen Wimpernschlag die mächtigen römischen Soldaten gegen die Felsen schleudern, das Kreuz in Splitter schlagen und zwölf Legionen von Engeln zu seiner Verteidigung vom Himmel herabrufen? Oder war er wirklich dort festgenagelt, an beiden Händen und beiden Füßen, gegen seinen Willen, unfähig, einem qualvollen Wie Martin, The Corinthian Body, S. 108–136, gezeigt hat, stritten die Heiligen in einer Stadt, der es nicht an griechischen Philosophen mangelte, die offensichtlich ihren Glauben geringschätzten.
11
289
John D. Caputo
Schicksal zu entgehen? Wie wird hier der unsichtbare Gott in all dieser schrecklichen Grausamkeit sichtbar gemacht? Die klassische Sichtweise erkennt den logos des Kreuzes in einem Jesus, der wil lentlich am Kreuz leidet, obwohl er die Macht besaß, seine Feinde zu vernichten. Das macht die Kreuzigung in erster Linie zu einer Übung in liebendem Gehorsam, Demut und Selbstbeherrschung, zur willentlichen Aufhebung der göttlichen Macht, die in all ihrer Wut hätte entfesselt werden können – aber auch zu einem Modell des Gehorsams Leidender gegenüber ihren Unterdrückern. In der Hohen Christologie des Thomas von Aquin war Jesus in seiner menschlichen Natur unmittelbar mit der seligmachenden Vision in seiner göttlichen Natur verbunden, so dass bei allem Leiden, das sein verletzlicher menschlicher Körper ertrug, die göttliche Natur unver wundbar blieb, souverän, hypostatisch verbunden mit und untrennbar von der menschlichen Natur, immun gegen Leiden und unberührt vom Tod. Diese unendliche Ressource, all ihre Kraft und Freude, stand ihm voll und ganz zur Verfügung, aber Jesus lehnte es ab, sie sich am Kreuz zunutze zu machen. Aber wenn die Logik der Ikone [icon]12 ernst genommen werden soll, kann der Mangel an Macht nicht nur scheinbar sein – eine Form von schwachem Doketismus –, hinter dem sich eine reale und unvergängliche Macht verbergen kann, die viel größer ist als die vergängliche Macht Roms und seiner Soldaten, eine andauernde Macht, die ihre Feinde schließlich zu ihren Fußschemeln machen wird. Das Leiden des Mannes muss an das Göttliche rühren und einen lei denden Gott offenbaren. Als die alte Kirche den »Patripassianismus« verdammte, gab sie einfach den Maximen der griechischen Metaphy sik nach, anstatt den Skandal und das Paradox des Neuen Testaments anzunehmen – was den Zorn Luthers erregte. Nach der Logik der beiden Leiber Jesu stellt die Kreuzigung nicht einen Mann dar, den wir bloß deshalb bewundern, weil er unter Verfolgung ruhig blieb, der mit Gnade und Würde starb, als er von den Römern, die sein Land besetzten, hingerichtet wurde. Auch Sokrates starb würdevoll. So wie viele andere tapfere Menschen auch. Diese Szene aus den Evangelien, zusammen mit dem Rest des Bildes Jesu, das von den Synoptikern gezeichnet, aber nie von Paulus zitiert wird, funktioniert auf einer 12 Anm. d. Übers.: Ich übersetze »icon« und »iconic« der Konsistenz wegen durchgän gig mit »Ikone« und »ikonisch«, obwohl im Deutschen an einigen Stellen »Symbol« bzw. »Abbild« naheliegender schiene. Eckige Klammern enthalten jene Ausdrücke, die sich im Original finden.
290
Eine radikale Theologie des Kreuzes
zweiten und ikonischen Ebene, wo sie nicht die Darstellung eines phronimos, sondern von Gott liefert. Die Evangelien sind nicht das Porträt eines gerechten Mannes, der tapfer starb und dem Gesetz bis zum Ende gehorsam war, wie etwa Sokrates, sondern ein ikonisches Porträt Gottes, so dass unser Blick von diesem gekreuzigten Körper auf Gott gelenkt werden soll. Meine Behauptung ist, dass, wenn das Zeichen Gottes im Chris tentum aus dem charakteristischen Bild Jesu gezogen wird, es sys tematisch auf der Seite der »schwachen« Merkmale – Vergebung, Frieden, Gewaltlosigkeit, Armut – zu finden ist, nicht auf der Seite der starken oder »virilen« Merkmale. Wenn in der Tat CRUX sola est nostra theologia, dann muss die menschliche Schwäche eine Ikone für die göttliche Schwäche und Verletzlichkeit sein, wenn auch so, dass »die Schwäche Gottes stärker ist als die menschliche Stärke« (1 Kor 1:25). Die in den Konzilien und der klassischen Orthodoxie vertretene Position, dass die menschliche Natur schwach, die göttliche Natur dagegen stark ist, widerspricht der Logik der Ikone. Dennoch geht es nicht um eine einseitige Verabsolutierung der Schwäche, sondern darum, die Unterscheidung zwischen Stärke und Schwäche im Sinne des ikonischen Lebens des Jesus neu zu fassen, in dem die Schwäche ein neuer und erstaunlicher göttlicher Name ist. Die Schwäche Jesu ist auch stark, aber sie ist nicht stark in dem Sinn, wie die Welt Stärke versteht. Die Göttlichkeit, die er offenbart, schafft nicht die Stärke zugunsten der Schwäche simpliciter ab, sondern beschreibt neu eine Schwäche, die stärker ist als das, was die Welt Stärke nennt. In dieser Hinsicht ist die Macht Jesu viel stärker als jede rein weltliche Demonstration von Stärke, sei es durch ihn oder irgendjemand anderen, so wie die Majestät des Körpers eines Königs nichts damit zu tun hat, ob er ein abscheulicher Anblick ist oder eine königliche Figur macht.
4. Von metaphysischer Theologie zu radikaler Theologie Natürlich hängt alles davon ab, dieses »stärker als« (ischuroteron) so zu verstehen, dass man die Würde des Kreuzes nicht gefährdet, indem man es in eine verkleidete Form von Macht verwandelt, die es auf eine List reduziert. Wenn wir eine Theologie haben wollen, die diesen Namen verdient, müssen wir, koste es was es wolle, an
291
John D. Caputo
das Theorem digne dicitur erinnern und so vermeiden, dass das Kreuz einer Ökonomie unterworfen, in eine Strategie verwandelt oder auf einen Schein reduziert wird. In einer radikalen Theologie stellt der logos des Kreuzes das klassische Konzept der Allmacht Gottes in Frage, und dadurch entfernt sie sich von jeder orthodoxen konfessionellen Theologie des Kreuzes. Eine radikalere Auffassung der Schwäche Gottes verlangt eine entsprechend radikalere Vorstel lung von der Stärke Gottes; das wird deutlich, wenn wir die beiden Quellen der klassischen Vorstellung von Allmacht untersuchen. In erster Linie wurzelt die Allmacht in einem System metaphysischer Unterscheidungen – zwischen Ewigkeit und Zeit, Sein und Werden, wirklichem und potentiellem Sein –, die auf Platon und Aristote les zurückgehen. Die Ironie könnte nicht größer sein: Genau darin besteht die Tradition der korinthischen Philosophen, die von Paulus verspottet wurden. Dieser Gott ist ein Bündel von Vollkommenheiten wie Allwissenheit und Allmacht, ein Überwesen, das in der Lage ist, jedes sublunare Wesen zu überflügeln und entmachten. Diese meta physischen Unterscheidungen gehen Hand in Hand mit klassischen politischen Modellen von Souveränität und Königtum, in denen die Macht Gottes sowohl metaphysischen als auch politischen Zwecken dient. Gemäß der von Paulus verspotteten Ordnung der ousia ist Gott die oberste und souveräne Macht, der König der Könige, an dessen Königtum seine Stellvertreter hier unten auf der Erde teilhaben.13 Die souveräne Macht Gottes ist ein Spieler im Machtspiel der Welt, in dem Gott, die höchste Allmacht, die jede bloß weltliche Macht in den Schatten stellt, per definitionem garantiert gewinnen wird. Das soll nicht heißen, dass dies alles den Griechen angelastet werden kann und dass es ausreichen würde, »die Metaphysik zu überwinden«. Das bringt uns zur zweiten Quelle, den Autoren des Gottes der Bibel, die wie die griechischen Philosophen in Ruhm und Macht verliebt sind. Die klassische Vorstellung vom »allmächtigen Gott« ist nicht nur von der griechischen Metaphysik durchdrungen, sondern auch von einer mythischen Welt, in der sich die dämonischen 13 Derrida nennt Gottes Souveränität ein »uneingestandenes Theologem«, das das Modell liefert für die Souveränität des Königs über die Nation, des Vaters über seine Familie, der Menschheit über die (anderen) Tiere und die Erde selbst, die souveräne Freiheit des autonomen Individuums und ein System von oben-unten-Binaritäten – König/Subjekt, Herr/Sklave, Vater/Familie, männlich/weiblich, Mensch/Tier, Menschheit/Erde. Siehe J. Derrida, Schurken, S 152.
292
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Mächte der Welt als nicht ebenbürtig mit der gewaltigen Macht Gottes erweisen. Das reformatorische Projekt der destructio, der Reinigung der Theologie von griechischer Metaphysik durch Rückbesinnung auf die Bibel, ist also bestenfalls ein halber Schritt. Auch wenn das Neue Testament nichts von der Metaphysik der ousia weiß, handelt es doch von mythischen Mächten und Fürstentümern, von auszutreibenden Dämonen und der kommenden Endzeit der von Jesus gepredigten Gottesherrschaft.14 Wenn die Metaphysik überwunden werden muss, muss das Neue Testament entmythologisiert werden. Gebraucht wird eine radikalere déconstruction, ein hermeneutischer Karfreitag, an dem die Theologie am Kreuz der Schwäche gekreuzigt wird – wenn die im Neuen Testament eingebettete Verheißung des Lebens freigesetzt werden soll. Eine kompromisslos betriebene Theologie des Kreuzes erfordert eine Dekonstruktion der Metaphysik der Macht, der Mythologie des Himmels in der Höhe und der Politik der Souveränität. Ihre Losung sind die revolutionären Texte von 1 Korinther 1, in denen Gott systematisch zugunsten aller am unteren Ende dieser binären Systeme Stellung bezieht – wo die Torheit der Weisheit spottet, das Nichtsein das Sein überwindet und die Schwäche die Macht beschämt. Im Gegensatz zu den mythischen Heldengöttern der Antike vergibt Jesus seinen Feinden, stellt sich auf die Seite der Unterdrückten und Gefangenen, der Außenseiter, der verlorenen Schafe usw. Die »göttli che Ordnung«, die sich um Jesus bildet, ist anarchisch, widerspenstig, auf den Kopf gestellt, verkehrt, kurzum, hieranarchisch, töricht in den Augen der Welt. Wie L. L. Welborn gezeigt hat, ist diese Torheit nicht nur eine intellektuelle Angelegenheit; in der populären griechischen Unterhaltung ist der moros eine komische Figur, Objekt des Spottes und der Verachtung – hässlich, dumm, vulgär, unerzogen, eine Art menschlicher Abschaum.15 Wenn Jesus ein König genannt wird, ist das ein Spott, ein Witz, in dem dieser niedriggeborenen Niemand durch einen königlichen Namen verspottet wird, und wenn er selbst von Gottes Königreich spricht, fügt er sofort hinzu, dass es nicht ein 14 John Dominic Crossan schreibt dazu: »But, for myself, while the New Testament starts with the first coming of a nonviolent historical Jesus, it ends with the second coming of a violent theological Christ.« (J. D. Crossan, »Response to Luke Timothy Johnson«, S. 187) Crossan beschuldigt die Kirche einer apokalyptischen Gewalt, aber Jesus ist unschuldig wie ein Lamm unter den Wölfen. 15 L. L. Welborn, Paul, the Fool of Christ, zitiert in J. Barclay, »Crucifixion as Wisdom«, S. 7 f.
293
John D. Caputo
Königreich der Art ist, wie die Welt Könige und Königreiche kennt. Tatsächlich waren es die Ungläubigen, die dachten, Jesus müsste vom Kreuz herabsteigen können, wenn er wirklich der Sohn Gottes wäre. Also verhöhnten sie ihn, ebenso wie es auch Satan getan hat: Lass uns sehen, wie du dich selbst rettest. Lass uns sehen, ob deine göttliche Kraft stärker ist als die der Römer – was heißt, dass sie Stärke an der Stärke von Holz und Nägeln maßen. Aber eine solche Stärke gehört in die Ordnung des Mythos und der Magie; von einem Hollywood-Superhelden mit übernatürlicher Kraft wird erwartet, dass er seine Feinde mit dem geringsten Gedanken zu Staub macht. Jesus und der Gott, dessen Ikone er ist, haben nichts mit einer solchen Vorstellung von Stärke und nichts mit solcher Magie zu tun. Jesus ist wirklich an dieses Kreuz genagelt und seine »Schwä che« am Kreuz, seine Verwundbarkeit, ist nicht eine willentliche Aussetzung der unendlichen Macht, die ihm zur Verfügung steht. Die Göttlichkeit in dieser ikonischen Szene findet sich in erster Linie in der Vergebung, die in Majestät vom Kreuz aufsteigt, sich über die Schwerter der römischen Soldaten, für die sie vollkommene Torheit ist, erhebt und durch die Jahrhunderte hindurch nachhallt. Sie gehört zu einer anderen Ordnung der Kraft, weil sie intrinsisch in Schwäche eingebettet und als solche für die Welt unverständlich ist. Die schwache Kraft der Vergebung ist Torheit für die mythologische, metaphysische und politische Macht. Sie ist eine Macht ohne Macht, eine Macht der Ohnmacht, die auf ihre eigene Weise größer ist als die Macht der römischen Armee, größer als die mythischen Mächte und Fürstentümer und größer als die Metaphysik der Allmacht. In der Vergebung wird die Macht des Gottes des Mythos und der Metaphysik dekonstruiert – ein Wort, das eine überraschend gelungene, sogar exegetisch präzise Glosse zu 1 Korinther 1:19 liefert.
5. 1 Korinther 2: Die Umkehrung16 Nun müssen wir eine Frage aufwerfen, die eine Art Testfall für meine These darstellt: Was meint Paulus, wenn er sagt, dass die Schwäche Gottes stärker ist als die menschliche Stärke? Meinte Paulus, dass Gottes Stärke – nicht die Macht der Ohnmacht, sondern die uneinge Anm. d. Übers.: »reversal« wird durchgehend mit »Umkehrung« übersetzt, kann aber auch »Umkehr« bedeuten.
16
294
Eine radikale Theologie des Kreuzes
schränkte göttliche Macht – letztlich, auf lange Sicht, in der und über die Welt triumphieren würde? Daran, denke ich, gibt es wenig Zweifel, von diesem Standpunkt muss ich jedoch – und das sage ich im Flüster ton, um von den Autoritäten nicht belauscht zu werden – abweichen. Paulus‘ Ansichten sind, wie die des Autors des Johannesevangeliums, in der Art eines riesigen kosmischen Christus-Victor-Dramas formu liert, von dem er glaubt, dass darin die Mächte Satans durch den Tod und die Auferstehung Jesu niedergeschlagen wurden. Von dieser mythischen Gewalt muss ich mich, so friedlich wie möglich, verab schieden. Denn wie weit ist eine solche Ansicht von Nietzsches Kritik des Ressentiments entfernt, vom Einsatz der Schwäche als tückische Waffe, um sich an die Starken und Gesunden heranzumachen und sie zu Fall zu bringen? Meine eigene Ansicht ist, dass Paulus nicht stark genug an die Schwäche glaubte, und während er der Macht der griechischen Eliten und ihrer Philosophen der ousia misstraute, tat er dies im Namen einer anderen, geheimen, entgegengesetzten und stärkeren göttlichen Macht, die nur den Auserwählten bekannt ist. Er trug die Figur der Schwäche in eine langfristige Ökonomie der göttlichen Stärke ein, die der Macht der Welt zu ähnlich war. Für Paulus ist die Investition in die Schwachheit hier und jetzt, wo wir die Dinge im Dunkeln sehen, nicht zu vergleichen mit der Herrlichkeit, die wir auf lange Sicht ernten werden, wenn alles klar sein wird und alle Rechnungen beglichen sein werden (Röm 8:18). In 1 Korinther 1–2 – ich nehme jetzt die beiden Kapitel zusam men – geht es um die Konfrontation von zwei gegensätzlichen Berei chen. Im ersten Kapitel stellt Paulus das Reich der Welt (aion, kosmos), der wohlhabenden Elite, der Mächtigen, der Besten und Klügsten, der Schönen, dem Reich Gottes gegenüber, denen, die nach den Maßstäben der Welt nichts sind. Doch im zweiten Kapitel wird diese Schichtung apokalyptisch zum Vorteil der Heiligen und katastrophal zum Nachteil der Welt umgedreht. Es stellt sich heraus, dass die Mächte dieser Welt von der Macht des Satans und die Weisheit dieser Welt von den Mächten der Finsternis gestützt werden, und sie sind dem Untergang geweiht. Verderben ist Verderben, und es spielt keine Rolle, ob man durch die Hand einer Armee aus Fleisch und Blut und Stahl oder durch Legionen von Engeln des Krieges zugrunde geht; es ist immer Verderben, wie die Welt es kennt. Apokalyptische Escha tologie ist göttliche Gewalt, so blutig und tödlich wie jede weltliche Macht, und in der Tat – entsprechend ihrer göttlichen Herkunft – sogar noch tödlicher. Die Welt wird durch die wahre Weisheit und
295
John D. Caputo
die wahre Macht Gottes umgestürzt werden. Ich bin in Schwachheit, in Furcht und Zittern zu euch gekommen, sagt er zu den Korinthern, aber diese weltliche Schwachheit ruht auf »der Macht Gottes« (1 Kor 2:5). Richtig, aber mit »Macht Gottes« meint Paulus den realen weltlichen Triumph, den entitativ-ontologischen Sieg, der durch eine apokalyptische Umkehrung erreicht wird. Mit dieser Umkehrung wird das radikal revolutionäre Potenzial der Rhetorik der Schwäche im ersten Kapitel durch die göttliche Gewalt, die apokalyptische Eschatologie des zweiten Kapitels, in der die Rhetorik von Schwäche versus Stärke offengelegt wird, kompromittiert. Mit »Macht Gottes« meint Paulus nicht die Macht der Vergebung, die Macht des Kusses, sondern die apokalyptische Macht und den mythischen Kampf mit Satan und seinen Schergen. Das radikal revolutionäre Potenzial des ersten Kapitels wird durch das zweite Kapitel, in dem Paulus seine Karten auf den Tisch legt, kompromittiert. Für die Erfahrenen, Reifen, Vervollkommneten auf den dauernden Pfaden Gottes (teleiois, 1 Kor 2:6), für die, die das vor der Welt verborgene Geheimnis kennen, ist Gott derjenige, der wahre Weisheit und wirkliche Macht hat. Wie Dale Martin sagt: »Letztlich ist das, was Paulus der menschlichen Macht entgegensetzen will, nicht Schwäche, sondern göttliche Macht (2:5) – eine Macht, die dem anderen Reich angehört.«17 Diejenigen, die das pneuma haben, die das Geheimnis kennen, wissen, dass Gott kommen und seine Herrschaft auf Erden aufrichten wird, dass der Böse gestürzt wird, während ihnen Gaben zuteilwerden, die kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Die mythische Szene wird spektakulär sein, mit der ganzen Magie eines Hollywood-Films. Jesus wird auf einer Wolke auf die Erde herunterkommen, die Dämonen werden zerstreut werden, die Toten werden aus den geöffneten Gräbern auferstehen, und die Mächte dieser Welt werden untergehen! Es wird eine endgültige Abrechnung geben, wenn Gott alles in allem sein wird, wenn es klar sein wird, wie unklug es war, die Torheit des Kreuzes abzulehnen. Die Weisen werden es noch bereuen. Hätten sie es gewusst, »hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nie gekreuzigt« (2:8). Paulus ruft die Mächtigen im Namen derer, die sie zermalmt haben, heraus – aber dann will er sich rächen. Der Spieß wird umgedreht, und die einfachen Christen werden die Herrlichkeit haben (2:7). Während das erste Kapitel eine Theologie des Kreuzes ist, umfasst das zweite eine Theologie der 17
D. B. Martin, Corinthian Body, S. 62.
296
Eine radikale Theologie des Kreuzes
kommenden Herrlichkeit. Selbst der gekreuzigte Leib Jesu ist jetzt die Ikone der Herrlichkeit, nicht der Schwäche. Diejenigen, die nicht im pneuma sind, werden gerichtet werden; sie werden ihre gerechte Strafe bekommen. Sie werden den Tag bereuen, an dem sie die (scheinbare) Schwäche, die Paulus preist, verspottet haben. Die Heiligen werden letztendlich die Oberhand haben – wenn sie geduldig sind; es wird nicht lange dauern. Der Film endet, der Abspann rollt über die Leinwand, die Musik ist triumphal. Gott hat seine Feinde besiegt. Gottes Schwäche ist nur scheinbar, seine wirkliche Macht zermalmt ihre Stärke. Die Gläubigen verlassen das Kino in der Gewissheit, dass die wahre Macht und Weisheit auf ihrer Seite sind. In der Sprache der Dekonstruktion sucht Paulus die »Umkehrung«, um den Spieß gegen die Mächtigen umzudrehen. Er lässt den Ort der wirklichen Macht – die Macht über Leben und Tod – bestehen, während er dafür sorgt, dass dieser Ort von Gott und nicht von Satan besetzt ist. Paulus geht nicht zu einer »Dislokation« über, zu einer radikalen Störung der Hierarchie, einer radikalen Hier-Anarchie, in der Stärke und Macht und Herrlichkeit in Begriffen neu umschrieben werden, die die Welt nicht verstehen wird. Die Welt wird die Herrlichkeit der kommenden Feuersbrunst nur zu gut verstehen. Die Welt wird den Tag bereuen, an dem sie Paulus nicht geglaubt hat.
6. Überwindung der Metaphysik, Entmythologisierung des Neuen Testaments Paulus, behaupte ich, vermeidet nicht, eine schlechte Sache (Gewalt) gut zu nennen. Er bleibt nicht bis zum bitteren Ende bei der Macht der Ohnmacht. Stattdessen macht er einen klügeren oder strategischen Gebrauch von Macht, bei dem die Schwäche schließlich, auf lange Sicht, die Oberhand gewinnt. Das ist genau die Geste, die von einer radikalen Theologie des Kreuzes entlarvt wird, genau der Kompro miss, der abgelehnt wird, genau die Quelle des Problems mit der Theologie, genau der Grund, warum die Theologie so weit verbreite tes Misstrauen, Verachtung und sogar odium hervorruft. Ich schlage vor, dass wir an ihrer Stelle eine kompromisslose Theologie des Kreuzes angehen, in der die Macht wirklich am Kreuz der Ohnmacht gekreuzigt wird. Daraus ergibt sich eine zweifache Forderung: Erstens, den Schwachen, Unglücklichen, Törichten und Machtlosen die Treue zu halten und diese Solidarität nicht als Teil einer langfristigen
297
John D. Caputo
Strategie zu behandeln, in eine Ökonomie einzubringen oder in einen mythischen Krieg mit den Mächten der Finsternis einzuschreiben. Zweitens ist eine radikalere Unterwerfung Gottes unter die Kreuzi gung der Schwäche und Ohnmacht erforderlich, eine, die über die Schwäche der Heiligen in Korinth hinaus zur Schwäche des Gottes in der Höhe übergeht, um kompromisslos, salva fide, das zu verfolgen, was Paulus evokativ die »Schwäche Gottes« nennt, um zu einem sterblichen und verletzlichen Gott zu gelangen. Erstens erfordert eine radikale Theologie des Kreuzes eine syste matische Schwächung der von oben nach unten verlaufenden Autori tätsordnung, die Paulus in Römer 13:1–3 beschreibt, eine, die mehr dem Egalitarismus von Galater 3:28 entspricht, wo Paulus die binären Differenzen zwischen Mann und Frau, Mann und Sklave, Nichtjude und Jude abschwächt. Wenn Jesus und das Reich Gottes, das im Mit telpunkt seiner Verkündigung steht, die Ikone konstituieren, durch die jede Gemeinschaft etabliert wird, dann sollte sie eine systemische Abschwächung der autoritären Strukturen widerspiegeln, die Paulus mit der Macht Gottes im Römerbrief wie auch durch die apokalypti sche Umkehrung in 1 Korinther 2 zu verstärken sucht. Wir sehen diese Alternative, sagen wir, diese andere Seite des Paulus, in den gegenwärtigen progressiven sozialen Bewegungen, die gekennzeich net sind durch die Schwächung des alten aristokratischen Privilegs der Wenigen (der Mächtigen, des Gesetzes) über die Vielen und die weite Verbreitung, Ausbreitung und Umverteilung der Vorstellung von Rechten unter ta me onta, unter denjenigen, die bisher Nichts und Niemand waren. Es geht um eine dezentrierende, de-kolonialisie rende, demokratisierende Bewegung in der ethischen, sozialen und politischen Ordnung, die die Vorherrschaft der Männer schwächt und die Würde der Frauen stärkt; die das Privileg des »Westens« schwächt und die »Dritte Welt« aufbaut; die sich über die »Menschen«-Rechte Gedanken macht, wenn sie auf Kosten von Tieren gehen, die für Nahrung, Vergnügen oder Schmuck zu Tode gequält werden; die unsere Herrschaft über die Erde schwächt und die »Rechte« der Erde respektiert, die mehr ist als Material für unsere Herrschaft. Es geht um eine Sicht des menschlichen Lebens, die die ousia, die Ordnung von Besitz, Macht, Eigentum und Prestige, entwertet und stattdessen eine Einfachheit und Armut des Lebens privilegiert, die im Widerspruch zur Herrschaft des globalen Kapitalismus und seiner Politik steht. Natürlich geht es bei solchen egalitären Bewegungen darum, die Entmachteten mächtiger zu machen. Ich fordere ein neues Verständ
298
Eine radikale Theologie des Kreuzes
nis von Macht und behaupte nicht, dass Macht ein böses Wort ist, das aus unseren Wörterbüchern gestrichen werden sollte. Es geht darum, die Macht so umzuverteilen, dass die Besitzlosen befähigt werden, ein Leben in Würde und Selbstachtung zu führen, befähigt, sich und den Ihren ein sinnvolles Leben zu ermöglichen, aber nicht so, dass sie einfach die Plätze tauschen und zu den neuen Machthabern werden, deren Rolle es ist, andere zu unterdrücken. Die kompromisslose Wirkung der Ikone der Schwachheit in 1 Korinther 1 besteht darin, immer und systematisch auf der Seite von ta me onta zu stehen, auf der Seite all dessen, was verletzlich, schwach und marginalisiert ist, auf der Grundlage des fundierten soziologischen Prinzips, dass die nuisances and nobodies immer unter uns sein werden. Der ikonische Leib Jesu ist immer die ironische »Herrschaft« der »Geringsten unter euch« (Mt 25:44). Er bedeutet genau das Gegenteil von Römer 13:1–3 und ist völlig frei von der apokalyptischen Umkehrung der Mächte in 1 Korinther 2. Zweitens reicht der ikonische Leib Jesu und seines Reiches über die Identifikation und Solidarität Gottes mit den Schwachen und Kranken hinaus in die innere Zitadelle der Theologie, in die Idee Gottes selbst; sie erfordert über die Kreuzigung der Theologie der Macht hinaus die Kreuzigung des Gottes der Macht. Die Theologie des Kreuzes ist nicht die Theologie eines bestimmten Gegenstandes von theologischem Interesse, des Kreuzes, sondern der Stil aller Theo logie, des Theologisierens selbst.18 Wir fordern von den Theologen, ein asketischeres Leben zu führen, das Kreuz auf sich zu nehmen und zuzulassen, dass sowohl der Mythos als auch die Metaphysik der Macht Gottes gekreuzigt werden. Über eine Armut des Geistes seitens der Theologen hinaus impliziert dies eine Armut Gottes, in der die Allmacht entmythologisiert und dekonstruiert wird. Die Schwäche Gottes impliziert nicht nur die Solidarität Gottes mit ta me onta; sie bedeutet, dass Gott zu ihnen gezählt wird (Emmanuel), nicht nur in dem, was die Hohe Christologie die »menschliche Natur« Jesu nennt, sondern radikaler in der göttlichen Natur, anstatt die göttliche Natur Das Kreuz ist das Symbol des Symbols, dass jedes Symbol gekreuzigt werden muss. Daher sagt Tillich, dass das Kreuz das Symbol ist, das sich selbst auslöscht, damit die Religion, in der es verkündet wird, sich nicht verabsolutiert (vgl. P. Tillich, The Inter pretation of History, S. 234–35). Er führt weiters aus, es sei das höchste Symbol und das Kriterium für jedes Symbol, angesichts dessen derjenige, »(who) embodies the fullness of the divine presence sacrifices himself in order not to become an idol, another god beside God.« (P. Tillich, Theology of Culture, S. 67). 18
299
John D. Caputo
gegen Schwäche und Leiden zu immunisieren. Soviel wird von der theologia crucis von Luther bis Moltmann und Barth adressiert.19 Aber die Logik der Ikone ruft uns – provoziert uns – weiter, über einen leidenden Gott hinaus, über einen Gott hinaus, der stark genug ist um zu leiden, zu einem wirklich schwachen Gott, zu einem Gott, der als schwache Kraft, nicht als starke, neu gedacht wird. Dazu gehört ein Golgatha, auf dem Gott nicht nur der metaphysischen Allmacht beraubt wird, sondern auch einer apokalyptischen Macht, die seine Feinde zu seinen Fußschemeln macht. Gott muss immer auf der Seite der schwachen Kräfte wie der Vergebung gefunden werden, nicht auf der Seite einer starken Kraft wie der des Triumphs über seine Feinde – sei es politisch, metaphysisch oder apokalyptisch. Solidarität – Gott steht auf der Seite von ta me onta – ist in der eigentlichen Realität Gottes verwurzelt – Gott gehört zur Ordnung von ta me onta. Die Schwäche Gottes geht den ganzen Weg nach unten; der soziologische Sinn von ta me onta dringt in den ontologischen Sinn ein. Die Macht Gottes ist ein gefährlicher powertrip, sowohl eine metaphysische Illusion als auch eine biblische Fantasie, verliebt in die Herrlichkeit, wie die Welt sie kennt, deren Konstruktion von Kant perfekt identifiziert wurde: Sie lässt einen Begriff ungehindert und frei von empirischen Zwängen auf die Vollendung zustreben. Das führt zu divine command-Theorien der Ethik, zur gefährlichen und zerstörerischen Absolutierung von Institutionen wie der Römischen Kirche (Unfehlbarkeit) oder von Büchern wie der Heiligen Schrift (Inerrantismus), zum Grübeln darüber, ob Gott die Macht hat, Kreise zu quadrieren oder die Vergangenheit zu ändern, und zu all den Verwirrungen der »Theodizee«, die herauszufinden versucht, warum Gott nicht Tsunamis aufhält, bevor sie geschehen, Krebs verhindert, Ch. Chalamet (»God’s Weakness and Power«) bietet eine scharfe und ökonomische Skizze der Geschichte der theologia crucis von Luther und Calvin bis Moltmann, Jüngel, und Barth, derzufolge Calvins Gott »erscheint« um im Leiden Jesu zu leiden, während Barth das Leiden Jesu in das Sein Gottes selbst einschreiben möchte – ein Projekt, das meinem viel näher steht. Aber ich habe nichts zu tun mit Barths unabläs siger Aufwertung der absoluten Transzendenz Gottes. Metaphysik muss überwunden werden, aber die Bibel muss entmythologisiert werden. Die Herausforderungen, vor die man dadurch gestellt wird, bestehen, wie Chalamet richtig bemerkt, nicht darin, Schwäche in ein Absolutes zu verwandeln, nicht darin, Gott in einer Schwäche gefangen zu halten, gänzlich und binär entgegengesetzt zur Macht, sondern exakt darin, die Macht der Schwäche zu verstehen, die schwache Kraft oder Macht der Machtlosigkeit, ohne die Schwäche in ein Spiel zu verwickeln, in dem die Schwäche triumphiert und sich in all ihrer Herrlichkeit als die wahre Macht zeigt. 19
300
Eine radikale Theologie des Kreuzes
bevor er entsteht, oder dafür sorgt, dass grausame Tyrannen gar nicht erst geboren werden. Sie beteiligt sich an obszönen Visionen von Gott, der seine Feinde grausam in Stücke schlägt. Das Schlimmste von allem ist, dass sie in der Obszönität aller Obszönitäten kulminiert, der pathologischen Fantasie des ewigen Leidens der Verdammten, ange sichts derer ein unversöhnlicher Gott, wie ein geistesgestörter und empörter Tyrann, seine Arme verschränkt und sich für immer gegen diejenigen richtet, die sich gegen seine Herrlichkeit vergangen haben, sich ewig weigert, einzulenken, ein ausnehmend vollkommener Widerspruch zum Gleichnis vom verlorenen Sohn und zu Jesu Pre digen über Vergebung. Christen empfinden eine perverse Befriedi gung, wenn sie über die Grausamkeit einer Römischen Kreuzigung – das Evangelium nach Mel Gibson – nachdenken, über den langsamen, qualvollen Tod und die schreckliche Demütigung. Aber die Römischen Folterknechte sind nichts gegen die Christen. Sie träumen von einer noch unvorstellbareren Qual, einer Omnifolter, einem unendlich schlimmeren Schmerz, weit quälender als das Kreuz selbst, und dem Grausamsten von allem – die Kunst der Folter liegt in der Verlänge rung des Schmerzes – der Unmöglichkeit des Todes. Die christliche Fantasie besteht darin, Leiden ad infinitum, für immer und ewig, zuzufügen; im Vergleich dazu ist die Römische Grausamkeit nur eine Lappalie, die gnädigerweise nach wenigen Stunden endet. Und das alles, wie Nietzsche sagt, im Namen der Liebe! Nietzsche nannte dies den »Geniestreich des Christentums«. »Sollte man’s glauben?«, fragt er.20 Daher Nietzsches Diagnose der religiösen Pathologie als ein Tier, das darauf aus ist, sich selbst krank zu machen, wobei die Religion nicht das ist, was uns antreibt, sondern das, was uns krank macht.
7. Der Ruf (call): Wie Gott Gott ist in der radikalen Theologie In einer radikalen Theologie des Kreuzes sind die Theologen gefor dert, ein asketisches Leben zu führen und ihr Kreuz auf sich zu nehmen, indem sie den Gott der Macht aufgeben, nicht nur für die Fastenzeit, sondern für immer, den Herrn der Heerscharen und dem König der Könige als Opfer darzubringen, ihrer langen und 20 F. Nietzsche, Genealogie der Moral, Zweite Abhandlung, Abschnitt 21–23, insb. S. 331. Diese Texte werden erläutert in Derrida, »Den Tod geben«, S. 437 ff.
301
John D. Caputo
unerlaubten Liebesaffäre mit der Macht und ihrem Ruhm zu entsagen. Aber wenn die Macht Gottes eine machtlose Macht ist, wenn sowohl die metaphysische als auch die mythische Macht gekreuzigt wurden, wenn die »Herrschaft«, die das Reich Gottes bedeutet, immer ironisch ist, ist das Ergebnis dann nicht, so werden die Theologen einwenden, eine Art Nihilismus der Schwäche, des Todes und der Niederlage, eine Art theologischer Masochismus, eine Geschichte, die am Karfreitag endet? Was bleibt übrig? Wie ist Gott noch Gott? Wie kann Gott, und nicht nur der Theologe, des Namens würdig sein (digne dicitur)? Was werden die Theologen den Gläubigen noch zu bieten haben, oder, wie Kierkegaard es formuliert haben könnte, wie werden sie ihren Lebens unterhalt verdienen können? Schließlich hängt ihr Lebensunterhalt von der Macht der Religion ab, vom »Triumph der Religion«: Die Priester besänftigen die Herzen (apaiser les coeurs), wie Lacan einmal sagte, und sie sind »absolut fabelhaft« darin!21 Das bringt uns wieder zurück zu der Frage der Methode, mit der wir begonnen haben. Für Heidegger bedeutet die Überwindung der Metaphysik, ihre Zerstörung, eine Wiedergewinnung der Meta physik, die einen »Ruf«22 oder »Anspruch«23 des Seins denkt, den die Metaphysik enthält, aber selbst nicht denken kann. Für Bultmann ist eine Entmythologisierung eine Umdeutung dessen, was zunächst in mythischen Begriffen verkündet wurde (kerygma) und nun so verkündet wird, dass sein Anspruch heute gehört werden kann. Für Derrida ist eine Dekonstruktion eine Destabilisierung der gegenwär tigen Ordnung, der Ordnung der Gegenwart, um offen zu bleiben für die Verheißung, für das Kommen des unvorhersehbaren Ereignisses, das uns anruft wie ein Fremder, der in der Nacht an unsere Tür klopft und unsere Antwort erwartet. In jedem Fall – dem Anspruch, der Verkündigung, der Verheißung – haben wir es mit einem »Ruf« zu tun, der immer ruft und immer wieder abgerufen wird, ein immer alter und immer neuer Ruf, auf den zu antworten wir aufgerufen sind. Dieser Ruf – und hier kommen wir zum Kern [crux] dieser theologia crucis – ist das, was mit »Gott« gemeint ist. Eine radikale Theologie des Kreuzes hat mit der Hermeneutik des Rufs zu tun, die im und durch den Namen (von) »Gott« beherbergt ist. Der Name (von) »Gott« ist der Name des Ereignisses, das selbst gerufen wird, im Medium 21 22 23
J. Lacan, Triumph der Religion, S. 70. Anm. d. Übers.: Im Original deutsch in Klammern. Anm. d. Übers.: Im Original englisch in Klammern.
302
Eine radikale Theologie des Kreuzes
[middle voice], in dem, was wir (als Antwort auf dieses Ereignis) »Gott« nennen, ein Ereignis, das verheißen wird, immer weich und schwach, immer eindringlich und unaufhörlich. Wie Nietzsche, der von einer neuen Spezies von Philosophen träumte, träume ich also von einer neuen Spezies von radikalen Theologen des Kreuzes, Theologen, die diesen Namen verdienen, kommenden Theologen, Theologen der Schwäche und der Beharrlich keit Gottes, Theologen jenes Lebens, das aus der Kreuzigung des Gottes des Seins, der Allmacht und der Allwissenheit am Kreuz des Nichtseins, der Schwäche und der Torheit erwächst. In der radikalen Theologie geht es bei Gottes Zuerst-Sein nicht um eine prima causa in der Seinsordnung, sondern um etwas »Unbedingtes« in der Ordnung eines Rufes oder einer Aufforderung. Gott ist kein höchstes Wesen, sondern eine suggestive Stimme; kein Kraftwerk der Macht, sondern eine unaufhörliche Aufforderung; kein mächtiger Eroberer, sondern ein schemenhafter [spectral] Geist; keine Vorführung »überwältigen der Kraft«, der Traum eines jeden Pentagon-Beamten, sondern eine Einladung. Gott ist in der Tat der Name von etwas, das an erster und letzter Stelle steht, nicht in der ontologischen Ordnung, sondern in der »hauntologischen« Ordnung. Gott ist ein Geist, ein heiliges und eindringliches Schema [specter]. Gott ist keine lokalisierbare oder identifizierbare Entität, weder ein materielles Wesen oben im Himmel noch ein immaterielles außerhalb von Raum und Zeit. Gott befindet sich weder auf einem Planeten, den wir erst entdecken müssen, noch in einer Art immaterieller Sphäre, die nur mit den in den Fabriken der Metaphysik hergestellten Vehikeln erreicht werden kann. Gott kommt nicht am Tag der Apokalypse, um unsere Feinde zu zerstreuen und die Gräber zu öffnen. Gott ist die schwache Kraft eines Geistes, eine schemenhafte Heimsuchung, eine schwer zu erkennende Auffor derung. Gott gehört nicht zur Ordnung des Seins, der Gegenwart, des Wesens, der Substanz, der Entität oder der Eigentlichkeit. Gott exis tiert nicht; Gott ruft. Gott subsistiert nicht; Gott insistiert. Gott ist nicht ein absolutes Sein, sondern ein unbedingter Ruf. Aber Gott ist kein Wesen, das den Ruf ausführt. Wer oder was genau ruft dann? Eine ähnliche Frage beschäftigte Paulus, und sie bot den Anlass für seinen Brief an die Gemeinde in Korinth (1 Kor 10–17). Ein paralleles Problem gibt es in der radikalen Theologie, wo es der Ruf ist, der
303
John D. Caputo
ruft. Dieser Heideggerianismus, wie die Sprache spricht,24 klingt wie eine leere Tautologie, ist aber in Wirklichkeit eine heilsame Warnung vor Hypostasierung, Ontologisierung, Mythologisierung. So wie »es regnet« nicht bedeutet, dass es ein »es« gibt, das »regnet«, meint Heidegger, dass es in der Struktur des authentischen Rufs keinen entitativen Rufer gibt, der den Ruf ausführt; vielmehr wird der Ruf selbst gerufen, wird sich selbst unterstellt, inmitten einer Kakophonie von Stimmen, wo die Identität des Rufers jenseits der Bestimmung liegt und sich selbst authentifizieren muss.25 Im authentischen Ruf muss die Autorität des Rufers gekreuzigt und der Ruf ungeschützt, verletzlich und unsouverän hängen gelassen werden. Die einzige Authentizität, auf die sich der Ruf berufen kann, ist die Authentizität der Antwort, durch die der Ruf weltliche Realität, Substanz, Kraft, Stärke, Prestige, Autorität anhäuft. Der Ruf ruft im oder unter dem Namen Gottes – aber auch unter anderen Namen, weshalb sich nicht jeder, der im Geiste ist, zum Christentum oder zu dem, was man im christlichen Latein »Religion« nennt, bekennt. Der Name des Rufers des Rufs und das, was schließlich gerufen wird, wird gekreuzigt, abgestreift, für immer vor der Welt verborgen. Denn die Welt existiert, aber der Ruf insistiert; die Welt ist sichtbar, aber der Ruf ist unsichtbar; die Welt ist offenkundig, aber der Ruf ist geheim. Diese Unfähigkeit, den Rufer des Rufs zu identifizieren, gehört konstitutiv zum authentischen Ruf; es handelt sich nicht um ein vorübergehend dunkles Glas, das später klar werden wird. Ich beeile mich hinzuzufügen, dass ich mit dem Versuch, dem Ruf einen identifizierbaren Rufer zu nehmen, nicht versuche, ihn für ungültig zu erklären, sondern die Verantwortung zu maximieren. Ich identifiziere seine Authentizität, indem ich alles an weltlichem Ruhm und Autori tät kreuzige, was sich an ihn heften kann. Indem ich den Ruf auf sich selbst zurückwerfe, ist er gezwungen, sich selbst zu authentifizieren. Das Einzige, was den Ruf authentisch machen kann, ist der Ruf selbst; das Einzige, was wir über die Authentizität des Rufs wissen, ist die Authentizität der Antwort. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Authentizität der Antwort auf den Ruf wird durch die Kreuzigung des Nichtwissens, der sie unterworfen ist, nicht geschmälert; sie wird durch diese Kreuzigung konstituiert. Es ist ihre Kreuzigung, die ihr ein schemenhaftes Leben verleiht. 24 25
Anm d. Übers.: Im Original deutsch. M. Heidegger, Sein und Zeit, §§ 56–57, S. 272–280.
304
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Von dem Moment an, in dem der Ruf in Herrlichkeit kommt, beginnt der Ruf annulliert zu werden. Von dem Moment an, in dem wir den Rufer des Rufs identifizieren, von dem Moment an, in dem der Ruf auf der identifizierbaren Autorität eines autoritativ-entitativen Rufers beruht – so dass wir sagen können: das ist Gott, das ist die Natur, das ist das Gesetz, das ist der Gesalbte des Herrn –, beginnt die Authentizität des Rufs annulliert und zu einer Sache des Befolgens der Befehle zu werden – der Befehle einer sicheren, mächtigen, angesehenen, identifizierbaren oder sogar verängstigenden Stimme (wie der Gott, der Hiob tyrannisiert). Wahre Verantwortung, d. h. die Verantwortung, die wir für den Ruf annehmen, verwandelt sich in eine befohlene Antwort. Gott ist kein Agent, der Dinge tut wie Rufen. Von dem Moment an, wo wir Gott Handlungsfähigkeit zuschreiben, sind wir wieder bei Mythologie, Metaphysik und Theodizee. Der Name Gottes ist stattdessen der Name von etwas Anonymen, das in und unter diesem Namen selbst benannt und gerufen wird, etwas, in dessen Namen Agenten mobilisiert werden. »Mobilisiert« ist ein starkes Wort, eine kriegerische Metapher – aber die Kraft, die so mobilisiert wird, wird nicht Gott zugeschrieben, sondern uns; sie ist ein menschliches Attribut, kein göttliches. Gott ist die Insistenz, für die wir Existenz liefern sollen, wobei wir diejenigen sind, die zur Ordnung der Existenz, des Seins, der Gegenwart und der Aktualität gehören.26 Gott ist eine inexistente Aufforderung, auf die wir die existentielle Antwort sein sollen. Gott insistiert; wir existieren. Wir sind verantwortlich für die Existenz Got tes, womit ich die Aktualisierung und Materialisierung, die materielle Instanziierung Gottes in der Welt meine27; wir sind aufgerufen, das auszufüllen, was im Leib Gottes fehlt, um noch einmal den Autor des Briefes an die Kolosser zu zitieren. Wir können nicht von Gott getrennt werden, und Gott kann nicht von uns getrennt werden, doch kann andererseits die Differenz zwischen Gott und uns auch nicht aufgehoben werden; es ist eine Distanz, die niemals überwunden wird, zwischen einer unbedingten Bitte auf der einen Seite und den bedingten Antworten von uns auf der anderen Seite. Gott ist die Frage, auf die wir die Antwort sein sollten; Gott ist das Problem, für das wir die Lösung sein sollten. Aber wir geben immer endliche Antworten 26 Für ausführlichere Erläuterungen zu diesem Punkt siehe mein The Insistence of God. 27 Anm. d. Hg.: Hierfür setzt J. D. Caputo in Cross and Cosmos. A Theology of Difficult Glory den Ausdruck »existance« Gottes (vgl. ebd. Kap. 8).
305
John D. Caputo
auf eine unendliche Frage, setzen endliche Reaktionen auf eine unend liche Forderung. Mit unbedingt meine ich also nicht ein Ideal, das der Vollendung zustrebt – eine grundlegende Operation, die sowohl der Metaphysik als auch der Mythologisierung gemeinsam ist. Das Unbedingte ist kein Ideal, sondern ein Anspruch, eine Aufforderung und eine »Hoffnung wider die Hoffnung« (Röm 4:18) in einer Zukunft mit offenem Ausgang. Die unbedingte Insistenz eines Rufes bedeutet, dass er unaus löschlich, aber auch schwach ist. In 1 Korinther 1 ist der Ruf deutlich hörbar als die unbedingte Aufforderung oder der Appell, der vom Leib des gekreuzigten Jesus ausgeht, der über ihm schwebt und ihn bewohnt. Der Geist des Gottes von Jesus erhebt sich vom Kreuz wie ein schemenhaftes Wesen, das uns heimsucht und fordert. Der Ruf ergeht in und unter dem Leib des gekreuzigten Jesus und drückt sich in der paradoxen, paralogischen und törichten Logik des Kreuzes aus, die ein Skandal für die Ordnung von Macht und Sein ist. Die Aus sonderung der Schwäche ist unbedingt: nicht Schwäche als Teil einer langfristigen Strategie, die das Abwarten des richtigen Zeitpunkts erfordert, sondern das bedingungslose Annehmen der Ordnung des ta me onta. Aber ein Ruf ist selbst eine schwache Kraft, nicht eine starke. Rufe können ignoriert, missverstanden, nicht beantwortet, manipuliert, abgelehnt und missachtet werden. In solchen Fällen hat der Ruf als solcher, der Ruf als Ruf, keine Armee, die er einberufen kann; er hat keine physische oder metaphysische Kraft, mit der er erzwingen kann, wonach er ruft. Das Gesetz hat die Polizei, um es durchzusetzen, und weltliche Könige haben Armeen, aber die Kraft des Rufs ist schwach und nackt und ohne Rückhalt, sich selbst überlassen, um für sich selbst zu sprechen. Der Ruf wird nicht von einem Über-Wesen [Über-Being] durchgesetzt, das dafür sorgen wird, dass wir den Tag bereuen, an dem wir seinen (sic!) Willen ignoriert haben. Er wird am Kreuz hängen gelassen, verlassen von seinem Gott. Eli, Eli. Wir wiederum sind die Berufenen, die ek-klesia, die Empfänger des Rufs, die Angesprochenen und die, auf die Anspruch erhoben wird, (1 Kor 1:24), angesprochen, um dem Ruf zu folgen, und als solche aufgerufen, stark zu sein. Wir sind aufgerufen, die Antwort28 auf Gottes Wort zu sein, stark zu machen, was in Gott noch schwach ist, dem Insistieren Gottes Existenz zu geben. Wir sind die, auf die 28
Anm. d. Übers.: »Antwort« und »Wort« im Original deutsch.
306
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Gott gewartet hat. Um die klassische Sprache der Metaphysik in einem streng phänomenologischen Sinn zu nutzen, würde ich sagen, dass die Essenz Gottes in seiner Insistenz liegt, während Gottes Existenz unsere Verantwortung ist.29 Gott gehört zur Ordnung der unbedingten Insistenz, nicht der unendlichen Existenz; zu einer Ordnung, die nicht existentiell, sondern vokativisch, evokativ, provokativ ist, während wir andererseits zur Ordnung der Existenz, der Berufung, der Verant wortung, der Gerufenen gehören – wie ein Apostel.
8. Weder Paulus noch Apollos noch Kephas (1 Kor 1:12): Die Entmythologisierung des Rufs Der unmittelbare Anlass des 1. Korintherbriefes ist das Bemühen des Paulus, die Streitigkeiten zu schlichten, die unter den verschiedenen Gruppen der Heiligen ausgebrochen sind, von denen einige dem Paulus, andere dem Apollos oder Kephas treu ergeben sind. Wie ich oben erwähnt habe, sehe ich in dieser Frage der korinthischen Querelen ein paralleles Problem, das für eine radikale Theologie des Kreuzes von besonderer Bedeutung ist und dessen Relevanz ich nun mit Rückgriff auf Bultmann ausbuchstabieren möchte. Es wäre ein Fehler zu denken, dass ich auf einem Umweg über die Dekonstruktion einfach zu Bultmann zurückgekehrt bin. Im Unter schied zu Heidegger versuche ich nicht, zu den frühen Griechen zurückzugehen, und im Unterschied zu Luther und Bultmann gehe ich nicht zurück zur Bibel. Sowohl die »Überwindung der Metaphysik« als auch die »Entmythologisierung der Bibel« sind meiner Meinung nach zu eng und zu monologisch, wenn es um den logos des Kreuzes geht. Ich versuche, vorsichtig und mit Furcht und Zittern zum Ereig nis, zum Ruf, zurückzukehren – mit allem an Hilfe, was ich von der Überwindung der Metaphysik, der Entmythologisierung der Bibel, der Dekonstruktion der Gegenwart bekommen kann, und mit Hilfe Was ich meine, findet man in Meister Eckharts Interpretation der Geschichte von Maria und Martha, in der Maria die Insistenz Gottes genießt, Martha hingegen versteht, dass es unsere Verantwortung ist zu sehen, dass Gott existiert; man findet es auch in Walter Benjamins Vorstellung des Messias, der zufolge wir im messianischen Zeitalter sind, diejenigen, die gerufen sind, die Ungerechtigkeit zu beheben, die den Toten zugefügt worden ist. Der Name Gottes ist eine Insistenz, die sich ohne Antwort auflösen würde und vergessen würde in einer Nacht von Nicht-Beachtung und Nicht-Existenz. 29
307
John D. Caputo
von allem, was mir sonst angeboten wird, aus welcher Quelle auch immer. Aber der Ruf, der mir vorschwebt, ist des weltlichen Schmucks entkleidet, seiner historischen Autorität und seines Prestiges beraubt, mit den Dornen der Unidentifizierbarkeit gekrönt, gedemütigt und gezwungen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich schließe mich also voll und ganz Bultmanns Idee an, den »Ruf« von seinem mythologischen Kontext im Neuen Testament zu befreien und ihn so zu rekontextua lisieren, dass der Ruf vom »modernen Mann« – wie er Mitte des 20. Jahrhunderts sagte – gehört werden kann, ein Ausdruck, den ich in seinem Namen als »postmoderne Männer und Frauen«, in all ihrer Komplexität und Vielfalt, aktualisieren möchte (wie er es heute sicher auch getan hätte). Meine Abweichung von Bultmann – und Paulus – liegt in der Bedeutung des »Rufs« und des »Ereignisses«, die Bultmann, wie Paulus, auf das Kerygma reduziert hat – d.h. auf die historische Verkündigung Jesu durch Paulus und die frühe Kirche als den Einen, den Einen, als das rettende Licht für die Völker, die Offenbarung Gottes an die Menschheit. Ich stimme natürlich zu, dass wir das mit Christentum meinen, ein Projekt, an dem ich mich beteilige, indem ich das Motiv der ikonischen Schwäche Jesu verfolge. Aber wenn das die Art und Weise ist, das Christentum zu identifizieren, dann ist es nicht das Kennzeichen des Rufs oder des Ereignisses als solchem, das nicht identifizierbar, wüstenhaft und karg ist. Das identifizierende Merkmal des Rufs als solchem ist, wie wir oben gese hen haben, dass er gerade unidentifizierbar, letztlich unbenennbar und anonym ist, dass es gerade unmöglich ist, den Rufer des Rufs herauszurufen, die Herkunft und Zukunft des Rufs zu lokalisieren, was seine Domestizierung und sein Ruin wäre. Der Ruf ist weder der des Paulus noch der des Apollos noch der des Kephas noch der irgendeines identifizierbaren Agenten, einschließlich des neutes tamentlichen Kerygmas. Das bedeutet, dass wir immer und überall von einer Sehnsucht angetrieben werden, die über die Sehnsucht hinausgeht, gerufen von einer Zukunft, die wir nicht vorhersehen können, während wir versuchen, uns an etwas Unvordenkliches zu erinnern. Die eine Sache, die wir also über das »Ereignis« wissen, ist, dass es so etwas wie das Ereignis, den Ruf, nicht gibt; es gibt nicht die Antwort auf einen Ruf, dessen definierendes Merkmal darin besteht, dass er uns nicht in Ruhe lässt. Es gibt keine Sache oder Person, von der man sagen kann, sie sei die Ikone des unsichtbaren Gottes, es gibt nicht das Kerygma oder »Religion«, im Singular, »la« religion. Es gibt
308
Eine radikale Theologie des Kreuzes
immer und überall viele Rufe, viele geschichtliche Offenbarungen, viele Götter und viele Alternativen zu Gott und den Göttern (ganz zu schweigen von vielen Planeten, Sonnensystemen, Galaxien, mehr Dimensionen als drei, und, wie man uns jetzt sagt, vielen Universen, und wer weiß wie vielen Lebensformen). Mein Vorwurf an Bultmann ist also nicht der orthodoxe, dass er die christliche Lehre ausgehöhlt hat – ich denke, dass er durch seine Entmystifizierung einen großen Beitrag zur Wiederbelebung des wahren Skandals des Kreuzes geleistet hat – sondern der radi kalere, dass selbst er es nicht ganz geschafft hat, sich vom Grund des Mythos zu lösen. Das Ereignis ist nicht das, was geschieht, sondern das, was in dem, was geschieht, vor sich geht. Das Ereignis ist nicht zu identifizieren mit Aischylos oder Shakespeare, Athen oder Jerusalem, dem Christus oder Buddha, Demokratie oder der all gemeinen Erklärung der Menschenrechte, Gott oder Vernunft, Kunst oder Politik. Die Welt ist weiter als das. Gottes Vorstellungskraft, so könnten wir sagen, ist nicht durch menschliche Konstruktionen begrenzt. Als faktisch situierte historische Wesen müssen wir immer und notwendigerweise das Ereignis nominieren, aber das Ereignis, immer schwach und bescheiden, lehnt die Nominierung immer ab, bleibt unnennbar, omni-nennbar und letztlich anonym. Das Ereignis ist das, was in diesen Geschehnissen vor sich geht, was dort gerufen und wieder abgerufen wird, was dort versprochen und begehrt wird, mit einem Begehren jenseits des Begehrens. Die eigentliche Struktur der mythischen Operation besteht darin, das Ereignis mit einer Enti tät zu verwechseln, das Insistieren des Ereignisses auf ein konkretes Existierendes zu reduzieren, den Namen oder das Begehren nach diesem oder jenem mit der strukturell ruhelosen Bewegung jenes Begehrens jenseits des Begehrens zu verwechseln, die die Zukunft offenhält und die Vergangenheit ständig wechselnden Bedeutungen unterwirft. Die Parole der Dekonstruktion, ihr erstes, letztes und beständiges Wort, ihr ständiges Gebet, ist »komm«, viens, oui, oui. In unserer historischen Faktizität oder Situiertheit wird das Ereignis nie gefunden, nie erfahren, außer in dieser oder jener Tradition, Zeit oder Ort, Text oder Person, aber der Ruf selbst hat nicht das Nötige dazu, um sein Haupt niederzulegen. Die finale Kreuzigung des Rufs besteht darin, zu bekennen, dass er niemals auf dieses oder jenes reduzierbar ist. Während wir immer einen gegebenen Ruf in einem gegebenen Text oder einer Tradition identifizieren können, ist kein Text oder keine Tradition jemals mit dem Ruf selbst identifizierbar.
309
John D. Caputo
Der Ruf selbst, wenn es so etwas gibt, ist nie selbst-identisch, er sug geriert immer eine Polyphonie, eine Kakophonie von Stimmen, ein Palimpsest von Rufen und Erinnerungen, die zu sehr miteinander verwoben sind, um sie zu entwirren. Das gilt paradigmatisch für unser eigenes Leben, was von Augustinus‘ quaestio mihi magna factus sum so schön eingefangen wird. Man könnte sagen, dass das, was ich radikale Theologie des Kreu zes nenne, mehr ist als Entmythologisierung, radikaler, dass es weiter geht als Bultmann und das Kerygma selbst als einen weiteren Mythos betrachtet, der entmythologisiert werden muss. Das wäre wahr genug. Aber ich würde eher sagen, dass es weniger als Entmythologisierung ist, viel schwächer, nicht annähernd so kühn oder stark genug, um den Ruf zu identifizieren, den Namen des Kerygmas, des Rufs, des Ereignisses auszusprechen. Die Entmythologisierung ist zu stark, zu glorreich für eine theologia crucis.
9. Auf der Straße nach Damaskus Nichts illustriert diesen Punkt über die Not des Rufs besser als Paulus selbst. Alles an Paulus spricht vom Ruf. Er ist ein Apostel, ein Mann, der auf eine Expedition rund um die bekannte Welt abgesandt (apo + stellein) wurde, als Antwort auf einen Ruf, den niemand sonst auf der Welt gehört hat, besonders nicht die Gemeinde in Jerusalem. Sein Leben ist die Auswirkung einer Anrede von traumatischem Ausmaß, einer Aufforderung, die in sein Leben einbrach und es umkrempelte. Aber was ist dieser Ruf – tatsächlich, konkret, wirklich, ontisch, ontologisch? Lukas wiederholt die Geschichte dreimal in der Apostelgeschichte (9:1–9; 22:6; 26:12–18) – eine Stimme und ein blendendes Licht ereilen ihn auf der Straße nach Damaskus –, und Paulus selbst stellt sie den Galatern (1:11–17) als eine Offenbarung des auferstandenen Jesus dar, ohne dass Lichter oder Stimmen oder die Straße nach Damaskus erwähnt werden. Eines der berühmtes ten visuellen Elemente, das Stoßen vom Pferd, verdanken wir den Künstlern, die es für uns visualisiert haben, Tintoretto und anderen Renaissance-Malern. Es ist also unmöglich, eindeutig festzulegen, was tatsächlich geschah, was in der entitativen Ordnung, der jeglicher weltliche oder profane Zeuge fehlte, stattfand oder nicht stattfand. Hätte es eine Videokamera am Ort des Geschehens gegeben, könnten
310
Eine radikale Theologie des Kreuzes
wir uns nicht sicher sein, ob sie einen Mann im stillen Gebet oder einen Mann auf einem Pferd aufgenommen hätte, von einem Licht getroffen, das seine Begleiter nicht sehen, obwohl sie die Stimme hören können. All diese Verwirrung deutet darauf hin, dass etwas an der Ausrichtung dieser Untersuchung nicht stimmt, etwas, das uns dazu einlädt, solche empirisch-entitativen Überlegungen zu unter lassen oder unsere Aufmerksamkeit davon abzuwenden. Was wir wissen, ist, dass ein Ruf gerufen und gehört wurde, dass es vor allem, als Erstes und Letztes, einen Ruf gab, einen unbedingten Ruf, der alles im Leben des Paulus veränderte. Gab es eine physische Stimme, die von einem Aufnahmegerät erfasst worden wäre? Ein sichtbares Wesen am Himmel, das mit der Kamera eingefangen worden wäre? Ein unsichtbares, unhörbares, übernatürliches Wesen, das den Ruf aussprach? Das ist alles Torheit, eine verständnislose Literalisierung eines Ereignisses, die Hypostasierung eines Appells, die Ontologisie rung einer Aufforderung. Der Ruf ist eine Insistenz, deren einzige Existenz in der Welt in der Antwort auf den Ruf zu finden ist, im Leben des Paulus, dessen Spuren am besten in sieben überlieferten kurzen Briefen erhalten geblieben sind. Was wir wissen, ist, dass der Ruf insistiert, während Paulus existiert. Was wir haben, was in der Welt erschienen ist, ist Paulus, nicht der Ruf. Paulus ist sichtbar; der Ruf ist unsichtbar, unhörbar. Die einzige Realität, die der Ruf besitzt, ist Paulus. Die einzige Existenz, die der Ruf genießt, findet sich in der Antwort, die das Leben des Paulus danach ist, und dann das Nachleben des Paulus in der Gemeinschaft, in der Wirkungsgeschichte30 des Paulus, von der viele Leute denken, dass sie ziemlich genau das ist, was wir unter Christentum verstehen. Aber selbst wenn es eine grobe Literalisierung ist, zu fragen, ob Paulus etwas mit seinen physischen Ohren gehört oder mit seinen physischen Augen gesehen hat, ist es dann nicht trotzdem fair zu fragen, wer oder was Paulus gerufen hat? War es nicht Jesus von Nazareth, wie Paulus sagte? Nicht im gewöhnlichen Sinn, da Jesus einige Jahre zuvor gekreuzigt worden war. Könnte es dann ein Ereignis gewesen sein, das tief in seinem Unterbewusstsein vergraben war – etwa die Steinigung des Stephanus oder eine unerwartete Begegnung mit Mitgliedern der Jesus-Bewegung –, das später in Form dieses Rufes wieder auftauchte? Könnte er irgendwann versehentlich einen flüchtigen Blick auf Jesus erhascht haben und für immer unfähig 30
Anm. d. Übers.: Im Original deutsch.
311
John D. Caputo
gewesen sein, diesen Moment zu vergessen, der ihn schließlich wieder einholte? War es Reue? War es ein Traum? Wurde Paulus plötzlich von einer Erinnerung an Jesus, von dem die Anhänger »des Weges« Zeugnis ablegten, heimgesucht, einer Erinnerung, die unerwartet sein Herz berührte und seinen abrupten Sinneswandel herbeiführte? Ging diesem Moment eine lange Überlegung voraus oder war es wirklich eine plötzliche Wendung? War es eine mystische Vision des auferstandenen Jesus, und war das eine Halluzination? Wir können es nicht sagen; wir wissen nur, was Paulus sagt, und der beschreibt eine »Offenbarung«, die ein phänomenologisches Ereignis ist, kein onto logisches, und gibt eine Erklärung dazu, die eine hermeneutische ist. Noch mehr interessiert mich nun allerdings, dass nicht nur wir nicht sagen können, was in der ontologischen oder entitativen Ordnung vor sich ging, sondern dass auch Paulus es nicht sagen kann. Ich meine nicht nur, dass er per definitionem nicht sagen kann, was in seinem Unbewussten vor sich geht, oder dass er durch eine über mächtige mystische Erfahrung sprachlos geworden ist. Im Gegenteil, wir könnten viele Bibliotheken mit den Reden der Menschen füllen, die Erfahrungen gemacht haben, die sie sprachlos gemacht haben. Ich meine vielmehr, dass das, was er sagt, ganz in die Bildersprache, das Vokabular und die messianischen Hoffnungen des Judentums, das er ererbt hat, und der Welt, in der er lebte, verstrickt und verwoben (texere) ist. In diesem Punkt gleicht seine Berufung anderen Berufungen anderer Menschen zu anderen Zeiten und an anderen Orten, die nicht weniger dramatisch und umwälzend sind, die aber völlig mit anderen Umständen verwoben oder verstrickt sind, in denen der Name Jesus völlig unbekannt ist. Wir können uns sogar kontrafaktisch vorstellen, dass, wenn Paulus sich in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort befunden, eine andere Sprache gesprochen und eine andere Tradition ererbt hätte, andere Bücher gelesen hätte und von anderen Meistern unterrichtet worden wäre, das, was ihm an diesem Tag (wenn es nur ein Tag gewesen) widerfahren wäre, ganz anders erfasst worden wäre. (So wie wir, wenn wir Augustinus beim Wort nehmen, fragen können, was Augustinus getan hätte, wenn das Buch, das zufällig auf dem Tisch lag, als er die Kinder tolle, lege spielen hörte, Ovids Metamorphosen gewesen wären und nicht der bequemer Weise ins Lateinische übersetzte Brief des Paulus an die Römer.) Rufe sind Ereignisse, die virtuell in Netzwerke von Texten und Botschaften, engelhafte oder andere, eingebettet sind, Ereignisse, die um uns kreisen und uns in einem naszierenden Zustand auffordern und die
312
Eine radikale Theologie des Kreuzes
gelegentlich einen Punkt explosiver Intensität in intensiven Persön lichkeiten und explosiven Agenten wie Paulus oder Augustinus oder dem Buddha unter dem Bodhi-Baum erreichen. Der Anlass des Rufs, der zu etwas Außergewöhnlichem führt, kann »für die ganze Welt« etwas Einfaches und Gewöhnliches und ontologisch Unscheinbares sein – Kinder beim Spielen oder ein Mann beim Gebet –, wenn plötzlich etwas auf einen einstürmt, etwas Insistentes, das in einer Woge in der Existenz mündet. Angesichts solcher Verdeckung ist es weise von Paulus, dass er alles vom Glauben abhängig macht. Aber hier würde ich den Glauben (fides, foi) von der Überzeugung (credere, croyance) unterscheiden, eine foi, die jeder gegebenen croyance zugrunde liegt, sie aber gleich zeitig destabilisiert, eine fides, die ein credo fundiert und entfundiert.31 Überzeugungen haben Gründe, aber der Glaube ist ein grundloser Grund. Die Überzeugung eines Bekenntnisses [creedal belief] gehört zur Welt. Sie ist auf ein identifizierbares Wesen oder eine tatsächliche Entität ausgerichtet, in dieser Welt oder in einer anderen Welt, auf ein vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges Wesen. Sie hat Anteil am Ruhm der Welt, am Prestige wirkmächtiger Sätze und an den Glaubensbekenntnissen berühmter Konzile, berühmter Orthodoxien, die berüchtigte Häresien verfolgen. Überzeugungen betreffen Wesen und Institutionen, Konzepte, Sätze und Argumente. Überzeugungen gehören zum Glanz der Welt, der Politik und der Religion; sie sind weltliche Tatsachen, und sie sind in der Lage, viel Blut zu vergießen. Aber der Glaube hat mit Nichtexistenz zu tun, mit einer armen und weltlosen und unidentifizierbaren Insistenz, mit einer Aufforderung durch etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist, das mich mit einer schemenhaften Präsenz anruft, von dem ich unerwartet besucht werde, wie ein Klopfen an der Tür mitten in der Nacht, das erst in meiner Antwort Körper, Substanz, Materialität, Existieren und weltliche Realität erlangt. Der Glaube lässt sich nicht auf stabile und identifizierbare Positionen und Propositionen reduzieren. Der Glaube hat mit einem ergebnisoffenen Versprechen von etwas, ich nicht weiß was, zu tun. Ich versuche nicht, den Glauben einfach der Überzeugung gegenüberzustellen, sondern die Dynamik ihrer Verflechtung oder Verschränkung zu beschreiben, durch die der Glaube die Überzeugung heimsucht, sie stört und entgründet und ihre Kontingenz offenlegt, während die Überzeugung dem Glauben Weltlichkeit, weltliche Rea 31
J. Derrida, »Glaube und Wissen«, S. 93f.
313
John D. Caputo
lität, Existenz verleiht. Der Glaube insistiert; die Überzeugung exis tiert. Ich beeile mich auch hinzuzufügen, dass ich nicht behaupte, alle Rufe wären gleich, es gäbe eine universelle a priori immergleiche Wahrheit in allen Rufen, alle »Religionen« wären gleich, alle »Myste rien« hätten die gleiche Botschaft. Ich verwandle die Dekonstruktion nicht in den historisch naiven Universalismus der alten Vergleichen den Religionswissenschaft. Im Gegenteil, ich habe damit begonnen, die spezifische und unverwechselbare, revolutionäre und radikale Neukonzeption Gottes in 1 Korinther 1 zu betonen, die »besondere Offenbarung«, die den (buchstäblich) entscheidenden [crucial] Punkt in dem ikonischen Blick auf Gott aufgreift, den wir in der Gestalt Jesu erhaschen. Ich will damit weder sagen, dass diese Erfahrung, diese Offenbarung, ungültig ist, noch dass alle Offenbarungen gleich sind. Ich versuche, das selbst-bestätigende, selbst-authentifizierende Element an Paulus zu identifizieren. Es gibt etwas Besonderes an Paulus und in dem Besonderen, das sich in 1 Korinther 1 sagen und rufen ließ, etwas, das in dem komplexen Netzwerk von Bedeutungen (der phänomenologischen Welt), in der Paulus lebte, zirkulierte, etwas, das erbeten und nach dem gerufen wurde, in dem, was mit Paulus geschah.
10. Konklusion In einer radikalen Theologie des Kreuzes wird der Ruf, der im Namen (von) »Gott« beherbergt wird, allen weltlichen Glanzes beraubt; seine Macht und sein Prestige werden verhöhnt und erniedrigt; und er wird auf sich selbst zurückgeworfen, auf seine Nacktheit, Weltlosigkeit, Seinslosigkeit, Verletzlichkeit, Nicht-Souveränität und Gottverlassenheit. Der Ruf wird auf einen inspirierenden Geist oder ein umhergeisterndes Schema reduziert, eine Stimme, die immer leise und tief ist, von unbekannter Herkunft, sans papiers, ohne Autorität, Zusicherungen oder Garantien, riskant und unsicher. Ihre einzige Legitimation ist der Ruf selbst, der Ruf, den sie ausspricht, ein Ruf, der für die Welt nicht fremder oder törichter sein könnte – die Feinde mit Liebe zu empfangen, den Übeltäter mit Vergebung, »komm« zu sagen zum Kommen des Unvorhersehbaren, das immer gefährlich ist. Ihre einzige Autorität ist die Autorität ohne Autorität eines Rufs, der eines
314
Eine radikale Theologie des Kreuzes
Autors beraubt ist; ihre einzige weltliche Realität ist die Antwort, die Geschichte der Antworten, die in ihrem Namen gegeben wurden. Aber der logos des Kreuzes ist kein Rezept für Ohnmacht und Nihilismus. Im Gegenteil, er ist das eigentliche Gewebe der Hoffnung im Leben, ein logos des tiefsten Glaubens im und an das Leben. Dieser Glaube ist nicht geschmückt mit der Pracht von Bekenntnissen, gekleidet in großartige und gut geschmückte Doktrinen, er trägt keinen Brustpanzer der Religion, ist nicht umgürtet mit dem Gürtel irrtumsloser Bücher und unfehlbarer Institutionen. Es ist ein reiner Glaube, sola fide, der als Antwort auf eine reine Anrede gegeben wird, unsicher und ausgesetzt, ungewiss und ungeschützt, ein gekreuzigter Glaube ohne Glauben, der nach dem, was kommen wird, ruft, der nach etwas Kommendem ruft, der etwas aus undenklicher Zeit zurückruft, der in einer unwahrscheinlichen, unordentlichen und diffizilen Herr lichkeit gipfelt. In einer radikalen theologia crucis ist dieser Glaube nackt; diese Nacktheit ist Glaube. Dieser Glaube ist in der/an die Zukunft, in der schemenhaften Möglichkeit des Andersseins, von etwas ganz anderem, von mehr Leben, was der Sinn der Auferstehung ist – im Einklang mit dem logos des Kreuzes und der Schwäche, die stärker ist als die Welt. Übersetzt aus dem Amerikanischen von Esther Heinrich-Ramharter.
Literaturverzeichnis Barclay, J., »Crucifixion as Wisdom: Exploring the Ideology of a Disreputable Social Movement«, in: Ch. Chalamet, H.-C. Askani (Hg.): Wisdom and Fool ishness, Minneapolis: Fortress 2015, S. 1–20 Breton, St., Saint Paul, Paris: Presses Universitaires de France 1988 —, A Radical Philosophy of Saint Paul, übers. von J. Ballan, New York: Columbia University Press 2011 Caputo, J. D., The Insistence of God. A Theology of Perhaps, Bloomington: Indiana University Press 2013. —, Cross and Cosmos. A Theology of Difficult Glory, Bloomington: Indiana University Press 2019 Chalamet, Ch., »God’s Weakness and Power«, in: Ch. Chalamet, H.-C. Askani (Hg.): The Wisdom and Foolishness of God: First Corinthians 1–2 in Theological Exploration, Minneapolis: Fortress 2015, S. 325–340
315
John D. Caputo
Crossan, J. D., Jesus: A Revolutionary Biography, San Francisco: HarperOne 1994 —, »Response to Luke Timothy Johnson«, in: Beilby, J. K., Eddy, P. R. (Hg.): The Historical Jesus: Five Views, Downers Grove, IL: IVP Academic 2009 Derrida, J., »Den Tod geben«, in: A. Haverkamp, Gewalt und Gerechtigkeit. Derrida – Benjamin, Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994, 331–445 —, »Glaube und Wissen. Die beiden Quellen ›der Religion‹ an den Quellen der bloßen Vernunft«, in: J. Derrida, G. Vattimo, Die Religion, Frankfurt/M.: Suhrkamp 2001, 7–106 —, Marx‘ Gespenster: Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005 —, Schurken: Zwei Essays über die Vernunft, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2005 —, Heidegger, M., Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer 182001 Lacan, J., Der Triumph der Religion welchem vorausgeht Der Diskurs der Katholi ken, übers. von H.-D. Gondek, Wien: Turia + Kant 2005 Martin, D. B., The Corinthian Body, New Haven, CT: Yale University Press 1995 Nietzsche, F., Zur Genealogie der Moral, in: ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe 5, hg. v. G. Colli, M. Montinari, München: dtv 1980 Tillich, P., The Interpretation of History, New York: Scribners’s Sons 1936 —, Theology of Culture, hg. V. R. C. Kimball, Oxford: Oxford University Press 1959 Welborn, L. L., Paul, the Fool of Christ: A Study of 1 Corinthians 1–4 in the Comic-Philosophic Tradition, London: T and T Clark, 2005
316
Marcus Schmücker
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Vorbemerkung1 Das Fortschreiten der Zeit ist ein Paradox unseres menschlichen Daseins. Im Fortschreiten der Zeit liegen Leben und Tod begründet sowie der Grund unserer Endlichkeit, durch die wir den Anfang unserer Existenz immer schon verloren haben und von Geburt an auf ein Ende zulaufen, von dem wir nicht wissen, wann es eintreten wird. Der Tod reißt uns aus dem Leben, er lässt uns im Leben bleiben oder auch warten. Geburt und Tod sind gegensätzliche, in sich unvereinbare Momente im Fortschreiten der Zeit. Dazwischen liegt die Spanne des Lebens, das ein endliches und begrenztes Leben bleibt. Das Fortschreiten der Zeit bestimmt das philosophische und theologische Denken in Indien, das damit eine Reflexion über die Zeitlichkeit des Menschen ist. In der Endlichkeit liegt der Grund menschlichen Leidens, das Leiden an dem unaufhaltsamen Fort schreiten der Zeit. Der Mensch leidet unter der notwendigen und unumkehrbaren Abfolge der Zeiten »Vergangenheit«, »Gegenwart« und »Zukunft«; diese Abfolge zeitlicher Bestimmungen drückt nichts anderes aus, als unser Fortschreiten auf ein unausweichliches Ende hin. Sobald wir ins Leben eintreten und dieser Zeitabfolge unterwor fen sind, erfahren wir uns in diesem unaufhaltsamen Gang zeitlicher Episoden. Über unsere Lebenszeit in ihrer Ganzheit zeitlicher Abfol gen verfügen wir nicht. 1 Der vorliegende Beitrag ist die ins Deutsche übertragene und überarbeitete Version eines in ihrem ersten Teil stark ergänzten und im zweiten Teil gekürzten, ursprünglich in Englisch abgefassten Aufsatzes, mit dem Titel: »On the relation between God and time in the later theistic Vedānta of Madhva, Jayatīrtha and Veṅkaṭanātha«, erschienen in: M. Schmücker, M. T. Williams, F. Fischer (Hg.). Temporality and Eternity. Nine perspectives on God and Time, Berlin: deGruyter 2022, S. 123–160.
317
Marcus Schmücker
Wir erleben zwar eine Gegenwart, aber wenn wir versuchen, sie festzuhalten, wird sie zur Vergangenheit. Dies ist ein weiterer Grund, warum wir unter der Zeit leiden: Wir spüren, dass unsere Lebenszeit verloren geht. Die Erfahrung des Vergehens verursacht Angst, in Zukunft nicht mehr zu existieren. Frei von einer solchen Angst zu sein, wird daher zu einem wichtigen Aspekt menschlicher Realität, ein Aspekt, der untrennbar mit der Endlichkeit des Menschen verbunden ist. Angesichts dieser Situation macht es Sinn, dass die Menschheit Gottesvorstellungen – Ewigkeitsvorstellungen – entworfen hat, die diese Beschränkung menschlichen Lebens aufheben oder über sie hinwegtrösten wollen. Mit der Annahme einer Ewigkeit, in der es keine zeitlichen Abfol gen gibt, versucht man eine nicht-zeitliche Struktur zu beschreiben, die den Menschen nicht dem hoffnungslosen Leiden der vergehenden Zeit aussetzt. Schließlich würde es der Annahme eines ewigen Gottes widersprechen, wenn ein solches Wesen unter der Abfolge zeitlicher Bestimmungen leiden müsste. Zeitlichkeit und Unvollkommenheit menschlicher Existenz finden im Begriff der Ewigkeit Gottes ihr hoffnungsvolles Gegenteil. In diesem Beitrag gehe ich auf zwei Vorstellungen von Ewig keit ein, die ich für das Zeitverständnis des vormodernen Indien in Anspruch nehmen möchte.2 Die erste Konzeption ist die einer zeitlosen Ewigkeit. Sie definiert Ewigkeit, insofern sie keine zeitlichen Bestimmungen hat. Ewigkeit liegt jenseits der genannten Zeitmodi. Als zeitlos ist sie ohne Leid. Die zweite Konzeption von Ewigkeit bringt diese mit allen Zeiten (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) zusammen. Ewigkeit ist bestimmt als die Fülle des Lebens in allen Zeiten. Aus dieser Perspektive bedeutet Ewigkeit nicht den Ausschluss zeitlicher Bestim mungen; Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft können mit einem als ewig vorgestellten personalen Gott vereinbart werden. Diese beiden Ewigkeitskonzepte werden in der indischen Tradi tion des theistischen Vedānta entwickelt. Doch bevor ich zeige, in welcher Weise Gott, Ewigkeit und das Fortschreiten der Zeit in dieser Tradition miteinander verbunden werden, möchte ich skizzieren, 2 Beide Vorstellungen von Ewigkeit werden in der analytischen Theologie diskutiert; vgl. Y. Y. Melamed, »Introduction«, S. 11–13, »Eternity as timeless existence, as opposed to eternity as existence in all times« (S. 11); vgl. auch N. Deng, God and Time, S. 4.
318
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
warum die Frage nach der Beziehung von Gott und Zeit in Indien überhaupt zu einem wichtigen Thema wird und welche alternativen Formen der Zeitbewältigung vorher oder auch parallel zum theisti schen Vedānta entwickelt werden.
1. Dem Fortschreiten der Zeit entgegen Der älteste Text der indischen Tradition, der Ṛgveda (1500 v. Chr.), enthält kein abstraktes Konzept von Zeit (der Terminus kāla wird nur einmal in Ṛgveda 10.42.9 erwähnt); indirekt wird aber bereits das Vergehen der Zeit thematisiert. Es ist kein Leiden an der Zeit, vielmehr bedeutet Zeit eine ständige Erneuerung. Sie findet sich in mehreren zentralen Konzepten des Ṛgveda wieder, einschließlich der kosmischen Ordnung (ṛta), durch die das Universum aufrechterhalten wird. Die kosmische Ordnung ist mit der Vorstellung eines Rades (cakra) verbunden, das wiederum zu verschiedenen Zeitabschnitten in Bezug gesetzt wird, von denen der wichtigste Abschnitt das Jahr (saṃvatsara)3 ist. Die wiederkehrende Abfolge der zeitlichen Einhei ten des Jahres, wie Tag und Nacht, gleicht der kreisförmigen Bewe gung eines Rades; seine Umdrehung ist nicht als eine Wiederholung seiner Bewegung zu deuten, sondern als ein beständiges sich Weiter drehen.4 Die Bewegung des Rades verweist nicht nur auf das Fortschreiten der Zeit, sondern auch darauf, dass sie vergeht. Erneuerung setzt Vergehen voraus. Diese Ambivalenz scheint im Ṛgveda noch nicht im Vordergrund zu stehen. Dennoch fallen Passagen auf, in denen deutlich ausgesprochen wird, dass der Mensch nicht unbegrenzt lebt, weil ihn zeitliche Erneuerung auch altern lässt und schließlich an sein Lebensende führt. Diese Einsicht drückt sich besonders in Liedern des Ṛgveda aus, die vergöttlichte Naturphänomene wie die 3 N. Yanchevskaya, M. Witzel, »Time and Space in Ancient India: Pre-philosophical Period« folgern hier (S. 26): »that a relationship of Vedic ṛta with time and the wheel of time (the wheel of the year in this case) is not accidental. Although we cannot say that ṛta is time, it is definitely on some older Indo-European level related to time both etymologically and functionally. It organizes the universe, creates a sequence of events, and exerts its power over all living beings.« 4 Darauf wird mehrfach verwiesen; vgl. z.B. A. Malinar, »Zeit und Zeitpunkt in den Upaniṣaden und im Epos«, S. 30‒32.
319
Marcus Schmücker
Morgendämmerung (uṣas) besingen, die hier (1.92.10; 1.113.10 – 11; 1.124.2) in folgenden Worten5 beschrieben wird: (Sie ist) die Uralte, die immer wieder geboren wird, […die] das Leben des Sterblichen abnimmt (und) alt macht. (1.92.10)6 Wie lange, dass sie [Uṣas] in der Mitte erscheinen wird (zwischen denen), die aufgegangen sind und die nun aufleuchten werden? […] (1.113.10)7 Gegangen sind die, die die früheren Uṣas aufgehen sahen, die Sterbli chen. Uns ist sie aber jetzt zu erblicken geworden. Es kommen anderer seits die, die sie in den zukünftigen (Nächten) sehen werden. (1.113.11)8 Ohne die göttlichen Gebote zu mindern, (aber) die menschlichen Lebenszeiten mindernd, ist Uṣas aufgeleuchtet als letzte der aufeinan derfolgend Vergangenen, als erste der Kommenden. (1.124.2)9
Das Bewusstsein von Vergänglichkeit, trotz der an vielen anderen Stellen im Ṛgveda genannten lebensfreudigen Aspekte der als junge, strahlende Frau versinnbildlichten Morgenröte, ist unübersehbar. Ihre regelmäßige Erscheinung verweist darauf, dass die Zeit fort schreitet und dadurch die Tage des Lebens abnehmen; der Mensch wird sterblich (martya) genannt; die zitierten Verse spiegeln daher keine Naturbetrachtung wieder, sondern zeugen von dem Bewusst sein, dass die Zeit fortschreitet. Bevor ich auf diesen destruktiven Aspekt des zeitlichen Ablau fes sowie auf die Bewältigung des unabänderlichen Fortschreitens eingehe, sollen zwei berühmten Hymnen (19,53–54) des Atharva veda (1200–1000 v. Chr.), die ausschließlich die Zeit thematisieren, genannt werden. Mit ihnen wird die Zeit als oberstes Prinzip genannt; sie wird gepriesen und ihre Allmacht deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Übersetzung wird zitiert aus: Rig-Veda. Das heilige Wissen. Erster und zweiter Liederkreis. Aus dem vedischen Sanskrit übersetzt und herausgegeben von Michael Witzel und Toshifumi Gotō. Frankfurt a.M., Leipzig: Verlag der Weltreligionen 2007. Der in den folgenden Fussnoten zitierte Sanskrittext ist der Online-Edition des Ṛgveda in GRETIL (=Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages, abgerufen am 01.03.2022) entnommen. 6 puna̍ḥ puna̱r jāya̍mānā purā̱ṇī […] āminā̱nā marta̍sya de̱vī ja̱raya̱nty āyu̍ḥ ||. 7 kiyā̱ty ā yat sa̱mayā̱ bhavā̍ti̱ yā vyū̱ṣur yāś ca̍ nū̱naṁ vyu̱cchān | […]. 8 ī̱yuṣ ṭe ye pūrva̍tarā̱m apa̍śyan vyu̱cchantī̍m u̱ṣasa̱m martyā̍saḥ | a̱smābhi̍r ū̱ nu pra̍ti̱cakṣyā̍bhū̱d o te ya̍nti̱ ye a̍pa̱rīṣu̱ paśyā̍n || . 9 ami̍natī̱ daivyā̍ni vra̱tāni̍ pramina̱tī ma̍nu̱ṣyā̍ yu̱gāni̍ | ī̱yuṣī̍ṇām upa̱mā śaśva̍tīnām āyatī̱nām pra̍tha̱moṣā vy a̍dyaut ||. 5
320
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Ihr Wirken erscheint für den Menschen ungefährlich: Sie ist zeitlos und zeitlich zugleich. Sie wird nicht nur mit dem identifiziert, was als das Höchste angesehen wird, d.i. mit dem Herrn von allem (sarvasyeśvara) oder dem Herrn der Geschöpfe (prajāpati), sie wird als unzerstörbar und »ohne Alter« (ajara) beschrieben. Weiterhin wird die Zeit mit verschiedenen zentralen Topoi des oben genannten Ṛgveda identifiziert: die Seher reiten die Zeit wie ein Pferd; sie selbst ist ein Pferd, das mit sieben Strahlen/Zügeln (saptaraśmi) läuft, tau send Augen (sahasrākṣa) hat, ohne Alter, reich an Samen; Zeit bewegt sich mit sieben Rädern und sieben Naben (nābhi), Unsterblichkeit (amṛta) ist ihre Achse (akṣa). Die beiden Hymnen des Atharvaveda beschreiben die Dinge, die aus der Zeit (kālāt) entstehen oder durch sie verursacht werden (kālena). Es ist Zeit, durch welche die Erde erschaffen wird, und deshalb sind die Zeitmodi von Vergangenheit und Zukunft, die Sonne, alle Wesen, das Auge, der Geist, der Atem, die Namen in der Zeit. Weiterhin ist die Zeit mit asketischer Hitze/ Glut (tapas), dem Höchsten (jyeṣṭham) sowie dem brahman selbst verbunden. Dass die Menschen die Zeit fürchten, wird nicht erwähnt; im Gegenteil, alle Geschöpfe sind glücklich über die Zeit, wenn sie herbei gekommen ist (19.53.7ab: kālena sarvā nandanti āgatena prajā imāḥ). Die beiden Hymnen des Artharvaveda vermitteln nicht den Ein druck, dass Zeit einen zerstörerischen Charakter hat. Vielmehr geht der Mensch mit der Zeit und nicht das Fortschreiten der Zeit gegen die Lebensspanne (āyus) des Menschen. Dass Zeit den Menschen über wältigt, bezeugt der Atharvaveda nicht. Erst im Śatapatha-Brāhmaṇa (7.-6. Jh. v. Chr.) wird das oben genannte Jahr (saṃvatsara) wie folgt beschrieben: Das Jahr fürwahr ist der Tod. Es zerstört das Leben der sterblichen Wesen durch Tage und Nächte; dann sterben sie. Deshalb ist das Jahr der Tod. Wer aber das Jahr als den Tod kennt, dessen Leben zerstört dieses Jahr nicht vor dem Alter [durch das Vergehen] von Tagen und Nächten; und er erreicht seine vollständige Lebensspanne. Dieses Jahr selbst ist der Beendende; denn den Sterblichen gelangt es an das Ende ihrer Lebensspanne [durch das Vergehen] von Tagen und Nächten; schließlich sterben sie. Deshalb ist es der Beendende. Wer aber das Jahr als den Beendenden, den Tod kennt, dessen Leben zerstört dieses Jahr nicht vor dem Alter [durch das Vergehen] von Tagen und Nächten; und er erlangt seine vollständige Lebensspanne.
321
Marcus Schmücker
Die Götter fürchteten sich vor diesem Herrn der Geschöpfe, vor dem Beendenden, dem Tod, dem Jahr, dass er nicht an das Ende ihres Lebens durch Tage und Nächte gelangen möge.10
Mit der Identifizierung des Jahres als Tod, als (das Leben) Beendender (antaka) und schließlich als Herrn aller Geschöpfe, wird ausgespro chen, dass das Fortschreiten der Zeit, d.h. der Zeitablauf eines Jahres (saṃvatsara) durch das Vergehen von Tagen und Nächten, den Men schen an sein Lebensende bringt. Aus dem unaufhaltsamen Vergehen dieser Tage und Nächte entsteht nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei den Göttern Angst davor, die volle Lebensspanne (āyus) nicht bis zum Ende leben zu können. Wenn in dieser Passage zweimal gesagt wird, dass der Mensch nicht vorzeitig stirbt, wenn er um die Gleichsetzung von Jahr und Tod weiß (sa yo haitam mṛtyuṃ saṃvats araṃ veda), sondern seine (ihm biologisch zugedachte) Lebensspanne von hundert Jahren erreichen kann, so kann dies weder durch eine rein formale Gleichsetzung, d.h. dem bloßen Faktum von A=B, verursacht sein, noch durch die Annahme, dass solches Wissen allein bewirken könnte, dass dem Menschen die Tage nicht vergehen. Vielmehr ver weist diese Identifizierung auf das Faktum, dass das unaufhaltsame Fortschreiten der Zeit, hier ist es der unaufhaltsame Ablauf des Jahres, nicht nur menschliches, sondern auch göttliches Leben an ein Ende bringt.11 Die Erkenntnis eines solchen unabwendbaren Faktums hält Śatapatha-Brāhmaṇa 10,4,3.1 – 3: eṣa vai mṛtyur yat saṃvatsaraḥ. eṣa hi martyānām ahorātrābhyām āyuḥ kṣiṇoty atha mriyante. tasmād eṣa eva mṛtyuḥ. sa yo haitam mṛtyuṃ saṃvatsaraṃ veda na hāsyaiṣa purā jaraso ’horātrābhyām āyuḥ kṣiṇoti sarvaṃ haivāyur eti eṣa u evāntakaḥ eṣa hi martyānām ahorātrābhyām āyuṣo ’ntaṃ gacaty atha mriyante tasmād eṣa evāntakaḥ sa yo haitam antakam mṛtyuṃ saṃvatsaraṃ veda na hāsyaiṣa purā jaraso ’horātrābhyām āyuṣ ’ntaṃ gacati sarvaṃ haivāyur eti. te devāḥ etasmād antakān mṛtyoḥ saṃvatsarāt prajāpater bibhayāṃ cakrur yad vai no ’yam ahorātrābhyām āyuṣo ’ntaṃ na gaced iti. Zur Wiedergabe des Sanskrittextes vgl. GRETIL (=Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages, abgerufen am 01.03.2022). 11 Diese Gleichsetzung von Jahr und Tod, mit weiteren Textreferenzen sowie dem Hinweis, dass es sich bei diesen Zitaten nicht allein um Theorie (»no mere theory«), sondern um eine existenzielle Identifizierung handelt, die den Menschen hoffen lässt, behandelt ausführlich auch J. Gonda, Prajāpati and the Year, S. 13: »However, all events and processes that result in decay and ruin take place in time, more precisely, in the course of a definite year. The year is indissolubly linked with processes such as decline, deterioration, destruction. The year causes some things to perish and calls others into existence« (AiĀ. 3, 2, 3). »Out of the year these creatures are born, in the year they grow, in the year they perish« (MaiU. 6, 15). It is time, a definite year, in which things come to an end, it is always a definite space of time that makes a being 10
322
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
das anfangslose Vergehen von Tagen und Nächten nicht auf, und wie der letzte Satz ausdrückt, auch die Angst davor nicht. Vielmehr lassen sich die zitierten Sätze des Śatapatha-Brāhmaṇa so deuten, dass dem Menschen bewusst werden soll, dass der Zeitfluss nicht umkehrbar ist, und dass die Lebenszeit auch verfrüht an ein Ende kommen kann. In der epischen Literatur, zu der neben dem Rāmāyana vor allem das Mahābhārata gehört, überwiegt der zerstörerische Aspekt der Zeit. Hier kommt die überwältigende Wirkung der Zeit als Gefahr für jedes menschliche Handeln deutlich zum Ausdruck. Wenn nichts über der Zeit steht, die Zeit keinen Herrscher hat, ist der Mensch der Zeit ausgeliefert. Bemerkenswert ist, dass im Mahābhārata die Haupthandlung innerhalb des bereits oben genannten »Jahres« (saṃvatsara) geschieht. Auch wenn das Jahr nicht der realen Zeit entspricht, in der die Haupthandlung dieses Epos erzählt wird, wird an die Vorstellung eines unabänderlichen Ablaufs angeknüpft.12 Eine oft wiederholte Beschreibung, die diesen Prozess für den Menschen metaphorisch beschreibt, findet sich im letztgenannten Epos. Hier wird erwähnt, dass »die Zeit die Lebewesen kocht« (kālaḥ pacati bhūtāni) und sie wie Früchte reifen lässt.13 Diese negative Sicht der Zeit war vielleicht der Grund, die Zeit einem höher stehenden Prinzip oder einem über der Zeit stehenden Gott unterzuordnen, der das Resultat der menschlichen Handlung verleiht. Die Übertragung der Metapher des Kochens auf einen höchsten personalen Gott, der kocht, lässt sich anhand der Verwendung der Verbalwurzel √pac, »kochen«, »backen«, »reifen lassen« deutlich belegen.14 Texte, die nach dem Mahābhārata abgefasst sind, sprechen nicht mehr vom end his days. »The year, verily, is death, for it is he (the year as a person) who, by means of day and night, makes an end of the duration of the life of mortal beings, and then they die; therefore the year is death« (SB. 10, 4, 3, 1). This is, in a Brāhmaṇa, no mere theory, no statement of a fact but a premise to a conclusion, an introduction to a prospect of help, escape or salvation, a foundation of the belief that by knowing the is fact – i.e. by identifying oneself existentially with it – »the year will not destroy, by day and night, one's life before old age, and one will attain one's full extent of life«.« 12 Vgl. dazu G. v. Simson, »Narrated time and its relation to the supposed Year Myth in the Mahābhārata«, S. 53–65. 13 Die Beschreibung der Zeit als »Kochen aller Wesen« scheint eindringlich im Gedächtnis zu bleiben über mehr als ein Jahrtausend. Auch Veṅkaṭanātha zitiert diesen Satz, wenn er die Beziehung zwischen Gott und Zeit diskutiert (siehe weiter unten). 14 Vgl. dazu Vassilkovs Bemerkung zur Bedeutung des »Kochens« in: Y. Vassilkov, »Kālavāda (the doctrine of Cyclical Time) in the Mahābhārata and the concept of Heroic Didactics«, S. 22: »The image of Time cooking living beings must have been derived from the reality of a sacrificial rite during which sacrificial cakes
323
Marcus Schmücker
Ablauf der Zeit, sondern von einem höchsten Wesen, das die Zeit ablaufen lässt, d.h. kocht und somit reifen lässt. Diese Verschiebung von Zeit, die kocht, hin zu einer Zeit, die gekocht wird, wird noch im Mahābhārata angedeutet, doch der Bedeutungswechsel für das Kochen der Zeit von einem Genitivus subjectivus zu einem Genitivus objectivus vollzieht sich erst in den späteren Upaniṣaden. Zwei oft genannte Upaniṣad-Passagen, die der Zeit ein Prinzip überordnen, deuten diese Tendenz an: Maitrāyaṇīya-Upaniṣad 6.15 nennt zwei Gestalten des höchsten Prinzips, des brahman: die eine Gestalt des brahman wird identifiziert mit Zeit, die andere Gestalt des brahman ist zeitlos. Das brahman in der Gestalt der Zeit beginnt mit dem Gang der Sonne; es ist zeitlich, besteht aus zeitlichen Teilen und wird mit dem Jahr gleichgesetzt; zunächst deutet das Zitat darauf, dass die Zeit alles beherrscht, doch auch hier rettet das Wissen. Das im Śatapatha-Brāhmaṇa genannte Jahr (saṃvatsara) in seiner negativen Bedeutung wird in diesem Textbeispiel erneut aufgegriffen, wenn es heißt: Aus dem Jahr wiederum sind die Lebewesen hervorgegangen. Durch das Jahr hindurch wachsen sie hier, nachdem sie geboren sind. Inner halb des Jahres vergehen sie. […] Deshalb heißt es: »Die Zeit kocht eben alle Wesen; aber wer das große Selbst kennt, in dem die Zeit gekocht wird, der ist des Veda kundig.15
Die Umkehrung von der kochenden Zeit zur gekochten Zeit spricht Śvetāśvatara-Upaniṣad (200 n. Chr.) deutlich aus; hier wird der höchste Gott genannt als die Matrix von allem (viśvayoniḥ), die die Eigennatur [inhärente Natur] (der Dinge) zur Reife bringt/kocht (svabhāvam pacati), und [wodurch] alle Dinge entstehen, die zur Reife gebracht werden können (pācyāṃś ca sarvān pariṇāmayet); er [d.h. Gott] herrscht über diese gesamte
(puroḍāśa) were baked for the gods. Following this pattern, time was probably per ceived as cooking/baking all living beings, who were later to be devoured by Death (Mṛtyu).« 15 Maitrayanīya-Upaniṣad 6.15: […] samvatsarāt khalv evemāḥ prajāḥ prajāyante. samvatsareṇeha vai jātā vivardhante. samvatsare pratyastaṃ yanti. […] evam hy āha – kālaḥ pacati bhūtāni sarvāny eva mahātmani. yasmiṃs tu pacyate kālo yas taṃ veda sa vedavit. Zu Edition und Übersetzung vgl. J.A.B. Van Buitenen, The Maitrāyaṇīya Upaniṣad, S. 45–46.
324
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Gesamtheit als der Eine, der alle guṇas anwendet [und alle Eigenschaf ten verteilt].16
Es ist also nicht mehr die Zeit (kāla), die das Rad in Bewegung hält (cakra, hier brahmacakra), sondern Gott (ŚU 6.1). Er ist derjenige, der der Zeit ihre Zeit gibt: er wird (Śvetāśvatara-Upaniṣad 6.2) als die »Zeit der Zeit« (kālakāla) definiert, während er selbst jenseits der drei (paras trikālād) steht (Śvetāśvatara-Upaniṣad 6.5). Als die die »Zeit der Zeit« ist er selbst nicht mehr zeitlich. Gott als über der Zeit stehend anzunehmen, führt zu neuen Fragen über die Beziehung zwischen einem zeittranszendierenden Gott und der fortschreitenden Zeitlichkeit der Zeit. Seine Gleichsetzung mit Zeit bedeutet nicht, dass Gott zeitlich wird, sondern er übernimmt die Bestimmungen der Zeit. Das Fortschreiten der Zeit ist jetzt Gottes Fortschreiten; die Zeit selbst ist kein transzendentes, unabhängiges Prinzip, sondern ihre Funktionen kehren mit einem göttlichen Prinzip wieder. Zwei Verse des Viṣṇupurāṇa (ca. 300 n. Chr.) belegen, dass Viṣṇu die Gottheit ist, die die Welt erhält, zugleich Ursache ihrer Zerstörung sowie ihrer erneuten Manifestierung ist. Die Zeit behält, gerade weil sie Gottes » eigenes Wesen« ist (kālasvarūpa), sowohl schöpferische als auch zerstörerische Kraft, die aber nicht mehr einer unabhängig fortschrei tenden »Zeit« zugehört, sondern zu seiner, d.h. Gottes schöpferischen, die Welt erhaltenden und sie wiederum auflösenden Kraft geworden ist. Neben anderen Belegen17 behandeln die beiden folgenden Verse des Viṣṇupurāṇa (1.2.24; 26) die Gleichsetzung der Zeit mit Gott; als solche bedingt sie nicht nur die ungeistige Urmaterie und die geistigen individuellen Seelen, sondern auch den ununterbrochenen Ablauf von Schöpfung, Bestehen und Vergehen der Welt.18 So lauten die beiden Verse: Die beiden anderen Gestalten, die Urmaterie und die Geistperson, sind verschieden von der eigentlichen Natur Viṣṇus, Brahmane. Von einer weiteren Form von ihm, fürwahr, werden diese beiden19 getragen, und 16 Übersetzung wird zitiert aus Th. Oberlies, »Die Śvetāśvatara-Upaniṣad: Edition und Übersetzung von Adhyāya IV–VI (Studien zu den »mittleren« Upaniṣads II – 3. Teil)«, S. 100. 17 Vgl. dazu H. W. Weßler, Zeit und Geschichte im Viṣṇupurāṇa, S. 197ff., 209ff. 18 Zitiert wird im Folgenden die Übersetzung von P. Schreiner, Viṣṇupurāṇa. Alther gebrachte Kunde über Viṣṇu, S. 18. 19 D.h. die vorher genannte Urmaterie und die Geistperson, d.h. die individu elle Seele.
325
Marcus Schmücker
sie sind davon getrennt; diese andere Form, Zweimalgeborener, hat die Benennung ›Zeit‹. … Der Gnädige, die Zeit, ist anfangslos; es gibt kein Ende, Zweimalgeborener. Deshalb aber sind diese Bedingungen von Schaffung, Bestand und Ende ununterbrochen.20
Die Besonderheit einer solchen Ansicht liegt darin, dass hier die Zeit von der Urmaterie und von der individuellen Seele getrennt wird. Beide werden nicht von der Zeit beherrscht; vielmehr ist es Gott, der in seinem Wesen Zeit ist, der beide nun beherrscht. Auch die śivaitische Tradition der Purāṇa-Literatur behandelt das Verhältnis von Gott und Zeit. Ausführlich beschreibt die zum Śiva purāṇa gehörige Vāyavīyasaṃhitā in einem Abschnitt über die Zeit, dass es nichts gibt, das nicht ihrem Wirken untergeordnet ist. Wenn es aber nicht Zeit ist, sondern der Gott Śiva, der diese beherrscht, dann fallen letztlich auch alle in dem Text genannten Bestimmungen der Zeit unter die Macht (vaśa) Gottes. Alle Bestimmungen der Zeit, die im folgenden Textabschnitt aufgezählt werden, sind damit auch Bestimmungen des Gottes Śiva, ohne dass dieser zeitlich wird. Im Gegensatz zum Zeitdenken des Viṣṇupurāṇa schlägt dieser Text jedoch eine andere radikalere Deutung vor. Zwar wird dieser Gott auch von der individuellen Seele und der Urmaterie sowie letztlich von der ganzen Welt strikt unterschieden (vgl. Vers 26), aber er wird nicht mehr mit Zeit gleichgesetzt, sondern es wird an den Leser appelliert, Gott als über der Zeit stehend (kālātīta) zu begreifen, nachdem zuvor alles als durch die Wirksamkeit der Zeit bestehend dargelegt worden ist: Aus der Zeit entsteht alles, der Zeit-Gott zerstört [alles]. Nirgendwo gibt es etwas, das unabhängig von der Zeit ist. (1) Sich in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft etc. aufgeteilt habend, lässt die Zeit die Lebewesen altern; in dieser Weise überaus mächtig geht sie dahin, überaus große Furcht verursachend. (4) Deshalb ist die Welt unter der Macht der Zeit; nicht die Zeit unter der Macht der Welt; im Gegensatz dazu ist die Zeit unter der Macht Śivas; nicht ist Śiva unter der Macht der Zeit. (9) Vgl. Viṣṇupurāṇa 1.2.24; 26: viṣṇoḥ svarūpāt paratodite dve rūpe pradhānaṃ puruṣaś ca vipra tasyaiva te ’nyena dhṛte viyukte, rūpāntaraṃ tad dvija kālasaṃjñam || 24 || anādir bhagavān kālo nānto ’sya vidyate. avyucchinnās tatas tv ete sargasthityan tasaṃyamāḥ || 26 ||. Zur Wiedergabe des Sanskrittextes vgl. GRETIL (=Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages, abgerufen am 01.03.2022). . 20
326
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Weder stirbt jemand oder wird geboren ohne Zeit, noch erblüht etwas ohne Zeit; weder gibt es Glückliches oder Leidhaftes ohne Zeit, noch gibt es irgendetwas Zeitloses. (22); Zeit ist die Ursache aller Dinge; Pflanzen entstehen und vergehen durch die Zeit; die Welt der lebendigen Wesen entsteht durch die Zeit. (24) Wer in realer Weise die Realität der Zeit erkennt, der sieht, nachdem er sie überwunden hat, das, was über die Zeit hinausgeht. (25) Verehrung dem höchsten Herrn, Śiva, dessen Gestalt wundervoll ist, für den es weder Zeit, noch Bindung und Erlösung gibt, und der weder [identisch mit der] Geistseele und der Urmaterie, noch das alles, [d.h. die Welt] ist. (26)21
Wenn aber die Zeit nun unter die Macht Gottes fällt, ändert sich nicht nur das Weltbild für den Menschen grundlegend, sondern er ist schließlich auch mit theologischen Fragestellungen konfrontiert. Die Zeit ist nun von Gott oder, wie wir sehen werden, von seinem Willen (icchā) abhängig und von seiner unvorstellbaren Kraft (acintyaśakti), die nicht durch Zeit beeinflussbar werden kann. Wenn Gott die Zeit beherrscht, oder ihr übergeordnet ist, dann gefährdet ihre zerstöreri sche Kraft die menschliche Existenz nicht mehr. Von nun an hängt der Mensch vollständig von der zeitbeherrschenden Macht Gottes ab.
21 Vāyavīyasaṃhitā (VII 1.7.7ff.): kālād utpadyate sarvaṃ kāladeva vipadyate | na kālanirapekṣaṃ hi kvacit kiṃ cana vidyate || 1 || bhūtabhavyabhaviṣyādyair vibhajya jarayan prajāḥ | atiprabhur iti svairaṃ var tate ’tibhayaṃkaraḥ || 4 || tasmāt kālavaśe viśvaṃ na sa viśvavaśe sthitaḥ | śivasya tu vaśe kālo na kālasya vaśe śivaḥ || 9 || nākālato yaṃ mriyate jāyate vā nākālataḥ puṣṭim agryām upaiti | nākālataḥ sukhitaṃ duḥkhitaṃ vā nākālikaṃ vastu samasti kiṃcit || 22 || kālaś ca sarvasya bhavasya hetuḥ kālena sasyāni bhavaṃti nityam | kālena sasyāni layaṃ prayāṃti kālena saṃjīvati jīvalokaḥ || 24 || itthaṃ kālātmanas tattvaṃ yo vijānāti tattvataḥ | kālātmānam atikramya kālātītaṃ sa paśyati || 25 || na yasya kālo na ca baṃdhamuktī na yaḥ pumān na prakṛtir na viśvam | vicitrarūpāya śivāya tasmai namaḥ parasmai parameśvarāya || 26 || Zur Wiedergabe des Sanskrittextes vgl. GRETIL (=Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages, abgerufen am 01.03.2022).
327
Marcus Schmücker
2. Die Annahme von Inexistenz, Irrealität oder Ewigkeit der Zeit als Formen ihrer Bewältigung Die hier skizzierte Entwicklung zu einem Monotheismus blieb nicht die einzige Reaktion auf das Fortschreiten der Zeit. Bevor ich wei ter verfolge, wie sich die Beziehung zwischen Gott und Zeit im (mono-)theistischen Vedānta entwickelt, einige Bemerkungen zu alternativ entworfenen Möglichkeiten, dem Fortschreiten der Zeit zu entgegnen. Um der destruktiven Wirkung der Zeit zu entgehen, wird sie entweder als inexistent, als irreal, oder als rein ewig gedeutet. Ohne die differenzierten Lehrmeinungen der buddhistischen Schulen zur Thematik der Zeit zu vereinfachen, fällt auf, nicht nur das Fortschreiten zeitlicher Bestimmungen der Zeit auszuschalten, sondern auch das Wirken der Zeit selbst zum Schwinden zu bringen. Um das deutlich zu machen, lässt sich wiederum an die Beschreibung des Vorgangs des »Kochens« anschließen, dessen Umkehrung ein Vers der buddhistischen Jātakas aufgreift. Es ist kein Gott, der die Zeit kocht, sondern der Erleuchtete, der die zerstörerische Wirkung der alle Wesen kochenden Zeit nochmals aufzehren kann. Der folgende Vers verwendet »Kochen«, um den zeitlichen Prozess zu beschreiben, doch hinzukommt die Verbalwurzel √ghas »verzehren; (auf)fressen«. Die Zeit verzehrt alle Lebewesen einschließlich sich selbst; welches Lebewesen aber die Zeit verzehrt, das kocht den Koch [d.h. die Zeit] aller Lebewesen.22
Die Zeit kocht nicht nur, sondern sie frisst, bzw. im übertragenen Sinne zehrt sie die Lebenszeit des Menschen auf: sie frisst nicht im wörtlichen Sinne Haut oder Fleisch des Menschen, sondern seine »Lebenszeit frisst sie und verbraucht sie, indem sie sie (āyu), ihre Schönheit und Kraft aufzehrt, ihre Jugend zerstört und ihre Gesundheit beschädigt« (api ca kho tesaṃ āyuvaṇṇabalāni khepento yobbaññaṃ maddanto ārogyaṃ vināsento ghasati khādatīti vuccati). Zwei wichtige Aussagen werden hinzugefügt, die weder im Epos noch in den genannten Upaniṣad-Zitaten zu finden sind; die erste ist, dass sich Zeit selbst verzehrt. Der eingangs im Kommentar genannte Bezug der Zeit auf eine frühere (purebhattakālo) oder die spätere kālo ghasati bhūtāni sabbān'; eva sah'; attanā, yo ca kālaghaso bhūto sa bhūtapa caniṃ pacīti. || Jātaka II:188. Zitiert wird der Pāli-Text aus E.W. Cowell, The Jātaka or Stories of the Buddha’s Former Births, 7 vols., New Delhi – Chennai: Asian Educational Services. Reprint of the Edition: Cambridge: University Press 1895–1913. 22
328
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Essenszeit (pacchābhattakālo) wird dahingehend erklärt, dass die Zeit nicht nur den Menschen, sondern sich selbst verzehrt und die frühere Essenszeit daher nicht die spätere erreicht; wesentlicher noch ist, dass in diesem Falle der Erleuchtete selbst die Zeit kocht; so erklärt der Kommentar: »Wer die Zeit verzehrt«, ist ein Epitheton für den Erleuchteten, weil er die Zeit des Wiederwerdens in der Zukunft (āyatiṃ) durch den Edlen Pfad aufbraucht und aufzehrt.23
Ein weiterer Versuch in der buddhistischen Tradition, der Zeit ihre destruktive Wirksamkeit zu nehmen, besteht darin, die Zeit auf den Augenblick (kṣaṇa) zu reduzieren, um zu beweisen, dass es die Zeit selbst nicht gibt. Diese Ansicht – die Leerheit (śūnyatā) der Zeit –, die in den frühen indischen buddhistischen Traditionen entwickelt wird, widerlegt die Existenz der Zeit, insofern sich nicht beweisen lässt, dass zeitliche Bestimmungen in einer einzigen Grundlage »Zeit« vorkom men können. Der Mensch leidet nicht mehr unter dem Fortschreiten der Zeit, wenn bewiesen ist, dass es die Zeitmodi »Vergangenheit«, »Gegenwart« und »Zukunft« und daher auch die Zeit selbst als ihre Grundlage nicht geben kann. Ein weiteres Beispiel: Das Fortschreiten der Zeit lässt sich auch als eine Macht/Kraft der Zeit (kālaśakti) denken; diesen Gedanken entwickelt der Sprachphilosoph Bhartṛhari (5. n. Jh.); ihm gemäß agiert die Zeit scheinbar eigenständig, wird aber in Wirklichkeit dem absoluten, zeitlosen brahman untergeordnet. Durch die Macht/ Kraft der Zeit, erscheinen die weltlichen Objekte, die menschlichen Handlungen, und besonders die Sprache, in einer Abfolge (krama). Die Kraft der Zeit wird also nicht geleugnet. Jedoch erscheint die Zeit lediglich in einer Abfolge; sie ist aber selbst nicht identisch mit dieser Abfolge. Wenn wir diese Unterscheidung nicht machen und Zeit selbst als ausschließlich für abfolgend halten, dann nur, weil wir infolge unseres Nichtwissens (avidyā) zeitliche Abfolgen und wahre Natur der Zeit miteinander verwechselt haben. Einen weiteren Schritt, Zeit in ihrer Wirkung einzuschränken, vollzieht die Tradition des Advaita-Vedānta; hier wird Zeit mit ihren zeitlichen Bestimmungen in den Bereich des irrealen Nichtwissens (avidyā) verlegt und im Falle des unmittelbaren Gewahrwerdens 23 yo ca kālaghaso bhūto ti khīṇāsavassa'; etaṃ adhivanam so hi ariyamaggena āyatiṃ paṭisandhikālaṃ khepetvā khāditvā. Ebd.
329
Marcus Schmücker
des brahman aufgelöst.24 Das Erlösungsziel ist frei von zeitlicher Abfolge;25 eine an der Zeit orientierte Beschreibung bleibt, wenn das Selbst als reine Gegenwart (vartamānatva) ohne Vergangenheit und Zukunft beschrieben wird. Dabei wird ein anderer wichtiger Aspekt entwickelt, um zeitliches Fortschreiten zu bewältigen; man reflektiert, dass zeitliche Veränderungen bewusst wahrgenommen werden, ohne dass das wahrnehmende Subjekt, d.h. Selbst/der Agens sich dabei verändert; vielmehr ist es sich (zeitfrei) bewusst, dass es durch die Erkenntnis zeitlicher Veränderungen hindurch stets dasselbe/derselbe unveränderte Selbst/Agens des Erkennens bleibt. Das Selbst/der Agens des Erkennens wird mit einer bleibenden Gegenwart gleichgesetzt. Das Erkennen des Selbst hat keine Abfolge; Śaṅkara, ein früher Lehrvertreter dieser Tradition drückt dies in seinem Kommentar zu den Brahmasūtren so aus: In solcher Weise bin ich es, der jetzt ein gegenwärtiges Ding erkennt; ebenso erkannte ich ein vergangenes und ein noch weiter in der Vergangenheit liegendes Ding, und ich werde ein zukünftiges Ding erkennen und eines, das noch weiter in der Zukunft liegt, daher gibt es für den Erkenner (d.h. ewige das Selbst) keine Veränderung, insofern es seiner Natur nach allzeit (bleibende) Gegenwart ist, auch wenn Veränderungen als etwas Vergangenes, Zukünftiges, Gegenwärtiges zu erkennen sind.26
Für Śaṅkaras Schüler Sureśvara kann die Dreiheit zeitlicher Bestim mungen der Zeit nicht mehr Ursache der Welt sein, weil sie nicht aus dem brahman, sondern ausschließlich aus dem Nichtwissen hervor geht.27 24 Vgl. für die späteren Vertreter des Advaita-Vedānta wie Śrīharṣa, Citsukha, and Madhusūdhana Sarasvatī auch: J. Duquette, K. Ramasubramanian, »Śrīharṣa on the Indefinability of Time«. 25 Vgl. dazu L. C. Orr, »The Concept of Time in Śaṅkara’s Brahmasūtra-Bhāṣya«. 26 Śaṅkaras Brahmasūtrabhāṣya zu Brahmasūtra 2.3.7: tathāham evedānīṃ jānāmi vartamānaṃ vastv aham evātītam atītataraṃ cājñāsiṣam aham evānāgatam anāgatataraṃ ca jñāsyāmīty atītānāgatavartamānabhāvenānyathābhavaty api jñātavye na jñātur anyathābhāvo 'sti, sarvadā vartamānasvabhāvatvāt. Für die Wiedergabe des Sanskrittext wurde verwendet: Brahmasūtra-Śaṅkarabhāṣyam. With the comm. Bhāṣyaratnaprabhā of Govindānanda, Bhāmatī of Vācaspatimiśra, Nyāyanirṇaya of Ānandagiri. J. L. Shastri (Ed.). Delhi: Motilal 1980. 27 Sureśvara’s, Taittirīyopaniṣadbhāṣyavārttika, Vers 147 (Brahmavalli): »Die Dreiheit der Zeit ist nicht die Ursache der Welt, weil sie aus dem Nichtwissen hervorgeht« (kālatryasyāvidyāyāḥ samutthānād ahetutā). Zu Sanskrittext und Übersetzung vgl. The Taittirīyopaniṣadbhāṣya-Vārtika of Sureśvara. Edited with introduction, English
330
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Auch der kaschmirische Śaivismus deutet die Zeit als Ursache für einen vom Bereich des reinen Bewusstseins getrennten Ablauf.28 Im Gegensatz zur Auffassung, das Fortschreiten der Zeit für etwas Unwirkliches zu halten, entwickelte die Schule des NyāyaVaiśeṣika eine andere Ansicht: die Zeit selbst wird mit einer zeit losen Ewigkeit gleichgesetzt. Damit wird die Zeit strikt von ihrer Zeitlichkeit getrennt, so dass sie paradoxerweise zu einer »zeitlo sen Substanz«29 wird; Zeitmaße sind nur limitierende Bedingungen (upādhi), die sekundär hinzutreten. Die Zeit selbst wird zu einer unveränderlichen und ewigen Substanz (dravya). Der gefährliche Aspekt des unabänderlichen Fortschreitens wird mit diesem Konzept der zeitlosen Ewigkeit ausgeblendet. Diese Auffassung beeinflusst die Lehre von einem höchsten Gott im Nyāya-Vaiśeṣika, der mit diesem Konzept einer zeitlosen Zeit gleichgesetzt wird. Die Auffassung von Zeit sowie die Gotteslehre dieser Schule sind aus der Sicht des theistischen Vedānta kritisierbar; dies soll im Folgenden noch deutlicher dargestellt werden. Zunächst muss jedoch festgehalten werden, dass es verschiedene Formen der Zeitbewältigung gibt, die miteinander in Widerspruch treten. Dabei fällt auf, dass die Zeit, obwohl sie in der Funktion ihrer Herrschaft relativiert wird, nicht verschwindet. Sie besteht weiterhin, insofern die Tatsache ihrer Existenz stets vorausgesetzt werden muss, wenn man versucht, sie zu negieren oder in ihrem Wirken aufzuhe ben. Ihre Unhintergehbarkkeit spielt aber auch dann eine Rolle, wenn ihr ein göttliches Wesen übergeordnet wird. Zwar steht das göttliche Wesen über der Zeit, doch keine Zeit anzunehmen, würde auch die Annahme eines Gottes sinnlos machen. Schließlich stellt sich die Frage, die am Beispiel zweier Lehrvertreter des theistischen Vedānta diskutiert werden soll: Wie kann Gott mit einer zeitlichen Bestim trans., annotation and indices by R. Balasubramanian. Madras: Radhakrishnan Insti tute for Advanced Study in Philosophy, 1984, S. 348. 28 Vgl. dazu B. Bäumer, »Sun, Consciousness and Time: The Way of Time and the Timeless in Kashmir Śaivism«, S. 74 f. Bäumer verweist vorwiegend auf das sechste und siebte Kapitel des Tantrāloka (vgl. u.a. VI 30; 179 180; 182–183; VII 21–25; VII 62–63). Betont wird in dieser Tradition besonders das begrenzende und einschrän kende Wirken der Zeit, das überwunden werden muss, bis hin zum Aufhören der Atembewegung: Bäumer bemerkt, ebd., 75: »Thus when the movement of breath stands still, Time itself ceases and with it the fragmented knowledge. At that moment pure consciousness shines forth without separation.« 29 Vgl. dazu W. Halbfass, On Being and What There Is. Classical Vaiśeṣika in the His tory of Indian Ontology, S. 221.
331
Marcus Schmücker
mung vereinbart werden, ohne dass diese zeitliche Bestimmung die destruktive Wirkung der Zeit bedeutet?
3. Gott und der Zeitpunkt der Schöpfung (sṛṣṭikāla) im theistischen Vedānta Zu den Vertretern der ersten zu dieser Thematik zu behandelnden Schule des theistischen Vedānta gehören Madhva (1238–1317) sowie sein Schüler und Kommentator Jayatīrtha (1345–1388). Madhva, der Begründer der sogenannten Schule des Dvaita-Vedānta, vertrat ein dualistisches Konzept begründet durch die Differenz zwischen Gott und Welt. Beide stehen sich allerdings nicht unvermittelt einan der gegenüber. Die Welt sowie die einzelnen Seelen sind von Gott abhängig (paratantra). Gott selbst ist unabhängig (svatantra) und frei von Zeit. Der Vertreter der zweiten hier behandelten vedāntischen Rich tung, ist Veṅkaṭanātha (1268–1369). Im Gegensatz zu Madhvas dualistischem Konzept von Gott und Welt, übernimmt und entwickelt Veṅkaṭanātha eine Gottlehre, welche eine relationale Einheit mit der Welt vertritt. Beide Traditionen verehren denselben Gott, Viṣṇu-Nārāyaṇa, aber ihre Ansichten über diesen Gott und die Ontologie der Welt unterscheiden sich. Beide denken darüber nach, wie die Beziehung Gottes zur ewigen Zeit am Anfang der zeitlich einsetzenden Schöp fung (sṛṣṭi) zu erklären sei und übernehmen die Ansicht, dass Gott die Welt nach einer Ruhezeit, der Zeitphase ihrer Auflösung (pralaya), erneut manifestiert. Beide bestimmen Zeit als anādipravāha, als »ein anfangsloses Dahinfließen«. Daher ist für beide Autoren auch die Zeit (kāla) nicht nichts, wenn die Welt im Zustand ihrer Auflösung besteht, vielmehr ist sie von einem einzigen (höchsten) Gott abhän gig, der die Welt in der konkreten Zeit der Schöpfung (sṛṣṭikāla) erneut zu manifestieren vermag. Madhva und Veṅkaṭanātha haben einen gemeinsamen theolo gischen Gegner, wenn sie diese Thematik erörtern. Dieser Gegner heißt Udayana (10.Jh.) und vertritt die oben genannte Lehre des Nyāya-Vaiśeṣika. Udayana lehrt allerdings ganz anders als in den
332
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
beiden angeführten Traditionen des Vedānta, Gottes Abhängigkeit30 von der Zeit: die Zeit selbst ist nicht durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bestimmt, sondern ihre Zeitmodi sind erst durch die erwähnten zusätzlichen und die reine Zeit einschränkenden Bedin gungen (upādhi) gegeben. Gemeinsam ist Madhva und Veṅkaṭanātha die Auffassung, dass das wichtigste Prinzip der Wille Gottes (īśvarecchā) ist. Beide definie ren diesen göttlichen Willen als eine für den Menschen unvorstellbare Kraft (atarkya-, acintyaśakti). Ihre Auffassung von Ewigkeit ist jedoch nicht dieselbe. Für Veṅkaṭanātha ist es kein Widerspruch zur Ewigkeit Gottes, wenn zeitliche Bestimmungen Gottes ewiges Erkennen spezifizieren. Das bedeutet, dass Gott selbst etwas erkennen kann, das zeitliche Bestim mungen hat, und dass zeitliche Bestimmungen in seinem Erkennen gegenwärtig sein können. Im Gegensatz dazu denkt Madhva die Ewigkeit Gottes als über der Zeit stehend. Nach seiner Auffassung, wie auch gemäß der seines Schülers und Kommentators Jayatīrtha, vermag ein solcher Gott im anfangslosen Fließen (pravāha) der Zeit,31 eine zeitliche Spezifizierung (viśeṣa) kraft seiner unvorstellbaren Macht zu setzen.
4. Madhva über die Beziehung von Gott und Schöpfungszeit Madhva und Veṅkaṭanātha kritisieren die Bestimmbarkeit der Zeit durch zusätzliche limitierende Bedingungen (upādhi) und überden Ich folge G. Chemparathy, An Indian rational Theology. Introduction to Udayana’s Nyāyakusumāñjali, wenn er sagt (S. 148): »As in his creation, Īśvara is dependent here, too, upon factors extraneous to him, especially the particular Time (kālaviśeṣaḥ), which is said to be one hundred Brahmā-years.« Vgl. auch ebd., S. 140: »The fact that Īśvara creates the universe according to certain conditions that are beyond his own choice makes his activity dependent (sāpekṣa-). […] the Creator is here reduced to a mere director who, endowed as he is with eternal omniscience, causes the pre-existing causes to start at the appointed time their combining action and directs it until the visible universe comes into being. “. 31 Von sich aus hat die Zeit keine Bestimmung; vgl. Anuvyākhyāna II.3.17 (2,2.162 – 164): kālapravāha evaiko nityo na tu viśeṣavān. Das Fortschreiten der Zeit ist unauf haltsam wie S. Siauve bemerkt in La Doctrine de Madhva. Dvaita-Vedānta (S. 157): »Il est un écoulement, un flot, pravāha, sans interruption, nirantara. Cette continuité est ici encore signe d’infinité: on ne peut pas plus penser l’absence du temps à l’intérieur de son cours qu’on ne peut la penser au-delà de lui.« 30
333
Marcus Schmücker
ken sie in ihrer Funktion. Madhva versteht sie als eine Spezifizierung (viśeṣa) der Zeit und betont die Realität einer solchen. Darüber hinaus zeigt er, dass das Fortschreiten der Zeit zwar geschieht, aber es bedeutet nicht, dass sich die Zeit von selbst in ihre spezifischen Zeiteinheiten teilt; eine bestimmte oder konkrete Zeit im anfangslo sen Fluss der Zeit (kāle) kann nur durch Gottes unvorstellbare Kraft (acintyaśakti) eintreten. Madhvas greift also die Frage auf, ob ein solcher Gott in der Lage ist, eine zeitliche Wirkung hervorzubringen. Wenn Gott nach der Zeit der Auflösung (pralaya) tätig wird, wäre es widersprüchlich, wenn Schöpfung eine zeitliche Wirkung innerhalb einer Ewigkeit wäre. Daher ist die entscheidende Frage, wie es möglich ist, dass ein ewiger Gott, um eine Wirkung (kārya) zu erzeugen, eine konkrete Zeitphase, d.h. die konkrete Zeit der Schöpfung (sṛṣṭikāla) »innerhalb« einer Ewigkeit erschaffen kann? Für Madhva hat die Zeit als anfangsloses Dahinfließen eine eigene Dynamik. In seinem Verständnis der Welterschaffung grenzt er sich von Udayanas Ansicht ab. Für ihn ist die Annahme mög lich, dass eine Wirkung aus Nichtseiendem entsteht (ārambhavāda/ asatkāryavāda). Madhva kritisiert diese Auffassung, insofern hier für Gott ausschließlich ein ewiger Wille (nityecchā) angenommen wird. Es ist daher widersprüchlich, wenn man behauptet, dass Gott zu Beginn (ārambha) der Schöpfung (sṛṣṭi) eine zeitliche Wirkung hervorbringen kann. Nach dem Verständnis der Lehre des NyāyaVaiśeṣika wird für Udayana das Universum während der Periode der Auflösung (pralaya) auf kleinste nichtwahrnehmbare Einheiten, d.h. Atome reduziert; sie sind letzte Ursachen. Atome einer Substanz müssen sich verbinden, um eine Dyade von Atomen (dvyaṇuka) zu bilden: drei Dyaden, die eine Triade von Atomen (tryaṇuka) bilden, sind die erste sichtbare Wirkung nach der Periode der Auflösung (pralaya). Die Verbindung dieser Atome mit dem individuellen Selbst, der Seele, geschieht durch den Willen Gottes. Während der Zeitphase der Auflösung existieren die Atome der Substanzen zusammen mit anderen ewigen, unverursachten Entitäten, wie dem individuellen Selbst, dem »Unsichtbaren« (adṛṣṭa), das definiert wird als eine aus guten und schlechten Handlungen bestehende Kraft der individuellen
334
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Seelen sowie ihren Erinnerungseindrücken (saṃskāra) und anderen ewigen Entitäten.32 Madhva und sein Kommentator Jayatīrtha kritisieren nun, dass diese Lehre nicht erklären kann, wie Gott eine zeitliche Wirkung hervorbringt, ohne dass dafür nicht etwas Ewiges vorausgesetzt haben zu müssen. Denn die kleinsten Einheiten (paramāṇu), die guten und schlechten Taten der Seelen (adṛṣṭa) sowie die Zeit (kāla) sind eben falls ewig. Wie aber kann Gott etwas Nicht-Ewiges hervorbringen, wenn sein Wille ausschließlich ewig ist? Wie sollte aus einer Ewigkeit eine zeitliche Wirkung entstehen? Nimmt man aber nicht an, dass Gottes Wille ewig (nitya) ist, dann wäre Gott nicht unabhängig von der Zeit. In den folgenden Versen seines Anuvyākhyāna33 (=Anuv) argumentiert Madhva, dass Gott zwar einen ewigen Willen hat, sein dynamisches Prinzip hingegen liegt aufgrund seiner Fähigkeit, alles verwirklichen zu können, jenseits des menschlichen Vorstellungsver mögens. Madhva skizziert die Position seines Gegners und kontras tiert sie mit seiner eigenen Ansicht: Gottes ewiger Wille vermag die Schöpfung zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen zu lassen. Die Zeit wird beherrscht, weil Gott sie mit seiner unvorstellbaren Kraft spezifizieren kann. Der Gott des Nyāya-Vaiśeṣika vermag hingegen keine zeitlichen Spezifizierungen in der ewigen Substanz Zeit bewir ken: Weil der Wille des höchsten Herrn ewig ist, insofern Atome immer [ewig] existieren, und weil das »Unsichtbare« (adṛṣṭa) und die Zeit [ewig] existieren, würde eine Wirkung [verursacht durch den ewigen Willen des Herrn] zu allen Zeiten [d.h. ewig] existieren (2,2.162). Denn in dieser Lehre [des Vaiśeṣika] gibt es keine besondere Unter scheidung in der Zeit, hingegen geschieht gemäß unserer Meinung [eine solche Spezifizierung der Zeit] durch Haris ewigen Willen, der mit der Schöpfung zu einer bestimmten Zeit beginnt (2,2.163). Und ausschließlich die Spezifizierungen der Zeit stehen ewig unter der Macht von Haris Willen, denn in der autoritativen Überlieferung (śruti) selbst [i.e. Mahānārāyaṇa Upaniṣad I.8] heißt es: »Jede momen tane Einheit« (2,2.164). Für eine Zusammenfassung der Vaiśeṣika-Schöpfungstheorie vgl. das 4. Kapitel in S. P. Kumar, Categories, Creation and cognition in Vaiśeṣika Philosophy, S. 60‒63. 33 Für die Wiedergabe des Sanskrittextes des Anuvyākhyāna wird die Edition: Works of Sri Madhwacharya. Sarvamūlagranthāḥ, Prasthānatrayī, saṃpuṭa 1. Ed. by B. Govindacharya. Udipi 1969, verwendet.
32
335
Marcus Schmücker
Auch seine Rede: »Er manifestiert die Kraft, die als Zeit bezeichnet wird«, ist kein Widerspruch, insofern die Zeit durch die Zeit voran geht (2,2.165).34
Mit dem letzten Vers bezieht sich Madhva auf die Zeit als ewig dahin fließend. Er betont, dass Zeit, auch wenn sie nicht von Gottes Willen unabhängig (tadgata, tadādhāra) ist, auf sich selbst beruht. Dieser Gedankengang wird auch in den nächsten Versen (2,2.166 – 168) weitergeführt: die Zeit »verweist auf sich selbst« (svoddiṣṭa), oder die Zeit »ist von sich selbst aus herbeigekommen« (svagata, svagatat vena). Die Implikation ist, dass der anfangslose und endlose Fluss der Zeit unaufhaltsam, unabhängig und daher von sich aus dahinfließt. Dies geschieht, ohne dass der Mensch dies beeinflussen kann. Der Mensch ist machtlos. Er kann den Fluss der Zeit nicht unterbrechen. In Bezug auf Gott bedeutet dies, dass, wenn die Zeit bereits immer schon dahinfließt, für ihn nur eine instrumentelle Ursache notwendig ist, keine materielle. Die Frage nach der Erschaffung der Zeit stellt sich nicht. Madhva setzt den Zeitfluss voraus. Es ist daher die Tatsache, dass Zeit existiert, d.h. dass Zeit fließt, die Gott die Möglichkeit gibt, mit der Schöpfung erneut zu beginnen. Die folgenden Verse können so verstanden werden, dass Gott aufgrund seiner Allmacht die Schöpfung bzw. die Zeit der Schöpfung selbständig beginnen kann, weil die Zeit als anfangsloser Zeitfluss immer schon gegeben und wirksam ist.. Dadurch wird Gott in die Lage versetzt, zeitliche Spezifizierungen in der Zeit zu manifestieren. So fährt Madhva fort: Deshalb wünscht der Herr fortwährend die Erschaffung dieser [bestimmten] Zeit, weil die Zeit [selbst] von sich aus geht, [indem Gott denkt]: »Dann mag diese [bestimmte] Zeit eintreten« (2,2.168). Es ist nur aufgrund von [Gottes] eigener göttlicher Natur, dass [sein] Wille dieser ist, denn die maßgebliche Stelle der autoritativen Überlie ferung sagt: »Dies ist die [eigene Natur] Gottes« (Māṇḍūkya Upaniṣad Anuv 2,2.162 – 165: nityecchatvāt pareśasya paramāṇusadātvataḥ | adṛṣṭakālayoś caiva bhāvāt kāryaṃ sadā bhavet || 2,2.162 na hi kālavibhedo ’sti tatpakṣe 'smanmate hareḥ | viśeṣakāla evaitatsṛṣṭyādīcchā sadātanī || 2,2.163 viśeṣāś caiva kālasya harer icchāvaśāḥ sadā | sarve nimeṣā iti hi śrutir evāha sādaram || 2,2.164 udīrayati kālākhyaśaktim ity asya vāg api | kālasya kālagatvena na virodho ’pi kaś cana || 2,2.165 ||.
34
336
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Kārikā 1.9). Es wurde bereits gesagt, dass auch die eigene Natur [d.h. die der Zeit] vom Willen des Höchsten abhängt (2,2.169).35
Wie aber ist Gottes Macht mit einer Spezifizierung (viśeṣa) in der Zeit verbunden, und wie ist die Zeit selbst mit ihrer Spezifizierung verbunden? Soweit sich aus diesen Versen sagen lässt, existiert für Madhva die Zeit von sich aus. Um aber eine bestimmte Zeit zu sein, um spezifiziert (viśeṣa) zu sein, bedarf sie der Macht Gottes. Daher erklärt Madhva, dass die Zeit, die Urmaterie und die Seelen aufgrund einer von Gott abhängigen Spezifikation (īśādhīnaviśeṣeṇa) entstehen (janyā). Jayatīrtha, in der Tradition Madhvas Nachfolger und Kommentator seiner Werke, führtdiesen Gedanken weiter aus und macht besonders deutlich, dass die Spezifizierung der Zeit erst hervorgebracht werden muss, gleichwohl Zeit selbst immer schon gegeben ist.. Er beschreibt den Vorgang als ein Hervorbringen von etwas, das vorher nicht manifest geworden ist (abhūtvābhavanam). Auch ein solches Hervorbringen beruht auf der unvorstellbaren Kraft Gottes.
5. Veṅkaṭanātha über das Verhältnis Gottes zur Zeit Der Gott Madhvas und Jayatīrthas vermag aus einer zeitlosen Ewig keit heraus zu erschaffen. Das Dahinfließen (pravāha) der Zeit wird unter eine göttliche Macht gebracht. Eine andere Möglichkeit, Zeit und Gott zu verbinden, schlägt Veṅkaṭanātha vor. Beide sind für ihn nicht identisch, aber da sie beide als all-durchdringend (vibhu) bestimmt werden, könnte man dies schlussfolgern. In seinem Tattva muktākalāpa (=TMK)36 diskutiert Veṅkaṭanātha, wie sich Gott und Zeit unterscheiden lassen. Sein Opponent vertritt zunächst die Mei nung, dass Gott und Zeit nicht voneinander unterschieden werden. Im Gegenzug legt Veṅkaṭanātha dar, dass Gott der Innere Lenker Anuv 2,2.168 – 2,2.169: tatkālasṛṣṭim evāto vāñchatīśaḥ sadaiva hi | syāt kālaḥ sa tadaiveti kālasya svagatatvataḥ || 2,2.168 || svabhāvād eva hīcchaiṣā devasyaiṣa iti śruteḥ | svabhāvo ’pi pareśecchāvaśa ity uditaḥ purā || 2,2.169 ||. 36 Für die Wiedergabe des Sanskrittextes des Tattvamuktākalāpa und des Kommen tares (Sarvārthasiddhi), wird die Edition: Srimad Vedanta Desika’s Tattvamuktaka lapa and Sarvartha Siddhi with Sanskrit Commentaries. Ed. by Uttamūr Śrīvātsya Vīrarāghavācārya, Madras: Ubhayavedāntagranthamālā 1973, verwendet. 35
337
Marcus Schmücker
(antaryāmin) von allem, und damit auch der alles durchdringenden Zeit ist. Daher ist keine Identität impliziert, auch wenn beide die gleichen Eigenschaften haben, denn als Innerer Lenker ist Gott auch die Grundlage der Zeit. [Einwand:] »Ich bin die Zeit« [Bhagavadgītā 11.32] – so lautet sein eigener Gesang [über sich (d.h. Gott) selbst]; die meisten vertrauens würdigen Menschen sagen, dass der Herr die Zeit ist; er ist die Ursache von allem, ewig, alldurchdringend, das Höchste. Warum sollte man etwas anderes [annehmen]? [Antwort:] Das ist nicht der Fall, denn [der Herr] ist der Innere Lenker der Zeit usw. Er wird in der Tat [als Zeit] verherrlicht. Wenn jedoch ein Unterschied [zwischen Gott und Zeit] angenommen wird, dann ist die Tatsache, dass beide die gleichen Eigenschaften haben, kein Grund dafür, ihre Einheit (aikya) [anzunehmen], denn [die Zeit] ist, wie andere [Dinge,] anders als der Herr, verherrlicht als seine Manifestation (tadvibhūtiḥ).37
Veṅkaṭanāthas Verständnis von Zeit weicht von Madhvas und Jayatīrthas Ausführungen erheblich ab. Er lehrt eine ewige Substanz mit zeitlich unterschiedenen, aber von ihr untrennbaren Zuständen. Eine Substanz (dravya) ist in ihrer eigenen Form (svarūpa) ewig, d.h. sie ist zeitlos; zugleich ist sie aber auch nicht-ewig (anitya), insofern ihr anfangslos dahinfließende Zustände zukommen müssen. Wie aber kann ein und dieselbe Entität zugleich ewig und nicht-ewig sein? Für Veṅkaṭanātha findet in der Abfolge von zeitlichen, nicht-ewigen Zuständen Veränderung statt. Die Zeit als unvergängliche Substanz ist der Grund dafür, dass die Welt ewig existiert und sich zugleich verändern kann. Wie der oben zitierte Vers (TMK 1.66) deutlich ausspricht, ist die Zeit von Gott als ihrem Inneren Lenker (antaryāmin) abhängig und wird von ihm durchdrungen (vyāpya). Wenn sie aber als alldurchdrin gend (sarvavibhu) definiert wird und als eine eigenständige Substanz angenommen wird, dann ist es widersprüchlich, zu behaupten, dass sie von einer anderen Substanz durchdrungen wird. Eine Erklärung dazu findet sich in einer kurzen Passage von Veṅkaṭanāthas Sarvārtha siddhi (=SAS), wo er den Vers 69 im ersten Kapitel seines TMK selbst kommentiert. Hier geht er auf den Widerspruch zwischen dem 37 TMK 1.66: kālo ’smīti svagītā, kathayati bhagavān kāla ity āptavaryo hetuḥ sarvasya nityo vibhur api ca paraḥ, kiṃ pareṇeti cen. na, kālāntaryāmitādeḥ. sa khalu samuditaḥ. saṃpratīte tu bhede sādharmyaṃ naikyahetuḥ, sa hi tad itaravad ghoṣitas tadvibhūtiḥ.
338
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
alles durchdringenden Höchsten (ekasya sarvavyāpakatvam) und der alles durchdringenden Zeit ein. Die Zeit kann von Gott durchdrungen werden, aber sie kann Gott nicht durchdringen. Aus diesem Grund greift Veṅkaṭanātha die oben erwähnte metaphorische Beschreibung der Zeit im Mahābhārata (MBh), die alle Wesen kocht (kālaḥ pacati bhūtāni), erneut auf, um deutlich zu machen, dass Gott die Zeit durchdringt und dass die Zeit an dem himmlischen Ort, wo Gott selbst weilt, nichts mehr zerstören kann. Und die Durchdringung [der Zeit] durch den Herrn wird mit folgenden Worten begründet: »Er kocht die Zeit; keine Zeit ist dort [in der ewigen Manifestation des Herrn], dort ist der Herr allein [MBh 12.25.9]«; ›dort‹ [d.h. in seiner ewigen Manifestation] gibt es keine Veränderun gen, die durch die Zeit festgelegt werden, wie es bei der Manifestation der Urmaterie (triguṇa) der Fall ist. Dass die Zeit die Ursache von allem ist, entweder weil sie die materielle Ursache ihrer eigenen Modifikatio nen ist, oder weil sie die instrumentelle Ursache für alles andere ist, wird mit Worten wie: »Die Zeit kocht alle Wesen« [ausgedrückt].38
Aus dieser Passage, insbesondere aus dem Zitat, dass die Zeit alle Wesen kocht, könnte man den Schluss ziehen, dass die Zeit noch eine eigene, von Gott unabhängige, alles beherrschende Wirksamkeit hat. Veṅkaṭanātha lässt jedoch keinen Zweifel daran, dass die Zeit unter Gottes Herrschaft steht; wo immer sie wirksam ist, ist sie von Gott durchdrungen und ihm untergeordnet: Da es, wo immer es Zeit gibt, in allen Fällen das höchste Selbst [, d.h. Gott vorauszusetzen] ist, durchdringt [das höchste Selbst] die Zeit, und dieses [Durchdringen der Zeit] ist auch in Bezug auf Gottes Erkennen festzustellen, das seine Eigenschaft39 ist.40
Wenn also Gott die Zeit durchdringt, und die Zeit als alldurchdrin gende Substanz ewig existiert, dann muss auch Gott die Zeit ewig durchdringen. Und weil die Zeit zu Gottes Körper (śarīra) gehört, aus 38 SAS (215,7–9) ad TMK 1.69: vyāptiś ca –›kālaṃ sa pacate tatra na kālas tatra vai prabhuḥ‹ ityādibhis siddhā. triguṇavibhūtivatkālapratiniyatavikārās tatra na santīty arthaḥ. svavikārāṇām upādānatayānyeṣāṃ nimittatayā vāsya sarvahetutvaṃ ›kālaḥ pacati bhūtāni‹ ityādibhir gamyate. 39 Zur Auffassung Veṅkaṭanāthas, dass das göttliche Erkennen eine Beschaffenheit Gottes ist, vgl. M. Schmücker, »Soul and Qualifying Knowledge (Dharmabhūtajñāna) in the Later Viśiṣṭādvaita Vedānta of Veṅkaṭanātha«. 40 SAS (215,13–14) ad TMK 1.69: ato yatra kālas tatra sarvatra paramātmāstīti tasya kālavyāpakatvam idaṃ ca tasya dharmabhūtajñāne ’pi draṣṭavyam.
339
Marcus Schmücker
dem die Welt besteht, sind auch Gott und Zeit untrennbar. Wenn nun aber – wie in dem Zitat erwähnt – auch Gottes Erkennen die Zeit durchdringt, dann muss dargelegt werden, wie es möglich ist, dass es durch zeitliche Zustände bestimmbar ist. Wie aber ist es möglich, dass einander sich ausschließende, zeitliche Zustände in ein und derselben Grundlage, dem ewig-göttlichen Erkennen, bestehen können? Wie aber löst Veṅkaṭanātha den Widerspruch zwischen einem zeitlich bedingten Zustand und dem göttlich-zeitlosen Erkennen auf?
6. Gottes Erkennen (dharmabhūtajñāna) und seine zeitlichen Bestimmungen Veṅkaṭanātha beschreibt Gottes Erkennen (dharmabhūtajñāna) in Bezug auf die Zeit ausführlich in Vers 76 des dritten Kapitels (nāyaka sara) des TMK und in seinem eigenen Kommentar (=SAS) zu diesem Vers. Hier äußert er sich über die unterschiedlichen Zustände des göttlichen Erkennens, die als zeitliche gedeutet werden. Er nennt sie ullekha, wörtlich »Einritzung«, was ich mit »mentalem Eindruck« wie dergebe. Analog zur Abfolge von Zuständen (avasthāsantati) der Sub stanz spricht er von der »Abfolge mentaler Eindrücke« (ullekhasan tati) des göttlichen Erkennens, das allwissend sein muss, wenn es die Welt erschaffen will. Gottes notwendige Allwissenheit (sarvajñatva) befindet sich aber im Einklang mit der Zeit. Die Zeit ist auch hier nicht mehr durch ihre zerstörerische Wirkung bestimmt,, vielmehr ist ihr Fortschreiten, bzw. »anfangsloses Dahinfließen« zeitlicher Bestim mungen notwendig, damit Gott die Welt erneut manifestieren kann. Um die Welt neu zu erschaffen, müssen in Gottes einem Erkennen die unterschiedlichen Zeitbestimmungen wie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereinbart werden können. Wenn aber Gottes Erkennen durch unterschiedliche zeitliche Bestimmungen charakterisiert ist, wie kann es dann ein ewiges Erkennen sein? In seinem eigenen Kommentar zu den Versen des Tattva muktākalāpa bezieht sich Veṅkaṭanātha zunächst auf einen Einwand, der auf den Widerspruch zwischen den zeitlichen Modi eines Objekts und dem einen ewig-göttlichen Erkennen verweist. Für den Oppo nenten können mentale Eindrücke nicht zu verschiedenen Zeiten in dem einen Erkennen Gottes auftreten. Gott kann daher weder etwas in der Vergangenheit noch etwas in der Zukunft erkennen, denn vergangene und gegenwärtige Zustände lassen sich nicht in ein
340
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
und derselben Grundlage vereinen. Falls er Zukünftiges kennt, wäre es für den Opponenten eine irrtümliche Erkenntnis, weil zeitliche Bestimmungen gleichzeitig eintreten müssten. Im Vers (TMK 3.76) bezieht sich Veṅkaṭanātha auf die Abfolge mentaler Eindrücke (ullekhasantati), die einen Unterschied (bheda) in dem göttlichen Erkennen erzeugen. Gott erkennt also zeitlich Bedingtes. Die einheitliche Form von Gottes Erkennen impliziert nicht, dass er nur einen einzigen Eindruck (ekollekha) hat. Für den Gegner kann, sobald ein Eindruck (ullekha) in Gottes Erkennen eintritt, kein weiterer Eindruck folgen, wenn man wie Veṅkaṭanātha annimmt, dass das Erkennen nur eine Form (aikarūpya) hat. Aber Gott muss, um allwissend zu sein, Veränderungen erfassen, indem er sowohl den gegenwärtigen (vartamānāvasthā), als auch den vergangenen Zustand (bhūtāvasthā) von etwas erkennt: [Einwand]: Was als zukünftig erkannt wird, wird [im Laufe der Zeit] gegenwärtig und hat dann eine Form, die vergangen ist. Daher gibt es einen Unterschied des Eindruckes (ullekhaḥ) [von einem anderen Eindruck] im Falle [der Erkenntnis] jener Entität. [Antwort:] Die Einheit der Form (aikarūpyaṃ), die nicht von den Sinnen erzeugt wird, dürfte [einem solchen Einwand] widersprechen. [Einwand:] Das Erkennen von etwas Zukünftigem wäre ein Irrtum, wenn der vorausgehende (wörtl. ältere) mentale Eindruck (pracīnol lekha) selbst, der vergangen ist, weiter fortbesteht [und nicht verge hen] würde. [Antwort:] Das ist nicht der Fall, weil mentalen Eindrücke, die durch die Abfolge von früher und später festgelegt sind, ewig existieren.41
Wie kann Erkennen, das nur eine Form hat (aikarūpya), durch eine Abfolge von Zuständen (avasthāsantati) bestimmt sein? Zeitliche Zustände eines Objekts (avasthātrayavati vastuni) entsprechen drei zeitlichen mentalen Eindrücken im Erkennen Gottes. Ein Objekt im zukünftigen Zustand erzeugt einen Eindruck von Zukünftigem; ein Objekt im gegenwärtigen und vergangenen Zustand erzeugt Eindrücke von etwas Gegenwärtigem oder etwas Vergangenem. Aber ein vergangener Eindruck (prācīnollekha) kann nicht, wie hingegen 41 TMK 3.76: yad bhāvitvena buddhaṃ, bhavati tad, atha cātītarūpaṃ. tad asminn ullekho bhidyate cet, akaraṇajamater aikarūpyaṃ prakupyet. prācīnollekha eva sthita vati tu gate bhāvibuddhir bhramaḥ syāt. maivaṃ, pūrvāparādikramaniyatasadollekha satyatvasiddheḥ.
341
Marcus Schmücker
Veṅkaṭanāthas Opponent vertreten würde, ewig existieren, sondern muss als ein solcher vergangen sein und deshalb nicht mehr existie ren. An diesem Punkt lehrt Veṅkaṭanātha, dass Gottes Erkennen eine anfangslose Abfolge von Zuständen hat, eine Abfolge von Eindrücken (ullekha), die durch einen »früheren« Eindruck festgelegt ist, der sich von einem »späteren« unterscheidet. Aber wie erklärt er, dass, obwohl die zeitlich bedingten Eindrücke verschieden sein müssen, dieser Unterschied (bheda) nicht im Widerspruch zu Gottes Erkennen steht, das sich nicht in einzelne zeitliche Bestimmungen aufsplittert, sondern ständig nur eine einzige Form bewahrt, in der dann alle zeit lichen Bestimmungen, ohne einander zu widersprechen, sein können?
7. Der Unterschied zwischen den mentalen Eindrücken Um diese Frage zu lösen, nimmt Veṅkaṭanātha ein zentrales Konzept seiner Lehre auf: er lehrt den Unterschied (bheda) zwischen früheren (vergangenen) und folgenden (gegenwärtigen/zukünftigen) menta len Eindrücken.. Dieser Unterschied ist immer von sich aus gegeben. Im Gegensatz zur Madhva-Schule, die den Unterschied (bheda) mit der eigenen Natur (svarūpa) eines Objekts identifiziert, verweist die ser für Veṅkaṭanātha grundlegende Begriff darauf, dass unterschiedli che Zustände (avasthā) oder Beschaffenheiten (dharma-) einer Sub stanz nur deshalb wahrnehmbar sind, weil sie sich unterscheiden. Dieser Unterschied ist daher auch eine Voraussetzung dafür, dass zeitliche Bestimmungen erkennbar sind. Er ist daher immer schon von sich aus gegebenen, weil sich ohne einen infiniten Regress kein Unterschied vom Unterschied erkennen lässt: der Unterschied zwischen zwei Dingen kann nicht als unterschieden (bhinna) erkannt werden. Der Unterschied selbst ist keine Beschaffenheit (dharma) einer Substanz (dravya). Deshalb ist er nicht ausschließlich von sich aus gegeben, sondern vermag zusätzlich auch, dass etwas anderes (para) als unterschieden erscheint. Dass der Unterschied aus sich selbst begründet ist, bedingt also, dass sich auch die Zustände/Eigen schaften einer Substanz voneinander unterscheiden. Der Unterschied zwischen den Zuständen (avasthā), und, auf das göttliche Erkennen bezogen, zwischen den mentalen Eindrücken (ullekha), bedeutet keinen gegenseitigen Ausschluss dieser Eindrü cke, denn dies würde die vollständige Nichtexistenz eines anderen
342
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Zustands implizieren, der eben nicht existiert, wenn ein anderer, neuer gegenwärtig wird. Jeder Zustand (avasthā) einer Substanz hat aufgrund seines Unterschiedes (bheda) zu einem anderen Zustand, der wiederum in seiner eigenen Zeit existiert, seine »Eigenzeit« (svakāla). Wenn ein Zustand gerade nicht gegenwärtig ist, wie ein vergangener oder zukünftiger Zustand, bedeutet das nicht, dass er inexistent ist. Er existiert in seiner eigenen spezifischen Zeit (svakāla), die sich von dem Zustand unterscheidet, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt existiert. Betrachten wir den Zustand eines Lehmklumpens (piṇḍāvasthā), der ein früherer Zustand ist und sich von dem späteren Zustand, ein Topf (ghaṭāvasthā) zu sein, unterscheidet. Jeder Zustand ist immer in seiner eigenen Zeit vorhanden und unterscheidet sich von anderen Zuständen, die in ihrer eigenen Zeit sind. Der Unterschied (bheda) zwischen Zuständen, die in ihrer eigenen Zeit sind, bestimmt auch, dass ein Zustand die Bedingung für die Entstehung des nächsten Zustandes ist. Dies gilt zum Beispiel nicht nur für verschiedene Zustände des Lehms (mṛt) wie es Klumpen oder Topf sein können, sondern es gilt auch für andere Substanzen wie Gottes Erkennen oder die alles durchdringende Zeit selbst. Für die hier skizzierte Problematik lässt sich das genannte Lehm-Beispiel so anwenden: Wie verschiedene Zustände des Lehms nicht gleichzeitig auftreten können, so ist es unmöglich, dass zwei zeitlich unterschiedene Eindrücke (ullekha) des göttlichen Erkennens gleichzeitig erscheinen. Der unaufhebbare, sich selbst begründende (svanirvāhaka) Unterschied zwischen diesen Eindrücken wird auf die gleiche Weise realisiert: Wenn der folgende Zustand eines Objekts eintritt, wird der Eindruck (ullekha) von Gottes Erkennen zu einem früheren, d.h. zu einem vergangenen: Jeder Eindruck existiert daher in seiner eigenen Zeit (svakāla) und nicht in der Zeit eines ande ren Eindrucks (anyatkāla). Gott kann daher Dinge erkennen, die entstehen und vergehen. Die Abfolge des göttlichen Erkennens ist daher ohne Anfang (anādi) und Ende (ananta). Der damit gegebene Regress ist für Veṅkaṭanātha kein Fehler, sondern bestätigt vielmehr, dass ein Zustand auf den nächsten folgt. Auch in diesem Zusammen hang verwendet Veṅkaṭanātha den Begriff pravāha, um das anfangs lose und endlose Fließen »mentaler Eindrücke« in Gottes Erkennen zu beschreiben. Und in [einer solchen] Abfolge mentaler Eindrücke (ullekhasantatau) ist der jeweils frühere [Eindruck] der Grund für den jeweils folgen
343
Marcus Schmücker
den. Und wegen der Anfangslosigkeit des Flusses dieser [mentalen Eindrücke] (tatpravāhānāditvāc), tritt nicht der Fall ein, dass [ein mentaler Eindruck] ohne Grundlage (nirmūlatvam) [d.h. ohne einen vorangehenden Eindruck] ist. Und ein so beschaffener unendlicher Regress ist kein Fehler.42
Wenn Gott etwas erkennt, das in der Vergangenheit geschah, so rela tiviert dies nicht sein Erkennen, das in seinem Wesen (svarūpa) ewig ist. Wie wir sahen, ist der Grund dafür Veṅkaṭanāthas Annahme eines stets vorauszusetzenden Unterschiedes (bheda). Der Unterschied ermöglicht, dass ein mentaler Eindruck eine spezifische Eigenzeit (svakāla) hat und nicht in die Eigenzeit eines anderen Eindruckes (ullekha) fällt – so wie in dem Prozess der Herstellung des Kruges, dieser noch nicht präsent war, als nur der Lehmklumpen vorhanden war, aus dem der Krug erst hergestellt werden musste.. Genauso hat jeder mentale Eindruck seine eigene Zeit (svakāla). Und wie die eigene Zeit des Lehmklumpens die Bedingung für die eigene Zeit des Kruges ist, so ist die eigene Zeit des mentalen Eindruckes die Bedingung für die eigene Zeit des nächsten, folgenden mentalen Eindruckes, sodass notwendig eine Abfolge von Eindrücken entsteht. Ein letztes Zitat, in dem Veṅkaṭanātha den Unterschied zwischen früheren und späteren Eindruck erklärt, macht seinen Gedanken deutlich: Jede Wirkung nämlich ist in ihrer eigenen Zeit (svakāle) [, in der sie existiert] niemals nicht-existent [d.h. vergänglich]. Und deshalb ist etwas als früher anzunehmen; etwas [anderes] ist als später anzuneh men. Auf dieselbe Weise ist also eine Wirkung, die die drei (Zeit-)Modi [Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit] hat, für [Gottes] Erkennen gegeben, das zu allen Zeiten eines bleibt.43
Die Aussage, dass »jede Wirkung niemals in ihrer eigenen Zeit nicht existiert«, verweist auf die Funktion des selbstgründenden Unterschiedes, ohne die ein und dieselbe Substanz nicht durch ver schiedene Zeitmodi charakterisiert werden könnte. Dies anzunehmen bedeutet, dass alles in seiner eigenen Zeit ist; und insofern alle Zustände deshalb auch zeitlich voneinander getrennt bleiben, gibt es keinen Widerspruch, wenn einander widersprechende Zustände in SAS (464,3–4) ad TMK 3.76: hetuś collekhasantatāv uttarottarasya pūrvapūrvaḥ. tatpravāhānāditvāc ca na kadā cin nirmūlatvam. na cedṛśānavasthā doṣa iti. 43 SAS (464,4–6) ad TMK 3.76: sarvaṃ kāryaṃ svakāle na hi nityāsat. tac ca kiṃ cid apekṣya pūrvaṃ, kiṃ cid apekṣyottaram. tata evaṃ triprakāraṃ kāryaṃ sarvadaikabud dhisamārūḍham. 42
344
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
ein und derselben Grundlage existieren.. Die Tatsache, dass Zustände sich gegenseitig bedingen und eine unendliche Folge bilden, setzt voraus, dass es ihren Unterschied gibt. Aber ohne die Annahme, dass Gottes Erkennen eine Form hat und nicht viele, wäre es nicht möglich, ein durch mentale Eindrücke vermitteltes Objekt in seiner zeitlichen Dauer zu erfassen. Das eine Erkennen Gottes kann daher auch als allwissend definiert werden, auch wenn es durch zeitlich unterschiedene mentale Eindrücke bestimmt ist. Ermöglicht wird dies durch die Annahme eines fundamentalen Unterschiedes, der diese Eindrücke in ihrer eigenen Zeit unterschieden sein lässt.. Aufgrund eines solchen von sich aus vorhandenen Unterschiedes existiert jeder zeitlich bedingte Eindruck in seiner Eigenzeit (svakāla). Wir können Veṅkaṭanāthas Ansicht über Gottes Erkennen (dharmabhūtajñāna) und die zeitbedingten Eindrücke (ullekha) wie folgt zusammenfassen: Die Zeit existiert neben Gott. Ihre zerstöreri sche Kraft ist überwunden. Letztlich erlaubt Veṅkaṭanāthas Zeitkon zept die Existenz eines allwissenden Gottes, der die Welt manifestie ren kann, um anschließend kontinuierlich in ihr wirksam zu sein.. So wird in Veṅkaṭanāthas Verständnis von Gott und Zeit keine zeitlose Ewigkeit angenommen. Durch den anfangs- und endlosen Lauf der Zeit kann Gott alles wissen, denn die Abfolge der Veränderung endet niemals. Für Veṅkaṭanātha ist Gott daher sowohl zeitlich als auch ewig. Obwohl die Zeit nicht zu Gottes eigener ewiger Natur (svarūpa) gehört, hängt sie von ihm ab. Und von Gott, der Zeit und dem Unterschied (bheda) ist alles weitere abhängig.
Schlussfolgerungen Welche Schwierigkeiten und Lösungsmöglichkeiten lassen sich in Bezug auf das Verhältnis von Gott und Zeit aufzeigen? Wenn einer seits die göttliche Ewigkeit zu sehr gewichtet wird, muss Gottes Ewigkeit mit zeitlicher Veränderung vereinbart werden. Wenn es andererseits keine Ewigkeit und damit kein Wesen gibt, das dauer haft existiert, ist der Mensch der Zeit ausgeliefert. Die Auseinander setzung mit diesen beiden widersprüchlichen Aspekten der Zeit – Ewigkeit und Zeitlichkeit – ist also grundlegend für die Annahme einer Gottesvorstellung, die dem Menschen die Furcht vor der zerstö rerischen Herrschaft der Zeit nehmen soll.
345
Marcus Schmücker
Es geht aber noch um eine andere religionsphilosophische Frage: Wenn ein ewiger Gott etwas will, wie kann er wissen, was er will, wenn das, was er will, zeitlich ist? Wie ist es für Gott möglich, zu erkennen, was in der sich zeitlich verändernden Welt geschieht, ohne dass er in seinem ewigen Sein relativiert wird. Diese Frage hängt ebenfalls mit dem Gegensatz zwischen Ewigkeit und Zeitlichkeit zusammen: Wie kann Gottes ewiges Wissen zeitlich und damit auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezogen werden, besonders wenn er die Welt erneut manifestieren muss? Madhvas (und seine Nachfolger) sowie Veṅkaṭanātha gehen von der Existenz der Zeit als ein ewiges Dahinfließen aus. Die Vertreter beider Vedānta-Schulen mögen nicht nur das unaufhaltsame Fortschreiten der Zeit, aber auch die Irreversibilität der Zeit im Sinn gehabt haben, die Grundlage für die Annahme der zerstörerischen Kraft der Zeit war. In einer (mono-)theistischen Tradition muss aber eine Erklärung dafür gefunden werden, wie ein alles beherrschender Gott mit einem solchen Zeitkonzept vereinbar sein kann: Gottes Wirksamkeit besteht für Madhva und seine Schule darin, das Dahin fließen der Zeitmomente (kṣaṇapravāha) zu unterbrechen, indem Gott eine spezifische Zeit der Schöpfung (sṛṣṭikāla) manifestiert; kein Mensch ist in der Lage, Spezifikationen in diesen Zeitfluss zu setzen. Im Gegensatz zu dieser Auffassung ist nach Veṅkaṭanātha der Fluss der Zeit bereits ein ewig spezifizierter Fluss zeitlicher Zustände; er bedarf keiner weiteren Spezifizierung; er ist immer schon spezifiziert. Für Madhva hingegen ist eine besondere Manifestation notwen dig. Für Veṅkaṭanātha aber ist die Zeit ein Teil von Gottes Körper, von dem jeder Teil (d.h. die Substanzen zusammen mit ihren modifi zierenden Zuständen) den Gott ewig qualifiziert. Für ihn ist es nur möglich, dass eine Substanz in einem besonderen Zustand erscheint. Und jeder besondere Zustand hat seine eigene Zeit, in der er präsent ist, und widerspricht nicht dem besonderen Zustand, der wiederum durch eine andere Eigenzeit bestimmt ist. Dies ist nur durch die Annahme des Unterschiedes möglich, der es wie z.B. zeitlichen Eindrücken ermöglicht, immer in ihrer eigenen Zeit (svakāla) zu erscheinen. Einerseits spricht Veṅkaṭanātha von der Ewigkeit der Zeit, die mit Gottes Ewigkeit zusammenbesteht. Andererseits erörtert er die Zeitlichkeit der Zeit, die eine Abfolge (santāna) von abwechseln den (d.h. früheren, späteren usw.) Zuständen (avasthā) hat. Dies wiederum verbindet er mit dem Erkennen (dharmabhūtajñāna) Got tes. Bei Madhva ist die Zeit ebenfalls Gott untergeordnet; die Zeit wird
346
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
durch zeitliche Bestimmungen (viśeṣa) spezifiziert, die von Gottes unvorstellbarer Kraft (acintyaśakti) abhängen.
Literaturverzeichnis Primärliteratur Anuvyākhyāna (Anuv), Madhva. Works of Sri Madhwacharya. Sar vamūlagranthāḥ, Prasthānatrayī, saṃpuṭa 1. Ed. by B. Govindacharya. Udipi 1969. Brahmasūtrabhāṣya (BSBh), Madhva: Ānandatīrthaviracitaṃ Brahmasūtrabhāṣyam Śrī Jayatīrtha viracita Tattvaprakāśikā sahitam. Ed. by K.T. Pandurangi. Bangalore: Dvaita Vedanta Studies& Research Foundation 2009. Brahmasūtrabhāṣya, Śaṅkara. Brahmasūtra-Śaṅkarabhāṣyam. With the comm. Bhāṣyaratnaprabhā of Govindānanda; Bhāmatī of Vācaspatimiśra, Nyāyanirṇaya of Ānandagiri. J. L. Shastra (Ed.). Delhi 1980. Nyāyasiddhāñjana (NSi), Veṅkaṭanātha: Veṅkaṭanāthārya Vedāntadeśika vira citaṃ Nyāyasiddhāñjanam, ed. Śrīnivāsatātācarya, Madras: Ubhayavedānta granthamālā. Madras 1976. Tattvamuktākalāpa (TMK), Veṅkaṭanātha. Srimad Vedanta Desika’s Tattvamukt akalapa and Sarvartha Siddhi with Sanskrit Commentaries. Ed. by Uttamūr Śrīvātsya Vīrarāghavācārya, Madras: Ubhayavedāntagranthamālā 1973. Taittirīya-Upaniṣad-Bhāṣya-Vārtika, Sureśvara, The TaittirīyopaniṣadbhāṣyaVārtika of Sureśvara. Edited with introduction, English trans., annotation and in dices by R. Balasubramanian. Madras: Radhakrishnan Institute for Advanced Study in Philosophy, 1984. Śatadūṣaṇī (ŚDū), Veṅkaṭanātha. Adhikaraṇasārāvalī Śatadūṣaṇī ca. Ed. by Aṇṇaṅgarāchārya. Conjeevaram: Śrīmadvedāntadeśikagranthamālā 1940.
Online-Quellen Sanskrittexte des/der: Rgveda, Śatapatha-Brahmana, Vayavīyasaṃhitā, Viṣṇupurāṇa, sind entnommen dem Göttingen Register of Electronic Texts in Indian Languages (=GRETIL, uni-goettingen.de; abgerufen am 1.3.2022).
Sekundärliteratur
Bäumer, B., »Sun, Consciousness and Time: The Way of Time and the Timeless in Kashmir Śaivism«, in: ders., Concepts of Time. Ancient and Modern, New Delhi: Gopson Papers 1996, S. 73–77. Chemparathy, G., An Indian rational Theology. Introduction to Udayana’s Nyāyakusumāñjali. [Publications of the De Nobili Research Library 1], Wien 1972. Deng, N., God and Time, Cambridge: Cambridge University Press 2019.
347
Marcus Schmücker
Duquette, J., Ramasubramanian, K., »Śrīharṣa on the Indefinability of Time«, in: S. Wuppuluri, G. Ghirardi (Hg.), Space, Time and the Limits of Human Under standing, Berlin, Heidelberg: Springer 2017, S. 43–60. Gonda, J., Prajāpati and the Year. Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afd. Leterrkunde, N.R., Deel 123, Amsterdam: North-Holland Publishing Company 1984. Halbfass, W., On Being and What There Is. Classical Vaiśeṣika in the History of Indian Ontology, New York: State University of New York Press 1992. Kumar, S. P., Categories, Creation and cognition in Vaiśeṣika Philosophy, Heidel berg: Springer 2019 Malinar, A., »Zeit und Zeitpunkt in den Upaniṣaden und im Epos«, in: W. Schweidler (Hg.), Zeit. Anfang und Ende – Time: Beginning and End. Ergebnisse und Beiträge des Internationalen Symposiums der Hermann und Marianne Stra niak-Stiftung, Weingarten 2002, St. Augustin: Academia Verlag 2002, S. 29– 46. Melamed, Y. Y., »Introduction«, in: ders. (Hg.), Eternity. A History, Oxford: Oxford University Press 2016, S. 1–13 Oberlies, Th., »Die Śvetāśvatara-Upaniṣad: Edition und Übersetzung von Adhyāya IV–VI (Studien zu den ›mittleren‹ Upaniṣads II – 3. Teil)«, in: Vienna Journal of South Asian Studies 42 (1998), S. 77–138 Orr, L. C., »The Concept of Time in Śaṅkara’s Brahmasūtra-Bhāṣya«, in: K. K. Young (Hg.), Hermeneutical Paths to the Sacred Worlds of India. Essays in Honour of Robert W. Stevenson, Atlanta, Georgia: Scholars Press 1992, S. 63–103 Schmücker, M., »Soul and Qualifying Knowledge (Dharmabhūtajñāna) in the Later Viśiṣṭādvaita Vedānta of Veṅkaṭanātha«, in: A. Maharaj (Hg.), The Bloomsbury Research Handbook of Vedānta. London: Bloomsbury 2020, S. 75–104. —, »On the relation between God and time in the later theistic Vedānta of Mad hva, Jayatīrtha and Veṅkaṭanātha«, in: M. Schmücker, M. T. Williams, F. Fis cher (Hg.), Temporality and Eternity. Nine perspectives on God and Time, Berlin: deGruyter 2022, S. 123–160. Schreiner, P., Viṣṇupurāṇa. Althergebrachte Kunde über Viṣṇu, aus dem Sanskrit übers. und hg. von P. Schreiner, Berlin: Verlag der Weltreligionen 2013. Siauve, S., La Doctrine de Madhva. Dvaita-Vedānta. [Publications de l’Institut francais d’Indologie 38]. Pondichéry: Sri Aurobindo Ashram 1968. Simson, G. v., »Narrated time and its relation to the supposed Year Myth in the Mahābhārata«, in: M. Brockington, P. Schreiner (Hg.), Composing a Tradition. Concepts, Techniques and Relationships, Zagreb: Munshiram Manoharlal 1999, S. 49–66 Van Buitenen, J. A. B., The Maitrāyaṇīya Upaniṣad, A Critical Essay with Text, Translation and Commentary. [Disputationes Rheno-Trajectinae VI], The Hague: Mouton & Co 1969.
348
Zeitbewältigung in philosophischen und theologischen Traditionen Indiens
Vassilkov, Y., »Kālavāda (the doctrine of Cyclical Time) in the Mahābhārata and the concept of Heroic Didactics«, in: M. Brockington, P. Schreiner (Hg.), Com posing a Tradition. Concepts, Techniques and Relationships, Zagreb: Munshi ram Manoharlal 1999, S. 17–33. Weßler, H. W., Zeit und Geschichte im Viṣṇupurāṇa. Formen ihrer Wahrnehmung und ihrer eschatologischen Bezüge, anhand der Textgestalt dargestellt. [Studia Religiosa Helvetica Series Altera 1], Bern: Lang Verlag 1995. Yanchevskaya, N., Witzel, M., »Time and Space in Ancient India: Pre-philo sophical Period«, in: Shyam Wuppuluri and G. Ghirardi (Hg.), Space, Time and the Limits of Human Understanding, Berlin, Heidelberg: Springer 2016, S. 23– 42.
349
D. Wechselwirkungen von Religion mit einem Außen/Soziale und politische Dimensionen von Philosophie
Nadja Furlan Štante
Ökofeministische Theologie der Interdependenz – ein konstruktiver philosophischer Ansatz zur gegenwärtigen ökologischen Krise1
Einführung Für Ökofeministinnen ist die ökologische Krise Realität, Bedrohung und Warnung für die heutige Menschheit. Der Klimawandel, die globale Erderwärmung und die Verringerung der biologischen Vielfalt sowie andere Prozesse, die als das Ergebnis von Umweltverschmut zung wie auch langfristiger übermäßiger Nutzung und Verbrauch natürlicher Ressourcen erscheinen, werden in diesem Kontext als das Spiegelbild und die Folge eines globalisierten Habitus einseiti ger imperialistischer Verbraucherbeziehungen zwischen Mensch und Natur verstanden und kritisch analysiert. Obwohl die Behauptung über die globale Erwärmung eines der umstrittensten wissenschaftlichen Themen unserer Zeit darstellt, auch weil einige Wissenschaftler behaupten, dass die anthropogene Bedrohung durch die globale Erwärmung nicht existiert2, sind die ökologische Krise und die globale Erwärmung nicht nur wissen Dieser wissenschaftliche Artikel wurde durch die finanzielle Unterstützung der Forschungsagentur der Republik Slowenien (ARRS) im Rahmen des Projekts Inter religiöser Dialog: Eine Grundlage für die Koexistenz der Vielfalt angesichts der Mig ration und der Flüchtlingskrise (ARRS Forschungsprojekt J6–9393) und des ARRS Forschungsprogramm (P6–0434) ermöglicht. 2 Der Grund für den Klimawandel liegt in Ereignissen in der Erdatmosphäre und kann als Folge bestimmter wichtiger Begebenheiten, wie z. B. dem Eintritt eines Kometen auf die Erdoberfläche, der natürlichen Klimavariabilität (kleine Eiszeit im 17. und 18. Jahrhundert, die natürliche Entwicklung der Atmosphäre) oder variabler Sonnenak tivitäten analysiert werden. Nur ein kleiner Teil der Fachöffentlichkeit kommt jedoch zum Schluss, dass die globale Erwärmung ein ernstes globales Problem darstellt. Der amerikanische Geologe James Lawrence Powell hat eine Analyse wissenschaftlicher 1
353
Nadja Furlan Štante
schaftliche Fragestellungen, sondern auch mit Wirtschaft, Soziolo gie, Ethik, Werten, Religion, (Geo-)Politik und individuellen Lebens stilentscheidungen verbunden. All dies erfordert eine sorgfältige Überlegung sowohl auf persönlicher als auch religiöser und sozialer Ebene. Unser Verständnis der Natur und unsere Einstellung zu ihr werden durch verschiedene sozialphilosophische und kulturelle Pro zesse konstruiert und entsprechend wahrgenommen. Diese Konzep tualisierung wird durch unterschiedliche Lebenspraktiken geschaffen, neu erstellt und transformiert. Die Konzeptualisierung der Natur ist ein dynamischer, kultureller Prozess, der ständig zwischen all täglicher Platzierung einerseits und sozialen Auswirkungen anderer seits schwankt. Das Stereotyp der menschlichen Überlegenheit gegenüber der Natur bleibt tief im kollektiven Bewusstsein der (insbesondere) west lichen Welt verwurzelt. Aus dieser Perspektive besehen erscheint der Beitrag des theologischen Ökofeminismus von großer Bedeutung zu sein, da er die Vorurteile des Modells der menschlichen Überlegenheit gegenüber der Natur anhand eines kritischen historischen Überblicks über einzelne religiöse Traditionen aufdeckt und dekonstruiert. Die ökofeministische Theologie ist ein globales interreligiöses Phäno men, welches die Ethik der grundlegenden Gegenseitigkeit und Inter dependenz aller Beziehungen im Lebensnetz hervorhebt. In diesem Artikel werde ich mich auf ökofeministische Theologien, die in einem christlichen Kontext artikuliert sind, konzentrieren. Im Bereich Religion und Ökologie hat sich eine überwältigende Mehrheit der geschlechtsspezifischen Überlegungen auf Frauen und insbesondere auf den Ökofeminismus konzentriert. In Anbetracht der Diskriminierung und Unterordnung von Frauen und Natur durch das patriarchalische System weist der Ökofeminismus kritisch auf die hierarchische Bewertung und Konstruktion bestimmter hetero normativ besetzter Dualitäten hin: Kultur/Natur; männlich/weib lich; ich/andere; Vernunft/Emotion; Mensch/Tier. Diese hierarchi sche Beziehungsstruktur wird der ökofeministischen Theorie zufolge vom patriarchalischen System geordnet und geschaffen und bleibt Arbeiten durchgeführt, die im Netzwerk Web of Science aufgezeichnet wurden: Von den 13.950 begutachteten wissenschaftlichen Forschungen zur globalen Erwärmung, die zwischen 1991 und 2012 veröffentlicht wurden, wird diese von nur 23 (0,16 %) geleugnet. Von den 33.690 AutorInnen dieser Studien wird die globale Erwärmung von nur 34 (0,1 %) geleugnet. Powell präsentierte die Ergebnisse dieser Studien in seiner Monografie Revolutions in Earth Sciences, From Heresy to Truth (2014).
354
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
entsprechend kritisch in Blick zu nehmen und zu dekonstruieren. Bevor wir jedoch in der Folge auf die Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur näher eingehen, zunächst einige Überlegungen zum Begriff »Ökofeminismus«.
1. Was ist Ökofeminismus? Ökologischer Feminismus oder Ökofeminismus ist eine feministische Perspektive, die auf der Annahme beruht, dass Frauen und Natur mit einander verbunden sind und einer wechselseitigen Abwertung in die Hände spielen. Der theologische Ökofeminismus hat seine Wurzeln im so genanntem säkularen Ökofeminismus. Der ökologische Femi nismus oder Ökofeminismus stellt eine feministische Perspektive dar, die auf der Prämisse basiert, dass die Unterdrückung der Frauen und die Ausbeutung der Natur zwei miteinander verbundene Phänomene. Es handelt sich mithin um zwei Kategorien, die dem patriarchalischen System inhärent sind und zu seinen zentralen Diskriminierungspra xen zählen. Der Ökofeminismus basiert im Wesentlichen auf der Prämisse, dass das, was zur Unterdrückung der Frauen und zur Ausbeutung der Natur führt, ein und dasselbe ist: das patriarchalische System, das cartesianische, dualistische (binäre) Denken3, das System der Dominanz, der globale Kapitalismus. Der gemeinsame Nenner aller Formen der Gewalt ist das patriarchalische System, welches als Quelle von Gewalt verstanden wird. Der Ökofeminismus beschreibt das patriarchalische System somit als ein System des Unfriedens, das auf einer ausbeuterischen hierarchischen Beziehung aufbaut, ohne sich der Gleichheit, Einheit und Verbundenheit aller Lebewesen im Raum des Lebens bewusst zu sein. Dies ist der Grund, warum das patriarchalische System die harmonische Verbindung von Mann und Frau, Mensch und Natur zerstört. Der Ökofeminismus entwickelte sich Ende des 20. Jahrhunderts als eine große Schule, in die philosophische und theologische Kon zeptionen ebenso Eingang fanden, wie soziale Analysen. Die legen däre Begründerin des Ökofeminismus ist die französische Autorin Die Frage, wie das Selbst in Bezug auf die Erde zu definieren sei, wird für Männer und Frauen gleichermaßen problematisch, wenn die (weiblich personalisierte) Erde als der archetypisch cartesianische Körper ohne Verstand betrachtet wird, d. h. ohne Rücksicht auf Vernunft – und deshalb, so könnte man annehmen, ohne ein Selbst. 3
355
Nadja Furlan Štante
Françoise D’Eaubonne, welche im Jahr 1974 mit dem von ihr neu geprägten Begriff Ökofeminismus die politische Meinung definierte, dass Frauen (als in der sozialen Ordnung untergeordnete Spezies) ein größeres Potenzial zur Verwirklichung von politischer Veränderung, die für die Erhaltung des Lebens auf unserem Planeten unverzichtbar sei, besäßen. In ihrem Buch Le Féminisme ou la Mort (Feminismus oder Tod) bezeichnete D’Eaubonne »die Frau« entsprechend als Hauptak teurin im Prozess der ökologischen Revolution. Im Jahr 1972 nahm Mary Daly diesen Begriff auf und integrierte ihn, wie auch die christlich-feministische Theologin Rosemary Radford Ruether, in den Kontext des christlich-theologischen Ökofeminismus.4 Angesichts der Vielfalt von Formen und Orientierungen des Ökofeminismus5 wäre es vielleicht besser, über eine Vielzahl von Ökofeminismen zu sprechen. Heather Eaton vergleicht diese große Vielfalt von Ökofeminismen mit »einem Schnittpunkt mehrerer Wege«, denn »[M]enschen kommen zum Ökofeminismus aus vielen Richtungen und haben ihn an andere Orte, Disziplinen und Tätigkei ten übertragen«6. Unabhängig von der Vielfalt der einzelnen Arten und Formen des Ökofeminismus, die sich aus vielen Disziplinen und Ansätzen ergeben (von den Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaf ten, Umweltstudien und STS bis hin zum politischen Aktivismus usw.), sind sich alle der Tatsache bewusst, dass es unmöglich ist, das ökologische Problem zu lösen, ohne gleichzeitig die feministische Frage einzubeziehen und umgekehrt. Das verbindende Element von Feminismus und Ökologie ist daher im Kampf um die Befreiung von den Fesseln kultureller und wirtschaftlicher Unterdrückung und Ausbeutung zu verorten. Der Zusammenhang zwischen dem Miss brauch der natürlichen Welt und der Unterdrückung von Frauen ist entsprechend der zentrale und gemeinsame Punkt aller Arten des Ökofeminismus.7 Ökofeminismus ist folglich alles andere als ein monolithisches Phänomen. Es gibt viele Arten von ökofeministi schen (religiösen) Gedanken, und es bestehen auf jeden Fall auch Spannungen zwischen den verschiedenen ökofeministisch-theologi A. Primavesi, »Ecofeminism«, S. 45. Heather Eaton unterteilt die verschiedenen Formen des Ökofeminismus in vier Modelle: das ökofeministische Modell des Aktivismus und der sozialen Bewegungen, das akademische, das religiöse und das globale Modell des Ökofeminismus (vgl. H. Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies.,S. 23). 6 H. Eaton, Introducing Ecofeminist Theologies, S. 12. 7 A. Baugh, »Gender«, S. 131. 4
5
356
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
schen Lagern (Reformer, Revolutionäre, Frauen usw.). Abgesehen von dem erwähnten gemeinsamen Punkt bieten die verschiedenen Arten des Ökofeminismus mithin sehr unterschiedliche Ansichten und Perspektiven zu bestimmten Themen. Festzuhalten ist dabei, dass die größten Meinungsverschiedenheiten unter ihnen im Blick auf die Frage nach der Verbindung zwischen Frau und Natur oder besser gesagt, die Frage, ob die Frau aufgrund ihrer Fähigkeit, das Leben zu gebären, der Natur näher sei als der Mann, entstanden sind. Der Ökofeminismus erkennt also eine grundlegende Verbindung zwischen der Herrschaft der Frauen und der Herrschaft der Natur. Diese Verbindung wird auf zwei Ebenen analysiert: einer ideologischkulturellen und einer sozioökonomischen Ebene. Die ideologischkulturelle Ebene basiert auf der Prämisse oder dem Vorurteil, dass Frauen der Natur, der emotionalen und der tierischen Welt näher als Männer sind und mehr (bzw. eher?) im Einklang mit ihrem eigenen Körper stehen. Die sozioökonomische Ebene hingegen bezieht sich auf die vielfach immer noch herrschende Beschränkung von Frauen auf die Bereiche der Fortpflanzung, der Erziehung und Betreuung von Kindern, auf das Kochen, Putzen, Aufräumen – kurz gesagt, die Beschränkung und Begrenzung der Frau auf den bloßen Haushalt und die Abwertung ihrer Aufgaben im Vergleich zu den öffentlichen Aufgaben und zur Macht der modernen Kultur, die traditionell in die Männerdomäne fallen. Rosemary Radford Ruether, eine Pionierin des christlich-theologischen Ökofeminismus, geht davon aus, dass die erste Ebene als ideologische Grundlage für die zweite dient.8 Der Ökofeminismus berührt auch die spirituell-religiöse Dimen sion, ordnet sie jedoch dem Feld kritischer Ansichten einer bestimm ten religiösen Tradition und ihres patriarchalischen Stempels zu. In der Tat traten alle großen Weltreligionen im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in eine Auseinandersetzung um den möglichen Schaden, den ihre Traditionen in unserem Verständnis der Umwelt, der Natur und nichtmenschlicher Wesen angerichtet hatten, ein und begannen, in ihren Traditionen nach positiven Elementen für eine ökologisch validierende Spiritualität und alltägliche Praxis zu suchen. In ihrer dritten Entwicklungsphase erweiterten feministische Theolo gien ihre Kritik an traditionellen Theologien auch in Bezug auf deren Haltung gegenüber der Natur und den nichtmenschlichen Wesen. Die R. Radford Ruether, Integrating Ecofeminism, Globalization and World Religions, S. 91.
8
357
Nadja Furlan Štante
verschiedenen Ökofeminismen oder ökofeministischen Theologien hinterfragten dabei kritisch den Zusammenhang zwischen Geschlech terhierarchien in einer individuellen Religion und Kultur, und der hierarchischen Festlegung des Wertes des Menschen als über der Natur stehend. Alle Arten des theologischen Ökofeminismus streben entsprechend eine Dekonstruktion des patriarchalischen Paradigmas, seiner hierarchischen Struktur, Methodik und seines Denkens an. Sie versuchen, das gesamte Paradigma der Vorherrschaft des Mannes über die Frau, des Verstandes über den Körper, des Himmels über die Erde, des Transzendenten über das Immanente, des männlichen Gottes, der entfremdet ist und über die gesamte Schöpfung herrscht, zu dekonstruieren – und all dies durch neue Alternativen zu ersetzen. Alle großen Weltreligionen sind in diesem Sinne aufgefordert, in ihrem Urteil der möglichen negativen Muster, die zur Umwelt zerstörung geführt haben und im Blick auf die Wiederherstellung umweltfreundlicher Traditionen, Selbstinfragestellung und Selbstkri tik zu üben. Aus ökofeministischer und umweltgerechter Sicht ist es wichtig, dass die Religionen die negativen Stereotypen, welche die Herrschaft über die Natur und die soziale Herrschaft stärken, abbauen.9 Die christliche Tradition hat zum Beispiel mehrere proble matische Bilder und Symbole, die sich in Form von Stereotypen und Vorurteilen gefestigt und überlebt haben und im Erbe des westlichen philosophisch-religiösen Denkens verwurzelt wurden, beigesteuert. Ökofeministische christliche Theologien versuchen daher, andere, oft verlorene Bilder und Symbole – wie bspw. jenes des Universums als Leib Gottes – wieder zu beleben (Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague). Das genannte Symbol war früher bspw. eine gängige Meta pher (wenn auch in verschiedenen Formen tradiert) und fungierte als das zentrale Bild der existenziellen Sensibilität der westlichen (mediterranen) Welt, wurde jedoch im 17. Jahrhundert durch ein mechanistisches Weltanschauungsmodell ersetzt (Carol Merchant 1980 und Vandana Shiva 1980). Im Jahr 1972 stellte die radikal-feministische Theologin Mary Daly eine Verbindung zwischen der ökologischen Krise, der sozialen Herrschaft und der christlichen Lehre her. Als Antithese zur christ lichen Ethik der Missionsarbeit im Sinne einer kompromisslosen Christianisierung (Bekehrung aller Heiden, die als Barbaren galten, um jeden Preis) bot sie die Vision eines kosmischen Engagements für 9
Ebd., S. XI.
358
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
die Schwesternschaft, die unsere Schwester Erde und all ihre mensch lichen und nichtmenschlichen Wesen und Elemente umfasst. Dies würde Dalys Ansicht zufolge eine potenziell positive Veränderung des ökologischen Bewusstseins und eine Umweltethik ermöglichen und uns von der Kultur der Raubtiere und Schänder in eine Kultur der Gegenseitigkeit führen, in der wir die Erde und andere Planeten als einzelne Teile des Ganzen, die zusammen mit uns und nicht für uns existieren, betrachten.10 Einige ökofeministische TheologInnen sind in ihrer Kritik an der patriarchalisch-hierarchischen Unterordnung von Frauen und Natur beim Christentum geblieben und haben eine Vision einer christlichen frauen- und umweltfreundlichen Theologie entwickelt, die als ent schlossener Mitgestalter qualitativ besserer Beziehungen im Gefüge eines vielfach abhängigen Lebens fungiert (Rosemary Radford Rue ther, Sally McFague usw.). Andere ökofeministische TheologInnen sind dagegen zu der Erkenntnis gelangt, dass die christliche Lehre unheilbar patriarchalisch sei und als solche nicht in der Lage wäre, radikale Reformen, die für eine integrative Ethik der Verantwortung gegenüber allen Lebewesen erforderlich sind, zu entwickeln (Cynthia Eller, Carol P. Christ, Carolyn Merchant usw.). Diese DenkerInnen haben sich in der Folge dem radikalen Feminismus oder dem neoheid nischen Ökofeminismus zugewandt. Im Jahr 1972 kam mit der Theologin Rosemary Radford Ruether die erste ökofeministische Stimme innerhalb des Christentums auf. Mit den Augen der Befreiungstheologie, genauer gesagt aus feminis tischer, somatischer und ökologischer Sicht, machte sie nachdrücklich auf die grundlegenden Dualismen aufmerksam, deren Ursprung sie dem apokalyptisch-platonischen Erbe des klassischen Christentums zuschrieb. Dazu zählt vor allem die Entfremdung des Geistes vom Körper, die des subjektiven Selbst von der objektiven Welt, der sub jektive Rückzug und die Entfremdung des Individuums vom breiteren menschlichen und sozialen Netzwerk sowie die Herrschaft des Geistes über die Natur. Um diese Dualismen zu überwinden, sollten wir laut Ruether zunächst ein neues Selbstverständnis unserer eigenen Identi tät in Bezug auf alle anderen Beziehungen innerhalb des Lebensnetzes entwickeln. In New Woman, New Earth setzt sich Ruether stark gegen das auf der Logik der Herrschaft basierende Beziehungsmodell ein und erklärt: 10
A. Primavesi, »Ecofeminism«, S. 46.
359
Nadja Furlan Štante
»[F]rauen müssen erkennen, dass es für sie keine Befreiung und keine Lösung für die ökologische Krise in einer Gesellschaft, deren grundlegendes Beziehungsmodell weiterhin auf der Herrschaft des Einen über den Anderen basiert, geben kann.«11
Einige religiös grundierte Feminismen haben verschiedene charakte ristische Modelle eines theologischen Ökofeminismus ausgebildet. Judith Plaskow (1993) hat zum Beispiel eine Vision des jüdischtheologischen Ökofeminismus geschaffen, während Johanna Macy (1991) eine buddhistisch-ökofeministische Perspektive, die sich auf das Konzept des abhängigen Mitentstehens oder der gegenseitigen Kausalität konzentriert, entwickelt hat. Angesichts der Verzweigung und auch Ausweitung der religiösen ökofeministischen Bewegungen und Bemühungen verschiedener Frauen ist es möglich geworden, über (öko)feministische Theologie als eine besondere Philosophie der Religionen12 und Ökotheologie der Religionen zu sprechen13. Eines der gemeinsamen Merkmale der verschiedenen Formen von Ökofeminismus ist, dass sie alle das patriarchalische System als ein Konfliktsystem, das auf einer hierarchischen Beziehung aufbaut und sich der Einheit und Verbundenheit der Lebewesen nicht bewusst ist, wahrnehmen. Aus ökofeministischer Sicht zerstört das patriarcha lische System also die harmonische Verbindung zwischen Mann und Frau, Mensch und Natur. Es handelt sich dabei um einen Schädling, der sowohl die Natur als auch die Frauen negativ beeinflusst. Der Ökofeminismus kämpft mithin für ein neues Bewusstsein, das beiden Geschlechtern beibringen könnte, friedlich miteinander und mit der Natur zu leben und zu agieren. Anhänger des christlich-theologischen Ökofeminismus (Rosemary Radford Ruether, Sallie McFague, Cyn R. Radford Ruether, New Woman, New Earth, S. 204. Die Möglichkeit, die feministische Theologie als Religionsphilosophie zu betrach ten, wurde von Pamela Sue Anderson festgestellt. Sie betrachtete die feministische Theologie als eine neue Form der Religionsphilosophie. Vgl. P. S. Anderson, »Feminist Theology as Philosophy of Religions«, bes. S. 40–57. 13 Feministische Theologie als Religionstheologie ist ein relativ neuer Ausdruck, der nach Ansicht von Rita Gross auf das Bewusstsein hindeutet, dass im Hintergrund der religiösen Pluralität und Vielfalt ein Merkmal besteht, das allen Religionen gemein sam ist. Im Falle der feministischen Theologie geht es daher um das gemeinsame Merkmal der Erfahrung von Frauen mit patriarchalischer Unterordnung und deren Diskriminierung durch alle Religionen. Gross appelliert an alle feministischen Theo loginnen, einen angemessenen Ansatz für die Teilnahme von Frauen am interreligiö sen Dialog zu entwickeln, um wirklich aufzuleben. Siehe R. Gross, »Feminist Theology as Theology of Religions«, S. 61. 11
12
360
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
thia Eller usw.) schöpfen dabei aus der christlichen Tradition, da sie überzeugt sind, dass diese das erwähnte Konzept der Einheit und Ver netzung aller Kreaturen Gottes beinhaltet. Die Wechselbeziehung zwischen Frau und Mann, Mensch und Natur sollte von allen Formen der Gewalt und Unterordnung befreit werden, da nur im Lichte von gegenseitiger Achtung und Respekt gegenüber der Natur die Harmo nie der Liebe Gottes vollständig (wieder?) zum Leben erweckt werden kann. Die Welt ist in diesem Sinne der Leib Gottes, dessen Glieder harmonisch und gesund fungieren.14
2. Ökologische Vernetzung, Interdependenz und die Darstellung (»enacting«)15 des Göttlichen Um die Logik der Herrschaft über Frauen und Natur zu überwin den, sollten laut Ruether die (westliche) Gesellschaften und die (christlichen) Religionen ihre Grundlagen rekonstruieren. Ruether entwickelte diese Hypothese in praktisch allen ihren späteren Werken, die sich mit ökofeministischen Themen befassten. Sie betonte auch die schon genannte Notwendigkeit, die Symbole zu ändern und »unser dualistisches Konzept der Realität – gespalten zwischen seelenloser Materie und transzendentem männlichen Bewusstsein – umzuge stalten« wie auch die Notwendigkeit, das entfremdete, männlich zentrierte Bild Gottes von »einem (menschlich) modellierten Gott, der nach dem männlichen Bewusstsein konstruiert, und als Herrscher über die Natur dargestellt wurde, in eine immanente Lebensquelle, welche die gesamte Planetengemeinschaft erhält, umzugestalten.«16 Sallie McFague ist eine weitere feministische Theologin, die eine Vision von Gott anbietet und die Gleichstellung von Frauen und Männern, sowie des Menschen mit der Natur und allen nicht menschlichen Wesen unterstützt. In The Body of God: An Ecologi I. Gebara, Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation. S. 176–78. Das englische »enact« kann zunächst »ein Gesetz erlassen« bedeuten, was eine kreative und aktive Handlung anzeigt. »Enact« kann aber auch bedeuten, »ein Stück zu inszenieren«. In diesem Fall agieren die »handelnden« Personen nicht als ein autonomes Ego, sondern sie sind ein Vehikel für etwas anderes, nämlich für die Cha raktere, die sie auf der Bühne darstellen. In diesem Sinne bedeutet »die Darstellung des Göttlichen«, die schöpferischen Kräfte des Selbst zu verwirklichen, während dieses Selbst zugleich durch etwas jenseits von sich selbst geformt wird. 16 R. Radford Ruether, Gaia and God, S. 21. 14 15
361
Nadja Furlan Štante
cal Theology kritisierte sie das traditionell legitimierte Bild Gottes als entfernter, überlegener König, der über die gesamte Schöpfung herrscht und sie beherrscht. Ihre Kritik basiert auf zwei Argumenten: 1) Dieses Bild Gottes habe erheblich zur Konstruktion des Konzepts der dualistischen Trennung zwischen dem Reich Gottes und der Erde beigetragen; 2) Dieses Bild habe die Menschheit ihrer Hauptverant wortung beraubt, nämlich der Sorge für die Natur, die Erde, für nichtmenschliche Wesen usw. Als Alternative fordert sie alle Christen auf, sich das gesamte Universum symbolisch als den Leib Gottes vorzustellen, anstatt Gott als einen externen, getrennten Monarchen zu betrachten, der über die Welt herrscht. Oder mit ihren Worten: »Man sollte Gott [besser] als etwas begreifen, das in, mit und unter dem Evolutionsprozess ist.«17 In Beziehung zu sein ist einem Großteil der ökofeministischen Theologie zufolge in erster Linie eine ethische Aktivität. Bei dieser Überlegung spielt der Kern der ökofeministischen Ethik der Rela tionalität – die Vernetzung aller Wesen im »Lebensnetz« –- eine Rolle. »Lebensnetz« ist eine weit verbreitete Metapher, die ihren Ursprung im Ökofeminismus hat und poetisch die Dynamik der kollektiven weiblichen Sichtweise einer Welt basal (?) verbundener Subjektivitäten bezeichnet. Rosemary Radford Ruether versteht öko logische Interdependenz im Sinne eines lebensspendenden Netzes als pantheistisches oder transzendental immanentes Lebensnetz. Diese gemeinsame Quelle fördert und erhält ihrer Meinung nach eine kon tinuierliche Erneuerung des natürlichen Lebenszyklus und ermöglicht uns in eins, die ausbeuterischen Formen hierarchischer Beziehungen zu bekämpfen und nach neuen Beziehungen gegenseitiger Anerken nung zu streben.18 Die Verbindung zwischen Gott und der Welt wird durch verschie dene Symbole dargestellt. Einige greifen auf weibliche Personifikatio nen der Natur und des Göttlichen zurück (insbesondere die Vertreter des »heidnischen Ökofeminismus« oder der Öko-Theologie), erken nen das göttliche Prinzip im Begriff »Gaia« an und nennen es daher Göttin, Mutter Erde. Sie sehen die Schöpfung als einen Körper, der verschiedene Ökosysteme umfasst; eine Menge an Vielfalt, vereint und verbunden in Koexistenz und Einheit. In einer solchen Schöpfung ist jede Frau und jeder Mann zuerst ein Mensch. In der gleichen 17 18
S. McFague, The Body of God, S. 93. R. Radford Ruether, Gaia and God, S. 260.
362
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
Menschlichkeit und interdependenten Verbundenheit liegt die Schön heit und Größe dieser Gemeinschaft, welche die Ökofeministinnen als biotische Gemeinschaft definieren.19 Aus dieser Sicht fördert der Ökofeminismus die globale Bewe gung, die auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und der Ach tung gegenüber der Vielfalt im Gegensatz zu allen Formen der Herr schaft und Gewalt, beruht. Die Fortsetzung des Lebens auf diesem Planeten erfordert aus ökofeministischer Sicht ein neues Verständnis unserer Haltung gegenüber uns selbst, unserem Körper, dem Ande ren, der Natur und nichtmenschlicher Wesen. Für die meisten Ver treter des theologischen (christlichen) Ökofeminismus bedeutet dies eine eingehende Studie, Dekonstruktion und Kritik androzentrischer Theologiemodelle, insbesondere in Bezug auf das Bild Gottes und seine Beziehung zum gesamten Kosmos. Die bloß ergänzende Einbe ziehung des »weiblichen Elements« in die bestehende theologische Agenda reicht demzufolge nicht aus. Ökofeministinnen zufolge ist es vielmehr notwendig, die traditionelle, d.h. patriarchalisch imprä gnierte theologische Denkweise und deren hierarchische Struktur und Ausgestaltung radikal zu dekonstruieren. Ivone Gebara hält in diesem Sinne fest: »Der Wechsel des patriarchalischen in ein ökofeministisches Para digma beginnt mit der Epistemologie, mit der Veränderung der Denk weise. Die patriarchalische Epistemologie gründet sich auf ewigen und unveränderlichen ›Wahrheiten‹, welche die Voraussetzung sind für das, was in Wahrheit ›ist‹. In der platonisch-aristotelischen Episte mologie, die das katholische Christentum geprägt hat, nimmt diese Epistemologie die Form von a priori existierenden ewigen Ideen an, deren physische Dinge blasse und partielle Ausdrücke sind. Der Katho lizismus fügte dem die Hierarchie der Offenbarung über die Vernunft hinzu; offenbarte Ideen kommen direkt von Gott und sind daher im Vergleich zu den aus der Vernunft abgeleiteten Ideen unveränderlich und unbestreitbar.«20
Gebaras ökofeministische Perspektive zeigt sich in ihrem Verständnis der engen Verbindung zwischen feministischen Ideen und Ökolo gie, die infolgedessen jeden Einzelnen nicht nur zur Möglichkeit einer echten Gleichstellung von Männern und Frauen und zwischen verschiedenen Kulturen führen, sondern auch für eine andere Bezie 19 20
N. Furlan Štante, Woman, Religion and Religion: Eco-feminist Perception, S. 90. I. Gebara, Looking for Running Water, S. 29.
363
Nadja Furlan Štante
hung zu uns selbst, mit der Erde und dem gesamten Universum öffnen sollte. Für Ivone Gebara ist die persönlich verkörperte Erfah rung die zentrale Voraussetzung für ein angemesseneres Verständnis der Beziehungen im Lebensnetz. Für Ökofeministinnen schafft das Bewusstsein für die Interdependenz und Vernetzung von menschli chen und nichtmenschlichen Wesen, Natur, Umwelt usw. einen öko zentrischen Egalitarismus, der dann als Grund- und Ausgangspunkt einer Ethik zwischenmenschlicher Beziehungen dienen kann. Für Karen J. Warren ist die ökofeministische Kritik am Patriarchat in ähnlicher Weise in den Prinzipien der Ökologie enthalten: »Alles ist verbunden; alle Teile eines jeden Ökosystems sind gleichwer tig; es gibt kein freies Mittagessen; ›die Natur weiß es am besten‹; gesunde, ausgewogene Ökosysteme müssen Vielfalt bewahren; es gibt Einheit in der Vielfalt.«21
Aus der Sicht des theologischen Ökofeminismus (insbesondere bei Ivone Gebara) ist das Verständnis der menschlichen Identität in einem Prisma der Betrachtung des Individuums im Beziehungsnetz veran kert. Das Individuum existiert daher nicht außerhalb dieser Beziehun gen. Er oder sie wird konstituiert in und durch die Beziehung. Die Schlussfolgerung ist, dass die Autonomie eines Individuums nicht den Ausschluss aus dem Lebensnetz bedeutet. Das wäre aus Sicht des Ökofeminismus illusorisch. Dieser Auffassung zufolge beinhaltet der Versuch, den Menschen von der kosmischen Gesamtheit zu tren nen, keine Autonomie und Individualität, sondern eine gefährliche Illusion. Die Individualität eines Menschen wird in der Perspektive der Verbundenheit von Individualitäten zu einem Ganzen verstanden. Eine einzelne Person als Individuum ist in diese Gesamtheit einge taucht, Teil davon und gleichzeitig autonom. Ihre Autonomie sollte sich in der gegenseitigen Verantwortung und der Achtung der Integri tät eines Individuums, der Mitmenschen, des Anderen widerspiegeln. Das entscheidende ethische Ziel des theologischen Ökofeminismus ist daher, die Qualität der Beziehungen zu verbessern. Der ökozentrische Egalitarismus umfasst alle Menschen sowie auch Nichtmenschen. Ökofeministinnen bestehen auf den engen Ver bindungen zwischen der Herrschaft von Frauen, Farbigen und anderen mit der Herrschaft der Natur. Das Bewusstsein für diese grundle gende Vernetzung und die daraus resultierende Interdependenz und 21
K. J. Warren, »Feminism and ecology«, S. 10.
364
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
gemeinsame Verantwortung im ethisch-moralischen Sinne ist daher der nächste Schritt in der Entwicklung zwischenmenschlicher sowie letztlich aller Beziehungen innerhalb des Lebensnetzes. Unter diesem Gesichtspunkt möchte die christliche ökofeminis tische Theologie die Idee der Immanenz überdenken und zentral in das Ersinnen der Theologie einbringen. Sie versteht Gott als Teil des Evolutionsprozesses der geschaffenen Ordnung. Als sein Schöpfer würde Gott sich nicht von ihm abheben. Dies hat direkte Konsequen zen für viele Bereiche der Theologie. So kann etwa die Christologie neu begriffen werden, weniger am Leitfaden einer Betrachtung des Herabkommens Christi denn im Zeichen der Betrachtung seines Wachstums im Rahmen des Prozesses der Gottwerdung von Gemein schaften und der darin befindlichen Individuen. Ethik wiederum kann nicht länger als ›herabgesandt‹ angesehen werden, sondern muss erneut als Entfaltung aus der (kon)kreativen Immanenz, die zwischen Menschen besteht, erlebt werden. Hier wird die Bedeutung der Relationalität betont. Relationalität tritt dabei, wie schon deut lich wurde, als Schlüsselbegriff in der ökofeministischen Theologie, insbesondere in der ökofeministischen Ethik, auf. Sie beinhaltet die Konzepte der Interdependenz und Gegenseitigkeit. In einigen Schulen des feministischen Diskurses deutet dies auch auf eine besondere Beziehung zwischen Frauen und der Natur hin. Es impliziert auch die Forderung nach einer Neukonzeptualisierung heiliger Symbole, um der Immanenz Rechnung zu tragen und neue Beziehungen zwischen der Gottheit, den Menschen und der Erde aufzubauen. Carol Gilligan argumentiert in ihrem Werk In a Different Voice, dass Frauen in der Ethik einen besonderen modus operandi haben. Dies ist zur klassi schen Aussage der Relationalität geworden. Sie zeigt, dass Frauen eine andere Perspektive auf das Selbst, die Beziehungen und die Moral haben, als dies durch traditionelle Theorien der moralischen Entwick lung beschrieben wird. Diese Diskussion wird von Ökofeministinnen weiter vorangetrieben. Mary Gray schlägt eine »Metaphysik der Ver bindung« vor, die mit dem Verständnis der Erlösung als Selbstbestä tigung und richtige Beziehung beginnt und ökologische Heilung und Wachstum fördert.22 Eine feministische Vision, welche die Bedeutung der Relationalität betont, erkennt in weiterer Folge die Notwendigkeit einer Neuformulierung der Metaerzählungen der westlichen Kultur 22 M. Gray, Redeeming the dream: feminism, redemption and Christian tradition, S. 146.
365
Nadja Furlan Štante
an. Rosemary Radford Ruether erörtert, dass wir auf der Suche nach der Erdheilung neue Erzählungen, die Öko-Gerechtigkeit hervorrufen und die Metaphysik der Verbindung unterstützen, schaffen müssen.23 Dies führt natürlich zur Neukonzeptualisierung der primären heiligen Symbole, so dass die menschliche Diskussion über das Göttliche die (Stärkung von) Relationalität anregt. Carter Heyward schlägt vor, den christlichen Gott als ein Modell von Macht zu verstehen, das in Beziehung ist, und meint damit, dass sich dieses Modell dann in egalitären und gerechten Beziehungen in der Gesellschaft widerspie geln könnte. In diesem Zusammenhang erfordert die Betonung der göttlichen Immanenz folglich den Aufbau einer neuen Beziehung zwischen der Menschheit und dem Rest der geschaffenen Ordnung: denn das Letzte vermittelt das Göttliche genauso wie das Erste.24 Was hier zu finden ist, betrifft den Übergang vom anthropozen trischen theologischen Paradigma zu einem sogenannten »lebenszen trierten theologischen Paradigma«, in dem Gottes gesamte Schöp fung, einschließlich der Frauen und der Natur, Gegenstand der Theologisierung wird. Ökofeministische TheologInnen setzen vor aus, dass dieses dialogische Paradigma alle wechselseitig bereichert und kritisch korrigiert – und so zum Leben der gesamten Schöpfung Gottes beiträgt. Die innewohnende Gegenwart Gottes in Mensch und Natur wird im Sinne des Weltmodells als Leib Gottes verstanden. Aus diesem Grund betrachtet der christliche (Öko)Feminismus das Land als Sakrament Gottes. Richard Grigg hat ein weiteres wichtiges Merkmal der (öko)feministischen Theologie im Hinblick auf das Verständnis des Göttlichen hervorgehoben und belegt dies dahingehend, dass »in einem Großteil der gegenwärtigen feministischen Theologie ein implizites Motiv, nach dem Gott eine Beziehung ist, die der Mensch darstellen möchte, vorhanden ist«25. Wie er weiter ausführt, bedeutet dies nicht, das Göttliche auf Feuerbach’sche Weise auf eine unbe wusste, entfremdende Projektion zu reduzieren oder es als bloß imaginäre Einheit abzulehnen. Im Gegenteil, wesentliche Bestand teile des Göttlichen können den Menschen wirklich transzendieren – sowohl die Natur als auch die »Kraft des Seins« sind bekannte Kandidaten in feministischer Denkweise – und man verwirklicht eine 23 24 25
Vgl. R. Radfort Ruether, Gaia and God. Vgl. C. Heyward, The Redemption of God: A Theology of Mutual Relation. R. Grigg, »Feminist Theology and the Being of God«, S. 507.
366
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
Beziehung zu ihnen bewusst und auf eine produktive Weise, die nicht entfremdend ist, sondern eine positive Transformation schafft. Gleichwohl wird Gott in dieser Strömung der feministischen Theolo gie nicht als eigenständige Realität vorgestellt. Menschen stellen nicht einfach eine Beziehung zum Göttlichen dar, sondern inszenieren viel mehr das Göttliche selbst, sofern Gott eine bestimmte transformative Beziehung zwischen dem Selbst und der Natur oder dem Selbst und der Kraft des Seins, oder vielleicht dem Selbst und einem anderen Selbst ist. Menschen entscheiden sich, das Göttliche zu inszenieren, sie sind aber zu einem Großteil Geschöpfe dieser Beziehung und nicht nur ihre Schöpfer. Oder wie Richard Grigg es formulierte: »[..…] der traditionelle westliche Theismus versteht das Göttliche als ein transzendentes höheres Wesen. Die Moderne negiert den Theismus, indem sie ihn auf eine Projektion menschlicher Subjektivität reduziert. Die feministische Position negiert diese Negation, indem sie das Göttliche weder als eigenständiges übernatürliches Wesen noch als Produkt fehlgeleiteter menschlicher Vorstellungskraft auffasst, son dern als Existenzweise, als eine besondere Art von Beziehung, die Menschen zwischen sich selbst und anderen, und zwischen sich selbst und nichtmenschlichen Wesen und Kräften inszenieren können […] Das Göttliche ist eine Beziehung, welche die Menschen darstellen wollen. Die Aufgabe der Theologie besteht also nicht darin, Zugang zu einer objektiven Einheit, von der sie naiv annimmt, dass sie ›da draußen‹ ist, zu erlangen und Behauptungen darüber aufzustellen, sondern das Göttliche zu verwirklichen.«26
Diese Behauptung folgt natürlich der feministischen Neigung, eine Theologie zu verfolgen, die im wahrsten Sinne des Wortes eine Theologie »von unten« ist, eine Theologie, die offen als eine Funktion der Erfahrungen und Ziele von Frauen fungiert. All dies impliziert eine Ablehnung des traditionellen Bildes des Göttlichen als überna türliches Wesen, das außerhalb des Begrenzten stehen kann. Gleich zeitig gibt es eine Art von Transzendenz, die mit der Betonung auf Immanenz kombiniert werden kann, die zumindest nach Ansicht von Denkern wie Radford Ruether für die feministische Theologie enorm wichtig ist. Sie lehnt den transzendenten imperialen Gott des patriarchalischen Christentums zugunsten des menschlichen Grund bildes des Göttlichen als Urmatrix, des großen Mutterleibes, in dem alle Dinge, Götter und Menschen, Himmel und Erde, Menschen und 26
Ebd., S. 508.
367
Nadja Furlan Štante
nichtmenschlichen Wesen erzeugt werden, ab. Das Göttliche befindet sich nicht dort oben als abstrahiertes Ego, sondern unter und um uns herum als umfassende Quelle und Erneuerung des Lebens.27 In dem Bild dessen, was Radford Ruether uns »Gott/Göttin« nennen lassen möchte, ist das Göttliche eindeutig immanent, in eins aber auch allumfassend – und bis zu einem gewissen Grad (bzw. in einem gewissen Sinn) auch transzendent. Der Begriff »Urmatrix« schlägt einen umfassenden Rahmen oder Boden – etwas jenseits von uns, zu dem wir dennoch gehören – vor. Oder, wie Carter Heyward behauptet, ist Gott die Kraft der Beziehung.28 In ähnlicher Weise behauptet Radford Ruether, dass Gott/Göttin »in und durch Beziehungen, in der Heilung unserer zerstörten Beziehung zu unserem Körper, zu anderen Menschen, zur Natur« wahrgenommen wird. Wenn wir die destruktive Denkweise von Mann gegen Frau, reich gegen arm und Geist gegen Materie überwinden – Dualismen, die uns von der Natur und von anderen Menschen trennen – kommen wir in die Beziehung zur Göttlichkeit: »Gemeinschaft mit Gott/Göttin existiert genau in und durch diese erneuerte Gemeinschaft der Schöpfung«.29 In dieser Harmonie findet Ivone Gebara in ähnlicher Weise das trinitarische Gottesverständnis wieder. In ihrer Interpretation übersetzt sich der Begriff der Heiligen Dreifaltigkeit nicht als Offen barung von oben, die als ewige, unbestreitbare Wahrheit, welche mit der Erfahrung des Alltags unvereinbar ist, verstanden werden sollte, sondern als jene, welche durch alltägliche Erfahrungen von Beziehun gen innerhalb des Lebensnetzes immer wieder neu konstruiert wird und als solche immer wieder neue Erscheinungen und Gesichter erhält.30 Nach dem ökofeministischen Verständnis von Vernetzung sollten Menschen Verwalter der Natur sein, die ihre Ausbeutung und Zerstörung verhindern. Radford Ruether behauptet, dass neue regionale Gemeinschaften ihre Beziehung zu Land, Landwirtschaft und Wasser auf nachhaltige Weise, basierend auf demokratischen Entscheidungen, die alle Parteien, einschließlich der nichtmenschli chen Natur, berücksichtigen, neu entwickeln müssen.31 R. Radford Ruether, Sexism and God-talk, S. 48–49. C. Heyward, The Redemption of God, S. 299. 29 R. Radford Ruether, Sexism and God-Talk, S. 163. 30 R. Radford Ruether, Integrating Ecofeminism, Globalization and World Religions, S. 113. 31 Ebd., S. 124. 27
28
368
Ökofeministische Theologie der Interdependenz
Die Transformation negativer Stereotypen, die jede Art von Herrschaft in einen ökozentrischen Egalitarismus zurückholen, scheint der nächste Schritt der Entwicklung menschlicher und nicht menschlicher Beziehungen im Lebensnetz zu sein. Veränderung beginnt zuerst in uns selbst. Mit den Worten von Rosemary Rad ford Ruether: »Wir müssen zunächst erkennen, dass Metanoia oder Bewusstseinsveränderung bei uns beginnt.«32
Literaturverzeichnis Anderson, P. S., »Feminist Theology as Philosophy of Religions«, in: S. F. Parsons (Hg.), The Cambridge Companion to Feminist Theology, Cambridge: Cam bridge University Press 1982, S. 40–57 Baugh, A., »Gender«, in: Bauman, A. W., Bohannon II R. R., O’Brien, K. J. (Hg.), Grounding Religion, London, New York: Routledge, 2011, 130–146 Daly, M., Beyond God the Father. Toward a Philosophy of Women's Liberation, Boston: Beacon Press 1973 Eaton, H., Introducing Ecofeminist Theologies, New York: T & T Clark Inerna tional 2005. Furlan Štante, N. Woman, Nature and Religion: Eco-feminist Perception, Koper: Univerzitetna založba Annales 2014. Grigg, R., »Feminist Theology and the Being of God«, in: Journal for the Study of Religion 74/4(1994), S. 506–523 Gross, R. M., »Feminist Theology as Theology of Religions«, in: S. F. Parsons (Hg.), The Cambridge Companion to Feminist Theology, Cambridge, New York: Cambridge University Press 2002, S. 60–79. Gilligan, C., In a Different Voice, Cambridge Massachusetts: Harvard University Press 1982 Gebara, I., Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation, Mineapolis: Fortress Press 1999 Gray, M., Redeeming the dream: feminism, redemption and Christian tradition, London: SPCK 1989. Heyward, C., The Redemption of God: A Theology of Mutual Relation, Lanham, Maryland: University Press of America 1982 Isherwood, V., McEwan, D., An A to Z of Feminist Theology, Sheffield: Sheffield Academic Press 1996 McFague, S., Models of God, Philadelphia: Fortress Press 1987 –. The Body of God: An Ecological Theology, Minneapolis: Fortress Press 1993 Powell, J. L., Four Revolutions in Earth Sciences, From Heresy to Truth, New York: Columbia University Press 2014
32
R. Radford Ruether, Gaia and God, S. 269.
369
Nadja Furlan Štante
Primavesi, A., »Ecofeminism«, in: V. Isherwood, D. McEwan (Hg.), An A to Z of Feminist Theology, Sheffield, Sheffield Academic Press 1996, 45–48 Radford Ruether, R. New Woman, New Earth, New York: Seabury Press 1975 –, Sexism and God-talk, Boston: Beacon Press 1983 –, Gaia and God, New York: HarperOne 1992 –, Integrating Ecofeminism Globalization and World Religions, New York: Row man & Littlefield 1995 Warren, K. J., »Feminism and ecology: Making connections«, in: Environmental Ethics 9/1 (1987), S. 3–20
370
Michael Staudigl
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt« Eine kritische Intervention1
Spätestens seit »9/11« hat die so genannte »Rückkehr der Religion« immense öffentliche Beachtung erregt. Ob es sich bei dieser Rede nun um ein soziologisches Faktum, ein philosophisches Artefakt oder gar ein theologisches Desiderat handelt, sei hier dahingestellt. Aus zugehen ist in jedem Fall von einer verstärkten Aufmerksamkeit für »Religion«, die sich in sehr verschiedenen Formen ausspricht. Auch mit dem Ausdruck ihrer »Rückkehr« assoziiert man eine ganze Reihe von sehr verschieden gelagerten Phänomenen. Man denke nur an die Entwicklung neuer Formen »gelebter Religiosität« und insbesondere »Spiritualität«2, an neuartige Artikulationen von »Transzendenzer fahrung«3, an die globale Sichtbarkeit »religiöser Gemeinschaften«4, an das virulente Wiederaufkommen »politischer Theologien«5 und natürlich an das in sich vielfältige Phänomen so genannter »religiöser Gewalt«. Besonders kontrovers diskutiert werden in diesem Zusam menhang nicht nur die verschiedenen Erscheinungsweisen solcher Gewalt, sondern auch ihre mediale Repräsentation und spektakuläre, oft geradezu voyeuristisch anmutende ästhetische Aufbereitung, und Der vorliegende Text wurde im Rahmen des FWF-Projekts „The Revenge of the Sacred“ (FWF P-31919) erarbeitet und stellt eine umfassend erweiterte deutsche Fassung von M. Staudigl, „Prolegomena Toward a Phenomenology of Religious Violence. An Introductory Exposition“ (Continental Philosophy Review 53(2020): 245-270) dar. 2 Hierzu paradigmatisch P. Heelas & L. Woodhead, The Spiritual Revolution, H. Knoblauch, Populäre Religion. 3 Vgl. dazu die systematischen Überlegungen bei B. Giesen, »Tales of Transcen dence«. 4 Vgl. mit einer Reihe von Beispielen H. Kippenberg, »Phoenix from the Ashes«. 5 Eine Übersicht hierzu bieten De Vries & Sullivan, Political Theologies. Public Religions in a Post-Secular World. 1
371
Michael Staudigl
last but not least die verschiedenen Formen ihrer Rechtfertigung. Wie Clarke anschaulich nachweist, handelt es sich bei den entsprechenden Rechtfertigungsstrategien nicht um aller Vernunft entbehrende Aus drücke bloßer Irrationalität, Monstrosität oder Verblendung, sondern um Argumentationsfiguren, die auch für »secular ears« keineswegs unverständlich sind.6 Die Frage, wovon man eigentlich spricht, wenn man von »religiöser Gewalt« spricht, was man nun als exemplari sche Formen und Fälle solcher Gewalt ansieht, was hier »religiös« bedeutet, etc. – all dies verweist darauf, dass die Kategorie als solche höchst unscharf, ja womöglich fragwürdig ist und kritisch ins Licht zu rücken bleibt.
1. Eine konzeptuelle Gratwanderung Um zu verdeutlichen, wie kontrovers, ja polemisch die Trope »reli giöse Gewalt« wahrgenommen, diskutiert und diskursiv eingesetzt wird, denke man nur an einige konkrete Fragen, die in diesem Kontext auftreten. Die Fragen danach, wie die Wahrnehmung dessen, was als »religiöser« »Fundamentalismus«, »Fanatismus« oder »Terroris mus« »im Namen Gottes« zu verstehen ist, die säuberlich getrennt scheinenden Register von säkular/religiös durcheinander bringt; wel che Rechtfertigungen »religiöser Gewalt« im Kontext sog. »heiliger Kriege« verfangen; welche Idiome bspw. eines sog. »caring Jihad« oder eines »sexual jihad« medienwirksam fungieren; wie überdeter minierte Sinnformeln wie die des »Selbstmordattentats« geradezu exemplarisch unsere Auffassung verschiedenster, hierunter subsum mierter Phänomene als irrationalen Atavismus, als »verblendeten Akt« (Habermas) oder als das »ganz Andere« diskursivierter Vernunft prägen; wie die »Rückkehr« verfemter Praxen von Exorzismus, Geiße lung oder auch Kreuzigung eine ganze imaginäre globale »Geographie der Gewalt« herbeizitiert7; oder auch, wie das Recycling von narrati ven Semantiken von »Schuld«, »Strafe« und »Reinigung« im Kontext der aktuellen »Corona-Krise« rezente Krisenwahrnehmungen mit entsprechenden religiösen Interpretamenten diskursiv überfrachtet 6 Vgl. S. Clarke, The Justifications of Religious Violence, S. 174 ff., zur basalen Intelli gibilität grundlegender Argumentationsfiguren (»Heiliger Krieg«, »Leben nach dem Tod«“ und »Bezug auf ›das Heilige‹“). 7 Vgl. S. Springer, »Violence Sits in Places? Cultural Practice, Neoliberal Rationalism, and Virulent Imaginative Geographies.«
372
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
— all diese Fragen zeigen, dass der Kampf um die Definitionshoheit »›religiöser‹ Gewalt« ein in der Tat integraler Bestandteil eines Phäno mens selbst ist. Diese Problemlage verdeutlicht nicht nur dieser höchst selektive Überblick in intuitiver Weise. Wie aktuelle Arbeiten zum Problem kreis »epistemischer Gewalt« in systematischer Weise zeigen, ist das Konzept »religiöse Gewalt« vielmehr als solches höchst problema tisch, da es in einer Reihe von Diskursen als vorgefertigte Vignette zur Erklärung »sozialer Pathologien«, »politischer Dysfunktionalität«, »zivilisatorischer Rückständigkeit« oder allgemein gesprochen als Marker von Irrationalität eingesetzt wird, der ganze Ideologien ratio naler Gegen-Gewalt legitimiert, wie man insbesondere nach 9/11 deutlich sehen konnte.8 Und in der Tat: Die medial verbreiteten Bilder »religiöser Gewalt«, die im Internet ob ihrer Spektakularität geradezu inflationär flottieren und uns dabei nur zu augenscheinlich mit der Evidenz versorgen, dass solche Dinge wirklich geschehen, uns dadurch in eins in eine abgründige Dialektik von Abstoßung und Fas zination einschreiben, geben unfraglich Anlass zur Sorge. Führt man sich zudem die allzu offensichtliche »Irrationalität«, unzeitgemäße »Barbarei« und jene zudem weitgehend noch aller Zweckrationalität spottende »Sinnlosigkeit«, ja den horrorism9 vor Augen, welche die Wurzel dieser Ereignisse zu bilden scheinen, so sind wir in der Tat auch rasch perplex und sprachlos. Wie Neil Whitehead aus kulturanthropo logischer Perspektive klarstellte, ist der Zustand solcher Verwirrung angesichts eines solchen horror religiosus jedoch keineswegs unschul dig. Er wird vielmehr geradezu habituell dazu verwendet, uns auf eine wissenschaftliche »Jagd nach Ursachen«10 einzuschwören, eine Jagd, der es in letzter Instanz immer darum geht, die »Dinge, die schief laufen«, einer rational begründeten Lösung zuzuführen, sei es nun, dass das Deviante sanktioniert, das Abweichende korrigiert, oder das Fehlende produziert wird. Diese sozial-technologische Logik der Problemlösung, die gesellschaftliche Ordnung bzw. prozedurales Funktionieren teleologisch sicherstellen soll, bleibt jedoch, das ist Vgl. W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, S.; zur Rolle epistemischer Gewalt vgl. etwa Claudia Brunners kritische Diskussion der Diskurse über »Selbst mordattentate« in Wissensobjekt Selbstmordattentat. 9 Dieser Neologismus geht zurück auf A. Cavarero, Horrorism. Naming Contempo rary Violence. 10 N. Whitehead, »The Poetics of Violence«, S. 40.
8
373
Michael Staudigl
ihr blinder Fleck, indifferent gegenüber der eigenen Gewalt, die sie oft moralisch verbrämt11, gegenüber der oft unsichtbaren Gewaltsamkeit der eigenen Ordnung –, und insbesondere blind für die Tatsache, dass sie »das Andere« als das zu Ordnende, als Gegenstand und Material des »Projekts Ordnung«, selbst (mit) (re)produziert.12 Eine phänomenologische Herangehensweise an das – in der Denkfigur »religiöser Gewalt« exemplarisch vor Augen tretende – Phänomen des Anderen der Vernunft muss unserer Auffassung zufolge ihren Ausgang von dem, was Husserl einmal »ethische Epoché« nannte, nehmen.13 Es handelt sich hierbei um eine praktische Epoché, die dazu dient, uns in einer Situation zu orientieren, in der die Dring lichkeit des Verstehens und entsprechenden Handelns klar aufscheint, kurzschlüssig moralisierendes Urteilen im Zeichen unbefragter, d.h. habituell verfestigter normativer Vorannahmen jedoch tunlichst zu vermeiden ist, um weitere Eskalationen zu vermeiden. »Gewalt« – insbesondere »religiöse Gewalt« – versinnbildlicht in der Tat jene Idee einer Andersheit, die uns be-trifft, wie von »außen« zustößt und unsere Kapazitäten, die Welt zu verstehen und sinnhaft auszu legen, in Frage stellt. Betrachtet man sie so, verkörpert sie in der Tat eine Herausforderung für die Vernunft. Dies trifft vor allem, wie mir scheint, jene prozeduralen Auffassungen von disengaged reason (Charles Taylor), die mit dem Siegeszug der politischen Moderne, der säkularistischen Doktrin und der Selbstgerechtigkeit des liberal imaginary prädominant, ja letztlich hegemonial wurden und mithin »unser« Selbstverständnis prägen. Selbst die »diskursive Vernunft« ist, wie Habermas in diesem Zusammenhang – eher wider Willen – zu verstehen gegeben hat14, Ebenso exemplarisch wie polemisch auf den Punkt gebracht bei Cavanaugh: »They have not yet learned to remove the dangerous infl uence of religion from political life. Their violence is therefore irrational and fanatical. Our violence, being secular, is rational, peace making, and sometimes regrettably necessary to contain their violence. We find ourselves obliged to bomb them into liberal democracy.« (W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence, S. 5). 12 Vgl. Z. Baumans Überlegungen in Modernity and Ambivalence zur vielfach dis kursiv überspielten Abhängigkeit »rationaler Ordnung« von der Produktion eines ihr gegenübergestellten Chaos, eines Anderen der Ordnung, eines »Rohmaterials« in eins, das zu ordnen bleibt, soll das »Projekt Ordnung« Zukunft haben (vgl. ebd. S. 4 ff.). 13 Zu diesem Konzept vgl. Staudigl, Phänomenologie der Gewalt, S. 163–168. 14 Die Ambiguität, die Habermas’ spätes Interesse an der Religion (vgl. J. Habermas, Zwischen Naturalismus und Religion; ders., »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«; ders., »Politik und Religion«; dazu noch Habermas & Ratzinger, Dialektik der Säkula 11
374
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
keineswegs unschuldig. Sie hat sich vielmehr definitiv selbst zu erhal ten angesichts ihres »Anderen« und insbesondere angesichts derart bedrohlicher Herausforderungen, wie »verblendete« Gewalt eben nur allzu augenscheinlich eine ist. Dabei aber muss sie, würde ich hinzu setzen, enorm wachsam bleiben, ja werden, damit sie nicht jenen Ima ginationen »drohender Unordnung« (Foucault) zum Opfer fällt, die in unseren »Kulturen der Angst«15 so folgenreich ihr Unwesen treiben. Um ihren Universalität heischenden Anspruch auf die »Einbeziehung des Anderen« (Habermas) in legitimer Weise voranzutreiben, muss die Praxis diskursiver Vernunft in jedem der Schritte, den sie setzt, Vorsicht walten lassen: Zum einen muss sie wie gesagt achtsam darauf sein, solche Andersheit nicht einfach weg zu rationalisieren, indem sie diese als ein bloßes Problem definiert, das schlicht einer funktionellen Lösung zuzuführen ist, d.h. als eine »soziale Pathologie«, für die es Abhilfe zu leisten gilt, eine »Devianz«, die zu sanktionieren bleibt, oder eine systemische »Dysfunktion«, die durch die Implementierung effektiver Systemadaptionen oder prozeduraler Erweiterungen repa riert werden kann. Sie muss es, anders formuliert, vermeiden, in eine selbstgerechte Position zu verfallen, die sich selbst allzu leicht sakrosankt sieht und sich dem Anderen nur auf der Grundlage eines paternalistischen Habitus zu öffnen vermag.16 Zum anderen muss die Praxis »diskursiver Vernunft« es aber auch vermeiden, sich von der Inspiration des »ganz Anderen« einfach absorbieren zu lassen: eines »ganz Anderen«, dessen Ansprüche zwar unwiderruflich nach Antworten verlangen, aber auch rasch überfordernd werden, was uns Levinas‘ Denken so deutlich vor Augen führt.17 Auf das »ganz risierung) begleitet, hat eine ebenso reichhaltige wie kontroverse Diskussion nach sich gezogen. Während ich mich hier einer umfassenden Darstellung und Evaluation dieser Diskussion nicht widmen kann, verwende ich diese Ambiguität als einen Leitfaden für die kritische Auseinandersetzung mit der leitenden Problematik. 15 Dazu eindrucksvoll z.B. M. Crépon, La guerre des civilisations: La culture de la peur. 16 Wie feministische Theorie überzeugend gezeigt hat, bindet uns das paternalisti sche imaginary an die schlechte Alternative, das Andere entweder beschützen oder bekämpfen zu wollen/müssen – das heißt an eine Logik der Konfrontation, welche die moderne Auffassung von Autonomie sowie Souveränität mit einer Kultur der Herrschaft und sie sichernder Gewalt verknüpft. Eine überzeugende Analyse dieser Geste findet sich D. Bergoffen, »The Flight from Vulnerability«; eine konkrete Exem plifikation in Abu-Lughods »Do Muslim Women Really Need Saving?«. 17 Kearney präsentiert in Strangers, Gods, and Monsters dieses Dilemma, das bereits in Levinas‘ Totalität und Unendlichkeit greifbar wird, sich in dessen Spätwerk noch verschärft, auf sehr anschauliche Weise: Sein Versuch, einen phänomenologisch-her
375
Michael Staudigl
Andere« und dessen in der Tat möglicherweise exzessive Ansprü che zu antworten, erscheint so als ein wahrlich schwierige, ja in gewisser Weise un-mögliche Aufgabe.18 Gefangen zwischen unseren Illusionen von Autonomie und Souveränität und jenen bedrohlichen Imaginationen von Heteronomie, finden wir uns in einer wahren Zwickmühle wider. Und genau hier wird entsprechend die Neigung groß, in jenen eingefahrenen Denkwegen zu verbleiben, die diesen Anspruch des Anderen stillstellen, sei es, dass sie ihn überhaupt zum Schweigen bringen, oder uns indifferent für das irrationale »Geschrei« machen, das er ja so greifbar verkörpert.19 Besieht man die Dinge so, dann verkomplizieren sie sich aller dings auch rapide. Indem die »säkulare Doktrin« »religiöse Gewalt« lange als einen Marker für die unterstellte Irrationalität der Religion präsentierte20, ventilierte sie nicht nur das klassische Schisma zwi schen religiösen und säkularen Weltbildern. Sie schaffte es damit in eins, jegliche kritische Infragestellung der normativen Ansprüche des Säkularismus als Relativismus und letztlich sogar als Fanatismus hinzustellen, ja geradezu zu brandmarken.21 Angesichts solcher eska lationsaffinen Konsequenzen argumentiere ich dafür, das säkulare Streben nach Ordnung genauer in Augenschein zu nehmen. Denn wie die vorhergehenden Überlegen mindestens anzeigen, scheint es seine Solidität offenbar dadurch zu erhalten, dass es eine abweichende, pathologische, ir-rationale bzw. un-ordentliche (unruly, disorderly) Qualität in seinen »relevanten Anderen« zu identifizieren vermag, insbesondere in seinen religiösen Anderen. Doch mehr noch, es arbeitet nicht nur daran, diese zu identifizieren, nein, die Integrität dieses Bestrebens selbst erweist sich aktuell zusehends abhängig von derartigen Projektionen – und dies in einem solchen Ausmaß, dass es sich geradezu als an solch unterstellter Andersheit parasi meneutischen Mittelweg zwischen unseren lieb gewonnenen »Illusionen von Autono mie« einerseits und den »postmodernen Verführungen« von Heterologie zu eröffnen, ist eine zentralen Inspiration für meine Überlegungen hier. 18 Vgl. mit explizitem Blick auf den »religiösen Anderen« M. Moyaert, »In Response to the Religious Other«. 19 Vgl. dazu die grundsätzlichen Überlegungen bei Rancière in Das Unvernehmen. 20 Eine erhellende Diskussion darüber, wie sich diese Doktrin ideologisch verhärtet, liefert S. Glendinning in »Japheth’s World: The Rise of Secularism and the Revival of Religion Today«. 21 Vgl. S. Mahmood, »Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?«.
376
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
tierend verrät.22 Indem das »liberale Mindset« (liberal imaginary) den (vorgeblich pazifizierenden) Effekten moderner Säkularität eine umfassende Vorstellungswelt »wilder« Gewalt gegenüberstellt, spielt es damit dem in die Hände, was William Cavanaugh trefflich den »Mythos religiöser Gewalt« genannt hat.23 Dasselbe gilt in der Folge für die von der Moderne propagierten Ideale »diskursivierter Ver nunft« und deliberativer Praxis, die sie aktiv implementiert, ohne zu sehen, inwiefern diese ihrerseits Gewalt verbrämen. Vergegenwär tigt man sich dies, wird deutlich, dass dieser Mythos eine effektive Weise darstellt, staatliche Gewalt, d.h. Gewalt im Namen faktisch fungierender Ordnung, zu exkulpieren. Aber nicht nur dies ist zu bemerken. Wahrlich ungeheuerlich daran ist vielmehr noch, dass dieser mentale Habitus uns den weitreichenden bzw. tiefgreifenden Effekten vielgestaltiger Gewalt gegenüber indifferent macht – und in der Folge die existenzialen Strukturen, in denen wir uns immer schon selbst verstehen, mit implizit gewaltsamen Ordnungselemen ten imprägniert, ja in letzter Instanz uns vielleicht dazu (ver)führt, solche Gewalt zu affirmieren.24 Vergegenwärtigt man sich dies, so wird deutlich, dass unsere Wahrnehmung von Gewalt (dessen also, was wir zunächst und zumeist darunter verstehen, bzw. zu verstehen gewohnt sind) mit Ambiguitäten durchsetzt ist. Die beunruhigendste darunter dürfte jene sein, die sich in der durch und durch ambivalenten Inklusion von vorgeblich äußerer, also zu exkludierender (religiöser) Gewalt in unseren vorgeblich nicht-gewaltsamen modernen Vorstel
Vgl. nochmals Z. Baumans Reflexionen zur parasitären Abhängigkeit moderner Ordnung von jenem Chaos, das sie als zu ordnendes Material braucht (und mithin produziert), soll das »Projekt Ordnung« Zukunft haben (vgl. Modernity and Ambiva lence, S. 4 ff.). Weiterführende Evidenzen für dieses konstitutive Zusammenspiel las sen sich in kulturanthropologischen Studien finden, die die klassischen Tropen des »Barbaren« (vgl. Schneider, Der Barbar. Endzeitstimmung und Kulturrecycling) oder des »Kannibalen« (N. Whitehead, »Divine Hunger: The Cannibal War Machine«) kri tisch reflektieren; für eine phänomenologische Analyse dieses Parasitismus vgl. Verf., »Parasitic Confrontations«. 23 Vgl. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. Wie Springer in »Violence sits in Places?« zeigt, wird diesem Mythos durch eine umfassende Geographie der Gewalt sekundiert, d.h. vermittels der Unterstellung, dass Gewalt an gewissen Orten sozusagen »sitze«, ansässig sei (»sits in places«). 24 Vgl. systematisch M. Crépon, Murderous Consent: On the Accomodation of Violent Death, sowie B. Liebsch, Verletztes Leben. Studien zur Affirmation von Schmerz und Gewalt im gegenwärtigen Denken. 22
377
Michael Staudigl
lungswelten (social imaginaries)25 artikuliert — im Sinne also einer »einschließenden Ausschließung«, um Agambens sinnfällige Formel zu zitieren. Mit Mahmood26 ließe sich dieser Zusammenhang auch wie folgt resümieren: Säkulare Notwendigkeit (secular necessity) und religiöse Bedrohung (religious threat) werden aktuell in komplexer Weise korreliert – eine Weise jedoch zeichnet sich übergreifend ab, jene nämlich, die einseitig den religiösen Affekt (religious affect) stigmatisiert und die säkulare Vernunft (secular reason) heilig spricht. Dies jedoch geschieht auf Kosten einer Ausblendung der Potentiale »religiöser Vernunft« und in eins einer Exkulpierung der Konsequen zen eines fehlgehenden säkularen Affekts (secular affect). Angesichts dieses Verdachts und im Zeichen der konzeptuellen Inadäquatheiten sowie der angesprochenen ethischen Indifferenz des philosophischen Kanons, wenn es darum geht, das vielschichtige Phänomen »religiöser Gewalt« ins Auge zu fassen, wird deutlich, dass der Diskurs hierüber in der Tat höchst problematisch ist. Wie auch im Kontext der religious studies neuerdings gezeigt wurde, ist die bloße Konzeptualisierung von »religiöser Gewalt« ein durch und durch kritischer Punkt, der selbst in rezenten philosophischen und phänomenologischen Diskursen, die Deskription, Kritik und Genea logie miteinander zu verbinden gelernt haben, ausgeblendet bleibt. Das ist nicht nur darauf zurückzuführen, dass diese Diskussion für allzu lange Zeit auf einschlägige Nachbardisziplinen in den Geistesund Humanwissenschaften ausgelagert wurde, ein Punkt, der für die Gewaltforschung im Allgemeinen zutrifft (sofern sie mehr am Erklären denn am Verstehen orientiert war und ist). Meiner Auffas sung zufolge ist das wahre Problem dabei, das sich in dieser empiri schen Auslagerung des Forschungsgegenstandes anzeigt, jedoch ein anderes. Es handelt sich um ein in der Tat kardinales Problem der Philosophie selbst, eines, das diese mit ihrem relevanten Anderen hat. Konfrontiert mit den »Gespenstern« des Glaubens und dem »unabgegoltenen Potential« religiöser Semantiken, die die Teleologie abendländischer Vernunftkonzeptionen (von Hegel bis Habermas) in Ich bevorzuge im Folgenden den Gebrauch der englischen Formel social imagina ries, da diese nicht nur eleganter ist, sondern in griffiger Weise die relevanten Dimen sionen und Implikationen des Konzepts vermittelt (vgl. Ch. Taylor, Modern Social Imaginaries), dabei neuerdings auch die Formen seiner leibhaftigen Verkörperung (dazu A. Steinbock, Moral Emotions, S. 268 ff.). 26 S. Mahmood, »Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?«. 25
378
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
einer unabsehbaren Weise ebenso herausfordern wie inspirieren, wird die Vernunft mit der Notwendigkeit konfrontiert, nicht nur ihr eigenes Unbehagen und ihre Ohnmacht, sondern vor allem auch die eigene Konstruktion ihrer relevanten Anderen zu reflektieren. Die Aufgabe der Philosophie wird damit freilich noch schwieriger, ja womöglich un-möglich, da sie sich in der Reinheit ihrer Reflexion bereits befleckt findet. Wird so aber eine diese Befleckung zum Ausdruck bringende »Pathetik des Elends«, von der der junge Paul Ricœur in Die Fehlbar keit des Menschen spricht, in unserem Zusammenhang zuletzt nicht zu einem vielleicht unüberwindbaren Hindernis? Vermag ihr auch der hermeneutische Pfad einer »suchenden Vernunft«, die ihren Umweg über die Symbole und Mythen nimmt, keinen Ausweg zu weisen, einen Ausweg, der zuletzt freilich in einer – wie auch immer gebro chenen – Dialektik noch eine letzte Zuflucht sucht?27 Oder ließen sich doch einige metaphorische Ressourcen der philosophischen Tradition heranziehen, um die skizzierte Situation zumindest ansatzweise auf den Begriff zu bringen? Ließe sich nicht etwa sagen, dass im Zwielicht (sich) versagender Vernunftpraxis der Flug der Eule der Minerva28, deren lautloses Gleiten ihren Raubzug majestätisch verbrämt, so tief ansetzen muss und so spät nur einsetzen kann, dass sie der Gefahr eines unzeitgemäßen Sonnenaufgangs nicht ausweichen kann, sodass ihr Gefieder versengt? Und in der Tat, im Gegensatz zu dem, was Husserl noch zu hoffen wagte, verbleibt uns keine Garantie dafür, dass »die Vernunft« noch jene phönix-gleichen Vermögen in sich trägt, die ihre Wiedergeburt in der Konfrontation mit dem Widersetzlichen der Faktizität, also angesichts »ratlosester Trauer« (Hegel), uns versichern 27 Vgl. P. Ricœur, Die Fehlbarkeit des Menschen (bes. S. 17–33 zur »Pathetik des Elends«) bzw. Die Symbolik des Bösen. Letztere führt die Frage der Fehlbarkeit anschauungsreich in die Frage nach den Chiffren der Verfehlung und ihrer Integration in die endliche Existenz des Menschen über, ohne dabei mehr als Andeutungen zur früh vom Autor in Aussicht gestellten »Poetik des Wollens« zu geben, der die Aufgabe zugekommen wäre, eine versöhnende Vermittlung herauszuarbeiten. Zum gebroche nen Hegelianismus Ricœurs kann in diesem Rahmen nicht Stellung genommen wer den, wiewohl es überaus spannend anmutet, diese Frage mit Blick auf die Rolle der »Religion«, die erst im Spätwerk wieder virulent wird, zu stellen. 28 Den Gegensatz zu diesem Bild spricht Raschke an, der in Force of God schreibt: »The ›out-of-jointedness‹ of today can be laid at the feet of the very forces Nietzsche divined. It is impossible to arrive at a sense of crisis without a commitment to a genealogical adventure, which one must forthwith undertake. It is no longer a question of the Owl of Minerva taking flight, but of the mongoose going for the coiled cobra, the cobra that is the senescent metaphysico-political order in its dying gesture of defiance.« (Ebd., S. 18).
379
Michael Staudigl
könnte. Oder anders formuliert, auf unsere Frage bezogen: Droht die Problematik sog. »religiöser Gewalt«, jene so schmerzende Neu auflage der klassischen Frage nach der Verhältnisbestimmung von Glauben und Wissen, aktuell nicht zum Waterloo begriffsbewehrter Philosophie zu werden? Oder verfügen wir doch noch über andere – ungehobene, ungedachte, unabgegoltene? – Werkzeuge, um dieser abgründigen Herausforderung entsprechen zu können? Um jenen gähnenden Abgrund (widening gyre) zu überbrücken, der alles zu verschlingen und die Welt der Anarchie — um Yates zu paraphrasieren — auszuliefern droht? Wenn auch diese Beschwörung klassischer philosophischer Vor stellungswelten manchen LeserInnen überzogen oder gar unange messenen erscheinen mag, ich denke doch, dass sie zumindest einen entscheidenden Punkt zu begreifen erlauben: Alles in diesem philo sophical imaginary scheint sich um den Topos einer Bedrohung zu drehen – »mere anarchy«, »Unordnung«, »Verblendung«, »soziale Pathologie« oder auch der drohende Fall in »Geistfeindschaft und Barbarei«29. Das moderne Geschäft der Vernunft wird damit, kurz gesagt, zu einem Projekt. Die Frage bleibt jedoch, ob es sich hierbei um eine Form der Vernunft handelt, die sich in allen Nachgestalten ihrer Odyssee nur wiederfindet, oder ob sie sich als Suche nach einer exilierten Vernunft, nach einer noch ungedachten Vernunft im Kommen zu begreifen beginnt, einer, die sowohl ihre relativistische Selbstliquidierung als auch die selbstgerechten (und hegemonialen) Formen ihrer universalisierenden Implementierung hinter sich zu lassen vermag. Diese Situation — die Ambiguität der Religion in Bezug auf die Gewalt, wie auch jene Ambiguität, in die sich die Philosophie, verstanden als Projekt der vernünftigen Durchdringung dieser Ambiguität, verwickelt findet, wenn sie diese Problematik direkt aufgreift – bedeutet eine in der Tat kardinale Herausforderung für die Philosophie heute. Diese Herausforderung spiegelt sich in vielen aktuellen Frage stellungen wider, die um das Verhältnis von säkularer Modernität und deren (projektiv verortetes) Anderes kreisen. In diesem Kontext sind Fragen wie »Waren wir je säkular?«30, »Trifft das Konzept der
29 30
E. Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften, S. 347. Vgl. übergreifend C. Taylors opus magnum Ein säkulares Zeitalter.
380
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Säkularisierung vielleicht nur auf Europa zu?«31; ja »Ist das Konzept der Religion selbst vielleicht nichts anderes als eine geheime Waffe des hegemonialen westlichen Universalismus?«32, allesamt von zentraler Bedeutung. Greifen wir Asads allgemeine Antwort auf, so lässt sich in der Tat festhalten, dass das Konzept der Säkularisierung »is neither continuous with the religious that supposedly preceded it […] nor a simple break from it«. Dass, wie Asad anschließt, »the concept of the secular cannot do without the idea of religion«33, ist so zwar nur folgerichtig, jedoch von entscheidender Bedeutung, und muss auf den Begriff gebracht werden. Diese Einsicht zeigt nämlich, dass jede ver nünftige Reflexion über irgendein »reines Wesen« »der Religion« und folglich irgendeinen permanenten (vorgeblich »opaken« und/oder »irrationalen«) Kern »religiöser Gewalt« im besten Fall irreführend ist, im schlimmsten aber auf ein uneingestandenes orientalistisches Prärogativ verweist.34 Während nun solch kritische Einschätzungen der Säkularisierung mittlerweile breiter vertreten sind und auch zuse hends akzeptiert werden, haben sie doch mit enormem Widerstand zu kämpfen, wie etwa S. Mahmood zeigt: »While these analytical reflections have complicated the state of aca demic debate about the religious and the secular, they are often challenged by scholars who fear that this manner of thinking forestalls effective action against the threat of ›religious extremism‹ that haunts our world today. By historicizing the truth of secular reason and questioning its normative claims, one paves the way for religious fanaticism to take hold of our institutions and society. One finds oneself on a slippery slope of the ever-present dangers of ›relativism.‹ Our temporal frame of action requires certainty and judgment rather than critical rethinking of secular goods.«35
Während die große Mehrzahl der einschlägigen Debatten bis vor relativ kurzer Zeit in den Human- und Sozialwissenschaften ihren Ort hatte, ist es meine Überzeugung, dass derartige Fragen nicht nur von Interesse für die Religionssoziologie, religious studies, Sozialpsy 31 Zu dieser Fragerichtung siehe Martin, On secularization. Towards a revised gen eral theory. 32 Vgl. zu dieser Argumentationslinie sodann exemplarisch die Arbeit von T. Asad, Formations of the Secular. 33 Ebd., S. 25, 200. 34 Vgl. diskursbildend hierfür natürlich E. Said, Orientalism. 35 S. Mahmood, »Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide? «, S. 65.
381
Michael Staudigl
chologie, inter-religiöse Pädagogik, oder Kulturanthropologie sind. Indem solche Fragen uns in aller Schärfe an die Ambiguität gemahnen, die das vorherrschende säkulare Selbstverständnis von »Religion« in der Spätmoderne lange bloß untergründig prägte, verdeutlichen sie, welch immenses, obgleich verstörendes philosophisches Potential in ihnen liegt. Und fraglos rückte diese Ambiguität neuerdings auch schon zusehends in den Fokus einer Reihe von Untersuchungen quer durch die Disziplinen, so zum Beispiel mit Blick auf die folgenden Themenkonstellationen: Einerseits wird die Religion (oder genauer: eine wahre Form derselben) oftmals als befriedend, in eins aber auch als potentiell gewaltmotivierend vorgestellt.36 Einerseits wird überaus kontrovers, ja oft polemisch diskutiert, ob wir nicht von einem sich aus sehr mundanen Quellen speisenden »Mythos religiöser Gewalt« zum Narren gehalten werden37; andererseits wird postuliert, dass sehr wohl intrinsisch religiöse Rechtfertigungen von Gewalt existie ren.38 Einerseits wird unterstellt, dass im Kern mundane Formen von Gewalt im Kleide vorgeblicher Heiligkeit agieren (Papst Franziskus), also die Herrlichkeit einer »göttlichen Gewalt« mimetisch ausbeuten und mithin »die Religion« instrumentell missbrauchen; andererseits wird ein enormer argumentativer Aufwand betrieben, um zu zeigen, dass es in »der Religion«, ja in allen Religionen einen irreduziblen »gewaltsamen Kern« gebe. Es wird also gefragt, so kann man vielleicht übergreifend zusammenfassen, ob Gewalt intrinsischer Bestandteil von »Religion« sei oder ob sie nicht eher als ein »temporarily misdi rected behavior fostered by the narrative semantics of religion«39 zu gelten habe, ob wir es also nicht mit einem bloß kontingenten Miss brauch zu tun haben, der ihre positiven Potentiale aktuell bloß (noch) überschattet. Wie sehr auch immer diese Distinktionen differenziert werden mögen, die kardinale Frage bleibt m. E. doch eine andere. Sie verweist uns auf eine andere Perspektive, die in dieser Diskussion einzunehmen bliebe. Dies betrifft den Verdacht, dass es sich bei Paradigmatisch hierzu S. Appleby, The Ambivalence of the Sacred. Dazu überaus erhellend W. Cavanaugh, The Myth of Religious Violence. 38 Eine Analyse solcher Legitimationsforme(l)n beitet S. Clarke, The Justifications of Religious Violence. 39 Srubar, »Religion and violence«, S. 502 (Hvh. MS); Srubars Diskussion bezieht sich auf Assmanns kritische Analyse der Gewalt in monotheistischen Religionen, ins besondere deren »Gewaltsprache« und die Weisen, wie diese sich in konkrete »Topo logien des Heiligen und des Profanen« übersetzt (J. Assmann, Die mosaische Unter scheidung). 36 37
382
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
dem genannten Verhältnis nicht um eines polarer Termini, also um keine binäre Konstellation handelt, in der die Demarkationen der Phänomene in letzter Instanz klar vorliegen sollten bzw. hergestellt werden können. Genau solche Klarheit und Distinktheit ist nicht her stellbar, sie herzustellen korrespondiert vielmehr selbst einem Gewaltakt, der auf der Grundlage eines »metaphysischen Humanis mus« reüssiert, also mit Ausschließungen im Namen universaler Wertsetzungen agiert. Und in der Tat, alle genannten Fragen bzw. Formulierungen kreisen letztlich um eine irreduzible Verflechtung dieser Termini, die sie erahnen, um ihren gemeinsamen Boden und ihr gemeinsames Schicksal. Doch wenn man dies annimmt, dass Reli gion und Gewalt einander nicht nur nicht fremd sind, sondern dass sie sich überschneiden, so fragt es sich, was eine solche – wiederum verallgemeinernde – Aussage uns hilft?
2. Zur Kontextualisierung des Problems: Das Unbehagen am Säkuarismus Die tiefen Bande zu unterstreichen, die zwischen Religion und Gewalt fraglos bestehen, dies ist, könnte man also einwerfen, eine ebenso alte wie allgemeine Einsicht. Sie sagt uns in der Tat auch wenig über das Verhältnis zwischen Religion und Gewalt als solches, über seine konkreten Formen, über die Dynamiken, die es freizusetzen vermag. Es ist also kein neues topic. Unsere Wahrnehmung und vielmehr noch unsere Interpretationen »religiöser Gewalt« spielten in der Her ausbildung der modernen politischen Philosophie, insbesondere bei Hobbes, eine in der Tat kardinale Rolle und beeinflussten seitdem ebenso hartnäckig wie nachhaltig das philosophical imaginary40 poli tischer Modernität. Nun haben sich heute jedoch, so meine These, die zentralen Koordinaten, denen gemäß wir diese Trope zu denken vermögen, verändert – und dies, obwohl es oft in eben jene Rolle eingerückt ist, die dem als Naturzustand apostrophierten »Krieg aller gegen alle« bei Hobbes zugesprochen wurde. Der Kulturanthropologe Arjun Appadurai argumentierte zuletzt mit Blick auf den »Mahlstrom der Globalisierung« vehement für Aufmerksamkeit gegenüber einer 40 Überlegungen zur geradezu intimen, entsprechend oft unterbelichteten Implika tion von Gewalt im traditionellen Selbstverständnis der Philosophie, finden sich in A. Murphys Studie Violence and the Philosophical Imaginary.
383
Michael Staudigl
neuen Logik der Gewalt.41 Man muss diesen Ruf heute noch stärker akzentuieren, ja er verlangt danach, die angesprochene Beziehung zwischen (globalisierter) Religion und (globalisierter) Gewalt aufs Neue ins Auge zu fassen und zu explizieren. Denn gerade ange sichts seiner spektakulären Ereignishaftigkeit und oft ungekannter Erscheinungsweisen42, in denen sich Faszination und Schrecken so bedrohlich annähern, gilt es, eine zeitgemäße Analyse des Phäno mens auszuarbeiten. Die von Appadurai angezeigte »neue Logik der Gewalt«, die sich im Kontext einer »aus der Bahn geratenden Modernisierung«43 entwickelt hat, hat massiven Einfluss darauf, wie wir das wahrnehmen und interpretieren, was wir in oft allzu einsinniger Weise als religiöse Gewalt zu etikettieren gewohnt. Fraglos wurde solche Gewalt früher oft als etwas repräsentiert, das wir als »verfemten Teil« (Bataille) oder als »zensiertes Kapitel« (Lacan) unserer (vormodernen) Abkunft überwunden zu haben vermeinen und in der Folge selbstgerecht oft auf »unsere Anderen« projizieren. Aktuell jedoch, im Zeichen des genannten »Mahlstroms der Globalisierung«, lässt sich »religiöse Gewalt« keinesfalls mehr symbolisch dadurch beherrschen, dass man Teratologien irrationaler Andersheit oder unzivilisierter Rückständig keit herbeizitiert.44 Eine solche Geste leugnet nicht nur die Vielfalt an bestehendem kritischem Wissen, die integraler Bestandteil aller religiösen Traditionen (»Weisheitstraditionen«) ist, wenn sie auch oft unterdrückt und entstellt sind. Das wahre Problem an dieser Geste ist vielmehr, dass sie solcherart verfährt, als ob unsere Ideale von Fortschritt 45, »rationalistischer Assimilation«46 oder »relationa A. Appadurai, Fear of Small Numbers, S. 35 ff. Vgl. zu dieser »Phänomenologie« J. Derrida, »Glaube und Wissen« sowie H. De Vries, »Phenomenal Violence«; zur Problematik der Faszination durch das ereignishaft Neue vgl. wiederum Soeffner, »Faszinosum Gewalt«, insbes. mit Blick auf religiös konnotierte terroristische Gewalt. 43 J. Habermas, »Vorpolitische Grundlagen«, S. 33. 44 Eine erhellende anthropologische Studie der Fabrizierung von Alterität im Zeichen ihrer vorgeblichen Rückständigkeit findet sich bei Fabian (Time and the Other); einen komplementären Zugang, der das Recycling dieser Trope in seiner konstitutiven Bedeutung für die Identifizierung der »eigenen Kultur« in Zeiten der Krise nachver folgt, liefert Schneider in Der Barbar. 45 Vgl. dazu A. Allen, The End of Progress, S. Springer, »The Violence of Neoliberal ism«. 46 Vgl. zu dieser Kritik R. Kearney, »Beyond Conflict: Radical Hospitality and Reli gious Identity«, S. 102–4. 41
42
384
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
ler Ko-Existenz« (s.u.) nicht ihrerseits gewaltsame und in der Tat monströse Implikationen zeitigten.47 Ja in der Tat ist vielleicht auch der Verdacht nicht unbegründet, dass diese Potentiale sich in unsere liberalen Sozialtechnologien derart eingeschrieben finden, dass wir sie mittlerweile habituell zu übersehen geneigt sind.48 In diesem unserem mentalen Habitus reichen sich gelebte Indifferenz und pro jektive Selbstflucht entsprechend einträchtig die Hand. Zu dieser an sich schon quälenden Einsicht tritt sodann noch ein weiteres Problem hinzu. Wie in vielerlei Hinsicht gezeigt wurde, erscheint »religiöse Gewalt« oftmals als eine kritische, womöglich unvermeidliche Reak tion auf das verstörende Unbehagen, das unsere spätmoderne Kultur hervorgebracht hat und beschleunigt weiter produziert. Vor diesem Hintergrund erscheint »religiöse Gewalt« zudem, wie Derrida es formulierte, als eine Art von Gewalt, die in eins »zwei Zeitaltern« zugehörig ist. Anders gesagt, sie wird gerade auch von jenen Ten denzen motiviert und in der Tat hervorgebracht, die die Moderne zu implementieren begann, um eben sie zu bannen. Hypermoderne Technologien und diskursivierte Vernunft gehen hier gewissermaßen eine verhängnisvolle Affäre ein: In unseren ›Religionskriegen‹ gehört die Gewalt zwei verschiedenen Zeitaltern an. Die eine Gewalt scheint (…) eine ›gegenwärtige‹ Gewalt zu sein, sie deckt oder verbündet sich mit der Überentwicklung und Überkultivierung der militärischen Fern-Technologie – der ›digitalen‹ Kultur und der Kultur des Cyberspace. Die andere Gewalt ist eine ›neue archaische Gewalt‹, wenn man so sagen kann. Sie ist ein Gegenstoß, der sich gegen die erste Gewalt richtet, gegen alles, was diese darstellt. Revanche, Vergeltung. Sie greift auf die gleichen Ressourcen der Medi enmacht zurück, um in die nächste Nähe zum eigentlichen Körper und zum vormaschinell Lebendigen zurückzukehren (…). Zumindest zu dessen Wunschvorstellung oder dessen gespenstischem Wunschbild. Selbst wenn er das Gegenteil verspricht, erscheint der rezente Diskurs über die sog. »relationality« und »relational co-existence« letztlich nur exemplarisch für dieselbe Tendenz zu sein. Wie Colebrook in »A Cut in Relationality« zeigt, ist das Narrativ einer »relational existence« seinerseits zutiefst abhängig von Existenzweisen (forms of existence), die negativ markiert bzw. konnotiert werden, nämlich im Zeichen einer sog. »impoverished conception of relationality« (ebd., 179), die sie bloß verkörpern. Die Nähe zu traditionellen Zivilisierungstheorien, die daraus eine moralische Überlegen heit der »Zivilisierenden« ableiten, ist beschämend deutlich. 48 Eine Analyse solcher Strategien der Verschleierung und Überlegungen zur Frage, wie sie sich in unsere Vorstellungswelten eingenistet haben, findet sich bei Staudigl, »From the Crisis of Secularism to the Predicament of Post-Secularism.« 47
385
Michael Staudigl
Man rächt sich an der enteignenden und entkörperlichenden Maschine, indem man auf die nackte Hand zurückgreift, indem man zum deutlich identifizierten Geschlecht zurückkehrt, indem man sich eines elemen taren Werkzeugs und einer Stoßwaffe bedient. Was man als ›Gemetzel‹ oder als ›Greuel‹ bezeichnet (Wörter, die man im Rahmen ›eigentli cher‹ oder ›sauberer‹ Kriege nicht wirklich verwendet), dort, wo man die Toten nicht mehr zählen kann (ferngesteuerte Sprengstoffkörper, die auf ganze Städte zielen, ›intelligente‹ Fernlenkwaffen etc.) meint Folterungen, Enthauptungen, Verstümmelungen aller Art. Stets geht es um eine ausdrückliche Rache, häufig eine Vergeltung, die sich als sexuelle Vergeltung ausgibt: Vergewaltigungen, quälend verwundete, entstellte, abgetötete Geschlechtsteile, abgehackte Hände, Ausstellen der Leichen, Verschicken von abgetrennten Köpfen, die man einst in Frankreich aufspießte und hochhielt (phallische Umzüge der ›natürli chen Religionen). (…) Wir erkennen die Symptome eines reaktiven oder negativen Rückgriffs, Rache des eigenen und eigentlichen Körpers an einer enteignenden und entortenden Wissenschaftstechnik, die man mit dem Weltmarkt gleichsetzt, mit der militärisch-kapitalistischen Hegemonie (…). Die archaische und dem Anschein nach rohere Radi kalisierung der ›religiösen‹ Gewalt möchte im Namen der ›Religion‹ bewirken, dass die lebendige Gemeinschaft wieder Wurzel fasst, dass sie ihren Ort, ihren Körper, ihr Idiom wiederfindet, unberührt, heil, geborgen, rein eigentlich. Überall bringt sie den Tod und entfesselt mit einer verzweifelten (auto-immunen) Geste eine Selbstzerstörung, die sich an dem Blut des eigenen Körpers schadlos hält, so als gelte es, die Entwurzelung zu entwurzeln und sich die unberührte und geborgene Heiligkeit des Lebens wieder anzueignen.49
Derrida zufolge zeugt diese »Logik der Autoimmunität« jedoch nicht nur von den angeblich mangelnden Kompetenzen religiöser Lebens formen, mit jenen Herausforderungen fertig zu werden, die Spätmo derne und Globalisierung zusehends freisetzen. Sie ist vielmehr noch ein wesentlicher, ja konstitutiver Bestandteil eines »ideologischen Säkularismus« und der mit dessen Hilfe zu legitimieren gesuchten »Gegen-Gewalt« schlechthin, die sie nicht nur durch fortschreitende Rationalisierung instrumentell verbrämt50, sondern durch den recht fertigenden Bezug auf die Freisetzung der Vernunft im Ganzen sank tioniert, wie Nancy es herausgestellt hat:
J. Derrida, »Glaube und Wissen«, S. 87 f. Zu den Grenzen der Legitimierung von Gewalt und ihrer möglichen Ausblendung in Rechtfertigungsdiskurs vgl. Waldenfels‘ »Grenzen der Legitimierung«. 49
50
386
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Da, wo die Rationalitäten im Verstand verharren (Rationalitäten, zuweilen Vernünfteleien der Techniken, der Rechte, der Ökonomien, der Ethiken und der Politiken), und da, wo die etablierten Religionen – seit vier oder fünf Jahrhunderten schon überholt – ihre Traditionen äußerst schlecht fortsetzen (in fundamentalistischer Verkrampfung oder humanistischem Kompromiss), und folglich da, wo der Leerraum entstanden ist – nirgendwo anders als mitten im Herzen der Gesell schaft oder der Menschheit oder der Kultur, im Auge des Zyklons namens Globalisierung –, dort wächst unablässig eine Erwartung heran – und mit ihr dunkel die Möglichkeit ihres Entflammens. / Anders gesagt: Was die Aufklärung bis heute nicht geklärt hat, was sie in sich selbst nicht hat erhellen können, das drängt nur danach, aufzulodern in messianischer, mystischer, prophetischer, seherischer und orakelnder Gestalt (…). Und die Wirkungen dieses Brandes wären noch fürchterlicher, als jene der faschistischen, revolutionären, surrea listischen, avantgardistischen oder mystischen Exaltationen jeder Art (..). / Es sind die Bedingungen für ein Delirium gegeben, das sich im Maße jener Sinn- und Wahrheitswüste auszubreiten droht, die wir gemacht haben oder wachsen ließen. Und tatsächlich steht seinem Ausbruch gerade jener Platz offen, auf den die stete Beschwörung der ›Politik‹ beharrlich verweist. Eine politische Erneuerung nämlich oder eine Erneuerung der Politik selbst zielt immer auf die Vernunft, die Vernunft als Ganze in ihr Recht zu setzen.«51
Was Nietzsche in Götzendämmerung als einen apollinischen »Schleier der Vernunft« uns zu denken aufgab, zeigt sich in diesem Kontext lediglich in aller Deutlichkeit und auch Nachdrücklichkeit, wie Der rida explizit ausführt: »Sind die Kriegshandlungen oder die militärischen Eingriffe des jüdisch-christlichen Abendlandes, die im Namen der ehrwürdigsten Sache geschehen (im Namen des internationalen Rechts, der Demo kratie, der Souveränität der Völker, der Nationen oder der Staaten ja im Namen humanitärer Gebote) in gewisser Weise nicht ebenfalls Religionskriege? Die in einer solchen Frage enthaltene Hypothese hat nicht zwangsläufig eine verleumdende Wirkung, sie ist nicht einmal besonders originell, außer in den Augen jener, die überstürzt glauben, dass die gerechte Sache, die aufgezählten Gründe weltlichen Wesens sind und rein, frei von Religiosität.«52
51 52
J.-L. Nancy, Dekonstruktion des Christentums, S. 10. J. Derrida, »Glaube und Wissen«, 44.
387
Michael Staudigl
Lesen wir diese Zitate zusammen, so werden die tiefen Verbindungen spürbar, die das Phänomen »religiöse Gewalt« auf untergründige Weise mit der Krise unserer gegenwärtigen, spätmodernen social ima ginaries, ja mit einer strukturellen »Krise der Immanenz«53 und einer in ihrem Bilde zu gestaltenden »Politik« im Allgemeinen verbinden. Denn in der Tat verrät die unerhörte phänomenale Präsenz »religiö ser« Motive und Rechtfertigungen, die im Kontext der genannten »neuen Logik der Gewalt« – etwa im Rahmen der sog. »neuen Kriege« und der exzessiven medialen Präsenz dort zur Schau gestellter »Irrationalität«, »Barbarei« und »Bestialität« – ventiliert werden, zumindest auch eines sehr deutlich: dass eine ebenso konstitutive wie verschleierte Beziehung zwischen unseren spätmodernen social imaginaries und dem, was wir als ihr vorgeblich Anderes zu verstehen gewohnt sind, was wir als solches imaginieren und letztlich projektiv verorten, besteht – was sich in seiner Genese jedoch nur mit Blick auf den wüstenhafte »Leerraum« verstehen lässt, den die beschleunig ten Modernisierungs- und Säkularisierungsprozesse dort verstärkt entstehen lassen, wo deren Versprechen augenscheinlich zu versagen beginnen.54 Die Trope »religiöser Gewalt«55 versinnbildlicht, ja ver körpert dieses »ganz Andere«, das einer ebenso unaufrichtig wie krampfhaft an diesen Versprechungen festhaltenden Moderne als die unterstellte Ursache ihres Versagens entgegengesetzt wird, in exem plarischer Weise. In formelhaften Repräsentationen nicht-assimilier barer »Opazität«, eines »Illegitimen per se«, oder auch einer »violence incarnate« ist diese dabei auch diskursiv am Werk und animiert solcherart Imaginationen der Unordnung. Sie bedient damit jedoch nichts anderes als die Selbstgerechtigkeit einer säkularen Vernunft, die sich dem Kreuzzug »rationalistischer Assimilierung« (Kearney) verschrieben hat, eine »inclusion on Draconian terms«56 betreibt, bzw. eine letztlich bloß provisorische Einbeziehung des (Habermas) verordnet, die sich mit gutem Gewissen sprachlich verwalten und sozialtechnologisch aussteuern lässt. Diese Praktiken sind demzu folge jedoch nicht unverdächtig, weil faktisch bloß unzureichend. Im 53 Vgl. das gleichlautende Buch von Höhn, Krise der Immanenz. Religion an den Grenzen der Moderne, das bereits vor der Jahrtausendwende sensibel die genannten Bruchlinien und daraus entstehende Dynamiken diagnostizierte. 54 Derrida, »Glaube und Wissen«, S. 11. 55 Zur Rolle dieser Trope im liberalen Diskurs vgl. King, »The Association of ›Reli gion‹ with Violence«. 56 A. Appadurai, Fear of small numbers, S. 34.
388
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Gegenteil erweisen sie sich als komplizenhaft verstrickt mit jener »anderen Gewalt«, der sie sich so ostentativ entgegenstellen. Dem ist der Fall, da sie zum einen ein Bild solcher Gewalt im Allgemeinen – und »religiöser Gewalt« im Besonderen – kreieren, das Bild eines »ganz Anderen«, zum anderen aber in ein und derselben Geste die ihr eigene Gewalt normativ verbrämen und d.h. letztlich als Gewalt verleugnen, die sie als bloße Antwort freizusetzen vorgeben. Aktuell zeugt eine Vielzahl an politischen Phänomenen und kulturellen Entwicklungen in der Tat von einem sich verbreiternden Unbehagen, das die globale Situation geradezu beschleunigt produ ziert. Man denke nur an die überzogenen Imperative einer zusehends »wilden« Globalisierung; an die neoliberale Weltordnung, die im Zeichen des immer noch weitgehend sakrosankten Fortschrittsmy thos immer rascher aus den Gleisen gerät und die Grenzen ihres rollout zusehends auch mit Gewalt zu versetzen und zu überwinden weiß; an die Bruchlinien politischer Modernität, die an ein Vakuum des Politischen rühren, das Populismus und tendenziell Schlimmeres geradezu einlädt; und nicht zuletzt an die nihilistischen Implikationen eines »ideologischen Säkularismus«57, der jenseits prozeduraler Kal küle und sozialtechnologischer Algorithmen keine Antworten mehr zu haben scheint auf die existenzialen Fragen der Endlichkeit, der Exklusion und des Leidens, ja für all das im Grunde, »was zum Himmel schreit«58. Diese verstörenden Phänomene verweisen alle samt, so würde ich argumentieren, auf die irreduzible Ambiguität unserer spätmodernen Situation in der, um nochmals mit Habermas zu sprechen, eine »Erschütterung des Normbewusstseins […] sich auch in schwindenden Sensibilitäten für gesellschaftliche Pathologien und verfehltes Leben überhaupt (manifestiert).«59 Es handelt sich dabei um eine Situation, die aus der Krise des Säkularismus und einer »desengagierten Vernunft« in der post-säkularen Konstellation resultiert, die angesichts ihrer spürbar werdenden Schwäche einesteils auf die Potentiale »der Religion« nicht mehr verzichten kann, in ihr aber andererseits reflexartig nur jenes Andere (mit) wahrzunehmen gewohnt ist, das sie verwirft und in ihren eigenen Praxen zudem auch performativ immer wieder mitproduziert.
57 58 59
Vgl. dazu J. Manemann, Der Dschihad und der Nihilismus des Westens. Vgl. J. Habermas, »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, S. 30 f. J. Habermas, »Die Grenze zwischen Gauben und Wissen«, S. 157.
389
Michael Staudigl
Die angesprochene Ambiguität der kontemporären Situation ist, so lautet folglich meine These, darauf zurückzuführen, dass im Zei chen jener aus der Bahn geratenden Modernisierung die sich immer weiter öffnenden Bruchlinien »säkularer Vernunft« nicht einfach als Defizite eines noch unvollendeten Projekts zu verstehen sind. Die ihr innewohnenden Antinomien kommen darin vielmehr auf neue Weise zum Ausdruck. Anders formuliert: Das Problem beruht nicht auf einer kontingenten Krise, die im Zeichen bspw. einer »Teleologie der Vernunft«, eines »Zivilisierungsprozesses«, einer »relationalen Immanenz« oder neuerdings eines sozialtechnologischen Algorith mus etc. bewältigt werden kann, sofern diese es sicherstellen, dass alle Formen von »Devianz«, »Unordnung« und »Irrationalität« im Zeichen solcher Ordnungsvorstellungen als bloß kontingente Man gelerscheinungen überwunden und korrigiert werden können – bzw. sich von selbst lösen, wenn man nur der Logik des Marktes etc. freie Hand lässt. Ganz im Gegenteil verweist die Problematik der skizzierten post-säkularen Konstellation auf eine tiefe Verflechtung der (späten) Moderne mit uneingestandener Gewalt, ja einer Reihe von Gewaltverhältnissen, wie sie bereits S. Eisenstadt als »Antinomien der Moderne« begrifflich auf den Punkt gebracht hatte.60 Wie neuerdings in vielerlei Hinsicht gezeigt wurde und wie auch das Derrida-Zitat oben unterstreichen sollte, wird diese Verflechtung im Zuge kritischer globaler Entwicklungen in Technologie, Telekom munikation und Finanzkapital aktuell immer greifbarer. Zutage treten hier jene Bruchlinien einer prätendierten Moderne, die lange durch unsere »großen Erzählungen« und entsprechend kalibrierte Konzepte von – um nur einige wichtige zu nennen – Fortschritt, kosmopoliti scher Gerechtigkeit, diskursivierter Vernunft, reziproker Anerkennung etc. normativ verbrämt wurden, ohne deren Gewaltimplikationen mitbedacht zu haben. Entwicklungen in eben den genannten Feldern führten zu einer ebenso profunden wie untergründig ablaufenden Transformation unserer politischen Ökonomie. Denn während wir diese traditionell in Begriffen einer »gegenstrebigen Fügung« (har monia palintrope) (von Heraklit bis Hegel und darüber hinaus) zu konzipieren bemüht waren, um unsere Gesellschaften in ihrem kriti schen Spagat zwischen apologetischer Rechtfertigung des Gewaltmo nopols und einem (utopischen, eschatologischen, etc.) Versprechen 60
Vgl. S. Eisenstadt, Comparative Civilizations and Multiple Modernities.
390
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
auf Gewaltverzicht zusammenzuhalten61, vertieften sich die genann ten Bruchlinien jedoch in einer Weise, die mit der Sichtbarmachung solcher Gewaltverhältnisse paradoxerweise die Bindekraft dieses Ver sprechens erodieren ließ. Die Verbreitung sogenannter »neuer Kriege« ist, um hier nur ein aktuelles Beispiel anzuführen, in diesem Rahmen sehr aufschluss reich. Sie macht deutlich, wie das Vertrauen in die Integrationskraft dieses Modells auf der Makroebene nachhaltig ins Wanken geraten konnte. Dieses seit den 90ern dokumentierte Phänomen reflektiert in der Tat eine substantielle Veränderung gegenwärtiger Erscheinungs formen und Praktiken des Krieges bzw. »kriegerischer Gewalt« und deren völkerrechtliche Sanktionierung. Entscheidend ist, dass Krieg sich hier in »a mutual enterprise rather than a contest of wills«62 verwandelt. Diese Entwicklung ist dabei nicht kontingent, sondern verweist m. E. auf eine tiefgreifende Transformation der okzidenta len Matrix politischen Denkens, in der wir Krieg lange zu denken gewohnt waren. Indem sie alle traditionellen Versuche, den Krieg im Blick auf ein übergreifendes Prinzip des Friedens bzw. der Arbeit an diesem zu denken, und so das »Band der Teilung« in all seiner Fragi lität mit Blick auf die Zukunft sicherzustellen, ist diese Entwicklung in der Tat obstruktiv. In dieser Perspektive bleiben jene Potentiale ins Auge zu fassen, die auf den beispiellosen Implikationen dessen beruhen, was eine aus den Gleisen geratende Modernisierung, insbe sondere die im Mahlstrom der Globalisierung zusehends versagende neoliberale Ideologie, hervorbringt. Man denke zum Beispiel an sog. »Kriegsökonomien«, die wiederum in umfassendere »Kulturen der Gewalt« zurückspielen – in denen wiederum nicht zuletzt religiöse Gewaltmotive wie auch Rechtfertigungsschemata als valide diskur sive Währung im Umlauf sind. Angesichts der Inkapazität unserer universale Integration ver heißenden master narratives von »Fortschritt«, »kosmopolitischer Gerechtigkeit«, »diskursiver Vernunft«, »wechselseitiger Anerken nung«, usw., den genannten Herausforderungen in einer konstrukti ven Weise zu begegnen63, verlangt diese Situation danach, anders, mit neuen begrifflichen Mitteln artikuliert und konstruktiv beantwortet zu werden. Exakt in diesem Kontext ist die so genannte »Rückkehr der 61 62
Vgl. Zu diesem Dilemma B. Liebsch, Zerbrechliche Lebensformen. M. Kaldor, »In defense of new wars«, S. 13.
63
391
Michael Staudigl
Religion« – gleich, ob sie nun soziologisches Faktum, philosophisches Artefakt oder theologisches Desiderat sein möge – faktisch jedoch von entscheidender Bedeutung. Denn zusehends gewinnt sie, wie wir bereits in einigen Hinsichten gezeigt haben, praktisch an Bedeu tung für unsere spätmodernen social imaginaries, nämlich in Bezug auf deren sich verstärkende Bruchlinien und das sich verstärkende Unbehagen an einer prekären Modernität, der zusehends die selbstreflexiven Potentiale abhanden zu kommen scheinen, um sich von ihren Einseitigkeiten und ihrer verbrämten Gewalt noch Rechenschaft zu geben. »Religion« bleibt in diesem Kontext entsprechend als ein potentiell Veränderung, ja gesellschaftliche Emanzipation und politische Befreiung versprechender way of life zu bedenken und zu reflektieren, nicht mehr aber in traditionellen Begriffen von Glaube oder Doktrin. Sie muss vielmehr, so lautet die phänomenologische These, als sinn-generatives Schema (oder als Matrix) verstanden werden, das – mit Ricœur gesprochen – unser Streben nach »Konkor danz in Diskordanz« anzuleiten vermag, nicht aber als ein im Voraus abqualifizierter »opaker Erfahrungskern« oder eine isolierte »Einstel lung«. Die Frage betrifft entsprechend die existenzielle Wirkmacht der Religion und ihre praktische wie expressive Relevanz. John D. Caputo weist uns diesbezüglich in exakt diese Richtung, wenn er darüber reflektiert, um welche »Wahrheit« es dabei gehen mag: Religious truth is not found in having certain information or beliefs that will gain one insight into a supersensible world or a ticket of admission to an after- life. Religious truth is not a matter of information—as if it reveals certain facts of the matter otherwise unavailable to empirical inquiry or speculative ›rea- son‹—but a matter of transformation, with the result that religious truth takes place in and as the truth of a form of life. […] Religious truth is more a matter of doing than of knowing, as when Kierkegaard said that the name of God is the name of a deed. That means that religious truth flies beneath the radar of both the theism and the atheism of the Enlightenment. Its truth has to do with a more elemental experience that precedes this distinction, one that cannot be held captive either by confessional religion or reductionistic critiques of religion.64
64
J. Caputo, »Forget Rationality: Is There Religious Truth?«, S. 33 (Hvh. M.S.).
392
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
3. Der Umweg einer Phänomenologie »religiöser Gewalt« Um diese »Wahrheit« und das transformative Potential zu ergründen, das »der Religion« innewohnt, sowohl zum Guten wie zu Schlechten, ist, wie ich argumentierte, eine phänomenologische Herangehens weise zur Anwendung zu bringen. Eine solche scheint angezeigt und angemessen zu sein, sofern sie uns in die Lage versetzt, die sinngenerative Macht ins Auge zu fassen, die diese elementare Erfahrung auf so ambivalente Weise in unsere social imaginaries einspeist — imaginaries, wie ich bislang argumentiert habe, die zusehends Bruch linien aufweisen und ein umfassendes existenzielles Unbehagen an ihrer diskursiv wie praktisch unbefragten Vorherrschaft (re)produzie ren. Was im Kontext der gegenwärtigen »Wiederkehr der Religion« und entsprechender Versuche, die »post-säkulare Konstellation« zu denken (ein Denken, das gerade in der Lage zu sein glaubt, dieser Herausforderung adäquat zu begegnen, dem zu begegnen, wovon wir Derrida zufolge nicht wissen können, was hier immer im Kom men geblieben sein wird), mithin greifbar wird, ist wie gesagt die grundsätzliche Ambiguität dessen, was hier und heute unter dem früheren Namen »der Religion« an-kommt. Denn einerseits erscheint die »post-säkulare Konstellation«, wenn man sie im Lichte der ange führten kritischen Diskurse reflektiert, voll, ja übervoll zu sein von Vorstellungen »religiöser Gewalt« und entsprechenden Sozialtechno logien, die diese Imaginationen von drohender Unordnung – innen wie außen – zu integrieren versprechen. Insbesondere hetero-nor mative Sozialtechnologien eines sog. »religion making« sind, wie Goldstone zeigt, in unserem weithin gepriesenen liberal imaginary wirksam, insbesondere dort, wo es um dessen Umgang mit dem »religiös Anderen« geht: To be sure, secularism takes on myriad configurations, and they do not all insinuate a common telos; likewise, the subjects it produces and the relation- ship to ›religion‹ it enjoins will vary across time and space. […] But amid the geopolitical-ideological terrain in which we currently find ourselves […] secularism is ineluctably bound up with sovereign power, and together they constitute a politics of reli gion-making. Violence figures prominently in this arrangement: both as that which might at any time erupt among certain forms of religious life and as that which the secular state inflicts in order to forestall such threats and to better facilitate its various modes of subjectivation and accumulation. One is transgressive, inhumane, gratuitous; the other,
393
Michael Staudigl
necessary and salvific, administered on behalf of universal humanity and in accordance with ›a secular calculus of social utility and a secular dream of happiness‹ (T. Asad).65
Andererseits wiederum bezeugen die verschiedenen Formen, in denen die »Wiederkehr der Religion« aktuell als Widerstand gegen einen »ideologischen«, ja mitunter explizit »sakrifiziellen« Säkularis mus66 auftritt (der bspw. in Form des Heilsversprechen von Fortschritt und Technologie oder als die bevorstehende Vergöttlichung des Post humanen zu reüssieren scheint), die immer noch unabgegoltenen kreativen und vergemeinschaftenden Potentiale »der Religion«, d.h. letztlich das Potential religiöser Imagination. Indem sie die Einsicht versinnbildlichen, dass hier in der Tat »etwas fehlt« (Habermas) in unseren säkularistisch verhärteten Versuchen, eine entgleiste Moder nität wieder ins Gleichgewicht zu bringen, bezeugt sie – zum Guten wie zum Schlechten – diese in der Tat poietische Kraft und letztlich den poietischen Imperativ, der sich darin affektiv wirkmächtig ankündigt und ermächtigend ins Werk gesetzt werden will. Diese motivierende Kraft (force) gestaltet und erhält jedoch keineswegs nur traditionelle Formen individueller und kollektiver Existenz. Entscheidend ist vielmehr, dass sie in reinster (wie allge meinster) Form die kritische Macht, diese zu verändern und neue Formen zu schaffen, verkörpert. So besehen ist sie »die Antwort«, wie Derrida im oben zitierten Kontext formuliert.67 Gerade indem »die Religion« dabei jedoch zwischen intrinsischer Gewalt, die im Namen religiöser Narrative der Reinheit oder Abstammung gerechtfertigt wird, und dem Versprechen gewalt-bannnender Selbsttranzendenz und gemeinsamen Transzendierens mäandert, verkörpert sie für viele – und zwar insbesondere für jene, deren Dissens im paternalistischen Medium »konsensuellen Konflikts« und »rettender Übersetzungen« nicht gehört werden kann – die vielleicht einzig verbleibende Macht
B. Goldstone, »Violence and the Liberal imaginary«, S. 116. Eine allgemeine, kri tisch-genealogische Analyse der liberalen Demokratie und der damit verbundenen Vorstellungswelten, die einerseits der »Rückkehr der Religion« eben in die Hand spie len, andererseits ein anderes Verständnis derselben aufscheinen lassen, liefert C. Raschke, Force of God. 66 Vgl. S. Glendinning, »Japheth’s World« und L. ten Kate, »Secularity as Sacrifice«. 67 Vgl. J. Derrida, »Glaube und Wissen«, S. 46. 65
394
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
der Ausnahme, d.h. nicht-souveräner Überschreitung (force of excep tion).68 Dieser in der Tat offenen Frage, ob sie die einzige Macht ist, die unsere »Sinn- und Wahrheitswüste, […] die wir gemacht haben oder wachsen ließen«69, zu transformieren und den Anspruch des Menschlichen in einer zusehends fragilen Weltordnung sicherzustel len vermag, kann ich hier nicht weiter nachgehen. Die viel bescheide nere, womöglich aber ähnlich quälende Frage, der wir uns hier zu stellen haben, ist eine andere: Denn in der Tat müssen wir uns fragen, wie der proteische Anspruch auf ein solchermaßen transformatives Potential, das sogar »Hoffnung für die Hoffnungslosen« (Raschke) und die »wahrlich Verzweifelten« (Appadurai) verspricht, konstruktiv geformt werden kann, um seiner offenbar irreduziblen Neigung, obsessiv, fundamentalistisch, fanatisch oder – allgemein gesprochen – gewaltsam zu geraten, entgehen zu können.70 68 Zur Exklusion des Dissenses als dem kardinalen Problem traditioneller politischer Theorie vgl. Rancière, Das Unvernehmen; zur Trope der Kraft und der Frage, wie diese heute in Diskursen über die Ausnahme an Zugkraft gewinnt, vgl. Raschke, Force of God. 69 J.-L. Nancy, Dekonstruktion des Christentums, S. 11. 70 Eine damit verbundene, in der Tat abgründige Frage wäre dabei, ob nicht die Weise, wie wir dieses Problem stellen, Teil des Problems selbst ist: Denn wenn wir in der Tat darüber sprechen, dass dieses oder jenes gewaltsam wird, insinuiert eine solche Wendung nicht, dass wir davon ausgehen, dass irgendein ursprünglicher, reiner, unberührter und d.h. nicht-gewaltsamer Ursprung, eine ursprüngliche Ordnung oder ein Kern (traditionell »das Gute«, »das Wahre« genannt) existiert habe, irgendwann, irgendwo—und dass die kommende Geschichte bloß das notwendige Drama seiner Wiederherstellung wäre? Doch nährt ein solches Narrativ nicht wiederum unsere vitiösen Zirkel von Gewalt und Gegen-Gewalt, während sie vorauszusetzen scheinen, dass man legitimerweise einen Anspruch auf das erheben kann, was als ursprünglich, ordnungshaft, und mithin »gut« gilt? Nährt zu guter Letzt also diese Unterstellung eines reinen und unberührten Ursprungs nicht die Institution der schon genannten »Imaginationen von Unordnung« und entsprechender »Symboliken des Bösen«, und letztlich sogar regelrechter »Theologien des Abfalls« (des Abweichenden, des Verwor fenen, der privatio), denen gegenüber wir uns gewöhnt haben, eine ganze Maschine kulturellen Recyclings in Gang zu halten, deren notwendige »Gewalt« wir indifferent hinnehmen (vgl. Crépon, Murderous consent)? Dieser Verdacht lässt sich, meine ich, nicht so einfach ausräumen. Er zeugt vielmehr von einem platonischen Restbestand im okzidentalen philosophischen Diskurs, der selbst in der aktuellen Sozialphilosophie, der politischen Philosophie und selbst der Religionsphilosophie noch am Werk zu sein scheint. Es geht um einen Habitus, der dazu (ver)führt, die vielfältige Gewalt, die in das – mehr oder minder reibungslose – Funktionieren unserer social imaginaries in konstitutiver Weise eingeflochten ist, letztlich indifferent zu übersehen. Die Trope »religiöser Gewalt« ist nichts anderes als ein akuter Hinweis hierauf.
395
Michael Staudigl
Wie wir gesehen haben, gewinnt diese Frage in einer Situation wie der unseren noch zusätzlich an Bedeutung, wenn die Krise des säkularen Liberalismus nämlich mit dem Kollaps einer tendenziell entkörperlichten und zusehends prozedural ausgesteuerten Gesell schaft konvergiert und traditionelle Sinnressourcen spürbar knapp werden. In diesem Kontext beginnen wir zu verstehen, dass die postsäkulare Prämisse nicht nur hyper-rationalistisch verfährt, sondern in gefährlichem Maße die affektiven Potentiale der gemeinschaftsstif tenden Funktion von Religion unterschätzt, deren Wirkmacht sich aktuell wieder einzustellen beginnt.71 In diesem Zusammenhang lässt sich, Charles Taylors Analyse in A Secular Age folgend, argumentie ren, dass das »abgepufferte Selbst« (buffered self), das die säkulare Moderne hervorgebracht hat, für seine neu gewonnene Autonomie »zu zahlen beginnt« – nämlich mit Symptomen der Erschöpfung und struktureller Depression, und für seine sozio-kulturelle Emanzi pation mit sich vertiefenden Erfahrungen der Einsamkeit und der Isolation. Unsere »Illusionen von Autonomie«, um es anders zu formulieren, produzieren also sich vertiefende soziale Bruchlinien und verschärfen das angesprochene Unbehagen an den leerlaufen den Versprechungen des Projekts der Moderne. Der oft verspürte Zusammenbruch klassischer Visionen eines »guten Lebens« und die Aushöhlung integrierender Ideale eines common good befeuern diese Entwicklung noch weiter, was unsere mittlerweile unheimliche Entfremdung von den uns umgreifenden Ökologien bezeugt. Ob diese in der Tat wuchernde Entfremdungsdynamik und der damit einherge hende affektive Zusammenbruch ganzer Gesellschaften dabei nur ein Nebeneffekt unserer allzu erfolgreichen Versuche ist, uns von den Zwängen unserer Natur, Endlichkeit und Kontingenz zu befreien, sei hier dahingestellt. Er bleibt auf jeden Fall in ihrem Kontext zu verste hen. Denn wie dem auch sei – im Zeichen der Projektion einer transoder posthumanen sozialen »Natur«, die geradezu dazu designed ist, eine »globale Immanenz« oder eine »relationale Existenz« in einem Zeitalter spektakulärer »super-diversity«72 herzustellen, konfrontiert uns die »tragedy of the modern condition«73 mit einem wahrhaften Vgl. Braeckman, »Habermas and Gauchet on Religion in Postsecular Society«, und Kippenberg, Gewalt als Gottesdienst. 72 Zu diesem Begriff vgl. Vertovec, »Super-diversity and its implications«. 73 Vgl. dazu Claude Leforts bekannten Text »The permanence of the theologicopolitical?«. Wie Lefort dort argumentiert, hat die Entkörperlichung des »politischen
71
396
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Verlust wirklicher Bedingungen respektive Beziehungen – einem Verlust der sich als Travestie vorgeblicher Autonomie geriert. Wie ein näherer Blick zeigt, exponiert diese Malaise nichts ande res als unsere tiefe, uneingestandene, ja geleugnete Abhängigkeit von jenen vermeintlichen Bedrohungen, die unsere Kulturen der Angst und eines paranoiden Sicherheitswahns systematisch produzieren und projizieren, und zwar in dem Maße, dass wir ihnen letztlich ver fallen, ja sie im Sinne eines parasitischen Habitus geradezu züchten. Eine kritische Diskussion des sog. »Anthropozäns« und eines unter dessen Prämissen angeblich greifbar werdenden, ja bevorstehenden »relationalen Universalismus« bezeugt diese in der Tat überaus tragi sche Ambiguität sehr deutlich: Despite the mournful tenor of discourses on the Anthropocene, where we regret having thought of ourselves as separate from nature for so long, the era of the Anthropocene has more often than not figured the end of the world as what must be avoided; we must not fall back into a nomadism that would bear no profound relationship to the globe. There is very little sense, however, that – despite the common recognition that the Anthropocene has a violent, destructive and barbarous history as its cause – other (less robustly global and relational) forms of existence might be viable, desirable, or recognizable. Those other forms of human existence, which were erased in order to achieve the statecentered history of humanity that recognizes itself as ›Anthropos,’ are deemed to be the ›end of the world‹ – primarily because of their impoverished conception of relationality.74
Wie diese beunruhigende Passage zeigt, produziert exakt der »expli zite Moralismus« einer »post-human relationality« (der Nachfolger Körpers« in der Moderne immer zu Versuchen geführt, die seine Wiederverkörperung forcierten. Gleichwohl kapriziert sich Lefort in diesem Kontext keineswegs nur auf die totalitären Bewegungen, sondern reflektiert bezeichnenderweise auch auf das, was er eben die »Permanenz des Theologisch-Politischen« nennt. Die sich hierin andeutende Affinität darf nun allerdings nicht so verstanden werden, als dass man die Logik der Totalitarismen schlicht und einfach auf gegenwärtige Formen eines religiösen Funda mentalismus umlegen dürfte. Unglücklicherweise ist solch ein Kurzschluss in rezenten Debatten durchaus zu finden. Im Gegensatz dazu wäre Lefort zufolge der entschei dende Punkt jedoch darin anzusetzen, dass »the religious is reactivated at the weak points of the social« – ja er ist in letzter Instanz als Konsequenz der Schwierigkeit, der »(difficulty that) political or philosophical thought has in assuming, without making a travesty, the tragedy of the modern condition« (ebd., S. 255), zu verstehen – er ist also als intrinsisches Potential zu verstehen, nicht als von außen kommend. 74 C. Colebrook, »A Cut in Relationality«, S. 179) (Hvh. M.S.).
397
Michael Staudigl
also des impliziten Moralismus der kommunikativen Vernunft) jenen »verfemten Teil« (Bataille), da unsere spätmodernen Sozialtechnolo gien seiner bedürfen, um überhaupt funktionieren zu können. Was auch immer in diesem Sinne der prätendierten Immanenz eines solchen »relationalen Werdens« und seinen prozeduralen Avataren – mit der Galionsfigur des Neoliberalismus allem voran – widerspricht, versinnbildlicht dementsprechend die schlimmste Gewalt, die dieser Diskurs kennt. Der Neoliberalismus ist, so besehen, nichts anderes als eine Theologie des Mülls: er recycelt, oder genauer noch, er produziert sein (ir)relevantes Anderes und er tut dies, indem er dessen Anders heit auf jene Orte rund um den Globus projiziert (sowohl innerwie außerhalb der traditionellen Grenzen von Nationalstaaten), die als gewaltaffin gelten, d.h. eine Gefahr für die reibungslose Imple mentation des neoliberalen rollout verkörpern.75 So besehen ist der Neoliberalismus denn auch geradezu paradigmatisch für die parasitie rende Logik der Moderne – parasitierend an der Imagination eines nicht-integrierbaren, gewaltsamen Anderen, die ihr eigenes Projekt legitimiert. Diese Figur des Anderen muss entsprechend permanent (re)produziert werden, um ihr – wortwörtlich – kritisches Geschäft aufrecht zu erhalten. Dieses der Moderne zugeschriebene kritische Potential erweist sich so gesehen jedoch aufs Engste verbunden mit der systemischen Krisis, die das Projekt der Moderne als solche nach sich zieht. Entsprechend verkörpern die kritischen Entwicklungen, mit denen ich mich im vorhergehenden Abschnitt auseinandergesetzt habe, auch nichts anderes als ein strukturelles Unbehagen an der Moderne und an ihrem Projekt, das augenscheinlich noch nicht an ihr Ende gelangt ist, ja dies per definitionem auch niemals vermag. In den Worten Kants heißt dies, dass auch unser moderner, auf geklärter Glaube an einen zivilisierenden Prozess (»Civilisierung«) es nicht vermocht hat, den »unvermeidlichen Antagonismus«, der die Menschheit mit ausmacht, zu transzendieren. Auch in seinem Zeichen ist es also nicht gelungen, durch jene Naturgeschichte der Zerstörung hindurch zu navigieren, den »gesetzlosen Zustand der Wilden« hinter sich zu lassen und jenen allgemeinen »Zustand von Ruhe und Sicherheit«76 zu erreichen, der sich zudem nicht durch eine »Teleologie der Vernunft« alleine einstellt, sondern zuletzt der Provi denz bedarf, um realisiert werden zu können. Die präzendenzlosen 75 76
S. Springer, »The Violence of Neoliberalism«, S. 155–159. I. Kant, Ideen zu einer allgemeinen Geschichte, AA VIII, S. 24.
398
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Entwicklungen einer aus den Gleisen geratenden Modernisierung mögen wo auch immer hinweisen, in die Richtung eines solchen angeblichen »Fortschreitens zum Bessern als unausbleibliche Folge«77 weisen sie nicht. Sie geben uns im Gegenteil zu verstehen, dass Gewalt in die Organisationsformen der politischen Moderne (Leforts »political forms of modernity«) auf irreduzible Weise eingeschrieben ist. Ja mehr noch, sie fordern uns auf, die mehr als unangenehme Einsicht in den Blick zu nehmen, dass wir an dieser »vorgefertigten« Andersheit solcher Gewalt parasitieren, wie irrational, opak oder diabolisch auch immer ihre kulturellen Darstellungen uns in der Tat erscheinen mögen, wie bestürzend unsere Beunruhigung durch ihre verführerischen Bilder auch sein mag.78 Allgemeiner formuliert heißt dies, dass die Vorstellung einer außerordentlichen, exzessiven und »wilden« Gewalt das (mehr oder minder) geschmeidige Funktio nieren von gesellschaftlichen Ordnungen komplementiert, indem es nämlich deren eigene, für diese Ordnungen konstitutive Gewaltver hältnisse korrelativ ausblendet.79 Die strukturelle Herrschaft verschiedener systemischer Formen von Gewalt, die hieraus resultierende Indifferenz dem Leiden des Anderen gegenüber, und das »todbringende Einvernehmen«80, das darin seinen Ausgang nimmt – all dies wird durch die Trope »der Gewalt« als dem »ganz Anderen«, dem »verfemten Teil«, wie wir I. Kant, Der Streit der Fakultäten, AA VII, S. 84. Vgl. dazu H.-G. Soeffner, »Gewalt als Faszinosum«, der dieser Ambivalenz etwa mit Blick auf 9/11 und eine »Ästhetik des Terrors« nachgeht. 79 Vgl. zu diesem Argument nochmals Bauman (Modernity and Ambivalence, S. 6 ff.) und weiterhin die Weiterentwicklung solcher Gedanken bei Agamben in Homo Sacer. Während Bauman auf luzide Weise eine »Dialektik der Ordnung« herausge stellt hat, die die Produktion von Unordnung im Sinne jenes verwertbaren Rohmate rials nach sich zieht, das Ordnung benötigt, um ihre Existenz sicherzustellen, gene ralisieren Agambens Überlegungen zur Problematik der Souveränität dieses Argument und entfalten sein Potential für die politische Theorie. Agamben argumen tiert hier, »Hobbes’ Naturzustand ist kein vorrechtlicher, dem Recht des Staates gleichgültiger Zustand, sondern die Ausnahme und Schwelle, die ihn konstituiert und bewohnt.« (Ebd., 116) Dies besagt weiterhin, »die Souveränität stellt sich somit wie eine Einverleibung des Naturzustandes der Gesellschaft dar oder, wen man will, wie eine Schwelle der Ununterschiedenheit zwischen Natur und Kultur, Gewalt und Gesetz, und genau in dieser Ununterscheidbarkeit liegt das Spezifische der souveränen Gewalt.« (Ebd., 47). 80 Zu diesem »todbringenden Einverständnis« (consentement meurtier) (Camus) und seiner strukturellen Präsenz in unseren social imaginaries vgl. M. Crépon, Le consentment meurtrier. 77
78
399
Michael Staudigl
mit Bataille schon formuliert hatten, ausgeblendet, unterdrückt und letztlich regeneriert. Die Vorstellung mithin von etwas, dessen man sich zu entledigen hat, wie es eben das Bild »religiöser Gewalt« so nachdrücklich insinuiert – von dem man aber auch nicht lassen kann, da es konstitutiv für die eigene Existenzweise erscheint. Der darin sich vielmehr aussprechende Parasitismus jener (aufgeklärten, vernünftigen, modernen, etc.) Ordnungsprojekte, die wir dagegen zu setzen gewohnt sind, ohne ihre eigene Gewalt noch mit dem selben Eifer ins Auge zu fassen, wie »äußere« Gewalt, ist folglich jedoch keineswegs in Begriffen kontingenter, also kollateraler Folgen kontingenterweise fehlgeleiteter Politik, ideologischer Verblendung, struktureller Entfremdung oder auch »sozialer Pathologie« abzutun. Er bleibt im Gegenteil, so die Quintessenz der Argumentation hier, als ein integrales Nebenprodukt dieser Projekte, insbesondere eines – aus der Bahn geratenden – Projekts der Moderne zu verstehen, als ihr »ursprüngliches Supplement«, um mit Derrida zu sprechen. Nach drücklich festzuhalten bleibt, dass diese Ausblendung der Gewalt ein ebenso grundlegendes wie irreduzibles Problem der Sozialphilo sophie und der politischen Philosophie darstellt. In der Tat wird dieses »Problem« insbesondere in der Genealogie des modernen Nationalstaats, genauer gesagt in der Rechtfertigung des staatlichen Gewaltmonopols, greifbar, wie Das and Poole es eindeutig auf den Begriff bringen: In this vision of political life, the state is conceived of as an always incomplete project that must constantly be spoken of—and imagined— through an invocation of the wilderness, lawlessness, and savagery that not only lies outside its borders but also threatens it from within.81
Nehmen wir diese Überlegungen ernst, so bedeutet dies, einer harten Wahrheit ins Auge zu sehen. Ihre Implikationen erstrecken sich nach mindestens zwei Seiten: Erstens geht es um die Einsicht, dass die frag liche Konstitution des Politischen mit Bezug auf einen kriegerischen »Naturzustand« (Hobbes), dem wir als Matrix der politischen Theo rie seit Jahrhunderten anhängen, praktisch die Konstruktion eines solchen (schon bei Hobbes als kontrafaktisch erkannten) Schreckge spensts erfordert, sei es nun, in Form eines »zensierten Kapitels« des modernen Selbst (Lacan), sei es in Form vielfältiger Projektionen auf unsere – vorgeblich uns bedrohende – Andere. Zweitens impliziert 81
V. Das, D. Poole, »The state and its margins«, S. 7.
400
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
diese Auffassung eine Ordnung der Gewalt (exemplarisch »religiöser Gewalt«). Diese jedoch führt im Gegenzug zu einer Marginalisierung und Ausblendung der Gewalt dieses Ordnungsprojekts selbst, die sie durch die Fabrikation der genannten Imaginationen von Unordnung – die anderen auf den Leib geschrieben wird – betreibt. Wie Goldstone überzeugend gezeigt hat, hat diese Ausblendung der Gewalt des Ord nens eine explizit theologisch-politische Dimension, lässt also auch hier Altbekanntes wiederkehren, wenn auch uneingestandenermaßen bzw. in höchst unaufrichtiger Weise: Remaining mindful of and, indeed, vigilant against this specter of the worst has played a constitutive role in the structuring of modern subjectivities, authorizing new political arrangements and the array of preventative and punitive measures – from profiling and surveillance to intimidation and torture – intended to keep the danger of religious passions at bay.[…] Equally significant, though, are the ways in which visions of what might be thought of as religion’s best possibilities – from helping to maintain civic virtues and mor- ally buttressing ideas such as democracy and human rights to, at the very least, mandating that one’s beliefs be held in a sufficiently modest and noncompulsory manner – have served to underwrite the brand of religiosity that a liberal culture normativizes and seeks to bring about or failing that, to marginalize and render obsolete. Which is only to say that it can no longer be assumed that secularism naturally resists all theologicopolitical formations, for it is precisely a distinctive – and often no less terrifying – political theology that it wishes to inaugurate.82
Es ist hier nicht mehr der Ort, um diese in der Tat verstörende Hypothese näher ins Auge zu fassen. Dies hieße in eins auch, zu zeigen, wie diese Unaufrichtigkeit viele der uns ans Herz gewachsenen Denkfiguren politischer Theorie korrumpiert hat. Gleichwohl eröff net uns dieser Verdacht alleine schon einen gewichtigen Leitfaden, um besser zu verstehen, welche Art phänomenologischer Herange hensweise einer solchen Analyse angemessen sein könnte. Wie ich argumentiert habe, ist die »Krise des Säkularismus« und das sich steigernde Unbehagen daran in einer diffizilen Weise damit verbun den, wie wir die »Rückkehr der Religion« wahrzunehmen gewohnt sind. Der Habitus dieser Wahrnehmung ist dabei insbesondere durch die, wie ich es nannte, black box »religiöser Gewalt« imprägniert.: 82 B. Goldstone, »Secularism, ›Religious Violence‹, and the Liberal Imaginary«, S. 109.
401
Michael Staudigl
Denn deren diffuses Bedrohungspotential flottiert in unseren social imaginaries als kritische Trope in diskursbildender Weise, soweit die leitende These hier. Wie die bisherigen Überlegungen nun gezeigt haben, müssen wir in dieser Hinsicht Heideggers hermeneutische Grundeinsicht rück haltlos unterschreiben, dass nämlich jede Phänomenologie des – in sich ebenso vielfältigen wie ambivalenten – »religiösen Lebens« und religiöser »Praxis« (was eben auch Praxen sog. »religiöser Gewalt« impliziert) grundsätzlich nur in der »eigenen historischen Situation« und ihrer »Faktizität« anheben kann.83 Diese Einsicht erfordert es in der Folge, dass die mit Blick auf diese Formen »religiösen Lebens« zur Anwendung gebrachte phänomenologische Methode in einer diakriti schen Weise verfahren muss. Sie muss, anders gesagt, aufs Genaueste jene »als-Struktur« in den Blick nehmen, die in einer weitgehend un-thematischen, prä-reflexiven Weise festschreibt, wie diese LebensFormen von uns in einer je schon vor-erfahrenen Weise sinnhaft gelebt werden. Genauer gesagt muss sie zeigen, wie eine spezifische Form sozialer Praxis als Gewalt wahrgenommen und interpretiert wird und wie dabei der Marker »religiös« in einer Weise normativ involviert ist, dass solche Praxis als »wilde Gewalt« erscheint, d.h. als den Rechtfertigungszumutungen faktisch geltender (insbesondere säkularer) Ordnungsdiskurse per definitionem nicht angemessen bzw. sich intentional entziehend.84 Wie ich zu zeigen versuchte, spielt die Imagination und symbolische Instituierung von Gewalt qua religiös exakt mit Blick auf die Sinnzuschreibungen von »Opazität«, »Irratio nalität« und »Sinnlosigkeit« eine in genau diesem Sinne kardinale Rolle in der diskursiven Integration unserer gegenwärtigen (liberalen) social imaginaries, die den schmalen Grat zwischen einer notwendigen Apologie der Gewalt und dem modernen Versprechen auf Gewalt
Vgl. M., Phänomenologie des religiösen Lebens, wo es heißt: »Die faktische Lebens erfahrung hat ihre ihr genuine Eigenexplikation, mitbestimmt von den Grunderfah rungen.« (S. 145) – Die Tendenz geht also nicht auf Wesensaussagen, wie wir sie ja, wie ich gezeigt zu haben hoffe, mit Blick auf eine unterstellte Kategorie wie die von »(religiöser) Gewalt« nicht ohne einen hermeneutischen Gewaltstreich haben können. 84 Vgl. zu dieser »Kategorie« »wilder Gewalt«, das heißt einer Gewalt, die sich selbst außerhalb des gesellschaftlich geltenden Rechtfertigungszusammenhangs und mithin außerhalb des sozialen Nexus stellt, B. Liebsch, Zerbrechliche Lebensformen, S. S. 342 und ff. 83
402
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
verzicht ohnehin kaum zu bewältigen vermögen.85 In dem Maße nämlich, wie sie zwischen Bedrohungsszenario und faszinierendem Gegenpol aller Ordnung oszilliert, verkörpert »religiöse Gewalt« geradezu das – um Rudolf Ottos Definition in einen anderen Kontext zu transponieren – »mysterium tremendum et fascinans« unserer uneingestandenen spätmodernen politischen Theologien souveräner Herrschaft, die sich durch die Absetzung hiervon selbst verstehen.86 In einer Ära vielfach unterminierter Nationalstaatlichkeit und fragiler Souveränität firmiert die Trope »religiöse Gewalt« entsprechend als geradezu paradigmatische Imagination drohender Unordnung, an der sich Projekte der Sicherung von Souveränität entsprechend entzün den. Ihr gegenüber müssen entsprechend unsere spätmodernen social imaginaries sich behaupten und unsere Konzeptionen von Freiheit, Autonomie und Souveränität im Zeichen ihrer Selbsterhaltung sich durchsetzen.87 Anders gesagt, diese sozio-kulturell und politisch rele vanten Ideale sind als Setzungen gegen jene drohende Verletzlichkeit und Desintegration zu verstehen, die von unseren Vorstellungen von »sinnloser Gewalt« in exemplarischer Weise ausgebeutet werden. Was sich in ihnen jedoch tatsächlich verkörpert, ist nichts anderes als ein unsere social imaginaries beherrschender Habitus der Flucht: Mit Bergoffen lässt sich diesbezüglich sehr trefflich von einer »Flucht vor der Verletzlichkeit« sprechen, in deren habituellem Banngriff wir das Andere nur als entweder zu Beschützendes oder als zu Verwerfendes Vgl. nochmals Liebsch, ebd., S. 343: »Die ›wilde‹ Gewalt wird in den politischen Ordnungen nicht nur nicht ein für allemal überwunden; sie kehrt auch in deren Über windungen wieder. Deren Radikalität aber zerstört die Illusion menschlicher Macht über die Gewalt und führt auf die Spur einer unvermeidlichen Gewaltsamkeit, die dem geschichtlichen Handeln überhaupt innewohnt.« Liebsch plädiert daher für eine inten sivierte Aufmerksamkeit für »unvermeidliche Gewalt«, da nur diese es ermöglicht, »Spielräume geringerer Gewalt« zu eröffnen, die nicht dezisionistisch vorgegeben sind, sondern aus dem Anspruch erwachsen, die uns leitenden Ökonomien der Gewalt zu entlarven. 86 Vgl. R. Otto, Das Heilige; wie Ottos Konzept und seine Analyse eines energetisie renden Potentials dieser Erfahrungsstruktur Evidenz im Spektakel religiöser Gewalt (hier »9/11«) gewinnt, zeigt anschaulich H.-G. Soeffner, »Gewalt als Faszinosum«. 87 Vgl. dazu Habermas’ desavouierende Argumentation in »Politik und Religion«, die im Kern lautet, dass wir uns angesichts unbedingt anmutender Ansprüche »[n]ur auf der Grundlage einer selbstbewussten Verteidigung universalistischer Ansprüche [...] von den Argumenten der anderen über unsere blinden Flecken im Verständnis und in der Anwendung der eigenen Prinzipien belehren lassen [können].« (S. 293) Die Gewalt einer Rechtfertigungszumutung, die sich nur nachträglich ihre womöglich verfehlte Verantwortung eingesteht, wird hier schmerzlich greifbar. 85
403
Michael Staudigl
zu erfahren vermögen, d.h. uns in eine Logik der Konfrontation verstrickt finden – eine Logik, die jeglichen Umgang mit Gewalt einem symmetrischen Antwortzwang auszuliefern scheint. *** Die Phänomenologie der Religion ist ein altbekanntes und bewährtes Feld phänomenologischer Forschung, das zuletzt v.a. im französi schen Kontext an neuer Aktualität erlangt hat. In den letzten ein, zwei Dekaden hat angewandte phänomenologische Forschung zudem eine Reihe von Beiträgen hervorgebracht, die der Beschreibung verschie dener Gewaltphänomene und vor allem auch der Dekonstruktion unreflektierter Gewaltbegriffe gewidmet waren. Insbesondere wurde hier der oben schon diskutierte »Mythos sinnloser Gewalt«88 kritisch ins Auge gefasst. Verschiedene Beiträge haben in diesem Kontext gezeigt, dass Gewalt nicht nur (sozialen) Sinn zerstört, sondern dass sie vielmehr auch in den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt, die Performativität kultureller Praxen und übergreifend in die Konstitu tion des Politischen eingearbeitet ist – und zwar auf Weisen, die zunächst und zumeist nicht wahrgenommen werden, da sie unsere Wahrnehmungs- und Interpretationsschemata auf prä-reflexiver, d.h. leibhaftig gelebter Ebene prä-determinieren.89 Wiewohl die Religion also schon lange Thema phänomenologischer Forschung ist und eine rezente phänomenologische Gewaltforschung dazu beigetragen hat, die vielen Gesichter der Gewalt – seien sie nun physisch, psycholo gisch, sprachlich, epistemisch, strukturell oder kollektiv – zu beschrei ben, eine explizite Phänomenologie religiöser Gewalt liegt bislang nicht vor. Es war nicht die Aufgabe dieses Beitrags, dieses Desiderat konkret aufzugreifen und an exemplarischen Fällen abzuarbeiten. Die Intention hier war vielmehr, eine phänomenologische Perspektive zu eröffnen, in der das, was wir zunächst und zumeist unter »religiöser Gewalt« zu verstehen gewohnt sind, als solches erscheint. Wie ich zu zeigen versuchte, wird der bloße Versuch, die Sache selbst auf den Begriff zu bringen, von schwerwiegenden Problemen heimgesucht. Diese Schwierigkeiten resultieren keineswegs nur aus Vgl. zu einer kritischen Infragestellung dieser Denkfigur aus kulturanthropologi scher Perspektive V. Blok, »The enigma of senseless violence«. 89 Vgl. zu diesem Strang bes. Dodd, Violence and Phenomenology; J. Mensch, Embo diments, S. 72 ff.; sowie synthetisierend v. Verf., Phänomenologie der Gewalt. 88
404
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
dem, was man traditionell die diskursive Konstruktion des Forschungs objekts genannt hat und was lateral als Thema einer hermeneutischen Phänomenologie durchaus auch berücksichtigt wird.90 Es betrifft viel mehr das, was man das transgressive Potential von Religion nennen kann, welches sich im Kontext der sog. »Rückkehr der Religion« zusehends als Antwort auf das sich verstärkende Unbehagen an einer aus den Gleisen geratenen Modernität und Globalisierung anbietet. Genau dadurch aber unterwandert »die Religion« die lange so klar anmutenden Grenzen jener modernen Denkfiguren, die wir aus der klassischen Grenzziehung von Glaube und Wissen in unsere Gegenwart zu retten versuchten, in nachhaltiger Weise – und wird gerade deshalb vielfach als (potentiell) gewaltsam wahrgenommen bzw. kodiert: Ob wir diese Grenzziehung nämlich in die konfliktuelle Topologie von Säkularem vs. Heiligem, moralischer Vernunftreligion vs. den parerga menschlicher Verfehlung, kommunikativer Vernunft vs. sozialer Pathologie transponieren, oder auch ganz allgemein in ihr das Widerspiel von Ordnung und Chaos (Bauman) wiedererkennen – der parasitische Charakter jeglicher sozialer Ordnung, die sich selbst als rein setzt und ihr Anderes sich entgegensetzt, um es als verwertbares Material in ihr Projekt zu integrieren, all dies verrät beredt die Gewaltsamkeit des modernen Ordnungsprojekts. Sofern Ordnung in dieser Weise gewaltsam ist, ist sie gleichwohl niemals ein sicherer Hafen, von dem aus wir andere Gewalt einfach identifizieren könnten, ganz gleich, was der Ankerpunkt dieser Ordnung sein mag – eine basale Sozialität, ein Apriori der Diskursgemeinschaft oder auch die prozedurale Effizienz spätmoderner Sozialtechnologien. In anderen Worten: »Religiöse Gewalt« ist nicht direkt zu analysieren, es bedarf dazu einer diakritischen Phänomenologie, die die relationale Konstitution des Phänomens mit in den Blick zu nehmen vermag. Denn die Phänomenologie religiöser Gewalt, wie die Phänomenolo gie der Gewalt schlechthin, muss selbst eine Phänomenologie gelesen werden, die jene Gewalt selbst schreibt, die unseren Ordnungen mithin irreduzibel innewohnt und dort umso virulenter wird, wo wir sie im Zeichen ihrer Rationalisierung selbstgerecht zu verkennen geneigt sind.
90
Vgl. etwa P. Ricoeur, An den Grenzen der Hermeneutik, S. 85 ff.
405
Michael Staudigl
Literaturverzeichnis Abu-Lughod, Lila, »Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others.« American Anthropologist 10473(2002): 783–790 Agamben, Giorgio, Homo Sacer: Die souveräne Macht und das nackte Leben. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2002 Allen, Amy. 2017. The End of Progress. New York: Columbia University Press Appadurai, Arjun, Fear of Small Numbers. An Essay in the Geography of Anger. Durham: Duke University Press 2006 Appleby, Scott, The Ambivalence of the Sacred. Religion, Violence, and Reconcili ation. Lanham: Rowman & Littlefield 2000 Asad, Talal, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity. Stanford CA: Stanford University Press 2003 Assmann, Jan, Die mosaische Unterscheidung. München: Hanser 2003 Bauman, Zygmunt, Modernity and Ambivalence. New York, NY: Polity 1993 Bergoffen, Debra, »The Flight from Vulnerability«, in: H. Landweer, I. Marcinski (Hg.), Dem Erleben auf der Spur: Feminismus und die Philosophie des Leibes, Bielefeld: transcript 2016, 137–152) Blok, Anton, »The Enigma of Senseless Violence«, in: G. Aijmer & J. Abbink (Hg.), Meanings of Violence. A Cross Cultural Perspective, Oxford: Berg 2000, S. 23–38. Braeckman, Antoon, »Habermas and Gauchet on Religion in Postsecular Society. A Critical Assessment.« Continental Philosophy Review 42/3(2009): 279–296 Brunner, Claudia, Wissensobjekt Selbstmordattentat. Epistemische Gewalt und okzidentalistische Selbstvergewisserung in der Terrorismusforschung. Wies baden: Springer 2011 Caputo, John D., »Forget Rationality: Is There Religious Truth?«, in: J. Borne mark & S.-O. Wallenstein (Hg.), Madness, Religion, and the Limits of Rea son, Stockholm: Elanders 2015, S. 23–40 Cavanaugh, William T., The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press 2009 Cavarero, Adriana, Horrorism. Naming Contemporary Violence. New York: Columbia University Press 2008 Clarke, Steven, The Justifications of Religious Violence. Malden: Wiley 2014 Colebrook, Claire, »A Cut in Relationality.« Angelaki 24/3(2019): 175–195 Crépon, Marc, La guerre des civilisations: La culture de la peur II. Paris: Gali lée 2010 —, Murderous Consent. On the Accommodation of Violent Death, Stanford: Stanford University Press 2018 Das, Veena, Deborah Poole, »The State and Its Margins: Comparative Ethno graphies.« In: V. Das, D. Poole (Hg.), Anthropology in the Margins of the State, Santa Fe NM: School of American Research Press 2004, S. 3–34
406
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Derrida, Jacques. 2000. »Glaube und Wissen. Die beiden Quellen der Religion an den Grenzen der bloßen Vernunft«, in: J. Derrida, G. Vattimo (Hg.), Die Religion, Frankfurt/M.: Suhrkamp, S. 9–1006 De Vries, Hent, »Phenomenal Violence and the Philosophy of Religion.« In: M. Jerryson, M. Juergensmeyer, M. Kitts (Hg.), The Oxford Handbook of Religion and Violence, Oxford: Oxford University Press 2013, S. 496–520 De Vries, Hent, Lawrence Sullivan (Hg.), Political Theologies. Public Religions in a Post-Secular World. New York: Fordham University Press 2006 Dodd, James, Violence and Phenomenology. New York: Routledge 2009 Eisenstadt, Shmuel, Comparative Civilizations and Multiple Modernities. Leiden: Brill 1998 Fabian, Johannes, Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object. New York: Columbia University Press 1983 Giesen, Bernhard, »Tales of Transcendence: Imagining the Sacred in Politics«, in: B. Giesen, Daniel Šuber (Hg.), Religion and Politics. Cultural Perspectives, Brill: Leiden 2005, 93–137 Glendinning, Simon, »Japheth’s World: The Rise of Secularism and the Revival of Religion Today.« The European Legacy 14/4(2009): 409–426. Goldstone, Brian, »Secularism, ›Religious Violence‹, and the Liberal Imagi nary.« In: Secularism and Religion-Making, hg. v. M. Dressler, A. Mandair, Oxford: Oxford University Press 2011, 104–124 Habermas, Jürgen, »Die Grenze zwischen Glauben und Wissen. Zur Wirkungs geschichte und aktuellen Bedeutung von Kants Religionsphilosophie«, in: H. Nagl-Docekal, R. Langthaler (Hg.), Recht – Geschichte – Religion. Die Bedeu tung Kants für die Gegenwart, Wien: Böhlau 2004, S. 141–160 —, »Vorpolitische Grundlagen des demokratischen Rechtsstaates?« In: ders., Joseph Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, Freiburg-Basel-Wien 2005, S. 15–37 —, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt/M.: Surhkamp 2005 —, »Ein Bewusstsein von dem, was fehlt«, in: M. Reder & J. Schmidt (Hg.), Ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Eine Diskussion mit Jürgen Habermas, Frank furt/M.: Suhrkamp 2008, S. 26–36. —, »Politik und Religion.« In: Politik und Religion. Zur Diagnose der Gegenwart, hg. v. Ferdinand W. Graf, München: Campus 2013, S. 287–300 Habermas, Jürgen, Josef Ratzinger, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion Freiburg: Herder 2005 Heelas, Paul, Linda Woodhead, The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell 2007 Heidegger, Martin, Phänomenologie des religiösen Lebens (Gesamtausgabe Bd. 60) Frankfurt/M.: Klostermann 1995 Husserl, Edmund, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzen dentale Phänome- nologie. The Hague: Martinus Nijhoff 1955 Kaldor, Mary, »In Defense of New Wars.« Stability 2/1(2013): 1–16.
407
Michael Staudigl
Kant, Immanuel, »Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht.« (1784) In: Akademie Ausgabe Bd. VIII: Abhandlungen nach 1781, Berlin: de Gruyter 1968, S. 15–32 —, »Der Streit der Fakultäten.« (1798) In: Akademie Ausgabe Bd. VII, Berlin: de Gruyter 1968, S. 1 – 116 Kearney, Richard, Strangers, Gods, and Monsters. Interpreting Otherness. London: Routledge 2003 —, »Beyond Conflict: Radical Hospitality and Religious Identity«, in: ed. N. Eckstrand, C. Yates (Hg.), Philosophy and the Return of Violence: Studies from This Widening Gyre, 101–111. New York, NY: Continuum 2011, 101–111 King, Richard, »The Association of ›Religion‹ with Violence: Reflections on a Modern Trope«, in: J. Hinnells, R. King (Hg.), Religion and Violence in South Asia. Theory and Practice, London: Routledge 2007, 214–42. Kippenberg, Hans G., Gewalt als Gottesdienst. Religionskriege im Zeitalter der Globalisierung. München: Beck 2008 —, „›Phoenix from the Ashes‹. Religious Communities Arising from Global ization.« Journal of Religion in Europe 6/(2013): 143–174. Knoblauch, Hubert, Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle Gesell schaft. Frankfurt: Campus 2009 Lefort, Claude, Democracy and Political Theory. Cambridge/Oxford: Polity Press 1991 Liebsch, Burkhard, Zerbrechliche Lebensformen. Widerstreit – Differenz – Gewalt, Berlin: Akademie 2001 —, Verletztes Leben. Studien zur Affirmation von Schmerz und Gewalt im gegen wärtigen Denken. Zug: Die blaue Eule 2014 Mahmood, Saba, »Religious Reason and Secular Affect: An Incommensurable Divide?« Critical Inquiry 3/4(2009): 836–862. Manemann, Jürgen, Der Dschihad und der Nihilismus des Westens. Bielefeld: Transcript 2015. Martin, David, On Secularization. Towards a Revised General Theory. Aldershot: Ashgate 2005 Mensch, James, Embodiments. From the Body to the Body-Politics. Evanston: Northwestern Uni- versity Press 2009 Murphy, Ann V., Violence and the Philosophical Imaginary. New York: SUNY Press 2012 Moyaert, Marianne, »In Response to the Religious Other. Levinas, Interreligious Dialogue and the Otherness of the Other«, in: R. Burggraeve (Hg.), Awakening to the Other. A Provocative Dialogue with Emmanuel Levinas, Leuven: Peeters 2008, 161–190. Nancy, Jean-Luc, Dekonstruktion des Christentums, Zürich: Diaphanes 2009 Otto, Rudolf, Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen. München: Beck 2014 Rancière, Jacques, Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2010 Raschke, Carl, Force of God. Political Theology and the Crisis of Liberal Democracy. New York: Columbia University Press 2015
408
Überlegungen zu einer Phänomenologie »religiöser Gewalt«
Ricœur, Paul, Die Fehlbarkeit des Menschen. Freiburg/München: Alber 1989 —, Symbolik des Bösen, Freiburg: München 1989 —, »Phänomenologie der Religion«, in: ders., An den Grenzen der Hermeneutik. Philosophische Reflexionen über die Religion, Freiburg/München: Alber 2008, S. 85–94 Said, Edward, Orientalism. London: Penguin Books 1985 Schneider, Manfred, Der Barbar: Endzeitstimmung und Kulturrecycling. Munich: Hanser 1987 Soeffner, Hans-Georg, »Faszinosum Gewalt.« In: Gewalt. Entwicklungen, Struk turen, Analyseprob- leme, Suhrkamp: Frankfurt/Main 2004, S. 62–85. Springer, Simon, »Violence Sits in Places? Cultural Practice, Neoliberal Rational ism, and Virulent Imaginative Geographies.« Political Geography 30/2(2011): 90–98. —, »The Violence of Neoliberalism.« In: The Handbook of Neoliberalism, hg. v. S. Springer, K. Birch, J. MacLeavy, 153–163. New York, NY: Routledge 2016, S. 153–163 Srubar, Ilja, »Religion and Violence. Paradoxes of Religious Communica tion.« Human Studies 40/4(2017): 501–518. Staudigl, Michael, Phänomenologie der Gewalt. Cham: Springer 2015 —, »Parasitic Confrontations: Toward a Phenomenology of Collective Violence.« Studia Phaenomenologica 19(2019): 75–101 —, »From the Crisis of Secularism to the Predicament of Post-Secularism. Late Modern Social Imaginaries and the Trope of Religious Violence.« Interdiscipli nary Journal for Religion and Transformation 5/2(2019): 377–410. Steinbock, Anthony J., The Moral Emotions. Reclaiming the Evidence of the Heart. Evanston: Northwestern University Press 2014 Taylor, Charles, Modern Social Imaginaries. Durham: Duke University Press 2004 —, A Secular Age. Cambridge: Belknap Press 2007 Ten Kate, Laurens, »Secularity as Sacrifice. Notes on the Dialectical Logic in Modernity and Its Monotheistic Prefigurations.« Journal for Religion and Transformation 1(2015): 22–45 Vertovec, Steven, »Superdiversity and Its Implications.« Ethnic and Racial Stu dies 30/6(2007): 1024–1054. Waldenfels, Bernhard, »Grenzen der Legitimierung und das Problem der Gewalt.« In: Ordnung im Zwielicht, Frankurt/Main: Suhrkamp 1990, S. 103–119 Whitehead, Neil, »The Poetics of Violence.« In: Violence, hg. v. Neil Whitehead. Santa Fe: School of American Research Press 2004, S. 55–77 —, Violence and Cultural Order. Daedalus 13(2007): 40–50. —, »Divine Hunger. The Cannibal War Machine.« Verfügbar im Internet: https:/ /www.academia.edu/701130/Divine_Hunger_-_The_Cannibal_War_Mac hine. Zugriff am 15. 10. 2019 (Spanische Druckfassung: »Hambre divina: la máquina de guerra caníbal.« Mundo Amazónico 4/2013: 7–30).
409
Jason W. Alvis
Souveränität des Leids Offener Theismus, schwache Theologie und politische Theodizee
»Notfälle waren schon immer der Vorwand, unter dem die Garantien der individuellen Freiheit ausgehöhlt wurden.« F. A. Hayek1
Das Verhältnis von sakral und säkular – auf das sich die Philosophen üblicherweise mit den eher individualisierten Begriffen von Glaube und Vernunft beziehen – kann nicht mehr als das eines streng dialekti schen Gegensatzes bezeichnet werden. Wir wissen nicht nur, dass die Geschichte des Säkularismus selbst mit der durch ihn mitbestimmten Heilsgeschichte verknüpft ist, sondern auch, dass die Geschichte der Philosophie immer in Beziehung zu ihrem metaphysischen Gegen stück des »Anderen« des Glaubens und dessen unauflösbaren reli giösen Spannungen stand. Dieses Fehlen einer klaren Abgrenzung zwischen sakral und säkular, zwischen Glaube und Vernunft, ist heute in unserer Kultur und in unserem Kontext, der aufgrund aller Widersprüche reich an Mehrdeutigkeit und Ambivalenz ist und sich vor allem durch den Ausnahmecharakter kennzeichnet, noch stärker ausgeprägt.2 Obwohl »wir« im Westen nicht mehr so christlich sind, Hayek setzt fort: »[...] und wenn diese einmal außer Kraft gesetzt sind, ist es für denjenigen, der diese Notstandsbefugnisse übernommen hat, nicht schwer, dafür zu sorgen, dass der Notstand andauert.« F.A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, S. 124. 2 »Die Affinitäten zwischen Heiligkeit und Ausnahmezustand sind nicht nur von historischem Interesse, denn sie sind ein weiterer Beweis für die enge Verbindung zwischen dem Bereich der Religion und jenem der Politik, eine Verbindung, in der, wie wir sehen werden, das Handeln des Herrschers eine entscheidende Rolle spielt... [...] Letztendlich ist das Auftauchen von Metaphern, die souveräne Entscheidungen beinhalten, der Versuch, die Natur der menschlichen Handlungsmacht zu erforschen, eine Erforschung, die es erfordert, die Handlungsmacht in ihrer nacktesten Form darzustellen – wobei Götter und Herrscher die Personifikationen dieser extremen Form der Handlungsmacht darstellen.« G. Benavides, »Holiness, State of Exception, Agency«, S. 64, 66. 1
411
Jason W. Alvis
wie wir es einmal waren (zumindest im traditionellen Sinne dieses Begriffs), sind wir trotzdem noch nicht nicht-christlich oder antichrist lich. Das liegt nicht nur an den Mehrdeutigkeiten, Ambivalenzen und unauflösbaren Spannungen, die die Kultur (zwischen dem Heiligen und dem Säkularen, dem Glauben und der Vernunft) durchziehen, sondern auch daran, dass viele der verwestlichten Alternativen zum Christentum nicht ohne einen inhärenten christlichen Einfluss aus kommen. Ob die »Säkularisierung« die Religion zumindest auf der soziokulturellen Ebene überwunden hat und sie zu einer neu gepräg ten Wiederholung, Ex-Karnation oder Metamorphose des Christen tums macht, oder ob es eine weltweite »Rückkehr der Religion« gibt, die sich gegen die Säkularisierung zur Wehr setzt, scheint noch nicht entschieden zu sein. Doch wenn das Christentum überleben und einige seiner Grundzüge beibehalten soll, muss es – analog zu Luthers lebendiger Reformation – sein operatives Heilsverständnis sichtlich von dem der »weltlichen« Ökonomie unterscheiden. In Anbetracht der Tatsache, dass die binäre Trennung zwischen dem Heiligen und dem Säkularen alles andere als eindeutig ist, bietet sich der Religionsphilosophie heute die Gelegenheit und die Herausforderung, zu ergründen, wie theologische und religiöse Kon zepte säkularisiert werden und umgekehrt. Der vorliegende Beitrag unternimmt dies, indem hier die Wechselbeziehung zwischen den Problemen des Leids und der Souveränität aufgezeigt wird; eine Wech selbeziehung, die auch bedeutet, dass insbesondere zwei Stränge der Religionsphilosophie (die Gotteslehre und die Theodizee) ihren Interessens- und Untersuchungsbereich auf die politische Philosophie und die politische Theologie ausdehnen müssen. Obwohl nicht alles Leid seinen Ursprung in einer Metaphysik, einer Politik der Souve ränität oder einem despotischen Versuch, Gewalt einzusetzen, hat, argumentiere ich hier, dass die Art und Weise, wie wir Souveränität (qua Allmacht) verstehen oder davon betroffen sind, einer der grundle gendsten Indikatoren dafür ist, wie wir leiden. Und unabhängig von der Art, dem Typus oder dem Grund des Leids hat es einen Bezug zur Souveränität. Kurz gesagt ist die Art und Weise, wie wir auf das Leid antworten (Theodizee), ein Indikator für die von uns gewählte Metaphysik der Allmacht, die sich in vielerlei Hinsicht in unserer Politik der Souveränität ex-karniert. Insgesamt funktionieren sowohl die Souveränität als auch das Leid gemäß einem Modell oder einer Bedingung des Ausnahmezu
412
Souveränität des Leids
standes: Souveräne schaffen politische Ausnahmen, indem sie sich als von der Norm abweichend deklarieren, und verursachen letztlich in Fällen von Machtmissbrauch in vielerlei Hinsicht Leid. Leid schafft ontologische Ausnahmen, die neue Regeln einführen, die unser Leben bestimmen und uns Ängste und Verhaltensweisen diktieren, was häu fig zum gesellschaftlichen Wunsch nach der Etablierung souveräner Figuren führt. Nachdem verschiedene Punkte der Wechselbeziehung zwischen Leid und Souveränität aufgezeigt werden, wendet sich der vorliegende Beitrag abschließend der »weak theology« und dem »Offenen Theismus« als zwei Möglichkeiten zu, Antworten auf die Probleme zu geben, die Leid und Souveränität unweigerlich aufwer fen. Der Offene Theismus und die Schwache Theologie bieten jeweils auf ihre eigene Weise Mittel, um den Kern von Leid und Souveränität und dessen einzigartige, aus deren Verwobenheit erwachsende Aus nahmestellung anzusprechen. In erster Linie verorten beide Ansätze diesen Kern im Begriff der göttlichen Allmacht verankert, da beide versuchen, das Leid (Offener Theismus) und die Souveränität (Schwa che Theologie) zu überwinden, und zwar durch ihr Beharren auf Verletzlichkeit und Leidensfähigkeit, Mitgefühl und Freiheit.
1. Das Leid und das Böse Es scheint unbestreitbar, dass es eine gewisse Universalität des Leids gibt. Wir alle leiden, haben gelitten oder werden in Zukunft leiden. Daher wird das Problem des Bösen, das vor allem in der analytischen Religionsphilosophie behandelt wird, oft als der größte Stolperstein angesehen, der heute gegen den theistischen Glauben ins Feld geführt wird. Humes folgende Behauptung sticht nach wie vor aufgrund ihrer Relevanz und Wirkung hervor: »Ist Gott willens, das Böse zu verhindern, aber dazu nicht fähig? Dann ist er impotent. Ist er dazu fähig, aber nicht willens? Dann ist er boshaft. Ist er beides, fähig und willens? Woher kommt dann das Böse?«3
Hume weist darauf hin, dass das unbestreitbare Vorhandensein von Leid, Gewalt und Bösem in der Welt in direktem Widerspruch zu Gottes mutmaßlicher Allgüte und Allmacht steht. Wenn Gott wirklich allmächtig und ewig gut ist, dann müsste er »den Willen« haben, Leid, 3
D. Hume, Dialoge über natürliche Religion. S. 99.
413
Jason W. Alvis
Gewalt und das Böse auszurotten. Dennoch erleben wir immer noch überall auf der Welt und ohne Ausnahme Böses, Gewalt und Leid. Daraus schließen einige, dass es Gott nicht geben kann, zumindest keinen Gott, der bedingungslos allmächtig und allgütig ist. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, was die gegenwärtige For schung, insbesondere in der analytischen Religionsphilosophie, zum Problem des Bösen angeht, ist es wichtig festzustellen, dass Wis senschaftler mehr tun, als nur Bedenken gegen den Theismus zu äußern4, nämlich insofern sie tatsächlich proaktive Argumente dafür entwickeln, dass der Theismus völlig irrational ist.5 Im Rahmen dieser Beschäftigung mit dem »Bösen« (das nicht gleichbedeutend mit Leid oder Gewalt ist) weisen sie auf ein strukturelles Problem hin, dessen Wurzeln jenseits des menschlichen Handelns liegen. Dieses Problem betrifft die so grundlegende Zerbrechlichkeit oder Verletzbarkeit des menschlichen Lebens, die letztlich bedeutet, dass sein Untergang gewiss ist. Die »Verteidigungen« (wie die Verteidigung des »freien Willens«) gegen das Böse versuchen in diesem Zusammenhang, sich mit logischen philosophischen Argumenten zu befassen. Diejenigen, die nicht auf den ersten Blick akzeptieren wollen, dass der Theismus aufgrund des Leids, der Gewalt und des Bösen irrational ist, neigen dazu, in Theodizeen nach einer Erklärung zu suchen. Obwohl die Theodizee oder die Versuche, Gott (theós) im Angesicht des Leids »zu verteidigen« (diké), erstmals von G.W. Leibniz im Jahr 1710 geprägt wurde, hat die Theodizeeforschung im 20. Jahrhundert einen großen Aufschwung erlebt, insbesondere nach den vielen unvorstellbaren Gräueltaten, die dieses Jahrhundert gesehen hat. Zeitgenössische Theodizeen versuchen, dem Leid mit interdisziplinären Mitteln einen Sinn zu geben (insbesondere durch die Frage, welche Art von Gott Leid zulassen würde) und Gottesleh ren mit den empirischen Realitäten alltäglichen Leids, Gewalt und Konflikt in Übereinstimmung zu bringen. In einer sich zunehmend globalisierenden Welt können wir Gewalt, Böses und Leid heute nicht mehr als Ausnahmen von der Norm betrachten, sondern müssen sie als für diese konstitutiv verstehen. Kurz gesagt wissen wir alle, dass Gewalt keine Ausnahme, sondern eine Alltagsnorm ist.6 Vgl. Rowe 1978; R. Swinburne, Providence and the Problem of Evil; P. van Inwagen, The Problem of Evil. 5 Vgl. J. L. Schellenberg, »A New Logical Problem of Evil«. 6 Vgl. dazu exemplarisch M. Staudigl, Phänomenologie der Gewalt. 4
414
Souveränität des Leids
Und da Leid überall um uns herum ist, müssen wir unabhängig von unseren theologischen »Verpflichtungen« einen Weg finden, um seine Anwesenheit zu verstehen. Es führt uns dazu, selbstver ständlich nach seinem Ursprung und seinem Zweck zu fragen. In einem Moment tiefen Leids und verletzender Gewalt neigen wir dazu, die Welt anders wahrzunehmen, indem wir uns nicht nur für ihren Ursprung interessieren, sondern auch für die besondere affektive Zerbrechlichkeit, die eine Instanziierung des Leids darstellt. Der Geschäftsmann, der uns ärgert, weil er auf der Straße an uns vorbeirauscht, zeigt sich anders, wenn ich ihn von einem Taxi ange fahren sehe. Wer er wirklich »ist«, zeigt sich, wenn er leidet, und dies fordert uns auf, mit ihm zu leiden. Selbst wenn wir also nicht mit unserem eigenen Leid konfrontiert werden, so sind wir doch mit dem unermesslichen Leid in dieser Welt konfrontiert, was dazu führt, dass wir, meist jede Person auf die ihr eigene Weise, unsere eigene Erklärung dafür anbieten, warum es Leid gibt. Selbst wenn wir den Ursache-Wirkung-Charakter des Leids aufgeben, entwickeln wir dennoch einen impliziten Wissensschatz darüber, wie wir mit dem Leid umgehen und was es uns über uns selbst, andere und unsere Welt sagt. Mit anderen Worten: Menschen leiden an der bloßen Vorstellung, dass es Leid gibt. Und in der Regel stürzen wir uns dann vom Hundertsten ins Tausendste der Theodizee, indem wir uns fragen: Wie ist Leid im Allgemeinen und dieses Leid insbesondere entstanden und was ist es? Theistischer gesprochen sind zwei der populärsten und bekann testen Beispiele für die Erklärung der Existenz sowohl des Leids als auch Gottes die Theodizee des freien Willens (Augustinus, Plantinga) und die seelenbildende Theodizee. Ersterer zufolge ist die beste aller möglichen Welten eine mit freiem Willen und die Abschaffung des Bösen (von Augustinus gemäß der Privationslehre als »Abwesen heit des Guten« definiert) und des Leids bedeutet daher auch die Abschaffung der Wahlfreiheit. Ein zweites Beispiel ist die »seelenbil dende Theodizee« (Hick), die davon ausgeht, dass Gott uns nicht nur kognitiv (siehe Descartes), sondern auch moralisch als tabula rasa geschaffen hat. Indem wir leiden, nimmt unsere Abneigung gegenüber den negativen Sozialitäten der Welt ab und wir werden sensibler für das Leid anderer. Wir werden als »unbeschriebene Blätter« geschaffen und durch unser Leid werden wir moralisch »fit« für diese Welt und für die Beziehung zu anderen. Dieser Ansatz geht zumeist davon aus, dass diese moralische Neutralität in Wirklichkeit
415
Jason W. Alvis
eher einem degenerierten moralischen Zustand ähnelt, insofern sie annimmt, dass wir von Natur aus tendenziell zur Selbstsucht streben; und dass man nur durch den Erwerb von moralischem Wissen die Möglichkeit hat, anderen überhaupt zu helfen (einige werden an die ser Stelle befürchten, dass es sich hierbei bereits um ein ichbezogenes Bestreben handelt) und nicht unabsichtlich Leid zu verursachen. Diese Positionen sind aus verschiedensten Blickwinkeln sowohl von außen (einige behaupten lediglich, dass die Nichtexistenz Gottes die beste Erklärung ist) als auch von innen (einige halten an der Existenz Gottes fest, ziehen es aber vor, das Leid weiterhin als Mysterium zu betrachten) kritisiert worden. Ein dritter (zumindest in der breiten Öffentlichkeit) populärer und überzeugender Ansatz zur Theodizee besagt, dass die traditionellen Theodizee-Narrative vom realen Leid anderer abstrahieren und damit ihren eigenen grundlegen den Absichten zuwiderlaufen. Dies hat zur Folge, dass das Leid ein Mysterium darstellt. Die Theodizee kann leicht zu einem Versuch werden, das Leiden anderer wegzuerklären, und vielleicht sogar »ist die Rechtfertigung des Schmerzes des Anderen mit Bestimmtheit der Ursprung aller Unmoral«7. Eine Figur, die diese Sichtweise philosophisch untermauert hat, ist der französisch-jüdische Denker Levinas, der eine »hyperbolische Ethik«8 vertritt, die mit dem Antlitz des Anderen beginnt, das stets den folgenden Befehl ausstößt: »Töte mich nicht.« Dies erfordert eine völlig andere Ontologie, die in vielerlei Hinsicht a) beim Prob lem des Leids ansetzt, b) eine »heteronomere« Art der Interaktion mit anderen in einem vernünftigen Dialog entwickelt und c) ihren praktischen Ausdruck in Taten des Mitgefühls findet. Seinen frühen Texten zufolge offenbart das Leid die Last des Seins und die Grenzen des Selbst, während in späteren Überlegungen das Leid als passiv, sinnlos oder böse dargestellt wird, was jegliche rationale Erklärung des Leids entschieden zurückweist. Nur dann könnte eine Theodizee »gerechtfertigt« werden. Wenn ich mittels Empathie als Antwort auf das Leid des anderen leide, kann ich mein eigenes Leid rechtfertigen und nützlich machen.9 Wenn andere ihre eigene Theodizee anbieten, E. Levinas, »Das sinnlose Leiden«, S126. J. Derrida, M. Ferraris, A Taste for the Secret. 9 »Vielleicht die umwälzendste Tatsache unseres Bewusstseins im 20. Jahrhundert […] ist die völlige Zerstörung des Gleichgewichts zwischen der expliziten und impli ziten Theodizee des westlichen Denkens und den Formen, die das Leiden und sein 7
8
416
Souveränität des Leids
sollten wir sie nicht verurteilen, da wir nicht wissen, wie ihr Leid beschaffen ist. Kurzum stellt für Levinas die Beziehung zum anderen die Quelle dar, auf die ich mich stütze, wenn ich Entscheidungen treffe oder mich auf das einlasse, was Ethiker ein »reflexives Gleichgewicht« nennen. Auch hier ist das Mitgefühl die letzte Antwort auf die Frage nach dem Leid: »das Leiden durch das Leiden, das Leiden wegen des sinnlosen Leidens des anderen Menschen, das gerechte Leiden in mir wegen des nicht zu rechtfertigenden Leidens des anderen Menschen […]«; eine solche Empathie »[eröffnet] dem Leiden die ethische Perspektive des Zwischenmenschlichen«10 Angesichts dieser unterschiedlichen Positionen hinsichtlich der Theodizee macht es durchaus Sinn anzuerkennen, dass die Art und Weise, wie wir in der Religionsphilosophie auf das Leid reagieren, zumindest ontologische und politische Konsequenzen hat, die eine wichtige Rolle dabei spielen, wie wir Herrschaft begreifen. Der pla tonischen Tradition der Begriffsaufteilung folgend, neigen wir dazu, unsere Welt in zwei undurchlässige Aspekte aufzuteilen (etwa in Dichotomien wie Falschheit/Wahrheit, gut/böse, heilig/profan), was die negative Konsequenz hat, Diskriminierungskulturen zu schaffen. Selbst wenn im Westen von »säkularen« Menschenrechten die Rede ist, ist ein Machtimperialismus am Werk, den wir versuchen über andere auszuüben, indem wir sie darauf reduzieren, »wie wir« zu sein oder zumindest eine ähnliche Willensstärke zu haben. Durch diese universalistische Tendenz wird Gleichheit dem Unterschied vorgezo gen. Wenn wir feststellen, dass Individuen und Menschengruppen nicht so sind wie wir, neigen wir historisch gesehen dazu, sie zu dominieren zu versuchen. Und da die westliche Religionsphilosophie die Theodizee vertritt, ist sie mitverantwortlich für die negativen Sozialitäten, die zu Kulturen der Diskriminierung, der Beherrschung und der Macht geführt haben, weil sie zu einem »ontologischen Imperialismus« beiträgt, der uns von anderen abstrahiert und uns abgeneigt gegenüber dem Anderssein macht.
Unheil im Verlauf dieses Jahrhunderts annehmen.« (E. Levinas, »Das sinnlose Lei den«, S. 124). 10 E. Levinas, »Das sinnlose Leiden«, S. 120.
417
Jason W. Alvis
Politische Theologie und die Souveränität des Leids Dies ist einer der Gründe, aus dem wir schließen können, dass Philosophien der Theodizee ohne ein Verständnis der konkreten Erfahrung von Leid, Gewalt und der Begrenztheit der menschlichen Endlichkeit weder Relevanz noch Grundlage erlangen können. Es ist daher notwendig, das Leid auch dort zu diagnostizieren, wo es nicht ohne weiteres sichtbar ist – selbst dort, wo es in Institutionen und kulturellen Praktiken verwurzelt ist. Dies ist es, was die antimoderne Kritik der letzten dreißig Jahre in den Werken von der politischen Theologie nahestehenden Denkern, wie etwa Milbank, Pabst, Hau erwas und Cavanaugh so aufschlussreich und oft scharfsinnig tat. Ihr Werk erschien zu einem besonderen Zeitpunkt, als wir nicht nur die kulturellen Bedingungen einer außer Kontrolle geratenen globalisierten Moderne aufzeigen mussten, sondern auch die prekä ren Lebensbedingungen (unabhängig von der sozialen Schicht oder dem finanziellen Status), unter denen wir stärker leiden, als unsere Vorstellungskraft es uns einzusehen erlaubt. Wie Halldorf es kürzlich formulierte, »ist die Moderne ein technologisches Wunderland und eine geistige Einöde. Die späte oder flüssige Moderne beschleunigt viele Probleme, die in der Hochmoderne zu beobachten sind: die Erschöpfung des sozialen Kapitals, das Fehlen tiefer Bindungen, die Oberflächlichkeit von Politik und Kultur, der Verlust der Hoffnung und ein allgemeines Gefühl der Fragmentierung.«11 Forscher, die eine Antwort auf dieses Problem der modernen geistigen Verödung finden wollen, haben sich oft dem Leben Christi zugewandt, das in den heiligen Schriften als politisches Modell dar gestellt wird. Zunächst (sogar von seinen engsten Jüngern) missver standen als ein politischer, auf Befreiung ausgerichteter Revolutionär, wurde Christus als Messias dargestellt, dem prophezeit wurde, dass er der die Souveränität Gottes bringende Kelch der Gerechtigkeit sein würde, der die herrschende Regierung stürzen und sie durch die wahre, »kontrastreiche Gesellschaft« Israels ersetzen würde (parado J. Halldorf, »What makes theological work so significant?«. Halldorf diagnostiziert den aktuellen Zustand der Politischen Theologie folgendermaßen: »Die Politische Theologie befindet sich in einem Dilemma: Wenn man die gegenwärtigen Strukturen des Liberalismus kritisiert, klingt man vielleicht wie ein Populist, aber wenn man sich der Kritik enthält, ist der Populismus die einzige Bewegung, in der Unzufriedenheit ausgedrückt wird.« 11
418
Souveränität des Leids
xerweise blühte Israel als Personenkreis in vielen Fällen tatsächlich auf, als es unter der Herrschaft ausländischer Despoten stand).12 Diese Institution sollte dazu dienen, die Spannungen zwischen der wohlha benden, der armen und der ausgegrenzten Schicht zu lösen. Wie aus außerbiblischen Berichten hervorgeht, wurden die frühen Anhänger Christi zu Ad-hoc-Revolutionären, deren »religiöse« Handlungen unzählige »politische« Konsequenzen und Auswirkungen hatten und zwar in solch einem Ausmaß, dass die politischen Autoritäten neue Wege suchten, ihre Macht öffentlich zu demonstrieren, indem sie viele dieser Anhänger zu Märtyrern machten oder maßregelten. Erst nach der Etablierung des Christentums als Staatsreligion (einer Art politischer Vereinnahmung des Christentums als Religion) kam Augustinus dazu, seine Tradition und seine theologischen Zeit genossen dafür zu kritisieren, dass sie kein gemeinsames »mensch liches Projekt«13 hatten, verkündeten oder verbreiteten, in dem das Reich Gottes auf Personen außerhalb der christlichen Gemeinschaft ausgedehnt wurde. In Ermangelung eines solchen Projekts sahen sich die Christen den Bedrohungen der Zugehörigkeit zum »Men schenstaat« ausgesetzt, in dem die Ziele des Lebens entweder darin bestehen, Macht zu erlangen, was zur Herrschaft über andere führt, oder sich der Herrschaft anderer zu unterwerfen und somit schwach zu sein. Darin spiegelt sich eine politische Unordnung, die auf das Ver sagen der Christen, zur Errichtung einer vernünftigen »moralischen Ordnung« oder öffentlichen Tugend beizutragen, zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang macht es durchaus Sinn, dass jemand wie Thomas von Aquin sich überlegte, inwiefern die moralische Ordnung daraus folgt, dass ein Zugang zur »Wahrheit« hergestellt wird. Politische Strukturen müssen uns auf irgendeine Weise einen besseren Zugang zur Wahrheit ermöglichen, die größer ist als die Könige und nicht dem Nutzen der Könige unterworfen werden kann.14 Der politische Führer, Souverän oder König hat das Potenzial, »unsere Wahrnehmung der natürlichen Ordnung der Dinge zu formen«, und wer die Wahrheit nicht beachtet, ist ein Tyrann.15 W. Brueggemann, »Scripture: Old Testament«, S. 8f. R. Williams zitiert in: Elshtain, »Augustine«, S. 41. 14 Für Calvin sind Kirche und Staat zwar verschieden, aber nicht unvereinbar. Die Treue gilt zuerst der Kirche als grundlegendere Wahrheit. Wann immer der Staat nicht mit der Wahrheit der Kirche übereinstimmt, ist er nicht nur mit ihr unvereinbar, sondern der Feind der Kirche. 15 F. C. Bauerschmidt, »Aquinas«, S. 49. 12
13
419
Jason W. Alvis
All dies zeigt, dass die enge Beziehung zwischen Souveränität und Leid keine Entwicklung des 20. Jahrhunderts darstellt, sondern (zumindest) für die abendländische philosophische Tradition von wesentlicher Bedeutung ist. Souveränität als Prinzip des Rechts verweist auf einen Entscheidungsträger, der einen göttlichen Vertre ter auf Erden einsetzt, um die öffentliche Tugend zu überwachen. Leid, sei es in der Gestalt des Schmerzes, politisch ausgegrenzt zu werden, oder in der Gestalt von Verletzungen durch vorsätzliche Gewalt oder grundloses Übel, weist auf die Notwendigkeit einer individuellen und gesellschaftlichen Antwort hin. Die politische Theologie ist zu einem wichtigen Instrument geworden, um nicht nur die politischen Problemfelder des Leids (Gutierrez, Cone), der Hoffnung (Moltmann) oder der Hoffnungslosigkeit (De La Torre) jenseits von politischer Utopie und Dystopie zu bestimmen, sondern auch die zugrundeliegende ontologische Matrix, die zu ihrer allzu menschlichen Fortdauer und Verbreitung beigetragen hat. Solche und andere Darstellungen (wie Terror [Jürgensmeyer], Horror [Cavarero], soziale Ächtung [Honneth]) sind notwendig, um nicht nur über das Faktum des Bösen zu philosophieren, sondern auch über seine kulturell vielfältigen Produktionen. Wenn Leid, Gewalt und das Böse in der Tat als eines der Hauptprobleme genannt werden, die Menschen vom »Glauben an Gott« abhalten, und wenn die Religionsphilosophie bisher nicht in der Lage gewesen ist, Leid, Gewalt und das Böse erfolgreich und beweiskräftig abzumildern (indem sie entweder zu der Schlussfolgerung führt, dass Gott existiert oder nicht), dann wäre es hilfreich zu fragen, wie andere Forschungsbereiche, die sich mehr auf die »gelebte Erfahrung« von Leid, Gewalt und dem Bösen konzen trieren, eine solche Abmilderung bekräftigen könnten. Letzteres wäre möglich, auch wenn eine vollständige und umfassende Darstellung dieser kulturellen Phänomene angesichts des unheilbaren Risses in unserem allzu menschlichen Verständnis davon, was es bedeutet, allzu menschlich zu sein, nicht möglich ist. Ein Thema, das von Religionsphilosophen oft nicht als wesent lich mit dem Leid verbunden betrachtet wird, ist, um nur ein Bei spiel zu nennen, das Opfer. Das Opfer ist eine der Grundlagen des religiösen Lebens16, und im Christentum steht es in direktem Zusammenhang mit dem Sühnetod Christi und der Überwindung des Todes. Das Opfer macht aus der Krise – der großen »List der 16
P. W. Kahn, Sacred violence: torture, terror, and sovereignty.
420
Souveränität des Leids
Geschichte« – eine Chance für sozialen Wandel und aus dem Leid ein gesellschaftspolitisches telos. Es könnte sogar sein, dass »eine wahre Religion ihre Wahrheit nur durch ihre Selbstaufhebung« oder ihr Opfer erreicht (Žižek 2008).17 Das Opfer Christi, von dem manche behaupten, es habe Gottes wahrhaft »kommunistische« und interre lationale Beschaffenheit begründet und demonstriert, hat eine meta theologisch-politische Grundlage. In Anlehnung an Tendenzen in der Theologie des »Todes Gottes« in der Mitte des 20. Jahrhunderts und der Prozesstheologie vertreten einige, wie z. B. Žižek, die Auffassung, dass Gott sich mit der Kreuzigung Christi durch den Heiligen Geist in die Menschen hinein verstreut hat. Eine Folge davon ist, dass unser Leid unser eigenes ist und kein »großer Anderer« (Gott) kommt, um uns vor uns selbst zu retten, sodass es in unserer Verantwortung liegt, sowohl das Leid als auch die Souveränität, mit der wir in der Welt konfrontiert sind, zu mildern. Diese Gemeinschaftlichkeit der Menschen kommt in unseren individuellen, inneren Krisen zum Aus druck, denn wir sind zerrissene Subjekte, deren »Perversionen« zu Werkzeugen Gottes werden, indem sie Gelegenheiten für göttliches Eingreifen und Offenbarung bieten. Das bedeutet auch, dass es eine unheilbare Selbstbeschädigung des Leids gibt, und jeder Versuch, uns davon zu befreien oder es zu sublimieren, endet damit, dass wir es nach außen projizieren, was uns noch gewaltsamer macht. Wenn wir über Žižek hinausgehen, ist vielleicht gerade die Projektion von Souveränität und Despotie auf einen allmächtigen Gott eine bloße Ablenkung von unserer eigenen unheilbaren Gewalt gegen andere und gegen uns selbst. Leid und Souveränität scheinen in der einen oder anderen Form Konstanten des menschlichen Lebens zu sein, insbesondere in Gestalt von einzigartigen Ausnahmen im Fluss des Alltäglichen. Die Souverä nität betrifft sowohl denjenigen, der Notfälle oder Ausnahmezustände ausruft, als auch denjenigen, der darunter leidet, eine Ausnahme vom Gesetz zu sein, da er von jeder politischen Gerechtigkeit ausgeschlos sen ist (z.B. in Agambens Figur des Homo Sacer). »Ausnahmen«, so wissen wir, haben die Tendenz, zur Regel zu werden und sich in die Norm aufzulösen. So werden souveräne Ausnahmen in den Prozess der Regelbildung und -erhaltung in der juristischen Beratung und der sozialen governance bis hin zu dem Punkt aufgenommen, an dem der Ausbruch unvorhersehbarer Ausnahmen die neue Norm darstellt. 17
S. Žižek, J. Milbank, C. Davis, The monstrosity of Christ, S. 287.
421
Jason W. Alvis
Wie wir von Agamben lernen, verliert das Individuum einen Aspekt seines Menschseins, wenn es von einer der primärsten gemeinschaft lichen Ordnungen, dem Gesetz, ausgeschlossen wird. Dies geschieht unter der Ordnung einer Macht, die für sich in Anspruch nimmt, auch außerhalb des Gesetzes zu stehen, als dessen Schöpfer und Gestalter – der Souverän.
2. Souveränität: theologisch und politisch Ansätze zur Souveränität gehen in der Regel auf theologische Per sönlichkeiten wie Augustinus, Hobbes, Schmitt oder Metz zurück.18 Deren Arbeiten gelten als Höhepunkt der Politischen Theologie, die sich mit der sogenannten »Säkularisierung« theologischer Konzepte und umgekehrt befasst. Aus diesem Grund befasst sie sich zumeist mit Formen menschlicher Staatsführung und unternimmt dabei drei übergreifende Untersuchungen: a) inwieweit die politische Frage der Souveränität theologische Einflüsse aufweist, b) inwiefern das theolo gische Anliegen der Allmacht kulturell und politisch eingebettet ist, und c) wie die anthropologischen Fragen der Unterordnung wiederum jene Einflüsse und Einbettungen beeinflussen. Mark Lilla hat versucht herauszufinden19, was uns Menschen dazu veranlasst, bestimmten Personen Autorität zuzuschreiben, damit sie uns regieren. Souveräni tät und der Wechsel von einer Person oder Form zu einer anderen (sei es durch eine Volksabstimmung, eine Revolution oder einen illegalen Regimewechsel) ist eine Frage der Übertragung von Legitimation. Politische Theologie beschränkt sich also nicht auf »Politik« oder »Theologie«, sondern trifft den Kern der Beziehung zwischen 18 Wie Schmitt es später in seiner Karriere ausdrückte: »Naive Projektionen, numi nose Phantasien, reflektierende Reduzierung des Unbekannten auf etwas Bekanntes, Analogien des Seins und des Erscheinens, ideologische Überbauten über einem Unter bau, sie alle treffen sich in dem unermesslichen, polymorphen Bereich der Politischen Theologie oder auch Metaphysik.« Carl Schmitt, Politische Theologie II, S. 41. In einem Aufsatz »Politische Theologie« von 1969 wendet Hans Maier sich sowohl gegen »das Schlagwort von der politischen Theologie, das heute umgeht«. Maier war, wie Schmitt meint, »auch gegen die zahlreichen Theorien und Aktionsprogramme (...), die heute die ,Theologie der Revolution‘ predigen.’ Seine kritische Polemik richtet sich vor allem gegen das, was der katholische Theologe J. B. Metz offen als seine politische Theologie unter dieser Bezeichnung vorträgt. In einem Buch Zur Theologie der Welt (1969).« (Schmitt, Politische Theologie II, S. 31). 19 Vgl. M. Lilla, The Stillborn God.
422
Souveränität des Leids
einem selbst und dem anderen – einem anderen, der entschieden unauslöschlich ist. Dies folgt aus der traditionelleren theologischen Einsicht, dass Souveränität und Autorität Gegenstand einer nicht ableitbaren Offenbarung sind. Und da Menschen auf Basis eines unauslöschlichen und stets wirksamen religiösen oder spirituellen »Antriebs« funktionieren, der sich auf der Ebene unserer soziopoliti schen Aktivitäten zeigt, haben selbst abstrakte Lehren über Gott (z. B. Allmacht) Auswirkungen darauf, wie wir uns selbst regieren und wen wir als unsere »Herren« aufstellen. Eine solche Sichtweise ist stark von der phänomenologischen Tradition beeinflusst, da diese aufzeigt, wie religiöse Phänomene in der Tat in zeitgenössische Formen insbe sondere der politischen Praxis, des rechtlichen Prozeduralismus und der Formen der beratenden, liberalen und demokratischen Vernunft eingebettet sind. Dies wirft auch die Frage auf, inwieweit das Christentum in ver schiedene Arten von Institutionen, Märkten, politischen Strukturen und sozialen Vorstellungen in-korporiert wird (ähnlich wie ein Unter nehmen sich selbst in-korporiert oder zu einem Körper wird). Eine solche In-Korporation betrifft auch die Art und Weise, wie wir unsere Vorstellung der göttlichen Allmacht in der Welt manifestieren, und damit auch, wie die (davon abweichenden) Themen der politischen Autorität, Macht, Herrschaft und Souveränität zur Sprache gebracht wurden, um die verschiedenen Arten und Weisen zu erklären, in denen wir uns etwas von der Herrschaft erhoffen, sie verachten oder sie passiv hinnehmen, insbesondere von der Herrschaft des Staates, der, wie Hobbes bereits wusste, immer »tetramorph« ist, d. h. menschlich, göttlich und maschinell.20 Souveränität ist in der Tat einer der Schlüsselbegriffe der Politi schen Theologie, vor allem aufgrund ihres scheinbar unzerstörbaren Charakters. Infolge des gegenwärtigen aufklärerischen Paradigmas der Befreiung und der angeblichen Demokratisierung des »Westens« im 20. Jahrhundert wurde erwartet, dass das klassische Königsmodell der politischen Souveränität verschwinden würde, was bedeutet, dass Souveränität und Autorität in das autonome Selbst verlagert und verinnerlicht würden (im Gegensatz zu den traditionellen äußeren Autoritäten). Mit diesem Paradigma ging der Glaube an die Ent-Theo »Der große Leviathan, der Staat des Thomas Hobbes, ist tetramorph: er ist sowohl der große, aber sterbliche Gott wie auch ein großes Tier, außerdem ein großer Mensch und eine große Maschine.« Schmitt Politische Theologie II, S. 41.
20
423
Jason W. Alvis
logisierung des Politischen einher, der das Problem der Souveränität dem Menschen übergab, damit dieser es beseitige.21 Wie unsere aktuellen globalen politischen Kämpfe gegen Nationalismus und Provinzialismus eindrücklich belegen, ist dieses weltweite Aufklä rungsprojekt jedoch nicht erfolgreich gewesen, vielleicht aufgrund der eher impliziten und verleugneten Formen von Heiligkeit und sogar Allmacht, die dem Politischen innewohnen, wenn auch nur in säkularisierter oder verwandelter Form. In diesem Sinne kann man den eigentlichen Impuls der Aufklärung, die tiefe Offenbarung oder Manifestation der universellen menschlichen Vernunft, als eine Art natürliche Theologie verstehen. Auf der Ebene der Souveränität ist also eine totale Auslöschung aller psychologischen Herrensignifikan ten unmöglich. Denn wir neigen dazu zu glauben, dass jegliche Form von Herrschaft und Souveränität sich lediglich von einer Figur auf eine andere überträgt und verschiebt. Dieses Verständnis von psychologischer Herrschaft ist jedoch für das historische Verständnis der Unausrottbarkeit dieses theo-politi schen Konzepts sicherlich nicht von Belang. Obwohl sich der Begriff seit jeher auf das bezieht, was mit einer »überragenden Macht« (Summa potestas, Plenitudo potestatis) und damit in unmittelbarem Bezug zum göttlichen Recht wirkt, betrifft die Souveränität spezifi scher die »höchste Macht des Staates« oder die Regierungsgewalt (superanus, wie von Aristoteles dargestellt). Beispielhaft für die Begriffsentwicklung ist das Argument von Jean Bodin (16. Jh.), dass die Souveränität unteilbar sei, da der Staatskörper über seine Bürger und Untertanen »ohne Einschränkung durch das Gesetz« wache. Hugo Grotius (17. Jh.) stimmte zu, dass sich die Souveränität auf das oberste Recht des Regierens beziehe (summum imperium, da es »durch keinen anderen menschlichen Willen außer Kraft gesetzt werden kann«), bestand jedoch im Gegensatz zu Bodin darauf, dass sie unter Völkern und Gruppen aufteilbar und nicht nur auf einen Menschen konzentriert sei. Burgess (19. Jh.) behauptete später, Souveränität beziehe sich nicht nur auf unbegrenzte Stärke, sondern auch auf die universelle Macht, Gehorsam zu fordern und zu »erzwingen«. So ging es in den europäischen Debatten vor allem darum, die Souveränität zu zerstreuen oder zu bürokratisieren, sei es durch ihre Verankerung im Verfassungsrecht, sei es durch ihre königliche, päpstliche oder parlamentarische konzeptuelle Ausgestaltung. 21
R. Klein, Depotenzierung der Souveränität.
424
Souveränität des Leids
In der Politikwissenschaft wird die Souveränität in ihren prak tischeren Formen betrachtet und anhand des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins bestimmter Merkmale untersucht, wie z. B. »Beständigkeit« (trotz des Wandels von Gesetzgebung und politi scher Herrschschaft kann die Souveränität ununterbrochen wirken), »Unveräußerlichkeit« (Staat und Souveränität sind untrennbar), »Exklusivität« (der Staat teilt seine Macht mit keiner anderen Auto rität oder Gruppe), »Absolutheit« (keine rechtliche Macht innerhalb oder außerhalb des Staates kann mit seiner Überlegenheit konkur rieren oder sie einschränken), »Universalität« (Souveränität ist uni versell anwendbar, da alle Menschen ihr unterworfen sind) und »Unteilbarkeit« (Souveränität kann nicht geteilt werden, da sonst mehr als ein Staat existiert). Außerdem ist »Souveränität« kein allgemeiner Begriff, der sich nur auf unveräußerliche Macht bezieht, sondern wurde nach verschiedenen Typen eingeteilt, wie z. B. die Titularsouveränität (Souveränität dem Namen nach, nicht in Wirk lichkeit), De-jure-Souveränität (nach dem Gesetz), De-facto-Souve ränität (Machtausübung trotz fehlender Unterstützung durch das Gesetz), Volkssouveränität (Macht der Mehrheit durch die Wähler schaft über rechtlich festgelegte Kanäle), Rechtssouveränität (Befehls gewalt durch das Gesetz) oder politische Souveränität (öffentlicher Wille oder wem auch immer die Bürger in einem Staat gehorchen). Diese eher enzyklopädischen Verweise auf die Souveränität sind nicht zuletzt deshalb erwähnenswert, weil diese praktischen Aspekte und Typen von Souveränität zeigen, dass die Erlangung von Macht selten ein bloßer Selbstzweck ist. Eine solche Macht erscheint einfach zu abstrakt in Anbetracht des ganzen Aufwands, sie zu erlangen. Souverän zu sein ist vielmehr ein Ausdruck von Macht, der auf der Entscheidung und der Wirksamkeit des Willens zur konkreten Verwirklichung und Aktualisierung eines ansonsten virtuellen und unbewussten Willens beruht. Der Souverän will auch sich selbst erkennen. Und das erlaubt es uns, hier einen theologischen Stachel zu erkennen, der in jeder dieser Formen und Typen steckt. Das oben erwähnte Paradigma der Aufklärung versuchte, Souveränität a-theologisch, als ein rein politisches Phänomen zu begreifen und das Heilige als eine Art abstrakte unsichtbare »Essenz« oder »leeren Signifikanten«22 unter dem Boden unserer »säkularen« politischen Ideale zu verstehen, was dazu diente, einen weiteren Keil zwischen 22
E. Laclau, »Why do empty signifiers matter to politics?«.
425
Jason W. Alvis
das Heilige und das Säkulare, respektive das Theologische und das Politische zu treiben. Die kulturelle und politische Herausbildung dieser Unterschei dung zwischen sakral und säkular hat ihren Ursprung in den moder nen Bemühungen, »eine bestimmte Art von sozialer Ordnung«23 zu etablieren; d.h. die Trennung zwischen den beiden stellt den Versuch dar, eine neue Herrschaft über die Menschen zu errichten. Diese vermeintliche Trennung mag einigen politischen Zwecken gedient haben, doch auf der soziokulturellen Ebene hat diese Trennung ihr Unbehagen in der weiten Verbreitung unserer desavouierten Theolo goumena und der metaphysischen Selbstdemontage oder Ex-Karna tion des Christentums zum Ausdruck gebracht. Indem wir stattdessen auf der Wechselbeziehung zwischen dem Theologischen und dem Politischen, dem Heiligen und dem Säkularen bestehen, scheint es, dass die Beschäftigung mit den – daher politisch relevanten und in der Tat verantwortlichen – Gotteslehren in der christlichen Religionsphi losophie eine Möglichkeit darstellen kann, sowohl Souveränität als auch Leid besser zu verstehen.
3. Offener Theismus Nachdem wir nun die Außergewöhnlichkeit und normkonstituie rende Kraft sowohl der Souveränität als auch des Leids und die Bedeutung der theo-politischen Matrix, die sie zusammen bilden, herausgestellt haben, ist es wichtig, sich einigen Antwortmöglich keiten zuzuwenden, die sich in diesem Aufsatz insbesondere mit der Frage befassen, wie beide Themen direkt mit der angeblichen Allmacht Gottes zusammenhängen. Der Rest dieses Aufsatzes stellt zwei miteinander verbundene, an einigen Stellen voneinander abwei chende und relativ neue Denkansätze vor, die für eine angemesse nere Behandlung dieser – inzwischen aufgezeigten – miteinander verbundenen Probleme fruchtbar sind: Offener Theismus und Schwa che Theologie.
23
W. E. Arnal, R. T. McCutcheon, The Sacred Is the Profane.
426
Souveränität des Leids
Offener Theismus Der Offene Theismus hat versucht, das zwiefache Anliegen sowohl der Theodizee des Leids als auch des kulturell relevanten Problems der Überbetonung der göttlichen Allmacht anzugehen. Er hat sich zu einer Bewegung von Denkern entwickelt, die das Gespräch zwi schen analytischer Religionsphilosophie und (meist amerikanischen) evangelikalen Theologen suchen. Diese Einflüsse machen es möglich, darzustellen, wie die Bewegung eine Art Balanceakt zwischen ana lytischer Präzision und biblischer Hermeneutik unternommen hat, indem sie einige Kernlehren des Christentums beugte, um sie der Realität anzupassen, ohne sie notwendigerweise zu brechen. In der Tradition von Anselm wird Gott als zeitlos, reiner Akt, allmächtig, allwissend, unveränderlich, und – in diesem Fall ganz wichtig – sou verän beschrieben. Offene Theisten versuchen all diese Eigenschaften in der einen oder anderen Form beizubehalten, auch wenn sie alle auf den Prüfstand gestellt werden, um die umfangreichen hellenistischen philosophischen Grundlagen und Einflüsse aufzuzeigen, die unser Verständnis dieser Gotteslehren, insbesondere der Allmacht und Allwissenheit, fälschlicherweise geprägt haben.24
Omnipotenz und Macht Es gibt natürlich eine Reihe von Interpretationen der Allmacht, die wir im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben. Einige haben auf der »absoluten Allmacht« bestanden, was bedeutet, dass Gott nicht einmal durch die Logik gebunden ist (z. B. könnte Gott ein Dreieck mit mehr als drei Seiten erschaffen). Andere Versionen der Allmacht gehen davon aus, dass Gott die Logik einhalten muss, oder dass Gott das, was möglich ist, auch tatsächlich tun muss (und es nicht bloß bei dessen Möglichkeit belässt), was ein weiteres Paradoxon darstellt, das Gott als begrenzt zeigt. Eine andere Variante der Allmacht besagt, dass die Fähigkeit Gottes, etwas zu tun, zunächst von der Möglichkeit Gottes abhängt, diese Handlung auszuführen.25 Im Allgemeinen geht es bei der »Allmacht« darum, dass es einfach kein reales/wirkliches Wesen beziehungsweise keine virtuelle/mögliche Person gibt, die mit 24 25
Vgl. C. Pinnock, Most Moved Mover. Vgl. Geach, »Omnipotence.
427
Jason W. Alvis
der Macht Gottes konkurrieren könnte (dies ist bekanntermaßen die Position Anselms). Laut den Offenen Theisten schränkt Gott seine Allmacht, bestimmte Dinge zu tun, aktiv ein. Obwohl eine Welt denkbar ist, in der Gott durchaus in der Lage ist, so zu handeln, dass er sich über den Willen bestimmter Menschen hinwegsetzt – ihre Absichten durchkreuzt oder sie sogar aktiv ihrer Handlungsfähigkeit beraubt –, geht der Offene Theismus stattdessen davon aus, dass es Ausdruck der Macht Gottes ist, seine eigene Macht zu begrenzen; ein notwendiger Schritt, um verletzlich zu werden. Wenn Gott kein »kapriziöser Despot« (Otto) ist und wirklich alles liebt, dann erlebt dieser Gott die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen nicht anders als die Men schen. Nur unter diesen Bedingungen ist es möglich zu behaupten, dass »die Souveränität Gottes die Souveränität der Liebe Gottes ist« und »nicht die Souveränität der Kontrolle«26. Der Offene Theismus versucht, seine ganze Gotteslehre um die Liebe herum aufzubauen, die für Offene Theisten die wichtigste »Charaktereigenschaft« Gottes darstellt. Wenn man von der Liebe ausgeht, ergibt sich eine Reihe von Problemen für die Tradition der christlichen Theologie, die üblicherweise versucht hat, Gott in einer zeitlosen ultimativen »Kontrolle« zu sehen. Diese Kontrolle ist, insbesondere wenn sie im Lichte von Gewalt und Leid betrachtet wird, unvereinbar mit der Vorstellung, dass Gott liebevoll ist und die Schmerzen anderer erleidet. Dies hat zu folgender Grundannahme geführt: »Gott kann das nicht.«27 Die Gründe dafür, was, warum und wann »Gott nicht kann«, variieren, insbesondere abhängig von der Position des Offenen Theisten bezüglich anderer Lehrfragen. Doch um der Folgerichtigkeit willen (und hier mit Blick auf die allgegenwärtige Gefahr des Anthropomorphismus): Wenn man einen 26 Siehe hier E. F. Tupper, A Scandalous Providence. In einem Interview mit Tripp Fuller am 24. Dezember 2016, Homebrewed Christianity Podcast, behauptete Tupper: »In allen Beziehungen, die ich kenne – zwischen Eltern und Kinder, Ehemännern und Ehefrauen – muss man sich selbst begrenzen, um eine positive Beziehung zum ande ren zu haben und ihn sowohl zu empfangen als auch in ihn zu investieren.« »Wenn ich also von der Selbstbegrenzung Gottes spreche, meine ich, dass Gott einen Raum zwischen sich und den Menschen geschaffen hat, damit wir in dieser persönlichen Beziehung die Bestätigung der Liebe erfahren können...« Tupper, https://trippfuller .com/2016/12/24/a-scandalous-providence-with-e-frank-tupper/. 27 T. Oord Gott kann das nicht! Wie man trotz Tragödien, Missbrauch oder anderem Unheil den Glauben an Gott und Seine Liebe bewahrt.
428
Souveränität des Leids
anderen Menschen liebt, ist das allerletzte, was man tun möchte, sich souverän über ihn zu erheben und zu versuchen, den Geliebten zu kontrollieren. Hier müsste man beginnen, sich zu fragen, was genau »Liebe« ist, die auch das Potenzial birgt, eine »erotische Souveränität« (im Gegensatz zum »agapeischen Dienst«) an den Tag zu legen, die auf solcherart destruktive Weise zu einer derartigen Besessenheit vom »Anderssein« neigen kann, dass erneut Gewalt ausgeübt wird.28 In seiner logischen Schlussfolgerung würde die Verkörperung der Agape durch Gott für den Offenen Theisten jedoch bedeuten, dass Gott ebenfalls keine Kontrolle über die Menschen oder über die gesamte Schöpfung ausübt. Das gilt sogar für diejenigen, die böse und gewalttätige Dinge tun. Wenn Gott ein Individuum davon abhalten würde, eine freie, gewollt böse Tat zu begehen, würde dies dem Wesen Gottes als allumfassend liebendem und eben nicht kontrollsüchtigem Gott grundsätzlich zuwiderlaufen. Obwohl es Gott nicht um Zwang geht29, unterscheidet sich Gott von den Menschen und kann nach wie vor Ver sprechen geben und halten, weil Gott immer noch allmächtig genug ist, um sich nicht durch den freien Willen anderer aufhalten zu lassen. Gott hat immer noch göttliche Macht. Darauf aufbauend stellen Offene Theisten weitere Behauptungen auf: Gott sei ein relationales Wesen, was bedeutet, dass Gott in erster Linie von Menschen affiziert wird (analog dazu, wie Menschen von anderen Menschen affiziert werden). Gott sei ein »Risikoträger« bei bestimmten Handlungen, der auf ein beabsichtigtes Ergebnis »hofft«. Ein wichtiger Aspekt des Offenen Theismus ist daher, dass Gott erfahrbar ist: dass Gott leidet, dass er zugänglich ist, oder »bezogen« durch Liebe. Anstelle von Aristoteles‘ Darstellung der Gottheit als »unbewegter Beweger« ist Gott der bewegteste Beweger30, der auch affektive Veränderungen in Bezug auf andere Personen erfährt. Für diese Denker ist es nicht möglich, sich Liebe und Leid getrennt voneinander vorzustellen (Moltmann).31 Diese Passivität (dass Gott leidet) steht im Widerspruch zur klassischen »Vorsehungs«-Ansicht (die besonders in reformierten Gemeinschaften verbreitet ist), die Vgl. W. Desmond, Ethics and the Between, S. 307, 311. Vgl. C. Pinnock, Most Moved Mover. 30 Pinnock, Most moved mover. 31 Für Moltmann gilt: »Wäre Gott in jeder Hinsicht unfähig zu leiden, also in einem absoluten Sinn, dann wäre er auch unfähig zu lieben.« J. Moltmann, The Crucified God, S. 230. 28
29
429
Jason W. Alvis
in letzter Konsequenz darauf hinauslaufen könnte, dass Gott zum unnachgiebigen Despoten oder souveränen Tyrannen wird. Tyrannen sind sicherlich nicht dafür bekannt, dass sie mit ihren Untertanen und den Bewohnern ihrer Reiche mitleiden. Die hellenistischen Götter galten im Allgemeinen als gleichgültig gegenüber den Gefühlen ihrer Anbeter, und auch die christliche Theologie hat sich viel zu lange auf dieses treibende Prinzip einer fernen, providentiellen Allmacht gestützt. Anders gedacht und angesichts der Realität des Leids sollte Gottes Fähigkeit, sich selbst zu begrenzen, vielmehr als höchster Ausdruck seiner Souveränität betrachtet werden. Diese Art »weiche« Allmacht und Souveränität oder »göttliche Verdichtung« der Beziehung Gottes zu den Menschen ist eine, die auf der freiwilligen Entscheidung beruht, zum Wohl der anderen zu leiden. Diese Passivität hat also weitreichende Konsequenzen: Die traditionelle Vorstellung von der »Unwandelbarkeit« Gottes muss ebenfalls überdacht werden, denn wenn Gott sich nicht bis zu einem gewissen Grad verändert oder verwandelt, dann ist er nicht leidensfähig. (Die Prozesstheologie treibt dies mit ihrem »zweipoli gen Theismus« auf die Spitze: Gott habe eine sich ständig verändernde Natur.) Die Überbetonung der Allmacht, oder anders ausgedrückt, die besondere Betonung der Unwandelbarkeit, lässt eine grundlegende Anerkennung der Tatsache missen, dass Gottes Macht in zeitlichen Situationen begrenzt ist (die meisten würden zum Beispiel nicht akzeptieren, dass Gott »die Vergangenheit« ändern könnte).32
Allwissenheit und Wissen Wichtig ist, dass der Offene Theismus (auch bekannt als »Theis mus des freien Willens«) auch eine Antwort auf theologische und philosophische Determinismen darstellt und sich somit nicht nur mit Allmacht, sondern auch mit Allwissenheit befasst. In der Tat bezieht sich das »Offene« im Offenen Theismus nicht auf Gott, sondern auf Gottes Beziehung zur Zeit, insbesondere zur Zukunft. Diese »Offenheit« der Zukunft impliziert, »dass die empirische und nicht-empirische Wirklichkeit im fundamentalsten Sinne zeitlich ist Vgl. G. Boyd, God of the Possible und »The Open Theism View,” J. S. Feinberg, Deceived by God.
32
430
Souveränität des Leids
und sowohl unsere als auch Gottes Zukunft nicht existiert«.33 Obwohl sie in engem Austausch mit analytischen Freiheitsphilosophen steht, ist die Sorge vielleicht eher theologischer als philosophischer Natur, wobei die Sorge um ein absolutes göttliches Vorherwissen (das wie derum in »calvinistischen«, reformierten Kreisen vorherrscht) als Konsequenz die absolute Unfreiheit des Menschen zum Handeln nach sich zieht. Die Schattenseite eines solchen allumfassenden Wissens (abgesehen von den vollendeten Tatsachen des göttlichen Wissens, die menschliche Entscheidungen scheinbar irrelevant machen) lässt es als eine Art »Panoptikum« der Überwachung erscheinen, aus dem die meisten schließen würden, dass es nicht so liebevoll ist, wie andere es uns weismachen wollen. Im Offenen Theismus schränkt Gott also seine Allwissenheit ein, die es ihm erlaubt, die Zukunft und die Folgen bestimmter Handlungen zu sehen, wenn er mit den Menschen interagiert, sodass Gott nicht um die Folgen aller menschlichen Handlungen »weiß« (Gott kann überrascht werden und muss Risiken eingehen, sogar bei seinen eigenen Handlungen). Dieses begrenzte Wissen hat sowohl positive als auch negative Folgen: Die Menschen können frei handeln, ohne befürchten zu müssen, dass Gott eine andere Handlung für sie vorgesehen hat, doch tragen die Menschen nun die volle Verant wortung, da kein Gott einschreitet, um sie vor Leid und Gewalt auf dieser Erde zu bewahren. Unsere gemeinsame menschliche Zukunft hängt von unserem gemeinsamen, menschlichen Handeln ab. Gottes Wissen erlaubt es ihm, alle möglichen Ergebnisse von Handlungen zu kennen, sie durch verschiedene Szenarien durchzuarbeiten und sie wahrscheinlich sogar logisch nach der geringsten und größten Wahrscheinlichkeit zu ordnen. Für den Offenen Theisten bleibt Gott immer noch die kenntnisreichste und logischste aller möglichen Perso nen. Auch wenn Gott weiß, was eintreten kann und was nicht, ist die Zukunft keine »feststehende Realität«. Wäre dies der Fall, würde Gott wieder zum willkürlichen Despoten, der bereit ist, entweder das Leid der Menschen für Gottes Zwecke zu nutzen oder dessen gewaltsame Präsenz zu übersehen. Obwohl der Offene Theist also immer noch der Meinung ist, dass Gott »vorsehend« bleibt, weil er die unendliche Intelligenz besitzt, alle möglichen Ergebnisse im Voraus durchzuarbeiten, und immer auf alles vorbereitet ist, was eintreten könnte, und dem Menschen einen freien Willen zugesteht, 33
J. Grössl »Offener Theismus«, S. 272.
431
Jason W. Alvis
trägt die Vorstellung, dass Gott passiv und risikofreudig ist, dazu bei, die Gerechtigkeit der Gegenwart zu gewährleisten, anstatt der Zukunft Priorität einzuräumen. Obwohl sie auch theologisch relevant ist, geht es bei dieser Position zum freien Willen und zur Souveränität Gottes um die philosophische Frage nach der Möglichkeit und Plausibilität des freien Willens des Menschen. Ob man sich entscheidet, sich einer souverä nen Macht zu unterwerfen oder eine Gewalttat zu begehen und andere leiden zu lassen, ist etwas anderes als die Frage, ob solche Entschei dungen überhaupt möglich sind. Eine beliebte zeitgenössische Form der Lösung des Problems des freien Willens34 in Bezug auf die göttli che Allwissenheit ist eine modifizierte Form des »mittleren Wissens«, auch bekannt als Molinismus (da seine erste, rudimentärste Version von Luis de Molina entwickelt wurde). Wenn Gott die volle Kontrolle hat, dann hat er die Zukunft vorherbestimmt, und das wirft ernste Probleme für den freien Willen auf. Die Lösung, die dieser modifi zierte Molinismus vorschlägt, besteht darin, dass Gott nicht nur weiß, was jeder freie Akteur tun wird, sondern auch, was ein freier Akteur in jeder unbegrenzt vorstellbaren Situation, die Gott für ihn schaffen könnte, tun würde. Diese These des mittleren Wissens erlaubt es den Molinisten, zu behaupten, dass Gott die bestmöglichen Umstände für diese Person geschaffen hat, um ein Maximum an Freiheit und Güte und ein Minimum an Leid und Übel zu ermöglichen. Sie dient dazu, die Bedenken des Determinismus zu entkräften und gleichzeitig an der göttlichen Vorsehung, Herrschaft und Souveränität festzuhalten, weil Gott qua mittleres Wissen nicht für den Handelnden entscheidet, obwohl er weiß, was geschehen könnte oder höchstwahrscheinlich geschehen wird. Mit dem göttlichen Vorherwissen handelt Gott in der Gegenwart so, dass der Zugang zu einer möglichen Freiheit in der Zukunft ermöglicht wird. Die Sichtweise des Offenen Theisten ist zwar ähnlich, aber insofern etwas anders, als sie davon ausgeht, dass Gottes Wissen um die Möglichkeit nicht notwendigerweise Gottes Wissen um die Wirklichkeit zukünftiger Ereignisse mit sich bringt. Während der Molinist sich darauf konzentriert, was Gott tun oder nicht tun würde, geht es dem Offenen Theisten bei seinem Verständnis von Gottes Wissen darum, was der Fall sein oder nicht sein könnte. Manche 34
A. Plantinga, God, Freedom, and Evil.
432
Souveränität des Leids
»könnte«- und »könnte nicht«-Sätze sind wahr.35 Der Offene Theist würde wahrscheinlich zustimmen, dass Gott unter allen Umständen die Wahrheit bzw. Falschheit jeder »bedeutungsvollen Aussage« kennt, aber wenn Gott sich selbst vollkommene Allwissenheit und vollständiges Wissen über die Zukunft zugestünde, schlösse dies die menschliche Freiheit notwendigerweise aus. Kurz gesagt, gemäß dem Offenen Theisten kennt Gott die Zukunft nicht vollständig und sein Wissen über die Zukunft hängt von den Entscheidungen ab, die die Menschen treffen. Selbst wenn Gott zeitlich ungebunden ist und sich mühelos zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bewegen kann, bedeutet dies nicht, dass Gott dies auch in seinen Beziehungen zu den Menschen und zur Erde will. Es ist daher wahrscheinlicher, dass Gott seine Zeiterfahrungen synchron und diachron in einer Weise begrenzt, die sie jener der Men schen nicht ganz unähnlich macht. Dies geschieht in dem Bemühen, den freien Willen des Menschen sowohl im negativen (Freiheit von) als auch im positiven Sinne (Freiheit zu) zu gewährleisten.36
Offener Theismus and Prozesstheologie Einen anderen Blickwinkel, unter dem wir den Offenen Theismus verstehen können, gewährt uns seine Gegenüberstellung mit der Prozesstheologie, einer Erbin der Whitehead’schen Prozessphiloso phie. Als eine Bewegung, die aus den Wurzeln des amerikanischen Evangelikalismus und der analytischen Philosophie erwachsen ist, unterscheidet sie sich von der Prozesstheologie dadurch, dass der Offene Theismus versucht, so orthodox wie möglich zu bleiben und sich an die christlichen Traditionen der übernatürlichen Wunder, der Schöpfung ex nihilo und eine Version der göttlichen Macht zu halten, die den systematischen Lehren der Heiligen Schrift nicht widerspricht. Im Unterschied zur Prozesstheologie gibt es im Offenen Theismus Vgl. G. Boyd, »Neo-Molinism and the Infinite Intelligence of God«. Laut dem verstorbenen Clark Pinnock gilt: »Was ich ›echte Freiheit‹ nenne, wird auch libertarische oder kontra-kausale Freiheit genannt. Eine Handlung wir dann als frei erachtet, wenn eine Person frei dazu ist, eine Handlung zu vollziehen oder zu unterlassen. Sie ist nicht vollständig durch frühere Einflüsse – Natur, Erziehung, Gott – determiniert. Libertarische Freiheit erkennt die Macht der entgegengesetzten Wahl an. Man handelt in einer Situation frei, wenn – und nur wenn – man anders hätte handeln können.« C. Pinnock, Most Moved Mover; Übersetzung von J. Grössl, 2019. 35
36
433
Jason W. Alvis
einen persönlichen Gott, der sich selbst auf bestimmte Mächte und Formen des zeitlich begrenzten Wissens über die Zukunft beschränkt, um die Zukunft offen zu halten.37 Beide Bewegungen haben jedoch seit ihren Anfängen auf ähnli che Weise versucht, Gott als leidensfähig, von Liebe für und Mitleid mit anderen motiviert darzustellen. Schon bei Whitehead besteht ein Interesse daran, Gott als von der Schöpfung beeinflusst, als einen Teil von ihr und in der Tat begrenzt darzustellen: »Die Liebe Gottes zur Welt [...] ist die besondere Vorsehung für besondere Anlässe [...] Gott ist der große Begleiter – der Leidensgenosse, der versteht.«38 Aufbauend auf Whiteheads Prozessdenken im Allgemeinen und gelegentlichen theologischen Behauptungen im Besonderen bestand die zentrale Motivation dieser Tradition (beginnend mit Charles Hartshorne, weiterentwickelt durch David Ray Griffin und John Cobb) im Wesentlichen darin, dass sie die Realität der menschlichen Evolution ernst nahm. Wenn man akzeptiert, dass das Universum einen langen und brutalen Evolutionsprozess erfahren, der unzählige leidvolle wie gewaltsame Taten mit sich gebracht hat, scheint es unmöglich, zu behaupten, dass Gott souverän ist.39 Da Cobb am heraklitischen Prinzip der Veränderung festhält, gibt es keine kon stante Ousia oder Substanz, da sich alle Dinge in einem zeitlich bedingten »Prozess« befinden, insofern sich Ereignisse verschieben: Gott steht nicht außerhalb dieses Veränderungsprozesses, somit ist Gott auch entsprechend der Entwicklung der Welt veränderlich. Und umgekehrt: Gott hilft der Welt, sich zu entwickeln, und er tut dies
Vgl. D. R. Griffin, Searching for an Adequate God. »Die Liebe Gottes zur Welt stellt sich als besondere Vorsehung für besondere Anlässe dar. Was in der Welt geschieht, verwandelt sich in eine himmlische Wirk lichkeit, und die himmlische Wirklichkeit geht in die Welt zurück. Aufgrund dieser wechselseitigen Beziehung geht die Liebe in der Welt in die Liebe im Himmel über und strömt wieder zurück in die Welt. In diesem Sinne ist Gott der große Begleiter – der Leidensgenosse, der versteht.« A. N. Whitehead, Process and Reality, S. 345 Die Prozesstheologin Marjorie Hewitt Suchocki drückt sich in Bezug auf die Liebe Gottes folgendermaßen aus: »Ganz gleich, welchen Text des Evangeliums wir heran ziehen, um das Leben Jesu zu betrachten, wir werden mit einem Menschen konfron tiert, der konsequent die Liebe manifestiert, zu der er andere aufruft.« M. H. Suchocki, God-Christ-Church, S. 101. 39 Vgl. M. Lodahl, »Divine Sovereignty in the Process Theological Tradition«, S. 77. 37
38
434
Souveränität des Leids
mit Überzeugung statt mit Zwang.40 Diese göttliche Überzeugung hilft uns dabei, »die Vorstellung zu verstehen, dass die göttliche Vorsehung an der Entwicklung unserer Welt beteiligt war«.41 Ähnlich wie der Offene Theismus geht die Prozesstheologie daher davon aus, dass »Gott in jedem Augenblick mit und an der Welt arbeitet, die [Gott] in diesem Augenblick gegeben ist.«42 Wie der Offene Theismus vertritt auch die Prozesstheologie die Auffassung, dass die zentrale Erfahrung des Christentums in der besonderen Verschmelzung von Transzendenz und Immanenz in der Inkarnation liegt, in der ein göttlicher Christus die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens und die Tiefen von Tod und Leid erfährt. Doch anders als der Offene Theist, der immer noch versucht, eine abgemilderte Variante der göttlichen Allmacht beizubehalten, gesteht der Prozesstheologe der Macht Gottes Einzigartigkeit gegenüber jener der Menschen zu: [Gott ist die] einzige Kraft am Anfang des Geschehens, die einen Bezug zu allem anderen hat, was das Geschehen vorgibt. Dieser Bezug verleiht ihm eine Vorherrschaft über die anderen, da er eine für das Ereignis notwendige, sonst nirgendwo im Universum vorhandene, richtungsweisende Kraft besitzt. Es handelt sich in der Tat um eine schöpferische Kraft Gottes, die die Bestimmtheit einführt, welche die Grundvoraussetzung für die Wirklichkeit ist. Dies ist die Vorsehung Gottes für die Welt, welche mit der Kreativität Gottes in der Welt gleichzusetzen ist.43
Insgesamt hat die Behauptung des Offenen Theismus, dass Gottes Wissen über die Zukunft begrenzt ist, notwendigerweise nicht nur Bedenken in Bezug auf Gottes Allwissenheit und Allmacht, sondern auch auf seine Souveränität aufgeworfen.44 Doch der Offene The ismus fügt der Frage, wie Gottes Souveränität aussehen könnte, weitere Nuancen hinzu, wenn es ihm gelingt, Gott als verletzlich und jeglicher Form von Kontrollsucht abgeneigt darzustellen. Kontrolle ist sicherlich ein wesentlicher, grundlegender Aspekt menschlicher Gewalt. Ein Gott, der in der Lage ist, die Zukunft zu kontrollieren, Die Prozesstheologie bekräftigt „,einen Gott der Überzeugung und nicht des Zwangs‘, der die Welt beeinflusst, ohne sie zu bestimmen.« I. G. Barbour Religion in an Age of Science, S. 29 und S. 224. 41 Vgl. J. Cobb und D. R. Griffin, Process Theology, S. 18. 42 J. Cobb, God and the World, S. 91f. 43 M. H. Suchocki, The End of Evil, S. 121. 44 Vgl. G. Boyd, God of the Possible. 40
435
Jason W. Alvis
ist ein Despot oder Tyrann und auf keinen Fall ein lobenswerter Souverän. Ein Gott, der ein Ereignis wie den Völkermord in Ruanda vorhergesehen hat, ist vielleicht zu fürchten, aber nicht zu verehren. Diese erhoffte Umwandlung von Gottes Souveränität und Allmacht ergibt sich aus der Darstellung des Apostels Paulus (1. Korinther 1,18–24), wonach der »ultimative« Ausdruck von Gottes »Macht« auf der Erde die Verletzlichkeit Gottes in der Inkarnation und im leidenden Sühnetod Christi ist. Kurz gesagt sollte Gottes Souveränität in der christlichen Tradition so aussehen und damit auch Einfluss darauf haben, wie menschliche politische Autorität zu verstehen ist. Ob eine »weiche« Souveränität oder politische Macht ein Widerspruch in sich ist oder, schlimmer noch, eine neue Form der Kontrolle, muss noch geklärt werden. Hierzu kann eine »Schwache Theologie« einen wichtigen Beitrag leisten.
4. Schwache Theologie Obwohl der Offene Theismus und die Schwache Theologie auf recht unterschiedlichen Einflüssen und Perspektiven beruhen (der Offene Theismus eher auf der anglo-analytischen Philosophie und dem Prozessdenken Whiteheads, die Schwache Theologie eher auf den kontinentalen Philosophien Nietzsches, Heideggers und Derridas), weisen sie doch einige Gemeinsamkeiten bezüglich des Inhalts und der Zielsetzung auf45, insbesondere was die Überwindung des Leids und der Souveränität betrifft. Wie die Prozesstheologie spiegelt auch die Schwache Theologie häufig die Motive der politischen Theologie und der Befreiungstheologie wieder, die versuchen, theologisch auf das politisch verursachte Leid marginalisierter Menschen zu reagie ren. Der Offene Theismus und die Schwache Theologie interessieren sich für eine Christologie der göttlichen Inkarnation, die Gott mit dem Verwundbaren in Verbindung bringt: Wenn Gott nicht verwundbar und leidensfähig ist, ist er dann wirklich allmächtig? Menschliche Ver körperlichung und Vertrauen sind Anlagen, die auf der wesentlichen Dimension der Verwundbarkeit beruhen. Drei Denker, deren Arbei ten die zugrundeliegende Theorie der Schwäche entweder explizit oder implizit untermauert haben, sind Derrida, Caputo und Vattimo. 45
Vgl. Keller & Daniell, Process and Difference.
436
Souveränität des Leids
Derrida und die schwache Kraft Obwohl Derrida nie ausdrücklich einen Bezug zwischen Schwäche und Theologie hergestellt hat, hat der Begriff der »schwachen Kraft« sowohl Caputo als auch Vattimo stark beeinflusst. Derridas Begriff der »schwachen Kraft« ist nicht so sehr eine »Fähigkeit« (denn das würde aus dem Begriff der Kraft/Macht folgen), sondern eine aktive Unfähigkeit oder »Verwundbarkeit, die das Leben bedingungslos offen macht für das, was kommt: es empfängt.«46 Es geht darum, eine Offenheit zu empfangen als Voraussetzung für Veränderung, was die »schwache Kraft« somit besonders relational macht. Sie ist eine Freiheit ohne Macht und um wirksam zu sein, muss sie bedingungslos sein. Eine solche Bedingungslosigkeit darf die Kraft jedoch nicht allmächtig oder souverän machen, sondern muss einen gewissen »unbedingten Verzicht auf die Souveränität« widerspiegeln.47 Wichtig ist, dass sie nicht so sehr das Gegenteil von Macht ist und sich als Kraft gegen die Macht darstellt. Vielmehr wird sie durch ihren Mangel qualifiziert. Dies wird deutlich, wenn Derrida über eines der einzigen Konzepte spricht, das er als »undekonstruierbar« bezeichnet, die Gerechtigkeit: »Es ist der Schwache, nicht der Starke, der der Dialektik trotzt. Das Recht ist dialektisch, die Gerechtigkeit ist nicht dialektisch, die Gerechtigkeit ist schwach [...]«.48 Sicherlich würden Derrida-Forscher schnell darauf hinweisen, dass die »schwache Kraft« kein zentraler Begriff in seinem philo sophischen Instrumentarium darstellt. Dennoch spielt sie für ihn eine wichtige Rolle, da sie die »Potenzialität« ermöglicht. Hier trifft die Potenzialität auf atemporale Weise auf eine relationale Verletz lichkeit, als »einzigartige Ankunft des anderen und folglich eine schwache Kraft. Diese verletzliche, kraftlose Kraft setzt sich dem Kom menden, der/das sie affiziert, bedingungslos aus.«49 Der besondere Widerstand, den die schwache Kraft darstellt, besteht darin, dass sie die Souveränität auf subtile Weise missachtet. Derrida behauptete vielleicht zur Verwirrung einiger seiner Kollegen und Kolleginnen, die andere politische Perspektiven vertraten, dass es nicht die Hege monien der Macht sind, sondern »die Schwachen, die sich am Ende 46 47 48 49
L. Lawlor, This Is Not Sufficient, S. 8. J. Derrida, Schurken, S. 12. J. Derrida und M. Ferraris, A Taste for the Secret, S. 33. J. Derida, Schurken, S. 12.
437
Jason W. Alvis
als die Stärksten erweisen werden und die Zukunft repräsentieren. Auch wenn ich kein Aktivist dieser Bewegungen bin, setze ich auf die schwache Kraft dieser globalisierungskritischen Bewegungen [...]«50 Doch wenn die schwache Kraft, die diese Bewegungen durchdringt, wirksam wird oder über ihr bloßes Potenzial hinausgeht, ist sie nicht weiter schwach.51 Die »größte Kraft ist im unendlichen Verzicht auf die Kraft zu sehen, in der absoluten Unterbrechung der Kraft durch die Kraftlosigkeit«.52 Schwäche ist nicht dialektisch und daher nicht notwendigerweise der Stärke oder Kraft entgegengesetzt, sondern findet sich in ebenjener Beschaffenheit einer jeden Kraft und der ihr entgegenwirkenden Gegenkraft.
Caputo und die Schwache Theologie Theologisch Interessierte werden schnell feststellen, dass Christus ein Beispiel für eine solche schwache politische Kraft war. Hier setzt John Caputo mit seiner Entwicklung der schwachen Theologie an, die Derridas schwache Kraft, Vattimos Hermeneutik und die Behauptung des heiligen Paulus im ersten Brief an die Korinther zusammenführt. Paulus beschreibt das Kreuz Christi als eine Torheit, denn es bedeutet, dass die Kraft in der Schwäche liegt.53 Dieser Aufruf beinhaltete eine Umkehrung des imperialen Verständnisses von Macht als politischer Vollstreckbarkeit, die aus einer autonomen Form hervorgeht, die ihren Ursprung in der Herrschaft der Starken und Standfesten über die Schwachen hat. Was das Christentum einführt, ist eine Univer salisierung der metanoia (die üblicherweise mit »Reue« übersetzt wird, sich aber auch auf einen »Sinneswandel« beziehen kann). Für Caputo ist metanoia sowohl politisch als auch theologisch. Sie hilft, »die Verengungen des Gesetzes aufzuheben und ... vom anderen belagert zu werden«, denn ihre Tätigkeit strukturiert, »wie man von einer schwachen Kraft berührt wird« und »für die Verletzlichkeit des anderen so empfindlich wird, dass man bei seiner Schwäche J. Derrida, zitiert in J. K.A Smith’s Jacques Derrida: Live Theory, S. 114. Es ist »ein Mögliches, das nur unter der Bedingung, als Mögliches möglich zu bleiben und sich selbst zu bezeichnen, potenzielles Sein ist« – J. Derrida, »By Force of Mourning«, S. 175. 52 J. Derrida, »By Force of Mourning«, S. 176. 53 Vgl. Stofanik, The Adventure of Weak Theology. 50 51
438
Souveränität des Leids
schwach wird, von seinen Wunden verwundet wird, von seinem Leid betroffen wird«.54 Insofern es sich um eine Theologie handelt, bezeichnet Caputo dies alternativ als »Gott ohne Religion« – ein »schwacher« Gott, der aus einer »Unbedingtheit ohne Zwang« oder Souveränität heraus handelt. In der Theologie geht es um eine Hermeneutik des »Ereig nisses«. Wie Caputo kürzlich zum Ausdruck brachte, ist sein Ver ständnis von Schwacher Theologie jedoch nicht einfach eine klug konzipierte Umkehrung der Norm, die Macht der Schwäche vorzieht. Die »schwierige Herrlichkeit« des Kreuzes Christi verweist auf eine Schwache Theologie, die sicherlich nicht auf eine einfache »Strategie, die wir den Starken überstülpen, um sie zu überrumpeln; eine Öko nomie, eine gute Investition mit langfristigem Gewinn; oder einen Doketismus, der das Leid und die Schwäche zu einem bloßen Schein macht, hinter dem die eigentliche Tätigkeit und Macht lauern«55, reduziert werden kann. Die häufige Verbindung von Macht (dynamis) und Schwäche (asthenia) durch Paulus weist darauf hin, dass beide in einzigartiger Weise für die Beziehung zwischen Mensch und Gott konstitutiv sind (Röm 8,17–27; 2 Kor 12,9). Gottes Macht (die sich für Paulus z. B. in der Auferstehung zeigt) und Gottes verletzliches Leid (Phil 3,9–10) weisen darauf hin, dass der Mensch einem solchen Gott auf eine Weise nacheifern soll, dass Leid göttlich und Schwäche himmlisch wird. Während die Kraft in der Regel als »Geist« Gottes dynamischer Präsenz bezeichnet wird (z. B. Gal 3,2–5, Röm 15,19, 12,6), wird die Schwäche als ein Weg bezeichnet, sich durch die Schwäche der Interrelationalität des Geistes interpersonell auf das Leid anderer einzulassen, was zu einer heteronomen Individuation durch Gemeinschaft führt (I Kor 4,7). Obwohl der Geist (pneuma) an einigen Stellen sogar ausdrücklich mit der Kraft (dynamis) verbunden und austauschbar ist (I Kor 2,4, Röm 1,4, II Tim 1,7), erschöpft sich die Kraft nicht in der Gesamtheit der paulinischen Hinweise auf den Geist. Das heißt, der Geist führt auch zu einer Dynamik der Schwäche und des verletzlichen Leids. Caputo macht sich diese Ambivalenz und Spannung zwischen Macht und Schwäche zunutze. Wie bereits 2006 zum Ausdruck gebracht, äußert Caputo bei der Lektüre von Paulus (vor allem in I 54 55
J. Caputo, The Weakness of God, S. 143. J. Caputo, Cross and Cosmos, S. 4.
439
Jason W. Alvis
Korinther 1,18–3156) die Sorge, dass die Darstellung des Lebens und des Todes Christi zu oft in Begriffen der Macht gefasst wird: Einerseits ist es der Ort der göttlichsten Abhandlungen über die Schwä che Gottes, andererseits ist es zu sehr in die Macht verliebt, verkauft seinen Körper ständig an die Interessen der Macht, setzt sich ständig mit der Macht an einen Tisch in einem entmutigenden Widerspruch zu seiner eigenen guten Nachricht. Je mehr es von Schwäche spricht, desto mehr können wir sicher sein, dass es die Macht im Ärmel hat.57
Wie Caputo abschließend feststellt, gibt es keine solche göttliche Despotie, weil es keinen Gott mit einer solchen Macht gibt. Da Gott in dem Sinne »schwach« ist, dass er nicht die Taktik von Despoten und machtgierigen Herrschern anwendet, ist es denkbar, dass Jesus verkündet, dass die Sanftmütigen und Schwachen »das Erdreich erer ben werden«. (Matthäus 5,5). Diese Stelle wird gewöhnlich als rein deskriptiv interpretiert. Für Caputo hat sie aber auch einen präskrip tiven Charakter: Wir sollen schwach werden wie ein Gott, der leidet, und den Wunsch aufgeben, Macht über andere auszuüben. Wenn es tatsächlich die Schwachen sind, die das Reich Gottes erben, würde dies dann nicht auch bedeuten, dass Gott als der paradoxe König – oder zumindest als der Begründer – dieses Reiches bis zu einem gewissen Grad ebenfalls »schwach« ist?
Vattimo und »Weak Thought« Vattimos »Weak Thought« (»schwaches Denken«) verfolgt einen etwas anderen Ansatz als der Caputos. Er versucht vielmehr, die eher gesellschaftlichen, symbolischen und intrinsischen Verbindungen I Korinther 1,25–31: »[…] Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. 26 Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. 27 Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschanden mache; und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschanden mache, was stark ist; 28 und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichtemache, was etwas ist, 29 auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. 30 Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, 31 auf dass gilt, wie geschrieben steht: ,Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn!‘“. 57 J. Caputo, The Weakness of God, S. 8. 56
440
Souveränität des Leids
zwischen Gewalt und Metaphysik aufzudecken, indem er Heideggers Ausführungen folgt, denen zufolge das scheinbar unschuldige Ziel der klassischen Metaphysik, die »Natur der Wirklichkeit« darzustel len, in Wirklichkeit eine Subjekt-Objekt-Spaltung beinhaltet, die eine Grundlage oder Rechtfertigung für gewaltsame Handlungen und Institutionen schafft. Heideggers Verständnis des Seins ist eine nicht-strukturalistische »schwache Ontologie«, die uns eine andere Art von Hermeneutik liefert. Diese Hermeneutik ist »schwach« in dem Sinne, dass sie nicht mit einer Machtdemonstration beginnt, im Zuge derer sie mittels einer Art imperialistischer Epistemologie (oder eines epistemischen Imperialismus) feste und unbewegliche Denk- und Lebensstrukturen entlarvt. Stattdessen operiert sie auf der Grundlage einer ständigen Interpretation neuer Interpretationen, die auch dazu führt, dass man »schwach«, verletzlich und offen für den anderen wird; kurz gesagt, sie ist kenotisch: An die Stelle der Metaphysik der Gegenwart setzt die hermeneutische Ontologie eine ,Auffassung‘ des Seins, von der diese Konnotation der Auflösung einen wesentlichen Teil darstellt; das Sein, das sich nicht ein für allemal in der Gegenwart ereignet, sondern als Verkündung geschieht und in den Interpretationen wächst, die es hören und darauf antworten, ist auch ein Sein, das auf die Spiritualisierung, auf die Entlastung oder, was dasselbe ist, auf die kénosis ausgerichtet ist.58
Was Derrida als »Metaphysik der Präsenz« bezeichnete, ist von Heraklit und Heidegger inspiriert und war als Pejorativum zu jenen philosophischen Ansätzen gemeint, die »Präsenz« als eine stabile, feste Entität voraussetzen, die Wahrheit ermöglicht, aber naiverweise Zeit und Veränderung nicht berücksichtigen. Vattimo knüpft an diese Kritik an, indem er eine »kenotische« Wahrheit anstrebt, die nicht mit »Universalität« (wie in der alten Metaphysik) beginnt, sondern mit Gastfreundschaft, mit dem Versuch, anderen zuzuhören und sich nicht durch den eigenen »positive Inhalte auf dem Gebiet des Glaubens« zu definieren.59 Dies ist ebenfalls höchst theologisch. Diese »Schwächung des Seins«, die zuerst von Heidegger in der Einführung in die Metaphy sik initiiert wurde, deutet auch darauf hin, wie das Christentum Christus fälschlicherweise mit dem hellenistischen und griechischen 58 59
G. Vattimo, Jenseits des Christentums, S. 97. Vgl. G. Vattimo Jenseits des Christentums, S. 183.
441
Jason W. Alvis
Verständnis von Logos, einem unveränderlichen Wort, identifiziert hat (man erinnere sich hier an Pinnocks an den Offenen Theismus anschließende Aussage). Diese falsche Identifizierung wurde benutzt und missbraucht, um schreckliche Übel und die Unterwerfung unter launische Despoten zu rechtfertigen. Wenn das Christentum tatsäch lich eine einzigartige und ursprüngliche Wahrheit darstellt, die sich von der Weisheit des gesunden Menschenverstandes unserer griechi schen und jüdischen Vorgänger und Traditionen unterscheidet, dann beginnt es für Vattimo mit einer Metaphysik der Schwäche, die eine wichtige Rolle bei der subtilen Entlarvung von Gewalt spielt.60 Die Inkarnation Christi hat unsere Auffassung von Macht auf den Kopf gestellt, indem sie die Göttlichkeit in den menschlichen Rahmen von Kontingenz, Verletzlichkeit und Machtlosigkeit gestellt hat. Und für diese Art von Wahrheit ist es unvermeidlich, politisch zu sein; sie hat gesellschaftliche und historische Konsequenzen, die Men schen zum Märtyrertod geführt haben. Die klassische Vorstellung von Allmacht sollte den Christen beleidigen, denn sie setzt autoritative und souveräne politische Mächte in Bewegung, fördert die Unterwer fung unter diese Mächte und stellt ein hellenistisches Denkmodell einer fernen Gottheit auf, das in gewisser Weise in Widerspruch zur christlichen Botschaft steht. Vattimo ist der festen Überzeugung, dass metaphysische Wahrheitsansprüche die Grundlage von Fundamen talismus und religiösen Konflikten sind.61 Fundamentalismus und Gewalt resultieren aus einer falschen Auffassung von Autorität und Allmacht, die das Produkt einer imperialistischen Metaphysik der Präsenz sind. Deshalb strebt Vattimo eine emanzipierte Metaphysik
60 Vattimo lehnt sich stark an Girards Auffassung der Mimesis und seiner Überzeu gung an, dass Christus ein »Detournement« der Gewalt vollzieht: »Girard [hat] mei nes Erachtens in überzeugender Weise gezeigt, dass, wenn es im Christentum eine ,göttliche‘ Wahrheit gibt, diese eben in der Enthüllung der gewalttätigen Mecha nismen liegt, aus denen das Heilige der natürlichen Religiosität, das heißt das für den metaphysischen Gott charakteristische Heilige, hervorgeht.« G. Vattimo, Jenseits des Christentums, S. 58. An anderer Stelle, in Belief, beansprucht Vattimo die schwache Lesart Heideggers und die Idee für sich, dass die Geschichte des Seins als Leitfaden für die Schwächung starker Strukturen [...] nichts anderes als die Transkription der christlichen Lehre von der Inkarnation des Gottessohnes war« (G. Vattimo, Belief, S. 80). 61 Gewalt und Fanatismus können nur vermieden werden, wenn wir uns von der »dogmatischen und tendenziell fundamentalistischen Form« lösen, die das Christen tum »bislang charakterisiert hat« (G. Vattimo, Jenseits des Christentums, S. 141).
442
Souveränität des Leids
an, wobei eine solche Emanzipation seiner Meinung nach durch »schwaches Denken« erreicht werden kann. Eine schwache Theologie bzw. ein schwaches Denken ist jedoch nicht unkritisch. Schwäche oder »Gegenmacht« kann leicht zu einem moralisierenden Hochgefühl werden, das wiederum zu einer weiteren Form der Macht wird. Auch wenn sie dadurch motiviert ist, das Leid insbesondere marginalisierter Menschen unter der Souveränität zu begrenzen, könnte sie auch das Ressentiment der Menschen gegenüber den Mächtigen weiter anheizen, wobei Armut und Schwäche als »Ehrenabzeichen« getragen werden.62 Wenn Paulus im 1. Korinther brief von Schwäche spricht, bezieht sich das auf Verletzlichkeit, doch ist asthenia nicht in jedem Fall etwas, worauf die Theologie stolz sein kann, da es sich auch auf Krankheit, Behinderung, Schüchternheit und Gebrechlichkeit beziehen kann.
Konklusion Ausgehend von den zu Beginn des Aufsatzes dargelegten Vorausset zungen ist jeder Versuch, eine multilaterale und strikte Trennung zwischen dem Heiligen und dem Säkularen zu konzipieren, mit großen Herausforderungen verbunden, und dies bedeutet, dass es immer eine Korrelation zwischen theologischen Lehren und politi scher Herrschaft geben wird; in diesem Fall insbesondere zwischen Allmacht und Souveränität (und Leid). Der politische Versuch, eine strikte Trennung zwischen sakral und säkular vorzunehmen, erfolgte aus dem Interesse heraus, Macht zu etablieren, die Herrschaft zu festigen und die Legitimation der Autorität zu übernehmen. Einige Religionsgemeinschaften haben ihre Macht und Autorität – und damit ihre Ausnahmestellung – auch damit begründet, dass sie »Kontrastgesellschaften« darstellen. Dies scheint im Widerspruch zu den Behauptungen einiger wich tiger Vordenker der theologischen Tradition zu stehen. Das christliche 62 »Dieser Zyklus der Verkündigung von Schwäche kann auch eine Art Ressentiment darstellen, oder etwas, das man als Ehrenabzeichen mit sich herumträgt«, wie Raschke betont: »Nietzsche war in diesem Punkt emphatisch. Die als, Theologie der Schwäche‘ getarnte Gegenmacht ist der Wille zur Macht der Ohnmächtigen, eine moralisierende Ontologie, eine Verrechtlichung Gottes im Namen eines Aufrufs zur, Gerechtigkeit‘, die undurchsichtig genug bleibt, um die Machenschaften derer zu heiligen, die sich ärgern, nicht an der Macht zu sein...« C. Raschke, »The Weakness of God«, S. 2.
443
Jason W. Alvis
Projekt der universalistischen Ausdehnung des Reiches Gottes (d. h. einschließlich, aber zugleich über das ursprüngliche Volk Gottes, Israel, hinaus) sollte ein umfassenderes politisches bzw. menschliches Projekt in Angriff nehmen (Augustinus). Durch die Ausdehnung des Reichs Gottes unterlag die Souveränität einer Art unendlichem Aufschub, und dadurch, dass dieses Projekt nicht umgesetzt wurde, unterwarfen sich die Gemeinschaften dem Willen zur Macht. Die tho mistische Sichtweise, dass die Wahrheit die »Größe« der Souveränität und die Ausnahmestellung des Königtums übersteigt, steht in völliger Übereinstimmung mit der oben erwähnten Korrelation zwischen dem Heiligen und dem Säkularen und trägt dazu bei, zu zeigen, dass mit dieser »Expansion« (im Guten wie im Schlechten) eine Ex-Karnation der Theologie oder zumindest eine Verstärkung des Aufwallens metaphysischer Bekenntnisse einhergeht. Die Despoten erkennen nicht, dass ihre Macht (ob teilbar oder unteilbar und egal, wie »zwingend« sie auch sein mag) eine ex-karnierte, verwandelte Form einer misslungenen Allmacht ist. Es ist schwer vorstellbar, wie es gemäß dem ontologischen Argument Anselms unwahr sein soll, dass »ein Gott per definitionem immer an der Macht ist«63, sodass der Begriff „,allmächtiger Gott‘ praktisch ein redundanter Ausdruck ist«.64 Man könnte sich hier mit Schmitt fragen, ob nicht auch das Gegenteil der Fall ist: dass derjenige, der an der Macht ist, bis zu einem gewissen Grad gottähn liche Eigenschaften angenommen hat. Ohne uns länger bei Schmitt aufzuhalten, ist seine 1921 aufgestellte Behauptung »Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet«65 ebenso philosophisch wie politisch.66 Die Berufung auf Ausnahmen ist ein Versuch, souve räne Macht zum Ausdruck zu bringen, und spielt zwangsläufig eine Rolle hinsichtlich menschlichen Leids. Wenn wir einer Sache, einer Idee oder einer Person potentia dei absoluta oder »heilige« Macht zuschreiben und ihnen die Befugnis geben, das Gesetz (ex lege) oder irgendeine Form von Normalität außer Kraft zu setzen, erhalten sie eine Ausnahmestellung und die Macht, gerade eine neue Normalität, Y. Sherwood, »The Impossibility of Theocracy«, S. 217. J. D. Caputo, The Weakness of God, S. 12. 65 C. Schmitt, Politische Theologie, S. 9. 66 »Der Leitsatz Tertullians ,Wir sind zu etwas verpflichtet, nicht weil es gut ist, son dern weil Gott es befiehlt‘, begleitet Schmitt durch alle Wendungen und Wechselfälle seines langen Lebens.« (R. Yelle, Sovereignty and the Sacred, S. 15). 63
64
444
Souveränität des Leids
ein neues Gesetz oder einen »Notfall« der Differenz im Alltag zu etablieren.67 Wir können auch nicht mehr so naiv sein zu glauben, Gewalt, Übel und Leid seien bloße Ausnahmen von der Norm, denn ihre Ausnahmestellung ist normkonstitutiv. Leid sollte nicht nur als Möglichkeit gedacht werden, sondern als Wirklichkeit und Realität, die in unsere Lebenswelt eingeflochten ist. Und hier kollidieren die Schicksale von Souveränität und Leid: Souveräne schaffen politische Ausnahmen, indem sie sie als Aus nahmen von ihren Normen deklarieren und ihren Untertanen Leid zufügen. Leid schafft ontologische Ausnahmen, indem es neue Regeln aufstellt, unser Leben prägt und uns bestimmte Ängste und Verhaltensweisen diktiert, was häufig zur Einsetzung souveräner Figuren führt. Angesichts der Unausrottbarkeit der Herrensignifikanten und der großen Anderen und unter der Annahme, dass sowohl die Ausnah mestellung als auch der normkonstitutive Charakter des Leids und der Souveränität ständig präsent sind, ergibt sich eine Schwierigkeit: Beide können leicht als bloßes »Mysterium« dargestellt werden, was den negativen Effekt mit sich bringen kann, dass beide fatalistisch verunendlicht werden, was ihren Ausnahmecharakter und ihre Macht, die Norm zu konstituieren, weiter festigt. Der Versuch, das »Leid« durch »Berufung auf das Mysterium« zu umgehen, sei es als Akt der Ehrerbietung gegenüber Gottes steter Übersteigung unseres Wis sens68 oder als irrtümlicher philosophischer, d.h. »pseudo-logischer Fehlschluss«, läuft Gefahr, sowohl theologisch als auch philosophisch verantwortungslos zu sein, weil er nichts daran ändert, wie wir unter der fortdauernden Präsenz sowohl des Leids als auch der Souveränität mit dem Leid umgehen können. Obwohl wir uns auch vor der Annahme am anderen Ende des Spektrums hüten sollten, der zufolge die menschliche Logik zur totalen Emanzipation fähig sei, sollte das Denken an seine Grenzen 67 Doch nicht alle Aufhebungen des Gesetzes sind politisch souverän in dem nega tiven Sinne, den sich manche in der politischen Theologie vorstellen. Einige soziore ligiöse, sogar pazifistische Revolutionen können »souverän« werden und mit einer anderen Art von gesetzeszerstörender Macht operieren. Selbst der »pazifistische« Aufenthalt Christi in der Wüste vor seiner Kreuzigung wurde von einigen als revolu tionärer Bruch mit der Souveränität des jüdischen Zeremonialgesetzes interpretiert. 68 K. Kilby, »Negative Theology and Meaningless Suffering«.
445
Jason W. Alvis
geführt werden, wenn wir versuchen, Antworten auf die Probleme zu finden, die für diese Wechselbeziehung zwischen Souveränität und Leid wesentlich sind. Eines davon ist die Frage nach der menschlichen Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit und Prekarität. Wie analytische Reli gionsphilosophen, die sich mit dem Problem des Bösen befassen, gezeigt haben, beruhen Leid, Gewalt und ‚das Böse darauf, dass die Verletzlichkeit in den Ablauf und die Funktionsweise der Welt selbst eingebaut zu sein scheint. Eine solche gewaltsame und leidens gesättigte Funktionsweise zeigt sich sowohl im brutalen und langen Evolutionsprozess als auch in der gegenwärtigen Fragmentierung, die wir in der globalisierten Spätmoderne beobachten. Der Offene Theismus und die Schwache Theologie bestehen darauf, dass die Vorstellung, Gott sei auch »verletzlich«, dazu beitra gen kann, die Probleme der menschlichen Anfälligkeit für Leid und Souveränität zu lösen. Gott muss verletzlich genug sein, um vom Leid betroffen zu sein, aber auch mächtig genug, um nicht davon überwältigt zu werden und manchmal Dinge zu tun, um das Leid anderer zu begrenzen. Der Ansatz der Schwachen Theologie besteht nicht darin, zu zeigen, dass Gott einfach nur leidensfähig, sondern auch verletzlich und zerbrechlich ist, was bedeutet, dass Gott selbst leidet. Gott darf nicht nur für das Vorhandensein des Bösen, des Leids und der Gewalt verantwortlich sein, sondern muss auch in der Lage sein, darauf zuweilen zu reagieren. Eine solche Antwort, die auf Gottes Leidensfähigkeit aufbaut, ist das Mitleiden (com-passio) oder das Mittragen des Leids anderer. Dies macht den Menschen zwar anfälliger für Leid, trägt aber auch zur Begrenzung des Leids bei. Als Levinas die ihm bekannten Theodizeen verwarf, stieß ihn die Vorrangstellung der Selbsterhaltung ab und er argumentierte stattdessen, dass unsere Beziehung zum Anderen die eigentliche Quelle unserer Fähigkeit zur Veränderung und zum Menschsein ist. Ein ethisches »reflexives Equilibrium«, verletzlich zu sein, ist das, was schwache Theologen metanoia oder die Fähigkeit zu einem Sinneswandel nennen. Wenn Gott nicht verletzlich ist, dann leidet er auch nicht. Wenn Gott nicht leidet, dann fehlt ihm ein Verständnis des Leids, das es ihm erlauben könnte, zu lieben, Mitgefühl zu zeigen oder die Macht zu haben, Gerechtigkeit auszu üben. Wenn Mitgefühl, Verletzlichkeit und Demut nicht zentral für die Göttlichkeit sind, warum sind sie dann Kardinaltugenden, nach denen der Mensch streben sollte?
446
Souveränität des Leids
Der Offene Theismus (der mehr daran interessiert ist, eine Antwort auf das Leid zu finden) und die Schwache Theologie (die mehr darauf ausgerichtet ist, das politische Problem der Souveränität anzugehen) können eingesetzt werden, um auf die einzigartige, mit einander verwobene Außergewöhnlichkeit dieser beiden Probleme zu antworten, indem Verletzlichkeit und Schwäche in den Kern der theo logischen Lehre von der göttlichen Allmacht eingefügt werden. Ob als zerstreuende oder als direktive Macht (Offener Theismus), »dipo larer Theismus« oder »Überzeugung« (Prozesstheologie), »Kenosis«, »Auflösung« oder »Gastfreundschaft« (Schwache Theologie), die Art und Weise, wie wir eine »schwache« oder »offene« Allmacht beschrei ben, wird zwangsläufig in verschiedenen Graden variieren, was dazu führt, dass wir zugeben müssen, dass die Fähigkeit keine unmittelbare Wirklichkeit darstellt, sondern eine Möglichkeit, die immer von einer Unfähigkeit begleitet wird, die den wirksamen Willen und die souve räne »Herrschaft« Gottes begrenzt. Wenn diese beiden Ansätze richtig sind, dann drückt sich die leidende Herrschaft Gottes nicht in einem festen, unbeweglichen Reich aus, sondern eher durch eine unauffällige Kraft, die Strukturen auflösen kann – angefangen bei den eigenen. Gottes Herrschaft wird immer wieder zu ihrer eigenen Ausnahme in einem Ausdruck von Macht, der sich immer wieder neu erfindet und totale Kontrolle verhindert. Um die Ausnahmesituation von Souveränität und Leid wirklich aufzulösen und letztlich Gott nicht nur nicht für beides verantwortlich zu machen, sondern ihn auch nicht auf der dem Mitleid entgegengesetzten Seite stehen zu lassen, ist eine Art positiver, onto logischer Abgleich zwischen Verletzlichkeit und Freiheit notwendig. Kurz gesagt: Ein Verzicht auf Allmacht reicht nicht aus.
Literaturverzeichnis Arnal, W. E., McCutcheon, R. T., The Sacred Is the Profane: the Political Nature of »religion«, New York, Oxford: Oxford University Press 2013 Barbour, I. G., Religion in an Age of Science. San Francisco: harper press 1990 Bauerschmidt, F. C., »Aquinas«, in: W. Cavanaugh, P. Scott (Hg.), The Blackwell Companion to Political Theology, Oxford: Blackwell 2004, S. 48–61 Benavides, G., »Holiness, State of Exception, Agency«, in: B. Luchesi, K. von Stuckrad (Hg.), Religion in Cultural Discourse: Essays in Honor of Hans Kip penberg on the Occasion of His 65th Birthday, Berlin: Walter de Gruyter 2004, S. 61–73
447
Jason W. Alvis
Boyd, G., »Neo-Molinism and the Infinite Intelligence of God«, Philosophy Christi 5/1 (2003) Boyd, G., »The Open Theism View«, in: J. K. Beilby, P. R. Eddy (Hg.), Divine Foreknowledge: Four Views, Downers Grove: InterVarsity Press 2001 Boyd, G., God of the Possible. A Biblical Introduction to the Open View of God, Grand Rapids: Eerdmans 2000 Boyd, G., The Openness of God: A Biblical Challenge to the Traditional Under standing of God, Downers Grove: InterVarsity Press 1994 Brueggemann, W., »Scripture: Old Testament«, in: W. Cavanaugh, P. Scott (Hg.), The Blackwell Companion to Political Theology, Oxford: Blackwell 2004, S. 5–20 Caputo, J. D., The Weakness of God: A Theology of the Event, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press 2006 Caputo, J. D., Cross and Cosmos, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press 2019 Cobb, J., Griffin, D. R., Process Theology: An Introductory Exposition, Philadel phia: Westminister 1976 Cobb, J., God and the World, Philadelphia: Westminister 1969 Derrida, J., »By Force of Mourning«, Critical Inquiry 22:2 (1996), S. 171–192 Derrida, J., Ferraris, M., A Taste for the Secret, übers. v. G. Donis, Malden, MA: Polity 2001 Derrida, J., Schurken. Zwei Essays über die Vernunft. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2006 Desmond, W., Ethics and the Between, New York: SUNY 2001 Elshtain, J. B., »Augustine«, in: W. Cavanaugh, P. Scott (Hg.), The Blackwell Companion to Political Theology, Oxford: Blackwell 2004, S. 35–47 Feinberg, J. S., Deceived by God: a journey through suffering, Wheaton Ill: Crossway Books 1997 Geach, P. T., »Omnipotence«, in: Philosophy of Religion: Selected Readings, Oxford: Oxford University Press 1998, S. 63–75 Griffin, D. R., Searching for an Adequate God: A Dialogue between Process and Free Will Theists, Grand Rapids: Eerdmans 2000 Grössl, J., »Offener Theismus«, in: K. Viertbauer, G. Gasser (Hg.), Handbuch Analytische Religionsphilosophie, Stuttgart: J.B. Metzler 2019, S. 272–282 Halldorf, J., »What makes theological work so significant?«, in: Syndicate online Journal https://syndicate.network/symposia/theology/syndicate-project-o n-the-state-of-theology/ (2020) Hayek, F.A., Law, Legislation and Liberty, Volume 3: The Political Order of a Free People, Chicago: University of Chicago Press 1979 Hick, J., Evil and the God of Love, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2007 Hume, D.: Dialoge über natürliche Religion, übers. v. N. Hoerster, Stuttgart: Reclam 1981 Kahn, P. W., Sacred violence: torture, terror, and sovereignty, Ann Arbor: Univer sity of Michigan Press 2008 Keller, C., Daniell, A., Process and Difference: Between Cosmological and Post structuralist Postmodernisms, New York: SUNY 2002
448
Souveränität des Leids
Kilby, K., »Negative Theology and Meaningless Suffering«, in: Modern Theology 36:1 (2019), S. 92–104 Klein, R., Depotenzierung der Souveranitat: Religion und politische Ideologie bei Claude Lefort, Slavoj Zizek und Karl Barth, Tübingen: Mohr Siebeck 2016 Laclau, E., »Why do empty signifiers matter to politics?«, in: ders. (Hg.), Eman cipations, London: Verso 1996, S. 36–46 Lawlor, L., This Is Not Sufficient: An Essay on Animality and Human Nature in Derrida, New York: Columbia University Press 2007 Levinas, E., »Das sinnlose Leiden«, in: ders., Zwischen uns. Versuche über das Denken an den Anderen, München: Hanser 1991, S. 117–131 Lilla, M., The stillborn God: religion, politics, and the modern West, New York: Vintage Books 2008 Lodahl, M., »Divine Sovereignty in the Process Theological Tradition«, in: D. S. Long, G. Kalantzis (Hg.), The Sovereignty of God Debate, Eugene, OR: Cascade Books 2008, S. 75–96 Long, D. S., Kalantzis, G. (Hg.), The Sovereignty of God debate. Eugene, OR: Cascade Books 2009 Moltmann, J., The Crucified God, London: SCM Press 2015 Oord, T. J., Gott kann das nicht! Wie man trotz Tragödien, Missbrauch oder anderem Unheil den Glauben an Gott und Seine Liebe bewahrt, k.O.: Sacra Sage 2020 Pinnock, C., Most Moved Mover, Carlisle: Paternoster 2001 Plantinga, A., God, Freedom, and Evil, Grand Rapids: Eerdmans 1974 Raschke, C., »The Weakness of God... and of Theological Thought for That Mat ter: Acta est Fabula Plaudite«, in: Journal for Cultural and Religious Theory 8:1 (2006), S. 1–9 Rowe, W. L., Philosophy of religion: an introduction, Encino, CA: Dickenson 1978 Sanders, J., »An Introduction to Open Theism«, in: Reformed Review 60 (2007), S. 34–50 Schellenberg, J. L., »A New Logical Problem of Evil«, in: J. P. McBrayer (Hg.), The Blackwell companion to the problem of evil, Oxford: Blackwell 2013, S. 34– 48. Schmitt, C., Politische Theologie – Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, Berlin: Duncker & Humblot 1922 Schmitt, C., Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder politi schen Theologie, Berlin: Duncker & Humblot 1984 Sherwood, Y., »The Impossibility of Theocracy: The Weakness of the Gods«, in: D. E. Tabachnick,T., Koivukoski, H., Meireles Teixeira (Hg.), Challenging Theocracy: Ancient Lessons for Global Politics, Toronto: University of Toronto Press 2018 Smith, J. K. A., Jacques Derrida: Live Theory, New York: Continuum 2005 Staudigl, M., Phänomenologie der Gewalt, Cham: Springer 2015 Stofanik, S., The Adventure of Weak Theology: Reading the Work of John D. Caputo Through Biographies and Events, New York: SUNY 2018 Suchocki, M. H., God-Christ-Church: A proactical Guide to Process theology, New York: Crossroad 1984
449
Jason W. Alvis
Suchocki, M. H., The End of Evil: Process Eschatology in Historical Context, Albany: State University of New York Press 1988 Swinburne, R., Providence and the Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press 1998 Tuggy, D., »Three Roads to Open Theism«, in: Faith and Philosophy 24 (2007), S. 28–51 Tupper, E. F., A Scandalous Providence: The Jesus Story of the Compassion of God, Macon, Georgia: Mercer University Press 2013 Tupper, E. F., Fuller, T., Interview, 24 December 2016, Homebrewed Christianity Podcast, https://trippfuller.com/2016/12/24/a-scandalous-providence-wit h-e-frank-tupper/ (2016) van Inwagen, P., The Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press 2008, S. 123–126 Vattimo, G., Jenseits des Christentums. Aus dem Italienischen von Martin Pfeiffer, München: Carl Hanser 2002 Vattimo. G., Belief, übers. v. L. D’Isanto, D. Webb, Stanford: Stanford University Press 1996 Whitehead, A. N., Process and Reality. Process and reality: an essay in cosmology, New York: Free Press 1985 Yelle, R., Sovereignty and the Sacred, Chicago: University of Chicago Press 2019 Žižek, S., Milbank, J., The monstrosity of Christ: paradox or dialectic?, hg. v. C. Davis, Cambridge MA: MIT Press 2011
450
E. Systematische Überlegungen zu Religion bzw. Religionsbegriff
Joachim Bromand
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie Negative Theologie, Robert Holcot, Nikolaus von Kues, Descartes und die neuere Entwicklung1
1. Einleitung: Widersprüche in der Theologie Bereits der antiken Auseinandersetzung mit theologischen Fragen stellt sich das Problem, dass einige theistische Überzeugungen zumin dest dem ersten Anschein nach in Widerspruch zueinander oder zu empirischen Tatsachen zu stehen scheinen. Ein berühmtes Beispiel bildet ein von Lactanz Epikur zugeschriebenes Fragment, in dem das später so genannte logische Problem des Übels skizziert wird, das in der Frage besteht, ob und gegebenenfalls wie die zahllosen natürlichen und moralischen Übel und das sinnlose Leid in der Welt zu vereinbaren sind mit einem oder mehreren allwissenden, allgütigen und allmächtigen Göttern, die um unser Leid wissen, dieses nicht wollen und ohne Weiteres verhindern könnten.2 Während der Autor des Fragments den sich abzeichnenden Widerspruch wohl dahingehend auflösen wollte, dass er in Zweifel zog, dass sich die Götter für menschliche Belange interessieren, lässt sich die scheinbare Paradoxie in religiösen Kontexten, in denen die göttliche Anteilnahme Für ausführliche Hinweise zu einer früheren Fassung des Textes danke ich Guido Kreis. 2 Epikur, Fragment 374 (überliefert bei Lactanz, De ira dei 13, 19–22): »Entweder will Gott die Übel beseitigen und er vermag es nicht, oder aber er kann es und will es nicht, oder aber er will es weder noch kann er es. Falls er es will und nicht kann, ist er ohn mächtig, was auf Gott nicht zutrifft. Falls er es kann und doch nicht will, ist er miss günstig, was Gott genauso fremd ist. Falls er es weder will noch kann, so ist er sowohl missgünstig als auch ohnmächtig und daher auch nicht Gott. Falls er es will und auch kann, was allein zu Gott passt, woher kommen dann die Übel? Und warum beseitigt er sie dann nicht?« Zit. n. H. Usener (Hg.), Epicurea, S. 252f. 1
453
Joachim Bromand
am Geschick der Menschen nicht zur Disposition steht, weniger leicht lösen. Hume greift den Gedankengang in seinen Dialogen über die natürliche Religion daher sogar im Sinne eines Arguments für den Atheismus auf und Leibnizʼ Theodizee stellt einen Versuch dar, es zu überwinden. John Mackie behauptete dann im Jahre 1955 explizit die logische Widersprüchlichkeit der im Fragment involvierten Thesen.3 Auch andere theologische Widersprüche scheinen sich aus den Eigenschaften zu ergeben, die zur Charakterisierung Gottes herange zogen werden – sowohl wenn man die Eigenschaften einzeln betrach tet als auch in verschiedenen Kombinationen. Einzeln betrachtet bereiten insbesondere die Allmacht (Omnipotenz) und die Allwis senheit (Omniszienz) Schwierigkeiten. Entsprechende theologische Widersprüche werden auch als ›Omni-Paradoxien‹ bezeichnet. Bei Descartes, der die Allmacht Gottes in einem sehr weitgehenden Sinne versteht, wird die Problematik besonders deutlich. So legt Descartes nahe, die Allmacht Gottes schließe auch die Möglichkeit ein, logisch Unmögliches zu tun (was nicht vereinbar mit Prinzipien der modernen Modallogik ist). Kann ein allmächtiges Wesen sogar einen ›überschweren‹ Stein schaffen, der so schwer ist, dass es selbst ihn nicht heben kann? Lautet die Antwort »ja«, scheint sich ein Widerspruch zur Allmacht zu ergeben, da das Wesen den Stein nicht heben kann. Lautet die Antwort hingegen »nein«, scheint sich wiede rum ein Widerspruch zur Allmacht zu ergeben, da das Wesen den Stein nicht schaffen kann (eine Aufgabe, die Menschen im Übrigen ohne Weiteres lösen können). Harry G. Frankfurt hat zur Lösung dieser Problematik vorgeschlagen, Gott nicht nur wie Descartes die Fähigkeit zuzusprechen, Widersprüchliches zu tun, sondern auch von ihm selbst widersprüchliche Eigenschaften auszusagen (dass er etwa mit Situationen umgehen könne – wie dem Heben des überschweren Steins –, mit denen er nicht umgehen kann).4 Patrick Grim weist zudem auf ähnliche Omni-Paradoxien hin, die nicht aus dem Begriff der Allmacht, sondern aus dem des Allwissens resultieren.5 Eine weitere, spezifisch christliche Quelle von theologischen Widersprüchen stellt die Trinitätslehre dar, der zufolge Gott in Form von drei göttlichen Personen existiert (dem Vater, dem Sohn und dem heiligen Geist). Wird darüber hinaus noch die Identität der drei 3 4 5
J. L. Mackie, »Evil and Omnipotence«, S. 200. Vgl. H. G. Frankfurt, »The Logic of Omnipotence«, S. 263. Vgl. P. Grim, The Incomplete Universe, Kap. 2 & 4.
454
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Personen behauptet und sollen diesen unterschiedliche Eigenschaften zugesprochen werden (der heilige Geist wurde im Gegensatz zu Christus etwa nicht gekreuzigt), droht ein Widerspruch aufgrund des Prinzips von der Ununterscheidbarkeit von Identischem zu resultie ren. Versuchen, die vermeintlichen Widersprüche unter Beibehal tung der klassischen Logik aufzulösen, bleibt dabei kaum eine Wahl, als eine oder mehrere der zugrundeliegenden Prämissen (wie die Allmacht oder Allwissenheit Gottes) abzuschwächen oder gänzlich aufzugeben. Bereits seit dem Mittelalter zeichnet sich jedoch als Alter native zu dieser Vorgehensweise ab, nicht eine der den Paradoxien zugrundeliegenden Prämissen zu revidieren, sondern die dem Schluss zugrundeliegende Logik. Dabei soll auf eine spezifische ›Logik des Glaubens‹ zurückgegriffen werden, so dass – zumindest im Rahmen einer Spielart dieser Idee – die vermeintlichen Widersprüche (zumin dest als partiell wahr) akzeptiert werden können. Solche Positionen, die die Existenz wahrer widersprüchlicher Sätze behaupten, werden dabei unter der Bezeichnung des Dialetheismus (gelegentlich auch Dialethismus) zusammengefasst. Dialetheistische Positionen bestrei ten somit den seit Aristoteles kaum angefochtenen und als vermeint lich sicherstes logisches Prinzip geltenden Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Aufgrund des in der klassischen Logik gültigen Prinzips ex falso quodlibet, dem zufolge aus widersprüchlichen Aussagen Beliebiges folgt, ist eine dialetheistische Position freilich nur sinnvoll, wenn sie nicht zusammen mit der klassischen Logik vertreten wird. In jüngster Zeit wurde vorgeschlagen, zu diesem Zweck alternativ auf so genannte parakonsistente Logiken zurückzugreifen, die sich dadurch auszeichnen, dass in ihnen das Prinzip ex falso quodlibet nicht gilt. Im Rahmen solcher Logiken können vereinzelte Widersprüche als wahr akzeptiert werden, ohne zugleich jede Aussage akzeptieren zu müssen. Auf diese Weise könnten auch theologische Widersprüche akzeptiert werden und es wäre zugleich möglich, vollumfänglich an den göttlichen Eigenschaften der Allmacht, Allwissenheit und Allgüte festzuhalten. Im Rahmen dieses Essays sollen aktuelle Ansätze parakonsisten ter Theologien vorgestellt sowie ihre historischen Vorläufer und dabei die Geschichte der Auseinandersetzung mit einer ›Logik des Glau bens‹ zur Behandlung theologischer Fragen anhand einiger wichtiger Protagonisten skizziert werden. Im folgenden Abschnitt 2 soll dazu auf die bis in die Antike zurückreichende Tradition der negativen
455
Joachim Bromand
Theologie eingegangen werden, auf mittelalterliche Bemühungen um eine ›Logik des Glaubens‹ sowie auf weitere Entwicklungen in Renais sance und früher Neuzeit. Im Falle der Renaissance soll auf die Über legungen des Nikolaus von Kues (Cusanus) eingegangen werden, der wohl als Erster vorschlägt, zur Erörterung des Göttlichen das zentrale logische Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch aufzugeben. Für dessen berühmte ›Koinzidenz der Gegensätze‹ (coincidentia opposi torum) wird dabei eine neue Interpretation vorgelegt. Als Vertreter der frühen Neuzeit werden wir auf Descartes zu sprechen kommen. Stellvertretend für die mittelalterlichen Anhänger einer ›Logik des Glaubens‹ soll auf den Theologen Robert Holcot eingegangen werden, dessen Überlegungen auf ihre Affinität zu modernen dialetheisti schen Ansätzen hin geprüft werden sollen. Im darauffolgenden Abschnitt 3 werden dann aktuell diskutierte Ansätze einer parakon sistenten Theologie erörtert. Das Vorgehen der hier diskutierten Ansätze kann dabei mit der von W. V. O. Quine im Rahmen seiner Metapher vom web of belief artikulierten Ansicht beschrieben werden, dass wir an jeder Überzeu gung festhalten können, wenn wir im Rahmen des Geflechts unserer Überzeugungen nur hinreichend drastische Änderungen vornehmen und etwa auch logische Prinzipien revidieren.6 Während im Rahmen der klassischen Theologie logischen Aussagen eine zentralere (revisi onsimmunere) Stellung in unserem web of belief eingeräumt wird, schlagen die hier diskutierten Ansätze einen diametralen Weg ein und wollen an zentralen Glaubenssätzen festhalten und Letztere mithin die zentralere (revisionsimmunere) Position in unserem Über zeugungsgeflecht einnehmen lassen.
2. Zum Verhältnis von theologischen Paradoxien, klassischer Logik und ihren Alternativen in Antike, Mittelalter, Renaissance und früher Neuzeit Die (christliche) Theologie weist in ihrer Geschichte verschiedentlich Spannungen zur klassischen Logik auf.7 Letztere finden sich bereits W. V. O. Quine, »Two Dogmas of Empiricism«, S. 40. Eine ausführlichere Darstellung erscheint in J. Bromand, G. Kreis (Hg.), Gotteswi derlegungen (in Vorbereitung).
6 7
456
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
in der negativen Theologie des heute als Pseudo-Dionysius Areopa gita bekannten, im späten fünften und frühen sechsten Jahrhundert tätigen Autors, der vermutlich ein Schüler des Proklos war8 und seine Schriften unter dem Namen des Dionysius Areopagita verfasste. Letzterer war laut der Apostelgeschichte ein durch Paulus bekehrtes Mitglied des Athener Gerichtshofs, des Areopag, und wurde später Bischof von Athen. Die negative Theologie des Pseudo-Dionysius zeichnet sich dabei insbesondere durch den Gedanken aus, dass von Gott keine wahren Aussagen gemacht werden können und ihm allenfalls – in einem ›metasprachlichen‹ Sinne – alle unsere Prädikate abgesprochen werden können, wie etwa im Folgenden:9 Der Satz »Gott ist verschieden von Jesus« ist nicht wahr und der Satz »Gott ist identisch mit Jesus« ist nicht wahr usw. Diese Position läuft somit darauf hinaus, das in der klassischen Logik gültige Prinzip der Zweiwertigkeit (bzw. Bivalenzprinzip) aufzugeben, dem zufolge jeder Satz wahr oder falsch ist (d. h. eine wahre Negation besitzt).10 Dieser Überzeugung schloss sich in seiner Darstellung der negativen Theologie etwa auch Johannes Scotus Eriugena (ca. 800 bis ca. 877) an, der die Schriften Pseudo-Dionysiusʼ in das Lateinische übersetzte. Während die frühen Vertreter der negativen Theologie keine Alternativen zur klassischen (aristotelischen) Logik diskutierten, wurden entsprechende Vorschläge ab dem Hochmittelalter unterbrei tet. Zu den Befürwortern des Einsatzes einer alternativen ›Logik des Glaubens‹ im Rahmen von theologischen Kontexten zählen dabei der Zisterziensermönch Wilhelm von St. Thierry (ca. 1075/80 bis 1148) und der dominikanische Theologe Robert Holcot (ca. 1290 bis 1349) sowie dessen Zeitgenosse Richard Campsall (ca. 1280 bis ca.1350). Wilhelm von St. Thierry vermerkt etwa in diesem Sinne in seiner Schrift Enigma of Faith: This way of speaking about God has its own discipline supported by the rules and limits of faith so as to teach a manner of speaking about God Ein Überblick über die verschiedenen historischen Positionen zur negativen Theo logie findet sich bei D. Westerkamp, Via negativa. Zur Person des Pseudo-Dionysius vgl. etwa ebd., S. 36–38. 9 Vgl. zu dieser Lesart negativer Theologie H. Putnam, »On Negative Theology«, S. 412, sowie R. M. White, »Analogy, Metaphor, and Literal Language«, S. 231, Fn. 2. 10 Pseudo-Dionysius Areopagita, Über die mystische Theologie, S. 80: »[Die Allursa che] gehört weder dem Bereich des Nichtseienden noch dem des Seienden an. […] Sie entzieht sich jeder (Wesens-)Bestimmung, Benennung und Erkenntnis. […] Man kann ihr überhaupt weder etwas zusprechen noch absprechen.« 8
457
Joachim Bromand
reasonably according to the reasoning of faith (secundum rationem fidei). […] Now, we say ›according to the reasoning of faith‹ because this manner of speaking about God has certain special words which are rational but not intelligible except in the reasoning of faith, not however in the reasoning of human understanding. What we said a little earlier – that the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, but that there are not three gods but one God – is understood to some extent according to the reasoning of faith, but not at all according to the reasoning of human understanding. For, in human matters, human reason acquires faith for itself, but in divine affairs faith comes first and then forms its own unique reasoning.11
Robert Holcots Überlegungen drehen sich um die Frage, ob die aristo telische Logik ›formal‹ sei, d. h., ob sie universell ohne Ansehung der Besonderheiten des jeweiligen Diskursbereiches angewandt werden könne. Holcot kommt dabei zu dem Schluss, dass dem nicht so sei und insbesondere die Trinität ein Phänomen darstelle, das außerhalb des Diskurses über das Göttliche nicht anzutreffen ist und das deshalb bei der Entwicklung der aristotelischen Logik nicht berücksichtigt werden konnte.12 Berücksichtigt man jedoch die Trinität, müsse die aristotelische Logik modifiziert werden. Bei seinen Modifikationsvor schlägen entwickelt Holcot zwar noch keine dialetheistische Position und behauptet nicht, dass eine Aussage und ihre Negation zugleich wahr sein können. Er nähert sich einer solchen Position aber doch beträchtlich an, indem er davon ausgeht, dass von Gott – im Gegen satz zu erschaffenen Dingen – scheinbar widersprüchliche Prädikate wie »Vater« und »Nicht-Vater« wahrheitsgemäß prädiziert werden können, da sie verschiedenen der drei göttlichen Personen (in diesem Fall dem Vater und dem Sohn) zukommen.13 Holcot greift dabei die Unterscheidung zwischen einer (›internen‹) Negation des Prädikats eines Satzes und der (›externen‹) Satznegation auf. In einfachen Zitiert nach J. T. Slotemaker, J. C. Witt, Robert Holcot, S. 82. Siehe R. Holcot, In quattuor libros Sententiarum quaestiones (Kommentar zu den Sentenzen des Petrus Lombardus), Teil I, Frage 5, »Utrum Deus sit tres personae dis tinctae«, in H. G. Gelber (Hg.), Exploring the Boundaries of Reason, S. 26–27, Anm. 72. Eine deutsche Übersetzung des Textes erscheint in J. Bromand, G. Kreis, Gotteswiderlegungen (in Vorbereitung). 13 Siehe hierzu und zu den folgenden Ausführungen R. Holcot, »Utrum cum unitate essentiae divinae stet pluralitatis personarum« (Determinatio 10), Artikel 3, ad 2 in H. G. Gelber (Hg.), Exploring the Boundaries of Reason, S. 87f. Eine deutsche Über setzung des Textes erscheint in J. Bromand & G. Kreis, Gotteswiderlegungen (in Vor bereitung). 11
12
458
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Fällen, in denen es um Sätze mit Subjekt-Prädikat-Form geht und das Satzsubjekt in einem nicht-leeren Eigennamen besteht wie im Falle von »Der Eiffelturm ist nicht-höher als 500 m«, folgt aus dem intern negierten Satz der extern negierte: »Es ist nicht der Fall, dass der Eiffelturm höher als 500 m ist.« Nach Holcot findet diese Schlussregel jedoch nur im uns vertrauten Bereich des Erschaffenen Anwendung, sie gilt hingegen nicht beim Räsonieren mit trinitarischen Termen, die sich auf eine Wesenheit beziehen, die identisch mit drei paarweise verschiedenen göttlichen Personen ist.14 Dabei geht Holcot davon aus, dass Gott alle Eigenschaften zukommen, die eine der drei göttlichen Personen besitzt. Somit wäre der Satz »die [göttliche] Wesenheit ist Vater und die [göttliche] Wesenheit ist Nicht-Vater« wahr, da der Vater unter das Prädikat »Vater« fällt, der Sohn hingegen unter das Prädikat »Nicht-Vater«. Holcot gesteht somit zu, dass ein Prädikat und seine (interne) Negation auf ein und dasselbe Objekt zutreffen können. Da nach Holcot der Schluss vom intern negierten »die [göttliche] Wesenheit ist Nicht-Vater« auf den extern negierten Satz »es ist nicht der Fall, dass die [göttliche] Wesenheit Vater ist« im tri nitarischen (Sonder-)Fall nicht wahrheitserhaltend ist und Letzterer somit nicht aus Ersterem folgt, kann Holcot an Ersterem und seiner nicht-negierten Entsprechung (»die [göttliche] Wesenheit ist Vater«) festhalten, ohne dass sich daraus der explizite Widerspruch »die [göttliche] Wesenheit ist Vater und es ist nicht der Fall, dass die [gött liche] Wesenheit Vater ist« ergäbe und daraus wiederum Beliebiges folgte.15 Holcot kann somit auch am Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch festhalten: »[K]ein Intellekt kann dem Gegenteil des ersten Prinzips zustimmen oder glauben, dass widersprüchliche Sätze zur gleichen Zeit wahr sind.«16 Ebenfalls unvereinbar mit der klassischen (aristotelischen) Logik sind die Überlegungen des Nikolaus von Kues bzw. Cusanus (1401 Vgl. zu diesem Punkt auch H. G. Gelber, Logic and the Trinity, S. 303f. Die Ungül tigkeit dieses Schlusses wurde dabei bereits vor Holcot von Adam Wodeham (ca. 1295 bis 1358) behauptet, dessen Einschätzung Holcot hier teilt. 15 Vgl. zu Holcots Strategie auch Uckelmans allgemeine Ausführungen zum Umgang mittelalterlicher Logiker mit theologischen Paradoxien in »Contradictions, Impossibi lity, and Triviality«, Abschnitt 4. 16 »Utrum haec sit concedenda: Deus est Pater et Filius et Spiritus Sanctus« (Quodli bet I), q. 2: »[N]ullus intellectus assentire potest opposito primi principii vel credere quod contradictoria sint simul vera.« Zititiert nach H. G. Gelber (Hg.), Exploring the Boundaries of Reason, S. 38 (Zeile 165–166). 14
459
Joachim Bromand
bis 1464), die zudem als eine weitere Annäherung an eine dialetheisti sche Position verstanden werden können. Cusanusʼ Schriften gehören ebenfalls der Tradition der negativen Theologie an und weisen neupla tonische Züge auf. Wie auch andere Vertreter der negativen Theologie sieht Cusanus neben dieser noch eine ›affirmative Theologie‹ vor, die Gottes Rolle als Ursache aller Entitäten widerspiegelt. So kann man Cusanusʼ affirmativer Theologie zufolge Gott alle Eigenschaften zuschreiben, da er deren Ursprung sei: »[Gott] kontrahiert keine Seinsbestimmung, da alles Sein von ihm kommt«.17 Entsprechend stellt Cusanus dann auch fest, dass das Göttliche »alles mögliche Sein in Wirklichkeit«18 ist bzw. dass Gott »in absoluter Aktualität alles ist, was sein kann«.19 Cusanusʼ affirmative Theologie gipfelt schließlich in seiner berühmten Lehre von der ›Koinzidenz der Gegensätze‹ (coincidentia oppositorum). Aufgrund der Koinzidenzlehre wird Cusanus oftmals als ein früher Vertreter einer dialetheistischen Position erachtet, der als einer der ersten Philosophen noch über Holcot und ähnliche Ansätze hinausgeht und es wagt, Aristotelesʼ Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch abzulehnen und damit die Existenz wahrer widersprüch licher Aussagen zu behaupten.20 Auch Jaspers stellt fest, dass Cusanus zufolge das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch nur einen begrenzten Anwendungsbereich habe und insbesondere nicht zur theologischen Erörterung des Göttlichen geeignet sei.21 Eine Passage, die insbesondere für diese Lesart der Koinzidenz der Gegensätze spricht, ist die folgende: All das, was als sein Sein begriffen wird, ist es ebenso sehr wie es dieses nicht ist, und all das, was als Nichtsein an ihm begriffen wird, ist es ebenso sehr nicht, wie es dieses ist. Vielmehr ist es dieses in der Weise, dass es alles ist, und es ist in der Weise alles, dass es keines ist. Es ist so sehr in höchstem Maße dieses, dass es in geringstem Maße eben dieses ist. So macht es keinen Unterschied, ob man sagt: »Gott, der die absolute Größe selbst ist, ist Licht«, oder ob man sagt: »Gott ist so in höchstem Maße Licht, dass er in geringstem Maße Licht ist«“22 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 2, S. 11. Ebd., Buch I, Kap. 2, S. 11. 19 Ebd., Buch I, Kap. 4, S. 19. 20 Vgl. etwa K. Flasch, Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, S. 24, 60, 99f., 105, 113, 185 und G. Priest, Beyond the Limits of Thought, S. 22f. 21 Vgl. K. Jaspers, Nikolaus Cusanus, S. 90. 22 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 4, S. 19. 17
18
460
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Im Gegensatz zu anderen Repräsentanten der Tradition der negati ven Theologie wie Pseudo-Dionysius und Eriugena scheint Cusanus jedoch die positiven Aussagen der affirmativen Theologie nicht als wahrheitswertlos zu erachten, sondern in ihnen ein ›Körnchen‹ Wahr heit zu vermuten, was die folgende Passage aus Kapitel 24 des ersten Buches von Die belehrte Unwissenheit nahelegt: [D]ie positiven Benennungen, die wir Gott zulegen, [kommen] ihm nur in unendlich verminderter Bedeutung [zu]. Denn diese Bezeich nungen werden ihm beigelegt auf Grund von Eigenschaften, die sich in den Geschöpfen finden. Da also auf Gott eine solche Bezeichnung, die ein Besonderes, Unterschiedenes, Im-Gegensatz-Stehendes zum Inhalt hat, höchstens in völlig abgeschwächtem Sinne zutreffen kann, deshalb sind positive Benennungen ohne Inhalt, wie Dionysius sagt. […] Da er aber nur Substanz ist, die alles ist und der nichts entgegen steht, nur Wahrheit ist, die alles ist und frei ist von Gegensatz, so können ihm jene partikularen Benennungen nur in unendlicher Weise in ihrer Bedeutung vermindert zukommen.23
Wie auch andere Vertreter der Tradition der negativen Theologie vor ihm wie Pseudo-Dionysius und Eriugena ergänzt auch Cusanus seine affirmative Theologie um ein negatives Pendant. Letztere erfüllt die Aufgabe eines Korrektivs zur affirmativen Theologie und deckt deren Unzulänglichkeiten auf, die aus der Anwendung von Begriffen für Weltliches auf Gott resultieren. Die Anwendung der Begriffe auf diesen Fall erweist sich als unzulänglich aufgrund der Transzendenz Gottes, d. h. seiner prinzipiellen Verschiedenheit von allen weltlichen Entitäten. Die Transzendenz Gottes stellt neben der Überzeugung, Gott sei Ursache von allem, die zweite zentrale Überzeugung der negativen Theologie dar, die aus neuplatonischem Gedankengut stammt. Im Sinne seiner Vorläufer betont auch Cusanus dabei, dass die negative Theologie »für die affirmative so unentbehrlich [sei], dass Gott ohne sie nicht als der unendliche Gott verehrt würde, sondern vielmehr als Geschöpf. Eine solche Gottesverehrung aber ist Götzendienst«.24 Die Transzendenz Gottes und die daraus resul tierende Adäquatheit der negativen Theologie beschreibt Cusanus wie folgt:
23 24
Ebd., Buch I, Kap. 24, S. 101. Ebd., Buch I, Kap. 26, S. 111.
461
Joachim Bromand
Die heilige Unwissenheit hat uns die Unaussprechlichkeit Gottes gelehrt, und zwar wegen seiner unendlichen Erhabenheit über alles, was sich benennen lässt. Weil dies unbedingt wahr ist, sprechen wir richtiger von ihm, wenn wir alles Geschöpfliche abstreifen und vernei nen.25
In dieser Passage und seinen Überlegungen zur negativen Theologie unterscheiden sich Cusanusʼ Ausführungen dabei am deutlichsten von denen seiner Vorläufer Pseudo-Dionysius und Eriugena und es deutet sich eine Erklärung an, wie es zur Koinzidenz der Gegensätze kommt: Da sowohl die Aussagen der positiven Theologie als auch ihre Negationen wahr sind, kommen Gott gegensätzliche Prädikate zu. Auffällig in der zuletzt zitierten Passage ist dabei Cusanusʼ Ausdrucksweise, dass die Negationen der Aussagen der positiven Theologie »richtiger« bzw. »wahrer« (»verius«) sind als ihre nicht negierten Gegenstücke. Diese Formulierung scheint mit Bedacht gewählt zu sein und Cusanus greift sie erneut im folgenden Zitat auf. Hier konstatiert er, dass negierte Aussagen in Bezug auf Gott im Allgemeinen ›wahrer‹ seien als ihre nicht negierten Gegenstücke. Dabei legt Cusanus, wie im Folgenden gezeigt werden soll, auf die Rede von Wahrheitsgraden durchaus systematisches Gewicht,26 was bereits nahelegt, dass auch Cusanusʼ Überlegungen nicht mit der (Semantik der) klassischen Logik zu vereinbaren sind: [I]n theologischen Aussagen [sind] Verneinungen wahr und positive Aussagen unzureichend […]. Ebenso sind die negativen Aussagen umso wahrer, je mehr sie Unvollkommenheiten vom schlechthin Vollkommenen abwehren, so wie es wahrer ist, dass Gott nicht Stein ist, als dass er nicht Leben oder Vernunft ist, und wahrer, dass er nicht Trunkenheit, als dass er nicht Tugend ist. Bei den bejahenden Aussagen gilt das Umgekehrte, denn die Aussage, die Gott Vernunft und Leben nennt, ist wahrer als die, welche ihn als Erde, Stein oder Körper bezeichnet.27
Ebd., Buch I, Kap. 26, S. 111. Auf ähnliche Wendungen, die bereits auf Pseudo-Dionysius Areopagita zurück gehen, weist auch D. Westerkamp, Via negativa, S. 140 und S. 263, Fn. 164, hin. Aller dings scheinen weder Pseudo-Dionysius noch Eriugena, bei dem sich ebenfalls ent sprechende Formulierungen finden, derart viel systematisches Gewicht auf diese Überlegungen zu legen wie Nikolaus von Kues. 27 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 26, S. 113. 25
26
462
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Cusanusʼ Rede von Wahrheitsgraden dürfte aus historischer Sicht auf (neu-)platonische Vorstellungen zurückzuführen sein.28 Dabei han delt es sich insbesondere um die Vorstellung der ›Überfülle‹ des Einen bzw. der Idee des Guten, dem im Sinne einer möglichen Deutung von Platons Parmenides kontradiktorische Prädikate – in verschiede nen Hinsichten – zukommen.29 Diese gewissermaßen ›harmonische‹ bzw. kohärente Vereinbarkeit kontradiktorischer Prädikate scheint Cusanus bei seiner Koinzidenz der Gegensätze Modell gestanden zu haben. Dabei ersetzt Cusanus die Rede davon, dass die kontradiktori schen Prädikate der Idee des Guten in der ein oder anderen Hinsicht zukommen, dadurch, dass kontradiktorische Prädikate Gott in unter schiedlichen Graden zukommen. Die systematischen Konsequenzen dieses Zuges sollen im Folgenden erörtert werden. Vom heutigen Standpunkt aus kann Cusanusʼ Rede von den Wahrheitsgraden vereinfachend mit der Semantik einer so genannten Fuzzy Logic verglichen werden; in entsprechenden Sprachen erhalten Aussagen einen Wahrheitswert in Form einer reellen Zahl aus dem Intervall [0, 1] zugeordnet, wobei 1 vollumfängliche Wahrheit und 0 Falschheit repräsentiert. Ist eine Aussage nur in geringem Maße wahr und besitzt etwa den Wahrheitswert 0,3, ist ihre Negation »umso wahrer« und besitzt den Wahrheitswert 0,7 (im Allgemeinen ist der Wahrheitswert der Negation einer Aussage p, die den Wahrheitswert r hat, identisch mit 1 – r; die Negation einer Aussage p ist also umso wahrer, je weniger wahr p ist). Liest man Cusanus in diesem Sinne, näherten sich dem ersten Satz der zuletzt zitierten Passage zufolge die Wahrheitswerte negierter Aussagen dabei deutlich näher der Wahr heit (1) an als die ihrer nicht negierten Gegenstücke. Diese Lesart wird auch von der zuvor zitierten Passage gestützt (De docta ignorantia, Buch I, Kap. 24, S. 101). Diese Beobachtungen legen nun die folgende Deutung von Cusa nusʼ Lehre der Koinzidenz der Gegensätze nahe: Gott können alle positiven Prädikate im Sinne der affirmativen Theologie zumindest in geringfügigem Maße wahrheitsgemäß zugesprochen werden – d. h., sie treffen nur in geringem Ausmaß auf ihn zu. Die Negatio nen solcher Behauptungen sind in umgekehrt proportionalem Maße Vgl. in diesem Zusammenhang auch U. Roth, Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus, S. 80, der Cusanusʼ superlativische Verwendung von »wahr« (verissimum) entsprechend erklärt. 29 Vgl. J. Halfwassen, Auf den Spuren des Einen, S. 313. 28
463
Joachim Bromand
wahrer (»umso wahrer«) und treffen ebenfalls auf Gott zu, in dem in diesem Sinne die Gegensätze koinzidieren. Vom Standpunkt des aristotelischen Verstandes aus (der keine solche Graduierung von Wahrheit vorsieht und insbesondere dem Prinzip vom ausgeschlosse nen Widerspruch verpflichtet ist), ist diese Koinzidenz bzw. kohärente Vereinbarkeit von Widersprüchlichem freilich unverständlich. Von Cusanusʼ Standpunkt aus betrachtet liegt im Falle von Gott jedoch ein Grenzfall vor, in dem das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch keine Gültigkeit besitzt. Entsprechend gilt im Rahmen der oben skizzierten Semantik das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht mehr in dem Sinne, dass es Aussagen p geben kann, die (geringfügig) wahr und falsch sind (etwa könnte p den Wert 0,1, nicht-p den Wert 0,9 annehmen).30 Der hier skizzierte Deutungsansatz kann aber nicht nur erklären, dass nach Cusanus in Gott die Gegensätze koinzidieren, sondern auch Cusanusʼ Rede davon, dass sich Gott jenseits der Gegensätze befinde bzw. »frei ist von Gegensatz«.31 Entsprechende Wendungen finden sich ebenfalls in späteren Schriften Cusanusʼ, besonders pointiert formuliert in De visione dei: »Du, o Gott, bist der Gegensatz der Gegensätze, weil du unendlich bist […]. In der Unendlichkeit ist der Gegensatz der Gegensätze ohne Gegensatz.«32 Auch dies legt nahe, dass die Gegensätze in Gott gewissermaßen ›harmonisch‹ bzw. »ohne Gegensatz« vereint sind. Der hier vertretene Interpretationsansatz erlaubt es dabei in kohärenter Weise zu beschreiben, wie gegensätz liche Prädikate ein und derselben Entität ›harmonisch‹ bzw. »ohne Gegensatz« zukommen können, insofern es keine kontradiktorischen Prädikate gibt, die Gott jeweils vollumfänglich zukämen. Im Gegen satz dazu verhindert die nach Cusanus dem Verstandesgebrauch zugrundeliegende aristotelische Logik und insbesondere das Prinzip Konjunktionen erhalten in dieser Semantik als Wahrheitswert das Minimum der Wahrheitswerte ihrer Bestandteile zugewiesen, so dass widersprüchliche Sätze der Form p und nicht-p ebenfalls nicht völlig falsch sein müssen (und maximal den Wert 0,5 annehmen können). Wenn sich bei Cusanus auch keine detaillierteren Überlegun gen zur Semantik solcher Konjunktionen finden, stellen seine Überlegungen zu Paaren von kontradiktorischen Aussagen, von denen beide (zumindest geringfügig) wahr sein können, doch eine klare Abkehr vom Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch in der Lesart dar, der zufolge es keine Paare von widersprüchlichen Aussagen gibt, von denen beide wahr sind. 31 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 24, S. 101. 32 Nikolaus von Kues, De visione dei, Kap. 13, in ders., Philosophisch-Theologische Schriften, Bd. 3, S. 151. 30
464
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
vom ausgeschlossenen Widerspruch eine solche adäquate Erfassung des Göttlichen mit seiner kohärenten (bzw. ›harmonischen‹) Vereini gung kontradiktorischer Prädikate. So vermerkt er in seiner Schrift De non-aliud: [D]er Verstand kann nicht zu dem vordringen, was ihm vorausgeht; noch viel weniger sind die von ihm hervorgebrachten Künste dazu fähig, einen Weg zu dem zu gehen, was jedem Verstande unbekannt ist. Jener Philosoph [Aristoteles] hielt es für unbedingt sicher, dass jede bejahende Aussage einer verneinenden widerspreche und dass man von einem Ding nicht zugleich einander widersprechende Aussagen machen kann. Das sagte er vermittels des Verstandes, der das als wahr erschließt. […] [D]as, was er als das erste Prinzip […] bezeichnet, [reicht] nicht für die Wahrheit [aus], welche vom Geist jenseits des Verstandes betrachtet wird.33
Das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch erweist sich nach Cusanus somit als unvereinbar mit der zur Erörterung des Göttlichen (im Rahmen der so genannten ›mystischen Theologie‹) unerlässli chen Koinzidenz der Gegensätze,34 so dass Cusanus aufgrund der in diesem Bereich auftretenden Probleme die universelle Anwendbar keit des Prinzips bestreitet. Cusanus räumt aber eine über die Vernunft hinausgehende Möglichkeit einer intellektuellen ›Anschauung‹ bzw. Einsicht ein (die sich bereits im letzten Satz der oben zitierten Passage aus De non-aliud andeutete). Während uns Gott vom Standpunkt unseres Verstandes aufgrund dessen Verhaftung am Satz vom ausgeschlosse nen Widerspruch als inkonsistentes Wesen unverständlich bleiben muss, können wir die (durch die obige Semantik modellierte) konsis tente Vereinbarkeit von Prädikaten (die vom Standpunkt der aristote lischen Logik aus nicht konsistent vereinbar sind) anschauen. Cusa nusʼ oben diskutierte Bemerkungen zu den Wahrheitsgraden deuten Nikolaus von Kues, De non-aliud, Kap. 19, in ders., Philosophisch-Theologische Schriften, Bd. 2, S. 531ff. 34 So schreibt Cusanus etwa in Apologia doctae ignorantiae (Philosophisch-Theologi sche Schriften, Bd. 1, S. 531): »Jetzt hat vor allem die aristotelische Richtung Geltung, die die Koinzidenz der Gegensätze, welche man anerkennen muss, um den Anfang des Aufstiegs zur mystischen Theologie zu finden, für eine Häresie hält. Den in dieser Schule Ausgebildeten scheint dieser Weg vollkommen unsinnig zu sein. Er wird als ein ihren Absichten entgegengesetzter völlig abgelehnt. Daher käme es einem Wunder gleich – ebenso wie es eine Umwandlung der Schule wäre –, wenn sie von Aristoteles abließen und höher gelangten.« 33
465
Joachim Bromand
aber bereits an, dass es sich hier um eine intellektuelle Anschauung (intellectualis visio) handelt. Dieses, dem Verstand übergeordnete, Vermögen wird vom Verstand auch oft als Vernunft differenziert und ist daher eher als überrational und nicht als irrational zu bezeichnen.35 Der Vernunft bzw. der intellektuellen Anschauung kommt dabei eine tragende Rolle in Cusanusʼ ›mystischer Theologie‹ zu. Sie könnte durchaus in einem intellektualistischeren Sinne konzipiert sein und weniger als eine Art von Vision oder Offenbarung (wie es bei PseudoDionysius nahegelegt zu werden scheint). Wie andere Vertreter der negativen Theologie behauptet Cusanus auch, dass Gott uns nicht auf einem rationalen Weg durch unseren Verstand begreifbar ist. Im Vergleich zu Pseudo-Dionysius und Eriugena könnten Passagen bei Cusanus aber nahelegen, dass er die Möglichkeiten einer zumindest partiell intellektuellen Annäherung an Gott durch die intellektuelle Anschauung bzw. die Vernunft optimistischer einschätzt: Doch dieser Sachverhalt übersteigt all unser Denken, das auf dem Wege des Verstandes das Widersprechende nicht in seinem Ursprung zu verbinden vermag. […] Weit unter jener unendlichen Kraft ste hend, vermag unser Verstand die Gegensätze mit ihrem unendlichen Abstand nicht in einer Einheit zu verbinden. Über allem diskursiven Vermögen des Verstandes schauen wir demnach in einer nicht ergrei fenden Weise die Unendlichkeit der absoluten Größe, die keinen Gegensatz kennt und mit der das Kleinste koinzidiert.36
Für diese intellektuelle Anschauung besitzt das Prinzip vom ausge schlossenen Widerspruch dabei keine Gültigkeit, wie Cusanus in seiner Verteidigung der wissenden Unwissenheit (Apologia doctae igno rantiae) festhält: »Denn dieses Prinzip [»das erste Prinzip«] ist zwar das erste hinsichtlich der schlussfolgernden Vernunft, ist es aber keineswegs in Bezug auf den schauenden Geist«.37 Auch in der These, dass wir Gott nicht durch den Verstand erfas sen können und auf eine andere, ›überrationale‹ Form der Einsicht angewiesen sind, zeigt sich die Nähe von Cusanus zur Tradition der negativen Theologie. Cusanusʼ Vorschlag, wie wir auf diese Begrenztheit unserer Erkenntnismöglichkeiten reagieren sollten, ist 35 Vgl. etwa K. Jaspers, Nikolaus Cusanus, S. 24ff., und K. M. Ziebart, Nicolaus Cusanus on Faith and the Intellect, S. 8ff. 36 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 4, S. 19. 37 Nikolaus von Kues, Apologia doctae ignorantiae (Philosophisch-Theologische Schrif ten, Bd. 1), S. 577.
466
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
die belehrte Unwissenheit: In dem Maße, in dem wir uns bewusst sind, dass und warum wir Gott mit Hilfe unseres Verstandes nicht erfassen können und inwiefern die Bemühungen unseres Verstandes fehlschlagen, wird uns das Göttliche deutlicher: »Je gründlicher wir in dieser Unwissenheit belehrt sind, desto näher kommen wir an die Wahrheit selbst heran.«38 Cusanusʼ oben vorgestellte Überlegungen zu den Wahrheitsgraden können zumindest als ein Teil der Umset zung dieses Ansatzes verstanden werden, indem sie aufzeigen, dass und inwieweit die Aussagen der positiven und negativen Theologie die volle Wahrheit verfehlen. Durch die Angabe, wie weit die jeweili gen Aussagen von der Wahrheit entfernt sind, können wir Letztere zumindest indirekt verorten. Zusammenfassend können wir festhalten, dass Cusanus, im Unterschied etwa zu Pseudo-Dionysius und Eriugena, die bestreiten, dass übliche Prädikate im wörtlichen Sinne wahrheitsgemäß von Gott prädiziert werden können, entsprechenden Aussagen zumindest einen geringfügigen Wahrheitsgehalt zubilligt. Deutlicher ist noch der Unterschied in Hinblick auf die jeweiligen negativen Theologien: Während nach Pseudo-Dionysius und Eriugena nur die im oben skizzierten metasprachlichen Sinne verstandenen Aussagen der nega tiven Theologie den Anspruch erheben können, wörtlich wahr zu sein, attestiert Cusanus negierten Aussagen über Gott einen größe ren Wahrheitsgehalt, so dass gegensätzliche Prädikate (zumindest partiell) wahrheitsgemäß von Gott prädiziert werden können, was die besagte Koinzidenz der Gegensätze ausmacht. Die dabei vorgesehene Möglichkeit einer überrationalen Betrachtung des Göttlichen mit Hilfe der Vernunft bzw. der intellektuellen Anschauung ist nicht mehr der aristotelischen Logik verpflichtet und insbesondere gilt in ihr das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch nicht. Wenn Cusanus auch keine detaillierte nicht-klassische Logik ausarbeitet, plädiert er damit doch deutlich für den Verzicht auf zentrale Prinzipien der klassischen aristotelischen Logik und für die Erwägung einer nicht-klassischen Semantik, die Wahrheitsgrade vorsieht.39 Nikolaus von Kues, De docta ignorantia, Buch I, Kap. 3, S. 15. Darüber hinaus scheint Cusanus ein noch umfassenderes Unternehmen zu ver folgen, wie Flasch, Nikolaus von Kues in seiner Zeit, S. 73, mit Verweis auf dessen Schrift De beryllo, insb. Kap. XXVIf., betont (Philosophisch-Theologische Schriften, Bd. 3, S. 51–57). Demzufolge ist die Koinzidenz der Gegensätze nicht nur ein Charakte ristikum Gottes, sondern ein allgemeineres Phänomen auch der physikalischen Welt, so dass es Cusanus nicht nur wie Holcot um eine ›Logik des Glaubens‹ geht, sondern 38
39
467
Joachim Bromand
Cusanus entzieht sich damit als einer der ersten abendländischen Denker der Autorität des Aristoteles, indem er nicht nur wie Hol cot die universelle Anwendbarkeit der aristotelischen Logik bestrei tet, sondern insbesondere auch die universelle Gültigkeit des nach Aristoteles vermeintlich sichersten logischen Grundsatzes ablehnt, des Prinzips vom ausgeschlossenen Widerspruch. Dies unterschei det Cusanusʼ Position von Vertretern der negativen Theologie wie Pseudo-Dionysius und Eriugena, deren nachdrückliche Hinweise auf die logische Vereinbarkeit der Aussagen von positiver und negativer Theologie wohl gerade der Sorge um die Beachtung des Prinzips vom ausgeschlossenen Widerspruch geschuldet sein dürften.40 Cusanus kann somit zu Recht als ein Wegbereiter des modernen Dialetheismus erachtet werden und wird von gegenwärtigen Vertretern dieser Posi tion wie Graham Priest auch als solcher gewürdigt.41 Wenn Cusanus so auch dem Dialetheismus nahe kommt, vertritt er aber doch selbst keine dialetheistische Position im gegenwärtigen Sinne, dem zufolge Aussagen vollumfänglich wahr und falsch sein können (bzw. die Werte 1 und 0 annehmen), sondern neigt aus heutiger Sicht eher zu einer Semantik, die verschiedene Grade von Wahrheit vorsieht, so dass widersprüchliche Aussagen zumindest in geringem Umfang wahr sein können. Wie bereits eingangs erwähnt, vertritt ebenfalls René Descartes die Auffassung, Gott sei nur inkonsistent zu beschreiben. Descartes behauptet dabei zunächst, dass es Gott möglich sei, Unmögliches (wie einen Berg ohne zugehöriges Tal) zu realisieren. Insbesondere behauptet Descartes, dass Gott als Schöpfer der logischen Gesetze diese nach Belieben ändern könne, wenn er dies denn wollte, und sogar kontradiktorische Aussagen zugleich wahr machen könne.42 Descartes kommt damit der Behauptung sehr nahe, dass Widersprü che (Sätze der Form p und nicht-p) möglicherweise wahr sind, was um ein umfassenderes erkenntnistheoretisches und naturphilosophisches »Pro gramm einer neuen Physik« (ebd.), in dessen Zentrum die Koinzidenzlehre und damit nicht-klassische logisch-semantische Prinzipien stehen. 40 Im Gegensatz zur obigen Interpretation wurde auch bereits bei Pseudo-Dionysius vermutet, dass er in Bezug auf die Rede von Gott das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch ›suspendieren‹ will. Vgl. etwa J. Halfwassen, Auf den Spuren des Einen, S. 307 ff. 41 G. Priest, Beyond the Limits of Thought, S. 22f. 42 Siehe den Brief an Mesland vom 2. Mai 1644 in R. Descartes, The Correspon dence, S. 235; vgl. auch den Brief an Mersenne vom 15. April 1630, S. 23.
468
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
aus Sicht moderner Modallogiken (zumindest solcher, die sich an der klassischen Logik orientieren) unmöglich ist:43 [Göttliche Macht] schließt einen Widerspruch für unser Verständnis ein; das heißt, sie ist uns unbegreiflich. Aber ich denke nicht, dass wir jemals von einer Sache sagen sollten, dass sie nicht von Gott herbeigeführt werden kann. […] Ich würde nicht zu behaupten wagen, dass Gott nicht einen Berg ohne ein Tal erschaffen kann, oder er nicht vermochte, es herbeizuführen, dass 1 und 2 nicht 3 sind. Ich sage nur, dass er mir einen solchen Verstand gegeben hat, dass ich einen Berg ohne Tal oder eine Summe aus 1 und 2, die nicht 3 ist, nicht begreifen kann; solche Dinge bringen einen Widerspruch für mein Verständnis mit sich.44
Ebenfalls Descartes kann somit als Wegbereiter einer dialetheisti schen Theologie erachtet werden. Die sich abzeichnenden theologi schen Widersprüche deutet Descartes dabei in epistemologischer Hinsicht als Zeichen unseres Unverständnisses des Göttlichen. Gott hat sich Descartes zufolge für die (notwendige) Wahrheit des Prin zips vom ausgeschlossenen Widerspruch entschieden und unseren Verstand entsprechend geformt, so dass sich die Möglichkeit wahrer widersprüchlicher Aussagen unserem Verständnis entzieht. Insbe sondere diese letzte epistemologische Konsequenz teilen moderne dialetheistische Theologien, um die es im Folgenden gehen soll, nicht.
3. Zur gegenwärtigen Debatte: Dialetheistische Theologie und parakonsistente Logik Die aktuell diskutierten dialetheistischen theologischen Ansätze tei len einige Züge ihrer historischen Vorläufer. Wie bei Holcot und Cusanus lassen sie bestimmte ›widersprüchliche‹ Satzpaare als ver einbar zu, ohne dass diese die Rolle von syntaktischen Kontradiktio nen in der klassischen Logik spielten und sie somit alles Beliebige 43 Zu Ersterem: Aus der Wahrheit widersprüchlicher Aussagen p, nicht-p folgt nicht unbedingt die Wahrheit der kontradiktorischen Aussage p und nicht-p. Zu Letzterem: Zumindest gilt dies in sog. normalen Modallogiken, die auf die klassische Logik aufbauen und in denen die Nezessitationsregel gültig ist, der zufolge für jedes Theorem A gilt, dass auch der Satz Notwendigerweise A ein Theorem ist. 44 Brief an Arnauld vom 29. Juli 1648 in R. Descartes, The Correspondence, S. 358– 359. Dt. Übers. J. B.
469
Joachim Bromand
implizierten. Im Gegensatz zu Cusanusʼ Position erlauben es para konsistente Logiken jedoch, widersprüchliche Aussagen von Gott gleichermaßen als vollumfänglich wahr zu erachten. Im Gegensatz zu Holcot unterscheiden die modernen dialetheistischen Theologien nicht mehr zwischen interner und externer Negation, was im Rahmen einer parakonsistenten Logik möglich ist, ohne dass aus einem Satz und seiner (externen) Negation Beliebiges folgte. In formaler Hinsicht stehen dabei verschiedene parakonsistente Logiken zum Einsatz im Rahmen von dialetheistischen Theologien zur Verfügung. In diesbezüglichen Abhandlungen wurde bislang die Logik LP (Logic of Paradox) Graham Priests sowie die Logik FDE (First Degree Entailment) diskutiert. LP sieht dabei für Aussagen drei mögliche semantische Zustände vor: (nur) wahr, (nur) falsch sowie wahr und falsch. Zu Zwecken der Veranschaulichung wollen wir hier der Einfachheit halber nur auf LP eingehen (FDE unterscheidet sich von LP unter anderem darin, dass es einen vierten semantischen Zustand, nämlich weder wahr noch falsch vorsieht). Einer negierten Aussage mit klassischem Wahrheitswert (also (nur) wahr oder (nur) falsch) kommt im Rahmen von LP dabei ihr klassischer Wahrheits wert zu (also (nur) falsch in ersterem, (nur) wahr in letzterem Falle). Ist eine Aussage wahr und falsch, gilt dasselbe auch für ihre Negation. Konjunktionen sind wahr, wenn ihre Konjunkte wahr sind, und falsch, wenn mindestens eines ihrer Konjunkte falsch ist. Besteht eine Konjunktion beispielsweise aus einem wahren Konjunkt und einem, das wahr und falsch ist, ist somit auch die gesamte Konjunktion wahr und falsch. Die anderen Junktoren können nun wie üblich mit Hilfe der Negation und der Konjunktion eingeführt werden. Im Rahmen von LP folgt dabei eine Konklusion aus Prämissen, wenn es nicht möglich ist, dass die Prämissen zugleich wahr (oder wahr und falsch) sind, die Konklusion aber nicht. Das Prinzip ex falso quodlibet gilt in diesem Rahmen nicht: Ist eine Aussage A wahr und falsch, sind die Prämissen A und A beide wahr und falsch, eine beliebige Konklusion B kann aber nur falsch sein. Somit impliziert ein widersprüchliches Satzpaar A, A im parakonsistenten Rahmen von LP – im Gegensatz zur klassischen Logik – nicht jeden beliebigen Satz B.45 Eine erste Einführung in die Logiken LP und FDE findet sich bei G. Priest, Non-Classical Logic, Kap. 7 und 8. Definiert man das Konditional in üblicher Weise, gilt auch Modus Ponens in LP nicht, weshalb es naheliegt, LP um einen geeignetes nicht-wahrheitsfunktionales Konditional zu ergänzen. 45
470
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Versuche, Theologie im Rahmen einer solchen parakonsistenten Logik zu betreiben, werden erst seit kurzem in Angriff genommen. Im Folgenden sollen drei Varianten solcher parakonsistenten theolo gischen Ansätze vorgestellt werden. Die Ansätze unterscheiden sich darin, wie viele Widersprüche (bzw. Paare von widersprüchlichen Aussagen) sie als wahr akzeptieren wollen. Während der erste Ansatz alle Aussagen über Gott als wahr und falsch akzeptieren will, lassen die darauffolgenden Ansätze jeweils weniger Widersprüche über Gott als wahr zu als die vor ihnen vorgestellten Varianten. Im Rahmen einer ersten, radikalen Möglichkeit sollen theologi sche Widersprüche universell als wahr akzeptiert werden, so dass alle Aussagen über Gott als wahr (und falsch) gelten. Die Position, jede Aussage sei wahr, wird auch als ›Trivialismus‹ bezeichnet, so dass hier von einem Trivialismus in Bezug auf das Göttliche gesprochen werden kann. Die Position geht dabei so weit, nicht nur die Existenz behauptung Gottes zu akzeptieren, sondern auch ihre Negation. Ein parakonsistenter Rahmen kann hier zwar die Verbreitung der Wider sprüche auf andere wissenschaftliche Fragen verhindern (so dass z. B. aus einem Paar widersprüchlicher Aussagen über Gott in diesem Rahmen nicht ohne Weiteres die Falschheit der Relativitätstheorie oder 1 = 0 folgt). Es scheint aber, dass eine Theologie in einem solchen Rahmen sich dem rationalen Diskurs entzieht: Sie verträte absurde Positionen wie die, dass Gott alles Leid gutheiße, und gäbe jeder religiösen Position, jedem Häretiker und selbst dem Atheisten in jedem Punkt Recht (und fügte jeweils noch die Negationen dieser Behauptungen hinzu). Graham Priest deutet Cusanus etwa als einen Vertreter dieser Position und beendet an dieser Stelle seine Diskussion von Cusanus, da für eine solche Position kaum etwas spricht.46 Da eine solche Position keine theoretischen Vorzüge aufzuweisen vermag und in dieser Radikalität auch philosophiehistorisch nicht an bedeutender Stelle vertreten wird (wie oben gezeigt, kann Cusanus wohlwollender verstanden werden), soll sie im Folgenden nicht weiter verfolgt werden. Eine zweite Möglichkeit, theologische Widersprüche als wahr zu akzeptieren, wird in einer Studie von Aaron Cotnoir diskutiert.47 Im Rahmen dieses Ansatzes sollen wahre Widersprüche in einem weni ger umfangreichen Maße nur als Reaktionen auf die theologischen 46 47
G. Priest, Beyond the Limits of Thought, S. 23. A. J. Cotnoir, »Theism and Dialethism«.
471
Joachim Bromand
Paradoxien zugelassen werden, insbesondere auf die der Allmacht (der überschwere Stein) und auf die von Patrick Grim aufgezeigten Paradoxien des Allwissens. Cotnoir schlägt als parakonsistente Reak tion auf die Paradoxie des überschweren Steins vor, zu akzeptieren, dass die Aussage, Gott könne alles tun, wahr und falsch ist; definiert man Allmacht als die Möglichkeit, alles tun zu können, ist Gott somit sowohl allmächtig als auch nicht.48 Analog schlägt er zur Lösung der Paradoxien der Allwissenheit vor, zu akzeptieren, dass Gott sowohl allwissend ist als auch nicht. Cotnoir löst damit die ›Omni-Parado xien‹ analog zur dialetheistischen Lösung der Lügner-Paradoxie, der zufolge der Lügner sowohl wahr als auch falsch ist. Im gewählten parakonsistenten Rahmen (im Falle Cotnoirs handelt es sich um die Logik LP) kann dabei aus diesen Widersprüchen nicht Beliebiges hergeleitet werden. Ein Problem von Cotnoirs Ansatz besteht darin, die theologi schen Paradoxien einzugrenzen. Während aus ihnen aufgrund der zugrundegelegten parakonsistenten Logik zwar nicht Beliebiges folgt, ergeben sich über die Omni-Paradoxien hinaus noch weitere theolo gische Widersprüche. Insbesondere ist im gewählten Rahmen auch die Existenzbehauptung eines allwissenden und allmächtigen Wesens wahr und falsch.49 Die parakonsistente Theologie enthielte in diesem Sinne die Behauptung der Nichtexistenz Gottes (neben der Behaup tung seiner Existenz). Damit gerät Cotnoirs Ansatz gefährlich nahe an die oben kritisierte Position des theologischen Trivialismus und es stellt sich die Frage, ob in diesem Rahmen noch ein rationaler Diskurs über das Göttliche möglich ist. Cotnoir analysiert in diesem Zusammenhang die Möglichkeit, den Schluss auf die Nichtexistenz Gottes durch logische Modifikationen (wie die Aufgabe der Kontra position) zu vermeiden, betont aber selbst, dass dieser Schritt nur dann nicht ad hoc ist, wenn für diese Modifikationen unabhängige Gründe (außer der Vermeidung der unliebsamen Konsequenz der Nichtexistenz Gottes) angeführt werden können.50 Eine weitere Kritik an diesem Ansatz resultiert aus dem Problem des Übels, welches in der Vereinbarkeit der vermeintlichen OmniEigenschaften Gottes mit dem Leiden in der Welt besteht. Zach 48 Siehe A. J. Cotnoir, »Theism and Dialethism«, S. 599, zur Definition der Allmacht s. S. 597. 49 A. J. Cotnoir, »Theism and Dialethism«, S. 604. 50 Ebd., S. 605.
472
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Weber argumentiert so etwa dafür, dass das Problem des Übels bereits zeige, dass wir an der Existenz Gottes nicht in rationaler Weise festhalten können und dass die Zuflucht zu einer dialetheistischen Position diese Problematik keineswegs entschärft.51 Weber argumen tiert dafür, dass die Widersprüche, die aus dem Problem des Übels resultieren, Absurditäten ähneln. Unter Letzteren versteht Weber Aussagen, die – im Gegensatz zu einfachen Widersprüchen – selbst in einem parakonsistenten Rahmen inakzeptabel bzw. ›bösartig‹ sind und jede Aussage implizieren. Dabei handelt es sich um Aussagen wie »Alles ist wahr« oder (identifiziert man die Wahrheitswerte wahr bzw. falsch mit 1 bzw. 0) »1 = 0«. Weber zufolge handelt es sich nun bei widersprüchlich wirkenden Aussagen, die aus einer dialetheistischen Lösung des Problems des Übels resultierten wie (*) Gott sieht enormem Leiden zu, das er verhindern kann und will, es aber nicht tut, und ist dennoch moralisch vollkommen gut nicht um einfache Widersprüche, sondern um auch für den Dialethe isten inakzeptable Absurditäten. Zwar folgt nach Weber aus (*) nicht Beliebiges, allerdings vertritt er die Position, dass (*) den Begriff der (vollkommenen) moralischen Güte ad absurdum führe, so dass dieser auf alles anwendbar sei: »I suggest that [(*)] is outrageous enough to be at least trivializing the notion of goodness: if allowing (or causing) enormous preventable evil counts as good, then anything counts as good«.52 Hier könnte entsprechend von Überlegungen im Rahmen der Debatte um das Theodizeeproblem eingewandt werden, dass (*) eventuell nicht so unplausibel ist, wie Weber suggeriert: Es könnte etwa erforderlich sein, dass Gott – zur Etablierung von höherstufigem Gut (d. h. moralisch wünschenswerten Phänomenen, die es ohne bestimmte Übel nicht gäbe, wie beispielsweise Mitleid) – bestimmte Übel, die er eigentlich nicht zulassen will und auch verhindern könnte, in Kauf nehmen muss.53 Zudem ist am Einwand problematisch, dass er darauf hinauszulaufen scheint, Gottes Allmacht in Frage zu stellen. Eine eingehende Diskussion dieser Frage führte allerdings zu weit in die Theodizeedebatte hinein, als dass sie an dieser Stelle weiterver Z. Weber, »Atheism and Dialetheism«. Z. Weber, »Atheism and Dialetheism«, S. 405. Bei (*) handelt es sich um die Übersetzung von Webers Aussage (2) auf S. 404. 53 Als ein Argument gegen (*) in diesem Sinn können die Ausführungen von P. van Inwagen, The Problem of Evil, Kap. 6 verstanden werden. 51
52
473
Joachim Bromand
folgt werden könnte. Die zukünftige Diskussion wird zeigen müssen, ob in einem Rahmen wie dem Cotnoirs die erwähnten Probleme gelöst werden können.54 Eine dritte in der Literatur diskutierte Möglichkeit, theologische Widersprüche als wahr zu akzeptieren, besteht darin, Widersprüche nur sporadisch zuzulassen wie etwa im Falle der Trinitätsproblematik. Diesen Ansatz wählt J. C. Beall im Rahmen seiner ›kontradiktorischen Christologie‹.55 Die Akzeptanz wahrer Widersprüche dient hier der adäquaten Beschreibung der Ausnahmestellung Christus’ in Form seines widersprüchlichen Wesens. Während Christus etwa als unvoll kommener Mensch das Leid der Kreuzigung erduldete, ist er durch seine Göttlichkeit vollkommen und physischem Leid unzugänglich: The contradiction of Christ, on the proposed Christology, is not there because the Conciliar-text authors were sloppy; it’s there because Christ’s foundational role in Christianity requires something contra dictory – and thereby something extraordinary, unique and awesome. [… T]he view is motivated by the screamingly apparent contradiction at the heart of Christ’s role – perfect God but also as human in imperfection and limitation as you and me. 56
Beall intendiert dabei nicht, auf wahre Widersprüche zur Behandlung jeglicher theologischen Paradoxien zurückzugreifen. Er tendiert so etwa dazu, die Paradoxien der Allmacht im Rahmen eines Ansatzes, der auf Wahrheitswertlücken zurückgreift (also Sätze, die weder wahr noch falsch sind), zu lösen.57 Vielmehr geht es Beall darum, nur solche widersprüchlichen Aussagen als wahr anzuerkennen, die sich aus dem ›fundamentalen Problem‹ der Christologie ergeben, also daraus, dass Christus sowohl als menschlich als auch als göttlich erachtet wird. So ergibt sich aus Christus’ menschlicher Natur etwa ebenfalls seine Sterblichkeit, während er aufgrund seines göttlichen Wesens zugleich nicht sterblich ist.58 Ein weiteres Problem für Ansätze wie den A. J. Cotnoirs, aber auch den im Folgenden diskutierten Ansatz J. C. Bealls, findet sich bei A. Tedder & G. Badia, »Currying Omnipotence: A Reply to Beall and Cotnoir«. 55 Vgl. J. C. Beall, »Christ – A Contradiction« und J. C. Beall et al., »Complete Symposium on J. C. Beall’s ›Christ – A Contradiction‹“ sowie insbesondere J. C. Beall, The Contradictory Christ. 56 J. C. Beall, »Christ – A Contradiction«, S. 416. 57 J. C. Beall, »Christ – A Contradiction«, S. 422, insb. Fn. 32. Vgl. dazu auch J. C. Beall & A. J. Cotnoir, »God of the gaps«. 58 Ebd., S. 400. 54
474
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Was könnte für Bealls kontradiktorische Christologie sprechen? Zunächst einmal nimmt der Ansatz die christliche Überlieferung ernst. Auf die Frage »Starb Christus am Kreuz?« kann Beall zufolge im wörtlichen Sinne geantwortet werden: »Ja und nein.« Im Rah men einer Theologie, die auf die klassische Logik baut und an Christus’ Unsterblichkeit festhalten will, kann eine solche Antwort bestenfalls in einem übertragenen Sinne gemeint sein wie »Es hatte den Anschein …«. Auch die Rede von ›Wiederauferstehung‹ wäre dann allerdings nur in einem abgeschwächten Sinne zu verstehen (vergleichbar mit der Erweckung einer Person aus dem Koma) und weitaus weniger beeindruckend als die Wiederauferstehung einer Person, die tatsächlich gestorben ist. An dieser Stelle ist der traditio nelle, in der klassischen Logik verhaftete Theologe mit dem bereits eingangs angesprochenen Problem der Trinität konfrontiert, zu dem bislang keine überzeugende und auf breiter Front akzeptierte konsis tente Lösung vorgelegt werden konnte. Vermutet werden könnte, dass das Problem des parakonsistenten Theologen noch viel größer ist, nämlich zu erklären, wie widersprüchliche Aussagen wahr sein können. Dem ist aber nicht so, da durchaus verschiedene Möglich keiten bestehen, die Existenz wahrer widersprüchlicher Aussagen zu plausibilisieren. Gemäß der klassischen deskriptiven Auffassung von Begriffen etwa fällt ein Objekt unter ein Prädikat, das einen Begriff ausdrückt, wenn es alle seine definierenden Merkmale erfüllt. Ein Objekt erfüllt die Negation des Begriffsworts, wenn es eines dieser Merkmale nicht erfüllt. Während übliche Gegenstände (einmal abgesehen von Fällen von Vagheit) somit stets entweder unter ein Begriffswort oder seine Negation fallen, könnte dies im außerordent lichen Fall eines trinitarischen Wesens anders liegen. Ähnlich den im letzten Abschnitt skizzierten Überlegungen Holcots könnte man etwa annehmen, dass Christus aufgrund seiner Identität bzw. zumindest seiner trinitarischen Beziehung zu Gott die Merkmale des Begriffs unsterblich erfüllt, aufgrund seiner menschlichen Natur und dem Tod am Kreuz zugleich jedoch die Merkmale des Begriffs sterblich. Der trinitarische Ausnahmefall macht dabei deutlich, dass unsere Prädikate die Objekte nur unter ›günstigen‹ Bedingungen vollständig in disjunkte Klassen einteilen. Es können Grenzfälle auftreten, die weder unter ein Prädikat noch unter dessen Negation fallen – wie im Falle von Vagheit –, aber auch Fälle, die unter ein Prädikat und dessen
475
Joachim Bromand
Negation fallen, wie eventuell im Falle von Christus.59 Während Fälle von Vagheit an der Tagesordnung sind, bilden Fälle von wahren widersprüchlichen Sätzen der Form a ist F und a ist nicht-F dabei die Ausnahme, was in der Funktion von Begriffswörtern wie F begründet ist: Diese erlauben es, Objekte informativ zu klassifizieren dadurch, dass sie sie einer (wenn eventuell auch nur vage begrenzten) echten Teilklasse aller Objekte zuordnen. Prädikate, die regelmäßig Objekten wahrheitsgemäß zu- und abgesprochen werden können, kommen dieser Aufgabe nicht nach und würden daher wohl revidiert oder aufgegeben werden. Legt man nicht die klassische Logik zugrunde, kann es aber durchaus vereinzelte Ausnahmefälle geben, die sowohl unter ein Begriffswort als auch unter dessen Negation fallen. Bealls Ansatz kann somit durchaus eine Anfangsplausibilität für sich verbuchen. Dabei wird die ›kontradiktorische Christologie‹ den Vergleich insbesondere mit konsistenten Theorien der Trinität nicht scheuen müssen und künftige Studien werden ›Kosten‹ und Nutzen beider Ansätze sorgfältig gegeneinander abzuwägen haben. Dem dialetheistischen Theologen fällt dabei jedenfalls nicht die Last zu, Vertreter anderer Disziplinen zur parakonsistenten Logik zu ›bekeh ren‹: Zwar wird er – wie die Befürworter einer ›Logik des Glaubens‹ – behaupten, dass die klassische Logik nicht universell gültig und insbesondere nicht zur Anwendung auf außerordentliche Fällen wie den der Trinität geeignet ist. Dies erfordert aber keine Abkehr von der klassischen Logik in anderen wissenschaftlichen Disziplinen wie etwa der Mathematik (zumindest solange diese sich nicht mit trinitarischen Entitäten beschäftigt). Gegen die kontradiktorische Christologie wurde eine Reihe von Einwänden erhoben, gegen die Beall seinen Ansatz verteidigt hat.60 Im Rahmen parakonsistenter Logiken wie LP haben Prädikate dabei – wie in der klassischen Prädikatenlogik auch – eine Extension (die Menge der Objekte, auf die das Prädikat zutrifft) und eine Antiextension (die Menge der Objekte, auf die die Negation des Prädikats zutrifft). Während Extension und Antiextension im Rahmen der klassischen Prädikatenlogik disjunkt sind, können sie im Rahmen von LP eine nicht-leere Schnittmenge besitzen. Ein nicht-theologisches Beispiel einer Entität, die unter ein Prädikat und dessen Negation fällt, könnte der Lügnersatz (»Dieser Satz ist falsch«) sein, der aufgrund des sog. W-Schemas (›p‹ ist wahr genau dann, wenn p) wahr zu sein scheint genau dann, wenn er es nicht ist. Semantische Paradoxien wie die des Lügners gaben den zentralen Anstoß zur Entwicklung parakonsistenter Logiken. 60 Vgl. J. C. Beall, The Contradictory Christ, sowie J. C. Beall, T. Pawl, T. McCall, A. J. Cotnoir, S. L. Uckelman, »Complete Symposium on J. C. Beall’s ›Christ – A Contra diction‹«. Eine frühe Kritik dialetheistischer theologischer Ansätze, auf die Beall im 59
476
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Weitere Bedenken bleiben allerdings noch auszuräumen. So stellt sich etwa die Frage, ob Bealls kontradiktorische Christologie nicht auch die Schwierigkeiten von Cotnoirs Ansatz teilt: Wie oben erwähnt, will Beall solche widersprüchlichen Aussagen als wahr anerkennen, die sich daraus ergeben, dass Christus sowohl als menschlich als auch als göttlich erachtet wird. Dann scheinen ausgehend von diesem ›fundamentalen Problem‹ der Christologie aber auch die Omni-Prä dikate Christus sowohl zu- als auch abgesprochen werden zu kön nen: So könnte man etwa vermuten, dass Christus wegen seiner menschlichen Natur weder allmächtig noch allwissend ist, aufgrund seines göttlichen Wesens aber doch beide Eigenschaften besitzt.61 Wir kämen dann ähnlich wie im Falle Cotnoirs dazu, dass Christus sowohl allwissend als auch nicht allwissend ist. Dies wäre zum einen nur schwer zu vereinbaren mit der von Beall ins Auge gefassten Lösung der Omni-Paradoxien durch Wahrheitswertlücken. Vor allem resultierte zum anderen aber wie in Cotnoirs Falle das Problem, dass sich die Behauptung der Nicht-Existenz von Christus als Teil der kontradiktorischen Christologie ergäbe. Diese letzte Möglichkeit lehnt Beall allerdings selbst explizit ab und erachtet die Behauptung der Nicht-Existenz Gottes als Absurdität, die selbst im Rahmen der kontradiktorischen Christologie inakzeptabel sei.62,63 Ob solche Bedenken ausgeräumt werden können, werden zukünftige Ausarbeitungen der Theorie zu zeigen haben.64 Auch wenn die Ansätze einer dialetheistischen Theologie bei Beall und Cot noir nicht unproblematisch sind, stellen sie doch vielversprechende Versuche dar, mit theologischen Paradoxien umzugehen. Insbeson dere die dialetheistische Behandlung des Trinitätsproblems bildet eine Rahmen des besagten Symposiums z. T. repliziert, findet sich bei J. Anderson, Paradox in Christian Theology, S. 117–126. 61 Zur Stützung dieser Vermutung vgl. auch J. C. Beall, The Contradictory Christ, S. 105. 62 J. C. Beall, »On Contradictory Christology: Preliminary Remarks, Notation and Terminology«, S. 438. 63 Wollte man bestreiten, dass Christus auch die Eigenschaften der Allwissenheit und Allmacht jeweils in kontradiktorischer Weise zukommen, wäre zu klären, welche Eigenschaften aus der menschlichen Natur Christus’ ›folgen‹ und welche aus seinem göttlichen Wesen ›folgen‹ und was unter ›folgen‹ hier zu verstehen ist. Versteht man ›göttliches Wesen‹ etwa im Sinne eines ›philosophischen‹ Gottesbegriffs wie im Falle von Anselm oder Descartes, liegt es zumindest nahe, dass die Omni-Eigenschaften daraus ›folgen‹. 64 Siehe J. C. Beall, The Contradictory Christ.
477
Joachim Bromand
aussichtsreiche Option, die Vergleiche mit Trinitätskonzeptionen, die an der klassischen Logik festhalten wollen, nicht scheuen muss. Die dialetheistischen Theologien können dabei als zeitgemäße Fortfüh rung einer Tradition erachtet werden, die sich um alternative Logiken zur Lösung vermeintlicher theologischer Widersprüche bemüht und bereits bis ins Mittelalter zurückreicht.
Literaturverzeichnis Anderson, J., Paradox in Christian Theology, Milton Keynes & Waynesboro: Paternoster Press 2007 Beall, J. C., »Christ – A Contradiction: A Defense of Contradictory Christology«, in: Journal of Analytic Theology 7 (2019), S. 400–433 Beall, J. C., »On Contradictory Christology: Preliminary Remarks, Notation and Terminology«, in: Journal of Analytic Theology 7 (2019), S. 434–439 Beall, J. C., Pawl, T., McCall, T., Cotnoir, A. J., Uckelman, S. L., »Complete Sym posium on J. C. Beall’s ›Christ – A Contradiction: A Defense of Contradictory Christology‹«, in: Journal of Analytic Theology 7 (2019), S. 400–577 Beall, J. C., The Contradictory Christ, Oxford: Oxford University Press 2021 Beall, J. C., Cotnoir, A. J., »God of the gaps: a neglected reply to God’s stone problem«, in: Analysis 77 (2017), S. 681–689 Bromand, J., Kreis, G. (Hg.), Gotteswiderlegungen, Berlin: Suhrkamp, in Vorbe reitung Cotnoir, A. J., »Theism and Dialethism«, in: Australasian Journal of Philosophy 96 (2018), S. 592–609 Cusanus (Nikolaus von Kues), De docta ignorantia/Die belehrte Unwissenheit, Buch I, übers. u. hg. v. P. Wilpert, 4., erw. Aufl. besorgt v. H. G. Senger, Hamburg: Felix Meiner Verlag 1994 Cusanus (Nikolaus von Kues), Philosophisch-Theologische Schriften, 3 Bde., hg. v. L. Gabriel, übers. u. kommentiert v. D. & W Dupré, Freiburg: Herder 2014 Descartes, R., The Philosophical Writings. Vol. III: The Correspondence, hg. von J. Cottingham, R. Stoothoff, D. Murdoch, A. Kenny, Cambridge: Cambridge University Press 1991 Flasch, K., Nikolaus von Kues. Geschichte einer Entwicklung, 3. Aufl., Frankfurt am Main: Klostermann 2008 Flasch, K., Nikolaus von Kues in seiner Zeit. Ein Essay, ergänzte Aufl., Stuttgart: Reclam 2018 Frankfurt, H. G., »The Logic of Omnipotence«, in: The Philosophical Review 73 (1964), S. 262–263 Gelber, H. G., Logic and the Trinity. A Clash of Values in Scholastic Thought, 1300–1335, PhD dissertation, University of Wisconsin-Madison 1974 Gelber, H. G. (Hg.), Exploring the Boundaries of Reason. Three Questions on the Nature of God by Robert Holcot, OP, Toronto: G. Alzani 1983 Grim, P., The Incomplete Universe, Cambridge (MA), London: MIT Press 1991
478
Von der ›Logik des Glaubens‹ zur parakonsistenten Theologie
Halfwassen, J., Auf den Spuren des Einen, Tübingen: Mohr Siebeck 2015 Jaspers, K., Nikolaus Cusanus, Wiederabdruck, München: dtv 1964 (zitiert nach dem Wiederabdruck 1968) Mackie, J. L., »Evil and Omnipotence«, in: Mind 64 (1955), S. 200–212 Priest, G., Beyond the Limits of Thought, 2. Aufl., Oxford: Clarendon Press 2002 Priest, G., An Introduction to Non-Classical Logic, 2. Aufl., Cambridge: Cam bridge University Press 2008 Pseudo-Dionysius Areopagita, Über die mystische Theologie und Briefe, Stuttgart: Anton Hiersemann 1994 Putnam, H., »On Negative Theology«, in: Faith and Philosophy 14 (1997), S. 407–422 Quine, W. V. O., »Two Dogmas of Empiricism«, in: The Philosophical Review 60 (1951), S. 20–43 Roth, U., Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus, Münster: Aschendorff 2000 Slotemaker, J. T., Witt, J. C., Robert Holcot, Oxford: Oxford University Press 2016 Tedder, A., Badia, G., »Currying Omnipotence: A Reply to Beall and Cotnoir«, in: Thought 7 (2018), S. 119–121 Uckelman, S. L., »Contradictions, Impossibility, and Triviality: A Response to J. C. Beall«, in: Journal of Analytic Theology 7 (2019), S. 544–559 Usener, H. (Hg.), Epicurea, Nachdruck, Stuttgart: Teubner 1966 Van Inwagen, P., The Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press 2006 Weber, Z., »Atheism and Dialetheism; or, ›Why I Am Not a (Paraconsistent) Christian‹“, in: Australasian Journal of Philosophy 97 (2019), S. 401–407 Westerkamp, D., Via negativa. Sprache und Methode der negativen Theologie, München: Wilhelm Fink Verlag 2006 White, R. M., »Analogy, Metaphor, and Literal Language«, in: G. Oppy (Hg.), The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of Religion, London, New York: Routledge 2015, S. 219–231 Ziebart, K. M., Nicolaus Cusanus on Faith and the Intellect, Leiden, Boston: Brill 2014
479
Christian Danz
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen Überlegungen zur religionsphilosophischen Grundlegung einer pluralismusoffenen Theologie1
Nachdem die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert die The menfelder Religion und Religionen weitgehend ausgeblendet hatte, kam es am Ende des Säkulums zu einer neuen Aufmerksamkeit auf das Religionsthema. Der religiöse Pluralismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den westeuropäischen Ländern zunehmend bewusster wurde, erreichte auch die akademische Theologie. Berück sichtigung fand er in sogenannten Religionstheologien, denen es um eine Neubestimmung des Verhältnisses der christlichen Sicht nicht christlicher Religionen ging. Angesichts der in den westeuropäischen Metropolen erlebten Koexistenz unterschiedlicher Religionskulturen erwiesen sich traditionelle Vorstellungen von einer Überlegenheit des Christentums als wenig plausibel. Dem sollte in der Theologie durch die Ausarbeitung von pluralistischen Religionstheologien Rechnung getragen werden, denen es um eine Begründung der Gleich-geltung nichtchristlicher Religionen mit der christlichen Religion ging.2 Verständlich wird die Entstehung der neuen pluralismusoffenen Theologie jedoch erst vor dem Hintergrund der theologischen Ent wicklung im 20. Jahrhundert. Es sind vor allem zwei Tendenzen, von denen sich diese Theologien absetzten. Auf der einen Seite etablier ten sich in der protestantischen Theologie seit den 1920er Jahren Konzeptionen, die den Religionsbegriff als Grundlage der Theologie durch die Offenbarung Gottes in Jesus Christus ersetzten. Nicht Religion, sondern Gott und seine Offenbarung seien der Gegenstand 1 Der Beitrag bietet eine Weiterführung von Überlegungen, die ich in meinem Aufsatz »Religious Diversity and the Concept of Religion« ausgeführt habe. 2 Vgl. J. Hick, P. F. Knitter (Hg.), The Myth of Christian Uniqueness.
481
Christian Danz
der Theologie. Einher ging mit diesen theologischen Neuentwürfen eine Einengung der theologischen Themen auf die Lehre von Jesus Christus, die alte Absolutheitsansprüche des Christentums zu erneu ern schien. Dem Christomonismus der protestantischen Theologie stand auf der anderen Seite in der römisch-katholischen Theologie eine substanz-ontologische Reformulierung der Religion gegenüber, mit der ein universaler Inklusivismus verbunden ist. Seinen die römische Theologie prägenden Ausdruck fand dieses cum grano salis vormoderne Religionsverständnis in den Aussagen des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Verhältnis des römischen Katholizis mus zu den nichtchristlichen Religionen. Zwar haben die Religionen dieser Welt Anteil an der Offenbarung Gottes, aber von dieser finden sich in den nichtchristlichen Religionen lediglich Spuren von Heil und Wahrheit, während die vollkommene Gottesoffenbarung in der eigenen römisch-katholischen Religion zu finden sei. Beiden Auffassungen widerspricht das pluralistische Modell der Religionstheologie, da einer bloßen Behauptung von Superioritätsan sprüchen vor dem Hintergrund des religiösen Pluralismus nur wenig Plausibilität zukommt. Demgegenüber müsse von der Theologie eine neue Sicht der nichtchristlichen Religionen ausgearbeitet werden, die es erlaubt, diese Religionen als gleich-gültig mit der eigenen zu würdigen. Es geht somit nicht um eine bloße Beschreibung der Religionsvielfalt, sondern um eine theologische Begründung der Geltung und Wahrheit der geschichtlichen Religionen.3 Allein das, nämlich eine theologische Grundlegung der Wahrheit der Religionen im Gottesgedanken, sei Religionstheologie. Ausgehend von dem Anstoß der pluralistische Religionstheolo gie hat sich in den letzten vierzig Jahren eine breite Debatte entwickelt, in der die unterschiedlichsten Konzeptionen vorgeschlagen wurden.4 Gemeinsam ist diesen Entwürfen, dass sie zu einer positiven Würdi gung nichtchristlicher Religionen durch eine theologische Grundle gung beitragen möchten. Andere Religionen sollen nicht mehr als Vgl. J. Hick, The Interpretation of Religion, S. 1: »The one type of theory that has seldom been attempted is a religious but not confessional interpretation of religion in its plurality of forms; and it is this that I shall be trying to offer here.« Vgl. auch P. Schmidt-Leukel, Religious Pluralism & Interreligious Theology, S. 1. 4 Die Debatte hat sich inzwischen auch lexikalisch Niederschlag gefunden. Vgl. H. M. Vroom, C. Schwöbel, J. D’Arcy May, »Theologie der Religionen«, S. 307–313. Vgl. auch P. F. Knitter, Introducing Theologies of Religions; C. Danz, Einführung in die Theo logie der Religionen. 3
482
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
gegenüber dem Christentum inferiore Religionsgestalten erscheinen, sondern als ebenbürtige.5 Es zeigt sich jedoch, dass dieses Ansinnen mit Schwierigkeiten konfrontiert ist. Zwar wird in allen religionstheo logischen Entwürfen eine Pluralität und Diversität der Religionen zugestanden, aber deren Begründung hebt diese wieder auf. Die genannte Aporie resultiert aus dem zugrunde gelegten Religionsbzw. Gottesbegriff. Einerseits erlaubt er es, das Christentum ebenso wie nichtchristliche Religionen als Religionen aufzufassen, anderer seits führt er dazu, die Religionen als geschichtliche Besonderungen eines ihnen gemeinsamen Allgemeinen zu begreifen. Damit ist jedoch die Eigenständigkeit der anderen Religionen zurückgenommen. Indes wird hier ein anderer Weg eingeschlagen, um zu einer pluralismusoffenen Theologie zu gelangen. Ausgangspunkt des Vor schlags zu einer Neubestimmung einer Religionstheologie ist eben falls der Religionsbegriff. Aber anders als in der religionstheologi schen Debatte wird er nicht als Allgemeinbegriff oder als universale Kategorie verstanden, sondern auf das Christentum bezogen. Er dient ausschließlich der gedanklichen Klärung des Christentums als Religion und wird nicht auf andere Religionen übertragen. Hieraus ergeben sich zwei Konsequenzen für die Konstruktion einer Religi onstheologie. Zunächst eröffnet der vorgeschlagene Ansatz, auf einen uniformen Religionsbegriff zu verzichten, die Möglichkeit, mit einer Pluralität der Bestimmung des Religiösen in den unterschiedlichen Religionen zu rechnen. Bereits das, was Religion ist, wird in den diversen Religionen höchst unterschiedlich verstanden. Sodann geht der Vorschlag von einer anderen Bestimmung des Verhältnisses von Theologie und Religion aus als in der Religionstheologie. Theologie beschreibt weder die Wahrheit der christlichen oder der nichtchristli chen Religionen, noch konstruiert sie eine wahre Religion. Vielmehr ist es die Aufgabe der systematischen Theologie, das Funktionieren der christlichen Religion als ein in sich strukturiertes Geschehen aus der Sicht der diese Religion Praktizierenden zu konstruieren. In den nachfolgenden Überlegungen wird die vorgeschlagene Neubestimmung einer pluralismusoffenen Theologie skizziert. Aus zugehen ist dabei von dem Stand der religionstheologischen Debatte und den mit ihr verbundenen systematischen Problemen. Im zweiten 5 Vor dem Hintergrund des Holocaust setzte in der deutschsprachigen Theologie bereits nach dem Zweiten Weltkrieg ein Umdenken im Hinblick auf das Judentum ein. Vgl. hierzu C. Danz, Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum.
483
Christian Danz
Abschnitt wird ein Religionsbegriff ausgearbeitet, der die Schwierig keiten hinter sich lässt, die mit einem universalen Begriff der Religion verbunden sind. Abschließend ist die Struktur einer pluralismusoffe nen Theologie zu skizzieren, wie sie sich aus den vorgestellten Über legungen ergibt.
1. Der Religionsbegriff der Theologie der Religionen Grundlegend für die gegenwärtige religionstheologische Debatte ist das pluralistische Modell, wie es von John Hick und ihm nachfol gend von Perry Schmidt-Leukel sowie anderen ausgearbeitet wurde.6 Seinem eigenen Anspruch nach stellt es eine weiterführende Alterna tive zu traditionellen Bestimmungen der christlichen Sicht anderer Religionen dar. Weder der sogenannte Exklusivismus der protestan tischen Theologie noch der Inklusivismus der römisch-katholischen Theologie gelangen zu einer angemessenen Würdigung nichtchrist licher Religionen. Für beide Relationsmodelle gebe es letztlich nur eine wahre Religion, nämlich die christliche, während alle anderen Religionen falsch bzw. nicht in der gleichen Weise wahr sind wie das Christentum. Eine solche Sicht der Stellung des Christentums unter den Religionen, wie sie im Exklusivismus und Inklusivismus zum Ausdruck kommt, ist in einer modernen, pluralen Kultur nicht mehr plausibel. Sie ist deshalb durch eine andere Sicht der nicht christlichen Religionen zu ersetzen, die von ihrer grundsätzlichen Gleich-gültigkeit gegenüber dem Christentum ausgeht.7 Ein solches Relationierungsmodell zu begründen, sei die Aufgabe einer Theologie der Religionen. Konstitutiv für das pluralistische Modell ist die kategoriale Unterscheidung zwischen einem strikt transzendenten Absoluten hinter den geschichtlichen Religionen und ihren Göttern und die sen Religionen. Letztere werden als Antworten auf Manifestationen des transzendenten Absoluten verstanden, die jeweils in besondere 6 Vgl. J. Hick, The Interpretation of Religion; P. Schmidt-Leukel, Gott ohne Grenzen; ders., Religious Pluralism & Interreligious Theology. Zum pluralistischen Modell vgl. C. Danz, Einführung in die Theologie der Religionen, S. 70–77; P. F. Knitter, Introducing Theologies of Religions, S. 109–169. 7 Hick bezieht sich dabei auf die sogenannten Weltreligionen, die in der sogenannten Achsenzeit entstanden sind. Vgl. J. Hick, An Interpretation of Religion, S. 21–35.
484
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
Kulturen eingebunden sind, die den religiösen Erfahrungen ihre kulturspezifische Gestalt und Ausdruck verleihen.8 Verbunden mit den religiösen Erfahrungen ist eine Neuausrichtung des Menschen von einer sündhaften »self-centredness to Reality-centredness«.9 Auf der einen Seite steht damit das transzendente Absolute, von dem sich aufgrund seiner Transzendenz außer dieser nichts aussagen lässt, und auf der anderen die geschichtlichen Religionen. Da aber das Absolute strikt transzendent ist, kann keine der geschichtlichen Religionen einen besonderen Zugang zu ihm für sich reklamieren. Wenn das jedoch der Fall ist, dann hat keine geschichtliche Religion einer anderen etwas voraus, so dass sie gleich-gültig sind. Die theologische Begründung der gleichen Wahrheit und Gel tung anderer Religionen mit dem Christentum hängt an dem tran szendenten Absoluten hinter den Religionen. Es fungiert als deren gemeinsamer Grund, auf den sie alle bezogen sind. Aber das tran szendente Absolute ist eine Konstruktion der Religionstheologie, um deren gleiche Wahrheit begründen zu können.10 Wie jedoch verhält sich die theologische Konstruktion der gleichen Wahrheit der geschichtlichen Religionen zur Selbstsicht dieser Religionen, in der das religionstheologische Postulat eines Absoluten hinter den Göttern nicht vorkommt? Bezogen sind die geschichtlichen Religionen auf ihre eigenen Götter und Kulte. Beides steht in Spannung, da die Sicht der geschichtlichen Religionen nicht die der Religionstheologie ist. Folglich hat die Anerkennung der gleichen Wahrheit der Religionen keinen Ort in den Religionen.11 Es ist lediglich die Ebene der Religi onstheologie, auf der die gleiche Wahrheit der Religionen konstruiert wird. Zu zeigen wäre somit, wie die gleiche Wahrheit der Religionen
Vgl. J. Hick, An Interpretation of Religion, S. 236: »We now have to distinguish between the Real an sich and the Real as variously experienced-and-thought by dif ferent human communities. In each of the great traditions a distinction has been drawn, though with varying degrees of emphasis, between the Real […] in itself and the Real as manifested within the intellectual and experiential purview of that tradi tion.« Vgl. ebenso P. Schmidt-Leukel, Religious Pluralism & Interreligious Theology, S. 25. 9 J. Hick, An Interpretation of Religion, S. 240. 10 Vgl. ebd., S. 249: »The answer is that the divine noumenon is a necessary postulate of the pluralistic religious life of humanity.« Vgl. auch P. F. Knitter, Introducing The ologies of Religions, S. 115. 11 Vgl. hierzu F. Wittekind, »Allgemeine Transzendenz – bestimmte Offenbarung?«, S. 169–182. 8
485
Christian Danz
auf der Ebene der Religionen selbst gewusst werden kann.12 Andern falls bleibt sie eine bloße Behauptung der Religionstheologie, die jedoch nicht selbst Religion ist. Es ist jedoch nicht nur das undeutliche Verhältnis von Theo logie und Religion in dem pluralistischen Modell, welches Fragen aufwirft. Auch der zugrunde gelegte Religionsbegriff ist problema tisch. Ihm zufolge ist Religion eine kulturgebundene Antwort auf Manifestationen des transzendenten Absoluten, die mit einem Über gang von Selbst- zu Realitätsbezogenheit verbunden ist. Damit ist ein universaler Religionsbegriff etabliert, nach dem in allen Religio nen ein identisches Wesen anzusetzen ist.13 In den geschichtlichen Religionen geschieht dasselbe, nur die kulturgebundene Oberfläche unterscheidet sich. Der dem Modell zugrunde gelegte Religionsbegriff hebt die Pluralität und Verschiedenheit der Religionen auf, indem er deren kulturbedingte Differenzen als kulturbedingte Oberfläche unwesentlich werden lässt. Auf diese Weise wird die zugestandene Diversität der Religionen im Religionsbegriff wieder aufgehoben bzw. monistisch reformuliert. Ging es dem pluralistischen Modell um eine Begründung der Gleich-gültigkeit der geschichtlichen Religionen, so gelangt sie zu dieser nur durch eine monistische Auflösung der Reli gionspluralität. 12 In seinem Buch Religious Pluralism & Interreligious Theology hat Perry SchmidtLeukel versucht, das pluralistische Modell auf die theologischen Selbstdarstellungen anderer Religionen zu übertragen, so dass die Funktion einer interkulturellen Theo logie in der Exekution des religionstheologischen Pluralismus in den diversen Reli gionen besteht. Vgl. P. Schmidt-Leukel, Religious Pluralism and Interreligious Theol ogy, S. 113: »The first step can be called a pluralist integration of different religions. The second step is the joint and reciprocal integration of different religion-specific plu ralisms within a process of multiperspectival exchange. Only the second step will con firm the validity of the first step and will prevent it from degenerating into the quasipluralism of the primus-inter-pares position. […] And this second step can be taken only within the broader context of interreligious theology.« Aber es bleibt auch hier das Problem, wie sich die theologische Konstruktion zur Selbstsicht der jeweiligen Religionen verhält. 13 Vgl. J. Hick, »Eine Philosophie des religiösen Pluralismus«, S. 304–318, hier S. 305: »Diese Umwandlung ist innerhalb der verschiedenen religiösen Kontexte, in denen sie sich ereignet, in ihrem Wesen dieselbe [!]: Ich würde sie formal definieren als die Umwandlung der menschlichen Existenz von der Selbst-Zentriertheit zur Rea litäts-Zentriertheit. Dies ist ein Ereignis bzw. der Prozeß von vitaler Bedeutung, den man bei einzelnen Menschen überall auf der Welt beobachten kann, und der innerhalb der Kontexte jener unterschiedlichen Wahrnehmungen des Unbedingten (›Ultimate‹), die die verschiedenartigen religiösen Traditionen eröffnen, jeweils unterschiedliche Formen annimmt.«
486
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
Angesichts der angesprochenen Probleme, die mit dem plura listischen Modell verbunden sind, wundert es nicht, dass in der religionstheologischen Debatte bald neue Wege eingeschlagen wur den. Wichtige Alternativen und Weiterführungen der pluralistischen Religionstheologie sind in der Ausarbeitung von neuen Formen des Inklusivismus und der komparativen Theologie zu sehen. In beiden Formen wird an der Intention festgehalten, zu einer positiven Wert schätzung nichtchristlicher Religionen zu gelangen. Anders als im pluralistischen Modell gehen diese religionstheologischen Konzep tionen von der eigenen Religion aus. Hicks ›Real an sich‹ hinter den Göttern der Religionen wird durch den Gott der eigenen Religion ersetzt. Dadurch soll die Standpunktgebundenheit der Religionstheo logie, von der auch der Pluralismus nicht abstrahieren kann, in die theologische Theoriebildung aufgenommen werden. Auf diese Weise gehen Formen eines neuen Inklusivismus von dem christlichen Gottesgedanken aus und setzen diesen als Grund lage der Religionstheologie an. Vermeiden möchte man freilich das mit inklusivistischen Konzeptionen verbundene Dilemma, religiöse Andersheit als unbewusste Form der christlichen Religion zu kon struieren.14 Einige Autoren gehen deshalb von einem sogenannten mutualen Inklusivismus aus, d.h. von einer wechselseitigen Kon struktion der jeweils anderen Religion aus der Sicht der jeweiligen eigenen.15 In den neuen inklusivistischen Konzeptionen bleibt jedoch der Gottesgedanke der übergeordnete Rahmen einer Begründung der gleichen Geltung der nichtchristlichen Religionen mit dem Chris tentum. Im Rückgriff auf die christliche Religion setzt man den trinitarischen Gott als Begründung der Religionsvielfalt an. Auch das kann unterschiedliche Formen annehmen, indem die zweite Person der Trinität für das Christentum reserviert wird und Gott der Vater und/oder der Heilige Geist gleichsam universalisiert und auf die nichtchristlichen Religionen übertragen werden.16 Indem aber an dem Gottesgedanken als übergeordneten Rah men der Religionstheologie festgehalten wird, alle geschichtlichen 14 Klassisch ist diese Form des Inklusivismus von dem katholischen Theologen Karl Rahner ausgearbeitet worden. Vgl. K. Rahner, »Das Christentum und die nichtchrist lichen Religionen«, S. 136–158. 15 Vgl. R. Bernhardt, Ende des Dialogs? Zur Debatte vgl. P. F. Knitter, Introducing Theologies of Religions, S. 216–237. 16 Vgl. R. Bernhardt, Ende des Dialogs?, S. 206–275; S. M. Heim, »The Depth of the Riches: Trinity and Religious Ends«, S. 387–402.
487
Christian Danz
Religionen also auf diesen Gott bezogen sind, bleibt es ebenso beim Inklusivismus und seinen Problemen wie bei einem monistischen Religionsbegriff, der die Diversität der geschichtlichen Religionen auflöst. Auch in dem neuen Inklusivismus ist in allen Religionen ein identischer Kern behauptet, der sich der religionstheologischen Konstruktion verdankt. Denn derselbe Gott, der als Grundlage der verschiedenen Religionen postuliert wird, hebt deren Verschiedenheit auf. Daran ändert auch die Trinitätslehre nichts, da diese keine neu trale Grundlage darstellt, sondern Ausdruck und Darstellung des christlichen Gottesverständnisses ist. Unklar bleibt in dem neuen Inklusivismus ebenfalls das Verhältnis von religionstheologischer Konstruktion und Religion, also die Frage, wie die gleiche Wahrheit der Religionen in der konkreten Religion selbst vorkommt. Anders als das pluralistische Modell und der neue Inklusivismus verfährt die komparative Theologie. Auch sie will zu einer positiven Sicht nichtchristlicher Religionen durch die christliche gelangen.17 Hierzu gehen diese Theologen nicht mehr von einem universalen Religionsbegriff aus, sondern von der eigenen Religion, von der bestimmte Elemente, Erzählungen, Inhalte, Riten etc. mit denen einer anderen Religion verglichen werden.18 In den Fokus der Religions theologie tritt die konkrete Begegnung mit einer anderen Religion, wobei der Austausch über einzelne Elemente zu einem besseren Verständnis der eigenen Religion und religiösen Tradition führen soll. Damit ist der Religionsbegriff, der die Grundlage für eine Fundierung des religiösen Pluralismus im pluralistischen Modell und im neuen Inklusivismus bildete, zurückgestellt. Ausgeschaltet scheint somit prima vista auch eine monistische Reduktion der Religionen durch einen universalen Religionsbegriff. Festgehalten wird aber in der komparativen Theologie an dem Gottesgedanken als Grundlage der Religionsvielfalt. Zwar rückt der Vergleich von konkreten Elementen Vgl. R. Bernhardt, K. v. Stosch (Hg.), Komparative Theologie; K. v. Stosch, Kompa rative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen; M. Khorchide, K. v. Stosch, Der andere Prophet; F. X. Clooney, »Comparative Theology. A Review of Recent Books (1989–1995)«, S. 521–550. 18 Vgl. J. J. Thatamanil, The Immanent Divine, S. 3: »Comparative theologians are not content to think generally about the meaning of religious diversity for Christian faith. Instead they wish to engage specific texts, motifs, and claims of particular traditions not only to understand better these traditions but also to determine the truth of the ological matters through conversation and collaboration.« Zur komparativen Theo logie vgl. P. F. Knitter, Introducing Theologies of Religions, S. 202–215. 17
488
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
von zwei Religionen in den Fokus, aber wie ist es methodisch mög lich, solche Elemente ohne Einbeziehung des Gesamtsystems der jeweiligen religiösen Traditionen19 sowie einer Vergleichsebene zu vergleichen? Woran erkennt man überhaupt, dass es sich bei diesen Elementen um Religion handelt? Es wird entweder vorausgesetzt, dass es sich bei ihnen um Religion handelt, oder es muss eine Vergleichsebene konstruiert werden, die es erst erlaubt, die einzelnen Elemente von zwei Religionen aufeinander zu beziehen.20 In der komparativen Theologie verschiebt sich indes lediglich das Problem. Denn zum Vergleich der religiösen Elemente von zwei Religionen ist ein Religionsbegriff bereits vorausgesetzt, sonst könnte man diese Elemente gar nicht vergleichen. Aber ein Religionsverständnis wird nur in Anspruch genommen, jedoch selbst nicht geklärt. Ebenso bleibt in der komparativen Theologie das Verhältnis von Theologie und Religion unklar. Damit aber auch die Frage, wie die religionstheolo gisch postulierte gleiche Wahrheit der Religionen, in die Selbstsicht der einzelnen Religionen aufgenommen werden kann.21 Deshalb ist es nicht überraschend, dass komparative Theologien einem latenten Inklusivismus verpflichtet bleiben, der die zugestandene Religions vielfalt monistisch aufhebt.22 Als neuralgischer Punkt der skizzierten religionstheologischen Konzeptionen zeigte sich der Religionsbegriff. Legt man einen uni versalen Religionsbegriff zugrunde, dann ist man mit dem Problem konfrontiert, dass dieser die Diversität der geschichtlichen Religionen aufhebt. Diese kommen dann lediglich als Besonderungen eines übergeordneten Allgemeinen in den Blick. Zu einer Anerkennung der Pluralität der Religionen gelangt man auf diese Weise nicht. Zudem bleibt das Verhältnis von Theologie und Religion in den diskutierten Dass ein Vergleich von einzelnen Elementen einer Religion ohne Einbeziehung des jeweiligen Religionssystems nicht möglich ist, betont K. v. Stosch, »Komparative Theologie als Hauptaufgabe der Theologie der Zukunft«, S. 15–33, bes. S. 21f. 20 So J. J. Thatamanil, The Immanent Divine, S. 12–16, im Anschluss an R. N. Neville, Normative Cultures, S. 74–81. 21 Vgl. K. v. Stosch, »Komparative Theologie als Hauptaufgabe der Theologie der Zukunft«, S. 18: »Zugleich muss diese Bemühung Wahrheitsansprüche anderer reli giöser Traditionen positiv in die eigenen Reflexionen zu integrieren versuchen.« 22 Besonders deutlich wird das in der komparativen Theologie von Klaus von Stosch. Im Hinblick auf das Judentum bleibt es bei ihm bei einer inklusivistischen Reformu lierung religiöser Alterität. Vgl. K. v. Stosch, Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, S. 255–291. Vgl. auch ders., »Komparative Theologie als Hauptaufgabe der Theologie der Zukunft«, S. 25. 19
489
Christian Danz
Modellen unklar. Eine Begründung der gleichen Wahrheit der Reli gionen lässt sich lediglich in der Religionstheologie konstruieren. Aber wie verhält sich diese Wahrheit der Theologie zu der der Religionen? Um in der Theologie zu einer Pluralismusfähigkeit zu gelangen, reicht die bisherige religionstheologische Debatte nicht aus. Diese ist auf eine neue religionstheoretische Grundlage zu stellen, die es erlaubt, sowohl die Besonderheit als auch die Absolutheit der einzelnen Religionen anzuerkennen.
2. Religion als Kommunikation Grundlage der gegenwärtigen Religionstheologie ist ein universaler Religionsbegriff. Mit ihm ist das Dilemma verbunden, dass die Diver sität der geschichtlichen Religionen durch ihn monistisch aufgelöst wird. Vermeiden lässt sich die genannte Konsequenz nur durch einen Verzicht auf einen universalen Religionsbegriff, der allen geschicht lichen Religionen als gemeinsamer Bezugspunkt zugrunde liegt. Deshalb wird hier der Vorschlag unterbreitet, von einer Pluralität des Religiösen und des Verständnisses von Religion auszugehen. Ein universaler Religionsbegriff wird also fallengelassen und stattdessen von einer Pluralität der Bestimmung dessen ausgegangen, was unter Religion zu verstehen ist. Nur so kann an der Besonderheit und Absolutheit der geschichtlichen Religionen festgehalten und deren Auflösung in eine unbestimmte Transzendenz vermieden werden.23 In den Vorschlag ist die Kritik an einem universalen Religionsbe griff aufgenommen, wie sie im 20. Jahrhundert sowohl in Religions wissenschaft, Religionsphilosophie als auch in der Theologie vorge bracht wurde. Von der protestantischen Theologie der Aufklärung wurde der Religionsbegriff als Grundlage einer Neubestimmung der Theologie als Wissenschaft eingeführt. Notwendig war dies, da das Theologie verständnis des alten Protestantismus des 16. und 17. Jahrhunderts unter den veränderten Erkenntnisbedingungen nicht mehr fortsetzbar war, wenn an dem Wissenschaftsverständnis der Theologie festgehal ten werden sollte. Ausgangspunkt und Prinzip der altprotestantischen Theologie waren die Bibel als Heilige Schrift sowie ein gegenständ 23 Vgl. hierzu den Vorschlag von F. Wittekind, »Allgemeine Transzendenz – bestimmte Offenbarung?«.
490
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
liches Verständnis von Gott als Gegenstand der Theologie. Beide Voraussetzungen löste die Aufklärung durch die historische Bibelkri tik und die Erkenntniskritik auf. Daraus resultierte die Notwendig keit einer Neubegründung der Theologie als Wissenschaft. An die Stelle der unfehlbaren Bibelautorität und des Gottesgedankens trat der Religionsbegriff, der in den in Folge der Kantischen Vernunftkri tik in den 1790er Jahren entstehenden Religionsphilosophien eine bewusstseinstheoretische Fassung erhielt. In den religionsgebunde nen Grundlegungen der Theologie seit der ›Sattelzeit der Moderne‹ (Reinhart Koselleck) ist nicht mehr Gott der Gegenstand der Theo logie, sondern das Gottesbewusstsein des Menschen. Eingeordnet wird die Religion in die Grundlegungsfunktion des Bewusstseins und seine Vermögensstruktur von Denken, Handeln und Fühlen. Durch diese Fundierung ist die Allgemeinheit der Religion begrün det. Sie gehört gleichsam zur vermögenstheoretischen Ausstattung des Menschen, so dass auch jeder Mensch als religiös in Anspruch genommen werden kann. Die humane Allgemeinheit der Religion, die den alten Gottesgedanken beerbt, ist jedoch nur ein Aspekt der religionsphilosophischen Grundlegungen um 1800. Hinzu kommt zweitens ein reflexives Verständnis der Religion. Als Bestandteil der Vermögenstruktur des Bewusstseins ist Religion in jedem Menschen angelegt. Ihre Aktualisierung im Menschen, die nun als Offenbarung, nämlich als Entstehung der Religion, beschrieben wird, ist verbunden mit symbolischen Formen, in denen sich die innere Religion, die selbst nicht zugänglich ist, darstellt. Diese religiösen Inhalte verweisen aber nicht mehr auf Gegenstände jenseits des Bewusstseins, sondern auf Religion als Bestandteil der Vermögensstruktur des Geistes. In den inhaltlichen Bestandteilen einer geschichtlichen Religion stellt sich nun die Religion als ein eigener Bereich der Kultur selbst dar. Um 1900 kommen diese religionsphilosophischen Grundlegun gen der Religion in der Vermögenstruktur des Bewusstseins vor dem Hintergrund der zunehmenden Ausdifferenzierung der Kultur in eine Krise. Durch den voranschreitenden Modernisierungsprozess verliert die Einordnung der Religion in die allgemeine Grundlegungsfunktion des Bewusstseins ihre Plausibilität. In der protestantischen Theologie, die vor dem Hintergrund der Ausdifferenzierung der religionsbezoge nen Wissenschaften ihr Verständnis als Wissenschaft neu bestimmen muss, wird der Plausibilitätsverlust von vermögenstheoretischen Religionsbegriffen als theologische Religionskritik aufgenommen. Diese ist nicht als Kritik an der Religion überhaupt zu verstehen,
491
Christian Danz
sondern als Kritik an den Voraussetzungskonstruktionen einer reli giösen Anlage in der Vermögenstruktur des Bewusstseins, wie sie das 19. Jahrhundert ausgearbeitete. Religion wird in den seit dem Ende des Ersten Weltkriegs entstehenden theologischen Konzeptionen als ein unableitbares Reflexionsgeschehen im Bewusstsein verstanden, von Vermögensstrukturen abgelöst und nun in der Theologie selbst beschrieben. Dafür stehen die theologischen Neubestimmungen der Religion als Offenbarung Gottes sowie als Glaube. Die theologische Kritik am Religionsbegriff in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zielt auf ein Neuverständnis der Religion. Diese ist dann keine Anlage mehr, die im Menschen von Natur aus mitgegeben ist, sondern ein an ihren unableitbaren Vollzug gebundenes Geschehen, welches um ihre Vollzugsbindung und Unableitbarkeit weiß. Beibehalten wird jedoch auch hier noch ebenso die Allgemeingültigkeit der Religion sowie ein reflexives Religionsverständnis. Denn die inhaltlichen Aussagen der Religion haben einen reflexiven Sinn und keinen gegenständli chen. Sie beschreiben die reflexive Struktur des religiösen Akts und seinen Geschehenscharakter. Aber nicht nur in der protestantischen Theologie, auch in den religionsphilosophischen und religionswissenschaftlichen Debatten des 20. Jahrhunderts ist ein universaler Religionsbegriff zunehmend in die Kritik geraten.24 Viele Religionstheoretiker argumentierten in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, der Begriff der Religion entstamme einer besonderen Religionskultur, nämlich dem neuzeitli chen Christentum. In seine Ausformulierungen seien Unterscheidun gen und Motive eingegangen, die sich in anderen Kulturen, aber auch im antiken und mittelalterlichen Christentum selbst nicht finden.25 Deshalb könne der Religionsbegriff nicht auf andere Kulturen über tragen werden, da diese weder einen allgemeinen Religionsbegriff noch die Unterscheidungen kennen, die für diesen konstitutiv sind.26 Insofern sei die Verwendung des Religionsbegriffs zur Erfassung nichtchristlicher Kulturen nichts anderes als eine Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln, nämlich denen der Wissenschaft. Vgl. hierzu M. Riesebrodt, Cultus und Heilsgeschehen, S. 17–107. Vgl. B. Nongbri, Before Religion. 26 Inzwischen wird diskutiert, ob man das antike Judentum des Zweiten Tempels als Religion verstehen könne, da der Religionsbegriff und seine Unterscheidungen dem neuzeitlichen Christentum entstammen. Viele Forscher plädieren deshalb dafür, vom antiken Judentum als einer Ethnie zu sprechen und nicht von einer Religion. Vgl. hierzu C. Danz, Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum, S. 178–187. 24 25
492
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
Was folgt aus der skizzierten Kritik am Religionsbegriff für seine Verwendung in der Religionsphilosophie und der Theologie? Deutlich ist, dass seine Verwendung nur möglich ist, wenn die Kritik an einem universalen Religionsbegriff aufgenommen wird. Als ein universaler Begriff, der gleichsam zur conditio humana gehört, da er in der Vermögensstruktur des Bewusstseins verankert ist, ist der Religionsbegriff nicht mehr aufrecht zu erhalten. Beides, seine Allge meinheit und seine anthropologische Notwendigkeit sind in einer Neubestimmung fallen zu lassen. Stattdessen ist der Religionsbegriff auf die christliche Religion zu beziehen und als Beschreibung des Christentums als Religion auszuarbeiten. Der Religionsbegriff dient der gedanklichen Selbstklärung der christlichen Religion und lässt sich als solcher nicht auf andere Religionen übertragen. In eine religionsphilosophische Grundlegung der Theologie ist die Sicht der Glaubenden auf ihre Religion aufzunehmen. Ohne eine Einbeziehung der Teilnehmerperspektive lässt sich ein angemessener Begriff der Religion nicht konzipieren.27 Allein das unterscheidet einen theolo gischen Religionsbegriff von anderen Beschreibungen der Religion. Aufgabe der Theologie ist es somit, die christliche Religion als ein selbstbezogenes Kommunikationsgeschehen zu erklären. Das ist der Theologie, die nicht selbst Religion, sondern Wissenschaft ist, nur vor dem Hintergrund der von ihr selbst vorgenommenen Unterschei dung von Theologie und Religion möglich. Systematische Theologie begründet also die christliche Religion nicht, sie konstruiert diese, die es bereits unabhängig von ihr gibt, als ein um sich wissendes, selbstbezogenes und strukturiertes Geschehen, das an Kommunika tion gebunden ist.28 Auf diese Weise wird die christliche Religion als eine in der Kul tur ausdifferenzierte Form der Kommunikation verstanden, die sich selbst als Religion versteht und als solche in der Kultur weitergegeben wird. Grundlage der christlichen Religion ist weder ein religiöses Sub jekt noch ein religiöses Objekt, aus dem die Religion hergeleitet wer den könnte. Beides, Subjekt und Objekt der Religion, sind vielmehr Bestandteile der christlichen Religion, die mit ihr zusammen erst entstehen. Aufgenommen ist sowohl die Umstellung vom Gottesauf den Religionsbegriff wie ihn die Theologie des 19. Jahrhunderts vorgenommen hat, als auch die Kritik an vermögenstheoretischen 27 28
So zu Recht M. Riesebrodt, Cultus und Heilsgeschehen, S. 108f. Vgl. hierzu C. Danz, Gottes Geist, S. 101–139.
493
Christian Danz
Religionsbegriffen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Beide Ableitungen der Religion werden ersetzt durch die religiöse Kommu nikation, die ein dreipoliges Wechselverhältnis darstellt. Als Religion entsteht die christliche allein in ihrer verstehenden Aneignung und symbolischen Darstellung durch Einzelne. Das setzt die christliche Religion als eine in der Kultur ausdifferenzierte religiöse Kommuni kation bereits voraus. Damit sich jedoch Religion konstituiert, muss die christlich-religiöse Kommunikation von Einzelnen angeeignet und als Religion gebraucht werden. Auf eines der drei Elemente lässt sich die christliche Religion nicht zurückführen, sie entspringt vielmehr aus dem triadischen Wechselverhältnis von Abhängigkeit, Aneignung und Darstellung und mit diesem zusammen. Zu ihrer Entstehung setzt die christliche Religion bereits Reli gion voraus. Religion entsteht aus sich selbst.29 Anders als in ver mögenstheoretischen Religionstheorien wird Religion hier nicht als eine dem Menschen mitgegebene Anlage verstanden, aus der sie entspringt. Eine solche ist nichts anderes als eine Hypostasierung des geschichtlichen Eingebundenseins jeder Religion, von der auszuge hen ist. Es muss also in der Kultur christlich-religiöse Kommunikation geben, die sich auf die Weitergabe der religiösen Erinnerung an Jesus Christus bezieht. Dass die christliche Religion zu ihrer Entstehung sich selbst bereits voraussetzt, bedeutet freilich nicht die Vorausset zung eines bestimmten Glaubensverständnisses oder eines Gottesbe griffs. Vorauszusetzen ist lediglich religiöse Kommunikation, die sich auf Jesus Christus bezieht. Aber die christlich-religiöse Kommunika tion, die in der Kultur durch diverse Medien weitergegeben wird, ist nur ein Hinweis auf Religion, selbst aber noch nicht Religion.30 Zwar muss die christlich-religiöse Kommunikation eine inhaltlich bestimmte sein, anderes wäre sie nicht als solche zu erkennen, aber aus den inhaltlichen Bestimmungen folgt noch nicht, dass es sich bei dieser Kommunikation um Religion handelt. So lässt sich aus dem Vorkommen und dem Gebrauch des Gottesbegriffs in der Kom munikation gerade nicht auf das Vorliegen von Religion schließen, da die Inhalte jederzeit auch nichtreligiös benutzt werden können. Zur Religion wird die in der Kultur bereits ausdifferenzierte christlich-reli giöse Kommunikation erst dann, wenn sie als Religion angeeignet Vgl. R. Otto, Das Heilige, S. 160: »Religion fängt mit sich selber an und ist selber schon in ihren ›Vorstufen‹ des Mythischen und Dämonischen wirkend.« 30 Zwischen religiöser Tradition und Religion ist zu unterscheiden. 29
494
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
und gebraucht wird. Beides sind eigene Elemente der Religion, die in den Überlieferungen nicht enthalten sind. Das religiöse Verstehen ist das zweite Strukturelement der Religion. Ohne verstehende Aneignung der christlich-religiösen Überlieferung kann das Christentum als Religion nicht entstehen. Dabei bleibt die eigene Aufnahme der religiösen Kommunikation unableitbar, da die vorgegebene Erinnerung an Jesus Christus stets auch anders als religiös benutzt werden kann. Von dem religiösen Verstehen, wie es hier als Strukturelement der Religion gebraucht ist, ist jede Vorstellung eines authentischen oder eigentlichen Verstehens fernzuhalten. Vielmehr besteht das religiöse Verstehen in der Unter scheidung von Mitteilung und gemeinten religiösem Sinn.31 Religiö ses Verstehen heißt, die Inhalte der Kommunikation als Ausdruck und Darstellung von Religion zu verstehen. Christlich-religiöse Inhalte fungieren in der christlichen Religion nicht in einem gegenständlichen Sinne. Sie bezeichnen keine Gegenstände, so dass ihr ›kultureller Sinn‹ geradezu negiert wird.32 Im religiösen Verstehen artikuliert sich Religion, die erst im Gebrauch der Kommunikation entsteht. Genau das muss verstanden werden, wenn die Überlieferung von Jesus Christus als Religion angeeignet wird. Religion hängt nicht nur am verstehenden Aneignen der in der Kultur vorgegebenen christlich-religiösen Kommunikation, sondern auch an der Benutzung zur symbolischen Artikulation der eigenen Religion durch Einzelne. Religiöse Darstellung bezeichnet das dritte Strukturmoment der christlichen Religion. Ohne religiöse Artikula tion, also den eigenen schöpferischen Gebrauch der aufgenommenen überlieferten religiösen Erinnerung an Jesus Christus, konstituiert Verstehen wird hier im Anschluss an Niklas Luhmann als Unterscheidung von Mitteilung und Information gefasst, durch die erst Kommunikation entsteht. Vgl. N. Luhmann, Soziale Systeme, S. 191–241. 32 Das ist der Grund, weshalb in den Religionstheorien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Entstehung der religiösen Formen mit einer Negation versehen wird. Vgl. nur P. Tillich, »Religiöser Stil und religiöser Stoff in der bildenden Kunst«, S. 88– 99, hier S. 96: »Es hat also der religiöse Stil, auf profane Gegenstände angewendet, immer etwas zu überwinden, den Eigengehalt des Stoffes, der ja nicht religiös ist und erst durch Negierung seiner profanen Beziehungen ins Religiöse erhoben werden muß.« Der Transzendenzbegriff ist folglich nicht wie in der pluralistischen Religions theologie als eine Substanz hinter den religiösen Symbolen zu verstehen, auf den diese verweisen. Vielmehr bezeichnet die Transzendenz Gottes eine Funktion für die Reli gion, nämlich die, dass Religion erst im und durch die Negation des gegenständlichen Verständnisses ihrer Aussagen, also durch ihren religiösen Gebrauch entsteht. 31
495
Christian Danz
sich die christliche Religion nicht. Sichtbar in der Kultur und damit existent wird die christliche Religion nur, indem sie sich in symbo lischen Formen darstellt. Eine innere oder unsichtbare Religion ist ein bloßes Postulat.33 Es verdankt sich einer Zuschreibung, die sich nicht überprüfen lässt, da eine solche unsichtbare Religion gar nicht sichtbar ist. Religion muss in der Kultur sichtbar und beobachtbar sein, ansonsten kann sie kein Bestandteil der Kultur sein, da sie gar nicht erkennbar wäre. Deshalb gelingt die religiöse Kommunika tion erst dann, wenn die verstehend angeeignete christlich-religiöse Kommunikation von Einzelnen zu symbolischen Darstellungen und Artikulationen ihrer Religion benutzt wird. Allein, die Benutzung der christlich-religiösen Kommunikation als Religion und gleichsam ihr Entstehen hängt an allen drei Elementen in ihrem Zusammenhang und lässt sich nicht auf eines zurückführen. Christliche Religion entspringt in und aus einem triadischen Kommunikationsgeschehen, das sich selbst als Religion versteht und bezeichnet. Mit dem skizzierten Religionsbegriff, der Religion als ein in Kommunikation eingebundenes Geschehen auffasst und es auf die christliche Religion bezieht, sind wichtige Konsequenzen verbunden, die abschließend noch zu benennen sind. Zunächst ist die christliche Religion selbstbezüglich. Sie bezieht sich ausschließlich auf sich selbst als Religion. In diesem Sinne ist die christliche Religion absolut. Absolutheit der Religion meint freilich kein inhaltliches Merkmal, sie ist vielmehr nichts anderes als Ausdruck der Selbstbezüglichkeit der christlichen Religion. Zweitens sind die inhaltlichen Aussagen der christlichen Religion keine Darstellungen von Gegenständen, die es unabhängig von ihr oder als Voraussetzung der Religion gibt. Gott, Christus, der Heilige Geist etc. sind Bestandteile der christlichen Religion, in und mit denen diese sich selbst und ihr Funktionieren als Religion darstellt und reflektiert. Mit ihnen beschreibt das Chris tentum die Besonderheit seines Verständnisses von Religion. Und schließlich ist das Wissen der Religion Praktizierenden, dass sie Religion kommunizieren, ein konstitutiver Bestandteil der christli chen Religion. Ohne ein solches Wissen ist das Christentum als Religion nicht möglich. Ebenso wenig wie eine unsichtbare Religion kann es eine unbewusste oder implizite Religion geben. Für eine wissenschaftliche Konstruktion der christlichen Religion sind solche 33
Vgl. T. Luckmann, Die unsichtbare Religion.
496
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
Allgemeinheitspostulate ungeeignet und mithin restlos auszuschei den. Damit ist ein Religionsbegriff ausgeführt, der als Grundlage einer pluralismusoffenen Theologie dienen kann.
3. Theologie im religiösen Pluralismus Grundlage einer pluralismusoffenen Theologie bleibt ein Begriff der Religion. Er wird jedoch nicht mehr als Universalbegriff verstanden, sondern auf die christliche Religion beschränkt. Zu ihrer Klärung als Religion dient der Religionsbegriff. Erst diese Selbstbeschränkung des Religionsbegriffs eröffnet die Möglichkeit, in der Theologie eine Pluralität des Verständnisses von Religion sowie der Bestimmung des Religiösen einzuräumen und anzuerkennen. Die geschichtlichen Reli gionen werden nicht mehr als Besonderungen eines ihnen zugrund liegenden Allgemeinen verstanden. Sie sind hingegen eigenständige Bestimmungen des Religiösen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Geschichte, die selbst einem Wandel unterliegen. Zudem erlaubt es der vorgeschlagene Religionsbegriff, der Religion an ihren bewuss ten Gebrauch bindet und sie als eine kontingente kommunikativ hergestellte Deutung der Welt versteht, nichtreligiöse Lebensweisen als grundsätzlich berechtigt anzuerkennen. Das Dilemma von Religi onsbegriffen, die Religion in der conditio humana verankern, dass deren Nichtaktualisierung als humanes Defizit erscheint, ist damit vermieden. Religion ist kein notwendiger Bestandteil des Mensch seins, sondern eine geschichtlich gewordene und ausdifferenzierte Deutungssicht der Welt. Indem geschichtliche Religionen nicht mehr als Besonderungen eines ihnen gemeinsamen Allgemeinen verstanden werden, rückt deren jeweilige Besonderheit und Absolutheit in den Blick. Anders als in der bisherigen Religionstheologie werden auf diese Weise die Dif ferenzen zwischen den Religionen nicht unterlaufen oder nivelliert. Denn eine Ausschaltung und Marginalisierung von theologischen Differenzen zwischen den Religionen führt, wie die Debatten um eine Neubestimmung des Verhältnisses von Christentum und Judentum seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts deutlich machen, zu
497
Christian Danz
deren Vereinnahmung.34 Wenn es nämlich keine Unterscheide zwi schen den Religionen gibt, können sie auch nicht als eigenständige religiöse Zeichensysteme anerkannt werden. Deshalb kann es auch nicht die Aufgabe der Theologie sein, den religiösen Pluralismus oder die gleiche Wahrheit der Religionen zu begründen. Theologie fundiert weder die Wahrheit der christlichen noch die der anderen Religionen. Von einem solchen Verständnis von Religionstheologie ist Abschied zu nehmen, da es nicht über eine monistische Reformulierung der Diversität der Religionen hinausgelangt. Aufgabe der Theologie ist es demgegenüber, das Funktionieren der christlichen Religion aus der Sicht der diese Praktizierenden zu beschreiben. Damit stellt sich die Frage, wie andere Religionen in der Selbstsicht einer Religion überhaupt vorkommen. Systematische Theologie ist Wissenschaft von der christlichen Religion, aber selbst nicht Religion. Sie konstruiert in ihr als Wissen schaft die christliche Religion. Ihr Bild der Religion ist ein Konstrukt, das sie in sich selbst herstellt. Anders kann sich die Theologie nicht auf ihren Gegenstand beziehen oder von ihm wissen. So wenig wie sie eine Verlängerung der Religion oder des Glaubens in die Wissenschaft hinein ist, ebenso wenig ist Theologie der Ort, an dem über die Wahrheit der christlichen Religion verfügt wird.35 Beides hebt den Wissenschaftscharakter von Theologie auf. Diese beschreibt vielmehr die christliche Religion, die es unabhängig von ihr bereits gibt, als ein strukturiertes, selbstbezügliches und um sich als Religion wissendes Kommunikationsgeschehen. Theologie muss erklären können, wie das Christentum als Religion aus der Teilnehmerperspektive funktio niert. Sie ist jedoch kein Ort einer Religionsstiftung. Damit ist es aber auch gar nicht möglich, in der Theologie eine gleiche Wahrheit der geschichtlichen Religionen zu konstruieren, diese als die eigentliche religiöse Haltung zu postulieren und auf die christliche Religion zu übertragen. In und mit ihren inhaltlichen Bestimmungen beschreibt die christliche Religion sich selbst als Religion und wie sie als solche in der Geschichte weitergegeben wird. Ihre gegenständlichen Aussagen beziehen sich auf sie selbst als Religion und fungieren als Ausdruck 34
Vgl. hierzu C. Danz, Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum, S. 7–
89. 35 Vgl. hierzu die Überlegungen von J. Fischer, »Christlicher Wahrheitsanspruch und die Religionen«, S. 187–203.
498
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
und Reflexion von Religion in ihr. Andere Religionen und deren Wahrheit kommen in der Selbstsicht der christlichen Religion gar nicht vor. Unter den Bedingungen von modernen, pluralen Kultu ren, modernen Massenmedien und vielem anderen mehr erfolgt die religiöse Kommunikation, in und durch die Religion sich als solche herstellt, von vornherein in einem pluralen Horizont. Dadurch unterliegt die christliche Religion permanenten und divergierenden Selbstbeschreibungen, indem neue Elemente in ihre Darstellung aufgenommen und ältere Beschreibungselemente zurücktreten oder ersetzt werden. Das betrifft auch Elemente und Symbolbestände aus anderen religiösen Traditionen oder der Kultur. Wenn diese jedoch in die christlich-religiöse Kommunikation aufgenommen und als Ausdruck von dieser von den Einzelnen benutzt werden, fungieren sie als Darstellung der christlichen Religion. Religiöse Identitäten gibt es nur als symbolische Selbstdarstellung, die erst in und durch eine sym bolische Selbstherstellung entstehen. An den Inhalten und Zeichen, die in der Kommunikation vorkommen und benutzt werden, lässt es sich gerade noch nicht ablesen, ob sie in einem christlich-religiösen, einem anders-religiösen oder einem nicht-religiösen Sinn verwendet werden. Der religiöse Sinn der Kommunikation hängt ausschließlich am Gebrauch, den Einzelne in einer Kultur von ihr machen. Deshalb können dieselben Zeichen sowohl als Ausdruck und Darstellung christlich-religiöser Identität als auch nichtchristlich-religiöser oder nicht-religiöser Identität verwendet werden. Wenn aber Identitäten in Selbstbeschreibungen erst hergestellt werden, die durchgehend hybride Konstruktionen sind, die in einer geschichtlich gewordenen Kultur stehen und in diese sowie ihre komplexen kulturellen Sym boltransfers verwoben sind, dann ist es ebenso möglich, multiple religiöse Identitäten zu kreieren.36 Aber auch das besagt nicht, dass die Wahrheit anderer Religionen in der eigenen Religionssicht vor kommt. Auch die Theologie bezieht sich nicht auf andere Religionen und ihre Wahrheit. Sie konstruiert die christliche Religion als ein durchsichtiges und selbstbezügliches Kommunikationsgeschehen. Auf diese Weise erklärt die Theologie, wie die christliche Religion aus der Sicht der Glaubenden funktioniert und in der Geschichte weiterge 36 Vgl. hierzu J. Butler, Das Unbehagen der Geschlechter. Zur Konstruktion von multiplen religiösen Identitäten vgl. R. Bernhardt, P. Schmidt-Leukel (Hg.), Multiple religiöse Identitäten.
499
Christian Danz
geben wird. Eine andere Aufgabe hat die Theologie nicht. Aber indem sie ihren Religionsbegriff auf die christliche Religion beschränkt, erkennt sie an, dass in anderen Religionen Religion anders verstanden wird und anders funktioniert als im Christentum. Erst damit bekommt der interreligiöse Dialog eine angemessene Grundlage. Ein Vergleich von einzelnen Elementen von zwei sich begegnenden Religionen, die dann wechselseitig in das jeweils eigene religiöse Selbstverständnis aufgenommen werden, greift erheblich zu kurz. Es sind nämlich nicht die inhaltlichen Bestandteile von Religionen, etwa das Gottes verständnis, durch die sie sich unterscheiden.37 Dieses ist kein den Religionen zugrundeliegendes Allgemeines, so dass die Differenzen zwischen ihnen durch die Einführung von inhaltlichen Merkmalen entstehen. Schon das Gottesverständnis ist kein inhaltliches Element einer Religion, sondern ein reflexives. In ihrem Gottesgedanken stellt die christliche Religion sich selbst als Religion dar. Er ist also Ausdruck und Reflexion von Religion. Eben deshalb sind Christus und der Heilige Geist keine weiteren Inhalte, die das Christentum einem allgemeinen Gottesgedanken hinzufügt, den es zum Beispiel mit dem Judentum teilt. Im trinitarischen Gottesverständnis kommt dagegen zum Ausdruck, dass Religion im Christentum als individuelle Aneig nung Gottes verstanden wird, die von einer religiösen Überlieferung abhängig ist. Es ist die Besonderheit des Religionsverständnisses, wie es sich im Christentum herausgebildet hat, das seine Repräsentation in der trinitarischen Gottesanschauung findet.38 Pluralismusfähig wird die Theologie nicht dadurch, dass sie die Wahrheit anderer Religionen begründet oder deren Wahrheit in die Konstruktion der christlichen Religion aufnimmt. Derartige inklusi vistische Konzeptionen schließen ab ovo Unterschiede zwischen den Religionen aus bzw. marginalisieren diese. Mit dem Unterlaufen der Differenzen und Besonderheiten der geschichtlichen Religionen ist es nicht mehr möglich, nichtchristliche Religionen als eigenständige Zeichensysteme anzuerkennen. Eine Vereinnahmung von religiöser Alterität, und sei sie noch so sublim, lässt sich dann aber auch nicht mehr verhindern. Auf der Ebene der theologischen Theoriebildung kann man diesem fatalen Inklusivismus nur dann entgehen, wenn auf übergreifende Einheitskonzepte wie einen universalen Religions 37 So lassen sich neutestamentliche Evangelien, wie zum Beispiel das des Markus, als Diskussion über judäische Identität lesen, ohne dass sich etwas an ihrem Inhalt ändert. Vgl. hierzu D. Boyarin, Die jüdischen Evangelien. 38 Vgl. hierzu C. Danz, Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum.
500
Der Begriff der Religion und die Vielfalt des Religiösen
begriff oder einen allgemeinen Gottesgedanken verzichtet und von einer Pluralität des Religionsverständnisses in den geschichtlichen Religionen ausgegangen wird. Aber auch nur durch eine solche Selbstbeschränkung wird die akademische Theologie offen für den religiösen Pluralismus.
Literaturverzeichnis Bernhardt, R., Ende des Dialogs? Die Begegnung der Religionen und ihre theologi sche Reflexion, Zürich: TVZ 2005 Bernhardt, R., Schmidt-Leukel, P. (Hg.), Multiple religiöse Identitäten. Aus verschiedenen religiösen Traditionen schöpfen, Zürich: TVZ 2008 Bernhardt, R., Stosch, K. v. (Hg.), Komparative Theologie. Interreligiöse Vergleiche als Weg der Religionstheologie, Zürich: TVZ 2009 Boyarin, D., Die jüdischen Evangelien. Die Geschichte des jüdischen Christus, Würzburg: Ergon 2015 Butler, J., Das Unbehagen der Geschlechter, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991 Clooney, F. X., »Comparative Theology. A Review of Recent Books (1989– 1995)«, in: Theological Studies 56 (1995), S. 521–550 Danz, C., »Religious Diversity and the Concept of Religion. Theology and Reli gious Pluralism«, in: NZSTh 62 (2020), S. 101–113 Danz, C., Einführung in die Theologie der Religionen, Wien: LIT 2005 Danz, C., Gottes Geist. Eine Pneumatologie, Tübingen: Mohr Siebeck 2019 Danz, C., Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum. Eine christolo gische und religionstheologische Skizze, Tübingen: Mohr Siebeck 2020 Fischer, J., »Christlicher Wahrheitsanspruch und die Religionen«, in: C. Danz, U. H. J. Körtner (Hg.), Theologie der Religionen. Positionen und Perspektiven evangelischer Theologie, Neukirchen-Vluyn: Neunkirchener 2005, S. 187–203 Heim, S. M., »The Depth of the Riches: Trinity and Religious Ends«, in: Mortensen, V. (Hg.), Theology and the Religions. A Dialogue, Grand Rapids, Cambridge: Wm. B. Eerdmans 2003, S. 387–402 Hick, J., »Eine Philosophie des religiösen Pluralismus«, in: MThZ 45 (1994), S. 304–318 Hick, J., The Interpretation of Religion. Human Answers to the Transcendent, New Haven: Yale University Press 1989 Hick, J., Knitter, P. F. (Hg.), The Myth of Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of Religions, New York: Wipf & Stock 1988 Khorchide, M., Stosch, K. v., Der andere Prophet. Jesus im Koran, Freiburg i. Br.: Herder 2018 Knitter, P. F., Introducing Theologies of Religions, New York: Orbis 2002 Luckmann, T., Die unsichtbare Religion, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991 Luhmann, N., Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 51994
501
Christian Danz
Neville, R. N., Normative Cultures, Albany: State University of New York Press 1995 Nongbri, B., Before Religion. A History of a Modern Concept. New Haven, London: Yale University Press 2013 Otto, R., Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Ver hältnis zum Rationalen, hg. v. J. Lauster, P. Schüz, München: C. H. Beck 2014 Rahner, K., »Das Christentum und die nichtchristlichen Religionen«, in: ders., Schriften zur Theologie, Bd. V, Einsiedeln: Benziger 21964, S. 136–158 Riesebrodt, M., Cultus und Heilsgeschehen. Eine Theorie der Religionen, München: C. H. Beck: 2007 Schmidt-Leukel, P., Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theolo gie der Religionen, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2005 Schmidt-Leukel, P., Religious Pluralism & Interreligious Theology. The Gifford Lectures – An Extended Edition, New York: Orbis 2017 Stosch, K. v., »Komparative Theologie als Hauptaufgabe der Theologie der Zukunft«, in: R. Bernhardt, K. v. Stosch (Hg.), Komparative Theologie. Inter religiöse Vergleiche als Weg der Religionstheologie, Zürich: TVZ 2009, S. 15–33 Stosch, K. v., Komparative Theologie als Wegweiser in der Welt der Religionen, Paderborn, München, Wien: Ferdinand Schöningh 2012 Thatamanil, J. J., The Immanent Divine. God, Creation, and the Human Predica ment. An East-West Conversation, Minneapolis: Fortress 2006 Tillich, P., »Religiöser Stil und religiöser Stoff in der bildenden Kunst«, in: ders., Main Works/Hauptwerke, Bd. 2: Writings in the Philosophy of Culture, Berlin, New York: De Gruyter 1990, S. 88–99 Vroom, H. M., Schwöbel, C., D’Arcy May, J., Art.: »Theologie der Religionen«, in: RGG4, Bd. 8, Tübingen 2005, S. 307–313 Wittekind, F., »Allgemeine Transzendenz – bestimmte Offenbarung? Zur Struk tur von Wahrheit und Offenbarung im interreligiösen Diskurs und im Kontext einer Theologie religiöser Rede«, in: C. Danz, K. Ehrensperger, W. Homolka (Hg.), Christologie zwischen Christentum und Judentum. Jesus, der Jude aus Galiläa, und der christliche Erlöser, Tübingen: Mohr Siebeck 2020, S. 169–182
502
Richard Kearney
Rückkehr zu Gott nach Gott Levinas – Derrida – Ricœur1
In der zeitgenössischen französischen Philosophie wurde der soge nannte »religious turn« zutiefst von drei Denkern der phänomeno logischen Tradition geprägt: Emmanuel Levinas, Jacques Derrida und Paul Ricœur. Obwohl die Diskussion um diese »religiöse« oder auch »theologische Wende« durch einen entscheidenden Band2, her ausgegeben von Dominique Janicaud und Jean-François Courtine, allgemein bekannt wurde und mit der Kehrtwende von säkularer und wissenschaftlicher Phänomenologie oft mit einer Form des theologi schen Theismus assoziiert wird, ist es doch erstaunlich, dass eben diese drei Wegbereiter jener Strömung überzeugt waren, dass jeder Zugang zum Theismus aus philosophischer Sicht eine atheistischen Grundeinstellung als unentbehrlichen und authentischen Gegenspie ler annehmen muss. Diejenigen, von denen die »theologische Wende« ausging, waren mitunter Teil dessen, was ich die »ana-theistische« Strömung nennen würde, eine Strömung, die eine zweiteilige Bewegung des Verlassens und des Wiedererlangens beinhaltet. In diesem Sinne gilt, dass man nicht einmal dazu ansetzen kann, einen neuen — »messianischen« oder »eschatologischen« — Sinn für das Heilige wiederzuerlangen, wenn man nicht zuvor die »veraltete« Idee eines metaphysisch-kau sal-wirkenden Gottes und somit auch die Theodizee hinter sich gelassen hat. Gott kann nicht erscheinen, bevor wir uns nicht von der Vor stellung göttlicher Omnipotenz getrennt haben. Gott kann nicht
1 Dt. Übersetzung des Textes »Returning to God after God«, Research in Phenomenol ogy 39 (2009), S. 167–183. 2 Vgl. J.-F. Courtine, Phénoménologie et théologie; D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française (Anm. d. Hg.).
503
Richard Kearney
(an)kommen, bevor wir nicht unser endgültiges Adieu ausgespro chen haben.
Das Lévinas’sche A-Dieu Der Holocaust wirft einen Schatten auf das Schreiben des jüdischen Philosophen Emmanuel Lévinas. Lévinas, der in Dachau viele seiner Familienangehörigen verloren hatte, sprach von der Notwendigkeit, jenen Gott abzulehnen, der diese Schrecken zugelassen hatte.3 In diesem Sinne fand er im Atheismus eine gesunde, ja heilsame Mög lichkeit der Distanznahme von einer idolatrischen Verschmelzung mit der Totalität des Seins, die Möglichkeit einer Trennung also, durch die jede Person ihre radikale Interiorität als ein Selbst zu entdecken vermag, d.h. als ein »Ich.« Darin sieht er die Basis für Freiheit und Verantwortung: Diese Trennung ist so vollständig, dass das getrennte Seiende sich ganz allein in der Existenz erhält, ohne Teilhabe am Sein, von dem es getrennt ist — es ist allenfalls fähig, sich dem Sein im Glauben anzuhängen. Diese Trennung kann man Atheismus nennen. Der Bruch mit der Teilhabe ist implizit in der Fähigkeit zu Glauben enthalten. Man lebt außerhalb von Gott, bei sich zu Hause, man ist Ich […] Die Seele — die Dimension des Psychischen, der Vollzug der Trennung — ist ihrer Natur nach atheistisch. Unter Atheismus verstehen wir also eine Position, die früher ist als die Verneinung oder Bejahung des Göttlichen; wir verstehen darunter den Bruch der Teilhabe, von dem aus das Ich sich setzt als das Selbe und als Ich.4
Ohne diese atheistische Bewegung der Trennung kann das Andere als unendlich fremd und erstaunlich, ja als anders gar nicht anerkannt werden. Ebendas schließt für Lévinas aber die Möglichkeit aus, eine authentische religiöse Beziehung zu Gott aufzubauen, in der dieser als das absolut Andere aufgefasst wird. Wir müssen, so folgert Levinas, contre-dieu sein, bevor wir à-dieu sagen können in dem zweideutigen Sinne, dass wir den alten Gott verlassen, indem wir uns einem kommenden Gott zuwenden. Dies ist die Voraussetzung dafür, unser »Zuhause« wieder für das radikal Fremde zu öffnen. Nur aus dem 3 4
Vgl. E. Levinas, »Das sinnlose Leiden«. E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit, S. 75 f.
504
Rückkehr zu Gott nach Gott
atheistischen Moment der Innerlichkeit (interiorité) des Selbst heraus vermögen wir uns für die Exteriorität des Fremden zu öffnen: Einzig und allein dann, wenn ich mich als ein separates Wesen verstehe und den Anderen als Gastgeber begrüße, nur dann kann die Flucht vor einer ewigen Wiederkehr des Gleichen innerhalb der Interioriorität des Kreises gelingen. Wenn ich mich dem Anderen zuwende, wird Interiorität zu Exteriorität.5
In diesem Zusammenhang hält Lévinas den Atheismus für des Juden tums Geschenk an die Menschheit – im Sinne einer Trennung von Gott, um dem Anderen als dem absolut Anderen zu begegnen.
2. Derridas Messianismus Ein anderer Philosoph jüdischer Prägung, Jaques Derrida, der Lévinas‘ enger Kollege und Vertrauter in Paris war, fügte dieser Debatte eine weitere Wendung hinzu. Obwohl er in seinen frühen Werken die eigene jüdische Herkunft nicht berücksichtigt hatte, sprach er in seinem autobiographischen Werk Circumfession im Jahre 1999 öfters von eben diesem Aspekt seines eigenen Denkens. Derrida erinnert sich daran, aufgrund der antisemitischen Gesetze des Vichy Regimes in Algerien, wo er aufgewachsen war, der Schule verwiesen worden zu sein. Wie bereits der Titel seines Zeugnisses suggeriert, musste er sich die Spuren, die die Beschneidung hinterlassen hatte, eingestehen, anstatt sie zu verleugnen. Eine ganze Reihe seiner Werke zeugt von seinem zunehmenden Bewusstsein der tragischen Auswirkungen des Holocausts – insbesondere Cendres (1991) und Shibboleth: Für Paul Celan (1986), vor allem aber auch seine Stellungnahme zur Levinas’schen Denkfigur des radikal Anderen, die er in seinem Nach ruf Adieu (1996) beschrieben hat. Einer der wichtigsten Beiträge Derridas zur ana-theistischen Frage kommt dagegen erst, wie ich meine, in einem späten Aufsatz vor, nämlich in Sauf le Nom (1993), worin er davon spricht, dass wir den göttlichen »Namen« bewahren könnten, würde es nur abge lehnt werden, dessen Inhalt zu definieren. Dieses Sich-Enthalten davon, Gott zu benennen, grenzt an einen bestimmten Typus des A-Theismus, der versucht, den Namen Gottes zu bewahren, indem 5
J. Llewelyn, Emmanuel Levinas. The Genealogy of Ethics, S. 65.
505
Richard Kearney
Gott gar nicht erst als solcher benannt wird. Gleichwohl haben wir es hier nicht so sehr mit militantem Anti-Gott-Gerede zu tun, als mit subtilen Rechtfertigungen der apophatischen Theologie (damit, was wir über Gott nicht sagen können, wiewohl wir an ihn glauben). In der Tat scheint Derrida einen Raum für das zu schaffen, was man »mystischen Atheismus« nennen könnte. Und obwohl er diese Phrase selbst nicht verwendet, deutet er auf die seltsame Reversibilität von Mystizismus und Atheismus hin. Ja, Derrida gibt zu, dass er »zu Recht als Atheist durchgeht«, und macht uns zudem auf einen Moment radikaler Empfänglichkeit aufmerksam, der für ihn als messianisch bezeichnet werden kann — der Moment, in dem man alle übernom menen Gewissheiten, Annahmen und Erwartungen (einschließlich religiöser) aufgibt, um offen zu sein für die radikale Überraschung und den Schock des kommenden Anderen (the incoming Other). In Sauf le Nom — was sowohl bedeuten kann, sich des göttlichen Namens anzunehmen, als sich seiner zu entledigen — geht Derrida so weit, vorzuschlagen, dass das wahre Begehren Gottes ein gewisses Schwanken zwischen Atheismus und Theismus voraussetzt: Die Gottessehnsucht (désir de Dieu), Gott als der andere Name für das Begehren, verhandelt in der Wüste mit dem radikalen Atheismus. […] / [D]ie extremsten und konsequentesten Formen des erklärten Atheismus [haben] stets von einer intensiven Gottessehnsucht gezeugt […]. / Wie eine bestimmte Mystik ist der apophatische Diskurs immer des Atheismus verdächtigt worden. / […] Denn wenn der Atheismus wie die apophatische Theologie von Gottessehnsucht zeugt, wem gegenüber tut er dies?6
Es könnte Derrida unterstellt werden, dass er hier eine Post-Holocaust Übersetzung von Meister Eckharts Gebet zu Gott aufgreift, um sich Gottes zu entledigen. Wenn wir Gott nicht loslassen als ein Besitzoder Eigentum, dann können wir auch dem Anderen nicht als einem radikal Fremden begegnen. Sich auf solch Derrida’sche Art und Weise nach Gott zu sehnen, dies verweist auf ein »Begehren jenseits des Begehrens«, das eine wichtige theo-erotische Dimension des Ana theismus ausmacht. Anstelle der fühlbaren Abwesenheit des ›alten Gottes‹ (des Todesgottes) tritt ein Gefühl der Leere, das den Weg für ein neu aufblühendes Begehren nach Gott zu bahnen vermag, einen Weg für die Wiederkehr des anderen Gottes – jenes göttlichen Gastes, der Leben bringt. 6
J. Derrida, »Außer dem Namen (Post-scriptum)«, S. 110, 66–68.
506
Rückkehr zu Gott nach Gott
Es muss trotzdem eingestanden werden, dass Derrida aufgrund seiner dekonstruktiven Askese von traditionellen Messianismen und Religionen letztendlich für eine »Religion ohne Religion« plädiert, die Gott kaum irgendwie zu benennen vermag. Zeitweise scheint Derrida die Vorstellung einer »Messianizität« als etwas jenseits der konkreten, historischen Messianismen der abrahamitischen Traditio nen in Erwägung zu ziehen: einen Messianismus, der weniger als heilige, inkarnierte Präsenz in der Welt fungiert, sondern vielmehr als eine abstrakte Idee der Bedingungen der Möglichkeit von Religion im Allgemeinen. Sprich, Religion würde als endloses Warten aufgefasst, das nicht die leiseste Vorahnung davon enthält, in welcher Form ein göttliches (oder nicht-göttliches) Anderes erscheinen könnte. Es gibt hier keinen Platz für eine ignatianische »Unterscheidung der Geister«, für ein richtiges Urteil in einer Hermeneutik der Interpretation oder eine Verpflichtung gegenüber heiligen (eher als unheiligen) Geistern. (Denn für Dekonstruktivisten erscheinen alle Götter als Geister.) In anderen Worten, hier scheint keine Möglichkeit gegeben zu sein, das Antlitz jenseits oder mithilfe des Namens zu erfassen. An die Messianizität zu glauben, scheint beizeiten für Derrida die radikale Abwesenheit aller historischen Verwirklichungen des Göttlichen zu bedeuten — keine Epiphanien, Lieder, Zeugnisse, keine heiligen Inkarnationen oder Liturgien. Im Namen einer universellen Offenheit gegenüber jeglichem/n Anderen (tout autre est tout autre), scheint Derridas »Religion ohne Religion« gar kein benennbares Antlitz zu kennen, keinerlei verkörperte Präsenz in Raum und Zeit. Die messianische Hoffnung wird durch die Askese aller biblischen For men und sogar aller bestimmbaren Figuren der Erwartung entkleidet, sie entblößt sich dergestalt im Hinblick auf die Antwort auf das, was die absolute Gastfreundschaft sein muss, das ›Ja‹ zu dem oder der Ankommenden, das »Komm!« zur nicht antizipierbaren Zukunft … [diese] Gastfreundschaft ist nur absolut, wenn sie über ihre eigene Universalität wacht.7
Nun scheint ein solcher messianischer Universalismus jedoch nur auf Kosten des Partikulären gesichert zu sein; er verliert die leibhaftige Singularität alltäglicher Offenbarungen. Derrida schreibt diesbezüg lich:
7
J. Derrida, Marx’ Gespenster, S. 229.
507
Richard Kearney
[W]enn man auf das, was kommt, zählen könnte, was kommt, wäre die Hoffnung nichts als das Kalkül eines Programms. Man hätte die Vorschau, aber man würde nichts und niemanden mehr erwarten.8
Im Gegensatz dazu zeichnet sich das messianische Warten durch die Abwesenheit jeglichen Erwartungshorizonts aus. Askese ohne Offen barung. Derrida bezieht sich auf diese Abstinenz als eine »Epoché des Inhalts« des Glaubens; eine derartige Epoché – so stelle ich es mir vor – besagt, dass der Glaube zum leeren Warten wird. Eben dies nennt Derrida selbst die »Formalität eines strukturellen Messianis mus, eines Messianismus ohne Religion, eines Messianischen ohne Messianismus sogar (…).«9 Zusammenfassend gesprochen dient Glaube hier als etwas rein transzendentales, ein »formales Gefüge des Versprechens«, das nicht für eine weltliche Erfüllung oder Fleischwerdung von partikulären Glaubenssätzen plädiert. Somit könnte die »Epoché des Inhalts« – für die mystische Askese – als der provisorische Moment vor der Rückkehr in die Welt der alltäglichen Glaubens-sätze und Dienst leistungen angenommen werden, denn für Derrida scheint diese Suspendierung des Inhalts ein non-plus-ultra zu sein, ein point of no return. Hier erscheint folglich das Messianische von jeglichem konkreten Glauben an eine Person oder eine Präsenz (menschlich oder göttlich) so sehr entleert, dass es jeglichen Anspruch auf die historische Wirklichkeit verliert. Das aber führt mich zu der Frage: Riskiert es der dekonstruktive »Glaube« damit nicht, so entleert zu werden, dass der Glaube an das Hier und Jetzt gänzlich verloren geht? Ich denke, etwas derartiges könnte man niemals von Benjamin sagen, dessen »schwacher Messianismus« die Idee des mystischen Fremden – eines schwachen Messias – vorschlägt, der jederzeit das Kontinuum der Geschichte aufbrechen könnte, was Benjamin die Unterbrechung eines mystischen »Jetzt« (Jetztzeit) nennt. In gleicher Weise, und wie sehr er seinem Mentor auch verpflichtet gewesen sein mag, diese Auffassung einer rein formalen Messianizität machte es Derrida auch unmöglich, Lévinas’ Idee ethischer Verantwortung für das »Antlitz« des Anderen — der Witwe, des Waisen, des Fremden — im Sinne einer Spur Gottes zu übernehmen. Im Gegensatz zu Benjamin und Lévinas verbleibt Derridas Zugang zum Messianischen 8 9
Ebd., S. 230. Ebd., S. 88 f.
508
Rückkehr zu Gott nach Gott
im Vorzimmer des Messianismus. Anstatt die ana-theistische Mög lichkeit aufzugreifen, exploriert er sie bloß. Das (Be)Wahren des Namens beinhaltet für ihn keine Rückkehr zum Benannten. Im besten Falle ist es ein »endloses Warten in der Wüste.«10 Es ist ein Warten auf einen Godot, der niemals erscheint.
Ricœurs nach-religiöser Glaube Ricœur, ein vertrauter Kollege von Lévinas in Nanterre und Lehrer Derridas an der Sorbonne, spricht vom Glauben als der »Freude des Ja in der Trauer des Nein«. Er ist bekannt dafür, dass er seinen eigenen protestantischen Glauben beschrieb als einen »Zufall, der sich durch fortwährende Wahl in Schicksal verwandelt«. Nichts von Gott, argumentierte er, könnte als selbstverständlich angenommen werden. Im Gegenteil, nachdem er jahrelang in deutscher Kriegsgefangen schaft verbracht hatte, wusste Ricœur, dass es keine Rückkehr zum Glauben geben könnte, wenn man sich nicht des dunklen Abgrunds bewusst wird, den der Glaube selbstverständlich beinhaltet. Ricœur erkannte zudem ganz klar, dass die scharfen Religionskritiker und Atheisten Freud, Marx und Nietzsche – die er die drei großen Meister einer Hermeneutik des Verdachts nannte – in höchstem Maße ernst genommen werden müssten, wenn man den Glauben im Zeichen solcher Kritik neu fassen möchte. In seinem wegweisenden Essay »Religion, Atheismus und Glaube« entfaltet Ricœur einige Argumente für einen solchen postkritischen Glauben. Er spricht von der »religiösen Bedeutung des Atheismus«, und schlägt vor, dass die atheistische Beseitigung der negativen und lebensverneinenden Komponenten von Religion ernst genommen werden müsse, wenn eine authentische Form von Reli gion aus einer säkularen Gesellschaft hervorgehen soll. Ricœur nimmt dabei die Rolle des »Philosophen«, nicht die eines »Verkün digers« (prédicateur) ein, und versucht so, konkrete Möglichkeiten 10 Zur Frage des Messianismus und der Eschatologie vgl. J. Derrida, »Deconstruction and the Other«, S. 139 f. Vgl. des Weiteren auch unsere Analyse der epiphanischen und eschatologischen Zeit in Gaston Bachelards Philosophie des Augenblicks als einer Lücke innerhalb einer diskontinuierlichen Zeitlichkeit (pace Bergson Auffassung des zeitlichen Kontinuums oder der durée) (R. Kearney, »Bachelard and the Epiphanic Instant«).
509
Richard Kearney
eines post-atheistischen Glaubens aufzuzeigen, anstatt im Detail zu erläutern, was dieser Glaube in liturgischen und konfessionellen Kontexten zu bedeuten hätte. Ricœur war überzeugt, dass der Dis kurs des Philosophen der eines fortwährenden Anfängers sein muss, sprich ein »vorbereitender Diskurs.« Er fügt hinzu, dass dies unserem Zeitalter der Orientierungslosigkeit und Verwirrung angemessen sei, einem Zeitalter, in dem »der Tod der Religion vielleicht den wahren Einsatz verhüllt«, einem Zeitalter, das mithin »auch eine Zeit langer, langsamer und indirekter Vorbereitungen ist.«11 Ricœur zufolge verlangen zwei Aspekte der Religion nach radi kaler Kritik: Tabu und Alibi. Mit Blick auf den erstgenannten Aspekt geht es um das archaische, religiöse Gefühl der Angst, oder genauer die Angst vor göttlicher Strafe und Sühne. Mit Blick auf das Alibi hingegen geht es um das Bedürfnis nach Schutz und Trost. Ricœur definiert Religion dementsprechend als eine »archaische Struktur des Lebens, die stets durch den Glauben überwunden werden muss und die auf der Strafangst und dem Schutzbedürfnis beruht.«12 In diesem Zusammenhang erschließt sich die tatsächliche Rechtfertigung des Atheismus als sowohl destruktiv wie befreiend. Denn so werden die verborgenen Mechanismen religiöser Angst und infantiler Abhängig keit enthüllt – und somit dessen Destruktivität zerstört und neue Möglichkeiten zu existieren freigesetzt. Eine dieser Möglichkeiten, so schlägt Ricœur vor, betrifft einen Glauben, der sich jenseits von Schuld und Eskapismus situiert. So gesehen könnte dem Atheismus attestiert werden, dass er die Religion von sich selbst befreit und das Versprechen eines lebendigen Glaubens gibt, der sich innerhalb der historischen Religionen die Bahn zu brechen vermag. Dies jedenfalls scheint Ricœurs Wetteinsatz in Bezug auf einen post-religiösen Glau ben zu sein. In Bezug auf die Kategorie des Tabus beruft Ricœur sich auf die lehrreiche Kritik Freuds und Nietzsches. Im Gegensatz zu anderen Philosophen – wie die britischen Empiristen oder die Positivsten der Aufklärung, die Religion aufgrund ihrer mangelnden wissenschaftli chen Fundierung kritisieren –, entwickeln Freud und Nietzsche neue Formen einer atheistischen Kritik: Im Vordergrund steht dabei die 11 P. Ricœur, »Religion, Atheismus, Glaube«, S. 285. Für die Zitate über den Glauben siehe auch ders., »Die Fehlbarkeit des Menschen«, S. 91; bzw. »Critique and Convic tion«, S. 145. 12 P. Ricœur, »Religion, Atheismus, Glaube«, S. 285.
510
Rückkehr zu Gott nach Gott
Behauptung, dass Religion eine kulturelle Repräsentation verkappter Symptome von Angst und Not sei. Im Zuge dessen haben sie sich nicht weiter mit Argumenten bezüglich der Existenz oder Nicht-Exis tenz Gottes auseinandergesetzt, sondern sich vielmehr darauf kon zentriert, die Religion im Blick auf ihre Verbote, Schuldzuweisungen und Strafen zu dekonstruieren. Entsprechend entwickelten sie eine Hermeneutik des Verdachts, die die Illusionen der Religion in den Blick nahm und darauf abzielte, die verborgenen Motivationen der Frömmigkeit zu entlarven. Diese kritische Hermeneutik nahm die Form einer Genealogie an, die fest entschlossen war, Religionen als Erscheinungsformen eines zugrundeliegenden Konflikts von Kräf ten zu demaskieren. Nietzsches kritische Stoßrichtung galt einem maskierten »Willen zur Macht«, Freuds Fokus lag auf den perver tierten Ausdrucksgestalten der Libido, die ihm zufolge zu »obsessi vem Zwang« und Neurosen führen. Nietzsches genealogische Lesart wollte aufzeigen, dass der sogenannte »ideale« Raum der Religion das Nichts sei: Religion wird bei ihm als eine Vertuschung der lebensverneinenden Kräfte verstanden, als illusorische Projektion einer übersinnlichen Welt, die von der Verleumdung alles Weltlichen angetrieben wird. Das Ziel von Freuds psychoanalytischer Position wiederum war es, aufzuzeigen, dass die Grundlage der Religion in einer wahnhaften »Vorstellung des Urvaters« bestehe, das auf ein infantiles Abhängigkeitsverhältnis antwortet. Die Lösung, die Freud hierfür in seinem Werk über Leonardo da Vinci vorschlug, besteht in der Abkehr von der Vaterfigur, jener doppelten Fantasie von Angst und Schutzbedürfnis. Nur durch eine radikale Trauerarbeit am göttlichen Über-Ich, durch den Verzicht also auf dieses Phantasma absoluter (furchteinflößender) Autorität und (tröstender) Sicherheit, kann der Ursprung der Werte retabliert werden, nämlich im Eros und dessen ewigem Konflikt mit dem Thanatos.13 So kündigen Nietzsches und Freuds jeweilige Stimmen den »Tod Gottes« an. Die Frage, die bleibt, ist allerdings: »Welcher Gott stirbt?« Ricœur meint, dass es der onto-theologische Gott sei, der dies tatsächlich auch verdient habe. Der Begriff »Onto-theologie« wurde in den Allgemeinwortschatz aufgenommen, um das metaphysische Konzept eines höchsten, allgemeinsten und omnipotenten Wesens zu beschreiben, das von der menschlichen Lebenswelt getrennt existiere. Siehe auch Freuds berühmte Konklusion zu »Das Unbehagen in der Kultur«, S. 260–270.
13
511
Richard Kearney
In der westlichen Kulturgeschichte korrespondierte dieser Begriff viel fach mit der Vorstellung einer moralisierenden Gottheit, die anklagt und verurteilt. Die atheistische Kritik zielt darauf ab, diese Anklage ihrerseits anzuklagen, die Verdammung selbst zu verdammen. Diese Kritik ringt darum, den Nihilismus im Herzen der reli giösen Illusion zu enthüllen, den Mangel an Macht im Überich aufzudecken, die Kollusion dieser idealen Welt mit dem Nein-Sagen und dem Tod zu offenbaren. So gefasst bezeichnet der Atheismus einen Weg, auf dem die Illusionen der Religion sich selbst destruieren, sich als das zeigen, was sie tatsächlich sind: nichts. Und so stirbt der allmächtige Gott der Onto-theologie, jener Herrscher über die Welt. Mit ihm stirbt auch der allwissende Gott eines »selbst-genügsamen Wissens«, das die »Macht- und Seinsfülle über das Gute« und den »Gesetzesstatus über die gesetzes-überlegene Liebe und Demut«14 stellt. Und mit dem allmächtigen und allwissenden Gott stirbt schließ lich auch der omnipräsente Gott, der das Böse sowie das Gute sieht. So stirbt, um es kurz zu fassen, der beschworene All-Gott der Theodizee, der noch die schlimmsten Verbrechen rechtfertigen sollte. Dies ist derjenige Gott, der heute zu Recht verworfen wird, wie etwa Richard Dawkins auch argumentiert, wenn er uns einlädt, uns eine andere Welt vorzustellen: [Eine Welt in der es] keine Selbstmordattentäter, keinen 11. Septem ber, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Kreuzzüge, keine Hexenverfolgung, keinen Gunpowder Plot, keine Aufteilung Indiens, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben/Kroaten/Muslimen, keine Verfolgung von Juden als ›Chris tusmörder‹, keine ›Probleme‹ in Nordirland, keine ›Ehrenmorde‹, keine pomadigen Fernsehevangelisten im Glitzeranzug, die leichtgläu bigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen (›Gott will, dass ihr gebt, bis es wehtut.‹) [gibt]. Stellen wir uns vor: keine Zerstörung anti ker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel auf weibliche Haut für das Verbrechen, zwei Zentimeter nackte Haut zu zeigen.15
Wenn die Hermeneutik des Verdachts ihr Werk getan hat, dann ist es, in Ricœurs Worten, nicht mehr möglich, »eine Form des moralischen Lebens wiederherzustellen, die sich als eine bloße Unterwerfung unter Gebote, unter einen fremden oder höchsten Willen propagiert, 14 15
M. Scheler, Liebe und Erkenntnis, S. 23. R. Dawkins, Der Gotteswahn, S. 12.
512
Rückkehr zu Gott nach Gott
selbst, wenn dieser Wille als ein göttlicher vorgestellt würde«. Ricœur fordert deshalb, dass wir diese von der Schule des Verdachts vorge brachte Kritik von Ethik und Religion als etwas Positives annehmen sollten. Von daher, so argumentiert er, lernen wir zu verstehen, dass das »Gebot, das den Tod und nicht das Leben bringt, ein Produkt und eine Projektion unserer Schwäche« ist.16 *
*
*
Solange der Atheismus jedoch nur eine Negation bleibt, besteht die Gefahr, dass er als reaktionär und nicht als aktiv aufgefasst wird. Der Rebell kann dem Propheten nicht das Wasser reichen. Obwohl sie notwendig ist, kann die Anklage der Anklage nicht bei der Erneuerung des Lebens helfen, bei der Erkenntnis, dass alles in unserem säkularen Universum immer schon potentiell im Kern heilig ist. Nietzsche selbst sprach freilich von einer »Unschuld des Werdens« und begrüßte die »ewige Wiederkehr des Gleichen«. Und es ist einfach zu vergessen, dass der »irre Mensch,« der Gott für tot erklärte, seine Kundgebung mit den Worten »Ich suche Gott« begann.17 Indem er aber den »Willen zur Macht« zur elementarsten Wahrheit über die Existenz erklärte, blieb Nietzsche letztlich in seinem voluntaristischen Universum gefangen: in einer Welt, in der selbst die Erneuerung des Lebens fast zur persönlichen Mythologie wird, zu einem Lyrizismus des Geistes, einem Phantasieren darüber, wie die Dinge sein könnten – obwohl er als ein Befürworter und keine Gegenstimme zum Leben steht. Solcherart bereiten Ricœur, Lévinas, und Derrida, je auf ihre Art und Weise, die Möglichkeit für das, was ich Anatheismus nenne. Und ich betone dabei die Möglichkeit gegenüber der Wirklichkeit. Der Anatheismus bietet uns eine Möglichkeit, für einen Glauben nach dem Atheismus. Auf diesem Wege wird ein nach-religiöser Theismus nach Freud und Nietzsche möglich. Für Ricœur bleibt der Philosoph als ein verantwortungsbewusster Denker in der Schwebe zwischen Atheismus und Glaube, zwischen Säkularem und Heiligem. Auf diesem Wege eröffnet eine kritische Hermeneutik den Raum, in dem der »prophetische Verkünder« die Wiederherstellung eines befreiten Glaubens innerhalb der religiösen Traditionen erblicken mag. Ricœur imaginiert hier eine »radikale Rückkehr zum Ursprung 16 17
P. Ricœur, »Religion, Atheismus, Glaube«, S. 291. F. Nietzsche, »Die Fröhliche Wissenschaft«, S. 480 (§ 125).
513
Richard Kearney
des jüdischen und christlichen Glaubens«, eine Reise, die in eins »ursprunghaft und nachreligiös« sei – und uns heute anspräche.18 Der Philosoph träumt hier von einem Propheten, der die erlösende Stelle aus Exodus, die noch vor dem Gesetz existiert, zum Leben erwecken könnte: »Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.« (Ex 20:2) Ein Glaube wie dieser verkündet Freiheit und erklärt das Kreuz und die Auferstehung als Einladungen zu einem kreativeren Leben. Es handelt sich um einen Glauben, der die heutige Relevanz der paulinischen Distinktion von Geist und Gesetz auf den Begriff bringt und »Sünde« nicht so sehr als Tabu-Bruch interpretiert, sondern vielmehr als eine Verweigerung des Lebens. In diesem Fäll wäre ein Leben, das voller Angst gelebt wird, das sündhafte; eines, das »im Höllenkreis des Gesetzes, der Übertretung, der Schuld, und der Auflehnung gefangen bliebe«. Von einem solchen Glauben kann der Philosoph allerdings nur träumen. Es bleibt das Geschäft der post-religiösen Gläubigen, ihn zu verwirklichen. Der Philosoph hingegen befindet sich in einer »Übergangszeit«, zwischen der Trauer über die verstorbenen Götter und dem Ausschau-Halten nach Zeichen ihrer Wiederkehr. Während er auf eine »positive Hermeneutik« sinnt, die eine Rekreation des Biblischen Kerygmas wäre – der Propheten und der urchristlichen Gemeinschaft –, kann der Philosoph Ricœur zufolge das versprochene Land nicht betreten. Es sei nämlich in der Verant wortung des Philosophen, zu »denken«, das heißt, er muss »unter der Oberfläche der heutigen Antinomie nachgraben, die über den Atheis mus hinweg eine Vermittlung von Religion und Glaube ermöglicht.«19 Ricœurs Argumentation scheint mir hier zutiefst anatheistisch zu sein, sofern er nämlich vorschlägt, religiös zu denken heiße, nach-religiös zu denken. Eine solche Argumentation erkennt an, dass das Beste, das ein ana-theistischer Philosoph tun kann, darin besteht, einen Ort zu finden, an dem die Willensfreiheit im Hören jenes »Wortes« verwurzelt ist, das weder aus einem selbst kommt, noch von uns bemeistert wird. Diese Aufmerksamkeit auf das pri mordiale Ereignis des Wortes und der Bedeutung korrespondiert der angemessenen Berufung des Anatheisten, der – zumindest, wenn er philosophiert – vorläufig die metaphysischen Fragen über »Gott« und P. Ricœur, »Religion, Atheismus, Glaube«, S. 448; und für die nachfolgende Dis kussion über Sünde, S. 292. 19 Ebd., S. 293. 18
514
Rückkehr zu Gott nach Gott
»Religion« in Klammer setzt. Es handelt sich hierbei um eine Form des existentiellen »Horchens« auf das Kommen und Gehen, das Sein und Nicht-Sein dieser Bedeutung, die es vor aller konfessionellen oder institutionellen Interpretation des Wesens jenes Wortes gibt. Indem er sich so einem Empfangsort übereignet, einer Einstellung des Zuhörens (oftmals in Stille) durch etwas, das den eigenen Willen übersteigt, kann der anatheistische Philosoph eine Grundlage für jene Gläubigen schaffen, die es sich möglicherweise wünschen, das Kerygma ihres Glaubens aus dem Gefängnis von Verpflichtung und Zögern frei zu bekommen. Dem Wort der Existenz philosophisch zu lauschen – eben dies könnte uns bei diesem Ansinnen behilflich sein, das Wort Gottes theologisch zu empfangen, ohne die beiden zu vermengen. Exis tentielles Zuhören ermöglicht es uns Ricœur zufolge also, unsere ursprüngliche Lebensbejahung wiederherzustellen, unser ursprüng liches »Verlangen zu sein«: jenes Verlangen also, das es vor den vielen Unterbrechungen gab, die es erst zu einem Fremden seiner selbst machten. Ein solches Lauschen lädt uns ein, ganz von vorne zu beginnen. Wiederholung. Rekapitulation. Anakephalaiosis. Das Wort Existenz – das das Gute im Sein trotz seiner vielfachen Entfremdun gen bestätigt – spricht gemäß der Grammatik des Ana. Die Bejahung des Seins im Mangel an Sein, das ist die ursprünglichste Struktur an der Wurzel der Ethik. Die Ethik bedeutet in diesem radikalen Sinn also die fortschreitende Aneignung unseres Strebens nach Sein.20
Ohne diese ana-ethische Umdrehung und Rückkehr zur Existenz wäre der ana-theistische Glauben gar nicht möglich. Ricœur besteht entsprechend auch darauf, dass es etwas gibt, das der Ordnung des Willens und der Obligation vorausgeht, und ebendies ist nichts anderes als »der aktive Kern unserer Existenz«, also das Wort, denn dieses »besitzt das Vermögen, das Verständnis, das wir von uns selbst haben, zu verändern.«21 Zusammenfassend besehen kann also über den Anatheismus gesagt werden, dass er sowohl einen existentiellen Wunsch, als auch einen eschatologischen Glauben beinhaltet. Ebd., S. 297. Ebd. S. 298 f. Siehe auch unsere Analyse des ana-erotischen Paradigmas der mys tischen Erfahrung als eine Rückkehr zu einem zweiten Verlangen über Verlangen hinaus in R. Kearney, »The Shulammite Song: Eros Descending and Ascending«. 20
21
515
Richard Kearney
Eine bestimmte »Lücke« wird wohl immer zwischen der end losen Exploration (seitens des Philosophen) all der Neuanfänge innerhalb der Existenz, und der Ankündigung des praktizierenden Gläubigen, zum Wort Gottes zurückzukehren, verbleiben. Dennoch, also trotz dieser Lücke, räumt Ricœur ein, könne eine bestimmte »Kongruenz« zwischen einer Theologie, die zu den eigenen Wur zeln zurückkehrt, und einer Philosophie, die die atheistische Religi onskritik begrüßt, entstehen.22Anatheismus könnte als ein Versuch beschrieben werden, auf diese Kongruenz zu antworten. Ricœur selbst beschreibt nicht die Verwendung des Begriffs. Er bietet vielmehr, so scheint mir, das Fundament für eine Heilung Gottes nach Gott dar. Im Folgenden Passus fasst er zusammen, wie eine solche Heilung aussehen könnte: Eine prophetische Verkündigung, die zu den Ursprüngen des jüdischchristlichen Glaubens zurückkehren und gleichzeitig einen Neubeginn für unsere Zeit in die Wege leiten würde […] Es wäre dies ein Glaube, der im Dunkel voranschreitet, in einer neuen ›Nacht des Verstandes‹ – um mit den Mystikern zu reden –, vor einem Gott, der sich nicht mit den Attributen der ›Vorhersehung‹ umgibt, einem Gott, der mich beschützen will, sondern mich vielmehr den Gefahren eines Lebens aussetzt, das allein menschenwürdig genannt werden könnte. Ist dieser Gott nicht der Gekreuzigte, der Gott in mir, wie Bonhoeffer sagt, der allein durch seine Schwäche helfen kann?
Und Ricœur schließt mit Bezug auf Religion und Atheismus: Was Nacht für den Verstand bedeutet, bedeutet vor allem Nacht für den Wunsch wie für die Furcht, Nacht für die Sehnsucht nach einem Vater, der Schutz gewährt. Jenseits der Nacht, und nur jenseits ihrer, könnte man zur wahren Bedeutung des Gottes der Tröstung, des auferstandenen Gottes, des byzantinischen und römischen Pantokra tors zurückkommen.23
Im Anatheismus geht nichts verloren, haben wir nichts zu verlieren. Oder vielmehr kann das, was als Besitz verloren ist, als Geschenk wiedererhalten werden, nach der einsamen Nacht der atheistischen Kritik — so wie Hiob alles zurückerhalten wird, was er verloren wähnte, wie Abraham Isaak wiedererhalten hat, wie Jesus das Leben nach dem Tod wieder erhalten hat. Sogar der liebende »Vater« der 22 23
Ebd., S. 299 f. Ebd., S. 306.
516
Rückkehr zu Gott nach Gott
Schöpfung könnte in diesem Sinne anatheistisch wiederhergestellt werden, nämlich als ein Symbol des Lebens. Wenn in der Bibel Gott zwar als Vater präsentiert wird, was den Atheisten zur Annahme eines Vaterfetischs zwingt, so schlägt der Anatheist vor, dass das Bild des Vaters — wenn er als Idol überwunden wurde — symbolisch zu bewahren sei; ein Bild, freigiebig in seinen semantischen und GenderImplikationen. Dieses Symbol wäre ein Gleichnis der Verwurzelung in der Liebe; wir hätten in ihm die Entsprechung, wie sie eine Theologie der Liebe für eine Progression zu denken vermag, die uns von der bloßen Ergebung zum dichterischen Leben gebracht hat. Und gerade darin zeigt sich, wie ich glaube, die religiöse Bedeutung des Atheismus. Ein Idol muss sterben, damit ein Symbol des Seins zu sprechen beginnen kann.24
4. Letzte Testamente Nach fast vierzig Jahren radikaler Reflexion kehrt Ricœur in seinem letzten philosophischen Testament zur Frage des Todes und der Auf erstehung zurück. Vivant jusqu’à la mort wurde von ihm verfasst, als er im Sterben lag. Der Autor lässt hier die Unterscheidung zwi schen dem Philosophen und dem Prediger ineinander übergehen und vertraut seinem Leser mit ungekannter Aufrichtigkeit seine Gedanken an. Seine Geheimnisse klingen für mich wie die eines Anatheisten. Er spricht von einer Art »Gnade«, die seine Erfahrung des Sterbens begleitet25: Aus diesem Grunde […] spiele es für die Qualität dieses Augenblicks der Gnade keine Rolle, dass sich der mit dem Tode Ringende […] zu dieser oder jene Konfession oder Religion bekenne. Vielleicht erhebt sich das Religiöse nur angesichts des Todes zum Wesentlichen und wird Ebd., S. 314. Siehe auch P. Ricœur, »The Critique of Religion«, S. 213 f. Ricœur spricht von der Rückkehr zu einer »zweiten Naivität« des authentischen Glaubens, nachdem die dogmatischen Vorurteile von der eigenen ersten Naivität überwunden wurden. Ricœur handelt im Zuge dessen auch davon, falsche religiöse Fetische zu entlarven, sodass die Symbole des Heiligen (der Heiligkeit) wieder für sich selbst sprechen mögen. Anthony Steinbock entwirft eine ähnliche Bewegung in seiner Unterscheidung zwischen einer genuinen, »vertikalen« Erfahrung des Heiligen und einer »idolatrischen« Miskonstruktion desselben in seinem Buch Phenomenology and Mysticism, S. 211–240. 25 P. Ricœur, Lebendig bis in den Tod, S. 19. 24
517
Richard Kearney
nur hier die Schranke zwischen den Religionen, die Nicht-Religionen inbegriffen (ich denke hier natürlich an den Buddhismus), überwun den. Eben weil das Sterben transkulturell ist, ist es überkonfessionell, in diesem Sinne überreligiös […].
Von seinem eingestandenen Verdacht gegenüber den Ideen dem »Unmittelbaren, der Verschmelzung, dem Intuitiven« nimmt Ricœur nur die »Gnade eines bestimmten Sterbens«26 aus. Er handelt von dieser Gnade in paradoxen Begriffen »immanenter Transzendenz«, ja einer besonders »innerlichen Transzendenz des Wesentlichen, das die Schleier der Codes des konfessionell gebundenen Religiösen zer reißt.«27 Um eine solche, wahrhaftige Gnade zu erfahren, muss man, so Ricœur, damit aufhören, seine persönliche Erlösung voranzustellen – und diese Hoffnung in andere legen. Wir werden hier mit einem grundlegenden Paradox der Schrift in Berührung gebracht, dem »Wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren; wer es dagegen verliert, wird es erhalten.« (Lk 17:33). In James Joyces Worten: »Without sundering there is no reconcilia tion.«28 In diesem Zusammenhang bietet Ricœur eine überraschend erfrischende Interpretation der Eucharistie als dem Zelebrieren von Blut-als-Wein an, eine, die die Transsubstantiation als ein Zeichen des Lebens und Teilens zu verstehen gibt, nicht mehr aber als ein Zeichen sakrifiziellen Blutvergießens.29 Die eucharistische Erinnerung an die Hingabe des eigenen Lebens — »Tut dies zu meinem Gedächtnis« — wird so als eine Affirmation der Gabe des Lebens mit und für den Anderen verstanden, nicht mehr aber als angstvolle Sorge um persönlich-physisches Weiterleben beziehungsweise ein Leben nach dem Tod. Das heißt, wenn Christus sagte: »Es ist vollbracht«, so meinte er dies wirklich. Er gab sein Leben hin in einer zweiten Geste kenotischer Entäußerung (die erste war jene der Inkarnation, des Herabstiegs des Göttlichen in menschliches Fleisch), um anderen Leben zu geben, sowohl im Sinne des Dienstes (Lk 22:27), als auch im Sinne des Sakraments: im Brechen des Brotes von Emmaus, im Bereiten des Fisches für die Jünger durch den auferstandenen Diener, und schließlich, durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch, in
26 27 28 29
Ebd., S. 19. Ebd., S. 21. J. Joyce, Ulysses, S. 90 u. 195. Vgl. P. Ricœur, Lebendig bis in den Tod, S. 77.
518
Rückkehr zu Gott nach Gott
Gestalt des Nährens »der Geringsten unter ihnen«. Ricœur schließt sein letztes Testament mit dieser bemerkenswerten Notiz: Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und gebe. Das Band zwischen Tod und Überleben im anderen wird in dem Dienst für geknüpft… verbunden mit der Gabe des Lebens. Band zwischen Dienst und Mahl. Das Abendmahl verbindet das Sterben (des Selbst) (und) den Dienst (des anderen) in der Teilhabe am Mahl, das den Menschen des Todes mit der in der Gemeinde versammelten Menge der Überlebenden verbindet. Es ist erstaunlich, dass Jesus selbst diesen Bezug nicht theoretisiert hat und niemals gesagt hat, wer er ist. Er wusste es vielleicht nicht, er hatte es in der Geste des Abendmahls erlebt, die das Nahen des Todes und sein Jenseits in der Gemeinschaft miteinander verbindet. […] Übergang zum Ruhm. Aber keine Perspektive des Opferns.30
Was Ricœur in dieser Passage ablehnt, scheint mir die Auffassung von Tod und Sterben Christi im Sinne eines Sündenbock-Rituals, also eines regelmäßigen Blutvergießens, das Gottes Blutdurst zu stillen hat, zu sein. Er lehnt nicht ab, dass Christus sein Leben aus Liebe zum Anderen »opfert«. Ricœurs Intention scheint mir hier zutiefst anatheistisch zu sein, insofern nämlich, als er eine post-sakrifizielle Eucharistie des Teilens mit dem Fremden, dem Anderen, dem uner warteten Gast, ins Spiel bringt. Die Tatsache, dass Ricœur sich selbst als einen »Christen, der philosophisch schreibt«, bezeichnet, nicht aber als einen »christlichen Philosophen«, erscheint mir hier sehr wichtig. Indem er dies nämlich tut, erkennt er das Gewicht jener Lücke an, die es uns erlaubt, frei und phantasievoll zu den oft vergessenen Quellen traditioneller Religion zurückzukehren, ja diese womöglich freizusetzen. *
*
*
Eine letzte Frage an Ricœur bleibt gleichwohl offen: Was meint er damit, wenn er Gott als einen dieu capable bezeichnet? Als ein Denker, der sich immer gegen Dichotomien wandte, gab Ricœur zu verstehen, dass eine kritische Begegnung der Kategorien der griechischen Ontologie mit denen der biblischen Theologie, die in der Übersetzung von Exodus 3:14 am Werk sind, uns neue Ressourcen
30
Ebd., S. 79.
519
Richard Kearney
für ein Verständnis der Natur des Göttlichen als eines Fähigen oder auch Be-Fähigenden (enabling) zu eröffnen vermag. (Womöglich würde er diesbezüglich in der Tat Derrida zustimmen, dass es »Philo sophie« genau zwischen dem »tragischen« Sein im Sinne Athens und der »messianischen« Alterität Jerusalems gibt).31 An diesem Punkt erwähnt Ricœur auch die traditionelle Übersetzung des hebräischen »Ehyeh Asher ehyeh« als »Ich bin, der ich bin«, wiewohl ihn alternative Wiedergaben wie »Ich bin, wer ich sein möge«, oder »Ich bin, der mit dir sein wird« mehr interessieren. Gerade die letztere erkennt nämlich einen gewissen »heiligen Dynamismus« in der Hebräischen Ausdrucksweise an, die im Griechischen und im Lateinischen die bestehende Spannweite der ontologischen Kategorien von Sein und Nicht-Sein erweitert.32 Von besonderem Interesse hieran sind die in der Form von Exodus enthaltenen Konnotationen des Versprechens, des Werdens und der Zukünftigkeit. Ricœur ist geradezu fasziniert von dieser Spannung, die aus der Überkreuzung, ja Über-setzung (crossing over) von griechischer Ontologie und biblischer Theologie entsteht. Er schreibt diesbezüglich: It is truly the verb ›to be‹ but none of the senses found in the Greek. There is a sort of enlargement of the meaning of being as a being-with, or being-faithful, that is, the being accompanied by people, another dimension of being.33
Wenn Aristoteles erläutert, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, das Seiende auszusagen, so hatte er nicht, wie Ricœur feststellt, das Sein im Sinne von Exodus 3:14 berücksichtigt. In diesem Rah men sieht Ricœur eine wechselseitige Erweiterung der Ontologie in den verschiedenen griechischen und hebräischen Übersetzungen am Werk.
31 Siehe auch J. Derrida, »Gewalt und Metaphysik«, S. 198 f. Das ganze Zitat lautet: »Keine Philosophie, die die Verantwortung ihrer Sprache trägt, kann auf die Ipseität im Allgemeinen verzichten, und am wenigsten von allen die Philosophie der Escha tologie oder Trennung. Zwischen der ursprünglichen Tragödie und dem messianischen Triumph gibt es die Philosophie, in der die Gewalt im Wissen sich gegen sich selbst wendet, in der die originäre Endlichkeit sich selbst erscheint, und in der der Andere im und durch das Selbst geachtet wird.« 32 P. Ricœur, »From Interpretation to Translation«, S. 331 f. Siehe auch P. Ricœur, »La croyance religieuse. Le difficile chemin du religieux«, besonders den Teil »L´homme capable, destinataire du religieux«, S. 207 ff. 33 P. Ricœur, »A Colloquio con Ricœur«, S. 254.
520
Rückkehr zu Gott nach Gott
Hier finden wir zu guter letzt eine Eschatologie des Möglichen angedacht, geteilt von Philosophen und Theologen gleichermaßen. Diese Eschatologie lässt sich hier, Ricœur selbst zufolge, als sein intel lektuelles und spirituelles »Geheimnis« verstehen.34 Das Konzept kommt des Öfteren auf, wird allerdings zumeist erst gegen Ende manch hermeneutischer Analysen (wie z.B. in Freud und Philosophie) auf eine eher allusive Art ins Spiel gebracht. Der Begriff »Eschaton« dient Ricœur dabei als eine Art Horizont von Philosophie und Theo logie, was unschwer anhand der Betonung seiner Zwischenstellung – im Spätwerk Penser la bible — zwischen »philosophischer Theologie« und »theologischer Philosophie« zu erkennen ist.35 Die Anerkenntnis eines solchen eschatologischen posse trat bei Ricœur erst spät zu Tage, was einem Abschied von seiner früheren Reserviertheit — er nannte es seinen »methodologischen Asketismus« — gegenüber der Verflechtung von Philosophie und Theologie gleichkommt.36 In einem fesselnden Aufsatz über das Hohelied in Penser la bible, namentlich im Text La métaphore nuptiale dans le Cantique des Cantiques treibt Ricœur dieses eschatologische Geheimnis geradezu bis zum Punkt eines rhapsodischen Eingeständnisses.37 Hier finden P. Ricœur, »The Poetics of Language and Myth«, S. 99 f. P. Ricœur, »A Colloquio con Ricœur«, S. 255. 36 Ebd., S. 255. 37 P. Ricœur, »The Nuptial Metaphor«, S. 265 f. Siehe auch Ricœurs letzte Anspielung auf unser Verständnis des göttlichen posse in einem seiner letzten »Fragmente« in Lebendig bis in den Tod, S. 119–121. Diese findet sich im Kontext einer Diskussion von Mark Philonenkos Lesart des Vater-Unser. Ricœur bemerkt dort, dass es in diesem Gebet weniger um Gottes Sein geht (die Tatsache, dass Gott ist), als um den Aufruf zu tun und zu handeln. Ricœur sieht darin eine Bewegung, die über die herkömmliche Metaphysik des Seins hin zu einer Eschatologie der Ermöglichung führt: »Außerdem richtet sich eine Anrufung an einen Gott, der vermag, was er macht. [Kursivierung R.K.]. Bei den Bitten mit ›du‹ wird Gott darum gebeten, alles zu machen, auf dass er herrsche .... [Randbemerkung; Vielleicht ein Gott des posse (Richard Kearney)]. Die eschatologische Vision ist die einer Vollkommenheit des Handelns (S. 119). Auf sein oft geäußertes Ansinnen einer hermeneutischen Relektüre von Aristoteles‘ Dialektik von Möglichkeit und Wirklichkeit zurückkommend, notiert Ricœur, dass Christi Bitte an den Vater nicht nur die Form eines Wunsches, sondern einer Erwartung annimmt, des Vertrauens in den Vollzug der Handlung (agir). Ricœur findet hier eine »Ver knüpfung« von Fähigkeiten, menschlichen und göttlichen, die in einer »Verknüpfung« der Handlungen zu realisieren bleibt. »Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ver geben unseren Schuldigern«, etc. »Das wie (hôs) bewirkt auf verbaler Ebene, was die ungleiche Symmetrie der zwei Arten des Handelns in der Wirklichkeit bewirkt.« (S. 121) Ricœur beschließt die Überlegung mit einer eschatologischen Neuinterpreta tion von Aristoteles’ Ontologie von Akt und Potenz, die eine neue hermeneutische 34
35
521
Richard Kearney
wir das eschatologische Potential des Göttlichen, als etwas, das auf die liturgische Macht des Menschen in theo-erotischer Form antwortet. Ricœur kommentiert hier den Vers 8:6 des Hohelieds, wo die gekürzte und noch nie da gewesene Anspielung auf Gott (shalhevetya) als yah aufscheint – wobei Ricœur erwähnt, dass das berühmte »Siegel« ins Menschenherz eingebrannt sei, und sowohl als Weisheit wie als Sehnsucht verstanden werden könne: Unter dem Apfelbaum habe ich dich geweckt, / dort, wo deine Mutter dich empfing, / wo deine Gebärerin in Wehen lag. Leg mich wie ein Siegel auf dein Herz, / wie ein Siegel auf deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe, / die Leidenschaft ist hart wie die Unterwelt! (Hohelied, 8:5b-6a) Hier, so schlägt Ricœur vor, haben wir ein diskretes Eschaton vor uns, welches das Incognito eines intimen corps-à-corps respektiert, worin menschliche und göttliche Interessen ineinander übergehen. In diesem hochzeitlichen Austausch findet das »Ich kann« des Menschen seinen Korrespondenten im »Du kannst« heiliger Liebe. L’homme capable und le dieu capable antworten einander in einem Moment kühner Komplizität und Ko-Kreation. Und es ist tatsächlich kein Zufall, vermute ich, dass Ricœur sich entscheidet, hier den Begriff »Metapher« zu verwenden, um diesen göttlich-menschlichen Aus tausch zu beschreiben, da Metaphorizität eben das gespannte Verhält nis beschreibt, in dem die Macht der Sprache durch die Kreuzung von scheinbaren Gegen-sätzen – immanent-transzendent, sinnlichintelligibel, endlich-unendlich – zum Leben erweckt wird. Wenn man diesen Text liest, so wird klar, dass Ricœur das Göttliche als »fähig« versteht, weil es eros und agape ist: eine dynamische Wirkkraft (dynamis, conatus, appetitus), die sich in Form eines Begehrens zeigt, »Verknüpfung« samt einer radikalen Aufladung semantischer Erneuerung involviert: »Dies wäre die Ermöglichung, die einer Aussage in Begriffen des Handelns. Nicht griechisch. Aber Möglichkeit einer Neufassung des Verbs Sein auf Aristotelische Weise. Sein als dynamis – energeia. Das Handeln ermöglicht diese Neufassung des griechischen Seins. Wie bereits Exodus 3, 14–15. Siehe Penser le Bible über das ›Ich bin, der ich sein werde.‹“ (S. 121). In dieser Schlusspassage, die die eschatologische »Fähigkeit« zur Vergebung behandelt, verbindet Ricœur seine ontologischen und theologischen Einsichten in die transformative Macht des »Möglichen«.
522
Rückkehr zu Gott nach Gott
das weniger Mangel denn Überfluss ist: eschatologisches Begehren danach, den Menschen zu einer neuen Genesis, Menschwerdung, Natalität zu befähigen. Eher désir à être denn manque à être. Begehren jenseits des Begehrens. Anatheistisches Begehren im Sinne einer Liebe, die dem Begehren mit noch mehr Begehren antwortet — und dem Tod mit mehr Leben. In einem solchen Prozess wechselseitigen Austauschs wird Gott durch das Begehren bestimmt als ein ande rer Name für das »Mehr«, den »Überschuss«, die »Überraschung«, wonach die Menschen suchen. Nun gilt es zu fragen: Was sind die Implikationen eines sol chen »fähigen Gottes«, wenn es um die Fragen von Leben und Tod geht? Das eschatologische posse impliziert für Ricœur einen Gott des befähigenden Werks (enabling service), im Gegensatz zu einem des sakrifiziellen Blutvergießens; eine Gottheit, die willens ist, ihr Sein für ein Mehr der Anderen aufzugeben, eine liebende Gottheit. In diesem Sinne können wir von einem Gott sprechen, der die Reli gion transzendiert (im Sinne eines konfessionellen Absolutismus), mindestens von einem inter-religiösen oder trans-religiösen Gott. Ich denke, dass Ricœur mit dieser begrifflichen Verbindung sich am Ende sehr seinem Pariser Freund Stanislas Breton annäherte, der eine Form der mystischen Kenosis im Auge hatte, der zufolge das Göttliche »nichts« wird, damit die Menschheit menschlicher werden kann.38 Eine solche Auffassung des göttlichen posse — eines befähigenden Gottes, der sagt: »Du bist fähig, das zu tun!« — weist alle Formen der Theodizee und auch der Theokratie zurück, um die Macht und die Verantwortung den Menschen zurückzugeben. Es ist interessant, dass Ricœur in diesem Zusammenhang die großen Rheinischen Mystiker anführt, jene, die sich radikal distanziert hatten, um das Wesentliche offen zu legen, um – gerade in ihrer kontemplativen Distanziertheit – unglaublich aktiv zu werden im Schaffen neuer Ordnungen, im Unterrichten, im Reisen und insbesondere in ihrer Zuwendung zum Vergessenen dieser Welt. Indem sie so empfänglich für das Wesentli che in der Welt waren, fühlten sie sich berufen, die »Liebe zum Leben auf den anderen [zu übertragen].«39 S. Breton, Le verbe et la croix. P. Ricœur, Lebendig bis in den Tod, 61. Weitere bedeutsame Beiträge zur Debatte um »Gott nach der Metaphysik« – die im Kontext der sog. »theologischen Wende« der französischen Phänomenologie mit Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, Jean-Yves Lacoste und Michael Henry sowie im Gefolge von Derridas Dekonstruktion aufkam 38
39
523
Richard Kearney
Gott wird somit, so Ricœur, ein Gott nach Gott; ein Gott, der nicht mehr da ist, vielmehr wieder sein kann in der Form erneuerten Lebens. Eine solche Gottheit ist fähig, uns zu einem heiligen Leben zu befähigen; und zwar durch eine Entleerung des Göttlichen vom Sein zum Nicht-Sein, sodass eine Wiedergeburt zu mehr Sein möglich wird. Mit dieser Wahl der Natalität statt der Mortalität kann die Dichotomie zwischen dem Vor und dem Nach dem Tod umgestaltet werden, denn es steht die Geburt über dem Tod. Der Spielraum des Anatheismus öffnet sich aus diesem kann sein (may be). Doch es ist ein Raum freier Möglichkeiten – über die Unmöglichkeit hinaus; es ist niemals ein fait accompli, sondern ein Einsatz, einer, der immer und immer wieder gemacht werden muss. Übersetzt aus dem Englischen von Magdalena Sedmak & Michael Staudigl
Literaturverzeichnis Breton, S., Le verbe et la croix, Paris: Mame-Desclée 2010 Dawkins, R., Der Gotteswahn, übers. v. S. Vogel, Berlin: Ullrich 2007 Courtine, J.-F. (Hg.), Phénoménologie et théologie, Paris: Criterion 1997 Derrida, J., »Außer dem Namen (Post-scriptum)« [1993], in: ders., Über den Namen. Drei Essays, übers. v. H. D. Gondek, M. Sedlaczek, Wien: Passagen 2000, S. 63–121 —, »Gewalt und Metaphysik«, in: ders. Die Schrift und die Differenz, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1972, S. 121–235 —, Marx’ Gespenster, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1993 —, »Deconstruction and the Other«, in: R. Kearney (Hg.), Debates in Continental Philosophy, New York: Fordham University Press 2004, S. 139–154 Freud, S., »Das Unbehagen in der Kultur«, in: Studienausgabe, Bd. 9, Frankfurt am Main: S. Fischer 1974, S. 197–270 – finden sich in den Arbeiten von John Caputo, John Manoussakis und Mark Taylor. Diese Denker haben ebenso das Messianische nach der Metaphysik erforscht, was sie paradoxerweise, aber umso aussagekräftiger »Religion ohne Religion« nennen. Caputos Zugang nimmt seinen Weg über die »Schwäche Gottes«, ausgehend von seiner Interpretation der christlichen Kenosis, die er dekonstruktiv als eine Kompli zenschaft von Mystizismus und Atheismus versteht, wie wir sie auch in Derridas Sauf le Nom bereits identifizieren konnten. Manoussakis und Taylor entwickeln unterschiedliche Konklusionen in ihren Büchern, beide After God betitelt, wobei der eine eine theistische Richtung einschlägt, der andere eine atheistische.
524
Rückkehr zu Gott nach Gott
Janicaud, D., Le tournant théologique de la phénoménologie française, Paris: L’Eclat 1991 Joyce, J., Ulysses, London: Penguin 1968 Kearney, R., »The Shulammite Song: Eros Descending and Ascending«, in: V. Burrus, C. Keller (Hg.), A Theology of Passions, New York: Fordham University Press 2006, S. 306–340 —, »Bachelard and the Epiphanic Instant«, in: Philosophy Today 52 (Fall 2008/ SPEP Supplement), S. 38–45 Levinas, E., »Das sinnlose Leiden«, in: ders., Zwischen Uns. Versuche über das Denken an den Anderen, München: Hanser 1995, S. 117–131 —, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität, Freiburg, München: Alber 1987 Llewelyn, J., Emmanuel Levinas. The Genealogy of Ethics, London: Rout ledge, 1995 Nietzsche, F., »Die Fröhliche Wissenschaft«, in: G. Colli (Hg.), Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Einzelbänden. Band 3: Morgenröthe. Idyllen aus Messina. Die fröhliche Wissenschaft, Berlin, Boston: De Gruyter 2019 Ricœur, P., Die Fehlbarkeit des Menschen, Freiburg, München: Alber 1971 —, »Religion, Atheismus, Glaube«, in: ders., Hermeneutik und Psychoanalyse, München: Kösel 1974, S. 284–314. —, »The Critique of Religion«, in: C. Regan,a D. Stuart (Hg.), The Philosophy of Paul Ricœur, Boston: Beacon Press 1978, S. 222–246 —, Critique and Conviction, New York: Columbia University Press 1998 –, »From Interpretation to Translation«, in: ders., Thinking Biblically, Chicago: Chicago University Press 1998), S. 331–364 —, »The Nuptial Metaphor«, in: ders., Thinking Biblically, Chicago: Chicago University Press 1998, S. 265–306 —, »A Colloquio con Ricœur«, in: F. Turoldo (Hg.), Verità del Metodo, Padova: Il Poligrafo 2000, S. 241–290 —, »La croyance religieuse. Le difficile chemin du religieux«, in: Y. Michaud (Hg.), La Philosophie et l´Éthique. Université de tous les avoirs 11, Paris: Odile Jacob 2002, S. 207–224 —, Lebendig bis in den Tod. Fragmente aus dem Nachlass, Hamburg: Meiner 2011 —, »The Poetics of Language and Myth«, in: R. Kearney (Hg.), Debates in Con tinental Philosophy, New York: Fordham University Press 2004, S. 99–116. Scheler, M., Liebe und Erkenntnis, Bern, München: Francke 1970 Steinbock, A. J., Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience, Bloomington: Indiana University Press 2007
Die Bibel ist zitiert aus der Revidierten Einheitsübersetzung 2016. Abstract Die vorliegende Arbeit erörtert die ana-theistische Möglichkeit, zu Gott zurückzukehren, nachdem der Gott der Ontotheologie der anatheistischen Kritik unterzogen wurde. In einem ersten Schritt werden
525
Richard Kearney
Levinas’ und Derridas Ausführungen dazu, aber auch Freuds und Nietzsches atheistische Kritiken wiederholt. Dem folgt eine Ausein andersetzung mit Paul Ricœurs Werk, durch das die atheistische Kritik als ein notwendiges Moment in der Entwicklung eines nachreligiösen Glaubens entfaltet wird, eines Glaubens, der durch den Abweis von Angst und Abhängigkeit im Gegenzug Lebensbejahung und die Zuwendung zum Existentiellen mit sich bringt. Der Autor diskutiert sodann die Frage, wie die so angezeigte Rückkehr zu Gott möglich sei. Er argumentiert dafür mit Blick auf (1) die ethische Position, die sie ermöglicht, (2) auf die Reinterpretation biblischer Traditionen, die sie anzeigt und (3) übergreifend auf die neu zu denkende Beziehung zwischen dem anatheistischen Philosophen und dem Theologen, die eine derartige Renaissance eines fähigen/befähi genden/befähigten Gottes (enabling God) erst möglich macht. Schlagworte Levinas, Derrida, Ricœur, Anatheismus, Atheismus, Eschatologie
526
Jacob Rogozinski
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
»Aus den Tiefen rufe ich zu dir, JHWH! / Herr, höre auf meine Stimme! / Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme mei nes Flehens!« Psalm 130 »Du hast alle Tage deines Lebens zu Gott gerufen, und deine Tage sind vergangen. Da hat dich ein anderer ersetzt und er hat gerufen während seiner Tage. Du hier, er dort, ein anderer woanders […]. Es gibt also einen einzigen Menschen, der dauert bis ans Ende der Zeiten, und es sind seine Glieder, die stets rufen.« Augustin, Kommentare zu den Psalmen
Was kann uns die Phänomenologie über dieses so sonderbare Phäno men namens »Gott« beibringen? Diese Frage kann überraschen: Die von der Phänomenologie inspirierte Forschung setzt sich schon seit geraumer Zeit mit dieser Frage auseinander und hat entscheidende Fortschritte ermöglicht. Es könnte jedoch sein, dass diese Untersu chungen noch von Vorurteilen geprägt sind, die sie beeinträchtigen und ihre Analysen – zumindest teilweise – verfälschen. Falls diese Feststellung zutrifft, gilt es, die Vorurteile infrage zu stellen, um sich einen neuen Weg zu diesem Phänomen zu bahnen. Dies setzt voraus, dass man bereits über ein gewissen Vorverständnis von Gott verfügt, das es erlaubt, diese Vorurteile ausfindig zu machen. Wo ist dieser rote Faden zu finden? Was man gemeinhin »Gott« nennt, gibt sich in Glaubensphänomenen und diese stehen im Zusammenhang mit einer Religion, d.h. einem Glaubensdispositiv: eine Reihe von Vorstellungen, rituellen Praktiken, von der Tradition überlieferten Texten. Jedes solche Dispositiv bezeugt eine bestimmte Manifestation des Phänomens »Gott«, und streng genommen gibt es sich niemals auf andere Weise: Außer vielleicht im Wahnsinn gibt es keine »private Religion«, die den bereits existierenden Dispositiven vollständig fremd wäre. Die religiösen Traditionen gewähren den Zutritt zu diesem Phänomen auf je andere Weise, und nichts berechtigt uns
527
Jacob Rogozinski
dazu, einer davon auf Kosten der anderen den Vorzug zu geben. Eine phänomenologische Herangehensweise setzt in der Tat voraus, dass jegliche vorherige Befürwortung eines bestimmten Glaubens ausge klammert werde. Vollzieht man diese epoché, wird es unmöglich, eine »wahre Religion« zu bestimmen, die man »falschen Religionen« gegenüberstellen könnte. Was nicht bedeutet, dass die Religionen nichts mit der Wahrheit zu tun hätten, sondern dass der Kampf zwi schen Wahrheit und Unwahrheit alle Glaubensdispositive durchzieht. Um es auf eine knappe Weise zu sagen: Alle göttlichen Namen sind Namen Gottes. Dies veranlasst uns dazu, von diesem verehrungswürdigen und doch so abgenutzten Namen, »Gott«, Abstand zu nehmen. Gott zu sagen, ohne ihm ein Attribut oder einen Artikel beizufügen, und ihn zugleich mit einer Majestätsmajuskel verzierend1, bedeutet vorauszusetzen, dass eine bestimmte Gottheit einzig und universal ist und als einzige den Namen »Gott« wirklich verdient. Was dazu führt, dass zahlreiche andere göttliche Namen beiseite geschoben werden, wobei willkürlich eine bestimmte Tradition privilegiert wird: die unsrige, jene des westlichen Denkens, wo sich vage der in der Bibel bezeugte Gott und der aus Griechenland kommende Abgott, der »Gott der Philosophen«, vermischen. Dieses alte Wort »Gott« ist allzu gut bekannt, um nicht verkannt zu sein: Es ist so beladen mit sedimentierten Bedeutungen, dass es genügt, es auszusprechen, um jegliche Fragestellung vom Tisch zu wischen. Wir verfügen leider über keinen anderen Namen, um dieses Phänomen zu bezeichnen, und Ausdrücke wie »die Gottheit« oder »das Göttliche« sind dafür zu unpersönlich und unbestimmt. Darum habe ich beschlossen, ihn in diesem Text beizubehalten, allerdings indem ich ihm seine Majuskel nehme und ihm einen Artikel anhänge, was übrigens dem griechi schen und hebräischen Gebrauch (ho théos, und seltener ha-elohim) oder jenem Hölderlins mehr entspricht. Ich hoffe, dass der Leser mir diese Entscheidung, auf diese Weise den gott zu nennen (außer wenn ich andere Autoren zitiere), verzeihen wird. Dies scheint mir in einem Text angebracht, wo es genau um das Benennen und die Entscheidung gehen wird, die einen gott herbeiführen. Auf Französisch kann das Wort für »Gott« (dieu) sowohl klein, wenn es um »einen Gott« im Sinne einer Gottheit geht, als auch groß geschrieben werden, wenn es sich um den adressierbaren jüdisch-christlichen Gott handelt. Wir werden im Folgenden der Groß- bzw. Kleinschreibung des Autors folgen, sprich »gott« schreiben, wo im Original von »dieu« die Rede ist (und umgekehrt). [Anmerkung der Übersetzerin] 1
528
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
1. Die drei Vorurteile der Phänomenologie der Religion Keine der unterschiedlichen religiösen Traditionen ist wahrer als die anderen. Und doch muss man eine wählen, um einen ersten Zugang zum gott-Phänomen zu finden. Jeder religiöse Glaube nähert sich ihm auf eine so einzigartige, so idiomatische Weise an, dass es vergeblich wäre, eine allgemeine Auffassung von »gott« oder von der »Religion« überhaupt anzustreben. Man ist somit verpflichtet, wie Ricœur richtig erkannt hat, von »dem Ort, wo man sich anfänglich aufhält, auszugehen«, d.h. von einer bestimmten Tradition, um sich »sukzessive« den anderen Traditionen öffnen zu können.2 Ich werde von jener ausgehen, die mir vermittelt wurde, der hebräischen Bibel, aber auch einer benachbarten Tradition, jener der Evangelien, um die bedeutenden Vorurteile der gegenwärtigen Religionsphänomeno logie zu hinterfragen. Es gibt davon dreierlei, welche wiederum mit drei Namen verbunden sind, nämlich Jean-Luc Marion, Emmanuel Levinas und Michel Henry. Diese Phänomenologen – die ich respek tiere und denen ich immens viel schulde – setzen voraus: (a) die Vorrangigkeit des göttlichen Rufes gegenüber jeglicher menschlichen Antwort (Marion); (b) die unendliche Alterität des gottes (Levinas); (c) seine Nicht-Selbstheit, die es ihm unmöglich macht, ursprünglich ein Selbst (soi) oder ein Ich (moi)3 zu sein (Henry). Laut Marion zeichnen sich alle Phänomene durch den Vorrang ihrer Gegebenheit gegenüber dem Ich aus: »Gegebenheit geht näm lich, genau genommen, jeder anderen Instanz (das Ich besonders einbegriffen) voraus«4. Allerdings lassen sich die »dürftigen« oder »allgemeinen« Phänomene leicht durch die Macht eines konstitu ierenden Ichs (Je) unterjochen, im Unterschied zum »gesättigten« Phänomen, das es radikal übersteigt und dem Ich (Je) »durch einen je schon ergehenden Anruf [vorausgeht]«, sodass »das Ich (Je) […] seine Vorgängigkeit als Ichpol [verliert]« und »es einem solchen nicht zu konstituierenden Phänomen den Vorrang über sich«5 einräumen muss. Nun ist aber die Offenbarung Jesu Christi das gesättigte Phä Vgl. P. Ricœur, An den Grenzen der Hermeneutik, S. 88ff. und S. 95. Der Autor verwendet im Folgenden drei unterschiedliche Ausdrücke für das Ich (moi, Je und ego), die wir jeweils in Klammern hinzufügen werden. [Anmerkung der Übersetzerin] 4 J-L. Marion, Gegeben sei. Entwurf einer Phänomenologie der Gegebenheit, S. 318 5 Ebd., S. 362
2
3
529
Jacob Rogozinski
nomen schlechthin: das bedeutendste Beispiel dieser Gegebenheit, die dem Ich (moi) zuvorkommt und es »verdutzt« zurücklässt. Für Levinas ist der andere bereits der »ganz-Andere«, aber Gott ist »anders als der andere«, noch anderer als er, »transzendent bis hin zur Abwesenheit«: Seine Alterität ist jene eines Er jenseits des Du und des Antlitzes des anderen.6 Für Henry ist »die Essenz des Lebens Gott«; doch handelt es sich um ein absolutes Leben, »absolut anders« als das Leben des endlichen Ichs (ego); und dieses göttliche Leben, das der Vater ist, ist kein Ich (ego). Gewiss, die Selbstheit gehört zur Essenz des Lebens, doch ist es jene des »Ur-Sohns«, des »Erst-Lebendigen«, die das principium individuationis alles Lebendigen, Gott inklusive, ist. Somit offenbart sich Gott und gelangt er zum Selbst (Soi) nur »in der Offenbarung des Sohnes und als dieselbe«7. Es ist möglich zu zeigen, dass diese drei Thesen sich gegenseitig implizieren, da sie auf derselben Vorannahme beruhen. Da der gott unendlich-Anders ist (These b), entzieht er sich dem Griff des Ich (ego) und sein Ruf greift jeglicher menschlichen Initiative vor (These a). Da uns eine unendliche Distanz trennt (These b), gibt es nichts, was uns gemein wäre: der gott ist kein Ich (ego) (These c) und er manifestiert sich, indem er das Ich (ego) durch seinen Ruf destabilisiert, der ihm immer schon vorausgeht und es überfordert (These a). Es handelt sich jedes Mal um ein Phänomen, das das Ich (ego) radikal übersteigt und es somit enthebt: Was die Einheit der drei Thesen ausmacht, ist eine Ausrichtung, die von mehreren gegenwärtigen Denkern geteilt wird, nämlich diese Absicht, das Ich (ego) zu entheben, die ich Egozid nenne.8 Um ihre phänomenologische Legitimität zu klären, wäre eine lange Analyse notwendig. Diesen Weg werde ich hier nicht beschrei ten.9 Ich werde mich stattdessen damit begnügen, herauszufinden, ob 6 »Gott nicht einfach der ›erste Andere‹ oder der ›Andere schlechthin‹ oder der ›abso lut Andere‹, sondern ein Anderer als der Andere, in anderer Weise ein Anderer, ein Anderer, dessen Andersheit der Andersheit des Anderen, der ethischen Nötigung zum Nächsten hin, vorausliegt und der sich von jedem Nächsten unterscheidet, der bis in die Abwesenheit, bis zu seiner m glichen Verwechslung mit dem Hin-und-Her-Trei ben des Es gibt transzendiert. 23 siehe E. Levinas, »Gott und die Philosophie«, S. 108. 7 M. Henry, »Ich bin die Wahrheit.« Für eine Philosophie des Christentums, S. 97 8 In diesem Sinne hat diese Arbeit die Kritik der wichtigsten gegenwärtigen Egozide zum Ziel, die ich in Le moi et la chair – introduction à l'ego-analyse, begonnen habe. 9 Ich habe diese Analyse an anderer Stelle begonnen: vgl. »De la caresse à la blessure: outrance de Levinas«, Les Temps modernes n° 664, S. 119–136, und bezüglich M. Henry, »De temps en temps la vie fait un saut«, in: La phénoménologie et la Vie, S. 469–483
530
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
diese Thesen dem treu sind, was die Tora und die Evangelien über den gott sagen. Es ist natürlich nicht die Rede davon, diesen Autoren im Namen einer vermeintlichen Orthodoxie eine Strafpredigt zu halten, sondern eher, sie mit den Traditionen zu konfrontieren, auf die sie sich alle drei berufen. Wir werden uns folglich fragen, ob der Beleg, den uns die Bibel diesbezüglich gibt, die Thesen der Religionsphäno menologie bestätigt oder ob sie sie infrage stellt.
2. »Hier bin ich, ich antworte« Wenden wir uns einer der emblematischsten biblischen Episoden zu. Mithilfe der Flammen eines Busches ruft ein gott Moses, der mit hineini, »hier bin ich«, antwortet. Er offenbart ihm dann, dass er »der gott seines Vaters« ist und bittet ihn, sein Volk zu befreien. Auf den ersten Blick ist es der gott, der die Initiative zum Ruf ergreift: seine vorherige Einladung fährt dem Subjekt, das sie passiv erhält, ins Wort. Dies ist jedoch bloß eine partielle Interpretation der Episode, die sie vom narrativen Kontext, von der das Schicksal der Hebräer in Ägypten heraufbeschwörenden Erzählung, trennt: »Und die Söhne Israels stöhnten unter ihrer Knechtschaft und schrien, und ihr Schreien aus ihrer Knechtschaft stieg auf zu Gott. Und Gott erhörte ihr Wehklagen und gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah auf die Söhne Israels und nahm sich ihrer an.«10 Im darauffolgenden Vers führt uns die Erzählung auf die Hänge des Sinai, wo der Hirte Moses JHWH begegnen wird. Zuerst kommt also nicht der göttliche Ruf: Ihm geht der Schmerzensschrei der Unterjochten voraus. Ihr Ruf geht dem seinigen voraus, ruft ihn an, lädt ihn zu einer Antwort ein: Er appelliert an den göttlichen Ruf, sodass der gott als der dem Ruf Verpflichtete erscheint. Moses' hineini schien zu bedeuten, dass der Mensch immer nur auf den ursprünglichen Ruf des gottes antwortet; doch hier ist es der gott, der den Menschen antwortet, als ob der Platz des Antwortenden abwechselnd von einem Menschen oder durch den gott selbst besetzt werden könnte. Jesaja, der uns dieses Wort JHWHs überliefert hat, bestätigt dies: »Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht: Hier bin ich!« (52,6). »Hier bin ich, ich antworte« könnte einer der göttlichen 10
Exodus 2,23–25
531
Jacob Rogozinski
Namen sein. Könnte es sein, dass der gott nichts anderes ist als seine Antwort auf den Ruf der Menschen? Wir entdecken hier einen sehr anderen gott als die gleichmütige Gottheit Platons oder den unpersönlichen Natur-Gott Spinozas, näm lich einen gott, der fähig ist, die Klage der Menschen zu vernehmen, ihre Not zu sehen, ihnen zur Hilfe zu kommen. Ein gott, der nicht das Absolute, der Allmächtige, der Allwissende der rationalen Theologie ist: Er zeichnet sich im Gegenteil durch seine Nicht-Allmacht, sein Nicht-Wissen aus, da es ja vom Ruf der Menschen abhängt, dass er zu diesem gott wird, der sich erinnert, der sieht und weiß. Wir verstehen nun, was in uns den Eindruck erweckt, dass er als erster ruft. Er antwortet nicht auf Moses' Ruf, sondern auf einen anderen Ruf, dem der vom Haus der Knechtschaft aufsteigt. Jene, die rufen, und jener, der die Antwort des gottes erhält, sind nicht dieselben: diese Diskrepanz lässt sein Erscheinen unerwartet und geheimnisvoll anmuten und kann seine Antwort als einen ersten Ruf wirken lassen. Vielleicht verstehen wir auch, warum die Menschen so oft mit dem Schweigen des gottes, seiner mangelnden Reaktion, seinem NichtErscheinen, konfrontiert sind, wie dies bereits die Klagelieder oder das »Warum hast du mich verlassen?«, das sich vom Golgotha aus erhebt, bezeugen. Auch wenn seine Antwort den Menschen dazu aufruft, ihn zu erhören und ihm seinerseits »hier bin ich« zu antworten, kann es sein, dass gott bereits auf den Hilferuf geantwortet hat; dass er unaufhörlich darauf geantwortet hat, ohne vernommen zu werden; oder auch dass seine Rufe keine Spur hinterlassen haben, weil im Unterschied zu jener Moses' die Antwort unzähliger menschlicher Antwortender erstickt und vergessen wurde. Bleibt diese Episode ein Einzelfall unter all jenen, wo es der gott ist, der offensichtlich die Initiative ergreift? Oder hat sie beispielhaften Wert? Die Bibel gibt andere Beispiele dieser paradoxen Situation, wo, indem er einem Menschen antwortet, der ihn nicht angerufen hat, der gott tatsächlich auf einen vorherigen Ruf antwortet, den andere Menschen an ihn gerichtet haben. Als der junge Samuel nachts im Heiligtum eine Stimme hörte, die ihn rief, erkannte er sie nicht auf Anhieb als jene JHWHs; und er konnte sie nicht erkennen, da er selbst den gott nicht beschworen hatte: Es war Hannah, seine unfruchtbare und erniedrigte Mutter, die ihn angefleht hatte –, mit leiser Stimme, wie der Text präzisiert – ihr ein Kind zu gewähren. Und wenn JHWH ihn kommen lässt, um aus ihm seinen Propheten zu machen, dann weil sie seit vor seiner Geburt versprochen hatte, ihn ihm zu weihen
532
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
(vgl. I Samuel, 1). Seine prophetische Berufung und seine Existenz selbst sind bereits die Antwort auf einen Ruf, der dem göttlichen Ruf vorausgeht. Es kommt im Übrigen vor, dass im Unterschied zu Moses und Samuel der Rufende und der Gerufene derselbe sind, aber er nicht weiß, woher der Ruf kommt, da er selbst nicht weiß, dass er gerufen hat. Ein Fanatiker namens Saul steuert auf Damaskus zu, wo er sich anschickt, die Jünger Jesu zu verfolgen. Als er eine Stimme hört, die zu ihm schreit: »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?«, gelingt es ihm nicht, diese Stimme zu identifizieren, und er fragt stattdessen »Wer bist du, Herr?«. Jener, der nur »Drohung und Mord schnaubte« gegen die ersten Christen (Apostelgeschichte 9,1), hat nicht bemerkt, dass sein Hass ein Ruf war und dass er bereits undeutlich jenen anrief, dessen Anhänger er verfolgte. Das ursprüngliche Phänomen ist somit nicht der Ruf des got tes, sondern jener der ihn anrufenden Menschen. Nennen wir die sen ersten Ruf die Anrufung (invocation) nach Ricœur. Es handelt sich dabei nicht unbedingt um eine explizite Bitte. Die Anrufung setzt sprachliche Vermittlung, den Hauch einer Stimme, die Spur einer Schrift voraus; doch sie beschränkt sich nicht allein auf die gesprochene Sprache: Sie beginnt bereits mit dem stillen Gebet (wie dem Hannahs), der unartikulierten Klage, dem Zwischenruf, dem Schmerzens- oder Zornesschrei, und sie entfaltet sich gemäß allen Anredemodi, die es einem Menschen ermöglichen, zu rufen. Sie gestaltet sich auch als Lobpreis und Segen – die meisten jüdischen Gebete beginnen mit »gesegnet seist du JHWH« –, aber auch als Klage oder sogar Verwünschung und Blasphemie. Sie vollzieht sich ebenfalls über Rituale, eine Opfergabe, das Studium der Schriften, mystische Ekstase, Askese, Gesang, Tanz und so viele andere Wege der Anrufung. Es kann sein, dass ein gott sich niemals anders zeigt: Er ist jedes Mal der auf einen Ruf Antwortende, der Angerufene einer Anrufung. So wie er auf unterschiedliche Weise angerufen wird, ist seine Art zu antworten ebenfalls sehr divers. Sie nimmt nicht unbedingt die Form eines »erhabenen«, von seinem Exzess an Phänomenalität gesättigten, unbedingten, unerträglichen, unanseh baren Phänomens an. Manchmal zeigt er sich wie dem Propheten Elijah weder durch einen Orkan noch durch Glut, sondern durch eine »Stimme aus feinem Schweigen«, die dem »Rascheln einer leichten Brise« ähnelt (I Könige 19,11–13). Und sofern kenosis statthat, sofern der gott sich seiner selbst entleert, indem er auf seine göttliche Form verzichtet, wird die Welt ihn nicht als einen gott wiedererkennen und
533
Jacob Rogozinski
die seinigen werden ihn nicht aufnehmen. Dieses Nicht-Erkennen gehört zu seinem Erscheinen als eine wesentliche Möglichkeit.11
3. Ich bin jener, der sagt Ich bin Dass der gott der Angerufene einer Anrufung ist, stellt die drei Thesen der Religionsphänomenologie infrage, nicht nur jene, die die Vorrangigkeit seines Erscheinens behauptet, sondern auch jene, die ihn als unendlich-Anders charakterisiert, und jene, die ihm eine ursprüngliche Selbstheit abspricht. Sehen wir uns die beiden letzteren Vorurteile an. Wenn der gott der »ganz-Andere«, von uns durch eine unendliche Distanz Getrennte wäre, wie könnte die Anrufung eines Menschen ihn auf solch eine Weise erreichen, dass sie eine Antwort hervorrufen würde? Und wie könnte seine Antwort im Gegenzug den ihn anrufenden Menschen erreichen? Wie könnten sie einen Bund schließen, so wie es der gott Israels und sein Volk taten? Es ist also ein Einverständnis zwischen den Menschen und ihm, eine bestimmte Art von Gemeinschaft, möglich. Es geht nicht darum, die sie trennende Distanz zu leugnen, sondern darum, zuzugeben, dass es trotz dieser Distanz einen gemeinsamen Nenner gibt, der sie einander annähert. Öffnen wir abermals die Tora zu dem feierlichen Zeitpunkt, wo der gott, kurz bevor er die Zehn Gebote ausspricht, sich vorstellt: »Ich bin JHWH, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.« (Exodus 20,2) Noch bevor er sich als Befreier der Unterjochten definiert, stellt er sich in der ersten Person durch ein ich bin vor. Was in diesem Wort zählt, ist zugleich die Feststellung einer Beziehung – »ich bin dein gott« – und jene eines Ich (Je), d.h. einer lebendigen, zu einer Antwort fähigen Singularität. Auf diese Weise hatte der gott sich bereits Moses gezeigt, indem er auf 11 Man muss J.-L. Marion zugestehen, dass er diese Möglichkeit nicht vollkommen ausgeschlossen hat: Er merkt in der Tat an, dass »die Sättigung des Phänomens […] hier in erster Linie von der stillen und eventuell gehaltsarmen Umkehr ihres Fließens her[rührt], mehr als von seinem eventuellen Überschuss«; sodass das absolut gesät tigte Phänomen in der Phänomenalität »dort aber keinen Platz zu seiner Entfaltung [hätte] finden« und nicht als solches erkannt hätte werden können. – Vgl. Gegeben sei, S. 385 und S. 354. Die Sättigung eines Phänomens könnte sich also durch seine scheinbare Nicht-Sättigung auszeichnen. Indem sie die gesättigten und ungesättigten Phänomene ununterscheidbar macht, wirkt sich diese Möglichkeit nicht auf die gesamte Problematik aus?
534
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
die Frage nach seinem Namen mit dem geheimnisvollen Ausspruch ehyeh asher ehyeh antwortete. Dieser Satz wurde auf unterschiedliche Weisen übersetzt und es gibt mehrere Arten, ihn zu interpretieren. Die Mehrheit der Philosophen sah darin die Behauptung einer onto logischen Identität zwischen dem Sein und »Gott« (»ich bin jener, der ist«), während andere ihn als eine Antwortverweigerung deuteten (»ich bin, wer ich bin« … und mehr werde ich dir nicht sagen!). Da sein Zeitmodus unabgeschlossen, eine Art Futur ist, müsste man ihn eher mit »ich werde sein, wer ich sein werde« (oder »wie ich sein werde«) übersetzen. Vom Talmud bis zu Raschi verstand die jüdische Tradition darunter das Versprechen, mit zu sein, das Versprechen von Unterstützung und Bündnis (»ich werde mit dir in dieser Not sein, so wie ich mit deinem Volk in den zu kommenden Nöten sein werde«). Merken wir uns vor allem, dass der gott sich in der ersten Person singular vorstellt, und dies drückt dieser Satz zunächst aus. Jenem, der ihn fragt, wie er heißt, antwortet er »ich bin jener, der sagt ich bin«: jener, der, indem er das Wort ergreift, »ich« sagt. Unter seinen zahlreichen möglichen Übersetzungen ist die passendste somit jene, die Cassirer vorschlägt: »Ich bin, der Ich bin«12 – oder vielleicht die riskantere Variante Lacans: »Ich bin, was das Ich (Je) ist«13. Man kann Wiederholungen dieses Ausspruchs in gewissen Jesus zugeschriebenen Worten hören: »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben« – »Ehe Abraham war, bin ich«. Doch das Privileg, ich bin zu sagen, gehört nicht nur dem gott der Bibel: Es handelt sich um eine grundlegende Möglichkeit, die jedem menschlichen Ich (moi) offensteht. Der Philosoph, der als erster die ursprüngliche Wahrheit des »Ich bin« entdeckte, wusste zugleich diese eigenartige Ähnlichkeit zwischen der Selbstoffenbarung des gottes und jener des ego cogito auszumachen. Es ist gewiss kein Zufall, wenn Descartes in dem Moment, wo er seine Entdeckung darlegt, Formulierungen verwendet, die an die Worte des Sinai erinnern. In seiner Abhandlung über die Methode beschwört er bereits »dieses Ich (moi), d.h. die Seele, durch die ich das bin, was ich bin«14. Und wenn er abermals in den Metaphysischen Meditationen die absolute Offenkundigkeit des Ichs (ego) feststellt, fährt er sogleich mit einem Ausspruch fort, welchen
12 13 14
Vgl. E. Cassirer, Sprache und Mythos, S. 63 J. Lacan, Séminaire XVI, D'un Autre à l'autre, S. 70–71 R. Descartes, Discours de le méthode, S. 59 [meine Hervorhebung]
535
Jacob Rogozinski
man als eine Variante dieses Wortes erkennen kann.15 Man kann sich fragen, welche Absicht Descartes hatte. Möchte er andeuten, dass das neue Prinzip (das Cogito) das vorherige (Gott) seines Privilegs, ich zu sagen, enthebt? Oder bloß, dass die Distanz zwischen beiden nicht so groß ist, sodass »wir in gewisser Weise Gott gleich sind«, wie er der Königin Christine schreiben wird? Es ist hier nicht der Ort, um diese Fragestellungen weiter zu vertiefen. Was diese paradoxe Ähnlichkeit zeigt, ist, dass der gott und die Menschen denselben Aussagemodus teilen, in derselben ursprüngli chen Wahrheit verwurzelt sind, nämlich in der Selbstoffenbarung eines singulären Ichs (ego). Indem er wie ich »ich« (je) sagt, offenbart der gott, dass er auch ein Ich (moi) ist: ein anderes Ich (moi), anders als ich (moi), und das mir dennoch durch seine Fähigkeit, »ich« (je) zu sagen, ähnelt – ein alter Ego. In einem anderen Kontext bringt Derrida ein vergleichbares Argument gegen Levinas und seine Auffassung des anderen als ganz-Anderen auf. Er stellt ihm in Husserlschem Stil die Behauptung des »irreduzibel ichliche[n] Wesen[s] der Erfahrung«, der meinigen wie jener des anderen, entgegen: »Der Andere ist nicht Ich [moi], […] er ist aber ein Ich [Moi]« und »dieser Übergang des Ich [Moi] zum Andern als zu einem Ich [Moi] ist der Übergang zur wesenhaften, nicht-empirischen Ichheit [égoité] der subjektiven Existenz überhaupt«16. Daraus folgt, dass es keinen ganz-Anderen gibt, und das Argument bleibt gültig, egal, ob es sich um den anderen oder um den gott handelt, da sie sich beide über den Modus des Ich-Sagens (Je) ausdrücken, sich mir als einem anderen Ich (moi) geben. Diese Ichlichkeit des gottes offenbart sich in jeder seiner Erscheinungen, jedes Mal, wenn er das Wort ergreift, um auf einen Ruf zu antworten. Wir werden uns somit nicht Henry anschließen, wenn er behauptet, dass das absolute Leben noch kein Ich (ego) ist und dass einzig sein »Ur-Sohn« es ihm ermöglichen würde, sich zu individuieren. Der gott, der sich Moses – oder Mohammed – offenbart, muss keinen Sohn zeugen, um Ich (Je) sagen zu können. Wir werden uns auch Levinas nicht anschließen, wenn er den gott durch seine Illeität (illéité) charakterisiert: Seine Transzendenz sei so radikal, dass sie jenseits »…sim ego [...] qui [...] sum«, Meditationes de prima philosophia, S. 48 (II, § 5). Vgl. die Analyse, die E. Balibar davon gibt in »Ego sum, ego existo – Descartes au point d'hérésie«, S. 79–123 16 J. Derrida, »Gewalt und Metaphysik«, Die Schrift und die Differenz, S. 168 und S. 199 15
536
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
des einander Gegenüberstehens, jenseits des Antlitzes zu situieren sei und nicht mehr durch ein Du und noch weniger durch ein Ich (Je) ausgedrückt werden könne, sondern einzig durch ein Er (Il), dieses Pronomen, das Distanz und Abwesenheit bedeutet, wie das lateinische ille, von welchem es abstammt. Ihm zufolge wird »[i]m Namen […] das Du zum Er«, so als würde der göttliche Name von der »Direktheit des Du« zum »Absoluten der Heiligkeit« übergehen, womit es den Abstand, der es vom Ich (Je) trennt, weiter vertieft.17 Die umgekehrte Geste dazu beschreibt ein fundamentaler Text der jüdischen Tradition, der Zohar. Anstatt einer Entfernung zieht er im Gegenteil einen Ansatz in Erwägung, in welchem der gott sich im Rahmen seiner selbstoffenbarenden Bewegung aus dem Boden- und Namenlosen herausreißt: Sein Fortgang führt ihn vom Nichts zum Er, dann zum Du und schließlich zum Ich (Je), der höchsten Phase seines Erscheinens, in der er schließlich ehyeh, »ich bin«, verlautbaren lässt.18 Man könnte meinen, dass Levinas' Denken besser zu einer Zeit passt, die geprägt ist vom Rückzug und Schweigen eines »bis hin zur Abwesenheit transzendenten« gottes. Man könnte ebenfalls urteilen, dass die Sichtweise des Zohar zu spekulativ oder mystisch ist, sich in ihrem Anspruch, das Unbekannte zu kennen, zu weit vorwagt. Sie bleibt jedoch auf ihre Weise der Behauptung eines gottes, der sich vorstellt, indem er ich sagt, treu. Die hier skizzierte Vorgehensweise kann mehrere Einwände hervorrufen. Ist sie nicht auf grobe Weise ethnozentrisch, einzig auf den gott der Bibel fokussiert, während sie die Religionen, in welchen der gott sich nicht durch ein »ich bin« ausdrückt, ignoriert? Und doch gehört das Ich-Sagen (Je) – die Aussage in der ersten Person – zu allen menschlichen Sprachen und dieses bemerkenswerte Charakteristikum bestimmt zwangsläufig die möglichen Anrufungsund Antwortmodi. Begnügen wir uns mit einem Zeugnis, das wir von einer der unseren entfernten Zivilisation erhalten haben, dem präch tigen Hymnus Ich bin Shiva des indischen Philosophen Shankara.19 E. Levinas, »Der Name Gottes in einigen talmudischen Texten«, S. 56 Zu diesem Ich-Werden des gottes laut des Zohars, vgl. G. Scholem, Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, S. 236 19 …»Ich kenne weder Angst noch Tod noch irgendeinen Kastenunterschied, ich habe weder Vater noch Mutter noch Geburt noch Freund noch Jünger noch Herr. Ich bin ewige Ekstase und grenzenloses Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva! / Ich habe weder Form noch Begehren, ich existiere überall, ich bin weder das Heil noch etwas Erkennbares. Ich bin ewige Ekstase und grenzenloses Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich 17
18
537
Jacob Rogozinski
Genauso gut könnten wir aber auch den ersten Vers der Bacchanten Euripides' zitieren: »Hier bin ich, ich bin Dionysos, Sohn des Zeus…« Man kann ebenfalls einwerfen, dass man den gott verfehlt, wenn man sich ihm über sein Ich-Sagen (Je) annähert, da er sich nicht in eine menschliche Sprache einsperren lässt bzw. sich darin nur insofern einschreibt, als er radikal über sie hinausgeht. Gewiss, doch verhält es sich bei jedem Ich (moi) genauso – beim meinigen wie bei dem anderer –, da sich seine lebendige Singularität nicht auf seine sprach lichen Marker, auf das Pronomen »ich« (je) oder einen Eigennamen reduzieren lässt, auch wenn diese erforderlich sind, damit es sich aus drücken kann. Das durch das Sagen gestützte gott-Phänomen hängt ebenfalls von der Gastfreundschaft einer Sprache, deren Syntax und Wörter, und vor allem dem kleinen Wort »ich« (je) ab, über das unser Ruf und seine Antwort laufen. Wenn es stimmt, dass wir »als Eben bild« dieses gottes geschaffen wurden, ähneln wir ihm vor allem, weil wir dasselbe Vermögen, ich (je) zu sagen, besitzen. Wir teilen mit ihm diesen Hauch der Stimme, der es uns ermöglicht, dieses Pronomen in allen menschlichen Sprachen auszusprechen. Wahrscheinlich bezeichnet der Zohar darum das Pronomen »ich« (je) als das »Wort der Wörter«, in welchem sich alles vereinigt, »was oben und was unten ist«.
4. Der Rufname und das Vergessen der Vokabel Wir haben entdeckt, dass das Phänomen gott sich immer als der Angerufene einer Anrufung gibt. Was sagt uns die Bibel über diesen ersten Ruf? Dass ihm eine affektive Intensität zugrunde liegt, dass eine Singularität ihn an eine andere Singularität adressiert und dass er herbeiführt, was er erfleht. Wenn der gott antwortet und seine Antwort erhört und über eine Erzählung weitergegeben wird, scheint sie nicht durch den Logos hervorgerufen worden zu sein (es gibt nichts Wortkargeres als den »gott« der Philosophen...), sondern durch den Affekt, durch die Not eines unterdrückten Volkes, das Gebet einer erniedrigten Frau, oder gar die Wut eines Verfolgers. Dieser Schrei, der aus den Tiefen emporsteigt, ist er es, der dem gott seinen bin Shiva!« – Hymne à Shiva (8. Jh. n. Chr.), in P. Martin-Dubost, Çankara et le Vedânta, S. 113–115
538
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
Namen gibt? Manche muslimischen Mystiker behaupten, dass der Name »Allah« vom Ausruf ah! stammt und ebenso wurde bereits die Frage erörtert, ob der Name JHWH nicht aus einem Zwischenruf her vorgegangen, er nicht »de[r] urzeitliche Anrufsname«20 ist. Warum antwortet der gott vorzugsweise auf eine leidvolle Anrufung? Wenn die Bibel von seiner Wut, seiner Liebe, seiner Eifersucht, seiner Reue spricht, handelt es sich dabei um bloße von einem bedauerlichen »Anthropomorphismus« befleckte Bilder? Vielleicht deuten diese Metaphern auf einen gott hin, der nicht Logos und Noesis, sich selbst denkendes Denken ist, sondern Leben, das sich selbst mit seinem Leben, seiner eigenen affektiven Intensität affiziert: »am Herzen empfindlicher gott« und nicht »gott der Philosophen«. Doch wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Dass die Anrufung Pathos und nicht Logos ist, beweist nicht, dass es sich beim Adressaten gleich verhält. Wollen wir es vermeiden, über Unbekanntes zu spekulieren, werden wir uns damit begnügen, das Phänomen der Anrufung zu beschreiben, ohne uns zu fragen, ob ihr Ziel wirklich dem entspricht, was sie erreichen soll. Was lehrt uns die Bibel über dieses Ziel? »Moses, Moses!«, »Saul, Saul!»… Sobald der gott ruft, nennt er jenen, den er ruft, zweimal, wie um auf die Sache des Nennens zu insistieren: Jemanden bei seinem Eigennamen zu nennen, bedeutet, sich an ihn persönlich in seiner intimsten Singularität zu richten, damit er ohne Ausflüchte »hier bin ich« antworten kann. Die Anrufung, die die Menschen an ihn richten, richtet sich auch an eine Singularität, indem sie ihn bei seinem Eigennamen anrufen. Jede Anrufung impliziert ein Nennen, jenes eines anrufbaren Namens, was ich nunmehr als eine Vokabel bezeichnen werde. Ob dieses Nennen nun der Anrufung vorausgeht, sie begleitet oder auf sie folgt, es ist jedes Mal vonnöten: Nennen bedeutet, rufen zu können, und jedes Nennen ist bereits ein Ruf. Die Frage des Namens des gottes ist somit fundamental und nimmt eine gewisse Tragik an, wenn der gott sich weigert, seinen Namen preiszugeben. Manchmal wird behauptet, dass darin der Sinn der Antwort, die er Mose gibt, besteht, doch dies ist alles andere als gewiss. Mit dieser Nicht-Antwort ist jedenfalls Jakob konfrontiert, als er, nachdem er die ganze Nacht lang mit einem Unbekannten gekämpft hat, diesen fragt, wie er heißt. »Warum fragst du mich Wie dies insbesondere M. Buber und F. Rosenzweig denken. Vgl. die Anmerkun gen Bubers in Königtum Gottes, S. 69
20
539
Jacob Rogozinski
nach meinem Namen?«, antwortet der Unbekannte und geht, ohne seine Identität zu enthüllen. »Jakob gab dem Ort den Namen Peniël – Gottes Angesicht – und sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.« (Genesis 32,30f.) Indem er diesen Ort so nennt, benennt er zugleich den Unbekannten, da er ihm ja den Namen El, d.h. »gott«, gibt. Obwohl der gott – falls er es war – sich zurückgezogen hat, kommt es dem Menschen zu, den Mangel an Vokabeln auszugleichen; auf das Schweigen und den Rückzug des gottes zu antworten, indem er ihm im Nachhinein diesen Namen, der verweigert worden war, zuspricht. Wir Abendländer der neueren Zeit schauen herablassend auf die Menschen anderer Epochen oder Kulturen, die an die Kraft der Namen glauben, und auf die Listen, die sie einsetzen, um den einem Menschen oder gott eigensten Namen zu verbergen. Wir sehen darin das Symptom einer »primitiven Mentalität«, eines »Animismus«, der das Wort und die Sache verwechselt; ohne zu merken, dass ein Eigenname, zusammen mit dem Pronomen ich (je), dasjenige ist, worin sich in der Sprache als universalem Element die radikale Singularität eines menschlichen Ichs (moi) zeigt. Dies wird merklich, wenn seine subjektive Struktur zusammenbricht: Der Psychotiker ist oft unfähig dazu, »ich« (je) zu sagen und mit seinem Namen zu unterzeichnen, weil er, indem er den Zugang zur Singularität seines Ichs (moi) verloren hat, zugleich seinen Ankerpunkt in der Sprache verloren hat. Wir verstehen nicht, warum Jakob, Moses oder Paulus so viel Wert darauflegen, den Namen von jenem zu kennen, der sich ihnen gezeigt hat; und wie, indem er seinen Namen Moses offenbart hat, JHWH die Befreiung der Unterjochten ermöglicht. Wir vermögen ihn nicht mehr zu hören, da wir nicht mehr anzurufen wissen. Was in unserer entzauberten Welt an die Stelle der Götter von früher getreten ist, sind Substantive – Geld, Geschichte, Staat, Nation, Menschheit … – und es ist uns unmöglich, sie anzurufen, denn eine Anrufung ist immer ein singulärer sich an eine Singularität richtende Ruf. Es ist schon lange her, dass die Vokabeln begonnen haben sich uns zu entziehen. Möglicherweise begann dieser Rückzug bereits, als die griechischen Philosophen aufhörten, Zeus oder Apollon anzurufen, um stattdessen von der Gottheit im Allgemeinen zu sprechen und sie mit dem Einen, dem Guten, der ersten Ursache zu identifizieren. Dieser Rückzug der Vokabeln hat zeitgleich, aber auf andere Weise begonnen, als der Name JHWHs unaussprechbar und schließlich komplett getilgt wurde und sich stattdessen in andere Dispositive
540
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
verlagerte, wo er zu »der Herr«, »der Vater«, »der Schöpfer« oder ein fach »Gott« wurde, d.h. erneut zu Substantiven. Dieser Rückzug des befreienden Namens ist aber nur partiell, da die Juden ihn weiterhin anrufen, ohne ihn aussprechen zu können: indem sie einander einzig seine Konsonanten überlieferten – »J.H.W.H.« – und ihn ha-schem, »der Name«, nannten; während die Christen, oft ohne es zu wissen, ihn mittels des Namens Jesus anriefen, auf Hebräisch Jehoschu'a, was »JHWH (ist der) Retter«, bedeutet. Man hätte jedoch unrecht zu glauben, dass es genügen würde, einen bestimmten Namen auszusprechen, um einen gott anzurufen. Eine Anrufung definiert sich nicht anhand dessen, was sie anvisiert, sondern durch ihre Art, dies zu tun, und durch das, was sie sagen will, durch ihre Bedeutungsabsicht. Sie ist es, die dem Namen »JHWH« seine Bedeutung verleiht: Ohne diese wäre er bloß toter Buchstabe. Die Verfasser der Tora wussten dies, da das zweite Gebot verbietet, den Namen JHWH »fälschlich« anzurufen. In der Geschichte der Menschen gibt es viele, die vorgeben, einen göttlichen Namen anzu rufen, während sie andere Menschen massakrieren, ohne zu merken, dass sie ihren gott entstellen, wenn sie ihn auf diese Weise anrufen, dass sie auf ihn ihren eigenen Hass, ihre Mordlust projizieren, so als wäre dies der Wunsch des gottes selbst... Wenn es möglich ist, einen gott zu entstellen, indem er auf falsche Weise angerufen wird, so muss es auch möglich sein, ihn wahrhaftig anzurufen, ihn so anzuvisieren, wie er sich gibt, ohne auf ihn unsere eigenen Affekte zu projizieren. Indem sie sich auf diese Weise an ihn richtet, modifiziert die Anrufung die Bedeutung des Namens, den sie anruft. Wenn in der extremen Intensität des Gebets oder der Freude, des Entzückens oder des Genusses, des Leides, der Angst oder der Verzweiflung ein Mensch schreit: »Oh mein Gott!«, ruft er wie einen singulären göttlichen Namen das an, was seit Langem ein Substantiv geworden war. Die Linguisten nennen diese Transformation eines Gattungsna mens in einen Eigennamen (oder die umgekehrte Operation, denn es handelt sich um einen umkehrbaren Prozess) Antonomase. Hier ist es der Gattungsterminus, der die Gottheit bezeichnet, dieses alte Wort »Gott«, das plötzlich die rege Kraft einer Vokabel wiederfindet. Diese Metamorphose vollzieht sich durch die Macht der Anrufung und wird bei jeder neuen Anrufung wiederholt. Man könnte somit in Betracht ziehen, dass der gott polyonym ist, dass alle Namen passend sind, dass jedes der Wörter der Sprache in einen seiner Eigennamen verwandelt werden kann. Etwas nüchterner lehrt der Talmud, dass die
541
Jacob Rogozinski
Begriffe El und elohim, die auf Hebräisch »den gott« bezeichnen, nicht als Substantive betrachtet werden dürfen: »der Name Gottes sei in den Schriften immer ein Eigenname«, denn es »gibt weder eine göttliche Art noch ein Gattungswort, um diese zu bezeichnen«21.
5. »Wenn du an ihn glaubst« Dem ist so, weil die Bibel kein philosophisches Traktat ist. Die göttlichen Namen sind darin nur eingeschrieben in Hinblick darauf, angerufen zu werden, und diese Anrufung führt jenen herbei, den sie anruft. Dies behaupten die Tora – »an jedem Ort, wo ich meines Namens werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen« (Exodus 20,24) – wie auch die Evangelien – »denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen[11], da bin ich in ihrer Mitte« (Matthäus 18,20) – und auch der Koran: »Ich will antworten dem Ruf des Rufenden, so er mich ruft« (Sure 2,186). Was ist diese Macht, einen gott auftreten zu lassen, indem man ihn anruft, oder, was auf dasselbe hinausläuft, indem man sich »in seinem Namen« versammelt? Sie hat nichts Magisches noch Mysteriöses: Sie manifestiert die performative (oder »illokutionäre«) Kraft der Anrufung und des Nennens, die davon untrennbar ist. Auch hier ist sagen gleich tun. Genauer gesagt: Das Sagen bringt jenen zum Vorschein, dessen Namen angerufen wird. Auf welche Weise wird er erscheinen? Worauf die Anrufung abzielt, ist dieses singuläre Phänomen, das man einen gott nennt. Es unterscheidet sich von jenen, die sich in der Wahrnehmung oder ihren abgeleiteten Modi geben, da es sich dabei um Glaubensphänomene handelt. Ehrlich gesagt knüpft jede Wahrnehmung bereits an einen »perzeptiven Glauben« an. Wie wir von Husserl wissen, impliziert er, »Position zu beziehen«, zu glauben, dass das, was man wahrnimmt, wirklich so existiert, wie es wahrgenommen wird.22 Es müssen jedoch – was Husserl nicht tut – zwei sehr unterschiedliche Glaubensmodi unterschieden werden: der Glauben-dass als Aussage, die sich darauf beschränkt, ohne jegli che Gewissheit festzustellen, und die performative Behauptung des E. Levinas, »Der Name Gottes in einigen talmudischen Texten«, S. 51 Vgl. Husserls Analyse der Glaubensakte und der Stellungnahmen, die sie begrün den, in den § 103–105 und § 115 der Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phä nomenologischen Philosophie 21
22
542
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
Glaubens-an.23 »Ich glaube an dich«: Wenn er diese Worte ausspricht, ruft der Verliebte, Jünger oder Gläubige den oder die herbei, an den oder die er glaubt. Er führt das Objekt seiner Liebe, seinen Herrn oder seinen gott, herbei, oder lädt ihn erneut ein. Einzig in diesem Fall kann der Glaubensakt mit der Anrufung eines gottes in eins fallen. Man hat es dann mit einem reinen Glaubensphänomen zu tun, denn seine Bedeutung gründet vollständig auf dem Glauben, der ihn sich zum Gegenstand wählt, auf der ursprünglichen Entscheidung, Glauben zu schenken. Wenn diese nicht statthätte, wäre es noch immer möglich, eine rufende Stimme zu hören, einen brennenden Busch zu sehen oder den Körper eines Gekreuzigten, doch diese Stimme, dieser Busch, dieser Körper hätten nichts Göttliches mehr. Indem anders, im Rahmen eines anderen Dispositivs, Position bezogen wird, wird man dies für eine bloße Halluzination halten. Dies bedeutet nicht, dass dieses Dispositiv – jenes der modernen Wissenschaft, der Psychiatrie, die sich wissenschaftlich dünkt – »wahrer« ist als das andere, oder gar das einzig Wahre. Es ist Zeit, dass die Anhänger der Wissenschaft verstehen, dass die Wahrheit sich auf vielfältige Weise gibt und der Modus der Gegebenheit der Phänomene, der das Feld der wissenschaftlichen Wahrheiten eröffnet, nicht der einzig mögliche ist, noch der ursprünglichste. Muss man daraus schließen, dass ein gott nicht wirklich außer halb des sich auf ihn richtenden Glaubens existiert? Die beste Antwort auf diese Frage ist jene, die Luka, der messianische Vagabund aus Gorkis Nachtasyl – Szenen aus der Tiefe, gibt: »Wenn du an ihn glaubst – gibt's einen; glaubst du nicht, dann gibt's keinen.« Sie entspricht einer der kühnsten Behauptungen der jüdischen Tradition. Einen Vers Jesajas kommentierend – »ihr seid meine Zeugen, verkündet JHWH, und ich bin Gott« – interpretiert ihn ein Midrasch folgendermaßen: »Dies bedeutet: wenn ihr meine Zeugen seid, bin ich Gott, und wenn ihr nicht meine Zeugen seid, bin ich nicht Gott«24. Dieselbe Kühnheit findet sich bei einem der bedeutendsten Denker des Christentums wieder, als dieser verkündet: »In meiner Geburt wurden alle Dinge geboren […]; daß Gott ›Gott‹ ist, dafür bin ich die Ursache; 23 Bzgl. dieser Unterscheidung verweise ich auf die Analyse eines zu früh von uns gegangenen Freundes, Marcel Hénaff, »Rites, prières et actes de langage«, in: Dire la croyance religieuse, S. 121–154 24 Sifré Devarim (2. Jh. n. Chr.), zitiert in: A. LaCoque, P. Ricœur, Penser la Bible, S. 337 Fußnote.
543
Jacob Rogozinski
wäre ich nicht, so wäre Gott nicht ›Gott‹.«25 Solcherlei Aussagen haben nichts Arrogantes oder Verrücktes. Sie verdeutlichen bloß, was das Phänomen des Glaubens bedeutet. Wenn er ihn anruft, bezeugt der Gläubige zugleich, dass sein gott existiert; andernfalls könnte er ihn nicht anrufen. Er braucht nicht nach rationalen Beweisen seiner Existenz zu suchen, wie es die Philosophen tun: Es genügt ihm, an ihn zu glauben, auch wenn ihm dies absurd scheint (oder gerade weil es absurd ist...). Die Existenz, die sein Glaubensakt bezeugt, gehört vollkommen diesem Glaubensphänomen an. Würde er aufhören an ihn zu glauben, würde sein gott augenblicklich aufhören zu existieren und somit auch gott zu sein. In diesem Sinne haben die Bibel und der Koran recht: Jener, der den gott anruft, lässt ihn jedes Mal in seinem Glauben entstehen. Egal, ob er außerhalb dessen existiert oder nicht: Es genügt, dass er sich jenem zeigt, der glaubt und ihn ruft. Früher oder später, auf die eine oder andere Weise, antwortet der gott auf seinen Ruf, sonst wäre er nicht gott. In unserer Analyse des Phänomens der Anrufung haben wir ent deckt, dass es eine Gemeinschaft der Ichs (egos) begründet, die jenen (oder all jene), der anruft oder die anrufen, und den Angerufenen ver eint. Wenn man diese Aussage bis zu ihren äußersten Konsequenzen ausfaltet, ist es nicht mehr bloß eine Gemeinschaft, die zwischen dem gott und uns entsteht. Von der Nähe, der Ähnlichkeit gelangt man zur Reversibilität, gar zur Identität. Der gott und jener, der ihn anruft, machen in der Tat vom selben Wort »ich« (je) Gebrauch, besetzen abwechselnd dieselben Positionen, jene des Anrufenden und jene des Antwortenden, und beide können dem anderen sagen »hier bin ich«. Was sich hier abzeichnet, ist die Fluchtlinie jedes Glaubensdispositivs, sein mystisches Element, dieser äußerste Punkt, wo das »ich bin« des menschlichen Subjekts und jenes des gottes ununterscheidbar werden, wo der gott nur mehr eins mit dem Ich (moi) ist, wo es möglich wird, wie einer der Mystiker des Islams zu sagen: »Ich bin Jener geworden, den ich liebe, und Jener, den ich liebe, ist ich geworden. / Wir sind zwei in ein und denselben Körper verschmolzene Hauche. / Mich zu sehen, ist Ihn zu sehen. / Ihn zu sehen, ist uns zu sehen.«26
25 26
Meister Eckhart, Predigt Nr. 52 (1324–1327) in : ders., Werke I, S. 560–563 Hallâj, Diwân (10. Jhd. nach Christus), S. 117
544
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
Diese Aussprüche sind so extrem, dass sie die von den Priestern und Staaten errichteten Schutzmaßnahmen übersteigen. All jene, die wie Halladsch, Eckhart oder Artaud – und vielleicht bereits der Nazarener – die Kühnheit hatten, ihre Identität mit Gott zu behaupten, haben dafür zahlen müssen. Die geteilte Erfahrung der Gläubigen hält sich diesseits dessen und allein so führt sie zu einer Gemeinschaft. Darin ähnelt sie jener der Hebräer auf dem Sinai, die sich verbieten die von Moses am Fuße des Berges gezogene Grenze zu überschreiten, »sonst würden viele von ihnen sterben«. Die Distanz zu wahren, um nicht in einer ekstatischen Vereinigung zu versinken, setzt voraus, dass die Anrufung zugleich Nähe und Abstand bewahrt. Auf diese Weise stellt sich der gott auch einem seiner Propheten vor: »ich, der ganz-nahe gott, bin ich nicht auch ein ferner gott?« (Jeremia 23,23); und Jahrhun derte später wird ein Dichter fast dieselben Worte verwenden, um jene sich zurückhaltende Annäherung auszusprechen: »Nah ist / Und schwer zu fassen der Gott.«27
6. Den Fremden empfangen Ist es möglich, darüber hinaus zu gehen? Trotz allem zu versuchen, dieses zugleich nahe und ferne Phänomen, diesen anderen, der, obwohl zutiefst anders, wie ich (moi) »ich« (je) sagt, zu fassen? In meiner alltäglichen Erfahrung begegnet mir ständig ein ähnliches Phänomen, ein anderes mir ähnelndes und sich von mir unterschei dendes Ich (moi). Dieser Nächste, von dem ich dennoch wie durch einen Abgrund getrennt bin, ist der andere Mensch. Sagen wir also wie Levinas, dass »der Andere […] Gott ähnlich [ist]«28? Bietet diese Affi nität zwischen dem gott-Phänomen und dem die-anderen-Phänomen einen Weg, sich dem gott anzunähern? Dies ist nicht gewiss, denn das, was sie unterscheidet, ist genauso wichtig wie das, was sie ein ander annähert. Um ausfindig zu machen, worin dieser Unterschied besteht, vollziehen wir in der Vorstellung eine Veränderung. Es ist mir unmöglich, eine Welt ohne andere vorzustellen: Dies wäre gar keine Welt, sondern eine Reihe von gewiss übereinstimmenden, aber jeglicher intersubjektiver Validierung entbehrender Abschattungen. Im Gegenzug ist es durchaus möglich, sich eine Welt vorzustellen, aus 27 28
F. Hölderlin, »Patmos« (1801–1802) E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit, S. 424
545
Jacob Rogozinski
welcher sich der gott für eine gewisse Zeit oder für immer entfernt hätte, und eine solche Welt gleicht der unseren hoffnungslos. Wenn das gott-Phänomen nicht an der intersubjektiven Konstituierung der Welt teilnimmt, dann weil es nicht wesentlich eidetisch zu unserer transzendentalen Erfahrung der Welt gehört. Im Unterschied zu den anderen, ist es fremd in dieser Welt. Gewiss, auch der andere erscheint mir als ein Fremder, aber die Fremdheit des gottes ist radikaler als die des Fremden. Da er der fremdeste aller Fremden ist – und gleichwohl ganz nah –, zeigt er sich zuerst über den Modus des Rätselhaften, ohne als das erkennbar zu werden, was er ist; sodass es möglich wird, den Rufenden zu fragen: »Herr, wer bist du?«, oder eine ganz Nacht lang mit einem Unbekannten zu kämpfen, ohne in seinen sich verflüchtigenden Zügen das Angesicht des gottes zu entdecken. Dieser Unterschied zwischen dem gott-Phänomen und dem die-anderen-Phänomen muss seine Quelle in ihrer unterschiedlichen Gegebenheitsweise haben. Der Gegebenheitsmodus des anderen gründet sich tatsächlich auf einer intuitiven Vorstellung. Laut Husserl ist es die Wahrnehmung einer Ähnlichkeit zwischen seinem Körper und dem meinen, die eine »analogische Übertragung« von meinem Leib und dem davon ununterscheidbaren Ich (ego) zu dem fremden Körper, wo das Alter Ego mir »appräsentiert« wird, erlaubt. Im Falle eines gottes gebricht es an dieser ursprünglichen Anerkennung und unsere Ähnlichkeit wird sich immer entziehen, auch wenn der gott auf seine göttliche Form verzichtet hat, um sich in menschlicher Form zu zeigen. Der Anblick eines gekreuzigten Körpers genügt nicht, um ihn als den eines gottes zu erkennen: Dafür braucht es einen Glaubensakt. Kein in der Intuition gegebenes Phänomen präsentiert oder appräsentiert den gott, denn er gibt sich einzig als Phänomen des Glaubens ohne jedweden anderen Ankerpunkt in der Erfahrung. Er ist somit prekärer als die anderen, da er ausschließlich vom Ruf, der ihn anruft und auf den er antwortet, abhängt. Ist es nicht diese Fragilität des gottes, seine Nicht-Allmacht, die der Unbekannte nahelegt, als er Jakob den Namen Israel – »stark-gegen-den-gott« – gibt, denn, wie er sagt, »du hast mit dem gott gekämpft […] und du bist der Stärkere gewesen«? Es ist die Anrufung, die wir an ihn wahrhaftig oder fälschlich richten, es ist unsere Art, ihn zu nennen und an ihn zu glauben, die über sein Sich-Zeigen oder Verschwinden, das Antlitz, das er uns zeigen wird, und seine immer mögliche Entstellung bestim men. Seine Ungewissheit entspricht dem, was Levinas manchmal als seine »Demut« bezeichnet: Sie ist die Bedingung eines gottes, dessen
546
Den gott anrufen, den Fremden empfangen
Ankunft von uns abhängt, von unserer Entscheidung, ihm einen schönen Empfang zu bereiten oder ihn abzulehnen.29 Die Aufnahme eines Fremden nennt sich Gastfreundschaft. Eine griechische Tugend und ein biblisches Gebot: Verlangt die Tora nicht den Fremden »wie einen Einheimischen« zu behandeln und »ihn zu lieben wie sich selbst«30? Dieser Imperativ der Gastfreundschaft gilt für alle Fremden und in erster Linie für die verletzlichsten, den Sklaven auf der Flucht, den Waisen und die Witwe, den Exilierten, den Migranten, den Verfolgten. Er gilt gleichermaßen für den Fremdesten, den fragilsten der anderen Ichs (Je). Es ist die Prekarität des gottes, die an unsere Gastfreundschaft appelliert, und seine Anrufung ist eins mit der Aufnahme des Fremden. Übersetzt aus dem Französischen von Natalie Eder
Literaturverzeichnis Balibar, E., »Ego sum, ego existo – Descartes au point d'hérésie«, Bulletin de la Société Française de Philosophie 86.3 (1992), S. 87–119 Buber, M., Königtum Gottes, Heidelberg: Verlag Lambert Schneider 1956 Cassirer, E., Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Götternamen, Berlin: Teubner 1925 Derrida, J., »Gewalt und Metaphysik«, in: Die Schrift und die Differenz, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1972 Descartes, R., Discours de la méthode. Zweisprachige Ausgabe. Hamburg: Mei ner 2011 –, Meditationes de prima philosophia. Lateinisch-Deutsch, Hamburg: Mei ner 2008 Hallâj, Diwân, Paris: Seuil 1992 Hénaff, M., »Rites, prières et actes de langage«, in: Dire la croyance religieuse, Brüssel: Peter Lang 2012 Henry, M., »Ich bin die Wahrheit«. Für eine Philosophie des Christentums, Freiburg, München: Alber 1999
29 »Es liegt an uns, oder genauer, es liegt an mir, diesen Gott ohne Verwegenheit festzuhalten oder zurückzustoßen: diesen Gott, der im Exil ist, weil alliiert mit dem Verlierer, verfolgt und von daher ab-solut (…).« [Levinas' Hervorhebung], E. Levinas, »Rätsel und Phänomen«, S. 245. Doch kann ein gott, der so sehr von meiner Ent scheidung, ihn zurückzuhalten, abhängt, noch als »ganz-Anderer« charakterisiert werden? 30 Levitikus 19,33–34
547
Jacob Rogozinski
Hölderlin, F., »Patmos« (1801–1802). In: Sämtliche Werke in 6 Bänden, Band 2, Stuttgart 1953, S. 172–180 Husserl, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Den Haag: Nijhoff Lacan, J., Séminaire XVI. D'un Autre à l'autre (1968–69), Paris: Seuil 2006 La Coque, A., Ricœur, P., Penser la Bible, Paris: Seuil 1998 Levinas, E., »Der Name Gottes in einigen talmudischen Texten«, in: Anspruchs volles Judentum. Talmudische Diskurse, Frankfurt a. M.: Verlag Neue Kri tik 2005 – »Enigme et phénomène«, in: En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Paris: Vrin 1994 (1967) – Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exterirität, Freiburg: Alber 2002 – De Dieu qui vient à l'idée, Paris: Vrin 1982 Marion, J.-L., Gegeben sei. Entwurfe einer Phänomenologie der Gegebenheit, Freiburg: Alber 2015 Martin-Dubost, P., Çankara et le Vedânta, Paris: Seuil 1973 Meister Eckhart, Predigt Nr. 52 (1324–1327), in: ders., Werke I. Texte und Über setzungen von Josef Quint, hg. u. komm. v. N. Largier, Frankfurt a. M.: Deut scher Klassiker Verlag 1993 Ricœur, P., An den Grenzen der Hermeneutik, Freiburg: Alber 2008 Rogozinski, J., »De la caresse à la blessure: outrance de Levinas«, in: Les Temps modernes n° 664 (2011), S. 119–136 –, »De temps en temps la vie fait un saut«, in: La phénoménologie et la Vie, dir. Y.C. Zarka et A. Zafrani, Paris: Cerf 2019 –, Le moi et la chair – introduction à l'ego-analyse, Paris: Cerf 2006 Scholem, G., Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen, Zürich; Rhein-Ver lag 1957 Sifré Devarim, zitiert in: A. LaCoque et P. Ricœur, Penser la Bible, Paris: Seuil 1998
548