Projektion und Wirklichkeit: Die unbewusste Botschaft des Films 9783666451799, 3525451792, 9783525451793
145 67 1MB
German Pages [236] Year 2006
Polecaj historie
Citation preview
Schriften des Sigmund-Freud-Institus
Herausgegeben von Marianne Leuzinger-Bohleber und Rolf Haubl Reihe 2 Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog Herausgegeben von Marianne Leuzinger-Bohleber, Rolf Haubl, Stephan Hau Band 5 Projektion und Wirklichkeit Die unbewusste Botschaft des Films
Ralf Zwiebel /Annegret Mahler-Bungers (Hg.)
Projektion und Wirklichkeit Die unbewusste Botschaft des Films
Vandenhoeck & Ruprecht
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar. ISBN 10: 3-525-45179-2 ISBN 13: 978-3-525-45179-3 Umschlagabbildung: Gregory Peck in Spellbound, 1945 Drehbuch: Ben Hecht u. a. Regie: Alfred Hitchcock © 2007, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen. Internet: www.v-r.de Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages. Hinweis zu § 52a UrhG: Weder das Werk noch seine Teile dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Verlages öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch bei einer entsprechenden Nutzung für Lehr- und Unterrichtszwecke. Printed in Germany. Schrift: Minion Satz: SchwabScantechnik, Göttingen Druck und Bindung: Hubert & Co., Göttingen Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Teil I: Theoretische Annäherungen Überleitung 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Annegret Mahler-Bungers und Ralf Zwiebel Die unbewusste Botschaft des Films. Überlegungen zur Film-Psychoanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Mechthild Zeul Einführende Überlegungen zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
Dirk Blothner Wirkungsanalyse von »American Beauty«. Ein Beitrag zu psychoanalytischem Verstehen von Spielfilmen . . . . . . . .
61
Teil II: Subjekt und Geschichte – Zur Beziehung von Innen- und Außenwelt Überleitung 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Timo Hoyer Filmarbeit – Traumarbeit. Andrej Tarkowskij und sein Film »Der Spiegel« (»Serkalo«) . . . . . . . . . . . . . . . .
85
6
Inhalt
Christel Eckart Tanz um Anerkennung: Kampf und Feier. Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson« . . . . . . . . . . . . . . 111 Marianne Leuzinger-Bohleber Überlegungen zu Constantin Costa-Gavras’ »Music Box« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Ralf Zwiebel Ist psychoanalytisches Denken interkontextuell? Film-psychoanalytische Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen am Beispiel von Roman Polanskis »Der Mieter« Überleitung 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Annegret Mahler-Bungers Projektion und Wirklichkeit. Zu Roman Polanskis »Der Mieter« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Gerhard Bliersbach Der Einzug in die Finsternis. Roman Polanskis »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof . . . 204 Gerhard Schneider »Der Mieter« – Roman Polanskis filmische Analyse eines psychotischen Universums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Vorwort
Das Buch »Projektion und Wirklichkeit – Die unbewusste Botschaft des Films« ist ein Beitrag zur aktuellen Diskussion der FilmPsychoanalyse und geht auf eine Tagung im Januar 2004 und eine Ringvorlesung mit dem Thema »Psychoanalyse im Film – Psychoanalyse des Films« im Wintersemester 2004/2005 zurück, die das Institut für Psychoanalyse der Universität Kassel veranstaltete. Diese Veranstaltungen waren bereits Folge von intensiven Auseinandersetzungen mit der Film-Psychoanalyse in Seminaren an der Hochschule, in Publikationen und in öffentlichen Filmvorführungen – etwa der Kasseler Veranstaltungsreihe »Film und Psychoanalyse« in Zusammenarbeit mit dem Bali-Kino – oder der aktiven Teilnahme an der von Gerhard Schneider und Peter Bär organisierten Mannheimer Tagung »Psychoanalyse und Filmwissenschaft im Dialog« und der Teilnahme an den von Andrea Sabbadini geleiteten »European Psychoanalytic Film Festivals« in London. Das Buch ist in drei Abschnitte gegliedert, die der gegenwärtigen, aktuellen Diskussion der Film-Psychoanalyse unserer Ansicht nach gerecht werden. Der erste Abschnitt »Theoretische Annäherungen« gibt einen vertieften Einblick in den theoretischen Stand der Diskussion. Der zweiten Abschnitt behandelt das bisherige Kernstück der Film-Psychoanalyse, nämlich das psychoanalytisch orientierte Nachdenken über einzelne Spielfilme. Anhand einzelner Filme wird die für die Film-Psychoanalyse zentrale Thematik »Zur Beziehung von Innen- und Außenwelt« diskutiert. Im dritten Abschnitt schließlich steht das Thema der psychoanalytischen Filminterpretation im Zentrum. Hier wollen wir anhand der verschiedenen Interpretationen von Polanskis Film »Der Mieter« die Vielfalt der interpretativen Ansätze zeigen.
8
Vorwort
Wir hoffen, dass wir mit diesem Band die Diskussionen um die Film-Psychoanalyse anregen und ein Stück bereichern können. Wir möchten an dieser Stelle Frau Ute Ochtendung für ihre umsichtige und tatkräftige Unterstützung bei der redaktionellen Bearbeitung der vorliegenden Beiträge danken. Ralf Zwiebel und Annegret Mahler-Bungers
■ Teil I: Theoretische Annäherungen
Überleitung 1
Die ersten drei Beiträge dieses Bandes konzentrieren sich auf jeweils unterschiedliche Aspekte einer theoretischen Annäherung an die Film-Psychoanalyse. Ausgehend von der gegenwärtig stärkeren Beachtung von »Film und Psychoanalyse« werden in dem Beitrag »Die unbewusste Botschaft des Films« vor allem die Frage, was ein Film ist, und die Wege einer psychoanalytischen Filminterpretation in einem eher generellen Sinn zu beantworten versucht. Dabei wird von einem triadischen Prozess ausgegangen, der vom Künstler über sein Werk zum Rezipienten führt. Dieser triadische Prozess wird anhand der filmspezifischen Begriffe Einstellung, Darstellung und Vorstellung näher eingekreist. Die Wege zu einer psychoanalytischen Filminterpretation gehen tendenziell den umgekehrten Weg: Ausgehend von der unmittelbaren Filmerfahrung der Vorstellung setzt ein Reflexionsprozess ein, der vor allem auch die Darstellung berücksichtigt und mögliche Einstellungen offenlegen kann, die man als unbewusste Botschaft des Film auffassen könnte. Mechthild Zeul konstatiert eine Heterogenität der theoretischen und interpretativen Ansätze und einen Mangel an theoretischer und methodologischer Reflexion jetziger filmpsychoanalytischer Arbeiten. Sie versucht, das Erleben des Zuschauers auf der Basis sehr früher, unbewusster Kindheitserfahrungen zu konstruieren. Sie bezieht dabei vor allem die Thesen von Lewin über die orale Trias (Essen, Gegessen-Werden und Schlafen), die Traumleinwand und die bildlosen Träume, die Arbeiten von René Spitz zur Urhöhle und neue Ergebnisse der Säuglingsforschung, vor allem von Daniel Stern, in ihre Überlegungen mit ein. Das FilmeSehen wird danach als ein regressiver Prozess angesehen, in dem
12
Teil I: Theoretische Annäherungen
der Zuschauer auf eine primitive, orale Ebene regrediert, die durchaus mit der Nahrungsaufnahme des Säuglings vergleichbar ist. Unter Bezug auf das von Spitz beschriebene Urhöhlen-Erlebnis wird der Kinosaal als Urhöhle verstanden, in dem der ZuschauerSäugling in primärprozesshafter Weise in das »Gesicht« und die »Augen« der Mutter schaut (die Filmleinwand mit ihren Bildern) und dabei einen regressiven Wahrnehmungsprozess erlebt, in dem nicht klar zwischen Innen und Außen, zwischen Aktivität und Passivität unterschieden werden kann. So betrachtet ist das Filme-Sehen ein Eintauchen in die ganzheitliche, vorsprachliche Welt des Säuglings. Bei der Lektüre ihres Beitrags wird deutlich werden, dass hier vor allem das Erleben, weniger das Verstehen des Films im Vordergrund steht und dass Zeul vor allem die regressive Komponente betont. Vermutlich wird jedoch in den weiteren Diskussionen das Wechselspiel zwischen regressiven und progressiven Bewegungen während des Filme-Sehens (oder zwischen Primär- und Sekundärprozess) eine stärkere Beachtung finden. Dirk Blothner fokussiert in seiner Arbeit vor allem die Ebene der Filmwirkung – in dem eben formulierten triadischen Prozess also die Vorstellung – und versucht diese Filmwirkung beim Zuschauer auf im Film thematisierte Komplexentwicklungen zu beziehen, die ihre besondere emotionale Wirkung den in ihnen enthaltenen lebenspraktischen Grundverhältnissen verdanken. Filme werden so als inszenierte Tagträume verstanden, die Alltagserfahrungen unter phantasierten oder simulierten Bedingungen behandeln und so den Zuschauer in eine begrenzte Stundenwelt des sicheren Rückzugs und der Wunscherfüllung tauchen lassen. Am Beispiel des viel beachteten Films »American Beauty« arbeitet Blothner verschiedene dieser Komplexe heraus und berichtet schließlich über Befragungen des Zuschauererlebens, die sich vor allem auf eine spezifische Schlüsselszene des Films beziehen und deren Ergebnis teilweise ganz unterschiedliche Einschätzungen erkennen lassen. Der Vergleich mit anderen Arbeiten über »American Beauty« (z. B. Danckwardt 2003) zeigt die potenziell unendliche Deutungsvielfalt bei dem Film und belegt die grundlegend kontextuelle beziehungsweise multifokale und intertextuelle Arbeitsweise des Filmanalytikers, auf die in späteren Beiträgen noch eingegangen wird.
Überleitung 1
13
■ Literatur Danckwardt, J. F. (2003): Vom Krimi zum Kultfilm: Das Mediale als Matrix der Identität oder: »Ich würde mich auch nicht an mich erinnern«. Psychoanalyse im Widerspruch 16. Jg., Heft 30: 81–87.
■ Annegret Mahler-Bungers und Ralf Zwiebel
Die unbewusste Botschaft des Films Überlegungen zur Film-Psychoanalyse
Seit etwa zehn bis fünfzehn Jahren entwickelt sich weltweit ein zunehmendes Interesse von Psychoanalytikern an der Thematik von Film und Psychoanalyse. Dieses dokumentiert sich beispielsweise in Filmvorführungen mit anschließenden Diskussionen in öffentlichen Kinos und auf Tagungen der psychoanalytischen Gesellschaften, in der steigenden Anzahl von filmanalytischen Beiträgen in Fachzeitschriften und in speziellen Tagungen zur Thematik (etwa in den von Gerhard Schneider und Peter Bär organisierten Mannheimer Tagungen, die sich dem Dialog zwischen Filmwissenschaftlern und Psychoanalytikern widmen, oder in dem von Andrea Sabbadini organisierten European Psychoanalytic Film Festival in London, auf dem das Gespräch zwischen Filmkünstlern, Filmkritikern und Psychoanalytikern im Zentrum steht). Die Zeitschrift »Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse« hat 1994 ein Heft zu dieser Thematik herausgebracht, in dem einige klassische Arbeiten und eine kritische Sicht der psychoanalytischen Beiträge seit Beginn der Psychoanalyse von Mechthild Zeul vorgelegt wurden (Zeul 1994). Seitdem sind weitere Arbeiten erschienen, die sich der Gesamtthematik widmen; zu erwähnen sind vor allem Gabbard (2001) und Sabbadini (2003). Gabbard plädiert im Vorwort seines Sammelbandes dafür, sich bei der Filminterpretation an die psychoanalytische Einsicht der vielfachen Determination von Phänomenen zu halten und dementsprechend sich einen multidimensionalen Blick zu bewahren. Die Brauchbarkeit einer psychoanalytischen Filminterpretation erweise sich aber letztlich daran, ob dem Leser durch sie neue und erhellende Perspektiven in der Filmbetrachtung eröffnet werden. In dem Buch von Sabbadini werden die Beiträge des ersten
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
15
European Psychoanalytic Film Festivals in London vorgestellt. Seinen besonderen Reiz gewinnt dieses Buch durch den darin enthaltenen Austausch zwischen Psychoanalytikern, Geistes- und Filmwissenschaftlern und Regisseuren, wodurch die psychoanalytische Sichtweise um bedeutende Perspektiven interdisziplinär erweitert wird. In seiner Einführung sieht Sabbadini in der Anwendung der Psychoanalyse auf den Film eine besondere Herausforderung, weil es eine privilegierte Ähnlichkeit zwischen dem Kino und dem menschlichen Geist gebe. Die Filmwissenschaftlerin Laura Mulvey schreibt in ihrem Vorwort zu diesem Buch, dass das Faszinierende am Kino seine Beziehung zur Ungewissheit (uncertainty) sei: Das Interesse des menschlichen Geistes richte sich nicht darauf, durch Illusion getäuscht zu werden, um dann dieser Täuschung gewahr zu werden, sondern umgekehrt auf die Erkenntnis, wie illusionär unsere Sicherheit (des Wissens) als solche ist, wodurch andere Möglichkeiten des Weltverständnisses eröffnet werden können. Um die Realität zu verstehen, sei daher Unsicherheit eine bessere Voraussetzung als sicheres Wissen, das notwendigerweise illusionär sei (Mulvey 2003b, S. xvii). Mit diesem Gedanken trifft Mulvey den Kern dessen, was die Faszination des Kinos ausmacht: Gerade das große illusionistische Täuschungspotenzial des Kinos – das Realität scheinbar so wirklichkeitsgetreu abzubilden vermag – belehrt uns, wie wenig sicher unser Wissen über diese Realität ist, oder anders ausgedrückt: Sowohl die Täuschung wie die EntTäuschung des Kinos – mehr als die jeder anderen Kunst – veranlassen uns, unser vermeintliches Wissen infrage zu stellen, zu erweitern oder auch neu zu formulieren. Vielleicht ist der Umstand, dass das Kino zur gleichen Zeit wie die psychoanalytische Wissenschaft entstanden ist, dafür verantwortlich, dass Filmwissenschaftler und Psychoanalytiker sich immer wieder mit den Ähnlichkeiten von Kino und menschlichem Geist, das heißt mit den Entsprechungen zwischen kinematologischer Technik und unserem Vorstellungsvermögen, dem »psychischen Apparat« (Freud), beschäftigt haben. Schon Freud zog zur Beschreibung seelischer Vorgänge in seiner »Traumdeutung« (Freud 1900) optische Metaphern wie »Mikroskop« oder »photographischer Apparat« heran. Der Filmtheoretiker Jean-Louis Baudry (1994) sieht im Dispositiv der »Höhle«, wie Platon sie in sei-
16
Teil I: Theoretische Annäherungen
nem berühmten Höhlengleichnis beschrieben hat, eine Antizipation des Kinosaals: In ihr sind die Menschen gefangen, gefesselt und im wahrsten Sinne des Wortes fasziniert von Abbildern (Schatten) der draußen vorbeigehenden Gestalten und sie verkennen diese Erscheinungen illusionär als die wahre Welt. Für Baudry ist Platons Höhlengleichnis ein Index für den regressiven Wunsch des Menschen nach einer verlorengegangenen Befriedigung, die in der Projektion des Wunsches auf eine (Traum-)Leinwand besteht. Baudry greift hierbei Lewins Konzept der oralen Trias von Schlaf, Mund und Traumleinwand (Lewin 1946) auf. Das Kino reproduziere in seinem Dispositiv regressiv-passiver Rezeption eine archaische Szene: die halluzinatorische Befriedigung der oralen Phase mit ihrer Verschmelzung von Innen und Außen und der fehlenden Unterscheidung von Vorstellung und Wahrnehmung. Diesen Gedanken hat in letzter Zeit Mechthild Zeul wieder aufgenommen und vertieft (vgl. den Beitrag von Zeul in diesem Band). In den oben erwähnten metapsychologischen Theorien zur Rezeptionsästhetik des Kinos steht der Vergleich zwischen Film und Traum im Mittelpunkt, nicht nur weil beide im Wahrnehmungsmodus bewegter Bilder sich abspielen und dabei über unbegrenzte Darstellungsmittel verfügen, sondern weil im Gesamt-Dispositiv sowohl des Kinos wie des Traums das Subjekt des Unbewussten eine aktive Rolle spielt (Baudry 1994, S. 1067). Der bedeutende und bis heute maßgebliche Filmtheoretiker mit psychoanalytischem Ansatz, Christian Metz, widmete 1975 der Beziehung zwischen Traum und Film einen Aufsatz, in dem er Ähnlichkeiten und Unterschiede im Hinblick auf Kategorien wie bewusste Wahrnehmung, Regression und Realitätseindruck beschrieb. Er kommt zu dem Schluss, dass die Filmrezeption eher mit dem Tagtraum zu vergleichen sei, der – wie Filmproduktion und Filmrezeption – sowohl unbewusste wie bewusste Aktivitäten voraussetzt (Metz 1975/1994). Die wichtigsten Unterschiede zwischen Traum und Film sind wohl in den Traum- und Filmproduktionsbedingungen zu suchen. Der Traum ist ein primärprozesshaftes Gebilde, das auf einer inneren Leinwand abläuft, welches das unbewusste Subjekt ohne Mitautorschaft des bewussten Subjekts erschafft, während der Film, wie jedes Kunstwerk, vor allem auch ein bewusstes, sekundärpro-
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
17
zesshaftes und artifizielles Produkt einer Einstellung, eines Wollens, einer Intention ist, meistens sogar einer ganzen Gruppe von Künstlern, die an der Darstellung beteiligt sind. Das bewusst gestaltete Kunstwerk setzt eine vorgängige »Opus-Phantasie« (von Matt 1994) voraus, die das Werk in seiner Entstehungsphase ständig modifiziert und deren wichtiges Merkmal die bewusste und unbewusste Antizipation eines zukünftigen Rezipienten (Zuschauers) ist. Auf einen Zuhörer (also einen dritten) ist der Traum nicht angewiesen. Er wird gewöhnlich ganz unabhängig von einem möglichen Zuhörer produziert, sieht man einmal von der kommunikativen Natur mancher Träume ab, die sich an einen anderen richten wie etwa die so genannten »Gefälligkeitsträume« während einer psychoanalytischen Behandlung. Daher nannte Freud den Traum im Zusammenhang mit seiner Abhandlung über den Witz, welcher ansonsten sich gleicher Gestaltungsmittel wie der Traum bediene (Verschiebung und Verdichtung usw.), ein »asoziales« Gebilde, während der Witz, der sich erst mit dem Lachen des Zuhörers vollende, ein »soziales« Gebilde sei (Freud 1905, S. 204). Weit mehr noch als den Witz muss man den Film als ein in hohem Maße soziales Gebilde von den strukturellen Eigentümlichkeiten des Traums abgrenzen. Sowohl in seinen Entstehungsbedingungen als in seiner Rezeption ist der Film mehr noch als jede andere Kunst ein öffentliches, soziales Phänomen, das in einem öffentlichen Raum (dem Kino) von einer großen Gruppe von Zuschauern gleichzeitig rezipiert wird. Metz hat darüber hinaus darauf aufmerksam gemacht, dass kein Film so absurd wie ein Traum konstruiert ist (Metz 1975/1994). In der Regel zeigen die Traumgeschichten keine narrative Logik wie der diegetische Film, der, weil er einem Zuschauer etwas plausibel erzählen will, einer kommunikativen Logik folgt, einer bewussten Erzählstrategie also, die in den verschiedenen Anordnungen der Einstellungen sich zeigen. Das bewusst gestaltete audiovisuelle Narrativ des Films verdeckt den unbewussten Subtext ungleich stärker als der manifeste Traum den latenten Traum zu entstellen vermag. Natürlich ist das träumende Subjekt auch eine Art Regisseur seiner Träume, wobei Zensur und Rhetorik des Traums (Metapher, Metonymie, Rücksicht auf Darstellbarkeit) unbewusste Aktivitäten des Träumers sind, die mit bestimmten bewussten aber
18
Teil I: Theoretische Annäherungen
auch unbewussten Erzählstrategien des Filmregisseurs verglichen werden können. Interessant in diesem Zusammenhang ist die Traumtheorie von Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin, die sich insbesondere mit der Traumgenerierung (im Vergleich zur Trauminterpretation) befassen, wobei sie vom manifesten Traum ausgehen, für den sie ein komplexes Kodierungssystem entwickelt haben. Den Traum verstehen sie als simulative Mikrowelt, in der Situationen mit Subjekt- und Objektprozessoren aufgrund einer affektiven Regulierung entworfen werden, um ungelöste konfliktive oder traumatische Komplexe nachträglich zu bearbeiten und andere, bessere Lösungen zu finden. Diese Bearbeitung hängt vor allem von der affektiven Regulierung zwischen emotionalem Involvement und dem Sicherheitsgefühl ab; werden die Affekte zu intensiv, kommt es zu einem interrupt und die Situation oder der ganze Traum wird abgebrochen (Moser u. von Zeppelin 1996). Man könnte die interrupts im Traum mit bestimmten filmischen Schnitttechniken vergleichen, mittels derer die Affekte der Zuschauer reguliert werden. Diese sehr interessante Traumtheorie ist unserer Ansicht nach in der psychoanalytisch orientierten Filmtheorie und Filminterpretation noch nicht ausreichend gewürdigt worden. Abschließend lässt sich sagen, dass man, ohne Film und Traum in Entstehung und Struktur vollkommen gleichzusetzen, von der Annahme einer strukturellen Schnittmenge zwischen filmischen Darstellungsmitteln und den Darstellungsverfahren des Traums ausgehen kann. Des Weiteren muss das Kino als bevorzugte Produktionsstätte bewusster und unbewusster gesellschaftlicher Mythen verstanden werden, als »Apparat« gesellschaftlichen Denkens im Sinne eines Transformations- und Verarbeitungsmediums von sozialen Konflikten, von Geschlechterbeziehungen oder von historischen Traumata, weil es wie keine andere Kunst im öffentlichen Raum rezipiert wird, am meisten Menschen erreicht und am leichtesten konsumierbar ist, wie beispielsweise Studien zur filmischen Verarbeitung des Holocaust zeigen (Mahler-Bungers 2005). Das Kino konnte daher aber auch von Beginn an – weit wirkungsvoller als andere Künste – für propagandistische Zwecke missbraucht werden oder – mehr latent als bewusst – gesellschaftliche Basisannahmen und Selbstdefinitionen fortschreiben oder auch neu formulieren
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
19
wie beispielsweise Geschlechterrollen, Feindbilder, Geschichtsmythen und Utopien. Die feministisch orientierte Filmwissenschaft beschäftigte sich in den 1970er Jahren mit der Analyse der Geschlechterrollen, mit der Frau als Objekt des männlichen Blicks und des männlichen Begehrens im Hollywood-Kino. Hier ist vor allem Laura Mulveys Aufsatz »Visuelle Lust und narratives Kino« von 1973 zu erwähnen (Mulvey 2003a). Als Medium des gesellschaftlichen Unbewussten kann das Kino sowohl affirmativer wie kritischer Kulturpraxis dienen und als Bildmedium im wörtlichen Sinne (positive wie negative) Visionen gesellschaftlicher Zustände im Sinne einer selbstreflexiven kulturellen Sinngebungspraxis entwerfen. All diese Überlegungen beschäftigen sich entweder mit dem Kino-Subjekt im Sinne einer metapsychologischen Rezeptionsästhetik des Kinos oder mit dem Kino als allgemeine Kulturpraxis, nicht aber mit dem einzelnen Film als Werk, das aus einer umfassenden multikontextuellen Praxis von Produktion und Rezeption hervorgeht. In einer solchen psychoanalytischen Betrachtungsweise steht nun der einzelne, konkrete Film und die unbewusste Botschaft seines komplexen audiovisuellen Narrativs im Mittelpunkt, eine Herangehensweise, die in letzter Zeit auch in der Öffentlichkeit auf immer größeres Interesse gestoßen ist. Daher wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, auf welche Weise der psychoanalytische Filminterpret zu seinen Überlegungen kommen kann.
■ Generative versus angewandte Psychoanalyse Die Einsichten des Psychoanalytikers in unbewusste Vorgänge sind in seiner klinischen Arbeit an das Setting der Behandlungssituation gebunden, das sich natürlich wesentlich von der Filmrezeption im dunklen Kinosaal unterscheidet. Darüber hinaus sind die Phänomene, mit denen er es in beiden Fällen zu tun hat, zum Teil fundamental unterschiedlich. Und gerade die mangelnde Reflexion dieses Unterschieds hat die Anwendung der Psychoanalyse auf Phänomene der Kunst lange Zeit in Verruf gebracht. Aus diesen Unterschieden zwischen Patienten- und Filmanalyse ergeben sich
20
Teil I: Theoretische Annäherungen
epistemologische Differenzen, die gleichzeitig übergreifende Gemeinsamkeiten deutlich werden lassen. Dabei möchten wir bei der Frage Was ist Film? etwas länger verweilen und Antworten suchen, die eine psychoanalytische Herangehensweise an dieses Phänomen plausibel machen könnte. Des Weiteren erörtern wir die Wege, die uns anhand dieses »Gegenstands« zu psychoanalytischen Interpretationen führen können. Gegenstand der Patientenanalyse ist die innere Realität des Patienten, die sich im Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen im Rahmen des analytischen Settings zwischen Analytiker und Analysand entfaltet, das heißt, in einem symbolischen analytischen Raum, der Befriedigung und Versagung in der Schwebe hält und sich über einen langen Zeitraum hin erstreckt. Ihr Zweck ist die bessere Einsicht des Patienten in seine innere Realität, die sein Leiden an dieser mindern soll. Medium für diese Einsicht sind das intersubjektive Spiel der freien Assoziationen des Patienten und die unbewussten Inszenierungen in Übertragung und Gegenübertragung, die in offene Prozessdeutungen übersetzt werden. Die psychoanalytische Behandlung ist folglich ein Prozess, der potenziell unabschließbar ist. Selbst am Ende der Analyse liegt uns also kein geschlossenes Werk vor. Gegenstand der Filmanalyse ist – phänomenologisch – ein scheinbar in sich geschlossenes Gebilde: der Film. Er ist kein situationsabhängiges, unvorhersehbares und offenes Phänomen wie die Assoziationen und Inszenierungen des Patienten in einer sich über Monate oder Jahre hinziehenden Behandlung. Der Film beruht auf einer Einwegkommunikation vom Regisseur zum Betrachter, im Gegensatz zur Behandlungssituation, in der die szenische Gestalt, die sich das Unbewusste gibt, von der je besonderen und einzigartigen Gesprächssituation zwischen Analysand und Analytiker geprägt ist, in der beide Partner sich wechselseitig beeinflussen. Der Film aber liegt als fertige Filmrolle vor und ist das Produkt eines zum großen Teil bewussten und sekundärprozesshaften Gestaltungswillens im Gegensatz zu den freien Assoziationen des Patienten, die, wenn sie nicht vorwiegend vom Widerstand geleitet sind, primärprozesshaft dem Unbewussten gehorchen. Der Film kann im Kino oder zu Hause als DVD immer wieder angeschaut werden, ist also potenziell unendlich reproduzierbar. Der Zweck, ihn
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
21
zu analysieren, ist nicht identisch mit dem der Patientenanalyse, in der es primär darum geht, das Leiden des Patienten zu mindern. Darüber hinaus ist die analytische Situation eine exklusive, private Situation von hoher Intimität. Der Analytiker kann zwar eine »Fallgeschichte« aus seiner Sicht über einen analytischen Prozess schreiben, die jedoch nur begrenzt nachprüfbar ist, während der Filmanalytiker seine Geschichte in einem öffentlichen Raum schreibt, die die übrigen Zuschauer direkt nachvollziehen und überprüfen können. Aber eine fundamentale Gemeinsamkeit zwischen psychoanalytischer Filmbetrachtung und Patientenbehandlung besteht im »geteilten Grund« beider Aktivitäten: der emotionalen Einsicht in die menschliche Natur und das menschliche Leiden (vgl. Sabbadini 2003). Denn sowohl bei der Patientenbehandlung wie bei der Film-Psychoanalyse hegt der Analytiker den Wunsch, im Austausch mit dem Patienten oder bei der Filmbetrachtung neue Einblicke in seine eigenen inneren Vorgänge und in die Natur des Menschen allgemein zu gewinnen und sein psychoanalytisches Wissen zu modifizieren und zu bereichern. Eine solche Ingebrauchnahme psychoanalytischen Wissens und psychoanalytischer Haltung in der Patientenbehandlung sowie in der Kunstbetrachtung geht über die bloße Anwendung der Psychoanalyse hinaus und kann mit Gerhard Schneider generativ genannt werden (vgl. den Beitrag von Schneider in diesem Band). In diesem Sinne kann der Film ein Lehrmeister in Sachen menschlicher Psyche genannt werden. Schon Freud gestand den Künstlern zu, dass es ihnen gegeben sei, »aus dem Wirbel der eigenen Gefühle die tiefsten Einsichten doch eigentlich mühelos heraufzuholen, zu denen wir anderen uns durch qualvolle Unsicherheit und rastloses Tasten den Weg zu bahnen suchen« (Freud 1930, S. 493).
■ Was ist ein Film? Um zu klären, mit was für einem Phänomen wir es zu tun haben, wenn wir vom Film (im Unterschied zum Patienten) sprechen, können wir, wie bei jedem Kunstwerk, von einem grundsätzlich
22
Teil I: Theoretische Annäherungen
triadischen Prozess ausgehen, der den Künstler (im Fall des Films den Regisseur und sein Team), das Werk (die fertige Filmrolle) und den Rezipienten (den Zuschauer) umfasst. Diese Trias kann man unter drei Begriffen, die zudem genuin filmisch sind, abhandeln: Einstellung, Darstellung und Vorstellung.
■ Einstellung Unter Einstellung, für die die Kameraeinstellung das filmische Paradigma ist, verstehen wir alles, was dem Film in seiner auf Zelluloid gebannten Darstellung voraus- und dann in sie eingeht. Da sind zunächst die Intentionen und Absichten des Regisseurs: seine Weltanschauung, seine Philosophie und seine Obsessionen, sein Verhältnis zum Medium Film, seine künstlerische Sozialisation, der filmhistorische Kontext, auf den er sich bezieht, seine künstlerischen Vorbilder, seine Erzählabsicht, der vorphantasierte Zuschauer. Darüber hinaus spielen die allgemeine Marktlage und die Filmindustrie, in die er eingebunden ist oder auch nicht, eine erhebliche Rolle. In all dieser Komplexität ist die Einstellung teils bewusst, teils unbewusst, und dies gilt gleichermaßen für den persönlich-biographischen, den filmästhetischen und filmgeschichtlichen sowie für den historisch-gesellschaftlichen Kontext, der in die Darstellung eingeht. Jeder Künstler hat eine Phantasie von dem künftigen Werk, wie es einmal vorliegen und der Welt übergeben wird, eine »OpusPhantasie« (von Matt 1994). Die Phantasie über das künftige Werk umfasst nicht nur Form und Inhalt der Geschichte, die erzählt werden soll, sondern vor allem auch einen vorphantasierten Rezipienten (beim Film also einen vorphantasierten Zuschauer), der implizit, also gleichsam »latent« in die filmische Darstellung mit eingeht. Dieser Zuschauer ist zum einen bewusst intendiert, und viele Regisseure haben ihre Einstellung in Hinblick auf den Zuschauer, den sie sich wünschen und für den sie den Film machen, auch explizit benannt. Daneben aber spielt in der Opus-Phantasie auch ein vorbewusst oder unbewusst vorphantasierter Zuschauer eine Rolle im Sinne der allgemeinen unbewussten Phantasie eines inneren Anderen, den jede Kommunikation impliziert.1
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
23
Die linguistisch orientierte Filmwissenschaft behandelt die ästhetischen Mittel des Films wie eine Sprache, deren kleinste Einheit die einzelne Einstellung ist, obwohl diese kleinste Einheit weitaus komplexer ist als das lexikalische Wort der Sprache (Metz 2003, S. 329). Metz hat eine Tabelle der großen Syntagmen (Bilderfolgen) im Film aufgestellt, in der alle Typen auf der kleinsten Einheit, der autonomen Einstellung, aufbauen und aus diesen autonomen Einstellungen zusammengesetzt sind. Man kann daher sagen, dass die Einstellung und ihre Anordnungen das fundamentale Medium der Grammatik (und Rhetorik) des narrativen Films ausmachen. Denn sie inszenieren den Blick des Zuschauers, sie positionieren ihn im Hinblick auf das, was er zu sehen bekommt und was nicht, und bestimmen die Perspektive, aus der er das Geschehen betrachten soll. Die Einstellung identifiziert den Blick des Zuschauers mit dem Blick des Regisseurs und seines Kameramanns und ist daher in besonderem Maß das Medium bewusster und unbewusster Botschaften. Die Dramaturgie der Einstellungen und Syntagmen ist ein so bedeutendes Moment in der Darstellung, dass sie vielleicht als »Königsweg« zum Unbewussten des Films aufgefasst werden kann. Sie entspricht der »Traumarbeit«, wie Freud sie in der »Traumdeutung« (1900) beschrieben hat (Verschiebung, Verdichtung, Darstellung durch das Gegenteil, Rücksicht auf Darstellbarkeit), deren Nachvollzug mehr als die manifesten Bilder des Traums die unbewussten Konfliktkonstellationen des Traums enthüllen. Neben diesen spezifisch filmsprachlichen Mitteln (Einstellungen, Schnitt, Montage) ist die mise en scène das zweite bedeutende Darstellungsverfahren im Film, die in der Tradition des Theaters wurzelt. Die Personeninszenierungen (angefangen vom Casting) sind beim Film ebenso wie die filmsprachlichen Verfahren Produkte von (inneren) Einstellungen, wobei sich in der Regel die persönlichen Einstellungen des Schauspielers mit denen des Regisseurs kreativ vermischen. In diesem Zusammenhang möchten wir 1 So kann sich ein Regisseur mehr oder weniger bewusst mit einem inneren Vorbild in seiner Arbeit auseinandersetzen. Für viele Regisseure sind es die großen Ikonen der Filmregie Hitchcock, Orson Welles und Truffaut. Bei unbewussten inneren Anderen wird es sich eher um primäre Objekte handeln.
24
Teil I: Theoretische Annäherungen
nicht unerwähnt lassen, dass der Opus-Phantasie und damit den Intentionen und Einstellungen des Regisseurs wie in keiner anderen Kunst durch die jeweiligen technischen Möglichkeiten des Films, durch seinen Produzenten und den finanziellen Rahmen, der zur Verfügung steht, sowie der allgemeinen Marktlage Grenzen gesetzt sind. Das gilt auch für die mise en scène, denn nicht jeder Filmproduzent kann sich den Schauspieler, den sich der Regisseur für eine bestimmte Rolle vorstellt, leisten. Schließlich ist der Einsatz der Tonspur der dritte wesentliche Operator der Einstellung. Musik und Hintergrundgeräusche werden meist nur vorbewusst wahrgenommen, obwohl sie sehr bewusst vom Filmemacher eingesetzt werden. Sie dienen nicht nur bestimmten Affektregulierungen wie Angst, Beruhigung, Spannung, Glück, sondern können auch Träger unbewusster Vorstellungsinhalte wie Verbundenheit, Geborgenheit, Zerbrechlichkeit, Gefährdung, Verlassenheit sein. Umgekehrt ist auch der Verzicht jeglicher Musik signifikant und kann je nach Kontext verschiedene Bedeutungen annehmen und eine je spezifische Einstellung des Regisseurs zu seinem Gegenstand indizieren.
■ Darstellung Ist der Film einmal fertig, liegt er in der Filmrolle als unverrückbare Darstellung, als in bewegten Bildern und einer Tonspur erzähltes audiovisuelles Narrativ vor. Darstellung ist Repräsentation von etwas, verweist auf etwas. Die Möglichkeiten, etwas filmisch zu repräsentieren und eine Geschichte zu erzählen, sind fast unendlich, weil der Film über mehr Darstellungsmittel (Zeichen) verfügt als jede andere Kunst, über bewegte Bilder, Sprache, Musik. Im Hinblick auf die Beziehung von der Darstellung zum Dargestellten ist der Vergleich mit der Behandlungssituation von Bedeutung: Der Film präsentiert sich in seiner spezifischen, vor allem visuellen Filmsprache und unterscheidet sich dabei in relevanter Art und Weise von der dem Analytiker vertrauten psychoanalytischen Situation, in der das Visuelle gerade auf ein Minimum beschränkt wird und das Hören und Zuhören ganz im Zentrum steht. Obwohl es in beiden Fällen um Narrative geht, inszenieren sich die
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
25
»Geschichten« des Patienten im Übertragungs-Gegenübertragungs-Geschehen, das heißt, die Darstellung ist ein fließendes Geschehen, das einer fortwährenden Übersetzung bedarf, so dass es sich hier um ein sich entwickelndes Narrativ im Prozess handelt, das sich ständig im Zusammenspiel mit dem Analytiker verändert, und die Aufgabe beider besteht darin, diesem Zusammenspiel einen Sinn zu verleihen. Das Narrativ des Films liegt dagegen als geschlossene Darstellung vor, an dem der Betrachter nichts verändern kann. Dennoch kann man auch hier von einer Art Zusammenspiel von Film und Betrachter reden, über das wir uns unter dem Begriff Vorstellung Gedanken machen (s. u.). Aber während es im Behandlungsfall in erster Linie um den Sinn geht, den das Leiden eines Patienten hat, dient der Film wohl eher dem besseren Verständnis unserer eigenen inneren Situation und vor allem unseres Leidens. Nicht wir legen den Film auf die Couch, sondern, wenn dieser Vergleich überhaupt sinnvoll ist, dann legt der Film uns auf die Couch. Dabei steht uns natürlich – wie dem Patienten auch – frei, ob wir die Deutungen, die der Film für menschliche Phänomene und die Welt anbietet, annehmen oder zurückweisen. Denn die Darstellung ist nicht einfach Abbild von Realität, sondern selbst schon Interpretation von Realität und als solche Deutung (eben durch seine Einstellungen). Insofern kann jeder einzelne Film als Kristallisationspunkt eines individuellen und gesellschaftlichen Sinngebungsprozesses verstanden werden. Diese Überlegung ist wichtig, wenn man beispielsweise an den Dokumentarfilm denkt, von dem man naiverweise annehmen könnte, dass er die Realität unverfälscht abbildet. Unsere Wahrnehmung von Welt und erst recht unsere Darstellung derselben (alltagsprachlich oder künstlerisch) ist immer schon Interpretation dieser Welt. Und in diesem Punkt gibt es die bedeutendste Gemeinsamkeit von Film und Rede des Patienten: Beide stehen im Kontext eines genuin unabschließbaren Sinngebungsprozesses (man denke an den Wandel der eigenen Lebensgeschichte innerhalb einer Analyse, die sich am Anfang oft ganz anders anhört als am Ende der Behandlung). Wir interpretieren also in beiden Fällen Interpretationen und deuten Selbst- und Weltdeutungen. Die »Wahrheit«, um die es in der analytischen Behandlung geht, ist nicht in der Sprache als Einwegzeichen, das heißt nicht in ihrer denotativen Potenz
26
Teil I: Theoretische Annäherungen
zu finden, sondern in ihrem metaphorischen, konnotativen Spiel und in der Form, die sie annimmt, mit der sie Übertragung und Gegenübertragung, also Affekte und Emotionen, als Äußerungen des Triebs ins Spiel bringt und inszeniert. Doch auch die Filmsprache ist nicht denotativ, obwohl das photographische Abbild scheinbar ein Einwegzeichen ist, welches das bedeutet, was es zeigt. Konnotation und Metaphorik kommen hier durch die Einstellungen und die Syntagmen ins Spiel. Sie lassen sich bei genauer Analyse der Filmdarstellung im Einzelnen nachweisen. Sie lösen die komplexen Reaktionen des Zuschauers während der Vorstellung aus, was nun unmittelbar zum dritten Moment der Trias, die den Film ausmacht, führt.
■ Vorstellung Die Vorstellung ist der dritte Agent der Kino-Trias. Denn der Film (oder die Filmrolle) bedarf der Vorstellung, das heißt der Projektion auf eine Leinwand durch einen Vorführapparat in einem dunklen Kinosaal und eines Publikums, um überhaupt zu dem zu werden, was wir Film nennen. (So wie ein Roman gelesen werden muss, um zu einem Roman zu werden.) Im Zuschauer wird durch die Kinovorstellung eine Vorstellung vom Dargestellten erzeugt, die nicht – und das ist entscheidend und interessant für den psychoanalytischen Filminterpreten – identisch ist mit der (»objektiven«) Darstellung. Denn die Darstellung trifft auf die individuelle Vorstellungskraft (Imagination) des Zuschauers, auf seine bewussten, vorbewussten und unbewussten Erwartungen an den Film, seine individuelle innere Welt, seine Phantasien und Projektionen, seine inneren Konflikte und Ängste, auf kulturelle, religiöse und soziale Grundannahmen und Vorurteile, mit denen er bewusst und unbewusst kontextuell vernetzt ist, auf sein Wissen sowie seine Fähigkeit und Geübtheit, Filme zu entziffern, und auf seine Sehgewohnheiten. All dies und vieles mehr hängt von seiner individuellen Geschichte und seinem Geschlecht ebenso ab wie von der gesellschaftlich-historischen Matrix, in der er lebt, und bestimmt darüber hinaus den Grad, wie weit und auf welche Weise er sich überhaupt auf das Narrativ des Films einlassen kann und will, wel-
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
27
che Wahrnehmungswiderstände oder Überidentifikationen ihm widerfahren und welche emotionalen Reaktionen er zeigt. Auf jeden Fall mischt sich die filmische Darstellung während der Vorstellung mit den individuellen Modalitäten der Rezeption und Vorstellungskraft des Zuschauers, so dass der Film letztlich erst im Kopf des Zuschauers entsteht, wie Alexander Kluge einmal gesagt hat. Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, wie verschieden unsere Filmwahrnehmung ein und desselben Films zu verschiedenen Zeiten sein kann, um dieses Phänomen zu bestätigen. Psychoanalytisch betrachtet (das heißt vom unbewussten Wunsch aus betrachtet) handelt es sich um die Verschränkung zweier Projektionen: der realen des Films auf die Kinoleinwand und der Projektion unbewusster Wünsche (und Ängste) des Zuschauers auf die Darstellung, die in der Vorstellung fusionieren und die Darstellung modifizieren. Mit dieser Aktivität des Zuschauers bei der Filmrezeption wurde schon sehr früh in der Filmgeschichte gerechnet. Der russische Regisseur Eisenstein entwickelte in den 1920er Jahren die Montagetechnik und formulierte eine Theorie dazu, die den Zuschauer als aktiven und gleichwertigen Partner bei der Entstehung der Filmrealität und ihrer Bedeutung mit einkalkulierte. Auch wenn es Filme gibt, die das genaue Gegenteil intendieren und der aktiven Imagination des Zuschauers möglichst wenig Spielraum überlassen, das heißt, seine Wahrnehmung kontrollieren und geschlossene Deutungen der Realität anbieten wollen, bleibt jeder Film doch immer eine gemeinsame Schöpfung von filmischer Repräsentation und Imagination des Zuschauers während der Vorstellung, obwohl der Zuschauer an der objektiven Darstellung nichts ändern kann. Die schöpferische Aktivität des Zuschauers besteht in der Transformation der filmischen Repräsentationen in seine eigene Vorstellungswelt, das heißt, die ästhetische Erfahrung hat immer auch mit psychischer Arbeit zu tun (vgl. Kristeva 1980; Segal 1996), die in einem fließenden, allgemein kulturellen wie subjektiven transformativen Sinngebungsprozess eingebunden ist.
28
Teil I: Theoretische Annäherungen
■ Wege zu einer psychoanalytischen Filminterpretation Es geht uns nun um die Frage nach dem Weg zu einer psychoanalytischen Interpretation von Filmen. Dieser Weg zeigt Ähnlichkeit mit den mentalen Einstellungen und Denkmodalitäten des Analytikers in und nach der Behandlungssituation, mittels derer er zu seinen Deutungen gelangt. Dabei schlägt der Prozess des NachDenkens über den Film naturgemäß die umgekehrte Richtung ein, die der Filmherstellungsprozess genommen hatte. Die Interpretation geht also von der Vorstellung des Films als dem ersten, unmittelbaren Filmerleben aus, reflektiert danach – aus der Erinnerung und durch nochmaliges Anschauen des Films – seine formalen Darstellungsverfahren, um dann die unbewusste Botschaft ihrer Einstellung zu entziffern, die ihrerseits eine Deutung ist und Deutungsverlangen auslöst. Das erlaubt noch einmal einen Vergleich zwischen der Traumdeutung und der Filmdeutung: Das Unverständliche, Bizarre, Irritierende der Traumbilder löst in der Regel den Deutungswunsch des Träumers aus, der die unverständlichen Traumbilder in sein bewusstes Identitätserleben zu integrieren versucht (vgl. Bartels 1979). Ein ähnliches Motiv kann man für den Zuschauer des Films und vor allem den Film-Psychoanalytiker postulieren, der gerade von dem Unverstandenen, Rätselhaften und Schockierenden der Bilder und des Narrativs oder, um in einem Terminus der Ästhetik zu sprechen, von der Verfremdung im Kunstwerk ausgeht, die das gewohnte, identifizierende Welt- und Selbstverständnis irritiert und aufbricht und zu einer immer wieder sich wandelnden Sinngebung auffordert.
■ Das unmittelbare Filmerlebnis (Vorstellung) Der Analytiker geht in der Regel nicht mit der Absicht ins Kino, um einen Film, den er noch gar nicht kennt, analytisch zu interpretieren. Vielmehr wird das unmittelbare Filmerlebnis ihn dazu anregen oder nicht. Er rezipiert die Vorstellung also zunächst nicht anders als jeder andere Zuschauer. Er begibt sich in das spezifische »Kino-Setting«, also in den dunklen Kinosaal, und setzt sich passi-
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
29
ver Rezeption aus, die regressive Prozesse fördert wie die Aktivierung früher Objektbeziehungen und Introjektions- und Projektionsmechanismen auslöst, begleitet von affektiven Regulierungen im Sinne emotionalen Involvements und Sicherheit im Sinne von Distanzierung. Seine unbewusste Wahrnehmung wird ebenso ins Spiel kommen wie das Beachten von Widersprüchen in der Darstellung und seiner eigenen Spannungstoleranz sowie Abwehrphänomene und Fehlleistungen wie Verleugnen, Vergessen und Übersehen. Allerdings wird er, wenn er sich für Filminterpretation interessiert, für all diese Phänomene eine geschärfte Wahrnehmung entwickeln, weil er gleichzeitig den Film aus der Haltung gleichschwebender Aufmerksamkeit heraus betrachtet und vielleicht anders als der »normale« Zuschauer und ähnlich wie in der analytischen Situation eine Art Ich-Spaltung vornimmt zwischen Wahrnehmen und Erleben einerseits und Nachdenken und Reflektieren andererseits. Der Film-Psychoanalytiker macht sich also Haltungen zunutze, die er aus der Behandlungssituation kennt (Mahler-Bungers 2004a). Schwerpunktmäßig wird diese Reflexion aber erst nach der Filmvorstellung, also nach dem unmittelbaren Filmerleben einsetzen. Das Erinnern des Films setzt sich mit der in ihm entstandenen Vorstellung, also mit der Repräsentation des Films in der Erinnerung des Interpreten selbst auseinander, das Reimut Reiche auch metaphorisch ein »Bild« nennt (das einen Rahmen hat) (Reiche 2001, S. 25). Man könnte hier eine strukturelle Ähnlichkeit mit Mosers und von Zeppelins Unterscheidung von geträumtem, erinnertem und erzähltem Traum sehen: Der geträumte Traum ist präsentisch (wie die Kinovorstellung), der erinnerte eine Re-Präsentation (die Vorstellung, das Bild, das der Zuschauer vom Film hat) und der erzählte Traum ist in eine kommunikative Struktur eingebunden – hier wird der Traum zum interaktiven, sozialen Phänomen (Moser u. von Zeppelin 1996). Der erzählte Traum ist nicht der geträumte Traum, er ist selbst schon Interpretation durch Versprachlichung und fordert zur Deutung in einer Art Meta-Erzählung heraus, die mit der Filminterpretation zu vergleichen ist. Die Vorstellung des erinnerten Films kann nicht identisch mit seiner Darstellung sein, und diese Nicht-Identität ist nicht nur ein Effekt der kreativen Aktivität der Rezeption, sondern auch Wir-
30
Teil I: Theoretische Annäherungen
kung der Überfülle an Zeichen, die der Film kumuliert. Kein Kunstwerk ist »an sich« zu haben, aber die Kluft zwischen Darstellung und Vorstellung ist bei Filmen besonders groß, da ihre Zeichenstruktur unübersehbar komplex ist. Das Nach-Denken über den Film gestaltet sich ähnlich wie das Nachdenken, also die nachträgliche Reflexion, über das Geschehen in der analytischen Situation. Erinnerung an die einzelnen Filmbilder und -sequenzen, der Versuch, die Geschichte und die eigenen Reaktionen nachzuvollziehen und das Nicht-Verstehen für das Verstehen fruchtbar zu machen, wobei Wünsche auftauchen, den Film mit anderen zu diskutieren, ihn noch einmal zu sehen (reflektieren) und mehr Informationen über die Hintergründe, die Geschichte und den Regisseur zu bekommen. Eine bedeutende Rolle bei dieser Reflexion spielt die eigene Reaktion auf den Film, die zumindest teilweise Effekt des impliziten, latent mitinszenierten Zuschauers ist, der in der Opus-Phantasie bewusst und unbewusst ins Spiel gekommen war. In diesem Punkt beginnt das Unbewusste des Regisseurs oder besser des »FilmSubjekts«, wenn man den Film, wie Schneider vorgeschlagen hat, als »Quasi-Person« betrachtet (Schneider, in Vorb.), mit dem Unbewussten des Zuschauers zu kommunizieren. Den psychoanalytischen Filminterpreten wird dieser latent mitinszenierte Zuschauer deshalb besonders interessieren, weil es zu seiner klinischen Arbeit gehört, seine eigenen Reaktionen auf die Mitteilungen des Patienten (und zwar nicht nur auf deren Inhalte, sondern vor allem auch auf ihre Form) für das Verständnis der unbewussten Erzählstrategien des Patienten nutzbar zu machen. Diese analytische Fähigkeit ist also ohne weiteres übertragbar auf das Filmverständnis. Der Wandel der Psychoanalyse von einer Einpersonenpsychologie zu einer Zweipersonenpsychologie hat auch die psychoanalytische Kunstbetrachtung modifiziert. Da sich jetzt das Erkenntnisinteresse nicht mehr einseitig auf die Äußerungen des Patienten und sein Unbewusstes richtet, sondern die Reaktionen und unbewussten Antworten des Analytikers (Gegenübertragung, projektive Identifizierung) und seine Interaktion mit dem Patienten mit in den Deutungsprozess der Mitteilungen des Patienten einbezogen werden, initiierte die Gegenübertragungsanalyse auch eine neue Formen der Kunstbetrachtung, die in gewisser Hin-
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
31
sicht an die Rezeptionsanalyse in Literatur- und Kunstwissenschaft, wie sie seit längerem dort schon gang und gäbe war, anknüpfen konnte. Der Versuch, die klinischen Begriffe von Übertragung- und Gegenübertragung, die epistemologisch, wenn auch nicht phänomenologisch, an das Behandlungs-Setting gebunden sind, auf die psychoanalytische Interpretation von Filmen (oder von Literatur und Kunst) eins zu eins zu übertragen und anzuwenden, erscheint uns jedoch ebenso problematisch wie eine einseitig psychogenetisch-biographische Kunstbetrachtung. Natürlich gibt es in der Kinorezeption, wie im Leben überall, Übertragungs- und Gegenübertragungs-Phänomene. Aber streng genommen sollten wir lieber allgemein von emotionalen Reaktionen, Abwehrformen oder Projektionen sprechen und die klinischen Begriffe »Übertragung« und »Gegenübertragung« für das klinische Setting reserviert lassen. Außerdem besteht bei dieser Betrachtungsweise die Gefahr, die spezifische formale Struktur des Kunstwerks zu vernachlässigen, ganz abgesehen von gesellschaftlich-kulturellen Aspekten, die in ein Kunstwerk eingehen, und damit die eigenen subjektiven Reaktionen zu verabsolutieren (als »Gegenübertragung« oder auch als »Übertragung« auf das Kunstwerk). Die Reaktionen des Film-Analytikers und seine im Zusammenspiel mit der Filmrezeption entstehende Vorstellung und Interpretation des Films muss sich vor allem an den Darstellungsverfahren bewähren, um aussagekräftig zu sein, darauf hat Schneider in jüngster Zeit ausdrücklich hingewiesen (Schneider, in Vorb.).
■ Die analytisch-reflexive Bearbeitung des Films
(Darstellung und Einstellung) Auf dieser Ebene wird das unmittelbare Filmerleben und -verständnis abstrahiert und durch möglichst breit gestreute theoretische Aspekte differenziert (formal-künstlerische Aspekte, Aspekte verschiedener psychoanalytischer Theorien wie die Bedeutung primitiver, infantiler Antriebe und Motivationen des Menschen und deren Konflikte mit den gesellschaftlichen Normen, die Bedeutung des Verdrängten und seiner Wiederkehr in Form des Wiederholungszwangs, Traumaprozesse und Traumaverarbeitung, der
32
Teil I: Theoretische Annäherungen
Einfluss unbewusster, verinnerlichter Konflikte auf das Erleben und Verhalten des Menschen, entwicklungspsychologische Überlegungen, Geschlechterbeziehung und Sexualität, gesellschaftlichkulturelle Kontexte und möglicherweise auch biographische Aspekte). Da sich gerade in diesem Modus leicht theoretische Einseitigkeiten einschleichen im Sinne einer subsumtionslogischen Anwendung psychoanalytischen Wissens (Reiche 2001; Schneider, in Vorb.), möchten wir auf einen Grundsatz hinweisen, der auch für die Patientenbehandlungen gilt, dass nämlich der Film nicht für die Theorie da ist, sondern die Theorie für den Film, mit anderen Worten: Die Phänomene, die wir interpretieren, sind nicht dafür da, dass sie unsere Theorien bestätigen, sondern die Theorien helfen uns, einen – wenn auch vorläufigen – Zugang zu den Phänomene zu bekommen, wobei wir dem Patienten ebenso wie dem Kunstwerk Respekt zollen. Er zeigt sich in unserer Bereitschaft, uns von ihnen belehren zu lassen, so dass unsere Theorien von ihnen modifiziert, vertieft oder sogar grundlegend verändert werden können. Die Ungewissheiten, Fragen und Irritationen, die eine Behandlung oder ein Film auslösen, also die Kluft zwischen dem, was in der Behandlung oder durch die Darstellung des Films während seiner Vorstellung geschieht, und unserem Verstehen oder Nichtverstehen wird leider allzu oft von vorschnellen theoretischen Überstülpungen zu überbrücken versucht, weil sie uns unheimlich ist und beunruhigt. Wenn wir uns jedoch dem Kunstwerk nicht als Experten, sondern als Fragende nähern, impliziert dies die schmerzhafte Einsicht, dass die Kluft zwischen Verstehen und Nicht-Verstehen letztendlich niemals zu schließen ist und immer ein rätselhafter Rest bleibt, mit dem sich das Kunstwerk unserem Verstehen entzieht und zu immer neuen Anstrengungen einer Sinngebung herausfordert. Das entspricht auch der inneren Arbeitsweise des Analytikers in der analytischen Situation, die als ein Prozess von »problematischen Momenten« und »problematischen Situationen« im Sinne von Krisen des Verstehens und Krisen des Kontakts beschrieben werden kann, die nicht voreilig durch theoretische Konstrukte überbrückt werden dürfen, sondern in der Schwebe gehalten werden müssen, damit sich ein Verstehen der psychischen Realität entfalten kann (Zwiebel 2004). Um dieser Falle einer theoretischen subsumtionslogischen
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
33
»Vergewaltigung« des Films zu entgehen, gebührt als Erstes den filmischen Darstellungsverfahren und ihrer jeweiligen Funktion in dem besonderen Film Aufmerksamkeit, was nur durch ein wiederholtes und möglichst genaues Anschauen des Films erfolgen kann. Die Filmtheoretikerin Kristin Thompson nennt die Begründung für das Auftreten bestimmter filmischer Verfahren (wie zum Beispiel die von Metz aufgelisteten Syntagmen oder auch den Einsatz der Tonspur, Farbmetaphorik, Licht usw.) deren Motivation (Was motiviert den Einsatz gerade dieses filmischen Verfahrens an dieser Stelle?). Sie fasst die Motivation als cue auf, der vom Werk ausgeht und dazu veranlasst, uns über die Rechtfertigung des jeweiligen Verfahrens Gedanken zu machen, denn die cues generieren signifikante Interaktionen zwischen der Werkstruktur und der Aktivität des Zuschauers (vgl. Thompson 2003, S. 435).2 Die cues werden zwar von den spezifischen Darstellungsverfahren des Films geliefert und regen den Zuschauer zu verschiedenen Wahrnehmungsaktivitäten an, aber diese können nicht nur individuell variieren, sondern verändern sich auch im Kontext gesellschaftlichhistorischer Prozesse, so dass die Bedeutungen im Sinne des fließenden Sinngebungsprozesses sich verändern. Thompson differenziert vier solche durch die cues ausgelösten Wahrnehmungsaktivitäten des Zuschauers, die für eine psychoanalytische Interpretation von Filmen sehr hilfreich sein können: eine physiologische, eine vorbewusste, eine bewusste und eine unbewusste. Mit physiologischen Aktivitäten sind automatische und vom Zuschauer nicht kontrollierbare Wahrnehmungsprozesse gemeint wie Hören, die Wahrnehmung von schnell aufeinander folgenden statischen Bildern als Bewegung und so weiter. Unter »vorbewussten Aktivitäten« versteht Thompson automatische Informationsverarbeitungsprozesse wie das Erkennen von Objekten und das Herstellen von Kohärenz der Erzählung, obwohl es Schnitte, ungewöhnliche Kamerafahrten, Einstellungswechsel, Montagen gibt. Die bewussten Aktivitäten, die die neoformalistische Schule am meisten interes2 Eine solche Vorgehensweise hat Freud in seiner Arbeit über Michelangelos Mosesstatue praktiziert. Immer wieder fragt er danach, was die besondere Stellung der linken Hand des Moses motiviert haben mag und zu welcher Denkaktivität der Künstler den Betrachter durch diese rätselhafte Stellung anregen will (vgl. Freud 1914).
34
Teil I: Theoretische Annäherungen
siert, bestehen darin, sich die vorbewussten Wahrnehmungsaktivitäten bewusst zu machen. Für eine psychoanalytische Interpretation sind die vorbewussten und des Weiteren vor allem die unbewussten Aktivitäten, die von den cues ausgelöst werden, natürlich die interessantesten, auch wenn Thompson die unbewussten als »unnötiges Konstrukt« bezeichnet (Thompson 2003, S. 445), da sie sich von subsumtionslogischer Anwendung feststehender psychoanalytischer Interpretationsmuster mit Recht abgeschreckt zeigt.3 Die Darstellungsformen, die ihrerseits Transformationen unbewusster Prozesse sind, die sich in den Einstellungen manifestieren, treten hier mit den unbewussten Einstellungen des Zuschauers in einen Dialog. Hier kommen basale Kategorien ins Spiel wie Raum und Zeit, die unsere Erfahrungen strukturieren und deren filmische Verfremdungen (z. B. durch Weitwinkeltechniken, Verdunkelungen, Verengungen) das »Unheimliche« ins Spiel bringen können, das uns mit der Wiederkehr des Verdrängten in Berührung bringt. Weitwinkeleinstellungen beispielsweise können den Raum so ausdehnen, dass der Protagonist oder das betrachtende Subjekt zu verschwinden und den sicheren Standpunkt seiner »Zentralperspektive« zu verlieren droht, oder Räume können so labyrinthisch werden, als sei das Subjekt im Fremden seiner selbst, das zugleich das Vertrauteste ist, klaustrophobisch eingesperrt, wie dies in den Filmen von Kubrick oder Polanski meisterhaft durchgeführt ist. Bei den von den cues ausgelösten unbewussten Aktivitäten können verschiedene komplexe psychoanalytische Fähigkeiten, die der Analytiker in seiner klinischen Arbeit erworben hat, zur Anwendung kommen und eine »Tiefenhermeneutik« des Films (Lorenzer 1986) ermöglichen. Es geht dabei um die Beobachtung und kritische Reflexion der eigenen Reaktionen auf den Film, die Feinwahrnehmung unbewusster Kommunikationsstrukturen durch das »szenische Verstehen« (Lorenzer 1970), in dem es um die Aktivierung und die Identifizierung unbewusster Konflikte in Darstel3 »Die psychoanalytische Argumentation beruht auf den Interpretationen, die diese cues ermöglichen, doch handelt es sich hier im allgemeinen um die Plätzchenform-Variante, die aus jedem Film einen Kastrationskomplex ausstanzt oder feststellt, dass, ›wer über den Blick verfügt, auch über die Macht verfügt‹« (Thompson 2003, S. 445).
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
35
lung, Vorstellung und Einstellung geht, sowie um die Wahrnehmung und Reflexion der unbewussten gesellschaftlich-kulturellen Matrix, in der Film und Betrachter eingebunden sind. Die Analyse der formalen Strukturen eines Films mithilfe des Konzepts der cues und die professionellen Fähigkeiten des Analytikers können also auf verschiedenen Ebenen für das Verständnis seiner unbewussten Botschaften sensibilisieren. Denn seit dem intersubjective turn in der Psychoanalyse wird auch das Kunstwerk als gemeinsame Schöpfung von Betrachter und Werk gesehen, auch wenn es sich strukturell im Wesentlichen um eine andere Gemeinsamkeit handelt als die der Patientenanalyse, was die Reflexion der unbewussten persönlichen und gesellschaftlich bedingten Projektionen des Interpreten auf das Werk impliziert, die für die Interpretation fruchtbar gemacht werden, wenn sie auch in den einzelnen Interpretationen nicht immer angesprochen werden. In einer psychoanalytischen Formanalyse geht es also nicht um eine bloß formalistische Bestandsaufnahme und Beschreibung der filmischen Mittel, sondern die Form selbst wird verstanden als Produkt der Arbeit des Unbewussten. Diese Arbeit des Unbewussten als Formgebung durch Verschiebung, Verdichtung, Darstellung durch das Gegenteil, Rücksicht auf Darstellbarkeit und so weiter war der zentrale Gedanke von Freuds »Traumdeutung«. Er nannte sie »Traumarbeit«. Motiviert wird diese Arbeit durch den unbewussten Konflikt, in der Sprache des Formalismus ist er der cue, der die Gestaltung motiviert. Er ist der »tiefe Grund« der Einstellung. Die Formarbeit des Films ist zwar höchst bewusst, aber gerade die sekundärprozesshafte Anstrengung der Verschiebungs- und Entstellungsarbeit zeigt die Handschrift des Unbewussten, das sich darin verbirgt und gleichzeitig zeigt. Form ist immer signifikant, denn gerade weil sie selbst präverbal, präsymbolisch ist, verweist sie auf das »Jenseits-des-Sprachlich-Symbolischen«, das die unbewusste Phantasie ist, auch wenn dies widersprüchlich zu sein scheint (vgl. Segal 1996). Die je besondere audiovisuelle Form des Films, seine Einstellungen und Syntagmen, sein Umgang mit Raum, Zeit, Licht, Farbe und Klang sind die Oberfläche, von der Freud, wie uns Reiche wieder ins Bewusstsein gebracht hat, bereits in den »Studien zur Hysterie« schrieb, dass man von ihren oberflächlichen Schichten ausgehen
36
Teil I: Theoretische Annäherungen
müsse, um zu erkennen »an welchen Stellen es in die Tiefe geht« (zit. nach Reiche 2001, S. 35).
■ Literatur Baudry, J. L. (1994): Das Dispositiv: Metapsychologische Betrachtungen des Realitätseindrucks. Psyche – Z. Psychoanal. 48: 1047–1074. Bartels, M. (1979): Ist der Traum eine Wunscherfüllung? Psyche – Z. Psychoanal. 33: 97–131. Freud, S. (1900): Die Traumdeutung. G. W. Bd. II/III. Frankfurt a. M. Freud, S. (1905): Der Witz und seine Beziehung zum Unbewussten. G. W. Bd. VI. Frankfurt a. M. Freud, S. (1914): Der Moses des Michelangelo. G. W. Bd. X. Frankfurt a. M. Freud, S. (1930): Das Unbehagen in der Kultur. G. W. Bd. XIV. Frankfurt a. M. Gabbard, G. O. (Hg.) (2001): Psychoanalysis & Film. London. Kristeva, J. (1980): Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt a. M. Lewin, B. (1946): Sleep, the Mouth and the Dream Screen. Psychoanalytic Quarterly 15: 419–434. Lorenzer, A. (1970): Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt a. M. Lorenzer, A. (1986): Tiefenhermeneutische Kulturanalyse. In: König, H. D.; Lorenzer, A. u. a. (Hg.): Kultur-Analysen. Frankfurt a. M., S. 11–98. Mahler-Bungers, A. (2004a): Die Metamorphosen des ›Bösen‹. Überlegungen zur Filmographie Roman Polanskis. In: Cinema Quadrat e.V. Mannheim, Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie, Heidelberg-Mannheim e.V., Psychoanalytisches Institut Heidelberg-Karlsruhe der DPV (Hg.): Im Dialog: Psychoanalyse und Filmwissenschaft, Schriftenreihe Band 2 »Roman Polanski«, S. 2–15. Mahler-Bungers, A. (2004b): Die Metamorphosen des Bösen. Roman Polanski und seine Filme. Merkur, Zeitschrift für europäisches Denken XII/05: 1101–1110. Mahler-Bungers, A. (2005): Einstellung – Darstellung – Vorstellung. Zu Claude Lanzmanns filmischer Repräsentation des Holocaust. In: Psychoanalyse im Widerspruch 17: 34, S. 7–22. Matt, P. von (1994): Die Opus-Phantsie. Das phantasierte Werk als Metaphantasie im kreativen Prozeß. In: ders.: Das Schicksal der Phantasie: Studien zur deutschen Literatur. München u. Wien, S. 43–60. Metz, C. (1994): Traum und Film. Psyche – Z. Psychoanal. 48: 1005–1045 (1975). Metz, C. (2003): Probleme der Denotation im Spielfilm. In: Albersmeier, F. J. (Hg.): Texte zur Theorie des Films. 5. Auflage. Stuttgart, S. 321–370. Moser, U.; Zeppelin, I. von (1996): Der geträumte Traum Wie Träume entstehen und sich verändern. Stuttgart u. a.
A. Mahler-Bungers u. R. Zwiebel · Die unbewusste Botschaft des Films
37
Mulvey, L. (2003a): Visuelle Lust und narratives Kino. In: Albersmeier, F. J. (Hg.): Texte zur Theorie des Films. 5. Auflage. Stuttgart, S. 389–408. Mulvey, L. (2003b): Foreword of A. Sabbadini (Hg.): The Couch and the Silver Screen. Psychoanalytic Reflections on European Cinema. New York, S. xv– xx. Reiche, R. (2001): Mutterseelenallein. Kunst, Form und Psychoanalyse. Frankfurt a. M. u. Basel. Sabbadini, A. (Hg.) (2003): The Couch and the Silver Screen. Psychoanalytic Reflections on European Cinema. New York. Segal, H. (1996): Traum, Phantasie und Kunst. Stuttgart. Schneider, G. (in Vorb.): Film und psychoanalytische Theorie. In: Pfarr, U. et al. (Hg.): Lexikon psychoanalytischer Begriffe für die Kunstwissenschaft. Thompson, K. (2003): Neoformalistische Filmanalyse. In: Albersmeier, F. J. (Hg.): Texte zur Theorie des Films. 5. Auflage. Stuttgart, S. 427–464. Zeul, M. (1994): Bilder des Unbewussten. Zur Geschichte der psychoanalytischen Filmtheorie. Psyche – Z. Psychoanal. 48: 975–1003. Zwiebel, R. (2004): Der Analytiker als Anderer: Überlegungen zum Einfluß der Person des Analytikers in der analytischen Praxis. Psyche – Z. Psychoanal. 58: 836–868. 1
■ Mechthild Zeul
Einführende Überlegungen zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
Ich beschränke mich darauf, eine kurze Zusammenfassung des Verhältnisses von Film und Psychoanalyse seit ihrem Bestehen zu geben, weil die Texte in ihrer Gänze dazu leicht zugängig und die dort vertretenen Thesen gut nachlesbar sind. Ich habe mich in einer Übersichtsarbeit aus dem Jahr 1994 ausführlich mit dem Stand dieses Verhältnisses auseinandergesetzt. Deshalb will ich hier nur kurz die wesentlichen Resultate erwähnen, die auf einer Auswertung aller zum Thema gehörenden Arbeiten, die im Grinstein- und im Chicago-Katalog aufgeführt waren, beruhen und die den Zeitraum von 1917 bis 1990 umfassen. Die Beiträge zum Thema Psychoanalyse und Film zeichnen sich durch Heterogenität in ihren theoretischen und interpretativen Ansätzen und durch das Fehlen eines Austausches der Autoren und Autorinnen untereinander aus. Zugleich fällt aber auch ein theoretischer Reichtum der verstreut publizierten Arbeiten auf. Ich kam damals zu dem Schluss, »dass der Eindruck entsteht, dass einzelne vom Film persönlich angezogene Analytiker und Analytikerinnen sich zwar mit ihm auseinandersetzen, aber kein Interesse an Weiterentwicklung, Korrektur oder Bestätigung der eigenen konkreten Filmtheorie hatten« (Zeul 1994, S. 971). Insbesondere in den 1930er und 1940er Jahren wird in den psychoanalytischen Publikationen dem Thema von Traum und Film besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei geht es im Wesentlichen um eine theoretische Abgrenzung beziehungsweise Parallelisierung von Traum und Film sowohl im Hinblick auf die Gestaltungsmechanismen wie Verschiebung, Verdichtung, Rücksicht auf Darstellbarkeit als auch im Hinblick auf traumähnliche Zustände, die im Zuschauer beim Sehen eines Films ausgelöst werden, wobei insbesondere auf den re-
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
39
gressiven halluzinatorisch befriedigenden Aspekt verwiesen wird.1 Seit den späten 1990er Jahren ist verstärkt ein wiedererwachtes Interesse der Psychoanalyse am Medium Film zu verzeichnen. Auch die aktuellen Veröffentlichungen und Vorträge über Psychoanalyse und Film sind ebenfalls geprägt durch Heterogenität.2 Ich möchte auch die Versuche, Psychoanalyse zu verfilmen, nicht unerwähnt lassen, obgleich diese auch in der Literatur eingehende Erwähnung finden. Freud hatte aus seiner ablehnenden Haltung dem neuen Medium gegenüber nie einen Hehl gemacht. Die Auseinandersetzung zwischen Freud auf der einen und Abraham, Sachs und Bernfeld auf der anderen Seite im Zusammenhang mit dem Projekt der Verfilmung von Psychoanalyse ist in den letzten Jahren immer wieder dokumentiert worden (vgl. Eppensteiner et al. 1987; Fallend u. Reichmayr 1992; Zeul 1994; Ries 2000). Freud hatte im Zusammenhang mit dem geplanten Filmprojekt Abraham gegenüber geäußert: »Mein Haupteinwand bleibt, dass ich es nicht für möglich halte, unsere Abstraktionen in irgendwie respektabler Weise plastisch darzustellen« (Freud an Abraham, in: Abraham u. Freud 1965, S. 357). Im gleichen Jahr 1 Vgl. Montani u. Pietranera 1946. Die Autoren führen aus: »Die Bildersprache ist die geeignete Form, Unbewusstes auszudrücken« (S. 179); und weiter: »Der Film [ist] die Sprache des Unbewussten, die Literatur die des Bewussten« (S. 181), zitiert in: Zeul 1994, S. 984f. Vgl. auch ChasseguetSmirgel 1971. 1996 hat die amerikanische Filmzeitschrift »Projections« (The Forum of the Psychoanalytic Study of Film) ein Heft dem Verhältnis von Traum und Film gewidmet. Trotz unterschiedlicher Positionen vertreten die Autoren und Autorinnen eine Nähe von Traum und Film, sowohl im Hinblick auf Gestaltungsmechanismen als auch im Hinblick auf Filmrezeption. Von diesen Ansätzen unterscheidet sich die Arbeit von Pratt 1943. Für den Autor ist »die Traumähnlichkeit des Films etwas über den kinematographischen Apparat Hergestelltes, das aus dem Zusammenspiel von regressiven Prozessen im Zuschauer, der Dunkelheit des Kinosaals, der Ästhetik und der Technizität des Films resultiere« (zitiert in Zeul 1994, S. 984). 2 Vgl. Rubrik Film-Revue in »Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse«, eingerichtet seit 2000 (54. Jg.); im »International Journal of Psychoanalysis« sind seit 1997 Filminterpretationen erschienen. Buchveröffentlichungen: Gabbard 2001 und Sabbadini 2003. In den letzten Jahren vergeht fast keine internationale, europäische oder deutsche psychoanalytische Tagung, auf der nicht eine Filminterpretation vorgestellt wird.
40
Teil I: Theoretische Annäherungen
(1925), als »Geheimnisse einer Seele« unter der wissenschaftlichen Mitwirkung von Sachs und Abraham erstellt wurde, hatte Bernfeld ein Drehbuch mit dem Titel »Entwurf zu einer filmischen Darstellung der Freudschen Psychoanalyse« im Rahmen eines abendfüllenden Spielfilms vorgelegt (vgl. Sierek u. Eppensteiner 2000, S. 37ff.). Das Drehbuch, das überliefert ist, wurde nie verfilmt, weil Bernfeld keinen Verleih fand. Beide Projekte zeichnen sich durch mangelnde Übersetzung oder – um mit Pontalis zu sprechen – Verfälschung psychischer Realität in filmisch materielle aus.3 Ich werde mich auch nicht mit dem methodischen Vorgehen bei der psychoanalytischen Filminterpretation beschäftigen, Kritik an der vorherrschenden Praxis üben, die häufig vom Inhalt eines Films oder der Psychopathologie des Regisseurs ausgehend auf unbewusste Botschaften schließt, die der Film vermeintlich bereithält. Pontalis (1984) hatte in seinem Vorwort zum Sartre-Drehbuch über »Freud« unmissverständlich festgestellt: »Das Bild nimmt das Unbewusste nicht an« und »das Unbewusste lässt sich ebenso wenig sehen wie das Sein der Philosophen« (Pontalis 1984/ 1993, S. 28). Ich will hier auch nicht meinen eigenen methodischen Zugang zur Filminterpretation referieren (vgl. dazu Zeul 1997 und unveröffentlichtes Manuskript). Ich werde vielmehr Thesen zu einer psychoanalytischen Rezeptionsanalyse vorlegen, die sich auszeichnet durch regressive orale Erlebnisqualitäten, die zwischen Sehen und Essen angesiedelt sind, und primitive, primäre Bewusstseinszustände der Zuschauer mit Hilfe psychoanalytischer Theorie benennen.
3 Zur Einschätzung des Bernfeld-Drehbuchs vgl. Zeul 1997, S. 181ff., und Zeul 2000, S. 99ff.
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
41
■ »Urhöhle als Höhlenhaus der Träume« (René Spitz) Sich in den Film fallen lassen: vom Film geschluckt (gegessen) werden Den Anstoß zu meinen Überlegungen zur Rezeption von Film hat ein Aufsatz von Gertrud Koch (2002) gegeben, die sich mit Lewins Begriff der »Traumleinwand« (1946) im Hinblick auf ihre filmtheoretische Verwendbarkeit auseinandersetzt, um spezifische Bewusstseinszustände, die mit dem Filmsehen verbunden sind, dingfest zu machen. Sich auf Spitz (1955) beziehend, diskutiert Koch die der Traumleinwand zugrunde liegende Annahme, dass sie eine visuelle Erinnerungsspur der Mutterbrust darstelle. Sie vertritt die Auffassung in Übereinstimmung mit den Beobachtungen von Spitz, dass das erste visuell wahrgenommene Objekt nicht die Brust der Mutter, sondern deren Gesicht ist. Die Theorie Bertram Lewins von der Erweiterung der Oralität als Teil einer primären Objektbeziehung (vgl. Beland 1991; Lewin 1946, 1950, 1953), in die der Autor zusätzlich zu dem vielfach in der psychoanalytischen Literatur beschriebenen oralen Vorgang der aktiven Einverleibung (vgl. insbes. Abraham 1924; Torok 1968) die Phänomene des lustvoll, aber auch ängstigend erlebten Gefühls vom Verschlungenwerden, sich Fallenlassen und des Schlafs aufnimmt, dient mir dazu, den bereits erwähnten Regressionsprozess im Hinblick auf spezifische Phantasien zu präzisieren, aber insbesondere auf die durch den Film regressiv ausgelösten Bewusstseinszustände aufmerksam zu machen. Lewin stellt der oralen Phantasie vom Verschlingen, dem Fressen, Saugen und Beißen die Phantasie des Verschlungen- oder Aufgefressenwerdens, des sich Fallenlassens, sich Hingebens, sich Aufgebens und des Vorgangs des Einschlafens zur Seite. Bei den oralen Phantasien des Verschlungen- und des Aufgefressenwerdens handelt es sich – so Lewin – »nicht einfach [um] eine Umkehrung des Triebziels vom Aktiven ins Passive, das heißt eine Art Selbstbestrafung für die orale Aggression […], sondern [um einen] psychische[n] Vorgang […], in dem ein Erlebnis des Säuglings nach der Sättigung wiederkehrt« (Lewin 1950/1982, S. 112). An anderer Stelle führt er aus: »Der Wunsch nach Schlaf und Ruhe ist nach meiner Auffassung das libidinöse Fundament der Vorstellung vom Gefressen- und
42
Teil I: Theoretische Annäherungen
Verschlungenwerden« (Lewin 1950/1982, S. 126). Er betont, dass es sich bei dieser Annahme um eine Konstruktion im psychoanalytischen Sinn handele, und führt aus: »Im wesentlichen ist mit dieser Annahme, dass der Säugling sich wünscht, gefressen zu werden, gemeint, dass er zum Ende des Stillens hin, wenn er sich dem Einschlafen nähert, bestimmte Wahrnehmungen und Empfindungen hat, die man mit sich überlassen, entspannen und mit fallen umschreiben kann. Diese Erlebnisweisen hinterlassen eine intensive Erinnerungsspur, die zugleich der Kern ist, um den sich später die verschiedenen Ausgestaltungen des Wunsches gruppieren, verschlungen zu werden« (Lewin 1950/1982, S. 101). Einschlafen, die Empfindungen von sich Fallenlassen, sich Überlassen sind für Lewin mit völliger, von allen Spannungen freier, totaler Befriedigung verbunden. Er hat (1946, 1950, 1953) nicht eigentlich eine Theorie der Träume, sondern vielmehr des Schlafs als einem der Bestandteile der oralen Trias formuliert. Die Träume siedelt er dann in einem herabgesetzten Bewusstseinszustand an, womit er nicht nur den nächtlichen Schlaf meint, sondern viele Übergangsstadien vom Dösen zum Schlafen. Er vertritt die Auffassung, dass Freud, obgleich er den Schlafwunsch als Voraussetzung des Träumens nennt und den Traum als den Hüter des Schlafs, jedoch wenig über den Schlafwunsch selbst ausführt. Der Schlaf, auch im Erwachsenen, wiederhole – so Lewin – eine oral determinierte infantile Situation und ist bewusst und unbewusst mit der Idee vom gesättigten Säugling verbunden, der an der Mutterbrust in einen leeren Säuglingsschlaf falle. »Der Schlaf hat seinen wesentlichen Ursprung in oraler Befriedigung. Nach dem Stillen fällt der Säugling in einen vermutlich traumlosen Schlaf. Theoretisch korrekter ist es, wenn wir sagen, dass der Säugling einen ›bildlosen Traum‹ (›blank dream‹) hat, eine ›Erscheinung‹ (vision) gleichförmiger Leere, die ein andauerndes Nachbild der Brust ist« (Lewin 1950/1982, S. 79). An einen Gedankengang von Simmel (1944) anknüpfend, nimmt Lewin dessen Argument auf, »den Schlaf […] als einen Zustand [zu] betrachten, in dem sich unsere Interessen, die sich gerade noch auf die Objekte und in erster Line auf die Nahrung richteten, ins Körperinnere wenden« (Lewin 1950/1982, S. 125) und dort dem inneren Weg der Verdauung des Gegessenen folgen. Sich in den
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
43
Schlaf fallen lassen kommt demnach dem Prozess der Nahrungsaufnahme gleich, in dem der Säugling selbst zur Nahrung wird, sich aber auch über die Nahrungsaufnahme metaphorisch gesprochen neu erschafft. »Mit einer gewissen Freiheit des Ausdrucks kann man sagen, dass der Säugling, wenn er seine eigenen Körperteile belutscht und bekaut, in einem autokannibalistischen Akt schwelgt. So wird, wenn wir dieses Geschehen theoretisch formulieren, jedes Objekt, das gegessen wird, wie das Subjekt behandelt. Das Subjekt identifiziert sich selbst mit dem Objekt und übernimmt damit die Phantasiemöglichkeit des Gegessenwerdens« (Lewin 1950/1982, S. 104). Folgt man Lewins Gedankengang, dann lässt sich die These vertreten, dass das Sich in den Schlaf fallen lassen, dem der Vorgang der Nahrungsaufnahme zugrunde liegt, einem primitiven Identifizierungsprozess gleichkommt, in dem noch nicht zwischen Subjekt und Objekt zu unterscheiden ist und den Maria Torok (1968) mit Introjektion bezeichnet. Introjektionsvorgänge begleiten das primitive Wahrnehmen von Film, wenn der Film gegessen wird, dieser aber auch die Zuschauer verschluckt. Spitz sollte diesen Vorgang mit Hilfe der Säuglingsbeobachtung und unter der Postulierung einer Phase der »Nicht-Differenzierung« (Spitz 1956, S. 643) von Ich und NichtIch, Selbst und Nicht-Selbst, Körper und Psyche bestätigen. Obgleich Lewin das eindeutige, vom Schlaf getrennte Wachsein als Merkmal des Erwachsenenalters postuliert und die fließenden Übergänge zwischen Wachsein und Schlafen hauptsächlich in der Kindheit ansiedelt, so verweist er doch darauf, dass mit Schlaf auch im Erwachsenenalter unterschiedliche Bewusstseinszustände gemeint sind, zu denen das Träumen gehört. Um seine These zu untermauern, zitiert Lewin Kubie (1948): »Wir sind nie ganz wach, und ebenso wenig schlafen wir völlig. Beim Schlafen oder Wachsein geht es um relative, nicht um absolute Verhältnisse. Während wir wach sind, schlafen wir auch zu einem gewissen Teil, der wiederum wach sein kann, wenn wir schlafen; dazwischen finden sich alle Abstufungen von Aktivität und Inaktivität« (zit. nach Lewin 1950/1982, S. 81). Das Filmesehen stellt ein solches Übergangsstadium zwischen Wachsein und Schlafen dar, vielleicht kann man es am ehesten als waches Dösen bezeichnen. In diesem Zustand kommt es dann zu einer – wenn man dies so sagen will –
44
Teil I: Theoretische Annäherungen
primitiven Nahrungsaufnahme. Am Schlaf festzuhalten, nicht aufwachen zu wollen, bedeutet in diesem Kontext, die wunscherfüllende Halluzination vom Einschlafen nach der Fütterung durch die Mutter nicht aufgeben zu wollen als eines ersten Wünschens, das, so Freud – »ein halluzinatorisches Besetzen der Befriedigungserinnerung« (Freud 1900, S. 42) darstellt. Dass die Träume mit dem Älterwerden der Kinder, den neuen Erfahrungen, die sie in ihr Leben aufnehmen, womit auch zunehmend mehr Phasen von Wachsein verknüpft sind, komplexer und komplizierter werden, führt dazu, dass der ruhige Säuglingsschlaf nun nicht mehr möglich ist, dass es vielmehr zu einem »schlechten Schlaf« (Lewin 1950/1982, S. 150) kommt, der durch »Leibreize« (S. 150) wie Hunger, aber auch durch Angstträume gestört werden kann. »In dem Maße […], in dem das Kind intensiven Kontakt zur Umwelt aufnimmt und die Zeit seines Wachseins länger, komplexer und bedeutungsvoller wird, durchsetzen auch immer mehr Vorstellungen und Wünsche aus dem Wachzustand sein nächtliches Erleben. Dann stellen sich dem Schlafwunsch andere Wünsche entgegen, unbewusste und vorbewusste, auf Wecken und Stören ausgerichtete Regungen (disturbers, wakers), die mit mehr oder weniger Entstellung den manifesten Inhalt späterer Träume bilden« (Lewin 1950/1982, S. 80). Aus dem von Lewin gewählten Blickwinkel der Gegenüberstellung des frühen befriedigenden Säuglingsschlafs, der sich auszeichnet durch bildlose leere Träume (blank dreams), mit den Bilderträumen der älteren Kinder und der Erwachsenen, deren Bilder diesen leeren und befriedigenden Schlaf stören, ließe sich mit einiger Vorsicht und auch möglicherweise mit einer gewissen Ungenauigkeit sagen, der Inhalt eines Films komme psychoanalytisch metaphorisch verstanden eher dem manifesten Traum eines Erwachsenen oder eines Kindes gleich, dessen Bilder die Befriedigung des leeren Säuglingsschlafs stören. Dies bedeutet dann auch, dass die Filmwahrnehmung nie völlige Befriedigung bereitstellt, dass diese schon immer durch bestimmte Filmbilder gestört wird. Die Phantasien vom lustvoll erlebten Verschlungenwerden, sich Fallenlassen, sich Überlassen manifestieren sich im Schwelgen in der Ästhetik der Filmbilder, in der Sucht nach Kino, darin im Film einen Tröster zu suchen, einen Ort des entspannten Abstandneh-
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
45
mens von als unerträglich erlebten Forderungen des Alltags. Die Filmsituation hat häufig die Funktion eines Refugiums, eines Ortes des völligen Rückzugs, metaphorisch gesprochen dem bedürfnislosen frühen Säuglingsschlaf nach der Fütterung nachgebildet, in der es zu der Verdauung der vorher aufgenommenen Film-Nahrung kommt.
■ Traumleinwand (Dream Screen) und Fernwahrnehmung Das Konzept der Traumleinwand gehört – so Lewin – als visuelle Erinnerungsspur der mütterlichen Brust, die von taktilen und thermischen Qualitäten nicht zu trennen ist, ebenfalls zu der oralen Trias. Sie stellt eine Repräsentanz der frühen Fütter- und Schlafsituation dar. In der Traumleinwand sieht Lewin »ein wunscherfüllendes Element im Traum, eine Reproduktion der Brust, die der Träumer essen möchte, von der der Träumer gegessen werden will und die ihn in den Schlaf wiegt« (Lewin 1953, S. 175, Übersetzung v. d. Verf.). Und an anderer Stelle hatte er ausgeführt: »Dieses unausgefüllte Bild der abgeflachten Brust bleibt im späteren Leben als eine Art Hintergrund oder Projektionsschirm für unsere Träume erhalten; die Bilder, die wir als visuellen manifesten Traum bezeichnen, werden ähnlich wie im Kino auf diesen Hintergrund, die Traumleinwand (Dream Screen), projiziert« (Lewin 1950/1982, S. 79). Lewin führt weiter zur Traumleinwand aus: »Ich entdeckte, dass die Funktion der Brust, auf die die Traumleinwand verweist, in der Macht bestand, Schlaf zu ermöglichen. Ich sagte, dass die Traumleinwand die Brust repräsentierte, aber auch den Schlaf an der Brust. Ich postulierte die so genannte Trias oraler Wünsche. Ich kam zu dem Schluss, dass die Traumleinwand die Situation während des Fütterns repräsentierte und dass ihre Anwesenheit in Träumen die halluzinatorische Bedürfnisbefriedigung einer oder mehrerer dieser drei Wünsche anzeigte: den Wunsch zu essen, gegessen zu werden und zu schlafen. Die Traumleinwand ist deshalb nicht einfach eine Projektionsleinwand für das Traumbild« (Lewin 1953, S. 175, Übersetzung v. d.
46
Teil I: Theoretische Annäherungen
Verf.). In ihr manifestiert sich demnach nicht der reale Wunsch zu schlafen oder auch weiter schlafen zu wollen. Sie stellt nicht etwa eine Wunsch erfüllende Antwort auf den vorbewussten Wunsch nach Schlaf dar, in ihr kommt vielmehr die halluzinatorische Erfüllung eines Wunsches, nicht die wirkliche Erfüllung, nämlich zu schlafen, zum Ausdruck. Ihre Anwesenheit manifestiert sich im halluzinatorischen Schlafwunsch, während ihr sich Wegbewegen das Aufwachen ankündigt. Die Traumleinwand fungiert als Hüterin halluzinatorischer Wunscherfüllung im Schlaf. Lewin vertritt die Auffassung, dass das von Isakower (1936) beschriebene Phänomen, das in Träumen Erwachsener kurz vor dem Einschlafen, in halbwachen Zuständen und in fiebrigen Erkrankungen auftritt, ebenso wie die Traumleinwand eine visuelle Erinnerungsspur der mütterlichen Brust darstelle. Der Schläfer sieht dann häufig eine dunkle Masse auf sich zukommen, die ihn umfängt, zugleich berichtet er von sandigen, trockenen, teigigen Sensationen im Mund. Dabei handelt es sich – so Isakower – um ursprüngliche Empfindungen in der Mundhöhle des Säuglings, die dem Autor zufolge mit ähnlichen Empfindungen zusammenfließen, die auf der Hautoberfläche gemacht werden. Die Empfindungen von Trockenem, Sandigem im Mund der Erwachsenen vor dem Einschlafen stellen – so Spitz – »archaische Erinnerungsspuren eines ursprünglichen Beginns der Wahrnehmung« (Spitz 1965, S. 81) dar. Die visuelle Komponente der Masse, die der Träumer oder die Träumende auf sich zukommen sieht, repräsentiert nach Lewins und Isakowers Auffassung die mütterliche Brust. In seiner Revision der Traumleinwand (1953) grenzt Lewin das Isakower-Phänomen, die bildlosen Träume und die Traumleinwand voneinander ab. »Das Isakower Phänomen besteht aus einem Konglomerat von relativ formlosen, visuellen und nicht-visuellen Halluzinationen, die am besten in hypnagogen Zuständen zu beobachten sind, die aber auch in Träumen und neurotischen Erkrankungen vorkommen. Die Traumleinwand im engeren Sinn ist ein visuelles Element des oben genannten Konglomerats; sie hat die metapsychologische Struktur eines Traums und bildet den Hintergrund oder die Projektionsfläche für das Traumbild. Sie ist flach wie die Oberfläche der Erde, denn sie ist genetisch ein Segment vom riesigen Bild des Babys von der Brustwarzen-Hemis-
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
47
phäre. Die Klasse der bildlosen (blank) Träume besteht aus mehreren Untergruppen; ihnen ist die Abwesenheit oder beinahe Abwesenheit von geformten, manifesten, visuellen Details und eines Plots gemeinsam. Es gibt einfache, visuell leere Träume, sie können auch zusammengesetzt aus verschiedenen Zügen des Isakower Phänomens vorkommen oder auch mit späteren Eindrücken vermischt auftreten. Sie sind oft nicht mit konkreten Worten beschreibbar, sondern nur mit Hilfe von Metaphern, sie haben mehr Ähnlichkeit mit Gefühlen und Affekten als mit Bildern. […] Vom genetischen Standpunkt aus betrachtet sind die drei Typen, das Isakower Phänomen, die Traumleinwand und die bildlosen (blank) Träume, ein und dasselbe. Sie reproduzieren die Eindrücke, die das Baby an der Brust hat« (Lewin 1953, S. 198, Übersetzung v. d. Verf.). Spitz (1956) hält den Ausführungen Lewins, dass es sich bei der Traumleinwand um eine visuelle Repräsentanz der mütterlichen Brust handele, entgegen, dass der Säugling beim Trinken nicht die Brust, sondern das Gesicht der Mutter fixiere. Er widerspricht Lewin »in zweifacher Hinsicht. Erstens ist […] die sich aus den wogenden Nebelmassen kristallisierende erste Wahrnehmung in der Welt des Säuglings das menschliche Gesicht. Zweitens kann jeder […] ohne weiteres die Feststellung machen, dass das trinkende Kind die Brust gar nicht ansieht. […] Es starrt vielmehr unverwandt vom Anfang bis zum Ende des Stillakts in das Gesicht der Mutter« (Spitz 1956, S. 644). Moderne Säuglingsforscher (vgl. Stern 1977, 1985, 1990 und Robson 1967) betonen, dass sich die Brust viel zu dicht am Gesicht des Säuglings befindet, um als visuelles Wahrnehmungsobjekt zu dienen. Sie verweisen auf die »20cm-Blase« (vgl. Stern 1977/1979, S. 51), die bis zum dritten Lebensmonat bestehe, so dass alle Wahrnehmungsgegenstände, die zu dicht oder zu weit davon entfernt seien, vom Säugling nicht scharf gesehen werden könnten. Spitz hält dafür, dass der Säugling beim Trinken an der Mutterbrust oder an der Flasche das Gesicht der Mutter sehe, aber die Brustwarze, den Schnuller, die Milch in seinem Mund fühle. Dass die Milch als »erste[r] postnatale[r] Durststiller« (Spitz 1956, S. 647) Unlust beseitigen kann, wird vom Säugling passiv erlebt. »Der Akt des Saugens und Schluckens (hingegen) ist die erste ko-
48
Teil I: Theoretische Annäherungen
ordinierte Muskeltätigkeit des Säuglings. Die daran beteiligten Organe sind die Zunge, die Lippen und die Wangen« (Spitz 1956, S. 648). Diese Organe stellen »die ersten Körperoberflächen [dar], die zur taktilen Wahrnehmung und Entdeckung der Außenwelt benutzt werden« (S. 648). Spitz geht davon aus, dass seine Funde mit den lewinschen Thesen von der Traumleinwand vereinbar seien, wenn an die Stelle des visuellen Perzepts Brust das des Gesichts der Mutter trete. Die Annahme Lewins von den die Traumleinwand begleitenden taktilen und thermischen Sensationen wird von Spitz bestätigt. Er fügt die Empfindung der Tiefensensibilität hinzu, die mit dem Schlucken verbunden ist. »Der Knotenpunkt liegt bei der Beobachtung, dass der Säugling, während er an der Brust trinkt, zugleich das Gesicht der Mutter anstarrt; so wird das zeitlich simultane Erlebnis von Brust und Gesicht auch räumlich und körperlich voneinander nicht unterscheidbar und als Einheit erlebt« (Spitz 1956, S. 645). Spitz vertritt die These, dass »alle Wahrnehmung in der Mundhöhle beginnt« (Spitz 1965, S. 80). Diese Wahrnehmung rechnet er der Tastwahrnehmung zu, die ursprünglicher ist als die Fernwahrnehmung, die sich erst im Prozess der Entwicklung des Säuglings mit Hilfe der Objektbeziehungen herausbildet. »Wenn das Kind also an der Brust trinkt, fühlt es die Brustwarze im Mund, während es zur gleichen Zeit das Gesicht der Mutter sieht. Hier vermischt sich Tastwahrnehmung mit Fernwahrnehmung. Beide werden Bestandteile ein und derselben Erfahrung. Diese Vermischung macht den Weg frei für einen allmählichen Übergang von der Orientierung durch Berührung zur Orientierung durch Fernwahrnehmung« (Spitz 1965, S. 83). Die lewinsche Traumleinwand siedelt Spitz nun in diesem Übergangsstadium an, in dem Tast- oder Kontaktwahrnehmung und visuelle Wahrnehmung noch miteinander vermischt sind. Für dieses Stadium sei das »Überfließen« (Spitz 1956, S. 648) typisch. »Wenn das Kind gestillt wird und gewisse Sinnesreizungen in der Mundhöhle erfährt, während es zugleich das Gesicht der Mutter anstarrt, so vereinigen sich in ihm die taktilen und die visuellen Wahrnehmungen, die ja Wahrnehmungen einer Gesamtsituation sind, zu einer undifferenzierten Einheit, einer ›Gestalt‹, in welcher jedes Teilerlebnis für das Gesamterlebnis steht« (Spitz 1956, S. 648).
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
49
Spitz nimmt eine – für meine Absicht der psychoanalytischen Nachzeichnung von Filmwahrnehmung – hilfreiche chronologische Verankerung der verschiedenen Wahrnehmungsformen, der taktilen und der visuellen, innerhalb der menschlichen Entwicklung vor, die regressiv im Erwachsenenalter wiederbesetzt werden können. Innerhalb der »coenästhetischen Organisation« (Spitz 1956, S. 659) komme es zu einer ganzheitlichen Tast- und Fernwahrnehmung, für die nächste Stufe in der Wahrnehmung der diakritischen gelte, dass »visuelle Bilder auftreten« (Spitz, S. 659). Im Traum regrediere das Subjekt von der »Symbolfunktion« (S. 659) »auf die Stufe visueller Wahrnehmung und Bildvorstellung« (S. 659). Hier, im Alter zwischen sechs und zwölf Monaten, siedelt Spitz genetisch verstanden, entsprechend seiner Annahme von der visuellen Gedächtnisspur, die mit dem Gesicht der Mutter verbunden ist, die lewinsche Traumleinwand an. Mit der Traumleinwand verbunden ist ein komplexes Erleben des Säuglings, das zusammengesetzt ist aus der visuellen Wahrnehmung des Gesichts der Mutter mit taktilen Empfindungen in der Mundhöhle. Aus spitzscher Sicht stellt die Traumleinwand einen überwiegend visuellen Teil im Urhöhlenerleben des Menschen dar. In seinem einfallsreichen Aufsatz über »Die Urhöhle« (Spitz 1956) verbindet Spitz das von Lewin (1946) in die Debatte eingebrachte Konzept der Traumleinwand und das von Isakower (1936) beschriebene regressive Einschlafphänomen mit seiner Säuglingsbeobachtung. Während Lewin und Isakower zwei Stufen im rekonstruktiv erschlossenen Regressionsprozess beschreiben, geht Spitz den umgekehrten Weg, indem er die Progression in der frühen Entwicklung des Menschen nachzeichnet. Er kann überzeugend nachweisen, dass sich beide Vorgehensweisen durchaus miteinander vereinbaren lassen. Sie treffen sich in der »Urhöhle«, wie Spitz die Mundhöhle bezeichnet, in der jede Wahrnehmung ihren Ausgang nimmt. Der Mensch besitze »eine lokalisierte Wahrnehmungszone, in der sich Elemente sowohl der inneren als auch der äußeren Wahrnehmung vereinigen: dies ist der Mund« (Spitz 1956, S. 645). In ihm kommt es zu einer Vereinigung innerer und äußerer Reizung. »Eine solche Reizung findet statt, wenn die Brustwarze in den Mund des Säuglings hineinkommt« (S. 646). Die Mundhöhle »erhält damit die Funktion einer Brücke vom primären ›Empfan-
50
Teil I: Theoretische Annäherungen
gen‹ der aus dem Körperinneren stammenden Reize zum äußeren Wahrnehmen« (Spitz 1956, S. 647). Sie ist deshalb so geeignet für die primitivste Form der Wahrnehmung, die Kontaktwahrnehmung, weil in »der Mundhöhle die verschiedenartigsten Sinneswahrnehmungen angelegt sind. Gefühl, Geschmack, Temperatur-, Geruchs- und Schmerzempfindung sind in der Anlage vorhanden, aber auch die mit dem Akt des Schluckens verbundene Tiefensensibilität. So ist in der Tat die Mundhöhle besser als jede andere Körperregion geeignet, die Kluft zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung zu überbrücken« (Spitz 1956, S. 648). In der von Spitz angenommenen ersten Phase in der menschlichen Entwicklung, die ungefähr die beiden ersten Lebensmonate umfasst, die sich durch »Nicht-Differenzierung« (vgl. Spitz 1956, S. 643) zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Psyche und Körper auszeichnet, sind keine visuellen Wahrnehmungen zu beobachten. Etwa in der Mitte des zweiten Lebensmonats wird das menschliche Gesicht visuell wahrgenommen. Was Spitz über »die Welt der Urhöhle« (Spitz 1956, S. 665) sagt, lässt sich meiner Meinung nach ausgezeichnet auf die von den Zuschauern wahrgenommene Welt des Films übertragen. Die Urhöhle sei »undeutlich, unbestimmt, zugleich lustvoll und unlustvoll, [sie] überbrückt […] den Abgrund zwischen Innen und Außen, zwischen Passivität und Aktivität. Die ersten Sinneserlebnisse von Ereignissen, die in der Urhöhle stattfinden, werden auf dem Niveau des Primärprozesses verarbeitet und führen doch zur Entwicklung des Sekundärprozesses« (Spitz 1956, S. 665). Der dunkle Kinosaal kann als Urhöhle bezeichnet werden, in dem die Zuschauer Lust und Unlust erleben, Innen und Außen, Aktivität und Passivität nicht voneinander zu unterscheiden sind. Ich gehe davon aus, dass das Wahrnehmen von Film überwiegend dem Primärprozess unterliegt; wenn sich die Zuschauer aber aus dem Kinosaal herausbegeben, nach der Beendigung der Filmvorführung, folgen ihre Gedanken und Einfälle dem Sekundärprozess. In der Film-Höhle gibt es viel zu sehen und vieles ist passiv aufzunehmen, dem Säugling in der Füttersituation ähnlich. So könnte die Leinwand für das Gesicht, aber zuallererst für die Augen der Mutter stehen, in die die Zuschauer hineinblicken, während in ihre Mundhöhle, die auf die Leinwand projiziert ist, Nahrung hinein-
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
51
kommt. Wenn der Zuschauer und die Zuschauerin ins Kino gehen, begeben sie sich in die Welt der Urhöhle, in der taktile, visuelle und andere Sinneswahrnehmungen wie Geruch, Geschmack, Schmerzempfindungen und Tiefensensibilität nicht voneinander unterschieden werden. Über eine Kombination aus Innen- und Außenwahrnehmung wird der Film – in Abwandlung eines Satzes von Spitz – einerseits passiv hingenommen, andererseits auch aktiv wahrgenommen (gesehen). Nacht für Nacht begibt sich das Subjekt in die Passivität des Schlafens zurück, dabei kommt es zur Wiederbelebung des Primärprozesses, »und die Urhöhle wird zum Höhlenhaus der Träume« (Spitz 1956, S. 666). Wenn ich vom Kino als dem »Höhlenhaus der Träume« spreche, dann geht es mir nicht darum, den Film mit einem Traum gleichzusetzen, sondern die Metapher dient mir vielmehr als Indikator für die Feststellung unterschiedlicher Stufen im Regressionsprozess und damit verbunden verschiedener Bewusstseinszustände, die die Filmwahrnehmung begleiten.
■ Bildlose Träume (Blank Dreams): Regression auf die vor-bildliche Phase in der Entwicklung War Lewin (1946) zunächst davon ausgegangen, dass die Traumleinwand und der bildlose Traum identisch seien und Prototypen aller Träume darstellten, so unterscheidet er nun (1953) zwischen bildlosen und fast bildlosen Säuglingsträumen und der Repräsentanz der Mutterbrust, die im späteren Leben als bedürfnisbefriedigende Komponente in allen Träumen in der völlig leeren Leinwand auffindbar ist. Die bildlosen Träume stellen den ersten Traum des gesättigten Säuglings dar. Bildlose Träume zeigen die »Erfüllung des Schlafwunsches, in der Freud bekanntlich den übergeordneten Anlass für das Träumen sah in Reinkultur« (Lewin 1950/1982, S. 85). Genetisch verankert er das Vorkommen bildloser Träume in einer Zeit in der individuellen Entwicklung, die vor der Herausbildung des Körper-Ich liegt (vgl. insbes. Lewin 1968). »Bevor das Baby seine Körpergrenzen kennt, oder präziser formuliert, bevor es ein Bild von ihnen hat, haben seine Träume
52
Teil I: Theoretische Annäherungen
möglicherweise bildlose Qualität, ›reines Gefühl‹ (pure feeling) […] dem ›ozeanischen Gefühl‹ gleich« (Lewin 1968, S. 54, Übersetzung v. d. Verf.). Spitz (1956) präzisiert, dass von dieser vorbildlichen Phase etwa bis zum dritten Lebensmonat ausgegangen werden kann. Er bestätigt die bereits von Lewin (vgl. 1953) geäußerte Annahme, dass die Gedächtnisspuren aus dieser frühen Zeit nicht aus Bildern, sondern aus Affekten und taktilen und thermischen Empfindungen bestehen. Der bildlose Traum kann – so Lewin – wie der Bildertraum erinnert werden, obwohl seine Generierung in eine vorsprachliche Zeit fällt. Häufig fassen Patienten in der psychoanalytischen Behandlung zum ersten Mal ein vages, nicht definierbares Gefühl in Worte. Wenn in der Analyse bildlose Träume erzählt werden, dann verwenden Patienten keine Bilder, sondern sprechen von Emotionen und Körpergefühlen (»like an emotion, or like an organic feeling«, Lewin 1968, S. 55), die sie nach dem Aufwachen erinnern. Die Emotionen und Körpersensationen werden als befriedigend erlebt wie beispielsweise Orgasmen. Sie können aber auch ängstigender Natur sein wie klaustrophobische und andere diffuse Panikzustände und Todesängste. In meiner psychoanalytischen Arbeit konnte ich immer wieder verschiedene Formen bildloser Träume beobachten. So kommt es insbesondere bei früh traumatisierten Patienten vor, dass sie davon sprechen, sie hätten geträumt, erinnerten aber keinerlei bildlichen Inhalt, sondern nur Körpersensationen wie Panik, aber auch völlige Entspannung und Gefühle von Wohlbefinden und Zufriedenheit mit sich selbst. Die Analytikerin steht dann vor der Aufgabe, diese unterschiedlichen Sensationen gemeinsam mit den Patienten in Sprache zu fassen. Eine Patientin formulierte dies so, sie habe einen Traum gehabt, es sei wie ein »flash« gewesen, der sich ihr näherte. Mit dem »flash« verbindet sie dann in ihrer Erzählung in der psychoanalytischen Stunde das Gefühl mit sich eins, bei sich angekommen zu sein. Es gibt aber auch Mitteilungen von nächtlichen Angst- und Panikanfällen, die mit Aufstehen und Schreien einhergehen, ohne dass dazu Bilder erinnert würden. Eine Filmemacherin aus einem lateinamerikanischen Land, deren Mutter einäugig war, leidet immer dann, wenn wir uns in der Übertragung der Mutterbeziehung nähern, unter qualvollem nächtlichem Aufschrecken. Jedes Mal,
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
53
wenn sie kurz vor dem Einschlafen ist, sich ihre Muskeln entspannen, schreckt sie hoch und es kommt zu schrecklichen Panikattacken, in denen sie fürchtet sterben zu müssen. Wenn sie sich nach ein bis zwei Stunden beruhigt hat und wieder einschlafen will, schreckt sie erneut hoch und gerät wieder in Panik. In solchen Nächten kann sie erst im Morgengrauen einschlafen. Sie hatte diese Attacken zum ersten Mal, als sie fürchtete, dass ihre kranke Mutter bald sterben werde. Die Patientin hatte um Analyse nachgesucht, weil sie nach einer von ihrem Freund provozierten, für sie unverständlichen Trennung, qualvollen Panikattacken ausgeliefert gewesen war. Ihre Kreativität war zum völligen Erliegen gekommen. Inmitten einer Phase von Panikattacken, die zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Analyse gehäuft auftraten, hatte die Patientin einen Bildertraum. Sie wird im Traum in der Wohnung ihres ehemaligen Freundes wach. Sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist, eines ist jedoch sicher: Sie ist nicht willkommen. Um sich zu orientieren, läuft sie durch die Zimmer. Sie versucht zu telefonieren, weiß aber nicht, wen sie anrufen und wohin sie gehen will. Auf dem Telefon sind keine Zahlen. Eine Freundin steht neben ihr, und sie vermutet, dass diese vielleicht mit dem Telefon umgehen und ihr beim Telefonieren helfen kann. Als sie sich im Schlafzimmer befindet, kommt ihr Freund zur Tür herein. Er wird wütend, als er ihrer ansichtig wird. Sie versucht, seine Augen zu fixieren, um ihm klar zu machen, dass sie nichts Böses im Schilde führt. Aber sie findet seine Augen nicht. Sie verändern sich beständig. Einmal werden an der Stelle von lebendigen Augen gemalte blinde Augen sichtbar, oder seine Augen sind blicklos, sie verwandeln sich aber auch in die dunklen Augen eines Vogels. Es sei sehr ängstigend gewesen, dass sie ihn nicht fixieren konnte. Sie wacht auf, ohne erreicht zu haben, dass er ihren Blick erwiderte. Wir stellten in der Analyse einen Zusammenhang her zwischen den Panikanfällen, in deren Verlauf sie glaubte sterben zu müssen, und der Unmöglichkeit, mit dem Freund in Blickkontakt zu kommen. Bereits in anderen Szenen hatten wir die Mutter-Stellvertreterfunktion des ehemaligen Freundes herausgearbeitet. Die bildlosen Träume, die in den Panikanfällen der Patientin bestanden, waren demnach in Sprache zu fassen; darauf hatte Lewin ja bereits ver-
54
Teil I: Theoretische Annäherungen
wiesen. Offenbar war es der Patientin schon als Säugling nicht möglich, in einen traumlosen, befriedigenden Schlaf zu fallen, weil sie beim Trinken die Augen der Mutter nicht fixieren konnte. Rekonstruktiv lässt sich sagen, dass die Unerreichbarkeit der Mutter über den Blick die Patientin auf eine vorsprachliche Phase in ihrer Entwicklung regredieren ließ, die beherrscht war von Panik und Todesängsten. Wenige Wochen nach der Bearbeitung dieses Zusammenhangs, der sich als extrem schwierig herausstellte, weil die Patientin sich aus Scham weigerte, die Bedeutung des behinderten Blickkontakts mit der Mutter für ihr psychisches Erleben anzuerkennen und immer wieder von nächtlichen Panikattacken berichtete, kam sie zu einer Stunde und teilte mir mit, dass sie die damals bei der Trennung von ihrem Freund abgebrochene Arbeit habe wieder aufnehmen können, nämlich ein neues Filmprojekt zu planen, in dem vor allem Gesichter eine wesentliche Rolle spielen sollten, bei deren Anblick der Eindruck entstehe, dass sie wegdrifteten, sich beständig in Bewegung befänden, nicht fixierbar seien. Es besteht demnach ein enger Zusammenhang zwischen diffusen Körpergefühlen und Ängsten, die die Patientin im Traum in Bildersprache fassen konnte, und den sich daran anschließenden Versuchen der künstlerischen Gestaltung ihres Traumas, das in der Unmöglichkeit bestand, die Augen der Mutter fixieren zu können. Ich sehe meine Aufgabe prinzipiell nicht darin, Vermutungen über filmische Gestaltung und die Tiefe der Regression anzustellen, die diesem Schaffensprozess zugrunde liegt und ihn möglicherweise überhaupt erst in Gang setzt und der in der Konstruktion von Bildersprache seinen Ausdruck findet. Es geht mir auch keineswegs um die Analyse eines je einzelnen Regisseurs. Das Beispiel meiner Filmregisseurin, die mit Hilfe des Analyseprozesses über diffuse Körpersensation zur Traum-(Bilder-)Sprache und von dort zur Wiedergewinnung ihrer Kreativität gelangte, ermutigt mich jedoch dazu, mit aller Vorsicht ähnliche Prozesse beim Filmschaffen zu vermuten. Diese Annahme macht dann auch plausibel, dass beim Filmsehen ähnlich regressive Prozesse im Publikum ablaufen können. Für meine Absicht der Benennung der psychischen Prozesse beim Wahrnehmen von Film ist dieses Beispiel besonders aufschlussreich. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich die
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
55
psychoanalytische Behandlung nicht mit der Filmrezeption gleichsetzte. Aber Ergebnisse aus meiner klinischen Arbeit erlauben es mir, psychische Prozesse für die Wahrnehmung von Film herauszuarbeiten und aufzuzeigen. Ich vertrete die Auffassung, dass Filme bildlose Träume in der weiter vorn beschriebenen Form auszulösen vermögen. Die multiplen körperlichen Reaktionen der Zuschauer auf das Medium, sexuelle Erregung, Angst- und Panikzustände können als Reaktivierung bildloser Träume im Publikum verstanden werden, womit vor allem die Tiefe der Regression im Wahrnehmungsprozess der Zuschauer aufgezeigt werden kann. Häufig ist zu hören, dieser oder jener Film habe gefallen, oder aber er sei schrecklich, ohne dass dieses Urteil anhand der Bilder konkretisiert würde. Aber dieses Beispiel aus der Klinik kann auch dazu dienen, den Wechsel in den Regressionsprozessen, denen die Zuschauer unterliegen, mit Hilfe des Konzepts von bildlosen Träumen und Bilderträumen, in denen die Traumleinwand anwesend ist, zu beschreiben. Die Filmsituation vermag es, in den Zuschauern tiefe Regressionen auszulösen, die sich in Bewusstseinszuständen manifestieren, in denen bildlose Träume für die Auslösung diffuser Körpergefühle und befriedigender und Angst machender Emotionen sorgen. Häufig aber hat Filmsehen einen befriedigenden Charakter, so dass davon auszugehen ist, dass die Traumleinwand bei der Rezeption halluzinatorisch wiederbelebt wird. In dieser Situation wären die Zuschauer mit dem in der Anwesenheit der Mutter gestillten, zufriedenen Säugling zu vergleichen. Die durch den Film angestoßene Erinnerungsspur führt zur Wiederbelebung der befriedigenden, Lust verschaffenden Wahrnehmung des Gesichts der Mutter, insbesondere aber ihrer Augen, während der Film geschluckt wird. Stern (1977, 1985, 1990), aber auch Robson (1967) – beide gehen von einer interaktionellen Theorie aus – verweisen darauf, dass für den Säugling die Augen im Gesicht der Mutter von besonderer Bedeutung sind. Ab der 6. Lebenswoche ist das Kleinkind in der Lage, die Augen der Mutter »visuell zu fixieren und diese Fixierung beizubehalten« (Stern 1977/1979, S. 50). Da die Mutter nun das sichere Gefühl hat, dass ihr Kind sie anblickt, erwidert sie in den meisten Fällen diesen Blick freudig, worüber soziale Interaktion in Gang kommt. Wie auch später Stern (1985), betont Robson
56
Teil I: Theoretische Annäherungen
(1967) den aktiven Part des Säuglings beim Sehen. Spitz hatte in einer anderen Terminologie bereits auf diesen Umstand aufmerksam gemacht. Aus lewinscher Sichtweise würde es sich beim Sehen zugleich um das Auffressen beziehungsweise das Aufgefressenwerden handeln. »Es muss daran erinnert werden, dass das Kind in dieser Phase (vom dritten bis sechsten Lebensmonat, d. Verf.) noch nicht laufen und die Bewegungen seiner Gliedmaßen sowie die Auge-Hand-Koordination erst geringfügig kontrollieren kann. Dagegen ist das visuell-motorische System schon nahezu ausgereift, und im Blickverhalten ist das Kind ein erstaunlich tüchtiger Interaktionspartner. Der Blickkontakt ist eine wichtige Form sozialer Kommunikation. Beobachtet man das Blickverhalten von Mutter und Kind in dieser Phase, so sieht man zwei Menschen, die dasselbe Sozialverhalten beinahe gleichermaßen beherrschen. […] [Es] wird deutlich, dass Säuglinge in hohem Maß die Kontrolle über Einleitung, Fortsetzung, Beendigung und Vermeidung des Sozialkontakts mit der Mutter ausüben; mit anderen Worten: Sie tragen zur Steuerung des Kontakts bei. Außerdem regulieren sie selbst durch Kontrolle der eigenen Blickrichtung das Niveau und Ausmaß der sozialen Stimulierung, der sie ausgesetzt werden. Sie können den Blick abwenden, die Augen schließen, an etwas vorbei- oder durch etwas ›hindurchsehen‹« (Stern 1985/1992, S. 39). Auf die Filmrezeption bezogen, besteht die Aktivität in der Aneignung des Mediums anhand von Übertragung. Stern (1990) spricht in seinem »Tagebuch eines Babys« von der Faszination, die für den Säugling von den Augen der Mutter ausgeht, dies gilt insbesondere für die Zeit ab dem zweiten bis zum Ende des sechsten Lebensmonats. Diese Beobachtung stimmt mit der spitzschen überein, der ebenfalls den Beginn der visuellen Wahrnehmung in der 2. Hälfte des 2. Lebensmonats ansiedelt. Stern geht davon aus, dass für den Säugling aufgrund »angeborener Präferenzen« (Stern 1990/1991, S. 52) das menschliche Gesicht, in den meisten Fällen das der Mutter, das »faszinierendste und beeindruckendste von allen Objekten« (S. 51) in seiner Umgebung sei. Dabei gilt seine Vorliebe nicht dem Gesicht selbst, sondern bestimmten formalen Eigenschaften, die es aufweist. Es »zieht beispielsweise Rundungen und Wölbungen (wie bei Augenbrauen und Wangen) geraden Linien vor und mag starke Hell-Dunkel-Kontraste (wie die Pupille im Kontrast
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
57
zum weißen Augapfel« (Stern 1990/1991, S. 52). Robson (1967) führt zur Attraktion, die die Augen der Mutter für den Säugling haben, aus: »Der Reiz, den die Augen der Mutter für das Kind haben (und seine Augen für sie) wird gefördert durch die Reichhaltigkeit des Stimulus. Im Vergleich mit anderen Teilen der Körperoberfläche hat das Auge eine stattliche Reihe von interessanten Qualitäten, wie das Leuchten des Augapfels, seine Beweglichkeit, während er zur gleichen Zeit fixiert ist, die Kontraste zwischen der Pupille-Iris-Konfiguration, die Kapazität der Pupille, den Diameter zu verändern, und die Variationen in der Weite der Spalte der Augenlider« (Robson 1967, S. 14, Übersetzung v. d. Verf.). Vielleicht haben die Augen der Mutter in ihrer Beweglichkeit einerseits und ihrer festen Verankerung andererseits Ähnlichkeit mit den sich bewegenden Bildern des Films, fixiert auf einer Leinwand, vor der die Zuschauer gebannt sitzen, das Gesehene gierig in sich aufnehmen und dabei zufrieden wie gestillte Säuglinge sind. So verstanden, blickt der Zuschauer-Säugling gebannt und fasziniert in das Gesicht der Mutter, können Filme immer wieder diesen beglückenden Zustand mit ihren Mitteln bewerkstelligen. Das umwerfend schöne Gesicht Ava Gardners im Film »Die barfüssige Gräfin« (Mankiewicz 1954) kann auf die Säuglings-Zuschauerin und den -Zuschauer einen extrem verführerischen Reiz ausüben.
■ Die Welt der vermischten Sinneswahrnehmungen – der vermischten Gefühle Daniel Stern (1985 u. 1990) hat immer wieder auf die frühe präverbale, ganzheitliche Wahrnehmung der Säuglinge aufmerksam gemacht. Ähnliches meint Spitz, wenn er physiologisch formuliert vom »Überfließen« beim Säugling spricht, der einen in einem sensorischen Bereich gesetzten Reiz durch Reaktionen beantwortet, die in einem anderen zugehören. Das »Überfließen« führt beispielsweise zu einer Vermischung zwischen verschiedenen Sinneswahrnehmungen, die der Säugling in der Urhöhle macht. Stern verankert die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen hingegen im Verhalten und in den Gefühlen des Kleinkindes.
58
Teil I: Theoretische Annäherungen
Im Tagebuch eines Babys schildert Stern (1990) eindrucksvoll, wie anhand der Einführung von Sprache die ganzheitliche Erlebnis- und Erfahrungswelt des kleinen Kindes zusammenbricht und wie »gleichberechtigte Elemente ganz verschiedener Sinnesmodalitäten: Intensität, Wärme, Vibration und Leuchtkraft« (Stern 1990/1991, S. 131) auf visuelle Wahrnehmung reduziert werden. Der knapp zweijährige Joey hatte im Alter von sechs Wochen in seinem Kinderzimmer den Reflex wahrgenommen, den ein Sonnenstrahl am frühen Morgen auf dem Boden seines Kinderzimmers hinterlassen hatte. Im Alter von knapp zwei Jahren begegnet er seinem Freund, dem Sonnenstrahl, wieder an einem frühen Morgen in seinem Kinderzimmer. Joey »sieht den Sonnenschein auf Wand und Fußboden. Er geht zu einem Lichtstreifen, der auf dem dunklen Holzboden liegt. Ganz fasziniert lässt er sich auf Hände und Knie nieder. Er sieht das Licht. Er berührt es mit der Hand. Er beugt sich hinunter und berührt den Sonnenstrahl mit den Lippen. In diesem Moment kommt seine Mutter zurück und sieht ihn. Sie ist überrascht und etwas angeekelt. Sie ruft: ›Lass das sein Joey, was tust du da?‹ Er starrt auf das Sonnenlicht und blickt dann seine Mutter an. Sie geht zu ihm, beugt sich zu ihm hinab, legt den Arm um ihn und sagt besänftigend, sogar mit einem Lächeln: ›Das ist doch nur ein Sonnenschein, mein Schatz. Den darf man nur anschauen. Es ist doch nur Licht auf dem Fußboden. Den Sonnensschein kann man doch nicht essen! Er ist schmutzig.‹ Joey sieht sie eine Weile an und schaut dann zurück zu dem Sonnenlicht auf dem Boden. Er löst sich aus ihren Armen und geht aus dem Zimmer« (Stern 1990/1991, S. 127). Das Faszinierende des Films besteht darin, dass er es mit Hilfe seiner technischen Mittel, beispielsweise der Manipulation der Beleuchtung und der Montage, vermag, dem Publikum vorübergehend die verloren geglaubte, aber zugleich umso mehr herbeigesehnte ganzheitliche, vorsprachliche Weltsicht zu ermöglichen, in sie einzutauchen, wie der kleine Joey in den Sonnenstrahl eingetaucht war. Die (Wieder-)Herstellung dieser vorsprachlichen Welt macht aus dem Sonnenstrahl nicht nur etwas Sichtbares, sondern auch Essbares, etwas, was man anfassen kann. Niemand schimpft die Zuschauer dafür – wie im sternschen Beispiel die Mutter ihren kleinen Sohn –, dass sie die Filmbilder in den Mund nehmen, sich
M. Zeul · Zur Erstellung einer psychoanalytischen Filmtheorie
59
in ihnen baden, mit ihnen tanzen wollen und phantasieren, mit ihnen eins zu werden. Das Gefühl von Desorientierung und Irritation, das häufig in jedem von uns nach dem Verlassen des Kinosaals zu beobachten ist, markiert schmerzlich den Bruch zwischen der kurzzeitlich wiedergefundenen, befriedigenden ganzheitlichen »Welt der vermischten Sinneswahrnehmungen« und der Welt der Worte. Lewin hatte vom triebtheoretischen Standpunkt aus im Kontext der Entwicklung des Wirklichkeitssinns drei Stufen unterschieden, die orale, die sensomotorische und die verbale, und zieht den Schluss: »Die Welt wird immer weniger essbar« (Lewin 1950/1982, S. 175).
■ Literatur Abraham, H. C.; Freud, E. L. (Hg.) (1965): Sigmund Freud – Karl Abraham. Briefe 1907–1926. Frankfurt a. M. Abraham, K. (1924): Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Libido auf Grund der Psychoanalyse seelischer Störungen. In: Gesammelte Schriften, Bd. II. Frankfurt a. M. 1982, S. 32–83. Beland, H. (1991): Nachwort zur Taschenbuchausgabe der Traumdeutung. Frankfurt a. M., S. 629–634. Chasseguet-Smirgel, J. (1971): Unterhaltung über das Kino. In: ChasseguetSmirgel, J.: Kunst und schöpferische Persönlichkeit. München u. Wien, 1988, S. 82–87. Eppensteiner, B.; Fallend, K.; Reichmayr, J. (1987): Die Psychoanalyse im Film 1925/26 (Berlin/Wien). Psyche – Z. Psychoanal. 41: 129–139. Fallend, K.; Reichmayr, J. (1992): Siegfried Bernfeld oder die Grenzen der Psychoanalyse. Frankfurt a. M. Freud, S. (1900): Die Traumdeutung. G. W. Bd. II/III. Frankfurt a. M., S. 1– 642. Gabbard, G. (Hg.): (2001): Psychoanalysis and Film. London. Isakower, O. (1936): Beitrag zur Psychopathologie des Einschlafphänomens. Int. Zeitschrift f. Psychoanal. 22: 466–477. Koch, G. (2002): Traumleinwand – filmtheoretische Ausdeutungen eines psychoanalytischen Konzepts. In: Hau, S.; Leuschner, W.; Deserno, H. (Hg.): Traum-Expeditionen. Tübingen, S. 277–288. Kubie, L. S. (1948): Instincts and Homeostasis. Psychosomatic Medicine 10: 15–30. Lewin, B. (1946): Sleep, the Mouth and the Dream Screen. Psychoanal. Quart. 15: 419–434.
60
Teil I: Theoretische Annäherungen
Lewin, B. (1950): Das Hochgefühl. Zur Psychoanalyse der gehobenen, hypomanischen und manischen Stimmung. Übers. und mit einem Nachwort von H. Deserno. Frankfurt a. M., 1982. Lewin, B. (1953): Reconsideration of the Dream Screen. Psychoanal. Quart. 22: 174–199. Lewin, B. (1968): The Image and the Past. New York. Montani, A.; Pietranera, G. (1946): First Contributions of the Psychoanalysis and Aesthetics of Motion-Picture. Psychoanal. Rev. 177–196. Pontalis, J.-B. (1984): Vorwort. Drehbuch Freud, Drehbuch Sartre. In: Sartre (J.-P.): Freud. Das Drehbuch. Reinbek, 1993, S. 7–30. Pratt, J. (1943): Notes on Commercial Movie Technique. Int. J. Psychoanal. 24: 185–188. Projections. The Forum of the Psychoanalytic Study of Film 1966. Ries, P. (2000): Film und Psychoanalyse in Berlin und Wien 1925. In: Sierek, K.; Eppensteiner, B. (Hg.): Der Analytiker im Kino. Frankfurt a. M., S. 171–196. Robson, K. S. (1967): The Role of the Eye to Eye Contact in Maternal-Infant Attachment. J. of Child Psychology and Psychiatry 13–25. Sabbadini, A. (Hg.) (2003): The Couch and the Silver Screen. Hove u. New York. Sierek, K.; Eppensteiner, B. (Hg.) (2000): Der Analytiker im Kino. Frankfurt a. M. Simmel, E. (1944): Self-Preservation and the Death Instinct. Psychoanal. Quart. 13: 160–185. Spitz, R. (1956): Die Urhöhle. Psyche – Z. Psychoanal. 9: 641–667. Spitz, R. (1965): Vom Säugling zum Kleinkind. Naturgeschichte der MutterKind-Beziehungen im ersten Lebensjahr. Übers. v. G. Theusner-Stampa. Stuttgart, 1985. Stern, D. N. (1977): Mutter und Kind. Die erste Beziehung. Stuttgart, 1979. Stern, D. N. (1985): Die Lebenserfahrung eines Säuglings. Übers. v. W. Krege; überarbeitet v. E. Vorspohl. Stuttgart, 1992. Stern, D. N. (1990): Tagebuch eines Babys. Was ein Kind sieht, spürt, fühlt und denkt. München u. Zürich, 1991. Torok, M. (1968): Trauerkrankheit und Phantasma des »Cadavre exquis«. Psyche – Z. Psychoanal. 37: 497–519 (1983). Zeul, M. (1994): Bilder des Unbewussten. Zur Geschichte der psychoanalytischen Filmtheorie. Psyche – Z. Psychoanal. 48: 975–1003. Zeul, M. (1997): Carmen und Co. Weiblichkeit und Sexualität im Film. Stuttgart. Zeul, M. (2000): Männerträume vom ewig Weiblichen. In: Sierek, K.; Eppensteiner, B. (Hg.): Der Analytiker im Kino. Frankfurt a. M., S. 99–109.
■ Dirk Blothner
Wirkungsanalyse von »American Beauty« Ein Beitrag zu psychoanalytischem Verstehen von Spielfilmen
Der hier vorgestellte Ansatz der Psychoanalyse von Spielfilmen hat seine Geburtsstunde in Sigmund Freuds Analyse der Moses-Plastik des Michelangelo: Kunstwerk und Betrachter bilden eine Wirkungseinheit, die sich im Umgang entwickelt und entfaltet. Dieser Wirkungsprozess, in dem die Beschaffenheit des Kunstwerks eine eigene strukturierende Größe einbringt, lässt sich beschreibend rekonstruieren. Freud stellte an der Plastik in Rom heraus, dass deren spezifische Gestalt den Betrachter in die Wendungen eines allgemein-menschlichen Grundproblems involviert. Sie halte den Moment fest, in dem der Begründer der monotheistischen Religion, angesichts der Anbetung des Goldenen Kalbs durch sein Volk, einen in ihm aufsteigenden mächtigen Zornaffekt niederringt. Die Plastik versetze zwischen den Impuls, dem Affekt direkten Ausdruck zu verleihen, und das Bestreben, ihn um eines höheren Ziels willen zu beherrschen (Freud 1914, S. 194). Wirkungsanalysen arbeiten heraus, welche ganzheitlichen Sinnentwicklungen mit einem spezifischen Werk verbunden sind.
■ Filmwirkungsanalyse Seit Anfang der 1960er Jahre wird dieser Ansatz an der Universität Köln auf das Medium Film angewandt und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer eigenen Forschungsrichtung entwickelt (Salber 1977; Ahren 1998; Blothner 1999, 2003). Sie konzentriert sich auf die Ebene der Filmwirkung, die man als eine durch das anschauliche Material des Filmwerks strukturierte »Komplex-
62
Teil I: Theoretische Annäherungen
entwicklung« (Salber 1960, S. 44ff.) fassen kann. Die ersten Szenen beleben einen spezifischen, seelischen Sinnzusammenhang und überführen ihn über Steigerungen, Variationen, Abwandlungen und Wendungen in eine mehr oder weniger fesselnde Entwicklung. Dieser Komplex legt die Filmszenen teils aus, teils wird er von ihnen weiterentwickelt, vertieft oder zugespitzt. Dabei setzen die Filme auf die aktive Gestaltung der Zuschauer. Diese bringen einen Wirkungszusammenhang ein, der selbst filmanaloge Züge aufweist (Salber 1990). Denn das Psychische vermittelt auch im Alltag sein Nacheinander über Montagen, wird durch Umschwünge ebenso bestimmt wie durch Steigerungen und Zuspitzungen. Da es sich stets in Weiterführungen zu entfalten sucht, bilden die Zuschauer im Kino Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen aus, wenn sie der Geschichte folgen. Und weil es auf Schließungen aus ist, können Autor und Regisseur darauf setzen, dass die Zuschauer die Ellipsen in der Filmerzählung zu einem sinnvollen Zusammenhang ergänzen. So gesehen sind die Zuschauer alles andere als passive Rezipienten. Sie sind aktive Mitgestalter bei der jeweiligen Wirkungswelt des Films. Film ereignet sich in dieser Auffassung weder nur auf der Leinwand noch nur in den Wahrnehmungsprozessen der Zuschauer. Film ist eine inhaltlich zentrierte Wirkungseinheit, die sich zwischen einem anschaulichen Material und einem jeweils gegebenen seelischen Wirkungszusammenhang strukturiert. Spielfilme entfalten eine stark bewegende Wirkung, wenn sie ihre Komplexentwicklungen um lebenspraktische Grundverhältnisse strukturieren. Wie kein anderes Unterhaltungsmedium eröffnet der Kinofilm für die rund zwei Stunden eine ungewöhnlich zentrierte Erfahrung über die Wendungen der Wirklichkeit. Manche Geschichten involvieren in das Problem von Macht und Ohnmacht. Andere binden in das Problem von Alles und Etwas ein oder strukturieren das Erleben der Zuschauer über das Spannungsfeld von Vielfalt und Richtung. Wann immer ein Film solche Grundverhältnisse zum organisierenden Zentrum werden lässt, fühlen sich die Kinogänger nicht nur gut unterhalten, sondern auch tief bewegt.
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
63
■ Tagträume der Gesellschaft? In Träumen behandeln die Menschen die Wirklichkeit unter veränderten Bedingungen. Da sie sich im Schlaf aus den Verpflichtungen und Notwendigkeiten des gelebten Alltags herauslösen, ist eine weitaus größere Beweglichkeit möglich. Sie können zum Beispiel mit Anläufen, die sie am Tag nicht zu Ende führten, ganz anders umgehen. In Träumen werden die Probleme und Konflikte des gelebten Alltags in einem phantastischen und konsequenzenfreien Rahmen behandelt und weitergeführt (Salber 1997). Das Kino hat in gewisser Hinsicht eine ähnliche Funktion wie das Träumen. Es eröffnet den Menschen thematisch zentrierte Tagträume, in denen sie mehr oder weniger virulente Hoffnungen und Befürchtungen ausgestalten können (Blothner 2001; Domke 2001). Im Unterschied zum Fernsehen und anderen Unterhaltungsformen ist der Kinofilm darauf angelegt, über zwei Stunden eine ungewöhnlich zentrierte und verdichtete Wirkungsfolge zu realisieren. Die Kinogänger klinken sich in diese dynamischen Wirkungseinheiten ein, lassen sich für die Dauer der Vorstellung von ihnen anverwandeln und manchmal auf Lösungen zuführen, die sie im Alltag selbst nicht erbringen könnten. Sie behandeln ihre Alltagserfahrungen unter phantastischen Bedingungen. Die Filme bieten ein breites Spektrum an Verwandlungsrichtungen an. Wenn das Kinopublikum sie trotz handwerklich guter Umsetzung und hohen Staraufgebots links liegen lässt, kann das heißen, dass es in der angebotenen Erlebniswelt zurzeit keine Perspektive sieht. Wenn sich die Kinogänger umgekehrt auf sie einlassen, kann dies bedeuten, dass der Film ihren realen Hoffnungen und Befürchtungen Ausdruck verleiht. Auf diese Weise unterhalten Kultur und Filmwirtschaft ein Zwiegespräch, in dem noch unartikulierte Entwicklungstendenzen der Gesellschaft belebt und ausgestaltet werden. Hollywoodfilme produzieren daher nicht nur Ideologien, die sich über das Netz der menschlichen Beziehungen legen (Wexman 1993), sondern sind in vielen Fällen auch ein Angebot, eine Erfahrung über Begrenzungen und Möglichkeiten der westlichen Kultur zu machen und mit ihnen in einem von Konsequenzen befreiten Raum zu experimentieren. Paradoxerweise zeigt gerade das ameri-
64
Teil I: Theoretische Annäherungen
kanische Kino, dass breitenwirksame Filme oft mehr sind als reine Zerstreuung. Publikumserfolge wie »Forrest Gump« (Blothner 1999, S. 193ff.), »Truman Show«, »Castaway« oder auch »Fight Club« (Blothner 2003) führen Entwicklungstendenzen, die der zeitgenössische Alltag ausbildet, im Rahmen ihrer Stundenwelten weiter aus und verleihen ihnen eine eindringliche Physiognomie. Filme, die wie zum Beispiel »Titanic« aktuelle Befürchtungen in Halt versprechende Lösungen verwandeln und Hoffnungen ausgestalten, stabilisieren das Gefüge der Kultur, weil sie Kompensationen anbieten. Eine andere Sorte bezeichnen wir als »Spiegelfilme«, weil sie unbemerkte oder verleugnete Zusammenhänge der Alltagskultur karikierend herausstellen und so die Zuschauer tiefer als üblich in das Getriebe des Alltags hineinführen. Zu diesen gehört der im Jahr 2000 viermal mit dem Oscar ausgezeichnete Film von Sam Mendes nach dem Drehbuch von Alan Ball »American Beauty«. Im Folgenden werde ich auf der Grundlage von zwei Gruppeninterviews mit insgesamt 25 Teilnehmern und 11 Einzelinterviews die Komplexentwicklung von »American Beauty« rekonstruieren.
■ Psychisch-sozialer Komplex »American Beauty« beginnt mit der Androhung eines Mordes. Vor laufender Videokamera beklagt sich eine junge Frau über ihren Vater. Wenn sie eine Freundin mit nach Hause bringe, verliere er vor Erregung die Fassung. Das sei peinlich und ekelhaft. Die Stimme eines Mannes fragt sie, ob er ihren Vater für sie umbringen solle. Die junge Frau richtet sich interessiert auf und antwortet: »Ja, würdest du?« Diese Eingangsszene macht es den Zuschauern nicht einfach. Einerseits können sie die Enttäuschung des Mädchens über ihren Vater verstehen, andererseits aber finden sie ihre Reaktion überzogen. Sie richten sich darauf ein, dass ihnen der Film die Geschichte eines Mordes präsentieren wird. Aber schon die nächsten Szenen, in denen Lester Burnham (Kevin Spacey) mit sympathischer Off-Stimme seinen baldigen Tod ankündigt und sein eingeengtes und von Leere bestimmtes Leben
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
65
beschreibt, lösen die Antipathien, die in der ersten Szene gegen ihn aufkamen, schnell wieder auf. Jetzt sind es Lesters Ehefrau und seine Tochter, die fragwürdig erscheinen. Ehefrau Carolyn (Annette Benning) wirkt in ihrem Bemühen, Kleidung, Schuhe und Gartenwerkszeuge Ton in Ton zu halten, in ihren aufgesetzten Smalltalks mit den Nachbarn eigenartig aufgedreht und steif. Tochter Jane (Thora Birch), die von der Natur mit allen weiblichen Reizen versehen wurde, hat die fixe Idee, ihre Brüste vergrößern zu lassen. Und als sich die kleine Familie nach dem Frühstück im Auto auf den Weg in die Stadt macht, wird offensichtlich, dass Lester das schwächste Glied in diesem Gefüge ist. Wenn ihm nun von seinem jüngeren Chef auch noch deutlich gemacht wird, dass sein Arbeitsplatz Rationalisierungen zum Opfer fallen wird, beginnen sich Wünsche zu regen, dass Lester gegen die ihn bestimmenden Zwänge angehen möge. Diese verstärken sich, wenn kurz darauf im Haus Burnham beim gemeinsamen Abendessen spürbar wird, in welchem Ausmaß der Mann von seiner Frau beherrscht und von seiner Tochter verachtet wird. Die Zuschauer wollen, dass er sich aus seiner unwürdigen Lage befreit. In der nächsten Szene wird deutlich, dass Carolyn ihren Mann zwar dominiert, selbst aber von psychischen Zwängen eingeengt ist. In einer beeindruckenden Sequenz stellt sie ihren Putzzwang und ihren brennenden Ehrgeiz, als Maklerin dem sehr viel erfolgreicheren Konkurrenten Buddy Kane nachzueifern, zur Schau. Wenn sie beim Verkauf eines Hauses scheitert und sich anschließend auf demütigende Weise selbst bezichtigt und schlägt, stellen die Zuschauer fest, dass in dieser Geschichte mehr oder weniger alle Protagonisten nicht Herren im eigenen Haus sind. Vor den Augen der Zuschauer entfaltet sich Szene für Szene das Zustandsbild einer Gesellschaft, die in Zwängen festzusitzen scheint, und bildet sich als Hoffnungsträger der anfangs als fragwürdig eingeführte Protagonist Lester Burnham heraus. Man hofft, dass er sich aus diesem das Leben in seiner Vielfalt erstickenden Gefüge befreien wird. Drückende Enge und Hoffnung auf Befreiung haben sich in den ersten dreizehn Minuten als strukturierender Komplex herausgebildet.
66
Teil I: Theoretische Annäherungen
■ Zwänge im zeitgenössischen Alltag Man kann sich die Frage stellen, welche Verbindungen »American Beauty« zum Alltag, wie die Menschen ihn heute erfahren, unterhält. Ist der Film reine Fiktion, oder behandelt er Inhalte, die zur Lebensrealität der Zuschauer in Beziehung stehen? Die westliche Kultur bezieht ihren Zusammenhalt immer weniger durch allgemein verbindliche Lebensbilder. Die christlichen Religionen haben ihre orientierende Bedeutung für den Alltag verloren. Mit den großen politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts verbinden die Menschen keine Orientierung mehr, sondern schmerzhafte Enttäuschungen. Soziale Klassen und Schichten, die dazu geeignet waren, einen festen Platz im gesellschaftlichen Gefüge mit mehr oder weniger expliziten Verhaltensregeln zu weisen, lassen sich nur noch rudimentär ausmachen. Das Resultat ist eine »Ästhetisierung des Alltagslebens« (Schulze 1992, S. 33ff.) und damit einhergehend eine zunehmende Inflation der Lebensbilder, die den Menschen auf der einen Seite ein noch nie erreichtes Maß an individuellen Wahlmöglichkeiten eröffnen, sie aber auf der anderen Seite auch stark verunsichern (Salber 1993, S. 184–193). In ihrem Selbstverständnis hebt die Kultur die Freiheit der individuellen Lebensgestaltung als einen zentralen Wert heraus. Jeder habe die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und könne auf seine Art glücklich werden. Dabei wird allerdings übersehen, dass eine solche Offenheit die Menschen auch belastet. Jeden Moment aus der konkreten Situation heraus zu entscheiden, was »richtig« ist, ist ein denkbares Ideal, lässt sich aber mit der Praxis der Alltagsgestaltung nur in Ausnahmefällen zur Deckung bringen. Da sich die Einzelnen nicht an allgemein verbindlichen Lebensbildern orientieren können, setzen sich hinterrücks Abhängigkeiten, unbewusste Zwänge und Muster durch, die sie schließlich noch stärker steuern als die verlorengegangenen gesellschaftlichen Orientierungen (Salber u. Salber 1999). Wenn wir heute das Problem der hohen Drogen- und Alkoholabhängigkeit, der Konsumzwänge und Medienbezogenheit von Jugendlichen diskutieren, zeigen sich darin einige Phänomene, die ich im Blick habe. »American Beauty« führt in eine Wirklichkeit, in der Sinnleere und Taubheit mit zwanghaftem Masturbieren (Lester) ausgegli-
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
67
chen wird, in der die Menschen von brennendem Ehrgeiz, Putzzwängen und Moderegeln besetzt sind (Carolyn), in der junge Frauen davon beherrscht sind, einem abstrakten Schönheitsideal zu entsprechen (Jane). Mit solchen Übertreibungen legt der Film seinen Finger auf Verkehrungen der zeitgenössischen Alltagskultur. Wir lernen Menschen kennen, deren Wahlfreiheit sich in zwanghafte Verhaltensmuster verwandelt hat, in denen sie festsitzen und sich nach Lebendigkeit sehnen. Die Zuschauer erwarten, dass sich die Figuren befreien, und sind gespannt, wie ihnen das gelingen kann. Sie interessieren sich auch deshalb für eine solche Entwicklung der Geschichte, weil sie unbewusst spüren, dass der Film nicht nur eine Geschichte zeigt, sondern ihnen zugleich einen Spiegel vorhält. Über das Medium gemeinsamer Alltagserfahrungen verknüpfen sie das Schicksal der Filmfiguren mit ihrem eigenen und sind nun gespannt, wie man sich aus den zur zweiten Haut gewordenen Zwängen befreien kann.
■ Obsessionen befreien aus Zwängen Im Erleben der Zuschauer hat sich im Rahmen der Ausbreitung von erstickenden Mustern und Zwängen eine Hoffnung auf Befreiung herausgebildet. Der Film greift sie auf und konzentriert sich im Folgenden auf Lesters Ausbruch aus den erstarrten Koordinaten seines Alltags. Es ist Angela (Mena Suvari), die blonde Schulfreundin seiner Tochter Jane, die ihm während einer Sportveranstaltung den Kopf verdreht und in ihm eine Leidenschaft entfacht, die sein Leben von Grund auf umkrempelt. Der Film hebt den Anstoß zur Entwicklung seines Protagonisten deutlich heraus. Er setzt die Szenen, in denen sich die Anziehung zwischen Lester und Angela etabliert, in Zeitlupe um, wechselt den Stil des Musikscores, eskamotiert und verfremdet den Schauplatz und räumt der tiefroten Rosenart, die dem Film den Titel gab, eine Bild und Atmosphäre bestimmende Rolle ein. Mit diesen Mitteln bringt er die meisten Zuschauer dazu, sich von nun an auf Lesters Befreiung zu konzentrieren. Sie haben das Gefühl, dass sich in dem festgefahrenen Leben des Mannes entscheidend etwas ändert. Die Ankündi-
68
Teil I: Theoretische Annäherungen
gung seines Todes rückt damit in den Hintergrund. Viele Zuschauer greifen die erotische Begeisterung des Mittvierzigers für einen Teenager gern auf, und selbst wenn sie Lesters Begeisterung für das Mädchen nicht ganz ernst nehmen können, stellen sie doch zufrieden fest, dass sich das Leben des Protagonisten nun verändert. Auf einer Party, zu der ihn seine Frau Carolyn überredet hat, trifft Lester den Nachbarsjungen Ricky Fitts (Wes Bentley) und deckt sich bei ihm mit Haschisch ein. Da er gehört hat, dass Angela Männer mit trainierten Muskeln mag, kramt er ein paar alte Hanteln hervor und beginnt in der Garage zu trainieren. Lester bekommt mehr und mehr Züge eines Jugendlichen, der sich aus den Mustern seines Elternhauses herauszulösen sucht und sich dabei die eine oder andere Unflätigkeit leistet. Er trinkt Bier aus der Flasche und gibt seinem Chef und seiner Frau Widerworte. Das mag für sich genommen zweifelhaft erscheinen, im Kontext der Stundenwelt des Films wird dies jedoch als eine Perspektive erlebt, die weiterführt. Damit sind wir bei dem inhaltlichen Kern von »American Beauty« angekommen. Der Film führt in eine Gesellschaft, in der die Menschen von unverfügbaren Zwängen eingekastelt sind. Die Regie von Sam Mendes macht dies wiederholt mit Einstellungen deutlich, in denen die Familien wie Figuren in rechteckigen Puppenstuben gezeigt werden. Auch in solchen formalen Gestaltungen wird spürbar, in welchem Ausmaß sie von ihren psychischen und sozialen Zwängen in Besitz genommen sind. Die satirische Zuspitzung des Films besteht darin, dass er die Zuschauer dazu bringt, in anderen, noch mächtigeren Zwängen eine Perspektive zur Befreiung zu erleben. Denn um sich zu befreien, bilden die Figuren nun Obsessionen aus, deren einbindende Wucht es ihnen ermöglicht, sich aus den zur Fessel gewordenen Zwängen zu befreien. Die Einwohner des Vororts in »American Beauty« behandeln Zwänge mit Obsessionen und verschaffen sich auf diese Weise das Gefühl, dass es im Leben weitergeht. Und tatsächlich erfasst diese inhaltliche Richtung im Fortgang der Geschichte auch die anderen Figuren. Carolyn wird ihre seelischen Zwänge über eine heiße Affäre mit ihrem Konkurrenten Buddy Kane (Peter Gallagher) aufbrechen. Rickys Vater Colonel Fitts (Chris Cooper), der sich als Saubermann und Homosexuellenhasser darstellt, wird in einer regneri-
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
69
schen Nacht von seinen unterdrückten homoerotischen Wünschen mitgerissen werden. Jane und Ricky werden sich über die Obsession des Jungen, die Welt durch das Objektiv der Videokamera zu betrachten, ineinander verlieben und schließlich aus den Ordnungen ihrer Familien ausbrechen. Werden Obsessionen üblicherweise als Abnormitäten eingeschätzt, macht der Film deutlich, dass sie in einer individualisierten und von einem Wertevakuum bedrohten Gesellschaft zu einem Vehikel zur Veränderung geworden sind.
■ Öffnen und Schließen Filme, die eine starke und nachhaltige Wirkung haben, beziehen das Erleben der Zuschauer in einen Rhythmus von Wirkungsqualitäten ein, mit dem sie das Tiefenthema des Films aktuell verspüren, ohne darüber nachdenken zu müssen. Bei »American Beauty« handelt es sich um einen Rhythmus von Öffnen und Schließen, der über die gesamte Länge des Films das Erleben der Zuschauer strukturiert. Schon am Anfang wird spürbar, in welchem Ausmaß die Figuren in psychische und soziale Zwänge eingeschlossen sind. Der sich einstellende Wunsch, dass sie sich daraus befreien mögen, findet vor allem in Lesters Entwicklung Ausdruck. Genauer betrachtet, strukturieren sich aber alle Beziehungen, die von »American Beauty« beschrieben werden, um den Drehpunkt von Öffnen und Schließen. Auf diese Weise ergibt sich eine dichte Textur, die dem Erleben der Zuschauer eine unmittelbar erlebte Struktur verleiht. Für die Dauer des Films verwandelt sich ihr Erleben in ein Werk, in dem alle wesentlichen Wendungen auf Schließungen und Öffnungen hinauslaufen. Ein Beispiel: Zwischen den Nachbarskindern Jane und Ricky entwickelt sich eine Liebesbeziehung. Zunächst wird sie durch Rickys Videoobsession belastet. Seine Annäherung an das Mädchen besteht darin, Jane in allen möglichen Situationen heimlich oder auch offen zu filmen. Jane hält ihn daher zunächst für einen »Freak«, kann vor sich selbst aber auch nicht verheimlichen, dass sie von dieser Art der Beobachtung erregt und angezogen wird.
70
Teil I: Theoretische Annäherungen
Ricky macht Jane verständlich, dass er in seinen Clips die Schönheit des Lebens festzuhalten sucht. Ein beeindruckendes Beispiel ist die lange Aufnahme einer Papiertüte, die sich von den Wirbeln des Herbstwindes tragen lässt. Mit solchen Momenten bildet sich bei den Zuschauern das Gefühl heraus, dass die Jugendlichen einen Bereich besetzen, der den Erwachsenen versperrt ist: Sie sind dazu in der Lage, in einer durch Zwänge und vorgegebene Muster bestimmten Alltagswelt immer wieder Augenblicke entstehen zu lassen, die noch nicht eingekastelt, sondern offen erscheinen. Ein solcher Augenblick ereignet sich im Film in der 69. Minute. a) Einschließen: In ihrem Zimmer macht Carolyn ihrer Tochter Jane deutlich, wie undankbar und anspruchsvoll sie sei. Mit Vehemenz und schließlich, als sie ihre Machtlosigkeit spürt, mit einer schallenden Ohrfeige sucht sie das Mädchen auf ihre Lebensordnung einzuschwören. Hier wird an der physischen Gewalt der Mutter gegenüber ihrer Tochter unmittelbar spürbar, mit wie viel Wucht die Zwänge der Elterngeneration die Suchbewegungen der Jugendlichen einzuschließen suchen. Carolyn verlässt das Zimmer, und die bedrückte Jane geht zum Fenster. Sie wird darauf aufmerksam, dass Ricky im Nachbarhaus seine Kamera auf sie richtet. b) Öffnen: Wie um sich aus dem eben noch verspürten Zugriff zu befreien, greift das Mädchen den Augenblick auf und beginnt, sich vor der laufenden Kamera ihres Freundes zu entkleiden. Die Nähe, die trotz dieser vermittelten Form der Kontaktaufnahme spürbar wird, führt die Zuschauer aus der Enge der vorhergehenden Auseinandersetzung heraus und in einen unerwartet offenen Augenblick hinein. Sie sind gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. c) Wieder Einschließen: Im selben Moment ist ein lautes Geräusch zu hören, das Bild der Videokamera verrutscht, und man wird mit einem strengen und gewalttätigen Übergriff von Rickys Vater konfrontiert. Der glaubt einen Regelverstoß seines Sohnes festgestellt zu haben und sucht ihm nun Disziplin einzubläuen. Der Moment der zarten Annäherung ist damit zerstört. Am Fenster gegenüber sehen die Zuschauer Jane, die sich ihre Brust mit dem Fenstervorhang verdeckt. Einschließen, öffnen und wieder einschließen – der Film übt seine Zuschauer über diese
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
71
und ähnliche Szenen in seinen inhaltlichen Rhythmus ein, lässt sie ihn unmittelbar erleben.
■ Überraschende Öffnung Um die Fesselung der Zuschauer zu intensivieren, führen Filme in der Regel auf einen alles entscheidenden Umschwung zu. »American Beauty« gestaltet auch diese Klimax auf der inhaltlichen Linie von Öffnen und Schließen. Damit erreicht der Film gegen Ende eine ungewöhnlich packende Wucht. Die Zuschauer wissen, dass in Lester Burnhams Leben der letzte Tag begonnen hat. Die Getriebenheit, von der die Atmosphäre des Films bisher bestimmt war, verdichtet sich in allen Subplots. Carolyn hat sich von ihrem Liebhaber Buddy getrennt und fährt nach Hause. Wiederholt sagt sie sich vor, sie werde »niemals wieder Opfer« sein. Auf dem Beifahrersitz liegt eine Pistole. Auch Colonel Fitts muss eine Kränkung hinnehmen. Er wird von seinen verdrängten homophilen Neigungen überrascht und möchte sie mit seinem Nachbarn Lester, den er irrigerweise für schwul hält, ausleben. Nicht ohne Feingefühl weist Lester den verwirrten Mann zurück. Ricky verlässt nach einer weiteren gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem Vater sein Elterhaus und fragt Jane, ob sie mit ihm zusammen nach New York gehe, wo sie gemeinsam vom Drogenhandel leben könnten. Angela, Lesters Objekt des Begehrens, ist ebenfalls im Hause Burnham. Sie ist tief verletzt, weil Ricky ihr sagte, er halte sie für »gewöhnlich«. Die Zuschauer wissen, dass Lester am Ende der Geschichte sein Leben verlieren wird. Sie sind gespannt zu erfahren, wie sich dieses explosive Knäuel von Beziehungen wenden wird. a) Einschließen: Im dunklen Wohnzimmer treffen Lester und Angela aufeinander. Das Mädchen hat Tränen in den Augen, und Lester steht unter dem Eindruck seiner Begegnung mit Colonel Fitts. Schnell sind die beiden dazu bereit, ihre aufgewühlten Gefühle über eine sexuelle Annäherung zu ordnen. Lester kann sich nun endlich seinen lange gehegten Wunsch erfüllen. Ein ganzes Jahr lang hat er darauf hin gelebt. Jetzt
72
Teil I: Theoretische Annäherungen
wird er das Mädchen nehmen. Er macht sich daran, Angela zu entkleiden. b) Öffnen: In diesem außerordentlich dichten Moment hören die Zuschauer Angelas Stimme: »Es ist mein erstes Mal!« Und das Überraschende passiert: Obwohl er sich im Sog der Leidenschaft befindet, wird der Einwurf von Lester registriert. Er lässt von dem Mädchen ab, gibt ihr einen Pullover, damit sie ihre Blöße bedecken kann, und stellt sein Begehren zurück. Einige Momente später befinden sich Lester und Angela in der Küche. Er hat ihr ein Butterbrot gemacht. Das Mädchen wirkt erleichtert, besonders auch deshalb, weil Lester ihr glaubhaft versichert, dass er sich glücklich fühle. Seit vielen Jahren habe er das von sich nicht mehr sagen können. Als sich Angela kurz ins Badezimmer zurückzieht, nimmt Lester ein eingerahmtes Foto in die Hand: Es ist das Bild der jungen und glücklichen Familie Burnham. c) Erneut Einschließen: Der Film bleibt im Rhythmus von Öffnen und Schließen, wenn er im nächsten Augenblick seine Ankündigung aus der ersten Szene wahr macht und zeigt, wie Lester – das Familienfoto vor Augen – hinterrücks erschossen wird. Gerade hat er sich aus der Enge seiner zwanghaften Leidenschaft befreit, da wird er Opfer der obsessiven Rachegefühle von Colonel Fitts. d) Erneut Öffnen: Und erstaunlicherweise wendet sich hierauf die Atmosphäre des Ganzen noch einmal. Mit seinen letzten Atemzügen lässt Lester prägende Szenen seines Lebens an sich vorüberziehen. Es ist ein zerdehnter Moment des Glücks und des Staunens über die Schönheit des Lebens. Mit dieser letzten Öffnung findet die Geschichte von »American Beauty« ihren Abschluss. Der Verzicht auf das Ausleben eines lang andauernden und im Erleben der Zuschauer aufgebauten Begehrens ist die große Überraschung von »American Beauty«. Die getriebene Leidenschaft eines Vierzigjährigen für ein minderjähriges Mädchen verwandelt sich unerwartet in eine differenzierte Begegnung zwischen einem Erwachsenen und einer Jugendlichen. Die Obsession dreht sich in einen offenen, glücklichen Augenblick. Wenn man die Erlebensent-
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
73
wicklung des gesamten Films in einem Symbol fassen möchte, drängt sich an dieser Stelle das Bild einer Rose auf. Die Rose folgt einem ihr innewohnenden Programm. Sie kann nicht anders als dieses zu verwirklichen. Damit veranschaulicht sie die Getriebenheit, die mit jeder Obsession gegeben ist. Irgendwann jedoch kommt es im Wachstum der Rose zu einem qualitativen Umschwung. Das ist der Fall, wenn sie ihre Blüte entfaltet und damit ihre von den Menschen so bewunderte Pracht den Blicken preisgibt. American Beauty ist eine beliebte Rosenart, und wenn man den Titel des Films mit dem Kern seiner Erlebensprozesse in Austausch bringt, erscheint es naheliegend, diese Entwicklung vom Getriebensein in einen Augenblick, in dem die beeindruckende Schönheit des Lebens zur Entfaltung kommt, in dem materialen Symbol der Rose zu fassen.
■ Umgangsformen Von verschiedenen Forschungsrichtungen wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Filmwirkung ein aktiver Prozess der Bedeutungsgeneration ist (z. B. Eco 1985; De Certeau 1988). In unseren Untersuchungen fassen wir die empirischen Erlebensprozesse als Umgangsformen mit einem vom Film belebten Grundverhältnis. Zwar sieht jeder Zuschauer »seinen eigenen Film«, aber im Hinblick auf den seelischen Komplex, der dabei behandelt wird, sind die Erlebensverläufe vergleichbar. Bei »American Beauty« handelt es sich um das Verhältnis von Beweglichkeit und Zwang (Ich und Es / Über-Ich). Die Zuschauer nehmen dazu unterschiedliche Stellungen ein und setzen charakteristische Akzente. Bei unseren Befragungen konnten wir zum Beispiel vier Umgangsformen mit der Klimaxszene des Films unterscheiden. Bei der ersten ist ausschlaggebend, dass die Zuschauer erkannt haben, dass Angela nicht die in sexuellen Dingen erfahrene Frau ist, als die sie sich ausgibt. Der Film gibt hierfür einige Hinweise, zum Beispiel wenn er das Mädchen in seinem mit Fanfotos tapezierten Jugendzimmer zeigt oder wenn er deutlich macht, dass Angela sich Lester gegenüber nur so lange als Verführerin verhält, wie
74
Teil I: Theoretische Annäherungen
dieser sich in seiner Rolle als Mann unsicher ist. Sobald Lester ihrem Blick standhält und sich als Sexualpartner anbietet, weicht Angela zurück. Haben die Zuschauer die Unsicherheit des Mädchens registriert, erleben sie Lesters Annäherung im Wohnzimmer als Übergriff. Damit kehren sie zu der Antipathie zurück, die schon in der allerersten Szene belebt wurde, als Jane vor der Videokamera beschrieb, wie ekelhaft sie ihren Vater manchmal findet. Unter den beschriebenen Vorzeichen verliert Lester für diese Zuschauer in der Klimaxszene an Sympathien, und sie distanzieren sich von ihm. Auch wenn er schließlich von Angela ablässt, hat er sich in ihrer Auffassung doch schuldig gemacht. Die weitere Entwicklung der Geschichte (Lesters Tod und seinen Epilog) verfolgen sie daher mit Skepsis. Zusammengefasst wird Lesters Verhalten in der Klimaxszene von dieser Umgangsform als abstoßender Übergriff erlebt. Die zweite Umgangsform legt die Szene ganz anders aus. Hierbei handelt es sich um meist männliche Zuschauer, die sich von Lesters Emanzipation, seiner wiederbelebten Jugendlichkeit und seinem Begehren haben mitreißen lassen. Sie sehen in seiner Entwicklung einen notwendigen Befreiungsakt und wollen, dass er ihn bis zum Äußersten austrägt. Daher erleben sie Lesters Verzicht auf Angela als Inkonsequenz. Ihnen kommt der Mann feige vor, sie denken, dass er sich vor den Folgen seiner Leidenschaft fürchtet und sie deswegen preisgibt. Diese Zuschauer haben nicht das Gefühl, dass es sich bei Angela um eine schützenswerte Jugendliche handelt, sie erleben die Annäherung zwischen ihr und Lester als eine Begegnung zwischen Erwachsenen, bei der die gemeinsame Befreiung aus gesellschaftlichen Zwängen ein wesentlicher Antrieb ist. Diese Zuschauer sind am Ende von Lester enttäuscht – jedoch nicht, weil er ihre moralischen Gefühle verletzt, sondern weil er ihre Hoffnungen auf Befreiung frustriert. Diese zweite Umgangsform legt Lesters Verhalten als Zurückweichen vor der Herausforderung aus. Die dritte Auslegung, die wir erfragen konnten, wird von meist jungen Zuschauern gebildet, die während des Films Ricky und Jane als Hoffnungsträger erfahren. Für sie erhält die Begegnung zwischen Angela und Lester im Wohnzimmer gar nicht den herausgehobenen Charakter einer Klimaxszene, in der die Fäden der
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
75
Entwicklung in einer letzten, großen Wendung zusammenlaufen. Sie nehmen demgegenüber mit Genugtuung zur Kenntnis, dass den Kindern der Ausbruch aus ihren starren und lebensfeindlichen Elterhäusern gelingt. Dass Ricky in New York seine Drogengeschäfte weiterführen möchte, kann die Sympathien für die beiden jungen Leute nicht schmälern. Sie glauben an seine Fähigkeiten und stellen sich vor, dass er nach einiger Zeit des Suchens mit Jane an seiner Seite seinen Lebensunterhalt als Künstler verdienen wird. Diese Zuschauer erleben das Ende des Films als Ausbruch der Jugendlichen aus der starren Welt der Erwachsenen. Die Begegnung zwischen Lester und Angela im Wohnzimmer hat für sie eine zweitrangige Bedeutung. Die letzte Erlebensform lässt sich meines Erachtens am meisten auf die Wendung der Geschichte ein. Die Zuschauer werden von ihr überrascht, ohne dass sie ihnen aufgesetzt erscheint. Sie haben das Gefühl, dass die Tönung des Films an dieser Stelle eine neue Qualität annimmt. Nachdem er sie auf eine wesentlich durch Zwänge und Obsessionen bestimmte Wirklichkeit eingestimmt hat, finden sie sich mit einem Mal in einem Augenblick wieder, in dem sich Vielfalt und Widersprüchlichkeit des Lebens entfalten. Die zu einem Tunnel verdichtete Leidenschaft gebiert überraschenderweise eine Achtung vor den Gefühlen des anderen. Die Zuschauer sind gerührt, wenn Lester und Angela sich vorsichtig und mit gegenseitigem Respekt fragen, wie es ihnen gehe. Einigen kommen die Tränen, wenn sich Lester bei der Freundin seiner Tochter nach deren Befinden erkundigt. Und wenn der sterbende Held des Films in der abschließenden Montage die Schönheit und die glücklichen Momente seines Lebens beschreibt, bilden diese Zuschauer – trotz seines Todes – das Gefühl einer Versöhnung mit den Konflikten des Lebens und den Schwächen der Menschen aus. Auf diese Weise verlassen sie den Kinosaal nicht in gedrückter Stimmung, sondern eigentümlich entspannt und zufrieden. Diese vierte Umgangsform ist die am meisten verbreitete. Man kann ihr das Attribut paradox verleihen, da sie wider die übliche Meinung aushält, dass sich die Schönheit des Lebens gerade demjenigen erschließt, der bereit ist, sich auf die verrückten und manchmal auch abstoßenden Drehungen der Wirklichkeit einzulassen.
76
Teil I: Theoretische Annäherungen
■ Schlussbemerkung In meiner Sicht sind wirksame Filme mehr als gut erzählte Geschichten. Neben der Interpretation der Geschichte sehe ich die Aufgabe der Psychoanalyse auch darin, die manchmal erstaunlich starke Wirkung von Filmen zu untersuchen. Wenn sie Millionen erfassen, wachsen sie zu kollektiven Tagträumen aus, in denen die Menschen lebensbestimmende Komplexe einer medialen Behandlung überlassen. Die Kunst des Kinos besteht daher für mich auch weniger darin, den Zuschauern etwas zu zeigen, ihnen etwas vorzuführen. Fesselnde Filme entfalten ihre Wirkung dadurch, dass sie unbewusste Wirkungszusammenhänge beleben, die tief in den Alltagsunternehmungen der Menschen und den Entwicklungstendenzen der Kultur verwurzelt sind. Die Kunst des Films besteht für mich in der Belebung und Entwicklung eines Wirkungsraums, der den Zuschauern eine bedeutsame Verwandlung ohne die damit verbundenen Konsequenzen ermöglicht. Kino ist Verwandlung auf einem sicheren Stuhl. Der Wirkungsraum von »American Beauty« wird im Wesentlichen durch drei Qualitäten bestimmt. Da sind erstens zwanghafte Muster, die das Leben ausrichten, aber auch festlegen. Die Zuschauer erfahren sie als fragwürdige Vorurteile, als beklemmende Zwänge und fixe Ideen. Zum zweiten übernehmen in der Geschichte mehr und mehr Obsessionen die Führung. Diese werden teils als abstoßend, teils aber auch als weiterführend und befreiend erlebt. Letzteres besonders deshalb, weil sie dazu geeignet sind, die Figuren aus ihren einengenden Mustern – zumindest kurzfristig – zu befreien. Das Ineinandergreifen von Zwängen und Obsessionen für sich genommen ist jedoch noch nicht dazu geeignet, ein unterhaltsames Filmerlebnis hervorzubringen. »American Beauty« bringt daher eine dritte Wirkungsqualität ins Spiel, die man als schwebende Ästhetisierung bezeichnen kann. Die Plastiktüte, die minutenlang vom Wind herumgewirbelt wird, ist hierfür ein Beispiel. Aber auch jene offenen Momente, in denen man nicht absehen kann, was aus ihnen entstehen wird, gehören dazu. Vor allem aber versetzt der glückliche Augenblick am Ende des Films in eine solch schwebende Verfassung. So erweisen sich im Ganzen Momente der Ästhetisierung als Gegenpol zu der Dichte von Zwän-
D. Blothner · Wirkungsanalyse von »American Beauty«
77
gen und Obsessionen. Sie erlauben den Zuschauern, aus der Getriebenheit der meisten Szenen herauszutreten. Untersuchungen zur Jugendkultur in den vergangenen Jahren haben gezeigt, dass viele junge Menschen den Alltag in einem ähnlichen Spannungsfeld gestalten. Mit einer enormen Vielfalt an Lebensmöglichkeiten konfrontiert, stehen sie in Gefahr, dem Diktat der Mode, der Freizeittrends oder auch persönlichen Zwängen und Ängsten zu erliegen. Gegen diesen Sog bringen sie ihre Fähigkeiten zur Ästhetisierung und Ironisierung ins Spiel, die ihnen eine »immense Erweiterung des Wahrnehmungs-Spielraums« (Grünewald 1999, S. 24) eröffnen. Die viel beschriebene »Coolness« der Jugendlichen kann daher auch als Haltung verstanden werden, mit der sie sich gegen das Diktat der Konsumstile zu Wehr setzen, aber auch gegen ihre eigene Bereitschaft, in vorgegebenen Mustern und unwillkürlichen Zwängen Orientierung zu finden. Indem »American Beauty« seine Zuschauer in das Dreieck von Zwang, Obsession und Ästhetisierung versetzt, erlaubt der Film ihnen, im Rahmen eines Kinobesuchs Grundverhältnisse der zeitgenössischen Alltagskultur zu erleben. Weil Kinofilme darauf angelegt sind, die hohen Kosten, die in ihre Produktion investiert werden, auch wieder einzuspielen, suchen die Produzenten nach Geschichten, in denen sich aktuelle Grundverhältnisse zum Ausdruck bringen lassen. Solche Filmwerke können zu Erlebnissymbolen der Zeit werden, in der sie entstehen. Sie greifen Hoffnungen und Befürchtungen auf, die die Menschen bewegen, und transponieren sie in thematisch zentrierte Stundenwelten. »American Beauty« ist ein Film, der im Rahmen einer Satire ein Kernproblem der zeitgenössischen Alltagskultur zum Thema macht: In einer durch Individualisierung geprägten Gesellschaft sind zwanghaft sich durchsetzende Muster und Leidenschaften Wertungen, über die die Menschen Sinnerfahrungen machen. Sie bedeuten eine spürbare Orientierung und halten in ihrem Zusammenspiel den Lauf des Lebens in Gang. Der Film macht darauf aufmerksam, dass sich in unserer Alltagskultur eine Neubewertung der menschlichen Obsessionen vollzieht.
78
Teil I: Theoretische Annäherungen
■ Literatur Ahren, Y. (1998): Warum sehen wir Filme? Materialien zur Filmwirkungspsychologie. Aachen. Blothner, D. (1999): Erlebniswelt Kino – Über die unbewusste Wirkung des Films. Bergisch-Gladbach. Blothner, D. (2001): »Figuren im Traum eines Gottes …« – Wie das Kino die Sehnsucht der Kultur nach Veränderung behandelt. Zwischenschritte 19: 38–45. Blothner, D. (2003): Das geheime Drehbuch des Lebens. Kino als Spiegel der menschlichen Seele. Bergisch-Gladbach. De Certeau, M. (1988): Die Kunst des Handelns. Berlin. Domke, W. (2001): Der Tag als Albtraum. »Und täglich grüßt das Murmeltier«. Zwischenschritte 19: 94–99. Eco, U. (1985): Über Gott und die Welt. München. Freud, S. (1914): Der Moses des Michelangelo. G. W. Bd. X. Frankfurt a. M., S. 142–201. Grünewald, S. (1999): Schmerzlos im Paralleluniversum. Zwischenschritte 17: 23–29. Salber, W. (1960): Zur Psychologie des Filmerlebens. In: Salber, W. (1977): Wirkungsanalyse des Films. Köln, S. 39–94. Salber, W. (1977): Wirkungsanalyse des Films. Köln. Salber, W. (1990): Die Seele des Films. Eine filmpsychologische Analyse. In: Möhrmann, R. (Hg.): Theaterwissenschaft heute. Berlin, S. 297–316. Salber, W. (1993): Seelenrevolution. Komische Geschichte des Seelischen und der Psychologie. Bonn. Salber, W. (1997): Traum und Tag. Bonn. Salber, W.; Salber, D. (1999): Anarchie und Diktat – Perspektiven für 2020. Zwischenschritte 17: 73–77. Schulze, G. (1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a. M. Wexman, V. W. (1993): Creating the Couple: Love, Marriage, and Hollywood Performance. Princeton.
■ Teil II: Subjekt und Geschichte – Zur Beziehung von Innen- und Außenwelt
Überleitung 2
Die Beiträge im ersten Teil dieses Bandes zu theoretischen Aspekten der Film-Psychoanalyse wollten vor allem einen Überblick über die Gesamtthematik geben (Annegret Mahler-Bungers und Ralf Zwiebel) und sich dann mit dem Bereich der Vorstellung beschäftigen, also dem unmittelbaren und unbewussten Filmerleben (Mechthild Zeul) und den eher vorbewussten Aspekten der Wirkungsanalyse des Films (Dirk Blothner). Bereits diese Beiträge haben neben der Komplexität der Thematik deutlich gemacht, dass eine gemeinsame Sprache der Film-Psychoanalyse bislang nur sehr begrenzt entwickelt worden ist. Im zweiten Teil folgen nun Filmanalysen von sehr verschiedenen Filmen: »Der Spiegel« von Andrej Tarkowskji, »The Tango Lesson« von Sally Potter, »Music Box« von Constantin Costa-Gavras und »Spellbound« von Alfred Hitchcock. Es wird dabei deutlich, dass es hier eine sichtliche Verschiebung in der beschriebenen Trias von Einstellung – Darstellung – Vorstellung gibt. Wir haben diese Aufsätze mit der Überschrift Subjekt und Geschichte – Zur Beziehung von Innen- und Außenwelt versehen, weil alle implizit oder explizit um diese für die Film-Psychoanalyse zentrale Dynamik kreisen. Der Beitrag von Timo Hoyer über Tarkowskijs »Der Spiegel« beginnt mit dem ersten Aspekt der Trias, nämlich der Einstellung, in dem der Autor sich mit Tarkowskijs künstlerischem Verständnis des Films allgemein beschäftigt und den speziellen Film eingebettet sieht in die Biographie und die Filmographie des Autors. Auch wenn Timo Hoyer, selbst Erziehungswissenschaftler und Philosoph, das wunderbare Zitat von Tarkowskij erwähnt, dass nämlich der Film die einzigartige Möglichkeit biete »das, was sich auf der
82
Teil II: Subjekt und Geschichte
Leinwand ereignet, als eigenes Leben zu empfinden, eine zeitlich fixierte Erfahrung als eine eigene, zutiefst persönliche Erfahrung zu übernehmen, das eigene Leben zu dem auf der Leinwand Gezeigten in Beziehung zu setzen«, aber selbst als Subjekt nur indirekt zur Sprache kommt, erschließt sich doch dem Leser durch die Beschreibungen des Lebens von Tarkowskij und seiner Arbeitsweise (eben der Einstellung und der Darstellung) dieser besondere Film als ein künstlerisches Werk nicht nur über Erinnerungen, sondern selbst als heilsame Erinnerung, in dem vor allem das Traumerleben des Autors eine zentrale Stellung einnimmt. Der Film wird als ein radikaler Versuch verstanden, die subjektive Innenperspektive, gleichsam die Subjektkonstitution des Filmerzählers, in Form von Erinnerungen, Träumen, Phantasien zu rekonstruieren. Man könnte auch sagen, dass wir in diesem Film die psychische Arbeit des Künstlers verfolgen, die darin besteht, die Erfahrungen seiner Geschichte, die auch eine Realität und ein Außen darstellt, in seinem Inneren, in seiner Subjektivität zu gestalten, die zu seiner subjektiven Identität werden und geworden sind. Dies gehört zu einer der zentralen Grundannahmen der Psychoanalyse, nämlich die Verwobenheit von äußerer Realität und innerer Verarbeitung und Gestaltung. Als Soziologin und Sozialforscherin geht Christel Eckart in ihrer Arbeit über Potters Film »The Tango Lesson« von einem Vergleich zwischen Sozialforschung und Filmemachen aus, die sie beide als einen Reduktionsprozess begreift, der aber in einer Erweiterung von Wahrnehmungs- und Ausdrucksformen münden kann. Die Liebe zur Wahrnehmung als Ausdruck einer ästhetischen Philosophie, in der das Sichtbarmachen und Sichtbarwerden – anstelle des Verbalisierens – durch Gefühle, Bemerken, Vermissen, Erinnern und Erkennen betont wird, wirkt dabei leitend für ihren Versuch, den Film als ein künstlerisches Werk über das Filmemachen und über den Tanz als Symbol des Kampfes um Anerkennung in der Geschlechterspannung zu beschreiben. Stehen bei Timo Hoyer mehr die Erinnerungen und Träume im Zentrum seiner Überlegungen, so sind dies bei Christel Eckart das Sichtbarmachen, Schauen und Angeschaut-Werden, die für die Geschlechter-Spannung des Paars in dem paradoxen Ringen um Autonomie und Anerkennung wesentlich erscheinen. Die Beziehung von In-
Überleitung 2
83
nen und Außen wird hier weniger aus der Perspektive der individuellen Geschichte als aus dem zentralen Begriff der Intersubjektivität entwickelt, der vor allem auch darin besteht, dass das autonome Selbstgefühl der Anerkennung durch den signifikanten Anderen bedarf. Bereits der Vergleich dieser beiden Arbeiten erlaubt eine These, die wir im weiteren Verlauf dieses Bandes noch einmal aufgreifen wollen: Der Opus-Phantasie des Künstlers (Filmemachers), die latent im Werk enthalten ist, indem ein impliziter Filmerzähler einem impliziten Zuschauer unbewusste Mitteilungen über die filmästhetische Formensprache kommuniziert, generiert im jeweiligen Zuschauer oder dem Film-Psychoanalytiker eine zentrale Deutungsphantasie (hervorgehend aus seiner Vorstellung), das vorläufige Ergebnis eines intersubjektiven künstlerischen Sinngebungsprozesses. Sie verkehrt den triadischen Prozess vom Regisseur über den Film zum Zuschauer in die umgekehrte Richtung, indem sie den Film aus der subjektiven Perspektive des Rezipienten als Deutungswerk (opus) konstituiert (vgl. die Ausführungen zu Darstellung und Vorstellung von Mahler-Bungers und Zwiebel, in diesem Band, S. 14–37). Diese zentrale Deutungsphantasie ist unvermeidlich hochgradig individuell, da sie ja den Zuschauer als Subjekt mit seiner Geschichte, seiner Person und seinem Denken und Fühlen voraussetzt. Je stärker sie jedoch die Opusphantasie des Regisseurs zu spiegeln vermag, auf sie bezogen ist oder sie gleichsam »resoniert«, umso größer erscheint die Möglichkeit, dass die Wahrnehmung des bislang Unbekannten im Sinne der unbewussten Botschaft des Films sich der Opusphantasie des Autors zumindest annähert. Uns scheint, dass dies in den beiden Filmanalysen von Hoyer und Eckart sehr gut gelungen ist. Der Beitrag über »Spellbound« versucht in einer Einleitung den methodischen Ansatzpunkt des Autors zu umreißen; er postuliert eine Nähe des Filmemachens zu dem Verstehen von Filmen und der Psychoanalyse über einen Prozess des intertextuellen Denkens, der am Beispiel von Hitchcocks »Spellbound« konkretisiert wird. Es werden für die Filmpsychoanalyse drei relevante Kontexte betont, die sich auf die psychoanalytische Theorie, die analytische Situation und den selbstreflexiven Prozess beziehen. Danach werden diese Fragen nach Auffassung des Autors implizit in diesem Film angerissen und erlauben jeweils spezifische Deutungsmuster, die
84
Teil II: Subjekt und Geschichte
trotz des »Alters« des Films heute noch sehr aktuell sind. Inwieweit es gelungen ist, eine Resonanz zwischen der Opusphantasie von Hitchcock und der zentralen Deutungsphantasie des Betrachters herzustellen, mag der Leser selbst entscheiden.
■ Timo Hoyer
Filmarbeit – Traumarbeit Andrej Tarkowskij und sein Film »Der Spiegel« (»Serkalo«)
für Alexandra »Der Film ist eine wunderbare und gefährliche Waffe, wenn er von einem freien Geist gehandhabt wird. Er ist das beste Instrument, um die Welt der Träume, der Emotionen, des Instinkts auszudrücken. Der schöpferische Mechanismus der filmischen Bilder ist allein durch seine Art, wie er funktioniert, unter allen menschlichen Ausdrucksmitteln dasjenige, das der Funktionsweise des menschlichen Geistes am meisten ähnelt, mehr noch, es ist dasjenige, das die Arbeit des Geistes im Traum am besten imitiert« (Luis Buñuel 1991, S. 144).
■ Vorbemerkung Andrej Tarkowskijs Film »Der Spiegel« ist der in seiner Art einzigartige Versuch eines Regisseurs, sich die eigene Vergangenheit mit den ihm zu Gebote stehenden künstlerischen Mitteln zu vergegenwärtigen. Klaus Kreimeier hat über diesen Film gesagt, Tarkowskij gerate darin »über seine Biographie ins Träumen wie Narziß über sein Ebenbild im Wasser. Die Welt versinkt im Ich« (Kreimeier 1987, S. 134). Kein Regisseur hatte es zuvor gewagt, den Film als Medium und das Kino als Ort einer derart radikalen Selbstbespiegelung zu nutzen. »In diesem Film hatte ich mich zum ersten Mal dazu entschlossen, unmittelbar und vorbehaltlos von dem zu sprechen, was für mich das Wichtigste und Wertvollste, das Intimste ist« (Tarkowskij 1985, S. 154). Über weite Strecken besteht »Der Spiegel« aus Erinnerungen.
86
Teil II: Subjekt und Geschichte
Aber anders als beispielsweise Federico Fellinis »Amarcord« (1973) schildert »Serkalo« keine Erinnerungen, »er zeigt das Erinnern« (Jünger 1995, S. 137), er ist Erinnerung, und zwar eine für den Regisseur ausgesprochen heilsame. Nach Fertigstellung des Films war Tarkowskij nach eigener Auskunft von seinen »quälenden Erinnerungen« befreit: »Die mich viele Jahre lang verfolgenden, mir keine Ruhe gebenden Bilder meiner Kindheit verflüchtigten sich plötzlich. Ich hörte auf, in meinen Träumen das Haus zu sehen, in dem wir vor so langer Zeit gelebt hatten und von dem ich viele Jahre hindurch regelmäßig geträumt hatte« (Tarkowskij 1985, S. 148). Im Film werden die Bilder der Kindheit, die »quälenden Erinnerungen« und die entsprechenden Träume manifest. Um das mit einem Beispiel zu illustrieren, sei an den Anfang des Films erinnert. »Der Spiegel« setzt (nach einem Prolog und dem Vorspann) in der epischen Vergangenheit ein. Wir sehen eine Frau, die Mutter des Ich-Erzählers, rauchend auf einem Zaun sitzen. Die Kamera nähert sich ihr von hinten, vorsichtig wie auf Zehenspitzen. Ein Fremder kommt aus der Ferne auf sie zu, ein eigenartiges Gespräch beginnt. In einer wunderbaren Einstellung umkreist die Kamera die Mutter, liebevoll und doch distanziert, als wollte sie ihr Objekt mit Blicken umgarnen. Wir erfahren, dass der Ehemann der Mutter, der Vater des Ich-Erzählers, die Familie vor kurzem überraschend verlassen hat. Im weiteren Verlauf der Sequenz verändert sich die Perspektive. Aus der Betrachtung der Mutter wird im fließenden Übergang ein Traum des Ich-Erzählers. In ihm ist der Schmerz über den Verlust des Vaters mit Händen zu greifen. Eine Erklärung, warum der Vater die Familie verlassen hat, gibt der Film nicht, wie er sich überhaupt mit Erklärungen auffällig zurückhält. Tarkowskij ist nicht an psychologischen Deutungen interessiert. Er macht sich nicht auf die Suche nach den verborgenen Handlungsmotiven der Personen, er macht sich auf die Suche nach der vergangenen Zeit, anders gesagt, er macht sich ein Bild von der Vergangenheit, ein möglichst präzises, erinnerungs- und wirklichkeitsgetreues. Wenn hier vom Erinnerungscharakter des »Spiegels« gesprochen wird, dann bedeutet das nicht, Tarkowskij hätte ausschließlich eigene Erlebnisse im Film verarbeitet. Viele Passagen des Films, die in der epischen Vergangenheit spielen, kann der Ich-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
87
Erzähler nicht persönlich miterlebt haben. Zum Beispiel die Vorgänge, die in der imponierenden Druckerei-Sequenz geschildert werden. Die Erzählung fügt sich assoziativ in den Filmverlauf ein. In der Sequenz zuvor telefoniert der Ich-Erzähler (in der epischen Gegenwart) mit seiner Mutter Maria. Diese erwähnt, dass ihre ehemalige Kollegin aus der Druckerei, Lisaweta, gestorben sei. Kurz darauf befinden wir uns in der Vergangenheit, in der Druckerei. Die junge Maria ist in panischer Aufregung, weil sie befürchtet, einen Druckfehler übersehen zu haben.1 Nachdem sich der Verdacht als gegenstandslos erwiesen hat, sehen wir Maria mit besagter Lisaweta. Sie macht Maria aus heiterem Himmel schwere persönliche Vorwürfe. Maria verlässt daraufhin den Raum, verletzt und verärgert. Die Stimmungslage der Figuren ändert sich erneut. Die Szene bekommt einen Schlag ins Absurde. Die verständnislose Lisaweta folgt ihrer gekränkten Kollegin im Dauerlauf. Diese möchte duschen, aber die Dusche versagt plötzlich ihre Dienste, was Maria in einer eigenwilligen Mischung aus Belustigung und Verzweiflung quittiert. Draußen sehen wir Lisaweta, wie sie mit kauzigen Bewegungen fortgeht, die Eingangszeilen aus Dantes »Göttlicher Komödie« rezitierend. Sieht so eine authentische Szene aus? Die in Schwarz-Weiß gedrehte Sequenz wirkt realistisch und irreal zugleich, mal wie eine Verkürzung, mal wie eine Verdichtung von Vergangenem. Sie macht deutlich: Hier (re-)konstruiert sich einer die verflossene Zeit, und er verarbeitet dabei Erlebtes, Gesehenes, Gehörtes, Geträumtes. Dass Tarkowskijs »radikale Ausstellung seines Selbst« (Schlegel 1993, S. 322) keine privatistische Selbstbespiegelung geworden ist, danken wir seinem künstlerischen Verstand, seinem hoch reflektierten Umgang mit den Mitteln des Films und seinem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein als Filmschaffender. Er hat sein künstlerisches Ethos ausdrücklich in Absetzung von der als »despotisch« und indoktrinierend empfundenen Filmintention Sergej Eisensteins formuliert: 1 In der dem »Spiegel« zugrunde liegenden Novelle Tarkowkijs (1993, S. 7– 89) »Heller, heller Tag« wird deutlicher, dass es sich um den Druck einer Stalin-Gesamtausgabe handelt. Wer für Druckfehler in Texten Stalins verantwortlich war, musste mit einer Gefängnisstrafe rechnen.
88
Teil II: Subjekt und Geschichte
»Meine Art, dem Zuschauer Erfahrungen zu vermitteln, unterscheidet sich grundsätzlich von der Eisensteins. Sicher muß man der Gerechtigkeit halber hinzufügen, daß dieser Regisseur nicht einmal den Versuch gemacht hat, irgend jemandem eigene Erfahrungen weiterzugeben. Er wollte statt dessen Gedanken und Ideen in Reinform vermitteln. Dahinter steckt ein Filmverständnis, das mir absolut konträr ist. Und Eisensteins Montage-Diktat scheint mir überhaupt die generelle Grundlage filmspezifischer Wirkung zu beeinträchtigen … Es nimmt seinem Zuschauer das größte Privileg, das ihm das Kino aufgrund der ihm eigenen Rezeptionsweise im Unterschied zu Literatur und Philosophie bieten kann – die Möglichkeit nämlich, das, was sich auf der Leinwand ereignet, als eigenes Leben zu empfinden, eine zeitlich fixierte Erfahrung als eine eigene, zutiefst persönliche Erfahrung zu übernehmen, das eigene Leben zu dem auf der Leinwand Gezeigten in Beziehung zu setzen« (Tarkowskij 1985, S. 210f.).
Indem Tarkowskij seine persönlichen Erfahrungen und Erinnerungsspuren ins Medium Film übersetzt, lotet er nicht nur sich, sondern zugleich die Möglichkeiten dieses Mediums aus. Die künstlerische Herausforderung bestand im »Spiegel« darin, eine Form zu finden, in der subjektive Wahrhaftigkeit und objektive Wahrheit gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. »Im ›Spiegel‹ versuchte ich das Gefühl zu vermitteln, daß Bach, Pergolesi, der Puschkin-Brief, die den Sivasch überquerenden Soldaten in einem bestimmten Sinn auch für alle anderen Menschen den gleichen Wert besitzt« (Tarkowskij 1985, S. 219). Das vollständig Individuelle wird zum exemplarischen Fall. »Im ›Spiegel‹ wollte ich nicht von mir selbst erzählen, sondern vielmehr von den Gefühlen, die ich mir nahestehenden Menschen gegenüber empfinde, von meinen Beziehungen zu ihnen, meinem ewigen Mitgefühl für sie, aber auch von meinem Versagen und meinem Gefühl unaufhebbarer Schuld ihnen gegenüber. Die Ereignisse, an die sich der Held bis ins letzte Detail während seiner schwersten Krise erinnert, lassen ihn leiden, rufen in ihm Sehnsucht und Unrast hervor« (Tarkowskij 1985, S. 155f.). In »Serkalo« erzählt der Autor jedoch beileibe nicht nur von seinen Gefühlen. Der Film ist auf mehreren Ebenen ausgesprochen wirklichkeitshaltig. In keinem anderen Werk Tarkowskijs werden so zahlreiche Bezüge zur Zeitgeschichte hergestellt wie in diesem, seinem vermeintlich privatesten. Die Verweise auf historische Wirklichkeit sind prismatisch gebrochen durch die Linse des Ich-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
89
Erzählers. Aber in den detailgenau geschilderten Kindheitserlebnissen, in den eingefügten Dokumentaraufnahmen oder in der Szene mit den in Moskau untergekommenen spanischen Emigranten ist für viele Zeitgenossen Tarkowskijs ein Stück vom kollektiven Gedächtnis ihrer Generation eingefangen: »Darum könnte der Film«, wie Maja Josifowna Turkowskaja bemerkt hat, »auch ›Wir erinnern uns‹ heißen« (Turkowskaja u. Allardt-Nostitz 1981, S. 63). Das ändert indes nichts an der Tatsache, dass wir es beim »Spiegel« mit einem ausgesprochen »biographischen Film« (Tarkowskij 1985, S. 184) zu tun haben. Für dessen Verständnis ist also eine gewisse Vertrautheit mit der Person des Regisseurs unabdingbar. Deshalb werde ich meine Ausführungen mit einer biographischen Skizze beginnen. Tarkowskij hatte, das vorweg, das Gegenteil eines leichten Lebens. Seine Tagebücher tragen nicht zufällig den Titel »Matyrolog«: Lebens- als Leidensgeschichte. Diese Selbsteinschätzung Tarkowskijs ist gewiss zum Teil seinem zur Schwermut neigenden Naturell geschuldet. Nicht nur in seinen privaten Aufzeichnungen, auch und gerade in seiner Bilderwelt, »grübelt das melancholische Temperament«, um es mit Hartmut Böhme (1985, S. 149) zu sagen. Die äußeren Umstände seines Lebens gaben diesem Temperament aber auch reichlich Gelegenheit, sich zu entfalten. Zugesetzt hat ihm insbesondere die anhaltende Behinderung seiner Arbeit seitens der sowjetischen Filmbürokratie; darauf werde ich eingehen. Tarkowskij gehörte zu jenen Filmemachern, die eine unverwechselbare, vollkommen eigenständige Filmsprache entwickelt haben. Mit jedem neuen Film setzte er die Arbeit an dieser Sprache und mit dieser Sprache fort. Deshalb gehört sein früher Tod zweifellos zu den größten Verlusten, die das an innovativen Kräften arme Gegenwartskino hinzunehmen hatte. Das Formale stand bei ihm gleichwohl von Anfang an im Dienst des Inhaltlichen. Auch thematisch bestehen zwischen den aufeinander folgenden Filmen starke Korrespondenzen. Ich werde meine biographische Skizze aus diesem Grund mit wenigen Hinweisen auf sein schmales Gesamtwerk verbinden und »Serkalo« darin lokalisieren. Im Anschluss daran möchte ich auf den Film selbst näher eingehen. Dessen Entstehungsgeschichte ist aufschlussreich. Bereits
90
Teil II: Subjekt und Geschichte
1967 hatte Tarkowskij den Filmbehörden das Projekt unter dem prätentiösen Titel »Die Beichte« angeboten. Damals beabsichtigte Tarkowskij, mit geheimer Kamera ein Interview mit seiner Mutter aufzuzeichnen. 117 Fragen hatte er sich zu diesem Zweck ausgedacht: eine bunte Mischung aus Banalem (»Lieben Sie den Boxsport?«, »Was ist Ihr Lieblingsbaum?«), Intimem (»Haben Sie ihren Kindern einmal von Ihrer Liebe erzählt?«, »Erzählen Sie einen Traum, der Sie besonders tief beeindruckt hat!«) und philosophisch Anspruchsvollem (»Worin besteht der Sinn des Lebens?«) (vgl. Tarkowskij 1993, S. 12ff.). Die Intervieweinheiten sollten umrahmt werden von dokumentarischen und fiktiven Szenen, einerseits um das Gehörte zu vertiefen, andererseits um es perspektivisch zu kontrastieren: »So bedeutet zum Beispiel alles, was sie [die Mutter, der Verf.] über meine Kindheit erzählt, für sie etwas anderes als für mich. Sie kann von dem erzählen, was ihr vertraut ist, ich aber werde das drehen, was in meiner Erinnerung geblieben ist … Das wird nicht nur jene Ereignisse betreffen, die ich gut kenne und die sich vor meinen Augen abgespielt haben« (Tarkowskij 1993, S. 272). Das hat Tarkowskij 1967 dem Drehbuchkollegium erklärt, und im Prinzip hat er daran Jahre später bei den Dreharbeiten zum »Spiegel« festgehalten. Von der Idee mit den Interviews freilich hat er sich kurz nach Drehbeginn verabschiedet – auch, aber vermutlich nicht nur, weil die sowjetischen Filmverantwortlichen Einspruch erhoben haben (vgl. Tarkowskij 1993, S. 105ff.). So ist ein Film entstanden, dem immer wieder nachgesagt wurde, in ihm herrsche eine »Atmosphäre des Traums« (Kreimeier 1987, S. 127). Dieses Stichwort möchte ich aufgreifen. Ich werde zu beschreiben versuchen, worin der Traumcharakter von »Serkalo« besteht, und die expliziten Traumdarstellungen des Films beleuchten.
■ Filmarbeit – Leben und Werk Andrej Tarkowskijs Tarkowskij wurde am 4. April 1932 geboren. Sein Geburtsort Sawraschje liegt rund 300 km von Moskau entfernt im Nordosten. Im Sommer verbringt er gemeinsam mit seinen Eltern und seiner
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
91
Schwester die meiste Zeit auf der Datscha. »Der Spiegel« gibt uns ein getreues Abbild von der Landschaft seiner Kindheit. Aber nicht nur die Landschaft, auch die leiblichen Eltern Tarkowskijs sind im »Spiegel« präsent. In der Eingangs- und Schlusssequenz erblickt sich Maria als alte Frau, sie wird von der authentischen Mutter Tarkowskijs gespielt, Maria Iwanowna. Tarkowskijs Mutter hatte denselben Beruf wie die Maria im Film: Sie war Korrektorin in einer Druckerei. Der reale Vater des Regisseurs kommt im Film ebenfalls vor. Er rezitiert seine eigenen Gedichte. Arsenij Tarkowskij ist ein hierzulande weniger bekannter, in Russland aber hoch geschätzter Lyriker. In den Kindheitserinnerungen von Marina Tarkowskaja (2003, S. 35), der Schwester der Regisseurs, wird die Beziehung der Eltern als sehr angespannt beschrieben: »Die Gereiztheit auf beiden Seiten vergällte meinen Eltern das Leben. Vater wartete nur auf Gelegenheiten, dem Zuhause zu entfliehen. Hier war es eng, warteten Kinder, eine erschöpfte Ehefrau und Sorgen.« Auf eine Schilderung dieses Eheszenarios hat Tarkowskij in »Serkalo« bemerkenswerterweise verzichtet. Dafür reflektiert er Ehekonflikte in zwei Gesprächsszenen, die in der epischen Gegenwart spielen. Die beiden Sequenzen sind aus der Sicht von Alexej, dem Ich-Erzähler, gedreht. Wir sehen Natalja, dessen Ehefrau, während Alexej lediglich zu hören ist. Das Ehepaar lebt getrennt. Was sie noch verbindet, ist eine geteilte Vergangenheit und der gemeinsame Sohn Ignat. Von einer positiven emotionalen Verbindung ist in ihren Gesprächen nichts mehr zu spüren. »In der mißlungenen Beziehung spiegelt sich die eine Generation in der anderen – wohl auch, weil die Wünsche sich wiederholen und nicht zur Selbsterkenntnis erwachen, somit gleichermaßen ohne Erfüllung wie unerlöst bleiben müssen. ›Das einzige, was deine Mutter braucht, ist, daß du wieder zum Kind wirst, das sie auf Händen tragen kann‹, sagt Natalja zu Alexej. Der ganze Film freilich kreist um das Problem, daß Alexej keinen anderen Wunsch hegt als eben diesen und ihm – psychoanalytisch gedeutet – aus einem ›Konservatismus der Triebe‹ heraus auf seine Frau projiziert, die ihn zu erfüllen weder willens noch in der Lage ist« (Kreimeier 1987, S. 133). Der authentische Vater Tarkowskijs hat seine Familie 1937 ver-
92
Teil II: Subjekt und Geschichte
lassen (der Vater im Film verlässt seine Familie zwei Jahre früher). Arsenij Tarkowskijs fünfjähriger Sohn wuchs von nun an mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester Marina in einem Frauenhaushalt auf. Auch darauf wird im Film kurz angespielt. Alexej führt in der ersten Gesprächsszene mit Natalja die Mängel seines Charakters auf den Sachverhalt zurück, dass er ausschließlich von Frauen erzogen wurde. Tarkowskijs Familie musste mehrmals umziehen, davon ist im Film wenig zu sehen. Auch die nachfolgenden Jahre der Kindheit und Jugend werden im »Spiegel« nahezu ausgelassen. Eine Sequenz zeigt die vormilitärische Ausbildung. Der Protagonist ist hier jedoch nicht der junge Alexej, sondern ein widerspenstiger Bursche, der in Konflikt mit dem Ausbilder gerät. 1951 beginnt Tarkowskij ein Studium an der Moskauer Hochschule für Orientalistik, bricht es aber ab. Von 1954 an studiert er unter anderem bei Michail Romm an der Filmhochschule in Moskau. Sein halblanger Abschlussfilm trägt den Titel »Die Straßenwalze und die Geige« (»Katok I Skripka«). Schaut man sich diesen 1961 entstandenen Film heute an, so fallen einem eine ganze Reihe von inhaltlichen und formalen Eigenarten auf, die für das reife Werk Tarkowskijs charakteristisch sind. Bereits hier arbeitet er mit Bildmotiven (Regen, Spiegel, verschüttete Gegenstände usw.), die einen semantischen Eigenwert gewinnen und die Narration durchbrechen. Eine enorme Weiterentwicklung dieser Filmsprache dokumentiert »Iwans Kindheit« (»Iwanowo Detstwo«). Das Werk wird 1962 auf dem Filmfestival in Venedig aufgeführt und erhält den Hauptpreis. Weitere Preise folgen auf anderen Festivals. Der internationale Ruhm steht jedoch in krassem Gegensatz zu den Bedenken, die die Ideologieträger im eigenen Land zu hegen beginnen. In der vom Staatlichen Filminstitut der UdSSR herausgegebenen Enzyklopädie »Der sowjetische Film« mischen sich in die Bewunderung für die offensichtliche Originalität des Regisseurs bereits skeptische Untertöne: »Die filmische Form ist ungewöhnlich. Bilder des realen Lebens wechseln mit Traumvisionen und Erinnerungen an die Vergangenheit. Die assoziative Montage, die frappierenden Blickwinkel der Kamera, die ausdrucksstarken Details und die Lichteffekte dienen primär dazu, das Innere des Helden zu offen-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
93
baren. Manchmal allerdings tritt die komplizierte Bildsprache in den Vordergrund und erschwert dann den Zugang zur Grundidee des Films« (»Der sowjetische Film«, 1974, S. 125f.). Die Beschreibung könnte auch auf »Serkalo« gemünzt sein. Dabei ist »Iwans Kindheit« ein ungleich geradliniger erzählter Film. Er besitzt eine durchgehende, in der epischen Gegenwart erzählte Geschichte. Der zwölfjährige Iwan ist als Kundschafter im Krieg tätig und wird schließlich von der Gestapo hingerichtet. Neben dieser primären Erzählebene gibt es Dokumentaraufnahmen, die Künftiges vorwegnehmen (den Sieg der Roten Armee, die Leichen der Goebbels-Kinder etc.), und wir sehen Träume, Angst- oder Wunschvorstellungen, die die erste Erzählebene durchbrechen, »ohne sie freilich zum Einsturz zu bringen; sie verweben sich zu einer zweiten, emotionalen Struktur des Films, die seinen erzählbaren Kern aufsprengt, ohne ihn zu zerstören« (Kreimeier 1987, S. 88). Auf diesen »erzählbaren Kern« wird Tarkowskij im »Spiegel« verzichten. In »Der sowjetische Film« erheben die Autoren gegen »Iwans Kindheit« den Vorwurf des Formalismus. Diesen Vorwurf wird Tarkowskij noch ein ums andere Mal zu hören bekommen. Und aus dem leichten Stirnrunzeln der Filmideologen darüber, dass der Regisseur vorrangig am »Inneren des Helden« interessiert sei, wird mit den Jahren ein immer entschiedeneres Kopfschütteln. »Iwans Kindheit« ist der einzige Film Tarkowskijs, der in dem 1970 abgeschlossenen Buch zur sowjetischen Filmgeschichte erwähnt wird. Seinen zweiten, 1966 fertig gestellten Spielfilm »Andrej Rubljow« hat die sowjetische Filmzensur viele Jahre unter Verschluss gehalten. Tarkowskij weigerte sich, sämtliche Schnittauflagen zu befolgen. Als der Film 1969 endlich in Cannes dem internationalen Publikum vorgeführt wird – unter Protest der sowjetischen Kulturbehörde –, ist die Fachwelt begeistert. Aber erst vier Jahre später – zehn Jahre nach Drehbeginn – wird der Film zur internationalen Aufführung freigegeben. »Andrej Rubljow« schildert in einem Prolog, acht chronologischen Episoden und einem Epilog das Künstlerschicksal des mittelalterlichen Ikonenmalers (vgl. Tarkowskij 1969; 1991b). Der Erzählkern der Geschichte bleibt in diesem Film unangetastet. 1970 trennt sich Tarkowskij von seiner ersten Frau. Die Erfah-
94
Teil II: Subjekt und Geschichte
rungen des Scheiterns der Ehe werden im »Spiegel« einfließen. Im gleichen Jahr beginnt er Stanislaw Lems »Solaris« zu verfilmen. Ein großer Genresprung: vom historischen Film zur Science-Fiction. Der fertige Film wird zunächst vom Filmkomitee zurückgewiesen: »Es beginnt also wieder das gleiche Drama wie beim ›Rubljow‹«, schreibt sich Tarkowskij (1989, S. 90) bangend in sein Tagebuch. Aber dann, völlig unerwartet, passiert »Solaris« ohne größere Beanstandung die Zensur und erhält 1972 in Cannes den Preis der Jury. Lem ist unzufrieden mit dem Produkt, kein Wunder, denn Tarkowskij hat das Buch nicht einfach verfilmt, er hat es zu einem eigenständigen Werk umgearbeitet. Herausgekommen ist eine Meditation über die Liebe, die Moral, die Erkenntnis, die Kultur, die Wissenschaft, die Zivilisation, über Schuld und Sühne. Es folgt »Der Spiegel« (»Serkalo«): nach der Reise ins All, nun die Versenkung ins Ich. Mit dem »Spiegel« kehren die Schwierigkeiten mit den Ministerien in voller Wucht zurück. Das staatliche Filmkomitee belegt das Drehbuch mit Auflagen und greift immer wieder massiv in die Endmontage ein. Über Monate zieht sich das entwürdigende Prozedere der Filmabnahme hin: Probevorführung, Gutachten des Kunstrates, Nachbesserungen Tarkowskijs, Probevorführung, Gutachten, Nachbesserungen und so fort. Tarkowskij kämpft verbissen, hier und da durchaus kompromissbereit, in vielen Punkten unnachgiebig. Was wird von den Offiziellen beanstandet? Von den ersten Korrekturwünschen wissen wir aufgrund der Eintragungen Tarkowskijs in sein Arbeitstagebuch. 17. Mai 1974: »Die Sitzung hat stattgefunden. Entsetzlich. Das Resümee: phantastisch, aber unverständlich. Das Fazit: zwei Punkte: 1. Es wird nicht klar, wo es sich um die Ehefrau beziehungsweise die Mutter handelt. 2. Der Autor soll aus der Schlußsequenz verschwinden« (Tarkowskij 1993, S. 240). Beiden Kritikpunkten gegenüber zeigt sich Tarkowskij aufgeschlossen. Dass dieselbe Schauspielerin (Margarita Terechowa) zugleich die Ehefrau des Ich-Erzählers und die junge Mutter verkörpert, hatte nicht nur die Herren von der Zensurbehörde verwirrt: »Das Problem: ›wo Mutter – wo Natalja‹. Wir haben uns dahingehend geeinigt, daß die erste Szene mit Natalja neu synchronisiert wird – so daß die Betonung darauf liegt, war-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
95
um und in welcher Weise Natalja der Mutter gleicht. Ich mache dies um so bereitwilliger, als sogar mein Vater sagte, ihm sei diese Szene unverständlich« (Tarkowskij 1993, S. 241). Der zweite Einwand bezieht sich auf die Figur des Ich-Erzählers. Von Drehbeginn an hatte Tarkowskij damit geliebäugelt, am Ende des Films dem bis dahin physisch nicht in Erscheinung getretenen Erzähler eine identifizierbare Gestalt zu geben: die eigene. Dieser Einfall ist bei den Filmverantwortlichen sofort auf Widerstand gestoßen. »Der Autor soll nicht in Erscheinung treten« (Tarkowskij 1993, S. 107), notiert sich Tarkowskij während der Dreharbeiten am 8. Juni 1973. Lange hat er dennoch an der Idee festgehalten, nun aber, nach Abschluss der Dreharbeiten, gibt er sie ohne weitere Gegenwehr auf. Sein Entgegenkommen stellt die Filmbürokraten keineswegs zufrieden. Deren Bedenken weiten sich zu einer zehnpunktigen Korrekturliste aus. Generell moniert man die »komplizierte Gestaltungsform des Werks« (Tarkowskij 1993, S. 301). Der Prolog sollte gestrichen werden,2 ebenso jene kurze Szene, in der die junge Mutter in der Luft schwebt. Atmosphärische Aufheiterungen wünscht man sich in den Episoden mit dem vormilitärischen Ausbilder, den spanischen Emigranten, der Druckerei, und überhaupt missfällt den Behörden der pessimistische Grundton des Films. Als letzten Punkt der Mängelliste lesen wir noch: »Der ganze Film ist von Elementen der Mystik zu befreien« (Tarkowskij 1993, S. 303). Tarkowskij ist erneut bereit, auf einige Punkte einzugehen, aber jeden Aspekt zu berücksichtigen hätte bedeutet, einen neuen Film zu drehen. Er kürzt einige »pessimistische« Passagen und versucht durch Nachsynchronisation das vermeintlich Mystische zu entschärfen. Die Verantwortlichen des Filmkomitees bleiben unnachgiebig. Die »Übergänge von der Wirklichkeit zu den Träumen« seien zu »verdeutlichen«, heißt es in einem Diskussionsprotokoll (Tarkowskij 1993, S. 310). Vieles sei immer noch viel zu »trübselig«, unpointiert, unverständlich. »Nötig ist Klarheit des Sinns« (Tarkowskij 1993, S. 312). Über drei Szenen ereifern sich die Gemüter mit besonderem 2 Der dem Vorspann vorausgehende Prolog zeigt einen stotternden Jungen, der in Hypnose versetzt wird und anschließend problemlos sprechen kann.
96
Teil II: Subjekt und Geschichte
Nachdruck. Als Erstes die Szene mit dem Ausbilder. Nicht allein, dass sie keinen patriotischen Elan entfacht. Tarkowskij hatte dem unwirschen Ausbilder überdies als Zeichen seiner Kriegsversehrtheit einen Makel zugelegt: Er sollte stottern. Das ging den Filmräten zu weit (Tarkowskij 1993, S. 257). Tarkowskij wehrt sich lange, gibt den Kampf aber schließlich verloren. Am 9. Oktober 1974 schneidet er die Stelle heraus, in der das Stottern des Ausbilders zu sehen und zu hören gewesen ist. Der zweite Stein permanenten Anstoßes ist die winzige Traumsequenz mit der schwebenden Mutter. Man sehe nicht ein, heißt es in einem der Filmgutachten, »warum sie nötig sein sollte« (Tarkowskij 1993, S. 312), also raus damit. Tarkowskij, der in »Solaris« und in »Opfer« ähnliche Levitationsszenen eingefügt hat, will sich dieser Traumzensur nicht beugen. Er beschließt, die Einstellung drinzulassen »– koste es, was es wolle. Und wenn sie mir den Film nicht abnehmen!« (Tarkowskij 1993, S. 248). Er verändert ein wenig an der Gesamtgestaltung der Szene, die in seinen Aufzeichnungen den Titel ›Die Tröstung‹ trägt, aber herausgeschnitten wird sie nicht (Tarkowskij 1993, S. 250). Seine Begründung: Was die Schwerelosigkeit angehe, so könne hier »von Mystik überhaupt nicht die Rede sein. […] Die Episode ist das poetische Bild der seelischen Befindlichkeit einer liebenden Frau, ihres Glücks auf der Höhe eines Gefühls, das kein Vergessen kennt« (Tarkowskij 1993, S. 317). Diese Erklärung befriedigt die prosaischen Herren vom Komitee mitnichten; die Szene bleibt ihnen ein Dorn im Auge. Das dritte Ärgernis ist der Prolog, den man für völlig überflüssig erachtet. Anders der Regisseur: Der Prolog, so seine Antwort vom 12. August 1974, sei der »Schlüssel zum Film«. Er stimme auf die »dramaturgische Besonderheit dieses Werks ein, in dem sich die Handlung eher nach der assoziativen Gesetzmäßigkeit der Musik und Lyrik entwickelt als nach dem landläufigen Kanon der ›Kinobelletristik‹.« Darüber hinaus habe die Szene auch eine symbolische Bedeutung: »Sie gibt die Mühsal wieder, die der Held und Erzähler auf sich nimmt, weil er gedrängt ist, von sehr persönlichen und schwierigen Dingen zu erzählen, und zugleich aber auch das Gefühl der inneren Befreiung, der strahlenden Klarheit und Hinwendung zum Leben und zu den Menschen, das er im Finale erreicht« (Tarkowskij 1993, S. 317).
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
97
Weitere Korrekturvorschläge hat sich Tarkowskij in diesem Schreiben ausdrücklich verbeten. Umsonst. Das Gutachten vom September 1974 bemängelt weiterhin diverse Punkte: die »Mystik« des Films, das Fehlen »offensive(r) Kampfepisoden«, die zu negativ geratene Spanienepisode und den verflixten Prolog natürlich auch (Tarkowskij 1993, S. 319). Nach weiterem zähem Ringen wird der Film endlich am 22. Oktober 1974 akzeptiert. »Damit ist die ganze Prozedur der Filmabnahme erledigt« (Tarkowskij 1993, S. 260), trägt sich der erschöpfte und entnervte Regisseur in sein Arbeitstagebuch ein. Allein eine landesweite Aufführung des Films unterbleibt. 1975 wird »Serkalo« in nur drei Moskauer Kinos uraufgeführt, um danach von der Leinwand verbannt zu werden. In die internationalen Kinos kommt der Film erst Jahre später, 1978 ist die Premiere in Paris. Die Produktionsschwierigkeiten und die eher zwiespältige Reaktion einiger seiner sowjetischen Filmkollegen, die den Film als »›wirr‹ und ›freudianisch egozentrisch‹« (Turkowskaja u. AllardtNostitz 1981, S. 147) schmähen, bringen den Filmemacher an den Rand der Verzweiflung. Tarkowskij, dem das Kino alles bedeutet, spielt mit dem Gedanken, das Filmen aufzugeben (vgl. Tarkowskij 1985, S. 200). Ermutigt durch eine, wie er euphorisch schreibt, »überwältigende Menge von Zuschauerpost« (Tarkowskij 1985, S. 200), macht er sich jedoch 1975 auf den beschwerlichen Weg, ein weiteres Projekt zu realisieren. Es sollte sein letzter in Russland gedrehter Film werden: »Stalker«. Vor- und Dreharbeiten ziehen sich vier Jahre hin. Die Fertigstellung des Films wird abermals zur Zitterpartie, gelingt aber verhältnismäßig glimpflich. Die steigende Anerkennung aus dem Ausland übt offensichtlich Druck auf die sowjetischen Filmverantwortlichen aus. »Stalker« wird mit europäischen Filmpreisen ausgezeichnet, in der Bundesrepublik Deutschland beginnt mit diesem Film »die zum Teil enthusiastische Tarkowskij-Rezeption« (Jacobsen 1987, S. 182). Der Romanvorlage nach ist »Stalker« erneut ein Science-Fiction-Film. Aber im Unterschied zu »Solaris« bedient er in keiner Weise die Ikonographie des Genres. Der zweieinhalbstündige Film wirkt nach dem »Spiegel« wie ein Kahlschlag, wie eine formale Gegenthese. Er besteht aus einer extrem geringen Zahl an Einstellungen und spielt an wenigen Drehorten.
98
Teil II: Subjekt und Geschichte
Er wahrt die Einheit von Raum und Zeit und ist linear erzählt, wie in einem Atemzug. Traum- oder Erinnerungssequenzen fehlen. Mit Einwilligung der sowjetischen Filmbehörden beginnt Tarkowskij 1980 in Italien die Drehortbesichtigungen zu »Nostalghia«. Es wird nirgends von ihm ausgesprochen, aber mit dieser Auslandsreise probt er die Emigration. Die Aussicht, im Ausland endlich unbehelligt arbeiten zu können, ist zu verlockend. Die Dreharbeiten verlaufen relativ reibungslos. 1982 ist »Nostalghia« fertiggestellt. Es gibt keinen melancholischeren Film als diesen, keinen, in dem das Innenleben der Bilder von Schwermut so sehr befallen ist. »Die Nostalghia«, hat der Filmemacher im Mai 1983 auf der Pressekonferenz in Cannes erläutert, »ist die tödliche Krankheit eines Menschen, der an der Trennung von seiner Heimat leidet, in die er nicht zurückkehren kann.« Auf die Frage, warum er von einer Krankheit spreche, antwortete er: »Wie sollte man anders etwas bezeichnen, das einem allen vitalen Schwung, alle Energie, alle Lebensfreude nimmt? Das hat nichts mit Traurigkeit zu tun. Man ist benachteiligt, ein Teil von einem selbst hat sich verflüchtigt« (Tarkowskij 1984, S. 3). Diesen ruinösen Persönlichkeitszustand der seelischen Entkräftung schildert der Film in einer Realszenen und Traumsequenzen integrierenden Bild- und Tondramaturgie. Dafür erntet er Auszeichnungen im Ausland und Missgunst im Heimatland. Der Repressalien müde, der Anfeindungen seines künstlerischen Werks überdrüssig, entschließt sich Tarkowskij, gemeinsam mit seiner Frau Larissa, vorerst in Italien zu bleiben. Die Behörden drängen auf Rückkehr, auch sein Vater signalisiert nur Unverständnis (vgl. Tarkowskij 1991a, S. 127). Die Sowjetunion verweigert Tarkowskijs Söhnen die Ausreise. Dafür kann er sich endlich künstlerisch entfalten, wenn auch nur für wenige Jahre. In London bringt er die Oper »Boris Godunow« auf die Bühne, in Schweden wird das neue Filmprojekt realisiert: »Opfer« (»Offret«). Angesichts einer akuten atomaren Bedrohung schwört der Protagonist in Tarkowskijs letztem Film, sein Hab und Gut zu opfern und auf immer zu schweigen, falls das Unheil in letzter Sekunde abgewendet wird. Weil Letzteres eintritt, zögert er nicht, sein Haus in Flammen zu setzen und zu verstummen. Streng wie in »Stalker« wird in »Offret« erneut die Raum-Zeit-Einheit eingehalten. Aller-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
99
dings baut Tarkowskij Träume, Visionen und Ellipsen ein, durch die die Stringenz und Schlüssigkeit des Handlungsgeschehens ebenso wie die Eindeutigkeit der Botschaft unterlaufen werden – darin ähnelt der Film dem »Spiegel«. In einem Kommentar zum Film schreibt Tarkowskij: »Es gibt mehrere unterschiedliche Lesarten, und dies liegt durchaus in meiner Absicht – ich will keinem eine bestimmte Lösung aufdrängen, habe von dem ganzen aber natürlich meine eigene Auffassung. Eine auf Eindeutigkeit angelegte Interpretation jedenfalls liefe der inneren Struktur des Films zuwider« (Tarkowskij 1987, S. 181f.). 1986 ist in Cannes die Welturaufführung. Kurz zuvor durften Tarkowskijs Mutter und sein zweiter Sohn endlich ausreisen. Die sowjetischen Behörden hatten erfahren, dass der Regisseur im fortgeschrittenen Stadium an Krebs erkrankt war. Der vom Tod gezeichnete Vater, der vom Krankenbett aus die Fertigstellung von »Opfer« anleitet, und sein Sohn begegnen sich in Paris. Der Filmemacher Chris Marker hat das Wiedersehen aufgezeichnet und in seiner brillanten Dokumentation über Tarkowskij – »Une journée d’Andrei Arsenevitch« (1999) – eingearbeitet. Den Preis der Filmjury in Cannes nimmt der Sohn entgegen, der Vater ist zu schwach. Er stirbt am 29. Dezember 1986 in Paris.
■ Traumarbeit – »Der Spiegel« »Im Film muß man nicht erklären, sondern direkt auf die Gefühle des Zuschauers einwirken. Die erwachte Emotion bewegt dann die Gedanken vorwärts. Ich suche nach einem Montageprinzip, das es mir erlauben wird, nicht Sujetlogik, sondern die subjektive Logik – den Gedanken, den Traum, die Erinnerung – darzulegen. Ich suche nach einer Gestaltung, die sich aus der Situation und dem psychischen Zustand des Menschen ergibt, das heißt, aus den Umständen, die auf menschliches Verhalten objektiv einwirken. Das ist die erste Bedingung für die Wiedergabe psychologischer Wahrheit« (Begegnung mit Andrej Tarkowskij 1962).
Dieses frühe filmtheoretische Credo Tarkowskijs stammt aus einem Interview, das Gideon Bachmann mit dem Regisseur im Jahr der Uraufführung von »Iwans Kindheit« geführt hat. Tarkowskij hat seine Suche nach dem angesprochenen Montageprinzip, nach
100
Teil II: Subjekt und Geschichte
den filmischen Möglichkeiten, »psychologische Wahrheit« einzufangen, nie aufgegeben. In »Serkalo« ist er bei der Darlegung der »subjektiven Logik« am weitesten gegangen. Dieser Film ist konsequent aus der Perspektive des bettlägerigen Ich-Erzählers gefilmt, der zwar zu hören, aber niemals im Bild zu sehen ist; lediglich in der vorletzten Sequenz sieht man seinen Unterkörper und seine Hand, die einen Vogel in die Luft wirft. Marius Schmatloch vertritt in seiner Dissertation die These, Tarkowskijs Filme seien durchweg »als in sich kreisende Träume der Hauptprotagonisten« (Schmatloch 2003, S. 69) zu lesen. »Serkalo« rage in dieser Hinsicht heraus: »›Der Spiegel‹ bildet den Höhepunkt jener Bemühungen, die die Schranken zwischen Illusion und Wachheit zu verwischen versuchen […]. Der gesamte Film entpuppt sich als ein komplexer, in sich kreisender Endlostraum, wobei die einzelnen Episoden als Träume unterschiedlicher Intensität, als Träume, die differierende Gefühlslagen, Assoziationen, Synästhesien wecken, interpretiert werden können« (Schmatloch 2003, S. 73). In dieser Lesart kommt für meine Begriffe der Sachverhalt zu kurz, dass der Film über einen Ich-Erzähler im Wachzustand und eine epische Gegenwart verfügt. Erzähler und Gegenwart können schwerlich als Bestandteile eines Endlostraums gedeutet werden. Aber Tarkowskij setzt im »Spiegel« alle erdenklichen Mittel ein, um das narrative Gravitationszentrum aufzulösen. Gerät das fiktive Ich in den Strudel seiner Erinnerungen und Träume, so gerät die Ebene der erzählten Gegenwart in den Strudel der Zeiten, die durch epische wie dokumentarische Rückblenden evoziert werden. Die weitgehende Auflösung der gewohnten Erzählperspektive resultiert aus der Absicht Tarkowskijs, sich mit filmischen Mitteln so weit wie eben möglich ins Innere des Subjekts zu versenken. Was diese Innenansicht zutage fördert, sind Traum-, Erinnerungsund Geschichtsfragmente, die das Subjekt buchstäblich konstituieren. Was wir vom Ich-Erzähler erfahren, das erfahren wir (und er) zuvorderst in Gestalt von Erinnerungen und Träumen. Der Ich-Erzähler ist in gewisser Weise nichts anderes als diese labile Einheit, die sich aus den Trümmern der Geschichte, der biographischen und der Zeitgeschichte, herstellt – und zwar im Prozess des Erinnerns, Träumens und Reflektierens.
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
101
Auch wenn »Der Spiegel« nicht insgesamt als ein Endlostraum anzusehen ist, so ist er doch als Ganzes wie ein Traum konzipiert. Genauer gesagt: Dem Film liegen die Form- und Gestaltungsprinzipien zugrunde, nach denen Tarkowskij üblicherweise bei der Darstellung von Träumen verfahren ist. Über die zahlreichen Traumszenen in den Filmen Tarkowskijs hat Michael Ledel in seinem Nachruf auf den Regisseur geschrieben: »Diese Bilder bleiben irritierend vielschichtig, weil sie sich jeder stringenten Logik, jeglichen Handlungsgesetzen eines filmischen Sujets entziehen. Sie gehorchen einem assoziativen Kompositionsgesetz, das die Bilder nach ihren inneren, subjektiven Qualitäten strukturiert – nach ihrem Erinnerungswert« (Ledel 1987, S. 21). In »Der Spiegel« hat Tarkowskij dieses Stilprinzip auf den kompletten Film ausgedehnt. Bereits die Herstellung »Serkalos« spricht Bände. Von den Traumsequenzen ebenso wie vom Film als Ganzem hatte Tarkowskij während der Dreharbeiten zwar bestimmte Vorstellungen im Kopf. Aber es gab kein feststehendes Konzept von Aufbau und Anordnung der Szenen, zumindest keines, das nicht während der Dreharbeiten und schließlich am Schneidetisch unzählige Male grundlegend umgestaltet wurde. Von Drehbeginn an stand fest, dass der Film Traumdarstellungen enthalten sollte. Der erste Drehplan sah zwei längere Traumszenen vor, sie sollten im letzten Drittel vom »Spiegel« zu sehen sein (vgl. Tarkowskij 1993, S. 91). Was die Anzahl der Träume betrifft, hat der Regisseur im Prinzip an seiner Ausgangsidee festgehalten. Zwar sind in der Endfassung des Films mindestens drei, wenn nicht gar vier in sich geschlossene Traumpassagen auszumachen – dazu unten mehr –, gleichwohl verzeichnet die letzte Montagevariante (Tarkowskij 1993, S. 237) nach wie vor die besagten zwei Träume. Der innere Aufbau dieser Traumsequenzen und ihre Platzierung im Film änderten sich jedoch fortwährend. Nicht willkürlich, sondern zum einen nach Maßgabe der inneren, assoziativen Stimmigkeit der fraglichen Szenen und zum anderen in Abhängigkeit von den Modifikationen am Gesamtaufbau des Films. Während der anstrengenden Wochen der Endmontage hat Tarkowskij in seinem Arbeitstagebuch die sich beinahe täglich ändernden Montagevarianten des Films festgehalten (vgl. Tarkowskij 1993, S. 211ff.). In »Die versiegelte Zeit« hat er darüber berichtet:
102
Teil II: Subjekt und Geschichte
»Mich auf eigene Erfahrungen stützend, kann ich sagen, daß zum Beispiel die Montage des ›Spiegels‹ mit ungeheurer Mühe verbunden war: Hier gab es etwa über zwanzig Schnittvarianten. Ich meine dabei nicht etwa einzelne Schnittstellen, die ausgewechselt wurden, sondern prinzipielle Veränderungen der Konstruktion, der Episodenanordnung. Es gab Momente, in denen es sogar schien, als sei dieser Film überhaupt nicht zu montieren, was unverzeihliche Mißgriffe bei den Dreharbeiten offenbart hätte. Der Film fiel immer wieder in sich zusammen, wollte sich nicht auf die Beine stellen, floß vor unseren Augen immer wieder auseinander, hatte keinerlei Einheit, innere Verbindung, Konsequenz und Logik. Doch eines schönen Tages, als ich noch einen letzten verzweifelten Versuch wagte, entstand dann plötzlich eine filmisch geschlossene Bildeinheit. Das Material belebte sich, die Einzelteile des Filmes traten in wechselseitige Funktionsverhältnisse und vereinigten sich zu einem präzisen, organischen System« (Tarkowskij 1985, S. 133f.).
Tarkowskijs Montagearbeit am »Spiegel« gleicht in gewisser Weise der Traumarbeit, wenn für die Traumarbeit, nach einer Bemerkung Freuds, »eine Art von Nötigung besteht«, das vorhandene Material »zu einer Einheit im Traume zusammenzusetzen« (Freud 1900/1989, S. 192). Tarkowskij war nicht eher zufrieden, bis die disparaten Elemente untereinander ein für ihn schlüssiges Bedeutungsgefüge ergaben. Mit dem gleichen Verfahren und der gleichen Intention erstellte er auch die besagten Traumsequenzen. Auch die auftretenden Schwierigkeiten ähnelten sich: »Ich habe den 2. Traum geklebt. Bisher nicht gut, zerstückelt und ohne einheitliches Empfinden« (Tarkowskij 1993, S. 151), lautet ein Eintrag ins Arbeitstagebuch. Der Traumcharakter von »Serkalo« geht auf diese Art der Bedeutungskonstruktion zurück (vgl. auch Wuss 1998). Die Einheit des Films wird nicht über eine chronologische Erzählung, eine Geschichte hergestellt, sondern über semantische Korrespondenzen. Der Film setzt sich zu einem Großteil aus wiederkehrenden Bildund Themenmotiven zusammen, die miteinander kommunizieren. Nehmen wir als Beispiel das Vater-Motiv. Auffällig ist, dass die Väter in diesem Film primär in ihrer Abwesenheit präsent sind. Der Vater des Ich-Erzählers hat die Familie verlassen, er taucht in der Erinnerung nur einmal kurz als Kriegsheimkehrer auf, ansonsten sehen wir ihn seltsam entrückt und ungreifbar in Träumen und Visionen. Der Ich-Erzähler selbst – Vater eines Sohnes, der bei der Mutter lebt – wird im Film nicht verkörpert, sondern nur als
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
103
Stimme repräsentiert. Und auch der Ehemann jener schwangeren Frau, bei der Maria und ihr Sohn nach der Evakuierung aus Moskau um Hilfe bitten, ist nicht im Bild gegenwärtig. Das parallele Leitmotiv des Films, das Mutter-Kind-Verhältnis, wird in noch vielfältigeren Bezügen thematisiert. Hervorstechend ist hier die Diskrepanz zwischen der poetischen Apotheose der Mutter und den geschilderten Spannungen, die das Verhältnis zwischen Alexej und Maria belasten. Aber niemand würde dem Film vermutlich eine Atmosphäre des Traums attestieren, wenn er ausschließlich evidente oder leicht entschlüsselbare Sinnbezüge enthielte. »Serkalo« wurde als ein filmischer Traum rezipiert, weil er zahlreiche semantische Leerstellen aufweist, also Einstellungen und kurze Szenen, deren Bedeutung unerklärbar bleibt, sowie längere Passagen, die sich dem Verständnis entziehen. Zu denken ist beispielsweise an die in jeder Hinsicht geheimnisvolle Episode, in der Ignat, der Sohn des Ich-Erzählers, einer aus dem Nichts auftauchenden und wieder verschwindenden fremden Frau auf deren Bitte einen Brief Puschkins vorliest. Das ist an sich schon seltsam genug. Nach Beendigung der Lesung steht Maria, die Oma Ignats, vor der Wohnungstür. Nachdem Ignat ihr geöffnet hat, gibt sie vor, sich in der Tür geirrt zu haben, was ihr Enkel merkwürdigerweise nicht dementiert. Im Gegenteil. Als sein Vater ihn anruft und sich erkundigt, ob die Großmutter vorbeigekommen sei, verneint er dies. Diese Episode spielt in der epischen Gegenwart. Für gewöhnlich ist das die »objektive« Zeit- und Wirklichkeitsebene. Das ganze Szenario jedoch, einschließlich der unheimlichen Musik von Eduard Artemjew, ist eine einzige Erschütterung unseres Zutrauens ins vermeintlich Objektive. Die wirkliche Welt und die Welt des Traums rücken in »Serkalo« einander näher, wohlgemerkt, ohne völlig ineinander aufzugehen. Klaus Kreimeier hat im »Spiegel« vier Erzählebenen unterschieden, die durch spezifische »filmische[] Redeweisen« gekennzeichnet seien: »die epische Gegenwart des Films, epische Rückblenden, dokumentarische Rückblenden, Traumszenen« (Kreimeier 1987, S. 123). Das ist eine hilfreiche Einteilung, aber sie wird dem Film nicht vollauf gerecht. Tarkowskij vermeidet bewusst eine eindeutige Trennung der filmischen Redeweisen. Schauen wir uns beispielsweise die Farbgestaltung an, ein beliebtes Mittel, um Erzähle-
104
Teil II: Subjekt und Geschichte
benen zu differenzieren. Im »Spiegel« wird die Farbdramaturgie überaus virtuos eingesetzt. Die Vergangenheit wird entweder in Farbe oder in Schwarz-Weiß, die Gegenwart wird meistens in Farbe und die Träume werden meistens in Schwarz-Weiß gezeigt. Aber eben nur meistens. Das zweite Streitgespräch zwischen Natalja und Alexej spielt in der Gegenwart, ist aber in Schwarz-Weiß gefilmt, und umgekehrt sind manche Bilder, die in mutmaßlichen Traumszenen auftauchen, farbig. Ein anderes weithin gebräuchliches Stilmittel, um Realitätsoder Bewusstseinsebenen im Film voneinander abzugrenzen, ist der Einsatz der Zeitlupe. Tarkowskij verwendet sie in diesem Film ungewöhnlich häufig. Manchmal subtil, wie am Ende der Szene, in der Maria einen Hahn schlachtet, oder in der Druckerei-Sequenz, als sie vor Lisaweta davonläuft – beides epische Rückblenden –, andere Male ostentativ, wie in einigen Kindheitsszenen, die als Träume zu klassifizieren sind. Für Tarkowskij war Filmarbeit »Bildhauerei aus Zeit« (Tarkowskij 1985, S. 142). Mit der Zeitlupe konnte er am unmittelbarsten »den Zeitfluß innerhalb der Einstellungen« (Tarkowskij 1985, S. 132) verändern, was ihm gleichermaßen in den Erinnerungs- wie in den Traumsequenzen angebracht erschien. Die vierteilige Differenzierung Kreimeiers wird dem »Spiegel« aber auch deshalb nicht gerecht, weil der Film Erzählformen aufweist, die keiner der genannten Kategorien zuzuordnen sind. Wo etwa gehört die Schlusssequenz hin? Kreimeier macht es sich zu einfach. Er bezeichnet sie kurzerhand als »Traumszene: Kameraschwenk über Felder und Wald auf das Landhaus. Die junge Maria und ihr Mann liegen auf einer Wiese. Maria, in die Ferne blickend, sieht sich selbst: als alte Frau, über Wiesen und Felder gehend; sie führt den kleinen Alexej und seine Schwester an der Hand« (Kreimeier 1987, S. 126). Die Schlusssequenz spielt vor der Geburt der Kinder und enthält zugleich eine Zukunftsvision, in der sich die verschiedenen Generationen buchstäblich die Hand reichen. Sie ist in Farbe gedreht, ohne Zeitlupe. Der ganze Erzählduktus ist ein völlig anderer als der in den unzweifelhaften Traumepisoden. Aber auch als eine epische Rückblende wird man sie nicht bezeichnen können, dafür mischen sich in ihr zu sehr die Zeiten. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen hat Kreimeier wo-
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
105
möglich dazu bewogen, die Schlusssequenz den Träumen zuzuordnen. In den narrativen Künsten, dem Film, dem Roman, der Oper, werden Traumszenen oftmals herangezogen, um die gewohnte Raum-Zeit-Logik zu durchbrechen. Bernd Alois Zimmermann etwa hat in seine Oper »Die Soldaten« den vierten Akt mit einer Szene beginnen lassen, die, wie es im Libretto heißt, »den Charakter eines Traums« ausstrahlen soll. Die Szenenbeschreibung liest sich, als habe der Komponist kein Stück von Jakob Michael Lenz, sondern Tarkowskijs »Spiegel« für die Opernbühne bearbeitet: »Das Geschehen mehrerer Szenen spielt sich losgelöst von deren Raum und Zeit, der Handlung vorgreifend, auf sie zurückgreifend, gleichzeitig auf der Bühne, in drei Filmen und in den Lautsprechern ab. […] [D]ie Bühne wird in Höhe, Breite und Tiefe blitzartig von Bruchteilen der verschiedensten Szenen erhellt, hin- und herflackernd wie im Traum« (Zimmermann 1991, S. 194/196). Nicht nur in der Schlusssequenz von »Serkalo« löst Tarkowskij die vertraute Einheit von Raum und Zeit auf. Auch in verschiedenen anderen Episoden schieben sich unterschiedliche Zeit- und Raumebenen ineinander. Letztendlich kann der vollständige Film als ein Versuch verstanden werden, das durch Zeiträume Getrennte zu verschmelzen. Freud (1900/1989, S. 312) hat in Bezug auf die »Darstellungsweise« des Traums gesagt, Träume geben »logischen Zusammenhang wieder als Gleichzeitigkeit«. Das geschieht auch im »Spiegel«. Dieser Film spricht somit die Sprache des Traums in einer Weise, die über die bekannten Analogien zwischen Film und Traum (vgl. Schneider 1998; Gruner u. Zwiebel 2003) hinausgeht.
■ Die Träume in »Serkalo« Ich möchte abschließend auf die unzweifelhaften Traumszenen in »Serkalo« eingehen. Eindeutig als Träume identifizierbar sind drei Sequenzen, eine vierte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit als ein Traum einzustufen. Das in allen Träumen verarbeitete »Material« (Freud 1900/1989, S. 38) stammt aus der frühen Kindheit des IchErzählers.
106
Teil II: Subjekt und Geschichte
Die erste Traumepisode. Die erste Sequenz nach dem Titelvorspann endet mit einer in Schwarz-Weiß und überwiegend in starker Zeitlupe gedrehten Szenenfolge: Der junge Alexej liegt im Bett, ruft nach seinem Vater. Die Mutter wäscht sich die Haare. Die Stuckdecke des Raums zerfällt. Maria sieht sich als alte Frau im Spiegel. In der unmittelbar daran anschließenden Episode – wir befinden uns jetzt in der epischen Gegenwart – erzählt der IchErzähler seiner Mutter am Telefon, dass er gerade von ihr geträumt habe. Diese Erklärung ersetzt die aus vielen anderen Filmen bekannte narrative Einrahmung von Traumszenen, die es den Zuschauern erleichtern soll, das Gesehene als Traum zu deuten. Üblicherweise wird die zumeist schlafende oder gerade erwachende Person gezeigt, deren Traum wir zu sehen bekommen beziehungsweise zu sehen bekamen (vgl. Wulff 1998). Die zweite Traumepisode. Im letzten Drittel des Films gibt es eine Sequenz, in der im Off über einen immer wiederkehrenden Traum aus der Kindheit monologisiert wird. Der Ich-Erzähler erklärt unter anderem, dass ihm im Traum jedes Mal der Zugang zum Haus seiner Kindheit verwehrt werde. Dazu sehen wir Bilder aus der Kindheit, aus dem Inneren des Hauses, in Farbe, Realzeit, tonlos. Für Kreimeier sind diese Einstellungen bereits Traumszenen. Das scheint aber ein Irrtum. Tarkowskij unterscheidet im Arbeitstagebuch diese Passagen – er nennt sie »Interieur« – von dem daran anschließenden in Schwarz-Weiß gefilmten »Traum mit Wind« oder »Traum I« (Tarkowskij 1993, S. 237). Inhaltlich und formal macht diese Differenzierung Sinn. Erst die Collage mit den vom Wind bewegten Bäumen, der zerborstenen Fensterscheibe und dem jungen Alexej vor der verschlossenen Tür des Bauernhauses lässt uns am angekündigten Wiederholungstraum partizipieren. Extreme Zeitlupe und suggestive Tondramaturgie tragen ihren Teil dazu bei, dass man diese assoziative Bildfolge als Traum wahrnimmt, während man die vorherigen Innenraumszenen als Erinnerungen zu betrachten hat. Die dritte Traumepisode. Vom zweiten Traum gibt es gewissermaßen eine Fortsetzung; allerdings mit einer entscheidenden inhaltlichen Variation. Diese Sequenz folgt der Episode mit dem geschlachteten Hahn, nachdem Maria und ihr Sohn fluchtartig das Haus, in dem sie um Hilfe ersucht hatten, verlassen haben. Der
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
107
Betrachter identifiziert die unvermittelt einsetzenden impressionistischen Schwarz-Weiß-Bilder als Traumszenen aufgrund der formalen und motivischen Analogien zum zuvor beschriebenen Traum. Ein zusätzlicher Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um einen Traum handelt, fehlt allerdings. Inhaltlich ist diese Sequenz insofern von besonderer Bedeutung, als dem Jungen in diesem Traum genau das gelingt, was ihm bis dahin immer verwehrt worden ist: Er tritt mühelos ein in das Haus seiner Kindheit. Die Versöhnung mit der eigenen Vergangenheit scheint geglückt. Wir sehen ihn mit einer Karaffe voller Milch, eines der zentralen Motive aus der Symbolwelt Tarkowskijs. Die vierte Traumepisode. Die Szene mit der im Raum schwebenden Mutter. Was berechtigt uns, sie als Traum zu klassifizieren? Die Dichte der Indizien legt es sehr nahe. Erstens ist die Szene in Schwarz-Weiß und in Zeitlupe gedreht. Zweitens stammt das verarbeitete Material aus der frühen Kindheit Alexejs. Und schließlich ist das Sujet hinlänglich irreal, um als ein Traum durchzugehen. Aber weder durch einen Off-Kommentar noch durch den szenischen »Einbettungskontext« (Wulff 1998, S. 53) wird diese Episode als ein Traum ausgewiesen. In den zwei zuletzt genannten Szenen bricht Tarkowskij somit am entschiedensten mit der Konvention, jeden Filmtraum unmissverständlich als einen solchen kenntlich zu machen. Tarkowskij wäre vermutlich durchgängig so kühn verfahren, hätte ihn die sowjetische Filmbürokratie nicht daran gehindert. Aber auch so bleibt noch deutlich genug der Vorsatz erkennbar, Traumszenen als autonome Filmelemente zu behandeln. In Absetzung von den Gepflogenheiten des traditionellen Erzählkinos wird eine Funktionalisierung der Traumsequenzen unterlassen. Um den Unterschied zu illustrieren, sei an die bekannte erste Traumsequenz in Ingmar Bergmans »Wilde Erdbeeren« (»Smultronstället«, 1961) erinnert. Unter Verwendung schwergewichtiger Symbolik verdichtet dieser Traum die Todesphantasie des hochbetagten Protagonisten (vgl. Koebner 1998, S. 77f.). Das Ende des Traums fällt mit dem Erwachen der Hauptfigur zusammen. Bergman nutzt die Möglichkeiten der filmischen Traumdarstellung, um dem Zuschauer in nur wenigen Minuten ein Psychogramm
108
Teil II: Subjekt und Geschichte
der Hauptfigur und zugleich die Grundproblematik des Films vorzustellen. Der semantisch aufgeladene und filmästhetisch reizvolle Traum steht primär im Dienst der komprimierten Informationsübermittlung. Wie fast immer, wenn in den narrativen Künsten Traumdarstellungen eingeflochten werden, handelt es sich auch hier um einen Wahr-Traum. Die Zeiten, in denen man Träume als Wahngebilde oder Hirngespinste angesehen hat, scheinen seit langem vorbei. Vielmehr gilt: Träume mögen rätselhaft sein, aber sie lügen nicht (vgl. Koebner 1998, S. 74; Wulff 1998, S. 61ff.). Gerade im Film werden sie überwiegend so eingesetzt, als besäßen sie eine exklusive Nähe zur Wahrheit. Luis Buñuel, der ideenreichste Filmvirtuose des Traums (vgl. Gross 1998), gehört zu jenen Regisseuren, die gezielt gegen diese verbreitete psychologische Instrumentalisierung des Traums rebelliert haben. In diesem Punkt hat er sich zeitlebens seine surrealistische Gesinnung bewahrt. In »Der diskrete Charme der Bourgeoisie« (»Le charme discret de la bourgeoisie«, 1972) lässt er unvermittelt Randfiguren Träume erzählen, die weder der psychologischen Charakterisierung dienen noch in irgendeinem erkennbaren Bezug zur sonstigen Spielhandlung stehen. Von Bedeutungsschwere entlastet, gewinnt dadurch die ästhetische Qualität der Träume, das Verspielte, das Verrückte, das Unheimliche, an Gewicht. Buñuels augenzwinkernder Umgang mit dieser Materie war Tarkowskij, so sehr dieser seinen spanischen Kollegen schätzte, fremd. Aber wie für Buñuel, so besitzt auch für Tarkowskij der Traum einen signifikanten ästhetischen und ontologischen Eigenwert. Dieser tritt in »Der Spiegel« in dem Maß in den Vordergrund, wie eine Funktionalisierung der Träume unterbleibt. Tarkowskij filmt Träume so selbstverständlich, wie er Landschaften filmt. Und so, wie er der äußeren Natur ihr Geheimnis belässt, gibt er es der inneren Natur, den Träumen, zurück.
T. Hoyer · Andrej Tarkowski und sein Film »Der Spiegel«
109
■ Literatur Begegnung mit Andrej Tarkowskij (1962): Interview mit Gideon Bachmann. Filmkritik 12. Böhme, H. (1985): Ruinen – Landschaften. Naturgeschichte und Ästhetik der Allegorie in den späten Filmen von Andrej Tarkowskij. Konkursbuch 14: 117–157. Buñuel, L. (1991): Der Film als Instrument der Poesie. In: Buñuel, L.: Die Flecken der Giraffe. Ein- und Überfälle. Berlin, S. 142–148. Freud, S. (1900): Die Traumdeutung. Hg. v. Alexander Mitscherlich, Angela Richards, James Strachey. Studienausgabe Band II. Frankfurt a. M., 1989. Gross, S. (1998): Traumspiele. Stellenwert und Funktion der Träume im Kino Buñuels. In: Dieterle, B. (Hg.): Träumungen. Traumerzählung in Film und Literatur. St. Augustin, S. 117–144. Gruner, W.; Zwiebel, R. (2003): Einige Anmerkungen zum Verhältnis von Psychoanalyse und Film. In: Zwiebel, R.; Leuzinger-Bohleber, M. (Hg.): Träume, Spielräume II. Göttingen, S. 7–30. Jacobsen, W. (1987): Daten. In: Jansen, P. W.; Schütte, W. (Hg.): Andrej Tarkowskij. Reihe Film 39: 181–207. Jünger, H.-D. (1995): Kunst der Zeit und des Erinnerns. Andrej Tarkowskijs Konzept des Films. Ostfildern. Koebner, T. (1998): Erzählen im Irrealis. Zum Neuen Surrealismus im Film der sechziger Jahre. Eine Problemskizze. In: Dieterle, B. (Hg.): Träumungen. Traumerzählung in Film und Literatur. St. Augustin, S. 71–91. Kreimeier, K. (1987): Kommentierte Filmografie. In: Jansen, P. W.; Schütte, W. (Hg.): Andrej Tarkowskij. Reihe Film 39: 81–180. Ledel, M. (1987): In Memoriam Andrej Tarkowskij. Filmfaust 59: 20–21. Schlegel, H.-J. (1993): Der Zusammenhang des authentischen und des Poetischen. In: Tarkowskij, A.: Der Spiegel. Die Novelle und das Arbeitstagebuch zum Film. Frankfurt a. M. u. Berlin, S. 321–328. Schmatloch, M. (2003): Andrej Tarkowskijs Filme in philosophischer Betrachtung. St. Augustin. Schneider, I. (1998): Filmwahrnehmung und Traum. Ein theoriegeschichtlicher Streifzug. In: Dieterle, B. (Hg.): Träumungen. Traumerzählung in Film und Literatur. St. Augustin, S. 23–46. Der sowjetische Film, hg. v. Staatlichen Filminstitut der UdSSR (WGIK), Band 2, Henschelverlag: Berlin 1974. Tarkowskaja, M. (2003): Splitter des Spiegels. Die Familie des Andrej Tarkowskij. Berlin. Tarkowskij, A. (1969): Andrej Rubljow. Filmtext und Dokumente. Kinemathek 7, Nr. 41. Tarkowskij, A. (1984): »Im Augenblick will ich kein Kind mehr sein«. Pressekonferenz zum Film »Nostalghia« mit Andrej Tarkowskij. Montiert und Fragen gestellt von Cesare Biarese und Pantelis Karakas. Filmfaust 38: 3–8.
110
Teil II: Subjekt und Geschichte
Tarkowskij, A. (1985): Die versiegelte Zeit. Gedanken zur Kunst, zur Ästhetik und Poetik des Films. Berlin u. Frankfurt a. M. Tarkowskij, A. (1987): Opfer. Filmbuch. München. Tarkowskij, A. (1989): Martyrolog. Tagebücher 1970–1986. Berlin u. Frankfurt a. M. Tarkowskij, A. (1991a): Martyrolog II. Tagebücher 1981–1986. Berlin u. Frankfurt a. M. Tarkowskij, A. (1991b): Andrej Rubljow. Die Novelle. Berlin u. Frankfurt a. M. Tarkowskij, A. (1993): Der Spiegel. Die Novelle und das Arbeitstagebuch zum Film. Berlin u. Frankfurt a. M. Turowskaja, M. J.; Allardt-Nostitz, F. (1981): Andrej Tarkowskij. Film als Poesie – Poesie als Film. Bonn. Wulff, H. J. (1998): Intentionalität, Modalität, Subjektivtät: Der Filmtraum. In: Dieterle, B. (Hg.): Träumungen. Traumerzählung in Film und Literatur. St. Augustin, S. 53–69. Wuss, P. (1998): Träume als filmische Topics und Stereotypen. In: Dieterle, B. (Hg.): Träumungen. Traumerzählung in Film und Literatur. St. Augustin, S. 93–116. Zimmermann, B. A. (1991): Die Soldaten, Beiheft, Teldec Classics International (2CDs).
■ Christel Eckart
Tanz um Anerkennung: Kampf und Feier Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
Beim interdisziplinären Austausch über das Verständnis von Filmentstehung, -erleben und -interpretation gibt die Psychoanalyse als Wissenschaft vom Unbewussten den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Anstoß, anhand des Mediums Film in seiner künstlerischen Form über das Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen ihrer Disziplinen zu reflektieren. Als Soziologin und Sozialforscherin in der Frauen- und Geschlechterforschung beteilige ich mich an diesem Austausch. Ich habe persönlich Freude an Film und Kino und habe in Zeiten »disziplinierter Disziplinlosigkeit« an Filmprojekten mitgearbeitet und die Arbeit von Filme machenden Freundinnen und Freunden in der Nähe begleitet. Als Sozialforscherin sah ich Ähnlichkeiten des Arbeitens beim Machen eines Films und beim Durchführen eines empirischen Forschungsprojekts: die langen und vielfältigen Vorbereitungen, das Drehen ähnlich den Interviews und vor allem das Schneiden des Films und das Auswerten von Interviews, das Verhältnis von gedrehtem Filmmaterial zum Endschnitt wie den Berg von Interviewmaterial, aus dem eine nachvollziehbare Interpretation herausgefiltert wird und nur noch in Worte gefasst, in Text übersetzt wird. Wie beim Schneiden des Films nur noch mit den Bildstreifen gearbeitet wird, ist bei der qualitativen Interviewforschung schließlich nur noch der Text das Gegenüber, und die vielfältigen Kommunikations- und Wahrnehmungsprozesse, die persönlichen Interaktionen in der so genannten Feldphase sind eingedampft auf die Ausdrucksform der schriftlichen Sprache. Wenn dieser Reduktionsprozess gut gelingt, sollte er im lesbaren Endprodukt enthalten, was an Erweiterung der Wahrnehmungsweisen, des Unterscheidungsvermögens bei der ganzen Forscherei,
112
Teil II: Subjekt und Geschichte
gewonnen wurde – dazu muss man auch ein Ausdrucksvermögen haben oder entwickeln. Von hier aus blicken Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen bewundernd auf künstlerische Ausdrucksformen (wie Freud z. B. auf Arthur Schnitzlers »Traumnovelle«). Darum bin ich mir der Gefahr bewusst, durch das Reden in Begriffen einer psychoanalytisch inspirierten Frauen- und Geschlechterforschung über Sally Potters »The Tango Lesson« die Ausdrucksform des Films zu unterschreiten; hoffe aber, durch den Austausch über die Wahrnehmungen und die Eindrücke beim Sehen des Films auf die Symbolisierungsleistungen darin aufmerksam machen zu können.
■ Erweiterung alltäglicher Ausdrucksformen Künstlerische Gebilde überschreiten die Grenze des Sagbaren durch die Erweiterung alltäglicher Ausdrucksformen. Sie sind nicht nur Ausdruck von Leid in dem Sinn, wie ihn Goethes Torquato Tasso sich abringt: »und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott, zu sagen, wie ich leide«; sondern sie sprengen (Selbst-)Beschränkungen durch starre Deutungsmuster und Konventionen – oder durch innere persönliche Konflikte. Sie öffnen Phantasieräume und das Denken in Möglichkeiten (was nicht mit Flucht aus dem Alltag gleichzusetzen ist). Sie können auf schon vorhandene, aber noch nicht bewusst gewordene Lebensentwürfe zeigen. Ich betrachte Sally Potters »The Tango Lesson« als ästhetische Inszenierung des Kampfes um Anerkennung zwischen einer Frau und einem Mann, zwischen zwei Künstlern. Damit sage ich, was mir die Symbolisierungsleistungen des Films bedeuten, wo ich die Erweiterung von Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen erlebe. Wenn wir als Betrachter und Betrachterinnen von künstlerischen Produkten auf unsere eigenen beschränkten Ausdrucksmöglichkeiten gestoßen werden, können wir uns als Bewältigungsstrategie damit trösten, das bewunderte Produkt habe seinen Preis im Leid der Künstlerin, in einer konfliktgebeutelten Lebensgeschichte und so weiter. Wenn dem so wäre, wäre ich als Soziolo-
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
113
gin daran interessiert, an welchen sozialen Lebensbedingungen die Künstlerin oder der Künstler leidet. Sally Potters künstlerische Biographie scheint mir eher Ausdruck einer Lust an verschiedenen Formen der Darstellung, des kreativen Spiels mit Wahrnehmungsund Ausdrucksmöglichkeiten zu sein. Dazu gehört das Überschreiten von Geschlechtergrenzen sowohl im feministischen Engagement als auch als künstlerisches Sujet, wie etwa in der Verfilmung von Virginia Woolfs »Orlando«. Einige biographische Informationen: Sally Potter wurde 1949 in London in einer Künstlerfamilie geboren. Die Mutter war Musikerin, der Vater Designer und Dichter, beide Großmütter waren Schauspielerinnen. S. Potter ging als Teenager auf eine Kunstschule, dann auf eine Tanzschule; gründete mit Jacky Lansley eine eigene Tanzkompanie und drehte mehrere kurze Tanzfilme; gehörte zur London Filmmaker’s Co-op und zur London Women’s Film Group; drehte beachtete Kurzfilme (z. B. »Thriller«, 1979, der die Geschichte von »La Bohème« mit Humor aus der wenig glamourösen Perspektive der Näherin Mimi erzählt) und Featurefilme, für die der Minoritätensender »Channel 4« in den 1980er Jahren auch Feministinnen Gelegenheit bot (z. B. »Tears, Laughter, Fears and Rage«, eine Dokumentarserie 1986). S. Potter wirkte als Theaterregisseurin, Performance-Künstlerin, Lyrikerin und Musikerin, arbeitete mit Lindsay Cooper im »Lindsay Cooper’s Film und Music Orchestra« zusammen, das auch in Europa und USA auf Tour war. Mit »Orlando« (1992), verschaffte sich S. Potter Anerkennung im Mainstream-Kino. Mit Tilda Swinton in der Hauptrolle erhielt der Film zwei Oscar-Nominierungen und über zwanzig internationale Preise. Die Geschichte des elisabethanischen Edelmanns, der über vierhundert Jahre lang lebt und in der Hälfte der Zeit das Geschlecht wechselt, bleibt auf Distanz zum Erzählkino und wirft humorvolle Blicke auf die Geschichten hinter der Geschichte. Nach dem opulenten Kostümfilm mit Grenzüberschreitungen von Zeiten, Geschlechtertrennung und sozialer Klassenordnung folgte 1997 »The Tango Lesson«. In dem Schwarz-Weiß-Film sehen wir anfangs eine Frau, Sally, gespielt von Sally Potter selbst, die in einer Schaffenskrise steckt. An ihrem pedantisch geordneten, nahezu leeren Tisch in einer hellen, offenen Wohnung versucht sie, das Skript zu einem Filmpro-
114
Teil II: Subjekt und Geschichte
jekt »Rage« zu verfassen. Filmfetzen in Farbe werden eingestreut, Entwürfe für den neuen Film, in denen Models in üppigen Gewändern durch die Kulissen eines Parks staksen. Die Bilder scheinen Reminiszenzen an Sally Potters letzten Film »Orlando«, und es wird in diesen Abrissen und auch im Verlauf von »The Tango Lesson« deutlich, dass sie an diesen erfolgreichen Film nicht einfach mit den gleichen Mitteln anknüpfen kann. Die eingestreuten Szenen deuten vage eine Geschichte an, in der einem Designer ohne Beine nach und nach die grell und stoffreich gekleideten Models theatralisch abgeknallt werden. Die Bilder sind Teil eines Spannungsaufbaus in den einführenden Minuten des Films, der lähmend und aufreizend wirkt. Sally, die Figur der Filmregisseurin, unterbricht die stockende Arbeit am Filmskript für eine Pause, fährt nach Paris und trifft dort in einem Lokal auf den Tango und den Tangotänzer Pablo, gespielt vom bekannten argentinischen Tänzer Pablo Veron. Was zunächst ein erholsamer und kreativer Ausflug sein sollte, um an die Arbeit zum Filmprojekt »Rage« zurückzukehren, wird in der Beziehung mit dem Tänzer Pablo für Sally zu einem neuen Projekt. Der Boden ihres bisherigen Arbeitsplatzes wird Sally gründlich unter den Füßen weggerissen, ihre Wohnung wird wegen einer Reparatur zur Baustelle, und Sally macht deutlich ins Bild gesetzte neue Geh- und Bewegungsversuchte. Sally, die Filmregisseurin, nimmt Tangounterricht bei Pablo und bei zwei argentinischen Lehrern. Von da an ist der Film mit Zwischentiteln in zwölf Lektionen unterteilt, in denen der Prozess des Ringens um Anerkennung des Paars Sally und Pablo entlang der Entwicklung ihrer Fähigkeit, gemeinsam Tango zu tanzen und gemeinsam einen Film zu machen, dargestellt wird. Denn Sally entschließt sich im Verlauf ihrer Erfahrungen mit dem Tango-tanzen-Lernen – dazu fährt sie auch allein nach Buenos Aires, um dort Unterricht zu nehmen –, ihr Filmprojekt »Rage« aufzugeben, und plant, mit Pablo einen Film über das Tangotanzen zu drehen. Für die beiden Protagonisten der Geschichte im Film wird diese Verabredung zu einem Teil des Ringens um wechselseitige Anerkennung als Künstlerin und Künstler in der gemeinsamen kreativen Arbeit: Du leitest mich beim Tangotanzen an, ich leite dich als Schauspieler im Film. Zugleich beginnt für die Zuschauenden ein »Doppelfilm«: Wir sehen die Vorbereitungen zu einem Film von
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
115
Sally, in dem Pablo die Rolle eines Tangotänzers spielen soll, und wir sehen einen fertigen Film mit Sally Potter als Sally, der Filmregisseurin, die Tango tanzen lernt, mit Pablo Veron als Pablo, dem Tänzer. In diesen Verschränkungen des Erzählers, der Doppelfunktion der Figuren, der Verknüpfung von Tanz und Film, von Sehen und Gesehenwerden, dem Spiel mit Geschlechterstereotypen sehe ich Sally Potters Lust an der Koordination, der spielerischen Transformation, die Allmachtsphantasien nahe scheint. Durch die Verschränkungen gewinnt die präsentative Symbolik in Potters Film ihren Witz und gewinnen wir die Möglichkeit, das Beobachten zu beobachten und uns beim Beobachten zu beobachten. Diese Fähigkeit beschreibt J. P. Reemtsma als wesentlich für den Prozess der Symbolisierung und der Kommunikation über Symbole: »Im Individuum vertritt das Symbol die Stelle eines Vorstellungsinhalts, der im Bewusstsein nicht gehalten werden kann. […] Es ist aber nicht nur ein Notbehelf, ein quid pro quo, das die analytische Kur durch Klartext zu ersetzen hätte. Symbolisieren zu können bedeutet auch, an der Realität mehr wahrnehmen zu können als bloß diese. Symbole sind Realitätsinterpretationen, die ihrerseits interpretiert werden können. Sie sind Ergebnisse von Realitätsbeobachtungen unter riskanten Umständen, und darum decken sie, interpretiert, immer mehr auf, als sie gemäß der simplen Dynamik von Verdrängung und Symbol – als Symptombildung verdecken. Symbolisierungsfähig zu sein bedeutet, etwas sehen zu können, was man nicht sieht – soll heißen: die Fähigkeit zu haben, sich beim Beobachten zu beobachten. Darum ist die Unfähigkeit zu Symbolisieren Kennzeichen tiefgreifender seelischer Störungen und gerade ein Ausweis gravierend beeinträchtigter Realitätstauglichkeit. Im Vokabular der Systemtheorie nennt man dieses Beobachten des Beobachters ein Beobachten zweiter Ordnung. Wer die Welt beobachtet, kann sich nicht dabei beobachten. Der eigene Beobachterstandpunkt bleibt der blinde Fleck. Möglich aber ist es, andere beim Beobachten zu beobachten und dabei zu erkennen, wo deren blinder Fleck ist. Das Interpretieren von Symbolen ist ein Beobachten von Beobachtungsergebnissen – das Individuum kann zumindest erkennen, wo der eigene blinde Fleck war. Ich erfahre so etwas über die Welt und deren Beobachter, die Wahrnehmung wird komplexer – nicht nur bekomme ich mehr Informationen, sondern auch Informationen anderer Art« (Reemtsma 2001, S. 53f.). »Direkte Kommunikation über Realität ist dem Indikativ verhaftet, Kommunikation über Symbole führt, ebenso wie die Beobachtung zweiter Ordnung, die mich über die Standortgebundenheit jeder Beobachtung belehrt, den Konjunktiv ein […] Der Verlust der Symbolisierungsfähigkeit bedeutet, am Indikativ zu kleben wie der Vogel an dem Leim. Das
116
Teil II: Subjekt und Geschichte
kann dadurch geschehen, dass es die Wirklichkeit ist, die totalen Anspruch stellt […] Der totale Anspruch der Realität zerstört die Fähigkeit zu Metapher und Symbol, der totale Anspruch der Wirklichkeit tötet den Konjunktiv« (Reemtsma 2001, S. 56f.).
Sally Potter betonte, dass »The Tango Lesson« kein dokumentarischer Film sei, dass er auf ihren Erfahrungen beruhe, aber sich zwischen Realität und Fiktion befinde, und dass sie erschrocken sei über Leute, die alles im Film für real gehalten haben. Der Film steckt voller bekannter Klischees; er entfernt sich nicht sehr weit von Erfahrungen, die viele Paare kennen. Das Publikum lacht und schmunzelt in den humorigen Szenen beim Wiedererkennen von Paarkonflikten, und der Tango scheint schwungvoll über die Probleme hinweg zu tragen. Doch der Tango ist selbst traditionsreicher Ausdruck der Geschlechterspannung und hat es in sich. Jorge Luis Borges wird häufig mit der Charakterisierung zitiert: »The tango is a direct expression of something that poets have often tried to state in words: the belief that a fight may be a celebration« (so auch von Sally Potter in einem Interview). Und Sally Potter zelebriert den Kampf um Anerkennung vielschichtig in ihrem Produkt, dem Film, und als Autorin des Films, in dem sie in Personalunion Regisseurin, Schauspielerin, Tänzerin, Drehbuchautorin und Musikgestalterin ist. Darum ist in diesem Film, den wir als »simulierte Realität« sehen und erleben, vieles eine Mischung aus »fiction and feature«, in der wir das Beobachten beobachten können. Angesprochen auf ihre vielen Funktionen bei diesem Film, antwortete Sally Potter in einem Interview: »You’re wearing quite a lot of hats – you simply don’t sleep.« (Soviel zur Herstellung des Films als Sekundärprozess im Vergleich zum Traum als Primärprozess!) Diese Multifunktionalität der Künstlerin beeinflusst sicherlich das Filmerlebnis. Doch auf das Unterscheidungsvermögen der Zuschauerinnen und Zuschauer hat die Filmautorin wenig Einfluss. Der Film vermittelt einen Zusammenhang, nicht eine feste Ordnung, weder im Inhalt noch in der Rezeption.
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
117
■ Erweiterung des Wahrnehmungsvermögens Eine psychoanalytisch sensibilisierte Filmbetrachtung kann die Wahrnehmungsfähigkeit der Betrachter erweitern. Diese sind zu der ästhetischen Übung vielleicht deshalb bereit, weil sie Durchblicke für die Vielfalt der Wahrnehmung (wieder) gewinnen wollen, die im Alltag der Unterhaltung und Information zugeschüttet wird. Konzentrieren wir uns auf die augenblickliche Wahrnehmung des Films. Sie ist »eine Lektion, die sich nicht über die Disziplin des Bewusstseins vermittelt, sondern über die Disziplinlosigkeit des Fühlens, Wünschens und Träumens, der Phantasien, der Süchte und Sehnsüchte« (Programm der Kinothek Asta Nielsen, Frankfurt). Die Kamera ist dabei ein Übersetzungsmittel für eine vom Körper nicht zu trennende Geschichte des Films und seiner Rezeption. Dieses Programm der Kinothek Asta Nielsen folgt dem Projekt einer »Ästhetik des Kinos am Leitfaden der Liebe«, den Heide Schlüpmann, eine der Initiatorinnen der Kinothek, verfolgt: der »Liebe zur Wahrnehmung als Moment einer Theorie, die nicht identisch sein will mit der Wissenschaft« (Schlüpmann 1998, S. 18). Schlüpmann knüpft an die ästhetische Philosophie des 19. Jahrhunderts an (Schopenhauer, Nietzsche), die sich von der Liebe zur Weisheit weg- und der Liebe zur Wahrnehmung zuwendet. Die ästhetischen Philosophien reagieren auf das Schwinden von Wahrnehmungsfähigkeit in der Gesellschaft, wenden sich gegen eine Identifikation von Aufklärung mit der (empirischen) Wissenschaft. »Empirische Wissenschaft benutzt noch vorhandene Wahrnehmung, produziert aber keine neue. Nicht die pralle Unmittelbarkeit der Wahrnehmung, sondern die Abtrennung von der Wahrnehmung konstituiert daher die Liebe zur Wahrnehmung als Moment einer Theorie, die nicht identisch sein will mit der Wissenschaft« (Schlüpmann 1998, S. 18). Die Ästhetik des Kinos wird vom »naiven« Standpunkt der Liebe zur Wahrnehmung der Zuschauerin erfahren (freischwebende Aufmerksamkeit; naives Sehen). »Die scheinbare Naivität der Liebe dringt darauf, dass die über Filme hergestellte Unterhaltung nicht in der spielerischen Beherrschung der Bilder und virtuellen Realitäten aufgeht, sondern sich über den Film im Kino sinnliche
118
Teil II: Subjekt und Geschichte
und erinnernde Wahrnehmung reproduziert und zur öffentlichen Geltung bringt« (Schlüpmann 1998, S. 20) – zur öffentlichen Geltung bringt durch Sichtbarmachen, Wahrnehmbarmachen, Darstellen, anstelle von Verbalisieren, durch Gefühle, Bemerken, Vermissen, Erinnern, Erkennen. Um die Potenz, die im Sichtbarwerden und im Sichtbarmachen steckt, geht es auch in Sally Potters »The Tango Lesson«. Und auf diese weibliche Potenz trifft die Sehlust, die Schaulust, von der in der Analyse des Filmlebens die Rede ist: die orale Lust am Sehen; die Inkorporation durch das Auge; die Nähe der Bildersprache zum Primärprozess; die Schaulust als Bedürfnis nach mimetischer Weltaneignung (vgl. Lippert 1994; Zeul 1994). Von der Regression im dunklen Kino ist die Rede; vom gewollten Rückzug des Kinogängers von der Außenwelt; der Passivität und Anonymität im Dunkel des Kinosaals; von der Minderung der Realitätsprüfung in diesem Raum. Alle diese Haltungen werden vermutlich durch die vielseitige, omnipotente und omnipräsente Sally Potter irritiert, jedenfalls bei männlichen Zuschauern, doch nicht nur bei ihnen. Sie ist ein widerborstiges Objekt, das sich nicht so leicht inkorporieren lässt – das merkt auch Pablo –, und auch zur Identifikation bietet sie sich nicht umstandslos an. (An diesem Filmbeispiel wäre die These von Annegret Mahler-Bungers zu diskutieren, dass die simulierte Realität von Filmen Affekte der Bearbeitung zugänglich macht, die in der Realität nicht auszuhalten wären.) Die scheinbar simple Geschichte des Paars im Film hat Sally Potter pointiert: »Rather than boy meets girl and they fall in love, it’s director meets dancer and they fall in work.« Die ästhetische Leidenschaft beider, ihr Streben nach Perfektion in ihren Darstellungsformen und ihre erotische Begegnung führen keineswegs gradlinig zu einem künstlerischen Produkt. Die »Geschlechterspannung« produziert konflikthafte Subjekt-Objekt-Verhältnisse, in denen Sally sich müht, die Intersubjektivität und wechselseitige Anerkennung zwischen zwei Künstlern herzustellen. Im Medium des Films, im Schauen und Angeschautwerden, und des Tangotanzes, dem Führen und Geführtwerden, wird diese angestrebte Intersubjektivität symbolisiert.
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
119
■ Sichtbarmachen, Schauen und Angeschautwerden Das Bemühen der Regisseurin beschreibt Sally Potter: »We’re watching a film director thinking about imagining, struggling with how to turn what’s in her head into a film, how to move from looking, from the gaze, to beeing looked at«, wie sie vom Schauen, vom Blick zum Angeschautwerden kommen kann. Hier sei an eine feministische Filmtheorie aus den 1970er Jahren, Laura Mulveys Blicktheorie, erinnert. Es ging dabei vor allem um die Blick-Inszenierung im Film. »Es ist die Position des Blickes, die das Kino definiert, die Möglichkeit, den Blick zu variieren und sichtbar zu machen« (Mulvey 1980, S. 45). Mulvey analysiert ein bipolares System in den Filmen: Zwischen Schauspiel und Erzählung, zwischen Sehen und Gesehenwerden, zwischen dem aktiven männlichen Blick, der die Narration vorantreibt, und dem passiven weiblichen Blick als Objekt des begehrlichen Blicks des Mannes und der Erzählung. Die Frau ist dabei Trägerin von Bedeutung, aber sie schafft diese Bedeutung nicht selbst (wie z. B. Ingrid Bergmann als Analytikerin in »Spellbound«) (vgl. Lippert 1994, S. 1089). Die Debatte um »visuelle Lust und narratives Kino« und den »männlichen Blick« wurde – wie üblich unter Feministinnen – heftig geführt in den 1980er Jahren und kreiste um die vermeintlich starre geschlechtsspezifische Polarisierung (Vorwurf der Essentialisierung), nach der die Funktionen des Blicks und die Art der Schaulust aufgeteilt seien. Als Soziologin habe ich kein Bedürfnis nach Essentialisierung, doch ich betrachte die Auswirkungen sozialer Positionierungen von Frauen und Männern auf ihre Wahrnehmung und das Wahrgenommenwerden, auf ihr Selbstverständnis und ihre Handlungsspielräume und wie sie sich diese verschaffen. In unserem Filmbeispiel: als Regisseurin, Filmautorin einen Film über die eigene Arbeit und die Erotik darin zu machen. Ein Kritiker warf S. Potter vor, ihr Film sei selbstversessen und egozentrisch, selbstreferentiell und nicht für ein breites Publikum gemacht. Wenn man dies als Kritik gelten lassen wollte, gehörte dazu ein Bezug auf das soziale Feld, in dem die Regisseurin ihren Film macht und vorstellt, und auf die Geschlechterverhältnisse, in denen sie in diesem Film die Bedingungen ihrer künstlerischen Arbeit reflektiert.
120
Teil II: Subjekt und Geschichte
Ich greife die Blicktheorie noch einmal auf, um an die soziale Position, die darin festgehalten wurde, zu erinnern und die Perspektive darüber hinaus zu führen. Die Diskussion um die Blicktheorie stand zeitgenössisch im Zusammenhang mit dem vehementen Elan, mit dem die feministische Bewegung das Ende des Objektstatus von Frauen in ihren sexuellen Befreiungskämpfen als Ziel verfolgte. Barbara Sichtermann hat die Slogans der Frauenbewegung aus den Anfängen der 1970er Jahren (»Frauen zerreißt eure Ketten, Schluss mit Objekt sein in Betten, Frauen gemeinsam sind stark«) nach zehn Jahren sich vorgenommen und gefragt: Wenn das ehemalige Objekt nun frei ist, wie geht es weiter? Wie kommen die Frauen, die befreiten Objekte, dazu, selbst Objekte zu bilden? »›Objekte bilden‹ – das muss nicht gleich ein Bezwingen sein. Objekte können ja Widerstand bieten. Es heißt zunächst nur: sich selbst in ein aktives Verhältnis zur Welt setzen. […] ›Objekte bilden‹ hieße dann zugreifen, aneignen. Aber auch: Distanz herstellen, um zu beobachten, zu betrachten und um die Aufmerksamkeit wieder abzuwenden. Es hieße: den Gegenstand ergreifen, halten, etwas mit ihm machen, ihn loslassen, ihn ansehen, ihn beurteilen. Ein Prozess, in dem beide, Subjekt und Objekt, sich verändern können« (Sichtermann 1983, S. 71f.).
Es ist die »historische Schwäche« von Frauen, dass sie sich so schwer tun, Objekte zu bilden. »Das weibliche Begehren ›traut sich nicht‹, es greift zu kurz, und wenn es nicht weit vor- und ausgreifen kann, wenn es sich nicht aufbäumen darf, kann es sich nicht differenzieren, kann es sich nicht konzentrieren. Es wächst und wird doch nur am Objekt. Wenn das Objekt sich drückt, wird der Zugriff zag, die Phantasie bleibt kindisch und an Klischees gebunden« (Sichtermann 1983, S. 74). Wenn das Objekt sich drückt – in heterosexuelle Verhältnisse hineingefragt: »Wollen die Männer sich wirklich nicht begehren lassen? Sie wollen vielleicht schon, aber sie können selten. Hier haben sie jahrhundertelang nicht gelernt« (Sichtermann 1983, S. 75). Das Sich-zum-Objekt-machenLassen, als freiwilliger Part, setzt Mut voraus, sich dem anderen anzuvertrauen, »Hingabebereitschaft« in einem älteren Vokabular. (Es ist nicht das Gleiche, wie sich dem eigenen Begehren zu überlassen, Objekt der eigenen Begierde zu sein, Self-Sex zu prakti-
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
121
zieren.) In der Blicktheorie wird dieser Teil der kritisierten Geschlechterverhältnisse in der »Angst der Männer, weibliche Schaulust zuzulassen« (G. Koch, nach Lippert 1994, S. 1091) ausgemacht. Ich verwende diese Formulierung hier deskriptiv, ohne wie Gertrud Koch ihren Kontext in Freuds Theorie der frühkindlichen Bisexualität zu entfalten. »The Tango Lesson« hat viele Szenen, in denen das Schauen von Sally deutlich ausgestellt wird, beispielsweise wenn sie zum ersten Mal in das Lokal geht, in dem Pablo auftritt, und sie ihm, den Kopf auf die verschränkten Arme gestützt, zuschaut; in dem Tanzlokal in Buenos Aires, in dem sie den Paaren zuschaut, bis sie selbst aufgefordert wird (3. Lektion); in der 9. Lektion, als sie Pablo im Tanzlokal zuschaut, wie er mit seiner (Ex-)Partnerin tanzt; und ab der 10. Lektion, wenn das Filmprojekt in den Vordergrund tritt und sie den Tänzern, den Männern, beim Üben zuschaut und Anweisungen gibt. Bei dem ersten Treffen im Pariser Lokal sonnt sich Pablo noch in Sallys Blicken, in denen er die Bewunderung für ihn genießt. Bei dieser ersten Begegnung sagt sie zu ihm: »Sie haben die Anmut eines Engels.« (Ich wurde an den Schlusssatz der »Marquise von O.« erinnert, mit dem Heinrich von Kleist, der Dichter des Konjunktivs, die Wirren seiner Protagonistin zwischen Ohnmacht und Realitätstüchtigkeit enden lässt: »Er würde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht bei seiner ersten Erscheinung wie ein Engel vorgekommen wäre.«) Pablo wird die objektivierenden Blicke der Regisseurin noch kennenlernen. Er versucht, sich ihnen zu entziehen, versucht, Sally auf sich hier, unmittelbar, als der Mann vor ihr aufmerksam zu machen, er fühlt sich nicht wahrgenommen durch ihren Arbeitsblick. In der 12. Lektion, als es um die Vorbereitung des Films geht, in dem nach beider Verabredung Pablo die Rolle des Tänzers spielen soll, bewegt sich die Gruppe in einem großen leeren Friseursalon mit Spiegelwänden, Sally, Pablo und die beiden anderen Tangotänzer. Die beiden Freunde haben Sally auf einen Friseurstuhl gesetzt und tanzen für sie. Pablo sitzt abseits auch auf einem solchen Stuhl vor dem Spiegel und schweigt so laut, dass Sally zu ihm geht. Pablo: Schaust du mich an? Du bist eine Kamera geworden. Sally: Ich liebe dich durch meine Augen, meine Arbeit.
122
Teil II: Subjekt und Geschichte
Es fällt Pablo schwer, dieses Liebesangebot anzunehmen. Er hat das Angebot, in ihrem Film zu spielen, angenommen, weil er ein Filmstar werden möchte, die Darstellung seiner selbst reizt ihn. Doch die Arbeitsbeziehung, falling in work, scheint er nicht eingehen zu wollen. Es bleibt in der Erzählung des Films offen, ob das Filmprojekt zustande kommt. In der 11. Lektion gehen Sally und Pablo durch einen Park und streiten um ihre Rollen in Sallys geplantem Film. Sally: Ich muss führen, das erträgst du nicht. […] Sag: Ich bin ein Tänzer. Pablo: … das weißt du doch. Pablo weigert sich, von Sally, der Regisseurin, Anweisungen als Schauspieler anzunehmen. Sally beschreibt eine mögliche Szene, in der er sagen würde: Ich bin ein Tänzer und ein Jude, und eine Träne würde ihm über die Wange laufen. Pablo: … vielleicht habe ich keine Lust, eine Träne auf meinem Gesicht zu haben, vielleicht will ich gar nicht in deinem kleinen Film sein. Doch wir haben diese Szene in der 5. Lektion schon gesehen, wenn Sally und Pablo sich gegenüber sitzen und ihre Lebenseinstellungen austauschen. Wir sehen einen Film, den Sally Potter mit Pablo Veron gemacht hat. Wir schauen zu, wie sie als Sally und Pablo die Schwierigkeiten darstellen, Liebe und künstlerische (Zusammen-)Arbeit in einer erotischen Beziehung zu verbinden. Potters Spiel mit Fiktion und Realität, Dokumentarfilm und Spielfilm, einem Making-Of, das zugleich das Endprodukt ist, schubst uns Zuschauende in die Möglichkeit, das Beobachten zu beobachten, die allzu nahe liegende Identifikation mit dem Paar zu verlassen, um uns selbst beim Beobachten zu beobachten und mehr wahrzunehmen als die bekannten Paarkonflikte: eine Möglichkeit wechselseitiger Anerkennung in der Verschiedenheit. Neben dem Film und in dem Film, den wir sehen, ist der Tango die weitere künstlerische Domäne, in der unsere Wahrnehmungsfähigkeit in den Konjunktiv geführt wird.
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
123
■ Der Tango – Kampf und Feier Sally Potter inszeniert diesen höchst komplexen Paartanz als einen Tanz um Anerkennung; hier in dem Sinne gemeint, wie Jessica Benjamin Anerkennung in der psychoanalytischen Theorie der Intersubjektivität entfaltet hat. Das »Bedürfnis nach Anerkennung führt zu einem Paradoxon: In dem Augenblick, da wir unsere Unabhängigkeit erreichen, sind wir abhängig davon, sie uns gegenseitig zu bestätigen« (Benjamin 1990, S. 35). Es ist die reife Entwicklung weg vom (frühkindlichen) Zustand des monadischen Ich, des Zustands der Allmacht, in dem alles um mich her Erweiterung meiner selbst und meiner Macht ist. Jessica Benjamins Analyse des Verhältnisses von Autonomie und Anerkennung liest sich wie eine Beschreibung des Konflikts, durch den Sally und Pablo als Frau und Mann, als zwei Künstler gehen. »Die Autonomie entwickelt sich durch die Bestätigung der eigenen Fähigkeiten, andere durch sein Tun zu beeinflussen. Umgekehrt bestärkt fehlende Reaktion auf oder Unempfindlichkeit gegenüber den eigenen Handlungen […] ein Gefühl der Ohnmacht. Das eigene Gefühl für Wirkung wird durch eine gewisse Objektivierung der Absicht bestätigt, die vom Anderen und vom Selbst bewertet wird. Das heißt, dass menschliche Urheberschaft und Wirkung von intersubjektiver Anerkennung abhängen. Letztlich gipfelt die Notwendigkeit von Anerkennung in dem Paradox, dass man/frau vom Anderen abhängt, um seine/ihre Unabhängigkeit zu bestätigen. In dem eigenen Bemühen, Autonomie zu erlangen, bedarf man des Anderen, der den Wunsch nach Selbstbehauptung bzw. die Fähigkeit dazu anerkennen muss (oft verlangt der Wunsch oder die Absicht die stärkste Anerkennung). Kann dieses paradoxe Gleichgewicht zwischen Autonomie und Abhängigkeit nicht aufrechterhalten werden, so spalten sich die lebensnotwendigen Bedürfnisse« (Benjamin 1982, S. 439).
Ab der 4. Lektion, als Pablo Sally zum zweiten Mal – diesmal hellwach – zum Tangounterricht in seiner Wohnung empfängt, kommt Bewegung in den Film, bewegen sich Sally und Pablo aufeinander zu. Eine scheinbar zarte, blasse, ältere, englische Frau, Filmregisseurin, und ein junger, umschwärmter, machohafter, argentinischer Mann, Tänzer. Wie diese Stereotype so reiht Sally Potter jede Menge Szenen der üblichen Liebespaarkonflikte und der romantischen Annäherung auf. Die Dialoge sind oft holzschnittartig. (»Wie bist du zum Tango gekommen? – Ich bin nicht
124
Teil II: Subjekt und Geschichte
zum Tango gekommen. Der Tango ist auf mich gekommen.« 4. Lektion) Das Beeindruckende ist, wie Potter damit Sallys Kampf um Anerkennung darstellt, als Künstlerin, die sich nicht in einem Beziehungsclinch auf die Frau reduzieren lässt – was Pablo immer wieder versucht. Er agiert mehrmals so, dass er die Spannung des Anerkennungsverhältnisses, die wechselseitige Abhängigkeit in eine einseitige Unterwerfung oder Unterordnung umzubiegen sucht. Sally beobachtet ihn dabei, verletzt und traurig, aber nie zerstört. Sie zeigt ihm, dass sie seine kindlichen Zerstörungsversuche überlebt (i. S. von Winnicott). 7. Lektion. Pablo hat ihre gemeinsame Verabredung für die Silvesternacht vergessen, streunt durch einen Automatenspielsalon, während Sally vergeblich an seiner Wohnungstür klingelt. Später wird sie zu ihm sagen: Nein, ich bin nicht wütend – aber traurig. – Enttäuscht über seine egoistische, narzisstische Regression. Nach dieser Differenzierung durch Sally überrennt Pablo die von ihr hergestellte Distanz, indem er sie in ihrem Hotelzimmer aufsucht, wo sie im Bett liegt (8. Lektion). Er hält ihr in wohlbekannten Worten des »Beziehungsgesprächs« einen Vortrag darüber, dass sie ihre Beziehung klarer definieren sollten. Es sei gefährlich, Persönliches und Berufliches zu mischen; sie sollten ihre Anziehung in der Arbeit sublimieren. Und nach dem Satz: »Ich muss Abstand halten«, legt sich Pablo kindlich zusammengerollt neben Sally auf das Bett und schläft ein. Sally betrachtet ihn – schmunzelnd. Das vernünftige Programm von Pablo scheint für kurze Zeit zu tragen, doch es löst nicht das Problem, die emotionale Spannung der wechselseitigen Abhängigkeit, Angewiesenheit und Anerkennung zu ertragen. Dieses Problem wird im Film im erfolgreichen Auftritt des Paars auf der Bühne und dem anschließenden heftigen Krach in der Garderobe inszeniert (Ende 9. Lektion). Pablos Freundin und Tanzpartnerin hatte sich von ihm getrennt und Pablo hatte Sally, die inzwischen virtuos ihre Lektionen gelernt hat, gefragt, ob sie mit ihm auf der Bühne auftreten wolle. (Er fragt sie nach diesem gemeinsamen Auftritt, nachdem Sally ihm angeboten hat, in einem »eher persönlichen Film« über Tango mitzuspielen. Das Projekt »Rage« hat sie nach einem frustrierenden Gespräch mit Filmproduzenten in Hollywood aufgegeben. 6. Lektion)
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
125
Gerade weil sie gemeinsam erfolgreich waren auf der Bühne, scheut er vor der Anerkennung Sallys, der Anerkennung seiner Abhängigkeit von ihr für den fulminanten Auftritt, zurück. Er flüchtet sich in die diffuse Anerkennung von Fans und Bewunderern, Frauen und Männern, die in die Garderobe drängen, wendet sich von der konkreten Frau ab, versucht sie (wieder einmal) zu zerstören: »Du sollst folgen, einfach nur folgen. Du zerstörst meine Freiheit. So kann ich nicht tanzen.« Sally: Du warst nicht bei mir. Ich hatte dich verloren. Du warst mit denen da draußen! Wo bist du? Pablo: Ich bin hier! – vor dem Spiegel auftrumpfend. Sally verlässt das Theater allein, Pablo steckt im Pulk seiner Bewunderer. Die folgenden Streitdialoge am Telefon formulieren das Problem fast in theoretischer Sprache. Sally: »Warum hast du Angst vor mir? Du bist unfähig, mich anzuerkennen.« Nach dem Treffen unter dem Bild »Jakob kämpft mit dem Engel« kommt der Neubeginn. Sally und Pablo machen sich auf dem Weg nach Buenos Aires, seiner Heimat, um ihren Film vorzubereiten. Die explosive Konfliktszene des Films ist eng verwoben mit dem Tango. Die argentinische Geschichte dieses Tanzes, seine Symbolik der Paarbeziehung, die Körper in enger Bewegung miteinander, sind der Stoff des Films, an dem wir an der »Realität mehr wahrnehmen können als nur diese« (Reemtsma 2001, S. 53). Ähnlich wie Jorge Luis Borges – »The tango is a direct expression of something that poets have often tried to state in words: the belief that a fight may be a celebration« – beschreibt S. Potter in einem Interview den »Tango als Kampfkunst; Paarung; Meditation; wie tantrische Sexualität jenseits von Sex. Im Tanz geht es um Disziplin. Die wichtigste Lektion für Filmemacher: Disziplin. Organisation. Man verlässt sich nie auf Inspiration.« Die Texte des Tangos sind voll von den Klagen der Männer über die gescheiterte Liebe, über die extrem unzuverlässigen Frauen. Er ist die Darstellung machistischen Gebarens. Die Texte beklagen den verlassenen Mann, ein Opfer nicht nur der Frauen, sondern einer machistischen Kultur, die männliche Schwäche ständig demonstrativ übertrumpft. Die scheinbare Dominanz des Mannes in den Tanzfiguren verdeckt nicht die Angewiesenheit auf eine autonome Partnerin, erst recht nicht in den kunstvollen Choreografien
126
Teil II: Subjekt und Geschichte
(z. B. bei den Ganchos). Die Tango-Lehrerin und Psychoanalytikerin Lidia Ferrari aus Buenos Aires definiert diese Rollenverteilung als gegenseitige Vereinbarung zugunsten einer choreographischen Symbiose, die so lange dauert wie ein Tanz (vgl. Allebrand 1998, S. 71). In der Konfliktszene in der Garderobe beeilt sich Pablo, diese Symbiose nach dem Erfolg des Gesehenwerdens als Erster brutal aufzukündigen. Nach der Versöhnung ist Pablo bereit zu dem Versuch, Sally bei der Vorbereitung ihres Films zu folgen, mit den Sperren und Widerständen, von denen schon die Rede war. In Buenos Aires sind nun noch zwei Männer, Tangolehrer, bei den Übungen und Proben dabei. Die stilisierte Paarkonstellation des Tanzes wird dadurch aufgelöst, die Stereotype Geschlechterpolarität wird als Schaustellung sichtbar. In den Tangoschulen lehren Männer Männern die Schritte und lernen auch den weiblichen Part des Tanzes. Sie führen deshalb so gut, weil sie auch den geführten Part kennen. Die schönste Szene des Films ist für mich die, in der in der 11. Lektion Sally und die drei Männer zu Astor Piazollas »Libertango« raumgreifend durch eine weite, leere Hotelhalle tanzen und die Paarkonstellation zugunsten eines Tanzes der Gruppe aufgelöst wird. Die Kameraführung von Robby Müller, der auch mit Wim Wenders arbeitet, entspricht dem Tango. Seitliche Kamerafahrten begleiten die Tänzer durch den Raum. Schnittfolgen übernehmen den Rhythmus des Tango: von der Totalen zu den Köpfen, den Oberkörpern, den Beinen und Füßen. (Eine Tanzszene des Films ist ungeschnitten in einer Einstellung gedreht: die Abschiedsszene auf dem Flughafen, als Sally nach Hollywood fliegt, in der 5. Lektion. Auf den Laufbändern umtanzt Pablo Sally, ein kindliches Spiel gegen die Richtung der vorwärtsrollenden Bänder, romantische Gesten des Abschieds in einer unromantischen Umgebung.) Sally Potter führt ihre zwölf Lektionen zu einem Schluss, der die Einheit des Paars besingt »One is one and one are two. You are me, I am you.« Die Metapher für den Prozess der Auseinandersetzung wird im romantischen Tanz am Flussufer in dem Ausdruck festgehalten, in dem der Tango nicht Kampf, sondern – zeitweilig – Form der ausgesöhnten Geschlechterspannung ist.
C. Eckart · Notizen zu Sally Potters »The Tango Lesson«
127
■ Literatur Allebrand, R. (1998): Tango. Nostalgie und Abschied. Psychologie des Tango Argentino. Bad Honnef. Aravena, J. (1989): El Tango und die Geschichte von Carlos Gardel. Berlin. Benjamin, J. (1982): Die Antinomien des patriarchalischen Denkens. Kritische Theorie und Psychoanalyse. In: Bonß, W.; Honneth, A. (Hg.): Sozialforschung als Kritik. Frankfurt a. M., S. 426–455. Benjamin, J. (1990): Die Fesseln der Liebe: Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. Basel u. Frankfurt a. M., S. 34ff. Lippert, R. (1994): »Ist der Blick männlich?« Texte zur feministischen Filmtheorie. Psyche – Z. Psychoanal. 11: 1088–1099. Mulvey, L. (1980): Visuelle Lust und narratives Kino. In: Nabakowski, G.; Sander, H.; Gorsen, P. (Hg.): Frauen in der Kunst. Band 1. Frankfurt a. M., S. 30–46. Reemtsma, J. P. (2001): Was wird aus Hansens Garten? Gedanken über den fortschreitenden Verlust an Symbolisierungsfähigkeit. In: Libeskind, D.; Reemtsma, J. P.; Sennett, R. u. a.: Alles Kunst? Wie arbeitet der Mensch im neuen Jahrtausend, und was tut er in der übrigen Zeit? Reinbek, S. 37–75. Reichardt, D. (1984): Tango. Verweigerung und Trauer. Kontexte und Texte. Frankfurt a. M. Reiche, R (2001): Postfeministische Kunst – ein männlicher Blick. In: dies.: Mutterseelenallein. Kunst, Form und Psychoanalyse. Basel u. Frankfurt a. M. Schlüpmann, H. (1998): Abendröthe der Subjektphilosophie. Eine Ästhetik des Kinos. Basel u. Frankfurt a. M. Sichtermann, B. (1983): »Von einem Silbermesser zerteilt –« Über die Schwierigkeiten der Frauen, Objekte zu bilden und über die Folgen dieser Schwierigkeiten für die Liebe. In: Sichtermann, B.: Weiblichkeit. Zur Politik des Privaten. Berlin, S. 70–80. Tasker, Y. (Hg.) (2002): Fifty Contemporary Filmmakers. London, S. 272–280. Zeul, M. (1994): Bilder des Unbewussten. Zur Geschichte der Psychoanalytischen Filmtheorie. Psyche – Z. Psychoanal. 11: 975–1002. Diverse Interviews mit Sally Potter aus dem Internet, u. a. Augusta Palmer, Seven Questions with Sally Potter of »The Tango Lesson«. http://www.indiewire.com/people/int_Potter_Sally
■ Marianne Leuzinger-Bohleber
Überlegungen zu Constantin Costa-Gavras’ »Music Box«
■ Einführende Bemerkungen Der Film »Music Box«, den Constantin Costa-Gavras 1989 drehte, unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den anderen Filmen, die in diesem Band diskutiert und analysiert werden. James Monaco (1996) bezeichnet Costa-Gavras als politischen Regisseur. Wenn wir »Music Box« mit anderen politischen Filmen, beispielsweise »Der Untergang« von Bernd Eichinger oder »Das Leben ist schön« von Roberto Begnini vergleichen, fallen uns einige charakteristische Unterschiede auf. Costa-Gavras stellt zwar, wie die beiden anderen Regisseure auch, die politisch-historische Aufklärung ins Zentrum seiner filmischen Intention, doch versucht er nicht – wie Bernd Eichinger – ein Stück Geschichte so realistisch wie möglich zu gestalten. (Übrigens, wie mir scheint, ein höchst problematischer Versuch. Hitler kann man nicht »nach-spielen« lassen, auch nicht von einem noch so begabten Schauspieler wie Bruno Ganz.) Costa-Gavras geht auch nicht vor wie Begnini, der in seinem berührenden Film mit den narrativen und künstlerischen Mitteln eines Spielfilms ebenfalls eine aufklärerische Annäherung an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte versucht.1 Dagegen kommt uns Psychoanalytikern das detektivische, schonungslose und doch gleichzeitig sensible, vorsichtige Suchen nach Wahrheit in Costa-Gavras »Music Box« merkwürdig bekannt vor. Findet im Film ein psychoanalytischer Prozess im öffentlichen 1 Nach Micha Brumlik (mündliche Mitteilung) ist auch dieser Versuch insofern problematisch, als er durch die Kreativität, den Phantasiereichtum und den Humor des Protagonisten zu einer Verharmlosung des Holocaust beitragen könnte.
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
129
Raum statt? Auch Filme von Ingmar Bergman wurden – etwa von Gerhard Schneider und Gabriele Witt-Schneider (2003) mit einem psychoanalytischen Prozess verglichen. Doch im Gegensatz zu Bergman (z. B. in »Wilde Erdbeeren«) verzichtet Costa-Gavras auf viele filmische Mittel wie Retrospektion, Darstellung von Phantasien oder surrealistische Elemente: Er konzentriert sich in einer vielleicht bezüglich filmästhetischer Kriterien fast schlichten Weise auf eine zeitlich chronologische Indizienanalyse bei der Suche nach Wahrheit. Constantin Costa-Gavras, ein Sohn eines politisch verfolgten griechischen Anarchisten, hat sein Werk fast ausschließlich politischen Themen gewidmet, vor allem den Auswirkungen terroristischer Regime in Griechenland (»Z«), der Tschechoslowakei (»Das Geständnis«), Uruguay (»Der unsichtbare Aufstand«), der Nazibesetzung im Vichy Frankreichs (»Sondertribunal: Jeder kämpft für sich allein«), Chile (»Vermisst«) oder dem propalästinensischen Film »Hanna K.«. Er stützt sich in seinen Filmen auf detaillierte Quellenanalysen historischer Daten. Er verzichtet auf jede von der Suche nach historischer Aufklärung wegführenden filmästhetischen Brillanz: Nichts soll den Zuschauer von dem schwierigen, existentiellen Prozess der Wahrheitssuche ablenken, nichts ihn von der Frage nach dem Warum, von Verleugnung, Verneinung, Abspaltung und paranoider Abwehr von Schuld, Scham und Trauer abbringen oder gar eigene mentale Fluchttendenzen unterstützen – eine fast erbarmungslose Konfrontation mit dem Bösen, allerdings durch die filmische Qualität der Bilder und die liebevolle anteilnehmende Darstellung der Menschen und Landschaften gleichzeitig emotional gehalten. Eine holding function als Voraussetzung, dem Horror ins Auge zu schauen? Eine Einsicht, die Regisseur und Psychoanalytiker teilen? Bekanntlich können realistische Gestaltungen des Schreckens und des Unvorstellbaren leicht misslingen, doch denke ich, dass die vielen Preise, die Costa-Gavras gerade für die Kameraführung und die beste Regie erhalten hat, gerechtfertigt sind: »Music Box« ist trotz der realistischen Qualität ein filmisches Meisterwerk. Der Drehbuchautor von »Music Box«, Joe Eszterhas, ließ sich durch einen Prozess zu Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus inspirieren. John Demjanjuk, der in der Ukraine gebo-
130
Teil II: Subjekt und Geschichte
ren worden war, arbeitete als Automechaniker in einer Firma in Ohio. Er wurde beschuldigt, der berüchtigte »Iwan der Schreckliche« von Treblinka zu sein. Der Prozess stieß auf großes öffentliches Interesse. Joe Eszterhas verfolgte die Zeugenvernehmung, die Argumentationen des Verteidiger und des Staatsanwalt sowie die Reaktionen der Publikums und der Öffentlichkeit mit großem Interesse. Der Film »Music Box« zeigt mindestens drei gleichzeitige Dramen, die sich im Gerichtssaal vollziehen: – Das Drama eines Prozesses über die unvorstellbaren Greueltaten, um die es bei der Anklage geht, erhält durch die Rituale einer Gerichtsverhandlung eine merkwürdig irreale Qualität. – Das Drama für den Angeklagten, seine Familie und seine Freunde entfaltet sich im Gerichtssaal. Intimste Beziehungsphantasien und -realitäten werden dadurch an das Licht der Öffentlichkeit gezerrt und dort entlarvend inszeniert. – Das ursprüngliche Drama der Verfolgung wird durch die Zeugenaussagen in kleinsten Details rekonstruiert. Da das sukzessive Enthüllen der Wahrheit sowie die damit verbundenen Abwehr- und Suchprozesse für die Zuschauer auf Anhieb verständlich sind, erübrigt sich eine psychoanalytische Betrachtung weitgehend: »Music Box« zieht den Zuschauer in Bann und lässt ihn identifikatorisch an der sich entwickelnden Dynamik, dem Auf und Ab der Emotionen, der Erleichterung bei der Stabilisierung der Abwehr und dem Entsetzen bei ihrem Zusammenbruch – bei der Konfrontation mit dem Unvorstellbaren, Unerträglichen teilhaben und Anns unauflösbaren Konflikt, bedingt durch ihre Liebe zu ihrem Vater und dem Entsetzen über seine Verbrechen und ihre Verleugnung, nacherleben. Der Film teilt sich dem Zuhörer direkt mit: Er braucht keinen nachträglichen Interpreten, auch nicht einen psychoanalytischen. Lassen Sie mich dennoch mit einigen Überlegungen und Anregungen zu erläutern versuchen, warum mich der Film an einen »im öffentlichen Raum stattfindenden psychoanalytischen Prozess« erinnert und warum ich überzeugt bin, dass wir als Zuschauer und als klinisch tätige Psychoanalytiker neue Einsichten aus dem Film gewinnen beziehungsweise schon Bekanntes wiederent-
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
131
decken und vertiefen. Ich möchte mich auf drei Punkte beschränken: – Die Suche nach individueller und historischer »Wahrheit«: Wahrhaftigkeit und Erinnerung Der Film gestaltet einen Prozess der schmerzlichen Annäherung an historische und narrative Wahrheiten, von wiederkehrender Abwehr und dem Mut zum Hinschauen, ein Ringen um Erinnerung und Gedächtnis. – Der Kampf um Identität und Selbst Die Protagonistin kämpft um Identität und Selbst, um eine Externalisierung von malignen Introjekten und Identifikationen als Voraussetzung eines wahren, selbstreflexiven Selbst. – Die »Bestie« und die transgenerative Weitergabe von Schuld, Scham, Verbrechen und unbewussten Phantasien Dieser Selbst- und Identitätsfindungsprozess geschieht in einem Telescoping dreier Generationen, deren Schicksale ineinander geschoben sind (Faimberg 1987). Abgewehrte Schuld und Scham werden unbewusst an Kinder und Enkel weitergegeben (Cournut 1988). Wie vollzieht sich dieser unbewusste Prozess? Welche Folgen hat er, und wie kann er in seiner unheimlichen Wirkung erkannt und relativiert beziehungsweise unterbrochen werden? Doch zuerst noch eine kurze Zusammenfassung des Inhalts von »Music Box«. Der vor 40 Jahren in die USA emigrierte Ungar Mike Laszlo wird grausamer Kriegsverbrechen während der Nazi-Zeit beschuldigt. Ihm droht die Abschiebung. Seine Tochter Ann, eine erfolgreiche Anwältin, glaubt fest an seine Unschuld. Sie übernimmt die Verteidigung ihres Vaters und kämpft leidenschaftlich für seine Rehabilitation. Dank ihrer geschickten Prozessführung erwirkt sie einen Freispruch. Erst eine Music Box, die sie für einen Bekannten ihres Vaters im Pfandhaus einlöst, bringt die schreckliche Wahrheit ans Licht: Ann muss erkennen, dass der Mensch, den sie liebt, ein Monster ist …
132
Teil II: Subjekt und Geschichte
■ Die Suche nach individueller und historischer »Wahrheit«: Wahrhaftigkeit und Erinnerung »Wahrhaftigkeit und Erinnerung« waren schon immer zentrale Begriffe der Psychoanalyse. Freud hielt – trotz aller Modifikationen seiner Theorien im Lauf seines wissenschaftlichen Lebens – daran fest, dass es das zentrale Ziel einer analytischen Behandlung sei, verdrängte Erinnerungen an die lebensgeschichtliche Frühzeit mit ihren ungelösten frühkindlichen Konflikten und Phantasien ins Bewusstsein zu heben. Entscheidend war seine Entdeckung der Übertragung, in der der Analysand sich nicht bewusst an eine bestimmte Kindheitserfahrung erinnert, sondern sie stattdessen in der Beziehung zum Analytiker wiederholt und wieder erlebt. Das sukzessive Bewusstwerden dieses Agierens in der Übertragung wurde neben der Analyse von Träumen, Fehlleistungen und Fehlhandlungen und von neurotischen Symptomen zum »neuen Königsweg zum Unbewussten«. In vielen Szenen von »Music Box« erkennen wir eine Inszenierung von Unbewusstem anstelle von direkten Erinnerungen. Der Film ist, nebenbei erwähnt, eine meisterhafte Darstellung einer aktuellen Kontroverse innerhalb der Psychoanalyse und der Frage, welche Rolle rekonstruierte, historische Wahrheiten für psychoanalytische Prozesse spielen verglichen, mit narrativen Wahrheiten, die in der Übertragung inszeniert werden. Während ich-psychologische Autoren immer an der therapeutischen Wirksamkeit von Erinnerung und Rekonstruktion festhielten, bezweifelten neuere Objektbeziehungstheoretiker nach der narrativen Wende der Psychoanalyse zunehmend die Bedeutung rekonstruktiver Deutungen für den Veränderungsprozess des Analysanden. Wie unter anderem Donald Spence (1982) in den 1980er Jahren postuliert hat, kommen wir auch in langen Psychoanalysen nie direkt in Kontakt mit der historischen Realität: Stattdessen werden »Wahrheiten« stets in einem Narrativ eingebunden und daher in einer aktuellen Interaktionssituation »konstruiert«. Daher konzentrieren sich manche heutigen Analytiker, besonders Kollegen, die sich der kleinianischen Richtung verbunden fühlen, fast ausschließlich auf das Verstehen und Durcharbeiten von internalisierten Objektbeziehungen im Hier und Jetzt der Übertragung
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
133
und Gegenübertragung. Auch lebensgeschichtliche Erinnerungen werden vor allem in Bezug auf aktuelle Übertragungsphänomene verstanden und interpretiert. Für den therapeutischen Prozess haben sie ihre Bedeutung weitgehend eingebüßt. Interessanterweise haben vor allem Analytiker, die mit schwer traumatisierten Patienten arbeiten, gegen eine solche Relativierung historischer Wahrheiten protestiert, da sich bei diesen Patienten eine Annäherung an die »Realität« erlittener Traumatisierungen, an die »objektive historische Wahrheit«, als unverzichtbar für den therapeutischen Prozess und eine Linderung der durch das Trauma erlittenen psychischen Zerstörungen erweist. Sie halten daran fest, dass in psychoanalytischen Behandlungen sowohl die sorgfältige Analyse der narrativen Überarbeitungen von erlittenen Traumatisierungen in der therapeutischen Beziehung als auch die sukzessive Annäherung an die eigene Biographie notwendig sind. »Denn erst die Verbindung mit der Erinnerung an die Vergangenheit verschafft der Unmittelbarkeit des Übertragungserlebens und seiner therapeutischen Aufdeckung eine reflexive Tiefe und ein nachhaltiges heilsames Verstehen, das zu einem Zuwachs an seelischer Kontinuität und Integration führt« (Bohleber 2003, S. 787). Besonders eindringlich haben Laub und Auerhahn (1984) diese Überzeugung, basierend auf Erfahrungen mit »Testimonies« von Holocaustüberlebenden, beschrieben. Oft ist es für die Opfer der Shoah ein Leben lang nicht möglich, eine therapeutische »Heilung« der Symptome zu erleben, die sie an Erfahrungen an jene Orte erinnern, wohin, wie Hans Keilson (1979, 1989) es ausdrückte, »die Sprache nicht hin reicht«. So antwortet Herr Boday, der zweite Zeuge im Prozess, auf die Frage, ob er sich an Mishka erinnere: »Ich sehe ihn seit 40 Jahren jede Nacht, wenn ich die Augen schließe.« Alpträume, Flashbacks und psychosomatische Symptome ketten die Opfer von Extremtraumatisierungen oft lebenslang an die traumatische Vergangenheit: Die Bilder des Schreckens und »des Bösen« lassen sich nicht aus ihrem Bewusstsein verdrängen – sie werden zu ständigen Mahnmalen des Zivilisationsbruchs (Adorno). Analog zu den Erfahrungen mit Testimonies illustriert Herr Boday, dass oft nur durch den Versuch, der Öffentlichkeit und nachrückenden Generationen wenigstens eine Ahnung von dem Unvorstellbaren zu vermitteln, »was Menschen Menschen antun kön-
134
Teil II: Subjekt und Geschichte
nen«, ansatzweise ein Sinn der eigenen Existenz zurückgewonnen werden kann. »Was können Sie mir antun. Ich bin ein alter Mann, Ich habe keine Familie. Niemand kann mir was antun …« sagt Herr Boday. Aus dem hilflosen Opfer wird in dieser Szene ein Mann, der seine Würde wiedergewinnt, indem er den Mut aufbringt, sich dem Täter entgegenzustellen, ihm ins Gesicht zu schauen (der dritte Zeuge weicht angstvoll diesem Blick aus). Als unersetzbarer Zeuge trägt er zur Wiederherstellung von Recht und Wahrheit bei. Die letzte Zeugin schleudert dem Peiniger Mishka ihre Verachtung entgegen, indem sie ihm ins Gesicht spuckt. Doch zeigt die Gerichtsszene auch, wie traumatisch es für diese Zeugen sein kann, wenn sie durch kriminelle Techniken, wie sie Ann mit Hilfe ihres Schwiegervaters verwendet, erneut zu Opfern statt glaubhaften Zeugen und Anklägern werden. Ihr Schwiegervater hat unter anderem den Naziverbrecher Barbi verteidigt und sagt zu ihm und anderen Verbrechern: »Wir mussten mit den Nazis zusammenarbeiten. Keiner von den Männern, die ich kannte, war ein Monster, alles waren grundanständige Menschen, genauso wie dein Vater …«. Eine solche Relativierung humanistischer Grundwerte, eine Verwischung zwischen Tätern und Opfern, bedeutet für die Opfer eine erneute Traumatisierung, da für sie damit ein basales Vertrauen in Recht und Unrecht, in eine humane Welt mit klaren, eindeutigen Regeln nochmals zusammenbricht. Wir wissen auch aus Psychoanalysen, dass es nicht ausreicht, wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Intimität der analytischen Beziehung thematisiert werden. Costa-Gavras gestaltet diese Einsicht, nämlich dass nicht nur, aber besonders Verbrechen, die durch Vertreter von öffentlichen Institutionen oder terroristischer Regimes ausgeführt werden, im öffentlichen Raum thematisiert und – durch ein offizielles Gericht – klar verurteilt werden müssen. Dazu gehört auch ein wahrhaftiges Anerkennen der historischen Realitäten und der klaren Grenzen zwischen Opfern, Tätern und Mitläufern. Bekanntlich wurde immer wieder die »Wahrhaftigkeit« von Erinnerungen der Opfer an Verbrechen relativiert oder sogar grundsätzlich in Frage gestellt, nur weil sie narrativ überarbeitet waren und nicht im Sinne einer Eins-zu-einsRelation historischen Fakten entsprachen. So erhielten manche Überlebenden des Holocaust in den 1950er Jahren keine Wieder-
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
135
gutmachung durch den deutschen Staat, weil sie sich bei der Schilderung in Widersprüche verwickelten (z. B. eine historisch falsche Anzahl der Kamine der Vernichtungsöfen in Auschwitz nannten …). Ann versucht mit allen nur erdenklichen Methoden die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage zu stellen, beispielsweise indem sie den Zeugen, zu dem das Gericht nach Ungarn fliegt, als chronischen Lügner entlarvt, nur weil er – aus welchen psychologischen Gründen auch immer – von der Suche nach Mishka innerlich besessen ist und daher immer wieder glaubt, ihn gefunden zu haben. Es bleibt zudem offen, ob er erneut ein Opfer von Verleumdungen und Aktenfälschungen geworden ist. Auch den dritten Zeugen bringt Ann dazu, öffentlich einzugestehen, dass er soeben gelogen hat, weil er verschwieg, dass ihn letzte Nacht Herr Boday aufsuchte, um ihn nach Details der Ermordung seiner Familie zu fragen. Doch, wie die Kamera meisterhaft einfängt, bezeugt die Körpersprache, der Blick des Zeugen auf den Täter Mishka, dennoch die Wahrheit.
■ Das unendliche Leiden der Opfer und das scheinbar störungsfreie Leben der Täter In der psychoanalytischen Fachliteratur der letzten Jahrzehnte befassen sich viele Autoren mit der irritierenden Beobachtung, dass Opferfamilien offensichtlich bis ins zweite und dritte Glied unter der Folgen der erlittenen Extremtraumatisierungen leiden, an Flashbacks, Alpträumen, psychosomatischen Störungen, einer Unfähigkeit, tiefe menschliche Beziehungen einzugehen, weil das Grundvertrauen in das Selbst und den Anderen irreparabel zerstört worden ist. Dagegen scheinen die Täter auf den ersten Blick ein ungestörtes, »normales« Leben zu führen: Als Mishka öffentlich aufgrund eines Zeitungsberichts als Täter erkannt wird, wiederholt er in stereotyper Weise: »Ich arbeite im Hüttenwerk, ich ziehe meine Kinder hoch. Ich bin Amerikaner …«. So beginnt der Film mit einem »ganz normalen Familienfest«, einem scheinbar lustvollen, unbeschwert wirkenden Tanz von Ann mit ihrem Vater. Die Kamera bleibt lange auf das Gesicht von Ann
136
Teil II: Subjekt und Geschichte
fixiert – ein Bild der ödipalen Verführung und der narzisstischen Grandiosität? Auch Mishka scheint in den erotischen Tanz mit seiner Tochter versunken zu sein. Doch spiegeln sich wirklich Stolz und zärtliche Zuwendung in seinem bewegungslosen Gesicht, das keine mimischen Veränderungen zeigt? Die Kamera fixiert seinen merkwürdig leeren Blick (der gleiche Blick fiel mir später während der Zeugenaussagen gegen ihn im Gerichtssaal auf). Plötzlich wendet er sich abrupt ab – kalt und unberechenbar lässt er seine Tochter stehen – eine erste präzise Analyse seiner Empathiestörung und narzisstischer Pathologie. Die ersten gesprochenen Sätze: »Die ist hübsch, die Anwältin … Ja, das ist sie. Ihr Bruder soll ein Idiot sein, hoffentlich ist sie nicht so …« verraten die tiefgehenden Identitätsstörungen in der scheinbar heilen, strahlenden Familie: Die Anwältin, viel bewundert, schön und erfolgreich, verkörpert den einen, positiven und idealisierten Teil der Familie – der Bruder den versagenden, primitiven und vom Vater verachteten und entwerteten (vgl. spätere Kochszene2). Der wilde Tanz zwischen den Geschwistern verrät zudem die brutale, kaum sublimierte, inzestuös anmutende sexuelle und aggressive Dynamik in der Familie des Täters, die sich wie ein roter Faden durch den Film zieht: der schlagende Vater bei der TVFilmszene, körperlich übergriffige Umarmungen von Ann durch ihren Bruder, aber auch den tätlichen körperlichen Angriff von Ann auf den Staatsanwalt, als er mitfühlend sagt: »Sie urteilen mit dem Herzen. Es wird Ihnen gebrochen werden.« Er bietet ihr sogar an, eine Verschiebung des Prozesses zu beantragen, bis ein anderer Anwalt gefunden ist. Ann weist sein Mitgefühl brutal zurück. »Sie können mich mal … Er kommentiert verletzt: »Gewalt liegt wohl in der Familie … Wie der Vater, so die Tochter …« So scheut Ann auch vor keinen Mitteln zurück, um den Prozess zu gewinnen: Sie beschattet illegal die Zeugen in ihrem Hotel, hört ihre Telefongespräche ab, lügt den Richter an, indem sie sagt, sie habe das abendliche Treffen der beiden Zeugen erraten. Sie lädt den Staatsanwalt zum Essen ein, um ihn an seiner wundesten Stelle, dem tödlichen Unfall seiner Frau, zu treffen und ihn vor der Verhandlung psy2 In dieser Szene stellt Mishka seinen Sohn offen als Versager dar und demütigt ihn, während er seine Tochter idealisiert und bewundert.
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
137
chisch zu verwirren oder sogar schachmatt zu setzen. Sie sucht die Hilfe ihres korrupten Schwiegervaters (von dessen skrupellosen Anwaltspraktiken sie sich früher abgesetzt hatte), um durch den Hinweis auf »Harlekin« den Verdacht glaubhaft zu belegen, der Pass ihres Vaters sei durch den ungarischen Geheimdienst gefälscht worden. Dies alles sind Indikatoren für die unbewussten Identifikationen von Ann mit dem korrupten und sadistischen Über-Ich ihres Vaters: Alle Mittel sind ihr recht, um auf der Seite von Macht und Erfolg zu stehen und die Schuld ihres Vaters nicht sehen und wahrhaben zu wollen. Wer würde bei einer so strahlenden, schönen Frau solche Identifikationen vermuten? Ann wird, wie in einer Psychoanalyse, im Fortgang des Films immer wieder mit diesen unbewussten Identifikationen und Introjektionen und der Abwehr von Schuld und Scham konfrontiert. Der Staatsanwalt übernimmt dabei oft die Rolle des konfrontierenden Analytikers: Er spiegelt ihr seine Reaktionen, man könnte sie oft Gegenübertragungsreaktionen nennen, gesteht ihr aber auch seine anfängliche Sympathie, wohl der Grund, warum er sie schließlich überhaupt dazu bewegen kann, »in den Fluss zu schauen …«
■ Der Kampf um Identität und Selbst Ann sieht ihrer Mutter sehr ähnlich. Wer war diese Frau, die Mishka in einem österreichischen Flüchtlingslager kennenlernte und die so früh starb, das heißt, im jetzigen Alter von Ann, wie Mishka seiner Tochter in der Szene auf dem Friedhof, beim Besuch am Grab der Mutter, gesteht. Gern möchte man als Zuschauer glauben, dass es sich um ein zärtliches, zugewandtes Trauern handelt – doch bleibt ein merkwürdiges Gefühl: Auf den zweiten Blick wird ersichtlich, dass die Szene gestellt und unecht wirkt. Das Gesicht von Mishka zeigt keine Affekte, spiegelt wiederum die innere Leere und Kälte wie der Schnee, der auf dem Grab liegt. Auf ausdrücklichen Befehl des Vaters schmiegt sich Ann schließlich an ihn – ihre Suche nach Wärme und empathischem Verstandenwerden
138
Teil II: Subjekt und Geschichte
wird vom Vater missbraucht. Mishka vermittelt – bewusst und strategisch – seiner Tochter ein idealisiertes Bild seiner Beziehung zu seiner Frau. An vielen Stellen des Films finden sich Hinweise, dass auch in der ehelichen Beziehung vieles nicht stimmte. Als Zuschauerin entstand in mir die Phantasie, dass er mit der Idealisierung seiner Frau seine brutale sexuelle, vielleicht mörderische Beziehung zu ihr abwehrt. War seine Frau eine Jüdin? Hat er sie ebenso umgebracht wie Zoltán, als die Gefahr bestand, dass sie die historische Wahrheit ans Licht bringt? Der Film lässt dies offen. Aus klinisch-psychoanalytischen Erfahrungen wissen wir, dass gerade in den intimen sexuellen Beziehungen Kontinuitäten bestehen: sadistische, perverse Befriedigungsmodalitäten brechen in die Imtimbeziehungen ein oder müssen, beispielsweise durch eine rigide Spaltung zwischen sexueller und zärtlicher Beziehung, auf außereheliche Beziehungen gerichtet werden (vgl. Verachtung für die Zigeuner, Schlampe etc.). So scheint es nicht zufällig, dass die letzte Zeugin, die von den brutalen Vergewaltigungen und Misshandlungen berichtet, den Zusammenbruch von Mishka auslöst. Die Konfrontation mit der detaillierten Schilderung der historischen Wahrheit evoziert sprachliche Verleugnung und Verneinung, die wie eine schemenhafte, leere Wiederholung anmutet, eine Hülle seiner eingeübten Versuche, seiner Umwelt seine Unschuld zu beweisen. Der Körper jedoch – in seinem psychosomatischen Zusammenbruch – konstruiert die Erinnerungen und bestätigt die Wahrheit! Mishka ist – bis zum Schluss – entgegen den Erwartungen und Hoffnungen des Zuschauers – nicht in der Lage, zu den verbrecherischen Taten seiner Vergangenheit zu stehen: Seine Täteridentität wird durch ein korruptes Über-Ich gerechtfertigt, Spuren der nationalsozialistischen Ideologie, des Rassenwahns (die schwarze Anwältin bezeichnet er als »Schlampe«) und des Antisemitismus (»Wolltest du im Studium mit Juden was zu tun haben?«) und des paranoiden Verfolgungswahns (vgl. u. a. Kommunistenhass) sind ungebrochen. Costa-Gavras gestaltet eindringlich die für uns alle immer wieder kaum vorstellbare hermetische Schuldabwehr von Extremtätern. Die Nürnberger Prozesse, der Eichmann-Prozess in Jerusalem sowie Autobiographien von R. Höss oder auch A. Speer lehrten uns die schwer psychisch zu akzeptierende Lektion, dass
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
139
Extremtäter kein Schuldbewusstsein entwickeln, sondern sich – auch bei der Konfrontation der schlimmsten Taten und des furchtbaren Leidens der Opfer – immer noch im Recht fühlen. Sie halten an ihrer Ideologie fest, rechtfertigen Rassenwahn und Antisemitismus oder bezeichnen sich nur als Ausführende von Befehlen. Die eigene Verantwortung wird weit von sich gewiesen. Der Großteil der seelischen Energie scheint dafür verwendet zu werden, an ihrer Rechtfertigung festzuhalten oder, falls sie noch nicht gefasst wurden, in raffinierter Weise die Geheimnisse ihrer Vergangenheit zu verstecken. Viele der Nazitäter lebten, wie Mishka, in den USA, in Südamerika oder anderen Ländern ein »normales« Leben und bauten sich als Tarnung eine zweite Identität unter falschem Namen mit einer aktiv gefälschten Lebensgeschichte auf. Ihre Vergangenheit war aber nicht abgespalten oder dissoziiert: Die Täter wussten immer um ihre Verbrechen, eine Voraussetzung, um die raffinierte Tarnung durchzuhalten und die Täteridentität vertuschen zu können. Diese Mechanismen waren daher Teil ihrer Überlebensstrategie. Eine ansatzweise Einsicht in die eigene Schuld würde – wie die Gerichtsszene illustriert – zu einem psychischen oder psychosomatischen Zusammenbruch führen. In Mishkas Kommunistenhass lebt der bolschewistische Feind des Nazis ungebrochen weiter – getarnt als amerikanischer Patriotismus des Kalten Krieges. Von seiner Tochter kann er als »mutiger, amerikanischer Held« verehrt und im Rahmen des Gerichts glaubhaft als »guter Mensch« und »liebender Vater« dargestellt werden – eine raffinierte Tarnung der »Bestie«. Ann ist sein Alibi! Doch ein psychoanalytischer Blick enthüllt die Pathologie hinter der manifesten Normalität des Familienlebens: So funktionalisiert Mishka Ann narzisstisch: Schon mit zehn Jahren musste sie im familiären Alltagsleben die Mutter ersetzen. Es blieb ihr wohl nichts anderes übrig, als diese Rolle zu übernehmen, die Parentifizierung mitzuspielen und daraus einen narzisstischen Gewinn zu erzielen. Es ist zu vermuten, dass diese Befriedigung wesentlich dazu beitrug, die Verteidigung ihrer Vaters – trotz Warnungen von verschiedenen Seiten – selbst zu übernehmen. Wiederum hat der Vater keine Einfühlung, was er damit der Tochter aufbürdet, wie sehr er sie überfordert und gefährdet: Die Tochter ist die Verlängerung seiner väterlichen Bedürfnisse, ein Selbstobjekt. Ann kann
140
Teil II: Subjekt und Geschichte
dem narzisstischen Missbrauch, gekoppelt mit einer präödipalen und ödipalen Verführung, nicht widerstehen. Diese Dynamik verrät die irreparable Schädigung, die die verbrecherischen Taten auch bei den Extremtätern des Holocaust hinterlassen haben: die Empathiestörung, die Schädigung der Ich-Ideal- und Über-IchStrukturen und -Inhalte, die überstimulierten und nicht kontrollierbaren archaischen Triebimpulse führen zu einer Entleerung des Ich beziehungsweise des Selbst. Im leeren Blick von Mishka wird dies erkennbar, meisterhaft dargestellt von Armin Müller-Stahl. In der psychoanalytischen Fachliteratur bleibt offen, ob die nationalsozialistischen Extremtäter, wie Kernberg (1992) dies annimmt, zu den 5 Prozent der Bevölkerung gehörten, die schon vor den Verbrechen eine maligne narzisstische Persönlichkeitsstörung oder eine sadistische Psychopathologie aufwiesen, oder ob das Involviertsein in die deshumanisierenden Extremverbrechen die eben beschriebenen Pathologien erst zur Folge haben. Wie unter anderem Zygot Baumann (1991) eindrücklich diskutiert, ist die zweite Annahme fast noch beängstigender, da sie postuliert, dass in extremen gesellschaftlichen Situationen, in der institutionelle, die Zivilisation schützende Strukturen zusammenbrechen und Ideologien als Rechtfertigung von Verbrechen bereitgestellt werden, zusammen mit massen- und gruppenpsychologischen Mechanismen, potentielle verbrecherische Möglichkeiten mobilisieren können, die wir alle in uns tragen. – Auch diese Problematik wird in »Music Box« dargestellt: Mishka mutet uns nicht wie eine Bestie an. Die Tarnung funktioniert: Ann liebt ihren Vater, Mikie seinen Großvater, gerade weil er so menschlich, fürsorglich und zärtlich liebend wirkt. Erst der genaue, kritische Blick, der der Kameraführung folgt, enthüllt die Indizien, dass es sich um eine Fassade handelt, die eine Leere, eine schwere Über-Ich-Pathologie und eine grauenhafte, unsteuerbare Triebhaftigkeit kaschiert. Extremtäter delegieren, gerade weil ihnen jedes Schuldbewusstsein, jede Scham und Einsicht fehlen, diese Gefühle an die zweite Generation. Die Kinder werden dadurch, ähnlich und doch wieder in ganz anderer Weise als die Kinder von Holocaustüberlebenden, zu Trägern eines Geheimnisses, das dem Pakt des Schweigens entstammt, das sie aber ahnen und unbewusst identifikatorisch übernehmen. Statt sich in die Kinder und ihre Bedürfnisse einzufüh-
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
141
len, werden diese – im Sinne der eben beschriebenen Taktik der Tarnung – als Selbstobjekte eingesetzt und funktionalisiert. Ann und ihr Bruder mussten die »heile Familie« spielen, Halbwaisen, die ihrem Vater dankbar sein müssen, um öffentlich zu dokumentieren: »Mein Vater ist ein guter Mensch, ich weiß das …«. Doch enthüllt der Film schließlich, dass bisher keine wirkliche Kommunikation zwischen Vater und Tochter stattfand: Erst die Notwendigkeit, ihn zu verteidigen, führt zu dem Gespräch, indem er ihr über seine familiäre Vergangenheit, die großväterliche Herkunftsfamilie erzählt. Entlarvend dabei ist wiederum, dass auch diese Narration von Lügen durchzogen ist, der Tarnung statt der familiären Traditions- und Identitätsfindung dient. Die verbissen geführte Abwehr gegen die eigene Schuldeinsicht erfordert eine dauernde projektive Externalisierung.3 So haben weder Ann noch ihr Bruder die Freiheit, die projektiven Identifizierungen, bedingt durch die Abspaltung fragiler Selbstanteile ihres Vaters, zurückzuweisen oder wenigstens kritisch zu hinterfragen: Ann wird die bewunderte, erfolgreiche Tochter, ihr Bruder der primitive, brutale Versager, der in der Anfangsszene diese Rolle und die damit verbundene öffentliche Entwertung und Beschämung merkwürdig widerspruchslos annimmt. Menschen der zweiten Generation, auch hier zeichnet CostaGavras ein präzises Bild, haben eher die Chance einer reflexiven und dadurch korrigierenden Selbst- und Identitätsentwicklung. Sie haben sich nicht persönlich schuldig gemacht. In der erwähnten Szene im Gerichtssaal lässt Ann erstmals das Mitgefühl für die Opfer öffentlich zu – als Gegengewicht zu den bisher unbewussten Täteridentifikationen. Sie verzichtet auf den Versuch, die Glaubwürdigkeit der Zeugin in Frage zu stellen. Ist sie dazu in der Lage, weil sie auch andere, beispielsweise mütterliche Identifikationen 3 Bohleber (2000, 2001, 2003) diskutierete, dass dem Kind meist nichts anderes übrig bleibe, als sich mit diesen Zuschreibungen zu identifizieren, weil es auf die Liebe und Zuwendung der Eltern angewiesen sei. Die Kinder erlebten nun verschoben die fremde Schuld als die eigene. So dringe die nicht verantwortete Vergangenheit der Eltern in das Leben der Kinder ein und versperre den psychischen Raum, in dem das Kind seine Identität frei von der entfremdeten Macht des Narzissmus der Eltern hätte entfalten können.
142
Teil II: Subjekt und Geschichte
und Introjektionen in sich trägt? Ihre Mutter war sicher keine Ungarin, sonst würde Ann ihre mother tongue, Ungarisch, besser beherrschen. Ungarisch ist lediglich la langue du père. Schon während des Aktenstudiums ist sie immer wieder überwältigt von Mitgefühl für die Opfer und spürt den Wunsch, sich von dem Entsetzlichen, was die Nazitäter angerichtet haben, zu distanzieren.4 In Ann tobt begreiflicherweise ein innerlicher Kampf zwischen der Liebe zum Vater und der sich immer wieder aufdrängenden Ahnung, dass er »die Bestie« ist. So ist eindrücklich dargestellt, wie sie jeweils fast manisch reagiert, wenn sie neue »Beweise« für seine Unschuld findet (z. B. von einem Parallelfall erfährt, in dem jemand fälschlicherweise wegen Naziverbrechen angeklagt war; oder als es ihr gelingt, den kranken Mann in Budapest dank ihr zugespielter »Beweise« als unzurechnungsfähig zu erklären – und damit den Prozess höchstwahrscheinlich zu gewinnen). »Die Kinder der Nazitäter befinden sich (daher) in einem tiefen Loyalitätskonflikt. Die Folge ist eine Kompromittierung des Ich-Ideals und Über-Ich. Das Ich dieser Kinder ist unbewusst immer wieder der Gefahr ausgesetzt, zum Komplizen zu werden. So wird die historische Vergangenheit zu einer Last, die man verleugnen oder vergessen möchte, anstatt sie als eine wenn auch schmerzliche und quälende Quelle der Erinnerung und der Wahrheit zu nutzen, um die eigene Integrität zu gewinnen« (Bohleber 1998, S. 274). Und doch – in der folgenden Szene triumphiert ihr Körper einerseits, die Identifikationen mit dem gewalttätigen Vater sind andererseits erneut sichtbar; gleichzeitig finden sich nonverbale Indizien für ihre Zweifel und ihr unbewusstes Wissen um die »Wahrheit«. »Was geschehen war, ist geschehen … aber es ist nie zu spät, sich zu erinnern …« sagt Herr Burk – dies könnte auch ein Psychoanalytiker formulieren. Mir scheint plausibel, dass Ann in der Authentizität des Staatsanwalts das gute mütterliche Primärobjekt wiederfindet, das eine Melodie der Trauer in ihr aufsteigen lässt, ein Gegengewicht zu dem sadistisch uneinfühlsamen väterlichen Triumph über das 4 Costa-Gavras selbst kennt diese Problematik; er lebte in zwei Welten: Sein Vater war ein anarchistischer Widerstandskämpfer in Griechenland, seine Mutter erzog ihn griechisch-orthodox.
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
143
Schwache, Fragile, Humane. So steigt sie aus dem Taxi aus und blickt in den Fluss: Sie sucht ihr Spiegelbild – im Fluss und im Anderen.
■ Die »Bestie« und die transgenerative Weitergabe von Schuld, Scham, von Verbrechen und unbewussten Phantasien Dass Extremtraumatisierungen in Opferfamilien der Shoah an die zweite und dritte Generation weitergegeben wurden, hat die klinisch psychoanalytische Forschung eindrücklich dargelegt (vgl. u. a. Bergmann, Jucovy, Kestenberg 1982; Faimberg 1987; Grünberg 2000; Kogan 1995; Oliner 1982). Wie steht es damit in Täterfamilien? Und wie können wir uns die Prozesse vorstellen, die zu dieser transgenerativen Weitergabe führen? (vgl. dazu u. a. Leuzinger-Bohleber 1998, 2003a, 2003b; Radebold 2000; Reerink 2003; Schlesinger-Kipp 2002; Volz-Boers 2001). Identifikationen im Über-Ich- und Ich-Ideal werden über die Sprache (»Verpiss dich«, »Schlampe«, »Zigeunerin«), aber auch die Leugnung des Holocaust von Mishka (als Geheimnis Ann gegenüber) direkt an den Enkel weitergegeben. Doch wahrscheinlich weit wirksamer sind die unbewussten, über den Körper und seine Ausdruckweisen, vermittelten Identifikationen. Dazu ein exemplarisches Beispiel: Mishka verlangt von seinem Enkel, dass er täglich Liegestütze übt, und verbindet dies mit dem Satz, mit dem er ursprünglich seine Opfer quälte und in den Tod trieb: »Nur in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist«. Ann versteht (unbewusst) diese Parallele – verleugnet sie wieder –, doch stößt sie in der Art, wie Mishka seinem Enkel das Reiten beibringt, wiederum auf die Spuren seiner Täterschaft, die er – via körperlicher Identifikation – an ihren Sohn weitergibt. Ich kann in diesem Rahmen nur noch darauf verweisen, dass sich solche körperlichen Prozesse, das so genannte Embodiment, als Schlüssel zu Erinnerungen erwiesen haben, wie in einem aktuellen, interdisziplinären Diskurs zwischen den Neurowissenschaften und der Psychoanalyse diskutiert wird. Die Ergebnisse dieses
144
Teil II: Subjekt und Geschichte
Dialogs halfen mir unter anderem, die transgenerative Weitergabe von Traumatisierungen bei meinen Patientinnen und Patienten besser zu verstehen. Viele Gedächtnisforscher der letzten Jahre postulieren, dass zwischen einem deklarativen (autobiographischen) und einem prozeduralen (impliziten) Gedächtnis differenziert werden muss (vgl. siehe dazu u. a. Köhler 1998). Auf einer deskriptiven Ebene ist diese Unterscheidung durchaus sinnvoll. Im deklarativen Gedächtnis verfügen wir über sprachliche, visuelle und symbolisierte Erinnerungen; im prozeduralen Gedächtnis sind Erinnerungen an körperliche Prozesse enthalten, die sich der Bewusstmachung entziehen. Doch funktioniert das menschliche Gedächtnis, wie wir in verschiedenen Arbeiten diskutiert haben, nicht wie ein Computer: Es hat keine Festplatte und verfügt über keinen klar abgrenzbaren (verbalen und präverbalen) Langzeitspeicher, aus dem Wissen – falls benötigt – ins Kurzzeitgedächtnis transferiert und dann bewusst gemacht werden kann. Gedächtnis und Erinnern sind Funktionen des gesamten Organismus, das heißt eines komplexen, dynamischen, rekategorisierenden und interaktiven Prozesses, der immer embodied ist, das heißt auf sensomotorischen Prozessen beruht, die sich im gesamten Organismus (also nicht nur im Gehirn oder einer bestimmten Hirnregion) manifestieren. Dies bedeutet, dass Gedächtnis oder Erinnern auf keiner abstrakten kognitiven Funktion beruht, sondern immer auf aktuell ablaufenden sensomotorischen Stimulationen, die – da sie in analoger Weise unter anderem visuelle, haptische, olfaktorische und akustische Reize aufnehmen und verarbeiten, wie in einer früheren Situation – Analogien zwischen der aktuellen und dieser früheren Situation konstruieren und daraus Erinnerungen aktiv produzieren. In diesem Sinne ist embodied Erinnern nicht einfach »nonverbal« oder »deskriptiv-unbewusst«, sondern bedeutet einen komplexen, konstruierenden und immer wieder neuen Informationsverarbeitungsprozess in einer bestimmten System-Umwelt-Interaktion. Erinnern wird – unbewusst – gesteuert durch frühere Erfahrungen (inklusiv ihrer dysfunktionalen oder aber tabuisierten Anteile), die die aktuelle Informationsverarbeitung gezielt determinieren. Mishkas Erfahrungen während seiner verbrecherischen Zeit oder aber die erlittenen Traumatisierungen der Zeugen sind – wie
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
145
beispielsweise Edelman (1992) dies beschreibt – im Körper enthalten (worauf schon Freud mit seiner berühmten Formulierung, das Ich sei ursprünglich ein körperliches, hinwies). Sie führen in analogen Situationen (wie z. B. bei der Schilderung der Vergewaltigung durch die letzte Zeugin), beim Blick in ihr Gesicht und so weiter, unweigerlich, das heißt automatisch und unbewusst zur Erinnerung – auch wenn sich Mishka dagegen sträubt. Sein Körper erkennt die Analogien zu den früheren Situationen. Er bricht zusammen und verrät die »Wahrheit«. Noch ein zweiter Aspekt ist für unser Thema relevant. Die Körpererfahrungen werden durch spätere Erfahrungen – immer und immer wieder – umgeschrieben (Edelmans Konzeptualisierungen entsprechen daher en detail Freuds Nachträglichkeit). Daher können historische Wahrheiten nie im Sinne einer Eins-zueins-Beobachtung rekonstruiert werden. Sie sind zwar immer Konstruktionen, enthalten aber gleichzeitig Spuren der einzigartigen biographischen Wirklichkeit. Daher haben Gedächtnis und Erinnern immer eine subjektive und eine objektive Seite. Die subjektive entspricht dem (bewussten und unbewussten) Erinnern des Individuums, die objektive dem (prinzipiell messbarem, sich aber dem Bewusstsein des Individuums immer entziehenden) Niederschlag der biographischen Erfahrungen im neuronalen Netzwerk des Individuums (für detailliertere Informationen: siehe Leuzinger-Bohleber u. Pfeifer 2002). Daher sind die Fragen von Ann an die Zeugen nach Eins-zu-Eins-Relationen inadäquat. Auch wenn die subjektive Wahrheit (z. B. Auschwitz habe eine andere Anzahl Verbrennungsanlagen aufgewiesen als historisch belegt) von der objektiv-historischen abweichen sollte, sind sie dennoch wahr und geben das subjektive Erleben des unvorstellbaren Schreckens in wahrhaftiger Weise wieder. Für Ann werden die Indizien, dass der Körper die Wahrheit verrät, immer deutlicher. Sie sieht in der Schlussszene den kalten Blick ihres Vaters und erkennt seine raffinierte Tarnungsstrategie, in der jedes Mittel eingesetzt wird. Auch die narzisstische Funktionalisierung seines Enkels wird deutlich (»Er ist mein Kind«). Nun bricht es aus ihm hervor: »Du bist wie eine Fremde, wenn du so was sagst …«. Diese direkte, körperlich ausgedrückte und affektive Konfrontation mit der historischen Wahrheit in der aktuellen In-
146
Teil II: Subjekt und Geschichte
teraktion mit ihrem Vater vermittelt ihr den Mut, zur Wahrheit zu stehen und sich und ihren Sohn in Sicherheit zu bringen. Sie erkennt, dass nur die Externalisierung der unbewussten Identifikationen und Introjektionen mit dem verbrecherischen Vater ihr und ihrem Sohn im öffentlichen Raum ohne Wenn und Aber die Möglichkeit eröffnen, die unbewusste, transgenerative Nabelschnur zu durchschneiden und zu einem zwar unendlich schmerzlichen, aber wahrhaftigen Selbst- und Identitätsprozess zu finden. »Ich bin zum Ufer des Flusses gegangen …«
■ Literatur Baumann, Z. (1991): Modernity and the Holocaust. Cambridge. Bergmann, M. S.; Jucovy, M. E.; Kestenberg, J. S. (1982): Kinder der Opfer. Kinder der Täter. Psychoanalyse und Holocaust. Frankfurt a. M. Überarbeitete Fassung 1990. Deutsche Übersetzung 1995. Bohleber, W. (2000): Die Entwicklung der Traumatheorie in der Psychoanalyse. Psyche – Z. Psychoanal. 54: 797–839. Bohleber, W. (2001): Trauma, Trauer und Geschichte. In: Leuzinger-Bohleber, M.; Schmied-Kowarzik, W. (Hg.): »Gedenk und vergiß – im Abschaum der Geschichte«. Trauma und Erinnern. Hans Keilson zu Ehren. Tübingen, S. 49–65. Bohleber, W. (2003): Das Trauma und seine Bedeutung für das Verhältnis von innerer und äußerer Realität in der Psychoanalyse. In: Leuzinger-Bohleber, M.; Zwiebel, R. (Hg.): Trauma, Beziehung und soziale Realität. Tübingen, S. 11–33. Cournut, J. (1988): Ein Rest, der verbindet. Das unbewußte Schuldgefühl, das entlehnte betreffend. Jahrbuch der Psychoanalyse 22: 67–99. Edelman, G. E. (1992): Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind. New York. Faimberg, H. (1987): Das Ineinanderrücken der Generationen. Zur Genealogie gewisser Identifizierungen. Jahrbuch der Psychoanalyse 20: 114–143. Grünberg, K. (2000): Liebe nach Auschwitz. Die Zweite Generation. Tübingen. Keilson, H. (1979): Das Leben geht weiter. Frankfurt a. M. Keilson, H. (1989): Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Jahrbuch der Psychoanalyse 25: 9–28. Kernberg, O. (1992): Wut und Hass. Stuttgart. Kestenberg, J.S.; Brenner, I. (1986): Children who survived the Holocaust. Int. J. Psychoanal. 67: 309–316.
M. Leuzinger-Bohleber · Überlegungen zu Costa-Gavras »Music Box«
147
Kogan, I. (1995): The Cry of Mute Children. A Psychoanalytic Perspective of the Second Generation of the Holocaust. London. Köhler, L. (1998): Einführung in die Entstehung des Gedächtnisses. In: Koukkou-Lehmann, M.; Leuzinger-Bohleber, M.; Mertens, W. (Hg.): Erinnerung von Wirklichkeiten. Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog. Stuttgart, S. 131–223. Laub, D.; Auerhahn, N. C. (1984): Reverberations of Genocide: Its Expression in the Conscious and Unconscious of Post-Holocaust Generations. In: Luel, S. A.; Marcus, P. (Hg.): Psychoanalytic Reflections on the Holocaust: Selected Essays. New York, S. 155. Leuzinger-Bohleber, M. (1998): Pathogenes Leiden an der Schuld der Väter – eine Fallskizze. In: Leuzinger-Bohleber, M.; Lahme-Gronostaj, H.; MeyerStoll, T.; Michel, M. (Hg.): Psychoanalyse im Spannungsfeld zwischen Klinik und Kulturtheorie. Kassel: Institut für Psychoanalyse (Eigendruck), S. 79–99. Leuzinger-Bohleber, M. (2003a): Transgenerative Weitergabe von Traumatisierungen. Einige Beobachtungen aus einer repräsentativen Katamnesestudie. In: Leuzinger-Bohleber, M.; Zwiebel, R. (Hg): Trauma, Beziehung und soziale Realität. Tübingen, S. 107–137. Leuzinger-Bohleber, M. (2003b): Die langen Schatten von Krieg und Verfolgung: Kriegskinder in Psychoanalysen. Beobachtungen und Berichte aus der DPV-Katamnesestudie. Psyche – Z. Psychoanal. 57: 982–1016. Leuzinger-Bohleber, M.; Pfeifer, R. (2002): Remembering a depressive primary object: Memory in the Dialogue between Psychoanalysis and Cognitive Science. Int. J. Psychoanal. 83: 3–33. Monaco, J. (1996): Film verstehen: Kunst, Technik, Sprache, Geschichte und Theorie des Films und der Medien; mit einer Einführung in Multimedia. Hamburg. Oliner, M. M. (1982): Hysterical features among children of survivors. In: Bergman, M. C.; Jucovy, M. E. (Hg.): Generations of the Holocaust. New York, S. 267–286. Radebold, H. (2000): Abwesende Väter. Folgen der Kriegskindheit in Psychoanalysen. Göttingen. Reerink, G. (2003): Traumatisierte Patienten in der Katamnesestudie der DPV. Beobachtungen und Fragen zur Behandlungstechnik. Psyche – Z. Psychoanal. 57: 121–139. Schlesinger-Kipp, G. (2002): Psychoanalytische Behandlungen mit Kriegskindern – Ergebnisse der Katamnesestudie. In: Schlesinger-Kipp, G.; Warsitz, R. P. (Hg.): Entgrenzung – Spaltung – Integration. Arbeitstagung der DPV in Leipzig vom 8. bis 11. Mai 2002. Bad Homburg, S. 163–174. Schneider, G.; Witt-Schneider, G. (2003): Wilde Erdbeeren (Ingmar Bergman, 1957). Psyche – Z. Psychoanal. 58: 751–756. Spence, D. P. (1982): Narrative Truth and Historical Truth. Meaning and Interpretation in Psychoanalysis. New York.
148
Teil II: Subjekt und Geschichte
Volz-Boers, U. (2001): Theorie und Technik der psychoanalytischen Behandlung früher Traumatisierungen. In: Bohleber, W.; Drews, S. (Hg.) (2001): Die Gegenwart der Psychoanalyse – die Psychoanalyse der Gegenwart. Stuttgart, S. 450–460.
■ Ralf Zwiebel
Ist psychoanalytisches Denken interkontextuell? Film-psychoanalytische Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
■ Vorbemerkungen Im Eingangskapitel dieses Buches wurde wiederholt betont, dass wir uns als Psychoanalytiker, die sich für Kino, Filme generell und einzelne Filme im Besonderen interessieren und sie psychoanalytisch interpretieren wollen, immer wieder der spezifischen Möglichkeiten, aber auch Grenzen bewusst bleiben müssen und daher unseren methodischen Ansatz der »Film-Psychoanalyse«, wie Gerhard Schneider (in Vorb.) das psychoanalytische Nachdenken über Filme genannt hat, kritisch überdenken sollten (vgl. den Beitrag von Mahler-Bungers und Zwiebel in diesem Band). Diese Forderung resultiert nicht zuletzt aus der einfachen Feststellung, dass Psychoanalytiker auf dem Gebiet der Filmkunst, Filmtheorie und Filmkritik in der Regel Laien sind und sich damit vom durchschnittlichen Kinobesucher nicht wesentlich unterscheiden. In Diskussionen mit Regisseuren und Filmtheoretikern fällt immer wieder die unterschiedliche Gewichtung in Bezug auf die Elemente des Films auf, die wir als Einstellung, Darstellung und Vorstellung bezeichnet haben. Die Geschichte, ihre filmische Darstellbarkeit und die Realisierung des ganzen Films (einschließlich der finanziellen Möglichkeiten) stellen völlig unterschiedliche Kontexte dar gegenüber dem interpretativen Zugang des psychoanalytisch orientierten Zuschauers, der sich auf die Vorstellung des fertigen Films bezieht und dessen Wahrnehmen und Denken grundsätzlich einem klinischen Kontext entstammt. In diesem Sinne ist FilmPsychoanalyse nach meiner Auffassung grundsätzlich interkontextuell. Die These, die ich in diesem Kapitel am Beispiel von Hitchcocks »Spellbound« genauer diskutieren möchte, ist die Vermu-
150
Teil II: Subjekt und Geschichte
tung, dass zwischen der Filmkunst und der Psychoanalyse gerade durch diese interkontextuelle Arbeitsweise und das interkontextuelle Denken und Verstehen in beiden Feldern eine Affinität und Nähe besteht, die allerdings erst bei genauerer Betrachtung deutlich wird. Dazu noch einige Vorbemerkungen: Filmkünstler »explorieren« mit ihren Filmen kollektive und individuelle Existenzbedingungen und Probleme der Menschen in einer simulierten Filmwelt, die immer auch einen Bezug zur unbewussten Wirklichkeit haben: Liebe und Sexualität, Verlust, Vergänglichkeit und Tod, Versagen, Scheitern und Schuld und die Konflikte zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. In diesem Zusammenhang kann man auch von der »unbewussten Botschaft des Films« sprechen, in der ein Erkenntnisprozess zum Ausdruck gebracht wird, der allerdings mit künstlerischen und nicht mit wissenschaftlichen oder klinischen Mitteln generiert wird. Insofern kann man vom Filmkünstler auch von einem »Visu-Psychoanalytiker« und von der Film-Psychoanalyse als einer nicht nur angewandten, sondern auch generativen Psychoanalyse sprechen, wie dies Gerhard Schneider (in Vorb.) vorgeschlagen hat. Diese generative Potenz wird jedoch nur effektiv, wenn man die ganz unterschiedlichen Kontexte der Filmkunst und der klinischen Psychoanalyse und dies in dem interpretativen Ansatz des einzelnen Films im Sinne einer Interkontextualität berücksichtigt. Die Arbeitsweise des klinischen Psychoanalytikers ist grundsätzlich kontextuell und interkontextuell. Mit dem Begriff der Kontextualität wird zu formulieren versucht, dass Bedeutung immer kontextabhängig ist.1 Hans Dieter Huber gibt in seiner Arbeit »Interkontextualität und künstlerische Kompetenz« einige für unseren Zusammenhang wichtige Definitionen. 1 So schreibt K. Wilber: »Die Postmoderne an sich hat drei, wie ich glaube, sehr wichtige Wahrheiten eingeführt: Konstruktivismus, Kontextualismus und Pluralismus […] Der Kontextualismus verweist darauf, daß Bedeutung kontextabhängig ist. So bedeutet z. B. der ›Tau auf dem Gras‹ und das ›Tau eines Schiffes‹ in den beiden Sätzen jeweils etwas anderes; die Bedeutung hängt vom Kontext ab. Dies weist der Interpretation (auch Hermeneutik genannt) eine Schlüsselrolle für unser Weltverständnis zu, weil wir die Welt nicht einfach wahrnehmen, sondern interpretieren« (Wilber 2002, S. 204).
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
151
»Kontexte sind einfach gesagt, Rahmenbedingungen, Umfelder oder Zusammenhänge. Sie bilden Verhältnisse, in die z. B. ein Text, eine Performance oder ein Musikstück von einem Beobachter eingebettet werden. Kontexte können aber auch zeitlich oder diskursiv aufgefasst werden. Deutlich wird dabei, daß es nicht einen einzigen, für immer feststehenden Kontext eines Werkes gibt, sondern viele verschiedene, räumliche, zeitliche oder diskursive Kontexte, in denen ein Werk stehen […] kann. Entscheidend ist, daß es immer einen Kontext geben wird. Ein Werk kann nicht ohne jeglichen Kontext beobachtet werden […] Im Prinzip gibt es so viele verschiedenen Kontexte, wie ein Beobachter in der Lage ist, für sich herzustellen. Er entscheidet durch seine spezifische Art der Kontextualisierung darüber, in welchen Kontext er ein Werk einbetten möchte. In jeder neuen Kontextualisierung, die eine explizite oder implizite Inbeziehungsetzung ist, also das Resultat von Unterscheidungen und Bezeichnungen eines Beobachters, werden andere Eigenschaften und Bedeutungen des Werkes thematisiert und können auf diese Weise beobachtet werden. Interkontextualität ist also die Fragen nach den Beziehungen zwischen verschiedenen Kontexten« (Huber 2001, S. 30).
In diesem Sinn ist die Arbeitsweise des klinischen Psychoanalytikers kontextuell und interkontextuell, als er in einem klinischen Rahmen mit einem leidenden Menschen dessen unbewusste Wirklichkeit in seiner Bedeutung zu verstehen versucht, wobei die in der analytischen Situation auftauchenden Phänomene – die Symptome, die Assoziationen, Erzählungen, Erinnerungen, Träume und Inszenierungen, der interaktionelle Druck und die emotionalen Reaktionen des Analytikers – jeweils aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden: aus der kindlichen Vergangenheit, der aktuellen Gegenwart, der Übertragungs-Gegenübertragungs-Beziehung, der intersubjektiven Dynamik, konfliktiver (WunschAngst-Abwehr), struktureller oder traumatischer Gesichtspunkte. Ein lebendiges, tieferes Verstehen im Sinne einer emotionalen Einsicht entwickelt sich in der Regel nur dann, wenn etwa ein Traum unter Berücksichtigung verschiedener Kontexte (also etwa der Kindheit, der gegenwärtigen Lebenssituation und der Übertragung) verstanden wird und dabei die verschiedenen Kontexte ebenfalls berücksichtigt und aufeinander bezogen werden. Das wird hier in unserem Zusammenhang als interkontextuell verstanden. Der Filmpsychoanalytiker arbeitet insofern kontextuell und interkontextuell, wenn er einen bestimmten Film untersucht und diesen sowohl auf dem Hintergrund seiner klinischen Erfahrungen (einschließlich der psychoanalytischen Theorie) als Psycho-
152
Teil II: Subjekt und Geschichte
analytiker als auch auf dem Hintergrund der Erfahrungen des Film-Künstlers zu verstehen versucht. Dabei spielen vor allem drei zentrale Kontexte eine wichtige Rolle, die nach meiner Auffassung das Spezifische der Film-Psychoanalyse ausmachen könnten: – Der Kontext der psychoanalytischen Theorie. In diesem Kontext wird der Film als Visualisierung, als Fragestellung, als Hypothese eines spezifischen Aspekts der psychoanalytischen Theorie, der Filmkünstler in diesem Sinne als Visu-Psychoanalytiker betrachtet. Als ein Beispiel für diesen Kontext könnte man Hitchcocks »Vertigo« ansehen, den man auch als einen Beitrag zur Beziehung von Trauma und Melancholie ansehen könnte (Zwiebel 2003b). Ein anderes Beispiel wäre der Film aus der Dekalog-Reihe von Kieülowski, »Dekalog IV«, den man als eine Exploration der ödipalen Problematik einer jungen Frau betrachten kann, der vor allem den Aspekt der unbewussten und doppelten Botschaften der Eltern reflektiert (Zwiebel 2005). – Der Kontext der analytischen Situation und des analytischen Prozesses. Der Film wird als Visualisierung, als Hypothese eines spezifischen Aspekts der psychoanalytischen Situation und der analytischen Begegnung betrachtet. Auch wenn diese eine klinische und in gewisser Weise künstliche Situation darstellt, so kann man sie doch gleichzeitig als eine Art Laboratorium für die zwischenmenschliche Beziehung, ja, vielleicht sogar für die existentielle Beziehung des Menschen zu sich selbst, zum Anderen und zur Welt betrachten. Alle die schon erwähnten Grundthematiken tauchen in ihr natürlich auf und erfahren durch das besondere Setting eine spezifische Gestalt, die zu der speziellen, psychoanalytischen Theoretisierung führt. Aus der Sicht des klinischen Kontextes kann man manche Filme nun in der Tat als visuelle Reflexionen über diese analytische Situation begreifen; in manchen Filmen ist dies manifest gegeben, wie etwa in dem gleich zu besprechenden Film »Spellbound« oder in Morettis »Zimmer meines Sohnes«; in anderen Filmen ergibt sich dies erst aus dem interkontextuellen Bezug, den der Film-Psychoanalytiker zwischen dem Film und der analytischen Situation herstellt. Ich denke an Hitchcocks »Fenster zum Hof« und »Vertigo«, Cronenbergs »Existenz« und Kurosawas »Rashomon«. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
153
Filme, die problematische, scheiternde oder sogar katastrophale Beziehungsentwicklungen schildern, Beziehungen, in denen Hilfe, Wiedergutmachung und Rettung eine wesentliche Rolle spielen. – Der Kontext des selbstreflexiven Modus des Analytikers. In diesem Kontext wird der Film als visueller Kommentar zur eigenen, inneren Situation verstanden, der Film also aus dem Kontext des eigenen, persönlichen Lebens und der eigenen Biographie und der eigenen Konflikte betrachtet (»Der Film legt den Zuschauer auf die Couch«, siehe auch den Beitrag von Mahler-Bungers und Zwiebel in diesem Band). Es ist dies zwar ein Kontext, der auch den gewöhnlichen Zuschauer berührt und der wesentlich zur grundsätzlichen Wirkung des Filmerlebens beiträgt. Die bewusste selbstreflexive oder selbstanalytische Kapazität ist jedoch ein wesentliches Merkmal der analytischen Professionalität, die überhaupt erst garantiert, dass die analytische Arbeit auch über die auftauchenden Widerstände, Übertragungen und Gegenübertragungen fortschreiten kann. Dieser Aspekt ist sehr viel schwerer darzustellen, weil er wirklich die persönliche Situation des Film-Psychoanalytikers, im Grunde eine Form von radikaler Selbstanalyse berührt, die nur begrenzt nach außen darstellbar ist. Als ein Beispiel für eine solche interkontextuelle Analyse könnte ich noch einmal Hitchcocks »Vertigo« heranziehen, in dem man den männlichen Protagonisten des Films, Scottie, als einen »Analytiker« begreifen kann, der seine Kompetenz durch eine phobische Haltung verliert und damit zu einem entgleisenden, »analytischen Prozess« beiträgt. »Persönlich« würde in diesem Sinne bedeuten, dass ich mir meiner eigenen phobischen Haltung bewusst werde und sie sowohl in meinem persönlichen als auch in meinem professionellen Leben reflektieren kann (Zwiebel 2003c). Es ist meine Auffassung, dass insbesondere die Filme, die alle drei erwähnten Kontexte direkt oder indirekt berühren, auf ein besonderes Interesse beim Film-Psychoanalytiker stoßen. Ich wende mich nun einem solchen Film zu und werde versuchen, diese erwähnten Aspekte in Bezug auf Hitchcocks »Spellbound« näher zu diskutieren.
154
Teil II: Subjekt und Geschichte
■ Zum Film »Spellbound« Alfred Hitchcocks »Spellbound« (zu Deutsch: Ich kämpfe um dich) aus dem Jahr 1945 gehört in das interessante, wenn auch kleine Subgenre von Spielfilmen, in denen es direkt um die Psychoanalyse im Film geht. Andere Filme sind »Geheimnisse einer Seele« von G. W. Pabst, »Freud« von J. Huston und »1919« von H. Brody (vgl. Sabbadini 2001), vielleicht in neuester Zeit der Film von P. Leconte »Intime Fremde« und A. Morettis »Zimmer meines Sohnes«. Als ein anderes Subgenre von Spielfilmen könnte man Filme über die Psychiatrie oder über psychiatrische Krankheiten – vor allem Darstellungen von Psychosen – nennen, von denen ich hier nur einige wenige erwähnen möchte: »Einer flog übers Kuckucksnest« von M. Forman, »Vertigo«, »Psycho«, »Der falsche Mann« von A. Hitchcock, »Der Mieter«, »Der Ekel« von R. Polanski, »Spider« von D. Cronenberg, »Shining« von S. Kubrick, »Shine« von S. Hicks, »Das weiße Rauschen« von H. Weingartner, »A Beautiful Mind« von R. Howard. Interessant ist der Film »Spellbound«, weil sich an ihm auch die Beziehung der Psychiatrie und Psychoanalyse, vor allem auch in einer historisch bedeutungsvollen Zeit der 1940er Jahre in Amerika diskutieren ließe. Bevor ich drei für die Film-Psychoanalyse relevanten Kontexte diskutieren möchte, werde ich eine kurze Inhaltsangabe des Films geben. Die junge Ärztin Dr. Petersen (gespielt von Ingrid Bergman) arbeitet in einer psychiatrischen Klinik, in der das neue Heilverfahren der Psychoanalyse enthusiastisch angewendet wird. Die Kollegen erwarten den neuen Leiter der Klinik, einen Dr. Edwardes (gespielt von Gregory Peck), der den alten Chefarzt Dr. Murchison ablösen soll. Als jener eintrifft, verlieben sich die junge Ärztin und der junge Chefarzt auf einen Blick unsterblich ineinander; es stellt sich aber bald heraus, dass mit dem jungen Arzt etwas nicht stimmt, weil er selbst auffällige psychische Symptome, vor allem der Amnesie und Formen der traumatischen Erinnerung, entwickelt und sich bald der Verdacht einstellt, er selbst sei gar nicht Dr. Edwardes, sondern habe diesen womöglich ermordet, um dessen Identität und Stelle in der Klinik an- und einzunehmen. Trotz aller sich verdichtenden Verdachtsmomente glaubt Dr. Petersen unerschütterlich an die Unschuld ihres Geliebten, folgt ihm bei seiner Flucht nach New York und beginnt mit ihm in einer Mischung aus Detektivgeschichte und Psychoanalyse dessen Identität und Vergangenheit aufzudecken. Das flüchtende Paar sucht gemeinsam den alten Lehrer und Lehranalytiker von Dr. Petersen
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
155
auf. Im Zentrum dieses Besuchs steht die Analyse eines Traums, den der vermeintliche Dr. Edwardes – mittlerweile wissen wir, dass es sich tatsächlich um J. Ballantine, einen jungen, im Krieg traumatisierten Arzt handelt, der den berühmten Dr. Edwardes aufsuchte, um sich von ihm behandeln zu lassen – den beiden berichtet. Die junge Dr. Petersen und der alte Lehrer Dr. Brulov analysieren den Traum im Schnellverfahren und können mit Hilfe der Traumanalyse einen ersten Teil der Amnesie von J. Ballantine aufdecken: Dieser hatte Dr. Edwardes aufgesucht und war mit ihm in die Berge zum Skilaufen gefahren – sicherlich eine etwas ungewöhnliche Therapiemethode des Dr. Edwardes. Nachdem sie aufgrund der Traumanalyse den Namen dieses Skiorts herausgefunden haben, fahren Dr. Petersen und J. Ballantine dorthin und machen eine Skiabfahrt gleichsam im Sinne einer Expositionstherapie – Dr. Petersen vermutet, dass es bei diesem Skiurlaub zu einem Unfall gekommen ist, der als traumatischer Grund für die Amnesie und die Symptomatik von J. Ballantine verantwortlich ist – um die Amnesie durch ein neues Schockerlebnis aufzulösen. J. Ballantine erinnert sich tatsächlich in dramatischer Weise kurz vor dem gemeinsamen Absturz in den Abgrund an ein traumatisches Kindheitserlebnis, in dem er nämlich bei einem Spielunfall unabsichtlich seinen jüngeren Bruder tötete, ein Unfall, der in seiner Struktur mit der Skiabfahrt deutlich assoziiert erscheint. Für einen Moment scheint die Lösung des klinischen Falls gelungen, die Identität ist durch Auflösung der Amnesie und die wiedergewonnene und kathartisch wieder erlebte traumatische Erinnerung wiederhergestellt, als die Polizei die Leiche des wahren und ermordeten Dr. Edwardes an dem besagten Skiort entdeckt. J. Ballantine wird mit Mordverdacht festgenommen und Dr. Petersen kehrt verzweifelt in die Klinik zurück, in der mittlerweile der alte Chefarzt Dr. Murchison wieder die Regie übernommen hat. In einem Gespräch zwischen beiden schöpft sie plötzlich durch eine Unachtsamkeit des alten Arztes Verdacht, und sie überführt ihn des Mordes an seinem designierten Nachfolger (er hatte seine Ablösung nicht ertragen und daher beschlossen, seinen designierten Nachfolger in den Bergen aufzusuchen und ihn zu ermorden), in dem sie den Traum von J. Ballantine gemeinsam mit ihm noch einmal durchgeht und aufzeigt, dass J. Ballantine unbewusst den Mord und seine Zusammenhänge im Traum dargestellt hat, weil er nämlich Zeuge dieses Mordes in den Bergen geworden war, aber aufgrund seiner eigenen traumatischen Vergangenheit die Verantwortung und Schuld auf sich genommen hatte. Überführt richtet Dr. Murchison die Waffe gegen sich selbst, und Dr. Petersen und J. Ballantine sehen einer glücklichen, gemeinsamen Zukunft entgegen.
Da ich mich hier vor allem dem Thema der Interkontextualität im Zusammenhang mit der Film-Psychoanalyse zuwenden möchte, verzichte ich auf eine kurze filmhistorische Einleitung, die die Filmentstehung, Hitchcocks damalige Situation in Hollywood, die Bedeutung des Films in dem gesamten hitchcockschen Werk und
156
Teil II: Subjekt und Geschichte
die Rezeption des Films vor ziemlich genau 60 Jahren reflektiert. Auch die spätere Einschätzung der Filmwissenschaft und von Hitchcock selbst, wie er sie beispielsweise in seinem berühmten Gespräch mit Truffaut (1975/1989) formuliert hat, ist natürlich grundsätzlich von Interesse. Es sei lediglich erwähnt, dass der Film damals beim amerikanischen Publikum ein großer Erfolg war und das Interesse des allgemeinen Publikums an der Psychotherapie und an der Psychoanalyse weiter förderte, während die Kritik ihn heute als einen der schwächeren Hitchcock-Filme betrachtet. Und es sei auch erwähnt, dass Hitchcock, aber auch der Produzent Selznick und der Drehbuchautor Hecht unbedingt einen Film über Psychoanalyse oder Psychotherapie machen wollten, wie Hitchcock sogar meinte, den »ersten Film über Psychoanalyse« überhaupt.
■ Der erste Kontext: Psychoanalytische Theorie Wenn ich mit meiner emotionalen Reaktion auf den Film beginne, so lässt sich diese als sehr ambivalent beschreiben: auf der einen Seite eine Faszination und Begeisterung, die sich auch bei mehrmaligem Sehen nicht mildert, und auf der anderen Seite eine ironische, ja fast überhebliche Distanz, vor allem in Bezug auf die fast karikierte Darstellung der Psychoanalyse, und manche, heute fast dilettantisch oder zumindest künstlich wirkenden Filmszenen, etwa die Skiabfahrt, die die traumatische Erinnerung auslöst. Auch scheint mir, dass die ganze Geschichte aus heutiger Sicht recht unwahrscheinlich wirkt, was die ironische Distanz sicherlich erleichtert. Diese Mischung aus Faszination und Gelächter könnte man, wie Zizek am Beispiel der heutigen Rezeption des »film noir« der 1940er Jahre schreibt, auf die Tatsache zurückführen, dass wir den Film auch mit den Augen des damaligen Publikums sehen, also mit dem Blick des fremden, des anderen Zuschauers »der sich damals noch unmittelbar mit dem Universum des film noir identifizieren konnte« (Zizek 1998, S. 53f.). Auch wenn ich dieser Auffassung bei »Spellbound« zustimmen kann, so möchte ich noch eine weitere Hypothese formulieren, die für unser Thema von beson-
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
157
derem Interesse sein könnte. Die ambivalente Reaktion hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass der Film verschiedene, durchaus widersprüchliche oder konträre Erzählstränge und Ziele verfolgt, die zu dieser komplexen Reaktion des heutigen Zuschauers führen dürften (falls ich meine eigene Reaktion ein Stück weit verallgemeinern kann): Zum einen handelt es sich um einen didaktischen Film über Psychoanalyse, in dem unglaublich viel erklärt und doziert wird, was bereits mit dem Vorspann beginnt und sich in den Gesprächen zwischen den Ärzten und ihren Patienten fortsetzt, wobei die Allwissenheit der Ärzte vielleicht für heutige Zuschauer eine fast lächerliche Komponente hat; hier geht es um eine filmische Darstellung von Psychoanalyse, die vielleicht für die 1940er Jahre in USA relativ treffend war – nur Ärzte durften damals Psychoanalytiker werden und die analytische Psychotherapie war auch in den psychiatrischen Kliniken auf dem Vormarsch –, aber aus heutiger Sicht ziemlich veraltet erscheint, beispielsweise was die Traumanalyse oder auch die Rolle der erotischen Gegenübertragung betrifft (siehe auch Sabbadini 2001). Die Liebes- und Mordgeschichte ist dann praktisch nur der Anlass oder Aufhänger, um einen spannenden Lehrfilm über die damals in Amerika hoch aktuelle Psychoanalyse zu machen, der aus der Sicht von 60 Jahren später problematisch und verzerrt wirkt. Es scheinen sich Freuds Bedenken zu bestätigen, der dem Medium Film sehr kritisch gegenüberstand und es nicht für möglich hielt, die Annahmen der Psychoanalyse filmisch darzustellen (Zeul 1994). Wir können uns relativ leicht distanzieren, weil wir zu wissen meinen, dass so die Psychoanalyse missverstanden und zumindest teilweise falsch dargestellt ist. Der Film bleibt trotz dieser manifesten Perspektive einer Didaktik der Psychoanalyse erträglich, weil er auch in eine romantische Liebesgeschichte eingebettet ist, in der die Protagonistin sich nicht sicher sein kann, ob sie sich in einen Kranken oder in einen Mörder verliebt hat, woraus sich auch der »suspense« des Films ergibt. Die Methode der Psychoanalyse wird eingesetzt – und auf diesem Weg dem Zuschauer die »essentials« der Psychoanalyse zu erklären versucht –, um dieses quälende Rätsel der Protagonistin, eines Rätsels, das ihrem Glück im Weg steht, zu lösen. Am Ende lüftet sich das Geheimnis, der Geliebte ist kein Mörder, sondern ein Kranker, dessen Krankheit jedoch im Verlauf
158
Teil II: Subjekt und Geschichte
der Aufdeckung gleichzeitig geheilt wird. Die Detektivgeschichte verschmilzt gleichsam mit einem erfolgreichen Behandlungsprozess, an dessen Ende der wirkliche Mörder entlarvt und der Kranke geheilt ist. So gesehen hätte der Film neben der erzählerischen Spannung ein gewisses historisches Interesse, in dem wir uns fragen, wie damals vor 60 Jahren die Psychoanalyse gesehen und dargestellt wurde. Diese Version stellt also eine Außenbetrachtung der Psychoanalyse in historischer Perspektive dar, wobei es auf den ersten Blick keineswegs eindeutig ist, welches die besondere Sichtweise des Filmautors und welches die damals allgemein gültige Sicht des Publikums war. Von besonderem Interesse dabei erscheint mir in dieser didaktischen Version die innige Verzahnung zwischen Psychoanalyse und Medizin zu sein und die damit verbundene Frage, worum es sich bei dem psychoanalytischen Verfahren überhaupt handelt. Hier wird ein theoretischer Kontext berührt, den ich in den einleitenden Bemerkungen postuliert hatte: Hitchcock verstehe ich dann als einen »Visu-Psychoanalytiker«, der auf einer manifesten Ebene mit Überzeugung und scheinbarer Gewissheit dem Zuschauer zu erklären versucht, worum es sich bei der Psychoanalyse handelt. Dabei unterstelle ich zunächst einmal Hitchcock kein Missverständnis der Psychoanalyse, sondern vermute, dass er mit seinen filmischen Mitteln ein zentrales Problem der Psychoanalyse und des psychoanalytischen Denkens aufgegriffen hat. Dann wird deutlich, dass in dem Film ein ganz zentraler und immer wieder aktueller Gesichtspunkt aufgegriffen wird, der nämlich die Beziehung zwischen dem medizinischen und dem psychoanalytischen Denken betrifft. Diesen Punkt möchte ich ein wenig vertiefen. Berns, der die für die Psychotherapie relevante Unterscheidung zwischen dem medizinischen und dem kontextuellen Denkmodell herausgestellt hat, definiert das medizinische Denkmodell folgendermaßen: »Im medizinischen Denkmodell geht man davon aus, daß spezifische Noxen einen pathophysiologischen Prozeß im Körper auslösen, der zu Symptomen führt. Sofern der pathophysiologische Prozeß geklärt und eine medizinische Maßnahme bekannt ist, die hilft, diesen Prozess zu beenden, wird die entsprechende spezifische und ursächlich heilsame Maßnahme durchgeführt. Zentrales Charakteristikum dieses Denkmodells ist somit die Annahme einer ursäch-
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
159
lichen Erklärung der Störung und die weitere Annahme, diese könne mithilfe einer angemessenen spezifischen Maßnahme ursächlich behoben werden. In analoger Anwendung dieses Denkmodells auf die Psychotherapie wird angenommen, daß durch eine korrekte Erklärung der Störung, also durch die Aufdeckung ihrer Ätiopathogenese auch vorgegeben ist, welche spezifische therapeutischen Interventionen notwendig sind, um Heilung zu ermöglichen. Die verschiedenen Psychotherapieverfahren haben sich im Laufe der Geschichte alle das Ziel gesetzt, spezifische Interventionen entsprechend ihren Theorien zu entwickeln. Auch die Psychoanalyse begann und lebt seit hundert Jahren mit dieser Hintergrunddenkfigur, seit S. Freuds ›Vorläufige Mitteilungen‹ (1895). Denn hier ging er davon aus, daß bestimmte Symptome verursacht werden durch Verdrängung traumatischer Geschehnisse in das Unbewusste und dass die Symptomatik durch die spezifische Intervention der Deutung ausgelöst werden könne, sofern sie die Zusammenhänge zwischen Noxe und Symptomatik erhellt. Damit bewegte sich Freud im Rahmen des medizinischen Denkmodells. Andererseits vertrat Freud z. B. bei der Indikationsstellung nicht die Position des medizinischen Denkmodells, insofern er schrieb: ›Man hat eben nur eine Sondierung (gemeint ist: Probetherapie) vorgenommen, um den Fall kennen zu lernen und um zu entscheiden, ob er für die Psychoanalyse geeignet ist. Eine andere Art der Erprobung als einen solchen Versuch hat man nicht zur Verfügung; noch so lange fortgesetzte Unterhaltungen und Ausfragungen in der Sprechstunde würden keinen Ersatz bieten‹ (Freud 1913, S. 455). Aus diesem Zitat lese ich, daß Freud zu einer Probetherapie keine Alternative in einer Diagnose basierenden Indikationsstellung fand« (Berns 2004, S. 288).
Diese Auffassung des medizinischen Denkmodells ließe sich darüber hinaus durch folgende Momente ergänzen und konkretisieren: Der diagnostische und therapeutische Prozess im medizinischen Denkmodell ist lokalisatorisch und eliminatorisch – das Übel, die Krankheit muss dingfest gemacht und beseitigt werden; die therapeutische Beziehung ist eine Beziehung zwischen einem Wissenden, einem Experten und einem Laien oder mehr oder weniger Unwissenden, wodurch ein entsprechendes Machtgefälle entsteht, das auch oft dazu führt, dass der Patient verdinglicht, zum Organ oder zum Objekt reduziert wird. Heilung ist grundsätzlich möglich, falls die »Noxe« lokalisiert und ein Mittel gefunden ist, mit dem diese eliminiert werden kann. Psychoanalyse und Psychotherapie als Behandlungsverfahren von seelischen Störungen und Leiden ist von Beginn an mit diesem Modell assoziiert gewesen, allerdings gab es offenbar von Anfang an Momente, die diesem Modell widersprachen. Die spezifische »Noxe« aus psychoanalytischer
160
Teil II: Subjekt und Geschichte
Sicht war zu Beginn das traumatische Ereignis, meist in der Kindheit gelegen, das vor allem durch die Verdrängung zu dem neurotischen Komplex des späteren Kranken führte; der therapeutische Prozess vollzieht sich über die kathartische Aufdeckung und Aufhebung der Verdrängung dieses traumatischen Kindheitserlebnisses und damit zu einer Heilung von der Neurose. Es erscheint mir nun relativ offensichtlich, dass in der didaktischen Lesart des Films »Spellbound« genau dieses medizinische Denkmodell entfaltet wird: Der Film spielt überwiegend in einer psychiatrischen Klinik, die Psychoanalytiker sind Ärzte, die Kittel tragen, Medikamente verordnen, notfalls operieren, ihre Patienten von oben und distanziert und im günstigsten Fall pädagogisch behandeln, als Experten und Wissende auftreten, die die psychischen Leistungen der Patienten wie ihre Symptome oder Träume gleichsam wie Urin- oder Blutproben behandeln, die der Patient zu produzieren hat und die von den Ärzten als Experten analysiert werden. Den Schlüssel zum Wissen und die Macht über das Wissen haben die Ärzte und Analytiker. Dies kann man sehr deutlich an dem Umgang mit der berühmten Traumszene in dem Film sehen, den die beiden Analytiker als Experten ebenso zu deuten vermögen wie es später noch einmal Dr. Murchison tut, als Dr. Petersen ihm den Traum ihres Patienten erzählt. Sie verfügen auch über die spezifische Intervention, die darin besteht, den Patienten mit seinem ursprünglichen Trauma zu exponieren, wie es ja vor allem in der Skiabfahrt-Szene eindrücklich repräsentiert ist. Diese führt zu dem gewünschten kathartischen Erlebnis mit der Aufdeckung des kindlichen Traumas und ist verbunden mit der Heilung der neurotischen Amnesie und der Auflösung des Schuldkomplexes. Auch gibt es in dem Film – jedenfalls am Ende – klare Unterscheidungen zwischen Normalen oder Gesunden, Kranken und Verbrechern. Selbst wenn einige Widersprüche in dieser Darstellung auffallen könnten – etwa das Zitat zu Beginn des Films, dass nämlich »the fault« (das Übel, die Schuld, der Makel?) nicht in den Sternen, sondern in uns selbst liege und dies in meiner Lesart eine Aussage über die Verantwortlichkeit des Menschen für sein Leiden darstellt oder die Frage der Relation zwischen dem dargestellten therapeutischen Prozess und der gleichzeitigen persönlichen Liebesbeziehung zwischen den Protagonisten, ist doch die Darstellung der
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
161
Psychoanalyse unter dem Aspekt des medizinischen Denkmodells relativ klar und eindeutig. Der Aspekt der persönlichen Liebesbeziehung und damit das Problem der Beziehung in der Psychoanalyse, der mit der Entdeckung der Übertragung durch Freud eine wichtige Wende bekam, wird im Übrigen auch in dem Film berücksichtigt. Aber diese Übertragung wird selbst wieder zu einem methodischen Trick etwa im Sinne einer spezifischen Intervention, mit dessen Hilfe man die zentrale spezifische Intervention, nämlich die Exposition mit der traumatischen Vergangenheit, forcieren kann. So erklärt Dr. Petersen ihrem »Patienten« seine negativen Gefühle ihr gegenüber als Übertragung, und Dr. Brulov fordert ihn sogar auf, ihn als Vaterfigur zu betrachten, um die »kurze Analyse« voranzutreiben. Vermutlich entsprach diese Vorstellung einer weit verbreiteten Denkfigur, dass nämlich die Neurose des Patienten in eine Übertragungsneurose zu überführen sei, die dann schließlich kathartisch – die verdrängten und auf den Analytiker übertragenen libidinösen und aggressiven Gefühle den Eltern gegenüber werden bewusst erlebbar – und durch die Einsicht in ihre Irrationalität erkannt werden, was zur Auflösung des neurotischen Komplexes führt. Diese Auffassung impliziert auch, dass es in der therapeutischen Beziehung einen neutralen Standpunkt außerhalb des Systems gibt, der relativ unbeeinflusst von der affektiven Dynamik der Übertragungen bleibt. Schließlich ist zu bedenken, dass das Unbewusste in der Sicht des medizinischen Denkmodells zu einem spezifischen Ort und damit in gewisser Weise verdinglicht wird – die Metapher des Kellers oder des dunklen Abgrunds drückt dies deutlich aus – und der therapeutische Prozess damit ein eliminatorisches Element beibehält. Die Verdrängungen werden aufgehoben, aus Es soll Ich werden oder metaphorisch gesprochen: Der Keller wird aufgeräumt! Es spricht viel dafür, dass diese didaktische Version des Films der damaligen Auffassung der Psychoanalyse vor allem in den USA ziemlich nahe kam. Da es einen Fachberater für den Film gab und der Produzent Selznick und der Drehbuchautor Hecht eigene psychoanalytische oder psychotherapeutische Erfahrungen hatten, der Film eine solche Begeisterung bei dem Laienpublikum auslösen konnte und die damaligen, führenden Psychoanalytiker so ge-
162
Teil II: Subjekt und Geschichte
nannte Ich-Psychologen waren, ist der Film also eine Repräsentation der damaligen Auffassung der Psychoanalyse sowohl der führenden Psychoanalytiker als auch der interessierten Öffentlichkeit. Insofern können wir diese Betrachtungsweise als eine historisch interessante Sicht diskutieren, sie mit der Geschichte der Psychoanalyse in Beziehung setzen und uns ironisch, lächelnd und in Sicherheit wiegend nostalgisch distanzieren, da wir zu wissen meinen, dass dieses Modell längst überwunden ist. Aber genügt nicht ein kurzer Blick auf die gegenwärtige Situation der Psychoanalyse in der BRD, ihre Einbindung in das Kassensystem, in das Psychotherapeuten-Gesetz, die auf uns zukommenden Qualitätskontrollen, Fragen der Effektivität, das Gutachterverfahren und die diagnostischen Manuale, um aus der Außenperspektive das Spannungsfeld zum medizinischen Denkmodell keineswegs als nur noch historisch relevant zu betrachten? Und betrachten wir für einen Moment unsere eigene, klinische Situation, in der wir heute sehr viele Patienten sehen, die uns mit einem Anspruch konfrontieren und messen, der ganz stark vom medizinischen Denkmodell geprägt ist und in der wir selbst uns immer wieder mit Wünschen und Vorstellungen auseinandersetzen müssen, die auch als Resonanz unseres eigenen, zumindest impliziten medizinischen Denkmodells zu verstehen sind. Danach könnte man auch die Frage aufwerfen, ob der moderne Psychoanalytiker nicht unvermeidlich in einem Spannungsfeld steht, das zwischen den Polen des medizinischen Modells und dem psychoanalytischen Modell (das hier bislang nicht näher definiert wurde) liegt und daher unvermeidlich die Versuchung besteht, gleichsam einseitig auf das medizinische Modell zurückzugreifen, was in vielen Fällen als eine Abwehr oder ein Widerstand zu verstehen ist. Auch dies scheint zu belegen, dass der Film keineswegs nur aus historischen Gründen von Interesse ist, sondern einen grundlegenden, bis heute virulenten Konflikt zwischen dem medizinischen und dem genuin psychoanalytischen Denkmodell formuliert. Ich glaube, es lässt sich aber zeigen, dass Hitchcock durchaus einen kritischen und differenzierten Standpunkt in dieser Frage einnahm, vor allem, wenn man den Film aus der zweiten von mir formulierten Perspektive, nämlich als visuellen Kommentar zur analytisch-therapeutischen Situation und zum Behandlungsprozess betrachtet.
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
163
■ Der zweite Kontext: Der Behandlungsprozess In der Betrachtung innerhalb dieses Kontextes ist eine andere, eher implizite Lesart des Films denkbar, die dann noch mehr die Aktualität von »Spellbound« betont, aber als eher latentes Muster in dem Film postuliert werden kann. Hier würde das Lehrstück über die Psychoanalyse nicht der Angelpunkt sein, sondern nur der Anlass, um einen Film über einen zentralen Aspekt der therapeutischen Beziehung zu machen, und zwar explizit aus der Sicht des Analytikers und Therapeuten. Der Film stellt dann eine Krankenund Behandlungsgeschichte dar und wäre etwa vergleichbar mit Hitchcocks späteren, berühmteren Filmen wie »Vertigo« und »Marnie«. Danach würde der Film gleichsam die Innenperspektive der therapeutischen Beziehung darstellen und damit die Subjektivität des Analytikers in den Vordergrund stellen. Diese Version gerät in einen Gegensatz zum medizinischen Modell und lässt sich viel eher mit einem anderen Modell assoziieren, das Berns in der schon erwähnten Arbeit als das kontextuelle Modell bezeichnet hat. Die Komponenten dieses Modells beschreibt er folgendermaßen: »1. Komponente: Therapeuten sind hilfreich, weil und insofern sie ihre Persönlichkeit zur Gestaltung des therapeutischen Prozesses nutzen und sofern Patienten überzeugt sind, daß dies ein für sie hilfreiches, vernünftiges, professionelles psychotherapeutisches Vorgehen ist. […]
2. Komponente: Je nach Verfahren nutzt der Therapeut einen Behandlungsplan bzw. -schema oder einen -mythos, die zumindest ein Verständnis, wenn auch nicht notwendigerweise eine wahre Erklärung der Symptome des Patienten ermöglichen. […] 3. Komponente: Der Therapeut verfügt über Vorgehensmöglichkeiten, wie der Patient seine emotionalen Schwierigkeiten überwinden kann« (Berns 2004, S. 288f.).
Diesem kontextuellen Modell liegen wesentliche Befunde der modernen Psychotherapieforschung zugrunde, nach denen die spezifischen Interventionen der einzelnen Verfahren für therapeutische Veränderungen eine nur geringe Rolle spielen, dagegen die Persönlichkeit des Therapeuten, mit der er sich auf die therapeutische Beziehung einlässt, und vor allem auch seine Überzeugung und sein Glaube an die Methode, der entscheidende Faktor für den
164
Teil II: Subjekt und Geschichte
Veränderungsprozess darstellt. Das entspricht auch modernen Auffassungen der Psychoanalyse, die die analytische Situation als einen bipersonalen oder intersubjektiven Prozess beschreiben, in den der Analytiker unweigerlich mit seiner eigenen Persönlichkeit hineingezogen wird und diesen auch mit seiner Persönlichkeit und Problematik gestaltet, für die Entwicklung des Patienten nutzt, möglicherweise aber auch mit seinen eigenen, ungelösten Problemen und Konflikten blockiert. Der Patient und der Analytiker unterscheiden sich also nicht fundamental voneinander, der Behandlungsprozess ist immer ein Wagnis, die analytische Situation lässt sich nicht als ein steriles Operationsfeld darstellen und die »Störung« ist prinzipiell nicht lokalisierbar und eliminierbar, sondern kann lediglich verstanden, gemildert und erträglich werden. Vor allem geht es primär um die Bedeutung und um das Verstehen des Leidens, was immer kontextuell und interkontextuell aufzufassen ist – also auf dem Hintergrund der unbewussten Wirklichkeit, der Vergangenheit, der Konflikte und der gegenwärtigen Realität zu erfassen ist. Der Analytiker muss mit der Ungewissheit einer fragmentarischen, nicht bewiesenen Theorie und dem Fehlen sicherer, spezifischer Interventionen leben, aber gleichzeitig seinen Glauben an die analytische oder therapeutische Situation überzeugend vermitteln (z. B. dass es gut und hilfreich ist, zu versuchen, sich selbst und einem Anderen wahrhaftig gegenüberzutreten). Der Behandlungsprozess selbst wird als ein gemeinsamer Suchprozess verstanden, in dem der Analytiker mit seinen Interventionen dem Patienten die Grenzen seines Verstehens aufzeigt und in dem der Analytiker bereit ist, die unbewussten Antworten des Patienten auf seine Interventionen, die oft genug suchend und auch fehlerhaft sind, aufzugreifen und für das weitere Verständnis zu nutzen. Damit läuft der Behandlungsprozess über viele Verstrickungen und Irrwege, zu denen der Analytiker mit seinen Rollenübernahmen auch wesentlich beiträgt. Theoretischer formuliert beschreibt dieses kontextuelle Modell eine Position des Analytikers, die konträr zur Position im medizinischen Denkmodell ist. Schneider hat von der Atopie, also der Ortlosigkeit des Analytikers gesprochen und ich selbst habe als zentrale Dimension der analytischen Position von dem »Ort der Ortlosigkeit« gesprochen (vgl. Zwiebel 2001). Schneider schreibt:
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
165
»Ich sehe das Fundament der zentralen Bedeutung der atopischen Haltung für die Psychoanalyse in der psychoanalysespezifischen Dialektik von Wissen (Position des Wissens) und Nicht-Wissen und der ihr inhärenten Anerkennung des Nicht-Wissens als notwendigem und integralem und nicht in sich defizientem Teil des psychoanalytischen Denkens und der Praxis der Psychoanalyse (Position des Nicht-Wissens)« (Schneider 2003, S. 238).
Eine solche zweite Betrachtung wird möglich, wenn wir dem Film nicht nur konkret auf der manifesten Ebene von Situation zu Situation folgen, sondern nach dem fragen, was die einzelnen filmischen Situationen und ihre Sukzession über die unmittelbare Situation hinaus repräsentieren oder repräsentieren könnten. Hier eine andere, mögliche Betrachtungsweise des Films: Dr. Petersen ist eine junge Psychoanalytikerin, die selbst ein gravierendes, auch in ihrer eigenen Analyse ungelöstes, wahrscheinlich neurotisches Problem hat, nämlich dass sie selbst keine Liebeserfahrungen hat, da sie ihr diesbezügliches Wissen offenbar nur aus Büchern hat. Ihre sexuelle Hemmung könnte damit zusammenhängen, dass sie die Vater-Übertragung in ihrer eigenen Lehranalyse mit Dr. Brulov nicht gelöst hat, also inzestuös an ihn gebunden geblieben ist. Ironisch formuliert würden wir sie also als eine schlecht analysierte Analytikerin betrachten können. Bekanntlich macht dies besonders anfällig für starke Übertragungen und Gegenübertragungen gegenüber besonderen Patienten. Ein solcher »Patient« ist nun ohne Zweifel der angebliche Dr. Edwardes (er wird im Film förmlich in die Klinik »eingeliefert«): Es handelt sich um einen jungen, attraktiven Kollegen, der ihr Vorgesetzter sein oder werden könnte, also auch väterliche Züge hat, gleichzeitig aber sehr schnell seine schwere Erkrankung offenbart. Ihre Verliebtheit verstehen wir also nicht nur als eine wunderbare Liebe auf den ersten Blick, sondern als Repräsentation einer heftigen Übertragung aufgrund eigener ungelöster Probleme und Konflikte, die aber dazu führt, dass sie sich im Gegensatz zu ihren bisherigen Behandlungen (in denen sie kühl, distanziert und letztlich abweisend bleibt, im Notfall den Pflegedienst ruft oder Injektionen anordnet) voll auf ihren neuen »Patienten« einlässt. Man könnte auch sagen: Endlich stellt sie ihr eigenes medizinisches Denkmodell in Frage und beginnt nach dem kontextuellen Modell zu handeln. Sie erlebt nun die für einen analytischen Prozess durchaus charakteristischen Rollenzuweisun-
166
Teil II: Subjekt und Geschichte
gen durch ihren Patienten, in dem sie zur beschützenden, bedingungslos liebenden Mutterfigur, zur Geliebten, zur Detektivin, zur Therapeutin, zur Ärztin, zur Freundin und zur Retterin gemacht wird und teilweise diese Rollenzuweisungen auch übernimmt, weil sie sich nun voll auf die »therapeutische Beziehung« eingelassen hat. Wie wir heute wissen, gehört die Bereitschaft zur Rollenübernahme zur Voraussetzung einer gelingenden analytischen Behandlung, auch wenn dies natürlich nicht die erotische Liebe in ihrer konkreten Realisierung mit einschließt; diese würde ich in meiner Lesart gleichsam nicht konkretistisch verstehen, sondern als Ausdruck des unvermeidlichen Begehrens des Analytikers, das allerdings auf verschiedenen Ebenen gezügelt werden muss (nicht nur in erotischer Sicht, sondern auch in Bezug auf den Heilungswunsch und den Wunsch nach sicherem Wissen). Auch wird die Psychoanalytikerin im Film immer wieder von den Zweifeln angefallen, ob es sich bei ihrem Patienten nun um einen Täter (dafür steht der Verdacht, ein Mörder zu sein) oder um ein Opfer handelt (dafür steht der Verdacht, dass in seiner Kindheit oder Vergangenheit etwas Schreckliches vorgefallen sei). Mit anderen Worten: Aus dieser Sicht sehen wir eine Analytikerin, die keineswegs nur in der Position des Wissens verharrt, sondern sich mit ihren Gefühlen, ihren Konflikten und Zweifeln auf die therapeutische Beziehung einlässt und selbst ausgeprägte Reste einer neurotischen Problematik manifestiert. Dies lässt sich meiner Ansicht nach auch daran belegen, dass zwar die verbalen Äußerungen von Dr. Petersen aus der Position des Wissens kommen, sie jedoch in manchen ihrer nonverbalen Reaktionen durchaus unsicher und ängstlich wirkt, etwa die Szene am Anfang mit Mrs. Carmichal oder später die Szene mit Dr. Brulov, wo ihr »persönlicher Anteil« ganz stark zum Ausdruck kommt. In dieser Version erscheint die Haltung der Analytikerin sehr viel näher an einer modernen Auffassung der psychoanalytischen Haltung, die man auch als ein oszillierendes Spannungsfeld zwischen dem »Persönlichen« und dem »Technischen« auffassen kann, das sich nicht auflösen lässt, sondern toleriert werden muss und entscheidend für den therapeutischen Prozess zu nutzen ist (vgl. Hoffmann 1998; Zwiebel 2003a).
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
167
Schwieriger wird es, den Fortgang und das Ende der Geschichte zu interpretieren. Immerhin stellt der Suizid von Dr. Murchison ja die Beseitigung einer Vaterfigur dar und könnte somit die Lösung der inzestuösen Bindung bedeuten. Allerdings spricht vielleicht mehr für die Vermutung, dass ihre Übertragung und Gegenübertragung sie dazu verleitet, wieder in ihr medizinisches Denken zurückzufallen, zu glauben, dass man das Krankhafte, das Böse und die damit verbundene Schuld in irgendeiner Weise außen lokalisieren, aufspüren, dingfest machen und in gewisser Weise sogar ausmerzen kann, um auf diese Weise ihren kranken, geliebten Patienten zu heilen. Wir würden dies also als einen Rückfall in das medizinische Denkmodell verstehen, in dem ein gleichsam exorzistischer Prozess im Vordergrund steht, vielleicht als Folge ihrer nichtanalysierten, kritiklosen »Gegenübertragungsliebe«, in der sie an dem Glauben an die absolute Unschuld ihres »Patienten« festhält. Denn mit der Aufdeckung des Kindheitstraumas, in dem der Tod des Bruders als Unfall dargestellt und nicht in Erwägung gezogen wird, dass ja gerade die realisierten Todeswünsche ihm gegenüber die Quelle der quälenden Schuldgefühle sein mögen – und diese Möglichkeit wird durchaus in einer früheren Stelle des Films formuliert und wäre sozusagen als Deutung nach dieser Aufdeckung fällig –, scheint die Unschuld von J. Ballantine erwiesen und Dr. Petersen ist umso mehr schockiert, dass er nunmehr erneut unter realen Mordverdacht gerät. Um ihn jetzt zu retten, muss sie wirklich zur Detektivin werden und einen anderen Übeltäter dingfest machen, was ihr auch schließlich in der Entlarvung des Dr. Murchison, dieser wichtigen Vaterfigur, gelingt. Dies scheint mir aus der Innenperspektive des analytischen Prozesses die Gefahr zu repräsentieren, dass wir die als negativ und böse betrachteten Seiten unserer Patienten – den Hass, den Neid, die Entwertung, ja überhaupt die ganzen destruktiven Aspekte – gemeinsam mit dem Patienten verleugnen und sie als Opfer von bösen, mörderischen, übergriffigen Elternfiguren oder Lebensumständen begreifen wollen. Wir können also postulieren, dass das ganze Verhalten von Dr. Petersen ihrem Geliebten und »Patienten« gegenüber auch ihre implizite und sehr gespaltene Philosophie oder Theorie über seelische Störungen repräsentiert,
168
Teil II: Subjekt und Geschichte
die nämlich zwischen dem kontextuellen und dem medizinischen Denkmodell oszilliert. Aus dieser Sicht würde ich das Ende des Films als einen Rückfall in das medizinische Denken verstehen, in dem Dr. Petersen schließlich doch das kathartische Modell anwendet und der wahre Täter diagnostiziert und eliminiert wird. Mit anderen Worten: So gesehen, scheitert die Analyse, weil der Schuldkomplex von J. Ballantine nicht analysiert wird, weil nicht erkannt wird, dass es das eine traumatische Lebensereignis für die Entstehung der Neurose nicht gibt, dass das Trauma vielleicht sogar prinzipiell unzugänglich – jedenfalls in wichtigen Teilen – bleibt, wie auch fast alle Träume letztlich einen Nabel haben, wie Freud es genannt hat, der in unbekanntes und unzugängliches unbewusstes Feld führt, und weil sich J. Ballantine nicht wirklich mit seinen eigenen unbewussten, auch destruktiven Impulsen auseinander gesetzt hat. Diese Version erscheint mir jedoch insgesamt viel realistischer und entspricht auch meiner persönlichen und professionellen Erfahrung: Es gibt immer einen Punkt, an dem die Analyse zumindest begrenzt ist und letztlich einen ungewissen Ausgang hat, auch wenn es dem Analysanden in vielem besser geht und er sein Leben eindeutig verändert hat. Ein wesentlicher Punkt ist jedoch, dass sowohl der Analysand als auch der Analytiker für diese Unvollkommenheit die Verantwortung übernimmt, was wahrscheinlich nur möglich ist, wenn man den Versuchungen des medizinischen Denkmodells immer wieder widersteht und das medizinische Denken selbst als einen Rückfall beziehungsweise einen Widerstand gegenüber dem kontextuellen Denkmodell betrachtet. Während ich also gegenüber der ersten Version des Films eine distanzierte und ironische Haltung aufrechterhalten und aus einer ziemlichen Distanz einen historischen Bezug zur damaligen Situation der amerikanischen Psychoanalyse herstellen kann (falls ich die gegenwärtige »Medizinalisierung« der Psychoanalyse nicht beachte), fühle ich mich der zweiten Version, verstanden als subjektive Innenperspektive eines gegenwärtigen Analytikers, mit Dr. Petersen sehr verbunden, erkenne in den Abläufen eigene Erfahrungen und auch die Versuchungen der unterschiedlichen Rollenübernahmen und die Gefahren eines Rückfalls ins medizinische Denkmodell bis hin zu der Überlegung, dass ich womöglich im-
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
169
mer wieder in dieses Spannungsfeld gerate und von daher auch das erwünschte und ersehnte Happy-End, das ich vielleicht als Chirurg nach einem erfolgreich herausoperierten Blinddarm erleben könnte, in den analytischen Behandlungen nie erleben werde. So verstehe ich das letzte Bild mit dem fragenden und skeptischen Blick des Kontrolleurs als eine Botschaft von Hitchcock an uns Zuschauer, mit der er fragt, ob wir denn diese ganze Geschichte so wirklich glauben wollen. Der Film vermittelt nach dieser Deutung also zwei eher konträre, widersprüchliche Lesarten, die einem bei oberflächlicher Betrachtung eher entgehen. Auf der manifesten Ebene oder Oberfläche handelt es sich um einen Lehrfilm über Psychotherapie und Psychoanalyse, in dem die zentralen Theoreme der Psychoanalyse, das Unbewusste, die Konflikte, die traumatische Vergangenheit und ihre Heilbarkeit, dargestellt werden und beim Betrachter eine positive und optimistische Reaktion auszulösen vermögen; auf einer eher latenten Ebene handelt es sich um die Darstellung einer Krankengeschichte und ihrer Behandlung, in deren Verlauf die ganzen Verwicklungen und Verwirrungen aufgezeigt werden und eine Lösung angeboten wird, der man unweigerlich skeptisch gegenüber bleiben muss. Diese zweite Botschaft des Films, die womöglich auch dem Publikum einen kritischen Spiegel in seiner Begeisterung der Psychoanalyse gegenüber darstellt, dürfte eher untergegangen sein, wie man ja auch an der positiven Aufnahme des Films sehen kann und vor allem in der Steigerung der Nachfrage von Psychotherapie und Psychoanalyse. In dieser zweiten Sicht ist also der Film auch ein Film über die Gefahren der Psychoanalyse, vielleicht sogar eine Warnung vor ihr. Als praktizierender Psychoanalytiker muss ich allerdings gestehen, dass ich mich in dieser, vielleicht auch als ironisch zu bezeichnenden Version der Deutung von »Spellbound« und der Psychoanalyse von Hitchcock sehr verstanden fühle, weil er tatsächlich mehr von den Abgründen des psychoanalytischen Prozesses verstanden zu haben scheint als viele Bewunderer und Apologeten der Psychoanalyse, einschließlich der ganzen Ich-Psychologie in den 1940er Jahren in den USA.
170
Teil II: Subjekt und Geschichte
■ Der dritte Kontext: Selbstreflexion In dem ersten, besprochenen Kontext des Films geht es also vor allem auch um die Fragen, worum es sich bei der Psychoanalyse als Theorie und Behandlungsverfahren eigentlich handelt. Aus der Sicht des zweiten Kontextes, die partiell in einem deutlichen Widerspruch zu den Aussagen des ersteren stehen, geht es um die Frage nach der Natur des therapeutischen Prozesses. Ich habe zu zeigen versucht, dass die dabei in diesem Film aufgeworfenen Fragen keineswegs veraltet oder nur historisch zu verstehen sind, sondern dass sie selbst grundlegende, aktuelle Probleme der Verstrickung und persönlichen Beteiligung des Analytikers in der analytischen Situation berühren. Diese Überlegungen waren insofern interkontextuell, als sie ein In-Beziehung-Setzen zwischen dem Film selbst, der damaligen Situation der Psychoanalyse und der heutigen Betrachtungsweise versuchten. In dem dritten Kontext der Selbstreflexion möchte ich mich nun auf einen zentralen inhaltlichen Aspekt des Films beziehen, der nämlich mit der Schuldthematik in Verbindung steht. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass sich hier ein deutlicher Widerspruch in dem Film zeigen lässt, nämlich zwischen der Aussage zu Beginn des Films, dass die Schuld nicht in den Sternen, sondern in uns selbst liege, und dem »happy ending« des Films, der mit einem schuldlosen, erlösten und glücklichen Paar endet. Es sei hier kurz darauf verwiesen, dass diese Thematik der Schuld in sehr vielen Filmen von Hitchcock eine entscheidende Rolle spielt, vor allem in Filmen wie »Der falsche Mann«, »Vertigo«, »Psycho« und »Marnie«. Legendär in diesem Zusammenhang ist Hitchcocks immer wieder zitierte Anspielung auf seine eigene Kindheit, in der er einmal für kurze Zeit in ein Gefängnis auf Veranlassung des Vaters eingesperrt wurde, was man auch als Ausdruck eines kindlichen Schuldkomplexes betrachten kann, um den es ja in »Spellbound« auch geht. Der Vergleich mit anderen Filmen oder mit der Biographie von Hitchcock wären allerdings andere, interkontextuelle Bezüge, die ich hier nicht weiter betrachten möchte. Aus dem kontextuellen Bezug der Selbstreflexion möchte ich abschließend noch einige Gedanken zum »Schuldkomplex« des Analytikers äußern. Die Schwierigkeit in diesem Zusammenhang
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
171
ist der intime, persönliche Bezug, der in einer Veröffentlichung auf bestimmte Grenzen stößt, die allerdings nicht leicht auszuloten sind. Hier ein vorsichtiger Versuch, einen Bezug zwischen dem Film und meinen eigenen, persönlichen und professionellen Erfahrungen herzustellen. Die emotionale Berührung durch die Filmgeschichte und ihre Bilder hängt für mich persönlich vor allem mit der engen Verzahnung zwischen der persönlichen und technischen Ebene der Beziehung zwischen den Protagonisten und mit der darin bearbeiteten Schuldthematik und dem Wunsch, von der Schuld erlöst zu werden, zusammen. Dieser Wunsch nach Erlösung wird in dem Film durch die Liebe einer schönen und klugen Frau erfüllt: Schuld, Liebessehnsucht und Erlösung hängen also eng miteinander zusammen, und darin spiegelt sich nach meiner Auffassung eine zentrale Thematik vieler Analytiker und Therapeuten, die in ihrer Berufsmotivation und ihrer späteren Arbeit eine entscheidende Rolle spielen. Aus psychoanalytischer Sicht sind es die unbewussten, kindlichen Konflikte, die sich um die komplexe Verzahnung von Begehren und Aggression ranken, die einen Reparationswunsch und einen Wunsch nach Wiedergutmachung auslösen, um die in der Phantasie zerstörten Objekte wiederherzustellen. Der Schuldkomplex von J. Ballantine beruht demnach auf seinem unbewussten Todeswunsch seinem Bruder gegenüber, mit dem er um die Liebe seiner Eltern konkurrierte und der sich auf tragische Weise offenbar in der Wirklichkeit realisierte. Er wurde so zum »schuldigen Kind«, das der Erwachsene auch mit seiner Berufswahl unterdrücken oder erlösen wollte, bis es zu einer Wiederbelebung dieser Schuld kam, die seine neurotische Symptomatik auslöste. Constanze Petersen scheint in dem Sinne völlig »unschuldig«, aber wohl auch deshalb, weil ihre Sinnlichkeit weitgehend unterdrückt ist; durch die Begegnung mit J. Ballantine erwacht jedoch ihre Sinnlichkeit, die nun wiederum das »schuldige Kind« erlöst und befreit. Die Aufgabe der analytischen Ausbildung mit dem zentralen Teil der Lehranalyse besteht zu einem wesentlichen Teil darin, dieses »schuldige Kind« zu erkennen und seinen Anteil an dem Berufswunsch freizulegen und vor allem zu lernen, im Umgang mit der analytischen Situation und den Analysanden diesen kindlichen
172
Teil II: Subjekt und Geschichte
Teil nicht in den Vordergrund treten zu lassen (etwa in Form von illusionären Wiedergutmachungen oder missverstandenem therapeutischem Ehrgeiz). Wie auch in der Filmgeschichte deutlich wird, gelingt dies immer nur zu einem Teil, und das »schuldige Kind« bleibt im Unbewussten lebendig oder potentiell belebbar. Warum ist dies so? Zum einen, weil die frühen, verinnerlichten unbewussten Konflikte nicht auflösbar, sondern nur modifizierbar oder zu mildern sind. Zum anderen, weil die analytische Situation durch ihre regressive Prozesse fördernde Struktur besonders geeignet ist, auch das »schuldige Kind« im Analytiker wiederzuerwecken. Aus meiner persönlichen Sicht möchte ich sagen, dass dieser Punkt für die Entwicklung und Aufrechterhaltung der analytischen Position von entscheidender Wichtigkeit ist. Es dauert oft lange, bis man ohne starke Schuldgefühle einem Patienten eine Analyse anbieten kann, und es dauert manchmal noch länger, die Aktivierung des eigenen »schuldigen Kindes« in den Analysen zu erkennen, zu tolerieren und so gut es geht zu bearbeiten. Der Wunsch zu lieben und geliebt zu werden hängt wohl auf ganz intensive Weise mit diesem inneren »schuldigen Kind« zusammen, das auf diese Weise seine phantasierte Erlösung und Befreiung zu finden hofft. Vermutlich ist dies ein wesentliches, tieferes Motiv für viele Patienten, die eine Analyse oder Therapie aufsuchen, als der eher vordergründige Wunsch, von seinen Symptomen oder anderen Schwierigkeiten befreit zu werden. Kann ich als Analytiker meinen Patienten helfen, mit diesem Schuldkomplex, der aus dem »schuldigen Kind«, der Liebessehnsucht und dem Erlösungswunsch besteht, fertig zu werden, ihn zu modifizieren oder erträglich zu machen? In den analytischen Prozessen, die scheitern, gelingt dies offenbar nicht, und es kommt nicht selten zu einer Verstärkung des Schuldkomplexes, und zwar sowohl auf Seiten des Analytikers (er fühlt sich als schlechter Analytiker, der versagt hat) als auf Seiten des Patienten, der jedoch nicht selten seine Schuld durch Vorwürfe und Anklagen zu bewältigen versucht. Dies mag vielleicht ein wesentliches Risiko des analytischen Prozesses sein und zu der Angst beitragen, sich auf die analytische Beziehung voll einzulassen. Man bedenke, dass die Aufforderung zur freien Assoziation eine Ermutigung darstellt, sich auch seinen »schuldigen Seiten« zu stellen, was ja nur erträg-
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
173
lich bleibt, wenn diese durch Verständnis und Beziehung – durch einen empathischen Anderen – gepuffert werden und nicht wiederum zu einer Zerstörung (innen oder außen) führen. In den Prozessen, in denen dies jedenfalls partiell gelingt, wagen die Patienten, sich mit ihrem »schuldigen Kind« in die analytische Situation einzubringen, das heißt, auch ihr Begehren und ihre destruktiven Seiten zu erleben, und treffen auf einen Analytiker, der sich durch diese Angriffe nicht zerstören lässt. Das gelingt ihm aber nur, wenn er selbst in Kontakt mit seinem »schuldigen Kind« bleibt und sich nicht mit den Angriffen identifiziert – eine besondere Gefahr, die auch in dem Film durchgespielt wird, in dem J. Ballantine sich mit dem Mörder so weit identifiziert, dass er sich an seine Stelle setzt – oder seinerseits den Patienten zu attackieren beginnt, womit er das »schuldige Kind« im Patienten stärkt. Nach meiner persönlichen Erfahrung gibt es jedoch Situationen im Leben des Analytikers, in denen es ihm aufgrund von aktualisierten inneren Konflikten und äußeren Belastungssituationen schlechter gelingt, diesen sich immer wiederholenden Prozess mit seinen Patienten durchzustehen. Aus dieser Perspektive stellt die in der traumatischen Erinnerung wiederbelebte Szene, in der der kleine John Ballantine seinen jüngeren Bruder »beseitigt«, das zentrale, unbewusste Bild des »schuldigen Kindes« dar. Es handelt sich dabei um den Aspekt der ontologischen Schuld, der mit dem eigenen Dasein und der Behauptung der eigenen Lebendigkeit und des eigenen Platzes verbunden ist, und dem Aspekt der Beziehungsschuld, in dem es durch die eigenen Wünsche zu mehr oder weniger beabsichtigten Verletzungen des Anderen kommt, die sich entweder auf die Phantasie beschränken oder sich in der Wirklichkeit realisieren, eine Differenzierung, die das Kind in der Regel noch nicht ausreichend treffen kann.
■ Schlussbemerkung Bei einer weiterführenden interkontextuellen Betrachtung wären die drei näher diskutierten Kontexte in ihrer Beziehung untereinander vertieft herauszuarbeiten, nämlich der dem analytischen
174
Teil II: Subjekt und Geschichte
Verfahren inhärente Widerspruch zwischen dem medizinischen Denkmodell und dem kontextuellen Modell in Verbindung mit der intersubjektiven Beziehungsdimension und der Problematik des »schuldigen Kindes«. Interessanterweise ergäbe sich hier aus der Diskussion des Films eine Hypothese, die man in einem klinischen und selbstreflexiven Kontext weiter überprüfen müsste: Je mehr der Analytiker die Problematik seines inneren »schuldigen Kindes« durchgearbeitet und bewältigt hat, umso mehr wird er sich auf die analytische Situation als intersubjektives Geschehen einlassen können und umso mehr ist er vor den Gefahren eines einseitigen Rückfalls ins medizinische Denkmodell gefeit. Da dies den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen würde, kann ich hier diese Überlegungen nicht vertiefen. Eine solche Hypothese mag jedoch als ein Beleg für die eingangs erwähnte Auffassung der Film-Psychoanalyse betrachtet werden, nachdem wir sie auch als generative Psychoanalyse auffassen können und damit weiterführende Hypothesen über unsere klinische Tätigkeit und unsere Theorie zu entwickeln vermögen.
■ Literatur Berns, U. (2004): Spezifische psychoanalytische Interventionen. Forum Psychoanal. 20: 284–299. Hoffman, I. Z. (1998): Ritual and spontaneity in the psychoanalytic process. A dialectical-constructionist view. Hillsdale, NJ. Huber, H. D. (2001): Interkontextualität und künstlerische Kompetenz. In: Bühler, M.; Koch, A. (Hg.): Kunst & Interkontextualität. Materialien zum Symposium schau-vogel-schau. Köln, S. 29–47. Sabbadini, A. (2001): Psychoanalyse und ihre (Fehl)darstellung im Film – von Pabst über Hitchcock und Huston zu Brodys 1919. Psyche – Z Psychoanal. 55: 422–428. Schneider, G. (2003). Die Zukunft? Plädoyer für eine atopische Grundhaltung in der Psychoanalyse – mit einem Exkurs zu Melvilles Bartleby. Psyche – Z. Psychoanal. 57: 226–248. Schneider, G. (in Vorb.): Film und psychoanalytische Theorie. In: Pfarr, U. et al. (Hg.): Lexikon psychoanalytischer Begriffe für die Kunstwissenschaft. Truffaut, F. (1989): Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? München (Original 1975).
R. Zwiebel · Überlegungen zu Hitchcocks »Spellbound«
175
Original Wilber, K. (2002): Das Wahre, Schöne, Gute. Geist und Kultur im 3. Jahrtausend. Frankfurt a. M. Zeul, M. (1994): Bilder des Unbewußten. Zur Geschichte der psychoanalytischen Filmtheorie. Psyche – Z. Psychoanal. 48: 975–1003. Zizek, S. (1998): Ein Triumph des Blicks über das Auge: Psychoanalyse bei Hitchcock. Wien. Zwiebel, R. (2003a): Die Position des Analytikers. In: Gerlach, A.; Schlösser, A.-M.; Springer, A. (Hg.): Psychoanalyse mit und ohne Couch. Gießen, S. 36–59. Zwiebel, R. (2003b): Höhenschwindel – psychoanalytische Anmerkungen zu Trauma und Melancholie in Hitchcocks »Vertigo«. In: Cinema Quadrat e.V., Mannheim u. a. (Hg.): Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie, Schriftenreihe Band 1: Alfred Hitchcock. Mannheim, S. 40–51. Zwiebel, R. (2003c): Psychische Grenzen und die innere Arbeitsweise des Analytikers. Psyche – Z. Psychoanal. 57: 1131–1157. Zwiebel, R. (2005): Die doppelten Botschaften der Eltern. Überlegungen zum »Dekalog 4« von K. Kieslowski. In: Wellendorf, F.; Werner, H. (Hg.): Das Ende des Ödipus. Entwertung und Idealisierung ödipaler Konzepte in der Psychoanalyse heute. Tübingen, S. 343–364.
■ Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen am Beispiel von Roman Polanskis »Der Mieter«
Überleitung 3
Der letzte Teil dieses Bandes umfasst drei Beiträge zum Film »Der Mieter« von Roman Polanski. Auf der erwähnten Tagung »Projektion und Wirklichkeit« wurde dieser Film als einziger gezeigt und am folgenden Tag von verschiedenen Interpreten mit den Zuhörern diskutiert. Die im zweiten Teil angedeutete These über die zentrale Deutungsphantasie des Interpreten kann an diesen Beispielen weiter vertieft werden. Hatten wir es bislang mit Filmen von verschiedenen Regisseuren zu tun, die auch eine jeweils spezifische Resonanz in der Deutungsphantasie des interpretierenden Zuschauers ausgelöst hatten, so geht es hier um denselben Film, den Zuschauer zur selben Zeit gesehen haben und der hier von drei verschiedenen psychoanalytisch orientierten Interpreten besprochen wird. Da der Film »Der Mieter« (1976) in den folgenden Beiträgen mehrfach detailliert aufgegriffen wird, soll hier kurz der Inhalt wiedergegeben werden: Der Protagonist Trelkovsky, ein schüchterner junger Mann (gespielt von Roman Polanski selbst) bezieht in einem Pariser Wohnhaus eine schäbige, kleine Wohnung, die durch den selbstmörderischen Fenstersturz der Vormieterin frei geworden ist. Je länger er in der Wohnung lebt, umso mehr verschmilzt seine ohnehin fragile Identität mit der seiner Vormieterin, bis er sich am Ende des Films wie diese in den Abgrund des Hinterhofs stürzt. Annegret Mahler-Bungers warnt davor, den Film als »Krankengeschichte« zu lesen und damit seine irritierende Botschaft von sich fernzuhalten. Stattdessen betrachtet sie den Film anhand seiner scheinbar marginalen audiovisuellen Gestaltungsstrukturen und narrativen Details gleichsam multifokal als ein intertextuelles
180
Teil III: Psychoanalytische orientierte Filmbetrachtungen
Geflecht verschiedener Sinngebungsbemühungen, das heißt, als filmische Reflexion über Entstehung und Gefährdung des Ich (als »Mieter«), über die Rolle des Außenseiters (als »Abjekt«) der Gesellschaft und über die selbstdestruktiv-kreative Erschaffung des künstlerischen Subjekts (als »Narren«). Dabei geht sie dem meist übersehenen Verdoppelungsmotiv (besonders des Filmendes) und der Bedeutung des Witzes nach, die das klaustrophobische Universum der manifesten Filmerzählung sprengen. Ob ihre zentrale Deutungsphantasie in Kontakt mit der unbewussten Opusphantasie des Regisseurs kommt, könnte sich im Kontext seiner Bio- und Filmographie bewähren, was die Autorin anhand von Polanskis Film »Der Pianist« versucht hat. In Gerhard Bliersbachs Beitrag tritt der Autor sehr deutlich als Zuschauer in Erscheinung. Er ist ein Kinogänger und Kinokenner. Er betrachtet Filme als Reise und Selbstanalyse und scheut sich nicht, seine Ängste und Erinnerungen, die vom Film ausgelöst werden, zu notieren. Bliersbach geht nicht davon aus, dass der Film ein »Patient« ist, sondern ein »Kollege«. Sein methodischer Ansatz kreist um die beiden Fragen, wie er als Subjekt den Film liest und wie der formale Aspekt des Films zu beschreiben ist. Daher wendet er sich auch sehr detailliert den einzelnen Szenen des Films zu. Die ersten Szenen werden genau wie in einem analytischen Erstinterview beschrieben, mit einem zweiten Blick wird die erste Begegnung mit dem Protagonisten noch einmal vertieft und ein erster Befund geschildert, der das ganze weitere Verständnis strukturiert: ein Mensch, der vom Verschwinden bedroht ist und einen verzweifelten Kampf dagegen entfacht bis zu seiner eigenen Auslöschung. Diesen Beginn setzt er in einen intertextuellen Bezug zu Hitchcocks »Das Fenster zum Hof«, wobei an der Kameraführung bereits wesentliche Differenzen deutlich werden: Der Protagonist von »Das Fenster zum Hof« dringt ein, der von »Der Mieter« schreckt zurück (der Abscheu vor dem Hof). Es gibt auch eine Bezugnahme zu anderen Werken des Regisseurs (»Ekel«, »Rosemary’s Baby«), sein Verhältnis zu Hitchcock und zum Hollywood-Kino, aber kein Versuch, Polanski »auf die Couch« zu legen. Kehren wir damit zur zentralen Deutungsphantasie zurück, so könnte man vielleicht sagen, dass Bliersbach mit vorsichtigen, assoziativen Bemerkungen sich einer Deutungsfigur nähert, die da-
Überleitung 3
181
durch, dass sie nicht klar ausgesprochen wird, dem Leser und dem Zuschauer seine selbstanalytischen und selbstreflexiven Bemühungen nicht erspart. Insofern könnte man auch hier eine stimmige Resonanz zwischen dem Filmverständnis und der möglichen Opusphantasie oder auch der unbewussten Botschaft von Polanski vermuten. Gerhard Schneider beschreibt Polanski als Visu-Psychoanalytiker des klinischen Psychoanalytikers, der in seinem visuellen Medium einen Deutungsvorschlag macht, der sich auf die »inhärente Vernichtungslogik einer psychischen Identität [bezieht], die über einem primären Nein zu ihrem Träger aufgebaut ist«. Diese exemplifiziert Schneider anhand einer genauen Bildanalyse, die vor allem von der Eingangs- und Schlusssequenz des Films ausgeht. Die vergebliche Suche nach einem Halt gebenden Raum und der endgültige Sturz in einen grauenvollen Abgrund ist geprägt von dieser grundlegenden Dynamik, die sich als Unterwerfung, als Verbot des eigenen Nein, als Verbot des eigenen Begehrens und in Form der Löchrigkeit der psychischen Haut manifestiert und am Duktus der Filmbilder deutlich gemacht werden kann. Deutlicher als Bliersbach in seinem Beitrag formuliert Schneider eine These über die unbewusste Botschaft von Polanski, in der sich ein Aspekt seiner Opusphantasie ausdrücken mag. Es gehe Polanski darum »die (Selbst-)Vernichtungslogik erkennbar zu machen, die der durch eine primäre Negation definierten psychischen Verfasstheit oder Identität, vielleicht traumatisch bedingt, inhärent ist«. In dieser Formulierung der Botschaft des Films macht sich Schneider seine eigene zentrale Deutungsphantasie verfügbar oder formulierbar, deren Quellen in der sehr präzisen Untersuchung der Filmbilder und seiner eigenen theoretischen Interessen zur Identitätsproblematik liegen. Intertextuelle Bezüge (etwa ein Vergleich mit Hitchcocks »Vertigo«), biographische Hinweise (bis auf die Verweise zur sozio-kulturellen Perspektive, die auch den Regisseur betrifft) und direkte selbstreflexive Anmerkungen bleiben in der Latenz.
■ Annegret Mahler-Bungers
Projektion und Wirklichkeit Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
■ Vorbemerkung Die ersten Besucher des Kinos vor hundert Jahren erlitten beim Anschauen der laufenden Bilder einen Realitätsschock, denn sie hielten die filmischen Projektionen auf die Leinwand für Wirklichkeit. Das Kino war immer bestrebt, diese Illusion zu nähren, denn darin besteht sein Reiz. Das Kino spielt also in seinem Dispositiv mit der Neigung der menschlichen Psyche, Dinge und Qualitäten in der Außenwelt zu »sehen«, die dieser an sich nicht anhaften, sondern unserem Innenleben entstammen. Obwohl jede normale Wahrnehmung von Projektionen durchsetzt ist, sind wir bestrebt, Projektion und Wirklichkeit möglichst weitgehend zu unterscheiden, aber eine vornehmlich durch Projektionen verzerrte Realitätswahrnehmung gilt als pathologisches Phänomen. Aus psychoanalytischer Sicht ist Projektion eine Abwehr, mittels derer das Subjekt der Außenwelt – seien es Personen oder Dingen – Qualitäten, Gefühle oder Wünsche zuschreibt, die es in sich selbst ablehnt, verwirft und verleugnet. Bei der Projektion geht es also um eine mangelnde Unterscheidung von Innen und Außen, und bei der pathologischen Projektion um einen weitgehenden Kollaps dieser Unterscheidungsfähigkeit. In drei seiner Filme hat Roman Polanski thematisch mit diesem Verwirrspiel von Projektion und Wirklichkeit gespielt: in »Ekel« von 1965, in »Rosemary’s Baby« von 1968 und in »Der Mieter« von 1976 – Filme, die innerhalb seines Gesamtwerks eine Art Trilogie bilden. Alle drei Filme thematisieren die Desintegration einer Persönlichkeit, die sich in den klaustrophobischen Orten düsterer Mietswohnungen eingeschlossen sehen. Aber jeder dieser Filme kontrolliert und manipuliert
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
183
die Wahrnehmung des Zuschauers auf andere Weise. In »Rosemary’s Baby« wird die Frage von Projektion oder Wirklichkeit (auf der narrativen Ebene) letztlich nicht aufgelöst, während in »Ekel« der Zuschauer von Beginn die paranoide Entwicklung seiner Protagonistin als eine solche erkennen kann. Mein Versuch einer FilmPsychoanalyse von »Der Mieter« orientiert sich zunächst an der Art und Weise, wie Polanski das schwierige Wechselspiel von Projektion und Wirklichkeit audiovisuell und narrativ gestaltet hat und mit welchen Darstellungsmitteln er das paranoid-klaustrophobische Universum aufbricht und transzendiert.
■ Innere Welt Der Film »Der Mieter« erzählt auf der manifesten Ebene eine Krankengeschichte, welche die konsequente Desintegration einer Persönlichkeit bis hin zu ihrem Suizid zum Inhalt hat. Als eine solche Fallgeschichte könnte der Film jedoch allenfalls Psychiater interessieren. Daher scheint mir diese einfache Lesart vor allem eine Abwehr dagegen zu sein, sich von der Beunruhigung, die von der filmischen Darstellung ausgeht, berühren zu lassen. Der Film verführt andererseits zu einer solchen Interpretation. Polanski selbst charakterisiert den Protagonisten Trelkovsky in seiner Autobiographie lakonisch als einen »schüchternen, aus Polen stammenden Bankangestellten, dessen schleichende Schizophrenie zu Transvestitentum und Selbstmord führt« (Polanski 1984, S. 323). Jedoch möchte ich mich von diesem zurückhaltenden Kommentar des Regisseurs nicht zu einer Lesart verleiten lassen, die sich in einer Diagnose des Protagonisten erschöpft und sich von dessen Psychose, Schizophrenie und Persönlichkeitszerfall zu entsprechenden spekulativen psychogenetischen Rekonstruktionen hinreißen lässt, für die es keinerlei filmische Indizien gibt. Die Reduktion der Figuren auf quasi reale Figuren mit einer umschriebenen Pathologie würde den Film als Kunstwerk und damit das metaphorische und metonymische Spiel verfehlen, das der Film mit dem Zuschauer treibt. Ich möchte also versuchen, der Lesart des Films als Krankengeschichte zu widerstehen, und den Film zu-
184
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
nächst als Bebilderung einer inneren Welt betrachten, die zwar – innerhalb der Filmerzählung – die des Protagonisten ist, darüber hinaus aber gleichzeitig unsere eigene betrifft. Schon der Vorspann des Films bringt den Zuschauer mit eigenen Ängsten in Berührung, indem der subjektive Kamerablick unsere Wahrnehmung mit der des Protagonisten Trelkovskys identifiziert. In langsamem Schwenk kreist die Kamera über die Fassaden eines von dem Filmarchitekten Pierre Guffroy aufwendig gebauten düsteren, heruntergekommenen Pariser Innenhofs und evoziert dabei das Erleben eines klaustrophobischen Eingeschlossenseins. Zunächst schauen wir mit Trelkovsky auf ein altes Fenster, hinter dessen Gardine eine weibliche Gestalt den Zuschauer zu beobachten scheint, dann fährt die Kamera senkrecht die Hauswand hinunter bis zu dem Glasdach, in dem der Körper von Simone Choule, Trelkovskys Vormieterin, ein schwarzes Loch hinterlassen hat (was wir allerdings erst später erfahren), um dann kreisförmig über die schäbigen Fensterfronten des Mietshauskomplexes zu schwenken, wobei hinter den Gardinen immer wieder schemenhaft Gestalten erahnbar werden, bis schließlich eine Frau etwas deutlicher zu sehen ist, die fast unmerklich von der Gestalt des Protagonisten Trelkovsky überblendet wird. Auf diese Weise evoziert der Vorspann nicht nur ein Gefühl des Eingekreist- und Beobachtetseins, sondern durch die unmerkliche Überblendung konfrontiert er uns auch mit der Unsicherheit unserer Wahrnehmung und damit zugleich mit den unfesten Grenzen dessen, was wir unsere »Identität« nennen. Wäre dieser Vorspann ein Traum von mir, so würde ich diese filmische Topographie als mein Inneres deuten und die undeutlichen Figuren hinter den Fenstern als innere Objekte, deren Blicke mein (geträumtes) Ich kontrollieren. »Le locataire chimérique« heißt der Roman, den Polanski für diesen Film adaptierte. Eine Chimäre ist ein Organismus, der aus Heterogenem zusammengesetzt ist, genauer: aus genetisch verschiedenen Zellen. Aber nicht nur diese Gestalten, die Überblendung und das räumliche Eingeschlossensein allein erzeugen im Zuschauer ein Gefühl von Unsicherheit, es ist auch die Tonspur mit einem unaufdringlich-fragilen musikalischen Grundmotiv, teilweise auf einer Glasharfe gespielt, das dann eine Klarinette übernimmt, der
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
185
Glasharfenklänge als musikalischer Teppich unterliegen. Diese unaufdringliche Musik von Philippe Sarde indiziert eine beängstigende Zerbrechlichkeit und sie erklingt den ganzen Film hindurch immer dann, wenn sich das »Ich« aufs Neue durch die Übermacht innerer verfolgender Objekte gefährdet sieht. Auch fühlt sich der schauende Zuschauer selbst angeschaut. Der verfolgende, kontrollierende Blick ist ein Motiv, das sich durch den gesamten Film hindurchzieht und sich in verschiedenen Variationen wiederholt. Nicht nur Trelkovsky selbst beobachtet durch das Fenster die Gestalten, die sich gegenüber auf der Toilette aufhalten, sondern diese beobachten auch ihn, stundenlang und unbeweglich. Deren Blicke sind von Beginn an böswillig und vernichtend. Trelkovsky nähert sich freundlich zuvorkommend der Concierge (Shelley Winters) und begegnet einem hermetisch abweisenden Blick, der ihn und mit ihm den Zuschauer abprallen lässt. Als Trelkovsky mit Stella (Isabelle Adjani) im Kino sitzt, lässt der Blick eines hinter ihnen sitzenden Zuschauers die sexuelle Annäherung der beiden geradezu einfrieren. Schon der Titel appelliert an das jedem bekannte Mietergefühl, zwangsweise einer Gemeinschaft anzugehören, deren Regeln man sich zu unterwerfen hat, die man sich nicht aussuchen kann, auf Nachbarn Rücksicht nehmen zu müssen, ihren kritischen Blicken ausgesetzt zu sein und so weiter. In diesem Zusammenhang sind paranoide Anwandlungen durchaus etwas Normales, wenn auch in der Regel Flüchtiges. Als Freud das Diktum formulierte, dass das Ich nicht Herr im eigenen Hause sei, hat er dieses, obwohl es sich als »Hausbesitzer« fühlt, als einen Mieter charakterisiert. Er wollte damit sagen, dass das Ich einen hohen Preis hat, weil es mühsam den archaischen Triebkräften abgerungen werden musste und daher immer gefährdet bleibt durch die Kräfte des Unbewussten, die seine ihm fremd gewordenen Mitbewohner bleiben und es stets latent oder manifest in Frage zu stellen bereit sind. Im Haus unserer Subjektivität kann das Ich infolgedessen immer nur unter Mietvertrag stehen, der ihm jederzeit gekündigt werden kann. Die Hausordnung ist zwar zum Überleben notwendig, aber sie wird dem werdenden Ich von innen und außen mehr oder weniger aufgezwungen. Trelkovskys Eintritt in das Pariser Mietshaus und seine Unter-
186
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
werfung unter die Mietregeln des finsteren Besitzers M. Zy (Melvyn Douglas) kann man, sieht man den Film als eine Bebilderung unserer Innenwelt an, als Eintritt des Subjekts in die symbolische Ordnung der Sekundärprozesse lesen. Entscheidend dabei jedoch ist, dass diese Ordnung in »Der Mieter« sowohl verbal (in ihrer kleinbürgerlich einengenden Form) als auch visuell (die dunklen und engen Wohnungen) als ein Raum entworfen wird, der keine Öffnung hat, nicht ins Offene und Freie führt, sondern ein rigides, in sich geschlossenes System bildet, das sich durch strikte Verwerfung des ihm Fremden konstituiert. Sie ist ein klaustrophobischer Ort. Die Erfahrung der Gefahr eines solchen Einschlusses unseres Denkens und Fühlens in ein geschlossenes symbolisches System (z. B. in festgefügte Weltanschauungen, Ideologien oder auch Theoriegebäuden) ist keinem Zuschauer fremd und macht sich in einem Gefühl bedrückender Unfreiheit bemerkbar, die kreative innere Freiräume kollabieren lässt. In der Literatur über den Film wird gelegentlich auf Kafkas Erzählung »Die Verwandlung« verwiesen, in der Gregor Samsa sich morgens plötzlich in einen Käfer verwandelt sieht (Werner 1981). Der Eindruck des Kafkaesken in »Der Mieter« entsteht in meiner Sicht jedoch nicht durch das Verwandlungsmotiv, sondern durch die eigentümliche Verwischung von Projektion und Wirklichkeit, die atmosphärisch durch die Lichtgebung im Film unterstützt wird. Von gelegentlichen Aufhellungen abgesehen, sehen wir Trelkovsky, vor allem wenn er allein ist, im Halbdunkel, in einer Art Düsternis, durch die kein rechter Lichtstrahl dringt, als bewege er sich auf der Schwelle zwischen Bewusstsein und Unbewusstem, zwischen innerer und äußerer Realität. Bemerkenswert erscheint mir zudem eine akustische Metapher zu sein: Trelkovskys Aufenthalte in der Wohnung werden regelmäßig durch das unentwegte leise Tropfen des undichten Wasserhahns in seiner Küchenecke begleitet. Der »nicht ganz dichte« Wasserhahn schafft eine Verbindung zur »Unterwelt« der Stadt, ihrer Kanalisation (vgl. Visarius 1986), so als sei der Mieter ständig von den Strömen unbewusster Triebregungen bedroht. Das Zwie-Licht und der akustische Eindruck des Undichten lassen im Zuschauer jenes Gefühl des Unheimlichen entstehen, das bei der Infiltration des Bewusstseins durch unbewusste Vorstellungsinhalte entstehen kann und das
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
187
Freud als das verdrängte Vertraute, das fremd und unheimlich gewordene Heimelige charakterisiert hat (Freud 1919). Sowohl Kafka als auch Polanski hegen eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem Konstrukt des Ich und damit gegenüber einer eindeutig auszumachenden Grenze zwischen Innen und Außen. Sie zeigen in ihrem Werk, wie sich aus der vermeintlichen Einheit des Selbst seelische Fragmente ablösen, die dieses Selbst zu verfolgen beginnen. In einer zentralen Szene fragt sich Trelkovsky, was dieses Ich eigentlich sei, wo es beginne und wo es aufhöre: »Mir werden beide Arme amputiert, ich sage: ich und meine beiden Arme. Mir werden beide Beine abgenommen. Ich sage: ich und meine Glieder. Der Magen, die Leber, die Nieren werden – angenommen, es sei möglich – entfernt. Ich sage: ich und meine Organe. Man haut mir den Kopf ab: was soll ich sagen? Ich und mein Körper oder ich und mein Kopf? Mit welchem Recht maßt sich mein Kopf, der doch auch nur ein Glied ist, den Titel ›ich‹ an?« Trelkovsky als Typus des kleinen Angestellten erinnert vor allem an die Figur des Josef K. in Kafkas Roman »Der Prozess« (1925). Und wenn es in Kafkas literarischem Kosmos das »Gesetz« ist, das den allmählichen Untergang seiner Protagonisten vorantreibt, so ist es in »Der Mieter« die erdrückende Hausordnung, an der Trelkovsky zugrunde geht. Der innere Terror des Verbotssystems manifestiert sich auch bei Kafka projektiv in den kontrollierenden Blicken der Anderen. »K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete […]« lesen wir im ersten Kapitel von Kafkas »Der Prozess« und: »Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen« (Kafka 1925/1983, S. 7f.). »Alles« sind (im Film wie bei Kafka) die heterogenen Aspekte des chimärischen Subjekts, vor allem die verborgenen und verworfenen, die es den Blicken der anderen entziehen, aber auch vor sich selbst verstecken möchte. Obwohl Trelkovsky zunächst dem Zwang einschränkender Verbote, die ihm der Vermieter auferlegt, und dem hohen Mietpreis, den er zahlen soll, etwas entgegenzusetzen sucht, beugt er sich doch sehr schnell und unterwürfig allen Regeln und Bedingungen des Hausbesitzers, um
188
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
als Mieter akzeptiert zu werden. Die Bedingungen des M. Zy sind karikaturhafte Verdichtungen der fundamentaleren Tabus, auf deren Einhaltung die Ordnung des Ich (und der Kultur) beruht. M. Zys »Gesetz« verbietet Frauen (Sexualität), Kinder (ungezähmte Naturwesen), Lärm und Schmutz, also jede Form kreatürlicher Lebensäußerung. M. Zy fordert einen so radikalen Triebverzicht, dass seine Hausordnung in ein rigides und ideologisch in sich geschlossenes System pervertiert, das auf der Subjektebene klinisch als Zwangskrankheit beschrieben werden kann. Der Zwangskranke fühlt sich ständig von libidinösen oder aggressiven Triebdurchbrüchen bedroht und muss sich gegen sie hermetisch abdichten. Insofern sind M. Zy und Trelkovsky nur zwei Personalisierungen ein und derselben Problematik des Subjekts. Die labile, nicht »ganz dichte« Grenze zwischen Kultur und Natur, Symbolischem und Präsymbolischem, Ordnung und Chaos, Bewusstem und Unbewusstem, Über-Ich und Es, Subjekt und Objekt wird filmisch visuell und akustisch repräsentiert (auch durch die zerbrechliche Glasharfenmusik) und im Verlauf des Films durch wachsende konkrete Realitätsverzerrungen visualisiert (z. B. durch eine Vergrößerung des Raums und seiner Möbel, durch die Überblendung von Gesichtern mit projizierten Physiognomien usf.). Die eigentliche List der Darstellung liegt in den unauffälligen und gleichzeitig signifikanten Details, in denen das Tabuisierte selbst »zum Vorschwein« kommt, das ja eigentlich den Blicken der anderen entzogen werden soll, sich aber doch durch den ganzen Film hindurch den Blicken des Zuschauers darbietet. Diese scheinbar marginalen Details lösen im Zuschauer gleichsam kontrafaktisch keineswegs immer und in Identifikation mit Trelkovsky ein Gefühl des Unheimlichen, Horror oder Angst aus, sondern ein befreiendes Lachen. Auf das Phänomen des Komischen werde ich weiter unten genauer eingehen. Zunächst ist da die Toilette, die gleichsam aus der Wohnung exkommuniziert ist. Das Gesetz des M. Zy verbietet alle kreatürlichen und körperlichen Lebensäußerungen. Nichts wird von dieser Ordnung – und von Trelkovsky selbst – mehr gefürchtet und daher angstvoll abgewehrt als der Einbruch des kreatürlich Triebhaften, das in der unbewussten Phantasie mit dem primären, archaischen Objekt, der »frühen Mutter« verknüpft ist und mit Af-
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
189
fekten des Ekels und des Abscheus einhergeht. An dieser Stelle können die Überlegungen von Julia Kristeva über den Abscheu für das Verständnis des Films von großem Nutzen sein (Kristeva 1983). In Anlehnung an Freuds Konzept der »Urverdrängung« beschreibt sie den Beginn der Subjektwerdung als einen Akt notwendiger Gewalt, als gewaltsame Trennung, mit der das Ich sich setzt und absetzt von der Sphäre des primären Objekts, die nunmehr als bedrohliches Außen und als grauenerregender schwarzer Schlund erlebt wird, der umso faszinierender und damit anziehender ist, je labiler die Subjektgrenzen sind. »Die Loslösung von dem Körper der Mutter, das Fort-Da-Spiel, Analität und Oralität wirken als fortwirkende Negativität, die die imago und das isolierte Objekt zu vernichten trachtet« (Kristeva 1983, zit. nach Suchsland 1992, S. 121). Um der primären Fusion mit der Mutter zu entwachsen, muss das werdende Subjekt nach Kristeva quasi einen symbolischen Muttermord begehen, indem es die frühe Imago nunmehr als Ab-jekt (eine Analogiebildung zu Ob-jekt, wobei abjection das französische Wort für »Abscheu« ist), als das Unreine und das Fremde seiner selbst ausstößt und als Ausgestoßenes verabscheut, was beispielsweise im Ekel vor den Ausscheidungen des Körpers und vor dessen Verwesung und Verwesendem überhaupt zum Ausdruck kommt. Kulturell hat sich nach Kristeva dieser Vorgang der Abjektion (je nach Tradition) in rituellen Tabus des »Unreinen« (z. B. koscheres Essen bei den Juden, die »unreinen« Kasten bei den Indern) niedergeschlagen (vgl. Suchsland 1992, S. 133ff.). Bei der Besichtigung der Wohnung führt die Concierge Trelkovsky mit geradezu süffisanter Geste zum Fenster und lässt ihn in die Tiefe auf das Glasdach mit dem Loch schauen, das Simone Choules Körper durchschlagen hat, als sei dieser Weg die einzige Öffnung, die aus dem klaustrophobischen System des Hausgesetzes herausführt: das schwarze Loch, der Tod selbst. Die Szene gemahnt in meiner Sicht latent an die destruktive Ausstoßung des Abjekts, das die symbolische Ordnung stört und verunreinigt, aus der Einfriedung der Subjektivität. Auch das außerhalb der Wohnung gelegene Klo, der Ab-Ort indiziert den aus der Topographie der Wohnungen verbannten Ort des Abjekts. Das Abjekt als das Erste, wovon sich das Ich trennen muss, ist auf der Körperebene Abfall, Produkt eines Ausscheidungsprozesses, Müll, Erbrochenes,
190
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Rotz, Urin und Scheiße. Durch den Film geistern marginale, dafür aber hoch signifikante Details, die die Sphäre des Ekels und des Abscheus berühren, das heißt, das Ausgestoßene ist im Film immer anwesend; denn je heftiger es verworfen wird, desto mehr drängt es sich auf. Schon in seinem Film »Ekel« von 1965 (dessen original englischer Titel »Repulsion« mehr an den primären Abstoßungs- und Ausstoßungsakt erinnert) hatte Polanski einen Persönlichkeitszerfall intuitiv und treffend mit einem Gegenstand des Abscheus in Zusammenhang gebracht. Dort war es ein gebratenes, allmählich in einer Schüssel immer mehr verwesendes Kaninchen, das Carol zu »entsorgen« nicht in der Lage ist, während ihre Persönlichkeit langsam zerfällt. Die Spuren des Abjektalen sind in »Der Mieter« verstreuter, unaufdringlicher. Die Concierge putzt sich auf fast ekelhafte Weise die Nase, bevor sie dem neuen Mieter die Wohnung aufschließt. M. Zy pult sich mit einem Zahnstocher einen Essensrest aus den Zähnen, um ihn dann wieder in den Mund zu schieben. Als Trelkovsky Simone Choule im Krankenhaus besucht, schwenkt die Kamera kurz auf eine ältere Bettnachbarin, deren Gesicht in Erbrochenem liegt. Trelkovsky lässt die mitgebrachten Apfelsinen unter das Krankenbett fallen, und als er mit Stella vom Krankenhaus nach Hause geht, sehen wir ihn in Scheiße treten, das heißt, wir schließen darauf aus seinem Gang und der Art und Weise, wie er verstohlen etwas von seinem Fuß abzuwischen sucht. Wir werden dann – für die Handlung unnötigerweise – Zeuge, wie er im Café urinieren geht. Nach seiner Einweihungsfete zieht er eine Spur von Abfall auf der Treppe hinter sich her, der auf unheimliche Weise verschwunden ist, als er vom Mülleimer zurückkommt. Sein Kollege Scope (Bernard Fresson) pinkelt schamlos in das Abwaschbecken seiner Küche und zieht eine stinkende Socke unter seinem Sofa hervor, die er Trelkovsky ins Gesicht wirft. Er selbst erbricht in die Toilette von Stellas Wohnung. Madame Gaderian schmiert jedem Mieter, der die Petition gegen sie unterschrieben hat, einen Haufen Scheiße vor die Tür, als sie die Hausgemeinschaft verlässt, worauf Trelkovsky aus Angst, man könne ihn mit dieser Tat in Zusammenhang bringen, sich selbst auch ein bisschen davon vor die Tür legt. Durch das ganze Filmnarrativ zieht das Abjektale seine Spur, als Bedrohung und Verlockung zu-
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
191
gleich. Die Predigt des Pfarrers auf der Beerdigung von Simone Choule mündet in einer ekelerregenden Beschreibung des Fäulnisund Zerfallsprozesses des toten Fleisches, die Trelkovsky so zusetzt, dass er die Kirche verlassen muss, die zunächst klaustrophobisch verschlossen scheint. Vor allem aber die einbandagierte Simone Choule ebenso wie am Schluss des Films Trelkovsky selbst metaphorisieren das frühe Objekt-Abjekt, die archaische Mutter, den Tod selbst, den abscheulichen Kadaver (Kadaver kommt von lat. cadere, fallen). Zitzelsberger-Schlez (2004) hat darauf aufmerksam gemacht, dass nicht nur der Zuschauer, sondern auch alle, die über diesen Film geschrieben haben, beide Male die verbundenen Kranken als Mumien wahrnehmen und beschreiben, obwohl tatsächlich nur die Köpfe bis auf den Mund einbandagiert sind, und dass im Englischen (der Film ist in Englisch gedreht), Mumie und Mammi gleichlautend sind (mummy). Die Graffiti an den Wänden des Ab-Orts verwandeln sich in unentzifferbare Hieroglyphen (als Zeichen des Präsymbolisch-Archaischen) wie auf den Innenwänden einer ägyptischen Grabkammer. Schließlich sieht Trelkovsky Simone Choule als Mumie am Klofenster gegenüber stehen, die langsam unter verführerisch-lasziven Bewegungen ihre Mumifizierung löst, der Tod am Ort des Todes, als wolle sie Trelkovsky daran gemahnen, dass die Spuren der präsymbolischen Sphäre, die verworfenen Teile der Chimäre nicht in einem Grab zum Verschwinden zu bringen sind, dass sie in der Wiederkehr des Verdrängten ihn umso heftiger überwältigen werden, desto heftiger er sich ihrer zu erwehren sucht, so dass er (als das Subjekt) dadurch in einer soghaften regressiven Bewegung eins mit dem archaischen Objekt werden muss. Die Kamerafahrt in den Schlund des sterbenden Simone-Trelkovskys am Schluss des Films erscheint als das unheimliche Wiederverschlungenwerden vom (Mutter-)Mund, eine Kamerafahrt durch das Organische der feuchten Rachenschleimhaut ins absolute Schwarz, in den dunklen Abgrund der Todes selbst, in die endgültige Entdifferenzierung. Zur Psychodynamik des Abscheus gehört naturgemäß die der Scham, und die Figur des Trelkovsky zeigt sich folgerichtig vom Affekt der Scham beherrscht, die aufkommt, wenn der Blick der Anderen »alles« sieht, wie es in »Der Prozess« heißt. Als Josef K. am Ende des Romans erstochen wird, im Moment seiner endgülti-
192
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
gen Entsubjektivierung also, ist es ihm, »als müsste die Scham ihn überleben«. Mit diesem Satz endet der Roman. Schamgefühle heften sich an die eigene Blöße, die das nicht loszuwerdende Abjektale in uns freilegt, an unsere Tod-Verfallenheit und Hilflosigkeit. Wir schämen uns aller Zeichen und Spuren körperlicher Ausscheidungen und Alterungsprozesse, schämen uns unserer Schwächen und Gebrechen, schämen uns der Ausbrüche von Affekten, kurz all dessen, was von unserer kreatürlichen und gebrechlichen Existenz sichtbar wird und an sie erinnert, es ist letztlich nichts anderes als die Spur, die der Tod durch das Leben zieht als eine Bewegung von Verlust zu Verlust. Die Scham heftet sich an das, was vom Körper verfällt und abfällt so wie der Zahn, den Simone Choule in einem Loch in der Wand hinter dem Schrank versteckt hat, ein Fund, den Trelkovsky in blanken Schrecken versetzt. Mit den Blicken der anderen auf den Mieter in Polanskis Film in Form der Gestalten hinter den Fenstern oder auf dem Klo oder der Passanten, die sich nach seinem Unfall über ihn beugen, inszeniert Polanski die existentielle Scham des Subjekts über seine Gebrechlichkeit, Vergänglichkeit und Blöße und Trelkovskys Un-Fall wird lesbar als Metapher für den Sünden-Fall des Menschen überhaupt. Die Scham entsteht einerseits beim Blick der anderen auf uns und andererseits beim eigenen Blick auf uns selbst. Die Szene, in der Trelkovsky, nun selbst im Ab-Ort der Toilette stehend, sich am gegenüberliegenden Fenster erblickt, das heißt, sich dem eigenen Blick preisgibt, ist eine Inszenierung der doppelten Bewegung in der Scham: »In der Scham hat das Subjekt einzig seine Entsubjektivierung zum Inhalt, wird es Zeuge des eigenen Untergangs, erlebt mit, wie es als Subjekt verloren geht« (Agamben 2003, S. 91).
■ Äußere Welt Ich habe den Film bis hierher als Darstellung der Innenwelt betrachtet, als intrapsychisches Universum gleichsam, in dem die heterogenen Aspekte des »chimärischen« Subjekts in einem problematischen Verhältnis zueinander stehen. Im Mittelpunkt dieser Problematik steht ein die Identität und Stabilität des Ich bedro-
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
193
hendes Abjekt, bedrohlich deshalb, weil es nicht im Symbolischen verankert, sondern angstvoll von ihm ausgeschlossen ist. Lese ich den Film jedoch als Darstellung einer äußeren Welt und die Hausgemeinschaft als Parabel für eine gesellschaftlich-soziale Realität und deren Ordnung, bekommt die Problematik des »Abjekts« politische Relevanz. Wie bei einem Vexierbild erscheint in dieser Perspektive die Außenwelt, die Hausgemeinschaft oder Gesellschaft nicht mehr als Projektionsfläche der Ängste von Trelkovsky, sondern Trelkovsky seinerseits fungiert als Projektionsfläche unbewältigter Ängste der Gesellschaft. In dem Protagonisten bricht allerdings während dieses Vorgangs jede innere Stütze auf Druck der verfolgenden sozialen äußeren Realität ein, wodurch seine innere Welt der äußeren Realität (d. h. den Projektionen der Anderen auf ihn) immer mehr erliegt, aber der Film erzählt uns nichts darüber, warum Trelkovsky dem Druck nichts entgegenzusetzen weiß und ob dieser Mangel, die »Labilität« der Figur Trelkovsky, nicht selbst gesellschaftlich verursacht ist. Aus subjekttheoretischer Perspektive erscheint der Film also als ein Angsttraum, der die Fragilität und den Zerfall des Ich bebildert unter dem Druck des Terrors innerer verfolgender Objekte und eines archaischen Über-Ich. Aus gesellschafts- oder sozialkritischer Perspektive kann er als eine äußerst präzise Analyse der manifesten und latenten Mechanismen gesellschaftlicher Ausgrenzung gelesen werden, von Verfolgung und Vernichtung unliebsamer Minderheiten, von Fremdenhass und Antisemitismus, als eine Parabel des Totalitarismus also. Er beschäftigt sich mit der gesellschaftlichen Eliminierung von Schwäche, Behinderung und Verrücktheit nicht nur in der Gestalt Trelkovskys, sondern auch, in einer Art Verdoppelung, in Gestalt von Madame Gaderian (Lila Kredova) und ihrer behinderten Tochter, die in dem Haus nicht geduldet werden, weil sie anders sind und sich anders verhalten als die anderen Hausbewohner. Der Pole Trelkovsky pocht immer wieder auf seine französische Staatsbürgerschaft, aber diese ist für den Polen nur ein Papier, eines »in einem schlechten Zustand« befindliches dazu, wie der Polizeibeamte feststellt. Die französische Staatsbürgerschaft auf dem Papier korrespondiert nicht mit der entsprechenden sozialen Anerkennung, findet keine Stütze in den anderen und in ihm selbst, sie kann ihm jederzeit abgesprochen
194
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
werden und gleichsam verwahrlosen wie das entsprechende Dokument. Schließlich verschwindet all sein persönlicher Besitz nach einem Einbruch in seine Wohnung. Obwohl unschuldig an diesem Einbruch, wird er für schuldig erklärt, weil so ein Ereignis, wie M. Zy ihm vorwirft, das Ansehen des Hauses beschmutzt, ein weiterer Beitrag zur Projektion des Abjekts auf ihn. Allein die Tatsache, von Beginn an als ein »Fremder« definiert zu sein, motiviert Trelkovskys Labilität. In der Geschichte Europas ist dies eine genuin jüdische Problematik. Ich möchte nur zwei Überlegungen und Einfälle dazu ausführen, die der Film angeregt hat. In seinem Buch über den jüdischen Selbsthass hat Sander L. Gilman auf den für diesen Selbsthass wesentlichen Mechanismus der Übernahme von Projektionen der Gesellschaft ins Selbstbild hingewiesen, wir würden in psychoanalytischer Terminologie von »projektiver Identifizierung« sprechen: »Selbsthass entsteht dadurch, dass die Außenseiter das Wahnbild von ihnen als Wirklichkeit annehmen, das jene in der Gesellschaft entwerfen, die die Außenseiter definieren […] Auf der einen Seite steht die liberale Verheißung, jeder könne grundsätzlich an der Macht der Bezugsgruppe teilhaben (also als »Mieter« der Hausgemeinschaft angehören, d. Verf.), vorausgesetzt, er unterwirft sich den Regeln dieser Gruppe. […] So gaukelt die Phantasie dem Außenseiter eine Lösung seines Problems vor: Werde wie wir, höre auf, dich von uns zu unterscheiden, und du wirst zu uns gehören. […] Aber je mehr man versucht, sich jenen anzugleichen, von denen man als anders definiert wird, je mehr man die Werte, die sozialen Formen, die Verhaltensweisen der jeweils tonangebenden Gruppe akzeptiert, um so weniger akzeptabel erscheint man dieser in Wirklichkeit. […] Denn eigentlich wünscht man, niemals der Andere gewesen zu sein – ein unerreichbarer Zustand« (Gilman 1993, S. 12f.). Prominentester Vertreter jüdischen Selbsthasses war der österreichisch-jüdische Philosoph Otto Weininger. Er ist aus dem Grund für unseren Zusammenhang interessant, weil er in seinem Buch »Geschlecht und Charakter« von 1903 nicht nur einen ausgeprägten Antisemitismus predigt, sondern diesen in Zusammenhang bringt mit seinem Hass auf Frauen. Bei Weininger kann man studieren, dass die unbewusste Verknüpfung zwischen Frauenhass, Antisemitismus und jüdischem Selbsthass die destruktive Verwer-
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
195
fung und Projektion des Abjekts ist, das aus dem Selbstbild der Gesellschaft und dem des Individuums ausgestoßen werden muss und unbewusst mit dem archaischen, entdifferenzierenden »Weiblichen« identifiziert wird. (Diese Verknüpfung gilt auch für die Psychoanalyse, die es so schwer hat, weil sie sich mit dem unliebsamen Unbewussten beschäftigt, eine Wissenschaft, die nicht nur totalitären Systemen, sondern auch demokratischen Gesellschaften nach wie vor »unheimlich« ist.) Nach Weininger haben die Juden wie die Frauen keinen »Schwerpunkt« in sich selbst und in der Welt. Wurzellosigkeit ist ein alt hergebrachter antisemitischer Topos und der herumirrende Ahasver die entsprechende Figur der Heimatlosigkeit, der die »Hausbesitzer« umschriebener Nationen beunruhigt. Bei Weininger sind Juden und Frauen aufgrund ihres fehlenden Schwerpunkts in sich selbst nicht fähig, logisch klar zu denken, sie sind assoziativ (sic!), man könnte auch sagen: wie Ahasver herumirrend im Reich der Einfälle, also mit dem Unbewussten verbunden, nicht sauber und ordentlich und klar in ihrem Denken, sondern chaotisch, mit anderen Worten: »abjektal« und damit äußerst bedrohlich (vgl. Gilman 1993, S. 153ff.). Ich verzichte auf weitere Ausführungen, aber es ist vielleicht deutlich geworden, dass diese Gedankengänge dem Ausstoßungsprozess in »Der Mieter« genau entsprechen, der mit der Metamorphose von Trelkovsky vom Mann zur Frau einhergeht. Auch die anderen Ausgestoßenen sind weiblich: Frau Gaderian und ihre behinderte Tochter. Die Kontrastfigur zu dem wurzel- und schwerpunktlosen Helden Trelkovsky ist sein Kollege Score, der mit klarem Schwerpunkt und klarer Schwerkraft zu den Klängen lauter Marschmusik durch die Wohnung stampft und seinen kleinen Nachbarn, der sich wegen der Krankheit seiner Frau beschweren will, barsch entgegentritt, indem er ihm rät, seine Frau ins Krankenhaus zu schicken. Die Ausgrenzung der Kranken, Schwachen, Behinderten und Verrückten aus der totalitären Ordnung wird mit Madame Gaderian und ihrer behinderten Tochter thematisiert. In einem Fieberzustand beobachtet Trelkovsky, wie die beiden von den anderen Mitbewohnern auf den Hof gezerrt, umringt, gefesselt und gequält werden, eine Wahrnehmung, die wir nicht als krankhafte Halluzination eines Verrückten abtun, sondern als eine Bebilderung berechtigter sozialer Angst und Erfahrung lesen kön-
196
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
nen, wenn die Szene Sinn haben soll. Scores grobe Physiognomie und seine Körpergröße kontrastieren auffällig mit denen Trelkovskys, der in der entsprechenden Parallelszene verstummt und voller Scham sein kleines Einweihungsfest beendet, als sein Nachbar sich über den vergleichsweise harmlosen Lärm beschwert. Es liegt nahe, Figur und Auftreten Scores mit dem Prototyp eines Nazis zu assoziieren, während Trelkovsky dagegen den Prototyp eines verfolgten Juden abgibt, der unter dem Druck der Außenwelt seinen »Schwerpunkt« verloren hat und sich anzupassen sucht. Etliche Versuche, die wie vergebliche Aufschreie gegen seine langsame Entsubjektivierung wirken, sein Versuch, sich gegen den Barbesitzer durchzusetzen, der ihn zwingt, die Trink- und Rauchgewohnheiten der in den Tod gestürzten Simone Choule zu assimilieren, die Verweigerung seiner Unterschrift auf der Petition der Mietgemeinschaft gegen Madame Gaderian und seine gelegentlichen verzweifelten Wutausbrüche können den Prozess nicht mehr aufhalten. Der Fremde, der Jude ist im eliminatorischen Antisemitismus das aus der Gesellschaft auszuscheidende, zu vernichtende Abjekt (und nicht umsonst gab Wieslaw Kielar seinem Bericht über die fünf Jahre, die er in Auschwitz verbrachte, den Titel »Anus Mundi«).
■ Die unbewusste Botschaft Der Film hat jedoch noch einen latenten Subtext, den die offensichtliche Erzählung eines Persönlichkeitsverfalls fast vollkommen verdeckt. Der Zuschauer wird zum Zeugen einer Verwandlung, die der Protagonist auf der manifesten Erzählebene als aufgezwungen und äußerst destruktiv erlebt, eine Verwandlung, gegen die er sich bis zum Schluss zu wehren sucht: »Ich bin nicht Simone Choule, ich bin Trelkovsky!«, stößt er hervor, als er nach dem ersten Sturz aus dem Fenster als Frau verkleidet, verwundet und blutverschmiert die Treppe hinaufkriecht, um sich ein zweites Mal vom Fenster in den Hof zu stürzen. Aber jenseits dieses Horrors gibt es andere, eher versteckte Signale in der Darstellung, die im Zuschauer Lust und Vergnügen
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
197
hervorrufen. Solche Lustsignale vermissen wir in dem früheren Film »Ekel« übrigens vollständig. Diese Lust erlebt der Zuschauer vor allem in den Szenen, in denen der Regisseur uns mit den Abkömmlingen des Abjekts konfrontiert, beispielsweise als Trelkovsky in der so ernsten Situation am Bett der sterbenden Simone Choule die Apfelsinen unter ihrem Bett aufliest, als er in die Scheiße tritt, als Madame Gaderian ihn stolz mit den Scheißhaufen vor den Türen der Nachbarn konfrontiert. Ständig wird das Bild der beängstigenden Entsubjektivierung und Entdifferenzierung des Helden durch Witz unterlaufen, ja selbst der doppelte Suizidversuch von Trelkovsky hat auch einen witzigen Effekt, als würde das plötzliche Lachen, das uns überkommt, obwohl es uns nicht überkommen darf an dieser Stelle, die pessimistischen Behauptungen des Films zeitweise untergraben. Besonders zum Lachen reizt die Szene, in der Trelkovsky den Müll hinunter trägt. Nicht nur dass er ausgerechnet in Gegenwart von M. Zy auf der Treppe immer mehr Müll verliert, sondern vor allem seine Bemühung, der Müllsäcke durch wiederholtes Hochschnellen des angewinkelten Beins Herr zu werden, als wolle er das Abjekt, den Abfall hilflos in seine Grenzen weisen, ist zum Zerreißen komisch. Manche Kritiker haben Polanski diese Slapstick-Nummern vorgeworfen. Im Slapstick aber wiederholt sich etwas von der Grundproblematik des Films. Im Slapstick kämpft der Mensch gegen die Tücke von etwas, das stärker ist als er. Das Subjekt unterliegt dem Objekt. Es ist nicht Herr über die Dingwelt, so wie Charly Chaplin in »Modern Times« hilflos in das Räderwerk der Maschinen gerät. Und der Lachende ist auch nicht Herr seines Lachens, das zwingend und eruptionsartig aus seinem Unterleib aufsteigt und ausbricht, und dennoch befreit es ihn von der schamvollen Wahrnehmung fremder oder eigenen Entsubjektivierung. »Lachen befreit mich, gleichzeitig aber bin ich meinem Lachen gegenüber nicht frei. Ich ›muss‹ lachen. Nur wenn ich nicht anders konnte, habe ich richtig gelacht. Nur wenn ich gezwungen wurde, heißt das, habe ich mich befreit gefühlt« (v. Matt 1994, S. 100). Das befreiende Lachen des Zuschauers steht in geheimer Verbindung zur Scham des Protagonisten, indem das Lachen ein Reflex, eine Reflexion der inneren paradoxen Bewegung der Scham ist, der Bewegung des sich Erkennens, sich Wiedererkennens in der Hilflosigkeit.
198
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Das Lachen ist befreiend und lustvoll. Diese Lust stellt sich der Destrudo der Selbstvernichtung Trelkovskys entgegen und bricht die klaustrophobische Struktur des Wiederholungszwangs auf, der in Trelkovskys Wiederholung des Suizids von Simone Choule zu triumphieren scheint. Polanski hat seinen Film »Der Mieter«, der durchaus kein Publikumserfolg war, immer besonders hoch geschätzt. Und damit kommt ein biographisches Moment des Regisseurs Polanski ins Spiel, der Trelkovsky selber spielt. Und mit welch geheimer und doch offensichtlicher Lust er spielt, wenn er die hochhackigen Schuhe auspackt oder sich kokett als Simone Choule verkleidet im Spiegel betrachtet, den Rock rafft und Bein zeigt! In diesem Kontext ist ein kaum bemerktes und nur kurz aufscheinendes Detail von hoher Bedeutung: Als Madame Gaderian und ihre Tochter auf dem Hof gequält werden, stülpen die Nachbarn dem Kind eine rote Narrenkappe über mit einer Maske, die – für den Zuschauer kaum wahrnehmbar – die Züge Polanskis zeigt. Der Narr ist schon seit jeher Vertreter des »Anderen der Vernunft«, der in der geschlossenen symbolischen Ordnung der Welt eine Unordnung provoziert, ein Unordnung, die das von ihr Ausgegrenzte und Verworfene in Erinnerung ruft: die Unvernunft, die Verrücktheit, das Abjekt, auf die diese Ordnung angewiesen ist, um nicht an sich selbst zu ersticken. Der Narr betreibt die Subversion des Glaubens an die »Wahrheit« von Ideologien, Religionen und Weltanschauungen, in deren geschlossenen Denksystemen Roman Polanski »das Böse« sah: »Wo immer sie hingehen: die Saat des Bösen liegt in der Denkweise des Menschen, in der Art und Weise, wie er Dinge für gesichert hält«, sagte Polanski in einem Interview: »Sicherheit, würde ich sagen, ist die Saat des Bösen.« Der Narr ist ein Außenseiter, dessen Außenperspektive es erlaubt, die Verstrickungen der Menschen in ihre Sinnsysteme zu durchschauen, und das zu ihrem eigenen Wohl. Er entspringt der »paradoxen Notwendigkeit, dass der Mensch den Teufel sozusagen an die Wand malen muß, um nicht zu verteufeln« (Promies 1987, S. 326). Das Lachen, das er provoziert, befreit von der Unterdrückung einschränkender kultureller Gebote, die im Film durch die Regentschaft des M. Zy ins Karikaturhafte erhoben sind, indem sie jeden Abkömmling lebendiger Triebäußerung verteufeln. Insofern
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
199
sind die Szenen, in denen Polanski seine Zuschauer lachen macht, heilsam. Bei Shakespeare diente der Narr dazu, die Melancholie der dramatischen Person aufzuhellen (»König Lear«) oder den Wahnsinn der Liebeskrankheit zu hinterfragen (»Was ihr wollt«). Im 18. Jahrhundert galt er als Arzt gegen die Krankheit des Rationalismus. Er macht aus »dem Heillosen, das zu allen Zeiten in den Narren projiziert wurde, Heilsames« (Promies 1987, S. 324). (Der Narr also als Arzt, als Therapeut? Oder umgekehrt: Versteckt sich der Therapeut oder der Analytiker nicht auch ein bisschen hinter der Narrenkappe zum Wohle seiner Patienten?) Polanski hat »Der Mieter« seinen persönlichsten Film genannt. Zwar schreibt er in seiner Autobiographie, dass er die Rolle von Trelkovsky selbst habe spielen wollen, um inszenatorische Schwierigkeiten zu vermeiden, aber er war wohl auch – und mit Recht – überzeugt, dass er selbst diese Rolle am besten von innen heraus würde füllen können, und das betrifft vor allem auch die lustvoll komischen Seiten seiner Darstellung. Dies alles ist nicht in dem Sinn zu verstehen, Polanski habe »sich selbst« gespielt, in einer Eins-zu-eins-Übersetzung. Das könnte man nur in einer naiven biographischen Betrachtungsweise behaupten. Aber es gibt eine Fülle inszenatorischer Details, die einen ganz persönlichen Stempel tragen, nicht nur im künstlerischen Sinn – das versteht sich bei einem Regisseur wie Polanski von selbst –, sondern im Sinn unbewusster Biographik. Die Authentizität der Darstellung von psychischer Desintegration durch Polanski, die schon nach seinem Film »Ekel« die Bewunderung mancher Psychiater hervorrief, ihre innere »Wahrheit«, bezieht der Regisseur zweifellos aus seiner Biographie im Sinne eines unbewussten Wissens. Polanski ist nicht verrückt und war nie psychotisch, aber er wuchs in einer verrückten und destruktiven, psychotisch entgleisten und verfolgenden Welt auf. Als Kind polnisch-jüdischer Eltern in Krakau zerbrach nach Einmarsch der Deutschen in Polen die Ordnung seiner Welt und er wurde schon als kleines Kind zum Abjekt der Gesellschaft gemacht und als solches verfolgt und in dem klaustrophobischen Ort des Krakauer Ghettos eingeschlossen. Als er acht Jahre alt war, wurde seine Mutter in Auschwitz ermordet, sein Vater überlebte Mauthausen, eines der grausamsten Arbeitslager. Roman Polanski, viel zu früh auf
200
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
sich allein gestellt, überlebte in verschiedenen polnischen Familien und Verstecken. Angst, Verlust, Isolation und Einsamkeit müssen seine durchgängigen Kindheitsgefühle gewesen sein. Später verbrachte er Kindheit und Jugend in einem anderen totalitären System, im polnischen Kommunismus. Laut eigener Aussage ließ ihn eines überleben: seine künstlerische Leidenschaft. Sie galt dem Kino und der Schauspielerei. »Während der Okkupation liefen in Krakau amerikanische Filme, ich konnte nicht genug davon bekommen«, so Polanski 1994 in einem »Spiegel«-Interview. »Der kleine Junge, der ich damals war, flippte bei diesen Filmen total aus. Als sie dann das Ghetto abriegelten, konnten wir nicht mehr raus ins Kino gehen. Aber die Nazis zeigten gleich draußen vor der Mauer auf dem Marktplatz Propaganda-Wochenschauen. Ich fand eine Stelle, von der aus ich diese Filme sehen konnte, durch den Stacheldraht hindurch.« Später baute er sich selbst einen Projektor und spielte schon als Kind in Theaterstücken und Jugendfilmen mit. Schließlich studierte er an der berühmten polnischen Filmhochschule in Lodz. Auf die traumatische Erfahrung äußerer Verfolgung folgt gewöhnlich die innere Verfolgung durch das Erlebte in Form des Wiederholungszwangs. Auf struktureller Ebene durchzieht das Traumatische (zerstörte Ordnung, Wiederholungszwang, Identifikation mit dem Abjekt durch gesellschaftliche Gewalt, Perversion usf.) das künstlerische Gesamtwerk von Roman Polanski (vgl. Mahler-Bungers 2004a, 2004b) und eben diese Kunst war seine Rettung, seine Selbstsetzung, sein Widerstand gegen die Verfolgung; eine Rettung, die er in seinem Werk »Der Pianist« filmisch umgesetzt hat, eine Adaption der autobiographischen Überlebensgeschichte des polnisch-jüdischen Pianisten Wladislaw Szpilman. Polanski hat die künstlerische Imagination (in dem Film »Der Pianist« ist es die Musik) und die Fähigkeit zur Erhaltung und Schaffung innerer kultureller Anderer als Überwindung des Traumatischen und damit als Lebensrettung inszeniert, womit er der literarisch-autobiographischen Vorlage Szpilmans, an die er sich sonst genau gehalten hat, in einem wesentlichen Punkt seinen persönlichen Stempel aufgedrückt hat (vgl. Mahler-Bungers 2004a, 2004b, 2005). In ähnlicher und doch anderer, versteckterer Weise geschieht
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
201
dies auch in »Der Mieter«. Trelkovskys Ausweg aus innerer und äußerer Verfolgung ist nur scheinbar die vollkommene Identifikation mit Simone Choule und die Imitation ihres Selbstmords und damit die Selbstvernichtung. Denn wenn wir genauer hinsehen, wie Polanski dieses Ende inszeniert und spielt, so fällt auf, dass hier nicht ein Suizid inszeniert ist, sondern die Inszenierung und das Spiel eines Selbstmords, das heißt ein exhibitionistischer Akt gegen die Scham. Trelkovsky macht aus seinem Sturz großes Theater, natürlich – auf der narrativen Ebene – nur in seiner Phantasie, aber es wird filmische Wirklichkeit, also Polanskis Projektion auf die Leinwand. Polanski in der Rolle des Trelkovsky, der die Rolle der Simone Choule spielt, tritt ans Fenster, dessen Gardinen sich wie ein Vorhang (von hinter der Bühne gesehen) öffnen und den Blick freigeben auf eine begeisterte Zuschauerschaft, die in Logen sitzt und applaudiert. Es sind die Verfolger, Voyeure, die Nachbarn und Freunde, ja die Gesellschaft überhaupt. Die Szene ist abgründig und vieldeutig, denn es ist einerseits die Hausgemeinschaft, die lüstern voyeuristisch Trelkovskys Sprung in den Abgrund verfolgt – was seinem Wahn auf der Ebene der Erzählwirklichkeit entspricht –, und andererseits ist eben diese Gemeinschaft, die Gesellschaft zu einem anerkennend applaudierenden Publikum, zu kulturellen Anderen und der klaustrophobische Innenhof vom Beginn des Films zum Zuschauerraum eines Opernhauses mutiert, in dem Trelkovsky seine Subjektwerdung vorführt, als Akt der Selbstsetzung als Künstler (und Narr): durch Verkleidung, durch die mimetische Kunst der Rollenübernahme und Imitation eines Anderen, das heißt als Schauspieler und Regisseur, der der Welt etwas zeigt und vormacht und nun seinerseits über sie triumphiert. Dazu hören wir die bekannte Glasharfenmusik, in die sich ganz kurz ein bekanntes musikalisches Opernmotiv von Verdi mischt – Polanski inszenierte im selben Jahr noch Verdis »Rigoletto« in München –, und einen Tusch, wie wir ihn vom Zirkus kennen, bevor der Trapezkünstler oder Seiltänzer oder Tierbändiger seine todesmutigen Kunststücke beginnt. Die Kunst ist für den Künstler immer ein Drahtseilakt zwischen Erfolg und Absturz. Das ist das Persönlichste, was Polanski in diesen Film hineinbringt: seine Rettung vor einer verfolgenden äußeren und inneren Wirklichkeit
202
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
durch künstlerische Projektion dieser Wirklichkeiten auf die Leinwand. Ohne Imagination, Phantasie und Halluzinationskraft kann kein Regisseur großes Kino machen. Und das besteht nun einmal aus Projektion und nicht aus Wirklichkeit. Der Film hat also zwei Schlüsse, inszeniert in zwei Stürzen aus der klaustrophobischen symbolischen Ordnung einer Welt, die einschließt und ausschließt, in ihr System zwingt oder ausstößt. Der eine Schluss ist Trelkovskys Sprung in den Tod, der andere sein Sprung in die Kunst, der aus dem Wiederholungszwang herausführt. Diese Verdoppelung erklärt vielleicht das merkwürdige Ende des Films, in dem Trelkovsky wiederum in einer Verdoppelung, nämlich als lebender Zeuge seines eigenen Todes, auftritt.
■ Literatur Agamben, G. (2003): Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge. Frankfurt a. M. Freud, S. (1919). Das Unheimliche. G. W. Bd. XII. Frankfurt a. M. Gilman, S. L. (1993): Jüdischer Selbsthass. Antisemitismus und die verborgene Sprache der Juden. Frankfurt a. M. Kafka, F. (1925): Der Prozeß. In: Gesammelte Werke, hg. v. Max Brod. 7 Bände. Frankfurt a. M. 1983. Kielar, W. (1982): Anus Mundi. Fünf Jahre Auschwitz. Frankfurt a. M. Kristeva, J. (1983): Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection. Paris. Mahler-Bungers, A. (2004a): Die Metamorphosen des »Bösen« – Überlegungen zur Filmographie Roman Polanskis. In: Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie. Schriftenreihe Band 2 Roman Polanski. Cinema Quadrat e.V. Mannheim, Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie, HeidelbergMannheim e.V., Psychoanalytisches Institut Heidelberg-Karlsruhe der DPV, S. 2–15. Mahler-Bungers, A. (2004b): Die Metamorphosen des »Bösen«. Roman Polanski und seine Filme. Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches Denken 12/04, S. 1101–1110. Mahler-Bungers, A. (2005): Überlegungen zu Roman Polanskis Film »Der Pianist«. In: Karl-Abraham-Institut, Berlin. Semester-Journal 2005/2006, Nr. 9, S. 25–30. Matt, P. von (1994): Lachen in der Literatur. Überlegungen zur Frage, warum Schillers »Glocke« so ernst ist. In: Matt, P. von: Das Schicksal der Phantasie. München u. Wien.
A. Mahler-Bungers · Zu Roman Polanskis »Der Mieter«
203
Polanski, R. (1984): Roman Polanski von Roman Polanski. Autobiographie. Bern u. a. Promies, W. (1987): Der Bürger und der Narr oder das Risiko der Phantasie. Sechs Kapitel über das Irrationale in der Literatur des Rationalismus. Frankfurt a. M. Suchsland, I. (1992): Julia Kristeva zur Einführung. Hamburg. Visarius, K. (1986): Le locataire. Der Mieter. In: Roman Polanski. Mit Beiträgen von W. Jacobsen, P. W. Jansen, C. Maerker, K. Visarius. München u. Wien, S. 147–158. Werner, P. (1981): Roman Polanski. Frankfurt a. M. Zitzelsberger-Schlez, A. (2004): Tödliche Verwandlung – vom Selbstverlust zur Selbstvernichtung. In: Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie. Schriftenreihe Band 2 Roman Polanski. Cinema Quadrat e.V. Mannheim, Institut für Psychoanalyse und Psychotherapie, Heidelberg-Mannheim e.V., Psychoanalytisches Institut Heidelberg-Karlsruhe der DPV, S. 32–43.
■ Gerhard Bliersbach
Der Einzug in die Finsternis Roman Polanskis »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof
■ Eine Hypothese zur Bedeutung des Kinos Umberto Eco, undogmatischer Beobachter der populären Kunst, hat deren Bedeutung Mitte der 1980er Jahre so skizziert: »Das bildliche Werk (der Kinofilm, die TV-Reportage, das Wandplakat, der Comic strip, das Foto) ist heute bereits ein integraler Bestandteil unseres Gedächtnisses. Was etwas ganz anderes ist und eine fortgeschrittene Hypothese zu bestätigen scheint, nämlich daß die neuen Generationen sich, als Bestandteile ihres Verhaltens, eine Reihe von Bildern einverleibt haben, die durch die Filter der Massenmedien gegangen sind (und von denen einige aus den entlegensten Zonen der experimentellen Kunst unseres Jahrhunderts kommen). In Wahrheit braucht man nicht einmal von neuen Generationen zu sprechen: Es genügt, zur mittleren Generation zu gehören, um erfahren zu haben, wie sehr das gelebte Leben (Liebe, Angst und Hoffnung) durch ›schon gesehene‹ Bilder gefiltert wird« (Eco 1985, S. 214).
Wie im Kino sagen wir manchmal, wenn wir überrascht sind und staunen, wie unsere erfahrene Wirklichkeit einem erfahrenen filmischen Narrativ zu ähneln scheint. Andererseits, so weit hat sich das Kino in unserer Sprache niedergeschlagen, sagen wir, wenn wir überrascht und irritiert sind: Bin ich im falschen Film? Die Frage ist: In welchem Kino? In welchem Film? Welche Kinofilme sind unsere Referenz? Mit welchen sind wir beschäftigt? Welche Kinofilme lassen uns nicht mehr los? Welche Kinofilme machen wir uns zu eigen? Diese Fragen sind natürlich schwer zu beantworten. Je nach Generation sind wir zu unterschiedlichen Zeiten ins Kino gegangen und haben unterschiedliche Filme zuerst gesehen. Das mag trivial klingen, ist es aber nicht; denn auch für die Kinogängerin und den
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 205
Kinogänger gilt: Die ersten Kinoerfahrungen prägen. Wie sehr, stellt sich später heraus. Ich bin Ende der 1940er Jahre zum ersten Mal ins Kino gegangen und bin mit einigen Filmen der 1950er Jahre buchstäblich alt geworden; wieder und wieder habe ich sie gesehen – bis heute. Im Kino, auf Video und auf DVD. Das ist im Grunde nicht neu; mit einem Werk der Literatur, der Musik oder der bildenden Kunst wird man auch vertraut und alt.
■ Der Einzug in die Finsternis Das Kino hat seine spezifischen Erzählformen und narrativen Traditionen. Es nimmt uns in einer narrativen Bewegung mit, und wir kommen in eine eigene seelische Bewegung. Es ist, um eine Analogie zu gebrauchen, ähnlich wie beim Autofahren: Wir sind am Steuer unserer Automobile in Bewegung und zugleich in dem Prozess unserer Gedanken, Erinnerungen, Phantasien, Wünschen und Sehnsüchten, irgendwo anders und nicht nur auf der Straße. Wohin nimmt uns das Kino mit? Auf eine Reise der Selbstentfaltung und der Selbsterweiterung. Wir machen einen Besuch. Die Metapher der Reise ist als eine Annäherung an das gedacht, was die eigentümliche Verfassung des Filme-Sehens ausmacht. Die Reise der Selbstentfaltung und Selbsterweiterung ist mit dem Konzept der Komplexentwicklung (Salber 1966) verwandt: Wir sind vor der Leinwand oder vor dem Fernsehschirm auf sublime Weise mit uns beschäftigt. Psychoanalytisch ist das Konzept der Reise eine Auslegung des winnicottschen Konzepts des Objekt-Gebrauchs im intermediären Raum – zum Beispiel beim Spielen – im Dienste der strukturellen Differenzierung (Winnicott 1985). Und Christopher Bollas hat dieses winnicottsche Konzept gewissermaßen verfeinert als die Suche nach der (unbewussten) Artikulation des eigenen Idioms – beschrieben in seinem Buch »Genese der Persönlichkeit« (Bollas 2000). Mit diesen Struktur-Differenzierungskonzepten sind andere unbewusste Prozesse gemeint als die, welche wir als Produkte von Abwehroperationen zu klassifizieren gewohnt sind. Im Übrigen will die Metapher der Reise andeuten,
206
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
dass der Begriff der Identifikation zum Verständnis der Kinorezeption und der Kinoerfahrung zu kurz greift. Das Beispiel einer Kinoreise. John Sturges ist der Regisseur des Films mit dem melodiösen Titel »Bad Day at Black Rock« – auf Deutsch: »Stadt in Angst« von 1955 mit Spencer Tracey. Aus großer Höhe schaut man auf eine Wüstenlandschaft, die ein winziger Zug von links nach rechts durchquert. In der nächsten Einstellung fahren wir über den Gleisen dem Zug entgegen und über ihn hinweg. Dann sehen wir ihn von der Seite, wie er rechts in einer Felslandschaft verschwindet, während der Vorspann mit »Spencer Tracy« darüber gelegt ist. Nach und nach, Einstellung für Einstellung, wird der Zug größer und wir sind ihm näher. Bis die Kamera ihn eingeholt hat und ihn auf gleicher Höhe begleitet. Stets in einer Bewegung zur rechten Seite der Leinwand. Dann sehen wir ihn von vorn, bewegen uns mit der Lok, die uns anzuschauen scheint. Und schließlich sind wir ihm ganz nahe, er fährt durch hohe Gräser und Büsche und verringert sein Tempo. Die Bewohner des Städtchens merken auf, drehen ihre Köpfe in die Richtung des einfahrenden Zuges. Der Zug ist nicht gern gesehen – man ahnt es. Er transportiert einen unwillkommenen Passagier. Es ist heiß in »Black Rock«. Spencer Tracy steigt aus. Wir sind an seiner Seite. Wir sind schon mächtig in Bewegung und erleben: Ein Fremder wird unfreundlich empfangen. Zugleich sitzen wir, ein eigentümliches Paradox, im Stuhl vor der Leinwand oder dem Fernsehschirm, je nachdem. Ein Spielfilm ist ein kompliziertes künstlerisches Produkt. Das filmische Narrativ wird für uns erzählt – und zugleich sind wir aus dem Narrativ ausgeschlossen … jedenfalls sind die Protagonisten der Leinwand unerreichbar, wir sind wirklich Zuschauer, beziehen Position und ringen mit dem Wunsch und der Illusion, sie zu erreichen. Das macht die Lage vor der Leinwand nicht einfach. Der Film, sagt Harvey Greenberg (1975), Psychoanalytiker und Kinogänger, ist die einzige Kunst, die unseren Augenbewegungen entspricht. Die Kameraeinstellung kreiert den Raum und strukturiert unseren Blick. Unser Blick ist Ausdruck unserer Bewegungen des Orientierens und Begehrens. Der Kamerablick entspricht nicht genau unserem Blick, aber die Bewegungen des Kamerablicks, dessen Struktur und Rhythmus, organisieren unsere Blicke auf eine
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 207
schwer beschreibbare, höchst komplexe Weise, wobei Farben, Ausstattung, Musik und sound unsere Blicke und unsere inneren Bewegungen mit leiten. Es gibt einen Unterschied zwischen der Position des oder der Protagonisten, der Position und damit des Blicks der Kamera und der Position der Zuschauerin und des Zuschauers im filmischen Narrativ. Wir sitzen, um die Metapher des Autofahrens noch einmal aufzugreifen, je nach Inszenierung des Kinofilms auf dem Beifahrersitz oder im Fond oder ganz woanders – je nach Kinofilm haben wir unseren eigenen Platz und unseren Raum. Alfred Hitchcock platzierte sein Publikum ganz in die Nähe seiner Protagonisten und ließ es wenig weiter vorausschauen; Roman Polanski rückte sein Publikum direkt an die Protagonisten seiner Filme und ließ es nur die Erfahrungen machen, welche seine Protagonisten machen. Caroline Neubaur (2002) hat das methodische Problem psychoanalytisch orientierter Kunstbetrachtung auf die elegante Formel gebracht: Hat das Kunstwerk den Status eines Kollegen oder den Status eines Patienten? Der Patient Film ist der typisch psychoanalytische Zugriff. Der Protagonist eines Kinofilms wird als Fallgeschichte gelesen und ausgelegt. Wo bleiben wir, die vor der Leinwand sitzen und uns mitbewegen? Bewegen wir uns gewissermaßen im Gleichschritt zum Protagonisten oder anders? Die klinische Praxis ist eine interaktionelle Praxis, konzeptualisiert als der Prozess von Übertragung und Gegenübertragung. Wie ist das vor der Leinwand? Was ist dann eine psychoanalytische Betrachtung eines Films? Machen wir es wie Sigmund Freud und nehmen unser Filmerleben als unseren Erlebenstext, dessen Subtexte, anders als in der klinischen Interaktion, wir nicht im interaktionellen Austausch überprüfen und entwickeln, sondern im inneren Dialog lesen, auslegen, prüfen, mit unseren theoretischen Konzepten zu einer oder zu mehreren konsistenten, psychoanalytisch plausiblen Gestalten auslegen. Vor der Leinwand interagieren wir mit einem Spielfilm normalerweise (wenn wir uns nicht mit unserem Nachbarn oder unserer Nachbarin austauschen) im inneren Dialog – ähnlich wie bei einem Buch oder einem Gemälde. Der Film, sehen wir ihn mehrmals, gibt die gleichen oder andere Antworten – es hängt von unseren lebensgeschichtlich gewachse-
208
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
nen und beruflich sozialisierten Kontexten ab, wie wir ihn lesen. Die Beschäftigung mit einem Spielfilm wird dann vielleicht zu einem Prozess der Selbstanalyse – welche eigenen Kontexte hat der Film berührt –, und das, was er berührt, macht den von uns so gelesenen Film aus. Die Frage ist auch, wie ich die Lektüre anlege. Der Text des Traumerlebens, im Wachsein erinnert und versprachlicht, ist häufig flüchtig, selten so dicht wie eine Erzählung, der Affekt ist noch zu greifen – ich bin froh, wenn ich einen Text zustande kriege. Der Text des Filmerlebens ist überwältigend dicht und umfangreich; ich bin froh, wenn ich mich in meinem Text nicht verliere. Wie können wir die Lektüre organisieren? Reimut Reiche (2001) hat in seinem Buch »Mutterseelenallein« den Vorschlag gemacht, die tiefenhermeneutischen Anstrengungen zur Fragestellung Was macht der Text mit mir? sollten in zwei Fragen aufgelöst werden: 1. Was mache ich mit dem Text? Das ist die Frage nach meiner Lektüre des Films. 2. Was macht der Text? Das ist die Frage nach der künstlerischen Form. Zurück zur ersten Frage: Was mache ich mit dem Text? Das ist die Frage nach meiner Lektüre des Films. Ich komme auf die Reise zu sprechen, die Roman Polanski mit seinem Film »Der Mieter« inszeniert hat, und die ich den Einzug in die Finsternis nenne. Damit meine ich einmal das filmische Narrativ, das Roman Polanski gestaltet hat, und die eigene seelische Bewegung. Angelika Zitzelsberger-Schlez hat das so beschrieben: »Der Film ›Der Mieter‹ entlässt den Zuschauer mit einem Grauen. Wir haben den fürchterlichen dumpfen lang gezogenen Schrei Trelkovskys im Ohr, es geht durch Mark und Bein, wir stemmen uns entsetzt gegen den Sog des aufgerissenen Schlundes, in den die Kamera hinein fährt. Wäre das nicht das letzte Bild und käme dann nicht der Abspannschnitt: Dieser röhrende Schlund könnte uns verschlingen, wenn wir wie Trelkovsky gepolt wären« (Zitzelsberger-Schlez 2004, S. 32). Bis zu diesem Schlusstitel haben wir Trelkovsky, den Franzosen polnischer Herkunft, gut vierzehn Tage lang begleitet. Es fing
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 209
gleich seltsam an. Ein Mann in den Dreißigern, im engen, taillierten Straßenanzug mit Krawatte – seinen Namen Trelkovsky erfahren wir bald –, klopft bei der Concierge eines großen Pariser Wohnhauses an. Sie reagiert nicht sofort, lässt ihn zappeln, stößt ein paar unwillige Worte heraus, öffnet das obere Glasfenster der Eingangstür. Trelkovsky holpert eine Anrede heraus, und in sein Stocken fragt die Concierge Yes, what is it? hinein. Ein unfreundlicher Beginn. Sie schließt ohne ein weiteres Wort das Glasfenster und geht an ihr Küchenbecken zurück. Trelkovsky lässt sich nicht abwimmeln. Er öffnet die Tür zur Wohnung der Concierge und fragt, ob er hier richtig sei, hier werde doch ein Apartment frei und ob er stören dürfe: I don’t want to be a nuisance. Ein Satz der Unterwerfung. Englische Mütter schelten ihre Kinder schon einmal mit you’re a real nuisance. Aber ein erwachsener Mann benutzt dieses Wort? Seltsam. Das wirkt beflissen, devot. Offenbar muss er sich anstrengen, um sich zu behaupten. Die Concierge lässt sich herab, ihm die Wohnung zu zeigen. Sie greift sich ein Wischtuch und stapft vor ihm die Treppen hoch; ihr Gewicht macht ihr zu schaffen. Sie weiß ihre Kräfte zu dosieren: Während sie sich die Treppen hochquält, wischt sie den Handlauf ab. Oben bekommt die Concierge die Wohnungstür nicht auf. Zwei Schlösser müssen geöffnet werden. Hinter ihr steht Trelkovsky, auf dem Sprung, für sie aufzuschließen – seine rechte Hand greift schon nach dem Schlüssel. Aber sie lässt sich diese Arbeit und diese Machtposition nicht aus der Hand nehmen, hält durch und schließt auf. Trelkovsky betritt eine möblierte Wohnung, eine Bruchbude. Was will er da? Eine zerschlissene, ungepflegte Einrichtung, zwei Zimmer – verwohnt, sagt man dazu. Die Geschichte der Vormieterin wird erläutert. Die Vormieterin, erfährt Trelkovsky, ist noch gar nicht ausgezogen, sondern aus dem Fenster gesprungen und liegt im Koma in einem Krankenhaus. Trelkovsky sieht seine Chance schwinden und fragt, was ist, wenn sie wiederkommt. Überraschend sicher poltert die Concierge: No worry, she won’t. Sie nimmt ihn in den Arm und bugsiert ihn ans Fenster und drängt ihn, sich herauszubeugen und hinunterzuschauen – auf ein Loch in einem Vordach aus Glas. Die Bedingungen werden erläutert: 600 Francs Miete und 5.000
210
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Francs Vorschuss. Damit ist Trelkovsky nicht einverstanden. Er fragt nach den sanitären Einrichtungen. Die Toilette befindet sich am Ende des Korridors, der im rechten Winkel verläuft, so dass Trelkovsky von seinem Fenster aus einen genauen Blick auf sie hat. That’s a view worth looking at, dröhnt die Concierge mit Vergnügen. Ist Trelkovsky entsetzt? Eine Etagentoilette wie bei uns in der Nachkriegszeit? Die beste Gelegenheit, sich jetzt zu verabschieden und sich zu bedanken für diese Art von Geldschneiderei. Nein, sie gehen die Treppe hinunter. Sie zeigt ihm die Tür des Vermieters, er stockt, bewegt sich einen Moment von ihr weg – und folgt. Er klopft. Keine Reaktion. Er steht vor einer mächtigen Tür. Eine abweisende, dunkelhaarige Frau in den Sechzigern, die Frau des Vermieters oder dessen Zugehfrau, öffnet und lässt ihn herein. Trelkovsky betritt das Wohnzimmer; dort sitzt ein alter Mann an einem Tisch, offenbar der Vermieter, der mit großer Anstrengung mit einem Zahnstocher nach einem Essensrest sucht; deshalb bewegt er auch nur den kleinen Finger als Zeichen der Begrüßung. Ernste Atmosphäre. Der Vermieter, M. Zy, guckt so finster und eindringlich wie Sidney Blackmer aus »Rosemary’s Baby«. Verhandlungen über die Mietbedingungen. Trelkovsky fragt, ob er sich eine Zigarette anstecken kann. Er verhandelt. Er ist ganz gewitzt und weiß, wie man Einnahmen an der Steuer vorbei führt. Der Vermieter ist mit ihm einverstanden – you’re a serious young man; allerdings muss Trelkovsky noch warten, bis klar ist, ob er die Wohnung wirklich beziehen kann. Ortswechsel: Krankenhaus, in dem die Vormieterin Simone Choule liegt. Trelkovsky fragt sich durch. Er hat Obst mitgebracht; das macht der gesittete Besuch immer. Die strenge, überfordert wirkende Stationsschwester weist ihn zum Bett Nummer 18. »Nummer 17« ist der Titel des 1932 entstandenen Hitchcock-Krimis. Trelkovsky geht die Betten entlang. Gegenüber dem Bett von Simone Choule sitzt eine Gruppe Franzosen, die einen Kranken besuchen. Einer öffnet eine Flasche Rotwein. Trelkovsky steht an Simone Choules Bett. Er betrachtet sie. Der Kopf ist mit Mullbinden eingewickelt; für die Augen und den Mund sind Öffnungen gelassen worden. Unklar, wie ihre Verfassung ist. Augen und Mund sind aufgerissen. Die Stationsschwester hatte ihm eingeschärft, nicht mit ihr zu sprechen. Eine junge Frau steht plötzlich neben
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 211
ihm – lockiges, rotbraunes Haar, eine große rotbraune Brille, grüner Pullover, schwarzer Schal, helle Felljacke, groß gemusterter Mohair-Rock. Sie ist entsetzt, fassungslos. Trelkovsky fällt das Obst auf den Boden unters Bett. Er kriecht auf den Boden und sucht das Obst zusammen und steckt es in eine Tüte. Stella spricht ihre Freundin Simone an. Sie reagiert – mit einem enormen Schrei, der die beiden exponiert und sie vertreibt, missbilligend beobachtet von der Stationsschwester. Draußen, auf der Straße, versucht Trelkovsky Stella zu beruhigen und zu trösten: You shouldn’t give in to your grief, sind seine Worte. Er schlägt ihr einen Abstecher ins Bistro vor. Es ist kalt und hell. In das Bistro, das zur Straßenseite mit Glas verkleidet ist, scheint das Sonnenlicht. Trelkovsky bestellt ein Bier, korrigiert sich und ordert einen Kaffee. Als Stella sich ein kleines Glas Beaujolais wünscht, verändert Trelkovsky seine Order und wechselt zum Martini. Er passt seine Wünsche und Absichten an. Nicht ganz. Er müsse noch einen Kollegen anrufen, entschuldigt er sich. Allerdings passiert er das Telefon und geht auf die Toilette, stellt sich ans Urinoir und presst offenbar mit seinem Urin seine Erregung heraus. Wieder zurück, sprechen sie über Simone Choule. Trelkovsky verspricht sich, als er Simone mit dem Präteritum belegt und sich schnell mit dem Präsens korrigiert. Danach gehen Stella und Trelkovsky ins Kino. Sie sehen einen dieser Bänder- und Gelenke-brechenden Karatefilme mit Bruce Lee. Wer den Film aussuchte, ist unklar. Während auf der Leinwand Bruce Lee seine Mitstreiter malträtiert, tastet Stella den Oberschenkel bis zu Trelkovskys Geschlecht hoch und nimmt es in die Hand. Trelkovsky löst sich aus seiner engen Sitzhaltung und legt den linken Arm um Stella und drückt ihre linke Brust. Sie küssen sich. Er schaut zurück – in das Gesicht eines Kinogängers, der ihn mit einem starren Blick und hängender Unterlippe mustert. Sofort löst Trelkovsky seine Umarmung. Draußen vor dem Kino, der Kinogänger starrt ihn weiter an, versucht Trelkovsky, Stella einzuladen und zu binden: Would you like to have a drink? Sie will nicht. Er insistiert nicht. Er gibt sofort auf und verabschiedet sich mit einem Right. Good-bye. Hope to see you soon. Er wirkt erleichtert, dass sie auseinandergehen. Achtzehneinhalb Minuten sind vergangen. Was haben wir gese-
212
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
hen? Was haben wir erlebt? Die Kunst des Kinos besteht darin, mit der Beschreibung der Außenseite die Innenseite eines Protagonisten oder einer Protagonistin zu zeichnen. Ein Mann in den mittleren Jahren fragt nach einer Wohnung. Er trifft auf eine abweisende, einschüchternde, mächtige und beunruhigende, dunkle Welt (die Concierge, das Treppenhaus, die Wohnung, der Vermieter und dessen Frau). Die erste Szene ist bereits eine enorm präzise Skizze. Noch einmal zurück zum Anfang. Trelkovsky klopft dreimal an die Glasscheibe der Tür. Er tritt zurück und wartet, aufrecht – innerlich stramm könnte man sagen –, die Hände hinten gefaltet vor der Tür der Wohnung, in der die Concierge residiert. Good evening, Madame, beginnt Trelkovsky leise und stockend. Yes, what is it?, fährt sie ihm in den Satz (die deutsche Synchronisation dämpft ihre Amplitude und nivelliert die leise, undeutliche Artikulation des Englischen, das Trelkovsky mit einem sehr starken polnischen Akzent spricht). I don’t want to bother you, I was told about an apartment, erklärt Trelkovsky mit seiner gepressten, wenig modulierten Sprechweise. Die Concierge sagt nichts, schließt das Fenster und geht zu ihrem Küchenausguss. Trelkovsky öffnet die Tür, steckt den Kopf herein und fragt vorsichtig: This is the right building, isn’t it? Who told you?, schießt sie ihre Frage heraus. A friend of mine – a relation actually – ein Verwandter, kein Freund korrigiert er sich, als sei ein Freund eine unangemessen intime Beziehung, die er aus dieser heiklen Beziehung besser heraushält – nach dem strengen mütterlichen Muster: Bring mir keine Freunde ins Haus! Zögernd betritt er die Wohnung der Concierge. The door!, herrscht sie ihn an, die Tür schleunigst zu schließen. Indigniert schaut sie ihn an. A small two-room apartment, setzt Trelkovsky fort. Is that all I got to do?, beklagt sich die Concierge, some people think a concierge is a slave! No, no, not me, versucht Trelkovsky, sie zu beruhigen, I assure you. Would it be more convenient, if I come later, bietet er ihr eine Verschiebung der Audienz an.
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 213
Sie zeigt ihm das Apartment, lenkt ein. I don’t want to be a nuisance, beschwichtigt Trelkovsky sie. But if possible, I might offer you a small recompensation. It’s only reasonable. Er legt ihr das Geld auf den Tisch, schließt sorgfältig sein Portemonnaie, spielt mit dem Hund, der nach seiner Hand schnappt, und beglückwünscht die Concierge für den Namen ihres Hundes: Nice name. Sie verlassen die Wohnung. Er greift rasch vor und schließt die Tür für sie: Sorry! Ein wohlerzogener junger Mann. Eine Spur zu höflich – möchte man meinen – bei dieser Concierge, die ihren Unmut und ihre Unzufriedenheit an ihm auslässt. Wie reagiert Trelkovsky? Er wird noch höflicher. Er macht sich klein. Er bezahlt seine Peinigerin. It’s only reasonable. Er lobt den Namen des Hundes, der nach seiner Hand schnappte. Er schließt der Concierge die Tür, als sei sie behindert und benötigte Unterstützung. Soziologisch würde man sagen: Er stellt sich auf die Statusdifferenzen nicht ein. Psychologisch: Er etabliert ein riesiges Machtgefälle. Aber vor allem ist seine Beziehungsgestaltung merkwürdig, als er auf die barsche, kurze Frage der Concierge Who told you? mit der Korrektur antwortet: A friend of mine – a relation, actually. Ein Verwandter gab ihm den Tipp, kein Freund von ihm. Die Beziehung zu der Concierge, einer fremden Frau, gestaltet Trelkovsky nach dem Muster des tief gebundenen Sohnes, der es nicht wagt, eine fremde Beziehung zu präsentieren – sie sieht das nicht so gern. Trelkovsky, der beflissen und devot mit einer gestelzten Sprache spricht, die im Englischbuch abgedruckt, aber so kaum gesprochen wird, ist der tief gebundene Mann, der sich nicht Nein! zu sagen traut, der sich nicht trennen kann und der sich in Beziehungen verliert. Stella gegenüber verhält sich Trelkovsky ähnlich. Aufschlussreich ist die Reihenfolge seiner Bestellung im Bistro nach dem Krankenhausbesuch: erst das Bier, dann der Kaffee und schließlich der Martini. Seinen ersten Impuls, mit einem Bier seine Kontrolle zu lockern und seinem sexuellen Wunsch nachzugeben, revidiert er mit der Bestellung eines Kaffees, die er ein weiteres Mal korrigiert, als Stella das Glas Beaujolais ordert. Er folgt ihr. Er überlässt ihr die Initiative. Er fügt sich und verschwindet in der Beziehung.
214
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Mit Donald Woods Winnicott kann man sagen, dass Trelkovsky über keinen ausreichenden inneren Bewegungsspielraum (der Phantasien, Tagträume, Wünsche und Sehnsüchte) verfügt bei einem gering konturierten Selbst-Kern. Sexuelle Wünsche können nicht innerlich gehalten und gebunden werden in beispielsweise masturbatorischen Phantasien, sondern müssen verurteilt und ausgestoßen werden als öffentliche Verurteilungen – wie in der Szene der Totenmesse für die verstorbene Simone Choule, als der Priester die sexuelle Lust geißelte und Trelkovsky es nicht mehr aushielt und herauslief. Realitätskontakt vernichtet. Beziehungen vernichten. Trelkovsky kann sich nicht behaupten. Er kann nicht, wie Winnicott (1974) es formulierte, in Gegenwart anderer allein und damit er selbst sein. In Gegenwart anderer wird Trelkovsky kleiner und kleiner. Roman Polanski nimmt uns auf eine höchst beunruhigende Reise mit. Wir begleiten den Prozess des Verschwindens von Trelkovsky und den Prozess des Getriebenwerdens gegen diese Vernichtung. Wie behilft er sich? Er wird eine Andere; er staffiert sich mit einer fremden Individualität aus. Und die fremde Individualität treibt ihn weiter in die Defensive – Trelkovsky zieht buchstäblich ein in die Finsternis der Nicht-Existenz. Er wird zum locataire chimérique. Und wir sind mit unserer eigenen Gegenwehr beschäftigt, je weiter Trelkovskys psychische Dekonstruktion fortschreitet – der eigene Prozess, in dem wir lernten, unser Idiom nach und nach zu behaupten, wird labilisiert. Die Dämonen der befürchteten Vernichtung tauchen wieder auf; sie scheinen überall im Plot des »Mieters« zu warten. Der Gang zur Etagentoilette – der bedrohliche Weg bei Nacht – kehrt wieder als die alte Scheußlichkeit vergangener Zeit: die Wiederkehr der Verletzbarkeit. Wir kennen die Dämonen des verwirrenden Begehrens, weil wir sie ausgetragen haben in unserer Kindheit, und ihre Vorboten, die unerklärlichen Geräusche, die Behälter unserer Externalisierungsversuche. Wir erinnern uns höchst ungern daran, wie wir die Ecken in unseren Zimmern absuchten und unters Bett schauten, ob sich dort jemand befindet. Wir erinnern uns höchst ungern daran, wie lange es dauerte, bis sich in uns unklares, brennendes Begehren, Objekt-
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 215
Beziehungen und Objekt-Erfahrungen sortierten, beruhigten und stabilisierten. Diesen Entwicklungsprozess dekonstruiert Roman Polanski mit dem reversen Entwicklungsprozess seines Protagonisten Trelkovsky, und wir müssen uns erneut sortieren, orientieren, beruhigen und stabilisieren. Donald Woods Winnicott (1985) sprach von der lebenslangen Anstrengung, unterscheiden zu müssen zwischen dem fremden Anderen und sich, zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit. Es sind diese seelischen Bewegungen des Ausgreifens und Zurückziehens, die in ihren eigenen, individuellen Rhythmen unser Überleben sichern. Roman Polanski mutet uns die aus der Balance geratenen seelischen Bewegungen zu. »Der Mieter« Trelkovsky verschanzt sich in der Bewegung des Rückzugs als seiner Überlebensstrategie. Das war in Polanskis zweitem Spielfilm »Ekel« ähnlich: Carol, die Maniküre, erstarrt am Ende im Rückzug in ihre innere Welt. Trelkovsky bricht aus dem Rückzug in die Finsternis seiner Wohnung und seiner inneren Welt aus: Er verwandelt sich zu Simone Choule und verschmilzt mit ihr, der Vormieterin, der der Ausbruch gelungen war. You gang of killers!, schreit Trelkovsky. Es ist der Schrei dessen, der sein Exekutionskommando auf sich anlegen sieht. Das Exekutionskommando trägt die Fratze des Vermieters, der sich mit seinen Mietern und Stella auf dem Parkett und dem Balkon eingerichtet hat für das Schauspiel der Hinrichtung – und der Vermieter, muss man hinzudenken, trägt die Fratze des Vaters.
■ Zur Qualität des Kino-Textes Sie erinnern sich, wie Alfred Hitchcocks Film »Rear Window« – »Das Fenster zum Hof« begann? Während die Vorspanntitel ablaufen, werden die Jalousien nach und nach hochgezogen. Der Blick auf einen Hinterhof wird frei. Wir kennen das: Wenn man aufgestanden ist, noch im Schlafanzug die Vorhänge auf und die Rollläden hochzuziehen beginnt, wenn die Traumverfassung sich wie ein dünner Nebel lüftet, beginnt der Tag mit dem Blick nach draußen – wie ist das Wetter? Die Anstrengung des Realitätsge-
216
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
schäfts liegt vor einem, und die Wirklichkeiten beginnen sich in einem zu sortieren. Hitchcock lässt die Kamera auf die Fensterkante zu- und über sie hinausfahren – eine Kamerabewegung, als würden wir uns aus dem Fenster beugen und weit herausschauen. Was sehen wir? Eine Katze, die ein paar Stufen hochläuft; die Kamera schwenkt mit, wir blicken hoch. Ein Wohnhaus. Wir schauen nach links. Eine Frau duscht. Am Horizont Hochhäuser. Wir sind offenbar im südlichen Teil Manhattans. Die Kamera bewegt sich nach innen. Wir sehen den Kopf des Protagonisten (James Stewart). Er schwitzt; Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. Das Thermometer zeigt gute 90 Grad Fahrenheit (34 °C). Zurück in den Hof. Wir sehen etwas mehr. Lehnen wir uns mehr aus dem Fenster? Ein Mann rasiert sich; er wechselt den Radiosender. Ein Paar wird vom Wecker geweckt, rappelt sich auf dem Balkon hoch und nimmt das Bettzeug mit in die Wohnung. Eine Balletttänzerin trainiert und bewegt sich aufreizend in ihrer Wohnung. Die Kamera schwenkt zurück – wir sehen den Protagonisten, dessen linkes Bein ist komplett eingegipst, auf den Gips ist der Satz gekritzelt: »Here lie the broken bones of L. B. Jeffries«. Die Kamera schwenkt durch seine Wohnung: eine demolierte Fotokamera, eine Fotoausrüstung, Bilder von Unfällen, das eingerahmte Druckklischee einer blonden Frau, die auf dem Titelblatt einer Zeitschrift wieder auftaucht. Jeffries ist ein Fotograf. Er ist immobil. Ein ironischer Beginn. Alfred Hitchcock ließ die Kameraschwenks von rechts nach links ausführen, Roman Polanski von links nach rechts. Während L. B. Jeffries, gespielt von James Stewart, mit der Teleoptik und seinen gefräßigen Phantasien den kannibalistischen Blick in den Hinterhof auf die Nachbarn pflegt, scheut Trelkovsky den Blick in den Hinterhof. Dort in Paris – nicht in Manhattan – sind die Fenster geschlossen, die Gardinen vorgezogen, hinter denen sich die Nachbarn aufhalten – beobachtend, lauernd, könnte man vermuten, wenn man unsicher und fremd ist und nicht weiß, wie man seine Nachbarschaft einzuschätzen hat. Man könnte auch sagen: Der immobile Fotograf im Rollstuhl dringt ein und verschlingt die Innenwelten seiner Nachbarn, der mobile Disponent schreckt zurück und wartet gelähmt auf das vernichtende Echo seiner Projektionen. Deshalb der Abscheu vor dem Fenster zum Hof.
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 217
Wie beginnt Roman Polanski seinen Film »Der Mieter«? Blick auf ein Fensterkreuz, rechts und links sind Gardinen vorgezogen, dahinter ein Gesicht. Die Kamera schwenkt vier Stockwerke tiefer auf ein Glasdach. Sie schwenkt auf dasselbe Fenster zurück; jetzt ist ein Frauengesicht zu erkennen. Die Kamera schwenkt horizontal nach rechts und tastet die Wohnungen ab, bis zu einem Fenster, an dem eine junge Frau in einem schwarzen, geblümten Kleid steht, das Haar streng zurückgekämmt. Die Frau verwandelt sich in Roman Polanski – eine Anspielung auf Alfred Hitchcock, der regelmäßig zu Anfang in seinen Filmen auftaucht? Die Kamera schwenkt ein Stockwerk tiefer auf ein großes, bis auf den Boden reichendes Fenster mit einem Gitter. Die Kamera schwenkt eine weitere Etage tiefer vor ein mit Gardinen zugezogenes Fenster; wir sehen die Umrisse eines Mannes, der die Bettdecken aufschüttelt. Weiter schwenkt die Kamera an Wohnungen vorbei, fährt weiter in die Höhe, und wir schauen an einer Wohnung hoch, deren Fensterläden zugeklappt sind. Jetzt fährt die Kamera auf den Boden zu und bewegt sich in den Flur hinein – wir können die Eingangstür sehen, die jetzt geöffnet wird: Trelkovsky tritt ein. Er sollte besser draußen bleiben; in dieser kalten, abweisenden Welt hat er nichts zu suchen. Roman Polanski hat den Ton perfekt angeschlagen. Nachbarn, die sich verbergen, sind schreckliche Nachbarn. Er ist, Bild für Bild, ein Kinokünstler und ein Kinokomponist. Alfred Hitchcocks Hochglanz-Thriller »North By Northwest« ist für mich einer der am schönsten fotografierten Filme – mit einem wunderbaren Licht. Die Helle, schrieb Erwin Straus (1956), ist der Weite verwandt. Davon lebt das amerikanische Kino. Polanski steht mit seinen Lichtkompositionen nicht nach. Sven Nykvist, der Kameramann, hat eindrucksvolle Bilder geschaffen. Roman Polanski, von dessen Werk ich die Hälfte seiner Filme kenne, hat mehrmals Genres des amerikanischen und britischen Kinos aufgegriffen. Sein Abscheu vor dem Fenster zum Hof – sein Hinterhof als sein Gegenbild zu Alfred Hitchcocks Kino und vielleicht auch zum US-amerikanischen Kino – ist ambivalent. Denn »Rosemary’s Baby« beginnt mit einer Kamerafahrt aus größter Höhe auf ein Apartment in Manhattan zu – sehr ähnlich dem Beginn von Alfred Hitchcocks »Psycho«, in dem die Kamera aus der Aufsicht auf Phoenix, Arizona, sich auf das Fenster des
218
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Stundenhotels, in dem Marion Crane mit Sam ihre Mittagspause verbringt, zubewegt. »Wenn Katelbach kommt« (»Cul-de-sac« – »Sackgasse« heißt der Film im Original), ist ein ironischer, abgründiger Kommentar zu William Wylers »Desperate Hours« – »An einem Tag wie jeder andere« – aus dem Jahr 1955, in dem Humphrey Bogart mit seinen Kumpanen eine Familie terrorisiert. »Frantic« wirkt wie Polanskis Antwort auf Hitchcocks »Der Mann, der zuviel wusste« – hier, in Paris, verliert das amerikanische Ehepaar nicht sein Kind, sondern der Arzt Richard Walker (Harrison Ford) verliert seine Frau Sondra und macht sich in seiner wütenden, verzweifelten Rage und Not auf einen Weg durch Paris: kein Ausflug ins sonnige und herrlich Technicolor-bunte London, sondern die erschöpfte Suche in einem kalten, grau-blauen Paris. »Der Tanz der Vampire« und »Chinatown« sind gelungene Auslegungen alter Genres. In seinem autobiographischen Buch »Roman Polanski über Roman Polanski« erwähnt Polanski (1984) Alfred Hitchcock nicht. In dem Kapitel über »Der Mieter«, der beim Festival in Cannes nicht ausgezeichnet wurde, geht er auch nicht auf den Gewinner des damaligen Wettbewerbs ein: 1976 gewann Martin Scorsese die Goldene Palme für »The Taxidriver«, der eine andere Geschichte der Dekompensation erzählt, wiederum in einer expansiven, destruktiven Bewegung einer mörderischen Rache. Roman Polanski hat – anders als beispielsweise Alfred Hitchcock – wenig Auskunft über seine künstlerischen Wurzeln und die Motive seiner Arbeit gegeben. Als Künstler muss er das auch nicht. Alfred Hitchcock gab Auskunft, weil er sich als Künstler unterschätzt fühlte (Truffaut 1966). Polanski ist der Meister im Verstecken; er reüssierte im Hollywood-Kino, und gleichzeitig dekonstruierte er das HollywoodKino. Man kann verstehen, warum er »Der Mieter« für seinen persönlichsten Film hält. Annegret Mahler-Bungers hat Polanskis Stilprinzipien der »Bruchmetapher, Entropie, Zyklizität und Skepsis« aufgelistet und lebensgeschichtlich lokalisiert (Mahler-Bungers 2004). Katherine Stroczan und Lothar Bayer (2004) haben in zwei Filmen von Polanski – »Das Messer im Wasser« und »Der Tod und das Mädchen«, die Abwesenheit oder Nicht-Existenz von Elternpaaren diagnostiziert. Roman Polanskis Filme haben eine existentielle Dimension, die wahrzunehmen der Filmregisseur sein
G. Bliersbach · »Der Mieter« und der Abscheu vor dem Fenster zum Hof 219
Publikum zwingt. Anders soll es nicht gehen. Bitter muss es schmecken. Aber sardonisch darf es sein – schließlich ist Roman Polanski auch ein Kenner des Kinos Luis Buñuels: Wenn L. B. Jeffries im »Fenster zum Hof« von seinem Nachbarn aus dem Fenster gestoßen wird und sich das zweite Bein bricht, dann muss Trelkovsky zweimal springen.
■ Literatur Bollas, C. (2000): Genese der Persönlichkeit. Psychoanalyse und Selbsterfahrung. Stuttgart. Eco, U. (1985): Über Gott und die Welt. München. Greenberg, H. (1975): The Movies on Your Mind. Film Classics on the Couch, From Fellini to Frankenstein. New York. Mahler-Bungers, A. (2004): Die Metamorphosen des Bösen. Roman Polanski und seine Filme. Merkur 58, No. 668: 1101–1110. Neubaur, C. (2002): Das Bild – Patient oder Kollege? Zur Psychoanalyse der bildenden Kunst. Merkur 644: 1079–1090. Polanski, R. (1984): Roman Polanski von Roman Polanski. München. Reiche, R. (2001): Mutterseelenallein. Kunst, Form und Psychoanalyse. Frankfurt a. M. Salber, W. (1966): Die Morphologie des seelischen Geschehens. Düsseldorf. Straus, E. (1956): Vom Sinn der Sinne. Ein Beitrag zur Grundlegung der Psychologie. Berlin. Stroczan, K.; Bayer, L. (2004): Vom Drama zur Tragödie in Polanskis Filmen. Psyche – Z. Psychoanal. 58: 1182–1195. Truffaut, F. (1966): Le cinéma selon Hitchcock. Paris. Winnicott, D. W. (1974): Die Fähigkeit allein zu sein. In: Winnicott, D. W.: Reifungsprozesse und fördernde Umwelt. München. Winnicott, D. W. (1985): Playing and Reality. London. Zitzelsberger-Schlez, A. (2004): Tödliche Verwandlung – vom Selbstverlust zur Selbstvernichtung. Im Dialog: Psychoanalyse und Filmtheorie. Bd. 2: Roman Polanski. Mannheim.
■ Gerhard Schneider
»Der Mieter« – Roman Polanskis filmische Analyse eines psychotischen Universums1
■ »Der Mieter« – Roman Polanskis filmische Analyse eines psychotischen Universums Ralf Zwiebel (2003) hat in seinem Aufsatz zu Hitchcocks »Vertigo« zwei unterschiedliche psychoanalytische Zugangsweisen zu Filmen dargestellt. In der einen nehmen wir den jeweiligen Film als Traum des Regisseurs, den wir auf dem Hintergrund unserer Rezeptionserfahrung und unseres analytischen Wissens interpretieren. In der anderen, von Zwiebel inaugurierten und an »Vertigo« exemplarisch durchgeführten Zugangsweise betrachten wir ihn so, als hätte der Regisseur einen Traum des Analytikers verfilmt, und wir versuchen dementsprechend, diesen Traum zu deuten – in »Vertigo« wird in dieser Perspektive in Scotties Geschichte der Alptraum einer aufgrund von Rettungsphantasien des Analytikers entgleisenden analytischen Beziehung erkennbar. Ich glaube, es ist mit diesem letzteren Ansatz kompatibel, wenn ich, ein Stück darüber hinausgehend, den Regisseur als eine Art visuellen Psychoanalytiker des klinischen Analytikers verstehe, der diesem in seinem, dem visuellen Medium einen Interpretationsvorschlag macht. 1 Ich möchte diese Regisseur-als-Analytiker-Perspektive grundsätzlich aufnehmen, hör-sehe Polanski in Bezug auf »Der Mieter« aber sozusagen nicht von meinem üblichen Arbeitsplatz hinter der Couch her, sondern am Schreibtisch. Meine Zugangsweise ist dementsprechend die, nach dem ersten starken globalen Seh- und Gefühlseindruck im Kino mit einer »Der Mieter«-DVD im Laptop vor meinen Augen am Schreibtisch sein Elaborat – hilfsweise spre1 Meinem Freund Dr. Alexandre Métraux zum 60. Geburtstag gewidmet.
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
221
che ich von seinem »Text« – Bild für Bild – Zeile für Zeile – durchgehend mir anzueignen und zu artikulieren, was ich daran als »klassischer Analytiker« bemerkenswert finde.2 Nach diesen Eingangsbemerkungen, die meine Zugangsweise zu »Der Mieter« verdeutlichen und in einen Kontext stellen sollten, komme ich nun zum Film selbst. Wie bei einem Text auch ist es nützlich, sich dabei zunächst dem Vorspann als einer Art komprimierter Zusammenfassung des Ganzen und dem Schluss quasi als einer integrierenden Schlussformulierung zuzuwenden. Genau genommen endet »Der Mieter« als solcher, bevor das Signum der Verleihfirma den brutalen Schnitt macht, nicht mit einem klaren aristotelischen Ende, wie es früher oft durch das Schriftzeichen »Ende« bezeichnet wurde, auch wenn der bevorstehende Tod Trelkovskys ein solches Ende sein könnte. Nach seinem zweiten Fenstersturz folgt abrupt ein völlig dunkles Bild: Wir sehen plötzlich nichts mehr, analog dazu, dass Trelkovsky sich aus der Welt heraus in das Nichts der Bewusstlosigkeit, des Todes, gestürzt hat. Im Dunkel der Höhle des Kinos kann uns für einen Augenblick dieses Nichts streifen. In diesem Nichts taucht eine Szene auf, Stella und Trelkovsky an einem Krankenbett, die uns an die frühere Analogszene mit Simone Choule erinnert. Polanski filmt aber nicht primär eine Erinnerung, sondern schafft eine neue Präsenz: Weder sind wir, obwohl es derselbe zu sein scheint, »einfach« im selben Krankenhausraum, in dem wir vor etwa 100 Minuten dieses Bett 2 Übrigens taucht an dieser Stelle ein interessanter Aspekt auf. Polanski und ich gehören ja unterschiedlichen analytischen Schulen an: hören, sprechen, schreiben auf meiner Seite, der des klassischen Analytikers – sehen, visualisieren, montieren auf der des visuellen Analytikers. Wie aus der Hör- und Sprechzunft bekannt ist, sind schon hier die Gräben ausgeprägt – wann lesen (oder gar lernen) so genannte Freudianer, Selbstpsychologen, Kleinianer etc. (von)einander? – und im Hinblick auf die visuellen Analytiker geht es auch noch über einen großen medialen Graben hinweg. Andererseits wirft jede Schule und jede Perspektive ihren je eigenen Schatten, d. h. produziert ein je ihr eigenes adhärentes Unbewusstes (Schneider 1998), wie man sich klinisch an Jörg Scharffs (2002) Aufsatz zur Subjekt- und Objektlogik psychoanalytischen Verstehens in Bezug auf die kleinianische Perspektive klarmachen kann. Aber hier liegt auch die Selbstaufklärungschance (streng genommen sogar die Notwendigkeit) des Hinausgehens über den eigenen Welttellerrand, im Hinblick auf den Film also über den Schatten der Sprache in der klassischen analytischen Position.
222
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
gesehen haben, noch hören wir »einfach« die Stimmen von damals, vielmehr kommt Stellas hallende Stimme aus sternweiter Ferne und entfernt sich immer weiter. Wir werden so in diesem ansonsten menschenleeren, fast dunklen Raum in ein allmähliches Verhallen, in ein Entwerden, in Trelkovskys Sterben hineingezogen. Schnitt. Und ohne, dass da eine Hand ist, die dies Fallen hält: Wir sehen im Dunkel ein helles blutgetränktes Bandagenweiß, das jemanden, Trelkovsky, Simone Choule, all die anderen, in die absolute Bewegungslosigkeit einschnürt und nur einen Seh-MundSchlitz offen lässt, und es scheint, als solle uns die Verzweiflung dieses Halt-losen Verschwindens packen, denn da greift ein sich steigernder, dann allmählich im antworttoten Dunkel des letzten Nicht-Bildes verhallender Schrei nach uns, und die Kamera fährt langsam auf den schreienden geöffneten Mund zu, als ob wir in einen Mahlstrom hineingezogen werden sollen. Oder müssten? Müssten, um fühlen zu können, also am eigenen Leibe spüren zu können, warum ein Wieder-Holen, wie es die traumatische Erinnerung kennzeichnet, unbewusst die einzige Rettung sein könnte vor einem solchen Halt-losen Fall aus der Welt? Polanski beendet seinen Film also mit einer Auslöschung, dem Verschwinden der optisch wie auditorisch wahrnehmbaren Welt, verbunden mit dem Bild einer völligen Ausgeliefertheit und Hilflosigkeit, einer Zuständlichkeit namenlosen Entsetzens, dessen Präsenz, analog zu Edvard Munchs Bild »Der Schrei«, der grenzenlose leere Schrei ist. Mir scheint, dass in diesem Schluss das Potential der allerersten Bilder des Films Wirklichkeit geworden ist. Der Film beginnt mit einem kurzen Standbild, dem Blick auf ein mit einer Gardine großenteils, aber nicht gänzlich verhängtes, geschlossenes Fenster mit einem mittigen breiten, senkrechten Steg. Zu beiden Seiten blicken wir zwischen Steg und Gardine in ein undurchdringliches Schwarz im Inneren, in dem dann, sehr schemenhaft und nicht wirklich identifizierbar, links ein Mann mit einem oben aufgeknöpften hellen Hemd ahnbar wird. Der Kamerablick kippt sodann an der Hauswand entlang nach unten. Es entsteht ein leichter, aber spürbarer Tiefensog, der einen Impuls auslöst, als möchte man sich festhalten, und wir sehen unten eine opake, wohl beschädigte Glasfläche. Der Blick geht dann wieder nach oben, endet aber leicht nach rechts versetzt, und genau an
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
223
der Stelle des Mannes wird jetzt schemenhaft eine Frau erkennbar. Die Grundstimmung der Bilder ist dunkel und dem entspricht die Musik. Worum es also, rein von den Bildern und der Kamerabewegung her gesehen, geht, ist einmal der Blick in ein dunkles, kaum zugängliches Inneres und eine diffuse Ahnung von Überblendung, Ersetzung. Ferner vollziehen wir als zentrale Bewegung zwischen dem Erkennen der Schemen von Mann und Frau die Fallbewegung des Kamerablicks mit, die im Kontrast zum festen mittigen Fenster steht, als öffne sich das Fenster, schaue man nach außen und erlebe einen Schwindel beim Blick nach unten, der eine Beschädigung zeigt. Im Rückblick lässt sich der Film also, zugespitzt formuliert, als Entfaltung und Verknüpfung dieser beiden Eingangsmomente verstehen: des Blicks in ein Inneres und des Schwindels einer Abwärtsbewegung, eines Falls – und am Ende der Geschichte, um Freud zu paraphrasieren, wird das latent Entsetzliche dieses Anfangs klar (»Im Laufe der Begebenheiten wird alles klar werden«; Freud 1937d, S. 52). Um es als Doppelthese zu formulieren: Polanski zeigt die inhärente Vernichtungslogik einer psychischen Identität, die über einem primären »Nein!« zu ihrem »Träger« aufgebaut ist. Soziokulturell gesehen wird dieses Verhältnis einer primären Negation in der Figur des Fremden virulent, insoweit dessen (Pseudo-)Anerkennung darin besteht, dass er kein Fremder mehr sein soll, ohne dass aber die latente Fixierung auf sein Anderssein aufgegeben wird. Es handelt sich hierbei um eine primäre Negation, da der Fremde einerseits in der Forderung nach Anpassung, die eine Pseudoanerkennung verheißt, als Anderer ausgelöscht werden soll, andererseits aber doch latent zugleich auf einer Differenz, seinem Doch-anders-Sein bestanden wird, die ihn gegenläufig als Fremden fixiert und darin als Ungleichen ausschließt, aus der Gemeinschaft der Gleichen eliminiert. In Polanskis Film spiegelt und verdeutlicht meines Erachtens die soziokulturelle Perspektive zwar die erstgenannte, individualpsychologisch zentrierte, ist selbst aber durchaus nicht sekundär. Vielmehr analysiert Polanski die individuelle Verfassung zusammen mit ihrem soziokulturellen Hintergrund, wie es im Hinblick auf jemanden wie Trelkovsky, der trotz seines französischen Passes
224
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
ein Fremder bleibt, unabdingbar ist. Umgekehrt ließe sich sogar fragen, ob nicht überhaupt die soziokulturelle Perspektive die einzig angemessene sei, denn aus Trelkovskys Vergangenheit, die zu plausiblen psychogenetischen Überlegungen hinsichtlich seiner Verfasstheit führen könnte, erfahren wir nichts. Mir scheint, dass aber auch das nicht haltbar ist, denn es gibt klar erkennbar Szenen wie beispielsweise die mit dem Kind am See des Jardin du Luxembourg oder sein paranoides Umkippen beim Betrachten von Stellas Kinderfotos, die es rechtfertigen, eine psychische Verfasstheit (Identität) zu substruieren, die nicht einfach aus der soziokulturellen Perspektive ableitbar ist, vielmehr diese in ihrer Virulenz zur Erscheinung zu bringen vermag. Polanski verschränkt also beide Perspektiven und stellt sie als unablösbar voneinander dar. Bevor ich die in der These formulierte inhärente Logik von Trelkovskys Identität entfalte, komme ich noch einmal auf den Vorspann zurück, der in seinem weiteren Verlauf als die Darstellung von Trelkovskys Wunsch nach etwas, das ein bergendes Zuhause sein soll, aufgefasst werden kann – sei dies die Höhle des Mutterleibs, ein späterer schützender mütterlicher oder mütterlich-väterlicher Raum oder die Wohnung als eigener Raum des Erwachsenen in der Welt. Nach den beschriebenen Eingangseinstellungen gleitet der Kamerablick an der Hauswand entlang zu anderen Fenstern, eine Frau und Trelkovsky sind starr in einem länglich-hohen Fensterrechteck, dem der Toilette, zu sehen; man sieht ein Dach mit einem Schornstein, aus dem Rauch aufkräuselt, hinter Fenstern scheinen Menschen alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen; die Bilder werden heller und dem entspricht die Musik. Die Kamera gleitet noch einmal nach oben, um dann in einem sanften Schwung in den Hauseingangsbereich hinabzufahren. Ein dunkles, großes Tor mit eingesetztem Gitterwerk wird von außen geöffnet, jemand tritt ein, kommt näher, und man sieht ihn zum Fenster der Concierge gehen, wo er anklopft. Der Vorspann geht also mit einer Eintrittsszene, in der jemand, wozu auch immer, eingelassen werden möchte, in die Filmhandlung selbst über. Insgesamt hat sich bis zum Öffnen der Tür, vor dem wir zunächst wieder in einen dunkleren Raum eingetaucht sind, die Atmosphäre verändert, aufgehellt: Es ist im Wortsinn heller geworden, die Musik sanft, die Kamerabewegung weich und fließend. Es
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
225
entsteht der Eindruck einer heimeligen, vom Außen abgeschotteten Innenwelt, die Stimmung eines sanften Aufschwungs. In dieser Geborgenheit, wie es scheint, sucht Trelkovsky eine Wohnung – er kommt in diese Welt, zur Welt, um die Mutterleibs- oder wiegenweiche Stimmung dieses Teils aufzunehmen, auf der Suche nach einem Zuhause. Dabei macht der Eintritt von der ersten, abweisenden Reaktion der Concierge an deutlich, dass er hier weder erwartet noch willkommen ist (Szene mit der Concierge, die Türszene mit der Ehefrau von Monsieur Zy), und Trelkovsky wird sich in seinen Ansprüchen auch nicht behaupten oder gar durchsetzen können (Gespräch mit M. Zy). Es passt, dass die Wohnung, um die er sich, finanziell anscheinend bis zur Selbstausblutung, bemüht, die einer Sterbenden ist. Er wird Nachmieter einer Toten, von deren Habseligkeiten er sich auch nicht trennt. Mehr noch: Nicht nur erweist sich die von ihm ersehnte Bleibe als Totenzimmer, er wird unbewusst auch schuldig, denn er muss auf Simone Choules Tod hoffen, um ihren/seinen Platz einnehmen zu können. Und er ist in dieser Welt in den Augen der Anderen ein Fremder, als Pole trotz seines französischen Passes kein »wirklicher« oder »ganz-und-gar«-Franzose, wie später M. Zy und der Polizeikommissar deutlich machen werden oder wie es auch in der oktroyierenden Zuordnung von Schokolade statt Kaffee und der amerikanischen Marlboro-Zigaretten statt der von ihm gewünschten, bis in den Namen hinein urfranzösischen Gauloises im Bistro gegenüber permanent spürbar ist. Vielleicht war ja auch Mademoiselle Choule, mit der ihn der Bistrobesitzer identifiziert und deren Name auf eine jüdische Herkunft verweist, als solche nicht »einfach nur« Französin, sondern trug zugleich das (verleugnete) Stigma des Fremden? Mit der Verknüpfung Trelkovsky-Choule-Jude wird die in meiner These angesprochene Vernichtungslogik dem Fremden (und allgemein Fremdem) gegenüber evoziert. Sie wurde im nationalsozialistischen Deutschland unverstellt verwirklicht, indem die subsumtive ent-fremdende Pseudoanerkennung bei gleichzeitiger Markierung einer ausstoßenden Differenz und die darin enthaltene symbolische Vernichtung desymbolisiert und durch die direkte Eliminierung, die Ausrottung der Differenz, mörderisch konkretisiert wurde. Mir scheint, dass Polanski dies ansatzweise in den
226
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Blick nimmt, dann aber auch wieder in seiner ganzen Ungeheuerlichkeit entgleiten lässt, so wie es Trelkovsky in der Toilettenszene geht – ich erlaube mir die Assoziation »im Arsch des Hauses«: Aufgeschreckt aus seinen Alpträumen ist er zur Toilette gewankt, und mit seinem Eintreten dort zeigt die Kamera in Form von Graffiti auf der Wand unter anderem ein Hakenkreuz als Symbol der Vernichtungslogik; darüber sieht man das andere Symbol der Vernichtungslogik des 20. Jahrhunderts, Hammer und Sichel. Wie in einem luziden Alptraum wird Trelkovsky also für einen Augenblick der ihm selbst als Fremdem von außen eingeschriebenen Vernichtungslogik ansichtig, die für ihn aber nicht verstehbar und begreifbar wird, sondern, das ist die nächste Einstellung, von einem unverständlichen Hieroglyphentext überschrieben und unkenntlich gemacht wird. Meines Erachtens entspricht dem Polanskis partielles Überspielen dieser Logik im Film insgesamt durch das Einbringen okkulter Elemente (z. B. die Geschichte des versteckten Zahns) – das Mythisierend-Okkulte ist die Überdeckung der soziokulturellen Vernichtungsthematik, die, bis zur Unkenntlichkeit entstellt, noch in ihr nachklingt, beispielsweise im Motiv des ausgeschlagenen Zahns. Polanski zeigt die Vernichtungsthematik, vermittelt mit der Identitätslogik Trelkovksys, noch in einer anderen sie kenntlich machenden Entstellungsform: Trelkovskys Verfolgungswahn. Dessen wahrer Kern, entstellt erkennbar in der wahnhaften Verschwörungstheorie, die Hausbewohner hätten eine konkrete Absprache untereinander getroffen, ihn zu töten, indem sie ihn wie Simone Choule in den Suizid treiben würden, ist in meiner Sichtweise die gerade geschilderte Vernichtungslogik. Dieser Logik entspricht die auf einem primären Nein ihm gegenüber gegründete Identität Trelkovskys, wobei ich zu dieser Konstruktion zunächst gekommen bin, um die die Eingangsszene vollendenden Schlussbilder des Films mit ihrem namenlosen Entsetzen als Ausdruck seiner (sozio-)psychischen Verfasstheit artikulieren zu können.3 Ich werde im Nachfolgenden vier damit eng verbundene, Trelkovsky charakterisierende Konfigurationen aufzeigen, die ich als eine Art bestätigender Spiegelung meiner Grundkonstruktion verstehe: – Unterwerfung/selbstauslöschende Anpassung, – das Verbot des eigenen Nein/das Beraubt-Sein,
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
227
– das Verbot des eigenen Begehrens, – Schutzlosigkeit/das Löchrig-Sein der psychischen Haut. Die Anpassungslogik lässt sich dahingehend formulieren, dass, wo immer Trelkovksy mit einem eigenen Anspruch hinkommt, er dort den eines Anderen vorfindet, und dieser andere ist der Mächtigere, gegen den keine Auflehnung ankäme. Die Schlüsselbilder des Films dafür finden wir in Trelkovskys Verhältnis zum Hausbesitzer M. Zy und zum Besitzer des Bistros gegenüber – ich habe oben bereits kurz darauf hingewiesen. Wie tief seine Unfähigkeit zum eigenen widerstehenden »Nein!« geht, zeigt sich am Scheitern seiner entsprechenden Auflehnungsversuche. Zum einen bleiben sie folgenlos, beispielsweise nach dem Einbruch in seine Wohnung, als M. Zy wie mühelos nebenher seinen Impuls, zur Polizei zu gehen, entkräftet – wenig später sitzt Trelkovsky selbst als eine Art Angeklagter dort – oder wie sein Wutausbruch, als er Schokolade und Marlboro zurückweist, dann aber statt des bestellten Kaffees Rotwein nimmt. Zum anderen ziehen sie, wie seine Weigerung, sich der Denunziation der behinderten Mieterin anzuschließen, die indirekt auch ein Akt der Selbstverteidigung ist, massiv negative Konsequenzen nach sich und treiben ihn weiter in die tödliche Identifizierung mit Simone Choule: Wenige Einstellungen nach seiner Weigerung beispielsweise sieht man ihn sich die Fingernägel rot lackieren. Es schließt sich also ausweglos ein Kreis: Selbstbehauptung scheitert, und Anpassung/Unterwerfung ist demzufolge, weil ihr Gegenstück fehlt, Selbstauslöschung. Es folgt dies aus meiner Grundbestimmung seiner Identität und erhellt sie zugleich: Wenn an der Stelle der primären Bejahung eines Seins ein primäres Nein steht, dann kann es ein (temporäres) Überleben nur in einer Iden3 Mir kommt es rein auf die Identitätsstruktur Trelkovskys an, nicht auf deren mögliche lebensgeschichtliche Fundierung, die der Film offenlässt. Worin konkret lebensgeschichtlich der Prozess der primären Negation bestehen mag, kann hier also nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, auch wenn ich weiter unten auf eine mögliche traumatische Ursituation hinweise, die sich als primäre Negation interpretieren lässt. Im klinischen Kontext spricht Lichtenstein (1977, Kapitel 13) von der Erfahrung eines »to be negated in one’s existence« und eines »malignant no«.
228
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
tifizierung mit diesem Nein geben, also in der grundlegenden Bewegung der Selbstauslöschung. Trelkovskys paradoxe Identitätsverfassung ist demnach so zu charakterisieren: Zu sein heißt, sein eigenes Nicht-Sein zu vollziehen. Und das ist ein in sich endloses Martyrium, weil es kein Wegkommen von der primären Negation gibt, denn diese betrifft, was immer er ist und als »sich« ausgibt. Die Analogie zur Pseudoanerkennung des Fremden ist offenkundig: Der (oder das) Fremde soll als Fremder (Fremdes) verschwinden, aber in jeder Unterwerfung und Anpassung wird er/es doch als Fremder/Fremdes und damit als zu Eliminierender/Eliminierendes identifiziert. Mit anderen Worten: Die Pseudoanerkennung ist eine versteckte Form des primären Nein. Polanski legt überdies dar, dass es die Selbsterhaltung der primären Negation gibt, oder anders, dass die Vernichtung der Vernichtung entgeht, sich vielmehr selbst in Gang erhält und mästet: Simone Choule – Trelkovsky und so davor und so fort. Führen wir den Gedanken der Anpassung und des zwangsläufigen Scheiterns der Selbstbehauptung ein Stück weiter, dann können wir von einem Verbot des eigenen Nein, verbunden mit dem Beraubt-Werden/Sein sprechen. Als prototypische Szene dafür kann man die mit dem Bettler kurz nach dem Besuch im Krankenhaus bei Simone sehen. Trelkovsky will ihm ein paar Münzen geben, hat aber keine und hält ihm zur Rechtfertigung sein Portemonnaie hin, aus dem dieser sich dann großzügig bedient, ohne dass Trelkovsky dem ein Nein entgegensetzen, sprich: sich wehren würde. Beklaut zu werden oder, genauer noch, sich offenen Auges berauben zu lassen, scheint etwas in gewisser Weise Selbstverständliches, sozusagen dem Selbst Verständliches zu sein. Das Beraubt-Werden als Selbstverständliches weist auf den Zustand eines Beraubt-Seins hin, einen Zustand, der in Form des Raubes der Möglichkeit eines eigenen Seins als Konsequenz der primären Negation erscheint und diese spiegelt. Es ist also nur konsequent, wenn zu Trelkovksys Leidensweg, der allmählichen Aufdeckung seiner Verfasstheit, der Raub seiner ihm eigenen Wertsachen aus seiner Wohnung gehört, ohne dass dies irgendjemanden der Nachbarn gekümmert hätte; ja, in diesem nach außen grundsoliden Haus ist es nicht undenkbar, und es entspräche Trelkovskys Identitätslogik, wenn einer von ihnen der Täter wäre – so wie er die pri-
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
229
märe Negation als wirkende innere Beraubungs- und letztendlich Vernichtungslogik in sich trägt. Komplementär zum Verbot des eigenen Nein ist das Verbot des eigenen Begehrens, das in verschiedenen Facetten in seiner Begegnung mit Stella dargelegt wird. Zunächst erscheint es im Dazwischentreten eines eindringenden Beobachters in der Kinoszene. Wir sehen Bruce Lee als martialisch-machohaften Kämpfer, unerreichbares Gegenbild Trelkovskys, auf der Leinwand, als Stella sich ihm verführerisch nähert, er zögerlich darauf zu reagieren beginnt und dann einen Besucher aus der zweiten Reihe voyeurhaft sich quasi zwischen sie drängen sieht, was ihn sich zurückziehen lässt. In der späteren Parallelszene, in der Stella ihn mit sich nach Hause nimmt, erledigt er das selbst, indem er sich betrinkt und sich auf diese Weise »verkehrsunfähig« macht, dies philosophierend mit Fragmentierungs- und Spaltungsreflexionen begleitend, Ausdruck vielleicht melancholischer Kastrationsphantasien. In der Kirchenszene anlässlich Simones Beerdigung schließlich wird die innere Über-Ich-hafte Verbotsdynamik direkt erkennbar: Trelkovsky bekundet aus der Distanz sein Interesse an Stella, und zunehmend wird die Predigt, die er hört, für ihn zu einem apokalyptischen Verdammungsfluch, der ihn wahnhaft so sehr überfällt, dass er, gänzlich in die Ecke gedrängt, aus der Kirche fliehen muss. Die Anerkennung des eigenen Begehrens wäre ein Akt der Selbst-Konstitution jenseits der primären Negation, und unter deren Herrschaft kann ein solcher Akt nicht gelingen. Das zeigt sich in doppelter Weise in seiner transvestitischen Verwandlung in Simone Choule. Eine erste Faszination durch sie/ein Kleid von ihr ist spürbar, als er kurz nach seinem Einzug im Schrank dieses Kleid betastet, es hervorholt und dann nicht weglegt, wie es einem ersten Impuls zu entsprechen scheint, sondern es zurückhängt. Indem er schrittweise und immer mehr mit dem Lackieren der Fingernägel, dem Rouge eines Lippenstifts, Make-up, Perücke, Schuhen, Nylonstrümpfen und schließlich auch mit diesem Kleid sich in sie verwandelt, wird sein Begehren zu dem einer anderen und bleibt in dieser Verkleidung gleichsam vor ihm versteckt, beispielsweise sein narzisstisches Begehren, bewundert zu werden, wie es sich in seinem Wahn vor dem Sprung offenbart, in dem der Innenhof zum Zuschauerraum eines Opernhauses wird und er ein
230
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Star, eine umjubelte Diva ist. Richtet sich aber seine Bewunderung und sein sexuelles Begehren auf sich, so geschieht dies beispielsweise vor einem Spiegel, der ihm Simone zeigt, nicht sich selbst. Anders gesagt, um (wahnhaft) bewundert und begehrt zu werden und sich begehrenswert zu finden, also sein narzisstisches Begehrt-zu-Sein zu befriedigen, muss er sich in einen Anderen/eine Andere verwandeln, und zwar eine Tote, und sich damit, in Identifizierung mit ihr, töten. Das aber ist wiederum seiner Identitätslogik gemäß zwangsläufig: Sich zu finden heißt, die primäre Negation zu vollziehen, und ganz konkret ist das die Selbst-Tötung. Ich merke kurz an, dass hier der innere Bezug zu Hitchcocks »Vertigo« liegt, auf den es eine Reihe von Verweisen gibt: der Schwindel, die Treppenhausspirale, der doppelte Todessturz. Kann Scottie dort nur eine Tote lieben, so wird hier die Liebe Trelkovskys zu sich, das Begehren, er selbst zu werden, zu seiner SelbstVernichtung. – Als letztes Identitätsmoment nenne ich Trelkovskys in vielfältiger Weise erfahrbare Schutzlosigkeit, zu der das LöchrigSein seiner psychischen Haut gehört (vgl. Anzieu 1991, Kapitel 7). Damit ist gemeint, dass etwas in ihn eindringen kann, ohne dass dem eine Schutzhülle Widerstand entgegensetzen würde, und insofern besteht eine Nähe zum Verbot eines eigenen Nein. Ich will aber hier auf eine Art basale »Eindringbarkeit in ihn« hinaus, die noch vor diesem Verbot liegt. So, wie in die in Gips und Bandagen fixierte Simone von außen her Stimmen eindringen, so ist Trelkovskys sozusagen äußerlich-konkrete Körperhülle, sind die Wohnungswände für Geräusche durchlässig. Verbunden mit seinem Einzug wird dies in der Küche offenkundig, in der ein monotones, unablässiges und offenbar nicht abzustellendes Tropfgeräusch hörbar ist. Später hören wir heftiges Klopfen aus einer anderen Wohnung, wenn Trelkovsky, teils durch ihm zustoßende Missgeschicke wie das versehentliche Umstoßen einer Flasche, auf sich, seine Anwesenheit und damit sein Sein aufmerksam macht. Ich verstehe dieses Geschehen in der Wohnung als Ausdruck seines Selbst, und zwar so, dass Trelkovsky nicht geschützt ist, vielmehr jedes Auffällig-Werden im Sinne einer von ihm ausgehenden Existenzkundgabe mit einem einschüchternden inneren Angriff als Ausdruck der primären Negation zerstört oder unter Kontrolle gebracht werden soll. Das prototypische Beispiel dafür ist das Zum-
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
231
Schweigen-Bringen der ersten Kundgabe seines Einzugs, als er aufgrund der Intervention eines Nachbarn seine Einstandsparty mit seinen Arbeitskollegen abbricht. Ich fasse die bisherigen Ausführungen kurz zusammen. Ausgehend vom Schlusspunkt habe ich Trelkovskys Identitätslogik als die einer primären Negation charakterisiert und diese Logik zuletzt mit Bezug auf eine Reihe von Szenen in verschiedener Hinsicht entfaltet. Überdies habe ich gezeigt, dass sie mit einer Logik der Pseudoanerkennung des Fremden korrespondiert, was einen Zusammenhang zwischen Trelkovsky und Choule und seine tödliche Verwandlung in sie herstellt. In dieser Interpretationsperspektive repräsentieren M. Zy und die anderen Hausbewohner sowohl die der Pseudoanerkennung des Fremden inhärente soziokulturelle Vernichtungslogik als auch Trelkovskys innere Vernichtungslogik der primären Negation. Diese setzt sich gegen die anders gerichtete Erfahrung mit Stella durch, die er in seinem zunehmenden Wahn als Schutzfigur aufsucht. Es scheint, als zitiere Polanski in diesem Zusammenhang Bion. Trelkovsky, teilweise bereits überwältigt von seinem Verfolgungswahn und unfähig zu einem Abstand schaffenden Nachdenken, ist angewiesen auf die Realpräsenz eines guten, beruhigenden Objekts und bettelt die zur Arbeit gehende Stella an zu bleiben. Zunächst scheint er, versunken in ihr Fotoalbum mit Bildern aus ihrer Kindheit, ihre Abwesenheit ertragen zu können. Diese Abwesenheit verwandelt sich aber, ausgelöst durch ein in ihn eindringendes Klingeln an der Appartementtür, in die Präsenz des verfolgenden Bösen, zu dem jetzt auch Stella als Teil des Verschwörernetzes wird, was einen hassgetränkten Wutausbruch auslöst, in dem er, komplementär zu dem ihm Widerfahrenen, ihre Wohnung zertrümmert, ihr Geld stiehlt und dann in panischer Angst flieht. Dass Trelkovsky sich Kinderbilder angeschaut hat, könnte bedeutsam sein. Worin auch immer im Rahmen seiner Biographie die primäre Negation bestanden haben mag, wir können sie uns in ihrem Kern vielleicht als traumatische Überwältigung in einem getragen-abgeschlossenen Zustand des Eins-Seins vorstellen, die diesen zerstört hat, ohne dass auf den vernichtenden Angriff die wiederkehrende Präsenz eines Guten gefolgt wäre oder darauf geantwortet hätte. Eine dementsprechende Ausformung könnte die
232
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
Phantasie sein, immer schon verraten oder verlassen zu sein, was sich in seinem Erleben mit Stella wiederholt. Es gibt eine merkwürdige Szene kurz zuvor, die Trelkovsky im Jardin du Luxembourg zeigt, finster einen kleinen Jungen beobachtend, der, anscheinend ohne Mutter oder sonst jemanden bei sich, laut vor sich hin weint. Einer jungen Frau, die sich zu ihm herunterbeugt, sagt er weinend, dass sein Boot auf dem See unerreichbar für ihn ist.4 Die junge Frau geht dann weg, anscheinend will sie sich um das Schiffchen kümmern, kommt aber nicht zurück; um den Jungen ist eine merkwürdige Leere. Trelkovsky, der all das mitbekommt, geht zu ihm und verpasst ihm mit wutverzerrtem Gesicht eine heftige Ohrfeige, bevor er sich abwendet und weggeht – der Junge bleibt weinend an seinem Platz stehen. Wenig später sieht Trelkovsky halluzinierend im Innenhof seines Hauses die mittelalterlich verkleideten Hausbewohner die behinderte kleine Tochter der ausgestoßenen Mieterin wie mit Spießruten in ihrem Kreis herumstoßen; dann wird dem Mädchen eine Narrenkappe, die in ihrer ovalen Form dem Gesicht des Jungen ähnelt, mit seinen, Trelkovskys Zügen aufgesetzt. – Warum sein heftiger Affekt gegen den Jungen? Wird er da nicht projektiv einer eigenen katastrophalen Verlassenheit, Hilflosigkeit und Ausgeliefertheit gewahr, die so unerträglich ist, dass sie »weggemacht« werden muss, am besten sollte ihr Repräsentant umgebracht werden? Dieses solcherart Verleugnete kehrt dann in der gerade erwähnten Halluzination wieder, wahnhaft entstellt und doch in seiner Wahrheit erkennbar. Ich komme abschließend noch einmal auf meine Grundidee zurück, Polanski als visualisierend-präsentativ arbeitenden Analytiker zu verstehen. Meine leitende These ist, dass es ihm als FilmPsychoanalytiker in »Der Mieter« darum geht, die (Selbst-)Vernichtungslogik erkennbar zu machen, die der durch eine primäre Negation definierten psychischen Verfasstheit oder Identität, vielleicht traumatisch bedingt, inhärent ist. Wenn ich dabei von »Logik« spreche, dann deshalb, weil der Film selbst an keiner Stelle, 4 Übrigens drehte Polanski »Der Mieter« in einer durch Geldprobleme erzwungenen Drehpause seines Films »Die Piraten«, für den eigens ein Schiff gekauft worden war (Polanski 1985, S. 320ff.)
G. Schneider · Roman Polanskis filmische Analyse
233
auch in den Szenen zwischen Trelkovsky und Stella nicht, eine begründete Hoffnung aufkommen lässt, dass sich etwas verändern, Trelkovskys Weg in den Abgrund aufgehalten werden könnte. Visuell wird das insbesondere durch die Enge der Welt, in der er sich bewegt, präsent. Kein einziges Mal weitet sich der von ihm gelebte Raum um ihn herum zu einem Expansionsraum, was direkt (seine Wohnung) oder ex negativo erfahrbar wird (die Trostlosigkeit und Leere, als er, in sich versunken, an der Seine entlanggeht; die Unvorstellbarkeit einer Wohnung wie die des Bruders von Stellas intellektuellem Bekannten für ihn). Meinem Eindruck nach haben wir es mit einer Logik oder Zwangsläufigkeit zu tun, wie wir sie von Kafkas Figuren her kennen: Es ist eigentlich immer schon alles gelaufen, es muss nur noch geschehen, daher der lakonisch-schockhafte Beginn etwa in »Die Verwandlung«, in der Gregor als Käfer aufwacht, und die Möglichkeit einer Wendung ins Andere gibt es nicht, deswegen verfällt der hochgestimmte Aufbruch Georgs in »Das Urteil« im Nu in Nichts. Diese abgründige Ausweglosigkeit, deren psychisches Gewahrwerden ein namen- und wortloses Entsetzen ist, das der Film in seiner letzten Szene evoziert, ist die Konsequenz der Trelkovsky eingeschriebenen primären Negation. Polanski fasst die Identitätslogik Trelkovskys nicht allein als eine rein individuelle auf, sondern parallelisiert sie mit der der Pseudoanerkennung des Fremden inhärenten Vernichtungslogik – Trelkovsky als der Fremde und präziser noch der Jude, für den es als Fremden keine Wohnung, kein Zuhause gibt. Am hieroglyphisch wieder unkenntlich gemachten Symbol der freigesetzten Vernichtungslogik, dem Hakenkreuz auf der Toilette, wird diese soziokulturelle Logik für einen Augenblick manifest. Es scheint aber, als würde Polanski im Rahmen dieses Films, der im Herzen Frankreichs, seiner eigenen Geburtsstadt Paris, spielt, dies nur wie in einer Fußnote erwähnen und zugleich verstecken wollen. Meine letzte Bemerkung betrifft Trelkovskys (Nicht-)Wissen über das, was im Sinne der Entfaltung seiner primären Negation mit ihm geschieht. Deren Vernichtungslogik enthüllt sich ihm in seiner psychotischen Entwicklung, wobei Polanski dies mit dem Mittel der subjektiven Kameraperspektive visuell beklemmend mitvollzieht und für uns mitvollziehbar macht. Allerdings bleibt
234
Teil III: Psychoanalytisch orientierte Filmbetrachtungen
für Trelkovsky dieses Wissen aufgrund seiner wahnhaften Verkleidung zugleich auch unproduktiv in dem Sinne, dass er es nicht in irgendeiner Form von Befreiung für sich nutzen kann. Es wird nicht zu einem reflexiven Selbstwissen, das Nachdenken und Veränderung ermöglichen würde, vielmehr bleibt er ein wehrloses Opfer seiner Identitätslogik, die in die apokalyptischen letzten Szenen und Bilder mündet. Polanski hat mit »Der Mieter« einen psychoanalytischen Film gedreht, der fürwahr ins Herz der Finsternis führt.
■ Literatur Anzieu, D. (1991): Das Haut-Ich. Frankfurt a. M. Freud, S. (1937d): Konstruktionen in der Analyse. G. W. Bd. XVI. Frankfurt a. M. Lichtenstein, H. (1977): The Dilemma of Human Identity. New York. Polanski, R. (1985): Roman Polanski. Autobiographie. München. Scharff, J. M. (2002): Zur Zentrierung auf innere und äußere Faktoren als zwei Perspektiven klinischen Verstehens. Psyche – Z. Psychoanal. 56: 601–629. Schneider, G. (1998): Interdisziplinarität als Möglichkeit zur Extradisziplinarität – eine Anmerkung zur Frühjahrstagung 1998. DPV-Informationen 24: 23–24. Zwiebel, R. (2003): Höhenschwindel. Psychoanalytische Anmerkungen zu Trauma und Melancholie in Hitchcocks Vertigo. Psychoanalyse im Widerspruch 30: 33–44.
Die Autorinnen und Autoren
Gerhard Bliersbach, Diplom-Psychologe, Autor, ist Psychologischer Psychotherapeut in den Rheinischen Kliniken Düren. Dirk Blothner, Dr. phil., Diplom-Psychologe, Lehranalytiker, ist apl. Professor an der Universität Köln und Psychoanalytiker in eigener Praxis. Christel Eckart, Dr. phil., Diplom-Soziologin, ist Professorin für Frauenforschung an der Universität Kassel. Timo Hoyer, PD Dr. phil., ist Wissenschaftlicher Angestellter am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt am Main. Marianne Leuzinger-Bohleber, Dr. phil., ist Professorin für Psychoanalytische Psychologie an der Universität Kassel und Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts in Frankfurt am Main sowie Psychoanalytikerin in eigener Praxis. Annegret Mahler-Bungers, Dr. phil., Lehranalytikerin, ist Psychoanalytikerin in eigner Praxis. Gerhard Schneider, Dr. phil., Diplom-Psychologe, Diplom-Mathematiker, Lehranalytiker, ist Psychoanalytiker in eigener Praxis in Mannheim. Mechthild Zeul, Diplom-Psychologin, ist Psychoanalytikerin in eigener Praxis in Frankfurt am Main. Ralf Zwiebel, Dr. med., Arzt für Neurologie und Psychiatrie, Lehranalytiker, ist Professor für Psychoanalytische Psychologie an der Universität Kassel.
Das Unbewusste in der Kunst
Stavros Mentzos / Alois Münch (Hg.)
3V\FKRVH LP )LOP Forum der Psychoanalytischen Psychosentherapie, Band 14. 2006. 99 Seiten, kartoniert ISBN 10: 3-525-45115-6 ISBN 13: 978-3-525-45115-1
Psychologische respektive psychopathologische Phänomene bilden seit jeher eine reiche Ressource künstlerischer Bearbeitungsmöglichkeiten. Dieser Band untersucht, wie Psychosen in Filmen thematisiert und vom Publikum rezipiert werden.
Klaus Herding / Gerlinde Gehrig (Hg.)
2UWH GHV 8QKHLPOLFKHQ 'LH )DV]LQDWLRQ YHUERUJHQHQ *UDXHQV LQ /LWHUDWXU XQG ELOGHQGHU .XQVW Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2: Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog, Band 2. 2006. 300 Seiten mit 70 Abbildungen, kartoniert ISBN 10: 3-525-45176-8 ISBN 13: 978-3-525-45176-2
Zum ersten Mal wird Sigmund Freuds zentrales Werk »Das Unheimliche« (1919) nicht nur von psychoanalytischer und literaturwissenschaftlicher, sondern zugleich von kulturgeschichtlicher Seite aus kritisch gesichtet.



![Quanten und die Wirklichkeit des Geistes: Eine Untersuchung zum Leib-Seele-Problem [1. Aufl.]
9783839431733](https://dokumen.pub/img/200x200/quanten-und-die-wirklichkeit-des-geistes-eine-untersuchung-zum-leib-seele-problem-1-aufl-9783839431733.jpg)
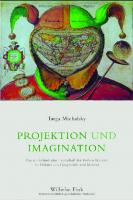


![Die Botschaft des Neuen Testaments: Eine kurz gefasste neutestamentliche Theologie [1 ed.]
9783788735050, 9783788735036](https://dokumen.pub/img/200x200/die-botschaft-des-neuen-testaments-eine-kurz-gefasste-neutestamentliche-theologie-1nbsped-9783788735050-9783788735036.jpg)


