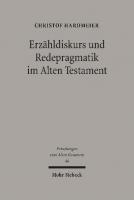Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum 9783963271984, 3963271981
Bei der Betrachtung der Quellen, die aus der Region Syrien-Palästina seit dem Chalkolithikum vorliegen und die Wesen mit
230 21 25MB
German Pages [174] Year 2023
Polecaj historie
Table of contents :
Vorwort
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Grundlagen
2.1 Eingrenzung der Materialbasis und des Vergleichsmaterials
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
2.2.1 Ein Kopf mit mehreren Gesichtern
2.2.2 Zwei Köpfe
2.2.3 Drei Köpfe
2.2.4 Zusammenfassung
3 Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
3.1 Objekte aus dem Chalkolithikum
3.2 Objekte aus der Frühbronzezeit
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
3.4 Zusammenfassung
4 Mehrköpfigkeit in der Bibel
4.1 Das Alte Testament
4.1.1 Das Buch Ezechiel
4.1.2 Das Buch Daniel
4.1.3 Psalm 74
4.1.4 Die syrische Pešitta
4.1.5 Zusammenfassung
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
4.2.1 Überlieferung
4.2.2 Interpretationen in der Forschung
4.2.3 Die siebenköpfige Schlange im Vorderen Orient
4.2.3.1 Mesopotamische Quellen
4.2.3.2 Ugaritische Quellen
4.2.3.3 Ägyptische Quellen
4.2.3.4 Syrische und koptische Quellen
4.2.4 Zusammenfassung
5 Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter
6 Résumé
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Indices
Götter und Wesen mit mehreren Gesichtern und Köpfen
Anzahl der Gesichter und Häupter
1. Quellen
2. Namen
3. Sachindex
Farbabbildungen
Citation preview
Ägypten und altes TestamenT 115 ÄAT 115 Theis • Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum
www.zaphon.de
Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum Christoffer Theis Zaphon
AeAT-115-Theis-Cover-1.indd 1
23.09.2022 12:28:17
Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum
Christoffer Theis
ÄGYPTEN UND ALTES TESTAMENT Studien zu Geschichte, Kultur und Religion Ägyptens und des Alten Testaments
Band 115
Gegründet von Manfred Görg Herausgegeben von Stefan Jakob Wimmer und Wolfgang Zwickel
Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum
Christoffer Theis
Zaphon Münster 2022
Illustration auf dem Einband: Elfenbeinrelief aus Megiddo, Chicago, OIM, A 22292. © Zeichnung: Rebekka-M. Müller.
Ägypten und Altes Testament, Band 115 Mehrköpfige Wesen in der Bibel und im syrisch-palästinischen Raum Christoffer Theis
© 2022 Zaphon, Enkingweg 36, Münster (www.zaphon.de) All rights reserved. Printed in Germany. Printed on acid-free paper. ISBN 978-3-96327-198-4 (Buch) ISBN 978-3-96327-199-1 (E-Book) ISSN 0720-9061
„Dise scheützliche sibenköpffige wasserschlang (…) soll im 1530. im Jenner gen Venedig gebracht/ und aldah gezeigt/ nachmalen dem König in Franckreych zuogeschickt und auff die sechstausend tugkaten geschetzt worden sey.“ Conrad GESSNER, Schlangenbuch 46rt.I
I
GESSNER 1589, 46rt.
Vorwort Bei der vorliegenden Monografie handelt es sich um eine erweiterte Fassung meiner Staatsexamensarbeit, die im Frühjahr 2018 an der Theologischen Fakultät der Ruprecht-KarlsUniversität Heidelberg eingereicht und von Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Oeming betreut wurde. Die Idee, sich mit diesem Thema im Rahmen einer Abschlussarbeit zu befassen, geht noch auf eine erste Skizze zu meiner Habilitationsschrift an der Ludwig-Maximilians-Universität München zurück. Nach meinem berufsbedingten Wechsel an die Universität Leipzig im Frühjahr 2019 erfolgte die Überarbeitung und Erweiterung der vorliegenden Arbeit ebenda. Seitdem wurde das Skript um neuerschienene Literatur und weitere Belegstellen ergänzt. Die Fertigstellung erfolgte neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit beim Freistaat Sachsen sowie meiner Stelle an der Universität Leipzig als Leiter des Projekts „Ägyptische Lehnwörter in altorientalischen Sprachen und dem Griechischen“, das durch die Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung gefördert und finanziert wird. Aufgrund der verschiedenen, zeitgleichen Tätigkeiten hat sich somit die Fertigstellung leider etwas verzögert. Forschungsarbeiten entstehen nie ohne die Unterstützung verschiedener Personen. An erster Stelle möchte ich Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred Oeming nennen. Ihm sei mein ganz besonderer Dank nicht nur für seine Betreuung dieser Arbeit, sondern auch für seine Förderung wie seine unermüdliche Unterstützung über viele Jahre in Heidelberg ausgesprochen. Für ihre kritische Durchsicht des Skripts danke ich Prof. Dr. Viktor Golinets und Dr. Elena Mahlich. Besonderer Dank gilt Rebekka-M. Müller, die die Zeichnungen anfertigte und damit die Arbeit immens bereicherte. Für ihre Hilfsbereitschaft bei Fragen zu verschiedenen Bereichen sei Prof. Dr. Viktor Golinets, Dr. Jörg Lippold, Dr. Elena Mahlich, Dr. Maximilian A. Räthel, PD Dr. Peter van der Veen und Dr. Patrick Wuchter herzlichst gedankt. PD Dr. Peter van der Veen sei für die Bereitstellung von Fotografien aus seiner eigenen Sammlung mein Dank ausgesprochen. Zu Dank verpflichtet bin ich den Herausgebern Herrn Prof. Dr. Stefan Jakob Wimmer und Herrn Prof. Dr. Wolfgang Zwickel für die Aufnahme meiner Arbeit in ihre Reihe Ägypten und Altes Testament. Herrn Dr. Kai Metzler sei für seine Hilfe bei Fragen zum Satz und zur Gestaltung der Arbeit hierzu mein Dank ausgesprochen. Für immerwährende Aufmunterungen und Unterstützung in jedweder Form, wenn man sie brauchte, sei meiner Oma Inge Elfriede gedankt – leider durfte Sie die Fertigstellung des Buchs nicht mehr erleben. Ihr sei dieses Werk gewidmet.
Christoffer Theis Leipzig, im Sommer 2022
Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................. 1 2 Grundlagen .............................................................................................................................. 4 2.1 Eingrenzung der Materialbasis und des Vergleichsmaterials ............................................ 5 2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität ........................................... 8 2.2.1 Ein Kopf mit mehreren Gesichtern ............................................................................. 9 2.2.2 Zwei Köpfe ............................................................................................................... 13 2.2.3 Drei Köpfe ................................................................................................................ 18 2.2.4 Zusammenfassung .................................................................................................... 20 3 Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum ............................................................... 24 3.1 Objekte aus dem Chalkolithikum ..................................................................................... 25 3.2 Objekte aus der Frühbronzezeit ....................................................................................... 28 3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend .................................. 32 3.4 Zusammenfassung............................................................................................................ 42 4 Mehrköpfigkeit in der Bibel ................................................................................................. 45 4.1 Das Alte Testament .......................................................................................................... 46 4.1.1 Das Buch Ezechiel .................................................................................................... 46 4.1.2 Das Buch Daniel ....................................................................................................... 61 4.1.3 Psalm 74 ................................................................................................................... 67 4.1.4 Die syrische Pešitta ................................................................................................... 69 4.1.5 Zusammenfassung .................................................................................................... 72 4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes ............. 74 4.2.1 Überlieferung ............................................................................................................ 75 4.2.2 Interpretationen in der Forschung ............................................................................. 77 4.2.3 Die siebenköpfige Schlange im Vorderen Orient ..................................................... 79 4.2.4 Zusammenfassung .................................................................................................... 91 5 Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter........................................ 93 6 Résumé ................................................................................................................................... 98
Literaturverzeichnis ................................................................................................................ 102 Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................ 130 Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................... 134 Indices ....................................................................................................................................... 135 Farbabbildungen ..................................................................................................................... 147
1 Einleitung Als Schnittstelle zwischen Ägypten, Mesopotamien und Anatolien spielte die Region der heutigen Staaten Israel, Jordanien, Libanon und Syrien in der Antike eine wichtige Rolle, aus der bereits seit dem Neolithikum archäologische Funde diverse Kultur- und Handelskontakte belegen.1 Speziell aus der Periode zwischen dem zweiten und ersten Jahrtausend nehmen die Funde und Befunde exorbitant zu. Die wohl hervorstechendste Fundgattung stellen Skarabäen mit verschiedensten Motiven dar.2 Die hier vorhandenen Darstellungen wurden in der Forschung bereits häufig auf ihre Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede hin untersucht. Doch spielte der syrisch-palästinische Bereich dabei, wenn man die Fundstücke aus Mesopotamien oder Ägypten vergleicht, in der Behandlung der Ikonografie oftmals eine eher vernachlässigte Rolle. Dass hier aber sehr viele Stücke mit einer hohen religionsgeschichtlichen Aussagekraft zu Tage getreten sind, die mit den umliegenden Kulturen kontextualisiert werden können, haben Silvia SCHROER und Othmar KEEL mit ihrer Reihe „Die Ikonographie Palästinas/Israels und der Alte Orient“ deutlich gezeigt.3 Stellt man sich ein über mehrere Köpfe verfügendes Wesen vor, werden dem biblisch vorgebildeten oder geprägten Individuum sicher zwei Passagen aus der Offenbarung des Johannes in den Sinn kommen, in denen von einer siebenköpfigen Schlange und einem siebenköpfigen Tier die Rede ist, die am Ende der Zeiten als Bedrohung Gottes erscheinen. Eher unbekannt dürfte hierbei aber die Tatsache sein, dass man für diese Wesen über ikonografische und textliche Referenzen eine Motivgeschichte herstellen kann,4 die klar verdeutlicht, dass sich der Schreiber der Offenbarung offenbar eines bekannten und recht alten Motivs im Vorderen Orient bediente. Durch die Zeiten hindurch ist dieses aus dem sumerischen Raum stammende Geschöpf, welches schon im dritten Jahrtausend v. Chr. einen Götterfeind darstellt, über die Offenbarung des Johannes bis in unsere heutige Zeit tradiert worden. Doch denkt man an Mehrköpfigkeit müssen nicht unbedingt mythologische oder biblische Inhalte in den Gedanken erscheinen, sondern es dürften auch Bilder von zweiköpfigen Tieren aus den Medien und Nachrichten in den Sinn kommen. Das Phänomen der Mehrköpfigkeit ist heutzutage noch immer präsent, zeigt sich aber bereits in vielfältiger Hinsicht in Texten und Darstellungen der verschiedenen ostzirkummediterranen Kulturen in der Antike wie in der Spätantike nach Christi Geburt. Betrachtet man Zusammenstellungen, wie z. B. Kataloge oder andere Materialsammlungen zu den betreffenden Regionen, wird deutlich, dass dem Phänomen der Mehrköpfigkeit oder Mehrgesichtigkeit im syrisch-palästinischen Bereich bisher nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Dies ist in den Altertumswissenschaften, den archäologischen Disziplinen und der theologischen Wissenschaft zu beobachten: Zwar liegen Darstellungen und Texte durchaus in einer sehr großen Menge über mehr als vier Jahrtausende aus unterschiedlichen Kulturen vor, doch wurde diese spezielle Erscheinungsform, sprich mehrere Köpfe oder mehrere Gesichter an einem einzigen Wesen, bisher nicht untersucht. Die bislang publizierten Quellen verdeutlichen, dass diese Erscheinungsformen von Göttern, Tieren und anderen Wesen in den Kulturen des östlichen Mittelmeerraums der Antike, die durch Statuen, Statuetten, Darstellungen auf Gemmen, Papyri, Reliefs, Tempelwänden und weiteren Bildträgern sowie beschreibende Texte belegt sind, ein interkulturelles Phänomen darstellen und sich in manchen 1
2 3 4
Siehe hierzu z. B. BEN-TOR 1998; 2003; 2004; 2007; 2011; COHEN 2002; SCHROER 2008, 15–21; 2011, 50–59; SCHROER u. KEEL 2005, 161–164; STREIT 2017; WEINSTEIN 1975, jeweils mit weiterführender Literatur. Hier sei nur auf die Zusammenstellungen des Materials von HERMANN 1998; 2003; 2004; 2007; 2011; KEEL 1995 verwiesen. Siehe SCHROER u. KEEL 2005, 11; SCHROER 2008; 2011. Siehe THEIS 2019; 2020; 2022.
2
1. Einleitung
Facetten zeitgleich in verschiedenen Kulturen greifen lassen. Die auf diese Weise abgebildeten oder beschriebenen Wesen konnten den verschiedensten Aufgaben gerecht werden und finden sich in der Welt der Götter wie der Menschen. Umso mehr erstaunt es, dass bisher eine Betrachtung der Mehrköpfigkeit in der Antike für die einzelnen Kulturen innerhalb der einzelnen Fachdisziplinen fehlt – dies ist nicht nur für den syrisch-palästinischen Raum der Fall, sondern diese Situation kann ebenso auf Ägypten und Mesopotamien ausgeweitet werden: Auch aus diesen Fachbereichen liegt bisher keine Zusammenstellung des Materials oder eine Betrachtung des Phänomens der Mehrköpfigkeit vor. Dass sich aufgrund vielfältiger transkultureller Phänomene wie auch motivgeschichtlicher Zusammenhänge und deutlicher Anklänge eine Betrachtung durchaus lohnt, wird in der vorliegenden Arbeit gezeigt. Im Folgenden soll eine quellennahe Untersuchung von mehrköpfigen Tieren und Göttern für den syrisch-palästinischen Raum der Antike durchgeführt werden, in der die derzeit vorliegenden ikonografischen und textlichen Belege gesammelt, untersucht und mit Vergleichsmaterial in Verbindung gesetzt werden. Die Darstellungen und Texte können ebenso zueinander in Verbindung gesetzt, aber auch mit vergleichbarem Material aus den Nachbarkulturen in Ägypten, Anatolien und Mesopotamien kontextualisiert werden. Eine Betrachtung der Quellen, welche die Mehrköpfigkeit oder Mehrgesichtigkeit bei Tier, Mensch und Gott überliefern, kann aufgrund der mannigfaltigen Parallelen einen Beitrag zur Religionsgeschichte der Region wie der Kontextualisierung selbiger mit anderen Kulturen liefern. In der vorliegenden Arbeit wird sich auf das Material aus dem syrisch-palästinischen Bereich beschränkt. Zwar werden vergleichbare Funde aus benachbarten Kulturen mit angesprochen, wenn sie einen Beitrag zur Motiv-, Überlieferungs- oder Tradierungsgeschichte liefern können, doch muss explizit darauf hingewiesen werden, dass keine Vollständigkeit für Quellen aus Ägypten oder Mesopotamien angestrebt wird. Sehr häufig zeigen sich zwar Parallelen bei verschiedenen Objekten oder Typen, doch sind diese Funde im Vergleich zu den syrisch-palästinischen Quellen chronologisch viel zu weit entfernt, als dass sich eine direkte Beeinflussung vertreten lassen würde. Aus diesem Grund sollen nur Quellen für die religionsgeschichtliche Betrachtung herangezogen werden, die aus demselben Zeitraum stammen und auch dieselben Charakteristika aufweisen. Speziell letztgenannter Punkt wurde in der Forschung sehr häufig nicht beachtet, was für manche der getroffenen Identifizierungen von Vorbildern für das Alte und das Neue Testament zu recht merkwürdigen Gleichungen geführt hat. Als Grundlage der Arbeit wird in Kapitel 2.1 dargelegt, wie die Eingrenzung des Materials und des Vergleichsmaterials aus anderen Kulturen erfolgte. Wie bereits erwähnt, liegen speziell aus Ägypten mehrköpfige oder mehrgesichtige Wesen in einer sehr großen Materialbasis vor. In der Sammlung des Autors konnten so etwa zweitausend Belege in Bild und Schrift zusammengetragen werden, die etwa von der Mitte des vierten Jahrtausends v. Chr. bis zum Ausklang der Antike reichen und deren Tradierung somit gut viertausend Jahre umfasst. Dementsprechend ist es unmöglich, in der vorliegenden Arbeit auf jede mögliche Parallele oder jedes Wesen einzugehen, welches an die Tiere und Götter aus dem syrisch-palästinischen Raum oder der Bibel erinnert. Aus diesem Grund musste eine Einschränkung des Materials auf verschiedene Weisen erfolgen. Eine weitere Grundlage bei der Beschäftigung mit Mehrköpfigkeit oder Mehrgesichtigkeit muss der Einbezug der realweltlichen Erscheinungen darstellen. Diese wird in Kapitel 2.2 geboten, wobei dieses Unterkapitel ebenfalls dafür genutzt wird, Definitionen für die einzelnen Erscheinungsformen darzulegen und für den Leser aufgearbeitet zusammenzufassen. Um eine Vorstellung vom Phänomen der Mehrköpfigkeit oder Mehrgesichtigkeit zu erhalten, wird der Untersuchung eine Abhandlung über diese Erscheinungen in der Realität vorangestellt, in der die verschiedenen Ausformungen mit medizinischen Termini beschrieben und anhand von real bezeugten Fehlbildungen erläutert werden. Bei der Begutachtung von medizinischen Fach-
1. Einleitung
3
publikationen stellt man fest, dass das Phänomen der Mehrköpfigkeit gar nicht so selten ist, wie man zuerst denken könnte – ebenfalls ist bei einer Durchsicht lateinischer und griechischer Autoren zu erkennen, dass mehrköpfige Tiere und Menschen offenbar einen beträchtlichen Eindruck hinterlassen haben, werden diese doch in vielen Quellen genannt und oftmals recht ausführlich und detailliert beschrieben. Aufgrund der Quellenlage wird mit den ikonografischen Belegen aus der Region der Levante in Kapitel 3 begonnen. Es ist ein interessantes Bild, dass mehrere Köpfe zuerst im unbeseelten Bereich erscheinen und erst hiernach auf ‚lebendige‘ Wesen übergegangen zu sein scheinen. Die ersten Zeugnisse für Objekte mit mehreren Köpfen bzw. der Kombination selbiger sind bereits aus dem Chalkolithikum bekannt und damit bereits einige tausend Jahre älter als die biblischen Texte. In den folgenden Jahrtausenden können immer wieder wenige bildliche Darstellungen von Göttern und Tieren im syrisch-palästinischen Raum beobachtet werden, doch liegen diese, was ihre Anzahl betrifft, deutlich hinter den Kulturen Ägyptens und Mesopotamiens zurück. Nichtsdestotrotz ergeben sich immer wieder erstaunliche Gemeinsamkeiten zu anderen Darstellungen und Darstellungstypen aus Afrika und Vorderasien. Textliche Referenzen aus dem ersten Jahrtausend liegen mehrheitlich aus der Bibel vor, wie sie in Kapitel 4.1 aufgeführt werden, diese können aber durchaus mit älterem Material aus der Region wie auch vergleichbaren Stücken aus anderen Kulturen in Verbindung gebracht werden. Speziell bei einer Untersuchung der mehrköpfigen Wesen aus dem Alten Testament, wie auch der syrischen Pešitta, können zum Vergleich immer wieder Gestalten aus Ägypten und Babylonien herangezogen werden. Bei manchen Wesen sind die Gemeinsamkeiten derart offensichtlich, dass man kaum von purem Zufall sprechen kann – vielmehr muss man von einer gegenseitigen Beeinflussung ausgehen. Doch nicht nur im Alten Testament liegen mehrköpfige Wesen vor, sondern auch in einer recht prominenten Stelle in der Offenbarung des Johannes werden, wie oben bereits erwähnt, Götterfeinde am Ende der Tage als Wesen mit sieben Köpfen beschrieben (Kap. 4.2). Diesen Entitäten, wie sie in Apokalypse 12, 3 und in 13, 1 f. erscheinen, wurde in der Forschung bereits recht viel Aufmerksamkeit zuteil, doch kann durch eine spezielle Betrachtung der Motivgeschichte deutlich herausgestellt werden, dass es sich bei diesen Götterfeinden nicht um eine Erfindung des Verfassers der Offenbarung handelt, sondern das diese spezielle Ausformung als der Götterfeind par excellence bereits seit dem dritten Jahrtausend in sumerischen Quellen nachweisbar ist. Es ist forschungs- wie motivgeschichtlich spannend, auch einen Blick auf die Überlieferung und/oder Tradierung von Mehrköpfigkeit im Mittelalter im speziellen Zusammenhang mit der Bibel oder vorgeblichen Feinden der Kirche zu werfen (Kap. 5). Hierdurch schließt sich der Kreis bis in die Neuzeit, was die Überlieferung mehrköpfiger Wesen aus dem syrisch-palästinischen Raum seit der Antike betrifft, die aber offenbar in manchen Fällen auf mesopotamische Vorbilder zurückgeführt werden können. In einem abschließenden Résumé (Kap. 6) werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungen geboten.
2 Grundlagen Darstellungen von Wesen, die mehr als einen Kopf aufweisen und dementsprechend aus dem natürlichen Raster bzw. dem Raster des Natürlichen herausfallen, sind seit dem vierten Jahrtausend v. Chr. verbreitet. Für die folgende Studie wird sich auf Fundstücke aus dem syrischpalästinischen Raum beschränkt. Vergleichbare Objekte oder Darstellungen aus den Nachbarkulturen Ägypten und Mesopotamien wie auch aus dem anatolischen Raum werden als Parallelen mit in die Betrachtung einfließen, sollten diese chronologisch nah zur betreffenden Quelle situiert sein oder aufgrund ihrer Verteilung offenbar weitere Verbreitung und Bekanntheit erlangt haben, so dass man in beiden Fällen von einer Beeinflussung ausgehen kann. Hierbei wird sich aufgrund der chronologischen und lokalen Nähe zur betreffenden Region auf den östlichen Mittelmeerraum der Antike beschränkt. Zwar sind Wesen mit mehreren Köpfen z. B. auch aus Afghanistan,1 Kerma,2 Luristan oder Oberitalien bekannt,3 doch bewegt man sich mit diesen Darstellungen in einem viel zu weit ausgedehnten zeitlichen wie geographischen Horizont. Speziell gilt dies für den Gott Janus, der für die Darstellungsweise des Janiceps namensgebend ist (Abbildung 63).4 So nennt Ovid in Fasti I, 655 und in Ex ponto IV, 23 den Gott Janus biceps.6 Mit Janus bzw. seiner Darstellung stehen auch andere Götter über diesen Typus in Verbindung. So zeigen die Gemmen Wien, Kunsthist. Mus., Inv. IX B 796 und Inv. IX B 1320 den Kopf der Africa, aus dessen Rückseite das Gesicht von Jupiter tritt.7 Durch Belege dieser Art wird aber lediglich deutlich, dass das Phänomen eines Janiceps kulturübergreifend bekannt war, woraus allerdings kaum weiterführende Schlüsse für die Religionsgeschichte eines spezifischen Raumes gezogen werden können. Es muss darauf hingewiesen werden, dass bei einer wie auch immer gearteten ‚Religionsgeschichte‘ lediglich ein Zugang oder ein Entwurf möglich ist,8 da durch die Zeiten hindurch zu viele Objekte und Texte verloren gegangen sind, als dass man ein umfassendes Bild entwickeln könnte.
1
2 3
4
5 6 7 8
Ein Axtkopf mit doppelköpfigem anthropomorphem Falken, heute New York, MMA, Harris Brisbane Dick Fund, James N. Spear and Schimmel Foundation, Inc. Gifts, 1982 (1982.5), siehe CAMPBELL 2014, 15; DORMAN 1987, 132 f.; MONTEBELLO 1992, 53 (Nr. 6); PITTMAN 1988, 35; und auch http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1982.5 [Zugriff am 22. Juli 2022]. Z. B. Elfenbein-Einlagen bei R. FISCHER 1980, 27, die einen zweiköpfigen Vogel zeigen. Z. B. der Anhänger in Form von zwei Widdern, die an ihrem Hinterkörper zusammengefügt wurden, publiziert bei SOTHEBY’S 1989, Nr. 426, etwa siebtes Jhd. v. Chr. Hingewiesen werden kann auch auf einen etruskischen Skarabäus, der einen knienden Gott mit drei Stierköpfen zeigt und sich heute in der Sammlung Vidoni befindet, siehe KIRFEL 1948, Tf. 40, Abb. 114. Z. B. der Kopf bei SOTHEBY’S 2011, Nr. 39, aus einer Privatsammlung in Connecticut; auf einer Gemme bei KING 1872, Tf. 50, 6 und G. M. RICHTER 1956, 86 (Nr. 379), Slg. King, Acc. No. 81.6.195; und einer Gemme bei SANDRAT VON STOCKAU 1680, Tf. c, Nr. 4. Lateinischer Text nach FRAZER 1989, 12 und BÖMER 1957, 62. Lateinischer Text nach WHEELER 1924, 436. Publiziert von ZWIERLEIN-DIEHL 1991, 130 (Nr. 2095 und 2097). Vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 11.
2.1 Eingrenzung der Materialbasis und des Vergleichsmaterials
5
2.1 Eingrenzung der Materialbasis und des Vergleichsmaterials Aus dem syrisch-palästinischen Raum der Antike sind nur wenige Belege für mehrköpfige Wesen oder für Gestalten mit mehreren Gesichtern erhalten geblieben, wobei dies generell für bildliche wie textliche Funde aus der Region zu konstatieren ist. Teilweise können Darstellungsweisen bzw. die betreffenden Vorstellungen auch nur durch Textfunde er- bzw. rückerschlossen werden, doch ist wohl durchaus davon auszugehen, dass einst auch diejenigen Wesen, die heute nur noch in Textquellen vorliegen, dargestellt oder abgebildet worden waren. In der vorliegenden Arbeit wird sich ausschließlich mit dem Phänomen von doppelt oder mehrfach vorkommenden Gesichtern und Köpfen an einem Leib befasst. Dieses Phänomen ist aus der realen Welt bekannt und findet sich bereits in der Antike in vielen Berichten von griechischen und lateinischen Autoren (Kap. 2.2), auf die diese spezielle Erscheinung bei Mensch und Tier offenbar einen gewissen Eindruck gemacht zu haben scheint. Abbildungen, die ein derartiges Merkmal aufweisen, liegen aus dem syrisch-palästinischen Raum wie auch aus Ägypten seit dem vierten Jahrtausend v. Chr. vor. Allerdings sind Texte, die dieses Merkmal benennen, erst seit etwa der Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. aus Syrien bekannt, was sich mit der Überlieferungssituation erklären lässt. Die frühesten Textzeugnisse stellen kurze Erwähnungen in ugaritischen Mythen dar. Ein spezielles Wesen kann dann durch die Zeiten hindurch bis in die Spätantike verfolgt werden (Kap. 4.2), und wurde auch noch im mittelalterlichen Europa dargestellt (Kap. 5). Da dieses siebenköpfige Geschöpf aus der Offenbarung des Johannes in Europa bis heute durch die Tradition der Bibel geläufig ist, sich aber ebenso auf frühen mesopotamischen Objekten nachweisen lässt, kann es als ein herausragendes Beispiel einer longue durée im östlichen Mittelmeerraum benannt werden. Eine wichtige Einschränkung der Materialbasis stellt dar, dass mehrere Gesichter oder Köpfe an einem Leib bzw. an einem Wesen dargestellt worden sein müssen, um als wirkliche Mehrköpfigkeit oder Mehrgesichtigkeit zu gelten. Dementsprechend wären als solche bezeichnete ‚Doppelwesen‘, die in Form des Ischiopagos oder Vergleichbarem abgebildet wurden, keine wirkliche Mehrköpfigkeit, wurden doch zwei Leiber mit jeweils einem Kopf abgebildet. Da es sich bei den Funden aber um recht frühe Darstellungen handelt, werden diese für die fortschreitende Entwicklung in Kapitel 3.1 mit angesprochen. Des Weiteren werden Attribute oder attributive Tiere nicht als eigene Köpfe betrachtet. Auch werden Anhänger, die zwei Tiere oder Götter Rücken an Rücken zusammengestellt zeigen, ausgeschlossen, da es sich hierbei um zwei Wesen und nicht nur um ein einziges handelt. Dies ist u. a. der Fall bei einer doppelten Stierprotome (Abbildung 64).9 Das Stück ist 5,1 × 3,4 × 2 Zentimeter groß und befindet sich heute in einer Privatsammlung in Süddeutschland. Es wird angenommen, dass dieses Objekt ursprünglich aus der Levante stammt.10 Anhänger, die in dieser Form ausgeführt wurden, sind aus dem Vorderen Orient in großer Anzahl bekannt und können verschiedene Tiere darstellen.11 Doch nicht nur ‚lebendige‘ Tiere oder Götter wurden in der Antike mit mehreren Köpfen versehen, sondern auch unbeseelte Prunkobjekte und Alltagsgegenstände, was speziell bei der Betrachtung von Objekten aus den frühen Epochen in Kapitel 3.1 von Bedeutung sein wird. 9 VAN DER VEEN 2015. 10 Vgl. VAN DER VEEN 2015, 235. 11 Z. B. die Amulette Kairo, Äg. Mus., CG 12362 bei REISNER 1907, 174, Tf. 21; CG 12361 ibd. 173, Tf. 21; CG 12617 bei id. 1958, 11, Tf. 2, 22; CG 12617 ibd. 11, Tf. 2, 22; London, BM, EA 57871, siehe https://www.britishmuseum.org/collection/object/Y_EA57871 [Zugriff am 22. Juli 2022]; London, U. C., E. 1 bei FLINDERS PETRIE 1914, 45, Tf. 39 (Nr. 220b); London, U. C., P. 6 ibd. 45, Tf. 39 (Nr. 220a). In Qantir wurde ein Model für Amulette in Form von Doppellöwen gefunden, welches sicher in die Zeit der 19.–20. Dynastie datiert werden kann, siehe HERRMANN 1985, 35 (Nr. 119); HERRMANN u. STAUBLI 2010, 92 (Nr. 8).
6
2. Grundlagen
Dies bedeutet, wenn ein zusätzlicher Kopf oder Köpfe an einem Objekt wie z. B. einem Altar erscheinen, werden diese Objekte nicht in der vorliegenden Arbeit betrachtet, da es sich um keine ‚lebendigen‘ Wesen handelt. Auf diese Beispiele wird in Ausnahmefällen referiert oder sie werden als Parallele herangezogen. Speziell aus Ägypten sind viele Gegenstände und Darstellungen erhalten geblieben, die mit zusätzlichen Köpfen ausgestattet worden sind. Objekte wie z. B. Kämme,12 Lampen,13 Nadeln,14 Ornamente,15 Platten,16 Schiffe,17 Schmuck,18 Stabaufsätze,19 Ständer20 oder Waffen21 wurden mit mehreren Köpfen oder Gesichtern gestaltet. Bei diesen Gegenständen handelt es sich aber aufgrund ihrer Gestaltung nicht um ‚Wesen‘ an sich, sondern um Objekte, an denen lediglich verschiedene Attribute kombiniert wurden. Als ein Beispiel aus Mesopotamien kann auf Doppellöwenkeulen verwiesen werden, wie sie z. B. auf Kudurru und anderen Objekten wie Siegeln (Abbildung 1) dargestellt wurden. So zeigen z. B. Berlin, Vorderas. Mus., VA 211 und VA 208 oder Berlin, Vorderas. Mus., VA Bab. 4375 diesen speziellen Keulentypus.22 Des Weiteren existieren Abbildungen, die Götter mit dreiköpfigen Szeptern zeigen.23 So ist aus der Gemdet Nasr-Zeit um 3000 v. Chr. ein Keulenkopf, heute New York, MMA, 1989.281.1, erhalten geblieben, der mit zwei antithetisch aufgesetzten
12 Z. B. die bei FLINDERS PETRIE 1920, Tf. 29 und QUIBELL 1904, Tf. 57 abgebildeten Stücke. 13 Z. B. Vatikanstadt, Mus. Greg. Eg., Inv. 15633 bei GRENIER 2002, 253 (Nr. 538). 14 Z. B. ein Stück aus Luristan, etwa 900 v. Chr., bei SOTHEBY’S 2014, Nr. 46; oder New York, MMA, 1989.281.21 bei MONTEBELLO 1992, 10 aus Urarṭu, etwa siebtes Jhd. v. Chr. Auffallend ist, dass sich zwar aus Urarṭu Gefäße mit mehreren Köpfen, wie z. B. Boston, MFA, 1981.654 (siehe SIMPSON 1987, 92 f.), erhalten haben, aber bisher kein Gott oder ein Mischwesen aus diesem Gebiet mit zwei Gesichtern oder Köpfen bekannt ist, siehe z. B. die Zusammenstellung von WARTKE 1998, 123–141. 15 Z. B. Leipzig, ÄMUL, Inv. 3792 bei WENIG 1978, 152 (Nr. 56) aus Nubien oder New York, TBM, Rogers Fund, 1954 (54.3.2) bei DORMAN 1987, 142 (Nr. 103) aus dem Iran. 16 Z. B. New York, MMA, 1986.322.2 bei MONTEBELLO 1992, 39 f. Das Stück stammt aus Griechenland und kann zwischen das sechste bis zweite Jhd. v. Chr. datiert werden. 17 Z. B. die Sonnenbarke im 1098. Spruch der Sargtexte bei BACKES 2005, Abb. 9; ein Papyrusnachen in der vierten Stunde des Amduat (Amd. 317) bei HORNUNG 1963, Tf. 4; die Sonnenbarke im aenigmatischen Bild im Grab Ramses’ VI. bei DARNELL 2004, Tf. 15; oder die Prozessionsbarke des Tempels von Dendara bei CAUVILLE 1998, Tf. 18. 18 Z. B. das Verschlusstück eines Menits aus Ägypten in einer Privatsammlung bei BRUNNER-TRAUT, BRUNNER u. ZICK-NISSEN 1984, 55 f.; Tübingen, ÄS, Inv.-Nr. 421 bei BRUNNER-TRAUT u. BRUNNER 1981, 69, Tf. 133; ein Stück aus Luristan mit zwei Löwenköpfen, siehe SOTHEBY’S 1978, Nr. 177; oder ein etruskisches Armband, Slg. Julien Gréau, Nr. 488 bei FROEHNER 1885, 99, Tf. 69. 19 Z. B. New York, TBM, Harris Brisbane Dick Fund, 1954 (54.3.4a,b) bei DORMAN 1987, 143 (Nr. 104) aus dem Iran sowie die Stücke bei SOTHEBY’S 1989, Nr. 27 und 2014, Nr. 46 aus Luristan. 20 Z. B. Slg. Norbert Schimmel, Nr. 12, publiziert von SETTGAST 1978, Nr. 114. Datiert wird das 25,2 Zentimeter breite Objekt bereits in das Neolithikum in Anatolien und könnte als Ständer für ein Gefäß gedient haben. 21 Z. B. New York, TBM, Joseph Pulitzer Bequest, 1955 (55.137.5) bei DORMAN 1987, 117 (Nr. 82) aus Anatolien; die Axt von Šarkišlar, heute Berlin, Staatl. Mus., Inv.-Nr. VA 15652 bei EMRE 2002, 225, 355 (Nr. 147); oder ein Axtkopf aus Luristan bei SOTHEBY’S 1989, Nr. 140, der mit vier Köpfen geschmückt ist. 22 SEIDL 1989, 40 f., 57 f. und speziell 157–161; generell zum Objekt POMPONIO 1973. So auch auf einem Reliefbruchstück aus Nippur aus dem 13. Jhd. v. Chr. bei OPIFICIUS 1961, 100 (Nr. 335). Ebenso stellt dies ein beliebtes Element auf Siegeln dar, siehe z. B. die Abrollung bei BLOCHER 1992, 89 (Nr. 266); vgl. auch die Nennung eines Szepters mit zwei Köpfen in Berlin, Vorderas. Mus., VAT 10057, Rs. 11 bei LIVINGSTONE 1989, 72. Siegelabrollungen mit diesem Element liegen z. B. bei COLBOW 1991, 151 f., 155–159, 168–170 vor. 23 Siehe die Literatur bei WIGGERMANN 1997b, 36, Anm. 29.
2.1 Eingrenzung der Materialbasis und des Vergleichsmaterials
7
Stierköpfen geschmückt ist.24 Von der Kreation einer Keule mit einem dreiköpfigen Löwen berichtet Gudea auf seiner Statuette B, Kol. VI, 31 und 36.25
Abbildung 1: Gott mit Doppellöwenkeule, Siegel Bagdad, IM 15218
Die aufgeführten Beispiele zeigen deutlich, dass der Ausstattung eines Objekts mit mehreren Köpfen in antiken Kulturen eine gewisse Verbreitung und offensichtlich auch eine Bedeutung zukam, die sich wohl am ehesten mit einer Übernahme der dem Kopf inhärenten Macht erklären lässt. Die verschiedensten Objektgattungen sind aus praktisch allen Kulturen und Gebieten des östlichen Mittelmeerraums der Antike bekannt, so dass die Ausstattung mit multiplen Köpfen definitiv ein transkulturelles Phänomen darstellt. Das Material wird, wie oben beschrieben, auf mehrere Köpfe am Leib eines Wesens eingeschränkt. Ausgeklammert werden somit: -
Masken, die klar als solche zu erkennen sind Mehrere Köpfe ohne Leib Mischwesen, die nur einen Kopf aufweisen Köpfe an Objekten, die keinen menschlichen oder tierischen Leib aufweisen (wie z. B. Köpfe an einer Sonnenscheibe; Altäre, Gefäße, etc.)
Als ein Beispiel, wie ein vorschneller Blick Mehrköpfigkeit suggerieren kann, die aber nicht existiert, kann das Siegel Boston, MFA, 65.1413 genannt werden (Abbildung 2).26 Auf diesem Siegel wurde ein sitzender Gott dargestellt, aus dessen Schurz fünf Schlangenköpfe herauszukommen scheinen. Bei einer genaueren Betrachtung zeigen sich aber unter und hinter dem Thron des Gottes noch fünf Schlangenkörper, so dass die Reptilien sich offensichtlich nur hinter dem Thron schlängeln, aber kein essentieller Bestandteil des Gottes oder der Sitzfläche sind. Es handelt sich somit nicht um einen mehrköpfigen Gott.
24 Publiziert von MONTEBELLO 1992, 54 (Nr. 11) und SETTGAST 1978, Nr. 120; ex-Slg. Norbert Schimmel, Nr. 111. 25 Publiziert von EDZARD 1997, 34. Dass solche Waffen real existierten, beweisen ihre Nennungen als Kultgaben, vgl. id. 1980, 579. 26 Publiziert von WIGGERMANN 1997b, 38, 52, Abb. 3c, 6a.
8
2. Grundlagen
Abbildung 2: Darstellung von sieben Schlangen auf Siegel Boston, MFA, 65.1413
Die Datierungen und Bezeichnungen der verschiedenen Epochen, aus denen Funde für mehrköpfige Wesen vorliegen, richten sich nach den Angaben bei Silvia SCHROER und Othmar KEEL.27 Das Chalkolithikum als erste Epoche mit betreffenden Funden beginnt um 4500 v. Chr. und wird 3600 v. Chr. vom Spätchalkolithikum abgelöst.28 Die Frühbronzezeit I umfasst den Zeitraum von 3500–3000 v. Chr., worauf die Frühbronzezeit II bis 2700 v. Chr., die Frühbronzezeit III bis 2300 v. Chr. und die Frühbronzezeit IV bis 1950 v. Chr. folgt. Letztgenannte Epoche entspricht bereits der Mittleren Bronzezeit I. Es folgt bis 1700 v. Chr. die Mittlere Bronzezeit IIA und bis 1550 v. Chr. die Mittlere Bronzezeit IIB. Gleichzeitig mit dem Beginn des Neuen Reiches in Ägypten beginnt in Syrien-Palästina um 1550 v. Chr. die Spätbronzezeit I, auf die sich zwischen 1400 und 1300 v. Chr. die Spätbronzezeit IIA und zwischen 1300 und 1150 v. Chr. die Spätbronzezeit IIB anschließen. Es folgt die Eisenzeit I bis zum ausgehenden 10. oder dem beginnenden 9. Jahrhundert v. Chr., sowie die Eisenzeit II bis 539 v. Chr.29 2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität Das Phänomen der Mehrköpfigkeit und der Mehrgesichtigkeit umfasst mehrere Bereiche, die sich durch verschiedene Aspekte voneinander unterscheiden.30 Mit diesen Arten der Missbildungen beschäftigt sich die Lehre der Teratologie; durch medizinische Erkenntnisse können die verschiedenen Fehlbildungen heute erklärt werden. Wenn es sich im menschlichen Bereich um siamesische Zwillinge handelt, müssen diese immer monozygotischen Ursprungs sein, d. h. eine unvollständige Spaltung der Eizelle muss um
27 SCHROER u. KEEL 2005, 49.103.155; SCHROER 2008, 9; 2011, 10. Für Ägypten sei hier auf HORNUNG, KRAUSS u. WARBURTON 2006 und TASSIE 2014, 424 f. verwiesen. Es ergibt sich in Syrien-Palästina eine größere Lücke zwischen dem keramischen Neolithikum, das etwa um 6000–5000 v. Chr. (cal. 6400–5800) angesiedelt werden kann, und dem Beginn des Chalkolithikums um 4500 v. Chr., vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 49, 103. 28 Die vorhergehenden Epochen des PPNA von 9400–8800 v. Chr., PPNB von 8800–7000 v. Chr. und PPNC von 7000–6400 v. Chr. weisen keine in Frage kommenden Funde auf; vgl. die Daten bei SCHROER u. KEEL 2005, 49. 29 Vgl. JERICKE 2015, § 2.1 f.; ZWINGENBERGER 2007, § 2. 30 Zu den verschiedenen Aspekten und Bezeichnungen sei auf VON GRÄFE, VON HUFELAND u. BUSCH 1840, 49–66; GURLT 1832; JAGGARD 1898, 922–938 und PSCHYREMBEL 2014 verwiesen.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
9
den 14. Tag nach der Befruchtung geschehen sein.31 Es ist darauf hinzuweisen, dass siamesische Zwillinge nicht wirklich ‚zusammengewachsen‘ oder ‚verwachsen‘ sind, da sie in ihren Anlagen nie wirklich voneinander separiert waren. Die Prozentzahl des Anteils von Zwillingen wie auch von siamesischen Zwillingen an der Zahl der Gesamtgeburten dürfte in der Antike im Vergleich zu heutigen Zahlen nicht anders zu bewerten sein, nimmt man rein natürliche Vorgänge als Grundlage. Doch sind die Überlebenschancen für Zwei- und Mehrfachgeburten aufgrund des geringeren Geburtsgewichts der einzelnen Säuglinge auf jeden Fall schlechter, so dass der reale Prozentsatz von Zwillingen oder Drillingen an der Gesamtbevölkerung in der Antike wohl etwas geringer als heute gewesen sein dürfte. Nach der Hellin-Regel liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für Drillinge bei 1:852, für Vierlinge bei 1:853 und für Fünflinge bei 1:854. Das bedeutet, dass auf etwa 600.000 Geburten eine Vierlingsgeburt wahrscheinlich ist, eine Geburt von Fünflingen aber nur unter etwa 50.000.000 Geburten zu erwarten ist.32 Die Häufigkeit von siamesischen Zwillingen wird mit etwa eins zu 500.000 bis einer Million Geburten angegeben.33 Unter Bezugnahme zur Hellin-Regel und dem Verweis auf die statistische Wahrscheinlichkeit eines dikephalen Zwillings wird ein trikephaler Drilling statistisch somit recht unwahrscheinlich. Doch zeigen die realiter bezeugten Beispiele sehr deutlich, dass diese Phänomene nicht nur für die Neuzeit sondern ebenso für die Antike anzunehmen sind. Es muss darauf hingewiesen werden, dass trotz der geringen Wahrscheinlichkeit durchaus Häufungen in einem relativ kleinen zeitlichen wie lokalen Raum auftreten können, wie es medizinisch belegt ist.34 Hingewiesen sei hier nur auf einen besonderen Beleg, in dem über eine Bauersfrau berichtet wird, die „16 mal Zwillinge, siebenmal Drillinge und viermal Vierlinge“35 bekommen haben soll. Im Folgenden sollen die für die vorliegende Arbeit als Grundlage zu betrachtenden Phänomene bei Menschen und Tieren betrachtet und beschrieben werden. Es werden nur diejenigen Beobachtungen aus der Natur erwähnt, die mit den im syrisch-palästinischen Bereich vorhandenen Funden in Verbindung zu bringen sind. Anhand dieser sollen die betreffenden medizinischen Fachtermini eingeführt werden, um die verschiedenen Ausprägungen von mehrköpfigen und mehrgesichtigen Wesen zu verdeutlichen.
2.2.1 Ein Kopf mit mehreren Gesichtern Der einfachste Typus besteht aus einem Kopf, der zwei Gesichter aufweist. Es handelt sich hierbei um eine kraniofaziale Vervielfältigung des Gesichts, die auch als Doppelgesicht, Dicranus oder Diprosopos – abgeleitet vom griechischen διπρόσωπος – bezeichnet wird.36 Hierbei handelt es sich nicht um eine Missbildung bei Zwillingen, sondern um die Vervielfältigung des 31 Vgl. KARCHER 1975, 85–90 und RATHMAYR 2000, 85. 32 Hierzu sei nur auf GEDDA 1961, 52–61 und den Beitrag von KULKARNI et al. 2013 verwiesen (hier allerdings nur eine Betrachtung für die Vereinigten Staaten von Amerika). Zur statistischen Wahrscheinlichkeit von Mehrfachgeburten und Zwillingen im Tierreich GEDDA 1961, 37–51. 33 Vgl. BONDESON 2004, 183. 34 Siehe BHETTAY, NELSON u. BEIGHTON 1975, 741–743 und für die Häufung von ‚normalen‘ Zwillingen GEDDA 1961, 57 und RATHMAYR 2000, 67. Eine Zusammenstellung von Lebend- und Totgeburten liegt bei MILHAM 1966, 644 f. vor. 35 KARCHER 1975, 147f. und RATHMAYR 2000, 67. Man vergleiche auch die Berichte bei Aristoteles, Historia animalium VII, 4 (584a) bei BALME 2002, 482 und Plinius, Naturalis Historia VII, 3 bei RACKHAM 1989, 528. 36 Zu Unterscheidungen und Beispielen FIRST u. PIERSOL 1891a, 147–150; GILBERT-BARNESS u. DEBICH-SPICER 2004, 628; GURLT 1832, 40 und JAGGARD 1898, 926. Das genaue Gegenteil, nämlich Wesen, die ohne Kopf geboren wurden, hat bereits ELBEN 1821 gesammelt. So berichtet auch Conrad Lykosthenes, dass im Mai 1525 ein Kind ohne Kopf geboren worden sei, siehe TIEDEMANN 1813, 7.
10
2. Grundlagen
Gesichts bei einem Individuum. Diese Fehlbildung wird durch ein Übermaß des Proteins Sonic Hedgehog in einem frühen Stadium der Schwangerschaft ausgelöst.37 Die Vervielfältigung des Gesichts ist genauer zu differenzieren nach Diprosopos iniodymos, bei dem zwischen beiden Gesichtern ein breiterer Abstand besteht und bei beiden alle Knochen zweimal vorhanden sind; und opodymos, bei dem die zwei mittleren Augen bereits aneinanderstoßen.38 Kann dieses Phänomen in der Natur neben der gesamten Vervielfältigung des Gesichts auch nur teilweise auftreten, d. h. die Nase oder ein weiteres Auge erscheinen,39 weisen die Abbildungen aus der Antike immer eine saubere Differenzierung der Gesichter auf – ein Phänomen des Diprosopos opodymos ist nicht belegt und würde dem göttlichen Wesen der Darstellungen direkt widersprechen. Dies bedeutet, dass doppelgesichtige Wesen immer zwei vollständig ausgeformte Gesichter zeigen. Für menschliche Säuglinge sind die Überlebenschancen mit der Fehlbildung Diprosopos nicht sehr groß, wobei ein beträchtlicher Prozentsatz bereits tot geboren wird.40 Dass es solche extremen Fälle wirklich gegeben hat, belegt die medizinische Literatur beispielsweise mit einem Bericht über einen Mann mit vier Augen.41 Belege für diese Art der Missbildung liegen auch in mesopotamischen Omina vor, wie z. B. in Šumma izbu, Tf. V, 68 über die Geburt eines Löwen mit zwei Mündern berichtet wird.42 Die Anomalie eines Triprosopos, sprich drei Gesichter an einem Haupt, konnte bisher für einen Menschen nicht nachgewiesen werden und ist in der Natur nur einmal bei einem Schaf dokumentiert worden.43 Einen Triprosopos im mythologischen Bereich, bei dem beide Augen des Hauptgesichtes mit den Augen der Nebengesichter zusammengefallen sind, zeigt ein Gott auf dem gallo-keltischen Altar aus Reims.44 Direkt zu differenzieren ist dies vom κύκλωψ, dem „Kreisäugigen“, der unter der gängigen Bezeichnung Zyklop bekannt ist, da bei dieser Fehlbildung beide Augen in einer knöchernen Augenhöhle liegen.45 Dies findet sich in der Mythologie z. B. bei Hesiod, Theogonia 139–141; 144 f. und 501–50346 sowie bei Nonnos von Panopolis, Dionysiaca XIV, 52 f.47 Der bekannteste Zyklop dürfte wohl Polyphemos aus der Odyssee sein (Abbildung 3). Es wird davon ausgegangen, dass Elefantenschädel (Abbildung 4) als Inspirationsquelle für antike Zyklopenmythen dienten.48 Auch in der mesopotamischen Kunst finden sich Zyklopen, wie auf einer Plakette aus
37 Vgl. YOUNG et al. 2000, 308–313. 38 Vgl. z. B. VON GRÄFE, VON HUFELAND u. BUSCH 1840, 49–51; JAGGARD 1898, 926, Abb. 1 f.; KASTENBAUM et al. 2009; so bereits abgebildet bei LYKOSTHENES 1557, 8. Dies kann soweit gehen, dass beide Gesichter siamesischer Zwillinge praktisch ineinander übergehen, siehe die Beschreibung von SCHWINK 1884 und bereits aus dem Jahr 1665 n. Chr. von LICETUS 1665, 89 f.; vergleichbar ist auch der von RODRÍGUEZ-MORALES, CORREA-RIVAS u. COLÓN-CASTILLO 2002 beschriebene Fall. 39 Siehe z. B. die bei AMR u. HAMMOURI 1995, 79 f. und WU et al. 2002, 283 genannte Literatur. 40 Über einen zwölf Monate alten Säugling mit Diprosopos wurde bei HÄHNEL et al. 2003, 210–213 berichtet. 41 Vgl. den Fall bei GOULD u. PYLE 1898, 258 f. 42 LEICHTY 1970, 79. 43 Siehe FÖRSTER 1865, 110. LIDDELL u. SCOTT 1961, 1822 führen zumindest zwei Quellen für die Antike auf. 44 Siehe KIRFEL 1948, Tf. 48, Abb. 139. 45 Beispiele aus der Natur bei GOULD u. PYLE 1898, 258 und SHOJAEI et al. 2006, 463. 46 SOLMSEN, MERKELBACH u. WEST 1990, 11, 26 und VON SCHIRNDING 2012, 16, 42. 47 GERLAUD 1994, 26. Vgl. hierzu auch Euripides, Cyclops 79 sowie weitere Stellen bei ROSCHER 1886–1890, 1677. 48 Vgl. z. B. MAYOR 2001, 35. Die Fehlbildung eines Cyclokephalos ist auch bei menschlichen Kindern belegt, siehe die Berichte bei FIRST u. PIERSOL 1891b, 114, Tf. 23 oder LICETUS 1665, 133–135.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
11
Hafagi, wobei es sich bei dem dargestellten Wesen offenbar um einen Götterfeind handelt, der gerade von Marduk mit einem Messer getötet wird.49
Abbildung 3: Kopf des Polyphemos, wohl 2. Jhd. v. Chr.
Abbildung 4: Zeichnung eines Elefantenschädels
Eine dem Diprosopos vergleichbare Missbildung ist der Janiceps, bei dem es sich eigentlich um zwei Individuen handelt, die an ihrem Hinterkopf verbunden sind.50 Auch dieses Phänomen kann dem Diprosopos vergleichbar nach Janiceps asymmetros und Janiceps symmetros unterteilt werden.51 In der Ausformung symmetros besteht zwischen beiden Gesichtern ein breiterer Abstand, sie sind am Hinterhauptsbein verbunden, womit alle Knochen doppelt vorhanden sind. In der Form asymmetros können die beiden mittleren Augen bereits aneinanderstoßen, da die Verbindung der beiden Köpfe vom Hinterhauptsbein bis zu den Jochbeinen geht und durchaus auch ‚schief‘ vorliegen kann. Die Missbildung tritt neben Katzen, die als Januskatzen bezeichnet werden, auch bei anderen Tieren wie z. B. Ratten52 und Schweinen53 auf. In wenigen Fällen ist auch bei menschlichen Neugeborenen die Missbildung Janiceps belegt.54 Die aus der Neuzeit bekannten Kinder mit der Fehlbildung Janiceps, die längere Zeit überlebt haben, lassen ebenso nur eine geringe Überlebenschance für die Antike vermuten. Die 49 Siehe die Abbildung bei GRAFMAN 1972, 48. 50 Zur Definition siehe z. B. GILBERT-BARNESS u. DEBICH-SPICER 2004, 632 – per definitionem wären damit viele der zweidimensionalen Darstellungen des Gottes Janus (Abbildung 63) kein Janiceps sondern ein Diprosopos. Eine Beschreibung des bei einem Menschen auftretenden Phänomens bietet RÜHE 1894. 51 Siehe z. B. die Beschreibungen von CHEN et al. 1997; SITZINSKY 1899 und KHANNA, PUNGAVKAR u. PATKAR 2005 bei einem Menschen. Desgleichen ist auch die Missbildung des Janiceps monosymmetros belegt, bei der nur auf einer Seite der verbundenen Häupter ein Gesicht erscheint, siehe z. B. die Fälle bei HOVORAKOVA et al. 2008 und SINGH, SINGH u. SHALIGRAM 2003. 52 Z. B. HARRIS u. GOLDENTHAL 1977. 53 Z. B. LEROI 2005, 78. 54 Hierzu FIRST u. PIERSOL 1891b, 172 und JAGGARD 1898, 935, Abb. 16.
12
2. Grundlagen
Doppelgesichtigkeit in Form des Diprosopos wie des Janiceps mancher Gottheiten könnte sich vielleicht aus einem bei einem Menschen oder bei einem Tier zu beobachtenden Geburtsfehler erklären lassen, aus dem dann eine Art der Vergöttlichung entstand.55 Oftmals wird in der griechischen Mythologie der Vater von dergestaltigen Zwillingen als ein Gott beschrieben.56 Zwar handelt es sich damit um Sagen und Legenden, doch zeigt das wiederkehrende Motiv, dass ein göttlicher Ursprung des Kindes in der Antike für möglich gehalten wurde. Wenn es sich um die Verbindung von Menschen handelt, wäre auch hier die vom Vater ausgehende Vergöttlichung anzunehmen. Doch muss auch darauf hingewiesen werden, dass durchaus auch die Tötung von unter dieser Fehlbildung leidenden Zwillingen in der Antike – wie noch in der Neuzeit – belegt ist,57 was bedeutet, dass Anomalien in der menschlichen oder tierischen Anatomie nicht immer als ein gutes Omen betrachtet wurden.58 So sollte nach Lykurgos von Sparta, wie es Plutarch, Lykurgos XVI, 1 überliefert, der Staat das Recht haben zu entscheiden, ob Kinder mit Missbildungen leben dürfen.59 Bereits in mesopotamischen Omina der Serie Šumma izbu ist dies zu beobachten, wobei hier nur das Omen für die Missbildung eines Janiceps oder eines Diprosopos in Tf. I, 74 genannt werden soll: šumma sinništu usumia ūlid šar kiššati palûšu inakkir „Wenn eine Frau ein Kind mit zwei Gesichtern gebiert, dann wird sich die Herrschaft des Königs der Welt verändern.“60 Die Abbildungen aus dem antiken Vorderen Orient weisen immer eine saubere Differenzierung der Gesichter auf; der Janiceps asymmetros61 ist nicht belegt und würde dem göttlichen Wesen der Darstellungen wohl widersprechen. Bisher liegen keine Belege dafür vor, dass ein doppelgesichtiges Wesen im östlichen Mittelmeerraum der Antike direkt mit einem Menschen assoziert wurde. Aufgrund der Definition der beiden Erscheinungsformen – Diprosopos und Janiceps – wären Götter mit zwei Gesichtern derart zu unterteilen, dass wenn ein Gott zwei Gesichter hat, dieser als Diprosopos angesprochen werden sollte;62 wenn aber zwei Götter am Kopf verbunden sind und über zwei Gesichter verfügen, es sich um einen Janiceps handelt.
55 So wurde die am 10. März 2008 im Dorf Sanai Sampūra in Indien geborene Lali Singh nach einem Beitrag von NICK SCHIFRIN in den abc-News unter http://abcnews.go.com/Health/Story?id=4549608 &page=1#.T2T0zdlyaM8 [Zugriff am 22. Juli 2022] als eine Inkarnation des Gottes Ganeša verehrt. 56 Siehe die Belege bei RATHMAYR 2000, 5–15, 24–28, 39 und DASEN 1997, 51–56. 57 Siehe NEUMANN 1992, 216 und RATHMAYR 2000, 16–23. Als Beispiele werden z. B. die Pygmäen, der Stamm der Kratyi in Togo, der Efiks und der Ibibio in Nigeria genannt. 58 Diese Diskrepanz wird z. B. in der mesopotamischen Omenserie Šumma ālu ina mēlê šakin deutlich. Weibliche Drillinge wurden nach Tf. I, 101 und 114 f. als positives Omen für den Prinzen sowie das Land gewertet, während männliche Drillinge nach Tf. I, 104 schlechte Zeichen für das Land bringen, siehe LEICHTY 1970, 42. Dahingegen sind männliche Vierlinge nach Tf. I, 116 wieder ein gutes Zeichen für das eigene Land, da das Land des Gegners Zerstörung erfahren wird, doch nach Tf. I, 117 auch ein schlechtes Zeichen, wenn sie überleben, siehe ibd., 43. 59 Siehe KESSLER 1910, 73 f.; generell zu Lykurgos THOMMEN 2003, 31–34. 60 LEICHTY 1970, 38 und DE ZORZI 2014, 358. 61 Siehe z. B. die Beschreibung von RÜHE 1894 bei einem Menschen. 62 So liegt z. B. in der Oase Dachla im Grab des P#-d+-B#Èt.t ein typischer Diprosopos während der Römerzeit vor; siehe die Abbildung bei VENIT 2016, 159.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
13
2.2.2 Zwei Köpfe Eine andere Erscheinung ist die Dikephalie, bei der an oder auf einem Rumpf zwei Köpfe je eines Individuums vorhanden sind. Unterschieden werden kann die reine Doppelköpfigkeit in Dikephalos monauchenos und Dikephalos diauchenos.63 Im ersten Fall sind zwei Köpfe auf einem Hals, im zweiten auf zwei verschiedenen Hälsen vorhanden, die aus der Oberseite des Rumpfes hervortreten. Es handelt sich um eine spezielle Form der siamesischen Zwillinge, bei denen noch Ansätze von zwei verschiedenen oberen Rumpfteilen vorhanden sein können, wie z. B. ein zweites Armpaar.64 Für diese Art der unvollständigen Fötenteilung im Mutterleib existieren aus der Neuzeit einige Belege von etwa normal langen Lebensspannen im Gegensatz zu Wesen mit Diprosopos.65 Zwar versterben viele dikephale siamesische Zwillinge bereits im Säuglingsalter,66 doch überlebten auch einige dokumentierte Fälle mehrere Jahre.67 Einer der frühesten bekannten Fälle einer symmetrischen Fehlbildung ist durch Mary und Eliza Chulkhurst (1100–1134 n. Chr.) aus England bekannt.68 Die beiden Frauen sind heute sogar eines der Wahrzeichen der Gemeinde Biddenden in Kent (Abbildung 65), in dem sie geboren wurden. Eines der geläufigsten Beispiele dürften Giovanni Battista und Giacomo Tocci sein, die am 4. Oktober 1877 n. Chr. als Dikephalos diauchenos mit vier Armen geboren wurden und im Jahr 1912 wohl noch am Leben waren.69 Das Phänomen tritt in den verschiedenen Ausformungen – d. h. bei den verschiedensten Missbildungen bei Zwillingen – ebenso bei Tieren auf: so sind z. B. dikephale Delfine,70 Eidechsen,71 Gorillas,72 Katzen,73 Rhesusäffchen,74 Rinder,75 Schafe,76 Schlangen,77 Schild-
63 Vgl. FIRST u. PIERSOL 1891b, 1 f., Tf. 30 f. sowie z. B. die Fälle bei ESENKAYA, GÜRBÜZ u. YALTI 2004; ROSENTHAL 1916 und VESTERGAARD 1972. 64 Einige Belege hierzu sind bei BONDESON 2000, 207 f.; JAGGARD 1898, 930 und auch LICETUS 1665, 296–298, 336 zu finden. Die für den Fall der „siamesischen Zwillinge“ namengebenden Geschwister Chang und Eng Bunker (1811–1874 n. Chr.) waren nur an ihren Oberkörpern verbunden, so dass jeder zwei Beine besaß. Ihre Fehlbildung wird bereits von VIRCHOW 1870 beschrieben; Allgemeines hierzu bei SPENCER 2003, 58–63. 65 Belege für diese Art Missbildung nennt JAGGARD 1898, 928 f. sowie die Zusammenstellung von BATES 2002, 522 f. allein für das 16. Jhd. n. Chr. 66 Siehe BONDESON 2000, 222–226; 2004, 163–173; GOULD u. PYLE 1898, 185 f. und LEROI 2005, 25– 27; weitere Literatur zu dokumentierten Fällen bei FIRST u. PIERSOL 1891b, 212. 67 Siehe BONDESON 2000, 162–165.211–215.226–234; 2004, 173–182 und GOULD u. PYLE 1898, 186 für Beispiele. 68 Siehe hierzu BONDESON 1992, 217–221; 2000, 189–202; 2004, 141–159 und GOULD u. PYLE 1898, 174–176. 69 Siehe BONDESON 2000, 211–215, 226–234; 2004, 173–182 und GOULD u. PYLE 1898, 186. 70 Z. B. KOMPANJE 2005 und AYTEMIZ et al. 2014. 71 Z. B. BROADLEY 1975, 8. 72 Z. B. LANGER et al. 2014. 73 Z. B. CAMON et al. 1992. 74 Z. B. BOLK 1926. 75 So z. B. BUCK et al. 2009; CHAUDHARI et al. 2010; GÜLBAHAR et al. 2005; GURLT 1832, 43 f.; KRAUSE u. TILLMANNS 1937; MADARAME, TAKAI u. ITO 1994; MOINODDIN et al. 2012; ÜNVER, KILINÇ u. ÖZYURTLU 2007; und die Zusammenfassung von DROMMER 1967. Dies wurde bereits von LICETUS 1665, 17 beschrieben. Fälle von Diprosopos liegen bei NAK et al. 2011; SINGH et al. 2011; 2013 und SHARMA, SHARMA u. VASISHTA 2010 dokumentiert vor. 76 Z. B. GURLT 1832, 21, 43 f. und MONFARED, NAVARD u. SHEIBANI 2013. 77 So z. B. DE ALBUQUERQUE, PIATTI u. WALLACH 2013; DE ALBUQUERQUE et al. 1989–1994; BROADLEY 1975, 8; WALLACH 2012.
14
2. Grundlagen
kröten,78 Schweine,79 Ziegen80 und sogar Haie81 belegt.82 Von diesen Tieren haben einige für eine längere Zeit überlebt. Das älteste bisher bekannte Zeugnis für Dikephalie liegt mit einem Fossil eines Hyphalosaurus lingyuanensis bereits aus der Unterkreide und hier der Stufe Aptium um 122 Millionen Jahre vor unserer Zeit vor (Abbildung 5).83
Abbildung 5: Umzeichnung des Fossils des Hyphalosaurus lingyuanensis
Viele derartige Lebewesen wurden der Überlieferung als würdig erachtet. Von einem zweiköpfigen Lamm, das in Ateste geboren wurde (agnus biceps natus Ateste), weiß Iulius Obsequens, Liber prodigiorum L zu berichten, der die Geburt in das Konsulat von L. Crassus und Q. Scaevola datiert.84 Auch nennt er in Liber prodigiorum XXXI ein zweiköpfiges Kalb in Satura (Saturae vitulus biceps natus). Livius, Ab urbe condita XXXII, 29 nennt ein zweiköpfiges Lamm mit fünf Beinen, welches in Aefula geboren wurde (Aefulae agnus biceps cum quinque pedibus natus).85 Des Weiteren nennt er ein Schwein mit zwei Köpfen aus Caere (Caere porcus biceps (…) natus erat) in XXVIII, 11.86 Von einem besonderen Tier aus Ägypten, dass mehrere Köpfe besaß, weiß Claudius Aelianus, De natura animalium XII, 3 zu berichten: Λέγουσιν Αἰγύπτιοι (…) δέ οὖν ἄρνα καὶ ὀκτάπουν καὶ δίκερκον κατὰ τὸν Βόκχωριν τὸν ᾀδόμενον ἐκεῖνον γενέσθαι καὶ ῥῆξαι φωνήν. καὶ δύο κεφαλὰς ᾄδουσι τῆς ἀρνός καὶ τετράκερω γενέσθαι φασὶ τὴν αὐτήν. „Die Ägypter sagen, (…) dass in den Tagen von Bokchoris ein Lamm mit acht Füßen und zwei Schwänzen geboren worden sei, und dass es sprach. Sie sagen auch über es, dass es zwei Köpfe und vier Hörner gehabt hat.“87
78 79 80 81
82 83 84 85 86 87
So z. B. PALMIERI et al. 2013. Siehe z. B. GURLT 1832, 46; NORDBY u. TAYLOR 1928 und THURINGER 1919. Siehe z. B. RAMADAN 2010. Ein Diprosopos ist von OMOBOWALE et al. 2014 dokumentiert. Siehe z. B. die Publikationen von DELPIANI et al. 2011; GEDDA 1961, 103; MUŇOZ-OSORIO, MEJÍAFALLA u. NAVIA 2013; DOS SANTOS u. GADIG 2014 und WAGNER, RICE u. PEASE 2013. Ein Diprosopos liegt bei HEVIA-HORMAZÁBAL, PASTÉN-MARAMBIO u. VEGA 2011 vor. Zum inneren Aufbau siehe BISHOP 1908. Publiziert von BUFFETAUT et al. 2007. Text nach POHLKE 2010, Kap. 50. Text nach BRISCOE 1991, 109. Text nach JAL 1995, 24. GARCÍA VALDÉS, LLERA FUEYO u. RODRÍGUEZ-NORIEGA GUILLÉN 2006, 280.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
15
Claudius Aelianus weist ferner darauf hin, dass ihn die Ägypter mit ihrer Geschichte aber nicht überzeugt hätten (καὶ ἐμὲ μὲν ἥκιστα πείθουσι). Zweiköpfige Wesen scheinen in der Antike einen gewissen Eindruck hinterlassen zu haben, was ihre häufige Nennung beweist. So soll es z. B. unter Nero laut Publius Cornelius Tacitus, Annales XV, 47 dazu gekommen sein, dass als schlechte Vorzeichen bicipites hominum aliorumque animalium partus abiecti in publicum. „Menschen und anderes Lebendiges mit zwei Köpfen der Öffentlichkeit gezeigt wurden.“88 Bereits Cicero, De divinatione I, 121 nannte die Geburt eines zweiköpfigen Mädchens als ein schlechtes Vorzeichen.89 Titus Livius, Ab urbe condita XLI, 21 berichtet von einem zweiköpfigen Jungen im Gebiet von Veientium (In Veienti agro biceps natur puer).90 Unter Antoninus Pius (138–161 n. Chr.) soll nach Historia Augusta IX, 3 ebenfalls ein zweiköpfiger Knabe geboren worden sein (natus est et biceps puer).91 Ammian, Res Gestae XIX, 12, 19 erwähnt, dass 359 n. Chr. in Daphne bei Antiochia ein Säugling, welchen er als „Monster“ beschreibt, mit zwei Gesichtern, zwei Mündern, einem Bart, vier Augen, aber nur mit zwei kleinen Ohren geboren wurde: Natum est monstrum infans ore gemino cum dentibus binis et barba quattuorque oculis et brevissimis duabus auriculis.92 Er weist darauf hin, dass das Kind die doppelte Anzahl von Zähnen (cum dentibus binis) aufweisen würde, was durch die ontogenetische Entwicklung bedingt für eine Lebensspanne von mehreren Wochen und Monaten spricht, die die Zwillinge erreicht haben müssen, bis sich die Zähne entwickelt haben.93 Für das Jahr 375 n. Chr. wird durch Ranulf Higden, Polychronicon von einem doppelköpfigen Jungen aus Emmaus berichtet, der zwei Jahre alt geworden sein soll, bevor er starb.94 Augustinus von Hippo, De civitate Dei XVI, 8 überliefert im fünften Jahrhundert n. Chr., dass im Osten ein Mann geboren worden sei, der doppelt in seiner oberen, aber einzeln in seiner unteren Hälfte gewesen sei: In Oriente duplex homo natus est superioribus membris inferioribus simplex.95 Seine Beschreibung führt er folgend genauer aus: Nam duo erant capita duo pectora quattuor manus venter autem unus et pedes duo sicut uni homini. „Er hatte aber zwei Köpfe, zwei Brustbereiche, vier Hände, aber nur einen Körper und zwei Füße.“96 Augustinus beschreibt somit einen Dikephalos tetrabrachion. Wichtig ist anzumerken, dass Augustinus darauf hinweist, dass er lange genug gelebt hätte, dass ihn viele Menschen gesehen hätten (multos ad eum videndum). Im Jahr 1697 n. Chr. soll ein erwachsener Mann, der als
88 89 90 91 92 93 94 95 96
Text nach WELLESLEY 1986, 46. Text bei PEASE 1920, 313. Lateinischer Text nach BRISCOE 1986, 33. Text bei HOHL 1927, 43. Text nach ROLFE 1956, 542–544 und SEYFARTH 1978, 181. Ein Mann mit vier Augen wird bei GOULD u. PYLE 1898, 258 f. beschrieben. Vgl. NELSON 2015, 23–28. Siehe BONDESON 2000, 213; 2004, 163. Lateinischer Text nach DOMBART u. KALB 1955, 509. Lateinischer Text nach DOMBART u. KALB 1955, 509.
16
2. Grundlagen
Dikephalos diauchenos zu beschreiben ist, gefangen genommen worden sein,97 was bedeutet, dass Individuen mit dieser speziellen Fehlbildung das Erwachsenenalter erreichen konnten. Auch Berossos, Babyloniaca erwähnte nach Eusebius, Chronicon VI, 8 Menschen, die σῶμα μὲν ἔχοντας ἕν κεφαλὰς δὲ δύο „einen Körper und zwei Köpfen haben.“98 Zwar erscheinen diese in einem mythologisch durchsetzten Abschnitt, doch sollte die Erwähnung der reinen Dikephalie nicht per se ins Reich der Legenden verwiesen werden, was die realen Belege deutlich machen. Fälle von zweiköpfigen Menschen (Abbildung 66) beschrieb auch Fortunius LICETUS in seinem Werk De Monstris aus dem Jahr 1665 als De monstrorum humanorum reali existentia.99 So soll 1540 n. Chr. in Ferrari, Italien, ein doppelköpfiges Kind geboren worden sein, von dem ein Kopf männlich und ein Kopf weiblich gewesen sein soll,100 was aber medizinisch betrachtet nicht möglich ist. Dass doppelköpfige Kinder vergleichbar einem Janiceps oder einem Diprosopos nicht immer ein gutes Vorzeichen waren, legen, wie es vergleichbar in Kapitel 2.2.1 für die genannten Missbildungen bereits genannt wurde, antike Quellen nahe. Nach Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XXV wurde unter Trajan im Jahr 112 n. Chr. ein doppelköpfiges Kind (δικέφαλος) auf den Rat der Opferpriester hin in den Tiber geworfen.101 In der Omenserie Šumma izbu wird in Tf. I, 74 wie folgt berichtet: šumma sinništu ūlidma 2 qaqqadātušu tību dannu ana māti itebbīma šarru ina kussîšu itebbi „Wenn eine Frau gebiert und (das Kind) hat zwei Köpfe, dann wird sich ein starker Angriff gegen das Land erheben und der König wird sich von seinem Thron erheben.“102 Auch aus dem Reich der Hethiter sind wenige der Teratomantie zuordenbare Omina bekannt, die mehrköpfige Wesen erwähnen. Den bisherigen Belegen nach scheint es sich bei allen Textvertretern in hethitischer Sprache um Übersetzungen aus dem Akkadischen zu handeln, die auf die Zeit des 14. Jahrhunderts v. Chr. zurückgehen.103 Als ein Beispiel kann AnAr 10753, x+1–4' genannt werden, wobei hier lediglich noch „Wenn eine Frau gebiert und [ihm? …] zwei seine Köpfe, zwei sei[ne] Leiber […], die Schulter aber an [seinem …], anhaftet: das Land […]“ lesbar ist.104 Es ist bedauerlich, dass die betreffenden Tontafeln heute mehrheitlich zerstört sind. 97 Siehe BONDESON 2000, 217 f.; 2004, 168 f. 98 Siehe die Überlieferung bei JACOBY 1958, 371 (FGrHist 680, F1) und VERBRUGGHE u. WICKERSHAM 1996, 45. Allgemein zur Babyloniaca BURSTEIN 1980 und VERBRUGGHE u. WICKERSHAM 1996, 13– 91. 99 LICETUS 1665, 11. Ab dem 16. Jahrhundert n. Chr. erlebten Missbildungen mit mehreren Körperteilen in Europa offenbar einen regelrechten Interessenansturm, der sich in verschiedenen Werken wie z. B. LYKOSTHENES 1557 oder PARÉ 1573 zeigt. Weitere Beispiele nennt WUNDERLICH 1999, 26. 100 Hierzu GOULD u. PYLE 1898, 165. 101 Siehe den Text bei STRAMAGLIA 2011, 54. 102 LEICHTY 1970, 47 und DE ZORZI 2014, 397; vgl. auch die Omina in Šumma izbu wird in Tf. II, 21– 43 oder Tf. VIII, 48'–52', siehe LEICHTY 1970, 48 f., 104 (hier Z. 35'–37') und DE ZORZI 2014, 397– 399, 571. Ein Omen für ein doppelköpfiges Kind liegt mit YOS X, 56, II, 8 f. bereits aus der altbabylonischen Zeit vor: Auch hier wird ein fremder Herrscher den Thron an sich reißen; vgl. DE ZORZI 2011, 55, Anm. 52. 103 Siehe die Texte bei RIEMSCHNEIDER 1970, 10 und KAMMENHUBER 1976, 71. 104 RIEMSCHNEIDER 1970, 39 f. Im folgenden Omen ist nur noch erhalten, dass es sich um ein Wesen mit zwei Köpfen handelt. Vgl. auch Bo 5306 und KUB VIII, 42 ibd. 41 f. Ebenfalls wird in KBo XIII, 31, Vs. II, 7'–9' und Vs. II, 10'–13' über ein missgebildetes Tier mit zwei Köpfen berichtet, siehe ibd. 76. Einen dem Omen vergleichbaren Anblick bietet z. B. eine Schildkröte in Kiew, siehe
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
17
Ebenfalls liegt ein Fragment in hurritischer Sprache vor.105 Leider ist auch dieser Text KUB XXIX, 12 zum größten Teil zerstört, doch ist in den beiden Zeilen I, x+5 f. noch „[…] wenn die Missgeburt zwei Köpfe [hat …], zwei […] Löwe“ zu lesen. Dies beweist, dass die betreffenden Omina über Doppelköpfigkeit auch ins Hurritische übersetzt wurden, wie es für viele Ritualtexte aus Hattuša belegt ist. Demnach darf die Kenntnis von dieser Art der Missbildungen auch für das hurritisch sprechende Milieu vorauszusetzen sein.
Abbildung 6: New York, MMA, Acc.-No. 10.176.78
Aus Ägypten sind Schminkpaletten bekannt,106 die Tiere mit zwei Köpfen zeigen und – zeitlich dem syrisch palästinischen Raum vergleichbar – die Darstellung von Geschöpfen mit dieser Missbildung bereits im vierten vorchristlichen Jahrtausend belegen.107 Als herausragendes Objekt kann New York, MMA, Acc.-No. 10.176.78 (Rogers-Fund, 1910) genannt werden (Abbildung 6).108 Das Stück wird in die frühe Naqada II-Zeit datiert, ist 15,3 × 16 × 0,6 Zentimeter groß und wurde aus Grauwacke hergestellt. Von besonderem Interesse ist hier die Darstellung des Tiers mit zwei Köpfen; in anderen Fällen wird bei dieser Art der Paletten lediglich ein Kopf dargestellt, wie es z. B. bei New York, MMA, Acc.-No. 10.176.81 (RogersFund, 1910) der Fall ist.109 Es dürfte deutlich sein, dass der Künstler eventuell ein reales Geschöpf dieser Art vor sich hatte und dieses, wohl aufgrund seiner Andersartigkeit, in einer Palette verewigte.
105 106 107 108 109
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-insolite-tortue-deux-tetesmusee-kiev-37079/ [Zugriff am 22. Juli 2022]. KAMMENHUBER 1976, 153f.; LAROCHE 1972, 47; LEICHTY 1970, 209 und DE MARTINO 1992, 99 (Nr. 44). Z. B. die bei CHAPPAZ 2000, 198 (Nr. 56 f.); FLINDERS PETRIE 1920, Tf. 44 f. und QUIBELL 1904, Tf. 45 abgebildeten Stücke. Vgl. hierzu zuletzt THEIS 2017. Siehe FAY 1998, 24, Abb. 3; H. G. FISCHER 1968, 24, Abb. 10; 1966, 195, Abb. 4; HAYES 1960, 24, Abb. 17. Siehe http://www.metmuseum.org/art/collection/search/547369 [Zugriff am 22. Juli 2022]. Das Stück ist 15 Zentimeter lang und wurde aus Grauwacke gefertigt. Vgl. z. B. auch Manchester, UM, Inv.-Nr. 9479 bei PATENAUDE u. SHAW 2011, 49 und die Zusammenstellung bei FLINDERS PETRIE 1921, Tf. 52.
18
2. Grundlagen
Für manche Darstellungen aus der Antike wäre anhand der Beleglage ein real existenter Dikephalos als Inspiration bzw. Beeinflussung denkbar. Das Phänomen tritt in den verschiedenen Ausformungen bei menschlichen Zwillingen auf und ist außerdem im Tierreich zu beobachten.110 Von den zweiköpfigen Tieren hat den Belegen nach die zweiköpfige Schlange in der Antike offenbar die größte Aufmerksamkeit gefunden. Dies ist möglicherweise mit einem verstärkten Auftreten dieser Fehlbildung bei Reptilien zu erklären. Eine weitere Form der Missbildung, bei der zwei Köpfe vorliegen, stellt der Thoracopagos parasiticos oder Omphalopagos parasiticos dar. Diese Missbildung liegt z. B. in Šumma izbu, Tf. VIII, 50' vor: šumma izbu 2 qaqqadātušu šanû ina irtišu šakin mār šarri kussâ iṣabbat „Wenn eine Missgeburt zwei Köpfe hat (und) der andere ist auf ihrer Brust, dann wird der Sohn des Königs den Thron ergreifen.“111 In diesem Fall ist der Kopf oder bereits der obere Rumpfbereich mit Kopf an der Brust des anderen Zwillings zu finden. Auch solche Fälle sind lebensfähig, zumindest was den Zwilling betrifft, aus dessen Brust das zweite Individuum herauswächst. Einen bekannten Fall beim Menschen stellen die beiden Brüder Lazarus und Joannes Baptista Colloredo dar, die 1617 geboren wurden und erst nach 1646 verstarben.112 Joannes Baptista trat an seinem Bauch-Brustbereich aus der Brust seines Bruders heraus – insgesamt betrachtet kann ein solcher Fall für die vorliegenden Omina als Vorlage aus der Natur gelten. Die Nennung in einem Omen zeigt, dass auch das Auftreten dieser Art der Missbildung für die Antike anzunehmen ist. Es liegt keine Darstellung eines göttlichen Wesens aus der Antike vor, die diese Missbildung zeigen würde, was simpel mit dem Grund erklärt werden kann, dass dies wohl einer göttlichen Darstellung zuwiderlaufen würde. Interessant ist, dass auch einige akkadische Personennamen mit dem Element izbu gebildet wurden.113 Wenn die Eltern ihr Kind Izbu-līšir nennen, scheint ein gewisser Stolz mitzuschwingen. Es bleibt die Frage, ob sich unter einem Izbu-līšir oder einem Izbu genannten Mensch auch zwei Personen respektive ein Körper mit zwei Köpfen verbergen könnten? Diese Frage kann auch für den bereits aus Tafeln aus Kültepe bekannten Namen Izumuš gelten,114 der klar mit akkadischem Usmû in Verbindung steht. Ließe sich auch zumindest ein Individuum, welches diesen Namen trug, als ein Diprosopos oder weiter gefasst als ein dikephales Kind verstehen?
2.2.3 Drei Köpfe Da schon Drillinge nach der Hellin-Regel mit 1:852 relativ selten sind, sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Missbildung eines Trikephalos dementsprechend. Doch zeigen bekannte Fälle, von denen einer bereits im Jahr 1831 dokumentiert wurde, dass ein Trikephalos durchaus im Bereich des Möglichen liegt.115 Das Wesen war aber nicht lebensfähig. Weitere Fälle wurden für das 19.
110 Hier sei auf die auf Seite 10 genannten Tiere verwiesen. 111 LEICHTY 1970, 104 (hier Z. 37') und DE ZORZI 2014, 571. Vgl. auch die Nennungen in Šumma izbu, Tf. VIII, 53'–62' bei LEICHTY 1970, 106. In Tf. VIII, 63'–67' werden wohl Missbildungen der Form Craniopagos parasiticos beschrieben; siehe hierzu GOULD u. PYLE 1898, 187–189. 112 Hierzu GOULD u. PYLE 1898, 191 f. 113 Siehe STAMM 1939, 49 f., 265. 114 Siehe STEPHENS 1928, 51. Dies dürfte auch für den Namen *Uzzammi aus Alalaḫ bei WISEMAN 1953, 151 der Fall sein. 115 FIRST u. PIERSOL 1891b, 202 f.; FÖRSTER 1865, 110; RUIDISCH 1869, 8; SAINT-HILAIRE 1837, 236 und SPENCER 2003, 376 f. nennen nur je zwei oder drei Beispiele. Bei VESTERGAARD 1972 liegt ein
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
19
Jahrhundert gesammelt.116 Eine Schwangerschaft mit nicht getrennten Drillingen wurde zu Beginn der 2000er abgebrochen.117 Dahingegen scheint ein Kind mit drei Köpfen, das im Oktober 2011 in Indonesien geboren wurde, noch längere Zeit gelebt zu haben,118 wie auch ein Kind mit drei Häuptern in Guyana zumindest zwei Monate alt wurde.119 In seiner Lebensbeschreibung des Apollonius von Tyana berichtet Flavius Philostratos, Vita Apollonii V, 13 von einem Fall eines Trikephalos in der Ausformung triauchenos bei einem Menschen im zweiten nachchristlichen Jahrhundert: τρεῖς γὰρ τῷ βρέφει κεφάλαι ἦσαν ἐξ οἰκείας ἑκάστηδέρης τὰ δὲ ἐπ᾿ αὐταῖς ἑνὸς πάντα. „Das Kind aber hatte drei Köpfe, jeder auf einem eigenen Hals, aber darunter war es ein Körper.“120 Im Tierreich sind vergleichbare Fälle bei verschiedenen Spezien dokumentiert worden. Ein dreiköpfiges Schaf soll im Jahr 1577 geboren worden sein, dessen mittlerer Kopf deutlich größer als die anderen war.121 Ein weiteres Schaf mit drei Köpfen wird im Jahr 1665 bei Fortunius LICETUS, De Monstris abgebildet (Abbildung 68).122 Im 19. Jahrhundert wurden bei Schafen Drillings-Missgeburten beobachtet.123 Es finden sich auch Berichte über dreiköpfige Hunde und Katzen.124 Wenn wie im 19. Jahrhundert ein dreiköpfiger Hund geboren wurde,125 kann man diesen durchaus als einen real existierenden Kerberos bezeichnen, wie er neben vielen Überlieferungen z. B. bei Propertius, Elegiae III, 5, 43 f. und III, 18, 23 angesprochen wird (s. auch Abbildung 69).126 Bereits aus neuassyrischer Zeit liegen in der Omenserie Šumma izbu in Tf. VI, 47 f. zwei Vorzeichen vor, die verbundene Drillinge bei Schafen benennen.127 Dass Tiere mit dieser Fehlbildung real existieren, zeigt das Beispiel einer dreiköpfigen Schildkröte aus Taiwan.128 Allerdings sind bei diesem Exemplar nur zwei Köpfe voll entwickelt, während der
116 117
118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128
Beleg vor, dass zwei der Drillinge als Dikephalos nicht getrennt waren, der dritte Foetus aber normal entwickelt war. Siehe die Belege bei GOULD u. PYLE 1898, 167 f. Siehe ATHANASIADIS, MIKOS u. ZAFRAKAS 2007, 242; ATHANASIADIS et al. 2005; zur Wahrscheinlichkeit bei Drillingen MURRAY 2012, 790–793. Die bei LICETUS 1665, 192 gegebene Abbildung eines siebenköpfigen Menschen (Abbildung 67) ist der Phantasie zuzuschreiben, obwohl der Autor dies unter seiner Kapitelunterschrift „Monstra multiformia, diversas animalium species in eodem genere proximo reserentia, non esse figmenta, sed in rerum natura reperiri“ führt. Die Abbildung ist klar inspiriert durch „The True Portrait of a Prodigious Monster, taken in the Mountains of Zarana“, welches in London im Jahr 1655 veröffentlicht wurde; online verfügbar unter http:// www.strangehistory.net/2014/06/14/prodigious-portrait-seven-headed-monster/ [Zugriff am 22. Juli 2022]. So nach dem Bericht unter http://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/general/reportthree-headed-baby-born-in-sumatra-indonesia/ [Zugriff am 22. Juli 2022]. So nach dem Bericht unter http://www.kaieteurnewsonline.com/2009/06/09/three-headed-babydelivered-at-city-hospital/ [Zugriff am 22. Juli 2022]. Vielleicht liegt mit KUB XXXIV, 20, x+5' f. die Beschreibung eines menschlichen Trikephalos in einem hethitischen Omen vor, siehe RIEMSCHNEIDER 1970, 41 f. Griechischer Text nach C. P. JONES 2005, 20. Siehe GOULD u. PYLE 1898, 166. Siehe LICETUS 1665, 22. Berichte bei VON GRÄFE, VON HUFELAND u. BUSCH 1840, 65 f.; GURLT 1832, 38 f. Siehe GOULD u. PYLE 1898, 167; GURLT 1832, 38 f. Hierzu GOULD u. PYLE 1898, 167. Text bei HEYWORTH 2007, 109, 135–137. Siehe den Text bei LEICHTY 1970, 89. In Tf. VI, 50 f. wird als negatives Vorzeichen die Verbindung von vier Schafen bei der Geburt benannt. Siehe den Bericht unter http://www.annexed.net/notes/acnanne10.html [Zugriff am 22. Juli 2022].
20
2. Grundlagen
mittlere deutlich kleiner ist. In Sumerset im Südwesten Englands wurde eine Kröte gefunden, die drei Köpfe aufwies.129 Die Körper und Köpfe der Kröte waren voll entwickelt. Betrachtet man die Überlieferungen in den mesopotamischen Omenserien Šumma izbu und Šumma ālu ina mēlê šakin könnte man rückschließen, dass in der Antike klar war, dass nicht getrennte Drillinge oder sogar Vierlinge extrem selten auftreten; aus diesem Grund werden drei oder vier verbundene Lämmer nur jeweils kurz in Šumma izbu, Tf. VI, 47 f. und 50 f. genannt.130 Dementsprechend ließe sich dies, klammert man die völlig unnatürlichen Omina aus den beiden Serien aus, mit Naturbeobachtungen erklären.
2.2.4 Zusammenfassung In der Zusammenschau der bei antiken lateinischen und griechischen Autoren gebotenen Überlieferungen in Kombination mit medizinischen Publikationen aus der Neuzeit hat sich gezeigt, dass mehrköpfige oder mehrgesichtige Menschen und Tiere wohl für alle Zeiten anzunehmen sind und diese durchaus auch ein gewisses Lebensalter erreichen konnten. Der Beleglage zufolge ist die Dikephalie noch recht häufig zu erwarten, ein Wesen mit drei Köpfen aber bereits statistisch recht unwahrscheinlich. Es wurden einige Beispiele für Fehlbildungen genannt, die vielleicht eine reale Vorlage für das Phänomen der Dikephalie sein könnten. Doch muss bei der Entstehung eines siebenköpfigen Wesens mehr die Gedankenwelt eines theologisch geschulten Menschen als Vorlage herangezogen werden. Bisher sind m. W. aus der Antike keine Skelettfunde eines Menschen bekannt, die das Phänomen der Dikephalie beweisen würden, doch existieren aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit schriftliche Quellen, die belegen, dass Menschen in der Form eines Dikephalos diauchenos oder Vergleichbarem das Erwachsenenalter erreichen konnten. Rein statistisch betrachtet, müssen auch im Vorderen Orient in der Antike Geburten mit vier, fünf oder sogar mehr Kindern aufgetreten sein,131 wobei, wie oben erwähnt, deren Wahrscheinlichkeit mit größerer Anzahl umso mehr sinkt. Bei Fünflingen ist medizinisch gesichert, dass alle Kinder lebend zur Welt kommen und auch das Kleinkindalter erreichen können.132 Auch ist ein Fall bekannt, in denen von Achtlingen sieben Kinder das Kleinkindalter erreichten,133 doch wird es bei vergleichbaren oder höheren Kinderzahlen immer wahrscheinlicher, dass mehrere oder alle Kinder nur wenige Stunden oder Tage überleben.134 So nennt Aristoteles, Historia animalium VII, 4 (585a) den Fall einer Frau, die zwölf Totgeburten auf einmal zur Welt brachte.135 Aristoteles berichtet in seinen Werken De generatione animalium IV, 4 (770) und Historia animalium VII, 4 (584a) im vierten vorchristlichen Jahrhundert, dass zwar einerseits die Einfachgeburt den Normalfall darstellt, aber auch zwei, drei oder vier Kinder vorkom129 Siehe den Bericht unter https://www.independent.co.uk/environment/three-headed-frog-leaves-ex perts-on-the-hop-72452.html und die Videoaufnahme unter https://www.youtube.com/watch?v= u1uWAW4K1nE [Zugriff am 22. Juli 2022]. 130 LEICHTY 1970, 89 und DE ZORZI 2014, 513. 131 Dies gilt ebenso für Tiere, wie z. B. Aristoteles, Mirabilia 128 berichtet, dass Ziegen auch drei, vier oder fünf Jungtiere auf einmal zur Welt bringen können, siehe LOVEDAY et al. 1913, 842b. 132 Hier seien als Beispiel nur die Fünflinge Yvonne, Annette, Cécile, Emilie und Marie Dionne (geboren am 28. Mai 1934) genannt, siehe GEDDA 1961, 74 und WRIGHT 1994. 133 So z. B. in der Familie Chukwu, geboren im Dezember 1998; siehe http://www.chron.com/news/ houston-texas/article/Houston-octuplets-celebrate-10th-birthday-1594890.php [Zugriff am 22. Juli 2022]. 134 Siehe die bei PINCHKUK 2000, 29, Anm. 1–5 genannten Fälle und die Berechnungen bei RATHMAYR 2000, 80–85. 135 BALME 2002, 484; zur Textstelle speziell DASEN 1997, 50.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
21
men. Als höchste bekannte Anzahl nennt er in Historia animalium VII, 4 (584a) fünf, die aber bereits öfter geboren worden sein soll.136 Von Fünflingen berichten ebenso Antigonos von Karystos, Mirabilia 119 im ersten Jahrhundert v. Chr. und Aulus Gellius, Noctes Atticae X, 2 im zweiten Jahrhundert n. Chr.137 Aulus Gellius weist direkt darauf hin, dass die Kinder nicht lange überlebt haben. Plinius, Naturalis Historia VII, 3 nennt Fünflinge in Peloponnes, doch zählt er auch Siebenlinge einer Frau in Ägypten auf.138 Nach Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XXIX hat Trajan die Fünflinge einer Frau auf seine eigenen Kosten aufziehen lassen.139 Für Zwillinge ist die Beleglage besser.140 So liegt mit CIL XIV, 838 die Grabinschrift der beiden Zwillingsschwestern Claudia Chreste und Claudia Amabilis vor, die nur 3 ½ Jahre alt wurden. Synesios von Kyrene berichtet in seinem Werk Epistulae 55 und 79 von Geburt und Tod seiner beiden Zwillingssöhne.141 Die Geburt von Zwillingen und Drillingen hat sogar Eingang in die Anthologia Palatina, 166 und 168 gefunden.142 Bei Iulius Obsequens, Liber de prodigiis XIV wird die Geburt von Drillingen als schlechtes Omen für die römische Zeit vor Christi Geburt überliefert.143 Nach Plinius, Naturalis Historia VII, 3 endete mit der Geburt von Vierlingen eine Hungersnot.144 Pseudo-Aristoteles, Problemata physica X, 28 und Pseudo-Quintilian, Declamationes maior VIII, 3 weisen auf die schwache physische Konstitution von Zwillingen hin.145 Die hier in Auswahl vorgelegten Überlieferungen antiker Autoren beweisen, dass man sicher von Mehrfachgeburten sprechen kann, allerdings ist bisher aus der Antike keine Überlieferung bekannt, die einen Menschen mit mehr als zwei Köpfen erwähnen würde. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist statistisch gesehen äußerst gering. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die gebotenen Missbildungen aus der Natur bekannt sind und auch überliefert wurden. Dementsprechend wären für die antiken Belege der Dikephalie durchaus eine Einflussnahme durch real existierende Menschen oder Tiere möglich. Auch wäre eine Beeinflussung durch Fossilienfunde denkbar, wie sie das bereits angesprochene 122 Millionen Jahre alte Zeugnis des Hyphalosaurus lingyuanensis (Abbildung 5) aus der Unterkreide zeigt. Dass Fossilien bereits in der Antike bekannt waren und anscheinend gesammelt wurden, zeigen Beispiele aus Rom,146 Griechenland147 und auch aus Ägypten.148 Von der Sammlung der Knochen von Augustus berichtet anschaulich Gaius Suetonis Tranquillus, Vita Divi Augusti 72, 3. Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XV verweist darauf, dass in Nitriai in Ägypten Gerippe ausgestellt seien, die von einer übernatürlichen Größe seien.149 Ebenfalls berichtet er in De rebus mirabilibus XIV, dass nach einem Erdbeben unter Kaiser 136 137 138 139 140 141 142 143
144 145 146 147 148 149
BALME 2002, 482. P. K. MARSHALL 1968, 303. RACKHAM 1989, 528. BRODERSEN 2002, 66. Siehe nur die Zusammenfassung von GEDDA 1961, 18–32; DASEN 1997, 51 nennt etwa 30 bekannte Fälle aus dem mythologischen Bereich. GARZYA u. ROQUES 2003, 73. BECKBY 1965, 102.104. POHLKE 2010, Kap. 14. Das folgende Zitat von Plinius, Naturalis Historia VII, 3 zeigt aber deutlich, dass Mehrfachgeburten auch positiv konnotiert sein können, und nicht zwangsläufig, wie es DASEN 1997, 58 ausdrückt, negativ besetzt sein müssen. RACKHAM 1989, 528. FORSTER 1927, 893b. Siehe MAYOR 2001, 142–144 zur Villa des Augustus und 144–148 zur Sammlung von Tiberius. Von Knochenfunden liegen Berichte bei GOULD u. PYLE 1898, 325–327 vor. Siehe MAYOR 2000. Siehe KUHN 2011, 175 f.; MAYOR 2001, 175–178, 255–259 und WELVAERT 2002, 167–169. Siehe den Text bei STRAMAGLIA 2011, 49. Des Weiteren berichtet er in De rebus mirabilibus XVI und XVIII auf riesige Knochen auf Rhodos und in Karthago.
22
2. Grundlagen
Tiberius in Kleinasien in Erdspalten viele Gerippe entdeckt worden seien, die durchaus als Fossilien anzusprechen sind. In De rebus mirabilibus XIX spricht er von riesigen Knochen, die ebenfalls nach einem Erdbeben am Kimmerischen Bosporus gefunden wurden.150 Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass sich unter den vielfältigen Funden aus der Antike kein einziges dikephales Wesen befindet – das singuläre Beispiel des Hyphalosaurus lingyuanensis aus China zeigt, wie selten solche Funde sind. Doch zeigen die Beispiele, dass dieses Phänomen ebenso für die Antike anzunehmen ist und die beiden Individuen auch sehr wohl älter geworden sein könnten. Der Legende zufolge waren auch Hāšim ibn cAbd Manāf und sein Zwillingsbruder cAbd Šams bei ihrer Geburt 464 n. Chr. „siamesische Zwillinge“, da ein Finger von Hāšim am Kopf seines Bruders festgewachsen war. Ihr Vater habe sie daraufhin mit einem Schwert getrennt, und sie hätten noch über dreißig Jahre gelebt.151 Es existieren nur wenige Überlieferungen aus der Antike, wie es zu Zwillingsgeburten und mit diesen in Verbindung stehenden Geburtsvorgängen kommen konnte. Nach Empedokles, frag. A 81 gehen Zwillinge auf eine Teilung der Samenflüssigkeit zurück.152 Anders macht Demokrit von Abdera, frag. A 151 die Beschaffenheit der weiblichen Gebärmutter für Zwillinge verantwortlich.153 Auch diese beiden Berichte im fünften vorchristlichen Jahrhundert beweisen, welchen Eindruck Zwillingsgeburten machten.154 Für die Entstehung von Fehlbildungen mit mehreren Köpfen oder Extremitäten wurden in der Antike u. a. Schläge oder Stöße auf den Leib der Schwangeren oder eine Erkrankung des Unterleibes als Ursachen genannt.155 Ebenso wurde der göttliche Wille oder eine Verzauberung durch einen Menschen für eine Missbildung verantwortlich gemacht.156 Es ist davon auszugehen, dass auch weitere Missbildungen in der Antike bei Menschen oder Tieren vorkamen. So wären z. B. der Ischiopagos, bei dem zwei Individuen an der Hüfte verbunden sind,157 oder des Thoracopagos, bei dem zwei Individuen an der Vorderseite des Thorax wie auch dem Gesicht aneinander hängen, zu erwähnen.158 Vergleichbar zum Ischiopagos erscheinen als solche bezeichnete ‚Doppelwesen‘, die an ihrer Hüfte zusammengefügt sind und denen die Hinterbeine fehlen. Der erste sicher belegte Fall eines Ischiopagos stammt von Zwillingen in Florenz, die dort im Jahr 1316 geboren wurden.159 In der Antike wurden Menschen und Tiere mit angeborenen Fehlbildungen unter dem Begriff τέρας oder monstrum/monstra geführt.160 Aufgrund der Fundlage muss offenbleiben, ob z. B. die Doppelköpfigkeit wirklich immer als etwas widernatürliches (τεράστιος) gesehen wur-
150 Siehe STRAMAGLIA 2011, 51. 151 Siehe den Bericht bei WATT 1988, 17. 152 Siehe den Text bei DIELS u. KRANZ 2004, 300. Generell zu Theorien in der Antike BALSS 1936, 73– 76. Des Weiteren ist dies auch für die Missbildung von überzähligen Gliedmaßen angenommen worden, siehe die Belege bei id. 1936, 72. 153 Siehe den Text bei DIELS u. KRANZ 2005, 125; vgl. hierzu auch NEUMANN 1992, 218. Zum Zeugnis von Demokrit ist Aristoteles, De generatione animalium IV, 4 vergleichbar, der dies aber nur für mehrfachgebärende Tiere gelten lässt, siehe BALME 2002, IV, 4. 154 Einen Überblick bietet RATHMAYR 2000, 53–67, 89–100. 155 Vgl. v. a. WUNDERLICH 1999, 25. 156 Vgl. STOL 1993, 14–16; 2000, 167. Zu den Deutungen bei griechischen Autoren und Kirchenvätern siehe NEUMANN 1992, 215–230. 157 Vgl. die Fälle bei GOULD u. PYLE 1898, 182–184. 158 Allgemein hierzu FIRST u. PIERSOL 1891b, 158 f.; VON GRÄFE, VON HUFELAND u. BUSCH 1840, 52 f.; SPENCER 2003, 102–107.184–189 und SPENCER u. ROBICHAUX 1998. Zum Ischiopagos parasiticos FIRST u. PIERSOL 1891b, 186 f. 159 Siehe das Relief bei GEDDA 1961, 110, Abb. 69. 160 Vgl. u. a. WUNDERLICH 1999, 23.
2.2 Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen in der Realität
23
de, wie es Paulos von Aigina, Opus de re medica III, 76, 1 überliefert,161 da die im Folgenden zu nennenden Quellen keine wertende Intention aufweisen. Dass es sich um eine Fehlbildung handelt, stellte bereits Isidor von Sevilla, Etymologiae XI, 3, 7 fest, der den biceps als ein Körperteil zu viel bezeichnete.162 Fakt ist, dass eine Missbildung mit mehr als vier Köpfen in der Natur aus anatomischen Gründen nicht möglich ist. Zwar berichtet Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XX von einem Kind mit vier Köpfen, welches unter Nero im Jahr 61 n. Chr. geboren worden sein soll (παιδίον πρὸς Νέρωνα ἐκομίσθη τετρακέφαλον),163 doch muss offenbleiben, ob man diese Geschichte ernst nehmen kann, besonders da das Kind längere Zeit gelebt haben soll. Bisher sind meines Wissens aus der Antike keine Skelettfunde eines Menschen bekannt, die das Phänomen der Dikephalie beweisen würden. Somit ließe sich annehmen, dass zumindest einige der Wesen auf eine Naturbeobachtung zurückgehen könnten und die Widernatürlichkeit selbst die Menschen zu dessen Verehrung inspirierte – doch ist zur Entstehung eines siebenköpfigen Wesens mehr die Gedankenwelt eines theologisch geschulten Menschen bzw. ein religiös-mythologisches Umfeld als Vorlage heranzuziehen. Die gebotenen Bezeichnungen für die verschiedenen Ausführungen von multiplen Körperteilen lassen sich wie folgt zur besseren Übersichtlichkeit zusammenfassen. Tabelle 1: Bezeichnungen für multiple Körperteile und ihre Bedeutungen Dikephalos Diprosopos Ischiopagos Janiceps Tetrabrachion Thoracopagos Trikephalos Triprosopos
monauchenos diauchenos iniodymos opodymos
symmetros asymmetros
Zwei Köpfe auf einem Hals auf zwei Hälsen Doppeltes Gesicht mit zwei vollständigen Gesichtern mit zwei ineinander übergehenden Gesichtern An der Hüfte verbundene Zwillinge Zwei am Kopf verbundene Zwillinge verbunden an der gegenüberliegenden Seite des Kopfes schief am Kopf Vier Arme/Zwei Armpaare Am Thorax verbundene Zwillinge Drei Köpfe Drei Gesichter an einem Kopf
Da in der Literatur oft verschiedene Bezeichnungen zu einem Objekt vorliegen, werden die oben gebotenen Beschreibungen für die Erscheinungsformen von Mehrgesichtigkeit oder Mehrköpfigkeit verwendet. Bei den Benennungen als Di- oder Triauchenos muss darauf hingewiesen werden, dass sich diese immer nur auf ‚reale‘ Hälse beziehen, die aus dem Oberkörper oder dem Schulterbereich austreten.
161 Griechischer Text nach HEIBERG 1921, 295. 162 Siehe den Text bei LINDSAY 1957, XI, 3, 7. 163 STRAMAGLIA 2011, 52. Für weitere Quellen zum τετρακέφαλος siehe LIDDELL u. SCOTT 1961, 1780.
3 Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum Aus dem Vorderen Orient der Antike sind mannigfaltige Quellen für Wesen mit mehreren Köpfen oder Gesichtern überliefert, die sich in zwei- und dreidimensionalen Darstellungen sowie in Texten greifen lassen. Durch eine grobe Schätzung des Materials kann man davon ausgehen, dass aus Ägypten im Bereich der Darstellungen die weitaus größte Menge vorliegt, was sich auch mit den generell aus Ägypten überlieferten Quellen begründen lässt. Betrachtet man die textlichen Referenzen, die sich explizit mit mehreren Gesichtern oder Köpfen befassen, dürfte aus Mesopotamien und Ägypten in etwa dieselbe Menge vorliegen. Im Gegensatz zu den beiden Bereichen sind aus der Region Syrien-Palästina weder eine vergleichbare Anzahl von Texten noch von Abbildungen bekannt. Dies lässt sich aber generell mit einer schlechteren Quellenlage erklären, da die Region allgemein fundärmer wie die Überreste der großen Kulturen im Südwesten und im Osten ist. Allerdings ist das Gebiet der heutigen Staaten Jordanien, Israel, Libanon und Syrien als Übergangsregion zwischen den einzelnen Kulturen im östlichen Mittelmeerraum von immanenter Bedeutung, da hierüber die bereits angesprochenen Handelsrouten und Kulturkontakte verliefen. In der Region zeigen sich, wie es im Folgenden anhand des Materials verdeutlicht wird, neben Übernahmen aus einem anderen Bereich auch eigene Kreationen von Wesen, die so sonst nicht überliefert sind. Auch scheint in Syrien-Palästina als erster Kulturregion den Übergang von einem zu mehreren Häuptern an einem Objekt vollzogen worden zu sein, wie es verschiedene Funde aus Naḥal Mišmar und Givcat Ha-Oranim beweisen. Auf diese Funde, die zwar keine ‚lebendigen‘ Wesen an sich darstellen, aber die Kombination von mehreren Köpfen an einem Objekt bereits sicher im Chalkolithikum nachweisen, wird in Kapitel 3.1 eingegangen. In die Betrachtung der verschiedenen Quellen werden vergleichbare Darstellungen aus benachbarten Kulturen mit einfließen. Hierbei sollte speziell beachtet werden, dass diese aus einem etwa gleichen chronologischen Rahmen vorliegen – Vergleichsobjekte, wie sie in manchen Fällen in der Literatur zu finden sind und teilweise mehre tausend Jahre jünger oder älter sind, können wohl kaum als direkte Parallele fungieren, speziell wenn sie lediglich eine recht uniforme Darstellung ohne spezifische Attribute aufweisen. Derartige Funde verdeutlichen nur, dass manche Darstellungsweisen als eine Art von Allgemeingut zu werten bzw. zu definieren sind. Aufgrund mancher Aufführungen sollte davon Abstand genommen werden, eine spezifische Kultur als Ausgangspunkt zu benennen. Der Fundzufall spielt bei manchen der im Folgenden gebotenen Objekte eine zu große Rolle, als dass eine verallgemeinernde oder spezifische Aussage über ein Objekt möglich wäre, speziell was die Urvorlage bzw. die Kreation einer speziellen Darstellungsweise anbetrifft. Dass mit den seit früher Zeit bekannten Kultur- und Handelskontakten auch Ideen und Vorstellungen mehrköpfige Götter betreffend auf diesem Wege ‚gereist‘ sind, wäre durchaus anzunehmen. Anhand der bisher bekannten Darstellungen kann zumeist nicht nachgewiesen werden, ob mehrköpfige Wesen direkt durch eine Nachbarkultur beeinflusst oder die Vorstellung importiert wurde. Aus diesem Abschnitt werden die schriftlichen Quellen aus Ugarit ausgeklammert und in die Betrachtung der siebenköpfigen Wesen in der Apokalypse des Johannes in Kapitel 4.2.3.2 mit einfließen, da sich hier direkte Überschneidungen bei den Bezeichnungen nachweisen lassen, die für die Motivgeschichte von wesentlicher Bedeutung sind.
3.1 Objekte aus dem Chalkolithikum
25
3.1 Objekte aus dem Chalkolithikum Als die bisher frühesten Darstellungen von mehrköpfigen Wesen aus der Region wurden Objekte interpretiert, die aus der frühneolithischen Siedlung cAyn Gazal, gelegen am Fluss Nahr az-Zarqa nahe Amman in Jordanien, stammen. Es handelt sich bei den in Frage kommenden Stücken um die Plastiken Nr. 3 mit einer Höhe von 46,5 Zentimetern, Nr. 4/8 mit einer Größe von 83 Zentimetern und Nr. 5/6 mit einer Höhe von 88 Zentimetern (Abbildung 70).1 Hergestellt wurden diese Stücke aus Mörtel und Bitumen, wobei speziell deren Größe die Bedeutung der Objekte herausstellt. Die Stücke werden in das achte Jahrtausend datiert und stammen damit bereits aus der Zeit des PPNB. Die Statuetten zeigen jeweils zwei Köpfe, die aus einem als langer Mantel zu interpretierenden Teil heraustreten. Bei den genannten Objekten liegt aber m. E. kein Beleg für eine Darstellung von Doppelköpfigkeit im präkeramischen Neolithikum B (PPNB) vor.2 Im Normalfall weisen Statuetten mit einem Kopf weitere menschliche Züge am Körper auf, während dies bei diesen Objekten nicht gegeben ist. Die Darstellungen sind vielmehr als zwei Individuen zu verstehen, die unter einer Decke oder einem Mantel vereint recht nahe beieinander sitzen, wie man es sich z. B. bei der Darstellung eines Ehepaares vorstellen könnte. Vergleichbare Darstellungen sind aus späterer Zeit aus dem gesamten Nahen Osten belegt.3 Die ersten Funde, die dezidiert die Kombination von mehreren Köpfen an einem Objekt darstellen, liegen erst aus dem Chalkolithikum vor. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass es sich bei den im Folgenden genannten Objekten um die bisher ältesten Funde aus dem gesamten Vorderen Orient handelt, die dieses Merkmal besitzen. Wenn man dies nicht nur dem Fundzufall zuschreiben möchte, spielte somit die betreffende Region eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung. Als eine Vorstufe der Entwicklung hin zu mehrköpfigen Wesen im Raum des heutigen Israel – und wohl auch vergleichbar zu anderen Kulturbereichen – kann ein Szepter mit fünf Köpfen gesehen werden (Abbildung 7), welches sich heute in Jerusalem, IMJ, IAA 61–88 befindet.4 Das Stück wurde in einer Höhle westlich des Toten Meeres bei Naḥal Mišmar in einem Hortfund gefunden und wird auf das frühe bis mittlere Chalkolithikum zwischen 4500– 4000 datiert.5 Es wurde aus Kupfer hergestellt, ist 27,5 Zentimeter lang und weist einen Durchmesser von 2,3 Zentimetern auf. Zwei kleinere Capriden zieren die Spitze, darunter befinden sich in einem kleinen Abstand zwei nach außen gerichtete Capridenköpfe sowie ein nach vorne gerichteter Kopf.6 Dieses Haupt weist deutlich von den anderen abweichende Hörner mit doppelter Windung auf. Es handelt sich somit sicher um ein anderes Tier. Mit diesem Stück liegt die Kombination von mehreren Tierköpfen an einem Objekt bereits im fünften Jahrtausend vor und man kann durchaus annehmen, dass derartige Objekte einen Einfluss auf die Gestaltung von Objekten bzw. die Entwicklung hin zu Mehrköpfigkeit ausgewirkt haben. 1
2 3 4 5 6
Siehe die Abbildungen bei SALJE 2004, 33 f. und TASSIE 2014, Tf. 2; generell zu den Figurinen GRISSOM 2000, hier speziell 27 f.; ROLLEFSON, SIMMONS u. KAFAFI 1992, 464–467; SALJE 2004 und TUBB 1985. Man vergleiche auch eine Statuette aus Çatal Höyük, die ebenfalls zwei Köpfe besitzt und durch die Gestaltung des Brustbereichs mit zwei Oberkörper dargestellt ist; s. die Abbildung bei MELLAART 1967, Tf. 70. Zur Datierung dieser Epoche KAFAFI 2002. Vgl. die Darstellung eines sitzenden Paares aus sumerischer Zeit bei ROAF 1992, 90. Publiziert von BAR-ADON 1980, 42–45 (Nr. 17); KATZ, KAHANE u. BROSHI 1968, 50 f. und SCHROER u. KEEL 2005, 118 f. (Nr. 52) mit weiterer Literatur. Generell zur Höhle BAR-ADON 1980, 2–14. Da die Köpfe nur in drei Richtungen schauen, ist die von ELLIOTT 1977, 8 f. geäußerte Vermutung, dass die Wesen Götter der Himmelsrichtungen symbolisieren, abzulehnen.
26
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
Abbildung 7: Jerusalem, IMJ, IAA 61–88
Eine vergleichbare Darstellung weist ein weiterer Stab mit drei Steinbockköpfen, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–86, auf.7 Dieser wurde ebenso in der Höhle bei Naḥal Mišmar gefunden. Aus Kupfer hergestellt, ist das Stück 18,2 Zentimeter hoch, weist einen Durchmesser von 1,8 Zentimetern auf und wird ebenfalls in die zweite Hälfte des fünften Jahrtausends datiert. Zwei der Köpfe können sicher als Capriden gedeutet werden, bei dem dritten könnte es sich um ein Mischwesen handeln.8 Vergleichbar ist eine Standarte aus Givcat Ha-Oranim aus dem Chalkolithikum.9 Diese besteht aus zwei übereinander gesetzten Keulenköpfen. Am unteren runden Objekt wurden vier Köpfe von Capriden angebracht, die in die vier Himmelsrichtungen blicken. In seiner Ausführung erinnert das Stück an Jerusalem, IMJ, IAA 61–88 aus Naḥal Mišmar (Abbildung 7). Die Kombination von zwei Capriden liegt mit einem aus Kupfer gefertigten Stabaufsatz, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–119 vor,10 der demselben Hortfund entstammt wie
7
Publiziert von BAR-ADON 1980, 47 (Nr. 19) und SCHROER u. KEEL 2005, 124 f. (Nr. 60) mit weiterer Literatur. 8 Vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 124. 9 Publiziert von SCHEFTELOWITZ u. OREN 2004, 70–73 (Nr. 17). 10 Publiziert von BAR-ADON 1980, 100 f. (Nr. 153) und SCHROER u. KEEL 2005, 118 f. (Nr. 51) mit weiterer Literatur.
3.1 Objekte aus dem Chalkolithikum
27
das oben genannte Szepter Jerusalem, IMJ, IAA 61–88. Aus einem einzigen Rücken wachsen bei diesem Aufsatz spiegelbildlich zwei entgegengestellte Capridenleiber, d. h. es ist ein Wesen mit zwei Vorderleibern und zwei Köpfen dargestellt. Diese Kombination ist aus dem fünften Jahrtausend bisher ebenfalls einzigartig und beweist die Zusammenstellung von Tierleibern nebst deren Köpfen bereits in dieser frühen Zeit. Diese Kombination von zwei Wesen an ihren Hinterleibern, die im Folgenden als ‚Doppelwesen‘ bezeichnet werden, ist speziell für das zweite und erste vorchristliche Jahrtausend in ganz Vorderasien belegt. Am ehesten wäre diese Kombination als Ischiopagos zu erklären, bei dem die Hinterläufe der Tiere nicht mit abgebildet wurden oder fehlen.
Abbildung 8: Krone aus der Schatzhöhle von Naḥal Mišmar, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–177
In die Kategorie der Vorstufen zur Mehrköpfigkeit kann ebenfalls eine Krone aus der Schatzhöhle von Naḥal Mišmar eingeteilt werden, die sich heute in Jerusalem, IMJ, IAA 61–177 befindet (Abbildung 8).11 Das Objekt wurde aus Kupfer hergestellt, ist 17,5 Zentimeter hoch und besitzt einen Durchmesser von 16,8 Zentimetern. Auf dem Stück sitzen zwei Tauben, die zusammen in eine Richtung gewandt sind, neben denen zwei torartige Öffnungen angebracht wurden, auf denen je ein Capridenkopf sitzt. Insgesamt weist die Krone somit vier Tierköpfe auf. Die genannten Funde bezeugen deutlich, dass die Vorstellung, mehrere Köpfe an einem Objekt zu situieren, bereits während des fünften vorchristlichen Jahrtausends im syrisch-palästinischen Raum aufkam. Von der Darstellung mehrerer Häupter an einer Krone oder an einem Stab ist eine Entwicklung hin zu zwei oder mehreren Köpfen an einem Leib sehr gut vorstellbar.12 Von der Kombination mehrerer Häupter an einem eindeutig als Prestigeobjekt zu bezeich11 Publiziert von BAR-ADON 1980, 24–28 (Nr. 7); KATZ, KAHANE u. BROSHI 1968, 38 f. und SCHROER u. KEEL 2005, 130 f. (Nr. 68) mit weiterer Literatur. 12 Auch aus dem vierten nachchristlichen Jahrhundert ist eine Krone bekannt, die mit mehreren Schlangen sowie einem Widderkopf direkt über der Stirn versehen wurde, siehe TAYLOR 1991, 61.
28
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
nenden Gegenstand wie an einer Krone oder einem Szepter, ist es nur noch ein kleiner Schritt hin zur Kreation eines mehrköpfigen Gottes. Aufgrund der Fundlage ist zu postulieren, dass zuerst Prestigeobjekte eines Herrschers als machtgeladene Symbole wie Stäbe oder Kronen mit mehreren Köpfen versehen wurden, um die Macht der dargestellten Wesen auf den Träger übergehen zu lassen – in einem weiteren Schritt wurde der ‚Mittler‘ respektive der ‚Zwischenschritt‘ Krone oder Stab ausgelassen und die Köpfe direkt mit dem Wesen selbst verbunden. 3.2 Objekte aus der Frühbronzezeit Wurde im vorhergehenden Abschnitt deutlich, dass aus dem Chalkolithikum, d. h. der Zeit zwischen 4500 und 3600 v. Chr., bisher nur dreidimensionale Objekte bekannt sind, welche mehrere Häupter aufweisen, und diese lediglich in einem Fall mit dem Stabaufsatz Jerusalem, IMJ, IAA 61–119 ein Tier mit zwei Köpfen darstellen, werden in der Frühbronzezeit die Funde zahlreicher. Die Frühbronzezeit umfasst im syrisch-palästinischen Raum etwa den Zeitraum zwischen 3500–3000 v. Chr. Bei diesen frühen Funden handelt es sich ausnahmslos um Wesen auf Siegelabrollungen, die man aufgrund ihrer Darstellungsweise als ‚Doppelwesen‘ bezeichnen kann, da sie als Ischiopagos abgebildet wurden. Ebenso liegen Zeugnisse vor, die klar einen Dikephalos diauchenos zeigen. Von besonderem Interesse für eine interkulturelle Betrachtung ist hierbei der Umstand, dass die Form als Ischiopagos in etwa zeitgleich in mehreren Kulturen des östlichen Mittelmeerraums auftritt, worauf bereits Beatrice TEISSIER hinwies.13
Abbildung 9: Doppelwesen aus Byblos
Die bisher früheste bekannte Darstellung stammt aus Byblos und wird in die Frühbronzezeit I datiert (Abbildung 9).14 Die Siegelabrollung zeigt zwei Tiere, die an ihren Hinterleibern zusammengefügt sind, deren Spezies aufgrund fehlender Merkmale aber unbestimmt bleiben muss. Beide Köpfe sind sich zugewandt und wurden wie die Beine nur als plumpe Rechtecke ausgeführt. Die Darstellung ist deutlich als Ischiopagos zu charakterisieren. Es zeigt sich im Vergleich zu den folgenden Siegeln, dass aufgrund der fehlenden Einzelheiten wohl nur ein Versuch oder eine Art von früher Vorstufe vorliegt, ein Wesen mit zwei Köpfen zu kreieren. Vergleichbare Stücke, die ebenfalls kaum Einzelheiten aufweisen, sind aus dem vierten Jahrtausend aus Ägypten bekannt (s. u). Auf einem Siegel aus Gabal Aruda in Syrien wurden zwei Antilopen zusammengestellt (Abbildung 10).15 Das Stück wird in die Frühe Bronzezeit I datiert und zeigt einen Tierleib mit vier Beinen, aus dessen Oberseite zwei Antilopenköpfe hervortreten, deren Hörner typisch für diese Spezies ausgearbeitet worden sind. Dahingegen wurden Einzelheiten an den Leibern nicht berücksichtigt. Es handelt sich hierbei im Gegensatz zu den anderen Darstellungen von Siegeln
13 Siehe TEISSIER 1987. 14 Publiziert von DUNAND 1945, Tf. 4 (Abb. 5a); TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2d). 15 Publiziert von TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2c).
3.2 Objekte aus der Frühbronzezeit
29
aus der Region um einen Dikephalos diauchenos und um das älteste Stück, dass diese spezielle Form der Mehrköpfigkeit abbildet.
Abbildung 10: Wesen mit zwei Antilopenköpfen auf einem Siegel aus Gabal Aruda, Syrien
Abbildung 11: Doppelwesen auf einem Siegel aus Byblos
Eine weitere Siegelabrollung aus Byblos zeigt ein Doppelwesen (Abbildung 11) in der Form des Ischiopagos.16 Diese Abrollung wird bereits an den Übergang zwischen der Frühen Bronzezeit I und II datiert und ist somit um 3000 v. Chr. entstanden. Beim linken Kopf könnt es sich um den einer Antilope oder eines Steinbocks handeln. Das rechte Haupt wäre aufgrund von Parallelen wohl am ehesten als das eines Löwen zu interpretieren, wie es das folgende Objekt (Abbildung 12) darstellt. Im Gegensatz zum ersten Stück aus Gabal Aruda sind die beiden Köpfe einander zugewandt. Hierbei handelt es sich auch um das erste Beispiel aus dem vorderasiatischen Raum, in dem sicher zwei unterschiedliche Spezies an einem Leib zusammengefügt wurden. Dies bedeutet, dass in der Levante etwa am Übergang von der Frühbronzezeit I und II zum ersten Mal ein Mischwesen mit zwei Köpfen kreiert wurde.
Abbildung 12: Doppellöwe aus Byblos
Ebenfalls aus Byblos ist die Gestaltung in Form eines Doppellöwen bekannt (Abbildung 12).17 Das Objekt wird ebenso an den Übergang zwischen der Frühen Bronzezeit I zu II datiert und zeigt zwei an ihren Hinterleibern verbundene Tiere, bei denen es sich wohl um Löwen handeln soll. Im Gegensatz zu den anderen Stücken wurden hier die Vorderläufe relativ gut ausgearbeitet. Aufgrund der Fundlage kann somit für die Zeit um 3000 v. Chr. eine Hochphase der Siegelgestaltung mit Doppelwesen im gesamten Vorderen Orient festgestellt werden. Die Funde aus der Levante sind etwa kontemporär zu ägyptischen wie auch mesopotamischen Objekten. Hingewiesen werden kann auf verschiedene Darstellungen aus Ägypten. So liegt ein Doppelwesen, bei dem die Köpfe nicht sicher identifiziert werden können (Abbildung 13), auf einer Siegelabrollung aus dem großen Grab in Naqada vor, womit das Stück in die Zeit der Reichseinigung 16 Publiziert von TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2e). 17 Publiziert von DUNAND 1945, 63, Tf. 7h; VAN DRIEL 1983, 42; TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2f).
30
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
um 2900 v. Chr. zu datieren ist.18 Auf dieser Siegelabrollung ist ebenfalls ein weiteres Doppelwesen vorhanden (Abbildung 14),19 aus dessen Rücken ein unidentifizierbares Objekt hervortritt. Vergleichbar ist eine Darstellung auf der Siegelabrollung Kairo, Äg. Mus., CG 11187 (Abbildung 15),20 die aus Saqqara stammt und ebenfalls in die Zeit der Reichseinigung datiert wird. Eine Abrollung, die wohl zwei Löwen zeigt, ist aus Abydos erhalten und datiert in die Zeit von König Horus Aḥa (Abbildung 16).21 Aus derselben Zeit stammt eine Abrollung aus der Mastaba S 3357 in Saqqara (Abbildung 17),22 während die Darstellung London, U. C., 11746 (Abbildung 18) etwas jünger ist und bereits in die Frühdynastische Zeit datiert wird.23
Abbildung 13: Siegelabrollung aus Naqada
Abbildung 14: Siegelabrollung aus Naqada
Abbildung 15: Siegelabrollung Kairo, Äg. Mus., CG 11187
Abbildung 16: Siegeldarstellung aus der Zeit von Horus Aḥa
Abbildung 17: Doppellöwe auf einem Siegel aus S 3357
Abbildung 18: Siegelabrollung London, U. C., 11746
Aus Mesopotamien stammt z. B. die Darstellung eines Mischwesens aus Tepe Gawra, Schicht X, welche in die Zeit Uruk IV zwischen 3300 und 3100 v. Chr. datiert wird (Abbildung 19).24 Bei dieser Darstellung muss offenbleiben, um was für Tiere es sich handelt; aufgrund der Darstellung auf der rechten Seite könnte man auch gut an einen Schwanz anstelle eines Kopfes denken, womit dementsprechend kein Doppelwesen vorliegen würde. Da Einzelheiten nicht ausgearbeitet wurden, könnte man eventuell an ein gehörntes Tier denken. Eine Siegelabrollung mit Hirschen als Doppelwesen stammt aus Susa (Abbildung 20) und datiert in die Zeit Susa II um 3100 v. Chr.25 Dargestellt wurde hier der Leib von zwei Hirschen, die an ihren Hinterteilen
18 KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 57). 19 KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 57). 20 KAPLONY 1963, Tf. 26 (Nr. 62). Bei dieser Abbildung muss offenbleiben, ob es sich wirklich um Löwen handelt, oder ob nicht auch ein Schakal gemeint sein könnte. 21 KAPLONY 1963, Tf. 6 (Nr. 7). Praktisch identisch ist die Darstellung von zwei Löwen als Doppelwesen auf einer Siegelabrollung aus Grab S 3504 des ÜXm-k#-ÈD in Saqqara, siehe KAPLONY 1963, Tf. 99 (Nr. 423). Das Stück datiert in die Zeit von König E.t und damit etwa um 2820 v. Chr. 22 KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 56). 23 KAPLONY 1963, Tf. 107 (Nr. 531). 24 TOBLER 1950, Tf. 169; TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2b). 25 TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2a). Mit London, BM, 89332 liegt ein Siegel vor, welches ein anthropomorphes Wesen mit zwei Hirschköpfen zeigt. Das Siegel datiert etwa in das 14. Jahrhundert v. Chr. und ist 3,3 × 1,8 Zentimeter groß; siehe die Publikation von COLLON 1987, 182f. (Nr. 868); WARD 1910, 304, Abb. 954. Bei diesem Siegel ist aber unklar, woher es ursprünglich stammt; als mögliche antike Herstellungsorte wird die Region Nordsyrien, Waššukanni oder Zypern genannt. Von der Gestaltung
3.2 Objekte aus der Frühbronzezeit
31
verbunden sind. Auf beiden Seiten sind nur noch jeweils die Vorderbeine unterhalb der Körper zu erkennen. Auf demselben Siegel wurde wohl eine Antilope als Ischiopagos dargestellt, die aber an jedem Leib zwei Köpfe aufweist. Bereits aus dem dritten Jahrtausend datiert ein Amulett, welches einen Stier in der Form eines Doppelwesens zeigt.26
Abbildung 19: Darstellung eines Mischwesens aus Tepe Gawra
Abbildung 20: Siegelabrollung mit einem Vierfüßer als Doppelwesen aus Susa
Da die Belege aus Susa, die Vertreter der Gattung Doppelwesen zeigen, etwa in den Zeitraum um 3100 v. Chr. datieren, wurde hieraus geschlossen, dass sich das Motiv aus dem elamischen Raum nach Westen ausbreitete.27 Dies stellt aber nur eine Möglichkeit dar, da, wie oben erwähnt, die Siegeldarstellung aus Byblos (Abbildung 9) nur generell in die Frühbronzezeit I datiert werden kann und somit durchaus älter sein könnte, als es die Belege aus Susa sind. Dementsprechend kann bis auf weiteres keine sichere Herleitung dieses Motivs aus einem Kulturkreis erfolgen. Es ist ein auffallendes Bild, dass nach der Wende vom vierten zum dritten Jahrtausend v. Chr. die Funde von Siegeldarstellungen mit dem Motiv Ischiopagos im Vorderen Orient praktisch verschwinden. Diese Missbildung kann sich bei Zwillingen durchaus im Mutterleib ereignen und wurde auf vielfältigste Weise in der modernen Medizin dokumentiert. Es kann wohl kein Zufall sein, dass die Kombination von zwei Tieren an ihrem Hinterleib von Ägypten über Syrien bis nach Mesopotamien in etwa derselben Zeit bekannt ist – dieses Motiv dürfte durch Handelskontakte mit den Menschen gereist sein und hat sich offenbar einer größeren Beliebtheit erfreut. Aus mehreren Kulturbereichen des zirkummediterranen Raums liegen aus den jüngeren Epochen Anhänger vor,28 die zwei Tiere zeigen, die an ihrem Hinterleib zusammengefügt wurden. Diese Darstellungsweise erscheint auch als Schmuck auf Waffen29 oder z. B. in Ägypten in verschiedenen Gräbern und Tempeln.30 Somit ist diese Kombination über mehrere Jahrhunderte bis weit in das erste vorchristliche Jahrtausend hinein bezeugt.
26 27 28
29 30
her erinnert dieses Wesen an ein Geschöpf auf einem Siegel in der Slg. Ladders 76, siehe MATTHEWS 1990b, Nr. 470. CHAPPAZ 2000, 195 (Nr. 20); Größe 3,5 × 4,4 × 1,3 Zentimeter, hergestellt aus Lapislazuli; heute Sammlung J.-P. C., Genf. Vgl. TEISSIER 1984, 37, 46. So Stücke aus Luristan bei GORNY u. MOSCH 2013b, Nr. 612 und SOTHEBY’S 1990, Nr. 228, aus dem achten Jhd. v. Chr.; sowie vergleichbar GORNY u. MOSCH 2013b, Nr. 290 und SOTHEBY’S 1980, Nr. 206. So ein Stück aus Anatolien bei SOTHEBY’S 1976, Nr. 142, etwa aus dem zehnten bis siebten Jhd. v. Chr. So z. B. im Zweiwegebuch, erste Sektion, bei BACKES 2005, Abb. 5; im Amduat (Amd. 730) bei HORNUNG 1963, 167, Tf. 10; 1991, 148, Abb. 84; 1997a, 126; 1997b, 164f.; MORENZ 1984, Tf. 9; im
32
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
Abbildung 21: Siegelabrollung mit einer mehrköpfigen Antilope aus Susa
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend Die Darstellung eines Wesens, welches das Merkmal Diprosopos aufweist, ist aus dem syrischpalästinischen Gebiet das erste Mal vom Ende des dritten vorchristlichen Jahrtausends bekannt. So zeigt eine Szene auf dem Silberbecher aus cĒn Sāmiye, heute Jerusalem, IMJ, IAA, K 2919, ein Wesen mit zwei Gesichtern an einem Kopf (Abbildung 22).31 Das Stück stammt aus der Mittelbronzezeit I um 2300–2000 v. Chr. und wurde im Friedhof von cĒn Sāmiye in Grab 204,32 etwa 16 Kilometer südöstlich von Rām Allāh gelegen, gefunden. Der Silberbecher ist 8,2 Zentimeter hoch und weist einen Durchmesser von 25 Zentimeter am oberen Rand sowie einen Durchmesser von 23 Zentimeter am Fuß auf. Von der Darstellung ist heute noch etwa 80 Prozent erhalten. Unterhalb des doppelgesichtigen Wesens auf dem Silberbecher wurde eine Rosette angebracht, auf der linken Seite befindet sich eine große, sich aufbäumende Schlange und auf der rechten Seite ein Mann mit einer Rosette. Das Wesen, welches nur einen anthropomorphen Oberkörper aufweist, besitzt einen Kopf, an dem rechts und links je ein menschliches Gesicht dargestellt wurde. Der nackte, menschliche Oberkörper mit je einem Zweig in den Händen wurde frontal wiedergegeben und tritt aus einem doppelten Stierleib hervor, dessen Teile in Seitenansicht abgebildet wurden. Diese stehen sich antithetisch gegenüber und verleihen der Figur ein kurioses Aussehen.33 Es handelt sich der Gestaltung nach um eine spezielle Art von Doppelkentauros mit nur einem einzigen Oberkörper, der sich aber wieder zu zwei Gesichtern aufspaltet. Eine identische Abbildung liegt m. W. aus dem gesamten Vorderen Orient nicht vor, doch existieren aus den benachbarten Kulturen vielfältige andere Darstellungen von Kentauroi.
Pfortenbuch, Zehnte Stunde, 63. Szene, oberes Register bei HORNUNG 1984b, 230f.; 1997a, 139; 1997b, 275f.; im Tempel von Esna (Esna 401) bei VON LIEVEN 2000, 30, Tf. 1a. 31 Publiziert von BUCHHOLZ 2000, 58, Abb. 5e; SCHROER u. KEEL 2005, 324 f. (Nr. 231) mit älterer Literatur; YADIN 1971. 32 Zu diesem Grab speziell SHANTUR u. LABADI 1971. 33 Vgl. das Schulterstück aus Luristan bei FRANKFORT 1954, 210, Abb. 104 f.
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
Abbildung 22: Silberbecher aus cĒn Sāmiye, heute Jerusalem, IMJ, IAA, K 2919
Abbildung 23: Kentauros auf Berlin, VA 4375
Abbildung 24: Kentauros auf einem Kudurru, Kassitenzeit
Abbildung 25: Doppelgesichtiger Kentauros aus einem Grab in Athribis, 2. Jhd. n. Chr.
33
34
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
Dass Kentauroi mit mehreren Gesichtern dargestellt wurden, ist von späteren Funden bekannt, wie sie aus Mesopotamien auf Kudurru, wie auf Berlin, Vorderas. Mus., VA 4375 (Abbildung 23) und auf einem Stück ohne Inventarnummer (Abbildung 24) aus der Kassitenzeit belegt sind.34 Darstellungen aus Ägypten, wie sie im Tierkreis in Dendara35 aus griechischer Zeit und im Grab des AIb-p#-mny und des P(#-n)-mHy.t aus Athribis (Abbildung 25)36 aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert vorliegen, sind jedoch erst viel später entstanden. Diese wurden in Form eines Diprosopos oder eines Dikephalos gestaltet. Die Darstellung eines Mischwesens im Stil der Gestalt des Silberbechers von cĒn Sāmiye ist bisher im gesamten Vorderen Orient einzigartig.37 Da der Becher von cĒn Sāmiye nicht beschriftet ist, wurden verschiedene Deutungen vorgeschlagen. So wurde der doppelgesichtige Mann positiv konnotiert als Kosmoswächter interpretiert, der den Bereich der Vegetation vor dem Chaos beschützt, das durch die sich aufbäumende Schlange symbolisiert wird.38 Auf der anderen Seite des Bechers halten zwei Männer eine Sonnenscheibe in einer Schale oder in einem Band. Darunter liegt eine Schlange. Dies soll das Gleichgewicht der Mächte zwischen Sonne und Unterwelt symbolisieren, die durch zwei Himmelsträger getrennt werden.39 Zwar wurde vorgeschlagen, einen mesopotamischen Einfluss erkennen zu wollen, doch ebenso könnte das Stück direkt vor Ort oder in näherer Umgebung gefertigt worden sein. Aufgrund der Darstellung muss allerdings die Frage gestellt werden, welche Art von mesopotamischem Einfluss man annehmen soll, wenn eine vergleichbare Darstellung bis in die Kassitenzeit nicht belegt ist. Zwar werden in verschiedenen Texten wie Mythen und Omina mehrköpfige Wesen angesprochen, diese sind aber entweder nur aus sehr viel späterer Zeit belegt oder sie beschreiben völlig anders geartete Gestalten. Auf Beispiele für mehrköpfige Wesen aus Mesopotamien wird in Kapitel 4.2.3.1 eingegangen. Nach einer anderen Interpretation soll es sich laut Rafi GRAFMAN bei dem doppelgesichtigen Wesen um Marduk handeln,40 wobei er seine Deutung von der anderen Szene herleitet. Auch SCHROER und KEEL boten die Möglichkeit, dass es sich um die syrische Variante des Kampfes zwischen Marduk und Tiāmat handeln könnte.41 Zur Übereinstimmung kann hier auf eine Beschreibung des Götterkönigs Marduk im Enūma elîš, Tf. I, 95 und 97 f. als ein Wesen mit vier Ohren und vier Augen hingewiesen werden. 4 īnātušu 4 uznātušu (…) 4 ḫasīsā u īnān kīma šuātu ibarrâ gimrēti „Vier waren seine {beiden} Augen, vier waren seine {beiden} Ohren. (…) vier (Stück) – (seine) Ohren und (seine) beiden Augen ebenso: Sie sahen alles!“42 Würde somit die Beschreibung der Gesichter zwar übereinstimmen, wäre es aber mehr als auffällig, dass die beiden Unterleiber von Pferden nicht erwähnt werden. Aufgrund der Unter34 Publiziert von STIEHLER-ALEGRIA DELGADO 1996, Tf. 14. 35 Publiziert in Dendara X, Tf. 60. 36 NEUGEBAUER u. PARKER 1969, 181, Tf. 51; FLINDERS PETRIE 1908, Tf. 36. Vgl. zu dieser Darstellung auch BOLL 1903, 190; QUACK 2018, 83 f. 37 Eine Darstellung von zwei Löwen auf einem präsargonischen Siegel, das von AMIET 1964, 190 (Abb. 1) publiziert wurde, erweckt zwar den Anschein eines ‚Doppelwesens‘, doch scheint die Interpretation als zwei aufrecht und eng beieinander stehende Löwen naheliegender. Vergleichbar ist eine Darstellung auf dem Siegel London, BM, 123.348 bei id. 1979, 346 (Abb. 19). 38 Vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 324. 39 Vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 324. 40 Vgl. GRAFMAN 1972, 49. 41 Vgl. SCHROER u. KEEL 2005, 324. 42 Vgl. den Text bei KÄMMERER u. METZLER 2012, 134 und LAMBERT 2013, 64–57 sowie die Übersetzung bei FOSTER 1993, 357.
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
35
schiede und der Einmaligkeit der Darstellung sollte somit davon Abstand genommen werden, das zweigesichtige Wesen des Silberbechers direkt mit einer Entität aus Mesopotamien identifizieren zu wollen. Ein einmaliger Fund liegt mit einem Relief in Tokio, Ancient Orient Museum, o. Inv. vor (Abbildung 26).43 Das Stück zeigt eine Gottheit mit drei Gesichtern und wird auf den Zeitraum um 2000–1500 v. Chr. datiert.44 Die Gesichter wurden so an einem Kopf angebracht, dass eines nach vorne frontal und auf beiden Seiten jeweils eins in Seitenansicht abgebildet wurde. Dargestellt wurden drei bärtige Gesichter an einem Haupt, die hier dementsprechend in der Form Triprosopos vorliegen. Die mandelförmigen Augen wurden tief eingeritzt und die Nase recht gut herausgearbeitet. Der Bart ist durch einige Bartlocken gekennzeichnet. Die Lippen wurden zusammengepresst dargestellt; die Ohren sind recht klein gehalten. Auf dem Kopf befinden sich Reste einer Hörnerkappe, die das Wesen als Gott ausweisen. Der menschliche Oberkörper ist heute nur noch bis zur Brust erhalten; der linke Arm wurde zur Seite ausgestreckt und hält eine Standarte oder einen Stab, der rechte Arm ist heute verloren. Eine vergleichbare Darbietung ist bisher aus dem syrisch-palästinischen Raum nicht bekannt.
Abbildung 26: Relief Tokio, Ancient Orient Museum, o. Inv.
Aufgrund der Darstellungsweise erinnert das Stück im dreidimensionalen Bereich an die Statuette eines Gottes aus Iščali in der Diyala-Region, heute Chicago, OIM, A 7119 (Abbildung 71),45 die in die altbabylonische Zeit datiert wird. Dargestellt wurde ein Gott mit vier Gesichtern in der Anordnung Tetraprosopos. Der Gott weist einen menschlichen Körper ohne besondere 43 Publiziert von NUNN 1992, 143 f., Tf. 60. 44 Vgl. die Überlegungen von NUNN 1992, 143. 45 Publiziert von FRANKFORT 1943, 21 f.; 1954, Tf. 66; HILL u. JACOBSEN 1990, 100–104, Tf. 26 f.; HROUDA 1991, 229; ORTHMANN 1975, Nr. 165b; ROAF 1992, 77; SUSMILCH 1982, 78 f. Das Stück ist 17,3 Zentimeter hoch und wurde aus Bronze gegossen.
36
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
Attribute auf. Der linke Arm ist an die Brust gelegt, der rechte hängt am Körper herab und hält eine Waffe, bei der es sich möglicherweise um eine Axt handeln könnte, in der Hand. Bekleidet ist er mit einem langen Gewand aus Schafsfell, welches in Falten um den Körper fällt, aus dem die nackten Füße herausschauen. Auf dem Rücken hängt eine Schlange mit dem Kopf nach unten und reicht der Figur bis zu den Knöcheln; wobei die Figur selbst wiederum auf einem Widder steht, der auf einer schmalen Basisfläche liegt. Aufgrund der Gemeinsamkeiten, speziell was die Gestaltung der Gesichter an einem Kopf anbetrifft, und den beiden Datierungsansätzen wäre eine Beeinflussung vertretbar – wenn man das Objekt aus Tokio nicht als verschleppt bezeichnen möchte, wogegen aber die Beobachtungen von Astrid NUNN sprechen würden.46 Direkt bei der Statuette Chicago, OIM, A 7119 wurde diejenige einer viergesichtigen Göttin gefunden, die sich heute ebenso in Chicago, OIM, A 7120, befindet.47 Die vier weiblichen Gesichter schauen jeweils in eine Himmelsrichtung und weisen keine besonderen Attribute auf. Das Wesen wurde mit einem menschlichen Körper ohne besondere Merkmale dargestellt. Bekleidet ist es mit einem Gewand, das in Falten bis zum Boden herabfällt. Beide Arme sind zur Brust gestreckt und halten ein Gefäß in den Händen, aus dem Wasser tritt. An den Handgelenken trägt es Ringe. Das Stück wurde im Fundort „Serai“, Raum 7-R.35 gefunden. Dabei handelt es sich um einen großen Raum in einem Privathaus aus der Herrschaft von Ibal-pî-el II. Die Statuetten wurden unter dem Fußboden deponiert; entweder geschah dies aus Gründen eines Schutzrituals für den Raum, wie sie z. B. mit dem mehrgesichtigen Stück New York, MMA, 57.27.12 (ND 5296) aus neuassyrischer Zeit vorliegt, oder der Eigentümer wollte sein Gut in Sicherheit wissen. Als Identifikation der Göttin der Statuette aus Iščali, heute Chicago, OIM, A 7120 wurde in der Forschung Ninhursang oder Nintu(r) vorgeschlagen,48 während die Gleichsetzung des viergesichtigen Gottes mit Marduk abgelehnt werden kann. Da es im Flachbild nicht möglich ist, vier Gesichter an einem Haupt darzustellen, wäre für das Stück in Tokio, Ancient Orient Museum (Abbildung 26) anzunehmen, dass es sich eigentlich um eine viergesichtige Gottheit handelt, die mit den angesprochenen Stücken Chicago, OIM, A 7119 (Abbildung 71) und A 7120 im dreidimensionalen Raum mit vier Gesichtern dargestellt wurde.49 Das vierte Gesicht konnte aus Gründen der Darstellungsmöglichkeiten im Flachbild nicht abgebildet werden. Der Bezug zum mesopotamischen Raum ist offensichtlich. Dass es sich explizit um drei bzw. vier Gesichter an einem Kopf handeln soll, wird mit einem Vergleich zu einer Darstellung auf einem Terrakottarelief deutlich. Dieses befindet sich heute in Bagdad, Iraq-Museum, 9574 (Abbildung 27).50 Das Stück stammt wahrscheinlich aus Ešnunna/ Tall Asmar im Diyala-Tal und wird ebenso in die altbabylonische Zeit datiert. Dargestellt wurde eine im Falbelkleid bekleidete Göttin, die insgesamt drei Köpfe besitzt. Aus beiden Schultern tritt hier jeweils ein menschlicher Kopf aus, wobei es sich wohl um Männerköpfe ohne besondere Attribute handelt.51 Durch die Ausführung dürfte klar werden, dass das Motiv einer 46 Vgl. NUNN 1992, 143. 47 HILL u. JACOBSEN 1990, 100, Tf. 28 f.; FRANKFORT 1954, Tf. 66; SUSMILCH 1982, 78 f. Das Stück ist 16,2 Zentimeter hoch und wurde aus Bronze gegossen. 48 Vgl. SEIDL 1989, 200 f. 49 Zwar wurde von BUCHHOLZ 2000, 62 und JACOBSEN 1990, 101–104 vorgeschlagen, das Wesen als Marduk nach Enūma elîš I, 95 und 97 f. zu identifizieren, was aber aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Gesichter, die im Text genannt werden, wohl kaum möglich ist; vgl. den Text bei KÄMMERER u. METZLER 2012, 134. 50 Publiziert von KEEL 1980, 182 f. (Nr. 277a); OPIFICIUS 1961, 76 (Nr. 224). Das Stück ist lediglich 11 Zentimeter hoch. Das Relief ist mit Paris, Louvre, AO 12442 praktisch identisch, siehe OPIFICIUS 1961, 76 (Nr. 225); SCHROER 2008, 164 f. (Nr. 383). Hierzu ist noch ein Reliefbruchstück mit unbekannter Herkunft in der Slg. Hartmut Schmökel zu rechnen, siehe OPIFICIUS 1961, 76 (Nr. 226). 51 Vgl. SEIDL 1989, 200.
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
37
dreigesichtigen und einer dreiköpfigen Gottheit klar voneinander zu separieren ist. Durch die Darstellung zweier Ω-Symbole auf dem Relief Bagdad, Iraq-Museum, 9574 dürfte Ninhursang oder Nintu(r) dargestellt sein, für die das Ω-Symbol gewöhnlicherweise auf Kudurru steht.52 Eine Gleichsetzung mit Ištar erscheint nicht möglich, da die Göttin den textlichen Quellen zufolge nur über zwei Gesichter verfügte.
Abbildung 27: Terrakottarelief Bagdad, Irak-Museum, IM 9574
Vier weitere Belege für mehrgesichtige Wesen aus der Levante stammen aus der Zitadelle von Amman in Jordanien. Es handelt sich hierbei um vier schlecht erhaltene Göttinnenköpfe, die jeweils mit zwei Gesichtern dargestellt wurden.53 Die Augen wurden eingelegt und fein bemalt. Die Perücke wurde als aus zehn breiten Haarsträhnen bestehend dargestellt. Über der Stirn zu den Ohren hin laufend befindet sich ein Band. Auf der Oberseite des Kopfes befindet sich jeweils ein Loch, so dass in der Antike etwas auf den Köpfen angebracht worden war. Bisher existieren aus dem syrisch-palästinischen Bereich keine vergleichbaren Objekte. Als eine Deutung wurde von TELL eine Wiedergabe der Göttin Ištar vorgeschlagen, die einen Tempel in der Stadt gehabt haben könnte.54 Die Erscheinungsform mit zwei Gesichtern
52 Vgl. SEIDL 1989, 200 f. 53 Objekt 1: 29,3 Zentimeter hoch und 20,6 Zentimeter breit, mit einem Loch auf der Oberseite des Kopfes von 3,7 Zentimeter Durchmesser bei einer Tiefe von 3,8 Zentimeter, publiziert von CAMR 1988, 56 f. (Nr. 1); Objekt 2: 30,3 Zentimeter hoch und 25 Zentimeter breit, mit einem Loch auf der oberen Kopfseite von 4,2 × 3,4 Zentimeter, publiziert von ibd., 174, 57 f. (Nr. 2); Objekt 3: 30,4 Zentimeter hoch und 24,2 Zentimeter breit, das Loch auf der oberen Kopfseite misst 4,2 × 3,6 Zentimeter, publiziert von ebd. 174, 58 (Nr. 3); Objekt 4: 30 Zentimeter hoch und 22,2 Zentimeter breit, da der Kopf schwer beschädigt ist, bleibt unklar, ob dieser auch ein Loch auf der Oberseite aufwies, publiziert von ebd. 174, 59 (Nr. 4). 54 Zitiert bei CAMR 1988, 55.
38
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
wird für die Göttin einmal in VAT 8917 = KAR 307, 19–21 beschrieben, wonach sie vier Augen und vier Ohren besessen haben soll. 19 d
[ ]Ištar ša URUDurna Tiāmat šī mušēniqtu ša dBēl šīma 20[4 īnāt]uša 4 uznātuša e[lât]iša dBēl šaplātiša dNinlil „Ištar von Durna ist Tiāmat; sie ist die Amme von Bēl und [vier sind] ihre [Auge]n (und) vier sind ihre Ohren. Ihr o[be]res ist Bēl, ihr unteres Ninlil.“55 12
Demnach besaß die Ištar von Durna zwei Gesichter. Wichtig ist auch darauf hinzuweisen, dass ihr Körper als unten weiblich und oben männlich beschrieben wird.56 Nach ABRT 1, VII, 6 (K. 1286) war die Göttin bärtig,57 so dass zumindest eines der Gesichter als das eines Mannes charakterisiert wurde, woraus sich die Vorstellung eines Diprosopos ergibt, da das andere ihrer Gesichter folgerichtig weiblich war.58 Vergleichbar wird dies allegorisch auch in KAR 307, Rs. 3 ausformuliert, da hier der Tigris (ÍDIdiglat) ihre beiden rechten Augen und der Euphrat (ÍDPurattu) ihre beiden linken Augen sein sollen, womit sich ebenfalls wieder ein doppelgesichtiges Wesen ergibt.59 Sie wird in KAR 307, 19 mit Tiāmat verglichen, was einen Bezug zur doppelgesichtigen Form dieser Göttin zieht und sich so von einer Übernahme ausgehen lässt. Somit wäre es zwar möglich, die doppelgesichtigen Göttinnenköpfe als Ištar zu deuten, allerdings wäre in diesem Fall auch darauf hinzuweisen, dass nach dem oben genannten Beleg eben eines ihrer Gesichter das eines Mannes sein sollte, was in den Funden aus Amman nicht der Fall ist. Abdel-Jalil CAMR wollte in den Köpfen aus der Zitadelle von Amman die Dualität von Isis und Nephthys erkennen.60 Diese These vermag anhand des Materials nicht zu überzeugen, darüber hinaus fehlen Darstellungen dieses Typus für Isis und Nephthys aus Ägypten völlig. Die von CAMR genannten Quellen zeigen so auch kein einziges Mal die beiden Geschwistergottheiten als ein einziges Wesen; die ebenso als Parallele herangezogene Darstellung einer weiblichen Gottheit mit den beiden Gesichtern eines Löwen und eines Krokodils, wie sie z. B. auf Sarg Leiden, AMM, 16 aus der 21. Dynastie (Abbildung 28) oder dem Papyrus des NÈ-p#q#+-Sw.t¦, Pap. Paris, Louvre, E 17401, aus der Ptolemäerzeit vorliegt,61 kann aus dem simplen Grund der verschiedenen Gesichter als Parallele ausgeschlossen werden.
55 Publiziert von LIVINGSTONE 1989, 99 und EBELING 1931, 32. Generell zu ihrem Wesen BALZCOCHOIS 1992 und COLBOW 1991. 56 Hierzu speziell GRONEBERG 1986, 25–46. 57 Siehe den Text bei CRAIG 1895, Nr. VII, Z. 6. 58 Bei der auf der Tafel Ass. 2001.D-1500+1515, die in das 13. Jhd. v. Chr. datiert, in einer Siegelabrollung gezeigten Göttin mit zwei Gesichtern liegt der erste Beleg für diesen Typus im assyrischen Kulturkreis vor, wobei es sich bei der dargestellten Göttin um Ištar-Aššurītu handeln könnte, siehe FRAHM 2002, 66–68. Hier sind aber nur zwei weibliche Gesichter dargestellt. In SpTU I, 50, 11f. aus spätbabylonischer Zeit wird eine zweigesichtige, Statuette aus mesu-Holz genannt, die vorne ein männliches und hinten ein weibliches Gesicht aufweisen soll, vgl. HUNGER 1976, 60. 59 Publiziert von EBELING 1931, 35. So vielleicht auch in VAT 9947, Z. 17 bei ibd. 39. 60 Vgl. CAMR 1988, 59–63. 61 Publiziert von PIANKOFF u. RAMBOVA 1957, Tf. 9; SEEBER 1976, 119. Hierzu liegen mannigfaltige weitere Parallelen aus Ägypten vor, wie z. B. auf Sarg Kairo, Äg. Mus., CG 6008 aus der 21. Dynastie, publiziert von CHASSINAT 1909, 30, Abb. 27; im Tempel von Hibis, Oase Charga aus der Zeit von Dareios’ I., publiziert von DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 2, 9; oder auf der Metternichstele, New York, MMA, 50.85 aus der Zeit des Nektanebos, publiziert von GOLÉNISCHEFF 1877, Tf. 3.
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
39
Abbildung 28: Göttin mit zwei Gesichtern auf Sarg Leiden, AMM, 16
Anders brachten Rudolph DORNEMANN und Fawzi ZAYADINE die doppelgesichtigen Köpfe aus Amman mit Hathor in Verbindung.62 Zwar ist die Beschreibung wie die Darstellung der Hathor mit vier Gesichtern die häufigste, die sich so noch in römischen Tempeltexten finden lässt,63 doch weisen die Darstellungen aus Amman deutliche Analogien zu Hathorkapitellen in Sarabit al-Chadim auf dem Sinai auf, die mit zwei oder mit vier Gesichtern dargestellt wurden und aus dem 15. Jhd. v. Chr. stammen.64 Hierbei ist speziell die Gestaltung von Kapitellen in Form des Janiceps als deutliche Parallele heranzuziehen. In etwa kontemporär zu den Stücken aus Amman sind Kapitelle aus Bubastis entstanden, die in die Zeit der 22. und 23. Dynastie datiert werden.65 Von der Art der Darstellung her wie auch vom Vergleichsmaterial scheinen die Köpfe aus Amman somit entweder die ägyptische Göttin Hathor zu verkörpern, oder zumindest ikonografisch von dieser beeinflusst worden zu sein. Bei einem weiteren Objekt ist die antike Provenienz, da das Stück aus dem Kunsthandel stammt, nicht gesichert. Aufgrund der Ausführung könnte man an eine Herkunft aus dem syrisch-palästinischen Raum denken, genauso gut wäre aber auch eine Herstellung in Mesopotamien denkbar. Es handelt sich um die Votivfigur einer Gottheit (Abbildung 29), die auf etwa 2000–1500 v. Chr. datiert wird.66 Das Stück ist 19,7 Zentimeter hoch und wurde aus Ton modelliert. Die Frage muss offenbleiben, ob es sich hierbei wirklich um eine als dreiköpfiges Wesen gedachte Gottheit handelt, oder ob diese lediglich zwei Vögel auf ihren Schultern sitzen hat.
62 Vgl. DORNEMANN 1983, 161 und ZAYADINE 1973, 34 f.; weitere Deutungen bei CAMR 1988, 55. 63 Vgl. hierzu DERCHAIN 1972, 3–6, wie sie mit vier Gesichtern z. B. in Dendara I, 98, 8; II, 212, 6; III, 157, 9 f.; 175, 1 f.; IV, 250, 7; IX, 29, 15; oder in Philä II, 423, 14, siehe JUNKER u. WINTER 1965, 423, 14 angesprochen wird. 64 Siehe FLINDERS PETRIE 1906, Abb. 95, 100–104; SCHROER 2011, 212 f. (Nr. 742). 65 Vgl. BERNHAUER 2007, 53–65; PINCH 2006, 202–204; YASUOKA 2016, 85. 66 Auktion Sotheby’s 1980, 16. Mai, Nr. 101 bei SOTHEBY’S 1980, Nr. 101.
40
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
Abbildung 29: Dreiköpfiges Wesen, Auktion Sotheby’s 1980, 16. Mai, Nr. 101
Neben den genannten Wesen sind aus der zweiten Hälfte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends aus dem nordsyrischen und südtürkischen Raum Siegelabrollungen bekannt, die Wesen mit zwei Köpfen zeigen. Vom Tell Atšana, dem antiken Alalaḫ, stammt aus Schicht IV, Raum 10 ein Siegel, welches sich heute in Antakya, Arch. Mus., Inv. 8832 befindet (Abbildung 30).67 Dargestellt wurde hier eine anthropomorphe Entität mit zwei Köpfen und zwei Flügeln, wobei unklar bleibt, welche Tiere die Köpfe eigentlich darstellen sollen. Am Hals weist das Wesen mehrere Ausbuchtungen auf. Das Wesen ist bekleidet und hält in seinen Händen jeweils ein Tier, das mit seinem Kopf nach unten hängt, womit das zweiköpfige Wesen somit als Bezwinger der Tiere dargestellt ist. Ebenfalls vom Tell Atšana, Schicht XII, stammt ein Siegel, das einen doppelköpfigen Vogel mit zwei Schwingen zeigt (Abbildung 31).68 Die Flügel wurden hier recht elaboriert ausgeführt, doch muss offenbleiben, welche Spezies die Köpfe genau dar67 MATTHEWS 1990b, Nr. 590 und COLLON 1975, Tf. 13, 45 (Nr. 218). Als Parallelen zur Darstellung können Berlin, Vorderas. Mus., VAT 9009 bei BERAN 1957, 144f., Abb. 2; MARZAHN 2003, 162; MATTHEWS 1990b, Nr. 476; WEBER 1920, Abb. 316a; VA 2722 bei MOORTGAT 1940, 138 (Nr. 584) (vgl. hierzu auch S. 57); London, BM, 22433 bei MATTHEWS 1990b, Nr. 146 und STIEHLER-ALEGRIA DELGADO 1996, Nr. 294 genannt werden. Die Köpfe sind in den genannten Fällen klar als Löwen zu erkennen. 68 FUHR-JAEPPELT 1972, 198f. (Abb. 203). Bei dieser Darstellung dürfte der doppelköpfige Löwenadler gemeint sein, wie er von Ilse FUHR-JAEPPELT gesammelt beschrieben wurde. Die anderen Darstellungen von Tell Atšana entsprechen diesem Typus aber nur rudimentär, da die Köpfe anders gestaltet wurden. Zur Darstellungsweise kann auch auf ein Siegel mit einem doppelköpfigen Vogel, heute Berlin, Vorderas. Mus., 3605, hingewiesen werden, dass bereits aus der Akkadezeit stammt, siehe MOORTGAT 1940, 105 (Nr. 243); vergleichbare Darstellungen liegen bei MATTHEWS 1990b, Nr. 135; STEIN 1988, 191 (Abb. 6); STIEHLER-ALEGRIA DELGADO 1996, 215 (Nr. 275 f.), 224 (Nr. 344) vor.
3.3 Von der Mittelbronzezeit zum ersten vorchristlichen Jahrtausend
41
stellen sollen. Desgleichen stammt aus dem genannten Fundort ein weiteres Siegel, dass sich heute in Antakya, Arch. Mus., Inv. 10120 befindet (Abbildung 32).69 Bei diesem Wesen erinnern die Köpfe aber mehr an die von Krokodilen als an Vogelköpfe. Der Körper und die Flügel wurden mit einigen angedeuteten Federn dargestellt. Auffallend ist, dass der rechte Hals bis zum Kopf mit Linien versehen ist, während der linke Hals nur bis zu etwa einem Drittel mit Linien gestaltet wurde. Die Siegel weisen aufgrund ihrer Gestaltung deutlich mesopotamische Einflüsse auf.70
Abbildung 30: Darstellung des Siegels Antakya, Arch. Mus., Inv. 8832
Abbildung 31: Darstellung des Siegels aus Schicht XII von Tell Atšana
Abbildung 32: Darstellung auf dem Siegel Antakya, Arch. Mus., Inv. 10120
Aus dem syrisch-palästinischen Raum sind ebenfalls Münzen erhalten,71 die mit der Thematik der Mehrgesichtigkeit in Verbindung stehen und deren Gestaltung eventuell auch einen gewissen Einfluss auf die späten Belege ausgeübt haben könnte. So existiert z. B. aus Ašdod eine Drachme, die in das vierte Jahrhundert v. Chr. datiert wird.72 Auf der Vorderseite wurde eine Gottheit dargestellt, bei der es sich eventuell um Athena handeln könnte; auf der Rückseite befindet sich die Abbildung eines Januskopfes, der ein Horusauge auf seinem Kopf aufweist. Ein weiterer typischer Janiceps liegt auf einer weiteren Münze aus Ašdod vor.73 Vergleichbar zeigt eine andere Münze, die nur grob zwischen die Mitte des fünften und dem Ende des vierten Jahrhunderts v. Chr. datiert wird, eine Art von Janiceps.74 Hierbei schaut das rechte Gesicht nicht wie in anderen Darstellungen dieser Art typisch auch nach rechts, sondern blickt den Betrachter direkt an. Als Fundregion dieser Münze wird nur der palästinische Raum generell angeführt. Eine Münze aus Aškalon aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. zeigt zwei Pferde in der Ordnung Ischiopagos,75 wie diese Art der Darstellung aus der Region bereits aus der Frühbronzezeit bekannt ist (s. S. 28 f.).
69 FUHR-JAEPPELT 1972, 199 (Abb. 207) und COLLON 1987, 42f. (Nr. 142); hergestellt aus schwarzem Stein; Größe 3,1 × 1,6 Zentimeter. 70 Speziell zum doppelköpfigen Vogel vgl. die in Anm. 67 oben genannten Beispiele. 71 Grundlegend sei hier auf GITLER u. TAL 2006 und WACKS 2021 verwiesen. 72 GITLER u. TAL 2006, Nr. II.13D; GALST u. VAN ALFEN 2013, 502, Nr. XIV.2. 73 GITLER u. TAL 2006, Nr. II.5D. 74 GITLER u. TAL 2006, Nr. XVII.8D. 75 GITLER 1996, 6, Nr. H.
42
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
3.4 Zusammenfassung Anhand der Quellenlage zeigt sich, dass im syrisch-palästinischen Raum in der Antike mehrköpfige Tiere oder Götter zwar einerseits bekannt waren, diese aber offenbar kaum eine größere Rolle gespielt haben, da man sonst sicher von weitaus mehr Quellen in schriftlicher oder ikonografischer Form ausgehen könnte. Als Beginn der Mehrköpfigkeit in dieser Region konnte die Zeit des Chalkolithikums definiert werden – die Interpretation von Sitzstatuen aus cAyn Gazal in Jordanien konnte naheliegender als ein unter einem Mantel zusammensitzendes Ehepaar ausgelegt werden. In der Zeit zwischen dem frühen bis mittleren Chalkolithikum zwischen 4500–4000 v. Chr. erscheinen Prestigeobjekte wie ein Szepter mit fünf Köpfen, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–88 (Abbildung 7),76 ein Stabaufsatz mit zwei Köpfen, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–119,77 oder ein Stab mit drei Steinbockköpfen, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–86,78 als die ersten Belege für Kombinationen von multiplen Häuptern. Es ist anzunehmen, dass derartige Objekte einen Einfluss auf die Gestaltung von Wesen mit mehreren Häuptern ausgeübt haben. Dies dürfte besonders mit der Krone aus der Schatzhöhle von Naḥal Mišmar, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–177 (Abbildung 8),79 zu verdeutlichen sein, da sich in diesem Fall die multiplen Häupter bereits am Kopf des Trägers befinden bzw. an einem Objekt am Kopf angebracht sind. In einem weiteren Schritt wurde dann der ‚Zwischenschritt‘ Krone oder Stab einfach weggelassen und die Köpfe direkt mit dem Gott oder mit dem Menschen selbst verbunden. Zwischen diesen Funden und den chronologisch folgenden Siegelabrollungen liegt mehr als ein Jahrtausend. Die Doppelwesen in der Form eines Ischiopagos liegen in wenigen Fällen aus der Frühbronzezeit I und II vor. Diese Darstellung lässt sich sehr gut mit einer realen Beobachtung aus der Natur erklären, in der zwei Tiere an ihrem Hinterleib zusammengewachsen sind. In der Natur erscheint zum einen die Form des Pygopagos,80 bei der die Zwillinge am Steiß verbunden sind. Die andere Form ist der Ischiopagos, bei der die beiden Wesen am Unterbauch verschmolzen sind, wobei die unteren Extremitäten von beiden Kindern vorhanden sein können, was aber nicht der Fall sein muss.81 Für die Darstellungen auf Siegeln konnte mehrheitlich der Ischiopagos herausgearbeitet werden. Die Abbildung einer Antilope mit zwei Köpfen auf einem Siegel aus Gabal Aruda (Abbildung 10)82 zeigt klar einen Dikephalos diauchenos, wie er für viele Tiere und Menschen medizinisch nachgewiesen ist (vgl. Kap. 2.2.2). Dementsprechend ließen sich die Darstellungen auf den frühen Siegelabrollungen mit dem Eindruck erklären, welche derartige Neugeburten auf ihre Betrachter gemacht haben müssen. Elaborierte Wesen erscheinen das erste Mal auf dem Silberbecher aus cĒn Sāmiye, heute Jerusalem, IMJ, IAA, K 2919 (Abbildung 22),83 auf dem ein Kentauros mit zwei Gesichtern und zwei Unterleibern dargestellt wurde. Das Stück kann auf die Zeit zwischen 2300–2000 v. Chr. datiert werden. Diesen doppelköpfigen Kentauros kann man durchaus als Gott ansprechen,
76 BAR-ADON 1980, 42–45 (Nr. 17); KATZ, KAHANE u. BROSHI 1968, 50 f. und SCHROER u. KEEL 2005, 118 f. (Nr. 52) mit weiterer Literatur. 77 BAR-ADON 1980, 100 f. (Nr. 153) und SCHROER u. KEEL 2005, 118 f. (Nr. 51) mit weiterer Literatur. 78 BAR-ADON 1980, 47 (Nr. 19) und SCHROER u. KEEL 2005, 124 f. (Nr. 60) mit weiterer Literatur. 79 BAR-ADON 1980, 24–28 (Nr. 7); KATZ, KAHANE u. BROSHI 1968, 38 f. und SCHROER u. KEEL 2005, 130 f. (Nr. 68) mit weiterer Literatur. 80 Dies tritt auch bei Menschen auf, siehe z. B. GUPTA 1966; JAIN et al. 2014; MCDOWELL et al. 2003; SPENCER 2003, 348–314 81 So z. B. als tripus oder tetrapus belegt, siehe z. B. EADES u. THOMAS 1966; HUNG et al. 1986; MESTEL et al. 1971. 82 TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2c). 83 BUCHHOLZ 2000, 58, Abb. 5e; SCHROER u. KEEL 2005, 324 f. (Nr. 231) mit älterer Literatur; YADIN 1971.
3.4 Zusammenfassung
43
womit in der Frühbronzezeit IV das erste Mal im syrisch-palästinischen Raum ein Gott mit mehreren Gesichtern sicher nachgewiesen werden kann, da es sich bei den Funden vorher entweder nur um Prunkobjekte oder um Darstellungen von Tieren handelt. Aus der Zeit um 2000–1500 v. Chr. liegt dann auf einem Relief in Tokio, Ancient Orient Museum, o. Inv. (Abbildung 26) die Darstellung einer dreigesichtigen Gottheit vor,84 die aufgrund ihrer singulären Erscheinung in der Region wohl sicher von mesopotamischen Objekten bzw. Vorstellungen beeinflusst worden ist. Als zeitgleiche Parallelen im dreidimensionalen Raum konnten die Statuetten Chicago, OIM, A 7119 (Abbildung 71) und A 7120 genannt werden, die in die altbabylonische Zeit datieren. Es ist davon auszugehen, dass es sich auf dem Relief Tokio, Ancient Orient Museum, o. Inv. eigentlich um die Wiedergabe von vier Gesichtern handelt, die im Flachbild aber nicht dargestellt werden konnten. Für die vier Göttinnenköpfe von der Zitadelle von Amman, die jeweils mit zwei Gesichtern dargestellt wurden,85 konnte eine Beeinflussung durch Hathorkapitelle, wie sie z. B. auf dem Sinai belegt sind, deutlich gemacht werden. Aufgrund fehlender weiterer Parallelen konnten andere Deutungen, wie sie in der Literatur z. B. mit Isis und Nephthys oder Ištar vorgebracht wurden, abgelehnt werden. Das Motiv einer doppelgesichtigen Göttin liegt ebenso bereits aus der späten Bronzezeit IIB um 1200 v. Chr. mit dem Stück Jerusalem, Rockefeller Museum, IAA 43–162 vor.86 Es handelt sich hierbei um einen Becher, der in Tel Abu Ḥawam beim heutigen Haifa gefunden wurde, der die als solche bezeichnete Fürstin mit dem hohen Polos als Gestaltungsmerkmal aufweist. Man konnte aus ihrem Polos trinken, wobei beide Gesichter in Form eines Janiceps unterhalb des Polos ausgeführt wurden. Aus dem ersten Jahrtausend ist im Flachbild nur einmal ein doppelgesichtiger Bacal als Diprosopos auf einem Stelenfragment des Barrakab aus dem achten Jahrhundert dargestellt,87 auf den in Kapitel 4.1.4 genauer eingegangen wird. Insgesamt betrachtet ist die Fundlage aus dem syrisch-palästinischen Raum recht schmal, wenn man bedenkt, dass zwischen den ersten Funden aus dem Chalkolithikum und den letzten Belegen im ersten vorchristlichen Jahrtausend etwa fünf Jahrtausende Geschichte liegen. Mehrköpfige Wesen scheinen dementsprechend keine wichtige Rolle gespielt zu haben, sieht man einmal von ihrem Fungieren im Götterkampf, wie er in Ugarit ab etwa 1500 v. Chr. belegt ist, ab. Das Auftreten einer siebenköpfigen Schlange kann direkt auf ältere mesopotamische Mythen zurückgeführt werden, wie es in der Betrachtung der Motivgeschichte der siebenköpfigen Schlange in der Offenbarung in Kapitel 4.2.3 gezeigt wird. Für viele der Funde konnte ein direkter Einfluss durch andere Kulturen als nicht zwangsläufig abgelehnt werden, obwohl dieser in der Literatur oft postuliert wurde. Viele der genannten Belege wie z. B. die Doppelwesen erscheinen in etwa zeitgleich im gesamten Vorderen Orient, ohne dass man einen Ursprung festlegen könnte. Dies könnte aber auch ein Problem der Quellenlage sein, so dass potentiell durch neue Funde hier genauere Aussagen möglich sein werden. Viele der spezifischen Identifikationen mit Göttern aus dem ägyptischen oder mesopotamischen Pantheon konnten als nicht stichhaltig zurückgewiesen werden, wobei bei einigen Darstellungen durchaus von eigenständigen Kreationen im syrisch-palästinischen Raum der Antike gesprochen werden kann. Auf einen weiteren Fund, der aus viel früherer Zeit stammt, kann in diesem Zusammenhang ebenso hingewiesen werden. Bereits aus der Magdalénien-Zeit im Oberen Jungpaläolithikum ist ein Objekt erhalten geblieben, welches drei Pferdeköpfe, die in verschiedene Richtungen
84 NUNN 1992, 143 f., Tf. 60. 85 CAMR 1988, 174, 56–59 (Nr. 1–4). 86 SCHROER 2011, 380 f. (Nr. 954). 87 BOSSERT 1959, Tf. 2; DONNER u. RÖLLIG 1969, Tf. 12, Nr. 217; KEEL 1977, 224 f., Abb. 176; YADIN 1970, 209 f.
44
3. Mehrköpfigkeit im syrisch-palästinischen Raum
schauen, kombiniert.88 Allerdings muss hier die Frage gestellt werden, ob es sich wirklich bereits in dieser Stufe der menschlichen Entwicklung um die Darstellung eines Wesens in Form eines Trikephalos handeln soll, oder ob drei Pferde nebeneinander als unterschiedliche Wesen abgebildet wurden.89 Die oben genannten Funde aus dem Vorderen Orient sind, zumindest was ihre Darstellungsweise angeht, hier definitiv eindeutiger.
88 Siehe die Abbildung bei GIEDION 1962, 253; heute befindet sich das Objekt im Museum St. Germainen-Laye. 89 WENGROW 2014, 71–73 führt die Entstehung von Mischwesen auf die Kunst des Siegelschneidens zurück, da in einer urbanen Gesellschaft mehr Siegel benötigt wurden, als Tiere etc. als Vorlagen vorhanden waren, wurden diese zu immer neuen Wesen kombiniert, um den Eigentümer sicher identifizieren zu können.
4 Mehrköpfigkeit in der Bibel In Kapitel 3 konnte für den syrisch-palästinischen Bereich in der Antike herausgestellt werden, dass sich, soweit sich dies aufgrund der verstreuten Funde sagen lässt, Tiere oder Götter mit mehreren Gesichtern oder Köpfen offenbar in Etappen entwickelten. Diese speziellen Erscheinungsformen scheinen allerdings kaum eine größere Rolle gespielt zu haben, da sonst mit zahlreicheren Darstellungen z. B. auf Siegeln oder Amuletten zu rechnen wäre. Diese Sicht kann auch auf die Bibel übertragen werden, in der die Erscheinungsform eines mehrgesichtigen oder mehrköpfigen Wesens nur in wenigen Stellen thematisiert wird. Es dürfte wohl unstrittig sein, dass die Grundschriften des Alten Testaments – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in und um den Bereich des heutigen Israel entstanden sind. Für viele der neutestamentlichen Schriften werden andere Entstehungsorte angenommen, wie sie z. B. in Ägypten oder Anatolien verortet werden. Hiermit wird deutlich, dass auch alt- und neutestamentliche Beschreibungen von Entitäten mit mehreren Gesichtern oder Köpfen im gleichen Kulturkreis entstanden sind und mit dem kulturhistorischen Horizont des Vorderen Orients in Verbindung zu bringen sind. Diese Gemeinsamkeiten der lokalen Entstehung und deren Beziehung zu denselben Kulturen verbinden die Bereiche Archäologie und Quellen aus der Bibel. Wenn im Folgenden Darstellungen oder Texte zu biblischen Büchern genannt werden, die aus anderen altorientalischen Kulturkreisen stammen, sollen diese primär nur als Parallelen verstanden werden. Wenn von einer direkten Abhängigkeit aufgrund der spezifischen Darstellung ausgegangen werden kann, wird hierauf explizit hingewiesen und diese Anlehnung motivgeschichtlich weiter untersucht und beleuchtet. Oftmals sind für die Postulierung einer direkten Abhängigkeit die zeitlichen Abstände zu groß; wie aber gezeigt werden kann, sind wenige Bilder bzw. Darstellungsmuster im kulturellen Gedächtnis so verankert, dass sie als Gemeingut Vorderasiens gelten können und in einem gewissen Maß sicher auch Beeinflussungen vorliegen. Es handelt sich dementsprechend bei vielen Bildern bzw. Themen wohl vielmehr um Parallelen als um direkte Vorbilder. Aus dem syrisch-palästinischen Bereich sind bisher keine Omentexte bekannt, in denen das Auftreten von Mehrköpfigkeit bei Mensch und Tier thematisiert und gedeutet werden,1 wie es in sehr vielen Belegen aus Mesopotamien der Fall ist.2 Dies lässt sich für den alttestamentlichen Befund damit erklären, dass Divination nach Lev 19, 26 wie auch die Totenbeschwörung nach Lev 19, 31 und 20, 6.27 sowie Dtn 18, 10 f. verboten war.3 In Jes 57, 3–5 wird gar die Divination mit Kinderopfern verglichen. Die Texte legen nahe, dass es in vorexilischer Zeit sicher Omendeutungen gab, von denen man sich aber streng abgrenzen wollte.4 Die einzigen bisher bekannten Listen von Omina liegen mit den Rollen 4Q318 und 4Q186 aus Qumran vor.5 Aufgrund von Parallelen aus Mesopotamien wäre zu vermuten, dass in den älteren Omentexten
1 2
3
4 5
Als einführende Literatur zum Thema Divination und Orakel im antiken Israel seien LANGE 1997; 2008; CRYER 1994; JEFFERS 1996 und B. B. SCHMIDT 1994 genannt. Hier sei nur auf die vielfältigen Nennungen in den Omenserien Šumma ālu ina mēlê šakin und Šumma izbu verwiesen, siehe die Publikationen von FREEDMAN 2006; LEICHTY 1970; 2005; DE ZORZI 2014. Neben verschiedenen Missbildungen von multiplen Körperteilen Neugeborener werden in diesen Serien auch Abnormitäten beim Aussehen erwähnt. Zur bekannten Totenbeschwörung von Samuel durch die Priesterin von cĒn-Dor siehe GASS 2012; KLEINER 1995 und B. B. SCHMIDT 2002, 111–120. Generell zum Magieverbot SCHMITT 2004, 335– 346. Vgl. LANGE 2007, § 1.2. Zu den beiden Texten ALBANI 1993; 1999; GREENFIELD u. SOKOLOFF 2000 und JACOBUS 2010; 2014, 5 f., 155–157.
46
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
auch mehrköpfige Kinder oder Tiere thematisiert wurden, wobei diese Annahme aber bis auf weiteres spekulativ bleiben muss. 4.1 Das Alte Testament 4.1.1 Das Buch Ezechiel Eine der bekanntesten Schilderungen der Bibel, in der ein Wesen mit multiplen Köpfen erwähnt wird, dürfte die Vision des Propheten Ezechiel in Ez 1 sein.6 In der heutigen Forschung wird eine Entstehung der Grundschrift des Buches in Babylon um 600–560 v. Chr. angenommen,7 wozu während des vierten Jahrhunderts v. Chr. noch Erweiterungen und Ergänzungen traten.8 Der Prophet selbst war nach Ez 1, 3 ein judäischer Priester und gehörte zu den ersten ins babylonische Exil verschleppten Personen nach der Eroberung Jerusalems am 16. März 597 v. Chr. durch Nebukadrezzar II. (605–562 v. Chr.).9 Die Vision, in der der Prophet ein mehrköpfiges Wesen beschreibt, findet sich im ersten Abschnitt des Ezechielbuches, der von Kapitel 1 bis 24 verläuft. Hier tadelt der Prophet das Volk wegen seines Unglaubens und anderer Sünden. In Kapitel 1 bis 3 wird über die Berufung des Propheten berichtet, in der Ezechiel eine Vision hat, in der ein mehrgesichtiges Wesen eine wichtige Rolle spielt. In Ez 1, 4–6 und 9b–10 wird das Gesicht durch den Propheten wie folgt beschrieben:10
lAdG" !n"[' !ApC'h;-!mi ha'B' hr'['s. x;Wr hNEhiw> ar,aew4" `vaeh' %ATmi lm;v.x;h; !y[eK. Hk'ATmiW bybis' Al Hg:nOw> tx;Q;l;t.mi vaew> `hN"hEl' ~d'a' tWmD> !h,yaer>m; hz tAYx; [B;r>a; tWmD> Hk'ATmiW5 (…) `~h,l' tx;a;l. ~yIp:n"K. [B;r>a;w> tx'a,l. ~ynIp' h['B'r>a;w6> `WkleyE wyn"P' rb,[e-la, vyai !T'k.l,b. WBS;yI-al9{ ~T'[.B;r>a;l. !ymiY"h;-la, hyEr>a; ynEp.W ~d'a' ynEP. ~h,ynEP. tWmd>W10 `!T"[.B;r>a;l. rv,n rt;aB' `Hl; byhiy> !j"l.v'w> at'w>yxel. !yviare h['B.r>a;w> HY:B;G:-l[; @A[-yDI „Nach diesem schaute ich, und siehe, ein anderes (Tier), wie ein Leopard. Es hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte vier Köpfe und Herrschaft wurde ihm gegeben.“91 Der Angelus interpres erläutert in Dan 7, 17, dass jedes der Tiere für ein Königreich stehen würde; vergleichbar wird dies in Dan 8, 21 f. ausformuliert. Leider wird im Folgenden nur eine genauere Ausdeutung des vierten Geschöpfs in Dan 7, 19–27 geboten, das dritte Tier mit seinen vier Köpfen bleibt unerläutert. Aufgrund der Aussage des Angelus interpres werden die Kreaturen in der Forschung in ihrer Reihenfolge als Abfolge von Weltreichen gedeutet. Der Löwe an erster Position wird als das Neubabylonische Reich, der Bär als das der Meder und das unbestimmte Tier an vierter Position als das Makedonenreich Alexanders des Großen interpretiert. Das dritte Tier, welches wie ein Leopard ()נָמֵ ר92 erscheint und vier Köpfe aufweist, soll in dieser Konstruktion für das Reich der Perser stehen.93 Zur genaueren Deutung bzw. Ausdeutung des mehrköpfigen Tieres wurde vorgeschlagen, dass die Häupter die vier in Dan 11, 2 genannten Perserkönige94 oder vier Diadochen95 symbolisieren sollen. Allerdings hat keine dieser speziellen Deutungen einen Rückhalt im Text selbst und es muss die Frage gestellt werden, wie selbst ein in Geschichte gebildeter Leser diesen Zusammenhang hätte herstellen sollen, wenn doch kein einziger Hinweis bei Daniel existiert, in welche Richtung die Deutung erfolgen sollte. Es muss ebenso die Frage gestellt werden, welche vier Könige der Perser denn eigentlich gemeint sein sollen bzw. welche vier Diadochen? Vom sechsten bis zum vierten vorchristlichen Jahrhundert regierten das Achämenidenreich deutlich mehr Könige wie auch nach dem Tod Alexanders des Großen am 10. Juni 323 v. Chr. unverkennbar mehr als vier Diadochenreiche entstanden.96 Zur speziellen Ausdeutung der vier Köpfe als die in Dan 11, 2 genannten vier Perserkönige, wie es z. B. Dieter BAUER vorschlug,97 sei darauf hingewiesen, dass nach Dan 11, 3 f. noch ein weiterer König im Land regieren und erst nach diesem sein Land anderen zuteilwerden wird. Dementsprechend müsste das Tier eigentlich fünf Köpfe aufweisen, wenn nach Dan 11, 2–4
91 92 93
94 95 96 97
Fortleben der vier Reiche GLESSMER 2001, wobei in den gebotene Textstellen aber keine multiplen Köpfe mehr erscheinen. Der Text folgt der Biblica Hebraica Stuttgartensia; zur Septuaginta bestehen nur wenige Unterschiede, die H.-F. RICHTER 2007, 157 zusammengestellt hat. Zur Deutung des Tiers GESENIUS 1987–2010, 820; MULDER 1998, 433. Vgl. z. B. BAUER 1996, 145–147; COLLINS 1993a, 166–170; FLUSSER 1972; LEBRAM 1984, 88 f.; LIWAK 2006, § 1; KOCH 1980, 182–205; MERTENS 1971, 136–139; MONTGOMERY 1950, 289; REDDITT 1999, 121 f.; ROLOFF 2002, 12 und H. SCHNEIDER 1954, 48. Vergleichbar werden sie auch in Dan 2 durch Metalle in einem Traum Nebukadrezzars II. symbolisiert; zum Vergleich zwischen Dan 2 und 7 siehe MAIER 1982, 263 f. Im Barnabasbrief 4, 3–5 wird zwar ein vergleichbares Tier genannt, doch erscheinen keine multiplen Köpfe, siehe ibd. 29. Bereits Herodot, Historiae I, 95 und 130 unterteilte die letzte Geschichtsepoche in die drei Reiche der Assyrer, Meder und Perser, siehe FEIX 1977, 94, 126. Eine vergleichbare Konstruktion wurde auch für Dinon von Kolophon, FGrHist 690, F1–3 bei JACOBY 1958, 522 f. angenommen, doch brachten hierzu LENFANT 2009, 60 und MADREITER 2012, 136 berechtigte Zweifel vor. Vgl. BAUER 1996, 151. Vgl. GOLDINGAY 1989, 163; hierzu auch MAIER 1982, 269 und REDDITT 1999, 121. Von vier Königen spricht auch GOETTSBERGER 1928, 54. Siehe nur die Aufstellungen bei GEHRKE 2008, 256 f., 306–308. Vgl. BAUER 1996, 151.
4.1 Das Alte Testament
63
fünf Herrscher in Persien regieren sollen.98 Ein direkter Bezug zu Kyros II. (559–530 v. Chr.), wie ihn Mathias DELCOR in Erwägung zog, da der König als „Herrscher der vier Weltgegenden“ („le monarque des quatre quartiers“) bezeichnet wurde, vermag nicht zu überzeugen, da es sich um ein generelles Epitheton mesopotamischer Könige handelt.99 Auch wurde in der Forschung ein mesopotamischer Einfluss und hier speziell der Omina aus der Serie Šumma izbu für die Vision angenommen,100 doch zeigt sich bei einer Durchsicht des Materials klar, dass zwar generell viele Missgeburten genannt werden, aber kein Omen dem bei Daniel geschilderten Wesen gleicht. In der Omenserie Šumma izbu wird einmal in Tf. VI, 50 f. ein Tetrakephalos bei einem Schaf als negatives Vorzeichen beschrieben: „Wenn ein Mutterschaf vier (Jungen) gebiert und sie sind an ihrer Schulter verbunden, dann (wird) ein Angriff von Elam (stattfinden); das Land […] (Var.Usurpator); ein Angriff von Elam […].“ Allerdings wird hier explizit darauf hingewiesen, dass die vier Lämmer an ihren Schultern verbunden sind.101 In der Serie Šumma ālu ina mēlê šakin wird in Tf. 25 f., iii, 23' einmal von einer vierköpfigen Schlange berichtet.102 „[Wenn] man [eine Schlange mit] vier Köpfen sieht, dann wird [di]eser Ma[nn] in einem Monat sterben.“ Vergleichbar ist die Aufzählung von fünf Tierköpfen in Šumma izbu, Tf. V, 25:103 „Wenn ein Mutterschaf einen Löwen gebiert und er hat fünf Köpfe, (davon) ist einer der Kopf eines Löwen, einer der Ko[pf eine Hund]es, [einer der Ko]pf einer Ziege, einer ist der Kopf eines Schweins, einer ist der Kopf einer männlichen Ziege, dann wird Chaos im Lande sein und die Edlen werden den König töten.“ Diese Aufzählung findet sich in einer Passage, in der das Mutterschaf (U8) viele verschiedene, anatomisch nicht mögliche Neugeborene wirft. Das Wesen soll der Beschreibung nach den Körper eines Löwen mit fünf Köpfen (Löwe, Hund, Schwein, Steinbock und Gazelle) aufweisen. Es dürfte klar sein, dass dies sicher nicht der Realität entsprechen kann, selbst wenn man annimmt, dass die Tierköpfe lediglich als Metaphern für missgebildete, zusätzliche Häupter des Schafs stehen sollen. Bei diesem Omen dürfte eine Vermengung mit dem Vorzeichen in Šumma izbu, Tf. VI, 53 vorliegen, wo von einem Wurf von fünf Schafen die Rede ist, von denen je ein Neugeborenes einen der oben genannten Köpfe aufweisen soll.104 Durch die gewählten Beispiele aus den verschiedenen Omenserien dürfte deutlich werden, dass in diesen keine Missbildung erscheint, die einem Leoparden mit vier Köpfen auch nur im Entferntesten gleichen 98 Es sei die Frage gestellt, was die letzten fünf Perserherrscher (Dareios II., Artaxerxes II., Artaxerxes III., Arses und Dareios III.) von den anderen abgrenzt und warum nur diese in Dan 11 eine Rolle spielen. 99 DELCOR 1971, 147. Dieses Epitheton erscheint bereits im dritten vorchristlichen Jahrtausend, siehe nur SALLABERGER 1999, 151–154, 180. 100 Vgl. z. B. PORTER 1983, 17–22. 101 Publiziert von LEICHTY 1970, 77. Überlebende Vierlinge von Schafen sind auch mit der Tafel 83-118,234, Z. 5–7 ein schlechtes Vorzeichen, siehe HUNGER 1992, 131 (Nr. 240). 102 Publiziert von FREEDMAN 2006, 112. 103 Text bei DE ZORZI 2014, 469. Entspricht dem Omen auf der Tafel New York, MMA 86.11.383A, Rs. 4'f. bei LEICHTY 2005, 190: „[Wenn ein Mutterschaf (laḫru) einen L]öw[en] (nēšu) gebiert und (dieser hat) fünf Köpfe, (wovon) einer der Kopf eines Löwen (nēšu), einer der Kopf eines Hundes (kalbu), einer der Kopf eines Schweins (šaḫû), einer der Kopf eines Steinbocks (turāḫu) (und) einer der Kopf einer [Gazelle] (ṣabītu) ist (…).“ 104 Text bei LEICHTY 1970, 89 und DE ZORZI 2014, 515.
64
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
würde. Auch wird kein Leopard oder ein vergleichbares Raubtier generell mit mehreren Köpfen beschrieben, so dass eine Rückführung des dritten Tieres aus der Vision von Daniel auf mesopotamische Omina abzulehnen ist. Wie es bereits als Vorlage für die mehrgesichtigen Wesen in der Vision von Ezechiel herausgestellt wurde, kann auch für das in Dan 7, 6 genannte Tier kein Kulturkreis bzw. ein direktes Vorbild genannt werden.105 Zwar sind wenige Parallelen zum Enūma elîš oder dem Anzu-Mythos zu erkennen, doch enthält kein mesopotamisches Werk alle Motive106 und wie gezeigt sind auch die heute bekannten Omina völlig verschieden. Zwar sind aus Ägypten und Mesopotamien in verschiedenen Belegen vierköpfige Wesen bekannt, doch erscheint aufgrund keiner direkten Parallele eine Herleitung möglich. So existiert z. B. aus dem Neuen Reich die Statuette eines Löwen mit vier Gesichtern, heute Leiden, RMO, AED. 24 (Abbildung 47)107 und zur Zeit Trajans (98–117 n. Chr.) wird einmal in situ im Tempel von Kom Ombo der Südwind als ein Löwe mit vier Köpfen dargestellt (Abbildung 48).108 Aus der frühdynastischen Zeit II liegt ein Siegel mit unbekannter Herkunft aus Mesopotamien vor (Abbildung 49), das einen vierköpfigen Löwen zeigt, der gerade von zwei Helden mit Speeren angegriffen wird.109 Doch weisen die genannten Beispiele wieder Unterschiede zu Dan 7, 6 auf wie auch eine chronologische Diskrepanz besteht. Auch wurde eine Herkunft apokalyptischer Motive aus Ägypten erwogen, wie sie von Jürgen-Christian LEBRAM zum Buch Daniel vertreten wurde, nach dessen Meinung Antiochos IV. (175–164 v. Chr.) bei Daniel als Götterfeind ägyptischen Typs auftritt.110 Hiernach seien die Motive von ägyptischen Priestern den auf Elephantine lebenden Juden mitgeteilt worden, die diese dann wieder den Verfassern der apokalyptischen Texte, wie z. B. des Danielbuches, weitertrugen. Vergleichbar leitete auch Karlheinz MÜLLER die Motive aus dem ägyptischen Kulturkreis her, erkannte aber keine direkte Abhängigkeit, sondern nennt den Hellenismus als Auslöser, der in den verschiedensten Kulturen eschatologische Tendenzen hervorgerufen haben soll.111 Diese These ist aber seit dem Fund der aramäischen Fragmente des äthiopischen Buches Henoch nicht mehr aufrecht zu erhalten, da dieses Werk wohl schon zwischen dem späten dritten und dem Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts entstanden ist,112 und somit die Teile äthHen 1–36, das Buch der gefallenen Engel, und 83–90, das Buch der Traumvisionen, in dem wie in Dan 7 vier Großmächte beschrieben werden, die durch theriomorphe Bilder darge-
105 Gegenüber einer Verbindung zu den vier Gesichtern in Ez 1 wie sie PLÖGER 1965, 110 vorschlug, sollte man skeptisch bleiben, da lediglich durch die Nennung der Zahl Vier eine Parallele besteht, die Tiere aber völlig verschieden sind. Gegen eine Beeinflussung von Dan 7 durch ugaritische Mythen sprachen sich bereits COLLINS 1993b, 135 f. und FERCH 1980, 85 f. aus, so dass hierauf nicht weiter eingegangen werden muss. 106 Vgl. WALTON 2001, 85–88. 107 Publiziert von HORNEMANN 1969, Nr. 1749. 108 Publiziert von HÖLBL 2000, 94 f.; KEEL 1977, Abb. 186a. Eine anthropomorphe Gestalt mit vier Löwenköpfen liegt auch auf der Gemme New York, MMA, 41.160.642 (CBd-1129) vor, die in das dritte Jhd. n. Chr. datiert wird, siehe BONNER 1950, 297 (Nr. 266). 109 UEHLINGER 1995, 88, Abb. 5. 110 Vgl. LEBRAM 1975, 737–772; vgl. auch id. 1978, 189–202. 111 MÜLLER 1978, 211. Hierzu auch der Forschungsüberblick von BEYERLE 1998, 34–59. 112 Publiziert von MILIK 1976. Zur Datierungsfrage auch GARCIA MARTINEZ u. TIGCHELAAR 1989/90, 141–146 und KOCH 1996, 5. Zu den Fragmenten speziell KNIBB 1982, 6–15.
4.1 Das Alte Testament
65
stellt wurden, als bisher älteste überlieferte Apokalypsen bezeichnet werden können, die schon einige Jahrzehnte vor Antiochos IV. kreiert wurden.113
Abbildung 47: Statuette eines Löwen mit vier Gesichtern, Leiden, RMO, AED. 24
Abbildung 48: Südwind im Tempel von Kom Ombo
Abbildung 49: Siegeldarstellung aus der frühdynastischen Zeit II mit unbekannter Herkunft
113 Trotzdem wird auch in neuerer Literatur die Religionspolitik Antiochos IV. immer wieder als Auslöser oder zumindest dessen Regierungszeit als Entstehungszeitpunkt apokalyptischer Literatur genannt, so z. B. von SCHIPPER 2007, 28.
66
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
Durch die genannten Beispiele dürfte deutlich werden, dass sich das Motiv eines vierköpfigen Tiers nicht auf einen Kulturkreis einengen lässt, da Geschöpfe mit dieser Kopfzahl praktisch aus dem gesamten Vorderen Orient bekannt sind. Auch kann kein direkter Vorläufer benannt werden, da sich bisher keine Darstellung exakt mit dem bei Daniel beschriebenen Tier gleichsetzen lässt oder die chronologischen Diskrepanzen viel zu groß sind, als dass man eine direkte Abhängigkeit postulieren könnte. Durch die mannigfaltigen Belege dieser Anzahl von Köpfen, wie auch von Gesichtern im Vorderen Orient sollte mehr von einer generellen Darstellungsweise als einer Beeinflussung ausgegangen werden.114 Der Autor, welcher das vierköpfige Wesen im Danielbuch schuf, scheint vielmehr im mythischen Bereich Vorderasiens recht bewandert gewesen zu sein. Allgemein lassen sich die drei von Daniel genannten Tiere – Löwe, Bär und Leopard – erneut als Auswahl aus dem innerbiblischen Befund erklären. So weist z. B. Hos 13, 7 f. JHWH diese Attributtiere zu, mit denen er im Norden wüten kann. Sie besitzen also eine besondere Macht. Als Feind kann der Löwe z. B. im Vergleich von Jer 4, 7 und 50, 17 zu Nebukadrezzar II. dienen. Der Leopard erscheint an wichtiger Position in Apk 13, 2, wo er die Grundform des Leibes des Antichristen darstellt – der auch wie das dritte Tier in Dan 7, 6 über multiple Köpfe verfügt. Interessant ist, dass der Körper des siebenköpfigen Wesens auf Jerusalem, BLMJ, 2051 (Abbildung 53) als derjenige eines Leoparden oder Panthers gedeutet werden kann, womit sich die Kombination von mehreren Köpfen an diesem Leib bereits viel früher als bisher angenommen zeigt, da das Stück in die Frühdynastische Zeit III (2550–2350 v. Chr.) datiert wird.115 Wie in Kapitel 3 und insbesondere in 3.3 dargelegt, sind aus dem syrisch-palästinischen Raum bereits lange vor der Entstehung des Danielbuchs Götter und Wesen mit mehreren Köpfen bekannt. Aufgrund der Befundlage ist anzunehmen, dass der Autor ein neues Geschöpf schuf um der Gestaltung seiner Vision mehr Eindruck zu verleihen. Mit der Vision Daniels kann die als solche bezeichnete Adlervision in 4. Esra 11 f. in Verbindung gebracht werden. Die Entstehung des Buches wird gemeinhin im ersten nachchristlichen Jahrhundert verortet.116 Hier heißt es in Kapitel 11, 1.4.33–35 und 12, 9b–12: 11, 1
Et factum est secunda nocte, et vidi somnium, et ecce ascendebat de mari aquila, cui erant duodecim alae pinnarum et capita tria (…) 4nam capita eius erant quiescentia, et de medium caput erat maius aliorum capitum, sed et ipsa quiescebat cum eis. (…) 33Et vidi post haec, et ecce medium caput subito non conparuit, et hoc sicut alae. 34Superaverunt autem duo capita, quae et ipsa similiter regnaverunt super terram et super eos qui habitant in ea. 35Et vidi, et ecce devoravit caput a dextera parte illud quod est a leva. (…) 12, 9bEt dixit ad me: 10Haec est interpretatio visionis huius quam vidisti: 11aquilam quam vidisti ascendentem de mari, hoc est regnum quartum, quod visum est in visu Danihelo fratri tuo. 12Sed non est illi interpretatum, quomodo ego nunc tibi interpretor vel interpretavi. „11, 1Und es geschah in der zweiten Nacht, und ich sah einen Traum, und siehe es stieg herauf vom Meer ein Adler, der hatte zwölf Federflügel und drei Häupter. (…) 4denn seine Köpfe waren ruhig, und das mittlere Haupt war größer als die anderen Häupter, aber auch es selbst war ruhig mit ihnen. (…) 33Und ich sah danach, und siehe, das mitt114 Auch der Bezug von PORTEOUS 1968, 83 der Tiere der Vision zu Begleitern Tiāmats vermag nicht zu überzeugen, da einfach zu wenige Übereinstimmungen vorhanden sind. 115 Publiziert von BLACK u. GREEN 1992, 165; BRAUN-HOLZINGER 2013, 176; KAHLER 2008, Abb. 3; KEEL 2001, 16; MCBEATH 1999, 68; PRITCHARD 1954, 218 (Nr. 671); SCHROER u. KEEL 2005, 326 f. (Nr. 233); UEHLINGER 1995, 89, Abb. 9. 116 Vgl. HIEKE 2005, § 3 mit weiterer Literatur.
4.1 Das Alte Testament
67
lere Haupt war plötzlich nicht (mehr) sichtbar, und zwar es selbst wie auch die Flügel. 34 Es blieben aber übrig zwei Häupter, die auch selbst regierten über die Erde und über die, die auf ihr wohnten. 35Und ich sah, und siehe, es verschlang das Haupt auf der rechten Seite jenes, das auf der linken Seite ist. (…) 12, 9bUnd er sagte zu mir: 10Dies ist die Deutung dieser Vision, die du gesehen hast: 11Der Adler, den du hast aufsteigen sehen vom Meer, dies ist das vierte Reich, das erschienen ist im Gesicht Daniel, deinem Bruder. 12Aber es ist ihm nicht gedeutet worden, wie ich es jetzt dir deute oder gedeutet habe.“117 Der Angelus interpres weist in 4. Esra eine Deutung aus, die Daniel vorenthalten wurde: sein viertes Tier wird als Adler mit drei Köpfen bezeichnet. Interpretiert wird dieses Tier als das Römische Imperium.118 Der Schilderung nach verschwindet zuerst ein Kopf, so dass aus einem Trikephalos ein Dikephalos wird, worauf dann einer der Köpfe von seinem Nachbarn verschlungen wird. Es handelt sich hier somit um eine Weiterführung der Vision von Daniel. Wenn aber das vierte Tier nun in der Forschung als das Römische Imperium gedeutet wird, was sich mit der Entstehung von 4. Esra als Reaktion auf die Zerstörung des Tempels von Jerusalem im Jahr 70 n. Chr. in Verbindung bringen lässt,119 dann können die anderen Tiere aber nicht mehr die Abfolge Neubabylonisches Reich – Mederreich – Perserreich – Makedonenreich darstellen, da dementsprechend das Makedonenreich durch das Römische Imperium ersetzt worden ist. Hiermit ergibt sich aber eine Diskrepanz im chronologischen Verlauf und dies zeigt auch deutlich, auf welchen tönernen Füßen – um den Worten Daniels in Dan 2, 33–35 und 41–43 zu folgen – manche Interpretationen von Visionen stehen.120
4.1.3 Psalm 74 Als eine weitere Quelle aus dem Alten Testament kann auf Ps 74 hingewiesen werden.121 Hier werden zwei Wesen genannt,122 von denen eines für die Betrachtung der Motivgeschichte der siebenköpfigen Schlange in der Offenbarung von Johannes, die in Kapitel 4.2.3 thematisiert wird, von immanenter Bedeutung ist. Die Entstehung von Psalm 74 wird in der Forschung in die Exilszeit datiert, eine späte Entstehung in der Makkabäerzeit wird direkt ausgeschlossen.123 In Ps 74, 3–9 wird beklagt, dass ein Feind in den Tempel und damit das Allerheiligste eingedrungen ist, was als Erfahrung der Katastrophe von 587 v. Chr. gedeutet wird.124 Wenn das Heiligtum aber zerstört wird, ist dies wie ein Angriff auf die Gottheit selbst, womit die beiden mehrköpfigen Wesen im Psalm praktisch zu Götterfeinden par excellence stilisiert werden. 117 Vgl. BERGER 1992, 110 f., 115, 118 f. In der syrischen Apokalypse des Baruch liegt zu diesem Wesen keine Parallele vor; lediglich in Kap. 39, 5 wird das vierte Reich gedeutet, siehe ibd. 119. Auch werden in Apk 19, 11–22, 5 weitere eschatologische Geschehensabläufe kombiniert, die auch auf 4. Esra 7, 26–44 zurückgehen, vgl. ZAGER 2005, 320 f. 118 Vgl. ROLOFF 2002, 22 f. mit weiterführender Literatur. 119 Vgl. HIEKE 2005, § 3. 120 So nennt z. B. Tacitus, Historiae V, 8 bei BORST 2010, 522 die Abfolge Assyrer – Meder – Perser – Makedonier, wozu als fünftes Weltreich noch die Römer kommen – dementsprechend hätte es bei Daniel auch ein Tier mehr sein können. 121 Als neuere Kommentare zu diesem Psalm sei hier in Auswahl auf DAHOOD 1968, 198–208; GUNKEL 1986, 320–326; HOSSFELD u. ZENGER 2000, 355–372; KRAUS 1989, 675–683; OEMING u. VETTE 2010, 181–187; SEYBOLD 1996, 285–290 und TATE 1990, 240–255 verwiesen. 122 S. zu den folgenden Ausführungen auch THEIS 2022a, 301–304. 123 Vgl. HOSSFELD u. ZENGER 2000, 361 f. sowie DAHOOD 1968, 199. 124 Hierzu WÄLCHLI 2012, 58 f.
68
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
Nach Ps 74, 13b (vgl. Jes 27, 1) weist ein Tannīn ( )תַּ נִּ יןsowie nach Vers 14a der Liwyatan ()לִ וְ יַתַ ן mehrere Köpfe auf, ohne dass eine genaue Anzahl genannt wird.125 Es wurde auch die Meinung vertreten, dass die pluralische Nennung der Häupter in V. 13b aus 14a übernommen wurde, womit der Tannīn ( )תַּ נִּ יןeigentlich nur einen Kopf besäße (der Plural ist ebenso in der Septuaginta mit τάς κεφαλάς bezeugt).126 Das hebräische Tannīn ( )תַּ נִּ יןkann aufgrund des gleichen Namens mit dem ugaritischen Tunnanu gleichgesetzt werden,127 für den mit KTU 1.83, Z. 5 (s. S. 85) deutlich wird, dass er aufgrund der genannten zwei Zungen (lšnm) wohl auch zwei Gesichter besitzt.128 Ebenfalls ist dies mit dem späteren Tannīna in Oden Salomos XXII, 5 zu identifizieren, nach dem das Wesen sieben Köpfe hat, wie es auf Seite 90 beschrieben wird. Die Kopf- oder Gesichterzahl scheint demnach nicht festgestanden zu haben, lässt sich aber in beiden Fällen mit dem Plural im Hebräischen parallelisieren. Durch Parallelen aus dem vorderasiatischen Raum, die direkt auf die Mehrköpfigkeit verweisen und die in Kapitel 4.2.3.2 vorgestellt werden, vermag die Interpretation als Angleichung oder eine simple Streichung im Kontext der weiteren altorientalischen Quellen nicht wirklich zu überzeugen. Der Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןwird zwar in Hiob 40, 25–41, 26 recht ausführlich beschrieben, doch sind die Deutungen in der Forschung nicht eindeutig.129 So wird das Geschöpf sehr häufig als ein Krokodil bestimmt.130 Da dieses Tier in Israel aber nicht heimisch ist, könnte es über Geschichten oder Objekte wie Skarabäen seinen Eingang in die Gottesreden im Hiobbuch gefunden haben.131 Eventuell wäre es möglich, dass ein Wesen mit mehreren Köpfen aus dem ägyp125 In 4. Esra 6, 49 und in der syrischen Apokalypse des Baruch 29, 4 wird nichts über multiple Häupter des Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןberichtet, siehe BERGER 1992, 54.188. Bei Liwyatan handelt es sich sicher nicht um ein Lehnwort aus der ägyptischen Sprache, siehe THEIS 2021. 126 So z. B. SEYBOLD 1996, 289. KALT 1936, 271 streicht sogar den Plural bei den Häuptern des Liwyatan ()לִ וְ יַתַ ן. 127 Insgesamt erscheint der Begriff im Alten Testament vierzehn Mal (Gen 1, 21; Ex 7, 9 f.12; Dtn 32, 33; Hiob 7, 12; Ps 74, 13; 91, 13; 148, 7; Jes 27, 1; 51, 9.34; Ez 29, 3; 32, 2). Das Wesen in Ex 7, 10–12 wird von den Exegeten als Krokodil wie von BAETHGEN 1892, 234; CASSUTO 1967, 94; GRESSMANN 1922, 42 und HERKENNE 1936, 253 (der das Wesen darüber hinaus als „Emblem für Ägypten“ bezeichnet); als Drache von BEER 1939, 47; BRIGGS u. BRIGGS 1925, 155; DUHM 1922, 287 (die Drachen sind hier die schwimmenden Feldherren des Pharaos! Diese Deutung vermag nicht wirklich zu überzeugen); GUNKEL 1986, 325; HOSSFELD u. ZENGER 2002, 424; KALT 1936, 271; KITTEL 1929, 249; KRAUS 1989, 676; MEISER 1963, 352; H. SCHMIDT 1934, 141 und VAN UCHELEN 1986, 247 oder als Seemonster von TATE 1990, 240 gedeutet. 128 Ugaritischer Text bei DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 101. Generell zu einem Vergleich zwischen Texten aus Ugarit und Ps 74 siehe DONNER 1967, 338–344. 129 Zur Entstehungszeit des Hiobbuchs mit einer letzten Bearbeitungsstufe um 100 v. Chr. sei hier auf VAN OORSCHOT 1995, 355–374; 2007, 166–184 und WITTE 1994, 173–178 verwiesen. Zur Vokalisierung siehe jetzt WILSON-WRIGHT u. HUEHNERGARD 2021. 130 So z. B. KEEL 1978, 141–143; FUCHS 1993, 225–262, hier speziell 229, wo das Tier gleichzeitig für Krokodil und Nilpferd, aber auch für ein Chaoswesen aus dem mythischen Bereich gehalten wird. FOX 2013 wollte als Grundlage für den Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןeinen Wal sehen. 131 Vgl. EBACH 1984, 15–28; GORDIS 1978, 569–572 und KEEL 1978, 127–156. Für weitere in der Forschung vorgeschlagene Parallelen zwischen Hiob und Ägypten siehe ebd., 63–125; VON RAD 1955, 293–301 (da lediglich neun Einträge miteinander korrespondieren und sich dies mit demselben Aufbau der beiden Listen besser erklären lässt, ist sicher keine direkte Abhängigkeit vorhanden; vgl. auch FOHRER 1983, 128; FOX 1986, 306–308; KEEL 1978, 26; T. SCHNEIDER 1991, 111 f.); SCHELLENBERG 2007, 55–79 (Es sei die Frage gestellt, ob man bei einem Dialog zwischen Mensch und Gott sowie der Schlechtigkeit der Welt von einer Parallele sprechen sollte, wenn doch beide Gespräche auch dezidiert Unterschiede aufweisen) und T. SCHNEIDER 1991, 108–124; etwas zurückhaltender äußerte sich UEHLINGER 2007, 122. Als Beispiele für weitere, der Forschung nach aus Ägypten stammende Wendungen etc. im Alten Testament sei hier auf COUROYER 1956, 209–219;
4.1 Das Alte Testament
69
tischen Raum als eine Art von Vorlage verwendet wurde. So existiert in situ im Tempel von Hibis in der Oase Charga eine in Frage kommende Darstellung, welche durch die Entstehung des Tempels in die Zeit von Dareios I. (522–486 v. Chr.) oder kurze Zeit vorher zu datieren ist.132 Abgebildet wurde ein Wesen mit dem Körper eines Krokodils, welches zwei Falkengesichter in der Ordnung Janiceps symmetros aufweist und auf seinem Rücken zwei Flügel besitzt (Abbildung 50). Dieses wird als Or ¦m.¦ c¦mn „Horus, der in c¦mn ist“ bezeichnet. Zumindest würde hier aus etwa derselben Epoche, in die auch die Entstehung von Ps 74 datiert wird, ein Krokodil mit zwei Gesichtern vorliegen, doch sollte man dieses nur als ideengeschichtliche Parallele ansprechen, da in der Beschreibung des Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןin Hiob 40, 25–41, 26 sonst bestimmt die beiden Flügel als sehr auffälliges Merkmal Erwähnung gefunden hätten. Gesamt betrachtet kann der zweite Teil des Psalms als eine Betonung der Macht Gottes durch seinen Sieg im Kampf gegen das Chaos gesehen werden, welcher der Erhaltung der Schöpfung dient – die genannten mehrköpfigen Wesen sind sozusagen der Ausdruck der Unordnung par excellence, wie sie in vielen vorderasiatischen Werken mit dieser Assoziation verknüpft sind.133 Durch den ersten Teil des Psalms und dem hier vorliegenden Bezug zur Eroberung Jerusalems im Jahr 587 v. Chr. entsteht darüber hinaus eine weitere Deutungsebene: Die mehrköpfigen Wesen stehen in Verbindung zum feindlichen König, wie es auch für das dritte Tier in Dan 7, 6 der Fall ist. Den Tannīn ( )תַּ נִּ יןtritt Gott neben Löwen und der Schlange auch nach Ps 91, 13 nieder, womit erneut ein mehrköpfiges Wesen als Feind der Welt wie der Schöpfung charakterisiert wird.
Abbildung 50: Zweiköpfiges Krokodil im Tempel von Hibis, Oase Charga
4.1.4 Die syrische Pešitta Bei der Pešitta handelt es sich um die Bibelübersetzung in die syrische Sprache, die die geläufigste Übersetzung für syrische Christen darstellt. Es handelt sich somit um eine relativ späte Quelle, in der aber einige kleinere Textabschnitte enthalten sind, die keinen Eingang in den Text 1960, 42–48; 1981, 333–339; GILULA 1967, 114; LAMBDIN 1953, 145–155; MORENZ 1959, 73 f.; VON NORDHEIM 1979, 227–241; OCKINGA 1980, 38–42 und TVEDTNESS 1982, 215–222 verwiesen. 132 DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 20; Tf. 4, 4. 133 Nach Sæfær Šimmūš Tēhillīm § 81 diente der Psalm, am Morgen und am Abend aufgesagt, der Abwehr von Feinden, siehe den Text bei REBIGER 2010, 142.
70
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
des Alten Testaments gefunden haben. Aus der Pešitta ist eine Passage zu 2Chr 33, 7 über König Manasse (696–642 v. Chr.)134 von Bedeutung: „Und er stellte ein Götzenbild mit vier Gesichtern, das er anfertigen ließ, im Hause des Herrn auf, von welchem der Herr zu David und Salomo, seinem Sohne, gesagt hatte: In diesem Hause in Jerusalem, das ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels, will ich meine Herrlichkeit wohnen lassen in Ewigkeit.“135 Die zitierte Textpassage wird wohl nicht vor dem vierten nachchristlichen Jahrhundert entstanden sein,136 so dass die Frage gestellt werden muss, ob sich der Autor an einem ihm bekannten Gott aus dem Bereich Syrien-Palästina orientierte und die Verehrung eines mehrgesichtigen Bacal in Manasses Verfehlungen einreihte, von denen sonst im Text der Bibel keine weiteren Spuren zu finden sind.137 Eine Beeinflussung durch die Beschreibung eines mehrköpfigen Wesens in Ez 1 wurde in der Forschung negiert.138 Dies wäre allein durch die Benennung Kerubim und Bacal wohl auch kaum vorstellbar. Zur möglichen Einflussnahme kann auf das Stelenfragment des Barrakab verwiesen werden (Abbildung 51), welches an das Ende des achten Jahrhunderts v. Chr. datiert werden kann. Hier wurde der Kopf von Bacal in der Ordnung Diprosopos ohne Körper dargestellt, wobei er je ein Gesicht zu beiden Seiten aufweist.139 Hierbei handelt es sich um den bisher einzigen Beleg für einen doppelgesichtigen Bacal.140 Zwar nannte Othmar KEEL die Angabe der syrischen Pešitta wie auch das Stelenfragment des Barrakab in seiner Betrachtung des mehrköpfigen Wesens in Ez 1, doch setzte er die Darstellungen nicht in direkte Verbindung.141 Man kann wohl davon ausgehen, dass es sich bei der Angabe aus der Pešitta zu 2Chr 33, 7 über König Manasse nicht um eine Erfindung aus der Zeit nach Christi Geburt handelt. Viergesichte Götter sind aus dem ersten vorchristlichen Jahrtausend in mannigfaltigen Belegen bekannt. Wenn aber in der Epoche des achten Jahrhunderts ein mehrgesichtiger Bacal in Sam’al, dem Fundort der Stele bekannt war, und somit recht zeitnah zu König Manasse vorliegt, wäre eine Beeinflussung durchaus denkbar. Da in der Pešitta von einem viergesichtigen Bacal die Rede ist, wäre eine Entwicklung des Gottes im Laufe der Zeit anzunehmen, für deren Erläuterung auf eine andere Quelle zurückgegriffen werden kann. So erklärt Rabbi Jochanan in Traktat Sanhedrin 103b:
134 Datierung nach THIELE 1983. 135 LANDERSDORFER 1918, 8; für weitere Quellen siehe ibd. 3–10. In der arabischen Pešitta ist mit ibd. 10 noch der Zusatz erhalten, dass es sich um „ein Götzenbild, das vier Köpfe mit vier Gesichtern hatte“ gehandelt hat, woraus dann eigentlich ein Gott mit 16 Gesichtern rückzuschließen ist. Warum ebd., 19–38 in seiner Behandlung des Themas einen Zusammenhang zu Michas Bilderdienst in Ri 17 ziehen will, bleibt unklar, da hier nicht von vier Gesichtern die Rede ist, wie auch die Quelle nach der innerbiblischen Chronologie lange vor Manasse anzusetzen ist. 136 Vgl. LANDERSDORFER 1918, 8. 137 Zu den weitführenden Schlussfolgerungen von LANDERSDORFER war bereits VOGT 1979, 329 f. recht kritisch; vgl. auch ZIMMERLI 1969, 60. Gegen andere Identifikationen als vierköpfige Wesen wie in 1Kön 16, 30–34 und 18, 19–46 haben sich bereits HÖHNE 1954, 41–46 und KEEL 1977, 226 f. gewandt. 138 Vgl. ZIMMERLI 1969, 60. 139 Publiziert von BOSSERT 1959, Tf. 2; DONNER u. RÖLLIG 1969, Tf. 12, Nr. 217; KEEL 1977, 224 f., Abb. 176; YADIN 1970, 209 f. Die Inschrift der Stele liegt bei DONNER u. RÖLLIG 1966, 40, Nr. 217 publiziert vor. 140 Siehe die vergleichende Überschau des Materials von CORNELIUS 1994. 141 Vgl. KEEL 1977, 224–226.
4.1 Das Alte Testament
71
„Anfangs machte er (sc. Manasse) ihm (sc. Bacal) ein Gesicht, später machte er ihm vier Gesichter, damit die Šechina es sehe und Ärgernis nehme.“142 Es würde somit eine Art von Entwicklung vorliegen. Der Götze verfügte zuerst nur über ein Gesicht; diese Gestalt wurde anschließend verworfen und die Anzahl seiner Gesichter auf vier erhöht. Dies dürfte sich erneut mit einer zu steigernden Machtfülle erklären lassen: Da viele Götter der Nachbarvölker und -kulturen mehrere Gesichter aufwiesen, sollte auch der eigene Gott dieses Merkmal besitzen. Dass Manasse den Gott Bacal verehrte, wird z. B. durch 2Kön 21, 3 deutlich, in dem der König neue Altäre für ihn wie die Göttin Ašera errichten ließ.143 In etwa zeitgleich zur genannten Stelle aus der Pešitta wird der vierköpfige Bacal noch bei Eustathios von Antiochia, Contra Horigenem de Engastrimytho 8 im vierten nachchristlichen Jahrhundert erwähnt.144
Abbildung 51: Bacal auf der Stele des Barrakab
Eine Beeinflussung der Gestaltung von Bacal auf der Stele des Barrakab wäre ebenso von vorderasiatischen Abbildungen denkbar. So existiert z. B. mit der Siegelabrollung Oxford, Ashmolean Museum, 1939.332.208 und London, BM, 126498, die an das Ende des dritten Jahrtausends datiert wird und in Tell Brak gefunden wurde, die Darstellung eines zweigesichtigen Gottes.145 Abgebildet wurde ein typischer Janiceps symmetros auf einem menschlichen Leib. Ebenfalls ist an die vielfältig aus Mesopotamien bekannten Darstellungen von Usmû (Abbildung 34) zu denken, wie sie bereits auf Seite 50 angesprochen wurden. Als Parallele kann das Siegel Fribourg, Slg. Bibel+Orient, VR 1981.254 (Abbildung 52) genannt werden.146 Dieses Siegel stammt aus der altbabylonischen Zeit und wurde in Syrien gefunden. Dieser Fund in der betreffenden Region, wie auch andere Siegel, die diesen Gotttypus aufweisen, zeigen deutlich, dass die Vorstellung eines Gottes in der Darstellungsweise eines Janiceps symmetros sicher bereits von Mesopotamien durch Händler oder Reisende bekannt gemacht wurden.147
142 143 144 145 146 147
GOLDSCHMIDT 1934, 156. Zum Bezug zwischen dem Gott und Manasse siehe LEVIN 2013, 161 f. und SCHENKER 2004, 47–52. Siehe den Text bei KLOSTERMANN 1912, 26. MATTHEWS 1997, 267 (Nr. 329). KEEL-LEU u. TEISSIER 2004, 286 (Nr. 332); hergestellt aus Hämatit, Größe: 1,5 × 0,9 Zentimeter. An dieser Stelle kann auch auf Siegelabrollungen hingewiesen werden, die im antiken Mitanni gefunden wurden und einen zweiköpfigen Herrn der Tiere zeigen, wie es z. B. mit einem Stück bei KEEL 1978, 122, Abb. 64 vorliegt. Der Herr der Tiere wurde hier mit der typischen mesopotamischen Hörnerkrone dargestellt und ist mit einem knöchellangen Schurz bekleidet. Dieses Objekt zeigt, dass auch diese, eigentlich aus dem Zweistromland stammende Darstellung ihren Weg bereits in andere Bereiche Vorderasiens gefunden hatte. Siegel aus der Kassitenzeit aus Nippur, die eine vergleichbare Darstellung zeigen, und aufgrund ihrer Datierung in etwa zeitgleich mit dem Objekt aus Mitanni sind, liegen bei KEEL 1978, 117–122, Abb. 61 und MATTHEWS 1990a, Nr. 148 f. vor.
72
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
Abbildung 52: Fribourg, Sammlung Bibel+Orient, VR 1981.254
4.1.5 Zusammenfassung Durch die Belege aus dem Alten Testament wird deutlich, dass Wesen mit mehreren Köpfen oder Gesichtern nicht allzu häufig belegt sind und demnach im mythischen Bereich keine größere Rolle gespielt zu haben scheinen. Dieser Befund lässt sich mit dem bereits in Kapitel 3 für die Region der Levante herausgestellten Befund in Verbindung bringen. Für die wenigen Belege in der Bibel wäre es unter Heranziehung der in Kapitel 4.1.4 genannten Quelle aus der Pešitta zu 2Chr 33, 7 auch denkbar, dass manche Gestalten irgendwann einfach gestrichen worden sein könnten. Für ein derartiges Vorgehen gegenüber anderen mehrköpfigen Wesen existieren aber m. W. keine weiteren Belege aus dem Text des Alten Testaments. In Ez 1, 4–6.9b–10 wird eine spezielle Form des Tetraprosopos genannt, bei dem vier unterschiedliche Gesichter an einem Kopf situiert sind. Die Gesichter werden als die eines Menschen, eines Löwen, eines Rinds und eines Adlers beschrieben. Die Kombination von vier Gesichtern kann in vielen Kulturen der Antike nachgewiesen werden, wobei aber die spezielle Kombination bei Ezechiel bisher ohne Parallele ist und somit durchaus eine eigenständige Kreation des Autors darstellen könnte. Die in anderen Quellen vorliegende Beschreibung der Kerubim im Tempel, wie sie z. B. in 1Kön 6, 24–27 und 2Chr 3, 10–13 vorliegen, weisen keine multiplen Gesichter auf. Die Auswahl der Tiere konnte durch innerbiblische Motive bzw. den Erfahrungsschatz eines schriftgewandten Propheten erklärt werden und werden später in den Attributtieren der vier Evangelisten aus dem Neuen Testament aufgegriffen; eine Herleitung aus mesopotamischen oder ägyptischen Quellen ist aufgrund fehlender Parallelen abzulehnen. Dies ist auch für Ez 10, 14 der Fall, wo die Gesichter zu dem eines Kerubs, eines Menschen, eines Löwen und eines Adlers verändert wurden. Eine ideengeschichtliche Parallele des zweigesichtigen Kerubs in Ez 41, 18b–19 konnte aber deutlich für dessen Aufgabe als Himmelsträger bzw. Träger einer Gottheit zu anderen Darstellungen aus dem Vorderen Orient nachgewiesen werden.148 Bei der Gestaltung der Träger mit zwei Gesichtern liegt somit eine interkulturell gemeinsame Vorstellung vor, die zumindest seit dem zweiten Jahrtausend v. Chr. bekannt war. Von besonderem Interesse ist die kurze Erwähnung in Ez 10, 12, dass jeder der viergesichtigen Kerubim „ganz mit Augen bedeckt“ sei. Es konnte zwar keine direkte Parallele aufgewiesen werden, doch ist die Überschneidung eines mit Augen bedeckten, mehrköpfigen Bes aus Ägypten, wie er von Pap. Brooklyn 47.218.156 und zahlreichen Darstellungen aus dem ersten vorchristlichen
148 Vgl. auch KEEL 1977, 230–233.
4.1 Das Alte Testament
73
Jahrtausend bekannt ist (Abbildung 39 f.), sehr auffällig und man könnte durchaus eine Einflussnahme annehmen. Auch der vierköpfige Leopard mit Flügeln in Dan 7, 6, der nach der Aussage des Angelus interpres in Dan 7, 17 für ein Weltreich stehen soll, konnte nicht auf eine spezifische Kultur zurückgeführt werden. Vielmehr ist die Gestaltung eines Tieres mit vier Köpfen ebenfalls aus dem gesamten Vorderen Orient belegt. Die Auswahl der vier Tiere in Dan 7 entspricht wie bei Ezechiel erneut innerbiblischen Motiven. Omenserien aus Mesopotamien wie Šumma ālu ina mēlê šakin oder Šumma izbu konnten als direkte Vorläufer ausgeschlossen werden, da kaum Parallelen in der Beschreibung vorhanden sind. Noch spezifischere Identifizierungen der Köpfe, wie sie z. B. mit den vier in Dan 11, 2 genannten Perserkönigen149 oder vier Diadochen150 in der Forschung vorgeschlagen wurden, sind aufgrund der Nennung eines fünften Herrschers in Dan 11, 3 f. nicht haltbar. Nimmt man dann noch die Adlervision aus 4. Esra 11 f. und die hier vorliegende Deutung des Angelus interpres mit hinzu,151 wird deutlich, auf wie viele unterschiedliche Arten manche Visionen eigentlich gedeutet werden (können). Von besonderem Interesse für die im folgenden Kapitel 4.2 anzusprechende Motivgeschichte mehrköpfiger Wesen aus der Offenbarung des Johannes konnte ein Wesen in Ps 74 herausgearbeitet werden. Speziell der Tannīn ( )תַּ נִּ יןweist in mannigfaltigen Quellen des Vorderen Orients, die sich über mehrere Jahrtausende erstrecken, mehrere Köpfe auf, sodass vorgenommene Streichungen des Plurals oder eine vorgebliche Übernahme von der Beschreibung des Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןin Ps 74, 14 im Text der Biblia Hebraica völlig unhaltbar werden.152 Wenn es sich beim Liwyatan ()לִ וְ יַתַ ן, wie er recht ausführlich in Hiob 40, 25–41, 26 beschrieben wird, um ein mehrköpfiges Krokodil handelt, ließe sich als zeitnah entstandene Parallele eine Darstellung im Tempel von Hibis in der Oase Charga (Abbildung 50) aus der Zeit von Dareios I. (522–486 v. Chr.) anführen.153 In der Septuaginta wird das hebräische Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןin Jes 27, 1, Ps 74, 14 und 104, 26 jeweils mit δράκων übersetzt, wie auch das hebräische Tannīn ( )תַּ נִּ יןin Ex 7, 9 f.12, Dtn 32, 33 und Jes 27, 1 mit diesem Wort ins Griechische übertragen wird. Da, wie gezeigt, beide Wesen nach Ps 74, 13 f. als mehrköpfig imaginiert wurden und dies beim Tannīn ( )תַּ נִּ יןsicher auf frühere Überlieferungen zurückgeht, ließe sich bei der Übersetzung ins Griechische vielleicht an eine Vermischung mit der bekannten Hydra denken, die auch als δράκων bezeichnet wurde. Wie es auf Seite 78 mit Quellen belegt wird, weist die Hydra mehrere Köpfe auf, so dass ein in der griechischen Mythologie bewanderter Übersetzer den Tannīn ( )תַּ נִּ יןals mehrköpfige Schlange gesehen haben könnte. So wie JHWH z. B. in Ps 74, 12–17 die beiden mehrköpfigen Chaosmächte bezwingt und damit den Erhalt der Schöpfung garantiert, ist dies auch in der griechischen Mythologie der Fall. Außerhalb des Kanons des Alten Testaments wird in der syrischen Pešitta zu 2Chr 33, 7 ein viergesichtiger Bacal in der Zeit von König Manasse (696–642 v. Chr.) beschrieben, als dessen ideengeschichtliche Parallele eines mehrgesichtigen Gottes das Stelenfragment des Barrakab (Abbildung 51) vom Ende des achten vorchristlichen Jahrhunderts herangezogen werden konnte.154 Hierbei muss aber die chronologische Diskrepanz zwischen den beiden Quellen beachtet werden. Nimmt man allerdings an, dass auch im Originaltext des zweiten Chronikbuchs einst ein derartiger Passus stand, der hiernach gestrichen wurde, wäre der Unterschied zwischen der Entstehung der beiden Quellen nicht mehr allzu groß. Hierbei handelt es sich aber um eine 149 150 151 152 153 154
Vgl. BAUER 1996, 151. Vgl. GOLDINGAY 1989, 163; hierzu auch MAIER 1982, 269 und REDDITT 1999, 121. Übersetzung nach BERGER 1992, 110 f., 115, 118 f. So z. B. SEYBOLD 1996, 289 oder KALT 1936, 271. DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 20; Tf. 4, 4. Publiziert von BOSSERT 1959, Tf. 2; DONNER u. RÖLLIG 1969, Tf. 12, Nr. 217; KEEL 1977, 224 f., Abb. 176; YADIN 1970, 209 f.
74
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
spekulative These, für die m. W. keine weiteren Belege im Text des Alten Testaments vorliegen. Die Erklärung für die Zunahme der Gesichter lieferte Rabbi Jochanan in Traktat Sanhedrin 103b.155 Der viergesichtige Bacal wird auch noch bei Eustathios von Antiochia, Contra Horigenem de Engastrimytho 8 im vierten nachchristlichen Jahrhundert erwähnt,156 womit man sich in etwa derselben Zeit befindet wie die Übersetzung der Pešitta. Es hat sich bei der Behandlung der verschiedenen Wesen, wie sie bei den Propheten Ezechiel und Daniel, in Psalm 74 und in der syrischen Pešitta vorliegen, deutlich gezeigt, dass sich die Autoren bei der Kreation der Geschöpfe vorderasiatischen Gedankenguts bedienen, ohne allerdings direkt einen Text oder eine Abbildung zu referieren. Es handelt sich bei den Wesen mehr um religionsgeschichtliche Parallelen als Allgemeingut, die kaum auf direkte Vorbilder zurückgeführt werden können. Geschöpfe mit vier Gesichtern oder Tiere mit vier Köpfen sind im Vorderen Orient in der Antike viel zu sehr verbreitet, als dass eine spezifische Kultur als Ausgangspunkt benannt werden könnte. 4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes Als die wohl bekannteste Quelle für ein mehrköpfiges Wesen in der Bibel darf eine Passage in der Apokalypse des Johannes gelten. Denkt man an eine Gottesbedrohung oder an die letzten Ereignisse im Verlauf der Welt, dürfte dem biblisch gebildeten Leser beim Stichwort Mehrköpfigkeit recht schnell die Kombination von sieben Häuptern an einem Wesen in den Sinn kommen, wie der Gottesfeind in Form einer Schlange in Apk 12, 3 und in 13, 1 f. erscheint. Der Seher Johannes selbst setzt in Apk 12, 9 dieses Wesen mit dem Satan und damit mit dem Widersacher Gottes par excellence gleich. Die Offenbarung wird gemeinhin in die letzten Regierungsjahre von Kaiser Domitian datiert,157 der zwischen 81 und 96 n. Chr. regierte.158 Nach eigener Angabe in Apk 1, 9 wurde das Werk auf der Kykladeninsel Patmos von einem Johannes verfasst.159 In den Kapiteln 12 und 13 greift der Schreiber in Teilen auf die Tiervision von Daniel zurück, was sich nach Jürgen 155 Siehe GOLDSCHMIDT 1934, 156. 156 Siehe den Text bei KLOSTERMANN 1912, 26. 157 Es existieren aber auch gegensätzliche Meinungen. So datierte HADORN 1928, 221 f., 225 f. das Werk vor das Jahr 70 n. Chr. WILSON 1993, 587–605 setzt die Entstehung unter Nero (54–68 n. Chr.) oder Galba an. BERGER 1995, 616–618 spricht sich für das Vier-Kaiser-Jahr 68/69 n. Chr. aus, während J. W. MARSHALL 2001, 2 etwa das Jahr 69/70 n. Chr. ansetzt. Unter Galba datierte es TORREY 1958, 89. Dahingegen stellte KRAFT 1974, 93 f. die These auf, dass das Buch über einen längeren Zeitraum zwischen 97/98 und 114/115 n. Chr. und damit unter Nerva (96–98 n. Chr.) und Trajan (98–117 n. Chr.) verfasst worden sei. Eine Zusammenfassung der bisherigen Meinungen liegt bei WITULSKI 2007a, 14–52 vor. 158 So unter anderen z. B. BACHMANN 2000, 360–362; BÖCHER 2010, 14; BROER 2001, 669–672; FOUILLET 1962, 77; KLAUCK 1992, 161; KOLLMANN 2007, 54 f.; MOUNCE 2009, 15 f.; RITT 2009, Sp. 997; SCHNELLE 2002, 562–566; SCOTT 1949, 30 und YARBRO COLLINS 1981, 377–403. Für eine Datierung unter Domitian traten auch bereits die frühen Kirchenväter ein, wie z. B. Clemens Alexandrinus, Quis dives 42; Eusebius, Historia Ecclesiastica III, 18, 3; Hieronymus, De viris illustriis 9 und Irenäus, Adversus Haereses V, 30, 3, worauf bereits ROLOFF 2002, 34, Anm. 63 hinwies. Dagegen brachte WITULSKI 2007a, 346–350; 2007b, 174 die These in die Forschung ein, das Buch sei unter Hadrian (117–138 n. Chr.), genauer zwischen den Jahren 132 und 135 n. Chr. entstanden. 159 Hier soll nicht auf die Zusammenhänge zwischen dem Evangelium des Johannes und der Apokalypse eingegangen werden, siehe hierzu zusammenfassend BÖCHER 1980a, 289–301; 1980b, 1–12, speziell 10 f.; EHRMAN 2004, 467–471; SCHÜSSLER FIORENZA 1976/77, 402–427 und STAUFFER 1952, 160–209. Ältere Literatur zur Apokalypse hat BÖCHER 1988 gesammelt.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
75
ROLOFF dadurch erklären lässt, dass diese Vision zum „Grundmaterial apokalyptischen Weltund Geschichtsverständnisses“ gehört.160 Das Ziel des vorliegenden Kapitels ist, die verschiedenen Quellen für eine siebenköpfige Schlange zu sammeln und die motivgeschichtlichen Hintergründe für die Vision in der Johannesapokalypse zu betrachten. Diese werden in einem folgenden Schritt mit den bereits angesprochenen Belegen aus dem Alten Testament in Verbindung gebracht. Nur in wenigen Fällen wurde in Kommentaren eine mögliche Herkunft der siebenköpfigen Wesen in Apk 12 und 13 angesprochen, diese sollte aber im Licht neuerer Funde erneut aufgegriffen werden. Anhand weiterer Quellen wird sich deutlich zeigen, dass die Schlange mit sieben Köpfen ein Thema im gesamten Vorderen Orient darstellte. In einem weiteren Schritt soll auf die möglichen Gründe eingegangen werden, warum eine Schlange die Bedrohung (eines) Gottes par excellence darstellte und in dieser Form noch in die Apokalypse des Johannes eingegangen ist. Da zwei siebenköpfige Wesen nach dem Zeugnis der Offenbarung während der Endzeit auftreten, sind beide dezidiert eschatologisch zu begreifen und stehen mit der Thematik des Götterkampfes in Verbindung, dessen positiver Ausgang die Vollendung der Schöpfung durch den endgültigen Sieg über das Böse bedeutet. Die siebenköpfige Schlange muss also „im Rahmen der von Gott gelenkten geschichtlichen Entwicklung zuletzt“161 erscheinen, um Gottes Werk erst zu einem Abschluss bringen zu können.
4.2.1 Überlieferung In der Vision in Apk 12 und 13 werden zwei Tiere beschrieben, die über mehrere Köpfe verfügen. Bevor das erste Wesen in Apk 12, 3 erscheint, wird eine Frau am Himmel sichtbar (Apk 12, 1 f.), die soeben ein Kind geboren hat. Es besteht kein Zweifel, dass es sich hierbei um den Messias handelt. καὶ ὤϕθη ἄλλο σημεῖον ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἰδοὺ δράκων μέγας πυρρὸς ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ἑπτὰ διαδήματα „Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel; und siehe, eine große, rote Schlange (war es), die hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf ihren Köpfen hatte sie sieben Diademe.“162 Das griechische δράκων bezeichnet das mythische Wesen wie auch reale Schlangen, wie es bei verschiedenen antiken Schriftstellern vorliegt.163 Das Wesen, das als Widersacher Gottes definiert wird, hat sieben Häupter, zehn Hörner und darauf sieben Diademe. Der Text ist in allen Textzeugen praktisch einheitlich überliefert, nur in wenigen wird das Wort μέγας ausgelassen.164 Es ist etwas diffizil, sich zehn Hörner auf sieben Köpfen vorzustellen. Entweder man situiert die Hörner alle auf einem (dem letzten) Haupt und bringt die Vorstellung somit in Einklang mit Daniel;165 oder manche der Häupter tragen zwei und manche nur ein Horn, woraus
160 161 162 163 164
ROLOFF 2002, 35. LEONHARDT 2009, 388. Griechischer Text nach NESTLE u. ALAND 1995, 654. Zum Symbol der Schlange siehe EGLI 1982, 144–256. Siehe den kritischen Apparat bei NESTLE u. ALAND 1995, 654 und die Zusammenstellung bei KARRER 2012, 438.441. 165 So THOMAS 1995, 123.
76
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
sich insgesamt zehn ergeben. Verstanden wird dieses Tier als Gegenbild zu Christus und als Ausgestaltung des Antichristen.166 Bevor die siebenköpfige Schlange (δράκων μέγας) gegen das Kind vorgehen kann, wird dieses nach Apk 12, 5 entrückt und das Wesen durch den Erzengel Michael in 12, 7 f. besiegt. Das gestürzte Geschöpf begibt sich daraufhin an das Meer und dann sieht der Prophet nach Apk 13, 1 f. ein weiteres, aus dem Meer aufsteigendes Tier (θηρίον) – es handelt sich also um das Gegenbild zum ersten, welches auf dem Land erschien: καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκά διαδήματα καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος καὶ ἔδωκεν αὐτῷ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην „Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern waren zehn Diademe und auf seinen Köpfen waren Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht.“167 Der Körper wird wie der eines Leoparden (παρδάλις), die Füße wie die eines Bären (ἄρκος) und das Maul wie das eines Löwen (λέων) beschrieben. Es handelt sich um eine Mischgestalt, wobei der Körper teilweise wie der des Wesens aus Dan 7, 6 geformt ist. Das zweite Wesen ist ein Helfer des ersten,168 welches das Tier (θηρίον) aus dem Meer heraufholt, indem die große Schlange (δράκων μέγας) in Apk 12, 18 an den Strand tritt. Dies bedeutet, dass gleichzeitig zwei siebenköpfige Wesen nahe beieinander an einem Strand stehen. Dass die beiden Tiere zusammengehören, wird durch Apk 16, 13 klar, da hier aus ihren beiden Mündern und dem des Pseudopropheten (ψευδοπροφήτης) drei unreine Geister (πνεύματα τρία ἀκάθαρτα) hervortreten, die wie Frösche (βάτραχοι) aussehen. Von den Köpfen des zweiten Tieres wird in Apk 13, 3 nur einer hervorgehoben. Dieses Haupt ist tödlich verwundet (καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον), es wird im Folgenden aber von der Wunde geheilt (καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη).169 Ein letztes Mal sieht der Prophet das Tier in der Wüste. In Apk 17, 3 wird berichtet, dass der Prophet eine Frau sah, die auf einem scharlachroten Tier mit sieben Häupter und zehn Hörner saß, wobei das Tier erneut mit Namen der Lästerung versehen war (καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον γέμοντα ὀνόματα βλασφημίας ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα). Es handelt sich somit klar um das zweite Tier; kurz aufgegriffen wird dieses Bild erneut in Apk 17, 7.
166 Vgl. ROLOFF 2002, 40, 48 f. Der Ausdruck Ἀντίχριστος ist im Neuen Testament nicht vor den Johannesbriefen 1Joh 2, 18.22; 4, 3 und 2Joh 7 belegt; hierzu speziell KLAUCK 1990, 237–248 und auch weiterführend JENKS 1991. 167 Griechischer Text nach NESTLE u. ALAND 1995, 656. Als andere Lesart existiert für ὀνόματα in Apk 13, 1 ὀνόμα nur im Singular. 168 Z. B. von LOHMEYER 1926, 115; HADORN 1928, 144 und SICKENBERGER 1942, 131 als der Pseudoprophet interpretiert. 169 Dieser Kopf wird von BOUSSET 1906, 360 f.; CHARLES 1920, 348–350; HADORN 1928, 143 und REDDISH 2001, 250 f. als Kaiser Nero gedeutet. Gegen geschichtliche Deutungen wendet sich BARR 2013.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
77
4.2.2 Interpretationen in der Forschung Die Interpretation der sieben Häupter der beiden Tiere hat in der Forschung verschiedene, teils recht spezielle Thesen hervorgebracht. Die gängigste Interpretation stellt diejenige dar, dass das Tier als Symbol für das römische Imperium und die Köpfe für dessen Herrschergestalten stehen.170 Vergleichbar wollte Robert L. THOMAS die Köpfe als zukünftige Herrscher und Imperien sehen, womit eine reale Prophezeiung vorliegen würde,171 doch benennt er keine spezifischen Deutungen. Vergleichbar ist auch die Meinung von Hubert RITT, nach dem das Tier pars pro toto ein Sinnbild für die endzeitliche Staatsmacht darstelle, die totalitär wirke und das Kommen des Reichs Gottes nur beschleunige.172 Die Zuschreibung von Tieren zu bekannten Weltreichen wurde in der Forschung auch für die Tiere in der Vision in Dan 7 vorgeschlagen. Dass das erste Tier bei Johannes ausgerechnet sieben Häupter hat, wurde mit der Abfolge der römischen Kaiser erklärt. Die Köpfe wurden mit den Imperatoren Tiberius bis Domitian (Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus, Domitian) unter Ausschluss von Galba, Otho und Vitellius identifiziert, womit man auf die Zahl Sieben kommt – was aber willkürlich anmutet, wenn bestimmte Herrscher nicht mit in die Abfolge einbezogen werden und Augustus ganz fehlt. Dies gilt auch für die Deutung von Mitchell G. REDDISH, der im zweiten Tier eine Symbolisierung aller Machthaber des Römischen Reichs sehen möchte,173 doch bleibt unklar, wie dann die sieben Köpfe mit den Herrschern zu kombinieren sind – und vor allem: Warum muss eigentlich eine Identifikation mit spezifischen Personen erfolgen? Nicht mit mehreren Herrschern des römischen Reiches sondern lediglich mit Hadrian (117– 138 n. Chr.) möchte Thomas WITULSKI das in Apk 13, 1–18 genannte Tier identifizieren, da seiner Meinung nach die Offenbarung auch unter diesem Kaiser entstanden ist.174 Diese Spätdatierung vermochte aber bisher in der Literatur nicht zu überzeugen und es muss erneut die Frage gestellt werden, warum das Tier explizit einen einzigen Herrscher darstellen soll, wenn doch kein einziger Hinweis in der Offenbarung selbst dies nahelegt. Auch wurde eine Identifizierung des siebenköpfigen Wesens mit der Schlange aus dem Garten Eden vorgeschlagen,175 doch muss bedacht werden, dass die Schlange aus Genesis nie mit mehreren Köpfen in Verbindung gebracht wird und ihr dementsprechend sechs weitere Häupter gewachsen sein müssten. Eine andere Deutung setzt das Reptil aus der Apokalypse mit Satan gleich,176 wie es sich mit Apk 12, 9 innertextlich erklären lässt, wozu aber keine Erklärung der vielfachen Köpfe erfolgte. Bei den Deutungen wird oftmals auf Ez 29, 3 und 32, 2 verwiesen, da hier der ägyptische Pharao als Schlange bezeichnet wird, woraus eine Gesamtdeutung der siebenköpfigen Schlange als Ägypten erfolgte. Allerdings wird hier außer Acht gelassen, dass an genannten Stellen die Identifizierung nie mit einem mehrköpfigen Wesen erfolgt und das verbindende Element lediglich die Schlange ist. Eine direkte Identifizierung des mehrköpfigen Reptils der Apokalypse mit Tiāmat oder der Schlange Python aus dem Mythos um die Göttin Leto, wie sie REDDISH traf,177 ist abzulehnen, 170 Vgl. z. B. BÖCHER 1988, 82 f.; BOUSSET 1906, 367; CHARLES 1920, 345–347; HADORN 1928, 141; PREUß u. BERGER 2003, 394; MOUNCE 2009, 245 f.; RITT 1986, 66; ROLOFF 2002, 39 und WIKENHAUSER 1959, 104 f. 171 Vgl. THOMAS 1995, 123. 172 Vgl. RITT 2009, Sp. 997. 173 Vgl. REDDISH 2001, 258. 174 Vgl. WITULSKI 2007a, 346–350; 2007b, 174. 175 Vgl. z. B. CHARLES 1920, 325; HADORN 1928, 134; KORPEL u. DE MEER 2017, 4; LOHMEYER 1926, 101; SICKENBERGER 1942, 121 f. und WIKENHAUSER 1959, 96. 176 Vgl. z. B. LARKIN 1919, 91; LUPIERI 1999, 191; MBOSOWO 2010, 103 und MORRIS 2002, 153. 177 REDDISH 2001, 234.
78
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
da weder Python noch Tiāmat sieben Köpfe besitzen. Tiāmat weist zwar nach dem singulären Beleg STC I, 213, 12 ein männliches und ein weibliches Gesicht auf,178 doch ist die Form des Janiceps symmetros bei Gottwesen in der Antike viel zu verbreitet, als dass eine direkte Vorlage genannt werden könnte. Von Leon MORRIS wurde die Hydra als Vorbild herangezogen.179 Wirft man allerdings einen genaueren Blick in die griechischen Texte, kann diese aufgrund ihrer hier genannten Kopfzahl nicht als mögliches Pendant herangezogen werden, da sie nie mit sieben Köpfen beschrieben wird.180 Ebenso ist ein Vergleich der Frau zu Isis, die vor Typhon flieht, wie es Hubert RITT formulierte,181 mehr als fragwürdig, da weder Seth noch dessen interpretatio graeca Typhon über sieben Köpfe verfügen.182 Nur das Beispiel einer schwangeren Frau, die vor einem Widersacher flieht, kann als Hinweis auf eine Tradition nicht genügen, da es sich um ein gängiges Motiv – nicht nur in der Antike, sondern auch in der Neuzeit – handelt.183 Auch die von Adela YARBRO COLLINS und Robert H. CHARLES gebotene Identifizierung des Drachen der Apokalypse mit „mušruššusic tâmtim“ erscheint nicht haltbar,184 da keiner der bekannten Darstellungen eines Mušḫuššu aus Mesopotamien, wie er z. B. am Tor der Ištar aus Babylon dargestellt ist, mehrere Köpfe aufweist. Anders wollten Ernst LOHMEYER und Hubert RITT den Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןund den Tannīn ()תַּ נִּ ין hinter den beiden Tieren der Apokalypse sehen,185 was zur folgenden Betrachtung der Motivgeschichte einer siebenköpfigen Schlange im Vorderen Orient noch eine Rolle spielen wird. Die meisten Aussagen der Apokalypse basieren auf eschatologischen Vorstellungen des Judentums,186 allerdings sind auch Verbindungen zum griechisch-römischen und iranischen
178 Siehe REYNOLDS 1999, 377 und MCBEATH 1999, 29. 179 MORRIS 2002, 153. 180 Nach Alkaios, frag. 443 hatte sie neun Köpfe (ἐννεα κέφαλος), siehe den Text bei LIBERMAN 1999, 193; sie kann nach Simonides, frag. 569 aber auch „fünfzigköpfig“ (πεντηκοντακέφαλον) sein, siehe PAGE 1962, 294. Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica IV, 11, 5 weist darauf hin, dass „sie einhundert Nacken hat, jeder mit dem Kopf einer Schlange versehen“ (ἑκατὸν αὐχένες ἔχοντες κεφαλὰς ὄφεων διετετύπωντο), siehe OLDFATHER 1956, 376. So ist es auch bei Ovid, Metamorphoses IX, 1956 (centum numero) und in der Suda überliefert, siehe die Überlieferung bei MILLER 1984, 6 und s. v. Ὕδραν τέμνειν bei ADLER 1935, 635. Pseudo-Hyginus, Fabulae 30 nennt ebenfalls neun Köpfe (cum capitibus novem); siehe die Überlieferung bei P. K. MARSHALL 1993, 44. Euripides, Phoenissae 1135 nennt zwar einmal hundert Köpfe, doch wird dies in erzählerischer Form für die Bemalung des Schildes des Adrastus genannt, siehe die Überlieferung bei KOVACS 2002, 332. 181 So die These von RITT 1986, 65; vergleichbar auch VAN DE KAMP 2017, 168, der Gen 3 als Parallele führt; YARBRO COLLINS 2001, 75 f. und CHARLES 1920, 313, bei dem aber Hathor die fliehende Frau ist. 182 Nach der Überlieferung verschiedener Autoren soll Typhon hundert Köpfe besessen haben, wie es Aischylos, Prometheus vinctus 353 f. (ἑκατογκάρανος, siehe SOMMERSTEIN 2008, 480), Aristophanes, Nubes 336 (ἑκατογκεφάλα τυφῶ, siehe DOVER 1968, 24), Hesiod, Theogonia 824–826 (siehe VON SCHIRNDING 2012, 66), Oppian, Halieutica III, 15 (siehe FAJEN 1999, 144), Pindaros, Pythia I, 16 f. (ἑκατοντακάρανος, siehe RACE 1997, 88.214.330), VIII, 16 (ἑκατόγκρανος) und Olympian IV, 6 f. (ἑκατογκεφάλος), Pseudo-Hyginus, Fabulae 152 (siehe P. K. MARSHALL 1993, 131) sowie Seneca, Hercules furens 784 (siehe BILLERBECH 1999, 144) nennen. Diese große Anzahl an Köpfen konnte natürlich nicht dargestellt werden; hier sei auf die Belege bei TOUCHEFEUMEYNIER 1997, Tf. 112 f. verwiesen. Bei Strabo, Geographika XIII, 4, 6 wird in einem Fragment von Pindaros von nur fünfzig Köpfen (πεντηκοντοκέφαλος) berichtet; griechischer Text nach RADT 2004, 650. 183 Vgl. z. B. die Belege bei BOUSSET 1895, 20–74. 184 So bei YARBRO COLLINS 2001, 77; die gleiche Meinung vertrat auch CHARLES 1920, 318. 185 LOHMEYER 1926, 113; so auch RITT 1986, 66.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
79
Raum zu erkennen.187 So nennt Platon, De republica 614b–615b und 621d eine tausendjährige Wanderung der Seelen nach einem Gericht, ebenso wie Vergil Anchises in der Aeneis VI, 478 berichten lässt. Auch im dritten Buch der Sibyllischen Orakel, 652–697 wird eine Art Zwischenreich angekündigt.188 Nach Plutarch, De Iside et Osiride 47 glaubten auch die iranischen Weisen an eine tausendjährige Epoche, die sich an einen 3000 Jahre währenden Krieg anschließen soll.189 Das Bundahišn berichtet in 3, 11 und 26 von einem Drachen Aḥriman, der mit Gewalt den Himmel nach 3000 Jahren zu stürmen sucht, diesen Kampf aber verliert und geschlagen wird.190 Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass zwar Verbindungen zwischen den Visionen von Daniel, Ezechiel und Johannes bestehen,191 die mehrköpfigen Wesen in Dan 7, 6 und Ez 1, 4–10 und 41, 18b–19 sich von den siebenköpfigen Gestalten in der Apokalypse aber unterscheiden, womit eine direkte Übernahme oder Kopie nicht zu überzeugen vermag. Parallelen wurden in vorderasiatischen Mythen und speziell dem Kampf eines Gottes gegen das Chaos gesehen,192 worauf im Folgenden genauer eingegangen werden soll.
4.2.3 Die siebenköpfige Schlange im Vorderen Orient Durch die Zusammenstellung der bisher in der Literatur genannten Deutungen zur siebenköpfigen Schlange in Apk 12 wird deutlich, dass diese nicht zu überzeugen vermögen. So weisen die in der Forschung angesprochenen Wesen in der Antike entweder überhaupt keine multiplen Häupter auf, oder es wird wie bei Hydra oder Typhon neben den verschiedenen, in der Antike erscheinenden Zahlen nie auf die spezifische Sieben hingewiesen. Auch ist die Deutung der Häupter als römische Herrscher mehr als willkürlich, wenn manche Kaiser einfach nicht mitgezählt sondern vielmehr ausgelassen werden um die Zahl Sieben zu erreichen. Im Folgenden sollen die verschiedenen Quellen für siebenköpfige Schlangen aus dem Vorderen Orient gesammelt werden, die in ihrer Gesamtschau bezeugen, dass sich dieses Motiv nicht auf eine Kultur oder einen Zeitraum eingrenzen lässt. Im Quellenüberblick kann sich auf den Vorderen Orient beschränkt werden, da aus Griechenland zwar eine große Anzahl von Göttern bekannt ist, die mit verschiedensten Anzahlen an Köpfen ausgestattet gewesen sein sollen, die Zahl Sieben aber bisher auffälligerweise nicht belegt ist. Begonnen werden kann chronologisch mit Quellen aus Mesopotamien, da aus dem Zweistromland die ältesten Zeugnisse vorliegen. Über die in ugaritischen Mythen genannten Wesen kann durch einen Namen der Bogen zu Quellen aus der Zeit nach Christi Geburt und damit zur Apokalypse geschlagen werden.
186 So nannten z. B. BEALE 1998, 365; KOWALSKI 2004, 391–407 und WELLHAUSEN 1907, 32 Ez 38 f. als Quelle für Apk 19 f. Grob auf die Kapitel Ez 34–39 führt MOYISE 1995, 64–84 Apk. 19 f. zurück. Einen anderen Weg schlug BÖCHER 1980b, 11 ein, der für das Motiv des Feuergerichts Predigt und Praxis Jesu nannte und damit die Evangelien als Quelle heranzog. 187 Vgl. BÖCHER 1988, 135–137, speziell Anm. 5 mit weiterführender Literatur. 188 Siehe die Übersetzung von GEFFCKEN 1902 zu betreffender Textstelle. 189 Vgl. GRIFFITHS 1970, 193–195. 190 Übersetzung von JUSTI 1868, 5. Siehe auch die vergleichbare Stelle in 2Hen 29, 4. Zur Beeinflussung auch HARTMAN 1989, 73. 191 Siehe KOWALSKI 2004, 504–507; zur Parallele zu Daniel MOYISE 1995, 51–53; für Parallelen zu Jesaja FEKKES 1994, 175–190. 192 Vgl. z. B. BOUSSET 1895, 171–173.
80
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
4.2.3.1 Mesopotamische Quellen Das dritte Jahrtausend scheint in Mesopotamien generell eine Periode gewesen zu sein, in der mehrköpfige Wesen und Götter erschaffen wurden. Der bisher früheste schriftliche Beleg liegt aus der Frühdynastischen Zeit III auf der Tafel Bagdad, IM 081446, rs. ii 3 vor. Hier werden im Sumerischen MIN SAG „zwei Köpfe“ in unklarem Zusammenhang genannt.193 Ebenso erscheint der Kampf mit einer mehrköpfigen Schlange bereits ab der Frühdynastischen Zeit III um 2550–2350 v. Chr. als Motiv in der Kleinkunst. Der Keulenkopf Kopenhagen, Nationalmuseum, Antikenslg., Nr. 5413194 zeigt eine siebenköpfige Schlange über drei löwenköpfigen Adlern, wobei hier allerdings kein Kampf wie in den folgenden drei Beispielen stattfindet. Da das mehrköpfige Wesen neben dem Leib einer Schlange auch den eines Panthers aufweisen kann, wird die Szene als ‚Drachenkampf‘ bezeichnet.195 Ein Muschelplättchen mit der Darstellung einer siebenköpfigen Monsterschlange befindet sich heute in Jerusalem, BLMJ, 2051 (Abbildung 53).196 Es wird in die Frühdynastische Zeit III (2500–2350 v. Chr.) datiert. Dargestellt ist ein Wesen mit Pantherkörper und sieben Schlangen als Köpfen. Vor ihm sitzt ein bärtiger Gott im Knielauf mit einer Hörnerkappe, die mit zwei Zweigen geschmückt ist. Sein Wurfholz hat bereits den untersten Kopf des Wesens getroffen und scheint durch dessen Hals gedrungen zu sein. Der kämpfende Gott wird als ein Vegetationsgott, vielleicht Ningirsu oder Ninurta, und das Ungetüm als Personifikation der Dürre gedeutet.197 Die Darstellung erinnert an ein mehrköpfiges Wesen auf einem Siegel aus der Frühdynastischen Zeit II (Abbildung 54), das in Fara/Šuruppak gefunden wurde.198 Heute sind noch vier Köpfe zu erkennen, die Abrollung ist aber nicht ganz erhalten, so dass durchaus auch weitere Köpfe vorhanden gewesen sein könnten.199 Ein weiteres Stück ist mit Chicago, OIM, A 34753 (Abbildung 55) erhalten.200 Es datiert wie das vorhergehende Exemplar in die Frühdynastische Zeit III. Auf der Siegelabrollung ist ein einziger Schlangenkörper zu erkennen, aus dem einst sieben Schlangenköpfe hervortraten. Der eher wenig qualitätsvoll dargestellte „Herr der Tiere“ vor der Schlange hält zwei bereits abgeschlagene Köpfe in seinen Händen. Hinter dem Reptil steht ein Hund, der von zwei Skorpionen verfolgt wird. Im Register über der Schlange sind Skorpionpaare abgebildet. Im obersten Register bäumt sich eine Schlange auf, die von je einem Skorpionpaar auf jeder Seite in Schach gehalten wird.
193 Publiziert von BIGGS u. POSTGATE 1975, 108.112, Abb. 3 (Nr. 523). 194 Publiziert von FRANKFORT 1935, 105–108 und MCBEATH 1999, 68. Hergestellt aus Alabaster, Fundort unbekannt; Größe: 10 Zentimeter hoch, Ø 13,5 Zentimeter. 195 So z. B. SCHROER u. KEEL 2005, 324 oder UEHLINGER 1995. 196 Publiziert von BLACK u. GREEN 1992, 165; 1981; BRAUN-HOLZINGER 2013, 176; HANSEN 1987, 60 f., Tf. 16, 29; KAHLER 2008, Abb. 3; KEEL 2001, 16; MCBEATH 1999, 68; PRITCHARD 1954, 218 (Nr. 671); SCHROER u. KEEL 2005, 326 f. (Nr. 233) und UEHLINGER 1995, 89, Abb. 9. Das Stück stammt aus dem Kunsthandel; Größe: 3,9 × 6,5 × 0,7 Zentimeter. 197 So die möglichen Deutungen bei BLACK u. GREEN 1992, 165 und SCHROER u. KEEL 2005, 326. 198 HANSEN 1981, 61, Tf. 16, 30; HEINRICH u. ANDRAE 1931, Tf. 60. Vgl. auch die Darstellung auf einem Siegel aus al-Hiba, siehe den Hinweis bei HANSEN 1981, 61, Anm. 19. 199 Als Parallele zur Gestaltung des Halses kann auf ein Siegel in Berlin, VA bei ORTHMANN 1975, Abb. 41k verwiesen werden. 200 Publiziert von BRAUN-HOLZINGER 2013, 186 (Nr. 30); VAN BUREN 1946, Abb. 16; FRANKFORT 1935, 121; KEEL 2001, 16; MCBEATH 1999, 67 f.; SCHROER u. KEEL 2005, 326 f. (Nr. 232) und UEHLINGER 1995, 88, Abb. 7. Gefunden in Ešnunna, Tall Asmar, Ältester Nordpalast, Locus unter E 15:1, Feld-Nr. AS 32.992; Größe: 4,5 × 9 Zentimeter.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
Abbildung 53: Jerusalem, BLMJ, 2051
Abbildung 54: Darstellung eines Siegels aus Fara/Šuruppak
Abbildung 55: Chicago, OIM, A 34753
81
82
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
Als weiteres Beispiel kann ein Siegel aus Ešnunna, heute Bagdad, IM 15618 genannt werden (Abbildung 56), das in die frühe Akkadzeit (~2300 v. Chr.) datiert wird.201 Aus dem Leib eines vierfüßigen Wesens, das an einen Panther erinnert, treten sieben Schlangen als Köpfe aus. Aus dem Rücken kommen fünf Flammen hervor.202 Das Wesen wird von einem Gott mit einer Lanze gespeert, drei Schlangen hängen bereits schlaff herab, eine vierte wird gerade durchbohrt, während drei weitere noch steil aufgerichtet sind. Der Gott trägt eine Hörnerkrone und einen kurzen Rock.203 Ein fast identisch aussehender Gott speert das Wesen an seinem Hinterteil. Auf jeder Seite stehen zwei unbeteiligte Personen in andächtiger Pose. Bei diesen Göttern könnte es sich um Ninazu von Ešnunna, dessen Sohn Ningišzidda oder um Tišpak handeln.204 Ebenso wurden Gilgameš und Enkidu, die von Utu und Ninurta unterstützt werden, als mögliche Identifikationen vorgeschlagen.205 Allerdings erscheinen die hier genannten Textbezüge nicht ausreichend, um eine Identifizierung der Szene mit einer Tat aus dem Epos des Gilgameš zu rechtfertigen.
Abbildung 56: Darstellung auf dem Siegel Bagdad, IM 15618
Durch die erhaltenen Szenen wird klar, dass der Kampf und damit die Bezwingung eines Wesens mit sieben Köpfen das essentielle Motiv darstellt. Die bereits abgetrennten Köpfe der Pantherschlangen oder auch der Angriff eines Helden sprechen hier klar für sich. Die Szenen machen insgesamt betrachtet einen recht lebendigen Eindruck und sind so für Darstellungen mehrköpfiger Wesen aus Mesopotamien einzigartig.
201 Publiziert von BRAUN-HOLZINGER 2013, 186 (Nr. 29); KAHLER 2008, 71–73, Abb. 4 f.; KEEL 2001, 16; MCBEATH 1999, 68; ORTHMANN 1975, Nr. 135d; PRITCHARD 1954, 221 (Nr. 691); SCHROER u. KEEL 2005, 328 f. (Nr. 234) und UEHLINGER 1995, 89, Abb. 10. Gefunden in Ešnunna, Tall Asmar, Single Shrine IV, Locus D 17:1, Feld-Nr. AS 32.738; Größe: 3,2 Zentimeter hoch; Ø 2,2 Zentimeter. 202 KAHLER 2008, 72 hält hier auch die Deutung als Schlangen für möglich. Flammen sind ein wichtiges Merkmal von Göttern in der Siegelkunst der Akkadezeit und treten wie auf Paris, Louvre, A 142, O 2485 bei SCHROER u. KEEL 2005, 346 f. (Nr. 247) aus deren Schultern aus; und sind hier zufälligerweise ebenso in einer Siebenzahl angeordnet. Ein weiteres Siegel aus dieser Zeit bei SCHROER u. KEEL 2005, 348 f. (Nr. 251) wurde in einem Grab aus dem achten oder siebten Jhd. v. Chr. westlich des Jaffa-Tores in Jerusalem gefunden und weist ebenso sieben Flammen auf, die aus den Schultern einer Gottheit hervortreten. 203 Zur Entwicklung der Hörnerkrone BOEHMER 1967, 273–291 und FURLONG 1987. 204 So die Deutungen bei SCHROER u. KEEL 2005, 328. 205 So die Deutung von KAHLER 2008, 75.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
83
Die mehrköpfige Schlange dürfte mit der in Texten erwähnten MUŠ SAG.IMIN „Schlange mit sieben Köpfen“206 sowie in späteren Quellen mit MUŠ.MAḪ SAG.IMIN zu identifizieren sein.207 Zu vergleichen ist hierzu SLT 51, Kol. IV, 11.208 Mit diesem Wesen könnte die MUŠ EME.IMIN.BI „Schlange mit sieben Zungen“ in Verbindung stehen, die in Ur5-ra, Tf. XIV, Z. 17 genannt wird.209 Sieben Zungen würde zumindest eine Identifikation mit sieben Köpfen nahelegen. Betrachtet man die Darstellungen, welche dieses Wesen mit sieben Köpfen zeigen, ist direkt auffällig, dass alle aus dem dritten Jahrtausend v. Chr. stammen. Hiernach verschwinden sie und die Darstellung scheint keine Rolle mehr gespielt zu haben. Auf die Tötung der siebenköpfigen Schlange wird in AN.GIM, Z. 32–40 und Z. 52–62 angespielt.210 Die Schlange erscheint unter ihrer Bezeichnung ebenso als Feind des Ningirsu in LUGAL-e, Z. 133,211 wobei beide Kompositionen von der Altbabylonischen bis in die Neubabylonische Zeit belegt sind.212 Die besiegten Feinde von Ningirsu werden aufgezählt und im Folgenden laut AN.GIM vom Gott an seinem Streitwagen angebracht. Doch liegt bisher kein Text vor, in dem die Episode wirklich erzählerisch dargestellt oder aufgearbeitet ist. In der Sammlung William F. Albright befindet sich eine Tafel, in der in Vs. 16 von Ningirsu als demjenigen berichtet wird, der MUŠ SAG.IMIN-na mu-un-ug5-ga-a-ni „die siebenköpfige Schlange getötet hat“.213 Die Tafel stammt aus Dayr aus spätbabylonischer oder bereits persischer Zeit. Da in AN.GIM bereits von der siegreichen Heimkehr des Ningirsu berichtet wird, hängt nach Z. 54 das Wildschaf als Staubschutz an dessen Streitwagen und die siebenköpfige Schlange nach Z. 62 an dessen Umfassung, wobei speziell die Betonung als Staubschutz wohl eine diffamierende Sicht auf die besiegten Feinde ausdrücken soll. Eine weitere Quelle für eine siebenköpfige Schlange stellt die Omenserie Šumma ālu ina mēlê šakin dar,214 in der verschiedene Vorzeichen genannt werden, die Tiere mit multiplen Köpfen, aber auch anderen Körperteilen beinhalten. Die größte Anzahl von Textvertretern stammt aus der Mitte des siebten Jahrhunderts aus Ninive, es liegen aber ebenso Textzeugen bis in das dritte Jahrhundert v. Chr. in neubabylonischer Sprache vor, was die lange Tradierung und die Bedeutung der Omina beweist,215 worauf auch die weit gestreuten Fundorte der Tafeln hinweisen. Hier heißt es in Šumma ālu ina mēlê šakin, Tf. 23, 91: „Wenn man eine Schlange mit sieben Kö[pfen] im Haus eines Mannes sieht, dann wird der Herr dieses Hauses dem Vordersten entkommen.“ Als eine späte Nachwirkung der siebenköpfigen Schlange kann auf ein sassanidisches Stempelsiegel (Abbildung 57) verwiesen werden, welches nur grob in die Zeit zwischen 224–642 n. Chr. datiert werden kann.216 Dargestellt wurde hier ein Reiter auf einem Pferd, der mit einem Speer eine siebenköpfige Schlange ersticht. Der Reiter selbst sitzt auf einem normalen Pferd, weist aber zwei Flügel an seinen Schultern auf. Auf dem Kopf trägt er einen auffallenden Kopfputz, der an Federn erinnert. 206 Diese findet sich so auch in lexikalischen Listen wie z. B. CDLI, Nr. P461397, Z. 277 belegt, siehe cdli.ucla.edu/search/search_results.php?CompositeNumber=Q000001 [Zugriff am 22. Juli 2022]. 207 So z. B. VAN BUREN 1946, 18 f.; HEIMPEL 1968, 480–482 und LANDSBERGER 1934, 53. 208 Publiziert von FRANKFORT 1935, 105–107 und CHIERA 1929, Nr. 51. 209 Publiziert von LANDSBERGER 1934, 8. 210 Publiziert von COOPER 1978, 60–65. 211 Siehe COOPER 1978, 144. 212 Vgl. COOPER 1978, 2. 213 Publiziert von LAMBERT 1971, 345; siehe auch WIGGERMANN 1992, 162. 214 Siehe die Edition FREEDMAN 2006. 215 Zum Konzept der Tradierung generell THEIS u. WILHELMI 2015, 710–713, 715 f. 216 Publiziert von WARD 1910, 211, Abb. 641.
84
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
Abbildung 57: Sassanidisches Stempelsiegel, J. Pierpont Morgan Library
Insgesamt betrachtet ist die Schlange mit sieben Köpfen in Mesopotamien somit immer ein Feind, der in den Belegen von anderen Göttern angegriffen und besiegt wird. Lediglich im genannten Beleg aus den Omina Šumma ālu ist die Schlange ein gutes Vorzeichen. Das Motiv des Götterfeindes in Mesopotamien in Gestalt einer siebenköpfigen Schlange ist so explizit der Thematik aus der Apokalypse verwandt.
4.2.3.2 Ugaritische Quellen Aus Ugarit, dem heutigen an der Küste Syriens gelegenen Ra’s Šamra, sind ab der Mitte des zweiten Jahrtausends v. Chr. bedeutende Mythen und Epen überliefert, die einen tiefen Einblick in die religiöse Vorstellungswelt der Region bieten. Viele der hier erwähnten Mythen und Vorstellungen erscheinen noch ein Jahrtausend später in identischer oder leicht abgewandelter Form. Aus Ugarit liegen ebenso bedeutende Omensammlungen vor,217 die sicher aufgrund von zahlreichen Parallelen von babylonischen Vorbildern beeinflusst oder direkt abgeschrieben wurden.218 Wie es auch für Mesopotamien der Fall ist, sind Geburtsomina nach Vorzeichen an Mensch und Tier differenziert. Die Tieromina betreffen übergreifend Kleinvieh (ṣin), die in KTU 1.103 + 145 (RS 24.247 +…), Z. 1 als att ṣin „Omen von Kleinvieh“ beschrieben werden; in KTU 1.140 (RS 24.302), Z. 1'.3'.5'.7'.9'.14' wird es beim Menschen als k tld aṯt „wenn eine Frau gebiert“ ausgedrückt.219 Gestaltet sind sie nach Protasis und Apodosis und treffen Aussagen über das Herrscherhaus, das Land und den König im Speziellen. Der private Bereich bleibt im ugaritischen Material unberücksichtigt. Eine strikte Abfolge der Vorzeichen, wie z. B. a capite ad calcem, ist nicht zu erkennen; sie wurden stattdessen nach kleinen Sachgruppen sortiert. Leider ist aus den bisher bekannten Zeugnissen kein Fall bekannt, in denen ein mehrköpfiges Wesen erwähnt wurde. Durch die zahlreichen Parallelen scheinen die Texte nicht in Ugarit verfasst, sondern vielmehr nur von Vorlagen übersetzt worden zu sein. Da in den mesopotamischen Omenserien wie Šumma ālu ina mēlê šakin oder Šumma izbu, wie erwähnt, sehr viele mehrköpfige Tiere erscheinen, wäre zu schlussfolgern, dass die Kenntnis von Omina über mehrköpfige Wesen auch in Ugarit vorhanden war, von denen (bisher) lediglich noch keine Zeugnisse bekannt sind. Dementsprechend kann sich in der folgenden Betrachtung auf mythologische Quellen beschränkt werden. 217 Siehe die Publikationen von DIETRICH u. LORETZ 1986, 99 f.; 1990, 1–86. 218 Dies konnte auch für Lebermodelle aus Ugarit nachgewiesen werden, vgl. MEYER 1990, 274. 219 Publiziert von DIETRICH u. LORETZ 1986, 96–99; 1990, 92.160; PARDEE 1986, 118 und XELLA 1981, 191–200 (hier sind die Nummern der Tafeln vertauscht).
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
85
Einen Hinweis auf eine siebenköpfige Schlange als Götterfeind findet sich in einer der zentralen Mythen aus Ugarit.220 In KTU 1.5, I, 1–4 im als solchen bezeichneten Bacal-Zyklus (KTU 1.1–6+1.8)221 wird kurz zu Beginn der zweiten Kampfepisode eine Rede des Gottes Mōtu mit Bacal überliefert: k tmḫṣ Ltn bṯn brḥ tkly bṯn cqltn [[š]] šlyṭ d šbct r’ašm tṯkḥ „Fürwahr, du hast Lītanu222, die flüchtige Schlange, erschlagen. Du hast die sich windende Schlange vernichtet; die Mächtige, die mit sieben Häuptern, hast du verachtet!“223 Die siebenköpfige Schlange mit dem Namen Lītanu ist demnach ein Götterfeind, der durch den Gott Bacal vernichtet werden musste. Die Schlange selbst wird schwächer als Mōtu imaginiert, da dieser Bacal bezwingen kann, Bacal aber selbst die Schlange vernichten konnte. Eingebunden ist diese Erwähnung in den Kampf Bacals gegen den Gott des Todes Mōtu. Weitere Feinde werden in KTU 1.3, III, 37–46 genannt; hier wird in III, 41 f. erneut eine sich windende Schlange (bṯn cqltn; baṯnu cAqallatānu)224 mit sieben Köpfen (šbct r’ašm) angesprochen.225 Ihr Name wird in KTU 1.3, III, 40 als Tunnanu (Tnn) angegeben.226 Anat rühmt sich in diesem Text, die verschiedensten Feinde vernichtet zu haben, darunter auch in III, 40 Tunnanu (Tnn). Speziell dieser Feind wie auch andere Gemeinsamkeiten setzen den Text in Verbindung zu biblischen Texten wie Jes 27, 1; 51, 9; Ps 74, 13 f.; 89, 11; 104, 26; 148, 7 und Hiob 7, 12; 9, 13; 41, 26. Die genannten biblischen Quellen wie auch weitere Textpassagen werden in der Forschung als eine Wiedergabe des ‚Chaoskampfes‘ interpretiert.227 Recht deutlich werden die Analogien dadurch, dass in Hiob 26, 12 f. die Wendung erscheint, dass Gott die flüchtige Schlange erschlagen hat. Aus verschiedenen weiteren Quellen wird deutlich, dass es sich bei Lītanu und Šlyṭ um Wesen handelt, die im Meer leben und dem Gott Yam mit ihrer Hilfe zu Seite stehen.228 Dieses Motiv hat sich somit ebenso bis in Apk 13, 1 gehalten, da hier das siebenköpfige Tier ebenso aus dem Meer entsteigt. Wie erwähnt, hat die Göttin Anat unter verschiedenen Feinden nach KTU 1.3, III, 40 auch ein Wesen namens Tunnanu (Tnn) erschlagen.229 Dass Tunnanu mehr als einen Kopf oder ein Gesicht besaß, dürfte durch die ugaritische Quelle KTU 1.83, 5 deutlich werden, da das Wesen hiernach zumindest zwei Zungen (lšnm) hat,230 was dementsprechend auch als zwei Köpfe oder zwei Gesichter zu interpretieren ist. Da in einer Tafel aus Ugarit Tunnanu mit sumerisch MUŠ
220 221 222 223
224 225 226
227 228 229 230
Siehe zu den folgenden Ausführungen auch THEIS 2022a, 292–295. Literatur zum Mythos liegt bei NIEHR 2015, 188–190 gesammelt vor. Zu dieser Vokalisation siehe jetzt WILSON-WRIGHT u. HUEHNERGARD 2021, 154 f. Ugaritischer Text nach DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 22; vgl. speziell den Kommentar von DIETRICH u. LORETZ 1999–2000, 56–74. Entspricht CTA V, Kol. I, Z. 1–4 bei HERDNER 1963, 32. Vgl. WILSON-WRIGHT u. HUEHNERGARD 2021, 159: cAqallatānu „serving as an alternative name for Leviathan.“ Siehe den Text bei DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 12; SMITH u. PITARD 2009, 204 und NIEHR 2015, 206 f. Vgl. KAISER 1959, 75 und SMITH u. PITARD 2009, 257f.; ugaritischer Text bei DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 12. Auch UEHLINGER 1999, 512 sieht an dieser Stelle ein weiteres Wesen. Für weitere Stellen, in denen Tunnanu genannt wird, siehe HEIDER 1999, 835. Vgl. BAUKS 2006, § 3.1.2; für weitere Quellen siehe § 3.2 und EBERHARDT 2007, 89 f. Vgl. z. B. auch KAISER 1959, 74 f., 145; eine Identifizierung mit Yam ist allerdings abzulehnen. Siehe z. B. DIETRICH u. LORETZ 1999–2000, 75 und DONNER 1967, 343. Vgl. KAISER 1959, 75 und SMITH u. PITARD 2009, 257 f.; ugaritischer Text bei DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 12. Ugaritischer Text bei DIETRICH, LORETZ u. SANMARTÍN 1995, 101.
86
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
und akkadisch Bašmu geglichen wird,231 muss es sich somit um eine Schlange handeln. Nach KAR 6, Kol. II, 26 handelt es sich bei Bašmu ebenfalls wieder um ein Meeresungeheuer.232 Zur weiteren Verdeutlichung kann auf einen zentralen mesopotamischen Mythos verwiesen werden. So erschuf Tiāmat nach Enūma elîš, Tf. I, 141–145 elf Monster, unter denen Bašmu genannt wird.233 In einer Beschwörung auf der Tafel Bagdad, IM 51328 (=51292), Z. 17–21 (Par. in einer Hymne auf Bagdad, IM 54616, Z. 9) wird Bašmu wie folgt beschrieben: ša Bašmi šišit pīšu sebet lišānušu sebet ú-lu-mi-ku ša libbišu „(Von denen) hatte Bašmu sechs Münder, sieben Zungen (und) sieben … an seinem Bauch.“234 Wenn aber Bašmu sechs Münder hat, sollte diese Schlange der Beschreibung nach auch über sechs Köpfe oder zumindest sechs Gesichter verfügen.235 Die sieben Zungen ließen sich auch als sieben Gesichter oder Köpfe interpretieren. Bašmu wird in der Forschung mit der Darstellung einer Hornviper (Cerastes cerastes) gleichgesetzt, die auf in der Kassitenzeit auf Kudurru und in der neuassyrischen Zeit als Gestaltungselement auf Siegeln erscheint.236 In diesen Darstellungen weist die Schlange aber keine multiplen Köpfe auf, was dann einer Interpretation der Nennung von „sechs Mündern“ auf der Tafel Bagdad, IM 51328 wie auch der Beschreibung in KTU 1.3, III, 42 und KTU 1.83 widersprechen würde. Dementsprechend muss man entweder davon ausgehen, dass Bašmu auch als Wesen mit nur einem Kopf erscheinen kann, sprich die Darstellungsweise auf Kudurru und Siegeln angepasst oder verändert wurde, oder die Identifikation mit den Darstellungen überdacht werden muss. Nach KAR 6, Kol. II, 26 handelt es sich bei ihm um ein Meeresungeheuer.237 Da Tunnanu in der gebotenen Quelle KTU 1.3, III, 40–42 als ein von der Göttin Anat besiegtes Wesen beschrieben wird, sind beide – Tunnanu und Lītanu – als Götterfeinde mit mehreren Häuptern anzusprechen. Bei dem ugaritischen Tunnanu handelt es sich aber um kein anderes Wesen wie den in Ps 74, 13b genannten Tannīn ()תַּ נִּין, der, wie in Kapitel 4.1.3 gezeigt, auch in der Bibel als mehrköpfiges Wesen erscheint. Durch die direkte Parallele aus Ugarit nebst den vergleichenden und erläuternden Quellen wird klar, dass für die Meinung, dass es sich bei Tannīn ( )תַּ נִּ יןnur um ein einköpfiges Wesen handelt, oder der Plural sogar gestrichen werden soll, keinerlei Anzeichen existieren. Die Nennung beider Wesen in den zitierten Textstellen aus dem Mythos von Bacal steht in direkter Parallele zur Nennung des Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןund des Tannīn ( )תַּ נִּ יןin Ps 74 (s. Kap. 4.1.3). Es scheint folgerichtig, in einigen der Darstellungen aus dem Vorderen Orient den in ugaritischen Texten beschriebenen Götterkampf abgebildet zu erkennen. So wird ein Relief des 231 232 233 234 235
Publiziert von NOUGAYROL et al. 1968, 24 (Nr. 137, I, 8ʹ). Siehe den Text bei LANDSBERGER 1934, 58. Vgl. den Text bei KÄMMERER u. METZLER 2012, 145 und LAMBERT 2013, 58 f. Akkadischer Text nach VAN DIJK 1957, 93, 95. Unter den Feinden von Ninurta erscheint in AN.GIM, Z. 32 und 54 ein Wildschaf (atūdu) mit sechs Köpfen (ŠEG9 SAG-ÀŠ); siehe COOPER 1978, 60, 62. Dieses Wesen scheint bisher in keiner Abbildung vorzuliegen. Auf Zylinder A, Kol. XXV, 24–26 berichtet Gudea, dass er den Krieger und das Wildschaf (UR.SAG ŠEG9 SAG-ÀŠ) in einem Raum mit Waffen im Tempel aufgestellt habe; vgl. EDZARD 1997, 85. 236 Vgl. BLACK u. GREEN 1992, 168 und WIGGERMANN 1992, 166–168, 186. Bereits in AN.GIM, Z. 33 und 55 wie auch in LUGAL-e, Z. 129 wird Bašmu (hier UŠUM UR.SAG) als ein Feind Ningirsus genannt, den dieser wie andere mythologische Kreaturen besiegt; vgl. COOPER 1978, 60–65. In diesem Mythos weist Bašmu allerdings keine weiteren Köpfe auf – vielleicht wurde er so gedacht, ohne dass es explizit beschrieben wurde. 237 Siehe den Text bei LANDSBERGER 1934, 58.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
87
Löwentors aus Arslantepe, heute Ankara, AM, No. 12250 (Abbildung 58), aus dem zehnten Jahrhundert als dieser Kampf gedeutet.238 Ursprünglich stammt das Stück aus Arslantepe nahe Malatya in Ostanatolien. Dargestellt ist eine doppelköpfige Schlange,239 die gerade von zwei vor ihr stehenden Gottheiten angegriffen wird. Auf den Rücken scheinen Blitze einzuschießen; die weiteren kleinen Punkte, die auf den Rücken einzufallen scheinen, werden als Hagelkörner interpretiert. Deutlich erkennbar ist die Parallele zum Kampf eines Gottes gegen eine Schlange mit mehreren Köpfen. Das Relief wird als Darstellung des Kampfes des Wettergottes gegen den Schlangendrachen interpretiert.240 Für die Darstellung wurde somit eine Gleichsetzung mit dem Mythos von Illuyanka in CTH 321 postuliert, wogegen aber spricht, dass Illuyanka im Mythos nicht als mehrköpfig angesprochen wird.241 Aufgrund des im syrisch-palästinischen Bereich mehrfach bekannten Motivs des Kampfes gegen eine mehrköpfige Schlange wäre ein Bezug zum Sieg Bacals gegen die Schlange mit sieben Häuptern wahrscheinlicher, wie es in KTU 1.5, Vs. I, 1–3 im Bacal-Zyklus (KTU 1.1–6+1.8) berichtet wird.
Abbildung 58: Kampf gegen die Schlange; Relief vom Löwentor von Arslantepe
4.2.3.3 Ägyptische Quellen Obwohl die Entwicklung von mehrköpfigen Wesen in Ägypten der bisherigen Quellenlage nach bereits im vierten Jahrtausend einsetzt, wie es durch Schminkpaletten deutlich wird, die Tiere mit mehreren Köpfen zeigen,242 und aus den folgenden drei Jahrtausenden sehr viele Belege für Mehrköpfigkeit generell vorliegen, ist im Gegensatz zu Mesopotamien oder Ugarit eine siebenköpfige Schlange bisher nur selten belegt. Aus dem magischen Milieu kann auf die Darstellung eines siebenköpfigen Wesens auf Pap. Berlin P. 15770 hingewiesen werden,243 das sieben Häupter einer Schlange und zusätzlich den Kopf einer Antilope besitzt. Das Geschöpf wird von 238 Publiziert von DELAPORTE 1940, Tf. 22; KEEL 2001, 19; VAN LOON 1990, Tf. 3 und PRITCHARD 1954, 218 (Nr. 670). 239 Vergleichbar liegt eine doppelköpfige Schlange auch bereits auf einer Libationsvase von Gudea und damit aus der Zeit um etwa 2150 v. Chr. vor, heute Paris, Louvre, AO 190, siehe VAN BUREN 1946, 15; MCBEATH 1999, 136; PRITCHARD 1954, 174 (Nr. 511). 240 So SCHWEMER 2006, Abb. 2. 241 Siehe die letzte Übersetzung von BAUER et al. 2015, 147–149. Hier wäre eher an eine Darstellung wie auf dem Siegel Fribourg, Slg. Bibel+Orient, VR 1993.6, zu denken, wo der Kampf eines Gottes gegen einen Schlangendrachen dargestellt wird, dieses Wesen aber nur einen Kopf aufweist; siehe KEEL-LEU u. TEISSIER 2004, 179 (Nr. 179). 242 Vgl. hierzu zuletzt THEIS 2017. 243 Publiziert von FISCHER-ELFERT 2015, 141–145.
88
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
einer dem Gott Seth ähnlichen Gestalt mit einem Speer angegriffen; das Amulett sollte zum Schutz eines Mannes wirken. Es handelt sich mit einer anhand der Paläographie bestimmten Datierung in die 20. Dynastie (1183–1070 v. Chr.) um den frühesten Vertreter dieser Gattung aus Ägypten, der etwas Feindliches aufweist.
Abbildung 59: Siebenköpfige Schlange im Tempel von Hibis
Abbildung 60: Gemme Cambridge (Massachusetts), 2012.1.144 (Slg. Sossidi, Nr. 10)
Eine Schlange mit sieben Köpfen wird auch in der sechsten Stunde des Amduat auf dem Sarkophag des AIw=f-o#, der während der späten 26. Dynastie (664–525 v. Chr.) lebte, dargestellt,
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
89
die in den Belegen aus dem Neuen Reich aber über eine andere Kopfanzahl verfügt.244 Eine übelabwehrende Funktion zeigt sich bei der im Tempel von Hibis in der Oase Charga dargestellten Schlange (Abbildung 59) aus der Zeit von Dareios I. (522–486 v. Chr.).245 Dieses Wesen mit sieben Schlangenköpfen wird als cb+(.w) HDr.w „Die, die die Würmer, die den Leichnam fressen, vertreibt“ bezeichnet, sie übt demnach eine den Verstorbenen behütende Funktion aus. Die Schlange wird hier similia similibus als Gegenpart zur Bedrohung durch Schlangen zu verstehen sein, die in vielen Gräbern als Widersacher des Leichnams genannt werden.246 Ein später Vertreter eines Wesens mit sieben Schlangenköpfen liegt mit einer Darstellung auf der Gemme Cambridge (Massachusetts), 2012.1.144 (Slg. Sossidi, Nr. 10) vor (Abbildung 60).247 Dargestellt wurde hier eine anthropomorphe Gottheit mit sieben Schlangen als Köpfen. Aus der Oberseite des Rumpfes treten anstatt eines Kopfes sieben, sich aufbäumende Schlangen aus. Die äußersten Schlangen sitzen bereits auf den Schultern und den Armen auf, da auf dem Rumpf nicht genügend Platz vorhanden war.248
4.2.3.4 Syrische und koptische Quellen Waren die bisher genannten Quellen, die eine siebenköpfige Schlange im Vorderen Orient bezeugen, mit Ausnahme der genannten Gemme (Abbildung 60) in die Zeit vor Christi Geburt zu datieren, liegen auch zur Offenbarung kontemporäre Quellen vor, welche die lange Tradierung dieses Motiv eindeutig belegen. In eine direkte Verbindung zur Schlange der Apokalypse kann eine Passage aus den Oden Salomos gesetzt werden. Die Entstehung der Oden wurde von Michael LATTKE zuletzt im ersten Viertel des zweiten Jahrhunderts nach Christus angesetzt, wobei der Entstehungsort nur grob auf die östliche Mittelmeerwelt eingegrenzt werden kann.249 Mit diesem Zeitansatz bewegt man sich in etwa derselben Zeit, in die auch, wie auf Seite 74 angemerkt, die Entstehung der Offenbarung des Johannes gemeinhin in der Forschung datiert wird. In Ode XXII, 5 wird ebenfalls von einer siebenköpfigen Schlange berichtet:
244 Publiziert von BAREŠ u. SMOLÁRIKOVÁ 2008, Tf. 26a. Bei der dreiköpfigen Schlange, welche KORPEL u. DE MEER 2017, 7 abbilden, handelt es sich um Amd. 485 (z. B. HORNUNG 1963, 110, Tf. 6), die sicher nicht wie angegeben Apophis darstellt, sondern der Inschrift nach als „‚Zahlreich an Gesichtern‘ “ und als der „Schützer (von %pr¦)“ (oS#-Hr.w m s#_.w) anzusprechen ist. Des Übrigen wird diese Schlange auch mit fünf Köpfen dargestellt. 245 Publiziert von DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 3, 2. 246 Hierzu THEIS 2014, 613–619. 247 Publiziert von MICHEL 2004, 332, Tf. 59, 2; siehe zu dieser Gemme auch THEIS 2023, 40 f. 248 Die Gestaltung eines anthropomorphen Gottes, der mehrere Schlangen als Köpfe aufweist, ist in Ägypten bereits früher belegt. So liegt ein anthropomorpher Gott mit drei Schlangenköpfen auf Pap. Paris, Bibl. nat., Inv.-Nr. 158–161 vor, der in die Dritte Zwischenzeit datiert wird, siehe PIANKOFF 1964, 110. Praktisch identische Wesen mit drei Köpfen befinden sich auch auf der Metternichstele, die in die 30. Dynastie in die Zeit von Nektanebos datiert und sich heute in New York, MMA, 50.85 befindet, siehe GOLÉNISCHEFF 1877, Tf. 1; auf Sarg Kairo, Äg. Mus., CG 29306, siehe MASPERO 1908, 233 u. Tf. 20; im Tempel von Dendara in Dendara X, Tf. 176.203; und im Tempel von Edfu in Edfou IX, Tf. 24a. Eine antropomorphe Gottheit mit vier Schlangen als Köpfen liegt bereits in der 19. Dynastie im Pfortenbuch, Elfte Stunde, 69. Szene, oberes Register vor, siehe HORNUNG 1984, 246 f., Tf. 11. 249 Siehe LATTKE 2011, 12 f.
90
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
yhw$YD* )OB$D] )NYNtL yD]Y^)B pXSD] w[h hāw d-saḥḥep b-iḏay l-Ṯannīna ḏ-šabcā rḝšaw „Er, der die Schlange mit sieben Köpfen durch meine Hände stürzte.“250 Vergleichbar ist die koptische Übersetzung der Ode: pentafpatasse 'mvof eto 'nsakfe 'nape x'n naWij „Er, der die Schlange mit sieben Köpfen mit meinen Händen erschlagen hat.“251 Gesprochen wird hier von Jesus; der Passus über eine siebenköpfige Schlange ist in eine Ode eingearbeitet, in der Gott verschiedene Taten und eine große Machtfülle zugesprochen werden. In der syrischen Version wird die Schlange als )NYNt (Tannīna) bezeichnet.252 Dass es sich bei dem Wesen namens Tannīna um ein Reptil dieser Art handelt, wurde bereits für den im Ugaritischen belegten Tunnanu auf Seite 85 deutlich gemacht.253 Tunnanu ist in der ugaritischen Mythologie der Feind des Sturmgottes Bacal und wird auf den Mythos von Illuyanka zurückgeführt.254 Für die betreffende Ode Salomos wurde Tannīna in der Forschung als mythologische Bezeichnung des Teufels gedeutet,255 doch erscheint es mit dem verfügbaren Vergleichsmaterial aus dem Vorderen Orient einleuchtender, in dieser simpel eine siebenköpfige Schlange als Widersacher Gottes zu erkennen, bei dem es sich nicht spezifisch um den Teufel handeln muss. Die Formulierung in der Ode Salomos erinnert stark an Pistis Sophia 71. Hier bedrängt ein Basilisk mit sieben Köpfen als Verkörperung des Authades beständig die Pistis Sophia, doch ist dieser Tat kein Erfolg beschieden. akpatasse 'mvof 'nsit pa+sakfe 'nape akno'j'f ebol 'x'n naWij „Du hast die Schlange niedergeschlagen, die mit den sieben Köpfen. Du hast sie in meine Hände geworfen!“256 Speziell aufgrund der fast identischen Wortwahl kann man kaum von einem Zufall sprechen. Somit liegt auch hier der Typus des Götterkampfes gegen eine siebenköpfige Schlange vor, der sich somit auch in der koptischen Tradition greifen lässt, wobei die Pistis Sophia geläufig in das dritte nachchristliche Jahrhundert datiert wird. Die koptische Übersetzung der Offenbarung benennt in Apk 12, 3 das Tier mit sieben Köpfen als „ große, rote Schlange“ (ounoW 'ndrakwn eftrekrwk), „die sieben Köpfe und zehn Hörner hat, und sieben Diademe auf ihren Köpfen“ (ere sakfe 'nape 'mmof m'n mht 'ntap auw sawfe 'nWrhpe xij'n nefaphue).257 Vergleichbar wird das Tier (chrion) in Apk 13, 1 als „es hatte zehn Hörner, sieben Köpfe, zehn Diademe waren auf seinen Hörnern und auf seinen Köpfen war ein Name der Blasphemie geschrieben“ (eu'n mht 'ntap 'mmof auw sakfe 'nape ere mhte 'nWrhpe xij'n neftap efshx exrai ej'n nefaphue 'nWiouran 'njioua) bezeichnet.258
250 251 252 253 254 255 256 257 258
Syrischer Text nach LATTKE 2001, 147; 2011, 86. Koptischer Text nach LATTKE 2001, 147; Kommentar ibd. 145–147; 2011, 86. Für Literatur sei hier auf NIEHR 2006, 726 verwiesen. Publiziert von NOUGAYROL et al. 1968, 24 (Nr. 137, I, 8ʹ). Vgl. NIEHR 2006, 727. Vgl. LATTKE 2001, 155. Koptischer Text nach C. SCHMIDT 1925, 156; Übersetzung bei id. 1905, 102. Koptischer Text nach HORNER 1924, 390. Koptischer Text nach HORNER 1924, 400.402.
4.2 Das Neue Testament – Siebenköpfige Wesen in der Apokalypse des Johannes
91
4.2.4 Zusammenfassung Durch die zahlreichen Belege wird deutlich, dass eine siebenköpfige Schlange bzw. ein pantherartiges Tier mit sieben Schlangen als Köpfen seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend als Götterfeind erscheint. Belege liegen in mesopotamischen, ägyptischen und ugaritischen Quellen vor und das Wesen behält ebenso in der Zeit nach Christi Geburt seine Rolle als Widersacher Gottes bei. Besonders deutlich wird die Tradierung durch die Bezeichnung in ugaritischen Quellen als Tunnanu, in Ps 74, 13b als Tannīn ( )תַּ נִּ יןund in der Zeit nach Christi Geburt als )NYNt (Tannīna). Wie LOHMEYER und RITT den Tannīn ( )תַּ נִּ יןals einen der Vorläufer eines der Tiere der Apokalypse sehen wollten,259 kann diese Sicht aufgrund der Parallelen zwischen den Kreaturen und der Betrachtung der komplexen Motivgeschichte einer siebenköpfigen Schlange im Vorderen Orient erhärtet werden. Wenn in Apk 12, 3 von δράκων μέγας die Rede ist, scheint hier in analogiam zu Ps 74, 13 eventuell im Griechischen zwar die Bezeichnung δράκων verwendet worden, aber vielleicht realiter ein Tannīn gemeint sein. Die Zahl von sieben Häuptern lässt sich durch die besondere Funktion der Zahl im Vorderen Orient als Versinnbildlichung der Gesamtheit und der Vollendung erklären:260 im Alten Testament erscheint sie das erste Mal in Gen 2, 2, wo Gott am siebten Tag von seinem Werk ruht. Nach Gen 4, 15 zieht der Mörder von Kain siebenfache Rache auf sich. Noah nahm nach Gen 7, 2 f. von allem reinen Vieh und den Vögeln sieben mit auf die Arche und Johannes schrieb nach Apk 1, 4.11 an sieben Gemeinden. Hierzu ließen sich viele weitere Stellen anführen. Auch in Mesopotamien ist die Zahl Sieben ein beliebtes Gestaltungselement. So berichtet Gudea auf seiner Statuette B, Kol. V, 39 von einer Waffe namens ŠÁR.GAZ, die sieben (IMIN) Spitzen (URUDGAG) aufweise und dem Gott Ningirsu gehöre.261 Ein siebenköpfiger Stab mit verschiedenen Protomen ist auf Yale, Babylonian Collection, 13463 dargestellt und datiert in die Ur IIIZeit.262 Eine Schlange mit sieben Köpfen wird in Šumma ālu ina mēlê šakin, Tf. 25f., Rs. 5 genannt.263 In Tf. 23, Z. 91 wird sie mit einem positiven Effekt beschrieben: šumma ṣerra 7 qaq[qadātiš]u ina bīt amēli īmur bēl bīti šuāti ašarēda uṣṣa „Wenn man eine Schlange mit sieben Kö[pfen] im Haus eines Mannes sieht, wird der Herr dieses Hauses dem Ersten entkommen.“264 In der Apokalyptik spiegelt die Zahl Sieben insbesondere die Gesamtheit wider.265 Die Köpfe des Tiers können somit als Ausdruck der Gesamtheit des Bösen begriffen werden. In Nag Ham259 LOHMEYER 1926, 113; so auch RITT 1986, 66. 260 Vgl. zur Symbolik der Vollendung REINHOLD 2008. Für Ägypten sei hier nur auf die Materialsammlung von ROCHHOLZ 2002 verwiesen. 261 Publiziert von EDZARD 1997, 33. Die šita-Waffe mit sieben Köpfen (SAG IMIN-e) gehörte nach der Erzählung Inanna und Ebiḫ, Z. 57 Inanna, siehe den Text bei BOTTÉRO u. KRAMER 1993, 222. 262 Publiziert von BUCHANAN 1981, 258 f. (Nr. 673). 263 Vgl. FREEDMAN 2006, 102. 264 FREEDMAN 2006, 46. 265 Siehe MOUNCE 2009, 245 f. für Quellen. Es erscheint nicht logisch, wie KORPEL u. DE MEER 2017, 7 zu behaupten „Apparently the number of heads did not matter much to the Ancients,“ wenn doch wie in den Belegen genannt die genaue Zahl immer eine wichtige Rolle spielt. Und vor allem sollte nicht jede mehrköpfige Schlange mit der siebenköpfigen Schlange der Offenbarung parallelisiert werden. Zwar weist nach Pseudo-Apollodor, Bibliotheca II, 5, 11 Ladon einhundert Köpfe (κεφαλὰς ἔχων ἑκατόν) auf, von denen jeder eine andere Sprache spricht (ἐχρῆτο δὲ φωναῖς παντοίαις καὶ ποικίλαις), siehe FRAZER 1921, 220, doch sollte man aufgrund der unzähligen Belege für mehrköpfige Schlangen aus dem Vorderen Orient davon absehen, auch Ladon mit in die Diskussion einzubringen, wie KORPEL u. DE MEER 2017, 8.14 es taten.
92
4. Mehrköpfigkeit in der Bibel
madi II, 1, 11, 26–35 wird auch einmal ¢Oaw als ein Gott beschrieben, der den Kopf einer Schlange (drakwn) mit sieben Köpfen (sakfe 'nape) aufweist.266 In Apk 12, 9 wird der besiegte δράκων als Schlange (ὄφις) bezeichnet, die man auch Teufel (Διάβολος) und Satan (ὁ Σατανᾶς) nennt. Dass es sich dabei um den Gottesfeind par excellence handelt, dürfte durch die Beinamen klar werden. Die zehn Diademe sind als Ausdruck seiner Herrschaft zu verstehen. So wird διάδημα in 1Makk 11, 13 als Sinnbild für die Herrschaft von Ptolemaios über Vorderasien verwendet. Die Sieben als Anzahl der Köpfe stellt den Belegen nach in Mesopotamien die wichtigste Zahl der Köpfe dar. So wird u. a. auf der Tafel London, BM, K. 2054 die Zahl Sieben mit kiššatu „Gesamtheit“ gleichgesetzt, ebenso wie mit den Städten Babylon, Uruk, Kiš und Jamutbala.267 Dementsprechend ließe sich schlussfolgern, dass die Verwendung der spezifischen Zahl Sieben für die Anzahl der Köpfe sozusagen die Gesamtheit der ‚Monsterkräfte‘ darstellen könnte, die durch die verschiedenen Helden in den einzelnen, in Kapitel 4.2.3.1 genannten Darstellungen bekämpft werden. Das Merkmal mehrerer Köpfe nebst dem Chaoskampf kann seit dem dritten vorchristlichen Jahrtausend in Mesopotamien nachgewiesen werden. Dass es sich ausgerechnet um einen siebenköpfigen Drachen handelt, verweist ebenso auf die frühen Darstellungen wie auch die vorhandenen textlichen Belege über mehrköpfige Wesen.268 Vielmehr lässt sich die Gestaltung einer Schlange oder eines Drachen (δράκων μέγας) wie auch eines Tieres (θηρίον) mit sieben Häuptern aus gemeinmythischen Vorstellungen des Vorderen Orients wie auch der Bedeutung, die dieser Zahl in der Antike zugesprochen wurde, erklären. Betrachtet man die Belege aus dem Neuen Testament zusammengefasst und unter Hinzuziehung der Oden Salomos wie auch älteren Quellen aus dem Vorderen Orient, dürfte klar sein, dass eine siebenköpfige Schlange über gut 2500 Jahre als Götterfeind in den verschiedensten Kulturen zu greifen ist. Eine Erklärung mit spezifischen Herrschern oder Symboliken muss daher für Apk 12 und 13 nicht erfolgen – vielmehr kann das Wesen vor dem gemeinmythologischen Hintergrund der Antike betrachtet und erklärt werden. Hingewiesen werden kann an dieser Stelle noch auf einen weiteren Götterfeind mit sieben Köpfen, der aber der Quellenlage nach keine weitere Verbreitung gefunden zu haben scheint. Auf Zylinder A, Kol. XXV, 27 f. berichtet Gudea, dass er einen siebenköpfigen Hund (UR.SAG IMIN-ÀM), vor der Stadt aufgestellt habe.269 Dieser Passus erscheint in einem größeren Abschnitt in Kol. XXV, 24–XXVI, 16. Hiernach ließ Gudea verschiedene Feinde, die als geschlagen bezeichnet werden und durch ihre Zusammenstellung als diejenigen von Ningirsu zu greifen sind, in verschiedenen Städten aufstellen. Dies ist so zu deuten, dass Gudea Statuen von Götterfeinden, die bereits besiegt wurden, an wichtigen Orten aufstellen ließ, was sich unter einem abschreckenden oder apotropäischen Aspekt verstehen lässt. Dass der Aufstellung eine wichtige Komponente inhärent war, zeigt sich als Abschluss in Kol. XXVI, 17–19 mit „Gudea, der Ensi von Lagaš, machte ihre Namen bedeutend unter den Göttern“.270
266 Koptischer Text nach WALDSTEIN u. WISSE 1995, 71–73; Übersetzung bei WALDSTEIN 2001, 118 f. 267 Entspricht CT XVIII, 29 f., Teilpublikation von HEHN 1907, 4; siehe ibd. 4–6, 16 f. für weitere Quellen für die Gleichung Sieben = kiššatu. 268 Anders möchte MALINA 2002, 174 f. den Drachen als Wiedergabe des Sternbilds Skorpion ♏ sehen (die vorher genannte schwangere Frau entspricht bei ihm dem Sternbild Jungfrau ♍). Diese Identifizierung erscheint doch etwas weit hergeholt, besonders wenn man die Symboliken mit anderen, aus dem Vorderen Orient bekannten Symboliken vergleicht. So setzte REDDISH 2001, 231 f. die Frau und ihr Kind mit dem Mythos der Geburt von Apollo gleich. 269 Siehe den Text bei EDZARD 1997, 85. 270 Siehe den Text bei EDZARD 1997, 86.
5 Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter Wesen mit mehreren Köpfen oder Gesichtern, deren Darstellungen klar durch biblische Vorbilder beeinflusst sind, sind im Mittelalter recht häufig anzutreffen.1 Durch diese Wiedergaben kann die Motivgeschichte von der Antike bis in unsere heutige Zeit für das biblische Zeugnis weitergeführt werden. Wollte man die Pluralität eines Wesens aufzeigen oder die multiplen Kräfte eines Widersachers der Kirche darstellen, konnte sich ebenso wie Jahrtausende zuvor einer Darstellung mit multiplen Gesichtern oder Häuptern bedient werden. Nachdem auf dem Konzil von Konstantinopel 381 n. Chr. die Wesensgleichheit der drei Teile der Trinität zum Dogma erhoben worden war, fand im achten oder neunten nachchristlichen Jahrhundert eine Gestaltung mit drei Köpfen auf einem Körper zum ersten Mal zur Darstellung der Einheit von Vater, Sohn und Heiliger Geist Verwendung.2 Es handelt sich um zwei Wandmalereien in einer koptischen Kirche, die in Abd al-Gadir beim Wadi Halfa erbaut worden ist.3 Auch wird die Gestaltung als Triprosopos dazu verwendet, die christliche Trinität Vater, Sohn und Heiliger Geist darzustellen.4 Ein bekanntes Beispiel liegt hierfür mit einer Darstellung in Codex 2780 der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien vor (Abbildung 72), der im Jahr 1423 n. Chr. geschaffen wurde.5 Die dreigesichtigen Ausführungen der Dreifaltigkeit wurden später offenbar als anstößig empfunden, so dass Papst Urban VIII. (1623–1644 n. Chr.) Bilder, die dieses Gestaltungsmerkmal aufwiesen, am 11. August 1628 n. Chr. verbrennen ließ.6 Auch der Teufel konnte mit drei Gesichtern dargestellt werden. So wird er in Paris, Bibl. nat., Codex Nr. 6770 als Triprosopos abgebildet.7 Auf seinen beiden Brustmuskeln liegt je ein weiterer Kopf auf und seine beiden Schultern scheinen Köpfe auszuspucken. Bei diesem Wesen ist ebenso der Phallus in Form eines großen Gesichts mit herausgestreckter Zunge sowie die beiden Kniescheiben als Köpfe ausgeführt worden. Die Gestaltung von Phallus und Kniescheiben erinnert stark an die Wiedergaben polymorpher Bes-Gestalten (Abbildung 39 f.), die kleine Löwenköpfe auf den Knien und den Phallus in Form eines Katzen- oder Löwenkopfes zeigen. Es wäre gut möglich, dass dem Gestalter der französischen Miniatur aus dem 15. Jahrhundert die Darstellung eines polymorphen Bes von einer Gemme bekannt war. Dass derartige, ursprünglich aus einem völlig anderen Kulturraum stammende Gemmen mit ägyptischen Motiven in Europa um diese Zeit bekannt waren, zeigen z. B. die Zusammenstellungen von Anne Claude PHILIPPE DE CAYLUS oder Jean CHIFLET.8 Die Kombination von Phallus und Kniescheiben in Form von Köpfen, wie auch manche Gestaltungselemente des Brustbereichs auf Gemmen durchaus als Köpfe falsch verstanden worden sein könnten, mit einem mehrgesichtigen Wesen, ist kaum als Zufall zu erklären, speziell wenn man mit einbezieht, dass die kleinen Tierprotome an den Seiten der Häupter auch als Nase und Zunge misszuverstehen sind. Selbst das Geweih auf dem Kopf ließe sich mit einer schlechten Wiedergabe einer #tf-Krone in Verbin1 2 3 4 5 6 7
8
Siehe z. B. zur Rezeption der Kerubin im Mittelalter ANTHONIOZ 2021, 103 f. Vgl. TROESCHER 1955, 503. Vgl. VON BISSING 1937, 157 f. Siehe KIRFEL 1948, 147–155. Abgebildet bei KIRFEL 1948, Tf. 54, Abb. 155; weitere Beispiele für die Dreifaltigkeit hat TROESCHER 1955, 503 f. gesammelt. Vgl. USENER 1903, 182. Abgebildet bei KIRFEL 1948, Tf. 61, Abb. 186. Aus dem 15. Jahrhundert stammt eine heute in Florenz, Bibliotheca Laurenziana, befindliche Darstellung des Antichristen, die diesen mit dem Kopf eines bärtigen Mannes auf einem geflügelten Drachenleib zeigt, dessen Schwanz in Form eines Schlangenkopfes gearbeitet ist, siehe GIORGI 2006, 252. Zählt man den Kopf am Ende des Schwanzes mit, wäre der Teufel in diesem Fall ein zweiköpfiges Wesen. CAYLUS 1761; CHIFLET 1657.
94
5. Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter
dung bringen, die ebenso über drei ‚Spitzen‘ verfügt. Auch in zwei lateinischen Handschriften des Evangeliums des Nikodemus wird der Teufel als triceps Beelzebub bezeichnet.9 Zu vergleichen ist eine Darstellung auf dem Bildteppich von Skog, der in das 13. Jahrhundert n. Chr. datiert.10
Abbildung 61: Kupferstich von Matthäus MERIAN zur Schlange aus Apk 13 aus dem Jahr 1630
Es ist nicht verwunderlich, dass die siebenköpfige Schlange aus der Offenbarung ebenso ihren Nachhall in der mittelalterlichen und frühbarocken Kunst fand,11 wie sie z. B. bei Matthäus MERIAN in seinem Werk Iconum Biblicarum aus dem Jahr 1630 erscheint (Abbildung 61).12 Auf dem Gemälde von Peter Paul RUBENS „Maria als die Jungfrau der Apokalypse“ (Abbildung 73),13 dass um 1623 n. Chr. entstanden ist, bekämpft der heilige Michael das Tier mit sieben Schlangenköpfen mit Feuerpfeilen, welches die sie befehdenden Engel mit ihrem Schwanz eingewickelt hat. Etwas anders stellen zwei Illustrationen der Apokalypse aus dem 14. Jhd. n. Chr.
9 Siehe den Text bei THILO 1832, 729. 10 Abbildung bei KIRFEL 1948, Tf. 61, Abb. 183 f. 11 Die Zahl Sieben findet generell auch in anderen Vergleichen Anwendung, die einen Feind beschreiben. So überliefert z. B. Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana I, 3, 3 bei HAGENMEYER 1913, 134 und PETERS 1971, 53 die Zahl, die Urban II. während seiner Rede auf der Synode von Clermont am 28. November 1095 n. Chr. verwendet hätte, da die Christen „siebenmal besiegt“ worden seien, wodurch der Zug in das Heilige Land nötig wäre. 12 MERIAN 1630b, 151. 13 Abgebildet bei GIORGI 2006, 267. Generell zur Apokalypse in der mittelalterlichen Kunst siehe die Zusammenstellung von VAN DER MEER 1978.
5. Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter
95
das Wesen dar, die sich heute in Toulouse, Musée des Augustins befinden.14 Im ersten Fall hat das Wesen sieben gehörnte Schlangenköpfe auf einem unbestimmbaren Leib mit nur zwei Tatzen und einem eingedrehten Schwanz. Im zweiten Fall wurden am Körper eines Löwen sieben Löwenhäupter mit einer Mähne angebracht. Im Gemälde von Pacino DI BONAGUIDA „Erscheinung des Heiligen Michael“, welches um 1340 n. Chr. entstanden ist und sich heute in der British Library befindet, ist das Tier als Schlange mit zwei Flügeln und zwei Löwenpranken dargestellt.15 Aus dem Mund spuckt es Feuer und auf dem Hauptkopf befindet sich eine Krone; die anderen sechs Häupter sind völlig unnatürlich auf der Rückseite des Kopfes und des Oberkörpers der Schlange angebracht. Cesare RIPA dachte in seinem Werk Iconologia von 1593 sicher an das Monster aus der Offenbarung, wenn er das Laster als siebenköpfiges Wesen darstellte (Abbildung 74).16 Auch Albertus SEBA wird in seinem Werk Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio aus dem Jahr 1743 sicher von der Offenbarung des Johannes beeinflusst worden sein, stellt er doch eine Art von Drache mit sieben Köpfen dar (Abbildung 75).17 Die Bedrohung eines Gottes durch eine siebenköpfige Schlange oder ein siebenköpfiges Tier wurde durch textliche wie ikonografische Referenzen aus dem Alten Orient durch die Zeiten hindurch über die Offenbarung des Johannes somit bis in unsere heutige Zeit weitertradiert. Selbst Martin Luther wurde als Karikatur des siebenköpfigen Drachen aus der Apokalypse dargestellt. So zeichnete Johannes COCHLÄUS (1479–1552) Luther mit sieben Köpfen auf seinem Flugblatt „Sieben Köpfe Luthers vom Sakrament des Altars“ (Abbildung 76).18 Von COCHLÄUS existiert noch eine weitere Zeichnung von Martin LUTHER, die als Titelblatt des Werks Dialogus de bello contra Turcas in Antilogias Lutheri aus dem Jahr 1512 fungierte (Abbildung 77). Auf der Brust der Darstellung ist Marti(n):Lu|ther:Bic|eps geschrieben. Eine sehr elaborierte Darstellung der beiden siebenköpfigen Wesen aus der Apokalypse (Abbildung 78) liegt auf dem Wandteppich Zyklus der Apokalypse (Tapisserie de l’Apocalypse) vor, der zwischen 1373 und 1382 n. Chr. geschaffen wurde. Die beiden Tiere werden hier völlig unterschiedlich dargestellt. Auf der linken Seite ist ein Wesen abgebildet, das man heute am ehesten als einen geflügelten Drachen mit sieben Köpfen bezeichnen würde. Die sieben Köpfe sitzen hierbei jeweils auf einem einzigen Hals. Aufgrund der Darstellungsweise handelt es sich hierbei um die große rote Schlange (δράκων μέγας πυρρὸς) aus Apk 12, 1 f. Die zehn Hörner wurden hier derart dargestellt, dass der Hauptkopf in der Mitte vier Hörner trägt, die anderen Köpfe aber nur jeweils ein Horn aufweisen. In seiner rechten Vorderpranke hält es ein Szepter, das ebenfalls durch das zweite Tier mit seiner rechten Vorderpfote gegriffen wird. Dieses zweite Tier auf der rechten Seite weist einen pantherartigen Körper auf, was in Einklang mit der Beschreibung in Apk 13, 1 f. steht, da der Leib als der eines Leoparden (παρδάλις) beschrieben wird. Die sieben Köpfe, die als diejenigen von Löwen erkennbar sind, wie es auch in der Apokalypse mit λέων vorliegt, befinden sich aber im Gegensatz zum ersten Tier auf einem einzigen Hals, was speziell im oberen Teil einen doch recht kuriosen Eindruck macht. Insgesamt betrachtet hat sich der Künstler des Wandteppichs bei der Darstellung der beiden Wesen sehr gut an der Beschreibung der Apokalypse orientiert. In einer weiteren Darstellung wird dann der siebenköpfige Drache durch den Erzengel Michael besiegt (Abbildung 79). 14 15 16 17 18
Abgebildet bei GIORGI 2006, 268 f. Abgebildet bei GIORGI 2006, 314. RIPA 1593, 515; MASER 1971, 68. SEBA 1743, Tf. 102. Zum Flugblatt siehe LAUBE 2000, 989–1015. Dahingegen legte Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae 1010 die sieben Häupter des Drachen als principialia vicia aus (De quo dracone surgent VII capita quia de fonte diabolo oriuntur VII principialia vicia); lateinischer Text nach MIGNE 1895, 1010.
96
5. Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter
Francisco PETRARCA stellte die Habgier 1572 in seinem Werk „Trostspiegel in Glück und Unglück“ als vierköpfigen Drachen dar.19 Dieser besitzt einen Löwenleib und einen langen Schwanz, der sich wie eine Würgeschlange um einen habgierigen Menschen windet. Die vier Köpfe sind alle ein wenig unterschiedlich ausgeformt. So ist z. B. einer behornt, so dass man an einen Stier denken könnte, und einer erinnert durch seine Ohren an einen Löwen, so dass man gut davon ausgehen könnte, dass hier vier unterschiedliche Tierköpfe angedeutet werden. Es bleibt die Frage offen, woher PETRARCA seine Inspiration zog oder welche Grundlage er verwendete. Aufgrund der beiden Köpfe, die man als Löwe und als Stier ansprechen kann, könnte man gut an eine Beeinflussung durch Ez 1, 4–6 und 9b–10 denken. In der Bibel erscheinen, wie in Kapitel 4 angesprochen, nur wenige mehrköpfige Tiere. In Dan 7, 6 wird von einem vierköpfigen Tier berichtet, dass von drei weiteren Tieren, die aus dem Meer aufsteigen, begleitet wird. Hierbei handelt es sich um einen Löwen mit Adlerflügeln in Vers 4, einen Bären in Vers 5 und ein furchterregendes und starkes Tier in Vers 7. Das dritte Tier hat der Überlieferung nach (vgl. Kap. 4.1.2) vier Köpfe, vier Flügel und gleicht einem Leoparden. Diese vier Geschöpfe wurden im Jahr 1630 durch Matthäus MERIAN in einem berühmten Kupferstich verewigt (Abbildung 62).20
Abbildung 62: Kupferstich von Matthäus MERIAN zu Daniel 7 aus dem Jahr 1630
Bereits in Kapitel 4.1.2 wurde auf die vielfältigen Deutungen, speziell was die Köpfe dieses Wesens anbetrifft, hingewiesen. Hierzu liegt ebenfalls eine Deutung von Martin LUTHER vor, die deutlich macht, wie unterschiedlich biblische Texte in verschiedenen Zeiten kontextualisiert und gedeutet werden können. Martin LUTHER deutete in seiner „Heerpredigt wider den 19 PETRARCA 1572, Kap. 35 und MICHEL 2013, 41. 20 MERIAN 1630a, 43.
5. Exkurs: Biblische Wesen mit mehreren Köpfen im Mittelalter
97
Türcken“21 die Prophezeiung in Daniel 7 auf eine völlig andere Art, als es heute in der modernen Wissenschaft der Fall ist. LUTHER legte die Tiere zwar ebenfalls als Reiche aus, kam aber zu einem ganz anderen Schluss: „Diese Weissagung Danielis ist eintrechtiglich von allen lerern ausgelegt von den vier folgenden keiserthum: Das erst das kaiserthum zu Assyrien und Babilonien, Das ander das kaiserthum der Persen und Meden, Das dritte das keiserthum des grossen Alexanders und der Griechen, das vierde das Römische kaiserthum, welchs das grössest, gewaltigst und grausamest, dazu auch das letzte ist auff erden, wie hie Daniel herlich zeigt, das nach dem Vierden thier odder kaiserthum das gericht folget und kein ander keiserthum mehr, sondern das reich der heiligen das ewig ist. (…) So mus draus folgen, das der Türck im Römischen kaiserthum sein wird und im vierden thier (…). So wird und kan der Türcke immer mehr so mechtig werden, als das Römisch reich gewesen ist, sonst würden nicht vier, sondern funff keiserthum auff erden komen.“22 LUTHER erkannte im Alten Testament gesamt eine Vorhersage von Christus, d. h. er deutete das Alte Testament christologisch.23 Dies ist mit der Auffassung LUTHERs des sensus literalis, bei dem das Alte Testament eschatologisch auf Gottes Handeln in Jesus Christus bezogen verstanden werden kann,24 zu verbinden. Dementsprechend muss die Vision des Propheten aus dem Alten Testament einen Bezug zur Zeit LUTHERs selbst aufweisen, da eschatologisch das Ende offensichtlich nicht vorher eingetreten ist.
Neben den genannten Wesen wurde auch die Vierheit der Evangelisten während des Mittelalters in einem einzigen Geschöpf dargestellt. So existiert im Dom von Monreale auf Sizilien die Darstellung eines Tetramorphos mit sechs Flügeln, der klar die vier Symbole der Evangelisten zu einem vierköpfigen Wesen zusammenstellt:25 Der Menschenkopf für Matthäus, auf der rechten Seite der Stier für Lukas, auf der linken der Löwe für Markus und über allen der Adler für Johannes. Hiermit wird aber offensichtlich nur der Tetraprosopos aus Ez 1, 10 dargestellt, wie ihn Ezechiel bzw. ein Redaktor sah. Vergleichbar wurden diese auch in islamischen Werken zusammenstellt, wie v. a. in einer osttürkischen Miniatur aus dem Jahr 1436.26 Auch in der Geschichte des Bulūkiya aus Tausend und eine Nacht, Nacht 781 findet sich vergleichbares, als der Erzähler einen Baum sieht, unter dem vier Engel stehen.27 Diese beschreibt er im Folgenden als in Gestalt von Mensch, von Raubtier, von Vogel und von Stier – die Parallele zu den früheren Viergestalten ist offensichtlich. Es zeigt sich somit deutlich, dass, wenn man die Betrachtung nicht nur auf die Antike beschränkt, noch deutliche Analogien durch biblische Berichte bis in das europäische Mittelalter vorliegen, die altorientalische Wesen noch lange Zeit weitertradieren, nachdem die Kultur, die sie dereinst geschaffen hat, bereits lange untergegangen ist.
21 LUTHER 1529, 166 f.; vgl. hierzu auch BORNKAMM 1948, 82 sowie zur Situation generell BRANDT 2016, 32 f. Nach AURELL 2004, 94 deutete der Zisterzienserabt Joachim von Fiore (~1130–1202 n. Chr.) Ṣalāḥ ad-Dīn (~1137–1193 n. Chr.) als das siebte Haupt des Drachen der Offenbarung. 22 LUTHER 1529, 166. 23 Vgl. BORNKAMM 1948, 86; HECKEL 2016, 710; WALLMANN 2010, 297; siehe auch ASENDORF 1988, 35, 62, 154, 198. 24 Vgl. HARTENSTEIN 2017, 21. 25 Abbildung bei DEMISCH 1977, 215, Abb. 589; vgl. auch die Miniatur bei ibd. 214, Abb. 588. 26 Abbildung bei DEMISCH 1977, 215, Abb. 590. 27 Siehe WEIL 1841, 180.
6 Résumé Bei der Betrachtung der Quellen, die aus der Region Syrien-Palästina seit dem Chalkolithikum vorliegen und die Wesen mit mehr als einem Kopf oder einem Gesicht darstellen oder beschreiben, lassen sich zwei Bemerkungen direkt treffen. Einerseits hat sich deutlich gezeigt, dass nur wenige Quellen vorliegen und somit Wesen mit mehreren Gesichtern oder Köpfen keine größere Rolle im realweltlichen oder mythologischen Bereich in der Region gespielt zu haben scheinen, vergleicht man die realiter bezeugten Belege mit anderen Kulturen des Vorderen Orients. Zum anderen sind aber auch deutliche Neuerungen oder Erfindungen zu erkennen, die die Region unverkennbar von anderen Kulturen, wie z. B. Ägypten, abhebt. Hinweise auf Mehrköpfigkeit erstrecken sich in der Region Syrien-Palästina vom fünften Jahrtausend bis in die Zeit nach Christi Geburt, während die Mehrgesichtigkeit erst gegen Ende des dritten Jahrtausends mit dem Silberbecher aus cĒn Sāmiye, heute Jerusalem, IMJ, IAA, K 2919, erscheint. Es konnte eine Entwicklungslinie von den frühesten Funden, wie sie z. B. mit der Krone aus Naḥal Mišmar, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61–177 vorliegt und die mehrere Köpfe an einem Objekt aufweist, zu einem ‚realen‘ Wesen mit multiplen Häuptern postuliert werden. Durch Funde von Stäben, Stabaufsätzen und Kronen, die mit mehreren Tierköpfen versehen sind und bereits aus dem Chalkolithikum stammen, ist die Zusammensetzung von mehreren Häuptern an einem Objekt bereits in dieser frühen Zeit der Menschheitsgeschichte gegeben. Durch die Funde wird klar, dass zuerst Machtinsignien wie Stäbe oder Kronen mit mehreren Köpfen versehen wurden. Dies dürfte aus Gründen der Machtdemonstration geschehen sein, die diese somit symbolisch auf die Träger des Stücks übergehen ließen. In einem weiteren Schritt wurde der ‚Mittler‘ respektive der ‚Zwischenschritt‘ Krone oder Stab übergangen und die Köpfe direkt mit der Gottheit selbst verbunden. Somit ist eine Entwicklungsgeschichte zu fassen: Köpfe oder Gesichter von Tieren bewegen sich über Machtsymbole zum Hauptkopf des Gottes hin, wobei letztgenannter Schritt durch archäologische Funde aber erst im dritten vorchristlichen Jahrtausend zu greifen ist. Ebenso dürfte deutlich geworden sein, dass zweiköpfige Wesen durchaus auf eine realweltliche Beobachtung zurückzuführen sein können. Durch die derzeit vorhandenen Belege ist klar, dass die Kombination von zwei Tieren an ihren Körpern in Form von als solchen zu bezeichnenden Doppelwesen wie auch in der Gestalt eines Dikephalos, wie es z. B. mit einem Siegel aus Gabal Aruda, Syrien vorliegt (s. Abbildung 10 auf S. 29), die ältesten Formen darstellen. Abbildungen haben sich bereits aus der Zeit um 3000 v. Chr. aus den verschiedensten Kulturen wie Ägypten, Mesopotamien und Syrien erhalten. Aufgrund der in etwa kontemporär auftretenden Darstellungen auf Siegel ist zu vermuten, dass die Doppelwesen mit Händlern gereist sind – welche Kultur allerdings hierbei den Anfang machte, kann nicht gesagt werden. Bei den in der Bibel vorliegenden Geschöpfen mit mehreren Häuptern oder Gesichtern zeigt sich ein zweigeteilter Befund: Zum einen sind diese, wie es z. B. explizit für die siebenköpfige Schlange in Apk 12, 3 herausgearbeitet werden konnte, in eine längere Motivgeschichte im Vorderen Orient einzuarbeiten und damit klar als Teil einer Art von allgemeinen Vorstellung zu erkennen. Zum anderen sind Ausführungen, wie z. B. der viergesichtige Kerub in Ez 1, 10, aufgrund fehlender Parallelen als Selbstschöpfung respektive Erfindung des Autoren zu betrachten. Eine Schlange mit mehreren Häuptern stellt den verschiedenen Belegen nach im Vorderen Orient eines der beliebtesten mehrköpfigen Wesensmotive dar. So bezeichnete Damaskios, De principiis den Zeitgott Chronos selbst als dreiköpfige Schlange, der die Häupter eines Stiers und eines Löwen als Neben- sowie das Antlitz Gottes als Hauptkopf aufweist.1 Speziell zweiköpfige Schlangen liegen in mannigfaltigen griechischen und lateinischen Quellen vor. Eine solche 1
Siehe RUELLE 1889, 317.
6. Résumé
99
Fehlbildung ist u. a. bei Claudius Aelianus, De natura animalium VIII, 7, IX, 23 und XVI, 42,2 Lucan, Pharsalia IX, 719,3 Nikandros von Kolophon, Theriaca 372–383,4 Plinius, Naturalis Historia VIII, 235 oder Gaius Julius Solinus, De mirabilibus mundi XXVII, 296 beschrieben. Hier wird ein solches Wesen oftmals als ἀμφικάρηνος/Amphisbaena neben dem bekannten δικέφαλος bezeichnet.7 Isidor von Sevilla, Etymologiae XII, 4, 20 geht mit seiner Beschreibung „Amphisbaena (…) duo capita habeat, unum in loco suo, alterum in cauda“8 darauf ein, wo sich die beiden Köpfe an dem Reptil befinden. Wie ein solches Wesen wirkte, beschrieb Cassius Dio, Historia Romana L, 8, nach dem eine zweiköpfige Schlange (δράκων δικέφαλος) in Etrurien für viel Verwirrung gesorgt haben soll.9 Ebenfalls schilderte Plinius, Naturalis Historia XXX, 44 eine doppelköpfige Schlange als negatives Zeichen, da die Schwangerschaft einer Frau abgebrochen werden würde (abortum faciet), wenn sie an einer Amphisbaena vorbeigeht, und sei es auch nur eine tote Schlange dieser Art.10 Selbst König Assarhaddon (680–669 v. Chr.) waren doppelköpfige Schlangen eine Notiz im Bericht zu seinem zehnten Feldzug wert: erbetti bērū qaqqar mālak 2 ūmē ṣerrī 2 qaqqadāti .[…] mūtuma addīšma ētiq „Vier Doppelstunden, eine Strecke von zwei Tagen, zertrat ich immer wieder Schlangen mit zwei Köpfen, [deren Anblick? /Berührung? …] den Tod bedeuten, und zog weiter!“11 In der Serie Šumma ālu ina mēlê šakin wird in Tf. 25f., iii, 25'f. über die Sichtung einer zweiköpfigen Schlange wie folgt berichtet: [šumma] ṣerra 2 qaq[qadātīš]u ina āli ū ugāri īmur amēlu lā māti kussâ iṣabbat āla u ugāra šuāti inaddi „[Wenn] man eine Schlange mit zwei Kö[pfen] in der Stadt oder auf dem Felde gesehen hat, wird ein Mann, der nicht aus dem Land stammt, den Thron ergreifen. Diese Stadt und die Felder werden verfallen.“12 Eine doppelköpfige Schlange wird auch im Jahr 1665 von Fortunius LICETUS, De Monstris abgebildet (Abbildung 68) und somit der Überlieferung als würdig erachtet.13 Dass es sich hierbei um eine reale Erscheinung gehandelt haben könnte, dürfte den Quellen nach außer Frage stehen, was im Gegensatz zu anderen Wesen steht, die LICETUS unter De monstrorum humanorum reali existentia zusammenfasste und die so nicht in der Natur erscheinen können. Als wie wichtig Missgeburten im mesopotamischen Raum in der Antike betrachtet wurden, worunter dementsprechend auch die Doppel- oder Mehrköpfigkeit zu subsumieren sind, zeigen Briefe aus dem zweiten und ersten vorchristlichen Jahrtausend, die an den Herrscher geschickt
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GARCÍA VALDÉS, LLERA FUEYO u. RODRÍGUEZ-NORIEGA GUILLÉN 2006, 195.217.403 (δικέφαλος). Text bei BAILEY 2009, 251. Text bei OVERDUIN 2015, 153 f. VON JAN u. MAYHOFF 1967, 107. Text bei MOMMSEN 1895, 12 (amphisbaena consurgit in caput geminum). Siehe TLL I, 1983, 30–35. Aischylos, Agamemnon 1233 bezeichnet so auch eine hinterhältige Frau, siehe die Überlieferung bei SOMMERSTEIN 2008, 148. Text bei LINDSAY 1957, XII, 4, 20. Griechischer Text nach FREYBURGER u. RODDAZ 1991, 9. Seinem Bericht nach sei die Schlange 85 Fuß lang gewesen, was dem Zeugnis die Glaubwürdigkeit nimmt. Lateinischer Text nach W. H. S. JONES 1963, 360. Entspricht Ash. S. 112 (=K 3082+K 3086+Sm 2027), Rs. 5 bei BORGER 1956, 112. FREEDMAN 2006, 112. Eine Schlange mit zwei Köpfen findet ebenso Erwähnung in Tf. 25f., Rs. 4, doch wird hier kein Effekt genannt; vgl. ibd.,102. Siehe LICETUS 1665, 22.
100
6. Résumé
wurden und die diesen über das Vorzeichen informieren.14 Ebenso mussten Gelehrte schwören, ein izbu nicht zu verschweigen.15 Fassen wir die Thesen zu mehrköpfigen Wesen im syrisch-palästinischen Raum der Antike zusammen: Die ältesten Funde aus dem Chalkolithikum stellen mehrere Tiere bzw. deren Köpfe an einem Objekt (wie z. B. einer Krone oder einem Stab) dar. Es ist anzunehmen, dass sich von diesen Objekten ausgehend die Mehrköpfigkeit von Göttern entwickelte. Die frühesten Ausformungen doppelköpfiger Tiere wurden aus der Natur entlehnt und in den folgenden Jahrhunderten in den göttlichen Bereich erhoben. Manche der aus der Bibel bekannten mehrköpfigen oder mehrgesichtigen Wesen lassen sich, wie auch viele der anderen Funde aus dem syrisch-palästinischen Raum, auf mesopotamische Vorbilder oder allgemein bekannte Darstellungen zurückführen. Die siebenköpfige Schlange kann als Götterfeind par excellence begriffen werden, die in vielen schriftlichen Belegen und Abbildungen bezwungen wird und im gesamten östlichen Mittelmeerraum bekannt war. Von Mesopotamien ausgehend ist sie über ugaritische Quellen bis hin zur Offenbarung des Johannes und koptische Quellen bekannt, wobei die Siebenzahl der Ausdruck für das Böse insgesamt ist. Mehrköpfigkeit ist einerseits ein Zeichen von Macht, aber auch des Chaos und des Bösen. Die Vervielfältigung der Köpfe ist ein Ausdruck von Macht: der Kampf eines Gottes mit einem Wesen mit multiplen Köpfen wie dessen Bezwingung lässt das Ringen in einem völlig anderen Licht erscheinen, als wenn der Feind nur einen Kopf hätte. Doch nicht nur im Vorderen Orient sind Götter mit mehreren Gesichtern und Köpfen belegt, sondern derartig dargestellte Wesen sind auch in vielen anderen Kulturkreisen und Religionen zu finden. So existieren dreiköpfige Gottheiten z. B. auch im Hinduismus und im Jinismus.16 Die bekanntesten Beispiele dürften die hinduistischen Gottheiten Śīva (Abbildung 80) und Viṣņu sein, wobei letztgenannter dann zusätzlich Tierköpfe aufweist.17 In Ṛgveda X, 8, 8 wird ein Dämon Viśvarūpa erwähnt, der über drei Köpfe (triśīrṣan)18 verfügt; in Ṛgveda V, 48, 5 wird Agni als „viergesichtig“ (caturanīka-) beschrieben, wobei er Feuer in alle Weltgegenden schleudern kann.19 Auch für die Gens Lucretia, eine bedeutende Sippe aus Rom, die zwischen dem Ende des sechsten bis zum beginnenden vierten vorchristlichen Jahrhundert bestand, wurde ein Gott mit drei Köpfen aus dem Beinamen Tricipitinus erschlossen, den einige der Familienangehörigen trugen.20 Aus dem gallo-keltischen Bereich sind ebenfalls dreiköpfige wie dreigesichtige Gestalten bekannt.21 So stellt eine Statue aus Kalkstein, die während des zweiten Jhd. v. Chr. geschaffen wurde und sich heute in Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 60.2.2 befindet, den Gott Cernunnos als typischen Trikephalos dar.22 Ebenso wurden im slawischen Kulturkreis Götter wie Triglaw,23 Porevith oder Suantovith mit drei oder vier Köpfen dargestellt.24 Drei14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Für Belege siehe MAUL 2003, 63. Siehe DURAND 1988, 13, 19 f. Siehe zusammenfassend KIRFLER 1948, 11–81. Siehe die Abbildung bei KIRFLER 1948, Tf. 6. Vgl. SRINIVASAN 1997, 24.179. Vgl. SRINIVASAN 1997, 30. Vgl. USENER 1903, 176. Zusammenfassend KIRFEL 1948, 132–146; ROSS 1967, 53–56. Publiziert von BLÁZQUEZ 1988, 840, Tf. 561 (Nr. 9). Siehe DYNDA 2014.
6. Résumé
101
köpfige Wesen und die Darstellung eines Diprosopos existieren in zahlreichen Belegen auch aus Mittel- und Südamerika.25 Hieraus folgt, dass die Zusammenstellung eine Körpers in menschlicher oder tierischer Form mit zwei, drei oder mehreren Köpfen oder Gesichtern mehr als eine gesamt-kulturelle Konzeption als eine speziell auf eine Kultur zu beschränkendes religiöses Darstellungscredo zu verstehen ist. Doch nicht nur auf der Erde existieren derartige Wesen mit mehreren Köpfen – denn zumindest in der Vorstellung von Lukian von Samosata, Verae historiae I, 11 sind solche Geschöpfe auch auf dem Mond beheimatet: Μεγάλοι γὰρ οἱ γῦπες καὶ ὡς ἐπίπαν τρικέφαλον „Denn groß waren die Geier und sie hatten drei Köpfe!“26
24 Siehe die Abbildungen bei KIRFLER 1948, Tf. 26. 25 Siehe QUIRARTE 1981 für Belege. 26 Griechischer Text nach VON MÖLLENDORFF 2000, 96.
Literaturverzeichnis Adler (1935): Ada Adler, Suidae Lexicon, Leipzig. Albani (1993): Matthias Albani, „Der Zodiakos in 4Q318 und die Henoch-Astronomie“, Mitteilungen und Beiträge der Forschungsstelle Judentum 7, 3–42. Albani (1999): Matthias Albani, „Horoscopes in the Qumran Scrolls“, in: Peter W. Flint u. James C. Vanderkam (Hgg.), The Dead Sea Scrolls after Fifty Years. A Comprehensive Assessment, Leiden, 279–330. Albani (2010): Matthias Albani, Daniel. Traumdeuter und Endzeitprophet (Biblische Gestalten 21), Leipzig. Albuquerque, Piatti u. Wallach (2013): Nelson R. de Albuquerque, Liliana Piatti u. Van Wallach, „Dicephalism in the Green Racer Snake, Philodryas Patagoniensis (Serpentes, Colubridae), from southeastern Brazil“, Herpetology Notes 6, 85–87. Albuquerque et al. (1989–1994): Nelson R. de Albuquerque et al., „A Dicephalic Yellow Anaconda Snake, Eunectes notaeus (Serpentes: Boidae), from Southern Pantanal, Brazil“, Journal of Natural History 44, 1989–1994. Amiet (1964): Pierre Amiet, „Cylindres syriens présargoniques“, Syria 41, 189–193. Amr u. Hammouri (1995): Samir S. Amr u. Mahmoud F. Hammouri, „Craniofacial Duplication (Diprosopus): Report of a Case with a Review of the Literature“, European Journal of Obstretics and Gynecology and Reproductive Biology 58, 77–80. c Amr (1988): Abdel-Jalil cAmr, „Four unique Double-Faced Female Heads from the Amman Citadel“, Palestine Exploration Quarterly 120, 55–63. Anthonioz (2021): Stéphanie Anthonioz, „Chérubins/Keruvim. Évolutions et mutation“, in: Philippe Abrahami u. Stéphanie Anthonioz (Hgg.), Les Chérubins/Keruvim dans l’Antiquité. Approche historique et compare (Kasion 6), Münster, 93–114. Asendorf (1988): Ulrich Asendorf, Die Theologie Martin Luthers nach seinen Predigten, Göttingen. Athanasiadis, Mikos u. Zafrakas (2007): Apostolos Athanasiadis, Themistoklis Mikos u. Meinelaos Zafrakas, „Prenatal Diagnosis and Management of Conjoined Fetuses“, in: Asim Kurjak, F. A. Chervenak u. J. M. Carrera (Hgg.), Donald School Atlas of Fetal Anomalies, Neu-Delhi, 237–244. Athanasiadis et al. (2005): Apostolos Athanasiadis, Christinne Tzannatos, Themistoklis Mikos, Menelaos Zafrakas u. John N. Bontis, „A unique Case of Conjoined Triplets“, American Journal of Obstretics and Gynecology 192, 2084–2087. Aurell (2004): Martin Aurell, „Die ersten Könige aus dem Hause Anjou (1154–1216)“, in: Hanna Vollrath u. Natalie Fryde (Hgg.), Die englischen Könige im Mittelalter. Von Wilhelm dem Eroberer bis Richard III., München, 71–101. Aytemiz et al. (2014): Işil Aytemiz et al., „Preliminary Report of a conjoined Bottlenose Dolphin (Tursiops truncatus) Calf stranded on the Aegean Sea Coast of Turkey“, Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 20, 274–279. Bachmann (2000): Michael Bachmann, „Die Johannesoffenbarung“, in: Karl-Wilhelm Niebuhr (Hg.), Grundinformation Neues Testament (UTB 2108), Göttingen, 346–370. Backes (2005): Burkhard Backes, Das altägyptische »Zweiwegebuch«. Studien zu den Sargtext-Sprüchen 1029–1130 (Ägyptologische Abhandlungen 69), Wiesbaden. Baethgen (1892): Friedrich Baethgen, Die Psalmen (Handkommentar zum Alten Testament 2, 2), Göttingen. Bailey (2009): D. R. Shackleton Bailey, M. Annaei Lucani – De Bello Civili, Libri X (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana 1502), Berlin. Balme (2002): David M. Balme, Aristotle – Historia Animalium, Bd. 1: Books I–X, Cambridge. Balss (1936): Heinrich Balss, „Die Zeugungslehre und Embryologie in der Antike. Eine Übersicht“, in: Paul Diepgen u. Julius Ruska (Hgg.), Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin 5, Berlin. Balz-Cochois (1992): Helgard Balz-Cochois, Inanna. Wesensbild und Kult einer unmütterlichen Göttin, Gütersloh. Bar-Adon (1980): Pessaḥ Bar-Adon, The Cave of the Treasure. The Finds from the Caves in Naḥal Mišmar, Jerusalem.
Literaturverzeichnis
103
Bareš u. Smoláriková (2008): Ladislav Bareš u. Kvĕta Smoláriková, The Shaft Tomb of Iufaa, Vol. 1: Archaeology (Abusir 17), Prag. Barr (2013): David L. Barr, „John is not Daniel: the ahistorical Apocalypticism of Apocalypse“, Perspectives in Religious Studies 40, 49–63. Bates (2002): Alan W. Bates, „Conjoined Twins in the 16th Century“, Twin Research 5, 521–528. Bauer et al. (2015): Anna Bauer, Susanne Görke, Jürgen Lorenz u. Elisabeth Rieken, „Mythologische Texte in hethitischer Sprache“, in: Bernd Janowski u. Daniel Schwemer (Hgg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge 8: Weisheitstexte, Mythen und Epen, Gütersloh, 145–176. Bauer (1996): Dieter Bauer, Das Buch Daniel (Neuer Stuttgarter Kommentar, Altes Testament 22), Stuttgart. Bauks (2006): Michaela Bauks, „Chaos/Chaoskampf“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15897, Zugriff am 22. Juli 2022]. Beale (1998): Gregory K. Beale, John’s Use of the Old Testament in Revelation (Journal for the Study of the New Testament, Suppl. Series 166), Sheffield. Beckby (1965): Hermann Beckby, Anthologia Graeca, Buch VII–VIII, München. Beer (1939): Georg Beer, Exodus (Handbuch zum Alten Testament 1, 3), Tübingen. Beile-Bohn et al. (1998): Manuela Beile-Bohn et al., „Neolithische Forschungen in Obermesopotamien. Gürcütepe und Göbekli Tepe“, Istanbuler Mitteilungen 48, 5–78. Ben-Tor (1998): Daphna Ben-Tor, „The Relations between Egypt and Palestina during the Middle Kingdom as reflected by Contemporary Canaanite Scarabs“, in: Christopher J. Eyre (Hg.), Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists (Orientalia Lovaniensia Analecta 82), Leuven, 149–163. Ben-Tor (2003): Daphna Ben-Tor, „Egyptian-Levantine Relations and Chronology in the Middle Bronze Age: Scarab Research“, in: Manfred Bietak (Hg.), The Synchronisation of Civilisations in the Eastern Mediterranean in the Second Millenium B.C. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Denkschriften der Gesamtakademie 29), 2003, 239–248. Ben-Tor (2004): Daphna Ben-Tor, „The Political Implications of the Early Scarab Series in Palestine“, in: Astrid Nunn u. Regine Schulz (Hgg.), Skarabäen außerhalb Ägyptens: Lokale Produktion oder Import? (BAR International Series 1205), Oxford, 1–6. Ben-Tor (2007): Daphna Ben-Tor, Scarabs, Chronology, and Interconnections. Egypt and Palestine in the Second Intermediate Period (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 27), Fribourg. Ben-Tor (2011): Daphna Ben-Tor, „Egyptian-Canaanite Relations in the Middle and Late Bronze Ages as Reflected by Scarabs, in: Shay Bar, Dan’el Kahn u. J. J. Shirley (Hgg.), Egypt, Canaan and Israel: History, Imperialism, Ideology and Literature. Proceedings of a Conference at the University of Haifa, 3–7 May 2009 (Culture and History of the Ancient Near East 52), Leiden/Boston, 23–43. Beran (1957): Thomas Beran, „Assyrische Glyptik des 14. Jahrhunderts“, Zeitschrift für Assyriologie 52, 141–215. Berger (1992): Klaus Berger, Synopse des Vierten Buches Esra und der Syrischen Baruch-Apokalypse (TANZ 8), Tübingen/Basel. Berger (1995): Klaus Berger, Theologiegeschichte des Urchristentums, Tübingen. Bernett u. Keel (1998): Monika Bernett u. Othmar Keel, Mond, Stier und Kult am Stadttor. Die Stele von Betsaida (et-Tell) (Orbis Biblicus et Orientalis 161), Fribourg/Göttingen. Bernhauer (2007): Edith Bernhauer, „Die Hathorkapitelle von Bubastis“, in: Ben J. J. Haring u. Andrea Klug (Hgg.), 6. Ägyptologische Tempeltagung: Funktion und Gebrauch altägyptischer Tempelräume (Königtum, Staat und Gesellschaft früher Hochkulturen 3, 1), Wiesbaden, 53–65. Bertholet (1936): Alfred Bertholet, Hesekiel (Handbuch zum Alten Testament 13), Tübingen. Beyerle (1998): Stefan Beyerle, „Die Wiederentdeckung der Apokalyptik in den Schriften Altisraels und des Frühjudentums“, Verkündigung und Forschung 43, 34–59. Bhettay, Nelson u. Beighton (1975): E. Nhettay, M. M. Nelson u. P. Beighton, „Epidemic of Conjoined Twins in Southern Africa?“, The Lancet 306, 741–743. Bianchi (2011): Robert S. Bianchi (Hg.), Ancient Egyptian Art and Magic. Treasures from the Fondation Gandur pour l’Art, St. Petersburg.
104
Literaturverzeichnis
Bianchi et al. (2014): Robert S. Bianchi, Christiane Ziegler u. Jean Claude Gandur, Egyptian Bronzes in the Fondation Gandur pour l’Art, Genf. Biggs u. Postgate (1975): Robert D. Biggs u. J. Nicholas Postgate, „Inscriptions from Abu Salabikh”, Iraq 40, 101–118. Billerbech (1999): Margarethe Billerbech, Seneca – Hercules furens. Einleitung, Text, Übersetzung und Kommentar, Leiden/Boston/Köln. Bishop (1908): Mabel Bishop, „Heart and Anterior Arteries in Monsters of the Dicephalus Group: A Comparative Study of Cosmobia“, American Journal of Anatomy 8, 441–472. Bissing (1937): Wilhelm Freiherr von Bissing, „Die Kirche von Ab del Gadir bei Wadi Halfa und ihre Wandmalereien“, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo 7, 128– 183. Bittel (1976): Kurt Bittel, Die Hethiter. Die Kunst Anatoliens vom Ende des 3. bis zum Anfang des 1. Jahrtausends vor Christus, München. Black u. Green (1992): Jeremy Black u. Anthony Green, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. An illustrated Dictionary, Austin. Blázquez (1988): José M. Blázquez, „Cernunnos“, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae IV, Zürich/München, 839–844. Blocher (1992): Felix Blocher, Siegelabrollungen auf frühaltbabylonischen Tontafeln im British Museum (Münchener Universitäts-Schriften 12), München/Wien. Block (1997): Daniel I. Block, The Book of Ezekiel, Chapers 1–24, Grand Rapids, Michigan/Cambridge. Böcher (1980a): Otto Böcher, „Das Verhältnis der Apokalypse des Johannes zum Evangelium des Johannes“, in: Jan Lambrecht (Hg.), L’Apocalypse Johannique et l’apocalyptique dans le nouveau Testament, Leuven, 289–301. Böcher (1980b): Otto Böcher, „Johanneisches in der Apokalypse des Johannes“, in: Otto Böcher (Hg.), Kirche in Zeit und Endzeit. Aufsätze zur Offenbarung des Johannes, Neukirchen-Vluyn, 1–12. Böcher (1988): Otto Böcher, Die Johannesapokalypse (Erträge der Forschung 41), Darmstadt. Böcher (2010): Otto Böcher, Johannes-Offenbarung und Kirchenbau. Das Gotteshaus als Himmelsstadt, Neukirchen-Vluyn. Boehmer (1967): Rainer M. Boehmer, „Die Entwicklung der Hörnerkrone von ihren Anfängen bis zum Ende der Akkad-Zeit“, Berliner Jahrbuch für Vorgeschichte 7, 273–291. Bolk (1926): Ludwig Bolk, „Die Doppelmissbildung eines Affen“, Beiträge zur pathologischen Anatomie 76, 238–253. Boll (1903): Franz Boll, Sphaera. Neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder, Leipzig. Bömer (1977): Franz Bömer, P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Buch VIII–IV, Heidelberg. Bondeson (1992): Jan Bondeson, „The Biddenden Maids: A Curious Chapter in the History of Conjoined Twins“, Journal of the Royal Society of Medicine 85, 217–221. Bondeson (2000): Jan Bondeson, The Pig-Faced Lady of Manchester Square and other medical Marvels, Gloucestershire. Bondeson (2004): Jan Bondeson, The Two-Headed Boy and Other Medical Marvels, New York. Bonnard (1977): Émile Bonnard, Saint Jérôme. Commentaire sur S. Matthieu, Tome 1 (Livres I–II). Texte latin, introduction, traduction et notes (Sources Chrétiennes 242), Paris. Bonner (1950): Campbell Bonner, Studies in Magical Amulets chiefly Graeco-Egyptian, Ann Arbor. Borger (1956): Riekele Borger, Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien (Archiv für Orientforschung, Beiheft 9), Graz. Börker-Klähn (1982): Jutta Börker-Klähn, Altvorderasiatische Bildstelen und vergleichbare Felsreliefs (Baghdader Forschungen 4), Mainz. Bornkamm (1948): Heinrich Bornkamm, Luther und das Alte Testament, Tübingen. Borst (2010): Joseph Borst (Hg.), Tacitus. Historien/Historiae: Lateinisch – Deutsch, Mannheim. Bossert (1959): H. Theodor Bossert, Janus und der Mann mit der Adler- oder Greifenmaske, Istanbul. Bottéro u. Kramer (1993): Jean Bottéro u. Samuel N. Kramer, Lorsque les dieux faisaient l’homme, Paris. Botterweck (1974): Gerhard J. Botterweck, „“א ֲִרי, in: Gerhard J. Botterweck, Helmer Ringgren u. HeinzJosef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. I, Grand Rapids, Michigan, 374–388.
Literaturverzeichnis
105
Bousset (1895): Wilhelm Bousset, Der Antichrist in der Überlieferung des Judentums, des neuen Testaments und der alten Kirche. Ein Beitrag zu Auslegung der Apokalypse, Hildesheim. Bousset (1906): Wilhelm Bousset, Die Offenbarung Johannis, Göttingen. Box (1919): George H. Box, The Apocalypse of Abraham (Translations of Early Documents Series I: Palestinian Jewish Texts), New York. Brakke et al. (1991a): David Brakke et al., Homiletica from the Pierpont Morgan Library. Seven Coptic Homilies attributed to Basil the Great, John Chrysostom, and Euodius of Rome (Scriptores Coptici 43), Leuven. Brakke et al. (1991b): David Brakke et al., Homiletica from the Pierpont Morgan Library. Seven Coptic Homilies attributed to Basil the Great, John Chrysostom, and Euodius of Rome, Translated (Scriptores Coptici 44), Leuven. Brandt (2016): Niels Brandt, Gute Ritter, Böse Heiden. Das Türkenbild auf den Kreuzzügen (1095–1291), Köln/Weimar/Wien. Braun-Holzinger (2013): Eva A. Braun-Holzinger, Frühe Götterdarstellungen in Mesopotamien (Orbis Biblicus et Orientalis 261), Fribourg/Göttingen. Briggs u. Briggs (1925): Charles A. Briggs u. Emilie G. Briggs, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms, Edinburgh. Briscoe (1986): John Briscoe, Titus Livius – Ab urbe condita. Libri XLI–XLV, Oxford. Briscoe (1991): John Briscoe, Titi Livi – Ab Urbe Condita. Libri XXXI–XL (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Stuttgart. Broadley (1975): Donald G. Broadley, „Dicepalism in African Reptiles“, The Journal of the Herpetological Association of Africa 13, 8–9. Brodersen (2002): Kai Brodersen, Phlegon von Tralleis. Das Buch der Wunder (Texte zur Forschung 79), Darmstadt. Broer (2001): Ingo Broer, Einleitung in das Neue Testament, Würzburg. Brunner-Traut u. Brunner (1981): Emma Brunner-Traut u. Hellmut Brunner (Hgg.), Die Ägyptische Sammlung der Universität Tübingen, Mainz. Brunner-Traut, Brunner u. Zick-Nissen (1984): Emma Brunner-Traut, Hellmut Brunner u. Johanna ZickNissen (Hgg.), Osiris, Kreuz und Halbmond. Die drei Religionen Ägyptens, Mainz. Buchanan (1981): Briggs Buchanan, Early Near Eastern Seals in the Yale Babylonian Collection, New Haven/London. Buchholz (2000): Hans-Günter Buchholz, „Furcht vor Schlangen und Umgang mit Schlangen in Altsyrien, Altkypros und dem Umfeld“, Ugarit-Forschungen 32 (2000), 37–168. Buck et al. (2009): B. C. Buck, M. Zoeller, W. Baumgärtner u. O. Distl, „A rare Occurrence of Dicephalus, Scoliosis and Complex Heart Anomalies in a Male Black and White German Holstein Calf “, Berliner und Münchner Tierärztliche Wochenschrift 122, 116–120. Buffetaut et al. (2007): Eric Buffetaut, Jianjun Li, Haiyan Tong u. He Zhang, „A two-headed Reptile from the Cretaceous of China“, Biology Letters 3, 80–81. Bührer (2020): Walter Bührer, Ezechiel und die Priesterschrift, in: Jan C. Gertz, Corinna Körting u. Markus Witte (Hgg.), Das Buch Ezechiel. Komposition, Redaktion und Rezeption, Berlin/Boston, 175–206. Buren (1946): E. Douglas van Buren, „The Dragon in Ancient Mesopotamia“, Orientalia NS 15, 1–45. Burstein (1980): Stanley M. Burstein, The Babyloniaca of Berossus, Malibu, California. Camón et. al. (1992): J. Camón, D. Sabaté, J. Verdú, J. Rutllant u. C. López-Plana, „Morphology of a Dicephalic Cat“, Anatomy and Embryology 185, 45–55. Campbell (2014): Thomas P. Campbell, The Metropolitan Museum of Art Guide, New York. Caquot (1997): André Caquot, „“דֹּ ב, in: Gerhard J. Botterweck, Helmer Ringgren u. Heinz-Josef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. III, Grand Rapids, Michigan, 70–71. Carley (1974): Keith W. Carley, The Book of the Prophet Ezekiel, Cambridge. Cassuto (1967): Umberto Cassuto, A Commentary on the Book of Exodus, Jerusalem. Cauville (1998): Sylvie Cauville, Dendara I – Traduction (Orientalia Lovaniensia Analecta 81), Leuven. Caylus (1761): Anne Claude Philippe de Caylus, Recueil d’Antiquités, Egyptiennes, Etrusques, Grecques et Romaines 4, Paris.
106
Literaturverzeichnis
Chappaz (2000): Jean-Luc Chappaz, „Animaux de pharaon“, in: Animaux d’art et d’histoire. Bestiaire des collections genevoises, 30 mars – 24 septembre 2000, Musée d’art et d’histoire, Genève, Genf, 15–28. Chappaz (2001): Jean-Luc Chappaz u. Jacques Chamay, Reflets du divin. Antiquités pharaoniques et classiques d’une collection privée (Musée d’art et d’histoire, Genève du 30 août 2001 au 3 février 2002), Genf. Charles (1920): Robert H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John with Introduction, Notes and Indices, also the Greek Text and English Translation, Edinburgh. Chassinat (1909): Émile Chassinat, La seconde trouvaille de Deir el-Bahari (Sarcophages) (Catalogue Général des Antiquités égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 6001–6029), Leipzig. Chaudhari et al. (2010): N. F. Chaudhari, C. F. Chaudhari, V. S. Daubas u. L. C. Modi, „Dicephalus Monster in a Krankrej Cow: A Case Report“, The Indian Cow: The Scientific and Economic Journal 7, 18–19. Chen et al (1997): Chih-Ping Chen et al., „Prenatal Diagnosis of Cephalothoracopagus Janiceps Monosymmetros“, Prenatal Diagnosis 17, 384–388. Chiera (1929): Edward Chiera, Sumerian Lexical Texts from the Temple School of Nippur (Oriental Institute Publications 11), Chicago. Chiflet (1657): Jean Chiflet (Hg.), Ioannis Macarii, Abraxas seu Apistopitus quae est antiquaria de gemmis Basilidianis disquisitio, Antwerpen. Cohen (2002): Susan L. Cohen, Canaanites, Chronologies, and Connections: The Relationship of Middle Bronze IIA Canaan to Middle Kingdom Egypt, Winona Lake, Indiana. Colbow (1991): Gudrun Colbow, Die kriegerische Ištar. Zu den Erscheinungsformen bewaffneter Gottheiten zwischen der Mitte des 3. und der Mitte des 2. Jahrtausends (Münchner vorderasiatische Studien 8), München. Collins (1993a): John J. Collins, Daniel. A Commentary on the Book of Daniel, Minneapolis. Collins (1993b): John J. Collins, „Stirring up the Great Sea. The Religio-Historical Background of Daniel 7“, in: A. S. van der Wounde (Hg.), The Book of Daniel in the Light of New Findings (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 106), Leuven, 121–136. Collins (2001): John J. Collins, „Current Issues in the Study of Daniel“, in: John J. Collins u. Peter W. Flint (Hgg.), The Book of Daniel. Composition and Reception (Vetus Testamentum Suppl. 83, 1), Leiden/Boston/Köln, 1–15. Collon (1975): Dominique Collon, The Seal Impressions from Tell Atchana/Alalakh (Alter Orient und Altes Testament 27), Neukirchen-Vluyn. Collon (1987): Dominique Collon, First Impressions. Cylinder Seals in the Ancient Near East, London. Cooper (1978): Jerrold S. Cooper, The Return of Ninurta to Nippur. An-gim dím-ma (Analecta Orientalia 52), Rom. Cornelius (1994): Izak Cornelius, The Iconography of the Canaanite Gods Reshef and Bacal. Late Bronze and Iron Age I Periods (c 1500 – 1000 BCE) (Orbis Biblicus et Orientalis 140), Fribourg/Göttingen. Couroyer (1956): Bernard Couroyer, „Quelques égyptianismes dans l’Exode“, Revue Biblique 63, 209– 219. Couroyer (1960): Bernard Couroyer, „Un égyptianisme biblique. « Depuis la fondation de l’Égypte », Exode IX, 18“, Revue Biblique 67, 42–48. Craig (1895): James A. Craig, Assyrian and Babylonian Religious Texts being Prayers, Oracles, Hymns (Assyriologische Bibliothek 13) Leipzig. Cryer (1994): Frederick H. Cryer, Divination in Ancient Israel and its Near Eastern Environment. A Socio-Historical Investigation (Journal of the Society of the Old Testament, Suppl. 142), Sheffield. Dahood (1968): Mitchell Dahood, Psalms II: 51–100 (The Anchor Bible), New York. Darnell (2004): John C. Darnell, The Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity. Cryptographic Compositions in the Tombs of Tutankhamun, Ramesses VI and Ramesses IX (Orbis Biblicus et Orientalis 198), Fribourg/Göttingen. Dasen (1997): Veronique Dasen, „Multiple Births in Graeco-Roman Antiquity“, Oxford Journal of Archaeology 16, 49–63. Delaporte (1923): Louis Delaporte, Catalogue des cylindres orientaux. Cachets et pierres gravées du Musée du Louvre, II: Acquisitions, Paris.
Literaturverzeichnis
107
Delaporte (1940): Louis Delaporte, Malatya: Fouilles de la Mission Archéologique Française. Tome 1,1: Arslantepe – La porte des Lions, Paris. Delcor (1971): Mathias Delcor, Le livre de Daniel (Sources Bibliques), Paris. Delpiani et al. (2011): S. M. Delpiani, M. Y. Deli Antoni, S. A. Barbini u. D. E. Figueroa, „First Record of a Dicephalic Specimen of Tope Galeorhinus galeus (Elasmobranchii: Triakidae)“, Journal of Fish Biology 78, 941–944. Demisch (1977): Heinz Demisch, Die Sphinx. Geschichte ihrer Darstellung von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart. Dendara: Le temple de Dendara, 15 Bde., Kairo 1934–2000. Bd. I–V: É. Chassinat; Bd. VI: É. Chassinat und F. Daumas; Bd. VII–IX: F. Daumas; Bd. X–XV: S. Cauville (Band XIII–XV nur als download unter http://www.dendara.net/download/). Derchain (1972): Philippe Derchain, Hathor Quadrifrons. Recherches sur la syntaxe d’un mythe égyptien, Istanbul. Diels u. Kranz (2004): Hermann Diels u. Walther Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und Deutsch, Bd. 1, Hildesheim (6. Auflage). Dietrich u. Loretz (1986): Manfried Dietrich u. Oswald Loretz, „Ugaritische Omentexte“, in: Otto Kaiser (Hg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Band II: Religiöse Texte, Gütersloh, 94–101. Dietrich u. Loretz (1990): Manfried Dietrich u. Oswald Loretz, Mantik in Ugarit. Keilalphabetische Texte der Opferschau – Omensammlungen, Nekromantie (Abhandlungen zur Literatur Alt-Syren-Palästinas und Mesopotamiens 3), Münster. Dietrich u. Loretz (1999–2000): Manfried Dietrich u. Oswald Loretz, „Baal, Leviathan und der siebenköpfige Šlyṭ in der Rede des Todesgottes Môt (KTU 1.5 I 1–8 II 27a–31“, Aula Orientalis 17–18, 55–80. Dietrich, Loretz u. Sanmartín (1995): Manfried Dietrich, Oswald Loretz u. Joaquín Sanmartín, The Cuneiform Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and other Places (KTU: second, enlarged Edition) (Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens 8), Münster. Dijk (1957): Jacobus J. A. van Dijk, „Textes divers du musée de Baghdad II“, Sumer 13, 65–133. Dohmen (2010): Christoph Dohmen, Visionen von einem Neuanfang. Hinführung zum Buch Ezechiel, Klosterneuburg. Dombart u. Kalb (1955): Bernard Dombart u. Alphons Kalb, Sancti Aurelii Augustini – De Civitate Dei, Libri XI–XXII (Corpus Christianorum Series Latina 47), Leipzig. Donner (1967): Herbert Donner, „Ugaritismen in der Psalmenforschung“, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 67, 322–350. Donner u. Röllig (1966): Herbert Donner u. Wolfgang Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften, Band I: Texte, Wiesbaden. Donner u. Röllig (1969): Herbert Donner u. Wolfgang Röllig, Kanaanäische und aramäische Inschriften, Band III: Glossare und Indizes, Tafeln, Wiesbaden (Zweite Auflage). Dorman (1987): Peter F. Dorman, The Metropolitan Museum of Art. Egypt and the Ancient Near East, New York. Dornemann (1983): Rudolph H. Dornemann, The Archaeology of the Transjordan in the Bronze and Iron Ages, Milwaukee. Dover (1968): Kenneth J. Dover, Aristophanes – Clouds, Oxford. Driel (1983): G. van Driel, „Seals and Sealings from Jebel Aruda“, Akkadika 33, 34–62. Drommer (1967): W. Drommer, „Morphologische und röntgenologische Untersuchungen an dicephalen Doppelmißbildungen beim Rind“, Zentralblatt für Veterinärmedizin Reihe A 14, 515–527. Duhm (1922): Bernhard Duhm, Die Psalmen (Kurzer Hand-Kommentar zum Alten Testament XIV), Tübingen. Dunand (1945): Maurice Dunand, Byblia Grammata. Documents et Recherches sur le développement de l’écriture en Phénice, Beirut. Durand (1988): Jean-Marie Durand, Archives épistolaires de Mari I (Archives royales de Mari 26), Paris. Dynda (2014): Jiří Dynda, „The Three Headed One at the Crossroad: The Comparative Study of the Slavic God Triglav“, Studia Mythologica Slavica 17, 57–82. Eades u. Thomas (1966): Joseph W. Eades u. Colin G. Thomas, „Successful Separation of Ischiopagus Tetrapus-conjoined Twins“, Annals of Surgery 164, 1059–1072.
108
Literaturverzeichnis
Ebach (1984): Jürgen Ebach, Leviathan und Behemoth. Eine biblische Erinnerung wider die Kolonisierung der Lebenswelt durch das Prinzip der Zweckrationalität, Raderborn et al. Ebeling (1931): Erich Ebeling, Tod und Leben nach den Vorstellungen der Babylonier, Berlin/Leipzig. Eberhardt (2007): Gönke Eberhardt, JHWH und die Unterwelt. Spuren einer Kompetenzausweitung JHWHs im Alten Testament, Tübingen. Edzard (1980): Dietz O. Edzard, „Keule. A. Philologisch“, in: Dietz Otto Edzard (Hg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie V, Berlin, 578–579. Edzard (1997): Dietz O. Edzard, Gudea and his Dynasty (Royal Inscriptions of Mesopotamia, Early Periods III, 1), Toronto. Ehrman (2004): Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings, New York/Oxford. Eichler (2015): Raanan Eichler, „Cherub: A History of Interpretation“, Biblica 96, 26–38. Elben (1821): Ernesto Elben, De Acephalis sive Monstris corde Carentibus, Berlin. Elliott (1977): Carolyn Elliott, „The Religious Beliefs of the Ghassulians, c. 4000–3000 B. C.“, Levant 10, 37–54. Ellul (2014): Danielle Ellul, „Ezéchiel et la vision de la gloire de Dieu“, Bulletin de Littérature Ecclésiastique 115, 255–269. Emre (2002): Kutlu Emre, „Felsreliefs, Stelen, Orthostaten. Großplastik als monumentale Form staatlicher und religiöser Repräsentation“, in: Helga Willinghöfer (Hg.), Die Hethiter und ihr Reich – Das Volk der 1000 Götter, Stuttgart, 218–233. Esenkaya, Gürbüz u. Yalti (2004): Semra Esenkaya, Birgül Gürbüz u. Serap Yalti, „Asymmetric Parasitic Dicephalus Conjoined Twins“, Journal of Clinical Ultrasound 32, 102–105. Feix (1977): Josef Feix (Hg.), Herodot – Historien, Erster Band, München (Zweite Auflage). Fajen (1999): Fritz Fajen, Oppianus – Halieutica. Einführung, und Text, Übersetzung in deutscher Sprache, Stuttgart/Leipzig. Fay (1998): Biri Fay, „Egyptian Duck Flasks of Blue Anhydrite“, The Metropolitan Museum of Art Journal 33, 23–48. Fekkes (1994): Jan Fekkes III, Isaiah and Prophetic Traditions in the Book of Revelation. Visionary Antecedents and their Development (Journal for the Study of the New Testament, Supplement Series 93), Sheffield. Ferch (1980): Arthur J. Ferch, „Daniel 7 and Ugarit: A Reconsideration“, Journal of Biblical Literature 99, 75–86. First u. Piersol (1891a): Barton C. First u. George A. Piersol, Human Monstrosities III, Philadelphia. First u. Piersol (1891b): Barton C. First u. George A. Piersol, Human Monstrosities IV, Philadelphia. Fischer, H. G. (1966): Henry G. Fischer, „Egyptian Turtles“, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, February 1966, 193–200. Fischer, H. G. (1968): Henry G. Fischer, Ancient Egyptian Representations of Turtles (The Metropolitan Museum of Art Papers 13), New York 1968. Fischer, R. (1980): Rudolf Fischer, Die schwarzen Pharaonen. Tausend Jahre Geschichte und Kunst der ersten innerafrikanischen Hochkultur, Bergisch Gladbach. Fischer-Elfert (2015): Hans-Werner Fischer-Elfert, Magika Hieratika in Berlin, Hannover, Heidelberg und München (Ägyptische und Orientalische Papyri und Handschriften des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung Berlin 2), Berlin/München/Boston. Flinders Petrie (1906): William M. Flinders Petrie, Researches in Sinai, London. Flinders Petrie (1908): William M. Flinders Petrie, Athribis, London. Flinders Petrie (1914): William M. Flinders Petrie, Amulets. Illustrated by the Egyptian Collection in University College, London, London. Flinders Petrie (1920): William M. Flinders Petrie, Prehistoric Egypt (British School of Archaeology in Egypt 31), London. Flinders Petrie (1921): William M. Flinders Petrie, Corpus of Prehistoric Pottery and Palettes (British School of Archaeology in Egypt 32), London. Flusser (1972): David Flusser, „The four Empires in the Fourth Sibyl and in the Book of Daniel“, Israel Oriental Studies 2, 148–175. Fohrer (1955): Georg Fohrer, Ezechiel (Handbuch zum Alten Testament 1, 13), Tübingen.
Literaturverzeichnis
109
Fohrer (1983): Georg Fohrer, „Gottes Antwort aus dem Sturmwind (Hi 38–41)“, in: Georg Fohrer (Hg.), Studien zum Buche Hiob (1956–1979), Berlin/New York, 114–134. Förg (2013): Florian Förg, Die Ursprünge der alttestamentlichen Apokalyptik (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 45), Leipzig. Forster (1927): E. S. Forster, The Works of Aristotle, Volume VII, Problemata, Oxford. Förster (1865): August Förster, Handbuch der allgemeinen Pathologischen Anatomie, Leipzig. Foster (1993): Benjamin R. Foster, Before the Muses. An Anthology of Akkadian Literature I, Bethesda. Fouillet (1962): André Fouillet, L’Apocalypse (Studia Neotestamentica Subsidia 3), Paris. Fox (1986): Michael V. Fox, „Egyptian Onomastica and Biblical Wisdom“, Vetus Testamentum 36, 302– 310. Fox (2012): Michael V. Fox, „Behemoth and Leviathan“, Biblica 93, 261–267. Frahm (2002): Eckart Frahm, „Assur 2001: Die Schriftfunde“, Mitteilungen der Deutschen OrientGesellschaft 134, 47–85. Frankfort (1935): Henri Frankfort, „Early Dynastic Sculptured Maceheads“, Analecta Orientalia 12, 105– 121. Frankfort (1939): Henri Frankfort, Cylinder Seals. A Documentary Essay on the Art and Religion of the Ancient Near East, London. Frankfort (1943): Henri Frankfort, More Sculpture from the Diyala Region (Oriental Institute Publications 60), Chicago. Frankfort (1954): Henri Frankfort, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Harmondsworth. Frazer (1921): James G. Frazer, Apollodorus. The Library, Cambridge, Massachusetts/London. Frazer (1989): James G. Frazer, Ovid – Fasti, Cambridge, Massachusetts/London. Freedman (2006): Sally M. Freedman, If a City is Set on a Height. The Akkadian Omen Series Šumma Alu ina Mēlê Šakin, Volume 2: Tablets 22–40 (Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 19), Philadelphia. Freyburger u. Roddaz (1991): Marie-Laure Freyburger u. Jean-Michel Roddaz, Dion Cassius – Histoire Romaine, Livre 50 et 50, Paris. Froehner (1885): Wilhelm Froehner, Collection Julien Gréau. Catalogue des Bronzes antiques et des objets d’art du Moyen Age et de la Renaissance, Paris. Fuchs (1993): Gisela Fuchs, Mythos und Hiobdichtung. Aufnahme und Umdeutung altorientalischer Vorstellungen, Stuttgart/Berlin/Köln. Fuhr-Jaeppelt (1972): Ilse Fuhr-Jaeppelt, Materialien zur Ikonographie des Löwenadlers Anzu-Imdugud, München. Fuhs (1984): Hans F. Fuhs, Ezechiel 1–24 (Die Neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung), Würzburg. Furlani (1935): Giuseppe Furlani, „Dei e démoni bifronti e bicefali dell’Asia occidentale antica“, in: Miscellanea orientalia dedicata A. Deimel annos LXX complenti (Analecta Orientalia 12), Rom, 136– 162. Furlong (1987): Iris Furlong, Divine Headdresses of Mesopotamia in the Early Dynastic Period (BAR 334), Oxford. Galst u. van Alfen (2013): Jay M. Galst u. Peter G. van Alfen, Ophthalmologia Optica & Visio in Nummis, Wayenborgh. Garcia Martinez u. Tigchelaar (1989/90): Florentino Garcia Martinez u. Eibert J. C. Tigchelaar, „The Books of Enoch (1 Enoch) and the Aramaic Fragments from Qumran“, Restoration Quarterly 14, 141–146. García Valdés, Llera Fueyo u. Rodríguez-Noriega Guillén (2006): Manuela García Valdés, Luis Alfonso Llera Fueyo u. Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, Claudius Aelianus – De Natura Animalium (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Berlin. Garis Davies (1953): Norman de Garis Davies, The Temple of Hibis III: The Decoration (Publications of the Metropolitan Museum of Art Egyptian Expedition 17), New York. Garzya u. Roques (2003): Antonio Garzya u. Dennis Roques, Synésios de Cyrène, Tome II, Correspondance, Lettres I–LXIII, Paris. Gaß (2012): Erasmus Gaß, „Saul in En-Dor (1Sam 28). Ein literarkritischer Versuch“, Welt des Orients 42, 153–185.
110
Literaturverzeichnis
Gedda (1961): Luigi Gedda, Twins in History and Science, Springfield, Illinois. Geffcken (1902): Johannes Geffcken, Die Oracula Sibyllina, Leipzig. Gehrke (2008): Hans-Joachim Gehrke, Geschichte des Hellenismus, München (Vierte Auflage). Gerlaud (1994): Bernard Gerlaud, Nonnos de Panopolis – Les Dionysiaques, Tome VI: Chants XIV– XVII, Paris. Gesenius (1987–2010): Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, Berlin et al. (18. Auflage). Gessner (1589): Conrad Gessner, Schlangenbuch, Zürich. Giedion (1962): Sigfried Giedion, Die Entstehung der Kunst, Köln. Gilbert-Barness u. Debich-Spicher (2004): Enid Gilbert-Barness u. Diane Debich-Spicer, Embryo and Fetal Pathology. Color Atlas with ultrasound Correlation, Cambridge et al. Gilula (1967): Mordecai Gilula, „An Egyptian Parallel to Jeremiah I 4–5“, Vetus Testamentum 17, 114. Giorgi (2006): Rosa Giorgi, Engel, Dämonen und phantastische Wesen (Bildlexikon der Kunst 6), Mailand. Gitler (1996): Haim Gitler, „New Fourth-Century BC Coins from Ascalon“, The Numismatic Chronicle 156, 1–9. Gitler u. Tal (2006): Haim Gitler u. Oren Tal, The Coinage of Philistia of the Fifth and Fourth Centuries BC. A Study of the Earliest Coins of Palestine (Collezioni numismatiche. Materiali pubblici e private 6), Mailand. Glessmer (2001): Uwe Glessmer, „Die ‘vier Reiche’ aus Daniel in der Targumischen Literatur“, in: John J. Collins u. Peter W. Flint (Hgg.), The Book of Daniel. Composition and Reception (Vetus Testamentum, Suppl. 83, 2), Leiden/Boston/Köln, 468–489. Goettsberger (1928): Johann Goettsberger, Das Buch Daniel (Die Heilige Schrift des Alten Testamentes 8, 2), Bonn. Goldingay (1989): John Goldingay, Daniel (World Biblica Commentary 30), Dallas. Goldschmidt (1934): Lazarus Goldschmidt, Der babylonische Talmud VII, Haag. Golénischeff (1877): Vladimir S. Golénischeff, Die Metternichstele in der Originalgröße, Leipzig. Gonnella, Khayyata u. Kohlmeyer (2005): Julia Gonnella, Wahid Khayyata u. Kay Kohlmeyer, Die Zitadelle von Aleppo und der Tempel des Wettergottes. Neue Forschungen und Entdeckungen, Münster. Gordis (1978): Robert Gordis, The Book of Job. Commentary, New Translation and Special Studies, New York. Gorny u. Mosch (2013): Gorny u. Mosch, Giessener Münzhandlung GmbH, Auktion Kunst der Antike, 19. Juni 2013, Nr. 214, Gießen. Gould u. Pyle (1898): George M. Gould u. Walter L. Pyle, Anomalies and Curiosities of Medicine being an Encyclopedic Collection of Rare and Extraordinary Cases, and of the most Striking Instances of Abnormality in all Branches of Medicine and Surgery, derived from an exhaustive research of Medical Literature from its Origin to the present Day, abstracted, classified, annotated, and indexed, Philadelphia. Gräfe, von Hufeland u. Busch (1840): Carl Ferdinand von Gräfe, Christoph Wilhelm von Hufeland u. Dietrich W. Busch, Encyclopädisches Wörterbuch der medicinischen Wissenschaften, Band 24: Mons veneris – Natrium, Berlin. Grafman (1972): Rafi Grafman, „Bringing Tiamat to Earth“, Israel Exploration Journal 22 (1972), 47– 49. Green (1983): Anthony Green, „Neo-Assyrian Apotropaic Figures: Figurines, Rituals and Monumental Art, with Special Reference to the Figurines from the Excavations of the British School of Archaeology in Iraq at Nimrud“, Iraq 45, 87–96. Greenberg (2001): Moshe Greenberg, Ezechiel 1–20 (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament), Freiburg. Greenberg (2005): Moshe Greenberg, Ezechiel 21–37 (Herders theologischer Kommentar zum Alten Testament), Freiburg. Greenfield u. Sokoloff (2000): Jonas C. Greenfield u. Michael Sokoloff, „4QZodiology and Brontology“, Discoveries in the Judean Dessert 36, 259–274. Grenier (2002): Jean-Claude Grenier, Les bronzes du Museo Gregoriano Egizio (Monumenti Musei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano Egizio Aegyptiaca Gregoriana 5), Vatikanstadt.
Literaturverzeichnis
111
Gressmann (1922): Hugo Gressmann, Die Anfänge Israels (Von 2. Mose bis Richter und Ruth) (Die Schriften des Alten Testaments 1, 2), Göttingen. Griffiths (1970): John Gwyn Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride, Cambridge. Grissom (2000): Carol A. Grissom, „Neolithic Statues from cAin Ghazal: Construction and Form“, American Journal of Archaeology 104, 25–45. Groneberg (1986): Brigitte Groneberg, „Die sumerisch-akkadische Inanna /Ištar: Hermaphroditos?“, Welt des Orients 17, 25–46. Gülbahar et al. (2005): M. Yavuz Gülbahar, Hayati Yüksel, Zafer Soygüder u. Ö. Faruk Erçin, „Dicephalus, Arnold-Chiari Malformation, Spinal Dysraphism and other associated Anomalies in a Newborn Holstein Calf“, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29, 565–570. Gunkel (1986): Hermann Gunkel, Die Psalmen, Göttingen. Gupta (1966): J. M. Gupta, „Pygopagus Conjoined Twins“, British Medical Journal 2, 868–871. Gurlt (1832): E. F. Gurlt, Lehrbuch der pathologischen Anatomie der Haus-Säugehtiere, Zweiter Theil: Die Classification, Beschreibung und Anatomie der Missgeburten, Berlin. Gutbub (1977): Adolphe Gutbub, „Die vier Winde im Tempel von Kom Ombo (Ägypten)“, in: Othmar Keel (Hg.), Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine neue Deutung der Majestätsschilderungen in Jes 6, Ez 1 und 10 und Sach 4 (Stuttgarter Bibelstudien 84/85), Stuttgart, 328–353. Hadorn (1928): Wilhelm Hadorn, Die Offenbarung des Johannes (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament mit Text und Paraphrase XVIII), Leipzig. Hagenmeyer (1913): Heinrich Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. Historia Hierosolymitana, Heidelberg. Hähnel et al. (2003): Stefan Hähnel, Peter Schramm, Stefan Hassfeld, Hans H. Steiner u. Angelika Seitz, „Craniofacial Duplication (Diprosopus): CT, MR Imaging, and MR Angiography Findings – Case Report“, Radiology 226, 210–123. Hamidović (2021): D. Hamidović, „Les chérubins et la trône-char divin (merkavah) dans les écrits des palais célestes (hekhalot)“, in: Philippe Abrahami u. Stéphanie Anthonioz (Hgg.), Les Chérubins/ Keruvim dans l’Antiquité. Approche historique et compare (Kasion 6), Münster, 131–146. Hansen (1987): Donald P. Hansen, „The Fantastic World of Sumerian Art: Seal Impressions from Ancient Lagash“, in: Ann E. Farkas, Prudence O. Harper u. Evelyn B. Harrison (Hgg.), Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds. Papers presented in Honor of Edith Porada, Mainz, 53–63. Harris u. Goldenthal (1977): S. B. Harris u. E. I. Goldenthal, „Conjoined Twins (Cephalothoracopagus) in a Charles River CD Rat“, Veterinary Pathology 14, 519–520. Hartenstein (2017): Friedhelm Hartenstein, „Weshalb braucht die christliche Theologie eine Theologe des Alten Testaments?“, in: Friedhelm Hartenstein (Hg.), Die bleibende Bedeutung des Alten Testaments. Studien zur Relevanz des ersten Kanonteils für Theologie und Kirche (Biblisch-Theologische Studien 165), Göttingen, 15–53. Hartman (1989): Sven S. Hartman, „Datierung der jungavestischen Apokalyptik“, in: David Helleholm (Hg.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East. Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, August 12–17, 1979, Tübingen, 61–75. Hayes (1960): William C. Hayes, The Scepter of Egypt. A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art, Part I: From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom, Cambridge, Massachusetts 1960 (Zweite Auflage). Heckel (2016): Martin Heckel, Martin Luthers Reformation und das Recht, Tübingen. Hehn (1907): Johannes Hehn, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im Alten Testament. Eine religionsgeschichtliche Studie, Leipzig. Heiberg (1921): Johan L. Heiberg, Paulus Aegineta (Corpus Medicorum Graecorum 9), Leipzig. Heider (1999): C. G. Heider, „Tannin“, in: Bob Becking u. Pieter W. van der Horst (Hgg.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden/Boston/Köln, 832–836 (Zweite Auflage). Heimpel (1968): Wolfgang Heimpel, Tierbilder in der sumerischen Literatur, Rom. Heinisch (1923): Paul Heinisch, Das Buch Ezechiel (Die Heilige Schrift des Alten Testaments 7, 1), Bonn. Heinrich u. Andrae (1931): Ernst Heinrich u. Walter Andrae, Fara. Ergebnisse der Ausgrabungen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Fara und Abu Hatab 1902/03, Berlin.
112
Literaturverzeichnis
Herdner (1963): Andrée Herdner, Corpus des Tablettes en cunéiformes alphabétiques découvertes à Ras Shamra-Ugarit de 1929 à 1939 (Mission de Ras Shamra 10), Paris. Herkenne (1936): Heinrich Herkenne, Das Buch der Psalmen (Die Heilige Schrift des Alten Testaments 5, 2), Bonn. Herrmann (1985): Christian Herrmann, Formen für ägyptische Fayencen. Katalog der Sammlung des Biblischen Instituts der Universität Freiburg, Schweiz, und einer Privatsammlung (Orbis Biblicus et Orientalis 60), Fribourg/Göttingen. Herrmann (1994): Christian Herrmann, Ägyptische Amulette aus Palästina / Israel. Mit einem Ausblick auf ihre Rezeption durch das Alte Testament (Orbis Biblicus et Orientalis 138), Fribourg/Göttingen. Herrmann (2002): Christian Herrmann, Die ägyptischen Amulette der Sammlungen Bibel + Orient der Universität Freiburg, Schweiz. Anthropomorphe Gestalten und Tiere (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 22), Göttingen. Herrmann (2006): Christian Herrmann, Ägyptische Amulette aus Palästina / Israel, Bd. III (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 24), Fribourg/Göttingen. Herrmann u. Staubli (2010): Christian Herrmann u. Thomas Staubli, 1001 Amulett. Altägyptischer Zauber, monotheisierte Talismane, säkulare Magie, mit Beiträgen von Simone Berger-Lober, Othmar Keel und Georg Schönbächler, Freiburg. Herzfeld (1937): Ernst Herzfeld, „Die Kunst des 2. Jahrtausends in Vorderasien, 1. Teil“, Archäologische Mitteilungen aus dem Iran 9, 1–79. Hevia-Hormazábal, Pastén-Marambio u. Vega (2011): Valentina Hevia-Hormazábal, Victor PasténMarambio u. Alonso Vega, „Registro de un Monstruo Diprósopo de Tiburón Azul (Prionace glauca) en Chile“, International Journal of Morphology 29, 509–513. Heyworth (2007): Stephen J. Heyworth, Sexti Properti Elegos, Oxford. Hieke (2005): Thomas Hieke, „Esra-Schriften, außerbiblische (AT)“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/11533, Zugriff am 22. Juli 2022]. Hill u. Jacobsen (1990): Harold D. Hill u. Thorkild Jacobsen, Old Babylonian Public Buildings in the Diyala Region, Part One: Excavations at Ishcali, Part Two: Khafājah Mounds B, C, and D (Oriental Institute Publications 98), Chicago, Illinois. Hohl (1927): Ernestus Hohl, Scriptores Historiae Augustae, Vol. 1, Leipzig. Höhne (1954): Ernst Höhne, Die Thronwagenvision Hesekiels. Hes. 1, 4–28, Erlangen. Hölbl (2000): Günther Hölbl, Altägypten im Römischen Reich. Der römische Pharao und seine Tempel, I: Römische Politik und altägyptische Ideologie von Augustus bis Diocletian, Tempelbau in Oberägypten (Zaberns Bildbände zur Archäologie), Mainz. Hornemann (1969): Bodil Hornemann, Types of Ancient Egyptian Statuary VI, Kopenhagen. Horner (1924): George W. Horner (Hg.), The Coptic Version of the New Testament in the southern Dialect, otherwise called Sahidic and Thebaic with critical Apparatus, Literal English Translation, Register and Notes of Fragments, Oxford. Hornung (1963): Erik Hornung, Das Amduat. Die Schrift des verborgenen Raumes, 2 Bde. (Ägyptologische Abhandlungen 7), Wiesbaden. Hornung (1984): Erik Hornung, Das Buch von den Pforten des Jenseits nach den Versionen des Neuen Reiches, Teil II: Übersetzung und Kommentar (Aegyptiaca Helvetica 8), Genf. Hornung (1991): Erik Hornung, The Tomb of Pharaoh Seti I, Zürich/München. Hornung (1997a): Erik Hornung, Altägyptische Jenseitsbücher. Ein einführender Überblick, Darmstadt. Hornung (1997b): Erik Hornung, Die Unterweltsbücher der Ägypter, Düsseldorf/Zürich. Hornung, Krauss u. Warburton (2006): Erik Hornung, Rolf Krauss u. David A. Warburton (Hgg.), Ancient Egyptian Chronology (Handbuch der Orientalistik I/83), Leiden/Boston. Hossfeld u. Zenger (2000): Frank-Lothar Hossfeld u. Erich Zenger, Psalmen 51–100 (Herders Theologischer Kommentar, Altes Testament), Freiburg/Basel/Wien. Hossfeld u. Zenger (2002): Frank-Lothar Hossfeld u. Erich Zenger, Hans F. Fuhs, Die Psalmen II: Psalm 51–100 (Die Neue Echter Bibel, Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung), Würzburg.
Literaturverzeichnis
113
Hovorakova et al. (2008): M. Hovorakova, R. Peterkova, Z. Likovsky u. M. Peterka, „A Case of Conjoined Twin’s Cephalothoracopagus Janiceps disymmetros“, Reproductive Toxicology 26, 178– 182. Hrouda (1991): Barthel Hrouda, Der alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien, Gütersloh. Hung et al. (1986): Wen-Tsung Hung et al., „Successful Separation of Ischiopagus Tripus Conjoined Twins“, Journal of Pediatric Surgery 21, 920–923. Hunger (1976): Hermann Hunger, Spätbabylonische Texte aus Uruk, Teil I (Ausgrabungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 9), Berlin. Hunger (1992): Hermann Hunger, Astrological Reports to Assyrian Kings (State Archives of Assyria 8), Helsinki. Jacobsen (1990): Thorkild Jacobsen, „Description of Major Finds from Ishchali“, in: Harold D. Hill u. Thorkild Jacobsen, Old Babylonian Public Buildings in the Diyala Region, Part One: Excavations at Ishcali, Part Two: Khafājah Mounds B, C, and D (Oriental Institute Publications 98), Chicago, Illinois, 99–107. Jacobus (2010): Helen R. Jacobus, „4Q318: A Jewish Zodiac Calendar at Qumran?“, in: Charlotte Hempel (Hg.), The Dead Sea Scrolls. Text and Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 90), Leiden, 365–395. Jacobus (2014): Helen R. Jacobus, Zodiac Calendars in the Dead Sea Scrolls and their Reception: Ancient Astronomy and Astrology in Early Judaism (Studies in Judaica), Leiden. Jacoby (1958): Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker (F Gr Hist), Dritter Teil: Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie). C: Autoren über einzelne Laender, Nr. 608a–856 (Zweiter Band: Illyrien – Thrakien Nr. 709–856), Leiden. Jaggard (1898): William Wright Jaggard, „Joined Twins“, in: John M. Keating (Hg.), Cyclopaedia of the Diseases of Children. Medical and Surgical, Philadelphia, 922–939. Jain et al. (2014): Prashant Jain et al., „Surgical Separation of Pygopagus Twins: A Case Report“, Journal of Pediatric Surgery Case Reports 2, 119–122. Jal (1995): Paul Jal, Tite Live – Histoire Romaine, Tome XVIII: Livre XXVIII, Paris. Jan u. Mayhoff (1967): Ludwig von Jan u. Carl Mayhoff, C. Plini Secundi – Naturalis Historiae, Libri XXXVII. Vol. II: Libri VII–XV, Stuttgart. Jeffers (1996): Ann Jeffers, Magic and Divination in Ancient Palestine and Syria (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East 8), Leiden/New York/Köln. Jenks (1991): Gregory C. Jenks, The Origins and Early Development of the Antichrist Myth (Beihefte zur Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 59), Berlin. Jericke (2015): Detlef Jericke, „Eisenzeit II“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibel wissenschaft.de/stichwort/17100, Zugriff am 22. Juli 2022]. Jones, C. P. (2005): Christopher P. Jones, Philostratos. The Life of Apollonius of Tyana, Books V–VIII, London. Jones, W. H. S. (1963): William H. S. Jones, Pliny – Natural History, Books 28–32, Cambridge, Massachusetts/London. Junker u. Winter (1965): Hermann Junker u. Erich Winter, Das Geburtshaus des Tempels der Isis in Philä (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, Denkschriften, Sonderband 2), Wien. Justi (1868): Ferdinand Justi, Der Bundehesh, Leipzig. Kafafi (2002): Zeidan A. Kafafi, „The Neolithic of the Levant and Anatolia“, in: Arnulf Hausleiter et al. (Hgg.), Material Culture and Mental Spheres. Rezeption archäologischer Denkrichtungen in der Vorderasiatischen Altertumskunde. Internationales Symposium für Hans J. Nissen, Berlin, 23.–24. Juni 2000 (Alter Orient und Altes Testament 293), Münster 329–241. Kahler (2008): Birgit Kahler, „A four-legged Creature with seven Snake-Heads depicted on a Cylinder Seal of Tell Asmar, Iraq“, in: Gotthard G. G. Reinhold (Hg.), Die Zahl Sieben im Alten Orient, Frankfurt et al., 71–76. Kaiser (1959): Otto Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel (Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 78), Berlin.
114
Literaturverzeichnis
Kammenhuber (1976): Annelies Kammenhuber, Orakelpraxis, Träume und Vorzeichenschau bei den Hethitern, Heidelberg. Kamp (2017): Henk van de Kamp, „Leviathan and the Monsters in Revelation“, in: Koert van Bekkum et al. (Hgg.), Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Leiden, 167–175. Kaplony (1963): Peter Kaplony, Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit (Ägyptologische Abhandlungen 8), Wiesbaden. Karcher (1975): Helmut L. Karcher, Wie ein Ei dem anderen. Alles über Zwillinge, München. Kastenbaum et al. (2009): Hannah A. Kastenbaum, Elizabeth W. McPherson, Geoffrey H. Murdoch u. John A. Ozolek, „Janiceps Conjoined Twins with extreme Asymmetry: Case Report with Complete Auopsy and Histopathologic Findings“, Pediatric and Developmental Pathology 12, 374–382. Kalt (1936): Edmund Kalt, Die Psalmen (Herders Bibelkommentar IV), Freiburg. Kämmerer u. Metzler (2012): Thomas R. Kämmerer u. Kai A. Metzler (Hgg.), Das babylonische Weltschöpfungsepos Enūma elîš (Alter Orient und Altes Testament 375), Münster. Karrer (2012): Martin Karrer, „Übersetzungen des Textes nach dem Codex Sinaiticus, Alexandrinus und Ephraeni Rescriptus“, in: Michael Labahn u. Martin Karrer (Hgg.), Die Johannesoffenbarung. Ihr Text und ihre Auslegung (Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte 38), Leipzig, 399–473. Katz, Kahane u. Broshi (1968): Karl Katz, P. P. Kahane u. Magen Broshi, Von Anbeginn. Vier Jahrtausende Heiliges Land im modernsten Museum der Welt, Hamburg. Keel (1977): Othmar Keel, Jahwe-Visionen und Siegelkunst. Eine neue Deutung der Majestätsschilderungen in Jes 6, Ez 1 und 10 und Sach 4 (Stuttgarter Bibelstudien 84/85), Stuttgart. Keel (1978): Othmar Keel, Jahwes Entgegnung an Ijob. Eine Deutung von Ijob 38–41 vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Bildkunst, Göttingen. Keel (1980): Othmar Keel, Die Welt der altorientalischen Bildymbolik und das Alte Testament am Beispiel der Psalmen, Neukirchen. Keel (1992): Othmar Keel, Das Recht der Bilder, gesehen zu werden. Drei Fallstudien zur Methode der Interpretation altorientalischer Bilder (Orbis Biblicus et Orientalis 122), Fribourg/Göttingen. Keel (1995): Othmar Keel, Corpus der Stempelsiegel-Amulette aus Palästina / Israel. Von den Anfängen bis zur Perserzeit: Einleitung (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 10), Fribourg/Göttingen. Keel (2001): Othmar Keel, „Drachenkämpfe noch und noch im Alten Orient und in der Bibel“, in: Sylvia Hahn, Sigrid Metken u. Peter B. Steiner (Hgg.), Sanct Georg. Der Ritter mit dem Drachen, Freising, 14–26. Keel-Leu u. Teissier (2004): Hildi Keel-Leu u. Beatrice Teissier, Die vorderasiatischen Rollsiegel der Sammlungen «Bibel+Orient» der Universität Freiburg Schweiz (Orbis Biblicus et Orientalis 200), Fribourg/Göttingen. Kessler (1910): Ernst Kessler, Plutarchs Leben des Lykurgos (Quellen und Forschungen zur Alten Geschichte und Geographie 23), Berlin. Khanna, Pungavkar u. Patkar (2005): P. C. Khanna, S. A. Pungavkar u. D. P. Patkar, „Ultrafast Magnetic Resonance Imaging of Cephalothoracopagus Janiceps disymmetros“, Journal of Postgraduate Medicine 51, 228–229. King (1872): Charles William King, Antique Gems and Rings, London. Kirfel (1948): Willibald Kirfel, Die dreiköpfige Gottheit. Archäologisch-ethnologischer Streifzug durch die Ikonographie der Religionen, Bonn. Kittel (1929): Rudolf Kittel, Die Psalmen (Kommentar zum Alten Testament XIII), Leipzig. Klauck (1990): Hans-Josef Klauck, „Das Antichrist und das johanneische Schisma. Zu 1Joh 2,18–19“, in: Karl Kertelge (Hg.), Christus bezeugen. Festschrift für Wolfgang Trilling, Freiburg, 237–248. Klauck (1992): Hans-Josef Klauck, „Das Sendschreiben nach Pergamon und der Kaiserkult der Johannesoffenbarung“, Biblica 73, 153–182. Kleiner (1995): Michael Kleiner, Saul in En-Dor. Wahrsagung oder Totenbeschwörung? Eine synchrone und diachrone Untersuchung zu 1 Sam 28, Leipzig. Klostermann (1912): Erich Klostermann, Origenes, Eustathius von Antiochien und Gregor von Nyssa über die Hexe von Endor, Bonn.
Literaturverzeichnis
115
Knibb (1982): Michael A. Knibb, The Ethiopic Book of Enoch. A New Edition in the Light of the Aramaic Dead Sea Fragments, Oxford. Koch (1980): Klaus Koch, Das Buch Daniel (Erträge der Forschung 144), Darmstadt. Koch (1996): Klaus Koch, „Die Anfänge der Apokalyptik in Israel und die Rolle des astronomischen Henochbuches“, in: Klaus Koch (Hg.), Vor der Wende der Zeiten. Beiträge zu apokalyptischen Literatur, Gesammelte Aufsätze III, Neukirchen-Vluyn, 3–39. Koenen (1994): Klaus Koenen, „ ‚… denn wie der Mensch jedes Tier nennt, so soll es heißen‘ (Gen 2,19). Zur Bezeichnung von Rindern im Alten Testament“, Biblica 75, 539–546. Koenen (2016): Klaus Koenen, „Rind“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibel wissenschaft.de/stichwort/33506, Zugriff am 22. Juli 2022]. Kollmann (2007): Bernd Kollmann, „Zwischen Trost und Drohung – Apokalyptik im Neuen Testament“, in: Bernd U. Schipper u. Georg Plasger (Hgg.), Apokalyptik und kein Ende? (Biblisch-theologische Schwerpunkte 29), Göttingen, 51–73. Kompanje (2005): Erwin J. O. Kompanje, „A Case of Symmetrical Conjoined Twins in a Bottlenose Dolphin Tursiops Truncatus (Mammalia, Cetacea)“, DEINSEA 11, 147–150. Korpel u. de Moor (2017): Marjo Korpel u. Johannes de Moor, „The Leviathan in the Ancient Near East“, in: Koert van Bekkum et al. (Hgg.), Playing with Leviathan. Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World, Leiden, 3–18. Kovacs (2002): David Kovacs, Euripides – Helen. Phoenician Women. Orestes, Cambridge, Massachusetts/London. Kowalski (2004): Beate Kowalski, Die Rezeption des Propheten Ezechiel in der Offenbarung des Johannes (Stuttgarter Biblische Beiträge 52), Stuttgart. Kraft (1974): Heinrich Kraft, Die Offenbarung des Johannes (Handbuch zum Neuen Testament 16), Tübingen. Kratz (2001): Reinhard G. Kratz, „The Visions of Daniel“, in: John J. Collins u. Peter W. Flint (Hgg.), The Book of Daniel. Composition and Reception (Vetus Testamentum, Suppl. 83, 1), Leiden/Boston/ Köln, 91–113. Kraus (1989): Hans-Joachim Kraus, Psalmen (Biblischer Kommentar: Altes Testament 15, 2), Neukirchen-Vlyun. Krause u. Tillmanns (1937): C. Krause u. St. Tillmanns, „Über einen Dicephalus bispinalis triscelus s. Tleothoracopagus triscelus bichirus“, Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte 107, 788– 797. Kronholm (2000): Tryggve Kronholm, „“נֶשֶׁ ר, in: Gerhard Johannes Botterweck, Helmer Ringgren u. Heinz-Josef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. X, Grand Rapids, Michigan, 77–85. Kuhn (2011): Robert Kuhn, „Überlegungen zur Herkunft und Bedeutung eines Mischwesens in der formativen Phase des alten Ägypten“, in: Ludwig D. Morenz u. Robert Kuhn (Hgg.), Vorspann oder formative Phase? Ägypten und der Vordere Orient 3500–2700 v. Chr. (Philippika 48), Wiesbaden, 163–186. Kulkarni et al. (2013): Aniket D. Kulkarni et al., „Fertility Treatments and Multiple Births in the United States“, The New England Journal of Medicine 369, 2218–2225. Kutsch (1985): Ernst Kutsch, Die chronologischen Daten des Ezechielbuches (Orbis Biblicus et Orientalis 62), Göttingen. Kutsko (2000): John F. Kutsko, Between Heaven and Earth. Divine Presence and Absence in the Book of Ezekiel (Biblical and Judaic Studies 7), Winona Lake, Indiana. Lambdin (1953): Thomas O. Lambdin, „Egyptian Loan Words in the Old Testament“, Journal of the American Oriental Society 73, 145–155. Lambert (1971): Winfried G. Lambert, „The Converse Tablet: A Litany with Musical Instructions“, in: Hans Goedicke (Hg.), Near Eastern Studies in Honor of William Foxwell Albright, Baltimore, 335–353. Lambert (2013): Winfried G. Lambert, Babylonian Creation Myths (Mesopotamian Civilizations 16), Winona Lake, Indiana.
116
Literaturverzeichnis
Lamparter (1968): Helmut Lamparter, Zum Wächter bestellt. Der Prophet Hesekiel (Die Botschaft des Alten Testaments 21), Stuttgart. Landersdorfer (1918): Simon Landersdorfer, Der ΒΑΑΛ ΤΕΤΡΑΜΟΡΦΟΣ und die Kerube des Ezechiel (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums 9, 3), Paderborn. Landsberger (1934): Benno Landsberger, Die Fauna des alten Mesopotamien nach der 14. Tafel der Serie ḪAR.RA.ḪUBULLU (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil.-Hist. Klasse 42, 6), Leipzig. Lange (1997): Armin Lange, „Divinatorische Träume und Apokalyptik im Jubiläenbuch“, in: Matthias Albani, Jörg Frey u. Armin Lange (Hgg.), Studies in the Book of Jubilees (Texte und Studien zum antiken Judentum 65), Tübingen, 25–38. Lange (2007): Armin Lange, „Divination (AT)“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www. bibelwissenschaft.de/stichwort/16521, Zugriff am 22. Juli 2022]. Langer et al. (2014): S. Langer, K. Jurczynski, A. Gessler, F.-J. Kaup, M. Bleyer u. K. Mätz-Rensing, „Ischiopagus Tripus Conjoined Twins in a Western Lowland Gorilla (Gorilla gorilla)“, Journal of Comparative Pathology 150, 469–473. Laroche (1972): Emmanuel Laroche, „Rezension zu Heinrich Otten, Ein althethitisches Ritual für das Königspaar (Studien zu den Boğazköy-Texten, hrsg. von der Kommision für den alten Orient der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Heft 8), Wiesbaden“, Bibliotheca Orientalis 29, 46– 48. Larkin (1919): Clarence Larkin, The Book of Revelation, New York. Lattke (2001): Michael Lattke, Oden Salomos. Text, Übersetzung, Kommentar, Teil 2: Oden 15–28 (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 41, 2), Fribourg/Göttingen. Lattke (2011): Michael Lattke, Die Oden Salomos. Griechisch – koptisch – syrisch mit deutscher Übersetzung, Darmstadt. Laube (2000): Adolf Laube, Flugschriften gegen die Reformation (1525–1530), Band II, Berlin. Lebram (1975): Jürgen-Christian Lebram, „König Antiochos im Buch Daniel“, Vetus Testamentum 25, 737–772. Lebram (1978): Jürgen-Christian Lebram, „Apokalyptik/Apokalypse II: Altes Testament“, in: Theologische Realenzyklopädie 1, 189–202. Lebram (1984): Jürgen-Christian Lebram, Das Buch Daniel (Zürcher Bibelkommentare, Altes Testament 23), Zürich. Leichty (1970): Erle Leichty, The Omen Series Šumma Izbu, New York. Leichty (2005): Erle Leichty, „Documents from Abnormal Births: Šumma izbu“, in: Ira Spar u. Winfried G. Lambert (Hgg.), Literary and Scholastic Texts of the First Millenium B. C. (Cuneiform Texts in the Metropolitan Museum of Art II), New York, 188–192. Leitz (2011): Christian Leitz, Der Sarg des Panehemisis in Wien (Studien zur Spätägyptischen Religion 3), Wiesbaden. Lenfant (2009): Dominique Lenfant, Les histoires Perses de Dinon et d’Heraclide. Fragments édités, traduits et commentés (Persica 13), Paris. Leonhardt (2009): Rochus Leonhardt, Grundinformation Dogmatik, Göttingen (Vierte Auflage). Leroi (2005): Armand M. Leroi, Mutants. On Genetic Variety and the Human Body, Harmondsworth. Levin (2013): Christoph Levin, Verheißung und Rechtfertigung. Gesammelte Studien zum Alten Testament II, Berlin/Boston. Liberman (1999): Gauthier Liberman, Alcée – Fragments, Tome II, Paris. Licetus (1665): Fortunius Licetus, De Monstris, Amsterdam. Liddell u. Scott (1961): Henry G. Liddell u. Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Oxford (Neudruck der neunten Auflage). Liebi (2011): Roger Liebi, Hesekiel – Ezra, Düsseldorf. Lieven (2000): Alexandra von Lieven, Der Himmel über Esna. Eine Fallstudie zur religiösen Astronomie in Ägypten (Ägyptologische Abhandlungen 64), Wiesbaden. Lieven (2008): Alexandra von Lieven, „Rezension zu Dimitri Meeks, Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus Brooklyn 47.218.84 (Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d'archéologie orientale du Caire 125), Kairo 2006“, Bibliotheca Orientalis 65, 618–622.
Literaturverzeichnis
117
Lindsay (1957): Wallace M. Lindsay, Isidori Hispalensis Episcopi. Etymologiarum sine originem, Libri XX, Tomus II, Oxford. Livingstone (1989): Alasdair Livingstone, Court Poetry and Literary Miscellanea (State Archives of Assyria 3), Helsinki. Liwak (2006): Rüdiger Liwak, „Weltreiche“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibel wissenschaft.de/stichwort/14634, Zugriff am 22. Juli 2022]. Lohmeyer (1926): Ernst Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes (Handbuch zum Neuen Testament XVI), Tübingen. Loon (1990): Mauritius N. van Loon, Anatolia in the Earlier First Millennium B. C. (Iconography of Religions XV, 13), Leiden. Loud (1939): Gordon Loud, The Megiddo Ivories (Oriental Institute Publications 52), Chicago. Loveday et al. (1919): Thomas Loveday et al., The Works of Aristotle, Volume VI, Oxford. Lupieri (1999): Edmondo F. Lupieri, A Commentary on the Apocalypse of John, Grand Rapids, Michigan/ Cambridge. Luther (1529): Martin Luther, „Eine Heerpredigt wider den Türcken, 1529“, in: D. Martin Luthers Werke. Weimarer Ausgabe, Bd. 30 II, Weimar, 160–198. Lykosthenes (1557): Konrad Lykosthenes, Prodigiorum ac ostentorum chronicon quae praeter naturae ordinem, motum, et operationem, et in superioribus et his inferioribus mundi regionibus, ab exordio mundi usque ad haec nostra tempora acciderunt, Basel. Madarame, Takai u. Ito (1994): H. Madarame, S. Takai u. N. Ito, „Two-Headed, Two-Necked Conjoined Twin Calf with Arnold-Chiari Malformation in a Japanese Shorthorn Calf“, Anatomia Histologia Embryologia 23, 275–280. Madreiter (2012): Irene Madreiter, Stereotypisierung – Idealisierung – Indifferenz. Formen der Auseinandersetzung mit dem Achämeniden-Reich in der griechischen Persika-Literatur (Classica et Orientalia 4), Wiesbaden. Maier (1982): Gerhard Maier, Der Prophet Daniel (Wuppertaler Studienbibel, Reihe Altes Testament), Wuppertal. Malina (2002): Bruce J. Malina, Die Offenbarung des Johannes. Sternvisionen und Himmelsreisen, Stuttgart. Marshall, J. W. (2001): John W. Marshall, Parables of War: Reading John’s Jewish Apocalypse, Waterloo. Marshall, P. K. (1968): Peter K. Marshall, A. Gellii – Noctes Atticae. Tomus I, Libri I–X, Oxford. Marshall, P. K. (1993): Peter K. Marshall, Hygini – Fabulae, Stuttgart/Leipzig. Martino (1992): Stefano de Martino, Die mantischen Texte (Corpus der hurritischen Sprachdenkmäler), Rom. Marzahn (2003): Joachim Marzahn (Hg.), Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien, Mainz. Maser (1971): Edward A. Maser, Cesare Ripa – Baroque and Rococo Pictorial Imagery. The 1758–60 Hertel Edition of Ripa’s Iconologia with 200 Engraved Illustrations, New York. Maspero (1908): Gaston Maspero, Sarcophages des époques persane et ptolémaïque (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 29301–29306), Kairo. Matthews (1990a): Donald M. Matthews, The Kassite Glyptic of Nippur (Orbis Biblicus et Orientalis 116), Fribourg/Göttingen. Matthews (1990b): Donald M. Matthews, Principles of Composition in Near Eastern Glyptic of the Later Second Millennium B.C. (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 8), Fribourg/Göttingen. Matthews (1997): Donald M. Matthews, The Early Glyptic of Tell Brak. Cylinder Seals of Third Millennium Syria (Orbis Biblicus et Orientalis, Series Archaeologica 15), Fribourg/Göttingen. Maul (2003): Stefan M. Maul, „Omina und Orakel. A. Mesopotamien“, in: Dietz O. Edzard u. Michael P. Streck (Hgg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie X, Berlin/New York, 45–88. Mayfield (2010): Tyler D. Mayfield, Literary Structure and Setting in Ezekiel, Tübingen. Mayor (2000): Adrienne Mayor, „A Time of Giants and Monsters. The Discovery of Huge Bones in Antiquits spawned vivid and imaginative Myths“, Archaeology 53, 58–61.
118
Literaturverzeichnis
Mayor (2001): Adrienne Mayor, The First Fossil Hunters. Palaeontology in Greek and Roman Times, Princeton. Mbosowo (2010): Donald E. Mbosowo, Understanding the Book of Revelation: The Mystery of the Book of Revelation is finally revealed, Washington. McBeath (1999): Alastair McBeath, Tiamat’s Brood: An Investigation into the Dragons of Ancient Mesopotamia, London. McDowell et al. (2003): Brad C. McDowell et al., „Separation of Conjoined Pygopagus Twins“, Plastic and Reconstructive Surgery 111, 1998–2002. Meer (1978): Fritz van der Meer, Apokalypse. Die Visionen des Johannes in der europäischen Kunst, Freiburg/Basel/Wien. Meiser (1974): Artur Meiser, Die Psalmen (Das Alte Testament Deutsch 14/15), Göttingen. Mellaart (1967): James Mellaart, Çatal Hüyük. A Neolithic Town in Anatolia, New York. Merian (1630a): Matthäus Merian, Inconum Biblicarum, Pars III, Straßburg. Merian (1630b): Matthäus Merian, Inconum Biblicarum, Pars IV, Straßburg. Mertens (1971): Alfred Mertens, Das Buch Daniel im Lichte der Texte vom Toten Meer (Stuttgarter Biblische Monographien 12), Stuttgart. Messel (1945): Nils Messel, Ezechielfragen, Oslo. Mestel et al. (1971): Ascher L. Mestel et al., „Ischiopagus tripus conjoined Twins: Case Report of a Successful Separation“, Surgery 69, 75–73. Metzger (1993): Martin Metzger, „Keruben und Palmetten als Dekoration im Jerusalemer Heiligtum und Jahwe, ‚der Nahrung gibt allem Fleisch‘ “, in: Ferdinand Hahn et al. (Hgg.), Zion – Ort der Begegnung. Festschrift für Laurentius Klein zur Vollendung des 65. Lebensjahres (Bonner Biblische Beiträge 90), Frankfurt, 503–529. Meyer (1990): Jan-Waalke Meyer, „Zur Interpretation der Leber- und Lungenmodelle aus Ugarit“, in: Manfried Dietrich u. Oswald Loretz, Mantik in Ugarit. Keilalphabetische Texte der Opferschau – Omensammlungen, Nekromantie (Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas und Mesopotamiens 3), Münster, 241–280. Michel (2004): Simone Michel, Die Magischen Gemmen. Zu Bildern und Zauberformeln auf geschnittenen Steinen der Antike und Neuzeit (Studien aus dem Warburg-Haus 7), Berlin. Michel (2013): Paul Michel, „Einführung“, in: Paul Michel (Hg.), Spinnenfuß und Krötenbauch. Genese und Symbolik von Kompositwesen (Schriften zur Symbolforschung 16), Zürich, 9–52. Migne (1895): Jacques P. Migne, Patrologiae Cursus Completus, Tomus CLXXII: Honorii Augustodenensis – Opera omnia, Paris. Milham (1966): Samuel Milham Jr., „Symmetrical Conjoined Twins: An Analysis of the Birth Records of Twenty-Two Sets“, The Journal of Pediatrics 69, 643–647. Milik (1976): Józef T. Milik, The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, Oxford. Miller (1984): Frank J. Miller, Ovid – Metamorphoses, Vol. II: Books IX–XV, Cambridge, Massachusetts/ London. Min (2015): Yoo Hong Min, Die Grundschrift des Ezechielbuches und ihre Botschaft (Forschungen zum Alten Testament 81), Tübingen. Minorsky (1950): V. Minorsky, Abū-Dulaf Mis’ar ibn Muhalil’s Travels in Iran, ca. 950 AD, Kairo. Moinoddin et al. (2012): Pathan Muqtar Ahmed Moinoddin et al., „Dicephalus tetrapus tetrabrachius tricaudatus ischiopagus: A Conjoined Twin Calf“, Indian Jorunal of Veterinary Pathology 36, 86–87. Möllendorff (2000): Peter von Möllendorff, Auf der Suche nach der Verlogenen Wahrheit. Lukians Wahre Geschichten (Classica Monacensia 21), Tübingen. Mommsen (1895): Theodor Mommsen, C. Iulii Solini – Collectanea Rerum Memorabilium, Berlin. Monfared, Navard u. Sheibani (2013): Ali L. Monfared, Sahar H. Navard u. Mohammad T. Sheibani, „Case Report of a Congenital Defect (Dicephalus) in a Lamb“, Global Veterinaria 10, 90–92. Montebello (1992): Philippe de Montebello, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, Spring/1992, New York. Montgomery (1950): James A. Montgomery, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel, Edinburgh. Moortgat (1940): Anton Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel. Ein Beitrag zu Geschichte der Steinschneidekunst, Berlin.
Literaturverzeichnis
119
Morenz (1959): Siegfried Morenz, „Eine weitere Spur der Weisheit Amenopes in der Bibel“, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 84, 79–80. Morenz (1984): Siegfried Morenz, Gott und Mensch im alten Ägypten, Leipzig. Morris, (2002): Leon Morris, Revelation (The Tyndale New Testament Commentaries), Grand Rapids, Michigan. Mounce (2009): Robert H. Mounce, The Book of Revelation, Grand Rapids. Moyise (1995): Steve Moyise, The Old Testament in the Book of Revelation (Journal for the Study of the New Testament, Suppl. Series 115), Sheffield. Mulder (1998): M. J. Mulder, „“נָמֵ ר, in: Gerhard Johannes Botterweck, Helmer Ringgren u. Heinz-Josef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. IX, Grand Rapids, Michigan, 432– 437. Müller (1978): Karl-Heinz Müller, „Apokalyptik/Apokalypsen III: Die jüdische Apokalyptik. Anfänge und Merkmale“, Theologische Realenzyklopädie 1, 202–251. Muňoz-Osorio, Mejía-Falla u. Navia (2013): L. A. Muňoz-Osorio, P. A. Mejía-Falla u. A. F. Navia, „First Record of a Bicephalic Embryo of Smalltail Shark Carcharhinus porosus“, Journal of Fish Biology 82, 1753–1757. Murray (2012): J. D. Murray, „Why are there no 3-headed Monsters? Mathematical Modeling in Biology“, Notices of the American Mathematical Society 59, 785–795. Nak et al. (2011): Deniz Nak, Rahşan Yilmaz u. Gülnaz Yilmazbaş, „A rare Case of Diprosopus, Tetraophtalmus and Meningoencephalocele in a Lamb“, The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas 17, 333–336. Nelson (2015): Stanley J. Nelson, Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, & Occlusion, o. O. Nestle u. Aland (1995): Eberhard Nestle u. Kurt Aland, Novum Testamentum Graecae post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Barbara et Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger, Stuttgart. Neugebauer u. Parker (1969): Otto Neugebauer u. Richard A. Parker, Egyptian Astronomical Texts, III: Decans, Planets, Constellations and Zodiacs, London. Neumann (1992): Josef N. Neumann, „Die Mißgestalt des Menschen – ihre Deutung im Weltbild von Antike und Frühmittelalter“, Sudhoffs Archiv 76, 214–231. Niehr (2006): Herbert Niehr, „“תַּ נִּין, in: G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren u. Heinz-Josef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament XV, Grand Rapids, Michigan, 726–732. Niehr (2015): Herbert Niehr, „Texte aus Syrien: Mythen und Epen aus Ugarit“, in: Bernd Janowski u. Daniel Schwemer (Hgg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments, Neue Folge 8: Weisheitstexte, Mythen und Epen, Gütersloh, 177–301. Nogalski (2017): James D. Nogalski, The Book of the Twelve and Beyond. Collected Essays of James D. Nogalski, Atlanta. Nordby u. Taylor (1928): J. E. Nordby u. B. L. Taylor, „A Syncephalus Thoracopagus Monster in Swine“, The American Naturalist 62, 34–47. Nordheim (1979): Eckard von Nordheim, „Der große Hymnus des Echnaton und Psalm 104. Gott und Mensch im Ägypten der Amarnazeit und in Israel“, Studien zur Altägyptischen Kultur 7, 227–241. Nougayrol et al.: (1968): Jean Nougayrol, Emmanuel Laroche, Charles Virolleaud u. Claude F. A. Schaeffer, Ugaritica V. Nouveaux textes accadiens, hourrites et ugaritiques des archives et bibliothèques privées d’Ugarit, commentaires des textes historiques (Première Partie) (Mission de Ras Shamra 16), Paris. Nunn (1992): Astrid Nunn, „Die Mehrgesichtigkeit oder die Weisheit“, in: Barthel Hrouda, Stephan Kroll u. Peter Z. Spanos (Hgg.), Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger. Studien und Aufsätze von Kollegen und Freunden, München/Wien, 143–149. Ockinga (1980): Boyo Ockinga, „An Example of Egyptian Royal Phraseology in Psalm 132“, Biblische Notizen 11, 38–42. Oeming u. Vette (2010): Manfred Oeming u. Joachim Vette, Das Buch der Psalmen. Psalm 42–89 (Neuer Stuttgarter Kommentar, Altes Testament 13/2), Stuttgart. Oldfather (1956). Charles H. Oldfather, Diodorus of Sicily, Vol. II: Books II–IV, Cambridge, Massachusetts/London.
120
Literaturverzeichnis
Omobowale et al. (2014): T. O. Omobowale et al., „Craniofacial Duplication (Diprosopus) in a Domestic Lamb (Ovis aries)“, Journal of Veterinary Anatomy 7, 57–61. Oorschot (1995): Jürgen van Oorschot, „Tendenzen der Hiobforschung“, Theologische Rundschau N. F. 60, 351–388. Opificius (1961): Ruth Opificius, Das altbabylonische Terrakottarelief (Untersuchungen zur Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie 2), Berlin. O’Rourke (2002): Paul F. O’Rourke, An Egyptian royal Book of Protection of the Late Period (p. Brooklyn 47.218.49), New York. Orthmann (1975): Winfried Orthmann, Der alte Orient, Berlin. Overduin (2015): Floris Overduin, Nicander of Colophon’s Theriaca (Mnemosyne Supplements 374), Leiden/Boston. Page (1962): Denys L. Page, Poetae Melici Graeci, Oxford. Palmieri et al. (2013): C. Palmieri, P. Selleri, N. di Girolamo, A. Montani u. L. della Salda, „Multiple Congenital Malformations in a Dicephalic Spur-Thighed Tortoise (Testudo graeca ibera)“, Journal of Comparative Pathology 149, 368–371. Pardee (1986): Dennis Pardee, „Ugaritic. The Ugaritic šumma izbu Text“, Archiv für Orientforschung 33, 117–147. Paré (1573): Ambroise Paré, Des monstres tant terrestres que marins avec leurs portraits, Paris. Patenaude u. Shaw (2011): Julie Patenaude u. Garry J. Shaw, A Catalogue of Egyptian Cosmetic Palettes in the Manchester University Museum Collection (Catalogue Egypt Collections Manchester Museum Vol. 1), Manchester 2011. Pease (1920): Arthur S. Pease, M. Tulli Ciceronis – De divinatione, Liber primus, Illinois. Peters (1971): Edward Peters (ed.), The First Crusade. The Chronicle of Fulcher of Chartres and other Source Materials, Philadelphia (Zweite Auflage). Petrarca (1572): Francesco Petrarca, Trostspiegel in Glück und Unglück. De remediis utriusque fortunae, Frankfurt. Piankoff (1964): Alexandre Piankoff, The Litany of Re (Bollingen Series XL,4), New York. Piankoff u. Rambova (1957): Alexandre Piankoff u. Natacha Rambova, Mythological Papyri, Texts (Bollingen Series 40, 3), New York. Pinch (2006): Geraldine Pinch, „The Nicholson Museum Hathor Capital“, in: Karin N. Sowada u. Boyo G. Ockinga (Hgg.), Egyptian Art in the Nicholson Museum, Sydney, Sydney, 197–210. Pinchkuk (2000): Stacey Pinchkuk, „A Difficult Choice in a Different Voice: Multiple Births, Selective Reduction and Abortion“, Duke Journal of Gender Law and Policy 7:29, 29–56. Pittman (1988): Holly Pittman, Ancient Art in Miniature. Near Eastern Seals from the Collection of Martin and Sarah Cherkasky, New York. Plöger (1965): Otto Plöger, Das Buch Daniel (Kommentar zum Alten Testament 18), Gütersloh. Pohlke (2010): Annette Pohlke, Der liber prodigiorum des Iulius Obsequens, o. O. [Online verfügbar unter http://aillyacum.de/Obsequens.html, Zugriff am 22. Juli 2022]. Pohlmann (1992): Karl-Friedrich Pohlmann, Ezechielstudien (Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 202), Berlin. Pohlmann (1996): Karl-Friedrich Pohlmann, Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel), Kapitel 1–19 (Das Alte Testament Deutsch 22, 1), Göttingen. Pohlmann (2001): Karl-Friedrich Pohlmann, Das Buch des Propheten Hesekiel (Ezechiel), Kapitel 20–48 (Das Alte Testament Deutsch 22, 2), Göttingen. Pohlmann (2004): Karl-Friedrich Pohlmann, „Forschungen am Ezechielbuch 1969–2004“, Theologische Rundschau 71, 60–90.164–191.265–309. Pohlmann (2008): Karl-Friedrich Pohlmann, Ezechiel. Der Stand der theologischen Diskussion, Darmstadt. Pomponio (1973): Francesco V. Pomponio, „‘Löwenstab’ e ‘Doppellöwenkeule’. Studio su due simboli del’iconografia Mesopotamica“, Oriens Antiquus 12, 183–208. Porter (1983): Paul A. Porter, Metaphors and Monsters. A Literary-Critical Study of Daniel 7 and 8, Lund. Porteous (1968): Norman M. Porteous, Das Buch Daniel (Das Alte Testament Deutsch 23), Göttingen.
Literaturverzeichnis
121
Preuß u. Berger (2003): Horst D. Preuß u. Klaus Berger, Bibelkunde des Alten und Neuen Testaments 2, Zweiter Teil: Neues Testament (UTB 972), Tübingen/Basel. Pritchard (1954): James B. Pritchard, The Ancient Near East in Pictures relating to the Old Testament, Priceton, New Jersey. Pschyrembel (2014): Willibald Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin/Boston. Quack (2007): Joachim F. Quack, „Rezension zu Dimitri Meeks, Mythes et légendes du Delta d’après le papyrus Brookyln 47.218.84 (Mémoires publiés par les membres de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire 125), Kairo 2006“, Orientalia NS 77, 106–111. Quack (2013): Joachim F. Quack, „Rezension zu Jean-Claude Goyon, Le recueil de prophylaxie contre les agressions des animaux venimeux du Musée de Brooklyn (Papyrus Wilbour 47.218.138) (SSR 5), Wiesbaden 2012“, Welt des Orients 43, 256–272. Quack (2018): Joachim F. Quack, „Egypt as an Astronomical-Astrological Centre between Mesopotamia, Greece, and India“, in: David Brown (Hg.), The Interactions of Ancient Astral Science, Bremen, 69– 123. Quibell (1904): James E. Quibell, Archaic Objects (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 11001–12000 et 14001–14754), Kairo. Quirarte (1981): Jacinto Quirarte, „Tricephalic Units in Olmec, Izapan-Style, and Maye Art“, in: Matthew W. Stirling, Michael d. Coe u. David C. Grove (Hgg.), The Olmec and their Neighbors. Essays in Memory of Matthew W. Stirling, Washington, DC, 289–308. Race (1997): William H. Race, Pindar – Olympian and Pythian Odes, Cambridge, Massachusetts/ London. Rackham (1989): Harris Rackham, Pliny – Natural History II, Libri III–VII, Cambridge, Massachusetts/ London. Rad (1955): Gerhard von Rad, „Hiob 38 und die altägyptische Listenweisheit“, in: Martin Noth u. D. Winton Thomas (Hgg.), Wisdom in Israel and the Ancient Near East presented to Harold Henry Rowley in celebration of his 65th birthday, 24 March 1955 (Vetus Testamentum, Suppl. 3), Leiden, 293–301. Radt (2004): Stefan Radt (Hg.), Strabons Geographika, Bd. III: Buch IX–XIII: Text und Übersetzung, Göttingen. Ramadan (2010): R. O. Ramadan, „A Dicephalic Goat with other Defects“, Journal of Veterinary Medicine Series 43, 337–343. Rathmayr (2000): Reinhard Rathmayr, Zwillinge in der griechisch-römischen Antike (Alltag und Kultur im Altertum 4), Wien. Rebiger (2010): Bill Rebiger, Sefer Shimmush Tehillim (Texts and Studies in Ancient Judaism 137), Tübingen. Reddish (2001): Mitchell G. Reddish, Revelation (Smyth and Helwys Bible Commentary), Macon, Georgia. Redditt (1999): Paul L. Redditt, Daniel (New Century Bible Commentary), Sheffield. Reinhold (2008): Gotthard G. G. Reinhold, „Die Zahl Sieben und der biblische Text“, in: Gotthard G. G. Reinhold (Hg.), Die Zahl Sieben im Alten Orient, Frankfurt et al., 145–151. Reisner (1907): George A. Reisner, Amulets (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 5218–6000 et 12001–12527), Kairo. Reisner (1958): George A. Reisner, Amulets II (Catalogue Général des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire, Nos. 12528–13595), Kairo. Renz (2002): Thomas Renz, The Rhetorical Function of the Book of Ezekiel, Boston/Leiden. Reynolds (1999): Frances Reynolds, „Stellar Representations of Tiāmat and Qingu in a Learned Calendar Text“, in: Karel van Lerberghe u. Gabriela Voet (Hgg.), Languages and Cultures in Contact: At the Crossroads of Civilizations in the Syro-Mesopotamian Realm, Leuven, 369–378. Richter, G. M. (1956): Gisela M. A. Richter, Catalogue of Engraved Gems: Greek, Etruscan, and Roman, The Metropolitan Museum of Art, New York/Rom. Richter, H.-F. (2007): Hans-Friedrich Richter, Daniel 2–7. Ein Apparat zum aramäischen Text (unter Berücksichtigung der Septuaginta, Theodotions, der Vulgata und der Peschitta) (Semitica et Semitohamitica Beroliensia 8), Aachen.
122
Literaturverzeichnis
Riede (2010a): Peter Riede, „Adler“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibel wissenschaft.de/stichwort/12504, Zugriff am 22. Juli 2022]. Riede (2010b): Peter Riede, „Löwe“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibel wissenschaft.de/stichwort/25081, Zugriff am 22. Juli 2022]. Riede (2011): Peter Riede, „Keruben/Kerubenthroner“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/15921, Zugriff am 22. Juli 2022]. Riemschneider (1970): Kaspar K. Riemschneider, Babylonische Geburtsomina in hethitischer Sprache (Studien zu den Boğazköy-Texten 9), Wiesbaden. Ripa (1593): Cesare Ripa, Iconologia Overo Descrittione di diverse Imagini cauate dall’antichità, et di propria inventione, Rom. Ritt (1986): Hubert Ritt, Offenbarung des Johannes, Würzburg. Ritt (2009): Hubert Ritt, „Offenbarung des Johannes“, in: Lexikon für Theologie und Kirche3, Sp. 995– 998. Roaf (1992): Michael Roaf, Weltatlas der alten Kulturen – Mesopotamien, München. Rochholz (2002): Matthias Rochholz, Schöpfung, Feindvernichtung, Regeneration. Untersuchung zum Symbolgehalt der machtgeladenen Zahl 7 im alten Ägypten (Ägypten und Altes Testament 56), Wiesbaden. Rodríguez-Morales, Correa-Rivas u. Colón-Castillo (2002): Edda L. Rodríguez-Morales, María S. Correa-Rivas u. Lillian E. Colón-Castillo, „Monocephalus Diprosopus, a Rare Form of Conjoined Twins, and Associated Congenital Anomalies“, Puerto Rico Health Sciences Journal 21, 237–240. Rolfe (1956): John C. Rolfe, Ammianus Marcellinus, Vol. I, London/Cambridge, Massachusetts. Rollefson, Simmons u. Kafafi (1992): Gary O. Rollefson, Alan H. Simmons u. Zeidan Kafafi, „Neolithic Cultures at ’Ain Ghazal, Jordan“, Journal of Field Archaeology 19, 443–470. Roloff (2001): Jürgen Roloff, Die Offenbarung des Johannes (Zürcher Bibelkommentare: Neues Testament 18), Zürich. Roloff (2002): Jürgen Roloff, Die Adaption der Tiervision (Daniel 7) in frühjüdischer und frühchristlicher Apokalyptik (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse, 2002/2), München. Roscher (1886–1890): Wilhelm H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 7 Bde., Leipzig. Rosenthal (1916): Richard Rosenthal, Ueber einen Fall von Dicephalus dibrachius monauchenos tetrophthalmus diötus mit bemerkenswerten inneren Missbildungen, München. Ross (1967): Anne Ross, „A Celtic three-faced Head from Wiltshire“, Antiquity 41, 53–56. Rudnig (2000): Thilo A. Rudnig, Heilig und Profan. Redaktionskritische Studien zu Ez 40–48 (Beihefte zur Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft 287), Berlin/New York. Ruelle (1889): Charles Ruelle, Damascii Successoris dubitationes et solutiones de primis principiis in Platonis Parmenidem, 2 Bde., Paris. Rühe (1894): Ernst L. F. Rühe, Anatomische Beschreibung eines menschlichen Janiceps asymmetros, nebst Versuch einer genetischen Erklärung, Leipzig. Ruidisch (1869): Ludwig Ruidisch, Die Geburten zusammengewachsener oder ineinander verschmolzener Zwillinge, München. Saint-Hilaire (1837): Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et les animaux III: Des monstruosités, des varietés et de conformation ou Traité de Tératologie, Paris. Salje (2004): Beate Salje, „Die Statuen aus cAin Ghazal – Begegnung mit Figuren aus einer vergangenen Welt“, in: Beate Salje, Nadine Riedl u. Günther Schauerte (Hgg.), Gesichter des Orients. 10000 Jahre Kunst und Kultur aus Jordanien, Mainz, 29–36. Sallaberger (1999): Walther Sallaberger, „Ur III-Zeit“, in: Walther Sallaberger u. Aage Westenholz (Hgg.), Mesopotamien. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit (Orbis Biblicus et Orientalis 160, 3), Fribourg, 119–390. Sandrat auf Stockau (1680): Joachim von Sandrat auf Stockau, Iconologia Deorum. Oder Abbildung der Götter, welche von den Alten verehret wurden, Nürnberg.
Literaturverzeichnis
123
Santos u. Gadig (2014): Camila M. H. dos Santos u. Otto B. F. Gadig, „Abnormal Embryos of Sharpnose Sharks, Rhizoprionodon Porosus and Rhizoprionodon lalandii (Elasmobranchii: Carcharhinidae), from Brazialian Coast, Western South Atlantic“, Marine Biodiversity Records 7, 1–6. Sauneron (1963): Serge Sauneron, Le temple d’Esna II, Nos. 1–193 (Publications de l’Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire), Kairo. Sauneron (1970): Serge Sauneron, Le papyrus magique illustré de Brooklyn [Brooklyn Museum 47.218.156], Brooklyn, New York. Scheftelowitz u. Oren (2004): Na’ama Scheftelowitz u. Ronit Oren, Givcat Ha-Oranim. A Chalcolithic Site (Salvage Excavation Reports 1), Tel Aviv. Schellenberg (2007): Annette Schellenberg, „Hiob und Ipuwer. Zum Vergleich des alttestamentlichen Hiobbuchs mit ägyptischen Texten im Allgemeinen und den Admonitions im Besonderen“, in: Thomas Krüger et al. (Hgg.), Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.–19. August 2005 (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 88), Zürich, 55–79. Schenker (2004): Adrian Schenker, Ältere Textgeschichte der Königsbücher. Die hebräische Vorlage der ursprünglichen Septuaginta als älteste Textform der Königsbücher (Orbis Biblicus et Orientalis 199), Göttingen. Schipper (2007): Bernd U. Schipper, „Endzeitszenarien im Alten Orient. Die Anfänge apokalyptischen Denkens“, in: Bernd U. Schipper u. Georg Plasger (Hgg.), Apokalyptik und kein Ende? (Biblischtheologische Schwerpunkte 29), Göttingen, 11–30. Schirnding (2012): Albert von Schirnding, Hesiod – Theogonie. Werke und Tage, Berlin. Schmid (2007): Konrad Schmid, Hintere Propheten (Nebiim), in: Jan C. Gertz (Hg.), Grundinformation Altes Testament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Alten Testaments (UTB 2745), Göttingen, 303–403 (Zweite Auflage). Schmidt, B. B. (1994): Brian B. Schmidt, Israel’s Beneficent Dead. Ancestor Cult and Necromancy in Ancient Israelite Religion and Tradition (Forschungen zum Alten Testament 11), Tübingen. Schmidt, B. B. (2002): Brian B. Schmidt, „The ‘Witch’ of En-Dor, 1 Samuel 28, and Ancient Near Eastern Necromancy“, in: Paul Mirecki u. Marvin Meyer (Hgg.), Magic and Ritual in the Ancient World (Religions in the Graeco-Roman World 141), Leiden/Boston/Köln, 111–129. Schmidt, C. (1905): Carl Schmidt, Koptisch-gnostische Schriften I: Die Pistis Sophia. Die beiden Bücher des Jeû. Unbekanntes altgnostisches Werk, Leipzig. Schmidt, C. (1925): Carl Schmidt, Pistis Sophia. Neu herausgegeben mit Einleitung nebst griechischem und koptischem Wort- und Namenregister, Hauniae. Schmidt, H. (1934): Hans Schmidt, Die Psalmen (Handbuch zum Alten Testament 16), Tübingen. Schmitt (2004): Rüdiger Schmitt, Magie im Alten Testament (Alter Orient und Altes Testament 313), Münster. Schneider, H. (1954): Heinrich Schneider, Das Buch Daniel. Das Buch der Klagelieder. Das Buch Baruch (Herders Bibelkommentar 9, 2), Freiburg. Schneider, T. (1991): Thomas Schneider, „Hiob 38 und die demotische Weisheit (Papyrus Insinger 24)“, Theologische Zeitschrift 47, 108–124. Schnelle (2002): Udo Schnelle, Einleitung in das Neue Testament (UTB 1830), Göttingen. Schöpflin (2002): Karin Schöpflin, Theologie als Biographie im Ezechielbuch. Ein Beitrag zur Konzeption alttestamentlicher Prophetie (Forschungen zum Alten Testament 36), Tübingen. Schroer (1987): Silvia Schroer, In Israel gab es Bilder (Orbis Biblicus et Orientalis 74), Fribourg/Göttingen. Schroer (2008): Silvia Schroer, Die Ikonographie Palästinas / Israels und der Alte Orient. Eine Religiongsgeschichte in Bildern, Band 2: Die Mittelbronzezeit, Fribourg. Schroer (2011): Silvia Schroer, Die Ikonographie Palästinas / Israels und der Alte Orient. Eine Religiongsgeschichte in Bildern, Band 3: Die Spätbronzezeit, Fribourg. Schroer u. Keel (2005): Silvia Schroer u. Othmar Keel, Die Ikonographie Palästinas / Israels und der Alte Orient. Eine Religionsgeschichte in Bildern, Band 1: Vom ausgehenden Mesolithikum bis zur Frühbronzezeit, Fribourg. Schüssler Fiorenza (1976/77): Elisabeth Schüssler Fiorenza, „The Quest for the Johannine School. The Apocalypse and the Fourth Gospel“, New Testament Studies 23, 402–427.
124
Literaturverzeichnis
Schwemer (2006): Daniel Schwemer, „Teššub“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www. bibelwissenschaft.de/de/stichwort/33278/, Zugriff am 22. Juli 2022]. Schwink (1884): Friedrich Schwink, Die zwei Gehirne in einem Januskopf. Ein Beitrag zur Anatomie der Missbildungen, München. Scott (1949): Ernest F. Scott, The Book of Revelation, London. Seba (1743): Albertus Seba, Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, et iconibus artificiosissimis expressio, per universam physices historiam: opus, cui, in hoc rerum genere, nullum par exstitit/ex toto terrarum orbe collegit, digessit, descripsit, et depingendum, Amsterdam. Sedlmeier (2020): Franz Sedlmeier, „‚Ich will euch gnädig annehmen …‘ (Ez 20, 41) – Ez 20,39.40–44 im Horizont des Ezechielbuches“, in: Jan C. Gertz, Corinna Körting u. Markus Witte (Hgg.), Das Buch Ezechiel. Komposition, Redaktion und Rezeption, Berlin/Boston, 125–150. Sedlmeier (2013): Franz Sedlmeier, Das Buch Ezechiel, Teil 2: Kapitel 25–48 (Neuer Stuttgarter Kommentar; Altes Testament 21, 2), Stuttgart. Seeber (1976): Christine Seeber, Untersuchungen zur Darstellung des Totengerichtes im Alten Ägypten (Münchner Ägyptologische Studien 35), München/Berlin. Seidl (1989): Ursula Seidl, Die babylonischen Kudurru-Reliefs. Symbole mesopotamischer Gottheiten (Orbis Biblicus et Orientalis 87), Fribourg/Göttingen. Settgast (1978): Jürgen Settgast (Hg.), Von Troja bis Amarna. The Norbert Schimmel Collection, New York, Mainz. Seybold (1996): Klaus Seybold, Die Psalmen (Handbuch zum Alten Testament 1, 15), Tübingen. Seyfarth (1978): Wolfgang Seyfarth, Ammiani Marcellini Rerum Gestarum Libri Qui Supersunt, Vol. I: Libri XIV–XXV (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Leipzig. Shantur u. Labadi (1971): Bakizah Shantur u. Y. Labadi, „Tomb 204 at cAin-Samiya“, Israel Exploration Journal 21, 73–77. Sharma, Sharma u. Vasishta (2010): Amit Sharma, Subbash Sharma u. N. K. Vasishta, „A Diprosopus Buffalo Neonate: A Case Report“, Buffalo Bulletin 29, 72–74. Shojaei et al. (2006): Bahador Shojaei, Amir Derakhshanfar, Mohammad Mehdi Oloumi u. Shadi Hashemnia, „Diprosopus, Spina bifida and Kyphoscoliosis in a Lamb – A Case Report“, Veterinarski Arhiv 76, 461–469. Sickenberger (1942): Joseph Sickenberger, Erklärung der Johannesapokalypse, Bonn. Simpson (1987): William Kelly Simpson, A Table of Offerings. 17 Years of Acquisitions of Egyptian and Ancient Near Eastern Art, Boston, Massachusetts. Singh et al. (2011): Gyan Singh et al., „A Case of rare Monstrosity in a Cow Calf“, Haryana Vet. 50, 101–102. Singh, Singh u. Shaligram (2003): Mandavi Singh, K. P. Singh u. Pragya Shaligram, „Conjoined Twins Cephalopagus Janiceps Monosymmetros: A Case Report“, Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology 67, 268–272. Sitzinsky (1899): A. A. Sitzinsky, „Janiceps symmetros“, Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie 10, 35–51. Smith u. Pitard (2009): Mark S. Smith u. Wayne T. Pitard, The Ugaritic Baal Cycle, Volume II: Introduction with Text, Translation and Commentary of KTU /CAT 1.3–1.4 (Vetus Testamentum, Suppl. 114), Leiden/Boston. Solmsen, Merkelbach u. West (1990): Friedrich Solmsen, Reinhold Merkelbach u. Martin L. West (Hgg.), Hesiodi Theogonia Opera et Dies Scutum, Fragmenta Selecta, Oxford (Dritte Auflage). Sommerstein (2008): Alan H. Sommerstein, Aeschylus – Persians, Seven against Thebes, Suppliants, Prometheus Unbound, Cambridge, Massachusetts/London. Sotheby’s (1976): Fine Egyptian, Western Asiatic, and Classical Antiquities; Public auction: Saturday, December 11th, 1976, New York. Sotheby’s (1978): Fine Egyptian, Classical, Western Asiatic and Islamic Antiquities. Property of various Owners including The Estate of Dr. Grete L. Bibring, Cambridge; The Estate of Greta S. Heckett, Pittsburgh; The Estate of Fahim Kouchakji, New York. Auction Friday, February 17, 1978 at 10:15 a.m. and 2 p.m., New York.
Literaturverzeichnis
125
Sotheby’s (1980): Important Egyptian, Classical, and Western Asiatic Antiquities, Property of Various Owners: Dr. and Mrs. Herbert Hidde, Massachusetts; The Estate of Nelson A. Rockefeller; Lady Annabel Sutherland; The Estate of Gretchen Hoyt Corbett, Oregon; William Meyer, New York; Elizabeth and Marie Khayat; The Estate of Michel Abemayor; The Estate of Bess J. Cohen, New York; The Estate of Susette Khayat; Auction New York, Friday, May 16, 1980, New York. Sotheby’s (1989): Egyptian, Greek, Etruscan, Roman and Western Asiatic Antiquities and Islamic Works of Art; Auction Friday, June 23, 1989 at 10:15 am and 2 pm, New York. Sotheby’s (1990): Egyptian, Greek, Etruscan, Roman and Western Asiatic Antiquities and Islamic Works of Art; Auction Wednesday, June 20, 1990 at 2 pm, New York. Sotheby’s (2011): Egyptian, Classical & Western Asiatic Antiquities including the Collection of Sideo Fromboluti and Nora Speyer; Auction in New York, Wednesday 8 June 2011, 2:00 pm, New York. Sotheby’s (2014): Egyptian, Classical and Western Asiatic Antiquities. Auction in New York, 12th December 2014, 2:00 pm, New York. Spencer (2003): Rowena Spencer, Conjoined Twins: Developmental Malformations and Clinical Implications, Baltimore, Maryland. Spencer u. Robichaux (1998): Rowena Spencer u. William H. Robichaux, „Prosopo-Thoracopagus conjoined Twins and other Cephalopagus-Thoracopagus intermediates: Case Report and Review of the Literature“, Pediatric and Developmental Pathology 1, 164–171. Srinivasan (1997): Doris Srinivasan, Many Heads, Arms and Eyes. Origin, Meaning and Form of Multiplicity in Indian Art (Studies in Asian Art and Archaeology 20), Leiden/New York/Köln. Stamm (1939): Johann J. Stamm, Die akkadische Namengebung (Mitteilungen der VorderasiatischAegyptischen Gesellschaft 44), Leipzig. Stauffer (1952): Ethelbert Stauffer, Christus und die Caesaren. Historische Skizzen, Hamburg. Stein (1988): Diana L. Stein, „Mythologische Inhalte der Nuzi-Glyptik“, in: Volkert Haas (Hg.), Hurriter und Hurritisch (Xenia. Konstanzer Althistorische Vorträge und Forschungen 21), Konstanz, 173– 209. Stephens (1928): Ferris J. Stephens, Personal Names from Cuneiform Inscriptions of Cappadocia (Yale Oriental Series XIII, 1), New Haven/London. Stiehler-Alegria Delgado (1996): Gisela Stiehler-Alegria Delgado, Die Kassitische Glyptik (Münchener Universitäts-Schriften 12), München/Wien. Stol (1993): Marten Stol, Epilepsy in Babylonia (Cuneiform Monographs 2), Groningen. Stol (2000): Marten Stol, Birth in Babylonia and the Bible. Its Mediterranean Setting. With a Chapter by Frans A. M. Wiggermann (Cuneiform Monographs 14), Groningen. Stramaglia (2011): A. Stramaglia, Phlegon Trallianus: Opuscula De rebus mirabilibus et De longaevis (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneria), Berlin. Strawn (2005): Brent A. Strawn, What is Stronger than a Lion? Leonine Image and Metaphor n the Hebrew Bible and the Ancient Near East (Orbis Biblicus et Orientalis 212), Fribourg/Göttingen. Streit (2017): Katharina Streit, „Transregional Interactions between Egypt and the Southern Levant in the 6th Millennium calBC“, Ägypten und Levante 27, 403–429. Susmilch (1982): Cynthia Susmilch, A Guide to The Oriental Institute Museum, Chicago. Taracha (1987): Piotr Taracha, „Göttertiere und Kultfassaden. Ein Beitrag zur Interpretation hethitischer Kultdarstellungen“, Altorientalische Forschungen 14, 263–273. Tassie (2014): Geoffrey J. Tassie, Prehistoric Egypt. Socioeconomic Transformations in North-east Africa from the Last Glacial Maximum to the Neolithic, 24.000 to 6.000 cal BP, London. Tate (1990): Marvin E. Tate, Psalms 51–100 (World Biblical Commentary), Dallas, Texas. Teissier (1987): Beatrice Teissier, „Glyptic Evidence for a Connection between Iran, Syrio-Palestine and Egypt in the Fourth and Third Millennia“, Iran 25, 27–53. Theis (2014): Christoffer Theis, Magie und Raum. Der magische Schutz ausgewählter Räume im alten Ägypten nebst einem Vergleich zu angrenzenden Kulturbereichen (Orientalische Religionen in der Antike 13), Tübingen. Theis (2017): Christoffer Theis, „Schminkpaletten mit zwei Köpfen – Reale Vorbilder aus der Natur?“, Göttinger Miszellen 253, 131–136. Theis (2019): Christoffer Theis, „Die siebenköpfige Schlange im Vorderen Orient“, in: Marc Brose et al. (Hgg.), En détail – Philologie und Archäologie im Diskurs. Festschrift für Hans-Werner Fischer-
126
Literaturverzeichnis
Elfert (Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde – Beihefte 7), Berlin/Boston, 1123– 1136. Theis (2020): Christoffer Theis, „Creatures with Seven Heads in the Revelation of John. A History of the Motif in the Ancient Near East“, in: Catharina Baumgartner et al. (Hgg.), Ideologie und Organisation. Komparative Untersuchungen antiker Gesellschaften (Distant Worlds Journal 5), München, 38–58. Theis (2021): Christoffer Theis, „Beiträge zum Wortschatz des Alten Testaments: Liwyatan ( )לִ וְ יַתַ ןund Nəhūštān (“)נְ ח ְֻשׁתָּ ן, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 148 (2021), 239–242. Theis (2022a): Christoffer Theis, „Mehrköpfige Wesen in Ugarit in ihrem altorientalischen Kontext“, in: Reinhard Müller, Hans Neumann u. Reettakaisa Sofia Salo (Hgg.), Rituale und Magie in Ugarit. Praxis, Kontexte und Bedeutung (Orientalische Religionen in der Antike 47), Tübingen 2022, 292– 310. Theis (2022b): Christoffer Theis, „Der Stier als apotropäisches Symbol im Alten Orient“, in: Aglaia Bianchi (Hg.), Beiträge der Jungen Akademie | Mainz 2021 (Schriftenreihe der Jungen Akademie der Wissenschaften und der Literatur | Mainz 7), Mainz, 25–58. Theis (2023): Christoffer Theis, „Of Comprehensible and Incomprehensible Inscriptions. Remarks on some Gems with Multi-headed Gods“, in: Christoffer Theis u. Paolo Vitellozzi (Hgg.), Textual Amulets from Antiquity to Early Modern Times. The Shape of Words, London/New York/Dublin, 34–55; 146–151; 176–181. Theis (in Vorbereitung): Christoffer Theis, Der polymorphe Bes – Untersuchungen zu Entwicklung, Devianz und Tradition eines mehrköpfigen göttlichen Konstrukts im alten Ägypten. Theis u. Wilhelmi (2015): Christoffer Theis u. Lisa Wilhelmi, „Tradieren“, in: Thomas Meier, Michael R. Ott u. Rebecca Sauer (Hgg.), Materiale Textkulturen. Konzepte – Materialien – Praktiken (Materiale Textkulturen 1), Berlin/München/Boston, 709–721. Thiele (1983): Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Grand Rapids (Dritte Auflage). Thilo (1832): Johann Carl Thilo, Codex Apocryphus Novi Testamenti, Leipzig. Thissen (2001): Heinz J. Thissen, Des Niloten Horapollon Hieroglyphenbuch, Band 1: Text und Übersetzung (Archiv für Papyrusforschung – Beihefte 6), Leipzig. Thomas (1995): Robert L. Thomas, Revelation 8–22. An Exegetical Commentary, Chicago. Thommen (2003): Lukas Thommen, Sparta. Verfassungs- und Sozialgeschichte einer griechischen Polis, Stuttgart/Weimar. Thuringer (1919): Joseph M. Thuringer, „The Anatomy of a Dicephalic Pig, Monosomus Diprospopus“, The Anatomical Record 15, 358–367. Tiedemann (1813): Friedrich Tiedemann, Anatomie der kopflosen Missgeburten, Landshut. Tobler (1950): Arthur J. Tobler, Excavations at Tepe Gawra II, Levels IX–XX, Philadelphia. Töpfer (2014): Susanne Töpfer, „Heter. Ein thebanischer Priester mit drei Funerärtexten und einem Sarg“, in: Verena M. Lepper (Hg.), Persönlichkeiten aus dem Alten Ägypten im Neuen Museum, Petersberg, 155–168. Torrey (1958): Charles C. Torrey, The Apocalypse of John, New Haven. Touchefeu-Meynier (1997): Odette Touchefeu-Meynier, „Typhon“, in: Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae VIII, Zürich/München, 147–152. Tubb (1985): Kathryn W. Tubb, „Preliminary Report on the ‘Ain Ghazal Statues“, Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 117, 117–134. Troescher (1955): Georg Troescher, „Dreikopfgottheit (und Dreigesicht)“, in: Reallexikon der Deutschen Kunstgeschichte IV, München, Sp. 501–512. Tvedtness (1982): John A. Tvedtness, „Egyptian Etymologies for Biblical Cultic Paraphernalia“, in: Sarah I. Groll (Hg.), Egyptological Studies, Jerusalem, 215–221. Uchelen (1986): N. A. van Uchelen, Psalmen, deel II (41–80), Nijkerk. Uehlinger (1995): Christoph Uehlinger, „Drachen und Drachenkämpfe im alten Vorderen Orient und in der Bibel“, in: Bernd Schmelz u. Rüdiger Vossen (Hgg.), Auf Drachenspuren. Ein Buch zum Drachenprojekt des Hamburgischen Museums für Völkerkunde, Bonn, 55–101. Uehlinger (1999): Christoph Uehlinger, „Leviathan“, in: Bob Becking u. Pieter W. van der Horst (Hgg.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden/Boston/Köln, 510–515 (Zweite Auflage).
Literaturverzeichnis
127
Uehlinger (2007): Christoph Uehlinger, „Das Hiob-Buch im Kontext der altorientalischen Literatur- und Religionsgeschichte“, in: Thomas Krüger et al. (Hgg.), Das Buch Hiob und seine Interpretationen. Beträge zum Hiob-Symposium auf dem Monte Verità vom 14.–19. August 2005 (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 88), Zürich, 97–163. Ungnad (1929): Athur Ungnad, „Der babylonische Janus“, Archiv für Orientforschung 5, 185. Ünver, Kilinç u. Özyurtlu (2007): Özkan Ünver, Mehmet Kilinç u. Özyurtlu, „Cranial Duplication (Dicephalus) in a Lamb“, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 31, 415–417. Usener (1903): Hermann Usener, „Dreiheit“, Rhein. Museum 58, 1–47, 167–208, 321–362. Van der Veen (2015): Peter van der Veen, „A Double-Headed Bull Protome – Does it represent the Aramaean Moon God?“, in: Claire Gottlieb, Chaim Cohen u. Mayer Gruber (Hgg.), Visions of Life. Essays in Honor of Meir Lubetski, Sheffield, 235–248. Venit (2016): Marjorie S. Venit, Visualizing the Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt, Cambridge. Verbrugghe u. Wickersham (1996): Gerald P. Verbrugghe u. John M. Wickersham, Berossos and Manetho. Introduced and Translated, Ann Arbor, Michigan. Vestergaard (1972): Per Vestergaard, „Triplets Pregnancy with a normal Foetus and a Dicephalus Dibrachius Sirenomelus“, Acta Obstetricia et Gynecologia Scandinavica 51, 93–94. Virchow (1870): Rudolf Virchow, Die Siamesischen Zwillinge. Vortrag gehalten vor der medicinischen Gesellschaft am 14. März 1870, Berlin. Vogt (1979): Ernst Vogt, „Die vier ‘Gesichter’ (pānīm) der Keruben in Ez“, Biblica 60, 327–347. Vogt (1981): Ernst Vogt, Untersuchungen zum Buch Ezechiel (Analecta Biblica 95), Rom. Wacks (2021): Mel Wacks, The Handbook of Biblical Numismatics, Woodland Hills, California. Wagner, Rice u. Pease (2013): C. M. Wagner, P. H. Rice u. A. P. Pease, „First Record of dicephalia in a bull shark Carcharhinus leucas (Chondrichthyes: Carcharhiniae) foetus from the Gulf of Mexico, U.S.A.“, Journal of Fish Biology 82, 1419–1422. Wälchli (2012): Stefan H. Wälchli, Gottes Zorn in den Psalmen. Eine Studie zur Rede vom Zorn Gottes in den Psalmen im Kontext des Alten Testamentes und des Alten Orients (Orbis Biblicus et Orientalis 244), Fribourg/Göttingen. Waldstein (2001): Michael Waldstein, „Das Apokryphon des Johannes (NHC II, 1; III, 1; IV, 1 und BG 2“, in: Hans-Martin Schenke, Hans-Gebhard Bethge u. Ursula U. Kaiser (Hgg.), Nag Hammadi Deutsch, 1. Band: NHC I,1–V,1 (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, NF 8), Berlin/New York, 95–150. Waldstein u. Wisse (1995): Michael Waldstein u. Frederik Wisse, The Apocryphon of John. Synopsis of Nag Hammadi Codices II,1; III,1; and IV,1 with BG 8502,2 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 33), Leiden/New York/Köln. Wallach (2012): Van Wallach, „Two-Headed Snakes Make High Maintenance Pets“, Bulletin of the Chicago Herpetological Society 47, 137–139. Wallmann (2010): Johannes Wallmann, Pietismus und Orthodoxie. Gesammelte Aufsätze III, Tübingen. Walton (2001): John H. Walton, „The Anzu Myth as relevant Background for Daniel 7?“, in: John J. Collins u. Peter W. Flint (Hgg.), The Book of Daniel. Composition and Reception (Vetus Testamentum, Suppl. 83, 1), Leiden/Boston/Köln, 69–89. Ward (1910): William H. Ward, The Seal Cylinders of Western Asia (Publications of the Carnegie Institution of Washington 100), Washington, D. C. Wartke (1998): Ralf-Bernhard Wartke, Urartu. Das Reich am Ararat (Kulturgeschichte der antiken Welt 59), Mainz. Watt (1988): William M. Watt, Muḥammad at Mecca (The History of al-Tabari VI), Albany. Weber (1920): Otto Weber, Altorientalische Siegelbilder, Leipzig. Weidner (1922): Ernst Weidner, „Vokabular-Studien“, American Journal of Semitic Languages and Literatures 38, 153–213. Weil (1841): Gustav Weil, Tausend und eine Nacht. Arabische Erzählungen zum ersten Male aus dem Urtext treu übersetzt, Band IV, Pforzheim. Weinstein (1975): James M. Weinstein, „Egyptian Relations with Palestine in the Middle Kingdom“, Bulletin of the American Schools of Oriental Research 217, 1–16.
128
Literaturverzeichnis
Weippert (1961): Manfred Weippert, „Gott und Stier“, Zeitschrift des Deutschen Palästinavereins 77, 93–117. Weippert (1997): Manfred Weippert, Jahwe und die anderen Götter. Studien zur Religionsgeschichte des antiken Israel in ihrem syrisch-palästinischen Kontext (Forschungen zum Alten Testament 18), Tübingen. Wellesley (1986): Kenneth Wellesley, Cornelii Taciti Libri qui supersunt, Tomus I, Pars Secundus: Ab excessu divi Augusti, Libri XI–XVI, Leipzig. Wellhausen (1907): Julius Wellhausen, Analyse der Offenbarung Johannis, Berlin. Welvaert (2002): Eric Welvaert, „The Fossils of Qau el Kebir and their Role in Mythology of the 10th Nome of Upper-Egypt“, Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 129, 166–183. Wengrow (2014). David Wengrow, The Origins of Monsters. Image and Cognition in the First Age of Mechanical Reproduction, Princeton, New Jersey. Wenig (1978): Steffen Wenig, Africa in Antiquity II. The Arts of Ancient Nubia and the Sudan, the Catalogue, Brooklyn, New York. Wheeler (1924): A. L. Wheeler, Ovid – Tristia. Ex Ponto, Cambridge, Massachusetts/London. Wiggermann (1992): Frans A. M. Wiggermann, Mesopotamian Protective Spirits. The Ritual Texts (CM 1), Groningen. Wiggermann (1997a): Frans A. M. Wiggermann, „Mischwesen A“, in: Dietz Otto Edzard (Hg.), Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie VII, Berlin, 222–245. Wiggermann (1997b): Frans A. M. Wiggermann, „Transtigridian Snake Gods“, in: Irving L. Finkel u. Mark J. Geller (Hgg.), Sumerian Gods and their Representations (Cuneiform Monographs 7), Groningen, 33–55. Wikenhauser (1959): Alfred Wikenhauser, Die Offenbarung des Johannes übersetzt und erklärt (Regensburger Neues Testament 9), Regensburg. Wilson (1993): J. C. Wilson, „The Problem of the Domitianic Date of Revelation“, New Testament Studies 39, 587–605. Wilson-Wright u. Huehnergard (2021): Aren Wilson-Wright u. John Huehnergard, „How to Kill a Dragon in Northwest Semitic: Three Linguistic Observations regarding Ugaritic ltn and Hebrew liwyātān“, Vetus Testamentum 72, 151–162. Wiseman (1953): Donald J. Wiseman, The Alalakh Tablets (Occasional Publications of the British Institute of Archaeology at Ankara 2), London. Wit (1957): Constant de Wit, „Les génies des quatre vents au temple d’Opet“, Chronique d’Égypte 32, 25–39. Witte (1994): Markus Witte, Vom Leiden zur Lehre. Der dritte Redegang (Hiob 21 – 27) und die Redaktionsgeschichte des Hiobbuches (Beihefte zur Zeitschrift für die Altestamentliche Wissenschaft 230), Berlin/New York. Witulski (2007a): Thomas Witulski, Die Johannesoffenbarung und Kaiser Hadrian. Studien zur Datierung der neutestamentlichen Apokalypse (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 221), Göttingen. Witulski (2007b): Thomas Witulski, Kaiserkult in Kleinasien. Die Entwicklung der kultisch-religiösen Kaiserverehrung in der römischen Provinz Asia. Von Augustus bis Antoninus Pius (Novum Testamentum et Orbis antiquus – Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 63), Göttingen. Wright (1994): Cynthia Wright, „The were Five. The Dionne Quintuplets Revisited“, Journal of Canadian Studes 29, 5–14. Wu et al. (2002): June Wu, David A. Staffenberg, John B. Mulliken u. Alan L. Shanske, „Diprosopus: A Unique Case and Review of the Literature“, Teratology 66, 282–287. Wunderlich (1999): Werner Wunderlich, „Dämonen, Monster, Fabelwesen. Eine kleine Einführung in Mythen und Typen phantastischer Geschöpfe“, in: Ulrich Müller u. Werner Wunderlich (Hgg.), Dämonen – Monster – Fabelwesen (Mittelalter Mythen 2), St. Gallen, 11–38. Xella (1981): Paolo Xella, I Testi Rituali di Ugarit-I (Pubblicazioni del Centro di Studio per la Civiltà Fenicia e Punica 21), Rom. Yadin (1970): Yigael Yadin, „Symbols of Deities at Zinjirli, Carthage and Hazor“, in: James A. Sanders (Hg.), Near Eastern Archaeology in the 20th Century. Essays in Honor of Nelson Glueck, New York, 199–231.
Literaturverzeichnis
129
Yadin (1971): Yigael Yadin, „A Note on the Scenes Depicted on the cAin-Samiya Cup“, Israel Exploration Journal 21, 82–85. Yarbro Collins (1981): Adela Yarbro Collins, „Myth and History in the Book of Revelation: The Problem of its Date“, in: Baruch Halpern (Hg.), Traditions and Transformations: Turning Points in Biblical Faith, Winona Lake, 377–403. Yarbro Collins (2001): Adela Yarbro Collins, The Combat Myth in the Book of Revelation, Eugene, Or. Yasuoka (2016): Yoshifumi Yasuoka, Untersuchungen zu den Altägyptischen Säulen als Spiegel der Architekturphilosophie der Ägypter (Quellen und Interpretationen – Altägypten 2), Hützel. Young et al. (2000): D. L. Young, R. A. Schneider, D. Hu u. J. A. Helms, „Genetic and Teratogenic Approaches to Craniofacial Development“, Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 11, 3, 304– 317. Zager (2005): Werner Zager, „Gericht Gottes in der Johannesapokalypse“, in: Friedrich W. Horn u. Michael Wolter (Hgg.), Studien zur Johannesoffenbarung und ihrer Auslegung. Festschrift für Otto Böcher zum 70. Geburtstag, Neukirchen-Vluyn, 310–327. Zayadine (1973): Fawzi Zayadine, „Recent Excavations on the Citadel of Amman“, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 18, 17–35. Zimmerli (1969): Walther Zimmerli, Ezechiel (Bibel und Kirche 13, 1), Neukirchen. Zobel (2004): Hans-Jürgen Zobel, „“שׁוֹר, in: Gerhard Johannes Botterweck, Helmer Ringgren u. HeinzJosef Fabry (Hgg.), Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. XIV, Grand Rapids, Michigan, 546–552. Zorzi (2011): Nicla de Zorzi, „The Omen Series Šumma izbu: Internal Structure and Hermeneutic Strategies“, KASKAL 8, 43–75. Zorzi (2014): Nicla de Zorzi, La serie teratomantica Šumma izbu. Testo, Tradizione, Orizzonti culturali (History of the Ancient Near East/Monographs 15), Padova. Zwierlein-Diehl (1991): Erika Zwierlein-Diehl, Die Antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museum in Wien, Band III: Die Gemmen der späteren römischen Kaiserzeit, Teil 2; Masken / Masken-Kombinationen / Phantasie- und Märchentiere / Gemmen mit Inschriften / Christliche Gemmen / Magische Gemmen / Sāsānidische Siegel / Rundplastik aus Edelstein und verwandtem Material / Kameen / Rundplastik, Gegenstände mit figürlichem Relief und Einlegearbeiten aus Glas / Antike Glyptik in Wiederverwendung / Nachantike Glyptik / Nachträge und Ergänzungen zu Band I und II, München. Zwingenberger (2007): Uta Zwingenberger, „Eisenzeit I“, in: Stefan Alkier, Michaela Bauks u. Klaus Koenen (Hgg.), WiBiLex. Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet [Online verfügbar unter http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/17088, Zugriff am 22. Juli 2022].
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1, S. 7: Abbildung 2, S. 8: Abbildung 3, S. 11:
Abbildung 4, S. 11:
Abbildung 5, S. 14: Abbildung 6, S. 17: Abbildung 7, S. 26: Abbildung 8, S. 27: Abbildung 9, S. 28: Abbildung 10, S. 29: Abbildung 11, S. 29: Abbildung 12, S. 29: Abbildung 13, S. 30: Abbildung 14, S. 30: Abbildung 15, S. 30: Abbildung 16, S. 30: Abbildung 17, S. 30: Abbildung 18, S. 30: Abbildung 19, S. 31: Abbildung 20, S. 31: Abbildung 21, S. 32: Abbildung 22, S. 33: Abbildung 23, S. 33: Abbildung 24, S. 33:
Gott mit Doppellöwenkeule, Siegel Bagdad, IM 15218. Zeichnung: RebekkaM. Müller. Darstellung von sieben Schlangen auf Siegel Boston, MFA, 65.1413. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach WIGGERMANN 1997b, 38, 52, Abb. 3c, 6a Kopf des Polyphemos. Hergestellt aus Marmor, Griechenland, wohl 2. Jhd. v. Chr. ® Captmondo, Wikimedia commons [https://de.wikipedia.org/wiki/ Kyklop#/media/Datei:Polyphemos-MuseumOfFineArtsBoston-March25-07. png; Zugriff am 22. Juli 2022]. Zeichnung eines Elefantenschädels. ® Johann David Schubert, Wikimedia commons [https://de.wikipedia.org/wiki/Kyklop#/media/Datei:goethe.elefant. schaedel2.jpg; Zugriff am 22. Juli 2022]. Umzeichnung des Fossils des Hyphalosaurus lingyuanensis. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach BUFFETAUT et al. 2007, 81. New York, MMA, Acc.-No. 10.176.78. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach HAYES 1960, S. 24, Abb. 17. Szepter Jerusalem, IMJ, IAA 61–88. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SCHROER u. KEEL 2005, 118 f. (Nr. 52). Krone aus der Schatzhöhle von Naḥal Mišmar, heute Jerusalem, IMJ, IAA 61– 177. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach BAR-ADON 1980, 24–28 (Nr. 7). Doppelwesen aus Byblos. Zeichnung: Christoffer Theis nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2d). Wesen mit zwei Antilopenköpfen auf einem Siegel aus Gabal Aruda, Syrien. Zeichnung: Christoffer Theis nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2c). Doppelwesen auf einem Siegel aus Byblos. Zeichnung: Christoffer Theis nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2e). Doppellöwe auf einem Siegel aus Byblos. Zeichnung: Christoffer Theis nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2f). Doppelwesen auf einer Siegelabrollung aus dem großen Grab in Naqada. Zeichnung: Christoffer Theis nach KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 57). Doppelwesen auf einer Siegelabrollung aus dem großen Grab in Naqada. Zeichnung: Christoffer Theis nach KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 57). Siegelabrollung Kairo, Äg. Mus., CG 11187. Zeichnung: Christoffer Theis nach KAPLONY 1963, Tf. 26 (Nr. 62). Siegeldarstellung aus der Zeit von Horus Aḥa. Zeichnung: Christoffer Theis nach KAPLONY 1963, Tf. 6 (Nr. 7). Doppellöwe auf einem Siegel aus S 3357. Zeichnung: Christoffer Theis nach KAPLONY 1963, Tf. 25 (Nr. 56). Siegelabrollung London, U.C., 11746. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KAPLONY 1963, Tf. 107 (Nr. 531). Darstellung eines Mischwesens aus Tepe Gawra. Zeichnung: Christoffer Theis nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2b). Siegelabrollung mit einem Vierfüßer als Doppelwesen aus Susa. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2a). Siegelabrollung mit einer doppelköpfigen Antilope aus Susa. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach TEISSIER 1987, 30 (Abb. 2a). Silberbecher aus cĒn Sāmiye, heute Jerusalem, IMJ, IAA, K 2919. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SCHROER u. KEEL 2005, 324 f. (Nr. 231). Kentauros auf Berlin, VA, 4375. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach STIEHLER-ALEGRIA DELGADO 1996, Tf. 14. Kentauros auf einem Kudurru, Kassitenzeit. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach STIEHLER-ALEGRIA DELGADO 1996, Tf. 14.
Abbildungsverzeichnis Abbildung 25, S. 33:
Abbildung 26, S. 35: Abbildung 27, S. 37: Abbildung 28, S. 39: Abbildung 29, S. 40: Abbildung 30, S. 41: Abbildung 31, S. 41: Abbildung 32, S. 41: Abbildung 33, S. 48: Abbildung 34, S. 50: Abbildung 35, S. 52: Abbildung 36, S. 52: Abbildung 37, S. 54: Abbildung 38, S. 54: Abbildung 39, S. 56:
Abbildung 40, S. 57:
Abbildung 41, S. 58: Abbildung 42, S. 58: Abbildung 43, S. 60: Abbildung 44, S. 60: Abbildung 45, S. 60: Abbildung 46, S. 60:
Abbildung 47, S. 65: Abbildung 48, S. 65: Abbildung 49, S. 65:
131
Doppelgesichtiger Kentauros aus dem Grab in Athribis, 2. Jhd. n. Chr. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach NEUGEBAUER u. PARKER 1969, 181, Tf. 51. Relief Tokio, Ancient Orient Museum, o. Inv. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach NUNN 1992, 143 f., Tf. 60. Terrakottarelief Bagdad, Irak-Museum, IM 9574. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL 1980, 182 f. (Nr. 277a) und OPIFICIUS 1961, 76 (Nr. 224). Göttin mit zwei Gesichtern auf Sarg Leiden, AMM, 16. Zeichnung: RebekkaM. Müller nach SEEBER 1976, 119. Dreiköpfiges Wesen, Auktion Sotheby’s 1980, 16. Mai, Nr. 101. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SOTHEBY’S 1980, Nr. 101. Darstellung des Siegels Antakya, Arch. Mus., Inv. 8832. Zeichnung: RebekkaM. Müller nach MATTHEWS 1990b, Nr. 590. Darstellung des Siegels aus Schicht XII von Tell Atšana. Zeichnung: RebekkaM. Müller nach FUHR-JAEPPELT 1972, 198f. (Abb. 203). Darstellung auf dem Siegel Antakya, Arch. Mus., Inv. 10120. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach FUHR-JAEPPELT 1972, 199 (Abb. 207). Kupferstich von Matthäus Merian zur Vision in Ez 1 aus dem Jahr 1630; aus MERIAN 1630a, 43. Typische Darstellung des Usmû. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach BOSSERT 1959, Tf. 2, Abb. 3. Elfenbeinrelief aus Megiddo, Chicago, OIM, A 22292. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach DEMISCH 1977, 59, Abb. 146 und SCHROER 2011, 400 f. (Nr. 978). Relief vom Tell Halaf. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL 1977, 231 f., Abb. 181. Vierköpfiger Widder als Nordwind in Deir el-Medina. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach GUTBUB 1977, 329, Abb. 242 und DE WIT 1957, 27–29, Abb. 3. Westwind im Tempel von Dendara. Zeichnung: Christoffer Theis nach GUTBUB 1977, 332, Abb. 253. Statuette Fondation Gandur pour l’Art, EG 170, Vorderseite: Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach BIANCHI 2011, 192 f.; 2014, 172–175 (Nr. 46) und CHAPPAZ u. CHAMAY 2001, 118 f. (Nr. 110). Statuette Fondation Gandur pour l’Art, EG 170, Rückseite: Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach BIANCHI 2011, 192 f.; 2014, 172–175 (Nr. 46) und CHAPPAZ u. CHAMAY 2001, 118 f. (Nr. 110). Papyruszeichnung des neunköpfigen Bes auf Pap. Brooklyn 47.218.156. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SAUNERON 1970, 11 f., Abb. 2. Siegel Berlin, VA 2722. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach MOORTGAT 1940, 138 (Nr. 584). Mischwesen auf einem Relief aus Karkemiš. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL 1977, 244 f., Abb. 187. Mischwesen auf einem Relief vom Tell Halaf. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL 1977, 244 f., Abb. 188. Thoëris auf der Metternichstele, heute New York, MMA, 50.85. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach GOLÉNISCHEFF 1877, Tf. 3. Darstellung der Venus in Athribis im Grab des AIb-p#-mny und des P(#-n)-mHy.t. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach NEUGEBAUER u. PARKER 1969, 181, Tf. 51; FLINDERS PETRIE 1908, Tf. 36. Statuette eines Löwen mit vier Gesichtern, Leiden, RMO, AED. 24. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach HORNEMANN 1969, Nr. 1749. Südwind im Tempel von Kom Ombo. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL 1977, Abb. 186a. Siegeldarstellung aus der frühdynastischen Zeit II mit unbekannter Herkunft. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach UEHLINGER 1995, 88, Abb. 5.
132 Abbildung 50, S. 69: Abbildung 51, S. 71: Abbildung 52, S. 72:
Abbildung 53, S. 81: Abbildung 54, S. 81: Abbildung 55, S. 81: Abbildung 56, S. 82: Abbildung 57, S. 84: Abbildung 58, S. 87: Abbildung 59, S. 88: Abbildung 60, S. 88: Abbildung 61, S. 94: Abbildung 62, S. 96:
Farbabbildungen Abbildung 63, S. 147:
Abbildung 64, S. 147: Abbildung 65, S. 148:
Abbildung 66, S. 149: Abbildung 67, S. 150: Abbildung 68, S. 151: Abbildung 69, S. 152:
Abbildung 70, S. 152:
Abbildung 71, S. 153:
Abbildungsverzeichnis Zweiköpfiges Krokodil im Tempel von Hibis, Oase Charga. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 20; Tf. 4, 4. Doppelgesichtiger Bacal auf der Stele des Barrakab. Zeichnung: Christoffer Theis nach KEEL 1977, 225, Abb. 176. Doppelgesichtiger Gott auf dem Siegel Fribourg, Sammlung Bibel+ Orient, VR 1981.254. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach KEEL-LEU u. TEISSIER 2004, 286 (Nr. 332). Jerusalem, BLMJ, 2051. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SCHROER u. KEEL 2005, 326 f. (Nr. 233). Darstellung eines Siegels aus Fara/Šuruppak. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach HANSEN 1981, 61, Tf. 16, 30. Chicago, OIM, A 34753. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SCHROER u. KEEL 2005, 326 f. (Nr. 232). Darstellung auf dem Siegel Bagdad, IM 15618. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach SCHROER u. KEEL 2005, 328 f. (Nr. 234) Sassanidisches Stempelsiegel, J. Pierpont Morgan Library. Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach WARD 1910, 211, Abb. 641. Kampf gegen die Schlange; Relief vom Löwentor von Arslantepe. Kopie aus DELAPORTE 1940, Tf. 22. Siebenköpfige Schlange im Tempel von Hibis. Zeichnung: Christoffer Theis nach DE GARIS DAVIES 1953, Tf. 3, 2. Gemme Cambridge (Massachusetts), 2012.1.144 (Slg. Sossidi, Nr. 10). Zeichnung: Rebekka-M. Müller nach MICHEL 2004, 332, Tf. 59, 2. Kupferstich von Matthäus Merian zur Schlange aus Apk 13 aus dem Jahr 1630; aus MERIAN 1630b, 151. Kupferstich von Matthäus Merian zu Daniel 7 aus dem Jahr 1630; aus MERIAN 1630a, 43.
Statue des Janus, heute Vatikan, Gregorianische Museen; ® Fubar Obfusco, Wikimedia commons [https://de.wikipedia.org/wiki/Janus_(Mythologie)#/med ia/Datei:Janus-Vatican.JPG; Zugriff am 22. Juli 2022]. Doppelstierprotome, Seitenansicht, Slg. Peter van der Veen. ® Peter van der Veen. Mary und Eliza Chulkhurst als Wahrzeichen der Stadt Biddenden. ® Amras Wi, Wikimedia commons [https://de.wikipedia.org/wiki/Mary_und_Eliza_ Chulkhurst#/media/Datei:Mary_und_Eliza_Chulkhurst.JPG; Zugriff am 22. Juli 2022]. Zweiköpfiger Mann bei LICETUS 1665, 11. Siebenköpfiger Mensch bei LICETUS 1665, 192. Dreiköpfiges Schaf bei LICETUS 1665, 22. Kerberos auf einer Caeretaner Hydria, um 525 v. Chr. ® Eagle Painter, Wikimedia commons [https://de.wikipedia.org/wiki/Kerberos#/media/Datei: Herakles_Kerberos_Eurystheus_Louvre_E701.jpg; Zugriff am 22. Juli 2022]. Statue Nr. 5/6 mit zwei Köpfen aus cAyn Gazal. ® Osama Shukir Muhammed Amin, Creative commons [https://en.wikipedia.org/wiki/%CA%BFAin_ Ghazal_statues#/media/File:Two-headed_statue_from_Ain_Ghazal,_Jordan_ Museum,_Amman.jpg, Zugriff am 22. Juli 2022; Lizenzvertrag: https:// creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode]. Statuette eines Gottes aus Iščali, heute Chicago, OIM, A 7119. ® Daderot, Creative commons [https://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Ishchali#/media/File: Four-faced_god,_Ishchali,_Isin-Larsa_to_Old_Babylonia_periods,_2000-1600_ BC,_bronze_-_Oriental_Institute_Museum,_University_of_Chicago_-_(detail). jpg, Zugriff am 22. Juli 2022].
Abbildungsverzeichnis Abbildung 72, S. 154:
Abbildung 73, S. 155:
Abbildung 74, S. 156: Abbildung 75, S. 157: Abbildung 76, S. 158:
Abbildung 77, S. 159: Abbildung 78, S. 160:
Abbildung 79, S. 161:
Abbildung 80, S. 162:
133
Triprosopos in Codex 2780, fol. 8r: Schwabenspiegel und Stadtrecht von Wr. Neustadt, Österreichische Nationalbibliothek in Wien; Kopie von https://onb. digital/result/10FF64F5 [Zugriff am 22. Juli 2022]. Peter Paul RUBENS „Maria als die Jungfrau der Apokalypse“; @ Peter Paul Rubens – J. Paul Getty Museum, Wikimedia commons [https://www.wikidata. org/wiki/Q20185488#/media/File:Peter_Paul_Rubens_-_The_Virgin_as_the_ Woman_of_the_Apocalypse_-_85.PB.146_-_J._Paul_Getty_Museum.jpg, Zugriff am 22. Juli 2022]. Cesare RIPA, Iconologia von 1593: Darstellung des Lasters als siebenköpfige Schlange. Albertus SEBA, Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio, Tf. 102: ein siebenköpfiger Drache. Johannes COCHLÄUS, „Sieben Köpfe Luthers vom Sakrament des Altars“; Kopie von http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00026093/ima ges/ [Zugriff am 22. Juli 2022; Lizenzvertrag: https://creativecommons. org/licenses/by-nc-sa/4.0/, Zugriff am 22. Juli 2022]. Der zweiköpfige Martin Luther. Titelblatt von Johannes COCHLÄUS, Dialogus de bello contra Turcas in Antilogias Lutheri, Leipzig 1512. Die beiden Tiere der Apokalypse vom Wandteppich Zyklus der Apokalypse (Tapisserie de l’Apocalypse). Hier: La bête de la Mer. ® Gribeco, Creative commons [https://de.wikipedia.org/wiki/Apokalypse_(Wandteppich)#/media/ Datei:La_Bête_de_la_Mer.jpg; Zugriff am 22. Juli 2022; Lizenzvertrag: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/; Zugriff am 22. Juli 2022]. Michael bezwingt den Drachen auf dem Wandteppich Zyklus der Apokalypse (Tapisserie de l’Apocalypse). ® Remi Jouan, Creative commons [https://de. wikipedia.org/wiki/Apokalypse_(Wandteppich)#/media/Datei:Angers-_Apo calypse_(8).JPG; Zugriff am 22. Juli 2022; Lizenzvertrag: https://creative commons.org/licenses/by-sa/3.0/; Zugriff am 22. Juli 2022]. Die Göttin Śīva in den Elephanta-Höhlen, Maharashtra, 6. Jahrhundert n. Chr. ® Christian Haugen, Creative commons [https://en.wikipedia.org/wiki/ Elephanta_Caves#/media/File:Elephanta_Caves_Trimurti.jpg; Zugriff am 22. Juli 2022; Lizenzvertrag: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legal code].
Abkürzungsverzeichnis ABRT Äg. Mus. AM AM ÄMUL ÄS Ass Bibl. nat. BLMJ BM CBd CG CT FGrHist IAA IM IMJ KAR KTU Kunsthist. Mus. MMA Mus. Greg. Eg. OIM Pap. Privatslg. RMO SLT TBM U. C. UM VA VAT YOS
Assyrian and Babylonian Religious Texts (Edition J. A. CRAIG 1895) Ägyptisches Museum (mit Standortangabe) Arkeoloji Müzesinde, Ankara Ashmolean Museum, Oxford Ägyptisches Museum der Universität Leipzig Ägyptische Sammlung (mit Standortangabe) Assur-Fundnummer aus dem Fundjournal Bibliothèque Nationale, Paris Bible Lands Museum, Jerusalem British Museum, London Campbell Bonner Magical Gems Database Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire The Egyptian Coffin Texts (ed. Adriaan DE BUCK 1935–1961) Fragmente griechischer Historiker (ed. JACOBY 1958) Israel Antiquities Authority Irak-Museum, Bagdad Israel Museum, Jerusalem Keilschrifttexte aus Assur religiösen Inhalts (Edition EBELING 1931) Keilalphabetische Texte aus Ugarit Kunsthistorisches Museum (mit Standortangabe) Metropolitan Museum of Art, New York Museo Gregoriano Egizio, Vatikanstadt Oriental Institute Museum, Chicago Papyrus Privatsammlung Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Sumerian Lexical Texts from the Temple School of Nippur (ed. CHIERA 1929) The Brooklyn Museum, New York University College, London University Museum (mit Standortangabe) Vorderasiatisches Museum, Berlin Vorderastisches Museum, Berlin, Tontafel-Sammlung Yale Oriental Series, Babylonian Texts (New Haven/London/Oxford 1915ff.)
Indices Götter und Wesen mit mehreren Gesichtern und Köpfen Nota bene: Das Zeichen bedeutet, dass keine genaue Anzahl der Köpfe in den betreffenden Quellen genannt wird, sondern lediglich ein Plural bezeichnet wird. Tabelle 1: Mesopotamien und Anatolien Anzahl der Köpfe
Seite
6/7
86
VAT 8917 = KAR 307, 19–21; ABRT 1, VII, 6
2
38
Marduk
Enūma elîš, Tf. I, 95, 97 f.
2
34
Mimma lemnu
VAT 10057, Rs. 7
2
53
MUŠ EME.IMIN.BI
Ur5-ra, Tf. XIV, Z. 17
7
83
MUŠ SAG.IMIN
AN.GIM, Z. 32–40.52–62; LUGAL-e, Z. 133
7
83
MUŠ.MAḪ SAG.IMIN
Verschiedene
7
83
Schlange
Ash. S. 112, Rs. 5
2
99
ŠEG9 SAG-ÀŠ
AN.GIM, Z. 32.54; LUGAL-e, Z. 130
6
86
Tiāmat
STC I, 213,12
2
78
UR SAG.IMIN
Gudea, Zylinder A, Kol. XXV, 27 f.
7
92
Usmû
Berlin, VAT 9718, I, 38 und verschiedene
2
51
Anzahl der Köpfe
Seite
Wesen
Textstelle
Bašmu
Bagdad, IM 51328, Z. 17–19 (Par. IM 54616, Z. 9)
Ištar
Tabelle 2: Biblische, syrische und ugaritische Quellen Wesen
Textstelle
Adler
4. Esra 11, 1.4.33–35
4
66
Syrische Pešitta zu 2. Chronik 33, 7
4
70
Eustathios, Contra Horigenem de Engastrimytho 8
4
74
Traktat Sanhedrin 103b
4
71
Ezechiel 1, 4–10
4
47
Ezechiel 41, 18b–19
2
59
Tausend und eine Nacht, Nacht 781
4
97
Apkokalypse 12, 3
7
75
Lītanu
KTU 1.5, Vs. I, 1–3
7
85
Liwyatan
Psalm 74, 14
73 f.
c
Ba al
Kerubim
Drache (δράκων μέγας)
136
Indices Anzahl der Köpfe
Seite
Johannes Cochläus, Flugblatt
7
95
KTU 1.5, Vs. I, 1–3
7
85
KTU 1.3, III, 37–46
7
85
Oden Salomos, Ode XXII, 5
7
90
Pistis Sophia 71
7
90
Tannīn
Psalm 74, 13
68 f.
Teufel
Nikodemusevangelium
3
94
Tier
Daniel 7, 6
4
62
Apokalypse 13, 1
7
76
Apokalypse 17, 3
7
76
KTU 1.83, 5
2
85
Wesen
Textstelle
Luther, Martin Schlange
Tunnanu
Anzahl der Gesichter und Häupter Tabelle 3: Mesopotamien und Anatolien Anzahl der Wesen Köpfe 2
6 6/7 7
Textstelle
Seite
Ištar
VAT 8917 = KAR 307, 19–21; ABRT 1, VII, 6
38
Marduk
Enūma elîš, Tf. I, 95, 97 f.
34
Mimma lemnu
VAT 10057, Rs. 7
53
Schlange
Ash. S. 112, Rs. 5
99
Tiāmat
STC I, 213,12
78
Usmû
Berlin, VAT 9718, I, 38 und weitere
51
ŠEG9 SAG-ÀŠ
AN.GIM, Z. 32.54; LUGAL-e, Z. 130
86
Bašmu
Bagdad, IM 51328, Z. 17–19 (IM 54616, Z. 9)
86
MUŠ EME.IMIN.BI
Ur5-ra, Tf. XIV, Z. 17
83
MUŠ SAG.IMIN
AN.GIM, Z. 32–40, 52–62; LUGAL-e, Z. 133
83
MUŠ.MAḪ SAG.IMIN
Verschiedene
83
UR SAG.IMIN
Gudea, Zylinder A, Kol. XXV, 27 f.
92
Indices
137
Tabelle 4: Biblische, syrische und ugaritische Quellen Anzahl der Wesen Köpfe 2
Textstelle
Seite
Kerubim
Ezechiel 41, 18b–19
59
Tunnanu
KTU 1.83, 5
85
3
Teufel
Nikodemusevangelium
94
4
Adler
4. Esra 11, 1.4.33–35
66
Bacal
Syrische Pešitta zu 2. Chronik 33, 7
70
Eustathios, Contra Horigenem de Engastrimytho 8
74
Traktat Sanhedrin 103b
71
Ezechiel 1, 4–10
47
Tausend und eine Nacht, Nacht 781
97
Tier
Daniel 7, 6
62
Drache (δράκων)
Apokalypse 12, 3
75
Lītanu
KTU 1.5, Vs. I, 1–3
85
Luther, Martin
Johannes Cochläus, Flugblatt
95
Schlange
KTU 1.5, Vs. I, 1–3
85
KTU 1.3, III, 37–46
85
Oden Salomos, Ode XXII, 5
90
Pistis Sophia 71
90
Apokalypse 13, 1
76
Apokalypse 17, 3
76
Kerubim
7
θηρίον
Liwyatan
Psalm 74, 14
73 f.
Tannīn
Psalm 74, 13
68 f.
Tabelle 5: Quellen zur realen Mehrköpfigkeit aus der Antike und der Neuzeit Wesen
Text/Quelle
Datierung
Anzahl der Köpfe
Seite
Frauen
Berichte über Mary und Eliza Chulkhurst
12. Jhd. n. Chr.
2
13
Hund
Verschiedene
19. Jhd. n. Chr.
3
19
Katze
Verschiedene
19. Jhd. n. Chr.
3
19
Kind
Ammian, Res Gestae XIX, 12, 19
359 n. Chr.
2
15
5. Jhd. n. Chr.
2
15
1540 n. Chr.
2
16
2. Jhd. n. Chr.
3
19
1665 n. Chr.
2
16
Antoninus Pius
2
15
Augustinus, De civitate Dei XVI, 8 Ferrari, Italien Flavius Philostratos, Vita Apollonii V, 13 Fortunius Licetus, De Monstris Historia Augusta IX, 3
138
Indices Datierung
Anzahl der Köpfe
Seite
Isidor von Sevilla, Etymologia XI, 3, 7
7. Jhd. n. Chr.
2
23
Titus Livius, Ab urbe condita XLI, 21, 12
1. Jhd. v. Chr. /
2
15
2
16
Nero, 61 n. Chr.
4
23
375 n. Chr.
2
15
Wesen
Text/Quelle
1. Jhd. n. Chr. Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XXV Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XX Ranulf Higden, Polychronicon
Trajan, 112 n. Chr.
Kröte
Sumerset, England
21. Jhd. n. Chr.
3
20
Lamm
Claudius Aelianus, De natura animalium XII, 3
3. Jhd. n. Chr.
2
14
L. Crassus /
2
14
2
14
Iulius Obsequens, Liber prodigiorum L
Q. Scaevola Titus Livius, Ab urbe condita XXXII, 29
1. Jhd. v. Chr. / 1. Jhd. n. Chr.
Mensch, generell
Augustinus von Hippo, De civitate Dei XVI, 8
5. Jhd. n. Chr.
2
15
Berossos, Babyloniaca (= Eusebius, Chronicon VI, 8)
3. Jhd. v. Chr.
2
16 f.
Nero
2
15
Fortunius Licetus, De Monstris
1665 n. Chr.
3
19
Verschiedene
1577 n. Chr.
3
19
Schildkröte Taiwan
20. Jhd. n. Chr.
3
19
Schlange (in Auswahl)
Cassius Dio, Historia Romana L, 8
3. Jhd. n. Chr.
2
99
Lucanus, Pharsalia IX, 719
1. Jhd. n. Chr.
2
99
Nikandros, Theriaca 372–383
2. Jhd. v. Chr.
2
99
Solinus, De mirabilibus mundi XXVII, 29
4. Jhd. n. Chr.
2
99
Titus Livius, Ab urbe condita XXVIII, 11
1. Jhd. v. Chr. /
2
14
Nero
2
15
7. Jhd. n. Chr.
2
23
Tacitus, Annales XV, 47 Schaf
Schwein
1. Jhd. n. Chr. Tier, generell
Tacitus, Annales XV, 47 Paulos von Aigina, Opus de re medica III, 76, 1
Indices
1. Quellen 1.1 Ägyptische Quellen Aenigmatische Wand, KV 6 ............................. 6 Amduat 317 .............................................................. 6 485 ............................................................ 89 730 ............................................................ 31 Athribis, Grab des AIb-p#-mny und des P(#-n)MHy.t .......................................... 34, 59, 131 Berlin P. 15770 ............................................... 87 Dendara I, 98, 8 ...................................................... 39 II 212, 6 ................................................... 39 25–28 ................................................... 53 III 157, 9 f. ................................................ 39 175, 1 f. ................................................ 39 IV, 250, 7 ............................................. 39 Esna 401 .......................................................... 32 %o+=f, Sarg ....................................................... 54 Hibis, Tempel ...................................... 38, 69, 73 AIw=f-o#, Sarkophag.......................................... 88 Kairo, Äg. Mus., CG 6008 .......................................................... 38 12361 .......................................................... 5 12362 .......................................................... 5 12617 .......................................................... 5 29306 ........................................................ 89 Leiden, AMM, 16...................................... 38, 39 Leipzig, ÄMUL, Inv.-Nr. 3792 ......................... 6 London, BM, EA 57871 .................................... 5 London, U. C. 11746 ........................................................ 30 E. 1 ............................................................. 5 P. 6 ............................................................. 5 Metternichstele ................................................ 89 New York, TBM, Rogers Fund, 1954 (54.3.2) . 6 New York, MMA 50.85 ............................................. 38, 59, 89 Acc.-No. 10.176.78 .................................. 17 Acc.-No. 10.176.81 .................................. 17 Paris, Bibl. nat., Inv.-Nr. 158–161 .................. 89 Paris, Louvre E 11554 .................................................... 55 E 17401 .................................................... 38 Pfortenbuch 69. Szene .................................................. 89 Zehnte Stunde........................................... 32 Elfte Stunde .............................................. 89 Philä II, 423, 14 ............................................... 39 Sargtexte, Spruch 1098 ..................................... 6 Tübingen, ÄS, Inv.-Nr. 421 .............................. 6 Vatikanstadt, Mus. Greg. Eg., 15633 ................ 6 Wien, Kunsthist. Mus., P#-nHm-#È.t, Sarg ....... 54
139
Zweiwegebuch, erste Sektion ......................... 31 onX.t, Sarg ....................................................... 54 1.2 Koptische Quellen Apokalypse 12, 3 ......................................................... 90 13, 1 ......................................................... 90 Oden Salomos, Ode XXII ............................... 90 Pistis Sophia 71 .............................................. 90 Pseudo-Johannes Chrysostomos, In quattuor animalia 44 .............................................. 50 1.3 Mesopotamische Quellen 1.3.1 Sumerische Quellen AN.GIM Z. 32 ......................................................... 86 Z. 32–40 ................................................... 83 Z. 33 ......................................................... 86 Z. 52–62 ................................................... 83 Z. 54 ......................................................... 86 Z. 55 ......................................................... 86 Bagdad, IM 081446, rs. ii 3 ............................ 80 Boston, MFA, 65.1413 ................................. 7, 8 Chicago, OIM, A 34753 ................................. 80 Gudea Statuette B Kol. V, 39 ............................................ 91 Kol. VI, 31............................................. 7 Kol. VI, 36............................................. 7 Zylinder A Kol. XXV, 24–26 ................................ 86 Kol. XXV, 24–XXVI, 16 .................... 92 Kol. XXV, 27f. .................................... 92 Kol. XXVI, 17–19 ............................... 92 Inanna und Ebiḫ, Z. 57 ................................... 91 Jerusalem, BLMJ, 2051 ............................ 66, 80 Kopenhagen, Nationalmuseum, Antikenslg., Nr. 5413 ................................................... 80 LUGAL-e Z. 129 ....................................................... 86 Z. 133 ....................................................... 83 New York, MMA, 1989.281.1.......................... 6 Oxford, AM, 1939.332.208 ............................ 71 SLT 51, Kol. IV, 11 ........................................ 83 Ur5-ra, Tf. XIV, Z. 17 ..................................... 83 1.3.2 Akkadische Quellen ABRT 1, VII, 6 ............................................... 38 Antakya, Arch. Mus., Inv. 8832 ............... 40, 41 Ash. S. 112 ..................................................... 99 Ass. 2001.D-1500+1515 ................................. 38 Bagdad, IM 9574 ................................................... 36, 37 15618 ....................................................... 82 51328, Z. 17–21 ....................................... 86
140 54616, Z. 9 ............................................... 86 Berlin, Vorderasiatisches Museum 3605 .......................................................... 40 VA 208 ....................................................... 6 VA 211 ....................................................... 6 VA 2722 ............................................. 40, 58 VA 4375 ............................................... 6, 34 VAT 9009................................................. 40 VAT 9718, I, 38 ....................................... 51 VAT 10057, Rs. 7 .................................... 53 VAT 10057, Rs. 11 .................................... 6 Chicago, OIM A 7119 .............................. 35, 36, 43, 47, 50 A 7120 .......................................... 36, 43, 50 Enūma elîš Tf. I, 95 ............................................... 34, 36 Tf. I, 97 f. ........................................... 34, 36 Tf. I, 141–145 ........................................... 86 Fribourg, Slg. Bibel+Orient, VR 1981.254 ..... 71 KAR 6, Kol. II, 26 ............................................. 86 19 .............................................................. 38 307, 19–21 ................................................ 38 Ladders, Slg., 76 ............................................. 31 London, BM 22433 ........................................................ 40 K. 2054 ..................................................... 92 New York, MMA 57.27.12 (ND 5296) ..................... 36, 53, 59 86.11.383A, Rs. 4'f. .................................. 63 Harris Brisbane Dick Fund 1954....................... 6 James N. Spear and Schimmel Foundation, Inc. Gifts, 1982 ........................................... 4 Paris, Louvre A 142, O 2485 .......................................... 82 AO 1180 ................................................... 51 AO 12442 ................................................. 36 SpTU I, 50, 11f. .............................................. 38 Šumma ālu ina mēlê šakin Tf. 23, 91 .................................................. 83 Tf. 25 f. iii, 23' .................................................. 63 iii, 25f. ................................................. 99 rs. 4 ............................................... 99 rs. 5 ............................................... 91 Šumma izbu Tf. I 74 ............................................ 12, 16 101 .................................................. 12 104 .................................................. 12 114 f. ................................................... 12 116 ....................................................... 12 117 ....................................................... 12 Tf. II, 21–43 ............................................. 16 Tf. V 25 ....................................................... 63
Indices 68 ....................................................... 10 Tf. VI 47 f. ............................................... 19, 20 50 f. ............................................... 20, 63 53 ....................................................... 63 Tf. VIII 48–52 .................................................. 16 50 ....................................................... 18 63–67 .................................................. 18 William F. Albright, Slg., Vs. 16 .................... 83 Yale, Babylonian Collection, 13463 ............... 91 YOS X, 56, II, 8 f. .......................................... 16 1.3.3 Hethitische Quellen AnAr 10753, x+1–4' ....................................... 16 Ankara, Arkeoloji Müzesinde, No. 12250 ...... 87 Boğazköy, Siegel ............................................ 51 Chicago, OIM, A 22292 ................................. 51 CTH 321 ......................................................... 87 KBo XIII, 31, Vs. II, 7'–9' .............................. 16 KUB XXIX, 12 ................................................. 17 XXXIV, 20, x+5'f. ................................... 19 Siegel, Kirkukglyptik...................................... 51 1.3.4 Ugaritische Quellen KTU 1.1–6+1.8 ........................................... 85, 87 1.3 III, 37–46 ............................................ 85 III, 40 .................................................. 85 III, 41 f. ............................................... 85 1.5, Vs. I, 1–3..................................... 85, 87 1.83, 5 ................................................ 68, 85 1.103 + 145 (RS 24.247 +…), 1 .............. 84 1.140 (RS 24.302), 1'–14' ........................ 84 1.3.5 Urarṭäische Quellen Boston, MFA, 1981.654 ................................... 6 New York, MMA, 1989.281.21........................ 6 1.4 Bibel 1.4.1 Altes Testament Genesis 2, 2 ........................................................... 91 3, 24 ......................................................... 49 4, 15 ......................................................... 91 7, 2 f. ........................................................ 91 Exodus 7, 9 f. .................................................. 68, 73 7, 10–12 ................................................... 68 7, 12 ................................................... 68, 73 25, 18–22 ................................................. 49 27, 2 ......................................................... 54 29, 2 ......................................................... 54 30, 2 f. ...................................................... 54
Indices 37, 25 f. .................................................... 54 38, 2 .......................................................... 54 Levitikus 4, 7 ............................................................ 54 4, 18 .......................................................... 54 4, 25 .......................................................... 54 4, 34 .......................................................... 54 8, 15 .......................................................... 54 9, 9 ............................................................ 54 16, 18 ........................................................ 54 19, 26 ........................................................ 45 19, 31 ........................................................ 45 Deuteronomium 18, 10 f. .................................................... 45 32, 33 .................................................. 68, 73 Richter 14, 18 ........................................................ 55 17 .............................................................. 70 1. Könige 1, 50 f. ...................................................... 54 2, 28 .......................................................... 54 6, 23–28 .............................................. 49, 61 6, 24–27 .............................................. 49, 72 6, 29 .......................................................... 61 6, 32 .......................................................... 61 6, 35 .......................................................... 61 16, 30–34 .................................................. 70 18, 19–46 .................................................. 70 2. Könige 7, 29 .......................................................... 61 7, 36 .......................................................... 61 2. Chronik 3, 10–13 .............................................. 49, 72 33, 7 .............................................. 70, 72, 73 Hiob 7, 12 .................................................... 68, 85 9, 13 .......................................................... 85 10, 16 ........................................................ 55 26, 12 f. .................................................... 85 39, 29 ........................................................ 54 40, 25–41, 26 ...................................... 68, 69 41, 26 ........................................................ 85 Psalmen 22, 14 ........................................................ 55 74, 3–9 ...................................................... 67 74, 12–17 .................................................. 73 74, 13 ............................................ 68, 86, 91 74, 13 f. .............................................. 73, 85 74, 14 .................................................. 68, 73 89, 11 ........................................................ 85 91, 13 .................................................. 68, 69 104, 26 ................................................ 73, 85 118, 27 ...................................................... 54 148, 7 .................................................. 68, 85 Sprüche 30, 30 ................................................ 55
141 Jesaja 6, 2 ........................................................... 47 27, 1 ............................................. 68, 73, 85 40, 31 ....................................................... 54 51, 9 ................................................... 68, 85 51, 34 ....................................................... 68 57, 3–5 ..................................................... 45 Jeremia 4, 7 ........................................................... 66 50, 17 ....................................................... 66 Ezechiel 1 ......................................................... 61, 64 1, 4–6 ....................................................... 72 1, 4–10 ................................... 46, 47, 79, 96 1, 9b–10 ................................................... 72 1, 10 ......................................................... 55 9, 3 ........................................................... 61 10 ............................................................. 61 10, 4 ......................................................... 61 10, 12 ..................................... 49, 55, 56, 72 10, 13–16 ................................................. 49 10, 14 ........................................... 49, 56, 72 29, 3 ................................................... 68, 77 32, 2 ................................................... 68, 77 34–39 ....................................................... 79 41, 18 f. .................................. 59, 60, 72, 79 43, 15 ....................................................... 54 43, 20 ....................................................... 54 Daniel 1, 4 ........................................................... 61 1, 5 f. ........................................................ 61 2 ............................................................... 62 2, 33–35 ................................................... 67 2, 41–43 ................................................... 67 7 ......................................................... 64, 77 7, 1 ........................................................... 61 7, 4 ..................................................... 61, 96 7, 5 ..................................................... 61, 96 7, 6 ................. 61, 64, 66, 69, 73, 76, 79, 96 7, 17 ................................................... 62, 73 7, 19–27 ................................................... 62 8, 21 f. ...................................................... 62 11 ............................................................. 63 11, 2 ................................................... 62, 73 11, 2–4 ..................................................... 62 11, 3 f. ................................................ 62, 73 Hosea 13, 7 f. ............................................ 61, 66 1.4.2 Neues Testament 1. Johannes 2, 18 ......................................................... 76 2, 22 ......................................................... 76 4, 3 ........................................................... 76 2. Johannes 7 .................................................. 76 Apokalypse 1, 4 ........................................................... 91
142
Indices 1, 9 ............................................................ 74 1, 11 .......................................................... 91 4, 6 ............................................................ 59 12 ............................................ 74, 75, 79, 92 12, 1 f. ...................................................... 75 12, 3 ................................................ 3, 74, 75 12, 5 .......................................................... 76 12, 7 f. ...................................................... 76 12, 9 .............................................. 74, 77, 92 12, 18 ........................................................ 76 13 .................................................. 74, 75, 92 13, 1 .................................................... 76, 85 13, 1 f. ............................................ 3, 74, 76 13, 1–18 .................................................... 77 13, 2 .......................................................... 66 13, 3 .......................................................... 76 16, 13 ........................................................ 76 17, 3 .......................................................... 76 17, 7 .......................................................... 76 19 f. .......................................................... 79
1.4.3 Apokryphen und Pseudepigraphen 1. Makkabäer 11, 13 ........................................ 92 4. Esra 6, 49 .......................................................... 68 7, 26–44 .................................................... 67 11 f. .................................................... 66, 73 Apokalypse des Abraham XVIII, 4 ................. 50 Äthiopisches Henochbuch 1–36 .......................................................... 64 83–90 ........................................................ 64 Barnabasbrief 4, 3–5 ....................................... 62 Nikodemusevangelium.................................... 94 Slawisches Henochbuch 29,4 .......................... 79 1.5 Syrisch-palästinische Quellen Amman, Göttinnenköpfe ............... 37, 38, 39, 43 Barrakab, Stelenfragment.......................... 43, 70 Baruchapokalypse 29, 4 .................................. 68 Byblos, Siegel ..................................... 28, 29, 31 Gabal Aruda, Siegel ............................ 28, 29, 42 Jerusalem, IMJ IAA 61–86 .......................................... 26, 42 IAA 61–88 .............................. 25, 26, 27, 42 IAA 61–119 .................................. 26, 28, 42 IAA 61–177 .................................. 27, 42, 98 IAA, K 2919 ................................. 32, 42, 98 Jerusalem, Rockefeller Museum, IAA 43–162 ..................................................... 43 London, BM, 123.348 ..................................... 34 Oden Salomos, Ode XXII ......................... 68, 89 Pešitta zu 2. Chronik 33, 7 .............................. 73 Qumran 4Q186 ....................................................... 45 4Q318 ....................................................... 45 Sæfær Šimmūš Tēhillīm § 81 ........................... 69
Sanhedrin 103b ............................................... 70 Statuetten aus cAyn Gazal......................... 25, 42 Tokio, Ancient Orient Museum, Relief ... 35, 43, 47, 50 1.6 Griechische Quellen Aelianus, De natura animalium VIII, 7 ...................................................... 99 IX, 23 ....................................................... 99 XII, 3 ........................................................ 14 Aischylos Agamemnon 1233 .................................... 99 Prometheus vinctus 353 f. ....................... 78 Alkaios, frag. 443 .......................................... 78 Antigonos von Karystos, Mirabilia 119 ......... 21 Aristophanes, Nubes 336 ............................... 78 Aristoteles De generatione animalium IV, 4 ....... 20, 22 Historia animalium VII, 4 ............. 9, 20, 21 Mirabilia 128 ........................................... 20 Problemata physica X, 28........................ 21 Berossos, Babyloniaca.................................... 16 Cassius Dio, Historia Romana L, 8 ................ 99 Clemens Alexandrinus, Quis dives 42 ............ 74 Damaskios, De principiis ............................... 98 Demokrit von Abdera, frag. A 151 ................. 22 Dinon von Kolophon ...................................... 62 Diodorus Siculus, Bibl. Hist. IV, 11, 5 .......... 78 Empedokles, frag. A 81 .................................. 22 Euripides Cyclops 79 ............................................... 10 Phoenissae 1135 ...................................... 78 Eusebius, Historia Ecclesiastica III, 18, 3...... 74 Eustathios, Contra Horigenem de Engastrimytho 8 ................................. 71, 74 FGrHist 680, F1 ..................................................... 16 690, F1–3 ................................................. 62 Flavius Philostratos, Vita Apollonii V, 13 ..... 19 Herodot, Historiae I, 95.130 ........................... 62 Hesiod, Theogonia 139–141 ................................................... 10 144 f. ........................................................ 10 501–503 ................................................... 10 824–826 ................................................... 78 Horapollo, Hieroglyphica I, 19 ....................... 60 Irenäus, Adversus Haereses V, 30, 3 .............. 74 Johannes Tzetzes, Exegesis in Iliadem I,97 .... 61 Lukian, Verae historiae I, 11 ........................ 101 New York, MMA, 1986.322.2.......................... 6 Nikandros, Theriaca 372–383 ........................ 99 Nonnos von Panopolis, Dionysiaca XIV, 52 f. .......................................................... 10 Oppian, Halieutica III, 15............................... 78 Paulos von Aigina, Opus de re medica III, 76, 1 ........................................................ 23
Indices Phlegon von Tralleis, De rebus mirabilibus XIV........................................................... 21 XV ............................................................ 21 XVI........................................................... 21 XVIII ........................................................ 21 XIX........................................................... 22 XX ............................................................ 23 XXV ......................................................... 16 XXIX ........................................................ 21 Pindaros Olympian IV, 6 f. ..................................... 78 Pythia I, 16 f................................................... 78 VIII, 16 ............................................... 78 Platon, De republica 614b–615b..................... 79 Plutarch De Iside et Osiride, 47.............................. 79 Lykurgos XVI, 1 ....................................... 12 Pseudo-Apollodor, Bibliotheca II, 5, 11 ......... 91 Pseudo-Quintilian, Declamationes maior VIII, 3 ....................................................... 21 Sibyllische Orakel III, 652–697 ...................... 79 Simonides, frag. 569 ...................................... 78 Strabo, Geographika XIII, 4, 6 ....................... 78 Vidoni, Slg. ....................................................... 4 1.7 Lateinische Quellen Ammian, Res Gestae XIX, 12, 19 ................... 15 Anthologia Palatina 166 ............................................................ 21 168 ............................................................ 21 Augustinus, De civitate Die XVI, 8 ................ 15 Aulus Gellius, Noctes Atticae X, 2.................. 21 Cicero, De divinatione I, 121 .......................... 15 CIL, 838 .......................................................... 21 Eusebius, Chronicon VI, 8 .............................. 16 Fortunius Licetus, De Monstris ........... 16, 19, 99 Fulcher von Chartres, Historia Hierosolymitana I, 3, 3 ............................................ 94 Gaius Julius Solinus, De mirabilibus mundi XXVII, 29 ................................................ 99 Hieronymus, De viris illustriis 9 ..................... 74 Historia Augusta IX, 3 .................................... 15 Honorius Augustodunensis, Speculum Ecclesiae 1010.......................................... 95 Isidor von Sevilla, Etymologiae XI, 3, 7...................................................... 23 XII, 4, 20 .................................................. 99 Iulius Obsequens, Liber de prodigiis XIV........................................................... 21 XXXI ........................................................ 14 L ............................................................... 14 Livius, Ab urbe condita XXXII, 29 ................................................ 14 XXXVIII, 11 ............................................ 14 XLI, 21, 12 ............................................... 15
143 Lucan, Pharsalia IX, 719 ............................... 99 Ovid Ex ponto IV, 23 .......................................... 4 Fasti I, 65 ................................................... 4 Metamorphoses IX, 1956 ........................ 78 Paris, Bibl. nat., Codex 6770 .......................... 93 Plinius, Naturalis Historia VII, 3 .................................................... 9, 21 VIII, 23 .................................................... 99 XXX, 44................................................... 99 Propertius, Elegiae III, 5 ......................................................... 19 III, 18 ....................................................... 19 Pseudo-Hyginus, Fabulae 30 ............................................................. 78 152 ........................................................... 78 Ranulf Higden, Polychronicon ....................... 15 Seneca, Hercules furens 784 .......................... 78 Sueton, Vita Divi Augusti 72, 3 ...................... 21 Synesios, Epistulae 55 ............................................................. 21 79 ............................................................. 21 Tacitus Annales XV, 47 ........................................ 15 Historiae V, 8 .......................................... 67 Vergil, Aeneis VI, 478 .................................... 79 1.8 Etruskische Quellen Bordeaux, Musée d’Aquitaine, 60.2.2 .......... 100 Slg. Julien Gréau, Nr. 488 ................................ 6 1.9 Romanische Quellen Bonaguida, Pacino di, Erscheinung des Heiligen Michael...................................... 95 Cochläus, Johannes, Sieben Köpfe Luthers vom Sakrament des Altars ....................... 95 Luther, Martin, Heerpredigt wider den Türcken .................................................... 97 Monreale, Dom ............................................... 97 Petrarca, Francisco, Trostspiegel in Glück und Unglück............................................. 96 Ripa, Cesare, Iconologia ................................ 95 Rubens, Peter Paul, Maria als die Jungfrau der Apokalypse ........................................ 94 Seba, Albertus, Locupletissimi ....................... 95 Skog, Bildteppich ........................................... 94 Toulouse, Musée des Augustins ..................... 95 Wien, Nat.-Bibl., Codex 2780 ........................ 93 Zyklus der Apokalypse, Wandteppich ............ 95 1.10 Indische Quellen Berlin, Museum für Indische Kunst, Inv.-Nr. I.10.126 .................................................... 51 Bundahišn III,11 ............................................. 79 Oxford, AM, Inv.-No. x 267 ........................... 51
144 Ṛgveda V, 48, 5 ................................................... 100 X, 8, 8 ..................................................... 100 1.11 Gemmen Bonner 266 ...................................................... 64 King, Slg., Acc. No. 81.6.195 ........................... 4 New York, MMA, 41.160.642 ........................ 64 Sossidi, Slg., Nr. 10......................................... 89 Wien, Kunsthist. Mus. IX B 796..................................................... 4 IX B 1320................................................... 4 1.12 Arabische Quellen Pešitta zu 2. Chronik 33 .................................. 70 Tausend und eine Nacht, Nacht 781................ 97 1.13 Sonstige Quellen Gallo-keltischer Altar aus Reims .................... 10 New York, TBM, Joseph Pulitzer Bequest 1955 ............................................................ 6 Schimmel, Slg., Nr. 12 ...................................... 6 2. Namen 2.1 Herrschernamen Antoninus Pius ................................................ 15 Assarhaddon .................................................... 99 Augustus ......................................................... 77 Barrakab .................................................... 70, 73 Bokchoris ........................................................ 14 Caligula ........................................................... 77 Claudius .......................................................... 77 Dareios I. ....................................... 38, 69, 73, 89 Domitian ................................................... 74, 77 Galba ......................................................... 74, 77 Gudea ........................................ 7, 86, 87, 91, 92 Hadrian...................................................... 74, 77 Ibal-pî-el II. ..................................................... 36 Manasse .............................................. 70, 71, 73 Nebukadrezzar II. ................................ 46, 61, 66 Nero ........................................ 15, 23, 74, 76, 77 Nerva ............................................................... 74 Otho ................................................................ 77 Ptolemaios ....................................................... 92 Tiberius ..................................................... 21, 77 Titus ................................................................ 77 Trajan .............................................................. 74 Vespasian ........................................................ 77 Vitellius ........................................................... 77 2.2 Eigennamen Abd Manāf ...................................................... 22 Abd Šams ........................................................ 22 Adrastus .......................................................... 78 Amabilis, Claudia ........................................... 21 Apollonius von Tyana ..................................... 19
Indices Bulūkiya ......................................................... 97 Bunker, Chang und Eng.................................. 13 Chulkhurst, Mary und Eliza............................ 13 Colloredo, Lazarus und Johannes ................... 18 Izbu ................................................................. 18 Izbu-līšir ......................................................... 18 Izumuš............................................................. 18 Johannes ................................................... 49, 97 Lukas ........................................................ 49, 97 Luther, Martin..................................... 95, 96, 97 Lykosthenes, Conrad ........................................ 9 Markus ...................................................... 49, 97 Matthäus ................................................... 49, 97 Ṣalāḥ ad-Dīn ................................................... 97 Tocci, Giacomo .............................................. 13 Tocci, Giovanni .............................................. 13 Urban II. ......................................................... 94 Urban VIII ...................................................... 93 Uzzammi ......................................................... 18 2.3 Götter und göttliche Wesen Africa ................................................................ 4 Agni .............................................................. 100 Apollo ............................................................. 92 Ašera............................................................... 71 Bacal ................................. 43, 70, 71, 73, 74, 85 Bašmu ............................................................. 86 Bēl ................................................................. 38 Belzebub ......................................................... 94 Bes ............................................... 55, 56, 72, 93 Chronos .......................................................... 98 Dreifaltigkeit................................................... 93 Enki ................................................................ 50 Enkidu ............................................................ 82 Gilgameš ......................................................... 82 Hathor ........................................... 39, 43, 53, 78 Hydra .................................................. 73, 78, 79 Iaw .................................................................. 92 Isis ...................................................... 38, 43, 78 Ištar ............................................. 37, 38, 43, 78 Janus ................................................................. 4 Jupiter ............................................................... 4 Kerub/Kerubim ........... 48, 49, 55, 59, 61, 70, 72 Leto ................................................................. 77 Lītanu.............................................................. 85 Marduk ............................................... 11, 34, 36 Michael, Erzengel ..................................... 76, 94 Mōtu ............................................................... 85 Mušḫuššu ........................................................ 78 Nephthys ................................................... 38, 43 Ninazu ............................................................ 82 Ningirsu .................................................... 80, 83 Ningišzidda ..................................................... 82 Ninhursang ............................................... 36, 37 Ninlil ............................................................... 38 Nintur........................................................ 36, 37
Indices Ninurta ...................................................... 80, 82 Polyphemos ..................................................... 10 Porevith ......................................................... 100 Python ............................................................. 77 Satan.............................................. 74, 77, 92, 94 Seth ........................................................... 78, 88 Śīva ............................................................... 100 Šlyṭ .................................................................. 85 Suantovith ..................................................... 100 Tiāmat ....................................................... 34, 77 Tišpak.............................................................. 82 Triglaw .......................................................... 100 Typhon ...................................................... 78, 79 Usmû ............................................. 18, 50, 51, 71 Utu .................................................................. 82 Viṣņu ............................................................. 100 Viśvarūpa ...................................................... 100 Yam ................................................................. 85 2.4 Forscherinnen und Forscher Amr, Abdel-Jalil ............................................. 38 Bauer, Dieter ................................................... 62 Charles, Robert H............................................ 78 Delcor, Mathias ............................................... 63 Dornemann, Rudolph ...................................... 39 Fohrer, Georg .................................................. 48 Fuhr-Jaeppelt, Ilse ........................................... 40 Grafman, Rafi ................................................. 34 Keel, Othmar ................... 1, 8, 34, 49, 50, 53, 60 Lattke, Michael ............................................... 89 Lebram, Christian ........................................... 64 Lohmeyer, Ernst .............................................. 78 Morris, Leon ................................................... 78 Müller, Karlheinz ............................................ 64 Nunn, Astrid .................................................... 36 Reddish, Mitchell G. ....................................... 77 Ritt, Hubert ............................................... 77, 78 Roloff, Jürgen ................................................. 75 Schroer, Silvia ......................................... 1, 8, 34 Teissier, Beatrice............................................. 28 Thomas, Robert L. .......................................... 77 Vogt, Ernst ................................................ 48, 55 Witulski, Thomas ............................................ 77 Yabro Collins, Adela....................................... 78 Zayadine, Fawzi .............................................. 39 3. Sachindex Adler ................................ 49, 50, 53, 54, 66, 72 Adlervision ................................................ 66, 73 Aefula.............................................................. 14 Amulett ........................................... 5, 31, 45, 88 Angelus interpres ................................ 62, 67, 73 Antichrist ........................................................ 93 Antilope .................................................... 28, 31 Augen ............................................ 55, 56, 59, 72 Axt .................................................................. 36
145 Babylonisches Exil ............................. 46, 61, 67 Bär ......................................... 61, 62, 66, 76, 96 Bärtige Göttin ................................................. 38 Bartlocke ........................................................ 35 Berufungsvision .............................................. 47 biceps .......................................................... 4, 14 Biddenden, Gemeinde .................................... 13 Bubastis .......................................................... 39 Bundeslade ..................................................... 49 Capride ..................................................... 26, 27 Craniopagos ................................................... 18 Cyclokephalos................................................. 10 Dämon ............................................................ 53 Daphne............................................................ 15 Delphin ........................................................... 13 Diadochen, vier......................................... 62, 73 Dicranus ........................................................... 9 Dikephalos ...................................................... 67 Diprosopos .................................. . 9, 10, 12, 13, 16, 18, 32, 34, 38, 43, 50, 51, 53, 59, 70, 101 Divination ....................................................... 45 Doppellöwenkeule ............................................ 6 Doppelwesen ...5, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 42, 43, 98 Dreifaltigkeit................................................... 93 Eidechse.......................................................... 13 Elam.......................................................... 31, 63 Emmaus .......................................................... 15 Eroberung Jerusalems ..................................... 46 Eschatologie ................................................... 64 Euphrat ........................................................... 38 Evangelisten, vier ........................................... 49 Falbelkleid ...................................................... 36 Ferrari ............................................................. 16 Feuergericht .................................................... 79 Flamme ........................................................... 82 Florenz ............................................................ 22 Flügel, vier.......................................... 46, 57, 62 Frosch ............................................................. 76 Fruchtbarkeit................................................... 55 Fürstin mit dem hohen Polos .......................... 43 Gazelle ............................................................ 63 Gebärmutter .................................................... 22 Geister, unreine............................................... 76 Givcat Ha-Oranim ..................................... 24, 26 Gleichgewicht der Mächte .............................. 34 Gorilla ............................................................. 13 Götzenbild ................................................ 70, 71 Gründungsbox ................................................ 59 Hai .................................................................. 14 Handelskontakte ............................. 1, 24, 31, 71 Hellin-Regel ............................................... 9, 18 Herr der Tiere ........................................... 71, 80 Himmelsrichtungen, vier .............. 26, 36, 53, 57 Himmelsträger .............................. 51, 53, 61, 72 Hirsch ............................................................. 30
146 Hörneraltar ...................................................... 54 Hörnerkappe.............................................. 35, 80 Hörnerkrone ........................................ 59, 71, 82 Hortfund .............................................. 25, 26, 51 Hund.................................................... 19, 63, 80 Hyphalosaurus lingyuanensis ............. 14, 21, 22 Ischiopagos ................... 5, 22, 27, 28, 29, 31, 42 Janiceps .......... 4, 11, 12, 16, 39, 43, 59, 71, 78 Januskatze ....................................................... 11 Jungfrau, Sternbild .......................................... 92 Katze ......................................................... 13, 19 Kentauros ...................................... 32, 33, 42, 59 Kerberos .......................................................... 19 Keulenkopf...................................................... 26 Kinderopfer ..................................................... 45 Königreiche, vier....................................... 62, 67 Konzil von Konstantinopel ............................. 93 Kosmoswächter ............................................... 34 Krokodil ........................................ 41, 68, 69, 73 Krone ...................................... 27, 28, 42, 95, 98 Kudurru ..................................... 6, 34, 37, 59, 86 Lamm .............................................................. 14 Leopard ............................. 62, 64, 66, 73, 76, 96 Liwyatan.................................. 68, 69, 73, 78, 86 Löwe .. 29, 30, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 72, 76, 96 Löwenadler ..................................................... 40 Magdalénien-Zeit ............................................ 43 Mastaba S 3357 ............................................... 30 mesu-Holz ....................................................... 38 Mischgestalt .... 6, 26, 29, 30, 34, 44, 47, 49, 50, 59, 76 Monster, elf ..................................................... 86 Naḥal Mišmar.................... 24, 25, 26, 27, 42, 98 Naqada ............................................................ 29 Nihavand ......................................................... 54 Nilpferd ........................................................... 68 Nordwind ........................................................ 53 Omphalopagos ................................................ 18 Opferpriester ................................................... 16 Orakel.............................................................. 45 Ostwind ........................................................... 54 Panther ................................................ 66, 80, 82 Perserkönige, vier...................................... 62, 73 Pest .................................................................. 54 Pferd ................................................................ 83 Polos................................................................ 43 Pseudoprophet ................................................. 76 Pygopagos ....................................................... 42 Redaktionsstufe ............................................... 49
Indices Rhesusäffchen................................................. 13 Römisches Imperium ................................ 67, 77 Rosette ............................................................ 32 Samenflüssigkeit............................................. 22 Schaf ................................................... 13, 19, 63 Schild des Adrastus ........................................ 78 Schildkröte.......................................... 14, 16, 19 Schminkpalette ............................................... 87 Schutzritual ............................................... 36, 53 Schwein .................................................... 14, 63 Seemonster ..................................................... 68 Silberbecher .................................. 32, 34, 35, 42 Skorpion ......................................................... 80 Skorpion, Sternbild ......................................... 92 Steinbock ........................................................ 29 Stier .................................. 49, 50, 53, 54, 59, 72 Streitwagen ..................................................... 83 Südwind .............................................. 53, 54, 64 Sündenfall ....................................................... 49 Tannīn ............................... 68, 69, 73, 78, 86, 91 Taube .............................................................. 27 Teratologie........................................................ 8 Teratomantie ................................................... 16 Tetrakephalos ................................................. 63 Tetraprosopos ............................... 36, 47, 54, 72 Thoracopagos ........................................... 18, 22 Tigris .............................................................. 38 Totenbeschwörung ......................................... 45 Triceps ............................................................ 94 Trikephalos ............................... 9, 18, 19, 44, 67 Trinität ............................................................ 93 Triprosopos ........................................ 10, 35, 93 Veientium ....................................................... 15 Verzauberung ................................................. 22 Vier-Kaiser-Jahr ............................................. 74 Viper ............................................................... 86 Votivfigur ....................................................... 39 Wal ................................................................. 68 Westwind ........................................................ 54 Widder ...................................................... 53, 54 Winde, vier ..................................................... 53 Wurfholz ......................................................... 80 Ziege ......................................................... 14, 63 Zweig ........................................................ 32, 80 Zwillinge, siamesische................ 8, 9, 10, 13, 22 Zyklop ............................................................ 10 δράκων μέγας ......................... 75, 76, 91, 92, 95 θηρίον ....................................................... 76, 92 Ω-Symbol ....................................................... 37
Farbabbildungen
Abbildung 63: Statue des Janus, heute Vatikan, Gregorianische Museen
Abbildung 64: Doppelstierprotome, Seitenansicht, Slg. Peter van der Veen
148
Farbabbildungen
Abbildung 65: Mary und Eliza Chulkhurst als Wahrzeichen der Stadt Biddenden
Farbabbildungen
Abbildung 66: Zweiköpfiger Mann bei LICETUS 1665, 11
149
150
Farbabbildungen
Abbildung 67: Siebenköpfiger Mensch bei LICETUS 1665, 192
Farbabbildungen
Abbildung 68: Dreiköpfiges Schaf bei LICETUS 1665, 22
151
152
Farbabbildungen
Abbildung 69: Kerberos auf einer Caeretaner Hydria, um 525 v. Chr.
Abbildung 70: Statue Nr. 5/6 mit zwei Köpfen aus cAyn Gazal
Farbabbildungen
Abbildung 71: Statuette eines Gottes aus Iščali, heute Chicago, OIM, A 7119
153
154
Farbabbildungen
Abbildung 72: Triprosopos in Codex 2780 der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien
Farbabbildungen
Abbildung 73: Peter Paul RUBENS „Maria als die Jungfrau der Apokalypse“
155
156
Farbabbildungen
Abbildung 74: Cesare RIPA, Iconologia von 1593: Darstellung des Lasters als siebenköpfige Schlange.
Farbabbildungen
Abbildung 75: Albertus SEBA, Locupletissimi rerum naturalium thesauri accurata descriptio: ein siebenköpfiger Drache
157
158
Farbabbildungen
Abbildung 76: Johannes COCHLÄUS „Sieben Köpfe Luthers vom Sakrament des Altars“
Farbabbildungen
159
Abbildung 77: Der zweiköpfige Martin Luther. Titelblatt von Johannes COCHLÄUS, Dialogus de bello contra Turcas in Antilogias Lutheri
160
Farbabbildungen
Abbildung 78: Die beiden Tiere der Apokalypse vom Wandteppich Zyklus der Apokalypse (Tapisserie de l’Apocalypse)
Farbabbildungen
Abbildung 79: Michael bezwingt den Drachen auf dem Wandteppich Zyklus der Apokalypse (Tapisserie de l’Apocalypse).
161
162
Farbabbildungen
Abbildung 80: Die Göttin Śīva in den Elephanta-Höhlen, Maharashtra, 6. Jahrhundert n. Chr.


![Werbung und Identität im multikulturellen Raum: Der Werbediskurs in Luxemburg. Ein kommunikationswissenschaftlicher Beitrag [1. Aufl.]
9783839419885](https://dokumen.pub/img/200x200/werbung-und-identitt-im-multikulturellen-raum-der-werbediskurs-in-luxemburg-ein-kommunikationswissenschaftlicher-beitrag-1-aufl-9783839419885.jpg)
![Transformation im ländlichen Raum: Ein Ökodorf und seine Wirkung in der Region [1. Aufl.]
9783658312749, 9783658312756](https://dokumen.pub/img/200x200/transformation-im-lndlichen-raum-ein-kodorf-und-seine-wirkung-in-der-region-1-aufl-9783658312749-9783658312756.jpg)
![Raum-Zeiten im Umbruch: Erzählen und Zeigen im Sevilla der Frühen Neuzeit [1. Aufl.]
9783839417591](https://dokumen.pub/img/200x200/raum-zeiten-im-umbruch-erzhlen-und-zeigen-im-sevilla-der-frhen-neuzeit-1-aufl-9783839417591.jpg)
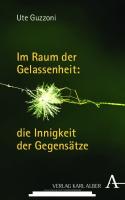


![Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert [3. erw. Aufl. Reprint 2019]
9783110892628, 9783110010985](https://dokumen.pub/img/200x200/das-wesen-der-reprsentation-und-der-gestaltwandel-der-demokratie-im-20-jahrhundert-3-erw-aufl-reprint-2019-9783110892628-9783110010985.jpg)